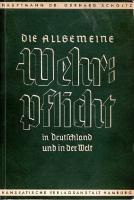Lutherisch und selbstständig: Einführung in die Geschichte selbstständiger evangelisch-lutherischer Kirchen in Deutschland 9783846903568, 3846903568, 9783846903551
Freikirchengeschichte übersichtlich - diese Beiträge stellen die Geschichte der Kirchen dar, die sich 1972 bzw. 1991 zur
126 19 7MB
German Pages 146 [150] Year 2020
Polecaj historie
Table of contents :
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Die „Evangelisch-lutherische (altlutherische) Kirche“
Citation preview
Copyright © Edition Ruprecht ISBN: 9783846903568
Werner Klän, Gilberto da Silva
Lutherisch und selbstständig
Edition Ruprecht
Werner Klän und Gilberto da Silva (Hrsg.) Lutherisch und selbstständig Eine Einführung in die Geschichte selbstständiger evangelisch-lutherischer Kirchen 2. Auflage
Inh. Dr. Reinhilde Ruprecht e.K.
Mit 34 Abbildungen. Verhandlungen und Vollzug lutherischen Glaubens, in Buchstaben gefasste Lehre und im Gottesdienstraum gefeierte Liturgie, Wortgebilde und Kirchenarchitektur: Das Titelbild kombiniert zwei Meilensteine in der Geschichte selbstständiger lutherischer Kirchen in Deutschland. Es zeigt zum einen das „erste Kirchgebäude“ einer selbstständigen lutherischen Gemeinde – die Katharinenkirche in Breslau, erbaut kurz nach 1300 als Klosterkirche, seit 1843 Kirche der lutherischen Gemeinde, 1945 schwer zerstört, heutige Nutzung: Konzerthalle und Restaurant. Zu sehen ist zum andern das Titelblatt der „Einigungssätze“ – eines Konsensdokumentes aus dem Jahr 1948, das das Ergebnis intensiver Bemühungen von Vertretern verschiedener Vorgängerkirchen darstellt, die Vereinigung selbstständiger lutherischer Kirchen zur Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche zu ermöglichen.
®
www.fsc.org
MIX Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C083411
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. Eine eBook-Ausgabe ist erhältlich unter DOI 10.2364/3846903568. © Edition Ruprecht Inh. Dr. R. Ruprecht e.K., Postfach 17 16, 37007 Göttingen – 2020 www.edition-ruprecht.de © 1. Auflage: Edition Ruprecht, Göttingen – 2012 Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlags. Diese ist auch erforderlich bei einer Nutzung für Lehrund Unterrichtszwecke nach § 52a UrhG. Satz und Layout: mm interaktiv, Dortmund Druck: CPI buchbücher.de GmbH, Birkach Umschlaggestaltung: klartext GmbH, Göttingen ISBN: 978-3-8469-0355-1 (Print), 978-3-8469-0356-8 (eBook)
Inhaltsverzeichnis Vorwort ............................................................................................................. 7 Geleitwort ......................................................................................................... 9 1.
Die „Evangelisch-lutherische (altlutherische) Kirche“ ........................... 11
2.
Die „Evangelisch-lutherische Immanuelsynode“ ................................... 20
3. 3.1 3.2 3.3
Die „Evangelisch-lutherische Kirche in Baden“ ..................................... 23 Die badische Landeskirche in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts........ 23 Die lutherische Separation ....................................................................... 24 Ökumenische Beziehungen der lutherischen Gemeinden im 20. und 21. Jahrhundert ....................................................................................... 31
4.
Die „Evangelisch-Lutherische Freikirche“ (in Sachsen und anderen Staaten) ................................................................................................ 35
5.
Die „Renitente Kirche ungeänderter Augsburger Konfession“ .............. 43
6.
Die „Selbständige evangelisch-lutherische Kirche in den hessischen Landen“ ................................................................................................ 51
7.
Die Hannover’schen evangelisch-lutherischen Freikirchen .................... 56
8. 8.1 8.2 8.3 8.4
Lutherische Bekenntniskirchen in der DDR .......................................... 64 Weltpolitische und kirchenpolitische Situation ......................................... 64 Kirchlicher Alltag in der DDR ................................................................... 65 Auf dem Weg zu einer vereinigten Bekenntniskirche ................................. 69 Der „Beitritt“ zur SELK ............................................................................ 70
9.
Mission ................................................................................................. 73
10. 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5
Diakonie ............................................................................................... 81 Selbstverständnis..................................................................................... 81 Diakonische Aktivitäten ........................................................................... 83 Diakonische Strukturen ........................................................................... 86 Diakoniestruktur in der SELK .................................................................. 86 Gesamtkirchliche Ordnungen .................................................................. 87
11.
Liturgie ................................................................................................. 88
12.
Verhältnis Kirche und Judentum ........................................................... 93
13.
Ausbildungsstätten ............................................................................... 96
14.
Vereinbarungen, Zusammenschlüsse, Vereinigungen.......................... 104
6
Inhaltsverzeichnis
15.
Ökumene .............................................................................................113
Anhang........................................................................................................... 119 Quellenverzeichnis ........................................................................................ 120 Biogramme ................................................................................................... 134 Bildquellenverzeichnis ...................................................................................140 Verzeichnis der Mitarbeiter dieses Buchs........................................................142 Personenregister ............................................................................................143 Ortsregister ....................................................................................................144
Vorwort Diese kleine Geschichte selbstständiger evangelisch-lutherischer Kirchen in Deutschland ist gedacht für Gemeindeglieder, Studierende, kirchlich und geschichtlich Interessierte. Ihnen soll ermöglicht werden, sich einen raschen Überblick über die Entstehung und Entwicklung besonders von Vorgängerkirchen der heutigen „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK) zu verschaffen. Zum Bereich konfessioneller evangelisch-lutherischer Kirchen sind aber auch die „EvangelischLutherische Freikirche“ (ELFK) und die „Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden“ (ELKiB) zu zählen, die eigenständig neben der SELK bestehen. In den zurückliegenden Jahren hat die Erforschung und Darstellung der Geschichte selbstständiger evangelisch-lutherischer Kirchen größere Fortschritte ge1 macht. Dies war ein Hauptgrund für die erweiterte Neuauflage des Bands „Quellen zur Geschichte selbstständiger evangelisch-lutherischer Kirchen in Deutschland“.2 Die Herausgeber konnten eine Reihe jüngerer Forscher*innen zur Mitarbeit gewinnen. Ihre Hinführungen zu den Dokumenten des Quellenbands sind in diesem Buch, in aktualisierter, überarbeiteter und teilweise erweiterter Gestalt, zu einer knappen Gesamtdarstellung zusammengefasst und durch Beiträge zu weiteren Themen ergänzt. Wer eine tiefer reichende Kenntnis der wichtigsten Dokumente zur diesem Gebiet der Kirchengeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts erwerben will, sei auf diesen Quellenband verwiesen. Die Liste der dort veröffentlichten Dokumente findet sich im Anhang dieses Buchs, ergänzt um Hinweise auf seit Erscheinen des Quellenbandes neu entstandene oder neu erschlossene Quellen. Biogramme wichtiger Akteure in der Geschichte der konkordienlutherischen Kirchen sind ebenfalls im Anhang abgedruckt. In diesem Buch wird vorwiegend die Geschichte der verschiedenen konkordienlutherischen Kirchenbildungen nachgezeichnet, die seit dem 19. Jahrhundert in Deutschland entstanden. Gemeinhin und ein wenig pauschal werden sie bis heute oft als „Altlutheraner“ bezeichnet. Zeitweise wurden sie auch mit dem Etikett
1
2
Monografien und Sammelbände z.B.: Christoph Barnbrock: Die Predigten C.F.W. Walthers im Kontext deutscher Auswanderergemeinden in den USA. Hintergründe – Analysen – Perspektiven, Hamburg 2003; Frank Martin Brunn: Union oder Separation? Eine Untersuchung über die historischen, ekklesiologischen und rechtlichen Aspekte der lutherischen Separation in Baden in der Mitte des 19. Jahrhunderts (VVKGB 64), Karlsruhe 2006; Andrea Grünhagen: Erweckung und konfessionelle Bewusstwerdung am Beispiel Hermannsburgs im 19. Jahrhundert, Quellen und Beiträge zur Geschichte der Hermannsburger Mission und des Evangelisch-lutherischen Missionswerks in Niedersachsen, Münster 2010; Jürgen Kampmann/Werner Klän (Hrsg.): Preußische Union, lutherisches Bekenntnis und kirchliche Prägungen (= Oberurseler Hefte Ergänzungsband 14), Göttingen 2014; Werner Klän/Gilberto da Silva (Hrsg.): Mission und Apartheid (= Oberurseler Hefte Ergänzungsband 13), Göttingen 2013; Volker Stolle: Lutherische Kirche in gesellschaftlichem Wandel (= Oberurseler Hefte Ergänzungsband 23), Göttingen 2019. Werner Klän/Gilberto da Silva (Hrsg.): Quellen zur Geschichte selbstständiger evangelischlutherischer Kirchen in Deutschland (= Oberurseler Hefte Ergänzungsband 6), Göttingen 2010.
8
Vorwort
des „Neuluthertums“ bedacht.3 Neuerdings ist versucht worden, sie konfessionskundlich zusammen mit den Altreformierten und Altkatholiken in eine Gruppe der „Altkonfessionellen“ einzuordnen.4 Diese Darstellung nimmt vor allem die Entstehung der verschiedenen konkordienlutherischen Kirchen in den Blick und verfolgt schwerpunktmäßig die Entwicklung ihrer Verfassungen, auch die Konflikte, an denen es zu Trennungen, später auch zu (Wieder-)Vereinigungen kam. Überdies wird in einem neu verfassten Beitrag der Weg der „Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche“ zwischen 1945 und 1990 in der (ehemaligen) DDR nachgezeichnet5, das Kapitel zur „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ wurde aktualisiert. Neben diesen organisations- und verfassungsgeschichtlich ausgerichteten Kapiteln kommen weitere Gesichtspunkte thematisch zur Sprache: Hierher gehören die Schilderungen der teilweise bis in die Entstehungsgeschichte dieser Kirchen zurück reichenden Arbeitsfelder in Mission und Diakonie; hier sind die neueren Entwicklungen nachgezeichnet. Die Skizze über die Liturgie stellt eine bedeutende Ergänzung des Gesamtkonzepts dar. Auch das Kapitel über Gründung und Weg der theologischen Ausbildungsstätten der behandelten Kirchen ist auf den neuesten Stand gebracht worden. Schließlich ist es von Bedeutung, das Verhältnis von selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirchen und Judentum sowie das Feld der ökumenischen Beziehungen dieser Kirchen vor Augen zu führen; dabei finden Aktivitäten im nationalen wie im internationalen Kontext gebührende Berücksichtigung, auch hier sind Ergänzungen und Aktualisierungen vorgenommen worden. Diese vermehrte Auflage berücksichtigt im Vergleich zur ersten Auflage eine Reihe zusätzlicher Quellen, die ausgewertet wurden; das erweiterte Quellenverzeichnis weist ab Seite 131 die Fundorte auch dieser Dokumente nach. Diese in den Beiträgen der Vorauflage, durch zusätzliche Beiträge sowie im Quellenverzeichnis erweiterte und aktualisierte Neuauflage erscheint im Vorfeld des fünfzigsten Jahrestag der Gründung der SELK (25. Juni 1972). Wir Herausgeber hoffen, dass sie ihren Lesern und Leserinnen ein unentbehrliches Hilfsmittel zu einer ersten Erschließung der Geschichte konfessionell bestimmter, staatsfreier lutherischer Kirchen werden möge. Andererseits sind wir überzeugt, dass dieser Band wie schon die erste Auflage einen wesentlichen Beitrag zur differenzierten Wahrnehmung eines modernen Kirchentypus mit betont konkordienlutherischer Ausrichtung leistet. Lübeck/Oberursel, Ostern 2020 Werner Klän und Gilberto da Silva 3 4 5
Vgl. Friedrich Wilhelm Kantzenbach/Joachim Mehlhausen: Neuluthertum. In: Theologische Realenzyklopädie 24 (1994), S. 327–341. Georg Hintzen: Altkonfessionelle Kirchen. In: Kleine Konfessionskunde, hrsg. vom Johann-AdamMöhler-Institut, Paderborn 2005, S. 315–325. Vgl. zum Beitritt der „Altlutheraner“ zur SELK nach der „Wende“: Gilberto da Silva/Stefan Süß (Hrsg.): Und es geschah doch 19 Jahre später … Der Beitritt der Evangelisch-Lutherischen (altlutherischen) Kirche in der ehemaligen DDR zur Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche 1991, Oberursel 2011 (OUH 51).
Geleitwort Dass nun eine neu bearbeitete und erweiterte Auflage dieses kirchengeschichtlichen Abrisses selbstständiger evangelisch-lutherischer Kirchen in Deutschland erscheint, ist eine große Freude. Das Buch, das zum 40. Gründungsjubiläum der SELK am Gedenktag des Augsburger Bekenntnisses 2012 erschien, hat sich in unseren Gemeinden, bei anderen, die am konfessionellen Luthertum in Deutschland kirchengeschichtlich interessiert sind, sowie unter Theologiestudierenden fast schon als ein Standardwerk erwiesen. Am Tag des Augsburger Bekenntnisses, dem 25. Juni 1972 schlossen sich die meisten der in diesem Buch vorgestellten lutherischen Bekenntniskirchen zur heutigen Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) zusammen. Dass sich die Gemeinden dieser hier in ihrem geschichtlichen Werden beschriebenen Vorgängerkirchen der SELK in ihren unterschiedlichen Prägungen in diesem halben Jahrhundert seit 1972 durchmischt haben, ist auch ein Zeichen kirchlicher Vitalität. Gleichwohl sind lokale Färbungen erkennbar, zu deren Ursprüngen dieses Buch Auskunft geben kann. Es ist durchaus festzustellen, dass SELK in diesem Zeitraum so etwas wie eine spezifische lutherische Bekenntnisidentität entwickelt hat. Die „lutherische Messe“, wie der lutherische Hauptgottesdienst mit heiligem Abendmahl nach CA XXIV auch zu nennen ist, bestimmt eine solche lutherische Bekenntnisidentität der SELK vor allem. Deshalb ist es eine besondere Freude, dass in einem neuen Beitrag von Christoph Barnbrock die verschiedenen liturgischen Traditionen der SELK-Vorgängerkirchen bis hin zur heutigen „Evangelisch-Lutherischen Kirchenagende“ der SELK in den Blick genommen werden. Letztere wird mit hoher Verbindlichkeit in den Gemeinden der SELK verwendet. In diesem Zusammenhang empfehle ich ebenso den neu ergänzten Beitrag über die lutherischen Bekenntniskirchen in der sowjetischen Besatzungszone in Deutschland, der späteren „Deutschen Demokratischen Republik“, den Albrecht Adam verfasst hat. Wer sich weiteren Studien der in diesem Band nach ihrem historischen Herkommen beschriebenen Kirchen widmen möchte, sei auf die „Quellen zur Geschichte selbständiger evangelisch-lutherischer Kirchen in Deutschland“ verwiesen, die die historischen Dokumente der hier dargestellten Kirchengeschichte präsentieren und im gleichen Verlag erschienen sind. So wünsche ich dieser erweiterten und durchgängig aktualisierten Darstellung, dass sie selbst einen bescheidenen Teil zur Entfaltung der lutherischen Bekenntnisidentität der SELK beitragen möge. Hannover, Ostern 2020
Hans-Jörg Voigt, Bischof der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche
1. Die „Evangelisch-lutherische (altlutherische) Kirche“ Gilberto da Silva Die im 19. Jahrhundert herrschenden Mentalitäten begünstigten die Idee einer Union der seit der Reformation getrennten evangelischen – lutherischen und reformierten – Kirchen in den deutschen Territorien. Die Aufklärung hatte zu einer Säkularisierung von Staat und Gesellschaft geführt, die die Rationalität als Grundprinzip von Geisteshaltung und Lebensgestaltung stellte. Diese Rationalität verlangte eine Neugestaltung veralteter Strukturen und Institutionen, die auch Kirche und Theologie betraf. Dazu gehörte das Plädoyer für eine „rationale“ Religion als Menschheits- oder Kulturreligion, in der das Dogma keinen Platz mehr haben und die Praxisorientierung ihren Sinn ergeben sollte. Darin verloren zwangsweise die innerevangelischen konfessionellen Unterschiede ihre Bedeutung. Diese „rationale“ Geisteshaltung wurde durch eine „emotionale“ ergänzt, die vom Pietismus auf die Tagesordnung gebracht wurde. Dieser erstrebte eine Frömmigkeitserneuerung durch Verinnerlichung und Individualisierung, in der der persönliche Glaube und das eigene fromme Gefühl wichtiger als Kirche und Konfession waren. Hier wurde der Akzent auf das gläubige Leben statt auf die theologische Lehre gesetzt, wobei in der Betonung der Praxisorientierung Pietismus und Aufklärung eine bedeutende Schnittmenge vorzuweisen hatten und mit der zunehmenden Technisierung des Lebens dieser Epoche in Einklang standen. Im Königreich Preußen spielten neben den herrschenden Mentalitäten weitere Faktoren eine wichtige Rolle bezüglich der Unionsidee. Auf der theologischen Ebene ist Friedrich Schleiermacher (1768–1834) von zentraler Bedeutung. Indem er das Wesen der Religion als Anschauung und Gefühl bzw. als unmittelbares Erleben des Unendlichen beschrieb, machte Schleiermacher den individuell-existentiellen Glauben zum Kriterium für die Wahrheit der biblischen und dogmatischkonfessionellen Lehren und stand so am Schnittpunkt von Aufklärung und Pietismus. Demgemäß erkannte Schleiermachers Glaubenslehre in den innerevangelischen Lehrunterschieden keine für die (evangelische) Konfession konstitutive Relevanz mehr. Im Zuge dessen verlangte diese Glaubenslehre, die durch ihr „evangelisches“ Gepräge nur noch die Wesensdifferenz zwischen evangelischem Glauben und römischem Katholizismus anerkannte, Konsequenzen für die kirchlichen Strukturen, nämlich die Luthertum und Reformiertentum in einer „Synthese“ überwindende Konsensunion. Auf der politischen Ebene hatte der preußische Staat durchaus Interesse an einer innerevangelischen Union. Eine Vereinigung der evangelischen Kirchen würde auf der einen Seite Einsparungen im Haushalt bringen, denn man hätte damit nicht
12
Die „Evangelisch-lutherische (altlutherische) Kirche“
mehr zwei, sondern nur eine Kirchenstruktur zu unterhalten. Auf der anderen Seite würde aus der Sicht des Staates eine solche Union eine politische Zentralisierung und eine Vereinigung der Kräfte nach dem 1806 verlorenen Krieg gegen Frankreich bringen. In diesem Zusammenhang spielte das Selbstverständnis des preußischen Staates als Mittel im Kampf des Reichs der Wahrheit und Gerechtigkeit gegen das Reich der Lüge und Finsternis, eine nahezu transzendente Vorstellung des Staates als Stätte der Wirksamkeit für Menschenbildung und intellektuelle Kultur eine zentrale Rolle. Außerdem würde eine evangelische Union die Administration des Schulwesens und die Versorgung der Gemeinden um Einiges vereinfachen. Zu diesen „politischen“ Gründen kam das Interesse des seit 1613 reformierten Herrscherhauses, eine Lösung für die nach wie vor mehrheitlich lutherische Landeskirche herbeizuführen. In dieser Hinsicht strebte Friedrich Wilhelm III. (*1770, 1797–1840) von Anfang an eine Union von Lutheranern und Reformierten an. Für ihn waren die symbolischen Bücher der beiden evangelischen Konfessionen nur Dokumente religiöser Meinung früherer Jahrhunderte, wobei er in Übereinstimmung mit den herrschenden Mentalitäten der „wahren Religion des Herzens“ den Vorrang gab. Die ersten Reformen im Sinne einer Vereinigung der evangelischen Kirchen in Preußen fanden bereits 1809 mit der Einrichtung einer gemeinsamen Prüfungskommission für lutherische und reformierte Kandidaten der Theologie statt. Ein weiterer Schritt in diese Richtung wurde 1813 mit der Ordinationsverpflichtung nur auf die Heilige Schrift – ohne die Bindung an die jeweiligen symbolischen Bücher der Konfessionen – beschlossen. Die entscheidenden Ereignisse nahmen jedoch erst ab 1817 ihren Lauf. Friedrich Wilhelm III. nahm die bevorstehenden Feierlichkeiten zum 300. Jubiläum der Reformation zum Anlass, den beiden evangelischen Kirchen in Preußen die Union „aus der Freiheit eigener Ueberzeugung“ nahe zu legen und sie in der Hof- und Garnisonsgemeinde zu Potsdam zu verwirklichen. Viele Gemeinden folgten dem Aufruf des Königs und veranstalteten gemeinsame Abendmahlsfeiern von Lutheranern und Reformierten, kehrten aber kurz danach zur traditionellen Trennung zurück. Parallel zu diesen eher administrativen Maßnahmen versuchte der König, die Union auf dem liturgischen Wege voranzutreiben. Die 1821/22 erschienene „Liturgie zum Hauptgottesdienste an Sonn- und Feiertagen und zur Abendmahlsfeier für die Hof- und Domkirche zu Berlin“ war die Umarbeitung einer Agende, die der König selbst 1816 für die Garnisonskirche in Potsdam erarbeitet hatte. Die königliche Agende bedeutete auf der einen Seite einen Vorstoß gegen den herrschenden Rationalismus unter der Pfarrerschaft, die sich bereits von einer liturgischen „Enge“ verabschiedet hatte. In diesem Rahmen bemühte sich der König um eine größere Feierlichkeit des Gottesdienstes: (Wieder-)Einführung des Talars, des Chorgesangs, von Kruzifixen und Kerzen auf den Altären – unter anderem. Auf der anderen Seite spiegelte die Agende den Zeitgeist wider, indem sie die liturgische Vereinigung von lutherischem und reformiertem Gottesdienst versuchte. Ein Beispiel dafür war die vorgesehene Darreichung des Abendmahls unter Verwendung einer Berichtsformel: „Unser Herr und Heiland Jesus Christus spricht:
Gilberto da Silva
13
‚Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird […]‘. Unser Herr und Heiland Jesus Christus spricht: ‚Das ist der Kelch, das Neue Testament in meinem Blute, das für euch vergossen wird‘.“1 Damit sollten sich sowohl Lutheraner als auch Reformierte mit ihren unterschiedlichen Auffassungen wieder finden.
Johann Gottfried Scheibel, *1783, †1843, Professor der Theologie in Breslau seit 1811, Diakonus an St. Elisabeth in Breslau seit 1817, Suspension wegen seines Widerstands gegen die Einführung der Union 1830, aus Preußen ausgewiesen 1832, im Exil in Sachsen 1832–1839, im Exil in Nürnberg, 1839–1843.
Das Unionsvorhaben des Königs blieb nicht ohne Opposition. Der Breslauer Theologieprofessor und Diakonus an St. Elisabeth, Johann Gottfried Scheibel (1783– 1843)2, der bereits 1817 Aufmerksamkeit auf sich zog, indem er als einziger unter den Theologieprofessoren an der unierten Abendmahlsfeier nicht teilnahm, lehnte die neue Agende strikt ab. Geboren in einem lutherisch geprägten Haus, bewegte sich Scheibel zunächst im Rahmen des starken konfessionellen Bewusstseins der lutherischen Kirche in Schlesien. Dieses konfessionelle Bewusstsein war durch die Geschichte der schlesischen lutherischen Kirche, die zwischen dem Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) und der preußischen Annexion nach dem Ersten Schlesischen Krieg (1740–1742) unter starken habsburgischen Rekatholisierungsmaßnahmen litt, bedingt. Mentalitätengeschichtlich gesehen spielten Aufklärung und Pietismus in Schlesien eine geringere Rolle als im übrigen Preußen. Während seines Theologiestudiums in Halle ab 1801 sah sich Scheibel mit dem theologischen Rationalismus konfrontiert. In der zweiten Hälfte des Studiums (1803) spielte er sogar mit dem Gedanken, nach Göttingen zu wechseln und Historiker, nicht Theologe, zu werden. Die zusätzliche Beschäftigung mit der Naturphilosophie führte während des Studiums zu einer Glaubenskrise, die Scheibel jedoch überwand. Er kehrte nach Breslau zurück und legte vor dem Stadtkonsistorium in den Jahren 1804 und 1 2
Kirchen-Agende für die Hof- und Domkirche in Berlin, 2. Auflage, Berlin 1822, 23. Für eine ausführlichere Darstellung vgl. Martin Kiunke, Johann Gottfried Scheibel und sein Ringen um die Kirche der lutherischen Reformation (Kirche im Osten 19), Göttingen 1985.
14
Die „Evangelisch-lutherische (altlutherische) Kirche“
1806 seine Examina ab. Danach bestritt er die übliche Laufbahn für den Kirchendienst in Breslau, 1807 als Lektor in St. Barbara, 1808 in St. Elisabeth, 1809 als „Mittagsprediger“ wieder in St. Barbara, seit 1815 fünfter Diakonus an St. Elisabeth. Mit einer Schrift über die methodische Behandlung der Geschichte bewarb er sich um eine Professur an der 1811 (neu-)gegründeten Schlesischen FriedrichWilhelms-Universität zu Breslau und wurde im selben Jahr außerordentlicher, ab 1818 ordentlicher Professor an deren theologischer Fakultät. Als Pfarrer sammelte Scheibel eine Art „Personalgemeinde“ um sich, die seine Gottesdienste schätzte und für eine Erweckung in Breslau sorgte. Entscheidend für Scheibels Opposition gegen die preußische Union ist seine in die Breslauer Zeit fallende (Wieder-) Entdeckung der normativen Bedeutung der lutherischen Bekenntnisschriften für die lutherische Kirche. In diesem Zusammenhang wurde die lutherische Abendmahlslehre zum Zentrum seiner Theologie. Für ihn war die Abendmahlsfeier nicht eine einzelne Feier oder eine für sich bestehende Lehre, sondern sie hatte die „bedeutsamste Wirkung“ auf den ganzen Glauben an Jesus Christus und die ganze christliche Hoffnung auf ihn. Dabei wehrte er sich immer wieder gegen die herrschende rationalistische Theologie. Seine deutliche Absage an die königliche Agende ließ sich von zwei Prinzipien leiten: 1. Der Zusammenhang von Gottesdienst, Bekenntnis und Kirche ist unauflöslich. Das bedeutet, dass eine lutherische Gemeinde nur eine lutherische Agende, die bei der Abendmahlsliturgie die Realpräsenz von Christi Leib und Blut deutlich bezeugt, verwenden kann. 2. Das ius liturgicum des Königs in dieser Angelegenheit ist fraglich, da er dabei in die Zuständigkeit der Gemeinden eingreift und, noch problematischer, als reformiertes Kirchenoberhaupt liturgische Änderungen für die lutherische Kirche diktiert.
Georg Philipp Eduard Huschke, *1801, †1886, Professor der Rechte 1824–1827 in Rostock, seit 1827 in Breslau, Doktor der Theologie, erster Direktor des Oberkirchenkollegiums der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“ 1841–1886.
Ungeachtet der zum Teil heftigen Opposition fuhr Friedrich Wilhelm III. mit seinen Plänen fort und führte die Union 1830 endgültig ein. Daraufhin sammelte sich um
Gilberto da Silva
15
Scheibel, den Juristen Georg Philipp Eduard Huschke (1801–1886)3 und den Naturphilosophen Henrich Steffens (1773–1845) eine immer größer werdende Gruppe von konfessionellen Lutheranern, die den Übertritt zur preußischen Union nicht vollziehen wollten. Die preußische Regierung antwortete zunächst mit der Amtssuspendierung Scheibels, danach wurden die Sanktionen gegen ihn mit seiner Exilierung nach Sachsen im Jahr 1832 verschärft. Mit dem Weggang Scheibels übernahm Huschke die Leitung der konfessionell-lutherischen Opposition in Breslau. Einige Pfarrer aus Ortschaften außerhalb Breslaus (z.B. Hermannsdorf; Hönigern, Kaulwitz, Freystadt) schlossen sich nun der Bewegung an. Auch diese Pfarrer wurden suspendiert. Gegen Ende 1830 dürfte es um die 1.000 konfessionelllutherische Oppositionelle in Breslau gegeben haben, die in dieser Zeit anhand wiederholter Bittschriften die Wiederherstellung der Rechte der lutherischen Kirche in Preußen ersuchten, während ihre Bewegung eine weitere Ausdehnung in Schlesien erfuhr. Bald gab es konfessionell-lutherische Oppositionelle auch in Brandenburg, Pommern, Posen und Halle/Saale. Der preußische König nahm die Sache jedoch zunehmend persönlich und antwortete den Breslauern schroff und abschlägig. Auch ein weiterer Versuch der Lutheraner blieb erfolglos. Es begann eine harte Verfolgungszeit für die konfessionell-lutherische Opposition, die mit Zwangsgeldern, Pfändungen und Verhaftungen immer wieder bestraft wurde.
Hönigern, Kirche, erbaut 1787, auf Befehl der polnischen Regierung abgerissen 1956, bis zur Dragonade von Hönigern am 24.12.1834 evangelisch-lutherisch, danach evangelischuniert, Aufnahme: 1934.
3
Für eine ausführliche Darstellung vgl. Jobst Schöne, Kirchen und Kirchenregiment im Wirken und Denken Georg Philipp Eduard Huschkes, Berlin/Hamburg 1969.
16
Die „Evangelisch-lutherische (altlutherische) Kirche“
Tiefpunkt der Auseinandersetzungen waren die Ereignisse im Dorf Hönigern/Miodary (Kreis Namslau/Namysłów) am Heiligabend des Jahres 1834: Die evangelischlutherische Gemeinde weigerte sich zusammen mit ihrem Pfarrer Eduard Gustav Kellner (1801–1878), der zwar suspendiert wurde, aber die Suspension nicht anerkannte, die neue königliche unierte Kirchenagende einzuführen, und ließ sich auch nicht durch Drängen des zuständigen Superintendenten dazu bewegen. Der Landrat verlangte die Herausgabe des Kirchenschlüssels, aber die Kirchengemeinde weigerte sich, ihn auszuhändigen. Es folgte ein vom königlichen Polizeipräsidenten, dem königlichen Konsistorialrat und dem königlichen Landrat unterzeichnetes Ultimatum, das in deutscher und polnischer Sprache gedruckt, an die Kirche und die Zäune angeheftet wurde und mit dem Einmarsch des Militärs drohte. Da Kellner und seine Gemeindeglieder nicht nachgaben, schritt das preußische Militär mit 400 Mann Infanterie, 50 Kürassieren (schwere Kavallerie) und 50 Husaren (leichte Kavallerie) ein (einige Quellen wissen auch von zwei Kanonen zu berichten), um die von ca. 200 Dorfbewohnern geschlossen gehaltene und bewachte Dorfkirche aufzuschließen. Die Soldaten nahmen die Kirche mittels Kolbenschläge und Verprügelungen in Besitz und legten die unierte Agende demonstrativ auf den Altar. Erst nach sechs Tagen zog das Militär wieder ab. Zurück blieb eine Gemeinde ohne Pfarrer, deren Vertrauen in Landeskirche und Regierung stark erschüttert und die lange in ihrer Entwicklung lahmgelegt worden war. Die sogenannte „Hönigern’sche Dragonade“ blieb außerhalb Preußens nicht unbemerkt: es erschienen in der englischen Presse Artikel darüber, und der britische Botschafter in Berlin leitete diplomatische Schritte ein. Es folgten ebenfalls eine Anfrage der dänischen Regierung, eine Protestnote der sächsischen Regierung und zahlreiche Protestschreiben einiger Theologen. Diese unnötige und unverhältnismäßige Gewaltanwendung gegen Zivilisten zeigt, wie empfindlich Friedrich Wilhelm III. und seine Regierung, besonders Kultusminister Karl Freiher vom Stein zum Altenstein (*1770–1840), gegen die konfessionell-lutherische Opposition in Schlesien inzwischen geworden waren. Das dadurch erregte Aufsehen und Empörung in Preußen und im Ausland stand mentalitätengeschichtlich auf der hintergründigen Vorstellung, dass solch eine Anwendung brachialer Gewalt in geistlichen Angelegenheiten einer aufgeklärten Gesellschaft nicht mehr würdig sei.
Gilberto da Silva
17
Eduard Gustav Kellner, *1802, †1878, Pfarrer in Hönigern 1826–1834, wegen Widerstandes gegen Einführung der Union von 1834 bis 1838 in Haft, Bedienung lutherischer Gemeinden in ganz Preußen im Untergrund 1839–1841, Pfarrer in Schwirz seit 1841.
Der Beginn einer Wende kam mit dem Tod Altensteins (14. Mai 1840) und Friedrich Wilhelms III. (7. Juni 1840) sowie dem darauffolgenden Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. (*1795, 1840–1858, †1861) 1840. Bereits seinerzeit als preußischer Kronprinz missfiel ihm die Verfolgungspolitik der Regierung gegen die konfessionellen Lutheraner in Schlesien. Das geschah allerdings nicht, weil er Sympathien für sie regte oder ihr Anliegen als berechtigt erachtete, sondern weil er im Gesamtzusammenhang einen „ministeriellen Absolutismus“4 zu sehen glaubte. Sobald er sein Amt als König antrat, versuchte er diesen „ministeriellen Absolutismus“ durch souveräne königliche Maßnahmen zu schwächen, was unter anderem den konfessionellen Lutheranern zugute kam. Der neue König verfügte bereits im August desselben Jahres die Freilassung inhaftierter Pfarrer und erlaubte ihre Amtsausübung in den Gemeinden. Im Ganzen gewährte der neue König den konfessionellen Lutheranern eine Duldung. Die neue Situation ermöglichte es sie, ihre kirchliche Organisation in Angriff zu nehmen, wodurch die definitive Bildung einer Freikirche lutherischen Bekenntnisses ihren Lauf nahm. Dabei kamen vor allem konsistoriale und synodale Züge zum Tragen. Verhandlungen mit dem Staat führten zu einer ausführlichen Darstellung des konfessionell-lutherischen Anliegens, die Voraussetzung für eine mögliche staatliche Anerkennung sein sollte. Der preußische Staat gewährte der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preu5 ßen“ im Juli 1845 mittels einer Generalkonzession schließlich eine, wenn auch 4 5
Rathgeber, Christina (Hg.): Die Altlutheraner und die preußische Religionspolitik (1830–1847) (Acta Borussica. Neue Folge. 2. Reihe: Preußen als Kulturstaat). Berlin/Boston 2017, 32. So die beanspruchte, aber staatlicherseits nicht anerkannte Bezeichnung seit ihrer Entstehung. Aufgrund der historisch bedingten besonderen Situation Preußens wurde der Kirchennamen mehrmals geändert: zurzeit der Gründung hieß sie „Evangelisch-lutherische Kirche in Preußen“, seit 1933 „Evangelisch-lutherische Kirche Altpreußens“, nach dem Zweiten Weltkrieg „Evangelisch-lutherische Kirche im früheren Altpreußen“ und seit 1954 „Evangelisch-lutherische (altlutherische) Kirche“.
18
Die „Evangelisch-lutherische (altlutherische) Kirche“
stark eingeschränkte, Anerkennung, indem sie die Rechte einer „moralischen Person“ bekam. Darin wird sie allerdings nicht „Kirche“, sondern „die von der Gemeinschaft der evangelischen Landeskirche sich getrennt haltenden Lutheraner“ genannt. Von großer Bedeutung für sie war allerdings die in der Konzession verfügte Befreiung von der Kirchensteuerzahlung. Die sogenannte „Spezialkonzession“ vom August 1847 benannte auch die Einzelgemeinden mit den jeweils residierenden Pfarrern, denen die Konzession von 1845 gelten sollte, und listete die Namen der Pfarrer, die amtieren durften, auf. Diejenigen, die 1847 nicht mehr amtierten, wurden nachträglich rehabilitiert. Nicht preußische Staatsangehörige hätten allerdings zuerst die „Aufnahme in den Preußischen Unterthanen-Verband […] nachzusuchen“. Doch die konfessionellen Lutheraner sahen sich immer wieder genötigt, um die uneingeschränkte Anerkennung ihrer kirchlichen Stellung bei den Staatsbehörden nachzusuchen. Erst 1908 konnte die „Evangelisch-lutherische Kirche in Preußen“ als Kirche und für ihre Gemeinden Korporationsrechte erlangen. Schließlich knapp 100 Jahre nach ihrer Entstehung erhielt die „Altlutherische Kirche“ die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Auseinandersetzungen um das lutherische Bekenntnis führten auch innerhalb der unierten preußischen Landeskirche zu einem Erwachen der konfessionellen Frage. Im Zuge dessen kam es in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts zum Anschluss einer „zweiten Generation“ konfessionell-lutherischer Pfarrer an die „Evangelisch-lutherische Kirche in Preußen“, nachdem einer Klärung des Bekenntnisstandes in der Union nicht hatte herbeigeführt werden können. Julius Nagel, Julius Diedrich, Wilhelm Friedrich Besser, und Hermann Alexander Pistorius waren die führenden Köpfe dieser Gruppe. Es entzündete sich jedoch bald ein heftiger Streit zwischen dieser Gruppe, insbesondere darin Diedrich, und dem unter der Führung Huschkes stehenden Oberkirchenkollegium in Breslau um die Fragen von Kirchenamt, -regiment und -ordnung. Die Auseinandersetzung führte zur Trennung 6 von Pfarrern und Gemeinden und Gründung der „Immanuelsynode“ . Die Ereignisse des Jahres 1866 mit der „Ausdehnung“ des preußischen Staates brachten eine teils faktische, teils rechtliche Einführung der Union in den bis dahin lutherischen Landeskirchen der nun preußischen Provinzen. Dies nötigte die „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“ zu einer Überprüfung ihrer Stellung zu den lutherischen „Provinzialkirchen“. Dazu wurden Grundsätze für die Beurteilung des Bekenntnisstandes der Landeskirchen entwickelt, die den Umgang der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“ unter der Leitung des Oberkirchenkollegiums mit jenen Kirchen orientieren sollten. Die weitere Entwicklung in den Landeskirchen führte aber dazu, dass diese Grundsätze später (1878) präzisiert und an konkreten Beispielen bezüglich der Aufhebung von Kirchengemeinschaft angewendet werden mussten. Nicht nur das Verhältnis zu den (lutherischen) Landeskirchen musste geklärt werden, sondern auch das Verhältnis zu den sich in 6
Vgl. S. 20–22.
Gilberto da Silva
19
anderen deutschen Territorien bildenden selbstständigen lutherischen Kirchen. Auch hier spielte der Bekenntnisstand die entscheidende Rolle. Ein Beispiel für die Auswirkungen dieses „Klärungsprozesses“ ist die Suspension der Kirchengemeinschaft mit der Landeskirche Hannovers. Das gemeinsame konfessionell-lutherische Anliegen legte die Bemühung um die Einigung mit den anderen deutschen selbstständigen lutherischen Kirchen, einschließlich der „Immanuelsynode“, nahe und wurde durch eine synodale Stellungnahme bekräftigt. Aus diesen Bemühungen ging der Vorschlag zur Bildung eines gemeinsamen Delegiertenkonvents selbstständiger lutherischer Kirchen hervor. Diese neue Lage am Anfang des 20. Jahrhunderts führte zu weiteren Klärungen bezüglich des Verhältnisses zu den Landeskirchen auf der einen und zu den selbstständigen lutherischen Kirchen auf der anderen Seite. Ein Beispiel für diese Klärung ist die eindeutige Entscheidung zugunsten der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ und der „Evangelisch-Lutherischen Hermannsburger Freikirche“. Somit definierte die „Evangelisch-lutherische Kirche in Preußen“ ihren Platz in der kirchlichen Landschaft Deutschlands und arbeitete nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs zusammen mit den anderen selbstständigen lutherischen Kirchen mit dem Ziel eines 7 Zusammenschlusses , der 1972 in Westdeutschland (BRD) mit der Gründung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) verwirklicht wurde. In der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) ist die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg eine andere gewesen.8 Angesichts der Schwierigkeit, eine gemeinsame Kirchenleitung für Ost und West nach der innerdeutschen Grenzziehung aufrechtzuerhalten, hat sich die Evangelisch-lutherische (altlutherische) Kirche in den 1950er Jahren administrativ neuformiert, faktisch mit je einer selbstständigen Kirche in der Bundesrepublik und in der DDR. Im sozialistischen Staat kam es aber 1972 nicht zum kirchlichen Zusammenschluss. Stattdessen bildeten die dort vorhandenen „altlutherische“ und „Evangelisch-Lutherische Freikirche“9 lediglich eine lose „Vereinigung selbständiger evangelisch-lutherischer Kirchen in der DDR“ (VselK). Die wachsende Entfremdung zwischen den beiden Kirchenkörpern in der DDR führte schließlich zum Bruch mit der Aufhebung der Kirchengemeinschaft im Jahre 1984.
7 8 9
Vgl. S. 113–118. Vgl. S. 64–72. Vgl. S. 35–42.
2. Die „Evangelisch-lutherische Immanuelsynode“ Werner Klän Die „Evangelisch-lutherische Immanuelsynode“ stellt eine Kirchenbildung dar, die zunächst in Preußen im Gefolge der ekklesiologischen Auseinandersetzungen des 19. Jahrhunderts ins Dasein trat. An den Diskussionen um Kirche und Amt, die nicht nur das deutsche Luthertum, sondern auch die nordamerikanischen und australischen Auswandererkirchen lutherischer Konfession bewegten, waren Vertreter der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“ von Beginn an beteiligt. Während die Debatten in den staatskirchenrechtlich weithin gesicherten lutherischen Landeskirchen so gut wie keine bestandsgefährdenden Auswirkungen hatten, wirkten die Konflikte in den notgedrungen staatsfrei organisierten lutherischen Kirchen Preußens, aber auch der nordamerikanischen Staaten als Sprengsatz, die den Bestand der jungen Kirchbildungen bedrohten. Aus den Reihen der in den späten 1840er Jahren neu zur „Evangelischlutherischen Kirche in Preußen“ getretenen Pastoren erhob sich alsbald heftige Kritik an der aus der Verfolgungszeit herausgewachsenen konsistorial-synodalen Verfassung, besonders an der Stellung des Oberkirchenkollegiums als Leitungsbehörde. Dessen Selbstverständnis als kirchliche „Obrigkeit“ wurde von den Kritikern entschieden in Zweifel gezogen. Dieser Konflikt ist ein eindrückliches Paradigma für die historischen und systematischen Schwierigkeiten bei der Beantwortung der Frage, die sich strukturell in der Bildung der konfessionsbestimmten lutherischen Kirchentümer seit Beginn des 19. Jahrhunderts abzeichnete, nämlich wer bei oder nach Erledigung des landesherrlichen Kirchenregiments, die Leitung der Kirche, und verbunden mit welchen Rechten übernehme. Unter den Bedingungen staatsfreier kirchlicher Existenz führten diese Auseinandersetzungen die „Evangelisch-lutherische Kirche in Preußen“ in ihre erste und schwerste Existenz- und Glaubwürdigkeitskrise. Die Spaltung über die Frage des Kirchenregiments und der Kirchenverfassung führte zur Diskreditierung ihres konfessionellen Anliegens in weiten Kreisen der kirchlichen Öffentlichkeit.
Werner Klän
21
Franz Wilhelm Julius Diedrich, *1819, †1890, Pfarrer in Saatzke (Zaatzke) bei Wittstock/ Dosse 1845–1847, Übertritt zur „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“ 1847, Pfarrer in Jabel bei Wittstock/Dosse 1847–1874, Lossagung vom Oberkirchenkollegium 1861, Mitbegründer der „Evangelisch-lutherischen Immanuelsynode“ 1864, Pfarrer in Frankfurt/Main 1874–1883, Pfarrer in Straßburg 1883–1890.
Nach längeren internen Auseinandersetzungen, bei denen die Kritiker der bestehenden Kirchenordnung keinerlei Reformansätze durchsetzen konnten, kam es unter Federführung von Julius Diedrich, Pastor in Jabel bei Wittstock/Dosse, zur Lossagung von der Leitung des Oberkirchenkollegiums, ohne dass diese Entwicklung damit zum Stillstand gekommen wäre. Die sezedierten Pastoren konnten eine staatliche Anerkennung ihrer Stellung und ihrer Gemeinden nicht erlangen, so sehr sie sich auch um eine eigenständige kirchliche Organisation bemühten, die freilich stark independentistische Züge trug. Auch dringliche Petitionen um Ausweitung der in der Generalkonzession gewährten Rechte auf den Bereich der „Immanuelsynode“ oder Bitten um neue staatskirchenrechtliche Regelungen blieben ohne Erfolg. Die Generalsynode der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“ hingegen beschuldigte die „Immanuelsynode“ des „Separatismus“ und erklärte die Kirchengemeinschaft mit ihren Pastoren und Gemeinden für aufgehoben. Die erste Generation der selbstständigen Lutheraner hatte gemeint, die kirchliche Reorganisation durch Rückgriff auf historisch vorgegebene Institutionen, teilweise aber auch durch Schaffung neuer, zeitgenössischer Einrichtungen, wie Kirchenvorstände und Synoden, vornehmlich aber auf juridischem Wege vollziehen zu müssen. Die Kritik gegen die so erarbeiteten Lösungen betraf vor allem die mangelnde theologische Reflexion der kirchlichen Verfassungsgestalt und die Überfremdung kirchlichen Handelns durch rechtliche Bestimmungen. Der Ablösungsprozess, wie er daraufhin in Preußen stattfand, zeigte aber in den 1869er Jahren noch Weiterungen; dazu zählen die Gründung der „EvangelischLutherischen Kirche in Baden“ und die besonderen Wege der selbstständigen lu-
22
Die „Evangelisch-lutherische Immanuelsynode“
therischen Gemeinden in Nassau, die später in Verbindung mit der „Lutherischen Kirche–Missouri-Synode“ traten. In ihrer Sonderexistenz verloren die leitenden Geistlichen der „Immanuelsynode“ die Aufgabe der Einigung der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirchen allerdings nicht aus dem Blick. So machten sie schon 1874 erste Versuche, eine Annäherung unter den selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirchen herbeizuführen, die allerdings schon bald darauf scheiterten. Nur ein Jahr später (1875) erarbeitete die „Immanuelsynode“ Thesen zur Kirchengemeinschaft, die eben die neu entstandenen bekenntnisbestimmten lutherischen Kirchen zu integrieren suchten. Bezüglich der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“ erfuhren diese Thesen ein gutes Jahrzehnt später (1886) eine charakteristische Modifikation, indem nun den Gliedern der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“, die den Beschluss der Generalsynode zur Aufhebung der Kirchengemeinschaft mit den „Immanueliten“ von 1864 missbilligten, die Hand zur Versöhnung gereicht wurde. In langwierigen Verhandlungen während der 1890er Jahre kam es, nicht zuletzt weil auf beiden Seiten eine neue Generation in leitende Stellungen aufrückte, zu gewissen Annäherungen zwischen der „Immanuelsynode“ und der „Evangelischlutherischen Kirche in Preußen“. Nachdem sich die „Immanuelsynode“ aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen dazu entschlossen hatte, ein relatives Recht übergeordneter Kirchenleitung einzugestehen, die „Evangelisch-lutherische Kirche in Preußen“ wiederum von extremen Positionen der sechziger Jahre abzurücken bereit war, kam es im Jahr 1904 – von ganz geringen Ausnahmen abgesehen – zur Wie1 dervereinigung der konfessionellen Lutheraner in Preußen. Bei diesem Prozess waren freilich weniger theologische als pragmatische Gesichtspunkte leitend. Allerdings brach sich in diesem Zusammenschluss auch die Einsicht Bahn, dass das Zusammenstehen derjenigen, die eine konfessionsbestimmte Gestalt lutherischen Kirchentums vertraten, unabweisbar notwendig werde, je deutlicher wurde, dass die kirchlich-theologische Entwicklung in Deutschland insgesamt von den konkordienlutherischen Grundpositionen der selbstständigen Lutheraner fortführte.
1
Vgl. S. 104–112.
3. Die „Evangelisch-lutherische Kirche in Baden“ Frank Martin Brunn Die Wurzeln der „Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden“ liegen in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Seit dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts gab es in Europa verschiedentlich Rekonfessionalisierungsbewegungen in den Kirchen und in der Theologie. An einigen Orten führten diese zu Separationen, zuerst im Bereich von Unionskirchen, seit den 1870er Jahren dann auch im Bereich lutherischer Landeskirchen. Ausgelöst wurden die Separationen durch vier mit einander in Wechselwirkung tretende Faktoren: 1. dadurch, dass sich der theologische Rationalismus des frühen 19. Jahrhunderts in den kirchlichen Agenden, Gesangbüchern und Katechismen niederschlug, 2. durch die Erweckungsbewegung, die sich dezidiert vom Rationalismus abgrenzte und an rationalistisch geprägten kirchlichen Büchern Anstoß nahm, 3. durch das Neuluthertum, das zum Teil aus der Erweckungsbewegung hervorging, sich aber theologisch an der altprotestantischen Orthodoxie orientierte, und 4. durch das seit 1848 hervorgetretene neue bürgerliche Selbstbewusstsein, das überkommene Autoritäten hinterfragte. Aus dieser theologisch-kirchenpolitischen Gemengelage entstanden in ganz Deutschland und dem Elsass kleine selbstständige, konfessionell lutherische Partikularkirchen. Sie legten auf die Bindung an den kompletten Kanon der Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, also an das Konkordienbuch, großen Wert. Sie verfolgten eine konkordienlutherische Theologie mit antimodernistischem Einschlag. Es handelte sich um eine konservative Revolution. Zahlenmäßig sind diese Kirchen bis heute eine kleine Gruppe geblieben.
3.1 Die badische Landeskirche in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Im Großherzogtum Baden kam es Anfang der 1850er Jahre zu Separationen von der Landeskirche. 1821 hatten sich die evangelisch-lutherische und die reformierte Landeskirche Badens mit einer Generalsynode und der Bestätigung ihrer Beschlüsse durch den Großherzog zu einer Konsensunion zusammengeschlossen.1 Seit 1
Vgl. Johannes Ehmann, Union und Konstitution. Die Anfänge des kirchlichen Liberalismus in Baden im Zusammenhang der Unionsgeschichte (1797–1834) (VVKGB 50), Karlsruhe 1994.
24
Die „Evangelisch-lutherische Kirche in Baden“
1807 schon hatten die lutherischen und die reformierten Gemeinden eine gemeinsame Kirchenbehörde in Karlsruhe. 1809 wurde diese Behörde, der „Evangelische Oberkirchenrat“, ins Innenministerium integriert und 1812 zur evangelischen Kirchensektion im zweiten Department des Innenministeriums umgestaltet. Im Vorlauf der Unionsgründung von 1821 gab es also Verwaltungsreformen. Die Eingliederung des „Evangelischen Oberkirchenrats“ in das Innenministerium und die damit verbundene Rationalität der kirchlichen Verwaltung wirkte sich auf den Ablauf der späteren Ereignisse aus. Die Union selber ist aber nicht die Folge einer Verwaltungsreform, sondern erfolgte im Nachgang des Reformationsjubiläums von 1817 im Geist des Liberalismus. 13 Jahre später, 1830, wurde das nächste große Reformationsjubiläum gefeiert: 300 Jahre Confessio Augustana. In der Folge orientierte sich die Erweckungsbewegung in Baden theologisch am Augsburgischen Bekenntnis. Im Jubiläumsjahr 1830 wurde in Baden auch – endlich – der schon bei der Unionssynode 1821 angekündigte neue Landeskatechismus provisorisch eingeführt. Aus der Erweckungsbewegung heraus, insbesondere aus dem Kreis um den von der römisch-katholischen Kirche 2 konvertierten Pfarrer Alois Henhöfer , kam es zum Streit über diesen Landeskatechismus. In diesem Streit ging es um einzelne Lehraussagen des Katechismus, aber zugleich ging es um den Bekenntnisstand der Landeskirche. Der Streit endete 1836 mit einer Revision des Katechismusentwurfs. Der Katechismus wurde eingeführt, ausdrücklich nur als Lehrbuch und nicht, wie ursprünglich gedacht, als Bekenntnisschrift. Innerkirchlich standen sich, grob gesprochen, zwei Lager gegenüber: die kirchlich und politisch liberal Gesinnten, die eine eher rationalistische Theologie pflegten, und die kirchlich und politisch konservativ Gesinnten, die eine eher konfessionelle Theologie pflegten. Während Teile der Liberalen auch politische Reformen forderten, standen die Konservativen treu zum Großherzog.
3.2 Die lutherische Separation3 Die Separation von der badischen Landeskirche und die Neugründung evangelischlutherischer Gemeinden in Baden geht auf das Wirken der Pfarrer Carl Eichhorn
2
3
Vgl. Gerhard Schwinge, Alois Henhöfer (1789–1862), in: ders. (Hg.), Lebensbilder aus der evangelischen Kirche in Baden, Band IV: Erweckung/Innere Mission/Diakonie/Theologinnen, Karlsruhe 2015, 12–39. Vgl. Frank Martin Brunn, Union oder Separation? Eine Untersuchung über die historischen, ekklesiologischen und rechtlichen Aspekte der lutherischen Separation in Baden in der Mitte des 19. Jahrhunderts (VVKGB 64), Karlsruhe 2006; ders., Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden, in: Klaus Blümlein u.a. (Hrsg.), Kirchengeschichte am Oberrhein – ökumenisch und grenzüberschreitend, Ubstadt-Weiher u.a. 2013, 203–207.
Frank Martin Brunn
25
(1810–1890)4, August Wilhelm Ludwig (1815–1901), Georg Friedrich Haag (1806–1875) und Max Frommel (1830–1890) zurück. Der Anfang der lutherischen Separation in Baden lag in dem kleinen Ort Nußloch bei Heidelberg. Hier war Carl Eichhorn seit 1847 Pfarrer. Es war seine zweite Stelle. Zuvor war er 12 Jahre in Bofsheim Pfarrer gewesen. In Bofsheim hatten sich einige lutherische Bräuche gehalten. Nußloch war im Gegensatz dazu reformiert geprägt. Eichhorn verwendete im Konfirmandenunterricht neben dem Unionskatechismus auch den Kleinen Katechismus Martin Luthers und zitierte daraus in seinen Predigten. Das brachte der Dorfschullehrer im Juni 1848 zur Anzeige beim Oberkirchenrat. Der Oberkirchenrat verbot Eichhorn daraufhin die Verwendung von Luthers Katechismus. Eichhorn suchte die theologische Diskussion mit dem Oberkirchenrat und erläuterte, in welchen Zusammenhängen und warum er Luthers Kleinen Katechismus hinzuzog. Er sah sich selbst auf dem Boden der Unionsurkunde, weil diese Luthers Kleinem Katechismus und dem Heidelberger Katechismus eine normative Funktion zuerkannte. Der Oberkirchenrat wies Eichhorns Argumentation jedoch zurück und betonte, dass der Landeskatechismus verpflichtend eingeführt sei. Zudem dürfe nicht in ehemals reformierten Gemeinden Luthers Kleiner Katechismus eingeführt werden, genauso wenig wie in ehemals lutherischen Gemeinden der Heidelberger Katechismus eingeführt werden dürfe. In dieser Auseinandersetzung zeigte sich der Oberkirchenrat wenig sensibel für Eichhorns theologisches Anliegen. Eichhorn zeigte allerdings ebenso wenig Sensibilität für die konfessionelle Tradition seiner Kirchengemeinde.
4
Vgl. Frank Martin Brunn, Carl Eichhorn (1810–1890), in: Johannes Ehmann (Hg.), Lebensbilder aus der badischen evangelischen Kirche im 19. und 20. Jahrhundert, Bd. II: Kirchenpolitische Richtungen, (VVKGB), Karlsruhe 2010, 139–167; sowie ders., Carl Eichhorn (1810–1890): ein Pionier lutherischer Freikirchen, in: Lutherische Theologie und Kirche (34. Jg) 2010, 35–75.
26
Die „Evangelisch-lutherische Kirche in Baden“
Carl Eichhorn, *1810, †1890, Pfarrer in Bofsheim/Baden, Pfarrer in Nußloch b. Heidelberg 1847–1850, Austritt aus der unierten badischen Landeskirche 1850, gründete die erste lutherische Gemeinde in Baden in Ihringen am Kaiserstuhl 1851, Pfarrer in Ihringen und Nußloch 1851–1867, Pfarrer in Korbach seit 1867.
Zu diesem Konflikt um die Verwendung von Luthers Kleinen Katechismus kam ein Konflikt um Bibelstunden am Sonntagabend und um die Feier der Abendmahlsliturgie nach der alten badischen lutherischen Agende. Für die Abendmahlsliturgie war die Unionsagende vorgeschrieben. Versammlungen nach Sonnenuntergang waren generell verboten, eine Folge der Niederschlagung der Revolution von 1848. Eichhorn hielt allerdings gerade um der öffentlichen Ordnung willen und um eines Zurückdrängens des Revolutionsgeistes willen Bibelstunden für hilfreich. Er war konservativ gesinnt und hielt die Revolution für falsch und unchristlich. Von den Revolutionstruppen war er verhaftet worden, weil er für den Großherzog eingetreten war. Die Konflikte mit seiner Kirchenleitung lösten bei Eichhorn eine Gewissenskrise bezüglich seiner kirchlichen Stellung aus. Er fragte sich, ob er mit seinen Überzeugungen in der unierten badischen Kirche richtig war. Im November 1850 legte Eichhorn sein Pfarramt nieder und erklärte seinen Austritt aus der Landeskirche. Er begründete das mit der Bindung an das evangelisch-lutherische Bekenntnis, die 5 ihm zunehmend wichtig geworden war. Daraufhin wurde er des Ortes verwiesen und zog mit seiner Familie nach Durlach bei Karlsruhe. Auf Vermittlung durch den Straßburger Pfarrer Friedrich Horning wurde Eichhorn zu Vorträgen ins badische Oberland eingeladen. Infolgedessen bildete sich im Frühjahr 1851 in Ihringen im Kaiserstuhl eine erste, von der Landeskirche separierte kleine lutherische Gemeinde. Eichhorn schloss sich daraufhin der „Evangelisch-Lutherischen Kirche in Preußen“ an, um eine ordentliche Vokation für 5
Vgl. Werner Klän und Gilberto da Silva (Hrsg.), Quellen zur Geschichte selbstständiger evangelisch-lutherischer Kirchen in Deutschland (Oberurseler Hefte Ergänzungsband 6), Göttingen 2 2010, 147–183, Dokument 50.
Frank Martin Brunn
27
die Arbeit in Ihringen zu erhalten. Die „Evangelisch-Lutherische Kirche in Preußen“ war aus einer Separation von der preußischen Unionskirche in den 1830er Jahren hervorgegangen. Im Sommer des Jahres 1851 separierten sich in Nußloch einige Mitglieder von Eichhorns früherer Kirchengemeinde und bildeten ebenfalls eine kleine lutherische Gemeinde. Die beiden Gemeinden in Ihringen und Nußloch wurden hinfort von Eichhorn betreut. Sie gehörten der Generalsynode der „Evangelisch-Lutherischen Kirche in Preußen“ an.6 Anfang des Jahres 1855 legte August Wilhelm Ludwig in Söllingen bei Karlsruhe sein Pfarramt nieder und trat aus der Landeskirche aus. Auch er war mit Unionsagende und Landeskatechismus unzufrieden und suchte wie Eichhorn die Bindung an die Bekenntnisschriften der lutherischen Reformation. Wie Eichhorn war auch er von den Revolutionären 1849 wegen seines Eintretens für den Großherzog verhaftet worden. In Folge seines Austritts bildeten sich separierte Gemeinden in Söllingen und im benachbarten Berghausen. Im Frühjahr 1855 wurde in Ispringen bei Pforzheim Georg Friedrich Haag durch den Evangelischen Oberkirchenrat der Landeskirche abgesetzt. Haag hatte im Katechismusstreit in den 1830er Jahren zum Kreis um Alois Henhöfer gehört, der gegen die rationalistische Theologie Position bezog. Seit 1853 hatte Haag erfolglos versucht, innerhalb der unierten Landeskirche seine Gemeinde konfessionell-lutherisch auszurichten und deswegen auch Petitionen an den Oberkirchenrat und das Innenministerium gerichtet. Seiner Absetzung vorausgegangen waren mehrere Abmahnungen wegen seiner Abendmahlspraxis, die an der Agende der früheren lutherischen Kirche Badens orientiert war. In Folge der Absetzung Haags bildeten sich in Ispringen und den Orten in der Umgebung ebenfalls eine separierte lutherische Gemeinde, mit anfangs 800 Mitgliedern, die größte seit der Separation Eichhorns. Der badische Staat ging von Anfang an mit polizeilichen Maßnahmen gegen die lutherischen Geistlichen vor, um die Separation einzudämmen und um so genannte Proselytenmacherei zu verhindern. Nach den Revolutionskriegen von 1848/49 fürchtete man neue Unruhen. Darum wurde die Bewegungsfreiheit der lutherischen Geistlichen eingeschränkt, Versammlungen wurden verboten, Gottesdienste wurden aufgelöst, Eichhorn und Ludwig wurden mehrfach inhaftiert, unter Hausarrest gestellt und mit Geldstrafen belegt. Haag wich dieser Situation im Sommer 1855 aus, indem er an das „Evangelische Missionshaus“ der unierten preußischen Landeskirche in Berlin wechselte. Bald darauf trat er in die „Evangelisch-Lutherische Kirche in Preußen“ ein und wurde Pfarrer in Stolp in Pommern. Seinen ausgetretenen Gemeindegliedern in Ispringen vermittelte Haag den unions-lutherischen preußischen Pfarrer Rohde. Einen unions-lutherischen Pfarrer nach Ispringen zu bringen, war von Haag als 6
Vgl. a.a.O., Dok. 51.
28
Die „Evangelisch-lutherische Kirche in Baden“
Vermittlungsversuch und alternative Strategie zum Wirken von Eichhorn und Ludwig gedacht. Aber nach knapp einem Jahr Tätigkeit gab Rohde auf. Seine Tätigkeit war geprägt durch staatliche Einschränkungen und Konflikte in den Ortschaften um Gottesdienstbesuche, Taufen, Kinderunterricht, Trauungen und Beerdigungen. Rund die Hälfte der in Ispringen und Umgebung Ausgetretenen kehrte während Rohdes Tätigkeit in die Landeskirche zurück. Enttäuscht ging Rohde nach Preußen zurück. Nach etlichen Bittgesuchen und Eingaben an die badische Regierung erteilte das Staatsministerium im November 1856 schließlich den Pfarrern Eichhorn und Ludwig unter erheblichen Auflagen die Duldung zur Betreuung der separierten lutherischen Gemeinden. Das Innenministerium hatte schon anlässlich der Generalsynode 1855 den Oberkirchenrat gedrängt, die lutherische Separation zu ordnen. Doch der Oberkirchenrat hoffte, der Separation durch Reformen der Generalsynode den inhaltlichen Nährboden zu entziehen und durch äußeren Druck ihre Mitglieder zu zermürben. Diesen Weg war allerdings das Innenministerium im November 1856 nicht mehr bereit zu unterstützen. Es hatte diplomatische Anfragen bezüglich des Umgangs mit der lutherischen Separation aus Preußen und Sachsen gegeben. Vor allem aber hatte der zeitgleiche massive Konflikt mit dem Freiburger Erzbischof Herrmann von Vicari und dem Papst, der als „Badischer Kulturkampf“ in die Geschichtsbücher eingegangen ist, zu einem Wechsel an der Spitze 7 des Innenministeriums geführt. Prinzregent Friedrich, der an Stelle des Großherzogs die Regierungsgeschäfte führte, bildete das Regierungskabinett um. Den separierten Lutheranern kam diese Kurskorrektur zugute. Nach weiterer Verhandlung Anfang des Jahres 1857 wurde die gesamte bisherige Praxis der kleinen Gemeinden legalisiert. Um der so genannten Proselytenmacherei zu wehren, mussten sie aber dennoch verschiedene Einschränkungen hinnehmen, z.B. eine Begrenzung der Größe des Gottesdienstlokales. Damit glich ab 1857 der Rechtsstatus der lutherischen Separation in Baden dem einer geduldeten Religionsgemein8 schaft. Im Herbst 1857 schlossen sich die lutherischen Gemeinden der „EvangelischLutherischen Kirche in Preußen“ an und wurden in zwei Pfarrbezirke eingeteilt, Ispringen und Durlach. Zum Pfarrbezirk Durlach gehörten neben Gottesdienstorten in der näheren Umgebung auch Ihringen. Die separierte lutherische Gemeinde in Ispringen berief im Frühjahr 1858 Max Frommel als ihren Pfarrer. Max Frommel ist der zwei Jahre jüngere Bruder von Emil Frommel9, dem Henhöfer-Biographen. Sein Vater, Karl-Ludwig Frommel, war Professor an der Großherzoglichen Malerakademie und großherzoglich badischer 7 8 9
2
Vgl. auch Annette Borchardt-Wenzel, Kleine Geschichte Badens, Regensburg 2016 , 107–110. Vgl. Klän/da Silva, Quellen (wie Anm. 5), Dok. 52 und 53. Vgl. Gerhard Schwinge, Emil Frommel (1828–1896), in: ders., Lebensbilder aus der Evangelischen Kirche in Baden im 19. und 20. Jahrhundert, Bd. V: Kultur und Bildung, Heidelberg u.a. 2007, 77–99.
Frank Martin Brunn
29
Galeriedirektor in Karlsruhe. Die Mutter, Henriette Frommel10, war seit Mitte der 1830er Jahre eine führende Persönlichkeit bei der Gründung von Anstalten der Inneren Mission in Karlsruhe. Max Frommel studierte in Halle, Leipzig und Erlangen Theologie. Durch Vorlesungen bei Adolf von Harleß in Leipzig wurde sein konfessionelles Bewusstsein geweckt. Während seines Theologiestudiums trat er gemeinsam mit seiner Mutter in die „Evangelisch-Lutherische Kirche in Preußen“ über. Seine erste Pfarrstelle trat er 1854 in Reinswalde in Schlesien an. Vier Jahre später, 1858, kehrt er nach Baden zurück und wurde Pfarrer in Ispringen.
Max Frommel, *1830, †1890, Übertritt zur „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“ 1852, Hilfsprediger (Vikar) in Liegnitz/Schlesien, 1854 Pfarrer in Reinswalde/Schlesien, 1858–1880 Pfarrer in Ispringen/Baden, 1865 Trennung von der zur „EvangelischLutherischen Kirche in Preußen“ und Gründung der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Ispringen, 1871 Gründung der „Vereinigten evangelisch-lutherischen Gemeinden im Großherzogtum Baden“, 1880 Generalsuperintendent in Celle (Landeskirche Hannovers).
Weitere vier Jahre später kehrte Haag aus Stolp in Pommern zurück. Er gründete 1862 auf dem bei Remchingen in der Nähe von Pforzheim gelegenem Sperlingshof eine separierte lutherische Gemeinde. Frommel gelang es, 1867 in Karlsruhe und 1869 in Freiburg je eine separierte lutherische Kirchengemeinde zu gründen. Alle diese Gemeinden bestehen bis heute. 1876 wurde in Baden-Baden ein von Ispringen aus betreuter Gottesdienstort eingerichtet. Die Anfangsjahre der neuen lutherischen Kirchengemeinden im Großherzogtum Baden waren nicht nur durch staatliche Restriktionen geprägt, sondern auch 10
Vgl. Gerhard Schwinge, Henriette Frommel (1801–1865), in: ders. (Hg.), Lebensbilder aus der evangelischen Kirche in Baden, Band IV: Erweckung/Innere Mission/Diakonie/Theologinnen, Karlsruhe 2015, 184–201.
30
Die „Evangelisch-lutherische Kirche in Baden“
von Konflikten zwischen den Pfarrern und Teilen der Gemeinden. Haag wurde sich mit Eichhorn und Frommel über Pfarrbezirk übergreifende Kompetenzen der Pfarrer nicht einig. Zudem kritisierte er Eichhorns zurückhaltende Zulassungspraxis beim Abendmahl. Auch die von Eichhorn eingerichtete Anbindung der badischen Gemeinden an die „Evangelisch-Lutherische Kirche in Preußen“ missfiel ihm. Als Anfang der 1860er Jahre ein Konflikt innerhalb der „Evangelisch-Lutherischen Kirche in Preußen“ zur Spaltung führte und die „Immanuelsynode“ entstand, sagte sich Haag im Sommer 1862 vom Breslauer Oberkirchenkollegium der „Evangelisch-Lutherische Kirche in Preußen“ los. Eichhorn wollte diesen Bruch nicht mitvollziehen und auch für Frommel kam er zu schnell. So kam es zur Trennung zwischen Haag auf der einen und Eichhorn und Frommel auf der anderen Seite. Ludwig war von diesen Entwicklungen völlig irritiert. Außerdem war er unzufrieden mit seiner persönlichen Situation. Darum kehrte er in dieser Zeit in die Landeskirche zurück. Auch zwischen Eichhorn und Frommel gab es Differenzen. Die erheblichste betraf die schon von Haag kritisierte Unterstellung der badischen Gemeinden unter das Oberkirchenkollegium der „Evangelisch-Lutherischen Kirche in Preußen“ in 11 Breslau. Frommel legte seine Position im Sommer 1862 in einer Denkschrift dar. Im Frühjahr 1865 war schließlich auch Frommel zum Bruch mit dem Oberkirchenkollegium in Breslau bereit und gründete eine selbstständige evangelischlutherische Kirchengemeinde in Ispringen. Daraufhin wurde er durch das Oberkirchenkollegium seines Amtes enthoben, wie drei Jahre zuvor auch schon Haag.12 Da Eichhorn Frommels Schritt in die badische Selbstständigkeit nicht mit vollziehen wollte, sondern an der Bindung an das Breslauer Oberkirchenkollegium festhielt, kam es auch zwischen Eichhorn und Frommel zum Bruch. So waren drei separierte lutherische Gruppierungen in Baden entstanden, denn Frommel vereinigte sich auch nicht wieder mit Haag. Die drei lutherischen Gruppierungen pflegten keine Kirchengemeinschaft miteinander. Diese Situation, insbesondere die Trennung zwischen Eichhorn und Frommel sowie Eichhorns Festhalten an der Verbindung mit der „Evangelisch-Lutherischen Kirche in Preußen“, war in den separierten Gemeinden nur schwer zu vermitteln. Darum wendeten sich in Eichhorns Gemeinden etliche Gläubige von Eichhorn ab und schlossen sich Frommel an. So kam es, dass Eichhorn sich nicht mehr halten konnte. 1866 nahm er einen Ruf aus Waldeck in die zur „Evangelisch-Lutherischen Kirche in Preußen“ gehörende Gemeinde in Korbach und Umgebung an. 1871 gaben sich Frommels Gemeinden als „Vereinigte evangelisch-lutherische Gemeinden im Großherzogtum Baden“ eine Kirchenordnung, die sie in synodaler 13 Weise verfasste. Auf Grund der theologischen und kirchenrechtlichen Konkurrenz der Gemeinden zur unierten, mit dem badischen Staat verbundenen Landes11 12 13
Vgl. Klän/da Silva, Quellen (wie Anm. 5), Dok. 54. Vgl. a.a.O., Dok. 55–57. Vgl. a.a.O., Dok. 58.
Frank Martin Brunn
31
kirche, konnten die Gemeinden als Vereinigung erst nach dem Ersten Weltkrieg im August 1919 die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erlangen. Haag starb 1875 auf dem Sperlingshof. Frommel nahm 1880 den Ruf als Superintendent nach Celle in die Landeskirche Hannovers an. Damit waren alle Gründer der Separation abgetreten. 1903 wurde die Kirchenordnung revidiert und endlich auch die Trennung zwischen den Eichhorn’schen und den Frommel’schen Gemeinden überwunden. Das Oberkirchenkollegium der „Evangelisch-Lutherischen Kirche in Preußen“ und die „Evangelisch-Lutherische Synode im Großherzogtum Baden“ unterzeichneten einen Vertrag über die Wiederaufrichtung von Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft. 1919 wurde die Evangelisch-Lutherische Synode auf Grundlage der neuen badischen Verfassung und der Weimarer Reichsverfassung als Körperschaft öffentlichen Rechts anerkannt. 1921 schloss sich die von Haag gegründete Gemeinde auf dem Sperlingshof der Evangelisch-Lutherischen Synode im Großherzogtum Baden an. 1926 erneuerte die Evangelisch-Lutherische Synode in Baden ihre Kirchenordnung und änderte den Namen zu „Badische Evangelisch-Lutherische Freikirche“.
3.3 Ökumenische Beziehungen der lutherischen Gemeinden im 20. und 21. Jahrhundert Als nach dem Zweiten Weltkrieg 1947 die „Evangelische Kirche in Deutschland“ (EKD) gegründet wurde, reagierten einige der lutherischen Freikirchen in Deutschland darauf mit einem lockeren Zusammenschluss zur so genannten alten „Selbständigen evangelisch-lutherischen Kirche“ (alte SelK). Ihr traten die badischen Lutheraner 1948 als badische Diözese, „Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden“, bei. Mit dem kirchenpolitischen Kurs der alten SelK waren sie aber bald nicht mehr einverstanden, insbesondere mit deren Haltung gegenüber den lutherischen Landeskirchen. Die badische Diözese erlebte sich als lutherische Diaspora in einem unierten Umfeld. An einer Abgrenzung gegen lutherische Landeskirchen, wie sie die alte SelK vollzog, war ihr nicht gelegen. 1965 beschloss die Synode der „Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden“, aus dem Verband der alten SelK auszuscheiden und sich selbständig zu verfassen, um eigenständig Gespräche mit der Verei14 nigten Evangelisch-Lutherischen Kirche (VELKD) führen zu können. Seitdem ist die „Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden“ (ELKiB) selbständig. Mit der VELKD wurde 1965 die Vereinbarung getroffen, dass der Superintendent der ELKiB als „ständiger Gast“ an der Bischofskonferenz der VELKD teilnimmt. Nach der Anerkennung der „Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden“ als Körperschaft des öffentlichen Rechts ergab sich die von der Landeskirche nach 14
Vgl. a.a.O., Dok. 59.
32
Die „Evangelisch-lutherische Kirche in Baden“
dem Territorialprinzip geordnete Kirchenmitgliedschaft als der zentrale Konfliktpunkt zwischen beiden Kirchen. Zog ein evangelisches Kirchenmitglied aus dem Gebiet einer lutherischen Landeskirchen in das Gebiet der badischen Landeskirche, trat es automatisch in die unierte Landeskirche ein. Nach dem Verständnis der separierten Lutheraner durfte aber nicht das landeskirchliche Territorium ausschlaggebend für die neue Kirchenzugehörigkeit sein, sondern ausschlaggebend für die Kirchenzugehörigkeit sollte das Bekenntnis der Herkunftskirche sein. 1962 wurde in dem Abschluss der „Vereinbarung über Kirchenmitgliedschaft und Kirchensteuerpflicht“ zwischen der badischen Landeskirche und der ELKiB mit einer Widerspruchsregelung ein einvernehmliche Vereinbarung in dieser Sache gefunden. Durch die Kirchensteuerurteile des Bundesverfassungsgerichts von 1965 wurde diese in kirchensteuerrechtlicher Hinsicht präzisiert. Das Bundesverfassungsgericht sprach den Kirchen den Charakter von Gebietskörperschaften ab. 1993 wurde die Vereinbarung über Kirchenmitgliedschaft und Kirchensteuerpflicht zwischen Landeskirche und ELKiB erneuert. Seit Ende der 1960er Jahre strebte die ELKiB auch die Aufnahme in den „Lutherischen Weltbund“ (LWB) an. Zu dieser Zeit war der „Lutherische Weltbund“ noch ein auf Bekenntnisbindung gebauter Bund ohne verfassungsrechtlich geordnete Kirchengemeinschaft der darin organisierten Kirchen. Als im Rahmen des Aufnahmeverfahrens der Evangelische Oberkirchenrat der badischen Landeskirche um eine Stellungnahme gebeten wurde, äußerte dieser den Wunsch, dass anstatt der Aufnahme der ELKiB in den Lutherischen Weltbund die bestehenden Kontakte zur Landeskirche intensiviert werden sollten. Im August 1968 erfolgte dennoch der Beschluss des Exekutiv-Komitees des Lutherischen Weltbundes, die 15 ELKiB aufzunehmen, im August 1969 trat er in Kraft. 1972 gründete sich als Zusammenschluss der alten SelK mit anderen lutherischen Freikirchen die „Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche“ (SELK). Die ELKiB schloss sich nicht an, sondern pflegte die Verbindung zu den evangelischlutherischen Landeskirchen. 1973 war sie Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Baden-Württemberg. Die Annäherung der lutherischen und der reformierten Tradition in Deutschland begleitete die ELKiB dennoch weiterhin kritisch. Als Reaktion auf die Leuenberger Konkordie verabschiedete die Synode der ELKiB im Sommer 1975 eine Entschließung, in der sie auf das ungeklärte Verhältnis der Konkordie zu den evangelisch-lutherischen Bekenntnisschriften hinwies und die Bekenntnisschriften als 16 Grundlage für Kirchengemeinschaft benannte. Diese Position teilten in ihrer Ausschließlichkeit die Mehrzahl der im Lutherischen Weltbund verbundenen Kirchen nicht. Deshalb wollte die ELKiB die Erklärung von Kirchengemeinschaft in der Souveränität der Synoden wissen. Als der Lutherische Weltbund 1990 in Curi-
15 16
Vgl. a.a.O., Dok. 60. Vgl. a.a.O., Dok. 61.
Frank Martin Brunn
33
tiba seine Verfassung änderte und die Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft der Mitgliedskirchen festschrieb, legte die ELKiB Anfang des Jahres 1991 gemeinsam mit den lutherischen Kirchen von Dänemark und Madagaska Widerspruch ein.17 – War die Nähe der ELKiB zur SELK also doch größer als zu den lutherischen Landeskirchen? Anfang der 1980er Jahre näherten sich die SELK und die ELKiB einander an. Nach einer „Gemeinsamen Erklärung“ am 10. März 1981 kam ein synodaler Prozess in Gang, der mit Synodalbeschlüssen der ELKiB am 20. März 1982 in Freiburg und der SELK am 14. September 1983 in Allendorf/Lumda das Bestehen der Kirchengemeinschaft zwischen beiden Kirchen feststellte. Es entstand eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden in Süddeutschland, insbesondere im Bereich von Jugendarbeit und Kirchenmusik. Aber es blieben auch Differenzen. Am deutlichsten wurden diese in der Amtstheologie deutlich. 1994 führte die Synode der ELKiB die Ordination von Frauen 18 zum Pfarramt ein. Obwohl zunächst keine Frau eine Pfarrstelle in der ELKiB übernahm, führte das zu neuen erheblichen Irritationen im Verhältnis zur SELK. Die SELK diskutiert diesen Schritt seit ihrer Gründung 1972 kontrovers, aber hat ihn bisher nicht vollzogen.19 Die Irritationen nahmen erneut zu, als die Erlöserkirchengemeinde der ELKiB in Freiburg 2011 erstmals eine Pfarrerin berief, Cornelia Hübner (*1958). Anlässlich des 175-jährigen Unionsjubiläums der badischen Landeskirche 1996 wurden Gespräche zwischen der Landeskirche und der ELKiB geführt mit dem Ziel, die bestehenden Beziehungen zwischen beiden Kirchen zu festigen und zu vertiefen. Aus den Gesprächen resultierte eine „Gemeinsame Erklärung“, die im Herbst 1996 in Karlsruhe unterzeichnet wurde. Darin erklären beide Kirchen, die Kooperationen beim schulischen Religionsunterricht, in der Seelsorge und bei Amtshandlungen weiter auszubauen. Außerdem erklären beide Kirchen eucharisti20 sche Gastbereitschaft und Gastfreundschaft bei der Feier des Abendmahls. Die Leuenberger Konkordie und die Verfassungsänderung des Lutherischen Weltbundes in Curitiba waren ökumenische Anlässe gewesen, das eigene lutherische Profil zu betonen, ebenso auch die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ (GER) zwischen Lutherischen Weltbund und Römisch-Katholischer Kirche 1998. Als der Lutherische Weltbund seinen Mitgliedskirchen die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ zur Ratifikation vorlegte, erklärte die Synode der ELKiB,
17 18 19 20
Vgl. a.a.O., Dok. 62. Vgl. a.a.O., Dok. 63. Vgl. a.a.O., Dok. 64 und 65. Vgl. a.a.O., Dok. 66.
34
Die „Evangelisch-lutherische Kirche in Baden“
dass und warum aus ihrer Sicht ein Konsens noch nicht erreicht sei.21 Sie lag mit ihrer Kritik auf der Linie etlicher deutscher Theologieprofessoren.22 2012 befasste sich die Synode der ELKiB erneut mit der Leuenberger Konkordie. Nach ausführlicher theologischer und kirchenpolitischer Diskussion fand sich jedoch keine Mehrheit für die Annahme der Konkordie und einer damit verbundenen Änderung der Grundordnung der ELKiB. Die ökumenische Verbundenheit der ELKiB wurde anlässlich des gewaltsamen Todes von Superintendent Christof Schorling (1959–2014) sehr deutlich. Sie zeigte sich in einer breite Anteilnahme von vielen Seiten, in der zum Ausdruck kam, wie sehr Schorling in der Ökumene geschätzt wurde. Die ELKiB umfasst heute sechs Gemeinden. Neben den genannten Gemeinden in Ispringen, Karlsruhe, Freiburg und Baden-Baden sind dies Gemeinden in Pforzheim sowie Lörrach und Steinen.
21 22
Vgl. a.a.O., Dok. 67. Vgl. Votum der Hochschullehrer zur Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre, in: epdDokumentationen 7/1998, 1–4; Stellungnahme theologischer Hochschullehrer zur geplanten Unterzeichnung der Gemeinsamen Offiziellen Feststellung zur Rechtfertigungslehre, in: epd-Dokumentationen 45/1999, 23.
4. Die „Evangelisch-Lutherische Freikirche“ (in Sachsen und anderen Staaten) Gottfried Herrmann Die älteste Wurzel der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ (in Sachsen und anderen Staaten) liegt im Herzogtum Nassau. Hier vollzog Friedrich Brunn 1846 den Austritt aus der 1817 eingeführten Union, durch Gutachten von Adolf von Harleß und enge Verbindung mit Wilhelm Löhe zu diesem Schritt ermutigt. Er schloss sich zunächst der „Evangelisch-lutherische Kirche in Preußen“ an1, löste die Verbindung jedoch im Zusammenhang mit dem Streit um Kirche und Kirchenregiment. Daraufhin wurde er vom Oberkirchenkollegium seines Amtes enthoben. Unterstützung fand er dann bei Carl Ferdinand Wilhelm Walther und der nordamerikanischen „Missouri-Synode“, für die er im Steedener Proseminar Zöglinge heranbildete.2
Carl Ferdinand Wilhelm Walther, *1811, †1887, Pfarrer in Bräunsdorf bei Penig/Sachsen 1836–1838, mit Martin Stephan in die USA ausgewandert 1838, Pfarrer in Perry County, 1839–1841, Pfarrer in St. Louis/Missouri 1841–1887, 1. Allgemeiner Präses der „Missouri-Synode“ (heute: „Lutheran Church–Missouri Synod“ [LCMS]) 1847–1850; 1864–1878.
Im Königreich Sachsen richtete sich der Protest bekenntnistreuer Lutheraner zuallererst gegen die Zulassung von Unierten zum Abendmahl in der nominell 1 2
Vgl. S. 11–19. Vgl. dazu auch Christoph Barnbrock, Die Predigten C.F.W. Walthers im Kontext deutscher Auswanderergemeinden in den USA. Hintergründe – Analysen – Perspektiven, Hamburg 2003.
36
Die „Evangelisch-Lutherische Freikirche“ (in Sachsen und anderen Staaten)
lutherischen Landeskirche, allerdings vergeblich. In den 1860er Jahren wurde der sozialdiakonisch orientierte „Verein evangelisch-lutherischer Glaubensgenossen“ in Dresden zum Sammelbecken bekenntnisbewusster Lutheraner. Seit 1868 organisierten sie sich an verschiedenen Orten als „Lutheranervereine“ und wurden mit mehreren Eingaben beim Kultusministerium vorstellig, ohne jedoch zufrieden stellende Antworten zu erhalten. Die unnachgiebige Haltung des Ministeriums führte im Jahre 1871 schließlich zu Austritten aus der sächsischen Landeskirche. Aktuellen Anlass für diese Konsequenz war die Abschwächung des Religionseides (Ordinationsverpflichtung) durch die Landessynode. Die so entstandenen Gemeinden beriefen Carl Friedrich Theodor Ruhland zu ihrem Pastor. Andere Pastoren schlossen sich in den folgenden Jahren der selbstständigen lutherischen Gemeinden an.
Karl Georg Stöckhardt, *1842, †1913, Diakonus in Planitz 1873–1876, Übertritt zur „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ 1876, zweiter Pfarrer der separierten evangelischlutherischen St. Johannisgemeinde in Planitz 1876–1878, Pfarrer der Heilig-KreuzGemeinde in St. Louis/Missouri 1878–1887, Professor am Concordia-Seminar der Missouri-Synode in St. Louis 1887–1913.
In einem zweiten Zug führte Karl Georg Stöckhardt im Zusammenhang mit der Zivilstandsgesetzgebung 1875/76 eine Auseinandersetzung mit dem Landeskonsistorium, die mit seiner Beurlaubung und Amtsniederlegung endete. Fast gleichzeitig sahen sich vier Missionare, nach vergeblichen Versuchen, die Leitung der Leipziger Mission zur tatsächlichen Anwendung der Bekenntnisbindung in Ausbildung und Praxis zu bewegen, zum Austritt aus der Mission genötigt3. Unter Anschluss der 3
Vgl. Werner Klän und Gilberto da Silva (Hrsg.), Quellen zur Geschichte selbstständiger evangelisch-lutherischer Kirchen in Deutschland, Oberurseler Hefte Ergänzungsband 6, Göttingen 2010, Dok. 151 und 152, 416–418; vgl. ebenfalls Dok. 125, 127 in: Manfred Roensch und Werner Klän (Hrsg.), Quellen zur Entstehung und Entwicklung selbständiger evangelisch-lutherischer Kirchen in Deutschland, Frankfurt a.M./Bern/New York 1987, 419–423; 429–434. 2
Gottfried Herrmann
37
selbstständigen Lutheraner in Nassau wurde im Jahre 1876/77 die „EvangelischLutherische Freikirche in Sachsen und anderen Staaten Deutschlands“ mit einer eigenen Synodalordnung gegründet, in der das Laienelement besonders zu Geltung kam. Weitere Auseinandersetzungen im Raum der Leipziger Mission4 in der ersten Hälfte der 1890er Jahre führten zu einer erneuten Austrittsbewegung, die ebenfalls Anschluss an die Evangelisch-Lutherische Freikirche fand. Später gliederten sich die Hermannsburger evangelisch-lutherische Freikirche und selbstständige lutherische Gemeinden in Süddeutschland, Ostpreußen und Thüringen an. Die aus der Reorganisation der 1945 aufgelösten „Evangelisch-lutherischen Freikirche in Polen“ hervorgegangenen Gemeinden im Osten Deutschlands bildeten 1953 den „Diaspora-Bezirk“ der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ (der bis 2002 bestanden hat).
Zwickau-Planitz, St. Johanneskirche, erbaut 1879 auf dem Grundstück des Heckelschen Gutes in Niederplanitz, durch Kauf erworben 1871, zweiter Kirchbau der Gemeinde. Die erste Kirche (eine umgebaute Scheune) dient seither als Gemeindeheim.
Die Evangelisch-Lutherische Freikirche (ELFK) ist eine Kirche, die – bedingt durch ihre Entstehung im Bereich einer nominell lutherischen Landeskirche – von Anfang an großen Wert darauf gelegt hat, dass nicht nur die formal-rechtliche (de iure) Geltung des Bekenntnisses für die Einschätzung des Bekenntnisstandes einer Kirche ausschlaggebend sein kann, sondern ihr tatsächlicher Zustand (de facto). Andere selbstständige lutherische Kirchen (z.B. die preußischen „Altlutheraner“) 4
Vgl. Roensch/Klän a.a.O., Dok. 128, 129 a. a. O., 435–441 sowie Klän/da Silva a.a.O. Dok. 227 und 228, 579–582.
38
Die „Evangelisch-Lutherische Freikirche“ (in Sachsen und anderen Staaten)
haben lange Zeit im Wesentlichen den de-jure-Standpunkt eingenommen. Die fehlende Übereinstimmung in dieser Grundsatzfrage hat jahrzehntelang eine Einigung zwischen den verschiedenen lutherischen Freikirchen in Deutschland verhindert. Umso überraschender war, dass nach 1945 eine relativ schnelle Einigung zwischen der ELFK und der Evangelisch-lutherischen Kirche im früheren Altpreußen, ab 1954 Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche, zustande kam. Die Überwindung der bisherigen Differenzen wurde in den „Einigungssätzen“ von 19485 dokumentiert. Vorausgegangen war der sich abzeichnende Zusammenschluss aller evangelischen Landeskirchen Deutschlands unter dem Dachverband der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKiD). Damit hatten die lutherischen Landeskirchen auch formal die exklusive Geltung des lutherischen Bekenntnisses aufgegeben. Die selbstständigen lutherischen Kirchen nahmen zu diesem Vorgang in einer gemeinsamen Erklärung vom 31.10.1948 Stellung.6 Sie sahen sich nun alle nicht mehr in der Lage, die Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft mit den lutherischen Landeskirchen fortzusetzen (sofern sie überhaupt noch bestand). In den Jahren 1948/49 kam es dann auch zu Einigungsverhandlungen zwischen der „alten“ Selbständigen evangelisch-lutherischen Kirche (alte SelK) und der ELFK. Die alte SelK war 1947/48 durch den Zusammenschluss von fünf selbstständigen lutherischen Kirchen in Hessen, Niedersachsen und Baden entstanden. Einen Eckpfeiler der Einigung mit der ELFK bildete die positive Stellungnahme der alten SelK zu den Einigungssätzen. Die Diözesen der alten SelK erklärten am 7.4.1949 gemeinsam, dass „sie in denselben nichts finden, was gegen Schrift und Bekenntnis verstößt oder inhaltlich über dieselben hinausgeht“. Geklärt werden konnte in gemeinsamen Verhandlungen der zum Teil unterschiedliche Gebrauch der Begriffe „Berufung“ (vocatio) und „Ordination“. Als größte Schwierigkeit erwies sich die Frage nach dem Verhältnis der alten SelK zur Hermannsburger Mission. Die „Hermannsburg-Hamburger evangelischlutherische Freikirche“ (jetzt eine Diözese der alten SelK) stand traditionell in enger Verbindung zur Hermannsburger Mission. Man betrachtete die Mission als neutrales Terrain, auf dem Mitglieder von Landeskirche und Freikirche ohne Einschränkung zusammenarbeiteten. Details waren in Verträgen von 1889/90 und 1924 geregelt worden. Dies konnte nach der Gründung der EKiD (1948) nicht so bleiben, weil die Landeskirche Hannovers damit auch formal einen unionistischen Standpunkt eingenommen hatte. Es wurde unumgänglich, sich auf die neue Lage einzustellen. Die selbstständigen lutherischen Kirchen (inkl. der alten SelK) hatten ihre Ablehnung gegenüber der EKiD als Unionskirche deutlich zum Ausdruck gebracht. Angesichts der historisch gewachsenen Verbindungen hielt man in Hermannsburg eine sofortige Aufgabe der freikirchlichen Mitarbeit in der Mission für undurchführbar. Man erklärte aber, dass durch den EKiD-Anschluss die ursprüng-
5 6
Vgl. Klän/da Silva, a.a.O, Dok. 243, 612–617. A.a.O., Dok. 237, 598–602.
Gottfried Herrmann
39
lich angenommenen Voraussetzungen (von 1890) nicht mehr gegeben seien. Die ELFK erklärte sich durch ihre Verhandlungsführer bereit, diese Haltung als Proteststatus (status confessionis) zu werten, der vorübergehend möglich ist und auf eine endgültige Klärung abzielt. Unter diesen Voraussetzungen erklärte sich die ELFK am 24.11.1949 zur Aufrichtung der Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft gegenüber der alten SelK bereit. Durch die Aufrichtung von Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft zwischen allen bestehenden selbstständigen lutherischen Kirchen in Deutschland während der Jahre 1948/49 eröffnete sich die Möglichkeit, auf einen organisatorischen Zusammenschluss dieser Kirchen hinzuarbeiten. Dieses Unternehmen wurde in den 1950er und 1960er Jahren in mehreren Phasen vorangetrieben. Dabei gab es zwischenzeitlich erhebliche Rückschläge: 1.
2.
3.
1959 ließ sich ein Pastor der alten SelK (Hans-Otto Harms) zum Kondirektor der Hermannsburger Mission wählen. Dies geschah mit Billigung seiner Kirchenleitung. Die ELFK konnte in diesem Schritt nur ein Zurückgehen hinter die 1948/49 gemachten Zusagen der alten SelK sehen, die zur Aufrichtung der Kirchengemeinschaft geführt hatten. Die ELFK wandte sich deshalb 1962 mit einem „Brüderlichen Wort“ an die Schwesterkirche. Trotzdem zogen sich die Verhandlungen über Jahre hin. Erst im unmittelbaren Vorfeld der Fusion (1970), wurde durch die alte SelK signalisiert, dass man vorhabe, nun die Verbindung zur Hermannsburger Mission ganz aufzugeben. Wie die letzten Jahre gezeigt haben, sind aber bis zur Gegenwart keine praktischen Konsequenzen daraus gezogen worden. 1965 schied die Badische Diözese aus der alten SelK aus und konstituierte sich wieder als „Evangelisch-lutherische Kirche in Baden“. Anschließend wurde die Kirchengemeinschaft mit lutherischen Landeskirchen („Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche in Deutschland“, VELKD) wieder aufgerichtet. Dadurch kam es zum Abbruch der Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft mit den übrigen selbstständigen lutherischen Kirchen. (1983 erklärte die neue SELK die Kirchengemeinschaft mit der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Baden“ als bestehend.) 1958 fasste außerdem die Generalsynode der „Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche“ den Beschluss, in Verhandlungen mit den lutherischen Landeskirchen (VELKD) einzutreten mit dem Ziel, die Kirchengemeinschaft wieder aufzurichten. Dies sorgte für erhebliche Irritationen in der ELFK. 1962 nahm die nächste Generalsynode diese Entscheidung zurück und eröffnete damit wieder den Weg für eine Fusion der selbstständigen lutherischen Kirchen. In diesen Jahren stießen vor allem die Einigungssätze von 1948 immer wieder auf Kritik innerhalb der Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche. Man empfand sie als Einengung und Behinderung bei weiterer theologischer Arbeit. Umstritten war auch ihr Stellenwert als Maßstab für Lehrzucht, da sie (von allen selbstständigen lutherischen Kirchen) nicht in die Bekenntnisverpflichtung bei der Ordination eingeschlossen wurden. Diese Diskussionen führten dazu, dass die ELFK eine erneute Bestätigung der Verbindlichkeit der Einigungssätze zur
40
Die „Evangelisch-Lutherische Freikirche“ (in Sachsen und anderen Staaten)
Vorbedingung für die geplante Fusion der selbstständigen lutherischen Kirchen machte. Diesem Anliegen entsprach die „Gemeinsame Erklärung zur Verbindlichkeit der Einigungssätze“ von 1968, die sowohl von der ELFK als auch von der Generalsynode der Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche verabschiedet wurde. Damit stand im Westen Deutschlands einer Fusion fast aller lutherischen Freikirchen (abgesehen von der „Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden“) nichts mehr im Weg. Alle organisatorischen Fragen und Ordnungsprobleme konnten gemeinsam geregelt werden. Die Fusion zur „neuen“ „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ erfolgte am 25.6.1972. In ihr gingen die Gemeinden der „Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche“ und der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ in Westdeutschland sowie alle Gemeinden der „alten“ Selbständigen evangelisch-lutherischen Kirche auf.
Im Osten Deutschlands (DDR) verlief die Entwicklung anders. Durch den „eisernen Vorhang“ befand man sich bei den Fusionsverhandlungen weitgehend in der Zuschauerrolle. Nach dem Mauerbau in Berlin waren (seit 1965) keine gemeinsamen Synoden oder Kirchenleitungssitzungen mehr möglich. Trotzdem verfolgte man auch im Ostteil der ELFK den Gang der Dinge im Westen zunächst durchaus mit Wohlwollen. 1969 wurde durch einen Beschluss der ELFK (Teilsynoden Ost und West) der Weg freigemacht für unterschiedliche Geschwindigkeiten im Fusionsprozess in Ost und West. Die jeweiligen Teilsynoden wurden ermächtigt, für ihren Bereich die nötigen Entscheidungen zu treffen. In der DDR existierten nur Gemeinden von zwei selbstständigen lutherischen Kirchen, der Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche und der ELFK. Weil die Körperschaftsrechte beider Kirchen im kommunistischen Staat nicht gefährdet werden sollten, kam es im September 1972 zunächst zur Bildung eines gemeinsamen Dachverbandes, der „Vereinigung selbständiger evangelisch-lutherischer Kirchen“ (VselK). Arbeitsgrundlage der Zusammenarbeit beider Kirchen bildete eine „Vereinbarung“, die bei der ersten gemeinsamen Synode im September 1972 in ZwickauPlanitz von beiden Teilsynoden gesondert angenommen wurde. Bevor die körperschaftsrechtlichen Fragen nicht geklärt waren, sollte an den theologischen Voraussetzungen einer Fusion gearbeitet werden. Da im Osten die Gemeinden beider Kirchen in räumlich abgegrenzten Bereichen existierten, war der gegenseitige Annäherungsprozess noch nicht so fortgeschritten wie im Westen. Deshalb sollte zunächst die Zusammenarbeit zwischen 7 den Kirchen intensiviert werden. Auch die Ausbildung des Pfarrernachwuchses lief zunächst nicht gemeinsam (wie z.B. in Oberursel). Erst seit Ende der 1960er Jahre kamen verstärkt auch „altlutherische“ Studenten an das Leipziger Seminar der ELFK. Die gegenseitige Annäherung offenbarte erhebliche Unterschiede in der kirchlichen Tradition und Praxis. Zum Stolperstein wurden aber mehr und mehr unterschiedliche Auffassungen in theologischen Grundsatzfragen. Diese zeigten sich 7
Vgl. S. 96–103.
Gottfried Herrmann
41
erstmals für die größere Öffentlichkeit bei der zweiten gemeinsamen Synode 1976 in Berlin, bei der – wie zuvor im Westen – die gemeinsame Erklärung zur Verbindlichkeit der Einigungssätze diskutiert wurde. Bei der abschließenden Abstimmung enthielten sich einzelne „altlutherische“ Pastoren der Stimme. Auf Befragen erklärten sie, dass sie einzelnen Aussagen der Einigungssätze (z.B. zur Schriftlehre) nicht zustimmen könnten. Die Vertreter der ELFK bestanden darauf, dass diese Fragen vor einer geplanten Fusion im Osten geklärt werden müssten. Eine gemeinsame theologische Kommission wurde berufen, welche die Differenzen aufarbeiten sollte. Die 1978 veranstaltete dritte gemeinsame Synode beriet zwar die geplante Grundordnung einer fusionierten Kirche, konnte aber den praktischen Vollzug nicht beschließen, da die theologischen Differenzen nicht ausgeräumt waren. Nach zwischenzeitlich positiven Teilergebnissen gerieten die theologischen Verhandlungen Anfang der 1980er Jahre in die Sackgasse. Trotz aller Bemühungen (dazu gehörte auch der Wechsel in der Besetzung der Kommissionen) war eine Einigung in grundsätzlichen Fragen nicht möglich. Unterschiedliche Anschauungen gab es vor allem in Bezug auf die beiden Themen Bibelkritik und Ökumene: 1. Sind die historischkritischen Methoden (Bibelkritik) der Heiligen Schrift angemessen (Verbalinspiration) oder nicht? 2. Sollte die geistliche Zusammenarbeit mit anderen Kirchen, Gemeinschaften und Gremien weiter von der vollen Übereinstimmung in der Lehre abhängig gemacht werden oder nicht? Als sich alle Hoffnungen auf einen gemeinsamen Weg zerschlagen hatten, beschloss die in Hartenstein versammelte Synode der ELFK am 26.5.1984 die vorläufige Suspension der Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft gegenüber der Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche. Es zeigte sich, dass trotz jahrelanger Verhandlungen nicht nur die geplante Fusion gescheitert, sondern sogar die Einigkeit in Lehre und Praxis als gemeinsame Grundlage für Kirchengemeinschaft verloren gegangen war. In den folgenden Jahren bemühte sich die SELK vom Westen Deutschlands aus, den Gesprächsfaden wieder anzuknüpfen. Da sie aber in den beiden strittigen Fragen selbst mehr oder weniger offen die Position der Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche teilte, blieben die Vermittlungsversuche ohne Erfolg. Als die ELFK daraufhin die Basis für Kirchengemeinschaft gefährdet sah und offizielle Lehrverhandlungen erbat, stieß sie damit auf Ablehnung bei der Kirchenleitung der SELK. So kam es am 7.10.1989 dazu, dass die Synode der ELFK auch die Kanzelund Abendmahlsgemeinschaft zur SELK aufkündigte. Die „Evangelisch-lutherische (altlutherische) Kirche“ (DDR) fusionierte nach der Einigung Deutschlands mit der SELK (1991). Die Trennung von der SELK konnte nicht ohne Auswirkungen auf das Verhältnis der ELFK zu anderen selbstständigen lutherischen Kirchen außerhalb Deutschlands bleiben. Diese standen weiter in Kirchengemeinschaft mit SELK und ELFK, die aber untereinander keine Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft mehr hatten. Die ELFK wandte sich deshalb an diese Schwesterkirchen mit der Bitte, zu den
42
Die „Evangelisch-Lutherische Freikirche“ (in Sachsen und anderen Staaten)
aufgebrochenen Fragen in Deutschland Stellung zu nehmen. In den Jahren ab 1989 wurde mit diesen Kirchen schriftlich bzw. in Gesprächen verhandelt. Obwohl einige von ihnen (Frankreich, Dänemark, Finnland) die ELFK-Beanstandungen gegenüber der SELK in der Sache teilten, waren sie doch nicht in der Lage, daraus praktische Konsequenzen zu ziehen. So sah sich die ELFK-Synode 1992 genötigt, die Kirchengemeinschaft auch gegenüber diesen Kirchen vorerst aufzuheben. Gleiches geschah im Verhältnis zur Lutheran Church-Missouri Synod, zu der seit der Gründungszeit der ELFK enge Verbindungen bestanden hatten. Im Gegenzug wurden die Beziehungen der ELFK zur Wisconsin Evangelical Lutheran Synod (WELS) und zur Evangelical Lutheran Synod (ELS) erneuert. Auch hier mussten Fragen geklärt werden. So kam es zwischen 1990 und 1994 zu einer Serie von Lehrgesprächen über das Thema „Kirche und Amt“ mit der WELS, die mit einer beiderseits akzeptierten Einigung endeten. 1993 konnte auf Initiative von WELS und ELS die „Konfessionelle Evangelisch-Lutherische Konferenz“ (KELK) als neuer weltweiter Zusammenschluss bekenntnisbewusster lutherischer Kirchen gegründet werden. Die ELFK schloss sich diesem Verband an. Sie war Gastgeber der KELK-Gründungsversammlung in Oberwesel/Rhein. Inzwischen gehören mehr als 30 lutherische Kirchen in der Welt zur KELK (u.a. in Schweden, Norwegen, Lettland, Ukraine, Tschechien, Bulgarien und Portugal). In den letzten Jahren seit 2000 konnte eine den veränderten Verhältnissen angepasste Verschlankung der organisatorischen Strukturen in der ELFK durchgeführt werden. So wurde 2002 die Bezirkseinteilung vorläufig aufgehoben (Sächsischer und Diaspora-Bezirk) und eine Begrenzung von Amtszeiten für leitende Ämter eingeführt. Dieser Prozess schlug sich in der überarbeiteten Kirchenverfassung von 2006 nieder, erneut überarbeitet 2018.
5. Die „Renitente Kirche ungeänderter Augsburger Konfession“ Gilberto da Silva Nach einigen Kontakten des Landgrafen Philipp I. (des Großmütigen, *1504, 1518– 1567) mit evangelisch gesinnten Geistlichen schaffte den reformatorischen Durchbruch in der Landgrafschaft Hessen die von ihm einberufene „Homberger Synode“, eigentlich eine Disputation, von 1526. Aus dieser zum Zweck einer Kirchenreform einberufene Synode entstand die „Reformatio Ecclesiarum Hassiae“, die erste reformatorische Kirchenordnung Hessens. Theologisch folgte sie meistens Luther, aber auch mittelalterlichen und oberdeutschen Traditionen. Um seine Meinung über die Ordnung gebeten, antwortete Luther in einem Brief an Philipp, dass er die Ordnung nicht befürworte. Hauptgrund für Luthers Ablehnung war die Tatsache, dass sie unter dem Gesichtspunkt von Ordnung und Zucht („ein hauffen gesetze“) 1 gestellt sei. Daraufhin wurde die „Reformatio Ecclesiarum Hassiae“ in ihrer ursprünglichen Form nicht umgesetzt bzw. ist nie geltendes Recht geworden. Stattdessen wurde die Reformation in Hessen nach dem sächsischen bzw. wittenbergischen Modell, d.h. hauptsächlich durch Visitationen, allmählich durchgeführt. In den folgenden Jahren 1527–1537 erschienen Teilordnungen, die einzelne Gebiete des kirchlichen Lebens in Hessen regelten. Diese Ordnungen regelten auch die Einsetzung von Synoden, die zu den höchsten geistlichen Autoritäten der hessischen Kirche wurden. Der evangelische Gottesdienst wurde in einer Ordnung aus dem Jahr 1532 geregelt, wobei auch hier die Frage der Kirchenzucht einen breiten Raum einnahm. Zur Lehre äußerte sich diese Ordnung in etwas allgemeiner Weise und die darin enthaltene Kirchenagende vereinte wittenbergische und oberdeutsche Elemente, ohne einen bestimmt ausgeprägten konfessionellen Charakter zu zeigen. Nach dem Tod des Landgrafen Philipp 1567 wurde die Landgrafschaft Hessen unter seine vier Söhne geteilt. Durch den sogenannten „Brüdervergleich“ von 1568 entstanden die Landgrafschaften Niederhessen (Hessen-Kassel) und Oberhessen (Hessen-Marburg), die Niedergrafschaft Katzenelnbogen (Hessen-Rheinfels) sowie die Obergrafschaft Katzenelnbogen (Hessen-Darmstadt). Trotz der territorialen Teilung verwalteten die Brüder einige Angelegenheiten wie die kirchlichen zunächst gemeinsam. Doch Streitigkeiten über die konfessionelle Richtung brachten die Ära der gemeinsamen Generalsynoden 1582 zu Ende. Zuvor aber beschloss man 1577 die
1
Luther, Martin, Nr. 1071. Luther an Philipp von Hessen, in: WA.BR 4, 157f.
44
Die „Renitente Kirche ungeänderter Augsburger Konfession“
Ablehnung des Konkordienwerks bzw. der Konkordienformel auf einem Konvent in Treysa. Diese Ablehnung bestätigte eine noch gemeinsame Synode 1581. Mit dem Tod des kinderlosen Landgrafen Philipp d. J. von Hessen-Rheinfels 1583 fiel dessen Territorium fast vollständig an Hessen-Kassel, die anderen beiden Landgrafen erhielten einige kleinere Ämter. Ludwig III./IV. von Hessen-Marburg starb 1604 ebenfalls kinderlos, verfügte aber vorher in seinem Testament, dass sein Land zwar in gleichen Teilen den beiden übrig gebliebenen Linien Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt zufallen sollte, dass aber der lutherische Bekenntnisstand von Oberhessen bei Verlust des Erbes nicht geändert werden dürfte. Somit blieben mit Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt die beiden hessischen Hauptlinien übrig, die nach dem Tod der Landgrafen Wilhelm IV. (1592) und Georg I. (1596) sich stärker verselbstständigten. Die Polarität – auch in konfessioneller Hinsicht – zeigte sich sehr deutlich unter den jeweiligen Nachfolgern, Moritz (*1572, 1592–1627, †1632) in Hessen-Kassel und Ludwig V. (*1577, 1596–1626) in Hessen-Darmstadt. Durch seine zweite Ehe mit Juliane von Nassau-Dillenburg (1587–1643) 1603 nahm Moritz das reformierte Bekenntnis seiner Frau, dem er bereits seit seiner Jugend zugeneigt war, an. Danach ließ er in seinem Land die berühmten „Mauritianischen Verbesserungspunkte“ einführen. Sie verlangten „1) Daß die gefährlichen und unerbaulichen Disputationes und Streit von der Person Christi eingezogen, und von der Allenthalbenheit Christi und was derselben anhängig in concreto, als: ‚Christus ist allenthalben;‘ und nicht in abstracto ‚die Menschheit Christi ist allenthalben,‘ gelehrt, 2) Das [sic] die zehn Gebote Gottes, wie sie der Herr selbst geredet, mit seinen eignen Fingern auf die steinernen Tafeln und von Mose in der Bibel geschrieben, gelehrt und gelernt, und die noch vom Papsttum an etlichen Orten überbliebenen Bilder abgethan, 3) Daß in der Administration und Gebrauch des heiligen Abendmals das gesegnete Brot nach der Einsetzung des Herrn soll gebrochen werden.“2
Durch seine Reformbemühungen wollte der Landgraf mit einem seiner Meinung nach Rückgang auf den biblischen Wortlaut die innerevangelischen Gegensätze überbrücken und so eine einheitliche Religionsausübung in seinem Land erreichen. Politisch bedeutete das allerdings den Anschluss an die reformiert geprägten Länder Europas, die sich als fortschrittlich und modern ausgaben. Die konfessionelle Richtungsänderung brachte auch Konflikte um den Bekenntnisstand Oberhessens mit sich, die unter anderem zur Gründung der Universität Gießen 1607 durch Ludwig V. führten. In Bezug auf den Bekenntnisstand einigte man sich im sogenannten „Rezess“ vom 14. April 1648 darin, dass Oberhessen lutherisch bleibe, aber dem Landgrafen von Hessen-Kassel gestattet sei, überall reformierte Gemeinden zu gründen. 2
Zitiert nach Heppe, Heinrich, Die Einführung der Verbesserungspunkte in Hessen von 1604–1610 und die Entstehung der hessischen Kirchenordnung von 1657 als Beitrag zur Geschichte der deutsch-reformierten Kirche urkundlich dargestellt, Kassel 1849, 15.
Gilberto da Silva
45
Im Rahmen des Reichsdeputationshauptschlusses erhielt Hessen-Kassel 1803 die Kurwürde mit der Bezeichnung Kurfürstentum Hessen, kurz Kurhessen. Durch Napoleon 1807 aufgelöst, kam der größte Teil der Fläche zum Königreich Westphalen, durch die Beschlüsse des Wiener Kongresses 1814/15 wurde das Kurfürstentum restituiert und war dann bis zur preußischen Annexion 1866 Mitglied im Deutschen Bund. Im Zuge der „Revolution“ von 1848/49 wurden in Kurhessen Reformen eingeführt, die eine größere Religionsfreiheit und Ablösung des engen Bandes zwischen Staat und Kirche als Ziel hatten. Diese Reformen brachten aber die Kritik einiger kurhessischer Geistlicher, die angesichts der veränderten politischen Lage auch für Strukturreformen in der Landeskirche plädierten, da die Kirche ihrer Meinung nach von einem nichtchristlichen oder gar gottlosen Staat – so ihre Ansicht über die liberale Demokratie – nicht mehr regiert werden könne. Somit spielte die Frage nach dem seit der Reformation für die Landeskirchen charakteristischen landesherrlichen Kirchenregiment eine wichtige Rolle. Die Auseinandersetzungen jedoch, die mit der Entstehung selbstständiger 3 evangelisch-lutherischer Gemeinden in Kurhessen in engem Zusammenhang stehen, sind mit der Persönlichkeit und Wirksamkeit von August Friedrich Christian Vilmar (1800–1868)4 verbunden. Geboren in Solz bei Bebra, trat A. Vilmar anfangs akademisch mit ersten Untersuchungen und Veröffentlichungen zur griechischen und altsächsischen Syntax hervor. Der frühe A. Vilmar betätigte sich politisch durchaus liberal. Jedoch unter dem Eindruck der Ereignisse von 1848 und der hessischen Religionsgesetzgebung gründete er die Zeitung „Hessischer Volksfreund“, die eine restaurativ-konservative politische Programmatik vertrat und dezidiert antirevolutionär war. A. Vilmar sah die Revolution, eine nahezu Konstante in den Umwälzungen des 19. Jahrhunderts, in einem Gesamtzusammenhang des Umsturzes von Politik und Religion, der Entchristlichung von Staat und Kirche. Die gottgegebene Ordnung für Staat und Kirche auf revolutionäre Weise, gleich ob es durch eine Revolution „von oben“ oder eine von „von unten“, zu ändern, sei ein apokalyptisches Zeichen, das Vorbereiten des Antichristen-Reichs. Der Absolutismus, der auch in der Kirche herrschen will, sei die Revolution „von oben“, der Liberalismus die Revolution „von unten“. A. Vilmar sieht in seiner Zeit einen „Zerstörungskampf“ gegen die Fundamente menschlicher Gesellschaft, dem entgegenzutreten Pflicht für das geistliche Amt sei.
3 4
Vgl. Karl Wicke, Die hessische Renitenz. Ihre Geschichte und ihr Sinn, Kassel 1930. Vgl. Klaus Engelbrecht, Um Kirchentum und Kirche. Metropolitan Wilhelm Vilmar (1804–1884) als Verfechter einer eigentümlichen Kirchengeschichtsdeutung und betont hessischen Theologie, Frankfurt a.M. u.a. 1984.
46
Die „Renitente Kirche ungeänderter Augsburger Konfession“
August Friedrich Christian Vilmar, *1800, †1868, Theologe, Gymnasiallehrer in Marburg 1827–1833, Gymnasialdirektor in Marburg 1833–1850, Staatsrat im Ministerium Hassenpflug (Kultus- und Justizminister im Kurfürstentum Hessen-Kassel) 1850/51, Vertreter des Generalsuperintendenten 1850–1855, nach seiner Wahl zum Generalsuperintendenten 1855 vom Kurfürsten nicht bestätigt, Professor in Marburg 1855–1868.
Für die Kirche bzw. theologisch betonte A. Vilmar das kirchlich-prophetische Wächteramt, das auf die Wahrung der göttlichen Weltordnung vor den Gefahren von Revolutionen zu drängen habe. Dabei wurde von ihm die Lehre vom geistlichen Amt stark hervorgehoben, denn eben nur dieses Amt habe das Mandat, die Kirche zu regieren. Die Geschichte der Landeskirchen unter dem Zeichen des landesherrlichen Kirchenregiments sah er als eine Usurpation der Kirchenregierung von Seiten der weltlichen Reichsstände. A. Vilmar betrachtete das geistliche Amt der Kirche nach Schrift und Bekenntnis nicht etwa als ein „machtloses Redeamt“, sondern als ein „Hirtenamt“, indem er ihm einen wesentlich führenden, regierenden, normgebenden Charakter zusprach. Das ministerium ecclesiasticum habe kraft seiner göttlichen Einsetzung zu der Gemeinde zu reden. Der Mandatsträger erhalte sein Mandat ausschließlich von Christus selbst, könne also wie nur in seinem Auftrag, so auch nur in seinem Namen alle Funktionen des Amtes ausführen. In diesem Sinne hätten im Unterschied zu den so genannten Laien die Pfarrer ein besonderes Mandat vom Herrn bekommen. Dementsprechend sollen die Gemeinden den Pfarrern Gehorsam leisten, denn Gott hat das geistliche Amt zur Kirchenregierung eingesetzt. Die Gemeinde ist in Sachen Wort und Sakramente nur Empfängerin. Berühmt sind A. Vilmars Worte aus einem Brief von 1849: „‚Synode‘ (es ist, als wenn 5 jedes Mal der Teufel bei mir vorüberflöge, wenn ich das Wort höre oder schreibe)“. Damit drückte A. Vilmar seine Abneigung gegen die im Zuge der Revolution eingesetzten Synoden, die mit Laien und Geistlichen bestückt waren. Die Amtslehre A.
5
Hopf, Wilhelm, August Vilmar. Ein Lebens- und Zeitbild, Bd. 2, Erlangen 1913, 66f.
Gilberto da Silva
47
Vilmars prägte in der weiteren geschichtlichen Entwicklung maßgeblich die selbstständige evangelisch-lutherische Kirchenbildung in Kurhessen. Die sogenannte „Liberale Revolution“ wollte eine weitgehende Trennung von Staat und Kirche herbeiführen. Dies brachte mit sich die Notwendigkeit, die Kirchenverfassung in Kurhessen dementsprechend zu ändern. Zu diesem Zweck berief die Staatsregierung im Oktober 1848 eine „Kirchencommission zur Vorbereitung einer zu berufenden General-Synode der kurhessischen evangelischen Landeskirche“ ein. Um der „Kirchencommission“ Vorschläge zu präsentieren, trafen sich in Kurhessen Pastoralkonferenzen zusammen. Die bedeutendste dieser Konferenzen ist die, die 1849 unter A. Vilmars führender Beteiligung in Jesberg stattgefunden hat. Diese Konferenz drängte auf Verfassungsänderungen und forderte die Übertragung der Kirchengewalt auf die Geistlichen sowie die Zurückdrängung des Laientums in Fragen der Kirchenzucht und Gemeindeleitung. Damit verbunden war die Forderung, die Ausübung der Kirchengewalt in Kurhessen von der Staatsregierung bzw. dem Kurfürsten auf die „Superintendenten und Inspektoren“ zu übertragen. Kurfürst Friedrich Wilhelm I. (*1802, 1847–1866, †1875) verfolgte beim Abklang der Revolution 1849 zunächst die Absicht, A. Vilmar als Innenminister zu berufen, doch nahm er wegen dessen kirchenpolitisch-ekklesiologischer Einstellung davon Abstand. 1850 bewarb sich A. Vilmar um die Kasseler Pfarrstelle St. Martin, musste aber nach dem heftigen Widerstand der Gemeinde seine Kandidatur zurücknehmen. Ein Jahr später wurde er Ministerialreferent für geistliche und Schulfragen. Schließlich ernannte der Kurfürst ihn 1855 zum Professor in Marburg, um ihn aus der Politik fernzuhalten. Etwa zwei Jahre vor A. Vilmars Tod marschierte Preußen im Juni 1866 in Kurhessen ein und annektierte es zusammen mit dem Herzogtum Nassau und der Freien Stadt Frankfurt im Oktober desselben Jahres. Eine Angleichung an die preußischen Verwaltungsstrukturen wurde durchgesetzt. Die Annexion brachte für die evangelische Kirche tiefgreifende Veränderungen, die in den Augen vieler eine Rückkehr zum „religionslosen“ bzw. „unchristlichen“ Staat von 1848/49 bedeuteten. Die Befürchtung um die Kirchenregierung durch den „konfessionslosen Staat“ bekam eine weitere, jetzt neue Komponente hinzu, die Konfessionsfrage. Denn die Möglichkeit der Verschmelzung mit der preußischen unierten Landeskirche entzündete die nicht geklärte bzw. sehr umstrittene Frage nach dem Konfessionstand der niederhessischen Kirche: Während die Verteidiger des reformierten bzw. „deutsch-reformierten“ Charakters der niederhessischen Kirche deren Eingliederung in die preußische Landeskirche als Provinzialkirche oder sogar die Errichtung einer deutschen evangelischen Nationalkirche mit unierten Charakter anstrebten, fürchteten die Verteidiger des lutherischen Charakters der niederhessischen Kirche um das Fortbestehen der lutherischen Kirche. Die Implikationen und Schwierigkeiten des bevorstehenden Bekenntniskampfes wurden bald von A. Vilmar vorausgesehen. In diese Vorphase der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirchenbildung in Kurhessen tritt die Persönlichkeit
48
Die „Renitente Kirche ungeänderter Augsburger Konfession“
und Wirksamkeit des jüngeren Bruders A. Vilmars, Jakob Wilhelm Georg Vilmar (1804–1884), ein. Wilhelm Vilmar, wie er bekannt war, studierte Theologie in Marburg und war ab 1830 Pfarrer in Rotenburg a. d. Fulda; 1851 trat er die Stelle des Pfarrers und Metropolitans in Melsungen an. Im Jahr 1862 gründete W. Vilmar die „Niederhessische Pastoralkonferenz“, die die Problematik von Jesberg wieder aufnahm. Interessant dabei ist die darin entwickelte Geschichtsvorstellung, die den Anbruch einer neuen Epoche der Kirche mit der „Erfahrung“ des „Königtums Jesu Christi“ annahm. Nach der preußischen Annexion plante man die Umbildung des Kirchenregiments in der Provinz Hessen-Nassau im Sinne des Presbyterial- und Synodalsystems nach dem Muster der rheinisch-westfälischen Kirchenverfassung. Das führte zur Opposition von Seiten der Gruppe um W. Vilmar, in der die problematische Frage nach dem Bekenntnisstand der niederhessischen Kirche besondere Achtung fand. W. Vilmar betrachtete Preußen wegen seiner Verfassung als einen „religionslosen Staat“ und sprach dem preußischen König das Recht ab, summus episcopus der niederhessischen Kirche angesichts seiner Zugehörigkeit zu einer fremden (unierten) Konfession zu sein. Die Regierung reagierte mit der Versetzung W. Vilmars von Melsungen nach Sand, der allerdings an den König appellierte und Melsungen nicht verlassen musste.
Jakob Wilhelm Georg Vilmar, *1804, †1884, Pfarrer in Rotenburg a. d. Fulda seit 1830, Pfarrer und Metropolitan in Melsungen seit 1851, führender Vertreter der hessischen Renitenz seit 1866/1873, (endgültige) Suspension 1873, Pfarrer der renitenten Gemeinde in Melsungen seit 1873, Ausbildung von Proseminaristen zum Theologiestudium in Mendota/Illinois für die (deutsche) lutherische Iowa-Synode in den U.S.A. seit 1870, nach seinem Tod fortgeführt bis 1912.
Aufgrund ihrer komplexen Entstehungsgeschichte bestand die kurhessische Landeskirche faktisch aus drei Teilkirchen, die von drei Konsistorien geleitet waren: Kassel, das als reformiert, Marburg, das als lutherisch und Hanau, das als bereits uniert galt. Im Rahmen der geplanten Verwaltungsreformen beabsichtigte die
Gilberto da Silva
49
preußische Regierung auch die Zusammenlegung der drei Konsistorien zu einem mit Sitz in Kassel. Diese Maßnahmen, die 1871 an der aus finanziellen Gesichtspunkten begründeten Ablehnung des preußischen Abgeordnetenhauses zunächst scheiterten, waren Gegenstand heftigen Protestes von Seiten W. Vilmars. In diesem Stadium der Auseinandersetzungen zwischen den preußischen und den oppositionell-hessischen Kirchenvorstellungen gab es also drei Konfliktstoffbereiche aus hessischer Sicht: (1) Die Kirchenverfassungsänderung als Rechtsbruch; (2) die Einführung der evangelischen Union nach preußischem Modell als Bekenntnisbruch und (3) die angestrebte Beteiligung der Laien im Rahmen der presbyterialen Synodalordnung als Verstoß gegen das biblische und bekenntnismäßige exklusive Kirchenregierungsmandat des geistlichen Amtes. Die Protestation führte zur Amtssuspendierung W. Vilmars und zur Einleitung von Strafverfahren wegen unerlaubter Abhaltung von Bibelstunden und Konfirmandenunterricht. Bedingt durch das Erstarken Preußens nach Krieg und Reichsgründung 1870/71 wurde 1872 nochmalig der Versuch unternommen, ein Gesamtkonsistorium für die hessische Provinz zu errichten. Dies scheiterte allerdings wieder einmal unter anderem an der Kostenfrage. Nach vielen Auseinandersetzungen trat der Ernstfall für die kirchliche Opposition dann schließlich Mitte 1873 ein. Bereits im Februar bewilligte der Landtag die beantragten Kosten des Gesamtkonsistoriums; im April erschien der entsprechende „Allerhöchste Erlaß“. Nach Ernennung seiner Mitglieder sollte die neue Behörde am 28. Juli ihre Geschäfte aufnehmen. Noch vor der offiziellen Installation des Gesamtkonsistoriums unterschrieben 43 bzw. 45 niederhessischen Pfarrer, angeführt von W. Vilmar in Melsungen und Friedrich Wilhelm Hoffmann (1803–1889) in Felsberg, eine Protestschrift, die als „Juliprotest“ in die Geschichte eingegangen ist. Von den „Renitenten“ – wie sie bald bekannt wurden – wurde dieses Dokument als ihre „Renitenzurkunde“ bewertet. Die Protestierenden betonen darin, dass die Umgestaltung der niederhessischen Kirche durch die Einrichtung des Gesamtkonsistoriums der Aufhebung des Bestands ihrer Kirche gleichkommt. Die Regierung antwortete mit Suspensionen und Amtsenthebungen, wobei W. Vilmar dann endgültig des Amtes enthoben wurde. Die Betroffenen erkannten in einer „Offenen Erklärung“ die Strafen wegen der „kirchlichen Unzuständigkeit der Behörde“ aber nicht an, denn ihrer Auffassung nach dürfe nur das geistliche Amt in der Kirche regieren. Im Gefolge dieser Auseinandersetzung bildeten sich Ende 1873 in Melsungen und anderen Teilen Niederhessens so genannte „renitente“ Gemeinden, die zu ihren Pfarrern hielten und die Neugestaltung der hessischen Kirche ablehnten. Die antiunionistische Opposition spaltete sich aber gleich im Jahr 1874 in „Melsunger Konvent“ (unter der Leitung W. Vilmars) und „Homberger Konvent“ (unter der Leitung F. W. Hoffmanns). Es ging dabei um die Beibehaltung in der sich nun formierenden selbstständigen Kirche der so genannten „Mauritianischen Verbesserungspunkte“, die in der hessischen Kirche immer noch galten. Auslöser des Streits war ein Vorstoß von Geistlichen der „Hannoverschen evangelisch-luthe-
50
Die „Renitente Kirche ungeänderter Augsburger Konfession“
rischen Freikirche“6, die eine deutliche Verwerfung der „Verbesserungspunkte“ ob ihres unlutherischen Charakters von Seiten der Renitenz verlangten. Während die Mehrheit der Renitenten unter W. Vilmar (Melsungen) an den „Verbesserungspunkten“ festhielt, denn sie sah in ihnen „einen Theil des Bekenntnißstandes unserer hessischen Landeskirche“, der aus eigenem Vermögen nicht verändert werden könne, trennte sich eine kleinere Gruppe unter Hoffmann (Homberg), bildete einen eigenen kirchlichen Zusammenschluss 1877 und gab die „Verbesserungspunkte“ teilweise auf. Ein Jahr später verband sich der „Homberger Konvent“ mit der im benachbarten Hessen-Darmstadt entstandenen selbstständigen evangelischlutherischen Kirche; 1889 erfolgte die Vereinigung beider Kirchen zur „Selbständi7 gen Evangelisch-Lutherischen Kirche in den Hessischen Landen“ . Dabei nahmen die Homberger die Konkordienformel in ihren Bekenntniskanon auf. Im Jahr 1880 kam es zu einem weiteren Konflikt innerhalb des „Melsunger Konvents“ mit der Abspaltung des „Sander Konvents“, diesmal um die Frage von Organisation und Kirchenregiment, in der die teilweise Ablehnung des umstrittenen Führungsstils W. Vilmars eine wichtige Rolle spielte. Diese beiden Konvente vereinigten sich aber 1907 wieder. Die so wiedervereinigte „Renitente Kirche ungeänderter Augsburger Konfession“ bildete im Jahr 1910 eine Konföderation mit der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirchen in den Hessischen Landen“ (in der der „Homberger Konvent“ seit 1889 bereits integriert war); im Jahr 1924 kam es zu einer Konföderation mit der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Frei8 kirche“ . Nach dem Zweiten Weltkrieg schließlich vereinigten sich die selbstständigen Kirchenbildungen in Baden, Hessen und Hannover zur (alten) „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“. Auch hier spielte die Tatsache, dass die Renitenten die Konkordienformel nicht als Teil ihres Bekenntniskanons hatten, eine wichtige Rolle. Nach langen und nicht konfliktfreien Auseinandersetzungen verpflichteten sich die Geistlichen der „Renitenten Kirche ungeänderter Augsburger Konfession“ 1950 auch auf die Konkordienformel, was ihnen den Weg zum Zusammenschluss mit den anderen selbständigen Lutheranern frei machte.
6 7 8
Vgl. S. 56–63. Vgl. S. 51–55. Vgl. S. 104–113.
6. Die „Selbständige evangelisch-lutherische Kirche in den hessischen Landen“ Gilberto da Silva
Die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt entstand aus der komplizierten territorialgeschichtlichen Entwicklung der Landgrafschaft Hessen nach dem Tod Philipps I. (des Großmütigen, *1504, 1518–1567) 15671. Mit den napoleonischen Kriegen kamen weitere Veränderungen, die kirchengeschichtlich von Bedeutung sind. Im Jahr 1806 wurde die Landgrafschaft, gegen Stellung hoher Militärkontingente an Frankreich und den Beitritt zum Rheinbund, von Napoleon zum Großherzogtum Hessen-Darmstadt erhoben und bekam weitere Gebiete dazu. Das betraf unter anderem die Grafschaft Erbach, die ursprünglich zum fränkischen Reichskreis gehörte, aber 1806 infolge der Rheinbundakte größtenteils an das Großherzogtum Hessen-Darmstadt fiel. Durch den Wiener Kongress erhielt Hessen-Darmstadt 1815/16 noch weitere Gebiete, unter anderem das sogenannte Rheinhessen. Durch diese territorialen Veränderungen erhöhte sich die Zahl von Gemeinden reformierten Bekenntnisses, besonders aus der Pfalz, im Großherzogtum. Als Rheinhessen dem Großherzogtum einverleibt wurde, bestanden in ihm 52 lutherische und 53 reformierte Pfarrstellen. Die neue territorial-kirchliche Lage führte zu einer praktischen Union im Großherzogtum. Nach einem längeren Entscheidungsprozess wurde die Union in Rheinhessen am 28. November 1822 rechtskräftig. Am 1. Weihnachtstag 1833 fand die kirchliche Einführung der Union in Darmstadt statt. Damit gewann die Union kirchenrechtlichen Charakter mit der Einführung einer einzigen Kirchenordnung für die ganze hessisch-darmstädter Landeskirche, so dass die lutherische, reformierte und unierte Konfession nun unter einem Dach standen. Damit verbunden war auch die Vorgabe an die Pfarrer, die Union zu fördern. Ein neues, 1860 erlassenes Ordinationsformular verpflichtete die angehenden Geistlichen aller drei Konfessionen auf die Bekenntnisschriften „unserer Kirche“, wobei den Kandidaten freigestellt war, darunter die Bekenntnisschriften seiner Konfession zu verstehen. Aus Sorge um den Weiterbestand der lutherischen Kirche gründeten einige Geistliche des Großherzogtums bereits 1851 eine „lutherische Einigung“. Ihr Zweck war es, „das kirchliche Leben nach allen Seiten zu fördern, in Lehre, Gottesdienstordnung und Verfassung.“ Ebenso wollte sie „in den kirchlichen Werken der äußeren und inneren Mission die Grundsätze der lutherischen Kirche zur Geltung bringen 1
Vgl. S. 43–50.
52
Die „Selbständige evangelisch-lutherische Kirche in den hessischen Landen“
und durch dies alles eine Wiederherstellung und lebendige Organisation derselben in Hessen anstreben“.2 Zu der „lutherischen Einigung“ gehörten 1855 insgesamt 26 Geistliche. Im Jahr 1870 trat eine Presbyterial- und Synodalverfassung provisorisch in Kraft, nachdem ein erster Versuch 1863 gescheitert war. Das Ziel dieser neuen Verfassung war „der Ausbau der evangelischen Kirchen Deutschlands auf Grund des Gemeindeprinzips und die Anbahnung einer von Dogmenzwang und Priesterherrschaft gereinigten, deutschen evangelischen Nationalkirche“.3 Die neue Kirchenverfassung war deutlich sowohl von unionistischen als auch rationalistischen Grundmentalitäten geprägt. Um diese Zeit gab es die ersten Proteste einzelner Pfarrer, die Geldstrafen bezahlen mussten oder gar des Amtes suspendiert wurden. Drei Jahre später versammelte sich die konstituierende Synode, deren Mitglieder nicht auf ein spezifisches Bekenntnis oder auf Gottes Wort verpflichtet werden konnten, sondern lediglich auf ihr „bestes Wissen und Gewissen“. Die Synode bestätigte mit der neuen Kirchenverfassung die anhand verschiedener Urkunden vorhandenen Union, zum einen durch den Beschluss, dass die Landeskirche des Großherzogtums sämtliche evangelische (lutherische, reformierte und unierte) Gemeinden des Landes unbeschadet deren Bekenntnisstandes umfasse und dass eine Abendmahlsgemeinschaft „obligatorisch“ sei, d.h. jeder Pfarrer müsse jeden zur Landeskirche Gehörenden unabhängig von seiner Konfession zum Abendmahl zulassen. Als die neue Kirchenverfassung dann 1874 in Kraft trat, lehnten sie fünfzehn lutherische Pfarrer aus Bekenntnisgründen ab. Sie wurden wiederholt aufgefordert, die Verfassung anzunehmen, widersetzten sie sich aber immer wieder. Das führte zu Geldstrafen, Amtssuspensionen und Gehaltsentziehungen. Schließlich verfügte im Juni 1875 das neue Konsistorium auf Grund der neuen Kirchenverfassung bzw. des Synodalbeschlusses die Amtsenthebung für sieben der protestierenden Pfarrer. Des Amtes enthoben wurden die Pfarrer Georg Anthes (Reichelsheim i.O.), Hermann Bichmann (Güttersbach i.O.), Emil Kraus (Rothenberg i.O.), Gustav Baist (Ulfa bei Nidda), Karl Ferdinand Bingmann (Höchst a. d. Nidder), Friedrich Kraus (Volkartshain bei Gedern), Dr. Ernst Eduard Lucius (Rodheim a.d. Horloff). Die Pfarrer erhoben öffentlich Protest gegen die Maßnahmen des Konsistoriums und wiesen seine Entscheidung als „wider Recht und Gerechtigkeit verstoßendes kirchenordnungswidriges Urteil“ mit der Argumentation zurück, dass durch die Einführung der neuen Kirchenverfassung auch die „bekenntnislose Union“ eingeführt worden sei, „wodurch unsre evangelisch-lutherische Kirche in ihrem verbürgten Rechts- und Bekenntnisbestande so gut wie aufgehoben und ihr damit der Schutz, auf welchen sie Anspruch hatte, völlig entzogen ward“. Sie erklärten, dass sie „für sich, ihre Kinder und die der lutherischen Kirche treu bleibenden Familien ihrer 2 3
Müller, Karl, Die selbständige evangelisch-lutherische Kirche in den hessischen Landen, Elberfeld 1906, 9. Zitiert nach Müller, a.a.O., 14.
Gilberto da Silva
53
Gemeinden“ die neue Verfassung nicht annehmen könnten. Dabei sagten sie sich vom landesfürstlichen Kirchenregiment los, was in dieser Form innerhalb des sich zu dieser Zeit in Deutschland formierenden selbstständigen Luthertums einmalig war.
Karl Ferdinand Bingmann, *1822, †1898, Pfarrer in Höchst/Nidder seit 1849, Amtsentsetzung wegen Widerstandes gegen die unionistische Kirchenverfassung 1875, Mitbegründer der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ im Großherzogtum Hessen und deren erster Superintendent seit 1877.
Noch 1875 wurde vom Konsistorium die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, Untersuchungen gegen die „renitenten“ Pfarrer „wegen unbefugter Ausübung des geistlichen Amtes“ einzuleiten. Die Anklage bestand darin, dass ein abgesetzter Pfarrer, kirchenrechtlich gesehen ein Laie und Mitglied der Landeskirche, gesetzeswidrig Amtshandlungen an Gliedern der Landeskirche vornehme. Dies führte auch zum Teil zu Gottesdienstüberwachungen durch die Polizei. Es folgten Verurteilungen, die mit Geld- und Gefängnisstrafen vollstreckt wurden. Letztere wurden allerdings nie ausgeführt, weil man sich doch gegen die Lutheraner im Großherzogtum so 4 vorzugehen scheute, wie es vierzig Jahre zuvor in Preußen geschehen war . Die protestierenden Lutheraner erfuhren aber auch Unterstützung, besonders aus lutherischen Kreisen, wie z.B. aus der bayrischen Landeskirche. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Unterstützung, die von Seiten der „Evangelical Alliance“ aus England kam. Obwohl kirchlich und theologisch von den selbstständigen Lutheranern in Hessen-Darmstadt weit entfernt, lenkte sie zunächst die öffentliche Aufmerksamkeit durch Artikel in englischen Zeitungen auf „die religiöse Intoleranz in Hessen-Darmstadt“. Dann wurde ein Vertreter der Allianz, ein gewisser Dr. J. S. Blackwood, zum Großherzog und sein Ministerium geschickt, um mit ihnen zu verhandeln. Der öffentliche Druck führte dazu, dass im September 1878 ein „Aus-
4
Vgl. S. 11–19.
54
Die „Selbständige evangelisch-lutherische Kirche in den hessischen Landen“
trittsgesetz“, das die Selbstständigkeit der oppositionellen Lutheraner gegenüber der Landeskirche ermöglichte, erlassen wurde. Doch nicht in allen Gemeinden folgten Gemeindeglieder ihren Pfarrern, sodass aus der Protestbewegung fünf selbstständige lutherische Gemeinden entstanden: Reichelsheim im Odenwald, Rothenberg im Odenwald, Fürstenau bei Michelstadt, Höchst an der Nidder und Usenborn bei Ortenberg. Im November 1877 fand in Stammheim in der Wetterau die konstituierende Synode der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ in Hessen-Darmstadt statt, auf der die Pfarrer und Vertreter aus den Gemeinden anwesend waren. Der Theologe und Gymnasiallehrer Ferdinand Lucius († 1877) erarbeitete eine eigene Kirchenordnung für die neu entstandene Kirche, die von der Synode angenommen wurde, und spätere Überarbeitungen bzw. Ergänzungen erfuhr. Charakteristisch für diese Kirchenordnung ist die Betonung des bischöflichen Charakters vom Superintendentenamt. Mit einer klaren Trennung zwischen Pfarr- und Seniorenamt versucht diese Ordnung eine Problematik vorzubeugen, die in den selbstständigen 5 lutherischen Kirchen immer wieder für Konflikte sorgte. Dabei bekundete man auch die Absicht, von anderen selbstständigen lutherischen Kirchen unabhängig zu bleiben, um „von andern gemachten Fehler“ zu vermeiden. Als erster Superintendent wurde 1877 Karl Ferdinand Bingmann (1822–1898) gewählt und eingeführt. Die anfangs betonte strukturelle Unabhängigkeit von anderen selbstständigen lutherischen Kirchen hinderte die Lutheraner aus Hessen-Darmstadt jedoch nicht daran, Kirchengemeinschaft mit ihnen zu suchen. Somit wurde gleich 1878 die Kirchengemeinschaft mit dem „Homberger Konvent“ der „Renitenten Kirche ungeänderter Augsburger Konfession“, nachdem dieser die so genannten „Mauritiani6 schen Verbesserungspunkte“ abgelehnt hatte, beschlossen ; 1889 schlossen sich beide Gruppen zusammen, nachdem die Homberger die Konkordienformel in ihren Bekenntniskanon aufgenommen hatten. Im Jahr 1880 kam die Kirchengemeinschaft mit der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Kirche“7; 1888 mit der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“8; 1904 mit der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Baden“.9 In diesem Jahr kamen auch die Gemeinden Dreihausen und Marburg (mit dem Predigtort Warzenbach), nach Auseinandersetzungen mit der „Renitenten Kirche ungeänderter Augsburger Konfession („Melsunger Konvent“) zur nun „Evangelisch-Lutherischen Kirche in den Hessischen Landen“. Im Jahr 1906 zählte der neue Kirchenkörper 12 Gemeinden mit 3050 Gemeindegliedern. Schließlich vereinigten sich nach dem Zweiten Weltkrieg die selbstständigen
5 6 7 8 9
Vgl. S. 20–22. Vgl. S. 43–50. Vgl. S. 56–63. Vgl. S. 11–19. Vgl. S. 23–30.
Gilberto da Silva
55
Kirchenbildungen in Baden, Hessen und Hannover zur (alten) „Selbständigen evangelisch-lutherischen Kirche“.10 Ein für die wissenschaftliche Nachwelt wichtiger Beitrag der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche in den Hessischen Landen“ geht auf Pfarrer Christian Müller (1825–1892) zurück, der in Beerfelden und als Hausgeistlicher sowie Erzieher der Grafen Erbach-Fürstenau seit 1867 tätig war. Seit 1870 war er Schlosspfarrer auf Schloss Fürstenau und gehörte ebenfalls zu den Pfarrern, die die neue Kirchenverfassung von 1874 ablehnten. Neben der Tätigkeit als Pfarrer veröffentlichte Müller Andachts-, Predigt- und Gebetbücher, die weite Verbreitung fanden. Diesem Schwerpunkt der Tätigkeiten auf dem Gebiet der Praktischen Theologie entspricht die Ausrichtung seiner Privatbibliothek, denn neben einer wertvollen und umfassenden Sammlung von Quellenschriften aus dem 16. und 17. Jahrhundert enthält sie vor allem Kirchenordnungen, Agenden, Katechetik- und Erbauungsliteratur des Luthertums vom 16. Jahrhundert an bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Pfarrer Karl Müller (1859–1929), Sohn und Nachfolger von Christian Müller in Fürstenau, gab 1898 einen Katalog der gesammelten Werke heraus, der heute noch verwendet wird. Die wertvolle Sammlung Müllers mit der Bezeichnung „Kirchenbibliothek zu Fürstenau im Odenwald“ ging 1972 in den Besitz der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ über und gehört als Dauerleihgabe zum 11 Bibliotheksbestand der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel.
Christian Müller, *1825, †1892, Pfarrer in Beerfelden und zugleich Hausgeistlicher und Erzieher der Grafen Erbach-Fürstenau seit 1867, Schlossgeistlicher auf Schloss Fürstenau seit 1870, Protest gegen die unionistische Kirchenverfassung 1874, regelmäßige lutherische Gottesdienste in der Schlosskapelle auf Schloss Fürstenau seit 1875, Mitbegründer der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ im Großherzogtum Hessen 1877.
10 11
Vgl. S. 104–112. Vgl. S. 96–103.
7. Die Hannover’schen evangelisch-lutherischen Freikirchen Andrea Grünhagen Die lutherische Freikirchentwicklung im Hannoverland des 19. Jahrhunderts nahm ihren Ausgang in einer lutherischen Erweckungsbewegung um den Pastor Louis Harms in Hermannsburg.1
Georg Ludwig Detlef Theodor (genannt: Louis) Harms, *1808, †1865, Erweckungsprediger, Kollaborator (Mitarbeit im Pfarramt) seines Vaters in Hermannsburg 1844–1849, Pfarrer in Hermannsburg seit 1849, Gründung der „Hermannsburger Mission“ (heute: „Evangelisch-lutherisches Missionswerk in Niedersachsen“ [ELM]) 1849.
Georg Ludwig Detlef Theodor Harms, mit Rufnamen Louis genannt, wurde am 5.5.1808 in Walsrode geboren, wo sein Vater Christian Harms Pastor und Schulrektor war. 1817 wechselte Christian Harms auf die Pfarrstelle nach Hermannsburg. Dort kam Theodor Harms am 19.3.1819 zur Welt. Die Familie hatte zehn Kinder, acht Söhne und zwei Töchter. Der Vater unterrichtete die Kinder in seiner Privatschule selbst. Er war ein engagierter Pädagoge. Als Pfarrer war er von einem milden Rationalismus bestimmt, nüchtern und konsequent. Louis Harms besuchte das Gymnasium in Celle und studierte danach Theologie in Göttingen (1827–1830). Nach dem Examen wurde er Hauslehrer in Lauen1
Vgl. dazu auch Andrea Grünhagen, Erweckung und konfessionelle Bewußtwerdung am Beispiel Hermannsburgs im 19. Jahrhundert, Quellen und Beiträge zur Geschichte der Hermannsburger Mission und des Evangelisch-lutherischenMissionswerkes in Niedersachsen, Münster 2010.
Andrea Grünhagen
57
burg und Lüneburg. 14 Jahre lang, auch für damalige Verhältnisse sehr ungewöhnlich, fand sich für ihn keine Stelle in seiner Kirche. Er galt dem Konsistorium als zu eigenständig. Erst 1844, als sein Vater ihn als Hilfsprediger benötigte, wurde er ordiniert. Schon in seiner Zeit als Hilfsprediger in Hermannsburg, begann das, was man die Hermannsburger Erweckung nennt. Dazu gehört z.B. die Hausandacht in den Familien. Der Gottesdienstbesuch stieg sprunghaft an. Sonntagsheiligung wurde zu einem wichtigen Kennzeichen der Erweckung. Ein Sonntag in Hermannsburg übte zu jener Zeit auch eine beträchtliche Anziehung auf Christen aus anderen Gemeinden und Kirchspielen aus. In Hermannsburg erlebten sie vor allem Gottesdienste, mit denen der ganze Sonntag ausgefüllt war. Der Vormittagsgottesdienst dauerte mindestens drei Stunden. L. Harms hielt eine Auslegung der Lesungen und eine Predigt, die eine Stunde und mehr beanspruchte. Auch fanden an jedem Sonntag eine Abendmahlsfeier und mehrere Taufen statt. Außerdem ließ L. Harms grundsätzlich alle Strophen der Choräle singen. Nachmittags folgte die so genannte Kinderlehre, eine Katechese für die Kinder und Jugendlichen, zu der in Hermannsburg aber die ganze Gemeinde erschien. Besonders genossen einzelne Gemeindeglieder, die es wollten, abends noch eine Versammlung im Pfarrhaus, in der L. Harms auf Plattdeutsch die Bibel auslegte und Geschichten erzählte. Diese Abende haben durch ihre Volkstümlichkeit eine gewisse Berühmtheit erlangt. Man darf aber nicht vergessen, dass L. Harms, wie schon sein Vater, außer in Kirche und Schule mit den Gemeindegliedern überhaupt immer Plattdeutsch sprach. Als Christian Harms 1848 starb, wurde Louis sein Nachfolger als Pfarrer in Hermannsburg. Seit seiner Kandidatenzeit hatte sich L. Harms für die Sache der Mission engagiert, 1836 beispielsweise die Norddeutsche Missionsgesellschaft mitbegründet. Seit 1845 spendeten auch Hermannsburger Gemeindeglieder für die Mission. Überdies meldeten sich junge Männer, die Missionare werden wollten. Nun, als selbstständiger Pfarrer, konnte L. Harms daran gehen, ihnen eine Ausbildung zu geben. Dazu gründete er das Hermannsburger Missionshaus (12.10.1849), in welchem zunächst zwölf so genannte Zöglinge aufgenommen wurden. Lehrer im Missionshaus wurde Theodor Harms, Louis Harms’ jüngerer Bruder. Er hatte das Gymnasium in Lüneburg besucht, in Göttingen Theologie studiert und danach als Hauslehrer gearbeitet. Erwähnenswert ist, dass die Kirchenmusik für Theodor Harms eine große Rolle spielte. Er brachte den Missionszöglingen das Posaunespielen bei. Außerdem gründete er mit ihnen und jungen Gemeindegliedern einen Singchor. Das war für die Gemeinde etwas Neues und stärkte ihr Selbstbewusstsein und ihren Eifer.
58
Die Hannover’schen evangelisch-lutherischen Freikirchen
Theodor Harms, *1819, †1885, Theologe, Inspektor des neu errichteten Missionsseminars in Hermannsburg seit 1849, Pfarrer in Müden/Oertze seit 1858, Leiter der Hermannsburger Mission seit 1865, Pfarrer in Hermannsburg seit 1865, Amtsenthebung aufgrund seines Widerstandes gegen die veränderte Trauliturgie 1878, Mitbegründer der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ 1878.
Zur Hermannsburger Erweckung gehörten also vor allem zwei Dinge, das aktive kirchliche Leben und die Mission. Beides blieb auch prägend für die Gemeinden, die aus der Landeskirche austraten. Diese Trennung hatte ihren Grund hauptsächlich in der Besonderheit dieser Erweckung als einer konfessionell bewusst lutherischen. Theodor Harms vertrat eine entschieden lutherische Position und auch Louis Harms entwickelte sich besonders durch die kirchlichen Streitigkeiten seiner letzten Lebensjahre, von denen noch zu reden sein wird, in diese Richtung. Er erkannte immer mehr, dass die Heilsgewissheit der Menschen nicht an ihrer „Bekehrung“ hängt, obwohl er davon auch viel zu reden wusste. Er meinte damit aber weniger eine Hinwendung zu Gott aus menschlichem Willen und Kräften, sondern ein radikales Ernstmachen mit einer christlichen Lebensführung. Doch das ist für ihn nicht der Grund der Seligkeit, diese hängt allein an Gottes Wirken in den Gnadenmitteln der Kirche, Wort und Sakrament. Dies schätzte L. Harms sehr hoch. Er liebte die lutherische Kirche seiner Heimat, weil er ein geschichtlich denkender Mensch war und ihm das von den Vorfahren Überkommene teuer war. Deshalb war er auch nie etwas anderes, als Lutheraner. Aber er ist es immer bewusster geworden. Dazu gehört auch die Erkenntnis, was der lutherischen Kirche geschenkt ist, auch im Vergleich zu anderen Kirchen. Gleichwohl achtete er Frömmigkeit und Eifer in jeder Kirche. Diese Erweckungsbewegung hatte also ein bewusst konfessionelles und kirchliches Profil. Dies ist wichtig für den weiteren Verlauf der Dinge. Die „Hannoversche lutherische Freikirche“ ist dadurch geprägt, dass sie im Gegenüber zu einer dem Recht nach lutherischen Landeskirche entstand. Im Vordergrund stand also nicht der Widerstand gegen die Einführung der Union. Es gab
Andrea Grünhagen
59
andere Differenzen innerhalb zur Landeskirche Hannovers. Nicht nur Louis Harms war damals mehr und mehr zum konfessionellen Lutheraner geworden, auch der bekannte Pastor Ludwig Adolf Petri (1803–1873) in Hannover und weite Kreise um ihn teilten diese Einstellung. Nicht zuletzt stand auch das Hannover’sche Königshaus auf ihrer Seite. Doch in den Jahren 1862/63 kam es für diese Gruppe zu einer herben Enttäuschung. Der so genannte Katechismusstreit zeigte, dass die Kräfte des theologischen Rationalismus und Liberalismus doch noch die Macht und Mehrheit hatten. König Georg V. gedachte 1862, anlässlich der Konfirmation des Kronprinzen, den zu dieser Zeit gebräuchlichen Landeskatechismus von 1790 durch eine Neubearbeitung des früher üblichen Katechismus des Celler Generalsuperintendenten Walther von 1653 ablösen zu lassen. Doch der neue Walther’sche Katechismus stieß auf erbitterten Widerstand. Der König musste sich beugen, nachdem es in Hannover zu politischen Unruhen und dem Sturz des Ministeriums gekommen war und somit erfolgte die Einführung nur fakultativ. Louis Harms und die mit Hermannsburg verbundenen Kreise kämpften für den Walther’schen Katechismus und waren enttäuscht über die Machtlosigkeit des Königs. Sie erkannten an diesem Streit, wie es theologisch und kirchenpolitisch um ihre Kirche bestellt war. Es erstarkten die liberalen Kräfte, die sich im Protestantenverein zusammenschlossen, um eine deutsche, unierte Gesamtkirche anzustreben. Außerdem forderten sie mehr Demokratie in der Kirche und zu diesem Zweck die Einberufung einer Synode. Auch hier widersprach Louis Harms heftig. Nichts lag ihm ferner als der Gedanke, über Glaubensfragen könnte per Abstimmung (vor allem von Laien) entschieden werden. Eine Synode war für ihn Rebellion gegen die von Gott gesetzte Obrigkeit. Die Landeskirche Hannovers erhielt dennoch eine synodale Verfassung. Auf der ersten stattfindenden Vorsynode sollte besonders die Frage nach der Teufelsentsagung bei der Taufe diskutiert werden. Unter dem Einfluss von Aufklärung und Rationalismus war sie meistens unterlassen worden. Nun hatten einige Pastoren sie mit Zustimmung des Konsistoriums, aber ohne ihre Gemeinden zu fragen, wieder eingeführt. Das Konsistorium erlaubte aber, dass ein anderer Pfarrer taufen durfte, wenn die Eltern die Abrenuntiation ablehnten. Louis Harms sah darin ein Zeichen des Unglaubens, die Verweigerung der Teufelsentsagung zeige, dass viele die Existenz des Teufels und der Erbsünde leugneten. Die einsamen Wege der erweckten Lutheraner begannen sich abzuzeichnen. Als das Königreich Hannover im Jahr 1866 seine politische Selbstständigkeit verlor und preußische Provinz wurde, hatte dies auch Auswirkungen auf die kirchlichen Kreise. Theodor Harms und seine Mitstreiter hingen am welfischen Königshaus und hielten die Annexion für ein Unrecht, das sie aber zu erleiden hätten im Gehorsam gegen Gott. Die Entstehung der „Hannoverschen Freikirche“ ist jedoch nicht durch die antipreußische Haltung der Protagonisten zu erklären. Die politische Situation gab zwar den äußeren Rahmen ab und lieferte den Anlass zur Tren-
60
Die Hannover’schen evangelisch-lutherischen Freikirchen
nung, war aber nicht der Grund. Es handelte sich vielmehr um einen Konflikt innerhalb der Landeskirche Hannovers. Zunächst fürchteten diejenigen, die eine konfessionelle Haltung vertraten wie Theodor Harms, es könnte durch den preußischen König zu einer Einführung der Union in Hannover kommen. Dies verhinderte Otto von Bismarck jedoch, der eine offene Rebellion in der neuen Provinz vermeiden wollte und sich gegen den Berliner Oberkirchenrat durchsetzte. Gleichzeitig rang der preußische Staat im Kulturkampf darum, alle gesellschaftlichen Kräfte zu bündeln und zu kontrollieren. Richteten sich zwar viele der angewandten Maßnahmen gegen die römisch-katholische Kirche, so trafen sie auch die lutherische. Der Kirche wurde die Schulaufsicht entzogen. Mit der Einführung der Zivilstandsgesetzgebung und der Einrichtung von Standesämtern wurde der Kirche weiterer öffentlicher Einfluss genommen. Der kirchlichen Trauung musste nun die Ziviltrauung vorangehen. Damit sind wir beim äußeren Anlass der Freikirchenbildung. Das Problem entstand durch die Art und Weise, wie die kirchlichen Behörden in Hannover auf das neue Gesetz reagierten. Die im Sommer 1876 tagende Landessynode beschloss eine Änderung der bisherigen Trauagende. Um den Unterschied zu verstehen, muss man die alte und neue Trauformel vergleichen: In der alten Form geht man davon aus, dass zwei Brautleute in die Kirche kommen, damit sie dort durch den Pastor zu Eheleuten zusammengesprochen werden und so ihre christliche Ehe beginnt. Bei der neuen Form handelt es sich um Eheleute, die schon verheiratet sind und nun noch einmal zusammengesprochen werden. Theodor Harms und einige andere Pastoren protestierten gegen die neue Trauordnung und baten, dass ihnen durch eine Ausnahmeregelung der Gebrauch der alten Agende weiter gestattet sein möge. Dies wurde ihnen nicht gewährt. Sie hatten nur die Wahl, die neue Agende mit schlechtem Gewissen zu benutzen oder sich zu weigern und die Konsequenzen zu tragen. Für Theodor Harms und seine Mitstreiter war der Punkt erreicht, an dem sie den Weg ihrer Kirche nicht mehr mitgehen konnten. Es ging ihnen nicht um die Ziviltrauung an sich. Sie haben nie deren Rechtsgültigkeit für den bürgerlichen Bereich bestritten. Aber als christliche Trauung konnten sie sie nicht gelten lassen. Besonders zuwider war ihnen die Unaufrichtigkeit der neuen Agende, bei der eigentlich konsequenterweise nur ein Segen der bestehenden Ehe hätte erfolgen können, nun aber durch das Zusammensprechen der Eindruck erweckt werden sollte, es sei alles beim Alten geblieben, obwohl eben undeutlich blieb, zu was zusammengesprochen wurde. Das empfanden sie als Heuchelei. Es blieb den Gegnern der neuen Trauordnung kein anderer Weg, als sich offen zu widersetzen. Sofern sie sich nicht schon im Ruhestand befanden, hatte dies die Amtsenthebung zur Folge. Man bot Theodor Harms um seiner besonderen Stellung in Hermannsburg willen an, sich bei Trauungen durch einen Vikar vertreten zu lassen. Er lehnte ab und schöpfte alle rechtlichen Mittel aus. Dennoch wurde er am
Andrea Grünhagen
61
22.1.1878 suspendiert und am 31.1.1878 seines Amtes enthoben. Er selbst erklärte daraufhin am 4.2.1878 den Austritt aus der Landeskirche. Viele Gemeindeglieder folgten ihm und am 13.2.1878 konstituierte sich die Kreuzgemeinde in Hermannsburg. Auch andere Pastoren, die an der Seite von Theodor Harms standen, wurden abgesetzt. Gemeindeglieder folgten ihnen und es entstanden weitere Gemeinden in Scharnebeck (Pastor Stromburg), Nettelkamp (Pastor Heicke), Wriedel (Pastor C. Dreves) und Hannover (Pastor Rocholl). An manchen Orten waren es nur einzelne Familien, die sich dann an die neuen Gemeinden anschlossen, zum Teil entstanden auch Gemeinden ohne Pastor, die sich zumeist als Filialen von Hermannsburg verstanden wie in Bleckmar, Brunsbrock, Hörpel, Sottrum, Soltau und Wittingen. Am 30.4.1878 wurde die „Hannoversche evangelisch-lutherische Freikirche“ gegründet. Theodor Harms wurde ihr erster Präses.
Rudolf Rocholl, *1822, †1905, Pfarrer in Sachsenberg (Waldeck) 1850–1861, Amtsniederlegung aus Protest gegen die Union 1861, Pfarrer in Brese (Hannover) 1861–1867, Pfarrer und Superintendent in Göttingen 1867–1878, Amtsniederlegung aus Widerstand gegen die veränderte Trauliturgie und gegen die Forderung der Abendmahlsgemeinschaft mit den Unierten 1878, Übertritt zur „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“ 1878, Pfarrer in Radevormwald 1878–1885, Pfarrer in Breslau 1885–1891, Superintendent und Kirchenrat seit 1885, emeritiert 1891.
Es gab jedoch Spannungen innerhalb der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“, die durch unterschiedliche theologische Standpunkte zu der Frage nach dem Verhältnis von Amt und Gemeinde entstanden. Die Überzeugung der Theologen war u.a. durch ihr kirchliches Herkommen bestimmt. Da es für die „Hannoversche Freikirche“ nicht genügend Pastoren aus den eigenen Reihen gab, beriefen einige Gemeinden Seelsorger aus der 1873 entstandenen „Renitenten
62
Die Hannover’schen evangelisch-lutherischen Freikirchen
Kirche ungeänderter Augsburgischer Konfession“ in Kurhessen. Diese Pastoren vertraten in der Frage der Zuordnung von Pastor und Gemeinde und deren Rechten die Position ihres theologischen Lehrers, des Marburger Professors August Friedrich Christian Vilmar (1800–1868). Speziell ging es um die Frage, ob der Gemeinde ein Entscheidungsrecht in Fragen der Lehre, der Kirchenzucht und der Berufung des Pfarrers zusteht. Nun prallte die Auffassung der aus Hessen stammenden Pastoren, die von einer sehr starken Stellung des Amtes im Gegenüber zur Gemeinde ausgingen und der Gemeinde kein Recht in den oben genannten Punkten zugestehen wollten, mit der Position von Theodor Harms zusammen. Dieser folgte in diesen Fragen der Meinung von Julius Diedrich (1819–1890), der über der Frage nach dem Kirchenregiment die Spaltung zwischen der „Evangelisch-lutherische Kirche 2 3 in Preußen“ und der „Immanuelsynode“ im Jahr 1864 auslöste. Diedrich und mit ihm Harms vertraten das Recht der einzelnen Gemeinde und ihres Pastors – das ist die Pointe – gegen den Eingriff einer übergeordneten Kirchenleitung. Genau dies geschah nach Meinung von Th. Harms im Jahr 1880. Die „Hannoversche Freikirche“ bildete einen Synodalausschuss, zunächst auf Probe. Dieser Ausschuss erhielt das Recht, nach vorheriger Vorstellung, Pfarrer für die Gemeinden anzustellen. Dies kollidierte aber mit dem Berufungsrecht der Gemeinden, wie die Hermannsburger Gemeindeordnung es vorsah, und so handelte Th. Harms als Präses der „Hannoverschen Freikirche“ und Hermannsburger Pfarrer wiederholt, ohne das Einverständnis der anderen Ausschussmitglieder einzuholen. Mit Vehemenz vertrat er auch das Berufungsrecht der Gemeinde. Solange Th. Harms lebte, ertrug die „Hannoversche Freikirche“ diese Spannungen. Doch als es nach seinem Tod 1885 um die Frage seines Nachfolgers ging, brachen diese Spannungen auf. Am 16.4.1886 sagte sich die Mehrheit der Hermannsburger Gemeinde vom Synodalausschuss der „Hannoverschen Freikirche“ los; sie bildeten die Große Kreuzgemeinde. Ein Teil blieb jedoch mit Pastor Conrad Dreves bei der „Hannoverschen Freikirche“ und gründete die Kleine Kreuzgemeinde. Auch andere Gemeinden spalteten sich, Gemeindeglieder aus Nestau, Molzen und Gistenbeck schlossen sich zur Gemeinde Nestau zusammen, deren Pfarrer 1887 Heinrich Madaus (1853– 1915) aus der „Immanuelsynode“ wurde. Auch ganze Gemeinden spalteten sich ab, so Groß Oesingen mit Wilhelm Wöhling, Hörpel mit Alert Dierks, Brunsbrock mit Christoph Meyer, Soltau und Wittingen mit Pastor Wetje. Dazu kam Pastor Meinel mit der Zionsgemeinde Hamburg. Am 9. November konstituierte sich dann das noch ohne Namen, was die „Hermannsburg-Hamburger Freikirche“ werden sollte. Doch auch in diesem neuen Versuch einer lutherischen Freikirche brachen Differenzen auf. Es ging einerseits um die Frage der Hermannsburger Mission. Da dort Landes- und Freikirche nach wie vor zusammenarbeiteten, war die Frage, ob man dadurch nicht in eine problematische Kirchengemeinschaft komme, die eigentlich
2 3
Vgl. S. 11–19. Vgl. S. 20–22.
Andrea Grünhagen
63
eine Union sei. Andererseits entstand ein Streit zwischen Th. Harms’ Nachfolger Johannes Ehlers, ebenfalls aus der „Immanuelsynode“, und Wilhelm Wöhling in Groß Oesingen, der aus der „Missouri-Synode“ kam. Es ging um die Frage nach der Eingebung der Bibel durch Gott. Während Ehlers die Inspiration der Schrift so verstand, dass sie unfehlbar zum Heil der Menschen führe, vertrat Wöhling die absolute Irrtumslosigkeit der Schrift in allen Einzelheiten. Dies hielt Ehlers zwar für eine tolerable Meinung, aber nicht für verbindliche Lehre. Es kam zum Bruch. Ehlers, Madaus und Meinel trennten sich mit ihren Gemeinden Hermannsburg Groß Kreuz, Nestau und Hamburg von der Hermannsburger Freikirche und bildeten die „Hermannsburg-Hamburger Freikirche“, die sich in der Missionsfrage dafür entschied, weiterhin die Hermannsburger Mission zu unterstützen. 1894 trat die „Hermannsburger Freikirche“ in Kirchengemeinschaft mit der „Sächsischen Freikirche“, 1908 kam es zur Fusion und die Kirche hieß nun „Evangelisch-Lutherischen Kirche in Sachsen und anderen Staaten“ (von den anderen 4 Freikirchen als „Missourier“ bezeichnet). Nach dem Zweiten Weltkrieg vereinigten sich 1947 die „Hannoversche Freikirche“ und die „Hermannsburg-Hamburger Freikirche“ mit den hessischen Lutheranern zur (alten) „Selbständigen evangelisch-lutherischen Kirche“. 1948 gab es Kirchengemeinschaft zwischen den Altlutheranern und der sächsischen Freikirche, 1949 auch zur (alten) SELK. Damit waren die im 19. Jahrhundert entstandenen Spaltungen zwar beseitigt5, die unterschiedlichen Traditionen (z.B. die Unterstützung der Hermannsburger oder der Bleckmarer Mission) blieben jedoch bestehen.
4 5
Vgl. S. 35–42. Vgl. S. 99–107.
8. Lutherische Bekenntniskirchen in der DDR Albrecht Adam 8.1 Weltpolitische und kirchenpolitische Situation Der II. Weltkrieg brachte über die Völker Europas und darüber hinaus unsagbares Leid. Mehr als 50 Millionen Tote waren zu beklagen, Städte lagen in Trümmern. Konnte Europa aus diesem Desaster neu erstehen? Was für die Völker galt, traf auch auf Einzelpersonen zu. Familien waren zertrennt und konnten oft erst nach Jahren wieder zueinander finden. Expatriierte und sogenannte „displaced persons“, Menschen ohne Heimat und amtliche Identität, irrten durch Mitteleuropa. Völker verloren ihre traditionellen Siedlungsgebiete und wurden neu angesiedelt. Das traf auch auf ca. 11 Millionen1 Deutsche aus den östlichen Gebieten zu, die nach den alliierten Verträgen in Regionen westlich von Oder und Neiße angesiedelt werden sollten. Die „Evangelisch-lutherische Kirche Altpreußens“ verlor in diesem Zusammenhang einen beträchtlichen Teil ihres Bestands: den Sitz der Kirchenleitung in Breslau und ihr gesamtes schlesisches Stammgebiet mit etwa zwei Dritteln ihrer Gemeinden und Predigtplätze. Viele lutherische Christen von Osten her kommend fanden vorläufige Aufnahme in den Gemeinden auf dem Gebiet der sowjetischen 2 Besatzungszone. Es wurde eine „Flüchtlingsparochie Vorpommern“ eingerichtet. Die verbliebenen Gemeinden erfuhren auf diesem Wege einen bedeutenden Mitgliederzuwachs. Die bis in die 1960er Jahre anhaltende Fluchtbewegung in die westlichen Zonen ließ diesen Zuwachs zwar deutlich schwinden, dennoch bildeten sich neben den bestehenden Gemeinden neue, ausschließlich aus Flüchtlingen und Vertriebenen gebildete Gemeinden. Häufig bildeten diese, spiegelbildlich, verlassene Gemeinden von östlich der nun gezogenen Oder-Neiße-Grenze ab. Das Oberkirchenkollegium (OKC) nahm nach Verlassen Breslaus zunächst seinen Sitz in Berlin und 1954 in Wuppertal-Elberfeld („Dienststelle West des Oberkirchenkollegiums in Wuppertal-Elberfeld“). Die bereits in den 1920er Jahren geführten Lehrgespräche zwischen der „Evangelisch-lutherischeKirche Altpreußens“ und der „Evangelisch-lutherischen Freikirche (in Sachsen und anderen Staaten)“ über strittige Punkte der kirchlichen Lehre führten u.a. angesichts der Weltkriegskatastrophe aber auch angesichts des 1
2
Gemäß der Volkszählung in allen 4 Besatzungszonen Deutschlands vom 29.10.1946 wurden insgesamt 9.683000 Vertriebene sowie1.022000 Zugewanderte aktenkundig gemacht. So in: Frank Grube und Gerhard Richter, Flucht und Vertreibung, Stuttgart o.J., S. 230 Vgl. OKC, Prot. 5.12.1949
Albrecht Adam
65
verstärkten aufeinander Zugehens der konfessionell unterschiedlich geprägten Landeskirchen (lutherisch, reformiert, uniert)3 zur Intensivierung der Lehrgespräche und in den Einigungssätzen „zur vollen Einigkeit im Glauben und in der Lehre“. Bei den Themen „Von der Heiligen Schrift“, „Von der Bekehrung und Gnadenwahl“, „Von der Kirche und dem Predigtamt“ sowie „Von den letzten Dingen“ schuf man die notwendige Einigkeit, um den bis dahin erfolglosen Gesprächsprozess zu vorläufiger Einmütigkeit zu führen. Vereinbarungen über weitere Zusammenarbeit auf den Gebieten kirchlicher Strukturen, der kirchlichen Werke sowie der theologischen Ausbildung wurden getroffen. Die Einigungssätze von 1947 bildeten den Grundstock für die folgenden Schritte hin zur Gründung der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK) 1972.
8.2 Kirchlicher Alltag in der DDR Schon die Selbstbezeichnung „Evangelisch-lutherische Kirche im früheren Altpreußen“4 deutet auf den Anspruch hin, lutherische Kirche in den ehemaligen preußischen Provinzen zu sein. Damit war sie juristisch wie faktisch über einen beträchtlichen Bereich Deutschlands verbreitet. Wenngleich stark dezimiert, fanden die Gesamtkirche und ihre Ortsgemeinden schon bald nach dem Krieg intern zu arbeits- und lebensfähigen Strukturen zurück. Anders stand es in den Außenbeziehungen. Während die ELAK in den Westzonen in ihre Rechte einer Öffentlichen Körperschaft wieder eintrat, war diese Rechtsform in der östlichen, der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) durchaus in Frage gestellt (Protokoll OKC 19.1.1950). Das OKC wurde von der Polizei um Auflistung der Mitgliedschaft im Sinne des Vereinsrechts angefragt, was dieses allerdings verweigerte mit Verweis auf den geltenden Rechtsstatus. Mit der Zwangsvereinigung von Sozialdemokratischer und Kommunistischer Partei zur „Sozialistischen Einheitspartei“ (SED) in der SBZ und dem NichtAnschluss an die Währungsreform (1948) sowie der Bildung zweier deutscher Staaten 1949 entfaltete der importierte Stalinismus seine Wirkung im östlichen
3
4
Die lutherischen Freikirchen führten 1948 den Nachweis, dass der Zusammenschluss der konfessionell unterschiedlich geprägten Landeskirchen zur „Evangelischen Kirche in Deutschland“, EKD, nicht nur nominell, sondern auch faktisch Kirche sei. Dies war (ein) Grund für die Intensivierung der Verhandlungen auf dem Wege zu einer Lutherischen Freikirche in Deutschland. Vgl. Manfred Roensch/Werner Klän (Hrsg.), Quellen zur Entstehung und Entwicklung selbständiger evangelisch-lutherischer Kirchen in Deutschland, Frankfurt 1987, S. 543–548. Die Selbstbezeichnung ist nicht durchgängig einheitlich. „Evangelisch-lutherische Kirche in Preußen“ findet sich vor allem in der Zeit vor dem Ende des II. Weltkriegs. Die Spezifizierung „ehemaliges“ bzw./und „Altpreußen“ dürfte auf den Beschluss des Alliierten Kontrollrates von 1947 zurückgehen, den Staat Preußen zu liquideren. Seit 1954 lautet die Selbstbezeichnung: „Evangelisch-lutherische (altlutherische) Kirche“, abgekürzt: ELAK.
66
Lutherische Bekenntniskirchen in der DDR
Teil. Darunter hatten alle Kirchen, somit auch die ELAK, zu leiden.5 Die sich bildenden Junge-Gemeinde-Gruppen und Kirchenchöre standen unter besonderer „Beobachtung“. Das Tragen des Junge-Gemeinde-Ansteckers in der Öffentlichkeit, das Kreuz auf einer Weltkugel, wurde verboten, Übertretungen konnten ggf. das Ende einer Karriere bedeuten.6 Das OKC nahm dazu kritisch Stellung. Ein problematischer Punkt, der Bekenntnisstatus erlangte, war die Frage nach Teilnahme an Konfirmation oder Jugendweihe. Insoweit bei der Jugendweihe ein Bekenntnis zur sozialistischen Ideologie verlangt wurde, war es für die Gläubigen nicht annehmbar und wurde in den Gemeinden und deren Veröffentlichungen heftig diskutiert. Dabei verlief die Sollbruchstelle der Beurteilung einerseits zwischen den Pastoren untereinander und andererseits zwischen Seelsorgern und Gemeindegliedern. Für viele junge Christen – aber ebenso für ihre Eltern – war diese Frage schwer zu ertragen, denn sie markierte die Kluft in der Argumentation zwischen dem Bekenntnis zum christlichen Glauben und der auch in der Heiligen Schrift geforderten Einordnung 7 in den Staat. Sie forderte Menschen zu Entscheidungen heraus. Viele Christen sahen die Lösung allein im Verlassen der DDR und der Flucht bzw. Übersiedlung in die BRD. Durch diesen Exodus sah sich die DDR in ihrer Existenz ernsthaft bedroht.
5
6
7
OKC Protokoll 15.4.1953: „Sup. Wottrich weist darauf hin, daß die Möglichkeit besteht, daß die Regierung der DDR in nächster Zeit einen Treueeid der Pastoren fordert.“ Dies ist u.W. nach nicht durchgeführt worden. Dass Politik in der DDR, insbesondere im Erziehungs- und Bildungsbereich, selten auf der Grundlage der staatlichen Gesetze, sondern oft nach dem Gusto der Verantwortungsträger geschah, zeigt folgende Episode: Albrecht Biehler, Sohn von Pfarrer Johannes Biehler, wurde in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) auf die Erweiterte Oberschule (Gymnasium) mit einem musischen Ausbildungszweig auf Grund der Leistungskriterien zugelassen. Vor seinem Abitur zog die Familie nach Jabel (Brandenburg). Als er sich der Direktorin des zuständigen Gymnasiums vorstellte, wurde er mit folgenden Worten begrüßt. „Da Sie in Ihrer ehemaligen Schule zum Abitur zugelassen worden waren, können wir das hier nicht negieren. Ihr Antrag wäre aber an unserer sozialistischen Schule auf Grund Ihrer politischen und religiösen Haltung strikt abgelehnt worden.“ Dies hatten die vier Kinder das Vorgängers von Pfarrer Biehler sämtlich so erlebt. An diesem Punkt hat die Staatsmacht der DDR partiell den Sieg davon getragen. Die geschlossene Front der Teilnahmeverweigerung an der Jugendweihe löste sich im Laufe der Jahre merklich auf. Das hatte u.a. folgende Gründe: 1. Der Druck der staatlichen Organe auf die Familien war immens, viele hielten dem nicht stand. 2. Die Bekenntnisformel der Jugendweihe zu der Ideologie des Sozialismus (Atheismus, kommunistische Zukunftsvision) wurde in späteren Jahren abgemildert im Sinne des Bekenntnisses zum bestehenden Staat und seiner gesellschaftlichen Ausprägung, was im Sinne von Jeremia 29,7 auch von Christen akzeptiert werden konnte. 3. Die Bindungskraft der Christen an ihre Gemeinden, besonders in den Landeskirchen, nahm im Verlauf der Jahre ab. Dieses Phänomen war allerdings in der ELAK nicht so stark ausgeprägt, so dass noch bis zum Ende der DDR dort die meisten Kinder zur Konfirmation geführt werden konnten und nur ein Teil beide Feiern (Konfirmation und Jugendweihe) vollzogen.
Albrecht Adam
67
Evangelisch-lutherische Kirche „Zum Heiligen Kreuz“, erbaut 1908, Turm und Eingangsbereich in der beim Umbau 1953/1958 veränderten Form. Sitz der „Dienststelle DDR“ des Oberkirchenkollegiums der „Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche“ bis 1961. Foto vom 17.1.2008.
Die Schließung der innerdeutschen Grenze und der Mauerbau 1961 waren eine Konsequenz aus den Ereignissen der späten 1950er Jahre. Dies brachte – abgesehen von den vielfältig dokumentierten Tragödien – einen wirtschaftlichen Aufschwung für die DDR. Das weltweit gepriesene Wirtschaftswunder im Westen Deutschlands wurde mit Verspätung und im kleinen Maßstab in der DDR nachgeholt. Mit der zwangsweise und militärisch gesicherten Souveränität ergab sich eine Lockerung der rigiden stalinistischen Innenpolitik. Es kam zu Gesprächen zwischen Kirchenverantwortlichen und Vertretern des Staates, was zu einer organisatorischen Verselbständigung der Kirchen auf DDR-Gebiet führte, andererseits manche Erleichterung ermöglichte, z.B. Renovierung von Kirchen, Lockerung des Zwangs zur Jugendweihe, Lieferungsgenehmigungen dringend benötigter Ausstattung der Pfarrämter (Kopierer, Fahrzeuge, liturgische Gewänder). Wegbereiter für die atmosphärische Entspannung zwischen Staat und Kirchen war der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche von Thüringen, Moritz Mitzenheim. Er war zwar wegen seines Eintretens für eine Zusammenarbeit mit den staat8 lichen Institutionen der DDR innerhalb der evangelischen Kirche umstritten , erreichte aber mit seinem viel beachteten Treffen mit Vertretern des Staates unter 8
„Er betrieb die Politik des sogenannten „Thüringer Weges“, der – im Gegensatz zu den meisten übrigen ostdeutschen Landeskirchen – loyal zum SED-Staat war. Mitzenheim war deshalb ein wichtiger Ansprechpartner der DDR-Regierungsstellen und wurde 1961 mit dem „Vaterländischen Verdienstorden in Gold“ geehrt. (Wikipedia zur Person)
68
Lutherische Bekenntniskirchen in der DDR
Leitung von Walter Ulbricht, 1964 auf der Wartburg, eine Öffnung für die Anliegen der Kirchen. Auch zwischen dem OKC und dem Sekretariat für Kirchenfragen gab es regelmäßig Kontaktgespräche. Laut Aussagen von Klaus Ketelhut, Mitglied im OKC und nachmaligem Präsidenten der „Gemeinsamen Kirchenleitung“ (GKL) der „Vereinigung selbständiger evangelisch-lutherischer Kirchen“ (VselK) dienten diese Gespräche dem gegenseitigen Informationsaustausch und gaben dem OKC Gelegenheit, Misshelligkeiten mit staatlichen Stellen auf Ortsgemeinde-Ebene anzusprechen. So konnten Genehmigungen für pfarramtliche Büroausstattung sowie Reiseerlaubnisse in beide Richtungen der deutsch-deutschen Grenze erwirkt werden. Auf staatlicher Seite war den Behörden daran gelegen, die Kirchen als stabilisierende Faktoren in innenpolitisch schwierigen Situationen zu wissen. Das war für die ELAK von der lutherischen Zwei-Regimente-Lehre her möglich. Das OKC hat auf die faktische Teilung Deutschlands früh reagiert. So gab es getrennte Sitzungen der Dienststellen West und Ost, wobei die Sitzungen West an verschiedenen Orten stattfanden (Wuppertal, Bochum, Oberursel, Wiesbaden), hingegen die OKC-Dienststelle Ost durchgängig ihren Sitz in Berlin hatte, nach dem Bau der Mauer ausschließlich in Berlin-Ost. Die Leitung-Ost lag seit 1961 in den Händen des „Geschäftsführenden Kirchenrates“. Er lud zu den OKC-Sitzungen – nach Themenlage auch die Superintendenten der drei Diözesen – ein.
Berlin-Mitte, Annenstraße, Evangelisch-lutherische Kirche, erbaut 1857, beschädigt 1945, Schulhaus rechts neben der Kirche 1945 zerstört, Sitz der „Dienststelle DDR“ des Oberkirchenkollegiums der „Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche“ seit 1961, Sitz des Oberkirchenkollegiums des in der DDR fortbestehenden Teils der „Evangelischlutherischen (altlutherischen) Kirche“ seit 1972. Fast unmittelbar hinter dem Kirchgrundstück verlief 1961–1989 der so genannte Todesstreifen und die Berliner Mauer. Sehr seltene Aufnahme: 1981.
Albrecht Adam
69
Wesentlich für die Kirchen wurde die Durchlässigkeit auf theologischem Gebiet: Lizenzausgaben theologischer Literatur verhinderten die vollständige Isolation von Forschung und Lehre und ermöglichten den Anschluss an die Diskurse in der deutschsprachigen Theologie. Spenden theologischer Standartliteratur für die Ausbildung (z.B. K. Aland, Novum Testamentum Graece) durch Fonds und Partnerkirchen machten die Weitergabe möglich. Hinzu kam die partielle Durchlässigkeit der Grenze: Vertreter der ELAK-West und der späteren SELK nahmen regelmäßig an Synoden und Konferenzen der ELAK-Ost teil, in geringer Zahl wurde die Teilnahme an Synoden im West-Teil Deutschlands auch Vertretern der ELAK-Ost genehmigt. Unterhalb der Ebene dieses offiziellen Austauschs brachte die Leipziger Messe jährlich Gelegenheiten des Transfers, ebenso wie der staatlicherseits mindestens hingenommene Touristenverkehr von West- nach Ost-Berlin. Diesen Kanal nutzten kirchliche Gruppen aller Altersstufen intensiv. So konnte die bestehende Kirchengemeinschaft real aufrechterhalten bleiben und nach Fall der Mauer neu belebt werden. Den Einfluss des Staates auf das Privatleben der Bewohner zu intensivieren und dies gleichzeitig konfliktfrei zu gestalten, war erklärtes Ziel des DDR-Bildungssek9 tors sowie weiterer gesellschaftlicher Bereiche. Dies konzentrierte sich 1968 in dem Bestreben, die Verfassung von 1949 durch eine der Zeit angepasste Fassung zu ersetzen. Der Verfassungstext wurde im Vorfeld breit diskutiert – wenngleich die Kontroverse im staatlich gelenkten Rahmen verblieb. Die Kirchen kritisierten vor allem den schmaler werdenden Rahmen10 der konzedierten Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 20.1), der Bildung von Vereinigungen (Art. 29) sowie der Freiheit der Kirchen, ihre Angelegenheiten intern zu regeln (Art. 39). In diesem Sinne nahm auch das OKC der ELAK offiziell Stellung. Freilich, der Effekt beiderseits hielt sich in Grenzen: Weder erreichten die Kirchen eine Abänderung von Formulierungen, noch vermochten staatliche Stellen ihren ohnehin begrenzten Einfluss auf das innerkirchliche Leben durch die neue Verfassung zu intensivieren. Die Freiheit, Gottesdienste zu feiern und die Freiheit der theologischen und katechetischen Ausbildung blieben unangetastet. Das nahmen die Kirchglieder der ELAK dankbar zu Kenntnis und erfüllten es mit Leben im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten einer kleinen lutherischen Bekenntniskirche.
8.3 Auf dem Weg zu einer vereinigten Bekenntniskirche Die Einigungssätze von 1947 zwischen der ELAK und der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche in Sachsen und anderen Staaten“ (ELF) bildeten die Grundlage für eine Intensivierung der Beziehungen der lutherischen Bekenntniskirchen in
9 10
Verabschiedet 6. April 1968; Neufassung 7. Oktober 1974 Man vergleiche die hier aufgeführten Artikel von 1974 mit dem eigens diesem Thema gewidmeten Kapitel V, Religion und Religionsgemeinschaften (= Artikel 41–49) der Verfassung von 1949.
70
Lutherische Bekenntniskirchen in der DDR
Deutschland11. Die Schritte dorthin gestalteten sich im Osten vergleichsweise schwieriger. An dem Zusammenschluss der lutherischen Bekenntniskirchen 1972 zur „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK) wurden die in der DDR bestehenden Gemeinden durch die deutsche Teilung gehindert. Die grundsätzliche Übereinstimmung im Lehren und Bekennen, wie sie in den Einigungssätzen ihren Ausdruck gefunden hatte, ließen aber auch die ELAK-Ost und die ELFOst zu einer Intensivierung der kirchlichen Gemeinschaft kommen. So kam es ebenfalls 1972 zur „Vereinigung selbständiger evangelisch-lutherischer Kirchen in der DDR“ (VselK). Diese informelle Vereinigung entfaltete eine eigene Dynamik kirchlichen Lebens, indem gegenseitige Besuche von Veranstaltungen und gemeinsame Konferenzen zu einem praktischen Zusammenwachsen führten. Kirchliche Werke (Musik, Diakonie, Jugend, Mission u.a.) arbeiteten bewusst gemeinsam und harmonisierten ihre Strukturen. Das Informationsblatt „Aus den lutherischen Freikirchen“ erschien sechs Mal im Jahr und informierte die Gemeinden der VselK über gemeinsame Veranstaltungen; die „Amtlichen Bekanntmachungen“ wurden von den Leitungen beider Kirchen, dem OKC der ELAK und dem Synodalrat der ELF, verantwortet. Den eigenen Entscheidungsgremien wurden eine „Gemeinsame 12 Kirchenleitung“ (GKL) und gemeinsame Synoden zur Seite gestellt . Die Hoffnung brach auf, dass auch unter den andersartigen Verhältnissen ein Zusammenwachsen des Bekenntnisluthertums, vergleichbar der SELK in der BRD, möglich sein könne. Diese Hoffnungen jedoch erfüllten sich nicht. Zu nicht geklärten Differenzpunkten gesellten sich neue, die nicht von den Einigungssätzen erfasst waren. Besonders hermeneutische Fragen (Wie viel wörtliches Verständnis ist nötig, wie viel symbolisches Verständnis ist möglich?) und kirchenpolitische (Wie viel ökumenisch Gemeinsames ist möglich, wie viel Abgrenzung ist nötig?) spalteten die gemeinsamen Konferenzen und führten zu gegenseitigem Misstrauen, 1982 zum Zerbrechen der VselK und schließlich zu ihrer Auflösung.
8.4 Der „Beitritt“ zur SELK Es bedurfte der Umwälzungen in der DDR im Herbst 1989, dass der staatlich verhinderte Zusammenschluss zur SELK auch für die Gemeinden auf dem Territorium der DDR Wirklichkeit wurde. Bereits unmittelbar nach Öffnung der Grenze traten 11
12
Das OKC/Dienststelle Ost empfiehlt in einem Rundschreiben, die „Bleckmarer Mission“ als die gemeinsame anzusehen und finanziell zu unterstützen. Die traditionellen Verbindungen zur Leipziger Mission sollen dabei nicht gekappt werden. (aus den Protokollen des OKC, Berlin 15.2.1950, gez. M. Schulz) Es gab Kirchenbezirke in lokaler Nähe, die für ihren Bereich eine Vereinigung vorwegnahmen. In den „Amtlichen Bekanntmachungen“ 1977/5 heißt es: „Der sächsische Bezirk der ,Evangelischlutherischen Freikirche‘ und die Lausitzer Diözese der ELAK haben am 10. April 1977 eine Vereinbarung über Zusammenarbeit als Simultanbezirk der VselK getroffen. Sie wollen damit der Intention des § 11 der ,Vereinbarung‘ vom 23.9.1972 folgen und dem Beschluß der 2. Gemeinsamen Synode zur künftigen Neugliederung der Kirchenbezirke nachkommen.“
Albrecht Adam
71
die Vertreter der Kirchenleitungen sowie der kirchlichen Werke für je ihren Bereich zusammen mit der Frage, ob und wenn ja wie ein Zusammenschluss bzw. Anschluss aussehen könne. Auch im kirchlichen Bereich hatte das Wort „Beitritt“ Konjunktur. Allerdings anders als im gesellschaftlichen Diskurs wurde ein Beitritt der ELAK zur SELK nicht als Überstülpen oder Bevormunden durch den westlichen Partner gesehen, sondern als eine sinnvolle Form des Zusammengehens, das bewährte Strukturen der SELK13 mit Anliegen der Frömmigkeit auf Seiten der ELAK in Einklang bringt14. So treffen beide Kirchen eine am 12.10.1990 von Bischof Dr. Jobst Schöne (SELK) und Kirchenrat Johannes Zellmer unterzeichnete „Vereinbarung über den Beitritt der Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche zur Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“. In der Präambel dieser Vereinbarung heißt es: „Die Evangelisch-lutherische (altluth.) Kirche in der Deutschen Demokratischen Republik war durch die staatlichen Verhältnisse bisher gehindert, den 1972 erfolgten Zusammenschluss der mit ihr verbundenen lutherischen Kirchen in der Bundrepublik Deutschland, nämlich der damaligen Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche Evangelisch-lutherischen (altluth.) Kirche und Evangelisch-Lutherischen Freikirche zur Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche mitzuvollziehen. Nachdem die bisherigen Hindernisse entfallen sind, beabsichtigt die Evangelisch-lutherische (altlutherische) Kirche sich dem in der Bundesrepublik Deutschland erfolgten Zusammenschluß lutherischer Kirchen anzuschließen. Sie will damit der Einigkeit im Glauben und Bekenntnis sichtbaren Ausdruck verleihen und in der Gemeinsamkeit kirchlichen Handelns alle Aufgaben einer evangelisch-lutherischen Kirche wahrnehmen und fördern.“
Am Tag des Apostels Andreas, dem 30. November 1991, feierten die Vertreter und Gemeindeglieder beider Kirchen in der evangelisch-lutherischen Kirche Berlin-
13
14
Die Synodalkommission für Recht und Verfassung (SynKoReVe) empfiehlt auf ihrer Sitzung, 23.6.1990 in Hannover: „Der Sitz der Kirchenleitung muß in der Grundordnung festgelegt werden. Die Kommission empfiehlt, Hannover als Sitz der Kirchenleitung beizubehalten, da H. zentral liegt … und im übrigen eine Sitzverlegung eine Neuerteilung der Körperschaftsrechte erforderlich machen könnte.“ Aus dem Protokoll der gemeinsamen Kirchenleitungssitzung der Kirchenleitung der SELK und des OKC mit den Superintendenten der ELAK, 6.7.1990: „TOP 2.1. Form des Zusammenschlusses beider Kirchen … KR Ketelhut berichtet von der OKC-Sitzung am Vormittag des Tages und teilt das dort beschlossene Ergebnis mit. Das OKC empfiehlt den Zusammenschluß beider Kirchen durch Anschluß der ELAK an die SELK … Dieser Weg vereinfacht die juristischen Konsequenzen. Die Körperschaftrechte der SELK könnten dann auf die ehemalige ELAK übertragen werden. Die Grundordnung der SELK könnte bestehen bleiben und würde nur an einigen Stellen korrigiert bzw. ergänzt. Dies erscheint auch den Anwesenden der einfachste Weg.“
72
Lutherische Bekenntniskirchen in der DDR
Mitte einen festlichen Gottesdienst. Sie dankten Gott dem Herrn für seine Gnade und besiegelten die Vereinigung. Damit fanden am Folgetag, dem 1. Adventssonntag, die Gottesdienste in der nunmehr vereinigten „Selbständigen EvangelischLutherischen Kirche“ statt.
9. Mission Volker Stolle (unter Mitarbeit von Martin Benhöfer und Werner Klän) Die Entstehung der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirchen ist eng mit der neueren Missionsbewegung verbunden. Einerseits ist diese ein Phänomen der Erweckungsbewegung, die einen wichtigen Faktor der konfessionellen Bewusstwerdung darstellt. Andererseits boten die Missionsfeste und Missionsblätter eine Gelegenheit, über die Parochialgrenzen hinaus christliche Gemeinschaft zu pflegen, Gedanken auszutauschen und sich mit Gleichgesinnten zusammenzufinden. Die Christinnen und Christen, die sich dann in selbstständigen Gemeinden zusammenfanden, hatten in vielen Fällen vorher gemeinsam schon Missionsfeste gefeiert. Sowohl im geistlichen Bewusstsein als auch in den kommunikativen Strukturen bestand eine enge Verbindung zwischen Mission und konfessioneller Kirchenbildung. Ein bezeichnendes Beispiel ist der 1843 gegründete „Waldeckische Missionsverein“. Er positionierte sich 1855 bekenntnismäßig und geriet nach der Bildung selbstständiger lutherischer Gemeinden in seinem Wirkungsbereich 1864 in eine Krise, die zu seiner Auflösung im Jahre 1873 führte. Die Bildung selbstständiger lutherischer Gemeinden war ihrerseits mit Auswanderungsbewegungen verbunden, die dann zu lutherischer Mission genutzt wurden. So erfolgte im Jahre 1838 die Auswanderung unter August Ludwig Christian Kavel nach Australien auch unter einer missionarischen Programmatik. Die Auswanderungen nach Nordamerika führten zu Indianermission, ohne dass diese länger Bestand hatte. Johann Gottfried Scheibel gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Breslauer Missionsvereins (1816). Dieser war zunächst als reiner Unterstützungsverein für die Berliner Missionsgesellschaft tätig. Im Zuge der Auseinandersetzungen um Union, Konfession und Kirche wurden die Bekenntnisgebundenheit und der kirchliche Charakter auch der missionarischen Aufgabe mehr und mehr betont und der Wechsel zur 1836 neu gegründeten Dresdener Mission vollzogen, welche die alte lutherische Mission in Tranquebar in Indien fortsetzte, nachdem sie in Australien begonnen hatte und bevor sie später (seit 1893) auch in Ostafrika wirkte. Auch einen Judenmissionsverein rief Scheibel ins Leben (1822), dessen Arbeit die Breslauer lutherische Gemeinde in begrenztem Maße fortführte. Die Breslauer Bibelgesellschaft (1814), deren treibende Kraft Scheibel ebenfalls war, arbeitete dagegen betont konfessionsübergreifend. Nach der Reorganisation der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“ wurde die Mission ausdrücklich als Aufgabe der Kirche anerkannt. Der Breslauer Missionsverein unter Leitung von Georg Philipp Eduard Huschke wurde Institut der Kirche. Mit der Verlegung der Dresdener Missionsanstalt nach Leipzig wurden
74
Mission
Prüfung, Ordination und Aussendung von Missionaren aus der „Evangelischlutherischen Kirche in Preußen“ der Leipziger Mission überlassen. Allerdings blieb das Verhältnis auf Dauer nicht spannungsfrei. Erste Irritationen brachte die Zulassung unierter Missionszöglinge zum Abendmahl Ende der 1850er Jahre. Neue Schwierigkeiten brachte die Zusammenarbeit mit Missionsvereinen aus nicht (mehr) eindeutig lutherischen Kirchengebieten. Nach der Unterbrechung im Ersten Weltkrieg wurde die Missionsarbeit fortgeführt und bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs die Verbindung der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“ mit der „Leipziger Mission“ weitgehend aufrechterhalten. Während des ersten Jahrhunderts der „Leipziger Mission“ waren in ihr mehrere Pastoren aus dem Kreis der preußischen Lutheraner in deren Missionarsausbildung tätig. Aus ihrer Mitte gingen 16 Missionare in die Arbeit dieser Mission. Innerhalb der „Leipziger Mission“ kam es 1875 zu einer Auseinandersetzung, die in Indien zum Austritt einiger Missionare führte. Diese (Alfred Heinrich Grubert, Otto Heinrich Theodor Willkomm, Carl Manthey-Zorn, Friedrich Zucker) standen in Kontakt mit der „Missouri-Synode“ in den Vereinigten Staaten von Amerika und den zur Freikirchenbildung tendierenden Lutheranern in Sachsen und beurteilten die Lehrstellung der Mission als nicht mehr eindeutig lutherisch. Weitere personelle und lehrmäßige Differenzen im Raum der Leipziger Mission führten in den 1890er Jahren zur Entlassung der Missionare Karl Gustav Theodor Näther und Franz Eduard Mohn. In diesem Fall stellte sich das Oberkirchenkollegium in Breslau hinter das Missionskollegium. Während die frühere Gruppe das indische Missionsgebiet verlassen hatte, setzten diese beiden Missionare 1894 ihre Arbeit in Indien fort, nun getragen von der „Missouri-Synode“ und von der „EvangelischLutherischen Freikirche“ in Sachsen unterstützt. Auf das Wirken von Ludwig Harms geht die Gründung der Hermannsburger Mission zurück. Im Jahre 1849 gründete er eine eigene Missionsanstalt, deren Statuten als Privatanstalt aber erst 1856 genehmigt wurden. Charakteristisch für seinen missionstheologischen Ansatz sind sein Entwurf für Statuten der Hermannsburger Mission und die bei der ersten Aussendung, die nach Ostafrika führen sollte, ausgestellte Ordnung. Die Gemeinde in Hermannsburg gründete eine Zweiggemeinde in Afrika, bestehend aus (zunächst ledigen) Missionaren, Handwerkern und Landwirten. Theodor Harms übernahm nach dem Tod seines Bruders die Leitung der Hermannsburger Mission. Von den Kämpfen im Zusammenhang mit der Entstehung der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ wurde nach und nach auch die Mission betroffen. Zwar meinte Theodor Harms, die Mission für neutral erklären zu können; jedoch erwies sich dieser Ansatz im Laufe der Zeit als illusionär. Eine Vereinbarung zwischen der Leitung der Hermannsburger Mission und dem Hannover’schen Landeskonsistorium in der Frage der Abendmahlsgemeinschaft bewog die „Hannoversche evangelisch-lutherische Freikirche“ zu Grundsatzerklärungen über das Verhältnis von Konfession, Separation und Mission.
Volker Stolle (unter Mitarbeit von Martin Benhöfer und Werner Klän)
75
Schließlich kam es zum Austritt der freikirchlichen Mitglieder des Hermannsburger Missionsausschusses und zur Gründung eines eigenen kirchlichen Missionswerkes; ein Missionshaus wurde in Bleckmar, Ortsteil von Bergen, gebaut. Arbeitsgebiet blieb das südliche Afrika. Seit 1899 erschien das „Missionsblatt der Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“, um für das Werk in breiteren Kreisen zu werben. Unterstützung erfuhr dieses Missionswerk von der „Freien evangelisch-lutherischen Synode in Südafrika“, der „Selbstständigen EvangelischLutherischen Kirche in Hessen“, aus der „Evangelisch-Lutherischen Kirche in Preußen“ und von der evangelisch-lutherischen Buffalosynode in Nordamerika. Im Jahre 1903 wurde eine Missionsordnung erstellt. Nachdem das Missionsseminar bereits seit 1937 geschlossen war, musste die Arbeit in der Heimat 1943 fast ganz eingestellt werden. Das Sammlungsverbot hatte sich noch nicht stark ausgewirkt, weil diese Mission sich vor allem durch gottesdienstliche Kollekten finanzierte. Aber die Devisenbewirtschaftung konnte nur bewältigt werden, weil die deutschen Gemeinden der „Freien evangelisch-lutherischen Synode in Südafrika“ (FELSiSA) sich enorm für die Weiterführung der Missionsarbeit vor Ort engagierten.
Bleckmar, Missionshaus der Lutherischen Kirchenmission (Bleckmarer Mission), gegründet 1892, Aufnahme: vor 2010.
Im Zuge der Auseinandersetzung um den konfessionellen Status der Hermannsburger Mission kam es zu zwei Abspaltungen von der „Hannoverschen evangelischlutherischen Freikirche“. Eine Gruppierung unter der Führung von Wilhelm Wöhling, die „Evangelisch-Lutherische Hermannsburger Freikirche“, stand in enger Beziehung zur „Evangelisch-lutherischen Freikirche“ in Sachsen und betrieb von 1892 bis 1906 eine eigene Mission unter den Maori in Neuseeland; ihr 1897 gegründetes Seminar in Uelzen sollte auch dem Missionarsnachwuchs dienen. Ein anderer Teil um die Große Kreuzgemeinde in Hermannsburg hielt an der Mitarbeit in der Hermannsburger Mission fest. Bis 2016 bestand ein Verband von Gemeinden
76
Mission
und Freundeskreisen innerhalb der SELK zur Unterstützung des „Evangelischlutherischen Missionswerks in Niedersachsen“ (ELM), in dem die „Hermannsburger Mission“ 1972 aufgegangen ist. Auch heute noch wird das ELM von Gemeinden und Einzelpersonen aus der SELK unterstützt. Eine besondere Sparte der Missionstätigkeit stellte die Vorbildung junger Männer in Deutschland für ein Theologiestudium in Nordamerika dar, um den dort herrschenden Pfarrermangel beheben zu helfen. 1861 begründete Friedrich Brunn ein Proseminar in Steeden, das 1865 in einem Anbau des Pfarrhauses eigene Räumlichkeiten erhielt und das bis zu seinem Ende im Jahre 1886 nahezu 250 Schüler durchliefen. Als Publikationsorgan ließ Brunn seit 1866 das Blatt „Evangelisch-lutherische Mission und Kirche“ herausgehen. Dabei ist zu beachten, dass Brunn sein Unternehmen zunächst nicht als missionarisch charakterisierte, später aber sehr wohl. Der Missionsbegriff wies eine große Bedeutungsbreite auf. Eine entsprechende Einrichtung rief Jakob Wilhelm Georg Vilmar 1870 in Melsungen ins Leben, nachdem bereits zehn Jahre früher ein programmatischer Aufruf zur Bildung einer spezifisch „Niederhessischen Mission“ vorausgegangen war; diese Einrichtung wurde von vornherein als Missionshaus bezeichnet. Für das Werk warb seit 1871 das „Melsunger Missionsblatt“. Auch in Dreihausen bestand auf Betreiben von Heinrich Schedtler von 1877 bis 1895 eine solche Ausbildungsstätte. Die zunehmende Konsolidierung der lutherischen Kirchen in Nordamerika erübrigte diese Unterstützung zum Ende des Jahrhunderts hin. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand sich der größte Teil der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirchen in Deutschland zur Zusammenarbeit mit der Bleckmarer Mission als Mission evangelisch-lutherischer Freikirchen bereit, die dadurch eine deutliche Neubelebung und Ausweitung erfuhr. Im Bereich der DDR hielten viele Gemeinden der „Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche“ jedoch an ihren alten Beziehungen zur Leipziger Mission fest. Allerdings ließen die politischen Verhältnisse überhaupt wenig Spielraum für die Unterstützung einer Missionsarbeit im Ausland. Mit viel Fantasie wurden dennoch immer wieder gangbare Wege gesucht. Das Bleckmarer Missionsseminar hatte seine Arbeit bereits 1948 wieder aufgenommen. Die kirchlich-konfessionelle Prägung, wie sie von Anfang an die Missionsarbeit selbstständiger evangelisch-lutherischer Kirchen geprägt hatte, fand ihre Anwendung auch auf die Frage nach der Zusammenarbeit lutherischer Missionen in Südafrika. In verschiedenen Schritten wurde die aus der Mission der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ hervorgegangene Kirche in die Selbstständigkeit entlassen, so dass sie seit 1967 als „Lutheran Church in Southern Africa“ (LCSA) mit eigenständiger Verfassung besteht. 1979 versuchte Friedrich Wilhelm Hopf eine eigene Stellungnahme zu der Situation der Apartheid in Südafrika. 1986 erbat die Kirchenleitung der SELK von der Missionsleitung und von der Theologischen Kommission Gutachten zur Frage des Rassismus. Im Mai 2003 lud die Kirchenleitung der LCSA die Missionsleitung ein, gemeinsam mit ihr die Position
Volker Stolle (unter Mitarbeit von Martin Benhöfer und Werner Klän)
77
der Bleckmarer Mission und der LCSA in der Zeit der Apartheid hinsichtlich der Verletzung von Menschenrechten zu erörtern und zu klären und strukturierte die Thematik in neun Fragen. Diese Fragen wurden 2009 vom damaligen Missionsdirektor Nietzke in Absprache mit der Missionsleitung beantwortet.
Friedrich Wilhelm Karl August Christoph Hopf, *1910, †1982, Pfarrer in Mühlhausen/Franken 1936–1949, Versetzung in den Wartestand wegen seines Protestes gegen den Beitritt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern zur „Evangelischen Kirche in Deutschland“ (EKD) 1949, Übertritt zur „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (so genannte „alte“ SelK) 1950, Missionsdirektor der „Bleckmarer Mission“ (heute: „Lutherische Kirchenmission“ [LKM]) 1950–1978, emeritiert 1978. Aufnahme: beim Missionsfest auf dem Sperlingshof am 26.6.1955.
Eine trilaterale Arbeitsgruppe aus Vertretern der LCSA, der FELSiSA und der LKM/„Mission of Lutheran Churches“/„Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche“ wurde im Jahr 2012 als gemeinsames Projekt der oben genannten Partner ins Leben gerufen worden, um die Geschichte dieser Kirchen in der Zeit der Apartheid in Südafrika aufzuarbeiten. Zur Arbeitsgruppe gehören Bischof em. David Tswaedi (LCSA, Sekretär), Pastor und Missionar Christoph Weber (LKM/MLC), Herr Peter Ntshoe (LCSA), Pastor Dieter Schnackenberg (FELSiSA), Pastor Matthias Albers (FELSiSA), Prof. Dr. Werner Klän D.Litt. (SELK, Vorsitzender); kooptiert wurden Pastor Dr. Karl Böhmer (FELSiSA) und Missionar Thomas Beneke (LKM/MLC). Die Arbeit dieser Kommission ist bisher (2020) nur zu einem vorläufigen Abschluss gekommen. „Im Raum der lutherischen Kirchen, nicht nur in Südafrika, harren noch viele Fragen der Beantwortung: Welches war das Verhältnis zwischen der Lehre von der Heiligen Schrift und der tatsächlichen Auslegung in den verschiedenen Kirchen? – Wie verhielt sich die konfessionelle Grundhaltung der Lutheraner zu ihrem Eintreten und Zeugnis für Gottes Wort und das lutherische Bekenntnis? – Wie kann die Ver-
78
Mission
hältnisbestimmung zwischen dem Konzept der ,Schöpfungsordnung(en)‘ und der Heilsordnung gefasst werden? – Ist zu vermuten, dass das Konzept der ,Schöpfungsordnung(en)‘ und die Zwei-(Be-)Reiche-Lehre unzulänglich ins Verhältnis gesetzt wurden oder durch politisch-religiöse Gedanken angereichert wurden, die eher im calvinistischen Raum beheimatet sind? Wie reagierten die leitenden Geistlichen und Gremien auf die Apartheids-Gesetzgebung (bzw. zu den Gesetzgebungsmaßnahmen, die letztlich zur Errichtung des Apartheid-Regimes führten? – Welches Verhältnis bestand zwischen Seelsorge, Verteidigung der Unterdrückten, theologischer Einrede (nach Act 5, 19) und politischer Anpassung an das ApartheidSystem? – Wie ist das Verhältnis zwischen dem Schriftprinzip und dem so genannten ,Zeitgeist‘ zu bestimmen? – War die Gabe der ,Unterscheidung der Geister‘ in jenen Jahren in den Kirchen vorhanden und/oder lebendig? – Wie wurde die Lehre von den zwei (Be-)Reichen zur Beschönigung offenkundiger Ungerechtigkeit missbraucht? – Nach welchen Grundsätzen wurden Entscheidungen getroffen, um beim Südafrikanischen Staat und/oder seinen Sicherheitskräften zu intervenieren? – Wie kam der politische/bürgerliche Gebrauch des Gesetzes (im lutherischen Verständnis) in Stellungnahmen, in der Verkündigung und im Unterricht der konfessionellen lutherischen Kirchen zur Anwendung? – Werden Pastoren, Kirchenvorsteher, Gemeindeglieder, kirchliche Verantwortungsträger jener Jahre in der Lage sein, persönliches Fehlverhalten, strukturelle Ungleichheiten, falsche und fehlerhafte Entscheidungen einzusehen und einzugestehen?“1
In der Diskussion über den Wandel des Missionsverständnisses schlossen sich 1970 Vertreter der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ mit gewissen Vorbehalten der „Frankfurter Erklärung zur Grundlagenkrise der Mission“ des „Theologischen Konvents Bekennender Gemeinschaften“ an. Die „Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche“ erkannte in ihrer Grundordnung aus dem Jahre 1972 die Mission als kirchliche Lebensäußerung an. Im Jahre 1973 gab sich die Mission evangelischlutherischer Freikirchen eine neue Ordnung, in der sie sich als kirchliches Werk zu erkennen gibt. Eine spätere Unstrukturierung der Arbeitsformen war mit einer Namensänderung verbunden; sie heißt seitdem „Lutherische Kirchenmission (Bleckmarer Mission) e.V.“ Die Lutherische Kirchemission (LKM) führt heute durchweg Einzelprojekte in Rahmen bestehender Kirchen durch, und zwar sowohl innerhalb ihrer Trägerkirche, der SELK, als auch im Dienst von Partnerkirchen weltweit. Die Vereinbarung zwischen SELK und LKM von 1998 zeigt die Struktur solcher Zusammenarbeit auf. An die Stelle einer Vereinbarung zwischen LKM und LCSA ist 2009 eine Vereinbarung zwischen LCSA und SELK getreten, die auch die Rolle der LKM in diesem Miteinander bestimmt. Insofern gilt der 1953 aufgestellte 2 Grundsatz: „Lutherische Mission muß zu Lutherischer Kirche führen“ nicht mehr.
1 2
Zitiert nach Werner Klän, „Das ,dritte Sakrament‘“, in: Werner Klän/Gilberto da Silva (Hrsg.): Mission und Apartheid (= Oberurseler Hefte Ergänzungsband 13), Göttingen 2013, 63f: Vgl. auch Friedrich Wilhelm Hopf, Lutherische Kirche treibt lutherische Mission. Zuerst erschienen 1967, wieder abgedruckt in: Friedrich Wilhelm Hopf, Kritische Standpunkte für die Gegen-
Volker Stolle (unter Mitarbeit von Martin Benhöfer und Werner Klän)
79
Es geht heute meistens um missionarischen Gemeindeaufbau innerhalb schon bestehender lutherischer Kirchen. Jedoch kann es, wie das Beispiel der seit 2005 neu entstandenen „Christlichen Concordia-Kirche Mosambik“ (ICCM) zeigt, auch heute noch der Fall sein, dass die LKM im Sinne ihrer überkommenen Grundsätze bei der Kirchwerdung mitwirkt. Die Missionarsausbildung am eigenen Seminar in Bleckmar ruht seit 1984. Die Missionare und sonstige Mitarbeiter, die vor allem im diakonischen Bereich tätig sind, werden mit Zeitverträgen angestellt. Auch weil es immer schwieriger wird, Visa für dauerhafte Einsätze von aus Deutschland entsandten Missionaren in Südafrika zu bekommen, stellt die LKM seit der Jahrtausendwende zunehmend einheimische Mitarbeiter ein oder kooperiert mit lokalen Partnerkirchen und -organisationen. Derzeit (2020) gibt es in Südafrika keinen aus Deutschland stammenden Missionar mehr. Als Plattform für die Zusammenarbeit von LKM, LCSA und FELSiSA in Südafrika wurde dort 2004 die „Mission of Lutheran Churches“ (MLC) in der Rechtsform der „Public Benefit Organization“ (gemeinnützige Organisation) ins Leben gerufen. Sie ist offen für die Mitarbeit weiterer Kirchen und Organisationen. MLC fungiert auch als lokaler Arbeitgeber für Missionare, die nicht direkt bei der LKM in Deutschland angestellt sind. Ebenso dient MLC der stärkeren lokalen Verankerung der Missionsarbeit. Die Kooperation verschiedener Partner auf der Basis von MLC erweist sich auch bei der Entwicklung der Missionsarbeit über Südafrika hinaus als hilfreich, etwa beim Aufbau einer Ausbildung für Pastoren ICCM in Mosambik. Hier kooperieren neben LKM, LCSA und FELSiSA auch die „Evangelisch-Lutherische Kirche von Brasilien“ (IELB), die „Lutherische Kirche–Missouri-Synode“ (LCMS) und die „Lutherische Kirche–Kanada“ (LCC). Neben dem Arbeitsschwerpunkt im südlichen Afrika, zu dem von 1972 bis 2015 auch eine Arbeit in Botswana gehörte, entstanden seit den 1990er Jahren zeitlich begrenzte Missionsprojekte in Deutschland. Ab 1994 wurden in Gifhorn vorwiegend Deutsche aus der früheren Sowjetunion gesammelt. Später kamen Projekte im (Ost-)Berliner Stadtteil Marzahn, in Cottbus-Döbbrick und Leipzig dazu. Während sich die inzwischen in Gemeinden der SELK überführten Projekte in Gifhorn, Döbbrick und Berlin-Marzahn vorwiegend an Menschen mit deutscher Muttersprache wandten, richtete sich die weiterhin unter dem Dach der LKM befindliche Arbeit in Leipzig („Die Brücke“ – ebenfalls gemeinsam mit z.T. internationalen Kooperationspartnern) zunächst an Migranten, vorwiegend aus dem Iran. Daneben jedoch entwickelte sich die Arbeit der „Brücke“ seit dem Umzug der Räumlichkeiten nach Leipzig-Volkmarsdorf zusätzlich zu einer Stadtteilarbeit mit dem Fokus auf sozial benachteiligte Menschen. Diese Arbeit im Kontext einer deut-
wart, herausgegeben von Markus Büttner und Werner Klän (Oberurseler Hefte Ergänzungsband 11), Göttingen 2012, 219–254.
80
Mission
schen Großstadt zeigt überraschende Parallelen zu einer Arbeit der LKM in der südafrikanischen Großstadt Durban („Lutherkirche“): Auch dort finden sich Menschen verschiedener Nationalitäten, Sprachen und Hautfarben in einer Gemeinde zusammen. Diese Parallele ist paradigmatisch für den Wandel, den die Missionsarbeit der LKM in der sich verändernden Welt durchläuft: Standen noch bis in die 1990er Jahre vorwiegend ethnisch, sprachlich und sozial homogene Gruppen von Menschen – zumeist in ländlichen Gebieten Südafrikas und Botswanas – im Fokus, so sind es heute zunehmend die in vieler Hinsicht inhomogenen urbanen Gesellschaften, die sich, nicht zuletzt durch Flüchtlingsbewegungen, in vielen Regionen der Welt bilden. Den Menschen, die in diesen Gesellschaften leben, das eine Evangelium zu verkünden, erweist sich im fortschreitenden 21. Jahrhundert zunehmend als eine zentrale Herausforderung der LKM und ihrer Partner.
10. Diakonie Stefan Süß 10.1 Selbstverständnis1 Die SELK hat sich 1972 mit ihrem Zusammenschluss aus mehreren lutherischen Teilkirchen in ihrer Grundordnung auch zur Diakonie bekannt. In Artikel 8 der Grundordnung heißt es: „Mission und Diakonie sind ungeachtet der Rechtsform ihrer Werke durch den Auftrag Gottes geforderte Lebensäußerungen der Kirche und ihrer Gemeinden.“2 Unter Bezugnahme auf Artikel 8 der Grundordnung hat die 7. Kirchensynode der SELK 1991 in fünf Thesen ihr theologisches Verständnis von Diakonie niedergelegt: ∙ Grundlegend geht das Diakonieverständnis der SELK von der Erlösungsbotschaft des 2. Artikels aus und verortet Diakonie damit in der Christologie. ∙ Rechtfertigung und Glaube eröffnen auf dem Weg der Nachfolge Christi den Dienst am Nächsten (Diakonie). ∙ Diakonie speist sich aus den Gnadenmitteln der Kirche und geht damit vom Altar der Gemeinde (Wilhelm Löhe) aus (Gnadenmittellehre). ∙ Kirche ist diakonisch, weil der Geist Gottes Gemeinden „treibt“, Zuwendung zu Menschen in allen Lebenslagen zu leben (Ekklesiologie). ∙ Diakonie gehört zum „Vorletzten“ und vollendet sich mit der Aufnahme von Menschen in die Ewigkeit (Eschatologie). Diakonie wird hier definiert als ist eine Folge der Rechtfertigung des Sünders und damit als eine Frucht des Glaubens, nicht seine Voraussetzung. Unberücksichtigt ist dabei, dass bereits das Alte Testament und damit das Judentum eine soziale Verantwortungsübernahme verankert hat. Zielführender ist deshalb eine gesamtbiblische Betrachtung, die schöpfungstheologisch argumentiert und den von Gott geschaffenen Menschen als ein „pro-soziales“ Wesen versteht, in dem sich gerade 3 darin die Ebenbildlichkeit Gottes zeigt. 1
2 3
Herzlichen Dank an Barbara Hauschild, Diakoniedirektorin der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“! Sie hat diesen Aufsatz und vor allem die Liste der ab Seite 131 unter den Nummern 198–205 genannten Dokumente durchgesehen. Diese sind teilweise durch die geschichtliche Entwicklung überholt. Manche Aktivitäten sind aus unterschiedlichen Gründen eingestellt und neue eröffnet worden. Dies ist in den chronologisch sortierten neuen Quellennachweisen zu finden. Geltendes Recht ist entsprechend ausgewiesen. Ordnungen für die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK). Herausgegeben von der Kirchenleitung der SELK, El 16 (2005), 100. Vgl. Heinz Rüegger/Christoph Sigrist, Diakonie eine Einführung. Zur theologischen Begründung helfenden Handelns, Zürich 2011.
82
Diakonie
Diese Betrachtung korrespondiert mit der Weltgerichtsrede aus Mt. 25, bei der Christus die soziale Verantwortungsübernahme in den Tugenden der Barmherzigkeit als eine fast selbstvergessene Lebenshaltung der „Schafe“ fasst. „Diakonie hat auf anthropologischer Ebene ihr primäres Korrelat nicht in der Hilfsbedürftigkeit des anderen, sondern in dem Selbstverständnis des Menschen … Ein Diakonieverständnis, das nicht in dieser Perspektive bei der Rechtfertigung des Sünders einsetzt, müsste zwangsläufig in der ekklesiologischen Entfaltung gesetzlich werden.“4 Diakonie versteht sich damit als eine von Gott geschaffene Lebensform des Menschen, die ihm eigen ist. Diese schöpfungstheologische Gabe Gottes für den Menschen erfährt mit dem Neuen Testament ihre beispielhafte Darstellung im Lebenszeugnis von Jesus Christus in seinen Gleichnissen und Taten bis dahin, dass er sein Leben dienend „zu einer Erlösung für viele“ gegeben hat (Mt 20, 28). Diakonie ist damit Wesensäußerung des von Gott geschaffenen Menschen, weil sie darin dem Wesen des schöpferischen Gottes entspricht. Das biblische Zeugnis von der Diakonie ist also deutlich früher zu verorten als erst im Neuen Testament. Dennoch beginnt Gottes sichtbare Diakonie noch einmal neu in der Weihnachtsgeschichte: „Das Wort ward Fleisch“. Das Wort ist der „einziggeborene“ Sohn des Vaters. Er ist trotz menschlicher Gestalt der ganz andere, die Repräsentanz Gottes in einer von Gott gelösten Welt. „Wahrhaftiger Gott vom wahrhaftigen Gott … und Mensch geworden“ bekennt die Kirche im Nicänum. Gottes Wort inkarniert mit der Absicht, die verloren gegangene Gotteskindschaft an die zu verschenken, „die an seinen Namen glauben“ (Joh 1, 12). Damit definiert das Johannesevangelium in seinem Prolog die gesamte Menschheit als 5 erlösungssbedürftige „Diakoniefälle“ . Mit dem Eintritt in unsere Welt ist Jesus Christus auch ihrer Struktur unterworfen, „unter das Gesetz getan“ (Gal 4, 4), unter das „Gesetz der Sünde“ der Trennung vom Gott des Lebens. Aber in diese gottlose Welt bringt Jesus Christus das Wesen Gottes hinein. Gott inkarniert und damit das, was Jesus in so vielen Gleichnissen und mit seiner Lebenshaltung zeigt: die Liebe des Schöpfers zu seiner Schöpfung, die Liebe des Vaters zu seinen verlorenen Töchtern und Söhnen. Damit inkarniert das Wesen Gottes. Damit inkarniert diakonisches Wesen. Auch der Karfreitag, mit dem die Sendungsgeschichte des Christus irdisch endet, ist eine diakonische Tat. Aus menschlicher Perspektive ist es der Tiefpunkt der „via dolorosa“, aus der Perspektive der Ewigkeit, der Höhepunkt seiner Sendung. „Es ist vollbracht“, mit diesen Worten am Kreuz endet Gottes grundlegende Diakonie zur Erlösung dieser Welt und es beginnt die Diakonie seiner Kirche. Diakonisches Handeln der Kirche hat deshalb zu Recht Maß genommen an Jesus Christus und seinem Leben.
4 5
Hanns-Stephan Haas, Diakonie-Profil, Gütersloh 2004, 33. Ebd.
Stefan Süß
83
In dieser Erlösung „extra nos“ liegt die Freiheit der Diakonie. In der Anerkennung der Erlösungsbedürftigkeit aller Menschen vor dem lebendigen Gott liegt der diakonische Ansatz als einem „Helfen mit Wort und Tat“. Diese Betrachtungsweise macht Diakonie evangelisch und verbindet sie unmittelbar mit der Mission. Die Sprachregelung des 19. Jahrhunderts, die lediglich in Äußere und Innere Mission unterschied, war theologisch sachgerecht, ist aber spätestens seit den 1970er Jahren in Deutschland nicht mehr mit dieser Begrifflichkeit vermittelbar. Die Verankerung des Diakonieverständnisses der SELK in den Satzungen von diakonischen Einrichtungen ist eine der Aufnahmebedingungen, um Mitglied im Diakonischen Werk (DW) der SELK werden zu können. Mit dem Diakonieverständnis der SELK von 1991 hat sich die SELK zugleich eine binnenkirchliche Struktur für ihre diakonische Arbeit gegeben (Ordnung des Diakonischen Werkes der SELK) und das Amt eines/einer Diakonierektors/Diakoniedirektorin geschaffen.
10.2 Diakonische Aktivitäten Die diakonische Arbeit der SELK ist älter als ihre Ordnungen. In den lutherischen Teilkirchen, die sich 1972 zur SELK zusammenschlossen, existierten bereits diakonische Einrichtungen und diakonische Initiativen. Es waren insbesondere Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts, die der sozialen Frage gegenüber aufgeschlossen waren und in Einzelinitiativen erste diakonische Akzente setzten.
Wuppertal-Elberfeld, St. Petrikirche, erbaut 1858, zerstört 1943, Aufnahme: vor 1943.
84
Diakonie
Pfarrer Ludwig Feldner (1805–1890), zuletzt Pastor der „altlutherischen“ Gemeinde in Wuppertal, bediente sich des seinerzeit modernen Mittels des Vereinswesens, um eine christlicher Gesinnung entsprechende soziale Verpflichtung Gestalt werden zu lassen. Der Verstädterung will er durch die Aktivierung der „Laien“ eine eigenständige christliche Alternative bieten. So war er Mitbegründer der „Evangelischen Gesellschaft für Deutschland“ (1848) unterstütze den „Barmer Enthaltsamkeitsverein“, beteiligte sich an der Elberfelder „Armenkommission“, übernahm das Präsidium der Wuppertaler Traktatgesellschaft (1848), förderte die Arbeit der Jünglingsvereine und trug zur Gründung des Privatgymnasiums in Gütersloh maßgeblich bei (1848). Besonders zu würdigen ist sein Beitrag zur Organisation der Armenpflege unter konfessionellem Vorzeichen; dies geschah im Sinn eines privaten Sozialfürsorgewesens. Die Feldner’sche Programmatik führte zum Aufleben kirchlich-diakonischer Arbeit, indem er für jede Gemeinde Diakone vorsah, die in genau umschriebenen Bezirken tätig wurden. In gewisser Hinsicht deutet sich in diesen Bemühungen bereits das moderne Subsidiaritätssystem des Sozialstaats an. Pfarrer Adolf Burgdorf (1855–1935), der 1888 das altlutherische Pfarramt in Fürstenwalde übernommen hatte und im gleichen Jahr mit dem Aufbau sozialer Einrichtungen begann, die 1892 zur Gründung der Samariteranstalten Fürstenwalde führten. Die Einrichtung ist durch politische und wirtschaftliche Schwierigkeiten 1935 der Evangelischen Kirche Altpreußens, der heutigen Evangelischen Kirche Berlin Brandenburg Schlesische Oberlausitz (EKBO), übergeben worden und besteht bis heute fort. Der Unternehmer Friedrich Wilke (1829–1908) schuf aus christlicher Verantwortung heraus mit der Privatstiftung des Naëmi-Wilke-Stifts in Guben die bis heute größte diakonische Institution innerhalb der SELK.
Guben, Naëmi-Wilke-Stift, vor der Pforte des Krankenhauses: Diakonissen mit Oberin Else Frey (erste Reihe siebente von links) und Vorsteher Pfarrer Wilhelm Brachmann (Mitte), Aufnahme: 1954.
Stefan Süß
85
Folgende Einrichtungen, die heute zur SELK gehören, sind in der Zeit vor 1972 entstanden: ∙ 1877 wurde das „Evangelisch-Lutherische Gertrudenstift“ in Baunatal begründet. ∙ 1878 entstand das „Naëmi-Wilke-Stift“ in Guben als Privatstiftung eines Hutfabrikanten. ∙ 1921 gründete sich in Remchingen bei Pforzheim die „Ev.angelisch-lutherische Kinderfreund-Gesellschaft“, das heutige Heilpädagogische Kinder- und Jugendheim Sperlingshof. ∙ 1946 entstand mit Unterstützung der Lutheran Church–Missouri-Synod (LCMS) in Hesel ein Auffangort für Heimatvertriebene, der Beginn der Seniorenarbeit des späteren „Evangelisch-lutherischen Altenheims“ in Hesel. ∙ 1948 entstand auf Initiative einer Pfarrfrau der „Diakonisch-Missionarische Frauendienst“, die Frauenarbeit der SELK; die formal zum DW der SELK gehört hat und bis 2019 bestand. Diese Entwicklung hat sich nach Gründung der SELK fortgesetzt und erscheint unabgeschlossen: ∙ 1977 wurde die Kurklinik in Rothenberg (Odenwald) umstrukturiert zum „Evangelisch-Lutherischen Haus Cordula“, einer Senioreneinrichtung (s.u.). ∙ 1999 wurde aus dem losen Netzwerk der Diakone, die aus der SELK stammen, ein eigener Diakonenverband ins Leben gerufen. ∙ 2005 gründete sich der Verein „Humanitäre Hilfe Osteuropa e.V.“, der mit Hilfslieferungen vor allem in die Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion (UdSSR) den Fall des „Eisernen Vorhangs“ 1989 nutzte. ∙ 2006 sammelte sich im Verein „Hausgemeinschaft Villa Curamus e.V.“ ein lokales christlich-bürgerschaftliches Engagement zur Begleitung altgewordener Mitmenschen. ∙ 2019 Einweihung eines Mehrgenerationenhauses durch die Kreuzgemeinde Cottbus der SELK mit 20 Wohneinheiten. Neben den neuen Aktivitäten (etwa das „Diakonische Jahr“) haben sich die bereits bestehenden diakonischen Einrichtungen der SELK weiterentwickelt zu zeitgemäßen diakonischen Dienstleistungsunternehmen und teilweise ihre Arbeitsfelder erheblich ausgebaut. Zu konstatieren sind jedoch inzwischen auch einige Rückschläge dieser Entwicklung. ∙ So ist das 1977 gegründete „Haus Cordula“ 2014 durch Insolvenz des Unternehmens privatisiert worden und ist seit dem 01.01.2015 in der Hand der AzuritGruppe und nicht mehr Teil des DW der SELK. ∙ Ebenso ist die Traditionseinrichtung, das 1946 gegründete spätere „Evangelischlutherische Altenpflegeheim Hesel“ durch Insolvenz 2018 in private Trägerschaft der Convivo-Unternehmensgruppe überführt worden. ∙ Der 1948 entstandene Diakonisch-Missionarische Frauendienst ist zum 31.12.2018 aufgelöst worden.
86
Diakonie
10.3 Diakonische Strukturen Bedingt durch die Teilung Deutschlands von 1961–1989 lag die Mehrzahl der diakonischen Einrichtungen in der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland (West). Nur das Naëmi-Wilke-Stift im östlichen Guben lag auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Die westlichen Einrichtungen haben sich 1988 eigene Grundsätze für eine strukturierte Zusammenarbeit gegeben. Mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik West und dem Beitritt der „Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche“ (ELAK) in der ehemaligen DDR zur SELK sind auch die diakonischen Strukturen der SELK gebündelt worden in der gemeinsamen „Ordnung für die diakonische Arbeit der SELK“. Die diakonischen Rechtsträger der SELK, die dem DW der SELK angehören, sind zugleich Mitglieder der jeweiligen sie umgebenden landeskirchlichen diakonischen Werke (Landesverbände im EWDE). Diese enge Kooperation auf der Grundlage des Vereinsrechtes ist notwendig als Teil der Sozialstaatsstruktur der Bundesrepublik Deutschland nach dem sogenannten Subsidiaritätsprinzip. Die Spitzenverbandsvertretung der Freien Wohlfahrtspflege in der Bundesrepublik übernehmen sechs anerkannte Wohlfahrtsverbände, unter ihnen die Diakonie Deutschland als Teilwerk des „Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung“ (EWDE) als Dachverband der Diakonie und der Entwicklungshilfe aller evangelischen Landesund Freikirchen. Die SELK als Kirche ist deshalb Mitglied im EWDE und arbeitet aktiv in der Arbeitsgemeinschaft evangelischer Kirchen für Diakonie und Entwicklung (AeK), der eigenen Arbeitsgemeinschaft der Freikirchen zusammen mit dem EWDE mit. Das EWDE hat für diese Zusammenarbeit 2019 ein Verbindungsbüro für die AeK in Berlin geschaffen mit einer entsprechenden Referentenstelle.
10.4 Diakoniestruktur in der SELK Mit dem Diakonieverständnis der SELK von 1991 hat sich die SELK zugleich eine binnenkirchliche Struktur für ihre diakonische Arbeit gegeben (Ordnung des Diakonischen Werkes der SELK) und das Amt eines/einer Diakonierektors/Diakoniedirektorin geschaffen. Die Verankerung des Diakonieverständnisses der SELK in den Satzungen von diakonischen Einrichtungen ist damit eine der Aufnahmebedingungen, um Mitglied im Diakonischen Werk (DW) der SELK werden zu können. Die Ordnung des DW der SELK fasst die gesamte diakonische Arbeit der SELK in einer rechtlich offenen Form zusammen. Die jährliche Vollversammlung des DW der SELK vereint diakonische Rechtsträger und weitere diakonische Initiativen mit je zwei Vertretern aus jedem der elf Kirchenbezirke der SELK. Dadurch wird die diakonische Arbeit der SELK direkt mit den gemeindlichen Aktivitäten in den Kirchenbe-
Stefan Süß
87
zirken strukturell verbunden. Die Vollversammlung des DW der SELK ist das jährlich tagende Entscheidungsgremium des nicht eingetragenen Vereins DW-SELK. In den Jahren seit 1990 hat die SELK stärker selbstständig von ihren rechtlichen Möglichkeiten als Körperschaft des öffentlichen Rechts Gebrauch gemacht und über ihre Kirchensynoden diakonische Rechtstexte erlassen, die die diakonischen Einrichtungsträger der Kirche als kirchliches Recht anwenden können wie z.B. die Bestimmungen über das Amt des Diakons/der Diakonin, ein eigenes Mitarbeitervertretungsgesetz oder die Richtlinie der SELK über die Anforderungen der privatrechtlichen Mitarbeit in der SELK (Loyalitätsrichtlinie) sowie eine eigene Zuordnungsrichtlinie von diakonischen Einrichtungen zur Kirche.
10.5 Gesamtkirchliche Ordnungen Die SELK hat sich in den zurückliegenden Jahren verstärkt ihrer Diakonie gewidmet und sich mit der „Ordnung für die diakonische Arbeit der SELK“ eine eigene Struktur gegeben. 2016 hat das DW der SELK in einer eigenen Broschüre alle rechtlichen Grundlagen und Ordnungen des DW der SELK veröffentlicht.
11. Liturgie Christoph Barnbrock In den Gemeinden, die später in unterschiedlichen Territorien selbstständige evangelisch-lutherische Kirchen bildeten, standen bis ins 19. Jahrhundert die jeweiligen Kirchenordnungen und Agenden aus dem 16. bzw. 17. Jahrhundert in Geltung. Diese wurden deswegen bis ins 19. Jahrhundert immer wieder nachgedruckt. Zugleich lassen sich seit der Reformationszeit auch Abbruchs- und Umbruchsphänomene wahrnehmen. Die gottesdienstliche Praxis war in manchen Bereichen verkümmert. Nicht überall waren die Kirchenordnungen noch flächendeckend greifbar. Andernorts bildeten sich Lokaltraditionen heraus, die gleichwohl aus Gründen der Legitimation – bisweilen nicht präzise zutreffend – auf die Reformation zurückgeführt wurden. Von dieser Ausgangslage her entsteht vor allem im 19. Jahrhundert eine vielfältige liturgische Erneuerungsbewegung. Es werden Agenden erarbeitet, die die überkommene liturgische Tradition wieder in Erinnerung rufen wollen. Diese stehen neben solchen, die innovative und zum Teil auch schon ökumenische Impulse aufgreifen. Bemerkenswert ist weiterhin das Phänomen, dass nun zunehmend Einzelpersonen Agenden verfassen, die nicht notwendigerweise kirchlich appro1 biert sind. An den Fragen der Einführung von Agenden und neuen gottesdienstlichen Formen entzündeten sich dann auch Konflikte, die in bestimmten Staaten zur Gründung selbstständiger lutherischer Kirchen bzw. zur Auswanderung auf andere Kontinente geführt haben. Dabei ist zu beobachten, dass auch in diesen Auseinandersetzungen unterschiedliche Fragestellungen miteinander verwoben waren: 1
Christoph Barnbrock, Liturgie als Ausdruck kirchlicher Identität. Entwicklung und Gebrauch der Agenden im 19. Jahrhundert. Im Raum der (entstehenden) altlutherischen Kirche, in: Jürgen Kampmann/Werner Klän (Hrsg.), Preußische Union, lutherisches Bekenntnis und kirchliche Prägungen Oberurseler Hefte Ergänzungsband 14), Göttingen 2013, 133–157 sowie ders., Die Agenden in der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche in den Spannungsfeldern von Dogmatik und Liturgik sowie von Freiheit und Verbindlichkeit, LuThK 40 (2016), 274–286. Zum Folgenden vgl. Wolfgang Fenske, Das Abendmahl nach den Ordnungen der selbständigen lutherischen Kirchen, in: Irmgard Pahl (Hg.), Coena Domini II. Die Abendmahlsliturgie der Reformationskirchen vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert (Spicilegium Friburgense 43), Fribourg 2005, 218–237 sowie Michael Meyer-Blanck, Lutherische Liturgie im 20. Jahrhundert, in: Jürgen Bärsch/Benedikt Kranemann (Hrsg.), Geschichte der Liturgie in den Kirchen des Westens, Bd. 2: Moderne und Gegenwart, Münster 2018, 365–397 und Klaus Raschzok, Lutherische Liturgie vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, in: Jürgen Bärsch/Benedikt Kranemann (Hrsg.), Geschichte der Liturgie in den Kirchen des Westens, Bd. 1: Von der Antike bis zur Neuzeit, Münster 2018, 575–646.
Christoph Barnbrock
89
Welche Kompetenzen hat der Staat in gottesdienstlichen Angelegenheiten? Wie sind das Recht des Bewährten und Überkommenen auf der einen Seite und das Recht der Innovation und Adaption auf der anderen Seite miteinander auszutarieren? Welche Veränderungen in dem, was eine Kirche glaubt und bekennt, ergeben sich durch Modifikationen in der Liturgie? Unter den innovativen Gottesdienstreformbemühungen, von denen sich lutherische Bekenntniskirchen in ihrer Entstehungszeit im 19. Jahrhundert in besonderer Weise abgrenzten, sind vor allem diejenigen zu nennen, die Impulse der Aufklärung für die Gestaltung des Gottesdienstlebens aufnahmen (Rationalismus), und diejenigen, im Rahmen derer überkonfessionelle gottesdienstliche Modelle geschaffen wurden (Union). Für letztgenannten Bereich haben insbesondere die zum Teil mit Staatsgewalt durchgesetzten Gottesdienstreformen des preußischen Königs 2 Friedrich Wilhelm III. liturgiegeschichtlich besondere Bedeutung gewonnen, die im Bereich des bekenntniskirchlichen Luthertums als Gegenbewegung zur Bildung der „Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche in Preußen“ geführt haben. Unter den Bemühungen Einzelner aus dem Bereich des konfessionellen Luthertums sind die „Agende der Hannoverschen Kirchenordnungen“3 von Ludwig Adolf Petri und die „Agende für christliche Gemeinden des lutherischen Bekenntnisses“ in besonderer Weise hervorzuheben. Insbesondere die letztgenannte Agende hat, wie sich nicht zuletzt an den Widmungen für Friedrich Wyneken und Eduard Huschke erkennen lässt, die entstehenden konfessionellen lutherischen Gemeinden und Kirchen in Deutschland und den USA explizit im Blick. Mehr noch: Die prekäre geistliche Situation der deutschen Auswanderer in den USA war der Kontext, für den Wilhelm Löhe seine Agende primär erarbeitet hat. So gehört dieser Entwurf unmittelbar zur Agendentradition der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und anderen Staaten (heute: „The Lutheran Church–Missouri Synod“). Im Zuge der Institutionalisierung und Selbstständigwerdung konfessioneller lutherischer Kirchen ergab sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch die Notwendigkeit, das gottesdienstliche Leben (neu) zu ordnen. Da in einigen lutherischen Bekenntniskirchen auch Gemeinden aus unterschiedlichen Staaten zusammengeschlossen waren, war der Rückgriff auf eine einzige territoriale Gottesdiensttradition so einfach nicht mehr möglich. Auch die Veränderungen, die sich angesichts der nun eigenständigen kirchlichen Struktur ergaben, machten ebenfalls Anpassung nötig. Und nicht zuletzt eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Gottesdiensttradition führten zu agendarischen Neuentwürfen. Wie stark die Prägung durch die überkommene Kirchenordnung im Raum der Hannover’schen evangelisch-lutherischen Freikirchen war, lässt sich daran erkennen, dass bei den Formularen zur Gottesdienstordnung der Rückbezug zur „Lüne-
2 3
Vgl. S. 11–19. Vgl., auch zum Folgenden, S. 56–63.
90
Liturgie
burger Kirchenordnung“ deutlich erkennbar ist. 1860 bereits hatte Theodor Harms ein „Kantional zur Lüneburgischen Kirchenordnung“ herausgegeben. Und noch 1911 wurde eine Gottesdienstordnung veröffentlicht, die sich ebenfalls ausdrücklich in diese Traditionslinie stellt: „Agendarischer Anhang zur Lüneburger Kirchenordnung“. 1904 ist für diesen kirchlichen Bereich außerdem die „Ordnung der Gottesdienste für die Gemeinden der Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ erschienen. Neben der Rückbindung an die eigene territoriale Kirchenordnung spielten nun aber auch bereits Einflüsse aus der „Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche“ eine Rolle. In letztgenannter Kirche wurde nach einem längeren Vorlauf im Jahr 1886 die erste eigenständige Agende veröffentlicht („Agende für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Preußen“). Eine neubearbeitete Fassung erschien dann 1935 unter dem Titel „Agende der Evangelisch-lutherischen Kirche Altpreußens“. 4 Für die „Selbständige evangelisch-lutherische Kirche in Hessen-Darmstadt“ bzw. später „in den hessischen Landen“ liegt mit „Gedenke, Gott, an Deine Gemeinde!“ (1892) eine erste Agende vor, die von Christian und Karl Müller erarbeitet worden war. Christian Müller hatte bereits zuvor mit Georg Christian Dieffenbach eine „Evangelische Handagende“ (1858) herausgegeben. Die Agende „Gedenke, Gott, an Deine Gemeinde!“ hat im Odenwald noch bis ins 21. Jahrhundert eine Bedeutung als liturgische Lokaltradition. Für die „Evangelisch-Lutherische Freikirche“5 ist die Agendentradition der nordamerikanischen Missouri-Synode von großer Bedeutung gewesen. Diese hat bereits 1856 eine eigene „Kirchen-Agende für Evangelisch-Lutherische Gemeinden ungeänderter Augsburgischer Confession“ vorgelegt, die bis 1922 in „mehrfach veränderter Form“ immer wieder herausgegeben worden ist und auch in Deutschland im Raum der Gemeinden der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ bis nach dem Zweiten Weltkrieg in Geltung stand. Insbesondere für das 19. Jahrhundert ist auch noch mit einer Vielzahl an lokalen Gottesdienstordnungen bzw. Eigentümlichkeiten des gottesdienstlichen Lebens zu rechnen. Eine Erfassung all dessen stellt aber wie eine umfangreichere Untersuchung der Liturgiegeschichte der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirchen bislang noch ein Forschungsdesiderat dar. Einen Einschnitt für die Agendengeschichte der konfessionellen lutherischen Kirchen in Deutschland (wie für die evangelischen Landeskirchen) stellt der Zweite Weltkrieg dar. Neben den liturgischen Neuaufbrüchen, in deren Kontext schon in Kriegszeiten mit Vorarbeiten zur späteren „Agende I“ der „Vereinigten EvangelischLutherischen Kirche Deutschlands“ (VELKD) begonnen wurde, dürften die Migrationsbewegungen, die zu einer Durchmischung von Gemeinden mit Gliedern, die aus unterschiedlichen gottesdienstlichen Traditionen stammten, und der Verlust
4 5
Vgl. S. 51–55. Vgl. S. 35–42.
Christoph Barnbrock
91
von Agenden in Rahmen von Kriegsschäden hinreichende Gründe dargestellt haben, ein neues Agendenwerk zu erarbeiten. Der unter der Federführung von Christhard Mahrenholz erarbeitete und 1955 erschienene Band I dieses Agendenwerks mit der Ordnung des Hauptgottesdienstes und der übrigen Predigt- und Abendmahlsgottesdienste lässt sich in gewisser Weise als Abschluss der Bemühungen um eine Restauration der lutherischen Liturgie verstehen, die im 19. Jahrhundert ihren Ausgang genommen hatte. Von daher ist es leicht verständlich, dass diese Agende auch in konfessionellen Kreisen geradezu begeistert aufgenommen worden ist. 1957/58 erschien dann auch eine leicht modifizierte Fassung (mit „Sonderbestimmungen“) für die „Evangelisch-lutherische (altlutherische) Kirche“, die in ihren Gemeinden und spätestens mit dem Zusammenschluss der lutherischen Bekenntniskirchen zur „Selbständigen EvangelischLutherischen Kirche“ (SELK) im Jahr 1972 auch darüber hinaus im bekenntniskirchlichen Luthertum bis in die 1990er Jahre in Geltung stand. Obwohl sie nicht als offizielle Agenden der eigenen Kirche approbiert waren, wurden auch die weiteren Agenden aus dem Agendenwerk der VELKD (insbesondere die Bände III und IV) in den Gemeinden der SELK genutzt und waren – zum Teil mit Sonderbestimmungen – für den gottesdienstlichen Gebrauch freigegeben. Die letzte Agende, für die dies gilt, ist die Neubearbeitung der Bestattungsagende der VELKD aus dem Jahr 1996. Andere Agendenneubearbeitungen aus dem Raum der VELKD waren zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr von der SELK offiziell approbiert worden. Ende der 1990er Jahre ist dann mit dem ersten Band der „Evangelisch-lutherischen Kirchenagende“ (1997 als Altarausgabe erschienen, 2009 zusätzlich als Handausgabe) der Beginn eines eigenständigen Agendenwerks gemacht worden, im Rahmen dessen bis heute zwei weitere Bände zu Taufe (2010) und Konfirmation (2016) gefolgt sind. Ein weiterer Band zu Gottesdiensten im Kontext von Einführungs- und Segenshandlungen und der Ordination ist im Erscheinen begriffen. Während sich die „Evangelisch-lutherische Kirchenagende“ (1997) noch als eine behutsame Fortschreibung der „Agende I“ und ihrem liturgischen Ansatz – gerade in Abgrenzung vom etwa zeitgleich erschienenen „Evangelischen Gottesdienstbuch“ (2000) – verstehen lässt, geht die SELK mit den weiteren Bänden ihres Agendenwerks deutlicher erkennbar eigene Wege, die sich nicht mehr einlinig auf die Entwicklungen im landeskirchlichen Luthertum zurückführen lassen. Nach rund einem halben Jahrhundert des Verzichts auf eigene Agenden hat die SELK damit an die Tradition ihrer Vorgängerkirchen angeknüpft und wieder mit der selbstständigen Erarbeitung von Gottesdienstordnungen begonnen. Während die Agenden weiterhin eine hohe Verbindlichkeit im Raum der SELK besitzen und so auch eine erkennbare Homogenität und Wiedererkennbarkeit der Gottesdienste in unterschiedlichen Gemeinden und in unterschiedlichen Regionen gewährleistet, ist doch seit spätestens Ende des 20. Jahrhunderts auch der Trend zu einer vielfältigeren Ausformung der Gottesdienste erkennbar. Die „Evangelisch-
92
Liturgie
lutherische Kirchenagende“ (Band I) trägt dem mit umfangreichen Hinweisen zu „Gestaltungsvarianten“ Rechnung. So haben Jugend- und Familiengottesdienste, Gottesdienste nach der Ordnung der Kommunität von Taizé oder musikalisch besonders ausgestaltete Gottesdienste längst ihren festen Platz in vielen Gemeinden der SELK erhalten. Besonders deutlich erkennbar wird dies auch am neuen „Evangelisch-lutherischen Kirchengesangbuch“ (ELKG), dessen Erscheinen für das Jahr 2020 angekündigt ist und das sowohl in der Auswahl des Liedbestands als auch hinsichtlich der Formen von Gottesdiensten und Andachten ein deutlich breiteres Spektrum abbildet als bisher. Dieses neue ELKG wird seinen namensgleichen Vorgänger aus dem Jahr 1987 ersetzen, der im Wesentlichen eine Fortschreibung des „Evangelischen Kirchengesangbuchs“ (EKG) aus dem Raum der „Evangelischen Kirche in Deutschland“ darstellt, ergänzt um eigene Teile – dazu an einigen wenigen Stellen gekürzt bzw. modifiziert. Das EKG (in den Landeskirchen zwischen 1950 und 1969 eingeführt) war bereits zuvor in vielen Gemeinden der SELK in Gebrauch. Anstelle des EKG bzw. des alten ELKG nutzten einzelne Gemeinden der SELK bzw. ihrer Vorgängerkirchen das 1956 erschienene „Lutherische Kirchengesangbuch“. Vor der Mitte des 20. Jahrhunderts waren eine Reihe von regional unterschiedlichen 6 Gesangbüchern in den lutherischen Bekenntniskirchen verbreitet. Heute werden außerdem in vielen Gemeinden der SELK neben dem alten ELKG auch das 2000 veröffentlichte „Beiheft“ zum ELKG sowie die Jugendliederbücher „Come on and sing“ (Bd. 1–3: 1990, 1996 und 2012) auch für den gottesdienstlichen Gesang eingesetzt.
6
Vgl. Manfred Weingarten, Liedgut und Musik in den Gesangbüchern der Selbständigen Ev.-Luth. Kirche und ihrer Vorgängerkirchen, http://kirchenmusik-selk-nord.de/gesangbuch/files/2012/ 11/2012_Vortrag-Propst-em.-Manfred-Weingarten.pdf (abgerufen 02.04.2020).
12. Verhältnis Kirche und Judentum Volker Stolle Bei der Missionswirksamkeit selbstständiger lutherischer Kirchen waren von Anfang an nicht nur heidnische Völker im Blick, sondern auch Israeliten/Juden. Dies war um so selbstverständlicher, als in Preußen eine Reihe der Pastoren der EvangelischLutherischen Kirche vorher in der Judenmission tätig gewesen war (Heinrich Kaspar Wedemann, Ludwig Otto Ehlers, Johann Georg Wermelskirch, Philipp Jakob Oster, Karl Friedrich Becker) und in Hessen die von Ludwig Saul 1861 ins Leben gerufene Balhorner Judenmission eng mit der Bildung der „Renitenten Kirche“1 verbunden war. Allerdings nahm dieser Arbeitszweig keine festeren Formen an.
Johann Georg Gottfried Wermelskirch, *1803, †1872, Judenmissionar in Warschau 1824–1825 und der Provinz Posen 1825–1835, Leiter der Dresdner (später Leipziger) Mission 1836–1842, Pfarrer der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“ in Berlin 1842–1844, Pfarrer in Erfurt 1844–1872.
Tatsächlich wurde das Postulat der Judenmission nur in ganz geringen Ansätzen umgesetzt. Als einer der Judenmissionare, die in den Dienst der „EvangelischLutherischen Kirche in Preußen“ getreten waren, Karl Friedrich Becker, dem Grundsatzbeschluss gemäß, dass die Missionstätigkeit unter den Israeliten Angelegenheit der Kirche als solcher sei, 1856 beantragte, hauptamtlich in der Judenmission eingesetzt zu werden, lehnte die Generalsynode dies ab. Als 1871 in Leipzig der „Evangelisch-Lutherische Zentralverein für Mission unter Israel“ gegründet wurde, 1
Vgl. S. 43–50.
94
Verhältnis Kirche und Judentum
gehörte zwar die renitente Balhorner Gemeinde zu den Gründungsmitgliedern, aber die „Evangelisch-Lutherische Kirche in Preußen“ konnte sich nicht zu einer korporativen Mitgliedschaft entschließen, sondern nur einzelnen Kirchgliedern einen Beitritt freistellen. Der Einsatz für diese Sache wurde auch nicht stärker, als es auf Betreiben von Ernst Ziemer 1915 zur Gründung einer „Vereinigung der Freunde Israels innerhalb der lutherischen Kirche in Preußen“ kam, die den Zentralverein vor allem in der Arbeit seiner Breslauer Station unterstützte. Die ausdrückliche kirchliche Billigung für diesen Schritt bedeutete zugleich, dass dieser Tätigkeitsbereich stillschweigend aus dem Aufgabenfeld des Oberkirchenkollegiums herausgenommen wurde. Diese Vereinigung löste sich 1935 selbst auf. Bereits 1946 rief das Oberkirchenkollegium dazu auf, den wiedererstandenen Zentralverein in seiner Arbeit durch eine Kollekte zu unterstützen. Das Verhältnis zum Judentum wurde in der Zeit des Nationalsozialismus sehr kontrovers diskutiert; es fehlen aber kirchliche Erklärungen zum Thema. Auch das Verhalten gegenüber Juden und Christen jüdischer oder teilweise jüdischer Abstammung weist eine starke Divergenz aus. Die Spannbreite zeigen etwa die Thesen von Gottfried Riegel und die Stellungnahme von Friedrich Priegel zum Arierparagraphen in der Kirche. Zwölf Namen und Lebensläufe von Personen oder Familien jüdischer Abstammung ließen sich ermitteln, die von der Vernichtungspolitik des NS-Staates betroffen waren, darunter auch Pfarrer Erwin Horwitz (1894–1982); zwei Frauen kamen in Vernichtungslagern um, die anderen Betroffenen überlebten die Zeit der Ausgrenzung. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb eine Aufarbeitung aus. In den Einigungssätzen von 1947 werden nur chiliastische Erwartungen hinsichtlich der Rückkehr der Juden in ihr Land und hinsichtlich einer allgemeinen Judenbekehrung ausdrücklich zurückgewiesen. Allerdings wurde der Weg des 1945 wieder gegründeten „Zentralvereins“ begleitet und mitgegangen, der seine Position zögernd überdachte. Diese Entwicklung fand ihren Niederschlag in mehreren Namenänderungen (1871: Mission unter Israel, 1985: Zeugnis und Dienst unter Juden und Christen, 2000: Begegnung von Christen und Juden). Ein Schritt auf diesem Wege war die so genannte „Leipziger Erklärung“ von 1991. Um das Zeugnis unter den Juden zu fördern, etablierte sich 1984 ein „Arbeitskreis der „Selbständigen EvangelischLutherischen Kirche“ für Zeugnis unter den Juden e.V.“, in dessen Auftrag von 1991 bis 1998 ein Missionar im Raum Johannesburg/Südafrika arbeitete. Dieser Arbeitskreis löste sich 2002 wieder auf. Daraufhin berief die SELK einen Koordinator Kirche und Judentum. Ein wichtiger Schritt erfolgte mit der Annahme der Charta Oecumenica (2003), die den Abschnitt „10. Gemeinschaft mit dem Judentum 2 vertiefen“ enthält. Die Kirchensynode der SELK 2007 hat den Beschluss gefasst, die Frage des christlich-jüdischen Verhältnisses zu klären. Als Ergebnis dieses Nachdenkens legte die Theologische Kommission die Studie „Lutherische Kirche 2
Vgl. S. 113–118.
Volker Stolle
95
und Judentum“ vor, die von der 14. Kirchensynode der SELK 2019 in Balhorn nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern auch als Gesprächsgrundlage empfohlen wurde, da das Verhältnis zwischen Kirche und Judentum ein wichtiges Thema und eine bleibende Aufgabe sei. Die Kirchenleitung erstellte für diese Weiterarbeit das Arbeitsblatt „Lutherische Kirche und Judentum“, das zusammen mit dem Beschluss der Kirchenleitung als Rundschreiben verschickt wurde.
13. Ausbildungsstätten Gilberto da Silva Das Anliegen der in den deutschen Territorien des 19. Jahrhunderts entstandenen selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirchen beinhaltete unter anderem auch die Sorge um die konfessionelle Ausbildung des eigenen Pfarrernachwuchses. In zwei von diesen Kirchen kam es zur Einrichtung eigener theologischer Ausbildungsstätten.
Seminar der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“, vordere Reihe, zweiter von rechts: Oberkirchenrat Dr. Gottfried Nagel (*1876, †1944), Aufnahme: 1932 in Breslau.
Die „Evangelisch-lutherische Kirche in Preußen“ (ELKP)1 beantragte bei der Staatsregierung gleich ein Jahr nach der 1840 erreichten Duldung die Einrichtung eines theologischen Lehrstuhls für die Belange der lutherischen Kirche an einer Universität. Dem Antrag wurde nicht stattgegeben. In einer Petition von 1864 ersuchte die Generalsynode der ELKP die Anstellung eines staatlich besoldeten Professors für lutherische Theologie, hatte damit aber auch keinen Erfolg. Aufgrund dieser Absagen fasste man erstmals den Gedanken, eine eigene, von der Kirche getragenen „Professur“ einzurichten. Konkrete Pläne für die Eröffnung einer eigenen Ausbildungsstätte wurden jedoch erst Jahre später vom Oberkirchenkollegium, der Kirchenleitung der ELKP in Breslau, veröffentlicht. Daraufhin beschloss die Generalsynode der ELKP im Jahr 1882, nachdem die benötigten Mittel in einem Seminarfonds angesammelt wurden, die Einrichtung eines theologischen Seminars in Breslau, wobei sie im Ganzen den vom Oberkirchenkollegium dargelegten Grundzü1
Vgl. S. 11–19.
Gilberto da Silva
97
gen für die Errichtung der Anstalt folgte. Bis zur Eröffnung des Seminars 1883 studierten die zukünftigen Pfarrer der ELKP an den staatlichen Universitäten und wurden nach Ablegung eines Kolloquiums in den Dienst dieser Kirche übernommen. Mit der Einrichtung einer eigenen Ausbildungsstätte begann die ELKP in eigener Verantwortung ihren theologischen Nachwuchs auszubilden. In der Zeit von 1883–1908 durchliefen mehr als 100 Studierende aus der ELKP und anderen Kirchen die Ausbildung am Seminar in Breslau; mehr als die Hälfte der 87 Pfarrer, die 1907 im Dienst der ELKP standen, waren an ihrem eigenen Seminar ausgebildet worden. Eine Zäsur in der Entwicklung des Seminars markiert der Erste Weltkrieg. Das Wintersemester 1914/15 konnte in Breslau mangels Studierender nicht eröffnet werden. Gab es im Sommersemester 1914 noch 14 eingeschriebene Studierende, waren die meisten gegen Ende des Semesters in „patriotischer Begeisterung“ als Freiwillige in den Krieg gezogen; die übrigen wurden im Herbst eingezogen. Das Theologische Seminar der ELKP konnte erst zum Sommersemester 1919 wiedereröffnet werden. Im Jahr 1933 konnte das 50-jährige Bestehen des Theologischen Seminars der nun „Evangelisch-Lutherischen Kirchen Altpreußens“ (ELKA) in Breslau gefeiert werden. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten es 294 Studierende auch aus anderen, vornehmlich lutherischen Freikirchen durchlaufen.
Breslau, Hohenzollernstraße, Christuskirche, erbaut 1901, zerstört 1945, Sitz des Oberkirchenkollegiums und des Seminars der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“. Die Außenansicht zeigt den Gebäudekomplex von der Straßenfront (Südwestseite), Zeichnung: Paul Bunke 1930. Die Innenansicht zeigt den Blick Richtung Altar (Nordostseite), Aufnahme: vor 1945. Das Areal ist heute mit Wohngebäuden überbaut.
98
Ausbildungsstätten
Es war ihm in dieser Zeit jedoch nicht gelungen, die Anerkennung als juristische Person zu erlangen. Unter der nationalsozialistischen Diktatur konnte die Ausbildung am Seminar zunächst offenbar weitgehend ungehindert fortgesetzt werden. Es wurde aber 1935 amtlich darauf aufmerksam gemacht, dass auch das erste Semester des Theologiestudiums in Breslau verbracht werden sollte. Es ist hier durchaus der Versuch zu erkennen, den Studierenden angesichts des Kirchenkampfs in der „Deutschen Evangelischen Kirche“ eine Grundorientierung zu geben. Die Zahl der Studierenden im Studienjahr 1935/36 bewegte sich zwischen zehn und vierzehn. Diese Zahl reduzierte sich im Studienjahr 1937/38 auf sechs, im Sommersemester 1938 auf vier, im Wintersemester 1938/39 auf nur noch drei Studierende. Ab Kriegsbeginn im September 1939 fehlen Nachrichten über das Seminar; nur noch die Abnahme der Examina lässt sich noch bis 1942 belegen. Verschiedene Hinweise in den Quellen lassen jedoch erkennen, dass der Seminarbetrieb, obwohl eingeschränkt, bis Dezember 1944 aufrechterhalten werden konnte. Im folgenden Jahr wurde das Schicksal des Theologischen Seminars besiegelt, in dem die Kriegshandlungen Breslau erreichten. In deren Verlauf wurde auch der gesamte Gebäudekomplex in der Hohenzollernstraße mit der Christuskirche, der Geschäftsstelle des Oberkirchenkollegiums, den Seminarräumen und Wohnungen zerstört. Bibliothek und Archiv waren zuvor noch ausgelagert worden, aber die Gutsgebäude, in denen sie untergebracht waren, wurden gleichfalls zerstört. Damit wurde auch der größte Teil der kirchlichen Unterlagen, Dokumente und Akten der „Altlutherischen Kirche“ vernichtet. Die Bemühungen der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche in Sachsen“ 2 (ELFK) um den theologischen Nachwuchs setzten mit der Eröffnung des Proseminars in Runkel/Steeden durch Pfarrer Friedrich Brunn (1819–1895)3 bereits sehr früh ein. Brunn, der 1846 die nassauische Landeskirche aus bekenntnisgründen verließ, schloss sich zunächst der ELKP an, sagte sich aber 1865 von ihr wegen theologischer Unstimmigkeiten mit dem Oberkirchenkollegium in Breslau los. Der Entfremdung gegenüber Breslau, die letztlich zum Bruch geführt hat, stand einer wachsenden Annäherung an die US-amerikanischen Missouri-Synode gegenüber. Die Beziehungen Brunns zur Missouri-Synode traten in eine intensivere Phase ein, als Carl Ferdinand Wilhelm Walther (1811–1887), eine der leitenden Gestalten der US-amerikanischen lutherischen Kirche, 1860 Steeden besuchte. Es war bereits die zweite Reise Walthers nach Deutschland, der auf der Suche nach einem Verbindungsmann in Sachen Theologenausbildung war. Anlässlich der ersten Reise 1851 gab es aber kein Treffen zwischen Walther und Brunn. Beim Treffen 1860 ist es Walther dann gelungen, Brunn dazu zu bewegen, im Auftrag der Missouri-Synode junge Männer für den Pfarrer- und Lehrerberuf in den USA vorzubereiten. Daraufhin gelang es Brunn, zu Ostern 1861 den Unterricht mit sieben Zöglingen zu begin2 3
Vgl. S. 35–42. Gilberto da Silva (Hg.), „Ein feste Burg ist unser Gott“. Friedrich Brunn (1819–1895) und die lutherische Bewegung in Nassau (OUH 57), Oberursel 2020.
Gilberto da Silva
99
nen, während eine große Zahl Interessierter sich bei ihm meldete. Im zweiten Jahr waren es schon acht, im dritten zehn und zwölf und im vierten Jahr vierundzwanzig Zöglinge. Dafür bekam das Haus 1865 einen „großen schönen Anbau“.4 Die Zahl der Zöglinge blieb bei vierundzwanzig in den nächsten Jahren bis 1873 konstant, ab dann wurde sie wieder kleiner.
Friedrich August Brunn, *1819, †1895, Austritt aus der nassauischen Landeskirche 1846, Pfarrer in Steeden 1846–1879, Aufnahme in die „Evangelisch-lutherische Kirche in Preußen“ 1852, Lossagung vom Oberkirchenkollegium 1865, in Verbindung mit der „Immanuelsynode“ bis längstens 1873, Glied der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ seit 1877.
Zweck des Steedener Proseminars war nicht eine vollständige theologische Ausbildung, sondern wie mit Walther vereinbart die Vorbereitung der Kandidaten für die Aufnahme des Theologiestudiums in einem der beiden Seminare des MissouriSynode in St. Louis/Missouri oder Ft. Wayne/Indiana. Diese Vorbereitungszeit in Steeden dauerte zunächst ein Jahr, später gab es auch eine zweijährige Ausbildung für Zöglinge, die noch zu jung waren. Für den Unterhalt war Brunn auf Spenden aus der Missouri-Synode und aus Bayern, Sachsen, Hannover, Mecklenburg und Lauenburg, wo es lutherische Landeskirchen gab, angewiesen. In dieser Hinsicht unternahm er auch nebst seiner Tätigkeit als Pfarrer und Lehrer „große Kollekten5 reisen durch ganz Deutschland“ um Fundraising zu betreiben. Eine Wende in der Entwicklung des Steedener Proseminars zeigte sich in den Jahren 1872/73. Durch den krankheitsbedingten Ausfall der Reisen Brunns durch die lutherischen Landeskirchen nahm die Zahl die entsandten Zöglinge und die Spenden stetig ab. Erschwerend dazu kam der Bruch Brunns mit den lutherischen Landeskirchen im 4 5
Friedrich Brunn, Mitteilungen aus meinem Leben für meine Kinder und Freunde zu meinem 50jährigen Amtsjubiläum, Zwickau [1893], 156. Brunn (wie Anm. 1), 162.
100
Ausbildungsstätten
Zuge der Gründung der ELFK 18766 und die Tatsache, dass die Zahl der Theologiestudierenden in den Seminaren der Missouri-Synode allmählich wuchs, sodass der Bedarf an Kandidaten aus Deutschland geringer wurde. Dies führte letztendlich dazu, dass Brunn 1878 das Proseminar schloss und die letzten acht Zöglinge in die USA schickte. Darüber hinaus unterrichtete er in den Jahren 1881–1886 drei bis vier Schüler pro Jahr, die aus der ELFK stammten. Die ELFK selbst unternahm bereits im 19. Jahrhundert Versuche, eine eigene theologische Ausbildungsstätte ins Leben zu rufen, die aber gescheitert sind. Daraufhin eröffnete sich ihr durch die enge Verbindung mit der Missouri-Synode die Möglichkeit, die künftigen eigenen Pfarrer zum Theologiestudium an die Seminare dieser Kirche zu senden. Diese Lösung funktionierte einwandfrei bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, als die Unmöglichkeit, Studierende zur Ausbildung in die USA zu schicken, die Suche nach neuen Wegen nötig machte. Die Studierenden mussten dann zeitweise notgedrungen an die staatlichen Fakultäten in Deutschland gehen. Über diese Schwierigkeit hinaus zeichnete sich in den Ausbildungsstätten der Missouri-Synode in den USA ein Sprachwechsel vom Deutschen zum Englischen immer stärker ab, was die Lage der Studierenden erschwerte. Angesichts dessen gründete die ELFK nach Kriegsende 1920 eine „Theologische Hilfs- und Beratungsstelle“ in Leipzig, die seit 1921 den Namen „Theologisches Seminar der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche in Sachsen und anderen Staaten“ führte. Ein Jahr später wurde mit Hilfe von Spenden aus der Missouri-Synode, die auch die Unterhaltungs- und Verwaltungskosten übernahm, ein Gelände in Kleinmachnow bei Berlin erworben, wohin das Seminar dann umsiedelte. Durch Synodalbeschluss wurde 1924 die Bezeichnung in „Theologische Hochschule“ geändert. Bis 1945 wurden an der Hochschule in Kleinmachnow sämtliche Pfarrer der ELFK und teilweise auch verbündeter Kirchen ausgebildet. Durch Kriegseinwirkung verlor die Hochschule 1945 zwei ihrer vier Gebäude. Da außerdem der Ort Kleinmachnow durch die Grenzziehung um Berlin komplett vom Verkehr abgeschnitten war, kam die Arbeit der Theologischen Hochschule der ELFK nach dem Zweiten Weltkrieg völlig zum Erliegen.
6
Vgl. S. 35–42.
Gilberto da Silva
101
Kleinmachnow bei Berlin, ehemalige Theologische Hochschule der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ 1922–1945, ehemaliges Seemannserholungsheim der Kriegsmarine mit vier Gebäuden, durch Kauf erworben 1922, z.T. 1945 zerstört, ein Teil des Geländes enteignet und später durch die „Nationale Volksarmee“ (NVA) der DDR genutzt, nach 1945 Pfarramt und Kirchsaal einer Gemeinde der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“, heutige Nutzung: Wohnungen, Pfarramt und Kirchsaal, Aufnahme aus den 1970er Jahren.
Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, bereits im Jahr 1945, setzten Lehrgespräche zwischen den selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirchen in Deutschland ein, die zu Vereinbarungen und Zusammenschlüssen führten.7 Die Gespräche zwischen der ELAK und der ELFK hatten aber auch als Verhandlungsgegenstand die Eröffnung einer gemeinsamen Ausbildungsstätte in Westdeutschland. Das erste konkrete Ergebnis dieser Gespräche war die Gründung des gemeinsamen Proseminars im September 1946 im Dorf Groß Oesingen in der Lüneburger Heide, das dem Erlernen der alten Sprachen dienen sollte. Die Einrichtung in Groß Oesingen war jedoch von Anfang an als ein Provisorium gedacht, weil man die gemeinsame Ausbildungsstätte in Frankfurt am Main bzw. in dessen Nähe eröffnen wollte. Die Missouri-Synode kaufte dafür ein geeignetes Gelände in der Stadt Oberursel (Taunus) und stellte es den beiden Kirchen zur Verfügung mit der Aussicht, es ihnen später zu veräußern. Nach den notwendigen Vorbereitungen und einem noch in Groß Oesingen abgehaltenen „Notsemester“ konnte dann das Sommersemester der Lutherischen Theologischen Hochschule (LThH) am 19. Mai 1948 in Oberursel 8 eröffnet werden. Das Proseminar blieb noch bis einschließlich des Wintersemesters 1951/52 in Groß Oesingen, danach wurde es in die LThH in Oberursel inte7 8
Vgl. S. 104–114. Vgl. auch Werner Klän, Theologische Ausbildungsstätten selbständiger evangelisch-lutherischer Kirchen in Deutschland, in: Lutherische Theologische Hochschule Oberursel 1948–1998. Festschrift zum 50jährigen Jubiläum (OUH 3), Oberursel 1998.
102
Ausbildungsstätten
griert. Im Jahr 1950 erhielt die LThH durch Erlass des Hessischen Ministers für Erziehung und Volksbildung unter gewissen Auflagen die offizielle Anerkennung als „Kirchliche Hochschule“. Nach Erfüllung der Auflagen wurde 1955 die endgültige Anerkennung ausgesprochen. Bedingt durch die innerdeutsche Grenzziehung und die zunehmenden Schwierigkeiten für Studierende aus der DDR in Oberursel zu studieren, gründete die ELFK 1953 das Lutherische Theologische Seminar in Leipzig.9 Somit unterschieden sich die Ausbildungswege der selbstständigen Lutheraner in den beiden deutschen Staaten deutlich: in der BRD studierten die zukünftigen Pfarrer nahezu aller selbstständigen lutherischen Kirche in Oberursel, der theologische Nachwuchs der Ost-ELAK ging an die dortigen staatlichen Fakultäten und kirchlichen Hochschulen, die Ost-ELFK schickte ihre Studierenden zum eigenen Seminar nach Leipzig. Dort studierten und lehrten zwar auch Altlutheraner, aber im Lauf der Jahre zeichneten sich die Unterschiede beider Ausbildungskonzepte immer stärker ab.
Oberursel, Lutherische Theologische Hochschule (LThH), Verwaltungsgebäude, ehemals: Salomons Gärtchen, 2019 abgerissen – nach dem Zweiten Weltkrieg von der nordamerikanischen „Missouri-Synode“ gekauft worden, seit 1948 Sitz der LThH, Aufnahme: 15.6.2010.
Als die Missouri-Synode in den 1950er Jahren damit begann, ihre finanzielle Unterstützung für die Hochschule zurückzufahren, gründete 1956 eine Gruppe von lutherischen Christen, die die weitere Existenz der Hochschule gefährdet sah, zwecks finanzieller Unterstützung der LThH den „Kreis der Freunde und Förderer
9
Vgl. „Auf dein Wort.“ 50 Jahre Lutherisches Theologisches Seminar Leipzig, Zwickau 2003, 173 sowie Gottfried Herrmann, 50 Jahre Lutherisches Theologisches Seminar Leipzig. Ein Rückblick, Theologische Information und Handreichung 22/2004, 2–8 elfk.de/html/docs/wp-content/ uploads/2018/02/thi_2004_1.pdf (abgerufen 21.04.2020).
Gilberto da Silva
103
der Lutherischen Theologischen Hochschule und des Theologischen Proseminars in Oberursel e.V.“ Mit dem Zusammenschluss selbstständiger evangelisch-lutherischer Kirchen zur SELK im Jahr 197210 übernahm diese die alleinige Trägerschaft der LThH. Diese ist somit ein gesamtkirchliches Werk mit einer von der Fakultät bejahten klaren gesamtkirchlichen Verantwortung, die fest im kirchlichen, theologischen und institutionellen Selbstverständnis der LThH verankert ist. Durch ihre staatliche Anerkennung ist die LThH Mitglied in der Deutschen Hochschulrektorenkonferenz und im Evangelisch-theologischen Fakultätentag. Im Zuge der 1999 vereinbarten europäischen Hochschulreform mit dem Ziel einer europaweiten Vereinheitlichung von Studiengängen und -abschlüssen, des sogenannten „Bologna-Prozesses“, ließ die LThH die Studiengänge „Evangelische Theologie – Kirchliches Examen“ und „Evangelische Theologie – Magister/Magistra Theologiae“ 2013 akkreditieren und 2019 reakkreditieren. Dies brachte eine Reihe struktureller Veränderungen im akademischen Bereich mit sich, die jedoch das kirchliche, theologische und institutionelle Selbstverständnis der LThH als kirchliches Werk der SELK nicht verändern, sondern bestätigen und stärken.
10
Vgl. S. 104–114.
14. Vereinbarungen, Zusammenschlüsse, Vereinigungen Werner Klän Solange die „Evangelisch-lutherische Kirche in Preußen“ die einzige lutherischkonfessionelle Freikirche in Deutschland darstellte, legte sich die Assoziation gleich ausgerichteter Gemeinden außerhalb Preußens an diese Kirchenbildung nahe. In der Tat unterstellten sich die lutherischen Gemeinden in Nassau und Baden bald nach ihrem Austritt aus den sie umgebenden Unionskirchen dem Oberkirchenkollegium in Breslau, ohne jedoch eine vollständige Integration in den Bestand des größeren Kirchentums zu vollziehen; sie behielten einen Sonderstatus ohne die Übernahme der „Synodalbeschlüsse“. Die erste Gemeinde staatsfreier Konstitution im Bereich einer lutherischen Landeskirche, die „Evangelisch-lutherische Zionsgemeinde“ in Hamburg, suchte zunächst gleichfalls Verbindung mit den preußischen Lutheranern, blieb aber organisatorisch fast völlig für sich. Solange die „Evangelisch-lutherische Kirche in Preußen“ die Verbindung mit der „Hamburgischen Landeskirche“ nicht aufkündigen wollte, konnte es nicht zu einem Anschluss der Evangelisch-lutherischen Zionsgemeinde in Hamburg kommen. Dieselben Schwierigkeiten ergaben sich mit der Gründung der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“. Erst 1880 kam es zur Suspendierung der Kirchengemeinschaft mit der „Landeskirche Hannovers“, die aber nicht völlig durchgehalten, sondern wie das Verhältnis zu den übrigen lutherischen Landeskirchen dahingehend modifiziert wurde, dass zwar mit dem Kirchenkörper insgesamt die Kirchengemeinschaft festgehalten, in Gemeinden, in denen der Bekenntnisstand allerdings de facto verletzt wurde, nicht praktiziert wurde. Während die „Evangelisch-Lutherische Freikirche in Sachsen (u.a. St.)“ strikt an der prinzipiellen Ablehnung des Landeskirchentums festhielt, da sie konsequent 1 auf die de-facto-Geltung des lutherischen Bekenntnisses achtete , setzte sich diese Grundhaltung in denjenigen lutherischen Freikirchen, die aus der Ablehnung einer Union entstanden waren, nur zögernd durch. Zu ersten umfassenderen Vereinbarungen über die gastweise Gewährung von Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft kam es 1885/87 zwischen der „Evangelischlutherischen Kirche in Preußen“, der „Selbständigen evangelisch-lutherischen Kirche in Hessen-Darmstadt“, der „Renitenten Kirche ungeänderter Augsburger Konfession“ und der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“. Die Unterschiede in der kirchlichen Verfassung, besonders die Frage der Beteiligung 1
Vgl. S. 35–42.
Werner Klän
105
der Laien an der Kirchenleitung, wurden zwar als Differenz, aber nicht als eine die „Bekenntniseinheit störende“ gewertet. Dementsprechend sah man die nach CA VII erforderliche Lehreinheit gegeben. Hier war im Bereich der lutherischen Freikirchen zum ersten Mal die kirchenpolitische Praxis der Anschauung gefolgt, dass es Auffassungsunterschiede in der Interpretation von Schrift und Bekenntnis geben könne, ohne dass diese kirchentrennenden Charakter haben müssten. Nichtsdestoweniger wurden die Meinungsverschiedenheiten weiterer theologischer Erörterung empfohlen. Der Prozess der Annäherung wurde also nicht mit der Feststellung der Kirchengemeinschaft als beendet angesehen, sondern als im Fortgang befindlich betrachtet. Dieser Grundsatz fand im Jahr 1903 auch Anwendung auf die Regelung des Verhältnisses zwischen den preußischen und den badischen Lutheranern. In diesem Fall wurden die bestehenden Unterschiede in den Vorstellungen von der kirchlichen Verfassung ebenfalls nicht ausgeräumt, aber für tragbar erklärt. Nachdem 1904 der Bruch zwischen „Breslau“ und „Immanuel“ geheilt werden konnte, indem beide Seiten die theologisch-polemischen Spitzensätze aus der Zeit der Kirchentrennung historisch und sachlich relativierten, kam es im Jahr 1907 zur Bildung des „Delegierten-Konvents“ aus den Reihen der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirchen in Deutschland. Ausdrücklicher Zweck dieser Verbindung war die Erörterung theologischer Fragen und die Vereinbarung von Grundlinien für gemeinsames kirchliches Handeln nach außen. Die den beteiligten Kirchen gemeinsame Sicht der Entwicklung in den Landeskirchen wirkte in ihrem eigenen Bereich mehr und mehr als integrierender Faktor. Zwar wurde die Autonomie der einzelnen Kirchentümer noch stark hervorgehoben, zugleich aber die Möglichkeit ins Auge gefasst, dass Beschlüsse des Konvents durch die zuständigen Gemeinden der einzelnen Partnerkirchen ratifiziert werden. Damit war der Ansatz für ein gemeinschaftliches Vorgehen und Auftreten eines nicht unerheblichen Teils der konkordienlutherischen Kirchenfamilie geschaffen. Nur ein Jahr später erreichten die „Hannoversche evangelisch-lutherische Freikirche“ und die „Evangelisch-lutherische Hermannsburg-Hamburger Freikirche“ einen modus vivendi, der unter freilich nur teilweiser Aufarbeitung der Gründe, die 1886 zur Trennung geführt hatten, zwar noch nicht die vollständige Kirchengemeinschaft erklärte, aber Möglichkeiten der pastoralen Bedienung, der Überweisung von Gemeindegliedern, der Übernahme von Patenschaften regelte. Ausdrücklich wurde die seinerzeitige Trennung bedauert und die gegenwärtige Regelung als Zwischenlösung gekennzeichnet. Die dritte der in Hannover bestehenden selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirchen, die „Hermannsburger evangelisch-lutherische Freikirche“, schloss sich im selben Jahr der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche in Sachsen“ (u.a. St.) an. Gemäß dem Gemeindeprinzip stellte jede Gemeinde für sich einen Aufnahmeantrag, über den die Synode je gesondert abstimmte. Im Jahr 1921 tat ein Teil der „Süddeutschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ denselben Schritt.
106
Vereinbarungen, Zusammenschlüsse, Vereinigungen
Parallel dazu kam es in den Lehrverhandlungen zwischen der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ und der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche in Sachsen (u.a. St.)“ zu einem Teilergebnis; in den Fragen der Schriftlehre einigte man sich auf eine antimodernistische Festlegung, auf die Lehre von der Verbalinspiration; die Bekenntnisschriften wurden als norma normata „ihrem gesamten Lehrinhalt nach“ für verbindlich erachtet. Bemerkenswert ist, dass die Beschlussfassung über einen Passus, in dem die Unterscheidung von kirchentrennenden und nicht kirchentrennenden Auslegungsvarianten verworfen wurde, vorerst ausgesetzt wurde. Es kam gleichwohl ein Jahr darauf zur Verabschiedung gemeinsamer „Thesen über die Kirche“; das aus der Entstehungszeit beiden Freikirchen als Gegenüber vorfindliche Landeskirchentum mit nominell lutherischem Bekenntnisstand ließ die vorhandenen Grundübereinstimmungen in der Ekklesiologie erkennen und gemeinsam formulieren. Allerdings wurde erst 1913 in sehr offenen Formulierungen eine Konvergenz in der Amtsfrage aussagbar, in denen sich tendenziell die sächsische Position deutlicher durchsetzte. Diese Verhandlungsrunden markieren aber den Ansatz zu einem ersten umfassenderen Dialog der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ mit konfessionellen Kirchentümern grundsätzlich anderer Prägung. Ebenfalls noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs traten die benachbarten selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirchen in Hessen in nähere Verbindung. Nachdem sich schon 1878 der Homberger Konvent der „Selbständigen evangelischlutherischen Kirche“ (nunmehr: „in den hessischen Landen“) angeschlossen hatte, verabschiedeten diese und die Hessische Renitenz im Jahr 1910 ein Konföderationsstatut, in dem sie sich Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft gewährten. Das Festhalten der Niederhessen an ihrem besonderen Bekenntnisstand wurde nicht mehr als Hinderungsgrund für die notwendige Einheit nach CA VII verstanden. Gemeinsam konnten beide Kirchen das aus ihren Anfängen herausgearbeitete „Bekenntnis zu dem alleinigen Königtum Jesu Christi in der Kirche und in der Abwehr der staatlichen Eingriffe in allen kirchlichen Einrichtungen“ zum Ausdruck bringen. Damit war ein wichtiges Motiv selbstständigen kirchlichen Daseins zur Geltung gebracht, dem sich nicht sogleich alle selbstständigen evangelischlutherischen Kirchen anschlossen, zumal wenn sie, wie die „Evangelisch-lutherische Kirche in Preußen“, auf die staatliche Anerkennung als die lutherische Kirche ihres Landes warteten. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die „Vereinigung evangelisch-lutherischer Freikirchen“ gegründet, die zunächst aus sechs selbstständigen Kirchen bestand. Sie sah sich als Arbeitsgemeinschaft, die sich bekenntniskirchlich, damit aber antiunionistisch und antiliberalistisch begriff nach dem Motto: „Hindurch zur lutherischen Bekenntniskirche um jeden Preis!“ Die Verhandlungen auf den Vertretertagen der Vereinigung wurden durchgängig von dem Gegensatz zwischen Vertretern einer der Kooperation mit den lutherischen Landeskirchen zuneigenden Anschauung und strengen Anhängern des freikirchlichen Weges beherrscht. So kam
Werner Klän
107
der angestrebte kirchliche Zusammenschluss vorerst nicht zustande. Dennoch schritten die lutherischen Freikirchen auf dem Weg zu einer weitergehenden organisatorischen Vereinigung in Teilbereichen durchaus voran. Die relative räumliche Nähe und die enge Verwandtschaft im Amtsverständnis ließen die lutherischen Freikirchern in Hessen und Hannover in verbindlichere Gemeinschaft treten. Im Jahr 1920 wurde durch das „Friedens-Dokument“ die Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft zwischen der „Hannoverschen evangelischlutherischen Freikirche“ und der „Hermannsburg-Hamburger evangelisch-lutherischen Freikirche“ formell festgestellt, obwohl in der Frage der Beteiligung an der (überwiegend von der Landeskirche Hannovers getragenen) Hermannsburger Mission keine völlige Übereinkunft erzielt worden war. Das „Konföderationsstatut“ zwischen der „Renitenten Kirche ungeänderter Augsburger Konfession“ und der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ stellte 1924 auch zwischen diesen beiden Kirchen Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft fest. Zugleich war es die unmittelbare Voraussetzung für die Bildung eines gemeinsamen Superintendentur-Kollegiums der beiden hessischen und der beiden hannoverschen Freikirchen. Die Bildung des SuperintendenturKollegiums wurde durchaus als Mittel zur Förderung eines Zusammenschlusses aller selbstständigen lutherischen Kirchen begriffen. Damit war zum ersten Mal auf kirchenleitender Ebene eine verbindliche Organisationsform geschaffen worden. Sechs Jahre später schritten die an diesem Konzept beteiligten Kirchen zur Gründung des „Bundes selbständiger evangelisch-lutherischer Kirchen in Hessen und Niedersachsen“ fort. Die einzelnen Körperschaften gaben Teilkompetenzen an den „Kirchenausschuss“ als Leitungsorgan ab und unterstellten sich den Beschlüssen eines „Allgemeinen Kirchentags“, der als Gesamtvertretung des Bundes fungierte. Dagegen verblieb die Pfarrstellenbesetzung in der Hoheit der Einzelkirchen. Mit der Schaffung überregionaler Gemeinschaftsorgane in verbindlicher Funktion schon 1930 war ein wesentlicher Schritt zur Herausbildung einer das gesamte freikirchliche Luthertum umfassenden Verfassung getan, der vorerst allerdings auf Hessen und Hannover beschränkt blieb. Die Jahre unter der Herrschaft des Nationalsozialismus bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs brachten für das Lager der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirchen keinen weiteren Fortschritt mehr in ihren Einigungsbemühungen. Obwohl sie sich, zumal nach Gründung der DEK, in ihrer konfessionellen Sonderexistenz historisch und theologisch legitimiert sahen, konnten sie weder einer der in den Reihen der Bekennenden Kirche vertretenen Positionen uneingeschränkt beipflichten, noch konnten sie eine übereinstimmende Alternative dazu in ihren eigenen Reihen bieten. Andererseits war man im Lager der selbstständigen evangelischlutherischen Kirchen nicht in der Lage, ein Einigungsmodell zu entwickeln, das als tragfähige Alternative zu den bestehenden Konstellationen und über diese hinausweisend realisierbar gewesen wäre.
108
Vereinbarungen, Zusammenschlüsse, Vereinigungen
Der Ausgang des Zweiten Weltkriegs brachte in verschiedener Hinsicht eine notwendige, wenn auch teils erzwungene Neuorientierung; dies gilt auch für die selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirchen in Deutschland. Am schwersten wurde die „Evangelisch-lutherische Kirche in Preußen“ von dem Untergang der nationalsozialistischen Diktatur betroffen; sie verlor mit ihren schlesischen und pommerschen Kerngebieten zwei Drittel ihrer Kirchen, Pfarrhäuser und Friedhöfe. Die übrigen selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirchen mit den Schwerpunkten in Sachsen bzw. dem westlichen Deutschland waren von den Folgen der Niederlage des Deutschen Reichs längst nicht in diesem Ausmaß betroffen. Im Raum der evangelischen Landeskirchen setzten sich gleich nach dem Krieg Entwicklungen fort, die längst zuvor begonnen hatten und durch den Ertrag des „Kirchenkampfs“ kaum in eine wirklich neue Richtung gingen: Sie führten zur Gründung der „Evangelischen Kirche in Deutschland“ (EKD), die von allen lutherischen Freikirchen einhellig als Unionskirche identifiziert wurde. Nach der Wiedervereinigung der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“ und der „Evangelisch-lutherischen Immanuelsynode“ stellt der Zusammenschluss der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“, der „Selbständigen evangelisch-lutherischen Kirche in Hessen“ und der „Evangelisch-lutherischen Hermannsburg-Hamburger Freikirche“ 1947 die erste formelle Vereinigung bisher getrennter Kirchenkörper mit gemeinsamer Verfassung und gemeinsamer Kirchenleitung dar. Die Verfassung der „Selbständigen evangelisch-lutherischen Kirche“ von 1947 trug bewusst Übergangscharakter; sie beließ die bisherigen Teilkirchen als Diözesen in relativer verfassungsmäßiger und finanzieller Eigenständigkeit und hielt darüber hinaus die Möglichkeit für einen engeren Zusammenschluss nach innen wie einen weiteren Anschluss anderer lutherischer Freikirchen offen. Tatsächlich schlossen sich 1948 die „Evangelisch-lutherische Kirche in Baden“ und 1950 die „Renitente Kirche ungeänderter Augsburger Konfession“ dem neuen Kirchenkörper an. Es bedurfte allerdings, um die Annahme dieses Vorgangs in Hessen zu ermöglichen, ausführlicher Erklärungen seitens der kirchenleitenden Organe. Der hessischen Renitenz wurde weitgehende Selbstständigkeit garantiert; sie musste allerdings die Konkordienformel als Bekenntnisgrundlage in der Verfassung der „Selbständigen evangelisch-lutherischen Kirche“ von 1947 rezipieren; dies kam einer Erweiterung, nicht aber Veränderung ihres bisherigen Bekenntnisstandes gleich. Für die Feststellung der Kirchengemeinschaft zwischen der „EvangelischLutherischen Freikirche in Sachsen (u.a. St.)“ und den übrigen selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirchen waren ausgiebige Lehrverhandlungen erforderlich; die Schriftlehre, die Lehre von Bekehrung und Gnadenwahl, Ekklesiologie und Amtstheologie sowie Eschatologie waren Gegenstand der Erörterungen, die mit den „Einigungssätzen zwischen der ,Evangelisch-lutherischen Kirche Altpreußens‘ und der ,Evangelisch-Lutherischen Freikirche‘“ 1947 abgeschlossen wurden. Dieses Dokument stellt einen ausdrücklichen Lehrkonsens in bisher umstrittenen
Werner Klän
109
Fragen fest, allerdings wird ihre systematische Geltung durch einen ungeschichtlichen Ansatz gewonnen. Der Stellenwert der „Einigungssätze“ wurde denn auch zwischen den Kirchen nicht völlig einhellig gesehen. Nichtsdestoweniger stellte dieses Dokument, nachdem infolge der Entscheidungen von Eisenach, die zur Gründung der EKD führten, auch die preußischen „Altlutheraner“ die Kirchengemeinschaft mit den lutherischen Landeskirchen aufgekündigt hatten, die Bedingung der Möglichkeit für die Aufrichtung von Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft zwischen sämtlichen lutherischen Freikirchen in Deutschland dar. Die „Einigungssätze“ wurden denn auch von der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ zustimmend zur Kenntnis genommen, ohne freilich förmlich rezipiert zu werden. Ihren institutionellen Ausdruck fand die erreichte Lehrübereinkunft in der Bildung der „Arbeitsgemeinschaft freier evangelisch-lutherischer Kirchen in Deutschland“. Sie bestand aus einer „Vertretung der Kirchenleitungen“ als Leitungsgremium und einer „Versammlung der Kirchenvertreter“ als Repräsentativorgan in synodalen Formen. Etwa seit Mitte der 1960er Jahre gab das Oberkirchenkollegium der „Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche“ dem Ziel einer Vereinigung der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirchen in Deutschland kirchenpolitisch den Vorrang. Je deutlicher die lutherischen Landeskirchen den Vollzug der Abendmahlsgemeinschaft in der EKD befürworteten, desto klarer wurde auch die Distanzierung der freikirchlichen Lutheraner von einer Kooperationswilligkeit mit der „Vereinigten Evangelisch-Lutherische Kirche in Deutschland“, VELKD. Auch von Seiten der „Selbständigen evangelisch-lutherischen Kirche“ wurde dieses Bemühen eindeutig favorisiert; die zunehmende Integrationsfähigkeit in diesem Bereich ist somit auch als Kehrseite eines Abstandnehmens von tendenziell als unionistisch verstandenen Entwicklungen innerhalb der lutherischen Landeskirchen zu deuten. Allerdings blieb der Erfolg all dieser Bestrebungen zunächst auf die Teilkirchen im Bereich der Bundesrepublik Deutschland – abgesehen von der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Baden“ – beschränkt. Die politischen Gegebenheiten brachten es mit sich, dass die auf dem Staatsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik befindlichen Gemeinden der „Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche“ und der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ mehr und mehr ihre Eigenständigkeit betonten und sich schließlich Anfang der siebziger Jahre organisatorisch von den westdeutschen Glaubensgenos2 sen trennten. Hier kam es zwar zunächst zu Annäherungen, die 1972 zur Gründung der „Vereinigung selbständiger evangelisch-lutherischer Kirchen in der DDR“ führten; diese stellte jedoch nie einen vollständigen Zusammenschluss dar. Im Jahr 1984 wurde seitens der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ die Kirchengemeinschaft mit der „Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche“ aufgehoben.
2
Vgl. S. 64–72.
110
Vereinbarungen, Zusammenschlüsse, Vereinigungen
In der Bundesrepublik hingegen kam es 1972 zur Gründung der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK), in der sich die „Evangelisch-lutherische (altlutherische) Kirche“, die „Evangelisch-Lutherische Freikirche“ und die (alte) „Selbständige evangelisch-lutherische Kirche“ zusammenschlossen. In der Verfassung (Grundordnung) der SELK von 1972 sind die früher kontrovers diskutierten Positionen zur Amtstheologie in ein neues Gesamtbild integriert und balanciert. So ist dem Bischof als geistlichem Leiter der Kirche die „Kirchenleitung“ als ein Gremium aus den Pröpsten der ursprünglich drei, seit Vereinigung mit der Evangelischlutherischen (altlutherischen) Kirche in der ehemaligen DDR im Jahr 1991 vier Sprengel (seit 2019 Regionen), weiteren fünf „Laien“-Kirchenräten und dem Geschäftsführenden Kirchenrat (ordinierter Pfarrer) beigegeben. Gesetzgebendes Organ ist die „Kirchensynode“ aus ordinierten und nicht-ordinierten Kirchgliedern, deren Beschlüsse in Lehr-, Gottesdienst- und Kirchengemeinschaftsfragen allerdings der Vorberatung durch den „Allgemeinen Pfarrkonvent“ bedürfen.
Dr. Gerhard Rost, LL.D., *1922, †2003, seit 1967 Präsident des Oberkirchenkollegiums der „Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche“, Bischof der SELK 1973–1985, Aufnahme: Mai 1992.
Der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ schloss sich 1976 die „Evangelisch-lutherische Bekenntniskirche“, die westdeutsche Nachfolgeorganisation der 1924 gegründeten und 1945 aufgelösten „Evangelisch-lutherischen Freikirche in Polen“ an. Im Jahr 1983 konnte Kirchengemeinschaft zwischen der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ und der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Baden“, die seit 1965 eigenständige Wege ging3, festgestellt werden. Durch die Umwälzung der politischen Verhältnisse in Europa seit 1989 wurde 1991 der Zusammenschluss von „Selbständiger Evangelisch-Lutherischer Kirche“ und „Evan-
3
Vgl. S. 23–34.
Werner Klän
111
gelisch-lutherischer (altlutherischer) Kirche“, der zuvor nur aufgrund der bestehenden politischen Grenzen verhindert worden war, möglich.4
Dr. Jobst Schöne, D.D., *1931, Bischof der SELK 1985–1996. Er unterzeichnete u.a. die hier erwähnten Dokumente zur Kirchengemeinschaft mit der „Lutheran Church-Canada“, mit der „Igreja Evangélica Luterana do Brasil“ sowie mit der „Freien Evangelisch-Lutherischen Synode in Südafrika“ und begründete 1996 das eigenständige Agendenwerk der SELK.
Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung zunehmender internationaler Verflochtenheit der konkordienlutherischen Kirchen wurden Vereinbarungen über die Feststellung bzw. die Art der Ausübung von Kirchengemeinschaft mit der „Lutheran Church–Canada“ (Lutherische Kirche–Kanada, 1990/91), mit der „Igreja Evangélica Luterana do Brasil“ (Evangelisch-Lutherische Kirche von Brasilien, 1994), mit der „Freien Evangelisch-Lutherischen Synode in Südafrika“ (1995) abgeschlossen. Eine Feststellung der Kirchengemeinschaft wurde 2009 mit der „Lutherischen Kirche im Südlichen Afrika“ (Lutheran Church in Southern Africa) getroffen; außerdem stellte die 14. Kirchensynode der SELK 2019 das Bestehen von Kirchengemeinschaft mit mit der „American Association of Lutheran Churches“ (AALS|USA), mit der „Evangelisch-Lutherischen Kirche Argentiniens“, mit der „Evangelisch-Lutherischen Missionsdiözese von Finnland“, mit der „EvangelischLutherischen Diözese“ in Norwegen, mit der „Missionsprovinz“ in Schweden und mit der „Lutherischen Kirche Synode von Nicaragua“ fest. Aufgrund einer Vereinbarung aus dem Jahr 2015 wurde zudem Kirchengemeinschaft mit der „Concordia-Gemeinde – Evangelisch-Lutherische Freikirche
4
Vgl. S. 64–72.
112
Vereinbarungen, Zusammenschlüsse, Vereinigungen
e.V. in Celle“, zu der die SELK bisher schon in geordneten partnerschaftlichen Beziehungen stand, festgestellt.
Hannover, Kirchenbüro der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“, Schopenhauerstraße 7, erbaut ca. 1915, durch Kauf erworben, Sitz der Kirchenleitung der SELK seit 1975, Aufnahme: 23.1.2010.
Im Jahr 2018 unterzeichneten der Bischof der SELK, Hans-Jörg Voigt DD, und der Präses der „Lutherischen Kirche–Missouri-Synode“, Dr. Matthew Harrison eine „Protokollarische Vereinbarung“, in der Grundlage und Ziel dieser Partnerschaft näher beschrieben wurden, darunter eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Mission, Fortbildung von Gemeindegliedern, Publikationen und Medien und im gottesdienstlichen Leben. Auch wurden Konsultationen im Zusammenhang mit der Erklärung von Kirchengemeinschaft mit anderen Kirchen vereinbart. Die Zugehörigkeit zur konkordienlutherischen Weltfamilie wird durch die Zugehörigkeit zum „International Lutheran Council“ (ILC, Internationaler Lutherischer Rat) dokumentiert.
15. Ökumene Werner Klän Kurz vor Abschluss der Verhandlungen, die schließlich 1972 zum Zusammenschluss eines Großteils der bekenntnisgebundenen lutherischen Kirchen Deutschlands in der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK) führten, legten die damals noch „verbündeten“ Kirchenleitungen ein Positionspapier zur Frage der Kirchengemeinschaft vor, das in erkennbarer Auseinandersetzung mit den Bestrebungen innerhalb des landeskirchlich bestimmten Protestantismus in Deutschland und darüber hinaus steht, die schließlich 1973 in die „Leuenberger Konkordie“ mündeten. Dagegen setzten die konkordienlutherischen Kirchen auf dem Weg in die SELK die Ablehnung jeder Abendmahlsgemeinschaft ohne Glaubenseinigkeit. Tatsächlich aber kann die faktische Bedeutung des an die „Leuenberger Konkordie“ anknüpfenden Prozesses, dem inzwischen auch Kirchen aus der methodistischen Tradition beigetreten sind, nicht unterschätzt werden. Die Rezeption der „Leuenberger Konkordie“ durch sämtliche Mitgliedskirchen der „Evangelischen Kirche in Deutschland“ (EKD), einschließlich der lutherischen Landeskirchen, hat diese nach der herrschenden Interpretation der „Leuenberger Konkordie“ in eine engere kirchliche Gemeinschaft geführt, die folgerichtig die Frage nach der ekklesialen Dignität der EKD neuen Antworten zugeführt hat. Nicht zufällig stellt der Text zur Frage der „Kirchengemeinschaft nach evangelischem Verständnis“, wie er vom Rat der „Evangelischen Kirche in Deutschland“ 1 2001 veröffentlicht wurde , eine Fortschreibung jener leuenbergischen Ansätze dar, hat doch die EKD die „Leuenberger Konkordie“ 1983 in Artikel 1 ihrer Grundordnung aufgenommen und 1999 auch formell unterzeichnet. Der Bischof der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ hat solcher Vereinnahmungsstrategie gegenüber auf der Linie der in den konkordienlutherischen Kirchen, aber nicht nur bei ihnen, in Geltung stehenden Grundsätze reagiert und v. a. die Modifikation des Begriffs von Kirchengemeinschaft, wie er in diesem Text aus der EKD gebraucht wird, als Versuch kritisiert, eine flächendeckende Unionisierung der evangelischen Landschaft in Deutschland zu legitimieren. Inzwischen hat sich das Selbstverständnis der EKD, nicht zuletzt auf der Grundlage der Leuenberger Konkordie von 1973, hin zu einem eigentlichen Kirchesein entwickelt; damit wurde eine nachgerade zwangsläufige Folgerung aus der Gründung der EKD gezogen, deren Kirchesein seit den vierziger Jahren zunächst in 1
Vgl. Kirchengemeinschaft nach evangelischem Verständnis. Ein Votum zum geordneten Miteinander bekenntnisverschiedener Kirchen. Ein Beitrag des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (= EKD-Texte 69, 2001).
114
Ökumene
Abrede gestellt worden war. Aus konkordienlutherischer Sicht war dieser Sachverhalt freilich bereits im Ansatz gegeben. Nachdem zwischen den konkordienlutherischen Kirchen und den verschiedenen Kirchen der Union in Deutschland fast zwei Jahrhunderte keine offiziellen Kontakte stattgefunden hatten, kam es seit 2009 zu intensiven theologischen Gesprächen, die in einem Kolloquium in der Lutherstadt Wittenberg (2012)2 verdichtet wurden. Am Buß- und Bettag 2017 fand in Berlin-Mitte im Rahmen des Gedenkens „Evangelische Unionskirchen und selbstständige evangelisch-lutherische Kirchen 1817–2017“ ein ökumenischer Buß- und Dankgottesdienst statt, in dem durch Kirchenpräsident Christian Schad von der Union Evangelischer Kirchen (UEK) und SELK-Bischof Hans-Jörg Voigt D.D. ein „Brief an die Gemeinden“ der UEK und der SELK verlesen wurde. Zudem wurde durch Schad und Voigt ein „Gemeinsames Wort“ beider Kirchen unterzeichnet. Darin heißt es: „Beide Kirchen, SELK und UEK, nehmen die ausgesprochene Bitte um Vergebung an und sprechen einander unter dem Kreuz Christi solche menschliche Vergebung zu.“ Dieser Satz nimmt Bezug auf die teilweise von Schuld und Leid belastete Geschichte beider Kirchen.
Kirchenpräsident Christian Schad (UEK, rechts) und Bischof Hans-Jörg Voigt (SELK) unterzeichnen am 22.11.2017 in der Evangelisch-lutherischen Kirche Berlin-Mitte einen „Brief an die Gemeinden“ und ein „Gemeinsames Wort“.
Inzwischen wurde eine neue Arbeitsgruppe gebildet, an der auch die „Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands“ (VELKD) beteiligt ist. Mit der „Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands“ finden seit Langem jährliche Konsultationsgespräche statt. 2
Überarbeitet und erweitert veröffentlicht als: Jürgen Kampmann/Werner Klän (Hrsg.), Preußische Union, lutherisches Bekenntnis und kirchliche Prägungen (Oberurseler Hefte Ergänzungsband 14), Göttingen 2014.
Werner Klän
115
Schon 1984 hat es Stellungnahmen von Mitgliedern der Theologischen Kommission der SELK zu den Konvergenzerklärungen des ÖRK über Taufe, Eucharistie und Amt gegeben.3 Sie lassen erkennen, wie die SELK sich über den Bereich der klassischen Kontroversen mit dem Problem der innerprotestantischen Union und der Auseinandersetzung mit den spezifischen Verhältnissen im Gegenüber zum deutschen Protestantismus den Einigungsbemühungen in der weltweiten Christenheit zuwandte. Mit diesen Stellungnahmen haben sich Repräsentanten der SELK erstmals in einen weltweiten ökumenischen Gesprächsprozess, an dem sie als Kirche zuvor nicht beteiligt war, eingebracht; dabei sind ihre Positionierungen als entschieden konkordienlutherische, zugleich aber ökumenisch gesprächsfähig einzuschätzen. Kirchliche Grundüberzeugungen und Verhaltensmaßstäbe, die in den zwischenkirchlichen Außenbeziehungen zur Geltung kommen, müssen um der kirchlichen und ökumenischen Wahrhaftigkeit willen freilich auch im Innenbereich Gültigkeit haben. Dementsprechend hat die „Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche“ in ihrer Grundordnung (Verfassung) wie in einer Reihe kirchenrechtlicher Bestimmungen bis hin zu liturgischen Formularen, die Grundsätze der Kirchengemeinschaft auch nach innen festgestellt. Diese zielen nach innen wie nach außen darauf, in die „Kirchengemeinschaft des reinen Evangeliums und der stiftungsgemäßen Sakramentsverwaltung“, allerdings nicht schrankenlos, einzuladen. So gehören die Feststellungen über die Kirchengemeinschaft zu den Grundartikeln der Grundordnung der SELK. Diese Prinzipien finden als Soll-Bestimmungen Niederschlag in den rechtlichen Regelungen der Lebensordnung („Wegweisung“) der SELK; jedoch wird erkennbar, dass bestimmte seelsorgliche Situationen die Möglichkeit einer Sakramentszulassung, jenseits und unbeschadet dieser Grundsätze, eröffnen. Dass damit die Problematik der Ekklesiologie berührt wird, ist in den Erwägungen im Vorfeld einer verbindlichen Regelung durch den „Allgemeinen Pfarrkonvent“ der SELK durchaus bewusst; dass solches Handeln in Gewährung und Verweigerung eucharistischer Gemeinschaft ökumenische Implikationen enthält, ist aus den einschlägigen Bestimmungen über „Ökumenische Verantwortung“ ersichtlich. In diesen Zusammenhang gehört auch die Tatsache, dass Kirchenleitung und Kollegium der Superintendenten auf ihrer Tagung vom 12. bis zum 14. März 1992 in Bleckmar für die Gesamtkirche beschlossen haben, „der Bundes-ACK als Vollmitglied beizutreten“. Dieser Beschluss ist dann auf der Tagung vom 22. bis zum 24. Oktober 1992 in Bleckmar „bestätigt“ worden; im Oktober folgte der Bestätigung schließlich der Protokollsatz: „Der Antrag soll baldmöglichst bei der BundesACK eingereicht werden.“ In den Außenbeziehungen der SELK zeigt sich, dass die Aufnahme von Verbindungen zu lutherischen Kirchen in Ostmittel- und Osteuropa und dem Baltikum seit 3
Vgl. die Texte in: LuThK 8 (1984), 102–146.
116
Ökumene
Beginn der 1990er Jahre sie vor neue Herausforderungen stellte. Hier kam es zur Begegnung mit lutherischen Kirchen, die den Wegen konkordienlutherischer Kirchen mit einer gewissen Sympathie gegenüber stehen, auch wenn sie selbst historische Verbindungen und Bindungen zum Lutherischen Weltbund, nicht zuletzt seinen deutschen Mitgliedskirchen haben und pflegen. Hier hat sich die SELK bemüht, behutsam neue Wege kirchlicher Kooperation zu finden, die den jeweiligen Gegebenheiten angemessen sind. So bestehen Partnerschaftsvereinbarungen mit der „Evangelisch-Lutherischen Kirche von Lettland“, der „Evangelisch-Lutherischen Ingermanlandkirche“ in Russland und der „Schlesischen Evangelischen Kirche Augsburger Konfession“ in der Tschechischen Republik. Die Besonderheiten des kirchlichen Engagements in der Lutherstadt Wittenberg brachten die Notwendigkeit mit sich, Klärungen im Verhältnis zwischen der „Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen“ und der SELK herbeizuführen. Die Grundüberzeugung des unauflöslichen Zusammenhangs der Übereinstimmung im Glauben, Lehren und Bekennen mit dem Vollzug gottesdienstlicher, zumal eucharistischer Gemeinschaft in kirchlicher Verbindlichkeit konnte schließlich auf der europäischen Regionalkonferenz des „Internationalen Lutherischen Rats“ (International Lutheran Council, ILC), die 2004 in Antwerpen stattfand, von der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ gemeinsam mit konkordienlutherischen Kirchen aus ganz Europa, namentlich aus Ostmittel- und Osteuropa und dem Baltikum formuliert werden. Hier wird festgehalten, dass Kirchengemeinschaft den Konsens im Glauben, Lehren und Bekennen zur Voraussetzung hat. Diese Überzeugung schließt die Wahrnehmung ein, dass die Fragen kirchlicher Gemeinschaft in konfessioneller Verbindlichkeit angesichts der Herausforderungen, die zumindest der europäische Einigungsprozess an die Kirchen stellt, auch aus Sicht der konkordienlutherisch geprägten Kirchen neu bedacht werden müssen. Die SELK hat, obwohl sie an dem Dialog nicht unmittelbar beteiligt war, im Prozess der Entstehung der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ zwei Stellungnahmen abgegeben; einmal zum Entwurfstext von 1998 – im März 1999 – und zur verabschiedeten und später unterzeichneten Fassung samt der „Gemeinsamen Offiziellen Feststellung“ – im September 1999. Sie nimmt das Bemühen der Dialogpartner um Verständigung in Sachen Rechtfertigungslehre ernst und weiß die im Dialog erreichten Fortschritte zu würdigen, hält aber auch weitere Punkte für klärungsbedürftig: Dazu gehören die in der „Stellungnahme zur ‚Gemeinsamen offiziellen Feststellung des Lutherischen Weltbundes und der römisch-katholischen Kirche‘ samt ‚Annex‘“ vom September 1999 markierten Fragen nach dem Sündenverständnis, sowohl im Blick auf das „simul“ als auch hinsichtlich der Konkupiszenz, nach dem „sola fide“ unter Berücksichtigung des Verhältnisses von Rechtfertigung und Heiligung, nach dem Bewahren der Gnade, nach Gericht und Lohn sowie nach der kriteriologischen Funktion der Rechtfertigungslehre. Inzwischen haben sich der Weltrat methodistischer Kirchen (2006), die Anglikanische Gemeinschaft (2016) und die Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen (2017) der Erklärung angeschlos-
Werner Klän
117
sen. Zum 20-jährigen Jubiläum erschien unter Mitarbeit der SELK ein Dokument des „Deutschen Ökumenische Studienausschusses“ (DÖSTA). Auch für die römisch-katholische Kirche und die orthodoxen Kirchen der östlichen Tradition in der Christenheit, ist die Übereinstimmung im Verständnis des Evangeliums die unabdingbare Voraussetzung für die Bestätigung und Betätigung (voller) kirchlicher Gemeinschaft. Die „Charta Oecumenica“ hat für den europäischen kirchlichen Kontext diesen Sachverhalt bestätigt, wenn sie formuliert: „Noch verhindern wesentliche Unterschiede im Glauben die sichtbare Einheit. Es gibt verschiedene Auffassungen, vor allem von der Kirche und ihrer Einheit, von den Sakramenten und den Ämtern.“ Zu Recht fährt dieses ökumenisch ehrliche Dokument fort: „Damit dürfen wir uns nicht abfinden“, und leitet daraus die Selbstverpflichtung der Kirchen ab, „uns beharrlich um ein gemeinsames Verständnis der Heilsbotschaft Christi im Evangelium zu bemühen“. Im Blick auf die Frage der Kirchengemeinschaft wird unzweideutig festgehalten: „Ohne Einheit im Glauben gibt es keine volle Kirchengemeinschaft.“ Mit der Unterzeichnung der „Charta Oecumenica“ durch den Bischof der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ hat die SELK diese Grundbestimmungen angenommen, weil sie seit jeher zum Grundbestand ihrer konfessionellen Selbstvergewisserung und ihrer ökumenischen Verpflichtung gehört haben. Die Vollmitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland“ (ACK) seit 1991 führte zur Beteiligung an multikonfessionellen Vereinbarungen. Dazu zählt auch die 2007 in Magdeburg auch von der SELK auf Beschluss ihrer Kirchenleitung unterzeichnete „Erklärung zur Taufanerkennung.“ Mit dem Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen fanden zwischen Vertretern der SELK und Referenten und Direktoren des Johann-AdamMöhler-Instituts (Paderborn) zunächst auf nationaler Ebene Gespräch statt. Deren Ertrag ließ es wünschenswert erscheinen, in einen „inoffiziellen Dialog“ zwischen dem „Internationalen Lutherischen Rat“ und dem „Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen“ einzutreten. Die Ergebnisse dieser Gesprächsrunden werden dem Exekutivkomitee des „Internationalen Lutherischen Rats“ und dem „Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen“ unterbreitet. Für die Grundhaltung der SELK im ökumenischen Zeitalter ist demnach festzuhalten: Konfessionelle Ortsbestimmung und ökumenische Verpflichtung bedingen einander.
Anhang
Quellenverzeichnis Die Beiträge in diesem Buch bieten eine erste Orientierung, die durch die Lektüre von Quellen vertieft werden kann. Die Zählung in diesem Quellenverzeichnis stammt aus: Werner Klän und Gilberto da Silva (Hrsg.), Quellen zur Geschichte selbstständiger evangelischlutherischer Kirchen in Deutschland, Oberurseler Hefte Ergänzungsband 6, Göttingen 22010. Dort sind die Texte dieser 270 Quellen ganz oder in Auszügen abgedruckt. Bibliographische Hinweise auf seither erschlossene oder entstandene Quellen finden sich (ohne Nummerierung chronologisch sortiert) am Ende des Verzeichnisses. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
Kabinettsordre Friedrich Wilhelm III vom 27.9.1817 Bittschrift Johann Gottfried Scheibels an den König vom 3.6.1830 Kabinettsordre vom 4.4.1830 an von Altenstein Erlass vom 30.4.1830 Erste Bittschrift der lutherischen Gemeinde Breslau vom 27.6.1830 Zweite Bittschrift der lutherischen Gemeinde Breslau vom 26.7.1830 Dritte Bittschrift der lutherischen Gemeinde Breslau vom 30.8.1830 Vierte Bittschrift der lutherischen Gemeinde Breslau vom 1.11.1830 Wünsche der lutherischen Gemeinde Breslau vom April 1831 Kabinettsordre Friedrich Wilhelm III vom 28.2.1834 Petition der schlesischen Lutheraner um Anerkennung ihrer Rechte vom 4.4.1834 Anschreiben vom 2.2.1842 Aus der Instruktion für das Oberkirchenkollegium (1841) Über das Vorsteheramt (1841) Aus den Bestimmungen über gottesdienstliche Gemeinschaft (1841) Ganz gehorsamstes Promemoria vom 15.8.1841 Die Generalkonzession für die von der Gemeinschaft der evangelischen Landeskirche sich getrennt haltenden Lutheraner vom 23.7.1845 Zirkular-Erlass der Minister des Kultus, der Justiz und des Innern vom 7.8.1847, betreffend die Regulierung der Verhältnisse der von der evangelischen Landeskirche sich getrennt haltenden Lutheraner Petition des Oberkirchenkollegiums um Anerkennung der kirchlichen Rechte vom 17.12.1868 Gesetz, betreffend die Ergänzung und Abänderung der Generalkonzession für die von der Gemeinschaft der evangelischen Landeskirche sich getrennt haltenden Lutheraner vom 23.7.1845, vom 23.5.1908 Satzungen für den Verein evangelisch-altlutherischer Kirchengemeinden vom 9.9.1910 Erteilung der Rechte einer juristischen Person vom 3.11.1910 Erteilung der Körperschaftsrechte vom 19.6.1930 Petition lutherischer Pastoren (1847) Stellungnahme der Generalsynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen über das Verhältnis zu den lutherischen Landeskirchen (1868)
Quellenverzeichnis
26. 27. 28. 29.
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
39. 40. 41.
42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
121
Stellungnahme der Generalsynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen über das Verhältnis zu den lutherischen Landeskirchen (1873) Stellungnahme der Generalsynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen über das Verhältnis zu anderen Kirchen (1878) Stellungnahme der Generalsynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen über das Verhältnis zu den lutherischen Freikirchen (1878) Stellungnahme der Generalsynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen zur Suspension der Kirchengemeinschaft mit der Hannoverschen Landeskirche (1882) Stellungnahme der Generalsynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen zu den Einigungsbemühungen im freikirchlichen Luthertum (1886) Stellungnahme der Generalsynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen zur geplanten Bildung eines Delegiertenkonvents lutherischer Freikirchen (1906) Erklärung der Generalsynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen über das Verhältnis zu den lutherischen Landeskirchen und Freikirchen (1906) Beschluss der Generalsynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen über das Verhältnis zu den Hannoverschen Freikirchenbildungen (1910) Stellungnahme des Oberkirchenkollegiums zur DDR-Verfassung von 1968 Hirtenwort des Oberkirchenkollegiums zur Aufhebung der Kirchengemeinschaft durch die Evangelisch-Lutherische Freikirche (1984) Julius Diedrich über „Wert und Wesen des Kirchenregiments“ (1859) Lossagung Julius Diedrichs vom Kirchenregiment des Oberkirchenkollegiums (1861) Erklärung des Oberpräsidiums der Provinz Brandenburg zu den Rechtsverhältnissen der aus der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen ausgeschiedenen Pastoren und Gemeinden vom 19.12.1861 Gründungsurkunde der „Evangelisch-lutherischen Immanuelsynode“ vom 21.7.1864 Petition der „Evangelisch-lutherischen Immanuelsynode“ um rechtliche Anerkennung vom 19.2.1865 Entscheidung der Generalsynode der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“ über den Lehrstreit und die Aufhebung der Kirchengemeinschaft mit den sezedierten Pastoren und Gemeinden (1864) Thesen von Julius Diedrich über die lutherischen Landeskirchen (1874) Thesen von Julius Diedrich über die lutherischen Freikirchen (1874) Thesen der „Immanuelsynode“ über Kirchengemeinschaft (1875) Von der Konferenz angenommene Einigungssätze vom 5./6.10.1875 Thesen 11 und 12 über Kirchengemeinschaft in der revidierten Fassung von 1886 Instruktion für den Senior der „Immanuelsynode“ vom 25.8.1888 Lehrstellung der „Immanuelsynode“ in den Fragen von Kirche, den Kirchenordnungen und dem Kirchenregiment (1897) Stellungnahme der Generalsynode der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“ über die Möglichkeit einer Wiedervereinigung mit der „Immanuelsynode“ (1902)
122
Quellenverzeichnis
50.
Erklärung Carl Eichhorns über seinen Austritt aus der Union und seinen Übertritt zur lutherischen Kirche vom 3.11.1850 Stellungnahme der Generalsynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen über den Anschluss der badischen Lutheraner an die Evangelisch-lutherische Kirche in Preußen (1852) Duldungsedikt für die Pastoration der badischen Lutheraner durch die Pfarrer Eichhorn und Ludwig (1856) Der Bericht im Kirchenblatt über die Duldung der badischen Lutheraner (1856) Aus der Denkschrift über die Stellung der lutherischen Kirche in Baden vom 23.7.1862 Gründungsurkunde der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Baden vom 12.3.1865 Lossagung Max Frommels vom Kirchenregiment des Oberkirchenkollegiums vom 14.3.1865 Amtsentsetzung Max Frommels durch das Oberkirchenkollegium vom 11.4.1865 Aus der Kirchenordnung der vereinigten evangelisch-lutherischen Gemeinden im Großherzogtum Baden (1871) Mitteilung des Kirchensuperintendenten der (alten) „Selbständigen EvangelischLutherischen Kirche“ zum badischen Synodalbeschluss vom 1.5.1965 Beitritt zum Lutherischen Weltbund (1968) Entschließung zur Leuenberger Konkordie (1975) Protest zu den Beschlüssen von Curitiba (1991) Beschluss der Synode vom 27.8.1994 zur Frage der Ordination von Frauen zum Pfarramt Reaktionen der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK): Beschluss der 9. Kirchensynode (1999) Reaktionen der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK): Beschluss der 10. Kirchensynode (2003) Gemeinsame Erklärung der „Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden“ und der Evangelischen Landeskirche in Baden von 1996 Protest gegen die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ (1998) Die Kirchenordnung der „Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden“ (2001) Brief Adolf von Harleß’ an Friedrich Brunn (1846) Brief Wilhelm Löhes an Friedrich Brunn vom 24.6.1846 Brief Friedrich Brunns an Kirchenrat Wilhelmi, Wiesbaden, vom 13.7.1846 Friedrich Brunn über die Generalsynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen von 1852 Friedrich Brunn über seine Lossagung vom Kirchenregiment des Oberkirchenkollegiums vom 23.2.1865 Aus der Synodalstatistik der Superintendenturen und Parochien der Evangelischlutherischen Kirche in Preußen (1864; Anmerkung von 1865) Amtsentsetzung Friedrich Brunns durch das Oberkirchenkollegium vom 11.4.1865 Aus einem Brief Carl Ferdinand Wilhelm Walthers an Friedrich Brunn vom 2.3.1861 Eingabe des Pastors Heinrich Fröhlich und Genossen vom 15.6.1868
51.
52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.
Quellenverzeichnis
78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.
95.
96. 97. 98. 99.
100. 101.
102.
103. 104.
123
Antwort des Kultusministeriums vom 24.5.1869 Aufruf des Vereins evangelisch-lutherischer Glaubensgenossen vom April 1867 Statuten des Lutheraner-Vereins zu Dresden vom 9.4.1868 Eingabe der Lutheraner-Vereine zu Dresden, Planitz und Zwickau vom 31.10.1870 Antwort des Kultusministeriums vom 21.12.1870 Eingabe der Lutheraner-Vereine zu Dresden, Planitz und Zwickau vom 17.2.1871 Eingabe der Lutheraner-Vereine zu Dresden, Planitz und Zwickau vom 22.7.1871 Antwort des Kultusministeriums vom 10.8.1871 Austrittserklärung Eduard Gnaucks, Dresden, vom 26.8.1871 Gelöbnisformel für Religionslehrer im Königreich Sachsen (1862) Gelöbnisformel für Religionslehrer im Königreich Sachsen (1871) Gemeindeordnung der evangelisch-lutherischen St. Johannis-Gemeinde Planitz vom 31.10.1872 Petition von 15 Pastoren betreffend das Suspensionsrecht gegenüber Tauf- und Trauungsverächtern vom 15.1.1876 Antwort des Landeskonsistoriums vom 19.1.1876 Letzte Eingabe Karl Georg Stöckhardts vom 6.6.1876 Verfassung der Synode der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ in Sachsen und anderen Staaten Deutschlands (1876/77) Bekanntmachung zur Aufrichtung der Kirchengemeinschaft zwischen der Evangelisch-lutherischen Kirche im früheren Altpreußen und der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“, 16.1.1948 Zwei Mitteilungen an die Gemeinden der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ über die Einigung mit der (alten) „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (1949) Gemeinsame Erklärung zur Verbindlichkeit der Einigungssätze (1968/72) Synodalbeschluss Hartenstein 1969 der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ (Ost) Vereinbarung zwischen der Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche und der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ (1972) Synodalbeschluss der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ vom 26.5.1984 in Hartenstein, betr. die Suspendierung der Kirchengemeinschaft mit der Evangelischlutherischen (altlutherischen) Kirche Was das Verhältnis der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ (ELFK) zur „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK) belastet (Dezember 1988) Synodalbeschluss der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ vom 7.10.1989 in Karl-Marx-Stadt, betr. die Aufhebung der Kirchengemeinschaft mit der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ Synodalbeschluss 2.1 der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ vom 10.10.1992 in Hartenstein, betr. die Aufhebung der Kirchengemeinschaft mit der Lutheran Church – Missouri Synod Synodalbeschluss 2.3 der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ vom 10.10.1992, betr. den Beitritt zur Konfessionellen Evangelisch-Lutherischen Konferenz (KELK) Verfassung der Konfessionellen Evangelisch-Lutherischen Konferenz (1993/2008)
124
Quellenverzeichnis
105. 106.
Überarbeitete Verfassung der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ (2006) Thesen August Friedrich Christian Vilmars über die Kirche, ihr Wesen, ihre Regierung und ihre Verfassung (1861) Anträge der Jesberger Konferenz auf Aufhebung des landesherrlichen Summepiskopats (1849) Aus einem Brief August Friedrich Christian Vilmars an Jakob Wilhelm Georg Vilmar über den Bekenntnisstand der niederhessischen Kirche vom 21.5.1867 Petition der Geistlichen des Konsistorialbezirks Kassel um Aufrechterhaltung der Kirchenordnung von 1657, vom 12.7.1867318 Deklaration über den Bekenntnisstand der niederhessischen Kirche (1867) Allerhöchster Erlass betreffend die Vereinigung der Konsistorien Kassel, Marburg und Hanau zu einem gemeinschaftlichen Konsistorium in Marburg vom 13.6.1868 Allerhöchster Erlass vom 9.8.1869 Aus der Verordnung vom 9.8.1869 Protest Jakob Wilhelm Georg Vilmars gegen die Einführung der neuen Presbyterialund Synodalordnung vom 29.9.1869 Der „Juliprotest“ (1873) Amtsenthebung Jakob Wilhelm Georg Vilmars vom 12.11.1873 „Offene Erklärung“ der abgesetzten Pfarrer (Dezember 1873) Antwort auf die Zuschrift der Hochwürdigen Herren Superintendenten Dankwerts und Rocholl in Göttingen und Pastoren Th. Harms in Hermannsburg und H. Steinmetz in Celle an die am 8.7.1874 in Melsungen versammelte niederhessische Pastoralkonferenz Gründungsdokument des Homberger Konvents vom 19.9.1877 Lossagung des Homberger Konvents von den mauritianischen Verbesserungspunkten und der Deklaration der hessischen Generalsynode von 1607, vom 19.9.1877 Amtsenthebung des Pfarrers Ferdinand Bingmann zu Höchst an der Nidder vom 14.6.1875 Lossagung der renitenten Pfarrer vom landesfürstlichen Kirchenregiment vom 30.6.1875 Aus der Kirchenordnung der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (1876) Aus der Kirchenordnung der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (1902) Ordnung der Wahl und Weihe eines Superintendenten (nach 1945) Synopse der alten und neuen Form der Trauordnung Eingabe und Bitte verschiedener Kirchenglieder Trauung betreffend vom 23.3.1877 Die Unterlüßer Erklärung vom 6.6.1877 Theodor Harms’ Stellungnahme zu seiner Suspension vom 22.1.1878 Theodor Harms’ Amtsentsetzung (1878) Theodor Harms über die Gründung der Kreuzgemeinde Hermannsburg (1878) Ordnung der Kreuzgemeinde Hermannsburg vom 9.11.1878 Protokollarische Zusammenstellung der Beschlüsse der ordentlichen Synoden der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ (30.4.1878–2.6.1885)
107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118.
119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133.
Quellenverzeichnis
134.
135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146.
147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157.
125
Aus der öffentlichen Erklärung betreffend die Loslösung der Kreuzgemeinde zu Hermannsburg vom Synodalausschuss der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ (Mai 1886) Aus einem Brief August Ludwig Christian Kavels an Georg Philipp Eduard Huschke vom 18.12.1835 Aus einem Brief Georg Philipp Eduard Huschkes an den Leipziger Missionsverein (Juni 1833) Aus dem 3. Jahresbericht des Breslauer Missionsvereins (1833) Johann Gottfried Scheibel: „Wie verhält sich die Lutherische Kirche zu den Missions-Gesellschaften und den dazu gehörigen Instituten in unsrer Zeit?“ (1835) Aus der Instruktion für das Oberkirchenkollegium (1841) Beschluss der Generalsynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen über die Missionsangelegenheit (1841) Aufruf der Dresdner Evangelisch-lutherischen Missionsgesellschaft vom 30.9.1836 Beschluss der Generalsynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen über das Verhältnis zur Leipziger Mission (1848) Aus dem Schreiben des Oberkirchenkollegiums der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen an das Missionskollegium der Leipziger Mission vom 16.4.1858 Beschluss der Generalsynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen über das Verhältnis zur Leipziger Mission (1860) Resolution der Generalversammlung der Leipziger Mission zu § 6 der neuen Statuten (1881) Stellungnahme der Generalsynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen zur Resolution von 1881 und dem Stimmrecht des Marburger Missionsvereins (1894) Beschlüsse der Generalsynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen über Missionsangelegenheiten (1898) Beschlüsse der Generalsynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen über Missionsangelegenheiten (1902) Beschlüsse der Generalsynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen über Missionsangelegenheiten (1910) Beschlüsse der Generalsynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen über Mission (1921) Eingabe der Missionare Grubert, Schäffer, Willkomm, Zorn und Zucker an das Kollegium der Leipziger Mission (September 1875) Eingabe der Missionare Grubert, Schäffer, Willkomm, Zorn und Zucker an das Direktorat der Leipziger Mission (November 1875) Zirkular des Missionsdirektors an die Missionare der Leipziger Mission in Indien vom 8.1.1894 Julius Nagel, Zur Missionsfrage (1894) Statuten der Hermannsburger Mission, bestätigt am 2.5.1856 Nicht genehmigter Entwurf eines Statuts für die Hermannsburger Mission von Ludwig Harms, dem Landeskonsistorium Hannover eingereicht am 30.12.1851 Die von Ludwig Harms bei der ersten Aussendung von Missionaren und Kolonisten mitgegebene Ordnung (1853)
126
Quellenverzeichnis
158.
Theodor Harms über die Stellung der Hermannsburger Mission zu Landeskirche und Freikirche (1878) Vereinbarung zwischen der Leitung der Hermannsburger Mission und dem Hannoverschen Landeskonsistorium vom 15.3.1890 Grundsatzerklärung der Synode der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ vom 18.6.1889 Stellungnahme der Synode der „“Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche zur Vereinbarung zwischen der Leitung der Hermannsburger Mission und dem Hannoverschen Landeskonsistorium, vom 5.6.1890 Austrittserklärung der zur „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ gehörigen Mitglieder des Hermannsburger Missionshauses vom 10.5.1892 Beschlüsse der Synode der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ über die Errichtung einer eigenen Mission (1892) Satzungen der Mission der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ (1903) Schreiben von Superintendent Böttcher vom 19.6.1943 „Ein Noth- und Hülferuf aus Nordamerika“, mitgeteilt von Friedrich Brunn, lutherischer Pastor in Steeden (1860) Gründungsurkunde des Melsunger Missionshauses vom 9.10.1870 Bekanntmachung über die Bildung der Mission evangelisch-lutherischer Freikirchen (Bleckmarer Mission) vom 1.11.1950 Beschluss der 25. Generalsynode der „Evangelisch-lutherischen (altluth.) Kirche“ über das Verhältnis zur Bleckmarer Mission (1954) Erklärung zur Frage nach der Zusammenarbeit lutherischer Missionen in Südafrika (1953) Wegweisung für die „Junge Kirche“ (1956) Aus der Verfassung der „Lutherischen Kirche im Südlichen Afrika“ (1967) Friedrich Wilhelm Hopf: Versuch einer eigenen Stellungnahme (1979) Stellungnahme der Missionsleitung zum Rassismus, vom 4.12.1986 Stellungnahme der Theologischen Kommission zum Rassismus, vom 10.3.1987 Vertreter der Evangelisch-Lutherischen Freikirchen haben sich der „Frankfurter Erklärung“ mit folgender Zusatzerklärung angeschlossen (1970) Aus der Grundordnung der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“: Artikel 8: Mission und Diakonie (1972) Ordnung für die Mission evangelisch-lutherischer Freikirchen (Bleckmarer Mission; 1973) Satzung des Vereins „Lutherische Kirchenmission (Bleckmarer Mission) e.V.“ Vereinbarung zwischen der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ – vertreten durch die Kirchenleitung – und der Lutherischen Kirchenmission (Bleckmarer Mission) e.V. – vertreten durch die Missionsleitung (1998) Vereinbarung zwischen der Lutheran Church in Southern Africa (LCSA) und der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK; 2009) „Der Herr kommt! ein Ruf zur Mission auch unter Israel“ (1867)
159. 160. 161.
162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180.
181. 182.
Quellenverzeichnis
183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203.
204. 205.
206. 207.
127
Ablehnung des Antrags von Karl Becker auf Anstellung als Judenmissionar durch die Generalsynode 1856 Carl Becker: Ach, daß die Hülfe aus Zion über Israel käme, und der Herr sein gefangen Volk erlösete! Ps. 14,7 (1857) Nachschrift der Redaktion, zu: Alfons Wagner: Noch ein Wort über Judenmission (1871) Aufruf zur Bildung eines Vereins für Judenmission (1916) Bestätigung der „Vereinigung der Freunde Israels innerhalb der lutherischen Kirche in Preußen“ durch die Generalsynode von 1921 Auflösung der „Vereinigung der Freunde Israels innerhalb der lutherischen Kirche in Preußen“ (1935) Kollekte für Mission unter Israel (1946) Thesen von Pfarrer Gottfried Riegel auf dem Herbstkonvent der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ in Hessen am 10./11.10.1933 in Dreihausen „Der Arierparagraph“ von Seminardirektor Friedrich Priegel (1933) 120 Jahre Zentralverein (1991) Satzung des Arbeitskreises der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ für Zeugnis unter den Juden (1998) Was meint der Arbeitskreis der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ für Zeugnis unter den Juden (AZJ) mit „Zeugnis unter den Juden“? (1998) Luther und die Juden – und wir lutherischen Christen (1998) Koordinator der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK) für „Kirche und Judentum“ (2003) Beschluss der 11. Kirchensynode der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ in Radevormwald vom 12.–17.6.2007 Diakonieverständnis der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (1991) Richtlinien für ein Diakonisches Jahr (1992) Grundsätze und Aufgaben des Diakonischen Werkes der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (1988) Ordnung für die diakonische Arbeit der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (2003) Geschäftsordnung der Vollversammlung des Diakonierates der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK; 2006) Das Amt des Diakons/der Diakonin in der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK) sowie Richtlinien bei der Ausbildung von Gliedern der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK) zu Diakoninnen/Diakonen (2008) Mitarbeitervertretungsgesetz für das Diakonische Werk der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (MVG-DW-SELK; 2007) Richtlinie der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK) über die Anforderungen der privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit in der SELK – (Loyalitätsrichtlinie SELK; 2007) Synodalbeschluss über die Einrichtung einer von der Kirche getragenen Professur in Breslau (1864) Synodalbeschluss über die Einrichtung eines Seminars in Breslau (1882)
128
Quellenverzeichnis
208. 209. 210. 211. 212.
Amtliche Bekanntmachung zum ersten theologischen Semester (1935) Eröffnung einer „Theologischen Hilfs- und Beratungsstelle“ in Leipzig (1920) Namensänderung der Ausbildungsstätte in Klein-Machnow (1924) Gründung des Proseminars in Groß Oesingen (1946) Vorläufiges Statut der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel (1948/51) Vorläufige staatliche Anerkennung der Hochschule vom 14.6.1950 Endgültige staatliche Anerkennung der Hochschule vom 2.5.1955 Vereinssatzung zur Gründung des Freundeskreises (1956) Vereinssatzung Kreis der Freunde und Förderer der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel e.V. (1990) Statut der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel (2007) Die Homberger Vereinbarung zwischen der Evangelisch- lutherischen Kirche in Preußen der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ in HessenDarmstadt, der Renitenten Kirche ungeänderter Augsburger Konfession (Homberger Konvent) und der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ vom 9.11.1885 Vereinbarung über die gastweise Gewährung von Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft zwischen der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“, der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ in Hessen-Darmstadt, der „Renitenten Kirche ungeänderter Augsburger Konfession“ (Homberger Konvent) und der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ (1887) Vereinbarung betreffend die Kanzel- und Altargemeinschaft zwischen der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“ und der „Evangelisch-lutherischen Synode in Baden“ (Mai 1903) Gemeinsame Bekanntmachung über die Wiedervereinigung der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“ und der „Evangelisch-lutherischen Immanuelsynode“ (1904) Amtliche Bekanntmachung des Oberkirchenkollegiums über die Wiedervereinigung der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen und der „Evangelisch-lutherischen Immanuelsynode“ vom 17.5.1904 Satzungen des „Delegierten-Konventes“ der vom Staate unabhängigen lutherischen Kirchen in Deutschland vom 6.2.1907 Kundgebung der „Vereinigung evangelisch-lutherischer Freikirchen in Deutschland“ (August 1919) Friedens-Instrument zwischen der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ und der „Evangelisch-lutherischen Hermannsburg-Hamburger Freikirche“ (1908) Friedens-Dokument zwischen der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ und der „Evangelisch-lutherischen Hermannsburg-Hamburger Freikirche“ (1920) Aufnahme der „Hermannsburger evangelisch-lutherischen Freikirche“ in die „Evangelisch-Lutherische Freikirche“ (in Sachsen und anderen Staaten; 1908) Aufnahme eines Teils der „Süddeutschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ in die „Evangelisch-Lutherische Freikirche“ (in Sachsen und anderen Staaten; 1921)
213. 214. 215. 216. 217. 218.
219.
220.
221.
222.
223. 224. 225.
226.
227. 228.
Quellenverzeichnis
229.
230.
231.
232.
233.
234. 235.
236. 237. 238. 239. 240. 241.
242.
243.
244.
245.
129
Ergebnis der Verhandlungen zwischen der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ und der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ (in Sachsen und anderen Staaten) vom 23./24.6.1908 – Thesen über Schrift und Bekenntnis Ergebnis der Verhandlungen zwischen der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ und der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ (in Sachsen und anderen Staaten) vom 16./17.6.1909 – Thesen über die Kirche Ergebnis der Verhandlungen zwischen der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ und der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ (in Sachsen und anderen Staaten) vom 15./16.4.1913 Ergebnis der Verhandlungen zwischen der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ und der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ (in Sachsen und anderen Staaten) vom 9./10.9.1913 Konföderationsstatut zwischen der „Renitenten Kirche ungeänderter Augsburger Konfession“ und der „Selbständigen evangelisch-lutherischen Kirche in den hessischen Landen“ (1910) Konföderationsstatut zwischen der „Renitenten Kirche ungeänderter Augsburger Konfession“ und der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“ (1924) Bildung eines gemeinsamen Superintendentur-Kollegiums der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“, der „Selbständigen evangelisch-lutherischen Kirche“ in Hessen, der „Evangelisch-lutherischen Hermannsburg-Hamburger Freikirche“ und der „Renitenten Kirche ungeänderter Augsburger Konfession“ (1924) „Bund selbständiger evangelisch-lutherischer Kirchen in Hessen und Niedersachsen“, Satzung vom 28.5.1930 Die Evangelisch-lutherischen Freikirchen und die Entscheidungen von Eisenach im Juli 1948, vom 31.10.1948 Verfassung der (alten) „Selbständigen evangelisch-lutherischen Kirche“ (1947) Die „Evangelisch-lutherische Kirche in Baden“ (1948) Vereinbarung über den Anschluss der „Renitenten Kirche ungeänderter Augsburger Konfession“ an die „Selbständige evangelisch-lutherische Kirche“ vom 7.9.1950 Erklärung von Superintendent Wicke zum Anschluss der „Renitenten Kirche ungeänderter Augsburger Konfession“ an die (alte) „Selbständige evangelisch-lutherische Kirche“ (1950) Mitteilung für die Gemeinden der hessischen Diözese, zugleich Bekanntgabe für die anderen Diözesen der (alten) „Selbständigen evangelisch-lutherischen Kirche“ über den Anschluss der „Renitenten Kirche ungeänderter Augsburger Konfession“ (September 1950) Aus den Einigungssätzen zwischen der „Evangelisch-lutherischen Kirche Altpreußens“ und der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ (in Sachsen und anderen Staaten; 1947) Mitteilung für die Gemeinden der (alten) „Selbständigen evangelisch-lutherischen Kirche“ über die gegenseitige Anerkennung der Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft zwischen der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ (in Sachsen und anderen Staaten) und der (alten) „Selbständigen evangelisch-lutherischen Kirche“ (Dezember 1949) Grundordnung der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (1972)
130
Quellenverzeichnis
246.
Vertrag zur „Vereinigung der Evangelisch-Lutherischen Bekenntniskirche“ (ELBK) mit der „Selbständigen-Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK; 1975) Kirchengemeinschaft zwischen der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Baden“ und der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (1983) Schlusserklärung der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Baden“ und der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ zur Kasseler Übereinkunft (1997) Vereinbarung über den Beitritt der „Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche“ zur „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (1990/91) Vereinbarung über eine Kooperation zwischen der „Selbständigen EvangelischLutherischen Kirche“ (SELK) und der „Concordia-Gemeinde, evangelischlutherische Freikirche e.V.“ in Celle (Concordia-Gemeinde; 2004) Vereinbarung zwischen der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ und „The Lutheran Church–Canada“ (1990/91) Partnerschaftsvereinbarung zwischen der „Igreja Evangélica Luterana do Brasil“ und der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (1994) Vereinbarung zwischen der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK) und der „Freien Evangelisch-Lutherischen Synode von Südafrika“ (FELSISA; 1995) „International Lutheran Council“: Constitution (2010) Erklärung der Kirchenleitungen „Freier evangelisch-lutherischer Kirchen in Deutschland“ zur Frage nach der Abendmahlsgemeinschaft (1969) Stellungnahme von Bischof Dr. Diethardt Roth („Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche“) zu dem Dokument „Kirchengemeinschaft nach evangelischem Verständnis“ (2002) Abendmahlsgemeinschaft im Kontext der Ekklesiologie (1989) Kirchengemeinschaft. Bestimmungen aus der Handreichung „Ökumenische Verantwortung“ (1994) Vereinbarung über partnerschaftliche Beziehungen zwischen der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK) und der „Schlesischen Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses“ in der Tschechischen Republik (SEKAB; 2001) Vereinbarung über partnerschaftliche Beziehungen zwischen der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK) und der „Evangelisch-Lutherischen Ingermanlandkirche in Russland“ (ELKIR; 2001) Vereinbarung zwischen der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK) in Deutschland und der „Evangelisch-Lutherischen Kirche Lettlands“ (ELKL; 2002) Vereinbarung zur Entwicklung der Kontakte zwischen der „Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen“ (EKKPS) und der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK) in Wittenberg (2008) Thesen zur Kirchengemeinschaft; Entschließung der Teilnehmer der „European Regional ILC Conference“ (Antwerpen, Belgien, 11.–14.6.2004) an ihre Kirchen Stellungnahme der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ zur „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ (römisch-katholische Kirche und Lutherischer Weltbund; März 1999)
247. 248. 249. 250.
251. 252. 253.
254. 255. 256.
257. 258. 259.
260.
261.
262.
263. 264.
Quellenverzeichnis
265. 266. 267. 268. 269. 270.
131
Stellungnahme zur „Gemeinsamen offiziellen Feststellung des Lutherischen Weltbundes und der römisch-katholischen Kirche“ samt „Anhang“ (1999) „Charta Oecumenica“ (2001) Beschluss zur „Charta Oecumenica“ von Kirchenleitung und Kollegium der Superintendenten der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (2003) Anschreiben von Bischof Dr. Diethardt Roth zur „Charta Oecumenica“ (2003) Der Text der wechselseitigen Taufanerkennung im Magdeburger Dom am 29.4.2007 Beschluss der Kirchenleitung zur Taufanerkennung vom 22./23.2.2007
Bibliographische Hinweise auf seit der 1. Auflage von 2012 erschlossene oder entstandene Quellen 1817: 1949:
1989: 1990:
1990:
1991:
1996:
2009:
2009:
Kabinettsordre Friedrich Wilhelm III vom 27.9.1817, Faksimile und Transkription, Geheimes Staatsarchiv der Stiftung Preußischer Kulturbesitz „An alle Herrn Pastoren in der Ostzone“. Das Oberkirchenkollegium der „Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche Altpreußens“, Berlin, 08. Dezember 1949 (Protokolle des OKC 1949, Hannover) Wort an unsere Gemeinden. Das Oberkirchenkollegium, Berlin, 05.10.1989. In: Michael Voigt (Hrsg.), Offene Türen, Groß Oesingen 1991, S. 12 Vereinbarung über den Beitritt der „Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche“ (ELAK) zur „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK) vom 01.09.1990 (von der 35. Generalsynode der ELAK in Klitten vom 12.10. bis 14.10.1990 und der 7. Kirchensynode der SELK in Wiesbaden vom 02.07. bis 07.07.1991 angenommen). In: Michael Voigt (Hrsg.), Offene Türen, Groß Oesingen 1991, S. 34–38 Hirtenwort des Oberkirchenkollegiums an die Gemeinden der altlutherischen Kirche vom 15. Februar 1990. In: Michael Voigt (Hrsg.), Offene Türen, Groß Oesingen 1991, S. 20–25 Vereinbarung über die Zusammenarbeit der „Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche“ (ELAK) und der „Lutherischen Kirchenmission (Bleckmarer Mission) e.V.“ (LKM) vom 28.03./24.04.1990. In: Michael Voigt (Hrsg.), Offene Türen, Groß Oesingen 1991, S. 31 Jobst Schöne, Geleitwort zu Evangelisch-Lutherische Kirchenagende. In: „Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche“, Evangelisch-Lutherische Kirchenagende Band I, Freiburg/Basel/Wien 1996, S. 5* 9 Fragen der LCSA an die Lutherische Kirchenmission beantwortet von Missionsdirektor Markus Nietzke (englisch – deutsch), https://www.mission-bleckmar.de/ wp-content/uploads/2014/09/9_Fragen_LCSA_Deutsch_Englisch.pdf, abgerufen 06.03.2020 Vertrag über die Feststellung der Kirchengemeinschaft mit der „Lutherischen Kirche im Südlichen Afrika“. In: Kirchliche Ordnungen der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche, herausgegeben von der Kirchenleitung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK), Ordnungsnummer 610, Hannover 2009
132
2011:
2012:
2013:
2015:
2015:
2017:
2017:
2017:
2018:
2018:
Quellenverzeichnis
Ordnung für die diakonische Arbeit der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche. In: Ordnungstexte des Diakonischen Werks der Selbständigen EvangelischLutherischen Kirche (SELK), herausgegeben von KR Michael Schätzel in Zusammenarbeit mit Diakoniedirektorin Barbara Hauschild, Hannover 2015, S. 2–9 Geschäftsordnung für das Diakonische Werk der Selbständigen EvangelischLutherischen Kirche (SELK): In: Ordnungstexte des Diakonischen Werks der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK), herausgegeben von KR Michael Schätzel in Zusammenarbeit mit Diakoniedirektorin Barbara Hauschild, Hannover 2015, S. 10–12 Akkreditierung der „Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel“ vom 13.05.2020. In: Datenbank der Stiftung Akkreditierungsrat, Bonn, https://antrag.akkreditierungsrat.de/akkrstudiengaenge/?hochschule=bbc4fe14d72a-cbcc-9c6e-054bbccd3475&ordering=ordering_name&limit=10&offset=0, abgerufen 23.03.2020; 2019: Reakkreditierung „Lutherische Kirche und Judentum“, hg. von der Theologischen Kommission (TK) SELK, Lutherische Orientierung Band 12, Hannover 2017 (2019: Beschluss zum Antrag 440.03 an die 14. Kirchensynode der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche [SELK], https://selk.de/download/synode2019/013_Protokolle.pdf, abgerufen 08.03.2020) Mitarbeitervertretungsgesetz für das Diakonische Werk der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche. In: Ordnungstexte des Diakonischen Werks der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK), herausgegeben vom Präsidium des Diakonischen Werkes der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK), Hannover 2015, S. 18–52 „Lasset uns aber wahrhaftig sein in der Liebe …“ Evangelische Unionskirchen und selbstständige evangelisch-lutherische Kirchen 1817–2017. Brief an die Gemeinden der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) und der Union Evangelischer Kirchen in der EKD (UEK), https://selk.de/download/SELK-UEK2017_Brief-an-die-Gemeinden.pdf, abgerufen 08.03.2020 „Lasset uns aber wahrhaftig sein in der Liebe …“ Evangelische Unionskirchen und selbstständige evangelisch-lutherische Kirchen 1817–2017. Gemeinsames Wort der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) und der Union Evangelischer Kirchen in der EKD (UEK), https://selk.de/download/UEK-SELK2017_Gemeinsames-Wort.pdf, abgerufen 08.03.2020 Vereinssatzung „Kreis der Freunde und Förderer der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel e.V.“, beschlossen am 16.09.2017. Herausgegeben vom „Kreis der Freunde und Förderer der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel e.V.“, Oberursel 2017 Kirchenverfassung der Evangelisch-Lutherischen Freikirche (überarbeitete Version der Kirchenverfassung von 2006), herausgegeben von der Evangelisch-Lutherischen Freikirche, Zwickau 2018. Protokollarische Vereinbarung zwischen der „Lutherischen Kirche–MissouriSynode“ und der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK). In: Kirchliche Ordnungen der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche, herausgegeben von der Kirchenleitung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK), Hannover, im Druck
Quellenverzeichnis
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2020:
133
Begleitende Informationen und Impulse zu der Veröffentlichung „Lutherische Kirche und Judentum.“ Auszug des Rundschreibens 240 vom 29.10.2019 der Kirchenleitung der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK) https://selk.de/download/LO12_Begleitinfo_und_Impulse.pdf, abgerufen 12.03.2020 Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Jubiläumsausgabe, herausgegeben vom Lutherischen Weltbund und der römisch-katholischen Kirche, mit Kommentaren vom Weltrat Methodistischer Kirchen, der Anglikanischen Kirchengemeinschaft und der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen. In englischer Sprache, Genf 2019, https://www.lutheranworld.org/content/resource-joint-declaration-doctrinejustification-20th-anniversary-edition, abgerufen 09.03.2020 Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligung und unsere Erlösung. Ein Wort des DÖSTA und eine Erklärung der Mitgliederversammlung der ACK 20 Jahre nach der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“, herausgegeben vom „Deutschen Ökumenischen Studienausschuss“ (DÖSTA), https://www.oekumeneack.de/fileadmin/user_upload/Texte_und_Publikationen/2019-09-18_20_Jahre_ GER_final.pdf, abgerufen 11.03.2020 Vertrag über die Feststellung von Kirchengemeinschaft Evangelisch-Lutherischen Missionsdiözese von Finnland, der Evangelisch-Lutherischen Diözese in Norwegen und der Missionsprovinz in Schweden (Antrag 403 an die 14. Kirchensynode der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche [SELK], https://selk.de/download/synode2019/013_Protokolle.pdf, abgerufen 08.03.2020) Vertrag über die Feststellung von Kirchengemeinschaft Evangelisch-Lutherischen Missionsdiözese von Finnland, der Evangelisch-Lutherischen Diözese in Norwegen und der Missionsprovinz in Schweden (Antrag 403 an die 14. Kirchensynode der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche [SELK], https://selk.de/download/synode2019/013_Protokolle.pdf, abgerufen 08.03.2020) Vertrag über die Feststellung von Kirchengemeinschaft mit der American Association of Lutheran Churches (Antrag 401 an die 14. Kirchensynode der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche [SELK], https://selk.de/download/synode2019/013_Protokolle.pdf, abgerufen 08.03.2020) Vertrag über die Feststellung von Kirchengemeinschaft mit der ConcordiaGemeinde Celle (Antrag 400 an die 14. Kirchensynode der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche [SELK], https://selk.de/download/synode2019/013_Protokolle.pdf, abgerufen 08.03.2020) Vertrag über die Feststellung von Kirchengemeinschaft mit der EvangelischLutherischen Kirche Argentiniens (Antrag 402 an die 14. Kirchensynode der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche [SELK], https://selk.de/download/synode2019/013_Protokolle.pdf, abgerufen 08.03.2020) Vertrag über die Feststellung von Kirchengemeinschaft mit der Lutherischen Kirche Synode von Nicaragua (Antrag 405 an die 14. Kirchensynode der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche [SELK], https://selk.de/download/synode2019/013_Protokolle.pdf, abgerufen 08.03.2020) Statut der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel (Beschlussfassung vom 26.03.2020, Inkraftsetzung zum 01.05.2020, https://lthh.de/images/Downloads/ Ordnungen/260_-_Statut_der_LThH_-_El_20.pdf, abgerufen 22.05.2020)
Biogramme Zu etlichen im Buch erwähnten Personen sind nachfolgend knappe Informationen abgedruckt. Auf Darstellungen zu anderweitig gut dokumentierten Biographien wurde verzichtet. Das Personenregister (Seite 143f.) enthält zusätzliche Namen. Wilhelm Friedrich Besser: Pastor, Kirchenrat, *27.9.1816 in Warnstedt/Harz; bis 1847 Pastor in Wulkow/Brandenburg; 1847 Übertritt zur „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“; 1847–1853 Pastor in Seefeld; 1853–1856 Kondirektor der Leipziger Mission; 1857–1864 Pastor in Waldenburg/Schlesien; seit 1863 Kirchenrat; †26.9.1884 in Niederlößnitz bei Dresden Karl Ferdinand Bingmann: Pastor, Superintendent, *22.2.1822 in Oberroßbach/Oberhessen; 1849–1898 Pastor in Höchst/Nidda; seit 1877 Superintendent; †16.2.1898 in Höchst/Nidda Jakob Böttcher: Pastor, Superintendent, *9.12.1872 in Madras; seit 1903 Pastor und Superintendent im Pfarrbezirk Molzen; 1.5.1956 emeritiert; †1958 Friedrich August Brunn: Pastor, *15.2.1819 in Schaumburg/Lahn; 1842–1846 Hilfsgeistlicher in Runkel/Lahn; 1846–1879 Pastor in Steeden/Nassau; seit 1877 Glied der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“; 1879 emeritiert; †27.3.1895 in Steeden Horst Brügmann: Pastor, Kirchensuperintendent, Propst, *20.7.1927, 1954–1973 Pastor in Wriedel, Ruhestand in Lüneburg ; † Lüneburg 15.09.1984 Franz Wilhelm Julius Diedrich: Pastor, *15.7.1819 in Stettin; 1845–1847 Pastor der evangelischen Kirche in Zaatzke bei Wittstock/Dosse; 1847 Übertritt zur „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“; 1847–1874 Pastor in Jabel bei Wittstock/Dosse; 1861 Trennung vom Oberkirchenkollegium in Breslau; 1864 Mitbegründer der „Immanuelsynode“; 1874–1883 Pastor in Frankfurt/M.; 1883–1890 Pastor in Straßburg; †9.3.1890 in Straßburg Conrad Dreves: Pastor, *1837 in Waldeck; bis 1882 in Nordamerika; 1883–1885 zweiter Pastor an der Kreuzgemeinde Hermannsburg; seit 1886 Pastor an der Kleinen Kreuzgemeinde Hermannsburg; 1916 emeritiert; †26.3.1917 in Lüneburg Johannes Ehlers: Pastor, Superintendent, *29.4.1848 in Liegnitz; seit 1901 Superintendent der „Hermannsburg-Hamburger Freikirche“; 1886–1926 Pastor in Hermannsburg Große Kreuzkirche; †21.3.1929 in Hermannsburg Carl Eichhorn: Pastor, *11.7.1810 in Kembach/Baden; seit 1832 Pastor in Bofsheim/Baden; bis 1850 Pastor in Nußloch/Baden; 1850 Übertritt zur „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“; 1851–1867 Pastor in dieser Kirche in Ihringen/Baden; 1867–1889 Pastor in Korbach/Waldeck; †8.2.1890 bei Züschen/Waldeck Max Frommel: Pastor, Generalsuperintendent, Konsistorialrat, *15.3.1830 in Karlsruhe; 1852 Übertritt zur „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“; 1852–1854 Vikar in Liegnitz/Schlesien; 1854–1858 Pastor in Reinswalde bei Sorau/Schlesien; 1858–1880 Pastor in Ispringen/Baden; 1865 Trennung von der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“; 1871 Gründung der „Vereinigten evangelisch-lutherischen Gemeinden im Großherzogtum Baden“; 1880–1890 Generalsuperintendent und Konsistorialrat in Celle; †5.1.1890 in Celle Hartmut Günther: Professor, *20.12.1931 in Waldenburg/Schlesien, seit 1960 Lehrer für Hebräisch, Bibelkunde und Neues Testament an der Lutherischen Theologischen Hoch-
Biogramme
135
schule in Oberursel (LThH); 1993 Promotion an der Universität Erlangen; seit 1963 Professor für Biblische Theologie an der LThH; 1996 emeritiert; †21.11.2008 in Groß Oesingen Georg Friedrich Haag: Pastor, *15.1.1806 in Karlsruhe/Baden, bis 1855 Pfarrer der „Vereinigten evangelisch-protestantischen Kirche“ im Großherzogtum Baden, 1831 Protest gegen den Unionskatechismus, wechselnde Pfarrstellen, 1849–1855 Pfarrer in Ispringen bei Pforzheim/Baden, Versuch der konfessionell-lutherischen Ausrichtung seiner Kirchengemeinde, 1855 Amtsenthebung, 1855–1857 Missionsinspektor beim Evangelischen Missionshaus in Berlin, 1857–1862 Pastor der „Evangelisch-Lutherischen Kirche in Preußen“ in Stolp/Pommern, 1862 Erwerb des Sperlingshofs bei Pforzheim/Baden und Gründung der „Freien Evangelisch-Lutherischen Gemeinde Sperlingshof-Söllingen“, 1862–1875 Pfarrer auf dem Sperlingshof, †19.3.1875 auf dem Sperlingshof Adolf von Harleß: Professor, Oberhofprediger, *21.11.1806 in Nürnberg; 1830–1833 Privatdozent in Erlangen; 1833–1845 Professor in Erlangen; 1845 im „Kniebeugestreit“ suspendiert, dann Konsistorialrat in Bayreuth; 1845–1850 Professor in Leipzig; 1850–1851 Oberhofprediger in Dresden; seit 1852 Präsident des Oberkonsistoriums in München; 1852–1879 Präsident der Leipziger Mission; 1879 emeritiert; †5.9.1978 in München Ludwig Harms: Pastor, *5.5.1808 in Walsrode; vor 1844 Hauslehrer in Lauenburg und Lüneburg; 1844–1849 Kollaborator seines Vaters in Hermannsburg; 1849–1865 Pastor in Hermannsburg; 1849 Gründung der Hermannsburger Mission; †14.11.1865 in Hermannsburg Theodor Harms: Pastor, *19.3.1819 in Hermannsburg; 1849–1857 Lehrer am Missionshaus in Hermannsburg; 1857–1865 Pastor in Müden; 1865–1885 Pastor und Missionsdirektor in Hermannsburg; 1878 Amtsentsetzung und Gründung der „Hannoverschen evangelisch-lutherischen Freikirche“; †16.2.1885 in Hermannsburg Friedrich Wilhelm Hoffmann: Pastor, Metropolitan, *6.5.1803 in Hartmuthsachsen; seit Ende der zwanziger Jahre Pastor in Siden an der Diemel; 1851–1864 Metropolitan der Klasse Homberg/Efze; seit 1864 Metropolitan in Felsberg; nach 1866 Mitstreiter Wilhelm Vilmars; 1869–1872 suspendiert; 1873 kurzfristig restituiert; wegen seines Widerstandes gegen die Einführung des Gesamtkonsistoriums im November 1873 des Amtes enthoben; seitdem Pastor in Homberg; in der Frage der Geltung der „mauritianischen Verbesserungspunkte“ Anführer der von Wilhelm Vilmar dissentierenden Minderheiten der renitenten Pastoren („Homberger Konvent“); †30.10.1889 in Homberg Gottfried Hoffmann: Pastor, Professor, *3.7.1930 in Leipzig; seit 1957 Pastor in Oberursel/ Taunus; 1963–1965 Lehrer an der Lutherischen Theologischen Hochschule (LThH); 1965–1968 Pastor in Hörpel und stellvertretender Präses der „EvangelischLutherischen Freikirche“; 1968–1972 Lehrer für dogmatische Theologie an der LThH; 1972 Promotion an der Universität Heidelberg; seit 1972 Professor an der LThH; 1993 emeritiert; † 16.01. 2016 in Landau Friedrich Wilhelm Hopf: Pastor, Missionsinspektor, Missionsdirektor, *31.5.1910 in Melsungen; 1936–1949 Pastor in Mühlhausen/Franken; 1950–1978 Missionsinspektor, dann Missionsdirektor der „Mission evangelisch-lutherischen Freikirchen“ in Bleckmar; 1968 Ehrendoktor der Theologie; †19.7.1982 in Hermannsburg Georg Philipp Eduard Huschke: Professor, *26.6.1801 in Hannoversch-Münden; 1824–1827 Professor für Jura in Rostock; seit 1827 Professor in Breslau; 1830 Mitbegründer der
136
Biogramme
Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen; seit 1841 Präsident des Oberkirchenkollegiums dieser Kirche; †7.2.1886 in Breslau August Ludwig Christian Kavel: Pastor, *3.9.1798 in Berlin, seit 1826 Pastor in Klemzig Kreis Züllichau, 1835 Anschluss an die „Evangelisch-lutherische Kirche in Preußen“, 1838 Auswanderung nach Australien, Gründung von Siedlungen im Barossatal in Südaustralien, Begründer des Luthertums in Australien, †12.2.1860 in Tanunda (Langmeil)/Australien Klaus Ketelhut: Pfarrer, Kirchenrat, Präsident, Propst, *18.12.1930 in Mühlhausen in Thüringen; Pfarrer in Schwerin, Gotha und Halle/Saale. Von 1975 bis 1991 gehörte er dem Oberkirchenkollegium der „Evangelisch-Lutherischen (altlutherischen) Kirche“ (ELAK) als Kirchenrat an, langjährig Präsident der Gemeinsamen Kirchenleitung der Vereinigung selbständiger evangelisch-lutherischer Kirchen in der ehemaligen DDR; 1991–1995 Propst im Sprengel Ost der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK) Hans Kirsten: Pastor, Professor, Präses, Propst, *9.3.1902 in Annaberg/Erzgebirge, 1925– 1928 Pastor in Groß Oesingen, 1928–1940 Pastor in der Bethlehems-Gemeinde der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ in Hannover, 1946–1948 Leitung des Theologischen Proseminars in Groß Oesingen, 1948 Gründungsrektor und Dozent an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel, 1952 Promotion an der Universität Heidelberg; 1959–1969 Professor für Praktische Theologie an der LThH, seit 1968 Präses der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“, 1972–1976 Propst im Sprengel Süd der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“, †1.4.1994 in Hesel/Ostfriesland Martin Kiunke: Pastor, Professor, Kirchenrat, *27.8.1898 in Breslau, 1925–1930 Pastor in Groß-Justin/Pommern, seit 1930 Pastor in Liegnitz, 1939 Promotion an der Universität Erlangen; seit 1944 Kirchenrat im Oberkirchenkollegium (OKK) der „Evangelischlutherischen Kirche Altpreußens“, seit 1948 Professor für Kirchengeschichte und Neues Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel, 1953 Ausscheidung aus dem Dienst der „Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche“ und Wechsel in ein Pfarramt der Landeskirche Hannovers, †13.4.1983 in Mötzingen Johannes Konrad Wilhelm Löhe: Pastor, *21.2.1808 in Fürth; bis 1837 Vikar in Bayern; seit 1837 Pastor in Neuendettelsau; seit 1842 Ausbildung von Pastoren für die lutherischen Kirchen in Nordamerika; 1854 Gründung der Diakonissenanstalt Neuendettelsau; †2.1.1872 in Neuendettelsau Ferdinand Lucius: Lehrer, Pastor, *2.3.1880 in Echzell; seit 1923 Pastor im Pfarrbezirk Herrenbreitungen mit Herrenbreitungen (Brotterode) und Homberg (Verna); †14.06.1947 in Erfurt Heinrich Martin: Pastor, Superintendent, Kirchensuperintendent, *10.5.1884 in Kassel, seit 1913 Pastor und seit 1925 Superintendent im Pfarrbezirk Marburg a.d. Lahn mit Marburg, Warzenbach, und Treisbach; 1947 Kirchensuperintendent der „Selbständigen evangelischlutherischen Kirche“; 1955 Ehrendoktor des Concordia-Seminars in St. Louis/USA; 1959 emeritiert; †7.7.1972 Hartmut Moritz Mitzenheim: Pastor, Dozent, Landesbischof, *17.08.1891 in Hildburghausen, wurde im September 1914 ordiniert; nach 1916 Pfarrer in Wallendorf, Saalfeld sowie von 1929 bis 1945 in Eisenach, daneben Dozent am „Neulandhaus“, ab1943 Vorsitzender der Lutherischen Bekenntnisgemeinschaft in Thüringen, im Mai 1945 Landesoberpfarrer, ab Dezember Landesbischof und von 1945 (bis 1970) Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche von Thüringen; †04.08.1977 in Eisenach
Biogramme
137
Julius Nagel: Pastor, Superintendent, Kirchenrat, *1809 in Stecklin/Pommern; bis 1842 Militärgeistlicher in Stargard; 1842–1847 Pastor in Trieglaff; 1847 Übertritt zur „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“; seit 1852 Superintendent und Kirchenrat in Breslau; emeritiert 1881; †17.1.1884 in Breslau Wilhelm Martin Oesch: Pastor, *9.11.1896 in Westcliffe/Colorado, 1922–1933 Pastor der Immanuels-Gemeinde der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ in Sachsen und anderen Staaten in Stuttgart, 1940–1945 Vakanzpastor in der Dreieinigkeitsgemeinde in Groß Oesingen und Lachendorf, später in Hamburg; 1948–1968 Professor für Systematische Theologie und Symbolik an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel, emeritiert 1968, †18.1.1982 in Oberursel Hermann Alexander Pistorius: Pastor, Kirchenrat, *27.8.1811 in Walbeck; 1843–1848 Pastor in Süplingen; 1848–1851 Pastor der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“ in Wernigerode; 1851–1863 Pastor in Wollin; seit 1857 Kirchenrat in Breslau; 1863– 1877 Pastor in Basedow/Mecklenburg; †24.4.1877 in Basedow Rudolf Rocholl: Pastor, Superintendent, Kirchenrat, *27.9.1822 in Rhoden/Waldeck; 1850– 1861 Pastor in Sachsenberg; 1861 Übertritt in die lutherische Landeskirche Hannovers; seit 1867 Superintendent in Göttingen; 1878 Übertritt zur „Hannoverschen evangelischlutherischen“ Freikirche, Pastor in Hannover und Arpke, noch in demselben Jahr Übertritt zur „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“; 1878–1885 Pastor in Radevormwald; seit 1881 Superintendent in Breslau und Mitglied des Oberkirchenkollegiums (1886–1891 dessen Geschäftsführer); †26.11.1905 in Düsseldorf Manfred Roensch: Pastor, Professor, *16.3.1930 in Liegnitz; seit 1956–1966 Pastor im Pfarrbezirk Heidelberg und Mannheim; 1958 Promotion an der Universität Heidelberg; seit 1966 Professor für Historische Theologie und Symbolik an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel, 1995 emeritiert; †10.4.2001 in Oberursel Gerhard Rost: Professor, Bischof, *20.1.1922 in Halle/Saale; seit 1954 Dozent für Historische Theologie, Neues Testament und Homiletik an der Lutherischen Theologischen Hochschule (LThH) in Oberursel; 1960 Promotion an der Universität Münster; seit 1961 Professor an der LThH; 1963–1967 geschäftsführender Kirchenrat in Wuppertal; seit 1967 Präsident des Oberkirchenkollegiums der „Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche“; 1973–1985 erster Bischof der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“; †19.5.2003 in Berlin Diethardt Roth: Pastor, Superintendent, Bischof, *24.7.1941 in Leslau a.d. Weichsel; 1970– 1996 Pastor in Melsungen; 1972 Promotion an der Universität Göttingen; 1985–1991 Superintendent im Kirchenbezirk Hessen-Nord der „Selbständigen EvangelischLutherischen Kirche“ (SELK); 1991–1996 Propst im Sprengel Süd der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“; 1996–2006 Bischof der „Selbständigen EvangelischLutherischen Kirche“ in Hannover; 1.7.2006 emeritiert Rudolf Rothfuchs: Pastor, Superintendent, *28.11.1904 in Rodenberg/Deister; seit 1933 Pastor der Parochie Rodenberg/Deister; seit 1956 Superintendent der hessischen Diözese; †17.1.1968 in Rodenberg/Deister Carl Friedrich Theodor Ruhland: Pastor, Präses, *26.4.1836 in Grohnde/Weser; 1857 Auswanderung nach Nordamerika; 1857–1859 Theologiestudium in St. Louis/Missouri; 1859–1862 Pastor in Oshkosh/Wisconsin (Missouri-Synode); 1862–1866 Pastor in Wolcottsville/N.Y.; 1866–1867 Pastor in Buffalo; 1867–1871 Pastor in Pleasant
138
Biogramme
Ridge/Illinois; 1872–1873 Pastor in Dresden; 1873–1879 Pastor in Planitz; 1876–1879 Präses der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“; †3.6.1879 bei Amhertsburg/Ontario Hermann Sasse: Pastor, Professor, *17.7.1895 in Sonnewalde/Thüringen; 1920 Pastor in Templin/Brandenburg; 1921–1928 Pastor in Oranienburg; 1923 Promotion an der Universität Berlin; 1927 Delegierter und Dolmetscher bei der Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung (Faith and Order) in Lausanne; Habilitation im Fach Neues Testament; seit 1928 Pastor in Berlin; 1933 Professor für Kirchen- und Dogmengeschichte sowie Konfessionskunde an der Universität Erlangen; seit 1949 Professor am Immanuel Theological Seminary der „Vereinigten Lutherischen Kirche“ in North Adelaide/SüdAustralien; †8.8.1976 in North Adelaide/Australien Ludwig Saul: Pastor, *24.10.1813 in Kassel-Harleshausen, 1848 Pastor in Netra, 1853 in Balhorn, †28.7.1877 in Balhorn Johann Gottfried Scheibel: Pastor, Professor, *16.9.1783 in Breslau; seit 1807 Lektor in Breslau; seit 1811 außerordentlicher Professor; seit 1817 Diakonus an St. Elisabeth in Breslau; seit 1818 ordentlicher Professor; 1830 Suspension wegen Widerstandes gegen die Einführung der Union; 1832–1833 in Dresden; 1833–1836 in Hermsdorf bei Dresden; 1836–1839 in Glauchau; seit 1839 in Nürnberg; †21.3.1843 in Nürnberg Jobst Schöne: Pastor, Superintendent, Bischof, *20.10.1931 in Naumburg/Saale; seit 1959 Pastor in Köln; 1962–1985 Pastor in Berlin-Zehlendorf und Berlin-Spandau; 1968 Promotion an der Universität Münster; 1978 Ehrendoktorwürde des Concordia Theological Seminary in Fort Wayne/Indiana; 1972–1985 Superintendent im Bezirk Berlin-West der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK); 1985–1996 Bischof der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ in Hannover; 1996 emeritiert Werner Srocka: Pastor, Superintendent, Kirchensuperintendent, *6.2.1900 in Swinemünde; 1926 Promotion zum Lic. theol., 1926–1931 Pastor in Mühlhausen (Thüringen), seit 1931 Pastor im Pfarrbezirk Seefeld mit Seefeld, Kolberg und Zuchen; 1945–1963 Pastor in Hermannsburg Große Kreuzkirche, seit 1946 zugleich auch Superintendent; 1956– 1963 Kirchensuperintendent der „Selbständigen evangelisch-lutherischen Kirche“; †2.9.1963 in Hermannsburg Heinrich Stallmann: Pastor, Präses, *5.7.1887 in Allendorf/Lumda; 1920–1923 Pastor in Wittingen; 1926–1927 Pastor der Erlösergemeinde in Bochum, 1927–1956 Pastor der Kreuz-Gemeinde in Bochum; †16.6.1969 in Wittingen Henrich Steffens: Professor, *2.5.1773 in Stavanger/Dänemark; 1796 Habilitation in Kiel; 1803 ordentlicher Professor für Naturphilosophie; Physiologie und Mineralogie in Halle; ab 1811 in Breslau; enge Freundschaft mit Scheibel; 1830 Mitbegründer der lutherischen Gemeinde in Breslau; ab 1832 Professor in Berlin; †13.2.1845 in Berlin Karl Georg Stöckhardt: Pastor, Professor, *17.2.1842 in Chemnitz; 1867–1870 Lehrer am Luisenstift in Tharandt; 1870 Hilfsprediger in Paris; 1871–1873 Repetent und Religionslehrer in Erlangen; 1873–1876 Diakonus in Planitz; 1876–1878 zweiter Pastor an der St. Johannis-Gemeinde der „Evangelisch-Lutherischen Freikirche“ in Planitz; 1878–1887 Pastor und Privatdozent in St. Louis/Missouri; 1887–1913 Professor am ConcordiaSeminar der „Missouri-Synode“ in St. Louis; †9.1.1913 in St. Louis August Friedrich Christian Vilmar: Professor, *21.11.1800 in Solz/Hessen; 1827–1833 Gymnasiallehrer in Marburg; 1833–1850 Gymnasialdirektor in Marburg; 1850–1851 Vortragender Rat im Ministerium Hassenpflug; 1851–1855 Vertreter des Generalsuper-
Biogramme
139
intendenten; 1855 Wahl zum Generalsuperintendenten; vom Kurfürst nicht bestätigt; 1855–1868 Professor in Marburg; †30.6.1868 in Marburg Jakob Wilhelm Georg Vilmar: Pastor, Metropolitan, *1804 in Solz/Hessen; 1830 Pastor an der Altstädter Gemeinde in Rotenburg; seit 1851 Metropolitan in Melsungen; 1866 Versetzung nach Sand; 1867 Rückkehr nach Melsungen; 1868 Absetzung als Metropolitan; 1873 Amtsentsetzung; danach Pastor an der renitenten Gemeinde in Melsungen; †7.12.1884 in Melsungen Hans-Jörg Voigt: Pastor, Superintendent, Bischof, *7.6.1962 in Dresden; 1991–2006 Pastor in Greifswald; 2001–2003 Superintendent des Kirchenbezirks Berlin-Brandenburg der Selbständigen „Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK); 2003–2006 Leiter des Praktisch Theologischen Seminars der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“; seit 2006 Bischof der „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ in Hannover Carl Ferdinand Wilhelm Walther: Pastor, Präses, Professor; *25.10.1811 in Langenchursdorf/Sachsen; 1834–1836 Hauslehrer; 1836–1838 Pastor in Bräunsdorf bei Penig; 1838 Auswanderung mit Martin Stephan nach Nordamerika; 1839–1841 Pastor in Perry County/Missouri; 1841–1887 Pastor der „Missouri-Synode“ in St. Louis/Missouri; 1847 Mitbegründer dieser Synode; 1847–1850 und 1864–1878 Allgemeiner Präses dieser Synode; seit 1849 Professor am Concordia-Seminar in St. Louis; †7.5.1887 in St. Louis Johann Georg Wermelskirch: Judenmissionar, Pastor, *22.2.1803 in Bremen; 1824–1825 Judenmissionar in Warschau und der Provinz Posen 1825–1835; 1836–1842 Leiter der Dresdener (später Leipziger) Mission; 1842–1844 Pastor der „Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen“ in Berlin; 1844–1872 Pastor in Erfurt; †20.12.1872 in Erfurt Wilhelm Wöhling: Pastor, Präses, *4.2.1860 in Molzen/Hannover; 1886–1890 Pastor der „Hermannsburger evangelisch-lutherischen Freikirche“ in Groß Oesingen; 1890–1925 Pastor in Uelzen; 1891–1908 Präses der „Hermannsburger evangelisch-lutherischen Freikirche“; 1908 Anschluss an die „Evangelisch-Lutherische Freikirche“; †25.8.1927 in München Ernst Ziemer: Pastor, Kirchenrat, *21.6.1872 in Stettin; seit 1897 Kirchenrat; seit 1921 Pastor im Pfarrbezirk Breslau-Süd mit Brockau und Rogau-Rosenau; †2.10.1949 in Berlin-Dahlem
Bildquellenverzeichnis Herausgeber und Verlag haben sich bemüht, nach bestem Wissen und Gewissen die Urheberrechte der in diesem Band gedruckten Abbildungen zu ermitteln und hier entsprechend nachzuweisen. Sollten dennoch an irgendeiner Stelle Urheberrechte verletzt worden sein, so bitten wir um Entschuldigung und um eine entsprechende Mitteilung an den Verlag. Wir danken allen sehr herzlich, die freundlicherweise zur Beschaffung von Bildmaterial für dieses Buch beigetragen haben. Seite 13 Seite 14 Seite 15 Seite 17 Seite 21 Seite 26 Seite 29 Seite 35 Seite 36 Seite 37
Seite 46 Seite 48 Seite 53 Seite 55 Seite 56 Seite 58 Seite 61 Seite 67
Johann Gottfried Scheibel, Foto, Datum der Aufnahme unbekannt, © Archiv der Lutherischen Theologischen Hochschule (LThH). Georg Philipp Eduard Huschke, Foto, Datum der Aufnahme unbekannt, © Archiv der LThH. Hönigern, Kirche, Postkarte, 1934, © Wir danken Herrn Berthold Blomeyer, dass er uns freundlicherweise das genannte Bild zur Verfügung gestellt hat. Eduard Gustav Kellner, Foto, Datum der Aufnahme unbekannt, © Archiv der LThH. Franz Wilhelm Julius Diedrich, Foto, Datum der Aufnahme unbekannt, © Archiv der LThH. Carl Eichhorn, Foto vom Gemälde: Theodor Rocholl, © Eigentum der Evangelisch-lutherischen Christusgemeinde Korbach. Max Frommel, Foto, Datum der Aufnahme unbekannt, © Archiv Mützelfeldt. Carl Ferdinand Wilhelm Walther, Foto, Datum der Aufnahme unbekannt, © Archiv der LThH. Karl Georg Stöckhardt, Foto, Datum der Aufnahme unbekannt, © Archiv der Kirchenleitung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK). Zwickau-Planitz, St. Johanneskirche, Foto, Datum der Aufnahme unbekannt, © Archiv der Kirchenleitung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK). August Friedrich Christian Vilmar, Foto, Datum der Aufnahme unbekannt, © Archiv der LThH. Jakob Wilhelm Georg Vilmar, Foto, Datum der Aufnahme unbekannt, © Archiv der LThH. Karl Ferdinand Bingmann, Foto, Datum der Aufnahme unbekannt, © Archiv der Kirchenleitung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK). Christian Müller, Foto, Datum der Aufnahme unbekannt, © Archiv der Kirchenleitung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK). Georg Ludwig Detlef Theodor (genannt: Louis) Harms, Gemälde, Datum unbekannt, © Evangelisch-lutherisches Missionswerk in Niedersachsen. Theodor Harms, Foto, Datum der Aufnahme unbekannt, © Archiv der LThH. Rudolf Rocholl, Foto eines Gemäldes von Theodor Rocholl, um 1875, © Fotostudio Benari 2019. Berlin-Wilmersdorf, Kirche „Zum Heiligen Kreuz“, Foto vom 17.01. 2008 © Jörg Zägel.
Bildquellenverzeichnis
Seite 68 Seite 75 Seite 77 Seite 83 Seite 84
Seite 93
Seite 96 Seite 97
Seite 97
Seite 99 Seite 101
Seite 102 Seite 110 Seite 111 Seite 112 Seite 114
141
Berlin-Mitte, Annenstraße, Evangelisch-lutherische Kirche, Foto, 1981, © Archiv der Kirchenleitung der SELK. Bleckmar, Missionshaus der Lutherischen Kirchenmission (Bleckmarer Mission), Foto, vor 2010, © Lutherische Kirchenmission. Friedrich Wilhelm Karl August Christoph Hopf, Foto, 26.6.1955, © Archiv der Kirchenleitung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK). Wuppertal-Elberfeld, St. Petrikirche, Postkarte, vor 1943, © Archiv der Kirchenleitung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK). Guben, Naëmi-Wilke-Stift, vor der Pforte des Krankenhauses: Diakonissen mit Oberin Else Frey und Vorsteher Pfarrer Wilhelm Brachmann, Foto, 1954, © Archiv des Naëmi-Wilke-Stifts. Johann Georg Gottfried Wermelskirch, Foto, Datum der Aufnahme unbekannt, © Archiv der Kirchenleitung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK). Seminar der Evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen, Foto, 1932, © Archiv der Kirchenleitung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK). Breslau, Hohenzollernstraße, Christuskirche, Außenansicht, Postkarte, Zeichnung: Paul Bunke 1930, © Archiv der Kirchenleitung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK). Breslau, Hohenzollernstraße, Christuskirche, Innenansicht, Foto, vor 1945, © Archiv der Kirchenleitung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK). Friedrich August Brunn, Foto, Datum der Aufnahme unbekannt, © Archiv der LThH. Kleinmachnow bei Berlin, ehemalige Theologische Hochschule der „EvangelischLutherischen Freikirche“, Foto, Aufnahme aus den 1970er Jahren, © Archiv der Kirchenleitung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK). Oberursel, Lutherische Theologische Hochschule (LThH), Verwaltungsgebäude, Foto, 15.6.2010, © Trixi Reiter. Dr. Gerhard Rost, LL.D., Foto, Mai 1992, © Archiv der Kirchenleitung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK). Dr. Jobst Schöne, D.D., Foto, vor 1996, © Dr. Jobst Schöne, D.D. Hannover-Kleefeld, Schopenhauerstraße 7, Kirchenbüro der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK), Foto, 23.01.2010, © Michael Schätzel. Hans-Jörg Voigt, D.D. (links) und Christian Schad (rechts), Foto, 22.11.2017 © evkirchepfalz/Jahn.
Verzeichnis der Mitarbeiter dieses Buchs Dr. Albrecht Adam ist emeritierter Pfarrer der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche, wohnhaft in Berlin. Er nimmt einen Lehrauftrag am Theologischen Institut der „Evangelisch-lutherischen Kirche Ingriens“ in St. Petersburg/Russland wahr. Dr. Christoph Barnbrock ist Professor für Praktische Theologie an der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel/Taunus und seit dem Sommersemester 2017 ihr Rektor. Martin Benhöfer ist Vorstandsmitglied der Lutherischen Kirchenmission (Bleckmarer Mission) e.V. in Bergen und verantwortet deren Öffentlichkeitsarbeit. Dr. Frank Martin Brunn ist Wissenschaftlicher Geschäftsführer der Arbeitsstelle Kirche und Gemeinwesen am Fachbereich Evangelische Theologie der Universität Hamburg. Er ist Privatdozent für Systematische Theologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Dr. Andrea Grünhagen ist Referentin für Theologie und Kirche der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche in Hannover. Dr. Gottfried Herrmann ist seit 1989 Dozent für Kirchengeschichte am Lutherischen Theologischen Seminar der „Evangelisch-lutherischen Freikirche“ in Leipzig und war bis 2018 Leiter der Concordia-Verlagsbuchhandlung in Zwickau. Gottfried Heyn arbeitet als Pastor der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) in Hannover (Bildredaktion). Prof. Dr. Werner Klän D. Litt. ist emeritierter Professor für Systematische Theologie der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel und lebt im Ruhestand in Lübeck. Prof. Dr. Gilberto da Silva ist Professor für Historische Theologie an der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel. Prof. i. R. Dr. Volker Stolle ist emeritierter Professor für Neues Testament der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel und lebt im Ruhestand in Mannheim. Stefan Süß war Rektor des Naëmi-Wilke-Stifts in Guben und Vorsitzender des Stiftsvorstandes dieser diakonischen Einrichtung in der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK). Er war außerdem Lehrbeauftragter der SELK für Diakonik an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel. Hans-Jörg Voigt D.D. ist seit 2006 Bischof der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) und seit 2012 Vorsitzender des Internationalen Lutherischen Rates (ILC).
Personenregister Albers, Matthias 77 Altenstein, Karl Sigmund Freiherr vom Stein 16 Anthes, Georg 52 Baist, Gustav 52 Barnbrock, Christoph 7, 35, 88 Bärsch, Jürgen 88 Becker, Karl Friedrich 93 Besser, Wilhelm Friedrich 18 Bichmann, Hermann 52 Biehler, Albrecht 66 Biehler, Johannes 66 Bingmann, Karl Ferdinand 52–54 Bismarck, Otto von 60 Blackwood, James S. 53 Böhmer, Karl 77 Borchardt-Wenzel, Annette 28 Brachmann, Wilhelm 84 Brunn, Frank Martin 23–25 Brunn, Friedrich August 35, 76, 98f. Burgdorf, Adolf 84 Büttner, Markus 79 Diedrich, Franz Wilhelm Julius 18, 21, 62 Dieffenbach, Georg Christian 90 Dierks, Alert 62 Dreves, Conrad 61 Ehlers, Johannes 63 Ehlers, Ludwig Otto 93 Ehmann, Johannes 23, 25 Eichhorn, Carl 24–26 Feldner, Ludwig 84 Fenske, Wolfgang 88 Friedrich von Baden, Prinzregent 28 Friedrich Wilhelm I., Kurfürst 47 Friedrich Wilhelm III., König 12, 14, 16, 89 Friedrich Wilhelm IV., König 17 Frommel, Max 25, 28f. Georg V. von Hannover, König 59 Grubert, Alfred Heinrich 74 Grünhagen, Andrea 7, 56 Haag, Georg Friedrich 25, 27, 29–31 Haas, Hanns-Stephan 82 Harleß, Adolf von 29, 35
Harms, Christian 56 Harms, Georg Ludwig Detlef Theodor 56–59 Harms, Hans-Otto 39 Harms, Theodor 57f. Hassenpflug, Ludwig 46 Hauschild, Barbara 81 Heicke, A. 61 Henhöfer, Alois 24, 27 Herrmann, Gottfried 35 Hoffmann, Friedrich Wilhelm 49f. Hopf, Friedrich Wilhelm Karl August Christoph 46, 76–78 Horning, Friedrich 26 Hübner, Cornelia 33 Huschke, Georg Philipp Eduard 14f., 73, 89 Kampmann, Jürgen 7, 9, 88, 114 Kavel, August Ludwig Christian 73 Kellner, Eduard Gustav 16f. Ketelhut , Klaus 68 Klän, Werner 7, 9, 20, 26, 36, 65, 73, 77–79, 88, 101, 104, 113f. Kranemann, Benedikt 88 Kraus, Emil 52 Kraus, Friedrich 52 Löhe, Wilhelm 35, 81, 89 Lucius, Ernst Eduard 52 Lucius, Ferdinand 54 Ludwig, August Wilhelm 25, 27 Madaus, Heinrich 62 Mahrenholz, Christhard 91 Manthey-Zorn, Carl 74 Meinel, Johann Christian Albert 62f. Meyer, Christoph 62 Meyer-Blanck, Michael 88 Mitzenheim, Moritz 67 Mohn, Franz Eduard 74 Moritz von Hessen-Kassel, Landgraf 44 Müller, Christian 55, 90 Müller, Karl 52, 55, 90 Nagel, Gottfried 96 Nagel, Julius 18 Napoleon 45, 51
144
Register
Näther, Karl Gustav Theodor 74 Nietzke, Markus 77 Ntshoe, Peter 77 Oster, Philipp Jakob 93 Pahl, Irmgard 88 Petri, Ludwig Adolf 59, 89 Philipp I. von Hessen 43 Pistorius, Hermann Alexander 18 Priegel, Friedrich 94 Raschzok, Klaus 88 Riegel, Gottfried 94 Rocholl, Rudolf 61 Roensch, Manfred 36, 65 Rohde 27 Rüegger, Heinz 81 Ruhland, Carl Friedrich Theodor 36 Saul, Ludwig 93 Schad, Christian 114 Schedtler, Heinrich 76 Scheibel, Johann Gottfried 13, 73 Schleiermacher, Friedrich 11 Schnackenberg, Dieter 77 Schöne, Jobst 15, 71, 111 Schorling, Christoph 34 Schwinge, Gerhard 24, 28f. Sigrist, Christoph 81 Silva, Gilberto da 7f., 11, 26, 36, 43, 51, 78, 96, 98
Steffens, Henrich 15 Stephan, Martin 35 Stöckhardt, Karl Georg 36 Stolle, Volker 7, 73, 93 Stromburg, Robert 61 Süß, Stefan 8, 81 Tswaedi, David 77 Ulbricht, Walter 68 Vicari, Herrmann von 28 Vilmar, August Friedrich Christian 45– 47, 62 Vilmar, Jakob Wilhelm Georg 45, 48– 50, 76 Walther, Carl Ferdinand Wilhelm 35, 59, 98 Walther, Michael 59 Weber, Christoph 77 Wedemann, Johann Heinrich Kaspar 93 Wermelskirch, Johann Georg Gottfried 93 Wetje, Johann Friedrich Hermann 62 Wilke, Friedrich 84 Willkomm, Otto Heinrich Theodor 74 Wöhling, Wilhelm 62f., 75 Wyneken, Friedrich 89 Zellmer, Johannes 71 Ziemer, Ernst 94 Zucker, Friedrich 74
Ortsregister Allendorf/Lumda 33 Altpreußen 17, 38, 65 Antwerpen 116 Australien 73 Baden 7, 21, 23–26, 28–32, 34, 38–40, 50, 54, 104, 108–110 Baden-Baden 29, 34 Balhorn 95 Baltikum 115f. Baunatal 85 Beerfelden 55 Berghausen 27
Berlin 12, 16, 27, 40f., 64, 68–71, 79, 84, 86, 93, 100f., 114 Bleckmar 61, 75, 79, 115 Bochum 68 Bofsheim 25f. Botswana 79 Brandenburg 15, 66, 84 Bräunsdorf 35 Brese 61 Breslau 13–15, 18, 30, 61, 64, 74, 96– 98, 104f. Brunsbrock 61f. Bulgarien 42
Ortsregister
Celle 31, 56, 112 Curitiba 33 Dänemark 33, 42 Darmstadt 44, 51, 53 Deutsche Demokratische Republik (DDR) 8f., 19, 40f., 64–70, 76, 86, 101, 109f. Deutschland 7, 22f., 26, 31f., 36, 38f., 42, 53, 65, 70f., 76f., 79, 83f., 86, 89f., 92, 98–101, 104f., 108f., 113f., 117 Dreihausen 54, 76 Dresden 36 Durlach 26, 28 Erbach 51, 55 Europa 23, 64, 110, 116 Felsberg 49 Finnland 42, 111 Frankfurt am Main 21, 47, 101 Frankreich 12, 42, 51 Freiburg 29, 33f. Fürstenau 54f. Fürstenwalde 84 Gifhorn 79 Gistenbeck 62 Göttingen 9, 56f., 61 Groß Oesingen 62f., 101 Guben 84–86 Gütersloh 84 Halle 13, 15, 29 Hamburg 7, 35, 62f., 104 Hanau 48 Hannover 50, 55f., 59–61, 71, 74, 89, 99, 105, 107, 112 Heidelberg 25f. Hermannsburg 38, 56–63, 74f., 105, 107f. Hesel 85 Hessen 38, 43–46, 48, 50–55, 62, 75, 90, 93, 104, 106 –108 Hessen-Darmstadt 43f., 50f., 53f., 90, 104 Hessen-Kassel 43 –47, 62, 106 Hessen-Nassau 48 Höchst an der Nidder 52–54 Homberg 50 Hönigern 15–17
Hörpel 61f. Ihringen 26–28 Indien 73f. Iran 79 Ispringen 27–30, 34 Jabel 21, 66 Jesberg 47f, Johannesburg/Südafrika 94 Karlsruhe 7, 26f., 29, 33f. Kassel 43f., 48 Kleinmachnow 101 Korbach 26, 30 Lauenburg 57, 99 Leipzig 29, 73, 79, 93, 100 Lettland 42, 116 Lüneburg 57 Marburg 43f., 46–48, 54 Melsungen 48–50, 76 Mendota/Illinois 48 Molzen 62 Mosambik 79 Mühlhausen 77 Nassau 22, 35, 37, 44, 47, 98, 104 Nestau 62f. Nettelkamp 61 Neuseeland 75 Niederplanitz 37 Niedersachsen 7, 38, 56, 76, 107 Nordamerika 73, 75f. Norwegen 42, 111 Nürnberg 13 Nußloch 25–27 Oberursel 8, 40, 55, 68, 101f. Oberwesel 42 Odenwald 54f., 85, 90 Ostafrika 73f. Ostmittel- und Osteuropa 115f. Ostpreußen 37 Penig/Sachsen 35 Perry County 35 Pforzheim 27, 29, 34, 85 Planitz 36 Pommern 15, 27, 29 Portugal 42 Posen 15, 93 Potsdam 12
145
146
Register
Preußen 11–18, 20–22, 26–31, 35, 47f., 53f., 61f., 65, 73–75, 89f., 93, 96f., 99, 104, 106, 108 Radevormwald 61 Reichelsheim 52, 54 Reinswalde bei Sorau 29 Remchingen 29, 85 Rheinhessen 51 Rostock 14 Rotenburg a. d. Fulda 48 Rothenberg 52, 54, 85 Sachsen 13, 15, 28, 35, 37, 63f., 66, 69, 74f., 98–100, 104–106, 108, 116 Sachsenberg 61 Sand 48 Scharnebeck 61 Schlesien 13, 15, 16f., 29 Schweden 42, 111 Schwirz 17 Söllingen 27 Soltau 61f. Solz bei Bebra 45 Sottrum 61 Sowjetunion, frühere 79, 85 Sperlingshof 29, 31, 77, 85
St. Louis/Missouri 35f., 99 Stammheim 54 Steeden 76, 98f. Steinen 34 Stolp 27, 29 Straßburg 21 Südafrika 75–77, 79, 111 Süddeutschland 33, 37 Thüringen 37, 67 Tschechien 42 Uelzen 75 Ukraine 42 Usenborn 54 Waldeck 30, 61 Walsrode 56 Warschau 93 Wartburg 68 Warzenbach 54 Wernigerode 66 Wiesbaden 68 Wittenberg 114, 116 Wittingen 61f. Wriedel 61 Zaatzke 21 Zwickau-Planitz 37, 40


![Die Shoah in Geschichte und Erinnerung: Perspektiven medialer Vermittlung in Italien und Deutschland [1. Aufl.]
9783839427941](https://dokumen.pub/img/200x200/die-shoah-in-geschichte-und-erinnerung-perspektiven-medialer-vermittlung-in-italien-und-deutschland-1-aufl-9783839427941.jpg)





![Die politische Erziehung in Deutschland: Geschichte und Probleme 1750 - 1880 [Reprint 2012 ed.]
9783111424798, 9783111060019](https://dokumen.pub/img/200x200/die-politische-erziehung-in-deutschland-geschichte-und-probleme-1750-1880-reprint-2012nbsped-9783111424798-9783111060019.jpg)