Grundfragen einer Reform des deutschen Gebrauchsmusterrechts [1 ed.] 9783428452156, 9783428052158
123 87 42MB
German Pages 217 [218] Year 1982
Polecaj historie
Citation preview
Schriften zum Wirtschaftsrecht Band 42
Grundfragen einer Reform des deutschen Gebrauchsmusterrechts
Von
Ferdinand Nielsen
Duncker & Humblot · Berlin
FERDINAND NIELSEN Grundfragen einer Reform des deutschen Gebrauchsmusterrechts
Schriften zum Wirtschaftsrecht
Band 42
Grundfragen einer Reform des deutschen Gebrauchsmusterrechts
Von
D.r. Ferdinand Nielsen
DUNCKER
&
HUMBLOT
/ BERLIN
Alle Rechte vorbehalten © 1982 Duncl�er & Humblot, Berlin 41 Gedruckt 1982 bei Berliner Buchdruckerei Union GmbH., 1000 Berlin 61 Prlnted in Germany ISBN 3 428 05215 3
Meinem Vater Meiner Mutter zum Gedächtnis
Vorwort Die vorliegende Untersuchung zum Gebrauchsmusterrecht wurde von der Juristischen Fakultät der Münchener Ludwig-Maximilians-Univer sität im Wintersemester 1981/82 als Dissertation angenommen; sie ist am Lehrstuhl für Privatrecht und Patentrecht an der Technischen Uni versität München entstanden. :Es ist mir ein Bedürfnis, an dieser Stelle meinem - auch über das Juristische hinaus - hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Rudolf Kraßer, dem Inhaber dieses Lehrstuhls, zu danken. Prof. Kraßer hat die Anregung zu der Arbeit gegeben und mich bei ihrer Anfertigung durch wertvolle kritische Hinweise unterstützt. Herrn Prof. Dr. Wolfgang Fikentscher bin ich für die Übernahme des Erstberichts verbunden. Mein Dank gilt ferner Herrn Senator E. h. Ministerialrat a. D. Prof. Dr. J. Broermann für die Einbeziehung meiner Arbeit in sein Verlags programm und schließlich der Technischen Universität München für die Gewährung einer großzügigen Druckbeihilfe. München, im August 1982
Ferdinand Nielsen
Inhaltsverzeichnis Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 I. Rechtfertigung des Reformvorschlags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
II. Geschichtliche Entwicklung des Gebrauchsmusterrechts . . . . . . . . . . . .
18
III. Bedeutung des Gebrauchsmusters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Erstes Kapitel: Schutzgegenstand und Schutzvoraussetzungen (§ 1 GbmG) 1. 2. 3. 4.
Abschnitt: Der Begriff „Gebrauchsmuster" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt: Der Erfindungsgedanke als Schutzgegenstand . . . . . . . . . . . Abschnitt: Überblick über die Schutzvoraussetzungen . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt: Arbeitsgerätschaften, Gebrauchsgegenstände . . . . . . . . . . . I. Gebrauchsdienlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Formfestlegbarkeit und -beständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Handbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Einheitlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Bestimmtheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Wertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Abschnitt: Raumform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Begriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Wahrnehmbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Bestimmtheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Einheitlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Reformüberlegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Die Bindung an „Gegenstand" und „Raumform" . . . . . . . . . . . . a) Folgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Ungereimtheiten bei der Raumform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Notwendigkeit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Lösungswege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Aufrechterhaltung der Rechtssituation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Verzicht auf die Kriterien „Gegenstand" und „Raumform" aa) Vorteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb) Einwände, insbesondere das Verhältnis des Gebrauchs musterrechts zum Straßburger Patentübereinkommen c) Verzicht nur auf das Merkmal „Raumform" . . . . . . . . . . . . . 6. Abschnitt: Technische Natur des Erfindungsgedankens . . . . . . . . . . . .
31 32 34 36 38 39 40 41 43 43 46 46 48 49 50 50 51 51 53 54 54 55 55 55 56 58 62
10
Inhaltsverzeichnis
7. 8. 9. 10.
Abschnitt: Arbeits- und Gebrauchszweck .... . ..................... Abschnitt: Nützlichkeit .............................. . ............ Abschnitt: Gewerbliche Anwendbarkeit ..... . ..................... Abschnitt: Neuheit ..... . ......................................... I. Begriff ....................................................... II. Änderungen .................................................. 1. ,,Zeit der Anmeldung" ............................... . ..... 2. ,,Öffentliche Druckschrift" ................................. 3. Absolut formeller Neuheitsbegriff .......................... 4. Beibehaltung der Neuheitsschonfrist .......... . . .. . ......... 11. Abschnitt: Fortschritt .............................. ............... I. Begriff ....................................................... II. Keine Einfügung in das Gesetz .............................. 12. Abschnitt: Erfindungshöhe .................. . ..................... I. Rechtsprechung ............................................... II. Kritik .......................... . . ............................ III. Erforderlichkeit .............................................. IV. Geringeres Maß als beim Patent ........................ . ..... 1. Möglichkeit ................................................ 2. Meßbarkeit ............................... . ................ V. Einführung des Begriffs „Neuerung" ..........................
63 66 67 68 68 69 71 71 71 74 77 77 79 80 80 80 82 82 84 84 87
13. Abschnitt: Schutzausschließungsgründe ............................ 88
Zweites Kapitel: Das Anmeldeverfahren (§ 2 GbmG) 1. Abschnitt: Die Anmeldung .................. . ............ . ........ 89 I. Voraussetzungen ... . ......................................... 89 II. Zeitpunkt .................................................... 90 III. Offenbarung ................................................. 94 IV. Erfindernennung und -benennung .. . ........ . ................. 95 2. Abschnitt: Die Änderung von Anmeldeunterlagen ................. 97 I. Änderungen im Eintragungsverfahren ........................ 97 II. .Änderungen nach Eintragung ................................. 100 III. Folgen unzulässiger .Änderungen .............................. 101 IV. Reformüberlegungen .......................................... 102 1. Grundsatz ................................................. 103 2. Maßgeblicher Zeitpunkt: Erlaß der Eintragungsverfügung .. 103 3. Änderungen nach Eintragungsverfügung; keine Anie4mung an § 64 PatG .............................................. 104 4. Konsequenzen bei Rechtsverstößen ......................... 107 5. ,,Löschungsgrund der unzulässigen Erweiterung" ........... 108 3. Abschnitt: Innere Priorität für Gebrauchsmusteranmeldungen ..... 109 I. Gründe für eine solche Maßnahme ............................ 110 II. Neuregelung der Rücknahmefiktion des § 40 Abs.5 PatG ...... 113
Inhaltsverzeichnis
11
4. Abschnitt: Die Gebrauchsmusterhilfsanmeldung ................... 118 I. Sinn und Zweck .............................................. 119 I. Ersetzung durch Abzweigung? ................................ 123
Drittes Kapitel: Das Eintragungsverfahren (§ 3 GbmG) 1. Abschnitt: Prüfungsumfang ....................................... 129
I. Die g,egenwärtige beschränkte Prüfung ........................ 129 II. Reformüberlegungen .... . .............. . ..................... 132 1. Umfassende Vorprüfung ................................... 132 2. Offensichtlichkeitsprüfung ................................. 135 3. Fakultative Vorprüfung? ................................... 137 2. Abschnitt: Die Eintragungsentscheidung .......................... 139 I. Form ........................................................ 139 II. Beanstandungen des Patentamts ............................. . 140 III. Aussetzung der Eintragung ................................... 141 3. Abschnitt: Gebrauchsmusterschrift ................................ 142
Viertes Kapitel: Inhalt und Umfang des Schutzes (§ 5 GbmG) 1. Abschnitt: Die Benutzungsarten .................................. 146 2. Abschnitt: Die Ermittlung des Schutzumfangs ..................... 148 I. Dreiteilungslehre ............................................. 149 II. Die neue Rechtsprechung des Bundespatentgerichts ............ 151 ...,_ III. Erforderlichkeit einer gesetzlichen Regelung ................... 153 3. Abschnitt: Schutzhindernisse und -beschränkungen ................ 156 I. Entgegenstehendes älteres Recht ................. . ............ 156 II. Widerrechtliche Entnahme ..................... ...... . ........ 157 III. Sonstige Ausnahmen von der Schutzwirkung ..... . ............ 159 4. Abschnitt: Das Verhältnis des Gebrauchsmusters zum jüngeren Patent ............................................................ 161
Fünftes Kapitel: Das L6scbungsverfahren 1. Abschnitt: Beibehaltung der Grundstruktur des Löschungsverfahrens 163
I. Doppelspurigkeit von Löschungs- und Verletzungsverfahren ... 163 II. Zuständigkeit ................................................. 165 III. Leichtere Löschbarkeit des Gebrauchsmusters? ................ 165
12
Inhaltsverzeichnis
2. Abschnitt: Reformüberlegungen ................................... 169 I. § 7 GbmG .................................................... 169 II. § 8 GbmG .................................................... 170 III. § 9 GbmG .................................................... 171 1. ,,Inhaber" bzw. ,,Eingetragener" ............................ 171 2. Löschung bei unterbliebenem Widerspruch ................. 172 3. Streichung des § 9 Abs.2 S.4 GbmG ........................ 175 4. Mündliche Verhandlup.g .................................... 175 5. Kosten .................. . ............. . . . . ...... . ......... 176 3. Abschnitt: Negativer Feststellungsantrag .......................... 178 4. Abschnitt: Das Löschungsv-erfahren in der Beschwerdeinstanz ..... 180 5. Abschnitt: Auswirkungen des Löschungsverfahrens auf einen anhän gigen Zivilrechtsstreit ................................ . ............ 181 I. Die Aussetzungsanordnung in § 11 S.1, 2 GbmG ............... 182 II. Die Bindung des Gerichts an zurückgewiesene Löschungsanträge in § 11 S.3 GbmG .. . . .................. . ........... . . ........ 183 Sechstes Kapitel: Die Schutzfrist (§ 14 GbmG) 185 1. Abschnitt: Begriffe „Schutzdauer", ,,Laufzeit", ,,Schutzfrist" 2. Abschnitt: Länge ................................................. 186 Siebentes Kapitel: Die Schutzrechtsverletzung 1. Abschnitt: Folgen (§§ 15, 16 GbmG) ................................ 189 I. Ansprüche des Gebrauchsmusterinhabers ..... . . .... . .......... 189 II. Strafvor,schriften .................... . . .............. . ........ 190 2. Abschnitt: Zuständigkeiten bei Gebrauchsmusterstreitsachen (§§ 18, 19 GbmG) ........................................................ 193 Achtes Kapitel: Verweisungen auf das Patentgesetz Zusammenfassung
196
Gesetzesvorschlag ...... . .. . ............ . ..... . ... . . . . ....... . . .... . ... 199 Literaturverzeichnis ......................................... . .... ..... 208
Abkürzungsverzeichnis a.A.
aaO Abs. Abschn. a.E. a. F. amtl. Anm. ArbnErfG Art. BayVBI. BB BGB BGB!. BGH BGHZ Bl. BPatG BPatGE bzw. ders. dgl. Einl. DÖV DPA DVBI. EPÜ ff.
FN
Gbm GbmG gern. GeschmMG GG GPatG
anderer Ansicht am angegebenen Ort Absatz Abschnitt am Ende alte Fassung amtlich Anmerkung Arbeitnehmererfindungsgesetz Artikel Bayerische Verwaltungsblätter Der Betriebs-Berater Bürgerliches Gesetzbuch Bundesgesetzblatt Bundesgerichtshof Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (amtliche Sammlung) Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen Bundespatentgericht Entscheidungen -des Bundespatentgerichts (amtliche Sammlung) beziehungsweise derselbe dergleichen Einleitung Die Öffentliche Verwaltung Deutsches Patentamt Deutsches Verwaltungsblatt Europäisches Patentübereinkommen folgende Fußnote Gebrauchsmuster Gebrauchsmustergesetz gemäß Geschmacksmustergesetz Grundgesetz Gemeinschaftspatentgesetz
14 GPÜ GrSen GRUR GRURint. GWB h.L. h. M. idR idS insb. IntPatüG iSd
iSv
HS JW JZ Kap. LG lit. LS l. Sp. Mitt. MuW m. (w.) N. n.F. NJW Nr. OLG PA PatG PatGebG PCT PräsPA PVO RG RGBl. RGSt RGZ RN ROHG
Abkürzungsverzeichnis Gemeinschaftspatentübereinkommen Großer Senat Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internatio naler Teil (seit 1967, früher GRUR Ausl.) Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen herrschende Lehre herrschende Meinung in der Regel in diesem Sinne insbesondere Gesetz über internationale Patentübereinkommen im Sinne des im Sinne von Halbsatz Juristische Wochenschrift Juristen-Zeitung Kapitel Landgericht litera (Buchstabe) Leitsatz linke Spalte Mitteilungen der deutschen Patentanwälte Markenschutz und Wettbewerb mit (weiteren) Nachweisen neue Fassung Neue Juristische Wochenschrift Nummer Oberlandesgericht Patentamt Patentgesetz Gesetz über die Gebühren des Patentamts und des Patent gerichts vom 2. 1. 1968 Patent Cooperation Treaty (Patentzusammenarbeitsvertrag) Präsident des Patentamts Pariser Verbandsübereinkunft Reich,sgericht Reichsgesetzblatt Reichsgerichtsentscheidungen in Strafsachen (amtliche Sammlung) Reichsgerichtsentscheidungen in Zivilsachen (amtliche Sammlung) Randnummer Reichsoberhandelsgericht
Abkürzungsverzeichnis RPA r.Sp. s s. StGB Straü st. Rspr. ÜG UrhG u.U. UWG vgl. WRP WuW WZG z.B. ZHR ZPO ZRP zust.
15
Reichspatentamt rechte Spalte Satz, Seite siehe Strafgesetzbuch Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfinderpatente vom 27.11.1963 (Straßburger Patentübereinkommen) ständige Rechtsprechung Überleitungsgesetz Urheberrechtsgesetz unter Umständen Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vergleiche Wettbewerb in Recht und Praxis Wirtschaft und Wettbewerb Warenzeichengesetz zum Beispiel Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschafts recht Zivilprozeßordnung Zeitschrift für Rechtspolitik zustimmend
Einführung I. Rechtfertigung des Reformvorschlags
Zu einer Zeit, da eine steigende Gesetzesflut beklagt und nach Mög lichkeiten ihrer Eindämmung gesucht wird\ bedarf der Vorschlag der Reform eines ganzen Gesetzes besonderer Rechtfertigung. In dem Be wußtsein, mit der Schaffung neuer und der Änderung bestehender Rechtsnormen behutsam sein zu müssen, nicht ohne Zwang einer Novel lierung das Wort reden zu dürfen und nicht verlangen zu können, daß sich mit einem „Blick ins Gesetzbuch a11e Fälle gleichsam von selbst lösen"2, gilt es zunächst zu klären, was die gegenwärtige Fassung zu leisten vermag; stellt sich dabei aber heraus, daß das Gesetz auf eine Fülle von Zweifelsfragen die Antwort schuldig bleibt, Ungereimtheiten aufweist, lückenhaft ist, und daß die Einfügung neuer Gedanken Vor teile3 bietet, erscheint eine umfassende Neuregelung angezeigt. Aus dem Text des Gebrauchsmustergesetzes ist seine Deutung, die es durch die jahrzehntelange Rechtsprechung und Praxis erfahren hat, nicht mehr zu ersehen4 ; der Rechtszustand wird in vielerlei Hinsicht als unbefriedigend oder zumindest als verbesserungsfähig empfunden5 . Die Materie überschaubarer zu machen, dem Gebot der Rechtssicherheit zu folgen, Gesetzesklarheit Zl\.l schaffen und damit die Rechtsfindung zu erleichtern, muß das Bestreben sein ; daraus erklärt sich die Forde rung nach einer Reform des Gebrauchsmusterrechts6 • Vgl. etwa Maassen NJW 79, 1473 ; Zuck NJW 79, 1 681 ; Starck ZRP 79, Sendler ZRP 79, 227 ; Vogel JZ 79, 321 ; Lang,e DVBL 79, 533 ; Hillermeier BayVBl. 78, 321 ; Berner BayVBl. 78, 6 1 7 ; Weiß DÖV 78, 601 ; (sämtliche m. w. N.). 2 Vogel JZ 79, 323 r. Sp. ; vgl. ferner Loewenheim GRUR 77, 683, 685 r. Sp., der darauf hinweist, daß im Gebrauchsmusterrecht der präzisen rechtlichen Definition durch die Vielgestaltigkeit der technischen und wirtschaftlichen Vorgänge insoweit Grenzen gesetzt sind, als jene auch an zukünftige Ent wicklungen anpassungsfähig sein soll. 3 Wank DB 79, 1877 r. Sp., 1878 1. Sp. : ,.Ein wichtiger Grund für abweichen des Gesetzesrecht liegt darin, daß Gerichte aus dem geltenden Recht heraus argumentieren müssen, während der Gesetzgeber in seiner Regelung freier ist und auch dem bisherigen Recht unbekannte Gedanken einführen kann." 4 Vgl. Trüstedt GRUR 60, 414 1. Sp. ; durch die Neufassung des Gesetzes vom '2. 1. 68 und die darauffolgenden geringfügigen Änderungen hat sich an der Berechtigung dieser Aussage nichts g,eändert. 5 Vgl. hierzu die Nachweise bei der Behandlung der einzelnen Problem kreise. 1
209 ;
2 Nlelsen
18
Einführung
II. Geschichtliche Entwicklung des Gebrauchsmusterrechts Bevor man darangeht zu verändern, muß man sich um das Verständ nis für das Bestehende bemühen; die Geschichte trägt dazu bei ; es ist daher ein Blick auf die historische Entwicklung insoweit zu werfen, als dadurch das geltende Recht begreiflicher7 wird. Das Gebrauchsmuster wurde am 1. 6. 1 89 1 in Deutschland gesetzlich eingeführt8 • Für den Schutz von Neuerungen auf gewerblichem Gebiet standen bereits vorher das Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mu stern und Modellen vom 1 1 . 1. 1876 und das Patentgesetz vom 25. 5. 1877 zur Verfügung9 ; wie sich jedoch bald zeigte, reichten die vorhandenen Gesetze nicht aus, um einen lückenlosen Schutz zu gewährleisten.
Das Reichsoberhandelsgericht hatte in seiner Entscheidung varn 3. 9. 187810 nämlich festgestellt, daß das Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen von 1876 nur solche Muster erfasse, die sich an den Schönheitssinn wendeten und durch ihre neue Gestaltung ästhe tische Wirkung erreichten: die sogenannten Geschmacksmuster; Neu bildungen hingegen, die einen praktischen Zweck verfolgten, die Er höhung der Verwendbarkeit, wurde der Schutz nach diesem Gesetz versagt11 ; das ROHG hielt es auch nicht für erforderlich, die sogenann ten Nützlichkeits- oder Gebrauchsmuster dem Gesetz von 1876 ·zu unter stellen, da ihnen das Patentgesetz zur Seite stehe. 6 GRUR-Unterausschuß GRUR 79, 29 ff. ; für Gesetzesrev.i sion auch Müller GRUR 79, 453 ff. ; Conradt GRUR 63, 405 ff., 407 r. Sp. Vgl. ferner Wolf GRUR 80, 265 ff. ; Kulhavy Mitt. 80, 206 ff. - a. A. Bossung GRUR 79, 668 (FN 31), der die Stunde für eine Gebrauchsmusterreform für noch nicht gekommen hält; gegen eine Reform zum j etzigen Zeitpunkt ferner Schlitzberger - in Mitt. 68, 101 ff., 1 1 1 r. Sp. hielt er sie im Rahmen der großen Patentrechts reform für notwendig -, Dihm/Starck/Bühring GRUR 79, 193 ff., die aber eine weitere gründliche Diskussion befürworten, die auf einer möglichst breiten Grundlage stattfinden und bezüglich der einzelnen Fragenkreise um fassend sein soll. 7 Auf diesen Aspekt weisen auch Busse GRUR 52, 123 r. Sp. und Weber, S. 8 hin. 8 RGBL 1891 Nr. 18, S. 290-293 ; Inkrafttreten gern. § 15 GbmG 1891 am 1 . 10. 1891. 9 Die schon vor dem Gebrauchsmustergesetz erlassenen, ebenfalls gegen unbefugte Nachbildung schützenden Gesetze - Gesetz betreffend das Ur heberrecht an Werken der bildenden Künste vom 9. 1. 1876 und Gesetz be treffend den Schutz der Photographien gegen unbefugte Nachbildung vom 10. 1 . 1876 - spielen in diesem Zusammenhang keine Rolle. 10 ROHG Bd. 24, 109. 11 Vor der Entscheidung des ROHG aaO war die Frage umstritten, ob das Gesetz von 1876 nicht auch die Gebrauchsmuster schütze (so z. B. die Vor instanz) ; der Text dieses Gesetzes schloß die Möglichkeit nicht klar aus, weil nach seinem § 1 als Muster oder Modelle iSd Gesetzes „neue und eigentüm liche Erzeugnisse" angesehen werden ; vgl. dazu Isay GbmG Einl., RN 1 (S. 553), Lutter, S. 486, 487 und Landgraf § 1, Anm. 1.
Einführung
19
Die durch das Patentgesetz gebotene Möglichkeit war indes für die einfachen, unbedeutenden Neuerungen dann nicht geeignet, wenn sie nur einen geringen finanziellen Erfolg versprachen und sich die hohen Patentgebühren für sie nicht lohnten oder wenn, wie bei Saisonarti keln12, das patentamtliche Prüfungsverfahren zu langwierig war13 . Häu fig, und darin liegt das Entscheidende, war dieser Weg nicht nur unpas send, sondern verschlossen : die Neuerung mochte zwar technisch ver wertbar sein, war aber nicht patentfähig, weil sie den an eine Erfindung iSd Patentgesetzes gestellten Anforderungen nicht entsprach14 • Die betroffenen Industriekreise wollten weder auf den Reklamezweck (,,gesetzlich geschützt") verzichten15 noch sich damit abfinden, daß ihre kleinen praktischen Verbesserungen der Nachahmung durch die Kon kurrenz preisgegeben waren16 • Sie versuchten daher, ihre Ideen in einer der beiden anderen Kategorien gewerblicher Erzeugnisse, für die Schutz bestand, unterzubringen1 7 • Dieses Verhalten führte m einer Fülle rechtsungültiger Eintragungen in die Geschmacksmusterregister18 , da die hierfür zuständigen Amts gerichte eine Vorprüfung hinsichtlich der materiellen Berechtigung des Schutzes nicht vorzunehmen hatten. Wurde dagegen ein Patent begehrt, so sah sich das Patentamt - ohnehin überlastet1 9 , wozu die bedeutende Anzahl der von vornherein aussichtslosen Anmeldungen nicht unerheb lich beitrug - häufig in dem Dilemma, entweder das für eine Erfindung erforderliche Niveau zu senken oder aber die Anmeldung zurückzu weisen, und zwar auch dann, wenn die Neuerung eines Schutzes würdig erschien20 • Diese unbefriedigende Lage bei den Mustergerichten und beim Patentamt galt es zu beseitigen. Bei der Patentenquete 1886 wurde schließlich mit nur einer Gegen stimme beschlossen : ,,Es möge in Erwägung genommen werden, ob und
12 Landgraf § 1, Anm.1, S. 155 : insb. in der Kurzwaren-, Schreibmaterialien- und Spielwarenbranche. 13 Busse GRUR 52, 123 r. Sp. ; Landgraf aaO (FN 12). 1 4 Seligsohn, S .459. 1 5 Landgraf § 1, Anm. 1, S. 154. 1 6 Bomborn, S.158 ; Busse GRUR 52, 124 1. Sp. ; Weber, S. 8. 1 7 Begründung zum Entwurf des Gesetzes von 1891, vor § 1. 1 8 Seligsohn, S. 459 ; Busse GRUR 52, 124 1. Sp. ; Landgraf § 1, Anm. 1, S. 157, der Beispiele von rechtsungültigen Eintragungen in das Offenbacher Muster register aufführt, wie etwa, um nur einige zu nennen : Druck- und Saug pumpen für Petroleum, Verschlüsse für Flaschen, Büchsen und dgl., eiserne Transportfässer, Militärtornister, Jagdstühle, Federhalter mit Tintenregula tor, Reisetaschen-Einrichtungen, Sägegestelle, Korkzieher und ähnliches mehr. 19 Begründung zum Entwurf des Gesetzes von 1891, vor § 1; Patentenquete Kommission 1886, S.33 ; Busse GRUR 52, 124 1. Sp. 20 Vgl. Isay, S.553.
20
Einführung
in welcher Weise ein Schutz auf Nützlichkeitsmuster eingeführt werden kann21. " Die Enquetekommission, die damit einem in gewerblichen Kreisen weit verbreiteten Wunsch Rechnung trug, versprach sich davon eine Entlastung des Patentamts und eine strengere Praxis bei der Er teilung der Erfinderpatente22 • Der dem Reichstag am 25. 1 1 . 1890 nebst Begründung vorgelegte Entwurf wurde am 5. 12. 1890 in 1 . Lesung be raten und an die schon mit dem Patentgesetz befaßte Kommission überwiesen, die nur geringfügi,ge Änderungen vornahm23 • Nach zwei weiteren Lesungen am 24. und 30. 4. 1891 und nach Zustimmung des Bundesrates wurde das Gesetz am 1 . 6. 1891 verkündet ; es trat am 1 . 10. 1891 in Kraft. Grund für die Schaffung des Gebrauchsmustergesetzes war also nicht die Absicht, ,,Patente zweiter Klasse" zu schaffen24 ; vielmehr sollte die gesetzgeberische Lücke geschlossen werden, die mit der Entscheidung des ROHG vom 3. 9. 1878 offenbar25 gewor,den war. Auch zweckdienliche Verbesserungen an „Arbeitsgerätschaften oder Gebrauchsgegenständen" ohne erfinderische Qualität im patentrechtlichen Sinne wurden als schutzbedüdtig anerkannt26 ; die Abweichung von bereits Bekanntem hatte freilich eine „selbständi
![Ansätze einer Reform des Ermittlungsverfahrens [1 ed.]
9783428507511, 9783428107513](https://dokumen.pub/img/200x200/anstze-einer-reform-des-ermittlungsverfahrens-1nbsped-9783428507511-9783428107513.jpg)
![Verteidigung des Menschen Grundfragen einer verkörperten Anthropologie [1. Originalausgabe ed.]
9783518765326, 3518765329](https://dokumen.pub/img/200x200/verteidigung-des-menschen-grundfragen-einer-verkrperten-anthropologie-1-originalausgabenbsped-9783518765326-3518765329.jpg)

![Aufbruch an deutschen Hochschulen: Beiträge zur Reform des deutschen Hochschulwesens [1 ed.]
9783428503704, 9783428103706](https://dokumen.pub/img/200x200/aufbruch-an-deutschen-hochschulen-beitrge-zur-reform-des-deutschen-hochschulwesens-1nbsped-9783428503704-9783428103706.jpg)

![Grundfragen einer Kompetenzlehre [1 ed.]
9783428454044, 9783428054046](https://dokumen.pub/img/200x200/grundfragen-einer-kompetenzlehre-1nbsped-9783428454044-9783428054046.jpg)

![Das parlamentarische Untersuchungsrecht in England - Vorbild einer deutschen Reform? [1 ed.]
9783428471089, 9783428071081](https://dokumen.pub/img/200x200/das-parlamentarische-untersuchungsrecht-in-england-vorbild-einer-deutschen-reform-1nbsped-9783428471089-9783428071081.jpg)

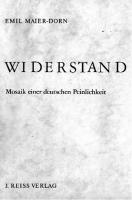
![Grundfragen einer Reform des deutschen Gebrauchsmusterrechts [1 ed.]
9783428452156, 9783428052158](https://dokumen.pub/img/200x200/grundfragen-einer-reform-des-deutschen-gebrauchsmusterrechts-1nbsped-9783428452156-9783428052158.jpg)