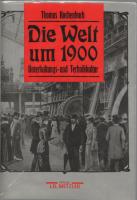Epochenwechsel um 476: Odoaker, Theoderich d. Gr. und die Umwandlungen. Anhang: Pannonica 9630532905, 3774921075, 9783774921078
László Várady legt mit diesem schmalen Band ein engagiertes Plädoyer sowohl für seine 'Progressofunktionelle Gesc
282 29 10MB
German Pages 150 [156] Year 1984
Polecaj historie
Table of contents :
Einleitung
1. Reflexionen über die Periodengrenze 476 7
2. Die Thesen: Ein vorweggenommenes Resümee 13
I. Teil. Probleme des rechtlichen und politischen Charakters der Königtümer Odoakers und Theoderichs 19
1. Terminologisches zur Aufgabe der Eigenstaatlichkeit des Westreiches 19
2. Die ambivalente Aufnahme Odoakers in das byzantinische politische System 26
3. Die Stärke des Odoakerschen Königtums 30
4. Die Errichtung des zweiten barbarischen Königtums in Italien als Folge des klientelmäßigen Auftrages an Theoderich 37
II. Teil. Revolutionäre Faktoren der Umwandlung in der Wirtschafts- und Sozialstruktur: Barbarische Staatlichkeit, Agrarbesteuerung 63
1. Eigenstaatlichkeit und Landteilung 63
2. Agrarbesteuerung 75
Exkurs A: Das Problem der 'bina et terna' 90
Exkurs B: Einige Fragen der Agrarbevölkerung und Agrarbesteuerung im westgotischen Recht 91
Anhang. Pannonica 99
1. Interpretationsprobleme der 'antiqui barbari' Cassiodors 99
2. Politische und quellenkritische Erwägungen über den Aufenthalt der Langobarden in Pannonien 105
3. Notizen über die diplomatische Tätigkeit Olympiodors und über eine Datierungsfrage der Notitia Dignitatum (Einsichten mit mittelbaren Konsequenzen für die spätrömische Geschichte Pannoniens) 123
Quellen- und Literaturverzeichnis 129
Stellenregister 137
Namens- und Sachregister 143
Citation preview
Epochenwechsel um 476 Odoaker, Theoderich d. Gr. und die Umwandlungen Anhang: Pannonica
László Várady
Epochenwechsel um 476 Odoaker, Theoderich d. Gr. und die Umwandlungen
Anhang: Pannonica
Akadémiai Kiadó Budapest
1984
Dr. Rudolf Habelt GmbH Bonn
ISBN 963 05 3290 5 Akadémiai Kiadó ISBN 3-7749-2107-5 Dr. Rudolf Habéit GmbH
© Akadémiai Kiadó, Budapest 1984 Vertrieb für alle nichtsozialistischen Länder: Dr. Rudolf Habelt GmbH, Am Buchenhang 1, D-5300 Bonn 1, BRD Vertrieb für die sozialistischen Länder: Akadémiai Kiadó, Budapest Printed in Hungary
Inhalt
Einleitung 1. Reflexionen über die Periodengrenze 476....................................... 2. Die Thesen: Ein vorweggenommenes R esüm ee ..............................
7 13
I. Teil
1. 2. 3. 4.
Probleme des rechtlichen und politischen Charakters der Königtümer Odoakers und Theoderichs............................................................... Terminologisches zur Aufgabe der Eigenstaatlichkeit des Westreiches Die ambivalente Aufnahme Odoakers in das byzantinische politische System........................................................................................... Die Stärke des Odoakerschen Königtums...................................... Die Errichtung des zweiten barbarischen Königtums in Italien als Folge des klientelmäßigen Auftrages an Theoderich .....................
19 19 26 30 37
II. Teil
1. 2.
Revolutionäre Faktoren der Umwandlung in der Wirtschafts- und Sozialstruktur: Barbarische Staatlichkeit, Agrarbesteuerung........... Eigenstaatlichkeit und Landteilung................................................. Agrarbesteuerung........................................................................... Exkurs A: Das Problem der bina et terna.............................. Exkurs B: Einige Fragen der Agrarbevölkerung und Agrar besteuerung im westgotischen Recht.....................
63 63 75 90 91 5
Anhang
1. 2. 3.
6
Pannonica........................................................................................ Interpretationsprobleme der ,.antiqui barbari“ Cassiodors ............. Politische und queilenkritische Erwägungen über den Aufenthalt der Langobarden in Pannonien ........................................................... Notizen über die diplomatische Tätigkeit Olympiodors und über eine Datierungsfrage der Notitia Dignitatum (Einsichten mit mittelbaren Konsequenzen für die spätrömische Geschichte Pannoniens).........
99 99 105
Quellen- und Literaturverzeichnis....................................................
129
Stellenregister.................................................................................
137
Namens- und Sachregister...............................................................
143
123
Einleitung
1. Reflexionen über die Periodengrenze 476
In meinem unlängst erschienenen Buch „Die Auflösung des Altertums. Beiträge zu einer Umdeutung der Alten Geschichte“ habe ich eine neue „Hermeneutik“ zum Verständnis der Alten Geschichte vorgeschlagen (selbstverständlich nur betont skizzenhaft), wodurch viele, sonst bekannte Daten und Phänomene des althistorischen Entwicklungsablaufes anders zu erläutern wären, als sie in Lehrbüchern, zusammenfassenden Standard monographien oder enzyklopädischen Werken erscheinen. Dabei wurden auch manche konkrete Einzelheiten des spätantiken Quellenmaterials in diesem Sinne analysiert. Es könnte meines Erachtens eine historisch realistischer abgewogene, d. h. die historischen Fakten nach ihren entwicklungsmäßigen Funktio nen tiefer erfassende und deshalb wissenschaftlich adäquatere, sozial zugleich wirksamere,, Pr o g re s so fu n k tio n e lle G e s c h ic h ts in te rp re ta tio n “ angebahnt werden (wenn man sie, faute de mieux, so bezeichnen darf). Sie soll demnach angesichts einer im allgemeinen ideologischen Rahmen gehaltenen Geschichtsphilosophie als eine fachwissenschaftlich angewandte Konzeption (so in mehrfachem Sinne als ein Verfeinerungs mittel) zum wesensgerechten und doch konkreten historischen Verständ nis gelten, d. h. sie wurde weitgehend „geschichtsimmanent“ gedacht — ohne jede kafexochen geschichts-philosophische Prätention. Gerade bei diesen Analysen stellte es sich heraus, daß dadurch auch der herkömmliche Markstein, das Jahr 476, eine neue und andersgeartete Bedeutung erhalten kann, wobei seine neue, wesensgerechtere Begrün dung das Verständnis des Altertums und Mittelalters gleicherweise beträchtlich zu fördern vermag. Die Geschichtswissenschaft leidet 7
ohnehin schon seit langem unter der Diskreditierung ihrer Marksteinjah re, die ja als technische Stützen ihres Darstellungs- und Deutungssystems durchaus unentbehrlich sind. Das Prinzip der Schwerpunktmäßigkeit bei der Wahl der Periodengrenzen als allein brauchbarer Grundsatz für ein realistisches Periodisierungsverfahren wurde in der angeführten Arbeit ausführlich erörtert. Die wissenschaftlich-methodologisch vielmals und vielerorts verschmähte ereignismäßige Periodengrenzwahl ist demnach trotz allem dann berechtigt, wenn sie unter der Berücksichtigung dieses Prinzips erfolgt. Ich will hier deshalb auf die verschiedenen, teils nüchtern gelehrsamen, teils leidenschaftlichen Einwände sowie auf manche sarka stische Ablehnungen des Jahres 476 oder irgendeines Jahres nicht eingehen. Wie bekannt, erschienen in der einschlägigen Forschung mehrere Periodisierungsvorschläge, die nicht die Geschehnisse um 476, sondern andere Ereignisse oder aber längere, sich auf mehrere Jahre, Jahrzehnte, sogar auch auf Jahrhunderte erstreckende Vorgänge als adäquater hinstellen, Altertum und Mittelalter historiographisch-chronologisch voneinander zu trennen. Es ist indes kein Wunder, daß das „Schwerpunktgefühl“ in der modernen Forschung in bezug auf die Kriterien für den Abschluß des Altertums und für das Ende des Westreiches ziemlich versagte. Zeichen dafür sind die von der traditionellen nur scheinbar, nicht aber grundsätz lich abweichenden Periodisierungen, die eine neue, bis dahin unberück sichtigte oder vermeintlich nicht gebührend beachtete Seite des Entwick lungsprozesses hervortreten ließen. Es unterliegt m. E. keinem Zweifel, daß erst durch das Bewußtwerden eines realen Schwerpunktprinzips die unterschiedlichen Seiten des Geschichtsablaufes in ein Gesamtbild hypotaktisch eingeordnet und koordiniert werden können.1
1 Vgl. V árady , Auflösung, 51—53. 72—86. Es sei hier nur auf die bekannte Stellungnahme der drei großen Standardmonographien namentlich hingewiesen: Seeck , Untg. VI 379—380 betrachtete das Jahr 476 unter Berufung auf den formal-symbolischen Charakter der Abschaffung des westlichen Kaisertums und auf das danach verbliebene System von Nachfolgestaaten als epochal; Bury , LRE I 406—411, bes. 408 ging zwar von irrigen Voraussetzungen in bezug auf das Bestehen eines „Weströmischen Reiches44aus, im wesentlichen erkannte er doch eine epochemachende Revolution an; Stein , HBEI 398—399 nahm dazu mit großem Nachdruck in gleichem Sinne Stellung.
8
Die Errichtung des ersten barbarischen Königtums in Italien durch den Föderatenbefehlshaber und skirischen Fürsten Odoaker hat — als Schlußakt eines Prozesses — dem Weströmischen Kaisertum und damit dem Weströmischen Reich als einer spezifischen staatsrechtlichen Institu tion ein Ende bereitet. Ich habe zu einer neukonzipierten Begründung dieses objektiv einschneidenden Ereignisses das zeitgenössische Selbstverständnis, die staatsrechtlichen Prämissen sowie die Stellung Odoakers bei seiner Machtübernahme in Ansätzen bereits untersucht.2 Dieser Ereigniskomplex bedeutete einen radikalen Eingriff in das politische System des Westens mit weittragender Bedeutung für die Beziehungen zwischen Ost und West. An dieses mit Recht als revolutionär zu betrachtende Geschehnis knüpfen sich nämlich alle jene sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen, die unter der Oberfläche überlebender römischer oder pseudorömischer Institutionen letztlich doch die unaus weichliche Durchsetzung der mittelalterlichen Ordnung herbeigeführt haben. Unter Berücksichtigung meiner früheren Erörterungen und Ermittlun gen habe ich nun vor, das Periodisierungsjahr 476 durch spezielle Quellenanalysen zu erhärten, nicht zuletzt gerade von jener staatsrechtli chen Seite her, von der die Berechtigtheit der Wahl des Jahres 476 als Abschluß des Altertums neuerdings in Frage gestellt wurde. Frau Prof. E. D e m o u g eo t soll man gewiß für ihren einschlägigen Diskussionsbeitrag sehr dankbar sein, da ihre Argumentation und Dokumentation im Interesse der Annahme des Jahres 488 als Datum für das Ende des Weströmischen Reiches nicht nur die m eh rseitig e Begründung meiner Wahl für das Jahr 476 veranlaßte, sondern auch wertvolle Anregungen zur Ü b e rp rü fu n g der Quellenaussagen gab, wodurch auch eine Anzahl von neuen Einsichten gewonnen wurde. Wenn diese Erörterungen letztlich darauf abzielen, das Problem des Periodenwechsels der Lösung näherzubringen, so ist doch diese Arbeit ihrem Themenbereich sowie ihren Einzeluntersuchungen nach zu weitläu fig, um bloß auf dieses Problem ausgerichtet betrachtet zu werden. Sie
2 V árady , Auflösung, 93— 125.
9
bringt nämlich Erträge, die zu den politischen, wirtschaftlich-sozialen und rechtlichen Sphären der angesprochenen Epoche auch spezifische Bezie hung haben. Die grundsätzliche Wahl des Jahres 488 als Zeitenwende, d. h. als Theoderich d. Gr. vom Kaiser Zenon den Auftrag erhielt, Odoaker in Italien zu bekämpfen, ergab sich für die staatsrechtliche Anschauungswei se eigentlich aus der Ambivalenz von Byzanz im Verhalten und Vorgehen gegenüber dem Odoakerschen Regime sowie auch aus dem anfänglichen Übergangscharakter der neuen Situation, unter Berücksichtigung ähnli cher Vorfälle in der Vergangenheit. Selbst der Umstand, daß ein legitimer Kaiser des Westens, Iulius Nepos, 475 entthront, um 476 noch am Leben war, scheint die staatsrechtliche Sicht der Forschung zu bestätigen. Diese Umstände jedoch, mag man ihnen aus der Sicht des römischen öffentlichen Rechts noch so große Wichtigkeit beimessen, können die historische Deutung des Aufstandes bzw. der Machtübernahme Odoakers als eine revolutionäre Zeitenwende und als die Errichtung des ersten barbarischen Königtums in Italien, das das Weströmische Kaisertum endgültig abgeschafft und damit das „Altertum14abgeschlossen hat, kaum beeinträchtigen. Die Vorgänge um 488 können wir aber, wie sich weiter unten heraussteilen wird, selbst aus der Sicht des römischen öffentlichen Rechts nicht als wirkliche Zäsur betrachten. Das Weströmische Kaisertum bzw. Reich als eine staatsrechtliche Institution wurde von Byzanz praktisch schon um 476 und auch offiziell um 480, nach der Ermordung des Iulius Nepos, aufgegeben, indem kein neuer Kaiser für das Westreich ernannt wurde. Der Prozeß der Machtübernahme Theoderichs in Italien war somit in Wirklichkeit keineswegs ein für das Westreich staatsrechtlich „zäsurge rechter“ Akt, geschweige daß dies selbst in byzantinischer Beziehung ein problemloser Vorgang war. Nach 476 bzw. 480 kann man dem Wesen nach keine Ereignisse mehr finden, die für das Ende des Weströmischen Kaisertums und Reiches« als reale (staatsrechtliche, politische oder sozialökonomische) Anhaltspunkte gelten könnten. Es gibt in diesem Bereich nur jene Ereignisse, die die unterschiedlichen Entwicklungspha sen der Machtansprüche und der Machtausübung des Byzantinischen Kaisertums in Italien bzw. die Phasen der byzantinisch-ostgotischen
10
Beziehungen markieren.3 Gegenüber dem seit 476 bestehenden De-factoZustand sind mithin die Geschehnisse um 488 oder später kaum als Träger von kennzeichnenden Momenten zu betrachten, auf deren Grundlage eine Verschiebung und Verlagerung der Periodengrenze angebracht wäre. Aus der Sicht der sozialen und wirtschaftlichen Umwandlungen kommt man aber auf Grund der weiter unten durchzuführenden Untersuchungen zu derselben Schlußfolgerung.’"
3 D emougeot, Klio 60, 1978, 371—381, wo die Abgrenzung mit dem Jahr 488 vertreten wurde. Jüngstens bekannte sich die Autorin zum Jahr 497, D emougeot, BZ 74,1981,72—74, wonach Theoderich „pouvoirs impériaux4' von Anastasios zuerkannt worden sei; damit sei das Ende der staatsrechtlichen Zuständigkeit des Kaisers für Italien gegeben; die Bedeutung der Barbareninvasionen (darunter wohl auch der Odoakerschen) sei jedenfalls anzuerken nen, u. zw. „trotz der Weltanschauung“ (?), d. h. richtig: trotz meiner konzeptionsmäßigen Geschichtsinterpretation. — Es gibt selbst aus staatsrechtlicher Sicht zumindest fünf Jahre — 476,480,488,493,497—, über die man diskutieren könnte (und die in dieser Arbeit auch erörtert werden), ohne jemals ein hinsichtlich des rigoros genommenen öffentlichen Rechts unanfechtbares definitives Datum erarbeiten zu können. Es liegt nahe, daß man dem Problem nur auf Grund sozialökonomisch ausgerichteter politischer Ordnungsprinzipien gerecht werden kann. * An dieser Stelle sei gestattet, meinem oben zitierten Buch „Die Auflösung des Altertums44 manche Berichtigungen mit Nachträgen sowie eine Reflexion hinzuzufügen: (Z = Zeile(n); v. o. = von oben; v. u. = von unten; del. ** delea(n)tur; nicht sinnstörende Fehler sind hier nicht beachtet) S. 95 v .u .Z . 13 statt 398: 397. 119 v. o. Z. 19(Anm. 80): ined. Amm. 1,26—27; der letzte Ante-quem-Zeitpunkt: 397. 124 v. u. Z. 12: 52, 1962, 126— 130. 125 v. o. Z. 2: Prokop. BG I, 1, 12. 4: Prokop. BG 1, 1, 29. 134 v. o. Z. 1-2: del. 24: 52, 1962, 126-130. 141 rechte Spalte v. o. Z. 12 Nachtrag nach „Läten44: bzw. Gentiles. 143 rechte Spalte v. o. Z. 20 Nachtrag nach „Läten44: mit Gentiles. 148 rechte Spalte v. u. Z. 9 Nachtrag vor „Africae44: Italiae. Im Gedankenbau der Monographie äußerte sich eine Konzeption, in der anhand korrelativ abgestimmter, stets aufs Ganze gerichteter Ideen eine logische, koordinierte Einheit angestrebt wurde (in einem „Überblick44 resümiert). Die Konsequenzen, die aus meinen Erörterungen für die Gegenwart oder für die Zukunft gezogen werden könnten, wären vollkommen irrtümlich, wenn man in bezug auf künftige Realisationsweisen historischer Entwicklungstendenzen kurzfristig und kurzsichtig „gegenwartsgebunden44 verfahren würde. Andererseits gilt der Zeitbogen vom Altertum bis zur Gegenwart immer weniger als zu weit gespannt, und der Historiker kann und soll diesen nicht allzu großen Bogen fortwährend vor Augen halten. Vor diesem Hintergrund soll er doch die Geschehnisse, Ideen
11
und Personen auf ihre historische Funktion hin prüfen, statt daß er sie nach tagespolitisch ausgerichteter, geschichtsfremd systembedingt angenommener Finalität beurteilt. Die einzige reale und der Geschichtswissenschaft adäquate „Finalität“ liegt nämlich in der forschungsmäßigen Erkenntnis der Entwicklungsgesetze, da ja sich das Entwicklungsprinzip als entsprechendes Grundgesetz und objektiv-verläßliches Ordnungsprinzip in der moder nen Geschichtswissenschaft schon mit Selbstverständlichkeit abstrahieren läßt. Auf dieser Grundlage können Fortschritt und Zurückgebliebenheit, Lebensniveau fördernde und hemmende Faktoren, die Relativitäten und die bis zur jeweiligen Gegenwart wahrnehmbare Entwicklungslinie wissenschaftlich einwandfrei festgestellt und erklärt werden. Angesichts der bedauerlichen Zwangsidee von einer gegenwartsgerichteten Finalität aller Geschichtsdeutung muß man außerdem noch zwei Dinge klar auseinanderhalten. Jede Geschichtsinterpretation schöpft ihre Aspekte und Ordnungsprinzipien notwendigerweise nicht nur aus dem jeweiligen, sich seit langem anhäufenden geistigen Erbgut, sondern auch aus dem Erfahrungsgut der immer komplizierter werdenden und zugleich immer bewußter erlebten Gegenwart, wodurch sie der historischen Realität immer näher kommt. Das andere ist das Erfordernis, die Finalitätsanfälligkeit bewußt abzuwenden, indem der Historiker im Sinne des Sine-ira-et-studio-Gebotes es als eine „Ehrensache“ der Forschung betrachtet, nie zeitgeschichtliche Situationskomplexe zur Interpretation historischer Phänomene identifi zierend anzuwenden, und umgekehrt, nie jene durch diese bestätigen zu lassen, sondern die jeweilige Gegenwart nur als ein Produkt der gesetzmäßigen historischen Entwicklung zu erklären. Meine ziemlich differenziert dargelegte Konzeption von der Spezifität des Altertums, in der der spezifische althistorische, servilisationsbedingte Antagonismus zwischen Kulturzen tren und Barbaricum betont wurde und die Barbarenrevolution im Weströmischen Reich — wodurch tatsächlich neotera, res novae entstanden — als den Epochenwechsel bestimmende End- und Anfangsphase erschien, wird im Bann der genannten Zwangsidee in dem Moment schlicht außer acht gelassen, sobald aktuelle Angstkomplexe die entsprechenden Mißver ständnisse aufdrängen und in jeder Geschichtsdeutung gegenwartsbezogene Paradigmata ahnen lassen. Die sich nie wiederholende Einmaligkeit, mit der sich die konkreten Medien eines Entwicklungstaktes funktionell realisieren, ist in meiner Konzeption klar zu ermessen, wenn man den historischen Sachverhalt ohne Prämissen berücksichtigt und an meine Interpreta tionen mit korrektem, sinn- und wortgetreuem Verständnis herangeht. Was die historische Sachlage betrifft, sei z. B. die spätantike Barbarenproblematik erwähnt, deren verzerrende Auslegung fast schon ans Phantastische grenzt und die meisten faktenmäßigen Spezifika unberücksichtigt läßt, u. a. den innerterritorialen, enklavenartigen Status der Revolutions barbaren im Römischen Reich als „Föderatenpatronenstaat“, dessen Militär- und Wirtschaftspolitik den Födera mit den Barbarenvölkem und ihren Eingliederungsbestre bungen Vorschub leistete; die Unzulänglichkeit der Außenhandelsbeziehungen, das Problem der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Angleichung des peripheren Barbaricum zu lösen, u. dgl. m. Es stellen sich somit enorme Schäden in verhängnisvollen Ausmaßen heraus, die die seit Jahrhunderten praktizierte historisierend-philosophierende Publizistik (sei es in noch so wissenschaftlich anmutendem Gewand verhüllt oder gelegentlich von noch so ehrenvollen Gelehrten geübt) der tatsachenbezogenen und koordinierenden Geschichtsinterpretation zugefügt hat. Darüber hinaus mögen auch die Ismen und Ismenbildungen an den unheilvollen, alles verzerrenden Vorurteilen einen erheblichen Anteil haben. Sie veranlassen zu leicht zu irreführenden Verallgemeinerungen (d. h. zu einer oberflächlichen oder
12
2. Die Thesen: Ein vorweggenommenes Resümee Die Untersuchungen in dieser Arbeit sind, im ganzen betrachtet, zu den folgenden Ergebnissen gekommen (wegen der stellenweise zu detaillierten Analysen seien sie hier, einer klaren Verfolgung des Gedankenganges zuliebe, thesenhaft vorweggenommen): (1) Das Weströmische Kaisertum bzw. Reich als von 395 an selbständi ger institutionsmäßiger Bruderstaat (imperium Occidentis ~ Occidentale) des östlichen Reiches im ideell einheitlichen „Römischen Reich“ wurde nach dem Jahr 476 vom oströmischen, nunmehr in der Historiographie „byzantinisch“ genannten Kaisertum als nicht mehr existent betrach tet.
dogmatischen Behandlung der Ideen von Denkern, die selber wohl am meisten dagegen protestieren würden) und schalten die eigene Urteilsbildung beinahe völlig aus. Die zu lösenden Probleme der künftigen Welt beanspruchen aber schon zur Zeit den in Zukunftsdimensionen freizügig denkenden und von Gegenwartsdogmatik kaum gefesselten Schaffensgeist. Diesen Ansprüchen muß insbesondere die Geschichtswissenschaft entspre chen, indem sie einem breitangelegten und demokratisch aktivierten Realitätssinn verhilft, sich im historisch-politischen Bewußtsein der Gesellschaft durchzusetzen. Ihre Koordinie rungskategorien müssen allerdings dem ungeheueren Erfahrungs- und Problembestand der gegenwärtigen Gesellschaften im „Osten“ und „Westen“, im „Norden“ und „Süden“, in der „Ersten“, „Zweiten“ und „Dritten“ Welt gerecht werden. Meine „Progressofunktionelle Geschichtsinterpretation“ (wenn ich sie durch Vorweg nahme einer gesonderten Darlegung so benennen darf) besagt: Seit dem Mittelalter setzt sich das Grundgesetz der Geschichte, die Universalisierung der Kulturgüter, unter immer breiteren Gesellschaftsschichten und in immer weiterem Kreis der Völker, keinesfalls auf dem Wege militärischer Eroberungen durch, und die Welt, samt den entwickelten Industriestaaten des Westens, befindet sich schon seit Anfang dieses Jahrhunderts inmitten eines neuen Entwicklungstaktes zur Realisation des besagten Grundgesetzes, dessen eigentlicher Wirkungsraum in den unterentwickelten Gebieten der Welt zu finden ist. Ich danke allen jenen, die der „Auflösung des Altertums“ — trotz der konzentrierten und gezwungenermaßen öfters ungewöhnlichen Ausdrucksweise einer Neukonzipierung — Geduld und unvoreingenommene Verständnisbereitschaft mit Toleranz entgegengebracht haben, ob sie nun einverstanden waren oder nicht. Zum Schluß noch ein Hinweis: Wenn ich mich in der „Auflösung“ an die Alexander von Humboldt-Stiftung (Bonn—Bad Godesberg) und an ihren ehemaligen Präsidenten, Professor W. H eisenberg, sowie an den Gastgeber, Professor S. L auffer (Universität München), in großer Dankbarkeit entsann, so gilt ihnen auch hier ein Dank, da ja bei der Fassung dieser Arbeit eine Menge von wissenschaftlichen Imponderabilien förderlich war, die ich mir ohne meinen einstigen, von der Stiftung ermöglichten Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland nicht verschaffen hätte können.
13
(2) I t al i en (die italische Präfektur), bzw. der weitere Besitz des Römerstaates im Westen, wurde hingegen im Falle des Odoakerschen Königtums von den Oströmern staatsrechtlich ebensowenig preisgegeben wie im Falle des ostgotischen Königtums des Theoderich (die Forschung ist darüber einig); im ersten Fall konnte zwar keine Maßnahme zur Wiedereinsetzung des Iulius Nepos oder zur effektiven Eingliederung der westlichen partes unter oströmische Hoheit mit einer eventuellen Regelung des König-Status Odoakers ergriffen werden, im zweiten Fall wurde hingegen die Einordnung der italischen Präfektur in das Ostreich durch die Ostgoten in der Form eines K l i e n t e l k ö n i g t u m s im Re i chsi nner en mit aller Entschlossenheit angestrebt. (3) Das barbarische Königtum Odoakers — das erste solcher Art in Italien überhaupt — wurde mangels eines gültigen foedus bzw. Klientel friedensabkommens vom Kaiser offiziell nicht anerkannt. Nur im Besitz des Patriziats mit dem römischen Heeresmagisteriat über die römische Bevölkerung Italiens sowie über das Föderatenheer durfte Odoaker als ein römischer Generalissimus, nicht aber als ein König, die Verwaltungs- und Befehlsgewalt unter nomineller Hoheit des Kaisers ausüben; von Odoakers K ö n i g t u m über ganz Italien (Barbaren und Römer) hat Byzanz nur als von einer „ T y r a n n e i “ Kenntnis genommen. (4) Odoaker verfügte über ein Barbarenkonglomerat beträchtlicher Größe, das in seiner ursprünglichen Beschaffenheit als Föderatenheer im römischen Dienst zu einer kompakten Qu a s i - Vö l k e r s c h a f t herange wachsen war. Diese aus stehendem Heer und Militarbauern bestehende Volksbasis ermöglichte es Odoaker — wider Erwarten —, gut drei Jahre hindurch den Ostgoten erfolgreich Widerstand leisten zu können. (5) Theoderich, König der Ostgoten, bekämpfte zwar Odoaker im Aufträge des Kaisers, aber er war von 489 bis 497 nach römischem öffentlichen Recht nicht mehr als Odoaker, d. h. Patrizier und Oberbe fehlshaber des Kaisers von Byzanz, bzw. von 493 als König über Italien: ein „ T y r a n n “ . Er war bis 493 im Besitz des kaiserlichen Auftrages, den vorigen Patrizier, der als König gleichfalls „Tyrann“ war, zu bekämpfen und dessen illegitimes barbarisches Königtum zunächst durch eine Adinterim-Stufe der patriziatisch-magisterialen Stellvertretung des Kaisers, dann aber durch sein Klientelkönigtum zu ersetzen, das der Kaiser anzuerkennen versprach. 14
(6) Bei der s t a a t s r e c h t l i c h e n Kl i ent el lassen sich eigenartige Mischphänomene bei Römern und Barbaren verzeichnen; ihre spezifi schen Charakteristika sind unentbehrlich zur richtigen Einschätzung des ostgotischen Königtums und seines Beziehungskomplexes zum Byzantini schen Reich. (7) Theoderich, trotz der vertraglichen Beauftragung und der Erwar tungen des Kaisers sowie trotz der 497 erfolgten Anerkennung seiner Herrschaft als Klientelkönigtum über Goten und Römer, hat sich seit seiner Ankunft in Italien durchweg „tyrannengeneigt“ benommen, d. h., er hat seinem Auftrag und dann den Bedingungen des Klientelbündnisses insbesondere in der hochwichtigen mi l i t ä r i sche n U n t e r o r d n u n g gegenüber dem Kaiser nicht tadellos entsprochen. (8) Kardinale Unterschiede zwischen dem „Tyrannei-Königtum“ Odoakers und dem tyranneianfälligen Königtum Theoderichs über die partes der italischen Präfektur (bzw. im Falle Theoderichs noch darüber hinaus) lassen sich selbst aus staatsrechtlicher Sicht nicht feststellen. Nur die Etablierung des Staatswesens unterscheidet sie in dieser Beziehung voneinander. (9) Die erste Ausrufung eines barbarischen Königtums in Italien um 476 erlaubt die Annahme, daß für die quellenmäßig äußerst spärlich belegten inneren Umwandlungen im Königtum Odoakers eben die relativ reichlich dokumentierten inneren Verhältnisse des zweiten barbarischen Königtums in Italien als brauchbare Analogien heranzuziehen sind. Demzufolge sei festgestellt: In den beiden ersten barbarischen Königtümern Italiens waren die Barbaren auch Militärbauern (dafür sprechen gewichtige mittelbare Quellenaussagen) und nach ihren Dritteln auch steuerpflichtig (das läßt sich auf einer breiteren Quellengrundlage nachweisen, als es bisher erfolgte). Die Steuern wurden unter weit günstigeren Umständen und Maßnahmen erhoben als zu imperialrömi scher Zeit. Die für die Lebensfähigkeit der neuen barbarischen Staaten sowie für den dauernden Erfolg der Umwälzungen hochwichtige A g r a r b e s t e u e r u n g der Ba r b a r e n kann mit größerer Gewißheit als bisher auch beim westgotischen Königtum ermittelt werden, wo deren früheste Regelung per analogiam das Odoakersche bzw. ostgotische Agrarsteuersystem und Steuergesetzgebung beeinflußt haben dürfte. Im ostgotischen Königtum ergab sich eine erhebliche Z u n a h m e von 15
A g r a r p r o d u z e n t e n , wodurch die Steuerlasten relativ erträglicher wurden. (10) Folge der Umwandlungen (darunter der wichtigsten, d. h. der politischen Machtübernahme der Barbaren) war eine entscheidende Umwälzung im sozialökonomischen Bereich: frühfeudale Eigenstaatlich keit der Barbaren, totale Umkehrung in der Stellung der Römer, erweiterte Produktionsbasen, Zunahme der Agrarproduzenten, gesunder Staatshaushalt, Lebensniveauerhöhung. (11) Die barbarische Eigenstaatlichkeit samt demographischer Ver schiebung, die sich auf ganz Italien erstreckende Landteilung und das Agrarbesteuerungswesen bilden einen Phänomenkomplex, wodurch die feudale Entwicklung selbst im ehemaligen Kernland des römischen bzw. weströmischen Reiches in Gang gesetzt und somit eine epochemachende Zäsur geschaffen wurde. (12) Auf Grund einer quellenmäßigen Analyse bzw. Umdeutung des De-facto-Tatbestandes scheint es vollkommen begründet, schon die Errichtung des ersten barbarischen Königtums unter Odoaker in Italien um 476 als Ende des Weströmischen Reiches zu betrachten (da die bewertbaren staatsrechtlichen Umstände dies nicht beeinträchtigen). Das schließt sinngemäß mit ein, daß die erste Erscheinung eines frühfeudalen barbarischen Eigenstaates im Zentralgebiet des aufgelösten Kaisertums zugleich für ein revolutionäres Abschlußmoment der Epoche „Altertum“ und für den Anbruch des feudalen Mittelalters zu halten ist, wenn man dem Prinzip der koordinierten Schwerpunktmäßigkeit in der Periodisierung und der erkennbaren Spezifität des Altertums im sozialen Entwick lungsprozeß gerecht werden will. Die im Anhang „Pannonica“ erzielten Ergebnisse lassen sich folgender maßen resümieren: (13) Zur ethnischen Bestimmung der nichtgotischen barbarischen Volkssplitter in der pannonischen Provinz Savia wurden quellenkritische bzw. textkritische Untersuchungen angestellt, auf deren Grundlage die hiesige Anwesenheit von suebischen Siedlungen völlig auszuschließen, der Fortbestand von Siedlungen der alten pannonischen Föderaten hingegen als bezeugt anzunehmen ist; diese letztgenannten sind bei Cassiodor die „antiqui barbari44in Savia, die „barbariper Pannoniam constituti44aber die Gépidén in Pannonia Sirmiensis. 16
(14) Gleichfalls anhand quellen- bzw. textkritischer Analysen ist die Herrschaft der Langobarden in Pannonien nördlich der Drau (d. h. vor der Besitznahme Südpannoniens zwischen Drau und Save um 546 auf Grund eines foedus mit Byzanz) schon seit etwa 511 festzustellen: Die Bestimmung der Dauer ihres Aufenthalts in Pannonien mit 42 Jahren beruht auf einem Irrtum. (15) Nach einer historisch-philologischen Textanalyse der von Photios exzerpierten Berichte Olympiodors steht einwandfrei fest, daß Olympiodor von der o s t r ö m i s c h e n Regierung mit der Gesandtschaft zu den Hunnen beauftragt wurde; er ist somit als Zeuge für ein frühes Erscheinen der äußeren Hunnen in der Nähe Pannoniens bzw. im Karpatenbecken keinesfalls heranzuziehen. (16) Für die zeitliche Bestimmung des Ostverzeichnisses der Notitia dignitatum, d. h. für den letzten Zeitpunkt, an dem das noch geführt bzw. auf den neuesten Stand gebracht wurde, fällt der bisherige Ante-quemZeitpunkt weg, da die Forschung zu dessen Annahme von einem terminologischen Mißverständnis veranlaßt wurde. Wegen der Interrela tionen zwischen Ost- und Westverzeichnis läßt u. a. auch dieser Sachverhalt die Indizien für eine zu frühe zeitliche Begrenzung der Gültigkeit der Pannonien betreffenden Angaben aufheben.
2
17
I. TEIL
Probleme des rechtlichen und politischen Charakters der Königtümer Odoakers und Theoderichs
1. Terminologisches zur Aufgabe der Eigenstaatlichkeit des Westreiches
Zunächst seien einige Betrachtungen über die terminologischen Eigen tümlichkeiten der Staatsbezeichnung in den Quellenaussagen angestellt.4 Ein offiziöser Chronist des Byzantinischen Reiches, Marcellinus Comes, spricht im 518 herausgegebenen Teil seines Chronicon passim (ad a. 424. 454. 465) vom Hesperium Occidentale regnum, Occidentis principatus (zwar hier, im Falle des Severus, nur als Gegenstand einer illegitimen Machtergreifung) und zum Jahre 476 vom Hesperium Romanae gentis imperium, d. h., sowohl das „Weströmische Kaisertum“ als das „Weströmische Reich“ erscheinen bei ihm als korrelative staatsrechtliche Termini. Der in der byzantinischen politischen Begriffs welt als nicht minder offiziös zu betrachtende Jordanes übernimmt im allgemeinen in seinen um 551/552 auf Grund des Werkes Cassiodors verfaßten Getica sowie in seiner Schrift Romana die Fassungen der Marcellinus-Lemmata (abgesehen von seiner sonstigen Anlehnung an den byzantinisch ebenfalls gut orientierten Cassiodor). So spricht er in Verfolgung des Lemmas für 476 in den Getica auch vom Hesperium Romanae gentis imperium, zugleich aber erweitert er den Terminus in seinen Romana auf solche Weise: Hesperium regnum Romanique populi principatum, womit gleichfalls das „Weströmische Kaisertum“ und das „Weströmische Reich“ verstanden wurden. Das Adjektiv Hesperium (ein Zeichen oströmischer Herkunft) bezieht sich freilich auch auf das principatum (übrigens irrtümlich in der Funktion eines Nominativs). 4 Meine Ausführungen knüpfen z. T. an meine früheren Erörterungen an: V árady, Chiron 6, 1976, 475—480; V árady , Auflösung, 110—114.
2*
19
Das Weströmische Kaisertum bzw. Reich wurde somit in byzantini scher Sicht beim Rückblick aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts auf die Zeitspanne vor 476 eindeutig als ein Bruderreich betrachtet und bezeichnet. Der Gedanke und Standpunkt, wonach dieses Reich um 476 unwiderruflich untergegangen und die italische Präfektur nunmehr als partes des östlichen Kaisertums zu betrachten sei, kennzeichnen im weiteren die byzantinische Sicht, wie dies sich vor allem im erwähnten Marcellinus-Lemma ad a. 476 bzw. in dessen Wiedergabe von Jordanes widerspiegelt. In dieser Fassung wird der Untergang des Westreiches durch den Ausdruck periit definiert. Einen Auftakt zu dieser Betrach tungsweise kann man bereits beim ebenfalls Byzantiner Priskos Panites finden. Marcellinus und Jordanes hatten als Quelle an den angeführten Stellen die bis 502 geführte und uns nur in Fragmenten überlieferte große Epitome chronike des Eustathios von Epiphaneia, von dem das Westreich mit einer drastischen terminologischen Abkürzung als „Rom“ bezeichnet wird. Marcellinus Comes und, ihm folgend, aucti Jordanes geben das von Odoaker in Besitz genommene Rumpfterritorium des Westreiches durch den bloßen Namen „Rom“ an — Romam optinuit — und bezeichnen die Gotenkönige Italiens als Romam tenentes. Für die Zeitspanne seit Severus (461) sprechen sie übrigens den Herrschaftsbereich der einzelnen Kaiser im Westen gleicherweise mit „Rom“ an.5 Unter den anonymen chronikartigen Quellen entspricht das Kaiserver zeichnis Laterculus imperatorum ad Justinum /. (offensichtlich auf Grund byzantinischer Quellen zusammengestellt) derselben Gewohnheit. Sein Verfasser nimmt zwar von der Spaltung des Gesamtreiches um 395 nicht gleich bei den Söhnen des Theodosius I. Kenntnis, sondern erst bei deren unmittelbaren Nachfolgern, Theodosius II. und dem Gegenkaiser Iohannes (es fehlt jeder Hinweis auf die Teilung des Reiches unter mehreren Augusti). Bei den besagten beiden Herrschern erscheinen nun die Bezeichnungen Orientale imperium bzw. Occiduum imperium, aber für
5 Marc. Com. 424, 454. 465. 476; lord. Get. 243; Rom. 345; Priskos fr. 30 FHG IV 104 = HGM I 340=fr. 14 ExcLeg 586: 5—6; Io. Antioch, fr. 200,2 FHG IV 614, vgl. Anm. M üllers zu FR 200 bzw. 203; Eust. Epiph. fr. 4 FHG IV 141 = HGM I 360; fr. 1.3 FHG IV 138. 140= HGM I 355. 358.
20
das Westreich benutzt er dann solch einen Terminus nie mehr, sondern lediglich den Stadtnamen Rom. Obwohl er auch für das Ostreich den Stadtnamen Konstantinopel gebraucht, kommt doch dafür auch die Bezeichnung Orientales (bei Leo I.) und noch einmal Orientale imperium (bei Anastasios) vor. Dies alles kann freilich auch Zufälligkeit sein, so viel ist jedoch sicher, daß dem Verfasser des kleinen Laterculus die Bezeich nung des Westreiches als ein „Westreich“ seit der Spaltung nicht mehr einfiel, am allerwenigsten um 476.6 Der gewiß aus byzantinisch orientierter Quelle schöpfende Anonymus Valesianus der Theodericiana berichtet darüber, daß Kaiser Zenon seinen Patrizier Theoderich nach dem Westen ad defendendam sibi Italiam aufbrechen ließ.7 In gleichem Sinne beschreibt auch Jordanes die Beauftragung Theoderichs durch Zenon: ad partes eum Italiae mandans. Als er sich bei der Besetzung Italiens durch Odoaker doch über das regnum Italiae ausspricht, hat der Terminus regnum nur die Bedeutung „Herr schaft“ — wie auch anderswo passim bei ihm. Es gibt für ihn ohnehin nie mehr ein „Hesperium regnum“.8 Theoderich d. Gr. hatte sich erst nach seinen Erfolgen in Gallien im Zuge der Ausbreitung seiner Herrschaft Richtung Westen erlaubt, seinem Königtum die Geltung eines Duplikats der Herrschaftsform im Osten (mit den Titeln dominus und princeps), wenn auch inmitten der postulierten Reichseinheit, geben zu lassen (regnum nostrum imitatio vestra est . . . unici exemplar imperii). In demselben Brief an Kaiser Anastasios um 508 hatte er sich noch deutlicher ausgedrückt. Es erscheint nämlich darin auch die selbstsichere Formel utraque res publica. Außer der erfolgreichen Gebietserweiterung nach Westen dürfte dazu freilich auch beigetragen haben, daß der erste, der rangältere römische Senat in Rom als ein günstiger Hintergrund vorhanden war.9 Das bedeutete jedoch keineswegs die Verneinung oder Bezweiflung der Geltung des Prinzips vom unicum imperium.
6 ChronMin III 418—423 (Laterculus). 7 ExcVal 49. 8 lord. Rom. 348. 9 Zu den außenpolitischen Erfolgen Theoderichs vgl. Schmidt, Ostg. 339—350; E nsslin. Theoderich, 132—151.
21
Im Gegenteil: Gerade dieses Prinzip und die sich daran logisch anschließende Formel utraque res publica wurden als terminologische Anhaltspunkte einer markanten Verselbständigungspolitik benutzt. Um 511, gleichfalls in einem Brief Theoderichs an Anastasios, wiederholte sich dieselbe Formel.10 Demnach darf man daraus den naheliegenden Schluß ziehen, daß im Gebrauch der Formel utraque res publica, in der die westliche eine bloße imitatio der östlichen ist und beide exemplaria unici imperii sind, eine bewußte Anmaßung enthalten ist. Theoderich und seine Nachfolger haben ja für ihren Staat den Terminus res publica auch ohne jede Anmaßung benutzt, da der Ausdruck selbstverständlich war. Sobald jedoch utraque res publica verwendet wird, entsteht sogleich ein verfassungsrechtliches Dilemma. Dadurch wird nämlich eine staatsrecht liche Gleichheit zwischen den westlichen .partes mit den östlichen prätendiert, wogegen es feststeht, daß alle partes Teile des einzigen imperium sind, welches aber vom östlichen Herrscher, präziser: von dem im Osten residierenden Kaiser, verkörpert und von ihm regiert wird, im Westen allerdings mittelbar, durch einen Klientelkönig. Byzanz hat in dieser terminologischen Beziehung nur ein einziges Mal, in einer bedrängten politischen Situation, ein Zugeständnis gemacht. Im Laufe der langdauernden Verhandlungen über die Kircheneinheit hat der Kaiser Anastasios 516 an den Senat von Rom ein Schreiben gerichtet,11 in dem er die Formel utraque res publica sowohl gegenüber dem Senat als mittelbar auch gegenüber Theoderich mit schmeichelndem Entgegenkom men benutzte, obwohl der Begriff von diesen beiden mit unterschiedli chem Akzent und Inhalt verstanden wurde. Aber selbst dieses Zugeständ nis entbehrte nicht mancher fein formulierten Beschränkungen: Der Senat wird als „senatus meus“ (1) angesprochen; der rex erscheint als Inhaber der regendi potestas com m issa (4); neben utraque res publica (2. 4) wird auch der Terminus pars rei publicae für Italien (4) und partes überhaupt (2), d. h. rei publicae ~ imperii, eingefügt. Im Antwortschreiben des Senats
10 Cassiod. var. 1,1 (c. 508) Anastasio imperatori Jheodericus rex 3. 4; 2, 1 (511) Piissimo Anastasio imperatori Theodericus rex 4; das nächste Mal erscheint die Formel erst in Cassiod. var. 10, 32 (536) lustiniano imperatori Witigis rèx 4. 11 Coli Ave» 113(516).
22
im selben Jahr12 wird das terminologische Zugeständnis quasi mittelbar durch die gleiche Benutzung der Formel utraque res publica bestätigt (7), Theoderich aber bezeichnenderweise betont als Klientelkönig angespro chen: rex Theodericus filius vester mandatorum vestrorum oboedientiam praecipiens (1). (Das Problem des Klientelkönigtums wird w. u. ausführ lich untersucht.) In der durch die sog. Collectio A vellana überlieferten kirchenpolitischen Korrespondenz der byzantinischen Kaiser begegnet man nie mehr der Formel utraque res publica. In Byzanz blieb fortwährend die weiter oben dargelegte Anschauung in Geltung, d. h., diese Staatsbezeichnung Theoderichs wurde byzantinischerseits nicht anerkannt, um so weniger, als der König die 497 erhaltene Legitimität seiner Herrschaft aus byzantinischer Sicht keineswegs unanfechtbar gelten ließ (s. w. u.). Der Konstantinopeler Standpunkt spiegelt sich z. B. auch in der Ausdrucks weise des Malchos von Philadelphia sowie des Prokopios von Kaisareia wider. Bei Prokopios erscheint der byzantinische staatsrechtliche Stand punkt gegenüber dem westlichen Kaisertum terminologisch ganz eigenar tig, indem er die historische Tiefe des Momentes um 476 im Rahmen eines bereits seit langem im Gange befindlichen Prozesses als Ender ge bni s der großen Auseinandersetzung zwischen Römern und Barbaren — insbeson dere im Reichsinneren — begreift. Er bezeichnet Romulus Augustulus als Kaiser auf dem Thron des Westens, ungeachtet, daß dieser letzte weströmische Kaiser eigentlich illegitim gewesen war. Das westliche Kaisertum des Augustulus (bei Prokop ohne Deminutiv: Augustus) wird als hesperion kratos angesprochen, während — etwas weiter unten — die von Theoderich für Zenon zurückzuerobernden westlichen partes nun mehr bloß hesperia epikratesis genannt werden. Damit war also die Suzeränität über den Westen gemeint. Die Akme um 476 gilt für Prokop alseine V o l l e n d u n g der tyranneianfälligen Bestrebungen der Föderaten (teleutontes), als diese unter der Führung Odoakers die Forderung gestellt hatten, das gesamt e Agrarland Italiens (betont xympantas tus epi 12 Coll Aveil 114 (516); zur Frage der Staatstitulatur Theoderichs vgl. E nsslin, Theoderich, 157, bzw. zu den Verhandlungen um die Kircheneinheit zwischen Anastasios und dem Papst bzw. dem Senat von Rom um 514—516: S. 297—301.
23
tes Italias agrus) zu verteilen, was der Bemächtigung ganz Italiens gleichkam.13 Von Malchos von Philadelphia haben wir allerdings nur Fragmente, unter denen bedauerlicherweise die einschlägige Stelle über die italischen Geschehnisse um 476 nicht erhalten geblieben ist. Seine Byzantiaka wurden auch als die Fortsetzung des Priskos behandelt, und seine Darstellung der sieben Jahre von 474 bis 480 (bis zur Ermordung des Iulius Nepos) dürfte als ein zeitgenössisches Zeugnis ersten Ranges gegolten haben. Photios im 9. Jahrhundert zollt diesem Teil des nach der Suda (verfaßt etwa um 1000) bis Anastasios geführten Werkes Bewunde rung. Neben seinem Hauptthema widmete Malchos — nach Photios — in seinem siebenten Buch auch den weströmischen Angelegenheiten Auf merksamkeit und schloß dieses Buch mit dem Tod des Nepos. Von Photios darf man gewiß nicht erwarten, daß er der Malchosschen Würdigung der Vorgänge um 476 Interesse entgegengebracht haben sollte. Dasselbe ist der Fall auch bei den Exzerptoren. Die Redaktion dieses besagten „weströmischen“ Buches deutet jedenfalls daraufhin, daß er den offiziellen, formellen Standpunkt der Konstantinopeler Regierung vertrat, als er das Ende des Weströmischen Kaisertums mit dem Tod des letzten legitimen Kaisers eintreten ließ — wie dies auch seinem erhaltenen Fragment über die Gesandtschaft Odoakers an Zenon zu entnehmen ist. Da Photios sich über dieses weströmische Buch des Malchos in enger Verbindung mit dessen Abschluß, d. h. dem Tod des Nepos, äußert, benutzt er für die Bezeichnung des nunmehr offiziell als westliche partes geltenden Komplexes ebenfalls nur den Namen der Stadt Rom — vermutlich unter dem Einfluß der Malchosschen Terminologie. Das Fragment über die von Odoaker veranlaßte Senatsgesandtschaft aus Rom nach Konstantinopel enthält nicht mehr den Bericht von den vorangehenden ominösen Vorkommnissen: Aufstand, Machtübernahme und erste Maßnahmen Odoakers. Malchos ließ jedoch bei der Wiedergabe des Auftrages der Gesandten den römischen Senat selbst sprechen, woraus ziemlich deutlich hervorgeht, welche Bedeutung der Historiker dem früher geschilderten Umsturz in Ravenna beigemessen haben mag. Die Senatsge-1 11 Prokop. BG 1, I, 2 -1 0 .
24
sandtschaft teilt nämlich dem Kaiser den Senatsbeschluß mit: der Senat von Rom bedürfe des weiteren keines eigenen Kaisers, da ein gemeinsa mer Kaiser genüge, der allein als Imperator für beide Gebietskomplexe gelte. Obwohl der Kaiser das Kaisertum des Nepos förmlich-offiziell nicht aufgeben durfte, erteilte er jedoch Odoaker seine Zustimmung, Italien als Patrizier-Heermeister zu verwalten. Im Fragment kommen für das nun von Odoaker kontrollierte ehemalige Weströmische Reich nur noch die Bezeichnungen perata ( —fines) und Italon dioikesis ( = Italiae, d. h. der Rumpfkomplex der Präfektur) vor, während basileia scnon lediglich für das verlorene Kaisertum des Nepos benutzt wird, der offiziell freilich auch weiterhin als der Kaiser des Westens gelten sollte, obzwar praktisch gehindert an der Ausübung seiner Befugnisse. Wenn Malchos den erwähnten Inhalt des Senatsbeschlusses (gleichgül tig, wie weit dieser unter politischem Druck gefaßt wurde) kannte und die faktische Lage bei der Bezeichnung der westlichen Gebiete gleichfalls zur Kenntnis nahm, ist cs beinahe unvorstellbar, daß er auf die Tragweite der Machtergreifung Odoakers, mindestens in ihrer Auswirkung auf das Bestehen des Weströmischen Reiches, nicht hingewiesen hätte.14 Die mehr oder weniger zeitgenössische, italisch orientierte Historiogra phie — wie bekannt — hatte verständlicherweise die legitime Kontinuität betont, die Rolle der Barbarenkönige darin einmal als loyal hingestellt, ein andermal war sie ihrer Anmaßung der Gleichrangigkeit mit Verständnis gefolgt.1S Aus dieser wohl nicht lückenlosen Umschau gilt für unsere Betrachtun gen als historisch wichtigste Schlußfolgerung, daß Byzanz — entspre chend seiner verfeinerten historischen Weitsicht und seinem traditionellen politischen Realitätssinn — die Geschehnisse um 476, sogar bereits ihre früheren Ansätze, für eine historisch-politisch-staatsrechtliche Grundlage gehalten hatte, worauf der übriggebliebene Teil des Weströmischen Reiches, vornehmlich Italien, als Teil des byzantinischen Herrschaftsge bietes zu betrachten sei, indem die Eigenstaatlichkeit des „Weströmischen Reiches“ grundsätzlich aufgegeben wurde. 14 Malchos fr. 10 FHGIV 119 = HGM I 397—398 = fr. 3 ExcLeg 570—571, vgl. Phot. 78 H enry I 160—161.
15 Zur Beurteilung des Schicksalsjahres 476 in der römisch-westlichen Historiographie s. bes. W es, Das Ende, 52—86 als eine nützliche Quellenzusammenstellung; seine Kombinatio-
25
2. Die ambivalente Aufnahme Odoakers in das byzantinische politische System
Die im 2. und 3. Punkt der oben vorgelegten Leitsätze Odoaker betreffenden Behauptungen finden ihren Nachweis in sonst bekannten Quellen. Es genügt hier, den wesentlichen Tatbestand über jene obigen thesenhäften Hervorhebungen und meine früheren einschlägigen Erörte rungen16 hinaus, nur mit manchen nuancierenden Rekapitulierungen zu ergänzen. Die Frage, in welcher Eigenschaft, d. h. im Besitz welcher Kommando stellung, Odoaker 476 in Italien zum König durch die Föderaten ausgerufen wurde, ist für das vorliegende Thema wohl irrelevant. Dagegen soll weiter unten noch erörtert werden, welche Völkerschaften ihn zum*10 nen und Konklusionen sind jedoch m. E. kaum einleuchtend bzw. nicht überzeugend; s. noch w. u. 10 V árady , Auflösung, 111—114. — Quellenaussagen über Odoaker: N agl , RE 17 (1937) 1888—1896; vgl. Bury , LRE I 406—411 (er bezeichnet den Aufstand Odoakers als “the Italian revolution“); Stein , HBE II 46—47; Schmidt , Ostg. 294—301. 317—337 (gilt trotz mancher überholter Interpretationen als die hervorragendste Darstellung der Geschichte Odoakers, die insbesondere seiner staatsmännischen und menschlichen Größe gerecht wurde); Schw arz , GermStkunde, 51—52 (auch über die Skiren); J ones, JRS 52, 1962, 126—130; C hastagnol , Le sénat; W es, Das Ende, 57—82. 94. 149— 160. Erfreulicherweise hat auch W es (S. 71. 149—153) einen — zwar anders gemeinten — revolutionären Charakter des Odoakerschen Regimes und die Bedeutung von 476 beim Periodenwechsel — wenn auch mit Motivationen und in einem Konzept, die m. E. unannehmbar sind — anerkannt; sein Verdienst ist zweifellos, daß er die ältere italienische Literatur in seine Erörterungen in extenso einbezogen hatte (ein wertvolles Zurückgreifen auf die ältere Forschung); vgl. ferner V árady , Pannonien 343—345 (S. 345 v. u. Z. 1—11 sind zu streichen). — Die Behauptungen von W es, Das Ende, 74—88. 123— 148 (bes. 126. 147—148). 156—157 über die von den Zeitgenossen den Geschehnissen um 476 beigemesse ne Bedeutung scheinen mir, s. V árady , Auflösung, 123 Anm. 121, mehr als bedenklich (Quintus Aurelius Memmius Symmachus angenommen als Autor des Hesperia-Lemmas bei Marcellinus Comes ad a. 476, wo der endgültige Untergang des Westreiches registriert Wurde). Der 3. Abschnitt seines Buches „Das Jahr 476 in den Quellen“ (S. 52—88) hat zwar, wie gesagt, einen erheblichen Informationswert, seine Schlüsse werden jedoch durch die m. E. irrige Arbeitshypothese überschattet. Ich meinerseits behandle auch das zeitgenössische Selbstverständnis als einen objektiven Bestandteil der historiographischen Objektivierung der Periodengrenze 476. — Für die perspektivische Beurteilung der Herrschaft Odoakers als historische Zeitenwende hat K raus, Münzen, 46—52 der eigenen Münzprägung mit Recht eine hohe Wichtigkeit beigemessen. Beschreibung seiner Münzen: S. 52—57. 59—62. (Die Abbildung auf dem Schutzumschlag dieses meines Buches ist auf Taf. I — 25: Halbsiliqua, Silber — zu finden.)
26
König ausgerufen hatten, und ferner, welchen Charakter die von ihnen veranlaßten Landteilungen gehabt hatten. Von Interesse sind hier nur die folgenden Überlegungen: Das staatsrechtliche Verhältnis Odoakers zum oströmischen Kaisertum wurde im Herbst 476 im an ihn gerichteten Brief Kaiser Zenons in dessen bedrängter Lage so festgesetzt, daß dieser, dem durch Odoaker angereg ten Wunsch und Beschluß des Senats von Rom entgegenkommend, Odoaker die Befugnisse eines patricius mit denen eines magister utriusque militiae über die italischen partes zuerkannte.17 Aus dem einschlägigen, im vorangehenden Abschnitt schon erörterten Malchos-Text sei eigens hervorgehoben: Odoaker ließ eine Senatsgesandtschaft beim Kaiser mit der Mitteilung eines Senatsbeschlusses vorstellig werden, wonach (a) der Kaiserthron des Westens, den unlängst der 475 entthronte, vom Osten ernannte Iulius Nepos, dann aber der vom Osten nicht anerkannte und nun gleichfalls abgesetzte Romulus Augustulus innehatten, staatsrechtlich für immer abgeschafft wurde; (b) die alleinige kaiserliche Befugnis für die westlichen partes nunmehr dem Kaiser von Konstantinopel eingeräumt wurde; und (c) Odoaker die Verwaltungsbefugnis über Italiae zuerkannt wurde, dessen Einsetzung und Ernennung zum Patrizier-Verweser hiermit dem Kaiser empfohlen wird. Ein ähnlicher Senatsbeschluß war in diesem Zuständigkeitsbereich des ehrwürdigen Gremiums nicht lange zuvor auch im Herbst 457 gefaßt worden, woraufhin Majorian, durch das Heer bestätigt, am 28. Dezember desselben Jahres zum Kaiser erhoben worden war. Der Kaiser des Ostens hatte sich die Anerkennung in solchen, im übrigen verfassungsmäßigen Fällen selbstverständlich Vorbehalten.18 Da dieser Beschluß an sich dem Konzept von Byzanz grundsätzlich entsprach, begnügte sich der Kaiser damit, sein Bedauern über das Schicksal des von Byzanz ernannten Kaisers im Westen zu äußern, und ließ die Senatsgesandtschaft wissen, daß er den Thron des Nepos, der noch am Leben sei, nur aus rein formellen Gründen nicht als abgeschafft
17 Malchos fr. 10 FHG IV 119=HGM I 397: 29—398: 32 = fr. 3 ExcLeg II 570: 28— 571: 26; vgl. VArady , Auflösung, 113. 124 Anm. 123. 18 Vgl. Stein , HBE I 375; grundsätzlich auch a u f S. 35.
27
betrachten bzw. den diesbezüglichen Beschluß nicht billigen dürfe. Er ist aber den beiden weiteren Bestimmungen des Beschlusses im wesentlichen entgegengekommen: er war es letztlich, der in seiner an Odoaker gerichteten Urkunde seine Stellungnahme zu dieser Angelegenheit offiziell bekannt gab, Odoaker die Würde eines Patriziers erteilte und dessen auf den Prinzipien der römischen Verfassung fußende — mit dem Senatsbe schluß bereits ohnehin im Gange befindliche — Regierung guthieß. Es ist übrigens zu beachten, daß es in einer gerade von demselben Zenon herausgegebenen Verordnung hieß: Nemini ad sublimem patriciatus honorem, qui ceteris omnibus anteponitur, adscendere liceat, nisi prius aut consulatus honore potiatur aut praefecturae praetorio [Orientis?] vel Illyrici vel urbis administrationem aut m a g istri m ilitu m aut magistri officiorum, in actu videlicet positus, gessisse noscatur . . . , was an sich schon auch die Verleihung des Magisteriats vorausgesetzt hatte.1920 Wir wissen nichts Sicheres darüber, ob Odoaker bereits von Iulius Nepos zum Heermeister ernannt worden war. (Im folgenden Abschnitt sollen hierüber allerdings noch gewisse logische Überlegungen angestellt werden.) Aus dem Malchos-Text geht jedenfalls soviel hervor, daß sich der Senatsbeschluß und sinngemäß auch die Empfehlung an den Kaiser sowohl auf die politische wie auf die militärische Verwaltungsbefugnis bezog, die nur einem Patrizier zuteil werden konnte. Odoaker wurde nämlich darin mit zweierlei Begründungen zur Ausübung seiner allgemei nen Verwaltungsbefugnis als höchstgeeignet beurteilt: ton Odoachron hyp ’ autón probeblesthai hikanon onta sozein ta par’aut ois pragmata, d. h. kraft seiner Kenntnisse sowohl um die Staatsverwaltung (synesis politike) als um das Militärwesen (synesis machime). Dementsprechend erfolgt die konkrete Empfehlung für den Patriziat (patrikiu axia) und für die Verwaltung von Italiae ( ton Italon dioikesis), worunter nur die Kombina tion der Funktion des magister militum mit der Würde des patricius verstanden werden konnte. Dies kam nach der engeren BegrifTlichkeit der westlichen Praxis der Stellung des höchsten Machtinhabers nach dem Kaiser gleich: der eines Generalissimus (,,patricius noster“) .10 19 CJ 12, 2, 3 praef. 20 Vgl. Bury , L R E 1 252 mit zutreffenden Bemerkungen über den Patriziat, die zuletzt im wesentlichen auch von der akribischen Studie von Barnes, Phoenix 29, 1975. 155— 170
28
Der Einschnitt-Charakter des Odoakerschen Umsturzes wurde insbe sondere dadurch unterstrichen, daß er als vom Heer ausgerufener rex von Byzanz nie anerkannt wurde. Dementsprechend wurde seine Macht über Italien (d. h. über Barbaren und Römer) in dieser höheren staatsrechtli chen Eigenschaft als „Tyrannei“ bezeichnet bzw. gebrandmarkt. Die Möglichkeit der Errichtung eines Klientelkönigtums für Odoaker wurde von Konstantinopel offensichtlich wegen der byzanzfremden Orientiertheit Odoakers nicht einmal erwogen; ein foedus mit ihm wäre hingegen wegen der massiven Fait-accompli-Situation in der Landteilung bereits überholt gewesen. Die Qualifizierung seines Königtums als „Tyrannei“ war eigentlich ein für die Konstantinopeler Regierung immer naheliegen der Grund oder Vorwand, militärische Maßnahmen zur Abschaffung seiner Herrschaft zu ergreifen. Wenn das bis 488 — bis zum Aufträge Theoderichs, Odoaker zu bekämpfen — doch nicht getan wurde, so ist es auf zwei Umstände zurückzuführen. Zum einen: Für jede oströmische Regierung galt seit der Reichsspal tung um 395 als axiomatischer Grundsatz, die barbarischen Feinde des Westreiches erst dann zu bekämpfen bzw. bekämpfen zu helfen, wenn die wirtschaftlichen Interessen des Ostens in Italien bzw. im Mittelmeerraum (Seewege, Häfen) gefährdet waren oder von Italien her ein barbarischer Feind den Osten tatsächlich anzugreifen drohte.21 Bei Odoaker schien keine der beiden Voraussetzungen akut vorzuliegen, obwohl seine Herrschaftsausbreitung auf Dalmatien um 481/482 sowie die Konsolidie rung seiner Machtstellung als König in Italien gewisse Vorzeichen gewesen sein, sogar vielleicht bereits manche ungünstigen Vorgänge hervorgebracht haben dürften, die sowohl im Bereich der Wirtschaft als auch in dem der Politik für Byzanz notwendigerweise als bedrohend erschienen.22 bekräftigt wurden; Angabe der Stellung bzw. Befugnis Theoderichs bis 493 m it,.patricius“in ExcVal 49. 51. 52. 53. 54. — Die von W es, Das Ende, 154— 155 vorgebrachten bzw. angeführten Zweifel über die Verleihung des Patriziats an Odoaker sind auch im Spiegel der Quellenaussagen unbegründet. 21 Vgl. Várady, Auflösung, 94^-95. 98—108. 114. 11 Zu Odoakers Rolle und seinen vermutlichen weiteren Aspirationen s. noch W irth , Historia 16, 1967, 243 Anm. 76; 251 Anm. 122; an eine wirkliche Bedrohung der Interessen von Byzanz durch die Ernennung des Sohnes Odoakers, Thela, zum caesar glaube ich nicht, vgl. Io. Antioch, fr. 99 Exclns 140.
29
Zum anderen: Zenons Kaisertum machte gerade damals bedenkliche innenpolitische Schwierigkeiten durch, die eine direkte oströmische Expedition gegen Odoaker fortwährend hinderten. Diese konnte um so mehr entbehrlich sein, als das Verhalten des Barbarenkönigs gegenüber Ostrom sie praktisch wirklich nicht als allzu dringlich erscheinen ließ.23
3. Die Stärke des Odoakerschen Königtums
Zur richtigen Einschätzung der Bedeutung, die der Errichtung des ersten barbarischen Königtums in Italien nach der Abschaffung des Weströmischen Kaisertums bei der Grenzbestimmung zwischen „Alter tum“ und „Mittelalter“ zukommt, muß man über die ethnischen und machtpolitischen Grundlagen dieses Königtums etwas eingehender als bisher unterrichtet sein. Aus einer näheren Analyse der Quellenaussagen gewinnt man ein völlig anderes Bild von den Machtausmaßen dieses Königtums, als es üblicherweise dargestellt wurde. Zunächst einige logische Überlegungen: (a) Odoaker war unseres Wissens skirischer Herkunft, u. zw. Sohn des Skirenfürsten Edeko; als er seinen Dienst in Westrom antrat, mußte er zumindest seine eigenen Buccellarier bei sich gehabt haben. (b) Die Quellen, die über seine Ausrufung zum König durch Barbaren in römischem Dienst Auskunft geben, zählen eine ganze Reihe von Völkerschaften auf, darunter auch die Skiren; diese Barbaren müssen unbedingt als Föderaten und Buccellarier zum Westreich gehört haben. (c) Odoaker mußte mithin ihr Kommandant gewesen sein. (d) Der Anspruch des Odoakerschen Heeres auf ein Drittel des ganzen landwirtschaftlichen Güterbestandes in Italien bezeugt das Vorhanden sein eines kompakten Föderatenblocks beträchtlicher Größe; es beweist samt der Königswahl den tiefen ethnisch-nationalen Charakter dieses Blocks, was nahelegt, daß es sich um ein Föderatenkonglomerat handelte, das schon früher gewissermaßen zusammengeschmolzen worden war.
23 Vgl. Prokop. BG 2, 6, 15— 16. 21; zur Geschichte der inneren Wirren: Stein, HBE I 363—364; II 7—20. 28—31.
30
(e) Odoaker konnte den magister militum Orestes besiegen, ebenso wie er sich später gegen Theoderich gut fünf Jahre hindurch zu behaupten vermochte, was allein schon seine beträchtliche militärische Stärke beweist. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen erscheinen die Quellen aussagen in damit völlig übereinstimmendem Sinne. Für die militärische (und demographische) Stärke der Skiren sei zunächst festgestellt, daß ihr Volk nach der Auflösung des Hunnenreiches in zwei Teile zerfiel: Der eine Teil erhielt von der Konstantinopeler Regierung Siedlungsstätten in den Provinzen Scythia und Moesia Secunda,24 der andere Teil aber verblieb im Gebiet zwischen Donau und Theiß, u. zw. ganz im Süden zwischen der Drau- und Theißmündung, wahrscheinlich schon damals als äußere foederati,25 Die Eigenschaft dieser Skiren als äußere foederpti geht zum Teil aus ihrem Hilfeersuchen um 469 in Konstantinopel hervor, aber auch aus dem Umstand, daß sich eine Gruppe des Volkes unter der Führung Odoakers um 468 nach Italien begeben zu haben scheint, um an der großen Vandalenexpedition des Kaisers Anthemius teilzunehmen.26 An ihren Siedlungsstätten zwischen Donau und Theiß gerieten sie 469 mit den Goten — höchstwahrscheinlich mit dem Hauptblock Walamirs— in Feindseligkeiten, wobei sie sich schließlich der großen gotenfeindlichen Koalition der Sueven anschlossen. Da sie es waren, die sich in der exponiertesten Lage gegenüber den Hauptkräften der Goten befanden, erbaten sie — wie gesagt — vom Kaiser Leo militärischen Beistand. Dies taten zu gleicher Zeit auch die Goten, bei denen das Zustandekommen des gegen sie gerichteten Bündnisses verständliche Besorgnis erregte. Leo entschied sich für die Hilfeleistung an die Skiren, die Goten errangen aber trotzdem 469 am Fluß Bolia in Pannonien einen Sieg über die Koalition.27
24 lord. Get. 265. 25 Vgl. V árady , Pannonien, 327. 333. 339, wo die Ansicht von Schmidt widerlegt wird, der die im ganzen richtige Vorstellung A lföldis bezweifelte. 24 Eugipp. vSev comm. 6, wo allerdings weder von einer Gefolgschaft Odoakers noch von seinem angenommenen Reiseziel die Rede ist. Aus der legendär stilisierten Darstellung des Eugippius läßt sich jedoch dieser Schluß ziehen. 27 Vgl. V árady , Pannonien, 337—340.
31
Insbesondere in der Schilderung von Priskos28 erscheinen die Skiren etwa um 466 als Machtfaktoren vergleichbarer Stärke gegenüber dem Volk Walamirs. Daß sie dennoch eine Niederlage erlitten haben (vermutlich bei einer sehr bescheidenen Hilfe seitens des magister militum per Illyricum), ist wohl manchen nicht voraussehbaren Faktoren zuzuschreiben, über die uns nichts überliefert ist. In der zweiten Hälfte des kurzlebigen Kaisertums des Anthemius — etwa nach 469 — begegnen wir Odoaker im hohen Korps der domestici.29 In dieser Stellung gehörte er zugleich zum plethos ton oikeion barbáron.30 Ob er nach der Thronbesteigung des Glycerius um 473 die bisherige Stellung des neuen Kaisers (einer Kreatur des neuen Burgunder-Patriziers Gundobad), d. h. die des comes domesticorum, übernommen hatte, soll dahingestellt bleiben.31 Mit dem Sturz des Glycerius und der Thronerhebung des Iulius Nepos durch Ostrom wurde eine neue Orientierung gegenüber dem Einfluß Galliens angebahnt, was in der Ernennung des pannonischen Orestes zum magister militum an Stelle des in Gallien amtierenden Ecdicius spektakulä ren Ausdruck gefunden hat.32 Zweifelsohne zielte diese Ernennung auf die Aktivierung der in Pannonien angesiedelten älteren und neueren barbari schen Föderaten ab, zu denen Orestes seit Attilas Zeit die besten Beziehungen hatte. Wie bekannt, waren er und der Vater Odoakers, Edeco, die engsten Vertrauensleute des Hunnenkönigs. Bereits zur Zeit der Vorbereitungen Majorians für eine großangelegte Expedition gegen die Vandalen um 458 erschienen die neuen donauländi schen Barbaren auf dem Plan der Reichspolitik.33 In der Aufzählung des Sidonius Apollinaris finden wir unter ihnen neben den älteren, nunmehr 28 Priskos fr. 35 FHG IV 107 = HGM I 345 = fr. 17 ExcLeg 587. 29 lo. Antioch, fr. 209 FHG IV 617 = fr. 93 Exclns 131; bei Prokop. BG 1,1, 6 erscheint Odoaker — wohl irrtümlich — selbst noch um 476 in einer dem comes domesticorum untergeordneten Stellung. 30 Im Kontext erscheint dies bei Io. Antioch, fr. 209 FHG IV 617 = fr. 93 Exclns 131 als die barbarischen Hilfskräfte Ricimers gegenüber Anthemius: to de Rhekimeri to ton oikeion barbáron plethos. Synen de kai Odoakros, genos on ton prosagoreuomenon Skiron. . . . somatophylakos. ktl. 31 Zu den Geschehnissen um Anthemius bis Julius NepoS vgl. Stein , HBE I 394—395. 32 lord. Get. 241; vgl. Seeck , Untg. VI 377; Stein , HBE I 395—396. 33 Vgl. Värady, Pannonien, 340—343.
32
im römischen Numeralbestand zu aktivem Kriegsdienst verpflichteten hunnischen, alanischen (vermutlich auch ostgotischen) Föderaten Panno niens die Teile des großen Volksblocks der Ostgoten und von jenseits der Donau Gépidén (unter dem Namen Dacus), ferner Rugier und Alanen.34 Nach dem Auszug der Ostgoten aus Pannonien um 471 dürften manche, bis dahin äußere Föderaten jenseits der Donau in das Reichsgebiet übergesiedelt sein, was das Gewicht Pannoniens in der Politik Ravennas, aber mittelbar auch Konstantinopels, erheblich erhöhen mußte. Wir erfahren aus den Quellen nichts Sicheres über das Schicksal bzw. über die amtliche Laufbahn Odoakers unter dem Oberkommando des Orestes zur Zeit des Nepos und Romulus Augustulus. Dabei sind wir eigentlich nur auf logische Folgerungen angewiesen. Als neue Föderaten im Reichsinneren erschienen nun die Heruler, Gépidén, Alanen, diese im Einklang mit der Aufzählung des Sidonius Apollinaris, wo sie noch als äußere Föderaten gegolten haben. Es kamen noch die Skiren mit den Turkilingen als eigene Völkerschaften Odoakers hinzu. Da aber diese Völker, zum Teil unter dem Sammelnamen diversarum gentium auxiliarii3S (u. a. wohl Gépidén und Alanen), Odoaker 476 zum König, zu ihrem König ausgerufen hatten, mußte er vorher unbedingt ihr Kommandant gewesen bzw. wohl zum Oberbefehlshaber der in Italien stationierten Föderatenkontingente und Buccellarier, vermutlich im Range eines magister militum, ernannt geworden sein. Als das Reservoir für diese Kontingente galten zuvor selbstverständlich ihre Siedlungsstätten in Pannonien bzw. in Noricum.36
34 Sid. Apoll, carm 5: 470—479; vgl. Seeck, Untg. VI 342. 344; Stein , HBEI 377—379; Várady, Pannonien, 341—342. 509—510 Anm. 847—852. 35 lord. Get. 242. 36 Für die Zusammensetzung des Odoakerschen Heeres vgl. lord. Get. 242. 291; Rom. 344 (Skiren, Rugier, Heruler, Turkilingen); Marcell. Com. 476, 2 (Goten — ein Mißverständnis); Prokop. BG 1,1,3 (Skiren, Alanen und andere gotische Stämme, zwar nicht dem Heere Odoakers zugewiesen, sondern erwähnt am Anfang eines historischen Rückblicks auf die Rolle der barbarischen Föderaten im Reichsinneren — doch, zur Erklärung des k onkreten Falles; deshalb sind die aufgezählten Völkernamen im Anschluß an Orestes bzw. im Hinblick auf Odoaker namentlich erwähnt); vgl. noch Várady , Pannonien, 344—345; Várady , Chiron 6, 1976, 475—476. — Zu den nirgendwo anders, d. h. nur von Jordanes, erwähnten Turkilingen vgl. Schw arz , GermStkunde, 52, wo er meint, es handle sich um den Namen des skirischen Fürstengeschlechtes. 3
33
Sobald aber Odoaker von seinem Föderatenheer zum König ausgeru fen worden war und kurz danach eine Landteilung als Forderung dieser Truppen stattgefunden hatte, mußten die bisherigen ständigen Siedlungs stätten dieser Völkerschaften — wohl, wie gesagt, zum guten Teil in Pannonien — nunmehr nach Italien verlegt worden sein. (Selbst dann, wenn unter dem Terminus „ltalia" der Territorialkomplex der Präfektur Italiae verstanden wird, wozu auch Pannonien gehörte.) Die Familien der Barbaren auf den neuen tertiae, d. h. auf Landgütern guter Qualität, waren nun zu einem reichlichen Volksreservoir für das Heer Odoakers und dadurch zu einer breiteren Basis für seine Machtstellung geworden. Daß dieses Föderatenkonglomerat in einer kompakten Einheit als ein einziges Quasi-Volk hervortreten und sich in der Person Odoakers einen gemeinsamen König wählen konnte, war gewiß seinem einstigen Zusam menleben im Hunnenreich zu verdanken, wo die Mehrzahl zur Opposition Attilas gezählt hatte und somit auch den Ostgoten, die in der Entschei dungsschlacht am Fluß Nedao um 455 aufSeiten der Hunnen gekämpft hatten, feindlich gegenüberstand.37 Dieser Umstand darf keineswegs unberücksichtigt bleiben, wenn man die militärischen Stützen Odoakers bzw. seine Heeresstärke in Italien gegenüber den Ostgoten Theoderichs (früher auch schon bei seinem Sieg über Orestes) richtig einschätzen will. Wenn man indes den demographisch-politischen Hintergrund Odoakers richtig ermessen will, bleibt unbezweifelbar, daß sich hinter seinem Königtum ein geringerer ethnischer Zusammenschluß befand als bei dem Sproß der hochgeachteten Amaler an der Spitze eines ethnisch annähernd einheitlichen barbarischen Volksstammes.38 Odoaker hatte 481 eine Expedition nach Dalmatien unternommen, mit der Begründung, er wolle die Mörder des im Mai 480 umgebrachten Iulius Ncpos bestrafen. Als Ergebnis dieses Unternehmens hatte er Dalmatien seinem Königtum angeschlossen.39 Dadurch wird mittelbar bekräftigt, daß er von Anfang an im vollen Besitz Pannoniens gewesen war. Der 37 Vgl. V árady , Pannonien, 332—335. 399. 38 Dies wurde von Bertolini in I Goti, 26—27 richtig betont. 39 Stein, HBE II 50. Die richtigen einschlägigen Quellenhinweise bei Demougeot, Klio 60, 1978, 373 Anm. 12: Consltal FastiVindob 626. 628—630, AuctHavn a. 480. 482; Cassiod. chron. 1309. Stein bezweifelte, daß Dalmatien in die Präfektur Italiae eingegliedert wurde, Demougeot hingegen bejaht diese Eingliederung mit vollem Recht.
34
westliche Teil von Illyricum (Pannoniae und Dalmatiae) war unter dem Namen „Dalm atia“ (nach oströmischem Protokoll) unbestrittener Bestandteil des Weströmischen Reiches bzw. der Präfektur Italiae gewesen und nur insoweit oströmisch orientiert, als der Kaiser Ostroms selbst für Italien zuständig gewesen sein konnte.40 Die* in Pannonien verbliebenen barbarischen Föderaten bildeten mithin eine feste Basis für das Königtum Odoakers. Die Stärke Odoakers ist wohl am anschaulichsten an den Geschehnis sen zur Zeit der Endphase seiner Auseinandersetzung mit Theoderich zu ermessen. Im Gegensatz zu den entstellten philogotischen Darstellungen des Jordanes und des Anonymus Valesianus Theodericianorum41 gibt der Byzantiner Prokopios den wirklichen Sachverhalt an. Demnach sei nicht nur Odoaker durch die dreijährige Belagerung Ravennas ermüdet gewesen, sondern auch Theoderich. Mit Hilfe der Vermittlung des Bischofs von Ravenna sei nun eine Vereinbarung zustandegekommen (am 25. Februar 493), wonach beide Parteien, „sowohl Theoderich als Odoaker, auf der gleichen Rangstufe unter den gleichen Bedingungen in Ravenna ihren Sitz haben werden“ . Und das Abkommen sei auch wirklich in Kraft getreten und beide hätten es eingehalten, dann aber „habe Theoderich — wie gesagt — Odoaker auf einer gegen ihn gerichteten Verschwörung ertappt, ihn mit arglistiger Absicht zu einem Gastmahl eingeladen und umgebracht“ (am 15. März). Des weiteren habe Theoderich die das erste Blutbad überlebende Anhängerschaft Odoakers für sich selbst gewonnen.42 40 Vgl. Várady , AAntHung 11, 1963, 397—400 über „Dalmatia“ im 5. Jahrhundert. 41 lord. Rom.*349: magnisque proeliisfatigatum Odoacrum Ravenna in deditione suscepit, deinde vero ac si suspectum Ravenna in palatio iugulans . . . ; lord. Get. 294—295: Odoaker aus der von den Goten umzingelten Stadt Ravenna missa legatione veniam supplicat, cui et primum concedens Theodoricus postmodum ab hac luce privavit. . . ; ExcVal 55: Igitur coactus Odoacar dedit filium suum Thelanem obsidem Theoderico, accepta fide securum se esse de sanguine. Sic ingressus est Theodericus: et post aliquot dies, dum ei Odoacar insidiaretur, detectus ante ab eo praeventus in palatio, manu sua Theodericus eum in Lauretum pervenientem gladio interemit. 42 Prokop. BG I 24—25; in gleichem Sinne (obwohl ausführlicher in anderen Beziehungen) berichtet auch Io. Antioch, fr. 99 Exclns 140; vgl. Bury , LRE I 426; an den Darstellungen der Consltal AuctHavn a. 490.491.493 ChronMin I 317. 319. 321, vgl. W es, Das Ende, 64—66, läßt sich die Schwierigkeit der Niederschlagung Odoakers ermessen; Schmidt , Ostg. 295—299. 336; E nsslin, Theoderich, 66—76. 3*
35
Aus dem Umstand, daß die besagte Vereinbarung überhaupt erzielt werden konnte, stellt sich — ganz unabhängig von ihrer Dauer — offensichtlich heraus, daß ein gewisses Gleichgewicht der Kräfte zwischen den beiden Parteien vorhanden war. Zudem darf man nicht annehmen, daß Odoaker alle seine Militärmacht in der Stadt Ravenna konzentriert hatte. Seine Barbaren als stets mobilisierbare Militärbauern waren vielmehr in Italien weit zerstreut. Auf dieser Basis konnte er den Ostgoten von 489 bis 493 mit Erfolg Widerstand leisten. Beachtenswert ist darüber hinaus, daß seine Herrschaft nur durch eine Arglist, unter einem böswilligen Vorwand und erst durch seine physische Vernichtung endgültig abgeschafft werden konnte. (Es ist eine andere Frage, wie weit das Abkommen zwischen ihm und Theoderich auf längere Sicht realistisch war.) Die unmittelbare persönliche Gefolgschaft Odoakers (darunter ver schiedene Kategorien der Klientel), die ihm im belagerten Ravenna zur Seite stand, belief sich selbstverständlich wohl nur auf einige Tausende. (Bei der Hungersnot erwies sich selbst diese Anzahl als zu groß.) Eine übliche, sozusagen „vorschriftsmäßige“ Anzahl von Waffensöhnen, Klienten und Buccellariern, d. h. von Gefolgschaft, läßt sich z. B. in der Angabe des Ioannes Antiocheus erkennen, wo er 6000 Bewaffnete an der Seite Ricimers registriert: . . . hexakischilius andras es ton kata Bandeion polemon hyp’autón tattomenus .. . 43 Die gleiche obligate Anzahl läßt sich aus dem Bericht des Jordanes ermitteln, wo er bei einem Überfall des jungen Theoderich auf das vom Sarmatenkönig Babai besetzte Singidunum bemerkt: Theoderich habe diesen Sieg ascitis certis ex satellitibus patris et ex populo suo amatores sibi clientesque consocians, paene sex milia viros errungen.44 Dieselbe Gefolgschaft Theoderichs wurde später, in Verbindung mit Ereignissen um 479, wieder erwähnt: meta hexakischilion ton malista machimon.4S Wir haben ferner eine weitere einschlägige Angabe in der Vandalen geschichte des Prokopios, der davon berichtet, daß Theoderich um 500 seine Schwester Amalafrida mit dem Vandalenkönig Thrasamund
43 Io. Antioch, fr. 207 FHG IV 617 = fr. 91 Exclns 130: 26—29. 44 lord. Get. 282. 45 Malchos fr. 18 FHG IV 129 = HGM I 417: 6—7 = fr. 1 ExcLeg I 162: 3 ^ t .
36
vermählt und mit ihr eine Gefolgschaft von etwa 6000 Männern nacn Afrika entsandt hatte. Merkwürdigerweise hat Prokop auch die Zusam mensetzung dieser Gefolgschaft mitgeteilt. Demnach bestand sie aus einer Elitetruppe von 1000 Mann und aus einer Schar von Gefolgsleuten, etwa 5000 Köpfe stark, insgesamt also auch diesmal 6000 Krieger: ho de hoi kai ten adelphen epempse kai Gotthon dokimon chilim en doryphoron logo, hois de homilos therapeias heipeto es pente malista chiliadas andron machimon. Nachdem Amalafrida 525 als Witwe wegen eines ihr zur Last gelegten Hochverrates gefangen genommen bzw. ermordet worden war, wurde auch ihre ganze Gefolgschaft niedergemetzelt: ten tegar Amalaphridan en phylake eschon kai tus Got thus diephtheiran hapantas . . . 46 Aus der Jordanes-Stelle dürfen wir wohl darauf schließen, daß die Verteilung der Gefolgschaft Theoderichs auf amatores und clientes der Verteilung der Gefolgschaft Amalafridas auf klientele Elite und einfache Buccellarier genau entsprach. Nicht minder aufschlußreich ist dieser Prokop-Bericht auch wegen der Mitteilung, Amalafrida sei von König Hilderich verdächtigt worden, sie habe mit dieser gotischen Gefolgschaft einen Umsturz herbeizuführen beabsichtigt. Der unmittelbare „TruppenbedarP‘ zu einem Staatsstreich war mithin in zeitgenössischer Sicht und in Anbetracht der Praxis im allgemeinen nicht allzu hoch eingeschätzt: Eine übliche Gefolgschaft konnte die ersten, entscheidenden Schläge grund sätzlich auch ganz allein, vom Gros des Volkes getrennt, versetzen.
4. Die Errichtung des zweiten barbarischen Königtums in Italien als Folge des klientelmäßigen Auftrages an Theoderich
Die maßgeblichen Quellenaussagen über das bedeutungsvolle Ereignis, als Kaiser Zenon um 488 Theoderich den Auftrag erteilte, sich nach Italien zu begeben und dort Odoaker zu bekämpfen, wurden uns vom Anonymus Valesianus Theodericianorum sowie von Jordanes überliefert. Die einschlägige Stelle beim Anonymus lautet: Zeno itaque récompensons
46 Prokop. BV 1, 8, 12; 1, 9, 4.
37
beneficiis Theodericum, quem fecit patricium et consulem, donans ei multum et mittens eum ad Italiam, cui Theodericus pactuatus est, ut, si victus fuisset Odoacar, pro merito laborum suorum loco eius, dum adveniret, tantum praeregnaret. ergo superveniente Theoderico patricio de civitate Nova cum gente Gothica, missus ab imperatore Zenone de partibus Orientis ad defendendam sibi Italiam.*1 In den Romana des Jordanes heißt es: (348) Theodoricus vero Zenonis Augusti humanitate pellectus Constantinopolim venit, ubi magister militum praesentis effectus consulis ordinarii triumphum ex publico dono peregit, sed quia tunc, ut diximus, Odoacer regnum Italiae occupasset, Zenon imperator cernens iam gentes illam patriam possidere, maluit Theodorico ac si proprio iam clienti eam committi quam illi quem nec noverat, secumque ita deliberans, ad partes eum Italiae mandans, Romanum illi populum senatumque commendat. (349) obansque rex gentium et consul Romanus Theodoricus Italiam petiit. . . 48 47 ExcVal 49; textmäßig richtig gedeutet von M ommsen, GSch VI 386 Anm. 1; Schmidt , Ostg. 290—291; E nsslin , Theoderich, 79. — Zur Geschichte Theoderichs seit 488 vgl. Schmidt , Ostg. 287—301.337—398; Stein , H B E II54—58.107—156.247—251.254—264; E nsslin , Theoderich, 62—354; J ones, JRS 52, 1962, 126—130; W irth , Historia 16, 1967, 244—245; W es, Das Ende, 160— 173 (zur Beweisführung für seine eigene Konzeption herangezogen); darüber selbst heute noch lesens- und beachtenswerte Gedanken enthält der Vortrag von Stauffenberg , Imperium und Völkerwanderung, 128— 142: „Theoderich der Große und seine römische Sendung“, sowie sein kleiner Artikel (143— 156): „Theoderich der Große und Chlodwig“ . Eine jüngst erschienene Darstellung der Gotengeschichte auf rund 500 Seiten: W olfram , Goten, worin die Ostgoten in der hier relevanten Zeitspanne, d. h. von 488 bis 526, auf S. 346—411 behandelt werden. Die Monographie W olframs kann als Handbuch nicht die bisherigen Standardwerke ersetzen, die vom Vf. mit zwar reichlichen, doch nicht immer glücklich angeordneten bibliographischen Hinweisen auf die neuere Forschung ergänzt wurden. Einer neuen einschlägigen Arbeit von Burns, Ostrogoths, mangelt es — trotz der bunten Reihe der herangezogenen Quellengattungen und Literatur — an einer gebührend koordinierten, auf heutigem Niveau der Forschung abgewogenen Bearbeitung des Stoffes L. Schmidt als großer Erforscher der Germanengeschichte ist dem Vf., wenigstens dem Apparat und Literaturverzeichnis nach, völlig unbekannt. Verzeichnet ist nur ein kurzer Aufsatz von ihm, was die Nichtkenntnis (Nichtbeachtung ?) eher betont als verwischt. Aber auch T h . M ommsen, E. Stein und W. E nsslin , denen die Forschung auch in der hier angesprochenen Beziehung ja viel zu verdanken hat, werden in der Schrift kein einziges Mal angeführt. 48 lord. Rom. 348. 349; weit ungenauer und mit erzählerischem Gepräge lord. Get. 292; auffällig ist, daß Jordanes die patricius- Würde Theoderichs nie erwähnt — wohl nach seiner
38
Durch eine sinngetreue Deutung der beiden Texte erschließen sich nun wichtige Einsichten in den Charakter des Theoderichschen Auftrages und seines Regimes überhaupt. Zum Anonymus-Text ist zunächst eine Paraphrase vorauszuschicken. In der für uns relevanten Partie des Textes wird ausgesprochen, daß Theoderich sich dem Kaiser verpflichtet habe, nach einer definitiven Besiegung Odoakers als Vergütung für seine eigenen Opfer, Italien in Vertretung des Kaisers solange zu regieren,*49*bis sich der Kaiser dorthin begeben werde. Der in Aussicht genommene Besuch des Kaisers in Italien war offensichtlich so gemeint, daß dieser nach der Niederschlagung des „Tyrannen“ Odoaker durch die Goten über den neuen Status und Verwaltung der westlichen partes, für die er sich zunächst das volle Territorial- und Verwaltungsrecht vorbehielt (s. defendere sibi Italiam), persönlich verordnen, zugleich aber auch den Status der Ostgoten und ihres Königs (der diesen Titel ohne Land vorläufig nur nach barbarischem Recht führte) vereinbaren sollte. Teils vom Anonymus, teils von Jordanes erfahren wir, daß Theoderich bis dahin nach römischem Recht als ein oströmischer patricius, magister militum praesentalis, exconsul ordinarius d. J. 484 (damit selbstverständ lich römischer Bürger), nach barbarischem Recht hingegen seit 471 als rex gentium bzw. gentis suaeso gegolten hatte.51 Er war mithin aus römischer
Vortage, wo nach traditionell-römischer Sicht gemeint worden sein mag, die Würde eines Konsuls habe die des „Patriziers“ übertroffen, vgl. z. B. CTh 6,6,1 ( 1.4.382): . . . consulatus anteponendus est omnibus fastigiis dignitatum . . . , und NovVal 11(13.3. 443): (praef.) . . . pro sui magnitudine ac reverentia vetustatis . . . (2) . . . Ea enim dignitas . . . universis honoribus antecellet; Prokop. BG 1,1,9 erwähnt beide Würden, da ja im Osten nachNovIust 62,2,1 (537) inter proceres nostros moris est patriciatus infulas consularifastigio anteponi, et in amplissimo senatu idem exemplum observandum est. 49 Zum Ausdruck praeregnare sei bemerkt, daß regnum bei Anonymus, ExcVal 37.38.39, für das römische kaiserliche imperium gebraucht wird, womit der weitere Ausdruck ad defendendam sibi Italiam (d. h. die Rechte des Kaisers in Italien geltend zu machen) in vollem Einklang steht. 90 Vgl. lord. Get. 288. 289; dazu E nsslin, Theoderich, 40—41. 91 Über die ethnische Zusammensetzung und Zahl des Gotenvolkes unter Theoderich ist die Forschung nicht einig, vgl. Schmidt , Ostg. 292. 360. 361; E nsslin, Theoderich, 66. Bei W olfram , Goten, 371 wird Ennod. 263 (paneg. Theod.) 26 (S. 206: 20—21): tunc a te conmonitis longe lateque viribus innumeros diffusa per populos gens una contrahitur für eine „Polyethnie“ angeführt, wo es gerade das Gegenteil heißt, da es um die siedlungsmäßige Zerstreutheit der Goten geht. Wenn die Formulierung des Ennodius „geradezu klassisch
39
staatsrechtlicher Sicht privatus, d. h. ein Magistrat mit Kommandogewalt über ein Föderatenheer, aber ohne fürstliche Gewalt über die Römer. Eine solche, letztgenannte, neuartige Gewalt durfte er erst dann innehaben, wenn ihm ein dominatähnliches Königtum auf römischem Boden gemeinsam über Römer und Goten bzw. Barbaren vom Kaiser zuerkannt und seine Einsetzung durch die Übersendung von Herrschaftsinsignien aus Byzanz vorgenommen worden war.52 Erst dann durfte er als
wirkt“ (S. 371 Anm. 51), so ist das richtig, doch nur wegen der dem klassischen Latein entsprechenden Manier des Ennodius, die mit einer „Polyethnie“ des Gotenvolkes freilich nichts zu tun hat. Ennodius weist mithin gewiß weder auf die Rugier Friedrichs noch auf andere Volkssplitter hin, die sich — wohl in Gemeinschaft mit den Rugiern — den Goten angeschlossen hatten, vgl. Eugipp. vSev 44,4 und Prokop. BG 3,2, 2, wo er die beibehaltene ethnische Selbständigkeit der Rugier, u. zw. mit Weiterbestehen ihres eigenen Volksnamens, betonte. Vgl. noch Schmidt , Ostg. 123. 366; bzw. 292 Anm. 4, wo er Ennodius wegen dessen „bombastischer“ monoethnischer Formulierung tadelt. ExcVal 72 für eine „Polyethnie“ heranzuziehen, W olfram , Goten, 371 Anm. 53, ist ebenso irrig, da es an der angef. Stelle des Anonymus um etwas ganz anderes geht: Theoderich sic enim oblectavit vicinas gentes, ut se illi sub foedus darent, aliae gentes sibi eum regem sperantes. Das gleiche Mißverständnis auch auf S. 373. Prokop sprach zuvor an der angef. Stelle über ein „Übergehen in das Gotenvolk“ (d. h. der Rugier) und benutzte dabei für das „Gotenvolk“ den Ausdruck Gotthon genos; dies bedeutet jedoch keineswegs die gens in technischem Sinne, was auch schon der Verweis auf den Rugiemamen beweist. Prokop benutzte ethnos und genos durchaus synonym, aber allerdings kommt nur ethnos bei Differenzierung unter mehreren Stämmen einer Völkerfami lie vor. Dabei verflicht er den ethnischen und den politischen Aspekt miteinander (deshalb schrieb er mitunter synonym laos). Zur erwähnten Stelle haben wir übrigens in einem parallelen Bericht ein direktes Synonym Prokops selbst, als er bei dem Anschluß der Rugier (er benutzte dafür das Verb anameignymi) das Gotenvolk präziser Gotthon stratos statt Gotthon genos bezeichnete, Prokop. BG 2, 14, 24. Wenn er darüber berichtete, daß die angeschlossenen Volkssplitter in das Herrschervolk unter dessen Namen ohne Beibehaltung ihrer eigenen Namen aufgegangen waren, benutzte er merkwürdigerweise weder genos noch ethnos für das Hauptvolk, sondern verwies nur auf die Namensübertragung selbst, wie bei der Einordnung der Alanen und anderer Splitter in das Vandalenvolk, Prokop. BV 1, 5, 21, wobei er das gleiche Verb wie bei BG 3, 2, 2 verwendete. (Die Titulatur Gelimers hieß trotzdem auch bei Prokop: „König der Vandalen und Alanen“, Prokop. BV 1,24,3.) Für die gleichwertige Synonymie von ethnos und genos bei Prokop seien hier die folgenden Stellen angeführt, wo genos wie ethnos benutzt wurde: Prokop. BP 1,19,28; 2,3,12; BV 2,12,28; 2, 21, 2; BG 1, 9, 6; 1, 12, 25; 3, 2, 2; 3, 8, 19; 3, 21, 9; 4, 5, 5; 4, 6, 3; ethnos ist nicht zu verzeichnen, da es passim vorkommt; genos in engerem Sinne, technisch benutzt für Bezeichnung der Abstammung: Prokop. BV 1, 11,9; 1,17,2; 2,4, 29; BG 3, 39, 21 ; 4, 3,17; 4, 8, 15. 21; 4, 10, 11; 4, 20, 12; 4, 31, 13; 4, 32, 31 (es gab ersichtlich eine „Periode“ in Prokops Stil im 4. Buch des BG, wo er genos in dieser Funktion mit Vorliebe verwendete). 52 Vgl. lord. Get. 295.
40
Gothorum Romanorumque regnator gelten, der regnum gentis sui et Romani populi principatum bekleidet — wie dies von Jordanes bzw. Cassiodor definiert wurde, wo der Terminus principatus nicht in römischem verfassungsrechtlichem Sinne verstanden wurde. Wie ich es früher begründet habe, hatte Jordanes den Terminus principatus als ein floskelhaftes paraphrasierendes Synonym des regnum benutzt, welches früher — ebenso floskelhaft-paraphrasiert — in den Romana bei der Variation des sog. Hesperia-Lemmas von Marcellinus Comes an Stelle des imperium (d. h. Romanae gentis) verwendet wurde.S3 Wie Prokop später zum Ausdruck brachte, sollte Theoderich „sich nach Italien begeben, Odoaker angreifen und die Herrschaft über den Westen dem Kaiser Zenon und den Goten verschaffen“ .54 Daß Zenon versprochen hatte, Theoderich nach der Besiegung Odoakers in ein Königtum über Römer und Goten einzusetzen, geht allerdings nur mittelbar und zweideutig aus der Jordanes-Stelle hervor, wonach Theoderich tertioque, ut diximus, anno ingressus sui in Italia Z enonem que imp. consultu privatum abitum suaeque gentis vestitum seponens insigne regio amictu, quasi iam Gothorum Romanorumque regnator, adsumit.5S Die unklare Fassung des Jordanes erklärt sich zufriedenstellend aus dem Umstand, daß es sich um eine illegitime Ausrufung handelte, zu der Theoderich durch das frühere bloße Versprechen des Kaisers noch keineswegs ermächtigt war. Die Entschul digungsabsicht der Jordanesschen Fassung geht aus „quasi iam“ klar hervor, deshalb läßt eigentlich auch diese Jordanes-Aussage keinen Zweifel über die Faktizität des Versprechens bestehen. Beachtenswert ist übrigens am Prokop-Text im Vergleich zur Jordanes-Fassung die
53 lord. Rom. 349 vgl. 345 bzw. Marc. Com. 476, 2; lord. Get. 295, mit dem nach römischen Kategorien richtigeren Ausdruck — wohl Cassiodors — Gothorum Romanorum que. regnator; bei Rom. 349 hatte Jordanes somit die andere, staatsrechtlich inadäquate Bezeichnung nach seinem eigenen Ermessen benutzt, vgl. M ommsen in ed. lord. 195 s. v. „princeps, principatus '; E nsslin, Theoderich, 116. 160—161. 164. Dazu s. noch Várady , Chiron 6,1976,477. 479 Anm. 20, in bezug auf principatus mit einer anderen Variation des vermutlichen Textes einer angenommenen Vorlage. 54 Prokop. BG 1, 1, 10: ten hesperian epikratesin hauto [d. h. dem Kaiser] le kai Gotthois porizesthai. 55 lord. Get. 295.
41
Beschränkung der in Aussicht gestellten Herrschaftskompetenz Theoderichs: An erster Stelle steht die Person des Kaisers als oberster Herrscher, an zweiter Stelle werden die Goten in ihrer Gesamtheit als Machtinhaber erwähnt, somit sind die Romani eng an den Kaiser gebunden. Wenn der Jordanes-Text durch seine Ausdrucksweise den Anschein erwecken sollte, als sei die Ausrufung Theoderichs zum König um 493 nach dem Ersuchen um Zenons Verfügung, auf Grund dessen wirklich erteilter Billigung erfolgt, so sieht der Tatbestand etwas anders aus. Diese Zustimmung blieb zuerst nach dem Ersuchen um 490/491 durch den caput senatus Festus,56 formell wegen der Unzulänglichkeit der Kriegserfolge gegen Odoaker, noch aus. Beim nächstfolgenden Ersuchen um 492/493 durch den magister officiorum Flavius Anicius Probus Faustus Niger war es ebenso,57 da der Nachfolger des 491 verstorbenen Zenon, Anastasios, seine Anerkennung gleichfalls verweigerte. Auf die Frage des Warum werde ich unten eingehen. Zunächst sei aber dieses in Aussicht gestellte, dann hartnäckig verweigerte, endlich jedoch selbst nach römischem öffentlichem Recht errichtete Königtum auf seinen Charakter geprüft. Die Ansatzpunkte zur gemeinrechtlichen Charakterbestimmung dieses Mischkönigtums, welches bereits Odoaker anstrebte, aber erst Theoderich tatsächlich erwerben konnte (zwar gar nicht problemlos, weder in bezug auf die Erwerbung, noch auf die Ausübung), ergeben sich aus der anfangs zitierten Jordanes-Stelle. Aufschlußreich sind darin die folgenden Feststellungen: Der Kaiser Zenon bzw. die Konstantinopeler Regierung betrachteten Italien als einen Gebietskomplex (partes) unter ihrer nominellen Herrschaft, der, weil praktisch von Barbarenvölkem überschwemmt, nicht mehr als ein von Römern beherrschtes Land gelten kann: cernens iam gentes illam patriam possidere. Dies ist an sich eine Tatsachenfeststel lung im klaren Bewußtsein der Lage, woraus hochwichtige Konsequenzen gezogen wurden. Die Unwiderruflichkeit und Endgültigkeit der unmittel baren barbarischen Herrschaft wurde durch die Stellung der anderen
56 Über diese Amtsgattung s. S tein, HBE II 44. 788—790; S tein mißt seine Einrichtung dem Odoaker bei, wohl mit Recht, da es ihm als ein Mittel zur legitimen Verfahrensweise in römischen Angelegenheiten dienen sollte, wie vermutlich auch dem Theoderich. 57 Vgl. E nsslin , Theoderich, 78; ExcVal 53. 57.
42
barbarischen Alternative gegen die Herrschaft der Odoakerschen gentes grundsätzlich anerkannt. Dieser Einschätzung der Lage gab auch der demographische Faktor eine besondere Veranlassung: die massenhafte Landnahme der Barbaren Odoakers. In den ethnischen Charaktermerk malen Italiens trat schon durch die Ansiedlung einer beträchtlichen Anzahl von dediticii-gentiles eine wesentliche Verschiebung zugunsten des barbarischen Anteils ein, der dann zur Zeit des Föderatensystems im Reichsinneren noch weiter zunahm, bis dessen Zustand allmählich einem äußeren föderierten Barbarenstaat ähnelte. Die Herrschaft über Italien einem Barbarenvolk zu überlassen, welches nur mit einem üblichen foedus mit Ostrom verbunden wäre, mußte indes einer völligen Preisgabe dieses für Byzanz so wichtigen Gebietskomplexes mit der Stadt Rom gleichkom men. Zugleich aber erwies sich wohl auch das Odoakersche Regime als immer ungünstiger für Byzanz, da ja Odoaker — in Ostrom persönlich unbekannt und von ihm unabhängig — sein ohnehin illegitimes Königtum allmählich zu einer praktisch ganz souveränen Herrschaft über die Präfektur Italiae, über Römer und Barbaren umzuwandeln bestrebt war. Nach diesen Bedenken dürfte die neue gemeinrechtliche Formel zustande gekommen sein, auf die mit den Worten der hochwichtigen Jordanes-Stelle gedeutet wurde: Der Kaiser Zenon maluit Theodorico ac si proprio iam clienti eam [d. h. Italien] committi quam illi [d. h. dem Odoaker] quem nec noverat.58 Dieser gewiß von Cassiodor verfaßten Definition nach war Theoderich „gleichsam Klient“ des Kaisers, wodurch auch die römisch-staatsrechtliche Natur seines Königtums in Italien mittelbar bestimmt war. Das heißt, es sei .ein Klientelkönigtum im Reichsinneren errichtet worden. Das ac si verweist wohl auf das Vorbereitungsstadium des Klientelkönigtums; das iam hingegen auf das bereits bestehende Klientelverhältnis Theoderichs zum Kaiser. Auf dieses Klientel Verhältnis beziehen sich eigentlich die Ausdrücke der fiktiven Ansprache des Ostgoten an Kaiser Zenon bei Jordanes (gleichfalls wohl nach Cassiodor): .expedit namque, ut ego, qui sum servus vester et filiu s , si vicero [d. h. in Italien], vobis donantibus regnum possedeam; haut ille, quem non nostis [d. h. den Odoaker], tyrannico iugo senatum vestrum partemque rei publicae captivitatis servitio premat, ego58 58 lord. Rom. 348.
43
enim si vicero, vestro dono vestroque m unere possedebo. . . “, wo die Fachausdrücke servus, filius, donum und munus ihre klientelmäßige Bedeutung haben, jedoch nicht nur nach römischem öffentlichem Recht.59 Die römische staatsrechtliche Begrifllichkeit dieses Verhältnisses deutet nur die eine Seite dieser Beziehung an. Als ein wichtiges Moment beim Zustandekommen des Klientelverhält nisses wird im Jordanes-Text der Umstand erwähnt, daß der Klient zu seinem patronus-dominus in p e rs ö n lic h e r Beziehung steht. Bei deren Fehlen dürfte das Mindestmaß des persönlichen Zuges im Klientelver hältnis die Abkunft von Personen oder enge Verwandtschaft mit jenen gewesen sein, die ihrerseits die Klientelstellung innehatten. Das war das größte Handikap Odoakers, quem [Zenon] nec noverat und in der Ansprache Theoderichs an Zenon: „quem non nostis". Die Bezeichnungen von Theoderichs Klientelverhältnis an der einen Stelle mit dem Terminus cliens, an der anderen mit servus et filius lassen darüber keinen Zweifel aufkommen, daß Jordanes-Cassiodor die römische und die barbarische Deutung und Bezeichnung dieses Beziehungskomplexes alternativ bzw. parallel verwendete. Bei den staatsrechtlichen Realisationen dieser Rechtsbegriffe sind wohl viele wesentliche Merkmale sowohl nach deren römischer wie nach deren barbarischer Auffassung gemeinsam. Es bestanden jedoch wichtige graduelle und qualitative Unterschiede unter den Klientelverhältnissen in barbarischer Beziehung, worauf hier nicht einzugehen ist. Es genügt festzustellen, daß der höchste Grad eines Klientelverhältnisses bei Barbaren die Stellung eines barbarisch-staats rechtlichen adoptiven Waffensohnes gewesen zu sein scheint. Die umfassende quellenmäßige Darstellung der eigenartigen Verflech tung der römischen privat- und staatsrechtlichen Klientel mit der barbarischen Institution des adoptiven Waffensohnes ist infolge der ungünstigen Quellenlage wohl kaum zu erwarten. Soweit es um den römischen Teil geht, steht allerdings fest, daß ein barbarischer Klientelkö nig weder die Stellung eines kaiserlichen Adoptivsohnes noch die eines kaiserlichen filius-caesar innehaben durfte. Von barbarischer Seite her bedurfte man hingegen des über alle Zweifel erhabenen adoptiven filius59 lord. Get. 291; fur die Bezeichnung Theoderichs als servus bei Jordanes vgl. M ommsen in ed. lord. 197 s.v. „servire, servus": de subditis qui domino militarem operam praestant.
44
per-arma-Verhältnisses offensichtlich nur wegen der Festlegung und Rechtfertigung der römischen Klientel, die sonst nach barbarischem Recht allein keine Gültigkeit gehabt hätte. In diesem Fall wäre die Sicherheit eines Klientelkönigs inmitten seines eigenen Volkes unter den neuen Umständen des späten 5. und des 6. Jahrhunderts stets gefährdet worden. Andererseits hätte auch der römische Teil keine Garantie für die Wahrnehmung der vertraglichen Verpflichtungen seitens des barbari schen Klientelkönigs gehabt. Bei Verträgen mit den Barbaren war die Annahme und Anwendung des barbarischen Protokolls schon seit langem üblich.60 Neu war hingegen bei den byzantinisch-barbarischen Klientel verträgen, daß der römische Teil am barbarisch-staatsrechtlichen Ver tragsakt aktiv teilgenommen hatte, u. zw. als Auctor in der führenden Rolle eines barbarischen Rechtsprozesses. Es handelte sich somit um eine am meisten dem mittelalterlichen Lehnswesen ähnliche staatsrechtliche Institution des spätrömisch-byzantinischen Reiches. Für die unterschiedlichen Stufen der Klientel ist es kennzeichnend, daß selbst im Jordanes-Text Klienten verschiedener Stellung Vorkommen: clientes in Mehrzahl neben amatores des jungen Theoderich;61 namentlich erwähnte Klienten unterer Stellung, manchmal sogar mit der Bezeichnung clientulus62, und Klienten in der Stellung eines Herrschers an anderen Textstellen. In dieser letzteren Kategorie ist es von neuem nachweisbar, daß bei führenden politischen Persönlichkeiten der Waffensohn bzw. filius in der Jordanesschen Terminologie auch mit dem Sammelbegriff cliens bezeichnet wird, wie es im Falle Theoderichs geschah. Hunimund wurde von Thiudimer als sein Waffensohn zum König der Sueben ernannt: Thiudimer . . . regem Hunimundum . . . adoptans sibi filium, remisit cum suis in Suavia.63 Eine andersartige Einsetzung als die des Hunimund erfolgte viel später auch seitens des Westgotenkönigs Theoderich II., als er
60 Siehe z. B. den Friedensvertrag mit den Alemannen um 354, Amm. 14,10,16: icto . . . foedere gentium ritu perfectaque sollemnitate; dieses Prinzip dürfte sich jedoch bei allen von Ammian mehr oder weniger ausführlich erwähnten Abkommen mit den Barbaren durchgesetzt haben. 61 lord. Get. 282. 62 lord. Rom. 328. 369: clientuli; Rom. 338: cliens Zenons, Domitianus, unter dessen Mitwirkung Iulius Nepos inthronisiert wurde. 63 lord. Get. 274.
45
457 seinen Klienten Agriwulf als Statthalter, d. h. an die Spitze der Sueben bestellte: Theoderidus . . . preponens Suavis, quos subegerat, clientem proprium nomine Agrivulfum. Das war folglich dem Statthalterauftrag an Theoderich durch Kaiser Zenon ähnlich: eine niedrigere Stufe der klientelen Herrschaft. Ein adoptiver filius durfte hingegen auf eine höhere Stufe solcher Klientelherrschaft Anspruch erheben: er sollte ein Klientel könig werden. Vermutlich hatte Agriwulf mangels entsprechender Voraussetzungen auf diese höhere Stufe keine Aussicht, deshalb ließ er sich eigenmächtig, tyrannica elatione superbiens, zum König ausrufen.64 Ganz in gleichem Sinne wie in den Jordanes-Schriften erscheint der Begriff filius auch bei Cassiodor (Variae). Dem armis filius factus Gesimund, dem sagenhaften Helden der Ostgoten, hatte diese Stellung eine königliche Herrschaft eingetragen,65 und der Herulerkönig Rodulf wurde gleichfalls per arma filius factus. An letztgenannter Stelle erfahren wir von Cassiodor, nach welchen Grundsätzen und durch welche feierlichen Förmlichkeiten die Inthronisierung eines Klientelkönigs unter barbarischen Partnern in dieser Epoche stattfand:66 (1) per arma fieri posse filium grande inter gentes constat praeconium, quia non est dignus adoptari, nisi fortissimus meretur agnosci... (2) Et ideo more gentium et conditione virili filium te praesenti munere procreamus, ut competenter per arma nascaris, qui bellicosus esse dinosceris. damus tibi quidem equos enses clipeos et reliqua instrumenta bellorum: sed quae sunt omnimodis fortiora, largimur tibi nostra iudicia. . . (3) Sume itaque arma mihi tibique profutura. Ille a te devotionem petit, qui te magis defensare disponit: proba tuum animum et opus non habebis obsequium. . . Es wird demnach festgestellt, daß es dabei um einen mos gentium, d. h. um eine Institution unter den Barbarenvölkem, gehe und im Rahmen der obligaten devotio des Klienten die Befolgung der iudicia des Patrons, d. h. der Gehorsam gegenüber diesen iudicia, das wichtigste Moment sei. Für die Verweigerung der devotio, d. h. der fides gegenüber dem Patron, ist sehr merkwürdig die Darstellung des Jordanes-Cassiodor67 von der
64 lord. Get. 233; vgl. Schmidt , Ostg. 381. 383.
65 Cassiod. var. 8, 9, 8 (526 fin.). *• Cassiod. var. 4, 2, 1—3 (507/511) Regi Erutorum Theodericus rex. ‘7 lord. Get. 233—234.
46
Treulosigkeit des oben erwähnten Agriwulf, (233) . . . qui in brevi animu praevaricatione Suavorum suasionibus commutans neglexit imperata conplere, potius tyrannica elatione superbiens credensque se ea virtute provinciam obtinere, qua dudum cum domino suo ea subigisset. vir siquidem erat Varnorum stirpe genitus, longe a Gothici sanguinis nobilitate seiunctus, idcirco nec libertatem studens nec patrono fidem reservans. (234) quo conperto Theodoridus [d. h. Theoderich II.] mox contra eum, qui eum de regno pervaso deicerent, destinavit. Weitere wichtige Schlüsse für den Charakter des Klientelkönigtums Theoderichs ergeben sich aus einer von Cassiodor verfaßten Urkunde, die im Namen des zehnjährigen Athalarich (526—534) an Kaiser Iustinus I. (518—527) gerichtet wurde.68 Unter anderem heißt es darin: (3) vos avum nostrum in vestra civitate celsis curulibus extulistis, vos genitorem meum in Italia palmatae claritate decorastis, desiderio quoque concordiae factus est per arma filius, qui annis vobis paene videbatur aequaevus, hoc nomen adulescenti congruentius dabitis, qualia [d. h. die Stellung eines per arma filius] nostris senioribus [d. h. dem Theoderich d. Gr. und Eutharich] praestitistis, in parentelae locum vester iam transire debet affectus: nam ex filio vestro genitus naturae legibus vobis non habetur extraneus. (4) Atque ideo pacem non longinquus, sed proximus peto, quia tunc mihi dedistis gratiam nepotis, quando meo parenti adoptionis gaudia praestitistis, introducamur et in vestram mentem, qui adpeti sumus regiam hereditatem, illud mihi est supra dominatum tantum ac talem rectorem habere propitium, primordia itaque nostra solacia mereantur principis habere longaevi: pueritia tuitionem gratiae consequantur et non in totum a parentibus destituimus, qui tali protectione fulcimur. (5) Sit vobis regnum nostrum gratiae vinculis obligatum, plus in illa parte regnabitis, ubi omnia caritate iubetis. quapropter ad serenitatem vestram illum et illum [ = NN] legatos nostros aestimavimus esse dirigendos, ut amicitiam nobis illis pactis, illis conditionibus concedatis, quas cum divae memoriae domno avo nostro inclitos decessores vestros constat habuisse. Theoderich, der nach der Schrift des Jordanes der cliens Zenons gewesen war, sowie Eutharich erscheinen hier unter der gleichwertigen
68 Cassiod. var. 8, 1, 3—5 (526 post Aug. 30) Iustino imperatori Athalaricus rex.
47
Bezeichnung per armafilius ( qualia [ nomina ] senioribus praestitistis ). Aus der Urkunde geht ferner hervor, daß beim Thronwechsel in den barbarischen Klientelkönigtümern der neue Herrscher einer vertragsmä ßigen Erneuerung des Klientelverhältnisses bedurfte. Erst im Falle einer adoptiven Verleihung der filius-per-arma-Stellung und einer klientelmä ßigen Inthronisierung unter den entsprechenden Vertragsbestimmungen fand er Anerkennung (hoc nomen . . . dabitis — adoptionis gaudia — sit ív
![Wittgenstein und die Folgen [1. Aufl.]
978-3-476-04934-6;978-3-476-04935-3](https://dokumen.pub/img/200x200/wittgenstein-und-die-folgen-1-aufl-978-3-476-04934-6978-3-476-04935-3.jpg)
![Kindai Bijutsu : Die Rezeption westlicher Kunstkonzepte in Japan um 1900 [1. Aufl.]
978-3-476-04786-1;978-3-476-04787-8](https://dokumen.pub/img/200x200/kindai-bijutsu-die-rezeption-westlicher-kunstkonzepte-in-japan-um-1900-1-aufl-978-3-476-04786-1978-3-476-04787-8.jpg)
![Nietzsche und die Folgen [2. Aufl. 2019]
978-3-476-04889-9, 978-3-476-04890-5](https://dokumen.pub/img/200x200/nietzsche-und-die-folgen-2-aufl-2019-978-3-476-04889-9-978-3-476-04890-5.jpg)
![Praktische Intelligenz und die Zweiteilung des Wissens [1. Aufl.]
978-3-476-04918-6;978-3-476-04919-3](https://dokumen.pub/img/200x200/praktische-intelligenz-und-die-zweiteilung-des-wissens-1-aufl-978-3-476-04918-6978-3-476-04919-3.jpg)
![Philosophische Psychologie um 1900 [1. Aufl. 2019]
978-3-476-05027-4, 978-3-476-05092-2](https://dokumen.pub/img/200x200/philosophische-psychologie-um-1900-1-aufl-2019-978-3-476-05027-4-978-3-476-05092-2.jpg)
![Die Vorschriften über die Prüfungen für den höheren Justiz- und Verwaltungsdienst in Bayern: Und die Vorschriften über die Praxis der geprüften Bewerber um Anstellung im höheren bayerischen Justizstaatsdienst. Mit einem Anhang, enthaltend die Studienpläne [Reprint 2021 ed.]
9783112413708, 9783112413692](https://dokumen.pub/img/200x200/die-vorschriften-ber-die-prfungen-fr-den-hheren-justiz-und-verwaltungsdienst-in-bayern-und-die-vorschriften-ber-die-praxis-der-geprften-bewerber-um-anstellung-im-hheren-bayerischen-justizstaatsdienst-mit-einem-anhang-enthaltend-die-studienplne-reprint-2021nbsped-9783112413708-9783112413692.jpg)