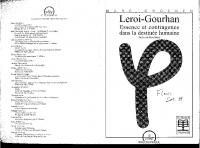Die phänomenologische Metaphysik Marc Richirs 346504553X, 9783465045533
Marc Richir (1943-2015) is one of the most authoritative phenomenologists of his generation with disciples all over the
112 38
German Pages 284 [285] Year 2020
Polecaj historie
Table of contents :
Front Cover
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Analytisches Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kap. I: Phänomen und Phänomenalisierung
Kap. II: Phänomenologie und Metaphysik
Kap. III: Sprache, Phantasie, Kreativität
Kap. IV: Leib und Leiblichkeit
Kap. V: Zeitlichkeit und Affektivität
Kap. VI: Räumlichkeit und Äußerlichkeit
Kap. VII: Die Stiftung der Idealität
Kap. VIII: Das phänomenologische Unendliche
Kap. IX: Transzendenz und Selbst
Kap. X: Richirs letztes Wort: Abständigkeit und Vibration
Schluss
Citation preview
RoteReihe Klostermann
Alexander Schnell Die phänomenologische Metaphysik Marc Richirs
Alexander Schnell · Die phänomenologische Metaphysik Marc Richirs
Alexander Schnell
Die phänomenologische Metaphysik Marc Richirs
KlostermannRoteReihe
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. Originalausgabe © 2021 · Vittorio Klostermann GmbH · Frankfurt am Main Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die des Nachdrucks und der Übersetzung. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, dieses Werk oder Teile in einem photomechanischen oder s onstigen Reproduktionsverfahren oder unter Verwendung elektronischer Systeme zu verarbeiten, zu vervielfältigen und zu verbreiten. Gedruckt auf Eos Werkdruck der Firma Salzer, alterungsbeständig ISO 9706. Druck und Bindung: docupoint GmbH, Barleben Printed in Germany ISSN 1865-7095 ISBN 978-3-465-04553-3
Für Anselm Aristée (über den Marc Richir gesagt hat, dass er sein Leben lang versuchen wird, vollkommen zu sein, um zu beweisen, dass er existiert)
Inhaltsverzeichnis Analytisches Inhaltsverzeichnis ........................................
9..
................................................................
19..
Einleitung
Kapitel I: Phänomen und Phänomenalisierung ...................... 43.. Kapitel II: Phänomenologie und Metaphysik ........................ 65.. Kapitel III: Sprache, Phantasie, Kreativität ........................... 89.. Kapitel IV: Leib und Leiblichkeit ...................................... 111.. Kapitel V: Zeitlichkeit und Affektivität ............................... 143.. Kapitel VI: Räumlichkeit und Äußerlichkeit ......................... 165.. Kapitel VII: Die Stiftung der Idealität
................................ 185..
Kapitel VIII: Das phänomenologische Unendliche ................. 215.. Kapitel IX: Transzendenz und Selbst ................................. 235.. Kapitel X: Richirs letztes Wort: Abständigkeit und Vibration ..... 257.. Schluss
.................................................................... 277..
Analytisches Inhaltsverzeichnis Einleitung Kurze Vorstellung des Phänomenologen Marc Richir. Richirs Verortung innerhalb der verschiedenen phänomenologischen Richtungen im Lichte von Tengelyis Begriff einer „denkerischen Erfahrung“. Das gemeinsame Grundmotiv von Richirs Neugründung der transzendentalen Phänomenologie und von den frühen Arbeiten der Protagonisten der Klassischen Deutschen Philosophie. Allgemeine Betrachtungen zur „phänomenologischen Metaphysik“. Richirs Auffassung einer solchen. Die Frage nach dem „transzendental-phänomenologischen Ursprung“ in der Phänomenologie: die „transzendentale Matrize“. Phänomen und Ereignis. Phänomen und transzendentales Subjekt. Das „Phänomenologische“ und die „symbolische Stiftung“. Das „Phänomenologische“ und das „Proto-Ontologische“ bzw. die „Affektivität“ innerhalb des „wilden phänomenologischen Feldes“. Die grundlegende Dualität innerhalb des Sinnbildungsprozesses zwischen „Schematismus“ und „wilden Wesen“ bzw. „Phantasien-Affektionen“. Schematismus, wilde Wesen und Phantasien-Affektionen. Negative und positive Charakterisierung des Schematismus. Die „wilden Wesen“ qua „phänomenologische Konkretheiten der Welt“. „Wilde Wesen“ und „Phantasien-Affektionen“. Die drei „Zustände des Philosophierens“ bei Richir (nach Patrice Loraux). „Inchoativität“, „Werk“ und „Nicht-Reduzierbares“ als drei „Zustände“ des Richir’schen Denkens, die auf die „transzendentale Matrize“ der Neugründung der transzendentalen Phänomenologie verweisen. Die Grundbestimmungen von Richirs Neugründung einer transzendentalen Phänomenologie (Ursprungshaftigkeit, Fließen, Zickzack-Bewegung, Retro-jektion).
10
Analytisches Inhaltsverzeichnis
Kapitel I Phänomen und Phänomenalisierung Richirs Grundauffassung der Phänomenologie. Die phänomenologische « Sache ». Epoché und Reduktion laut Richir. Die Zick-zackAnalyse. Das Verhältnis von Phänomenologie und Ontologie. Die Phänomenalisierung in den „Notes sur la phénoménalisation“ (1969–70). Die Entkopplung von „Phänomenalität“ und „Eidetizität“. Der „Kreis des Vor-Sehens“. Der „ontisch-ontologische Zirkel“. „Phänomenalisierung“ und „Schrift“. Phänomenalisierung und Architektonik. Die Architektonik als spezifischer Modus der Phänomenalisierung. Kapitel II Phänomenologie und Metaphysik Phänomen und Phänomenalität. „Phänomen“ und „Phänomenalisierung“ in „Le rien enroulé“ (1969–70). Die Abkopplung von Phänomenalität und Gegenständlichkeit. Das „Phänomen als ‚nichts als Phänomen‘“. „Phänomen“ und „Simulacrum“. Die transzendentale Konstitution qua „Retrojektion“. Richirs „negativer“ Metaphysik-Begriff und die „Sinnbildung“. Die „Fixierung“. Nochmals zum „Symbolischen“ und zum „Phänomenologischen“. Die „symbolische Tautologie“. Die „Phantasie(n)“. Richirs „positiver“ Metaphysik-Begriff: die „transzendentale Matrize“ und die „Doppelbewegung“ der Phänomenalisierung. Die „transzendentale Matrize“ des Phänomens. Die fünf Motive der „Doppelbewegung der Phänomenalisierung“ in „Le rien enroulé“: 1.) die Endogeneisierung des phänomenologischen Feldes; 2.) das „austretende Eintreten“ (= erste Doppelbewegung der Phänomenalisierung); 3.) das „Einrollen-Ausrollen“ (= zweite Doppelbewegung der Phänomenalisierung); 4.) Doppelbewegung von Einrollen-Ausrollen und Seinsabsetzung (= zweifache Doppelbewegung der Phänomenalisierung); 5.) die „Kehre der Sprache“ (im dichterischen Schreiben) als genuine Ausdrucksform der metaphysischen Phänomenologie. „Phänomen“ und „Schein“ in der ersten der Recherches phénoménologiques (1981). Die Zirkularität in der Korrelation von Denken und Sein. Der innere Bezug von „Transzendentalität“ und „Phänomenalität“. Die Zweideutigkeit der Husserl’schen Reduktion. Die Re-
Analytisches Inhaltsverzeichnis
11
duktion qua „Simulation“. Das Phänomen qua „Illusion“, „Simulacrum“ oder „Schein“. Die „innere Reflexivität“ des Phänomens. Der Scheincharakter des konstitutiven Apriori qua „transzendentale Illusion“. Die Phänomenalisierung qua „Sich-Erscheinen des Scheins als Schein des sich entziehenden Apriori“. Die fundamentale Rolle der „Retrojektion“. Der Status des „Simulacrums“. Die „ursprüngliche Verzerrung“ und die „Verzerrung der Verzerrung“. Die „Doppelbewegung der Phänomenalisierung“ in der ersten der Recherches phénoménologiques. Der architektonische „Ort“ der Phänomenalisierung diesseits der Unterscheidung von „Transzendentalität“ und „Ontologizität“. Der „‚Moment‘ des Erhabenen“. Richirs Gegenüberstellung von der „Doppelbewegung der Phänomenalisierung“ in den Frühschriften und des „‚Moments‘ des Erhabenen“ in den späten Werken. Vorblickende Betrachtungen auf die „augenblickliche Vibration“. Kapitel III Sprache, Phantasie, Kreativität Die Epoché und die hyperbolische phänomenologische Reduktion. Das „Denken“ als Phänomen. Der Genius malignus. Sprache und Simulacrum in Heideggers Auslegung Hölderlins. Der Genius malignus als Ursache der Fixierung des symbolisch Gestifteten. Das „Gestell“. Die „Reflexivität“ des sich bildenden Sinnes. Das „ontologische Simulacrum“ als Ausdruck des Husserl’schen und Heidegger’schen Subjektivismus. Entkopplung von „Selbigkeit“ und „Selbstheit“. Die „Erfahrung des Erhabenen“ in den Phänomenologischen Meditationen. Die „Zwischen-Apperzeptionen“ als „Organ der Phänomenalisierung“. Das Erhabene als „Grundstimmung“. Das Erhabene als Ursprung der Apperzeption des Selbst. Das Erhabene und der „symbolische Stifter“. Die Erfahrung des Unendlichen. Die „transzendentale Selbst-Zwischen-Apperzeption“. Die Analogie zwischen „Selbst“ und „symbolischem Stifter“. Die Grundunterscheidung von „Bildbewusstsein“ und „Phantasie“: Vorliegen (bzw. Nicht-Vorliegen) eines Bildobjekts. Die Phantasie als Grund der Nicht-Unterscheidung von Wirklichem und Unwirklichem. „Passive Synthesis“, „Urstiftung“ und „Apperzeption“ bei Husserl. „Phantasiebewegungen“ oder „-erscheinungen“, „passive Synthesen“ und „symbolische Stiftung“ (der Apperzeptionen und der Urstiftung) bei Richir.
12
Analytisches Inhaltsverzeichnis
Richirs Auffassung des „Sinns“ gegenüber jener bei Husserl und jener bei Heidegger. Die sprachliche Kreativität im Sinne der sprachlichen „Generativität“. Die Kritik an Husserls Eidetik. Die „Wesenstautologie“. Erneute Betrachtung der „wilden Wesen“. Richirs Sprachphänomen. Die drei Bezugsarten des Sprachphänomens. Sprachphänomen, „Transpossibilität“ und „Transpassibilität“ (Maldiney). Die Phänomenologie der Sprache und die Phänomenologie der Interfaktizität. Die Verflechtung der Sprachphänomene und der Phantasieerscheinungen. Die „perzeptive Phantasie“. „Perzeptive Phantasie“ und „aktive, nicht bildliche Mimesis von innen“. Husserls „Einverstehen“. Die auf die Vermittlung von „virtuellem Blick“ und „‚perzeptiver‘ Phantasie“ gegründete Urkommunikation als „archaischste transzendentale Matrize der Sprache“. Kapitel IV Leib und Leiblichkeit Die Grundfrage nach der „Individuation“ der „Leiblichkeit“ bei Merleau-Ponty und Richir. Merleau-Pontys Auffassung des „Eigenleibs“ als Erweiterung von Husserls Theorie der „Abschattungen“. „Leiblichkeit“, „Existenz“ und Sprache (Bedeutung) bei MerleauPonty. Vier entscheidende Aspekte des „Leibes“ bei MerleauPonty: 1.) das leiblich vermittelte In-der-Welt-Sein; 2.) die eigene Mobilität als „urtümliche Intentionalität“; 3.) die leibeigene Zeitlichkeit und Räumlichkeit und 4.) die sinnlich-affektive Dimension der ursprünglichen Welteröffnung. Richirs Analyse von Leib und Leiblichkeit. Die vier wesentlichen Problemfelder: 1.) die Funktion der Leiblichkeit in der „archaischen“ Sphäre der transzendentalen Subjektivität (Kritik an Levinas und Merleau-Ponty); 2.) die Grundbestimmungen der Leiblichkeit (die Leiblichkeit qua Assoziationsfundament der „sinnlichen Tendenzen“ und qua chora); 3.) Leiblichkeit und Affektivität (Leibhaftigkeit) (die Einflüsse Binswangers, Heideggers sowie der Anthropologien Lipps’ und Kolnais); 4.) die „Individuation“ der Leiblichkeit (Phantasieleib und Phantomleib) (anhand der Beispiele der Betrachtung eines Kunstwerks und der Fremderfahrung). Vier Veranschaulichungen des Bezugs von Phantasieleib und Phantomleib: 1.)
Analytisches Inhaltsverzeichnis
13
die Betrachtung einer schönen Landschaft, Korrelat einer Stimmung, 2.) das Korrelat des Bildobjekts, 3.) das Korrelat eines bloßen Bildes und 4.) der Leib des Sehens. Kapitel V Zeitlichkeit und Affektivität Der Ausgangspunkt von Richirs Zeitphänomenologie: die Versetzung der Intentionalität in den ihr genuin zugehörigen Kreisverlauf. Die drei (von Richir zurückgewiesenen) Voraussetzungen der Husserl’schen Zeitphänomenologie: 1.) die Beschränkung auf die Setzung (auf das „Positionale“); 2.) die kategorische Behauptung der Kontinuität der Zeit und 3.) die Beschränkung auf die „Erlebniszeit“. Die „sprachlichen wilden Wesen“. „Sprachliche Wesen“, „Phantasien-Affektionen“ und „‚perzeptive‘ Phantasien“. Die zwei „Quellen“ der Phantasie: „aisthesis“ und „Trieb“. Die Zeitigung der Phantasie. Vergleich mit Husserls Zeitphänomenologie in den Bernauer Manuskripten. Die Zeitigung „in Gegenwart“ (Husserl) und die Zeitigung „in Gegenwärtigkeit“ (Richir). Das „blinde Treiben“, die „ersten Affekte“ und die „zweiten Affekte“. Die „archaischste Form der Affektivität“. Der zweite Affekt als „exogen scheinender“. Die drei Charakteristiken der „Unumkehrbarkeit“ der Zeit laut Richir. Vertiefung der „Zeitigung in Gegenwärtigkeit“. „Reflexivität ‚mit Selbstheit‘“ und „Reflexivität ‚ohne Selbstheit‘“. „Sprachliche Zeitigung in Gegenwärtigkeit“ und „außersprachliche Proto-Zeitigung in Gegenwärtigkeit“. Die drei Stufen der Zeitlichkeit laut Richir. Kapitel VI Räumlichkeit und Äußerlichkeit Die Frage nach der „Verinnerlichung“ bzw. „Immanentisierung“. Die Rolle der „Doxa“ auf der räumlichen, bzw. der vor-räumlichen Ebene. Die Ur-Räumlichkeit der chora. Der „Urleib“. Die Doxa und die „erste Objektivierung“. Die Konstitution der räumlichen Äußerlichkeit durch den „zweiten, exogen scheinenden Affekt“ (= erste Objektivierung). Die Räumlichkeit des Leibes. Das Paradoxon des Leibes. „Alterität“ und „Äußerlichkeit“. Die Stiftung des (menschlichen) „Selbst“ und der ersten Alterität durch den „Blickaustausch“. Die Bedeutsamkeit der Analysen des Blickaustauschs:
14
Analytisches Inhaltsverzeichnis
1.) Herstellung des Kontrasts zur reflexiven Philosophie; 2.) Herausstellung des Unterschieds zur Psychoanalyse Lacans; 3.) Formulierung einer Definition des Menschen im Rahmen einer phänomenologischen Anthropologie. Die Konstitution des „räumlichen Außen“ qua „wirkliche Äußerlichkeit“ (= zweite Objektivierung). Definition des „Grundelements des Schematismus“. Die Rolle dieses „Grundelements“ bei der Konstitution des „räumlichen Außen“. Das „Grundelement“ und der „Übergangsraum“. Das „Grundelement“ und der „Schematismus“. Die Stiftung des (Raum)punktes. Die drei Arten von Punkten bzw. „Stufen der Monade“: der „metaphysische“, der „mathematische“ und der „physikalische“ Punkt. Das „Flimmern“ von Punkt und verräumlichender distentio (= „Ausdehnung“). Die drei Thesen Richirs zur Raumkonstitution. Kapitel VII Die Stiftung der Idealität Der erste Ansatz von L’institution de l’idéalité. Die hervorgehobene Rolle des „Schematismus“ bei der Erklärung des Status der Idealität. Richirs Auslegung der §§ 86–89 von Erfahrung und Urteil. Die universalitäts- und apriorizitätsstiftende Funktion der eidetischen Variation laut Husserl. Eidos und „kategorische Hypothetizität“. Die Rolle der Phantasie für die Stiftung der Idealität. Die „passive Vorkonstitution“ des „dritten Begriffs“ in der Stiftung der Idealität. Das Ungenügen des Husserl’schen Ansatzes. Richirs Vertiefung der Problematik (indem die Rolle der „reinen Phantasie“ bei der Stiftung der Idealität genauer erläutert wird). Der Unterschied zwischen dem eidos und jeder Art des „Bildes“. Die Rolle des Schematismus in der Stiftung der Idealität. Die „Matrize der Idealität“. Die „schematische Einprägung“ bzw. das „schematische Bild“. Das eidos qua unzugängliche Grundlage des „schematischen Bildes“ (= Bild „zweiten Grades“) des intelligiblen (unsichtbaren/nicht sinnlichen) „Gegenstandes“ und die hervorgehobene Rolle der „architektonischen Transposition“ in dieser gesamten Konfiguration. Die „Zusätze und Verbesserungen“ zu L’institution de l’idéalité. Die Rolle der „‚perzeptiven Phantasien‘“ für die Stiftung der Idealität. Die Zirkularität zwischen „Vorbild“ und eidos. Das „Flim-
Analytisches Inhaltsverzeichnis
15
mern“ der „‚perzeptiven‘ Phantasien“ mit dem „Element des Intelligiblen“. Die Rolle der „schematischen Fetzen“ bei der Stiftung der Idealität. Das „Flimmern“ dieser „Fetzen“ zwischen ihrem darstellbaren und ihrem nicht darstellbaren Teil. Die „schematische Einprägung“ qua „‚perzeptive‘ Phantasie“ (und nicht mehr qua „Bild zweiten Grades“). Die Frage nach der Bestimmung des Verlaufs der Variation. Die unterschiedlichen „architektonischen Transpositionen“ in der Stiftung der Idealität. Der „endogene“ Status des Kongruenzprinzips zwischen den Bildern. Der Sinn des „Variationsverlaufs“ (und seine Folgen für die „Wesensschau“). Drei Parallelen zwischen den Analysen zum Status der Phantasie und jenen zur Stiftung der Idealität. Die Rolle der „architektonischen Transposition“ des „Grundelements“ in das „Element des Intelligiblen“ bei der Stiftung der Idealität. Der zweifache Status des „Selbst“ in der Stiftung der Idealität. Die „Selbstheit“ des Sinns und der Sprache. Der Charakter des „Übergangs“ der „‚perzeptiven‘ Phantasien“. Das „Selbst“ der „‚perzeptiven‘ Phantasien“. Die Rolle des (cartesianischen) „Zeitpunkts“ in der Stiftung der Idealität. Die Rolle des „phänomenologischen Erhabenen“ in der Stiftung der Idealität. Die Zeitigung des Flimmerns der „‚perzeptiven‘ Phantasie“ mit dem „Element des Intelligiblen“. Die Rolle des „eidetischen Siebs“ und des „Zeitsiebs“ bei der Stiftung der Idealität. Drei bedeutsame Vertiefungen bezüglich der Stiftung der Idealität in Fragments phénoménologiques sur le langage: 1.) in Bezug auf den Status des Verlaufs der eidetischen Variation (und auf sein Verhältnis zur „kontinuierlichen Schöpfung“ Descartes’); 2.) bezüglich der Rolle der „‚perzeptiven‘ Phantasie“ (qua „endogenem“ Kongruenzprinzip zwischen den „Bildern“); und 3.) den „phänomenologischen Schematismus der Phänomenalisierung“ qua „vereinheitlichendem Faktor“ der „Bilder“ betreffend. Die Verbindung zwischen den sprachlichen „‚perzeptiven‘ Phantasien“ und den außersprachlichen archaischsten Phantasien. Der Bezug von „wilden Wesen“, Phantasien (bzw. „‚perzeptiven‘ Phantasien“), (sprachlichen und außersprachlichen) phänomenologischen Schematismen, Affektivität und Selbst. Die zweifache Struktur der schematischen Einprägungen und die zweifache „Sachlichkeit“ im Herzen der Stiftung der Idealität. Richirs Definition des eidos: „Knoten von schematischen Einprägungen, in denen sich unbestimmte schematische
16
Analytisches Inhaltsverzeichnis
Fetzen kreuzen“. Die Rolle des „Schematismus der sich wiederholenden Wiederholung“ in der Stiftung der Idealität. Kapitel VIII Das phänomenologische Unendliche Tengelyis „diakritische Phänomenologie“. Tengelyis Konzeption des Unendlichen. Richirs Rekonstruktion von Levinas’ Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. Die „Diachronie“. Die „Substitution“. Die „Illeität“. Der „Prophetismus“. Ziel dieser Auseinandersetzung: Klärung des Gedankens der „inneren Verunendlichung“ der Phänomenalität. Richirs Kritik an Levinas. Erneute Betrachtung der „symbolischen Tautologie“. Der „symbolische Stifter“. Aufweisung der Idee, dass der „‚Moment‘ des Erhabenen“ die Grenzen des Levinas’schen Ansatzes zu überwinden gestattet. Das phänomenologische Unendliche und die Sinnbildung. Kapitel IX Transzendenz und Selbst Die „architektonischen Gebote“ bezüglich der Einführung der Begriffe der „Transzendenz“ und des „Selbst“. Die verschiedenen Dualismen, in denen sich der „archaische chorismos“ dekliniert. Die vierfache Funktion der „absoluten Transzendenz“: 1.) sie eröffnet den Sinn; 2.) sie ist die Bedingung für die symbolische Stiftung; 3.) sie eröffnet den Referenten der Sprache (= die „physisch-kosmische Transzendenz“, die ihren Ursprung in Schellings Naturphilosophie hat); 4.) sie konstituiert das Selbst. Der kantische Ursprung des „phänomenologischen Erhabenen“. Die Auseinandersetzung zwischen Fichte und Schelling über den Status des „Selbstbewusstseins“. Nochmals zur „Selbigkeit“ und zur „Selbstheit“. Das „Selbst“ und das „Sich“. Das „Sich“ in Fichtes Bildlehre. Das „Sich-Haben“ und die Affektivität (Heidegger). Das „Erhabene“ und das „Selbst“ laut Richir. Die den „‚Moment‘ des Erhabenen“ charakterisierende Doppelbewegung (qua „Systolē“ und „Diastolē“) auf dem Grund des „Selbst“. Die zweifache Unterbrechung im „‚Moment‘ des Erhabenen“. Die die Reflexion ermöglichende „absolute Transzendenz“. „Schematismus“ und „transzendentale Interfaktizität“. Der „transzendentale Schoß“.
Analytisches Inhaltsverzeichnis
17
Kapitel X Richirs letztes Wort: Abständigkeit und Vibration Richirs Problem des „Ursprungs“ qua „phänomenologische Genese des Anfangs“. Erneute Betrachtung der „transzendentalen Matrize der Phänomenalisierung“. Die Neuorientierung des Transzendentalismus bei Richir. Letztmaliger Rückgang auf den „‚Moment‘ des Erhabenen“. Die Affektivität. Die absolute Transzendenz. Das zweifache Flimmern des cartesianischen Augenblicks. Das Flimmern zwischen cartesianischem Augenblick und Husserl’schem Zeitpunkt. Die symbolische Tautologie in Husserls Zeitphänomenologie. Erste Annäherung des „differenziellen Abstands“ für die Klarstellung des phänomenologischen Status der Wörter der gestifteten Sprache und des dichterischen Ausdrucks. Der differenzielle Abstand. Das Flimmern zwischen cartesianischem Augenblick und Augenblicklichem (= Platons exaiphnès). Die „zwei Versionen“ des cartesianischen Augenblicks. Der cartesianische Augenblick qua (Er)schein(ung) des zwischen Schein des Nichts und Simulacrum des Seins flimmernden Simulacrums. Das Simulacrum des cartesianischen Augenblicks qua Sitz der „‚perzeptiven‘ Phantasien“. Das „phänomenologische ‚Als‘“. Die augenblickliche Variation. Die sich verdoppelnde Verdopplung als Hauptcharakteristikum der augenblicklichen Variation. Die Vibration als „Überbrückung im Augenblick“ jeglichen Abstands. Der Status der „Negativität“ in der augenblicklichen Vibration. Die Vibration qua Vibration „von Nichts zu Nichts“. Die Überbrückung. Die „physisch-kosmische absolute Transzendenz“. Letzte Bemerkungen zur „physisch-kosmischen absoluten Transzendenz“ und zur „absoluten Transzendenz“. Schluss Die neun Hauptassertionen dieser Untersuchung: Die Assertion zum Verhältnis von Phänomenalität und Eidetizität des Bewusstseinserlebnisses. Die Assertion zur Phänomenalisierung. Die Assertion zum Ursprung der Sprache. Die Assertion zur Leiblichkeit der Sinnbildung. Die Assertion zur Zeitphänomenologie. Die Assertion zur Raumphänomenologie. Die Assertion zur Stiftung der Idealität. Die Assertion zum phänomenologischen Unendlichen bzw. Erhabenen. Die Assertion zum Ursprung der Sinnbildung.
18
Analytisches Inhaltsverzeichnis
Die zwei Hauptrichtungen, die sich in Richirs Neugründung der Phänomenologie herauskristallisieren: 1.) Die („präimmanente“) Korrelation diesseits des klassischen Subjekt-Objekt-Bezugs. 2.) Die „transzendentale Matrize“. Tafel der verschiedenen Ausarbeitungen einer „transzendentalen Matrize“, die das gesamte Werk Richirs durchziehen. Aufweis des gegenseitigen Bezugs von „präimmanenter Korrelation“ und „transzendentaler Matrize“. Richirs Beitrag zum Denken der „Alterität“.
Einleitung Marc Richir ist ein 1943 in Belgien geborener Phänomenologe, der 2015 in Südfrankreich – unweit seines Wohnortes, an dem er fast ein halbes Jahrhundert verbracht hat – verstorben ist. Forscher am belgischen Fonds de la Recherche Scientifique, Professor an der Université Libre de Bruxelles, hat er sein Leben ganz dem Verfassen zum Teil hochkomplexer Schriften gewidmet. Sein in französischer Sprache veröffentlichtes Werk1 umfasst dabei mehr als 10 000 Druckseiten. Die Richir-Forschung ist seit Jahren vor allem im französischen und spanischen Sprachraum voll im Gange. In Deutschland läuft sie seit kurzem an.2 Eine ausschließlich Richir gewidmete Monographie lag für das deutschsprachige Publikum bislang noch nicht vor.3 Dieses Buch soll diese Lücke schließen. Richirs Werk hat die etwas ungewöhnliche Eigenschaft, sich offenbar an zwei sehr unterschiedliche Adressaten zu richten. Auf der einen Seite spricht es das phänomenologisch interessierte Fachpublikum an, das Richirs Fortführung der phänomenologischen Tradition insbesondere im Anschluss an Husserl, Heidegger und Merleau-Ponty zu folgen gewillt ist. Auf der anderen Seite wird dieses 1 Die bislang einzige Übersetzung eines seiner Hauptwerke ist J. Trinks zu verdanken: Phänomenologische Meditationen. Phänomenologie und Phänomenologie des Sprachlichen, Wien, Turia & Kant, 2000. 2 2019 wurde an der Bergischen Universität Wuppertal das Marc-RichirArchiv eröffnet, das den gesamten Nachlass Richirs sowie dessen private Handbibliothek der Forschung zugänglich macht. 3 Die von L. Tengelyi verfassten Kapitel zu Richir, die in seinem gemeinsam mit H.-G. Gondek publizierten Band Neue Phänomenologie in Frankreich, Berlin, Suhrkamp, 2011, erschienen sind, stellen freilich bereits eine exzellente Einleitung zu Teilen des Werkes Richirs dar. Unbedingt zu nennen ist ferner P. Flock, Das Phänomenologische und das Symbolische. Marc Richirs Phänomenologie der Sinnbildung, Reihe Phaenomenologica, New York, Springer (im Erscheinen), das die erste bedeutsame Monographie zu Richir in deutscher Sprache sein wird. F. Erhardt hat schließlich 2020 an der Bergischen Universität Wuppertal seine ausgezeichnete Inauguraldissertation Doppelte Nicht-Koinzidenz. Zu Marc Richirs „Denken der Phänomenalisierung“ vorgelegt.
20
Einleitung
Werk aber auch – dank seines sehr weiten Themenspektrums (Transzendentalphilosophie, Metaphysik, politische Philosophie, Strukturalismus und Post-Strukturalismus, Anthropologie, Mythologie-Forschung, Psychopathologie, Musik, Literatur, Poesie usw.) – außerhalb phänomenologischer und zum Teil auch außerhalb philosophischer Kreise rezipiert. Im Folgenden soll insbesondere auf Richirs Neugründung der transzendentalen Phänomenologie eingegangen werden. Dabei wird zumindest unterschwellig deutlich werden, dass Richirs Versuch, die transzendentale Phänomenologie an die Klassische Deutsche Philosophie4 zurückzubinden, höchst bedeutsame Beiträge zu einer phänomenologischen Metaphysik zu liefern vermag. Zu zeigen, wie sich das – auf eine operative und differenzierte Weise – darstellt, ist eines der vornehmlichen Anliegen dieser Abhandlung. * Einleitend ist, was Richirs Position innerhalb einer Verortung der verschiedenen phänomenologischen Grundrichtungen angeht, auf Tengelyis bedeutsames Schlusswort in Erfahrung und Ausdruck zu verweisen.5 Tengelyi hatte dort hervorgehoben, dass die Phänomenologie grundlegend als „denkerische Erfahrung“ angesehen werden muss. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass sie je eine Erfahrung ist, die man mit den den jeweiligen thematischen Gegenständen zugrunde liegenden Denkfiguren macht. Diese „Denkfiguren“ entsprechen den der „Erfahrung des Bewusstseins“ zugänglichen „Gestalten“, von denen in Hegels Phänomenologie des Geistes die Rede ist und die jene Momente in der Philosophiegeschichte bezeichnen, die von bleibender systematischer Bedeutung sind. 6 Eine solche 4 Dieser Aspekt wird insbesondere in den letzten beiden Kapiteln zur Sprache kommen. 5 L. Tengelyi, „Phänomenologie als denkerischer Ausdruck der Erfahrung“, in Erfahrung und Ausdruck. Phänomenologie im Umbruch bei Husserl und seinen Nachfolgern, „Phaenomenologica“, Nr. 180, Dordrecht, Springer, 2007, S. 348–352. Ich danke Inga Römer für diesen wertvollen Hinweis. 6 Der Unterschied zwischen Tengelyis Ansatz und jenem von Hegel liegt darin, dass bei letzterem eine Denkfigur im Rahmen der dialektischen Logik in die nächste hineinführt, während es ersterem darum geht, dass wir uns klassische, uns prägende Denkfiguren bewusst zu machen und diese an unserer Erfahrung zu prüfen haben – die Differenz oder die Spannung, die
Einleitung
21
„denkerische Erfahrung“ hat Richir in der Tat mit den Protagonisten der Klassischen Deutschen Philosophie gemacht. Worin besteht sie? Das Aufzeigen dieser denkerischen Erfahrung kann vielleicht nicht als alleiniges Kriterium für die Bestimmung der unterschiedlichen phänomenologischen Richtungen herhalten, es hat aber doch eine wesentliche Funktion. Von dem Zeitpunkt an, als Daubert, Reinach und andere nach dem Erscheinen der Logischen Untersuchungen Husserl nach Göttingen gefolgt sind, Husserl selbst aber zwischenzeitlich seine „transzendentale Wende“ vollzogen hatte, ist es üblich, zwischen einer „realistischen“ und einer „transzendentalen“ Phänomenologie zu unterscheiden. Man könnte7 als Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen beiden festhalten, dass die eine Richtung – die des „phänomenologischen Realismus“ – sich erstrangig den Gegenständen zuwendet und es sich zur Aufgabe macht, deren Konstitutionsweisen zu bestimmen. Zu diesen Gegenständen gehören alles konkret Erfahrbare aber auch etwa die „Idealitäten“ und „Wesen“ (eidé). Eine zweite Richtung (und diese scheint mit dem Grundanliegen Husserls nach der transzendentalen Wende aber auch mit Heidegger deutlich treffender übereinzustimmen) erweitert die phänomenologische Thematik sowie ihr genuines Forschungsfeld über die gegenstandsbezogene Sichtweise hinaus in Richtung dessen, was man (wie Fink und Richir) die „Phänomenalisierung“ nennen kann. Hier geht es nicht nur um Aufklärung des Sinnes der Gegenstände, sondern auch – und „letztursprünglich“ – um das Erscheinen qua Erscheinen, um die „phénomènes comme rien que phénomènes [Phänomene als nichts als Phänomene]“, wie Richir oft geschrieben hat. Dies ist Aufgabe und Bereich einer transzendentalen Phänomenologie – und zwar seit Husserls Wende zur „Präphänomenalität“ bzw. „Präimmanenz“, wie das in seinen Zeitanalysen zuerst zum Ausdruck gebracht wurde. Man könnte aber eben auch, wie gesagt, auf die spezifische „denkerische Erfahrung“ hin-
wir hierbei erfahren, ist dann genau das Phänomenologische und vom Phänomenologen zu Bedenkende. Ich danke Inga Römer für diesen Hinweis wie auch für die vervollständigende Bemerkung in der übernächsten Fußnote. 7 Vgl. v. Vf. Seinsschwingungen. Zur Frage nach dem Sein in der transzendentalen Phänomenologie, Tübingen, Mohr Siebeck, 2020, S. 170f.
22
Einleitung
weisen, die von den einzelnen Phänomenologen jeweils in den Vordergrund gerückt werden.8 Und dabei erweist sich, dass jene „transzendentale Wende“ Husserls weit über den Gedanken hinausgeht, dieser habe nach den Logischen Untersuchungen unter dem Einfluss des Neukantianismus gestanden. Was als Grundfolie der als transzendentaler Idealismus verstandenen Phänomenologie dient, ist ein Grundmotiv der Klassischen Deutschen Philosophie: nämlich der Gedanke, dass der Begriff des „Transzendentalen“ sich nicht lediglich auf eine Erkenntnisbedingung beschränken kann, sondern eine genuin „transzendentale Erfahrung“ (dies ist ein bekannter Ausdruck Husserls) geltend machen muss. Und das impliziert wiederum, dass man sich gerade nicht mit dem unmittelbar Erscheinenden begnügen darf, sondern die (transzendentale) Erscheinungsmöglichkeit des Erscheinens selbst qua Erscheinens zum Thema macht. Dies hat nicht in der durch Epoché und Reduktion eröffneten phänomenologischen Sphäre – jener der „Immanenz“ – statt, sondern spielt sich gleichsam „unterhalb“ derselben ab. Husserl selbst hat in den angesprochenen Zeitanalysen hierfür, wie gesagt, den Begriff der „Präimmanenz“ bzw. „Präphänomenalität“ geprägt. Und nicht weniger deutlich stellt sich das auch in Heideggers Analysen einer „ursprünglichen Zeitlichkeit“ dar, die nicht nur unterhalb der objektiven Zeitlichkeit, sondern auch unterhalb der „Weltzeit“ bzw. „besorgten Zeit“ angesiedelt ist. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Zeitanalysen der Gründerväter der Phänomenologie sich mit dem Grundmotiv des frühen Fichte (und in der Folge auch des frühen Schelling und Hegel) kreuzen – nämlich in der Aufweisung einer genuinen Erfahrung des Transzendentalen, was insbesondere miteinschließt, dass dieses einen eigenen Erfahrungsbereich ausmacht, der sich keinesfalls (wie bei Kant) auf eine logische „Bedingung der Möglichkeit“ beschränkt. Und genau einer solchen Erfahrbarkeit sowie dem Ausloten der präphänomenalen aber auch präintentionalen Fungierungsleistungen der Sinnbildung ver-
8 Es gibt nämlich bestimmte Probleme, allen voran die Zeitproblematik, welche die Phänomenologie von innen heraus an ihre Grenzen führen. Eben diese Grenzphänomene vermag Richir dadurch präziser zu fassen und in ihrer Tragweite zu erörtern, weil er sie vor dem Hintergrund von Denkfiguren versteht, die aus der Klassischen Deutschen Philosophie stammen.
Einleitung
23
schreibt sich Richir nun in seiner „Neugründung der transzendentalen Phänomenologie“, mit der er an Grundintentionen Finks, Husserls und Heideggers anschließt, deren Ausarbeitungen er zugleich aber auch in völlig neue Richtungen weiterentwickelt. * Richir geht in seinem Denkansatz von zwei ursprünglichen Voraussetzungen aus. Der phänomenologische Diskurs erscheint ihm zum einen als derart selbständig und autonom, dass er keiner eigenen Rechtfertigung und nicht einmal besonderer Vorkehrungen etwa gegenüber den phänomenologisch weniger geschulten Leserinnen und Lesern bedarf, weil Richir schlicht davon überzeugt ist, dass die Grundfragen der philosophia perennis und der Phänomenologie zusammenfallen. Zum anderen erwartet er von seinen Leserinnen und Lesern, dass sie den von ihm aufgewiesenen, weit verästelten und teilweise ungewohnte Wege beschreitenden Sinnbildungsprozessen folgen, so wie das etwa auch beim Studium von Husserls Arbeitsmanuskripten erforderlich ist, die ihrerseits häufig weder Anfang noch Ende haben. Richir verlangt dabei ganz offensichtlich (wenn auch unausgesprochen), dass sie sich auf die gleiche Verständnisebene begeben wie er selbst – sowohl, was die von ihm mehr oder weniger explizit zitierte Literatur der philosophischen Klassiker, als auch was sein eigenes Werk (!) betrifft. Umso mehr ist es geboten, Brücken zu schlagen und dieses Werk dem Publikum – und das heißt zunächst: den phänomenologisch interessierten Leserinnen und Lesern – zu öffnen. Eine weitere Absicht der vorliegenden Studie ist es, bei der Lösung dieser vorbereitenden Aufgabe mitzuwirken. Zwar erfreut sich die Metaphysik – außerhalb der phänomenologischen Forschung, aber auch innerhalb derselben – seit einiger Zeit wieder erhöhter Aufmerksamkeit. Damit ist aber noch nicht ausgemacht, ob mit der Idee einer „phänomenologischen Metaphysik“9 nicht doch vielleicht Unvereinbares zusammengeführt werden
9 Siehe u. a. G. Funke, Phänomenologie – Metaphysik oder Methode?, Bonn, Bouvier, 1966; Phénoménologie et métaphysique, J.-L. Marion, G. Planty-Bonjour (Hsg.), Paris, PUF, 1984; La phénoménologie comme philosophie première, K. Novotny, A. Schnell, L. Tengelyi (Hsg.), Mémoires des Annales de
24
Einleitung
soll. In der Tat: Handelt es sich dabei nicht um eine contradictio in adiecto bzw. um ein Oxymoron?10 Auf der methodologischen Ebene jedenfalls – ohne sogleich in die von Husserl aufgeworfenen Schwierigkeiten einzusteigen, wie das Verhältnis von der als „erste Philosophie“ verstandenen Phänomenologie (= die „transzendentale Wesenswissenschaft“ qua „Wissenschaft der Möglichkeit“) zu eben dieser Phänomenologie, sofern sie als „zweite Wissenschaft“ aufgefasst wird (= „Wissenschaft der Einheit und Totalität des Wirklichen“ qua „Wissenschaft der faktischen Wirklichkeit“11), aufzufassen ist – scheint die „deskriptive“ Herangehensweise der Phänomenologie letztlich mit der metaphysischen Spekulation unvereinbar zu sein. 12 Wenn man dagegen den Standpunkt vertritt, die Phänomenologie komme ganz da zu sich selbst, wo sie an ihre metaphysischen Grenzbereiche stößt, was eine Infragestellung des Vorrangs und der
Phénoménologie, Band X, Amiens/Praha, 2011; Phänomenologie und Metaphysik – Phénoménologie & Métaphysique, I. Römer, A. Schnell (Hsg.), Hamburg, Meiner, „Beihefte zu den ‘Phänomenologischen Forschungen’“, 2020; Phänomenologische Metaphysik. Konturen eines Problems seit Husserl, T. Keiling (Hsg.), Tübingen, Mohr Siebeck, utb, 2020. 10 Siehe hierzu die exzellenten Studien von I. Römer, „Was ist phänomenologische Metaphysik?“, in Welt und Unendlichkeit. Ein deutsch-ungarischer Dialog im memoriam László Tengelyi, M. Gabriel, C. Olay, S. Ostritsch (Hsg.), Freiburg/München, Alber, 2017, S. 115–129; „La métaphysique des faits originaires à l’épreuve d’une hénologie brisée. Deux amorces dans l’œuvre de Husserl“, Annales de phénoménologie – Nouvelle série, Nr. 17/2018, S. 57–70. Vgl. auch T. Keiling/T. Arnold, „Einleitung – Phänomenologische Metaphysik?“, in Phänomenologische Metaphysik. Konturen eines Problems seit Husserl, op. cit., S. 1–19. 11 Siehe die zweite Vorlesung des ersten Teils von Erste Philosophie (Husserliana VII, S. 13f.). Siehe auch L. Tengelyi, Welt und Unendlichkeit. Zum Problem phänomenologischer Metaphysik, Freiburg/München, Alber, 2014. 12 Fink geht sogar so weit zu behaupten, dass die Husserl’sche Art, Phänomenologie zu betreiben, mit der Metaphysik unvereinbar sei – hierfür wäre zunächst vonnöten, dass sich jene ihrer ungerechtfertigten Voraussetzungen entledige. Für Fink habe Husserls Phänomenologie keinen authentischen Bezug zur Metaphysik und ihrer Geschichte: Sie sei nicht bloß eine Ablehnung der Metaphysik, sondern zudem auch eine irrige Interpretation derselben, siehe E. Fink, „Elemente einer Husserl-Kritik (Frühjahr 1940)“, Fink-Archiv der Universität Freiburg, Signatur „E 15/441“ (bzw. HusserlArchiv, Leuven, Signatur „Y Fink“).
Einleitung
25
universalen Tragweite der beschreibenden („deskriptiven“) Vorgehensweise zur Folge hat und dadurch ein Vorstoßen zu Fragen nach den spekulativen Grundlagen der Phänomenologie mit sich bringt, dann kann man zu der Auffassung gelangen, dass eine radikale Phänomenologie letztlich die Metaphysik doch berührt, wenn nicht gar mitumgreifen muss. Das ist jedenfalls die Ausrichtung, gemäß derer bei Richir der Versuch einer „Neugründung“ der Phänomenologie verfolgt wird.13 Zugleich hat Richir selbst aber der Metaphysik gegenüber stets gewisse Vorbehalte gehabt – unter anderem auch aufgrund einer Bemerkung Derridas, die ihn nicht wenig irritiert hatte.14 Neben Max Loreau15 war es Derrida, der ihn zum Denken der „Mobilität“, der „Pluralität“, bzw. der „Differenzialität“ und der „Vibration“ gebracht hat – und dieser Derrida hatte ihn nun als Metaphysiker bezeichnet! Diese Anekdote ist für die „Sache“ – in diesem Fall: für das Problem des Bezugs zum „Archaischen“, zum „Ursprung“, zum „Anfang“ – natürlich zweitrangig. Es gilt vielmehr, diesem Bezug Rechnung zu tragen, ohne dieses Archaische zu „verdrehen [distordre]“, bzw. es geht darum, davon zu handeln, und dabei stets mitzubedenken, dass der Zugang dazu nur durch eine solche „Verdrehung“, „Transposition“ oder „Transmutation“ möglich ist. Hierin liegen Schwierigkeiten, die je eine Spannung zwischen einer vorschnellen Identifizierung, die allein auf Einheit ausgerichtet ist (welche vermieden werden soll, da sie zu stark von einer zu überwindenden Tradition geprägt ist), und einem Sich-tragen-Lassen von der „différance“ (Derrida), die in die „Implosion des Sinnes“ oder schlicht in
13 Zu einer anderen Blickrichtung auf Richirs phänomenologische Metaphysik, die sich in erster Linie auf L’expérience du penser stützt, siehe H.-D. Gondek & L. Tengelyi, Neue Phänomenologie in Frankreich, op. cit., S. 238– 259; ferner L. Tengelyi, „Aux prises avec l’idéal transcendantal“, Annales de Phénoménologie, Nr. 6/2007, S. 169–183. 14 „Man hat mir […] zugetragen, dass Derrida über mich gesagt hat: ‚Ja, Richir, jemand mit großem Verstand, kenne ich gut, aber wie kommt es, dass er nie aus der Metaphysik herausgelangt ist?‘“, M. Richir, L’écart et le rien. Conversation avec Sacha Carlson, Grenoble, J. Millon, 2015, S. 35. 15 Zur bedeutsamen Rolle Loreaus für den Werdegang des jungen Richir, siehe R. Alexander, Phénoménologie de l’espace-temps chez Marc Richir, Grenoble, J. Millon, 2013, insbesondere S. 131–153.
26
Einleitung
einen radikalen und nicht zu akzeptierenden Relativismus 16 mündet, zum Ausdruck bringt. Richir versucht, dieser Spannung zwischen „Einheit“ und „Differenz“ Herr zu werden. * Worin besteht nun der positive Ansatz einer phänomenologischen Metaphysik bei Richir? Da er selbst hierüber keine expliziten Überlegungen angestellt hat, lässt sich dies nur nachträglich in von außen an sein Werk herangetragenen Betrachtungen darlegen. Die Phänomenologie erfährt bei Richir methodologisch und inhaltlich bedeutsame Aus- und Erweiterungen. Hierzu gehören, was die methodologische Ebene betrifft, einerseits etwa die „hyperbolische Epoché“ und die „architektonische Transposition“ und andererseits Unterscheidungen wie die von „Phänomenologischem“ und „symbolisch Gestiftetem“. Inhaltlich wären u. a. Begriffe wie die „symbolische Tautologie“, das „Simulacrum“, das „phänomenologische Erhabene“ zu nennen. (Auf all dies wird im weiteren Verlauf ausführlich eingegangen.) Für die Perspektive einer phänomenologischen Metaphysik ist aber besonders relevant, dass Richir die Grundlage dafür gelegt hat, auf der tiefsten, „ursprünglichen“ Ebene der Sinnbildung (Richir spricht diesbezüglich vom „archaischen Register“ derselben) eine „Matrize“ der Phänomenalisierung herauszustellen, die sozusagen als „Movens“ des Sinnbildungsprozesses überhaupt fungiert – gleichsam eine dynamische „Kategorientafel“ dessen, was das Erscheinen als Erscheinen ermöglicht. Hiermit geht Richir weit über das hinaus, was bei Husserl mit dem Verweis auf eine Sphäre der „Präimmanenz“ oder bei Heidegger in dessen Betrachtungen des Seins als „singulare tantum“ lediglich angezeigt wird. Die Betonung der Herausstellung einer solchen „transzendentalen Matrize“ schließt auf eine andere Art an die Lesart Robert Alexanders an, der in einer ersten systematischen Auslegung des Richir’schen Werkes auf ein ähnliches solches „Movens“ gestoßen ist und es auf seine eigene Weise ausgelegt hat. Sein Grundgedanke besteht darin, dass dieses Werk durch und durch von einem – von ihm als „Ogkorhythmus“ – bezeichneten „transversalen Verste16 So hat jedenfalls Richir Derridas Philosophie der Dekonstruktion letztlich gewertet.
Einleitung
27
henselement“ durchzogen wird, welches das „transzendentale Lebensmilieu der Verständlichkeit, der ‚Re-flexibilität‘ und der ‚NeuGründung‘ der Phänomenalisierung“17 ausmacht. Indem Patrice Loraux im Denken Richirs ferner „drei Zustände des Philosophierens“ bestimmt, lenkt er seinerseits die Aufmerksamkeit auf den Gedanken einer zugrundeliegenden, einheitlichen „Bewegung des Denkens“ bei Richir.18 Der Idee eines heuristischen Verstehensprinzips im Werke Richirs, das darin nicht nur eine tiefe Kohärenz erblickt, sondern darin auch „Schemata“, „Matrizen“, „Grundmotive“ am Werk sieht, die sich nicht lediglich wiederholen, sondern in immer neuen Gewändern sich in verschiedenen Hinsichten zeigen, ist zweifellos zuzustimmen. Es geht dabei aber nicht bloß um eine innere Kohärenz im Werke Richirs. Die Stärke des Gedankens der „transzendentalen Matrize“ liegt vielmehr darin, dass Richir das phänomenologische Feld – wie etwa Fink – hinsichtlich einer präimmanenten Dimension erweitert, in welcher der „sich bildende“ und „sich machende“ Sinn sucht und findet.19 Die Entdeckung eines solchen Motivs, die sich einer „phänomenologischen Spekulation“, bzw. einer „phänomenologischen Dialektik – allerdings ohne „Aufhebung“ – nicht verschließt, macht einen ganz wesentlichen Aspekt einer „phänomenologischen Metaphysik“ bei Richir aus. Damit ist nicht gemeint, dass eine Dialektik (im Hegel’schen Sinne) die weitläufigen Ansätze Richirs durchzöge. Vielmehr deckt Richir in der Phänomenologie, sobald sie sich selbst auf ihr „archaisches Register“ einlässt, wie gesagt, ein „Grundschema“,
R. Alexander, Phénoménologie de l’espace-temps chez Marc Richir, op. cit. P. Loraux, „Pour n’en pas finir“, Annales de phénoménologie, Nr. 15/2016, S. 7–14. 19 Zu einer anderen Auslegung und Ausarbeitung einer solchen Ausweitung des phänomenologischen Feldes, siehe v. Vf. Seinsschwingungen, op. cit. Der Unterschied besteht dabei darin, dass laut Richir der „‚Moment‘ des Erhabenen“ ein Strukturmoment des Bewusstseins, das sich phänomenologisch analysieren lässt, ausmacht (auch wenn dieses nur indirekt zugänglich ist), während nach dem Dafürhalten des Ansatzes in Seinsschwingungen die „transzendentale Matrize der Sinnbildung“ einer Dimension der selbstreflexiven Prozessualität der Sinnbildung zuzurechnen ist, die sich (mittels phänomenologischer Konstruktionen verschiedener „Gattungen“) performativ und selbstdurchsichtig vollzieht. 17 18
28
Einleitung
ein „Element“ oder eben eine „Matrize“ auf – er spricht diesbezüglich auch vom „transzendental-phänomenologischen Ursprung“ 20 –, die allesamt die Prozessualität der Sinnbildung steuern und bestimmen. Neben seinen Darlegungen einer „Neugründung der transzendentalen Phänomenologie“, sofern sie die eben angesprochenen Grundlagen zu einer „phänomenologischen Metaphysik“ liefern, besteht ein weiterer sehr bedeutsamer Beitrag Richirs zur neueren Phänomenologie darin, die Begriffe des „Phänomens“ und der „Phänomenalisierung“ völlig neu zu fassen. Dies wird in den ersten beiden Kapiteln ausführlich dargelegt. Einige kurze Worte sollen diesbezüglich aber bereits an dieser Stelle vorangeschickt werden. Im bemerkenswerten, oben bereits erwähnten Buch Neue Phänomenologie in Frankreich21 wurde Richir – neben Henry und Marion – als einer der Hauptvertreter der dritten Phänomenologen-Generation in Frankreich vorgestellt. Die Grundthese dieses Buches besagt, dass diese dritte Generation einen neuen Begriff des „Phänomens“ entworfen und durchforscht hat, nämlich den des „Ereignisses“, das in erster Linie durch seine Nichtantizipierbarkeit und sein Vermögen zu überraschen, gekennzeichnet sei. Das Ereignis breche aus dem engen Rahmen der Husserl’schen Intentionalität – mit deren retentionalen und vor allen Dingen protentionalen Horizonten – aus und ermögliche so, von innen heraus die Grundstruktur des transzendentalen Bewusstseins aufzusprengen, was entscheidende Folgerungen für den Status des Subjekts und des Begriffs des Transzendentalen mit sich bringe. Trotz der Fruchtbarkeit dieser Arbeitshypothese ist es gleichwohl fraglich, ob sie sich tatsächlich auch auf Richir anwenden lässt (welcher sie in einem privaten Gespräch übrigens verworfen hat). 22 Unabhängig davon, dass es ohnehin zweifelhaft ist, diesen sehr unterschiedlichen Vertretern jener 20 M. Richir, Phénomènes, temps et êtres. Ontologie et Phénoménologie, Grenoble, J. Millon, 1987, S. 142. In der Folge beziehen sich die Zitate der beiden Werke – durch Phénomènes, temps et êtres I und Phénomènes, temps et êtres II – auf die Ausgabe von 2018 (ebenfalls erschienen bei J. Millon), in der sie beide in einem Band herausgegeben wurden (für die hier angegebene Stelle, op. cit., S. 105). 21 H.-D. Gondek & L. Tengelyi, Neue Phänomenologie in Frankreich, op. cit. 22 Es muss jedoch angemerkt werden, dass in den bisher noch nicht veröffentlichten „Notes sur la phénoménalisation“ (1969–1970) Richir sich
Einleitung
29
Phänomenologen-Generation auf der systematischen Ebene eine allgültige Gemeinsamkeit zuschreiben zu können (was natürlich Überschneidungen nicht ausschließt, da sie ja die gleichen philosophischen Ursprünge haben), hebt sich Richir in verschiedenen Hinsichten von seinen Zeitgenossen ab. Wenden wir uns zunächst Richirs „Phänomen“-Begriff zu sowie seiner Auffassung der Rolle und des Status des „transzendentalen Feldes“, bevor wir näher auf mehrere seiner Grundbegriffe eingehen – und zwar insbesondere den „Schematismus“, die „wilden Wesen“ und die „Phantasien-Affektionen“. Die folgenden Darlegungen sollen einige Grundbegriffe Richirs in einer ersten Annäherung vorstellen, die im weiteren Verlauf ausführlicher entwickelt und vertieft werden. * Richir ist ein Denker der Dualität, er ist ein Dualist. 23 Eines der Begriffspaare, die sein gesamtes Werk durchherrscht, ist die Zweiheit „Phänomenologie (‚wildes phänomenologisches Feld‘)/symbolische Stiftung“, die nicht mit jener von „Phänomenologischem“ und „Ontologischem“ verwechselt werden darf (hierzu sofort mehr). Die Zusammenhänge zwischen „Phänomenologischem“ und „symbolisch Gestiftetem“ sind äußerst komplex. Vereinfachend kann schon einmal gesagt werden (da es auch zu Verwebungen kommt, welche diese Unterscheidungen aufweichen 24), dass das symbolisch Gestiftete je etwas mit (sprachlichen manchmal aber auch außersprachlichen) „Fixierungen“ zu tun hat, während sich das Phänomenologische – das der ursprünglichen Sinnbildung zugrunde liegt und gerade nicht erscheint – sich der symbolischen Vereinnahmung entzieht. Richir vollzieht kohärent eine „Phänomenologie des Unscheinbaren“, und in diesem Sinne ist das „Gegebene“ nicht auf das „Phänomenologische“ reduzierbar.
– selbstverständlich „avant la lettre“ – dieser Lesart Gondeks und Tengelyis angeschlossen hatte. 23 Das ist ein erstes Indiz dafür, dass Richir sich nicht in die – eher monistische – Strömung der „Phänomenologie des Ereignisses“ einschreibt. 24 Siehe hierzu Florian Forestier, La phénoménologie génétique de Marc Richir, „Phænomenologica“, New York, Springer, 2014, S. 53ff.
30
Einleitung
Innerhalb des „wilden phänomenologischen Feldes“ scheint eine weitere Dualität durch – die zwischen dem „Phänomenologischen“ (in einem engeren Sinne) und dem „Proto-ontologischen [proto-ontologique]“. Dieser Begriff erhält seinen Sinn dadurch, dass die Ontologie zwar in erster Linie (und in Richirs früheren Arbeiten) Sache des symbolisch Gestifteten ist, dem Phänomenologischen aber auch ein gewisser Seinssinn (Seynssinn?) zugesprochen werden muss. Seit den 2000er Jahren hat Richir jedoch den Gebrauch dieses Begriffs zugunsten des lexikalen Felds der „Affektivität“ aufgegeben. Dadurch soll die sinnlich-affektive Dimension dessen unterstrichen werden, was dasjenige „erfüllt“, welches von nun an (im Gefolge Husserls) als „Phantasien“ bezeichnet wird; und zugleich soll damit die Absage an eine ontologisierende Perspektive akzentuiert werden. Diese „Phantasien“, hierauf wird noch eingehender zurückzukommen sein, bezeichnen die konstituierenden Vorstellungen des phänomenologischen Feldes, die jedem intentionalen Bezug zugrunde liegen. Das „Phänomenologische“ – das muss noch hinzugefügt werden – ist ein Feld,25 das Richir nicht ipso facto mit der „transzendentalen Subjektivität“ gleichsetzt. Dieses Feld ist vielmehr jenes der Sinnbildung. Der Sinn wird hier „erzeugt“ bzw. „konstituiert“, wobei ihm allerdings weder ein Anfangs- noch ein Endpunkt zugesprochen werden kann (auch nicht im räumlich-zeitlichen Sinne). Der Sinnbildung unterliegt laut Richir die Dualität von „Schematismus“ und „wilden Wesen“ (die, wie gesagt, seit 2000 eher als „Phantasien“ bzw. „Phantasien-Affektionen“ bezeichnet werden). All diese Begriffe sollen nun näher erläutert werden. * Wenden wir uns zunächst dem „Schematismus“ und den „wilden Wesen“ zu. Obwohl beide im Prinzip unzertrennlich sind, können sie separat dargestellt werden. Zunächst ist hervorzuheben, dass der Schematismus (mit dem Richir zunächst von Kant und Heidegger ausgeht und dem er später eine eigenständige Bedeutung zuschreibt) als „logische“ Artikulie25 Einer Einsicht entsprechend, die auf Sartres La transcendance de l’Ego zurückweist.
Einleitung
31
rung dessen aufgefasst werden kann, was den Sinn „zusammenhält“. Für diesen Begriff gilt, was auch auf die anderen Begriffe der Neugründung von Richirs transzendentaler Phänomenologie zutrifft, nämlich, dass er gleichsam in der „Schwebe“ zwischen einer minimalen phänomenologischen Beschreib- und Erfahrbarkeit und einer transzendentalen Bedingung im kantischen Sinne ist, der keine „konkrete Realität“ zukommt und die der Phänomenologe einführt, um die epistemische Bestimmbarkeit der Phänomenalisierung leisten zu können. Streng genommen ist er weder das eine noch das andere. So wie das auch für die anderen Termini gilt, die dem archaischen Register der Sinnbildung zuzurechnen sind, handelt es sich hierbei um einen Begriff, der seine Wirklichkeit und Wirksamkeit nur in der Verwirklichung und Ausführung seiner Analysen erweist. Aber keinesfalls können diese Analysen an einer vorausgegebenen Wirklichkeit bemessen werden. Daher kann auch nicht mit dem Finger auf den Schematismus gewiesen werden; zugleich verfügt er aber über eine Kohärenz und über eine Konsistenz, der sich Richir unentwegt und durch sein ganzes Werk hindurch angenähert hat. Der Schematismus kann zunächst negativ umrissen werden. Er ist an-archisch (im Sinne von: ohne Altersbestimmung) und a-teleologisch. Er ist weder in der Zeit noch im Raum. Es gibt sowohl sprachliche Schematismen, die Sinn hervorbringen, als auch außersprachliche Schematismen, die in nichts Sinnvollem münden. Der Schematismus ist weder objektiv noch subjektiv, genauer: Er ist eine präsubjektive Struktur, die ursprünglich die „elementaren“ Entitäten, die jeder Sinnregung zugrunde liegen und die Richir als „wilde Wesen“ bezeichnet, miteinander artikuliert – wobei diese „wilden Wesen“ nur durch ein „Selbst“ – durch dessen „Leben“, näher durch seine Affektivität – bezeugt werden können. Obwohl diese wilden Wesen als „Abstraktionen“ zu kennzeichnen sind, ist es ebenso zutreffend, sie als phänomenale Konkretheiten, die eben durch den Schematismus artikuliert werden, aufzufassen. Der Schematismus ist keine „Gestaltung“ oder „Gestaltwerdung“ – trotz seiner etymologischen Bedeutung. Er besteht in einer
32
Einleitung
Mobilität von „Kondensationen“ und „Auflösungen“26 von „Sinnfetzen“ und „Sinnregungen“27, die keinerlei „Laufweg“ oder „Flugbahn“ hat („mobilité sans trajectoire“) und daher paradox und schwierig zu denken ist. Er bezeichnet die unbewusste (nicht im Sinne der Psychoanalyse, da hier nirgends von „Verdrängung“ die Rede ist) Artikulierung verschiedener Sorten von Rhythmen jener Kondensationen und Auflösungen. Es handelt sich dabei genauer um eine Art „transzendentale Verdichtung“, die den Prozess der Sinnbildung begleitet, ausrichtet und ihm auch zugrunde liegt. Aus der positiven Bestimmung des Schematismus – den Richir einmal in einem Interview mit Florian Forestier als „Dynamik des Transzendentalen“28 bezeichnet hat und der für die Sinnbildung von konstitutiver Bedeutung ist – wird einerseits deutlich, dass er die zweifache Funktion einer „Artikulierung“ und einer „Aneignung“ hat. Durch den Schematismus werden die Phänomene gewissermaßen „zusammengehalten“. Und dank seiner „aneignenden“ Funktion wird der Sinn, ganz gleich, ob er gerade im Sich-Bilden begriffen ist oder deutlich erfassbar ist, zu einem Sinn für uns. Und andererseits drückt er das Prinzip der Zeitigung-Verräumlichung (die selbst weder zeitlich noch räumlich ist) sowie das, was dem Diskurs – vom „logischen“ Gesichtspunkt aus betrachtet – Konsistenz verleiht, aus (wobei hier die „Logik“ aber [genauso wenig wie die Grammatik oder die Syntax] nicht von universaler Relevanz ist, wie das etwa am Beispiel der Dichtung deutlich gemacht werden kann). Der Schematismus setzt sich somit an die Stelle der klassischen (und phänomenologisch unbefriedigenden) Auffassung einer „Formierung“ eines (sinnlichen) Stoffs durch eine synthetische Verstandesaktivität. Er ist damit kein Seinsgeschehen, sondern ein Moment 26 Siehe hierzu die ausführlichen Analysen von R. Alexander in Phénoménologie de l’espace-temps chez Marc Richir, op. cit. 27 „Sinnregungen [amorces de sens]“ und nicht „Sinnansätze [sens en amorce]“, weil diese die Transmutationen jener sind, welche diesen Sinnansätzen den phänomenologischen Status eines Simulacrums verleihen (wohingegen die „Sinnregungen“ im „phänomenologischen Feld“ gleichsam „schweben“). 28 Siehe www.actu-philosophia.com („Entretien avec Marc Richir: Autour des ‚Variations sur le sublime et le soi‘“). Vgl. auch F. Forestier, „La phénoménologie transcendantale comme réflexivité agie“, Annales de Phénoménologie, Nr. 13/2014, Amiens, Association pour la promotion de la phénoménologie, S. 43ff.
Einleitung
33
der Sinnbildung, dabei wiederum aber gerade kein Vermögen oder gar Akt eines Subjekts, das auf dieser Stufe noch gar nicht geltend gemacht werden kann. Worin bestehen nun darüber hinaus die „wilden Wesen“ und die „Phantasien-Affektionen“? Die „wilden Wesen“, die kein offenbares „Seiendes“ sind (wenn man sie setzend fixieren wollte, würden sie sich sofort entziehen), müssen durch den Phänomenologen notwendig als „archaischste Basis“ des phänomenologischen Feldes vorausgesetzt werden – sie sind also für Richir ein integrierender Bestandteil der Neugründung der Phänomenologie. Er übernimmt den Ausdruck „wilde Wesen“ aus Merleau-Pontys Das Sichtbare und das Unsichtbare, allerdings in einer etwas anderen Bedeutung. Bei Richir liefern die „wilden Wesen“ den elementaren Gehalt für eine Art „dislozierten Logos“, bzw. für das, was Derrida in La grammatologie „archi-écriture“ (= „Urschrift“) genannt hat (die für den Richir’schen „Schematismus“ die Grundlage geliefert hat). Die „wilden Wesen“ machen dabei laut Richir die „Konkretheit“ dieser Urschrift aus. In den Phänomenologischen Meditationen (1992) setzt Richir die „wilden Wesen“ mit den „phänomenologischen Welt-Konkretheiten“29 bzw. den „scheinhaften [apparents] Phänomenalitäts-Fetzen oder Spänen“30 gleich. Sie machen „schematische Proto-Zeitigungen/Proto-Räumlichungen“31 aus, die „in sich und durch sich selbst auf die Sinnregungen hin […] öffnen, d. h. auf die inneren Anfänge der Sprachphänomene selbst.“32 In Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace (2006) setzt Richir dem noch eine neue Bestimmung hinzu. Die „wilden Wesen“, die nicht nominal, sondern verbal verstanden werden müssen (es handelt sich dabei also um keine „Ideen“ im Sinne des Platonismus), sind, was den „Inhalt“ angeht, nichts anderes als „Wesen von Phantasien-Affektionen“. Sie werden dabei („innerlich“ und nicht
29 M. Richir, Méditations phénoménologiques. Phénoménologie et phénoménologie du langage, Grenoble, J. Millon, 1992, S. 124f.; ders. Phänomenologische Meditationen. Zur Phänomenologie des Sprachlichen, op. cit., S. 132f. 30 Méditations phénoménologiques, op. cit., S. 125; dt. Übersetzung, S. 127. 31 Méditations phénoménologiques, op. cit., S. 169; dt. Übersetzung, S. 180. 32 Méditations phénoménologiques, op. cit., S. 152; dt. Übersetzung, S. 163.
34
Einleitung
intentional) dank dessen, was Richir die „‚perzeptiven‘ Phantasien“33 nennt, „wahrgenommen“.34 Näher betrachtet verleihen die „wilden Wesen“ den „Phantasien-Affektionen“ – also dem, was die „wilden Wesen“ (wenn auch nur indirekt) tatsächlich ausweist – eine Konkretheit. Es lässt sich somit sagen, dass die „wilden Wesen“ als solche unzugänglich sind, zugleich aber auch den PhantasienAffektionen innewohnen. Sie „wesen“ (heideggerianisch gesprochen) in ihnen. Selbst unsagbar, sind sie eine Abstraktion, die sich aus der Schematisierung der Affektivität ergibt. Sie liegen somit „tiefer“ als die Phantasien-Affektionen, welche ihrerseits aus der Begegnung von „wilden Wesen“ und Affektivität resultieren. 35 Diese Verhältnisse lassen sich folgendermaßen veranschaulichen: Phantasien-Affektionen Selbst-„Wahrnehmung“ durch die „perzeptiven“ Phantasien (die ihrerseits in den das Sprachphänomen kennzeichnenden „Sinnregungen“ „verkettet“ sind) wilde Wesen Diese einmal eingeführten Grundbegriffe haben für Richirs Gesamtwerk Bestand. In den folgenden Kapiteln wird aufgezeigt werden, wie sie sich bei der konkreten Behandlung der jeweiligen phänomenologischen Grundthemen weiterentwickeln und ausdifferenzieren. Bevor das in Angriff genommen wird, soll jetzt ein synthetischer Rückblick auf das Gesamtwerk geworfen werden. Niemand ist hierfür besser geeignet als Patrice Loraux (ein ehemaliger Dozent
33 Richir übernimmt diesen Begriff von Husserl, siehe den Text Nr. 18 in Husserliana XXIII, insbesondere S. 504–506 und S. 514–524. 34 Die jedes „Sprachphänomen“ kennzeichnenden „Sinnregungen“ bestehen in „schematischen Verkettungen“ der „‚perzeptiven‘ Phantasien“ – und zwar so, dass der Sinn sich in diesen Sinnregungen im Hinblick auf die Auffassung der jede Setzung konstituierenden Phänomene zu stabilisieren sucht. 35 Zu den „wilden Wesen“, siehe auch Kapitel III.
Einleitung
35
an der Pariser Sorbonne), der Richirs Werk über Jahrzehnte mitverfolgt hat. * In einem in den Annales de Phénoménologie publizierten Artikel,36 den Loraux Richir nach dessen Tod gewidmet hat, stellt er das heraus, was er die „drei Zustände der Philosophie“ nennt und die „Denkbewegung“ seines langjährigen Freundes kennzeichnet. Es handelt sich dabei nicht um Begriffe, die dessen gesamtes Werk durchzögen, sondern eher um einen grobzügigen Entwurf des „‚Kontakts‘ mit dem Denken Marc Richirs“. In diesem Entwurf werden die offenkundigen Spuren der Klassischen Deutschen Philosophie (insbesondere in Bezug auf Hegel und Fichte) im Denken Richirs aufgewiesen und verfolgt. Loraux macht zunächst auf ein Hegel’sches Motiv bei Richir aufmerksam – nämlich die Untrennbarkeit von Leben und „unverhoffter Möglichkeit“ – der „Möglichkeit, das ‚Leben anders‘ zu leben“ –, welche die Philosophie überhaupt ausmacht. Während Hegel das Absolute als Leben gekennzeichnet hatte, hat Richir die Philosophie zum Absoluten seines Lebens gemacht. Das Leben hat zwei Grundzüge: Es verläuft je in seiner Unabgeschlossenheit und kann sich dabei verflüchtigen; und es ist „Vibration“, d.h. es kann sich nie mit sich selbst decken (bzw. es ist „ein ewiges Versteckspiel zwischen vollkommener Übereinstimmung und Nicht-Deckung“). Diese beiden Eigenschaften laufen in einer einzigen zusammen: in dem Denken, das als eigentliches Leben sich weder an sich selbst bindet, noch an die Tradition, an Modelle, Vorfahren, Lehrmeister usw., sondern sich so „auf den Weg macht“, dass dabei der von Loraux herausgestellte Imperativ der Verbindung von „Treue und Mut zur Transposition“ beachtet wird (wodurch zugleich der Inbegriff des trefflichen Bezugs von Lehrer und Schüler oder einfach zur Philosophie überhaupt zum Ausdruck gebracht wird). Welche Rolle und welchen Platz nimmt das „Selbst“ in dieser Bewegung ein? Dergestalt sich „auf den Weg machend“, muss das „Selbst“, so wie es von der Tradition aufgefasst wurde, um nicht 36 P. Loraux, „Pour n’en pas finir“, Art. cit. (alle folgenden Zitate sind diesem Text entnommen).
36
Einleitung
dem philosophischen Narzissmus zu verfallen, zwar hinter uns gelassen werden. Gleichwohl verlangt dieser Gestus aber nach einer „minimalen Verankerung“, die „in der Schwebe“ und mit dem gebührenden Abstand zu den Dingen belassen werden muss, eine Verankerung, die Richir in seinen letzten Schriften eben als „Selbst“ zu denken versucht hat, als „nicht identisches Selbst“, da es sich nicht mit sich selbst in Deckung bringen lässt. In einer engen Bindung an Husserl, Heidegger und Merleau-Ponty denkt Richir dieses „Selbst“ zeitlich (und räumlich): „eine prätemporale ‚lebendige Gegenwart‘, die […] verständlich macht, dass seine ‚Entspannung‘ der Prozess der Zeitigung/Verräumlichung selbst ist; oder auch ein ‚verdichtetes‘ Selbst, das sich entspannt und dadurch die Welt hervorbringt.“37 Was von der Artikulierung zwischen dem Selbst und der Zeit (sowie dem Raum) zeugt, ist die Vibration als Grundcharakteristik des Lebens – und des Phänomens: „[…] wenn das – selbst vibrierende – ‚Ich‘ mit der gleichen Frequenz vibrierte wie der Raum und die Zeit, dann könnte dieses Ich sich nicht einmal gewahr werden, dass es zeitigend und verräumlichend ist. Alles ist also eine Sache der Komposition von Vibrationen.“38 Loraux zeigt auf, dass laut Richir zwei Abwege vermieden werden müssen. Das erste ist das einer Denktätigkeit, die sich an Hegels „Geist“ angleicht und sich in nicht ausweisbaren „chimärischen Erzeugungen“ verliert. Das zweite besteht darin, diese Tätigkeit auf ihre eigene Ausübung, auf ihren bloßen Selbstbezug zu beschränken. Die Alternative, die bei Richir durchscheint, ist das „verhältnislose Verhältnis“ oder das, was Loraux ein „‚schwieriges‘ Verhältnis“ nennt, ein Ausdruck, der auf Jean-Claude Milners Gedanken eines „schwierigen Universellen“ im Gegensatz zu einem „‚einfachen Universellen“ zurückgeht. Worin besteht ein solches „schwieriges Verhältnis“? Es handelt sich dabei um ein Verhältnis, in dem das Denken weiterhin in Kontakt zu sich selbst steht und dabei zugleich ein „unendliches Gespräch“ (Blanchot) mit „Anderem [de l’autrement]“ eingeht, einem „unbestimmten Gesprächs‚partner’“, mit einer höchsten „Transzendenz“, die sich auch je „verflüchtigen“ kann, zugleich aber verhindert, dass die Sinnbildung implodiert oder sich einfach verläuft. Und was dabei „schwierig“ ist, ist das Vermeiden 37 38
Loraux spielt hier auf den „‚Moment‘ des Erhabenen“ an. Hierauf kommen wir im letzten Kapitel zurück.
Einleitung
37
übereilter Identifikationen, um der philosophischen Tätigkeit ihren eigenen „Ort“ zuzuteilen, welcher der der „Epoché“ ist, einer „unaufhörlichen Entleerung“, der „Kenose […] der Positivitäten“, die alleine die Gewähr zu bieten vermögen, dass das „Denken ein ‚offenes‘“ bleibt. Loraux verweist hier – zumindest implizit und unter anderem – auf ein wesentliches Charakteristikum von Richirs Auffassung des phänomenologischen Feldes, nämlich jenes, das sich auf die „Phänomene als nichts als Phänomene“ bezieht. Richir schrieb hierzu im Jahre 1987, als er seinen eigenen Ansatz noch explizit als „transzendentale Phänomenologie“ bezeichnete: Die transzendentale Phänomenologie hängt zutiefst […] an der Frage nach dem Phänomen, sofern es nicht je schon als Phänomen von etwas anderem als ihm selbst ausgelegt wird (eine vorgängige Struktur, ein Ding oder ein Gegenstand, dem bestimmte Begriffe oder Ideen entsprechen), folglich an der Frage nach dem Phänomen, sofern es als nichts als Phänomen betrachtet wird, wo nur das Phänomen scheint und erscheint. […] Unsere Betrachtung des Phänomens als nichts als Phänomen kommt somit der Radikalisierung der Husserl’schen phänomenologischen Reduktion gleich und verleiht dieser einen neuen Sinn: Es geht dabei darum, das Phänomen (durch Einklammerung oder Ausschaltung) außerhalb jeglicher Positivität und Bestimmtheit zu betrachten, die ihm nach unserem Dafürhalten nur durch etwas anderes oder von woanders zukommen kann, wovon es zugleich aber auch […] die transzendentale Matrize ausmacht.39
Mit anderen Worten, das Denken kann in der Tat nur dann wirklich „offen“ sein, wenn es selbst eine „präimmanente“ Sphäre eröffnet, die nichts anderes als das oben beschriebene phänomenologische Feld ist. Diese Sphäre trägt der „reinen Phänomenalisierung“ Rechnung, diesseits der konstituierten Objektivität und selbst diesseits der immanenten Gegebenheit. Genau an dieser Stelle macht Loraux nun „drei Zustände der Philosophie“ aus, die der angesprochenen „transzendentalen Matrize“ einen konkreten Inhalt verleihen. Dieser Inhalt offenbart dabei eine „Transposition“, die sich in einem „geläuterten Register“ abspielt, „wo sich das die Erfahrung auf sich zurückführende Selbst und das, was in keiner Weise ‚für ein Selbst‘ ist, aufeinanderstoßen und sich gegenseitig erproben“.
39
Phénomènes, temps et êtres I, op. cit., S. 13f.
38
Einleitung
Mit diesem Gedanken einer „Aufsplitterung des Zustands der Philosophie“ drückt Loraux die wesentliche Einsicht aus, dass der Sinnbildungsprozess drei Momente enthält, die „quasi gleichzeitig sind, allerdings mit Verschiebungen“40. Loraux bezeichnet diese drei „Momente“ oder „Zustände“, die nach seinem Dafürhalten im Herzen von Richirs Denkbewegung angelegt sind, als „Inchoativität“, „Werk“ und „Nicht-Reduzierbares“. Diese „Zustände“ oder „Momente“ drücken eine bestimmte Disharmonie aus (in dieser Hinsicht breche Richir mit Leibniz). Es besteht nämlich eine Unvereinbarkeit zwischen der „objektiven“ und der „subjektiven“ Ebene, d. h. zwischen der „Ebene der Positivitäten“ und der notwendigen Neuorganisierung der Scheidung von dem Ich, das sich zu identifizieren und sich mit sich selbst zu reidentifizieren sucht einerseits, und einer radikal anonymen Instanz andererseits.41 Im tiefsten Inneren des Selbst tut sich eine Sich- oder Selbst-Spaltung auf (keine Ich-Spaltung!), die diese Denkbewegung wesenhaft kennzeichnet. Das erste Moment ist die Inchoativität, d. h. ein rätselhaftes Hinstreben der „reinen Energie des Denkens“ (zwar zitiert Loraux in diesem Zusammenhang nicht Fichte, aber die Nähe dieser affektiven „Energie“ zu Fichtes „absoluter Tätigkeit“ oder „Energie“ ist offenkundig), die sich ursprungs- und ziellos verteilt und sich einen Weg zu bahnen sucht, „wo Anschauungen unkontrolliert, augenblicklich und in unendlicher Geschwindigkeit umherschwirren“. „Ursprungslos und ziellos“ heißt bei Loraux „ohne wirklichen Leitfaden“ und sich an dem stoßend, „was trotz mangelnder Konsistenz widerständig ist“. Der Grundgedanke dabei ist, dass dabei etwas anfängt (obgleich es keinen „Ausgangspunkt“ hat), dass Sinn sich regt, ohne dass freilich gewährleistet werden kann, dass diese Sinnregung auch wirklich an ihr Ziel gelangt.
40 In Wirklichkeitsbilder (Tübingen, Mohr Siebeck, 2015) hat Vf. einen ähnlichen Ansatz verfolgt. Im Mittelpunkt steht dabei der Begriff des „Urbildes“ (der Begriff der „transzendentalen Matrize“ träfe genauso zu), der ebenfalls durch drei Momente ausgezeichnet ist (nämlich die Phänomenalisierung, die Plastizität und die Reflexibilität). 41 Das weist wiederum auf den „‚Moment’ des Erhabenen“ voraus, in dem das Selbst vom nichtreflexiven Abstand zu sich selbst nicht zu trennen ist.
Einleitung
39
Dieser erste Zustand sieht sich nun zwei Arten von „Notwendigkeiten“ oder „Zwängen“ gegenüber: erstens, der „Unausweichlichkeit, sich bereits gestifteter Begriffe zu bedienen“; zweitens, dem „Zwang, ein Werk zu begründen“. Was ist damit gemeint? Mit dem inchoativen Elan der Energie des Denkens, die den Sinn „in Bewegung“ setzt, ihn „regt“, aber auch „versetzt“, vollzieht sich zugleich eine „Fixierung“, die der „Schwere des Signifikanten“ zuzuschreiben ist und das Denken an etablierte oder gestiftete Bedeutungen „festklammert“. Damit sind wir beim zweiten angesprochenen Aspekt, „dem gefürchteten Moment des ‚Werkzustandes‘, in dem eine Philosophie riskiert, sich in einer ontologischen oder spekulativen Terminologie zu verlieren“. Die Inchoativität wird also gewissermaßen zweifach gefährdet: durch den ihr zugrundeliegenden Fixiertheitsanspruch und durch den „je wiederkehrenden Eleatismus“, das heißt also durch eine Tendenz hin zur Ontologisierung. Diese beiden „Momente“ widersprechen sich. Hierbei wird aber auf keine dialektische „Aufhebung“ zurückgegriffen, um diesen Widerspruch zu überwinden: Es geht vielmehr darum, dem Zirkel einer Taubheit, einer „Ankylose“, zu entgehen, die so erforderlich wie unüberwindbar ist. Sich an einen früheren Entwurf erinnernd, der auf die dritte Ausgabe der Zeitschrift „Epokhè“ (1993) zurückreicht und bereits den gleichen Titel trug, stellt Loraux ein drittes – gleichzeitiges – Moment der transzendentalen Matrize heraus – das „Nicht-Reduzierbare“. Dieser Begriff führt denselben Widerspruch einer Zurückweisung und einer Behauptung mit sich: einer Zurückweisung einer „Übereinstimmung mit der ‚zutreffenden‘ Bedeutung“; und einer Behauptung eines „Wiederauftauchens des ‚schwierigen Verhältnisses‘“, einer „[oxymorischen] Instabilität des Zustandes“. Das Nicht-Reduzierbare ist deswegen gleichzeitig mit der Inchoativität, weil es genau so nah an der Quelle, der arché, ist wie diese – aber dieser „mangelt es an Entscheidung“. Und es ist auch mit dem Werk gleichzeitig, da es mit diesem das Vermögen „einen Rahmen zu setzen“ teilt – aber dieses „vibriert“ nicht mehr. Das Nicht-Reduzierbare hat somit einen „rebellischen“ Charakter (insbesondere gegen die Definition der Philosophie), es entzieht sich der Domestizierung und bringt eine Art „Ungehorsam“ zum Ausdruck, einen „unbändigen Widerstand“ gegen die „Sprache des… Zu-Sagenden, die man weder milde zu stimmen noch zu züchtigen vermag“.
40
Einleitung
Das Nicht-Reduzierbare in der Philosophie ist auch, was von Richirs Werk nach dessen Tod verbleibt: „die letzte Ablehnung der Übereinstimmung mit der ‚trefflichen‘ Bedeutung“. Der affektive Ausdruck dieses Begriffs ist zum Beispiel in Cézannes Briefwechsel zu finden: das Gefühl einer stetigen Unbefriedigtheit, einer radikalen Unvollendetheit und zugleich das Bewusstsein dafür, dass etwas „berührt“ oder „getroffen“ wurde. Dieser Begriff ist sowohl ein Motor des gesamten Werkes als auch der Aufhänger dafür, es permanent und innerlich in Frage zu stellen. Das Nicht-Reduzierbare steht hierdurch mit Derridas Begriff der „Spur“ in Einklang, der ein anderes Spannungsfeld der Sinnbildung bezeichnet, das nicht weniger anarchisch und ateleologisch ist. In diesen durchaus innigen Worten wird vieles angesprochen, das im Grunde nur den mit Richirs Werk vertrauten Leserinnen und Lesern einsichtig sein kann. Um diese Denkfährten und groben Umrisse zur höchstmöglichen Klarheit zu erheben, wird nun Richirs Werk hinsichtlich seiner Grundbegriffe systematisch und inhaltlich vorgestellt. Leitfaden ist, wie gesagt, Richirs Beitrag zur neueren Phänomenologie im Allgemeinen sowie zu einer „phänomenologischen Metaphysik“ im Besonderen. Vorher aber noch eine letzte einführende Bemerkung. * Die Verständnisschwierigkeiten, die Richir seinen Leserinnen und Lesern bereitet, sind gewissermaßen schon legendär. Sie sind aber nicht einer kapriziösen Haltung geschuldet, die einen Hang zur Dunkelheit offenbaren würde. Zwar ist Richirs Stil teilweise schwerfällig, aber das erklärt noch nicht, was genau das Hindernis für einen einfachen und direkten Zugang zu seinem Werk ausmacht. Jedenfalls stellt es auch für den Interpreten keine geringe Herausforderung dar, diesen Klippen zu entgehen. Folgende Hinweise mögen abschließend eine Hilfestellung bieten, um die Probleme, die hierbei aufgeworfen werden, zu umreißen, und einsichtig zu machen, weshalb und auf welche Weise jene Schwierigkeiten in der „Sache“ selbst liegen. Manche Denker setzen in jedem einzelnen Werk neu an und nehmen Früheres nicht wieder auf. Ganz anders bei Richir. Er hat sich, wie oben bereits betont, zur Aufgabe gemacht, eine „Neugrün-
Einleitung
41
dung“ („refondation“ bzw. „refonte“) der transzendentalen Phänomenologie zu liefern, und dabei geht es immer und immer wieder darum, Anfang, Grund, Ursprung („commencement“, „fondement“, „origine“) des Seienden, des Erscheinenden (bzw. des Erscheinens) und des Philosophierens selbst zu denken. Sein gesamtes Werk ist in ständigem Fluss und schließt fortwährend an vormalig bereits Erarbeitetes an. Dabei sind aber die gebrauchten Begriffe ihrerseits im Fluss – und das heißt auch: im ständigen Wandel – begriffen, ohne dass das eigens gekennzeichnet würde oder gar Richir selbst völlig bewusst geworden wäre. Für die Leserinnen und Leser verkompliziert das den Zugang, da es ständig geboten ist, wachsam hinsichtlich dessen zu sein, wo und wie diverse begriffliche Modifikationen sich jeweils vollzogen haben. Das Projekt einer Neugründung der transzendentalen Phänomenologie wird von Richir ferner dahingehend ernst genommen, dass er sowohl den Grundgestus der kantischen Transzendentalphilosophie übernimmt (was die Erfahrung möglich macht, lässt sich selbst wiederum nicht [direkt] erfahren), als auch Heideggers Phänomenbegriff treu bleibt (also dem, „was sich zunächst und zumeist gerade nicht zeigt, was gegenüber dem, was sich zunächst und zumeist zeigt, verborgen ist, aber zugleich etwas ist, was wesenhaft zu dem, was sich zunächst und zumeist zeigt, gehört, so zwar, dass es seinen Sinn und Grund ausmacht“42). Das „Phänomen“ und das, was Richir dann extrapolierend „das Phänomenologische [le phénoménologique]“ überhaupt nennt, ist somit entzogen, es kann nicht direkt zugänglich gemacht werden und liegt als Verborgenes nicht offen vor. Im „Unscheinbaren“ werden bei Richir Verborgenheit und Entzughaftigkeit stets zusammengedacht. Es kommt aber noch hinzu, dass nach seinem Dafürhalten das Konstituierende sich nicht nur nicht angemessen sagen, sondern auch nicht einmal begrifflich fassen lässt. Dies erfordert daher ein „phänomenologisches Zickzack“, d. h. ein ständiges Hin und Her zwischen dem Erscheinenden, phänomenal sich Bekundenden, das in der Sprache des Konstituierten ausgedrückt wird, und dem, von dem Richir sagt, dass es nur durch eine „architektonische Transposition“ bzw. „ursprüngliche Verzerrung [distorsion originaire]“ zugänglich sei (und in Bezug auf welches uns „die Namen fehlen“). Dieses Zugänglichmachen – 42 M. Heidegger, Sein und Zeit, HGA 2, F.-W. von Herrmann (Hsg.), Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1977, S. 47.
42
Einleitung
das die genuine Aufgabe einer Phänomenologie des „Phänomenalisierens“ ist – hat laut Richir auf eine hervorgehobene Art mit einem „Flimmern“ und „Vibrieren“ zwischen zwei „Registern“ zu tun – so nennt er jeweils diese „Bereiche“ oder „Gebiete“ des Phänomenalen (Unverborgenen) und des Phänomenologischen („Archaischen“, Verborgenen) –, das in der vorliegenden Studie beständig zum Thema gemacht werden soll. Schließlich hängt beides – also das je im Fluss begriffene Denken sowie die Verborgenheit und Entzughaftigkeit des Phänomenologischen – in besagter Neugründung der transzendentalen Phänomenologie zusammen. Der Fluss trägt mit sich fort, was im Laufe des Fließens hinweggetragen wurde; er entledigt sich aber auch ständig dessen, was sich in ihm unentwegt absetzt, und lässt es in nicht mehr betretbare Abgründe versinken. Wenn man dem von Loraux angesprochenen Zwang, „ein Werk zu begründen“, gerecht wird, dann offenbart sich, dass das Werk ähnlichen Gesetzen folgt wie der Konstitutionsprozess („zwischen“ „Archaischem“ und Phänomenalen) selbst, der freilich immer nur in „retro-jizierender“, „rückwärtsgewandter [à rebours]“ Bewegung nachgezeichnet werden kann. Ein Zurück ist unmöglich, das Denken ist immer schon sich selbst voraus und projiziert sich in die nächste anstehende Aufgabe. Es mag sein, dass Richir nicht deutlich genug gesehen hat, dass diese Aufgabe in Wirklichkeit stets dieselbe „Sache“ seines Denkens geblieben ist – was gerade Variierungen dabei nicht ausschließt, sondern vielmehr erfordert. Wie dem auch sei: Diese „Sache“ zu fassen und dem Verständnis näher zu bringen, ist das entschiedene Hauptanliegen dieser Untersuchung. Dieses soll in mehr oder weniger chronologischer Reihenfolge durch das Prisma der wichtigsten Sachthemen in Richirs Werk hindurch in Angriff genommen werden.
Kapitel I Phänomen und Phänomenalisierung Ziel des ersten Kapitels ist es, einen wesentlichen methodologischen Aspekt im Werke Richirs vorzustellen, der sowohl den Sinn des „Phänomens“ als auch die Art, wie es eigens zugänglich ist – und damit die sogenannte „Phänomenalisierung“ –, betrifft. Diese beiden Begriffe beziehen sich nicht bloß innerlich auf Richirs Werk, sondern verweisen in einem weiteren Rahmen auf das Grundproblem des Bezugs von „Erscheinen“ und „Sein“ in der Phänomenologie überhaupt. Mit dem bereits erörterten Begriff des „Phänomenalisierens“ steigt man unmittelbar in die Tiefen der Richir’schen Neugründung der transzendentalen Phänomenologie ein. Vereinfachend gesagt, geht es darum, Heideggers Aufforderung an die Phänomenologie, „Sinn und Grund“1 des je Erscheinenden auszumachen, einer sowohl transzendentalen Perspektive – also hinsichtlich der Frage, worin die Möglichkeitsbedingungen der Erkenntnis bestehen – als auch der von Heidegger selbst so definierten „phänomenologischen“ Herangehensweise gemäß – die den nicht sich zeigenden ursprünglichen Phänomenen auf dem Grund des Erscheinens überhaupt nachgeht2 – gerecht zu werden. Im Folgenden werden die Begriffe des „Phänomens“ und der „Phänomenalisierung“ in dreifacher Hinsicht beleuchtet. In einem ersten Schritt wird Richirs „Anmerkung des Herausgebers“ (2002) analysiert, die er anlässlich der ersten Ausgabe der von ihm gegründeten Zeitschrift Annales de Phénoménologie verfasst hat. Diese Anmerkung fokussiert sich auf den Begriff der Phänomenologie und stellt heraus, inwiefern der Seinsbegriff in der Phänomenologie als „Simulacrum“ aufgefasst werden muss; in einem zweiten Teil wird auf den sehr frühen Richir zurückgegangen, wobei einige Auszüge der „Notes sur la phénoménalisation“ (1969–70) hinsichtlich des Begriffs der „Phänomenalisierung“ untersucht werden; und schließlich wird auf den Begriff der „Architektonik“ beim späten 1 2
Sein und Zeit, op. cit. S. 47 (bereits zitiert). Ebd.
44
Kapitel I
Richir eingegangen, der eine ganz neue Auffassung des „Phänomenalisierens“ bereithält. * In jener „Anmerkung des Herausgebers“ steht folgendes: Während der phänomenologische Diskurs nur dann einen präzisen Sinn haben kann, wenn er genau zu verstehen gibt, wovon (von welchem Problem oder welcher Frage) er jedes Mal spricht, und wenn dabei dieses „Was“ (die „Sache selbst“) dadurch (direkt oder indirekt) im Vollzug (im mathematischen Sinne) der Leistung, die den Bezug dazu ermöglicht, ausweisbar sein muss, besteht der Charakter der Spekulation, die ihre klassische Strenge (ihre eigene „Logik“, weit jenseits der Logik) mittlerweile verloren hat, heutzutage darin, dass darin so gut wie alles über alles ausgesagt werden kann, sofern nur die spekulative „Konstruktion“ den Eindruck vermittelt, mehr oder weniger haltbar zu sein – oft (aber nicht immer) durch Verkettungen von (nicht nachvollziehbaren) Pseudo-Begriffen, die bloß zurechtgeflickt sind und sich mehr der Ideologie als der methodisch entwickelten „Logik“ einer Ausarbeitung, die sich ihre Regeln und die Herangehensweise ihrer Probleme selbst gibt, verdanken. […] Husserls Werk, das seit der Editionsarbeit der Husserliana nicht mehr wie noch vor fünfzig Jahren gelesen werden kann, ist eine riesige Baustelle, in der es keine einzige Frage gibt, die nicht ein wiederaufzunehmendes, umzuarbeitendes, neu zu definierendes Problem darstellt, ggf. gemäß anderer „Koordinatenachsen“, und zwar sowohl durch die Herausstellung des konkreten geschichtlichen Kontextes, in dem Husserls Denken sich entfaltet hat, als auch durch anders ausgerichtete Forschungen, die von den „Sachen selbst“, die Husserl berührt hatte oder die darin noch verschwiegen „impliziert“ waren, handeln. […] Um nun diesen Geist zu beleben oder wieder aufleben zu lassen, muss […] so manches Hindernis beseitigt und der Husserl’sche Sinn des Phänomens (der weder Erscheinung, noch Erscheinendes, noch unscheinbares Spiel beider ist) sowie der Husserl’sche Sinn des Transzendentalen (der nicht auf die Ordnung von Bedingungen der Möglichkeit a priori im kantischen Verständnis reduziert werden kann, sondern einem fungierenden Apriori zuzuschreiben ist, das durch die Epoché und die Reduktion und sodann durch die Zickzack-Analyse offengelegt werden muss) verstanden werden. Hierbei bleibt – hinsichtlich der Analyse der komplexen intentionalen Strukturen (den Husserl’schen Phänomenen), die bereits in ihren vielfältigen Potentialitäten, d. h. selbst außerhalb der Gegenwart und womöglich außerhalb der Gegenwärtigkeit fungieren – so manche Ressource unerkannt. […]
Phänomen und Phänomenalisierung
45
Hierdurch wird bereits deutlich, dass das Husserl’sche phänomenologische Feld – was darüber auch sonst gesagt werden mag – deutlich weitläufiger ist als das, was auf den einen oder anderen ontologisierenden Entwurf zurückgeführt werden kann. Die Frage nach dem Phänomen in seinem Husserl’schen, revolutionären Sinn, in seinem genuin phänomenologischen Sinn, hat nur sehr sekundär und örtlich beschränkt mit der Frage nach dem Sein zu tun.
Folgende Punkte sind hierbei hervorzuheben: 1.) Die „Sache“, das „Was“, von dem im phänomenologischen Diskurs die Rede ist, ist nichts direkt Gegebenes, sondern entfaltet sich erstens in einer Ausarbeitung, die einerseits vollzogen werden muss und andererseits über eine eigene „Logik“ verfügt, die ihre Regeln und Herangehensweisen mit sich bringt, von denen her es analysiert werden kann. Dieser phänomenologische Diskurs erfordert zweitens, dass offengelegt wird, was lediglich „impliziert“ wird, „verdeckt“ und „außerhalb der Gegenwart und womöglich außerhalb der Gegenwärtigkeit“3 fungiert. Die „Sache“ weist sich somit in einem Vollzug aus, der keinesfalls einfach „da“ ist, sondern in der Tat geleistet werden muss; und in diesem geleisteten – und je zu leistenden – Vollzug scheint nicht das bereits Gestiftete, sondern – wie bereits zu Ende der Einleitung angekündigt – „das Phänomenologische“ vor. Was ist damit näher gemeint? 2.) Es geht dabei um eine Bedeutung des Phänomens und des Transzendentalen, die bei Husserl angelegt ist, aber nicht immer auf eine befriedigende Weise geltend gemacht worden ist. Wenn nun „der Husserl’sche Sinn des Phänomens […] weder Erscheinung, noch Erscheinendes, noch unscheinbares Spiel beider ist“ (hervorgehoben v. Vf.), dann bedeutet das, dass er weder das „unscheinbare Spiel“ der Erscheinung, noch des Erscheinenden, sondern das „Unscheinbare“ als solches, die „Unscheinbarkeit“ als solche ist. Das besagt: nicht das unscheinbare Spiel irgendeines Erscheinenden, sondern eben das „unscheinbare ‚Spiel‘“ selbst. Dabei ist freilich der Status des Unscheinbaren zu klären. Es handelt sich dabei nicht um etwas, 3 Der hier in der Folge J. Trinks’ mit „Gegenwärtigkeit“ wiedergegebene Begriff der „présence“ bezeichnet eine Form der „Gegenwärtigkeit“, in der sich der Sinn zwar „für eine gewisse Zeit“ hält, der aber gleichwohl keine „Gegenwart“ im husserlschen Sinne zugeschrieben werden kann. Der Sinn kann nämlich nicht fixiert werden, ohne dass eine solche Fixierung ihn entgleiten ließe, und deshalb kann er sich auch nicht in eine Jetzt-Reihe, die ja die (fixierte) „Objektivität“ auszeichnet, einschreiben.
46
Kapitel I
das vom Feld der Gegenwärtigkeit und der Offenbarung in eine unsichtbare Sphäre verschoben würde und allererst ans Licht gebracht werden müsste. Es handelt sich um überhaupt keine Art genuiner Gegenständlichkeit, sondern um ein „Fungieren“, dessen „Offenlegung“ nach der Epoché, der Reduktion und der ZickzackAnalyse sowie nach „operativen Begriffen“ verlangt, deren Status geklärt werden muss. Hiermit wird nicht – wie etwa bei Heideggers Auffassung der Unscheinbarkeit, die auf sein Verständnis der sowohl phänomenalisierenden als auch entzogenen „aletheia“ zurückzuführen ist – „die“ Unscheinbarkeit als solche gleichsam hypostasiert, sondern, wie gesagt, der Begriff des „Transzendentalen“ (in seiner Ermöglichungsfunktion) für den phänomenologischen Ansatz fruchtbar gemacht. Epoché und Reduktion. Richir ist ein radikaler Denker der Bewegung und Dynamizität. Dies trifft in einem weiten Maße auch auf seine Auffassung der Epoché und Reduktion zu. Er entwickelt den Unterschied beider Begriffe auf eine originelle Art, wenngleich er auch einer Sichtweise anhängt, die zuerst von Patočka eröffnet wurde.4 Dessen Grundidee besteht darin, eine Radikalisierung der Epoché zu vollziehen, um so die Grundlage für eine „asubjektive Phänomenologie“ zu liefern. Für Richir sind die Epoché und die Reduktion noch enger verbunden: Die Reduktion fixiert dabei, was die Epoché zunächst auseinandergelegt hatte. Die Epoché stellt also nicht bloß – negativ – eine Ausschaltung oder Suspendierung, sondern – positiv – eine Eröffnung dar. Die Epoché eröffnet die Dimension der „Fluidität“ des Sinngeschehens (im Gegensatz zur scheinbaren Fixiertheit der „realen“ Gegenständlichkeiten), und die Reduktion vertieft sich in das Diesseits gegenüber dem diese Eröffnung der „Fluidität“ ausmachenden Jenseits (hierfür gebraucht Richir in seinen letzten Schriften den Begriff der „Hyperbel“). Die Reduktion lässt eine gewisse Positivität dort aufscheinen, wo sich alles unendlich zersplittert und auflöst. Dieses enge, durch die Idee der „Positivität“ vermittelte Verhältnis kann auch folgendermaßen
4 Siehe J. Patočka, „Epoché und Reduktion“, in Die Bewegung der menschlichen Existenz, K. Nellen, J. Němec, I. Srubar (Hsg.), Stuttgart, Klett Cotta, 1991, S. 415–423; A. Schnell, Was ist Phänomenologie?, Frankfurt am Main, Klostermann, 2019, S. 424–452.
Phänomen und Phänomenalisierung
47
beschrieben werden: Die Epoché „transzendiert“ (im Heidegger’schen Sinne)5 die Positivität, um aufscheinen zu lassen, was sie „vibrieren“ oder „flimmern“ lässt; und die Reduktion nimmt die Positivität (die selbstverständlich nicht die Positivität der „realen“ Gegenstände, sondern des Phänomens selbst ist) auf sich, um eben die Sphäre „diesseits“ des Phänomens aufzuzeigen. Ein letzter Punkt muss noch bezüglich dieses wesentlichen methodologischen Begriffspaars hinzugefügt werden: Richir hat im Grunde wenig über seine eigene Methode nachgedacht oder zumindest wenig darüber kundgetan. Der Grund dafür liegt darin, dass seine Methode sich von seiner Denkbewegung überhaupt nicht trennen lässt. Darüber hinaus hat sich diese methodologische Bemerkung zur Epoché und zur Reduktion einer Idee zu verdanken, die man auch an anderer Stelle antrifft. Dies betrifft den in Richirs letzten Schriften allgegenwärtigen „‚Moment‘ des Erhabenen“. Vielleicht spiegelt sich im Verhältnis zwischen Epoché und Reduktion in gewisser Weise jenes zwischen „Systolē“ und „Diastolē“ des „‚Moments‘ des Erhabenen“ wider. Vielleicht „erfordert“ die fixierende und fixierte Eröffnung ein Erschlaffen, das einer proto-ontologischen, affektiven, aber stets virtuellen Kondensierung und Konzentration folgt. Wie dem auch sei,6 dieses „Vielleicht“ verweist womöglich auf ein spezifisches Verhältnis von „Methode“ und „Architektonik“, das weiter unten näher erläutert wird. Zickzack-Analyse. Zwischen welchen Instanzen schwingt die auf Husserl zurückgehende „Zickzack-Analyse“ bei Richir hin und her? Zunächst zwischen den Gegenständlichkeiten, die, wenngleich sie hinsichtlich ihres Ansichseins „eingeklammert“ sind, mit ihrer „Typik“ und ihren „Motivierungen“ als „Leitfäden“ für die phänomenologische Analyse dienen. Das Wesentliche liegt aber woanders. Ein vertiefteres – „verschütteteres“ – Zickzack besteht zwischen der erscheinenden Dimension (bei Beibehaltung der Epoché) und der unscheinbaren, das Phänomen konstituierenden Dimension (also dem, was Richir „das Phänomenologische“ nennt). Oder zwischen der phänomenalen Fluidität, einerseits, und der „präphänomenalen“, „präimmanenten“ Positivität, andererseits – einer 5 Siehe M. Heidegger, Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz, HGA 26, K. Held (Hsg.), Frankfurt am Main, Klostermann, 1978. 6 Auf den „‚Moment‘ des Erhabenen“ wird in der Folge an verschiedenen Stellen zurückzukommen sein.
48
Kapitel I
„Positivität“, die mit dem Siegel der „Negativität“ versehen ist, die Richir in De la négativité en phénoménologie (2014) beschäftigt hat und verständlich macht, weshalb – in Richirs Augen – die strikt eingehaltene phänomenologische Einstellung einen Rückgang zur „naiven“ natürlichen Einstellung unmöglich macht. 3.) Der dritte Punkt ist der subtilste und vielleicht schwierigste und betrifft das Verhältnis von Phänomenologie und Ontologie. In der oben zitierten Anmerkung des Herausgebers wird deutlich, dass das phänomenologische Feld sich weit über das Feld „dieses oder jenes ontologisierenden Entwurfs“ hinaus erstreckt. Hiermit sind sowohl Heideggers als auch vielleicht Levinas’ Entwurf gemeint. Aber der Hintergrund des hier Angesprochenen geht über eine polemische Auseinandersetzung mit den Verfassern von Sein und Zeit und Autrement qu’être ou au-delà de l’essence hinaus. Richir strebt vielmehr an, grundlegende Zweifel an der Berechtigung des „ontologischen Arguments“ (wie es in der philosophischen Tradition in den Vordergrund gerückt wurde) geltend zu machen. Im Mittelpunkt dieser Diskussion steht der Begriff des „Simulacrums“. Was die „Positivität“ in phänomenologischer Hinsicht betrifft, wurde soeben erwähnt, dass sie mit dem Siegel der Negativität versehen ist. In der Tradition – und auf diese (insbesondere jene Platons) bezieht Richir sich hier – wird das mit Negativität bzw. Nicht-Sein befleckte Sein als „Schein“ bezeichnet. Insbesondere die Phänomenologen der zweiten Generation (dabei vor allem in Frankreich) haben auf die Mehrdeutigkeit des „Scheins“, des „Scheinens [paraître]“, hingewiesen, nämlich zwischen Erscheinung und Erscheinen einerseits und dem bloßen Erscheinen oder Illusion und Trug andererseits. Genau bei dieser Zweideutigkeit setzt nun auch Richir an. Er geht jedoch weiter und stellt dabei einen tiefen phänomenologischen Sinn heraus. Die wesentliche Schwierigkeit bei der Bestimmung der „Positivität“ in der Phänomenologie betrifft die Tatsache, dass keine vorgegebene Realität, keine im Voraus aufgestellte Gegenständlichkeit, kein Sein an sich als Maßstab dafür dienen kann, anhand dessen sich die „Stimmigkeit“7 der phänomenologischen Positivität messen ließe. Diese unterliegt daher ständig der Gefahr des Scheins. Anders ausgedrückt: Die Positivität zeitigt permanent einen Schein der 7 Für diesen Begriff siehe Seinsschwingungen, op. cit. („Entwurf einer generativen Ontologie“).
Phänomen und Phänomenalisierung
49
Positivität. Richir hat mindestens zwei Mal versucht, die Konsequenzen aus dieser Einsicht zu ziehen, nämlich in den Recherches phénoménologiques (1981, 1983) sowie in Phénoménologie en esquisses. Nouvelles fondations (2000), wo die Phantasie (in ihrem subtilen und inneren Bezug zu den imaginativen Transpositionen) die Stelle von „Schein“, „Illusion“ und „Simulacrum“ einnimmt. Die ontologischen Schlussfolgerungen aus dem soeben Dargelegten machen dann auch Richirs Kritik am „ontologischen Argument“ der metaphysischen Tradition verständlich: Er hinterfragt nicht bloß dieses Argument bei Anselm, Descartes oder Leibniz, um dessen Einfluss auf die moderne philosophische Tradition zu brandmarken, sondern er behauptet geradeheraus, dass jegliche Seinsannahme ein Simulacrum darstellt. Sein und Schein stehen sich nicht einfach gegenüber. Daher ist für ihn auch der Übergang von Phänomenalität als nichts als Phänomenalität zu einem transzendenten oder gar korrelativen Sein nicht akzeptabel. Um Richir zu verstehen, muss seine Auffassung der „Realität“ deutlich gemacht werden, und um das zu tun, muss die Ausschaltung des ontologischen Arguments radikal – das heißt ein für alle Mal – verallgemeinert werden. Das „Phänomen“ und das „Phänomenologische“ sind somit kein bloßer Schein, sondern auch ein Nicht-Sein (sofern das Sein für Richir je durch eine gewisse „Stabilität“ und „Fixiertheit“ gekennzeichnet ist). * Dieser letzte Aspekt ist bereits beim ganz frühen Richir, in seinen (bis heute unveröffentlichten) „Notes sur la phénoménalisation“ (1969–1970) zu finden. Sehen wir nun zu, welch andere Perspektive hinsichtlich des Seins und Status des Phänomenalisierens in diesen „Notizen“ sichtbar wird. Was bedeutet die „Phänomenalisierung“? Sie wird durch verschiedene „Motive“, die ihren Ursprung in einer frühen Auseinandersetzung Richirs mit Husserls und Heideggers Texten haben, bestimmt.8
8 Siehe den Text vom 12. Januar 1969, der den Titel „Le problème de la phénoménalisation“ trägt.
50
Kapitel I
In „Das Problem der Phänomenalisierung“ behauptet Richir in Bezug auf Husserl, dass die Phänomenalisierung zu dem „Horizont“begriff in Beziehung gesetzt werden muss. Dieser wird dabei erstens als „Idee im kantischen Sinne“ und zweitens als „leere Form“ definiert, die weder gegenwärtig noch abwesend und dazu unendlich ist (das heißt kein Gegenstand einer endlichen Anschauung), also als eine leere Form, welche die Erscheinung im Blick auf das Erscheinende erfasst. Heidegger zufolge denkt die Phänomenalisierung dagegen die Bewegung des Zirkels des Vorverständnisses (im Sinne der Platon’schen „theoria [Schau]“). Diese Bewegung besteht (auf der Ebene der Zeughaftigkeit, also der alltäglichen „Dinge“ vor ihrer theoretischen und erkenntnismäßigen Objektivierung) darin, im Schauen (bzw. in der Anschauung) in den Vor-griff zu nehmen, wie das Seiende zum Seienden wird, bzw. wodurch das Seiende erscheint, d. h. in seinem Sein offenbart (entdeckt) wird. Heidegger gelingt es somit, den Zirkel des Schauens zum Thema zu machen, sofern das Beschreiben dieses Zirkels (seine Einschreibung) für das Dasein konstitutiv ist. Das Verstehen […] dieses Zirkels eröffnet also, in der Bewegung seines Be-schreibens (d. h. auch seines Aus-schreibens [désinscrire]), die Frage nach dem Sinn des Seins, sofern diese Bewegung jene Bewegung „ist“, durch die das Sein in seinem Zirkel den Ort beschreibt, in dem das Seiende zum Erscheinen kommt.9
Richir nimmt sich sodann folgende Aufgabe vor (die in derselben Notiz vom 12. Januar 1969 umrissen wird): Mit anderen Worten, Heidegger bewegt sich immer schon im Kreis. Was ungedacht bleibt, ist das BESCHREIBEN des Kreises, das heißt die phänomenalisierende Bewegung, eine nicht zweckhafte (nicht einmal mittels der Zeughaftigkeit) blinde Bewegung, wodurch das Zweckhafte (das mundane Wohnen), zum Sein kommt. Dies wirft die schwierige Frage nach dem Davor und dem Danach auf. Sofern dieses „Davor“ „vor der Zweckhaftigkeit“ ist, ist es weder zeitlich noch räumlich, Un-Sinn, Nullhaftigkeit des Sinns, formloses Nichts. Das Problem ist also das des Aufkommens der Zweckhaftigkeit, das heißt der „Erfindung“ des Werkzeugs.10 9 Ebd. Die hervorgehobene Rolle der „Schrift“ (einem bekannten Motiv Derridas) ist hier nicht zu übersehen. 10 Ebd.
Phänomen und Phänomenalisierung
51
Richir beschreibt hier nun zwei mögliche „Richtungen“ der Phänomenalisierung – die von seinem Lehrer Loreau und die von Derrida. Laut ersterem muss man den Versuch unternehmen, „außerhalb des Zirkels“ zu denken. Um den Ursprung des Zweckhaften, der Teleologie zu begreifen, müsse man sich dann an anderen Paradigmen orientieren: entweder am Menschenaffen, der das Werkzeug erfunden hat, oder am neue Formen hervorbringenden Künstler, welche beide „nichts“ besitzen. Derrida strebt dagegen ein „Denken der Schrift“ an „oder vielmehr das Denken als Schrift, als Spiel des Differierens, das als solches die Spur und dadurch die Gegenwärtigkeit erzeugt. Also das Spiel des Differierens als Phänomenalisierungsleistung.“11 Dann käme aber erneut Loreau ins Spiel: Wie ist nämlich der Übergang möglich vom chaotischen Spiel (d. h. von dem nicht zweckhaften Aufruhr der Körper, von der „absoluten“ Herrschaft der „Ungeschicklichkeit“ und dem anfänglichen Gebrabbel) hin zum Spiel des Differierens, d. h. vom Chaos der Elemente hin zum Spiel des Zurückhaltens [jeu de la mise en réserve]? Mit anderen Worten, wie kann die „erste Spur“ gedacht werden? Wie bildet und wandelt sich der Zufall in Nicht-Zufall, in die Erzeugung des Sinnzirkels, durch welchen die ungebundene Geste sich zur zweckhaften Geste in und durch das Werkzeug macht? Richir sieht dabei ein grundlegendes Problem: Jenes des Davor und des Danach, jenes der „ersten“ Spur, was das Problem der Genese aufwirft, das von Heidegger völlig vernachlässigt wird (dieser bleibt ein Denker der Geschichte, unter der Ägide der Geschichtlichkeit des Seins, die als Geschick der Möglichkeiten erscheint, als die hermeneutische Entfaltung und Entwicklung des Zirkels), und jenes der Zeitigung. Eine „erste Spur“ zu suchen, d. h. aus der Spur eine Gegenwärtigkeit zu machen, gehört zweifellos noch dem metaphysischen Denken an. Dabei geht es aber weniger darum, als um die Suche nach den „Bedingungen der Möglichkeiten“ der Spur, d. h. zunächst um eine Suche, welche die Logik der Spur betrifft, die sich in einem Zirkel Heidegger’schen Stils bewegt, da die Aufstellung der Logik der Spur die Spur voraussetzt. Was es zu denken gilt, ist das Spur-Werden der Spur, das In-Umlauf-Bringen [mise en économie] des Spiels. In dieser Hinsicht enthält die Theorie der phänomenologischen Reduktion – freilich „unterschwellig“ und an einem „Punkt“ ihrer Artikulierung – das Spur-Werden, nämlich dort, wo 11
Ebd.
52
Kapitel I
Husserl in einem ungedacht gebliebenen Gestus vom Spiel der Welt (dem Chaos der Abschattungen) zum transzendentalen Absoluten übergeht. Diese „Fiktion“ müsste radikalisiert werden, es müsste das Vorurteil eines transzendentalen Bewusstseins aufgehoben, also das, was ich in meiner Abschlussarbeit12 unternommen habe, noch weiter vertieft werden. Vielleicht müsste man auf der impliziten Ebene von Husserls genetischen Forschungen eine radikale Problematik der Genese hervorkehren, die es ermöglichen würde, zu einem Denken des Spur-Werdens der Spur zu gelangen, zu einem Denken der Transgression, durch die der Zufall zu Sinn wird (vgl. Husserls Cartesianische Meditationen: „die […] noch stumme Erfahrung, die nun erst zur reinen Aussprache ihres eigenen Sinnes zu bringen ist“). Das Problem der „Erfindung des Werkzeugs“, der Erzeugung einer Zweckhaftigkeit (in der Geste, die durch, für und im Werkzeug gezähmt wurde), geht somit nur über das Problem der Phänomenalisierung und der Zeitigung. Es ist zugleich das Problem des „Ursprungs“ der Schrift. In der Tat lässt sich hier die von Derrida versuchte „Regression“ hin zu den „Ursprüngen“ umreißen. Die Schrift wurde ihrerseits als ein Instrument gedacht (wiederum von Heidegger in Sein und Zeit, vgl. S. 168 und allgemeiner die §§ 34–35). Die Frage nach der Geburt des Werkzeugs ist also „analog“ zu jener nach der Geburt der Schrift. Die „instrumentale“ Seite des Werkzeugs muss daher dekonstruiert, es muss daran die „Erzeugung [instauration]“ der Spur, die „Ur-Bewegung“ der Ur-Schrift, aufgewiesen werden. Das Werkzeug ist „gleichzeitig“ Erzeugung der Spur und Erzeugung einer Zweckhaftigkeit. → Kann die Spur gedacht werden, ohne sie in den Rahmen einer Zweckhaftigkeit einzuschreiben? Hieran hängt alles.13
Loreau geht daher gerade vom nicht zweckhaften Denken aus, das sich insofern einen Zweck setzt, als es sich selbst in der Kunst darlegt (was zur Voraussetzung hat, „Heideggers Denken der Kunst zu dekonstruieren und zu betrachten, wie sein Ausgangspunkt bei der Zeughaftigkeit ihn den Wahn Dubuffets einer graphischen Einschreibung ‚verpassen‘ lässt“). Aber Loreau bleibt nach Richirs Dafürhalten noch zu „nahe“ an Platon.
12 Richir bezieht sich hier auf seine Diplomarbeit, die den Titel „La fondation de la phénoménologie transcendantale (1887–1913)“ trägt und von Max Loreau an der Freien Universität Brüssel (ULB) betreut wurde. Richir hatte diese kurz zuvor (1968) verteidigt. 13 Ebd.
Phänomen und Phänomenalisierung
53
Richirs eigene Überlegungen gehen somit in die Richtung einer radikalisierten Reduktion, die es vermag, die Weltapperzeption zu entwurzeln, um so zu einem Phänomenalisierungstypus zu gelangen, der diesseits der Metaphysik bzw. Onto-Theologie angelegt ist. * Ein anderer wesentlicher Gedanke bezüglich der „Phänomenalisierung“ – vielleicht der bedeutendste – wird im „Exposé succinct de l’état actuel de nos recherches [Kurzexposé des aktuellen Stands unserer Forschungen] (20.–24. Januar 1969)“ entwickelt. In diesem Text ersten Ranges kommt Richir auf seine Diplomarbeit von 1968 zurück und stellt das, was er „das phänomenologische Problem“ nennt, heraus. Dieses Problem wird im Band II von Husserls Logischen Untersuchungen umrissen – ein Text, der für Richir zu diesem Zeitpunkt von großer Bedeutung war. „Formal“ ist es aber bereits in Hegels Phänomenologie des Geistes angelegt.14 Die Grundproblematik ist hierbei folgende: Es geht Husserl darum, die logischen Begriffe zu klären, um auf dieser Grundlage eine apodiktische Grundlage der Logik liefern zu können. Eine solche Grundlage lässt sich nun aber nur in jenen „Bewusstseinserlebnissen“ finden, die den logischen Begriff „vermeinen“. Und dafür ist eine reine Beschreibung des Erlebnisses erforderlich. In folgendem längeren – und entscheidenden – Passus wird jenes „phänomenologische Problem“ explizit formuliert (und es kommt damit ein Problemstrang zum Vorschein, der Richirs Werk mindestens bis zu den Phänomenologischen Meditationen durchziehen wird): 14 Für Richirs frühe Bekanntheit mit Hegel war Loreaus Auslegung der Phänomenologie des Geistes maßgeblich; siehe M. Loreau, „Lecture de l’Introduction à la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel“, Textures, 69/5, S. 3–34 (dieser Artikel wurde in En quête d’un autre commencement, éditions Lebeer Hossmann, Brüssel, 1987, unter dem Titel „L’introduction à la phénoménologie de l’esprit de Hegel“, S. 11–42) erneut publiziert; ferner M. Loreau, „Hegel et le corps récalcitrant (Lecture de la ‘Certitude Sensible’, chapitre 1er de la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel)“, Textures, 70/7–8, S. 55–102 (auch dieser Artikel wurde in En quête d’un autre commencement unter dem Titel „Hegel et le corps récalcitrant [La certitude sensible]“, S. 43–89, wieder aufgenommen). Siehe auch R. Alexander, « Éléments de mobilité phénoménologique à partir de Hegel, Loreau et Richir », Eikasia, Nr. 60, November 2014, S. 125–136.
54
Kapitel I
Damit die Beschreibung des Erlebnisses rein sein kann, d. h. damit nichts von dem, was es explizit zu machen gilt, in der Beschreibung vorausgesetzt wird [die „Voraussetzungslosigkeit“ ist das Leitwort der Einleitung des zweiten Bandes der Logischen Untersuchungen], darf die Anschauung des zu beschreibenden Erlebnisses in keiner Weise durch die vorhergehende Anschauung der durch das Erlebnis anvisierten logischen Idealität kontaminiert werden; der anschauliche Blick, der sich auf das Erlebnis bezieht, muss vom auf die Idealität gerichteten Blick sauber trennbar sein können, und der Blick muss sich somit dergestalt verdoppeln, dass jedes seiner Teile gegenüber allen anderen völlig selbständig ist. Diese Position ist aber unmöglich: Denn wenn der auf das Erlebnis gerichtete Blick nicht mehr weiß, dass dieses Erlebnis eben jenes Erlebnis ist, in dem die zu klärende Idealität anvisiert wird, dann ist es überhaupt nicht mehr möglich zu sehen, dass der zu beschreibende Denkakt der Denkakt dieser Idealität ist. Anders ausgedrückt, die Korrelation zwischen Erlebnis und Idealität wird aufgehoben und die phänomenologische Beschreibung verliert ihre Bedeutung, die eben darin besteht, die gemeinte Idealität zu klären. Daraus folgt, dass das Erlebnis seine Bedeutung nur durch die Idealität, an die es sich bindet, erhält. Diese Idealität operiert also wie das Licht, das das Erlebnis beleuchtet, indem es ihm Form und Sinn verleiht, sodass das phänomenologische Projekt sich umkehrt: Was vorgreifend als Grund aufgefasst wird [= das Erlebnis], erscheint lediglich als ein [durch die Idealität] Gegründetes. Das zeigt, dass die phänomenologische Beschreibung, so wie sie in den [Logischen] Untersuchungen vollzogen wird, sich in einem Kreis bewegt: Nur dank einer VorSicht der zu klärenden Idealität wird diese Klärung selbst ermöglicht, das zu Klärende wird in der Klärung je schon vorausgesetzt. Das, was am Ende stehen soll (die geklärte Idealität), ist schon von Anfang an da. Die Idealität spielt somit die Rolle einer arché und eines télos. Sofern die Idealität je schon vor-gesehen ist, kann sie die phänomenologische Beschreibung des Erlebnisses abschließen. Wenn man hierüber nachdenkt, handelt es sich bei diesem Kreis um jenen der Metaphysik, so wie er von den Griechen eingeführt wurde: Die Wahrheit als richtige Schau des eidos, als Exaktheit des Blicks (orthotes, Platon, Staat, 515d), als homoiôsis, Übereinstimmung der Erkenntnis und der Sache selbst, kann sich nur verwirklichen (d. h. ihrem eigenen Kriterium genügen), wenn man schon im Voraus im Blick hat, was diese Exaktheit und diese Übereinstimmung sind, das heißt nur dann, wenn das eidos bereits vor-sehend in den Blick genommen wurde. Daher werden wir diesen Kreis „Kreis des Vor-sehens“ nennen. Das Paradoxon dabei ist, dass Husserl die widersprüchliche Forderung aufrechterhält, das Erlebnis zu beschreiben, ohne die im Erlebnis gemeinte Idealität zu betrachten. Diese paradoxe Situation hat ihn dazu bewegt, seine Theorie der phänomenologischen Reduktion auszuarbeiten. Ohne dass wir hier auf alle Einzelheiten eingehen könnten, sei lediglich erwähnt, dass diese widersprüchliche Forderung es ermöglicht, dem paradoxen Charakter der Reduktion Rechnung
Phänomen und Phänomenalisierung
55
zu tragen, der unserer Kenntnis nach noch von keinem Husserl-„Exegeten“ aufgewiesen wurde und in der „Ausschaltung“ besteht: Diese ist weder eine Streichung – cartesianische Aufhebung – noch eine Vernichtung, sondern Ausschaltung des Denkens, Außer-Spiel-Setzung. Hierdurch wird die Idealität nicht in eine Abwesenheit versetzt, sie wird aber auch nicht in der Gegenwärtigkeit behalten, sondern sie „schwebt“ vielmehr in einer Art „Zwischen“ zwischen Gegenwärtigkeit und Abwesenheit, wo sie als leerer, weder gegenwärtiger noch abwesender Pol fungiert, der dem Erlebnis Sinn verleiht. Auf diese Art gibt sich die reduzierte ideale Gegenständlichkeit (die nach der Ausweitung des phänomenologischen Gebiets über das logische Gebiet hinaus alle Objekttypen umfasst) von 1907 an (in Die Idee der Phänomenologie, Husserliana II) als eine leere Form, die – der endlichen Anschauung unzugänglich – im Unendlichen angesiedelt ist, unbestimmt erfüllbar durch das, was die endlichen Anschauungen zu sehen geben. Das télos einer vollkommenen Erfüllung einer leeren Form verleiht somit laut Husserl der Objektivität Sinn[.]15 Mit anderen Worten, ein Seiendes ist nur insofern ein Seiendes, als es sich – durch die Antizipation eines Ideals (jenes der vollkommen erfüllten Form, was also einer endlichen Anschauung in einer ins Unendliche projizierten Gegenwärtigkeit vollkommen zugänglich ist) – in die im Vorhinein eingeschriebene Furche [sillon pré-inscrit] einschreibt. Dadurch wird verständlich, dass das, was die endliche Anschauung ermöglicht, für Husserl die Antizipation von Horizonten (der Erfüllung) ist, innerhalb derer das Seiende zum Erscheinen kommt. Die Konstitution des Seienden ist die Konstitution einer Teleologie. Dies ist der Sinn der Intentionalität bei Husserl. 2.) Unser Problem Unser Problem, dessen Klärung wir zu versuchen beabsichtigen, ist folgendes: Ist es möglich, das Zum-Erscheinen-Kommen [la venue au paraître] des Seienden zu denken (was wir von nun an die Phänomenalisierung des Seienden nennen werden), ohne es in die durch einen Horizont, der das Erscheinen abschließt [finalise le paraître], im Vorhinein ein-geschriebene Furche einzuschreiben? Ist die Vor-Schreibung [pré-scription] dieser Furche für den Sinn unabdingbar? Setzt die Phänomenalisierung stets einen zweckhaften Abschluss [finalité] voraus? Ist die Phänomenalisierung notwendigerweise Hervor-Bringung eines Erscheinens in Hinsicht auf? Ist es möglich, dem Kreis des Vor-Sehens zu „entkommen“?
Richir stellt hier den Konflikt zwischen dem Leitwort der Voraussetzungslosigkeit und dem Anti-Psychologismus heraus, d. h. der Idee, dass das Erlebnis der Idealität (das geklärt werden muss) nicht 15
In Richirs Text steht hier ein Fragezeichen.
56
Kapitel I
selbstgenügsam ist (es muss also „wissen“, wovon es ein Erlebnis ist, denn es erhält seine Bedeutung nur dank dessen, wovon es ein Erlebnis ist). In diesem „Problem“ Richirs wird somit deutlich, dass sein allerorts ausgedrückter Gedanke einer Entkopplung von „Phänomenalität“ und „Eidetizität“ bereits in dieser Notiz aus 1969 angelegt ist. Es geht also darum, den „Kreis des Vor-sehens“ zu vermeiden. Dazu reicht es nicht hin, „die Tradition gedanklich beiseite zu schieben, um ihm so zu entkommen“. Deshalb erwägt Richir in einem ersten Schritt eine „Dekonstruktion der Tradition“. Diese bezieht sich auf ausgewählte Texte Husserls und Heideggers. Wozu diese „Dekonstruktion“? Weil die „Schreibenden [scripteurs]“ (Richir spricht bemerkenswerter Weise nicht von den „Autoren“), um ihrem System eine Kohärenz zu verleihen, dazu tendieren, „Möglichkeiten zu tilgen“. Richir möchte diese wieder „ausgraben“, um „die Möglichkeit neuer Antworten“ zu eröffnen. Dabei muss aber die Gefahr, in den Kreis des Vor-sehens zurückzufallen, vermieden werden. Daher strebt er, wie er sagt, ein „unverriegeltes Denken“ an (der Fragehorizont stellt etwa einen solchen Riegel dar). Sein eigenes Projekt besteht also in „einem Denken der Entriegelungsbewegung, d. h. einem Denken des philosophischen Schreibens“. Er fasst das folgendermaßen zusammen: „Kurz gesagt, werden wir – in der Bewegung unserer Untersuchung – nach und nach dazu angeleitet, die Antizipation unseres Horizonts „aus-zu-schreiben [désinscrire]“,16 den Sinn unserer Frage mehr und mehr zu erfahren (die allgemeine Korrelation zwischen dem angestrebten Ziel und dem, was der Untersuchung Sinn verleiht, zu prüfen).“ Richir verfährt dabei in drei Schritten. 1.) Erste These (im Ausgang von Husserl): Die Antizipation der transzendentalen Subjektivität – die qua absolute Gegenwärtigkeit sich in die durch den Zeithorizont vor-geschriebene Furche einschreibt – ist offenbar der Grund dafür, dass das, was Richir die „Phänomenalisierung“ nennt, Husserl „entgangen“ sei. Das Festhalten an der transzendentalen Subjektivität, sofern sie sich in den zeitlichen Horizont der „Gegenwärtigkeit“ einschreibt, stellt das Hindernis für ein angemessenes und treffliches Denken der Phäno16 „Aus-schreiben [désinscrire]“ bezeichnet hier das Gegenteil von „einschreiben [inscrire]“.
Phänomen und Phänomenalisierung
57
menalisierung dar. Der Horizontbegriff soll somit auf die Probe gestellt und die Dekonstruktion der Metaphysik auf dieser Grundlage vollzogen werden. 2.) Die „Nichtreduzierbarkeit“ des Horizonts soll hinterfragt werden. Daraus ergeben sich zwei neue Richtungen. Der zweite Teil handelt zunächst von Heidegger, der dritte wiederum von Husserl. (Nach Richirs Dafürhalten wird Heideggers Denken der Phänomenalisierung in der in Vom Wesen der Wahrheit (1930) vollzogenen „Kehre“ initiiert.)17 Zweite These: Heidegger gelingt es zwar, dem Kreis des Vor-Sehens zu entkommen, er bleibt dafür aber in einem anderen Zirkel gefangen, den Richir den „ontisch-ontologischen Zirkel“ nennt und dem zufolge jedes Seiende sich im „Horizont des Seins“ ansiedelt. Diese Vor-Schreibung der ontisch-ontologischen Differenz ist in Richirs Augen problematisch. Heidegger merze die Frage nach dem „Beschreiben [tracement]“ der ontisch-ontologischen Differenz aus. Es bestehe eine „geheime Absprache“ zwischen Husserls und Heideggers Auffassung der Phänomenalisierung, „wobei diese Phänomenalisierung ‚formal‘ in der Eröffnung einer Differenz zwischen einem gänzlich anwesenden Pol (dem Seienden) und einem leeren, weder gegenwärtigen noch abwesenden Pol (dem Husserl’schen Horizont, dem Heidegger’schen Sein) besteht“. Man kann hier bereits gewisse Vorbehalte von Seiten Richirs gegenüber Heidegger herauslesen (die sich später noch deutlich verschärfen werden), denn er regt an, „die ontisch-metaphysische Sprache aufs Äußerste zu treiben, indem die Strenge soweit wie möglich radikalisiert wird, um sie [d.h. die ontisch-metaphysische Sprache] dadurch aufbrechen zu lassen“. 3.) Schließlich sind laut Richir diejenigen Texte Husserls heranzuziehen, die vom Problem des Beschreibens des Horizonts handeln und die Frage nach den Horizonten, der Teleologie und der Zeitigung miteinander in Beziehung setzen. Immer dasselbe Zirkelproblem steht dabei im Vordergrund (diesmal in zeitlicher Hinsicht betrachtet): Wie kann der ursprünglichen Zeitlichkeit Rechnung getragen werden, ohne dass im Voraus ein zeitlicher Horizont angesetzt wird? Die hierfür heranzuziehenden Texte sind: das Manu17 Richir erwähnt zudem Zur Seinsfrage (1955), Identität und Differenz (1957) und Zeit und Sein (1962).
58
Kapitel I
skript A VII („Theorie der Weltapperzeption“); das Manuskript E III („Universale Teleologie“); die Manuskripte B III 3 und K III 11 („Phänomenologische Rekonstruktion = phänomenologische Archäologie“); und schließlich die C-Manuskripte (um Phänomenalisierung und Zeitigung zusammen zu denken). Dieser dritte Punkt geht über eine bloße Skizze nicht hinaus. Es wäre ratsam, sich auch auf die Bernauer Manuskripte zu berufen, zu denen Richir zu diesem Zeitpunkt freilich keinen Zugang hatte, um eine dritte These formulieren zu können, mit der sowohl der Anschluss an Fink als auch an Derrida hergestellt würde und die darin bestünde, die ursprüngliche Zeitigung und das Denken des Ursprungs, der Genese, welches nicht von der „Gegenwärtigkeit“ ausgeht und somit die „Vor-schreibung des Zeithorizonts“ vermeidet, auf ihre gemeinsamen Wurzeln hin zu betrachten. * Einige Monate später, am 20. März 1969, skizziert Richir – offenbar stark von Derrida beeinflusst – einige Überlegungen, die er „Leiblichkeit der Sprache – Phänomenalisierung“ betitelt. Um diese Betrachtungen zu schließen, soll nun noch folgender Auszug zitiert werden, der die „Phänomenalisierung“ in ihrem Bezug zur „Schrift“ von einem letzten wichtigen Gesichtspunkt aus betrachtet: Eine Sprache ohne Leiblichkeit, d.h. eine Sprache, die vor dem, was sie bedeutet, zurücktritt, vor dem, was sie re-präsentiert und zu sehen gibt, ist eine Sprache, die transkribiert, die nicht phänomenalisiert, d.h. die nichts präsentiert, sondern eben etwas repräsentiert, das bereits gegenwärtig, also bereits phänomenalisiert ist. […] Um zu phänomenalisieren, darf die Sprache nichts zu sagen haben, sie darf nichts ausdrücken. Es ist dies die Schrift in dem Sinne, den Maurice Blanchot diesem Wort gibt oder auch R. Barthes (das intransitive Schreiben: Das Schreiben, das nichts schreibt). Eine Sprache, die sich sozusagen engagiert, ohne etwas, was ihr äußerlich ist, sagen zu wollen, wäre zum Phänomenalisieren verurteilt. Man kann also das Denken der Phänomenalisierung und die Sprache der Phänomenalisierung voneinander trennen. Die Phänomenalisierung drückt sich nicht in einer Sprache aus, sondern die Phänomenalisierung schreibt [s’écrit] – im Sinne Derridas (Ur-Schrift) – die Phänomenalisierung ist Diktion.
Phänomen und Phänomenalisierung
59
Diese zweite Perspektive – die also einen Phänomenalisierungsmodus hervorkehrt, der sich von jeder Ausdrucksform über ein Seiendes unterscheidet – ist aber nicht Richirs letztes Wort zur Eliminierung jeglicher ontologischen Vorgehensweise in der Phänomenologie – weit gefehlt. Ein weiterer Phänomenalisierungsmodus betrifft den „Ausdruck“ einer inneren Logik, einer „Kohärenz“, in der Prozessualität der Sinnbildung im Allgemeinen und in Richirs Werk im Besonderen, der jedoch keinen neuen begrifflichen Gehalt offenbart (hierin besteht die Nähe zur Eliminierung der Ontologie). Deswegen ist es geboten, uns nun späteren Analysen Richirs zuzuwenden, um die Frage nach der Rolle und der Funktion der „Architektonik“ in dessen Methodologie zu beantworten. * Richirs Auffassung der „Architektonik“ hat im Grunde nur wenig mit jener Kants zu tun, selbst wenn sie selbstverständlich dort ihren Ursprung hat. Richir nimmt keinen „systematischen“ Charakter für die Phänomenologie in Anspruch (vgl. Kants Kennzeichnung der Architektonik als „Kunst der Systeme“) und vor allen Dingen geht es ihm nicht darum, die Phänomenologie zu einer „Wissenschaft“ zu machen (Kant hat die Architektonik ja auch als „Lehre des Scientifischen“ bezeichnet). Zwar hat Richir immer an der Idee einer „apriorischen ‚Organisation‘“ des menschlichen Geistes durch eine Architektonik Interesse gezeigt, aber er wollte und konnte dem allgemeineren oder gar extrapolierten „Phantasmus“ „einer Architektonik, die a priori existierte“18, nichts abgewinnen. Was ihn an einer solchen Auffassung störte, war das Nichtübereinkommen mit seinem eigenen Verständnis eines „Denkens der Bewegung“. Die Architektonik im Sinne Richirs kann keinesfalls statisch sein, sie ist beweglich und dynamisch. Die Beweglichkeit und Dynamik darin wird deutlich, wenn Richirs Bestimmung der „Tektonik“ und der „arché“ in Betracht gezogen wird. Unter „Tektonik“ versteht er die Gesamtheit der Bewegungen („Überlappungen“, „Drehungen“ bzw. „Verdrehungen“) der architektonischen Register der Sinnbildung, die keine „Schichten“ ausmachen (es handelt sich dabei also nicht um „Stratigraphien“), sondern „archai“ offenlegen, d. h. begriffliche Komplexe, 18
L’écart et le rien, op. cit., S. 192.
60
Kapitel I
welche der „Kunst [nicht der Wissenschaft] der Systeme“ eine Grundlage liefern. Von hier aus lassen sich bei Richir zwei Auffassungen der „Architektonik“ herausstellen. Die erste Bedeutung stellt den Zielpunkt von Richirs „‚Rückeroberung‘ der Phänomenologie gegen Heideggers phänomenologischer Metaphysik“19 dar. In der Tat hat Richir in den Phänomenologischen Meditationen entdeckt, „dass sich hinter der ‚Metaphysik-Fiktion‘ [in einer pejorativen, mit Heidegger assoziierten Bedeutung] eine allgemeine Architektonik der Phänomenologie verbirgt“, die als „systematische Ausgestaltung nicht von Sein und Seinsstufen [wie in Phénomènes, temps et êtres], sondern der Probleme und Fragen der Phänomenologie im Sinne eines Zurückgehens auf das Archaischste“ charakterisiert wird, wobei „das Archaische, und das Archaischste, in jedem Problem und jeder Frage immer implizit da sind, jedoch transformiert und transponiert in dem, was innerhalb des expliziten Problems und der expliziten Frage die Deformation [dieser Explizitheit] ist“.20 Mit anderen Worten, diese Bedeutung der Architektonik fällt schlicht mit Richirs wiederholter Thematisierung von Husserls Denken des Impliziten zusammen. Die Architektonik hat auch eine andere Auswirkung auf Richirs „Neugründung“ der transzendentalen Phänomenologie – und das macht deren zweite wesentliche Bedeutung aus. Über das „Symbolische“ (der symbolischen Stiftung) und das „Phänomenologische“ hinaus betrifft die „Architektonik“ noch einen dritten Aspekt. Sie dient dazu, im wörtlichen Sinne „Sinn zu bilden“ und „zu machen“ und zwar so, dass dessen verdeckte Implikationen offengelegt werden sollen – es geht dabei also um eine Explizitmachung des „Impliziten“ in einer anderen Bedeutung. Die Architektonik macht es nämlich möglich, der Aporie einer „Sprache ohne Leiblichkeit“, die sich gleichsam vor dem Bedeuteten auflöst, zu entgehen. Dieses Hervorkehren der dort durchscheinenden „Kohärenz“ (also dessen, was gedacht wurde, ohne ausgesprochen worden zu sein) und dieser „Unebenheit“ der Schrift (im Gegensatz zur glatten Ausdrucksart, die ausschließlich der Vermittlung des Gedachten dient) hat eine genuin phänomenologische Bedeutung und beschränkt sich nicht auf irgendeine Art von „Deduktion“. Die „Architektonik“ 19 M. Richir, Phénoménologie en esquisses. Nouvelles fondations, Grenoble, J. Millon, S. 25. 20 Phénoménologie en esquisses, S. 26.
Phänomen und Phänomenalisierung
61
steht also für eine eigene Ausweisungsart, die wie das „Phänomenologische“ (aber eben auf eine andere Art) indirekter Natur ist und die Phänomenalität, sofern sie sich auf ZUSAMMENHÄNGE UND KOHÄRENZEN DER SINNBILDUNG bezieht, betrifft.21 Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, dass die Architektonik einen neuen und originellen Phänomenalitätstypus (sowie der Aufweisung derselben) im Ganzen der Phänomenalisierung selbst ausmacht. Die Architektonik stellt somit Zusammenhänge und Verknüpfungen zwischen den Begriffen her, was manchmal zum Zweck der Verdeutlichung die Einführung neuer Begrifflichkeiten erfordert. 22 21 Die Architektonik steht also in Zusammenhang mit der „selbstreflexiven Prozessualität der Sinnbildung“, siehe hierzu v. Vf., Was ist Phänomenologie?, op. cit. 22 Hierzu lohnt es sich, folgenden längeren Auszug zu zitieren: „Alles spielt sich im Spiel der architektonischen Register ab, sowie im Spiel der Funken einer ‚Anschauung‘, die nichts anschaut, nichts anderes jedenfalls als den Funken, der durch die gegenseitige Reibung der formalen und widersprüchlichen Quasi-Anschauungen aufstiebt. […] In der Praxis besteht die Aufstellung der Architektonik darin – auf der Grundlage von Begriffen, die keinerlei Bestimmungen bezüglich der ‚Realität‘ implizieren –, von der relativen Definition eines Registers auszugehen und durch aufeinanderfolgende Transgressionen von Register zu Register auf der Suche nach der ‚Sachlichkeit‘, die sich den Begriffen mehr und mehr entzieht, zurückzugehen bis hin zu dem Punkt, der selbst variabel und relativ ist, wo das phänomenologisierende Selbst ans Ende seiner Möglichkeiten und seines Ausdrucksvermögens gelangt, somit zu dem, was unmöglich scheint, gegen das begonnene Verfahren aufbegehrend und offensichtlich eine Änderung des begrifflichen Koordinatensystems erfordernd. Denn jedes Register wird durch die architektonische Transposition eines architektonisch vorhergehenden Registers (der Basis) hin zu demjenigen, von dem ausgegangen wird, relativ bestimmt und welches zumindest nach einer relativen Änderung des begrifflichen Koordinatensystems verlangt, um dessen Autonomie hervortreten zu lassen oder vielmehr die Selbstkonsistenz eines konkreten Ganzen, das in Konkreszenz begriffen ist – und so immer weiter, durch aufeinanderfolgende Übersteigungen des hiatus, der jedes Mal ein Register vom anderen trennt, sodass sich hierdurch eine architektonische Aufschichtung der Register konstituiert, die so etwas wie ihre transzendentale Ordnung herstellt, allerdings nur insofern, als die in der Epoché wohl vollzogene Hyperbel jegliche Überbestimmung des Ausgangsregisters verbietet, jegliche Retrojektion in ein voraus-gesetztes (hypo-thetisches) Apriori (was in Wirklichkeit ein Simulacrum ausmacht) der in der Diastolē aufgekommenen Bestimmungs-Orientierungspunkte. Paradoxon sozusagen des
62
Kapitel I
Wie dem auch sei, sie beschränkt sich nicht lediglich darauf, die innere Kohärenz des Werkes Richirs zu verdeutlichen, sondern sie bezeichnet insbesondere ein neues Grundregister seiner Denkbewegung, indem – über das symbolisch Gestiftete und das Phänomenologische hinaus – ein drittes Feld, also ein dritter Parameter der Phänomenalisierung aufgetan wird. * Kommen wir zum Schluss. Allgemein gefasst betrifft die Grundproblematik der Richir’schen Neugründung der transzendentalen Phänomenologie den Bezug des „Erscheinens“, bzw. des „Phänomens“ und seiner „Phänomenalisierung“ zum Sein. In Richirs Werk können diesbezüglich zwei Tendenzen ausgemacht werden, die zumeist parallel verlaufen. Die erste Tendenz stellt eine deutliche Trennung zwischen Scheinen und Sein heraus, sie stellt die These einer Art Eliminierung der Ontologie in der Phänomenologie auf. Die zweite Tendenz behauptet dagegen, dass es möglich und sogar notwendig ist, dem Sein in der und durch die Phänomenalisierung Rechnung zu tragen – nämlich durch ihre These, dass die ontologische Grundlage des Seienden im „knirschenden Reiben“ der Doppelbewegung der Phänomenalisierung angelegt ist, aus dem „Funken“, „Späne“, „Schaum“ usw. hervorgehen, die sowohl an Derridas „Rest“ 23 erinnern als auch an Fichtes „Absatz der Äußerung des Lichts“.24 Dieses Kapitel war gänzlich auf die erste Tendenz fokussiert. 25 Drei verschiedene Perspektiven konnten dabei herausgearbeitet werden. Erstens wurde gezeigt, dass nach Richirs Dafürhalten jede Festhaltens in seiner Vagheit an dem, wovon man ausgeht, um dessen Sinn herauszuarbeiten“, M. Richir, De la négativité en phénoménologie, Grenoble, J. Millon, 2014, S. 44–46. 23 Siehe S. Jullien, La phénoménologie en suspens – Derrida et la question de l’apparaître, Mémoires des Annales de Phénoménologie, Band XIV, Dixmont, Association Internationale de Phénoménologie, 2020 (vierter Teil). 24 J. G. Fichte, Die Wissenschaftslehre 1804/II, J. G. Fichte – Gesamtausgabe, Band II/8, R. Lauth, H. Gliwitzky (Hsg.), Stuttgart – Bad Cannstatt, G. Holzboog, 1985, S. 59. 25 Für die zweite Tendenz und dabei insbesondere in Bezug auf die „Doppelbewegung der Phänomenalisierung“ in Richirs „Le rien enroulé“ (1970), siehe das folgende Kapitel.
Phänomen und Phänomenalisierung
63
Seinsbehauptung in der Phänomenologie einem Simulacrum gleichkommt. Zweitens wurde herausgestellt, dass das Phänomenalisieren nicht als ein „Ausdrücken“ (über etwas) aufgefasst werden darf, sondern einer anderen Form des „Erscheinen-lassens“ (zum Beispiel der „Schrift“) angehört. Schließlich wurde drittens deutlich gemacht, inwiefern die „Architektonik“ eine Form der Phänomenalisierung darzustellen vermag, die auch hier kein objektives Seiendes meint, sondern eine „innere Kohärenz“ des sich bildenden Sinnes (bzw. Werkes). Diese beiden Grundperspektiven – diejenige, die eine gewisse Seinsauffassung eliminiert, und diejenige, die eine solche propagiert – sind aber nicht unvereinbar. Wie oben auseinandergelegt wurde, hatte dies Loraux mit seinem Begriff des „NichtReduzierbaren“ hervorgehoben, der eine andere oben entwickelte Konstellation auf seine Art ausgeführt hat – nämlich das „Zickzack“ zwischen zwei Auffassungen von „Positivität“, jener jenseits der Fluidität des Scheinens (oder der Phänomenalität) und jener, verborgeneren, also in einem „Diesseits“ angesiedelten, welche diese Fluidität „fixiert“, allerdings nicht, um diese gleichsam zu „zementieren“, sondern um ihren Zugang und ihre Schematisierung zu ermöglichen. Zu guter Letzt muss noch hinzugefügt werden, dass dieser Bezug auch auf Richirs Auffassung des „Selbst“ verweist, das sich seinerseits in der Spannung zwischen einer Verflüssigung und einer notwendigen Fixierung hält, damit der Prozess der Sinnbildung sich phänomenologisch korrekt entfalten kann. 26
26
Hierzu näheres in Kapitel IX.
Kapitel II Phänomenologie und Metaphysik In diesem Kapitel1 soll es darum gehen, den Status der Metaphysik innerhalb der von Richir angestrebten „Neugründung der Phänomenologie“ nun frontal anzugehen. Richir hat verschiedene Auffassungen vom Begriff der Metaphysik – insbesondere eine kritische und eine operative. Eine explizite synthetische Darstellung derselben wird aber allenfalls angedeutet und niemals vollständig ausgeführt. Seine verschiedenen Ansätze dazu sollen hier in Form einer rohen Übersicht geordnet dargestellt werden. * In seiner ersten systematischen Studie – „Le rien enroulé“ (1969– 1970)2 –, die auf eine bemerkenswerte Weise sein Gesamtwerk vorzeichnet und vorwegnimmt, bezeichnet Richir seine eigene „Theorie“ als eine „metaphysische“.3 Mehrere seiner Artikel tragen den Titel (oder Untertitel) „Métaphysique et Phénoménologie“.4 Und in 1 Dieses Kapitel stellt eine vollständig umgearbeitete, in vielerlei Hinsicht vertiefte Version einer ersten Fassung dar, die unter dem Titel „Marc Richir – Phänomenalität und Phänomenalisierung“ in dem Band Phänomenologische Metaphysik. Konturen eines Problems seit Husserl, op. cit., erschienen ist und dort mehrere Aspekte der selben Thematik auf eine völlig andere Weise entwickelt. Aus diesem Artikel werden hier lediglich – und dazu auch bloß teilweise – die Überlegungen zu Richirs „negativem“ und „positivem“ Metaphysikbegriff übernommen. Tobias Keiling sei ganz herzlich für sein Einverständnis dazu gedankt. 2 Zu einer sehr ausführlichen Analyse dieser wichtigen Studie Richirs, siehe R. Alexander, Phénoménologie de l’espace-temps chez Marc Richir, op. cit., S. 85–107. 3 M. Richir, „Le Rien enroulé – Esquisse d’une pensée de la phénoménalisation“, Textures 70/7.8, Brüssel, 1970, S. 3. 4 M. Richir, „Métaphysique et Phénoménologie – Sur le sens du renversement critique kantien“, La liberté de l’Esprit, Nr. 14: Qu’est-ce que la phénoménologie?, Paris, Hachette, 1987, S. 99–155; M. Richir, „Métaphysique et phénoménologie: Prolégomènes pour une anthropologie phénoménologique“, Phénoménologie française et Phénoménologie allemande – Deutsche und
66
Kapitel II
seinen letzten beiden Werken,5 die gewissermaßen sein phänomenologisches Testament enthalten, kommen seine metaphysischen Gedanken auf die ausgeprägteste Weise zum Tragen. Worin besteht laut Richir die Notwendigkeit einer „Neugründung“ der Phänomenologie, und welche Auffassung von Metaphysik spiegelt sich darin wider? Um das beantworten zu können, sind mehrere Motive anzuführen, welche – die Einsichten des vorigen Kapitels wiederaufnehmend und weiter ausführend – die Bestimmung (und Neubestimmung) von Phänomenalität und Phänomenalisierung betreffen. Was macht laut Richir den genuinen Phänomenbegriff – sofern er je die Korrelativität von Erscheinungsprozessualität und Erscheinendem selbst kennzeichnet – aus? Für ihn ist das Phänomen – die Anlehnung an Heideggers einschlägige Ausführungen dazu (im § 7 von Sein und Zeit) ist hier nicht zu übersehen – dadurch ausgezeichnet, dass es all jenes am Erscheinenden bezeichnet, was das Erscheinen ermöglicht, jedoch nicht sich selbst bekundet. Er denkt die Phänomenalität somit stets dynamisch in ihrem Zusammenhang mit der Phänomenalisierung – mit dem „Zum-ErscheinenKommen“ des Seienden, mit dem also, was das Phänomen zu einem Phänomen macht und dem Erscheinen überhaupt zugrunde liegt. Was erfordert nun Richirs Meinung nach genau jene Neubestimmung der Phänomenalität? Der Grundgestus der Richir’schen Analyse des Phänomenbegriffs besteht in der Abkopplung von Phänomenalität und Gegenständlichkeit (Objektivität). Phänomen ist – hierzu äußert er sich in einem weiteren bedeutenden und wegweisenden programmatischen Text, der in der Einleitung bereits zitiert wurde6 – „Phänomen als ‚nichts als Phänomen‘“ (phénomène comme „rien que phénomène“). Das bedeutet, dass die Phänomenalisierung eines Phänomens als dieses Phänomens nicht (wie etwa bei Kant) einer Objektivitäts-Konstitution zu verdanken ist, die auf einer Synthe-
französische Phänomenologie, E. Escoubas & B. Waldenfels (Hsg.), Paris, L’Harmattan, S.103–128. 5 M. Richir, De la négativité en phénoménologie, op. cit.; M. Richir, Propositions buissonnières, Grenoble, J. Millon, 2016. 6 Phénomènes, temps et êtres I, op. cit., S. 13–20.
Phänomenologie und Metaphysik
67
sisleistung des je schon als vorgegeben betrachteten Verstandes beruht, sondern „am Phänomen selbst erscheint“.7 Die Phänomenalisierung betrachtet das Erscheinen als Erscheinen und nicht vordergründig als Erscheinen von Gegenständen.8 Objektivation ist nicht das Grundthema von Richirs transzendentaler Phänomenologie. Und damit hängt zugleich zusammen, dass die Phänomenalisierung (gleichfalls je dieses oder jenes Phänomens) insofern zutiefst prekär und damit auch vom Scheitern bedroht ist, als mit dem Phänomen sich auch je dessen „Simulacrum“ (qua „Scheinphänomen“) zeitigt. Dass die Prekarität der Phänomenalisierung sich gerade darin äußert, dass im tiefsten architektonischen Register9 „Phänomen“ und „Simulacrum“ sich gegenseitig durchdringen, ist eine von Richirs Hauptthesen, deren Bedeutung sich folgendermaßen fassen lässt. Richir denkt im Begriff des „Scheins“ (bzw. „Simulacrums“) zwei grundlegende Bestimmungen zusammen. Zum einen kann das ursprüngliche, transzendentale Apriori, auf das es die transzendentale Phänomenologie je abgesehen hat, eben als sich nicht selbst bekundendes nicht eigens gefasst werden, sondern ist nur von dessen aposteriorischem „Schein“ aus zugänglich – wodurch die transzendentale Konstitution sich je als „Retrojektion“ erweist. Zum anderen liegt gerade in diesem „Scheinen“ des – somit nur retrojizierend zugänglichen – Apriori seine konstitutive, phänomenalisierende Funktion. „Schein“ ist also zugleich auch transzendentalphänomenologisches „Erscheinen“ (wie gesagt, unter Berücksichtigung der solcherart sich bekundenden Nachträglichkeit). Beide Bestimmungen gilt es daher in der Tat gemeinsam zu berücksichtigen. Das „Simulacrum“ bezeichnet jene spezifische Dimension der konstitutiven Phänomenalität, die jene Bestimmung des „Scheins“ in sich aufnimmt. Hierdurch wird daher auch (in Richirs eigener Phénomènes, temps et êtres I, S. 16. Das ist – im Gefolge von Husserls Bernauer Manuskripten und Finks Vorlesung Sein, Wahrheit, Welt. Vor-Fragen zum Problem des Phänomen-Begriffs – Richirs wichtigster Beitrag zur transzendentalen Phänomenologie (gegenüber einem rein am Gegenstand und seinen Konstitutionsweisen orientierten phänomenologischen Realismus). 9 Richir benutzt diesen Ausdruck anstelle von „Konstitutionsstufe“, um so einen „freieren“ Begriff als „Stufe“, „Segment“ oder „Sphäre“ zu gebrauchen, der jede „Starrheit“ zu vermeiden gestattet und eben gerade darauf verweist, dass hier keine subjektzentrierte Konstitution statthat. 7 8
68
Kapitel II
Antwort auf seinen gleich zu erläuternden negativen Metaphysikbegriff) die nicht-metaphysische Denkhaltung im Herzen der Phänomenalisierung auf ihre Spitze getrieben: Nicht nur kann dem hier maßgeblichen Phänomen als „reinem Phänomen“ – d.h. als „Phänomen als ‚nichts als Phänomen‘“ – keinerlei Gegenstand als Richtmaß für Wahrheit angelegt werden, sondern in seiner Verzerrung als „Simulacrum“, als „Schein“, ist (der Auffassung des späten Heideggers zufolge, an der sich der frühe Richir ebenfalls orientiert) das Phänomen je zugleich in der Wahrheit und in der Unwahrheit. * Auf die Begriffe des „Scheins“ und des „Simulacrums“ wird weiter unten in der Betrachtung der ersten der Recherches phénoménologiques detailliert zurückzukommen sein. Voraussschickend lässt sich aber Richirs Metaphysik-Begriff bereits allgemein andeuten. Bevor dazu die mögliche positive Erläuterung des operativen Metaphysikbegriffs bei Richir geliefert werden kann, muss zunächst noch ein wenig ausführlicher auf dessen kritische Bedeutung eingegangen werden. Die metaphysische Verfahrensweise ist laut Richir durch zwei Grundtendenzen gekennzeichnet, nämlich durch die Inanspruchnahme eines „Absoluten“ und den Hang zur „Fixierung“. Während die erste dieser beiden Charakteristiken allseits bekannt ist und sich an Heideggers Metaphysik-Auffassung im Sinne der „Onto-theologie“ anlehnt,10 verdient die zweite Kennzeichnung eine vertieftere Betrachtung. Um sie verständlich zu machen, ist dabei der Rückgriff auf Richirs Auffassung der „Sinnbildung“ nötig. Dieser Begriff, der den Ausdruck „sens se faisant“ (wörtlich: „sich machender Sinn“, bzw. „sich vollziehender Sinn“) ins Deutsche zurückübersetzt (Richir geht dabei nämlich selbst von der ursprünglich Husserl’schen Unterscheidung von „Sinngebung“ und „Sinnstiftung“ aus und siedelt die „Sinnbildung“ – ganz wie Husserl das selbst im § 49 der Krisis-Schrift umrissen hat – diesseits dieser Unterscheidung an), hat mehrere Bedeutungsebenen. Zunächst ist dabei festzuhalten, dass es Richir um die der Sinnbildung ureigene „Beweglichkeit [mobilité]“ geht: Der Sinn ist immer anfänglich, sich entwerfend, in „Abständigkeit [en écart]“, und wenn er gefasst, also 10
Vgl. L. Tengelyi, Welt und Unendlichkeit, op. cit.
Phänomenologie und Metaphysik
69
gleichsam „zum Stehen“ gebracht wird, kann das nur vermittels einer „Transposition“ geschehen, die dessen Lebendigkeit und Beweglichkeit entgleiten lässt. Sinn auf ideelle, außer-zeitliche Träger zurückzuführen, wäre dementsprechend laut Richirs Auffassung ein „metaphysischer“ Gestus. Gleichwohl hat aber jenes „Fixieren“ auch eine genuin phänomenologische Dimension. Denn – und hier haben bedeutende Einsichten des Strukturalismus bzw. „PostStrukturalismus“ auch bei Richir seine Spuren hinterlassen (siehe hierzu die grundlegenden Untersuchungen von Alexander11 und insbesondere von Flock12) – zum „Sich-Machen“ des Sinnes gehört eben auch, dass er strukturiert und gegliedert werden muss, um so seine Verständlichkeit zu ermöglichen, was wiederum voraussetzt, dass das „Signifikat“ je mit einem „Signifikanten“ auftritt. Sich machender Sinn „spricht“ sich immer irgendwie „aus“ (was keine mündliche Verlautbarung sein muss), er hat eine Art „materiellen“ Träger, der selbst völlig „nicht-sinnhaft“ ist, aber Sinnhaftigkeit gleichsam „setzt“ und dabei eben immer auch „entrückt“. In der Folge Derridas sieht Richir diesen Aspekt als eine grundlegende Dimension der Sinnschöpfung an, die sich dem „Bewusstsein“ voll und ganz entzieht. Er bezeichnet ihn als das „Symbolische“. Dieses steht – wie bereits oben dargelegt wurde – dem genuin „Phänomenologischen“ gegenüber, das eben auf die Nicht-Fixierbarkeit, Mobilität und insbesondere auch auf die „Unscheinbarkeit“ verweist. Sofern dieses „fixierende“ Moment nun diese Zweideutigkeit mit sich führt, zugleich aber auch ein Grundaspekt der Richir’schen Metaphysikauffassung ausmacht, hat diese konsequenterweise auch eine Doppeldeutigkeit, ein gleichsam „negatives“ und auch ein „positives“ Moment. Die Ausgestaltung des letzteren verlangt aber noch nach weiteren vorgängigen Überlegungen und Hinweisen. Den eindeutigsten Beleg für die Art, wie Richir sich von der Metaphysik abzuheben meint, findet man in L’écart et le rien (2015). Richir bezeichnet dort jeden Ansatz, der eine „symbolische Tautologie“ – also die Setzung der Identität dieser oder jener Bestimmtheit und die zusätzliche Setzung des Seins (bzw. Existenz, sei es auch als bloße Möglichkeit) dieser Identitätssetzung – beinhaltet, R. Alexander, Phénoménologie de l’espace-temps chez Marc Richir, op. cit. P. Flock, Das Phänomenologische und das Symbolische. Marc Richirs Phänomenologie der Sinnbildung, coll. « Phaenomenologica », New York, Springer, 2020. 11 12
70
Kapitel II
als „metaphysisch“.13 Das anschaulichste Beispiel hierfür liefere Fichtes Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794/95). Eine Denkbestimmung „sein zu lassen“ – darin bestehe also der Grundgestus der Metaphysik, den Richir (zumindest in seinem späteren Werk) ablehnt. Wurden in Richirs Schriften aus den 1980er und 1990er Jahren noch die Begriffe des „Phänomens als nichts als Phänomen“ und des „Weltphänomens“14 gebraucht, um die Phänomenalisierung angemessen zu beschreiben, wendet sich Richir seit den 2000er Jahren jenem Register der Sinnbildung zu, das er bei Husserl entdeckt und sich dann progressiv selbst angeeignet hat: nämlich jenem der Phantasie.15 Angesichts der erwähnten „Deformierung“ des Phänomenologischen im symbolisch Gestifteten kann für Richir nicht mehr die Wahrnehmung – das Paradigma der objektivierenden Intentionalität – den adäquaten Ursprung der Phänomenologie ausmachen. Im Gegensatz zu Husserl ist der Ausgangspunkt der phänomenologischen Forschung somit nicht mehr in den intentionalen Erlebnissen des Bewusstseins zu suchen, d.h. in den objektivierenden Akten, für 13 L’écart et le rien, op. cit., S. 70. Im Kapitel VIII wird von der „symbolischen Tautologie“ ausführlicher die Rede sein. 14 Die „Weltphänomene“, die Richir Fink entnimmt (siehe VI. Cartesianische Meditation, Teil 1: „Die Idee einer transzendentalen Methodenlehre“, H. Ebeling, J. Holl, G. van Kerckhoven (Hsg.), Dordrecht/Boston/London, Kluwer, 1988, S. 11), werden anders bestimmt, als das Heideggers Kennzeichnungen des Phänomens der Welt glauben lassen könnten. Für Richir sind die „Weltphänomene“ chaotisch, vergänglich, ungeordnet, proteusartig, schimmernd, unstetig, kontingent, instabil. In seinen eigenen Worten: „Weltphänomene, und nicht Seinsphänomene oder Phänomene von Dingen. Also auch nicht Phänomene der Welt als Ganzheiten von Seiendem oder von Dingen, sondern ursprünglich vielfältige Phänomene, die als „nichts als Phänomene“ über das Nichts ausgespannt sind, über die Welt als Horizontvielheit, wo der Mensch zum Sein kommt“ (Du sublime en politique, op. cit., S. 14.). Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das, was für Richir „Welthaftigkeit“ ausmacht, nichts mit „Totalität“, „Allheit“ oder „Ganzheit“ zu tun hat, sondern eher Innerweltlich-Wirkliches meint (später wird der Begriff der „Phantasien-Affektion“ an die Stelle des „Weltphänomens“ treten). „Welt“ bzw. „Weltbezughaftigkeit“ ist das, was dafür sorgt, dass das Phänomen nicht rein „fiktional“ ist und auch nicht als „Simulacrum“ jeglichen Bezug zur Wirklichkeit verliert. 15 Hierfür maßgeblich: M. Richir, Phénoménologie en esquisses, op. cit.
Phänomenologie und Metaphysik
71
welche die Wahrnehmung den Maßstab jeglichen Objektbezugs lieferte, sondern in den vor-intentionalen Phantasie„vorstellungen“ diesseits jeder objektivierenden Wahrnehmung. Diese nicht darstellbaren „Phantasien“ erscheinen nur in der Form von „inchoativen Silhouetten“ bzw. „Schatten“, die nicht direkt erfassbar sind und sich nicht fixieren lassen (und hierdurch lässt sich dann auch die Verbindungslinie zu den früheren Arbeiten – und insbesondere zum gerade angesprochenen Begriff des „Weltphänomens“ – herstellen). Diese Phantasien sind am ehesten geeignet, dem ursprünglichen „Abstand zu sich selbst“ Rechnung zu tragen, der jede Erfahrung – und insbesondere jede menschliche Erfahrung – kennzeichnet. Der neue Ausgangspunkt der Phänomenologie Richirs besteht somit darin, die phantasiemäßige Basis der Intentionalität diesseits jeder Objektivierung zu erforschen. Hierbei handelt es sich in der Tat um ein „Schattentheater“ (was ein anderes Wort für das Feld der Phänomenalisierung ist), dessen Phänomene – und genau hierin besteht die Grundabsicht seines gesamten Werkes – dank einer „instabilen Mathesis der Instabilitäten“16 erfasst werden können. * Um diese „instabile Mathesis der Instabilitäten“ umreißen zu können, ist es notwendig, danach zu fragen, ob es in Richirs Werk eine Grundkonstellation oder ein Grundschema gibt, die (das) dieses Werk trägt. Heidegger hat so etwas in den Grundbegriffen der Metaphysik im Begriff des „Grundgeschehens“17 angedacht. Bei Richir selbst finden sich Ansätze hierzu – wenn er etwa in Phénomènes, Temps et Êtres, wie bereits betont, von einer „transzendentalen Matrize“18 des Phänomens spricht. Die erste konsequente und systematische Durchführung der Herausstellung des „Ortes der Verständlichkeit“, an dem sich die vielfältigen Ansätze Richirs einer „Neugründung der transzendentalen Phänomenologie“ entfalten, wurde 16 M. Richir, Sur le sublime et le soi. Variations II, Mémoires des Annales de Phénoménologie, Amiens, Association pour la promotion de la phénoménologie, 2011, S. 125 und 129. 17 M. Heidegger, Grundbegriffe der Metaphysik, HGA 29/30, Frankfurt am Main, Klostermann, 1983, S. 506ff. 18 Phénomènes, temps et êtres I, S. 14.
72
Kapitel II
– wie schon einleitend erwähnt – bereits in einer der ersten Dissertationen, die dieser „Neugründung der Phänomenologie“ gewidmet sind, geleistet.19 Robert Alexander fasst diesen „Ort“, dieses „philosophische Grundelement“, diese „Grundstruktur“, als „rhythmische Masse“ bzw. „Schwingungsvolumen“20 auf. Dieses rhythmische, schwingende „Masse-Volumen“ mache das Paradigma der Verständlichkeit der Phänomenalisierung aus und wird von Robert Alexander mit einem einzigen Terminus – dieser Ausdruck lehnt sich an Richir lediglich an – als „Ogkorhythmus“ bezeichnet. Es mag hier dahingestellt bleiben, ob eine solche Konzentrierung auf einen einzigen Grundbegriff der methodischen Spannweite von Richirs Gesamtwerk tatsächlich – so wie das Robert Alexander ja behauptet – gerecht wird. Sein entscheidendes Verdienst ist es jedenfalls, auf die jenen „Ogkorhythmus“ strukturierende „Doppelbewegung“ hingewiesen zu haben,21 die das Richirs Werk tragende Grundschema zu fassen gestattet und von ihm selbst in „Le rien enroulé“ aufgewiesen wurde. Aufgrund seiner überragenden Bedeutung für Richirs weiteren Denkweg soll diese „Doppelbewegung“ jetzt näher vorgestellt werden. Richirs Essay „Le rien enroulé“ („das eingerollte Nichts“) ist ein Zitat Maurice Blanchots aus dessen Hauptwerk L’entretien infini vorangestellt. Dieses lautet so: „Schreiben: einen Kreis beschreiben [tracer], innerhalb dessen sich das Außen jeglichen Kreises einschriebe.“22 Hiermit werden zwei entscheidende Aspekte von Richirs „metaphysischer“ (phänomenologischer) „Theorie“ zum Ausdruck gebracht: Auf der einen Seite spricht sich hier der Bezug zur Schrift im Allgemeinen und zu Derridas „Urschrift [archi-écriture]“ im Besonderen aus – das heißt zu dem, was Richir dann selbst den – an 19
R. Alexander, Phénoménologie de l’espace-temps chez Marc Richir, op. cit., S.
29. Ebd., S. 31. Robert Alexander führt hierzu aus, dass die Doppelbewegung bei Richir im Grunde unhaltbar ist, weil es eine solche überhaupt gar nicht gibt. Man kann allenfalls von einer sich selbst entgegenwirkenden Bewegung sprechen, die keinen Umschlagpunkt hat und sich bloß an sich selbst reibt (Phénoménologie de l’espace-temps chez Marc Richir, op. cit., S. 350) – daher das „Knirschen“. 22 M. Blanchot, L’entretien infini, Paris, Gallimard, 1969, S. 112; zitiert in M. Richir, „Le rien enroulé“, Art. cit., S. 3. 20 21
Phänomenologie und Metaphysik
73
Kant und Heidegger angelehnten – „Schematismus“ (der Phänomenalisierung) nennen wird; auf der anderen Seite nimmt Blanchot genau das vorweg, was Richir als eine „Doppelbewegung der Phänomenalisierung“ ansieht. Diese gehört einem Komplex von fünf Grundmotiven des phänomenologisch-metaphysischen Ansatzes Richirs an, die in jenem frühen Artikel entwickelt werden. Diese Motive sind: 1.) die Endogeneisierung des phänomenologischen Feldes; 2.) das „austretende Eintreten“ (= erste Doppelbewegung der Phänomenalisierung); 3.) das „Einrollen-Ausrollen“ (= zweite Doppelbewegung der Phänomenalisierung); 4.) Doppelbewegung von Einrollen-Ausrollen und Seinsabsetzung (= zweifache Doppelbewegung der Phänomenalisierung); 5.) die „Kehre der Sprache“ (im dichterischen Schreiben) als genuine Ausdrucksform der metaphysischen Phänomenologie. 1.) Das erste Grundmotiv entnimmt Richir dem, was er (im Gefolge Derridas und indirekt Levinas’) als „Husserls Problem“ identifiziert und dann – wie schon in den „Notes sur la phénoménalisation“ – als „phänomenologisches Problem“ überhaupt kennzeichnet. Das „Andere“, das sich entäußert hat, soll zu seiner Ursprungsstätte – zur „Innerlichkeit“ – zurückgeführt werden (was aber nicht, ohne dabei eine Zirkelhaftigkeit aufzuweisen, bewerkstelligt werden kann). Die Hauptfunktion dieser Zurückführung auf die Innerlichkeit, die ganz offenbar eine Art Widerhall der „transzendentalen Reduktion“ Husserls ist, besteht darin, die sinnbildend-genetisierende Dimension der Phänomenologie aufscheinen zu lassen. Um diese Doppelbedeutung – der verinnerlichenden Genetisierung bzw. der genetisierenden Innerlichkeit – zu betonen, bietet sich der Begriff der „Endogeneisierung“23 an. 2.) Wichtig ist, diese „Endogeneisierung“ nicht mit einer bloßen „Immanentisierung“ (also einer reinen Verinnerlichung), wie sie etwa bei Michel Henry in dessen allseits vollzogener Rückbeziehung auf das immanente, selbstaffektive Leben statthat, gleichzusetzen. Richir betont das ausdrücklich: Phänomenalisieren heißt, das Selbe in das Andere hinaustreten zu lassen (das Selbe dem Anderen zu öffnen), um das Andere in das Selbe hineintreten zu lassen. Das Außen ist das Innen des Innen, das Andere ist das Selbe des 23 Siehe hierzu v. Vf., Le sens se faisant. Marc Richir et la refondation de la phénoménologie transcendantale, Brüssel, Ousia, 2011, S. 25 und S. 211ff.
74
Kapitel II
Selben. Das Aus-sich-Heraustreten ist ein In-sich-Hineintreten. Es muss die Anstrengung unternommen werden, die Einheit dieser Doppelbewegung zu denken.24
Die erste Doppelbewegung bezeichnet hier den gegenseitigen Verweis von („äußerlicher“) Öffnung und („innerlicher“) Sinnerfassung. Dabei hat das „Innen“ gegenüber dem „Außen“ dennoch insofern einen Vorrang, als jene Genetisierung nur „innerlich“ möglich und das Außen selbst ein gleichsam „vergessenes“ (unbestimmtes, nicht gegenwärtiges) Inneres ist. Richir bezeichnet das als die genuine „Reflexivität des Selben“,25 welche impliziert, dass das „Außen“ eben nichts Anderes als „das Selbe des Selben“ ist (was freilich zugleich auch auf Fichtes Auffassung des Seins als „Reflexion der Reflexion“ verweist). 3.) Diese erste Doppelbewegung spezifiziert sich sodann zu einer zweiten, welche jene zugleich näher präzisiert. Wie ist die innigliche „Bewegung“ der Phänomenalisierung – also die vom Selben zum Anderen (bzw. vom Anderen zum Selben), von Ich zum Nicht-Ich, von Bewusstsein zum Sein usw. (und jeweils umgekehrt) – genau zu verstehen? Es geht hier um nicht weniger als um eine Neufassung des intentionalen Bezugs sowie – wie Levinas sagen würde (siehe „La ruine de la représentation“ 26) – um dessen „ontologische Gründung“. Richir drückt sich diesbezüglich genauso antiFichteanisch (es kann sich dabei um keine „geradlinige Bewegung“ handeln) wie anti-Heideggerianisch (es kann hier auch keinen „Sprung“ geben) aus: Die Bewegung geht sowohl nach innen als auch nach außen – sie ist, in Richirs eigenen Worten, die an Maine de Biran erinnern, ein zurückgehaltenes Anstrengen bzw. ein gespanntes Sich-Zurückhalten. Damit wird zweierlei unterstrichen: Einerseits werden die realistischen und idealistischen Fehlpositionen vermieden (nämlich das Sich-Verlieren im Anderen und die „Implosion“ im Ich); und andererseits wird implizit bereits die affektiv-leibliche Dimension der Phänomenalisierung hervorgehoben, die Richir allerdings erst in späteren Arbeiten27 in den Mittelpunkt „Le rien enroulé“, S. 7. Ebd., S. 6. 26 E. Levinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Paris, Vrin, 1988 (1. Aufl. 1949), S. 130–134. 27 Vor allem ab M. Richir, Le corps, Paris, Hachette, 1993; Phénoménologie en esquisses, op. cit.; Phantasía, imagination, affectivité, Grenoble, J. Millon, 2004. 24 25
Phänomenologie und Metaphysik
75
rücken wird. Für die gespannt sich zurückhaltende Bewegung „nach außen“ gebraucht Richir den Begriff des „Ausrollens“, für jene „nach innen“ den des „Einrollens“. Ihre Einheit beschreibt die (zweite) Doppelbewegung, nämlich die des „Einrollens-Ausrollens [double mouvement d’enroulement-déroulement]“. 4.) Diese Neufassung des Intentionalitätsbegriffs beschränkt sich aber nicht auf eine rein erkenntnistheoretische Dimension, sondern hat auch eine entscheidende ontologische Implikation. In dem Gegensatz von gespannter Anstrengung und Sich-Zurückhalten drückt sich eine innere Widerständigkeit aus, die Richir als „dif-férance der Bewegung in ihrer Gegen-Bewegung“ fasst (der Bezug zu Derrida ist hier abermals evident). Diese Widerständigkeit zwischen den beiden entgegengesetzt ausgerichteten Bewegungen des Ein- und des Ausrollens ruft ein (unhörbares) „Quietschen“ oder „Knirschen“ („grincement“) hervor, aus dem „Seiende(s) qua ausgestoßene Funken der Doppelbewegung hervorquillt“.28 Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass das „Sein“ (des Seienden) – wiederum wie bei Fichte – ein Absetzungsphänomen der Doppelbewegung der Phänomenalisierung ist. Wir haben es hier also mit einer zweifachen Doppelbewegung zu tun, die das Einrollen-Ausrollen und die Quelle des Seins betrifft. 5.) Wie sind diese Motive, die eine zusammenhängende Bewegung ausmachen, innerhalb derer verschiedene (verschieden komplexe) Momente unterschieden werden können, „begrifflich“ zu fassen, bzw. – wenn der „Begriff“ hier gerade versagt – „sprachlich“ einzuholen? Bereits am Anfang von „Le rien enroulé“ zeigt Richir den Weg dafür an. Die (phänomenologische) „Metaphysik“ kann nur so verstanden werden, dass sie in sich „ein-“ bzw. „zurückkehrt“, um (sich) aufzulösen.29 Dementsprechend „spricht“ sie von „nichts“. Das „Phänomenalisieren“ taucht in das „Nichts“ ein. Für Richir muss die Metaphysik ihre Sagbarkeit – die je schriftlich zum Tragen kommt – der Dichtung entlehnen. Diesen Gedanken nimmt er selbst in Phénoménologie en esquisses wieder auf, wenn er dort – „poésie“ und
28 „Le rien enroulé“, S. 9. Dies macht den Kernpunkt der am Ende des vorigen Kapitels angesprochenen „zweiten Tendenz“ innerhalb der Betrachtung des Bezugs des „Erscheinens“ (bzw. seiner „Phänomenalisierung“) zum „Sein“ aus. 29 Ebd., S. 3.
76
Kapitel II
„fiction“ miteinander in Beziehung setzend – von einer „Metaphysik-Fiktion“, d.h. von einer „rigorosen“ und „kohärenten“ „Fiktion der Metaphysik“, die der bloßen, kritisch verstandenen „metaphysics fiction“ ganz und gar entgegensteht, spricht.30 Zudem hält sich dieser Gedanke auch bis in Richirs letzte Schriften durch.31 Um das genuin „Phänomenologische“ fassen zu können, muss die phänomenologische „Metaphysik“ somit eine Ausdrucksform ausbilden, die dem Gehalt desselben nahekommt, weil es ihm ansonsten, wie gesagt, entgleitet. * Kehren wir nun ausführlicher auf den Bezug von „Phänomenalität“ und „Schein“ zurück. 1981 bringt der 38jährige Marc Richir sein erstes eigenständiges Werk – die Recherches phénoménologiques – heraus, nachdem er in den siebziger Jahren (über „Le rien enroulé“ hinaus) seine eher noch historiographisch ausgerichtete Doktorarbeit in zwei separaten Büchern publiziert hatte. 32 In der ersten Recherche liefert Richir die spekulative Grundlage seiner eigenen Neugründung der Phänomenologie. Allgemein formuliert, geht es Richir um die Aufklärung des Sinns der Korrelation von Denken und Sein. Es soll dabei – wie das bereits in den „Notes sur la phénoménalisation“ sichtbar wurde – die Fruchtbarkeit einer sie durchherrschenden Zirkularität aufgewiesen werden. Diese Korrelation wird zunächst im Licht der Husserl’schen phänomenologischen Perspektive, so wie dieser sie in den Logischen Untersuchungen eingeführt hatte, behandelt, nämlich durch das Prisma der Frage nach der Korrelation von „Erlebnis“ und „Idealität“. Hier liegt bereits insofern eine Zirkelhaftigkeit vor, als die Aufklärung der Idealität die Analyse ihrer bewusstseinsmäßigen Gegebenheit erfordert, zugleich aber auch umgekehrt das Aufscheinen des idealen Charakters des Bewusstseins (das ja nicht lediglich Phénoménologie en esquisses, op. cit., S. 24. M. Richir, Variations sur le sublime et le soi, op. cit.; ders., Sur le sublime et le soi. Variations II, op. cit.; ders., Propositions buissonnières, op. cit. 32 M. Richir, Au-delà du renversement copernicien. La question de la phénoménologie et de son fondement, Den Haag, M. Nijhoff, 1976; ders., Le rien et son apparence. Fondements pour la phénoménologie (Fichte: Doctrine de la Science 1794/95), Brüssel, Ousia, 1979. 30 31
Phänomenologie und Metaphysik
77
psychologistisch aufgefasst werden soll) die Idealität bereits voraussetzt. Dieser Befund weitet sich nun auf die Korrelation von Denken und Sein aus: Das Sein soll im Denken konstituiert werden; jedoch macht eine solche Konstitution es zugleich auch erforderlich, einen gewissen Seinscharakter des Denkens in Anspruch nehmen zu können. Um nun in der Tat die Fruchtbarkeit dieser Zirkelhaftigkeiten darlegen zu können, muss der Sinn der transzendentalen Reduktion aufgeklärt werden. Wie geht Richir hier genau vor? Der einschlägige Text hierfür ist der § 3 der ersten Recherche. Hier entwickelt er seine Hauptgedanken bezgl. der „Phänomenalisierung“ und der ontologisch (bzw. prä-ontologisch) relevanten „Doppelbewegung“ derselben. Hierfür müssen, so lautet seine zu erläuternde These, der Begriff des „Transzendentalen“ und die „phänomenale Dimension überhaupt“33 zusammengedacht werden. Richirs Argumentation gliedert sich dabei in vier Hauptpunkte: 1.) Worin besteht die transzendental-phänomenologische Reduktion? Nicht im Erscheinen-lassen der faktischen Subjekt-Objekt-Korrelation, sondern der „Phänomene in ihrer Reinheit“ 34. Hierdurch wird die „rein phänomenale Sphäre“ 35 eröffnet, die durch die Korrelation von (vor-faktischen) Erscheinungen und (vor-faktischem) Erscheinenden gekennzeichnet ist. Richir betont nun die fundamentale Zweideutigkeit, die seiner Auffassung nach in dem Gestus der Reduktion liege: Einerseits werde durch die Reduktion die „ontische Positivität“ des Objekts wie auch des Subjekts eingeklammert; andererseits aber vollziehe sich diese Reduktion auch nur so, als ob die ontisch-faktische Subjekt-Objekt-Struktur dadurch aufgegeben würde (in Wahrheit wirke sie „gleichsam lateral [en quelque sorte latéralement]“36 weiter). Somit stelle die Reduktion in Richirs Augen lediglich eine „Simulation“37 dar: man tue lediglich so, „als ob das ontische Faktum des Objekts abwesend wäre, um so dessen Bedingungen der Möglichkeit oder dessen apriorische Genese, die durch die rein phänomenologische Sphäre aufgewiesen
33
M. Richir, Recherches phénoménologiques, Band 1, Brüssel, Ousia, 1981, S.
29. Ebd. Ebd. 36 Recherches phénoménologiques, Band 1, S. 30. 37 Ebd. 34 35
78
Kapitel II
werden sollen, aufzusuchen“.38 Die phänomenologische Reduktion setze somit die ontische Faktizität nicht völlig außer Spiel, sondern sei vielmehr durch die grundlegende Spannung von Ontizität (Faktizität) und Transzendentalität (Genese) ausgezeichnet. Richir zeigt nun, dass dieser Zweideutigkeit eine andere zugrunde liegt, nämlich die des Scheins als Erscheinung und radikalem Entzug. 2.) Phänomen heißt: transzendentales Apriori, gegenüber dem die Subjekt-Objekt-Struktur lediglich eine aposteriorische Reflexion darstellt. Die „rein phänomenale Sphäre“ ist somit im gleichen Schlage eine „transzendentale Sphäre“.39 Das reine Phänomen ist „bloß transzendental“, es ist „transzendentales Prinzip der Reflexion“.40 3.) Wie kann nun aber das reine Phänomen apriorische Bedingung der Möglichkeit bzw. transzendentales Prinzip der aposteriorischen Subjekt-Objekt-Struktur sein? Wie kann vermieden werden, dass es sich dabei lediglich um einen (freilich notwendigen) „Parallelismus“41 handelt? Dies ist nur möglich dank einer „inneren Reflexivität“,42 die ein zweifaches konstitutives Vermögen ausmacht: nämlich einerseits des Objekt- und des Subjektpols; und andererseits (und zugleich) der „strikten transzendentalen Autonomie des Phänomens als solchen“. Was ist mit dieser „Autonomie“ gemeint? Es handelt sich dabei nicht um eine ursprünglich konstituierende Instanz, die linear von diesem Ursprung aus zu dem, was sich nach und nach konstituiert, aufzusteigen gestattete, sondern um die Eröffnung einer Sphäre, in der das Phänomen sich als „reines Phänomen“ oder als reiner Schein (pure apparence) reflektiert. Hier nun, so behauptet Richir, phänomenalisiert sich das Phänomen durch sich selbst als „Illusion“ oder „Simulacrum“. Es gilt, den Sinn des Auftretens dieses Simulacrums genauer zu verstehen und zu rechtfertigen. „Oder als reiner Schein“ – es muss zunächst das „oder“ erläutert werden. Man kann den Schwierigkeiten der Phänomenalisierung nur dann beikommen, wenn man einsieht, dass diese in ihrem ursprünglichen Register Eröffnung von Unbestimmtheit ist. Dieser hatte Ebd. Recherches phénoménologiques, Band 1, S. 31. 40 Ebd. 41 Recherches phénoménologiques, Band 1, S. 12. 42 Recherches phénoménologiques, Band 1, S. 31. 38 39
Phänomenologie und Metaphysik
79
sich schon Heidegger durch den Begriff des „Entzugs“ angenähert. In einer erkenntnistheoretischen Perspektive wird hiermit zudem Kants Ansicht, das Erkenntnis- und Erfahrungsermöglichende entziehe sich einer eigenen Art der Erfahrung, reflektiert. Die Modalität, durch die nun auch die genuin phänomenale (also im strengen Sinn phänomenologische) Dimension dieses Entzugscharakters behandelt werden kann, ist die des (wie gesagt mehrdeutigen) Scheins. „Schein“ heißt zunächst, in einem zweifachen Sinn (später werden noch weitere hinzukommen), mögliches Erscheinen-Lassen und auch „bloßer“ Schein im Sinne des Trugs und der Illusion. Richir macht hiermit ernst und verortet in der Quelle der Phänomenalisierung dieses Aufquellen von Erscheinung und Schein – transzendentale Konstitution (ursprüngliches Erscheinen, Phänomen-Werden, Phänomenalisieren) und Entzug (Illusion, bloßer Schein) bilden dabei ein Paar. Was ist nun die genaue Bedeutung dieser „inneren Reflexivität“ und was bringt sie genau mit sich? Zum einen impliziert die „strikte Autonomie“ des Phänomens seine Abkopplung von jeglicher Form der Gegenständlichkeit. Die einzige Bestimmtheit, die dem Phänomen dann zukommen kann, ist die des reinen „Scheins“ – des „reinen Scheinens“ in seiner phänomenalen Lauterkeit. Zugleich (und zum anderen) wird diesem aber eine konstitutive Funktion zugeschrieben. Wie kann nun etwas konstitutiv sein, zugleich aber auch nur den Charakter des Scheins an sich haben? Das ist nur verständlich, wenn der Gehalt überhaupt des Scheins näher auseinandergelegt wird. Der Schein verweist auf das, wovon er Schein ist. Das, wovon der Schein Schein ist, ist das konstitutive Apriori der (aposteriorischen) Subjekt-Objekt-Struktur. Der Schein ist also diesem gegenüber nur das Aposteriori, er ist das Aposteriori jenes Apriori – was erklärt, weshalb Richir behaupten kann, die „innere Reflexivität“ erweise das „Zugleich“, das „In-einem-und-selben-SchlageSein“, von Subjekt-Objekt-Struktur und Schein. Dann ist aber das Apriori selbst niemals eigens zugänglich – und wird so gewissermaßen selbst zu einem Schein oder einer Illusion. Man muss sich diesen Punkt klar vor Augen führen: Gerade sofern das konstitutive Apriori durch den Entzugscharakter bzw. die Unmöglichkeit, eigens erfahren werden zu können, ausgezeichnet ist, erweist es sich, strenggenommen, als Schein oder Illusion. Es ist, unverblümt ausgedrückt, illusorisch, des konstitutiven Apriori direkt habhaft zu wer-
80
Kapitel II
den – und gleichwohl ist die gesamte transzendentalphänomenologische Anstrengung eben genau hierauf ausgerichtet und lässt sich davon auch nicht abbringen. Richir nennt diesen Scheincharakter des konstitutiven Apriori eine „transzendentale Illusion“. Es wäre freilich hilfreich gewesen, für beide Scheins- oder Illusionsarten unterschiedliche Begriffe zu verwenden, da ihr inneres Schein-Wesen jeweils verschieden ist: Die transzendentale Illusion (des konstitutiven Apriori) ist eine absolute Illusion per se oder an sich, da dieses Apriori niemals originär gefasst werden kann und daher keinen direkten Zugang bietet; der aposteriorische Schein dagegen ist insofern Schein oder Illusion, als er Schein oder Illusion vom konstitutiven Apriori ist. Man könnte demgemäß Richirs Formulierung, das Phänomen phänomenalisiere sich „a posteriori als Schein oder Illusion eines Scheins oder einer Illusion a priori“ umformulieren in: das Phänomen phänomenalisiert sich als Schein oder Illusion einer konstitutiven, aber zugleich unzugänglichen (bzw. sich entziehenden) Struktur a priori. Damit wird gesagt, dass sich das Phänomen a priori niemals selbst a priori, sondern immer nur a posteriori konstituiert, oder anders gesagt: Die Phänomenalisierung ist je eine des Scheins und zwar solcherart, dass dieser sich selbst als Schein a posteriori der apriorischen, aber nicht erscheinenden, sondern sich eben nur in einem Schein a posteriori gebenden, konstitutiven Struktur erscheint. Phänomenalisierung ist – in den Worten Richirs – SichErscheinen des Scheins als Schein des Scheins; weniger zweideutig ausgedrückt (und die obige Unterscheidung miteinbeziehend): SichErscheinen des Scheins als Schein des sich entziehenden Apriori. Es wird somit deutlich, dass die lineare Konstitutionsbewegung – vom ursprünglichsten Apriori hin zum Konstituierten und Phänomenalisierten – von Richir dahingehend uminterpretiert und umgeleitet wird, dass die phänomenologische Analyse des Scheins die Aufklärung der apriorischen Konstitutionsart über den Umweg über das Konstituierte notwendig macht und das Apriorische somit nur mittels des Aposteriorischen erhellt werden kann. Das bedeutet, dass sich die Phänomenalisierung, sofern sie das transzendentale Prinzip der Reflexion in sich befasst, nicht (wie bei Fichte, Schelling oder Hegel) von einem Prinzip hin zu dessen Prinzipiaten entwickeln lässt, sondern fundamental „retrojizierend“ verfährt. Richir fasst das folgendermaßen zusammen, wobei er die „transzendentale
Phänomenologie und Metaphysik
81
Illusion“ (also das sich entziehende Apriori) mit einem „Nichts“ gleichsetzt: […] die Notwendigkeit eines Apriori zeigt sich erst nachträglich – im Aposteriori, im je schon phänomenalisierten Schein – an; eines Apriori, das der Schein von sich selbst aus als reinen Schein oder als reine transzendentale Illusion von Nichts retrojiziert, wobei dieses Nichts, das reine Apriori, nachträglich als ein solches erscheint, das sich immer schon als die Bedingung der Möglichkeit a priori jeglichen möglichen Scheins phänomenalisiert hat.43
Das Apriori phänomenalisiert sich in und durch die Retrojektion vom aposteriorischen (phänomenalisierten) Schein aus, welcher selbst also unvermeidlich durch Nachträglichkeit ausgezeichnet ist. Die (von Richir bereits in Au-delà du renversement copernicien als „ursprüngliche Verzerrung [distorsion originaire]“ bezeichnete) Unmöglichkeit der direkten Zugänglichkeit des Apriori, an dem Richir gleichwohl unerschütterlich festhält, steht im Zentrum seines Ansatzes einer Neufundierung der transzendentalen Phänomenologie. Richir geht dabei insofern über Heidegger hinaus, als er die transzendentalen und phänomenalen Verhältnisse, die hier maßgeblich sind, in aller Schärfe herausstellt. Von hier aus ist dann auch gut verständlich zu machen, was Richir genau unter „Simulacrum“ versteht. In der soeben auseinandergelegten Phänomenalisierung wurde der Status des „Apriori“ (= Nichts qua konstitutivem, nicht erscheinendem Ursprung der Subjekt-Objekt-Struktur der Intentionalität) und des „Aposteriori“ (= diese Subjekt-Objekt-Struktur selbst als Schein) präzise gefasst. In Richirs Augen zielt nun die Phänomenologie Husserls darauf ab zu zeigen, dass allein durch den radikal zu Ende geführten Vollzug – der vom Phänomen selbst geleisteten aposteriorischen Reflexion der apriorischen transzendentalen Illusion des Phänomens – dem Phänomen als reinem Phänomen, welches sich dergestalt auf eine einzige „globale Erscheinung“44 reduzierte, Rechnung getragen werden kann. Ein solcher Ansatz stellt somit die Behauptung auf, dass der Abstand zwischen dem Aposteriori und dem Apriori im Unendlichen überwunden werden könne. Genau das ist aber eine Illu43 44
Recherches phénoménologiques, Band 1, S. 32. Ebd.
82
Kapitel II
sion, die laut Richir unmittelbar aus der apriorischen transzendentalen Illusion folgt. Den „Effekt“ dieser Illusion nennt Richir das „Phänomen-Simulacrum (simulacre de phénomène)“. Ihm korreliert eine „Reifizierung“ dieser transzendentalen Illusion, eine Ontologisierung des reinen Apriori, woraus sich das „ontologische Simulacrum“ ergibt, d.h. das als reine ontologische Manifestierung des Nicht-Erscheinenden selbst aufgefasste „Phänomen“. 4.) Damit kann eine terminologische Klarstellung geliefert werden, die Richirs Ansatz in den Recherches phénoménologiques mit jenem in Au-delà du renversement copernicien in Verbindung zu setzen gestattet. Die absolute Unzugänglichkeit des Apriori hatte Richir in seinem ersten Buch als die „ursprüngliche Verzerrung [distorsion originaire]“ bezeichnet. Der illusionnierende „Effekt“ des (apriorischen) Phänomens dagegen (das sich ja, wie ausführlich dargelegt, als „transzendentale Illusion“ erwiesen hat), sofern es eben Phänomen der transzendentalen Illusion ist und also den (aposteriorischen) „Schein“ zeitigt, ist der „Motor“ dessen, was Richir 1976 die „Verzerrung der Verzerrung [distorsion de la distorsion]“ genannt hatte. Diese „ursprüngliche Verzerrung“ setzt Richir nun dem in seinen Augen irrtümlichen Ansatz der Husserl’schen Phänomenologie entgegen – was einen wichtigen Baustein seines Projekts einer Neugründung der Phänomenologie ausmacht. Richir weist somit auf einen „hiatus“ hin, der folgende zwei entscheidenden Einsichten zum Ausdruck bringt: […] dieser hiatus bedeutet, dass auf eine nicht reduzierbare Weise im Phänomen selbst ein nicht erscheinender Teil liegt, der die Reflexivität des Phänomens bedingt und zugleich ihren ganzheitlichen Vollzug unmöglich macht – der also die Phänomenalität des Phänomens zur Schau stellt und es zugleich in der Nicht-Phänomenalität verankert, die das Phänomen, sofern sie sich – als dessen innere Differenz – innerhalb desselben abspielt, an das Außen, an jedes andere mögliche Phänomen verweist.45
Zum einen hängen das Bedingungsvermögen der Reflexivität und die Unmöglichkeit der totalen Abschließbarkeit oder gelungenen Vollzugshaftigkeit derselben miteinander zusammen; zum anderen folgt aus dieser Unmöglichkeit, dass das Phänomen – in seiner Nicht-Erscheinbarkeit – so aufgefasst wird, als ließe es sich durch ein „Außen“ erfüllen (was also die Setzung desselben, die sich 45
Recherches phénoménologiques, Band 1, S. 34.
Phänomenologie und Metaphysik
83
dadurch auch nur als eine Illusion erweist, impliziert). Die Phänomenalität als „Schein“ kontaminiert das „Außen“ und macht es selbst zu einem solchen. Das „Außen“ ist deshalb ein „Außen als ob“, weil die Phänomenalisierung in ihrem tiefsten Innern eine transzendentale Illusion zeitigt. Richir erhebt den Anspruch, mit der Auffassung, das Phänomen sei ursprünglich „Schein“, den vermeintlichen Zirkel innerhalb der Phänomenalisierung aufgelöst zu haben. Worin besteht zunächst dieser Zirkel? In einem ersten Schritt wird das Phänomen als Bedingung der Möglichkeit a priori der Subjekt-Objekt-Struktur angesetzt; in einem zweiten Schritt ergibt sich aber, dass das Phänomen ein aposteriorisches Element ist, in dem sich die transzendentale Illusion als dessen apriorische Möglichkeitsbedingung reflektiert; oder anders ausgedrückt: Das (aposteriorisch angesetzte) Phänomen wird durch die transzendentale Illusion konstituiert. Allerdings ist – laut Richir – für Husserl46 das Apriori (das sich ja als transzendentale Illusion erweist) nichts anderes als die intentionale Subjekt-ObjektStruktur selbst – was nun eben einen Zirkelcharakter hervorruft, der auch schon von Levinas bemerkt wurde: Das Phänomen konstituiert die Subjekt-Objekt-Struktur und das als Subjekt-Objekt-Struktur aufgefasste Apriori konstituiert wiederum das Phänomen. Alles scheint demnach so, als sei das Phänomen dadurch konstituiert, wovon es selbst eigens konstitutiv ist. Dies ist aber deshalb nur eine Illusion, weil der Phänomenbegriff durch die transzendentale Reduktion hindurchgegangen ist und somit in beiden Fällen nicht die gleiche Bedeutung hat. Im ersten Fall, hierin besteht wie gesagt Richirs Auslegung, ist es apriorisch, im zweiten aposteriorisch. Hierdurch stellt Richir also den illusorischen Charakter des Zirkels heraus und löst ihn dadurch auf. Kommen wir nun zum letzten und systematisch entscheidenden Punkt. Richir hat mit seiner Analyse des „Scheins“ und der ihm zugrundeliegenden transzendentalen Illusion das ontologische Simulacrum aufgedeckt und dadurch einen unbegründeten ontologischen Anspruch der Phänomenologie (gemeint ist damit Heidegger) zurückgewiesen. Es darf aber das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet und durch die Analyse des Phänomens als „Schein“ jeglicher Bezug zum „Sein“ und zur „Realität“ unmöglich gemacht werden. Wie ist das aber möglich? Wie vermag Richir „Scheinhaftigkeit“ 46
Recherches phénoménologiques, Band 1, S. 32.
84
Kapitel II
und „ontologische“ Tragweite der Phänomenalisierung zusammenzudenken? Es folgt aus dem Vorigen, dass „der Ort der Generierung des intentionalen Bezugs im Schein selbst“ bzw. in der in ihr sich vollziehenden „Verschiebung vom Erscheinenden zum Nicht-Erscheinenden“47 (also eben im apriorischen transzendentalen Schein) liegt. Dabei muss aber laut Richir mitberücksichtigt werden, dass das als Schein aufgefasste Phänomen sich weder auf die lebendige Innerlichkeit des transzendentalen Ego noch auf die transzendente Äußerlichkeit zurückführen lässt, sondern vielmehr an der „instabilen Grenze [limite instable]“ zwischen Innen und Außen erscheint. Richir drückt das folgendermaßen aus: Als diese instabile Grenze erscheint der Schein lediglich als die erscheinende Haut zweier Nicht-Erscheinender [inapparences], jene der Innerlichkeit und jene der Äußerlichkeit, wobei diese beiden Nicht-Erscheinenden durch die intrinsische Spannung der Intentionalität aneinandergeschweißt sind.48
Wie ist diese „Grenze“ genau aufzufassen? Hierdurch berühren sich nicht lediglich zwei räumlich aneinander liegende, durch diese Grenze voneinander geschiedene Entitäten, sondern sie ist als ein Ort des Austauschs und des Übergangs beider, genauer: als das Ineinander selbst von Innen und Außen, die dadurch jeweils zu einer „äußeren Innerlichkeit“ und einer „inneren Äußerlichkeit“ werden, anzusehen. Hierdurch entfaltet sich wiederum eine „Doppelbewegung des Ausrollens und des Einrollens“,49 die Richir als die „Doppelbewegung der Phänomenalisierung“50 überhaupt betrachtet, durch welche sich der Schein somit „aus nichts phänomenalisiert“.51 Wirft das aber nicht die vorherige Frage – nämlich wie sich hier „Schein“ und „Sein“ bzw. „Transzendentalität“ des Phänomens und „Transzendenz“ desselben miteinander vereinbaren lassen – nur noch umso dringlicher auf? Dem ist nicht so, weil jene Seinsdimension bzw. Transzendenz eben gerade in dieser Doppelbewegung der Phänomenalisierung aufgeht. Der ontologischen Tragweite Recherches phénoménologiques, Band 1, S. 39. Recherches phénoménologiques, Band 1, S. 38f. 49 Recherches phénoménologiques, Band 1, S. 41. 50 Ebd. 51 Recherches phénoménologiques, Band 1, S. 42. 47 48
Phänomenologie und Metaphysik
85
der Phänomenalisierung kann nur dann Rechnung getragen werden, wenn man sich im ursprünglich-archaischen Register der Phänomenalisierung diesseits der Unterscheidung von „Transzendentalität“ und „Ontologizität“ (also sozusagen in einem sowohl prätranszendentalen als auch prä-ontologischen Register) ansiedelt. Dies bedeutet aber nicht, dass Richir einem irgendwie gearteten phänomenologischen Monismus anheimfiele! Er stellt sich hiermit vielmehr jeglicher monistischen Auffassungsweise insofern entgegen, als er – dem oben Auseinandergelegten entsprechend – die transzendentale Gründung als eine „zweifache“, „doppelte“52 ansieht: „Das Phänomen als solches ist ihm selbst sein eigener Grund [fondement]“ und „das Phänomen als solches phänomenalisiert sich mit der Illusion seines eigenen Grundes.“53 * Es soll nun die Brücke von Richirs Frühschriften zu seinen späten Arbeiten geschlagen werden. Hierfür muss die Aufmerksamkeit nun auf den einleitend hervorgehobenen Begriff der „transzendentalen Matrize“ gelenkt werden. Auf seinem gesamten Denkweg stellt Richir – wie bereits erwähnt – verschiedene solcher „transzendentaler Matrizen“ heraus. Über seinen letzten Schriften thront dabei der „‚Moment‘ des Erhabenen“. Die erste Erwähnung findet der „Moment [sic!] des Erhabenen“ in Phénoménologie et institution symbolique (Phénomènes, temps et êtres II). Es stellt dort die Einheit dreier Komponenten dar, nämlich 1.) der „phänomenologischen Begegnung […] des Symbolischen und des Phänomenologischen“,54 2.) des „symbolischen Stifters als todbringender Macht“55 (dieser Gedanke, welcher der „fruchterregenden Gestalt des Todes“ entspricht, schließt an Hegels Phänomenologie des Geistes an) und 3.) der Stiftung des Selbstbewusstseins (siehe Fichtes Naturrecht und vor allen Dingen die „Dialektik von Herr und Knecht“ wiederum in der Phänomenologie des Geistes, wo diese Gestalt des Todes ebenfalls vorkommt).56 Es ist bemerkenswert, dass hier Recherches phénoménologiques, Band 1, S. 45. Ebd. 54 Phénomènes, temps et êtres II, S. 349. 55 Phénomènes, temps et êtres II, S. 352f. 56 Phénomènes, temps et êtres II, S. 353. 52 53
86
Kapitel II
bereits 1.) die Artikulierung des Affektiven, Phänomenologischen („Systolē“) einerseits und des Schematischen, Symbolischen („Diastolē“) andererseits, 2.) ein Verweis auf die Transzendenz („Tod“) und 3.) der Bezug zum „Selbst“ anzutreffen sind. In Du sublime en politique57 bezeichnet der „Moment des Erhabenen“ sodann den Punkt der „Begegnung“ zwischen der „radikalen Unbestimmtheit und der (zumindest relativen oder scheinbaren) Bestimmtheit, zwischen dem Logologischen und dem Tautologischen, zwischen dem Nicht-Definierten und dem Definierten.“58 Richir präzisiert an gleicher Stelle, dass er „abgründig [en abîme], rätselhaft, kein Übergang vom phänomenologischen zum symbolischen ‚Pol‘ der Erfahrung ist, welcher Übergang ‚logisch‘ denkbar oder von der einen oder anderen Seite ableitbar wäre – denn damit würde man einen Hasen aus dem Hut hervorzaubern. Ganz so als wäre der Abgrund das mysteriöse Band zwischen beiden, weil wir immer in beiden und niemals ausschließlich in der Unbestimmtheit oder der Bestimmtheit leben.“59 Richir unterstreicht zudem, dass es beim „Erhabenen“ um das „Selbst“ geht. Dieser Aspekt wird auch in den Variations I und II seine zentrale Bedeutung beibehalten. Der „‚Moment‘ des Erhabenen“ wird dort als außerzeitlicher Augenblick (= dem exaiphnès aus Platons Parmenides) aufgefasst, wo eine „Hyperkondensierung“, das heißt eine unendliche Intensivierung der Affektivität, aufbricht, um sowohl eine Flucht ins Unendliche der absoluten Transzendenz als auch eine affektive Entspannung, die sich qua Vielfalt von „Affektionen“ entfaltet, zu verursachen. Richir bezeichnet die Seite „vor“ dem exaiphnès als „Systolē“ und jene danach als „Diastolē“. Die rein „affektive“ Systolē ist außer-schematisch, während die Diastolē sozusagen in einem „Neustart“ des Schematismus besteht. Im „‚Moment‘ des Erhabenen“ tritt die Affektivität (in einer Art „Proto-Reflexivität“ [dieser Ausdruck ist nicht von Richir]) in Kontakt mit sich selbst und lässt das „Selbst“ aufbrechen. Er stiftet somit ursprünglich das „Selbst“, das jeden sich bildenden Sinn „begleiten können muss“. Und es liefert den bestimmten Gehalt der Erfahrung, sofern es ursprünglich auf die „Konkretheit“ der „Welt“ und
M. Richir, Du sublime en politique, Paris, Payot, 1991. Du sublime en politique, S. 50f. 59 Du sublime en politique, S. 51. 57 58
Phänomenologie und Metaphysik
87
der „Wirklichkeit“ bezogen ist. Entscheidend ist dabei aber die (bereits angesprochene) Sinneröffnung, die eine „absolute Transzendenz“ ins Spiel bringt, welche sich ihrerseits differenziert: nämlich in die „absolute Transzendenz“ tout court, die den sich bildenden Sinn davor bewahrt, (durch eine „Flucht ins Unendliche“) zu „implodieren“; und in die „physisch-kosmische Transzendenz“, welche die „Referenz“ der Sprache ausmacht (und wiederum den Bezug zu den „Welt-Phänomenen“ herzustellen gestattet). Letztere ist der Horizont oder das Element, das dem „Knirschen“ der Phänomenalisierung zugrunde liegt, das in „Le rien enroulé“ noch nicht in seiner „welthaften“ Dimension gefasst wurde (und das heißt: in Bezug auf eine „wirkliche“ Innerweltlichkeit). Im „‚Moment‘ des Erhabenen“ wird die „Endogeneität“ bewahrt, die „Doppelbewegung“ wird auf ihre systolische und diastolische Grundmatrize zurückgeführt, und die „Funken“, „Späne“ bzw. „Schlacke“ des „Seins“ werden an die „physisch-kosmische Transzendenz“ gebunden.60 Indem er (nachträglich) einen reflexiven Rückblick auf diese Ausarbeitungen wirft, setzt Richir den „‚Moment‘ des Erhabenen“ mit der „Doppelbewegung“ aus seinem Essay „Le rien enroulé“ in Beziehung. Zu dieser merkt er Folgendes an: Eine Doppelbewegung ist das, was immer schon „Trägheit mit sich führend [‚inertiant‘]“ ist, und zwar in dem, was diese niemals mit sich führt – das eine und das andere vielmehr als das eine oder das andere, sofern sich darin immer schon ein Widerstand geltend macht: Vorrückend zieht sie sich auch immer schon zurück. Zu diesem Punkt verweise ich auf den schönen Artikel von Robert Alexander in den Annales.61 Was mich aber letztlich an dieser Auffassung der Doppelbewegung störte, ist, dass sie durchaus metaphysisch bleibt. Was ist eine Doppelbewegung? Eine Bewegung, die ihren Widerstand in sich selbst hat: Das hat mich seit „Le rien enroulé“ wirklich fasziniert – und zwar Jahre lang. Jetzt allerdings würde ich das nicht mehr in solchen Begriffen, die mir viel zu spekulativ erscheinen, sagen.62 60 In den letzten beiden Kapiteln werden noch andere Aspekte des „‚Moments‘ des Erhabenen“ behandelt, die Richir in seinen späten Schriften ausgeführt hat. 61 R. Alexander, „La question du mouvement dans la phénoménologie de Marc Richir“, Annales de Phénoménologie, Amiens, Nr. 10/2011, S. 133– 142. 62 L’écart et le rien, op. cit., S. 64.
88
Kapitel II
Während in „Le rien enroulé“ und in den Recherches phénoménologiques die Doppelbewegung in einem ausrollenden Einrollen bestand – bzw. in einem einrollenden Ausrollen –, geht aus den späteren Analysen des „‚Moments‘ des Erhabenen“ hervor, dass das „Ein-“ des Einrollens als eine „hyperdichte systolische Intensivierung“ und das „Aus-“ des Ausrollens als die „ins Unendliche fliehende absolute Transzendenz“ gefasst werden kann. Entscheidend ist nun Folgendes: Für Richir ist die Analyse aus den früheren Jahren – die eine Bewegung herausstellt, die zugleich eine Gegen-Bewegung ist – eine metaphysische, während die des „‚Moments‘ des Erhabenen“ – die der absoluten Transzendenz keinerlei Form von Äußerlichkeit zuschreibt, sondern diese vielmehr in den „‚Moment‘ des Erhabenen“ gleichsam integriert – mit jeglicher metaphysischen Perspektive geradezu bricht. Die „Endogeneisierung“ hat in der Tat bei Richir letztlich den Vorrang gegenüber der „Exogeneisierung“. In seinem letzten Werk – Propositions buissonnières – bringt Richir am „‚Moment‘ des Erhabenen“ eine letztere Änderung an, indem er „vor“ dem Flimmern – und das heißt: diesseits jeder Art von „Polen“ – eine bestimmte „Vibration“ ausmacht. Im letzten Kapitel wird man sehen, welche Konsequenzen Richir daraus zieht. Hier wird aber bereits deutlich, wie subtil der „metaphysische“ Charakter seiner Analysen ist: Sofern er an seiner Absage an jegliche Ontologisierung (will sagen: an jegliche Stabilisierung oder Fixierung) festhält, kann die Gültigkeit seiner Analysen in „Le rien enroulé“ und in den Recherches phénoménologiques im Namen einer (gewissermaßen „negativen“) Auffassung der Metaphysik bestritten werden. Das vermindert aber nicht den durchaus metaphysischen Charakter (nun im „positiven“ Sinne) seiner Analysen, wie sie in den letzten Ausarbeitungen seines Werkes zu finden sind.
Kapitel III Sprache, Phantasie, Kreativität Richirs denkerische Entwicklung lässt sich auf unterschiedliche Art und Weise darstellen. Eine mögliche Auffassungsform derselben könnte den Begriff der „Kreativität“ bzw. der „schöpferischen“ Bildung und Gestaltung in den Vordergrund dieses Schaffensprozesses stellen. Man würde dann sagen, dass der frühe Richir „Kreativität“ und „bildende Schöpfung“ noch im Husserl’sch-Heidegger’schen transzendentalen Rahmen zu denken versucht, der „mittlere“ Richir – ab dem Ende der 1980er Jahre und dabei insbesondere in den Phänomenologischen Meditationen (1992) – sie als „schöpferischen sprachlichen Ausdruck“ aufgefasst und der spätere Richir (ab 2000) sie dann mit Einbildungskraft und insbesondere Phantasie in Zusammenhang gebracht hat.1 Ziel dieses Kapitels ist es, Richirs Grundgedanken bezüglich einer Phänomenologie der Sprache und des Sprachlichen vorzustellen.2 Dabei soll aber nicht der Eindruck entstehen, es lägen hier streng getrennte Phasen einer Entwicklung vor, in der jeder dieser Phasen eine völlige Eigenständigkeit zukäme. Es ist vielmehr so, dass die Phänomenologischen Fragmente über die Sprache (2008) die „Vollendung eines Zyklus‘“3 darstellen, den Richir nach seinem Dafürhalten mit den Phänomenologischen Meditationen (1992) begonnen hatte. Damit 1 Der Vollständigkeit halber muss man hinzufügen, dass es noch einen „ganz späten“ Richir gibt (2009–2015), der mit den beiden Variationen-Bänden einsetzt. In dieser letzten Phase steht der „‚Moment‘ des Erhabenen“ in seiner letztlich metaphysischen Bedeutung im Mittelpunkt von Richirs Überlegungen. 2 Siehe hierzu H.-D. Gondek & L. Tengelyi, Neue Phänomenologie in Frankreich, op. cit. Dieses dritte Kapitel wurde in höchstem Maße durch die Lektüre der Richir gewidmeten Ausführungen dieser monumentalen Einführung in das Denken der dritten Phänomenologen-Generation angeregt und inspiriert. Die dort entfalteten Betrachtungen sind und bleiben für ein anfängliches und einführendes Verständnis Richirs unabdingbar. Das hier Entwickelte hat allenfalls zum Anspruch, jene Ausführungen einzuholen. 3 M. Richir, Fragments phénoménologiques sur le langage, Grenoble, Millon, 2008, S. 8.
90
Kapitel III
wird zum Ausdruck gebracht, dass Richirs „Phänomenologie der Sprache“ sowie seine „Phänomenologie der Phantasie“ untrennbar zusammengehören – wovon auch die Tatsache zeugt, dass er nach 2000 mehrmals auf das Thema der Sprache und des Sprachlichen zurückkommt. Deshalb werden nun auch die Aspekte der Sprache und der Phantasie (die in der Tat erst ab Anfang der 2000er Jahre bei Richir prominent wird) in einem gemeinsamen Kapitel erörtert. * Seit seinen philosophischen Anfängen hat Richir vielfach eine „Neugründung“ oder auch eine „Wiederaneignung“ der Phänomenologie beschworen. In den Phänomenologischen Meditationen ist Richir diesbezüglich zu wesentlichen neuen Einsichten hinsichtlich seiner eigenen Methode gelangt. Auf dieser methodologischen Ebene sind zwei Punkte hervorzuheben, die nun kurz ausgeführt werden sollen: nämlich die Rolle und der Status der „hyperbolischen phänomenologischen Epoché und Reduktion“ und die „Erfahrung des Erhabenen“. Hyperbolische phänomenologische Epoché und Reduktion. Dieses neuartige methodologische Werkzeug schließt an cartesianische Gedanken an (Descartes hatte Richir von seinen frühesten philosophischen Erfahrungen an stark geprägt). Allerdings handelt es sich dabei nicht lediglich um eine Wiederaufnahme cartesianischen Gedankenguts, sondern Richir strebt von vornherein eine Radikalisierung desselben an. Dies bedeutet, dass er das Denken selbst zum „Phänomen“4 macht, wovor Descartes gewissermaßen noch zurückgeschreckt war. Aber das Denken selbst zu „dem“ Phänomen zu machen, bringt es mit sich – und das ist sowohl eine Voraussetzung der Richir’schen Phänomenologie überhaupt als auch eine Folge des hier unternommenen Versuchs –, dass nicht entschieden ist und auch gar nicht entschieden werden kann, ob die „Erscheinung“, das „Phänomen“, nicht vielmehr bloßer „Schein“ ist. Dies ist eine „Voraussetzung“ – im Sinne eines je schon im Voraus Anzusetzenden –, da Richir diesen Gedanken seit seinen frühesten Versuchen verfolgt hatte; aber es ist auch eine „Folge“ des hier verfolgten Ansatzes, da Richir diesen, seinen schon lange gedachten Gedanken mit Descartes’ Figur des „Genius malignus“ verbindet. Die Notwendigkeit 4
Méditations phénoménologiques, op. cit., S. 80; dt. Übersetzung S. 86.
Sprache, Phantasie, Kreativität
91
einer Radikalisierung der phänomenologischen Epoché im Sinne einer hyperbolischen phänomenologischen Epoché liegt primär darin begründet, dass „ich“ als Phänomenologe dem Einwand begegnen muss, meine Gedanken und Erlebnisse könnten nicht meine Gedanken und Erlebnisse sein – sondern die eines „absolut despotischen und perversen Gottes“, der nicht nur Zweifel in mir heraufbeschwüre, ob meine Gedanken nicht vielmehr bloß Illusion und Schein seien, sondern mich gar in gänzlicher Unwissenheit darüber beließe. Die Funktion der hyperbolischen phänomenologischen Epoché besteht somit darin, dieser Problematik gewahr zu werden. Richir will sich damit nicht primär die Mittel geben, den Schein zu beseitigen, sondern vielmehr das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Phänomenalität im ursprünglichen phänomenologischen Register eben immer auch Scheinphänomenalität bedeuten kann. Die Untaten des „Genius malignus“ erstrecken sich aber noch weiter. Sie betreffen nicht nur den Kern eines jeden Gedankens oder Bewusstseinserlebnisses, sondern wirken sich auch auf das Gedachte selbst aus. Richir schließt hier an die Folgen einer wichtigen Idee Heideggers an (ohne diese freilich eigens zu kennzeichnen [Heideggers Vorlesung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht herausgegeben worden, Richir hatte insofern davon nur völlig indirekt – über Unterwegs zur Sprache – Kenntnis5]), die in dessen Werk immer wieder auftaucht und in der Vorlesung des Wintersemesters 1933/34 „Vom Wesen der Wahrheit“ prägnant zum Ausdruck gekommen ist: „Alles Große und Wesentliche hat – das gehört zu seinem Wesen – immer doch neben und vor sich sein Unwesen als sein Scheinbares“.6 Dieser auf Plato zurückgreifende Gedanke – der zum Beispiel dem Bild der Ähnlichkeit zwischen Hund und Wolf entspricht, wenn es darum geht, den Philosophen vom Sophisten zu unterscheiden – zielt auf das ebenso bedeutsame wie rätselhafte Phänomen ab, dass bei der Frage nach dem Erfassen des „Fundamentalen“ und „Grundlegenden“ (also des „Großen und Wesentlichen“) zu diesem sich je sein „Simulacrum“ gesellt. Der vermeintlichen phänomenologischen Unausweisbarkeit dieser Behauptung
5 Siehe M. Heidegger, Unterwegs zur Sprache, HGA 12, F.-W. von Herrmann (Hsg.), Frankfurt am Main, Klostermann, 1985, S. 141. 6 M. Heidegger, Sein und Wahrheit, HGA 36/37, H. Tietjen (Hsg.), Frankfurt am Main, Klostermann, 2001, S. 111.
92
Kapitel III
treten die auf ein „Bruchstück“ Hölderlins aufbauenden Ausführungen zu „Sein“ und „Schein“,7 bzw. zum „Verfall der Sprache“ entgegen – was insbesondere erkläre, weshalb die Sprache „der Güter Gefährlichstes“8 sei: „Unser Seyn geschieht […] als Gespräch, sofern wir, so angesprochen sprechend, das Seiende als ein solches zur Sprache bringen, das Seiende in dem, was es ist und wie es ist, eröffnen, aber auch zugleich verdecken und verstellen“.9 Mit anderen Worten: „In der Sprache geschieht die Offenbarung des Seienden, nicht erst ein nachdrücklicher Ausdruck des Enthüllten, sondern die ursprüngliche Enthüllung selbst, aber eben deshalb auch die Verhüllung und deren vorherrschende Abart, der Schein“10 bzw. das „Nichtsein“.11 Diese sprachliche Verankerung dessen, was Richir als „Gestell“12 bezeichnet, wirkt sich dann auch in genau dem gleichen Sinne auf den „Verfallscharakter der Sprache“ aus (und genau hierin bestehen die gerade angesprochenen Folgen): „Die ursprünglich das Seyn begründende Sprache steht im Verhängnis des notwendigen Verfalls“.13 Es ist eine wesentliche Eigenart nicht nur des existenzial analysierten Daseins (siehe den § 38 von Sein und Zeit), sondern eben auch einer der Wesensmöglichkeiten der Sprache selbst, das Seiende zu fixieren und zu versteifen und es so seiner ihm ureigenen Mobilität zu berauben. Mit anderen Worten, der „Genius malignus“ liegt ebenso auch der Tendenz zur Fixierung und Versteifung des symbolisch Gestifteten zugrunde. Das „Gestell“, von dem schon ausführlich in Phénomènes, temps et êtres I und II die Rede war und dessen Behandlung auch in 7 „Hölderlins Dasein hat diesen äußersten Gegensatz des Scheins und des Seins in seiner weitesten Spannung auseinander- und das heißt mit der größten Innigkeit zusammen- und ausgehalten“, M. Heidegger, Hölderlins Hymnen „Germanien“ und „Der Rhein“, HGA 39, S. Ziegler (Hsg.), Frankfurt am Main, Klostermann, 1980, S. 35. 8 Heidegger zitiert hier das Bruchstück 13, IV in der Ausgabe von Hellingraths (Hölderlins Hymnen „Germanien“ und „Der Rhein“, S. 60). 9 Hölderlins Hymnen „Germanien“ und „Der Rhein“, S. 70. 10 Hölderlins Hymnen „Germanien“ und „Der Rhein“, S. 62. 11 Hölderlins Hymnen „Germanien“ und „Der Rhein“, S. 70. 12 Zum Begriff des „Gestells“ bei Richir, siehe M. Richir, „Sens et Paroles: Pour une approche phénoménologique du langage“, Figures de la Rationalité. Etudes d’Anthropologie philosophique IV, Institut Supérieur de Philosophie de Louvain-La Neuve, 1991, S. 228–246. 13 Hölderlins Hymnen „Germanien“ und „Der Rhein“, S. 63.
Sprache, Phantasie, Kreativität
93
den Phänomenologischen Meditationen wiederaufgenommen wird, ist nichts Anderes als der Ausdruck für die Gerinnung und Verkrustung der phänomenologischen Sinnbildungsprozesse in den symbolischen Stiftungen. Ein dritter Aspekt dieses ersten Punktes betrifft die genuine Reflexivität der Sinnbildung. Anders ausgedrückt geht es dabei um die Frage nach dem Status des „Selbst“ in derselben. Richir setzt sich dabei von den beiden vorangegangenen Ansätzen (bei Husserl und bei Heidegger) ab. Wenn Husserl die Phänomenologie (insbesondere in den Cartesianischen Meditationen) als „egologische Wissenschaft“ auffasst, in der es durch und durch um die „Selbstauslegung meines Ego“14 geht, dann kann die darin in Anspruch genommene „reflexive“ Selbstbezüglichkeit nur so verstanden werden, dass Sinnauslegung eben immer auch Selbstauslegung der Subjektivität darstellt. Und wenn Heidegger in Sein und Zeit Dasein als In-derWelt-Sein auffasst, womit zum Ausdruck gebracht wird, dass das Dasein je auch die Welt (seine Welt) ist, und wenn dazu noch die das Sein des Daseins konstituierende „Zeit“ als „sich auslegende[s] Gegenwärtigen“15 definiert wird, dann wird auch hier zum Ausdruck gebracht, dass in dieser Selbstbezüglichkeit das „Selbst“ inhaltlich dem Sinn gewissermaßen seine Auslegungsrichtungen und auch die konkreten Auslegungen selbst vorgibt. Eine solche – „subjektivistische“ – Perspektive lehnt Richir voll und ganz ab. Sinnauslegung ist für ihn nicht je nur ichliche Selbstauslegung, denn die Selbstheit, die zweifellos der Sinnbildung beiwohnt (assiste) und ihr „assistiert“ (y assiste), vermag keinesfalls, die Gesamtheit der konkreten „Weltphänomene“ in sich zu antizipieren und sie aus sich zu entwickeln. Für das so verstandene „Ego“ (Husserl) bzw. „Dasein“ (Heidegger) führt Richir daher einen eigenen Begriff ein – den des „ontologischen Simulacrums“16 – „ontologisch“, weil es sich dabei wiederum um eine unsachgemäße Fixierung handelt; und „Simulacrum“, weil dieser „Subjektivismus“ für Richir eben eine pure Illusion ist. Er setzt dieser Auffassungsweise seinen eigenen Ansatz entgegen, der die durchaus bestehende Identität in dieser Selbstbezüglichkeit von der Selbstheit abkoppelt – wozu Ricœurs kurz zuvor erst eingeführte E. Husserl, Cartesianische Meditationen, Husserliana I, S. 118f. Sein und Zeit, op. cit., S. 539. 16 Zum Beispiel Méditations phénoménologiques, S. 33, 53, 91; dt. Übersetzung, S. 37, 58, 98. 14 15
94
Kapitel III
Unterscheidung aus Soi-même comme un autre (1990), nämlich die zwischen einer „identité-idem“ (Selbigkeit) und einer „identité-ipse“ (Selbstheit), Pate steht.17 Der Sinnbildungsprozess vollzieht sich unter Berücksichtigung der angesprochenen „Assistenz“ durch das „Selbst“ in sich und durch sich und kommt somit der Richtung einer „asubjektiven Phänomenologie“ nahe, wie sie von Patočka eingeführt wurde. Erfahrung des Erhabenen. Mit dem „Selbst“ verhält es sich aber noch differenzierter und komplizierter. Hilfreich sind hierbei die fünfte und sechste der Phänomenologischen Meditationen. Es geht Richir dabei allgemein gesagt darum, im ursprünglichen Register der Phänomenologie die „Praxis der Phänomenologie“ (gleiches gelte aber etwa auch für die Dichtung oder die Musik) so hervorzukehren, dass dabei Sinnaufgang und Sinnschöpfung „verständlich“ werden. Was für das Sprachphänomen gilt, trifft dabei auch auf die hier zu verortende „Bewusstseins“dimension (und damit auf das „Selbst“) zu: Der gesamte Prozess läuft dermaßen geschwind ab, dass in dem unentwegten „Flimmern,“18 d. h. dem Auftreten und Verschwinden der sinnkonstitutiven Phänomene, keine permanente „Begleitung“ dieser Phänomene durch ein (Selbst)bewusstsein möglich ist. Im Gegensatz zur kantischen „transzendentalen Apperzeption“, die „alle meine Vorstellungen begleiten können“ muss, sind hier le-
Méditations phénoménologiques, S. 320; dt. Übersetzung, S. 347. Das „Flimmern [clignotement]“ ist einer der wichtigsten operativen Begriffe der Phänomenologie Richirs. Es geht häufig (aber keineswegs immer) mit dem Begriff der „architektonischen Transposition“ einher und bezeichnet dabei das konstitutive Hin- und Herschwingen oder „Vibrieren“ zwischen den beiden Gliedern der in Rede stehenden Transposition. Die Stärke aber auch die durch es hervorgerufene Verständnisschwierigkeit besteht dabei darin, dass einerseits durch das „Flimmern“ der „Abgrund“ der Transposition gewissermaßen „überbrückt“ wird und dass das „Flimmern“ andererseits (was damit zusammenhängt) gleichsam diesseits einer ontologischen und einer erkenntnistheoretischen Perspektive zu verorten ist. Wie in den Kapiteln VI und VII deutlich werden wird, spielt das „Flimmern“ eine entscheidende Rolle bei der Konstitution des räumlichen „Außen“ sowie bei der Stiftung der Idealität. 17 18
Sprache, Phantasie, Kreativität
95
diglich „Zwischen-Apperzeptionen“ (Trinks übersetzt „entre-aperceptions“ durch „blitzhafte Apperzeptionen“19) zu verzeichnen,20 die Richir auch als das „Organ der Phänomenalisierung“ 21 bestimmt. Deren „Ort“ charakterisiert er hinsichtlich seines ontologischen Status folgendermaßen: Dieser Ort ist jenseits jeder Ontologie, sei sie auch die Fundamentalontologie, aber nicht jenseits jeden Denkens: damit wird wieder auf andere Weise gesagt, dass das Denken sich nicht orientieren kann, wenn es sich in einer Ontologie – oder in Ontologien – verankert entdeckt, sondern nur, indem es sich nun in seinem Verhältnis zum philosophischen Sprachsystem reflektiert, und zwar in einer Architektonik der damit verbundenen Probleme und Fragen. Mit einem Wort wird hier nicht mehr die Frage des Seins vorrangig, sondern die Frage als solche. Wir werden uns der Frage bewusst und dass es auch solche Fragen gibt, die keine Antwort zum Schweigen zu bringen vermag, weil sie letztlich auf eine mehr oder weniger radikale oder ursprüngliche Abwesenheit abzielen.22
So eindeutig Richir sich hier äußert, so problematisch ist das doch für den Status dieser eigentümlichen „Zwischen-Apperzeptionen“ selbst: „Zwischen“ Sein und Nicht-Sein (Abwesenheit) „flimmernd“, beantworten sie noch nicht die Frage, wie sich dadurch ihre Seinsart bestimmen lässt. Hier kommt die Erfahrung des „Erhabenen“ ins Spiel. Diese wird in der zweiten der Phänomenologischen Meditationen dreifach bestimmt. Das „Gefühl“ des Erhabenen ist für Richir zunächst die eigentliche „Grundstimmung“ – gleichsam die „wilde Leidenschaft“ des Denkens überhaupt – unter der Voraussetzung allerdings, dass, wie Richir betont, die traditionelle Zweiteilung von „Affektivität“ und „Denken“ aufgegeben wird. 23 Zudem weist Richir darauf hin, dass das Erhabene den Ursprung der Apperzeption des 19 Der von Richir häufig zitierte „blitzhafte Einfall“ rechtfertigt diese Wahl der Übersetzung, die auf den ersten Blick vielleicht etwas seltsam anmuten mag. 20 Méditations phénoménologiques, S. 323; dt. Übersetzung, S. 349. 21 Méditations phénoménologiques, S. 350ff. (vor allem S. 361); dt. Übersetzung, S. 379ff. (S. 391). 22 Méditations phénoménologiques, S. 323f.; dt. Übersetzung, S. 350 (modifizierte Übersetzung). 23 Méditations phénoménologiques, S. 59; dt. Übersetzung, S. 64.
96
Kapitel III
Selbst darstellt.24 Das Erhabene ist sowohl „Grundstimmung“ als auch – wie Richir auf Deutsch sagt – „Selbststimmung“. Dabei findet eine zweifache „Öffnung“ statt – hin zur Faktizität der Welt sowie des Selbst (die Nähe zu Heidegger ist hier nicht zu übersehen) und auch – und dies macht die dritte Bestimmung des Erhabenen aus – hin zu einem „symbolischen Stifter“, der bei Richir die Stelle von Gott einnimmt. Die beiden letzten Bestimmungen werden in der sechsten der Phänomenologischen Meditationen und im Anhang wiederaufgenommen und näher erläutert. Wie oben bereits ausgeführt, ist die ursprüngliche Sinnbildung ein blitzhaftes Auftreten von Sinnregungen, denen nicht weniger blitzhaft auftretende und verschwindende „Zwischen-Apperzeptionen“ entsprechen – oder anders gesagt, letztere durchziehen gleichsam die Sinnbildungsprozesse. In der Erfahrung des Erhabenen – das klang in der zweiten der Phänomenologischen Meditationen bereits an – findet durch den Bezug zum „symbolischen Stifter“ auch eine Erfahrung der Unendlichkeit statt. Diese ist, näher betrachtet, durch radikale Unbestimmtheit gekennzeichnet – wofür Richir den Begriff des „apeiron“ gebraucht. Diese Begegnung des Selbst, das radikal endlich ist, mit dem Un-endlichen ist für das Erfassen des „Erhabenen“ sehr bedeutsam. In einem bemerkenswerten Abschnitt25 bezeichnet Richir die besagte Apperzeption als „entre-aperception phénoménologique de l’ipse [phänomenologische blitzhafte Apperzeption des Selbst]“ oder als „auto-entre-aperception transcendantale [transzendentale Selbst-Ahnung (in Trinks Übersetzung) bzw. transzendentale Selbst-Zwischen-Apperzeption]“26 und setzt sie mit einer phänomenologischen Erfahrung des „göttlichen ‚Denkens‘“ in Zusammenhang. Führen wir nun Richirs Gedankengang in „Das phänomenologische blitzhafte Apperzipieren des Individuums (Selbst) und der Schematismus der Phänomenalisierung: die phänomenologische Erfahrung des phänomenologischen Erhabenen“ etwas weiter aus. Das in „Zwischen-Apperzeptionen“ je aufblitzende und wieder verschwindende Selbst ist ein „Flimmern [clignotement]“ bzw. „ekliptisches Pulsieren [battement en éclipses]“. Dies hatte Richir be-
Ebd. Méditations phénoménologiques, S. 370–373; dt. Übersetzung, S. 400–404. 26 Méditations phénoménologiques, S. 372; dt. Übersetzung, S. 403. 24 25
Sprache, Phantasie, Kreativität
97
reits ein Jahrzehnt zuvor in der dritten seiner Recherches phénoménologiques herausgestellt.27 Das Selbst „konstituiert“ sich dabei genauer gesagt in einem „Flimmern“ (im Sinne eines unaufhörlichen Aufblinkens und wieder Ausgehens) d. h. in einer Doppelbewegung von beständigem Auftreten und Verschwinden. Mehr ist aber „inhaltlich“ zum Selbst nicht zu sagen, keine konkretere Bestimmung kann geliefert werden, denn, wie Richir eindringlich hervorhebt, „auf die Frage Wer bin ich? ist keine bestimmte Antwort möglich, sie würde mich töten“.28 Das Sich-selbst-Gewahr-Werden des Ich wird dabei aber zugleich „formal“ als (nicht-begriffliche) phänomenologische Selbst-Reflexion der Doppelbewegung von Auftauchen und Schwinden bestimmt.29 Und genau hierin sieht Richir nun eine phänomenologische Bekundung des „symbolischen Stifters“: […] die „Gestalt“ des symbolischen Stifters [ist] darin noch dadurch phänomenologisch, dass sie sozusagen als die „absolute Einsamkeit“ der Doppelbewegung als solcher erscheint, des Flimmerns [clignotement] als solchem, das „mich“ zusammen mit den Phänomenen zwischen Individuation und der Desindividuation ständig aufblinken und wieder ausgehen lässt. Im Flimmern vollzieht sich eigentlich ein Durchgang durch den Tod, insofern es mich den Tod (Schwinden) zum Auftauchen hin durchschreiten lässt, und auch ein Durchgang durch das Leben, insofern es mich das Leben (das Auftauchen) zum Vergehen hin durchschreiten lässt. Im Durchgang durch beides lässt mich das Flimmern zwischen Leben und Tod, die beide gleichermaßen vergänglich sind, „pulsieren [palpiter]“. Und es verleiht mir eine Art sehr merkwürdiger Unsterblichkeit, da es in seinem ständigen Umschlag von einem Pol zum anderen zeitenthoben ist […].30
Was ist mit dieser „absoluten Einsamkeit“ genau gemeint? Richir zögert nicht, die Doppelbewegung als ein Flimmern des „göttlichen Denkens“ „vor“ der eigentlichen Schöpfung zu bezeichnen. Bezüglich der „Einsamkeit“ hatte sich Richir bereits in der dritten der Phänomenologischen Meditationen geäußert: Alles spielt sich nun im Flimmern der Phänomenalität des Selbst ab, das sich konkret als faktizielles [factice] Phänomen selbst-apperzipiert. In der M. Richir, Recherches phénoménologiques, Band 1, op. cit., S. 265–270. Méditations phénoménologiques, S. 370; dt. Übersetzung, S. 401. 29 Ebd. 30 Méditations phénoménologiques, S. 370f.; dt. Übersetzung, S. 401 (modifizierte Übersetzung). 27 28
98
Kapitel III
Epoché blinkt das Selbst im Schein (dem Gedanken), den das Denken anzunehmen scheint, auf, bevor es, von ihm verlassen, als reiner und einfacher flüchtiger Schein vergeht. Als unendliche Doppelbewegung des Flimmerns ist diese einzig und allein, hat aber nichts von einem solus ipse, und nur die transzendentale Illusion der Onto-Theologie konnte ihr den eigentlich paradoxen Status des wahrhaft metaphysischen Solipsismus verleihen – eines Gottes, der aus Einsamkeit „wahnsinnig“ würde und der in seinem Abgrund als unendliches Flimmern seiner selbst gefangen wäre. Nun ist diese Einsamkeit der Doppelbewegung nichts anderes als die auflösende Einsamkeit eines Denkens, das „sich“ wie im Vollzug der hyperbolisch-phänomenologischen Epoché geläutert hat und „sich“ als Umschlagen der Hyperbel läutert, indem gerade das, was sie bestreitet, sie wieder ins Spiel bringt, also durch ein weiteres Einklammern des Eingeklammerten, das seinerseits sich einklammern muss, ohne dass sich das „Selbst“ dieses „Sich“ jemals stabilisieren könnte, da es unerbittlich in diesem Flimmern fortgerissen wird. Von der anderen Seite aber ist – im phänomenologischen Erhabenen – diese scheinbare Einsamkeit oder diese scheinbare Vereinsamung im bodenlosen Abgrund eigentlich keine mehr, zunächst weil das „Selbst“ des Denkens oder des Einklammerns nicht mehr irgendeiner Identität zugeschrieben werden kann, die sich darin völlig aufgelöst hat, insbesondere aber auch, weil diese Auflösung, die jede Zuweisung irgendeines „Inhalts“ an irgendeine Identität gleichgültig werden lässt, sich sozusagen sofort auf alles ausbreitet, was demgegenüber als anders erscheint, auf alles, was sozusagen von innen die Wände des Abgrunds bekleidet, d. h. auf alles, was nun als Konkretisierung der Phänomene durchschimmert, die im gleichen Flimmern aufgenommen, also auf das Flimmern der Phänomenalität zurückgeführt werden. Die Einsamkeit der Doppelbewegung radikal zu denken, läuft also darauf hinaus, die anfängliche Abstraktion zu vergessen, die es in der Hyperbel der Epoché gibt, oder die bewusste Konzentration des Denkens auf das Denken des Denkens, die Ausdünnung, die das Denken auszehrt, zu vergessen, indem sie von allen Seiten und in alle Richtungen das das Denken durchqueren lässt, was auf den ersten Blick als seine Inchoativität erscheint.31
Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass im Flimmern, in der Doppelbewegung, zwei Seiten zu unterscheiden sind – und genau das macht hier das „Erhabene“ aus. Einerseits löst sich die absolut einsame Doppelbewegung, die als unendliche (was den Bezug zum „göttlichen“ Denken herstellt) zugleich auch die Einsamkeit eines
31 Méditations phénoménologiques, S. 117; dt. Übersetzung, S. 124 (modifizierte Übersetzung).
Sprache, Phantasie, Kreativität
99
je fortgerissenen Denkens ist, das sich niemals zu stabilisieren vermag, völlig auf. Andererseits findet aber auch eine Art „Umschlag“ statt, durch den diese radikale Auflösung zum Durchschimmern einer Konkretisierung der Phänomene wird – daher auch einige Zeilen weiter unten die Rede von „Spänen [copeaux]“ bzw. „scheinbaren Fetzen der Phänomenalität“32 der Doppelbewegung, womit Richir an seine Beschreibung der „Doppelbewegung der Phänomenalisierung“ in „Le rien enroulé“ anknüpft. Und welchen Sinn hat hierbei der „Gott“? Die beiden soeben geschilderten Seiten werden, wenn man ihren Bezug zueinander betrachtet, von Richir auch – korrekt übersetzt – als „endlos fliehende Abwesenheit in die Weltabwesenheits-Transzendenz“33 bezeichnet. Hierbei steht die „fliehende Abwesenheit“ für die Auflösung der Identität des Selbst und die „Transzendenz“ dafür, dass hier die gesamte Bewegung sich nicht in nichts auflöst, sondern Sinnbildung von nicht bloß Sinn von sich selbst seiendem Sinn – d. h. somit von Sinn von Seiendem – ermöglicht. Genau das kommt nun laut Richir der Übertragung des traditionellen christlichen Gottes, sofern er „allein mich als verleiblichtes Selbst – als ‚Kreatur‘ – individuieren kann“,34 ins phänomenologische Feld gleich. Das, was dem Selbst letztursprünglich zugrunde liegt, ist die zwischen Aufkommen und Schwinden flimmernde Doppelbewegung. Richir kann dementsprechend sagen, dass die phänomenologische Zwischen-Apperzeption des Individuums nichts anderes [ist] als die phänomenologische Zwischen-Apperzeption eines radikal Anderen; wir tragen es alle in uns, sofern wir ihm bloß in dieser unendlichen Bewegung nachspüren; wir sind von dieser radikalen Unheimlichkeit bewohnt, die uns unvermeidlich irren lässt, auf den Wegen und Umwegen, den glücklichen und unglücklichen Stunden [heurs et malheurs] unseres individuierten Rätsels. Es handelt sich dabei aber nicht um das Innewohnen eines anwesenden Gottes, auch nicht eines Gottes, der nur als Méditations phénoménologiques, S. 117; dt. Übersetzung, S. 125. Méditations phénoménologiques, S. 372; dt. Übersetzung, S. 402 (hervorgehoben v. Vf.). Es ist bemerkenswert, dass Richir bereits 1992 in Bezug auf das Erhabene und auf die dort hineinspielende Transzendenz von einer Bewegung, die „endlos fliehend [indéfiniment en fuite]“ ist, spricht. 34 Méditations phénoménologiques, S. 371; dt. Übersetzung, S. 402 (in Trinks Übersetzung fehlt die Spezifizierung, dass Gott „allein“ mich als Kreatur individuieren kann). 32 33
100
Kapitel III
Leichnam anwesend wäre – wie im Fall der symbolischen Verfehlung [malencontre], wo der Leichnam durch die Fäden des Gestells [im Sinne Heideggers] oder des symbolischen Gestells [im Sinne Richirs] wiederbelebt wird –, denn hier geht es um die Bewohnung durch eine endlos fliehende Abwesenheit in die Weltabwesenheits-Transzendenz.35
Mit anderen Worten, was das Selbst zu einem Selbst macht, ist die absolute Transzendenz eines radikal „Anderen“, das selbst eine „endlos fliehende Abwesenheit“ ist und diese zugleich auch dem „Cogito“36 einschreibt. Damit sind die Weichen für das Verständnis eines „Erhabenen“ gestellt, das in ganz ähnlicher Fassung dann auch im späteren Werk Richirs wieder auftreten wird. * Zur Richir’schen Neugründung der Phänomenologie gehört die Einsicht in die Notwendigkeit, in das architektonische Register hinabzusteigen, das diesseits der Intentionalität angesiedelt ist. Hierfür leistet Phénoménologie en esquisses insofern einen bedeutsamen Beitrag, als in diesem Buch aufgezeigt wird, dass diese Notwendigkeit sich am treffendsten im Ausgang von Husserls Analysen der „Phantasie“ begründen lässt. Hierbei kann sich Richir aber nicht auf eine bei Husserl voll ausgearbeitete Konzeption stützen. Husserl entdeckt zwar,37 dass es einen fundamentalen Unterschied zwischen dem auf einen materiellen Grund sich stützenden Bildbewusstsein (Gemälde, Foto usw.) und der reinen Phantasie gibt, wo solch eine Grundlage nicht vorhanden ist – dieser Unterschied liegt darin, dass im ersten Fall „Bildobjekt“ (= der gemalte, fotografierte usw. Gegenstand) und „Bildsujet“ (= der „durch“ die Imagination oder Phantasie anvisierte „äußere“ Gegenstand) unterschieden werden müssen, während in letzterem eine solche Unterscheidung nicht getroffen werden kann, weil hier gar kein Bildobjekt vorliegt. Aber er hält nicht konsequent daran fest, und vor allem zieht er nicht die methodologischen und architektonischen Konsequenzen daraus. Genau hier setzt Richir nun an. Zunächst stellt sich die Méditations phénoménologiques, S. 372; dt. Übersetzung, S. 402. Méditations phénoménologiques, S. 373; dt. Übersetzung, S. 403. 37 Siehe hierzu E. Husserl, Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung. Zur Phänomenologie der anschaulichen Vergegenwärtigungen, Husserliana XXIII, E. Marbach (Hsg.), Den Haag, M. Nijhoff, 1980, Text Nr. 1. 35 36
Sprache, Phantasie, Kreativität
101
Frage, weshalb Husserl daran festhält, trotz einer gegenteiligen phänomenalen Sachlage den Phantasievorstellungen ein Bildobjekt zuzuschreiben? Richirs Antwort lautet schlicht: weil das sonst die Absage an den unverrückbaren Vorrang der Intentionalität bedeutet hätte. Jeder Bewusstseinsbezug hat für Husserl einen intentionalen Charakter – das muss dann also auch für die Phantasie gelten. Wenn nun aber, wie Husserl selbst schreibt, das „phantasiemäßig Erscheinende […] nichtgegenwärtig“38 ist, dann bedeutet das, dass sich hier gar kein Gegenstand (d. h. ein „im“ cogito „getragenes“ „cogitatum“) konstituiert. Genau das ist aber – zumindest laut Husserls Definition – die Grundeigenschaft39 des Bewusstseins qua intentionalen Bewusstseins. Mit anderen Worten, Husserl entdeckt mit der Phantasie – ohne freilich, wie gesagt, konsequent daran festzuhalten –, dass die Zuschreibung des intentionalen Charakters nicht für das gesamte Bewusstseinsleben geltend gemacht werden kann. Indem Richir nun radikal die Konsequenzen aus den Erkenntnissen, welche die Analysen der Phantasie vor Augen führen, zieht,40 knüpft er an Einsichten an, zu denen er bereits zwei Jahrzehnte zuvor gelangt war. Während aber in den Recherches phénoménologiques der Befund, dass Phänomenalität je auch Scheinphänomenalität bedeutet (was die strikte Grenzziehung zwischen Wirklichem und Unwirklichem unmöglich macht), für ihn gleichsam einen „phänomenalen“ Sachbestand (auf tiefster konstitutiver Ebene) ausmachte, verhält es sich in Phénoménologie en esquisses gerade umgekehrt: Die Unterscheidung zwischen Realem (Wirklichem) und Irrealem (Unwirklichem) lässt sich noch nicht treffen, weil die Phantasie in der tiefsten „wilden Dimension“ des Bewusstseinslebens besteht. Auf dieser tiefsten Ebene bleiben beide gleichsam ungeschieden. Sofern das aber von bewusstseinskonstitutiver Relevanz ist, da Richir der Phantasie einen „archaischen“ Status zuschreibt, strahlt das dann auch auf Husserliana XXIII, S. 68. „Bewusstseinserlebnisse nennt man auch intentionale, wobei aber das Wort Intentionalität dann nichts anderes als diese allgemeine Grundeigenschaft des Bewusstseins, Bewusstsein von etwas zu sein, als cogito sein cogitatum in sich zu tragen, bedeutet“, E. Husserl, Cartesianische Meditationen, Husserliana I, op. cit., S. 72. 40 In der Abkopplung von Intentionalität und Gegenständlichkeit besteht ein ganz wesentlicher Zug von Richirs Neugründung der Phänomenologie. Sie macht auch das Hauptcharakteristikum der transzendentalen Phänomenologie überhaupt aus. 38 39
102
Kapitel III
alles Höherstufige aus. Imagination, aber insbesondere auch Wahrnehmung, Erinnerung sind dann erst durch eine „architektonische Transposition“ der Phantasie in Imagination, Wahrnehmung, Erinnerung usw. zu erklären. Hieraus ergibt sich für Richir eine neue Architektonik der Phänomenologie und insbesondere der genetischen Phänomenologie, sofern diese bei Husserl auf „passiver Synthesis“ beruht. Dieser hatte – in seiner genetischen Phänomenologie – „passive Synthesis“, „Urstiftung“ und „Apperzeption“ miteinander in Beziehung gesetzt. Wenn man versucht, die Wahrnehmung eines Gegenstands zu erklären, wird deutlich, dass das in der Wahrnehmung unmittelbar anschaulich Gegebene niemals an die – dank des „apperzeptiven“ Auffassungsaktes vollzogene – Gegenstandswahrnehmung überhaupt heranreicht. Diese ist dem unmittelbar Gegebenen gegenüber überschüssig. Die GegenstandsAUFFASSUNG – Husserl bezeichnet sie als „Apperzeption“ – enthält stets mehr als alle einseitigen aktuellen Gegenwärtigungen des Gegenstandes. Diese Apperzeption beruht auf einer „Urstiftung“: Jede Apperzeption, in der wir vorgegebene Gegenstände, etwa die vorgegebene Alltagswelt mit einem Blick auffassen und gewahrend erfassen, ohne weiteres ihren Sinn mit seinen Horizonten verstehen, weist intentional auf eine Urstiftung zurück, in der sich ein Gegenstand ähnlichen Sinnes erstmalig konstituiert hatte.41
Und dieser aktiven „Urstiftung“ – welche also die Erstkonstitution des Gegenstandes bezeichnet – liegt ihrerseits eine „passive Genesis“ zugrunde: [J]eder Bau der Aktivität [setzt] notwendig als unterste Stufe voraus eine vorgebende Passivität, und dem nachgehend stoßen wir auf die Konstitution durch passive Genesis. Was uns im Leben sozusagen fertig entgegentritt als daseiendes bloßes Ding […], das ist in der Ursprünglichkeit des es selbst in der Synthesis passiver Erfahrung gegeben. Als das ist es vorgegeben den mit dem aktiven Erfassen einsetzenden geistigen Aktivitäten.42
Wir haben somit folgendes Konstitutionsverhältnis:
41 42
Cartesianische Meditationen, Husserliana I, S. 141. Cartesianische Meditationen, Husserliana I, S. 112.
Sprache, Phantasie, Kreativität
103
Apperzeption Urstiftung passive Synthesis Von „passiver Synthesis“ war bei Richir bereits ausführlich in den Phänomenologischen Meditationen die Rede.43 Er unterschied dort zwischen passiven Synthesen „ersten“, „zweiten“ und „dritten“ Grades. Diese drei „Grade“ entsprechen den drei grundlegenden phänomenologischen „Registern“, nämlich: 1.) dem Register des „symbolischen Unbewussten“, 2.) dem Register des „Sprachlichen“ bzw. der „Sinnbildung“ und 3.) dem außersprachlichen archaischen Register. Das erste entspricht in etwa Husserls „immanenter“ Bewusstseinssphäre, die beiden letzteren stellen eine subtile Differenzierung innerhalb der „präimmanenten“ Bewusstseinssphäre dar.44 In Phénoménologie en esquisses werden nun einerseits Apperzeption und Urstiftung nicht mehr konstitutiv unterschieden, sondern auf die gleiche Ebene versetzt und als „symbolische Stiftungen“ aufgefasst und andererseits die passiven Synthesen auf Phantasiebewegungen bzw. -Erscheinungen zurückgeführt. Damit ergibt sich folgendes Schema: Apperzeption (bzw. Urstiftung)
symbolische Stiftung
passive Synthesen Phantasiebewegungen bzw. -Erscheinungen
Auf der Grundlage dieser vorbereitenden Überlegungen kann nun Richirs Grundauffassung zur Phänomenologie der Sprache und des Sprachlichen erläutert werden. Wenn von „Sinnbildung“, sich „bilSiehe hierzu v. Vf., Le sens se faisant, op. cit., S. 55–58. Im Kapitel V wird deutlich werden, dass dieser Unterschied zu Husserl sich auch in Richirs Zeitanalysen bestätigt. 43 44
104
Kapitel III
dendem“ oder „machendem“ Sinn die Rede ist, muss zunächst dieser Begriff des „Sinns“ geklärt werden. Richir schließt hierbei sowohl an Husserl als auch an Heidegger an, aber er verleiht dem jeweiligen Sinnbegriff der beiden Gründerväter der Phänomenologie eine etwas andere Bedeutung. Im § 124 der Ideen I hat Husserl betont, dass „Sinn“ über die AUSDRÜCKENDEN Akte hinaus auf alle Akte in der noetisch-noematischen Sphäre Anwendung zu finden habe. Er bezeichnet darüber hinaus „Sinn“ als die noematische Seite der noetisch-noematischen Korrelation, innerhalb derer die noetische Seite den sinn- bzw. bedeutungsverleihenden Akten entspricht. „Sinn“ ist also noematisches Korrelat eines noetischen Bewusstseinsakts. Um zu sehen, wie Richir sich bei seiner Sinnauffassung nun dem bewusstseinsphilosophischen Paradigma der Sinnauffassung Husserls entziehen kann, muss der Blick auf Heideggers Beitrag zum Verständnis des Sinns gerichtet werden. Einschlägig für Richir ist hier allerdings nicht dessen berühmte Definition des Sinnes aus dem § 65 von Sein und Zeit, wonach „Sinn“ das ist, „worin sich die Verstehbarkeit von etwas hält, ohne dass es selbst ausdrücklich und thematisch in den Blick kommt. Sinn bedeutet das Woraufhin des primären Entwurfs, aus dem her etwas als das, was es ist, in seiner Möglichkeit begriffen werden kann.“45 Richir stützt sich vielmehr auf Unterwegs zur Sprache (1959), und zwar auf eine der drei Bestimmungen der „Sage“ nämlich das „[Z]u-sagende“.46 Der Hauptgedanke hierbei – der genauso auch an Merleau-Ponty anschließt – ist der Situation entnommen, in der ein Gedanke sprachlich zum Ausdruck kommen soll, ohne dass unmittelbar das geeignete Wort dafür zur Verfügung stünde. Es handelt sich dabei um eine eigentümliche Bewegung hin vom Sagen („dire“) zum Gesagten („dit“) – Richir bezieht sich dabei aber nicht auf Levinas’ bekannte Unterscheidung. Ihn interessiert hierbei allgemein gesagt weder der subjektive Sprechakt noch die objektive Bedeutung, sondern das spannungshafte „Zwischen“ zwischen der „wilden“ Sphäre, in welcher der überhaupt noch nicht klar artikulierte Sinn sich sucht und bildet, und klar erfasster und sprachlich formulierter Bedeutung. Die bereits von Husserl selbst vollzogene und begrüßte „Erweiterung“ des Bedeutungsbegriffs hat aber bei Richir noch einen wei-
45 46
Sein und Zeit, op. cit., S. 428f. (hervorgehoben v. Vf.). M. Heidegger, Unterwegs zur Sprache, op. cit., S. 111 und 137.
Sprache, Phantasie, Kreativität
105
teren, tieferen Sinn. Dieser betrifft den Kernpunkt seiner Phänomenologie des Sprachlichen. Denn dieses Suchen nach dem zu Sagenden bedeutet nicht lediglich, dass dem Sprecher das Wort „auf der Zunge liegt“ und gerade nicht „einfällt“. Richir zielt vielmehr auf eine Erweiterung der jeweiligen Sprachbedeutung selbst ab. Es geht ihm also um jene Form der sprachlichen Kreativität, die in einer Neueröffnung bzw. womöglich in einer Neuschaffung von Sinn besteht – wie das etwa in der Dichtung statthat, sich allerdings keineswegs darauf beschränkt. Es geht also um den „schöpferischen Ausdruck [expression créatrice]“47 im Sinne Merleau-Pontys. (Man könnte auch sagen, dass es sich hierbei um „sprachliche Generativität“ handelt, sofern der Generativitätsbegriff den Kern des Sinnbildungsprozesses betrifft.48) Dessen Ausführungen zu einer „parole opérante [fungierende Rede]“49 bieten dabei die Grundlage,50 die Richir in seiner Phänomenologie des Sprachlichen weiter ausbildet. Wir wenden uns hierfür seiner Kritik an Husserls Eidetik, seiner Analyse der genuinen „Sprachphänomene“ und der Art, wie diese schließlich mit den Phantasievorstellungen verwoben werden, zu. Schon seit seinen frühesten Ausarbeitungen – und hierbei war die Begegnung mit Derrida zweifelsohne von großem Einfluss – hat Richir, wie in den vorigen Kapiteln bereits deutlich wurde, eine sehr skeptische Haltung gegenüber Husserls phänomenologischer Eidetik eingenommen. Der Gedanke, dass der phänomenologischen Analyse und ihren Gegebenheiten eine Wesensstruktur entsprechen muss, unterliegt für ihn dem Verdacht der unrechtmäßigen Annahme und Voraussetzung einer idealen Substruktur, die sich in gewisser Weise selbst das (vor)gibt, was doch allererst bewiesen werden soll. Mit anderen Worten, Husserls Eidetik ist für Richir Zeugnis und Resultat einer symbolischen Stiftung, die es auf ihre genuin „phänomenologische“ Grundlage zurückzuführen gilt. Was Richir insbesondere zu entlarven sucht, ist die Tatsache, dass die
47 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, S. 448. 48 Bezüglich der „Generativität“, siehe v. Vf., Wirklichkeitsbilder, op. cit. 49 M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1964, S. 156 und 199. 50 Siehe hierzu L. Tengelyi, Erfahrung und Ausdruck. Phänomenologie im Umbruch bei Husserl und seinen Nachfolgern, Dordrecht, Springer, 2007, S. 230f.
106
Kapitel III
Begriffe selbst, die sich bei Husserl als „invariante eidé“ oder „Wesen“ herauskristallisieren, von bereits sprachlich geprägten Ausdrücken abhängen. Mit anderen Worten, Richir moniert aufs Schärfste, was man eine „Begriffs“- oder „Wesenstautologie“ nennen könnte: also die Idee, dass den gesuchten „Begriffen“ (eidé) bereits „Begriffe“ zugrunde liegen, die durch sprachlichen Ausdruck an jene unrechtmäßig herangetragen werden. Um dem zu entgehen, führt Richir den Begriff der „wilden Wesen“ ein, der wiederum stark von Merleau-Ponty, der für deren genauere Kennzeichnung den Ausdruck einer „begriffslosen Kohäsion“51 geprägt hat, inspiriert ist. Es handelt sich dabei um begrifflich nicht vorgeprägte „Wesen“, welche im Zustand bloßer „Sinnfetzen [lambeaux de sens]“ die „sprachliche“ Grundlage des „sich machenden Sinnes“ (aus)bilden. Kommen wir nun zum Sprachphänomen. Richir definiert es als „phänomenologische gegenwärtigende Schematisierung eines sich bildenden Sinnes“, wobei dieser Sinn „(jemandem) etwas sagt, das anderes ist als es selbst“.52 Was nun das Sprachphänomen grundlegend kennzeichnet, ist seine Eingebundenheit in Zusammenhänge. Drei Typen von Zusammenhängen sind hierbei wesentlich: jener von „Sprachlichem“ und „Außersprachlichem“, von „Möglichkeiten“ und „Transpossibilitäten“ sowie von „Sinn“ und anderem „Sinn“. Dass das Sprachphänomen zu Außersprachlichem in Verbindung steht, äußert sich dadurch, dass es je einem „Weltphänomen“ entspricht. Dieses – und darin besteht der zweite Zusammenhang – ist von einer Vielzahl von Möglichkeitshorizonten durchwoben. Diese sind verschiedener Art. Sie können antizipiert werden oder auch sich jeder möglichen Vorwegnahme entziehen, bzw. die voraussehbaren Möglichkeiten übersteigen. Hierfür greift Richir auf Maldineys Begriff der „Transpossibilität“53 zurück, der genau eine solche erfahrungsüberschreitende Möglichkeit zum Ausdruck bringt. Die „Sinnfetzen“ schreiben dem Sprachphänomen eine entsprechende „Transpassibilität“ zu, d. h. eine Art „Empfänglichkeit“ Le visible et l’invisible, op. cit., S. 196. Fragments phénoménologiques sur le langage, op. cit., S. 19. 53 Siehe H. Maldiney, Penser l’homme et la folie, Grenoble, Millon, 1991, S. 263. Zu den Begriffen der „Transpossibilität“ und der „Transpassibilität“ siehe auch die sehr hilfreichen erläuternden Bemerkungen Till Grohmanns in seiner Einleitung zu H. Maldiney, Drei Beiträge zum Wahnsinn, T. Grohmann (Hsg.), Wien, Turia & Kant, 2018. 51 52
Sprache, Phantasie, Kreativität
107
für jene Transpossibilitäten. Diese Empfänglichkeit ermöglicht schließlich einen dritten Zusammenhangstypus – jenen von „Sinn zu Sinn durch die Transpassibilität“.54 Dies eröffnet im archaischsten Register der Sinnbildung die Intersubjektivität bzw. – in Richirs Worten – die Interfaktizität.55 Somit ist für ihn auch die Phänomenologie der Intersubjektivität auf eine Phänomenologie des Sprachlichen zurückzuführen. Dieser letzte Punkt wird verständlicher, wenn man hierzu wichtige Einsichten aus Richirs Phänomenologie der Phantasie – und zwar insbesondere ab Phantasia, imagination, affectivité und den beiden „Fragmenten“-Bänden – hinzuzieht. Zu diesen Einsichten gehören die Ergebnisse der Analyse des „Blickaustauschs“ zwischen Mutter und Säugling, die Richir Winnicott zu verdanken hat. Für Richir macht dieses „Moment“ nicht nur die Stiftung der humanitas des Menschen und der menschlichen Interfaktizität aus, sondern – als ursprüngliche Kommunikation – den Ursprung nicht nur der Sprache, sondern sogar des „Sprachlichen“ selbst. Hierfür ist nun aber die Phantasie insofern hinzuzuziehen, als der Proto-Raum des Sprachlichen zugleich Proto-Raum der Phantasie ist. Sprachliches und Phantasiemäßiges sind unauflöslich ineinander verwoben. Wenn aber das Sprachliche sich je auf einen ihm äußeren „Referenten“ bezieht, was prima facie nicht auf die Phantasievorstellungen zutrifft, wie ist dann diese Verwobenheit von Sprachphänomen und Phantasievorstellung genau aufzufassen? Die Fragments phénoménologiques sur le langage (2008) schlagen hierfür Problemlösungen vor. Méditations phénoménologiques, S. 213; dt. Übersetzung, S. 229. Der Unterschied zwischen der transzendentalen Intersubjektivität und der – zum ersten Mal in den Méditations phénoménologiques eingeführten – transzendentalen Interfaktizität besteht für Richir darin, dass jene die Gegenwart anderer im Leibkörper verkörperlichter Subjekte zur Voraussetzung hat. Wenn auch Husserl selbst gelegentlich die Dimension der Interfaktizität durchaus gesehen hat (siehe z. B. den Text Nr. 21 in Husserliana XV, wo er sie als „transzendentale Koexistenz“ bezeichnet), so ist er laut Richir doch prinzipiell im Irrtum, da er von der Möglichkeit einer Eidetik der transzendentalen Intersubjektivität überzeugt war. Eine solche Eidetik ist jedoch insofern völlig ausgeschlossen, als meine eigene Faktizität nicht in Klammern gesetzt werden kann. Husserls Irrglaube besteht somit darin (und das ist ein weiteres Anzeichen für seinen bekannten „Leibnizianismus“), zumindest implizit die eidetische Rationalität dieser Intersubjektivität vorausgesetzt zu haben. 54 55
108
Kapitel III
Richirs Gedanken kreisen dabei immerfort darum aufzuzeigen, dass die Phantasie auf eine entscheidende Weise in die „Referenz“ involviert ist. Damit kommt Richir auf ein ganz altes Problem zurück, das ihn schon von Anfang verfolgt hat, nämlich die Frage, inwiefern sich der Transzendentalphänomenologe – auch und insbesondere in und durch das „Sprachliche“ – auf „etwas“ bezieht. Richir antwortet hierauf im Rahmen seiner Phänomenologie der Phantasie mit zwei neuen Begriffen, nämlich dem der „‚perzeptiven‘ Phantasie“ und dem der „virtuellen Blicke“ in der „Interfaktizität“. Der Begriff der „‚perzeptiven‘ Phantasie“ soll zunächst allgemein dargestellt und dann anhand eines Beispiels erläutert werden. Richir hatte für den Begriff der „‚perzeptiven‘ Phantasie“ zunächst einen anderen Begriff gebraucht – den der „aktiven, nicht bildlichen Mimesis von innen [mimésis active, non spéculaire et du dedans]“. Die einschlägige Passage hierzu befindet sich in Phénoménologie en esquisses.56 Richir interpretiert hier eine bedeutsame Analyse Husserl, in der dieser den Begriff der „einverstehenden Auffassung“ einführt.57 „Einverstehen“ – nicht „Einfühlen“ – bezeichnet hierbei das „apprehensive Mitsetzen“,58 die „Mitapprehensionen“,59 die weder verbildlichend noch analogisierend sind und durch die eine „nicht gegenwärtige Gegenwart“60 (diesem Begriff Husserls entspricht Richirs Ausdruck „présence sans présent assignable“), welche durch eine „äußere Wahrnehmung motiviert“ ist, unmittelbar aufgefasst und erfasst wird (hierzu gehört insbesondere die genuine Fremderfahrung). Bemerkenswert ist nun, dass, obwohl Husserl selbst betont, dass das Einverstehen nicht perzeptiv ist, weil das sonst eine Zugehörigkeit zu meinem Leib bedeuten würde,61
Siehe hierzu Phénoménologie en esquisses, op. cit., S. 145. Siehe Husserliana XIII, Text Nr. 10 (1914–15), S. 311. 58 Husserliana XIII, S. 310. 59 Husserliana XIII, S. 311. 60 Ebd. 61 Ebd. 56 57
Sprache, Phantasie, Kreativität
109
Richir ab 200462 genau hierfür den Begriff der „perzeptiven Phantasie“ benutzen wird.63 Dieser kann anhand des Beispiels des Theaters illustriert werden. Sie fungiert dann, wenn ich auf der Grundlage des Spiels des Schauspielers nicht die Person des Schauspielers selbst, sondern die dargestellte Person (Hamlet, Faust usw.) vernehme. Es handelt sich dabei nicht um eine reine Wahrnehmung und auch nicht um eine reine Phantasie, sondern darum, dass in der „perzeptiven Phantasie“ sich immer zugleich „phantasiemäßige Perzeption“ der mehr oder weniger deutlichen Darstellbarkeit eines „Objekts“ (zum Beispiel König Lear in Shakespeares Theaterstück, das imaginäre Bildobjekt in der Malerei, die Töne der Instrumente in der Musik, die durch die Beschreibungen der Situationen unvollkommen dargestellten Bildsujets im Roman usw.) und zugleich eine ebensolche „phantasiemäßige Perzeption“ eines radikal Undarstellbaren (das jeweilige ästhetische oder intersubjektive Erlebnis) einstellt.64 Dadurch erklärt sich in der Tat laut Richir das ästhetische Erlebnis wie auch die Fremderfahrung.65 Was die „virtuellen Blicke“66 angeht, ist Richirs (zweifache) These relativ klar: Die Idee ist, dass einerseits durch den ursprünglichen Blickaustausch (in der „Interfaktizität“) ein „virtueller Blick“ gestiftet wird, der das denkende Selbst im weiteren Leben gleichsam ständig „begleiten“ wird. Andererseits betont Richir aber, dass dies kein Solipsismus67 bedeutet, sondern dass ganz im Gegenteil die 62 Phantasía, imagination, affectivité, op. cit., S. 499–507. Siehe hierzu I. Fazakas, Le clignotement du soi. Genèse et institutions de l’ipséité, Mémoires des Annales de Phénoménologie, Band XII, Dixmont, Association Internationale de Phénoménologie, 2020, S. 43ff. 63 Dieser Widerspruch ist einigermaßen verwirrend. Man kann ihn nur so vermeiden, dass man „perzeptiv“ bei Husserl mit „wahrnehmungsmäßig“ und bei Richir mit einer Dimension der Phantasie, die sich auf etwas jenseits (oder diesseits) von Wirklichem und Fiktivem bezieht (siehe hierzu Fragments phénoménologiques sur le langage, op. cit., S. 15), gleichsetzt. Zum Begriff der „perzeptiven Phantasie“, siehe auch F. Forestier, La Phénoménologie génétique de Marc Richir, op. cit., S. 100ff. 64 Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 17ff. 65 Im Falle der Fremderfahrung ist das Darstellbare das Antlitz bzw. die Leibkörperlichkeit und das radikal Undarstellbare der „Andere“ selbst. 66 Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 31f. 67 Siehe zum Beispiel Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 22 und 188.
110
Kapitel III
„Weltphänomene“ (und somit, in letzter Instanz, die „absolute Transzendenz“) eine Vielfältigkeit virtueller Blicke, also einen virtuellen Multiperspektivismus, auf diese Blicke selbst erlauben, der – so die (allerdings nicht weiter begründete) These – dem Referenten der Sprache „Konsistenz“68 verleiht. „Blickaustausch“ bzw. „virtueller Blick“ und „‚perzeptive‘ Phantasie“ gehen ein genuines Vermittlungsverhältnis ein, das qua „Urkommunikation“ sozusagen eine Urdimension des Sprachlichen ausbildet (für Richir ist also die „Kommunikation“ die erste Bezeugung von Sprachlichem) und diesbezüglich die Stelle dessen einnimmt, was Merleau-Ponty die „primordiale Bedeutungsleistung“ des Leibes genannt hat (siehe das nächste Kapitel). Wie dem auch sei, sofern jene Virtualität also die von „perzeptiven Phantasien“ ist, wird verständlich, inwiefern die auf „perzeptiven Phantasien“ gegründete Urkommunikation die „archaischste transzendentale Matrize des Sprachlichen“ 69 ausmachen kann.70
Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 37. Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 21. 70 Auf diesen Gedanken kommen wir in Kapitel VII noch einmal zurück. 68 69
Kapitel IV Leib und Leiblichkeit Das Ziel dieses Kapitels1 ist es, die Funktion des „Leibes“ und der „Leiblichkeit“ in der von Richir angestrebten Neufundierung der Phänomenologie darzustellen. Zu diesem Zweck wird zunächst auf Merleau-Pontys Analysen zum selben Thema Bezug genommen, in deren Kontrast sich Richirs origineller Standpunkt klar herausarbeiten lässt.2 * Die Grundidee Merleau-Pontys in Bezug auf die Leiblichkeitsproblematik besteht darin, die transzendentale Subjektivität, sofern sie dem cartesianischen Ego Cogito verpflichtet ist, einer eingehenden Revision zu unterziehen. Die Frage lautet dabei nicht, wie das individuierte, sich selbst gewisse Subjekt dazu kommt, sich zu transzendieren und eine Realität der Außenwelt anzunehmen, sondern wie es umgekehrt möglich ist, dass die intersubjektiv konstituierte, leibliche Welt sich in „absolute Hier“, individuierte „Bewusstseine“ vereinzelt. Merleau-Ponty war es nicht vergönnt, diese Frage befriedigend zu beantworten. Wie wir sehen werden, versucht Richir, die radikalen phänomenologischen Konsequenzen aus dieser Einsicht zu ziehen.
1 Dieses Kapitel wurde zuerst unter dem Titel „Leib und Leiblichkeit bei M. Merleau-Ponty und M. Richir“, in Gelebter Leib – verkörpertes Leben. Neue Beiträge zur Phänomenologie der Leiblichkeit, M. Staudigl (Hsg.), Würzburg, Königshausen & Neumann, 2012, S. 73–97 veröffentlicht. Ich danke M. Staudigl ganz herzlich für seine Erlaubnis, diese Ausarbeitungen leicht überarbeitet hier übernehmen zu dürfen. 2 Selbst wenn Richirs philosophische Position heute von der MerleauPontys deutlich zu unterscheiden ist, haben Richirs philosophische Anfänge Merleau-Ponty viel zu verdanken. Dies wird auch in den folgenden Seiten noch einmal deutlich werden.
112
Kapitel IV
Merleau-Pontys Auffassung des „Eigenleibs“ (corps propre) oder, kürzer, des Leibes3 kann zunächst einmal bloß als eine Weiterführung von Husserls Abschattungslehre verstanden werden: Das in der sinnlichen Wahrnehmung eigens Erscheinende, sofern es weder bloß ein Aggregat von sinnlichen Daten noch eine übersinnlichideale Einheit bzw. das Zusammenspiel der sie konstituierenden Verstandesakte ist, gibt sich, wie man weiß, dieser Lehre zufolge je als „abschattendes“, d.h. es stellt das Wahrgenommene von einer besonderen „Seite“ dar, auch wenn und gerade weil es zugleich je in einer intentionalen Bezogenheit zu diesem Wahrgenommenen selbst steht. Zwei Eigenschaften kennzeichnen hierbei im Besonderen das niemals in seiner Ganzheit zu gebende Wahrgenommene: seine Nicht-Transparenz, seine Undurchdringlichkeit für jede Form der Sicht bzw. der Einsicht (Merleau-Ponty gebraucht hierfür den Begriff der „opacité“) einerseits, und seine nicht reduzierbare Transzendenz andererseits. Der wesentliche Punkt hierbei ist, dass diese Eigenschaften im Subjekt selbst ihren Ursprung haben und letzteres somit von ihnen gewissermaßen „angesteckt“ („kontaminiert“) ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie auf das Subjekt lediglich übertragen werden, sondern dass die Dimension des Subjekts aufgefunden werden muss, die diese Eigenschaften zu erklären vermag – und genau hierin besteht eben nun das besondere Anliegen der Analyse des Leibes im Denken Merleau-Pontys. Worin besteht also genau die konstitutive Funktion des Leibes für Merleau-Ponty? Es geht ihm darum, den fundamentalontologischen Ansatz Heideggers um eine notwendige Dimension zu erweitern: Das menschliche Dasein ist nicht lediglich durch die „Existenz“, d.h. durch ein verstehendes Offensein für die Welt, bzw. durch ein sich entwerfendes Verstehen gekennzeichnet, sondern Existenz und Leiblichkeit setzen sich gegenseitig voraus und bilden so gleichursprünglich und in einer nicht-dialektischen Verschränkung den Grundhorizont des Verhältnisses zwischen Subjekt und Welt: „Der Leib ist die erstarrte oder verallgemeinerte Existenz und die Existenz eine immerwährende Verleiblichung.“4 Entscheidend 3 Wir übersetzen hier überall „corps“ durch „Leib“, weil es natürlich um den lebendigen Leib und nicht um den leblosen Körper geht. 4 M. Merleau-Ponty, La phénoménologie de la perception, Paris, „tel“, Gallimard, 1945 (dt. Übers. v. R. Boehm, Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin, de Gruyter 1966), S. 194 (die Übersetzungen sind v. Vf.).
Leib und Leiblichkeit
113
hierbei ist (und das wird dann auch bei Richir wieder deutlich),5 dass dieser Bezug von Leib und Existenz von dem Verhältnis von Sprache und Denken und insbesondere von der ursprünglichen Sinnstiftung (in Merleau-Pontys Worten: von einer „primordialen Bedeutungsleistung“) nicht zu trennen ist. Das folgende Zitat belegt dies eindringlich: Diesseits der üblichen Ausdrucksmittel, durch die dem Anderen mein Denken nur deshalb offenbart wird, weil – bereits bei mir wie auch bei ihm – jedem Zeichen Bedeutungen gegeben sind, die in diesem Sinne keine eigentliche Kommunikation wirklich werden lassen, muss […] eine primordiale Bedeutungsleistung anerkannt werden, bei der das Ausgedrückte nicht getrennt vom Ausdruck existiert und die Zeichen selbst ihren Sinn nach außen leiten. Genau auf diese Weise drückt der Leib die totale Existenz aus, nicht weil er sie äußerlich begleitete, sondern weil sie sich in ihm verwirklicht. Dieser verleiblichte Sinn ist das zentrale Phänomen, von dem Leib und Geist, Zeichen und Bedeutung bloß abstrakte Momente sind.6
Versuchen wir nun, den Begriff des Leibes näher zu erläutern. Der Leib, so wie ihn Merleau-Ponty in den hervorstechenden Analysen der Phänomenologie der Wahrnehmung abhandelt, muss als ein „Drittes (troisième terme)“,7 als eine „dritte Seinsgattung“,8 verstanden werden, das/die sich phänomenologisch durch vier aufeinander verweisende Gesichtspunkte bezeugen lässt: 1.) das leiblich vermittelte Inder-Welt-Sein; 2.) die eigene Mobilität als „originale (urtümliche) Intentionalität“; 3.) die leibeigene Zeitlichkeit und Räumlichkeit und 4.) die sinnlich-affektive Dimension der ursprünglichen Welteröffnung. Leiblichkeit und In-der-Welt-Sein. Der Ausgangspunkt von MerleauPontys Leibeslehre liegt also, wie gesagt, in dem Versuch nachzuweisen, dass die Existenzstruktur in ihrer leiblichen Vermittlung aufgefasst werden muss. Hierfür wagt er sich zunächst an eine Neuinterpretation des als In-der-Welt-Sein verstandenen, menschlichen Daseins. Er führt diesen – Heidegger verpflichteten – Ausdruck ein,
5 Siehe hierzu das Kapitel „Phantasía et perception“, in A. Schnell, Le sens se faisant, op. cit. 6 La phénoménologie de la perception, S. 193. 7 La phénoménologie de la perception, S. 117. 8 La phénoménologie de la perception, S. 402.
114
Kapitel IV
um insbesondere die Phänomene des „Phantomglieds“ und der „Anosognosie“, ohne dabei freilich jeglichem physiologischen oder psychologischen Reduktionismus zu verfallen, verständlich werden zu lassen. Unter einem „Phantomglied“ versteht man die weiterhin aktiven Gefühlsregungen an einem amputierten Arm oder Bein, ganz so, als sei der betreffenden Person dieses Glied gar nicht abgenommen worden. Die Anosognosie dagegen bezeichnet den Zustand eines Patienten, der z. B. ein Glied weder steuern noch empfinden kann, sich selbst dieses Unvermögens jedoch nicht bewusst ist (trotz der Tatsache, dass er sich unentwegt mit diesem Glied an die ihn umgebenden Gegenstände stößt o.ä.). Merleau-Ponty macht hier nun auf folgenden bedeutsamen Sachverhalt aufmerksam: Weder die Physiologie noch die Psychologie vermögen es, diesen Phänomenen in ihrer ganzen Komplexität gerecht zu werden. Der Physiologismus vermag es nicht zu erklären, dass das Phantomglied durch einen emotionalen Schock auftreten kann (wenn dem Patienten z. B. von den traumatischen Ereignissen berichtet wird, die seine Amputation schließlich nötig gemacht haben) oder aber auch (etwa bei seiner nachträglichen Zustimmung zu dieser Operation) wieder verschwinden kann. Andererseits darf nicht übersehen werden, dass die Durchtrennung bestimmter sensitiver Leiter die Erscheinungen des Phantomglieds abrupt beenden 9 – wodurch sich die Beschränkung auf den psychologischen Gesichtspunkt als ungenügend erweist. Dagegen wird dieses durch die physiologischen und psychologischen Erklärungen gleichermaßen entstellte Phänomen in der Perspektive des Inder-Welt-Seins verständlich. Die Verstümmelung und Defizienz wird in uns nämlich durch ein in einer gewissen physischen und zwischenmenschlichen Welt vereinnahmtes Ich, das weiter – trotz jeglicher Defizienz oder Verstümmelung – nach seiner Welt strebt und diese [scil. die Defizienz und die Verstümmelung] insofern de iure nicht anerkennt, abgelehnt. Die Ablehnung der Defizienz ist aber bloß die Kehrseite unseres Innewohnens in einer Welt – die implizite Verneinung dessen, was unserer natürlichen Bewegung, die uns an unsere Aufgaben, unsere Sorgen, unsere Situation, unsere vertrauten Horizonte verweist, entgegengesetzt ist.10
9
Zu alledem, siehe La phénoménologie de la perception, S. 93. La phénoménologie de la perception, S. 96f.
10
Leib und Leiblichkeit
115
Der kranke Leib ist also für dieses Unvermögen, das seinem Lebensentwurf in seiner eigenen Welt entgegensteht, blind. Diese Blindheit ist nun aber gewissermaßen nur die privative Modifikation einer ihm ureigenen Sicht, die Merleau-Ponty als eine „vorobjektive Sicht [vue préobjective]“ bezeichnet und explizit als ein Synonym für das In-der-Welt-Sein bestimmt:11 Damit wird nicht etwa angezeigt, dass seine Leibeslehre einseitig dem am Sehen orientierten Intellektualismus verpflichtet bliebe, sondern ganz im Gegenteil eine vorbewusste Seinsregion angesprochen, die gerade jeder (idealistisch durch Erkenntnisakte ermöglichten) Objektivierung vorausliegt. Diese Seinsregion hat also in der Tat ihre eigene „Sicht“ (Heidegger spricht diesbezüglich in Sein und Zeit von einer „Vorsicht“12 [worauf sich der Ausdruck der „vorobjektiven Sicht“ bei Merleau-Ponty selbstverständlich bezieht]), ihre eigene „Intentionalität“ – und die folgende Aufgabe wird es nun sein, deren leibliche Dimension näher auseinanderzulegen. Die Mobilität des Leibes als urtümliche Intentionalität. Merleau-Ponty betont, dass man sich von der Vorstellung lösen müsse, die leibliche Beweglichkeit sei lediglich die Dienerin des Bewusstseins. Weit davon entfernt, dass die Intentionalität des Bewusstseins unseren leiblichen Bewegungen vorausginge, ist vielmehr erstere in der leiblichen „Beweglichkeit als originaler Intentionalität“ 13 fundiert. Das ist explizit ersichtlich, wenn man all diejenigen Tätigkeiten in Betracht zieht, die ein leibliches Erlernen erfordern (schwimmen, Rad fahren, Auto fahren, Klavier spielen usw.), wo also die zu erlernende leibliche Bewegung ein leibliches Verständnis zur Voraussetzung hat (und wo der Leib sie sich somit „in seine Welt“ „einverleibt“ hat) – das Gleiche gilt selbstverständlich und umso mehr auch für grundlegendere Verhaltensweisen zur Welt (wahrnehmen, laufen, seine Gliedmaßen koordinieren usw.), die allerdings nur beim Anderen (insbesondere beim Kleinkind) erfahrbar sind –, denn der erwachsene Mensch hat diesen Lernprozess bereits dermaßen verinnerlicht, dass er sich hier dieser ursprünglichen Intentionalität nicht mehr bewusst werden kann. Warum besteht nun also ein solches Fundierungsverhältnis? Weil der Geist kein getrenntes Wesen an sich ist, sondern je schon in die Leiblichkeit eingebettet ist (was aber La phénoménologie de la perception, S. 94f. M. Heidegger, Sein und Zeit, op. cit., S. 199. 13 La phénoménologie de la perception, S. 160. 11 12
116
Kapitel IV
keine materialistische Sichtweise ausdrücken soll). Und dies ist selbstverständlich kein räumliches Verhältnis, sondern zunächst ein solches, das durch ein besonderes Verständnis – d.h. durch ein ganz bestimmtes „Können“ (und Heidegger betonte ja bereits, dass das Dasein kein allgemeines „Wesen“, sondern jemeiniges Seinkönnen ist) – ausgezeichnet ist. Der Leib ist, wie auch Husserl bereits wusste, kein „Ich weiß“ oder „Ich denke“ oder „Ich erkenne“, sondern ein „Ich kann“. Merleau-Ponty behauptet in diesem Zusammenhang, dass das Bewusstsein nur „vermittels des Leibs ein Seinzum-Ding“ sein kann.14 Dies bedeutet, dass sich in unserem Verhältnis zu den Gegenständen eine „Existenzbewegung“15 ausspricht, welche die radikale Mannigfaltigkeit der Inhalte zu einer „intersensoriellen Einheit einer ‚Welt’ hinorientiert. […] In der Geste der sich nach einem Gegenstand erhebenden Hand ist ein Gegenstandsbezug mit inbegriffen, bei dem dieser kein vorgestellter Gegenstand, sondern dieses ganz bestimmte Ding ist, auf das wir uns entwerfen, bei dem wir im Voraus schon sind und dem wir innerlich beiwohnen.“16 Die Zeitlichkeit und Räumlichkeit des Leibs. In dieser Existenzbewegung kommt eine dem Leib ureigene Zeitlichkeit und Räumlichkeit zum Vorschein. Wir zitieren hierzu noch eine weitere, sehr einschlägige Passage: Sofern ich einen Leib habe und durch ihn in der Welt tätig werde, sind der Raum und die Zeit für mich nicht die Summe von auseinander liegenden Punkten und auch nicht eine Unendlichkeit von Beziehungen, deren Synthese von meinem Bewusstsein vollzogen würde und in die mein Leib verwickelt wäre; ich bin nicht im Raum und in der Zeit, und ich denke auch nicht den Raum und die Zeit; ich bin „zum“ Raum und „zur“ Zeit [im Heidegger’schen Sinne des Zu-Seins, bzw. des je gestimmten „In-Seins“], mein Leib haftet sich an sie an und umfasst sie. Die Weite dieses Bezugs entspricht exakt der meiner eigenen Existenz; keinesfalls aber kann sie eine allumfassende sein: Denn der Raum und die Zeit, denen ich innewohne, haben stets zu allen Seiten unbestimmte Horizonte, die andere Standpunkte enthalten. Die Synthese der Zeit muss, ganz wie jene des Raums, stets von neuem vollzogen werden. Die Bewegungserfahrung unseres La phénoménologie de la perception, S. 161. Auch in diesem zusammengesetzten Begriff kommt wieder die Einheit von Existenz und Leiblichkeit zum Ausdruck. 16 La phénoménologie de la perception, S. 160f. 14 15
Leib und Leiblichkeit
117
Leibs ist kein Sonderfall der Erkenntnis, sondern sie liefert uns einen bestimmten Zugang zur Welt und zu den Gegenständen […].17
Auch hier wird also noch einmal deutlich, inwiefern der Leib unserer Existenz die Welt in der Tat ursprünglich (d.h. jedem Erkenntnisakt vorausgehend) erschließt. Dieses dem Leib ureigene „Innewohnen“ der Zeit (und des Raums) macht ferner verständlich, inwiefern unser Leib den Bezug zur ursprünglichen Zeitlichkeit veranschaulicht: Die Zeit besteht nämlich originär nicht aus drei auseinanderliegenden Dimensionen, sondern die Gegenwart impliziert je auf eine gewisse Art die Vergangenheit und die Zukunft (Merleau-Ponty bezieht sich hier natürlich implizit auf Husserls Zeitanalysen). In jedem Augenblick einer Bewegung sind die vorherigen Augenblicke enthalten, sie sind darin gewissermaßen verschachtelt – und das Gleiche gilt ebenso auch für die kommenden. Ebendeshalb, betont Merleau-Ponty, haben wir im gesunden Zustand keine leibliche Erinnerung, kein leibliches inneres Gefühl, das uns die Krankheit (anders als verstandesmäßig) vergegenwärtigte, und ebendeshalb kann der Erwachsene auch nicht den Leib seiner Kindheit wiedereinnehmen. Das ist kein „Gedächtnisloch“ in einer objektiven Zeitreihe, sondern eben der Ausdruck für die dem Leib ureigene Zeitlichkeit. 18 Wie ist es nun um die spezifische Räumlichkeit des Leibs bestellt? Merleau-Pontys Hauptidee ist, dass mein Leib für mich bei weitem nicht lediglich einen Teil des Raums einnimmt, sondern es vielmehr umgekehrt für mich gar keinen Raum geben könnte, wenn ich keinen Leib hätte.19 Jegliche räumliche Bestimmung – und insbesondere jegliche Bestimmung des „objektiven Raums“ – erhält ihren spezifisch räumlichen Sinn durch die ureigene „Räumlichkeit“ des Leibs (auch diese Idee kommt der Heidegger’schen Analyse der Räumlichkeit des Daseins sehr nahe). Diese ist nicht bloß eine „Form a priori der Sinnlichkeit“ (Kant), eben weil die Leiblichkeit hier von tragender Bedeutung ist. Merleau-Ponty drückt das in folgenden Worten aus:
La phénoménologie de la perception, S. 164. La phénoménologie de la perception, S. 163f. 19 La phénoménologie de la perception, S. 119. 17 18
118
Kapitel IV
Der leibliche Raum kann sich deshalb vom äußeren Raum unterscheiden […], weil er die Dunkelheit des Saals, die für die Theateraufführung notwendig ist, der Schlafhintergrund oder die vage Machtreserve ist, von denen sich die Geste und ihr Ziel abheben, das Gebiet des Nicht-Seins, vor welchem bestimmte Wesen, Gestalten und Punkte erscheinen können.20
Der Leib ist daher das stets implizit mitgemeinte „Dritte“ jener Struktur, welche die Beziehung zwischen einer Gestalt und ihrem Hintergrund kennzeichnet, „und jede Gestalt hebt sich von dem zweifachen Horizont des äußeren Raums und des leiblichen Raums ab“.21 Der Leib ist deshalb auch, wie kaum betont zu werden braucht, kein Gegenstand unter den anderen Gegenständen. Denn jeder Gegenstand kann ja aus dem Blickfeld verschwinden, während der Leib je „da“ ist – er ist je mit da und erweist sich somit als „der primordiale Habitus, der alle anderen bedingt und durch den diese verständlich werden“.22 Dabei ist dieses vermeinte „NichtSein“ freilich orientiert: Erst eine solche absolut ursprüngliche Orientierung ermöglicht es, die Dimensionen des „objektiven Raums“ zu bestimmen.23 Und dieser Raum der Leiblichkeit (auf den sich der cartesianische Raum gründet und von dem dieser lediglich eine Abstraktion ist) setzt somit die Grundkoordinaten24 fest, und er bestimmt die Situation des Leibs angesichts der von ihm zu erledigenden Aufgaben. Auch hier wird wiederum deutlich, inwieweit der Existenzentwurf diesen Überlegungen die Grundrichtung vorschreibt: Sowie das Dasein durch die Sorgestruktur gekennzeichnet ist, wird La phénoménologie de la perception, S. 117. Ebd. 22 La phénoménologie de la perception, S. 107. 23 Merleau-Ponty bestimmt das Verhältnis von leiblichem und objektivem Raum in folgenden Worten: „Der leibliche Raum kann nur dann wirklich zu einem Fragment des objektiven Raums werden, wenn er in seiner Einzelheit als leiblicher Raum das dialektische Ferment, das ihn in einen universellen Raum verwandelt, enthält“, La phénoménologie de la perception, S. 118. 24 Husserl bezeichnet den Leib als einen „absoluten Nullpunkt“, wobei jeder Leib einen solchen absoluten Nullpunkt ausmacht – was, wie Richir betont, zur (paradox anmutenden) Folge hat, dass die transzendentale Subjektivität (in Richirs Worten: die „transzendentale Interfaktizität“ [siehe Phantasía, imagination, affectivité, op. cit., S. 102ff. und S. 225ff.] – als eine Relativität von einer Vielzahl an Absoluta gedacht werden muss (siehe Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, Grenoble, Millon, 2006, S. 306). 20 21
Leib und Leiblichkeit
119
auch der Leib durch seine Aufgaben „polarisiert“ – sofern er nämlich als die bestimmte Haltung für aktuelle oder potentielle Aufgaben erscheint, existiert er umwillen ihrer und ist eben darum nicht weniger In-der-Welt-Sein als dieses selber – mit anderen Worten, erst in der Handlung vollzieht sich die Räumlichkeit des Leibs und wird diese in ihrer spezifischen Dimension verständlich.25 Wir kommen nun zum letzten Aspekt in dieser Charakterisierung des Leibbegriffs bei Merleau-Ponty. Hierbei werden wir uns auf die Leibeserfahrungen, die Merleau-Ponty bereits in der „klassischen Psychologie“ auffinden konnte, stützen.26 Ziel ist es hierbei, noch einmal klar zu verdeutlichen, inwiefern der Leib – in seiner sinnlichaffektiven Dimension – die Öffnung der Welt (und zur Welt hin) ermöglicht. Wie schon gesagt, ist der Leib kein Gegenstand unter den anderen Gegenständen. Er zeichnet sich dadurch aus, nicht gegenständlich wahrgenommen werden zu können – und das gilt z. B. sowohl für die sichtbaren Gliedmaßen als auch für sein Spiegelbild. Mein Leib ist nämlich diesseits aller visuellen, taktilen usw. Wahrnehmung. Merleau-Ponty erklärt das so: „Sofern mein Leib die Welt sieht oder berührt, kann er […] weder gesehen noch berührt werden.“27 Was ihn daran hindert, ein bloßer Gegenstand zu sein, ist die Tatsache, 25 Merleau-Ponty beschreibt die Originalität der Leibesbewegungen an anderer Stelle so: Die Bewegungen, die ich mit meinem Leib beschreibe, „greifen direkt der Endsituation vor, und meine Intention zeichnet einen räumlichen Weg nur darum vor, um das zuerst an seinem Ort gegebene Ziel zu erreichen, es gibt also so etwas wie einen ‚Keim‘ der Bewegung, der sich erst in zweiter Linie als ein objektiver Weg entwickelt. Die äußeren Gegenstände bewege ich mithilfe meines eigenen Leibs, der sie an einem Ort aufnimmt, um sie woanders hinzubringen. Ihn aber bewege ich direkt, ich finde ihn nicht an einem Punkt des objektiven Raums vor, um ihn woanders hinzuführen, ich brauche ihn auch nicht zu suchen, denn er ist schon immer bei mir – und ich brauche ihn also nicht zum Endpunkt der Bewegung hinzubringen, denn er berührt ihn schon von Anfang an, und er ist es, der sich dort hin (ent)wirft. Das Verhältnis zwischen meiner Entscheidung und meinem Leib in der Bewegung ist ein magisches Verhältnis“, La phénoménologie de la perception, S. 110. Diese „Magie“ besteht eben genau darin, dass in der leiblichen Bewegung Intention und Handlung nicht getrennt voneinander aufgefasst werden dürfen, sondern zusammenfallen. 26 La phénoménologie de la perception, S. 106–110. 27 Wie wir weiter unten sehen werden, macht Richir hierauf noch einmal in seiner Analyse des „Sehens“ aufmerksam.
120
Kapitel IV
dass die Gegenstände überhaupt erst durch ihn „sind“, bzw. erscheinen können. Gesehen oder berührt werden kann er deshalb nicht, weil er selbst gerade der Sehende oder Berührende ist. Der Leib ist also kein beliebiger äußerer Gegenstand, der bloß die Besonderheit böte, immer schon da zu sein. […] Die An- und Abwesenheit der äußeren Gegenstände sind nur Variierungen innerhalb eines primordialen Felds der Anwesenheit, eines Wahrnehmungsgebiets, über das mein Leib Macht hat.28
Die Beharrlichkeit wie auch der perspektivische Charakter der Gegenstände außer mir lässt sich bloß durch die meines eigenen Leibs erklären. Und bereits hier betont Merleau-Ponty einen Aspekt, der für seine Auffassung der Intersubjektivität bestimmend sein wird: Wenn die Gegenstände mir notwendigerweise je nur eine ihrer Seiten zeigen, dann deshalb, weil ich selbst an einem bestimmten Ort bin, von dem aus ich sie sehe und den ich selber nicht sehen kann.29
Die abschattungsmäßige Gegebenheit der Gegenstände der äußeren Wahrnehmung (und im Endeffekt auch, wenngleich auf eine etwas andere Weise, des Anderen) ist somit in meiner Leiblichkeit gegründet. Und das Gleiche gilt ebenso für die Konstanz der äußeren Welt, die ihrerseits in der Beharrlichkeit meines Leibs gründet: Der Leib ermöglicht also erst jeglichen Weltbezug und zwar dergestalt, dass die Welt nicht mehr als das Aggregat oder die Summe aller Gegenstände erscheint, sondern als der „latente Horizont unserer Erfahrung, der seinerseits vor jeglichem bestimmenden Denken ständig gegenwärtig ist“.30 In diesem Zusammenhang müssen nun auch die bekannten, von Husserl in den Ideen II erwähnten Doppelempfindungen (etwa der Hände) erwähnt werden. Mit meiner rechten Hand kann ich meine linke Hand berühren. Dann erscheint die linke Hand als ein Wahrnehmungsobjekt, während die rechte Hand die Rolle des Wahrnehmungssubjekts einnimmt. Im Gegensatz zur Berührung eines Gegenstands, der meinem Leib nicht angehört, findet nun aber (fast) gleichzeitig eine merkwürdige Gegenwahrnehmung statt – die linke La phénoménologie de la perception, S. 108. Ebd. 30 La phénoménologie de la perception, S. 109. 28 29
Leib und Leiblichkeit
121
Hand wird ihrerseits zu einer wahrnehmenden, wodurch nun die rechte Hand zum Wahrnehmungsobjekt wird. Zwar können beide Wahrnehmungen nicht im strengen Sinne des Wortes zugleich stattfinden, das Entscheidende ist dabei aber, dass hier eine Dimension des Leibs hervortritt, welche die ursprüngliche Welteröffnung möglich macht – die sich im vorliegenden Falle durch die ursprüngliche Spaltung des Leibes in einen sowohl wahrnehmenden als auch wahrgenommenen Leib ankündigt. Auch wenn also eine Hand nicht gleichzeitig eine tastende und eine betastete sein kann, so ist sie doch potentiell entweder das eine oder das andere – und gerade diese Eigenschaft macht eben dieses Leibesorgan (wie jedes andere natürlich auch) zu einem welteröffnenden. Schließlich muss auch Heideggers Begriff der „Befindlichkeit“ als ein leiblich vermittelter verstanden werden. Die „Befindlichkeit“ bezeichnet bekanntermaßen die ursprünglich affektive Welteröffnung – diese mag als eine nur mehr oder weniger leicht „gestimmte“ erscheinen oder aber durch affektive Extremsituationen (wie z. B. durch starken körperlichen Schmerz) gekennzeichnet sein (es ist völlig klar, dass sich die Ausführungen Merleau-Pontys hier an diesem Begriff orientiert haben). Und der Unterschied zwischen dem Leib und den „äußeren“ Gegenständen besteht eben gerade darin, dass jener ein „affektives Objekt“ ist, während diese lediglich (durch objektivierende Akte) vorgestellt werden. Entscheidend für MerleauPonty ist es, hier zu sehen, dass „mein Leib sich nicht auf die Art der Gegenstände des äußeren Sinns darbietet und diese sich vielleicht erst auf diesem affektiven Grund, der das Bewusstsein ursprünglich außerhalb seiner wirft, abheben“.31 Diese Ausführungen in der Phänomenologie der Wahrnehmung sind insofern sehr interessant und von bleibender Bedeutung, als sie – über den Reichtum der Einzelanalysen hinaus (die oft Husserls und Heideggers Ansätze übertreffen) – einen Bezug zur transzendentalen Subjektivität aufrechterhalten, welche die Abwege des szientistischen Empirismus und (im besten Falle) des „transzendentalen Realismus“ vermeiden. Der Leib ist je mein Leib – seine „Vermöglichkeiten“, „Potentialitäten“, „Leistungen“ können nur (im starken Sinne des Wortes) verstanden werden, wenn das Potential dessen, was Merleau-Ponty (wie oben erwähnt) die vorobjektive Sicht nennt, voll 31
La phénoménologie de la perception, S. 110.
122
Kapitel IV
ausgeschöpft wird. Dies wird aber gerade von Merleau-Ponty in seinem ersten Hauptwerk nicht geleistet. Und auch in seinen „späten“ Schriften ist das nicht der Fall – und dies umso weniger, als er sich von einem transzendentalphilosophischen Ansatz abwendet, um den Weg einer „Ontologie des Sichtbaren und des Unsichtbaren“ (zumindest in ihren Ansätzen) zu begründen. Gerade hier setzt nun Richirs Neufundierung der Phänomenologie an. * Der Begriff des Leibes nimmt bei Richir32 eine Doppelfunktion ein. Er spielt – wie bei Husserl – eine tragende Rolle bei der Frage, wie das Fremdbewusstsein zu explizieren ist. Wir werden sehen, dass er hierfür den Einfühlungsbegriff umdeutet. Und darüber hinaus bietet er ihm die Möglichkeit, die These Merleau-Pontys, wonach Heideggers Existenzbegriff durch den Gegenpol des Leibes vervollständigt werden muss, zu begründen. Hierfür liefert die Phantasie den vom architektonischen Gesichtspunkt aus entscheidenden Rahmen. Richir beschreitet somit einen Weg, der nicht nur über Merleau-Ponty hinausgeht, sondern eine neue Richtung vorzeichnet, die Husserls Andeutungen einer Phänomenologie der Phantasie in ihrer ganzen Reichweite fruchtbar macht. Richir setzt bei einer architektonisch höchst wichtigen Unterscheidung an,33 die zuerst von Husserl im Text Nr. 16 von Husserliana XXIII gemacht wurde.34 Man stelle sich eine Trauersituation vor. Drei Fälle sind hierbei möglich: Entweder ich stelle mir mich als einen Trauernden vor (mein trauerndes Ich geht also ganz in die Trauersituation ein), oder ich stelle mir in der betreffenden Situation eine trauernde Person vor (hier bin also nicht ich der als trauernd Vorgestellte), oder aber ich stelle mir meine Trauer nicht bloß phantasiemäßig vor, sondern ich „empfinde“ wirklich Trauer – aber auf-
32 Alle späteren Arbeiten Richirs wenden sich der Leibproblematik zu. Die wichtigsten Ausführungen hierzu findet man in Phénoménologie en esquisses (2000) und vor allem in Phantasía, imagination, affectivité. Phénoménologie et anthropologie phénoménologique (2004) und Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace (2006). 33 Siehe hierzu die Einleitung von Phantasía, imagination, affectivité, op. cit. 34 Husserliana XXIII, S. 466.
Leib und Leiblichkeit
123
grund der Vorstellung (d.h. ich trauere nicht „wirklich“). Dieses Beispiel lässt drei Grundaspekte hervortreten, die Richirs Phänomenologie der Leiblichkeit entscheidend bestimmen: Wir haben es hier mit einer Trauersituation zu tun, d.h. mit einer Situation, die affektiv geprägt ist; ferner handelt es sich dabei explizit um eine phantasiemäßig vorgestellte Situation, d.h. die Rolle der Phantasie ist hier zentral; und schließlich wird deutlich, dass das Ich nicht bloß mein aktuelles konkret vorstellendes Ich ist, sondern in die Phantasie selbst auf eine je spezifische Weise eingeht. Affektivität, Phantasie, ichrelevante (trotz aller Kritik an der Subjektivität) Beziehung bzw. (in Richirs Worten) Schematisierung – dies sind in der Tat die Grundbegriffe in Richirs Phänomenologie des Leibs und der Leiblichkeit. Von hier aus lässt sich anhand des oben Entwickelten festmachen, auf welche Fragen sie eigene, originelle Antworten liefert. Für die für Richir noch offenen Problemfelder können dabei folgende Titelanzeigen gewählt werden: 1.) Die Funktion der Leiblichkeit in der „archaischen“ Sphäre der transzendentalen Subjektivität; 2.) Grundbestimmungen der Leiblichkeit (Trieb und chora); 3.) Leiblichkeit und Affektivität (Leibhaftigkeit) und 4.) die „Individuation“ der Leiblichkeit (Phantasieleib und Phantomleib). Die Leiblichkeit in der „archaischen“ Sphäre der transzendentalen Subjektivität. Wie lässt sich die – oben schon in einer ersten Annäherung behandelte – leibliche Vermittlung der Grundstruktur der Existenz noch sachgemäßer bestimmen? In diesem Zusammenhang sind für Richir in Wirklichkeit zwei philosophische Ansätze der „zweiten“ Phänomenologen-Generation – und zwar über den von Merleau-Ponty hinaus auch der von Levinas – entscheidend: einerseits in Bezug auf eine (von beiden auf ihre eigene Art gelieferte) Husserl-Kritik, andererseits aber auch aufgrund von gewissen Unzulänglichkeiten, die es für Richir bei beiden Kritikansätzen dennoch zu korrigieren gilt. Sowohl MerleauPonty als auch Levinas verstehen ihre Auffassung des Bezugs zum Anderen nämlich in erster Linie als eine Kritik an Husserls fünfter der Cartesianischen Meditationen. Ihre jeweiligen Standpunkte können als zwei Extrempole aufgefasst werden, die – wie gesagt – ihrerseits wiederum einer Kritik unterworfen werden müssen. Fassen wir kurz, bevor wir uns Richirs eigenen Ausarbeitungen zuwenden, diese beiden Extremstandpunkte (wie auch Husserls Antwort darauf) zusammen.
124
Kapitel IV
Merleau-Ponty und auch Levinas werfen der Intentionalanalyse der fünften der Cartesianischen Meditation vor, aus einer egologischen, wenn nicht gar solipsistischen Sphäre nicht heraus zu gelangen und so den Anderen in seiner Andersheit nicht wirklich fassen zu können. Für Levinas liegt dieses Scheitern letztlich darin begründet, dass die objektivierende, wahrnehmungsmäßige Intentionalität nicht dafür geeignet ist, dem Bezug zum Anderen wahrheitsgetreu Rechnung zu tragen. Seine These ist, dass der Bezug zum Anderen kein Erkenntnisbezug ist und auch kein solcher sein kann. Erkennen heißt stets „identifizieren“, „gleichsetzen“, „gleichmachen“. Jeder Erkenntnisakt ist ein Akt der Identifikation – und zwar sowohl im Sinne des Sich-Ausdehnens als auch des Sich-Einverleibens.35 Nun entzieht sich der Andere als Anderer eben jeder Identifikation bzw. Gleichsetzung – wenn anders er seine Andersheit eben soll bewahren können. Mit anderen Worten, der Andere ist einer Erkenntnis ursprünglich nicht zugänglich, und dies ist eben der Grund für den bekannten Vorrang der Ethik im Levinas’schen Denken, sofern dieses dem ursprünglichen Bezug zum Anderen vor jeder Ontologie oder Erkenntnisphilosophie gerecht werden will. Merleau-Ponty entsagt seinerseits dem erkenntnismäßigen Bezug zum Anderen nicht. Bei ihm liegt, wie gesagt, das andere Extrem vor. Auch er versucht dem vermeintlichen Husserl’schen Solipsismus zu entgehen. Dafür ist es seines Erachtens aber notwendig, in der Struktur des transzendentalen Bewusstseins selbst die Möglichkeitsbedingungen der Begegnung des Anderen ausmachen zu können. Dies geschieht in der Phänomenologie der Wahrnehmung so, dass Merleau-Pontys Hauptkritik sich gegen die cartesianische Auffassung eines sich selbst gegenüber durchsichtigen, jeder Erkenntnis zugrundeliegenden Subjekts richtet. Ihm zufolge entspricht nämlich eine solche „Transparenz“ dem phänomenologischen Tatbestand nicht. Das Subjekt ist vielmehr gewissermaßen – allein schon durch seine grundlegend zeitliche Struktur – je schon sich selbst gegenüber entrückt und insofern nicht völlig mit sich selbst gleich. Es ist sich selbst immer auch schon ein Anderes. Im Bezug des Subjekts 35 Dies ist übrigens auch Levinas’ Auffassung zufolge ein Grund dafür, dass Heidegger in Sein und Zeit der Frage nach dem Anderen nicht nachgegangen ist und auch nicht nachgehen konnte – denn die Fundamentalontologie zeugt in ausgezeichneter Weise von diesem Vorrang der Identifikation innerhalb der Daseinssphäre.
Leib und Leiblichkeit
125
zu sich selbst tut sich somit eine „Spalte“ auf, in die sich jegliche Andersheit, und insbesondere die des anderen Subjekts, einnisten kann. Das Subjekt ist ursprünglich in Bezug zum Anderen, weil es strukturell nicht mit sich selbst gleich ist. Das Subjekt ist also sich selbst ein Anderes – und deshalb ist der Andere auch immer schon in ursprünglichem Bezug zum Subjekt. Merleau-Ponty meint somit, auf die solipsistischen Ausführungen Husserls die passende Antwort gefunden zu haben. Diese beiden Kritikansätze wurden in Wirklichkeit – wie Richir vertiefend auseinandersetzt – bereits von Husserl selbst widerlegt. Der einschlägige Text für das Verständnis der Konstitution der Fremderfahrung bei Husserl ist der § 54 der fünften der Cartesianischen Meditationen. Die Fremderfahrung kommt nämlich keiner präsentierenden Wahrnehmung (Perzeption), sondern einer Appräsentation (A-perzeption) gleich, die eine spezifische Art der Einfühlung ins Spiel bringt. Was ist darunter zu verstehen? Damit sich die Erfahrung des Anderen konstituieren kann, sind zwei Leiber notwendig: der Eigenleib und eben der Leib des Anderen. Dieser erscheint nun erst einmal bloß als ein Körper, es ist zunächst nicht auszumachen, ob dieser wirklich „beseelt“ ist. Die Bedingung der eigentlichen Fremderfahrung ist nun, dass beide Leiber – der des Ego und der fremde Leibkörper – sich zu einer Einheit verschmelzen, sich „paaren“ – das ist genau der Sinn der A-perzeption,36 bzw. der Appräsentation37 des fremden Leibs, welche sich freilich je in synthetischer Deckung mit der präsentativen Schicht vollzieht. Mit dem Dasein des Anderen treten wir aus der perzeptiven Welt der rein egologisch-subjektiven Dimension heraus und gewissermaßen in die a-perzeptive Welt der Intersubjektivität hinein. Hierzu sind Husserl zufolge drei Dinge notwendig: zunächst der Eigenleib als fungierender; ferner die reproduktive, „eingefühlte“ Erscheinung des Eigenleibs im Stellungswechsel „als wenn ich dort wäre“ und schließlich die den Erfahrungsstrom durchziehende „Einstimmigkeit“ des leiblichen Waltens, Gebarens und Gehabens des Anderen. 36 Es gilt also, die A-perzeption nicht lediglich als eine perzeptive Abwandlung (Modifikation), sondern als Eröffnung einer spezifischen – eben die Fremderfahrung ausmachenden – Auffassungsweise zu verstehen. 37 Die Appräsentation bezeichnet den zweifachen – äußerst bedeutenden – Sachverhalt, dass sie weder Präsentation fordert noch zulässt (Cartesianische Meditationen, Husserliana 1, § 54, S. 148).
126
Kapitel IV
Richirs Anliegen ist es nun, diese Analyse dahingehend zu vertiefen, dass der Sinn der hierin liegenden „Einfühlung“ deutlicher expliziert werden muss – u.a. damit jener jeglicher konstruktive38 Charakter genommen wird. Dadurch wird er auch den (wie er ihn nennt) „existenzialen Solipsismus“ Heideggers abwehren können. Letzterer fokussiert sich in erster Linie auf den vermeintlich „ekstatischen“ Charakter des Daseins. Die Ekstase ist für ihn eine bloß scheinbare: Ein „Draußen“, ein „Dort“ ist nur von einem „Hier“ aus möglich. Heideggers Fundamentalontologie vermag es nicht, aus dieser „existenzialen Blase“ hinauszugelangen. Dies wird nun aber durch eine Neuinterpretation von Husserls „Einfühlung“ möglich – und zwar durch den von Richir hervorgehobenen Begriff der „‚perzeptiven‘ Phantasie.“39 Die Einfühlung wird nämlich seiner Auffassung nach nur durch letztere ermöglicht. Bei der Einfühlung handelt es sich in keinem Falle um einen erkenntnismäßigen, sondern, sofern in der „‚perzeptiven‘ Phantasie“ die „Phantasien-Affektionen“ mitspielen, um einen affektgeladenen Bezug (Richir nähert sich hier also der Levinas’schen Position an). Dabei erweckt der Blick des Anderen meinen eigenen Blick:
38 In Bezug auf diesen konstruktiven Charakter der phänomenologischen Analyse der Fremderfahrung ist vielleicht das letzte Wort noch nicht gesprochen. Zwei Argumente scheinen hierfür bedeutend zu sein. Was den phänomenologischen Gehalt dieser Analyse angeht, so ist klar, dass die rein deskriptive Analyse hier an ihre Grenzen stößt: Eigenerfahrung und Fremderfahrung schließen sich letztlich gegenseitig aus. Damit der Sinn der erwähnten „Reproduktion“, bzw. „Appräsentation“ erfasst werden kann, muss man sehen, dass der „Kern“ der Appräsentation eines mitdaseienden Ego (Cartesianische Meditationen, Husserliana I, § 54, ebd.) phänomenologisch konstruiert wird (wobei diese phänomenologische Konstruktion keine spekulative, metaphysische Konstruktion ist). Darüber hinaus geht es Husserl um die spezifische Legitimation, um die Erkenntnisrechtfertigung dieser Analyse der Fremderfahrung. Diese kann unserer Auffassung nach nur durch eine konstruktive Phänomenologie geliefert werden (zu diesen beiden Punkten, siehe v. Vf. Husserl et les fondements de la phénoménologie constructive, Grenoble, Millon, 2007). 39 Eine treffende Erklärung dieses Ausdrucks, der die Perzeption eines Darstellbaren und zugleich eines prinzipiell Nicht-Darstellbaren bezeichnet, findet man in den Fragments phénoménologiques sur le langage, op. cit., S. 15ff. (siehe unten).
Leib und Leiblichkeit
127
Durch die Darstellbarkeit des Antlitzes und der Leibkörperlichkeit des Anderen kann ich – freilich mithilfe eines räumlich und zeitlich nichtigen Abstandes – den pochenden und lebendigen „Kern“ des Anderen „fühlen“, und von da aus, in der Transmutation dieses Abstands in einen solchen, der ein (sprachlich) zeitigender und verräumlichender Abstand ist (zwei absolute Hier), auch mich selbst als den Anderen dieses Anderen fühlen. Noch eigentlicher: Was ich im „Kern“ des lebendigen Blicks des Anderen „wahrnehme“, sind, durch die Vermittlung der Affektionen, die ich dort als sich in ihren unaufhörlichen Umschwüngen modulierende fühle, genauso auch die Phantasien des Anderen und unter ihnen die nicht darstellbaren „perzeptiven“ Phantasien, die sich dort tanzend abspielen […].40
Die Einfühlung findet nämlich je in der (der chora gleichzusetzenden) Leiblichkeit, die hier als eine Phantasieleiblichkeit aufzufassen ist, statt.41 Kommen wir nun also, nach einer ersten Verortung des Richir’schen Standpunkts innerhalb der phänomenologischen Tradition, zur eigentlichen Problematik. Richirs Neufundierung der Phänomenologie hat den Anspruch – auch wenn ihr Urheber nur zögerlich dazu bereit ist, hierin eine ontologische Neubestimmung ihrer „ersten Koordinaten“ zu sehen –, die Grundstrukturen der transzendentalen Subjektivität in ihrem ursprünglichsten (nämlich dem „archaischen“) „Register“ aufzudecken. Dies bedeutet, dass die Intentionalitätsstruktur – aber genauso auch die Begriffe „Subjekt“, „Noesis“, „Noema“ usw. – in einer tieferen (d. h. also vor-intentionalen), ihren Sinn ursprünglicher bestimmenden Sphäre aufzusuchen sind. Das Bemerkenswerte dabei ist, dass diese Grundsphäre in einem zweifachen Sinne mit dem Leibbegriff zusammenhängt. Wir werden nun zunächst diese beiden Zusammenhänge näher erläutern. Jede Sinnbildung kann in Richirs Worten als ein Sich-Artikulieren („se-dire“) „schematischer Wesen“ (und zwar in ihrer affektiven Dimension) aufgefasst werden, die sich (indirekt) ausschließlich in „Phantasien-Affektionen“ ausweisen lassen. Was ist hierunter zu verstehen? Die entscheidenden, in diesem Zusammenhang von Richir eingeführten Begriffe sind: „Wesen“, „Schematismen“, „Affektivität“ einerseits und, wie bereits erwähnt, „Phantasien-Affektionen“ an-
40 41
Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 19. Dieser Punkt wird weiter unten detaillierter behandelt werden.
128
Kapitel IV
dererseits. Richir geht hier nicht von einer konstituierenden „transzendentalen Subjektivität“ aus, sondern von der konkreten Sinnbildung, die zwar nicht in einem „Subjekt“ fundiert ist, andererseits aber auch nicht einer „asubjektiven Phänomenologie“ (im Sinne Patočkas) zugeordnet werden kann. Diese Sinnbildung vollzieht sich als ein „sich machender Sinn“, das heißt – wie bereits auseinandergelegt – im Sich-Artikulieren von „wilden Wesen“. Das Wort „Wesen“ bezeichnet dabei keine überzeitliche, ideale Wesenheit, sondern ist die Substantivierung von Heideggers Zeitwort „wesen“. Diese „wilden Wesen“ (in Richirs Sprachgebrauch, der sie im Gegensatz zu Heidegger auch im Plural verwendet) können nur in so genannten „Schematismen“ eigens erfasst („schematisiert“) werden – ein Erfassen, das ein Subjekt wenn nicht voraussetzt, so zumindest möglich macht (und deswegen handelt es sich hier nicht um eine „asubjektive Phänomenologie“!42). Von diesem so schematisierten Wesen (bzw. vom schematischen Wesen) kann die Affektivität nicht getrennt werden. Ein fast identischer Begriff für die Affektivität ist Richirs Begriff der „Leibhaftigkeit“, der jede Form der leiblichen (selbst „leibhaftigen“) Affektivität ausdrückt.43 (Hier tritt also zum ersten Mal eine leibhafte Dimension bei Richir auf.) Richirs Auffassung in seinen letzten Schriften ist nun, dass der Komplex schematische Wesen/Affektivität in den „Phantasien-Affektionen“ „west“ oder letzteren „innewohnt“ – die „PhantasienAffektionen“ sind somit „Schatten von nichts“ bzw. sie konstituieren das concretum der Phänomene als „nichts als Phänomene [rien que phénomènes]“ – ohne sie käme es sonst nämlich in der Tat in keiner Weise zu irgendeiner Form der Bewusstwerdung dieses Komplexes. Dieser „sich machende Sinn“, dieses Sich-Artikulieren der schematischen (und „leibhaftigen“) Wesen vollzieht sich nicht in einer abgründigen Leere, sondern in einer absoluten Urform jeglicher Räumlichkeit (von welcher der „Raum“ nur abstraktiv abzuziehen ist), die Richir mit der platonischen chora gleichsetzt (siehe hierzu
42 Und auch genau aus diesem Grunde sagten wir oben, dass Richir das transzendentalphilosophische Potential der Analysen Merleau-Pontys in der Phänomenologie der Wahrnehmung überzeugender als dieser selbst ausschöpft. 43 Der Begriff der „Leibhaftigkeit“ wird weiter unten genauer erläutert.
Leib und Leiblichkeit
129
den Timaios).44 Entscheidend ist nun, dass die chora (auf die wir weiter unten zurückkommen werden) fast völlig getreu durch den Begriff der „Leiblichkeit“45 übersetzt werden kann (diesen Begriff – wie auch den Begriff der „Leibhaftigkeit“ – gebraucht Richir in seinen Schriften auf Deutsch) – womit also auch der zweite Hinweis auf den Leibbegriff gegeben wäre. Erläutern wir nun die Begriffe des „Leibes“ und der „Leiblichkeit“ näher. Bestimmung der Leiblichkeit. Richirs Analysen der Leiblichkeit tragen zur Lösung eines Grundproblems bei, das sich in der transzendentalen Ästhetik in der Kritik der reinen Vernunft ergab. Kants Grundeinsicht, der Raum und die Zeit seien als „Formen der Sinnlichkeit“ Grundformen des transzendentalen Subjekts, wurden von allen Transzendentalphilosophen – wenn auch zumeist in einer veränderten Terminologie – übernommen. Das Problem, das jedoch nicht gelöst wurde, war folgendes: Wenn der Raum und die Zeit, als Bedingungen jeglichen Bezugs zur Welt, keine objektiven Bestimmungen der Welt sind, sondern vom Subjekt gewissermaßen an die Welt herangetragen werden, welche Raum- und Zeitbestimmungen müssen dann dem Affizierenden selbst zukommen, damit es den sinnlichen Formen des Subjekts „entsprechen“ und dieses eben affizieren kann? Für Richir liegt das vermittelnde Moment nicht im Raum und/oder in der Zeit, sondern eben in der Leiblichkeit.46 Genauer gesagt, besteht seine Antwort auf die obige Frage in
Siehe Kapitel VI. Richir setzt in den Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace die chora mit „der Leiblichkeit des primordialen Leibs“ gleich (a.a.O., S. 270). Wie aber weiter unten gezeigt wird, ist das nur die eine der beiden Bedeutungen, die Richir diesem Begriff verleiht. 46 Hier tritt der Standpunkt (einer „neuen Philosophie“) zu Tage, der – Bergson zufolge – schon zumindest implizit von Kant vertreten wurde, ohne dort allerdings in allen seinen Konsequenzen entwickelt worden zu sein: „Indem Kant in der Intelligenz vor allem ein Vermögen sah, Verhältnisse herzustellen, schrieb er den Gliedern, zwischen denen sich diese Verhältnisse herstellen, einen außer-verstandesmäßigen Ursprung zu. Er behauptete somit – gegen seine unmittelbaren Vorgänger –, dass die Erkenntnis nicht gänzlich in verstandesmäßige Begriffe aufzulösen sei. […] Dadurch bereitete er einer neuen Philosophie den Weg, die sich durch eine höhere Anstrengung der Anschauung in der außer-verstandesmäßigen Materie der Erkenntnis ansiedelte. Könnte nicht das Bewusstsein, sofern es 44 45
130
Kapitel IV
einer Neuinterpretation des Subjekt-Objekt-Bezugs, die zwei Grundbedeutungen der Leiblichkeit dergestalt in Beziehung setzt, dass diese Vermittlung zufriedenstellend erläutert und gelöst wird. Was versteht Richir also unter dem Begriff der „Leiblichkeit“? In der Tat müssen hier zwei Grundbedeutungen unterschieden werden: auf der „(vor-)subjektiven“ Seite die Leiblichkeit als Assoziationsgrund „sinnlicher Tendenzen“, und auf der „(vor-)objektiven“ Seite (genauer, wie bereits soeben angedeutet: diesseits der Unterscheidung zwischen einer subjektiven und einer objektiven Seite) die Leiblichkeit als chora. Wie oben erwähnt, ist – „architektonisch“ betrachtet – für Richir nicht die Wahrnehmung die Grundform jedes intentionalen Bezugs, sondern die Phantasie. Diese hat nun zwei Quellen – wobei eben die Leiblichkeit bei einer von diesen eine entscheidende Rolle spielt. Die erste Quelle ist die „aisthesis“. Sie entspricht in etwa dem Fichte’schen „Anstoß“ und liefert das, was im Nachhinein als „Empfindung“ (im kantischen Sinne) ausgemacht werden kann. Sie ist die Quelle „äußerer“ Empfindungsdaten – auch wenn eine „Empfindung“ in Wirklichkeit den Schmelzpunkt zwischen etwas Äußerem und etwas innerlich Empfundenem bezeichnet. Die zweite Quelle ist der Trieb (im Husserl’schen Sinne einer „Triebintentionalität“, die ja auf der Ebene der passiven Synthesis fungiert), d.h. „triebhafte“, „sinnliche“ oder „affektive“ Tendenzen, die in gewisser Weise der Phantasie innewohnen. Diese affektiven Tendenzen werden durch innere Assoziationen bestimmt, die von der Leiblichkeit (bzw. der inneren Einheit von Leiblichkeit und Leibhaftigkeit) herrühren.47 mit dieser Materie zusammenfällt und den gleichen Rhythmus und die gleiche Bewegung wie sie annimmt, durch zwei entgegengesetzte Anstrengungen – die jeweils nach oben und nach unten gerichtet sind – diese beiden Formen der Wirklichkeit, nämlich Körper und Geist, von innen erfassen und nicht mehr bloß von außen ansehen? […] Kant selbst hat diesen Weg aber nicht beschritten.“ (H. Bergson, L’évolution créatrice, in Œuvres, édition du centenaire, Paris, PUF, 1970, S. 797f.) Kant zwar nicht – wohl aber Fichte (in seiner Konzeption der Einbildungskraft und der genetischen Konstruktion) und eben Richir (in seiner Phänomenologie der Leiblichkeit). 47 Diese Idee findet man bereits bei Husserl in den „Bernauer Manuskripten“ (im Text Nr. 14 von Husserliana XXXIII) an, wo Husserl diese Assoziationen den affektiven Tendenzen – die Richir auch einfach als „Affektionen“ bezeichnet – zuschreibt.
Leib und Leiblichkeit
131
Die zweite Grundbedeutung der Leiblichkeit ist die oben erwähnte Platon’sche chora. Diese könnte man als die völlig unbestimmte, amorphe, formlose, archaische Mitte zwischen (übersinnlichem) Denken und (sinnlicher) Ausdehnung (bzw. Materie) bezeichnen, die bei jeder Sinnbildung vorausgesetzt werden muss und die Zeitigung und insbesondere die Verräumlichung des Schematismus möglich macht.48 Richir gibt somit dem von Merleau-Ponty eingeführten Begriff der „chair du monde“ (was etwa durch das „Fleisch der Welt“ wiedergegeben werden kann) eine neue Bestimmung, die insbesondere der (bei Merleau-Ponty nur unzureichend ausgeführten) bewusstseinsmäßigen Erfassung durch das Subjekt, seiner Aneignung und seinem ureigentlichen „Verstehen“ Rechnung trägt. Dieser Begriff ist bei Merleau-Ponty allerdings bloß der Name für ein Problem, nicht aber für dessen Lösung. Deswegen muss die Leiblichkeit dann auch nicht nur als das dem leiblichen Subjekt und der äußeren Welt „Gemeinsame“, das die Begegnung beider ermöglicht, sondern als ein Strukturmoment des (schematischen) Erfassens der Welt selbst aufgefasst werden. Dieser Punkt wird weiter unten noch genauer ausgeführt, wenn von der „Individuation“ der Leiblichkeit die Rede sein wird. Inwiefern ist nun also die Leiblichkeit das gesuchte Vermittlungsmoment zwischen „Subjekt“ und „Objekt“? Beide Bedeutungen der Leiblichkeit müssen zusammengedacht werden: Die Assoziationen der affektiven Tendenzen sind leibliche, auf der chora gegründete Assoziationen, und die chora selbst verweist ursprünglich je schon auf die „Affektivität“. Und die Lösung des oben skizzierten Problems liegt gerade darin, dass die Leiblichkeit sowohl eine „subjektive“ Dimension ausdrückt (nämlich in den endogenen Verweisen innerhalb der „Affektionen“), als auch – „choratisch“ – präsubjektiv und prä-objektiv gegenwärtig ist. Die Originalität des Richir’schen Ansatzes (über den von Merleau-Ponty hinaus) besteht also darin, auf diesen sehr bedeutsamen Zusammenhang hingewiesen zu haben.
48 Die chora und der Schematismus verweisen in der Tat aufeinander, indem sie sich gegenseitig möglich machen – nach Richirs Definition ist der Schematismus nämlich eine bewegliche Gliederung von „Kondensierungen“ (oder „Verdichtungen“) und „Dissipationen“ der sich entfaltenden chora (siehe Phénoménologie en esquisses, op. cit., S. 466ff.).
132
Kapitel IV
Aufweisung der ursprünglichen „Befindlichkeit“ (d.h. der „Leibhaftigkeit“). Wie bereits oben betont, nimmt Heideggers Begriff der „Befindlichkeit“ in der Phänomenologie des Leibes und der Leiblichkeit eine sehr wichtige Rolle ein – und dies gilt selbstverständlich für Richir nicht weniger als für Merleau-Ponty (und zwar gerade weil Heidegger in diesem Zusammenhang dem Leibbegriff nicht die ihm gebührende Achtung geschenkt hat). Die Befindlichkeit sondert sich nicht bloß deshalb von der „Sinnlichkeit“ ab, weil sie kein dem Verstand entgegengesetzter „Erkenntnisstamm“ ist, sondern sie bezieht sich darüber hinaus – sofern sie je ein Befinden und Sich-Befinden anzeigt – auch auf die dem existierenden Dasein je eigene Situation – ein Begriff der eben auf den Leib, seine „Orientiertheit“, seine ihm eigene „Räumlichkeit“ und „Zeitlichkeit“ usw. verweist. Anstatt nun den Begriff der „Befindlichkeit“ wieder aufzunehmen, wählt Richir den Begriff der „Leibhaftigkeit“. Hier nun einige Gesichtspunkte, die zur Begründung dieser terminologischen Verschiebung beitragen mögen. Die Wörter „leibhaft“ und „leibhaftig“ verweisen auf die „Jemeinigkeit“, „Faktizität“, „Leibhaftigkeit“ der Existenz. Das, was „leibhaft“ da oder gegeben ist, ist da, so „wie es ‚es selbst’“ ist. Das diffizile Problem der Individuation der Leiblichkeit wird, wie gesagt, weiter unten ausführlich behandelt – hier reicht es aus, zunächst festzuhalten, dass der Begriff der Leibhaftigkeit (im Gegensatz zur Leiblichkeit) die in diesem Sinne „leibhaftige“ (also der jemeinigen Faktizität ureigene) Affektivität bezeichnet.49 Explizit Pate gestanden haben für diese Einführung des Begriffs der Leibhaftigkeit bei Richir Binswanger (in seinen psychopathologischen Studien), Heidegger (vor allem durch den Begriff der „Stimmung“) und (etwas impliziter) die Anthropologien von H. Lipps und A. Kolnai. Binswangers Untersuchungen der Psychosen haben affektive Tiefen hervortreten lassen, die eben eine spezifisch leibhafte Bedeutung haben und sich also nicht auf intellektuelle Phänomene reduzieren lassen. Heideggers Ausführungen über die „Stimmungen“ sind hier ebenfalls sehr wichtig. Allerdings kritisiert Richir die Beschränkung der Stimmung auf eine – letztendlich den Begriff des 49 Hier unterscheidet sich Richir zwar nicht grundlegend von Heideggers Ausführungen – der Begriff der „Leibhaftigkeit“ betont aber die Vorrangstellung des Leibes in der faktischen Jemeinigkeit mehr, als dies bei Heidegger selbst der Fall ist.
Leib und Leiblichkeit
133
Verstehens kennzeichnende – Welteröffnung. Jede Stimmung ist nämlich eine leibliche – und nicht bloß eine solche der „Seele“, der „Psyche“… (Stimmungen sind nicht bloß Launen!). Zu ihnen gehört jede Form des Wohl- oder Unwohlseins, Ängste, Freuden, Trauer, Glück usw. Ein anschauliches Beispiel für dieses Phänomen der Leibhaftigkeit (im Unterschied zur Heidegger’schen Stimmung) ist das Gefühl der Erleichterung nach einer starken psychischen Anspannung. Wenn man z. B. nach einer solchen eine gute Neuigkeit erfährt und dann zum Ausdruck bringt, dass man sich „erleichtert“ fühle, so ist das nicht bloß ein leeres Wort, sondern man ist dann wirklich gewissermaßen „leichter“. Der Leib „fühlt“ diesen Unterschied – während das Körpergewicht „objektiv“ selbstverständlich unverändert bleibt. Eine Vertiefung dieser Aspekte wurde Richir durch die von Guy van Kerckhoven angeregte Lektüre von H. Lipps und A. Kolnai ermöglicht.50 Diese ist für ihn deshalb so interessant, weil sie den Status der Leibhaftigkeit des Leibes zu präzisieren gestattet – was zugleich auch die Möglichkeit bietet, den ontologischen Status des Leibes näher zu erläutern. Dieser ist nämlich zweideutig: Der Leib „ist“ zweifelsohne gewissermaßen – und andererseits auch nicht. Im Unterschied zum Ego Cogito Descartes’ ist er kein „ontologisches Simulacrum“. Das heißt: Der Leib ist deshalb keine (sich selbst erscheinende) Erscheinungsbedingung jeder möglichen Erscheinung, weil er selbst nicht eigentlich „ist“, sondern sich nur sich selbst schematisierend phänomenalisieren kann. (Dies bezeichnet hier eine Schematisierung „auf“ oder „in“ der chora, d.h. eine „choratische“ Schematisierung des Leibes.) Für Richir phänomenalisiert sich der Leib (im „archaischsten Register“) letztlich als ein schematisches Phänomen und zugleich als ein Sprachphänomen. Und genau diese Idee wird bei H. Lipps und A. Kolnai (die Binswangers Gedanken in einer anderen Richtung vertiefen) veranschaulicht. Auch bei ihnen wird z. B. der Ekel durch eine leibliche Bewegung verursacht, die dem physi-
50 Siehe G. van Kerckhoven, L’attachement au réel. Rencontres phénoménologiques avec W. Dilthey et le « cercle de Göttingen » (G. Misch, H. Lipps), ins Französische übersetzt von G. van Kerckhoven, A. Schnell, A. Mazzù und B. Vauthier (unter der Aufsicht von M. Richir), Amiens, Mémoires des Annales de Phénoménologie, 2007, 20202, insbes. S. 125ff.
134
Kapitel IV
ologisch Empfundenen analog ist. A. Kolnai beschreibt im Besonderen den Ekel,51 den man einer bestimmten Person gegenüber empfinden kann. Hier vollzieht sich eine sich im Leib abspielende, affektive Reaktionen mit sich bringende Bewegung, die keine physische, sondern eine Phantasiekinesthesen hervorrufende Bewegung ist. Der Leib wird dabei gewissermaßen von Phantasiekinesthesen durchzogen. Und dies erfordert laut Richir einen Schematismus, da diese Phänomene im „choratischen Feld“ auftreten – wodurch sich also genau dieser (oben erwähnte) zweideutige ontologische Status des Leibs ausdrückt. Phantasieleiblichkeit und Phantomleiblichkeit. Richir führt nun Merleau-Pontys (nicht radikal genug ausgeführte) Idee einer Wende des Subjekt-Welt-Bezugs insofern zu Ende, als er die Leiblichkeit „der Welt“ eingehender untersucht und die (schon mehrmals angeklungene) Frage nach der Individuierung der Leiblichkeit aufwirft. Nachdem der Begriff der Leiblichkeit (wie auch der Leibhaftigkeit) in einem ersten Umriss dargestellt wurde, stellt sich nun in der Tat die Frage nach dem Bezug der konkreten (vereinzelten) Subjektivität zu dieser Leiblichkeit. Richir führt hierzu zwei neue Begriffe ein – der des „Phantasieleibs“ und der des „Phantomleibs“ –, die der Art, wie das Subjekt sich auf sein Objekt bezieht – nämlich entweder „phantasiemäßig“ oder „einbildungsmäßig“ – Rechnung tragen. Um das zu veranschaulichen, kann man sich der Beispiele der Bildbetrachtung und der Fremderfahrung bedienen. Was „geschieht“ bei der Betrachtung eines Kunstwerkes – etwa einer der berühmten Frauendarstellungen Vermeers? Entweder „ruft“ hier die Betrachtung eines solchen Bildes „etwas hervor“, ein „Zirkulieren“ zwischen Betrachter und Bild, welches das Bild zu einem „lebendigen“ macht, oder aber die Farbe auf der Leinwand lässt den Betrachter kalt, das Bild ist und bleibt „leblos“. Im ersten Fall besteht ein leibliches Verhältnis (im Sinne Richirs) „zwischen“ Betrachter und Bild, im zweiten Fall nicht. Dieses leibliche Verhältnis ist nun für Richir aber kein körperlich wahrnehmbares (in Zeit und Raum), sondern ein „phantasieleibliches“, weil das, was den ästhetischen Wert des Bilds („in“ und „für“ den betreffenden Betrachter) ausmacht, gerade nicht eigens wahrgenommen wird. (Und im ersten Fall [„auf meiner Seite“] individuiert sich der Phantasieleib, im 51 A. Kolnai, Der Ekel, in Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, E. Husserl (Hsg.), Bd. X, Halle (Saale), 1929, S. 515–569.
Leib und Leiblichkeit
135
zweiten Fall [„auf der Seite des Anderen“] fungiert er nicht.) Der Phantasieleib bezeichnet also den nicht erscheinenden („unscheinbaren“) Teil in der Bildbetrachtung, der das Leben des Bildes ausmacht. Andererseits ist aber dieses Verhältnis keine freie Fiktion – um dieses so ermöglichte Verhältnis zu beschreiben, weist Richir deshalb auf die Rolle der oben bereits eingeführten „‚perzeptiven‘ Phantasie“ hin. Diese stellt in der Tat etwas vor, was teils dargestellt werden kann, teils aber auch nicht darstellbar ist. Darstellbar ist das, auf der Grundlage dessen die Phantasieleiblichkeit „zirkuliert“. Nicht darstellbar ist dagegen diese Phantasieleiblichkeit selbst – die jedoch nicht Nichts ist, sondern das ästhetische Gefallen allererst möglich macht. Richir bezeichnet den (nur der „perzeptiven“ Phantasie zugänglichen) „Leib“ desjenigen, für den diese Zirkulation stattfindet, als „Phantasieleib“. Für denjenigen aber, der „phantasieleiblich“ unberührt bleibt und in diesem Falle etwa nur ein „bloßes Bild“ erblickt, besteht hier ein rein einbildungsmäßiges Verhältnis, seine Phantasieleiblichkeit ist verflogen oder hat sich gar nicht erst ausbilden können: Sein Leib ist in diesem Verhältnis ein „Phantomleib“. (Und auf die Bildbetrachtung bezogen heißt das: Der in einem leiblichen Bezug zu etwas stehende – und dadurch eigens fungierende – Phantasieleib phänomenalisiert sich zwar, d.h. etwas „in“ ihm ruft eine Darstellung [= Erscheinung] hervor, jedoch, wenn dies sich hierauf beschränkte, dann wäre das Bild lediglich eine bloße Darstellung von etwas.) Der Phantomleib ist also das Überbleibsel der Leiblichkeit des Leibes, wenn der Betrachter des Bildes dieses nur als ein Bild auffasst. Und was von der Leiblichkeit übrigbleibt, ist eben eine im Sehen unverortete („nicht lokalisierbare“) Phantomleiblichkeit. Der Betrachter löst sich hier im Phantomleib auf und wird von ihm gewissermaßen gefangen genommen. Man kann auch sagen: Der Phantomleib ist eine „Atmosphäre“, ein herumirrendes Auge, das sich auf diese oder jene Darstellung der Einbildungskraft fixiert. Die Phantasieleiblichkeit spielt auch in die Erfahrung des Anderen hinein: Sie ist nämlich der Grund dafür, dass ich, um zur „Innerlichkeit“ des Anderen Zugang zu haben, mich nicht in diese Innerlichkeit hineinzuprojizieren brauche. Durch den Phantasieleib kann ich (durch einen Austausch der Blicke52) den Anderen „von innen 52 „L’échange des regards“ wurde in den Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace für Richir sozusagen zum Paradigma der Konstituierung der Erfahrung des Anderen (siehe z. B. a.a.O., S. 289ff. und 294ff.). Ich
136
Kapitel IV
her“ „fühlen“, ohne jedoch der Bewusstseinssphäre des Anderen anzugehören. Der Phantasieleib „zirkuliert“ dabei wiederum zwischen mir und dem Anderen.53 Das heißt aber, dass die konkrete Intersubjektivität, d.h. die intersubjektive Monadengemeinschaft „vor“ jeder Konstitution des einzelnen Subjekts (bzw. der einzelnen Monade) eine (in Richirs Worten) transzendentale Interfaktizität zur Voraussetzung hat. Diese bezeichnet eine radikale Pluralität „absoluter Hier“ (die nicht konkret gegenwärtig zu sein brauchen) als „Sitze (hedrai)“ der chora.54 In der Phantasieleiblichkeit spielt sich etwas ab, das den Bezug zweier absoluter Hier herstellt (wodurch sie gewissermaßen mit der chora zusammenfällt) – zwischen zwei hedrai besteht also ein ständiges Hin und Her. Im Phantomleib dagegen handelt es sich um den Bezug einer Einbildung zum Bilde – hier ist eine Verortung völlig unmöglich, da der Phantomleib überall und nirgends „ist“. Der Phantasieleib ist also zusammenfassend gesagt der Leib desjenigen, der einen phantasiemäßigen Bezug zu etwas hat, während der Phantomleib den Leib desjenigen bezeichnet, der nur einen einbildungsmäßigen Bezug zu etwas herstellt. Um das Verhältnis von Phantasieleib und Phantomleib noch klarer hervortreten zu lassen, können folgende vier Fälle unterschieden werden: 1.) die Betrachtung einer schönen Landschaft, das Korrelat einer Stimmung; 2.) das Korrelat des Bildobjekts; 3.) das Korrelat eines bloßen Bildes und 4.) der Leib des Sehens. 1.) Richir führt den Begriff des „Phantomleibs“ zum ersten Mal in der Einleitung seines Buchs Phantasía, imagination, affectivité (2004) – und zwar in seinem Kommentar zum Text Nr. 16 in Husserliana XXIII – ein. Diese Textstelle (bei Husserl) handelt von der bei einer kann aber auch, wie in früheren Schriften oft betont, dem Anderen gegenüber eine „aktive, nicht bildhafte Mimesis von innen (mimesis active non spéculaire et du dedans)“ vollziehen – „aktiv“, weil ich hierin tätig bin, „nicht bildhaft“, weil es sich dabei um keine – narzisstische (d.h. durch das Selbst und vom Selbst aus projizierte) – Simulation dessen handelt, was der Andere fühlt, und „von innen“, weil sich hier alles so verhält, „wie wenn ich dort wäre“. 53 Dabei kann dem Phantasieleib kein bestimmter Ort zugeteilt werden. Um den singulären „Leib“ zu verorten, führt Richir den Platon’schen Begriff der (verräumlichenden) „hedra“ (etwa: „Sitz“) ein. Der Leib ist für letztere konstitutiv – er konstituiert so ein vor-räumliches „absolutes Hier“. 54 Siehe oben.
Leib und Leiblichkeit
137
Landschaftsbetrachtung hervorgerufenen Stimmung, genauer: vom Status des Leibes bei dieser Betrachtung. Vom Standpunkt der Wahrnehmung aus ist in einer solchen Betrachtung im Prinzip alles darstellbar – mit der Einschränkung, dass das Gegebene nur abschattungsmäßig erscheint. Die Phantasieleiblichkeit dagegen tritt auf, wenn die Grenze zwischen der Betrachtung und der Träumerei verschwimmt. Hier fängt die Landschaft an, sich als eine Darstellung des nicht Darstellbaren zu verlebendigen – was im eigentlichen Sinne die Schönheit der Landschaft ausmacht. Etwas an der Phantasieleiblichkeit macht uns also das im Spiel der durch die Landschaft gelieferten Darstellungen nicht Darstellbare zugänglich. Aber das reicht noch nicht aus: Für den Einen ruft die Landschaft eine traurige, für den Nächsten eine melancholische und für einen Dritten eine depressive Stimmung hervor. Diese „affektive“ Dimension vereinzelt gewissermaßen die Stimmung. Welche Art von „Leib“ kann dem Betrachter hier zugeschrieben werden? Für Husserl (und Richir stimmt dem voll zu) kann es sich hier nur um das (leibliche) „Korrelat der Stimmung“ handeln – wobei dieses allerdings weder wahrnehmbar noch, im Gegensatz zum Phantasieleib, leiblich (in einem „absoluten Hier“) verankert ist. Dieser „Leib“ ist überall und nirgends, völlig unverortbar, ein „Phantom“ – Phantomleib. 2.) Das Beispiel der Stimmung ist aber nur ein Sonderfall für ein allgemeineres Phänomen. Der Phantomleib ist das Korrelat des Bildobjekts bei einer – die Einbildungskraft („imagination“) ins Spiel bringenden – Bild„wahrnehmung“ (es handelt sich dabei aber nicht eigentlich um eine Wahrnehmung, sondern um eine Form der Einbildung, die Husserl sehr ausführlich im Text Nr. 1 von Husserliana XXIII beschrieben hat).55 Dabei scheint es jedes Mal so, als „sei hier das nicht-positionale Ich selbst zu einem Teil des Bildobjekts geworden.“56 Wichtig ist dabei, dass der Phantomleib nicht das Korrelat der „architektonischen Transposition“ der Phantasie in die Einbildung (imagination) ist, sondern eben den Status des Leibs in der gekennzeichneten Entsprechung zum Bildobjekt zu charakterisieren vermag. 55 Siehe hierzu Phénoménologie en esquisses, op. cit., insbesondere S. 61–72 und v. Verf. Husserl et les fondements de la phénoménologie constructive, op. cit., insbesondere S. 123–129. 56 Phantasía, imagination, affectivité, S. 25.
138
Kapitel IV
3.) Allerdings kann er ein solches Korrelat sein – zum Beispiel, wenn man die Landschaft nicht in natura sondern auf einer Postkarte oder in einer Reisebürobroschüre betrachtet. Oder auch – um auf das obige Beispiel der Bildbetrachtung zurückzukommen – wenn der Betrachter sich (psychopathologisch) auf ein Objekt dieser Betrachtung „fixiert“, davon „fasziniert“ ist. Dann handelt es sich nämlich nicht, wie schon gezeigt, um einen Phantasie-, sondern um einen Phantomleib: Der Phantomleib ist sozusagen das Überbleibsel der Leiblichkeit oder die architektonische Spur der Phantasie und des Phantasieleibes in jener architektonischen Transposition, in der die Einbildung (imagination) sich mit ihrer Intentionalität stiftet. In diesem Sinne ist der Phantomleib der überall und nirgends „verdampfte“ Leib des Ich-Bildes im Bild, das Korrelat der Bildlichkeit des Bildes oder der Fiktionalität der „perzeptiven Apparenz“: In diesem Sinne also entziehen sich die einbildungsmäßig vermeinten, aber nicht als solche im Bildobjekt dargestellten Bedeutsamkeiten oder die „perzeptive Apparenz“ als solche, indem sie von der „Atmosphärisierung“ des Phantomleibs herzurühren scheinen.57
Im Grunde handelt es sich bei den letzten beiden Fällen um ein und dasselbe – und das liegt darin begründet, dass das Bildobjekt (wie Husserl im erwähnten Text Nr. 16 von Husserliana XXIII gezeigt hat) gar nicht existiert. Gäbe es nämlich einen „positiven“ Bezug zum Bildobjekt, dann wäre das eine „Scheinperzeption“ (oder „perzeptive Apparenz“) – wobei das Bildobjekt mittels eines „eidolon“ oder „Simulacrum“ (was also dem Bildobjekt gleichkäme) quasi-gesetzt wäre. Trotzdem liegt die Betonung in beiden Fällen nicht auf dem gleichen „Pol“. Man kann nämlich die Darstellung an sich selbst betrachten, diese kann besser oder schlechter sein (eine Skizze, eine Karikatur, ein Foto usw.) – wobei dann etwas durchaus die Rolle eines intentionalen Simulacrums einnimmt (allerdings bloß als ein die Intentionalität leitendes Milieu). Und darin besteht nun auch das Rätsel des Bildes und der Einbildung: Ein Teil der Leiblichkeit „verdampft“ im Bilde, und deswegen kann das Bild eine ungemeine Faszination ausüben, ohne dass man erklären könnte, weshalb dem eigentlich so ist. 4.) Schließlich wird der Phantomleib, wie in den Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace zu erfahren ist, auch als Leib 57
Phantasía, imagination, affectivité, S. 28f.
Leib und Leiblichkeit
139
des Sehens bestimmt – oder besser, umgekehrt, Richir übersetzt hier die „Atmosphärisierung“ des Leibs im Phantomleib durch das Sehen. Das Sehen – das sich sowohl auf das sinnliche als auch auf das intellektuelle Sehen bezieht – hat, wie Husserl bereits in den §§ 36– 39 der Ideen II gezeigt hatte, die strukturelle Übereinstimmung mit jedem intentionalen Bezug darin, dass es sich selbst als Sehen nicht sehen kann. Mit anderen Worten, es ist dem Leib gegenüber völlig „illokalisiert“ (unverortet). Dies hat das Sehen mit der Einbildung (imagination) gemein. Konkret bedeutet diese Illokalisierung, dass das Sehen (und das Einbilden) sich in einem Gesehenen (und in einem Eingebildeten), das sie gefangen nimmt und fixiert, vergessen, welches [Gesehene (und Eingebildete)] aber a priori und für sich selbst überall und nirgends sind – ohne dass also das Gesehene (und das Eingebildete) an sich [etwas] einen Sitz anders als relativ zu sich selbst zuschreiben oder auch sich selbst, als solche, anders als relativ zu sich selbst situieren könnten.58
Und dieses Sehen ist vom Licht nicht zu trennen, es ist nicht zu verorten, durchsichtig, selbst unsichtbar. Auch hier kann somit der entsprechende Leib bloß ein Phantomleib sein.59 * Abschließend seien noch zwei kurze Bemerkungen hinzugefügt. Zunächst ist zu sagen, dass Richir in der Tat die Konsequenzen aus der Idee der grundlegenden Nicht-Individualität der transzendentalen (als Interfaktizität aufzufassenden) Subjektivität zieht. Der Leib des „Subjekts“ ist (in der von ihm angestrebten Neufundierung der Phänomenologie) zunächst entweder Phantasie- oder Phantomleib – also kein individuierter Leib. Was diesen zum Individuum macht, ist die Erfahrung des „Erhabenen“ (die bereits der Säugling machen kann). In dieser finde „ich“ mich eigens selber. Diese Erfahrung, deren Beschreibung Richir Kant entlehnt, bezeichnet die übersinnliche Bestimmung des Menschen, die ästhetische Reflexion des
Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 283. „[…] die Leiblichkeit des Sehens ist – im Gegensatz zu der des Anblickens – Phantomleiblichkeit“, Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 289. 58 59
140
Kapitel IV
mich als Menschen individuierenden Unendlichen. Diese Erfahrung ist die einzige Erfahrung eines „Exzesses“, die keine traumatische ist – eben weil sie mich individuiert (in den Begriffen Winnicotts: durch sie erfahre ich mich als „true self [wahres Selbst]“, das – als nicht darstellbares – kein im Bilde gefangenes ist). Man könnte sich nun abschließend fragen, ob Richir mit dieser „Spaltung [clivage]“ zwischen Phantasieleiblichkeit und Phantomleiblichkeit (die der zwischen Phantasie und Einbildung entspricht) die – leiblich verankerte – Grundstruktur des Subjekt-Objekt-Bezugs (diesseits jeglicher Intentionalität und Sorgestruktur) aufgewiesen hat. Dem ist nicht ganz so. Allenfalls kann sie für eine indirekte60 phänomenologische Aufweisung von etwas noch Grundlegenderem herhalten – nämlich für die Rätselhaftigkeit dessen, dass wir niemals unserer Erfahrung voll und ganz „anhaften“, „innewohnen“ (wobei dies eine „dynamische“ Spaltung ausmacht). Hierdurch drückt sich eine Form der Reflexivität aus, die nicht mit der Reflexion verwechselt werden darf und an Fichtes „Reflexibilität“ erinnert. Sie besteht für Richir in der Möglichkeit, Abstand nehmen, bzw. einen Abstand (écart) herstellen zu können.61 Deswegen interpretiert Richir (wie erwähnt in der Folge Merleau-Pontys) das Ego Cogito neu. Das Ego Cogito ist die Erfahrung dieses Abstands selbst, es ist die Nichtübereinstimmung des Selbst mit sich selbst oder jedes anderen Seienden mit sich selbst. Für Richir stimmt nichts mit sich selbst überein – nicht einmal die mathematischen Idealitäten! Das Fundamentalste ist also für Richir die Nicht-Übereinstimmung zwischen dem Selbst und sich selbst. Hierin besteht eben genau die Wurzel der Intentionalität und auch der Sorge. Die Zeit ist dabei nicht das Konstitutivum dieses Abstands, sondern nur eine der Arten und Weisen, sie zu erfahren – auch hierin besteht also ein Unterschied zwischen Richirs Standpunkt und jenem Merleau-Pontys. Der Abstand stellt die Zeit allererst her. Das wurde schon von Maine de Biran (mit seinem Begriff des „effort“) und von Fichte (im „Streben“ und „Sehnen“ am Ende der Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre von 1794/1795) gesehen (siehe auch zum Beispiel die Wissenschaftslehre nova methodo, in der Fichte von der inneren Tätigkeit
60 Richir stellt einen solchen Zusammenhang aber auch nur zögerlich her (siehe z. Bsp. Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 326f.). 61 Ebd.
Leib und Leiblichkeit
141
des Geistes, die noch keine zeithafte ist, spricht). Beide Denker haben als erste eine Vorstellung davon gehabt, dass es einen „Abstand“ diesseits jeder Zeitlichkeit gibt – ein weiterer Punkt also, der sowohl Richirs Originalität in der heutigen phänomenologischen Forschung als auch seine Zugehörigkeit zur Tradition der neueren Metaphysik belegt.
Kapitel V Zeitlichkeit und Affektivität Richirs Auseinandersetzung mit der am Ende des vorigen Kapitels angeschnittenen Zeitproblematik reicht bis in sein philosophisches Frühwerk zurück. Er hatte diesbezüglich nicht nur Analysen,1 die von den maßgeblichen Vorreitern innerhalb der Zeitphänomenologie ausgingen, sondern – insbesondere am Ende der 1980er Jahre – auch eigenständige Arbeiten2 vorgelegt. Jedoch stand dort die Zeitproblematik – wie bei anderen Phänomenologen auch – im Dienste seiner eigenen Ausarbeitungen. Die Zeit wurde also nicht für sich selbst behandelt. Dies stellt sich 2006 in Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace gänzlich anders dar. Hier wird nun eine phänomenologische Analyse über das Wesen der Zeit entwickelt – und zwar im Lichte dessen, wozu Richir in der Zwischenzeit dank der Phänomenologie der Einbildungskraft und Phantasie Zugang gefunden hatte. Dies macht freilich eine erneute Auseinandersetzung mit Husserl nötig, und zwar insbesondere hinsichtlich der Frage nach den verschiedenen phänomenologischen Zeitstufen. In diesem Kapitel sollen nun Richirs Zeitanalysen, sofern sie aus jenen Fragments hervorgehen, vorgestellt werden. Ausgangspunkt von Richirs Zeitphänomenologie ist der Gedanke, dass die Intentionalität keinen linearen Bezug darstellt, sondern in den ihr genuin zugehörigen Kreisverlauf versetzt werden 1 „Ereignis, Temps, Phénomènes“, in Heidegger: Questions ouvertes, Collège International de Philosophie, Paris, Osiris, 1988, S. 13–36; „Synthèse passive et temporalisation/spatialisation“, in Husserl, E. Escoubas & M. Richir (Hsg.), Grenoble, J. Millon, 1989, S. 9–41; „Temps, espace et monde chez le jeune Fink“, in Eugen Fink, N. Depraz & M. Richir (Hsg.), Amsterdam, Rodopi, 1997, S. 27–42. 2 „Temps et Devenir“, in Le Temps, Brüssel, Cercle de Philosophie de Bruxelles, 1989, S. 4–19; „Le temps: Porte-à-faux originaire“, in L’expérience du temps – Mélanges offerts à J. Paumen, Brüssel, Ousia, 1989, S. 7–40; „Phénoménologie et temporalité (séminaire 1988/89)“, in Le cahier du Collège International de Philosophie Nr. 7, Paris, 1989, S. 186–188; „Temps/Espace, Proto-temps/Proto-espace“, in Le Temps et l’Espace, Brüssel, Ousia, 1992, S. 135–164. Réflexions sur le temps (1992).
144
Kapitel V
muss. Richir schließt hierbei an Überlegungen von Jean-Toussaint Desanti an.3 Für Richir lässt sich nur auf diese Art Husserls Dogma der Priorität der Setzung (bzw. der „Positionalität“) unterlaufen. Er versucht hierdurch die (vorintentionalen) Leistungen diesseits dreier Voraussetzungen Husserls, die er zurückweist, herauszustellen. Worin bestehen zunächst diese Voraussetzungen? Erstens stellt Richir heraus, weshalb Husserl sich auf das Feld des „Positionalen“ beschränkt. Dies liegt darin begründet (und dieser Gedanke wird dann in Propositions buissonnières wiederaufgenommen), dass Husserl für die Analysen der Zeit je vom Jetzt, von der 3 In Réflexions sur le temps (1992) hat Desanti – einer der bedeutendsten französischen Phänomenologen der Generation Sartres und Merleau-Pontys – es sich zur Aufgabe gemacht, den Gehalt der „These der Intentionalität“ zu entfalten. Gemäß dem, was er das „minimale Gebot“ dieser „These“ nennt, transzendiert der gemeinte Gegenstand das Bewusstsein, das somit „nichts enthält“. Folglich ist das, was „ist“, also was entlang des „intentionalen Bogens“ als Seiendes ausgemacht wird, der sich „zeigende“ Gegenstand, wie er in den Erlebnissen dank einer „Verknüpfung“ derselben identifiziert werden kann. Da die Quelle und das vermeinte Ziel den intentionalen Bogen transzendieren, aus ihm „herausfallen“, kann das „Seiende“ – das also entlang des Bogens verortet ist – als dem Bewusstsein „immanent“ bezeichnet werden (das „maximale Gebot“ der Intentionalität legt dagegen fest, dass das Gemeinte de jure in seinem Sein erfüllt zu werden vermag). Es besteht daher eine nicht reduzierbare Differenz zwischen dem („immanenten“) Seienden qua Vollzugsmoment im Erlebnis eines transzendenten „Gegenstandes“ und diesem transzendenten Gegenstand selbst. Wenn man nun diese beiden Gebote streng beachtet, dann impliziert die Neuinterpretation der Intentionalität, dass der Bezug des Subjektpols zum Sein des Gemeinten die Intentionalität nicht unterminieren darf – und zwar weder durch eine zugrunde gehende Intention noch durch eine „Verschmelzung“ von Subjektpol und Sein, die den intentionalen Bezug vernichten würde. Das ist aber nur möglich, wenn der Bezug dieser beiden Glieder sowohl einen Aufweisungs- als auch einen Entzugscharakter hat. Dies stellt kein sprachlich oder sonst wie vermittelndes Verhältnis dar, da ein solches je eine „ontologische Homogenität“ voraussetzt und es diese zwischen Sein und Seiendem eben nicht gibt. Diesen Bezug, der sich somit als kreisförmig erweist, wird als „Kreis der Öffnung [circuit de l’ouverture]“ bezeichnet; Desanti verleiht ihm einen spezifischen Existenzmodus – den der Zeitigung. Für eine genauere Darstellung dieser Thesen Desantis, siehe v. Vf., La genèse de l’apparaître. Études phénoménologiques sur le statut de l’intentionnalité, Mémoires des Annales de Phénoménologie, Band V, Beauvais, Association pour la promotion de la Phénoménologie, 2004, S. 111–125.
Zeitlichkeit und Affektivität
145
Gegenwart, ausgeht – ein Ausgangspunkt, der, wie bereits von Merleau-Ponty hervorgehoben wurde, den Vorrang der Wahrnehmung gegenüber den anderen Intentionalitätsmodi kennzeichnet. Zweitens lehnt Richir es ab, die von Husserl niemals in Frage gestellte Kontinuität der Zeit als gültig anzuerkennen. Drittens, und hierin besteht zweifellos der – bereits von van Kerckhoven zurecht angemerkte – bedeutendste Beitrag der Richir’schen Zeitphänomenologie, macht dieser es sich zur Aufgabe, dem beschränkten Rahmen der „Erlebniszeit“ zu entgehen (dem Husserl selbst bis zu seinen letzten Manuskripten nie entsagt hatte). An die Ergebnisse des dritten Kapitels anschließend, soll nun Richirs Zeitphänomenologie im Lichte seiner Einsichten zu „Sprache“ und „Phantasie“ nachgezeichnet werden. Eine Neugründung der Phänomenologie, welche die letztkonstituierenden Phänomene des „Positionalen“ aufzeigen möchte, kann auf das Feld der Sprache nicht verzichten. Nicht der konstituierten Sprache, sondern das der bereits thematisierten „wilden Sprachwesen“. Die Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace führen bezüglich dieses Begriffs über das bereits Behandelte hinaus neue Bestimmungen ein. Der Grundgedanke ist dabei folgender. Die das „Sprachphänomen“ kennzeichnenden „Sinnregungen [amorces de sens]“ machen, sofern sich in diesen (hinsichtlich der Aufklärung des Positionalen) Sinn „zu stabilisieren oder zu ‚besitzen‘ sucht“, „schematische Verkettungen“ der „‚perzeptiven‘ Phantasien“ aus. „Wilde Wesen“ sind somit dank „‚perzeptiver‘ Phantasien“ „wahrgenommene“ „Wesen von Phantasien-Affektionen“.4 Sie verleihen letzteren – also dem, was die „wilden Wesen“ (freilich bloß indirekt) bezeugt – eine „Konkretheit“.5 Man kann somit sagen, dass die wilden Wesen als solche unzugänglich sind, zugleich aber den Phantasien-Affektionen innewohnen, bzw. in ihnen „wesen“ (um mit Heidegger zu sprechen). 4 Man könnte sagen, dass in der „Phantasie-Affektion“ die Phantasie die Form und die Affektion den Inhalt ausmacht – allerdings erst nachträglich, vom Standpunkt der architektonischen Transposition der Phantasie-Affektion in einen Imagination-Affekt aus betrachtet. 5 Eine solche Konkretheit der Phantasie-Affektion muss in der Tat angenommen werden, weil sie sonst nicht von einem Simulacrum unterschieden werden könnte.
146
Kapitel V
Auf der architektonisch ursprünglichsten Ebene sind also die „wilden Wesen“ angesiedelt. Ihr Verhältnis zu den „Phantasien-Affektionen“ besteht darin,6 dass sie von ihnen „in Bewegung gesetzt“ werden. Die Phantasien-Affektionen stellen somit eine phänomenologische Konkretheit dar, die eine architektonische Transposition in die Imagination einerseits und in die Affekte andererseits erfahren können – welche architektonische Transposition die Phantasien-Affektionen zu fixieren und zu erfassen gestattet (freilich in einem anderen Register7 als diese selbst). * Indem er seine phänomenologischen Analysen mit den „Wesen von Phantasien-Affektionen“ beginnt, stellt Richir einmal mehr in den Vordergrund, dass die Wahrnehmung hinsichtlich des Verhältnisses vom Bewusstsein zu seinem Gegenstand keinen Vorrang hat. Vom „konstitutiven“ Standpunkt aus betrachtet, ist sie der Phantasie gegenüber abgeleitet. Um nun den Bezug von Wahrnehmung und Phantasie noch von einer anderen Seite aus zu betrachten, sollen zwei weitere Aspekte hinzugenommen werden – bezüglich ihrer Quellen und ihren Modi der Zeitigung. Husserl behandelt die Wahrnehmung stets mithilfe des „Auffassungs-Auffassungsinhalts-Schemas“,8 und auch Richir stellt zwei „Quellen“ der Phantasie heraus, nämlich die „aisthesis“ (im Sinne Platons) und den „Trieb“ (im Sinne Husserls). Erstere bezeichnet ein unentwegt in Bewegung Seiendes und erinnert – wie schon erwähnt – an Fichtes „Anstoß“. Sie ist sozusagen die phänomenologische Entsprechung dessen, was man in der Physik ein „Signal“
6 Dem muss hinzugefügt werden, dass die Affektionen den Phantasien eine „intensive Größe“ verleihen (vgl. Kants „Antizipationen der Wahrnehmung“) bzw. dass diese jenen durch ihre „Energie“ (in einem Fichte’schen Sinne) Intensität und Lebendigkeit verdanken. 7 In der Tat gibt es architektonische Transpositionen nur dort, wo von einem zum nächsten Register übergegangen wird (die verschiedenen Register unterscheiden sich nur durch eine Stiftung voneinander). Zwischen wilden Wesen und Phantasien besteht keine Registerdifferenz. Das Erfassen der wilden Wesen wird hier durch den Schematismus gewährleistet. 8 Siehe Temps et phénomène, op. cit., S. 21ff.
Zeitlichkeit und Affektivität
147
nennt, also keine Wahrnehmung, sondern – auf der Ebene der Sinnesorgane – das, was nachträglich9 als „sinnliches Datum“ (als eine noch nicht objektivierte Empfindung) bezeichnet wird. Ohne diesen Anstoß kann es keine Phantasie geben. Die aisthesis zeigt somit an, dass die Phantasie gleichsam nichts aus nichts erschafft. Die zweite Quelle entspricht dem, was Husserl die „sinnlichen Tendenzen“ nennt. Es handelt sich dabei um sozusagen „innere“10 Tendenzen, die der Leiblichkeit in ihrer inneren Einheit mit der Leibhaftigkeit entstammen bzw. Assoziationen, die zwischen den affektiven Tendenzen11 (also dem, was Richir als „Affektionen“ bezeichnet) hergestellt werden. Diese zweite Quelle gehört der Husserl’schen „Triebintentionalität“12 an. Kommen wir nun zur Kennzeichnung des Zeitigungsmodus der Phantasie gegenüber jenem der Wahrnehmung. * Richir geht es darum, das fundierende Register des Zeitbewusstseins zu untersuchen, sofern dieses in Wirklichkeit bereits ein fundiertes Register ist – nämlich in der Stiftung dessen, was gemeinhin als „Zeit“, in der es die Gegenwart gibt, verstanden wird. Wir haben es
9 Eigentlich sind die Ausdrücke „sinnliches Datum“ und „Empfindung“ nicht gut dafür geeignet, um diese „erste Quelle“ der Phantasie zu bestimmen. Sie sollen hier daher auch nur in einer ersten Annäherung gebraucht werden, um sie provisorisch zu fassen. Sie sind deshalb nicht besonders geeignet, weil sie das Ergebnis der architektonischen Transposition der Phantasie-Affektion in Imagination und Affekt betreffen. Das ist freilich ein bekanntes Phänomen: Auf der architektonisch tiefsten Stufe „fehlen uns die Namen“, um jedes Mal den Rückgriff auf die Terminologie aus einer höheren Konstitutionsstufe vermeiden zu können. 10 Zwar wohnen die sinnlichen Tendenzen in der Tat in gewisser Weise der Phantasie „inne“ und die aisthesis ist ihr gegenüber „äußerlich“; aber im Grunde kann diese Unterscheidung erst getroffen werden, nachdem in diesem architektonischen Register vom Raum die Rede gewesen ist. 11 E. Husserl, Die Bernauer Manuskripte über das Zeitbewusstsein 1917/18, Husserliana XXXIII, R. Bernet & D. Lohmar (Hsg.), 2001, Text Nr. 14, S. 275–276. 12 Siehe Phantasía, Imagination, affectivité, S. 252–267.
148
Kapitel V
also scheinbar mit zwei13 zeitlichen Registern zu tun: mit jenem, in dem die Zeit bereits gestiftet ist – und es wird dann darum gehen, ihre „Fundierung“ zu erklären; und mit dem genuin fundierenden Register. Besagt dies, dass Richir aufs Neue die Konstitution der immanenten Zeitlichkeit in einer präimmanenten Zeitlichkeit zu vollziehen beabsichtigt – so wie Husserl das bereits in den letzten Texten des Abschnitts B in Husserliana X sowie insbesondere in den Bernauer Manuskripten begonnen hatte? Dem ist nicht so. Um hier die Unterschiede klar machen zu können, muss kurz an Husserls „Lösungen“ von 1917/18 erinnert werden. Die berühmten Analysen aus Husserls 1928 von Heidegger herausgegebenen Zeitvorlesungen14 – der retentionalen und protentionalen Intentionalität (auch wenn letztere dort nur sehr skizzenhaft vorliegt), der Urimpression usw., sofern sie die „Zeitobjekte“ 15 konstituieren, die nicht bloß in der Zeit sind, sondern in sich selbst eine zeitliche Ausbreitung enthalten16 – entstammen der immanenten Sphäre des transzendentalen Bewusstseins. Ihr Leitfaden ist ein konstituiertes Zeitobjekt (Husserl bedient sich zumeist des Beispiels einer Melodie). Das in diesen Analysen ungelöste Problem besteht darin, aufzuzeigen, was die („subjektive“) Zeitlichkeit dieser „Ingredienzen“ der immanenten Sphäre selbst konstituiert. Diese konstituierende Zeitlichkeit kann selbstverständlich nicht die „objektive“ Zeit sein, denn diese wird ja in der immanenten Sphäre konstituiert und kann also nicht ihrerseits für dieselbe konstitutiv sein. Würde man dies annehmen, verfiele man in eine Petitio Principii. Würde
13 Aus den Schlussbemerkungen dieses Kapitels wird deutlich werden, dass Richirs Phänomenologie der Zeit in Wirklichkeit drei Konstitutionsstufen aufweist. 14 E. Husserl, Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, Halle, M. Niemeyer, 1928. 15 Was die „Zeitobjekte“ von den „zeitlichen Gegenständen“ unterscheidet, ist, dass diese erst einmal nichts genuin Zeitliches an sich haben – wenn man davon absieht, dass sie in einem zeitlichen Rahmen „ablaufen“ können –, während jene die Zeit selbst sind, nämlich die Zeit qua spezifisches „Objekt“, dessen Konstitutionsmodi es aufzuweisen gilt. 16 Husserliana X, S. 23. Um genau zu sein, ist diese Definition nicht den Zeitvorlesungen von 1905 entnommen, sondern der Vorlesung von 1906/07 mit dem Titel „Einleitung in die Logik und Erkenntnistheorie“, Husserliana XXIV, § 43 b, S. 255.
Zeitlichkeit und Affektivität
149
man dagegen eine tiefere subjektive Konstitutionsleistung veranschlagen, riefe das nach einer noch tieferen – und man stünde vor einem unendlichen Regress. Wie kann man aus diesem Dilemma herauskommen? Wir stehen hier exemplarisch vor dem Fall eines letzten „Faktums“, das die bloß deskriptiven Analysen nicht zu genetisieren vermögen. Daher die Notwendigkeit eines Rückgriffs auf die phänomenologische Konstruktion des „Urprozesses“, der durch eine „Erfüllung“ und „Entleerung“ seiner konstitutiven „Kerne“ („Abklangsphänomene“, „Urkerne“, „protentionale“ Kerne usw.) gekennzeichnet ist. Diese Konstruktion macht es nötig, in die präimmanente Sphäre des Bewusstseins – diesseits der immanenten Sphäre und insbesondere diesseits der Spaltung von Noesis und Noema, von Akt und Aktinhalt, von morphé und hylé – herabzusteigen, damit jene Genetisierung geleistet werden kann. 17 Während nun für Husserl die Zeitigung je, wie Richir sich ausdrückt, „Zeitigung in Gegenwart“ ist, das heißt, dass „1.) der quasi ausschließliche Ausgangspunkt der Analysen [wie oben bereits angemerkt] das ‚Jetzt‘ ist, 2.) der Verlauf der Gegenwart zunächst jener des Jetzt und stetig und homogen ist, 3.) diese Stetigkeit voraussetzt, dass in dem Verlauf nichts absolut verloren geht, jedes Jetzt also die abgelaufene Zeit ohne Verluste enthält und zugleich eine lückenlose Folge von sich selbst auf sich selbst ist“,18 geht es für Richir darum, den umgekehrten Weg gleichsam von der „niederen“ zur „höheren“ Konstitutionsebene, nämlich von der architektonischen Transposition der „Zeitigung in Gegenwärtigkeit“ in die „Zeitigung in Gegenwart“ zu beschreiten – es geht also darum, dieser (archaischen) „Zeitigung in Gegenwärtigkeit“ Rechnung zu tragen. Hierfür ist es notwendig zu erläutern, inwiefern in der Art, wie die Phantasien-Affektionen die „wilden Wesen“ in Bewegung setzen, „es bereits um das ursprüngliche Zeitbewusstsein geht.“19 Richir führt hierzu eine hochbedeutsame Unterscheidung ein, welche die gesamten Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace durchzieht
17 Siehe hierzu v. Vf., Hinaus. Entwürfe zu einer phänomenologischen Metaphysik und Anthropologie, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2011. 18 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 29. 19 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 47 (Richir zitiert hier einen Auszug aus dem Text Nr. 14 von Husserliana XXXIII).
150
Kapitel V
– nämlich die zwischen dem „blinden Treiben“ (von der insbesondere in der wichtigen Studie von 2004 20 die Rede ist), den „affektiven Tendenzen“ (= „erste Affekte“) und den „Affekten“ (= „zweite Affekte“). Das blinde Treiben betrifft im „archaischsten“ Register die „wilden (Welt-)Wesen“ – auf die also zurückgekommen werden muss – und dabei insbesondere ihren ontologischen (bzw. „proto-ontologischen“) Status. Inwiefern werden sie in der Tat durch ein solches „Treiben“ gekennzeichnet? Nach Richirs Dafürhalten sind die wilden Wesen der „Ort“ des „Proto-Ontologischen“ diesseits des Seins und auch des Seienden. Dieses Proto-Ontologische „schematisiert“ sich (das heißt, es ermöglicht für uns dessen „Be-greiflichMachen“) dank eines „phänomenologischen Schematismus“, der ursprünglich „in Abstand“ zu sich selbst steht. Das Verhältnis von phänomenologischem Schematismus und Proto-Ontologischem ist das eines „endlichen Unendlichen“ zu einem „unendlichen Unendlichen“. Zeitlich ausgedrückt, „scheint die proto-ontologische transzendentale Vergangenheit vergangener als alle schematisierte transzendentale Vergangenheit“ und „die proto-ontologische transzendentale Zukunft künftiger als alle schematisierte transzendentale Zukunft“.21 Sofern die wilden Wesen nun „immer schon und immer noch“ durch proto-ontologische „Tiefen [profondeurs]“ (d. h. durch Affektionen) „aufgeladen“ sind, da sie „schematisierte transzendentale Erinnerungen und Erwartungen“ sind, streben sie danach, „den inneren und ursprünglichen Abstand des Schematismus“ aufzuheben. Dieses durch die wilden Wesen „modulierte“ bzw. „irisierte“ Streben ist notwendig unendlich, weil dieser Abstand „nicht reduzierbar“ ist. Richir merkt hierzu an: „Durch seine architektonische Situation ist dieses unendliche Streben, das, wenn es sich vollenden würde, das phänomenologische Feld des Schematismus verschlingen würde, die archaischste Form der Affektivität, das, worin […] der ursprüngliche Abstand des Schematismus zu sich selbst verleiblicht und […] ‚Sehnsucht‘ genannt wird.“22 Hierbei sind jene „Irisierun-
20 M. Richir, „Pour une phénoménologie des racines archaïques de l’affectivité“, Annales de Phénoménologie, Nr. 3/2004, Beauvais, Association pour la promotion de la phénoménologie, S. 155–200. 21 A. a. O., S. 155. 22 Ebd.
Zeitlichkeit und Affektivität
151
gen“ und „Modulierungen“ nichts Anderes als das oben angesprochene „blinde Treiben“: Sie machen die – nicht intentionalen – archaischsten, das heißt „ursprünglich vielfältigen“, „blinden“ und „unbewussten“ „Affektionen“ aus. Es versteht sich von selbst, ganz gleich was Husserl darüber gedacht hat, dass dieses „blinde Treiben“ wesentlich dadurch charakterisiert ist, dass es nicht von Gegenwart zu Gegenwart gehen kann, denn die ursprünglichsten, sich darin (einer gewissen „Artikulierung“ gemäß) entfaltenden Assoziationen vollziehen sich „diesseits“ der „Zeitigung in Gegenwart“. Die in Richirs Zeitphänomenologie näher zu untersuchende Unterscheidung betrifft jene zwischen „affektiven Tendenzen“ und „Affekten“, die, so könnte man auch sagen, eine Unterscheidung zwischen zwei Arten von Affekten ist (den „ersten“ und „zweiten“ Affekten). Hiermit kann eine Antwort auf die schwierige Frage nach dem Status der „zeitlichen hylé“ geliefert werden. In den Bernauer Manuskripten hatte Husserl für das Problem der möglichen Vermittlung zwischen „Urimpressionen“ und deren retentionalen und protentionalen Modifizierungen eine „Lösung“ vorgeschlagen. Das Problem betraf hierbei den Wesensunterschied zwischen beiden. Diese Lösung bringt die Begriffe der „noematischen Formen“ sowie ihrer entsprechenden spezifischen „hyletischen Data“ ins Spiel. Husserl behauptet insbesondere, dass die letztkonstituierenden Phänomene der immanenten Zeitlichkeit – diesseits der Unterscheidung von Noesis und Noema im immanenten Sinne und also auf der Ebene der noetisch-noematischen Korrelation in ihrer radikalsten (nämlich „präimmanenten“) Bedeutung – einen sehr spezifischen hyletischen Charakter aufweisen (sie sind „unselbständige Bewusstseinskerne“23 bzw. „Kerngehalte“24 qua „Substrate“ der Noesis), der keinem Gegenstand zukommt, sondern der dem ursprünglich die Zeitobjekte konstituierenden intentionalen Bewusstsein zugesprochen werden muss.25 Für Richir ist der intentionale Charakter Vgl. Husserliana XXXIII, Beilage IV, S. 161. Husserliana XXXIII, S. 162. 25 Husserliana XXXIII, S. 161. Die Entkopplung der (präimmanenten) ursprünglichen Zeitlichkeit von der Gegenständlichkeit, die im „Urprozess“ und dabei insbesondere auf der Stufe seiner „Kerngehalte“ vollzogen wird, kann zweifelsohne (trotz Richirs Vorbehalte gegenüber einer intentionalen Auffassungsweise der zeitlichen hyle) als Antizipation – bei Husserl selbst – dessen ausgelegt werden, was Richir in Fragments phénoménologiques 23 24
152
Kapitel V
der zeitlichen hylé allerdings alles andere als selbstverständlich. Deswegen muss hier in der Tat eine Unterscheidung getroffen werden, nämlich die zwischen dem, was er den „ersten“ und den „zweiten“ Affekt nennt. Was ist damit genau gemeint? Zunächst sei daran erinnert, dass von „Zeit“ erst am Ende der architektonischen Transposition von Gegenwärtigkeit in Gegenwart die Rede sein kann, da die „Zeitigung in Gegenwärtigkeit“ lediglich eine „Proto-Zeitigung“ bezeichnet (dazu gleich mehr). Diese architektonische Transposition ist die, oben bereits angezeigte, der Phantasie-Affektion in Imagination und Affekt. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Affekttypen betrifft hier lediglich den „affektiven“ Rest, wenn man so will, dieser architektonischen Transposition (also von Affektion in Affekt) und nicht jener von Phantasie in Imagination. Dieser Affekt spaltet sich in die affektive Tendenz und in den Affekt selbst oder, anders ausgedrückt, in den „ersten“ und den „zweiten“ Affekt. Der erste Affekt ist ein „Form-Affekt [affectforme]“, „leere oder reine Form und bloße distentio, die einer Steigerungs- oder Minderungsvibration der Erregbarkeit entspricht“.26 Richir übernimmt auf dieser architektonischen Stufe – in der von Husserl in den Bernauer Manuskripten vollzogenen phänomenologischen Konstruktion der der präimmanenten Sphäre des transzendentalen Bewusstseins zukommenden Zeitlichkeit – ein Charakteristikum des „Urprozesses“ und seiner Kernstruktur. Dieses Charakteristikum betrifft die „Erfüllung“ und „Entleerung“ der Urkerne, sowie der retentionalen und protentionalen Kerne dieses Urprozesses. Was bei Husserl aber Erfüllung und Entleerung (bzw. Steigerung und Verminderung) der Kerne war, wird bei Richir zu einer Dimension der „Erregbarkeit [excitabilité]“ überhaupt. Er setzt
sur le temps et l’espace als „exogen scheinende Affekte“ bezeichnen wird. Dass Husserl selbst den Status der „Äußerlichkeit“ dessen, was dem noematischen Korrelat der intentionalen Noesis zugrunde liegt, in Frage stellt, ist in der Tat eine sehr wichtige Konsequenz aus der phänomenologischen Konstruktion der noematischen Seite des Urprozesses. Hierdurch eröffnet sich eine interessante Perspektive, die Ansätze wie diejenigen Fichtes und des frühen Schellings (bis zum System des transzendentalen Idealismus) mit jenen von Husserl, Henry und Richir in Verbindung zu setzen gestattet. 26 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 66.
Zeitlichkeit und Affektivität
153
diese in einen Zusammenhang mit bedeutenden Zeugnissen der philosophischen Zeit-Tradition: Mit diesem ersten Affekt, der den zweiten (einem empfindbaren Datum entsprechenden) Affekt nicht von vornherein enthält, verfügen wir also über die im eigentlichen Sinne oder rein zeitliche hyle, jene der ursprünglichen Ausbreitung „in der Zeit“, [d. h.] über das ursprüngliche Zeitdifferenzial, das dadurch zugleich das ursprüngliche Differenzial dieser hyle ist, die das Ich nicht erzeugt und nicht-ichlich, also für das Ich „passiv“ ist. Wir erkennen hierin die Plotin’sche diastasis, die distensio Augustins oder auch Levinas’ Diachronie. […] Wenn man so will, ist das […] die Gegenwart als reiner Übergang, die noch (durch transzendentale Abstraktion) durch keine Empfindung (= für uns der zweite Affekt) „besetzt“ wird, ihre Horizonte sind leer. Diese erste hyle, die durch ihren ursprünglichen Abstand zeitigend ist, in dem – Husserls Ausdrücken in den Bernauer Texten zufolge – ursprüngliche Retentionen und Protentionen, die den Verringerungen und Steigerungen der Erregbarkeitsschwelle entsprechen, gegeben werden, ist das, was wir in Phantasía, imagination, affectivité die „leere Zeit“ genannt haben.27
Der „erste Affekt“ bezeichnet also eine Art offenen Horizont der (variablen) „Rezeptivität“ einer Empfindung (= zweiter Affekt). Dabei ist diese Rezeptivität keinem „Bewusstsein“ oder „Subjekt“ (sei dies auch als „Urprozess“ verstanden) zuzuordnen, denn erst „in dieser Variabilität scheinen die sinnlichen Daten, selbst wenn sie Kerndaten sein sollten, ‚Subjekte‘ dieser Variabilität, die sie also nicht in sich selbst haben, zu werden“.28 Es handelt sich dabei aber nicht um eine „Selbstaffektion“ in Stile Henrys. Der zweite Affekt dagegen ist ein Inhalts-Affekt, der konkret empfunden wird, je schon in der distensio ausgebreitet ist und einem empfindbaren Datum entspricht. Dieser zweite Affekt entspricht Husserls Empfindung. Angesichts der Unterscheidung von erstem und zweitem Affekt kann der Affekt also nicht auf eine bloße Empfindung reduziert werden. Sein „äußerlich“ oder „exogen“ scheinender Charakter erklärt sich dadurch, dass er auf das noematische Korrelat der intentionalen Vermeinung „übertragen“ wird.29 Worin besteht nun genau die zeitliche Bedeutung davon? 27 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 49. Bezüglich der „leeren Zeit“, siehe Phantasía, imagination, affectivité, IV. Abschnitt, § 5. 28 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 48. 29 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 54–61, insbesondere S. 55 und 59.
154
Kapitel V
[…] Diese Bedeutung kann nicht die der Aufeinanderfolge von Früherem zu Späterem sein, da es sich um denselben Affekt handelt, von dem es widersinnig wäre zu behaupten, dass er sich selbst (in Protentionen) voranginge und sich selbst (in Retentionen) folgte. Die einzige Unterscheidung in ihm oder in Bezug auf ihn ist die des Alterns: die des älter oder jünger als er selbst gemäß Platons „Lehre“ des Einen im Parmenides: In der distensio ist der Affekt im Werden begriffen: Er wird in seiner noch frühen Jugend erweckt, reift in seinem sich einstellenden Höhepunkt und altert in seinem bereits eintretenden Einschlafen. Das ist unserer Auffassung nach die einzig30 mögliche, phänomenologisch kohärente Verständnisart der von Husserl in den Bernauer Manuskripten aufgewiesenen Struktur von Vorklang/Höhepunkt/Abklang, ohne dass dabei eine Reihenfolge des Früheren und Späteren vorausgesetzt werden muss, von der der Affekt selbst nichts weiß.31
Im Gegensatz zu Husserl interpretiert Richir diese „von Husserl aufgewiesene Struktur“ und das Älter- bzw. Jüngerwerden des Affekts nicht intentional, weil dies sonst „unvermeidlich einen fixen Mittelpunkt des Vermeinens (ein Ich) voraussetzte, einen Augenblick als zentralen Gesichtspunkt, der in zwei Richtungen offen wäre“.32 Richir fasst das folgendermaßen zusammen: Dies macht also das konstituierende Zeitbewusstsein möglich, ohne in einen unendlichen Regress zu verfallen, denn alles läuft in dieser oder jener Gegenwartsphase ab, aber auch in ihrer Unstetigkeit, denn jede Phase ist eine Phase der Erregbarkeit, des ersten „noch“ leeren Affekts, der selbst durch die Steigerung der Vorklänge (sein Wachwerden für den konkreten Affekt) und durch die Minderung der Abklänge (das Einschlafen des konkreten Affekts) begrenzt ist, und zwar von einem nicht zu verortenden „Grad Null“ aus bis zu einem genauso wenig zu verortenden „Grad Null“ (den Leerhorizonten der zweiten Affekte). Dies besagt, dass die diastasis oder distensio durch sich selbst ganz wie die Erregbarkeitsschwelle a priori unbestimmt und fließend ist und dass es phänomenologisch unangebracht wäre zu behaupten, die distensio ruhe stetig in sich selbst. Dies ist bestimmt auch
30 Für eine andere Lesart dieser Struktur, die ein Herabsteigen in die präimmanente Sphäre des transzendentalen Bewusstseins und eine „phänomenologische Konstruktion“ des „Urprozesses“ mit seiner „Kernstruktur“ notwendig macht, sei auf Temps et phénomène, op. cit., Abschnitt C, Kapitel III, S. 206–234 sowie auf Husserl et la phénoménologie constructive, op. cit., Kapitel IV, S. 182–195 verwiesen. 31 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 51. 32 Ebd.
Zeitlichkeit und Affektivität
155
der Grund dafür, dass Husserl der Auffassung war, dass allein die Assoziation die Einheit herstellen könne, was mit unseren Worten zumindest bedeutet, dass die passive Synthesis der unstetigen, aber dank dieses oder jenes zweiten, ihnen innewohnenden Affekts, unterschiedenen Gegenwartsphasen dazu beitragen kann, die Einheit der Zeit herzustellen – welche selbst noch keine […] Einheit eines Aufeinanderfolgens ist.33
Die soeben getrennt vorgetragenen Grundstücke einer höchst originellen Zeitanalyse sollen nun zusammengeführt werden, um deutlich werden zu lassen, wie Richir das Wesen der Zeit bestimmt. * Worin besteht in der Tat der entscheidende Beitrag der Phänomenologie Richirs zur Bestimmung des Wesens der Zeit? Um das herausstellen zu können, muss von der oben bereits erwähnten und von Richir vehement zurückgewiesenen Idee ausgegangen werden, dass die vermeintliche Stetigkeit der Zeit impliziere, nichts ginge im zeitlichen Ablauf gänzlich verloren. Richir schlägt eine Zeitauffassung vor, die diesem Husserl’schen Grunddogma diametral entgegensteht. Positiv lässt sich das Wesen der Zeit laut Richir durch ihre Unumkehrbarkeit bestimmen. Dieser Begriff enthält drei Aspekte. Da die Zeit nicht stetig verläuft, ist sie auch kein formaler Rahmen, in dem de jure alles aufbewahrt bliebe. Die Zeit ist vielmehr Vergessen. Ein Großteil dessen, was in unserem Leben geschieht, geht unwiederbringlich verloren. Dies ist aber nicht dem limitierten menschlichen Erinnerungsvermögen zuzuschreiben. Es besteht hier eine Analogie zur Wahrnehmung eines äußeren Gegenstandes: Wenn nicht zeitgleich alle Seiten eines Würfels wahrgenommen werden können, liegt das (bekannter Weise) wesenhaft an der abschattungshaften Gegebenheit dieses äußeren Gegenstandes. Und hier stehen die Dinge ganz ähnlich: Wenn wir uns nicht an alles Vergangene erinnern können, dann liegt das – wie Frédéric Vengeon treffend behauptet hat – daran, dass die „Wirklichkeit eine Struktur des Verlustes ist“. Und dies liegt wie gesagt nicht an irgendeinem Ungenügen der menschlichen Psyche, sondern hierdurch wird eine ontologische Struktur der Zeit selbst herausgestellt.
33
Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 51–52.
156
Kapitel V
Ferner bringt die Unumkehrbarkeit der Zeit ihr Altern zum Ausdruck. Auch dies darf nicht als eine Transposition oder Projektion eines menschlichen Erlebnisses auf die Natur der Zeit verstanden werden, sondern es ist vielmehr so, dass die Erfahrung des Alterns keine bloße Verminderung körperlicher und geistiger Fähigkeiten darstellt – jedes Altern setzt also das der Zeit selbst voraus, genauer: Die Zeit selbst wird immer älter als sie selbst (zugleich aber auch jünger). Schließlich drückt sich die Unumkehrbarkeit der Zeit auch dadurch aus – allerdings bloß auf einer abgeleiteten Ebene –, dass der Zeitpfeil lediglich in eine Richtung geht. Dieser rein formale Grundzug der Zeit ist kein bloßer Zeitmodus, sondern er folgt aus der Struktur der Zeit, die Richir sich in ihrem „archaischsten“ Register aufzuweisen vornimmt. Nachdem diese ersten Klarstellungen zur „Zeitigung in Gegenwart“ zum Abschluss gekommen sind, soll nun die „sprachliche Zeitigung in Gegenwärtigkeit“ untersucht werden, um herauszustellen, was jene „Zeitigung in Gegenwart“ fundiert. Diese Erläuterung wird das soeben über das Wesen der Zeit Herausgestellte bestätigen (ohne dass darauf eigens zurückgekommen wird) und die Anleitung für die Klarstellung der verschiedenen „Zeitstufen“ in Richirs Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace an die Hand geben. * Inwiefern kommt in der Sinnbildung die „Zeitlichkeit“ ins Spiel? Was bedeutet die Zeitigung „in Gegenwärtigkeit“? Antworten hierauf liefert das bemerkenswerte Fragment „Des phénomènes de langage.“34 Die „Sprachphänomene“, in denen – wie bereits zitiert – „Sinn sich zu stabilisieren oder zu ‚besitzen‘ sucht“ sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht eine ideale, fixierte, stabilisierte und dadurch „unzeitliche“ Bedeutung, einen Sachverhalt o. Ä. meinen, sondern dass das, was ausgesagt werden soll, gewissermaßen schon in unserem Besitz ist – sonst wüsste man ja nicht, was man genau sagen will – zugleich aber uns auch entgleitet – was eben nach dessen Festhalten (sei es auch nur vorübergehend) in der Sprache verlangt. 34
Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 19–28.
Zeitlichkeit und Affektivität
157
Dies hat die herausragende Bedeutung, dass der anbrechende Sinn – selbst in seinem inchoativsten Zustand – in einem und demselben Schlage Versprechen eines Sinnes, der sich nur durch seine Entfaltung offenbart, und Anspruch desselben Sinnes ist, den es eben gegenüber dem, was sich in ihm bereits offenbart hat, getreu zu entfalten gilt.35
Hierin besteht also die verborgenste zeitliche Dimension der Sinnbildung – und macht somit den ursprünglichen Ansatz der „Zeitigung ‚in Gegenwärtigkeit‘“ (für die der „Einfall“ ein beredtes Zeugnis abgibt) aus: Der Sinn, der sich auszusagen versucht, verweist, was sein Versprechen angeht, auf eine „künftige“ und, was seinen Anspruch betrifft, auf eine „vergangene“ Dimension. Da nun der sich aussprechende Sinn nicht als Idealität vermeint wird, sind die darin enthaltenen Proto-Protentionen und Proto-Retentionen keine solchen von etwas Gegenwärtigem, sondern sie wohnen dem, was sich auszusagen sucht, inne. Sie machen dadurch einen „inneren Abstand“ aus, der (wie bereits erwähnt) dem Abstand des „Schematismus“ entspricht. Mit anderen Worten, und hierauf wird zurückzukommen sein, die „Zeitigung in Gegenwärtigkeit“ ist die des phänomenologischen Schematismus selbst. „Sinn entfalten bedeutet also, Sinn in Gegenwärtigkeit ohne angebbare Gegenwart zu entfalten, den inneren Abstand zwischen den Protentionen und den Retentionen sozusagen zu verbreitern, um ihn um des Sinnes willen zu stabilisieren.“36 Diese Proto-Protentionen und Proto-Retentionen des Abstandes, welcher der Sinnbildung innewohnt, sind durch eine gegenseitige Verflechtung gekennzeichnet.37 Darüber hinaus impliziert die Entfaltung des Sinnes in Gegenwärtigkeit ohne angebbare Gegenwart dessen „Selbstheit“ (siehe weiter unten), das heißt, eine spezifische „Stetigkeit“, die nicht mit jener der „Zeitigung in Gegenwart“ verwechselt werden darf. Und zuletzt „verwandeln“ sich die Proto-Protentionen und
Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 20. Ebd. 37 Richir findet hier auf seine Weise eine der wichtigsten Entdeckungen der Bernauer Manuskripte wieder – nämlich die gegenseitige Verflechtung von „Protentionen“ und „Retentionen“ des „Urprozesses“ diesseits der immanenten Bewusstseinssphäre. 35 36
158
Kapitel V
Proto-Retentionen in ihrer Verflechtung, wobei „diese Verwandlungen die phänomenologischen ‚Zeichen‘ des Sinnes ausmachen“.38 Alle diese Punkte gilt es nun, näher zu erläutern. Zunächst muss hervorgehoben werden, dass der Zusammenhang von Sinn und ihn erfassendem „Subjekt“ keinesfalls als ein „Außen“ und „Innen“ aufgefasst werden darf. Es stellt sich hier genauso dar wie im Falle der (ursprünglichen) „Affizierung“ des „Subjekts“ durch die „Phantasien-Affektionen“, wo ebenfalls die Möglichkeit einer solchen Aneignung erwogen wurde, sofern die „Empfindung“ ihrerseits, wie man (von einem architektonischen Standpunkt aus) sagen könnte, aus der vorgängigen Gegebenheit einer Phantasie-Affektion resultiert. Der sich bildende Sinn ist keine äußere ideale Entität, sondern Sinn zu bilden, heißt, in diesem Bilden „der leistenden Selbstheit des Selbst“ (die selbstverständlich nicht die Selbstheit irgendeines Subjektes, sondern vielmehr die der Sinnbildung „leistenden“ Bewegung ist) „innezuwohnen [habiter]“, „sich an den Rhythmus der Zeitigung des Sinns in seiner Selbstheit sozusagen ‚anzulehnen’, das heißt die genuine Reflexivität des Sinns in seiner Selbstheit zu begleiten, ohne ihn ganz zu vollziehen“.39 Es sei also noch einmal betont: Wenn man in der Bewegung des SichBildens des Sinnes von einer „Subjektivität“ sprechen kann, dann nicht so, dass ein Subjekt sich auf einen „Sinn“, auf eine „Bedeutung“ oder auf eine äußere „Bedeutsamkeit“40 bezöge. Eine „Reflexivität“ gibt es hier überhaupt nur in dem Sinne, dass sie gewissermaßen dieser Bewegung selbst zugehört.41 Richir bezeichnet sie als
Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 21. Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 22. 40 Richirs Begriff der „Bedeutsamkeit“ deckt sich im Großen und Ganzen mit Husserls „Sinn“-Begriff, genauer: mit der Sinndimension, die durch den intentionalen Akt gemeint ist. 41 Dies erklärt, weshalb Richir diese „Reflexivität“ als eine solche kennzeichnet, „die keine Reflexion ist“: Die Art, wie der Sinn in seiner Selbstheit die Reflexivität begleitet, ist nämlich die „des Erweckens oder, wenn man so will, der unmittelbaren transzendentalen Apperzeption, des kantischen ‚Ich denke‘, das als solches nicht reflexiv ist, aber doch einem Sinnbildung leistenden Bewusstsein zugehört“, Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 22. Zur Unterscheidung von „Reflexivität“ und „Reflexion“, siehe auch D.-P. Zorn, Vom Gebäude zum Gerüst. Entwurf einer Komparatistik reflexiver Figurationen in der Philosophie, Berlin, Logos-Verlag, 2016. 38 39
Zeitlichkeit und Affektivität
159
„Reflexivität mit einer Selbstheit“, wobei diese „Selbstheit“ „eine gewisse ‚Kontinuität‘ des sich bildenden Sinnes in seinem Gleiten“ 42 selbst ist. Die ursprünglichste Korrelation (und damit auch die ursprünglichste „Entzweiung“) ist somit die „zweier“ Selbstheiten: jene des leistenden Ich einerseits und jene des sich bildenden Sinnes andererseits. Gleichwohl ist hier die letzte Stufe dieser Vertiefung des „reflexiven“ Charakters des sich bildenden Sinnes noch nicht erreicht. Wenn die Selbstheit des leistenden Selbst es vermag, sich an die Selbstheit des sich bildenden Sinnes „anzulehnen“, dann deshalb, weil die soeben herausgestellte ursprünglichste Zweiheit sich wiederum – und dabei noch grundlegender – auf eine „Einheit“43 zurückführen lässt (Richir bezeichnet diese zwar nicht als eine solche, aber dennoch handelt es sich zweifellos genau darum): nämlich auf eine „Reflexivität ohne eine Selbstheit“.44 „Der Sinn bildet sich nicht
Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 21. Dieser Begriff muss hier wie überall bei Richir mit Umsicht gebraucht werden. Diese Einheit – nicht Identität – ist prekär und offen. Obwohl für Richir (im Gegensatz zu Fichte und Husserl) die Vielheit (und nicht die Einheit) ursprünglich ist, wobei diese Vielheit, wenn sie konkret sein soll, nur eine Vielheit von „Wesen“ sein kann (da sie nicht gestiftet ist), muss diese Vielheit doch durch den Philosophen gestiftet sein. Die Vielheit ist eine Vielheit von Einem. Für Richir verweist dies auf das Selbst der Subjektivität (bzw. auf Plotins „Eines“). Daher auch die Unterscheidung in Richirs Werk zwischen der „architektonischen Struktur“ (= der Einheit) und den phänomenologischen Schreibarten selbst (= der Vielheit). Zur Bedeutung der „Einheit“ (qua „augenblicklicher Vibration“) beim ganz späten Richir, siehe Kapitel X. 44 Ist damit gesagt, dass die Selbstheit des leistenden Bewusstseins aus dem „Inneren“ der Selbstheit des sich bildenden Sinnes stammte? Keineswegs. Das (transzendentale) „tiefe“ Selbst (also die erste Selbstheit) wird genetisch durch den Moment des phänomenologischen Erhabenen (siehe Kapitel IX) konstituiert, das heißt durch die Unterbrechung des Sinnschematismus bzw. des außersprachlichen Schematismus. Die Selbstheit (oder das Selbst) des sich bildenden Sinnes konstituiert sich dagegen genetisch in der sprachlichen Zeitigung (der außersprachliche Schematismus wird dabei mit dem Selbst, das sich verdichtet hat, wiederaufgenommen). Beiläufig sei noch hinzugefügt, dass die Einführung dieser „Reflexivität ohne eine Selbstheit“ Richirs Analysen von jeder Art von „Daseinsanaly42 43
160
Kapitel V
völlig allein“45 (was die „Gegenwärtigkeit“ der Selbstheit des leistenden Selbst erklärt); und genauso „braucht“ der sich bildende Sinn „eine gewisse Zeit“, das heißt, er „zeitigt in Gegenwärtigkeit“ (sonst gäbe es überhaupt gar keinen Sinn). Diese „sprachliche Zeitigung in Gegenwärtigkeit“ – und das ist entscheidend – setzt somit voraus und wird innerlich gehalten von „etwas“, das die „Einschreibung“ der Zeitigung/Verräumlichung des Sinnes in seiner Selbstheit gestattet. Hierdurch kommt eine „relativ blinde Bewegung“ zum Ausdruck, die nichts anderes als der „phänomenologische Schematismus“ ist, das heißt, wie bereits erwähnt, nichts anderes als das Selbst-Erfassen (allerdings ohne ein Selbst) des sich bildenden Sinnes vor jeder Unterscheidung von „Subjekt“ und „Objekt“. Das ist allerdings nicht alles, denn die „Zeitigung in Gegenwärtigkeit“ stellt sich als noch komplexer dar. Die Zeitigung diesseits der „Zeitigung in Gegenwart“ ist im Erfassen eines sich bildenden Sinnes nicht „bloß“ diejenige zwischen „Protentionen“ und „Retentionen“, die ja nur sich verwandelnde Proto-Protentionen und Proto-Retentionen sind. In der Tat ist nämlich eine noch radikalere Unterscheidung zu treffen, bzw. ein noch tieferes Herabsteigen zu vollziehen. Dies spielt sich an der Grenze der Sprache ab, das heißt zwischen der (noch vorsprachlichen) Sinnregung und ihrem ersten sprachlichen „Ausdruck“. Dies wird deutlich, wenn man dieser „Sinnregung“ auf den Grund geht und auf ihre („anarchische“ und „ateleologische“) Quelle stößt. Sofern der Sinn – das ist ein hochbedeutsamer Punkt – nicht bloß Sinn von sich selbst ist, der sich „ex nihilo“ auf eine unverständliche Art aus sich selbst „erschafft“ (oder durch Gott erschaffen wird), sondern etwas Sinnvolles über etwas Anderes als sich selbst aussagt, kann der Sinn seine Anregung nur in etwas vor sich selbst finden, nämlich in dem, was zwar noch keine Regung des in Rede stehenden Sinnes, aber dennoch bereits Regung vielfältiger Sinne ist, wobei diese Regung vielfältiger Sinne eine Regung un-
tik“ unterscheiden. Dagegen lässt sich diese „Reflexivität ohne eine Selbstheit“ fruchtbar mit Fichtes Bildlehre und dabei insbesondere mit seinem „Reflexibilitäts“-Begriff in Verbindung setzen. 45 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 22. Diese Nicht-Reduzierbarkeit der Subjektivität nähert Richirs Ansatz jenem von Levinas an.
Zeitlichkeit und Affektivität
161
definierter Sinne ist, ganz in „Potentialität“, an der instabilen Grenze zwischen Sprachlichem und Außersprachlichem. Hier berührt in der Tat auf der Seite des Sprachlichen die Sprache das, was nicht sie selbst ist. 46
Es gibt also eine Sinnregung „vor“ dem Sinn selbst auf der Ebene dessen, was (je schon) eine Regung vielfältiger Sinne ist und zwar insofern, als der Sinn auf etwas Anderes als ihn selbst verweist und die Sprache sich auf Außersprachliches bezieht. Diese Grenze – und das macht einen wesentlichen Beitrag der Richir’schen Zeitphänomenologie aus – ist eine solche, weil das, was sie begrenzt, beiderseitig durch eine spezifische Zeitigung charakterisiert ist. Bis hierher wurde die „Zeitigung in Gegenwärtigkeit“ als Zeitigung des ursprünglichen Abstands zwischen (Proto-)Protentionen und (Proto-)Retentionen bestimmt. Nun erweist sich, dass diese bloß eine sprachliche Zeitigung in Gegenwärtigkeit ist. Angesichts der soeben behandelten Grenze zwischen „Sprachlichem und Außersprachlichem“ spaltet sich die „Zeitigung in Gegenwärtigkeit“ ihrerseits in sprachliche und außersprachliche Zeitigung in Gegenwärtigkeit. Hierbei fungiert wiederum die Reflexivität „noch ohne eine Selbstheit“, die nicht auf Protentionen und Retentionen eines sich bildenden Sinnes [verweist] [darin bestünde die „sprachliche Zeitigung in Gegenwärtigkeit“], sondern auf schematisierte transzendentale Erwartungen ohne télos des je Unreifen sowie auf schematisierte transzendentale Erinnerungen ohne arché des je Unerinnerbaren, d. h. auf proto-zeitliche (proto-räumliche) Horizonte der schematisierten transzendentalen Vergangenheit und Zukunft, die a priori nicht jene eines Sinnes oder mehrerer Sinne sind, welche in Gegenwärtigkeit gewesen sind oder es noch sein sollen.47
Diese Reflexivität ohne eine Selbstheit besteht in „Verwandlungen der Protentionen und Retentionen“ und „hält innerlich die sprachliche Zeitigung in Gegenwärtigkeit zusammen.“48 Was haben diese Verwandlungen der Retentionen und Protentionen genau zu bedeuten? Ihre Rolle besteht darin zu verdeutlichen, dass der Sinn „nicht in der Identität implodiert“, sondern offen bleibt (daher auch seine nicht reduzierbare Unbestimmtheit). Und diese Verwandlun-
Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 23. Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 23f. 48 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 22. 46 47
162
Kapitel V
gen selbst sind in der „remanenten Transpassibilität des sich bildenden Sinnes“ fundiert, das heißt in der Empfänglichkeit für die Transpossibilitäten, die den vielfältigen Sinnregungen, die in keiner Weise erschließbar sind (daher eben auch ihre „Transpossibilität“), eigens zukommen. Wir stehen hier also auf der dritten – der tiefsten – Stufe, jener der außersprachlichen Proto-Zeitigung. Nach Richirs Dafürhalten „bereitet“ diese Proto-Zeitigung die Zeitigung „vor“ und macht den letzten Grund des phänomenologischen Unbewussten (dem, was er das „Archaische“ nennt) aus. * Es kann also festgehalten werden, dass bei Richir wie auch bei Husserl (und bei Heidegger) drei Zeitstufen vorliegen: 1.) die „Zeitigung in Gegenwart“ (mit deren Regung, der Unterscheidung zwischen blindem Treiben, „erstem“ und „zweitem“ Affekt);49 2.) die „sprachliche Zeitigung in Gegenwärtigkeit“ (mit ihrer protentionalen und retentionalen Ausrichtung); 3.) die außersprachliche Proto-Zeitigung. Es erschließt sich hierdurch – in Entsprechung zu den bekannten Ergebnissen der traditionellen Zeitphilosophie, wonach die Quelle und der Ursprung der Zeit proto-zeitlich, wenn nicht gar außerzeitlich sind – eine nichtzeitliche, nämlich räumliche50 Bestimmung der ursprünglichen „Zeitlichkeit“ (von „außer“ und „Außen“ kann ja 49 Die Texte Nr. 14 und 15 von Husserliana XXXIII vervollständigen somit die „Zeitigung in Gegenwart“ (und stellen einen wichtigen zusätzlichen Beitrag zu Husserls Zeitphänomenologie dar), indem sie hier die affektive Dimension (und insbesondere die Tatsache, dass die Assoziationen in erster Linie Assoziationen der affektiven Tendenzen sind, bevor sie zu Vorstellungsassoziationen werden) mitberücksichtigen. 50 In Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace wird diese Notwendigkeit, den Raum zum Thema zu machen, deutlich, wenn es darum geht, auf die Frage zu antworten, wie ein „Außen“ gegenüber der „Innerlichkeit eines Innen“ gesetzt werden kann. Der erste Teil von Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace (über die Zeit) erschließt sich in der Tat erst nach der Lektüre des zweiten Teils (über den Raum), wodurch die Notwendigkeit des Übergangs zum nächsten Kapitel bereits vorgezeichnet ist.
Zeitlichkeit und Affektivität
163
nur in Bezug auf den Raum die Rede sein). Für Richir (wie übrigens auch für Figal) erhält somit die Phänomenologie der Zeit ihre letzte Begründung nur in und durch eine Phänomenologie des Raumes.
Kapitel VI Räumlichkeit und Äußerlichkeit Richir1 hat seine bedeutendsten Beiträge zur Raumkonstitution im zweiten Teil der Phänomenologischen Fragmente über die Zeit und den Raum, die sein letztes monumentales Werk geblieben sind, vorgelegt. Für ihn hängt die Frage nach der phänomenologischen Konstitution des Raums und insbesondere nach der Artikulierung von „Räumlichkeit“, „Leiblichkeit“ und „Phantasie“ mit dem grundlegenden Verhältnis von „Äußerlichkeit“ und „sich bildendem Sinn“ zusammen. Richir zielt darauf ab, zwei Fragen in ihrer Zusammengehörigkeit zu beantworten, nämlich: Was ermöglicht und sichert den Bezug zu einer Äußerlichkeit, die es zu verhindern vermag, dass die Sinnbildung in eine radikale Immanentisierung abgleitet? Und was ist überhaupt die leibliche Dimension jeder Sinnbildung? Es geht ihm also in erster Linie darum, nicht bloß Husserls Herausstellung des konstitutiven Zusammenhangs von Leib und Raum wiederaufzunehmen, sondern diesen insofern zu vertiefen, als aufgewiesen werden soll, dass hierdurch der Sinn als sich bildender betroffen wird. Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, Richirs höchst komplexe Ausarbeitungen bezüglich der Konstitution von Räumlichkeit und Äußerlichkeit nachzuzeichnen. Es wird dabei analytisch vorgegangen, wodurch es sich einmal mehr nicht vermeiden lässt, in die weit verzweigten Gedankengänge Richirs einzutreten, deren Bedeutung sich manchmal erst bei mehrmaliger Lektüre erschließt. In einem kurzen Schlussabsatz wird die gesamte Argumentation synthetisch zusammengefasst, um so deren Stringenz noch einmal prägnant herauszustellen. Von ihren phänomenologischen Betrachtungen über die Zeit, denen zufolge die „Äußerlichkeit“ der „Affekte“ darin gründet, dass diese auf das noematische Korrelat der intentionalen Meinung 1 Dieses Kapitel wurde zuerst unter dem Titel „Marc Richirs Phänomenologie der Raumkonstitution“, in Raum erfahren, D. Espinet, T. Keiling und N. Mirkovic (Hsg.), Tübingen, Mohr Siebeck, 2017, S. 31–46 veröffentlicht. Ich danke den drei Herausgebern ganz herzlich für ihre Erlaubnis, hier diese Ausarbeitungen leicht überarbeitet übernehmen zu dürfen.
166
Kapitel VI
„übertragen“ werden,2 bis hin zu jenen (späten)3 über die „Transzendenz“ und das „Selbst“ scheint die Richir’sche „Neugründung“ der Phänomenologie auf den ersten Blick eine Art „Verinnerlichung“ beziehungsweise „Immanentisierung“ des phänomenologisch Gegebenen zur Darstellung zu bringen. Eine solche Feststellung ist jedoch nicht haltbar: Nicht nur steht sie der scheinbaren Selbstverständlichkeit der Gegebenheit eines „realen Äußeren“ entgegen, sondern auch und vor allem haben die Begriffe der „Innerlichkeit“ und der „Immanenz“ ja nur in Bezug auf eine gewisse „Lokalisierung“ und d. h. eben auf ein äußeres Reales überhaupt einen Sinn. Zunächst reicht es hin, darauf zu verweisen, dass dieser Bezug laut Richir sowohl den grundlegenden Setzungscharakter, den er in seiner Lesart Husserls als „Doxa“ bezeichnet, als auch das, was hieraus folgt, nämlich das Problem des Status der „vor-räumlichen“ Äußerlichkeit, betrifft. Richir hatte bereits in Phénoménologie en esquisses4 dargelegt, dass die Wahrnehmung grundlegend durch eine ihr eigene Zeitigung gekennzeichnet ist – nämlich jener, dank derer die Doxa das Wesen, die intentionale Bedeutsamkeit des wahrgenommenen Gegenstands fixiert. Worin besteht nun genauer die Rolle dieser Doxa auf der räumlichen, bzw. vielmehr der vor-räumlichen Ebene? In der konstitutiven Betrachtung der „Räumlichkeit“ kommt die Doxa beim Übergang von dem, was den „räumlichen“ (bzw. den „vorräumlichen“) Charakter der chora5 (der Leiblichkeit, des Urleibs) ausmacht, hin zum „Außen“ bzw. zur eigentlichen „Äußerlichkeit“, d.h. da, wo die vereinzelten, einander äußerlich sich gegenüberstehenden Körper (bzw. Leibkörper) sich einschreiben, ins 2 Siehe den ersten Teil von M. Richir, Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, Grenoble, J. Millon, 2006, insbesondere das Fragment „La hylè proprement temporelle: autre relecture critique de Husserl sur le temps“. 3 Variations sur le sublime et le soi, op. cit.; Sur le sublime et le soi – Variations II, op. cit. 4 Phénoménologie en esquisses, op. cit. 5 Hierunter versteht Richir auf eine grundlegende Weise (und in Anlehnung an Platon) die völlig unbestimmte, amorphe, formlose, archaische Mitte zwischen (übersinnlichem) Denken und (sinnlicher) Ausdehnung (beziehungsweise Materie), die bei jeder Sinnbildung vorausgesetzt werden muss und jede Zeitigung und Verräumlichung möglich macht. Die Herausstellung des „Wie“ dieser Ermöglichung ist das Ziel dieser Untersuchung.
Räumlichkeit und Äußerlichkeit
167
Spiel. Worin besteht zunächst die Ur-Räumlichkeit der chora? Vom phänomenologischen Standpunkt aus betrachtet, also von jenem des Zugangs zur chora aus, verweist sie gerade auf die Leiblichkeit des „Urleibs“: In dieser Beziehung ist Husserls Lehre äußerst bemerkenswert. Der Urleib ist seiner Auffassung nach kein Körper, kann nicht in Körper unterteilt werden und enthält auch keine Körper; er bewegt sich nicht, befindet sich aber auch nicht in einer Ruhestellung. In diesem Sinne ist er der transzendentale Boden (die Ur-Arche) oder die transzendentale Erde, der formlose Behälter oder die Amme des Werdens, die Mutter als transzendentaler Schoß, als absolute transzendentale „Referenz“.6
Die Doxa ist der Ursprung jeder „Lokalisierung“. Wie findet diese nun aber genau statt? Und auf welche Art und Weise ermöglicht die Doxa die „erste Objektivierung“? Diese beiden Fragen verweisen laut Richir auf „dieselbe Bewegung“– und dass dies so ist, macht gerade die Originalität seines Ansatzes aus. Was zunächst die „erste Objektivierung“ angeht, schlägt Richir eine Lösung vor, die sich der Fichte’schen Trieblehre (und der Rolle, die die Affektivität darin spielt) annähert. Anstatt anzunehmen, dass ein physiologischer, biologischer oder gar psychoanalytischer Trieb eine Empfindung (zum Beispiel das Hungergefühl) bewirkt, wird „das Begehren (von diesem oder jenem partiellen ‚Gegenstand‘, von dem in der Psychoanalyse die Rede ist)“ durch das, was Richir den „Überschuss des zweiten,7 exogen scheinenden Affekts“ nennt, „hervorgerufen“.8 Wie von Richir des Häufigeren betont,9 „fungiert“ der zweite, exogen scheinende Affekt Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 268. Innerhalb seiner Theorie der „Affekte“ unterscheidet Richir auf einer transzendentalen Ebene – wie bereits erwähnt – zwischen dem „ersten Affekt“ und dem „zweiten Affekt“ qua „exogen scheinendem“. Ersterer bezeichnet gewissermaßen einen offenen Horizont, eine „Affekt-Form“, der eine Vibration der Steigerung beziehungsweise Verminderung der Reizbarkeit entspricht; letzterer ist der „empfundene „Inhalt“, die „Empfindung“ im Husserl’schen Sinn, die deswegen „exogen“ zu sein scheint, weil sie zwar eigens empfunden, ihre „Quelle“ aber auf eine den Reiz hervorrufende äußere Ursache projiziert wird. 8 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 271. 9 Siehe zum Beispiel Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 268, 271. 6 7
168
Kapitel VI
hier („durch eine Erregung“) als ein „Anstoß“ und ruft dadurch die triebhaften Tendenzen hervor. Hierdurch – und damit kommen wir zur Lokalisierung und insbesondere zur äußeren Lokalisierung – wird die räumliche Äußerlichkeit eigens konstituiert: In seiner „anstoßenden“ Funktion ruft der zweite, exogen scheinende Affekt nämlich in der Tat die äußere Empfindung und „die wahrnehmungsmäßige Doxa von etwas Äußerem, das die Empfindung in das hylemorphische Ganze des Noemas trägt, welches dadurch zu einem perzeptiven wird,“10 hervor. Das bedeutet, dass die Doxa hier gewissermaßen eine Mittlerrolle zwischen der affektiven Dimension des Urleibs und dem Außen spielt: Die Stiftung der Äußerlichkeit, des Außen der Realität, setzt das Vermeintsein – durch die Doxa – von etwas Lokalisiertem voraus, wobei diese Lokalisierung ihrerseits nur auf der Grundlage – wiederum dank der Doxa – eines Leibkörpers möglich ist, der im Leib (in der chora)11 gestiftet ist und sich dadurch eben in einem Außen „befindet“. Der Anstoß ruft somit auf der Ebene des zweiten, exogen scheinenden Affekts die wahrnehmungsmäßige Doxa eines äußerlichen Realen hervor. Richir fasst das folgendermaßen zusammen: Die Doxa ist nicht nur mit der architektonischen Transposition der Phantasie-Affektion in Imagination/Affekt und des Affekts sowohl in den leeren ersten Affekt (distentio, diastasis) als auch in den konkreten zweiten Affekt (der endogen ist und endogen scheint, da letzterer ja dessen doxischen „Akt“ in Gang setzt), sondern auch mit jener der chora (als „Behälter“ der PhantasieAffektionen) in den „Raum“ der Orte oder Situationen, wo etwas „Reales“ zur Erscheinung kommt, das heißt in ein Außen oder in eine Äußerlichkeit, die ohne solche Orte gar nicht bestünde, koextensiv.12
Um die Konstitution des Außen, der Äußerlichkeit, noch genauer analysieren zu können, muss nun die dem Leib eigene „Räumlichkeit“ näher bestimmt werden. Richir führt hierfür eine zweifache Unterscheidung ein, die ein bedeutsames Paradoxon zum Ausdruck bringt. Es muss in der Tat einerseits zwischen der Art der „Körperlichkeit“, die dem absoluten Hier eigen ist, und dem ihm entsprechenden „körperlichen Ganzen“, und andererseits zwischen den beiden Arten der „Räumlichkeit“, die diesen beiden Arten der Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 271. Siehe Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 273, 274. 12 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 272–273. 10 11
Räumlichkeit und Äußerlichkeit
169
„Körperlichkeit“ korrelieren, unterschieden werden. Die erste Unterscheidung entspricht der zwischen dem nicht darstellbaren, unteilbaren und dadurch „nicht lokalisierbaren“ Leib und dem „Leibkörper“, der das ihm entsprechende „körperliche Ganze“ bezeichnet, das als „materialisierbares“ in Stücke geteilt werden kann. Die dem Leib zukommende Räumlichkeit ist der „Ort“, der aristotelische „topos“, der ja bekanntlich als die „erste unbewegte (bzw. unbewegliche) Grenze des Umfassenden“13 definiert wird. Während der Leib (und korrelativ der Ort) nicht „im“ Raum verortet werden kann, ist der Leibkörper als körperliches Ganzes (holon) zumindest in räumliche „Teile“ teilbar (was impliziert, dass er einen „Teil“ des Raums einnimmt). Und was den ursprünglichen Status des Leibes angeht, so ist dieser „genauso auch [d.h. über die Tatsache hinaus, dass er der Ort seiner selbst ist] die Welt als Ort, obwohl er sich als solcher nur auf der Grundlage der Dualität oder sogar der ursprünglichen Pluralität von Orten, also von den Welten als absoluten Hier, eröffnen kann.“14 Das Paradoxon des Leibes besteht somit darin, dass er auf der Grundlage des absoluten Hier sowohl der Ort der Welt als auch jener der Welteröffnung überhaupt ist. Richir bringt das so zum Ausdruck: Das ist das Paradoxon […] der Koexistenz oder der transzendentalen Interfaktizität, in der die Orte (die absoluten Hier) nicht „Teile“ eines umfassenden Ortes, der jener der Welt wäre, sind, sondern jeder Ort, jedes absolute Hier eine Welt ist – ohne dass es eine Kompossibilität (zugleich bestehende Möglichkeit) zwischen beiden gäbe, da ihr Bezug schon „stärker“ ist als die Möglichkeit, weil sie ja die der Koexistenz ist, wo kein Ort den anderen – zumindest a priori – ausschließt (undurchdringbar sind bloß die Körper und Leibkörper).15
Um diesem Paradoxon zu entgehen, bietet Richir einen Ausweg an.16 Welcher Art ist diese mit dem Leib identische „Welt“? Sie ist auf eine grundlegende Art und Weise nicht mit sich selbst einstimmig – weil sie sonst ein körperliches Ganzes (holon) wäre, ein Leibkörper, der alle anderen Leibkörper mitumfasste. Für Richir bringt Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 285. Ebd. 15 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 285. 16 Siehe hierzu die kurzen Anmerkungen in Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 307. 13 14
170
Kapitel VI
diese Nichteinstimmigkeit einen „Abstand des Selbst zu sich selbst“ zum Ausdruck, der – dem Ansatz Merleau-Pontys entsprechend – zwei bedeutsame Konsequenzen hat. Einerseits vervielfältigt er die Welt in eine Unzahl von Welten, die ihrerseits nicht mit sich einstimmig und zugleich durch den phänomenologischen Schematismus aufeinander abgestimmt sind;17 und andererseits konstituiert er die „transzendentale Matrize“ des Raums und der Zeit. Wodurch rechtfertigt sich eine solche Behauptung? Bis hierher spielten in der Konstitution der räumlichen Äußerlichkeit die Doxa und die Empfindung (qua „zweiter“ exogen scheinender Affekt) eine bedeutsame Rolle. Was verleiht nun aber diesem, die erscheinende Äußerlichkeit stiftenden Prozess eine Konkretheit? Was ermöglicht den Übergang von einer erscheinenden zu einer „realen“ Äußerlichkeit? Um hierauf zu antworten, betrachtet Richir den „Urleib“ nun von einer anthropologisch-psychoanalytischen Warte aus. Hierbei kommt dem architektonisch höchst bedeutsamen „Blickaustausch zwischen Mutter und Säugling“ eine herausgehobene Rolle zu. Als „Urleib“ ist die chora nämlich auch die urräumliche Dimension des Säuglings, die „innerlich“ bleibt, solange es auf der affektiven Ebene dank des „‚Moments‘ des Erhabenen“18 zu keinem Überschuss kommt. Um diese, der chora eigens zukommende „UrRäumlichkeit“ näher zu bestimmen, führt Richir die Unterscheidung zwischen der „Alterität“ und der „Äußerlichkeit“ ein, die für den gesamten zweiten Teil der Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace bedeutsam bleiben wird: Während die jeweiligen Leibkörper des Säuglings und der Mutter sich im „Raum der Äußerlichkeit“ partes extra partes gegenüberstehen, „befinden sich“ die „absoluten Hier“ „desselben“ Säuglings und „derselben“ Mutter, die zueinander in einer „transzendentalen Koexistenz“ (oder in dem, was Richir die „transzendentale Interfaktizität“ nennt) stehen, in einem „Übergangsraum“ (im Sinne Winnicotts), d.h. in einem Raum, der durch eine „Präsenz“ gekennzeichnet ist, die keine „leibhaftige“ Anwesenheit erfordert und eben die besagte „Alterität“ ausmacht. 19 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 290. Siehe hierzu v. Vf. Wirklichkeitsbilder, op. cit., S. 206–208. 19 Richir merkt hierzu an: „Was auch immer er anblickt, blickt der erweckte Anblick im Angeblickten die Spur dessen an, was ihn erweckt hat“, Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 320. 17 18
Räumlichkeit und Äußerlichkeit
171
Dieser Übergangsraum ist dadurch ausgezeichnet, dass der Andere darin kein „Gegenstand“ für das „Ich“ ist und es darin überhaupt noch kein „Ich“ gibt, das etwa einbildungsmäßig aus sich heraus gelangen könnte, um sich an die Stelle eines anderen Ichs zu setzen. Bevor es durch den Anblick zu einem „Individuum“ wird, bildet der Säugling gemeinsam mit der Mutter – in einer Art „Vorpaarung“ oder „Urpaarung“ – den „transzendentalen Schoß“, einen „indifferenzierten, zugleich aber auch stabilen (oder relativ stabilen) Träger gegenüber dem Leben, das heißt […] den Behälter (hypodoché), die Amme (tithéné), die Mutter […].“20 Richir betont dabei, dass „es dort (und von einem nachträglichen Standpunkt aus betrachtet) nur eine ansätzliche Bildung des Außen – allerdings eines Außen, das der Phantasie noch innewohnt – gibt“.21 In diesem Blickaustausch werden das (menschliche) „Selbst“ und die erste Alterität (diesseits der räumlichen Äußerlichkeit) gestiftet. Hierbei muss zunächst von der Dualität des „Sehens“ und des „Anblickens“ ausgegangen werden, die sich gegenseitig voraussetzen und gleichsam zueinander in einem „Schwebeverhältnis“ (Fichte) stehen: Empirisch geht das Sehen dem Anblicken vorher (das Kleinkind ist zunächst ja gleichsam ein anonymes Sehen); „architektonisch“ setzt dagegen das Sehen das Anblicken voraus, denn der Blick ist „archaischer“ als das Sehen. 22 Im Blickaustausch wird das anonyme und herumirrende Sehen (des Kleinkinds) zum Anblicken erweckt, und der Blick der Mutter fixiert das Sehen des Säuglings in einem Blick, der seinen Blick kreuzt. Somit vermag der Säugling nur insofern zu blicken, als er angeblickt wird, als er verspürt (und fühlt), dass er angeblickt wird und zwar von einem „Irgendwoher“ her, das im tiefen Innern der Pupille nicht zu verorten ist, sich aber dennoch „bewegt“, „lebt“ und „zittert“, kurz: Er vermag nur insofern zu blicken, als [jenes „Irgendwoher“] leiblich ist. In diesem Blick tritt der Säugling wieder in den Übergangsraum ein, tauscht „etwas“ von seiner Leiblichkeit […] mit „etwas“ von der mütterlichen Leiblichkeit aus, wobei dieser Blick des Säuglings sich als eine in die chora gleitende Phantasie-Affektion konkretisiert. Mit anderen Worten, der Blick des Säuglings überrascht Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 281. Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 269. 22 Richir fügt an einer anderen Stelle hinzu, dass „das nicht verortbare Sehen […] sowohl diesseits als auch jenseits des Blickes ist“, Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 295. 20 21
172
Kapitel VI
sich dabei, den aktuellen und potenziellen Blick der Mutter anzublicken, bzw. diesen phantasiemäßig als durch Phantasie-Affektionen „durchlöchert“ „wahrzunehmen“.23
Diese Analysen des Blickaustauschs sind aus mehreren Gründen bedeutsam: Sie stellen den Kontrast zur reflexiven Philosophie her; sie zeigen den Unterschied zur Psychoanalyse Lacans an; sie liefern eine Definition des Menschen im Rahmen einer phänomenologischen Anthropologie. Richir hatte bereits anhand seiner in Phantasía, imagination, affectivité24 gelieferten Analysen des „Pseudo-Primordialen [le pseudoprimordial]“ betont, dass das selbst-reflexive, sich-selbst-setzende Selbstbewusstsein architektonisch betrachtet nicht ursprünglich ist. Insbesondere wird das Selbstbewusstsein nicht durch die Reflexion konstituiert. Dies wird dann auch durch die Analyse des Blickaustauschs bestätigt, denn „sich seiner selbst bewusst zu sein, heißt nicht, sich selbst zum Gegenstand einer inneren Wahrnehmung zu machen, sondern ganz im Gegenteil implizit die ‚perzeptive‘ Phantasie-Affektion (den Blick) des Anderen auf sich zu übertragen, ohne dass hierbei der Andere notwendig als ein gegenwärtiger Anblick da ist“.25 Und das schlägt dann natürlich auf den Status des „Selbst“ zurück: Weit davon entfernt, ein „cogito“ oder ein „sum“ zu sein, macht es lediglich eine Art „Hintergrund“ des Bewusstseins aus, der ihm ein präreflexives „Wissen“ seines Wachzustandes liefert.26 Die Tatsache, dass im Blickaustausch des Kleinkinds und der Mutter der Blick sich nicht als anblickend erblickt und hierdurch keine Spiegelung stattfindet, stellt eine ausdrückliche Kritik an der Rolle des „Spiegelstadiums“ für die Konstitution des „Selbst“ bei Jacques Lacan dar.27 Der „bekannte“ Irrtum bestehe laut Richir darin, das im Spiegel gesehene Bild des Körpers dem dem Leibkörper innewohnenden „Selbst“ anzugleichen. In Wirklichkeit ist dieses Bild jedoch nur ein Simulacrum, dessen Referent (= Bildsujet) nicht Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 286. Phantasía, imagination, affectivité, Grenoble, J. Millon, 2004. 25 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 335. 26 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 319 (bereits zitiert). 27 J. Lacan, „Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je“, in Ecrits I, Paris, Seuil, 1966, S. 92–99. 23 24
Räumlichkeit und Äußerlichkeit
173
einmal der Körper der sich im Spiegel sehenden Person ist, sondern lediglich ein eingebildeter, in gewissem Sinne „leibloser“ Körper: Das bedeutet, dass ich dieses im Bildsimulacrum erscheinende Subjekt (Bildsujet) nur dann als das Bild meiner selbst, oder vielmehr als das Bild meines Leibkörpers identifizieren kann, wenn es bereits für sich selbst gestiftet ist [eine Stiftung, die eben nur durch den mütterlichen Blick geleistet wird]. Zu behaupten, ich sei das selbst und nicht lediglich die sichtbare Seite meines Körpers, heißt, in die Spaltung des Imaginären zu verfallen, sich mit seinem eigenen Bild zu verwechseln, sich als „falsches Selbst“ aufzufassen […].28
Hieraus folgt eine neue Definition des Menschen im Rahmen einer phänomenologischen Anthropologie. Für Richir wird der Säugling erst durch den Blick der ihn anblickenden Mutter „vermenschlicht“!29 Die Stiftung des Menschen ist nämlich nur möglich, wenn die beiden Klippen eines absoluten Zusammenfallens und einer absoluten Trennung des Selbst mit beziehungsweise von sich selbst umschifft werden. Der Abstand des Selbst zu sich selbst gehört vielmehr, wie gesagt, einem „Übergangsraum“ an (Winnicott), der gerade durch den mütterlichen Blick eröffnet wird, was dem Selbst die Möglichkeit verleiht, sich in die Symbolisierung dessen, was „real“ abwesend ist, einzuschreiben. Laut dieser Bestimmung ist der Mensch also das im Abstand zu sich selbst seiende Wesen, das es vermag, sich im „Übergang“ zu halten.30
Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 274. Hieraus folgt, dass dieser Auffassung nach das pränatale Leben (noch) kein genuin menschliches Leben ist. Die dank des Blickaustauschs geleistete Stiftung des Menschen kann übrigens auf eine fruchtbare Art und Weise mit derselben Stiftung des Menschen in Levinas’ „Epiphanie des Gesichts“ in Beziehung gesetzt werden. Siehe hierzu v. Vf. En face de l’extériorité. Levinas et la question de la subjectivité, Paris, Vrin, 2010. 30 Richirs Entwurf einer „phänomenologischen Anthropologie“ enthält, etwas präziser formuliert, eine „negative“ (in Phantasía, imagination, affectivité) und zwei „positive“ Seiten (in den Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace und in den Fragments phénoménologiques sur le langage). Die negative Seite besteht darin, aufzuzeigen, dass im Ausgang von Binswanger eine Phänomenologie des „Menschen“ notwendig aus dem Rahmen einer Eidetik herausfällt, da es unmöglich ist, z. Bsp. die unterschiedlichen psychopathologischen Fallbeispiele aus irgendeiner Definition des „Wesens“ des Men28 29
174
Kapitel VI
Die gerade gemachten Unterscheidungen können nun für die Konstitution des räumlichen „Außen“ nutzbar gemacht werden. Das im Blick „in den Blick Genommene“ drückt eine Spannung aus, die für diese Konstitution eine entscheidende Rolle spielt. Einerseits wird hier ein Blick in den Blick genommen, der an einem „Ort“ angesiedelt ist, welcher ein absolutes Hier eines Leibs ausmacht. Das bedeutet, dass er keinerlei räumliche Ausdehnung hat und sich sozusagen auf einen „metaphysischen Punkt“ reduziert (auf dessen Status gleich näher eingegangen wird). Andererseits kann es, wenn die Leiblichkeit als „Schoß“ oder als chora in ihrer Ursprünglichkeit gefasst wird, keinen „anderen“ Leib geben, ohne dass dieser einen Leibkörper hätte, sodass das, was hier eigens gesehen wird, nicht der Leib der Mutter, sondern die Darstellung desselben – also sein Leibkörper – ist. Die Alterität des mütterlichen Leibes rührt eben daher, dass auch er als ein solcher Leibkörper erscheint. Mit anderen Worten: Trotz des Unterschiedes, der vom architektonischen Standpunkt aus betrachtet zwischen dem Anblicken und dem Sehen besteht, ist der Blickaustausch durch eine Vermittlung, durch einen gemeinsamen Vollzug beider ausgezeichnet. Richir deutet an, dass dieser Vermittlungsbezug, der ja letztlich ein solcher zwischen Alterität und Äußerlichkeit ist, es möglich macht, einen Ausweg aus dem oben angesprochenen Paradoxon zwischen der Einzigkeit des Leibes als einiger Welt und der Vielheit der Leiber, als Ort des Entspringens der Welt, das jedem absoluten Hier eigen ist, zu weisen.31 Der alles entscheidende Punkt hierbei ist die Tatsache, dass Richir den soeben aufgewiesenen Abstand zwischen dem Leib und dem Leibkörper, zwischen dem Ort und dem sich in ihm befindlichen Ganzen, mit jenem innerhalb des „phänomenologischen schen abzuleiten. (Aufgrund dieser Unmöglichkeit einer Eidetik des Menschen nimmt die Phänomenologie notwendigerweise eine besondere Rolle in der Richir’schen Neugründung der Phänomenologie ein.) Die „positiven“ Seiten bestehen darin, einerseits Winnicotts Werk für die transzendentale Phänomenologie fruchtbar zu machen, indem das ödipale Szenario der Vater-Mutter-Kind-Dreiheit durch den durch das „Mutter-Kind-Paar“ gebildeten, „transzendentalen Schoß“ ersetzt wird, und andererseits eine phänomenologische Genesis der Reflexion zu liefern, die den Bezug des Selbst zu sich selbst verständlich machen soll. 31 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 287.
Räumlichkeit und Äußerlichkeit
175
Schematismus“ – also zwischen32 dem schematisierten und dem sich bildenden Sinn – gleichsetzt.33 Sofern nämlich der Blickaustausch ein Sinnaustausch ist (= ein sprachliches Phänomen, in das eben der phänomenologische Schematismus hineinspielt) und dieser Austausch weder in einem physischen Ort (Leibkörper) noch in einem physischen Teil eines Ortes (körperlicher Teil innerhalb der Vermittlung von Leib und Leibkörper) „statt“finden kann, kann sich auch der Sinnaustausch nur im „‚Nirgendwo‘ der (immer noch übergänglichen) chora gegenüber dem topos“34 vollziehen, d.h. genauer in einer gewissen urtümlichen Gespanntheit des phänomenologischen Schematismus, die Richir das „Grundelement [élément fondamental]“ des Schematismus nennt und offenbar mit der Ur-Räumlichkeit in Zusammenhang gebracht werden muss. Für die genauere Bestimmung dieses Begriffs des „Grundelements“ weist das angesprochene, auf Fichtes Einbildungskraft verweisende Schweben zwischen Sehen und Anblicken die Richtung. Im Gegensatz zum in der Leiblichkeit (chora) verankerten Anblick, ist das Sehen, das ihm zwar wie gesagt empirisch vorhergeht, architektonisch aber nachfolgt, nicht lokalisierbar und dadurch notwendig an die phänomenologische Basis der Stiftung des Raums gebunden – und zwar durch eine „architektonische Transposition, die es [scil. das Sehen] in einen Nullpunkt überführt“.35 Gehen wir nun also auf dieses „Element“, dieses „Milieu“ des phänomenologischen Schematismus näher ein. Zur Klarstellung desselben muss noch einmal das Wesen der Phantasien-Affektionen (und insbesondere der „perzeptiven“ Phantasien-Affektionen) als phänomenologischen Konkretheiten (Wesen) der Phänomene im „Übergangsraum“ erläutert werden. Diese Phantasien-Affektionen bringen insofern den Schematismus 32 Dieses „Zwischen“ macht, wie gleich deutlich werden wird, durch ein architektonisches Gebot die (Voraus)-Setzung des „Grundelements“ notwendig. 33 Der – metaphysische – Grundgedanke dieser Gleichsetzung besteht darin, die Bewegung der Sinnbildung und die Verkörperung der Leiblichkeit, die sich wechselseitig erklären und erläutern, chiasmatisch miteinander zu verbinden. Richir will damit sagen, dass sich eine qualitative Selbigkeit zwischen der Leiblichkeit diesseits der Körperlichkeit und der Sinnbildung diesseits des gestifteten Sinns auftut. 34 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 290. 35 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 295.
176
Kapitel VI
und die Leiblichkeit (chora) ins Spiel, als sie phänomenologisch schematisiert, d.h. durch den phänomenologischen Schematismus „verflüssigt“ und „zerstreut“ werden, um dadurch „fixierbar“ und in der chora „aufgenommen“ bzw. „rezipiert“ werden zu können. Wäre die chora somit der „Ort“ dieser Schematisierung? Richir verneint dies, da „die chora als Behälter, Mutter oder Amme bereits zu konkret ist, bzw. zu sehr dazu neigt, zu affizieren oder affiziert zu werden, um die sozusagen indifferentere Rolle eines ‚Elements‘ der schematischen Entfaltung spielen“36 zu können. Und überhaupt „konstituiert der Schematismus keinen Ort, ist selbst an keinem Ort“ und „ist auch raumlos“.37 Gleichwohl vollzieht er sich doch „irgendwo“, bzw. „in irgendetwas“, wenngleich dieses „Irgendwo“ „nicht topisch“ und „nicht räumlich“ (somit also gewissermaßen, wie von Richir im gerade zitierten Satz behauptet, ein „Nirgendwo“) ist. 38 Einem architektonischen Gebot folgend wird Richir nun also dazu angeleitet, das besagte „Grundelement“ einzuführen, welches eben das „Element“, „Milieu“ oder „Medium“ des phänomenologischen Schematismus ist. Worin besteht hierbei aber der Zusammenhang mit dem „Übergangsraum“? Dieses Milieu, das sei noch einmal wiederholt, ist ortlos, und es ist auch nicht räumlich oder im Raume: Es ist das „Milieu“ oder „Element“ des Übergangsraums, eines, wenn man so will, unendlichen Übergangs (transition) zwischen der chora und dem Topos, nicht die Leiblichkeit selbst, sondern ein „Element“ der Leiblichkeit. Wie man weiß, sahen Platon und die Vorsokratiker dieses als eine körperliche Substanz an (Wasser, Erde, Luft, Feuer): Was kann das aber in der Phänomenologie besagen? 39
Richir bezeichnet als „Grundelement“ jenes „immaterielle, zutiefst rätselhafte ‚Element‘ (weder Feuer, noch Luft, noch Wasser, noch Erde), das die chora ‚durchschüttelt‘ und von derselben ‚durchgeschüttelt‘ wird – und einen Teil der phänomenologischen Basis von
Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 301. Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 297. 38 Zweifellos hallt in diesen Ausführungen Levinas’ Idee der „utopie“ wider, ohne dass Richir sich jedoch dessen ethischen Standpunkts zu eigen machen würde. 39 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 301. 36 37
Räumlichkeit und Äußerlichkeit
177
Raum und Zeit ausmacht“.40 Es ist übergangsmäßig – und zwar deshalb, weil sich der phänomenologische Schematismus nur in einem unendlichen Übergang vollziehen kann, der allein durch den Anblick (im Sinne Richirs) zugänglich wird. Dieses „Übergehen [transire]“ findet nicht zwischen zwei im Vorhinein bestimmten Orten statt, sondern es verortet diese zuallererst selbst (freilich bloß „ungefähr“, mit einer „nichtreduzierbaren Restunbestimmtheit“).41 Es wird also nicht nachträglich gesetzt, sondern vollzieht eine „Genesis“ (im Fichte’schen Sinne), die freilich insofern durch das Prisma der Richir’schen Mathesis der Instabilitäten betrachtet wird, als Richir – im Gegensatz zu Fichte – der Genesis keine (reflexiv) höherstehende Seinsart zuerkennt. Die andere Grundcharakteristik dieses Elements besteht über den Übergangscharakter hinaus darin, dass es den Sinn beisammenhält – und zwar mit dessen Abstand und Abweichungen. Richir kennzeichnet daher die Rolle des „Grundelements“ für den Schematismus wie folgt: Ohne das „Element“ fiele der Schematismus in sich zusammen, er verlöre seine Dynamik und wäre lediglich eine Gestalt (schema) des Raums. Mit anderen Worten, der Abstand des „Elements“ ist weder räumlich (er ist noch nicht die diastasis, die mit dem Nullpunkt wechselseitig flimmert), noch zeitlich (er ist genauso wenig die diastasis der Gegenwart), und gleichwohl ist er nicht nichts, sondern das „Element“ selbst der chora (und in der chora), in das die Phantasie-Affektionen als Widerklänge, innerhalb der archaischen Affektivität, der schematischen Verdichtungen/Zerstreuungen hineingleiten. Noch einmal: Die chora gibt es nur insofern, als es diese Verdichtungen/Zerstreuungen gibt, die sie „erleidet“, zugleich aber auch „hervorruft“. Hierdurch wird noch auf eine andere Weise ersichtlich, dass nicht die chora der Raum ist, sondern dass, wenn die Abstände der Schematismen „sich selbst“ gegenüber in Strecken (in unbestimmte diastemai) transponiert werden, diese Abstände gleichsam die phänomenologische Basis (nicht das Fundament) des Raums ausmachen, sofern die Stiftung desselben nur dank des (nicht räumlichen) Nullpunktes möglich ist, der für jede Übereinstimmung – und zwar insbesondere der des Raums mit sich selbst – unabdingbar ist [und der, wie ersichtlich werden wird, mit diesen „diastemai“ wechselseitig flimmert].42
Ebd. Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 302. 42 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 303. 40 41
178
Kapitel VI
Man sieht also, und das wurde ja bereits an mehreren Stellen deutlich, dass die Stiftung des Raumes auf jener des Punktes (der mit einer ursprünglichen diastasis wechselseitig flimmert) beruhen muss. Diese Stiftung und dieses Flimmern gilt es nun näher zu betrachten, denn nur so kann verständlich werden, wie die reale Äußerlichkeit abschließend konstituiert wird. Der Mensch wird, wie bereits erwähnt, durch seine ursprüngliche Nichteinstimmigkeit, durch seinen ursprünglichen Abstand qua „Nichts von Raum und Zeit“ zwischen dem „Selbst“ und dem „Selbst“ definiert, also durch das, was Richir eine „Nichthaftung“ bzw. „Nichtangebundenheit“ an unser Leben und an unsere Erfahrung“43 nennt. Dies ist übrigens ein wesentliches Indiz dafür, dass das Grundelement absolut transzendent 44 ist – denn wenn es einen Abstand gibt und dieser nicht räumlich ist, dann muss in der Tat ein „Milieu“ angenommen werden, in dem er sich entfalten kann. Wo tut sich aber dieser Abstand genau auf? Zwischen dem Leib und dem Leibkörper? Innerhalb des Schematismus? Zwischen der chora und der Affektivität? Zwischen dem, was dem Schematismus und dem, was der ur-ontologischen Sphäre angehört? Oder gar zwischen der chora und dem Grundelement selbst? Dieser Abstand besteht zwischen allen hier entgegengesetzten Begriffen. Die entscheidende Frage ist nun, was eben die letzte Quelle des wirklichen Außen ausmacht. Antwort: Diese besteht im Übergang von der NichtÜbereinstimmung (des Abstands qua Nichts von Raum und Zeit) zur Übereinstimmung. Dieser Übergang wird in zwei Schritten vollzogen. Genauer erläutert werden müssen dabei die Stiftung der wirklichen Entäußerung (die zwei Teile enthält) sowie das „Flimmern“ von Punkt und unbestimmter Urstrecke (diastasis). Der erste Teil der Stiftung der wirklichen Entäußerung besteht in Richirs Auslegung eines wichtigen Gedankens Maine de Birans, der den Bezug von Affektivität und Räumlichkeit betrifft. Das „Urfaktum“ des (menschlichen) Bewusstseins besteht für den französischen Philosophen des 19. Jahrhunderts in dem (an die zweifache Tätigkeit des Fichte’schen Ich erinnernden) Phänomen einer Anstrengung (eines „Ichtriebs“), sofern diese notwendig auf einen Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 329. Das „Grundelement“ darf dabei nicht mit der „absoluten Transzendenz“ (so wie Richir sie in den Variations sur le sublime et le soi eingeführt hat) verwechselt werden. 43 44
Räumlichkeit und Äußerlichkeit
179
Widerstand trifft. Laut Richir handelt es sich dabei um einen Kontakt „zwischen der Affektivität, der Leibhaftigkeit und der Leiblichkeit (die ebenso sehr eine Phantasieleiblichkeit ist); dieser ist allerdings kein körperlicher Kontakt, d. h. er ist ohne jeden Kontakt-Punkt (oder -Fläche), also ein Kontakt im und durch den Abstand als Nichts von Raum und Zeit“.45 Dieses „Urfaktum“ wirkt insofern auf das „wirkliche“ Außen ein, als es den „Übergang“ vom Affekt in die Empfindung ermöglicht: „Die Anwendung der einigen Zweiheit dieser Leibhaftigkeit/Leiblichkeit auf diesen oder jenen Affekt entäußert diesen sozusagen, indem sie ihn in einer Empfindung konkretisiert, die dadurch eine Empfindung eines Äußeren ist oder vielmehr, streng genommen, eine Empfindung, die sich gleichursprünglich mit einem Außen erstreckt.“46 Diese Beschreibung reicht aber noch nicht hin – es stellt sich nämlich die Frage, wie diese wirkliche Entäußerung sich genau vollzieht. Entscheidend hierbei ist die Rolle der architektonischen Transposition des Grundelements und des Abstands qua „Nichts von Raum und Zeit“ in einen Punkt, der „den einzigen nicht-räumlichen Abstand“ ausmacht, welcher „im Raum denkbar“47 ist. Was in dieser Transposition erhalten bleibt, ist die Tatsache, dass dieser Punkt nicht räumlich ist; was verloren geht, ist der Abstand – „nicht ganz allerdings, weil dieser gewissermaßen nach außen geworfen wird!“48 Bemerkenswert ist dabei, und dies macht den zweiten Teil der Stiftung der wirklichen Entäußerung aus, dass die betreffende architektonische Transposition sowohl einen – nicht räumlichen und nicht messbaren – Punkt als auch eben dank dieses „Wurfs hinaus“ das wirkliche „Außen“ konstituiert. Diese Konstitution oder vielmehr: diese „Transposition in einen Punkt“ enthält drei Momente. Es soll jetzt kurz diese Analyse49 nachgezeichnet werden, um darin das Wesentliche für die Stiftung des wirklichen „Außen“ bei Richir festzuhalten.
Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 334. Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 334–335 (hervorgehoben v. Vf.). 47 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 327. 48 Ebd. 49 Siehe Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 357–361 (insbesondere S. 359–360). 45 46
180
Kapitel VI
Worin bestehen zunächst diese drei Momente? In drei Arten von Punkten, bzw. „drei ‚Stufen‘ der ‚Monade‘“: dem „metaphysischen“, dem „mathematischen“ und dem „physikalischen“ Punkt. Der „metaphysische“ Punkt ist zwar absolut unausgedehnt, zugleich aber – und hierin besteht für ihn die durch die Transposition verloren gegangene Spur der chora – durch eine „appetitio“ und eine „perceptio“ (Leibniz) ausgezeichnet, die Richir als „implizite Transponiertheiten“ der Affektivität und des Schematismus auffasst. Der „mathematische“ Punkt ist ein Gesichtspunkt auf den (ebenfalls mathematischen) Raum. Und der „physikalische“ Punkt ist eine „gleichzeitige Wiederholung der Setzung“ (des Punktes qua Einheit). Diese drei Punkte sind insofern zusammengehörig, als es so scheint, als „hätte Leibniz versucht, das ‚Loch‘ zu denken, durch das die architektonische Trans-position des Grundelements hindurchgeht und hierdurch zugleich den Durchgang zum zunächst mathematischen (idealen) und dann physikalischen Raum eröffnet“.50 Was geschieht auf der ersten – der metaphysischen – Stufe? Folgende Situation ergibt sich aus der architektonischen Transposition des Abstands qua „Nichts von Raum und Zeit“ für die Affektivität (insbesondere für die Phantasien-Affektionen) und für den Schematismus: „Die Affektivität transponiert sich in appetitio und die ‚perzeptive‘ Phantasie in perceptio,“51 welche zwei Pole einer „Mobilität“ ausmachen, die den metaphysischen Punkt kennzeichnet; und der Schematismus verliert sich eben in dieser Mobilität beider, woraus eine verräumlichende distentio entspringt.52 Auf der mathematischen Stufe überträgt sich diese erste Dualität in eine zweite – jener von mathematischem Punkt und mathematischem Raum.53 Dies bedeutet (um einen anderen Begriff von Leibniz aufzugreifen), dass „die Setzung der Einheit (Monade) sich in
Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 357. Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 360. 52 Es handelt sich hierbei somit um eine (flimmernde) Dualität zwischen dem Punkt, sofern er fixiert wird, und seiner Mobilität in der distentio, auf die gleich näher eingegangen wird. 53 Siehe hierzu Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 360– 365. 50 51
Räumlichkeit und Äußerlichkeit
181
eine Setzung der Monade als (vereinigtem) 54 Gesichtspunkt auf das Universum überträgt“.55 Letzteres ist insofern räumlich, als der Raum durch seine mit sich selbst einstimmigen Punkte in Teile, die sich selbst gegenüber äußerlich sind, geteilt werden kann, beziehungsweise insofern, als in einem gleichen Maße das „Dort“, welches im „Übergangsraum“ bloß das Zeichen der Alterität war, zu einem äußeren „Dort“, also zu einem prinzipiell messbaren (quantitativen) Abstand zum „Hier“ wird – wobei das, was den Abstand zum „Hier“ definiert, auf diesem Register zunächst die Extremität der Strecke, nämlich den Punkt (beziehungsweise je nach der betrachteten Dimension des Raumes die Linie oder die Fläche), ausmacht und jene Punkte (des „Hier“ und des „Dort“) beliebig nah beieinander oder weit voneinander entfernt sein können.56
Auf der dritten – der physikalischen – Stufe decken sich der Ort (des Leibes), der Körper (des Leibkörpers) und das wechselseitige Flimmern von Punkt und Raum. Dabei spielt die Zeitlichkeit hinein, die somit für Richir, wie bereits angedeutet, auch für die Konstitution des Raumes bedeutsam ist. In der Tat gestattet es die Gleichzeitigkeit, den Punkt als eine „gleichzeitige Wiederholung der Setzung“ zu verstehen (um noch einmal auf Leibniz zurückzugreifen), das heißt als „Einstimmigkeit mit sich selbst aller möglichen Punkte des Raums im mit sich selbst einstimmigen Ablauf des Augenblicks in der Zeit (wobei der Raum sich in sich selbst ergießt)“.57 Was sich dort wiederholt, ist die Setzung; der Punkt ist ihr Resultat. Der zweite Schritt des Übergangs von der Nicht-Übereinstimmung (des Abstands) zur Übereinstimmung besteht in dem bereits angesprochenen, phänomenologischen gegenseitigen „Flimmern“ von Punkt und verräumlichender distentio (= „Ausdehnung“). Eine Schwierigkeit der Leibniz’schen Konzeption einer „gleichzeitigen 54 Das soll nicht heißen, dass dieser „Gesichtspunkt“ ausschließlich ein mathematischer wäre. Anstatt ihn auf die „Mathematisierung der Natur“ zu beschränken, wäre es vielleicht fruchtbarer, ihn als einen möglichen Ausweg aus dem mehrfach angeführten Paradoxon zwischen der Einzigkeit des Leibes als einiger Welt und der Vielheit der Leiber qua Entspringungsorte der Welt anzusehen. 55 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 363. 56 Ebd. 57 Leibniz spricht dies in einem Brief an den Pater des Bosses an, der auf den 21. Juli 1707 datiert ist (Die Philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, C.I. Gerhardt [Hsg.], Hildesheim, 1960, Band II, S. 335).
182
Kapitel VI
Wiederholung“ der Setzung besteht offenbar darin, dass sie eine zeitliche Folge vorauszusetzen scheint. Wie kann in der Tat eine Wiederholung aufgefasst werden, ohne dass hierbei eine zeitliche Folge veranschlagt wird? Das stellt für Richir in Wirklichkeit aber kein größeres Problem dar, da er – auf die entscheidende Rolle der Doxa zurückkommend und ihren Bezug zum „Grundelement“ herstellend – darauf verweist, dass diese Wiederholung eine „schematische“ ist, „das heißt, eine sich wiederholende Wiederholung des Flimmerns des Augenblickpunkts und der (zeitigenden und verräumlichenden) diastasis – wobei dieses Flimmern in einem Schlage die Zeit der Gegenwart und den homogenen Raum ausmacht“.58 Das kann nur so verstanden werden, dass das „Grundelement“, wie gesehen, durch ein architektonisches Gebot zugrunde gelegt werden muss – denn sonst wäre ja der „fixierende“, die chora ins Spiel bringende Vollzug dieses Schematismus (und insbesondere dieses „Milieus“) gar nicht möglich. Das „phänomenologische gegenseitige Flimmern“ von Punkt und diastasis spielt also – durch die architektonische Transposition der „einigen Zweiheit“ von Grundelement und chora in die „einige Zweiheit“ von Punkt und Ausdehnung – in die Raumkonstitution mit hinein. Laut Richir kann die Konstitution des Raums somit folgendermaßen auf den Punkt gebracht werden: Wenn das gegenseitige „Flimmern“ von Punkt und Ausdehnung sich trotz der Transposition der Nicht-Setzung in die Setzung schematisch wiederholt, kann behauptet werden, dass, insofern dieses „Flimmern“ auch jenes gegenseitige von Augenblick und zeitlicher diastasis (in Protentionen und Retentionen) ist, das, was sich hierin vollzieht, das Ziehen einer Linie ist, die nicht a priori bestimmt – also gleichsam „abenteuerlustig“ – und gegenüber jeder äußeren Bestimmung blind ist, und dass es sich nur durch die Setzung des mit sich selbst identischen und einstimmigen Schematismus in ein fixiertes Schema einer idealen Figur (Linie) verwandeln kann, die je schon und immer noch in ihrem Verlauf festgesetzt ist […]. Und hierdurch wird – in unserer Ausdrucksweise – der Übergang von der verräumlichenden distentio oder der Ausdehnung zum Raum vollzogen. Die Fluxion [= diastasis], die mit dem Punkt im „Flimmern“ begriffen ist, ist im archaischsten Register der Transposition allerdings gar nicht vorstellbar (bzw. „metaphysisch“), da sie ja die leere Spur (ohne Phantasien-Affektionen) der chora ist, also eine diastasis des Punktes ohne Sinn und Richtung – und gerade dies 58
Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 364.
Räumlichkeit und Äußerlichkeit
183
konstituiert offenbar in seinem gegenseitigen Flimmern mit dem Punkt die Ausdehnung als Phänomen und nichts als Phänomen.59
Sofern diese „Fixierung“ wie gesagt mit der Doxa zusammenhängt, wird einerseits die (oben analysierte) grundlegende Rolle letzterer in der Konstitution der räumlichen Äußerlichkeit bestätigt; und andererseits wird dadurch ersichtlich, wie der phänomenologische Schematismus die „Einschreibung“ der räumlichen Äußerlichkeit in die chora ermöglicht. * Der hier vorgestellte Denkweg soll jetzt noch einmal zusammengefasst werden. Der Ausgangspunkt der Überlegungen Richirs bezüglich der Konstitution des Raums ist die für die Leserinnen und Leser Husserls sowie Heideggers vertraute These, dass die ursprüngliche Räumlichkeit keine objektive, „subjekt“-unabhängige und leibungebundene Dimension ausmacht, sondern in eine Ebene hineingenommen werden muss, die von ihm als „Ur-Räumlichkeit“, transzendentaler „Schoß“ oder „Urleib“ bezeichnet wird. Um die Konstitution des Raums vollziehen (und nachvollziehen) zu können, müssen zunächst zwei wesentliche Aspekte, die laut Richir ineinander verwoben sind, hervorgehoben werden, nämlich einerseits eine grundlegende „doxische“ Setzungstätigkeit, die eine „fixierende“ Funktion hat, und andererseits die Bildung eines „Außen“, einer „Äußerlichkeit“. Im Hintergrund des gesamten zu entwickelnden Ansatzes steht die Unterscheidung zwischen der „Alterität“ und der „Äußerlichkeit“ im engen Sinne, die jener zwischen „Leib“ und „Leibkörper“ entspricht, die ihrerseits ihre jeweils eigene „(ur-)räumliche“ Dimension haben – der „Leib“ den „Topos“ und der „Leibkörper“ die „räumliche Situiertheit“. Auf der Grundlage dieses begrifflichen Rahmens stellt Richir dann drei, für die Raumkonstitution fundamentale Thesen auf: Erste These: Die Raumkonstitution vollzieht sich gemäß einer „ersten Objektivierung“, die – dank des primordialen „Blickaustauschs“ – die der Mutter durch den Säugling ist, sowie gemäß einer
59
Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 365f.
184
Kapitel VI
grundlegenden „Lokalisierung“, welche beide zusammen und untrennbar „dieselbe Bewegung“ beschreiben. Hierin spielt einerseits die „Doxa“ und andererseits der „Anstoß“ durch die „Empfindung“ (= „[zweiter] exogen scheinender Affekt“) hinein. Dank der Konkretisierung dieser Bewegung im „Blickaustausch“ wird deutlich, dass hier eine Spannung von Leib und Leibkörper, von Alterität und Äußerlichkeit besteht, die zugleich einen „Abstand“ zeitigt. Zweite These: Der „Abstand“ zwischen Leib und Leibkörper ist identisch mit jenem innerhalb der „Dynamik des Transzendentalen“, die Richir als den „phänomenologischen Schematismus“ bezeichnet – was, auf den Punkt gebracht, nichts anderes bedeutet als schlicht, dass das Denken (bzw. Sprechen) leiblich-räumlich waltet. Richir begründet diese bemerkenswerte, starke, metaphysische These durch die Einführung der fundamentalen Dimension eines „Grundelements“, das für ihn einen wesentlichen Teil der Raumkonstitution ausmacht, und insbesondere durch die Einsicht, dass der Abstand innerhalb dieses „Grundelements“ das Element des Urleibs selbst ist. Dritte These: Die Stiftung des Außen wird durch den Übergang von der den Abstand kennzeichnenden „Nicht-Übereinstimmung“ (des Abstands) zur fixierten „Übereinstimmung“ geleistet. Dieser Übergang enthält zwei Stufen: erstens, die Stiftung der „Entäußerung“, die einerseits den sich auf Maine de Biran berufenden Bezug von Affektivität und Äußerlichkeit und andererseits die Transposition vom „Nichts“ in einen „Punkt“ (und zwar auf einer metaphysischen, einer mathematischen und einer physikalischen Ebene) ins Spiel bringt; und zweitens das gegenseitige „Flimmern“ von Punkt und diastemai (= unbestimmten, urräumlichen Strecken), das den Bezug zwischen der „Doxa“ und dem „Grundelement“ verständlich macht. Alle drei Thesen entwickeln kohärent die nicht nur anfängliche, sondern dann konsequent weiterverfolgte Idee, der zufolge die ursprüngliche Raumkonstitution sowohl eine „schematisierende“ (im Sinne des „phänomenologischen Schematismus“) als auch eine leiblich-affektive, in der eigentlichen Bedeutung „veräußernde“ Dimension hat. In diesem Sinne verfolgt Richirs Absehen auf eine Neubearbeitung einer „transzendentalen Ästhetik“ mit vollem Recht das Ziel, die Raumproblematik aus dem begrenzten Rahmen der „Sinnlichkeit“ herauszunehmen und ihr ihren in der Vielfältigkeit der Sinnbildungsproblematik gebührenden Platz zuzuschreiben.
Kapitel VII Die Stiftung der Idealität Das Problem der Idealität und ihrer Stiftung1 durchzieht Richirs gesamtes Werk und hat in L’institution de l’idéalité (2002) – eine Art eigenständiger Beilage zu Phénoménologie en esquisses (2000) – seine ausgeprägteste Ausarbeitung gefunden. Zwischen diesem Buch und Fragments phénoménologiques sur le langage (2008) hat sich die Position Richirs jedoch noch einmal verschoben. In diesem Kapitel sollen zunächst die Grundideen der Abhandlung von 2002 vorgestellt und dann die einsichtsvollen „Zusätze und Verbesserungen“, die sechs Jahre später veröffentlicht wurden, dargelegt werden. Die Frage nach dem Wesen und dem Status der „Idealität“ interessiert den ausgebildeten Physiker Richir schon von früh auf. 2 Dabei reduziert sich diese aber keineswegs bloß auf die mathematischen Idealitäten, sondern bezieht sich insbesondere auch auf die „Ideen“ im Sinne Platons. Damit soll nicht dem „Platonismus“, der getrennte ideale Entitäten annimmt, das Wort geredet werden, sondern es soll dem Status der „Wesen“ Rechnung getragen werden, wenn Husserl etwa für die Phänomene sowohl eine Tatsachen- als auch eine Wesensdimension annimmt (siehe den Anfang von Ideen I).3 Der Hauptbeitrag der Richir’schen Neugründung der Phänomenologie hinsichtlich der Idealitätsproblematik besteht darin, die 1 Der Begriff der Idealitätsstiftung zeigt an, dass die Gegebenheit von Idealität sich nicht per se von selbst versteht. Für Richir siedelt sich der Status der Idealität zwischen Ideenrealismus und purer Fiktion an. Damit offenbart sich von vornherein ein grundlegender Unterschied zwischen Richirs und Husserls Analysen einer Phänomenologie der Idealität, denn die Idee, dass eidé in Evidenz einsichtig gemacht werden können, wird von Richir vehement bestritten. Die Aufgabe, der „Stiftung“ der Idealität nachzugehen, bedeutet somit, die genuine Gegebenheitsart der Idealität aufzuklären (was gerade auch eine Kritik der vermeintlichen „Anschauungs“art der Idealität miteinschließt). 2 Siehe bereits Recherches phénoménologiques und Phénomènes, temps et êtres I. 3 Im § 22 der Ideen I hat Husserl bekanntlich selbst die Auffassung, seine Phänomenologie käme dem Ideenplatonismus gleich, scharf zurückgewiesen. Zu der komplexen Frage nach dem Verhältnis Husserls zu Platon,
186
Kapitel VII
entscheidende Rolle der Schematismen hierbei herauszustellen: Im Gegensatz zur geläufigen These der philosophischen Tradition ist nicht die Schematisierung in der Idealität, sondern umgekehrt die Idealität in den Schematismen gegründet. Der phänomenologischen Grundperspektive gemäß werden die Idealitäten also auf eine spezifische Weise konstituiert. Wie stellt sich das laut Richir nun genauer dar? Sein Ausgangspunkt sind die Paragraphen 86–89 von Husserls spätem Werk Erfahrung und Urteil.4 Das Grundproblem betrifft den Status der eidé, der „Wesen“, der „reinen Begriffe“ in ihrer Universalität und Apriorizität (die den empirischen Einzeldingen von vornherein ihre Regeln und Gesetze vorschreiben und eine offene Extension ausmachen)5 im Gegensatz zu den „empirischen Begriffen“, deren spezifische, ebenfalls empirisch erhaltene Einheit jeweils kontingent ist. Was lässt nun die Universalität und die Apriorizität6 der eidé offenbar werden? Dies ist jeweils Husserls eidetischer Variation zu verdanken. Diese besteht in einer „Abwandlung“ einer wahrgenommenen oder eingebildeten Gegenständlichkeit, wodurch diese zu einem „beliebigen Exempel“, einem „Vorbild“ wird, das als Grundlage für die Erzeugung einer offenen und unendlichen Mannigfaltigkeit von „Varianten“, die Husserl als „Nachbilder“ bezeichnet, dient. Bemerkenswert ist dabei, und genau das kennzeichnet wesentlich die Idealität, dass die Variation sich in der Spannung zwi-
siehe T. Arnold, Phänomenologie als Platonismus: Zu den Platonischen Wesensmomenten der Philosophie Edmund Husserls, Berlin, De Gruyter, 2017. 4 Dieses von Landgrebe herausgegebene Werk ist 1939 ein Jahr nach Husserls Tod erschienen. 5 Es besteht ein bedeutsamer Unterschied zwischen der Unendlichkeit der Extension der empirischen und der reinen Begriffe. Die Extension der empirischen Begriffe (die der „schlechten Unendlichkeit“ Hegels entspricht) legt die Möglichkeit, die Gesamtheit der Individuen, die unter dem in Frage stehenden Begriff subsumiert werden, ad infinitum zu durchlaufen, auf keine evident einsichtige Weise dar. Was dagegen die Extension der reinen Begriffe betrifft, so ist die Möglichkeit eines solchen Durchlaufens durchaus gegeben. 6 Zum Begriff der Apriorizität der eidé siehe Phänomenologie als Platonismus: Zu den Platonischen Wesensmomenten der Philosophie Edmund Husserls, op. cit., S. 212f.
Die Stiftung der Idealität
187
schen einem „Vor-“ und einem „Nach-“ hält, ohne dabei das Wesen in seiner Gegenwärtigkeit zu fassen zu bekommen (was, wie deutlich werden wird, auf die Proteusartigkeit und Unfassbarkeit der Phantasie verweist). Die Schwierigkeit (und auch die Stärke) der eidetischen Variation Husserls besteht darin, dass zweierlei zusammengedacht werden muss: einerseits die Beliebigkeit (d. h. letztlich die Kontingenz) des Vorbildes und andererseits die Tatsache, dass die Vielfalt der „Nachgestaltungen“ von einer notwendigen Einheit durchzogen wird, eine „Invariante“ qua „notwendige und allgemeine Form“ der einzelnen Gegenständlichkeit, die diesem Wesen entspricht. Im Herzen von Husserls Auffassung der Stiftung der Idealität liegt somit ein Anzeichen dafür vor – das nach Kant bereits bei Fichte und Schelling anzutreffen ist –, dass der transzendentale Idealismus in seinem Bestreben, den Begriff des Transzendentalen zu begründen, durch die Hervorkehrung des Bezugs von „Hypothetizität“ (= Möglichkeit bzw. Kontingenz) (hier: die Beliebigkeit ([Kontingenz] des Vorbildes) und der „Kategorizität“ (hier: die Universalität und Apriorizität des Wesens) wesenhaft gekennzeichnet ist.7 Dabei unterscheidet sich Husserls transzendentaler Idealismus freilich grundlegend von jenem Fichtes und jenem Schellings: Weit davon entfernt, die „Synthesen“ oder die „die transzendentale Geschichte des Ich“ ausbildenden „Epochen“ in der intellektuellen Anschauung genetisch zu konstruieren, macht Husserl lediglich auf die besondere Rolle des „Blicks“, d. h. der Ideenschau aufmerksam, durch welche(n) das universelle Wesen gegeben wird: Dieses stellt sich heraus als das, ohne was ein Gegenstand dieser Art nicht gedacht werden kann, d. h. ohne was er nicht anschaulich als ein solcher phantasiert werden kann. Dieses allgemeine Wesen ist das eidos, die idea im platonischen Sinne, aber rein gefasst und frei von allen metaphysischen Interpretationen, also genau so genommen, wie es in der auf solchem Wege entspringenden Ideenschau uns unmittelbar intuitiv zur Gegebenheit kommt.8
7 Freilich geht der Begriff des Transzendentalen über die Apriorizität und Universalität der eidé hinaus. Es soll hier lediglich die strukturelle Ähnlichkeit zwischen beiden Begriffskonstellationen betont werden. Zum Bezug von „Hypothetizität“ und „Kategorizität“ in diesem Zusammenhang, siehe „Seinsschwingungen, op. cit. 8 E. Husserl, Erfahrung und Urteil, Hamburg, Meiner, 1985, S. 411.
188
Kapitel VII
Die Beliebigkeit des Vorbildes9 ist für die Unterscheidung von Wesen und Faktualität wie auch für die Gegebenheit einer „‚offen unendlichen‘ Mannigfaltigkeit“10 unabdingbar. Zugleich ist aber eben auch diese ideale Einheit gegeben, deren Möglichkeitsbedingungen jetzt nachgegangen werden muss. Wie konstituiert sich nun also das Wesen, das eidos? Das Wesen, so behauptet Husserl erneut, gründet sich „auf das Fundament des sich konstituierenden offenen Prozesses der Variation mit den wirklich in die Anschauung tretenden Varianten“.11 Zwei Punkte sind hierbei hervorzuheben. Erstens leitet uns in der Variation die „reine Phantasie“.12 Und zweitens führt diese Fundierung nicht auf die Zweiheit Tatsache/eidos, Individuum/allgemeine Wesenheit, sondern auf eine Dreiheit. Über diese beiden Begriffe hinaus stellt Husserl nämlich noch einen dritten Begriff heraus, der die „synthetische Einheit“ der ersteren konstituiert: Bei diesem Übergang von Nachbild zu Nachbild, von Ähnlichem zu Ähnlichem kommen alle die beliebigen Einzelheiten in der Folge ihres Auftretens zu überschiebender Deckung und treten rein passiv in eine synthetische Einheit, in der sie alle als Abwandlungen voneinander erscheinen, und dann weiter als beliebige Folgen von Einzelheiten, in denen sich dasselbe Allgemeine als eidos vereinzelt. Erst in dieser fortlaufenden Deckung kongruiert ein Selbiges, das nun rein für sich herausgeschaut werden kann. Das heißt, es ist als solches passiv vorkonstituiert, und die Erschauung des eidos beruht in der aktiven schauenden Erfassung des so Vorkonstituierten […].13
Dieser dritte Begriff, dieses „Selbige“, diese „synthetische Einheit“ ist also passiv vorkonstituiert. Wenn somit der Stiftung der Idealität Rechnung getragen werden soll, dann ist es geboten, die fungierenden Leistungen der transzendentalen Subjektivität aufzuweisen, die diese passive Vorkonstitution ausmachen. Hierbei wird, wie gesagt, der Phantasie eine entscheidende Rolle zukommen.
9 In den Unterparagraphen a) und b) des § 87 unterstreicht Husserl, dass die Beliebigkeit der „Varianten“ auch eine solche der „Variationen“ ist. 10 Erfahrung und Urteil, S. 413. 11 Ebd. 12 Ebd, S. 411. 13 Erfahrung und Urteil, S. 414.
Die Stiftung der Idealität
189
Husserl begnügt sich jedoch damit, lediglich die „alte Abstraktionslehre“ zu verbessern. Das Allgemeine wird nach seinem Dafürhalten nicht abstrahierend auf der Grundlage einzelner Anschauungen, sondern auf einer solchen eines „identischen Substrats“ konstituiert, das er als eine „Zwittereinheit“ bezeichnet: Was […] als Einheit im Widerstreit erschaut wird, ist kein Individuum, sondern eine konkrete Zwittereinheit sich wechselseitig aufhebender, sich koexistenzial ausschließender Individuen: ein eigenes Bewusstsein mit einem eigenen konkreten Inhalt, dessen Korrelat konkrete Einheit im Widerstreit, in der Unverträglichkeit heißt.14
Dadurch wird sowohl der Nominalismus als auch der Ideenrealismus zurückgewiesen: „Das Einzelne, das der Wesenserschauung zugrunde liegt, ist nicht im eigentlichen Sinne ein geschautes Individuum als solches. Die merkwürdige Einheit, die hier zugrunde liegt, ist vielmehr ein ‚Individuum‘ im Wechsel der ‚außerwesentlichen‘ konstitutiven Momente […]“.15 Diese „Zwittereinheit“ ist das Glied, welches das eidos mit dem Allgemeinen einerseits und dem mannigfaltigen Einzelnen andererseits verbindet. Es kommen hier also in der Tat drei Begriffe 16 ins Spiel, die in einem gleichsam schwebenden Verhältnis zueinander stehen: das Allgemeine, die mannigfaltigen Einzelnen und die „Zwittereinheit“, die eine Einheit der „Kongruenz“ und der „Differenz“17 ist und inniglich das eidos konstituiert. Wie dieser dritte Begriff passiv präkonstituiert wird, wird von Husserl nicht näher erläutert. Richir antwortet darauf so, dass er die Rolle der Phantasie sowie jener der „Zwittereinheit“ in der Stiftung der Idealität deutlich macht. Betrachten wir seinen Ansatz in L’institution de l’idéalité nun näher.
Ebd, S. 417. Ebd. 16 Obgleich sich keine ausweisbare geschichtliche Filiation zwischen Husserl und Fichte in diesem Punkt ausmachen lässt, erinnert diese „Triade“ stark an jene von reinem Unwandelbaren, Wandelbarem und „bloßem reinen Wandelbaren“ im dritten Vortrag der Wissenschaftslehre von 1804/II Fichtes. Siehe hierzu v. Vf., La genèse de l’apparaître, op. cit., S. 80f. 17 Erfahrung und Urteil, S. 418. 14 15
190
Kapitel VII
Jeder intentionale Sinn oder jede Sinnstruktur hat eidetische, durch die Phänomenologie aufzuweisende Implikationen. Ihr Methodenwerkzeug hierzu – die eidetische Variation – macht ein eidetisches Feld zugänglich, das eine unendliche Weite hat und dessen den Ausgangspunkt bildende Grundlage, die aus „Bildern“ (nämlich „Vorbildern“ und genauso auch „Nachbildern“) besteht, „beliebig“ sein muss (wie auch die Reihenfolge der Variationen selbst). „Geleitet“ wird diese Variation durch die reine Phantasie. Diese ist nicht bloß ein die Variation vollziehendes „Vermögen“, sondern erläutert zugleich den Status der Varianten (indem sie diese gleichsam „kontaminiert“). Mit anderen Worten, und das ist bedeutsam, die Varianten, auf der Grundlage welcher sich die eidé stiften, sind Phantasiegebilde. Deswegen gilt es in der Tat, die jeweilige Rolle der Phantasie und der Imagination bei der Stiftung der Idealität herauszustellen. Warum werden zunächst einmal die Varianten durch die (reine) Phantasie gebildet und nicht durch die Imagination? Weil das, was im Versuch, das eidos zu fassen, fixiert wird, nicht das sich verflüchtigende, fließende, intermittierende eidos selbst ist, sondern lediglich seine bildliche Vergegenwärtigung. Der architektonische Zusammenhang zwischen der Phantasie (in ihren spezifischen Leistungen) und der Imagination muss so verstanden werden, dass die (zunächst undarstellbaren) Phantasien dann in die Extension des eidos „eingehen“, wenn sie in der Imagination vergegenwärtigt werden und ihnen zugleich ein intentionaler (universal verstandener) Sinn zugeschrieben wird. „Die Phantasie wird somit (architektonisch) in ein Bild des Gegenstandes (und nicht der zugrundeliegenden Phantasie), das auf den Gegenstand intentional bezogen wird, transponiert.“18 Hierbei müssen zwei Fehler vermieden werden. Erstens darf das eidos selbst nicht für eine Art Bild gehalten werden. Dies ist „schwierig zu verstehen, weil paradox: Es gibt kein ‚mentales Bild‘ oder genauer: es existiert nur, wenn es nicht existiert – es ist ein nicht gesetztes ‚Gesetztes‘, das (quasi oder sozusagen) nur durch seinen intentionalen (selbst quasi seienden) Gegenstand ist, und seine Setzung für
18 M. Richir, L’institution de l’idéalité. Des schématismes phénoménologiques, Mémoires des Annales de phénoménologie, Beauvais, Association pour la promotion de la phénoménologie, 2002, S. 12.
Die Stiftung der Idealität
191
sich selbst vernichtet es“.19 Aber genau das bestimmt eben den Rahmen der Stiftung der Idealität: Die Idealität, und darin besteht die hervorgehobene Rolle der Phantasie, betrifft weder einen „Gegenstand“ noch ein „Bild“, sondern das, was der in Rede stehenden – imaginären – Erfassung zugrunde liegt, die selbst bloß die architektonische Transposition in eine Imagination ist! Und wenn diese Idealität erfasst werden soll, dann meint ihre Vergegenwärtigung, die, wie gesagt, nur durch den intentionalen Akt der Imagination geleistet werden kann, weder sie selbst noch ihr Bild (ihren Repräsentanten), sondern das einzig Übrigbleibende sozusagen, nämlich ihren intentionalen Gegenstand. (Und das, was im Akt gegenwärtig ist, ist also der intentionale Sinn.) Richir formuliert das so: Die Phantasie wird im gestifteten Akt der Imagination nur dann gegenwärtig (vergegenwärtigt), wenn sie im (selbst quasi gegenwärtigen oder nicht gegenwärtigen) Bild eines intentionalen, selbst quasi gegenwärtigen Gegenstandes „annulliert“ wird – allein der intentionale Sinn ist im Akt (intentional und nicht reell) gegenwärtig.20
Zweitens, die Tatsache, dass die Idealität Sache der Phantasie ist, bedeutet darum aber nicht, dass sie auf der Basis derselben gestiftet wird, sondern nur, dass beide einen ähnlichen Status haben (was den fließenden, intermittierenden und proteusartigen Charakter angeht, im Gegensatz zur Stabilität, die durch die Fixierung dank der Imagination gewährleistet wird). In der Tat wird die Idealität (genauer: der Schematismus der Idealität) auf der Grundlage des phänomenologischen Schematismus der Phänomenalisierung gestiftet, und zwar so, dass „‚etwas‘ dieses Schematismus zunächst in einer intentionalen Gegenwart in Bildern fixiert“21 wird. Dieses „Etwas“ ist eine „vermittelnde“ „dritte Komponente“, die sich als „‚Matrize‘ der Idealität“22 erweist. Husserl hatte diesbezüglich in Erfahrung und Urteil, wie das soeben angezeigt wurde, von einer „konkreten Zwittereinheit“ gesprochen. Richir führt dann auch diesen Begriff der „Matrize der Idealität“ von seiner eigenen Lektüre des § 87 c) dieses Spätwerks Husserls ausgehend ein. Er L’institution de l’idéalité, S. 13. Ebd. 21 L’institution de l’idéalité, S. 70. 22 L’institution de l’idéalité, S. 41. 19 20
192
Kapitel VII
erläutert diesbezüglich, dass – durch die Bezugnahme auf die passiven Synthesen, auf die Rolle, welche die Phantasie darin spielt, sowie auf die „Kongruenz“ hinsichtlich des eidos als „notwendiger Struktur“ – dieser Text anzeigt, inwiefern „in Wirklichkeit das, was die Verkettung der Reihe der Beispiele als Varianten motiviert, eine schematische Einprägung ist, das heißt ein Rhythmus des Blicks und allgemein der Aufmerksamkeit, als das ihre Wahl leitende“.23 Und Richir führt fort, indem er folgende rhetorische Fragen aufwirft: Ist das „gleiche“ Passive, das die Bilder (Vor- und Nachbilder) sich unendlich überlappen lässt, in seiner Indifferenz gegenüber der Passivität des Einfalls und der Aktivität des Umfingierens nicht die schematische Einprägung selbst qua „Bild“ – freilich zweiten Grades – des aktiv in der eidetischen Anschauung erfassten eidos? Also eine Art schematischer Habitus (eine „synthetische Einheit“), die alle anschaulichen, tatsächlich hervorgebrachten oder bloß möglichen Varianten als „Verwandlungen untereinander“ bereits unendlich zusammenhält?24
Dieser Auszug behauptet es klipp und klar: Die schematische Einprägung ist eine Art Bild des eidos. Wovon ist sie aber eine „Einprägung“? Oder, anders ausgedrückt, wie soll der Status dieses Bildes „zweiten Grades“ (Richir spricht diesbezüglich auch von einem „schematischen Bild“)25 verstanden werden? Um hierauf antworten zu können, muss man einerseits der Tatsache Rechnung tragen, dass die Idealität gewissermaßen „prinzipiell“ 26 ihre Anschaulichkeit zurückhält, und andererseits, dass in der Richir’schen Architektonik der Phänomenologie der Vorrang dem phänomenologischen Schematismus der Phänomenalisierung zukommt. Also noch einmal: „Wovon ist der Schematismus der Idealität das ‚Bild‘ (die ‚Bilder‘), wenn er weder Bild der wahrgenommenen noch der imaginierten Gegenstände ist?“27 Richir hat hierauf eine ganz entschiedene Antwort:
L’institution de l’idéalité, S. 85. Ebd. 25 Siehe zum Beispiel L’institution de l’idéalité, S. 40, 41 und 42. 26 L’institution de l’idéalité, S. 69. Hieraus folgt, das sei noch einmal betont, dass die Idealität weder Gegenstand der Wahrnehmung noch der Imagination sein kann (ebd.). 27 L’institution de l’idéalité, S. 69. 23 24
Die Stiftung der Idealität
193
Wenn es hier um einen Schematismus geht, und dazu um einen Schematismus, dessen anschauliche Darstellungen a priori mannigfaltig – sowohl wahrnehmungshaft als auch imaginativ – sind, dann deshalb, weil einerseits dieser Schematismus den phänomenologischen Schematismus der Phänomenalisierung zur phänomenologischen Basis hat, aber auch, weil er andererseits nicht selbst als das Bild (oder als der ‚Repräsentant‘ in Husserls Worten) des phänomenologischen Schematismus der Phänomenalisierung erscheint, sondern durch eine komplexe architektonische Transposition, die koextensiv zu dessen symbolischer Stiftung ist, als das ‚Bild‘ der Idealität, [bzw. als das ‚Bild‘] eines intelligiblen ‚Gegenstandes‘, der genauso unsichtbar (nicht sinnlich) ist wie der Schematismus der Phänomenalisierung selbst.28
Es wird somit deutlich, wodurch dieses Bestehen auf der Rolle der Phantasie bei der Stiftung der Idealität begründet ist: „Der grundlegende Punkt der hier in Rede stehenden Stiftung ist die architektonische Transposition, durch welche die phänomenologische Basis sich verdeckt oder verschwindet, sodass durch diese Stiftung und diese architektonische Transposition die Bilder nicht Bilder (nicht ‚Repräsentanten‘) des ‚Etwas‘ sind, das dort vom phänomenologischen Schematismus fixiert worden ist, sondern eben schematische Bilder des intelligiblen (unsichtbaren/nicht sinnlichen) ‚Gegenstandes‘“29 – wodurch also auf der Ebene der Stiftung der Idealität jene spezifische Leistung der Phantasie veranschaulicht wird. Es lässt sich also aus L’institution de l’idéalité festhalten, dass diese Stiftung sich auf der Basis einer „schematischen Einprägung“ vollzieht, einem Bild „zweiten Grades“ einer Schematisierung, die ihrerseits die – offene und un-endliche (das heißt „unbestimmte“ im Sinne des apeiron und des aoriston) – Einheit des eidos voraussetzt. Dieses „ist“ nicht eigentlich, das heißt, es lässt sich nicht fassen, keine ontologische Positivität kann ihm zugesprochen werden. Es ist bloß ein „Bild“, genauer: eine schematische Einprägung, und lässt sich nur durch eine architektonische Transposition ausmachen, die einen „Sprung“, einen „Bruch“, zwischen der Idealität und ihrer Schematisierung zum Ausdruck bringt. Die Konstitution des eidos beruht also auf dem (nicht sichtbaren) phänomenologischen Schematismus, der einen (ebenso wenig sichtbaren) intelligiblen Gegenstand schematisiert, was alles nur durch eine architektonische Transposi-
28 29
L’institution de l’idéalité, S. 69f. L’institution de l’idéalité, S. 70. Siehe auch ebd., S. 41.
194
Kapitel VII
tion sichtbar gemacht, dadurch aber auch nur „verzerrt“ zur Darstellung gebracht werden kann. Hier kommt – den aufmerksamen Leserinnen und Lesern ist das vielleicht nicht entgangen – eine (in den Anfangskapiteln bereits herausgestellte) Zirkelhaftigkeit ins Spiel, welche die Idealität eigens kennzeichnet und auf die Richir in Fragments phénoménologiques sur le langage zurückkommen wird. Sehen wir nun zu, worin die „Zusätze und Verbesserungen“ zur Stiftung der Idealität bestehen, die er in jenem Fragments-Band von 2008 entwickelt hat. * Die „Zusätze und Verbesserungen“ zur Stiftung der Idealität betreffen die Rolle des (bereits mehrfach behandelten) Begriffs der „‚perzeptiven‘ Phantasie“ bei dieser Idealitätsstiftung. Wie es von RenéFrançois Mairesse zurecht angemerkt wurde,30 werden in diesem Begriff zwei Bestimmungen auf eine paradoxe Weise zusammengeführt: nämlich die eines freien und nicht intentionalen Spiels der Phantasie und die der „Perzeption“ von „etwas“ (selbst wenn dieses bloß „intermediär“ [Winnicott] sein sollte). Wie schon erwähnt und oben zitiert,31 bezeichnet die „‚perzeptive‘ Phantasie“ den Bezug zu etwas, das sowohl darstellbar als auch zu großen Teilen nicht darstellbar ist – und hierin liegt ein wesentliches Charakteristikum der Phänomenologie Richirs (in seiner Absetzung von Husserl). Worin bestehen also die in Fragments phénoménologiques sur le langage eingeführten Neuheiten bezüglich der Frage nach der Stiftung der Idealität? Die Variation und die Anschauung der Idealität sind, wie gesagt, insofern durch eine Zirkelhaftigkeit gekennzeichnet, als einerseits das „Vorbild“ der Variation beliebig sein muss, damit sich ein universales und apriorisches eidos herauskristallisieren kann und andererseits ein gewisses Vorverständnis des eidos bereits gegeben sein muss, damit das Vorbild als Vorbild dieses eidos erkannt werden kann. In Richirs Worten (die an die frühen „Notes sur la phénoménalisation“ erinnern): „Das Vorbild kann nur dann als beliebig erscheinen, als Beispiel für das ‚zufällig gewählte‘ eidos, wenn es bereits eine
30 R.-F. Mairesse, „Phantasía perceptive et perception musicale“, in Annales de Phénoménologie, Nr. 8/2009, S. 7. 31 Fragments phénoménologiques sur le langage, op. cit., S. 18.
Die Stiftung der Idealität
195
‚Vor-sicht [pré-vision]‘ des eidos qua Idealität gibt, das heißt eine Eröffnung des Elements des Intelligiblen, oder wenn das Vorbild selbst bereits im Flimmern mit dem Element des Intelligiblen begriffen ‚ist‘.“32 Also kein eidos ohne Vorbild und zugleich kein Vorbild ohne eidos. Nun ist bekannt, dass Husserls Terminologie manchmal schwankend ist und er insbesondere die (in der Vorlesung von 1904/05 eingeführte) Unterscheidung zwischen Imagination und Phantasie nicht immer streng einhält. Wenn man dies aber tut, dann sind die Variationen nicht eigentlich Sache der Imagination, sondern der Phantasie. Die Neuheit in 2008 besteht darin, dass Richir nun folgende Konsequenzen daraus zieht: Streng genommen bedeutet das, dass alle möglichen Bilder der Variation nicht ursprünglich Bilder sind und die Variation dadurch fälschlich imaginär ist, weil sie nur eine Variation von Beispielen – qua Elemente der Extension des eidos – ist, die von Anfang an in das gegenseitige Flimmern mit dem Element des Intelligiblen transponiert worden sind. Sodann bedeutet das, dass jene Elemente nicht ursprünglich durch Imaginationen, die lediglich „perzeptive“ Apparenzen qua Darstellungen imaginierter Gegenstände zeitigten, konstituiert sind, sondern durch „perzeptive“ Phantasien, die im gegenseitigen Flimmern mit dem Element des Intelligiblen begriffen sind.33
Neu ist daran also nicht, dass der „imaginäre“ Charakter der Bilder (der Vorbilder sowie der Nachbilder) in Frage gestellt würde – L’institution de l’idéalité hat die Rolle der Phantasie bei dieser Stiftung und insbesondere die Transposition des „schematischen Bildes“ in das eidos bereits ausführlich genug betont –, sondern dass die hier in Rede stehenden Phantasien als „perzeptive“ Phantasien aufgefasst werden. Letztere „flimmern gegenseitig mit dem Element des Intelligiblen“ – was soll das bedeuten? Es handelt sich hierbei um eine Phänomenalisierung. Es sei noch einmal daran erinnert, dass (ab 2000) 32 Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 133. Das „Element des Intelligiblen“ verdankt sich (aufgrund eines „architektonischen Gebots“) der „architektonischen Transposition“ des „Grundelements“ (Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, op. cit., S. 384). Es ist insofern gleichsam das „Element der Idealität“, als es das „Denken“ (bzw. die „‚Realität‘ des Intelligiblen“) davor schützt, in seiner (bzw. ihrer) „Endogeneität“ in das rein „Imaginäre“ abzugleiten (ebd., S. 397). 33 Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 134.
196
Kapitel VII
für Richir die beiden phänomenologischen „Quellen“ der phänomenologischen Konkretheiten der Schematismus und die Phantasie (bzw. die Phantasien-Affektionen) sind. Dies impliziert, dass die Phantasie im Allgemeinen und die „perzeptiven“ Phantasien im Besonderen „in“ oder „an“ sich selbst keine „Verständnis“dimension haben – diese ist vielmehr dem Schematismus zuzuschreiben. Sofern nun die „perzeptiven“ Phantasien im architektonischen Register des Undarstellbaren zu verorten sind, ist der Schematismus der Phänomenalisierung nur ein solcher von „schematischen Fetzen“: Was im Falle der Idealitäten „flimmert“, sind in der Tat solche „Fetzen“, die zwischen ihrem darstellbaren Teil (hier ist dann das Schema mit sich selbst identisch) und ihrem nicht darstellbaren Teil (also dem, was ihnen ideale34 Konsistenz verleiht) im Flimmern, bzw. im Vibrieren begriffen sind. Richir zieht hieraus zwei wichtige Schlussfolgerungen. Die erste betrifft die unendliche Extension des eidos. Sofern einerseits das Vorbild als ursprüngliche „perzeptive“ Phantasie mit dem Element des Intelligiblen wechselseitig flimmert (oder präziser ausgedrückt: sofern es aus einer architektonischen Transposition der „perzeptiven“35 Phantasie resultiert und dabei zugleich in der Tat mit dem Element des Intelligiblen wechselseitig flimmert) und andererseits diese Eröffnung des Elements des Intelligiblen ipso facto Eröffnung des Verstehenshorizonts36 in seiner gesamten Extension ist, „ist das Element des Intelligiblen, in dem das eidos baden soll, ab 34 Die hier in Frage stehende „Idealität“ ist die eines „Gegenstands der ‚Sicht‘“ im Sinne Platons. 35 Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 133f. 36 Man müsste hier eine zusätzliche Unterscheidung einführen, die Richir zwar in Fragments phénoménologiques sur le langage noch nicht – zumindest nicht explizit – getroffen hatte, die er aber danach mündlich kundgetan hat. Es handelt sich um die Unterscheidung zwischen dem „Element des Intelligiblen“, das ganz allein Sache der Idealitäten ist, und dem „Element der Verständlichkeit [élément du compréhensible]“, das in einem weiteren Sinne das „semantische Milieu“ der „Sprache“ (also des „Denkens“ im Sinne Descartes’) betrifft. Während im Element des Intelligiblen ein sich selbst identischer Schematismus operiert, ist der Schematismus im Element der Verständlichkeit auf eine nicht reduzierbare Weise abständig gegenüber sich selbst. Deswegen muss zumindest an folgenden Stellen das „Element des Intelligiblen“ durch das „Element der Verständlichkeit“ ersetzt werden: Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 11, 37, 45, 51, 67, 104, 105.
Die Stiftung der Idealität
197
dem Vorbild ‚ganz‘ da“.37 Mit dem Vorbild verfügen wir also über die gesamte (unendliche) Extension des eidos – was zugleich die Möglichkeit seiner Kongruenz mit einem beliebigen Nachbild erklärt. Die zweite Schlussfolgerung bezieht sich auf den genauen Status dieses Vorbildes. Hierzu muss über das in L’institution de l’idéalité Herausgearbeitete hinausgegangen werden. Wie bereits gesagt, hatte Richir hierin aufgewiesen, dass der Verlauf von (Vor-)Bild zu (Nach-)Bild dem Schematismus, genauer gesagt: schematischen „Bildern“ bzw. „Einprägungen“ unterliegt. Nun wird deutlich, dass dies nicht genügt, da „der (sprachliche) Schematismus [wir wissen jetzt, dass es sich dabei eher um ‚schematische Fetzen‘ handelt], wenn auch nicht gegenüber dem sich suchenden und sich machenden Sinn, doch aber a priori gegenüber den eidé, blind ist“.38 Darin besteht der Sinn des Satzes: „Das Vorbild flimmert mit dem Intelligiblen“: Die „schematische Einprägung“ ist in Wirklichkeit zugleich eine „perzeptive“ Phantasie39 – nur so kann verständlich gemacht werden, wie sie in der Tat eine Einprägung des in Frage stehenden eidos sein kann, sofern die „perzeptive“ Phantasie ja für diese schematische Fetzen eine phänomenologische Konkretheit liefert. Die Frage nach dem, was den Verlauf der Variation bestimmt, durchzieht das gesamte Fragment der „Zusätze und Verbesserungen zur Stiftung der Idealität“. Um diesen Verlauf genauer fassen zu können, führt Richir zunächst den Begriff der „Sachlichkeit“ ein, die keine „Realität“ darstellt, sondern eben den „sachlichen“ Gehalt dessen bezeichnet, was an sich nicht darstellbar ist (und also die „Sachlichkeit“ des „sich bildenden Sinnes“ 40 selbst ausmacht): In einer ersten Annäherung geht es dabei um die „‚Perzeption (perception)‘ dieser oder jener Sache(n), die in dieser/diesen oder jener/jenen ‚perzeptiven‘ Phantasie(n) bereits in Ideen transponiert
Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 134. Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 135. 39 Und mutatis mutandis sind die im Flimmern mit dem Element des Intelligiblen begriffenen „perzeptiven“ Phantasien ursprünglich Sache der Schematismen (Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 135), wobei, wie betont werden muss, dies eben gerade wegen dieses gegenseitigen Flimmerns mit dem Element des Intelligiblen der Fall ist! 40 Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 147. 37 38
198
Kapitel VII
sind, welche Perzeption als Auswahlkriterium für die anderen Beispiele der Variation oder, wenn man so will, der Nachbilder des Vorbildes der Variation dient“.41 Der Sinn dieses ganzen Prozesses im Allgemeinen und dieser Transposition im Besonderen soll nun weiter erläutert werden. Richir legt dieses gegenseitige Vermittlungsverhältnis im archaischen architektonischen Register zwischen „perzeptiven“ Phantasien und dem Schematismus (sowie dem, was daraus folgt) so dar, dass verschiedene architektonische Transpositionen42 aufgewiesen werden, die darin auf eine entscheidende Weise hineinspielen, nämlich die architektonischen Transpositionen: 1.) des „schematischen Bildes“ der Phänomenalisierung als Schema (das eine Nicht-Übereinstimmung mit sich selbst ist) in ein mit sich selbst übereinstimmendes Schema der Idealitäten, die noch nicht in Vorbildern und Nachbildern fixiert sind; 2.) des „Grundelements“, aus dem die Phänomenalisierung hervorgeht (und in dem diese sich schematisiert), in das Element des Intelligiblen; 3.) korrelativ einer radikal nicht darstellbaren Alterität des Grundelements (= „absolute Transzendenz“) in eine genau so radikal nicht darstellbare Alterität des Elements des Intelligiblen;43 4.) der „perzeptiven“ Phantasien in Vorbilder und Nachbilder, die im Element des Intelligiblen flimmern. All diese Transpositionen (selbst die erste und die vierte) lassen sich auf eine einzige zurückführen: nämlich die der „perzeptiven“ Phantasien, sofern sie sich ursprünglich schematisieren (bzw. der „scheFragments phénoménologiques sur le langage, S. 135. „Das Nichts dieser architektonischen Transposition, das wir zumeist unwissentlich durchlaufen, genügt, damit die nicht darstellbaren ‚Sachen‘, die in der Sprache phantasiemäßig ‚perzipiert‘ werden, als transponiert erscheinen – und zwar klassisch in Ideen und phänomenologisch, für uns, in Vorbildern (und Nachbildern) als Beispielen von eidé“, Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 141f. 43 Die Rolle dieser beiden radikal nicht darstellbaren Alteritäten rechtfertigt es, diese architektonische Transposition von der vorhergehenden zu unterscheiden. 41 42
Die Stiftung der Idealität
199
matischen Fetzen“, sofern sie eine phänomenologische Konkretheit aufweisen, die sie eben den „perzeptiven“ Phantasien verdanken), in „intelligible“ Träger der Idealität – denn die architektonische Transposition kann, wie oben bereits gezeigt wurde, bloß eine Art „Bild“ der eidé hervorbringen, wobei die eidé selbst weder fassbar noch darstellbar sind. Zudem sei hinzugefügt – ein Aspekt, dessen Neuheit gegenüber L’institution de l’idéalité von Richir selbst vielleicht nicht genügend hervorgehoben wurde –, dass jene „Eröffnung“ des Elements des Intelligiblen, conditio sine qua non des Zugangs zum eidos, die Fungierung des „phänomenologischen Erhabenen“44 sowie die Stiftung eines „Selbst“ impliziert. Diese Transposition macht den Verlauf der eidetischen Variation (dessen Leitprinzip hier, wie gesagt, verfolgt wird) besser verständlich. Es sieht nämlich so aus, als ergäbe sich aus ihr eine Art „Staub“ aus „transzendentalen Matrizen von Ideen“, die es „auszusieben“ gelte, „um sie voneinander zu trennen und zu unterscheiden, was ja die Aufgabe der eidetischen Variation im Husserl’schen Sinne sein soll, deren Aufgabe es ist, Kongruenzkerne zu entdecken“.45 Mit anderen Worten, die architektonische Transposition „produziert“46 gleichsam die „ideelle Materie“ (die dadurch mit sich selbst übereinstimmt). Diese muss dann ihrerseits noch „in eine Form gebracht“ werden, d. h. es muss aufgewiesen werden, dass sie denselben Kongruenzkern hat. Entscheidend ist nun, dass das Prinzip jenes In-die-Form-Bringens – wie auch jene „Produktion“ selbst, die der Transposition innewohnt – demgegenüber, was dergestalt in eine Form gebracht wird, keineswegs äußerlich ist. Jenes „Sieb“ ist vielmehr die aufeinanderliegende Aufschichtung selbst dieser mit sich selbst übereinstimmenden Schemata. Der tiefe phänomenologische Sinn dieser Analyse ist somit offenbar der, dass diese „Bilder“ (die also noch nicht der Imagination zuzurechnen sind), diese Varianten, diese mit sich selbst übereinstimmenden Schemata, in ihnen selbst das Prinzip ihrer Kongruenz enthalten. Das ist gemeint, wenn
Siehe insbesondere Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 149. Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 136. 46 Wobei es sich hier freilich nicht um einen „Produktionsidealismus“ handelt, sondern um einen – transzendentalen – Idealismus, wie er etwa bereits Fichtes Wissenschaftslehre gekennzeichnet hatte. 44 45
200
Kapitel VII
Richir die Apriorizität der Kongruenz und des eidetischen Verlaufs47 betont – bzw. wenn er darauf hinweist, dass der intelligible Kongruenzhorizont der Bilder, der durch die eidetische Variation eröffnet wird, kein Welthorizont ist.48 Und es wird dadurch verständlich, inwiefern die eidetische Variation kein „äußeres“ Leitprinzip haben kann (was ja sonst auch wieder eine empirische Dimension in diese apriorische Sphäre hineinbrächte), denn die architektonische Transposition mündet eben in ein mit sich selbst übereinstimmendes Schema, in eine innere Kongruenz – die nicht mehr aber auch nicht weniger rätselhaft ist als der Status der Phantasie selbst, diesseits jeder vorausgesetzten Realität. Und was lässt sich dann also über den Verlauf der Variation sagen? Er besteht „in dem Durchqueren dieser Aufschichtung [der mit sich selbst übereinstimmenden Schemata] bei diesem oder jenem Bild (qua ‚perzeptiver‘ Phantasie, die mit dem Element des Intelligiblen flimmert), das jeweils in einem zufällig hervorgehobenen, mit sich selbst übereinstimmenden Schema zum Vorbild erhoben und sich dann als eines der Nachbilder in den anderen mit sich selbst übereinstimmenden Schemata der Aufschichtung wiederfinden wird“.49, 50 Zu einer solchen „zufälligen“ Hervorhebung kommt
47 Die „Kongruenz und der eidetische Verlauf der Varianten sind streng a priori. A priori heißt nicht ontologisch, denn alles spielt sich hier im intermediären Raum des Nicht-Positionalen ab – das eidos, ganz gleich was Husserl hierzu sagt, ist a priori nicht darstellbar“, Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 151. 48 Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 152. 49 Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 136f. Und die korrelative „Wesensschau“ stützt sich auf dieselbe „mit sich selbst übereinstimmende schematische Kette“, auf dieselbe „aufgeschichtete Verdichtung solcher schematischer Ketten, deren ‚perzeptive‘ Phantasien selbst in dieser Verdichtung verdichtet sind, wobei diese zweifache Verdichtung ihrer Transposition in das Flimmern mit dem Element des Intelligiblen (das seinerseits durch das ‚fungierende‘ Erhabene eröffnet wird) zu verdanken ist“, a. a. O., S. 138f. 50 Richir fasst denselben Gedanken prägnant folgendermaßen zusammen: „[…] es gibt Kohärenzen bzw. Kohäsionen, die sich auf der Basis von ‚perzeptiven‘ Phantasien ergeben und die sich auf der Grundlage der Variationen der Vor- und Nachbilder zu eidetischen Kongruenzen stiften – welche Variationen aus der architektonischen Transposition der ‚perzep-
Die Stiftung der Idealität
201
es gerade deshalb, weil, wenn die eidetische Variation vollzogen wird, das „Wesentliche“ von den Bildern bereits selbst geleistet worden ist, denn die Variation durchläuft lediglich einen (der Aufschichtung folgenden) „Weg“, der durch die mit sich selbst übereinstimmenden Schemata selbst vorgezeichnet wurde. Die Bedeutung dieser auf die in den Paragraphen 86–89 von Erfahrung und Urteil offengebliebenen Fragen antwortenden Analysen sticht somit deutlich hervor. Gleiches gilt ebenso für die Schlussfolgerung, die Richir daraus zieht: „Die Intentionalität ist für die Idealität nicht konstitutiv.“51 Es können somit bereits drei eindeutige Parallelen zwischen den Analysen über den Status der Phantasie und jenen über die Stiftung der Idealität gezogen werden: Es besteht nämlich eine Parallelität bezüglich der jeweils implizierten architektonischen Transposition, in Bezug auf die Infragestellung der Rolle der Intentionalität im archaischen Register beider und genauso auch, was das Fallenlassen der Doxa angeht, also die nicht mehr zulässige Voraussetzung einer vorgegebenen „Realität“ zugunsten dessen, was Richir als das „Welttheater [théâtre du monde]“52 bezeichnet. * Es wurde bereits betont, dass (und wodurch) die architektonische Transposition des „Grundelements“ in das „Element des Intelligiblen“ eine bedeutende Funktion in der Stiftung der Idealität einnimmt. Nun soll es darum gehen, den Sinn dieser Transposition noch näher zu bestimmen. Dadurch lässt sich auch der – zweifache – Status des Selbst in dieser Transposition verdeutlichen. Letzterer ist in der Tat zweifach, da er auf zwei Fragen antwortet: Worin besteht die „Selbstheit“ der Sinnbildung? Welchen Status hat das „Selbst“, das der eidetischen Variation sowohl beiwohnt als auch ihr assistiert, und somit das eidos als Kongruenzkern der Vari-
tiven‘ Phantasien resultieren, die mit dem (durch eine schematische Interruption des Intelligiblen [siehe weiter unten]) eröffneten Element flimmern“, Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 151. 51 Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 138. 52 Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 34. Siehe auch a. a. O., S. 101. Das „Welttheater“ erinnert dabei stark an das Fichte’sche „Bild“.
202
Kapitel VII
ation „apperzipiert“? Diese „beiden“ Auffassungen des Selbst entsprechen der wichtigen, oben bereits ausführlich erläuterten Unterscheidung zwischen „Anblicken“ und „Sehen“. „Wie steht es um das Selbst in der ‚perzeptiven‘ Phantasie – ‚in‘ ihr, weil es sich nicht um diese selbst handeln kann, da die ‚perzeptive‘ Phantasie kein intentionaler Akt ist, der von einem Selbst vollzogen würde und einen Gegenstand (oder eine Bedeutsamkeit) meinte?“53 Diese Frage impliziert, dass es sich hierbei nicht um ein „subjektives“ Selbst handelt, sondern um die Selbstheit des Sinnes, also des Sprachlichen selbst. Was ist darin enthalten? Es sei zunächst daran erinnert, dass die Phantasien, auf bzw. in denen die „perzeptiven“ Phantasien beruhen, je „perzeptive“ Phantasien-Affektionen sind.54 Wenn dabei nun ein Selbst hineinspielt, kann es nur in der den („perzeptiven“) Phantasien innewohnenden Affektion angesiedelt sein. Was wird nun aber genau in der „‚perzeptiven‘ Phantasie“ „perzipiert“? Es handelt sich hierbei nicht um eine Selbstperzeption des Selbst. Und zwar deshalb nicht, weil hier einerseits kein präreflexiver Bezug zum Selbst vorliegt, und andererseits (und vor allem), weil es eine „‚perzeptive‘ Phantasie“ nur durch und vermittels einer anderen „‚perzeptiven‘ Phantasie“ geben kann (die eben gerade dadurch zu einer „perzeptiven“ geworden ist). In der „‚perzeptiven‘ Phantasie“ wird – außerhalb jeder Form von Positionalität – „etwas“, nämlich die „Sache“, perzipiert, die prinzipiell nicht darstellbar und nicht äußerlich ist. Für Richir bestehen zwischen den verschiedenen „‚perzeptiven‘ Phantasien“ „Zwischenbezüge“55 (insbesondere zwischen der den Blick weckenden und der von ihm erweckten „‚perzeptiven‘ Phantasie“). Wesentlich ist dabei, dass die „‚perzeptive‘ Phantasie“ einer Sphäre des „Übergangs“ angehört, wodurch sie in diesen Austausch zwischen weckendem und gewecktem Blick eingebettet wird – und sei es auch nur für einen einzigen „Augenblick“. Und genau dieser Übergangscharakter, der also die „‚perzeptiven‘ Phantasien“ „schematisch und ‚perzeptiv‘“ in jene „Zwischenbezüglichkeit“ einschreibt, kennzeichnet eben
Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 139. Dass Richir nicht jedes Mal den vollständigen Ausdruck „(sprachliche) ‚perzeptive‘ Phantasien-Affektion“ gebraucht, ist lediglich der erleichternden Vereinfachung geschuldet. 55 Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 140. 53 54
Die Stiftung der Idealität
203
das Sprachphänomen56 und erklärt zugleich die Rolle des Blickaustauschs in demselben. Bezüglich dessen, was in der „‚perzeptiven‘ Phantasie“ „perzipiert“ wird, hält Richir Folgendes fest: Das durch und in der „perzeptiven“ Phantasie […] „perzipierte“ „Etwas“ (die Sache) betrifft dabei nicht ausschließlich das Selbst, sondern ebenso außersprachliche (radikal nicht darstellbare) phänomenologische Konkretheiten, die ihre Aufspaltung in Sprachregungen [amorces de langage] einleiten [amorcer] und virtuell durch den Blick anderer „Selbste“ getragen werden (für die das aber aktuell nur für gewisse Ausnahmen gilt, nämlich nur im Falle einer aktuellen Einfühlung), was von den Sachen selbst ausgehend die Reflexivität und somit die Selbstheit des Sinnes, also jene der Sprache selbst ausmacht.57
Soviel also zum Selbst als (zumindest virtueller) Selbstheit des Sinnes. Wenn das eben Auseinandergelegte zu den beiden Arten der architektonischen Transposition, von denen oben die Rede war, in Beziehung gesetzt wird, nämlich jener der „‚perzeptiven‘ Phantasien“ in Imaginationen und jener eben dieser „‚perzeptiven‘ Phantasien“ in mit sich selbst übereinstimmenden Schemata (= die Varianten der eidetischen Variation), dann können drei Arten des „Selbst“58 unterschieden werden: das Selbst, das durch „Fluktuationen oder affektive Modulationen des Sprachphänomens oder der Sinnbildung“ gekennzeichnet ist; das Selbst, das sich am Ende der architektonischen Transposition der „‚perzeptiven‘ Phantasien“ in Imaginationen herauskristallisiert (dies ist das Selbst der imaginativen Ebd. Dies war ja auch der Schlussgedanke von Kapitel III. Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 140f. 58 Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 147f. Im Seminar über das „Selbst“, das im Juli 2009 von der „Association pour la promotion de la Phénoménologie“ in Banon (Provence) veranstaltet wurde, hat Richir eine andere Unterscheidung vorgeschlagen, die mit jener aus den Fragments phénoménologiques sur le langage nicht voll und ganz übereinstimmt: 1.) das archaische Selbst in der das phänomenologische Erhabene (siehe Kapitel IX) kennzeichnenden Systolē/Diastolē, welche die Intimität des Blickaustauschs zeitigt (was der Zeitigung der Regung der Sprache entspricht); 2.) die (bewusste oder unterbewusste) Selbstintimität der reinen Zeit (die sich etwa in der Erfahrung der Langeweile bezeugt und der Zeitigung des Husserl’schen „Urprozesses“ in den Bernauer Manuskripten entspricht); 3.) die Intimität des gewöhnlichen Bewusstseins (die der durch die „zweiten Affekte“ „erfüllten“ Zeitlichkeit entspricht). 56 57
204
Kapitel VII
Intentionalität); und das Selbst, das sich aus der architektonischen Transposition der „‚perzeptiven‘ Phantasien“ in Bilder ergibt (damit sind sowohl das Vorbild als auch die Nachbilder gemeint) und das mit dem Flimmern dieser „‚perzeptiven‘ Phantasien“ mit dem Element des Intelligiblen koextensiv ist. Sehen wir nun zu, worin das „Selbst“ der „‚perzeptiven‘ Phantasien“ besteht. Es muss nämlich in der Tat noch geklärt werden, worin der Status des dem Verlauf der eidetischen Variation beiwohnenden und dieselbe assistierenden „Selbst“ besteht. Die Antwort hierauf ergibt sich aus der oben erwähnten Tatsache, dass in diesem gesamten Prozess das „phänomenologische Erhabene“ eine grundlegende Rolle spielt. Richir befragt nämlich die Bedingungen der Möglichkeit des Flimmerns mit dem Intelligiblen (dank welchem ein Bild von der „‚perzeptiven‘ Phantasie“ ausgehend transponiert wird), was einerseits den Status der Zeitigung dieser Stiftung und andererseits den Status des „Selbst“, sofern es diesem eidetischen Verlauf beiwohnt und ihm assistiert, verständlich macht. Zunächst zu letzterem Punkt. Wie schon angedeutet, versteht die philosophische Tradition die Instanz, die das Flimmern mit dem Element des Intelligiblen fixiert (und die also kein „subjektives“, sondern das im tiefsten archaischen Register „fungierende“ Korrelat ist), das heißt die Struktur, welche die „Ideen“ „trägt“ bzw. „erhellt“, als das „Gute“ (Platon), das „Eine“ (Plotin) oder „Gott“ (Descartes, Leibniz). „Die von Husserl – wenn auch undeutlich – eingeführte phänomenologische Neuerung ist nun, dass es zur Idealität keinen direkten Zugang gibt, der einen radikalen chorismos implizieren und damit alle Schwierigkeiten der Teilhabe mit sich bringen würde, sondern lediglich einen indirekten Zugang mittels der eidetischen Variation des Vorbildes und der Nachbilder.“59 Mit anderen Worten, die phänomenologische Neuerung besteht in der Absage, bzw. der Herausstellung der Unmöglichkeit, sich von vornherein in die Sphäre der Idealität versetzen zu können – was in der Tat problematisch ist, denn wie kann nun der Endlichkeit Rechnung getragen werden (was ja eine metaphysische Frage par excellence ausmacht)? Richir wirft diesbezüglich folgende wichtige Frage auf: Daraus folgt, dass, wenn die Teilhabe [also das, was der Endlichkeit Rechnung zu tragen vermag] sich in der Kongruenz der Elemente (der Beispiele) 59
Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 148.
Die Stiftung der Idealität
205
der Variation auflöst [was zugleich erklärt, was innerlich die Variation leitet, siehe oben], dann stellt sich von da aus die Frage, worin das Selbst besteht, das im Verlauf der Variation selbst im Spiel ist. […] Wo ist also das Selbst, das sozusagen das eidos als den Kern der Kongruenz der Variation „apperzipiert“? Ist es noch göttlich?60
Richirs Grundthese lautet, dass das Flimmern mit dem Element des Intelligiblen, das die „‚perzeptive‘ Phantasie“ in ein Bild transponiert, „nur mittels einer Stiftung stattfinden kann, die im Zeitpunkt, der keine Vergangenheit und keine Zukunft hat [= „cartesianischer Zeitpunkt“], abläuft“.61 Für unser Problem – das des Status des Selbst – ist nun von entscheidender Bedeutung, dass es dank dieser Konzentration im cartesianischen Zeitpunkt62 und des hier fungierenden phänomenologischen Erhabenen eine totale Verdichtung (die Richir auch eine „Hyperkondensierung“ nennt) der der „‚perzeptiven‘ Phantasie“ innewohnenden Affektivität im Selbst gibt. Das Selbst, das in Richirs „Neugründung“ der Phänomenologie die Stelle des Gottes der metaphysischen Tradition einnimmt, ist – im fundierenden Register der Idealität – jenes, das sich im phänomenologischen Erhabenen bekundet – eine Hyperkondensierung der Affektivität, die zugleich eine Unterbrechung des Schematismus bedeutet. Und sofern die Idealität unter anderem dadurch gekennzeichnet ist, dass sie sich sowohl von der Gegenwärtigkeit der Sprache als auch von der Gegenwart des Aktes der Imagination ablöst, „ist das Selbst, das sich auf das Vorbild und im Allgemeinen auf die Nachbilder bezieht, seinerseits durch das, was in Wirklichkeit eine Spaltung gegenüber dem intentionalen Selbst der Imagination oder dem Selbst der Wahrnehmung ausmacht, in eine Art ‚entleiblichtes‘, anonymes, von der Verankerung sowohl in das Perzeptive als auch das Imaginative losgelöstes Selbst transponiert“.63
Ebd. Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 152. 62 Auch wenn Richir diese Verbindung nicht explizit herstellt, und zwar weder bewusst noch unbewusst, kann doch beiläufig angemerkt werden, dass diese Stiftung des Selbst durch die Hyperkondensierung der Affektivität im „Augenblick“ stark an das Aufbrechen des Selbstbewusstseins in Schellings System des transzendentalen Idealismus erinnert (welches bei diesem zudem noch zeitkonstitutiv ist!). 63 Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 153. 60 61
206
Kapitel VII
Wenn Richir dazu sagt, dass es, „wenn man so will, bereits eine Präfiguration des göttlichen Selbst“64 sei, dann scheint das ein Euphemismus zu sein: Dieses Selbst beantwortet unsere Frage – es ist, und das ist keineswegs paradox, eine affektive Hyperkondensierung und zugleich völlig unpersönlich (bzw. „vor-persönlich“), anonym und selbst ideal.65 Der andere Punkt betrifft die spezifische Zeitigung des Flimmerns der „‚perzeptiven‘ Phantasie“ mit dem Element des Intelligiblen (sowie der gerade ausführlich besprochenen Stiftung des Selbst). Die Hyperkondensierung der Affektivität impliziert im selben Schlage die Unterbrechung des Schematismus. Diese findet im „instant cartésien“ statt, der nicht mit Schellings (und Heideggers) „Augenblick“ und auch nicht mit Platons „exaiphnès“ verwechselt werden darf. Dieser cartesianische Zeitpunkt „ist so etwas wie der in einer Wiederholung begriffene Widerhall des Augenblicklichen [l’instantané], um das herum das Flimmern (von ‚perzeptiver‘ Phantasie zum Element des Intelligiblen und umgekehrt) sich hin- und herbewegt“.66 Warum darf der „instant cartésien“ nicht mit dem „Augenblick“ oder dem „exaiphnès“ verwechselt werden? Eben weil er, sofern er keine Vergangenheit und keine Zukunft hat, die architektonische Transposition jenes anderen Typus von Zeitpunkt ist, der in einem „unentwegten“ Hin- und Herbewegen begriffen ist. Genauso wie es ein „eidetisches Sieb“ gibt, mit dem sich der „Staub aus transzendentalen Matrizen von Ideen“ aussieben lässt, gibt es gewissermaßen ein „Zeitsieb“ (dieser Ausdruck ist nicht von Richir), das der „Unzeitlichkeit“ der Idealität entspricht – und zwar eben dank einer architektonischen Transposition des „Augenblicks“ in den cartesianischen Zeitpunkt. * Weitere entscheidende Aspekte bezüglich der neugefassten Rolle der „‚perzeptiven‘ Phantasie“ innerhalb der Stiftung der Idealität werden in den letzten zehn Seiten der „Zusätze und Verbesserungen zur Stiftung der Idealität“ entwickelt. Diese Neufassung besteht
Ebd. Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 163. 66 Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 152. 64 65
Die Stiftung der Idealität
207
darin, dass Richir drei Punkte neu aufrollt, die nicht nur das weiterführen, was in L’institution de l’idéalité eingeführt wurde, sondern auch diese „Zusätze und Verbesserungen“ ihrerseits noch weiter vertieft, nämlich: 1.) den Status des Verlaufs der eidetischen Variation; 2.) die Rolle der „‚perzeptiven‘ Phantasie“ in der Stiftung der Idealität; 3.) den Schematismus als „vereinheitlichenden Faktor“ der Bilder. 1.) Die erste Neuerung besteht in der Gleichsetzung des eidetischen Verlaufs mit der „kontinuierlichen Schöpfung“ im Sinne Descartes’: eine kontinuierliche Schöpfung von Bildern, deren Invariante oder Kongruenzkern […] das eidos ist, ohne dass dabei der Verlauf etwas Anderes wäre als eine unzeitliche „Folge“, die gerade nicht einzeln durchlaufen zu werden braucht, weil sie bereits immer – in einem Schlage – da ist.67
Diese kontinuierliche Schöpfung hängt mit dem soeben über den cartesianischen „Zeitpunkt“ Ausgeführten eng zusammen: Sofern die Varianten nämlich nicht nur durch das „eidetische Sieb“ sondern auch durch das „Zeitsieb“ gefiltert werden, ist die Folge der Varianten unzeitlich – was zugleich verdeutlicht, inwiefern „das Vorbild versichert sein kann, als beliebiges Beispiel für den eidetischen Kongruenzkern zu dienen“.68 Die kontinuierliche Schöpfung ist eine solche von Bildern (in den oben gebrauchten Worten: sie „produziert“ die „ideelle Materie“). Ihre Rolle ist hierauf aber nicht beschränkt. Sie sorgt nämlich zudem auch für deren Stabilität. Denn „grundsätzlich“ sind die Bilder „instabil“; sie laufen Gefahr, entweder in der Fixierung durch die Imagination verloren zu gehen oder sich im Element des Intelligiblen aufzulösen. Über das Bild sagt Richir in der Tat, dass es formal bloß Auftreten/Verschwinden ist: Auftreten außerhalb des Elements des Intelligiblen, das, wenn es an sein Ende gelangte, zum Verschwinden des Elements des Intelligiblen führte, und dem Sehen ohne jegliches Hindernis die Transposition der „perzeptiven“ Phantasie in einen „perzeptiven“ Schein [apparence] der Imagination (in ein Simulacrum im imaginären Element oder in einen transzendentalen Schein [illusion]) eröffnete; und Verschwinden im Element des Intelligiblen, das, wenn 67 68
Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 153. Ebd.
208
Kapitel VII
es gelänge, eben gerade in das Auftreten des letzteren mündete, in die Auflösung jeglicher Phantasie, jeglichen Bildes und Vorbildes in ihm, das heißt in die Erfahrung des phänomenologischen Erhabenen, wo nur noch die hyperdichte Affektion des Selbst – in seinem Überschuss über sich selbst hinaus – in einem (reflexiven) Bezug zum Element des Intelligiblen, das dadurch leer und abgetrennt (choristos) ist, steht.69
2.) Der über der Stiftung der Idealität schwebende „Geist“ ist somit – über die Gefahr hinaus, dass die in Rede stehende „‚perzeptive‘ Phantasie“ sich durch die architektonische Transposition in der imaginativen Vorstellung gleichsam in Luft auflöst – der Geist der Leere. Wie kann er verscheucht werden? Es ist bereits deutlich geworden, dass einer der wesentlichen Beiträge des ersten Teils der „Zusätze und Verbesserungen zur Stiftung der Idealität“ darin besteht, einen „endogenen“ bzw. inneren Faktor zu bestimmen, der den Verlauf der eidetischen Variation leitet. Die Kongruenz zwischen den Bildern wird dadurch gewährleistet, dass sie selbst das Prinzip ihrer Kongruenz mit sich führen. Richir nimmt nun genau diesen Gedanken wieder auf, indem er dieses innere Kongruenzprinzip als eine „‚perzeptive‘ Phantasie“ auffasst: Das Element des Intelligiblen bliebe leer, wenn es keine Phantasie und keine „perzeptive“ Phantasie gäbe, die es zum „Vibrieren“ brächte, indem sie darin als „intelligibles“ Bild flimmerte – das dafür anfällig ist, die Rolle des Vor- und des Nachbildes einzunehmen, und keinesfalls mit einem eidos oder einer „Idee“ (die ja noch der Variation bedürfen) verwechselt werden darf.70
Diese Stelle bestätigt dazu den bereits 2002 geäußerten Gedanken, dass die Stiftung der Idealität eines dritten, vermittelnden Begriffs zwischen dem eidos und den einzelnen Mannigfaltigkeiten bedarf – so sollte jedenfalls der Hinweis aufgefasst werden, dass die „‚perzeptiven‘ Phantasien“ qua Vorbilder und Nachbilder nicht mit den eidé verwechselt werden dürfen. 3.) Richir liefert darüber hinaus auch neue Erläuterungen zur stabilisierenden und vereinigenden Instanz der Bilder bzw. der mit sich selbst übereinstimmenden Schemata. Während diese Instanz oben mit dem „Selbst“ qua Pol einer affektiven Hyperverdichtung 69 70
Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 154. Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 154.
Die Stiftung der Idealität
209
gleichgesetzt wurde, kommt er nun noch einmal auf den Grundgedanken von L’institution de l’idéalité zurück, demzufolge diese Instanz im phänomenologischen Schematismus der Phänomenalisierung zu suchen sei – und dabei insbesondere in den „schematischen Einprägungen“. Wir stoßen hier auf das „archaischste“ architektonische Register. Es stellt sich nämlich folgende Frage: Wenn bis hierher stets von „‚perzeptiven‘ Phantasien“ qua sprachlichen71 Phantasien die Rede war, worin besteht dann ihr Bezug zu den archaischsten Phantasien, die außersprachlich sind – also zu den „wilden Wesen“? Um hier klarer zu sehen, ist es hilfreich, vom architektonischen Standpunkt aus betrachtet den Bezug von „wilden Wesen“, („perzeptiven“) Phantasien, phänomenologischen Schematismen (seien sie sprachlich oder außersprachlich), Affektivität und Selbst noch einmal in Erinnerung zu rufen.72 Die wilden Wesen gehören dem archaischsten architektonischen Register an. Als letzte Konkretheiten der Phänomene erhalten sie durch die Affektivität einen bestimmten Intensitätsgrad, wodurch sich die Affektivität in ihnen in fluktuierende Affektionen wandelt (hierin besteht also eine erste „Wandlung“). Wie bereits betont, verweist die Affektivität auf das Selbst, das durch eine Hyperverdichtung derselben (im „Moment des phänomenologischen Erhabenen“) gewissermaßen „entspringt“. Von hier aus lässt sich nun der Bezug von „wilden Wesen“, „Selbst“ und „Phantasien“ fassen: „Die wilden Wesen wohnen […] dem, was zu einem Selbst werden wird und diese zugleich trägt, inne, und sie vermögen es somit, dessen ‚tiefes Leben‘ zu modulieren und – mittels Intensitätskontrasten – das zu eröffnen, was [Richir] […] die ‚Phantasien‘“ 73 nennt. Die phänomenologischen Schematismen verflechten die außersprachlichen Phantasien (und also auch die wilden Wesen) und – auf einem höheren architektonischen Register – die sprachlichen Phantasien miteinander und sorgen dafür, dass sie aufeinander verweisen.74 Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 148. Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 155f. 73 Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 156. 74 Die Modalität der Zeitigung ist in beiden Fällen unterschiedlich. Im Fall des Außersprachlichen „rhythmisiert“ der Schematismus auf eine nicht zeitliche Weise die „schematischen Kondensierungen/Dissipationen des Grundelements“, während im Fall der „perzeptiven“ Phantasien die Zeitigung eine „Zeitigung in Gegenwärtigkeit ohne angebbare Gegenwart“ ist. 71 72
210
Kapitel VII
Wie vollzieht sich nun aber konkret (mittels welchen „Assoziations“typen) diese „Verbindung“ von außersprachlichen „reinen“ oder „ursprünglichen“ Phantasien und den sprachlichen Phantasien (d. h. den „‚perzeptiven‘ Phantasien“)? Und wie wird zugleich letztursprünglich die Idealität gestiftet? Hierzu muss nun, wie gesagt, auf den in L’institution de l’idéalité eingeführten Begriff der „schematischen Einprägung“ zurückgegriffen werden. Dieser darf selbstverständlich nicht mit dem Schematismus verwechselt werden (weder dem sprachlichen noch dem außersprachlichen). Er ermöglicht die Beantwortung folgender (rhetorischer zugleich aber auch herantastender) Fragen: Die Frage, die sich dabei von vornherein (und vielleicht allzu schroff) stellt, ist, ob nicht diese oder jene schematischen Einprägungen dank eines eigenartigen „Assoziations“typus die Verbindung zwischen dem Vorbild und den Nachbildern herzustellen vermögen, und zwar unter der Voraussetzung, dass diese in Rede stehenden schematischen Einprägungen in die „perzeptiven“ Phantasien „übergehen“ (aber wie?), und unter der zusätzlichen Voraussetzung, dass sie sich nicht in der Transposition in Bilder völlig verlieren (aber warum und wie?). Mit anderen Worten, die Frage ist, ob diese schematischen Einprägungen nicht letztlich für die Kongruenz konstitutiv sind und für das, was wir als mit sich selbst übereinstimmenden Schematismus unterschieden haben, dessen Funktion sich darauf beschränkte, virtuelle „perzeptive“ Phantasien virtuell um diese oder jene „perzeptive“ Phantasie herum zu „verteilen“, wobei die Transposition einer der letzteren in das Vorbild zur Folge hätte, dass zugleich erstere in potenzielle Bilder (Nachbilder) für jede mögliche Variation, für jeden möglichen Variationsverlauf, der dadurch kein sprachlicher Verlauf wäre, transponiert würden. 75
All dies muss nun weiter ausgeführt und verdeutlicht werden. Es geht dabei insbesondere darum zu zeigen, wie der „Übergang“ von wilden Wesen zu „‚perzeptiven‘ Phantasien“ mittels der schematischen Einprägungen aufzufassen ist. Dies betrifft den Kern der Stiftung der Idealität. Hierfür kann auf einen längeren (bedeutsamen aber auch schwierigen) Auszug Bezug genommen werden, der das Verhältnis von außersprachlichen zu sprachlichen Wesen betrifft.76 In diesem Passus wird eine zweifache Struktur schematischer Einprägungen entwickelt qua „Verhältnisse, innerhalb derer die sprachli75 76
Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 157. Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 157, Z. 28 – S. 161, Z. 4.
Die Stiftung der Idealität
211
chen Verweise von ‚perzeptiven‘ Phantasien zu ‚perzeptiven‘ Phantasien und im selben Schlage von phantasiemäßig ‚perzipierten‘ (radikal nicht darstellbaren) Sachen zu phantasiemäßig ‚perzipierten‘ Sachen außersprachliche Verweise von Sachen zu Sachen bedecken [recouvrent], so wie ein Boden einen doppelten Boden bedeckt“.77 Es gibt hier also eine zweifache „Sachlichkeit“: die der „sprachlichen Verweise“ von „‚perzeptiven‘ Phantasien“ untereinander einerseits und die von „außersprachlichen Verweisen“ von nicht darstellbaren Wesen untereinander andererseits (die im Übergang in die „‚perzeptiven‘ Phantasien“ virtuell verbleiben). Und dieser Übergang der schematischen Einprägungen in die „‚perzeptiven‘ Phantasien“ findet also unabhängig von der Sprache statt. Richirs Grundthese lautet dann folgendermaßen: Unter diesen „‚perzeptiven‘ Phantasien“ (die also einen „doppelten Boden“, eine „zweifache Sachlichkeit“ haben) hebt sich eine davon aufgrund einer schematischen Unterbrechung ab. „Diese Abhebung […] führt zur Transposition [der „‚perzeptiven‘ Phantasie“] in ein Vorbild und in nichts Anderes.“78 Und die Aufschichtung der Bilder oder das, was Richir auch „die vertikale Achse, die das Vorbild sein wird“, nennt, konstituiert sich gerade durch die Verweise von Sachen zu Sachen, die radikal nicht darstellbar sind, wobei diese Verweise passiven Synthesen79 entsprechen, „durch die sich ‚perzeptive‘ Phantasien unabhängig von der Sprache […] versammeln, nämlich durch ihren ‚doppelten Boden‘, d. h. durch die sprachlichen und außersprachlichen schematischen Einprägungen, die in den Sachen, die darin ‚perzipiert‘ werden, im virtuellen Zustand verbleiben“.80 Zwei Aspekte sind hier von Bedeutung, die beide zum gleichen Ergebnis führen. Der Übergang von den schematischen Einprägungen zu den „‚perzeptiven‘ Phantasien“ überhaupt und insbesondere zu jener, die sich als Vorbild stiftet, kann in der Tat von zwei Seiten aus betrachtet werden. Einerseits vollzieht sich – um das noch einmal zu betonen – die in Rede stehende Ablösung der „‚perzeptiven‘ Phantasie“ außerhalb der Sprache, und am Ende dieser Transposition „trägt“ sie sozusagen weiterhin die Nicht-Darstellbarkeit mit sich; und andererseits betrifft der Übergang der Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 158 (hervorgehoben v. Vf.). Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 158f. 79 Siehe Kapitel III. 80 Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 158. 77 78
212
Kapitel VII
„‚perzeptiven‘ Phantasie“ in ein Vorbild nicht das, „was man seinem ‚Inhalt‘ […] zuschreiben kann“81 (womit zum Ausdruck gebracht wird, dass, weil das nicht den Inhalt betrifft, es den schematischen Einprägungen zugeschrieben werden muss): hieraus folgt (und das trifft in der Tat für beide Fälle zu und bestätigt zudem auch das oben Auseinandergelegte), dass das Kongruenzprinzip der Bilder aus nichts Äußerem herstammt, sondern aus der Innerlichkeit der Konkretheiten im archaischsten phänomenologischen Register. In der nicht weniger bedeutsamen weiteren Folge des angegebenen Ausschnitts erläutert Richir, worin die Bezüge zwischen jenen Konkretheiten bestehen. Die „flimmernden Überkreuzungen“ zwischen schematischen Fetzen und Sinnfetzen werden wie folgt beschrieben: Da jede schematische Einprägung durch eine a priori unbestimmte Vielfalt undefinierter sich kreuzender schematischer Fetzen konstituiert ist und da, durch die Tatsache, dass es hier das im Flimmern begriffene Element des Intelligiblen gibt, es somit auch in diesen schematischen Fetzen sich kreuzende Sinnfetzen gibt, die mit ihnen wechselseitig flimmern, bedeutet das, dass die in Rede stehenden Sinnfetzen, die aufgrund der schematischen Unterbrechung ganz genau diesem oder jenem Sprachphänomen entnommen wurden, je vielfältige Sinnfetzen sind, das heißt vielfältige Splitter von Sprachphänomenen, die, solange man beim Vorbild bleibt, rein potenziell sind. Diese vielfältigen Sinnfetzen sind also gewissermaßen im Vorbild – seiner „senkrechten“ Achse gemäß – verschmolzen; ihnen ist gemein, dass sie sich in der abgelösten „perzeptiven“ Phantasie und von da aus dann im Vorbild aufstocken oder überschieben; in letzterem transponiert sich jene durch diese Ablösung, indem sie mit dem Element des Intelligiblen flimmert. Darin besteht ihre Kondensierung in einer gewisser Weise hyperdichten Potentialität von Möglichkeiten vielfältiger Sinnfetzen; und dies sorgt dafür, dass diese Potentialität a priori den Möglichkeiten der konkreten Entfaltung dieses oder jenes Sprachphänomens gegenüber indifferent ist, welches sozusagen dafür anfällig ist, diesen oder jenen Sinnfetzen oder diese oder jene Ansammlung davon in Gegenwärtigkeit wieder zu verzeitlichen.82
Mit anderen Worten, die Stiftung der Idealität beruht auf der Ablösung einer der „‚perzeptiven‘ Phantasien“, die schematische Ein-
81 82
Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 159. Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 159f.
Die Stiftung der Idealität
213
prägungen haben, wobei diese Einprägungen ihrerseits durch Sinnfetzen konstituiert sind, durch Splitter von Sprachphänomenen, die mit schematischen Fetzen verflochten, vielfältig und rein potenziell sind und sodann im Vorbild verschmolzen, aufgeschichtet, verdichtet werden. Die eidé dagegen sind auf ewig nicht darstellbare „Kerne“ (bzw. „Knoten“). Dieses Verschmelzen, diese Aufschichtung, diese Kondensierung, findet keineswegs auf einer linearen Zeitreihe statt, sondern geht, wie angemerkt wurde, durch das „Zeitsieb“ des cartesianischen Zeitpunkts (der weder eine Vergangenheit noch eine Zukunft hat) hindurch, was auf eine „kontinuierliche Schöpfung“ hinausläuft (dieser Ausdruck ist zutreffender als der eines eidetischen „Verlaufs“, der zeitlich konnotiert ist, was hier nicht in Frage kommt). Kann das eidos nun also tatsächlich „definiert“ werden? Richir versucht sich darin. Die eidé wären somit Knoten (Kerne) von Sinnfetzen, die durch eine aufgeschichtete Überlagerung verdichtet werden, das heißt Knoten von schematischen Einprägungen, in denen sich unbestimmte [indéfinis] schematische Fetzen kreuzen, die eine auf ewig potenzielle, das heißt virtuelle Pluralität von Sprachphänomenen anregen […].83
Der letzte wichtige Punkt betrifft schließlich das Verhältnis dieses Vorbilds zu den Nachbildern – wodurch zugleich die Rolle des phänomenologischen Schematismus bei der Stiftung der Idealität abschließend erklärt werden kann. Die Nachbilder werden freilich auf die gleiche Art konstituiert wie das Vorbild – in ihnen wiederholt sich also (auf der Grundlage der mit sich übereinstimmenden Schemata) der gleiche Übergang der Sinnkerne in Bilder. Der Verlauf der Variation ist also durchaus insofern eine […] „kontinuierliche Schöpfung“ im Sinne Descartes’, als sich darin der Schematismus der sich wiederholenden Wiederholung des Zeitpunktes (der weder intrinsische Vergangenheit noch Zukunft hat) ins Spiel bringt […]. Dieser Schematismus der sich wiederholenden Wiederholung ist auch die „Form“ der sche-
83 Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 161 (hervorgehoben v. Vf.). Die Sprachphänomene sind dabei „durch ihre Überlagerung verflochten […] und [gehen] in ihrer Virtualität in der „Vertikalität“ des Vorbildes auf […], das dadurch, was seine Darstellbarkeit betrifft, beliebig ist“, ebd.
214
Kapitel VII
matischen Einprägungskerne und des Zeitpunktes ihres Auftretens/Verschwindens ohne Affektionen und Affekte, er sichert die Stabilität der Idealität und scheint die besagten Einprägungen nicht in sprachliche Schemata, wohl aber in Schemata der Idealität zu transponieren, welche sich in dieser Wiederholung zu fixieren und in Übereinstimmung zu identifizieren scheinen.84
Ganz am Ende seiner Analysen zur Stiftung der Idealität schließt Richir also erneut an eine Errungenschaft aus der vierten der Recherches Phénoménologiques (1983) an, in der er das „transzendentale Schema der sich wiederholenden Wiederholung“ ausgearbeitet hatte (das, wenn es sich als solches erkennt, laut Richir für die Zahlen konstitutiv ist).85 Sofern dieser Schematismus der sich wiederholenden Wiederholung sowohl die „Form“ der schematischen Einprägungskerne als auch des zeitlichen Prismas, auf der Grundlage dessen sich die eidé stiften, ausmacht, haben wir es hier in der Tat – so lautet jedenfalls Richirs Hauptthese seiner späten Überlegungen zur Stiftung der Idealität, und darin besteht auch das Neue zumindest gegenüber den Recherches phénoménologiques, wenn nicht gar gegenüber L’institution de l’idéalité – mit einer „endogenen“, „inneren“, „immanenten“ Stiftung zu tun, was in völliger Kohärenz steht zur Richir’schen „Neugründung“ der Phänomenologie, die ja nicht mehr die objektivierende Intentionalität, sondern die Phantasie und die „präintentionale“ Dimension des transzendentalen Bewusstseins in den Mittelpunkt dieser „Neugründung“ rückt.
Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 162. M. Richir, Recherches Phénoménologiques (IV, V). Du schématisme phénoménologique transcendantal, Brüssel, Ousia, 1983, S. 107. 84 85
Kapitel VIII Das phänomenologische Unendliche Der phänomenologische oder transzendentale Status [der Idee des Unendlichen] ist, wenn nicht unbegreiflich, so doch zumindest absolut außergewöhnlich. Es scheint, dass sie, indem sie die Phänomenologie rettet, damit auch deren gesamten Sinn verkehrt. J. Derrida (1954)
Im Folgenden1 geht es um einen Grundbegriff der zeitgenössischen Phänomenologie, nämlich um den des phänomenologischen Unendlichen, der hier außerhalb jeglicher vermeintlichen „theologischen Wende“ der Phänomenologie betrachtet wird. Grundlegend ist dieser Begriff schon deshalb, weil er, wie das von Natalie Depraz hervorgehoben wurde, den unausgesprochenen Bezug von „Gegebenheit“ und „Anschauung“ in Frage stellt.2 Aber vor allen Dingen vermag er naheliegender Weise die Phänomenologie mit der Metaphysik in Verbindung zu setzen. Kann man dabei aber auch so weit gehen zu behaupten, wie Derrida das in dem Zitat aus seiner frühen Arbeit über den Husserl’schen Begriff der Genese zu tun scheint, dass das Unendliche – als metaphysischer Begriff – die Phänomenologie „rette“? Zunächst soll hierbei von Tengelyis Auffassung eines „phänomenologischen Unendlichen“ ausgegangen werden, um zu prüfen, ob sie die Ergebnisse der Auseinandersetzung zwischen Richir und Levinas bestätigt, die ja ihrerseits bereits den für den Bezug von „Phänomenologie“ und „Metaphysik“ wesentlichen Begriff des 1 Eine erste Fassung dieses Kapitels ist erschienen unter dem Titel „Zum phänomenologischen Unendlichen“, in Phänomenologie & Metaphysik – Phénoménologie & Métaphysique, I. Römer, A. Schnell (Hsg.), Hamburg, Meiner, „Beihefte zu den ‚Phänomenologischen Forschungen‘“, 2020, S. 251–266 2 Siehe N. Depraz, „Y a-t-il une donation de l’infini?“, in La démesure, Epokhè, Nr. 5, 1995, S. 175–201, hier S. 180.
216
Kapitel VIII
Unendlichen auf eine für die nachfolgende Diskussion wegweisende Art in den Mittelpunkt gestellt hatte. Hierdurch wird natürlich zugleich die Frage nach dem Status der „Endlichkeit“ in den Vordergrund gerückt, die ja zunächst von Heidegger3 prominent gemacht wurde und bezüglich welcher diese bedeutenden Vertreter der zeitgenössischen Phänomenologie Argumente ins Spiel bringen, die durchaus Beachtung verdienen. Was war Tengelyis letztes philosophisches Wort? Er hat eine „diakritische Phänomenologie“ ausgearbeitet, die den letzten Baustein zu seinem „metontologischen Transzendentalismus“ ausmachen und in der ein als „offenes Unendliches“ verstandener phänomenologischer Unendlichkeitsbegriff herausgestellt werden sollte. Worin besteht die Bedeutung dieses Begriffs? Von einem „diakritischen System“ oder „Wert“ war zunächst bei Merleau-Ponty,4 dann auch bei Richir5 die Rede. Vor allem aber kann er als Leitfaden von Tengelyis eigenem philosophischen Projekt angesehen werden – und zwar von Der Zwitterbegriff Lebensgeschichte6 bis hin zu seinem letzten Werk.7 Inwiefern bestimmt die Frage nach dem phänomenologischen Unendlichen diesen Entwurf einer „diakritisch gewendeten“ Phänomenologie? Tengelyis Ausgangspunkt ist Husserls Idee, wonach das Unendliche nicht lediglich ein Denkobjekt ist, sondern ein Formbegriff (qua „Kategorie der Erfahrung“) oder, genauer, eine kategoriale Form, der korrelativ eine kategoriale Anschauung entspricht. In Tengelyis erhellenden – wenn auch, wie er meinte, „plakativen“ Worten – komme „das Unendliche nach phänomenologischer Auffassung mit uns in die Welt“.8
3 Für eine erste Ausarbeitung dieses Problems, siehe Phantasía, imagination, affectivité, op. cit., S. 237f. (der Paragraph trägt den Titel „Endliches und Unendliches“). 4 Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1964, S. 287. 5 La crise du sens et la phénoménologie, Grenoble, Millon, 1990, S. 18; Fragments phénoménologiques sur le langage, op. cit., S. 201. 6 Der Zwitterbegriff Lebensgeschichte, München, Wilhelm Fink Verlag, 1998, siehe insbesondere S. 37f. und S. 237; siehe auch L’histoire d’une vie et sa région sauvage, Grenoble, Millon, 2005, vor allem S. 221 und S. 331–338. 7 L. Tengelyi, Welt und Unendlichkeit, Freiburg/München, Alber, 2014. 8 Welt und Unendlichkeit, S. 535.
Das phänomenologische Unendliche
217
Für Husserl spielt in der Tat der Begriff des Unendlichen bereits in die Identifizierung von Erfahrungsding und der Idee im kantischen Sinne hinein: Ein unendliches Erfahrungskontinuum (eines erscheinenden Dings) kann ihm zufolge in einer evidenten (freilich inadäquaten) Anschauung gegeben werden. Dies bedeutet keineswegs eine Infragestellung der Realität des Dings, sondern stellt vielmehr die vollständige Bestimmung desselben sicher. Diese Dingstruktur – also seine Erscheinung in einem unendlichen System möglicher Erfahrungen – macht gerade in Tengelyis Augen ein „diakritisches System“ aus, das er in den Mittelpunkt seiner „diakritischen Phänomenologie“ rückt. Sofern sich nun diese Kennzeichnung des unendlichen Systems möglicher Erfahrungen als Idee im kantischen Sinne bei Husserl je auf ein „Ich kann“ bezieht, also auf ein ichliches Vermögen im Sinne einer „Habitualität“, besteht die Gefahr – zumindest laut Tengelyi – eines unannehmbaren Idealismus, sofern sich der Erfahrungshorizont hierbei auf ein bloßes Bewusstseinskorrelat beschränkt. Deswegen wird die diakritische Phänomenologie dazu geführt, jenes System sowohl von der Seinstotalität des Dings als auch von der Gesamtwirklichkeit der Welt zu unterscheiden. Für Tengelyi bedeutet das, dass von dem Gedanken Abstand genommen werden muss, das Ding in der Welt sei an sich vollständig bestimmt. Und hieraus folgt dann die Idee einer „offenen Unendlichkeit der Welt“. Auch diese Auffassung findet sich aber trotz des soeben in Erinnerung Gerufenen bereits bei Husserl. Wie von Tengelyi zurecht betont, fragte sich Husserl im Ausgang vom Gedanken des Aufkommens neuer Eigenschaften der Dinge (Tengelyi denkt hierbei etwa an kulturelle und soziale Prädikate, die zu den natürlich gegebenen Dingen hinzukommen können)9 (siehe den § 64 des zweiten Ideen-Bandes), ob der „unendliche“ Charakter der Welt nicht eine „Offenheit“ impliziert, welche die Idee einer transfiniten Unendlichkeit untergräbt.10 Die Dinge haben somit ein „offenes Wesen“ – und das bedeutet eben, dass sie nicht vollständig bestimmt sind, wodurch verständlich wird, weshalb Husserl sich vom Cantor’schen Gedanken des Transfiniten abwendet. 9 Er veranschaulicht seinen Gedanken mit dem Beispiel von Wohnhäusern und Tempeln, Dörfern und Städten, die aus Felsblöcken und sonstigem Gestein entstanden sind. 10 Ideen II, Den Haag, M. Nijhoff, 1952, S. 299.
218
Kapitel VIII
Die Argumentationsweise, die Tengelyi hierbei für angemessen betrachtet, ist eine „alteritätstheoretische“.11 Diese betrifft die theoretischen Aspekte der Alterität und dabei insbesondere das „Anderswerden der Dinge“. Tengelyi sieht darin eine „Dynamisierung“ des unendlichen Erscheinungskontinuums. Und vor allem wird dabei der Tendenzcharakter jeder „Einstimmigkeitstendenz“ hervorgehoben. Es ist aber nicht ganz von der Hand zu weisen, dass bei dieser Herausstellung der Unbestimmtheit in Tengelyis PhänomenologieEntwurf letztere ihrerseits gewissermaßen etwas unterbestimmt bleibt. Eine Weise, die theoretischen Aspekte der alteritätstheoretischen Argumentation und die impliziten Voraussetzungen jener Unbestimmtheitsdimension zusammenzudenken, lässt sich in einer Diskussion finden, die Richir zu Anfang der 1990er Jahre mit Levinas angeregt hat.12 Tengelyi kannte diese selbstverständlich, die Frage ist aber, ob diesbezüglich nicht einiges mehr entwickelt werden kann, als das in Welt und Unendlichkeit der Fall gewesen ist. Und es stellt sich insbesondere die Frage, ob der Gedanke, dass das Unendliche „mit uns“ in die Welt komme, wirklich voll und ganz haltbar ist, und was sich daraus für die Phänomenologie im Allgemeinen und für ihren Bezug zur Metaphysik im Besonderen ergibt. Schauen wir also näher hin, welche Auffassung eines phänomenologischen Unendlichen sich in dieser Diskussion herauskristallisiert. Levinas’ grundlegendes philosophisches Projekt in seinem zweiten Hauptwerk13 (auf das sich Richirs Lektüre ausschließlich fokussiert) betrifft, wie der Name schon sagt, ein Denken dessen, „was“ oder „wie“ „anders als Sein geschieht“. Es geht dabei darum, eine radikale Andersheit gegenüber dem „Sein“ zu denken, das heißt in erster Linie gegenüber dessen erster Bestimmung, die im Erscheinen besteht. Kurz gesagt zielt dieses Denken einer radikalen Andersheit auf eine grundlegende Unscheinbarkeit ab. Paradox ist hierbei, dass nach Levinas’ Ansicht in diesem Gedanken trotz dieser Unscheinbarkeit der Ursprung der Ethik und gewissermaßen auch des Mensch-Seins zu verorten ist (dazu später Welt und Unendlichkeit, S. 546. Siehe M. Richir, „Phénomène et infini“, in Levinas, Paris, éditions de l’Herne, 1991. 13 E. Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Den Haag, M. Nijhoff, 1978 (2. Aufl.). 11 12
Das phänomenologische Unendliche
219
mehr). Ein erster, sehr bemerkenswerter Punkt betrifft somit den Bezug innerhalb dieser Kennzeichnung des phänomenologischen Unendlichen zwischen Unscheinbarkeit und dem Ursprung des Mensch-Seins. „Ursprung des Mensch-Seins“ heißt (hier): Ursprung des grundlegendenden Verhältnisses von Selbst und Anderem. Dieses Verhältnis muss in den beiden hier in Frage kommenden Richtungen untersucht werden. Einerseits betrifft es das „Selbst“, das „Sich“ – ein Akkusativ, der jedem Nominativ vorausgeht. Andererseits ist es aber auch ein ursprüngliches „Trauma“,14 das dieses „Selbst“ mit einer „Positivität in der Verantwortlichkeit“ belegt, die von vornherein den Bezug zum Anderen herstellt. Genauer gesagt handelt es sich dabei um eine zweifache Positivität. Erstens (auf Seiten des Anderen) um eine Antwort, die auf eine „nicht thematisierbare Herausforderung“ eingeht; und zweitens (auf Seiten des Selbst) um eine Schuld, „die umso größer wird, je mehr sie erstattet wird“, und einem sich verunendlichenden Abstand gleichkommt, in dem „die Herrlichkeit des Unendlichen aufbricht“.15 Der Bezug von „Selbst“ und „Anderem“ verdichtet sich in diesem göttlichen Unendlichen dabei insofern, als dieses ein „Zum-Ich-Kommen“ qua „[Vom-Ich-]Ausgehen ermöglicht, welches das Selbst eine Bewegung hin zum Nächsten vollziehen lässt, bzw. „einen Rückzug ins Selbst, der eine Flucht ins Selbst ist“, möglich macht.16 Das göttliche Unendliche ist also die Quelle zweier zusammengehöriger Doppelbewegungen: jener – wechselseitigen – eines „Anstoßes“, der „von außen“ kommt (das heißt von einem nicht thematisierbaren, unscheinbaren Jenseits) und eines beweglichen Abstands, der sich „von innen“ verunendlicht;17 und jener eines (zum „Selbst“) 14 Richir sieht in der ethischen Dimension bei Levinas eine Dimension, welche die „Unterbrechung der phänomenologischen Tautologie“, das heißt der „Tauto-logie des Phänomens als dem Selbigen (le même)“, hervorruft (siehe weiter unten). 15 Dieses „In-der-Schuld-Sein“, das insofern anachronistisch ist, als es eine „Schuld“ bezeichnet, „die dem Leihen vorausgeht“, ist der ethische Modus der tiefen Asymmetrie, welche die Identität (Selbigkeit) des Selbst, der Selbstheit, in Frage stellt. 16 Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, S. 135. 17 Diese gleichsam „innere Verunendlichung“ spiegelt die Tatsache wider, dass Levinas hier auf Derridas berühmte in „Violence et métaphysique“ entwickelte Kritik an Levinas’ Ansatz in Totalité et infini eingeht. Laut
220
Kapitel VIII
Kommens und eines (vom „Selbst“) „Ausgehens“, die also den grundlegenden Bezug von Selbst und Anderem stiftet. Von hier aus entwickelt Richir eine bemerkenswerte Rekonstruktion des Gedankengangs von Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht, die sich in erster Linie an den Begriffen der „Diachronie“, der „Substitution“, der „Illeität“ und des „Prophetismus“ orientiert. Diachronie. Diese zweifache Doppelbewegung ist in der Diachronie qua „Spur des Unendlichen“ verortet. Diese ist ein Jenseits, das zugleich auch ein Diesseits ist. Es geht dabei darum, dort „hinaufzusteigen“, bzw. „die eigene Bedeutung des Sagens diesseits der Thematisierung des Gesagten aufzuzeigen“.18 „Diese Bedeutung aufzuzeigen“ heißt in Wirklichkeit aber „das Diachronische in der Unmöglichkeit seiner zeitlichen und wesenhaften Synchronisierung flimmern zu lassen“. Anders ausgedrückt handelt es sich dabei um ein „Hinaufsteigen“, das nicht zu einer neuartigen „Sphäre“ gelangt – einer transzendentalen oder phänomenologischen diesseits oder jenseits der objektiven oder erscheinenden Sphäre –, sondern zu einer Passivität, die „passiver als alle Passivität“ ist und die nicht reduzierbare Singularität des „Selbst“ (und das bedeutet: eine ontologisch nicht identifizierbare Singularität) ausmacht; also zu einer Passivität, in der die Dia-chronie eine Zeit, die ihrerseits nicht auf das Selbige reduziert werden kann und dadurch eben das Selbst eigens kennzeichnet, „vergehen“ lässt. Diese Singularität ist in der „unerinnerbaren Passivität“ verankert, außerhalb der Gegenwart und überhaupt aller Gegenwärtigkeit, als das Eine jenseits des Seins […], ein Selbst in unendlicher Flucht“.19 Substitution. Diese tiefe Verbindung zwischen der „Dimension“ des „Sagens“ (die also keine selbständige „Sphäre“ ausbildet und die Levinas nicht als eine „transzendentale“ ansieht, während Richir Derrida kann die Phänomenologie nämlich tatsächlich „gerettet“ (will sagen: eines subjektivistischen Ansatzes entrissen) werden, sofern sie bloß erkenntlich macht, dass das „Erscheinende“ sich „innerlich verunendlichen“ muss. Zur Idee einer „unendlichen Endlichkeit“ bei Derrida, siehe die hervorragende Abhandlung von S. Jullien, La phénoménologie en suspens – Derrida et la question de l’apparaître, op. cit. 18 Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, S. 255. 19 „Phénomène et infini“, S. 248. Richir führt hierzu näher aus: „Das Diesseits des Selbst in der Rekurrenz zu sich selbst ist zweifellos bereits, qua unerinnerbare Anarchie, das Unendliche, das die unendliche Flucht des Selbst anruft und in-spiriert“ (ebd., S. 250) (siehe weiter unten).
Das phänomenologische Unendliche
221
– im Gefolge Derridas – gerade den Gebrauch dieses Ausdrucks fordert) und der Singularität des „Selbst“ muss also betont werden. Es handelt sich dabei nicht um eine völlig „a-subjektive“ Dimension (Patočka), die eines jeglichen „Selbst“ beraubt wäre. Und es geht dabei auch nicht um eine „neutrale“ Gegebenheit (in der Form eines „es gibt“), die allererst im Ereignis „anzueignen“ wäre (Heidegger). Die Pointe in Levinas’ Gedankengang besteht, wie Richir ganz richtig gesehen hat, darin, dass man dem (vermeintlichen) Solipsismus Husserls nur dann entgeht, wenn erkannt wird, wie die Sprache sich auf etwas Anderes als sie selbst beziehen kann. Und hierfür ist eben der Rückgang auf eine „neutrale“ „A-subjektivität“ nicht hilfreich. Was dagegen notwendig ist, ist eine „reine, anarchische, nicht erinnerbare Gegebenheit, und zwar eine solche für den Anderen eines ‚Ich‘, welches durch das „‚Sich‘ des ‚sich Sagens‘ zur Geisel des Anderen wird; dank dieser Gegebenheit allein kann die Sprache, sofern sie von jenem Abstand oder jenem präoriginären Abgrund lebt, etwas Anderes als sie selbst sagen, außerhalb der Tauto-logie des Seins oder des Ereignisses“.20 Die Grundgegebenheit – diesseits des „Es gibt“ – ist somit eine solche für den Anderen gegenüber dem „Selbst“, das diesem nicht unterliegt im Sinne einer „Sub-stanz“, sondern welches es ersetzt (Levinas schreibt: „sub-stituiert“21 – die „Sub-stitution“ setzt sich also gleichermaßen an die Stelle der „Sub-stanz“). Dass das „Selbst“ im Akkusativ, das „Sich“, zur „Geisel“ des Anderen wird, heißt somit, dass die Sprache nur unter der Bedingung etwas (Anderes) sagen kann, dass das Selbst wortwörtlich das (bzw. den) Andere(n) sub-stituiert, sich „ver-andert“. Und dadurch wird dann auch verständlich, weshalb Levinas es ablehnt, jene Dimension als eine „transzendentale“ aufzufassen, denn dieser Begriff entzieht sich seiner Ansicht nach der Möglichkeit, „Phénomène et infini“, S. 248. Und diese Sub-stitution wird durch die „Rekurrenz“ bedingt (deren „Bewegung“ die „Verfolgung“ ist), d. h. durch eine unaufhörliche „Suche nach dem Selbst, nach seiner nicht begrifflichen, nicht ontologischen Identität, nach seiner unersetzlichen Einheit, […] nach einem Selbst, das nicht schon das mit dem Selbst identifizierte Selbst gemäß einer Stasis im Selbstbewusstsein ist“ („Phénomène et infini“, S. 248). In dem Gedanken einer „unaufhörlichen“ Suche kommt ein anderer Aspekt der hier analysierten Unendlichkeit zum Ausdruck: Gemeint ist eine „unendliche Rekurrenz des Selbst – endlose Regression“ (ebd.). 20 21
222
Kapitel VIII
nicht so sehr das bzw. den Andere(n) zu empfangen (es tut das vielleicht auch, aber Levinas geht noch einen Schritt weiter), sondern vielmehr das Selbst als Sub-stitution des Anderen zu denken.22 In Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht wird sich Levinas also der Vorrangigkeit des Seins-zum-Anderen gegenüber Heideggers In-derWelt-sein bewusst: Die Sub-stitution – die Richir hier also (noch) nicht in erster Linie als eine ethische denkt (was dann bei Tengelyi, wie oben angemerkt, Widerhall gefunden hat) – ist die durchaus transzendentale und (zugleich auch) alteritätstheoretische Bedingung des sich sagenden und Anderes als es selbst sagenden Sinns. Illeität. Die Substitution beschränkt sich aber nicht auf die Öffnung hin zum Anderen und zur alteritätstheoretischen Dimension des Sinns. Das Selbst ist in einer Radikalisierung zweiter Potenz, in einer Radikalisierung der Substitution – die ja ihrerseits bereits eine Radikalisierung der Rekurrenz war – also in einer Radikalisierung der Radikalisierung „Identität in diastasis“.23 Das bedeutet einerseits, dass das Selbst in dieser Radikalisierung jegliche relationale Struktur auflöst – und zwar insbesondere jeden Bezug zum Anderen aber auch zu sich selbst. Das Selbst fällt „diesseits des Selbst, in die diastasis des Selbst, die sich als Diachronie eröffnet“.24 Und zugleich eröffnet sich dadurch andererseits ein Abstand, der „eine nicht darstellbare Spur, eine Art des Unendlichen“, eine „Spur des Unendlichen“25 manifestiert. Diese Spur ist die Spur eines nicht erinnerbaren „Aufbruchs“, der also immer schon angefangen hat und nichts anderes ist als ein solcher der nicht erinnerbaren Passivität, von der oben die Rede war. Was ist der Status des Unendlichen, das hier zum Vorschein kommt? Das Unendliche wird von Levinas als „Illeität“ bezeichnet. Dieser Ausdruck verbindet in sich das französische „il“ (es) und das
22 Das ist durchaus überraschend, da – von Fichte bis zu Husserls Analysen der intersubjektiven Dimension der transzendentalen Subjektivität (Husserliana XIII-XV) und selbst darüber hinaus bis zu den theoretischen Ausarbeitungen der Transzendentalpragmatik (K.-O. Apel) – diese Berücksichtigung der Alterität innerhalb des transzendentalen Horizonts bereits des Öfteren und in unterschiedlichen Ausführungen geleistet wurde. 23 Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, S. 147. 24 „Phénomène et infini“, S. 250. 25 Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, S. 149.
Das phänomenologische Unendliche
223
lateinische „ille“ (jenes). Damit soll einerseits (zumindest unter anderem) die Neutralität des narrativen Schreibens bei Blanchot 26 bezeichnet werden, das die zweifache Bewegung der Selbstdistanzierung der Person und der Selbstdezentrierung des Werkes beim Schreiben zum Ausdruck bringt; andererseits wird hierdurch auf das „ille“ einer absoluten Transzendenz (so wie sie in der jüdischen Tradition gedacht wird) verwiesen, die sich stark von der Gott assimilierenden Tendenz absondert, die in Levinas’ Augen die christliche rationale Theologie kennzeichne. Diese Illeität ist nun laut Levinas nie gegenwärtig gegeben, sondern manifestiert sich eben höchstens in Form einer Spur, genauer gesagt, „als Spur des Entzugs, den das Unendliche als Unendliches vollzieht, bevor es kommt“.27 Hierbei bekundet sich der nicht ausschließlich ethische Sinn der Substitution – als Radikalisierung der Rekurrenz – nur umso deutlicher:28 Es handelt sich dabei um die „radikalste Hingabe an die Passivität, bei der nicht der Andere als anderes Selbst mich besitzt und verfolgt, sondern eben die Spur des Entzugs des Unendlichen […], ‚wo das Selbst sich vom Selbst ablöst‘ […], jenseits des Ich des Ich-selbst, das Unendliche“.29 Wer ist dieser „Illeität des Unendlichen“ genannte Gott? „Gott ‚ist nicht‘, weder in mir noch im Anderen […], denn er ‚ist‘ überhaupt nicht, immer schon und je noch woanders, in der nicht erinnerbaren Spur seines Entzugs.“30 Levinas denkt die diastasis des Selbst und den Entzug Gottes zusammen. Und im Ausgang von Richirs Kommentar zu den Levinas’schen Ausführungen, können auch „die Bedingung der Kreatur“ des Selbst (die, wie Levinas dies 26 Siehe insbesondere „La voix narrative (le ‚il‘, le neutre)“, in L’entretien infini, Paris, Gallimard, 1969, S. 556–567. 27 Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, S. 148, Fußnote 19. 28 Freilich ist es auch möglich, diese nicht ausschließlich ethische Lesart Levinas’ (die man durchaus mit Richir teilen kann) – dann allerdings gegen Richir – in eine weder theologische noch religiöse Richtung zu lenken. Hierfür genügt es, an die Definition der Religion zu erinnern, die Levinas selbst in Totalité et infini einführt: „Wir schlagen vor, mit ‚Religion‘ jenen Bezug zu bezeichnen, der zwischen dem Selbigen (le même) und dem Anderen (l’autre) besteht, ohne hierbei in eine Totalität einzugehen“ (Totalité et infini, Den Haag, M. Nijhoff, 1971 (4. Aufl.), S. 10). Hiermit stellt er nämlich ganz offensichtlich einen nicht religiösen Religionsbegriff auf. 29 „Phénomène et infini“, S. 251. 30 Ebd.
224
Kapitel VIII
in Totalité et infini zum Ausdruck gebracht hatte, im „Hinabsteigen von einer Bedingung diesseits dieser Bedingung“31 besteht) und die Idee, dass die „ursprüngliche Sühne“ sich in eine „Sühne für das Sein“32 verkehrt, zusammengedacht werden: Sofern Levinas über die Sühne klarstellt, dass sie „letztlich mit der außer-gewöhnlichen und dia-chronischen Umkehr des Selbigen ins Andere zusammenfällt“,33 wird deutlich, dass sich die Einheit von jener Suche des Unbedingten diesseits der Bedingung und von der Hingabe des Selbigen an das Andere im Entzug des Unendlichen vollziehen kann. Die „Sühne für das Sein“ soll dann offenbar die Hingabe des Gewichts des Seins an die Übernahme des Gewichts des Anderen bezeichnen. Dieser gesamte Gedanke lässt sich dann auch noch einmal folgendermaßen zum Ausdruck bringen: Sich auf das Unendliche zu beziehen, setzt voraus zu verstehen, dass die Suche nach dem Unbedingten einem Denken des Anderen, nicht aber des Selbigen gleichkommt – wobei dieses Denken des Anderen die Substitution (des Selbst gegenüber dem Anderen) als Radikalisierung der Rekurrenz (des Selbst) zur Voraussetzung hat. Und das Denken des Unendlichen schreibt diesem keinerlei positive Bestimmtheit zu, sondern lässt es eben als Entzug erscheinen. Prophetismus. Es stellt sich dann aber noch die Frage, wie – angesichts der Tatsache, dass Gott ja „nicht ist“ und also auch nicht als vor seiner Selbstmanifestation existierend angesehen werden kann – Gottes Wort, das Sprechen der Transzendenz, eigens zum Ausdruck kommen soll. Um hierauf eine Antwort geben zu können, führt Levinas den Begriff des „Prophetismus“ ein. Richir kennzeichnet diesen Begriff folgendermaßen: Der Status des prophetischen Sprechens ist […] ganz außergewöhnlich, denn anstatt dass es ein Zurück auf die bereits vernommene Stimme wäre, das die Syn-chronisierung des Hin mit diesem Zurück ermöglichte, ist es ganz im Gegenteil ein primordiales Hin, das in der diastasis oder der Versetzung der Identität des Selbst vorbehaltlos offen ist und das Zurück – durch sein präoriginäres Voraussein gegenüber demselben – […] je nur verspätet auf den Weg bringt34 Totalité et infini, S. 58. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, S. 151. 33 Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, S. 187. 34 „Phénomène et infini“, S. 255. 31 32
Das phänomenologische Unendliche
225
– wodurch sich das prophetische Sprechen als „‚Herrlichkeit des Unendlichen‘, […] Verunendlichung des Unendlichen (siehe oben), in einem nicht reduzierbaren Überschuss gegenüber dem Zurück“ bestehend erweist.35 Der Prophetismus ist eine – philosophische! – Diskursform, die sich als „Verunendlichung des Unendlichen“ in der diastasis des Selbst entfaltet und sich dabei nicht auf ein vorher erlebtes „Sehen“ (im Sinne einer „Offenbarung“) stützt, sondern als „primordiales Hin“ und im wörtlichen Sinne „vorursprünglich“ allererst den Sinnraum eröffnet, den das reflexive Denken nur nachträglich zu fassen vermag. Das prophetische Sprechen ist die ursprüngliche Verwirklichung einer Sinneröffnung, die jeder transzendenten Instanz je schon vorausliegt und sich somit auch nicht an irgendeiner vorausgesetzten Realität messen kann. Sofern er eine Antwort auf etwas ist, das keine im Voraus gestellte Frage ist, ist der Prophetismus die Stimme der wohl verstandenen phänomenologischen Konstruktion. Nachdem Richir diesen Rahmen seiner Lesart des Levinas’schen Denkens so großartig erstellt hat, macht er sich an die Kritik desselben. Um den Sinn des phänomenologischen Unendlichen angemessen am „Erhabenen“, so wie er es auffasst, begreiflich machen zu können, führt diese Kritik zwei Grundbegriffe ein: den der „symbolischen Tautologie“ und den des „symbolischen Stifters“. Der Grundeinwand, den Richir gegen Levinas ins Spiel bringt, besteht darin, dass die Eröffnung der Illeität, der Transzendenz, des Unendlichen in der Radikalisierung der Substitution und in ihrem Ausgesprochen-Werden im Prophetismus trotz allem eine unbefriedigende und ungenügende Zirkelhaftigkeit (bzw. ein zirkelhaftes „Wieder-holen“) enthält. Laut diesem Zirkel wird vorausgesetzt, dass das im Prophetismus Ausgesprochene, trotz des Hervorkehrens der theoretischen Aspekte dieser Ausarbeitungen, nur in einem transzendenten Unendlichen, das einer „menschlichen Möglichkeit“ entspringt, gewissermaßen seine Ausweisung und Rechtmäßigkeit erhält (auch wenn die Legitimitätsproblematik zweifelsohne bei Levinas ausgeklammert wird). Richir betont hierbei die „menschliche“ Komponente. Er setzt ihr eine andersgeartete Zirkelhaftigkeit entgegen, die er als „symbolische Tautologie“ bezeichnet und deren genuiner „Ort“ der „symbolische Stifter“ sei – welcher seinerseits 35
Ebd.
226
Kapitel VIII
eben das „phänomenologische Unendliche“ trage, so wie Richir es auffasst (was sogleich vertieft werden soll). Genauer gefasst enthält Richirs Kritik drei Seiten. Erstens zielt er auf eine „Ausweitung“ der Phänomenalität ab hin zum Unendlichen, bzw. zum „phänomenologischen apeiron“, das sich von Levinas’ Auffassung des Unendlichen abhebt. Dabei ist die Situation paradox: Auf der einen Seite bezeichnet Richir dieses Levinas’sche Unendliche als „absolut unendliches Unendliches“, „außerhalb der Phänomenalität“; auf der anderen Seite jedoch wirft er ihm durch die Verkettung desselben an eine ethische Ausrichtung, also an die menschliche Endlichkeit, vor, dessen „absoluter Transzendenz“ nicht Rechnung tragen zu können. Für Richir, und das ist der zweite Punkt, ist jene „Verunendlichung des Unendlichen“ nur begreiflich, wenn man darin ein „erhabenes“ Moment erkennt, das heißt, wenn man zuerkennt, dass das Unendliche außerhalb jeglichen Einbildungsvermögens verortet ist (wodurch sich bereits der Horizont seiner Phantasie-Auslegung erschließt, die ab den 2000er Jahren maßgeblich werden wird). Nur dann wird in der Tat das „wahrhaft Erhabene“36 oder, so könnte man hinzufügen, das wahrhaft Unendliche erfasst, jenseits jeder Einschreibung in einen menschlichen Horizont. Gleichwohl darf aber drittens das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden, das heißt, dass dieses Aufgeben des Bezugs zu einer menschlichen Dimension nicht zu einer „operativen ‚Rationalität‘, die ganz allein ablaufen soll“,37 führen darf: Es stellt sich in der Tat die Frage, wie wir dem Rechnung tragen können, wie wir „es sagen oder ‚wissen‘ können“, wie wir, in anderen Worten, die „minimalen Gebote der Phänomenologie“ (J.-T. Desanti) beachten können und zugleich auf die ethische Herangehensweise verzichten. Die Antwort besteht laut Richir darin, die Notwendigkeit der symbolischen Tautologie des Unendlichen außerhalb der Phänomenalität anzunehmen. Für die Erleichterung des Verständnisses empfiehlt es sich, hierzu das erste Kapitel von La crise du sens et la phénoménologie heranzuziehen.38 Der Begriff der „symbolischen Tautologie“, erläutert Richir, verweist zunächst auf jenen der „symbolischen Stiftung“. Diese bringt den Gedanken zum Ausdruck, dass der Mensch nicht der „Herr des „Phénomène et infini“, S. 257. „Phénomène et infini“, S. 259. 38 La crise du sens et la phénoménologie, op. cit. 36 37
Das phänomenologische Unendliche
227
Sinns“ ist. Das wirft das Problem auf, wie sich die Bedeutsamkeit im Allgemeinen und die Bedeutsamkeit des Realen, also Bedeutsamkeit und Realität, zueinander verhalten. Hierfür hält nun gerade die „symbolische Tautologie“ die Lösung bereit: Sie ist „der Ort symbolischer Identität zwischen dem symbolischen ‚System‘ und der Welt“,39 also, anders ausgedrückt, zwischen dem Symbolischen und dem Realen. Die ganze Schwierigkeit besteht dabei darin, jene „Identität“ nicht auf eine unfruchtbare Zirkelhaftigkeit zu reduzieren. Wie kann man einer solchen Reduktion entgehen? Indem man einsieht, dass dieser Ort sich von einem anderen Ort aus erhellt, „welcher der rätselhafte Ort dessen ist, was in sich selbst den Sinn seines Sinnes enthalten soll“,40 also der Ort der „Wahrheit, das heißt, einer gewissen zu suchenden Entsprechung oder Justierung vom Sinn der artikulierten Sprache und dem Sinn ihres Sinns (dem Sinn des Seins), einer gewissen aufzufindenden Anmessung ihrer Bedeutsamkeit und dem, was von ihrem Jenseits aus über sie hinausgeht und sie dabei doch gleichsam speist“.41 Die Bedeutsamkeit besteht in einem grundlegenden Bezug zu dem, was über sie hinausgeht und sie dabei doch speist – das ist also der genaue Sinn der „symbolischen Tautologie der Wahrheit“, sofern sie eben nicht in einen circulus vitiosus verfällt. Wie ist dieses „Jenseits“ dabei genau zu verstehen? Es handelt sich um einen Bezug, der „zugleich mit sich selbst das Jenseits, das ihm seinen eigenen Sinn verleiht“,42 bekundet, also gewissermaßen um eine Art Verdoppelung des Realen. Die Besonderheit dieser „Verdoppelung“ ist, dass sie nicht eine Duplizierung einer Ordnung ausmacht, die in einer anderen, positiven Ordnung gestiftet wäre, welche ihrerseits stiftenden Charakter hätte, sondern „den wahren Ort des Jenseits“ eröffnet, der „eine Art reiner harmonischer Logos“ ist, welcher eine „Musik des Nichts mit sich selbst“ spielt, die „allein den Sinn des Sinns zu liefern vermag“.43
La crise du sens et la phénoménologie, S. 12, Fußnote 1. La crise du sens et la phénoménologie, S. 14. 41 La crise du sens et la phénoménologie, S. 14f. 42 La crise du sens et la phénoménologie, S. 15. 43 La crise du sens et la phénoménologie, S. 19. 39 40
228
Kapitel VIII
Der Sinn des Sinns ist somit „nicht von der gleichen Ordnung wie der Sinn, und gleichwohl besteht zwischen beiden eine rätselhafte Vertrautheit, so dass die symbolische Tautologie den Sinn von einem Sinn des Sinns aus zu erhalten scheint, der sich in der NichtGegebenheit entzieht“.44 Die erwähnte „Verdoppelung“ eröffnet somit eine Ordnung, die nicht gegeben werden kann, sondern vielmehr das entdecken lässt, was Richir „die phänomenologische Dimension, den phänomenologischen Horizont, der mit den Mitteln jeder gestifteten Sprache nicht zu ergründen ist“,45 nennt. Diese phänomenologische Dimension, diese „Ordnung“, von der nicht behauptet werden kann, sie sei „höher“ – es handelt sich dabei eher um ein Jenseits, das (es sei noch einmal wiederholt) genauso auch ein Diesseits ist und sich nicht geben lässt – erzeugt vielfältige Sinne. Richir eignet sich somit insofern eine bekannte Einsicht Kants an, als er darlegt, dass die die symbolische Tautologie ausdrückenden Sätze synthetische Sätze a priori sein müssen. Was die Grundattribute der symbolischen Tautologie der Wahrheit angeht, sofern diese das Jenseits, das Unendliche, eröffnet, kann also festgehalten werden, dass sie nicht gegeben werden kann; dass sie eine Vielfalt neuer Sinne erzeugt; und auch dass sie unbestimmt und unbestimmbar ist („es sei denn durch das selbstreferentielle, tiefer liegende Sagen des harmonischen Logos“).46 Hierdurch spricht sich der wechselseitige Verweis der Phänomenologie und der Metaphysik aus. Bei Richir hört sich das so an: […] die Phänomenologie zu verwirklichen heißt, noch einen Schritt weiter zu gehen, nämlich die Metaphysik als symbolische Stiftung zu erkennen, und das heißt genauso auch zu verstehen, weshalb hierdurch die Metaphysik sich implizit aus einem phänomenologischen Sinnhorizont speist, den sie nicht aus sich selbst erschafft, sondern dem sie mit dem Abstand des in ihr fungierenden Jenseits begegnet.47
Aber dieses Beherzigen der „phänomenologischen Gebote“ und die Erklärung, wie wir „sagen und ‚wissen‘“ können, was die symbolische Tautologie zum Ausdruck bringt, erfordern noch radikaler, La crise du sens et la phénoménologie, S. 20. La crise du sens et la phénoménologie, S. 23. 46 Ebd. 47 La crise du sens et la phénoménologie, S. 23f. 44 45
Das phänomenologische Unendliche
229
ihr einen „Ort“ zuzuweisen, der, wie bereits angedeutet, auf den „symbolischen Stifter“ verweist. Richir schreibt dazu folgendes: In Bezug auf die von uns angepeilte Ausweitung und Neugründung der Phänomenologie wäre der „Ort“ der symbolischen Tautologie der Ort dessen, was wir als symbolischen Stifter bezeichnen […], der insofern anarchisch ist, als er, im Gegensatz zum Gott der Onto-Theologie, durch sich selbst nichts Seinsmäßiges stiftet, sondern nur der Träger der Frage oder des Rätsels der begriffslosen Identität (der Selbstheit) ist, welche die menschliche Identität ausmacht. Und diese Distanz zu dem, was der gestifteten symbolischen Ordnung angehört, […] kann sich darüber hinaus für uns nur in dem „offenbaren“, was wir als das phänomenologische Erhabene bezeichnen.48
Für Richir vermag also das Erhabene – als ultimative Dimension des Unendlichen – das Rätsel der menschlichen Identität zu lösen. „Das Andere als Anderes […] hält sich nur deshalb als solches, weil bereits hinter seiner Phänomenalität, aber auch, muss hinzufügt werden, in derselben als seinem Flimmern, das Unendliche als dynamische Spur seiner eigenen Flucht, als ‚Luftsog‘ oder ‚Seinsleere‘, die es hinterlässt, wenn es sich entzieht, ‚am Werk‘ ist. Das Unendliche, der Ort einer einzigartigen symbolischen Tautologie, lässt sich – im Feld des Begegnens und der Nähe – phänomenologisch in der Nicht-Bündigkeit dessen erfahren, was jedes Mal im Antlitz zu scheinen scheint, und zwar gegenüber dem, was sich dort ad infinitum entzieht, es in dem Entfernen und der Abwesenheit aufsaugt.“49 Um nun den genauen Sinn dieses „symbolischen Stifters“ (in seinem Bezug zum „Erhabenen“) und dessen, was hieraus für das Verständnis des phänomenologischen Unendlichen folgt, fassen zu können, muss über das, was in „Phénomène et infini“ angerissen wird, hinausgegangen werden. In seinen letzten Schriften – und man sieht einmal mehr, dass die Frage nach dem Unendlichen offenbar immer erst am Ende explizit gestellt wird – vereint Richir (ohne freilich diesen Zusammenhang herauszustellen) die verschiedenen Komponenten der früheren Ausarbeitungen in jenem Begriff, der sein Spätwerk überstrahlt und von ihm als „‚Moment‘ des
48 49
„Phénomène et infini“, S. 256. „Phénomène et infini“, S. 257f.
230
Kapitel VIII
Erhabenen“ bezeichnet wird.50 Die letzten Bücher – und dabei insbesondere die beiden „Variations“-Bände – handeln quasi ausschließlich von ihm. Das Folgende stützt sich in erster Linie auf die sehr hilfreiche Skizze „Architektonische Analytik der transzendental-phänomenologischen Genese des Selbst“ (aus dem ersten „Variationen“-Band von 2010).51 Unter diesen Komponenten sind die folgenden besonders erwähnenswert: die Frage nach dem Ursprung des Menschen (und ihr Bezug zur Unscheinbarkeit [also zum Richir’schen Begriff des „Phänomenologischen“]), die Frage nach der Genese des Selbst und ihres Bezugs zum Anderen (womit Richirs Begriff der „transzendentalen Interfaktizität“ wieder aufgenommen wird), das Grundereignis der „Substitution“, dank welchem der Sinn etwas Anderes „sagt“ als ihn selbst (und eben nicht nur Sinn seiner selbst ist), und der generative Charakter der Verunendlichung des Unendlichen. Der „‚Moment‘ des Erhabenen“ zielt hierbei darauf ab, dem Bezug zum Realen und dem Verständnis, das wir davon haben, Rechnung zu tragen – und zwar außerhalb jeder ontologischen sowie erkenntnislegitimierenden Perspektive. Hierbei kommt der wesentliche Bezug zur in unendlicher Flucht befindlichen „absoluten Transzendenz“ (die ganz offensichtlich nun die Stelle des „symbolischen Stifters“ einnimmt) zum Vorschein – und darin kristallisiert sich dann auch Richirs letztes Wort über das Unendliche. Er kennzeichnet den „‚Moment‘ des Erhabenen“ folgendermaßen: In seiner phänomenologischen Tiefe [d. h. am „Anfang“ der Analytik Richirs] ist der „Moment“ des Erhabenen jener „Moment“, in dem es – im archaischsten Register des phänomenologischen Feldes, in welchem der Schematismus und die Affektivität miteinander verwoben und verflochten sind – zunächst (und dieses „zunächst“ ist ein genetisches) zu einer Hyperbel der Affektivität und einer Unterbrechung des Schematismus kommt, 50 Der Begriff des „Erhabenen“ kommt bereits häufig in den Schriften der 1980er und 1990er Jahre vor; im Gewand der „Erfahrung des Erhabenen“ tritt der Gedanke des „‚Moments‘ des Erhabenen“ (von dem, wie in Kapitel II erwähnt, auch schon in Du sublime en politique (1991) die Rede ist) dann zum ersten Mal im letzten Kapitel der Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, Grenoble, J. Millon, 2006, auf. Für den Ausdruck „‚Moment‘ des Erhabenen“ selbst siehe insbesondere die Fragments phénoménologiques sur le langage, op. cit., S. 93f. 51 Variations sur le sublime et le soi, Grenoble, Millon, 2010.
Das phänomenologische Unendliche
231
das heißt zu einem Auswuchs an Intensität der Affektivität, der diese überschüssig werden lässt und sie in einem hyperdichten und außerschematischen „Kern“ kondensiert (Systolē), sodass sich hieraus in einer – ebenso genetischen – Folge […] die Affektivität auf sich selbst bezieht. Dieser überraschende, unerwartete, augenblickliche Selbstbezug eröffnet einen nicht zeitlichen und nicht räumlichen Abstand zwischen der Affektivität und jenem Überschuss […]. Durch seinen Abstand initiiert dieser Überschuss dann seinerseits die schematische Diastolē […] dieses Abstands und lässt zugleich die absolute Transzendenz52 als absolutes (nicht räumliches) „Außen“ der Frage nach dem Sinn phänomenologisch flimmern […].53
In dieser begrifflichen Konstellation – die hier nur vorgreifend angesprochen und dann im nächsten Kapitel vertieft werden soll – weist der Bezug von Denken (Bewusstsein) und Sein, sofern er eben durch ein sich entziehendes Unendliches vermittelt wird, drei Aspekte auf:54 die Kondensierung in einer hyperdichten Affektion eines Selbst (= Aufbrechen eines im wörtlichen Sinne undenkbaren „Urseins“),55 die Eröffnung einer absoluten Transzendenz (in unendlicher Flucht) und die Neu-Schematisierung des Schematismus (= eine Art „Neustart“ des durch die Hyperbel der Affektivität unterbrochenen Denkens). Man kann hierin eine Antwort auf das „Begriff-Licht-Sein-Schema“56 sehen, mit welchem Fichte in der Wissenschaftslehre von 1804 (zweite Fassung) bereits versucht hatte, das Grundprinzip der transzendentalen Korrelation von Sein und Denken darzustellen. In dieser Antwort lässt Richir das legitimierende Grundprinzip der transzendentalen Erkenntnis (das Fichte das „Soll“ genannt hatte und laut Richir ein unberechtigtes ontologisches Argument enthält) wegfallen. Er lässt es wegfallen, eben weil er für die Phänomenologie die Perspektive einer Erkenntnislegitimation zurückweist. Für Richir geht es in der Phänomenologie darum zu verstehen, nicht zu 52 Dass diese absolute Transzendenz je in „unendlicher Flucht“ begriffen ist, wird von Richir an unzähligen Stellen betont (siehe zum Beispiel Sur le sublime et le soi. Variations II, Amiens, Mémoires des Annales de phénoménologie, 2011, S. 125 oder Propositions buissonnières, op. cit., S. 10). 53 Variations sur le sublime et le soi, S. 197f. 54 Siehe insbesondere Fragments phénoménologiques sur le langage, S. 77. 55 Es sei, um genau zu sein, betont, dass das Selbst nicht eigentlich „ist“ und somit (zumindest) nicht als etwas Konstituiertes vorausgesetzt werden kann: Es ist weder setzend noch intentional, es ist weder fest noch stabil. 56 Siehe hierzu v. Vf., Réflexion et spéculation. L’idéalisme transcendantal chez Fichte et Schelling, Grenoble, Millon, 2009, S. 43–57.
232
Kapitel VIII
legitimieren. Und dem Unendlichen (im Mittelpunkt des „‚Moments‘ des Erhabenen“) kommt dabei eine wesentliche Funktion zu: Richir ersetzt die Fichte’sche Konstellation (die gleichsam das ontologische Argument an die legitimierende Reflexibilität anbindet) durch diejenige, in der die absolute Transzendenz – als „absolutes Außen“ – in ihrem Entzug, in ihrer unendlichen Flucht, die Frage nach dem Sinn eröffnet, das Selbst aufbrechen lässt (nämlich dank des Selbstbezugs der Affektivität durch die Eröffnung eines Abstands zwischen dieser Affektivität und dem gerade erwähnten Überschuss) und den Ursprung des Menschen ausmacht. Fassen wir das Ganze noch einmal zusammen. Welches sind die Grundlinien, die sich aus diesen Überlegungen über das phänomenologische Unendliche ergeben? Die – zumindest implizite – Ausgangsfrage war die, ob sich das Unendliche im phänomenologischen Feld der Korrelation (welches offenbar endlich ist) hält und sich dort auch halten lassen kann – eine Frage, die, das sei nur nebenher bemerkt, in gewisser Weise die Perspektive des „spekulativen Realismus“ widerspiegelt, welcher seine Kritik am Korrelationismus ja insbesondere darauf stützt, dass in diesem Rahmen der transzendentalen Korrelation dem Absoluten („nach“ oder „jenseits“ der Endlichkeit) nicht Rechnung getragen werden könne. Wie dem auch sei, scheint im vorigen Gedankengang ein nach und nach sich verstärkendes Ablösen festzustellen zu sein: Während Tengelyi den Begriff des Unendlichen in den Grenzen einer „kategorialen Form“ einbehalten will, deren Unbestimmtheitsdimension dabei stark betont wird, versteht ihn Levinas als eine „Spur“ seines eigenen „Entzugs“, was eine „radikale Andersheit“ eröffnet, die in letzter Instanz mit dem phänomenologischen Korrelationismus nicht mehr vereinbar zu sein scheint. Richir geht dann noch insofern einen Schritt weiter, als Levinas’ ethische Herangehensweise in seinen Augen das Unendliche auf eine menschliche Dimension reduziert, die ihrerseits in Frage gestellt werden muss. Dazu ist seiner Ansicht nach erforderlich – über die Notwendigkeit hinaus, die Phänomenalität auf das apeiron auszuweiten, so wie das auch von Tengelyi zurecht angemahnt wurde –, die „unendliche Flucht“ der absoluten Transzendenz ernst zu nehmen, welche die Bedingung eines Abstands ist, der den Sinn, die Selbstheit und sogar das Menschliche im Menschen allererst eröffnet. Mit dieser „unendlichen Flucht“ nimmt Richir Derridas gegen Levinas gerichtetes Motiv einer „unendlichen Endlichkeit [finitude
Das phänomenologische Unendliche
233
infinie]“ wieder auf. Derrida hatte gegen den Autor von Totalité et infini kritisch angemerkt, dass es zwar völlig berechtigt sei, das Denken des „Anderen“ dem Denken des „Selben“ entgegenzusetzen, zugleich aber auch, dass dies so geschehen müsse, dass dadurch das phänomenologische Feld nicht verlassen werde (weil es sonst dogmatische Züge annehmen würde). Dies bringt eine Verunendlichung zutage, also eine unendliche Auslegung, eine unendliche Entschälung, eine unendliche Entfaltung, des zu bestimmenden Phänomenalen, durch welche die subjektivistische Verinnerlichung gleichsam von innen implodiert und der Sinn sich dem Sinn von etwas Anderem als ihm selbst öffnet. Wir haben es somit beim Unendlichen mit einem Grenzbegriff zu tun, der das phänomenologische Feld von innen her in Richtung einer metaphysischen Perspektive implodieren lässt.57 Und hierin muss dann eine metaphysische Tendenz erkannt werden, die der Phänomenologie innezuwohnen scheint, sofern diese nur gewissenhaft auf ihre letzten Konsequenzen befragt wird – was Derrida dann Recht gäbe, sofern diese metaphysische „Verkehrung“ in der Tat ihren gesamten Sinn änderte. Diese Sinnverkehrung betrifft die Frage, ob „offene Wesen“ ohne Transzendenz auskommen können oder ob, damit zusammenhängend – sofern eine absolute Transzendenz ja auf Unendlichkeit verweist –, das phänomenologische Unendliche nicht vielmehr IM HERZEN DES PHÄNOMENOLOGISCHEN SELBST liegt. Richirs Antwort auf diese Frage liegt ganz eindeutig in Letzterem. Von hier aus lässt sich dann umreißen, was daraus für den Begriff des phänomenologischen Unendlichen systematisch folgt. Zum einen kann das Behandeln des phänomenologischen Unendlichen nicht bedeuten, dass man Erkenntnisse aus anderen Disziplinen – wie etwa der Mathematik – einfach auf die Phänomenologie überträgt oder in sie überführt. Das phänomenologische Unendliche muss sich in der phänomenologischen Analyse in seiner ihm eigenen Bestimmung bekunden und entfalten. Aus dieser Untersuchung ergab sich, dass das phänomenologische Unendliche ein 57 Diese metaphysische Perspektive kann dabei sogar durchaus im klassischen Sinne aufgefasst werden, da die drei Begriffe der metaphysica specialis hier neu interpretiert werden: nämlich die „Seele“ als „Selbst“, die „Welt“ als „physisch-kosmische Transzendenz“ und „Gott“ als „symbolischer Stifter“ bzw. als „absolute Transzendenz“. Ich danke I. Fazakas für diesen überzeugenden Hinweis.
234
Kapitel VIII
Schlüsselbegriff der Sinnbildung ist. In ihm eröffnen und versammeln (Richir würde sagen: schematisieren) sich die Grundparameter derselben. In der systematischen Linie: prophetisch sich äußernde Illeität – symbolische Stiftung – symbolischer Stifter – Erhabenes bekundet sich jeweils eine In-stanz (in Heideggers Worten: ein „ausstehendes Innestehen“), die prä-phänomenal und generativ vom SichBilden des Sinnes zeugt, sofern dieses sich nicht auf Vorgegebenes stützt, sondern das im vollen und tiefen Sinne Erscheinende allererst von einer sich unendlich verflüchtigenden Transzendenz aus aufbrechen und aufgehen lässt. Und diese Eigenschaft, dass also in der Kundgabe und in dem Aufgehen in bzw. aus der phänomenologischen Untersuchung eine begriffliche Konfiguration, die den Sinnbildungsprozess ermöglicht und maßgeblich prägt, aufscheint, besteht der entscheidende Wink dafür, wie die Artikulierung von Phänomenologie und Metaphysik aufgefasst werden kann. Die verinnerlichende Besinnung der Phänomenologie auf sich selbst treibt sie zur Metaphysik hinaus.
Kapitel IX Transzendenz und Selbst Da jegliche vorgegebene Positivität ausgeschaltet ist, kann allein der „Moment“ des Erhabenen vor dem Nihilismus „bewahren“1
In diesem Kapitel2 wird die Bedeutung der „Transzendenz“ und des „Selbst“ (sowie ihr spezifischer Zusammenhang) im Spätwerk Richirs3 ins Auge gefasst. Dabei kommt dem „‚Moment‘ des Erhabenen“ eine vorrangige Rolle zu. Dieser bereits mehrfach angesprochene Begriff – der insbesondere den krönenden Abschluss des vorigen Kapitels bildete – soll nun in systematischer Hinsicht analysiert und vertieft werden. Jeder feste Erwerb der phänomenologischen Analyse bringt architektonische „Gebote“ und „Notwendigkeiten“ ins Spiel. Richir versucht auf verschiedene Weisen, diesen Geboten gerecht zu werden. Man könnte sagen: Er gibt hierauf teils „analytische“ teils „synthetische“ Antworten (in einem nicht kantischen Sinne). Solche Antworten sind „analytisch“, wenn für ein bestimmtes Problem, ein Dilemma o. ä. Analysen entwickelt werden, die direkt in eine „Lösung“ (oder in einen Lösungsansatz) münden. Sie sind „synthetisch“ – und hier findet oft etwas, was zunächst in einem ganz anderen Kontext ausgearbeitet wurde, seine Begründung –, wenn sie 1 M. Richir, „Sublime et pseudo-sublime. Pourquoi y a-t-il phénoménologie plutôt que rien?“, in Annales de Phénoménologie, Nr. 9/2010, S. 31. 2 Dieses Kapitel ist in einer ersten Fassung unter dem Titel „‚Transzendenz‘ und ‚Selbst‘ bei Marc Richir“ in der Artikelsammlung des Vf. Hinaus, op. cit., S. 122–140 erschienen. Diese wurde dann unter dem Titel „Transzendenz und Selbst im Spätwerk Richirs“, in den Sammelband Figuren der Transzendenz. Transformationen eines phänomenologischen Grundbegriffs, M. Staudigl (Hsg.), Würzburg, Königshausen & Neumann, 2014, S. 85–104 aufgenommen (ich danke M. Staudigl ganz herzlich für seine Erlaubnis, die überarbeitete Version davon hier abdrucken zu dürfen). 3 Im Folgenden wird insbesondere auf Fragments phénoménologiques sur le langage, op. cit., und das wichtige Kapitel „Langage, poésie, musique“ in Variations sur le sublime et le soi, op. cit., S. 7–47 Bezug genommen.
236
Kapitel IX
zu einer ganz neuen architektonischen Konfiguration der grundlegenden, phänomenologischen Elemente hinführen und diese in ein neuartiges (keineswegs aber notwendigerweise endgültiges) architektonisches Ganzes ein-fügen oder ver-sammeln. Dies trifft nun insbesondere für die Begriffe des „Selbst“ (mit den Vertiefungen, die dabei die Analysen des „Erhabenen“ erfahren) und ganz besonders der „Transzendenz“ zu. Warum führt Richir in seinen letzten Arbeiten die Begriffe der „Transzendenz“ und des „Selbst“ ein? Weil sie eine neue „architektonische Konfigurierung“ im Werke Richirs ausmachen, die in der grundlegenden Rolle der Phantasie und der Affektivität, innerhalb der Richir’schen „Neugründung“ der Phänomenologie, impliziert ist (und in diesem Sinne stellen sie eine synthetische Antwort auf die architektonischen Gebote dar). Zwei Aspekte müssen dabei betont werden. 1.) Durch die Hervorhebung der Phantasie wird die ursprüngliche und vorherrschende Rolle der Wahrnehmung (das heißt der „doxischen“, objektivierenden Akte) in jeglicher Konstitution herabgesetzt. Das wissen wir bereits. Hieraus folgt aber noch mehr als das, was bisher angezeigt wurde. Richir zieht die Konsequenzen – und zwar über die Grenzen des strengen phänomenologischen Rahmens hinaus – aus der Forderung nach (metaphysischer) „Voraussetzungslosigkeit“ im Allgemeinen, und aus der Unmöglichkeit, ein „Gegebenes“ vorauszusetzen im Besonderen. Im Gegensatz zu Fink, der die Spaltung natürliche Einstellung/transzendentale Einstellung in einer Phänomenologie der Welt zu überwinden sucht, ist und bleibt Richir in seinem tiefsten Innern ein Skeptiker:4 Für ihn ist nicht nur die Realität der Welt dem „hyperbolischen Zweifel“ unterworfen (in Richirs eigenen Worten: sie muss permanent in der phänomenologischen hyperbolischen Epoché einbehalten werden), sondern sie wird auch dergestalt uminterpretiert, dass sie dem, was sich zunächst in den archaischsten phänomenologischen Registern ausbildet und was diese mit sich bringen, nicht vorgegeben sein kann. 2.) Und warum stellt sich Richir nun die Frage nach dem „Selbst“? Um dem „Ursprung des Bewusstseins“ und dem des „Selbstbewusstseins“ nachzugehen und die Art und Weise, wie das „Objekt“ des Selbstbewusstseins sich zum „Subjekt“ desselben verhält, aufzuklären – und zwar ohne in die 4 Siehe zum Beispiel „Langage et institution symbolique“, in Annales de Phénoménologie, Nr. 4/2005, S. 138.
Transzendenz und Selbst
237
Falle einer gewissen Auffassung der Reflexivität zu tappen. Untersuchen wir nun, wie sich das in den späteren Arbeiten Richirs konkret darstellt. * Die von Richir unternommene „Neugründung“ der Phänomenologie mündet keineswegs in einen Monismus. Indem er sich jeglicher Philosophie der „Immanenz“ entgegensetzt, stellt er einen nicht reduzierbaren Dualismus heraus, einen „archaischen chorismos“, der weder einem Rückgang auf eine „präimmanente“ Sphäre des transzendentalen Bewusstseins (Husserl) gleichkommt – auch wenn sein Begriff des „Virtuellen“ sich dem (allerdings in einem anderen „architektonischen Register“) durchaus annähert – noch gar die „Transzendenz“ der natürlichen Welt aufwertet (was Fink mit seiner Versöhnung der natürlichen und der transzendentalen Einstellung im Blick hatte). Dieser – bereits angesprochene – Dualismus soll nun näher betrachtet werden. Er drückt sich in verschiedenerlei Art aus: Er ist ein jegliches Sprachphänomen kennzeichnender Dualismus von „Schematismus“ und „absoluter Transzendenz“, er kann als ein Dualismus von zwei unterschiedlichen Arten von Transzendenz aufgefasst werden (nämlich der „absoluten Transzendenz“ und der „physisch-kosmischen Transzendenz“) und er bringt auch den Begriff des „Selbst“ ins Spiel: im Dualismus von „Selbst“ und „Schematismus“. Die verschiedenen, diese Dualismen ausmachenden Begriffe (in die jeweils, wie wir sehen werden, die „transzendentale Interfaktizität“ mit hineinspielt) sind keineswegs identisch, sondern treten in Verschränkungen auf, die es jetzt aufzuhellen gilt. Einer der Grundbegriffe der Richir’schen „Phänomenologie ‚nova methodo’“ ist der des „Sprachphänomens“. Das Sprachliche beschränkt sich dabei nicht auf die bloße „linguistische“ Sphäre, sondern betrifft das „Denken“ (im Sinne Descartes’). Richir zielt dabei auf das Aufgehen des Sinnes, welches er „Sinnregung“ („amorce de sens“) nennt, und die Art und Weise, wie das, was sich dort aneinanderreiht, „zusammengehalten“ wird, ab (wobei dieses „Zusammenhalten“ freilich dem „phänomenologischen Schematismus“ zu verdanken ist). Das den Sinn – und die Frage nach dem Sinn – (Er)öffnende ist nun das, was Richir die „absolute Transzendenz“ nennt. Diese hat eine vierfache Funktion. Über die Tatsache,
238
Kapitel IX
dass sie also 1.) den Sinn eröffnet, hinaus ist sie 2.) die Bedingung der „symbolischen Stiftung“, 3.) ermöglicht sie die Referenz des Sprachlichen (die „physisch-kosmische Transzendenz“) und 4.) konstituiert sie das „Selbst“. 1.) Weshalb (er)öffnet der Sinn sich nur durch die „absolute Transzendenz“? Der Sinn kann an sich selbst nicht zur Darstellung gebracht werden, genauer gesagt, er „geht“ von Undarstellbarem zu Undarstellbarem „über“ (und zwar „im“ Undarstellbaren). Das bedeutet, dass er stets sich selbst entgleitet, sich selbst gegenüber (und das heißt immer auch: gegenüber der ihm anhaftenden Affektivität) in einem Abstand, in einer absoluten Deckungsungleichheit steht. Transzendentale Bedingung dieses Abstandes ist die absolute Transzendenz, ein „radikales Äußeres“ (das „radikalste“, „außer“räumliche und „außer“zeitliche), das hier wie etwas Unmögliches mithineinspielt und den Abstand (der seinerseits auch ein außerräumlicher und außerzeitlicher ist) in die Affektivität hineinbringt; es hindert ihn sozusagen daran, mit sich selbst übereinzustimmen, eröffnet aber zugleich im Schematismus dieses Abstands den Sinneshorizont und das heißt im phänomenologischen Schematismus des Sprachlichen das Sinnes„milieu“.5
Die absolute Transzendenz konstituiert somit den ursprünglichen „Sinnesanruf“ (in welchem sich die Affektivität einnistet),6 seine Nichtübereinstimmung mit sich selbst, die ursprüngliche Öffnung, „in“ welcher der Sinn sich sucht und bildet. Diese Öffnung ist aber, wie gesagt, keine räumliche oder urräumliche (sie entspricht nicht dem, was Heidegger in den Beiträgen zur Philosophie das „Offene“7 nennt): Sie ist vielmehr lediglich ein architektonisches „Gebot“, das den Abstand des Sinns sich selbst gegenüber ermöglicht – sie ist das, was notwendig ist, damit der Sinn hinsichtlich seiner nicht reduzierbaren Grundmerkmale möglich wird. 2.) Die zweite Funktion der absoluten Transzendenz besteht darin, dass sie das „phänomenologische Feld“ und den „symbolischen Stifter“ einander begegnen lassen. Inwiefern ermöglicht zunächst die absolute Transzendenz die „symbolische Stiftung“? Richir bezeichnet Variations sur le sublime et le soi, S. 13. Variations sur le sublime et le soi, S. 39. 7 M. Heidegger, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), HGA 65, F.-W. von Herrmann (Hsg.), Frankfurt am Main, Klostermann, 1989, S. 328. 5 6
Transzendenz und Selbst
239
als „symbolische Stiftung“8 jene Stiftung, die einerseits eine „Basis“, einen „Grund“ (das Stiftende) und andererseits das Gestiftete miteinander in Beziehung setzt, wobei diese Beziehung durch einen nicht reduzierbaren „hiatus“ gekennzeichnet ist, das heißt durch einen „Sprung“, durch welchen (und in welchem) diese Basis nicht vollkommen vernichtet ist, sondern „virtuell“ (im Sinne der Maldiney’schen „transpossibilité“) weiterwirkt. Dies bedeutet insbesondere, dass das Gestiftete gleichsam „blindlings“ gestiftet ist, so dass keine Deduktion, keine rationale Rekonstruktion usw. in der Lage wäre, diesen „hiatus“ zu überwinden, und dass dessen „architektonische Transposition“ außerzeitlich und -räumlich ist. Der „Ursprung“ der Geometrie, der klassischen Physik oder der Ägyptischen Kultur sind somit nicht weniger das Resultat einer „symbolischen Stiftung“ als das Erwerben der Muttersprache oder das Erlernen des Klavierspiels. Die Dinge liegen also ähnlich wie im vorigen Fall: Gerade, weil die Stiftung „undatierbar“ und völlig diskontinuierlich in Bezug auf das fundierende Register ist, spiegelt sie eine absolute Transzendenz wider. Aber genauso wie die absolute Transzendenz das Fehlen jeglichen Ursprungs des Gestifteten zu verantworten hat, deckt sie auch, was Letzteres betrifft, die Unmöglichkeit jeglichen, rein symbolischen Fortschritts auf. Richir weist hierzu auf Folgendes hin (was zugleich die wichtige Frage nach dem Status der Geschichte und der Geschichtlichkeit aufwirft): Es sei noch bemerkt [...], dass es keine symbolische Stiftung ohne eine absolute Transzendenz geben kann, weil die symbolische Stiftung gar nicht vom menschlichen Willen abhängt. Dieser Transzendenz darf keinesfalls ein Name gegeben werden. Denn sie radikal außerhalb des Sprachlichen und selbst des Möglichen zu benennen (zum Beispiel: Gott), hieße, sie zu verraten, oder zumindest in die „Logik“ der symbolischen Stiftung einzutreten (die Religionen, die von weit unter dem Geforderten verbleibenden Intrigen und Ritualen durchwaltet sind, sind offenbar allzu „menschlich“ und zeugen je schon von der „Korruption“ oder der „Degeneriertheit“ der absoluten Transzendenz). Darüber hinaus scheint es widersinnig zu sein, an einen „symbolischen Fortschritt“ zu glauben (ganz so als wären wir die Einzigen, die in einem solchen begriffen wären oder dessen „Wahrheit“ besitzen müssten). Allein der Gedanke einer „Abweichung“ von der symbolischen 8 Es sei daran erinnert, dass laut Richir das „phänomenologische Feld“ nicht das eigens Gegebene, sondern das, was diesseits des symbolisch Gestifteten angesiedelt ist, umfasst.
240
Kapitel IX
Stiftung scheint uns annehmbar zu sein: Diese macht die Geschichte aus – zwischen Utopie und Eschatologie, wenn sie nämlich ihrerseits in einer symbolischen Stiftung reflektiert wird.9
3.) Die dritte Funktion der absoluten Transzendenz besteht darin, die Referenz des Sprachlichen (die nichts anderes als die „physischkosmische Transzendenz“ ist) zu eröffnen. In der Tat reflektiert sich im selben Schlage (ohne Begriff) der sprachliche Schematismus dank der den Sinn (bzw. die Frage nach dem Sinn) eröffnenden absoluten Transzendenz, wobei er auf einen anderen, nicht weniger radikalen Typus der Transzendenz verweist – den der Referenz des Sprachlichen (nicht der Sprache).10
Wir stoßen hier auf den Kern des oben angesprochenen „archaischen chorismos“. Zwei Arten von Transzendenzen müssen unterschieden werden: die radikal „absolute“ Transzendenz, über die nichts ausgesagt werden kann (außer den verschiedenen, hier entwickelten Aspekten) und jene Transzendenz, die der Grund dafür ist, dass der Sinn nicht bloß Sinn seiner selbst ist.11 Denn es gibt sehr wohl eine Referenz des Sprachlichen: die „physisch-kosmische Transzendenz“, die „für den Sinn, den sie gleichwohl möglich macht, unzugänglich ist, also unvordenklich (Schelling) und dadurch letztendlich […] virtuell und nicht setzend“.12 Mit dem Gebrauch des Ausdrucks „das Unvordenkliche“ verweist Richir hier explizit auf Schelling. Dieser hatte diesen Begriff zunächst in den Weltaltern und dann in seiner Einleitung in die Philosophie der Offenbarung eingeführt. Was den Begriff der „physisch-kosmischen Transzendenz“ angeht, ist gleichwohl nicht der „späte“, sondern der „frühe“, die „Naturphilosophie“ begründende Schelling von Bedeutung.13 Variations sur le sublime et le soi, S. 14f. Variations sur le sublime et le soi, S. 15. Siehe auch a.a.O., S. 18. 11 Variations sur le sublime et le soi, S. 21. 12 Variations sur le sublime et le soi, S. 18. 13 Hierauf hatte Vf. Richir selbst ursprünglich hingewiesen. Als begrifflicher Hintergrund für die Richir’sche „physisch-kosmische Transzendenz“ diente dabei die „Allgemeine Deduktion des dynamischen Prozesses“ (1800 von Schelling in den ersten beiden Heften des ersten Bandes der Zeitschrift für spekulative Physik herausgegeben). Schelling entwickelte dort 9
10
Transzendenz und Selbst
241
Die physisch-kosmische Transzendenz – ein „Außen“,14 das also die Referenz der Sprache ausmacht – ist durch den „außersprachlichen Schematismus“ und die „transzendentale Interfaktizität“ konstituiert. Auf letztere wird weiter unten zurückgekommen. Halten wir zunächst fest, dass diese Transzendenz (ganz wie der außersprachliche Schematismus) keinen Sinn hat (und insbesondere nicht „an sich“ existiert), sondern unterbrochen werden muss, damit ein solcher (zwischen den „Sinnesfetzen“ sich regender) Sinn überhaupt auftreten kann – in Richirs eigenen Worten: Die physischkosmische Transzendenz steht und „hält sich durch sich selbst dank des außersprachlichen Schematismus“.15 Somit wird vom architektonischen Standpunkt aus betrachtet deutlich, dass die physischkosmische Transzendenz das phänomenologische Residuum der hyperbolischen Epoché ist. Es muss schließlich noch betont werden, dass, wenn die absolute Transzendenz zwar die physisch-kosmische Transzendenz „eröffnet“, sie diese darum doch nicht „erschafft“ und auch nicht „formt“: Alles, was von ihr „gesagt“ werden kann, ist, dass das sein Konzept eines „Subjekt-Objekts“ (das er später, in seinem Briefwechsel mit Fichte ein „objektives Subjekt-Objekt“ genannt hat). Dieses ist das Prinzip der Natur, dem gegenüber das Selbstbewusstsein lediglich eine „höhere Potenz“ darstellt. Dieses Prinzip macht den Kern seiner Idealismus-Kritik aus: Weit davon entfernt zu behaupten (wie Fichte es tut), dass das Prinzip der Philosophie in einer bloßen Form bestehen könne, muss Schelling zufolge diese Form vielmehr durch einen Inhalt vervollständigt werden, welcher der Inhalt der Naturphilosophie selbst ist. Das SubjektObjekt macht somit in seiner eigenen Potenz („diesseits“ der Potenz des Selbstbewusstseins) eine Transzendenz „der Welten und der physis“ („Langage, poésie, musique“, S. 71) aus, die für Richir absolut „nicht objektiv und nicht objektivierbar“ (ebd.) ist, während sie für Schelling dank einer Selbstobjektivierung des Subjekts, des Ich, des Bewusstseins, objektiviert werden kann (er verwirklicht dieses Projekt in seinem „ersten System“ – dem System des transzendentalen Idealismus –, das gleichzeitig mit dem zitierten Artikel aus der Zeitschrift für spekulative Physik erschienen ist). Dies ist eine Vorgehensweise, deren (spekulative!) Konstruktion freilich nicht mit Richirs Neugründung der Phänomenologie vereinbar ist, was jedoch nichts daran ändert, dass sein Begriff der „physisch-kosmischen Transzendenz“ sehr wohl auf den frühen Schelling zurückzuführen ist. 14 Variations sur le sublime et le soi, S. 21. 15 Variations sur le sublime et le soi, S. 33.
242
Kapitel IX
„Sprachliche“, das je menschliches Sprachliches ist,16 diese (zumindest indirekt) phänomenologisch bezeugt. 4.) Richirs Begriff des „Erhabenen“ („sublime“) stammt nicht von Freuds „Sublimierung“,17 sondern von seiner eigenen Interpretation des kantischen „Erhabenen“. Bevor Richirs eigenes Verständnis dieses Begriffs erläutert wird, soll zunächst dessen „Quelle“ in der Kritik der Urteilskraft (1790) aufgesucht werden. Daraus wird sich ergeben, dass hieraus einerseits eine Diskussion zwischen Fichte und Schelling folgt, die (im Kontrast zur phänomenologischen Perspektive) von großem Wert für das Verständnis des „Selbst“ ist und dass andererseits ein kurzer Umweg über Heidegger, der den Begriff der „Affektivität“ betrifft, nötig sein wird. In der dritten Vernunftkritik hat Kant das „Erhabene“ als ein „Gefühl“ eingeführt, das von einer „Bewegung des Gemüts“ begleitet wird:18 „Das Gemüt fühlt sich in der Vorstellung des Erhabenen in der Natur bewegt.“19 Das Erhabene ist darüber hinaus durch einen gewissen Überschuss ausgezeichnet: „Erhaben nennen wir das, was schlechthin groß ist.“20 „Erhaben ist, was auch nur denken zu können ein Vermögen des Gemüts beweist, das jeden Maßstab der Sinne übertrifft.“21 Die dritte bedeutsame Charakteristik des kantischen Erhabenen betrifft die Tatsache, dass es durch das Gefühl einer „augenblicklichen Hemmung“22 der Lebenskräfte hervorgerufen wird (auf die freilich eine umso stärkere Befreiung derselben folgt). Inmitten des Erhabenen findet somit ein Stillstand, eine Unterbrechung der Affektivität statt. Schließlich bezieht sich das (Gefühl des) Erhabene(n) auf kein Naturding, „sondern nur in unserem Gemüte enthalten“,23
Ebd. Und er hat natürlich auch nichts mit dem „ozeanischen Gefühl“ gemein. 18 I. Kant, Kritik der Urteilskraft, 1790, 17993, S. 80 (im Folgenden wird jeweils auf die dritte Auflage Bezug genommen). Dieser Begriff der „Bewegung des Gemüts“ ist sehr häufig in den letzten Schriften Richirs anzutreffen. 19 Kritik der Urteilskraft, S. 98 (hervorgehoben v. Vf.). 20 Kritik der Urteilskraft, S. 80. Siehe auch S. 84. 21 Kritik der Urteilskraft, S. 85. Schon bei Kant verweist somit das Erhabene auf eine Transzendenz. 22 Kritik der Urteilskraft, S. 75 (hervorgehoben v. Vf.). Siehe auch S. 98. 23 Kritik der Urteilskraft, S. 109 (hervorgehoben v. Vf.). 16 17
Transzendenz und Selbst
243
sein Grund liegt nicht außer uns, sondern „bloß in uns“.24 Das Erhabene verweist somit das Subjekt an es selbst in seiner Einzelheit und beantwortet hiermit eine Grundfrage der transzendentalen Philosophie – nämlich die nach dem Status des „Selbst“. Stellen wir hierzu zunächst die Grundproblematik dar, für die Richirs Phänomenologie dann eine originelle Lösung anbietet. Selbst wenn, wie von Husserl hervorgehoben, Descartes derjenige gewesen sei, der die Perspektive der Transzendentalphilosophie eröffnet hat, hat erst Kant tatsächlich die Frage nach dem „Status“ des „transzendentalen Ich“ und aller ihrer sich an das transzendentale Ich anschließenden Begriffe („Subjekt“, „Bewusstsein“, „Selbst“ usw.) in ihrer ganzen Schärfe aufgeworfen. Schelling hat nun hierzu auf eine Schwierigkeit in Kants Text hingewiesen: Selbst wenn das transzendentale Ich, so wie es scheint, nicht im strengen Sinne „existieren“ kann – da die „Existenz“ eine Kategorie der Modalität ist und also nicht auf das Prinzip, das jenseits oder besser: diesseits jeglicher möglichen Erfahrung (auf die allein sich der rechtmäßige Gebrauch jeder Kategorie beschränkt) ist, angewendet werden kann –, schreibt Kant dennoch, wie von Schelling in den Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre (1796 et 1797)25 betont, dass das „Ich denke“ (wobei das „Ich“ eine rein verstandesmäßige Vorstellung darstellt) einen Existenzmodus impliziert, der hier noch keine Kategorie , als welche [= die Existenz] nicht auf ein unbestimmt gegebenes Objekt, sondern nur ein solches, davon man einen Begriff hat, und wovon man wissen will, ob es auch außer diesem Begriffe gesetzt sei, oder nicht, Beziehung hat.26
Dann stellt sich aber die Frage, was für eine Art „Existenz“ dem transzendentalen Ich zugeschrieben werden muss und wie dessen Selbstbezug Rechnung getragen werden kann. Wie kann das Subjekt sich überhaupt zu sich selbst verhalten? Um die „Bewusstseinsart“, die das Subjekt in seinem Selbstbezug charakterisiert, verstehen zu können, muss zunächst in Betracht gezogen werden, dass das Bewusstsein durch eine grundlegende Zweiheit gekennzeichnet ist, die mit der Notwendigkeit, dieses in seiner Kritik der Urteilskraft, S. 78 (hervorgehoben v. Vf.). F.W.J. Schelling, Sämtliche Werke (in der Ausgabe K.F.A. Schellings), I/1, S. 401f. 26 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 423. 24 25
244
Kapitel IX
Einheit darzustellen, in Konflikt gerät. Das Bewusstsein ist je Bewusstsein von etwas – es ist also gleichsam gespalten. Wenn es nun darum geht, das Selbstbewusstsein zu erklären, also die Art und Weise, wie das Bewusstsein sich selbst bewusst sein kann, wird allgemein angenommen, dass das Bewusstseinssubjekt mit seinem Objekt zusammenfällt. Dieser Bezug des (als „Subjekt“ verstandenen) Subjekts zum (als „Objekt“ aufgefassten) Subjekt wird üblicherweise durch die Reflexion erklärt: Wenn also das Subjekt sich selbst bewusst ist, dann deshalb, weil es auf sich reflektiert, weil es – dank eines reflexiven Rückgangs – sich gleichsam auf sich selbst zurückbiegt. Dann stellt sich aber folgendes, offensichtliches Problem: Wie kann man sich überhaupt dessen sicher sein, dass angesichts des in diesem reflexiven Rückgang implizierten Abstands des Subjekts sich selbst gegenüber dieses sich in der Tat auf sich selbst und nicht lediglich auf das, was es gewesen ist, bezieht – was nämlich hieße, dass es sich selbst ständig entglitte? Schelling, welcher der Überzeugung war, Fichte in diesem Punkt zu verbessern (obgleich dieser in Wirklichkeit keinen solchen vereinfachenden Standpunkt über die Reflexion eingenommen hat), meinte, diese Schwierigkeit in seinem zum ersten Mal 1801 dargestellten „Identitätssystem“,27 in dem der Ausgangspunkt jeder Philosophie in die absolute Identität (= Indifferenz) von Subjekt und Objekt – Subjekt-Objektivität oder Objekt-Subjektivität – gesetzt wurde, überwinden zu können. Dann taucht aber ein anderes Problem auf (das von Fichte und Hegel fast in denselben Begriffen Ausdruck fand): Wie kann diese Handlung der absoluten Setzung anders verstanden werden als ein gänzlich dogmatischer Akt? Zwei Klippen müssen hier umschifft werden: Es darf keine Zweiheit aufgestellt werden, wo eine Einheit gefordert wird (wodurch das Bewusstsein selbst entgleiten würde) und es darf nicht dogmatisch eine Einheit gesetzt werden, die nicht dem „Minimalgebot“ (J.-T. Desanti) jeder Bewusstseinsphilosophie Rechnung trägt. Wie kann man sich hier orientieren? Zunächst darf keinesfalls das Selbst verdinglicht werden. Das hatte Fichte im Auge, als er auf den Spuren der ersten kantischen Kategoriendeduktion das „absolute Ich“ (das unpersönlich, also eben kein „Ich“ ist) als „reine Tätigkeit“ kennzeichnete. Dieser Ausdruck des „Ich“ sollte jedoch 27 Es wäre hier aber womöglich hilfreicher, sich diesbezüglich dem System des transzendentalen Idealismus (1800) zuzuwenden (siehe unten).
Transzendenz und Selbst
245
besser vermieden werden – was Fichte selbst auch ziemlich schnell einsah. Um einem Missverständnis vorzubeugen ist es daher vorzuziehen, sich an den des „Selbst“ zu halten. In Soi-même comme un autre unterschied Ricœur diesbezüglich, wie in Kapitel III bereits erwähnt, zwischen einer „Idem-Identität“ und einer „Ipse-Identität“, die der Unterscheidung von „Selbigkeit“ und „Gleichheit“ entspricht. Die sich durch einen zeitlichen Fluss durchhaltende Sichselbst-Gleichheit eines Gegenstands (die an seinem Werden nichts ändert) muss von der „Selbigkeit“ qua „Selbstheit“ unterschieden werden, die allein die Identität des „Selbst“ betrifft. Sie kommt ausschließlich Existierendem des Typus „menschliches Dasein“ (im Heidegger’schen Sinne) zu und bezieht sich auf dessen spezifische Zeitlichkeit. Eine vertiefte Besinnung auf das „Selbst“ kann sich jedoch mit dieser ersten Unterscheidung nicht zufriedengeben. Im Ausdruck „sich selbst“ kann die Betonung auf das „Selbst“, aber auch auf das „Sich“ gelegt werden. Ersteres betont die „Identität“, während letzteres den reflexiven Charakter des Selbst unterstreicht. Es muss nun daran erinnert werden, dass die Klassische Deutsche Transzendentalphilosophie bezüglich der Frage nach dem Status des im Sinne des „Sich“ verstandenen „Selbst“ hochinteressante Lösungsvorschläge bereithält, deren Konfrontation mit Richirs Ausarbeitungen sich als sehr fruchtbar erweisen wird. Zunächst soll aber die hier bestehende Grundproblematik noch genauer gefasst werden. Jedes Gegenstandsbewusstsein ist dank des von Brentano so bezeichneten „inneren Bewusstseins“ je schon Selbstbewusstsein. Oder um mit Sartre zu sprechen (zum Beispiel in La transcendance de l’ego): Jedes „thetische“ (oder setzende) Bewusstsein eines Seienden ist „nicht thetisches“ Selbstbewusstsein. Wie soll aber ein solches „nicht thetisches“ Bewusstsein (oder in Richirs Begriffen: ein „nicht doxisches“28 Bewusstsein) aufgefasst werden? Die überzeugendste
28 Für Richir ist (ganz gleich, was Husserl hierzu behauptet hat) jedes intentionale Bewusstsein ipso facto Gegenstandsbewusstsein oder, wie er sich ausdrückt, „doxisches“ Bewusstsein (das dadurch definiert ist, dass das Meinen weiß, was es vermeint – wobei das Gemeinte überhaupt nicht zu existieren braucht oder widersinnig sein kann). Daraus folgt (weil das Selbst eben kein Gegenstand einer Objektivation ist), dass es im Bezug des Selbst zu sich selbst keine „Doxa“ geben kann.
246
Kapitel IX
Antwort auf diese Frage wurde (vom phänomenologischen Standpunkt aus betrachtet) nicht von Husserl oder von einem seiner unmittelbaren Nachfolger, sondern zuerst von Fichte (in der „Deduktion der Vorstellung“ in der Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre von 1794/95) und dann von Schelling (in seinem Briefwechsel mit Fichte, genauer: in seinem Brief vom 19. November 1800,29 das heißt noch vor der Herausgabe der Darstellung meines Systems der Philosophie (die eben das Identitätssystem darstellt) geliefert. Wenden wir uns nun Fichtes Argumentation zu.30 Das Selbstbewusstsein ist durch eine zweifache Tätigkeit ausgezeichnet: durch eine reflektierende und insbesondere durch eine anschauende Tätigkeit31 (die einer reflektierenden Tätigkeit zweiten Grades gleichkommt). Die reflektierende Tätigkeit (dank derer jedes Selbstbewusstsein erst Bewusstsein von etwas ist) ist die Aktivität, die den durch den „Anstoß“ hervorgerufenen Rückgang der absoluten Aktivität reflektiert, welcher jedem Bezug zu... zugrunde liegt (wobei eine der grundlegenden Aufgaben des Philosophen [und insbesondere des Phänomenologen] darin besteht, dieses Verhältnis zwischen „absoluter Tätigkeit“ und „Anstoß“ zu „reflektieren“ und zu „verstehen“). Und die anschauende Tätigkeit ist die Tätigkeit, die ihrerseits diese reflektierende Tätigkeit (die davon unabtrennbar ist) reflektiert – dies ist also diese spezifische Anschauung qua Reflexion der Reflexion, die das Selbstbewusstsein ermöglicht. Dies ist aber noch nicht Fichtes letztes Wort in Bezug auf das „Selbst“ (und das „Selbstbewusstsein“). Eine noch genauere Erörterung hiervon ist seine „Bildlehre“ von 1804 und vor allem von 1812 (in den jeweiligen Darstellungen seiner Wissenschaftslehre). Halten wir kurz das für unsere Absicht Wesentliche daraus fest, ohne auf alle Einzelheiten weiter einzugehen.32
29 Schelling – Fichte Briefwechsel. Kommentiert und herausgegeben von Hartmut Traub, Neuried, ars una, 2001. 30 Zu Näherem hierzu, siehe v. Vf. Réflexion et spéculation, op. cit. 31 Schelling führt diesen Begriff in seinem Brief an Fichte vom 19. November 1800 ein. 32 Zu einer vertieften Erörterung von Fichtes Bildlehre, siehe v. Vf. „Die drei Bildtypen in der transzendentalen Bildlehre J. G. Fichtes“, in Bild, Einbildung, Selbstbewusstsein, A. Schnell J. Kunes, (Hsg.), Fichte-Studien 42, 2015, S. 49–65.
Transzendenz und Selbst
247
Für Fichte ist das Selbst nichts Geringeres als das Grundprinzip der Wissenschaftslehre selbst. Es ist keine Substanz, kein bestimmter Inhalt, sondern eine bloße Form – eine „Sich-Form“33 – wodurch sich sein ausschließlich transzendentaler Status ausdrückt. Wie fasst Fichte es näher? Dank seiner Lehre des Bildes oder Schemas, die dem Grundprinzip des Wissens Rechnung zu tragen vermag. Diese Lehre führt drei Bild- oder Schematypen ein. Zunächst erscheint das Prinzip des Wissens als ein Bild, ein Begriff, eine Widerspiegelung des Prinzips selbst (erste Schematisierung). Sofern dieses erste Schema aber nur ein Schema ist – während doch das Prinzip und eben nicht bloß ein Schema davon gesucht wird – muss es vernichtet werden, um so ein zweites Schema auszubilden – nämlich das sich selbst erscheinende Wissen (zweite Schematisierung). Der entscheidende Begriff hierin ist der des „Sich“. Er wird durch eine (innere) Reflexion auf das erste Schema erhalten. Wie erscheint sich aber das Wissen? Durch ein drittes Schema, nämlich durch das sich ALS erscheinendes erscheinende Wissen, das nichts anderes als eine Reflexion der Reflexion (= Gesetz des Sich-Reflektierens) ist (dritte Schematisierung). Dieses dritte Schema ist ein reines Sehen. Wir finden hier also die gleiche Idee wieder, die sich bereits am Ende unserer kurzen Betrachtung der „Deduktion der Vorstellung“ in der Grundlage von 1794/95 angekündigt hatte: Das „Sich“ stellt sich in einer (intellektuellen) Anschauung als Reflexion der Reflexion dar. Der entscheidende Punkt dieser Lehre besteht darin, dass das Prinzip des Wissens kein „Ich“, sondern das – asubjektive – Gesetz der Selbstreflexion ist.34 Die Reflexionsphilosophie gelangt hier zu ihrem Höhepunkt und Abschluss – indem sie die Idee der Reflexion als bloßen Rückgang auf ein vorausgesetztes Ich völlig aufgibt. Das
33 Fichte gebraucht diesen Ausdruck in der Einleitung zur Wissenschaftslehre von 1812. Dies blieb lange unbeachtet, denn in der Version dieses Texts in den von Fichtes Sohn herausgegebenen Sämmtlichen Werken steht irrtümlicherweise „Ich-Form“ anstelle von „Sich-Form“. Dieser Fehler wurde von den Herausgebern der Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (Band II, 13) glücklicherweise korrigiert. 34 Siehe hierzu J.-C. Goddard, „1804–1805. La désubjectivation du transcendantal“, in J.G. Fichte 1804–1805. Lumière et existence, A. Schnell (Hsg.), Archives de Philosophie, Band 72 (2009), Heft Nr. 3, Juli-September.
248
Kapitel IX
Selbst, genauer: das Sich ist dabei nur das asubjektive und präobjektive Gesetz des Sich-Reflektierens. In diesem Sinne und allein in diesem Sinne betrachtet Fichte es als „rein“ oder „ab-solut“. Bevor wir uns Richirs Überlegungen zum „Erhabenen“ und zum „Selbst“ zuwenden (wo die Verbindungs- und Trennungslinien zu Fichte und Schelling deutlich werden) und um seinen eigenen Standpunkt noch klarer hervortreten zu lassen, muss noch eine andere Dimension des Selbst erörtert werden, die dem klassischen Transzendentalismus entgangen war:35 nämlich die der Affektivität. Einen Hinweis hierauf findet man beim ersten Heidegger,36 genauer: in der Gestalt des „Sich-Habens“ in den „Anmerkungen zu Karl Jaspers ‘Psychologie der Weltanschauungen’ (1919/1921)“.37 Auf die Frage, wie das Selbst sich zu sich selbst verhalten kann, liefert Heidegger eine hochinteressante und originelle Antwort, die auch ihn aus dem Paradigma der Reflexionsphilosophie herausführt. Wesentlich festzuhalten ist dabei Folgendes: In der Tradition der abendländischen Philosophie wird der Status des Selbst seit Descartes durch das Prisma des „cogito“ abgehandelt. Dieses bezeugt an sich selbst ein „sum“, das das „Bin“ eines „ego“ („Ich“) ist (auch wenn Descartes selbst es nicht explizit in diesen Begriffen fasst). Dieses „ego“ ist das Subjekt des „cogito“38 und es fasst sich
Mit Ausnahme des späten Fichte. In den folgenden Zeilen führen wir eine Konzeption aus, auf die Richir zwar nirgends persönlich verweist, die aber eine philosophische Position, die die Ausarbeitungen Richirs ermöglicht und noch besser rechtfertigt, erhellt. 37 M. Heidegger, Wegmarken, HGA 9, F.-W. von Herrmann (Hsg.), Frankfurt am Main, Klostermann, 1976, 1996², insbesondere S. 29f. 38 In Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace schreibt Richir im gleichen Sinne über das „Selbst“ als „‚Sitz’ der Affektivität“: „Es ist uns gelungen, etwas vom elementarsten, nicht setzenden, also der Setzung entgleitenden Selbstbewusstsein zu erfassen […]. Hier gibt es noch kein ‚cogito‘ und auch kein ‚sum‘, denn das Selbst ist hier noch gar nicht in der ersten Person. Mit dem Erwecken des Blicks erweckt es lediglich sich selbst als ein – auf den wechselseitigen, in Abstand zueinander seienden Kontakt der Affektionen, die ihrerseits in Abstand zueinander sind – reflektierendes Selbst, und dieses Selbst ist dabei noch anonym, austauschbar, unterschiedslos ‚ich‘ und ‚du‘. Von dem gerade erweckten Selbst kann daher nur gesagt werden, dass es ein – hinter jedem mehr oder weniger expliziten 35 36
Transzendenz und Selbst
249
in und durch das „Ich denke“. Sein Sein ist somit seinem Denken geschuldet. Heidegger ist nun der Ansicht, dass eine solche Einstellung nicht dem Rechnung zu tragen vermag, was das Selbst im Wesentlichen bestimmt. Der innerste Kontakt des Selbst mit sich selbst vollzieht sich nicht im Denken (das heißt in der Reflexion), sondern ursprünglicher in einer affektiven Dimension, in einer „Befindlichkeit“. Ursprünglich bin ich nicht zuerst ich selbst, sondern habe ich mich: Das „ego sum“ (im Nominativ) ist im Grunde ein „habeo me“ (im Akkusativ), und dieses ist (in einer ersten Grundcharakteristik) ein völlig unpersönliches, „asubjektives“ „Subjekt“ – eben das sich (wie bei Fichte) im „Sich“ aussprechende „Sich“. Und was ist die Bedeutung des Zeitworts „haben“ im „Sich-Haben“? Diese bringt (und das ist die zweite Grundcharakteristik) auf dieser ursprünglicheren „Stufe“, wenn es darum geht, des Selbstbezugs des Selbst Rechnung zu tragen, einen Bruch innerhalb der Sein-Denken-Korrelation zum Ausdruck. Und das Zeitwort, das diesen Bezug – der, wie gesagt, ein wesentlich affektiver ist – in der Tat am besten ausdrückt, ist nicht das vom „Denken“ und das heißt von der Reflexion untrennbare Verb „sein“, sondern eben „haben“. Wir verfügen nun über alle – historisch-kontextuellen und systematischen – Bausteine, um Richirs eigene Ausarbeitungen in Bezug auf das Erhabene und das Selbst näher betrachten zu können. Diese beiden Begriffe sind eng miteinander verbunden: Der „Moment“39 des Erhabenen ist eben gerade das, was für das Selbst ursprünglich konstitutiv ist (das heißt, was es zu erläutern gestattet, ohne ein bereits konstituiertes Selbst vorauszusetzen), bzw. was für Richir den Ursprung des Bewusstseins konstituiert. Dieser „Moment“ setzt eine Bewusstsein – unmittelbares transzendentales (Selbst-)Bewusstsein ist, wobei dieses Erwecken im und durch den Schematismus jeweils ‚im Übersprung‘ flimmert, und zwar von Affektion zu Affektion, von Blick zu Blick, von ‚perzeptiver‘ Phantasie zu ‚perzeptiver‘ Phantasie, um so eine Art Bewusstseinshintergrund zu bilden, durch den ich mich als erweckt weiß, ohne dass ich gleichwohl darauf zu reflektieren hätte. Ein Hintergrund, der kein Grund im Sinne des Trägers, des Substrats oder der Substanz (hypokeimenon) ist, da er eben des Seins, der bestimmenden Selbstsetzung, ermangelt. Wenn er ein Grund ist, dann nur im Sinne des transzendentalen ‚Schoßes’“, a. a. O., S. 319. 39 Richir setzt diesen Begriff in Anführungszeichen, weil es sich dabei nicht um ein „Jetzt“ oder um eine „sich in Gegenwärtigkeit zeitigende“ Phase handelt.
250
Kapitel IX
Grundkonfiguration in Szene, auf die er in seinen letzten Arbeiten wiederholt zurückkommt, nämlich jene, in welcher sich im archaischsten phänomenologischen Register – das heißt da, wo der außer-sprachliche Schematismus und die transzendentale Interfaktizität noch ineinander verwoben sind – folgende außerzeitliche Abfolge abspielt: erstens, eine „hyperbolische“, eine Unterbrechung des Schematismus mit sich führende Intensitätssteigerung der Affektivität, die sich dann, zweitens, augenblicklicher Weise (im Platon’schen „exaiphnès“) und unerwarteter Weise selbst unterbricht und einen Rückgang, einen Umschlag, der Affektivität auf sich selbst hervorruft (was dadurch, sofern es den Schematismus [wieder?] „in Gang setzt“, einen Abstand zwischen der Affektivität und diesem Überschuss herstellt). Zeichnen wir zunächst die „Genese“ dieser Bedeutung des Begriffs des „Erhabenen“ in Richirs Werk nach.40 Richir stellt diese Bedeutung klar in seinem bereits zitierten Artikel „Langage et institution symbolique“ heraus. Er betont hier insbesondere die „Verdichtung“ der Affektivität, sofern diese ein „archaisches“, „primitives“ Selbst ins Spiel bringt, welches das reflexive Selbst „aufzunehmen“ vermag – woraus folgt, dass es ihm „vorausgeht“: Dadurch, dass das symbolisch Stiftende (das Augenblickliche) als „phänomenologisches schwarzes Loch“ eine Anziehung auf das elementarste Schema des Überschreitens desselben ausübt, übt es auch eine Anziehung auf die in es hineinstürzende Affektion aus und bringt diese dazu, sich selbst zwischen dem Teil derselben, der dem schematischen Abstand als Überschreiten innewohnt, und jenem, der – ihr gegenüber im Überschuss – dieser Anziehung unterworfen ist, zu differenzieren. Und hierdurch wird die erhabene Affektion dazu angehalten, sich selbst und somit auch das Selbst zu reflektieren, sofern es ja schon in seiner Prekarität ein reflexives Selbst als Kondensat der Affektionen gewesen ist. Von einem „reflexiven“ Selbst, das in der Reflexivität der sprachlichen Phänomene als transzendentalem Kern oder als transzendentaler Matrize – in der transzendentalen Interfaktizität –, wo die sprachlichen Affektionen und die sprachlich gezeitigten Phantasien-Affektionen in Beziehung zueinander treten, verdichtet wurde, wird das Selbst vermittels der erhabenen Affektion, in der all diese Affektionen ineinander verschmelzen, und durch das, was den Überschuss der erhabenen Affektion sich selbst gegenüber hervorruft, zu einem Selbst, das 40 Wir betonen hier ganz besonders diese Bedeutung des Begriffs des „Erhabenen“, da er im Frühwerk zwar, wie gesagt, bereits vorkommt, aber dort noch nicht den Sinn hat, den er ab 2005 annehmen wird.
Transzendenz und Selbst
251
zumindest – in der „Ausschaltung“ der schematischen Zusammenhänge – die Selbstreflexion über sich selbst erregen kann. Auf diese Weise wird das Selbst zu einer Art hochdichtem Kondensat der gesamten Affektivität (der verschmolzenen Affektionen), das sowohl dazu geeignet ist, das reflexive Selbst aufzunehmen, als auch, von demselben aufgenommen zu werden […].41
Wie lässt sich dieses „schlechthin affektive Selbst“42 phänomenologisch ausweisen? In der „Quelle des phänomenologischen Erlebens und Erlebnisses“43 des reflexiven – allerdings noch nicht reflektierten – Selbst des Säuglings, das vermittels des Blicks (= die „leibliche“ Dimension des Blickaustauschs) durch das mütterliche Selbst gestiftet wird. Im „‚Moment‘ des Erhabenen“, dies wurde bereits angesprochen und wird weiter unten noch vertieft, kreuzen sich somit entscheidende Analysen Kants und Winnicotts. Im „‚Moment‘ des Erhabenen“ treffen wir erneut den grundlegenden „chorismos“ an, der sich hier am Begriffspaar Sinn/Schematismus äußert. Um diesen absolut wesentlichen „Moment“ zu veranschaulichen, gebraucht Richir im späteren (ebenfalls bereits zitierten) Kapitel „Langage, poésie, musique“ in Variations phénoménologiques sur le sublime et le soi die (auch bei Levinas und Maldiney anzutreffenden) Metaphern der „Spannung“ („Systolē“) und der „Entspannung“ („Diastolē“) des menschlichen Herzmuskels, die Richir aber völlig unräumlich und unzeitlich versteht: Unter Systolē kann das „Herausspringen“ der Affektivität im „Moment“ des Erhabenen verstanden werden, wobei dieses „Herausspringen“ einen schematischen Bruch darstellt, in dem die „momentan“ von jeglicher Bindung abgelöste Affektivität „sich selbst“ hyperbolisch in eine Art hyperdichten Zustand versetzt und sich selbst – immer noch „momentan“ – ohne jeden Begriff reflektiert, und zwar in ihrem Überschuss, dessen Horizont die absolute Transzendenz ist, welche die Frage nach dem Sinn44 insofern eröffnet, als sie unweigerlich verflüchtigend, unerfassbar, undarstellbar und somit unzugänglich und radikal unbestimmt ist. Würde dieser „Moment“ andauern, dann würde die Affektivität sich darin wie in einem „Langage et institution symbolique“, S. 139. „Langage et institution symbolique“, S. 135. 43 Ebd. 44 Dadurch, dass die Frage nach dem Sinn sich dank der „absoluten Transzendenz“ stellt, spielt letztere auch in der Konstitution des „Selbst“ eine entscheidende Rolle. 41 42
252
Kapitel IX
„schwarzen Loch“ verlieren, und zwar unwiederbringlich, was eine Art „psychischen Tod“ bedeuten würde. Auf die Systolē „folgt“ aber ganz im Gegenteil unmittelbar die „Diastolē“, welche die Entspannung derselben ausmacht […], die insofern bereits schematisch ist, als sie unmittelbar durch den Schematismus wiederaufgenommen wird, der nicht nur in den „perzeptiven“ Phantasien die Affektivität in Affektionen moduliert, sondern auch – korrelativ – den zu massiven und überreichlichen Sinn an mehrstimmige „Sinnfetzen“ verteilt, die durch den nun rufenden Sinn gehalten werden und zu diesem zugleich hintendieren, wobei der „Moment“ des Erhabenen weiter mithineinspielt, jedoch fungierend oder besser: als ein virtueller.45
Dabei muss betont werden, dass der „Moment“ des Erhabenen keiner Zeitreihe angehört, also außerzeitlich (und ungeschichtlich) ist 46 – was allein schon darin begründet ist, dass er nur durch Anwendung der phänomenologischen hyperbolischen Epoché, die jede Setzung und insbesondere jede im Voraus bestehende Zeitlichkeit in Klammern setzt, zugänglich ist: Somit gibt es hierin „vor“ der schematischen Wiederaufnahme in der Diastolē weder eine transzendentale Vergangenheit noch eine transzendentale Zukunft (die ja an den Schematismus und an die darin modulierte ur-ontologische Affektivität gebunden sind), sondern in gewisser Weise eine Ewigkeit oder, um nicht so weit zu gehen, eine Unzeitlichkeit, was eines der Grundcharakteristiken der schematischen Unterbrechung ausmacht – denn diese wäre ja, wie gesagt, dem „psychischen“ Tod koextensiv, wenn die Systolē sich nicht unmittelbar in einer Diastolē entspannte, in welcher der Schematismus sich selbst wiederaufnimmt und die Affektivität ein Kontakt des Selbst zu sich selbst ist, in der durch die durch die Entspannung ermöglichten Affektionen der Schematismus – dessen durch die Affektionen mobilisierte wilde Wesen sich in „perzeptive“ Phantasien verwandeln oder zumindest, sobald ein Blickaustausch vorliegt, fähig („vorbereitet“) sind, dies zu tun – innewohnt.47
Der „‚Moment‘ des Erhabenen“ ist also durch eine zweifache Unterbrechung gekennzeichnet: zunächst durch eine Unterbrechung des Schematismus (ganz gleich ob es sich dabei um einen sprachlichen handelt oder nicht), die eine Verdichtung der Affektivität hervorruft; und durch eine Unterbrechung dieser Verdichtung, dieses Variations sur le sublime et le soi, S. 23f. Variations sur le sublime et le soi, S. 25. 47 Ebd. 45 46
Transzendenz und Selbst
253
„Überschusses an Affektivität“, welcher der Wiederaufnahme des Schematismus und der eben aus diesem Umschlag der Affektivität resultierenden Konstitution des Kontakts, „in und durch einen Abstand als nichts von Raum und Zeit“, von Selbst zu Selbst (dem „wahren Selbst“), gleichkommt. Die „Spur“ der Transzendenz ist dieser nicht reduzierbare Abstand zwischen dem Selbst und dem Selbst – DER DESSEN REFLEXION ÜBERHAUPT ERST MÖGLICH MACHT – und der seine ebenso nicht reduzierbare Nicht-mit-sich-selbst-Übereinstimmung impliziert. Mit dieser Idee einer Spur der (asubjektiven) Transzendenz auf dem Grund des Selbst (das an Fichtes Bildlehre erinnert), schlägt Richir eine Alternative zu den verschiedenen Reflexionsmodellen (der Klassischen Deutschen Philosophie) vor, um somit den Kontakt des Sich mit sich selbst und das, was diesen überhaupt erst ermöglicht, zu erklären.48 Dank dieser Analyse des Erhabenen und des Selbst kann nunmehr der Zusammenhang zwischen „Schematismus“ und „transzendentaler Interfaktizität“ verdeutlicht werden. Zugleich lassen sich dadurch alle architektonischen Grundbausteine innerhalb der Richir’schen „Neugründung“ der Phänomenologie verorten. Hierzu ist es notwendig, noch ein letztes Mal auf den Begriff der „Transzendenz“ zurückzukommen. Letztere hat nämlich nur dann einen „Sinn“, wenn man über die Rolle des Schematismus hinaus auch die der „transzendentalen Interfaktizität“ ins Auge fasst und zwar deshalb, weil diese Interfaktizität die Bedingung dafür ist, dass das mit sich selbst in Kontakt seiende Selbst sich wirklich als Affektivität eines Selbst fühlt. Wenn „der sich der Möglichkeit, angeblickt zu werden, aussetzende Säugling diesen ihn anblickenden Blick seinerseits erblicken und sich mit ihm
48 Somit wäre es sehr vielversprechend, diese, einen bedeutenden Aspekt von Richirs phänomenologischer Anthropologie ausmachende, „Genese“ der Reflexion und des Selbst mit dem asubjektiven Gesetz des SichReflektierens bei Fichte (siehe oben) einerseits und mit der Genesis des Selbst in Schellings System des transzendentalen Idealismus andererseits (da Schellings „erstes System“ hier deutlich relevanter als sein Identitätssystem ist) in Beziehung zu setzen.
254
Kapitel IX
austauschen kann“ und wenn „genau darin das Selbst sich konstituiert,49 und zwar diesmal als ein absolutes Ich, das sich mit anderen absoluten ‚Ichen‘ der durch den Schematismus entfalteten chora austauscht“,50 dann wirft das die Frage auf, wie sich dieser interfaktische Bezug und der Schematismus genauer zueinander verhalten. Im archaischsten architektonischen Register (genauer: im Register der durch die „absolute Transzendenz“ eröffneten „physischkosmischen Transzendenz“) gibt es einen absolut grundlegenden „Moment“: der des „konkreten Ganzen“ von Mutter und Säugling, den Richir als einen „transzendentalen Schoß“ bezeichnet und durch eine „Hypersensibilität“, eine Grundstimmung, gekennzeichnet ist, die uns unser ganzes Leben lang durchstimmt. Der „‚Moment‘ des Erhabenen“ ist für seinen Teil im „Moment“ des konkreten Ganzen enthalten, wobei der Blick – „sofern er auch nur erblickt wird und dadurch im Austausch selber erblickend ist“51 – „die erste Äußerlichkeit innerhalb des [nicht schematischen] konkreten Ganzen ausmacht, welche Äußerlichkeit vermittels der Diastolē den sprachlichen Schematismus ‚auslöst’“.52 Da der „‚Moment‘ des Erhabenen“ diese Äußerlichkeit und dadurch den die transzendentale Interfaktizität ermöglichenden „Übergangsraum“ vermittels der absoluten Transzendenz konstituiert und der Schematismus das konkrete Ganze ursprünglich transzendiert, ist in der Tat im Register der physisch-kosmischen Transzendenz eine nicht reduzierbare Dualität (sowohl ein Transzendenz- als auch ein Verwebungszusammenhang, aber keine Vermischung) zwischen transzendentaler Interfaktizität und Schematismus auszumachen – wobei, wie gesagt, diese Interfaktizität im „transzendentalen Schoß“ (das heißt im durch die Hypersensibilität [des Säuglings gegenüber seiner Mutter] charakterisierten konkreten Ganzen), der im Übergangsraum den Blickaustausch und hierdurch den ersten interfaktischen Bezug ermöglicht, konstituiert wird, während der Schematismus im Austausch sprachlich wiederaufgenommen wird. Somit wird verständlich, wie in der 49 Diese Konstitution des Selbst durch den Blickaustausch (das heißt also durch die Tatsache, dass der Säugling sein „Erblickt-Sein“ selbst anblickt) macht einen wichtigen Aspekt dessen aus, was oben als die „Endogeneisierung“ des phänomenologischen Felds bei Richir bezeichnet wurde. 50 Variations sur le sublime et le soi, S. 42. 51 Variations sur le sublime et le soi, S. 45 (hervorgehoben v. Vf.). 52 Ebd.
Transzendenz und Selbst
255
Artikulierung vom „Moment“ des konkreten Ganzen und dem „‚Moment‘ des Erhabenen“ der sprachliche Schematismus hineinspielt: Er wird, wie gesagt, durch die Äußerlichkeit ausgelöst, die sich durch den Blickaustausch eröffnet und zugleich dafür sorgt, dass das Selbst sich auch als Selbst fühlt – denn das Selbst wird ja „immer schon“ (aber nicht jederzeit) „angeblickt“ (was also die transzendentale Interfaktizität voraussetzt) und nicht solipsistisch auf es selbst zurückgeworfen (was der Fall wäre, wenn ausschließlich die absolute Transzendenz hier einwirkte). Kommen wir zum Schluss. „Innerhalb“ des „archaischen chorismos“ von absoluter und physisch-kosmischer Transzendenz, von (der Frage nach dem) Sinn und Schematismus stellt Richir eine grundlegende und verwobene, die physisch-kosmische Transzendenz kennzeichnende Dualität zwischen transzendentaler Interfaktizität und Schematismus heraus. In diese spielen zwei „Momente“ hinein: das „Moment“ des konkreten ganzen (= „transzendentaler Schoß“) und der „‚Moment‘ des Erhabenen“ (welches das Selbst konstituiert), wobei letzterer im ersteren verortet ist. Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass diese Dualität dem, was er die „beiden Quellen“ der „reinen Phantasie“ nennt – nämlich einerseits dem Schematismus (sofern er die Phantasie-Affektionen „bewegt“) und andererseits der „anderen Quelle“, der Platon’schen „aisthesis“, dem Fichte’schen „Anstoß“ oder, in seinen eigenen Begriffen, dem mütterlichen „Blick“ –, entspricht. Somit bildet er die metaphysische Dreiheit Gott-Welt-Mensch insofern um, als er nicht von ersterem ausgeht (oder ihn voraussetzt), sondern das transzendentale Subjekt entthront und dadurch der transzendentalen Faktizität (und dem Blickaustausch im „transzendentalen Schoß“ als leibliche Dimension dieser Interfaktizität) die ihr gebührende Stellung zukommen lässt.
Kapitel X Richirs letztes Wort: Abständigkeit und Vibration In Richirs letztem Buch1 – das systematisch und architektonisch so bedeutsam bleibt wie die umfangreicheren früheren Werke – wird die Frage nach dem „Ursprung“ und dem „Anfang“ wahrscheinlich so direkt aufgeworfen und gestellt wie nirgends sonst. 2 Es handelt sich dabei sowohl um den Anfang der „neu gegründeten“ transzendentalen Phänomenologie als auch der Metaphysik. Richir strebt dabei zwar eine „phänomenologische Genese“3 dieses Anfangs an, aber es ist völlig klar, dass es genauso um einen „Ausgangspunkt“ geht, der sich von jenem der Klassischen Deutschen Philosophie (und dabei insbesondere von jenem Hegels) unterscheiden soll.4 Richirs Hinsicht ist also eindeutig phänomenologisch und metaphysisch zugleich. Man kann darin den Abschluss all seiner Versuche erkennen – von „Le rien enroulé“ über Phénomènes, temps et êtres und Variations sur le sublime et le soi bis zu diesem letzten Buch –, eine „transzendentale Matrize“ (dieser Begriff wird auch in Propositions buissonnières noch einmal gebraucht) der „Phänomenalisierung“ bzw. der „Sinnbildung [sens se faisant]“ herauszuarbeiten. Es sollen zunächst noch einmal einige Bemerkungen zu der grundsätzlichen Bedeutung dieser „Matrize“ vorangeschickt werden. Die Herausstellung einer „transzendentalen Matrize“ bei dem Versuch, den „Anfang“ zu denken, verweist auf die Ansätze Fichtes und Kants. In der Wissenschaftslehre 1804/II hatte Fichte die Grundbestimmung der klassischen Auffassung des Begriffs des Transzendentalen herausgearbeitet, die auch für die Phänomenologie wegweisend sein wird:
1 In diesem letzten Kapitel wird mehr oder weniger frei auf Propositions buissonnières Bezug genommen. 2 Die gleiche Problematik wird in seinem letzten Artikel „Quatre essais sur l’origine transcendantale des phénomènes“, der in den Annales de Phénoménologie, Nr. 14/2015, S. 121–193 erschienen ist, anhand der Frage nach dem „transzendentalen Ursprung der Phänomene“ behandelt. 3 Propositions buissonnières, S. 161. 4 Propositions buissonnières, S. 23.
258
Kapitel X
[W]enn er sich nur besinnen will, innewerden, dass schlechthin alles Sein ein Denken oder Bewusstsein desselben setzt: dass daher das bloße Sein immer nur die eine Hälfte zu einer zweiten, dem Denken desselben, sonach Glied einer ursprünglichen und höher liegenden Disjunktion ist, welche nur dem sich nicht Besinnenden, und flach Denkenden verschwindet. Die absolute Einheit kann daher eben so wenig in das Sein, als in das ihm gegenüberstehende Bewusstsein, eben so wenig in das Ding, als in die Vorstellung des Dinges […], sondern in das […] Prinzip der absoluten Einheit und Untrennbarkeit beider , das zugleich […] das Prinzip der Disjunktion beider ist […]. Dies entdeckte nun Kant und wurde dadurch der Stifter der Transzendental-Philosophie.5
In dieser Auslegung Kants wird der Begriff des „Transzendentalen“ also durch die Korrelation von Denken und Sein bzw. von Bewusstsein und entsprechendem Gegenstand bestimmt. Das Grundproblem der Fichte’schen Wissenschaftslehre von 1804 bestand in der aufzuweisenden Notwendigkeit, diesen „Korrelationismus“ mit der Grundabsicht der Philosophie überhaupt – nämlich „das Mannigfaltige auf Einheit zurückzuführen“ (in diesem Falle: die Zweiheit der Korrelationsglieder auf ihr Einheitsprinzip [das für Fichte zugleich ein „Disjunktionsprinzip“ ist]). Die zweite Perspektive, die eine genuin – und lange Zeit ausschließlich6 – kantische Perspektive gewesen ist, betrifft den Dualismus von sinnlichen und verstandesmäßigen Vorstellungen (niemand vor Kant, aber auch niemand nach ihm, hat in einem solchen Maße auf den nicht reduzierbaren qualitativen Unterschied von „Anschauung“ und „Begriff“ insistiert). Richir macht sich nun diese Grundbestimmungen des Transzendentalismus zu eigen. Die Dualität von Sein und Denken wird durch jene von („proto-ontologischer“) „Affektivität“ und „Schematismus“ übersetzt. Diese nimmt dabei jene von Sinnlichkeit und Verstand wieder auf, modifiziert sie jedoch grundlegend. Wie im 5 J. G. Fichte, Die Wissenschaftslehre 18042, J. G. Fichte – Gesamtausgabe, Band II, 8, R. Lauth, H. Gliwitzky (Hsg.) (unter Mitarbeit von E. Fuchs, E. Ruff und P. K. Schneider), Stuttgart – Bad Cannstatt, G. Holzboog, 1985, S. 13f. 6 Dass sie ebenso diejenige Richirs ist, wird sehr eindringlich von P. Flock in „Der Schein als reflexive Grundfigur der transzendentalen Phänomenologie. Ein Kommentar zur IIe Recherche phénoménologique Marc Richirs“, in Marc Richir: Méthode et Architectonique, I. Fazakas, K. Novotný, A. Schnell (Hsg.), Interpretationes, Studia Philosophica Europeanea IX, 2020 aufgezeigt.
Richirs letztes Wort: Abständigkeit und Vibration
259
vorigen Kapitel gezeigt wurde, drückt sich dieselbe Dualität im „‚Moment‘ des Erhabenen“ durch jene von (affektiver) „Systolē“ und der (schematisierenden) „diastolischen“ Entspannung aus. Dieser „Moment“ impliziert zudem noch eine dritte Instanz – die „absolute Transzendenz“ –, die sich im infinitesimalen Umschlagspunkt von Systolē und Diastolē (dem Platon’schen exaiphnès) ins Unendliche verflüchtigt und dabei gewährleistet, dass der Sinn nicht in einem bloßen Rückbezug auf sich selbst zugrunde geht. In Propositions buissonnières zieht Richir hieraus seine letzten Schlüsse 7 und führt noch ein letztes Mal neue Begriffe ein. Richir ist, wie bereits betont wurde, ein Dualist. In seinem letzten Werk wird jedoch trotz allem deutlich, dass er weitaus mehr, als dies in den Variations der Fall war, eine „Einheit“ ausfindig zu machen sucht, auf welche die phänomenale Mannigfaltigkeit freilich nicht zurückgeführt werden soll. Die hierfür entfaltete Begriffskonstellation ist äußerst komplex. Es soll dabei Schritt für Schritt vorgegangen werden. * Der „‚Moment‘ des Erhabenen“ ist die zentrale Figur in Richirs Spätwerk. Aber seine Darstellungsart ändert sich und wird komplizierter. Man kann hier entweder von der „absoluten Transzendenz“ 7 Bezüglich der „transzendentalen“ oder „generativen Matrize“ der „Sinnbildung“ in einer Perspektive, die Richirs Ausarbeitungen an jene Kants, Fichtes und Heideggers anknüpft und dabei eine mögliche Weiterführung und Vertiefung in der Absicht einer „Neugründung“ der transzendentalen Phänomenologie versucht, siehe Seinsschwingungen, op. cit. Der Sinn dieser „generativen Matrize der Sinnbildung“ besteht dort insbesondere darin, Heideggers Projekt in den Beiträgen zur Philosophie, nämlich der „Zerklüftung des Seins“ diesseits einer Kategorialisierung des Seienden (wie diese mit Kants Kategorientafel geleistet wurde) nachzugehen, konkret zu verwirklichen (zu diesem Projekt Heideggers, siehe die exzellente Studie von C. Serban, „La pensée de la fissuration de l’être [Zerklüftung des Seyns] dans les Beiträge zur Philosophie, in A. Schnell [Hsg.], Lire les Beiträge zur Philosophie de Heidegger, Paris, Hermann, 2017, S. 253–270). Die Hauptbegriffe dieser Matrize (Phänomenalität, Plastizität und Reflexibilität) entsprechen dabei auf der untersten Ebene der Sinnbildung (also in der Sphäre der „Präphänomenalität“) – und in Begriffen der „Modalität“ ausgedrückt – der Möglichkeit, der Wirklichkeit und der Notwendigkeit.
260
Kapitel X
oder von der „Affektivität“ ausgehen. Da letztere als zentral anzusehen ist, bietet es sich an, zunächst die von ihr ausgehende Darstellungsart zu wählen. Die Affektivität ist keine Dimension, Eigenschaft o.Ä. der menschlichen Psyche. Sie ist ein „blindes und quasi-tierisches Treiben des Lebens“.8 Es handelt sich dabei um ein (verbal formuliertes) „Leben“, das der Tätigkeit des „absoluten Ich“9 Fichtes gleicht, der dieses als „triebhaft“ bezeichnet hatte. Richir betont, dass die Affektivität „ohne ontologischen Status“ ist und von „Sein“ erst dann die Rede sein kann, wenn sie sich auf sich selbst bezieht. Die transzendentale Bedingung dieses Selbstbezugs ist das „Herausspringen“ im „‚Moment‘ des Erhabenen“ mit der Flucht ins Unendliche der absoluten Transzendenz, die ihrerseits keinen ontologischen Status hat. Im „‚Moment‘ des Erhabenen“, in dem es zu einer explosionsartigen, „Funken“ hervorrufenden, Kollision zwischen Affektivität und absoluter Transzendenz kommt, die beide ursprünglich „seinslos“ sind, wird die Grundlage für den Seinsaufgang gelegt, der – das muss noch einmal betont werden – die Proto-Reflexivität der sich zu sich selbst in Bezug setzenden Affektivität voraussetzt. Diese Erläuterung des „‚Moments‘ des Erhabenen“ schließt, wie bereits erwähnt, an die Beschreibung der Doppelbewegung der Phänomenalisierung (mit ihrem „Knirschen“) an, die Richir in „Le rien enroulé“10 geliefert hatte, wobei die Affektivität nun die Stelle des Einrollens und die absolute Transzendenz die des Ausrollens einnimmt. Was sich 1970 kreisförmig darstellte, nimmt 2014 eine line-
Propositions buissonnières, S. 9. Dieses „Ich“ hat bei Richir nichts „egologisches“ an sich, sondern lässt im „‚Moment‘ des Erhabenen“ das „Selbst“ allererst aufscheinen. 10 In L’écart et le rien wird deutlich, dass Richir dort eine andere Auffassung bezüglich des Verhältnisses zwischen der in „Le rien enroulé“ analysierten „Doppelbewegung“ und seinen späteren Arbeiten vertritt. Er erläutert dort nämlich, dass das, was er 1970 eine „Doppelbewegung“ genannt hatte, „eine in sich selbst widerständige Bewegung“ ist (op. cit., S. 64). Es ist zwar richtig, dass das, was im „‚Moment‘ des Erhabenen“ geschieht, genau das Gegensteil zu sein scheint: Das „Herausspringen [ressaut]“ stellt darin keine widerständige Bewegung dar, sondern einen Überschuss an affektiver Intensität (an) der Affektivität selbst. Trotz Richirs gegenteiliger Behauptung scheint es aber doch mehr als gerechtfertigt, eine direkte und enge Verbindung zwischen beiden Ansätzen herzustellen. 8 9
Richirs letztes Wort: Abständigkeit und Vibration
261
are Form (mit zwei Schrägen) an, wozu sich zudem noch eine intensivierende Dynamik (der sich jene Proto-Reflexivität verdankt) hinzugesellt.11 Zur Affektivität ist aber noch mehr zu sagen. Die Affektivität ist auch deshalb „zentral“, weil sie sich im „‚Moment‘ des Erhabenen“ (und durch dasselbe) in die „absolute Transzendenz“ und die „Affektionen“ teilt. Dieser Gegensatz scheint dem von „Nichts“ und „Sein“ zu entsprechen, was allerdings unzutreffend ist: Die Affektionen erscheinen nur (im Sinne von Trug und Illusion) „als die andere vervielfältigte Version des reinen Scheins [= als welcher die absolute Transzendenz erscheint], d. h. als seinsgegründet“.12 Die Affektionen sind lediglich „Seinssimulacren“. Die anti-ontologisierende Tendenz bleibt auch in Richirs letztem Werk vorherrschend. Die andere Darstellungsart des „‚Moments‘ des Erhabenen“ geht von der absoluten Transzendenz aus. Diese ist weder prädizier- noch erkennbar. Alles, was darüber ausgesagt werden kann – zumindest aus der Sichtweise von Propositions buissonnières, denn in den Variations-Bänden wurde der Bezug zum Referenten der Sprache stärker betont –, ist die Tatsache, dass sie im „‚Moment‘ des Erhabenen“ eine zweifache Augenblicklichkeit aufweist: eine Augenblicklichkeit von Nichts zu Nichts (von hyperdichter Affektivität und dieser absoluten Transzendenz selbst) und eine solche von Nichts zu Sein (von absoluter Transzendenz zur Vielfalt der Affektionen). Es liegt also sowohl eine zweifache „Augenblicklichkeit“ als auch, korrelativ, ein zweifaches Flimmern vor (das die Doppelbewegung der Phänomenalisierung in „Le rien enroulé“ ersetzt):
11 Beide Darstellungen der „transzendentalen Matrize“ haben ihre „Vorteile“ und sind somit gleich gültig: Das „eingerollte Nichts“ bringt die „Doppelbewegung“ ins Spiel, während der „‚Moment‘ des Erhabenen“ den Schwerpunkt auf die affektive Intensivierung sowie auf die angesprochene „proto-reflexive“ Dimension legt. 12 Propositions buissonnières, S. 9.
262
Kapitel X
der „cartesianische Augenblick“13 mit seinem gegenseitigen Flimmern von Nichts und Sein und das „Augenblickliche“ mit seinem gegenseitigen Flimmern von Nichts und Nichts.14 Richir selbst stellt dies ein wenig anders dar und gebraucht insbesondere das „Flimmern“ auf eine andere Art. Er unterscheidet zwar auch das „Augenblickliche“ (nämlich das der Flucht ins Unendliche der absoluten Transzendenz im „‚Moment‘ des Erhabenen“) und den „cartesianischen Augenblick“ (= absoluter Augenblick, ohne Vergangenheit und Zukunft, der dem Augenblick der „kontinuierlichen Schöpfung“, so wie dieser im Discours de la méthode und in den Meditationes de prima philosophia erläutert wird, entspricht).15 Wenn es nun aber ein phänomenologisches gegenseitiges Flimmern gibt – und sogar ein zweifaches –, dann einerseits von cartesianischem Augenblick und Augenblicklichem (= Platon’sches exaiphnès) und andererseits von cartesianischem Augenblick und Husserl’schem Zeitpunkt. Ersteren Fall, das Flimmern von cartesianischem Augenblick und Augenblicklichem der Flucht ins Unend13 In Kapitel VII war bereits vom „instant cartésien“ die Rede. In den dort zitierten Auszügen aus Fragments phénoménologiques sur le langage legt Richir dar, dass er einer architektonischen Transposition des „Augenblicklichen [instantané]“ entstammt. In Propositions buissonnières wird der Husserl’sche Zeitpunkt als architektonische Transposition des „instant cartésien“ verstanden. Schreibt sich also der „instant cartésien“ in zwei unterschiedliche Transpositionen ein, in denen er einmal das Resultat und ein anderes Mal der Ausgangspunkt der Transposition ist? Oder haben wir in Propositions buissonnières eine völlig neue Konstellation, in welcher der „instant cartésien“ architektonisch ursprünglicher aufgefasst wird und ihm somit eine systematisch bedeutsamere Rolle zukommt? Richir selbst liefert hierauf keine Antwort. Der Vf. neigt zur zweiten Auffassungsart. Daher wird in diesem Kapitel „instant cartésien“ nicht mehr durch „cartesianischer Zeitpunkt“, sondern durch „cartesianischer Augenblick“ übersetzt. 14 Richir bezeichnet selbst als „cartesianischen Augenblick“ das gegenseitige Flimmern von „Sein“ und „Nichts“ (Propositions buissonnières, S. 10); dass „das Augenblickliche [l’instantané]“ ein gegenseitiges Flimmern von Nichts und Nichts ausmacht, wird erst dann hervorgehoben werden, wenn von der „augenblicklichen Vibration“ die Rede sein wird (siehe weiter unten). 15 Für eine Analyse des cartesianischen Augenblicks außerhalb des „‚Moments‘ des Erhabenen“ siehe Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, op. cit., S. 113.
Richirs letztes Wort: Abständigkeit und Vibration
263
liche der absoluten Transzendenz, bezeichnet Richir als „differenziellen Abstand“ – hierzu gleich mehr. Zuvor soll der Fall des gegenseitigen Flimmerns von cartesianischem Augenblick und Zeitpunkt betrachtet werden.16 * Was bedeutet zunächst genau der „cartesianische Augenblick“? Es handelt sich dabei nicht lediglich um einen Gegenwartspunkt, der aus der „Jetzt“-Achse (also der Achse aller vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Jetztpunkte) einfach herausgenommen würde. Fünf Grundzüge zeichnen ihn aus. Er ist ein „Augenblick“, der keine Vergangenheit und Zukunft aufweist. Er ist ewig. Er ist einzig.17 Er ist unendlich klein. Und er ist ein „Pol eines Flimmerns“. Richir stellt zunächst heraus, dass er zwischen „Sein“ und „Nichts“ wechselseitig flimmert. Weiter unten wird aber deutlich werden, dass sein systematisch entscheidendes Flimmern allerdings davon abweicht. Hier findet jedenfalls ein gegenseitiges Flimmern von „absoluter Transzendenz“ und „Vielfalt der Affektionen“ (= Prinzip des Seins der Seienden) statt. Wenn das Flimmern, wie es zunächst betrachtet wird, ein solches vom cartesianischen Augenblick selbst und Husserl’schem Zeitpunkt ist, dann wird die Instanz, die an der Stelle des „Nichts-Pols“ steht (nämlich die „absolute Transzendenz“), durch den cartesianischen Augenblick ersetzt, der folglich „im Nichts, qua Pol, verschwindet“. Und dann „nimmt“ der Zeitpunkt – der seinerseits mit dem, was Richir die „Diastase“ nennt, wechselseitig flimmert, d. h. mit der Husserl’schen Konfiguration von Retentionen, Urphasen und Protentionen18 – „den Platz des Seins“19 ein.
16 Die Analyse dieses Falles ist Gegenstand der „Proposition XI-XVI“: „De l’instant cartésien à l’instant temporel (la significativité et l’intentionnalité)“. 17 M. Richir, „Quatre essais sur l’origine transcendantale des phénomènes“, Annales de Phénoménologie, Nr. 14/2015, S. 136. 18 Siehe Husserliana XXXIII. Vgl. hierzu v. Vf., Temps et phénomène. La phénoménologie husserlienne du temps (1893–1918), Hildesheim, Olms, 2004. 19 Propositions buissonnières, S. 17.
264
Kapitel X
In einer (vielleicht zu) kurzen Anspielung auf seine früheren und vertieften Analysen, die sich bereits 2006 auf Husserls Zeitphänomenologie bezogen,20 nimmt Richir den Gedanken wieder auf, dass Husserls Zeitanalysen durch eine „symbolische Tautologie“, genauer: durch die symbolische Tautologie der Gegenwart, bestimmt werden. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass Husserl es mit seinen Analysen der protentionalen und retentionalen Intentionalität sowie den entsprechenden Zeitdiagrammen21 nicht vermag, der „‚Kreativität‘ bzw. Konstitution der Gegenwart“ 22 (und der Zeitlichkeit überhaupt) Rechnung zu tragen. Wenn die Protentionen und die Retentionen jeweils durch ein eineindeutiges Verhältnis (das in allen Zeitdiagrammen zur Darstellung kommt) bestimmt sind, dann wird in dem, was 2016 als der „zirkuläre Verlauf dessen“ bezeichnet wird, „was den Zeitpunkt für das, was ihn vollzieht, ‚vorbereitet‘“,23 je das Gleiche erhalten bleiben – und die Zeit wird somit niemals aus einem festgesetzten Rahmen hinausgelangen können. Deshalb gilt es, laut Richir, das die Zeit wesenhaft kennzeichnende „Fließen“ anders zu betrachten. Was die hier in Rede stehende Problematik angeht, zieht er in Propositions buissonnières eine andere Konsequenz und knüpft an den in Fragments sur le langage und in Variations sur le sublime et le soi zum Ausdruck gebrachten Gedanken an, dass die absolute Transzendenz den Referenten der Sprache eröffnet. Im „‚Moment‘ des Erhabenen“ bricht die Sinnbildung jäh ab, bzw., wie Richir schreibt, „die Diastolē des sich bildenden Sinnes wird unterbrochen“.24 Zwei Fälle – „zwei Arten des Übergangs vom cartesianischen Augenblick zur Gegenwart“25 – sind dann möglich. Entweder „gelingt“ der Prozess, mit dem die Sinnbildung aufs Neue eingeleitet wird, oder er läuft auf ein Simulacrum hinaus. Letzterer Fall liegt vor, wenn die Diastolē des sich bildenden Sinnes durch Husserls Modell der Protentionen, Gegenwartsphasen und Retentionen (dessen Zirkelhaftigkeit bereits herausgestellt wurde) bzw. durch das, was Richir den „Zirkel der Gegenwart“ nennt, „verdeckt“ und „verborgen“ wird. Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 38ff. Siehe hierzu Hinaus, op. cit., S. 45–76. 22 Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, S. 42. 23 Propositions buissonnières, S. 17. 24 Ebd. 25 Propositions buissonnières, S. 20. 20 21
Richirs letztes Wort: Abständigkeit und Vibration
265
Dieser Zirkel ist dann „Zirkel […] der vollzogen sein sollenden Diastolē [diastole censée accomplie]“.26 Um ihm zu entgehen, greift Richir auf einen Begriff zurück, der in den Recherches phénoménologiques eingeführt und auch bereits in den Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace wieder aufgenommen wurde – nämlich der des „Schematismus der sich wiederholenden Wiederholung“, der den Sinn in einem Habitus fixiert. Richir kommt dann zu folgendem Schluss: „Obwohl es [= das phänomenologische gegenseitige Flimmern von Zeitpunkt und zeitlicher Diastase] je ein Seinssimulacrum ist, scheint es dies gar nicht [zu sein], da es sozusagen dem Sein näher steht; es stabilisiert sich in ihm nämlich so etwas wie die ousia – wobei allerdings die Gegenwart nie reine Gegenwart ist, sondern Gegenwart von etwas ‚Realem‘ oder ‚Imaginärem‘ –, welche [ousia] das Sein-Eines ist, das durch die symbolische Stiftung endgültig fixiert werden kann.“27 Dies ist allerdings nicht das letzte Wort hierzu. In seiner Auseinandersetzung mit Mallarmés Konzeption der Sprache28 stellt Richir heraus, dass, was den phänomenologischen Status der Worte der gestifteten Sprache und des dichterischen Ausdrucks betrifft, der Zeitpunkt durch den cartesianischen Augenblick qua „differenziellen Abstand“ polarisiert wird. Um diese Behauptung verdeutlichen und begründen zu können, muss zuvor die Bedeutung des letzteren erläutert werden. * In Propositions buissonnières denkt Richir eine „Existenz“ „ohne Sein“ (dieser von Fichte übernommene Gedanke29 wird dort mehrfach entwickelt).30 Vehikel oder Vermittler dieser „Existenz“, könnte man sagen, ist der dem „‚Moment‘ des Erhabenen“ zugehörige „cartesianische Augenblick“.31 Zudem setzt Richir diese Existenz mit dem Propositions buissonnières, S. 17 (hervorgehoben v. Vf.). Propositions buissonnières, S. 20f. 28 Siehe insbesondere Propositions buissonnières, S. 105ff. 29 Propositions buissonnières, S. 56f. 30 Siehe Propositions buissonnières, insbesondere S. 66 und 78. 31 Richir behauptet ausdrücklich, dass (im „‚Moment’ des Erhabenen“) die Flucht ins Unendliche nur dann in der „Zeit“ ablaufen kann, wenn dies im „cartesianischen Augenblick“ statthat, vgl. Propositions buissonnières, S. 86. 26 27
266
Kapitel X
Geist, dem „reinen Selbst“, gleich, das seinerseits den „phänomenologischen Status des cartesianischen Augenblicks“ 32 innehat. Die Überlegungen zum „differenziellen Abstand“ haben zum Ziel, die Bedeutung des cartesianischen Augenblicks zu bestimmen und noch eingehender zu beleuchten, wie hierbei der Zusammenhang mit dem sich bildenden Sinn hergestellt wird. Es stellt sich dabei die Frage, welches „Sein“ und folglich welche „Zeitlichkeit“ dem „‚Moment‘ des Erhabenen“ sowie den Ausführungen, die es zu deuten versuchen, zukommen. Nach Richirs Dafürhalten wird dies durch die quasi-zeitliche Modalität des „cartesianischen Augenblicks“ beantwortet. „Quasi“-zeitlich, da der cartesianische Augenblick, wie bereits betont wurde, nicht-zeitlich ist. Das Flimmern, das den cartesianischen Augenblick hauptsächlich betrifft, ist jenes gegenseitige von cartesianischem Augenblick selbst und „Augenblicklichem“ (= dem Platon’schen exaiphnès, welches das Scharnier zwischen dem „Nichts“ der absoluten Transzendenz und dem „Sein“ der Vielfalt der Affektionen ausmacht). Es soll nun Richirs Analyse dieses wesentlichen Flimmerns nachgezeichnet werden. Im „‚Moment‘ des Erhabenen“, der durch die systolische Hyperkondensierung und die diastolische Entspannung um das augenblickliche exaiphnès herum gekennzeichnet ist, liegen zwei „Versionen“ des cartesianischen Augenblicks vor. Diese beiden Versionen machen jeweils auf ihre Art verständlich, welche (vor-)ontologischen Aspekte dem Denken des „Anfangs“ in der Sinnbildung überhaupt zukommen. Wie bereits erwähnt, ist der „‚Moment‘ des Erhabenen“ (unter anderem) der Quellpunkt einer Proto-Reflexivität, mittels welcher die Affektivität sich auf sich selbst bezieht. Es stellt sich hier ein „innerer Kontakt des Selbst mit sich selbst“ ein, der den Kern des „konkreten Selbst“33 ausmacht, die „unbeständige Spur der Flucht ins Unendliche der absoluten Transzendenz“.34 Dieses Aufquellen des „Selbst“ ist zugleich auch ein solches des „Sich-fühlens“ und „Sich-spürens“ der Diastolē. Das, was sie zuvörderst spürt, ist die „Sehnsucht“ – eine „leere transzendentale Reminiszenz ihres [d.h.
Propositions buissonnières, S. 91. Propositions buissonnières, S. 74. 34 Propositions buissonnières, S. 91 und 112. 32 33
Richirs letztes Wort: Abständigkeit und Vibration
267
der Diastolē] ‚Anfangs‘, der als verlorener cartesianischer Augenblick seines Ursprungs erscheint“.35 Die Diastolē wird umgehend zum „Schmerz der Rückkehr“ des „‚Moments‘ des Erhabenen“. Das der Diastolē beiwohnende Selbst bleibt dabei aber nicht inaktiv. Es vollzieht diese Rückkehr in einer spezifischen Bewegung, die Richir als „umkehrende Retrogradation der Progradation qua blindes Treiben der Affektivität“36 bezeichnet. Diese „retrogradierende-progradierende“ Doppelbewegung wird in der Folge eine große Bedeutung erlangen. Auf der einen Seite ist also das progradierende Treiben der Affektivität (Streben und Trieb der Tätigkeit des „absoluten [nicht egologischen] Ich“) zu verzeichnen. Auf der anderen Seite liegt das retrogradierende Wiederaufsteigen des Selbst zum „Ursprung“ hin (= „‚Moment‘ des Erhabenen“) vor. Aber, und das ist das Entscheidende, dieser Ursprung kann NIEMALS (wieder) erreicht werden. Der Ursprung – der „niemals gewesen“ ist – ist auf immer verloren. Daher kann der cartesianische Augenblick qua Ursprung der Diastolē, und das ist nicht weniger entscheidend, zwar „nicht als ‚wirklicher‘ Ursprung, aber doch als selbst zwischen Schein des Nichts und Seinssimulacrum flimmerndes Simulacrum erscheinen“.37 Hierzu ist mehreres anzumerken. Zunächst wird von Richir behauptet, dass der cartesianische Augenblick in diesem Flimmern „erscheine [paraît]“. Das Verb „paraître“ ist hier vieldeutig. Einerseits wird damit zum Ausdruck gebracht, dass der cartesianische Augenblick eine genuin phänomenale Dimension hat, wobei sein „Erscheinen“ freilich unbeständig und fraglich ist. Diese Phänomenalität kann sich somit in einem Schein „verdoppeln“ bzw. als bloße Illusion erweisen (wie wir gesehen haben, tritt dieser Gedanke schon früh bei Richir auf). Andererseits, und das folgt unmittelbar aus der Unmöglichkeit, den Ursprung zu fassen, lässt sich der cartesianische Augenblick niemals als Sein ergreifen, sondern lediglich als Simulacrum. Und schließlich sind die Pole des Flimmerns der „Schein des Nichts“ (= das Augenblickliche, das nichts „ist“, wobei
Propositions buissonnières, S. 73. Propositions buissonnières, S. 74. 37 Ebd. 35 36
268
Kapitel X
dieses Sein nur „Schein“ ist) und das „Seinssimulacrum“ (= der cartesianische Augenblick, von dem gerade gesagt wurde, dass er nur ein „Simulacrum“ ist).38 Der cartesianische Augenblick hat somit in der Tat zwei „Versionen“: Er ist einer der beiden Pole (neben dem Augenblicklichen) des gegenseitigen Flimmerns von ihm selbst und diesem Augenblicklichen; und er ist das Simulacrum des Ursprungs der Diastolē. Diese beiden Versionen stehen sich aber nicht einfach gegenüber. Richir insistiert vielmehr auf der „genuin phänomenologischen Verschiebung“, die zwischen diesen beiden Versionen stattfindet: einer Verschiebung vom ersten Abstand – zwischen Augenblicklichem und cartesianischem Augenblick – hin zum (zweiten)39 differenziellen Abstand zwischen den Polen des Scheins des Nichts und des Seinssimulacrums. Diese Verschiebung führt dann zur „Verwandlung“ des cartesianischen Augenblicks von einem Pol des Flimmerns in ein Simulacrum „seiner selbst“. Dabei ist das „Selbst“, dass die Retrogradation vollführt, um – freilich ohne Erfolg – den Ursprung „wieder einzuholen“, aber nur dessen „Simulacrum“ zu fassen bekommt, das „konkrete Selbst, das die Sinnbildung einleitet“.40 Es begegnet hierin dem Simulacrum des cartesianischen Augenblicks mit der unendlichen Vielfalt der SPRACHLICHEN Retentionen und Protentionen. Dabei zeigt sich, dass im Abstand, innerhalb des Simulacrums des cartesianischen Augenblicks, dem in seinem Inneren das Augenblickliche der Umkehr, die jede transzendentale Proto-Zeitlichkeit vernichtet, innewohnt, […] das, was die Retrogradation auffindet, sobald sie die Stelle einer sprachlichen Retention einnimmt, immer zu spät kommt, ohne selbst eigens stattgefunden zu haben […] und das, was bezüglich der Präzession in der Retrogradation die Stelle einer sprachlichen Protention einnimmt, immer zu früh kommt […]. Diese UNDEFINIERTHEIT [indéfinition] selbst macht die Zeitigung des Sinnes in Gegenwärtigkeit ohne angebbare Gegenwart aus.41 38 Richir fügt hinzu, dass der Schein des Nichts „als Schein des Verschwindens des cartesianischen Augenblicks im Augenblicklichen“ und das Seinssimulacrum als „Schein des Auftretens des cartesianischen Augenblicks qua Ursprung der Diastolē“ erscheint, ebd. 39 Propositions buissonnières, S. 85. 40 Propositions buissonnières, S. 82. 41 Propositions buissonnières, S. 83 (die Hervorhebung des letzten Satzes ist v. Vf.).
Richirs letztes Wort: Abständigkeit und Vibration
269
Somit ist der Sinn selbst je im gegenseitigen Flimmern von Auftauchen und Verschwinden begriffen. Das Auftauchen stellt eine Zeitigung in Gegenwärtigkeit dar, die niemals vollendet ist, und das Verschwinden macht eine Proto-Zeitigung aus, in welcher der Sinn in den differenziellen Abstand des cartesianischen Augenblicks „hineinfällt“. Der erste Fall entspricht einem „Einfall“, den man zu fassen und auszudrücken versucht. Der zweite Fall lässt sich anhand des Verlustes des „Gedankenfadens“ veranschaulichen. Das Simulacrum des cartesianischen Augenblicks liefert schließlich den „Sitz“ für die „‚perzeptiven‘ Phantasien“. Diese „machen selbst affektive Differenziale“ aus; „in diesen differenziellen Abständen kann die Verstoffwechslung von nicht-phänomenologischen Signalen (Empfindungen, Tönen, Wörtern) stattfinden, durch welche Verstoffwechslung die Phantasien-Affektionen eine gewisse phänomenologische Konsistenz annehmen“.42 Diese Signale gehören dem phänomenologischen Feld nicht an (sie sind diesem äußerlich), während die Sinnbildung nur innerhalb desselben stattfindet. In einer Bemerkung, die Guy van Kerckhoven kurz vor Richirs Tod an ihn persönlich gerichtet hatte, brachte er zum Ausdruck, dass es so scheine, als trachte Richir in und durch sein Werk danach, „der Schöpfung der Welt beizuwohnen“. Ein Zeugnis davon findet sich vielleicht an folgender Stelle: Das Geschehen [se passer] erinnert an den „Schöpfungs“akt selbst, wobei allerdings der Handelnde (immer schon und immer wieder) ins Unendliche entschwunden ist, in einem unvorstellbaren nicht räumlichen und nicht zeitlichen absoluten Außen. Mit anderen Worten, wenn es diesen Akt gibt, ist er im cartesianischen Augenblick blind und anonym; und er ist […] ein Pol des Flimmerns, weil er mit dem, was er „erschaffen“ soll, inkompatibel ist. Und wenn er etwas erschaffen hat, dann kann das nur er selbst sein, blind und anonym, aber qua Simulacrum, das zwischen Schein des Nichts und Schein des Seins wechselseitig flimmert, also – noch einmal – als fliehender und instabiler differenzieller Abstand zwischen jenen beiden, dem in seinem Inneren das Augenblickliche qua Umkehr innewohnt.43
42 43
Propositions buissonnières, S. 84. Propositions buissonnières, S. 86f.
270
Kapitel X
Für Richir ist es in der Tat möglich, der Schöpfung beizuwohnen – was insbesondere auf das dichterische Schaffen zutrifft (siehe weiter oben) – und zwar insofern, als im differenziellen Abstand, dem Richirs letzte Analysen gewidmet sind (und in welchem allein es ein „Flimmern“44 geben kann), „ein Kontakt durch Überbrückung IM AUGENBLICK“45 hergestellt wird. Der differenzielle Abstand ist somit das „Phänomen“, das am ehesten dazu geeignet ist, sich einer Phänomenalität „vor“ ihrer Transposition in ein Simulacrum anzunähern. Das ist der eigentliche Sinn von Richirs Auffassung vom „phänomenologischen ‚Als‘“,46 das er bedauerlicherweise nicht weiter vertieft hat (wenn man einmal von seinen Bemerkungen zur Dichtung47 absieht). * Was Richir auf den letzten dreißig Seiten von Propositions buissonnières bezüglich der „Vibration“ – „Vibration des Augenblicklichen“ bzw. „augenblicklicher Vibration“ – entwickelt, stellt ein wahrhaftig „letztes Wort“ seiner „Neugründung“ der transzendentalen Phänomenologie dar. Und dieses mutet durchaus überraschend an. Richir vertieft hier, was er zuvor bereits über das „phänomenologische ‚Als‘“ umrissen hat. Er bezieht sich hierbei auf eine erneute (und letzte) Fichte-Lektüre. Es muss also betont werden, dass Fichte in dieser „Neugründung“ bis zum Ende eine herausragende Rolle spielt. Was hat Richir genau in der Wissenschaftslehre von 1805 (die mit den drei Fassungen von 1804 ein Ensemble bildet) entdeckt? Sie erlaubt es ihm das in das phänomenologische Feld einzuführen, was er selbst als die „Schlüsselformel“ der „Erlanger Fassung“ der WisPropositions buissonnières, S. 88 (Fußnote). Propositions buissonnières, S. 89 (hervorgehoben v. Vf.). 46 „Wie wir wissen, ist das Phänomen nicht mit sich selbst identisch, was nicht ausschließt, dass es ein ‚phänomenologisches Als‘ geben kann, das mittels eines systematisch ‚versetzten‘ Gebrauchs der Sprache und auf die Gefahr hin, dass diese Scheinmächte (Genius malignus) hervorbringt, Phänomenologie zu betreiben gestattet – wobei jegliche Identität, zumindest im vorintentionalen Register, das uns hier interessiert, so radikal, wie es dem Menschen möglich ist, ausgeschaltet wird“, ebd. 47 Propositions buissonnières, S. 100ff. 44 45
Richirs letztes Wort: Abständigkeit und Vibration
271
senschaftslehre ansieht. Diese befindet sich im 21. Vortrag und lautet: „Das Absolute kann nicht absolute […] existieren, ohne als Absolutes zu existieren u[nd] v[ice] v[ersa].“48 Richir insistiert dabei insbesondere auf das „Als“ (das auch Fichte schon unterstrichen hatte). Dieses drückt eine Verdoppelung aus, die „sich selbst in einer (intellektuellen) Anschauung der Bewegung verdoppelt, das heißt in einer Anschauung von nichts und von Wissen oder vielmehr in einem Begriff, der Begriff vom Sein, welches von sich, in sich und für sich ist, ist […] (eine Bewegung von Nichts zu Nichts im Nichts)“.49 Genau dieser Gedanke einer „sich verdoppelnden Verdoppelung“ wird nun auf das phänomenologische Feld übertragen und in der „augenblicklichen Vibration“ geltend gemacht. In dieser Auffassung einer „augenblicklichen Vibration“ kommt Richir auf das gegenseitige Flimmern von „Nichts“ und „Nichts“ zurück, das bereits am Anfang von Propositions buissonnières angeschnitten, dann aber nicht fortgeführt wurde. Diese beiden „Nichts“, um die es hier geht, sind – daran sei noch einmal erinnert – die der Flucht ins Unendliche und der Affektivität („vor“ deren Vervielfältigung in den „Affektionen“), die sich jeweils in Schein des Nichts und Seinssimulacrum verwandelt haben. Um nun dem „Ursprung der Zeit oder eher der Zeitigung, ‚der Zelle‘ der Gegenwärtigkeit ohne Gegenwart“50 (und damit dem Sinn) Rechnung tragen zu können, führt Richir also den Begriff der „augenblicklichen Vibration“, der das Flimmern gleichsam „alimentiert“ ein.51 Es handelt sich dabei um ein Pulsieren zweiten Grades – genauer: ein Pulsieren, welches das Flimmern, das dem differenziellen Abstand eigens zukommt, verdoppelt –, in dem sich also keine getrennten „Pole“ mehr ausmachen lassen und zwischen denen diese Umkehrung statthätte („ein Vibrieren von Nichts zu Nichts, also etwas völlig anderes als ein Intervall“).52 Folglich macht das unvorstellbare Augenblickliche „überhaupt“ [= die augenblickliche Vibration] auch das Herz jedes Flimmerns aus, ohne selbst im 48 J.G. Fichte, 4ter Vortrag der Wissenschaftslehre – Erlangen im Sommer 1805, J.G. Fichte Gesamtausgabe, Band II/9, Stuttgart – Bad Cannstatt, Frommann Holzboog, R. Lauth & H. Gliwitzky (Hsg.), 1993, S. 275. 49 Propositions buissonnières, S. 55. 50 Propositions buissonnières, S. 158. 51 Propositions buissonnières, S. 162. 52 Propositions buissonnières, S. 161.
272
Kapitel X
differenziellen Abstand, den es gleichwohl konstituiert, zu flimmern. Es ist sozusagen reine Vibration, reine außerräumliche und außerzeitliche Erschütterung. In diesem Sinne ist es der Ursprung jeder Phänomenologie, das ursprüngliche Zickzack, welches das phänomenologische Zickzack in Gang setzt.53
Wir gelangen somit zum Kern der „phänomenologischen Genese des Anfangs“, der den „Ursprung jeder Phänomenologie“ 54 ausmacht. „Im Herzen des Flimmerns“ stellt Richir einen vibrierenden Einheitspunkt heraus, der für den differenziellen Abstand letztkonstitutiv ist, ohne – wiederum durch ein Flimmern – in diesem Abstand „eingefasst“ zu sein. Zu behaupten, dass die Vibration nicht im differenziellen Abstand flimmert, ist eine andere Ausdrucksweise dafür, dass das „phänomenologische ‚Als‘“ sich in ihr selbstdurchsichtig macht und im Augenblick jeglichen Abstand überbrückt (jede Wiederaufnahme kann dann nur „nachträglich“ geschehen). Der ganz späte Richir gibt Derrida für Fichte auf. Was die „Schöpfung“ in der Phänomenologie betrifft, kann dann Folgendes festgehalten werden: Die „Schöpfung“ ist, vom phänomenologischen Standpunkt aus betrachtet, nur die augenblickliche Umkehr (die Vibration) des Nichts zu sich „selbst“ als Simulacrum, das heißt reiner Schein des cartesianischen Augenblicks.55
Das bedeutet, dass sich die „Schöpfung“ im zweifachen Abstand, im zweifachen Pulsieren, zwischen „Nichts“ und „Nichts“ einerseits und dem unzugänglichen Ursprung und seinem Simulacrum andererseits „abspielt“. Für Richir kommt hier die Negativität ins Spiel. In folgendem längeren Auszug werden alle wesentlichen Elemente des Gedankengangs einsichtig zusammengeführt: [D]ie hier in Rede stehende Negativität ist nur durch ihre Vibration, ihre Erschütterung, ihr Beben, ihren Umbruch aktiv, und dabei weitaus archai-
Propositions buissonnières, S. 162. Die „Proposition“ „Instantané et négativité (la vibration instantanée)“ ist somit von allerhöchster systematischer Bedeutung für Richirs Neugründung der Phänomenologie im Allgemeinen und für Propositions buissonnières im Besonderen. 55 Propositions buissonnières, S. 165. 53 54
Richirs letztes Wort: Abständigkeit und Vibration
273
scher als jede logische Negation. Die Negativität der absoluten Transzendenz, die aus Zeit und Raum herausfällt, bzw. die Negativität der augenblicklichen Kehrtwendung, „verneint“ aktiv die Absorbierung des Flimmerns (des cartesianischen Augenblicks, aber auch jedes Phänomens) durch einen seiner Pole, sie nimmt sozusagen die Rolle der Unterdrückung dieser Absorbierung ein – und […] selbst in dem Fall, wo die Absorbierung sozusagen unmittelbar bevorsteht, wirkt sich die Vibration weiterhin aus, um den differenziellen Abstand zwischen dem Pol und seinem Schein „herbeizuführen“. Die Vibration ohne Pole (die sie zu einem Flimmern machen würden) macht durchaus das Herz jedes Flimmerns aus, den differenziellen Abstand von Nichts zu Nichts, der völlig leer wäre, wenn es die Affektivität nicht gäbe. Denn a priori oder intrinsisch hängt die Vibration von der Affektivität überhaupt nicht ab. Ganz im Gegenteil: Die Affektivität würde sich ohne die Vibration, die diese zu „Selbem“ und „Anderem“ ohne Identität, also ohne Seiendheit, macht, nicht phänomenalisieren. Das Existieren ist archaischer als das Sein. Es fängt im Phantasiemäßigen an, in den Phantasien und ihrem Wechselspiel, und nicht – gemäß dem allgemeinen Irrtum, der heute noch unausrottbarer erscheint denn je – in einem Feld von Entitäten, die schon im Voraus in ihren Verhältnissen durch eine Ontologie geleitet sind, welche genetisch weitaus „später“, da völlig oberflächlich ist, ohne Tiefe im Archaischen, das keine arché ist. Es gibt in der Genese keine Kontinuität, sondern nur Sprünge (von einem architektonischen Register zum anderen).56
Man sieht also, dass Richir zwar – mit der Herausstellung der Vibration einer einheitlichen Instanz im Abstand, im Flimmern – die Verabsolutierung der Pluralität und der „différance“ in Frage stellt; das heißt aber nicht, dass er darum seine Vorbehalte gegenüber einer ontologischen Perspektive in der Phänomenologie aufgäbe. Dass aber Richir solche Vorbehalte hat, bedeutet wiederum nicht, dass er „jegliche ontologische Dimension verneinen“ würde. Dies bezeugen insbesondere die „Überarbeitungen“, die man in den letzten „Propositions“ findet und dem Status der „physisch-kosmischen Transzendenz“ sowie dem „Übergang“ des archaischen transzendentalen Registers hin zu dessen ersten phänomenologischen Konkretisierungen gewidmet sind.
56
Propositions buissonnières, S. 168f.
274
Kapitel X
* Richir setzt den „Anfang“ nun bei der augenblicklichen Vibration an, die Vibration „von Nichts zu Nichts“ ist, das heißt vom Treiben der Affektivität zum cartesianischen Augenblick qua „Augenblick“ des gegenseitigen Flimmerns von demselben und „Augenblicklichem“ (= dem exaiphnès des Umschlagens der Hyperkondensierung der Affektivität in die Flucht ins Unendliche der absoluten Transzendenz). Darüber hinaus verursacht die absolute Transzendenz im „‚Moment‘ des Erhabenen“ auch ein „Herausreißen eines Überschusses der Affektivität“, was ein „Loch schafft“, das als „reine Negativität“57 wirkt. Die gesamte Erklärung der Bedingungen der Möglichkeit der „phänomenologischen Konkretisierung“ hängt nun daran, dass die Affektivität (das „erste Nichts“, „bevor“ sie sich in der diastolischen Entspannung in Affektionen vervielfältigt) nicht in dieses „Loch“ „fällt“, sondern es überbrückt, „indem dieses Mal der ‚Übergang‘ von Nichts zu Nichts vollzogen wird, sodass dieser ‚Übergang‘ durch dieses Überbrücken zum differenziellen Abstand qua Abstand eines gegenseitigen Flimmerns von Augenblicklichem und cartesianischem Augenblick wird“.58 Aber dieses Flimmern ist nicht dasselbe wie jenes „vor“ diesem Übergang (obwohl dabei dieselben Begriffe wechselseitig flimmern [nämlich der cartesianische Augenblick und das Augenblickliche]). Was sich dabei geändert hat, und darin bestand ja bereits die Bedeutung jener „zweiten Version“ des cartesianischen Augenblicks, ist, dass wir es hier nicht mehr mit dem Augenblicklichen qua virtuellem Pol zu tun haben, sondern mit dem Schein des Nichts (der dem „reinen Selbst“ entsprechen wird); und am gegenüberliegenden Pol (denn die Affektivität treibt weiter „hin zum Sein“) haben wir es auch nicht mehr mit der „reinen“ Affektivität zu tun, sondern mit dem Seinssimulacrum, das nichts anderes als die Vielfalt der Affektionen ist. Der entscheidende Begriff, das sei noch einmal betont, ist also in der Tat der der „Überbrückung [enjambement]“. Hierdurch eröffnen sich laut Richir sowohl – dank dieses Überbrückens des differenziellen Abstands – der „Kontakt des Selbst mit sich selbst“
57 58
Propositions buissonnières, S. 171f. Propositions buissonnières, S. 172.
Richirs letztes Wort: Abständigkeit und Vibration
275
(und folglich das „konkrete Selbst“) als auch die „physisch-kosmische absolute Transzendenz“. Es sollen nun abschließend diese beiden wichtigen Punkte noch weiter ausgeführt werden. Richir setzt dieses Überbrücken mit Fichtes „Tathandlung“ gleich.59 Hieraus geht in der Tat das „konkrete Selbst“ hervor. Dieses ist jeweils durch die Art ausgezeichnet, wie es die Sehnsucht nach dem verlorenen Ursprung „verspürt“.60 Seine „Gegenstände“ sind die aus der „physisch-kosmischen absoluten Transzendenz“ hervorgehenden „Phantasien“. Mit alledem wird zum Ausdruck gebracht, dass das „Selbst“ sich nicht nachträglich selbst gewahr wird, sondern dass sein „Selbstbewusstsein“ augenblicklich durchsichtig (gemacht) wird. Das war mit der obigen Bemerkung in erster Linie gemeint, der ganz späte Richir gebe Derrida für Fichte auf. Die „physisch-kosmische (absolute) Transzendenz“ besteht in der aufs phänomenologische Feld vollzogenen Transposition einer gewissen Auslegung der Idee der „Natur“, die – wie im vorigen Kapitel ausführlich dargelegt wurde – an Schellings „Naturphilosophie“ angelehnt ist. Sie entspricht dem „kosmischen Fundus aller Affektion, aller Phantasie und so allen Selbsts“,61 „jenes Nichts, dem ‚reine‘ und ‚perzeptive‘ Phantasien in Fülle entweichen“.62 Zum Abschluss von Propositions buissonnières stellt Richir nun den Zusammenhang zwischen dem sich im cartesianischen Augenblick instanziierenden „Anfang“ und dieser „physisch-kosmischen absoluten Transzendenz“ her. Was am „Anfang“, zwischen dem „Nichts“ und dem „Schein des Nichts“, „erscheint“, ist das „unendliche Verschwinden der Affektivität“ sowie das „Auftreten“ der – freilich in eine Pluralität von Affektionen verwandelten – Affektivität. Verschwinden-Auftreten – man erkennt hier die Momente der Vernichtung und Erzeugung wieder, die Fichte in der Wissenschaftslehre von 1804/II aufgewiesen hatte und das, was man eine „reflexible Plastizität“63 nennen könnte, ausmachen – Richir selbst sieht diese auf dem Grund einer „mobilen Plastizität, die durch die physisch-kosmische Transzendenz modelliert wird und diese selbst
Propositions buissonnières, S. 173. Propositions buissonnières, S. 180. 61 Propositions buissonnières, S. 173. 62 Ebd. 63 Le clignotement de l’être, op. cit. 59 60
276
Kapitel X
modelliert“64 verortet. Und die augenblickliche Vibration lässt nun eben auch die physisch-kosmische absolute Transzendenz vibrieren, die „sowohl gegenüber aller Affektivität indifferent ist, als auch durch die Affektionen – in ihrer strikten Undarstellbarkeit im Spiel sozusagen zwischen Abstand und Nicht-Abstand – ‚angegangen‘ wird“.65 Diese physisch-kosmische absolute Transzendenz ist eine „absolute“, weil sie sich der absoluten Transzendenz tout court verdankt: Diese ist lediglich die „radikal kontingente Hyperbel“66 jener. Das hindert aber nicht daran, dass „der größte Teil unserer tiefen – wie auch kosmischen – Intimität uns radikal unzugänglich ist: Das ist der Sinn der Transzendenz der physisch-kosmischen Transzendenz, die sich gänzlich von der Welt und dem Kosmos, so wie wir sie kennen, unterscheidet, und von der wir wissen müssen, dass sie Teil unserer docta ignorantia ist.“67
Propositions buissonnières, S. 190. Propositions buissonnières, S. 183. 66 Propositions buissonnières, S. 185. 67 Propositions buissonnières, S. 191. 64 65
Schluss Selbstverständlich ist es nicht möglich, die weitverzweigten Analysen innerhalb des Werkes Richirs – von denen hier auch nur ein Ausschnitt geliefert werden konnte – erschöpfend zusammenzufassen. Gleichwohl soll aber der Versuch unternommen werden, die jeweiligen Grundassertione1 dieser Untersuchung noch einmal prägnant auf den Punkt zu bringen. Es wird sich herausstellen, dass sie allesamt in eine gemeinsame Richtung hindeuten, in welcher sich Richirs wesentliche Beiträge zur neueren Phänomenologie anzeigen lassen. Zunächst sollen die neun Grundassertionen kurz aufgezählt werden, bevor dann die beiden Hauptthesen des Buches formuliert werden. Assertion zum Verhältnis von Phänomenalität und Eidetizität des Bewusstseinserlebnisses. Der ursprüngliche Ansatz Husserls – aber auch der Heideggers – ist zirkulär. Die Zirkelhaftigkeit besteht bei Husserl im gegenseitigen Verweis von Idealität auf Erlebnis und von Erlebnis auf Idealität. Richir führt hierfür den Begriff des „Kreises des Vor-sehens“ ein. Dem entspricht bei Heidegger die Idee eines notwendigen ontologischen „Vorverständnisses“. Beides verweist laut Richir auf die klassische abendländische Tradition. Es gelte nun, diese Zirkelhaftigkeit aufzubrechen, zu „entriegeln“, um so – freilich unter Beachtung der „phänomenologischen Gebote“ – die phänomenologische Fruchtbarmachung der „Entkopplung“ von Phänomenalität und Eidetizität zu erweisen. Assertion zur Phänomenalisierung. Die transzendentale Phänomenologie zielt auf eine Form der „Erscheinung“ bzw. „Sichtbarmachung“ des phänomenologischen Ursprungs bzw. „Aprioris“ ab. Dieses Zur-Erscheinung-Kommen(-Lassen) bzw. dieses Sichtbarmachen wird von Richir als „Phänomenalisierung“ bezeichnet. Diese ermöglicht jedoch keinen „direkten“ Zugang zu diesem Apriori. Zudem ist in dem „Scheinen“ der Phänomenalisierung eine Zweideutigkeit angelegt, die das ursprüngliche Phänomen vom 1 „Assertionen“ und nicht „Thesen“, da im Folgenden im Wesentlichen die Quintessenz der jeweiligen Gedankengänge der einzelnen Kapitel zusammengefasst werden.
278
Schluss
Scheinphänomen nie gänzlich und endgültig zu unterscheiden gestattet. Somit handelt es sich bei der Phänomenalisierung vielmehr um ein „Sich-Erscheinen des Scheins als Schein des sich entziehenden Apriori“. Assertion zum Ursprung der Sprache. Das „Phänomen“ ist grundlegend „Sprachphänomen“. Die „Sprache“ – das „Sprachliche“ – hat ihren bzw. seinen Ursprung in der sogenannten „Urkommunikation“ sowie in der davon nicht ablösbaren Aufweisung der phänomenologisch zu analysierenden „Referenzialität“ der Sprache. Zentral für jene selbstheitsstiftende „Urkommunikation“ zwischen „Säugling“ und „Mutter“ ist das Vermittlungsverhältnis von „virtuellem Blick“ und „‚perzeptiver‘ Phantasie“. Dem „Referenten der Sprache“ indessen wird durch einen auf die Rolle der „Weltphänomene“ und, in letzter Instanz, der „absoluten Transzendenz“ zurückzuführenden „virtuellen Multiperspektivismus“ Konsistenz verliehen. Beide Aspekte liefern gemeinsam die Grundlage für die „transzendentale Matrize des Sprachlichen“. Assertion zur Leiblichkeit der Sinnbildung. Im Gefolge Merleau-Pontys stellt Richir die Vermittlung von „Dasein“ qua In-der-Welt-Sein und „Leiblichkeit“ heraus. Hierbei muss aber – gegen MerleauPonty und auch schon gegen Husserl – der Begriff der „Einfühlung“ in seiner konstitutiven Rolle bei der Fremderfahrung treffender ausgearbeitet werden, als dies bei seinen Vorgängern der Fall war (um insbesondere dem Vorwurf des „Solipsismus“ nicht ausgesetzt zu werden, der laut Richir nicht nur gegen Husserl, sondern auch gegen Merleau-Ponty vorgebracht werden kann). Hierbei erweisen sich einmal mehr die „‚perzeptiven‘ Phantasien“ als zentral – und zwar, im vorliegenden Falle, für die Aufweisung der leiblichen Dimension der Sinnbildung. Zudem stellt Richir die bedeutsame Rolle der chora heraus, die nicht nur dem „Proto-Raum“ der Fremderfahrung entspricht, sondern allgemeiner die „archaische Mitte“ (zwischen „Denken“ und „Materialität“) der Sinnbildung ausmacht. Assertion zur Zeitphänomenologie. Richirs Beitrag zur Phänomenologie der Zeit besteht in der Zurückweisung der Husserl’schen Voraussetzungen in Bezug auf die Zeit (Beschränkung auf die „Setzung“, Annahme einer Kontinuität der Zeit und Begrenzung auf die Erlebniszeit) und der entsprechenden Hervorkehrung seiner eigenen Auffassung der phänomenologischen Zeitlichkeit (die durch
Schluss
279
Nicht-Positionalität, Brüchigkeit und Präphänomenalität ausgezeichnet ist). Allerdings übernimmt er nicht einfach Husserls, Heideggers oder Finks Auffassung einer Dreistufigkeit der Zeitlichkeit (bezüglich der objektiven, der immanenten und der präimmanenten Zeit), sondern differenziert den Unterschied zwischen immanenter und präimmanenter Zeitlichkeit so aus, dass dabei auch dem Unterschied zwischen „Gegenwart“ und „Gegenwärtigkeit“ bzw. „Sprachlichem“ und „Außersprachlichem“ Rechnung getragen wird. Überlegungen zur „affektiven“ Dimension der Zeitlichkeit und zur „Unumkehrbarkeit“ der Zeit komplettieren diese Assertion. Assertion zur Raumphänomenologie. Richirs Phänomenologie der Zeit ist von der Phänomenologie des Raumes nicht zu trennen. Ein wichtiger Unterschied besteht jedoch in der Hervorkehrung nicht nur der affektiven, sondern auch der leiblichen Vermittlung, die in der Zeitphänomenologie so noch nicht zum Tragen gekommen ist. Einerseits sind in der Raumphänomenologie laut Richir zwei Objektivierungen maßgeblich: eine erste durch den „Blickaustausch“, welche die räumliche „Äußerlichkeit“ konstituiert; und eine zweite des (wirklichen) „Außen“ selbst, die mit der Stiftung des „Raumpunktes“ einhergeht. Andererseits wird hier der Begriff des „Flimmerns“ (in diesem Falle: zwischen Punkt und verräumlichter „distentio“ oder „diastase“) ins Spiel gebracht. Wenn man diese Assertion zu den beiden vorigen hinzunimmt, verdeutlichen sich die Grundzüge einer Neubearbeitung der „transzendentalen Ästhetik“ im Rahmen einer Phänomenologie der Sinnbildung, die über den traditionellen Rahmen der Sinnlichkeit (aisthesis) hinausgeht. Assertion zur Stiftung der Idealität. In den Ausarbeitungen zur Stiftung der Idealität kreuzen sich wichtige frühere Einsichten (bezüglich des „Scheins“, der „‚perzeptiven‘ Phantasien“ und des „Flimmerns“). 2002 liefert Richir eine erste Definition des eidos als unzugänglicher Grundlage der „schematischen Einprägung“ (= Bild „zweiten Grades“) des intelligiblen (unsichtbaren) Gegenstandes. 2008 werden folgende „Verbesserungen“ angebracht: Die schematischen Einprägungen werden nicht mehr als „Bilder ‚zweiten Grades‘“, sondern als „‚perzeptive‘ Phantasien“ aufgefasst (wobei diese die Rolle eines endogenen Kongruenzprinzips zwischen den Bildern – die durch den phänomenologischen Schematismus der Phänomenalisierung vereinheitlicht werden – einnehmen); und der Bezug von Einprägung zu intelligibler Gegenständlichkeit wird als
280
Schluss
„Flimmern“ zwischen den „‚perzeptiven‘ Phantasien“ und dem „Element des Intelligiblen“ bestimmt. Hieraus ergibt sich eine letzte Definition des eidos als Knoten von schematischen Einprägungen (qua „‚perzeptiven‘ Phantasien“), in denen sich unbestimmte schematische Fetzen kreuzen. Assertion zum phänomenologischen Unendlichen bzw. Erhabenen. Im Mittelpunkt der Betrachtung des „phänomenologischen Unendlichen“ steht Richirs Auseinandersetzung mit Levinas’ (auf Derrida zurückgreifenden) Gedanken einer „inneren Verunendlichung“ der Phänomenalität sowie die Frage, wie hierdurch der idealistische „Subjektivismus“ vermieden werden kann. Hierbei stößt die Phänomenologie auf ihre inneren Grenzen und wird zu einem metaphysischen Ansatz hinausgetrieben. Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht der „‚Moment‘ des Erhabenen“, der für die Erläuterung der Verunendlichung innerhalb der Phänomenalität alle wesentlichen Bausteine bereithält: die absolute Transzendenz (welche die Rolle des früher vorherrschenden „symbolischen Stifters“ einnimmt), die Eröffnung des Sinns, die Eröffnung des „Referenten der Sprache“, das Aufbrechen des Selbst und die Erklärung des Ursprungs des „Menschlichen“ im Menschen. Assertion zum Ursprung der Sinnbildung. In seinem letzten Werk liefert Richir eine metaphysische Metareflexion über das zeitliche Prisma des „‚Moments‘ des Erhabenen“. Damit wird einerseits die fundamentale Rolle der Zeitlichkeit im Denken Richirs noch einmal in den Vordergrund gerückt (und die Assertion zur Zeitphänomenologie vervollständigt); andererseits wird mit dem „cartesianischen Augenblick“ eine letzte Denkfigur eingeführt, die den Bezug von „‚Moment‘ des Erhabenen“ und phänomenaler Konkretisierung verdeutlicht. Das Hauptaugenmerk der allerletzten Ausarbeitung Richirs gilt der Herausarbeitung der „augenblicklichen Variation“ als (einheitlicher!) Grundlage des phänomenologischen „Flimmerns“. Durch ihre „Überbrückung im Augenblick“ jeglichen Abstands erklärt Richir, wie der unmittelbare Selbstbezug des „Selbstbewusstseins“ im Herzen der Phänomenalisierung durchsichtig gemacht und in seiner Denkbarkeit aufgewiesen werden kann. Worin besteht nun die angegebene „gemeinsame Richtung“ dieser neun Assertionen? Zwei Haupttendenzen haben sich in dieser Abhandlung herauskristallisiert. Von hier aus lässt sich die erste Hauptthese des Buches auf den Punkt bringen.
Schluss
281
1.) Richir reflektiert unentwegt das „phänomenologische Minimalgebot“ der Korrelation. Dabei stellt sich heraus, dass diesseits der immanenten Sphäre der transzendentalen Subjektivität – also auf der Ebene des „Nicht-Positionalen“ – bzw. diesseits der noetischnoematischen Korrelation (die je zwei „Pole“ in ihrer Korrelativität begreift) eine Korrelation fungiert, die nicht mehr mit den klassischen Begriffen des „Subjekts“ und des „Objekts“ gefasst werden kann. Bei Richir stellt sich diese „präimmanente Korrelation“ (dieser Ausdruck ist nicht von Richir) unterschiedlich dar – als „kreisförmiger“ Bezug, als „Doppelbewegung“, als „Überbrückung des Abstandes [enjambement de l’écart]“ oder (was systematisch von besonderem Belang ist) als „Flimmern“. 2.) Die zweite Haupttendenz besteht in der in der Einleitung vorbereitend angekündigten Herausstellung einer „transzendentalen Matrize“. Diese „Matrize“ nimmt zwischen 1970 und 2016 sehr unterschiedliche Formen an (sie betrifft die Phänomenalisierung, die Sinnbildung, aber auch die Sprache und insbesondere das Erhabene). Im Allgemeinen bietet sie sich in Form einer „Triade“ 2 dar. Folgende Tafel mag dazu dienen, die verschiedenen Gestalten dieser Triade zu veranschaulichen:
2 In anderen Ausarbeitungen Richirs spielt die „transzendentale Matrize“ ebenfalls eine wichtige Rolle (insbesondere etwa in Phénoménologie en esquisses) – ohne dass dabei jedes Mal eine solche „Triade“ aufzuweisen wäre. Es handelt sich hier nicht um eine erschöpfende Aufzählung, sondern lediglich um eine Orientierung für zukünftige Forschungen, die dem hier Umrissenen eine ausführlichere Behandlung werden zukommen lassen müssen.
282
Schluss
Werk „Le rien enroulé“ (Doppelbewegung der Phänomenalisierung) (1970) Phénomènes, temps et êtres I (transzendentale Matrize des Phänomens) (1987) Phénomènes, temps et êtres II (Moment des Erhabenen) (1988) Méditations phénoménologiques (Erfahrung des Erhabenen) (1992) Variations sur le sublime et le soi („‚Moment‘ des Erhabenen“) (2010) Variations sur le sublime et le soi und Propositions buissonnières („‚Moment‘ des Erhabenen“) (ab 2010) Propositions buissonnières („‚Moment‘ des Erhabenen“) (2016)
Einrollen
Ausrollen
(„Späne“ bzw. „Gischt“ absetzendes) „Knirschen“ Phänomene als „nichts als Phänomene“
Zeit
Sein
Phänomenologisches
Symbolisches
Phänomenologische „Begegnung“
Selbst
Symbolischer Stifter
Erhabenes
Systolē
Diastolē
Augenblickliches, exaiphnès
Affektivität
Absolute Transzendenz
Vielfältige Affektionen
Cartesianischer Augenblick
Augenblickliches, exaiphnès
Augenblickliche Vibration
Diese beiden Tendenzen hängen fundamental miteinander zusammen. Der Rückgriff auf die „transzendentale Matrize“ ist gewissermaßen der Versuch, der „präimmanenten Korrelation“ reflexiv beizukommen. Umgekehrt findet diese in jener eine spezifische Darstellungsform, deren (prä-)phänomenaler Gehalt, wie in der Tafel sichtbar wird, deutlich variiert. Im Aufweis dieses gegenseitigen Bezugs – der, wie in dieser Untersuchung dargestellt, systematisch entscheidende Anleihen bei der Klassischen Deutschen Philosophie
Schluss
283
macht – scheint vielleicht Richirs bedenkenswerteste Darbringung zu einer „phänomenologischen Metaphysik“ zu liegen. Richir liefert aber auch einen ganz wesentlichen Beitrag zum Denken der „Alterität“, der etwa für die Anthropologie von maßgeblicher Bedeutung sein könnte (und dabei wird deutlich, dass das, was im Rahmen einer phänomenologischen Metaphysik maßgeblich sein kann, nämlich die in Kapitel VI herausgestellte „Vibration“, sich nicht unbedingt auch auf die phänomenologische Anthropologie übertragen lässt). Hierin äußert sich nun die zweite Hauptthese dieser Untersuchung. Im Anschluss an Derrida und Levinas kann Richirs Ansatz in der Tat für das Denken der „Andersheit“ (im Kontrast zum Denken des „Selben“) fruchtbar gemacht werden. Von einer ähnlichen Konstellation wie der Levinas’schen Grundproblematik ausgehend – die das Unvermögen, im Rahmen einer „ersten Philosophie“ die Alterität begrifflich zu fassen, zum Ausdruck bringt – wird im zeitgenössischen anthropologischen und postkolonialen Denken dem okzidentalen Diskurs das Vermögen abgesprochen, sich seiner spezifischen Begrifflichkeit zu entsagen, was den Zugang zum „Anderen“ völlig unmöglich mache. Es stellt sich dabei die Frage, welche Alternative der postkoloniale Diskurs zu liefern vermag? Inwiefern entgeht der Anthropologe, der notgedrungen seinerseits auf die abendländischen Begriffe und Diskurse zurückgreift, dieser Schwierigkeit? Wie kann der Andere als Andere eigens zu Wort kommen? Richirs Werk liefert hierfür einen Lösungsansatz. Das Denken des „Anderen“ vollzieht sich nämlich so, dass die Verunendlichung (Kapitel VIII) und die Retrojektion (Kapitel II) – durch eine phänomenologische Konstruktion – zusammengedacht werden (müssen). Auf der einen Seite wird nämlich durch die Verunendlichung verhindert, dass man die Illusion (die Richir jedenfalls als eine solche ansieht) vermeidet, allein der „Sprung“ hin zur absoluten Transzendenz biete einen Zugang zur Andersheit – es ist nämlich vielmehr so, dass die Verunendlichung der Bestimmungen des Phänomenologischen diesseits der absoluten Transzendenz die Andersheit gleichsam aufspringen oder aufplatzen lässt; und auf der anderen Seite muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass dieses Phänomenologische sich nicht direkt begrifflich fassen lässt, sondern allein retrojizierend in einer nachträglichen Begriffsbestimmung, die das Phänomenologische unvermeidlich verzerrt, zugänglich wird – genau dadurch ergibt sich dann aber, dass die Andersheit überhaupt nicht
284
Schluss
begrifflich, sondern nur im Flimmern zwischen Verborgenheit und Gegebenheit durchscheint und die Treue zur Alterität durch diese retro-jizierende Abständigkeit gewährleistet ist. Richirs Phänomenologie liefert somit die konzeptuellen Behelfe, um der „Alterität“ gerecht zu werden.