Die Hitlerjugend: Geschichte einer überforderten Massenorganisation [1 ed.] 9783666360985, 9783525360989
275 48 12MB
German Pages [461] Year 2021
Polecaj historie
Citation preview
André Postert
Die Hitlerjugend Geschichte einer überforderten Massenorganisation
Schriften des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung Herausgegeben von Thomas Lindenberger und Clemens Vollnhals Band 68
Vandenhoeck & Ruprecht
André Postert
Die Hitlerjugend Geschichte einer überforderten Massenorganisation
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar. © 2021, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Umschlagabbildung: Kundgebung der Berliner Hitlerjugend in der Zeit des Uniformverbots 1932. Bild aus Privatbesitz. Satz: Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, Dresden
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com ISSN 2197-0971 ISBN 978-3-666-36098-5
Inhalt Einleitung
I.
9
Mythos Hitlerjugend Konzeption und Zielsetzung Quellen und Materialien
9 13 25
Genese einer Massenorganisation
31
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Revolution und Gleichschaltung Hitlerjugend als revolutionäres Abenteuer Gleich- und Ausschaltung der organisierten Jugend Die Bündischen in der Hitlerjugend Die konfessionellen Jugendverbände Die Eingliederungen in der Praxis
31 31 38 49 61 74
2. 2.1 2.2 2.3 2.4
Die Eroberung des Alltags Glaubensfragen in der Hitlerjugend Die Hitlerjugend in den Sportvereinen Die Hitlerjugend im Klassenzimmer Schule: Bastion der Hitlerjugend?
3. Von der Bewegung zum Apparat 3.1 Organisatorische Herausforderungen 3.2 Die ersten Enttäuschten II. Anspruch und Realität der Hitlerjugend 1. 1.1 1.2 1.3 1.4
Die prekäre Hitlerjugend Korruption, Unterschlagung, Bettelei Junge Parteivandalen und undisziplinierte Hitlerjugend Propaganda. Wenn Jugend um Jugend wirbt Unsittliche Hitlerjugend? Die Sexualitätsdiskurse
82 82 87 99 106 113 113 129 139 139 139 149 158 172
6
Inhalt
2. 2.1 2.2 2.3
Schulung und Antisemitismus Schulungen an der Basis Desinteressierte, Mitläufer, Radikale Vorgaben und Wirklichkeit an der Basis
190 190 202 208
3. 3.1 3.2 3.3
Die Hitlerjugend und die Judenverfolgung Antisemitische Praxis Die Hitlerjugend und die Novemberpogrome Apologien der Funktionäre
214 214 222 227
4. 4.1 4.2 4.3
Die Heimbeschaffung Die Situation der ersten Jahre Die Hitlerjugend im Konflikt mit Gemeinden Heimbauprojekte: Anspruch und Realität
234 234 239 241
5. 5.1 5.2 5.3 5.4
Millionen im Gleichschritt? Freiwilligkeit und Verpflichtung Zur Erfassung durch die Hitlerjugend um 1936 Massenorganisation der Karteileichen? Die Jugenddienstpflicht
249 249 253 257 267
III. Massenmobilisierung
275
1. 1.1 1.2 1.3 1.4
Mobilisierung in Permanenz Die Erfassungsappelle Die Grundlagen der Jugenddienstpflicht Die Alltagspraxis der Jugenddienstpflicht Ein Überblick: Die Hitlerjugend im Kriegsdienst
275 275 280 288 300
2. 2.1 2.2 2.3 2.4
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft Gegenkulturen, Unangepasste, Widerständler Disziplinarische Probleme und Jugendkriminalität Die Polizeiverordnung und die „Jugendverwahrlosung“ Das Beispiel einer Clique aus Dresden
323 323 335 351 370
3. Aussonderung und Umerziehung 3.1 Die Selektion junger Menschen 3.2 Spätes HJ-Pilotprojekt: die Landesjugendhöfe
378 378 383
7 4. Die letzten Parteigenossen 4.1 Eine späte erinnerungspolitische Debatte 4.2 Wie „freiwillig“ waren die letzten Parteieintritte?
393 393 398
Bilanz
409
Anhang
423
1. 2. 3. 4.
Abkürzungsverzeichnis Quellenverzeichnis Literaturverzeichnis Personenverzeichnis
423 427 437 455
Einleitung Mythos Hitlerjugend Reichsjugendführer Baldur von Schirach tönte am 6. September 1936 auf dem Reichsparteitag in Nürnberg: Nie habe es in der Menschheitsgeschichte eine gewaltigere Jugendorganisation als die Hitlerjugend gegeben. Aus fast allen Teilen des Reiches waren die Hitlerjungen über Tage angereist. Die Besten hatten über Wochen sogenannte Adolf-Hitler- oder Sternmärsche nach Nürnberg auf sich genommen; mit fast religiöser Aufladung dienten die Märsche auch der Inszenierung einer opferbereiten Jugend. Die meisten Angereisten hatten die Wegstrecke nach Nürnberg dennoch per Zug zurückgelegt. Rund 400 Fahnen hatten sie aus ihrer Heimat mitgebracht. Nun schwor zunächst Schirach die Angereisten auf das Spektakel des Nürnberger Reichsparteitags ein: „Wir lassen nicht zerstören, was das junge Deutschland geschaffen hat. Wir sind die Marscheinheiten der Jugend geworden und werden sie bleiben.“1 Die imposanten Aufnahmen vom Appell in der Hauptkampfbahn des Stadions fanden sich an den folgenden Wochen in Zeitungen und Illustrierten. Es war eine brachiale Inszenierung, die noch heute in Dokumentationen vielfach zu sehen ist und bei anderen und ähnlichen Massenspektakeln üblich war oder aus Propagandastreifen wie – der bekannteste und einflussreichste von allen – „Hitlerjunge Quex“ (1934), „Jungzug 2“ (1937) oder „Der Marsch zum Führer“ (1940) stammte. Die Szenen dominieren das Bild von der Hitlerjugend bis in die Gegenwart.2 Etwa zeitgleich arbeitete Otto Friedländer im Prager Exil an einem Buch. Es sollte die Situation der deutschen Jugend unter dem Hakenkreuz schildern. Friedländer, früher einmal Vorsitzender der sozialistischen und republikanischen Studentenschaft Deutschlands, 1932 Kandidat der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) für den Reichstag, war nach der „Machtergreifung“ in die Tschechoslowakei emigriert. Seither veröffentlichte er Artikel in der Exilpresse und studierte Berichte aus Deutschland. Sein umfangreiches Manuskript über
1
Zit. aus Schlussappell des Adolf-Hitler-Marsches. Ansprache des Reichsjugendführers. In: Deutsches Nachrichtenbüro, Sonderausgabe vom 6.9.1937. Vgl. auch Bericht erstattung über einen Adolf-Hitler-Marsch aus dem Gebiet Ostland. In: ebd. vom 21.7.1937. Autoren von Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln werden, soweit bekannt, genannt. Auf eine Kenntlichmachung unbekannter Autoren wird stillschweigend verzichtet. 2 Vgl. Rüdiger Steinlein, Der nationalsozialistische Jugendspielfilm. Der Autor und Regisseur Alfred Weidenmann als Hoffnungsträger der nationalsozialistischen Kulturpolitik. In: Manuel Köppen/Erhard Schütz (Hg.), Kunst der Propaganda. Der Film im Dritten Reich, 2. Auflage, Berlin 2008, S. 217–246.
10
Einleitung
die Hitlerjugend ist nie veröffentlicht worden.3 Die Vorstellung, die sich Friedländer von der Hitlerjugend machte, war eine andere, als es die Szenen vom Reichsparteitag suggerierten, obgleich er in den Aufmärschen mehr als bloß die Kulisse zur Massensuggestion und Täuschung sah. Der nationalsozialistische (NS-)Staat mit seinem mythischen Heldenkult trage, meinte Friedländer, im Grunde eine infantile, pubertäre Weltanschauung vor sich her. Das mache ihn in der Jugend, die sich ja nach Heldentum allenthalben sehne, attraktiv. Doch das Regime habe eigentlich nur wenige fanatische Parteisoldaten und eiserne Jungideologen gezüchtet. Der Erfolg der Hitlerjugend basiere im Gegenteil darauf, dass man die jungen Menschen entpolitisiere, sie jeder offenen Diskussion und einer eigenen Standpunktfindung entfremde: „Die Hitlerjugend wächst bereits in das Hitlerreich als eine soziale Gegebenheit hinein“, schrieb Friedländer 1938: „Es fehlt ihr im Grunde jede politische Einstellung zu ihm. Zum Wesen des totalitären Staates gehört es, den Einzelmenschen zu entpolitisieren, ihn an Führung und höhere Gewalt zu gewöhnen, […] wie den bäuerlichen ‚Hintersassen‘ [an] die feudalen Mächte des Mittelalters.“4 Der vorgebliche Erfolg des Regimes sei zugleich dessen Fehler. Die Sehnsucht nach Freiheit – nicht im politischen Sinne, sondern im Sinne von Selbstverwirklichung – sei im Jugendalter mindestens so groß wie die Sehnsucht nach dunkler Romantik und glanzvollen Heldentaten. Täglich wachse die Zahl der Unzufriedenen weiter, wie der Emigrant hoffte: „Manch einer wird schwach und verfällt in die Indifferenz, andere flüchten sich in die Traumgefilde der Phantasie, aber die wirklich aktiven und selbstständig denkenden Jugendlichen suchen einen Ausweg.“5 Diese Sicht bezeugt die Hoffnung eines Emigranten, dass das Hitler-Regime noch immer nicht fest im Sattel sitze. Der Kampf im Innern der Diktatur werde erst noch ausgefochten. Ihren Kerker werde die Jugend zerschlagen, weil der Wunsch nach Freiheit nie erlösche.6 Friedländer, der im Vorstand der Prager Exil-SPD tätig war, lagen zahlreiche Augenzeugenberichte von Freunden und Kontaktpersonen vor, auf die er sich für sein Buch stützte. Berichte aus der Diktatur und über die Hitlerjugend zirkulierten in den 1930er-Jahren zudem vielfach in der Auslandspresse. Einige der Artikel zeichneten ein ähnliches Bild von der Hitlerjugend. Ein Korrespondent aus Straßburg hatte 1936 für einige Wochen Deutschland bereist. In einem Bericht legte er seine Eindrücke von der deutschen Jugend dar. Ähnlich wie Friedländers Manuskript zeugt der Text von der Hoffnung auf den wachen
3 Vgl. Otto Friedländer (unter Pseudonym Otto Friedrich), Die deutsche Jugend. Im Auftrage der „Union für Recht und Freiheit“ verfasst auf Grund von Materialien und Dokumenten (unveröffentlichtes Manuskript), Prag 1938 (Swedish Labour Movement’s Archives and Library, Stockholm, Nachlass: Otto Friedländer). Dem Schwedischen Arbeiterarchiv gilt an dieser Stelle ein Dank für die großzügige Übersendung des gesamten Manuskripts. 4 Ebd., S. 329. 5 Ebd., S. 334. 6 Vgl. ebd.
Mythos Hitlerjugend
11
Widerstand junger Menschen. Die Organisation sei von „großer Unlust und Ermüdungserscheinungen“ geplagt. Man merke allerorts, dass die Hitlerjugend zur „Zwangsangelegenheit geworden“ sei. Die jungen Leute würden schlicht die Lust am Massenspektakel mehr und mehr verlieren. Das gemeinschaftliche Wandern und die vielen Sportaktivitäten hielten diese Organisation zwar noch zusammen, aber die Heimabende, mit deren Hilfe die Kinder und Jugendlichen zu zukünftigen Nationalsozialisten reifen sollten, seien inhaltlich meist dürftig und für junge Leute kaum attraktiv. „Schüler“, glaubte der Redakteur bilanzieren zu können, „treten der Hitlerjugend im letzten Schuljahr nur […] bei, um eine Lehrstelle zu erhalten. Sind sie einmal Lehrlinge, so verstehen sie es schon, von der Hitlerjugend freizukommen.“ Wege, um sich dem Zugriff der Parteijugend zu entziehen, böten sich jungen Menschen zu Genüge. Und weiteres falle bei näherem Hinsehen auf: Über Baldur von Schirach, Reichsjugendführer und Kopf der Hitlerjugend, werde in den untersten Reihen allenthalben geschimpft. Er sei ein eitler Bonze, würde man sich erzählen, und sei bloß auf Einkommen und Stellung bedacht. Die Kinder und Jugendlichen würden ihm überwiegend ganz ohne Begeisterung und Regung lauschen. Bei einem Auftritt in Hamburg sei eine Rede Schirachs sogar völlig untergangen. Statt sich an seinem Pathos zu berauschen, hätten die Jüngsten sich lieber mit Erdklumpen beworfen. Man solle sich nicht täuschen, betonte der Bericht: Adolf Hitler werde zwar bewundert und mit „brauchbaren und guten Führern“ würden gerade die Knaben durch dick und dünn gehen. Aber die charismatischen Führungskräfte, auf die es ja ankomme, seien in der Hitlerjugend Mangelware.7 Hoffnung auf einen Umschwung der Großwetterlage schwang auch in diesem Fall erkennbar mit. Ähnliche Berichte, die mit einer Mischung fast aus Schadenfreude und Mitleid über die Hitlerjugend herzogen, waren keine Seltenheit. „Es sei ganz und gar abwegig, zu glauben“, berief sich der „Neue Vorwärts“ auf einen protestantischen Pfarrer 1936, dessen Schützlinge nun Hitlerjungen waren, „dass die gesamte deutsche Jugend gleichgeschaltet sei und es an dem Oppositionsgeist […] fehle.“ Im Gegenteil, die Jugend „sei so kritisch gegenüber dem Bestehenden wie je eine Jugend zuvor“.8 In der Auslandspresse ebenso wie in Kreisen der Emigranten, die sich für die Jugendorganisation des „Dritten Reiches“ interessierten, waren zwei gegenläufige Deutungen dominant. Beide dienten auf je eigene Weise ihrer Diskreditierung. Die eine kennen wir zur Genüge. Sie beherrscht die Erinnerung an die Partei- und Staatsjugend bis heute. Die Organisation erschien als ein allumfassender Apparat. Die Hitlerjugend habe immensen Erfolg darin gehabt, junge Menschen an das Regime zu binden, sie zu formen und zu verhetzen, zu verblenden und als Material für Hitlers Krieg zu missbrauchen. Der Historiker Hermann Graml, Jahrgang 1928, schrieb: „Wer 1933 in Deutschland vier- und fünfzehn Jahre alt war, hat in den Organisationen 7 8
Erfahrungen mit der Hitler-Jugend. Ein Mitarbeiter des „Elsässer“, Straßburg, bereiste Deutschland. In: Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 29.2.1936. Grenzen der kirchlichen Opposition. In: Der Neue Vorwärts vom 18.10.1936.
12
Einleitung
der nationalsozialistischen Staatsjugend und in der Wehrmacht nicht nur, was ja evident und ganz unbestreitbar ist, funktioniert, er hat sich vielmehr von den Nationalsozialisten […], etliche Ausnahmen abgerechnet, bereitwillig oder doch gänzlich widerstandslos in Anspruch nehmen und dienstbar machen lassen.“9 Es ist eine Deutung der Hitlerjugend, die ihrer Propaganda schmeichelt und in Bildern marschierender Kolonnen bekräftigt scheint. Bilder täuschen. Fotografien der Kolonnen, wie es sie zu Tausenden gibt, überdecken, dass – sogar in der Kriegszeit noch – etliche Teilnehmer keine Uniform trugen, weil sie sich die nicht leisten konnten oder ihre Eltern die Anschaffung bewusst verweigerten. Damit die Nicht-Uniformierten das Bild nicht störten, mussten sie am Kolonnenende marschieren. Bei Veranstaltungen und in größeren Zeltlagern war den Jugendlichen das selbstständige Fotografieren verboten; nur die eigenen Referenten und Berichterstatter mit Ausweis des Propagandaministeriums durften das Geschehen auf Bild und Film festhalten.10 Momente wie hier auf dem Cover zu sehen – eine Szene aus Berlin in der sogenannten Verbotszeit 1932, erkennbar an den weißen Hemden, als die braune Uniformierung von der Brüning- Regierung verboten worden war – wurden nach 1933 zur Seltenheit. Spontanität oder undiszipliniertes Durcheinander inmitten der Propagandainszenierung wurde nicht mehr festgehalten oder im Nachhinein aussortiert. Alles sollte und musste kontrolliert erscheinen. Die andere, fast vergessene Deutung ist die spannendere, weil sie heute gefestigte Bilder von der Hitlerjugend ebenso wie ihre zeitgenössische Propa ganda infrage stellt. Der Straßburger Berichterstatter ebenso wie der sozial demokratische Emigrant Friedländer – letzterer aber mit Abstrichen – sind zwei Beispiele für einen irritierend anderen Blick auf die Massenorganisation: zwar großspurig auftretend und an Zahl der Mitglieder schwindelerregend, habe sie gleichwohl nur eine Minderheit tatsächlich sich unterwerfen, verführen und lenken können. Ein Teil habe sich gar zu entziehen versucht, viele seien gelangweilte Mitläufer gewesen. Ein Artikel aus der Pariser Tageszeitung behauptete 1936: Hitlerjungen der Weimarer Jahre müsse man von den Angehörigen der heutigen Massenorganisation unterscheiden. Erstere seien „ehrliche Idealisten“ und radikale Straßenkämpfer gewesen, die an Hitler inbrünstig geglaubt hät 9 Hermann Graml, Integration und Entfremdung. Inanspruchnahme durch Staatsjugend und Dienstpflicht. In: Ute Benz/Wolfang Benz (Hg.), Sozialisation und Traumatisierung. Kinder in der Zeit des Nationalsozialismus, Frankfurt a. M. 1992, S. 70–79, hier 70. 10 Hierzu beispielsweise Nicht-Uniformierte. In: Gebietsbefehle (GB): Franken, 6/42 vom 6.1942; Nichtuniformierte. In: Befehlsblätter (BB): Moselland, 4/42 vom 15.5.142: „Bei An- und Abmärschen zum Dienst haben die Nichtuniformierten am Schluss […] zu marschieren. Ist ein Propagandamarsch erforderlich, so werden die Nichtuniformierten zu anderer Dienstleistung abgestellt.“ Film- und Fotoaufnahmen bei HJ-Veranstaltungen. In: GB: Kurmark, 13/36 vom 3.7.1936. Zum Themenkomplex unter anderem Blickwinkel vgl. Alfons Kenkmann, Bilddokumente jugendlicher Devianz unter der NS-Herrschaft. In: Barbara Stambolis/Markus Köster (Hg.), Jugend im Fokus von Film und Fotografie. Zur visuellen Geschichte von Jugendkulturen im 20. Jahrhundert, Göttingen 2016, S. 233–252.
Konzeption und Zielsetzung
13
ten. Derzeit aber sei die Hitlerjugend lediglich eine müde Zwangsgemeinschaft: „Es gibt keinen Kampf, keinen Gegner mehr! Es gibt keinen Aufbau, es gibt nichts, wofür man sich einsetzen kann. Alles ist erreicht, es bleibt nichts zu tun […]. Diese Tatsache allein genügt, eine Jugendbewegung zu demoralisieren.“11 Die beiden diametral widersprüchlichen Deutungen sind auf je eigene Weise Zerrbilder. Sie waren nicht pauschal gültig. Aber man kann die Frage aufwerfen, welche Diagnose – verführerische Indoktrinationsmaschine oder brüchige Zwangsgemeinschaft – näher an der historischen Wirklichkeit liegt. Die Diskrepanz zwischen Propaganda und Realität oder zwischen Anspruch und Alltag dieser Organisation wird das vorliegende Buch behandeln. Es neigt, unter anderem Blickwinkel, der Ferndiagnose Friedländers zu. Die Jugend im Gleichschritt war und ist ein Mythos.
Konzeption und Zielsetzung Fragt man nach dem Verhältnis von Propaganda und Wirklichkeit oder nach dem Alltag der Hitlerjugend, sollte man zunächst ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass die Massenorganisation in den 1930er-Jahren selbst einen erheblichen Wandlungsprozess durchlief. Es ist demnach wichtig, den jeweiligen Horizont zu bestimmen, in welchem sich die Analyse bewegt. Begriffe und Schlagworte zur Charakterisierung sind schon im zeitgenössischen Schrifttum zahlreich gewesen, aber auch in der Wissenschaft bis heute anzutreffen. Ihr Sinn liegt darin, dass sie für spezifische Phasen Interpretationsangebote eröffnen. Die Hitlerjugend in Abschnitte einzuteilen, bedeutet ihre Geschichte bereits zu betrachten. Einleitend soll hier ein Überblick zumindest skizziert sein. Trotz ihres gewaltigen Wachstums zur Massenorganisation ist sie bis zum Schluss immer eine Parteijugend geblieben. Als Gliederung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) war sie mit dieser aufs engste verknüpft. In ihrer Frühphase und in den ersten Jahren der Diktatur kann die Hitlerjugend aber auch als eine nationalsozialistische Jugendbewegung charakterisiert werden – im Gegensatz zur staatlichen Institution, zu der sie nach und nach wurde. Zwar stellte sie eine junge Nachwuchstruppe für die Partei und Sturmabteilung (SA) dar; der letzteren blieb sie, per Verfügung Hitlers vom April 1931, zunächst formal untergeordnet.12 Allerdings rekrutierte die NS-Jugendbewegung nach dem Beginn der Weltwirtschaftskrise mit radikalen sozialrevolutionären Parolen durchaus eigenständig. Die Hitlerjugend entstand aus Klassenzimmern und höheren Schulen heraus. Ihre Einheiten gründeten sich auf dem Engagement von jungen Menschen, die sich für die Bewegung begeistern oder einspannen 11 Die Zwangsorganisation aller jungen Deutschen. In: Pariser Tageszeitung vom 18.11.1936. 12 Zentralverlag der NSDAP (Hg.), Die Organisation der Hitler-Jugend. Amtliche Gliederung der Reichsjugendführung der NSDAP. Stand am 1. August 1937, München 1937, S. 11.
14
Einleitung
ließen. Sie versprach Partizipation und Aussicht auf revolutionäre Mitgestaltung. Als Jugendbewegung blieb die Hitlerjugend aber lange ein chaotisches und volatiles Gebilde. Ihre frühe Entwicklung war von Ortsgegebenheiten abhängig. Mitunter erwies sie sich als fragil: Zahlreiche Einheiten tauchten plötzlich auf, verschwanden aber umgehend wieder. Erst mit Hitlers „Machtergreifung“ am 30. Januar 1933 schwoll diese Jugendbewegung rapide an. Zehntausende fanden binnen weniger Wochen in ihre Reihen. Das Jahr 1933 leitete zeitgleich den Umbau der Hitlerjugend in eine bürokratische Massenorganisation ein, wie sie im kollektiven Gedächtnis bis heute fest verankert ist. Man kann dies auch als Phase der Erstarrung oder Institutionalisierung beschreiben. Ein gewaltiger Apparat mit einem Dickicht schier unüberschaubarer Vorschriften und einem repressiven Verhaltenskodex entstand. Der schuf zwar durchaus attraktive Angebote, welche junge Menschen zahlreich nutzten, aber er griff gleichwohl in den jugendlichen Alltag mehr und mehr regulatorisch ein. In Hinblick auf die Zahl der Neueintritte stagnierte die Hitlerjugend 1935 zum ersten Mal. In Bonn, wo im April 1934 rund 40 Prozent der Schülerinnen und Schüler der Jugendorganisation angehört hatten, war etwa ein Jahr später kaum eine Vergrößerung eingetreten. In fast allen Städten und Regionen sah die Lage ähnlich aus.13 Mitte des Jahrzehnts hatte sie an revolutionärer Schwungkraft eingebüßt. Bei einem steigenden Anteil der Mitglieder handelte es sich zudem um Karteileichen. Dieses Buch wird sich an gegebener Stelle näher damit beschäftigen. Propagandistischer Aufwand sowie die Zusammenarbeit mit Schulen, Kommunen und Arbeitgebern waren in Zukunft notwendig, um immer weitere Kinder und Jugendliche in die Parteijugend zu holen. Der soziale Druck wuchs kontinuierlich an und lastete nicht zuletzt auf den Familien. Spätestens mit der Einführung der Jugenddienstpflicht im März 1939 gab die Reichsjugendführung (RJF) die alten Ideale preis, die sie Anfang des Jahrzehnts zu propagieren nicht müde geworden war. Ein Begriff, den zahlreiche HJ-Führer schon 1933 im Mund führten, wurde jetzt Wirklichkeit: Die Hitlerjugend war Partei- und Staatsjugend. Die Dienstpflicht leitete in ihre totalitäre Phase über. Jahrgangsweise sollten alle deutschen Kinder, notfalls durch Anwendung von Zwang, zum Dienst verpflichtet und herangezogen werden; wer sich nicht fügte oder zum Dienst nicht erschien, konnte bestraft werden. „Eine ordnungsgemäße Durchführung“, hieß es aus der RJF, sei nur dann möglich, „wenn die Jugendlichen […] zur Erfüllung ihrer Jugenddienstpflicht […] notfalls auch gezwungen werden können“.14 Indes darf man nicht übersehen, dass es – auf dem Land ebenso wie in größeren Städten – jungen Menschen dennoch gelang, ihrem Zugriff zu entweichen. Wie das gelingen konnte, welche Schlupflöcher existierten, wird das vorliegende Buch aufzeigen. Neue Dienststellen wurden
13 Vgl. Horst-Pierre Bothien, Das braune Bonn. Personen und Ereignisse, 1925–1939, Essen 2005, S. 69. 14 Gerhard Klemer, Die Erzwingung der Jugenddienstpflicht. In: Jugendführer des Deutschen Reiches (Hg.), Deutsches Jugendrecht, Berlin 1943, S. 58–70, hier 61.
Konzeption und Zielsetzung
15
eingerichtet, um die Lücken zu schließen; doch längst nicht überall erfolgreich, weil es im Zweiten Weltkrieg massiv an jugendlichem Personal fehlte. Die Repression nahm weiter zu. Am Ende stand das Verbrechen der Jugend-Konzentrationslager (KZ), mit denen sich die Forschung erst in jüngerer Zeit intensiver beschäftigt hat. Zudem trieb die RJF in der späten Kriegsphase ein eigenes Pilotprojekt für zukünftige Erziehungslager voran, die unter dem Dach der Hitlerjugend stehen sollten. Zweck dieser – bislang nicht beachteten – Landesjugendhöfe war die Umerziehung junger Abweichler und vermeintlich „Verwahrloster“, um sie für den Krieg als Arbeitskräfte nutzbar machen zu können. Dieser Verwandlungsprozess scheint der Logik eines totalitären Staates zu folgen. Dass aus der revolutionären Jugendbewegung der „Kampfzeit“ ein totalitärer Apparat erwuchs, war aber nicht einfach vorgezeichnet. Der Prozess folgte nicht nur einer Logik, die sich aus Ideologie und Verfügungsanspruch speiste, sondern resultierte mithin aus Defiziten, ideologischen Selbsttäuschungen und Widersprüchen, welche die Hitlerjugend über 1933 hinaus prägten. Damit wird die Geschichte der Organisation auch als Geschichte ihrer Misserfolge geschildert. Die Hitlerjugend, so die These dieses Buches, entwickelte sich zu einem totalitären Apparat, gerade weil es ihr nicht gelang, Utopie in Wirklichkeit zu überführen. Sie war vom eigenen Anspruch überfordert.15 Uns prägt die Vorstellung, dass die Hitlerjugend eine ganze Generation junger Menschen erfasst, erfolgreich indoktriniert und – Begriffe, bei denen Vorsicht geboten bleibt – verführt, getäuscht, betrogen habe. Es lasse sich kaum bestreiten, so meinte beispielsweise der Historiker Michael Kater, „dass es der Hitler-Jugend, zuerst unter [Reichsjugendführer] Schirachs wachsamen Augen und dann unter Axmann, gelang, den bei weitem größeren Teil der deutschen Jugend […] unter ihre Fittiche zu bekommen“.16 Karl Heinz Jahnke, der sich mit einer Fülle an Publikationen um die Erforschung der Jugend im Nationalsozialismus verdient gemacht hat, urteilte sehr ähnlich: Der Einfluss langjähriger Indoktrination durch die Staatsjugend habe derart nachhaltig gewirkt, dass der deutschen Jugend „eine wachsende Rolle für die Fortsetzung des Krieges“ zugefallen sei, ja sie den Wahnsinn des „Endkampfs“ überhaupt erst ermöglicht habe.17 Graml unterstrich, dass die Verfolgten, Abweichler oder Widerständler „quantitativ gesehen, Erscheinungen am Rande“ gewesen seien. Den Normal-
15 Vgl. Jörg Baberowski, Nationalsozialismus, Stalinismus und die Totalitarismustheorie. In: Martin Sabrow/Jürgen Danyel/Jan-Holger Kirsch (Hg.), 50 Klassiker der Zeitgeschichte, Göttingen 2013, S. 52–57, hier 55. „Man muss sich von der Vorstellung freimachen, die Essenz der totalitären Diktaturen sei die Übereinstimmung von Inszenierungen und Praktiken gewesen. Sie waren vielmehr Diktaturen mit totalitären Ansprüchen, die ihre Gewalttätigkeit gerade dadurch entfalteten, dass sie ihre politischen und sozialen Entwürfe nicht verwirklichen konnten.“ Ebd. 16 Michael H. Kater, Hitler-Jugend, Darmstadt 2005, S. 26. 17 Karl Heinz Jahnke, Hitlers letztes Aufgebot. Deutsche Jugend im sechsten Kriegsjahr 1944/45, Essen 1993, S. 34. Vgl. auch ders. (Hg.), Jugend unter der NS-Diktatur 1933– 1945. Eine Dokumentation, Rostock 2003.
16
Einleitung
fall habe er selbst abgebildet: eingereiht in die „zu einem kollektiv disziplinierten Heerscharen der Jugend“, aufgesessen – wie die große Mehrheit – „einer immanent kriminellen Ideologie“.18 Die vorliegende Studie beabsichtigt, und ein Risiko mag darin liegen, das Etablierte kritisch zu prüfen. Die Geschichte der Hitlerjugend ist meist von der Spitze der Organisation hinunter betrachtet worden. Ältere Gesamtdarstellungen sind auf die staatliche Politik hin gerichtete Gleichschaltungsgeschichten; eine der ersten wurde 1968 von Hans C. Brandenburg publiziert. Sie wollten erklären helfen, wie es dem Regime gelingen konnte, die deutsche Jugendbewegung in der Hitlerjugend – mehr oder weniger repressiv – aufgehen zu lassen.19 Jüngere Studien, wie von Christian Niemeyer 2013 erschienen, haben diese Frage aus der Weimarer Jugendbewegung selbst heraus beantwortet.20 Die Schnittmengen zwischen sogenannter bündischer Jugend und der nationalsozialistischen Jugendbewegung wurden in den Fokus genommen. Am uniform-homogenen Bild der Hitlerjugend haben neuere Darstellungen meist ebenso wenig wie ältere Studien gerüttelt. Der RJF, ab 1936 im Status einer Obersten Reichsbehörde, war im „Dritten Reich“ die Aufgabe zugewiesen, die Jugend zu erziehen, körperlich zu stählen, auf das Regime zu verpflichten. Die Parteijugend war hierfür sozusagen ihr perfides organisatorisches Instrument. Politik und Wirken der RJF hat der Historiker Michael Buddrus mit einem wissenschaftlichen Monumentalwerk aufgearbeitet.21 Kein Winkel der Jugendpolitik scheint heute nicht bereits ausgeleuchtet, kein Schriftstück nicht betrachtet und mehrfach gewendet. Die Frage, in welchem Maße die Vorgaben im Alltag eine Rolle spielten, wurde überraschend selten gestellt. Für die meisten Studien sind die Vorgaben von oben und die Alltagsrealität an der Basis nahezu ein- und dasselbe. Thomas Gloy hat bei der Analyse von Schulungsmaterial in der Hitlerjugend gemeint: Die Hefte seien „verbindliches Schulungsmaterial für die wöchentlichen Heimabende“ gewesen, „deshalb also tatsächlich millionenfach rezipiert“ worden.22 Man sollte bei solchen Kurzschlüssen ein Fragezeichen setzen. Die Organisation fußte auf einem Prinzip, das sich aus der „Kampfzeit“ und aus Traditionen der Jugendbewegung speiste. Es trug viel zur Begeisterung der Heranwachsenden bei: Jugend sollte von Jugend geführt werden. Ältere Studien haben die sogenannte Selbstführung mehrheitlich als Demagogie und Illusion zu enttarnen versucht. Die Selbstführung kollidierte mit der Vorstellung einer hierarchischen Diktatur und dem Befehlston der Jugendorganisation. „Die Befehle Deiner Führer hast du widerstandlos und sofort auszuführen, selbst wenn 18 Graml, Integration und Entfremdung, S. 75 und79. 19 Vgl. Hans Christian Brandenburg, Die Geschichte der HJ. Wege und Irrwege einer Generation, Köln 1968. 20 Christian Niemeyer, Die dunklen Seiten der Jugendbewegung. Vom Wandervogel zur Hitlerjugend, 2. Auflage, Tübingen 2013. 21 Michael Buddrus, Totale Erziehung für den totalen Krieg. Hitlerjugend und nationalsozialistische Jugendpolitik, 2 Bände, München 2003. 22 Thomas Gloy, Im Dienst der Gemeinschaft. Zur Ordnung der Moral in der HitlerJugend, Göttingen 2018, S. 19.
Konzeption und Zielsetzung
17
sie Dir falsch erscheinen sollten“, hieß es typisch in der Dienstvorschrift für das Deutsche Jungvolk (DJ) von 1940.23 Der Alltag der Organisation lag zugleich in den Händen von Kindern oder Jugendlichen, die kaum älter waren, als die ihnen Untergebenen. Eigentlich paradox: Wenn es ihre Aufgabe war, die Jugend dem Staat gefügig zu machen und sie auf Befehle zu verpflichten, war die autonome Selbstführung der Basis eigentlich nicht die effektive oder totalitäre Wahl. Aus dem Widerspruch zwischen Basisorganisation und totalitärem Anspruch folgten Konsequenzen. Die jungen Unterführer- und führerinnen handelten nicht immer nach Vorgaben. Die Einheiten standen selten unter Kontrolle oder Aufsicht. Ihr Alltag jenseits von Großveranstaltungen, Zeltlagern, Aufmärschen sowie Not- und Hilfsdiensten ließ Spielräume zu und bot Möglichkeiten für Eigenmächtigkeiten. Die Spielräume wurden unterschiedlich genutzt und eigensinnig ausgedeutet. Darum soll es im Folgenden gehen. Eigensinn, ein analytischer Begriff, den der Historiker Alf Lüdtke in die Historiografie mit Erfolg einführte, hat man mit Jugend im „Dritten Reich“ bislang wenig in Zusammenhänge gestellt – und erst recht nicht mit der Hitlerjugend.24 Hier wird auf das Konzept mehrfach zurückgegriffen. Eigensinn ist nicht in erster Linie ein Handlungsbegriff. Zudem ist er nicht mit einer Art Widerstand im Kleinen zu verwechseln. Der Begriff zielt vielmehr auf Handlungsmotive ab. Diese können durchaus in Widerstand münden – oder im Gegenteil im radikalen Überschuss, oder gar systemstabilisierend wirken. Wenn man nach der Eigensinnigkeit von Akteuren fragt, fragt man nach ihren kleinsten Handlungsspielräumen und nach individuellen Beweggründen. Hier wird von jugendlichem und sogar kindlichem Eigensinn erzählt: von jungen Menschen, die sich selbst ermächtigten und handelten, ohne einer Direktive zu folgen; von jungen Unterführerinnen und Unterführern, die sich über Vorgaben hinwegsetzten oder ihre Spielräume ausloteten; von Drückebergern und Desinteressierten, die unauffällig zu bleiben versuchten, oder von jungen Radikalen; von Hitlerjungen, die Kriegsgefangene erschossen, und solchen, die ihnen zur Flucht verhalfen.25 Eigensinn ist für die Forschung ein attraktives Konzept; und auch für dieses Buch, das einen Mythos des Gleichschritts hinterfragt.
23 Reichsjugendführung (Hg.), Der Jungvolkdienst. Übersicht über Wesen, Form und Arbeit des Deutschen Jungvolks in der HJ (Dienstvorschrift der Hitler-Jugend), Berlin 1940, S. 20. 24 Zur Ausnahme zählen jüngste Beiträge etwa von Alfons Kenkmann, Beispiele jugendbewegten Eigensinns im Zeitkäfig der NS-Zeit. In: Barbara Stambolis (Hg.), Die Jugendbewegung und ihre Wirkungen. Prägungen, Vernetzungen, gesellschaftliche Einflussnahmen, Göttingen 2015, S. 233–250. Zum Konzept und Begriff vgl. Alf Lüdtke, Eigen-Sinn. Fabrikalltag, Arbeitererfahrungen und Politik vom Kaiserreich bis in den Faschismus, Hamburg 1993; Thomas Lindenberger (Hg.), Herrschaft und EigenSinn in der Diktatur, Köln 1999. 25 Vgl. beispielsweise Ausschluss Heinz Richter, geb. 8.1.1925 in Rennersdorf, aus der Gefolgschaft 4/Pirna. In: BB: Sachsen, 10/42 vom 1.10.1942: „Der Beschuldigte hat einem französischen Kriegsgefangenen zur Flucht verholfen und diesem den Zivilanzug
18
Einleitung
Auf einen weiteren Aspekt ist hinzuweisen: Die Geschichte der Jugend im Nationalsozialismus ist bislang von Dichotomie geprägt. Den Angepassten hat man die Unangepassten und den Fanatisierten, Indoktrinierten oder Verführten die – an Zahl geringeren – Jungoppositionellen gegenübergestellt. Einer Dokumentation, die Arno Klönne 1982 herausgab, hatte er den griffigen Titel „Die Hitler-Jugend und ihre Gegner“ gegeben.26 Die Lebensrealität ebenso wie individuelle Biografien und Erfahrungen waren nicht derart schematisch. Die Trennung zwischen der Hitlerjugend auf der einen Seite und ihren Gegnern auf der anderen Seite zieht Grenzen, die es im Alltag selten gab. Studien über die Swing-Jugend oder die jugendliche Opposition aus dem Arbeitermilieu und von bündischen Gruppen haben dies am Rande immer wieder festgestellt.27 Forschungen – wie sie Alfons Kenkmann am Beispiel jugendlicher Cliquen aus dem Rhein- und Ruhrgebiet oder von Sascha Lange zu Leipzig vorliegen – haben die scharfe Gegenüberstellung fraglich werden lassen.28 Studien, die sich mit Abweichlern befassten, sind kaum überraschend zugleich auch jene, welche die totalitäre Kraft der Hitlerjugend am ehesten in Zweifel ziehen. Kenkmann sprach mit Blick auf die Kriegsjahre gar vom Scheitern der Jugendorganisation.29 Die Hitlerjugend brachte, könnte man zuspitzen, ihre Gegner zuletzt hervor. Mit dem Hitlerjugend-Gesetz 1936 und der Jugenddienstpflicht 1939 war die Mitgliedschaft in der Massenorganisation nach und nach zur gesetzlichen Pflicht geworden. Die RJF unternahm in der Kriegszeit gewaltige Anstrengungen, um mittels jährlicher Einberufungsappelle oder auf perfidesten Wegen jene Kinder, die der Staatsjugend bislang nicht angehört hatten, für ihren Dienstalltag heranzuziehen. Junge Menschen, die in die Massenorganisation gezwängt wurden, suchten nach Möglichkeiten, um ihr wieder zu entgehen. Andere kamen gerade erst durch Erfahrung in der Hitlerjugend mit alternativen Gruppen in Kontakt. Auswege existierten, die man nutzen konnte – jedenfalls solange man sich ihrer bewusst war. Auch die „Asozialen“, „Gemeinschaftsfremden“ und „Verwahrlosten“, die das Regime verfolgte, gehörten im Übrigen – wie hier zu zeigen ist – der totalitären Staatsjugend zahlreich an.
26
27
28
29
seines im Felde stehenden Bruders verschafft. […] Er wurde der Untersuchungshaftanstalt Bautzen zugeführt.“ Ebd. Arno Klönne, Jugend im Dritten Reich. Die Hitler-Jugend und ihre Gegner. Dokumente und Analysen, Düsseldorf 1982. Vgl. auch ders., Hitlerjugend. Die Jugend und ihre Organisation im Dritten Reich (Diss.), Hannover 1955; ders., Jugendliche Opposition im „Dritten Reich“, Erfurt 1996. Vgl. Jan Kurz, „Swinging Democracy“. Jugendprotest im 3. Reich, Münster 1995. Zu Beispielen für Überschneidungen zwischen bündischen Gruppen und Hitlerjugend, aber auch ihrer Differenzen vgl. die biografisch gelagerten Auseinandersetzungen bei Franz Josef Schäfer, Willi Graf und der Graue Orden. Jugendliche zwischen Kreuz und Hakenkreuz, St. Ingbert 2017, S. 212 f. Vgl. Alfons Kenkmann, Wilde Jugend. Lebenswelt großstädtischer Jugendlicher zwischen Weltwirtschaftskrise, Nationalsozialismus und Währungsreform, 2. Auflage, Essen 2002; Sascha Lange, Die Leipziger Meuten. Jugendopposition im Nationalsozialismus, 3. Auflage, Leipzig 2012. Ebd., S. 232.
Konzeption und Zielsetzung
19
Gegner, Fahnenflüchtige, Überläufer oder junge Oppositionelle waren nicht erst nach Kriegsbeginn Teil der Hitlerjugend. Sie standen in den 1930er-Jahren vielfach in der Nachwuchsorganisation. Manchmal taten sie aktiv Dienst, viele andere blieben passiv. Nach 1933 hatte die Hitlerjugend durch die Gleichschaltung eine wachsende Anzahl an Kindern und Jugendlichen aufgenommen, die zuvor anderen Gruppen oder Vereinen angehört hatten. Sie kamen aus nationalen und bündischen Organisationen, christlichen Vereinen, den Sportverbänden, selbst aus sozialdemokratischen oder kommunistischen Organisationen, die 1933 zerschlagen worden waren. Viele Eltern gaben ihre Kinder in die Hitlerjugend, um sich unter den neuen Verhältnissen politisch und sozial abzusichern. Ein Großteil dieser jungen Neulinge nahm die Organisation als Notwendigkeit ihres Alltags hin. Viele freundeten sich mit ihr an und nutzten bereitwillig attraktive Angebote. Nur die Minderheit – aber auch jene gab es – wuchs in der Hitlerjugend tatsächlich zu Abweichlern oder Kritikern heran. Die Organisation war ein Feld der Auseinandersetzungen und ein Möglichkeitsraum. 1936 berichtet zum Beispiel eine NS-Jugendzeitschrift über die HJ-Streifen in Berlin. „Dann wieder kaum glaubliche Fälle“, erläuterte der Artikel aus dem bunten Alltag der Streifengänger, „nämlich das Feststellen von Hitlerjungen, die überhaupt keine sind. Da trifft man Fähnlein-, Gefolgschafts- [und] sogar einen Bannführer […], der aus Versehen sich statt eines HJ-Messers einen SA-Dolch, statt der Mütze mit dem weißen Streifen ‚versehentlich‘ sich die eines Gebietsführers aneignete. Es kann vorkommen, dass dieser Knabe dann fünf bis sechs Ausweise bei sich hat, die bei Nachprüfung alle nicht stichhaltig sind.“30 Illegitime, schwindelnde oder verfolgte Angehörige der Parteijugend wird man im Verlauf dieses Buches mehrfach treffen. Die vermeintlichen oder tatsächlichen Gegner gehören nicht nur an den Rand der Massenorganisation, und schon gar nicht aus ihr herausgenommen, sondern in ihre Mitte verortet. Die vorliegende Geschichte der Hitlerjugend ist keine Erfolgsgeschichte. Weil sie – mit Blick auf die Basis sowie individuelle Handlungsspielräume – totalitären Herrschaftsanspruch und Alltagswirklichkeit kritisch zu hinterfragen sucht, begibt sie sich gelegentlich in Konflikt mit der kollektiven Erinnerung. Die Massenorganisation wird sich in dieser Studie als weit weniger durchherrscht und kontrolliert zeigen, als landläufig angenommen. Mit drei Begriffen wird operiert. Erstens: Fragil war die Hitlerjugend insofern, als ihre Strukturen gelegentlich brüchig waren; primär von der „Kampfzeit“ bis in die ersten Jahre der Diktatur, aber auch in räumlicher Hinsicht, in konfessionell gefestigten Regionen und in unübersichtlichen Metropolen wie Berlin und Hamburg. Nach einer Stabilisierungsphase ab Mitte des Jahrzehnts wurden ihre Strukturen im Zweiten Weltkrieg erneut herausgefordert, weil Personal an die Front beordert wurde und im Alltag nicht zur Verfügung stand. Fragilität öffnete Handlungsspielräume und Möglichkeiten, um die Hitlerjugend eigensinnig zu nutzen. 30 Auf Streifendienst in der Viermillionenstadt. In: Die HJ vom 22.8.1936.
20
Einleitung
Als defizitäre Organisation wird die Hitlerjugend zweitens charakterisiert, weil sie von ideologischen Widersprüchen geprägt war und bis zum Kriegsende blieb. Freiwillig sollte die Mitgliedschaft zwar sein, doch mündete sie immer weiter in Zwang; die Jugend sollte sich selbst führen und die Basis autonom sein, aber diese Selbstführung war mit effizienter Kontrolle nicht zu vereinbaren; in religiösen Belangen sollte die Hitlerjugend offiziell neutral sein, aber praktisch war sie oft das Gegenteil. Die Widersprüche belasteten Strukturen, behinderten Entscheidungen oder radikalisierten Entscheidungsträger. Drittens: Eine prekäre Organisation war die Hitlerjugend, weil ihre Alltagswirklichkeit selten in Gänze ihrer Propaganda entsprach. Diebstahl, Korruption, sexuelle Übergriffe, Vandalismus und Gewalt – das alles existierte, rief Kritik aus Teilen der Bevölkerung hervor, beschäftigte die Sicherheitsorgane ebenso wie Hitlerjugend-Dienststellen oder diente der Opposition zur Agitation. Man mag fragen und kann entgegnen: Wenn die Realität der Hitlerjugend derart von ihrem Mythos abwich, wie hier behauptet, warum brach sie nicht einfach in sich zusammen? Warum blieben Kinder, Jugendliche und junge Männer eingespannt in das System bis zur Katastrophe und warum hofften manche selbst in den letzten Tagen des Krieges weiterhin auf einen „Endsieg“? Diese Fragen dringen in die Mitte von historiografischen Debatten um den Nationalsozialismus vor. Die Hitlerjugend war stets nur eine Sozialisationsinstanz neben vielen und nicht von entscheidender Bedeutung – Schule, Familie, Milieu, Freundeskreis und Betrieb, auch dort wirkte selbstverständlich die nationalsozialistische „Volksgemeinschaft“ auf junge Menschen ein. Sich Alternativen vorzustellen oder auf sie hinzuwirken, wie im Falle von Hans und Sophie Scholl, war nur der Minderheit derer, die in den 1930er-Jahren sozialisiert wurden, möglich. Wer die Parteijugend – aus welchen Motiven auch immer – mied, sich ihr entzog oder sich dort langweilte, schikaniert wurde, den Dienst als unattraktiv empfand und ihn schwänzte, verfügte deshalb noch lange nicht über einen Horizont und über notwendiges Reflexionsvermögen, mit dem die politische Gegenwart infrage zu stellen möglich gewesen wäre. Historikerinnen und Historiker, welche die Attraktion der „Volksgemeinschaft“ und ihre integrative Wirkung zuletzt in den Mittelpunkt der Forschung rückten, haben zum Verständnis der NS-Gesellschaft erhebliches geleistet. An einigen Stellen dieses Buches sollen ihre Thesen erprobt werden. Mittlerweile hat man sich von der Vorstellung eines gelenkten, von oben nach unten durchregierenden „Führerstaats“ verabschiedet, stattdessen den Anteil und die Mitwirkung der „Volksgenossen“ hervorgehoben.31 Bisweilen gerät man in die Gefahr, 31 Zum Forschungsdiskurs und neueren Studien vgl. beispielhaft Detlef SchmiechenAckermann (Hg.), „Volksgemeinschaft“. Mythos, wirkungsmächtige soziale Verheißung oder soziale Realität im „Dritten Reich“?, Paderborn 2012; Thomas Rohkrämer, Die fatale Attraktion des Nationalsozialismus. Über die Popularität eines Unrechtsregimes, Paderborn 2013; zur Debatte um das Konzept vgl. Ian Kershaw, „Volksgemeinschaft“. Potenzial und Grenzen eines neuen Forschungskonzepts. In: Vierteljahreshefte für Zeit geschichte (VfZ), 59 (2011) 1, S. 1–17; sowie Michael Wildt, „Volksgemeinschaft“. Eine
Konzeption und Zielsetzung
21
die „Volksgemeinschaft“ nur noch mit dem Versprechen völkischer Nestwärme zu assoziieren, welche die Mehrheit der Deutschen sich bereitwillig aneignete oder darin einzurichten schien. Das „Dritte Reich“ blieb allerdings immer, was nicht aus dem Blick geraten sollte, eine Angst- und Terrorherrschaft, die auch nach Innen gerichtet war.32 Die Gewalt gegen jene, die aus rassistischen Gründen nicht hinzugehörten, und gegen solche, die sich dem Staat zu verweigern schienen, stellte einen Faktor der Stabilisierung dar. Angst hielt die Hitlerjugend zuletzt ebenfalls aufrecht. Junge Menschen, die sie zu verbreiten halfen, gab es an Zahl genug, um das Aufbäumen oder den Widerspruch der anderen zu hemmen. Jugendliche denunzierten Kameraden, die nur unwillig zum Dienst erschienen; selbstherrliche HJ-Streifen in den Großstädten schikanierten Gleichaltrige; Unterführer in Dienststellen schalteten schnell Polizei und Geheime Staatspolizei (Gestapo) ein, sobald sie den Eindruck gewannen, es müsse gegen vermeintliche Disziplinlosigkeiten vorgegangen werden. Die Hitlerjugend nicht in erster Linie als straff geführte Massenorganisation zu verstehen, sondern als prekäre Organisation mit Spielräumen, heißt auf gleiche Weise, den Blick zu schärfen, wie die einen Macht über die anderen gewannen und ausübten. Diese Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann keine Gesamtgeschichte über jugendliches Leben im „Dritten Reich“ anbieten. Sie soll eine Brücke schlagen zwischen den etablierten älteren Hitlerjugend-Geschichten und neueren Forschungen über die jugendliche Opposition im nationalsozialistischen Deutschland. Themenkreise, die zum institutionellen Geflecht und zur Praxis der Hitlerjugend hinzugehören, sind an anderer Stelle und in diversen Studien intensiver erschlossen. Manches, wie das Eindringen der Hitler hemenfelder, jugend in die Schulen, wird thematisiert. Doch eng benachbarte T wie die Adolf-Hitler-Schulen oder Nationalpolitischen Erziehungsanstalten (NAPOLAs) mit ihrer, so der Schüler und gleichnamige Sohn Martin Bormanns im Rückblick, „heilen nationalsozialistischen Idealwelt“, bleiben ausgespart – ebenso die Haushaltungsschulen des Bundes Deutscher Mädel (BDM) oder der Reichsarbeitsdienst (RAD), in den die Hitlerjugend überleitete.33 Die Kinderlandverschickung (KLV) oder der sogenannten Landdienst lassen sich im Folgenden nur streifen. Ihr organisatorischer Aufbau und das Wirken in den Antwort auf Ian Kershaw. In: Zeithistorische Forschungen, 8 (2011) 1, S. 102–109; Detlef Schmiechen-Ackermann/Marlis Buchholz/Bianca Roitsch/Christiane Schröder (Hg.), Der Ort der „Volksgemeinschaft“ in der deutschen Gesellschaftsgeschichte, Paderborn 2018. 32 Nikolaus Wachsmann, kl. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, München 2015, S. 38: „In den letzten Jahren haben einige Historiker die Bedeutung dieses nationalsozialistischen ‚Vorkriegsterrors‘ heruntergespielt. Sie beschreiben das Dritte Reich als eine Art ‚Wohlfühl-Diktatur‘ […]. Doch die Unterstützung […] ging nur bis zu einer gewissen Grenze, und Terror war deshalb unerlässlich, um die Millionen zum Schweigen zu bringen, die bisher […] widerstanden hatten.“ 33 Martin Bormann, „Vom Reichsschüler in Feldafing zum Missionar im Kongo“. In: Johannes Leeb, „Wir waren Hitlers Eliteschüler“. Ehemalige Zöglinge der NSAusleseschulen brechen ihr Schweigen, Hamburg 1998, S. 106–119, hier 117.
22
Einleitung
annektierten Gebieten nach 1939 harren weiter der Erforschung – ebenso die Auslandskontakte der Hitlerjugend, denen bislang kaum nachgegangen worden ist. Im Zentrum dieses Buches stehen Fragen nach dem Alltag von jungen Menschen in der Massenorganisation sowie insbesondere nach der Funktionsweise von Formationen und Einheiten an der Basis, in denen Kinder und Jugendliche Dienst taten. Männliche Jugendliche rücken – je nach Themenfeld – weit mehr als weibliche Angehörige in den Fokus dieser Untersuchung. Das wird man kritisieren können, weil der BDM ohnehin die von der Forschung lange vernachlässigte „zweite Hälfte der Hitler-Jugend“ gewesen ist.34 Es hat aber Gründe: Vandalismus oder gewalttätige Exzesse, die zu betrachten sein werden, gingen mehrheitlich von den 10- bis 14-Jährigen des Jungvolks sowie den 14- bis 18-Jährigen in der HJ aus, viel seltener von Mädchen und jungen Frauen. Die „Judenfrage“ sollte im BDM zwar genauso wie in der HJ zur Sprache gebracht werden. Antisemitische Übergriffe, mit denen sich ein Kapitel im Folgenden eigens beschäftigt, verübten aber in überwältigender Mehrheit männliche Jugendliche. Ein letztes Beispiel: Die Jugenddienstpflicht nach 1939 galt für Mädchen genauso wie für Jungen. Die Strafen trafen letztere aber härter. Ein Mitarbeiter der RJF bedauerte, dass man gegen renitente Mädchen wenig effiziente Instrumente besitze: „Bei Jungen greift in solchen Fällen der Jugenddienstarrest ein. Bei Mädeln gibt es kein passendes Disziplinarmittel.“35 Ihre disziplinarischen Strafen wandte die Organisation schon in den 1930er-Jahren in der überwältigenden Mehrzahl gegen männliche Angehörige an. Dennoch gerieten im Weltkrieg – durch die „Jugendschutzverordnung“ vom März 1940 – Mädchen in anderem Zusammenhang unter Verfolgungsdruck. Die Differenzen zwischen einerseits den weiblichen – Jungmädel und BDM – und andererseits den männlichen Gliederungen wird dieses Buch nach Möglichkeit herauszustellen sich bemühen, obgleich die Letzteren im Zentrum stehen.36 Wie weit reichte die Attraktion der Hitlerjugend für Mädchen und junge Frauen überhaupt, wie erlebten sie den Alltag in dieser Massenorganisation? Stimmt es, dass die Organisation – wie einige Studien behaupten – eine emanzipatorische Stoßrichtung beinhaltete, die auf Mädchen im Besonderen attraktiv
34 Gisela Miller-Kipp (Hg.), „Auch Du gehörst dem Führer“. Die Geschichte des Bundes Deutscher Mädel (BDM) in Quellen und Dokumenten, Weinheim 2001, S. 13. 35 Gerhard Klemer, Zum Disziplinarrecht der Hitler-Jugend. In: Das Junge Deutschland. Amtliches Organ des Jugendführers des Deutschen Reiches, (1944) 38, S. 157 f., hier 158. 36 Im Folgenden bezieht sich die Abkürzung BDM – wie in der Forschung üblich – auf die 14- bis 17/18-jährigen Mädchen. Die 10- bis 14-Jährigen werden als „Jungmädel“ des Jungmädelbunds (JMB) angesprochen. Ab 1942 bezog sich „BDM“ allerdings auf die Gesamtorganisation der weiblichen Jugend und die Gliederung für die mittlere Altersstufe (ab 14 Jahren) wurde „Mädelbund“ genannt. Vgl. Bezeichnung Bund Deutscher Mädel. In: GB: Franken, 11/42. Wird hier im weiteren Verlauf von der Hitlerjugend gesprochen, dann ist die Gesamtorganisation (HJ, BDM, DJV und JMB) gemeint. Die Abkürzung HJ hingegen bezieht sich auf die gleichnamige Gliederung der männlichen Jugend von 14 bis 18 Jahren.
Konzeption und Zielsetzung
23
irkte? Konnte der BDM gar modernisierende Effekte zeitigen?37 Zweifellos w schuf das Regime für die weibliche Jugend Angebote und Möglichkeiten, die zuvor in dieser Form nicht, nur in beschränktem Maße oder nur für bestimmte soziale Milieus bestanden. Die These von der besonderen Attraktivität der Hitlerjugend für Mädchen deckt sich mit nackten Zahlen bloß zum Teil: In den 1930er-Jahren waren viel weniger Mädchen durch die Hitlerjugend erfasst, als männliche Jugendliche. Der BDM hatte im März 1936 bis zu 20 Prozent der 14- bis 21-jährigen Mädchen und jungen Frauen erfasst, die HJ bis zu 60 Prozent der Jungen.38 Das weibliche Rollenbild – das sei einleitend angerissen – wandelte sich im Verlauf der Jahre erheblich. Mädchen, die vor oder unmittelbar nach 1933 zum BDM kamen, erlebten eine gänzlich andere Hitlerjugend, als jene, die in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts eintraten. Den sogenannten Kämpferinnen und Kameradinnen der frühen Jahre standen nachher die Heimchen und zukünftigen Mütter gegenüber. Im Januar 1934 kam die spätere BDM-Reichsreferentin Jutta Rüdiger in Düsseldorf in Führungsverantwortung: „eine schwer zu bändigende Schar“, wie sie in ihren Lebenserinnerungen über den innerstädtischen BDM schrieb, „man muss schon sagen: wilder Mädchen aus Arbeiterkreisen.“39 Die Mädchenorganisationen wurden, wenn man so will, im Zeitverlauf verbürgerlicht. Veränderungen in Rollen- und Idealbildern kamen dabei aber weniger aus der Hitlerjugend oder dem BDM selbst, sondern hatten mit dem gesellschaftlichen Kontext, älteren Sittlichkeitsdiskursen und tradierten Rollenbildern zu tun, denen sich die Hitlerjugend stellen musste. Oppositionelle Kreise gifteten gegen die Hitlerjugend. Und aus dem staatlichen Sicherheitsapparat wurden Bedenken an die Staatsjugend herangetragen. Das Selbstführungsprinzip an der Basis schien gerade für Mädchen und junge Frauen unangemessen. Auf die Diskurse um falsche Freizügigkeit, die auf oft üblen Gerüchten beruhten, oder sexuelle Verwahrlosung der Jugend schienen die RJF und ihre Dienststellen reagieren zu müssen. Dies trug dazu bei, dass gewisse emanzipatorische und modernisierende Elemente, die in der frühen Hitlerjugend durchaus angelegt waren, später zurückgefahren und zurückgenommen wurden. Existiert dann überhaupt eine „BDM-Generation“ – nicht bloß im Sinne einer Alterskohorte, sondern im Sinne von geteilten Erfahrungen –, so wie es eine Hitlerjugend-Generation angeblich gegeben hat?40
37 Vgl. knapp Hans Mommsen, Nationalsozialismus als vorgetäuschte Modernisierung. In: Walter H. Pehle (Hg.), Der historische Ort des Nationalsozialismus. Annäherungen, Frankfurt a. M. 1990, S. 31–46, hier 42. 38 Organisationsamt der Reichsjugendführung (Hg.), Statistik der Jugend, Ausgabe A, Teil 2, Berlin 1936, S. 6 f. (BArch Berlin, BDC 32.40). 39 Jutta Rüdiger, Ein Leben für die Jugend. Mädelführerin im Dritten Reich. Das Wirken der Reichsreferentin des BDM, Oldendorf 1999, S. 26. 40 Vgl. die Beiträge im ansonsten differenziert angelegten und argumentierenden Sammel band von Dagmar Reese (Hg.), Die BDM-Generation. Weibliche Jugendliche in Deutschland und Österreich im Nationalsozialismus, Berlin 2007.
24
Einleitung
Generationen-Konzepte sind in der Geschichtswissenschaft ebenso wie in der allgemeinen Öffentlichkeit populär. Sie versprechen sozialgeschichtliche Deutungen und liefern griffige Großerzählungen. Kollektivbiografien haben der Hitlerjugend mitunter die Funktion einer prägenden Sozialisationsinstanz zugewiesen. Ein generationelles Moment ist gewiss nicht von der Hand zu weisen: Junge Männer beispielsweise, die in der späten Weimarer Republik in der Hitlerjugend sozialisiert wurden, brachten ihre spezifischen Vorstellung mit, was diese nationalsozialistische Jugendbewegung im Speziellen und den Nationalsozialismus im Allgemeinen ausmachen sollte. Viele von ihnen kamen in den 1930er-Jahren auf hauptamtliche Leitungsposten in der Staatsjugend. Ihr „Erlebnis Hitlerjugend“ war aber ein anderes, als das von jenen, die Mitte des Jahrzehnts aufgrund zunehmenden Anpassungsdrucks hineinkamen. Das vorliegende Buch wird zur „Generation“ und Kollektivdeutung gleichwohl vorsichtig auf Abstand bleiben. Vielmehr sollen die zahlreichen Unterschiede und Widersprüche in den Erzählungen, Quellen und Materialien hervorgehoben werden. Jakob Benecke unterstrich sehr treffend: Eine sogenannte HJ-Generation lasse sich „nicht einfach aus der Tatsache einer quantitativ bemerkenswerten Zugehörigkeitsquote […] ableiten“. Es müssten die Unterschiede beachtet werden, anstatt Unterschiede einzuebnen. Der propagandistische Mythos der Partei- und Staatsjugend dürfe nicht nachträglich kolportiert, sondern müsse kritisch hinterfragt werden.41 „Das Bestreben, mich unter Druck zu setzen“, meinte ein früheres BDM-Mädchen, „trieb mich erst recht in die Opposition.“42 Dagmar Reese, die zur Geschichte des BDM viele Jahre intensiv gearbeitet hat, verwies auf jene lange Zeit unterschlagenen Biografien, die von Verweigerung, Unlust, staatlicher Verfolgung und Anpassungszwang bei der weiblichen Jugend erzählen.43 Die Hitlerjugend machte nicht aus allen Angehörigen unisono Marschierende, gleichgeschaltete Mitläufer. Die Erfahrungs- und Erlebnishorizonte unterschieden sich nicht nur je nach Alter, Familienhintergrund, Milieu und individuellem Entwicklungsstand, sondern auch nach der jeweiligen historischen Phase der Hitlerjugend. In diesem Buch geht es um die Spielräume für junge Menschen, um Entscheidungen und Handlungsoptionen; wie sich diese Spielräume innerhalb der Massenorganisation mit der Zeit veränderten, warum Räume zur Entfaltung enger geschnürt wurden, und wie aus einer radikalen, aktionistischen Jugendbewegung allmählich ein bürokratisch-totalitärer Apparat entstand. Es soll gezeigt werden, wie wenig die Hitlerjugend ihrem Anspruch genügte, wie verschieden sie erlebt und eigensinnig genutzt wurde. Uniform war die Hitlerjugend nur auf dem Reichsparteitag. 41 Jakob Benecke, Soziale Ungleichheit und Hitler-Jugend. Zur Systematisierung sozialer Differenz in der nationalsozialistischen Jugendorganisation, Weinheim 2015, S. 235. 42 Zit. aus dem Lebensbericht von Wera Fricke nach Gerda Szepansky, Frauen leisten Widerstand. 1933–1945. Lebensgeschichten nach Interviews und Dokumenten, Berlin 1983, S. 142. 43 Dagmar Reese, Zum Stellenwert der Freiwilligkeit. Hitler-Jugend und NSDAPMitgliedschaft. In: Mittelweg 36, 19 (2010) 3, S. 63–83.
Quellen und Materialien
25
Quellen und Materialien Mit den Forschungsarbeiten von Michael Buddrus kann die Politik der RJF als nahezu aufgearbeitet angesehen werden. Im Bundesarchiv lagernde Akten, die sich aus der RJF erhalten haben, sind ebenso akribisch durchleuchtet worden wie eine Vielzahl von publizierten Schriften aus der Obersten Reichsbehörde in Berlin. Weiteres zur RJF, hat es den Anschein, lässt sich kaum sagen und ergänzen. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht allerdings nicht zuerst die Politik der RJF. Es sollen vielmehr regionale Dienststellen und das Wirken der Hitlerjugend vor Ort in den Fokus rücken. In vielleicht keiner anderen Massenorganisation des „Dritten Reiches“ klaffte, so die These, die Diskrepanz zwischen dem, was das Regime konzeptionell anvisierte, und der Realität an der Basis derart auseinander. Warum das so war, wie man darauf reagierte und welche Folgen dies für die Hitlerjugend zeitigte, wird das vorliegende Buch erkunden. Hohen Stellenwert besitzen die bislang wenig genutzten „Gebietsbefehle“ – regionale Zeitschriften im Innendienst der Hitlerjugend. In den BDM-Gauen bzw. HJ-Gebieten erschienen die Materialien ab Mitte der 1930er-Jahre einmal monatlich; in einigen Fällen – wie in Berlin und Hamburg – hatte man die Zeitschriften früh nach der „Machtergreifung“ herausgegeben.44 Die Befehlsblätter finden, weil die Hitlerjugend eine Parteigliederung war, ihr direktes Pendant in den sogenannten Gaubefehlen der NSDAP, die freilich einen spezifischen Charakter haben und anderen Inhalts sind. Die Befehlsblätter enthalten einerseits die Anordnungen der jeweiligen regionalen Hitlerjugend-Führungen sowie der RJF an ihre nachgeordneten Dienststellen und Formationen. Andererseits griffen die Blätter auf, was sich in der Region, Praxis und im Alltag der Parteijugend abspielte. Will man erkunden, mit welchen Problemen sich die Führungsebene herumschlug, welche Mängel identifiziert wurden und wie man auf sie reagierte, sind die Befehlsblätter eine recht ergiebige Quelle.45 Sie zeigen, dass die regionalen Führungen mitunter widersprüchliche Anweisungen durchgaben – so, um ein Beispiel vorwegzunehmen, bezüglich des antisemitischen Hetzblattes „Der Stürmer“, welches das HJ-Führerkorps mancherorts verbot, aber andern orts den Unterführern zur Nutzung empfahl. Ebenso können sie belegen, dass Anweisungen aus der RJF oder der Partei nicht immer in deren Sinne oder im 44 Die Nummerierung der Ausgaben wechselte und unterschied sich zum Teil je nach Region. Eine einigermaßen einheitliche Kennzeichnung der GB setzte erst ab Mitte der 1930er-Jahre ein. Hier und im Folgenden wird für die GB ebenso wie für die BB die exakte Kennzeichnung verwendet, so wie darauf jeweils angegeben. 45 In der Hierarchie der Hitlerjugend zählten sämtliche hauptamtlich beschäftigten Führer (ab HJ-Bann bzw. BDM-Untergau) zum sogenannten Führerkorps; ab Februar 1941 gehörten auch Gefolgschafts- bzw. Haupt- und Oberfähnleinführer hinzu. Vgl. Neufestlegung und Erweiterung des Führerkorps. In: GB: Westfalen, 7/41K vom 10.1941. Zur Vereinfachung wird in der vorliegenden Arbeit die Ebene des Gebiets bzw. Gaus als höhere Dienststelle, die Ebene darunter (Banne, Untergaue, Jungbanne und Untergaue) als nachgeordnete Dienststellen bezeichnet. Die Ebene darunter – ungeachtet der verschiedenen Formationen und diversen Führungsränge – gilt im Folgenden vereinfacht als die Basis der Jugendorganisation.
26
Einleitung
korrekten Wortlaut an die Basis durchgereicht wurden. Gelegentlich fiel der eigensinnigen Auslegung immense Bedeutung zu. In Zusammenhang mit den Überführungen 17-Jähriger von der HJ in die NSDAP, wie sie ab 1943 erfolgte, ist dies zu zeigen. Die Parteikanzlei unterstrich zwar, dass die NSDAP-Mitgliedschaft freiwillig sei. Ein Aufnahmeantrag müsse unterschrieben, also die individuelle Einwilligung nachgewiesen sein. Die HJ-Dienststellen gaben aber Interpretationen nach unten weiter, die das Freiwilligkeitsprinzip aushöhlten, gar als Zwangsanweisung gelesen werden konnten. Diese Blätter durften nicht jenseits der Hitlerjugend weitergereicht oder gar veröffentlicht werden, obwohl das in Einzelfällen zum Ärger höherer Dienststellen geschah.46 Im Juli 1943 wies man beispielsweise darauf hin, dass, wenn in einem Befehl von „Pflicht“, „müssen“ oder Bestrafungen die Rede sei, dies natürlich nicht – schon gar nicht im Wortlaut – an die Öffentlichkeit durchgesteckt werden dürfe.47 Ebenso problematisch war es, wenn eine Weiterleitung nach unten erst gar nicht erfolgte. Es kam vor, dass die Befehle der Gebiete die Einheiten oder nachgeordnete Stellen nicht erreichten und auf dem Dienstweg versandeten.48 Zwar enthalten die Materialien mehr als nur Spuren von Propaganda, aber diese war nicht ihr Zweck. Es ging um den Aufbau, die Ausgestaltung – vielfach bis ins ermüdende Detail – und um Effizienzsteigerung, wozu das Beheben von vermeintlichen oder tatsächlichen Defiziten gehörte. Über die „Gebietsbefehle“ ist es gelegentlich möglich, in das lokale und regionale Innenleben der Parteijugend zu blicken, ohne sich allein auf ihr Propagandamaterial verlassen zu müssen. Die Zeitschriften und Befehlsblätter sind indes nicht für alle Gebiete lückenlos überliefert – meist nur bruchstückhaft oder lediglich in Regionen für überschaubare Zeiträume. Ebenso ist die Auflagenhöhe nicht durchgehend überschaubar. In Thüringen druckte man Anfang 1938 immerhin 4 500 Stück einer Ausgabe: 350 verblieben für die Mitarbeiter der Gebietsführung, je 10 Stück gingen an die 17 nachgeordneten Banne und Jungbanne des Gebiets, also an hauptamtliche Jugendführer. Der überwiegende Anteil wurde an die Formationen und in die Einheiten verteilt. Beim Äquivalent für die weib-
46 Durchgabe von Befehlen. In: GB: Mittelrhein, 12/36 vom 20.11.1936; Veröffentlichung von Dienstbefehlen. In: GB: Thüringen, A19/37 vom 15.12.1937; Bann- und Jungbannbefehle. In: GB: Berlin, 1/37 vom 18.1.1937. Bei einer Ausgabe „A“ handelt es sich um die allgemeine Fassung eines Gebietsbefehls. „B“ sind Zweitausgaben mit ergänzenden Sonderanweisungen, die nur an das hauptamtliche Personal (bis hinunter zum Bann bzw. Untergau) gingen. B-Ausgaben sind selten überliefert. 47 Dienstbefehle in der Presse. In: GB: Mittelelbe, 7/43K vom 7.1943. 48 Vgl. beispielhaft Weitergabe des Gebietsbefehls an die Unterführer. In: GB: Mittelelbe, 2/K43 vom 3.2.1943: „Anlässlich der durchgeführten Inspektionen in den Einheiten und bei den Zusammenkünften der Unterführer ist wiederholt festgestellt [worden], dass der Inhalt der Gebietsbefehle oftmals nicht […] weitergegeben wird. Die Gefolgschaftsund Fähnleinführer erhalten daher nochmals die Anweisung, den Inhalt […] zugänglich zu machen.“ Oder GB: Westfalen, A16/38 vom 15.10.1938: „Einige […] beschweren sich darüber, dass sie nie den Gebietsbefehl zu sehen bekommen, obwohl allen Bannen die Gebietsbefehle in genügender Anzahl zugehen.“
Quellen und Materialien
27
lichen Gliederungen – die „Gaubefehle“ des BDM – wird man von einer etwa ähnlichen Größenordnung ausgehen können.49 Die Durchgabe von Anweisungen an einzelne Einheiten, und damit an jene Kinder und Jugendlichen, die ehrenamtlich unterste Führungsränge bekleideten, erfolgte zudem häufig über die so betitelten Befehlsblätter – sozusagen abgespeckte „Gebietsbefehle“, die nur ein oder zwei Anweisungen zu bestimmten Anlässen enthielten. Aufgrund von Papierknappheit, auch weil Dienststellen nicht über genug Personal verfügten und die Befehle zunehmend in rascher Abfolge kurzfristig umgesetzt werden sollten, nahmen diese Anweisungsblätter in der Kriegszeit an Häufigkeit und Bedeutung zu – sie sind noch schwerer lückenlos zu greifen, als alle übrigen Zeitschriften.50 Die Thesen in einzelnen Kapiteln des vorliegenden Buches ergeben sich einerseits aus jenem Sammelsurium und Flickenteppich der oft sehr knapp gehaltenen Befehle und regionalen Berichte. Ging es um Dienstversäumnisse Jugendlicher, die nicht zur Hitlerjugend erscheinen, um Ausweise, die sie fälschen, um Vandalismus, den sie verüben, oder um Selbstermächtigung, der sich Hitlerjungen – entgegen anders lautender Anweisungen – gegen ihre Gegner bedienen, so wurde dies in den Gebietsbefehlen offen zur Sprache gebracht. Die Zeitschriften erlauben andererseits auch Aussagen über das Verhältnis von Stadt zu Land, katholischer zu protestantischer Region, Nord- zu Süddeutschland. Die Dienststellen selbst thematisierten die Unterschiede oder mussten auf Probleme reagieren, die sich aus örtlichen Besonderheiten ergaben.51 Materialien aus einzelnen Stadt-, Kreis- oder Landesarchiven vertiefen Fragestellungen und rahmen zentrale Thesen dieser Studie anhand von Beispielen. Naheliegend hat das Archivmaterial insbesondere zu jenen Themenfeldern Bezug, bei denen die Parteijugendorganisation mit staatlichen Stellen interagieren musste; das Gros des erhaltenen staatlichen Archivmaterials berührt Angelegenheiten um Finanzierung, Mittel- oder Raumbeschaffung sowie über die Hitlerjugend in Schulen. Insbesondere für die Kriegszeit ist das Material reichhaltig, weil Polizei, Kommunen und Justiz die Umsetzung der Jugenddienstpflicht gewährleisten und die Verstöße ahnden mussten. Das Buch greift außerdem auf Publikationen von Stadtarchiven zurück oder pflegt ein, was Geschichtswerkstätten, Sammler oder Dokumentationsstellen über die lokale Hitlerjugend zusammengetragen haben. Das NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln hat sich einen beeindruckenden Bestand erarbeitet, der digitalisiert der Forschung
49 Ausgabe der Gebietsbefehle. In: GB: Thüringen, A 1/38 vom 15.1.1938. 50 1942 betrug im Gebiet Sachsen die Auflage eines einzelnen Befehlsblatts für HJ und Jungvolk 2 800 Exemplare. 51 GB und BB sind in diversen Archiven und Bibliotheken Deutschlands und Österreichs verstreut; ein zentraler Bestand existiert nicht. Ein erheblicher Teil der Ausgaben, auf die hier und im Folgenden verwiesen wird, stammt aus der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig. Auf den Herkunftsort der jeweiligen Ausgabe wird aber im Folgenden zur Vereinfachung nicht verwiesen.
28
Einleitung
im Internet zur Verfügung gestellt wird.52 Um hinter ihre Propaganda-Kulisse zu gelangen, sind nicht zuletzt Gestapo- und Berichte von Gestapo und Sicherheitsdienst (SD) sowie die zeitgenössische Exil- und Auslandspresse von hohem Wert. Sie bringen das Bild einer vermeintlich totalitären und effizient arbeitenden Massenorganisation mitunter erheblich ins Wanken, werfen aber zugleich andere Probleme auf. Auch sie bilden gewiss nicht eine absolute historische Wahrheit ab. Parteinahe und staatliche Stellen, zumal Gestapo oder SD, nutzten ihr Berichtswesen zur Gefahrenerkennung; manches war aber ideologisch getrieben, anderes bewusst überzeichnet. Zudem war Profilierung der Beamten am Werk, indem sie sich als scharfsichtige Mahner präsentierten, denen an Gefahren auffiel, was anderen entging.53 Mit noch mehr Vorsicht sind die Artikel der Auslandspresse oder die Berichte aus Exilkreisen zu genießen, weil deren Negativbild der Hitlerjugend primär zur Gegenpropaganda und Diskreditierung des Regimes diente. Zu vernachlässigen ist das Material gleichwohl nicht, wie anhand der Sexualfrage später gezeigt werden wird. Ob und in welchem Maße beispielsweise Kindesmissbrauch in der Parteijugend existierte, könnte eine eigene Studie noch weitaus intensiver beschäftigen. Von Bedeutung war allerdings, dass solche Vorwürfe und allerlei Gerüchte im Raum standen und auch in der deutschen Bevölkerung kursierten. Sie beeinflussten die Entscheidungsträger und trugen mit dazu dabei, dass sich aus der Jugendbewegung allmählich ein Apparat formte, der in den Alltag junger Menschen reglementierend eingriff. Das genannte Material wird möglichst flankiert von Zeitzeugenberichten, Interviews sowie zeitgenössischen Quellen aus privater Hand, die gleichrangig – obgleich nicht im selben Umfang – neben den klassischen Materialien der Geschichtswissenschaft Verwendung finden. Statt individuelle Erinnerungen als subjektiv oder verfälscht gleich zu verwerfen, sollen sie hier der Beantwortung und dem Aufwerfen neuer Fragen dienen: Wo und in welcher Hinsicht decken sich die Erinnerungen der Zeitzeugen mit den Materialien – gerade in jenen Fällen, die unser herkömmliches Bild von der verführerischen Kraft der Hitlerjugend infrage stellen? Wie ist zu erklären, dass die Berichte über die Mas-
52 Die im Rahmen des Projekts „Jugend! Deutschland 1918–1945“ durch Martin Rüther am NS-Dokumentationszentrum (NSDOK) der Stadt Köln zusammengetragenen Interviews und digitalisierten Nachlässe sind als „Editionen zur Geschichte“ (im Folgenden EzG abgekürzt) auf der Webseite einsehbar (https://jugend1918-1945.de; 28.3.2019). Die im Zuge der Recherchen durch den Verfasser selbst eingeholten Privatdokumente und Interviews sind im Archiv des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung e.V. abgelegt. 53 Zur Quellengattung vgl. Rainer Eckert, Gestapo-Berichte. Abbildungen der Realität oder reine Spekulation? In: Gerhard Paul/Klaus-Michael Mallmann (Hg.), Die Gestapo. Mythos und Realität, Darmstadt 2003, S. 200–215; Alexander Bastian/Christian Stagge, Forschungsbericht zur Geschichte des heutigen Bundeslandes Sachsen-Anhalt im Nationalsozialismus. In: Detlef Schmiechen-Ackermann/Steffi Kaltenborn (Hg.), Stadtgeschichte in der NS-Zeit. Fallstudien aus Sachsen-Anhalt und vergleichende Perspektiven, Münster 2005, S. 150–179.
Quellen und Materialien
29
senorganisation sowohl mit der Propaganda des Regimes als auch mit unseren heutigen Erwartungen häufig in Konflikt zu stehen scheinen? So begegnet man im Schulungsmaterial der Hitlerjugend, um ein Beispiel vorwegzunehmen, dem Rassismus und Judenhass mehr als nur an einigen Stellen. Aber es gibt Zeitzeugen, die behaupteten, damit nie oder wenig in Berührung gekommen zu sein. Statt zu versuchen, sie der Verdrängung oder gleich der Lüge zu überführen, sollen ihre Aussagen ernst genommen werden. Gibt es Hinweise im Material, welche die Berichte – die an Zahl nicht gering ausfallen – stützen, zu erklären oder zumindest einzuordnen helfen? Die Hitlerjugend, die sich in diesem Buch präsentiert, ist eine Massenorganisation, die ihren Angehörigen teils erhebliche Spielräume bot. Junge Menschen nutzten sie – bewusst oder unbewusst – auf unterschiedliche Weise. Sie war eine fragile, prekäre Organisation, insofern sie an der Basis oft anders funktionierte, als es den Dienststellen vorschwebte, und sich das Handeln junger Menschen ihrer Kontrolle häufig entzog. Dennoch konnte sie als wichtige Stütze der Diktatur fungieren. Spielräume in der Hitlerjugend boten sich nämlich nicht nur den Gegnern, die in ihr untertauchten, oder den Desinteressierten, die sich bestmöglich durchzulavieren versuchten. Die Freiräume konnten zur Radikalisierung führen, zur Selbstermächtigung, und auf diese Weise als ideologische Resonanzräume und Verstärker wirken. Beides existierte nebeneinander.
I.
Genese einer Massenorganisation
1. Revolution und Gleichschaltung 1.1 Hitlerjugend als revolutionäres Abenteuer Die Hitlerjugend wurde in Weimar im Juli 1926 offiziell gegründet. Ihrem Führer, Kurt Gruber, übertrug man den neu geschaffenen Posten eines „Reichsjugendführers“ der NSDAP. Der von der Idee eines „nationalen Sozialismus“ überzeugte Aktivist hatte seit vielen Jahren versucht, der Hitler- Bewegung ein organisatorisches Rückgrat in der Jugend zu sichern. Als Student tat er sich 1922 mit Gründung eines NS-Jugendbunds im sächsischen Plauen hervor. Bis 1931 blieb Plauen der Sitz der Reichsleitung der HJ. Hier wurde die Hitlerjugend im Vereinsregister eingetragen: „Der Verein hat den Zweck“, hieß es in der Satzung von 1927, „alle ehrlich schaffenden Kreise der Jugend […] zusammenzuschließen, um […] der Jugend unseres Volkes die Vorbedingungen zur Erringung ihrer einstigen Freiheit und Selbstständigkeit zu schaffen.“1 Sachsen und Thüringen fiel eine besondere Bedeutung in der Frühphase zu. Von hier aus sollte die Bewegung aufgebaut und zur agilen Nachwuchstruppe für Partei und SA heranwachsen: „Wir schaffen einen dichten, breiten Befestigungsgürtel von zahlreichen Ortsgruppen und Stützpunkten rings um unsere Hochburg Plauen“, schrieb Gruber über seine „Trutzburg“ im März 1931.2 Damit ist viel über die Lage der HJ deutschlandweit gesagt, welche – abhängig von der Partei und SA, der sie bis 1933 formal unterstellt blieb – an lokale Möglichkeiten gebunden war. Die frühe HJ war weder straff organisiert noch von Grubers Plauener Reichleitung zentral gelenkt. Die Satzung von 1927 enthielt zur konkreten Organisation, außer dass sich die Bewegung in Gauverbänden organisieren sollte, kaum Angaben.3 Die NS-Jugendbewegung war in der Realität ein chaotisches Gebilde – höchst unübersichtlich und regional verschieden aufgestellt. In der Fläche hatte sie erst mit der Weltwirtschaftskrise 1929 Aufwind bekommen. Nun begann sie, junge Menschen in erheblichem Maße zu mobilisieren. Das Gros der HJ-Einheiten entstand an der Wende zu den 1930er-Jahren.4 Über
1 2 3 4
Satzung der Hitler-Jugend-Bewegung e.V. vom 1.7.1927, S. 2 (StadtA München, Bur 452, 13, unpag.). Bald wehen die Hitlerfahnen. Bericht von der Kampffront der Plauener Hitlerjugend. In: Der Freiheitskampf. Amtliche Tageszeitung der NSDAP im Gau Sachsen vom 3.3.1931. Satzung, S. 4 f. Vgl. beispielsweise Jungvolkgründung bei Bautzen. In: Jungvolk. Deutsche Jungenblätter, (1932) 1, S. 3. Weitere Artikel zur Gründung von HJ-Einheiten oder deren Jubiläen in: Der Freiheitskampf vom 8.8.1930, 27.4.1931 sowie 10.11.1931. Vgl. speziell zum Jungvolk in der „Kampfzeit“ Christoph Schubert-Weller, Hitlerjugend. Vom „Jungsturm Adolf Hitler“ zur Staatsjugend des Dritten Reiches, Weinheim 1993, S. 57–60.
32
Genese einer Massenorganisation
immerhin rund 50 000 männliche Mitglieder verfügte die NS-Jugendbewegung Ende 1932.5 Die HJ war als Nachwuchstruppe für die SA gedacht. Gruber, der eigene Ambitionen verfolgte, hatte Ende 1926 von Hitler jedoch erwirken können, dass ein Junge mit seinem achtzehnten Geburtstag nicht automatisch in die SA übertrat, sondern in der HJ als Unterführer verbleiben konnte. Die „Richtlinien für das Verhältnis von NSDAP und HJ e.V.“ gewährten der Jugendbewegung mehr Eigenständigkeit als bisher.6 Das langfristige Ziel Grubers war es, den chronischen Mangel an Personal zu beseitigen und die missliebige Abhängigkeit von der SA aufzulösen. Die HJ als „zweites Glied der braunen Freiheitsarmee“ musste aus seiner Sicht mehr Freiheiten erhalten, wollte sie auf lange Sicht an Bedeutung gewinnen.7 Die enge Anbindung an die Kampforganisation blieb in der Praxis jedoch bis 1933 bestehen.8 Gruber beklagte „die dauernde Abgabe der reiferen und ausgebildeten Kräfte an die SA“ noch Ende Dezember 1931, nur Wochen nach seiner Entmachtung als Reichsjugendführer der Partei.9 Die Hitlerjugend verstand sich als „nationalsozialistische Jugendbewegung“ und ordnete sich durchaus in die Traditionslinien der deutschen Jugendbewegung ein. Zwar kritisierten die HJ-Führer den älteren Wandervogel oder die Pfadfinder für deren angeblich bürgerlich-schwächliche Haltung. Doch wenn es darum ging, ihren Werbeeffekt zu stärken, suchte die Hitlerjugend an die Tradition der Jugendbewegung anzuknüpfen. Dazu gehörte seit 1928 die Stärkung eines „bündischen“ Elements. Unter dem Begriff firmierte alles, was die Tradition des Wandervogels, der in Kritik an der Industrialisierung um die Jahrhundertwende aufgekommen war, mit einer Vision von Gemeinschaft, Volk und Führung zu verbinden suchte. Im Bund sollte ein neues, echtes und emotionales Gemeinschaftsprinzip verwirklicht werden, aber auch ein Lebensgefühl, das sich nicht an der Rationalität und Technik der kapitalistischen Gesellschaft orientierte. Wie ein Bund im Konkreten aussehen sollte, blieb den Deutungen ihrer Wortführer überlassen. Hinter dem Begriff also stand kein Programm im engeren Sinn, vielmehr ein breites Repertoire an Stilmitteln, mit denen der kalten, leeren oder als erstarrt empfundenen modernen Gesellschaft begegnet werden konnte. Der Bund lebte vom Geist jugendlicher Rebellion gegen Kapitalismus, Technik, Verstädterung, Individualisierung und moralische Nivellierung, auch gegen Parlamentarismus, Parteigeist und Liberalismus. Die bündische Jugendbewegung reichte Ende der 1920er-Jahre in die völkische Bewegung hinein, aber beide 5 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 288. Anfang 1931 sollte, laut Selbstdarstellung, die HJ über 80 000 Mitglieder verfügt haben; vgl. Die Hitlerjugend Plauen. In: Der Freiheitskampf vom 10.1.1931. 6 Abgedruckt bei Schubert-Weller, Hitlerjugend, S. 19. 7 Die schaffende Jugend unter dem Hakenkreuz. Der Hitlerjugendtag in Freiberg. In: Der Freiheitskampf vom 26.8.1930. 8 Schubert-Weller, Hitlerjugend, S. 56. 9 Die Hitlerjugend Plauen. In: Der Freiheitskampf vom 10.1.1931. Im Zusammenhang vgl. Kathrin Kollmeier, Ordnung und Ausgrenzung: die Disziplinarpolitik der Hitler-Jugend, Göttingen 2007, S. 91–93; Brandenburg, Die Geschichte der HJ, S. 22–29, 102–113.
Revolution und Gleichschaltung
33
aren nicht deckungsgleich; so beriefen sich in der Zeit der NS-Diktatur nach w 1933 zahlreiche Jugendliche, die sich der HJ verweigerten, auf eben jene bündischen Traditionslinien, welche die HJ eigentlich zu beerben hoffte.10 Mit der Orientierung an bündischen Formeln und Kulturtechniken versuchte die HJ-Führung in den frühen 1930er-Jahren bislang eher unpolitische Jugendliche für Hitler zu gewinnen. Dass dies auch gelang, zeigt das Beispiel von Franz Schall. Er kam von den romantischen Ausflügen und Zeltlagern der Pfadfinder unversehens zur Hitlerjugend. Unter Grubers Nachfolgern Theodor Adrian von Renteln, der nur etwas mehr als ein halbes Jahr im Amt war, und Baldur von Schirach, der die HJ ab November 1931 prägte, setzte sich diese Entwicklung fort: Politik, Rassismus und kultische Romantik bedingten einander. In Hinblick auf Lieder oder Gedichte bediente sich die HJ bei der Jugendbewegung. Und auch die späteren Uniformen – braunes Fahrtenhemd, Schiffskäppchen, Halstuch mit Lederknoten – hatten hier ihre Vorbilder. Während der Wandervogel jedoch „immer noch untätig“ umherziehe, so meinten die NS-Monatshefte 1930, ließ sich Hitlers Jugend auf der Straße „die Knochen zerschlagen“.11 Romantische Schwärmerei und kultische Feiern wurden ebenso Kennzeichen wie Gewaltverherrlichung und Verrohung. Die bündische Romantik prägte vor allem das Jungvolk, das im März 1931 der Hitlerjugend angegliedert wurde; eine deutsch-völkische Splittergruppe von ursprünglich vernachlässigbarer Größe, die aus der Spätphase des Wander vogels hervorgegangen war. Sie bildete die Grundlage für jene Gliederung der Hitlerjugend, die sich bei Kindern ab 1933 durch ein ausgedehntes Freizeit- und Ferienangebot beliebt machen wollte. Das DJ erfasste später die zehn- bis vierzehnjährigen Jungen, bevor sie in die HJ eintreten konnten.12 Zur NS-Jugendbewegung zählten ab Juni 1932 ferner der Bund Deutscher Mädel sowie der Jungmädelbund.13 Junge Frauen traten in der „Kampfzeit“ durchaus vereinzelt als Straßenaktivistinnen in Erscheinung.14 Später erst wurde von ihnen anderes erwartet – wie es Magda Goebbels 1933 forderte: „Das Ziel der Erziehung der Hitlermädels ist aber ein anderes. Körperliche Erziehung, geistige Schulung, Erfassung des nationalen und sozialistischen Gedankens, um fruchtbringend […] die Aufgaben zu erfüllen, zu der sie von Natur aus bestimmt sind: Frau und Mutter zu sein. […] Den politischen Kampf in Versammlungen und auf der Straße, in S.A.-Heimen und in der Öffentlichkeit überlässt die junge 10 Vgl. Matthias von Hellfeld, Bündische Jugend und Hitlerjugend. Zur Geschichte von Anpassung und Widerstand 1930–1939, Köln 1987; Klönne, Jugend im Dritten Reich; Niemeyer, Die dunklen Seiten der Jugendbewegung. 11 Winfried Kiel, Der Weg der Jugendbünde zum Nationalsozialismus. In: NS-Monats hefte, (1930) 1, S. 59–63, hier 63. 12 Vgl. Brandenburg, Die Geschichte der HJ, S. 53–58. 13 Vgl. ebd., S. 51. Vgl. auch Johanna Gehmacher, Jugend ohne Zukunft: Hitler-Jugend und Bund Deutscher Mädel in Österreich vor 1938, Wien 1994; Martin Klaus, Mädchen im 3. Reich. Der Bund Deutscher Mädel, Köln 1998. 14 Vgl. etwa die gewiss übertriebene Schilderung: Vom BDM. Ein Rückblick auf unsere Kampfjahre. In: Der Thüringer Sturmtrupp, 1933, Sonderausgabe August, S. 14.
34
Genese einer Massenorganisation
ationalsozialistin bedingungslos dem Mann. So wird sie zu ihrem eigentlichen N Wert und zum eigentlichen Sinn ihres Daseins zurückgeführt.“15 Der Altenburger Pfadfinder Franz Schall war im Dezember 1930 der NS-Jugendbewegung beigetreten. Märsche und Propagandafahrten führten den 17-Jährigen fast rastlos durch Thüringen und Sachsen. Die Tagebücher, die er in dieser Zeit schrieb, gewähren Einblicke in jene irritierende Faszination, welche die Hitlerjugend ausüben konnte.16 Sie wiegelte gegen die Alltagsautoritären auf: Lehrer, Arbeitgeber und Eltern. Die Älteren, meinte Schall dann Ende 1933, würden den Sieg der Bewegung noch nicht völlig erfassen oder in sich aufnehmen können. Das Altgewohnte würden sie in den neuen Staat immer wieder hinüberzuretten versuchen. „Wir Jungen dagegen sind unbelastet“, war er überzeugt, „ganz unserer Bewegung innerlich wie äußerlich verschrieben und müssen nun mit […] Fanatismus den harten Kampf der Verwirklichung aufnehmen.“17 Die Hitlerjugend bot ein gefährliches Revolutionsabenteuer und einen Ausbruch aus der Enge der Kleinstädte. Werbe- und Propagandafahrten, die Schall in seinem Tagebuch im Detail festhielt, gehörten besonders im ländlichen Raum der späten Weimarer Jahre zu prägenden Erlebnissen. Das Ziel der Werbefahrten war es, die Jugend zur Gründung neuer Ortsgruppen zu motivieren. Für Mitteldeutschland besaß Plauen wesentliche Bedeutung. Die HJ-Zentrale wurde als RJF 1931 derweil nach München verlegt, bevor sie 1933 nach Berlin kam. Bei den Reichstagswahlen schulterte die HJ zahlreiche Aufgaben: Flugzettel wurden verteilt, Plakate geklebt, weshalb sie als „Klebekolonne“ der SA galt, und mit Gesang durch die Orte marschiert.18 Die Parole „Jugend führt Jugend“ speiste sich aus der „Kampfzeit“, war nicht bloß Propaganda, sondern spiegelt die Situation einer radikalen Jugendbewegung. Die Arbeiterhochburgen und von der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) geprägten Viertel wurden gezielt angesteuert. „Wir wollen ja“, schrieb Schall nach einem Marsch im August 1931, „die anständige Jugend aus den marxistischen Nestern aufmerksam und stutzig machen, um gerade sie für unsere Ideen zu gewinnen.“19 Eine Provokation der Gegner und zugleich heroisches Aben teuer für die eigenen Reihen: „Heute marschiert eine andere Armee auf den Straßen“, hatte Gruber im Mai 1930 bei einem Aufmarsch dem Gefolge zugerufen: „Die braunen Bataillone der nationalsozialistischen Freiheitsbewegung. Schaffende deutsche Arbeiterjugend, die unter den blutroten Hakenkreuzfah-
15 Magda Goebbels, Geleitwort. In: Eva Maria Wisser, Kämpfen und Glauben. Aus dem Leben eines Hitlermädels, Potsdam 1933, S. 3. 16 Vgl. André Postert, Hitlerjunge Schall. Die Tagebücher eines jungen Nationalsozialisten, München 2016, S. 7–27. 17 Ebd., S. 284. 18 Vgl. Klönne, Jugend im Dritten Reich, S. 19; Brandenburg, Die Geschichte der HJ, S. 30–45; Schubert-Weller, Hitlerjugend, S. 63–68. Die Bedeutung Plauens zur Gründung neuer HJ-Ortsgruppen unterstreichen diverse Artikel, z. B. der Bericht von der Kampffront der Plauener Hitlerjugend. In: Der Freiheitskampf vom 3.3.1931. 19 Postert, Hitlerjunge Schall, S. 70.
Revolution und Gleichschaltung
35
nen […] sich auf ihre völkische und rassische Kraft besonnen hat und bereit ist, die Herrschaft des Untermenschentums auf der Straße zu brechen.“20 Das Ziel, aus der Arbeiterbewegung zu rekrutieren, konnte die Hitlerjugend trotz ihres Bemühens um sogenannte Jungarbeiter aber nur begrenzt einlösen. Linke Jugendorganisationen – wozu maßgeblich der Kommunistische Jugendverband Deutschlands (KJVD) sowie die Sozialistische Arbeiterjugend (SAJ) zählten – hielten bis 1933 ihr Mitgliederniveau. Keinesfalls liefen, wie die NS-Propaganda behauptete, Jugendliche aus dem Arbeitermilieu in Scharen über, wenngleich in einzelnen Fällen – wie in Chemnitz, wo die SAJ 1932 offenbar viele Jugendliche verlor – seitens der Hitlerjugend Erfolge vermeldet werden konnten.21 Viele kamen aus der Mittelschicht und dem Kleinbürgertum, wo soziale und ökonomische Abstiegsängste verbreitet waren. Ab 1929 fungierte der NS-Schülerbund häufig als die Keimzelle für neue HJ-Einheiten, weshalb Schüler aus bürgerlichen Familien vergleichsweise häufig beteiligt waren. Eine kleine HJ-Ortsgruppe im sächsischen Pirna beispielsweise, gegründet im Juli 1930, nahm ihre Anfänge an höheren Schulen.22 Auch der Akademikersohn Schall stieß vom Schülerbund seines Gymnasiums zur HJ hinüber, die in Altenburg gerade gegründet worden war.23 In Eberswalde in Brandenburg fanden sich nahezu zeitgleich einige junge Menschen vor Ort als Hitlerjugend zusammen. Rückblickend unterstrich man den Ursprung als revolutionäre Kampfjugend: „Aus einer kleinen, scheinbar verlorenen Schar von Partei- und Jugendgenossen, umgeben von einer erdrückenden Zahl hasserfüllter Gegner, sollte die Idee des Führers in die breiten Massen der deutschen Jugend getragen werden. Und was heute als selbstverständlich angesehen wird, erschien damals phantastisch. […] Im Übrigen tanzte die Jugend Niggertänze und berauschte sich an der inhaltlosen Musik jüdischer Dirigenten. Da griff die Faust eines materialistischen Zeitalters unbarmherzig an die Kehle der deutschen Jugend. Also mussten wir zupacken und dem jungen Menschen einen Halt geben, wir mussten ihn dort hinstellen, wohin er gehörte: in die Front der deutschen Jugend, die sich selbstbewusst ihren Weg erkämpfte.“24 In Danzig war die HJ schon 1929 entstanden. Der junge Bannführer Heinz Glashagen blickte 1933 ganz ähnlich zurück: „Man verachtete, man verhöhnte uns, man stellte uns hin als dumme Jungens […]. Der Spott hatte uns nicht geschadet, er hat nur wehgetan […]. Wir werden
20 Kurt Gruber, Jungarbeiter, höret die Signale! In: Sturmjugend. Kampfblatt schaffender Jugend, (1930) 50, S. 68. 21 Vgl. Der Aufruhr in der SAJ schreitet fort. In: Der Freiheitskampf vom 8.1.1932. Vgl. zu den Schwierigkeiten der HJ im Arbeitermilieu exemplarisch Brandenburg, Die Geschichte der HJ, S. 93. 22 Zwei Jahre Hitler-Jugend Pirna. In: Der Freiheitskampf vom 10.11.1932. 23 Vgl. Postert, Hitlerjunge Schall, S. 40–42; zur Zusammenarbeit von NS-Schülerbund und HJ siehe Vormarsch der Hitlerjugend. In: Der Freiheitskampf vom 8.4.1931. 24 O. V., Aus der Zeit der Gründung der Oberbarnimer Hitler-Jugend. Zur Chronik des HJ-Bannes 196. In: Oberbarnimer Kreiskalender, Oberbarnim 1939, S. 44–46, hier 44.
36
Genese einer Massenorganisation
es nie vergessen, jene Zeit, in der in uns der Hass groß wurde gegen Marxismus und Bürgertum.“25 In den Industriezentren und Metropolen – im Ruhrgebiet, in Hamburg oder Berlin – blieb die Hitlerjugend in den Anfängen stecken; nach 1933 blieben viele Großstädte weiterhin ein hartes Pflaster. Das gestand die HJ-Führung in Berlin-Schöneberg unumwunden ein: „Es taten sich wohl Gruppen und Grüppchen auf […], die aber mit den wesentlichen Grundzügen der HJ nichts zu tun hatten. Die Folge davon war, dass der überwiegend gute Teil dieser Jungen zur SA kam. Erst im Jahre 1932 und später wurde es anders. Die Hitler-Jugend der ‚roten Insel‘ schloss sich zusammen und man konnte von da an erst von einer wirklichen Aufwärtsbewegung der Schöneberger HJ sprechen.“26 In Leipzig, wo seit Mitte der 1920er-Jahre wenige Hundert zur HJ zählten, tat sie sich gegen die Arbeiter- und konfessionelle Jugend ebenfalls schwer.27 Die Hitlerjugend war noch primär ein mittel- und süddeutsches Phänomen und in Kleinstädten erfolgreicher als in Metropolen. Für die HJ war wohl ähnliches zutreffend wie für die SA, von der Zeitgenosse Heinrich Bennecke später schätzte, dass „die Zahl der ehemaligen Marxisten […] höchstens 10 [Prozent]“ betragen habe.28 Artur Axmann, der die HJ in Berlin 1932 – zwischenzeitlich war sie von der Bildfläche offenbar gänzlich verschwunden – neu aufzubauen begann, konstatierte rückblickend, in der ihm typischen Art eines unbeirrten Nationalsozialisten, aber doch nicht ganz zu Unrecht: „Wenn ein junger Idealist aus dem Kommunistischen Jugendverband oder der Sozialistischen Arbeiterjugend zu uns übertrat, so wog das […] viel schwerer als der Übertritt eines Jungen aus den bürgerlichen Jugendverbänden. Die Kommunisten waren gewohnt, konsequent zu kämpfen.“29 In den Metropolen erlebte die versprengte Hitlerjugend ihr eigenes Revolutionsabenteuer. Eine Flut ideologischer Erinnerungsberichte, die ab 1933 auf den Buchmarkt schwemmte, verherrlichte den Einsatz junger Männer in den Zentren der Arbeiterbewegung: „Es ist der Hitlerjunge“, so schrieb der HJ-Funktionär Willi Ruder, der in Frankfurt am Main seine politische Laufbahn begonnen hatte, „der sich nachts durch die Straßen stehlen muss, weil ein vertiertes Untermenschentum ihm auflauert. Der gleiche, der diesen oft ekelhaften Kampf gegen Gemeinheit, Terror, Verleumdung, Lüge und blinden Hass zu 25 Heinz Glashagen, Die Geschichte der Danziger Hitlerjugend. In: Hitlerjugend Danzig (Hg.), Hitler-Jugend-Tag, Bann Danzig, 23.–24. September 1933, Danzig 1933, S. 6–13, hier 7. 26 Der Führer der Brigade 31, Oberführer Walch, grüßt den Bann 278. In: Das Gesicht der Hitler-Jugend. Den Freunden der Schöneberger Jugend zum 1-jährigen Bestehen des Bannes 278, Berlin 1934, S. 4. 27 Vgl. Alexander Lange, Meuten – Broadway-Cliquen – Junge Garde. Leipziger Jugend gruppen im Dritten Reich, Köln 2010, S. 32–56. 28 Zit. nach Andreas Peschel (Hg.), Die SA in Sachsen vor der „Machtübernahme“. Nachgelassenes von Heinrich Bennecke (1902–1972), Beucha 2012, S. 39. 29 Artur Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein. Hitlers letzter Reichsjugendführer erinnert sich, Koblenz 1995, S. 40. Vgl. auch Brandenburg, Die Geschichte der HJ, S. 116–119.
Revolution und Gleichschaltung
37
führen hat, behält in seinem Herzen von seinem Führer und seiner Idee ein so leuchtendes, herrliches Bild, dass er andere mitreißt, überzeugt, zu Kämpfern macht.“30 Je greller man die Gefahren im Rückblick zeichnete, desto mehr schien sich die Hitlerjugend als kämpferische Jugendbewegung bewährt zu haben. Das sollte sie von der älteren Jugendbewegung unterscheiden. Baldur von Schirach, der seit 1931 als neuer Reichsjugendführer den romantischen Stil der Jugendbewegung glatt kopierte, verzichtete auf dieses Bürgerkriegspathos im Rückblick nicht: „Die HJ gewann in dieser Zeit ihr bestes Menschenmaterial. Was in dieser Verbotszeit zu uns stieß, Mädel oder Junge, setzte alles aufs Spiel. Tausende und aber Tausende sind damals von der Schule geflogen oder sind arbeitslos geworden – sie hingen nur umso verbissener an unserer Fahne. Es war eine große Zeit, und so merkwürdig es klingen mag: Wir sind nie glücklicher gewesen als damals, als wir in beständiger Gefahr lebten. Wir fuhren mit der Pistole in der Manteltasche durch das Ruhrgebiet, während die Steine hinter uns herflogen. Wir zuckten bei jedem Läuten zusammen, weil wir dauernd Hausdurchsuchungen und Verhaftungen befürchten mussten.“31 Bei Straßenschlachten waren Hitlerjungen oft beteiligt. Die gewaltsame Eskalation wurde mitunter bewusst in Kauf genommen: „Der rote Mob von Striesen wollte Aufruhr machen“, notierte Hitlerjunge Schall im Sommer 1932, „aber die Polizei und wir waren auf dem Posten. […] Den roten Terror […] bricht nur die staatliche Macht in unserer Hand. Deshalb: Angetreten zum Kampf! Morgen geht’s durchs rote Löbtau.“32 Bis zum April 1933 hatten 21 Hitlerjungen mit ihrem Leben gebüßt. Der Märtyrerkult um Herbert Norkus, getötet im Januar 1932 in Berlin-Moabit, ist bis heute gut bekannt; nach 1933 hatte man ihn zum „Symbol der Opferbereitschaft aller Jugend, die Hitlers Namen trägt“ erhoben.33 Die Hitlerjugend griff schon in der Dämmerung der Republik auf viele weitere Heldenfiguren aus den eigenen Reihen zurück. Im mitteldeutschen Raum wurde Werner Gerhardt verehrt, ein Arbeiterjunge aus Zeitz, der Ende Juni 1932 Messerverletzungen erlag, die ihm angeblich hinterrücks ein Reichsbannermann zugefügt hatte.34 In Sachsen wurden zwei weitere Hitlerjungen als Märtyrer verehrt. Nach Hans Queitzsch, der als Schüler zur HJ gekommen war und 1927 getötet wurde, benannte man in Chemnitz eine Straße. Rudolf Schröter aus Leipzig war bei einer SA-Demonstration 1931 tödlich verwundet worden. Er wurde zum Namens patron der im April 1934 eröffneten Dresdner NAPOLA.35
30 Willi Ruder, Hitler-Jugend. In: Will Vesper (Hg.), Deutsche Jugend. 30 Jahre Geschichte einer Bewegung, Berlin 1934, S. 188–201, hier 192. 31 Baldur von Schirach, Die Hitler-Jugend. Idee und Gestalt, Berlin 1934, S. 26. 32 Postert, Hitlerjunge Schall, S. 178. 33 Baldur von Schirach, Vorwort. In: Rudolf Kamlow, Herbert Norkus? – Hier! Von Opfer und Sieg der Hitler-Jugend, Stuttgart 1933, S. 5. 34 Gerhard Heyne, Werner Gebhardt. Ein Vermächtnis an die Zukunft. Im Auftrage der Gebietsführung Mittelland der Hitler-Jugend, Halle o. D. (vermutlich 1934). 35 Heinz Görz/Franz-Otto Wrede, Unsterbliche Gefolgschaft, Berlin 1936, S. 7 f.
38
Genese einer Massenorganisation
Die Hitlerjungen glaubten an einen Zukunftsstaat, der ein Versprechen auf Teilhabe und Aufstieg beinhaltete. Jugendliche traf die Wirtschaftskrise hart. Von den rund sechs Millionen Arbeitslosen war 1932 schätzungsweise jeder Sechste unter 25 Jahren. Kaum jemand konnte in dieser Zeit erwarten, eine Lehre oder einen sicheren Arbeitsplatz zu finden.36 Hitler, hieß es, würde einer vernachlässigten Generation zu ihrem Recht verhelfen: „Wir Hitlerjungens“, schrieb Schall 1932, „haben den Glauben, und wenn auch Vergangenheit und Gegenwart wie ein schwarzes Gemälde sind, so bleibt uns der Glaube an Adolf Hitler und an sein Reich, das er uns bauen helfen wird; ein Reich der Freiheit, des Glaubens und der sozialen Gerechtigkeit.“37 Nur wenige Monate später – heute klingt es nach erschreckend düsterer Prophezeiung: „Deutschlands verratene Jugend lässt Euch nicht mehr schlafen. Wir sind wach und werden einst auf den Trümmern, die Ihr uns gelassen habt, ein Reich bauen, das mit Euren Begriffen von Staat nichts zu tun hat!“38 1.2
Gleich- und Ausschaltung der organisierten Jugend
Der Januar 1933 beendete die „Kampfzeit“ und eröffnete eine neue Phase auch für die Geschichte der Hitlerjugend. Die RJF wurde mit der weltanschaulichen Erziehung der gesamten Jugend betraut: „Zur […] Durchdringung der Jugend mit nationalsozialistischem Geist […] bedarf es einer weitreichenden, alle Lebensgebiete berührenden geistigen Schulung.“39 Schritt für Schritt wurden konkurrierende Organisationen zerschlagen oder mehr oder minder freiwillig eingegliedert; zunächst mit Ausnahme der katholischen Jugend, die seit Juli 1933 unter dem Schutz des Reichskonkordats stand. Nach 1933 veränderte die Hitlerjugend allmählich ihr Gesicht. Aus einer dynamischen, chaotischen, radikalen Jugendbewegung wuchs ein behäbiger Apparat. Im Rückblick scheint dies in der Logik der Gleichschaltungspolitik eines totalitären Staates zu liegen, aber die Entwicklung stand zur Programmatik der Hitlerjugend, die sich den Charakter einer Bewegung und Kampfjugend bewahren wollte, stark im Widerspruch. Zur Sommersonnenwende am 24. Juni 1933 beging das Regime das erste offizielle „Fest der Jugend“. Zehntausende Mädchen und Jungen wurden auf Geheiß der RJF auf Plätzen, Wiesen und Freilichtbühnen versammelt, um mit völkischem Kult – Fahnen, Liedern, „Feuersprüchen“ und Lagerfeuern – die politische „Erneuerung“ von Volk und Nation zu feiern. Zum ersten Mal nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 marschierte die Jugendorganisation landesweit auf. Sie tat es jedoch nicht allein. Die Kolon36 Zur Aufschlüsselung verschiedener Zahlen vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 510–512. 37 Postert, Hitlerjunge Schall, S. 90. 38 Ebd., S. 98. 39 Fritz Helke, Totale Jugend. In: Ruf der Jungen. Führerblätter der westdeutschen Hitler- Jugend, (1934) 1, S. 2–8, hier 3.
Revolution und Gleichschaltung
39
nen wurden von Schulklassen mit Lehrern, Mitgliedern der konfessionellen Jugendorganisationen sowie den kleineren Jugendbünden und Sportvereinen begleitet, die zur Teilnahme aufgefordert worden waren.40 Das „Fest der Jugend“ sollte die Vitalität des neuen Staates unter Beweis stellen und bekräftigen, dass die junge Generation – nicht nur eine Parteijugend – geschlossen zu Hitler stand. In Hannover ergriff Baldur von Schirach selbst das Wort: „Wenn ich euch in dieser gewaltigen Anzahl vor mir sehe, denke ich daran, dass es erst eine verhältnismäßig kurze Zeitspanne her ist, dass wir zum Staat und zur Führung des Staates ein anderes Verhältnis besitzen. […] Es ist immer so, dass eine Staatsführung immer nur stark ist, sofern sie die Jugend hinter sich hat. […] Der sterbende Staat von Weimar wurde durch eine revolutionäre Jugendbewegung abgelöst, die in sich bereits einen neuen lebendigen Staatsbegriff verkörperte zu einer Zeit, als der Staat nur noch eine Form ohne Inhalt war. So setzte die Jugend an die Stelle des Apparates, der Maschinerie und Bürokratie das lebendige Leben, und so entstand dieser Staat von heute.“41 Die Hitlerjugend trat mit dem Anspruch auf, dass sie für die Jugend in ihrer Gesamtheit spreche; nicht nur für jene, die ihr folgten. Die Spaltung in viele Organisationen, Vereine, Gruppen und Bünde sollte aufgehoben und die junge Generation zur Einheit geformt werden. Mit dieser Forderung standen die Nationalsozialisten längst nicht allein. Weit über das völkische Spektrum hinaus war in der Jugendbewegung Weimars das Partei- und Klassendenken zum Symptom einer Krisis der Gegenwart erklärt worden. Die HJ unterschied sich nur durch die Mittel und Wege und durch die Vorstellung davon, was Vereinigung in der konkreten Praxis bedeutete. Die RJF hatte die Zerschlagung der organisierten Konkurrenz von Beginn an im Auge. 1934 bewies dies Reichsjugendführer Schirach erneut in aller Deutlichkeit: „Die Organisation der HJ erklärt sich zur einzigen und alleinigen Vertretung der deutschen Jugend. Das ist ihr Totalitätsanspruch. Wie die NSDAP die einzige Partei Deutschlands ist, so ist die HJ die einzige deutsche Jugendorganisation.“42 Nach gängiger Lesart stand zu Beginn der Gleichschaltung eine kühne Einzelaktion: Am 5. April 1933 drangen, unter der Leitung von Stabsführer Karl Nabersberg und auf Geheiß Schirachs, rund 50 junge Männer in die Geschäftsstelle des Reichsausschusses der deutschen Jugendverbände (RddJ) ein. Das Bürogebäude in der Berliner Alsenstraße im Botschaftsviertel wurde besetzt, Akten wurden beschlagnahmt.43 In der Republik hatte der Verband das Gros
40 Zum Aufruf des Reichsinnenministers im Wortlaut vgl. Am 24. Juli: Fest der Jugend. In: Hamburger Anzeiger vom 9.6.1933. 41 Rede zit. nach Kurt Maßmann, Hitlerjugend – Neue Jugend! Vom Wege der Jugend in die deutsche Zukunft, Breslau 1933, S. 66–69. 42 Schirach, Idee und Gestalt, S. 69. 43 Buddrus, Totale Erziehung, Band 2, S. 1 191; Ernst Klee, Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945, Frankfurt a. M. 2005, S. 427; Die Geschäftsstelle des Reichsausschusses der Deutschen Jugendverbände. In: Das Junge Deutschland, (1930) 4, S. 211.
40
Genese einer Massenorganisation
der Jugendarbeit koordiniert und unter seinem Dach versammelt. Schätzungsweise neun Millionen Kinder und Jugendliche aus den verschiedenen Bünden, Vereinen oder Organisationen waren durch den RddJ erfasst worden – und damit etwa 40 Prozent aller männlichen und weiblichen Kinder und Jugendlichen im Alter bis 21 Jahren.44 Plötzlich war diese Dachorganisation handlungsunfähig. Die Akten und Unterlagen gaben der RJF umfänglich Auskunft: „Im Reichsausschuss gewannen wir ein ungeheures Material. Es war uns mit einem Schlage möglich, die Stärke aller deutschen Jugendverbände festzustellen“, konstatierte Schirach ein Jahr später.45 Die mit Abstand größte Gruppe im RddJ bildeten mit rund einer Million Mitglieder die Sportvereine. Ihnen folgten die christlichen Jugendverbände nach, dann kamen die Parteiorganisationen sowie die Gewerkschaftsjugend, zuletzt die diversen Jugendbünde.46 Die HJ hatte zu keinem Zeitpunkt dem RddJ angehört und bewusst Abstand gehalten. Aus der Sicht Schirachs war diese Dachorganisation ein „echt demokratisches Gebilde“, das man nun okkupieren und ausschalten musste, bevor sich der Monopolanspruch der Hitlerjugend durchsetzen ließ.47 Schirach nutzte die neue innenpolitische Lage, welche die Reichstagsbrandverordnung vom Februar und das „Ermächtigungsgesetz“ vom März 1933 geschaffen hatten, rücksichtlos aus. Sozialdemokratische, kommunistische und jüdische Jugendverbände wurden am 22. April aus dem RddJ ausgeschlossen. Der sozialdemokratische Geschäftsführer Hermann Maaß wurde entlassen. Ludwig Vogt, der Vorsitzende, fügte sich Schirach mehr oder weniger widerwillig; er fand später in der RJF in neuer Anstellung Verwendung. Das Vorgehen wiederholte Schirach kurz darauf beim Reichsverband der deutschen Jugendherbergen, dessen rund 2 000 Herbergen zukünftig unter der Kontrolle der RJF standen.48 Der Besuch von Herbergen, die in kirchlicher Hand waren, wurde der Hitlerjugend nach und nach verboten, ab 1934 der neue HJ-Streifendienst (SRD) zur Überwachung eingesetzt sowie Gebäude mit der Zeit geschlossen oder übernommen.49 Hitler belohnte den Aktionismus, indem er Schirach am 17. Juni 1933 zum „Jugendführer des deutschen
44 Zur Schwierigkeit, verlässliche Zahlen zu nennen, vgl. Thomas Rauschenbach, Jugendverbände im Spiegel der Statistik. In: ders./Hans Gängler/Lothar Böhnisch (Hg.), Handbuch Jugendverbände: eine Ortsbestimmung der Jugendverbandsarbeit in Analysen und Selbstdarstellungen, Weinheim 1991, S. 115–131, hier 122–124. 45 Schirach, Idee und Gestalt, S. 33. 46 Rauschenbach, Jugendverbände, S. 121 f. 47 Vgl. hierzu und zum Folgenden Georg Usadel, Entwicklung und Bedeutung der na tionalsozialistischen Jugendbewegung, Bielefeld 1934, S. 57 f. Vgl. auch die Aussagen Schirachs beim Verhör in Nürnberg durch Col. Thomas S. Hinkel am 11.10.1945, S. 13–15 (NARA, M1270, 647749, unpag.). 48 Eva Kraus, Das Deutsche Jugendherbergswerk 1909–1933. Programm. Personen. Gleichschaltung, Berlin 2013, S. 199 f. 49 Vgl. als Auswahl u. a. Aufgelöste Jugendherbergen. In: GB: Westfalen, A21/37, 21.12.1937; evangelische Jugendburg Wernfels. In: GB: Franken, 4/37 vom 4.1937; Sperrung einer christlichen Jugendherberge in Potsdam („Pfingsthof“). In: GB: Kurmark, 7/36 vom 3.4.1936.
Revolution und Gleichschaltung
41
Reiches“ ernannte. Als solcher stand er „an der Spitze aller Verbände der männlichen und weiblichen Jugend, auch der Jugendorganisationen von Erwachsenenverbänden“.50 Der Besetzung der RddJ-Zentrale gingen andernorts ähnliche Aktionen voraus. Es war nicht die einzigartige Tat, zu der sie im Nachgang stilisiert wurde. In Hamburg wurde der Landesausschuss des RddJ schon früher entmachtet. Dort hatte ihm der Senat Ende März die staatliche Anerkennung entzogen. Der Hamburger HJ-Bann wurde beauftragt, einen neuen Ausschuss zu bilden. Geschäftsstelle, Akten und Kasse des Landesausschusses übernahm die Hitlerjugend. Im zu bildenden neuen Ausschuss sollten die Jugendverbände der Hansestadt unter der Führung der Parteijugend neu geordnet werden. Nur jene sollten Aufnahme finden, „die den neuen Staat nicht bekämpfen oder ablehnen, sondern sich vielmehr zu ihm bekennen. Marxistische, artfremde und staatsfeindliche Verbände und Gruppen […] werden in den Ausschuss der Hamburger Jugendverbände nicht aufgenommen.“51 Wilhelm Kohlmeyer, der gewiefte HJ-Bannführer, trat mit einer Einladung an die Öffentlichkeit: alle nationalen Organisationen seien willkommen. Würden sie sich zu Hitler bekennen und für den neuen Staat eintreten, dann stünde ihrer Mitarbeit nichts im Wege. Tatsächlich wurde der Ausschuss unter Kohlmeyers Leitung Anfang April konstituiert; zeitgleich schuf Schirach in Berlin Tatsachen.52 Ein Teil des HJ-Führerkorps glaubte wohl tatsächlich noch, dass die Besetzung des RddJ in einer Sammlung nationaler Jugendverbände unter Ägide der Hitlerjugend münden würde. Nicht allen HJ-Führern war das heute Selbstverständliche ersichtlich, nämlich dass der Totalitätsanspruch, den Schirach und das Regime formulierten, auf die Zerstörung aller Konkurrenz hinauslief. Ende April organisierte der Ausschuss in Hamburg einen Fackelmarsch der nationalen Jugendorganisationen, unter Führung der Hitlerjugend, mit angeblich 10 000 Teilnehmern.53 Schnell jedoch zeigte sich, dass es Schirach um mehr ging: nicht nur um den Führungsanspruch, sondern um die „Schaffung einer großen Jugendorganisation, die […] nur die HJ. sein konnte“.54 Die Besetzung des RddJ war dabei lediglich Etappe. Am 22. Juni wurde er mitsamt seinen Landesausschüssen abgewickelt. Der Weg zum Monopol war für die Hitlerjugend geebnet.55 Die revolutionäre Phase der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ traf die Arbeiterbewegung zuerst. Rund 700 000 junge Menschen waren um 1930 von den linken Jugendorganisationen, die dem RddJ angehörten, erfasst 50 Wolffs Telegraphisches Büro über die Ernennung Baldur von Schirachs zum Jugendführer des Deutschen Reiches (17. Juni 1933). In: Jakob Benecke (Hg.), Die Hitler-Jugend 1933–1945. Programmatik, Alltag, Erinnerungen. Eine Dokumentation, Weinheim 2013, S. 100. 51 Neuordnung der Jugendbewegung. Ausschuss der Hamburger Jugendverbände. Aufruf des HJ-Banns Hamburg. In: Hamburger Nachrichten vom 29.3.1933. 52 Die Neuordnung der Hamburger Jugendbewegung. In: ebd. vom 7.4.1933. 53 Riesenaufmarsch nationaler Jugend. In: Altonaer Nachrichten vom 19.4.1933. 54 Schirach, Idee und Gestalt, S. 36. 55 Bildung des deutschen Jugendführerrats. Auflösung mehrerer Jugendverbände, 22. Juni 1933. In: Hamburger Nachrichten vom 23.6.1933.
42
Genese einer Massenorganisation
worden.56 Die Vereine wurden nach der Reichstagswahl am 5. März 1933 rasant zerschlagen: Die sozialistische Jugend, z. B. „Rote Falken“ und „Jungfalken“, sowie linke Jugendsportvereine wurden per Gesetz aufgelöst und in der Praxis mitunter gewaltsam verfolgt.57 Jugendhäuser und Volksheime wurden besetzt und in einzelnen Fällen kurzerhand zu Dienstgebäuden der Hitlerjugend umfunktioniert. Zwar residierte man, wie später zu zeigen ist, oft weiter in Kellerräumen oder Baracken, gerade in Kleinstädten – selbst an den Stadträndern Berlins war man Ende 1934 auf stillgelegte Eisenbahnwagen angewiesen – aber konkurrierende Einrichtungen in den Metropolen hatte die Hitlerjugend im Frühjahr 1933 vielfach okkupiert.58 Für Kinder und Jugendliche begann eine Phase der Orientierungslosigkeit, wie sie Werner Mork, geboren 1921, beispielhaft schilderte. Von den aufgelösten „Falken“ stieß er zu den Pfadfindern; und als auch die aufgelöst waren, ging er in die evangelische Jugend, um schließlich doch in der Hitlerjugend zu landen.59 Die Älteren aus SAJ und dem KJVD setzten sich derweil mit Flugblättern, mit Gewalt oder Sabotage zur Wehr. Der leitende Kopf der SAJ, Erich Ollenhauer, stand jeder Gewaltausübung allerdings mit Skepsis gegenüber. Er plädierte im April 1933 für die Selbstauflösung und Reorganisation der sozialdemokratischen Arbeiterjugend in legaler Form – ein Konzept, das illusorisch anmutet und das es in der Tat war. Er siedelte mit dem Exilvorstand der SPD einen Monat später nach Prag über. Der Streit darüber, ob und in welcher Form der Weg in den Untergrund beschritten werden sollte, engte die Aktionsmöglichkeiten der Sozialdemokratie und der politischen Linken insgesamt von Beginn ein. Bereits Mitte März waren die Arbeiterjugendorganisationen in mehreren Ländern – in Sachsen, Bayern, Baden und Württemberg – verboten worden.60 Die linken Gruppen waren untereinander zu zerstritten, um Widerstand effektiv zu organisieren. Die spätere DDR-Geschichtsschreibung hat oft das Zerrbild eines festen antifaschistischen Blocks gezeichnet, in welchem junge 56 Rauschenbach, Jugendverbände, S. 123. 57 Vgl. Anordnung des Reichskommissars in Baden zur Auflösung der Vereine und Verbände der Arbeiterbewegung (30.3.1933). In: Dirk Erb (Hg.), Gleichgeschaltet. Der Nazi-Terror gegen Gewerkschaften und Berufsverbände. Eine Dokumentation, Göttingen 2001, S. 154 f. 58 Zur Besetzung von Häusern der Arbeiterjugend beispielsweise in Köln vgl. Westdeutscher Beobachter vom 14.4.1933, 2.5.1933 sowie 28.6.1933. Im Zusammenhang vgl. hier Eisenbahnen als HJ-Heime. In: BB: Berlin, 65/34 vom 24.11.1933. Zur Besetzung von Volksheimen Ursel Hochmuth/Gertrud Meyer, Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand 1933–1945. Berichte und Dokumente, Frankfurt a. M. 1969, S. 52–54. 59 Zeitzeugenbericht von Werner Mork, Pfadfinder und Hitler-Jugend 1933 (DHM. Lebendiges Museum Online, https://www.dhm.de/lemo/zeitzeugen/werner-mork- pfadfinder-und-hitler-jugend-1933.html; 16.9.2019). 60 Wolfgang Uellenberg-van Dawen, Gegen Faschismus und Krieg. Die Auseinandersetzungen sozialdemokratischer Jugendorganisationen mit dem Nationalsozialismus, Essen 2014, S. 167–175; Gerhard Paul/Klaus-Michael Mallmann, Milieus und Widerstand. Eine Verhaltensgeschichte der Gesellschaft im Nationalsozialismus, Bonn 1995, S. 209 f.; Tilman Fichter, SDS und SPD. Parteilichkeit jenseits der Partei, Opladen 1988, S. 112 f.
Revolution und Gleichschaltung
43
Kommunisten gar „mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, den Kampf der Katholiken zu unterstützen“ versucht hätten.61 In Wahrheit handelte es sich stets um mutige Einzelgänger, kleinste informelle Netzwerke, die miteinander sporadisch in Kontakt standen. Sie arbeiteten unter großer Gefahr. Die junge Kommunistin Anna Pröll, die als 17-Jährige in Augsburg im Widerstand tätig war und Flugblätter verteilt hatte, wurde im September 1933 verhaftet, im Juni des folgenden Jahres zu neun Monaten Gefängnis verurteilt und anschließend ins Frauen-KZ Moringen verschleppt.62 Seit dem Frühjahr 1933 gelang es der Hitlerjugend zudem, verstärkt aus dem Arbeitermilieu sowie junge Lehrlinge für sich zu gewinnen.63 Mehrere SAJ-Bezirke hatten sich noch vor den offi ziellen Verboten von selbst aufgelöst, was üblicherweise damit begründet wird, sie hätten ihre „Mitglieder vor Verfolgungen zu bewahren“ gesucht.64 Ob dieses Motiv als Erklärung allein ausreicht, scheint aber fraglich. Die HJ drang in der ersten Phase der „Machtergreifung“ in das Arbeitermilieu mit wachsendem Erfolg ein. Erich Pohlmann aus Bielefeld ist ein typischer Fall. Aufgewachsen im SPD-Umfeld, hatte der Jugendliche kurz mit den nationalliberalen, radikal basisdemokratischen Jungdeutschen Orden geliebäugelt. Seine Ablehnung der Hitlerjugend und der NS-Herrschaft im Allgemeinen vertraute er seinem Tagebuch über lange Zeit ausführlich an. Schließlich gab er seine ablehnende Haltung aber doch auf. Der junge Fabriklehrling trat am 16. November 1933 zur HJ über: „Grundsätzlich ist meine Meinung dieselbe wie vor 3 Jahren; denn ich bin auch heute noch Sozialist“, rechtfertigte er sich in einer Notiz vor sich selbst.65 Er stand für die Mehrheit, obgleich nicht für alle. Einzelne Jugendliche und junge Männer aus SAJ und KJVD waren weit über 1933 hinaus in informellen Netzwerken im Untergrund tätig: Ausflüge, Treffen, gemeinsamer Gedankenaustausch. Die Sicherheitsorgane griffen schnell ein, sobald sie von illegalen Aktivitäten – wie der Verbreitung von Flugblättern, Kurier- oder Sammlungstätigkeit – erfuhren. Die Bremer Gestapo hielt die SAJ bereits im Sommer 1933 für weitgehend handlungsunfähig und ausgeschaltet.66 Andere Jugendliche gingen gezielt den Weg in die HJ – nicht aus Überzeugung, sondern mit Unterwanderungsabsicht. Mindestens konnte man hoffen, in der Parteijugend unbehelligt zu bleiben. Hans Hemme, der nach 1933 für die HJ-Propaganda tätig wurde, hat 61 Zit. nach Karl Heinz Jahnke, Jungkommunisten im Widerstandskampf gegen den Hitlerfaschismus, Berlin 1977, S. 182. 62 Vgl. Annemarie Hühne/Dietmar Sedlaczek, Nachruf auf Anna Pröll. In: Dokumente. Rundbrief der Lagergemeinschaft und Gedenkstätte KZ Moringen e. V., (2006) 24, S. 25 f. 63 Vgl. Winfried Speitkamp, Jugend in der Neuzeit. Deutschland vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, Göttingen 1998, S. 229; zudem Kenkmann, Wilde Jugend, S. 103–107. 64 Franz Osterrath, Sozialistische Arbeiterjugend. In: Werner Kindt (Hg.), Die deutsche Jugendbewegung 1920–1933. Die bündische Zeit. Quellenschriften, Köln 1974, S. 101 f., hier 101. 65 Tagebuch Erich Pohlmanns, Band 3, 23.10.–31.12.1933, S. 3 (NSDOK Köln, EzG, jugend1918-1945.de; online in EzG). 66 Vgl. Inge Marßolek/René Ott, Bremen im Dritten Reich. Anpassung – Widerstand – Verfolgung, Bremen 1986, S. 216–225 und 273–277.
44
Genese einer Massenorganisation
einen solchen Fall geschildert. Seine Rückblende, die er im Zusammenhang mit Rehabilitierungsbemühungen nach 1945 verfasste, ist mit Skepsis zu genießen: „Damals lernte ich Viktor Weimar kennen, der bei uns mitarbeitete“, so Henne über seine Lehrzeit in Duisburg. Er gab an, über Weimar einen Kontakt zur Arbeiterbewegung und illegalen KPD unterhalten zu haben: „Er war HJ-Führer. Seine HJ-Führerschaft war Tarnung, in Wirklichkeit war er einer der Führer des […] kommunistischen Jugendbundes, der seine Mitglieder in die Partei, in den damals noch bestehenden Christlichen Verein junger Männer und in den Bibelkranz höherer Schulen sandte. Weimar versuchte mich für seine Pläne zu gewinnen. Er gab mir illegale kommunistische Zeitschriften im Kleinformat, die ich auch auf den von mir besuchten Versammlungen liegenließ und verbreiten half. Ich tat es damals aus Freude an der Gefahr und an Verbotenem, weniger aus politischer Erkenntnis. Aber ich tat es. Weimar wurde […] verhaftet und zu 2½ Jahren Zuchthaus wegen Hochverrat […] verurteilt. Ich war wieder allein.“67 Oppositionelle Jugendgruppen konnten fortan meist nur im Schatten der Hitlerjugend, im Untergrund oder in Tarnvereinen, als Sportler oder Wanderer, mit Aussicht auf Erfolg agieren. In Westdeutschland, gerade in Köln und im Ruhrgebiet, musste die Hitlerjugend seit dem Sommer 1933 alsbald eine starke Zunahme sogenannter Straßenklubs feststellen. Dazu wurden primär „ehemalige Mitglieder der SAJ, ja sogar solche, die man früher in den Reihen der Antifa gesehen hatte“ gezählt. Auch mit schwarzen Hemden und bunten Halstüchern – den Erkennungsmerkmalen der bündischen Jugend – würden diese jungen Leute in Erscheinung treten und einander kenntlich machen. Die Hitlerjugend werde – so lautete es unverblümt – die Gruppen „mit brutaler Gewalt im Keim zu ersticken wissen“.68 In Berlin bemerkte die HJ-Führung 1934, dass junge Leute, die aus der HJ ausgetreten oder ausgeschlossen worden waren, sich mit anderen Versprengten zusammentäten. Speziell fürchtete die Berliner HJ-Führung die „roten Stoßtrupps“, eine linke sozialistische Widerstandsgruppe, deren illegale Blätter und Schriften bis zu einer Verhaftungswelle 1935 mehrere Tausend Leser fanden.69 Noch Anfang 1936 machten sich – nun im HJ-Schrifttum immer wieder als „Reste bündischer und konfessioneller Jugend“ tituliert – solche Gruppen gerade in roten Vierteln bemerkbar. Angeblich sangen sie kommunistische „Volkslieder“; ein Indiz dafür, dass Grenzen zwischen politisch linker, konfessioneller und bündischer Opposition im Informellen tatsächlich flüssig wurden. Der Hitlerjugend im Westen waren diese diversen Gruppen unter anderem als „Navajos“, „Freibeuter“, „Buschmänner“ oder „Schwarze Lupen“ bekannt.70 Nach dem Frühjahr 67 Hans H. Henne, Lebenslauf und Versuch einer Rechtfertigung, gesandt an die Kammer der Kunstschaffenden, 16.6.1945, S. 2 (Archiv des HAIT). 68 Jetzt machen wir Schluss mit den eigenwilligen Jugendklubs. In: Die Fanfare. Kampfschrift der Hitler-Jugend im Obergebiet West, (1933) 3, S. 12. 69 Ausgeschlossene Hitlerjungen und Stoßtrupps. In: GB: Berlin, 60/34 vom 10.1934; vgl. im Zusammenhang Dennis Egginger-Gonzalez, Der Rote Stoßtrupp. Eine frühe linkssozialistische Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus, Berlin 2018. 70 Ohrfeigen diesen Lumpen! In: Mittelrhein-Dienst. Nachrichtenblatt der HJ Mittelrhein, (1936) 5, S. 2; Schmierfinken! In: ebd., (1936) 10, S. 2.
Revolution und Gleichschaltung
45
1933 jedoch von weit mehr Bedeutung als das Anwachsen derartiger Cliquen in den Großstädten waren die organisierten bürgerlich-nationalen Verbände, die den Alltag junger Menschen noch immer prägten. Sie waren intakt und schienen mit der Hitlerjugend zu konkurrieren. Der Triumph der Hitlerjugend 1933 ist nicht nur durch Repression einer sich formierenden Diktatur zu erklären. Ihr jäher Aufstieg beruhte wesentlich auf der Erosion ihrer bürgerlichen Konkurrenz. Besonders auf nationalkonservativer Seite sowie bei den paramilitärischen Wehrverbänden, unter Einschluss des demokratischen Reichsbanners, war seit der Reichstagswahl vom 5. März 1933 ein enormer Aderlass hinzunehmen. Junge Männer strömten freiwillig zu Zehntausenden in die Reihen der NS-Jugendbewegung. Das prägnanteste Beispiel findet sich beim rechtsgerichteten Frontsoldatenverband Stahlhelm. Dessen Nachwuchs war in zwei Gruppen organisiert: die Jüngsten im Scharnhorst-Bund und die über 18-Jährigen im sogenannten Jungstahlhelm. Gemäß einer Absprache mit Stahlhelm-Führer Franz Seldte, der den Posten des Reichsarbeitsministers in Hitlers Kabinett zugeschanzt bekommen hatte, wurde der Jungstahlhelm Anfang Juli der Obersten SA-Führung unterstellt.71 Die Ortsgruppen hatten sich zu diesem Zeitpunkt in vielen Fällen bereits aufgelöst oder sie standen kurz vor der Selbstauflösung. Nach einer weiteren Vereinbarung sollten die rund 10–15 000 jüngeren Scharnhorst-Mitglieder bis Ende September ohne „unnötige Härten“ in die HJ sowie ins Jungvolk überführt werden.72 Auch aus dem Scharnhorst-Bund waren indes viele Jugendliche längst zur NS-Jugend übergelaufen. Im Dezember konnte der Führer des HJ-Gebiets „Nordsee“ daher wohl wahrheitsgemäß verkünden, es habe sich die Auflösung der gesamten Scharnhorst-Jugend im besten „Einvernehmen zwischen den eingegliederten und den bisherigen Kameraden der Hitlerjugend“ vollzogen. Die Überführung sei inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Ihre Uniformen durften die jungen Scharnhorst-Mitglieder – im Gegensatz zu anderen – noch eine Weile tragen, bis das eigene Geld oder das der Eltern für die neue HJ-Kluft reichte.73 Hermann Ziegler, geboren 1923 im niedersächsischen Nienburg und damit einer der Jüngsten in seiner Scharnhorst-Gruppe, berichtete über die Eingliederung seiner Einheit: „Ich sollte mich am Schlossplatz zu einer bestimmten Zeit einfinden. Dann kam ich dahin und da waren Hitlerjugend, Jungvolk und BDM aufmarschiert. Und dann wurde verkündet, dass die Scharnhorst-Jugend geschlossen in das Deutsche Jungvolk überführt worden sei. Dann war ich [also] im Jungvolk. […] Das habe ich sechs Wochen gemacht, dann gefiel mir der Dienst nicht.“ Bis zu seiner Schulentlassung im Jahr 1937 habe er sich 71 Vgl. Dokumente und Überlieferung BArch, R72, 1891 und 1892 sowie R72, 479 und 481, 1; 482, 2. 72 Der „Scharnhorst“ wird in die HJ. überführt. Ausführungsbestimmungen. In: Der Thüringer Sturmtrupp, (1933) 1, S. 2. 73 Vgl. Joachim Tautz, Militaristische Jugendpolitik in der Weimarer Republik. Die Jugendorganisationen des Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten: Jungstahlhelm und Scharnhorst, Bund deutscher Jungmannen, Regensburg 1998, S. 457.
46
Genese einer Massenorganisation
bei der Hitlerjugend nicht mehr blicken lassen. Kein Einzelfall: „Ich habe mich gewundert, dass hinterher nichts kam“, meinte Ziegler im Rückblick, und von seinem Jungvolkführer sei er zum Erscheinen beim Hitlerjugend-Dienst nicht weiter aufgefordert oder gedrängt worden.74 Innerhalb der Parteijugend, das deutete sich ab dem Sommer 1933 bereits an, sah ein großer Teil gerade der „alten Kämpfer“ derartige Massenübertritte keinesfalls einhellig positiv. Es erschien ihnen „ein ungeheurer Zustrom von solchen Jugendlichen eingesetzt“ zu haben, die im „fremden politischen Geiste erzogen worden“ waren, ihnen als Speerspitze einer revolutionären Jugendbewegung völlig untauglich schienen.75 Schlag auf Schlag folgte die Eingliederung der politischen Jugendorganisationen aus dem bürgerlich-nationalen Lager, darunter beispielsweise die Jugendabteilungen „Bismarckbund“ und „Kampfring junger Deutschnationaler“ der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) sowie die Jugendgruppen des Jungdeutschen Ordens, dessen selbsternannter „Hochmeister“ Artur Mahraun sich dem Verbot seiner Organisation nach Kräften widersetzte.76 Ob Verbot per Gesetz, spontane Selbstauflösung oder mehr freiwillige Eingliederung, das Muster ähnelte einander: In Anbetracht des Exodus von jungen Mitgliedern brachen Auseinandersetzungen über die Art der Zusammenarbeit mit der Hitlerjugend aus. Ortsgruppen wurden durch den Streit ihrer jungen Mitglieder und des Führungspersonals gelähmt. Die Nationalsozialisten nutzten die Gunst der Stunde, indem sie ihrer vielfach nicht minder antidemokratischen Konkurrenz unterstellten, sie sei marxistisch unterwandert oder nehme nicht aufrichtig genug Anteil an der revolutionären Staatswerdung.77 Die RJF und Hitlerjugend versprachen, die ersehnte „Volksgemeinschaft“ jenseits von Parteienhader und Klassenkampf zu verwirklichen. Die Auflösungsorder und Verbote besiegelten auf diese Weise vielfach lediglich, was sich seit März 1933 im bürgerlichen und nationalen Lager von selbst vollzog. Je mehr der Blick auf die rechtsgerichteten Jugendorganisationen oder auf die bündische Jugend fällt, desto stärker kommt dieses Muster zum Vorschein. Ein weiteres Beispiel ist der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband (DHV), eine mächtige Angestelltengewerkschaft mit Hauptsitz in Hamburg. Dieser hatte durch völkische Jugendarbeit eine politische Radikalisierung seiner Lehrlinge bereits in der Weimarer Republik massiv selbst befördert. Die Jugendarbeitslosigkeit stärkte zu Anfang der 1930er-Jahre vielfache Sympathien für die Hitler-Bewegung – allerdings, dieser Hinweis gehört hinzu, in Opposition zur Gewerkschaftsführung, die zuletzt einen autoritär-konservativen Kurs 74 Zeitzeugenbericht von Hermann Ziegler, geboren 1923 in Nienburg (Heimatverein Haßbergen, „Wir wussten nichts davon“, http://www.wir-wussten-nichts-davon.de/ wwnd_Seiten/Jugend/Jugendzeugen/hj1.html; 21.8.2019). 75 Badischer Landeskommissar über die Errichtung von Führerschulen im Land Baden vom 10.8.1933 (StA Freiburg B719/1, Bl. 037967). 76 Robert Werner, Der Jungdeutsche Orden im Widerstand. 1933–1945, München 1980. 77 Wolfgang Krabbe, Die gescheiterte Zukunft der ersten Republik. Jugendorganisationen bürgerlicher Parteien im Weimarer Staat, Opladen 1995, S. 195.
Revolution und Gleichschaltung
47
gesteuert und die Präsidialkabinette Papen und Schleicher gestützt hatte.78 Die Jugendgruppen des DHV entfremdeten sich dabei zunehmend ihrer Gewerkschaftsführung. Alfred Krebs, DHV-Funktionär und NSDAP-Mitglied, hatte Hitler 1930 berichtet, etwa Dreiviertel der Jugendlichen seien nationalsozialistisch eingestellt.79 Kaum verwunderlich, dass sich die DHV-Jugend nach dem Frühjahr 1933, oft in Eigeninitiative und lange vor der eigentlichen Überführung des DHV in die Deutsche Arbeitsfront, der HJ unterstellte. Der DHV-Wanderbund „Fahrende Gesellen“, für welchen der Kopf der Berliner Fichte-Hochschule, Heinz Dähnhardt, sprach, hatte Ende 1932 die „Liquidation der Demokratie“ selbst herbeigesehnt. Nun trat die Organisation jäh von der Bühne ab.80 Im April 1933 hatte der Bund seine Selbstauflösung beschlossen. Der DHV stand der Massenabwanderung zunächst ratlos gegenüber, um sie am Ende selbst abzusegnen. In Hamburg, dem Sitz des DHV, war die Überführung in die Hitlerjugend Ende November – von HJ-Bannführer Kohlmeyer „mit herzlichen und kameradschaftlichen Worten“ begleitet – erfolgt.81 Den Verantwortlichen blieb zu Jahresende 1933 wohl kaum etwas anderes übrig, als in Vereinbarungen mit HJ-Funktionären „mit allen Mitteln für die Eingliederung aller DHV-Lehrlingsmitglieder in die Hitler-Jugend“ einzutreten: „Das Ziel dieser Vereinigung ist die Stärkung der staatsbejahenden Jugendfront gegen alle berufsständischen und konfessionellen Zersplitterungsversuche in der deutschen Jugend.“82 Die DHV-Jugendführer sollten, um sie nicht unnötig zu verprellen, möglichst gleichwertige Posten innerhalb der HJ erhalten. Die DHV-Lehrlinge mussten formale Beitrittsgesuche einreichen, bevor sie danach in die HJ aufgenommen werden konnten. Der DHV-Landesjugendführer von Württemberg, Simon Winter, beispielsweise trat als Referent für Berufsfragen in die HJ-Gebietsführung ein.83 Mädchen und junge Frauen wurden von den Überführungswellen zuletzt erfasst. Der Organisationsgrad der weiblichen Jugend war in Weimarer Zeit aufgrund gesellschaftlich verankerter Geschlechterrollen signifikant geringer als derjenige junger Männer: Von rund 4,5 Millionen, welche der RddJ um 1930 erfasst hatte, waren immerhin 33 Prozent weiblich.84 Mädchen und junge
78 Vgl. André Postert, Von der Kritik der Parteien zur außerparlamentarischen Opposition. Die jungkonservative Klub-Bewegung in der Weimarer Republik und ihre Auflösung im Nationalsozialismus, Baden-Baden 2014, S. 369–391. 79 Vgl. George L. Mosse, Die deutsche Rechte und die Juden. In: Werner E. Mosse (Hg.), Entscheidungsjahr 1932. Zur Judenfrage in der Endphase der Weimarer Republik, 2. Auflage Tübingen 1966, S. 183–249, hier 226. 80 Heinz Dähnhardt, Die Liquidation der Demokratie. In: Der fahrende Gesell, (1932) 3, S. 42–45. Zu Dähnhardt und dem DHV vgl. auch Postert, Die jungkonservative Klub-Bewegung, S. 293–327 und 385–391. 81 Übernahme der DHV-Jugend in die Hitler-Jugend. In: Hamburger Nachrichten vom 28.11.1933. 82 Vereinbarungen zwischen der Gebietsführung 20 der Hitler-Jugend und dem DHV-Landesjugendführer Schwaben vom 7.12.1933 (StA Ludwigsburg, PL 509, Bü 25, unpag.). 83 Vgl. ebd. 84 Vgl. Rauschenbach, Jugendverbände, S. 123.
48
Genese einer Massenorganisation
rauen engagierten sich insbesondere im Umfeld der Kirchen oder in der soziaF listischen Arbeiterjugend.85 Organisationen für die weibliche Jugend existierten im bürgerlich-nationalen Spektrum vergleichsweise wenige. Familien zeigten sich allenfalls bereit, die Töchter der kirchlichen Obhut anzuvertrauen. Im Winter 1933/34 erfolgte die Eingliederung der größten politischen Organisation. Als eine Art konservative Wehrjugend organisiert, hatte sie bis dahin mit der NS-Jugendbewegung in Konkurrenz gestanden: Jung-Luisenbund und „Kornblümchen“ – beide waren dem monarchistisch orientierten Luisenbund angeschlossen.86 „Mein Bruder und ich hatten seit Jahren sehnsüchtig und voller Bewunderung auf die Jungen und Mädchen geblickt, die uns in den Pfadfindergruppen begegneten“, schrieb die frühere BDM-Führerin Melita Maschmann rückblickend: „Allmählich erlahmte die Abwehr unserer Eltern, und wir bekamen im Frühjahr die Erlaubnis, in einen Jugendbund einzutreten, freilich nur einen, dessen Ziele sich mit den politischen Auffassungen unserer Familie vertrugen. Mein Bruder wurde Mitglied der deutschnationalen Bismarck-Jugend, einige Monate ehe sie sich auflösen musste.“87 Sie selbst habe mit dem Luisenbund geliebäugelt. Dann sei sie ohne Einwilligung der Eltern zur Hitlerjugend gegangen. Das Geschwätz und die Tanzabende der „höheren Töchter“ habe sie im Luisenbund nicht mitmachen wollen.88 In Hinblick auf die weibliche Jugend war für die RJF Ende 1933 trotz der Eingliederung des Luisenbunds jedoch kaum etwas gewonnen. Die Mehrheit der Mädchen musste die Parteijugend fortan von den christlichen Verbänden abwerben und damit aus den Kirchen in die Massenorganisation erst noch hineinholen.89 Ende 1933 schien aber zumindest die Eingliederung der politischen und konservativ-nationalen Jugendverbände in Deutschland abgeschlossen. In einem Ort in Württemberg schrieb daher ein junger HJ-Unterbannführer im Dezember 1933: „Aus anfänglich kleinen Scharen entwickelten sich die mächtigen braunen Kolonnen deutscher Jugend, die heute […] marschieren. Wenn die Hitlerjugend anfänglich im neuen Staate darum zu kämpfen hatte, sich Ansehen und Achtung zu erwerben, so ist sie heute die deutsche Jugend, die Staatsjugend.“90
85 Vgl. kompakt Andreas Gestrich, Geschichte der Familie im 19. und 20. Jahrhundert, 3. Auflage, München 2013, S. 109–111. 86 Gegen die Parteien der Jugend. In: Der Thüringer Sturmtrupp, (1933) 1, S. 1. 87 Melita Maschmann, Fazit. Mein Weg in die Hitler-Jugend, 2. Auflage, München 1979, S. 15 88 Ebd., S. 16 89 Vgl. Birgit Retzlaff/Jörg-Johannes Lechner, Bund Deutscher Mädel in der Hitlerjugend. Fakultative Eintrittsgründe von Mädchen und jungen Frauen in den BDM, Hamburg 2008, S. 66 f. 90 Unterbannführer der Hitlerjugend III/121 an das Bürgermeisteramt und den Gemeinderat von Brackenheim vom 29.12.1933 (StA Ludwigsburg, PL 509, Bü 7, unpag.). Hervorhebung im Original.
Revolution und Gleichschaltung
1.3
49
Die Bündischen in der Hitlerjugend
Einen besonderen Status hatte in der Weimarer Republik, wie erwähnt, die sogenannte bündische Jugend innegehabt – nicht aufgrund ihrer Mitgliederstärke, die im Vergleich beispielsweise zu den Arbeiterjugendorganisationen oder den konfessionellen Jugendverbänden gering ausfiel, sondern wegen ihres kulturellen Einflusses: Liedgut, Dichtkunst und Literatur sowie Fahrtenwesen und Kleidung hatten auf die gesamte deutsche Jugendbewegung stilbildend gewirkt. Freilich war die bündische Jugend, deren Wurzel der Wandervogel um die Jahrhundertwende bildete, alles andere als eine homogene oder gar politisch geführte Einheit. Was „bündisch“ war oder einen Bund konkret ausmachen sollte, über reine Äußerlichkeiten und einen antimodernen Eskapismus hinaus, blieb den Wortführern der bündischen Gruppen überlassen. Die Hitlerjugend hatte sich, zumal beim Aufbau des Deutschen Jungvolks, an bündischem Lebensstil und Uniformierung orientiert. Rund drei Prozent der männlichen Jugendlichen zwischen 14 bis 18 Jahren gehörten Ende 1932 der HJ an. In einer Zeit, als mindestens die Hälfte der männlichen Jugendlichen vereinsmäßig organisiert war, hatte sie nur die Promillestärke einer Kleinstgruppierung inne.91 Doch zeitgleich mit dem Aufstieg der Hitler-Bewegung nach 1929 hatte wiederum die Hitlerjugend begonnen, ideologisch Druck auf die bündische Jugend auszuüben. Die Frage, wie anfällig die deutsche und bündische Jugendbewegung für den Nationalsozialismus war, hat akademische Debatten beschäftigt: Zuletzt hat Christian Niemeyer mit seinem Buch „Die dunklen Seite der Jugendbewegung“, erschienen 2013, mehr oder weniger eine direkte Linie vom Wandervogel der Jahrhundertwende über die Bünde der Weimarer Republik hin zur Hitlerjugend gezogen – und damit die Auseinandersetzung erneut befeuert.92 Es gibt gute Gründe, um auf die Kontinuitäten und Schnittmengen zwischen der bündischen Jugend und der völkischen Bewegung hinzuweisen. Durchaus zahlreich gingen Protagonisten der bündischen Jugend bereits vor 1933 den Weg in die Hitler-Bewegung. Franz Schall, der erwähnt wurde, trat von den Pfadfindern zur Hitlerjugend über. Gerade aus den völkischen Gruppen wechselten zu Anfang der 1930er-Jahre junge Männer in erheblichem Maße in das braune Lager. Die Hitlerjugend trug zudem einen Spaltpilz in die bündischen Gruppen. In Sachsen rekrutierte sie vor 1933 offenbar zahlreich in der bündischen Jungenschaft. Vergleichsweise wenige beharrten dort weiter auf Autonomie.93
91 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 288. 92 Vgl. Niemeyer, Die dunklen Seiten der Jugendbewegung. 93 Vgl. Friederike Hövelmans, Die Sächsische Jungenschaft – Abenteurer, Aufrührer, Angepasste? Die Jugendbewegung in Sachsen zwischen den beiden Weltkriegen am Beispiel einer Jugendgruppe. In: Katja M. Mieth/Justus H. Ulbricht/Elvira Werner (Hg.), „Vom fröhlichen Wandern“. Sächsische Jugendbewegung im Zeitalter der Extreme 1900–1945, Dresden 2016, S. 133–151, hier 146 f. Zahlreiche Beispiele findet man in der nach wie vor eindrucksvollen Dokumentensammlung von Kindt (Hg.), Die deutsche Jugendbewegung 1920 bis 1933.
50
Genese einer Massenorganisation
Vermehrt fassten die Wortführer der bündischen Jugend, über die Ziele der Hitlerjugend sich täuschend, eine Art Bündnis ins Auge. Gerade jene Gruppen, die dem Parlamentarismus selbst mit Skepsis oder Ablehnung begegneten, standen unter Rechtfertigungsdruck: Sie alle hatten die Losung ausgegeben, dass es die angeblich desaströse Zersplitterung Deutschlands in unzählige Gruppen und Parteien aufzuheben galt. Das Ideal der „Volksgemeinschaft“ war das erklärte Ziel; je weiter nach rechts man ging, desto mehr war damit politische und ethnische Homogenität gemeint. Die Hitler-Bewegung, und eben auch die Hitlerjugend, versprachen, dass sie genau dies in der Realität einlösen würden. Selbst in der Christlichen Pfadfinderschaft, die sich nach 1933 staatlicher Angriffe zuhauf zu erwehren hatte, gab man Ende 1932 zu verstehen: „Eine Willenseinheit junger Menschen ist im Werden, die dem alten liberalen Parteistaat von Weimar durch ein Aufgebot nationalistischer und sozialer Kräfte überwinden will. […] Die liberale Zeit der Nationalstaaten wird für uns Deutsche abgelöst durch das Ahnen des Reiches.“94 Und der ehemalige Pfadfinder und nunmehrige Hitlerjunge Schall aus Thüringen war im Februar 1932 bereits sicher: „Der Generalsturm auf die Jugend im anderen Lager bricht bald los, das alte Gerümpel von Jugendbewegung hat keine Existenzberechtigung mehr.“95 Anfang März 1933 hatten sich die wichtigsten Jugendbünde – mit Ausnahme der konfessionell geprägten Bünde, deren organisatorisches Rückgrat die Kirchen bildeten – im Großdeutschen Bund (GDB) zusammengeschlossen. Auf diese Weise wollten sie sich der Inanspruchnahme durch die Hitlerjugend zur Wehr setzen und ihre Eigenständigkeit im Hitler-Staat bewahren. Zum GDB gehörten so verschiedene Gruppen wie der Deutsche Pfadfinderbund, die Deutsche Freischar, ein 1926 organisierter Zusammenschluss aus Pfadfindern und Wandervögeln, oder der Jungsturm, eine paramilitärisch ausgerichtete Organisation mit mehreren Tausend Mitgliedern. Die untereinander zerstrittenen bündischen Führer, die über Jahre weder bei Zielen noch rein organisatorisch zueinander gefunden hatten, waren sich nur in dieser einen Hinsicht einig, nämlich in der Diktatur irgendwie überleben zu wollen; ein Defensivbündnis also, das die Lage zwingend erforderlich gemacht hatte. Rein zahlenmäßig war der GDB – im Vergleich mit den linken Jugendverbänden, deren Strukturen vielfach schon zerschlagen waren, oder der konfessionellen Jugend – nicht stark. Aber der Bund bildete gewissermaßen die letzte Bastion deutschnationaler und rechtskonservativer Kräfte. Er war insofern ein wichtiges Konkurrenzunternehmen zur Hitlerjugend im entstehenden „Dritten Reich“.96 Schutzpatron 94 Walter Homburg von der Christlichen Pfadfinderschaft auf dem Jungmannschaftslager in Bad Homburg. Zit. nach Joseph Fischer, Entwicklungen und Wandlungen in den Jugendverbänden 1932. In: Das Junge Deutschland, (1933) 2, S. 41–52, hier 46. Vgl. außerdem Günter Brakelmann, Kreuz und Hakenkreuz. Christliche Pfadfinderschaft und Nationalsozialismus in den Jahren 1933/1934, Kamen 2013. 95 Postert, Hitlerjunge Schall, S. 117. 96 Vgl. ausführlich Rüdiger Ahrens, Bündische Jugend: Eine neue Geschichte 1 918–1933, Göttingen 2015, S. 336–345.
Revolution und Gleichschaltung
51
Adolf von Trotha, der mit der Führung verschiedener rechtsnationaler Jugendverbände bereits in der Zeit der Republik betraut gewesen war, sollte – dank guter Verbindungen zu konservativen Politikern – die Verständigung mit der Hitler-Regierung bewerkstelligen.97 Aber weder Hitler noch Schirach waren an einer Koexistenz ihrer Parteijugend mit bündischen Gruppen interessiert. Der Verband war mehr ein Elitenprojekt und damit eine künstliche Erscheinung. Die jugendlichen Mitglieder der ihm angehörigen Bünde marschierten vielfach schon mit Hakenkreuz-Fahnen oder sangen NS-Kampflieder auf den Straßen. Die Bünde gerade im rechten Spektrum hatten in den letzten Jahren der Weimarer Republik ihre Forderung nach „Volksgemeinschaft“ mit völkisch-romantischem Kult und Kritik am Parlamentarismus verknüpft. Die Bereitschaft, sich für den neuen Staat zu engagieren, war unter ihnen dementsprechend besonders ausgeprägt, ihre Affinität zum Nationalsozialismus früh festzustellen gewesen. Zurecht hat Christoph Schubert-Weller konstatiert, dass es „in den Augen der Bünde vollkommen konsequent“ war, „sich Hitler zu unterstellen. Logisch war es [aber] auch […], dass die Bünde ihr Eigenleben weiterführen wollten.“98 Beim Jugendlager des GDB in Grunewald im April 1933, der die Kraft und Eigenständigkeit der bündischen Jugend sichtbar machen sollte, hatten Teilnehmer, wie Fotografien belegen, ihre Zelte aber schon mit Hakenkreuzfahnen geschmückt.99 Das Pfingstlager in der Lüneburger Heide, beinahe auf Schirachs Drängen hin verboten, dann nach Intervention der Hitlerjugend vorzeitig abgebrochen, machte Anfang Juni jedem der rund 7 000 jungen Teilnehmer und bündischen Führer deutlich: eine bündisch-nationale Dachorganisation jenseits der Parteijugend würde es nicht länger geben. Angesehene Wortführer der Bünde hatten ihren Gefolgsleuten schon empfohlen, statt sich im GDB von der politischen Reaktion instrumentalisieren zu lassen, lieber den Übertritt zur HJ zu wagen.100 Aus der Deutschen Freischar waren Teile der Führerschaft frühzeitig ins braune Lager übergewechselt, darunter z. B. der Chemiker Hermann Kügler oder Hans Raupach, viel später Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Halle. Andere, wie der evangelische Religionspädagoge Helmuth Kittel, repräsentierten im GDB einen nationalsozialistischen Flügel und torpedierten die Bundesführung, die sich um Wahrung der Autonomie bemühte. Nicht wenige glaubten zudem, man dürfe sich dem neuen Staat nicht verweigern, müsse überdies Hitler die Treue schwören. Man sah eine drohende Gleichschaltung hier nicht in erster Linie nur als feindliche Übernahme, sondern als eine geschichtliche Notwendigkeit, die zugleich neue Möglichkeiten zur Partizipation, Mitgestaltung und Selbstverwirklichung eröffnete. 97 Vgl. hier und im Folgenden Brandenburg, Die Geschichte der HJ, S. 149–153. 98 Schubert-Weller, Hitlerjugend, S. 94. 99 Foto vom Jugendlager des „Großdeutschen Bundes“ im Berliner Grunewald, April 1933 (Archiv der deutschen Jugendbewegung, Burg Ludwigstein). Weitere Fotografien von der Skagerrak-Gedenkfeier des Großdeutschen Bundes am 28.5.1933 (BArch Berlin, Bildarchiv, 102-14639, 102-14640). 100 Schubert-Weller, Hitlerjugend, S. 108; Ahrens, Bündische Jugend, S. 342.
52
Genese einer Massenorganisation
Wortführer der Jugendbewegung nutzten nach 1945 die Metaphorik, dass sie vom Nationalsozialismus überwältigt oder hinweggeschwemmt worden seien. Die Eigenständigkeit sei „nicht mehr durchzuhalten“ gewesen, befand schlicht Werner Kindt.101 Gänzlich von der Hand zu weisen ist das nicht, obgleich die Analogie der Hitler-Bewegung als Sturmflut gewiss dem Selbstschutz diente. Man könnte gleichsam von einer Aushöhlung sprechen, die im Legitimationsverlust ihren Ausgang besaß. Biografien wie jene von Ludwig Liebs, dem Gauleiter der Deutschen Freischar in Sachsen, zeigen dies. Er hoffte nach 1933 – allerdings ohne Erfolg – auf eine Synthese von bündischem Lebensentwurf und Parteijugend.102 Der größere Teil der bündischen Jugend wurde 1933 vom nationalen Revolutionsfieber gepackt. Zurecht konnten NS-Funktionäre und HJ-Führer behaupten, dass „die Angehörigen der kleineren Verbände in hel ührer len Scharen zur Hitlerjugend überliefen“.103 Viele Jugendliche und ihre F forderten nach der Reichstagswahl vom 5. März ein Zusammengehen mit den Repräsentanten des neuen Staates, wobei nur wenige an Selbstauflösung dachten. Vereinzelt, wie im Falle der Freischar junger Nation in Mecklenburg, warfen sich jedoch Gruppen geschlossen der HJ in die Arme.104 Die Bundesführung um Trotha erklärte Ende März dem Regime ihre Loyalität. Es war der Versuch, mit vorauseilendem Gehorsam einerseits einem Verbot zu entgehen und andererseits der Masse der eigenen Mitglieder zu versichern, dass GDB und HJ keine Gegensätze bildeten. Dieses taktische Manöver half jedoch nicht. Am 17. Juni – derselbe Tag, an dem Schirach den Posten eines Jugendführers des Deutschen Reiches erhielt – wurde die Überführung des GDB in die Parteijugend angeordnet.105 Statt sein Überleben zu sichern, erleichterte die Verbandsstruktur den Zugriff auf jene vielen Gruppierungen, die ihm angehörten. Anfang des Monats hatte sich Trotha der drohenden Eingliederung gefügt. Der Zerfall des GDB war nicht mehr aufzuhalten, und die Konservativen in der Hitler-Regierung waren nicht willens, das Projekt zu stützen. In der Bundesführung wurden Stimmen epublik gepaart mit laut, die auf Selbstauflösung drängten.106 Ein Hass auf die R deutschnationaler Staatshörigkeit verhinderte, dass der ehrliche Wunsch nach
101 Werner Kindt, Vorwort. In: ders. (Hg.), Die deutsche Jugendbewegung 1920 bis 1933, S. 5–7, hier 5. 102 Dirk Hermann, Am „Born des Jugendmutes und der Jugendlust“ in der Provinz. Bürgerliche Jugendbewegung in Zittau und Umgebung 1910–1933. In: Mieth/Ulbricht/Werner (Hg.), „Vom fröhlichen Wandern“, S. 261–268, hier 267. 103 Usadel, Entwicklung und Bedeutung, S. 56. 104 Der Landesführer der „Freischar junger Nation“ erlässt folgenden Aufruf. In: Niederdeutscher Beobachter vom 17.5.1933. Vgl. im Zusammenhang Hermann Langer, „Im gleichen Schritt und Tritt“. Die Geschichte der Hitlerjugend in Mecklenburg von den Anfängen bis 1945, Rostock 2001, S. 30–33. 105 Vgl., Der Jugendführer des Deutschen Reiches hat folgende Anordnung erlassen. In: Wille und Werk. Pressedienst der deutschen Jugendbewegung, (1933) 25. Vgl. auch Abdruck bei Klönne, Jugend im Dritten Reich, S. 22; sowie ders., Jugendliche Opposition, S. 41. 106 Christoph Schubert-Weller, Hitlerjugend, S. 109–111.
Revolution und Gleichschaltung
53
Autonomie in Opposition umschlug. Man rechtfertigte sich gegenüber den Mitgliedern: „Der Reichskanzler hat das […] erlassene Verbot […] nicht widerrufen. Die Entscheidung des Kanzlers ist als Befehl der Staatsgewalt für uns bindend. […] Der von uns geforderte Entschluss wird vielen unter uns schwerfallen. Aber wir sind uns bewusst, dass der Kampf um Deutschland, der heute gekämpft wird, von einem höheren Richter entschieden wird.“107 Das Verbot des GDB kam einem Paukenschlag gleich. Dessen Nachhall war nicht nur in den zugehörigen bündischen Organisationen zu hören. Alle Gruppen, die als „bündisch“ identifiziert werden konnten, waren mitgemeint. Besonders radikal unterstrich dies der Gauleiter von Mecklenburg, Friedrich Hildebrandt. Während des Aufmarschs von 15 000 jungen Menschen vor dem Schweriner Schloss am 19. Juni 1933 verkündete er, „dass in der kommenden Woche […] sämtliche Jugendbünde aufgelöst und verboten würden. Auch die sogenannten christlichen Jugendorganisationen hätten nicht das Recht, an jungen deutschen Menschen staatspolitische und sozialpolitische Erziehungsmethoden zu versuchen. Die körperliche Ertüchtigung unserer Jugend und ihre Erziehung zur Volksgemeinschaft, erklärte der Statthalter, werden wir allein in die Hand nehmen.“ Heime und Besitzungen anderer Verbände werde sich die Hitler jugend in Kürze einverleiben.108 Das stachelte an und hetzte gegen andere auf. HJ-Führer nahmen das Verbot des GDB zum Anlass, um gegen das konfessionelle Lager auf eigene Rechnung vorzugehen. Die Hitlerjugend ermächtigte sich selbst. Auf Anweisung der HJ-Bannführung in Aachen, aber ohne Legitimation der RJF, stürmten HJ-Einheiten Mitte Juni 1933 Privatwohnungen. Es kam zu Schlägereien mit Jugendlichen, die man für „Bündische“ hielt. Eine katholische Bibliothek wurde von DJ-Unterführern gestürmt. Offenbar aufgrund von Beschwerden aus der katholischen Bevölkerung und wegen Kritik der örtlichen Polizeibeamten, welche über die unbotmäßige Aneignung ihrer Befugnisse verärgert waren, wurde die Aachener HJ-Führung schließlich zur Ordnung gerufen. Reichsjugendführer Schirach reagierte am 5. Juli auf derartige Ausschreitungen. Ein Erlass der RJF verbot der Parteijugend dezidiert die Belästigung von Angehörigen diverser Jugendbünde: „Einzelaktionen werden bestraft.“109
107 Befehl des Großdeutschen Bundes vom 28.6.1833. In: Kurt Seidelmann, Die Pfadfinder in der deutschen Jugendgeschichte, Teil 2.1: Quellen und Dokumente aus der Zeit bis 1945, Hannover 1980, S. 258 f. 108 Auflösung der Jugendbünde in Mecklenburg-Schwerin angekündigt. In: Hamburger Nachrichten vom 19.6.1933. 109 Erlass des Reichsjugendführers der NSDAP. In: Westdeutscher Beobachter vom 5.7.1933. Im Zusammenhang zum Vorgehen in Aachen vgl. u. a. Schreiben des kom. [kommissarischen] Regierungspräsidenten in Aachen an den Preußischen Minister des Innern, 23.7.1933 (LHA Koblenz 403, 16755, Bl. 321–328); Der Reichsminister des Innern an den Preußischen Minister des Innern, 7.7.1933 (ebd., Bl. 333); Sonderanordnung für das Gebiet Köln-Aachen von Obergebietsführer Lauterbacher vom 12.7.1933 (ebd., Bl. 337).
52
Genese einer Massenorganisation
Die nationalen Bünde wurden im Verlauf der Sommermonate mehr oder weniger störungsfrei zur Hitlerjugend eingereiht. Auseinandersetzungen waren eher die Ausnahme. Ende Juni 1933 gehörten dazu: Nerother-Bund, Waldpfadfinder, Deutsche Falkenschaft und Wandervogel, Bund deutscher Pfadfinderinnen – letzterer stand, wie die RJF gesondert goutierte, „seit längerer Zeit auf dem Boden der nationalsozialistischen Weltanschauung“ – sowie die Kyffhäuserjugend. Zum Herbst und Winter 1933 folgten eine Reihe kleinerer bündischer Organisationen.110 Was sich nicht freiwillig in die Parteijugend einreihte, wurde schließlich verboten. Davon betroffen war die Reichsschaft Deutscher Pfadfinder, die aus Rücksicht auf die internationale Pfadfinderbewegung lange nicht bedrängt worden war. Im Mai 1934 traf sie ein Verbot, weil sie angeblich zur „Zufluchtsstätte dem neuen Staat feindlicher junger Menschen geworden“ sei.111 Möglicherweise war das nicht einmal nur aus der Luft gegriffene Demagogie. Die Pfadfinder besaßen zuletzt rund 4 000 Mitglieder – darunter sicherlich viele, deren Bünde in die Parteijugend überführt worden waren. In Hamburg hatte die Hitlerjugend im Sommer 1933 die Eingliederungen als „Stunde der offenbarten Einigung“ gefeiert. HJ-Bannführer Kohlmeyer versprach den Eingereihten und ihren Jugendführern, dass „alles das, was vor dieser Stunde der Vereinigung gewesen ist, nunmehr vergessen sein soll“.112 Frühere Unstimmigkeiten seien jetzt und für immer begraben. In Wahrheit rang die Hitlerjugend bis zum Ende des „Dritten Reiches“ mit ihrem bündischen Erbe. Der SRD, zunächst eine Art interne Überwachungstruppe, gegründet im Juli 1934, war fortan u. a. für das „Verschwinden jeder bündischen Tracht und Gleichtracht“, die „Erfassung der getarnten und verbotenen […] Schlupfwinkel, Sammelstätten, Tarnungsformen“ verantwortlich.113 Die örtlichen Dienststellen versuchten jene Gruppen zu identifizieren, die weiterhin außerhalb der Organisation standen oder in vermeintlicher Konkurrenz agierten. Aber auch den Überführten traute man nicht über den Weg. Eberhard „Tusk“ Koebel, die schillernde Gallionsfigur der späten Jugendbewegung, hatte mit der „Deutschen Jungenschaft vom 1. November 1929“ (dj.1.11) einen identifikationsstiftenden Bezugspunkt geschaffen. Koebel selbst legte einen erstaunlichen Weg zurück: vom nationalen Spektrum zum Sympathisanten der KPD, als der er schließlich 1933 zunächst sein Glück in der Hitlerjugend versuchte. Wegen kommunisti110 Die deutsche Jugend sammelt sich in der Hitler-Jugend. Die Pressestelle der Reichs jugendführung teilt mit. In: Der Freiheitskampf vom 29.6.1933. 111 Verfügung des geheimen Staatspolizeiamtes, gez. [gezeichnet] Heydrich vom 26.5.1934. In: Arno Klönne, Jugendliche Opposition im „Dritten Reich“, Dresden 2005, S. 42 f. Vgl. Übersicht über den Stand der Jugendverbände 1935, VOBl. [Verordnungsblatt] RJF III/10 vom 14.3.1935. In: Reichsjugendführung (Hg.), Vorschriftenhandbuch der Hitler- Jugend. 1. Ausgabe vom 1. Januar 1943, Band II, Gruppe 1–14, Berlin 1943, Gruppe 13: Verhältnis zu anderen Stellen, S. 1070 f. 112 Zusammenschluss der Jugendverbände. In: Hamburgischer Correspondent vom 3.7.1933. 113 Fernschreiben an alle Stapoleit- und Stapostellen bezüglich Streifendienst der HJ zu Pfingsten 1937 vom 10.5.1937 (StA Freiburg, B719/1, 5018, unpag.).
Revolution und Gleichschaltung
55
scher Umtriebe zwischenzeitlich verhaftet, seitens der RJF und der Hitlerjugend massiv angefeindet, emigrierte Koebel 1934 nach Schweden. Seine Schriften blieben eine Orientierung für jene, die sich mit der Hitlerjugend nicht abfinden wollten oder sich in anfänglichen Hoffnungen bald getäuscht sahen.114 Kleingruppen, Selbstbezeichnungen oder Netzwerke waren bis in die Mitte der 1930er-Jahre derart zahlreich, dass man sie an dieser Stelle kaum in Gänze erwähnen kann. Dem bedeutendsten Verlag für jugendbewegtes Schrifttum, dem Günther-Wolff-Verlag in Plauen, fiel eine bedeutende Rolle zu; die Hälfte aller bündischen Zeitschriften, welche die Hitlerjugend ihren Mitgliedern verbot und welche bis 1935 teils eingestellt werden mussten, kam hier zur Veröffentlichung.115 Das HJ-Führerkorps machte sich die Sache leicht: Der Verlag, meinte die Berliner Gebietsführung 1934, stünde „in direkter Beziehung zu dem kommunistischen Jugendführer Köbel, genannt Tusk. Außerdem erscheinen […] Bücher, Zeitschriften usw., die nicht nur nicht dem Charakter und Stil der HJ entsprechen, sondern sich darüber hinaus in ihrer Tendenz gegen den neuen Staat richten. Den Gliederungen […] ist es verboten, Schriften und Hefte, die in ihrer Tendenz antinationalsozialistisch gehalten sind, zu beziehen.“116 Der 1901 geborene Verleger kam aus der Jugendbewegung. Er wurde Ende Juni 1934 von SS-Angehörigen der HJ und der „Schutzstaffel“ (SS) überfallen und misshandelt. Sein Verlag blieb andauernder Schikanen ausgesetzt, konnte allerdings bis 1938 weiter publizieren, bevor Günther Wolff erneut verhaftet wurde und der Verlag schließen musste.117 Bündische Gruppen und deren Jugendführer, die seit dem Frühjahr und Sommer 1933 zur Hitlerjugend gewechselt waren, führten dort mitunter alte bündische Traditionen, Etiketten und ihr Fahrtenleben fort.118 Ähnlich Koebel, der 1933 auf eine sozialrevolutionäre, gewissermaßen linke Hitlerjugend gesetzt hatte, hofften andere Namenlose, die Parteijugend für ihre je eigenen Ideen von jugendbewegtem Leben nutzen zu können. Publikationen, Gedichte oder Liederbücher der Jugendbewegung wurden in der Hitlerjugend mindestens bis zur Mitte des Jahrzehnts vielfach weiter gelesen. Ein faszinierendes Beispiel findet sich in Ulm. Das dortige Jungvolk war über Jahre dem Vorwurf „bündischer Umtriebe“ ausgesetzt. Der neu gegründete Jungbann 120 stand seit Frühjahr 1933 unter der Führung von Karl Ruth, der in der Weimarer Jugendbewegung
114 Eckard Holler, Linke Strömungen in der freien bürgerlichen Jugendbewegung. In: Gideon Botsch/Josef Haverkamp (Hg.), Jugendbewegung, Antisemitismus und rechts radikale Politik, Berlin 2014, S. 165–194, hier 190 f. 115 Übersicht über das bündische Schrifttum. In: Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 13: Verhältnis zu anderen Stellen, S. 1 072–1 074. 116 Günther Wolff Verlag. In: BB: Gebiet Berlin, 67/34 vom 10.12.1934. 117 Vgl. Wolfgang Hess, Der Günther-Wolff-Verlag in Plauen und die bündische Jugend im III. Reich, Plauen 1993. 118 Vgl. Arno Klönne, Jugendbündische Gegenkultur in Zeiten der Staatsjugend. In: J oachim H. Knoll/Julius H. Schoeps (Hg.), Typisch deutsch. Die Jugendbewegung, Wiesbaden 1988, S. 177–190.
56
Genese einer Massenorganisation
sozialisiert worden war. In diese Position gelangte er wahrscheinlich, weil – ein verbreitetes Problem nach 1933 – der Personalbestand der Hitlerjugend nicht reichte, um Positionen mit eigenen Kräften zu besetzen. Ruth führte das DJ mit Beinfreiheit: Pfadfinder, Wandervögel, Bündische und Angehörige der aufgelösten Scharnhorst-Jugend schienen hier mehr ein Eigenleben zu führen, als sich an Vorgaben von oben zu halten. Die Jungbannzeitung „Totila“ – der Name verwies auf einen König der Ostgoten – zierte kein Hakenkreuz, keine Grußadresse an Hitler oder überhaupt eine erkennbar nationalsozialistische Handschrift. Über die bemerkenswerte Dauer von gut zweieinhalb Jahren konnte der Jungbann in dieser Form bestehen. Ende 1935 setzte man Ruth ab und berief mit Theodor Riedt einen DJ-Führer, der sich andernorts bewährt hatte. Ruth, zum Wehrdienst einberufen, wurde der Umgang mit ehemaligen Kameraden untersagt. Gleichzeitig teile man den Bann auf, Einheiten wurden neu aufgestellt und Jugendliche, die mit Ruth Kontakt gehabt hatten, auf neue Einheiten verteilt. Jetzt sollte auch ideologisch ein anderer Wind wehen.119 „Er fing mit der bündischen Jugend an“, so ein Ulmer Unterführer über den ersten Auftritt ihres neuen Führers Ende 1935: „Sie sei die größte Gefahr für uns […]. Schon vor der Machtübernahme sei sie der Abschaum der deutschen Jugend gewesen. […] Wer bündisch ist, der wird beurlaubt oder er solle vorher freiwillig gehen. Er hoffe aber, dass wir nicht bündisch seien.“120 Den einmal erworbenen Ruf wurde die Ulmer Hitlerjugend so schnell nicht los. Noch Anfang 1937 stand die Ulmer DJ-Führung bei ihrer höheren Dienststelle im Verdacht, gegen die „sonderbündlerischen“ Umtriebe nicht mit genug Entschiedenheit vorzugehen. Die Gebietsführung Württemberg brachte das Ulmer Jungvolk außerdem pauschal mit jener Gruppe um den später zu Berühmtheit gelangenden Widerstandskämpfer Hans Scholl in Verbindung. Scholl, Sohn eines Bürgermeisters, war 1933 in die Hitlerjugend eingetreten.121 Mittlerweile hatte er dort tatsächlich eine an der dj.1.11 orientierte Gruppierung gebildet.122 Selbst jene Ulmer HJ-Führer, die Scholls Aktivitäten nicht gut hießen, gerieten jetzt in den Verdacht bündischer Aktivitäten und wehrten sich dagegen, in einem Atemzug mit Scholl genannt zu werden.123 In der Kleinstadt herrschte ein unübersichtliches Durcheinander aus Animositäten und Loyalitä119 Zur organisatorischen Neuaufstellung vgl. Jungbann „Donauland“, Befehl vom 18.12.1935 (StadtA Ulm, NL Götz Lauser, 29, Bl. 9 f.); zur inhaltlichen Ausrichtung vgl. die darin überlieferten „Führerbriefe“ des Jungbanns 120 von Ende 1935 und Anfang 1936. 120 Zit. aus dem Erinnerungsbericht „Unterm Strich“ von Götz Lauser, S. 18 (ebd., 151a). 121 Kater, Hitler-Jugend, S. 107. 122 Vgl. Brief Hans von Neubeck an Theodor Riedt vom 6.1.1937 (StadtA Ulm, NL Lauser, 34b, unpag.); einordnende Anmerkung von Götz Lauser (ebd.); mit anderem Schwerpunkt auf die Ulmer HJ vgl. Barbara Beuys, Sophie Scholl. Biografie, München 2010, S. 116–122. 123 „Man wirft mir […] vor, aus Jungen des Stammes Ulm-West eine Sonderclique gebildet und geleitet zu haben […]. Ohne die Sache näher zu untersuchen, stellt man mich, Willi Euchner und Götz Lauser auf die gleiche Stufe mit Leuten um Ernst Rede und Hans Scholl. Leute, die gerade ich und die betreffenden Kameraden vor den Führern
Revolution und Gleichschaltung
57
ten. Solche Gruppenbildungen waren eher die Regel als die Ausnahme. Bündische Kreise, die das DJ für sich und als Rahmen für eigene Ideen nutzen, sind unter anderem aus Duisburg, Dresden, Hannover oder Köln bekannt.124 Eine Erhebung der RJF im Herbst 1934 hatte ergeben, dass immerhin rund 14 Prozent der HJ-Führer und 16 Prozent innerhalb des DJ einen bündischen Hintergrund besaßen.125 Nur eine kleine Minderheit unter den bündischen Jugendführern stand dem Staat oppositionell gegenüber. Jene HJ-Gebietsführer, die selbst aus der Jugendbewegung stammten, sahen das als dunklen Flecken in der eigenen Biografie. Gotthart Ammerlahn zum Beispiel, der aus dem Jungnationalen Bund zur Hitlerjugend gekommen und im Herbst 1933 in den Rang eines HJ-Obergebietsführers aufstiegen war, betrieb die Verfolgung des sogenannten bündischen Milieus mit besonderer Vehemenz.126 Bis weit in die 1930er-Jahre wurde der Kampf mit Eifer geführt – derart, dass bald alle vermeintlich oppositionell eingestellten Gruppen oder Strömungen als „bündisch“ tituliert wurden, obwohl sie aus historischer Perspektive sicherlich nicht so klassifiziert werden können. Die bündischen Organisationsformen, wie sie in der Weimarer Republik existiert hatten, begannen nach der „Machtergreifung“ zu verschwinden. Sie gingen in der Hitlerjugend auf oder ihre Akteure sahen sich Repression ausgesetzt. Die staatlichen Überwachungsorgane ebenso wie die Hitlerjugend selbst behielten die „bündischen Umtriebe“ im Blick. Im Sommer 1935 nahm man im Rheinland zehn junge Männer fest, die man den „Kittelbachpiraten“ zuordnete, einer rechtsmilitanten Gruppe, die sich 1933 offiziell aufgelöst hatte, aber informell weiter agierte; vor dem Volksgerichtshof in Essen wurde im Sommer 1937 den früheren Führern des aufgelösten Jungnationalen Bundes aufsehenerregend der Prozess gemacht; und in Halle nahm man Anfang 1936 eine junge Frau fest, weil sie angeblich Kontakte mit illegalen Pfadfindern pflegte.127 Prominente und weniger prominente Beispiele ließen sich ergänzen. Zu Beginn erkannte man die älteren Jugendbewegten weiterhin klar an ihrem äußeren Erscheinungsbild. Sympathisanten der dj.11. gaben sich mit schwarzen Hemden zu erkennen. Vereinzelt standen sie innerhalb der Parteijugend. Im Gebiet Berlin stellte die HJ-Führung im Herbst 1934 fest, dass derzeit „wieder ein großer im Stamm Ulm-Nord (diese ließen H. Scholl ja seit Sommer 1934 ungestört arbeiten) als erste ablehnten.“ Neubeck an Riedt vom 6.1.1937 (StadtA Ulm, NL Lauser, Nr. 34b, unpag.). 124 Vgl. Hellfeld, Bündische Jugend und Hitlerjugend, S. 100 f. 125 Brandenburg, Die Geschichte der HJ, S. 151. 126 Zu Gebietsführern und hauptamtlichen Funktionären mit bündischem Hintergrund vgl. Hellfeld, Bündische Jugend und Hitlerjugend, S. 101 f. 127 Zu den genannten Beispielen vgl. Gesamtbericht der Gestapostelle Düsseldorf für Juli 1935 vom 5.12.1935. In: Anselm Faust/Bernd A. Rusinek/Burkhard Dietz (Hg.), Lageberichte rheinischer Gestapostellen, Band II/2, Düsseldorf 2012 S. 811–820, hier 817; Hellfeld, Bündische Jugend und Hitlerjugend, S. 184; Lagebericht der Staatspolizeistelle Halle für Januar 1936 (7.2.1936). In: Hermann-J. Rupieper/Alexander Sperk (Hg.), Lageberichte der Geheimen Staatspolizei zur Provinz Sachsen 1933–1936, Band 2, Halle 2004, S. 584–604, hier 602.
58
Genese einer Massenorganisation
Kult mit den Schwarzhemden“ getrieben werde, und man untersagte sogleich den eigenen Mitgliedern das Tragen dieser schwarzen Blusen – nicht nur im Dienst, sondern darüber hinaus im Privatleben.128 In Ulm musste der erwähnte DJ-Führer Riedt auf das Verbot der dunklen Hemden Anfang 1936 hinweisen, weil sie wohl noch immer getragen wurden.129 Und zu Pfingsten 1937 befahl die RJF sogar einen landesweiten Großeinsatz des SRD, dessen Ziel unter anderem sein sollte: „Verschwinden jeder bündischen Tracht.“130 Mit einem speziellen Typ Zelt, das mit der Jugendbewegung gleichgesetzt wurde, verhielt es sich ähnlich. Die schwarzen Nomadenzelte traf man in den ersten Jahren nach der „Machtergreifung“ noch zahlreich in der Parteijugend an, denn bündische Gruppen waren geschlossen übergetreten und hatten ihr Inventar mitgebracht. Folglich verbot die Berliner HJ-Führung im Februar 1935 die Nutzung. Wer in solchen Zelten übernachtete, betrieb angeblich „Einführung bündischer Sitten“ in die Hitlerjugend.131 1937 wurden Zelte normiert.132 Ein Geheimbericht der RJF, datiert auf den 1. Februar 1936, trug die verfügbaren Informationen über die „bündischen Umtriebe“ zusammen; von diesem Dokument sind nur Auszüge und eine Abschrift verfügbar, angefertigt von einem ehemaligen Mitarbeiter der Gebietsführung in Baden. Die Authentizität der Abschrift – obgleich aufgrund des Kontexts als glaubwürdig einzuschätzen – konnte mit letzter Gewissheit nicht geklärt werden.133 Mehrere DJ- und HJ-Einheiten schienen, aus Sicht des internen Berichts, auf bündische Unternehmungen hereingefallen zu sein. Sie hätten 1933/34 beim Wolff-Verlag Schriften und Zeitschriften angefordert; zumal aus Franken seien „eine Menge Bestellungen“ nachweisbar. Die Vorwürfe bezogen selbst Teile des hauptamtlichen Führerkorps ein. In Sachsen soll eine Bannführung für bündisches Schrifttum geworben haben; ein Bann in Unterfranken plante wohl den Aufbau einer Bibliothek und hatte beim Wolff-Verlag um Bereitstellung von Literatur gebeten; einige hauptamtliche DJ- und HJ-Führer aus Köln und Düsseldorf sollen im Herbst 1933 die Zusendung jugendbewegter Schriften angefordert haben, um sie für ihre Führerschulen zu verwenden. Der Gebietsführer von Hessen-Nassau, Walter Kramer, geriet in Verdacht, mit Wolff im Austausch zu stehen. 1935 wurde Kramer – eine nicht untypische Verquickung der Vorwürfe – aufgrund seiner angeblichen Homosexualität gerichtlich verurteilt und aus der Hitlerjugend ausgeschlossen. Derartige bündische Kontakte erstreckten sich über drei Seiten
128 Befehlswiederholung: Schwarze Hemden. In: BB: Gebiet Berlin, 55/34 vom 14.9.1934. 129 Jungbannbefehl 2/36 vom 7.2.1936 (StadtA Ulm, NL Lauser, 29, Bl. 33). 130 Fernschreiben Gestapa [Geheimes Staatspolizeiamt] Berlin über den Streifendienst der HJ zu Pfingsten an alle Stapoleit- und Stapostellen vom 10.5.1937 (StA Freiburg, B719/1, 5018). 131 Lappen-Kohten. In: BB: Gebiet Berlin, 76/35 vom 23.2.1935. 132 Zelte. In: GB: Westmark, 4/37 vom 1.4.1937. 133 Zur Entstehung und Bewertung der Abschrift vgl. Materialien des Bündischen Arbeitskreises Burg Waldeck. Einleitung und erläuternde Texte vom 11.8.1983 (HStA Stuttgart, Q3/68, Bü. 577).
Revolution und Gleichschaltung
59
dieses Berichts, der das vermeintlich subversive Netzwerk der dj.1.11 und ihrer Gesinnungsgenossen durchleuchtete.134 Es war indes nur eine erste Andeutung. Denn die RJF hatte zur gleichen Zeit einen weiteren – offenbar verschollenen – Geheimbericht über die Frage anfertigen lassen, „inwieweit […] die bündische Jugend versucht, in die Reihen der Hitlerjugend einzudringen“.135 Das Verhältnis der Hitlerjugend zur bündischen Bewegung hatte nach 1933 einen erheblichen Wandel durchlaufen. Ihrem Monopolanspruch gemäß hatte sie bündische Organisationen aufgesogen und insbesondere die Angehörigen des nationalkonservativen Großdeutschen Bundes mit offenen Armen begrüßt; was ein leichtes Spiel darstellte, da der Großteil gerade der rechten Bünde k eine Gegenwehr leistete oder deren Angehörige sogar aus freien Stücken den Weg in die Hitlerjugend suchten. Wer danach jedoch an alten Traditionen, Stil und Äußerlichkeiten festhielt, oder gar die Parteijugend als Plattform für eigene Ideen zu nutzen versuchte – das war aus Sicht der RJF keine geringe Zahl – musste mit Ächtung und Verfolgung rechnen. Die Anpassungsleistung, welche die Hitlerjugend von ihren neuen Unterführern und jungen Mitgliedern erwartete, vollzogen mit der Zeit die meisten, wenn auch nicht alle. Nach einem umfassenden Verbot bündischer Betätigung durch das Innenministerium Anfang Februar 1936 wurden rund 150 Personen verhaftet.136 Wer es unternahm, „auf andere Personen durch Weitergabe von bündischem Schrifttum, Liederbüchern“ einzuwirken oder „bündische Bestrebungen in anderer Weise“ unterstützte, dem drohte mehrjährige Haft.137 Noch in der Kriegszeit ging man gegen die letzten Versprengten vor. Nach einem 1915 geborenen Mann aus Dresden suchte die HJ 1941 reichsweit, weil er in Kleidung der Jungenschaft auftrat, sich angeblich an Hitlerjungen heranmachte und, sich als Vertreter des SRD tarnend, in der Staatsjugend sein Unwesen trieb.138 Die Mehrheit derer, die sich bis 1939 in die Tradition der Jugendbewegung stellten oder an die Weimarer Bünde mit ihrer Ikonografie anknüpften, waren allerdings keine Jugendlichen im HJ-Alter mehr. Die Führungsfiguren des „Grauen Ordens“ beispielsweise – eine Gruppierung, hervorgegangen 1934 aus dem katholischem Schülerbund Neudeutschland und dem Quickborn – wurden Ende April 1938 in Mannheim vor Gericht gestellt. Unter den 18 Angeklagten waren lediglich drei Personen unter 18 Jahre alt. Die 134 Abschrift: Reichsjugendführung. Amt für Jugendverbände, Bündische Jugend. Entwicklung der dj.1.11 (geheim, Exemplar 021), hg. am 1.2.1936, S. 20–23 (ebd.). 135 Zit. nach ebd., S. 49. 136 Vgl. Rundschreiben Nr. 71 der Gestapo an alle Außenstellen bezüglich des Verbots der bündischen Jugend vom 17.4.1936, abgedruckt u. a. bei Klönne, Jugendliche Opposition im „Dritten Reich“, S. 42 f. Vgl. Stefan Krolle, „Bündische Umtriebe“. Geschichte des Nerother Wandervogels vor und unter dem NS-Staat. Ein Jugendbund zwischen Konformität und Widerstand, Münster 1986, S. 51; zu den verschiedenen Verboten Hellfeld, Bündische Jugend und Hitlerjugend, S. 195–201. 137 Verordnung betr. [betreffend] Verbot der bündischen Jugend. In: GB: Saarpfalz, A7/39 vom 17.8.1939. 138 W. G., geb. 14.11.1915 zu Dresden, Fahndungsaufruf. In: GB: Oberschlesien, K5/41 vom 15.10.1941.
60
Genese einer Massenorganisation
meisten, wie der Student Willi Graf, später Mitglied der Widerstandsgruppe Weiße Rose, hatten das 20. Lebensjahr längst überschritten. „In den letzten Jahren war festzustellen“, so die Anklageschrift, „dass sich in den konfessionellen Jugendbünden immer stärker das Gedankengut der Bündischen Jugend“ durchgesetzte habe, zudem Fahrten veranstaltet, bündische Lieder und ihre Zelte genutzt worden seien.139 Ein illegales Winterlager der dj.1.11, das ein 20-Jähriger mit HJ-Angehörigen Anfang 1935 organisiert hatte, wurde ausgehoben – angeblich fand man kommunistische Texte.140 Tatsächlich aber schwand der Einfluss der bündischen Gruppen sowie ihrer Schriften und Lieder inner- und außerhalb der Hitlerjugend bis 1939 zusehends. Das Regime ging dazu über, unter diesen Begriff verschiedene Gruppen ebenso wie politische Opposition und Subkulturen zu versammeln und zu vermischen. Neue subkulturelle Strömungen kamen vor Kriegsbeginn und in erheblichem Maße nach 1939 wieder auf, deren Verhältnis zur Staatsjugend ein anderes Kapitel beschäftigen wird. Teils griffen solche Jugendmilieus das Stilensem ble der älteren Jugendbewegung zwar auf – die sogenannte Jovy-Gruppe aus Bonn beispielsweise – ein Freundeskreis, deren Angehörige der Hitlerjugend angehörten – stellte sich in die Tradition der dj.1.11. 1940 wurde die Gruppe zerschlagen und ihr Anführer Michael Jovy zu Gefängnis verurteilt.141 Vieles an diesen Gruppen war aber neu, anderes schien der bündischen Jugend nur ähnlich. Aus Sicht der Hitlerjugend waren sie allesamt Kriminelle, eben bündische Cliquen. Der Begriff des Bündischen verkam auf diese Weise immer mehr zur reinen Phrase, diente umso mehr der Stigmatisierung und Kriminalisierung der Betroffenen sowie zur Legitimation der Verfolgung durch den Staat.142 Wie gravierend der Begriff sich gewandelt hatte, unterstreicht ein Bericht des Reichsjustizministeriums von 1944. Dieser widmete sich den Cliquen, welche im Krieg besonders in Großstädten und in Industriezentren Zulauf fanden. Diese Gruppen wurden in eine Kontinuität mit der bündischen Jugend gestellt, um sie zu kriminalisieren. Die involvierten Jugendlichen verband allerdings mit der historischen Jugendbewegung und mit spezifischen bündischen Organisationen der Weimarer Zeit oft nicht einmal mehr Äußerlichkeiten.143 139 Oberstaatsanwaltschaft Mannheim, Anklageschrift vom 25.4.1938. Zit. nach Abdruck bei Franz Josef Schäfer, Willi Graf und der Graue Orden. Jugendliche zwischen Kreuz und Hakenkreuz, St. Ingbert 2017, S. 194–203, hier 199. 140 Lagebericht der Staatspolizeistelle Erfurt für Februar 1935 vom 2.3.1935. In: Hermann-J. Rupieper/Alexander Sperk (Hg.), Lageberichte der Geheimen Staatspolizei zur Provinz Sachsen 1933–1936, Band 3, Halle (Saale) 2006, S. 149–167, hier 155. 141 Vgl. Horst-Pierre Bothien, Die Jovy-Gruppe. Eine historisch-soziologische Lokalstudie über nonkonforme Jugendliche im „Dritten Reich“, Münster 1995; Arno Klönne, Ein Leben aus dem Widerspruch. Michael Jovy (1920–1984). In: Jahrbuch des Archivs der Jugendbewegung, 15 (1984/85), S. 373–378. 142 Vgl. hierzu und im Folgenden umfassender Kenkmann, Wilde Jugend, S. 153–163. 143 Rundschreiben des Reichsführers SS über das Auftreten und die Bekämpfung jugendlicher Cliquen und Banden, 25.10.1944, abgedruckt bei Karl Heinz Jahnke (Hg.), Jugend unter der NS-Diktatur 1933–1945. Eine Dokumentation, Rostock 2003, S. 501–506; Bericht des Reichsjustizministeriums über das Auftreten und die Bekämpfung „jugendlicher Cliquen und Banden“, Anfang 1944. In: ebd., S. 623–631.
Revolution und Gleichschaltung
1.4
61
Die konfessionellen Jugendverbände
Dass die Hitlerjugend trotz ihrer unbestreitbaren Erfolge 1933 nicht mit der Jugend in Deutschland identisch war und in naher Zukunft nicht wurde, hatte zu Beginn viel mit der Autonomie besonders der katholischen Jugend zu tun. Zumindest ein Überblick dazu sei hier geboten. Die konfessionelle Frage blieb in der Parteijugend weitgehend ungeklärt, was mit der Gleichschaltung wie auch mit schwer aufzulösenden Widersprüchen zu tun hatte. Den Anspruch auf Totalität versuchte die RJF unmittelbar nach 1933 mit Angeboten und Drohungen gegenüber den christlichen Verbänden durchzusetzen. Die Staatsmacht ging nach dem Verbot der Zentrumspartei im Sommer 1933 massiv gegen katholischen Verbände und Vereine vor. Im Juli wurde auf Weisung des Geheimen Staatspolizeiamtes der Windthorstbund, die wankende Jugendorganisation der Zentrumspartei, liquidiert.144 Früh forderte man auch die Auflösung der katholischen Jugendvereine, und dies meinte – das Reichskonkordat mit der römischen Kirche war noch nicht ausgehandelt – deren Eingliederung in die Hitlerjugend. Die konfessionelle Jugend sollte dem Staat zugeführt und nicht zuletzt der Einfluss der Kirchen auf Jugendliche in Deutschland gebrochen werden. Die Geschäftsstellen und Jugendhäuser, wie im Fall von Köln, wo der Katholische Jungmännerverband (KJMV), eine der wichtigsten Dachorganisationen der Weimarer Jahre, kurzerhand handlungsunfähig gemacht wurde, hatte die Gestapo zwischenzeitlich besetzt und geschlossen. Akten und Korrespondenzen waren zum Teil beschlagnahmt worden.145 Die Landesregierungen sprachen darüber hinaus ab Sommer 1933, je zu unterschiedlichen Zeitpunkten, erste Verbote aus, welche sich gegen die Jugendorganisationen beider Konfessionen richteten. Verbote betrafen die Uniformierung oder das Tragen von Abzeichen, auch durfte nicht mehr gesungen, gezeltet, gewandert oder auf Plätzen zusammengekommen werden. Außerdem wurde jede sportliche Ertüchtigung sämtlichen Jugendorganisationen – nur unter Ausnahme der Sportvereine – untersagt. Auch dies richtete sich gerade gegen die konfessionellen Jugendbünde und Vereine. Diese Polizeiverordnungen, die in verschärfter Form in Sachsen, Baden und Preußen zuerst erlassen worden waren, galten ab August 1935 im gesamten Reich.146 Die Deutsche Jugendkraft, die größte Sportorganisation des Katholizismus, war zunächst zwar nicht betroffen. Sie wurde aber schließlich 1935 formal aufgelöst: „Die Deutsche Jugendkraft nicht zu retten“, notierte 144 Zum lokalen Wirken in der Weimarer Republik vgl. beispielhaft Dokumente und Zeitungsausschnitte im StA Sigmaringen, Dep. 1 T 6-7, 135 (NL Franz Keller). 145 Vgl. Stellungnahme des Generalpräsens zur Polizeiaktion gegen die katholischen Jugendverbände, o. D. (Historisches Archiv, Erzbistum Köln, Gen. I, 23.11.4, 2). Vgl. umfangreich auch Brandenburg, Die Geschichte der HJ, S. 152 f. 146 Vgl. Friedrich Kemper, Jugendführer des Landes Baden, Richtlinien für die Jugendarbeit des Landes Baden vom 12.8.1933 (StA Freiburg, B719/1, Bl. 061410 f.). Vgl. zudem die Aufstellung der Polizeiverordnungen gegen die konfessionelle Jugendarbeit nach Ländern im Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 13: Verhältnis zu anderen Stellen, S. 1 097–1101.
62
Genese einer Massenorganisation
Kardinal Michael Faulhaber vorausschauend im Oktober 1934.147 Der Sport war ein probates Mittel, um die kirchliche Jugendarbeit zu drangsalieren. In der Fränkischen Schweiz – ein Beispiel unter vielen – musste im August 1935 ein katholisches Jugendlager aufgelöst werden, weil die Hitlerjugend behauptet hatte, dort kämen Sportgeräte zum Einsatz.148 Doch nicht immer zeigten Verbote Wirkung. Viele Jugendliche versuchten der staatlichen Kontrolle zu entgehen, indem sie im Freien in Tarnung von HJ- oder BDM-Einheiten auftraten: „Täglich mehren sich die Fälle“, so ein Zeitungsbericht aus Hamburg im Mai 1933, „dass Jungens mit Abzeichen und sogar Uniformen der Hitlerjugend und des Jungvolks angetroffen werden, ohne dass sie Mitglied dieser Organisationen sind.“149 Auf diese Weise konnten sie Dinge tun, die ihnen inzwischen verboten waren. Der Landesjugendführer für Baden, Friedrich Kemper, rief Ende September 1933 die Behörden zur stichpunktartigen Überprüfung vermeintlicher Hitlerjugend im Freien auf: Man könne nicht hinnehmen, dass die Mitgliedschaft in der Parteijugend zur sportlichen Betätigung oder zum Wandern vorgetäuscht werde. Nicht nur in der Hitlerjugend, weil Millionen neu aufgenommen worden waren, gestaltete sich die Situation für lokale und höhere Dienststellen oft unübersichtlich. Die Kontrolle jener, die außerhalb standen, war ebenso schwer zu leisten.150 „Gegen das Uniformverbot für konfessionelle Jugendverbände“, so auch ein Stimmungsbericht aus Sachsen 1935, werde „noch mehrfach verstoßen“.151 Die Hitlerjugend legte den christlichen Vereinen möglichst viele Steine in den Weg; schikanös, wenn HJ oder BDM kurzerhand Turnhallen in Beschlag nahmen, um die Zusammenkünfte katholischer Tanzgruppen zu sabotieren. Einige DJ- und HJ-Mitglieder rissen im Revolutionseifer den christlichen Wandergruppen Abzeichen von den Uniformen. Aus Köln berichtete der KJMV sogar von Überfällen mit Schusswaffen auf die eigenen Leute.152 In Berlin und ähnlich in anderen Regionen musste die HJ-Gebietsführung nach Ausschreitungen ihre Mitglieder zur Ordnung rufen. Man fürchtete um einen Ansehensverlust 147 Michael Faulhaber, Tagebuch, S. 227, Eintrag vom 1.10.1934 (Kritische Online-Edition der Tagebücher, www.faulhaber-edition.de; 16.7.2020). 148 Vgl. Bericht aus Bayern, A 59. In: Klaus Behnken (Hg.), Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934–1940, 2 (1935), 4. Auflage, Frankfurt a. M. 1980, S. 1 306. 149 Unberechtigtes Tragen von Abzeichen der Hitlerjugend. In: Altonaer Nachrichten vom 4.5.1933. 150 Vgl. Friedrich Kemper, Jugendführer des Landes Baden, Richtlinien für die Jugendarbeit des Landes Baden vom 12.8.1933 (StA Freiburg, B719/1, Bl. 061410 f.). 151 Bericht der Abt. Innerpoli. [Innerpolitische] Abwehr. Übersicht über die politische und wirtschaftliche Lage und über die Stimmung der Bevölkerung im Lande Sachsen von Dezember 1935, o. D., S. 10 (BArch, R58, 3751, Bl. 67–101). 152 Vgl. dokumentierte Fälle im Schreiben des BDM 4/1/121 an Kaplan Heberle, Grundelsheim, 3.6.1934 (StA Ludwigsburg, PL 509, Bü 7, unpag.). Vgl. auch Aufruf von Karl Büchler, Bezirkspräses des KJMV Köln, an den Reichskanzler vom 22.6.1933 (Historisches Archiv Erzbistum Köln, Gen. I, 23.11,4; Dokumentation der Quelle in NSDOK Köln, EzG, jugend1918-1945.de; 16.7.2020).
Revolution und Gleichschaltung
63
in der Bevölkerung. Nachdrücklich müsse man darauf hinweisen, dass „jegliches Eingreifen in die Einheiten anderer Jugendverbände beider Konfessionen“, lautete es erneut im März 1935, „für sämtliche Formationen strengstens verboten“ sei.153 Allzu offen ausgetragene und gewaltsame Kämpfe drohten der Hitlerjugend zu schaden. Paul Fliege berichtete über einen Zusammenstoß mit der Parteijugend in Dorsten im Frühjahr 1934; ähnlich gab es sie vielfach in Deutschland. Ein Lager der katholischen Sturmschar mit rund 300 Teilnehmern hatte die HJ überfallen. Es kam zu Prügeleien und einem Polizeieinsatz, welcher mit der kurzzeitigen Verhaftung katholischer Jugendlicher endete: „Die Bevölkerung, die das alles mehr oder weniger selbst mitbekommen hatte, war über das Handeln der Hitlerjugend sehr erbost und erregt. Tagelang waren die Geschehnisse noch Stadtgespräch.“154 Fliege, der in einer Lokalzeitung aus Sicht der Sturmschar diesen Überfall schilderte, wurde vor ein Parteigericht geladen. Kleinlaut musste die Partei am Ende allerdings der Hitlerjugend Anmaßung attestieren. Derart kritisiert veröffentlichte jene Ende Mai eine Stellungnahme. Die Hitlerjugend habe Verantwortung für die Nation übernommen, erklärten die HJ-Unterführer selbstherrlich. Daraus folge ein „großes Recht“ für die Hitlerjugend. Sie dürfe „die restlose Ausübung der Macht“ für sich beanspruchen.155 Doch diese restlose Ausübung von Macht, zumindest die eigenmächtige Anwendung derselben, konnte nicht im Interesse der RJF liegen. Reichsjugendführer Schirach steuerte verschiedentlich gegen. Im Mai 1936 gab die RJF wieder einmal eine Anordnung dieser Art heraus: Nun sollte ottesdienstzeit sowie jegliche Störung das Vorbeimarschieren vor Kirchen zur G der kirchlichen Messen durch die Einheiten der Hitlerjugend untersagt sein.156 Missachtet wurden diese Anweisungen, welche dem Schutz des Ansehens der Parteijugend dienten, immer wieder. Die wenigsten Angehörigen der Hitlerjugend nahmen sie überhaupt zur Kenntnis. Im Rheinland sorgte eine G ruppe von HJ-Mitgliedern 1935 für Aufsehen, weil sie im Kölner Dom während einer Treuekundgebung katholischer Jugendlicher unter Protestgesang bis zum Altar vormarschierten. Unangenehm war der Vorfall für die RJF, weil er die Aufmerksamkeit des Auslands auf sich zog. Die Hitlerjugend, am Ende vor die Tür gesetzt, brach eine Prügelei auf dem Domplatz vom Zaun.157 „Hitler-Jugend 153 Streitfälle mit konfessionellen Jugendverbänden. In: GB: Berlin, 79/35 vom 23.3.1935. 154 Paul Fliege, Erinnerungen an die Auseinandersetzungen zwischen der katholischen Sturmschar und der Hitlerjugend im Frühjahr 1934. In: Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck und Dorsten e.V., (1995) 54, S. 52–57, hier 53. 155 Hitler-Jugend und Sturmschar. Es geht um Deutschland! (Dorstener Volkszeitung vom 27.5.1934), Abdruck im Anhang bei ebd., S. 57. 156 Befehl über die Vermeidung der Störung von Gottesdiensten. In: Werner Dolata, Chronik einer Jugend. Katholische Jugend im Bistum Berlin 1936–1949, Hildesheim 1988, S. 18; Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 13: Verhältnis zu anderen Stellen, S. 1 096. 157 Vgl. HJ-Demonstration in der Kirche. In: Sonderinformationen Deutscher Jugend, Oktober 1937, Nr. 1. In: Hans Ebeling/Dieter Hespers, Jugend contra Nationalsozialismus. „Rundbriefe“ und „Sonderinformationen deutscher Jugend“, 2. Auflage, Frechen 1968, S. 22–37, hier 35.
64
Genese einer Massenorganisation
stürmt den Kölner Dom“, titelte das „Pariser Tageblatt“, das die „beispiellosen antikatholischen Ausschreitungen im Rheinland“ ins Zentrum rückte.158 In den 1930er-Jahren kam es wiederholt zu derartigen Vorfällen. In Franken verbot man daher 1936 an Sonntagen „auf Plätzen vor den Kirchen“ in Erscheinung zu treten oder „Vorbeimärsche an Kirchen – besonders mit Marschmusik – zu veranstalten“.159 Im Gebiet Saarpfalz wurde im Februar 1937 eine Anweisung durchgegeben, nach der „Plätze vor den Kirchen […] nicht als Antrittsplätze“ zu benutzen seien.160 Die Verbote der katholischen Jugendorganisationen, die während des Frühsommers 1933 teils ausgesprochen worden waren, mussten wieder zurückgenommen werden. Sie drohten die Beziehungen zum Vatikanstaat zu belasten. Das Reichskonkordat, am 20. Juli 1933 mit dem Kirchenstaat ausgehandelt, sicherte die kirchliche Jugendarbeit in Zukunft ein Stück weit vor Angriffen ab, jedenfalls soweit sie den katholischen Behörden unterstand. Noch fürchtete das Regime, dass ein rigoroses Vorgehen gegen die Kirche Unmut in der Bevölkerung anfachen würde. Auch Schirach sah sich genötigt, seine junge Führerschaft auf die Regelungen des Konkordats zu verpflichten. Er versprach, „aus der Hitler-Jugend heraus“ würden alle „Angriffe auf den katholischen Glauben sowie die Kirchen“ unterlassen.161 Der KJMV war mit rund 390 000 männlichen Jugendlichen in rund 4 360 Vereinen im Jahr 1930 eine der wichtigsten Dachorganisationen.162 Mehr oder minder durch das Konkordat gesichert, konnte der Verband trotz erheblicher Einschränkungen und massiver Intervention fortexistieren. Das Konkordat schützte freilich nicht auf Dauer. Die KJMV-Zentrale in Düsseldorf wurde im November 1935 erstmalig geschlossen, der Generalsekretär verhaftet. Im Februar 1936 schlug die Gestapo zu: 57 Personen, darunter rheinische Jugendführer sowie Generalpräsens Ludwig Wolker, kamen in Haft. Ihnen wurde Hochverrat und die Zusammenarbeit mit Kommunisten vorgeworfen.163 Der KJMV war de facto handlungsunfähig und aus dem Weg geräumt, bevor der Verband mit seinen angeschlossenen Vereinen und Gruppen wie der katholische Sturmschar oder dem Bund Neudeutschland – ebenso wie sein Pendant, der Zentralverband der katholischen Jungfrauenvereinigungen – nach 1937 in den Ländern schrittweise verboten wurde. Im Zuge eines Verbots in Limburg rechtfertigte die HJ-Führung: Die „fraglichen katholischen 158 Hitler-Jugend stürmt den Kölner Dom. In: Pariser Tageblatt vom 7.7.1935. 159 Dienst der Hitlerjugend in der Zeit der Gottesdienste. In: GB: Franken, 3/36 vom 6.1936. 160 Antreten vor Kirchen während des Gottesdienstes. In: GB: Saarpfalz, A3/37 vom 15.2.1937. 161 Zit. nach Brigitte Lob, Albert Schmitt O.S.B. Abt in Grüssau und Wimpfen. Sein kirchenpolitisches Handeln in der Weimarer Republik und im Dritten Reich, Köln 2000, S. 243. 162 Vgl. Katholischer Jungmännerverband. In: Walter Kasper (Hg.), Lexikon für Theologie und Kirche, Band 5, Freiburg 1996, S. 1 368. 163 Vgl. Barbara Schellenberger, Katholische Jugend und Drittes Reich. Eine Geschichte des Katholischen Jungmännerverbandes 1933–1939 unter besonderer Berücksichtigung der Rheinprovinz, Mainz 1975, S. 84–86, 140–145 und 170.
Revolution und Gleichschaltung
65
Jugendorganisationen [haben] Fahrten ausgeführt, gezeltet, Geländespiele veranstaltet sowie alle möglichen Sportarten, wie Fechten, Boxen, Schießen usw. ausgeübt“.164 Aus beschlagnahmtem Material sei ersichtlich, dass eine „eindeutige staatsfeindliche Beeinflussung der Mitglieder durch ihre Führer“ vorliege.165 Umso erstaunlicher im Rückblick, dass die katholische Jugendarbeit – mit Einschränkungen selbst in den Kriegsjahren – trotz staatlicher Interventionen fortexistierte. In den ersten Jahren nach 1933 wurden die Verbote beispielsweise in Bezug auf bündische und konfessionelle Wander- und Sportgruppen von den Behörden nicht streng ausgelegt; den Polizeibeamten galten sie noch nicht per se als staatsgefährdend. Aus der Bevölkerung gab es zu Beginn nur wenige Anzeigen, polizeiliche Verhöre blieben unmittelbar nach 1933 vergleichsweise selten.166 Ab 1936 nahmen die Repressionen, Gerichtsverfahren und Verhöre allerdings zu – in Dortmund kamen 1937 40 katholische Jugendliche und junge Männer vor Gericht, weil man ihnen unerlaubtes Wandern und bündische Betätigung vorwarf.167 In den kirchlichen Raum reichte der Griff der Hitlerjugend immer nur bedingt hinein. Katholische ebenso wie evangelische Zeitschriften konnten nach 1933 weiter erscheinen; teils gewannen sie junge Leser hinzu.168 Die katholischen Sturmschärler gingen bis zu ihrem Verbot durchaus offen auf Ausflüge. Sie veranstalteten – obwohl dauernd bedroht – Freizeitlager. Nach 1939, als der KJMV im Deutschen Reich offiziell aufgelöst war, fungierte die kirchliche Seelsorge als Rückzugsraum. Gottesdienste wurden laut der Historikerin Barbara Stambolis zu „geschützten Reservaten“.169 Stellvertretend für viele ist der Erinnerungsbericht von Konrad Pöhler, geboren 1921 in Paderborn, einer Region, die über traditionell starke katholische Bindekraft verfügte: „Ich war bis 1935 in der Jungschar und danach in der Jungenschaft der katholischen Jugend aktiv, auch war ich in der Sturmschar. Die Zeit hat mir gefallen und ich war sehr engagiert. […] Mitglied der Hitler-Jugend war ich nie.“ Im Krieg, als die Strukturen offiziell zerschlagen waren, hörten die Aktivitäten aber nicht sofort auf. „Wir durften uns gegenüber der Hitler-Jugend nicht besonders aufspielen“, berichtete Pöhler, „weil wir verboten waren. So konnten wir nur im kirchlichen Raum tätig sein. Unsere Gruppenstunden und Treffen waren aber trotzdem sehr stark geprägt von der bündischen Jugend, von 164 Verbot und Auflösung katholischer Jugendverbände. In: GB: Hessen-Nassau, A13/37 vom 1.12.1937. 165 Ebd. 166 Vgl. Kenkmann, Wilde Jugend, S. 118 f. 167 Vgl. Georg Pahlke, Trotz verbot nicht tot. Katholische Jugend in ihrer Zeit 1933–1945, Paderborn 1995, S. 216–218. 168 Vgl. hierzu und im Folgenden Anette Zehnter, Widerstand und Verfolgung in Bochum und Wattenscheid 1933–1945, Essen 1992, S. 190–197. 169 Barbara Stambolis, „Fest soll mein Taufbund immer stehn“. Jugendliche im katholischen Milieu oder die Grenzen der Gleichschaltung – Lebensweltlich geprägte Resistenzräume im Dritten Reich. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 51 (2000) 3, S. 157–172, hier 169. 170 Dominik Gehling/Volker Gehling/Jonas Hofmann/Holger Nickel/Christopher Rüther (Hg.), „Das müssen Sie mir alles aufschreiben.“ Paderborner Zeitzeugen berichten 1933–1948, Paderborn 2005, S. 52.
66
Genese einer Massenorganisation
den Ideen der Jugendbewegung.“170 Einzelne fielen dennoch auf und gerieten dann ins Visier der Überwachungsorgane. In Westfalen zum Beispiel wurden im März 1942 zwölf Jugendliche aus der HJ ausgeschlossen, weil sie angeblich „am illegalen Auf- und Ausbau des im Jahre 1939 verbotenen Bundes ‚Neu-Deutschland‘ [ND] bzw. des im Jahre 1937 verbotenen Jungmännervereins beteiligt“ gewesen seien.171 Und 1941 wurde eine illegale ND-Gruppe aus Bruchsal von der Polizei zerschlagen, die Mitglieder verhaftet und im Juli 1942 verurteilt.172 Mit Blick auf die Repressionen, perfiden Winkelzüge und Verbote ist allerdings nur die eine Seite beschrieben. Das Werben und Umschmeicheln der konfessionell organsierten Kinder und Jugendlichen bildete die andere Seite, welche nicht zu vernachlässigen und deren Wirkung nicht zu unterschätzen ist. Die Revolution des Frühjahrs 1933 übte auf Teile der konfessionellen Jugend ebenfalls erhebliche Anziehungskraft aus. Bei Festzügen der Sturmschar, der am bündischen Stil orientierten Wandergruppe im KJMV, konnten 1933 – wie Fotografien zeigen – Hakenkreuz-Fahnen beobachtet werden; sicherlich nicht nur, wie später von wohlmeinenden Geschichtsschreibern behauptet, eine „flüchtige Illusion nach arglistiger Täuschung durch das NS-Regime“.173 Schirach hatte trügerische Hoffnungen aber tatsächlich bewusst geweckt. Der Reichsjugendführer versprach, nur jene „Jugendorganisationen aufzulösen und zu verbieten, die sich in irgendeiner Form dem revolutionären Wollen der deutschen Jugend entgegenzustellen“ wagten.174 Die Situation für die konfessionelle Jugend schien demnach noch immer offen. Bünde, Vereine und katholische Jugendführer hofften, ihre Existenz sei nicht bedroht, wenn sie ihr Bekenntnis zum Staat nur glaubhaft genug ablegten. Bereits beim „Fest der Jugend“ Ende Juni 1933 zeigte sich vielerorts, dass die Jugendlichen – viele freiwillig, nur manche durch Druck – den Erwartungen des neuen Regimes folgten. Katholiken beteiligten sich teilweise, wie für das Ruhrgebiet belegt, am völkischen Kult zur Sonnenwendfeier. In Xanten marschierten junge Vereinsmitglieder mit der Hitlerjugend in bizarrer Eintracht; die Verbandsleitung hatte ihren Vereinen empfohlen, durch die Beteiligung nationales Bewusstsein und guten Willen zu demonstrieren.175 Und im Bistum Münster hielt es der KJMV für eine „Ehrensache“, die Vereinsmitglieder teilnehmen zu lassen. Typisch sei im ländlichen Raum gewesen, so befand Historiker Christoph Kösters über das Münsterland, dass etwa „katholische Gesellen […] hinter SA, SS, HJ und Parteimitgliedern 171 HJ-Gericht. Ausschluss aus der Hitler-Jugend. In: GB: Westfalen, K4/42 vom 15.5.1942. 172 Geschichte und Dokumente zur Gruppe bei Otto B. Roegele, Gestapo gegen Schüler. Die Gruppe „Christopher“ in Bruchsal, Konstanz 1994. 173 Franz-Josef Krehwinkel, Sturmschar unter dem NS-Regime. In: Bernd Börger/Hans Schroer (Hg.), Sie hielten stand. Sturmschar und Katholischer Jungmännerverband Deutschlands, Düsseldorf 1989, S. 95–117, hier 99. 174 Baldur von Schirach über seine Aufgaben als Jugendführer des Deutschen Reiches vom 24.6.1933. In: Jahnke (Hg.), Eine Dokumentation, S. 56–59. 175 Vgl. Ralph Trost, Eine gänzlich zerstörte Stadt. Nationalsozialismus, Krieg und Kriegsende in Xanten, Band 1, Münster 2004, S. 125; Jugend beteiligt sich an den Sonnenwendfeiern. In: Essener Nationalzeitung vom 23.6.1933.
Revolution und Gleichschaltung
67
beim ‚Fest der Jugend‘ im Festumzug marschierten und zusammen mit dem ‚Stahlhelm‘ den Sprechchor ‚Ans Vaterland‘ vortrugen“.176 Der Revolutionstaumel ergriff breite Teile der christlichen Jugend ebenso wie viele andere. Konflikte zwischen Nationalsozialismus und Christentum blieben noch überdeckt. Die Hitlerjugend betrieb ab 1933 zudem keinen koordinierten oder in jeder Hinsicht eindeutigen Generalangriff auf die christlichen Kirchen. Zum Teil gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen der Hitlerjugend und katholischen Jugendlichen waren oft die Folge radikalen Eigensinns einzelner Gruppen und ihrer jungen Unterführer. 1934 kam es z. B. im Schwarzwald an einigen Orten zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen der katholischen Deutschen Jugendkraft und der HJ.177 Höhere Dienststellen der Parteijugend, denen mitunter sehr bewusst war, dass solche Konflikte für ihr Ansehen schädlich sein konnten, reagierten recht häufig mit Verbotsanweisungen – wie auch in Berlin im März 1935, wo nach Übergriffen durch HJ-Einheiten die Gebietsführung einschritt: „Jegliches Eingreifen in die Angelegenheiten anderer Jugendverbände beider Konfessionen“ sei für „sämtliche Formationen strengstens verboten“.178 Wenn die Parteijugend in Hochburgen der Kirche Werbung trieb, um weiter zu wachsen oder überhaupt erst eine organisatorische Basis für sich zu schaffen, setzten untere Dienststellen manchmal sogar auf Kooperation. In Münster umschmeichelte HJ-Bannführer Hermann Lindenburger, der später in Frankfurt am Main und während des Krieges in den Niederlanden seine HJ-Karriere fortsetzte, die Bevölkerung mit erstaunlichen Argumenten. Die Kritik an der säkularen Moderne und dem Materialismus machte sich der junge Mann durchaus geschickt zu Eigen. Nicht wenigen dürften seine Argumente eingeleuchtet haben. Die Hitlerjugend habe sich, versuchte der Bannführer Glauben zu machen, einer Gottlosigkeit der republikanischen Ordnung entgegengestellt. Der Jugend wieder Glauben zu geben, habe er sich zur Zukunftsaufgabe gemacht. Die Kirche auf der einen Seite und die Hitlerjugend auf der anderen Seite seien darum keine Gegensätze, sondern gar Partner in der Gestaltung einer neuen Zeit. Die Hitlerjugend strebe ebenso wie die Gläubigen nach einer grundsätzlich neuen Lebensauffassung.179 Derartige Fühlungnahme war einerseits nicht die Regel, andererseits auch keine Ausnahme. In Jülich, um ein zweites Beispiel zu nennen, nahm die Hitlerjugend anlässlich ihres „Fests der Jugend“ 1933 sogar einen Kirchgang mit Mittagsandacht in ihr Programm auf. Der Gebietsführer umwarb die k atholischen Jugendlichen und versuchte,
176 Christoph Kösters, Katholische Verbände und moderne Gesellschaft. Organisationsgeschichte und Vereinskultur im Bistum Münster 1918 bis 1945, Paderborn 1995, S. 264 177 Vgl. Bericht über die Lage in Deutschland, Nr. 8 vom 6/7.1934. In: Bernd Stöver (Hg.), Berichte über die Lage in Deutschland: Die Meldungen der Gruppe Neu Beginnen aus dem Dritten Reich 1933–1936, Bonn 1996, S. 167–222, hier 198. 178 Anweisung des Gebietsführers Steinacker über Streitfälle mit konfessionellen Jugendverbänden. In: BB: Berlin, 79/35 vom 23.3.1935. 179 Vgl. ebd., S. 269. Zur Karriere Lindenburgers vgl. knapp Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 776.
68
Genese einer Massenorganisation
sie zum Eintritt in die Hitlerjugend zu bewegen.180 Werbung und Repression prägten das Verhältnis der Hitlerjugend zum C hristentum auf gleiche Weise – aber je nach Ort und Personen in unterschiedlicher Weise. Die Gleichschaltung betraf die evangelischen Vereine und Organisationen nach 1933 zunächst in weit größeren Maß. Im protestantischen Milieu brach die Parteijugend tatsächlich früh erfolgreicher ein. Die Historiografie hat dies mit der Entwicklung des Protestantismus und der Situation der Kirchen 1933 speziell begründet. Die „Deutschen Christen“ (DC), die auf eine Verschmelzung von Christentum und völkischer Weltanschauung setzten, repräsentierten zwar längst nicht die Protestanten als Ganzes. Aber sie befanden sich im Frühjahr 1933 auf dem Höhepunkt ihres Einflusses. „In der nationalen Erhebung“, lautete es aus DC-Kreisen, „hat in unserem Vaterlande in einzigartiger Weise der Staat den Weg zum deutschen Volke und das deutsche Volk wieder den Weg zum Staat gefunden.“181 Die Kirchenwahlen am 23. Juli 1933 stärkten, mit Rückendeckung der NSDAP, die DC und läuteten eine „Machtergreifung“ innerhalb der evangelischen Kirchen ein.182 Das beschriebene Muster, welches die Zeit der Gleichschaltung prägte, ist auch im Falle der evangelischen Jugendorganisationen einmal mehr leicht auszumachen. Für die Vereine blieb der Aufwind der DC nicht folgenlos. Evangelische Jugendliche traten spätestens nach dem Frühjahr 1933 der Hitlerjugend zahlreich freiwillig und oft begeistert bei. Hitlerjunge Schall aus Dresden steht idealtypisch für jene Masse junger Menschen, die aus dem radikalisierten Protestantismus zur Hitler-Bewegung fanden. Schon Anfang der 1930er-Jahre hatte er sich für die Predigten der DC-Pfarrer begeistert. Zwischen Religion und Nationalsozialismus sah er keinen Widerspruch, im Gegenteil. Hitler hielt er für den Sendboten Gottes: „Kampf ist unsere Aufgabe heute […] gegen alles Unchristliche und Undeutsche, damit wieder Sitte, Reinheit und Sauberkeit in unser Vaterland kommen [kann] und ein deutsches Christentum den Sieg über alles erringe.“183 Die DC-Geistlichen, die der Bekennenden Kirche (BK) gegenüberstanden, predigten, dass – so der Soziologe Hansgeorg Schroth in einem Jugendblatt – der Glaube ebenso wie die Weltanschauung „in Rasse, Blut und Art angelegt“ und die „Rasse etwas Gott gegebenes“ sei.184 Aufgabe der Kirche müsse es sein, so forderte etwa ein Memorandum aus sächsischen DC-Kreisen, „innerhalb der großen Deutschen Jugendfront und aus ihr heraus ein neues Sammeln zu einer Jugendgemeinde zu beginnen. Dort, wo den jungen deutschen Menschen der
180 Vgl. Barbara Schellenberger, Ein „Fest der deutschen Jugend“ 1933 in Jülich. In: Neue Beiträge zur Jülicher Geschichte, (2011) 23, S. 109–115, hier 111. 181 Richtlinien der Glaubensbewegung „Deutsche Christen“, o. D., S. 1 (LKA Stuttgart, K24, 1255, unpag.). 182 Zum Zusammenhang vgl. Schubert-Weller, Hitlerjugend, S. 113–118. 183 Postert, Hitlerjunge Schall, S. 69. 184 Hansgeorg Schroth, Religion und Offenbarung. Ein Arbeitsplan zur Einleitung des Werkplans. In: Führerdienst. Neue Folge der Rundschau für evangelische Jugendführung und Jungmännermission, (1935) 6, S. 245–254, hier 245.
Revolution und Gleichschaltung
69
Heiland gepredigt und wo er von jungen Menschen geglaubt wird, dort wächst die junge Gemeinde, dort wächst die junge nationalsozialistische evangelische Kirche.“185 Nicht nur müsse man selbst auf die Hitlerjugend aktiv zugehen. Vielmehr sollten „die evangelische Jugendarbeit der Kirche und die Arbeit in der HJ eine erzieherische Ganzheit bilden“, weshalb man eigene Vertrauensleute in den Dienststellen der Hitlerjugend vor Ort sowie auf Gebietsebene gewinnen müsse.186 Mehrfach, wie im Rheinland, lösten sich evangelische Jugendvereine schon in der ersten Jahreshälfte 1933 auf, da – wie sie feststellten – eine „übergroße Abwanderung“ zur Hitlerjugend ihre Arbeit fast unmöglich machte.187 Im Reichsverband der Evangelischen Jungmännerbünde – dem zweitgrößten Dachverband – fiel es Geistlichen und Jugendführern, auch dann, wenn sie nicht zur DC-Bewegung gehörten, zunehmend schwer, sich der Forderung nach Eingliederung zu widersetzen. Sie hatten die „Volksgemeinschaft“ – ein wolkiges Gemeinschaftsideal, das man irgendwo jenseits von Parteien, Ständen und Klassen beschwor – seit Langem gefordert. Die Hitlerjugend schien angetreten, um diese Forderung einzulösen. Auf dem Bundesfest der evangelischen Jugend in Stuttgart im Sommer 1933 zeigte man Loyalität zur neuen Staatsordnung durch Grüßen der eigenen Fahnen mit erhobenem rechtem Arm.188 Auch aus der Christlichen Pfadfinderschaft waren bereits etwa 20 Prozent der Mitglieder zur HJ übergelaufen. Andere blieben, weil sie glaubten, das Regime habe nicht die Absicht, gegen sie einzuschreiten. Mindestens auf Aussöhnung mit der Hitlerjugend konnte man hoffen. „Der neue Staat“, so Historiker Günter Brakelmann über die Situation der evangelischen Jugendorganisationen 1933, „wurde als geschichtlicher Wille Gottes voll angenommen. Ihn mitaufzubauen, wurde Aufgabe. Aber – hier setzt der erste Konflikt ein – man wollte diese Mitarbeit als selbstständiger Partner.“189 Die gleichberechtigte Mitarbeit war eine trügerische Selbsttäuschung, die auf fatale Verkennung des Totalitäts- und Monopolanspruchs der Hitlerjugend ruhte. Die Illusion währte nur bis Jahresende 1933. Vertreter der evangelischen Jugend suchten zunächst oft vor Ort oder auf Länderebene zur Einigung mit der Hitlerjugend zu gelangen. Sogar potenzielle Aufgaben- und Tätigkeitsfelder, die man gegenüber der Parteijugend aufzugeben bereit war, wurden abgesteckt. Diese Strategie zielte auf Koexistenz und Partnerschaft.190 Der Ende September ernannte DC-Reichsbischof Ludwig Müller arbeitete im Herbst 1933 einen Vertragstext mit Schirach aus. Am 19. Dezember
185 Richtlinien zur Neuordnung der Jugendarbeit, o. D., S. 2 (LKA Dresden, Best. 5, 274, 2, Bl. 280–284). 186 Ebd., S. 4. 187 Diakon Schöttler an Westbund, Wuppertal-Barmen, 14.11.1933 (Westbundarchiv, 37– 15: CVJM Köln-Süd. Zit. nach NSDOK, EzG, jugend1918-1945.de; 16.7.2020). 188 Vgl. Anordnungen zum Bundesfest 1933 des Württ. [Württembergischen] Ev. [Evangelischen] Jungmännerwerks vom 25.8.1933 (LKA Stuttgart, K24, 1255, unpag.). 189 Brakelmann, Kreuz und Hakenkreuz, S. 225. 190 Vgl. Dieter von Lersner, Die Evangelischen Jugendverbände Württembergs und die Hitler-Jugend 1933/34, Göttingen 1958, S. 36.
70
Genese einer Massenorganisation
wurde er unterzeichnet. Kernbestandteil des Vertrags war die Eingliederung des Evangelischen Jugendwerks in die Hitlerjugend. Im Juli 1933 hatte man die wichtigsten Vereine, Verbände und Bünde in dieser Dachorganisation zusammengefasst. Damit hoffte man, die Autonomie der kirchlichen Jugendarbeit im „Dritten Reich“ abzusichern. Ebenso wie im Falle des Großdeutschen Bundes als bündischem Defensivunternehmen geschah hier das genaue Gegenteil. Schirach war nicht bereit, das Jugendwerk anzuerkennen. Und Reichsbischof Müller nutzte, in der Rolle des Handlangers, das Evangelische Jugendwerk als Instrument der Gleichschaltung. Junge Menschen unter 18 Jahren sollten, so sah es der Vertrag nun vor, „in die Hitler-Jugend und ihre Untergliederungen eingegliedert“ werden und sie sollten „entsprechend ihrer Zugehörigkeit […] den Dienstanzug der Hitler-Jugend tragen“.191 Bereits Anfang August hatte die RJF der Parteijugend eine Mitgliedschaft in einer konfessionellen Organisation verboten – und damit den Druck erhöht. Mit Abschluss des Vertrags tat die RJF nun den scheinbar entscheidenden Schritt hin zur Eingliederung der evangelischen Jugendorganisationen. Reichsbischof Müller und die von der DC-Bewegung mittlerweile dominierte evangelische Reichskirche hatten die Hitlerjugend „als Träger der Staatsidee“ formal anerkannt, ebenso, dass die „einheitliche staatspolitische Erziehung“ durch den neuen Staat erfolgen sollte.192 Zunächst galt allerdings eine Übergangsfrist. Bis spätestens Mitte Februar 1934 sollte die Eingliederung der evangelischen Mädchen und Jungen erfolgt sein.193 Die Überführungen verliefen vielfach nicht reibungslos. Das kündigte sich früh an, als in der Vorweihnachtszeit 1933 in Teilen Deutschlands kleinere Protestkundgebungen stattfanden. Zahlreiche Jugendliche empfanden es als Zumutung, in die Hitlerjugend per Vertrag eingereiht zu werden und ihre eigene Gemeinschaft aufgeben zu müssen.194 Reichsjugendpfarrer Karl Friedrich Zahn, einem überzeugten Parteigänger, wurde die Aufgabe zuteil, die Vertreter des Evangelischen Jugendwerks fügsam zu machen, um die Überführung der Vereine und Verbände zu bewerkstelligen. Seinem Vorgänger Erich S tange – der bei Reichsjugendführer Schirach schon gegen das Verbot der Doppelmitgliedschaft protestiert hatte – war vorgeworfen worden, die „Einigung zu sabotieren“. Anfang 1934 war Stange des Amtes entbunden und im Schnellverfahren aus der NSDAP ausgeschlossen worden.195 Bei seinem Nachfolger Zahn schienen in 191 Abkommen zwischen Baldur von Schirach und dem Reichsführer im Evangelischen Jugendwerk Deutschlands Ludwig Müller über die Eingliederung der evangelischen Jugendverbände in die Hitler-Jugend vom 19.12.1933. In: Benecke (Hg.), Hitler-Jugend 1933–1945, S. 108. 192 Ebd. 193 Vgl. Ausführungsbestimmungen zum Vertrag, gez. Reichsjugendführer Schirach und Reichsbischof Müller vom 19.12.1933 (LKA Stuttgart, K24, 1255, unpag.). 194 Schubert-Weller, Hitlerjugend, S. 144 und 122–132. 195 Baldur von Schirach beantragt Ausschluss des Reichsführers des evangelischen Jugendwerkes aus der NSDAP. In: Der Thüringer Sturmtrupp, (1934) 1, S. 1. Zur Selbstrechtfertigung Stanges gegenüber der evangelischen Jugend vgl. Rundschreiben, verfasst unmittelbar nach der Absetzung vom 22.12.1933 (LKA Dresden, 5, 274, 1, Bl. 274154–274156).
Revolution und Gleichschaltung
71
Hinblick auf seine Loyalität zum neuen Staat weniger Zweifel nötig: „Kirche und Jugend haben durch Reichsbischof und Jugendführer einen großen Schritt zueinander hin getan“, schrieb Zahn in einer programmatischen Schrift. „Die [evangelische] Kirche lässt ihre Jugend freudig mitmarschieren unter den Fahnen des Dritten Reiches und die Hitler-Jugend sieht fortan in der Kirche und ihrer Jugendarbeit nicht mehr einen Feind, sondern einen guten Freund.“196 Doch befand sich der neue Reichsjugendpfarrer in einer undankbaren Lage. Auf der einen Seite standen die radikalen HJ-Führer und Teile des Führerkorps, die von der Kirche im Allgemeinen nichts hielten. Ihrer Angriffe – gar in Leit organen der Hitlerjugend publiziert – musste sich Zahn erwehren.197 Auf der anderen Seite standen die eigenen Leute und die BK-Geistlichen, welche zu Recht einen Betrug am Grundsatz autonomer evangelischer Jugendarbeit kritisierten. Zahn bekam längst nicht in alle Führungsfiguren des Jugendwerks hinter sich. In der Praxis wurde das Abkommen vom Dezember 1933 vielfach unterlaufen, nicht eingehalten oder sogar offen attackiert. Aus dem Jugendwerk gingen leitende Köpfe Ende 1933 auf Konfrontation. Sie argumentierten: Der Dachverband stelle eine „selbständige Organisation“ dar, habe „mit der Kirche als solcher nichts zu tun“ und sei an Reichsbischof Müller nicht gebunden. Müller habe kein Entscheidungsrecht über die Zukunft der evangelischen Jugendarbeit.198 Vor allem Otto Riethmüller tat sich beeindruckend hervor. Seit 1928 war er verantwortlich für den Evangelischen Reichsverband weiblicher Jugend, welcher mit etwa 300 000 Mitgliedern von ganz erheblicher Bedeutung war. Ende Dezember 1933 hatte Riethmüller – in „ernster Stunde“, wie er betonte – ein Rundschreiben verfasst. Den Anspruch des nationalsozialistischen Staates auf Erziehung der Jugend erkannte er darin zwar an. Gleichzeitig wies er die Eingliederung der evangelischen Jugend in die Hitlerjugend jedoch zurück: „Wir wollen durchaus die Einheit der deutschen Jugend – ein freudiges Zusammenstehen der gesamten Jugend im Dienst des neuen Deutschland! Wir halten aber den […] Weg […] nach immer erneuter gründlicher Prüfung für praktisch undurchführbar. Er erreicht keine Einheit der deutschen Jugend, verhindert eine wirklich erziehliche Arbeit und zerstört allmählich alle selbstständige evangelische Jugendarbeit, auf die auch das Dritte Reich nicht verzichten kann.“199 Das Schreiben wurde massiv vervielfältigt. Auch aus anderen Kreisen kam Kritik. Die Führerschaft der Christlichen Pfadfinder erklärte, dass man sich dem „kirchlichen Machtanspruch zur Eingliederung in die Hitlerjugend […]
196 Karl Friedrich Zahn, Kirche und Hitlerjugend, Berlin 1934, S. 15. 197 Vgl. beispielsweise Protestschreiben des Reichsjugendpfarrers Zahn an die Schriftleitung des sächsischen HJ-Organs „Junger Wille“ vom 9.8.1935 (LKA Dresden, 5, 274, 2, Bl. 45 f.). 198 Bericht über eine Unterredung des sächsischen Innenministeriums mit dem Ortsgruppenführer des Evangelischen Jugendwerks Eberhard vom 11.1.1934 (HStA Dresden, 10736, 22522, unpag.). 199 Evangelischer Reichsverband weiblicher Jugend. Der Reichsführer Direktor O. Rietmüller, An die Eltern unserer evangelischen Jugend, o. D. (ebd.).
72
Genese einer Massenorganisation
nicht beugen“ wolle.200 Und der Gauführer des Berliner Jugendwerks, Helmut Mezger, trat Anfang 1934 einer Behauptung der NS-Presse entgegen, wonach die evangelische Jugend zur Zuflucht für Kommunisten geworden sei. Im roten Berlin-Wedding, wie Mezger entgegenhielt, gebe es lediglich zwei evangelische Jugendgruppen, allerhöchstens 60 Mann. Man selbst habe ja „in der marxistischen Zeit am allerschwersten zu kämpfen gehabt“, und die ablehnende Haltung der evangelischen Jugend zum Kommunismus sei heute noch genauso wie in der Weimarer Zeit.201 Die RJF treibe eine fadenscheinige und verlogene Politik. In Stuttgart – ein weiteres Beispiel – wies der Leiter des dortigen Jungmännerwerks im Dezember 1933 den Totalitätsanspruch der Hitlerjugend mit großem Selbstbewusstsein zurück: „Wir wollen als gute Streiter Jesu Christi den uns aufgedrungenen Kampf unverzagt weiterkämpfen.“202 Diese Gegenwehr aus Kreisen der kirchlichen Jugendarbeit fiel unerwartet heftig aus – derart heftig sogar, dass die sozialdemokratische Exilpresse im Dezember 1933 eine verfrühte Bilanz zog: „Der Kampf geht weiter und wie er auch ausfällt: er hat den braunen Erneuerern bis jetzt eine Niederlage nach der anderen beschert.“203 Am 4. Januar 1934 reagierte Reichsbischof Müller mit einem „Maulkorb erlass“ auf die Proteste. Er ließ Kundgebungen sowie den Druck von Flugblättern oder die Verbreitung von Rundschreiben verbieten. Etwa zeitgleich stellten sich erste Erfolge ein. Tatsächlich fanden nun Eingliederungen von evangelischen Vereinsmitgliedern statt – primär wohl dort, wo der Protestantismus tendenziell schwächer und die evangelische Jugendarbeit nicht stark aufgestellt war. Im Regierungsbezirk Düsseldorf wurde im Februar 1934 das geschlossene Auftreten der evangelischen Jugend untersagt; sie selbst allerdings nicht verboten. Am 7. Februar entließen die Vereine nach einer Vereinbarung mit der örtlichen HJ-Führung sämtliche Mitglieder unter 18 Jahren, damit sie von der Hitlerjugend übernommen werden konnten.204 Im Ruhrgebiet, wo die evangelische Jugend mit der Hitlerjugend im Sommer 1933 teils zusammen auf Fahrt gegangen und scheinbar einträchtig aufmarschiert war, aber zumindest bislang freiwillige Übertritte die Ausnahme blieben, verschwand sie dann im Winter 1934 binnen Wochen sang- und klanglos von der Bildfläche.205 Zu viel Protest oder Widerspruch scheint es in diesem Zuge aber nicht gekommen zu sein.
200 Memorandum: Unsere Stellung zur Jugend vom 11.12.1933. Zit. nach Brakelmann, Kreuz und Hakenkreuz, S. 168. 201 Der Gauführer von Groß-Berlin. In: Der junge Tag. Evangelische Jugendzeitschrift Deutschlands, (1934) 2, S. 24. 202 Wichtige Mitteilungen des Württembergischen Ev. Jungmännerwerks, Stuttgart, vom 5.12.1933 (LKA Stuttgart, K24, 1255, unpag.). 203 Aufruhr der Kanzeln. Pfarrer wider Pfarrer. In: Der Neue Vorwärts vom 31.12.1933. 204 „Volksparolen“ vom 10.2.1934 und 1.3.1934. In: Pädagogisches Institut der Landeshauptstadt Düsseldorf (Hg.), Dokumentation zur Geschichte der Stadt Düsseldorf, Band 4: 1935–1945, Düsseldorf 1983, S. 131. 205 Günter Brakelmann, Evangelische Kirche in Bochum 1933. Zustimmung und Widerstand, Norderstedt 2013, S. 26–30.
Revolution und Gleichschaltung
73
Anfängliche Kooperation, Zerfall durch Übertritte, schließlich Selbstauflösung – dieses Muster trat wohl fast überall zu Tage, die Ereignisse fanden aber je nach Ort und Akteuren zu verschiedenen Zeitpunkten statt. In West- und Norddeutschland erzielte die Hitlerjugend im Frühjahr 1934 Achtungserfolge. In Essen fand Werner Freund, geboren 1922, im Februar von der evangelischen Jungschar zur Hitlerjugend. Nicht einfach sei das gewesen, wie er Jahrzehnte später meinte. Man habe die Eingliederung nicht freudig aufgenommen. Erst mit der Zeit sei Gewöhnung eingetreten; umso mehr, weil man im Jungvolk auf Schulkameraden und gute Bekannte traf. Fließend sei das alles abgelaufen. Auch einen Antrag auf Aufnahme in die Hitlerjugend habe er nie gestellt – „das ging ja alles“, so Freund retrospektiv, „wie automatisch“.206 Ähnlich lautet ein Bericht von Friedrich Riegels, der die Eingliederung der evangelischen Jungschar in Heiligenhaus im Niederbergischen Land als Zehnjähriger miterlebte: „Nach einigen Reden wurden feierlich Fahnen ausgetauscht. Die neue Fahne war ein Banner mit einem weißen Runenzeichen auf schwarzem Tuch. Von da an waren wir Pimpfe […]. Wir hatten neue Führer und eine neue Uniform. So einfach war das! So erinnere ich mich auch noch, dass dann anstelle eines Jungschärlers mit dem Wimpel nun ein Pimpf mit der Jungvolkfahne bei mehreren Anlässen bei Gottesdiensten neben dem Altar in der Kirche stand.“207 Die Übertritte und Eingliederungen verliefen aus Sicht der Hitlerjugend allerdings längst nicht in allen Fällen derart zufriedenstellend. Die Propaganda erweckte zwar den Eindruck, dass die evangelischen Jugendorganisationen binnen weniger Wochen sämtlich und ohne Konflikte in die Hitlerjugend überführt worden seien. Der Realität entsprach dies indes nicht in allen Regionen. Die Historiografie hat durch den Vergleich mit der katholischen Jugend, welche ihre organisatorische Basis dank des Konkordats zunächst weit besser absichern konnte, diese Tatsache bislang nicht hinreichend beachtet. Ältere Studien haben überwiegend Regionen mit katholischer Mehrheitsbevölkerung in den Fokus genommen. „Da die Mitglieder der HJ und [ihrer] Nebenorganisationen vornehmlich aus der evangelischen Bevölkerung kommen“, so ein typischer Lagebericht
206 Interview mit Werner Freund, geboren 1922 in Essen (NSDOK Köln, EzG, jugend1918 -1945.de; 16.7.2020). Kinder und Jugendliche kamen 1933 zur Hitlerjugend, ohne dass ihre Aufnahme formal erfolgte. Formale Verfahren existierten erst 1934/35. Ab da war ein Aufnahmeantrag zu stellen. Unterschriften leisteten die Eltern. Für jene, die 1933 keinen Antrag gestellt hatten, wurden nun Mitgliedskarten erstellt. Weiterhin waren junge Menschen in der Hitlerjugend organisiert, ohne einen Ausweis zu besitzen: Aufnahme-Erklärungen. In: GB: Saarpfalz, 18/36 vom 5.12.1936 oder Reichsmitglieds-Ausweise. In: ebd., A1/37 vom 15.1.1937: „Mitglieder […], die […] nicht im Besitze eines Reichsmitglieds-Ausweises sind, füllen sofort Aufnahme-Erklärungen aus oder reichen sie über den Geldverwalter an die Kartei des Gebietes (Obergaues) ein. […] Jgg. [Jugendgenossen], die alte Eintrittsdaten bestätigt haben wollen, können nach diesem Zeitpunkt [31.3.1937] nicht mehr gehört werden.“ 207 Die Evangelische Jungschar und Hitler-Jugend. In: Geschichtsverein Heiligenhaus (Hg.), Cis Hilinciweg. Geschichte, Geschichten und Gedichte aus und über Heiligenhaus, Heiligenhaus 1996, S. 101–106, hier 102.
74
Genese einer Massenorganisation
aus Koblenz vom März 1938, „wird die Erfassung der Jugend durch die [evangelische] Kirche nie über ein Minimum hinauskommen.“208 Dort allerdings, wo der Protestantismus tiefer verwurzelt war, provozierte das Abkommen – dies selbst in DC-Hochburgen – mehr Gegenwehr. Oft fasste die Hitlerjugend nur schwer Tritt und mancherorts hatte sie mit unerwartetem Protest zu kämpfen. Die evangelischen Jugendführer ersannen außerdem teilweise wirkungsvolle Strategien, um die Eingliederungen mindestens zu unterlaufen. 1.5
Die Eingliederungen in der Praxis
Ein Großteil derjenigen, die zum Jahresende 1933 noch nicht in die Hitlerjugend übergetreten waren, hatte ihren Vereinen und Organisationen aus Überzeugung die Treue gehalten. Über die Kardinalfrage, wie man sich zum Monopol- und Totalitätsanspruch der Hitlerjugend verhalten sollte, hatten sich viele Gruppen im Sommer 1933 überworfen. Dieser Konflikt war Ende des Jahres vielfach schon ausgetragen. Als Beispiel mag der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) aus Meißen dienen. Dort hatte bereits Ende August ein Teil der Führerschaft die Auflösung des eigenen Vereins sowie dessen Aufgehen in der Hitlerjugend gefordert. Die Landeskirche jedoch bestand darauf, dass eine Selbstauflösung des CVJM nur dann möglich sei, wenn sie einstimmig beschlossen würde. „Die Darstellung […], als ob der gesamte CVJM […] zur Hitler- Jugend übergehen wolle, ist falsch“, unterstrichen folglich jene, die den Übertritt zur HJ nicht vollziehen wollten: „Vielmehr wird eine erhebliche Minderheit […], deren Zahl umgehend festgestellt werden wird, im CVJM verbleiben. […] Die hier versammelten Vertreter der kirchlichen Jugendarbeit in Meißen bitten den Herrn Landesbischof eindringlich, […] die uns gehörenden Räumlichkeiten sowie das Inventar und Vermögen unserer Vereine zu schützen und davor zu bewahren, dass sie in das Eigentum der Hitler-Jugend überführt werden. […] Die heute versammelten Vertreter […] werden selbstverständlich alles tun, um mit der Hitler-Jugend-Bewegung in ein gedeihliches Zusammenarbeiten einzutreten.“209 Bis in den Herbst hatte der CVJM in Meißen zwar einen erheblichen Schwund zu beklagen. Am Ende hielten ihm aber immerhin 300 Jugendliche im Alter ab 16 Jahren die Treue. Weitere 300 Jüngere hatten die Eltern zudem nicht aus dem Verein genommen.210 Ein anderer sächsischer CVJM-Ortsverein betonte Ende 1933 in einem Telegramm: 1 100 Jugendliche und deren Führer 208 Lagebericht für das 1. Vierteljahr 1938 vom 26.3.1938. In: Peter Brommer (Hg.), Die Partei hört mit. Lageberichte und andere Meldungen des Sicherheitsdienstes der SS aus dem Großraum Koblenz 1937–1941, Band 1, Koblenz 1988, S. 83–89, hier 86. 209 Aussprache unter Anwesenheit aller kirchlichen Träger, Protokoll des CVJM Meißen vom 28.8.1933 (LKA Dresden, Best. 5, 274, 2, unpag.); Führerschaft des CVJM Meißen an die Landeskirche vom 23.8.1933 (ebd.). 210 CVJM Meißen an das Evangelisch-lutherische Landeskirchenamt Sachsen vom 25.10.1933 (ebd.).
Revolution und Gleichschaltung
75
stünden dem Eingliederungsvertrag negativ gegenüber und würden bleiben wollen. Man protestiere gegen fehlende Rückendeckung der Landeskirche.211 Friedrich Coch, der im August neuer Landesbischof geworden war, bedauerte tatsächlich, dass „die Jungmännervereine die geschichtliche Wende nicht erkennen“ würden, „lieber in Vereinen unter sich“ blieben, außerdem „kein Ver trauen zum Führer“ hätten und sich die „große volksmissionarische Aufgabe in der Staatsjugend nicht zutrauen“ würden.212 Während der Eingliederungsvertrag an der Basis durchaus auf Vorbehalte stieß, knickten die regionalen Leitungen Ende 1933 mehrheitlich ein. Sie ebneten den Boden für die Überführungen. Die CVJM-Führung in Württemberg um Generalsekretär Hugo Hohloch beispielsweise räumte am 9. Februar 1934 alle Bedenken der Jugendführer und Pfarrer beiseite. Milderungen des Vertrages habe das Evangelische Jugendwerk nicht erzielen können. Deshalb gälte es nun, alle Enttäuschungen zurückzustellen: „Wir reichen den Mitgliedern der HJ herzlich die Hand und tun diesen Schritt nicht nur, weil er jetzt geboten ist, sondern mit dem tiefen Drang […] der deutschen Jugend und dem Reich zu dienen.“213 Ohne die Unterstützung der Kirchenbehörden oder der eigenen Führung blieb den Vereinen vor Ort meist nur wenig Wahlfreiheit. Der Meißner CVJM entließ seine Mitlieder fast zeitgleich in die Hitlerjugend – angeblich „harmonisch und ohne Schwierigkeit“, wie zumindest die örtliche Kirchenleitung behauptete.214 Die Vorbehalte gegenüber der Eingliederung sind, um das deutlich zu sagen, nicht mit politischem Widerstand gleichzusetzen; dennoch war der Wunsch vieler junger Menschen nach Autonomie ein ehrlicher. Mit denen also, die Ende 1933 noch immer nicht übergetreten waren, musste die Hitlerjugend rechnen. Ihre Gegenwehr gegen die Gleichschaltung stand zu erwarten. Im Winter 1933 rief die Hitlerjugend in Thüringen zum Kampf „gegen die konfessionelle Reaktion“. Bei den evangelischen Gruppen handele es sich um religiöse „Parteien der Jugend“. Viele Jugendführer würden die Vereinbarungen sabotieren. Angehörige der Hitlerjugend seien von evangelischen Gruppen gar attackiert worden.215 In Württemberg machte eine untere Dienststelle der HJ im Dezember 1933 beispielhaft aggressive Stimmung. Das Recht, „Staatsjugend zu sein“, werde sich die Hitlerjugend notfalls erkämpfen, hieß es in deren Rundschreiben. Keine anderen Jugendgruppen dürften in Zukunft neben der Hitlerjugend weiter bestehen: Die „Vorrevolutionserscheinungen der Novemberrepublik […] haben zu verschwinden.“216 In Sachsen – ebenfalls eine Region 211 Telegrammabschrift, CVJM an Landesbischof Coch in Dresden vom 30.12.1933 (ebd.). 212 Landesbischof Coch an den CVJM in Zwickau vom 2.1.1934 (ebd.). 213 CVJM Führung Württemberg in Stuttgart an unsere Mitglieder und die Eltern unserer Mitglieder in Jungschar und Jungvolk vom 9.2.1934 (LKA Stuttgart, K24, 1255, unpag.). 214 Superintendentur Meißen an Landeskirchenamt vom 15.2.1934 (LKA Dresden, 5, 274, 2, unpag.). 215 Sie sind gar bald verloren. In: Der Thüringer Sturmtrupp, (1933) 6, S. 1. 216 Unterbannrundschreiben 2/34, Vaihingen vom 23.9.1933 (LKA Stuttgart, K24, 1255, unpag.).
76
Genese einer Massenorganisation
mit überwiegend evangelischer Bevölkerung – kam es sogar noch bis in den Sommer 1934 zu heftigen Auseinandersetzungen.217 Ein Durchmarsch war der Hitlerjugend trotz Abkommen hier nicht beschieden. „Es ist nicht richtig“, lautete ein gemeinsamer Brief des evangelischen Jungmännerwerks und des Jungmädchenbunds, „dass die Mitglieder der […] Jugendverbände mit Freuden den Vertrag begrüßen. Es ist im Gegenteil eine tiefgehende Erregung zu verzeichnen vor allem darüber, dass der Reichsbischof die Selbstständigkeit […] preisgegeben hat, bevor nicht alle Verhandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind.“218 Geistliche lehnten es beispielsweise ab, den HJ-Führern Einblick in ihre Mitgliederverzeichnisse zu gewähren. Junge Aktivisten schrieben Flugblätter und Rundbriefe, machten auch Aushänge in Schaukästen, überklebten HJ-Propaganda oder forderten die Anerkennung eigenständiger Jugendarbeit. Mancher, wie ein evangelischer Pfarrer aus Bräunsdorf, der eine Jugendgruppe leitete, meinte, dass die Gleichschaltung nicht die Aufgabe der Eigenständigkeit bedeute: „Wir sind nicht aufgelöst“, schrieb er provokant in einem Rundbrief, „sondern in die Hitlerjugend eingegliedert. Das ist etwas ganz anderes.“219 Die jungen HJ-Unterführer schlichen sich bei evangelischen Jugendgruppen ein und trugen Aussagen zusammen, die angeblich aus vertraulichen Besprechungen der Geistlichen stammten. Auf eigene Faust wollten sie „staatsfeindliche Aktivitäten“ der Gegenseite festhalten. Der HJ-Bannführer Karl Linke legte einen Bericht, den seine jungen Spitzel verfasst hatten, dem Innenministerium in Dresden vor. Den angeblichen Satz eines Pfarrers – „Wir beanspruchen die ganze Totalität von Christus her“ – hob man als Beweis für Staatsfeindlichkeit hervor.220 In den späteren Jahren wurde die Observierung evangelischer Jugendgruppen zu einer Hauptbetätigung des HJ-SRD, dessen Mitglieder an Türen lauschten, Altersgenossen nach dem Kirchgang abfingen und schikanierten oder angebliche Belege für „zersetzende“ Aktivitäten der Geistlichen sammelten.221 Seit dem Frühjahr 1934 sah sich die Hitlerjugend veranlasst, eigene Pamphlete und hitzige Flugblätter in Umlauf zu bringen: „Überall werden Hetzflugschriften verbreitet“, wurde in Sachsen 1934 über die angeblich evangelischen Sabotageversuche behauptet: „Verachtet diese Frevler, die sich selbst aus der Volksgemeinschaft ausschließen! Vernichtet die Hetzschriften!“222 217 Laut Statistischem Reichsamt setzte sich die Bevölkerung Sachsens nach der Volkszählung vom 16. Juni 1933 zusammen aus rund 4,5 Millionen Evangelischen, 197 000 Katholiken, ferner 20 500 Juden und 452 000 anderen. Vgl. Konfessionelle Gliederung der Bevölkerung in Sachsen. In: Freiheitskampf vom 13.12.1934. 218 Evang.-Luth. [Evangelisch-lutherischer] Jungmädchenbund und Evang. Jungmännerwerk Sachsen in einem gemeinsamen Schreiben an das Evang. Jugendwerk vom 28.12.1933 (LKA Dresden, 36, 66, unpag.). 219 Schriftverkehr der Hitlerjugend von 1933/34 mit zitiertem Brief von Pfarrer Haase, dieser o. D. (HStA Dresden, 10736, 22522, unpag.). 220 Mitschrift übersandt an Bannführer Karl Linke vom 10.1.1934 (ebd.). 221 Vgl. Bericht über die evangelische Jugend in Memmingen, Anhang des SRD-Berichts für den Monat März 1941 (StA Augsburg, HJ-Gebiet Schwaben, 56: SRD: Memmingen). 222 HJ-Oberbann IV, gezeichnet Bannführer Süß, o. D. (HStA Dresden, 10736, 22522, unpag.).
Revolution und Gleichschaltung
77
Aus Sicht der RJF, die um ruhigen Aufbau ihrer Organisation bemüht war, musste die Entwicklung bedenklich stimmen. Eltern wandten sich an Lehrkräfte, weil sie befürchteten, dass durch die HJ und den BDM „entsprechende [negative] Beeinflussung in religiöser Hinsicht“ stattfinde.223 Ein Lagebericht, welcher die HJ-Gebietsführung in Sachsen erstellte, wies auf die hohe Verbreitung von Flugschriften und Schmierereien an ihren Dienstgebäuden hin. Außerdem würden evangelische Jugendgruppen, die sich vielerorts aufgelöst hätten, im Schatten weiter existieren oder unter anderem Namen neu gegründet. Hinter solchen negativen Lageberichten stand natürlich ein radikales Kalkül: „Die Meldungen der Sabotage und Quertreibereien im gesamten Lande häufen sich täglich. […] Es ist dringend notwendig, dass […] die notwendigen Maßnahmen gegen jene gewissenlosen Hetzer und Saboteure, die eine Einigung der deutschen Jugend verhindern wollen, ergriffen werden und dass diese Menschen, die die Nichtachtung ihres Volkes so unter Beweis stellen, eine empfindliche Strafe erleiden.“224 Dennoch zeigen diese Berichte auch, dass die evangelische Jugend mit der Hitlerjugend nicht überall umgehend oder gar störungsfrei verschmolz. Im Evangelischen Jungmännerwerk in Leipzig hatte man im März 1934 eine Übersicht erstellt: Wie viele Kinder und Jugendliche zwischen 10 bis 18 Jahren waren in die Gliederungen der Hitlerjugend überführt worden? Man unterschied die „Eingegliederten“ von sogenannten Gästen. Als letztere wurden Nicht-Überführte bezeichnet, welche man auf informelle Weise weiter zu betreuen hoffte. Aus dem Leipziger Jungmännerwerk wurden 1 219 Personen ins DJ oder in die HJ überführt, 226 wurden als „Gäste“ entlassen. Aus der Christlichen Pfadfinderschaft gingen alle 173 Knaben im Alter von unter 14 Jahren ins Jungvolk; bei den 14- bis 18-Jährigen nur 42 zur HJ, 139 blieben „Gäste“. Im Falle des Evangelischen Mädchenwerks wiederum waren die Zahlen – jedenfalls aus Sicht der Hitlerjugend – desaströs. 407 Mädchen und junge Frauen wurden den Leipziger Jungmädeln und dem BDM übergeben, 1 062 galten dagegen als „Gäste“ – ein Beleg dafür, dass Eltern gerade bei den Töchtern Vorbehalte hegten, was an anderer Stelle näher zu betrachten sein wird.225 Manche Protagonisten im Evangelischen Jugendwerk hofften, sich mit einem Etikettenschwindel durchzulavieren. Man werde, hieß es im Februar 1934, zukünftig auf den Begriff „Mitgliedschaft“ verzichten müssen. Stattdessen werde ein junger Mensch, der nun aus dem Werk ausgeschieden sei, als „Gast an der Wortverkündigung“ weiter teilnehmen. Den Anspruch, die ehemaligen Vereinsmitglieder im Einflussbereich der Kirche zu halten, gab man nicht in Gänze 223 Bericht des Oberstudiendirektors des Gymnasiums Halle vom 23.5.1935 (StadtA Halle, Schulverwaltungsamt, 556, 1, Bl. 139); hier auch Beschwerdeschreiben von Eltern über das örtliche Jungvolk. 224 Die Gebietsführung des Gebietes Sachsen in der HJ, Denkschrift über die Eingliederung der ev. Jugend in die Hitlerjugend, S. 5, o. D. (HStA Dresden, 10736, 22522, unpag.). 225 Vgl. die Abschrift der „Zusammenstellung des Evangelischen Jugendwerks Leipzig auf Grund des Eingliederungsvertrages“ vom 8.3.1934 (LKA Dresden, 5, 274, 1, Bl. 274379–274381).
78
Genese einer Massenorganisation
auf: „Nicht alle in unserer Gefolgschaft werden sofort die neuen Wege, [auf] die wir sie führen wollen, verstehen. Ihnen sagen wir, dass wir aus einer Zwangslage heraus handeln müssen.“226 Die Überführungen in Danzig, wo die evangelische Jugend offenbar im Spätherbst 1933 in die Hitlerjugend eingegliedert worden war, standen als ein Beispiel vor Augen, das Hoffnungen weckte. Die Gleichschaltung habe sich dort bloß auf einen feierlichen Akt beschränkt, glaubte man im sächsischen Jungmännerbund: „In Wirklichkeit ist sie insofern nicht erfolgt, als ja die evang. Jungen und Mädel nicht etwa eine geschlossene Gruppe innerhalb der HJ bilden, sondern jeder Einzelne seinen Eintritt […] erklären musste und einzeln aufgenommen wurde.“227 In Dresden machte man in einem Rundbrief aus diesem Grund deutlich, dass die informelle Jugendarbeit je nach Ortslage in Zukunft vermehrt notwendig sei: „Dieser Dienst [an der Jugend] wird grundsätzlich verschiedene Formen annehmen in Großstädten, Mittelund Kleinstädten, Dörfern.“228 Auch in Württemberg unterstrich man, dass die Betreuung der entlassenen jungen Menschen als Gäste keine „Umgehung des Vertrags“ darstelle, sondern „ein freiwilliges Darüberhinausgehen“ bedeute.229 Wie sich die evangelische Jugend lokal organisierte, wie sie zur Hitlerjugend stand, hing in Zukunft deshalb umso mehr von örtlichen Gegebenheiten ab, von den jeweiligen Akteuren sowie davon, ob es DC-Kreise oder Vertreter der BK waren, die in den kirchenpolitischen Konflikten die Oberhand gewannen.230 Die staatlichen Überwachungs- Hitlerjugend-Dienststellen beobachteten die informellen Zusammenschlüsse in der kirchlichen Jugendarbeit mit Argwohn.231 Man sah oft „staatsfeindliche“ oder gegnerische Aktivitäten am Werk ; was sie manchmal, aber in der überwiegenden Mehrheit sicherlich nicht waren. Als eine Konkurrenz zur Hitlerjugend fungierten sie jedoch faktisch – schon aus dem Grund, weil sie die Freizeit der jungen Menschen ebenfalls in Anspruch nahmen. Bibelkreise, Kaffeekränzchen, Jungbibelstunden, „Dienstscharen“ und Jugendnachmittage – das organisatorische oder bündische Gerüst der evangelischen Jugend hatte die RJF 1934 zwar zerschlagen, aber vielerorts existierte im Schatten derartige informelle Jugendarbeit weiter. In Württemberg versuchte man 1934 einen Trick anzuwenden, der eindrucksvoll aufzeigt, wie man den Eingliederungsvertrag unterlaufen wollte. Mädchen in sogenannten losen Gruppen sollten sich per Anmeldeschein registrieren; der 226 Das Evang. Jugendwerk Deutschlands an die Mitglieder vom 3.2.1934 (ebd., Bl. 274326). 227 Evang.-luth. Jungmännerbund in Sachsen an die Gau- und Kreisführer, Berufsarbeiter, C.P.-Gauführer und Mitglieder des Bundesvorstandes vom 14.11.1933 (ebd., Bl. 274099 f.). 228 84. Rundbrief des Evang.-luth. Jungmännerwerkes in Sachsen, Dresden, o. D. [vermutlich Anfang 1934] (ebd.). 229 Evg. [Evangelischer] Verband für die weibliche Jugend Württembergs an die Führer der Jungscharen vom 15.2.1934 (LKA Stuttgart, K24, 18, unpag.). 230 Vgl. als Beispiel die Lageberichte aus unterschiedlichen Orten Sachsens, zusammengetragen in der Niederschrift über die Sitzung des Jugend-Ausschusses der Bekennenden Kirche Sachsens, o. D. [vermutlich 1934] (LKA Dresden, 5, 274, 2, Bl. 105–108). 231 Weitere Beispiele und ausführliche Erörterungen bei Heinrich Riedel, Kampf und die Jugend. Evangelische Jugendarbeit 1933–1945, München 1976, S. 190–196, 203–235.
Revolution und Gleichschaltung
79
Verband führte sie offiziell nicht mehr als Mitglieder, vermittelte aber dennoch Kontakte, versandte Zeitschriften oder wollte sich – wie es zuvor üblich gewesen war – zum Beispiel um Fahrpreisermäßigungen für Ausflüge und Fahrten kümmern.232 Der Jungmädchenbund in Sachsen schrieb ähnlich Ende Februar 1934: Die Arbeit werde fortan in „Form der Bibelgruppen geführt, obwohl dieser Name nicht verpflichtend ist. Es ist eine Liste über all die zu führen […], die BDM-Mitglieder sind und regelmäßig zu den Bibelabenden […] kommen wollen. […] Die Arbeit an den Kindern ist an einem Nachmittag in der Woche unter Verzicht auf bündische Formen zu gestalten.“233 Die Hitlerjugend-Dienststellen wollten die Jugendlichen von kirchlichen Veranstaltungen fernhalten. Der staatliche Sicherheitsapparat intervenierte ebenfalls. Die informellen Gruppen erhielten meist auch nicht die Rückendeckung ihrer jeweiligen Landeskirchen oder des regionalen Jugendwerks; zumal dann nicht, wenn dort DC-Geistliche in den Amtsstuben saßen. Ein Beispiel aus Sachsen: In den Kirchenbezirken Plauen und Oelsnitz hatte die Hitlerjugend der Gestapo 1935 von zwei evangelischen Sportgruppen berichtet. Im evangelischen Älterenwerk würden sich einige unter 18-Jährige illegal sportlich betätigen. Dies würde von den Älteren geduldet. Nach massivem Druck knickte das Landeskirchenamt vor der HJ-Gebietsführung ein. Die evangelischen Gruppen, welche offenbar aus BK-Kreisen stammten und deren Verhalten die Hitlerjugend beanstandete, schloss man umgehend aus der Luthergemeinde aus: „Folgen, die euch nun als sogenannte ‚wilde Gruppe‘ zustoßen, müssen von euch selbst verantwortet werden. […] Demzufolge muss ich Dich bitten, alles Eigentum […] zurückzuführen.“234 Auch das Jugendwerk in Frankfurt am Main rief zur Achtung des Abkommens auf und forderte: „Keine bündischen Träume mehr!“235 Allerdings noch 1939 kritisierte man den „Eigensinn […] in der evangelischen Gemeinde-Jugendarbeit“, denn eine Reihe von Gemeinden schien Vorgaben zu ignorieren und zeigte kein Interesse, sich mit dem Jugendwerk abzustimmen.236 Mehrheitlich bemühten sich die örtlichen evangelischen Jugendführer um eine produktive Koexistenz mit der Hitlerjugend. Gerade im BDM, wo Kirchenfeindlichkeit weniger offen eine Rolle spielte als in der HJ, stammten viele Unterführerinnen aus kirchlich-konservativem Milieu. Eine Aufforderung aus dem Jungmädchenwerk, welches sich an BDM-Mädchen wandte, lautete: „Wir kommen zusammen: […] die deutschen Mädchen aus den Reihen des evang. Jugendwerks und ihr, die deutschen Mädchen des BDM. Uns schließt zusammen: ein 232 Bestimmungen für „Lose Gruppen“, o. D., sowie Vordruck eines Anmeldescheins (LKA Stuttgart, K24, 18, unpag.). 233 Jundmädchenbund Sachsen an die angeschlossenen Jungendscharen vom 26.2.1934 (LKA Dresden, 5, 274, 2, unpag.). 234 Beauftragter Kirchenbezirke Plauen und Oelsnitz an Hans R. vom 20.8.1935, sowie Schreiben u. a. des Ev. Jugenddienstes an das Landeskirchenamt vom 26.7.1935 (ebd., Best. 5, 274, 2). 235 Rückblick und Ausblick. In: Nachrichtenblatt für das Evangelische Jugendwerk, Frankfurt a. M., (1936) 1/2, S. 5 236 P. B., Aus der Arbeit – für die Arbeit. In: ebd., (1939) 7/8, S. 4.
80
Genese einer Massenorganisation
gemeinsames Wissen, ein gemeinsames Wollen und ein gemeinsames Lieben. Wir wissen alle, dass wir ein gemeinsames Vaterland haben.“237 Solches Werben innerhalb der Parteijugend begriffen deren höhere Dienststellen stets als Bedrohung ihres Totalitätsanspruchs. „Du hast ja in den Gemeinden Deines Bezirks solche guten Erfolge mit den Jugendgottesdiensten“, schrieb eine Vertreterin des sächsischen Jungmädchenwerks 1935 einem anderen evangelischen Jugendführer, um Ratschlag einzuholen: „Lädst Du […] über die HJ oder den BDM ein? […] Ich habe auf diesem Gebiet allenthalten Schwierigkeiten.“ Als Erfolg verbuchte sie, dass sie einen Jungbannführer für eines ihrer Konfirmandenlager gewonnen hatte. Der habe sich bereit erklärt, im Zeltlager das Sportprogramm zu leiten.238 Unter strenger Auslegung der geltenden Gesetzeslage, welche sportliche Betätigung in einem Lager, das rein religiösen Zwecken diente, verbot, war dies aber kein zulässiges Vorgehen.239 Man sah es außerdem mit Argwohn, wenn sich BDM-Mädchen in der kirchlichen Jugendarbeit oder im Umfeld informeller Zusammenschlüsse blicken ließen. Lageberichte aus dem Überwachungsapparat betonten immer wieder, dass die Hitlerjugend angeblich in der Hand der Pfaffen sei. Die Gestapo Erfurt berichtete Anfang 1936 über Versuche, „verlorene Jugendliche […] durch eine völlige Neuorganisation der kirchlichen Jugend zurückzugewinnen“. Es würden etwa Sommer- und Winterlager oder Freizeitfahren religiös getarnt, wobei man in diesem Zuge versuche, junge Menschen der Staatsjugend zu entfremden. Kinder und Jugendliche w ürden die NS-Jugendorganisation in wachsender Zahl meiden, da „sie ja auch in den religiös getarnten Vereinen gemeinschaftliche Pflichten zu erfüllen“ glaubten.240 Die Eingliederung der konfessionellen und insbesondere evangelischen Jugendorganisationen vollzog sich nicht schlagartig. Die Gleichschaltung war ein langwieriger Prozess und auf evangelischer Seite regional und lokal geprägt vom kirchenpolitischen Konflikt zwischen der DC- und der BK-Geistlichkeit. Historiker Arno Klönne bilanzierte, dass „der Eingliederungsvertrag die evangelischen Jugendverbände schon so rasch ihrer jugendlichen Basis beraubte, dass – anders als bei der katholischen Jugend – ein eigentlich jugendbündi237 „Ihr deutschen Mädel!“, abgedruckt in den Mitteilungen des evang. Verbands für die weibliche Jugend Württembergs vom 3.4.1934 (LKA Stuttgart, K24, 18 unpag.). 238 Beauftragte für Plauen und Oelsnitz, Jundmädchenbund, vom 22.2.1935 (ebd.). 239 Vgl. die Zusammenstellung zweier Mitteilungen des Preußischen Geheimen Staatspolizeiamtes über die Benutzung von Jugendherbergen und die Abhaltung von Lagern vom 23.4.1936 und 6.8.1935 (LKA Stuttgart, K24, 44, unpag.): „Geschlossene Lager zu rein religiösen Zwecken (Bibelarbeit ohne sportliche Betätigung) sind zu gestatten. Bei der Beurteilung des Begriffs sportliche Tätigkeit ist Baden und die Ausübung leichter Freiübungen nicht als Sport […] anzusehen.“ Vgl. ferner Erlass des ChdDtPol [Chefs der Deutschen Polizei], Heinrich Himmler, im Einvernehmen mit dem JFdDtR [Jugendführer des Deutschen Reiches], Baldur von Schirach vom 4.8.1937, über konfessionelle Jugendlager und Freizeiten (PP [II B], 5307/37], u. a. abgedruckt in: Kirchliches Amtsblatt der evangelisch-lutherischen Kirche in der freien und Hansestadt Lübeck, (1937) 25, S. 98. 240 Lagebericht der Staatspolizeistelle Erfurt für Januar 1936 vom 3.2.1936. In: Rupieper/ Sperk (Hg.), Lageberichte zur Provinz Sachsen, Band 3, S. 437–459, hier 452.
Revolution und Gleichschaltung
81
sches Leben […] ab 1934 kaum“ existiert habe.241 Doch über die 1930er-Jahre hinaus gab es autonome, informelle Räume sowohl für evangelische Jugendarbeit als auch für junge Vergemeinschaftung – es versteht sich, dass von einer oppositionellen Rolle der Kirche nicht zu sprechen ist. Die Räume waren in protestantischen genauso wie in katholischen Regionen vorhanden. Richard Reckewerth, HJ-Gebietsführer von „Mittelland“, meldete Ende 1933 mit Blick auf den Vertrag, es sei nun das „Werk der äußeren organisatorischen Einigung der deutschen Jugend und ihre Kraft und einheitliche Zusammenfassung in der Hitlerjugend […] endgültig abgeschlossen“.242 Derartige Propaganda sollte man nicht für Wirklichkeit halten. Die evangelischen Verbände seien zwar sämtlich aufgelöst, ja es gebe „keinen evangelischen Jugendverband mehr“, so bilanzierten Ende 1937 etwa die in den Niederlanden erscheinenden „Sonderinformationen Deutscher Jugend“, eine von bündischer Opposition und Emigration getragene Exilzeitschrift: „Wohl aber gibt es bewusst protestantische Jugend.“243 Diese Unterscheidung ist von Bedeutung. Friedhelm Fuchs, geboren 1929 in Marienhagen im Oberbergischen Land, hat davon erzählt. Er gehörte seit Mitte der 1930er-Jahre der Jungschar an, welche ab Februar 1939 offiziell verboten war. Die Mitglieder fanden sich dennoch unter der Leitung von Pastoren und Seelsorgern verdeckt zusammen. Damit sie auf ihren Ausflügen oder beim Sporttreiben im Freien nicht auffielen, schilderte Fuchs rückblickend, habe man sich in Grüppchen von je ein paar Mann aufgeteilt. Auf eine Uniformierung oder auffällige Abzeichen sei verzichtet worden. Erst mit Kriegsbeginn hatte sich die Lage merklich verschlechtert: Junge Männer rückten zum Militär ein, andere blieben fern, weil sie die staatliche Verfolgung fürchteten. Doch vollständig inaktiv sei die evangelische Jugendarbeit im Oberbergischen Land auch in den Kriegsjahren nicht gewesen. Noch 1944 fand in Wiehl ein großes Treffen der evangelischen Jugend statt – unter Beteiligung von Pastoren, Eltern und Soldaten, die auf Heimaturlaub waren. Die Partei schritt mit Rücksicht auf die Stimmung in der Bevölkerung nicht ein. Dass die Erinnerung heute so sehr von marschierenden Hitlerjugend-Kolonnen geprägt sei, ärgerte Fuchs im Rückblick. Der Alltag sei vielschichtiger gewesen und habe sich eben nicht nur in der nationalsozialistischen Staatsjugend abgespielt: „Wer da mitmachen wollte“, gab Fuchs über die konfessionellen Bünde in der Illegalität zu bedenken, „der konnte mitmachen!“244 Neben den informellen Räumen existierten vereinzelt kleinere Gruppen, die zunächst nicht verboten oder in die Partei- und Staatsjugend eingegliedert waren. Dazu zählten zum Beispiel die Jungenwacht-Gemeinden, die aus dem 241 Klönne, Jugend im Dritten Reich, S. 179. 242 Hitler-Jugend Gebiet Mittelland (Hg.), Werden. Sein. Wollen, Halle 1934, S. 2. 243 „Sonderinformationen deutscher Jugend“, (1937) 2. In: Ebeling/Hespers (Hg.), Jugend contra Nationalsozialismus, S. 38–58, hier 43; bei Arno Klönne, Jugendliche Opposi tion im „Dritten Reich“, Dresden 2005, S. 59–61, hier 60. 244 Interview mit Friedhelm Fuchs geführt von Martin Rüther (NSDOK Köln, EzG, jugend 1918-1945.de; 16.7.2020).
82
Genese einer Massenorganisation
Bund Deutscher Bibelkreise hervorgegangen waren. Sie konnten nach 1933 eine Weile bestehen bleiben, da sie nicht als konfessionelle Organisationen eingeordnet wurden. Die Hitlerjugend-Mitgliedschaft und das religiöse Engagement existierten oft nebeneinander. Der Theologe Rolf Rendtorff, später in Heidelberg lehrend, erinnerte sich, dass die „mehr oder weniger selbstverständliche Mitgliedschaft in der HJ“ für die meisten Angehörigen der Jungenwacht-Gemeinden gegolten habe.245 Erst ab Sommer 1937 wurden diese Gruppen seitens der RJF vermehrt bekämpft, schließlich die Teilnahme an deren „Arbeitsgemeinschaften, Lagern und […] Veranstaltungen“ offiziell verboten.246
2.
Die Eroberung des Alltags
2.1
Glaubensfragen in der Hitlerjugend
Die Eingliederung der evangelischen Jugend bedeutete nicht automatisch, dass die Parteijugend gestärkt aus der Gleichschaltung hervorging. Das Abkommen vom Dezember 1933 ist in seiner Bedeutung in der Historiografie maßlos überschätzt worden. Ein Teil der jungen Menschen war nicht in die Parteijugend eingegliedert, sondern aus ihren Vereinen entlassen worden. Zur Mitte des Jahrzehnts zeigte sich, dass die Hitlerjugend in einigen evangelisch dominierten Landesteilen sogar Nachholbedarf hatte. In Sachsen, Schlesien, Magdeburg-Anhalt oder Halle-Merseburg lagen die Erfassungsquoten bei männlichen Kindern und Jugendlichen unter dem Reichsdurchschnitt von 50 bis 60 Prozent. In manchen katholischen Gebieten hatte die Hitlerjugend schon deutlich mehr junge Menschen in ihrer Organisation erfasst; nur im Falle der Mädchen ließ sich reichsweit ein einheitlicheres Bild ausmachen. Deutungen, die auf die Konfession allein gerichtet sind, können zur Erklärung demnach nicht befriedigen. Das weitgehend evangelisch geprägte Sachsen stand mit einer Erfassung von 30 bis 40 Prozent durch die HJ dem katholischen Saar- oder Rheinland gegenüber, wo die Massenorganisation bereits bis zu 60 Prozent der 14- bis 18-Jährigen in ihren Reihen zählte. Anhand der offiziellen Statistiken ist jedenfalls nicht stichhaltig oder schlüssig belegbar, dass die Hitlerjugend in protestantisch geprägten Regionen eindeutig erfolgreicher gewesen wäre als in katholisch dominierten Gebieten.247 245 Rolf Rendtorff, Kontinuität im Widerspruch. Autobiographische Reflexionen, Göttingen 2007, S. 26. 246 Verbot der Mitgliedschaft zur Jungenwachtgemeinde und der Zeitschrift „Jungenwacht“, unter Bezugnahme auf die Verfügung des Reichsjugendführers im Verordnungsblatt V/14, 18.6.1937. In: GB: Pommern, A10/37 vom 1.9.1937. Zur Jungenwacht in Leipzig vgl. Lange, Meuten. Leipziger Jugendgruppen im Dritten Reich, S. 149, der konstatiert, dass die Zeitschrift von der „Ausblendung des NS-Staates und der Hitlerjugend“ gekennzeichnet gewesen sei. 247 Vgl. Reichsjugendführung (Hg.), Statistik der Jugend, A, 2, Berlin 1936, S. 6 f. (BArch, NS 26, 359).
Die Eroberung des Alltags
83
Die RJF und ihre regionalen Führungskräfte waren bemüht, was oft aus dem Blick gerät, die religiösen Spannungen im Alltag abzubauen. Reichsjugendführer Schirach betonte Anfang 1937 in einer Rede, mit der er sich an die Eltern richtete, dass die konfessionelle Frage angeblich keine sei: „Wie ich überhaupt alles vermeiden muss, was in die Jugend Zwiespalt und Uneinigkeit hineintragen könnte. Ich überlasse es also den Kirchen, die Jugend im Sinne ihrer Konfession religiös zu erziehen und werde ihnen […] niemals hineinreden.“248 Für die Konsolidierung der Parteijugend ebenso wie für ihr Wachstum war es von Bedeutung, dass den Bedenken der Familien sowie Argumenten der Geistlichkeit keine Nahrung gegeben wurde. Pfarrer durften nicht allzu offen attackiert, junge Mitglieder nicht ausgegrenzt werden. „Ich mache darauf aufmerksam“, mahnte die Gebietsführung in Sachsen im Sommer 1934, „dass religiöse Auseinandersetzungen innerhalb der HJ nicht erwünscht sind.“ Kurz darauf wurde betont, dass junge Leute „am freiwilligen Kirchenbesuch nicht behindert“ werden sollten.249 Großzügig gab sich die HJ-Führung in Hessen-Nassau. Bei Fahrten und Wanderungen bestünde sehr wohl die Möglichkeit zum Kirchenbesuch: „Die Fahrtstrecken sind so zu legen, dass zur Zeit des Gottesdienstes eine Kirche in erreichbarer Nähe ist.“250 Konfirmation und Kommunion, wie Schirach 1937 anwies, blieben in Uniform zunächst möglich.251 Nachgeordnete lokale Stellen mussten häufig auf diese Bestimmung verpflichtet werden. Das Uniformtragen sei den Gläubigen erlaubt.252 Viele Unterführer setzten sich über die Anweisungen allerdings eigenmächtig hinweg. Hans Josef Horchem beschrieb solche Reibungen im Alltag. Sein junger Stammführer hatte den Dienst bewusst in zeitlicher Nähe zum Gottesdienst angesetzt. Kinder und Jugendliche gingen vom Dienst umgehend in die Kirche, und dies regelmäßig uniformiert, weil zum Umziehen schlicht keine Zeit mehr blieb. Der Gottesdienst in Uniform sei den örtlichen HJ-Führern dann zwar auch nicht recht gewesen. Sie hätten aufgrund der Anweisungen ihrer Dienststellen allerdings nichts weiter dagegen tun können.253 Siegfried B. aus Dresden, der in einer Familie von Parteigenossen aufwuchs, erinnerte sich an seine Konfirmation 1937: „Wir waren 36 Jungen und etwa ebenso viele Mädchen. Von uns Jungen kamen fünf in Uniform – ich natürlich auch.“254 Einige Jahre später trat er – wie viele andere – aus der Kirche aus. 248 Baldur von Schirach, Aus der Rede des Reichsjugendführers an die deutsche Elternschaft. In: Das Junge Deutschland, (1937) 1, S. 43–50, hier 46. 249 Stellungnahmen der Gebietsführung Sachsen. In: GB: Sachsen, 5/34, Mai; und 9/34 November. Vgl. auch Deutschland-Berichte der Sopade, 2 (1935), S. 224. 250 Kirchenbesuch bei Fahrten. In: GB: Hessen-Nassau, A10/37 vom 12.8.1937 251 Konfirmation (Kommunion) mit Dienstanzug. In: Reichsbefehl, 5/II vom 5.2.1937. 252 Teilnahme von HJ-Angehörigen in Uniform an der Konfirmation. In: GB: Mittelelbe 4/38 vom 3.3.1938; Dienstanzug zur Konfirmation und Kommunion. In: GB: Pommern, A2/38 vom 1.2.1938. 253 Hans Josef Horchem, Kinder im Krieg. Kindheit und Jugend im Dritten Reich, Hamburg 2000, S. 54. 254 Erinnerungen von Siegfried B., Album 1, ohne Signatur, privater Nachlass (Archiv des HAIT).
84
Genese einer Massenorganisation
Erst im Februar 1939 hob die RJF ihre intern umstrittene Uniform-Regelung auf. Nunmehr waren christliche Feiern in uniformierter Kluft untersagt.255 Die offizielle Neutralität in religiösen Belangen, die sich in zahlreichen Anweisungen der höheren Dienststellen wiederfinden, hatte pragmatische Gründe. Sie ruhten nicht, wie Gegenbeispiele und Reden in großer Zahl zeigen würden, auf Überzeugung. Der RJF und dem Führerkorps ging es hauptsächlich um eine Beruhigung der angespannten Lage. Man war gewarnt: Im Rheinland und in Köln, wo einige BDM-Führerinnen bis 1934 immer wieder versuchten, ihre Mädchen vom Gottesdienst abzuhalten, kam es zu zahlreichen Beschwerden aus der katholischen Bevölkerung, auch zu Reibereien mit der Geistlichkeit und offenbar vielfach zu Austritten.256 In Oberschlesien hatte die krasse antikirchliche Agitation der HJ Ende 1934 bewirkt, dass einzelne Formationen angeblich „nur noch einen verschwindenden Bruchteil ihres Bestandes von Beginn dieses Jahres“ aufwiesen.257 Auch die Lageberichte der Überwachungsorgane strichen diesen Umstand häufig hervor: Die antireligiösen Angriffe der Parteijugend seien den Zielen der RJF wenig förderlich. Altgediente Unterführer von Jungvolk und HJ, weniger im BDM, sahen in den Kirchen ihre Gegner. Es war nicht zielführend, wenn – wie es in Cannstatt im November 1933 passierte – ein HJ-Redner gegen christliche Pfadfinder Stimmung machte und sich zum Entsetzen der Zuhörer als Heide bezeichnete.258 Bei Marienstadt wurde 1936 ein Geistlicher, der zu einem Kranken gerufen wurde, um ihn in den Tod zu begleiten, von Hitlerjungen auf der Straße angepöbelt und im Beisein von Passanten beleidigt.259 Konflikte zwischen Unterführern waren ebenfalls häufig. Je mehr die höheren Dienststellen derlei Konflikte noch befeuerten, desto mehr war das Wachstum der Massenorganisation gefährdet. Folglich gaben die Funktionäre in den 1930er-Jahren zueinander teils in Widerspruch stehende Anordnungen durch. Zumal von der neopaganen „Deutschen Glaubensbewegung“, welche nach ihrem Gründer, dem Religionswissenschaftler Jakob Hauer, als „Hauer-Bewegung“ tituliert wurde, mussten sich die höheren Dienststellen mehrfach distanzieren.260 Eine Aktivität in der heidnischen Hauer-Bewegung sei
255 Tragen des Dienstanzuges bei Konfirmation und Kommunion. RB RJF 6/IV vom 17.2.1939. In: Vorschriftenhandbuch, Gruppe 13: Verhältnis zu anderen Stellen, S. 1 096. 256 Vgl. die überlieferten Dokumente des Historischen Archivs des Erzbistums Köln (Signaturen WuV, 17; sowie Gen. 23, 6/4 und 6/5) in einer Online-Zusammenfassung des NSDOK Köln, EzG, jugend1918-1945.de; 16.7.2020. 257 Bericht aus Berlin, A66. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 2 (1935), S. 225. 258 Dieses Beispiel entnommen der Mitteilung des Evangelischen Jugendwerks Stuttgart, 5.12.1933 (LKA Stuttgart, K24, 1255, unpag.). 259 Lagebericht der Oberstaatsanwaltschaft Limburg/Lahn vom 5.8.1936. In: Thomas Klein/Oliver Uthe (Hg.), Die Lageberichte der Justiz aus Hessen 1940–1945, Darmstadt 1999, S. 577 f. 260 Zum schwierigen Verhältnis vgl. Jugendgruppen der Deutschen Glaubensbewegung. In: GB: Thüringen, 10/35 vom 7.9.1935.
Die Eroberung des Alltags
85
nicht erwünscht, hieß es in Saarpfalz 1939, „weil dadurch der Eindruck einer Bevorzugung […] entstehen“ könne.261 In Thüringen wurden die Unterführer 1935 sogar angewiesen, religiöse Fragen überhaupt nicht erst anzusprechen: „Wir warnen alle Kameraden davor, sich mit irgendwelchen Leuten in vollkommen sinnlose Diskussionen über Religionsfragen einzulassen. Der Erfolg ist meist der, dass durch Verdrehungen und Lügen der Gegner Äußerungen […] als Kampfmittel gegen die Hitlerjugend verwendet werden.“262 Dessen ungeachtet trieb man Weihnachten Bemühungen voran, die christliche Tradition mit einer vermeintlich „arischen“ Überlieferung zu verbinden: der Heiland wurde zum Held stilisiert, die Geburt Christi sollte ihre Analogie in den Heldensagen der isländischen Edda finden.263 Die Umwidmung christlicher Lieder durch Hinzufügen von NS-Vokabular wiederum wurde seitens des Führerkorps in späteren Jahren verboten.264 Das Verhältnis der Partei- und Staatsjugend zur Religion und den beiden christlichen Konfessionen blieb bis zum Ende der 1930er-Jahre ziemlich undurchsichtig. Die Aussagen verschiedener Zeitzeugen variieren deshalb enorm zwischen zwei Polen. Die einen streichen das anti-christliche Moment in der Hitlerjugend hervor und berichten, sie seien von Gleichaltrigen und ihren Führern schikaniert worden; Gerhard Laue, der in Erfurt aufwuchs, erzählte über laute Störaktionen der Hitlerjugend gegen katholische Fronleichnamsprozessionen oder davon, dass er im Umfeld seiner Einheit kein Wort über seine christliche Erziehung verlor, um nicht anzuecken.265 Wieder andere pochen jedoch mit Vehemenz darauf, dass ihr Glauben mit der Parteijugend gut vereinbar gewesen sei und sie keinerlei Probleme erlebt hätten. Beides existierte de facto nebeneinander. Erfahrungen hingen von der örtlichen Situation ab und davon, wie ernst Unterführer das offizielle Gebot der Neutralität in der Praxis handhabten. Die RJF erhöhte kontinuierlich den Druck auf die Kirchen, aber formulierte im gleichen Zuge diverse Vorgaben für den Dienst, um die lokalen Ausein andersetzungen mit den Kirchenvertretern zu befrieden. Am 18. Juni 1937 beispielsweise gab Schirach eine solche in Umlauf, welche die Gewährung von Urlaub zur Teilnahme an kirchlichen Veranstaltungen regelte, zudem erneut unterstrich, dass die RJF die „seelsorgerischen Aufgaben der Kirche“ anerkenne.266 Für zwei evangelische Sommerlager 1936 – eines auf Rügen, das andere
261 HJ-Führer und Glaubensbewegung. In: GB: Saarpfalz, A7/1939 vom 17.8.1939. 262 Vorsicht! In: GB: Thüringen, 10/35 vom 7.9.1935. 263 Sonderdruck der Kulturabteilung im Gebiet Kurmark, Vorschläge zur Ausgestaltung der Vorweihnachtszeit, der Wintersonnenwende und der Jahreswende. In: GB: Kurmark, 21/36 vom 3.12.1936. 264 Vgl. beispielhaft Neutextierungen von Chorälen und konfessionellen Liedern. In: GB: Westfalen, K1/42 vom 12.2.1942. 265 Gerhard Laue, Meine Jugend in Erfurt unter Hitler 1933–1945. Ein Zeitzeuge erzählt, Bad Langensalza 2016, S. 50. 266 Verfügung des Reichsjugendführers über die Urlaubsgewährung für kirchliche Veranstaltungen vom 18.6.1937 (LKA Stuttgart, K24, 44, unpag.).
86
Genese einer Massenorganisation
bei Berlin – konnte das Evangelische Jugendwerk gegenüber den Eltern darauf verweisen, dass der BDM verpflichtet sei, den Töchtern Urlaub zu gewähren.267 Freilich lag stets Drohpotenzial in den Regelungen. Davon ist auch ausgiebig Gebrauch gemacht worden: Hatte ein Jugendlicher keinen Urlaub beantragt, dann behielt sich die Hitlerjugend disziplinarische Sanktionen vor.268 Urlaubsanträge wurden dem örtlichen SRD zur Kenntnis gegeben.269 Zudem setzten nachgeordnete Dienststellen – trotz anderslautender Vereinbarungen – an jenen zwei Sonntagen des Monats, die eigentlich für die Jugendarbeit der Kirchen vorgesehen waren, oft sogenannten Sonderdienst an.270 Im Grundsatz jedoch galt offiziell: „Es ist strengstens verboten […] Urlaubsgesuche aus konfessionellen oder religiösen Gründen abzulehnen.“271 Anfang Mai 1937 rechnete der bayerische Gebietsführer Emil Klein höchst merkwürdig vor: Für die Erziehung eines jungen Menschen seien im Monat 240 Stunden den Eltern gegeben, 32 würden der Hitlerjugend gehören, 24 gewähre man für die kirchliche Arbeit, 96 für die Schulen. In der Praxis standen die verschiedenen Anweisungen aus der RJF oder die Aussagen der hauptamtlichen Führungskräfte jedoch häufig nur auf dem Papier.272 Die lokalen Unterführer handelten im eigenen Ermessen und sie sahen die Partei im Streitfall auf ihrer Seite. Das evangelische Stadtpfarramt in Marbach – um ein Beispiel herauszugreifen – reichte Anfang Juni 1937 eine Beschwerde beim Oberkirchenrat in Stuttgart ein. Die Befehle der RJF würden von den jungen Unterführern aus HJ und DJ nämlich mit überaus großer Willkür ausgelegt. Man setze die Dienststunden, aller religiösen Neutralität und der Vereinbarungen zum Trotz, weiter bewusst in Konkurrenz zur Kirche an.273 „Sie dürfen nie vergessen“, antwortete der HJ-Gefolgschaftsführer aus Marbach, der auf die Kritik mit hasserfüllter Arroganz reagierte, „dass wir, die Hitlerjugend, die Staatsjugend des Dritten Reiches sind, und dass deshalb für die heutige Jugend […] das allerwichtigste der Dienst in der Hitlerjugend ist. Alle anderen mehr oder weniger vorgeschriebenen Veranstaltungen […] sind lange, lange nicht so wichtig. […] Ob meine Hitler-Jungens tatsächlich das innerliche Bedürfnis hatten, bei der Christenlehre zugegen zu sein, möchte ich immerhin bezweifeln. Ich stütze mich hier auf Beobachtungen, die ich im Zusammensein mit meinen Kameraden machen konnte. Ich glaube wohl der Ansicht sein zu dürfen, dass 267 Werbeblatt für die Evangelischen Sommerlager 1936 „Jesus Christus. König aller Gewalten!“, o. D. (ebd.). 268 Teilnahme von HJ/DJ-Angehörigen an Veranstaltungen konfessioneller Jugendgruppen. In: GB: Berlin 14/37 vom 1.10.1937. 269 Urlaubsgewährung für kirchliche Veranstaltungen. In: GB: Kurmark, A14/37 vom 15.11.1937. 270 Sonntagsdienst. In: GB: Berlin, 19/37 vom 15.2.1937. 271 Urlaubsgewährung für kirchliche Veranstaltungen. In: GB: Franken, 4/38 vom 5.1938. 272 Emil Klein über die Zeit zum Dienst in der HJ. In: Wille und Macht, (1937) 9, vom 1.5.1937, S. 87 f. 273 Vgl. Schreiben des Stadtpfarramts an den Evangelischen Oberkirchenrat Stuttgart vom 1.6.1937 (LKA Stuttgart, D 42, unpag.).
Die Eroberung des Alltags
87
es einem richtigen Kerl bedeutend wohler dabei ist und dass es bestimmt mehr seiner Wesensart entspricht, wenn er im Dienste für die deutsche Nation körperlich gestählt und weltanschaulich im Sinne des Nationalsozialismus erzogen wird, als wenn er sich von den alten Juden etwas erzählen lassen muss, von denen er genau weiß, dass sie seine Todfeinde sind.“274 Unten an der Basis verhielten sich die Jugendlichen und jungen Führungskräfte selten so, wie es die RJF oben vorgab – weder in der einen, noch in der anderen Richtung. 2.2
Die Hitlerjugend in den Sportvereinen
Der Sport bildete bekanntermaßen eine wichtige Säule in der Jugenderziehung des Regimes, auch und gerade in der Hitlerjugend. Im Gegensatz zur Apologie, welche die Funktionäre nach 1945 in die Welt setzten, diente körperliche Ertüchtigung schon früh der militärischen Ausbildung der Jugend. Doch bis das Sportwesen soweit gediehen war, dass es dem Anspruch der RJF nahekam und dem Bild entsprach, das man sich in der Gegenwart von der Hitlerjugend macht, verging erhebliche Zeit. In Teilen wurde das Ideal nie realisiert. Sport, zumal fachkundig betrieben, hatte vor 1933 nichts mit dem HJ-Alltag gemein. Nach der „Machtergreifung“ stand die RJF in Hinblick auf den Aufbau eines sportlichen Programms ganz am Anfang. Zunächst versuchte man, Konkurrenz beiseite zu räumen. Am 30. April 1933 war der sozialdemokratische und gewerkschaftliche Arbeitersport im deutschen Staatsgebiet verboten worden. Die „Kampfgemeinschaft Rote Sporteinheit“ der KPD war bereits nach dem Reichstagsbrand Ende Februar geschlossen, ihr Leiter Ernst Grube verhaftet worden. Rund 4 000 politisch im linken Lager zu verortende Sportvereine mit etwa 250 000 Mitgliedern waren im Frühjahr 1933 für illegal erklärt worden. Sie wurden liquidiert oder lösten sich von selbst auf. Ihr Eigentum fiel zumeist an die Partei und den Staat. Die Parteijugend profitierte vom Terror, nahm vor Ort Turnhallen oder Sportplätze in Beschlag – wie der erste Sportplatz, den die Hitlerjugend in Leipzig besaß, der aber zuvor einem Arbeitersportverein gehört hatte. Der Verein war von der SS besetzt und der Platz im Herbst 1933 an die HJ übergeben worden.275 Nur vereinzelt konnten die zerschlagenen linken Vereine noch als kleinste informelle Keimzellen für den Untergrund fungieren.276 Eduard Weiland, damals 12 Jahre alt, gehörte bis zum Frühjahr 1933 der Jugendabteilung eines SPD-Arbeitersportvereins in Düsseldorf an. Dieser wurde nun abrupt zerschlagen. „Da der Verein von linksgerichteten Funktionären 274 Schreiben des Führers der Gefolgschaft 13/180 an das Evangelische Stadtpfarramt Marbach a. N. vom 25.5.1937 (ebd.). 275 Wie wir zu unserem Sportplatz kamen. In: Helmut Möckel (Hg.), Hitlerjugend kämpft, Sonderdruck „Junger Wille“ zum Führerappell und Gebietssportfest in Leipzig am 13./14.10.1934, Dresden 1934, S. 15 f. 276 Vgl. Uellenberg-van Dawen, Gegen Faschismus und Krieg, S. 180 f.; Michael Schneider, Unterm Hakenkreuz: Arbeiter und Arbeiterbewegung, 1933 bis 1939, Bonn 1999, S. 380–395.
88
Genese einer Massenorganisation
geleitet wurde“, erzählte Weiland, „war er den neuen Machthabern ein Dorn im Auge. Wieder einmal übten wir in der Turnhalle, als die SA in Begleitung von Polizei aufmarschierte und uns mit üblen Schmährufen und unter Schlägen aus der Turnhalle vertrieb. […] Mit dieser Aktion war der Verein zerstört, und meine Freunde und ich suchten neuen Anschluss bei anderen Gruppen.“277 Weiland ging zunächst in einen evangelischen Jugendbund, den ein Lehrer leitete. Die Zuflucht konnte mit der Überführung der Jugendverbände aber nicht von Dauer sein. Er irrlichterte durch diverse Gruppen und informelle Kreise. 1938 hatte er Anschluss an eine sogenannte illegale Clique gefunden und musste neun Monate Haft in einem Jugendgefängnis verbüßen. Sein Beispiel, das von einem linken Verein sukzessive in die Illegalität führte, ist ein besonderer, kein typischer Fall. Aber charakteristisch, und in ähnlichen Berichten zu finden, ist der unbeständige Wechsel von einer aufgelösten Organisation in die nächste. Insbesondere bürgerliche Sportvereine wurden 1933 zum Anker für junge Menschen, die nicht in die Hitlerjugend übertreten wollten. Konfessionellen Gruppen und Vereinen war, wie erwähnt, jede sportliche Betätigung ab 1935 ebenfalls untersagt. Jugendliche und junge Erwachsene gründeten mitunter Tarnvereine, die verboten wurden, sobald man sie als solche erkannte.278 Der vereinsmäßige Sport, obwohl nicht im eigentlichen Sinne politischer Akteur, behinderte somit die Durchsetzung des Monopolanspruchs der Hitlerjugend. Die bürgerlichen Sportverbände hatten in der Weimarer Republik bei weitem den stärksten Faktor im RddJ gebildet: rund eine Millionen Jugendliche beiderlei Geschlechts bis 21 Jahren waren Mitglied eines Vereins.279 Seit Januar 1933 konkurrierten im Wesentlichen zwei Protagonisten um Einfluss: Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten verfolgte eigene Ambitionen, die sich nicht automatisch mit dem Totalitätsanspruch der Hitlerjugend deckten. Die RJF ihrerseits bestand darauf, dass sie aus der „Einigung der deutschen Jugend“ hinsichtlich des organisierten Jugendsports Ansprüche ableitete. Körperliche Ertüchtigung sollte eine zentrale Aufgabe und Säule der Staatsjugend werden. Die Deutsche Turnerschaft (DT), einer der größten Verbände im RddJ, erklärte sich nach der „Machtergreifung“ Hitlers loyal. Edmund Neuendorff – völkischer Pädagoge, krasser Antisemit und DT-Spitzenfunktionär – legte die Grundlage zur staatlichen Gleichschaltung. Für das Deutsche Turnerfest in Stuttgart, das als „Fest des deutschen Volkes“ und „Erlebnis der Nation“ begangen wurde, war es Neuendorff gelungen, Hitler zur Übernahme der Schirmherrschaft zu bewe-
277 Hier und im Folgenden Bericht von Eduard Weiland. In: Pädagogisches Institut Düsseldorf (Hg.), Dokumentation, S. 178–183, hier 179. 278 Uellenberg-van Dawen, Gegen Faschismus und Krieg, S. 180–182. Zwei Beispiele für das Verbot von vermeintlichen oder tatsächlichen Tarnvereinen: Spielsperre für Heidenauer Sport-Club. Amtliche Bekanntmachung des Gaues Ostsachsen. In: Der Freiheitskampf vom 28.6.1933; Die Machtmittel des Staates. In: Hamburgischer Correspondent vom 11.5.1933. 279 Vgl. Rauschenbach, Jugendverbände, S. 121.
Die Eroberung des Alltags
89
gen.280 Obgleich Neuendorff 1934 in Konflikt mit dem Reichssportführer geriet und schließlich aus der NSDAP austrat, unterstützte er zunächst auch die RJF in ihrem Ziel, die Auflösung der bürgerlichen Sportvereine in der Parteijugend zu erreichen. Dahinter stand eine kühne Ambition: Durch Staat und Partei legitimiert, sollte der Jugendsport im Rahmen der Hitlerjugend zum vormilitärischen Wehrsport aufgewertet werden. In einer bemerkenswerten Schrift mit dem Titel „Der deutsche Jungendienst“, zu welcher auch Neuendorff einen kleinen Text beisteuerte, legten Pädagogen und Sportrepräsentanten Mitte 1933 ihre Ideen über die vormilitärische Ausbildung der Jugend dar – ein gemeinsames Werk, wie die Einleitung betonte, mit Anregungen „vieler Führer deutscher Jugendverbände“. Deren Botschaft war deutlich: „Die Jungen jubeln dem neuen Reiche zu. Sie geloben ihm Treue und letzte Hingabe.“281 Wieder wurde das „Fest der Jugend“ am 24. Juni 1933 genutzt, um Zukünftiges vorwegzunehmen: die Hitlerjugend einerseits und die Mitglieder der Sportvereine andererseits sollten zur Sonnenwende gemeinsam Seite an Seite aufmarschieren. Die Verbände forderte man auf, sich mit der Hitlerjugend vor Ort in Verbindung zu setzen.282 Der Torso des RddJ – dessen Stellen inzwischen wahrscheinlich mehrheitlich mit HJ-Führern besetzt waren – koordinierte, wie für Weimar dokumentiert, die Eingliederung verschiedener Sportgruppen in die Reihen der Parteijugend. Den Vereinsmitgliedern wurden Uniformteile, Mützen, Abzeichen und Fahnen ausgehändigt. Für Schaulustige waren diese Jugendlichen von Hitlerjungen und BDM-Mädchen nicht zu unterscheiden. Die Propaganda erzeugte auf diese Weise geschickt Uniformität und Gleichschritt, obwohl die Sportvereine mit der Hitlerjugend formal nicht verschmolzen waren. Wie das beiderseitige Verhältnis in Zukunft genau aussehen würde, blieb im Sommer 1933 weiter offen. Reichsjugendführer Schirach hielt sich, was eine taktische Rücksicht gegenüber dem Reichssportführer war, mit rigorosen Forderungen zurück. Viele Unterführer waren weniger befangen. Heinz Hohoff, ein SA-Mann aus dem Ruhrgebiet, seit Oktober am Aufbau der Hitlerjugend in Brandenburg beteiligt, wurde deutlich. Es sei nicht hinzunehmen, dass junge Menschen „in Vereinen einem Wimpel folgen, der vielleicht das Symbol 280 Rundfunkrede des Reichssportführers. Zukunftsaufgaben des deutschen Sports. In: Der Freiheitskampf vom 31.8.1933; vgl. Elk Franke, Der Sport nach 1933: Äußere Gleichschaltung oder innere Anpassung? In: Rüdiger vom Bruch (Hg.), Die Berliner Universität in der NS-Zeit, Band 2: Fachbereiche und Fakultäten, Wiesbaden 2005, S. 243–256, hier 243 f. 281 Vogt, Einleitung. In: Deutscher Jungendienst (Hg.), Deutscher Jungendienst. Ein Handbuch, 11.–20. Tausend, Potsdam 1933, S. 5 f., hier 6. Im Zusammenhang vgl. Lorenz Pfeiffer, „Auf zur Gefolgschaft und zur Tat!“ Deutsche Turnerschaft und Nationalso zialismus. Zwischen Selbstgleichschaltung und Selbstbehauptung? In: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, (1999) 4, S. 530–548. 282 Vgl. Mitteilungen der Thüringer Staatspressestelle. Anordnung des Thüringer Staatskommissars über die Durchführung des Festes der Jugend. In: Thüringer Staatszeitung vom 16.6.1933; sowie Ortsausschuss Weimar der deutschen Jugendverbände, Emil Schatz, an das Jugendamt der Stadt vom 14.6.1933 (StadtA Weimar, 16, 100-06, 5, unpag.).
90
Genese einer Massenorganisation
e ines durchaus guten Vereins trägt, aber trotzdem immer nur der Wimpel e ines Vereins bleiben wird. Wir wissen sehr wohl um die edlen Erziehungsziele des Turnens und des Sportes, müssen aber […] Turnen als Selbstzweck ablehnen.“283 Wie Hohoff, der 1938 zum Gebietsführer im Rheinland aufstieg, waren auch andere Funktionäre der Meinung, dass ihr Totalitätsanspruch vor dem Sport nicht Halt machen durfte. In den „Kampfjahren“ hatte die HJ, wie erwähnt, kaum Sport getrieben. Einen Leistungssport musste man erst aufbauen und geschultes Personal gewinnen. Es half den Dienststellen in vielen Fällen, dass Vereine selbstständig, also ohne Druck, mit ihnen zusammengingen. In Thüringen zum Beispiel erreichte die Gebietsführung im Oktober 1933 eine Einigung mit den Turn- und Sportverbänden. Demnach sollten die Vereinsmitglieder möglichst in die Reihen der Parteijugend aufgenommen werden, während den Mitgliedern der HJ wiederum ein Eintritt in die Vereine empfohlen wurde. Eine Aufgabenverteilung, die im Rückblick höchst ungewöhnlich scheint, sah diese Vereinbarung vor: Die Vereine sollten körperliche Ertüchtigung leisten, während die Hitlerjugend sich auf ihr Kerngebiet, nämliche die politische Schulung und politische Freizeitgestaltung zurückzog.284 In mehreren Städten wurden im Winter 1933/34 gegenseitige Überführungen auf Basis dieser wechselseitigen Einigung gefeiert. In Altenburg erklärte der Bannführer Kurt Pötschke: „Viel […] deutsches Volkstum bringt die Turnerjugend der Hitlerjugend mit und die Hitlerjugend nimmt diese Kräfte freudig auf, um sie […] nutzbar zu machen.“285 Derlei Übereinkünfte waren das Resultat der Eigeninitiative des regionalen HJ-Führerkorps. Man kann sie außerdem als Beleg für den Kooperationswillen zahlreicher Vereine und Verbände heranziehen. Aus Schirachs Sicht musste es sich jedoch um eine temporäre Lösung für ein Problem handeln, welches einer einheitlichen Lösung noch bedurfte. Lokale und regionale Entwicklungen konnten diejenigen auf Reichsebene vorwegnehmen. Zur einheitlichen Lösung kam es erst 1934, das Schirach zum Jahr der „Schulung und der inneren Ausrichtung“ erklärt hatte. Die Hitlerjugend sollte ihr Profil bei Leibesübungen, Geländesport und Wettkämpfen schärfen.286 Der Sportfunktionär, DT-Jugendführer und Dozent an der Preußischen Hochschule für Leibesübungen, Thilo Scheller, verkündete im März 1934, dass „wir […] jetzt bald in der größeren Volksgemeinschaft arbeiten. Der Reichssportführer wird uns in den nächsten Tagen in die Hitlerjugend überführen.“287 Dieser Ankündigung folgten erst im November 283 Heinz Hohoff, Turnen und Sport. Ein Teil der Gesamterziehungsarbeit. In: HJ im Vormarsch, (1934) 3, S. 4. 284 Zusammenschluss der Turn- und Sportjugend mit der HJ. Durchführungsbestimmungen. In: Der Thüringer Sturmtrupp, (1933) 2, S. 1. 285 Übernahme der Altenburger Turnerjugend in die HJ. In: ebd., (1933) 5, S. 1. 286 Reichsjugendführung (Hg.), HJ. im Dienst. Ausbildungsvorschrift für die Ertüchtigung der deutschen Jugend, Berlin 1935, S. 6. 287 Thilo Scheller, Volksgemeinschaft. In: Turnerjugend. Blätter vom jungen Leben in der Deutschen Turnerschaft, (1934) 3, Ausgabe A, S. 23; ders., Werden und Wesen der deutschen Turn- und Sportjugend. In: Vesper (Hg.), Deutsche Jugend, S. 322–332. Im Zusammenhang vgl. Helena Gand, Ideologie und Inszenierung zwischen Kontinuität
Die Eroberung des Alltags
91
Taten. Junge Menschen ab zehn Jahren, die einem Sportverein beitreten wollten, mussten in Zukunft eine Mitgliedschaft in der Hitlerjugend nachweisen. Das war ein geschickter Taschenspielertrick. Die Jugend- und Nachwuchsarbeit war den Sportvereinen, anders als anderen Organisationen und Akteuren, damit nämlich nicht in Gänze verboten. Der eigene Nachwuchs ließ sich aber nur noch in engster Verbindung mit der Hitlerjugend gewinnen. Das Abkommen, das Schirach mit dem Reichssportführer im Sommer verhandelt hatte, ersetzte jene Übereinkünfte, welche die Hitlerjugend auf regionaler Ebene mit den Verbänden zum Teil erzielt hatte: „Der Reichsjugendführer erwartet nunmehr eine verstärkte sportliche Betätigung der HJ in den Vereinen des Reichsbundes für Leibesübungen. Der Eintritt in die HJ-Gliederungen ist von den Vereinen […] zu fördern.“288 Unter angeblich freudiger Anteilnahme der Bevölkerung und der Eltern fanden ab Ende 1934 erneut örtliche Eingliederungsfeiern statt. In größeren Städten wurden sie von Massenaufmärschen und Reden begleitet.289 Der Begriff „Eingliederung“ führt hier allerdings mit Absicht in die Irre. Gerade das Nebeneinander von Hitlerjugend-Dienst und Vereinsengagement kennzeichnete die Praxis.290 Eingliederung hieß nicht Übernahme. Das macht folgender Passus deutlich: „Es wird erwartet, dass möglichst sämtliche Jugendliche in die HJ bzw. den BDM überführt werden. Die […] Entgegnung, dass die Beschaffung eines […] Dienstanzuges eine zu starke finanzielle Belastung für die Elternschaft sei, kann […] nicht als stichhaltig angesehen werden.“291 Einen Automatismus zum Übertritt in die Hitlerjugend gab es demnach nicht. Eher die möglichst enge Zusammenarbeit zwischen Vereinen und Parteijugend war mit „Eingliederung“ gemeint. Vereine sollten, wie der Beauftragte des Reichssportführers in Sachsen formulierte, „Hand in Hand mit der HJ gehen“.292 Die Hitlerjugend hielt, obwohl der Druck rapide anwuchs, an ihrem Prinzip fest, dass die Mitgliedschaft freiwillig sein sollte. Gemeinsam mit den Sportvereinen – oft über die „Arbeitsgemeinschaften für Jugenderziehung“ verwirklicht, die es in der Weimarer Republik auf kommunaler Ebene bereits gegeben hatte, in denen nun aber HJ-Führer ein gewichtiges Wort mitredeten – sollte die Parteijugend
und Kooperation. Das 15. Deutsche Turnfest 1933 als erstes Massensportereignis im Nationalsozialismus. In: Frank Becker/Ralf Schäfer (Hg.), Sport und Nationalsozialismus, Göttingen 2016, S. 107–124, hier 111–113. 288 Vgl. Es gibt nur noch die Hitler-Jugend. Die Abmachungen zwischen Reichssportführer und Reichsjugendführer, die die Eingliederung der Sportjugend festlegen. Gleiche Vereinbarung mit dem BDM. In: Der Freiheitskampf, Beilage: Turnen und Sport, vom 22.9.1934. 289 Hitler-Jugend und Sportjugend eins. In: Der Freiheitskampf vom 19.11.1934. 290 Aus der Vielzahl der überlieferten Quellen beispielhaft zitiert die Vereinsmitteilungen der Turngemeinde Pirna e.V., (1934) 11, S. 4. 291 Sportamtliche Bekanntmachungen. In: Der Freiheitskampf vom 13.11.1934. Es galt für die Eingliederungsfeiern am 18. November angeblich eine „Teilnahmepflicht aller Vereine“, zudem in Sachsen ein landesweites Spielverbot an jenem Tag. 292 Aus zwei Säulen wird eine. Heute in Sachsen Eingliederung der Turn- und Sportjugend in die HJ. In: Der Freiheitskampf vom 18.11.1934.
92
Genese einer Massenorganisation
in Zukunft beides anbieten: weltanschauliche Schulung ebenso wie körperliche Ertüchtigung. Für die Jungen kamen neben Turnen das Geländespiel, Schießen und Wehrsport hinzu, Mädchen trieben Gymnastik, Ballett und Tanz.293 Vereinbarungen mit anderen Verbänden folgten in den weiteren Jahren – wie mit dem Deutschen Schützenverband, der 1937 seine Schießstände der HJ zur Verfügung stellte und im Gegenzug in der Parteijugend um Nachwuchs werben durfte. Bis dahin war, wie die BDM-Führerin Jutta Rüdiger im Rückblick noch Jahrzehnte später klagte, die HJ „überall [nur] zu Gast“ gewesen, „musste bitten, wenn sie mit ihren Jungen ‚schießen‘ wollte“.294 Bereits im August 1936 war zudem ein ähnliches Abkommen mit dem Reichsfachamt für den Boxsport erzielt worden; die sogenannten Jugendwarte der HJ sollten auch in diesem Fall im Verein die enge Zusammenarbeit mit der Hitlerjugend gewährleisten.295 Für die Sportvereine wurde ein Zusammengehen mit der Hitlerjugend auch deshalb notwendig, weil sie nur so von staatlicher Förderungen profitieren konnten: Anschaffung von Sportgerät, Bau neuer Sportplätze oder Turnhallen, die von der Parteijugend genutzt werden sollten, alles koppelte man zunehmend an die Wünsche der Hitlerjugend-Dienststellen.296 Die Vereine wurden immer mehr in die Rolle der Handlager gedrängt. Sport sollte, wie die HJ-Gebietsführung von Sachsen erklärte, „nicht Selbstzweck [sein], wie das notgedrungen in den Turn- und Sportvereinen der Fall“ wäre. Aus der Jugend müsse vielmehr „ein kampffrohes, weltanschaulich gefestigtes und körperlich starkes Volk“ erwachsen.297 Die Gemengelage zwischen den Vereinen und der Hitlerjugend blieb lange Zeit komplex. Von Ort zu Ort konnte die Kooperation unterschiedlich aussehen. „Neben der geistigen Ausbildung steht auf gleicher Stufe die kör293 Vgl. Korrespondenzen und überlieferten Materialien einer dörflichen „Ortsarbeitsgemeinschaft für Jugenderziehung“ (StadtA Halle, Best. Wörmlitz-Böllberg, 100, Bd. 3, unpag.). 294 Zusammenarbeit mit dem Deutschen Schützenverband. In: GB: Hamburg, B3/1937 vom 12.4.1937; Jutta Rüdiger, Die Hitler-Jugend und ihr Selbstverständnis im Spiegel ihrer Aufgabengebiete, Studienausgabe, Lindhorst 1983, S. 82. 295 Vgl. Ausführungsbestimmungen zum Vertrag zwischen dem Jugendführer des Deutschen Reiches und dem Reichssportführer vom 1.8.1936, abgedruckt im GB: Pommern, A5/37 vom 1.5.1937. 296 Vgl. beispielhaft ein Schreiben des Landrats des Saalkreises bezüglich Jugendpflegeeinrichtungen an die Bürgermeister im Saalkreis vom 18.7.1935 (StadtA Halle, Wörmlitz-Böllberg, 100, 3, unpag.). „Der Minister hat aus dem Zentralfonds für Jugendpflege einen Beitrag zur Förderung und Erziehung der Jugend außerhalb der Schule bereitgestellt. […] Überall dort, wo es an geeigneten oder ausreichenden Turn- und Sportplätzen fehlt, soll dieser Mangel in erster Linie […] abgestellt werden. In zweiter Linie soll eine Heimbeschaffungsaktion eingeleitet werden, wobei die Fertigstellung der Heime möglichst so gefördert werden soll, dass diese zu Beginn der kalten Jahreszeit den HJund BdM-Einheiten zur Abhaltung ihrer Heimabende und für den Staatsjugendtag zur Verfügung stehen. Ferner soll auch der Turnhallenbau gefördert werden. […] Bei allen Maßnahmen zur Schaffung der […] Einrichtungen oder die zu errichtenden Anlagen ist ein selbstständiges Vorgehen der Gemeinden oder der örtlichen Jugend-, Turn-, und Sportorganisationen zu vermeiden.“ Ebd. 297 Der Führer des Gebietes 16/Sachsen HJ, Weltanschauliche Schulung und körperliche Ertüchtigung. In: Die Gefolgschaft, (1935) 6: Bann- und Jungbann-Sportfeste 1935, S. 1.
Die Eroberung des Alltags
93
perliche Ertüchtigung“, schrieb ein Gymnasiast aus Essen vermutlich 1936 in einem Aufsatz, mit dem er die unübersichtliche Lage ordnen wollte: „Die Arbeit, die früher die Sportvereine an der Jugend erfüllt haben, hat heute das Jungvolk zum größten Teil übernommen. Damit ist nicht gesagt, dass das Jungvolk den Turnvereinen die Leute nimmt. Nur die Schülergruppen wurden übernommen. Während im Sportverein die Besten zu Höchstleistungen ausgebildet werden, betreibt das Jungvolk den Massensport.“298 Was aber hieß das? Das Ziel der RJF bestand in der „Neuordnung des Jugendsportes“, was natürlich heißen sollte, dass er der Hitlerjugend möglichst umfassend einzuverleiben war.299 Die Vereine hatten von Beginn an überall Konzessionen zu machen: Sie sollten Sportgeräte überlassen, da viele Hitlerjugend-Einheiten keine besaßen und es an Geld zur Anschaffung fehlte; ebenso mussten sie verschmerzen, dass die Hitlerjugend für ihren Dienst zwei Wochenenden im Monat beanspruchte – Zeit, die den Vereinen für Nachwuchsarbeit nun fehlte. Viel hing davon ab, wie gut oder schlecht sich die Vereinsleiter mit der Hitlerjugend vor Ort verständigten. In Kleinstädten und auf dem Land stellten Sportvereine ihre Jugendarbeit vielfach früh unter das Dach der Hitlerjugend. Letztere warb auch um Turnoder Schwimmlehrer, um ihr Angebot zu erweitern. Die Gebietsführerschulen übernahmen die Ausbildung sogenannter Sportwartinnen und Sportwarte. In Berlin sollte seit 1934 jedes Jungvolkfähnlein einen Jungen für solche Lehrgänge entsenden. Man gab Kontingente vor, wie viele Kinder und Jugendliche insgesamt teilnehmen mussten. Diese jungen Sportlehrkräfte sollten nicht nur die Ausbildung in der Parteijugend gewährleisten, sondern insbesondere in den Vereinen für sie werben.300 In manchen Vereinen wurde ab 1936 zudem ein sogenannter Jugendvereinsleiter tätig – ein „Verbindungsmann […] zwischen dem Verein und dem Bann bzw. der örtlichen HJ-Einheit. […] Zum Beispiel sind Beurlaubungsanträge, die für irgendein Training oder Verbandsspiel bei der HJ gestellt werden, von ihm auf ihre Richtigkeit und Wichtigkeit zu prüfen. […] Weiterhin hat der Vereinsjugendleiter dahin zu wirken, dass seine Vereinsjugend restlos Mitglied der HJ wird.“301 Zur Mitte der 1930er-Jahre hatte die Hitlerjugend die Vereine mehr und mehr an den Rand gedrängt. Schon war von dem Sportmonopol der Staatsjugend die Rede, obwohl sie ein solches faktisch nicht besaß. Aber das Ziel rückte näher. Im August 1936 übernahm schließlich das Deutsche Jungvolk den gesamten Breiten- und Leistungssport für die 10bis 14-jährige männliche Jungend; ein Riesenschritt bei der Durchsetzung ihres Anspruchs auf Totalität. Die Nachwuchsabteilungen aller Vereine, welche zum Reichsbund für Leibesübungen gehörten, mussten nun aufgelöst werden. Der 298 Jahresarbeit am Gymnasium Essen-Borbeck, S. 36, o. D. (NSDOK Köln, EzG, jugend 1918-1945.de; 16.7.2020). 299 Sport der Jugend. In: GB: Pommern, A2/38 vom 1.2.1938. 300 Lehrgang der Gebietsführerschule zur Ausbildung von Sportwarten für das Deutsche Jungvolk. In: BB: Berlin, 52/34 vom 24.8.1934; Lehrgang auf der Geländesportschule Bunzlau. In: ebd., 55/34 vom 14.7.1934. 301 Der Vereinsjugendleiter. In: GB: Sachsen, 1/36 vom 5.2.1936.
94
Genese einer Massenorganisation
Reichssportführer hatte die Segel endgültig gestrichen. Der einstige Konflikt wurde gelöst, indem der Reichssportführer in die RJF eintrat; eine „von gegenseitigem Vertrauen getragene Vereinbarung“, wie Schirach unterstrich.302 Den älteren Jugendlichen blieb jedoch – unter der Voraussetzung, dass sie der Hitlerjugend beitraten – eine Leistungsqualifikation durch das Engagement in einem Verein möglich. Die Olympischen Spiele in Berlin im selben Jahr führten vor Augen, dass auf die Expertise der Vereine nicht verzichtet werden konnte. Deutschlands Sport sollte mit dem des Auslands weiter konkurrenzfähig bleiben. Die HJ bot keine Gewähr für einen professionellen und zukunftsfähigen Leistungssport. Jugendliche, die das 14. Lebensjahr erreichten, durften in Sportvereinen weiter aktiv sein.303 Und insofern standen sich Vereins- und Hitlerjugend-Alltag – schon allein in zeitlicher Hinsicht – in vielen Fällen konkurrierend gegenüber. Die „gesamte körperliche Ertüchtigung der deutschen Jugend“ unterstünde der Parteijugend, hieß es selbstbewusst aus deren Dienststellen.304 Autonomie besaßen die Vereine kaum. Sportfeste und Wettbewerbe wurden in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts von der RJF ausgelobt und über die Hitlerjugend ausgerichtet. Wer an einem Wettkampf oder Freundschaftsspiel teilnehmen wollte, musste die HJ-Mitgliedschaft besitzen; alle übrigen durften nur Übungsabende besuchen.305 Ab August 1938 wurde der Beitritt zu einem Verein an den Erwerb des HJ-Leistungsabzeichens gekoppelt; wer diese Prüfung bis zum 16. Lebensjahr nicht absolvierte, sollte nicht mehr am Vereinsleben teilnehmen dürfen. Die Überprüfung fiel den Stellenleitern für Leibesertüchtigungen in den HJ-Dienststellen zu.306 Im Übrigen wurde 1939 die Jugendmeisterschaft im Fußball erstmals nicht mehr zwischen Vereinen bestritten, sondern zwischen Gebietsmeistern ausgetragen, die sich im Vorfeld in sogenannten Bannauswahlwettkämpfen in einem HJ-Gebiet durchgesetzt hatten.307 Sportliche Betätigung, auch professionell betrieben, wurde völlig unabhängig von der Partei für Ju302 Verfügung des Reichsjugendführers. Durchführung des Leistungssports in der Hitler- Jugend, abgedruckt u. a. in: GB: Pommern, A13/37 vom 1.12.1937; GB: Westmark, 4/37 vom 1.4.1937. 303 Dies galt nach Einführung der Jugenddienstpflicht 1939 nur für Mitglieder der StammHJ. Männliche Jugendliche, die im Rahmen der Dienstpflicht in der Hitlerjugend erfasst wurden, durften in einem Verein keinen Leistungssport treiben. Einzelne Vereine verstießen aber offenbar gegen diese Verordnung. Vgl. Sport von Jugendlichen. In: GB- und Obergaubefehl: Westfalen, K1/41 vom 10.1.1941. 304 So die Formulierung bei Der Landesbeauftragte des Jugendführers des Deutschen Reiches und der Führer des Gebietes Baden, Haushaltsvorschlag für das Rechnungsjahr 1938 für Jugendarbeit der Hitler-Jugend, S. 4 (GLA Karlsruhe, 465c, 23587, unpag.). 305 Zugehörigkeit DRL-Jugendlicher zur HJ. In: GB: Thüringen, A19/37 vom 15.12.1937: „Alle Vereinsjugendlichen des DRL, die sich an irgendeiner Sportart wettkampfmäßig beteiligen, müssen Mitglied der HJ sein. Diese Bestimmung bezieht sich auf Wettspiele und Freundschaftsspiele. Ein Jugendlicher bis zu 18 Jahren, der einem Verein angehört und nicht Mitglied der HJ ist, kann nur die Übungsabende des Vereins besuchen.“ 306 Erfüllung der Bedingungen für das HJL [HJ-Leistungsabzeichen] der Jgg., die einem Turn- oder Sportverein angehören. In: GB: Düsseldorf, A3/1939 vom 1.3.1939. 307 Hierzu beispielhaft Spielplan für die Bannauswahlmannschaften im Fußball. In: GB: Düsseldorf, A1/39 vom 16.1.1939.
Die Eroberung des Alltags
95
gendliche weitgehend unmöglich. Für die Wettkämpfe unter ihrem Dach setzte die Staatsjugend mit der Zeit Sollzahlen für Teilnehmer fest, die indes selten erfüllt und manchmal weit unterschritten wurden.308 Die Hitlerjugend besaß jedoch kein Sportmonopol im eigentlichen Sinne; denn vieles von dem, was sie ausrichtete, betrieben in Wahrheit Vereine oder wurde von ihnen vorbereitet.309 Vielmehr hatte die Hitlerjugend bis Ende des Jahrzehnts die Regie inne. „Diese Aufgabenteilung“, wie die BDM-Führerin Jutta Rüdiger im Rückblick meinte, habe „sich bis zum Kriegsende bestens bewährt.“310 In Wahrheit waren aber Konflikte zwischen Hitlerjugend und Vereinswesen über die erste Phase der Diktatur hinaus an der Tagesordnung.311 Die übliche Lesart besagt, dass es Kindern und Jugendlichen im „Dritten Reich“ unmöglich gewesen sei, einem Sportverein beizutreten, ohne der Hitlerjugend anzugehören. Formal ist das für die Zeit ab Mitte der 1930er-Jahre korrekt. Dennoch kannte die Realität des Alltags viele Ausnahmen. Mehrere Fälle sind dokumentiert: Vereine prüften – zum Ärger der Hitlerjugend – bei der Aufnahme junger Menschen bewusst nachlässig. Die Turner würden sich nicht an Vereinbarungen halten, klagte beispielsweise die Hitlerjugend in Lippe 1934. Man hegte den Verdacht, junge Menschen seien in den Vereinen aktiv, welche eine Mitgliedschaft bei HJ oder BDM nicht vorweisen könnten. Man forderte die Mitgliederlisten der Vereine an, um sie mit eigenen Listen abgleichen zu können.312 Eine BDM-Führerin beklagte die Konkurrenz, die zum Schaden der Hitlerjugend bestünde. Durch die Turnvereine würde „ein Mädel nach 308 Hierzu die aufschlussreiche Gegenüberstellung von Soll- und Teilnehmerzahlen für BDM und JMB an Wettkämpfen des Jahres 1942. In: GB: Moselland, K1/43 vom 1.1.1943. In Fall eines Bannes hatten von den durch das Gebiet 163 geforderten BDM-Mädchen beispielsweise nur 27 teilgenommen. 309 Vgl. beispielhaft Schwimmwettkämpfe der deutschen Jugend. In: GB: Westfalen, 6/37 vom 1.5.1937: „Die Wettkämpfe werden als Einzelwettkämpfe in Zusammenarbeit mit den Schwimmvereinen […] durchgeführt“. Ein anderes Beispiel: In Niedersachsen wurde durch das Gebiet 1943 die Beteiligung der Banne an Handballgebietswettkämpfen angewiesen. In den meisten Bannen gab es noch keine Sportgruppen. In Aue wies man daher die Bildung solcher Handballsportgruppen an, betonte typisch: „Für die Trainingsarbeit können die Turnvereine herangezogen werden, wenn die Einheitenführer selbst nicht dazu in der Lage sind.“ Vgl. Handballspiel. In: BB: Bann Aue, 2/43 vom 2.6.1943. Charakteristisch auch ein Vorführungsantrag der Hitlerjugend an die Ortspolizeibehörde Essen zur Bestrafung eines säumigen Jugenddienstpflichtigen, vom 4.3.1941 (StadtA Essen, Rep.102, Abtl. XIV, 23): „Die Dienstversäumnisse des Jg. [ Jugendgenossen] B. beruhen mit großer Wahrscheinlichkeit auf seine Betätigung als Fußballspieler im Sportverein 09, Steele […]. Nun kommt es […] vor, dass unter den dienstpflichtigen Jgg. Leute sind, die in irgendeiner Sportart sich leistungsmäßig betätigen, d. h. sich also an Wettkämpfen beteiligen. Auch diese Leute machen ihren Sport zweifellos lieber, als den HJ-Dienst. Diese Wettkämpfe erfolgen nun zu über 90 % im Rahmen von HJ-Veranstaltungen, die Sieger werden auch als HJ-Angehörige bezeichnet.“ 310 Rüdiger, Die Hitler-Jugend und ihr Selbstverständnis, S. 75. 311 Vgl. Brandenburg, Die Geschichte der HJ, S. 170–177; Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 173–180. 312 Peter Pahmeyer/Lutz van Spankeren, Die Hitlerjugend in Lippe. Totalitäre Erziehung zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Bielefeld 1998, S. 220.
96
Genese einer Massenorganisation
dem anderen […] weggelockt“.313 Die Hitlerjugend übte massiven Druck aus. In Berlin wurden dem Kreisausschuss für Leibesübungen und Jugendpflege Ende 1934 die Mitgliedslisten sämtlicher HJ- und Jungvolkeinheiten ausgehändigt. Die Hitlerjugend drängte auf einen Abgleich, um illegitime Vereinsbeitritte aufzudecken.314 Schlupflöcher existierten ebenfalls: Wer aus der Parteijugend austrat oder ausgeschlossen wurde, konnte darauf setzen, dass die HJ-Dienststellen versäumten, dies den Vereinen mitzuteilen.315 Die Exil-SPD berichtete, dass die Vereine der Hauptstadt durch die Hitlerjugend zwar durchweg schwere Einbußen erfahren hatten. Doch die Eltern seien mit den Vereinbarungen zwischen Vereinen und Hitlerjugend, insbesondere im Falle kollektiver Übertritte, oft nicht einverstanden. Lieber würden sie den Austritt ihrer Kinder aus den Sportvereinen sehen, als deren Mitgliedschaft in der Hitlerjugend.316 Das mag eine Erklärung sein, weshalb mancher Verein – zumal in Hochburgen und Vierteln der Arbeiterbewegung – die Zusammenarbeit zumindest nicht forcierte. „Das gespannte Verhältnis zwischen der HJ einerseits und der ‚Sportjugend‘ andererseits dauert fort“, so ein Lagebericht aus Merseburg 1935, der sich bezeichnenderweise auf die Seite der Vereine schlug: Wolle man den Sport nicht gefährden, könne „auf eine sportliche Sonderausbildung des dazu geeigneten Teils der Jugend nicht verzichtet werden“.317 Die HJ-Funktionäre ließen nicht locker. Der Landesjugendführer für Sachsen, Wilhelm Busch, unterstrich im Mai 1935: die HJ- oder BDM-Mitgliedschaft sei für Vereinsangehörige Pflicht. Beim Sport dürften nur die Hitlerjugend-Uniformen getragen werden; und die Zugehörigkeit zur neuen Staatsjugend sei selbstverständliches Gebot eines jeden Jungen und Mädchens.318 Die Realität allerdings sah vielfach noch anders aus. Ein kleiner Turnverein im Osten von Halle beispielsweise gab auf Nachfrage 1935 an, von seinen 53 männlichen Jugendlichen seien 18 in der HJ oder im Jungvolk; bei 51 Mädchen immerhin 33 bei Jungmädeln oder im BDM.319 Die Vorstellung, dass der Vereinssport und die Hitlerjugend gewissermaßen umgehend fusionierten, entspricht nicht den Tatsachen. Das Sportprogramm der Parteijugend benötigte ebenfalls Zeit, um zu wachsen und die Vereine an den Rand zu drängen. Schirach klagte 1937, dass, wie mehrfach berichtet würde, der Sport im Jungvolk „nicht mit dem erforderlichen Nachdruck von der aktiven Führerschaft in Angriff genommen“ werde.320 In Westfalen urteilte die 313 Zit. nach ebd., S. 170. 314 Zählung der Jugendlichen 1934. In: BB: Berlin, 62/34 vom 2.11.1934. 315 Ausschlüsse gegen Mitglieder der HJ, die gleichzeitig Mitglieder eines Turnvereins sind. In: GB: Thüringen, 5/355 vom 14.4.1935. 316 Bericht aus Berlin, A 64. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 2 (1935), S. 222. 317 Lagebericht des Regierungspräsidiums Merseburg für November/Dezember 1935 vom 17.1.1936. In: Rupieper/Sperk (Hg.), Lageberichte zur Provinz Sachsen, Band 2, S. 544–567, hier 552. 318 Vgl. Reichsbund und Hitlerjugend. In: Der Freiheitskampf vom 26.5.1935. 319 Vgl. Aufstellung des Deutschen Turnvereins Reideburg vom 18.3.1935 (StadtA Halle, Diemitz, 642, 1). 320 Verfügung des Reichsjugendführers. Durchführung des Leistungssports in der Hitler- Jugend, abgedruckt u. a. in: GB: Pommern, A13/37 vom 1.12.1937; GB: Westmark, 4/37 vom 1.4.1937.
Die Eroberung des Alltags
97
ebietsführung, dass die Jugendabteilungen der Vereine zwar erfolgreich aufgeG löst seien, aber DJ-Sportgruppen „nur sehr wenige Jungbannführer“ bislang aufgestellt hätten. Im Allgemeinen sei die Lage in Westfalen so, dass „Pimpfe von 10–14 Jahren, die früher im Verein zum Teil sehr ordentlichen Turn- und Sportbetrieb gemacht haben […] heute nur einen sehr mangelhaften Sportdienst im DJ betreiben“.321 Noch Anfang 1939 räumte die RJF ein, dass wegen „willkürlichen Dienstansetzungen […] die Durchführung des freiwilligen Leistungssportes erschwert und vielfach sogar unmöglich gemacht“ würde.322 Auch in Thüringen zog die Gebietsführung 1938 eine kritische Bilanz: „Sportdienstgruppen in allen Sportarten“ seien weiter „nicht oder nicht in genügender Zahl aufgestellt“ worden. Es fehle in den Bannen „an den erforderlichen Führern und Übungsleitern“.323 Die Schuld schienen alle zu tragen, nur nicht die Führung selbst. Die Vereine einerseits würden der ihnen gestellten Pflicht nicht nachkommen, „helfend einzugreifen“. Und die eigenen Unterführer andererseits schienen den Funktionären untätig und faul. Nur im Falle von „beweisbaren politischen Bedenken“, wurde betont, sei die Kooperation mit einem Verein einzustellen.324 Gravierender aus Sicht der Hitlerjugend-Führung sowie der RJF musste jedoch anderes sein. Die Gleichschaltungspolitik, mit der man die Vereine überflüssig zu machen hoffte, hatte für die Parteijugend zum Teil negative Konsequenzen. Junge Menschen gingen zwar vermehrt in die Hitlerjugend, um einem Sportverein angehören zu dürfen. Die Doppelmitgliedschaft war ihnen ja zur Voraussetzung gemacht worden. Sie erschienen dann aber nicht zum Dienst. Eine gesetzliche Handhabe, um sie zur Beteiligung zu zwingen, existierte vor 1939 nicht, denn die RJF fürchtete, ihre Massenorganisation würde durch Zwangsausübung an Werbekraft einbüßen. Es war eine Inkonsequenz, deren Folge auf der Hand lag. Die Staatsjugend bestand zu einem rasant wachsenden Anteil aus Karteileichen, also passiven und vergleichsweise weniger engagierten Mitgliedern. Zahlreiche Defizite, welche die Dienststellen ab Mitte der 1930er-Jahre beklagten, kann man auf diesen Umstand zurückführen; mangelhafte Beteiligung, inflationäre Beurlaubungspraxis sowie ein Hang junger Menschen dazu, sich den Aufgaben zu entziehen, welche an sie herantragen wurden. 321 Jungbannführer und Sportdienstgruppen des DJ. In: GB: Westfalen, B2/37 vom 1.3.1937. Kritische Anmerkungen über fehlende Aktivität der HJ-Sportwarte. In: GB: Kurmark, A2/39 vom 1.2.1939. 322 Durchführung des Leistungssportes im HJ-Dienst. In: GB: Düsseldorf, A8/39 vom 31.5.1939. 323 Leistungssport des DJ und der HJ. In: GB: Thüringen, A2/38 vom 31.1.1938. 324 Ebd. Zur mangelnden Dienstauffassung vgl. u. a. auch ebd., 7/35 vom 4.6.1935: „Einige Führer […] haben aus bisher unerklärlichen Gründen in ihren Einheiten die Ansicht vertreten, dass die Leibesübungen und der Geländesport nicht als Dienst aufzufassen und die Teilnahme daher freiwillig sei.“. Lagebericht der Gestapo für das Jahr 1937 vom 13.12.1937. In: Brommer (Hg.), Die Partei hört mit, Band 1, S. 51–75, hier 59: „Die restlose Erfassung der Jugend in den Gliederungen der Partei ist noch in keiner Weise durchgeführt. Die Zusammenarbeit zwischen Reichsbund [f. L.] und HJ ist in ihren Anfängen steckengeblieben. Die eigensportliche Leibeserziehung durch die HJ leidet vielfach daran, dass Räume […] nicht zur Verfügung stehen.“
98
Genese einer Massenorganisation
Eine Besprechung der Gebietsführung in Berlin mit Sportlehrern, die in den untergeordneten HJ-Bannen den Turnbetrieb organisieren sollten, ergab im Oktober 1934: Zu wenige Jugendliche würden den separaten HJ-Turndienst besuchen, stattdessen andere Angebote jenseits der Hitlerjugend nutzen. Die jungen Unterführer seien auch nicht in der Lage, die jüngeren Kameraden ausreichend zu motivieren; zukünftig sollte die Beteiligung am HJ-Turnen mit Meldeblöcken festgehalten werden, um die Situation besser bewerten zu können.325 Drohungen seien dennoch zu unterlassen, mahnte die RJF: „Es ist dafür zu sorgen, dass die Dienstbeteiligung allein durch die Leistung der Einheit garantiert wird. Drohungen […] schädigen auf Dauer nicht nur das Ansehen der betreffenden Unterführer, sondern auch die Führung der HJ allgemein.“326 Solange kein gesetzliches Instrumentarium existierte, um die Beteiligung zu erzwingen, war die Hitlerjugend auf sozialen Druck angewiesen. Dem gaben nicht alle gleichermaßen nach. Das zeigt die Rückblende von Paul Kaißling auf seine Jugendjahre. Weil er in einem Stuttgarter Fußballverein aktiv sein wollte, trat der Sechzehnjährige in die HJ ein. Doch ein engagiertes Mitglied sei er in der Parteijugend nie gewesen: „Durch meine berufliche Tätigkeit war ich unter der Woche nicht zu erreichen, weil ich […] viel unterwegs war. Am Sonntag war Fußballspielen angesagt und somit konnte ich auch da keinen Dienst in der Hitlerjugend tun. Wenn kein Spiel war, ging ich um sechs Uhr aus dem Haus, damit meine Eltern sagen konnten, dass ich nicht da sei. Uniform habe ich mir keine angeschafft.“ Während seiner einjährigen Mitgliedschaft in der Hitlerjugend sei er dreimal beim Dienst gewesen.327 Tatsächlich ließ sich die Hitlerjugend noch lange ohne Konsequenzen schwänzen; erst 1939 sollte die gesetzliche Einführung der Jugenddienstpflicht mit den vielen Karteileichen ein Ende machen. Wenn die Abwesenheit auffiel und gemeldet wurde, drohte nun durch Streichung aus der Kartei des Banns ein unehrenhafter Ausschluss des Säumigen wegen „Interesselosigkeit“, und damit – zumindest, war es so angedacht – das Erlöschen der Vereinszugehörigkeit. Nicht wenige junge Menschen reizten diese Möglichkeiten aus, solange es ging. Sie nutzen Lücken, die sich ihnen boten, und setzten darauf, dass ihre Hitlerjugend-Unterführer Säumigkeit nicht streng verfolgten. Eine Phase unerwarteter Ermüdungserscheinungen kündigte sich an.328
325 Turnbetrieb der Banne. In: BB: Berlin, 63/34 vom 9.11.1934. 326 Dienstbefehle an HJ-Angehörige. In: Reichsbefehl, 7/II vom 19.2.1937; GB: Pommern, 3/37 vom 1.3.1937. 327 Paul Kaißling, Unter der Willkür der Macht. Erlebnisse eines Zeitzeugen von 1930 bis 1953, Norderstedt 2006, S. 15. 328 Vgl. zum Abschnitt Vogt, Vestische HJ, S. 309; Pahmeyer/Spankeren, Die Hitlerjugend in Lippe, S. 164–179; Sven Steinacker, Der Staat als Erzieher. Jugendpolitik und Jugendfürsorge im Rheinland vom Kaiserreich bis zum Ende des Nazismus, Stuttgart 2006, S. 451 f.; Matthias Thoma, Das Zusammenspiel von Hitlerjugend und Vereinen am Beispiel Eintracht Frankfurt. In: Markwart Herzog (Hg.), Fußball zur Zeit des Nationalsozialismus. Alltag. Medien. Künste. Stars, Stuttgart 2008, S. 39–45, hier 43 f.
Die Eroberung des Alltags
2.3
99
Die Hitlerjugend im Klassenzimmer
Früh titulierten mittlere und höhere HJ-Führer ihre Jugendorganisation als sogenannte Staatsjugend, obwohl mindestens bis Ende Dezember 1936 – also bis zur Einführung des Hitlerjugend-Gesetzes – ihre Stellung im polykratischen Herrschaftsgefüge des „Dritten Reiches“ nicht in Gänze feststand.329 Im Prinzip blieb die Hitlerjugend über die Phase der „Machtergreifung“ hinaus eine Parteiformation, obgleich die RJF mit dem Auftrag zur Erziehung, Schulung und körperlichen Ertüchtigung der gesamten Jugend in Deutschland betraut worden war. Die Hitlerjugend war bemüht, die wichtigsten Bastionen im Alltag junger Menschen zu erobern. Dazu gehörten – neben Betrieben, aus denen es Lehrlinge zu rekrutieren galt – die Schulen. Den NS-Schülerbund hatte die RJF im März 1933 in die Hitlerjugend eingegliedert, um deren Schlagkraft in den Klassen zu erhöhen. Ab Anfang 1934 war es zudem ausschließlich Angehörigen der Hitlerjugend erlaubt, Uniformen oder Abzeichen in der Schule zu tragen.330 Zum „Fest der Jugend“ im Juni 1933 wurden Schülerinnen und Schüler vielfach im Klassenverband den Feiern zugeführt. Häufig bildeten uniformierte Lehrer, die sie begleiteten, die Triebkraft. Primär in Städten, seltener auf dem Land, setzte die Hitlerjugend seit dem Sommer 1933 sogenannte Verbindungsmänner an Volks- und höheren Schulen sowie Berufsschulen ein. Es handelte sich meist um Jugendliche der älteren Jahrgänge, die an ihrer Schule um Mitglieder warben, zur Gründung von Einheiten motivierten oder den Dienststellen – oft unter Missbilligung der Lehrkräfte – die Erfassungszahlen an ihren Schulen mitteilten. Um erfolgreich arbeiten zu können, waren die Verbindungsmänner und HJ-Schuljugendwalter auf die Fürsprache eines Lehrers – der sogenannten Vertrauenslehrer, die oft der SA oder der HJ angehörten – sowie ihrer Schulleitung angewiesen.331 Im BDM versuchte man ab Ende 1933 mit den „Betreuerinnen“ ein weibliches Pendant an höheren Schulen zu etablieren; diese BDM-Führerinnen sollten, so die Münchnerin Lisl Schmidt, die eine enge Zusammenarbeit zwischen Nationalsozialistischem Lehrerbund (NSLB) und BDM anstrebte, „manches alte Schulhaus auf den Kopf“ stellen, Weltanschauung „aufsaugen
329 Friedrich Kemper an sämtliche Bezirksämter des Landes Baden vom 26.9.1933 (StA Freiburg, B719/1, unpag.); sowie „Das dritte Reich ist ein Werk der Jugend“. In: Thüringer Sturmtrupp, Sonderausgabe vom 15./16.8.1933, S. 6. 330 Der Minister des Innern, Erlass Nr. 139088: Hitlerjugend, an die Bezirksämter, die Polizeipräsidien und die Polizeidirektion vom 8.1.1934 (StA Freiburg, B719/1, 5018, Bl. 003146). 331 Zur Tätigkeit der Vertrauenslehrer vgl. Der Magistrat, Schulverwaltung an das Stadtgesundheitsamt vom 26.9.1933 (StadtA Halle, Schulverwaltungsamt, 556, 1). Weitere Materialien zu Vertrauenslehrern überliefert im StA Sigmaringen, Ho 235 T 26–28, 1049. Vgl. außerdem Uwe Schmidt, Hamburger Schulen im „Dritten Reich“, Band 1, Hamburg 2010, S. 418 f.; Wo die „Verbindungsmänner“ und Schuljugendwalter als „Schulführer“ firmieren. Zur Praxis der Einsetzung vgl. Schuljugendwalter an den Berufsschulen. In: GB: Berlin, 14/37 vom 1.10.1937.
100
Genese einer Massenorganisation
und hineintragen in das ganze Schulhaus“.332 Weil die „Betreuerinnen“ weder in der Überlieferung noch im Schrifttum tiefe Spuren hinterlassen haben, darf man davon ausgehen, dass dieser Versuch des BDM nicht von anhaltendem Erfolg gekrönt war. Hinzu kam in späteren Jahren auf der Ebene des HJ-Banns und des Gebiets jeweils ein „Schulbeauftragter“, der zwischen Hitlerjugend, NSLB und Direktoren vermittelte. Er sollte auch den Überblick behalten über sämtliche Schülerinnen und Schüler sowie über den Erfassungsgrad, den die Parteijugend an einzelnen Schulen erreichte.333 Wie wichtig die Lehrerschaft für das Wachstum war, zeigt der Bericht einer unbekannten 12-Jährigen, auf die sich Emigrant Otto Friedländer berief: „Unsere Lehrerin […] sagt immer, dass wir in die HJ eintreten sollen. […] An den Tagen, an denen die Heimabende der HJ sind, fragt sie, wer dort war. Wer nicht da gewesen ist, muss eine schriftliche Entschuldigung mitbringen. Wenn man nicht auf dem Heimabend war und sagt, man war zum Geburtstag, dann sagt die Lehrerin: Die HJ geht vor, und schlägt dabei mit dem Stock auf die Hände oder auf den Hintern. Sie hat einen dünnen Rohrstock, sie schlägt auch mit der Hand auf die Backe.“334 Auf die Lehrerschaft war nicht immer Verlass. Gerade in den ersten Jahren standen sich Schulen und HJ-Führer unversöhnlich gegenüber. Das Klima in den Klassen war vergiftet. Das hatte mit dem aufwieglerischen Impetus zu tun, den die NS-Jugendbewegung vor 1933 bewusst in die Schulen getragen hatte. Im Kern beruhte dies auf einer ideologischen Zuspitzung: Jung sollte sein, wer sich auf der Seite der Hitler-Bewegung schlug; alt war, wer zu den Gegnern gehörte oder das System der Republik repräsentierte. Am ehesten wurden die Klassenzimmer zu jenen Orten, wo man auf die Letzteren traf: „Den Schülern, die sich offen zu Adolf Hitler bekannten, machten sie große Schwierigkeiten“, schrieb ein Kölner Hitlerjunge im Tagebuch über seine Lehrer. Dessen Eltern, obwohl Parteimitglieder, hatten ihm 1930 den Eintritt in die HJ verwehrt, weil sie Nachteile für den Sohn fürchteten. „Aber zum Beitritt war die schriftliche Einwilligung der Eltern nötig, und die bekam ich vorläufig noch nicht. So verging nun das Jahr 1930, ohne dass ich einer dieser braunen Kampfgemeinschaft geworden war. Zwar war das nur äußerlich; denn im Stillen zählte ich mich auch als Hitlerjunge, machte auch dann einen Heimabend der Jungen mit. Ganz verstohlen hatte ich mir ein kleines silbernes Hakenkreuz als Anstecknadel gekauft, das ich […] stolz in der Penne an den Rockaufschlag steckte. Die Schulkameraden sahen es teils freudig, teils aber auch verbissen. Auch die Lehrer entdeckten es und ließen bald durchblicken, dass den Schülern das Tragen jeglicher Abzeichen in der Schule verboten sei. Sie wussten nun, zu welcher 332 Lisl Schmid, Lehrerin und weibliche Hitlerjugend. In: Auguste Reber-Gruber (Hg.), Weibliche Erziehung im NSLB. Vorträge der Ersten Erzieherinnentagung des NSLB in Alexisbad am 1., 2., und 3. Juni 1934, S. 110–119, hier 114. 333 Einsetzung von Schulbeauftragten. In: GB: Saarpfalz, A5/37 vom 15.3.1937; Erfassung der Schulen und Lehranstalten sowie Jahresberichte der Schulen. In: ebd., A7/37 vom 5.5.1937. 334 Bericht zit. nach Friedländer, Deutsche Jugend, unveröffentlichtes Manuskript, S. 46.
Die Eroberung des Alltags
101
Richtung ich gehörte.“335 Die HJ hatte ein großes Aufbegehren versprochen, weit mehr als die bündische Jugendbewegung, die sich zwar gegen die Industriegesellschaft richtete, die aber vielfach Autoritäten und Vertretern der alten Ordnung hörig blieb. Wer zur Hitlerjugend gefunden hatte, war gegen den Staat mitsamt seinen Vertretern aufgestanden, gegen alle Protagonisten der Vergangenheit. Man schien, wie die HJ suggeriert hatte, zu einer jungen Revolutionsbewegung zu stoßen, die ganz Neues begründen und das Alte hinwegfegen wollte. „Wie es Jünglinge unter den Greisen gibt, gibt es Greise in der Jugend“, schrieb Reichsjugendführer Schirach: „Ich habe sie kennengelernt in den Hochschulen, in der Jugendbewegung, überall. Die innerlich alten Menschen sind die Pest für ein gesundes Volk. Sie sind der zähe und erbitterte Widerstand gegen jede neue Idee. […] Nur die gesammelte Kraft einer entflammten Jugend vermag sie zu vernichten.“336 Dieser politisierte Jugendkult war kein Unikum der Hitlerjugend; fast die gesamte Jugendbewegung, was mit den Ideen des Wandervogels, aber ebenso mit Erlebnissen junger Soldaten im Ersten Weltkrieg zu tun hatte, war von jenem Antagonismus getragen, der die gesellschaftliche Wirklichkeit in alte und junge Kräften schied. Doch die HJ hatte das Alte, mehr als andere, auf politische Feindbilder projiziert. Der Zorn des Kölner Hitlerjungen auf die Lehrer brach sich in seinen Aufzeichnungen im Rückblick noch Bahn: „Ich begann nun die Schule zu hassen, die immer ein drückender Hemmschuh meiner Jugendwünsche war.“337 Und der HJ-Führer Franz Schall, der 1932 die Technischen Lehranstalten in Dresden besuchte, warf ein scharfes Auge auf die Dozenten: „Er riecht verdächtig nach Edelkommunist“, notierte er über einen Lehrer, der 1933 in den Ruhestand versetzt wurde.338 Franz Schall stammte selbst aus einer Lehrerfamilie. Sogar den eigenen Vater zählte er zu den verhassten Vertretern der alten Ordnung: „Nein, ich weiß, was Lehrer sind und kenne ihre Weltfremdheit dem Leben des Volkes gegenüber; deshalb wollte ich es ja nicht werden, darum wollte ich ja im Volke schaffen und in ihm groß werden.“339 Die HJ wies ihren Angehörigen beim Aufbau eines angeblich jungen Staates eine bedeutsame Zukunftsrolle zu. „Überall saßen in den verantwortlichen Stellen alte Männer“, lautet es in einem HJ-Schulungsvortrag über die untergegangene Republik: „Männer, die geistig einer versunkenen Welt angehörten und verknöchert, in hilfloser Unbeweglichkeit den Aufgaben der neuen Zeit gegenüberstanden. Es war ein Staat der Schwäche, ein Staat der Verantwortungslosigkeit. […] Es war ein Staat ohne Jugend und damit ein Staat ohne Zukunft.“340 335 Tagebücher von Werner Purrmann, S. 16 (EzG, jugend1918-1945.de; 16.7.2020). 336 Schirach, Idee und Gestalt, S. 18. 337 Purrmann, Tagebücher, S. 30. 338 Postert, Hitlerjunge Schall, S. 214. 339 Ebd., S. 258. 340 Nationalsozialistische Beamten- und Angestellten-Schulung in der Provinz Westfalen (Hg.), 6. Schulungsabend. Aufgaben und Zielsetzung der Hitlerjugend und des BDM. Von Landesreferent Bubenzer, Münster, ohne Ort und o. D., S. 156 f. (Digitalisat: EzG, jugend1918-1945.de; 16.7.2020).
102
Genese einer Massenorganisation
Die Hitlerjugend auf der einen Seite und die Schulen auf der anderen Seite standen nach 1933 nicht per se im Gegensatz zueinander; beiden war die Aufgabe zugewiesen, die Jugend im Sinne des Staates zu erziehen. In die Klassenzimmer drang der Einfluss der Staatsideologie mehr und mehr ein.341 Für ihre Werbeaktionen um neue Mitglieder setzte die Hitlerjugend auf die Schulen. Seit Mitte der 1930er-Jahre fand beispielsweise die Neuaufnahme eines Jahrgangs zum Teil im Klassenverband statt; über die Schulen wurden die 10-Jährigen registriert, erfasst, gemustert und für den Eintritt geworben.342 Doch Konflikte mit Lehrern, wenn sie nicht gerade zur Partei oder SA gehörten – was es in erklecklichem Maße ebenfalls gab –, blieben an der Tagesordnung. Der HJ-Führer Franz Köppe unterstrich noch 1935 öffentlich, dass die Hitlerjugend und die Lehrerschaft in den Weimarer Jahren „zuletzt in offenem Widerspruch“ zueinander gestanden hätten: „Unleugbar ist die Tatsache, dass der größte Teil der deutschen Erzieherwelt zur deutschen Jugend keinen inneren Kontakt mehr hatte.“343 Ein Abkommen, das Schirach mit Bildungsminister Bernhard Rust im August 1933 vereinbarte, befriedete die Konflikte nur bedingt. Hitlerjungen meldeten ihre Lehrer oder Direktoren wegen angeblich gegenrevolutionärer Gesinnung an ihre Vorgesetzten. Kein Einzelfall waren beispielhafte Vorkommnisse an einer Realschule in Pirna, wo die Gestapo Ende 1933 die Beobachtung eines Lehrers betrieb, weil ein Hitlerjunge dessen angeblich „staatsfeindliche“ Äußerungen an seine Hitlerjugend-Dienststelle gemeldet hatte.344 In Kochem in der Pfalz sorgte ein Bannführer der HJ noch 1939 für erhebliche Verärgerung bei einem Teil der Lehrerschaft. Er hatte nämlich öffentlich vor Schülern geäußert, dass Lehrer über 40 Jahren „wegen schon eingetretener Verkalkung“ für eine aktive Zusammenarbeit mit der Hitlerjugend nicht zu gebrauchen wären.345 Die Tätigkeiten der „Verbindungsmänner“, die an den Schulen eigentlich ein gutes Umfeld für das Wachstum der Hitlerjugend sichern sollten, erschöpften sich immer häufiger darin – so der Bericht aus einer Schule in Halle vom Oktober 1934 – „Streitfälle zwischen Klassenleitern und HJ-Führern zu schlichten“.346 In Augsburg meldete ein Gymnasiast und HJ-Unterbannführer im Juni 341 Klönne, Jugend im Dritten Reich, S. 52 f. 342 Vgl. beispielsweise Neuaufnahme des Jahrgangs 1927. In: GB: Saarpfalz, A3/37 vom 15.2.1937. 343 Franz Köppe, Die Hitlerjugend als politisch-soldatische Erziehungsgemeinschaft im neuen Deutschland. In: Die deutsche Schule, (1934) 3, S. 111–133, hier 112; auch bei Hans-Georg Herrlitz, Von der wilhelminischen Nationalerziehung zur demokratischen Bildungsreform. Eine Auswahl aus 90 Jahren „Die deutsche Schule“, Frankfurt a. M. 1987, S. 165–168. 344 Bericht des Geheimen Staatspolizeiamts Sachsen über Studienrat Kluge vom 11.3.1934 (StadtA Pirna, Polizeiamt, B-III-XXX-IX-2658). Zu weiteren Beispielen und Konflikten anhand von Einzelfällen vgl. Lutz van Dick (Hg.), Lehreropposition im NS-Staat. Biographische Berichte über den „aufrechten Gang“, Weinheim 1988. 345 Lagebericht des SD für den Monat Juni 1939 vom 26.6.1939. In: Brommer (Hg.), Die Partei hört mit, Band 1, S. 187–200, hier 193. 346 Bericht über die Zusammenarbeit der Schule und der Hitlerjugend an der Weingärtenschule, 29.10.1934 (StadtA Halle, Schulverwaltungsamt, 556, Bd. 1, Bl. 107).
Die Eroberung des Alltags
103
1934 die angeblich abfälligen Äußerungen seines Religionslehrers Adam Birner. Als katholischer Domprediger war der kein Unbekannter. In dreiwöchiger Haft, die für einige Erregung in der Bevölkerung sorgte, drängte man Birner, sich eine Stelle außerhalb von Augsburg zu suchen.347 Vergleichbare Fälle nahmen an Häufigkeit zu. Auch die Eltern mussten die Schule fürchten: „Das Ganze ist ein einziges Spitzelsystem für die Hitler-Jugend“, befand treffend ein Artikel im „Neuen Vorwärts“ 1935, „denn durch harmlose Kinderaussagen […] können oppositionelle Eltern ins Netz der Gestapo geraten.“348 Ein Jugendroman von 1935, welcher in der „Kampfzeit“ spielte, ermunterte Kinder zur Spitzeltätigkeit – der fiktive junge Nachwuchsspion, der als Held und Vorbild dienen sollte, berichtete für die Bewegung aus der kommunistischen Jugend, in die er eingeschleust worden war.349 Der fiktionale Stoff des Romans war mittlerweile Realität, insbesondere in den Schulen. Speziell vor dem zur Überwachung 1934 gegründeten SRD waren viele Lehrer an höheren Schulen in Sorge. Die Gestapo trat, wie in Offenburg Ende 1939, mitunter Vorwürfen entgegen, solche Hitlerjungen würden „zur Bespitzelung ihrer Lehrerschaft herangezogen“, wobei – die Perfidie der Diktatur offenlegend – man sogleich annahm, dieser Beschwerde liege wohl „ein politisch schlechtes Gewissen“ zugrunde.350 Die Beamten, die immerhin selbst in der Überwachung tätig waren, empfanden die Kritik als „bodenlose Gemeinheit“, die „indirekt die Beamten der hiesigen Außendienststelle treffen“ würde.351 Es war, wie diverse weitere Beispiele zeigen könnten, keine Ausnahme, dass HJ-Angehörige aus ihren Schulen Berichte sandten – an eigene Dienststellen und an die Gestapo.352 Im Gebiet Westfalen unterstrich die HJ-Führung 1941 in aller Offenheit, es sei über alle Fälle, „in denen Eltern oder andere Erzieher – verärgert durch irgendwelche Vorfälle […] – Äußerungen tun, die den Tatbestand der Beleidigung der Hitler-Jugend verwirklichen“ zu berichten, außerdem ein „Vorschlag des zuständigen Bannführers beizufügen, welche Maßnahmen für notwendig gehalten“ würden.353 Noch in anderer Hinsicht entstanden Reibungspunkte, denn Lehrer und Direktoren sahen sich – als Staatsbedienstete und Vertreter des Staates – berechtigt, Beschwerden über HJ-Unterführer einzureichen, die ihre Kameraden gegen die Schule aufzuwiegeln suchten. Das Abkommen von Anfang Juni 1934 sollte die Lage beruhigen und bezweckte ein „fruchtbares Zusammenwirken von 347 Vgl. Kündigung des Reichskonkordats? In: Neues Wiener Journal vom 26.6.1934. Vgl. auch Gerhard Hetzer, Die Industriestadt Augsburg. Eine Sozialgeschichte der Arbeiteropposition. In: Martin Broszat/Elke Fröhlich/Anton Grossmann (Hg.), Bayern in der NS-Zeit, Band III: Herrschaft und Gesellschaft im Konflikt, Teil B, S. 1–234, hier 218 f. 348 Die Schule als Spitzelinstitut. In: Der Neue Vorwärts vom 4.8.1935. 349 Vgl. Franz Glaser, Schar 6. HJ in Kampf und Spionage, Breslau 1935. 350 Gestapo-Leitstelle Karlsruhe an das Kultusministerium vom 6.11.1939 (GLA Karlsruhe, 235, 35688, unpag.). 351 Gestapo Außendienststelle Offenburg an die Gestapo-Leitstelle Karlsruhe vom 4.11.1939 (ebd.). 352 Vgl. beispielhaft Bericht über „Vorfall in der Geschichtsstunde bei Herrn Neumeister“ vom 11.3.1941 (StA Augsburg, HJ-Gebiet Schwaben, 44: SRD: Memmingen). 353 Beleidigung der Hitler-Jugend. In: GB: Westfalen, K18/41 vom 4.9.1941.
104
Genese einer Massenorganisation
Schule, Hitlerjugend und Elternhaus“.354 Die RJF und das Bildungsministerium fanden zu der Übereinkunft: „Der Hitler-Jugend stehen wöchentlich zwei Nachmittage zur freien Verfügung. Von diesen soll der eine mit dem bisher schon aufgabenfreien Nachmittag zusammenfallen, der andere möglichst auf den Sonnabend verlegt werden. […] Eingriffe in die Tätigkeit der Schule von außen her sind verboten. Im Schulleben haben die Schüler den Leitern und Lehrern unbedingt zu gehorchen.“355 Dieser „Staatsjugendtag“ schien Unstimmigkeiten auszuräumen und die Ansprüche beider Seiten miteinander auszusöhnen. In Wahrheit schuf die Regelung wieder neue Konflikte zwischen der Parteijugend und den Bildungsträgern. Wer wollte, konnte nun am Samstag, statt zur Schule zu gehen, sich an den Veranstaltungen der Hitlerjugend beteiligen. Für alle anderen galt regulärer Unterricht. Viele traten der Hitlerjugend bei, denn Sport, Ausflüge, Märsche und andere Aktivitäten zogen sie naturgemäß der Schulpflicht vor. Insofern hatte die RJF – anders als gegenüber den Arbeitgebern, die sich einer Freistellung ihrer Lehrlinge verweigerten – dem Bildungsministerium eine Regelung abgetrotzt, die ihr rasantes Wachstum maßgeblich mitbegründete.356 Aber diese Regelung war ein zweischneidiges Schwert: Propaganda werde für den Staatsjugendtag zwar intensiv getrieben, so ein Berichterstatter für die SPD, der in Westsachsen 1934 die Lage beurteilte: „Trotzdem beteiligen sich nicht alle Schulkinder an ihm.“ Bei den Mädchen seien es in einer Schule in Chemnitz etwa 55 Prozent, im Falle einer anderen Einrichtung allerdings nur etwa 20 Prozent; die Beteiligung der Jungen sei immerhin durchweg größer, nämlich bis zu etwa 60 Prozent.357 Ähnliche Zahlen sind andernorts dokumentiert worden. Der Staatsjugendtag spaltete so manches Klassenzimmer und stellte für Lehrer zweifellos ein Ärgernis dar.358 Die Unterrichtspläne kamen mit der Einführung des Staatsjugendtags durcheinander. Klassen wurden getrennt in Hitlerjugend-Angehörige und Nicht-Mitglieder. Die Unterführer sahen die Regelung außerdem als Ansporn und drängten folglich – ohne, dass es dafür eine Legitimation gegeben hätte – an anderen Tagen ebenfalls auf eine Freistellung der Kameraden. Besonders die HJ- und Jungvolkführer terminierten Veranstaltungen gezielt auf die Unterrichtszeit, da-
354 Rudolf Klein, Staatsjugendtag und körperliche Erziehung durch Hitlerjugend und Schule. In: Deutsches Philologen-Blatt, (1934) 42, S. 454 f.; sowie o. V., Zum Staats jugendtag. In: ebd., S. 455 f. Vgl. Michael H. Kater, Hitlerjugend und Schulen im Dritten Reich. In: Historische Zeitschrift, (1979) 228, S. 572–623. 355 Der Preußische Minister für Wissenschaft und Volksbildung vom 26.8.1933 (GLA Karlsruhe, 235, 35688, unpag.). Vgl. auch Abkommen zwischen dem Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung Bernhard Rust und dem Reichsjugendführer Baldur von Schirach zur Einführung des Staatsjugendtages vom 7.6.1934. In: Jahnke (Hg.), Eine Dokumentation, S. 75 f. 356 Vgl. umfangreicher Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 857. 357 Bericht aus Westsachsen, A 58. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 1 (1934), S. 560. 358 Vgl. als Beispiel Berthold Michael, Schule und Erziehung im Griff des totalitären Staates. Die Göttinger Schulen in der nationalsozialistischen Zeit von 1933 bis 1945, Göttingen 1994, S. 16 f.
Die Eroberung des Alltags
105
bei die Staatsmacht auf ihrer Seite wähnend. Lehrkräfte meinten, dass die schulischen Leistungen durch die Beanspruchung der Hitlerjugend zunehmend litten. Und Eltern verliehen ihren Bedenken Ausdruck. Die HJ-Führerschaft gestand ein: „Manche Lehrer schimpfen augenblicklich gar sehr darüber, dass bei den Hitlerjungen die Schularbeiten nachlassen“, hieß es in einer Jugendzeitschrift Anfang 1934: „Diese Tatsache als solche lässt sich auch nicht wegleugnen. Aber man muss doch zugestehen, dass im Jahre 1933 eben eine neue Zeit begonnen hat, die neue Jahrhunderte einleiten wird. Und nach hundert Jahren wird es sicher nicht registriert sein, dass sich Grießgram […] fürchterlich geärgert hat, weil ein Teil seiner Schüler während der Tage der deutschen Erneuerung 1933 vor lauter Freude die Schularbeiten vergessen hat.“359 Die Hitlerjugend schuf über die unmittelbare Phase nach 1933 hinaus ein dauerndes Konfliktpotenzial im Klassenzimmer.360 Noch in der späten Kriegsphase gebärdeten sich junge HJ-Unterführer nicht nur vereinzelt als Gegner der Schulen. Manche setzten Fahrten oder Dienste zur Unterrichtszeit an und handelten sich Tadel ihrer höheren Dienststellen ein.361 Der Staatsjugendtag, als „Staatsbummeltag“ bei Kritikern, Lehrern und einem Gutteil der Eltern verschrien, wurde 1936 wieder abgeschafft.362 Nun bekam ein Erlass des Reichserziehungsministeriums vom August 1933 neue Gültigkeit; anfangs war dieser Erlass nur als Übergangslösung gedacht gewesen. Demnach standen der Hitlerjugend nun zwei Nachmittage in der Woche zur Verfügung. Samstags waren die Schulen angehalten, nach der sechsten Stunde zu enden; sofern der Lehrplan es erlaubte, bevorzugt früher. Der Staatsjugendtag hatte mehr Querelen beschert, als dass er Unstimmigkeiten beseitigt hätte.363 Man kehrte also zu einer Regelung zurück, die – zumindest vorerst – die Schulen gegenüber der Hitlerjugend absicherten.
359 Zum Problem Jugend und Lehrerschaft. Ein Junge und ein Lehrer sagen ihre Meinung. In: Der Thüringer Sturmtrupp, (1934) 1, S. 3. 360 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 2, S. 852–865. 361 Vgl. beispielhaft Beurlaubungen von HJ-Angehörigen während der Schulzeit. In: GB: Franken, 6/43 vom 8.1943: „Ich habe wiederholt darauf hingewiesen, dass es vollkommen ausgeschlossen ist, dass Schüler ohne Beurlaubung dem Unterricht fernbleiben. Es sind nunmehr trotzdem wieder Fälle vorgekommen, bei denen die Führer der Fähnlein und Gefolgschaften Hitlerjungen während der Schulzeit eingesetzt haben […]. In einem Fall blieb ein Junge einfach von der Schule weg mit der Begründung, dass er auf Fahrt gehen müsse. […] Notwendigenfalls werde ich die Einheitenführer, die diese Anordnung unverantwortlicherweise nicht einhalten und damit die Zusammenarbeit mit der Schule bewusst stören, disziplinarisch zur Rechenschaft ziehen müssen.“ 362 Lagebericht der Staatspolizeistelle Potsdam für Mai 1935, o. D. In: Wolfgang Ribbe (Hg.), Die Lageberichte der Geheimen Staatspolizei über die Provinz Brandenburg und die Reichshauptstadt Berlin 1933 bis 1936, Teilband 1: Potsdam, Köln 1998, S. 261– 271, hier 271. 363 Vgl. Schreiben des Beauftragten für Schulfragen. In: GB: Mittelelbe, 3/37 vom 18.2.1937.
106 2.4
Genese einer Massenorganisation
Schule: Bastion der Hitlerjugend?
Wie sich die Hitlerjugend an Schulen entwickelte, hing im Einzelfall von der Bereitwilligkeit und politischen Einstellung der Lehrkräfte oder der Schulleitung ab. Dort, wo regimetreue Lehrer und Parteigenossen den Unterricht gestalteten, fand die Parteijugend mit ihren sogenannten Schuljugendwaltern und Verbindungsmännern in der Regel gute Bedingungen vor. Noch bis in die 1930er-Jahre hinein wurden, genauso wie in der Endphase der Republik, etliche Einheiten aus den Klassenzimmern heraus gegründet. Für die HJ besaßen die Gymnasien zentrale Bedeutung. Das Gros der ehrenamtlichen Unterführer in mittleren Positionen rekrutierte sich aus Schülern und nicht – wie die Propaganda behauptete – aus sogenannten Jungarbeitern und Lehrlingen. Je höher der HJ-Rang, desto weniger Lehrlinge waren vertreten.364 Volksschulen und höhere Schulen, nicht Betriebe, bildeten den primären Rekrutierungsort. Manchmal, wie in Kempen am Niederrhein, wo es an Unterführern fehlte, rekrutierte man aus der Lehrerschaft für Leitungsfunktionen.365 Fehlte solche Unterstützung, dann blieben die Erfolge zunächst überschaubar. Lehrer und Lehrerinnen mit Hitlerjugend-Mitgliedschaft waren kein Massenphänomen. Im ländlichen Kreis Bernburg zum Beispiel verfügte man Anfang 1936 an allen Volks- und Mittelschulen über lediglich 11 Lehrerinnen und Lehrer, die sich für die Parteijugend unmittelbar engagierten.366 Regional und vor Ort konnte die Mitgliederstärke an verschiedenen Schulen in völlig abweichende Richtungen weisen. Das Volksbildungsministerium wies 1935 erstmalig die Erhebung von Daten in allen Schulen Deutschlands an.367 Die RJF gewann ein Lagebild über das Wachstum der Hitlerjugend, obgleich staatliche Stellen vor Ort diese Datenerhebung anfangs zum Teil missbilligten und manche Gemeinde die Schulleitungen gegen Einflussnahme durch die Hitlerjugend von außen noch abzusichern suchte.368 364 Vgl. beispielhaft die statistische Aufstellung über die Zusammensetzung der Führerschaft im Gebiet Kurmark (Brandenburg). In: BB: Kurmark, 12/36 vom 24.6.1936. Insgesamt besaß das Gebiet 12 000 Unterführer; vom Rang des Gefolgschaftsführers aufwärts lag der Anteil der „Jungarbeiter“ in der HJ bei nur 27 % und im DJ ab Fähnleinführer bei nur 25 %. Die niederen Ränge waren demgegenüber ganz überwiegend von „Jungarbeitern“ besetzt. 365 Vgl. Hans Kaiser, Kempen unterm Hakenkreuz, Band 1. Eine niederrheinische Kreisstadt im Nationalsozialismus, Viersen 2013, S. 310–315. 366 Vgl. Aufstellung über Lehrerinnen und Lehrer sowie über Schülerinnen und Schüler in- und außerhalb der Hitlerjugend, Stand 15.2.1936, vom 24.2.1936 (LHASA, DE, KB BBG, 1487, Bl. 163 f.). 367 Erlass des Staatsministeriums für Unterricht und Kultur vom 31.1.1935, Nr. III 4088 zur Feststellung der Stärke der Hitler-Jugend an höheren Unterrichtsanstalten und Volksund Berufsschulen. In: Regierungsanzeiger vom 4.2.1935; sowie Ministerieller Erlass Nr. VIII 33/190 vom 4.7.1934. Ebd. 368 Vgl. z. B. Stellungnahme des Regierungspräsidenten Merseburg vom 26.11.1935: Ich teile „Ihnen mit, dass ich es nicht für gängig halte, dass dem HJ-Jugendwalter einer Schulgemeinde Angaben über die Zugehörigkeit der Schüler zur Hitler-Jugend gemacht werden. […] Außerdem sind die Schüler nicht verpflichtet, den Grund ihres Nichteintritts anzugeben. Danach ersuche ich, das Ansinnen des betreffenden Jugendwalters mit entsprechender Begründung zurückzuweisen.“ (StadtA Halle, Schulverwaltungsamt, 556, Bd. 1, Bl. 64).
Die Eroberung des Alltags
107
Verschiedene Studien haben in unterschiedlichem Zusammenhang auf diese Tatsache hingewiesen: An einigen Schulen warb die Hitlerjugend nach 1933 überaus erfolgreich um neue Mitglieder, an wieder anderen hatte sie vergleichsweise wenig Neueintritte von Mädchen und Jungen vorzuweisen. Typisch der für die Hitlerjugend positive Bericht einer Schule auf dem sächsischen Land, wo es 1935 über 131 Schülerinnen und Schüler hieß: „Von den Mädchen gehörten […] alle den Jungmädchen, von den Knaben nur 2 nicht dem Jungvolke an. Zwischen Schule und Hitlerjugend besteht gutes Einvernehmen.“369 Nicht selten, dass einzelne Volksschulen zwei Jahre nach der „Machtergreifung“ e inen Erfassungsgrad von 80 bis 100 Prozent durch die Parteijugend meldeten. Aus einer Schule im sächsischen Kamenz lautete es im Mai 1936, dass in den entsprechenden Jahrgängen lediglich neun Schüler nicht organisiert seien.370 Nur wenige Kilometer oder einen Landstrich entfernt konnte die Lage für die Hitlerjugend schon ganz anders aussehen.371 In Bernburg gehörten 1936 von 3 137 Schülern 883 nicht in der Hitlerjugend an. Im Falle der Mädchen standen den 2 623 Mitgliedern 1 286 Nichtorganisierte gegenüber. Auch hier meldeten einzelne Schulen eine nahezu vollständige Erfassung.372 Aus Halle meldete eine Schule für Mädchen im Herbst 1935, dass rund die Hälfte der 414 Schülerinnen im BDM erfasst sei; jene, die außerhalb stünden, führten Überbelastung, mangelnde Qualitäten des BDM-Personals oder Bedenken der eigenen Eltern als Gründe an.373 Für das ländliche Kempten in Oberbayern, einem Bezirk von überschaubarer Größe, ist das Aktenmaterial faszinierend umfangreich überliefert. In Kempten variierten die Erfassungsquoten an verschiedenen Volksschulen zwischen sechs im niedrigsten und 80 Prozent im höchsten Fall. Von 5 724 Schülerinnen und Schülern, die aufgrund ihres Alters für die Parteijugendmitgliedschaft infrage kamen, war im Oktober 1934 immerhin schon fast ein Drittel erfasst. Insgesamt konnte man diese Tatsache als großen Erfolg werten. In manch einer Schule war die Hitlerjugend jedoch so gut wie nicht präsent, was das Bild erheblich trübte. Die Schulleitung aus Kreuthal beispielsweise meldete, dass sieben ihrer 113 Schüler der HJ und zehn dem Jungvolk angehörten, womit diese kleine Dorfschule das absolute Schlusslicht bildete.374 369 Jahresbericht der Volksschule zu Hinterhermsdorf für die Zeit vom 1.4.1935 –31.3.1936 vom 18.4.1936 (KreisA Pirna, Best. Hinterhermsdorf, 158: Schulungsangelegenheiten, unpag.). 370 Vgl. Fragebogen für Höhere Schulen, ausgefüllt für die Lessingschule in Kamenz, Stand 15.5.1936 (StadtA Kamenz, A4/2, 689, Bl. 1–3). 371 Neben im Folgenden erläuterten Beispielen vgl. u. a. auch die statistische Erfassung zur „Ermittlung der Stärke der Hitlerjugend an den Schulen“ bis 1936 (StA Leipzig, 20192, 0042, 01.07). 372 Vgl. Aufstellung über Lehrerinnen und Lehrer sowie über Schülerinnen und Schüler in- und außerhalb der Hitlerjugend, Stand 15.2.1936, vom 24.2.1936 (LHASA, DE, KB BBG, 1487, Bl. 163 f.). 373 Vgl. Bericht der Helene-Lange-Schule Halle, betreffend Schule und BDM, an den Oberpräsidenten der Provinz Sachsen, Schulwesen, vom 11.9.1935 (StadtA Halle, Schulverwaltungsamt, 556, Bd. 1, Bl. 141). 374 Vgl. Meldung über die Stärke der Hitlerjugend im Bezirk Kempten vom 18.10.1934 (StA Augsburg, Bezirksamt Kempten, 221, 1, Bl. 1–2); sowie weitere Dokumente aus
108
Genese einer Massenorganisation
Zwar konnten die Zahlen bis 1936 an allen Volksschulen des Bezirks eträchtlich gesteigert werden; was, wie in Deutschland insgesamt, viel mit b gestiegenem Anpassungsdruck zu tun hatte sowie wohl auch damit, dass man widerspenstige Lehrkräfte in den Ruhestand schickte. Aber von einer lückenlosen Erfassung aller Schülerinnen und Schüler berichteten Ende 1936 nur eine Handvoll der 62 Schulen; einzelne, besonders im ländlichen Raum, lagen deutlich unter dem Durchschnitt.375 Die Spannbreite zeigte sich nicht allein im Bezirk Kempten, sondern überall in Bayern. Auf Landesebene existierten regional ebenfalls erhebliche Unterschiede. Bei der Erfassung an Volksschulen lag im Schuljahr 1934/35 Unterfranken vorn. Dort gehörten rund 57 Prozent der Kinder der Hitlerjugend an. Bemerkenswert: Je weiter man in den Süden gelangte, desto mehr nahm die Kraft der Parteijugend ab. In Ober- und Mittelfranken lag der Erfassungsgrad an Volksschulen bei 48,5 Prozent, in Niederbayern und der Oberpfalz bei 36,5 und in Schwaben bei lediglich rund 31 Prozent. Oberbayern ganz im Süden stemmte sich dem Trend nur dank der Hauptstadt München entgegen: Dort konnte die Parteijugend etwa 37,5 Prozent der Volksschülerinnen und Volksschüler gewinnen. In München selbst hatte sie bei rund 27 100 Personen ab 10 Jahren einen Erfassungsgrad von rund 43 Prozent vorzuweisen.376 Regionale Differenzen konnten teils erheblich ausfallen. Dies lässt sich zum Teil mit herkömmlichen Deutungsmustern erklären: Die Bindekraft der Religion und damit die konfessionelle Ausrichtung der Schulen spielten eine Rolle. Auch waren die Möglichkeiten für die Hitlerjugend auf dem Land und in Dörfern anders gelagert als in der Stadt. In ländlichen Gebieten war die Hitlerjugend zwar nicht grundsätzlich schlechter aufgestellt. Dort gab es jedoch überwiegend nur das Extrem: Entweder wuchs die Parteijugend in wenigen Jahren zur vollen Stärke heran oder ihre Strukturen blieben über lange Zeit schwach. „Durch das Fehlen eines ausgesprochenen Industriearbeiterstandes“, begründete die Hitlerjugend-Führung in Bayern dies rückblickend, „war die marxistische Zersetzung vielleicht nicht so stark wie in anderen Teilen des Reiches. Dafür stand der Gegner im Lager der politisierenden Kirche.“ Das Landvolk im Süden, das an den Traditionen und eigenem Brauchtum festhalte, habe mit einer „gewissen Vorsicht und Bedächtigkeit“ dem neuen Staat anfangs gegenübergestanden.377 Pauschal und sicherlich nicht für jeden Einzelfall zutreffend, hatte die HJ-Führung das Problem gerade im ländlichen Raum doch treffend beschrieben. Viel hing daran, wie sich die Repräsentanten der Hitlerjugend jeweils verhielten und ob sie in Zusammenarbeit mit Lehrkräften ein gutes Umfeld sichern konnten. einzelnen Schulen, u. a. zum Stand 1.2.1935 (Ebd., Bl. 7–9); 1.7.1935 (Ebd., Bl. 11–13), 1.10.1935 (Ebd., Bl. 14–16). 375 Übersicht über die der Hitlerjugend und dem Bund Deutscher Mädel angehörenden Schüler und Schülerinnen der Volksschulen im Amtsbezirk im 2. Drittel des Schuljahres 1936/1937 vom 22.10.1936 (ebd., unpag.). 376 Zu den Zahlen in Bayern insgesamt vgl. die Aufstellung über die Stärke der Hitlerjugend an den Volks- und Berufsschulen in Bayern, Schuljahr 1934/35, o. D., S. 1–24 (ebd.). 377 Hitlerjugend. Gebiet Hochland (Hg.), Unser Hochland, München 1939, S. 15 f.
Die Eroberung des Alltags
109
Die Tore von katholischen Missions- und Klosterschulen, konservative Bastionen der Geistlichkeit, blieben für die Hitlerjugend bezeichnenderweise verschlossen. Dort zählten DJ- und HJ-Mitglieder stets zur verschwindend kleinen Minderheit, sofern es sie überhaupt gab. Im ersten Kriegsjahr wurden die Missions- und Klosterschulen geschlossen.378 Die Rückblende von Hans Benders erscheint vor diesem Hintergrund als durchaus glaubwürdig. Der 1919 Geborene besuchte bis 1935 eine kleine Pallottiner-Klosterschule in Bruchsal: „Kein Radio war aufgestellt. Kein Großlautsprecher übertrug Reden oder Marsch musik. Keine Zeitung lag aus. Im Unterricht gab es keine Indoktrination.“379 Bis zum Ende seiner Schulzeit war er nach eigener Aussage vom Werben, Treiben und Anpassungsdruck der Hitlerjugend völlig unberührt geblieben. In den Metropolen sah die Lage für die Hitlerjugend insgesamt besser aus. In Hamburg hatte sie 1936 an einzelnen Schulen zwischen 50 bis 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler erreicht. Auch dort existierten allerdings Institutionen, wo sie nur schwer Fuß fasste; an den Schulen für Mädchen, an katholischen Einrichtungen sowie in einzelnen Berufsschulen, wo bis Juni 1935 nicht einmal die Hälfte den Weg zur Hitlerjugend gefunden hatte, lagen die Erfassungsraten unter dem Durchschnitt.380 In Stadtteilen und Orten mit vormals hoher Bindungskraft der KPD und SPD stieß die Hitlerjugend zu Beginn ebenfalls auf W iderstände. In Essen stellte die Hitlerjugend im Herbst 1935 durch eine Erhebung „die betrübliche Tatsache“ fest, dass „ein großer Prozentsatz von Schülerinnen der höheren Mädchenschulen […] nicht dem BDM“ angehörten.381 Die Eroberung des schulischen Raums war umso wichtiger. Das fing im Kleinen an. Das Oberpräsidium in Berlin erlaubte der Hitlerjugend im Dezember 1934, jeden Samstag die Turnhallen der Schulen nutzen zu dürfen; einige Einrichtungen hatten sich über Monate hinweg der Nutzung ihrer Räumlichkeiten durch die Parteijugend verweigert.382 Mit einer Vielzahl ähnlicher Maßnahmen eroberten Hitlerjugend-Führer nach und nach die Schulen. Einige Beispiele: Der NSLB ordnete 1934 an, dass Lehrkräfte im Unterricht Werbung für einen Eintritt in die Hitlerjugend zu treiben hätten. Materialien und Broschüren mussten ausgeteilt werden. In Sachsen verfügte das Bildungsministerium 1935, dass sämtliche Schulen eine Unterrichtsstunde aufzuwenden hätten, um die Werbeaktionen der Hitlerjugend zu flankieren. Ein Jahr später wurde der Besuch von Ausstellungen, mit welchen die Parteijugend ihre eigenen Freizeitangebote be378 Vgl. Holger Gast/Antonia Leugers/August H. Leugers-Scherzberg/Uwe Sandfuchs, Katholische Missionsschulen in Deutschland 1887–1940, Bad Heilbrunn 2013, S. 41–51. 379 Hans Bender, Willst Du nicht beitreten? In: Marcel Reich-Ranicki (Hg.), Meine Schulzeit im Dritten Reich. Erinnerungen deutscher Schriftsteller, Köln 1982, S. 31–39, hier 33. 380 Vgl. Schmidt, Hamburger Schulen, S. 426 f.; Kater, Hitler-Jugend, S. 25. 381 Gesamtübersicht der Gestapostelle Düsseldorf für September 1935 vom 5.10.1935. In: Faust/Rusinek/Dietz (Hg.), Lageberichte rheinischer Gestapostellen, Band II/2, S. 996–1042, hier 1041. 382 Vgl. Benutzung der Turnhallen am Staatsjugendtag. In: BB: Berlin, 69/34 vom 21.12.1934.
110
Genese einer Massenorganisation
warb, für Volksschulklassen verbindlich angeordnet.383 Im Widerspruch zum Selbstführungsprinzip, das die Organisation hochhielt, rekrutierte man außerdem immer mehr junge Lehrer, die als HJ- oder Jungvolkführer fungieren sollten. Rund 11 200 Lehrer standen 1939, mehr oder minder motiviert, im Dienst der Organisation. Unter den Unterführern stellten die Lehrkräfte damit zwar nur eine kleine Minderheit, aber im Einzelfall konnten sie von entscheidender Bedeutung für das Wachstum sein. Konflikte mit den Schulen blieben, wie erwähnt, zwar oft weiter bestehen, doch die Hitlerjugend drang in den Alltag der Klassenzimmer erfolgreich ein. Bildungsminister Rust, auf den viele Lehrende in Hinblick auf eine Verteidigung ihrer Autorität anfangs Hoffnungen gesetzt hatten, kapitulierte in den Kriegsjahren vor der RJF vollends.384 „Die Hitler-Jugend und Schule sind eins“, so lautete ein Bericht an die Exil-SPD aus Bayern schon 1937: „Bei uns in Bayern gibt es noch aus früherer Zeit die sogenannten Schulsitzungen. Es sind Sitzungen des Schulausschusses, zu denen die Eltern geladen werden. Auf diesen Schulausschuss-Sitzungen werden auch die Klagen der Hitler-Jugend über die Nichtbeteiligung von Kindern an ihren Veranstaltungen behandelt und es werden dann Strafen gegen die Schüler […] verhängt.“385 Ein fast unmögliches Unterfangen, jene riesige Masse an Zeitzeugenberichten zu sichten, die von der Gleichschaltung des schulischen Alltags erzählen. Oft heißt es, alle Schülerinnen und Schüler seien gleichermaßen Mitglied der Jugendorganisation gewesen. „Natürlich waren wir alle uniformiert“, erzählte Hannes Bienert, geboren 1928, über seine Schulzeit im Ruhrgebiet: „Wenn man mit Uniform in die Schule musste, kontrollierte der Lehrer, der auch organisiert war, […] erst einmal die Schulklasse. Wir mussten einzeln im Korridor antreten und dann marschierten wir gruppenweise im Gleichschritt auf den Schulhof.“386 Typischerweise schildern derartige Rückblenden, die subjektiv richtig sein und im Einzelfall die Wahrheit treffen mögen: „Es waren alle drin. Und so anfechtbar das klingt, man hat sich eigentlich gar nicht überlegt, dass mans auch anders machen kann.“387 Je nach Zeitraum, auf die solche Berichte bezogen sind, gilt es aber die Situation zu bedenken: Bis 1936 existierten noch Möglichkeiten, sich der Hitlerjugend zu entziehen, danach wurden die Freiräume auch in den Schulen enger. Im Kleinen des Alltags blieben sie auch dann noch vorhanden, wie eine Klage des Führerkorps in Brandenburg zeigt, das 1939 darüber berichtete, dass HJ-Mitglieder bei Abiturfeiern die Kleidungsvorschriften nicht einhielten, verbotene Schülermützen trugen sowie „unsinnige und überlebte studentische“
383 Ministerium für Volksbildung an die Bezirksschulämter und die höheren Schulen vom 21.4.1936 (StadtA Kamenz, A4, 2, 689, Bl. 14). 384 Vgl. Kater, Hitlerjugend und Schule, S. 605 und 617–625.; Konzeption einer Großwerbeaktion der Hitler-Jugend Sachsen, o. D., S. 16 (StadtA Plauen, Sondersammlung, 68). 385 Bericht zit. nach Friedländer, Deutsche Jugend, unveröffentlichtes Manuskript, S. 211. 386 Erinnerungsbericht von Hannes Bienert, geboren 1928 (DHM, Lebendiges Museum Online). 387 Zit. aus einem Zeitzeugenbericht bei Heidi Rosenbaum, „Und trotzdem war’s ne schöne Zeit“. Kinderalltag im Nationalsozialismus, Frankfurt a. M. 2014, S. 160.
Die Eroberung des Alltags
111
Rituale pflegten.388 Nicht alle Schulen waren gleichermaßen Bastionen der Partei- und Staatsjugend. „Die Schulkameraden haben mich so lange bekniet, bis sie mich mit hatten“, meinte Georg Köpper, geboren in Nienhagen 1924. Von den sozialistischen Falken, die seit 1933 verboten waren, kam er schließlich zur Hitlerjugend. Das Jungvolk habe er aber als beengend empfunden. Das dauernde Exerzieren sei nicht seine Sache gewesen und zum Dienst sei er am Ende nicht mehr gegangen; lieber habe er Ausflüge auf dem Fahrrad mit den Geschwistern und Freunden unternommen. Eine Uniform hätten ihm die Eltern wahrscheinlich bis zuletzt nicht gekauft. Er habe zumindest keine Erinnerungen an eine eigene Uniform. Weder seine Schulkameraden noch die Lehrer hätten ihn zum Erscheinen beim Jungvolk weiter aufgefordert.389 Solche Erinnerungsberichte, von denen es ebenfalls nicht wenige gibt, unterstreichen: Was der Hitlerjugend aus den Schulen an Erfassungsquoten gemeldet wurde, besagt nur wenig darüber, wie sich die neuen Mitglieder im Alltag verhielten. Aus einer unbekannten Schule in Chemnitz wurde der Gestapo 1935 berichtet, dort würden Schüler „Heil Moskau“ an die Toilettenwände schmieren oder Sprüche wie: „Der Kampf geht weiter […] mit Kreide und Scheiße.“390 Wer durch alte Fotoalben blättert, darin Bilder der Schulklassen findet, sieht sie in oft erklecklicher Zahl: jene, die selbst Ende des Jahrzehnts keine Uniform tragen, die zur Feierlichkeit oder bei schulischen Ausflügen in Zivil erscheinen. Nicht alle Schulräume hatte man vollends erobert; und dort, wo die Hitlerjugend die breite Mehrheit gewann, konnte es doch auch Einzelgänger, Desinteressierte und Passive geben. Das soll nicht heißen, dass der Nationalsozialismus nicht auch auf sie Einfluss ausübte; zumal die Lehrpläne immer mehr von Ideologie durchdrungen waren. Der erwähnte Hans Bender, der nach dem Besuch der Klosterschule 1935 auf ein Internat gewechselt war, hat das im Rückblick betont. Für die Hitlerjugend habe er keine Sympathien übrig gehabt, was aber nicht von politischer Urteilsfähigkeit herrührte: „Ein Teil der Schüler gehörte dem ‚Jungvolk‘ und der ‚Hitlerjugend‘ an; mehr Schüler der Realabteilung als der humanistischen Gymnasialabteilung. […] Da gab es Aufmärsche, wenn die Fähnlein oder die Banne zusammenkamen; Trommeln wurden geschlagen, Fanfaren geblasen, Gedichte und Kantaten rezitiert und Sonnenwendfeuer abgebrannt. […] Gab es Spannungen zwischen den organisierten und nicht-organisierten Schülern? Feindschaft zwischen den geistlichen Herren und den Schülern, die als Anführer sich hervortaten? Ich glaube nicht. Die Schulleitung passte sich an. […] Auch wir, Heinz und ich, die sich gern absonderten, die nicht […] sich gewinnen ließen, waren infiziert von den Bazillen, die umherflogen. Wir bockten auf […] und verachteten die Nazi-Barden und waren doch fast der gleichen Meinung wie die Mehrheit.“391 Wer nicht zur Hitlerjugend gestoßen war, gleich aus welchen Gründen, war nicht gegen ideologischen Einfluss immun. 388 Vgl. Abiturientenfeiern. In: GB: Kurmark, A1/39 vom 15.1.1939. 389 Interview mit Georg Köpper (NSDOK Köln, EzG, jugend 1918–1945.de; 16.7.2020). 390 Tagesrapport Nr. 8 der Gestapo Chemnitz vom 7.2.1938 (BArch Berlin, R58, 3733, Bl. 42). 391 Bender, Willst Du nicht beitreten?, S. 37 f.
112
Genese einer Massenorganisation
Erinnerungen an das Dasein als nicht-organisierter Außenseiter sind in der Nachkriegszeit, teils heute noch, nicht ausreichend ernstgenommen worden. Sie widersprachen dem Bild, das man sich von der vermeintlich allumfassenden Parteijugend machte. „In meiner Schulklasse trugen mittlerweile zwei Drittel aller Jungs die Jungvolk-Uniform“, berichtete Günter Lucks, der als Kind einer Arbeiterfamilie bis 1938 weder das Geld für die Kluft noch die Erlaubnis seines Vaters zum Eintritt in die Hitlerjugend erhalten hatte: „In meiner Wahrnehmung bildeten sie eine Art elitären Kreis, dem ich nicht angehörte. Das tat weh.“392 Hans-Jürgen Bersch, geboren 1925 in Hamburg an der Elbe, berichtete: „Gleichwohl gab es an allen mir bekannten Schulen immer eine kleine Zahl Schüler, die – kerngesund – nie der HJ beigetreten sind. Ich sehe […] vor mir auf dem Hof der Thomasschule die beiden Brüder J., ihr Vater im Schülerverzeichnis als Kaufmann ausgewiesen, die nach ihrer Konfirmation […] in Anzügen zur Schule gingen und besonders an Tagen mit Uniformzwang geradezu ins Auge stachen – ein Bild, das man nie vergisst.“393 Neben den Nicht-Organisierten habe es noch eine Reihe junger Menschen gegeben, die erfasst gewesen seien, dennoch nur auf dem Papier der Parteijugend angehörten. Seine Ehefrau, die in den Kriegsjahren eine Mädchenoberschule in Hamburg besucht hatte und ebenso einige ihrer Mitschülerinnen seien zwar formale Mitglieder gewesen, hätten aber keinen Dienst bei Jungmädeln oder im BDM geleistet: „Kein einziges Mal kam es auch nur zu einer ‚amtlichen‘ Nachfrage, geschweige denn zu seiner geharnischten Aufforderung, endlich zum BDM-Dienst zu erscheinen.“394 Der Wahrheitsgehalt solcher Schilderungen lässt sich im Einzelfall natürlich kaum überprüfen. Skepsis ist angebracht. Niemand habe ihm etwas getan, erinnerte sich Konrad Happe, geboren 1926 in Paderborn. Er sei, anders als die Mehrheit seiner Schulfreunde, zur Mitte der 1930er-Jahre nicht im Jungvolk gewesen. Stattdessen habe er sich in der Freizeit im Rahmen der katholischen Kirche engagiert. Bedrängt worden sei er deshalb in der Schule aber nicht. Lehrer hätten keinen Druck ausgeübt. Erstaunlich, weil – wie Happe richtig erinnerte – „die Lehrer […] irgendwie Vollzugsmeldungen machen [mussten], dass der weitaus größte Teil im Jungvolk oder in der Hitler-Jugend sei“.395 Staat, RJF und Hitlerjugend-Dienststellen übten nicht nur Druck aus. Man schuf mit Symbolik zugleich Anreize: Wo mehr als 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler erfasst waren, durfte beispielsweise die Hakenkreuzflagge gehisst werden.396 Es lag im
392 Günter Lucks/Harald Stutte, Der rote Hitlerjunge. Meine Kindheit zwischen Kom munismus und Hakenkreuz, Hamburg 2015, S. 118. 393 Hans-Jürgen Bersch, interviewt von Jonas Röhler. In: Schulmuseum – Werkstatt für Schulgeschichte Leipzig (Hg.), Kinder in Uniform. Generationen im Gespräch über Kindheit und Jugend in zwei deutschen Diktaturen, Leipzig 2008, S. 66–83, hier 71. 394 Ebd. 395 Aussage von Konrad Happe. In: Gehling /Gehling /Hofmann /Nickel /Rüther (Hg.), Paderborner Zeitzeugen berichten, S. 47. 396 Vgl. hierzu und zum gesamten Themenkomplex Steinacker, Der Staat als Erzieher, S. 453 f.
Von der Bewegung zum Apparat
113
Interesse der Schulleitungen, dass sie gute Zahlen meldeten, selbst wenn der Alltag anders aussah, als die Zahlen es suggerierten. Die Erfassungsquoten wurden nur noch in einem kurzen Zeitraum, nämlich bis Ende 1936 an allen Schulen in Deutschland erhoben.397 Danach bricht die archivalische Überlieferung abrupt ab. Der Grund ist leicht auszumachen: Mit dem Hitlerjugend-Gesetz vom 1. Dezember 1936 wurde die Sammlung dieser Daten obsolet und galt obendrein als nicht mehr opportun. Das Gesetz schrieb wahrheitswidrig fest, dass die „gesamte Jugend innerhalb des Reichsgebietes […] in der Hitlerjugend zusammengefasst“ sei.398 Zahlen, die daran Zweifel hätten nähren können, wollte man nicht mehr erheben. In der Hitlerjugend wurde jetzt mit Statistiken ebenfalls sehr sparsam umgegangen. Jenseits der Parteijugend durften die Erfassungs- oder Stärkezahlen ohnehin seit Längerem nicht weitergegeben werden.399 In Bayern wies man die Ämter unverzüglich an, die Ermittlung der Erfassungsquoten einzustellen. Im Bezirk Kempten, für welchen die Sammelwut lückenlos überliefert ist, wurden die Schulen am 21. Dezember über die neue Lage informiert: „Nachdem durch das Gesetz […] die gesamte Jugend innerhalb des Reichsgebietes in der Hitler-Jugend zusammengefasst wurde, haben die Schulen die bisher vorgeschriebenen Meldungen über die Stärke der Hitler-Jugend nicht mehr zu erstatten.“ Die auf 10. Oktober, 10. Februar und 10. Juli jeden Jahres vorgemerkten Termine seien zu streichen.400 Das Gesetz ersparte in naher Zukunft den Blick auf die widersprüchliche Realität.
3.
Von der Bewegung zum Apparat
3.1
Organisatorische Herausforderungen
Die Hitlerjugend war durch die Gleichschaltung in rasender Geschwindigkeit zur Massenorganisation herangewachsen: Ende 1933 gehörten ihr rund 1,7 Millionen männliche Kinder und Jugendliche sowie 593 000 weibliche an.401 Die Revolution in dauerhafte und übersichtliche Strukturen zu überführen musste ein Kernanliegen der RJF unmittelbar nach der „Machtergreifung“ sein. Mit diesem Prozess veränderte die Organisation Schritt für Schritt ihr Gesicht. Aus einer aktivistischen Jugendbewegung entstand allmählich der bürokratische, mehr und mehr reglementierende Hitlerjugend-Apparat. Die RJF unter Schirach, der 397 Vgl. z. B. Stat. [Statistische] Erfassung der Jugendlichen zum 3.11.1936. In: GB: Sachsen, 7/36 vom 29.8.1936. 398 Gesetz über die Hitler-Jugend vom 1.12.1936, §1. In: Reichsgesetzblatt [RGBl.], (1936) 113, Teil 1, S. 993. 399 Verbot der Anfertigung von statistischen Erhebungen auf Verlangen außerparteilicher Stellen. In: GB: Saarpfalz, A12/37 vom 15.8.1937. 400 Bezirksamt Kempten an die Schulleitungen des Amtsbezirkes, betrifft Feststellung der Stärke der Hitler-Jugend vom 21.12.1936 (StA Augsburg, Bezirksamt Kempten, 221, 1, unpag.). 401 Zahlen nach Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 288.
114
Genese einer Massenorganisation
eine Staatsjugend zu schaffen versuchte, griff zunehmend in alle Felder der Politik aus, welche das Jugendleben berührten: Sport, Beruf, Wohlfahrt, Schule, Kultur, Gesundheit, Jugendschutz und Jugendrecht, vieles lässt sich im Rahmen dieser Arbeit allenfalls streifen. Die Hitlerjugend wuchs zu einer bürokratischen Krake heran, von welcher der Exilant Otto Friedländer 1939 schrieb, man müsse nur deren Aufgaben und Arbeitsgebiete aufzählen, „um die Wahrhaftigkeit des Satzes ‚Jugend muss durch Jugend geführt werden‘ durch die zahllosen Bürokratenstellen zu widerlegen“.402 Die zunehmende Bürokratisierung und Institutionalisierung der Hitlerjugend war allerdings nicht intendiert gewesen. Ideal und Realität standen zueinander im Widerspruch. Die Jahre 1933/34 gingen nicht nur mit Erfolgen einher, sondern auch mit organisatorischen Unsicherheiten. Unter welchen Umständen eine Einheit gegründet worden war, welche jungen Menschen ihr angehörten oder unter wessen Führung sie standen, konnten weder die höheren noch die nachgeordneten Dienststellen überblicken. Weil der Zustrom an jungen Neumitgliedern im Zuge der Gleichschaltung ungeheuerlich war, mussten die Einheiten außerdem beständig neu aufgeteilt werden. Im zeitgenössischen Schrifttum ist diese Phase der Hitlerjugend als Zeit der „Reorganisation“ präsent. Am 1. Juli 1933 schrieb die RJF die Struktur ihrer wachsenden Massenorganisation fest. Die fünf Gliederungen sollten den maßgeblichen Rahmen darstellen: die 10 bis 14-jährigen Mädchen gehörten in den JMB, die männlichen Kinder gleichen Alters ins DJ. Die männlichen Jugendlichen ab 14 Jahren waren in die HJ zu überführen, sofern sie nicht Jungvolkführer blieben. Die 14- bis 18-jährigen Mädchen kamen in den BDM; ab 1938 wurden 17- bis 21-jährige Mädchen in das neue BDMWerk „Glaube und Schönheit“ überführt. Jede Einheit sollte ab 1935/36, sofern möglich, aus Gleichaltrigen bestehen. Im Idealfall gingen also, wie im Klassenzimmer, junge Menschen vom zehnten bis zum 18. Lebensjahr gemeinsam durch den Dienst.403 Die Schulungs- und Dienstpläne sollten auf diese Weise dem Alter angepasst sein. Auf dem Land oder wenn Wohnorte weit auseinanderlagen blieb der jahrgangsweise Aufbau der Hitlerjugend allerdings oft eine formale Vorgabe auf dem Papier. Dort mussten Einheiten meist mehrere Altersstufen zusammenfassen, weil anderes schlicht nicht möglich war. Selbst in Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet kam es zur Mitte des Jahrzehnts vor, dass Vorgaben nicht einmal in Hinblick auf das Eintrittsalter eingehalten wurden. Zu einigen DJ-Einheiten gehörten Kinder sogar unter zehn Jahren.404 Im Gebiet Hessen-Nassau war der jahrgangsweise Aufbau der Gliederungen Anfang 1939 noch immer nicht in Gänze abgeschlossen.405
402 Friedländer, Deutsche Jugend, unveröffentlichtes Manuskript, S. 232. 403 Vgl. Der jahrgangsweise Aufbau der Hitler-Jugend. In: GB: Franken, 5/36 vom 8.1936. 404 Vgl. Kenkmann, Wilde Jugend, S. 68. 405 Vgl. Jahrgangs-Aufbau. In: GB: Hessen-Nassau, A1/39 vom 20.1.1939.
Von der Bewegung zum Apparat
115
Der Apparat der Hitlerjugend blähte sich in der Aufbau- und Reorganisationsphase rasant auf. Jede der Gliederungen verfügte nun über eigene Dienststellen, Stäbe und Abteilungen. Neu war außerdem die strenge Hierarchie, mit der die RJF das rasante Wachstum der Parteijugend in den Griff zu bekommen hoffte. Auf höherer Ebene fanden sich die Gebietsführer jeweils für DJ und HJ sowie die Obergauführerinnen jeweils für JMB und BDM. Sie besaßen eigene hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche die Koordination, den Aufbau und die Verwaltung schulterten. 21 Gebiete bzw. Obergaue zählte man im Sommer 1933; bis 1940, im Zuge der Annexion Österreichs sowie durch die Eingliederung besetzter Gebiete, kamen 14 weitere hinzu.406 Auf Gebietsebene lag die Verantwortung für die Umsetzung dessen, was die RJF in Berlin von ihrer Organisation insgesamt erwartete. Die RJF ihrerseits musste wiederum auf Fehlentwicklungen und Kritik reagieren, die aus dem höheren Führerkorps an sie herangetragen wurde. Eine Ebene darunter lagen jene Dienststellen, die den eigentlichen Alltag und die Arbeit der Hitlerjugend in den Städten, Kleinstädten und auf dem Land bewältigten: „Jungbann“ und „Bann“ im Falle der männlichen Jugend, „JM-Untergau“ und „BDM-Untergau“ (später als Jungmädelringe bzw. Mädelringe bezeichnet) bei der weiblichen Jugend. Auch diese nachgeordneten Stellen besetzte meist besoldetes Personal. Mit einem Durchschnittsalter von 24 bis 30 Jahren waren diese Führungskräfte am jüngsten. Darunter stellten alle Positionen ein Ehrenamt dar. Hunderttausende junge Unterführer trugen die Verantwortung für ihre Einheiten und den Hitlerjugend-Alltag in ihrer Freizeit.407 Von den rund 765 000 Hitlerjugend-Führerinnen und -Führern aller Dienstgrade saßen im Jahr 1939 nur etwa 8 000 auf hauptamtlichen Posten.408 Was ein Organigramm einigermaßen kompakt veranschaulichte, bedeutete in der Realität eine unübersichtliche Aufbauarbeit. Es dauerte mindestens bis 1936, um diese Strukturen auch nur annähernd zu festigen.409 Gebiete ebenso wie Banne erhielten nach dem Vorbild der RJF Abteilungen für die tägliche Arbeit: Buchhaltung, Kartei- und Mitgliederwesen, Materialbeschaffung, Presse und Propaganda, Schulung und Kulturarbeit, Recht, Sport oder Fahrtenwesen.410
406 Vgl. Reichsjugendführung der NSDAP (Hg.), Aufbau, Gliederung und Anschriften der Hitlerjugend, Berlin 1934; sowie Günter Kaufmann, Das kommende Deutschland. Die Erziehung der Jugend im Reich Adolf Hitlers, Berlin 1940, S. 31. Eine Übersicht auch bei Buddrus, Totale Erziehung, Band 2, S. 1091–1093. 407 Vgl. Aufbau und Gliederung der Hitler-Jugend. In: Vorschriftenhandbuch der Hitler- Jugend, Gruppe 1: Organisation, S. 17–37. 408 Vgl. Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 36 und 39. 409 Der Hinweis bei Schubert-Weller, Hitlerjugend, S. 159, erscheint insoweit als problematisch. Er datierte den „vorläufigen Abschluss“ für die „Neuordnung der Regionalstruktur“ auf Anfang 1934, was eher Wunschdenken der HJ-Funktionäre als Realität der Organisation war. 410 Vgl. Unterbannführer Buckel, Die Verwaltung der HJ – ein wichtiges Glied der Gesamt organisation. In: Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 14 f. Eine organisatorische Übersicht mit sämtlichen Abteilungen, Ebenen und Strukturen von der RJF bis hinunter zur Bannebene findet sich bei Buddrus, Totale Erziehung, Band 2, S. 1096–1109.
116
Genese einer Massenorganisation
Das hauptamtliche Personal musste man erst finden, einstellen und schulen, die Abteilungen erst aufbauen.411 Gleichzeitig formierten sich jedoch viele Einheiten nach dem Frühjahr 1933 quasi wie aus dem Nichts. Welche Herausforderung das barg, kann das Beispiel des Banns bzw. Untergaus Halle-Merseburg knapp zeigen. Laut Plan der RJF sollte ein Gebiet jeweils etwa 100 000 junge Menschen umfassen. Weil die Masse an Neumitgliedern auf Bannebene nicht zu handhaben war, musste 1933 ein eigenständiges Gebiet bzw. ein Obergau mit Namen „Mittelland“ geformt werden. Personal wurde eingestellt, alte F ührungskräfte befördert, neue Banndienststellen wurden eingerichtet und andere aufgeteilt.412 Doch das gerade erst aufgebaute Gebiet „Mittelland“ hatte ab Sommer 1933 erneut ein solch enormes Wachstum zu verzeichnen, dass die Verwaltungsstrukturen erneut an Grenzen stießen. Im Frühjahr 1934 erfolgte deshalb abermals eine neue Reorganisation. Das junge Gebiet „Mittelland“ wurde aufgeteilt und es kam ein weiteres Gebiet mit dem Namen „Mittelelbe“ hinzu, welches wiederum mit Dienststellen und Personal zu bestücken war. Nochmals mussten Kinder und Jugendliche, je nach Standort, neu zugeteilt werden.413 Dieser dauernde Reorganisationsprozess, der sich in den ersten zwei bis drei Jahren überall ähnlich abspielte, warf Probleme auf – gerade, da die Hitlerjugend von jungen, ehrenamtlich tätigen Menschen getragen wurde. Insbesondere mit Blick auf die Hitlerjugend im lokalen Raum wird dies deutlich. In Lippe hatte man im August 1933 eine Bannführung eingerichtet. Weil es immer wieder zu Komplikationen bei der Aufstellung von Hitlerjugend-Einheiten kam, wurden dort – im Gegensatz zum ideologischen Grundprinzip „Jugend müsse von Jugend geführt werden“ – zeitweise SA-Männer gehobenen Alters an deren Spitze gesetzt. Auch der HJ-Bannführer selbst war ein SA-Mann. Jahrzehnte später berichte die ehemalige BDM-Untergauführerin von jenen Problemen, die in Lippe entstanden. Kaum jemand habe gewusst, wo Zuständigkeiten gelegen hätten. Es sei Verwaltungschaos an der Tagesordnung gewesen. Über geeignetes Personal habe man nicht verfügt. Eine intensive Kontrolle der jungen Mitglieder, wie man sich das heute vorstelle, habe zu Beginn gar nicht stattfinden können. Nicht einmal die Mitgliederbeiträge habe sie über Monate hinweg weiterreichen können, da sich niemand für Kassen- und Buchungswesen zuständig gefühlt habe.414 Wohl aus Frustration, wie etwa die Gebietsführung von Thüringen einräumte, war 1935 eine Reihe von Geldverwaltern freiwillig zurückgetreten.415 Die Phase der Reorganisationen eröffneten einerseits große 411 Vgl. beispielhaft zur später betriebenen Rekrutierung und Auswahl: Meldung von HJ-Angehörigen für hauptamtliche Tätigkeit. In: GB: Hessen-Nassau, A3/39 vom 6.3.1939. 412 Vgl. Bannführer Buschendorf, Die Aufgabe der Organisation. In: Hitler-Jugend Gebiet Mittelland (Hg.), Werden. Sein. Wollen, S. 12 f. 413 Vgl. Die Neueinteilung der Gebiete 15 und 23 der Hitler-Jugend. Von uns und anderen Gebieten. In: Der Thüringer Sturmtrupp, (1934) 10, S. 3; sowie Bannführer K. Buschendorf, Die Aufgabe der Organisation. In: Hitler-Jugend Gebiet Mittelland (Hg.), Werden. Sein. Wollen, S. 15 f. 414 Nach Pahmeyer/Spankeren, Hitlerjugend in Lippe, S. 116 f. 415 Vgl. Rücktritt der Geldverwalter. In: GB: Thüringen, 3/35 vom 24.2.1935.
Von der Bewegung zum Apparat
117
Handlungsspielräume bis hin zur Selbstermächtigung, brachten aber zugleich Belastungen mit sich. Diverse Missstände, die hier später eingehender zu thematisieren sind, gediehen in der Aufbauzeit: Fehden, Korruption, Unterschlagung, Vetternwirtschaft und nicht zuletzt Exzesse gegenüber angeblichen Gegnern. Der HJ-Bannführer von Berlin-Schönefeld, Fritz Quednow, blickte Ende 1934 auf die ersten Monate zurück: „Ich muss ganz ehrlich […] sagen, dass ich eine schwere Aufgabe mit dieser Formation übernommen hatte. Die HJ war alles andere als mustergültig, denn schon kurze Zeit vorher, während der ich mit der Schöneberger HJ in Verbindung stand, hatte ich viel gesehen und gehört, was bestimmt nicht mit den Aufgaben der HJ zu vereinbaren war.“416 Wie in diesem Fall pries mancher sogar das eigene vermeintliche Organisationstalent, indem man offen auf die Defekte der Hitlerjugend hinwies. Probleme waren nicht nur rein organisatorischer Art. Junge Menschen, die seit Frühjahr 1933 massenhaft hinzustießen, galt es zu integrieren. Gerade bei Jungvolk und HJ entstanden hierbei Reibungen. Auf die Neuankömmlinge und Überführten blickten die „alten Kämpfer“ mit Misstrauen. Die Ersteren stammten überwiegend aus konkurrierenden Organisationen, die Letzteren hielten sich für die junge Avantgarde der Hitler-Bewegung. Die Neulinge galten als Mitläufer, die den revolutionären Schwung der Vorjahre zu hemmen drohten. „Die Hitlerjugend entwickelt sich zu einem ganz besonderen Wesen innerhalb der NSDAP“, lautete es aus oppositionellen Kreisen in Ostsachsen im Herbst 1934: „Sie lassen sich von keiner Dienststelle imponieren. Die Betonung der Jugend und ihr Vorzug wird jetzt den parteiamtlichen Stellen unbequem.“417 In der Phase des Aufbaus besaßen die höheren Dienststellen kaum Überblick über das Geschehen innerhalb der Einheiten und Formationen. Gewalt gegenüber konfessionellen oder konkurrierenden Jugendgruppen ebenso wie körperliche Züchtigung und Überanstrengungen gründeten oft im Übereifer junger Führungskräfte.418 Gerade Neulingen wollten sie zeigen, was es hieß, zur Hitlerjugend zu stoßen: Mutproben, Gewaltmärsche, Überfälle oder Vandalismus prägten die ersten Jahre. Noch in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts kam es vor, dass DJ-Unterführer Wintermärsche bei knapper Kleidung zur „Abhärtung“ der Kinder durchführten, was längst offiziell verboten war.419 Die RJF empfahl ihren Dienststellen die Einführung von „Elternsprechstunden“. Dort konnten die Eltern Kritik an die HJ-Ärzte herantragen; es sollte so „das Vertrauensverhältnis zur Hitler-Jugend und ihrer Führung vertieft“ werden.420 Diesen Themen ist an späterer Stelle intensiv nachzugehen. Manches sei vorab erwähnt: Die ersten Kontakte der Eltern mit den lokalen Unterführern waren oft nicht förderlich. In Rundbriefen vergriffen sich die Repräsentanten der Parteijugend im Ton. Rüde 416 Fritz Quednow, Ein Jahr nationalsozialistische Erziehung. In: Das Gesicht der Hitler- Jugend, S. 8. 417 3. Bericht. In: Deutschland-Berichte, 1 (1934), S. 555. 418 Vgl. Überanstrengung. In: GB: Berlin, 14/37 vom 1.10.1937. 419 Vgl. Dienst bei schlechtem Wetter. In: GB: Saarpfalz, A1/37 vom 15.1.1937. 420 Elternsprechstunden. In: ebd., A17/37 vom 20.12.1937.
118
Genese einer Massenorganisation
forderten sie Beitragszahlungen oder die Söhne zum Eintritt in ihre Einheiten auf. Die berüchtigten „Elternbriefe“ ließen sich höhere Dienststellen deshalb bald auf dem Dienstweg vorgelegen, um deren Inhalt abzusegnen.421 Ebenso wurde das Abhalten sogenannter Elternabende den Unterführern s päter nicht ohne Grund verboten.422 Die Vorbehalte eines Teils der Eltern wurden auch dadurch bestärkt, dass der Sport wenig sportlich, dafür oft gewalttätig war: „Problematisch fand ich die Geländespiele“, so Wolfgang Krebs, der in Weimar aufwuchs. „Sie endeten regelmäßig in einer Rauferei, bei der ich freilich nicht mithalten konnte und manchen mitleidigen Blick erntete.“423 Diese Übungen schreckten ihn derart ab, dass er den Dienst in der Hitlerjugend quittierte: „Ich vermied Kontakte so lange wie möglich.“424 Der NSDAP-Gaukommissar in Lippe kritisierte aus diesem Grund schon im September 1933: „Viele […] halten ihre Kinder von der HJ und dem Jungvolk fern, weil die Führung gänzlich versagt und der Eindruck entsteht, als ob eine unnötige, übertriebene Soldaten-Spielerei für den ‚Führer‘ getrieben würde.“425 Und Friedländer, der im Prager Exil die Berichte studierte, befand: „Schlimm ist es […] nicht, wenn sich Jungen einmal prügeln, aber schlimm ist es, wenn daraus ein System gemacht wird.“426 Die Gewalttätigkeiten waren aber nicht nur die Folge einer gewaltverherrlichenden Ideologie. Es steckte auch weniger System dahinter, als vielmehr Übereifer und Selbstermächtigung seitens der Unterführer bei gleichzeitiger Abwesenheit von Kontrollen durch höhere Dienststellen. Die organisatorische Struktur der Hitlerjugend habe „Einzel- und Gruppensadismus, körperliche und physische Quälerei […] unter Gleichaltrigen“ befördert, urteilte treffend Michael Kater.427 Die Dienststellen gerade bei Jungvolk und HJ reagierten mehrfach mit eindringlichen Mahnungen: Überbeanspruchung, Mutproben sowie Dauerexerzieren sei unter allen Umständen zu vermeiden, Strafen und Züchtigung genauso wie Gewaltmärsche verboten. Im Gebiet Franken betonte die Führung 1936, dass von überführten 14-Jährige nicht dieselben Leistungen erbracht werden könnten, wie von älteren Angehörigen. Die Jüngsten, von denen etliche keine
421 Vgl. Elternbriefe. In: GB: Düsseldorf, A 10/39 vom 5.7.1939. Beispiele verschiedener Elternbriefe zit. in zahlreichen Berichten der Sopade sowie bei Friedländer, Deutsche Jugend, unveröffentlichtes Manuskript, S. 216–221. Zum Problem, das HJ-Führer auf Beschwerden von Eltern vielfach nicht angemessen reagierten vgl. Bearbeitung von Beschwerden. In: GB: Thüringen, A4/38 vom 1.4.1938. 422 Elternabende. In: GB: Mittelrhein, 13/36 vom 5.12.1936; Richtigstellung. In: ebd., 13/36 vom 5.12.1936. 423 Unveröffentlichtes Manuskript von Wolfgang Krebs über seine Jugend bis 1945, S. 7. (StadtA Weimar, ohne Signatur, und Archiv des HAIT). 424 Ebd., S. 13. 425 Schreiben des Gaukommissars der NSDAP in Lippe an Staatsminister Riecke vom 19.9.1933. Zit. nach Pahmeyer/Spankeren, Hitlerjugend in Lippe, S. 169. 426 Friedländer, Deutsche Jugend, unveröffentlichtes Manuskript, S. 218. 427 Kater, Hitler-Jugend, S. 31.
Von der Bewegung zum Apparat
119
Uniform besaßen, weshalb sie ein schlechtes Bild abzugeben schienen, wurden bei Märschen nach hinten gestellt. Sie konnten mit den Älteren dann allerdings nicht Schritt halten. Einige Mal waren offenbar auch Verkehrsunfälle die Folge. Man müsse „Jungen und Eltern mit der Zeit an den Dienstbetrieb gewöhnen“, und die unter 14-Jährigen sollten nach Möglichkeit nach Jahrgängen getrennt zusammengefasst werden.428 Das entstehende HJ-Gesundheitswesen mit eigenen Ärzten und Regularien speiste sich – neben rassistischer Ideologie und sozialpolitischem Kalkül – mit aus diesen Problemen. Angesichts der schwindelerregenden Masse der Neumitglieder verloren die lokalen und regionalen Dienststellen regelmäßig die Übersicht. Unter den Millionen, die nach 1933 zur Bewegung gestoßen waren, besaß ein Großteil nicht einmal einen Ausweis. Die HJ-Angehörigen stellten sich etwa für die Bewerbung auf eine Lehrstelle gegenseitig Bescheinigungen, dass sie der Partei jugend angehörten. Angehende Abiturienten, auf welche massiver Druck ausgeübt wurde, bekamen Bescheinigungen manchmal von Klassenkameraden, die als HJ-Unterführer agierten, obgleich sie aber nie zum Dienst erschienen waren. Das höhere Führerkorps untersagte die inflationäre Bescheinigungspraxis Mitte der 1930er-Jahre. Der Umbau der Bewegung in eine staatliche Institution ging mit der Katalogisierung der jungen Mitglieder erst einher. „Täglich beschweren sich viele Eltern“, lautete es aus der Führung in Nürnberg 1935, „dass ihre Söhne schon so und so lang der HJ und dem DJ angehören und immer noch nicht im Besitze ihres ordnungsgemäßen Mitgliedsausweises sind.“429 Am 15. März 1938 sollte die sogenannte Ausweisbeschaffungsaktion endlich offiziell zum Abschluss kommen. Wer nun keinen Ausweis beantragt oder erlangt hatte, sollte fortan kein Mitglied der Partei- und Staatsjugend sein.430 Aber Ende des Jahrzehnts besaßen dennoch weiter viele kein amtliches Dokument über ihre Zugehörigkeit zur Staatsjugend. Die Dienststellen waren oft heillos überfordert. In Brandenburg stellte man sogar Anfang 1939 noch fest, dass „einzelne Gefolgschaften und Fähnlein oft bis zu 70 % noch ohne Ausweise sind. Insbesondere kommt es vor, dass gerade die älteren HJ-Mitglieder trotz mehrmaliger Ausfüllung von Aufnahmescheinen […] nicht im Besitze des Reichsausweises sind.“431 Gerade in der Phase des Aufbaus waren die Dienststellen mehr mit sich und ihren Flügelkämpfen beschäftigt, als dass sie den Alltag kontrollierten. In Berlin regierte Chaos. Intrigen und Rivalitäten führten im Sommer und Herbst 1934 mehrfach zu selbstständigen Übertritten von jungen Männer. Ganze 428 Eingliederung der überwiesenen Pimpfe in die HJ. In: GB: Franken, 2/36, o. D. 429 Kartei. In: GB: Franken, III/3, 1935, o. D. 430 Vgl. z. B. Aufruf zur letztmaligen Registrierungsmöglichkeit für einen Ausweis, u. a. abgedruckt im GB: Saarpfalz, A2/38 vom 12.1.1938; Bescheinigung der Mitgliedschaft. In: ebd., A4/38 vom 4.4.1938. 431 Ausweisbeschaffung. In: GB: Kurmark, A2/39 vom 1.2.1939; Kartei. In: ebd., 19/36 vom 31.10.1936: „Es gibt noch immer in unserem Gebiet viele Jugendgenossen, die schon jahrelang Mitglied der Hitler-Jugend sind, aber noch keinen Mitglieds-Ausweis der RJF besitzen.“; Ausweis und Sparmarkenprüfung. In: GB: Mecklenburg, A2/39 vom 25.2.1939: „Es muss nun endlich für jeden Jungen der Ausweis beschafft werden können.“
120
Genese einer Massenorganisation
ormationen erklärten, sie seien jetzt für einen anderen Bannführer tätig.432 F Bis zur Konsolidierung um 1936 waren Absetzungen von lokalen Führern die Regel. In den wenigsten Fällen lassen sich die Gründe im Detail nachvollziehen. Der Führer der Hitlerjugend von Moabit und Schöneberg, Hans Müller, wurde im August 1935 seines Postens enthoben. Alte Rechnungen wurden beglichen, aber auch Richtungskämpfe ausgefochten. In diesem Fall lassen sich die Hintergründe immerhin ermitteln. In den parteiinternen Auseinandersetzungen der späten Weimarer Republik hatte Müller – nach Aussagen eines Weggefährten – auf Seiten der sozialrevolutionären Strasser-Brüder gestanden. Einige versuchten damals mit einer Abspaltung von der HJ und einer eigenen NS-Jugendbewegung den sozialrevolutionären Flügel der NSDAP zu unterstützen. Diese „Nationalsozialistische Arbeiter- und Bauernjugend“, die es in der Tat gab, war eine Splittergruppe, geführt vom antikapitalistischen Agrarromantiker Richard Schapke. Sie blieb allerdings eine kurze Episode. Dieser Bund, meinte der sozialdemokratische „Vorwärts“ 1931, werde „wohl kaum über einige infantile Trabanten hinausgelangen“.433 Viele kehrten nach der parteiinternen Führungskrise, die Ende 1932 zu Ungunsten der Strasser-Leute ausging, reuig um.434 Müller hatte die damalige Sezession zwar abgelehnt, betrieb aber nach 1933 – nun als Oberbannführer – die Aufnahme angeblich von Kommunisten und sozialrevolutionären Weggefährten. Damit habe er ein Gegengewicht zu den bürgerlich-deutschnationalen Kräften – Kindern der „Märzgefallenen“ – schaffen wollen. Müller wurde offenbar der Vorwurf einer Unterwanderung zum Verhängnis.435 Im Umfeld der Berliner HJ gab es nach 1933 weiterhin einen Teil dieser sozialrevolutionären Sympathisanten und sogenannten Nationalbolschewisten, von welchen man annahm, sie würden die HJ infiltrieren – etwa der Jugendbewegte Karl Otto Paetel, Mitbegründer der Gruppe Sozialrevolutionärer Nationalisten, dessen Emigration Anfang 1935 mit der Flucht nach Prag begann. Bis Kriegsbeginn versuchte er aus dem Exil mit seinen Schriften auf HJ-Führer in Deutschland Einfluss auszuüben und eine bündische Opposition zu stärken.436 432 Vgl. Übertritt von Formationen. In: BB: Berlin, 60/34 vom 19.10.1934. 433 Das Netz der Verschwörer. Die Quellen der nationalistischen Jugendvergiftung. In: Der Vorwärts vom 19.1.1931 (Abendausgabe). 434 Vgl. Langer, Die Geschichte der Hitlerjugend in Mecklenburg von den Anfängen bis 1945, S. 18 f.; Maurizio Bach/Stefan Breuer, Faschismus als Bewegung und Regime. Italien und Deutschland im Vergleich, Wiesbaden 2010, S. 198; Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 507; Hinweise zur Sezession auch im Bestand des Reichskommisars für die Überwachung der öffentlichen Ordnung (BArch, R1507/2072). 435 Vgl. zur Absetzung: Führung des Bannes 201, Moabit/Schöneberg. In: BB: Gebiet Berlin, 91/35 vom 9.8.1935; sowie zur Einordnung die spannende, insgesamt glaubwürdige, wenngleich in Details schwer überprüfbare Rückblende von Herbert Crüger, Verschwiegene Zeiten. Vom geheimen Apparat der KPD ins Gefängnis der Staatssicherheit, Berlin 1990, S. 33 f. 436 Vgl. Clemens Vollnhals, Der bündische Widerstandskreis um Karl Otto Paetel. Nationalrevolutionäre Ideologie und Politik aus dem Exil. In: Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte, 15 (1986), S. 399–430, besonders 407; ders., Karl Otto Paetel. Widerstand und Exil eines Nationalrevolutionärs. In: revue d’Allemagne, 16 (1984) 3, S. 499–509.
Von der Bewegung zum Apparat
121
Aufgrund der chaotischen Berliner Zustände hatte man Ende 1934 auch den Gebietsführer Erich Jahn, ein „alter Kämpfer“, der aus der deutschnationalen Bismarck-Jugend in den 1920er-Jahren zur Parteijugend gekommen war, seines Postens entbunden. Überaus eifrig und bei jungen Leuten beliebt sei HJ-Führer Jahn zwar gewesen, so urteilte die marxistische Gruppe „Neu Beginnen“. Den Richtungskämpfen seiner Unterführer sei er jedoch nicht gewachsen gewesen. Die RJF versuche durch derlei Absetzungen lokaler und regionaler Führungskräfte nun einen starken „Kurs auf Zentralisation“ zu steuern. Schirachs Ziel sei es, verlässliche Leute in Positionen zu bringen, welche im Sinne der RJF eine „Einschränkung der […] Selbstständigkeit“ der Bewegung betrieben.437 Die Befehle und Anordnungen aus der Berliner Gebietsführung zeichnen immer wieder ein besonders prekäres und fragiles Bild. In wohl keiner anderen Region thematisierte das Führerkorps derart offen die zahlreichen Probleme und Konflikte. Anfang Mai 1935 klagte die Führung im Gebiet Berlin: Längst überfällige Informationen zur Aufstellung neuer Formationen habe man seitens der Bann- und Jungbanndienststellen nicht erhalten. Man wisse daher letztlich nicht, wer in welchem Stadtgebiet eine Einheit führe, was für eine Einheit das sei oder wer ihr angehöre. Auf Stadtplänen sollten die lokalen Dienststellen nun Grenzlinien zeichnen und ihr Hoheitsgebiet festlegen, auch um die Streitigkeiten darüber, in welchen Bereich bestimmte Jugendliche und Schüler fielen, aus der Welt zu schaffen. Mitte 1936 wurde die Aufstellungspraxis der Einheiten dann grundsätzlich neu geregelt. Die Berliner Gebietsführung wollte auf diese Weise unterbinden, dass auf Bannebene fortwährend strukturelle Veränderungen vorgenommen wurden.438 Gebietsführer Axmann wähnte sich seinem Ziel der Konsolidierung im Sommer 1936 nahe: In der Hauptstadt entstehe nun bald eine Lage, welche „die sorgfältigste Ausführung jeder Anordnung und jedes Befehls irgendeiner höheren Dienststelle“ garantiere.439 Axmann griff bei Ungehorsam hart durch. Im September 1936 entfernte er – nicht zum ersten Mal – einige hauptamtliche Unterführer, weil sie angeblich Befehlen nicht Folge geleistet hatten: „Befehle sind dazu da, dass sie befolgt werden!“440 In Berlin, was die besonders schwierige Lage in der Hauptstadt unterstreicht, schnitt man um 1936 in Hinblick auf den Erfassungsgrad junger Menschen durch die Hitlerjugend von allen Regionen des Deutschen Reiches am schlechtesten ab.441 Für die Probleme machten sich die verschiedenen Dienststellen gegenseitig verantwortlich. Die RJF beschuldigte Mitte Mai 1934 ihr hauptamtliches Personal in auffallender Schärfe: „In vielen Untergliederungen […] werden Anordnungen nicht oder nur mangelhaft durchgeführt. Zum Teil liegt das an den 437 Bericht über die Lage in Deutschland, Nr. 11 vom 12.1934/1.1935. In: Stöver (Hg.), Die Meldungen der Gruppe Neu Beginnen aus dem Dritten Reich 1933–1936, S. 329–382, hier 372. 438 Vgl. Gliederungskarte bzw. Durchnummerierung. In: BB: Berlin, 84/35 vom 6.5.1935; Umorganisationen. In: ebd., 120/36 vom 12.6.1936. 439 Aufgabe und Arbeit der Organisationsdienststellen. In: ebd., 128/36 vom 28.8.1936. 440 Mitteilung des Obergebietsführers Axmann. In: ebd., 140/36 vom 11.9.1936. 441 Vgl. Reichsjugendführung (Hg.), Statistik der Jugend, A, 2, S. 5–9.
122
Genese einer Massenorganisation
Führern der höheren Einheiten der Hitler-Jugend und des BDM, die sich nicht genügend um Ausführung der Anordnungen bekümmern. […] In letzter Zeit machten sich bei verschiedenen Führern […] Spuren von beginnender Überheblichkeit bemerkbar. Die RJF wird in solchen Fällen durchgreifen.“442 Die Gebiete ihrerseits gaben den Druck nach unten weiter. Ein unmöglicher Zustand sei es, klagte man in Thüringen 1935, dass ständig neue Führer eingesetzt und andere abgesetzt würden: „Eine Einheit kann sich nicht entwickeln, wenn der Führer dauernd wechselt. Die Führer, die ohne sich viel dabei zu denken, fortwährend neue Unterführer einsetzen, werden […] zur Rechenschaft gezogen werden.“443 Die Bürokratisierung der Hitlerjugend wurde auf diese Weise immer weiter forciert. Die Gebietsführung in Sachsen beschloss 1935, dass Umorganisationen und Neuaufstellungen von Einheiten ab jetzt nur vierteljährlich zugelassen seien. Die RJF legte Anfang 1936 nach: Alle organisatorischen Fragen seien „auf etwa 2 bis 4 Zeitpunkte innerhalb eines Jahres zu konzentrieren“.444 Das Gebiet Mittelrhein übernahm die Empfehlung, indem sie Umorganisationen jeweils auf den Jahresanfang und die Sommerzeit terminierte.445 Und im Gebiet Franken legte man sich auf März und September fest, um zukünftig „eine gewisse Stetigkeit in die Organisation zu bringen“.446 Dass die Vorgaben weiterhin nicht befolgt wurden, zeigt eine Beschwerde der Führung in „Mittelelbe“ von 1938. Trotz der Anweisungen würde „laufend umorganisiert“, wodurch „erhebliche Schwierigkeiten“ für die Parteijugend entstünden. Unter anderem sei man deshalb nicht in der Lage, Mitgliedergelder zu kassieren.447 Die organisatorischen Restrukturierungen waren bis weit in die 1930er-Jahre nicht abgeschlossen. Zum Teil lag es auch daran, dass die Hitlerjugend wie besessen darauf fixiert war, ihre Organisationsstrukturen den Kreisgrenzen der NSDAP anzugleichen.448 Fragen der Organisation, Effizienz und Kommunikation trieben intensiv das hauptamtliche Führerkorps um. Doch an der Basis trafen organisatorische Fragen selten auf viel Verständnis. In Hamburg, wo im Verlauf des Jahres 1934 auf Anweisung der Gebietsleitung mehrfach umorganisiert und HJ-Einheiten neu zugeteilt wurden, machte ein HJ-Unterführer seinem Unverständnis Luft. Die Gründe für die dauernden Umstrukturierungen führte er auf vermeintlich fehlenden Diensteifer seiner neuen Kameraden zurück. Organisatorische Maßnahmen, meinte der junge HJ-Führer, würden an dem Grundproblem der laschen Dienstauffassung aber wenig ändern. In einem Brief, den er an die Eltern und die Angehörigen seiner Einheit richtete, stellte
442 Verordnungsblatt RJF 141 vom 19.5.1934, Abteilung 1. In: Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 8: Allgemeines Verhalten, S. 644. 443 Führerveränderungen. In: GB: Thüringen, 3/35 vom 24.2.1935. 444 Umorganisationen. In: Reichsbefehl, 1/II vom 24.1.1936. 445 Umorganisationen. In: GB: Mittelrhein, 13/36 vom 5.12.1936. 446 Umorganisation unterer Einheiten. In: GB: Franken, IV/2 vom 1.2.1936. 447 Umorganisation. In: GB: Mittelelbe, A11/38 vom 1.10.1938. 448 Vgl. beispielhaft Umorganisationen zum 1. April 1938 zur Anpassung an die NSDAPKreisgrenzen. In: GB: Westfalen, A5/38 vom 1.4.1938.
Von der Bewegung zum Apparat
123
der junge Mann seine Kameraden an den Pranger: Der „Grund dieser Versumpfung […] liegt bei euch. Bei euch hat ein Geist eingerissen, der schlimmer ist als der Geist einer verschwundenen SAJ. […] Ihr erscheint unentschuldigt nicht zum Dienst und geht privaten, persönlichen Vergnügungen nach. Bei euch gilt wieder das liberalistische ‚Ich‘, ihr verneint das nationalsozialistische ‚Wir‘.“449 Für sämtliche Belange – Ausflüge und Fahrten, Dienst, allgemeines Verhalten usw. – wurden jetzt nach und nach Regeln ersonnen. Dass die Hitlerjugend immer weitere dieser bürokratischen Instrumente entwickelte, lag nicht allein in der Logik ihres Totalitätsanspruchs. Man reagierte auf Defizite und Missstände. Das rasante Wachstum sollte in kontrollierbare Bahnen gelenkt werden. Im Einvernehmen mit der RJF wurde in Berlin im April 1934 erstmals eine Mitgliedersperre erlassen, die mehrere Monate dauerte, um den Neuaufnahmen und Überführungen des Vorjahres Herr zu werden. Ein Jahr später folgte eine erneute Aufnahmesperre, um Rückstände aufarbeiten zu können. Diese Aufnahmesperren wurden in diversen Regionen zeitweise verfügt. Im Mai 1936 erließ Schirach schließlich eine allgemeine Aufnahmesperre, welche in Zukunft für ganz Deutschland gültig blieb.450 Anlass war die Aufnahme von rund drei Millionen Minderjährigen in das Jungvolk im selben Jahr. Das Regime hatte im Frühjahr für den Eintritt massiv geworben und mit erheblichem Druck auf die Eltern und Schulen für ein erneutes Wachstum der Parteijugend gesorgt. Die Neueintritte sollten in Zukunft systematisch und einheitlich stattfinden – jahrgangsweise an Hitlers Geburtstag und feierlich umrahmt vom parteiamtlichen Zeremoniell. Die Aufnahmefeiern zum Stichtag des 20. April, welche Zeitzeugen oft schillernd schilderten, hatten einen praktischen Nutzen. Für die Dienststellen war eine solche kollektive Aufnahme von Kindern sehr viel ein facher zu handhaben. Darin – nicht allein vor dem Hintergrund des Führerkults – lag ihr Sinn. Der schleichende Wandel der Hitlerjugend von einer revolutionären Jugendbewegung hin zur bürokratischen Institution wird in ihrer Inspektions- und Überwachungspraxis im Besonderen sichtbar. Nach 1933 sollten die Inspektionen auf Gebiets- und Bannebene regelmäßig durchgeführt werden, um Loyalität und Diensteifer zu überprüfen, Mängel festzustellen und Unterführer auf das Regelwerk zu verpflichten. Dafür verfügten die Gebiete über einen Sonderbeauftragten, der seine Mitarbeiter in einzelne Formationen entsandte. Inspek tion hieß unangemeldeter Besuch von oben: Heimabend- und Dienstpläne, Kon trollbücher, Uniformen und sogar der Haarschnitt, alles kam auf den Prüfstand. Genau wurde sich angesehen, wie die Hitlerjugend-Heime und Diensträume aussahen, wie die Karteien und Unterlagen geführt wurden. Wo jugendliche 449 Befehl einer HJ-Einheit in Hamburg-Horn vom 22.9.1934, zit. nach dem Artikel „Das verfluchte Ich“. In: Der Neue Vorwärts vom 28.10.1934. 450 Aufnahmesperre der HJ. In: BB: Gebiet Berlin, 57/34 vom 28.9.1934, sowie Mitgliedssperre. In: ebd., 80/35 vom 1.4.1935. Vgl. auch Mitgliedersperre für die Hitler-Jugend. In: Unsere HJ, (1936) 2; sowie Lockerung der Mitgliedersperre der HJ für die Turn- und Sportjugend. In: GB: Pommern A7/37 vom 1.6.1937.
124
Genese einer Massenorganisation
Einheitenführer oder gar das hauptamtliche Personal ungeeignet schien, sollte durchgegriffen werden.451 Die Banne und Untergaue führten zudem sogenannte Besichtigungen durch. Schon die Andeutung solcher Kontrollen sollte Kinder und Jugendliche zur Disziplin anleiten.452 Manchmal, wie in Thüringen, wo Oberbannführer Gerhard Teichmann Ende 1933 auf mehrtätige Inspektionsfahrt rund um Erfurt ging, wurden sie von HJ-Presseleuten begleitet und in Propaganda umgemünzt.453 Eher spielerisch gelagerte „Besichtigungen“ gehörten zur Routine des Dienstalltags – sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen. Die Formationsführer sollten die ihnen unterstellten Einheiten regelmäßig inspizieren. An das „Antreten“ in Reih und Glied erinnern sich fast alle Zeitzeugen, die irgendwann Dienst in der Organisation versahen; die Musterungen durch junge Vorgesetzte sind – kaum überraschend – überwiegend negativ in Erinnerung geblieben.454 Wie die Besichtigungen gehandhabt wurden, hing an den jungen Akteuren und ihrem individuellen Eifer ab. Bei den Routinekontrollen verfügten sie über Freiraum. Eine Weile habe er beim Marsch oder beim Heimabend zugeschaut, erinnerte sich ein Ehemaliger. Zur Mitte des Jahrzehnts war er als 16-jähriger Jungstammführer in Brühl aktiv. Mit dem Fahrrad habe er die Stadt abgefahren, um die ihm unterstellten „Pimpfe“ im Auftrag des Jungbanns zu inspizieren. Einige Worte habe er zu diesen Anlässen wahrscheinlich gesagt, aber eine weltbewegende Sache sei das eigentlich nicht gewesen.455 In den Berichten jener, die aus austraten oder ausgeschlossen wurden, spielen diese Inspektionen allerdings häufig eine entscheidende Rolle. Die Zurechtweisungen, das Gebrüll oder mögliche körperliche Strafen sind dann die „Schlüsselereignisse“ solcher Geschichten, welche die „innere Kündigung mit der HJ“ begründen.456 Der im Juni 1934 gegründete SRD ist verschiedentlich bereits angesprochen worden. Die Sondereinheit war für die Kontrolle junger Menschen im Alltag zuständig – formal zunächst nur für Mitglieder der Parteijugend, de facto kontrollierte der SRD von Beginn an jene, die außerhalb der Hitlerjugend standen. Mit ihren Streifen schuf sich die Parteijugend eine eigene Überwachungstruppe. Die Aufgabe dieser Hilfspolizisten, im Alter von 14 Jahren aufwärts, lag insbesondere darin, die Eingereihten und Eingegliederten auf Linie zu bringen, undiszipliniertes Verhalten zu melden sowie junge Menschen außerhalb der Organisation unter Druck zu setzen. Die Gründung des SRD war allerdings zugleich eine 451 Vgl. Die Inspektion der HJ- und DJ-Einheiten. In: GB: Pommern, A6/1938 vom 20.5.1938. 452 Vgl. Verschiedene Schreiben zur Ankündigung von sogenannten Besichtigungen zit. bei Friedländer, Deutsche Jugend, unveröffentlichtes Manuskript, S. 215–234. 453 Besichtigungsfahrt des Oberbannführers Teichmann im Unterbann V/71. In: Thüringer Sturmtrupp, (1933) 5, S. 3. 454 Vgl. Heinz Schreckenberg, Ideologie und Alltag im Dritten Reich, Frankfurt a. M. 2003, S. 286 f. 455 Vgl. Interview mit Manfred Mammel (NSDOK Köln, EzG, jugend1918-1945.de; 16.7.2020). 456 Autobiografie von Gustav Renger, Meine Berge und Täler, 2. Auflage, Braunschweig 2014, S. 4.
Von der Bewegung zum Apparat
125
Reaktion der Dienststellen auf die Verfehlungen ihrer Unterführer. Letztere hatten im revolutionären Fieber ihre Macht in etlichen Fällen missbraucht, indem sie sich polizeiliche Befugnisse anmaßten, die ihnen nicht zustanden. Der SRD schuf gewissermaßen ein institutionelles Reglement und legte Befugnisse für die Kontrollen fest.457 Die Gebietsführung in Pommern unterstrich 1936, „dass aktive Führer ohne ausdrücklichen Befehl keinerlei Streifendiensttätigkeit“ ausführen dürften. Man habe zu diesem Zweck eigens den SRD geschaffen, „der durch eine entsprechende Ausbildung genau über seine Befugnisse unterrichtet ist und vor allem auch ihre Grenzen kennt“.458 Die Begründung für die Notwendigkeit des SRD legte man erstaunlich offenherzig dar: Junge Unterführer, die bislang eigenmächtig patrouillierten und kontrollierten, ohne aber entsprechend geschult worden zu sein, würden eine erhebliche Belastung für das Ansehen der HJ darstellen. Unterführer hätten sich Anmaßung und Beleidigung oder sogar der Nötigung schuldig gemacht.459 Die neuen Streifen wurden nun von lokalen Polizei- oder Gestapobeamten unterwiesen oder über die Gesetzeslage beispielsweise in Hinblick auf die konfessionellen Jugendorganisationen unterrichtet.460 In Brandenburg sollte 1937 jeder Bann – je nach Lage – über 35 bis 65 SRD-Angehörige verfügen; mancher Ort besaß zu diesem Zeitpunkt aber offenbar noch keinen einzigen.461 Im Gebiet Westmark verfügten 1937 zwei Banne noch über keinerlei Streifen.462 Der SRD war offenbar meist in Großstädten präsent, wo das Führerkorps die Formation auch zuerst aufbauen wollte.463 Dort lag deren wichtigste Aufgabe später unter anderem in der Überwachung von Straßenzügen, Lokalen und Gaststätten. Auch in diesem Fall hatten höhere Dienststellen gelegentlich die Eigenmächtigkeit der jungen Führerschaft beklagt. Es sei vorgekommen, so lautete es erneut in Pommern, „dass von unteren Einheiten Lokalverbote ausgesprochen“ wurden, obwohl dieses Recht nur den Hoheitsträgern der Partei und der Gebietsführung zustünde.464 Zumal in Berlin
457 Vgl. Anweisungen zur Ausbildung, zum Einsatz und zur Organisation des SRD. In: Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 11: Streifendienst und Überwachung, S. 881–894. 458 Eigenmächtige Ausübung von Streifendienstfunktionen. In: GB: Pommern, 8/36 vom 17.8.1936. 459 Ebd. 460 Vgl. Anfrage HJ-Bann 142, Lörrach, an den Regierungsrat bezüglich Vortrag für Streifendienstkurse vom 9.8.1935, sowie Antwortschreiben, o. D. (StA Freiburg, B719/1, 5018, unpag.). 461 Zu Sollzahlen in einzelnen Bannen des Gebietes vgl. Bannstreifendienstführer. In: GB: Kurmark, A6/37 vom 12.4.1937. 462 Vgl. Banne ohne Bannstreifendienst. In: GB: Westmark, 4/37 vom 1.4.1937. 463 Vgl. Innenministerium Karlsruhe an die Landräte vom 12.9.1938 (StA Freiburg, B719/1, 5018, unpag.): „Der von der HJ in einer Reihe von größeren Städten eingerichtete ‚Streifendienst‘ hat […] die Aufgabe, der HJ als eine Art internes Kontrollorgan über ihre Mitglieder zu dienen.“ 464 Gaststättenverbote. In: GB: Pommern, 11/36 vom 19.10.1936.
126
Genese einer Massenorganisation
und Hamburg reichte die Hitlerjugend – auf Basis der Meldungen ihrer Unterführer sowie in Zusammenarbeit mit der Partei erstellte – Listen mit verbotenen Gaststätten herum, welche die SRD-Angehörigen observierten. Aufgeführt waren vermeintlich „marxistische Nester“; außerdem Kneipen besonders im Rotlichtmilieu, an Vergnügungsmeilen sowie Gaststätten und Cafés, die vermeintlich in jüdischem Besitz waren oder als Homosexuellentreffpunkte galten. In Berlin wurden die Verbotslisten ab Februar 1935 erstellt.465 In Hamburg hatte man im August 1942 insgesamt 75 Lokale sowie drei Straßenzüge zu betreten verboten.466 Eine weitere Aufgabe, gerade in den ersten Jahren sowie wieder in der Kriegszeit, fiel den Streifen bei Fahndungen zu. In den diversen HJ-Befehlsblättern füllen die Vermisstenmeldungen ungezählte Seiten. Jugendliche rissen von zuhause unter dem Vorwand aus, dass sie mit der Parteijugend auf Fahrt gingen, aber tauchten nicht mehr auf.467 In diversen Fällen sollte auch nach Straftätern, Schwindlern oder Oppositionellen gefahndet werden, die in der Parteijugend Unterschlupf suchten.468 „Bei den Betrugsunternehmen“, lautete es beispielsweise aus Berlin 1935, „die oft mit verbrecherischen wie unsittlichen oder hochverräterischen Absichten verbunden sind, tarnen sie sich zumeist als Hitlerjugend-Führer (‚Inspekteure‘) oder tragen Wehrmachtsuniform, mit Vorliebe auch Kriegsauszeichnungen.“469 Der Fall eines 23-Jährigen, der als HJ-Führer auftrat und sich in den Dienst der Einheiten einschlich oder Eltern um Geld bedrängte, kam ähnlich häufig vor.470 Seltener waren extreme Einzelfälle wie jener des 15-jährige Hitlerjungen Oskar P. aus Gladbach, den die Polizei 1935 wegen Diebstahldelikten und Raubmord zur Fahndung ausschrieb. Ein anderes Feld, für das der SRD zuständig war: Mitglieder verloren aus Unachtsamkeit häufig ihre Ausweise, was sich dann jene zunutze machten, die sie fanden; der SRD musste nach allerlei Dokumenten, Papieren und Stempeln fahnden, welche für ungültig erklärt wurden.471 Die SRD-Angehörigen, trotzdem sie geschult worden waren, blieben fehlbare junge Menschen und waren keine ausgebildeten, erfahrenen Polizisten. Eine effiziente Überwachungstruppe konnte der SRD gewiss nicht sein. Im Gebiet Hessen-Nassau klagte man daher 1937, dass man Beschwerden seitens einfacher Hitlerjugend-Angehöriger nicht nachprü-
465 Lokalverbote für die HJ. In: BB: Gebiet Berlin, 76/34 vom 23.2.1935; zu den jeweiligen Orten vgl. die Rubrik „Lokalverbote“ in allen nachfolgenden Ausgaben. 466 Vgl. Verbotene Straßen und Lokale. In: GB: Hamburg, 7/42 vom 8.1942. 467 Vgl. beispielhaft Fahndungen. In: BB: Gebiet Berlin, 68/34 vom 17.12.1934; Vermisstenmeldungen. In: GB: Thüringen, 9/35 vom 15.8.1935. 468 Vgl. Fahndungen und Warnung. In: BB: Gebiet Berlin, 68/34 vom 17.12.1934. 469 Warnungen vor Schwindlern. In: ebd., 50/35 vom 1.4.1935. 470 Ebd. 471 Vgl. die Rubriken Verlorene HJ-Ehrenzeichen, Verlust von Ausweisen, ungültige oder verlorene Stempel in sämtlichen Gebietsbefehlen. Zum Fall P. vgl. Fahndung im GB: Thüringen, 9/35, 15.8.1935, außerdem hier auch den Fall eines verlorenen Ausweises, von dem man bereits annehmen konnte, dass „der Dieb sich mithilfe dieses Ausweises als Angehöriger des DJ ausgibt, da der Ausweis noch kein Lichtbild und Unterschrift des Inhabers enthielt“. Ebd.
Von der Bewegung zum Apparat
127
fen könne, weil beschlagnahmte Papiere, Ausweise und Gegenstände zahlreich verschwunden seien: „In Zukunft werde ich die Streifendienstführer […] disziplinarisch zur Verantwortung ziehen und sie schadensersatzpflichtig machen.“472 Der SRD, mit dem eigentlich eine formale Ordnung in das lokale Überwachungs- und Kontrollsystem der Hitlerjugend gebracht und Befugnisse festschrieben werden sollten, machte sich zudem selbst der Anmaßung und Übergriffe schuldig. Gewalttätige Konflikte ergaben sich aus dem oft schikanösen Verhalten der Streifen.473 Junge Männer, die ihre neugewonnene Macht missbrauchten, fielen regelmäßig – wie an diversen Stellen zu zeigen sein wird – negativ auf. Wiederum die Tätigkeiten der jungen Streifen zu überwachen sollte also der jeweilige Streifendienstführer im Bann leisten; und in der RJF existierte der Posten eines Inspekteurs für den gesamten SRD.474 Die Sonderformation, kaum dass man sie aus der Taufe gehoben hatte, verlor in der Breite der Parteijugend schnell jedes Ansehen. Nach dem ersten SRD-Großeinsatz zu Pfingsten 1935 klagte das thüringer Führerkorps: „Es werden uns Einzelfälle gemeldet, in denen Angehörige […] sich den Anordnungen von diensttuenden Streifendienstangehörigen widersetzen. Gegen diese Kameraden wird von uns […] eingeschritten werden. Wir weisen darauf hin, dass der Streifendienst ein Teil der HJ ist, der die Aufgabe hat, in der Öffentlichkeit über das tadellose Benehmen der Angehörigen der HJ zu wachen und dessen Dienst oftmals nicht leicht ist.“475 Zwei Jahre später empörte sich die RJF über den Umgang junger Menschen mit dem SRD. Einer „Unzahl von Meldungen“ sei zu entnehmen, dass die Kontrollarbeit unwirksam werde, weilMeldungen nicht ernst genommen und nicht bearbeitet würden. HJ-Mitglieder, welche die Streifen festsetzten, seien von Kameraden und Unterführern gegenüber dem SRD gar in Schutz genommen worden: „Dadurch wird aber lediglich erreicht, dass die Arbeit des Streifendienstes […] als lächerliche und überflüssige Kontrolle angesehen wird, da auf Feststellungen des Streifendienstes eine Bestrafung ja doch nicht erfolgt.“476 Das Ansehen des SRD ebenso wie die Bereitschaft Jugendlicher, in die schikanöse Sonderformation einzutreten, wurde bis Kriegsbeginn nicht besser, schwand nach 1939 sogar rapide dahin. Ein BDM-Pendant dezidiert zur Kontrolle der weiblichen Jugend wurde zwar geplant, allerdings nie realisiert.477 Neben ihren Streifen baute die Hitlerjugend ab 1934 vereinzelt sogenannte HJ-Wachen auf. Diese Jugendwachen, die ab Dezember 1938 seitens der RJF als eine Art Elitetruppe neu organisiert und zusammengefasst wurden, setzen die Gebiete – in Anlehnung an die SS in der Frühphase der Bewegung – für
472 Nachweis beschlagnahmter Gegenstände und Ausweise. In: GB: Hessen-Nassau, A12/37 vom 1.11.1937. 473 Vgl. Örtliche Beispiele für Rhein und Ruhr bei Kenkmann, Wilde Jugend, S. 124–127. 474 Vgl. umfassender Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 374–388. 475 Streifendienst. In: GB: Thüringen, 8/35 vom 28.6.1935. 476 Bestrafung der gemeldeten Jgg. In: Reichsbefehl, 35/II vom 13.10.1937. 477 Vgl. in Kürze Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 4.
128
Genese einer Massenorganisation
diverse Ordnungsdienste ein: Saalschutz, Bewachung von Dienststellen, Heimen, bei Kundgebungen, in Lagern oder auf Märschen. Sie wurden – anders als die einfachen SRD-Angehörigen – teilweise für ihre Arbeit bezahlt.478 In überwiegend ländlichen Regionen wie Thüringen waren diese Bannwachen offenbar eher selten; einzelne Wachen, die dort HJ-Bannscharen hießen, wurden 1938 aufgelöst und in den SRD überführt.479 Als Bedingungen zur Aufnahme für die 1938 vereinheitlichten HJ-Wachen galten: Mindestalter von 17 Jahren, politische Zuverlässigkeit und körperliche Eignung, Mindestgröße von 1,75 Meter, ein „rassisch gutes Erscheinungsbild“, eine Einwilligung der Eltern sowie die Selbstverpflichtung für Wachtätigkeiten von mindestens einem Jahr.480 Zusammengefasst hießen diese Jugendlichen nun „Wachgefolgschaft“ und ihre Formation trug den Ehrennamen des Reichsjugendführers Schirach. Zum Teil setzte sich die Wachformation aus früheren SRD-Mitgliedern zusammen, die übernommen worden waren.481 Wahrscheinlich setzte man die Wachgefolgschaft gerade in Großstädten ein, die ein schwieriges Pflaster blieben oder nach Kriegsbeginn 1939 erneut dazu wurden. An Freiwilligen für die Wachgefolgschaft der RJF scheint es jedenfalls einen großen Mangel gegeben zu haben.482 Sie blieb – anders als der SRD, der in den Alltag stark eingriff – von wohl eher nachrangiger Bedeutung.483 Das bürokratische Korsett der Hitlerjugend wurde immer enger, je weiter sie sich von ihrer Bewegungsphase hin zur Massenorganisation wandelte. Emigrant Friedländer, der die Lage von Prag aus beobachtete und an seinem Buch über die Hitlerjugend arbeitete, hoffte, dass der revolutionäre Elan der Anfangszeit bald ins Gegenteil umschlagen würde. Alles werde immer mehr reguliert und reglementiert. Dann müsse aber auch der Freiheitswunsch junger Menschen erheblich wachsen, lautete seine Überlegung. Friedländer setzte Hoffnung auf die Masse durchschnittlicher, nicht-fanatisierter, eher hineingepresster junger Menschen, die der Partei und Ideologie vermeintlich mit Gleichgültigkeit begegneten: „Das ewige Uniformtragen macht den Jungen auf Dauer keinen Spaß. Über die Strapazen der Märsche wird häufig geklagt, die Jugendlichen werden
478 Gebietswache. In: BB: Gebiet Berlin, 68/34 vom 17.12.1934. 479 Der Stabsleiter des Gebietes Thüringen, Hans Siegel, zur Überführung der Bannscharen in den Streifendienst. In: GB: Thüringen, A 11/38 vom 13.10.1938. 480 Einstellung in die Wache des Gebietes. In: GB: Düsseldorf, A3/39 vom 1.3.1939; Neueinstellungen in die Wachgefolgschaft „Baldur von Schirach“. In: GB: Hamburg, A2/39, 1.2.1939; GB: Thüringen, A13/38 vom 12.12.1938. 481 Vgl. Wachgefolgschaft Baldur von Schirach. In: Gebiets- und Obergaubefehl: Westfalen, K21/40 vom 30.5.1940. 482 Vgl. Neueinstellung in die Wachgefolgschaft. In: GB: Kurmark, A2/39 vom 1.2.1939: „Auf die Mitteilung der Personalabteilung […] sind zu wenig Meldungen eingegangen. Ich lege Wert darauf, dass aus jedem Bann mindestens ein Junge für die Wachgefolgschaft gemeldet wird. […] Ich mache die Bannführer hierfür verantwortlich.“ 483 Hinweise auch bei Hartmann Lauterbacher, Erlebt und mitgestaltet. Kronzeuge einer Epoche 1923–1945. Zu neuen Ufern nach Kriegsende, Preußisch Oldendorf 1984, S. 38 und 152.
Von der Bewegung zum Apparat
129
durch den SRD überwacht, ob sie etwa in Wanderkluft auf Fahrt gehen. Das alles macht böses Blut, man schimpft auch auf die Arroganz der jungen Bonzen. Hier beginnt die Unzufriedenheit bereits in eine ernstere Form der Kritik umzuschlagen. […] Junge Menschen glauben mit neuen Gedanken die Welt aufbauen zu können, zu mindestens aber wollen sie sich das Recht nicht nehmen lassen, auf Fehler und Mängel, die sie bemerken, hinzuweisen. Indem man ihnen dieses Recht nimmt, sucht man sie mundtot zu machen, aber Mundtote sind Scheintote. Dieser Scheintod äußert sich als Indifferenz.“484 In Hinblick auf das Widerstandspotenzial unterlag Friedländer zwar erheblicher Selbsttäuschungen. Hier aber beschrieb er aus zeitgenössischer Sicht ein Phänomen, das viele andere ähnlich erlebten. Auf der einen Seite wuchs die Hitlerjugend in schwindelerregender Geschwindigkeit zum Millionenheer heran; und viele traten mit Begeisterung ein, weil sie Möglichkeiten bot und Versprechungen machte. Andererseits wurde die Phase der Reorganisation immer wieder auch mit Ermüdung und Stagnation gleichgesetzt. Die BDM-Führerin Melita Maschmann hat dies retrospektiv ähnlich wie Friedländer geschildert: „Die Hitler-Jugend war, wenn man von ihren Anfängen […] absieht, keine ‚Bewegung‘, sie wurde mehr und mehr ‚Staatsjugend‘, d. h. sie institutionalisierte sich mehr und mehr und wurde schließlich ein Instrument.“485 Sie sei trotz ihres Kontrollapparats dennoch immer wieder an Grenzen gestoßen: „Mitglieder ließen sich zwar uniformieren und im Dienst reglementieren, aber sie hörten […] nicht auf, Jugendliche zu sein und sich wie Jugendliche zu verhalten.“486 3.2
Die ersten Enttäuschten
Der 30. Januar 1933 leitete eine politische Revolution in der deutschen Gesellschaft ein. Die nationalsozialistische „Kampfzeit“ gegen den Weimarer Staat war nun aber jäh beendet und eine neue Phase für die Entwicklung der Hitlerjugend eröffnet. Die im März 1933 geschaffene RJF unter Reichsjugendführer Schirach wurde mit der politischen und sportlichen Erziehung der Jugend und ihrer Verpflichtung auf den Staat betraut: „Zur […] Durchdringung der Jugend mit nationalsozialistischem Geist […] bedarf es einer weitreichenden, alle Lebensgebiete berührenden geistigen Schulung.“487 Wo man zuvor stets Kampf, Revolution und Umwälzung propagierte, sprach man jetzt häufiger von Erziehung, Formung und Schulung. Die Parteijugend musste „durchorganisiert“, ihr „eine straffe Form“ gegeben werden, um Kinder an den Staat zu binden.488 In
484 Friedländer, Deutsche Jugend, unveröffentlichtes Manuskript, S. 252. 485 Maschmann, Fazit, S. 151. 486 Ebd., S. 152. 487 Helke, Totale Jugend. In: Ruf der Jungen, S. 4. 488 Achim Blanckarts, Durchorganisation. In: Der Thüringer Sturmtrupp, 1933, Sonderausgabe 1, S. 2.
130
Genese einer Massenorganisation
Mecklenburg fassten die HJ-Funktionäre schließlich 1938 zusammen: „Mit 10 Jahren kommt der Junge zu uns und verlässt die Hitlerjugend mit 18 Jahren wieder. In dieser Zeitspanne erfasst ihn ein Plan wohldurchdachter Schulung und körperlicher Ertüchtigung, der bei seinem Eintritt […] genauso festliegt wie bei seinem Eintritt in die Schule der Lehrplan. […] Um diese Planmäßigkeit zu erzielen, ist eine genaue bis ins Kleinste feststehende Organisation notwendig.“489 Revolution, Dynamik und Bewegung gaukelte die Hitlerjugend ihren Mitgliedern zwar weiter vor. Doch gerade die Älteren, welche die „Kampfzeit“ miterlebt hatten, sahen sich in einem Sumpf aus Reglementierungen und Bürokratie versinkend. Symptomatisch die Rückblende des ehemaligen HJ-Obergebietsführers Gotthard Ammerlahn. Er stand, wie er in der Rückschau schilderte, den Ambitionen der RJF ablehnend gegenüber: „Wir alten HJ-Führer lehnten die nach 1933 vorgenommene Umstellung der HJ auf die Staatsjugend […] innerlich bis zum Letzten ab. Wir waren überzeugt, dass damit ursprünglicher Sinn und Geist der wirklichen, freiwilligen und begeisterten HJ kaputt gemacht würde.“490 Baldur von Schirach sei „bequem und keinesfalls ein Kämpfer“ gewesen und habe außerdem immer wieder Unmut in den untersten Reihen und an der Basis geschürt. Die „Alte Garde“ junger Kämpfer und die neuen, von der RJF eingesetzten Führer hätten einander argwöhnisch gegenübergestanden.491 Die selektive Rückschau Ammerlahns ist mit Skepsis zu betrachten. Seiner angeblich kritischen Haltung zum Trotz, hatte er nach 1933 beachtliche Karriere im Funktionärsapparat gemacht. Zeitweise war er mit dem gesamten Presse- und Propagandawesen der Jugendorganisation betraut gewesen.492 In seinen Aussagen ordnete sich Ammerlahn – analog zu Konfliktlinien in SA und Partei – einem sozialrevolutionären Flügel zu. Die Vorbehalte über die bürokratische Regulierungswut und das Wachstum der Hitlerjugend waren allerdings tatsächlich recht verbreitet, wie autobiografische Schilderungen und zeitgenössische Berichte zeigen. „Die Hitlerjugend findet noch immer, teilweise auch aus den eigenen Reihen, starke Kritik“, urteilte die Gestapo Potsdam 1934.493 Hartmann Lauterbacher, später RJF-Stabsführer, meinte über die „alten Kämpfer“ rückblickend: „Die zwei Millionen Mitglieder im Obergebiet West bildeten nicht nur meine ‚Hausmacht‘, sondern waren auch meine Kritiker.“494 Selbst Reichsjugendführer Schirach – gespeist aus biografischer Prägung, ideologischer Überzeugung und rhetorischen Konzessionen an seine Unterführer – malte 1934
489 HJ-Führerdienst, Gebiet: Mecklenburg, (1938) 1. Zit. nach Langer, Die Geschichte der Hitlerjugend in Mecklenburg von den Anfängen bis 1945, S. 60. 490 Niederschrift der Unterredung des Herrn Gotthard Ammerlahn mit Dr. Freiherr von Siegler im Auftrage des Instituts für Zeitgeschichte (IfZ) München, S. 3 (Archiv des IfZ München, 244, 52). 491 Ebd. 492 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 141. 493 Gestapo-Lagebericht für den Monat April 1934, o. D. In: Ribbe (Hg.), Lageberichte über die Provinz Brandenburg und die Reichshauptstadt, S. 103–111, hier 108. 494 Lauterbacher, Erlebt und mitgestaltet, S. 95.
Von der Bewegung zum Apparat
131
jene Gefahren an die Wand, welche in der Gleichschaltung zu liegen schien: Bürokratische Amtsstuben seien der Tod jeder begeisterten Jugend.495 Ein anderes Beispiel bietet Oskar Riegraf. 1911 in Fellbach geboren, hatte er während des Theologiestudiums in Tübingen Ende der 1920er-Jahre die dortige HJ aufgebaut. 1935, in der Funktion eines HJ-Bannführers, arbeitete Riegraf am Aufbau der Gebietsführerschule „Wilhelm Neth“ in Stuttgart. Sein Briefverkehr aus dieser Zeit ist umfassend überliefert und zeugt von intriganten Konflikten. Riegraf war ein fanatischer Überzeugungstäter: Den Eugenik-Film „Erbkrank“ führte er in seiner Führerschule mehrfach auf. Als Anhänger der DC-Bewegung war er mit den antisemitischen Pfarrern Julius Leutheuser und Siegfried Leffler aus Thüringen befreundet. In Hitler sah er einen Gottesboten. Dennoch gehörte Riegraf zu den Unzufriedenen und Kritikern der Gleichschaltung. Die Entwicklungen in der evangelischen Reichskirche, wo die DC ins Hintertreffen geriet, nährten die Kritik ebenso wie die Situation in der Hitlerjugend. Die RJF verrate alles, was die Bewegung einst stark gemacht habe, war Riegraf überzeugt. Sein Groll auf die Gebietsführung wuchs ständig. Alte Weggefährten, die er aus der „Kampfzeit“ kannte, schienen von ihren Posten zu Unrecht enthoben. Andere wurden bei der Besetzung von hauptamtlichen Stellen angeblich bewusst übergangen. Die HJ hielt er mal für einen üblen „Sauladen“, ein anderes Mal für einen „Saustall“, wo Eitelkeit und Dummheit herrschten. Jeder intrigiere, wie er meinte, gegen jeden.496 Dem SS-Mann Heinz Spieß schrieb er in einem Brief Ende 1938: „Was bei uns in der HJ gegenwärtig für ein Laden ist, wirst Du ja sicher wissen. Es passieren Dinge, die man als anständiger Mensch bald nicht mehr mitmachen kann.“497 Schon Monate zuvor hatte er bekundet: „Ich will es […] offen sagen, dass ich mit der HJ-Führung bei uns innerlich fertig bin. Was mich bindet, ist die Rücksicht auf den Kameradenkreis, für den ich hier die Verantwortung übernommen habe. Ich gehe, wenn mich der Gauleiter abberuft, und dann ohne Schmerzen.“498 Dennoch ging Riefgraf nicht. Ebenso wenig gingen andere, deren Kritik an der Gleichschaltung sich nie zur Opposition auswuchs. Im Gegenteil, Riegraf blieb als Oberbannführer tätig, stand später im Kriegseinsatz. Nach 1945 wurde ohne Erfolg nach ihm gefahndet, weil er in den letzten Kriegstagen einen Wirt wegen des Hissens einer weißen Fahne erschossen hatte.499 Nicht nur auf mittlerer und höherer Ebene, sondern gerade auch an der Basis der Hitlerjugend rumorte es zeitweise heftig. Die Erwartungshaltung vieler junger Nationalsozialisten ließ sich nach 1933 nur in Teilen befriedigen. Davon 495 Schirach, Idee und Gestalt, S. 66–75. 496 Vgl. den gesamten überlieferten Schriftverkehr in den Handakten des Schulleiters Riegraf. (StA Ludwigsburg, PL 704, Bü 1, unpag.); hier zit. Schreiben an Oberbannführer Hans Kölle vom 13.12.1938; sowie Schreiben an E. Schweizer vom 14.2.1938. 497 Riegraf an Obersturmbannführer Spieß vom 21.11.1938 (ebd.). 498 Riegraf an den Gauschulungswalter Ernst Muschler vom 11.4.1938 (ebd.). 499 Vgl. Klaus Harpprecht, Schräges Licht. Erinnerungen ans Überleben und Leben, Frankfurt a. M. 2014, S. 41 f.
132
Genese einer Massenorganisation
ist in den Tagebüchern des jungen Gefolgschaftsführers Franz Schall aus Dresden, wenig versiert, aber mit naiver Ehrlichkeit, viel zu lesen: „Organisation über Organisation“, notierte der junge Mann im August 1933: „Und wo bleibt die Gestaltung?“500 Hunderttausende, die aus Stahlhelm, Bünden oder konfessionellen Vereinen zur Hitlerjugend kamen, schienen die Nutznießer zu sein. Reibungen und Kollisionen zwischen Überführten und Altgedienten w aren zwangsläufig.501 „Die HJ macht einen sehr schlechten Eindruck“, glaubte Schall. Vorbehalte tauschte er mit Kameraden ganz offen aus: „Doch wir hoffen und glauben, dass der alte Kampfgeist […] wieder hochkommt trotz aller Gleichschalterei!“502 Flügelkämpfe gehörten 1933/34 zum Alltag und zehrten an der Geduld junger Männer, die sich in ihrem Idealismus betrogen wähnten. Die überzogenen Heilserwartungen ließen sich mit der Realität nur bedingt in Einklang bringen. In Dresden brachen offene Kämpfe aus. „Er behauptet, die neuen Führer seien Postenjäger“, schrieb Franz Schall nach der Unterredung mit einem Kameraden, der sich auf die Seite eines abgesetzten Unterbannführers geschlagen hatte. „Wer hat nun recht?“, verlor Schall im Februar 1933 die Übersicht: „Hoffentlich klärt sich alles schnell. Wir wollen doch kämpfen für Hitler. […] Was soll dann noch Streit und Zersplitterung?“503 Die verlockende Besoldung, die mit hauptamtlichen Posten einherging, spielte bei solchen Intrigen zwischen Männern, welche die Wirtschaftskrise hart getroffen hatte, sicher eine wichtige Rolle. Animositäten, Flügelkämpfe und private Fehden brachen sich aber ebenfalls Bahn. Selbst die Ebene der Gebietsführung war heftig umkämpft. Immer wieder spielte auch der Vorwurf der Homosexualität eine entscheidende Rolle. Franz August Schnaedter, der Anfang der 1920er-Jahren in bündisch-nationalen Kreisen verkehrte, war über die Münchner SA zur Hitler-Bewegung gestoßen und 1926 der NSDAP beigetreten. Die RJF übertrug ihm im März 1933 die Gebietsführung in Sachsen. Nur kurz darauf erklomm er eine weitere Stufe der HJ-Karriereleiter und übernahm die Führung des mitteldeutschen Obergebiets „Mitte“, einen der höchsten hauptamtlichen Posten in der HJ-Hierarchie. Seit dem Frühjahr 1934 wurde er polizeilich gesucht. Der Verdacht: homosexuelle Übergriffe auf einen Schüler sowie gleichgeschlechtlicher Umgang mit mindestens einem Adjutanten. Martin Ludwig, der ihn als Gebietsführer im März 1934 beerbt hatte, aber mittlerweile seines Postens ebenfalls wieder enthoben war, sagte gegenüber den Ermittlern gegen Schnaedter aus. Er nannte außerdem Namen von weiteren Personen, mit denen der frühere Obergebietsführer
500 Postert, Hitlerjunge Schall, S. 277. 501 Vgl. Alexander Lande, Jungkommunisten – Meuten – Broadway-Cliquen. Drei Jugend generationen zwischen Resistenz und Widerstand in Leipzig. In: Francesca Weil/ Günther Heydemann/Jan Erik Schulte (Hg.), Sachsen und der Nationalsozialismus, Göttingen 2014, S. 335–348, hier 343 f. 502 Postert, Hitlerjunge Schall, S. 275. 503 Ebd., S. 241.
Von der Bewegung zum Apparat
133
angeblich verkehrt hatte.504 Ludwig denunzierte nicht grundlos. Im Zuge des „Röhm-Putsches“ hatte man auch ihn am 30. Juni 1934 verhaftet und in das KZ Colambiahaus in Berlin verschleppt. Dort war er offenbar für etwa einen Monat interniert. Ebenfalls als Homosexueller diffamiert, von der Polizei mutmaßlich unter Druck gesetzt, kooperierte er zum Jahresende mit den Beamten, welche seit einigen Monaten Material gegen Schnaeder zusammentrugen.505 Letzterer war während seines Prozesses bemüht, sich als Opfer einer perfiden Intrige zu präsentieren. Schnaedter stritt vor Gericht ab, homosexuell oder gar übergriffig geworden zu sein. Der frühere Obergebietsführer kam für mehrere Jahre in Haft und zog sich nach der Freilassung in das Privatleben zurück. Auch Martin Ludwig gelang die Rehabilitierung nicht. Der Sturz der beiden hochrangigen mitteldeutschen HJ-Führer war einer der größten Skandale der Parteijugend in den ersten Jahren der Diktatur, obgleich es vergleichbare Fälle in anderen Regionen gab. Bedeutung fiel der Verhaftung Schnaedters insbesondere deshalb zu, weil sich die RJF ihre regionalen Führungen in Zukunft direkt zu unterstellen und dem HJ-Führerkorps weitere Befugnisse aus der Hand zu nehmen begann.506 Sachsen war in besonderer Weise umkämpft. Nahezu zeitgleich zur Absetzung Ludwigs und Schnaedters sorgte die Ermordung Karl Lämmermanns in Plauen am 1. Juli 1934 für Aufregung. Der Unterbannführer, ein Gymnasialschüler, kam aus der evangelischen Freischar, war also einer der sogenannten Bündischen, denen die „alten Kämpfer“ der NS-Bewegung mit Misstrauen begegneten. Lämmermann fiel offenbar der Denunziation seines Vorgesetzten zum Opfer. Dieser bezichtigte ihn, alte bündische Weggefährten zu protegieren, welche die Hitlerjugend angeblich unterwanderten. Abermals stand in diesem Fall eine angebliche Homosexualität im Raum. Den Mord an dem Plauener Gymnasiasten in der „Nacht der langen Messer“ griffen die Exilund Auslandsmedien kurz drauf intensiv auf.507 Die schwer zu durchschauenden Führungskämpfe waren zahlreich, gerade in der Aufbau- und Reorganisationsphase, obgleich sie nicht überall wie in Sachsen eskalierten. In Aachen sorgte im September 1934 die Absetzung eines 504 Vgl. die Ermittlungsakte zu Schnaedter, insbesondere die Aussagen Ludwigs im Nachtragsbericht des Kriminalamtes vom 22.12.1934 (HStA Dresden, 10789: Polizeipräsidium Dresden, 722, Bl. 10 f.); zur Ernennung Ludwigs als HJ-Gebietsführer Sachsens siehe Martin Ludwig. In: Der Freiheitskampf vom 26.3.1933; sowie Aus der Hitler-Jugend. In: ebd. vom 19.3.1934. 505 Kurzbiografien zu Ludwig und Schnaedter bei Buddrus, Totale Erziehung, Band 2, S. 1 182 und 1 208. 506 Vgl. die Prozessakte mit Urteilsbegründung vom 14.11.1935, sowie entsprechende Schriftsätze der Verteidigung und seine eigene Aussage (StA Chemnitz, 30071: Zuchthaus Zwickau, 19804, Bl. 3–25 und 36–45); Auch in der HJ wird aufgeräumt. Verfügung des Reichsjugendführers. In: Der Freiheitskampf vom 5.7.1934. 507 Ein Opfer des 20. Juni. In: Freie Stimme vom 18.8.1934. Vgl. zum Fall Friederike Hövelmans, Zwischen Weimarer Republik und Zweitem Weltkrieg. Die bürgerliche Jugend in Sachsen am Beispiel der Sächsischen Jungenschaft. In: Heydemann/Schulte/Weil (Hg.), Sachsen und der Nationalsozialismus, S. 319–335, hier 344; Lange, Meuten. Leipziger Jugendgruppen im Dritten Reich, S. 62; Kollmeier, Ordnung und Ausgrenzung, S. 170.
134
Genese einer Massenorganisation
HJ-Bannführers wegen vermeintlicher Verfehlungen für Tumulte. Ihm loyale Unterführer ließen sich aus Protest beurlauben. In einem Lokal entlud sich die Stimmung gegen den unbeliebten Gebietsführer, dem man Vetternwirtschaft vorwarf.508 Mit der Mord- und Verhaftungswelle vom 30. Juni 1934 gegen Ernst Röhm und die SA-Führung, die Hitler den Zuspruch der Reichswehr sicherte, entluden sich die Intrigen in der HJ mit Gewalt. Reinhard Heydrich hatte, bezugnehmend auf Paragraph 175 im Strafgesetzbuch, der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellte, am frühen Morgen des 1. Juli den Befehl erteilt, „alle 175er HJ-Führer und Schweine genau im Sinne der SA-Säuberungsaktion“ zu behandeln.509 Einige nutzten den Befehl, um private Rechnungen zu begleichen. Vermeintliche oder tatsächliche Homosexualität konnte schnell zum Vorwand werden, um Rivalen beiseite zu räumen. Waldemar Epp, damals im Danziger Jungvolk in leitender Funktion tätig, berichtete: „Ein verdächtiger Jungbannführer aus Danzig wurde auf die Oberbannführung bestellt, wo er in einen kleinen völlig verdunkelten Raum geführt wurde. Dort standen etwa 8 vermummte Gestalten, die ihm die Uniform vom Körper rissen und ihn über einen Holzblock legten. Zwei Gestalten schlugen mit Lederpeitschen auf den nackten Hintern, bis die Haut platzte. […] Er wurde solange geschlagen, bis er gestand, sich an Hitlerjungen vergangen zu haben – meines Wissens wurden damals von etwa 25 bis 30 Jungbannführern in Danzig und Ostpreußen 16 oder 17 auf ähnliche Art zu Geständnissen gezwungen.“510 Tatsächlich scheint sich in Danzig im Juli 1934 die Lage wie an nur wenig anderen Orten auf schauerliche Weise zugespitzt zu haben. Auch diese Vorgänge griff die Oppositionspresse später auf. Der Fall eines auf seiner Danziger Dienststelle gefolterten HJ-Führers beschäftigte dann 1936 auch die Oberstaatsanwaltschaft.511 Die Mordwelle im Zuge des „Röhm-Putsches“ war für die Hitlerjugend nicht nur von Belang, weil Fehden, Rivalitäten und Denunziationen blutig eskalierten. Die Parteijugend löste sich fortan von ihrer einst engen Bindung an die SA, erhielt im Alltag zudem mehr Eigenständigkeit, während zugleich der Einfluss der SS immer weiter zunahm – mit Blick auf den SRD, die antisemitisch-rassistische Schulung, später bei der skrupellosen Rekrutierung für die Waffen-SS, vor allem aus der Motor-HJ.512 508 Vgl. Lagebericht der Staatspolizeistelle für den Regierungsbezirk Aachen, Mitte September vom 6.10.1934. In: Bernhard Vollmer, Volksopposition im Polizeistaat. Gestapound Regierungsberichte 1934–1936, Stuttgart 1957, S. 94–104, hier 102 f. 509 Zit. nach Burkhard Jellonnek, Homosexuelle unter dem Hakenkreuz. Die Verfolgung von Homosexuellen im Dritten Reich, Paderborn 1990, S. 94. 510 Bericht von Waldemar Epp vom Juli 1974, S. 4 (Archiv des IfZ München, ZS 3058, 1). 511 Vgl. knapp Kollmeier, Ordnung und Ausgrenzung, S. 170; Christoph Pallaske, Die Hitlerjugend der Freien Stadt Danzig 1926–1939, Münster 1990, S. 130 f. 512 Diesem wichtigen Themenkomplex kann im Rahmen des Buches nicht nachgegangen werden. Die Befehlsblätter und Gebietsbefehle enthalten zahlreiche Anweisungen und Anordnungen über die Zusammenarbeit mit SS und Sicherheitsdienst (SD) sowie zur Werbung der Waffen-SS innerhalb der Hitlerjugend. Siehe als Auswahl: Einsatz von Schulungsmaterial der SS in der weltanschaulichen Schulungsarbeit. In: GB: Nordsee, 8/37 vom 18.5.1937; Werbung für die Waffen-SS. In: GB: Westmark, 7/43K vom 12.4.1943; Werbung der Waffen-SS. In: GB: Franken, 6/42 vom 6.1942; Motor-HJ und Nachwuchs für die motorisierte Waffen-SS. In: GB: Hessen-Nassau, 4/42K vom 4.1942.
Von der Bewegung zum Apparat
135
Die internen Machtkämpfe konnten junge Menschen und einfache Mitglieder, die 1933 zur Hitlerjugend hinzugestoßen waren, gewiss nicht durchschauen, sofern sie überhaupt davon erfuhren. Die Kritik an der Art und Weise der Gleichschaltung, die mit einem Umbau der NS-Jugendbewegung einherging, war allerdings grundsätzlicher Art. Bei den älteren Unterführern war sie weit verbreitet und von größerer Bedeutung als jene Schatten, welche die privaten Machtkämpfe auf die Parteijugend warfen. Für die RJF und das höhere Führerkorps stellte die Grundsatzkritik eine höchst unangenehme Erscheinung dar. Die Unzufriedenheit der alten Garde wurde offen thematisiert und ist in den Parolen der HJ-Funktionäre vielfach gespiegelt. Man dürfe sich die Parteijugend nicht wie irgendeinen beliebigen Verein vorstellen, unterstrich beispielsweise die Führung im Gebiet Mittelrhein 1934, um die Basis zu beschwichtigen. Jene Spießbürger, die glaubten, sie müssten nur ein Beitragsgeld entrichten, würden ansonsten aber in Ruhe gelassen, werde man umgehend wieder an die Luft setzen. Die Hitlerjugend sei weiter ganz auf Revolution geeicht. „Hitlerjugend bleibt Hitlerjugend“, sollte die Parole nach 1933 lauten: „Hitlerjugend bleibt, was sie immer war, bleibt Hitlerjugend, auch wenn sich alles um sie ändern sollte.“513 Man warb um Verständnis für den Umbau der Jugendbewegung und blieb umso mehr der revolutionären Tonlage treu. Nicht „verkalkte Gehirnakrobaten“ sollten „unter dem Mantel der Gleichschaltung richtungs- und maßgebend sein“, lautete das Versprechen der HJ-Funktionäre im Rheinland, denn wahrhaft „nationalsozialistisch denken und fühlen“ könnten schließlich nur diejenigen, „die in der Zeit der Verfolgung mit der Fahne […] gebangt, gehofft und gelitten“ hätten.514 Fast gleichlautend betonte Heinz Deinert, der Gebietsführer von Ruhr-Niederrhein während einer Rede in Dinslaken im Hochsommer 1935: Der Jugendbewegung sei weiterhin „jener revolutionäre Kampfgeist eigen, mit dem die alte Garde die Macht in Deutschland erobert“ habe.515 Solche Töne waren eine Konzession an das latente Revolutionsfieber der Hitlerjugend. Das Rumoren in Teilen der Basis wurde immer mal wieder deutlich vernommen. Im Herbst 1934 hatte man den Jungvolkführer von Berlin, Günther Dames, abgesetzt. Auch den Jungbannführer von Berlin-Ost, der in Ungnade gefallen war, wurde seines Postens enthoben.516 In Berlin griff erneut Unmut mit der RJF um sich. Der Gebietsführer Erich Jahn, der Ende der 1920er-Jahre die Berliner HJ aufzubauen begonnen hatte und bis November 1934 in dieser Funktion tätig blieb, wurde von der RJF aufgefordert, dass er die jungen Nörgler zur Raison bringen solle: „Durch verschiedene Klagen“, wie Jahn befand, „sehe ich mich veranlasst, zu befehlen, dass jede dumme Redensart, die einzelne Kameraden gebrauchen und dabei […] unberechtigte Vorwürfe machen, zu unterlassen 513 Hitlerjugend bleibt Hitlerjugend. In: Rheinische Hitlerjugend. Organ der HJ Gebiet Mittelhrein, 5/34, o. D. 514 In das Jahr der inneren Umgestaltung. In: Die Fanfare, (1934) 1, S. 1. 515 Gegen die Kritik der Spießer. In: Die Fanfare. Gebiet Ruhr-Niederrhein, (1935) 7, S. 2. 516 Gebietsjungvolkführer. In: BB: Berlin, 58/34 vom 5.10.1934; Führer des Jungvolks im Oberbann Berlin-Ost. In: ebd., 60/34 vom 19.10.1934.
136
Genese einer Massenorganisation
ist. Ich sehe mich gezwungen, bei Wiederholung solcher Vorfälle gegen den Verantwortlichen vorzugehen.“517 Die Unzufriedenheit war in HJ und DJ durchaus verbreitet, weit weniger im BDM, dessen Aufbau und Wachstum nach 1933 erst einsetzte. Die Hitlerjugend blieb, was die männlichen Gliederungen betraf, bis Mitte der 1930er-Jahre ein umkämpftes und fragiles Gebilde. Die wenigsten stellten den Staat infrage. Enttäuschung über die Entwicklung der Hitlerjugend ist also nicht mit Opposition zu verwechseln. Der Unmut war für die RJF gleichwohl ein Problem. Artur Axmann machte die Konflikte in seinen Memoiren zum Thema: Die Entscheidungen der RJF seien unter Kameraden oft nicht auf Zuspruch gestoßen. Ja, es sei nicht immer leicht gewesen, ihnen den „rechten Platz beim Aufbau zuzuweisen“ – und erst mit der Besserung der Arbeitsmarktsituation habe man die Kritiker schrittweise beschwichtigen können.518 Die RJF reagierte in dieser Phase mit Gesten und Symbolik. Das „Goldene HJ-Abzeichen“, eine symbolische Ehrung für ältere Kameraden, konnte ab 1934 beantragen, wer in „Kampfzeiten“ zur Bewegung gefunden hatte.519 Auch das Traditionszeichen an der Uniform wies diese älteren Kämpfer aus. Diese Zeichen trug übrigens nur eine verhältnismäßig geringe Zahl: Aus dem gesamten Gebiet Westmark besaßen 1937 nur 1 048 Personen die Berechtigung zum Tragen von Traditionszeichen. Mehrheitlich waren es junge Männer, die 1931/32 in die HJ eingetreten waren und nun bei HJ oder Jungvolk als Führer agierten.520 Bei Neuaufnahmen in die Hitlerjugend wurde die „Alte Garde“ stets geladen, um – wie die Gauleitung Sachsen formulierte – ihrer „zu gedenken und dadurch […] dem Nachwuchs aus der HJ ein Vorbild zu geben“.521 Ab Ende 1935 wurden – im Gegensatz zu dem, was Reichsjugendführer Schirach zuvor ablehnendes über Pfründe und Privilegien propagiert hatte – ältere Hitlerjungen in jene Sonderaktionen einbezogen, die eine bevorzugte Behandlung bei der Arbeitsplatzvergabe ermöglichte. Bis dahin hatten Tausende HJ-Führer nicht profitiert, weil Privilegien nur Parteimitgliedern zustanden. „Damit dürfte diese brennende Frage […] gelöst sein“, wie man den arbeitslosen Jung-Nationalsozialisten versprach: „Es ist dafür zu sorgen, dass in der ersten Hälfte des Jahres 1936 unsere Kameraden […] an die für sie geeigneten Arbeitsplätze gestellt werden. Es darf Mitte des Jahres 1936 keinen dieser HJ-Kameraden mehr
517 Reichsjugendführung. In: BB: Berlin, 62/34 vom 2.11.1934. Zu Jahn vgl. auch Baldur von Schirach, Die Pioniere des Dritten Reiches, Essen 1933, S. 117 f. 518 Vgl. Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 89 f. 519 Vgl. Brandenburg, Die Geschichte der HJ, S. 164. 520 Vgl. die vollständige Auflistung der Personen mit Name und Eintrittsdatum bei Berechtigte zum Tragen des Traditionsabzeichens. In: GB: Westmark, A7/37 vom 1.6.1937. 521 NSDAP, Gauleitung Sachsen, Rundschreiben Nr. III/28 vom 3.11.1936 (KreisA Pirna, Gemeinde Lichtenhain, 109, Bl. 96 f.). Ab 1937 wurde die Bezeichnung „alte Garde“ der Hitlerjugend verboten, da diese Begrifflichkeit „allein der Alten Garde des Führers vorbehalten“ sein sollte. „Alte Garde der HJ und des DJ“. In: GB: Saarpfalz, A17/37 vom 20.12.1937.
Von der Bewegung zum Apparat
137
geben, der noch ohne Arbeitsplatz ist.“522 Wer sich für den Landdienst meldete, bekam das Versprechen, „aus der Gruppe heraus […] in Arbeits- oder Lehrstellen“ vermittelt zu werden.523 Wie wichtig der symbolische Paternalismus war, zeigt sich gelegentlich in Tagebüchern oder privaten Briefen jener, die den sozialrevolutionären Impetus der Kampfjahre tief verinnerlicht hatten. Der Schwung von einst sei nicht mehr da, meinte Franz Schall 1934, „und ich selbst ringe schwer um jene unbekümmerte Frische, die uns einst tagtäglich neue Ideen und daraus neue schöpferische Taten entstehen ließ.“524 Die HJ-Angehörigen blieben in latenter Revolu tionsstimmung. An die jungen Dauerrevolutionäre gerichtet warb Schirach um Verständnis. Man dürfe die RJF nicht mit irgendeiner Reichsbehörde gleichsetzen, nichts anderes in ihr sehen „als den Umtransport von blauen Aktendeckeln von einem Reichsbüro in ein anderes“. Die RJF sei der institutionelle Beweis dafür, dass in Hitlers Staat „die Jugend […] dessen Anerkennung errungen“ habe.525 Der Konflikt der Generationen sollte nun beigelegt sein, die Jugend ihr Recht auf Teilhabe durchgesetzt haben. Schirach versprach, „die aus der nationalsozialistischen Kampfzeit geprägten […] Begriffe […] auch in Zukunft“ beizubehalten, keinen „riesigen Beamtenapparat aufzubauen“ sowie die „Verbindung zwischen der Jugend draußen und der Führung der Gesamtorganisation“ nicht abreißen zu lassen.526 Doch die Hitlerjugend war längst im Wandel.
522 Sonderaktion für alte Kämpfer. In: GB: Sachsen, 1/36 vom 5.2.1936; Unterbringung von alten Kämpfern der HJ [in Lehrstellen]. In: GB: Westmark, A2/37 vom 27.2.1937. Vgl. im Gegensatz dazu Schirach, Idee und Gestalt, S. 73: „Der Hitlerjunge soll es im Leben nicht leichter haben als jeder andere Junge auch. Er erhält den Lohn für seine Treue und für seinen Einsatz durch sein eigenes Bewusstsein. Er muss es aus Stolz ablehnen, in seiner beruflichen Tätigkeit wegen eines Dienstes gefördert zu werden, den er für Deutschland und für nichts anderes getan hat.“ 523 Landdienst-Führer. In: GB: Westmark, A9/37 vom 1.7.1937. 524 Postert, Hitlerjunge Schall, S. 313. 525 Baldur von Schirach, Der politische Weg der HJ. In: ders., Revolution der Erziehung. Reden aus den Jahren des Aufbaus, 3. Auflage München 1942, S. 37–44, hier 38. 526 Ebd., S. 41.
II. Anspruch und Realität der Hitlerjugend 1.
Die prekäre Hitlerjugend
1.1
Korruption, Unterschlagung, Bettelei
Die Erziehung in der Hitlerjugend zielte auf die Schaffung eines neuen Menschentypus: Gehorsam, treu und aufopferungsvoll sollte sich der junge Mensch in die „Volksgemeinschaft“ einordnen, das Persönliche stets hinter dem Großen zurücktreten. In der Hitlerjugend verkörpere sich – wie Reichsjugendführer Schirach schrieb – ein „Programm der Selbstlosigkeit“.1 Auch für die weib liche Jugend galt nichts anderes: „Neben dem Jungen steht das Mädel, genauso eingespannt, genauso gefordert, genauso selbstverständlich.“2 Die Propaganda zeichnete nach 1933 unermüdlich das Bild der aufopferungsvollen Hitler jugend. Zeitzeugen, im Rückblick nostalgisch geworden, wollen sich als Idealisten sehen. Jene Disziplin wird hervorgehoben, die angeblich geherrscht habe. Manchmal scheint es, als wirkten die Parolen weiter nach, wenn gar die Jugend der Gegenwart einem angeblichen Idealbild von damals entgegengesetzt wird: „Es kann nicht jeder leben, wie er will. Wenn [man] in der Gemeinschaft lebt, muss man sich auch unterordnen. Und das fehlt heute in vielen Fällen.“3 Aber waren diese Ideale wirklich die Alltagsrealität der Partei- und Staatsjugend? Im Folgenden soll es um die andere Seite der Hitlerjugend gehen. Ein Problem unmittelbar nach 1933 und in der Phase der Reorganisation war, wie bereits kurz erwähnt, die verbreitete Korruption. Schon in den 1920er- Jahren waren Vorwürfe auch in der HJ im Umlauf; selbst ihr Gründer Kurt Gruber wurde von internen Kritikern der schamlosen Bereicherung bezichtigt.4 Die Exil-SPD trug nach 1933 weiterhin viele Negativberichte über die HJ-Führung zusammen: Ab und an ging es um Gerüchte, die in der Bevölkerung die Runde machten, welche mit Diebstählen oder der Unterschlagung durch Funk tionäre zu tun hatten. Ein typischer Antifa-Bericht aus Sachsen vom Februar 1935: „In den Leitungen […] herrscht grenzenlose Korruption. […] In fast allen sächsischen Städten sind in letzter Zeit aus den Leitungen von Hitlerjugend und Bund deutscher Mädel führende Persönlichkeiten wegen Korruption
1 2 3 4
Schirach, Idee und Gestalt, S. 71. Freizeitlager zwingen zur Gemeinschaft. In: Das Deutsche Mädel. Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ, (1935) 7, S. 1. Transkript eines hier anonymisierten Zeitzeugeninterviews vom 19.7.2001, Teil 2, S. 7 (USHMM, Oral History Collection, RG-50.486.0020). Ein derartiger Bericht über Kurt Gruber, der sich auf interne Kritiker stützte, abgedruckt unter dem Titel: Ein würdiger Nazi-Bonze. Er versäuft die Groschen der Hitler-Jugend. In: Tagblatt. Organ für die Interessen des werktätigen Volkes vom 15.4.1931.
140
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
a usgeschlossen worden.“5 Solche Berichte entsprangen nicht allein oppositionellem Wunschdenken, waren nicht zwecks Gegenpropaganda frei erfunden. Die BDM-Führerin in Chemnitz, auf die sich dieser Bericht bezog, war Wochen vorher wegen Unterschlagung und Untreue festgenommen und von der RJF aus der Hitlerjugend ausgeschlossen worden. Eine „beunruhigend große Zahl“ anderer „sehr bedauerliche Vorkommnisse“, die der Lagebericht der Gestapo im selben Zusammenhang erwähnte, würden die „Eltern und Erzieher […] stark bewegen“.6 In Berlin wurden im Herbst 1934 in nicht einmal zwei Monaten rund 30 untere HJ-Führer aus der Organisation ausgeschlossen; die meisten entweder wegen Korruption, Diebstahl oder Unterschlagung von Beiträgen.7 Erst Monate später begann die RJF damit, diese Ausschlüsse in einer Warnkartei zu erfassen. Zurückliegende Fälle wurden nicht nachgetragen. Zudem kam es selbst in der späteren Kriegszeit noch vor, dass untere Dienststellen Streichungen und Ausschlüsse vornahmen. Darüber durften eigentlich nur die Gebietsführungen oder die RJF entscheiden. Es sei mehrfach festgestellt worden, hieß es z. B. Ende 1936 in Franken, dass die Unterführer „aus irgendwelchen Anlässen den Jungens die Ausweise zerrissen haben, mit dem Hinweis, sie seien aus der HJ ausgeschlossen. Ich mache darauf aufmerksam, dass Ausschluss aus der HJ nur auf dem Dienstweg erreicht werden kann.“8 Das wahre Ausmaß gerade für die Phase der „Machtergreifung“ liegt aus verschiedenen Gründen im Dunkeln.9 Finanzielle Delikte sowie Diebstahl und Betrug begründeten – neben Fällen mit sexuellem Hintergrund – bis Kriegsende das Gros der durch die RJF entschiedenen Ausschlüsse: die Gebiete Berlin, Ruhr-Niederrhein, Sachsen, Hessen-Nassau und Westfalen lagen an der Spitze.10 Die meisten, die sich disziplinarischer Verfehlungen oder kleinkrimineller Delikte schuldig machten, 5 Aus einem Bericht über antifaschistische Aktionen in Lagern des Arbeitsdienstes und der Landhilfe in Sachsen vom Februar 1934. In: Jahnke (Hg.), Eine Dokumentation, S. 217–219, hier 218. 6 Der Kreishauptmann zu Chemnitz, Sonderbericht zu Punkt 6: NSDAP und ihre Gliederungen, an das Ministerium des Innern vom 10.1.1935 (BArch R58, 3731, Bl. 37 f.). 7 Ausschlüsse aus der Hitlerjugend seit September 1934. In: BB: Berlin, 62/34 vom 11.1934. Diverse weitere Anordnungen sind überliefert, wie ebd., 76/35 vom 2.1935, bezüglich „schwarzer Konten“ oder ebd., 82/35 vom 4.1935, über Unterschlagung. 8 Mitgliedsausweise. In: GB: Franken, 9/36 vom 12.1936. 9 Vgl. Kollmeier, Ordnung und Ausgrenzung, S. 99–109 und Statistik über karteimäßig erfasste „Warnfälle“ 1933–45 auf S. 309. Zur Praxis und Dunkelziffer der Ausschlüsse seitens niederer Dienststellen vgl. die Anweisung Streichungen aus der Hitlerjugend. In: GB: Berlin 7/37 vom 1.4.1937: „Es muss immer wieder festgestellt werden, dass untergeordnete Einheiten [Jugendgenossen] aus der Hitler-Jugend ausschließen bzw. Streichungen vornehmen. Ich weise hierdurch nochmals darauf hin, dass grundsätzlich nur […] Ausschlüsse durch die Reichsjugendführung bestätigt werden können.“; oder Bemerkungen zur Jugenddienstpflicht. In: Gebiets- und Obergaubefehl: Westfalen, K44/40 vom 5.12.1940: „Es sind auf jeden Fall alle Bescheinigungen einzuziehen, wo irgendein Gefolgschaftsführer […] oder sonstige Dienststellen der HJ den Ausschluss bzw. das Ausscheiden […] verhängt haben. Hierfür allein zuständig ist das HJ-Gericht bzw. die Gebietsführung.“ 10 Vgl. Aufstellung bei Kollmeier, Ordnung und Ausgrenzung, S. 313–316.
Die prekäre Hitlerjugend
141
wurden nicht gleich vor die Tür gesetzt. Sie sollten auf disziplinarischem Weg zur Besserung erzogen werden. Im Normalfall bedurfte es der Verwarnungen, bevor die Unterführer einen Antrag auf Ausschluss stellen konnten. Bei kleinkriminellen Delikten und Disziplinlosigkeit entschied man im Einzelfall.11 Im Juli 1934 war eine Polizeiverbindungsstelle in der RJF eingerichtet worden, von der man sich eine bessere Kommunikation bei der Verfolgung von Straftaten erhoffte.12 Die Gebiete besaßen eigene Verbindungsstellen, die Fahndungen weitergaben, sofern es sich bei den Betroffenen um HJ-Mitglieder handelte.13 Anders als die RJF Glauben machte, nahmen Straftaten Jugendlicher durch den angeblich positiven Einfluss ihrer Jugendorganisation nicht ab. Die Gesamtzahl stieg ab 1934 sogar von rund 12 300 Straftaten auf 24 562 im Jahr 1937; die polizeiliche Verfolgung der Opposition spielte, anders als in den Kriegsjahren, eine eher untergeordnete Rolle.14 In München waren 1935 bei den verurteilten Straftätern unter 21 Jahren immerhin 30,5 Prozent in den Gliederungen der Partei organsiert.15 In Chemnitz gingen im Juni und Juli 1935 von den statistisch erfassten Eigentumsdelikten 61 auf HJ-Angehörige zurück; außerdem 39 Gewalt- und sonstige Delikte.16 Die örtliche BDM-Führerin war Anfang 1935 wegen Untreue und Unterschlagung abgesetzt worden.17 Die Lageberichte der Gestapo machten aus solchen Vorkommnissen keinen Hehl. In Köln liefen Anfang Januar 1935 „eine ganze Reihe von Strafverfahren gegen Unterführer der HJ wegen Unterschlagung, Betrug und Urkundenfälschung. Diese Vorgänge sind in der Bevölkerung“, wie der Bericht betonte, „nicht unbekannt geblieben und haben zur Folge gehabt, dass eine nicht unbeachtliche Zahl von Austritten […] zu verzeichnen war.“18 Aus Sicht der RJF unerträglich, wenn etwa Kassierer in örtlichen Dienststellen oder Formationen mittels „schwarzer Kassen“ und 11 Vgl. Streichungen aus den Listen der HJ. In: GB: Hessen-Nassau, A9/37 vom 10.8.1937. 12 Vgl. Armin Nolzen, Der Streifendienst der Hitler-Jugend (HJ) und die „Überwachung der Jugend“, 1934–1945. Forschungsprobleme und Fragestellungen. In: Christian Gerlach (Hg.), Durchschnittstäter. Handeln und Motive, Berlin 2000, S. 13–52, hier 17. 13 Vgl. die Meldungen der Verbindungsstellen in den Ausgaben „B“ der GB, u. a. Fall eines Motoraddiebstahls durch einen HJ-Unterführer. In: GB: Hessen-Nassau, B/15/37 vom 15.6.1937. 14 Vgl. Michael Hepp, „Bei Adolf wäre das nicht passiert“? Die Kriminalstatistik widerlegt eine zählebige Legende. In: Zeitschrift für Rechtspolitik, 32 (1999) 6, S. 253–260, hier 258. 15 Vgl. Klaus Seibert, Die Jugendkriminalität Münchens in den Jahren 1932 und 1935, Leipzig 1937, S. 41. 16 Bericht der Abt. Innerpol. Abwehr der Gestapo für Sachsen im Juli 1935, o. D., S. 32 (BArch Berlin, R58, 3751, Bl. 67–161). Auf S. 31 heißt es ferner: „Gerade die kriminellen Vergehen […] bilden besonders in ländlichen Bezirken eine schwere Gefahr für das Ansehen der Bewegung. Sie werden von den Staatsfeinden aller Richtungen durch Erzählen von Mund zu Mund verbreitet.“ 17 Kreishauptmann Chemnitz, Sonderbericht, Punkt 6: NSDAP und ihre Gliederungen vom 10.1.1935 (ebd., R58, 3731, Bl. 37 f.). 18 Lagebericht der Gestapostelle Köln für Januar 1935 vom 4.2.1935. In: Anselm Faust/ Bernd A. Rusinek/Burkhard Dietz (Hg.), Lageberichte rheinischer Gestapostellen, Band II/1, Düsseldorf 2015, S. 76–99, hier 95.
142
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
„Sonderumlagen“ Geld unterschlugen oder illegal einsammelten.19 Häufig kam das sogar im Kreise des hauptamtlichen Führerkorps vor. In Eichsfeld wurde 1934 der örtliche Bannführer seines Postens enthoben und aus der Partei ausgeschlossen, weil er Gelder veruntreut hatte.20 Dem im Februar 1936 verhafteten Gebietsführer von Hessen-Nassau, Walter Kramer, der zudem als Abgeordneter im Reichstag saß, wurden seine vermeintliche Homosexualität sowie finanzielle Bereicherung und „bündische“ Aktivitäten vorgeworfen.21 Alfred Loose, Leiter der RJF-Verwaltungsabteilung, wurde 1934 vor die Tür gesetzt und später in ein KZ verschleppt, auch weil er sich und Günstlingen hohe Gehälter gezahlt haben soll.22 Und in Berlin wurde Ende 1935 der Verwaltungsleiter des Gebiets verhaftet. Auch ihm warf man vor, hohe Summen entwendet zu haben.23 Der Gebietsführer und spätere Reichsjugendführer Artur Axmann widmete in seinen apologetischen Memoiren diesem Vorfall einige Seiten. Denn Schirach habe ihn damals fast seines Amtes enthoben; angeblich hatte der Geldverwalter der Berliner Hitlerjugend ihn mit Aussagen belastet und in die Straftaten hineinzuziehen versucht. „Vor Empörung schlug ich auf seinen Schreibtisch und sprach erregt auf ihn ein“, schildert Axmann das damalige Treffen mit Schirach pathetisch, „dass meine Mutter 16 Jahre lang in der Fabrik arbeiten gegangen ist, dass meine Brüder arbeitslos waren und wir in dieser Notzeit keinen Pfennig unrechtmäßig erworben hätten. Und jetzt wurde ich verdächtigt, unlauter gehandelt zu haben.“24 Axmann wähnte sich als Opfer einer Intrige, die in der RJF von seinem Rivalen, Stabschef Hartmann Lauterbacher, gegen ihn gesponnen worden sei. Zwischenzeitlich war aber sogar Schirach selbst zum Objekt derartiger Gerüchte geworden. Im August 1934, unmittelbar nach dem „RöhmPutsch“, hielt sich die Mär, der Reichsjugendführer „habe Unterschlagungen begangen, sei verhaftet worden und habe Selbstmord verübt“. Das Regime wies die Presse an, eine Rede Schirachs in aller Ausführlichkeit abzudrucken, um die
19 Vgl. beispielhaft Lagebericht der Gestapostelle Trier für September 1935 vom 5.10.1935. In: ebd., S. 1110–1116, hier 1111; Wie die Führer aussehen. In: Der Neue Vorwärts vom 11.2.1935; Bericht aus dem Rheinland, A 93. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 3 (1936), S. 240. Im GB: Oberschlesien, K2/41 vom 19.5.1941 wurde vor dem Führen „schwarzer Kassen“ noch in der Kriegszeit gewarnt; im GB: Westmark, 1/38 vom 15.1.1938 wurden „Sonderumlagen“ thematisiert, was zu unstatthaften Zwecken gesammelte, eingeforderte oder erworbene Gelder meinte. 20 Vgl. Mathias Degenhardt, Der Aufbau der Hitlerjugend von 1933 bis 1936 im Eichsfeld. Anmerkungen zur NS-Jugendorganisation anhand von Pressequellen. In: Eichsfeld-Jahrbuch, 24 (2016), S. 221–265, hier 241. Unter Stärkemeldung. In: GB: Westmark, 3/37 vom 15.3.1937 wurde beklagt, dass die Beitragsabrechnungen einzelner Einheiten oft nicht ihren Stärkemeldungen übereinstimmten. Es würden „Phantasiezahlen“ angegeben. 21 Vgl. Bericht aus dem Rheinland, A 93. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 3 (1936), S. 240; Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 378; Hellfeld, Bündische Jugend und Hitlerjugend, S. 101. 22 Bericht aus Berlin, A36. In: ebd., 1 (193) , S. 537; Korruptisten. In: Der Neue Vorwärts vom 30.9.1934. vgl. auch Kollmeier, Ordnung und Ausgrenzung, S. 182. 23 Ebd., S. 184. 24 Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 239.
Die prekäre Hitlerjugend
143
Unsinnigkeit dieser Gerüchte zu entlarven.25 Dass diese Geschichte überhaupt geglaubt wurde, hatte mit diversen Vorfällen zu tun, welche die Hitlerjugend belasteten. Die jungen Angehörigen verhielten sich nicht immer gemäß der Vorgaben, gerade in der Aufbau- und Reorganisationsphase nicht, als eine lückenlose Kontrolle durch ihre höheren Dienststellen nur begrenzt möglich war. Die Verbindungsstellen der Gebiete schrieben regelmäßig Fahndungen nach Hitlerjungen und Unterführern aus, die sich beispielsweise des Diebstahls oder Betrugs schuldig gemacht hatten und untergetaucht waren.26 Zur Erklärung gehört der Hinweis, dass vor allem „alte Kämpfer“, aber auch jene, die frisch in die Organisation aufgenommen worden waren, vielfach in ökonomisch prekären Verhältnissen lebten. Unter den Jugendlichen im HJ-Alter war der Anteil arbeitslos gemeldeter Angestellter mit 12,8 Prozent im Sommer 1933 – im Vergleich zu anderen Altersgruppen – vergleichsweise niedrig.27 Das allein hieß nicht viel: Die Jugendarbeitslosigkeit ging im Vergleich zu anderen Altersgruppen langsamer zurück und die Bedrohung durch sozialen Abstieg war für junge Menschen real, vor allem wenn die eigene Familie von der Krise getroffen war. Die Lage besserte sich nach der Weltwirtschaftskrise sukzessive, aber nicht schlagartig. In Hinblick auf die sozialökonomische Zusammensetzung ihrer Mitgliederbasis war die Hitlerjugend ein prekäres Gebilde. Die RJF setzte ein eigenes Sozialprogramm ins Werk, unterstützte den Aus- und Umbau des Freiwilligen Arbeitsdienstes oder schuf eigens Aktionsprogramme zur Arbeitsvermittlung und Berufsberatung. Regional und vor Ort versuchte die Parteijugend gelegentlich mit Nationalsozialistischer Volkswohlfahrt (NSV), NSDAP und Kommunen eigene sozialpolitische Projekte anzustoßen, um ihre Mitglieder in Lohn und Brot zu bringen. Zu diesem Zweck wurden auch die sogenannten HJ-Gefolg schaftssozialwarte eingesetzt, deren Erfolge allerdings überschaubar blieben.28 In Thüringen stand die Arbeitslosenversicherung für Lehrlinge – genannt „Notwerk der HJ“ – in den Jahren 1934/35 offenbar gleich mehrfach vor dem Aus.29 In Recklinghausen wurde die Dienststelle der Hitlerjugend bezeichnenderweise lange in einem Gebäude untergebracht, indem Arbeitslose umgeschult wurden.30 Und in Brandenburg musste man 1936 den Hitlerjugend-Einheiten 25 Presseanweisung ZSg. 101/4/82/690 vom 27.8.1934. In: Gabriele Toepser-Ziegert (Bearb.), NS-Presseanweisungen der Vorkriegszeit. Edition und Dokumentation, Band 2: 1934, München 1985, S. 334. 26 Vgl. beispielhaft die Fahndung nach dem „Herumtreiber“ Bruno D., welcher der Unterschlagung von Hitlerjugend-Geldern beschuldigt wurde: Warnung. In: GB: Saarpfalz, A2/37 vom 1.2.1937. 27 Vgl. hierzu und im Folgenden Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 505–515. 28 Vgl. Herbert Reyer, Aurich im Nationalsozialismus, Aurich 1989, S. 122–125; außerdem Einsetzung von Gefolgschaftssozialwarten. In: GB: Saarpfalz, A2/37 vom 1.2.1937. 29 Vgl. die Überlieferung zum „Notwerk der Thüringer HJ“ in den GB: Thüringen, insbesondere in den Jahrgängen 1934/35. 30 Vgl. Adolf Vogt, Vestische Hitlerjugend. Der „Bann 252 (Vest)“, Recklinghausen 2004, S. 28–30.
144
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
verbieten, Abfälle und Lumpen zu sammeln, die sie verkauften, um an Geld zu gelangen – angeblich, weil man um ihre Gesundheit fürchtete.31 Die sozialökonomisch prekäre Situation an der Basis ist also zu bedenken, betrachtet man die vielen Probleme der Organisation nach 1933. Die Parteijugend sollte, so lauteten ihr Anspruch und Ideal, zu gelebtem Sozialismus erziehen: „Wer in der Gemeinschaft der HJ eigennützig denkt“, hieß es in einem Schulungsheft, „der wird sich entweder bald ändern müssen oder er wird ausscheiden.“32 Die Mitglieder deuteten Sozialismus in einem ganz eigenen Sinne. Nicht nur in Einzelfällen kam es zu Unterschlagungen. Die Mitgliedsbeiträge wurden – gemäß dem Selbstführungsprinzip – durch junge Unterführer eingezogen. Einmal das Geld der Mitglieder oder ihrer Eltern in der Hand, war die Verlockung groß.33 Ein Phänomen, das die Funktionäre umtrieb, weil es dem hohen Anspruch der Hitlerjugend zuwiderlief, war das sogenannte Bettelunwesen. Der Begriff deutet bereits die Schwierigkeit an, die mit der retrospektiven Bewertung einhergeht. Bettelei wurde nicht nur in der HJ beklagt, sondern in der gesamten Partei. Das Vorgehen gegen sogenannte Bettler stand im engsten Zusammenhang mit der Ausgrenzung von Oberdachlosen und sogenannten Asozialen.34 In der Zeit des rapiden Anwachsens der Parteijugend nach 1933 fand es erstmals im internen Schrifttum der HJ Erwähnung. Zur Mitte des Jahrzehnts wurde es im Innendienst vielfach thematisiert. Unter das „Bettelunwesen“ fasste die Hitlerjugend allerdings sehr verschiedene Dinge: Bettelei Jugendlicher in Uniform aus persönlicher und familiärer Not, zum Zweck der Bereicherung oder auch zugunsten der eigenen Einheit. Es zählten beispielsweise nicht genehmigte Bittbriefe an Gemeinde, Bürgermeister oder Partei hinzu, mit denen die Unterführer um finanzielle Zuwendungen baten.35 Diese Bittbriefe waren verbreitet und in den ersten Jahren der Diktatur fielen sie in der Partei negativ auf. Die HJ-Unterführer benähmen sich undiszipliniert, erläuterte ein Lagebricht aus Magdeburg im Juli 1934. In Barby, einer Kleinstadt im Salzlandkreis, sei „der Bürgermeister in einer an Nötigung grenzenden Weise aufgefordert worden, der Hitler-Jugend sofort 500,- RM [Reichsmark] auszuzahlen, was selbstverständlich abgelehnt wurde. Der Führer dieser Jungen (18-jähriger Primaner) erzählte seinen Kameraden, dass er einmal zeigen wolle,
31 32 33 34 35
Vgl. Anweisung der Gesundheitsabteilung. In: BB: Kurmark, 6/37 vom 20.3.1936. Zit. aus Die Gefolgschaft, [o. J.] 7: Wochenend-Schulung. Sozialismus, S. 7. Vgl. Beitragseinzug der unteren Einheiten. In: GB: Berlin, 18/37 vom 1.12.1937. Vgl. ausführlicher Wolfgang Ayass, „Asoziale“ im Nationalsozialismus, Essen 1995. Lagebericht für Januar 1935 der Staatspolizeistelle für den Regierungsbezirk Aachen vom 6.2.1935. In: Vollmer, Volksopposition im Polizeistaat, S. 151–164, hier 163: „Eigene Mittel […] bleiben daher nicht übrig, sodass die HJ ebenso wie das Jungvolk und der BDM, bei denen die Verhältnisse ähnlich liegen sollen, auf Bitten und Betteln angewiesen sind. […] Aus dieser Sachlage heraus entstehen außer der gedrückten Stimmung dauernd Reibungen zwischen diesen Gliederungen und den Gemeindeverwaltungen, da der unumgängliche Bedarf nicht befriedigt werden kann.“
Die prekäre Hitlerjugend
145
wie man mit einem Bürgermeister umspringe.“36 Allerdings fasste die HJ-Führung gelegentlich sogar kleinkriminelle Betrügereien unter den vagen Begriff des Bettelunwesens. In Klein- und Großstädten kam es beispielsweise zu illegalen Sammelak tionen: Jugendliche, die als Hitlerjungen auf den Straßen um Gelder für diesen oder jenen Zweck warben, dafür aber auf Ausrüstung und Sammelbüchsen der Partei zurückgriffen. In Berlin verkauften Hitlerjungen Postkarten, vermeintlich im Auftrag von Partei oder RJF, um an Geld zu kommen; sie behielten das Geld für sich selbst. Eintrittsgelder für Elternabende oder Veranstaltungen wurden kassiert, obwohl das der Hitlerjugend untersagt war.37 In Uniform zog die Berliner Parteijugend zur großen Verärgerung der Gebietsführung bittstellend sogar durch die Kneipen.38 Jugendliche waren gewieft genug, um mit windigen Manövern ein Zubrot zu verdienen oder – die Spielräume der Revolution in ihrem Sinne auslegend – Vorteile für sich und ihre Einheiten zu erschleichen. Teile der Bevölkerung spendeten bereitwillig, weil sie annahmen, Uniformen und Abzeichen stünden für eine Wohlfahrtsaktion im Staats- oder Parteiauftrag. Für höhere Dienststellen, die sich um die Reputation der Hitlerjugend sorgten, waren es unangenehme Ereignisse. In letzter Zeit käme es wieder vermehrt vor, lautete es aus der Verwaltungsabteilung des Gebiets Berlin Ende 1937, „wo von einzelnen Angehörigen der HJ und des DJ Sammlungen jeder Art durchgeführt werden für alle möglichen Zwecke. Ich habe bereits in verschiedenen Gebietsbefehlen als auch in verschiedenen Rundschreiben immer wieder darauf hingewiesen, dass das Sammeln – gleichgültig in welcher Form und zu welchem Zweck – von den unteren Einheiten grundsätzlich verboten ist.“39 Einem Jugendlichen in Berlin-Treptow versuchte man etwa zur gleichen Zeit habhaft zu werden, weil er vermeintliche Mitglieder- und Fahrtenbeiträge von Eltern kassiert hatte.40 Das Gebiet Thüringen beklagte 1937, es würden trotz Ermahnungen „immer wieder Fälle bekannt, dass von Einheiten die Sammelverbotsbestimmungen übertreten werden. Es dürfte doch allmählich jeder [….] wissen, dass Sammeln in jeder Form nun einmal verboten ist und dass bei Verstößen […] unter Umständen auch eine
36 Lagebericht des Regierungspräsidenten Magdeburg für Juli 1935 vom 10.8.1934. In: Hermann-J. Rupieper/Alexander Sperk (Hg.), Lageberichte der Geheimen Staatspolizei zur Provinz Sachsen 1933–1936, Band 1, Halle 2003, S. 85–98, hier 96. 37 Unerlaubte Sammlungen. In: GB: Berlin, 108/36 vom 6.3.1936; ähnlich die Aufforderungen in den Anweisungen des Gebietsjungvolkführers Mögling. In: GB: Mittelelbe, 2/37 vom 2.2.1937; mehrere unzulässige Sammelaktionen – wie Verkauf von Eintrittskarten für Eltern- oder Werbeabende – bei Sammelverbot. In: ebd., 3/37 vom 18.2.1937; und Sammelverbot. In: GB: Berlin, 14/37 vom 1.10.1937. 38 Vgl. Verbot öffentlicher Sammlungen und Spendenerhebungen. In: BB: Gebiet Berlin, 77/35 vom 2.3.1935. 39 Sammeltätigkeit. In: GB: Berlin, 19/37 vom 15.12.1937. 40 Vgl. Warnung. In: ebd., 19/37 vom 15.12.1937.
146
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
gerichtliche Bestrafung erfolgen kann.“41 Nicht nur persönliche Bereicherung war ein Motiv. Einige Unterführer gingen mit Geld freigiebig um, sodass sich die Einheiten verschuldeten. Im Gebiet Saarpfalz monierte die Führung 1937, dass verschiedene Einheiten glaubten „nach Herzenslust über Geld und andere Vermögensteile der HJ“ verfügen zu können.42 In Thüringen hatten sich bis 1935 offensichtlich mehrere Formationen stark verschuldet; die Gebietsführung klagte, die Unterführer würden sich oft weigern, ihre Schulden zu begleichen.43 Noch ein Jahr später war man mit der Entschuldung befasst.44 Außerdem klagte das Gebiet im Juni 1935, dass Einheiten, deren Schulden die RJF inzwischen beglichen hatte, schon wieder neue Schulden machen würden.45 Bei Abrechnungen waren zudem Fehlbeträge aufgefallen und Beitragsmarken verschwunden.46 Es kam gelegentlich vor, dass bei Sammelaktionen wie Straßen- oder Altmetallsammlungen das Geld nicht weitergereicht wurde: „Es ist verboten, dass das Geld zurückbehalten wird oder von diesem Geld Anschaffungen getätigt werden, die sich der […] Kassenkontrolle entziehen.“47 Die Unterschlagungen und illegalen Sammlungen ließen sich in Gänze nicht abstellen. In den Kriegsjahren nahmen diese Betrügereien Jugendlicher in Uniform offenbar sogar massiv zu. Ein typischer Fall aus Wiesbaden vom April 1940: Hitlerjungen wurden festgenommen, da sie in „raffinierter Weise“ Geld gesammelt hatten – angeblich für Anwohner, die im Zuge des „Westwall“-Baus ihre Häuser verlassen mussten. Vermeintlich im Auftrag ihrer Führung und der NSV unterwegs, reichten sie die gesammelten Spendengelder nicht weiter.48 Die Gebietsführungen sahen sich nach 1939 veranlasst, Sonderbefehle mit Verbotsanweisungen in Bezug auf illegale Sammlungen, Unterschlagung oder „schwarze Kassen“ zu drucken. Die Kenntnisnahme mussten die nachgeordneten Dienststellen eigens durch Unterschrift bestätigen.49
41 Sammelverbot. In: GB: Thüringen, 3/37 vom 18.2.1937. 42 Beseitigung von Unklarheiten vermögensrechtlicher Art. In: GB: Saarpfalz, A1/37 vom 15.1.1937. 43 Vgl. Materialzahlungen der Gefolgschaften/Fähnlein. In: GB: Thüringen, 4/35 vom 31.3.1935. Unter „Verbot von Bestellungen“ wurde thematisiert, dass mehrere Einheiten Bestellungen tätigten, die sie nicht bezahlen konnten; das Gebiet musste für die entstandenen Kosten aufkommen und reagierte mit einem allgemeinen Bestellverbot für Waren im Wert über 30 RM. Vgl. ebd. 44 Vgl. Entschuldung. In: ebd., 2/36 vom 29.2.1936. 45 Vgl. Neuverschuldung. In: ebd., 8/35 vom 28.6.1935. 46 Vgl. Verwaltung der Beitragsmarken. In: ebd., 3/37 vom 18.2.1937. 47 Altmaterialsammlung. In: ebd., A6/38 vom 31.3.1938. 48 Lagebericht der Generalstaatsanwalt Frankfurt vom 30.5.1940. In: Klein/Uthe (Hg.), Lageberichte der Justiz aus Hessen, S. 140–145, hier 134. 49 Vgl. Hinweis auf das Sammelverbot, Führung „schwarzer Kassen“ und weiteren Anordnungen (Sonderdruck). In: GB: Westmark, K4/43 vom 10.3.1943, mit Nachwort zur Quittierung. Seit 1940 durften unterhalb der Bann-Ebene keine Kassen mehr geführt werden. Vgl. Auflösung der Einheitskassen. In: ebd., K12/a40 vom 15.12.1940.
Die prekäre Hitlerjugend
147
Die Hochphase der sogenannten Bettelei fiel während der 1930er-Jahre in die Wanderzeit im Frühjahr und Sommer, wenn die Einheiten durchs Land zogen und dabei nur bedingt überwacht werden konnten. Sogenannte Landstreicher, die dem Regime als „Asoziale“ galten, wurden verfolgt und junge Menschen waren ebenfalls von der staatlichen Verfolgung betroffen. Das Hitlerjugend-Fahrtenwesen wurde ab 1933 sukzessive reglementiert. Vieles, was auf dem Papier verboten war, wie das Trampen, wurde im Alltag gleichwohl praktiziert.50 Die Wanderzeit ging mit zahlreichen Beschwerden und Kritik an der Hitlerjugend einher. „Aus den Meldungen der Gebiete geht hervor“, wies die RJF 1935 den rund ein Jahr zuvor gegründeten SRD an, „dass hauptsächlich in Wandergebieten und Großstädten das Unwesen der Bettelei […] überhandnimmt. In den meisten Fällen wird versucht, unter Hinweis auf die Zugehörigkeit zur Hitlerjugend, Unterstützung bei Dienststellen der Bewegung oder auch bei Privatleuten zu bekommen. Da bei dieser Bettelei meistens der Dienstanzug der Hitlerjugend getragen wird, erleidet das Ansehen der gesamten Hitlerjugend […] großen Schaden.“51 Der SRD wurde aufgefordert sofort einzugreifen und Meldung zu erstatten. Die bettelnden Uniformierten kamen in Gewahrsam, wurden an die Polizeistellen übergeben und an ihre Wohnorte zurückgebracht. Dort ging die Hitlerjugend gegebenenfalls mit disziplinarischen Instrumenten gegen sie vor.52 Die Möglichkeiten des SRD – über ein engmaschiges Überwachungsnetz verfügte die Parteijugend nicht – waren begrenzt. In Wandergebieten konnten sie, weil es an Personal fehlte, oft nur ungenügend eingesetzt werden. Der Bürgermeister einer Kleinstadt an der Mosel beschwerte sich über jugendliche Wandergruppen, die „von Ort zu Ort ziehen und freie Unterkunft und Verpflegung verlangen.“ An mehreren Tagen seien die jugendlichen Gruppen im Ort vorstellig geworden und hätten verlangt, unentgeltlich untergebracht zu werden.53 Solche Beschwerden aus den Gemeinden waren häufig. Die Führung in Thüringen ermahnte deshalb zur Wandersaison 1938: „Es geht nicht an, dass Fahrtengruppen, die für genügend finanzielle Sicherung ihrer Fahrt nicht Sorge tragen, bettelnd und schnorrend durch das Land ziehen.“54
50 Vgl. Trampen. In: GB: Thüringen, A3/38 vom 1.3.1938; Tramp-Verbot für HJ-Angehörige. In: ebd., A8-9/38 vom 6.8.1938. 51 Zit. aus Rundschreiben des Polizeipräsidenten, Landeskriminalamt an die Landeskriminalpolizeistelle vom 4.11.1935 (GLA Karlsruhe, 465c, 23587, unpag.). 52 Vgl. Bettelunwesen innerhalb der Hitler-Jugend, Sonderdruck des Organisationsamtes vom 14.11.1938. In: Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 8: Allgemeines Verhalten, S. 637. 53 Lagebericht der Gestapostelle Koblenz für Oktober 1935 vom 5.11.1935. In: Faust/ Rusinek/Dietz (Hg.), Lageberichte rheinischer Gestapostellen, Band II/2, S. 1221– 1240, hier 1232. 54 Übernachtung und Verpflegung in Privatquartieren. In: GB: Thüringen, A3/38 vom 1.3.1938.
148
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Die sogenannte Bettelei, die vom Regime aus ideologischen Gründen kriminalisiert wurde, ebenso wie kleinkriminelle Betrügereien waren zum einen der wirtschaftlichen Not geschuldet. Aber sie resultierten zum anderen auch aus dem Eigensinn junger Unterführer. Weil die NS-Revolutionsrhetorik ihnen einen Platz im neuen Staat versprach, deuteten radikalisierte Jugendliche den Weg dorthin im eigenen Sinne aus. Junge Menschen stachelten einander an und deckten sich gegenseitig selbst bei Übertretung strafrechtlicher Grenzen. Bei Mönchengladbach nahm die Polizei im Oktober 1934 einige jugendliche Einbrecher fest, darunter sieben Angehörige der HJ sowie ein Unterführer niederen Rangs.55 In Aachen brachen im Sommer 1935 einige Hitlerjungen, die sich in einem Zeltlager befanden, in eine Villa ein; es kam im Ort nahe des Lagers zudem zu Sachbeschädigung und Diebstählen. „Der moralische Schaden […] ist nicht abzusehen und kommt letztlich auch nur den konfessionellen Jugendverbänden zugute“, klagte die Gestapo.56 Ein „besonders krasser Fall“, wie es hieß, erregte in Thüringen 1938 den Zorn der Gebietsführung. Ein Lehrling, der wegen Unterschlagung von Geldern gerichtlich verurteilt worden war, erhielt von seinen HJ-Kameraden wissentlich ein positives Zeugnis ausgestellt, um sich unbeschadet bei einem neuen Arbeitgeber bewerben zu können. „Das Vertrauen in die Richtigkeit der […] ausgestellten Dienstleistungszeugnisse wird dadurch erschüttert“, fürchtete zu Recht die Gebietsführung.57 Solche „Gefälligkeitszeugnisse“ verboten die höheren Dienststellen.58 Waren das alles Einzelfälle? Gewiss zogen nicht in breiter Mehrheit Hitlerjugend-Angehörige um Geld bittend oder gar mit Betrugsabsicht durch die Straßen und Dörfer. Doch bis in die zweite Hälfte der 1930er-Jahre kam es immer wieder zu ähnlichen Vorfällen; sie liefen dem Bild, das die RJF von ihrer Organisation zu zeichnen beabsichtigte, diametral entgegen. Die Hitlerjugend konnte eigennützige oder betrügerische Handlungen begünstigen: Mental und ideologisch, weil sich junge Menschen im Kampf wähnten, der aus ihrer Sicht vieles erlaubte; organisatorisch, da die Einheiten – ihrem Bewegungsanspruch gemäß – oft von jungen Männern und Jugendlichen geführt wurden, die im Alltag auf sich selbst gestellt waren und Spielräume vorfanden, welche die Machtübernahme 1933 ihnen eröffnet hatte.
55 Vgl. Gesamtübersicht der Gestapostelle Düsseldorf für Oktober 1934 vom 5.11.1934. In: Faust/Rusinek/Dietz (Hg.), Lageberichte rheinischer Gestapostellen, Band I, S. 460–503, hier 495. 56 Bericht der Gestapostelle Aachen für August 1935 vom 5.9.1935. In: ebd., S. 932–249, hier 948 f. 57 Dienstleistungszeugnisse. In: GB: Thüringen, A12/38 vom 15.11.1938. 58 Vgl. Ausstellung von Dienstzeugnissen und Dienstleistungszeugnissen. In: GB: Nordsee, A4/39 vom 27.4.1939.
Die prekäre Hitlerjugend
1.2
149
Junge Parteivandalen und undisziplinierte Hitlerjugend
Auf Burg Ludwigstein, Wallfahrtsort der deutschen Jugendbewegung, hatte die RJF im November 1933 eine HJ-Gebietsführerschule eingerichtet. Auch die dortige Jugendherberge stand seit geraumer Zeit unter ihrer Kontrolle. Für altgediente HJ-Führer, die auf der Burg verkehrten, blieb sie dennoch weiterhin ein Symbol und Hort der sogenannten bündischen Reaktion. 1942 wurde das Archiv geplündert. Er habe mit eigenen Augen gesehen, so berichtete der Burgwart später, dass „die Hitlerjugend wie die Vandalen auf der Burg gehaust hat, wie sie die Archivsachen aus den Schränken herausgerissen und über den Balkon auf den Burghof geworfen haben“.59 Eine Analogie, welche die Propaganda der RJF herausfordert: War die Hitlerjugend eine pöbelnde, kulturlose Vandalentruppe? Emigranten im Ausland, Oppositionelle, oft auch die parteiamtlichen Stellen und die Gestapo beschrieben HJ und DJ oft nicht zuerst als eine straff geführte, disziplinierte Nachwuchstruppe, sondern als aufgestachelte Jugendbande. Gewalt und Sachbeschädigung, die von der Hitlerjugend ausging, nahmen unterschiedliche Formen und Grade der Intensität an. Der Vandalismus variierte je nach Motiven, der Zeitphase und dem Alter der Beteiligten; außerdem war er in der HJ und beim DJ weit mehr verbreitet als beim BDM und unter den Jungmädeln. Zumindest niedrigschwelliger Art war Vandalismus und Sachbeschädigung ein Alltagsphänomen. Beschwerden wurden in der Wanderzeit von Anwohnern, Bauern, Partei und Polizei vorgetragen. Der wandernden Hitlerjugend begegnete die Landbevölkerung mit wechselhaften Gefühlen. Meist waren es beiläufige Anlässe – wie jene, die ein Zeitzeuge Jahrzehnte später wie nebenher schilderte: „Einmal sollten wir in dem zwanzig Kilometer entfernten Usedom an einem Appell mit dem Fähnleinführer aus Swinemünde teilnehmen“, erinnerte sich der ehemalige Jungvolk-Junge. Zu Fuß unterwegs, hatten sie es nicht mehr rechtzeitig zum Appell geschafft: „Dort sahen wir nur noch, wie der Fähnleinführer wieder mit dem Zug […] zurückfuhr und uns durch das offene Fenster zuwinkte. Wir trabten dann die fünf Kilometer […] heimwärts und plünderten […] ein Mohrrübenfeld, weil wir Hunger hatten.“60 Aus dem Forstbetrieb trafen in den höheren Dienststellen Klagen ein: Feuer wurde gelegt, Müll im Wald und im Umfeld der Zeltlager zurückgelassen, Schilder am Wegesrand abgerissen.61 Die Landbevölkerung brachte ihre Beschwerden über die Plünderung von Feldern oder Flurschäden vor. Im Umfeld von 59 Zit. nach Hans Wolf, Geschichte des Archivs der deutschen Jugendbewegung. In: Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung, 2 (1970), S. 115–128, hier 118. Vgl. auch Ulrich Linse, Der Wandervogel. In: Etienne François/Hagen Schulze (Hg.), Deutsche Erinnerungsorte, Band 3, München 2001, S. 531–548, hier 545 f. 60 Manfred Blunk, Memi. Kindheitserinnerungen an Korswandt, Norderstedt 2009, S. 71. 61 Als Auswahl Mitteilung der Forstverwaltung. In: BB: Berlin, 85/35 vom 30.4.1935; Flurschaden. In: GB: Mittelelbe, 1/37 vom 15.1.1937; Brandschäden im Walde zur Wandersaison. In: GB: Pommern, A4/37 vom 6.4.1937; Waldbrandverhütung. In: GB: Thüringen, A8-9/38 vom 6.12.1938; Entfernung von Lager-Resten. In: GB: Franken, 4/36 vom 7.1936.
150
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Zeltlagern, die über mehrere Tage hinweg neben „Erholung […] gemeinsam in straffer Kameradschaft zu Disziplin und Ordnung erziehen“ sollten, sowie bei größeren Geländespielen kam es seitens der Gemeinden immer wieder zu Kritik: Höfe und Felder seien betreten, Zäune mutwillig eingerissen worden. Schadensersatzforderungen gingen an die Dienststellen der Hitlerjugend und diese wiederum drohten ihren jungen Mitgliedern.62 Wiederholt würden, hieß es aus der Gebietsführung Berlin 1936, durch die „Gendarmerie der Landesbauernschaft Meldungen“ eingehen, dass „HJ-Formationen […] bei ihren Fahrten keineswegs die nötige Obacht walten“ lassen würden.63 Bereits im Herbst 1934 hatte man verfügt: Jugendliche Gruppen dürften höchstens in Gefolgschaftsstärke – etwa 160 Mann – gleichzeitig außerhalb Berlins unterwegs sein.64 Die RJF traf mal mit dem Reichsnährstand oder ein anderes Mal mit Hermann Göring als dem Reichsjägermeister Abkommen, um die Querelen um Fahrten, Lager und Manöver aus der Welt zu schaffen.65 Größere Zeltlager wurden zunehmend ummauert oder mit Zäunen gesichert. Heute interpretiert man derlei Abschottung als gewissermaßen natürliche Bestandteile der NS-Lagererziehung. Dass Lager eingezäunt wurden, wird daher oft mit dem Vorteil begründet, der sich aus der Abschottung von der Außenwelt ergab. Die Verhinderung von Vandalismus war aber ebenfalls ein wichtiges Motiv. Die Umzäunung der Lager sei notwendig, erläuterte die HJ-Führung sogar selbst, um Flurschäden zu verhüten. Konflikte mit der Bevölkerung würden vermieden, lautete das Argument aus der RJF, indem man die Lager entsprechend sichere.66 Dass ein Teil der Landbevölkerung die Lager skeptisch beäugte, zeigen sowohl Stimmungsberichte der Opposition als auch zahlreiche Lagebeurteilungen des staatlichen Überwachungsapparats.67 1933/34 war es die Hitlerjugend selbst gewesen, die bei der Auflösung konkurrierender Freizeitlager häufig angeblichen Vandalismus und Sachbeschädigung als Vorwand angeführt hatte. Beschwerden, die sich nun allerdings gegen die Hitlerjugend richteten, hatten viel bescheidenere 62 Zit. aus einem Schreiben der Hitlerjugend, Bann 142 Lörrach, an die Betriebsführer der Industrie, des Handels und des Handwerks vom 14.6.1939 (StA Freiburg, B719/1, 5018, unpag.). Vgl auch Zeltlager. In: BB: Berlin, 129/36 vom 4.9.1936. 63 Ungebührliches Benehmen der HJ. In: BB: Berlin, 131/36 vom 15.9.1936. 64 Spiele außerhalb Berlins. In: ebd., 58/34 vom 5.10.1934. 65 Störung von Jagdrevieren. Abkommen mit dem Reichsjägermeister. In: GB: Oberdonau, A K/4/41 vom 1.4.1941. 66 Hans-Joachim Kluge, Das Lager. In: Jungen, Eure Welt! Jahrbuch der Hitler-Jugend, 4 (1941), S. 464. Im Übrigen wurde die Organisation von Lagern durch untere Dienststellen ab Mitte der 1930er-Jahre auf Gebietsebene zustimmungspflichtig, weil es in selbst organisierten Lagern der lokalen HJ-Führer auch zu Versorgungsengpässen gekommen war. Anmeldung von Zeltlagern. In: GB: Westmark, A7/37 vom 1.6.1937. 67 Vgl. Bemerkung über die Lage in der Landwirtschaft, A 80. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 3 (1936), S. 906: „Das Gefühl der Bauern, nicht mehr Herr im eigenen Haus zu sein, wird dadurch verstärkt, dass das Regime mit bewährter Rücksichtslosigkeit auch bei anderen Anlässen über seine Interessen – oder buchstäblich über seine Felder – hinwegschreitet. Es mehren sich die Berichte über Flurschäden, die den Bauern durch Übungen der Reichswehr, der Wehrverbände, der Hitler-Jugend und durch sportliche Veranstaltungen zugefügt werden.“
Die prekäre Hitlerjugend
151
Erfolgsaussichten. Man war auf das Einsehen der HJ-Dienststellen oder auf die Unterstützung durch die Kommunen, Partei und Polizei angewiesen. Im Disziplinarwesen der Hitlerjugend zählte ab Mitte des Jahrzehnts „Sachbeschädigung in Uniform“ zu einem eigenen Tatbestand.68 Parteinahe Stellen und der staatliche Sicherheitsapparat erklärten sich den Vandalismus jugendlicher Gruppen damit, dass die Einheitenführer für ihre Aufgaben ungeeignet und lokale Dienststellen überfordert schienen, zudem Formationen oft herrenlos durch die Gegend streiften. Das Gebiet Berlin erhielt 1934 Mahnschreiben der Schutzpolizei wegen diverser Übertretungen des Feld- und Forstpolizeigesetzes durch HJ-Einheiten.69 Die Reichsbahn in Essen registrierte im ersten Halbjahr 1937 105 Fälle von Sachbeschädigung, verübt durch Jugendliche, darunter Steinwurf auf Züge oder mutwillige Zerstörung von Signaleinrichtungen. Auch der Verband Deutscher Verkehrsreklame wandte sich wegen Sachbeschädigung – mit Schwerpunkten in Brandenburg, Pommern und Schlesien – an die RJF. Das HJ-Führerkorps stritt nicht einmal ab, dass die Vandalen aus ihren Reihen kamen.70 Primär am Staatsjugendtag – 1936 wurde er, auch aus diesem Grund, wieder abgeschafft – handelte sich die Hitlerjugend Kritik von verschiedener Seite ein. Die Gestapo in Aachen beispielsweise hielt Ende 1934 fest, es würden „zahlreiche Gruppen von morgens bis abends so gut wie völlig undiszipliniert herumlaufen […]. Dies führt dann dazu, dass sie, wie es vorgekommen ist, sich mit dem Bewerfen von Zügen abgeben oder anderen Unfug stiften.“71 Die Hitlerjugend zeigte sich auch bei ihren Heimabenden nicht immer als jene vorbildliche, disziplinierte Gemeinschaft, welche die Propaganda stets präsentierte. Bis in die zweite Hälfte der 1930er-Jahre verfügte die Parteijugend kaum über eigene Heime. In der Regel mussten Klassenzimmer genutzt oder Räume in Gaststätten gemietet werden. Immer wieder kam es zu Sachbeschädigung, gerade durch DJ-Einheiten, wenn eine Aufsicht beim Dienst fehlte. Die Hitlerjugend sah sich nicht nur mit Kritik, sondern außerdem mit Schadensersatzforderungen konfrontiert. Ein kurioser Fall in Halle sei beispielhaft erwähnt. Ein Wirt hatte dort der Hitlerjugend aufgrund diverser Querelen gekündigt. Doch die Kündigung wurde seitens der örtlichen Hitlerjugend schlicht nicht beachtet und der wöchentliche Dienst im Nebenhaus der Gaststätte fortgesetzt. Der Bezirksbürgermeister musste 1939 die Zwangsräumung veranlassen: „Beim Aufräumen […] haben die Gemeindearbeiter große Unordnung festgestellt“, wie man unterstrich. Zukünftig brachte man die jungen „Vandalen“ in den Räumen der NSDAP-Ortsgruppe unter. Dort hatte man ein wachsames Auge auf sie.72 68 Vgl. auch Rosenbaum, Kinderalltag im Nationalsozialismus, S. 332. 69 Schreiben des Kommandos der Schutzpolizei. In: BB: Berlin, 57/34 vom 28.9.1934. 70 Vgl. beispielhaft: Bahnfrevel. In: GB: Berlin, 19/37 vom 15.12.1937; Beschädigung von Eisenbahnreklamen. In: GB: Thüringen, A5/38 vom 30.4.1938. 71 Lagebericht für den Monat November 1934 der Staatspolizeistelle Aachen vom 5.12.1934. In: Vollmer (Hg.), Volksopposition im Polizeistaat, S. 122–134, hier 133. 72 Notiz des Bezirksbürgermeisters, Diemitz vom 9.1.1939 (StadtA Halle, Diemitz, 642, Bd. 1, unpag.).
152
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Die Stadtverwaltung in Hamm war zeitgleich mit den Schadensersatzforderungen zweier Eigentümer beschäftigt. Der Bürgermeister hatte zuvor versprochen, man käme im Eventualfall für Schäden auf, welche die Hitlerjugend verursache. Nun hatten die Jungen tatsächlich marodiert, Türen zu Nebenräumen aufgebrochen und Inventar gestohlen.73 „Im allgemeinen wird in der HJ bei den abendlichen Zusammenkünften sehr viel dummes Zeug getrieben“, bilanzierte ein oppositioneller Bericht aus Süddeutschland: „Das wird ja […] nicht ganz allgemein so sein, sondern sehr stark von der jeweiligen Führung der Gruppe abhängen. Jedenfalls berichten uns die hineingezwungenen Kinder, dass man sehe, dass hineingepresst worden wäre. Viele betragen sich so, dass man merke, sie warten nur darauf, wieder hinausgeschmissen zu werden.“74 War das Eigentum der Parteijugend betroffen, griffen höhere Dienststellen alsbald zu disziplinarischen Mitteln. Im Januar 1936 wurde z. B. ein 19-jähriger Unterführer aus der Parteijugend geworfen und bei der RJF als „Warnfall“ eingetragen, weil er in den Räumen seiner Motorgefolgschaft gewütet hatte.75 Zu solchen Ausschlüssen rang man sich aber nur in wenigen Fällen durch. Sachbeschädigung galt in der Hitlerjugend als „Disziplinlosigkeit“ genauso wie alltägliche Trivialitäten. Wurde ein uniformierter Hoheitsträger in der Öffentlichkeit nicht gegrüßt, war dies ebenfalls eine Disziplinlosigkeit.76 Die „undeutsche Art des Pfeifens als Beifallsbekundung“ verbot man in Düsseldorf.77 Mädchen, die Ohrringe oder Schmuck trugen, machten sich einer disziplinarischen „Unsitte“ schuldig.78 Und im Zuge der Gesundheitspolitik galt ab 1933 ein Rauchverbot während des Dienstes. Zur Zigarette griffen übrigens weiterhin viele. Jugendheime dürften „weder öffentliche Lokale, noch Rauch- oder Versammlungshallen sein“, kritisierte eine höhere Dienststelle nach einer ausgelassenen Feier. Man habe die Heime gebaut, um die deutsche Jugend „endlich aus den qualmigen Gaststuben“ herauszukommen.79 Nach Schulungen, Fahrten oder Zeltlagern kritisierte man die Unterführer, weil ihre vulgären Umgangsformen negativ aufgefallen waren.80 In Berlin zogen, um ein Beispiel zu nennen, verschiedene HJ-Einheiten nach Einbruch der Dunkelheit spätabends mit Trommelgeschmetter provozierend durch die bürgerlichen Viertel, weshalb sich die 73 Eingabe der Vermieter bezüglich HJ-Heim in Hamm an die Bürgermeisterei vom 1.2.1939 (StadtA Worms, Abt. 231, 1675, unpag.). 74 Bericht aus Südwestdeutschland, A37. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 3 (1936), S. 187. 75 Vgl. Kollmeier, Ordnung und Ausgrenzung, S. 162. 76 Vgl. Grüßen in der Hitlerjugend. In: GB: Thüringen, A3/38 vom 1.3.1938. 77 Vgl. Beifallsbekundung durch Pfeifen. In: GB: Düsseldorf, A10/39 vom 5.7.1939. 78 Vgl. Dienstform des BDM. In: GB: Hessen-Nassau, 4/32K vom 4.1942. 79 Verhalten im HJ-Heim. In: GB: Thüringen, A2/37 vom 31.1.1937. 80 Vgl. z. B. Rauchen in Dienststellen. In: GB: Mittelelbe 1/37 vom 16.1.1937; Rauchen im Dienst und Rauchen in Dienststellen. In: GB: Düsseldorf, A1/38 vom 20.9.1938; Tischsprüche. In: GB: Berlin, A12/37 vom 16.1.1937: „In den Zeltlagern der Hitler-Jugend, anlässlich von Fahrten und Großfahrten, in Führerschulen usw. werden vielfach Tischsprüche gebraucht, die […] geradezu der nationalsozialistischen Auffassung von Zucht und Anständigkeit [widersprechen].“
Die prekäre Hitlerjugend
153
HJ-Gebietsführung mit einer amtlichen Beschwerde befassen musste.81 Aus dem Partei- und Überwachungsapparat sah man deshalb bisweilen mit durchaus erstaunlicher Geringschätzung auf die Parteijugend. Bei Zusammenkünften werde wenig geleistet, urteilte man in Aachen 1935. Jungvolk und HJ kämen nur zusammen, „um sich etwas zu raufen und eine belanglose Unterhaltung zu führen“.82 Und Berliner Parteigenossen reichten 1936 Beschwerde ein, weil Hitlerjungen auf einem Friedhof Besucher belästigt hatten.83 Sogenannte Disziplinlosigkeiten resultierten scheinbar immer aus fehlender Aufsicht. In der Parteijugend war dies ein Dauerthema. 1937 wurde beklagt, dass „sich mehrfach Brände in Heimen der HJ und des BDM ereignet“ hätten, deren Ursachen in Disziplinlosigkeiten lägen.84 Vieles, das in den Befehlsblättern der Staatsjugend thematisiert wurde, geht in die Richtung banaler Bagatellen; wie bei jenen Düsseldorfer DJ- und HJ-Einheiten, die im Winter 1942 die Zäune an Feuerlöschteichen herunterrissen, um auf dem Eis Schlittschuh zu fahren.85 Der Übermut und Eigensinn hatte aber ernste Folgen: Unfälle nach Mutproben, bei Messerstechereien oder durch Schusswaffen. Mitunter waren Tote zu beklagen. Bis zum August 1939 hatte die RJF immerhin 649 Todesfälle registriert, die in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem Hitlerjugend-Dienst standen: darunter 27 Unfälle mit Schusswaffen, 14 Tote bei Geländespielen, 139 Ertrunkene.86 Verletzte wurden nicht gezählt. Die Dunkelziffer war mutmaßlich erheblich. Der HJ-Versicherungsschutz, mit welcher die RJF öffentlich gern warb, griff übrigens bei vielen Dienstunfällen nicht.87 Die Zeitungen übten bei vielen Vorfällen offenbar Selbstzensur, während das Regime mit Presseanweisungen gelegentlich eingriff, damit besonders Unangenehmes keine Öffentlichkeit fand – wie bei einem Hitlerjungen, der Ende 1935 schwere Verletzungen sich selbst zufügt hatte, aber behauptete, das Opfer eines Überfalls durch politische Gegner zu sein.88 In den Befehlsblättern der Massenorganisation wurden diese und ähnliche Vorfälle aber sehr viel offener thematisiert.89
81 Vgl. Nachtruhe. In: BB: Gebiet Berlin, 77/35 vom 2.3.1935. 82 Gestapostelle Aachen für November 1935 vom 9.12.1935. In: Faust/Rusinek/Dietz (Hg.), Lageberichte rheinischer Gestapostellen, Band II/2, S. 1303–1338, hier 1328. 83 Vgl. Friedhof Stahnsdorf. In: BB: Berlin, 108/36 vom 6.3.1936. 84 Brände in Jugendheimen. In: GB: Kurmark, A9/37 vom 15.7.1937. 85 Vgl. Unfug an Feuerlöschteichen. In: GB: Düsseldorf, 2/43K vom 20.4.1943. 86 Vgl. Unfallstatistik der RJF über die Todesfälle in der Hitlerjugend vom 4.9.1939. In: Benecke (Hg.), Hitler-Jugend 1933–1935, S. 211. 87 Vgl. Unfallbegriff und Umfang des Versicherungsschutzes. In: GB: Thüringen, 3/35 vom 24.2.1935. 88 Vgl. ZsG. 101/224/1965 vom 17.12.1935 mit Auszügen aus Pressetexten. In: Gabriele Toepser-Ziegert (Bearb.), NS-Presseanweisungen der Vorkriegszeit. Edition und Dokumentation, Band 3/II: 1935, München 1987, S. 880 f. 89 Vgl. beispielhaft Führen von Schusswaffen. In: GB: Berlin, 13/37 vom 1.9.1937 über einen „kürzlich während des Dienstes erfolgten Todesfalles infolge missbräuchlichen Führens einer Schusswaffe“. Vgl. auch Schusswaffen in der Hand von Jugendlichen. In: GB: Saarpfalz, A4/38 vom 4.4.1938.
154
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Unfälle infolge sogenannter Disziplinlosigkeit wollte das Führerkorps möglichst abstellen. Im Zuge der vormilitärischen Ausbildung der männlichen Jugend häuften sich die Vorkommnisse. Anders als in den 1930er-Jahren, als Schusswaffen im Dienst kaum verbreitet waren – in Sachsen z. B. hatte die HJ 1936 nur 10 Schusswaffen im Besitz –, kamen sie in den Kriegsjahren massenhaft zum Einsatz.90 In Düsseldorf stellte man 1942 fest, es habe eine Reihe von Unglücken beim Schießtraining gegeben. Die Sicherheitsregeln seien nicht eingehalten worden; ohne einen erwachsenen Lehrer dürften sich die Einheiten nicht an die Waffe begeben.91 Die Gebietsführung wies noch auf ein anderes Problem hin: Man habe mehrfach beobachtet, dass junge Mitglieder Pistolen trugen. Das sei aber nur dem Führerkorps und mit Waffenschein gestattet.92 In Bayern wurde auf die Gefahr, dass junge Menschen leichter als bislang an Waffen gelangten, Ende 1940 eindringlich hingewiesen.93 Die Gefahr war real. Im sächsischen Stollberg wurde ein Hitlerjunge 1943 verhaftet, weil er die ihm für den Dienst anvertraute Munition zum Teil verkauft und zum Teil verschenkt hatte. Ein Zweiter hatte die Munition verwendet und in einem Wohnviertel um sich geschossen. Weil dabei keiner zu Schaden gekommen war, fielen die Strafen mild aus: 10 Tage Arrest für den Dieb, ein Verweis für den Schützen.94 In Pirna gab es 1942 einen Fall, bei dem ein Hitlerjunge gestohlene Pistolen verkaufte.95 In Oberschlesien wurde ein 17-jähriger Gefolgschaftsführer wegen fahrlässiger Tötung zu vier Wochen Jugendarrest verurteilt. Zwei 14-Jährige erhielten etwa zeitgleich je einen Monat Haft, nachdem sie einen gleichaltrigen Kameraden getötet hatten. Und einen 18-jährigen HJ-Unterführer bestrafte man mit neun Monaten Gefängnis, weil er eine wilde Schießerei zweier Einheiten organisiert hatte, in deren Folge ein 16-Jähriger gestorben war.96 Die Gebietsführung von Franken äußerte 1943: Man habe zwar Verständnis, dass „jeder Hitler-Junge den Wunsch hat, mit Schusswaffen umzugehen“, doch habe es „in der letzten Zeit mehrere Fälle“ mit schwersten Verletzungen gegeben.97 Gewalt und Vandalismus in den 1930er-Jahren verwiesen vor allem im DJ oft auf Probleme, die sich aus dem Selbstführungsprinzip ergaben. Kinder, die tatsächlich nur unzureichend unter Aufsicht standen, imponierten einander – in gefährlicher, manchmal destruktiver Weise. Nicht nur die Ideologie der Hitlerjugend, sondern auch lokale Unterführer schienen das gelegentlich zu befeuern. Ein Lehrer bei Bernburg beispielsweise reichte 1937 Beschwerde bei der Schul-
90 Zur Zahl der Schusswaffen vgl. Erhebungen. In: GB: Sachsen, 1/36 vom 5.2.1936. 91 Vgl. Unglücksfälle beim Kleinkaliber- und Luftgewehrschießen. In: GB: Düsseldorf, 7/42K vom 21.8.1942. 92 Vgl. Tragen von Pistolen. In: ebd. 93 Vgl. Tragen von Pistolen. In: GB: Hochland, K13/40 vom 1.11.1940. 94 Vgl. Jugenddienstarrest. In: BB: Gebiet Sachsen, 3/43 vom 1.4.1943. 95 Vgl. Beispiel unter Ausschluss aus der Hitlerjugend. In: ebd., 9/42 vom 1.9.1942. 96 Vgl. Rundschreiben der Reichsjugendführung, 21/42 vom 27.8.1942, abgedruckt u. a. bei BB: Moselland, 8/42 vom 15.9.1942. 97 Umgang mit Schusswaffen. In: GB: Franken, 7/43 vom 9.1943.
Die prekäre Hitlerjugend
155
aufsicht ein. Der örtliche Jungbannführer hatte den Kindern entgegengerufen, gerade von Jungen erwarte er, dass sie rotzfrech seien. Sie sollten sich schlagen und sich trauen, das Wort „Scheiße“ in den Mund zu nehmen. Auf dem „Boden dieser Erziehungsgrundsätze“, so meinte der Lehrer, sei er nicht bereit, seinen eigenen Sohn ins DJ zu geben.98 Die Gewalt aus der HJ mag ähnlich infantilen oder pubertären Ursprungs gewesen sein, aber gebärdete sich offensiver als politischer Kampf, der gegen angebliche Feinde zu führen war. Schon Ende der 1920er-Jahre stellte die HJ einen fragilen Sozialisationsraum für jugendliche Gewalttäter dar. Nach der „Machtergreifung“ trat keine grundsätzliche Veränderung ein. In Halle wurde noch im Januar 1933 der städtische HJ-Führer verhaftet, weil er seine Gefolgsleute zur Sachbeschädigung angestiftet hatte. Die NSDAP reagierte und schloss den jungen Mann aus der Gauleitung aus.99 Als sich 1935 der Besitzer eines Jugendhauses, das den Christlichen Pfadfindern gehörte, weigerte, das Grundstück der Hitlerjugend zu übertragen, drangen HJ-Einheiten ein und – so ein Erinnerungsbericht – schlugen „alles Inventar kurz und klein. […] Kein Stuhl, kein Tisch war mehr gebrauchsfähig.“100 Vorschriften, welche die höheren Dienststellen oder die RJF zum Schutz des Ansehens der Parteijugend vermehrt formulierten, wurden fortwährend übertreten. Blinde Zerstörungswut war gerade in der ersten Phase der Diktatur Normalität: Steinwürfe, zertrümmerte Fenster, Schmierereien, abgerissene Hinweis- und Namensschilder – kriminelle Delikte, die man nicht guthieß, die aber mit Revolutionspathos zugedeckt wurden. Vereinzelt lasteten Überwachungsorgane und HJ-Dienststellen solche „Unarten im Kampfe der HJ“ jenen Jugendlichen an, die früher der KPD nahegestanden hätten, nun aber in die HJ übernommen worden seien. Man hege den Verdacht, hieß es aus Trier, dass diese Jungkommunisten alte „Methoden wohl heute noch nachahmen“ wollten.101 Das war durchsichtige Ausflucht und Selbstbetrug auf gleiche Weise. Die „Nachwuchsdesperados“ sahen sich zum Terror legitimiert. In Wien – ein extremer Fall – verübten Angehörige der Hitlerjugend im Juni 1933 einen Bombenanschlag auf die Bahn. Zwei Kameradschaftsführer, der Student Theodor Kalla und Karl Ratzenberger, wurden verhaftet. Ein dritter beteiligter
98 Beschwerde aus der Volksschule Baalberge an das Anhaltische Kreisamt, Abteilung Schulaufsicht vom 20.3.1937 (LHASA, DE, KB BBG, 1487, Bl. 153); beispielhaft ein weiteres Schreiben der Schulleitung an den Landrat, Schaulaufsicht Bernburg vom 3.5.1944, über marodierende DJ-Einheiten auf Toiletten, „schweinischen Kritzeleien“ an den Tafeln oder herausgerissene elektrische Leitungen (ebd., Bl. 6). 99 Hans-Walter Schmuhl, Halle in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. In: Werner Freitag/Katrin Minner (Hg.), Geschichte der Stadt Halle. Band 2: Halle im 19. und 20. Jahrhundert, Halle 2006, S. 237–302, hier 277. 100 Erinnerungsbericht von Rudolf Hirsch. In: ders., Die evangelische Jugend Leipzigs im Widerstandskampf, undatierte Sammlung diverser Erinnerungsberichte und Quellenfragmente aus Leipzig, S. 12 (LKA Dresden, 5, 274, 2, Bl. 234–251). 101 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Juni 1934 vom 4.12.1934. In: Faust/Rusinek/ Dietz (Hg.), Lageberichte rheinische Gestapostellen, Band I, S. 277–289, hier 286.
156
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
J-Angehöriger blieb flüchtig. Dieser Fall machte Schlagzeilen.102 Nach 1933 H kühlte das Revolutionsfieber, trotz der veränderten politischen Lage, unter den lokalen HJ-Führern auch in Deutschland nicht ab: Terror und Gewalt richteten sich vielfach gegen die konfessionell gebundenen Gruppen, die – im Gegensatz zur Arbeiterjugend – nicht zerschlagen waren und im öffentlichen Raum sichtbar blieben. In Kiel, um ein Beispiel zu nennen, taten sich HJ-Einheiten mit gewalttätigen Aktionen gegen diverse christliche Jugendgruppen hervor.103 Es kam zu Beschwerden aus der Bevölkerung und die Polizei musste vereinzelt eingreifen. Die RJF sah sich Anfang 1934 zum Handeln genötigt. Zwei Bannführer wurden abgesetzt. Die Kieler HJ wurde aufgelöst, um Tage später wieder neu gebildet zu werden. Die Presse, die vereinzelt berichtete, wurde auf Stillschweigen verpflichtet.104 In einer Selbstdarstellung, welche die Kieler Hitlerjugend 1938 veröffentlichte, gestand man das alles rückblickend ein: „Vieles lag in dem zu schnellen Vorwärtsstürmen […] begründet, und in vielem hatten auch die bisherigen Gegner ihre Hand im Spiele. […] Die Kieler Hitler-Jugend handelte holsteinisch, wenn auch unrichtig.“105 Hatte die Parteijugend sich vor Ort erst den Ruf einer groben Vandalentruppe erworben, konnte ihr dies manchmal noch viele Jahre später nachhängen. In einer Stadt im Münsterland beispielsweise stand 1936 ein Verdacht hartnäckig im Raum. Es hieß, die örtliche HJ habe ein Heim des katholischen Gesellvereins abgebrannt. Der stellvertretende Gebietsjungvolkführer nährte den Vorwurf mit eher doppeldeutigen Aussagen vor Gericht, statt die Gerüchte auszuräumen, die im katholischen Milieu kursierten.106 Massiven Druck auf die christlichen Verbände aufrechtzuerhalten, war zwar das Ziel der RJF. Am 12. März 1934 beispielsweise hatte Schirach den konfessionellen Verbänden jedes „Recht auf Sonderdasein“ in Abrede gestellt. Man werde „keinen Halt vor der Gruppe der katholischen Jugendorganisationen“ machen.107 Aber der wütende Radikalismus mancher Unterführer half nur bedingt, Vertrauen in der ländlichen Bevölkerung aufzubauen. „Diese Aktion der Hitlerjugend hat in der Bevölkerung große Erbitterung hervorgerufen“, freute sich sicher nicht zu Unrecht die Exilpresse 1935, als man erneut Übergriffe
102 Vgl. Berichte über den Bombenanschlag. In: Arbeiter-Zeitung. Zentralorgan der Sozialdemokratie Deutschösterreichs vom 20.7.1933; Badener Zeitung vom 1.11.1933; Die Stunde, 1933 vom 28.10.1933. 103 Nolzen, Der Streifendienst, S. 38, nennt – was die folgenden Kapitel, wenngleich weniger systematisch, bestätigen können – vier voneinander abgrenzbare, aber zusammenhängende Typen der HJ-Gewalt: antisemitische, antikonfessionelle, rassistische und sexuelle als ubiquitäre Gewalt. 104 Vgl. Presseanweisung ZSg. 101/3/16/175 vom 12.1.1934. In: Toepser-Ziegert (Hg.), NS-Presseanweisungen der Vorkriegszeit, Band 2, S. 19. 105 Georg Hempel, Die Kieler Hitler-Jugend. Chronik, Geschichten und Aufsätze ihrer Kampfzeit, Kiel 1938, S. 18. 106 Vgl. Joachim Kuropka, Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Münster. Neuere Forschungen zu einigen Problemfeldern. In: Westfälische Zeitschrift. Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde, (1987) 138, S. 159–182, hier 172. 107 Die Jugend gehört dem Staat. In: National-Zeitung vom 12.3.1934.
Die prekäre Hitlerjugend
157
auf die katholische Jugend in Bayern meldete.108 Die RJF versuchte mit wenig Erfolg, den extremen Auswüchsen des Hitlerjugendterrors entgegenzusteuern. Ihre Androhungen disziplinarischer Sanktion und diverse Anweisungen, welche Eigenmächtigkeiten unterbinden sollten, standen allerdings meist nur auf Papier. Die Exzesse wurden innerhalb der Hitlerjugend ebenso wie durch die Partei, zunehmend sogar vonseiten der Justiz, gedeckt und Delikte juristisch nicht verfolgt. Verfahren wurden eröffnet und alsbald eingestellt. In Wuppertal-Barmen, wo sich die DJ- und HJ-Einheiten offenbar mehrfach hervortaten, hatten sie u. a. ein Missionskreuz für Schießübungen genutzt.109 In Schleiden war in ein Heim des Katholischen Jungmännervereins eingebrochen worden. Dort hatten junge Leute randaliert und ein Porträt des Papstes mit Hakenkreuzen verunstaltet.110 Ein wohl recht typischer Fall beschäftigte Anfang 1934 auch die Staatsanwaltschaft im westfälischen Erwitte. Dort hatte ein HJ-Unterführer Parolen an die Gebäude um den Kirchplatz geschmiert. Wegen angeblich lauterer Motive stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein.111 Zahlreiche Beispiele ließen sich an dieser Stelle ergänzen. Reichsjugendführer Schirach warb daher nicht ohne Grund um Verständnis: „Sie alle wissen, dass die größte Schwierigkeit beim Aufbau unserer Jugendorganisation in der Führerfrage lag“, erklärte Schirach Ende 1936 den Deutschen im Radio, als seien die Probleme sämtlich erledigt: „Sie werden sich vorstellen können, dass ich in den Jahren 1933 und 1934 mehr als genug zu tun hatte, um dieses Problem einigermaßen befriedigend lösen zu können. Wenn es trotzdem hier und da nicht gelungen ist, […] so liegt dies eben daran, dass die Jugendführer nicht mit abgeschlossener Ausbildung geboren werden. […] Und wenn Sie, die Eltern dieser Jugend, von all den vielen kleinen Dummheiten, Ungeschicklichkeiten und vielleicht auch Fehlern absehen, die […] gemacht worden sind, werden Sie doch mit Genugtuung […] feststellen können, dass sich die Jüngsten der Nation des Vertrauens nicht unwürdig gezeigt haben, das man in sie gesetzt hat. Unsere Pimpfe sind vielleicht keine braven Knaben im Sinne eines vergangenen Erziehungsideals. Es sind keine stillen Stubenhocker und Miniaturgelehrte.“112
108 Katholikenverfolgung in Deutschland. In: Der Neue Vorwärts vom 30.6.1935; bestätigt wird die Auslandsberichterstattung vielfach in Lageberichten wie jenem der Staatspolizeistelle Erfurt für März 1935 vom 4.4.1935. In: Rupieper/Sperk (Hg.), Lageberichte der Geheimen Staatspolizei zur Provinz Sachsen, Band 3: Erfurt, S. 168–189, hier 184: „An den meisten Ungezogenheiten und Übergriffen innerhalb der HJ tragen die Unterführer die Hauptschuld, weil sie zum größten Teil den ihnen übertragenen Aufgaben in keiner Weise gewachsen sind.“ 109 Vgl. Michael Burleigh, Die Zeit des Nationalsozialismus. Eine Gesamtdarstellung, Frankfurt a. M. 2000, S. 305. 110 Vgl. Lagebericht der Gestapostelle Aachen für September 1935 vom 7.1.1935. In: Faust/ Rusinek (Hg.), Lageberichte rheinischer Gestapostellen, Band II/2, S. 1043–1071, hier 1064. 111 Vgl. Georg Wagner, Nationalsozialismus in Erwitte und der kirchliche Widerstand unter Pfarrer Eberhard Klausenberg. In: Westfälische Zeitschrift, (1983) 133, S. 337–384, hier 365. 112 Die Rede des Reichsjugendführers. In: Deutsche Allgemeine Zeitung vom 10.12.1936.
158
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Die Hitlerjugend war nicht jene Vorbildjugend, welche die Propaganda sich zu präsentieren bemühte. Sie war es im Rückblick nicht und ebenso wenig gemessen am zeitgenössischen Anspruch. „Die Ansicht, dass die Jugend heute verwahrloster sei als in früheren Zeiten, nimmt leider zu“, so berichtete die Aachener Gestapo im März 1935, „gerade die Eltern betonen immer wieder, dass ihre Jungens heute zuchtloser geworden seien als sie es bisher waren.“113 1.3
Propaganda. Wenn Jugend um Jugend wirbt
Die Hitlerjugend war bis zum März 1939 noch keine Zwangsorganisation, die auf gesetzlicher Basis zur Teilnahme verpflichtet hätte. Sowohl die Mitgliedschaft als auch die Dienstbeteiligung blieben zumindest im Prinzip eine freiwillige Angelegenheit. Wer ihr nicht angehören wollte und dem Druck zur Anpassung widerstand, konnte Außenseiter bleiben. Aus ihren Reihen auszutreten, blieb zunächst ebenfalls möglich. Austrittswillige hatten es mit der Zeit allerdings zunehmend schwerer, weil Hemmnisse aufgebaut wurden.114 In Austrittserklärungen sollten Mitglieder oder die Eltern ihre Gründe darlegen.115 Obgleich Druck und Stigmatisierung zunahmen: Die Parteijugendorganisation blieb dennoch auf Werbung, Propaganda und die Beeinflussung von Familien, Schulen und Kirchen angewiesen, um zu wachsen und ihre Mitgliederzahl absichern zu können. Die Werbung wurde nach der Gleichschaltungswelle 1933/34 umso wichtiger, weil – auf hohem Niveau – die Erfassungsquoten der Hitlerjugend zu stagnieren begannen. Die HJ-Propaganda hatte stets drei Adressaten. Vordergründig richtete sie sich erstens an jene, die außerhalb standen und gewonnen werden mussten. Sie zielte zweitens auf Eltern, die aus politischen, religiösen oder anderen Erwägungen den Eintritt ihrer Kinder untersagten. Die Werbung richtete sich drittens an Kinder und Jugendliche, die zwar schon eingetreten waren, es allerdings an Diensteifer und Engagement vermissen ließen. Die Propaganda der Hitlerjugend wirkte auf diese Weise nach innen und außen gleichermaßen. Sie verband das Versprechen auf Gemeinschaft mit einer sozialen Drohkulisse. „Das deutsche Jungvolk sah mich nie wieder, bedrohte mich aber noch jahrelang“, so der Schriftsteller Günter de Bruyn über seine Kindheit. Nach anfänglicher Begeisterung, die ihn in das Berliner DJ geführt
113 Staatspolizeistelle Regierungsbezirk Aachen, Lagebericht für Februar 1935 vom 9.3.1935. In: Vollmer, Volksopposition im Polizeistaat, S. 172–180, hier 179. 114 Vgl. z. B. Austritt aus der HJ. In: GB: Pommern, A13/39 vom 1.12.1937: „Es wird darauf hingewiesen, dass jede Austrittserklärung an die Personalabteilung des Gebietes zur Nachprüfung eingesandt werden muss. In Zusammenarbeit mit der Verwaltungsabteilung wird jede Austrittserklärung nachgeprüft. Erst, wenn die Personalabteilung und die Verwaltungsabteilung keine Bedenken haben, gilt die Austrittserklärung als angenommen.“ 115 Austrittserklärungen. In: GB: Berlin, 14/37 vom 1.10.1937.
Die prekäre Hitlerjugend
159
hatte, zog er sich Mitte des Jahrzehnts enttäuscht zurück: „Jungen in Uniform brachten ‚Befehle‘, am Mittwoch zum ‚Dienst‘ zu kommen, und meine Mutter, die öffnen musste, ließ den Führer Grüße bestellen und ausrichten, dass ihr Sohn leider nicht auf dem Posten oder verreist oder schulisch verhindert sei.“116 Mut gehörte dazu, sich dieser Nachstellung zu erwehren. Die Hausbesuche hatten System. Werbung konnte heißen, überprüfend tätig zu sein. Jungen Menschen wurde – ob sie Mitglied waren oder nicht – im Alltag nachgestellt. Einen Großteil dieser Werbe- und Propagandaarbeit der Hitlerjugend schulterten die jungen Angehörigen zunächst selbst. Viel lag in deren eigener Verantwortung und Autonomie. Das Prinzip der Selbstführung galt in den 1930er-Jahren auf diese Weise sogar in Hinblick auf die Werbearbeit. Vorbereitungen für die Kampagnen, mit denen Kinder und Jugendliche in die Parteijugend geholt werden sollten, liefen jährlich im Februar und März an. Üblicherweise kulminierten die diversen Aktionen im April. Junge Menschen, die sich daran beteiligten, erlebten die Kampagnen mitunter als spannende, mitreißende Zeit. 1936, als die RJF eine 80- bis 85-prozentige Erfassung aller 10-jährigen Jungen als Ziel ausgegeben hatte, erreichte die Werbetätigkeit ihren Höhepunkt.117 Man übertraf die Erwartungen am Ende bei Weitem. Der 14. April bildete den Auftakt für eine lange Werbewoche. Am Anfang standen Appelle in Schulen. Es folgten Appelle in den Standorten und Betrieben. Schließlich kam es zum eigentlichen Höhepunkt. Am „Tag der öffentlichen Werbung“ zogen die Formationen durch die Straßen: Anmeldeformulare und Broschüren wurden verteilt, Schaukästen bestückt, Eltern per Post angeschrieben oder an der Haustür aufgesucht, mit Lautsprechern, Trommeln, Spruchbändern oder auf Lastwagen für die Hitlerjugend geworben. Die Banndienststellen stellten verschiedene Muster und Vorschläge für diese Aktionen zusammen. Die „Werbefeldzüge“ selbst lagen allerdings in der Hand der Unterführerschaft. Auf diese Weise sollte die Parteijugend ihre volle Anziehungskraft entfalten. Junge Menschen konnten sich für eine Sache einsetzen. Und Außenstehende wiederum sollten sehen, dass es sich um eine junge Bewegung handelte, in die einzutreten sich lohnen würde.118 Man warb mit politischen Parolen und Freizeitangeboten: soziale Gerechtigkeit, klassenlose Gesellschaft, Volksgemeinschaft, Sport, Kultur, Wandern, Zeltlager. Auf die vermeintliche Freiwilligkeit und Autonomie der Hitlerjugend legte man
116 Günter de Bruyn, Zwischenbilanz. Eine Jugend in Berlin, Frankfurt a. M. 1992, S. 92. 117 Diese Angabe nannte der Stellvertreter Schirach bei einem Besuch in Hamburg: Führertagung der Hitlerjugend. Stabsführer Lauterbacher. In: Hamburger Nachrichten vom 15.1.1936. 118 Recht typisch der kurze Hinweis über die Werbeaktion zur Aufnahme des Jahrgangs 1927. In: GB: Pommern, A3/37 vom 1.3.1937: „Für die Werbeaktion im März und April erscheint folgendes Werbematerial: Richtlinien für die Durchführung der Aktion, Plakate in zwei verschiedenen Größen, Bildbänder. Mehrere Schaukastendienste und Rednerdienste, in denen ausführliches Material über die Durchführung von Elternabenden usw. ist.“
160
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
großen Wert.119 Entscheidend waren aber weniger die politischen und weltanschaulichen Inhalte als vielmehr Aktivismus, angebliche Modernität und Vitalität, welche diese Aktion unter Beweis stellen sollte. Die Mitgliedschaft durfte nicht als langweilige Pflichtübung erscheinen. So schoss die männliche Jugend beispielsweise auf Rollschuhen waghalsig durch die Straßen und blies in Trillerpfeifen; die Motor-HJ nährte dagegen bei Kindern die Faszination für die moderne Technik und auch die Nachrichten-HJ erklärte, wie etwa ein Telefon funktionierte. Die Hitlerjugend sollte sich von ihrer attraktiven Seite zeigen. Freiraum wurde den jungen Unterführern bewusst gelassen. Allerdings hatte man bereits perfide Wege beschritten, die zeigen, dass es immer weniger um Freiwilligkeit ging. Junge Lehrlinge waren in den Betrieben dazu aufgefordert, zum Appell mit jenen anzutreten, die bereits zur Hitlerjugend gehörten. In die Zeltlager, die in den Tagen der Werbung zeitgleich stattfanden, führte man Schulklassen zur Besichtigung geschlossen hinein, um sie dort für den Eintritt zu begeistern. Mädchen holte man aus den Klassenzimmern, um ihnen die BDM-Sportveranstaltungen zu zeigen.120 Im gleichen Zuge wurden Drohungen formuliert, Schikanen aufgerichtet und Außenseiter verächtlich gemacht. Eine Handreichung gab beispielsweise einige Empfehlungen, wie die Werbefeldzüge konkret aussehen konnten. Beim Marsch durch die Straßen solle man etwa ein Schauspiel zum Besten geben: „Vorweg ein Haufen als Spießer angezogener Pimpfe – oder noch besser als Wandervögel verkleidet mit Mandoline, Laute und ‚Mädchens‘. Dahinter im Gleichschritt eine Auslesekolonne, die in sauberem Schritt mitreißende Marschlieder singt. Vorweg ein Schild: ‚So oder So!‘“121 Spott wurde abermals über die bündische Jugend ausgeschüttet und eine merkwürdige Darbietung hatte man als Vorschlag parat. Pimpfe sollten als Ziegen oder Kamele auftreten. Derart verkleidet, sollten sie ein lustiges Zwiegespräch zwischen fiktiven Hitlerjugend-Gegnern mimen. A ußerdem sollten bei den Heimabenden Plakate gebastelt werden. Man empfahl dabei Bilder hässlicher Fratzen, um die Nicht-Organisierten zu verhöhnen. Auf den Werbetouren sollten Transparente gezeigt werden, um das „Spießertum“ reaktionärer Eltern zu tadeln, die ihre Kinder nicht zum Jungvolk gaben.122 Unterführern fiel die Aufgabe zu, die Eltern zu besuchen und vom Beitritt der Söhne zu überzeugen. Die sogenannten Elternbesuche waren besonders delikat. Höhere Dienststellen stellten gleich mehrere Leitfäden bereit, die Empfehlungen enthielten, wie die Unterführer etwaigen Vorbehalten der Familien 119 Vgl. Gebiet Sachsen (Hg.), Wir rufen: Junge, zu uns!, Leipzig 1936, S. 15–19; sowie Botschaften der Werbewoche 1936 „Jugend soll von Jugend geführt werden. Erziehung zu Ordnung und Kameradschaft“. In: Der Freiheitskampf vom 9.4.1936; und Ablauf- und Veranstaltungsplan der Werbewoche. In: GB: Sachsen, 1/36 vom 5.2.1936. 120 Vgl. zu diesen und anderen Aktivitäten u. a. Werbung der Hitlerjugend, Gebiet und Obergau Sachsen. In: Die Gefolgschaft, (1935) 2: Werbung der Hitlerjugend; Anweisungen zur Werbewoche in der Broschüre: Gebiet Sachsen (Hg.), Unsere Arbeit zur Dienstgestaltung der Einheiten im Monat April, Dresden 1936, S. 3–10. 121 Gebiet Sachsen (Hg.), Wir rufen: Junge, zu uns!, S. 10. 122 Ebd., S. 9.
Die prekäre Hitlerjugend
161
begegnen könnten. Die Hitlerjugend sei konfessionell neutral, lautete ein Argument. Auch würden Kinder nicht vom Schulunterricht ferngehalten. Man überfordere sie im Dienst nicht, nehme im Sport und bei der Ausbildung Rücksicht auf körperliche Fähigkeiten. Die Mutproben – die von Eltern beklagt wurden – seien nur ein Gerücht und es gebe sie nicht. Aber in der Handreichung war dennoch zu lesen: „Es ist selbstverständlich, dass Jungen unter sich eben jungenhaft leben, dass sie rau und hart werden, braun von der Sonne und sich schlagen.“123 Die Werbewoche 1936 schloss am 20. April mit der Übertragung einer Rede von Reichsjugendführer Schirach sowie mit der gemeinschaftlichen Aufnahme von Jungen, die sich für die Parteijugend angemeldet hatten. Die propagandistischen Aktionen brachten der RJF einen Riesenerfolg; jedenfalls bei der Neuaufnahme des Jahrgangs 1926/27. Selbst dort war der Erfolg unverkennbar, wo die Hitlerjugend bislang einen schweren Stand gehabt hatte. Anfang März waren in Berlin nur rund 30 bis 40 Prozent der 10- bis 14-Jährigen vom Jungvolk erfasst gewesen; in keinem anderen Gebiet sah die Lage aus Sicht der RJF schlechter aus.124 Die Kampagnen brachten den Umschwung. Glaubhaft ist ein Sopade-Bericht im Herbst 1936, der aus der Hauptstadt erläuterte: „Bis zum Frühjahr wurde der Eintritt […] nicht gerade erzwungen. Wer nicht kam, blieb draußen und in den Schulen war die Zahl der nicht dem Jungvolk angehörigen Jungen meist in der Überzahl. […] Mit dem Geburtstag Hitlers […] setzte jedoch eine Werbeaktion ein, durch die auch der letzte Junge in das Jungvolk ‚freiwillig‘ hineingezwungen wurde. Anhand der Klassenlisten wurden zuerst die dem Jungvolk angehörenden Kinder in die Wohnungen der Eltern geschickt, um sie zur Anmeldung ihres Sohnes […] aufzufordern. Da diese Aktion nicht durchgreifend genug war, kamen wenige Tage später die zuständigen Orts- und Bezirksführer der Hitlerjugend, meist Bengels im Alter von 18, 20 Jahren und forderten die Eltern auf, die Kinder dem Jungvolk zuzuführen. Wo sie auf Widerstand stießen, ließen sie sich nicht abweisen, sondern forderten […] genaue Rechenschaft darüber, warum sie den Eintritt des Knaben nicht gestatten wollten.“125
Viele Eltern gaben ihren Widerstand am Ende wohl auf, obgleich sie mit dem Regime oder der Hitlerjugend vielleicht weiter nicht vollends einverstanden waren.126 Die RJF bemühte sich, den Erfolg in der Zukunft zu wiederholen. Mit dem Hitlerjugend-Gesetz vom Dezember 1936 trat keine grundsätzlich andere Lage ein. Die Werbefeldzüge blieben das wichtigste Instrument, um Nachwuchs zu gewinnen. In Sachsen informierte man die Unterführer Anfang 1937: „Im Hinblick auf das Gesetz […] weise ich darauf hin, dass das Freiwilligen-Prinzip nach wie vor besteht. Die Einheiten werden also wie im Vorjahr einen Werbefeldzug durchführen.“127 Der Zeitraum für die Aktionen im März und April
123 Ebd., S. 13. 124 Reichsjugendführung (Hg.), Statistik der Jugend, Teil 2, S. 5. 125 Bericht aus Berlin, A 69. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 3 (1936), S. 1307. 126 Vgl. auch entsprechende Berichte ebd., S. 1303 f. 127 Werbung des Jahrganges 1927. In: GB: Sachsen, 1/IV vom 20.1.1937.
162
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
urde ausgedehnt, zudem mussten DJ-Unterführer in kurzen Abständen an w ihre Dienststellen melden, wie viele Kinder sie bereits gewonnen hatten.128 Auch in den weiblichen Gliederungen wurde die Propaganda mit beachtlichem Erfolg intensiviert. Ende 1936 verzeichnete der JMB einen bemerkenswerten Zuwachs: 26 Prozent mehr Mädchen als im Vorjahr standen nun in der Hitlerjugend – rund 600 000, die neu eingetreten waren.129 Im Mai übrigens wurde Sophie Scholl zur Scharführerin befördert. Als solche war sie für rund 40 Mädchen verantwortlich. Schwester Inge Scholl, vier Jahre älter, war die Karriereleiter ebenfalls hinaufgeklettert und nun Ringführerin mit Verantwortung für bis zu 600 Kinder.130 Die Hitlerjugend schuf mit vielfältigen Teilhabe- und Kulturangeboten – wie Musik, Sport, Tanz, Schauspiel und Werkarbeit – für die Mädchen und jungen Frauen neue Räume zur Entfaltung, mit denen sie erfolgreich werben konnte. Der Druck zur Anpassung nahm aber ebenfalls zu, obgleich nicht im selben Maße wie bei Jungvolk und HJ. „Die meisten von ihnen“, so berichtete die Zeitzeugin Dorothea Negwer, die in Berlin aufwuchs, über ihre älteren Mitschülerinnen, „gehörten den Jahrgängen 1926/27 an, […] trugen bei feierlichen Anlässen, auch in der Schule, Uniform. Fast alle waren als sogenannte Jungmädel Angehörige der Hitler-Jugend. Ich wollte sein wie sie und dazugehören.“131 Die Hitlerjugend kombinierte steten Druck mit Lockangeboten. Diese Mischung blieb das Kerngeschäft für ihr Wachstum bis 1939. Die Werbearbeit verlief jedoch nicht immer unproblematisch. Der Gestaltungsspielraum, welcher den Einheiten und jungen Mitgliedern eingeräumt wurde, erwies sich als Vor- und Nachteil zugleich. Mancherorts kamen die Aktionen nicht in die Gänge oder zeitigten unerwünschte Folgen. Gut belegt ist das für die sogenannten Elternbriefe, welche die Unterführer meist im Vorfeld der Werbetage an Familien verschickten. Die Schreiben fielen oft rüde aus. In Düsseldorf urteilte man, sie seien „manchmal recht unglücklich“ formuliert. Im Sommer 1939, vergleichsweise spät, wurden sie dort für DJ-Führer genehmigungspflichtig.132 Ähnlich konnten auch die Elternbesuche im Fiasko enden. Otto Friedländer, der im Prager Exil die Berichte studierte, konstatierte ein „ganz unerträgliches Maß an Überheblichkeit“, das der Partei nicht immer zum Vorteil gereiche: „Die jungen Menschen, die über andere Alterskameraden ein unvorstellbares Maß von Macht besitzen, zeigen das Selbstgefühl dieser Macht auch den Eltern
128 Vgl. hierzu und zur Ausweitung der Werbewochen 1937 Stärkezwischenmeldungen zur Erfassung des Jahrganges 1927 (Verordnungsblatt 3/37 Sonderdruck). In: GB: Pommern, 4/37 vom 6.4.1937. 129 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 289. 130 Vgl. Barbara Beuys, Sophie Scholl. Biographie, 3. Auflage, München 2012, S. 109–115; Christine Friederich, Sophies Schwester: Inge Scholl und die Weiße Rose, München 2013, S. 18. 131 Dorothea Negwer, Das Leben und ich: eine Jugend in Berlin und anderswo, Norderstedt 2004, S. 95. 132 Elternbriefe. In: GB: Düsseldorf, A10/39 vom 5.7.1939.
Die prekäre Hitlerjugend
163
[…] gegenüber und es kommt dann mitunter zu Zwischenfällen“.133 Die Eltern wandten sich daher an die lokalen HJ-Dienststellen, um dort über die Unterführer Beschwerde einzureichen. Hier stießen sie aber oft auf taube Ohren, weshalb sie bei der nächst höheren Instanz umso eindringlicher klagten. Der Gebietsführung in Westfalen wurde es Anfang 1937 zu viel: „In letzter Zeit häufen sich in erschreckendem Maße die Fälle, wo Eltern […] zur Gebietsführung kommen, um sich hier […] zu beschweren.“134 Manches fiel negativ auf die Parteijugend zurück: Bei Werbemärschen kam es zu Prügeleien mit anderen Jugendgruppen, primär in katholischen Landstrichen oder großstädtischen Zentren der Arbeiterbewegung. Antikatholische Spottlieder, böse Plakatparolen, Gewalt oder Drohungen waren bisweilen derart kontraproduktiv, dass man in Trier 1935 vorhersagte, die Werbung der HJ werde „in einigen überwiegend katholischen Kreisen nicht den erhofften Erfolg haben“.135 Eine Theateraufführung der Hitlerjugend in der Festhalle in Freiburg im Breisgau 1935 gelangte gar in die Auslandspresse. Entgegen den Lippenbekenntnissen der RJF, die Regeln des Konkordats würden beachtet, giftete das Jungvolk dort massiv gegen die Kirche.136 Die Hitlerjugend betrieb ihre Propaganda nicht nur während der Eintrittskampagnen im Frühjahr. Werbung war eine sich dauerhaft stellende Aufgabe im Alltag. Und hatte man die großen Aktionen bewältigt, stellte sich bisweilen ermüdende Routine ein. Selten standen genügend Freiwillige für die Propagandaarbeit zur Verfügung. „Die Propaganda in den einzelnen Bannen ist sehr schlecht“, befand schlicht die Gebietsführung in Berlin im März 1936.137 Die Jugendlichen wurden für die Tätigkeiten, die sie in ihrer Freizeit ausübten, nicht bezahlt. Weil sich lokale Dienststellen mit der Arbeit überlastet fühlten, setzten einzelne Banne sogenannte Pressewarte befehlsmäßig ein. Junge Leute, die für die Propaganda- und Pressearbeit per Befehl abgestellt wurden, erfüllten sie erwartungsgemäß nicht mit großem Engagement. Die Leistungen blieben aus und die Banne dürften ihre Verantwortung für die Presse nicht einfach in die Einheiten wegdelegieren, kritisierte man beispielsweise Ende 1934 in Berlin oder auch Anfang 1936 in Pommern.138 Die Hitlerjugend selbst thematisierte die vielen Probleme in der Basisarbeit. Manches erscheint trivial. Plakate, die 133 Friedländer, Deutsche Jugend, unveröffentlichtes Manuskript, S. 281. 134 Besuche an Eltern. In: GB: Westfalen, B1/37 vom 4.2.1937. 135 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Mai 1935 vom 5.6.1935. In: Faust/Rusinek/ Dietz (Hg.), Lageberichte rheinischer Gestapo-Stellen, Band II/2, S. 615–632, hier 618 sowie 629 f. 136 Vgl. Wie es auf den Werbetagungen der Hitlerjugend zugeht. In: Pariser Tageblatt vom 2.11.1935. 137 Betr.: Propaganda. In: BB: Berlin, 111/36 vom 27.3.1936. 138 Vgl. Pressewarte der unteren Einheiten. In: GB: Pommern, 1/36 vom 11.1.1936; Propaganda-Referenten. In: BB: Berlin, 68/34 vom 17.12.1934. In Thüringen nahm das Gebiet eine ältere Anordnung über die Einsetzung von sogenannten Propagandareferenten auf Ebene der Banne 1935 wieder zurück, weil „geeignete Jugendgenossen schwer zu finden waren.“ Propaganda-Referenten. In: GB: Thüringen, 6/35 vom 10.5.1935.
164
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
im Zuge der Werbeaktionen geklebt wurden, blieben gelegentlich über Wochen hängen; die abgerissenen Reste und Fetzen an den Hauswänden, Zäunen und Mauern würden die Anwohner stören, bemerkten die höheren Dienststellen.139 Der Gebietsführer von Franken, Rudolf Gugel, beklagte eine „wilde Plakatpropaganda“, die einen „denkbar schlechten Eindruck“ erwecke, das Straßenbild beeinträchtige und „eine Reihe von Hausbesitzern und Ladeninhabern verärgert“ habe.140 Nichtigkeiten waren Anlass zum Tadel. Ein schlechtes Bild gebe die Hitlerjugend ab, meinte man in Wien 1941. Junge Leute würden mit „unsauberer Uniform“ herummarschieren, oft durch das „Herumstehen mit den Händen in den Hosentaschen“ ein überaus unwürdiges Bild abgeben.141 Derart auf die positive Außendarstellung der Parteijugend bedacht, verloren lokale und höhere Dienststellen manchmal jedes Verständnis für die jungen Mitglieder. Nicht unerwähnt bleiben sollen in diesem Zusammenhang die „Jugendfilmstunden“ – eine großflächige Aktion, um junge Menschen mit Filmvorführungen zu locken. Für Kinder und Jugendliche aus finanziell schwachen Familien, denen man einen Preisnachlass beim Eintritt gewährte, waren die Filmstunden in den 1930er-Jahren oft die einzige Möglichkeit, um einen aktuellen Spielfilm zu sehen. Dass die Vorführungen vor allem der Werbung dienten, wird daraus ersichtlich, dass sie sich nicht nur an Mitglieder der Parteijugend richteten, sondern von Außenstehenden besucht werden konnten. In Berlin liefen die ersten Vorführungen im April 1935 an.142 Die Filme wurden über die Gaufilmstellen bei den großen Verleihern bezogen. Für Vorführung, Kartenverkauf und Werbung zeichneten sich die lokalen Unterführer verantwortlich; die Kosten wurden nach der Veranstaltung mit der Gaufilmstelle abgerechnet. In Städten nutzte man Kinos, auf dem Land und für Vorführungen in Dörfern griff die Hitlerjugend auf Tonfilmwagen und Schmalfilmapparate zurück. Die Filmstunden konzentrierten sich auf den Herbst und Winter. Im Sommer wurden Vorführungen zunächst nur in den Zeltlagern veranstaltet; erst ab 1942 wurden sie auf Wunsch des Propagandaministeriums in der Sommerzeit durchgeführt.143 Zur Vorführung kamen verschiedene jugendfreie Filme. Hauptaugenmerk lag auf propagandistischen Streifen, die von der RJF zugelassen und mit dem
139 Vgl. Werbeplakate. In: GB: Pommern, 1/36 vom 22.1.1936; Werbeplakate des Jungvolks. In: BB: Berlin, 114/36 vom 24.4.1936; Anweisung der Propaganda-Abteilung. In: GB: Franken, 3/36 vom 6.1936; oder Plakatwesen. In: BB: Berlin, 111/36 vom 27.3.1936: „Es ist unmöglich, wie man es zur Zeit in allen Stadtteilen Berlins erleben kann, dass Plakate von Veranstaltungen, die bereits ein halbes Jahr zurückliegen, bis heute nicht entfernt wurden.“ 140 Plakatpropaganda. In: GB: Franken, 8/36 vom 11.1936. 141 Auftreten in der Öffentlichkeit. In: GB: Wien, K7/41 vom 1.7.1941. 142 Vgl. Erste Jugendfilmstunde im Gebiet Berlin. In: BB: Gebiet Berlin, 80/35 vom 1.4.1935. Erst nach Einführung der Jugenddienstpflicht und während des Krieges sollten Angehörige der Hitlerjugend bevorzugten Einlass bei den Filmstunden erhalten. Vgl. Nicht-Organisierte. In: GB: Westfalen, K18/40 vom 9.5.1940. 143 Vgl. Jugendfilmstunden. In: GB: Niederdonau, A1/40K vom 1.3.1940; Jugendfilm. In: ebd., 6/42K vom 20.6.1942.
Die prekäre Hitlerjugend
165
ütesiegel „jugendwert“ versehen waren. Einer der zweifellos hässlichsten anG tisemitischen Propagandafilme – „Der ewige Jude“, uraufgeführt Ende 1940 – galt der RJF als „jugendwert“. Die Formationen in Westfalen sollten „Sorge tragen, dass dieser Film von allen Jungen und Mädeln gesehen wird“.144 „Jud Süß“ galt ebenso als „jugendwert“ und bekam die Altersfreigabe ab 14 Jahren.145 Der Film „Jungens“, eine Produktion der Universum-Film Aktiengesellschaft (UfA), in dem eine dörfliche HJ-Einheit unter Leitung ihres Lehrers und HJ-Führers einen Schmuggler überführt, wurde zur Aufführung 1941 demgegenüber verboten, wie auch eine Reihe anderer Produktionen; der Film zeichnete kein vorteilhaftes Bild der Dorfgesellschaft.146 In der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre hatte man die Filmstunden vor allem zur Werbung genutzt. Filme wie „Jungzug 2“ oder „Hitlerjunge Quex“, dessen Aufführung dann in den Kriegsjahren verboten wurde, priesen die Vorzüge der Staatsjugend an.147 Statistiken über die Jugendfilmstunden sind für einzelne Banne u. a. im Gebiet Westfalen überliefert. Obgleich die einzelnen Städte und Landstriche aufgrund ihrer unterschiedlichen Größe und Einwohnerzahl gewiss nicht direkt vergleichbar sind, zeigt die Tendenz: In eher ländlichen Regionen, wo es keine Lichtspielhäuser gab, gewann die westfälische Hitlerjugend mit ihren Filmvorführungen ein großes Publikum; es kamen sogar viele, die der Partei- und Staatsjugend nicht angehörten. Im Ruhrgebiet, mit Ausnahme von Dortmund und Recklinghausen, organisierten die Unterführer weniger Vorführungen, vielleicht weil Jugendliche dort über mehr Alternativen verfügten. Die westfälische Hitlerjugend erreichte ab Oktober 1937 im Verlauf von zehn Monaten beachtliche 165 000 Besucherinnen und Besucher.148 Die Zahlen wiesen bis Kriegsbeginn 1939 interessanterweise eher nach unten als nach oben, die Beteiligung ging kontinuierlich zurück.149 Im Januar 1943 klagte die Führung, dass bloß „immer dieselben Jungen und Mädel teilnehmen“ würden.150 Im Gebiet Nordsee hatte man im Winter 1936/37 einen großen Zuspruch verzeichnet; angeblich waren es fast 140 Prozent mehr junge Besucher als im Vorjahr. Die örtliche Verteilung der Filmstunden sah etwas anders aus als im Rhein- und Ruhrgebiet. In Bremen hatten rund 27 500 junge Menschen in vier Monaten die Filmstunden besucht, in einigen kleineren Orten waren es mehrere Hundert oder Tausend. Möglicherweise weil das Gebiet nicht ausreichend über Filmwagen und Apparate verfügte, waren ländliche Regionen jedoch fast überhaupt 144 Vgl. Der Film „Der ewige Jude“ jugendwert. In: GB: Westfalen, K1/41 vom 19.1.1941. 145 Vgl. Jugendwerte/jugendfreie Filme. In: GB: Mark Brandenburg, 4/43K vom 26.8.1943. 146 Vgl. Der Ufa-Film „Jungens“. In: GB: Franken, 5/41K vom 8.1941. 147 Zum Verbot vgl. Hitlerjunge Quex. In: GB: Westfalen, K2/1943 vom 13.2.1943. 148 Vgl. Jugendfilmarbeit 1937/38. In: ebd., A16/38 vom 15.10.1938; Teilnahme von nichtorganisierten Jungen und Mädeln an Veranstaltungen der HJ. In: ebd., K18/40 vom 9.5.1940. 149 Vgl. die Aufstellungen über die Filmstunden in den westfälischen Bannen in diversen Ausgaben, überliefert zuletzt im GB: Westfalen A13/39 vom 15.7.1939; im April 1939 wurden demnach nur noch 11 500 Besucher und im Mai 10 714 Besucher gezählt. 150 Jugendfilmstunden. In: ebd., A1/43 vom 16.1.1943.
166
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
nicht bedient worden.151 In den Kriegswintern wurden die Filmvorführungen zumindest in einigen Gebieten einmal im Monat zum Pflichtdienst erklärt; was angesichts der Probleme, die sich der Hitlerjugend nach 1939 stellten, über die tatsächlich durchgeführten Veranstaltungen wenig aussagt.152 Die ländlichen Dienststellen verfügten teils nicht über Abspielgeräte und besaßen auch keine finanziellen Möglichkeiten, um Kinos anzumieten.153 Im Gebiet Niederdonau fiel die Bilanz im Winter 1942 verheerend aus. Vom „vollständigen Versagen in einigen Bannen“ war die Rede oder davon, dass „die Jugendfilmarbeit […] wieder ganz nachgelassen hat und fast um zwei Drittel gesunken“ sei.154 Auch im Gebiet Moselland wurde nun „ein spürbarer Rückgang“ registriert.155 Trotzdem die Jugendfilmstunden in der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre ein wichtiger und insgesamt erfolgreicher Bestandteil der Werbearbeit waren, verliefen sie schon zu dieser Zeit nicht ohne Probleme. Im Gebiet Westfalen wurden mehrere „Pannen“ offen thematisiert: Filmrollen standen nicht genügend zur Verfügung und bei zu späten Bestellungen durch die Formations- und Unterführer oder im Falle von Engpässen war es vorgekommen, dass Vorführungen abgesagt werden mussten. Die Besitzer der Lichtspielhäuser reichten Beschwerde ein, weil Unterführer die Veranstaltungen kurzfristig abgesagt hatten oder die vereinbarte Mindestzahl an Besuchern nicht erschienen war. Gravierender aus Sicht der höheren Dienststellen: In den Bannen, wo die Vorführungen im Nachgang abgerechnet werden mussten, herrschte mitunter erhebliche Schlamperei. Die Gaufilmstellen, die auf diese Abrechnungen angewiesen waren, konnten und durften deshalb keine Gebühr an die Verleiher zahlen. Ende 1937 nahmen die Rückstände ein so erhebliches Ausmaß an, dass sich die UfA – der wichtigste Filmproduzent und Verleiher – weigerte, der westfälischen Hitlerjugend überhaupt einen Film auszuleihen. Über mehrere Monate konnten keine UfA-Filme mehr von der Hitlerjugend gespielt werden.156 Ähnliches war offenbar auch in 151 Vgl. Teilnehmerzahlen an den Jugendfilmstunden. In: GB: Nordsee, 4/37 vom 4.3.1937; Abschluss der Winter-Filmarbeit. In: ebd., 8/37 vom 18.5.1937. Zum Problem der Gerätebeschaffung vgl. Hinweise unter Benutzung von Vorführungsapparaten. In: GB: Kurmark, 4/37 vom 1.4.1937. 152 Vgl. Jugendfilmstunden einmal im Monat. In: GB: Niederdonau, 11/42K vom 1.11.1942. 153 Nicht untypisch der Bericht der Außenstelle Oschatz im SD-Abschnitt Leipzig vom 31.1.1940 (Imperial War Museum Duxford, Morale Documents from Captain Branney, o. Sig., Digitalisat im Archiv des HAIT): „Da die HJ auf ihren Landeinheiten nicht in der Lage ist, die Filmtheater auszunützen, wurden Filmstunden noch nicht durchgeführt. […] Wenn im günstigsten Falle […] noch andere umliegende Orte dazu genommen [würden], ist es immer noch ein finanzielles Manko.“ Es sei der HJ nicht möglich, die Miete aus Eintrittsgeldern annähernd zu stemmen. 154 Jugendfilmstunden in den Bannen in den Monaten Oktober, November, Dezember 1942. In: ebd., 3/43K vom 30.3.1943. Nach Anweisung des Presse- und Propagandaamtes der RJF durften 1939 keine Besucherzahlen mehr zur Veröffentlichung kommen. Vgl. Besucherzahlen bei Durchführungsberichten über Jugendfilmstunden. In: GB: Westmark, A4/39 vom 1.4.1939. 155 Jugendfilmarbeit. In: GB: Moselland, K6/42 vom 1.6.1942. 156 Vgl. Schwierigkeiten in der Jugendfilmarbeit durch Nichtabrechnung der Jugendfilmstunden. In: GB: Westfalen: A1/38 vom 15.1.1938; ähnliche Probleme bei Jugendfilm-
Die prekäre Hitlerjugend
167
Brandenburg der Fall. Die Vorführungen spielten zu wenig ein und die Gaufilmstelle beschwerte sich gegenüber der Hitlerjugend. Die G ebietsführung wiederum beklagte sich über ihre nachgeordneten Stellen. In Städten würden zu wenige Filmstunden durchgeführt, man arbeite außerdem nicht kostendeckend: „Die Filmarbeit in […] Frankfurt-Oder, Brandenburg, Cottbus, Potsdam, Landsberg und Gorau muss wesentlich besser werden.“157 Die Werbung einzelner Formationen im Alltag lief primär über die Schaukästen. Seit 1933 fungierten sie als Ausstellfenster der Einheiten, mittels derer vor Ort neue Mitglieder geworben und die eigenen Vorzüge angepriesen wurden. Allein das Jungvolk in Sachsen verfügte 1935 über 1 025 Kästen – die meisten in Leipzig, Dresden und Chemnitz.158 Seit August 1937 trieb die RJF die Vereinheitlichung dieser Schaukästen voran. Für die Jungvolkwerbung waren sie wichtig. Vor Beginn der Werbewochen mussten die Jugendlichen die Schaukästen selbst bauen. Von der Idee, dafür die kostbare Freizeit zu opfern, waren nicht alle Jugendlichen begeistert. Im Gebiet Mittelelbe kam man im Herbst zu der Einsicht, dass in den Formationen „bis jetzt kaum ein Schaukasten […] angefertigt“ worden war. Um sie rechtzeitig für das Frühjahr 1938 fertigstellen zu können und zur Verfügung zu haben, zog man Tischlerlehrlinge und Berufsschulen hinzu.159 Fehlende, schlecht ausgestattete, veraltete oder mangelhafte Werbekästen wurden fortlaufend kritisiert. Anfang 1936 z. B. in Sachsen: Weil sie vielfach noch immer nicht zur Verfügung standen, veröffentlichte man Listen, wo sie bereits gebaut waren, um den Ehrgeiz der Einheiten anzuheizen.160 Waren sie fertiggestellt, mussten sie gepflegt und ausgestattet werden; alle zwei Wochen sollte der Inhalt erneuert werden.161 In Pommern konstatierte man im Frühjahr 1936, dass sie in „beklagenswerten Zustand“ seien. Die Kästen wären beschmiert und verschmutzt. Außerdem würden häufig Drohblätter gegen die „Drückeberger“ ausgehängt – das sei keine gute Werbung.162 Und in Westfalen kritisierte man 1940, dass die RJF-Werbematerialien „in einigen Bannen und Untergauen kaum zum Aushang gebracht worden“ seien.163 Insbesondere kirchenfeindliche Parolen waren oft Stein des Anstoßes. Nahe der Universitätsklinik Halle – um ein Beispiel zu nennen – hatte die Hitlerjugend 1935 einen Brandbrief ausgehangen: „Wir als Hitlerjungen können nur voller Verachtung oder Spott auf die jungen Leute sehen, die heute noch immer in ihre stunden in den Einheiten. In: GB: Saarpfalz, A5/37 vom 15.3.1937; Erfahrungen bei den Jugendfilmstunden. In: ebd., A10/37 vom 1.7.1937. 157 Jugendfilmstunden. In: GB: Kurmark, A2/39 vom 1.2.1939. 158 Vgl. Erhebungen. In: GB: Sachsen, 1/36 vom 5.2.1936. 159 Vgl. Reichseinheitliche Schaukästen. In: GB: Mittelelbe, A12/39 vom 1.11.1938. 160 Vgl. Schaukästen. In: GB: Sachsen, 1/36 vom 5.2.1936; Erhebungen. In: ebd. 161 Zur Akribie der Schaukastenpflege vgl. den Sonderdruck: Der Schaukasten der kurmärkischen Hitler-Jugend. Richtlinien für die Herstellung und Ausgestaltung unserer Schaukästen, Sonderausgabe des Gebietes Kurmark vom 12.1938. 162 Vgl. Schaukästen. In: GB: Pommern, 4/36 vom 27.4.1936; Schaukästen. In: GB: Nordmark, 3/36 vom 5.3.1936. 163 Schaukastendienst. In: Gebiets- und Obergaubefehl: Westfalen, K31/40 vom 22.8.1940.
168
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
lächerlichen evangelischen und katholischen Klubs laufen, um sich höchst überflüssigen religiösen Gefühlsduseleien hinzugeben.“ Die Hitlerjugend flehe nicht demütig um die Errettung ihrer „mehr oder minder schwarzen Seele“, rutsche auch nicht auf Knien oder Kirchbänken herum, warte nicht darauf, dass die Gnade des Himmels sie treffe. Die Hitlerjugend stehe im Leben, wissend: „Wer Adolf Hitler dient, dient Deutschland, wer Deutschland dient, dient Gott.“164 Ein Gestapo-Lagebericht aus Merseburg befand 1935 nicht zu Unrecht, diese Kästen der Hitlerjugend seien „geeignet, in der Bevölkerung Zweifel über die Aufrichtigkeit der Versicherung […] aufkommen zu lassen, dass die HJ sich in religiöser Hinsicht neutral verhalte“.165 Die RJF kritisierte schon Ende 1934 die Gebietsführungen, sie würden viele Plakate zum Druck freigeben, die aber mit „Haltung und Stil der Hitlerjugend nicht vereinbar“, zudem künstlerisch „vollkommen unzulänglich“ seien. Sie wies daher ihre nachgeordneten Stellen an, dass Entwürfe von nun an zuerst ihrem Propagandareferat vorgelegt werden müssten.166 Dass dies oft nicht geschah, in großem Maßstab kaum praktikabel und einigermaßen unrealistisch war, zeigen weitere Anweisungen auf Gebietsebene. In Berlin verbot man den unteren Einheiten im März 1935 die eigenmächtige Herausgabe von nicht autorisierten Blättern und Werbeschreiben, weil jene ein falsches Bild von der eigenen Arbeit und der Hitlerjugend im Gesamten vermitteln würden.167 Ende 1937 kritisierte das Führerkorps, dass junge Leute nicht nur die Anweisungen übergingen, sondern noch dazu „die schauderhaftesten Fetzen“ aushängen würden.168 In Thüringen untersagte die Führung ihren Unterführern im April 1938 das weitere Aushängen mutmaßlich antikirchlicher Parolen während der DJ-Werbetage, denn die Wortwahl schien angetan, „auf Außenstehende beunruhigend zu wirken.“169 Die Materialien der RJF zur Werbearbeit galten manchen Studien als Beleg dafür, dass die Hitlerjugendpropaganda reichseinheitlich betrieben und von oben gesteuert gewesen sei. Treffender wäre es, von einem Bemühen um Einheitlichkeit und Steuerung zu sprechen. Die höheren Dienststellen mussten die Werbearbeit nach und nach regulieren, weil das Selbstführungsprinzip an der Basis immer wieder Probleme aufwarf. Trotz dieser Vorgaben von oben oder der Bereitstellung von einheitlichen Materialien erfolgte diese HJ-Propaganda jedoch zu keinem Zeitpunkt tatsächlich einheitlich. In den ersten Kriegsjahren 164 Aus den Aushängekästen der Hitler-Jugend Schar 17/216, zit. aus Landesbruderrat der Bekennenden Evang.-luth. Kirche Sachsens. Mitteilungen für das Evangelische Jugendwerk vom 28.11.1935, S. 2 (LKA Dresden, Best. 5, 274, 2). 165 Lagebericht des Regierungspräsidenten Merseburg für September/Oktober 1935 vom 9.11.1935. In: Rupieper/Sperk (Hg.), Lageberichte der Geheimen Staatspolizei zur Provinz Sachsen, Band 2, S. 505–523, hier 512. 166 Herausgabe von Plakaten (Anordnung der RJF). In: BB: Berlin, 69/34 vom 21.12.1934. 167 Vgl. Mitteilungsblätter der unteren Einheiten. In: BB: Gebiet Berlin, 79/35 vom 23.3.1935. 168 Plakatgenehmigung, Plakataushang, Plakatentwürfe. In: GB: Berlin, 19/37 vom 15.12.1937. 169 Anfertigung von Plakaten politischen Inhalts. In: GB: Thüringen, A5/38 vom 30.4.1938.
Die prekäre Hitlerjugend
169
nahm außerdem die Bedeutung dieser Werbearbeit sukzessive ab, denn die Jugenddienstpflicht rückte nach 1939 an die Stelle der freiwilligen Mitgliedschaft. Werbung war deshalb nicht mehr so notwendig wie zuvor. In der HJ und im DJ fehlten die Unterführer, um die Arbeitslast im Alltag zu tragen. Die Probleme nahmen im Zeitverlauf sogar zu. „Veraltete Aushänge, verschmierte oder unsaubere Inschriften und Überschriften, schlechte Photographien“ fielen etwa bei Kontrollgängen auf. Wenig Sorgfalt würde von den Einheiten an den Tag gelegt; dabei sei doch der Schaukasten „das Fenster der Hitler-Jugend für den Außenstehenden“.170 Als Zumutung empfand es die Führung in Oberschlesien 1942, dass die Pflege der Werbekästen derart vernachlässigt würde. Teils hatten Einheiten Aushänge wohl über Monate hinweg nicht ausgetauscht. Den Pressestellen der Banne wurde zur Aufgabe gemacht, Kontrollgänge durchzuführen.171 In Nürnberg meinte man 1943, dass die Einheiten völlig untätig seien.172 Zur Werbearbeit gehörten in den 1930er-Jahren außerdem zahlreiche Veranstaltungen – wie Eltern- und Familienabende sowie kulturelle Aktivitäten, welche die Formationen ausführten. Sie alle sollten, meinte man im Gebiet Düsseldorf, „eine Leistungsschau sein, sodass […] wirklich unsere Arbeit gezeigt wird und die Erfolge unserer Erziehungsart zum Ausdruck kommen.“173 Eltern der Mitglieder wurden eingeladen, auch – über die Verbindungsmänner in den Schulen – Familien, deren Kinder den Weg in die Parteijugend bislang noch nicht gefunden hatten. Die Werbeerfolge gründeten maßgeblich auf derlei Veranstaltungen. Jugendliche und Formationsführer sollten vor Ort attraktive Angebote schaffen. Allerdings zeigte sich das Führerkorps nicht durchweg zufrieden. In Pommern sah man sich im Frühjahr 1937 genötigt, Unterführer rabiat zu kritisieren. Für die im Zuge der Jungvolkwerbung geplanten Elternabende seien die „Vorbereitungen […] in ungenügendem Maße getroffen worden“, weshalb man mit Ausfällen rechnete.174 Die Gebietsführung in Thüringen beanstandete 1935 die Pressearbeit ihrer Unterführer. Deren Texte hatte man sich regelmäßig zur Überprüfung vorlegen lassen. Dauernd würde darin Kritik an der Besucherzahl geübt: „Man schreibt dann meist etwas bitterböse und gallig, dass die erwachsene Generation nicht das nötige Interesse für die Jugend aufbringt […]. Diese Art Versammlungsbericht hat sofort zu unterbleiben, denn 170 Schaukastendienst. In: GB: Mittelelbe, A5/K41 vom 17.9.1941. 171 Vgl. Schaukastendienst. In: GB: Oberschlesien, K3/41 vom 19.6.1941. „Nur in ganz wenigen Einheiten befinden sich die Schaukästen in anständigem Zustand, sowohl auf äußeres Ansehen, als auch auf Ausgestaltung.“ Schaukästen. In: GB: Saarpfalz, A11/47 vom 26.7.1937. 172 Vgl. Zustand unserer Schaukästen. In: GB: Franken, 9/43 vom 12.1943: „Der Schaukasten […] hat, wie das Wort sagt, einerseits den Jugendgenossen über den Dienst und andererseits der Öffentlichkeit […] einen Einblick in unsere Arbeit zu vermitteln. Gemessen an dem Schaukasten muss ich bei manchen Einheiten annehmen, dass es mit ihrer Arbeit sehr schlecht aussieht.“ 173 Elternabende. In: GB: Düsseldorf, 5/38 vom 15.12.1938. 174 Elternabende im Rahmen der Jungvolkwerbeaktionen. In: GB: Pommern, A4/37 vom 6.4.1937.
170
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
es ist keine gute Propaganda, in der Öffentlichkeit den schlechten Besuch […] herauszustellen. Ist eine Veranstaltung wirklich schlecht besucht, dann machen wir uns den Vorwurf in unserem stillen Kämmerlein und rühren das nächste Mal etwas kräftiger die Propagandatrommel, denn es ist nicht die Schuld der Volksgenossen […], sondern einzig und allein die unsrige.“175 Die Werbeabende wurden gelegentlich mit Spendensammlungen verknüpft. Im Gebiet Mittelelbe, wo „Pimpfe“ Ende 1936 Spenden eintreiben sollten, zeigte sich die Führung im Nachgang enttäuscht. Nur die Hälfte dieser Abende sei erfolgreich verlaufen.176 Die Negativbeispiele lassen sich in die größere Entwicklung der Massenorganisation und ihre fortschreitende Bürokratisierung einordnen. Veranstaltungen in Eigenverantwortung abzuhalten, gehörte eigentlich zum Selbstführungs- und Basisprinzip der NS-Jugendbewegung. Werbung fiel in die Befugnis der Einheitenführer. Doch deren Aktivitäten wurden nach 1933 sukzessive zustimmungspflichtig. Die RJF sah ihre Werbearbeit in Konkurrenz stehend beispielsweise zu kirchlichen Angeboten, und das Gelingen der Werbetätigkeit war zu bedeutsam, um sie in der Verantwortung zweifelhafter Unterführer zu belassen. Spätestens ab Ende 1936 galt überall: Jede Veranstaltung, ob Eltern- oder Gemeinschaftsabend, Vorführung oder Feierlichkeit, musste durch den Bannführer genehmigt werden. Für Einladungen über die Presse verfügten die Banne über einen eigenen Mitarbeiter.177 Bei Feierstunden ließen sich die Gebietsführungen vier Wochen im Vorlauf das Programm zuschicken. Die Kulturstellenleiter der Banne sollten die „weltanschauliche“ Qualität überwachen. Den unsäglichen „Kitsch an Laienspielen und Theaterstücken“ beispielsweise sollten sie unterbinden helfen; nur die empfohlenen Stücke dürften aufgeführt werden.178 Zur Mitte des Jahrzehnts hatte man sich verstärkt vermeintlichen Problemen in diesem Bereich zugewandt. Zahlreiche Blätter zur Gestaltung dörflicher Kultur- und Heimabende brachten RJF und Gebiete in Umlauf. „In letzter Zeit“, kritisierte gleichwohl das Führerkorps im Gebiet Pommern, „macht sich wieder bei zahlreichen Veranstaltungen, in Liedern, Gedichten sowie in Presserzeugnissen ein gewaltiger Kitsch bemerkbar, den es mit allen Mitteln zu bekämpfen gilt.“179 Zum sogenannten Kitsch zählte man vorrangig alles, was mit den Traditionen 175 Versammlungsberichte. In: GB: Thüringen, 14/35 vom 19.12.1935; Kritik an den Presse-Stellenleitern unter Artikel und Berichte. In: GB: Kurmark, A13/38 vom 1.11.1938: „Die Aktivität […] in den Bannen und Jungbannen hat außerordentlich nachgelassen.“ 176 Vgl. Öffentliche Abende. In: GB: Mittelelbe, 1/37 vom 16.1.1937. 177 Vgl. beispielsweise Verkehr aller Einheiten mit der Presse. In: GB: Franken, 3/38 vom 4.1938. 178 Vgl. Richtigstellung sowie Elternabende – Feierstunden. In: GB: Mittelrhein, 13/36 vom 5.12.1936; Feier- und Freizeitgestaltung. In: GB: Pommern, 9/36 vom 2.7.1936. Im Gebiet Thüringen hatte die Führung schon im Frühjahr 1935 darauf hingewiesen, dass jede nicht zuvor genehmigte Veranstaltung im Zweifelsfall verboten würde. Vgl. Öffentliche Abende. In: GB: Thüringen, 5/35 vom 14.4.1935. Entsprechende Anweisungen durchziehen die Befehlsblätter, auch nach 1939, so z. B. bei Durchführung von Veranstaltungen. In: GB: Westmark, 7/43K vom 12.4.1943, mit typischen Formulierungen wie „Es ist wiederholt darauf hingewiesen worden …“. 179 Kampf dem Kitsch. In: GB: Pommern, 8/36 vom 17.8.1936.
Die prekäre Hitlerjugend
171
der älteren Jugendbewegung sowie der bündischen Jugend in Verbindung zu stehen schien. Es reichte aber noch weiter. Hitlerjungen, die Tänze aufführten, hielt man generell für geschmacklos. Wenn es denn „im Dorf gebräuchlich ist, dass jede Veranstaltung mit Tanz verbunden sein muss“, lamentierte man – nicht zufällig nach dem traditionellen „Tanz in den Mai“ – im Frühjahr 1938, sollten die HJ-Mitglieder wenigstens nicht in Uniform aufspielen. Unzulässig sei, dass man einen Gemeinschaftsabend, welcher ja der Werbung diene, noch dazu bis in die Morgenstunden treibe. Überhaupt dürfe nur getanzt werden, was die RJF in einem Heft über deutsche Tänze vorgebe.180 Die Einheiten und Formationen führten in etlichen Fällen Veranstaltungen durch, die von den Vorgaben abwichen. Im Gebiet Saarpfalz drohte der Gebietsführer Walter Kröcher 1939, er werde „in Zukunft alle kulturellen Veranstaltungen rücksichtslos verbieten und abblasen“, die nicht zuvor gemeldet worden seien.181 Manchmal legten die Unterführer – bewusst oder aus bloßer Unkenntnis – ihr Programm nicht vor, obwohl es genehmigungspflichtig war. Faszinierend und vielsagend ist eine ganz außergewöhnlich schroffe Kritik der Gebietsführung von Hamburg – damals das Epizentrum der US-amerikanisch beeinflussten Jugendkultur – von Anfang 1939. Es sei nicht hinnehmbar, tönte es aus der Dienststelle, dass „auf einem Gemeinschaftsabend mit Eltern und Bekannten […] Swing, Hot und Lambeth-Walk gespielt“ werde, dies eine HJ-Kapelle in Uniform noch dazu musikalisch begleite, und dabei „der ganze Saal (HJ, BDM und Elternschaft) nach diesen ‚Melodien‘ ‚tanzt‘ “. Genügend gute deutsche Tänze stünden zur Auswahl: „Die Balztänze der Neger und degenerierten Europäer passen nicht zu uns.“182 Wahrscheinlich war von einem der anwesenden Jugendlichen, vielleicht aber auch aus dem Kreis der Eltern, über die Swing-Kapelle auf der HJ-Veranstaltung nach oben berichtet worden. Eher eine besondere Ausnahme, nicht der Regelfall, was aber dreierlei aufzeigt: erstens, dass Vorgaben immer wieder missachtet wurden; zweitens, wie wenig Durchgriffsmöglichkeiten höhere Dienststellen im Zweifelsfall besaßen; und drittens, dass sogar Ende der 1930er-Jahre noch Spielräume, selbst innerhalb der bürokratisierten Staatsjugend existierten, welche die Mitglieder – obgleich unter Gefahr der Denunziation und Verfolgung – eigensinnig nutzen konnten.183 Die 180 Elternabende, Dorfabende mit anschließendem Tanz. In: GB: Pommern, A5/38 vom 1.5.1938; im selben Zusammenhang Verbot von „Volkstänzen“ auf Elternabenden im GB: Thüringen, A4/38 vom 1.4.1938; Eltern- und Dorfgemeinschaftsabende. In: GB: Koblenz-Trier, K2/41 vom 1.2.1941: „Es ist immer wieder festzustellen, dass die meisten Ausgestaltungen […] in der unmöglichsten Form geschehen, die in keiner Weise unserer nationalsozialistischen Haltung Ausdruck geben.“ Für kulturelle Vorgaben beispielhaft das Heft der Gebietsführung Nordmark (Hg.), Winke zur Dorfabendgestaltung, 1. Folge, Kiel 1937. 181 Kulturelle Veranstaltungen der HJ. In: GB: Saarpfalz, A2/39 vom 28.2.1939. 182 Elternabende, Gemeinschaftsabende usw. In: GB: Hamburg, A2/39 vom 1.2.1939. 183 Nochmals im Sommer 1939 wies man in Hamburg auf die Unzulänglichkeiten der Veranstaltungen hin. Einheiten würden die Zustimmung zu selten einholen; vgl. Gemeinschaftsabende, kulturelle Veranstaltungen usw. In: ebd., A10/39 vom 15.6.1939.
172
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
RJF berichtete 1943 über eine Zunahme jener „unwürdigen Kundgebungen swingfreundlicher Jugendlicher“, und die Reichsmusikkammer wollte zeitgleich Kapellen zu einer Erklärung verpflichten, wonach „keine Musikstücke […], die von Juden komponiert, instrumentiert, textiert“ waren, gespielt werden durften, das „Hotspielen und Hitimprovisation“ ebenso wie die Aufführung von „englischen, französischen und polnischen Musikstücken“ zu unterbleiben hatten.184 Manchmal, wie in diesem Fall, versuchten höhere Dienststellen nicht nur aus pragmatischen, sondern aus ideologisch-weltanschaulichen Motiven die Autonomie der Basis einzuschränken. Immerhin könnte man argumentieren, die Swing-Darbietung der Hamburger Einheit habe im urbanen Umfeld sehr wohl eine gelungene Werbung dargestellt. In anderen Fällen sabotierten junge Menschen das Anliegen der RJF tatsächlich. Sie gebärdeten sich auf destruktive Weise radikal, gerade in Hochburgen der katholischen Kirche, und schreckten mit ihren aggressiven Parolen mehr ab, als Außenstehende zu gewinnen. In wieder anderen Fällen waren aus Sicht des Führerkorps die jungen Beteiligten nicht ausreichend engagiert, um den hohen Ansprüchen der Propaganda- und Werbearbeit zu genügen. Weitere Beispiele ließen sich an dieser Stelle anfügen. Sie sollten nicht überbewertet, aber eben auch nicht unterschlagen werden. Will man erklären, warum die Hitlerjugend mancherorts schlechter aufgestellt blieb, gehört diese Art der Basisarbeit als Baustein zur Antwort dazu. An geeigneter Stelle ist der Blick auf die regionalen Unterschiede in Hinblick auf die Stärke und die unterschiedlichen Erfassungsquoten zu richten. Manchmal lassen sich diese Differenzen mit pauschalen Aussagen nicht zur Zufriedenheit erklären: Milieu, Konfession, Stadt oder Land, diese strukturellen Voraussetzungen waren sicherlich nicht unerheblich, aber im Einzelfall wohl nicht entscheidend. Der Erfolg oder Misserfolg entschied sich an der Basis. In Koblenz strichen die Überwachungsorgane Mitte 1934 heraus, dass trotz erheblicher „Gegenpropaganda“ durch die katholische Geistlichkeit die Hitlerjugend insgesamt gute Erfolge erzielt habe. In manchen Orten blieben die Eltern und Kinder jedoch auf Abstand. Das habe sich die Parteijugend in diesen Landstrichen aufgrund teils „überaus ungeschickter Propaganda“ selbst zuzuschreiben.185 1.4
Unsittliche Hitlerjugend? Die Sexualitätsdiskurse
Fragen von Sexualität, Liebe und Körperlichkeit wurden in der Hitlerjugend in Materialien, Vorträgen oder Schulungen fast ausschließlich im Kontext der Rassenideologie und Bevölkerungspolitik aufgeworfen. Eine sozusagen echte, am Individuum orientierte Sexualaufklärung fand kaum statt. Sie zeigte sich
184 Anweisung der RJF und Erklärung der Reichsmusikkammer, zit. nach Verbot der Swing-Musik. In: GB: Franken, 5/43 vom 6.1943. 185 Lagebericht der Gestapostelle Koblenz für Juli 1934 vom 5.8.1934. In: Faust/Rusinek/ Dietz (Hg.), Lageberichte rheinischer Gestapostellen, Band I, S. 265–276, hier 275.
Die prekäre Hitlerjugend
173
a llenfalls restriktiv, indem primär jene Dinge zur Sprache kamen, die sich aus sittlichen, bevölkerungspolitischen oder eben rassenideologischen Gründen zu tun verboten. Sexualitätsfragen bildeten auf diese Weise zwar einerseits ein Vehikel, um nationalsozialistische Ideologie zu vermitteln. In der Praxis der Massenorganisation war Sexualität andererseits aber vorwiegend problembelastet. Aus den Sittlichkeits- und Sexualitätsdiskursen der 1930er-Jahre konnte bisweilen sogar eine Gefahr für Ideal und Anspruch der Hitlerjugend erwachsen. Homosexualität im Besonderen galt als „volkszersetzend“; sie konnte, wie jedenfalls viele glaubten, ähnlich einer Krankheit um sich greifen.186 Das Führerkorps war bemüht, die Homosexualität zu einem Problem vornehmlich der bündischen Jugendbewegung zu stilisieren, wo sie angeblich in besonderer Weise grassiert habe.187 Vermeintlichen Gegnern oder Rivalen – wie dem ermordeten HJ-Führer Karl Lämmermann – wurde oft homosexuelle Veranlagung unterstellt. In einer Denkschrift der RJF über Unterwanderungsgefahr für die HJ hieß es 1936 bezeichnend: „Fast sämtliche […] Führer oder Anhänger der Bünde sind homosexuell oder gestatten den homosexuellen Verkehr ihrer Anhänger.“188 Die Jugendbewegung der Weimarer Zeit hatte zwar eine vergleichsweise freie Sexualmoral vertreten. Doch die Gleichsetzung der bündischen Jugend mit Homosexualität nach 1933 war ein Propagandamanöver der RJF, um von Vorkommnissen in den eigenen Reihen abzulenken. Zwei prominente, zuvor genannte Fälle, welche die HJ betrafen, waren Martin Ludwig und Franz Schnaedter, ehemalige Gebietsführer von Sachsen. 1934 waren sie unabhängig voneinander in Verdacht geraten, gleichgeschlechtliche Beziehungen unterhalten oder sich an Jüngeren vergangen zu haben. In beiden Fällen spielten wohl auch private Rivalitäten eine Rolle. Trotz der „unzweifelhaft erheblichen Verdienste um die Hitlerjugend“, lautete es im Urteil gegen Schnaedter, habe sich der Angeklagte so schwerwiegender Verbrechen schuldig gemacht, dass man mildernde Umstände nicht habe berücksichtigen können.189 Nicht nur der Gebietsführer, berichtete „Die Weltbühne“ 1934, sondern auch viele weitere „Jugendführer im Ruhrgebiet, in Schlesien und in Württemberg“ waren zeitgleich verhaftet worden.190 Die Verfolgung begann kurz nach der „Machtergreifung“. Das Gebiet Berlin schloss ab Januar 1934 binnen weniger Monate drei Personen aufgrund des Paragrafen 175 aus, der gleichgeschlechtliche Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte.191 Der „Röhm-Putsch“ hatte die Verfolgung nach dem Sommer 1934 erheblich verstärkt. Unter den bis 1941 in den 186 Vgl. hierzu und im Folgenden Oberbannführer Tetzlaff, Homosexualität und Jugend. In: Der HJ-Richter. Schulungsblatt der HJ-Gerichtsbarkeit, (1942) 5, S. 1–8, hier 1. 187 Vgl. Kollmeier, Ordnung und Ausgrenzung, S. 180. 188 Zit. nach Abschrift: Reichsjugendführung. Amt für Jugendverbände, Bündische Jugend. Entwicklung der dj.1.11 (geheim, Exemplar Nr. 021), erstellt am 1.2.1936 (StA Stuttgart, Q3/68, Bü. 5777). 189 Urteil (16 Js 158/35) gegen August Johann Schnaedter vom 14.11.1935, S. 28 (StA Chemnitz, 30071: Zuchthaus Zwickau, 19804). 190 Heinz Pol, Die Massenorganisationen. In: Die Weltbühne vom 19.7.1934. 191 Vgl. Ausschlüsse. In: BB: Berlin, 55/34 vom 14.9.1934.
174
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Karteien der RJF überlieferten Ausschlüssen begründeten sich 294 Fälle aus homosexuellen Handlungen, weitere 628 Ausschlüsse waren aufgrund nicht näher definierter „Sittlichkeitsdelikte“ erfolgt. Die überlieferten Ausschlüsse betrafen in 94 Prozent, also in überwältigender Mehrzahl männliche Mitglieder.192 Das sächsische Innenministerium rief Ende Juli 1934 alle staatlichen Stellen auf, jene Personen, die „bestraft oder homosexueller Betätigung verdächtig sind […], auch ohne Parteizugehörigkeit, als Angehörige der Jugendorganisation“ umgehend zu melden.193 Die RJF intensivierte – im „Bestreben, die ihr anvertraute Jugend von allen verbrecherischen Elementen rein und sie vor allen sittlichen Gefahren fern zu halten“ – bis Jahresende 1934 die Zusammenarbeit mit Polizei und Gestapo.194 Ins Visier der staatlichen Organe ebenso wie der HJ-Funktionäre gerieten zu Beginn primär die sogenannten Jugendverführer; dies meinte entweder junge Unterführer oder Erwachsene, welche die Einheiten und Formationen leiteten und sich sexueller Annäherungen oder des Missbrauchs strafbar gemacht hatten. „Bei der Hitlerjugend ist eine beunruhigend große Zahl von Fällen vorgekommen“, hieß es aus Chemnitz 1935, „in denen sich Jugendführer, ein Bannarzt und ähnliche Personen, in unzüchtiger Weise an den Jungen vergangen haben.“195 1936 wurde eine allgemeine und viel weitergehende Meldepflicht in der HJ eingeführt. Demnach sollten Hitlerjungen bei ihren Dienststellen jene Kameraden melden, die sie für Homosexuelle hielten, auch unabhängig von Annäherungsversuchen oder Übergriffen. Ließ sich nachweisen, dass gar hauptamtliche Führer derlei Meldungen bewusst unterließen, wurde gegen sie auf disziplinarischem Wege vorgegangen.196 Fahndungen wie jene nach dem 16-jährigen Otto P. aus Dresden wurden seit Mitte des Jahrzehnts in der Parteijugend gelegentlich verbreitet. Dieser sei „homosexuell veranlagt“ und versuche „in HJ-Einheiten […] seiner verbrecherischen Veranlagung zu frönen“.197
192 Vgl. Kollmeier, Ordnung und Ausgrenzung, S. 308. 193 Sächsisches Ministerium des Innern an die Amtshauptmannschaften, Zweigämter, staatlichen Polizeiämter und die Stadträte der Gemeinden vom 30.7.1934 (KreisA Pirna, Gemeinde Hohenstein, 503-14, 227, Verwaltungspolizei: Allgemeines, Bd. 1, unpag.). 194 Das Landeskriminalpolizeiamt Karlsruhe an die Polizeipräsidien, Polizeidirektionen und Bezirksämter über homosexuelle Betätigung in der Hitlerjugend vom 21.12.1934 (StA Freiburg, B719/1, 5018, Bl. 002521). 195 Kreishauptmann Chemnitz, Sonderbericht, Punkt 6: NSDAP und ihre Gliederungen vom 10.1.1935 (BArch Berlin, R85, 3731, Bl. 37 f.). 196 Ein Beispiel zur Entscheidung des HJ-Obergerichts über einen Bannführer, der Meldungen über „homosexuelle Verfehlungen“ unterließ, ist aufgeführt bei Tetzlaff, Homosexualität und Jugend, S. 7. Vgl. zudem Reichsjugendführung (Hg.), Sonderrichtlinien zur Bekämpfung gleichgeschlechtlicher Verfehlungen im Rahmen der Jugendorganisation, Berlin 1943, in Auszügen abgedruckt bei Günter Grau (Hg.), Homosexualität in der NS-Zeit. Dokumente einer Diskriminierung und Verfolgung, Frankfurt a. M. 1993, S. 294–301. 197 Fahndungsaufruf. In: GB: Thüringen, 8/36 vom 18.8.1936. Vgl. im Zusammenhang Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 447.
Die prekäre Hitlerjugend
175
Im BDM gab es derlei Vorgaben und Aufrufe nicht. Der Paragraf 175 bezog sich nur auf Männer. Homosexualität unter Mädchen und jungen Frauen lag jenseits der Vorstellungskraft der RJF; nach 1939 nahmen allerdings Forderungen nach Strafverfolgung durchaus zu.198 Lediglich bei vier BDM-Angehörigen wurde ein Ausschluss in den RJF-Karteien diesbezüglich begründet. Auch die sogenannten Warnfälle lassen sich bis 1942 an einer Hand abzählen.199 Obgleich Denunziation existierte, war sie in der Hitlerjugend offenbar nicht die Regel. Den meisten Fällen gingen Ermittlungen der Polizei und Gestapo voraus. Der Faktor der Denunziation in der Homosexuellenverfolgung, so die Einschätzung von Alexander Zinn, hat die Forschung lange Zeit maßlos überschätzt.200 Dem entspricht, dass die Gebietsführung von Westfalen Ende 1938 kritisierte, dass weiterhin zu wenig Eilmeldungen von Unterführern, aus HJ-Formationen oder nachgeordneten Dienststellen bei ihr einträfen: „Wir erhalten zum Teil Meldungen der Kriminalpolizei oder der Geheimen Staatspolizei und hören von Euch nichts.“201 Sowohl die Ausgrenzung und Verfolgung vermeintlicher Homosexueller als auch die Sittlichkeitsideale der Hitlerjugend sind in anderen Studien zumindest angerissen worden. Ob und in welcher Größenordnung sexueller Missbrauch von Kindern in der Staatsjugend existierte, ist völlig unerforscht.202 Einvernehmliche Annäherungen von Übergriffen zu unterscheiden, stellt sich im Übrigen oft als ein schwieriges Unterfangen dar.203 Im Folgenden soll in erster Linie interessieren, welche Bedeutung jenen Delikten zufiel, die publik wurden, und wie die RJF oder höhere HJ-Funktionäre auf die Vorfälle reagierten. Die Disziplinarpraxis ebenso wie die Sexualpolitik in der Hitlerjugend hatten, so die These, nicht nur eine genuin ideologische Seite, die auf Rassismus, biologistische Vorstellungen von „Volksgesundheit“, Ressentiments oder kulturpessimistische Degenerationsfantasien zurückverwies. Die RJF reagierte in Hinblick auf Geschlechterfragen und Sexualaufklärung mindestens ebenso auf Gerüchte, Skandale und vermeintliche Missstände, die sie massiv unter Druck setzten.204 198 Vgl. Tetzlaff, Homosexualität und Jugend, S. 6 f. 199 Vgl. Claudia Schoppmann, Nationalsozialistische Sexualpolitik und weibliche Homo sexualität, 2. Auflage, Pfaffenweiler 1997, S. 44 f. 200 Alexander Zinn, „Aus dem Volkskörper entfernt“? Homosexuelle Männer im Nationalsozialismus, Frankfurt 2018, S. 537. Zur laufenden Überwachungstätigkeit der Gestapo auf Basis von Anzeigen vgl. Schreiben des Geheimen Staatspolizeiamtes Karlsruhe über Verfehlungen der HJ-Angehörigen und Führern der Bewegung vom 21.3.1935 (GLA Karlsruhe, 465c, 23587, unpag.). 201 Eilmeldung bei Vergehen nach dem §175. In: GB: Westfalen, A19/38 vom 1.12.1938. 202 Eine Annäherung, ohne Blick auf die Institution der Hitlerjugend, bei Zinn, „Aus dem Volkskörper entfernt“, S. 492–499. 203 Vgl. Stefanie Wolter, Lebenssituationen und Repressionen von LSBTI im Nationalsozialismus. Desiderate und Perspektiven der Forschung. In: Michael Schwartz (Hg.), Homosexuelle im Nationalsozialismus. Neue Forschungsperspektiven zu Lebenssituationen von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen Menschen 1933 bis 1945, München 2014, S. 43–52. 204 Vgl. stellvertretend eine klassische Deutung bei Armin Nolzen, „Streng vertraulich!“. Die Bekämpfung „gleichgeschlechtlicher Verfehlungen“ in der Hitlerjugend. In: Susanne zur Nieden (Hg.), Homosexualität und Staatsräson. Männlichkeit, Homophobie und
176
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Um diesen Zusammenhang zu verdeutlichen, ist der Blick zunächst auf Hans Siemsen zu richten. Siemsen stammte aus der bündischen Jugend und war Mitte der 1930er-Jahre nach Paris emigriert. Die seinerzeit verbreiteten Vorwürfe gegen die Hitlerjugend nutzte er als Stoff für einen Skandalroman, der 1940 – auf Vermittlung Klaus Manns – in London erschien; deutsche Ausgaben kamen unmittelbar nach Kriegsende auf den Markt. Der Protagonist der Erzählung, Adolf Goers, ist ein ehemaliger Pfadfinder, der in die HJ übergetreten ist. Siemsen stützte sich beim Schreiben auf Berichte eines HJ-Führers namens Walter Dickhaut. Der war nach brutalen Gestapo-Verhören ebenfalls nach Paris geflohen und hatte sich dort mit Siemsen angefreundet, dem er seine Geschichte erzählte. „Hitler Youth“ war der erste größere Roman über die HJ, der im Ausland erschien und beanspruchte, ihr Innenleben offenzulegen. Die Staatsjugend wird dort nicht nur von Korruption, Intrigen und struktureller Gewalt, sondern auch von sexuellen Ausschweifungen und dem Missbrauch an Kindern beherrscht.205 „Die Homosexualität spielt in der HJ eine große, wichtige, nicht nur zufällige Rolle“, behauptete Siemsen: „Wer es bestreitet oder verschweigt, der weiß entweder nichts davon, oder er hat bestimmt Gründe, die Wahrheit nicht zu sagen.“206 HJ-Führer würden Beförderungen von sexuellen Gefälligkeiten abhängig machen. Mancher halte sich einen Harem gefügiger, gutaussehender Jungen. Über Schirach waren Gerüchte in Umlauf, die Siemsen in die Erzählung geschickt einbaute. Dem Propagandastreifen „Hitlerjunge Quex“, 1934 in die Kinos gekommen, seien pädophile Untertöne eigen. Unter jungen Männern seien gleichgeschlechtliche Handlungen daher als „quexen“ geläufig. Nur die Minderheit der HJ-Führer sei homosexuell veranlagt, viele würden ihre Macht bloß zur sexuellen Befriedigung missbrauchen. Unter jenen, die er kennengelernt habe, lässt Siemsen seinen Erzähler berichten, sei nur einer gewesen, der den Mut aufgebracht habe, darüber zu reden: „Nicht bei der HJ-Leitung oder der Polizei, sondern […] bei seinen Eltern. Die Eltern zeigten den Führer an. Es gab einen Prozess. Der Führer wurde zu Gefängnis verurteilt.“207 Der Bericht bediente antifaschistische Stereotype vom homosexuellen Nationalsozialisten, die sich im Ausland verbreiteten. Kindesmissbrauch und Homosexualität fielen hier zeittypisch in eins. Siemsen bemühte sich zwar durchaus um DifferenziePolitik in Deutschland 1900–1945, Frankfurt a. M. 2005, S. 253–281, hier 259 f.; eine kritische Bestandsaufnahme der Forschungsdiskurse bei Zinn, „Aus dem Volkskörper entfernt“, S. 532–545. 205 Vgl. Dieter Schiller, Der Traum von Hitlers Sturz: Studien zur deutschen Exilliteratur 1933–1945, Frankfurt a. M. 2010, S. 626–629; Wolfgang Popp, Männerliebe. Homosexualität und Literatur, Stuttgart 1992, S. 326; Eintrag zu Hans Siemsen. In: Bernd-Ulrich Hergemöller (Hg.), Mann für Mann. Biographisches Lexikon zur Geschichte von Freundesliebe und mannmännlicher Sexualität im deutschsprachigen Raum, Teilband 2, Berlin 2010, S. 1114–1116. 206 Hans Siemsen, Die Geschichte des Hitlerjungen Adolf Goers, Düsseldorf 1947, S. 169. Vgl. auch das Nachwort von Jörn Meve in der Neuausgabe unter selbigem Titel, Berlin 2000, S. 231–239. 207 Ebd., S. 173.
Die prekäre Hitlerjugend
177
rung, denn er urteilte nicht über alle HJ-Angehörigen pauschal. Den Charakter der HJ als Zwangsapparat, in den auch jene gepresst wurden, die innerlich auf Abstand blieben, beschrieb Siemsen bisweilen sogar treffend. Im Gesamten malte er allerdings bewusst das Skandalbild einer perversen, abgründigen Parteijugend. Siemsen hatte das Buch, basierend auf Aussagen eines Zeugen, nicht im luftleeren Raum reiner Spekulation verfasst. Er verarbeitete, was in Deutschland ebenso wie im Exil an Gerüchten verbreitet war. „Erschütternd ist die Zunahme der Sittlichkeitsdelikte“, befand ebenso Otto Friedländer im Prager Exil: „Besonders auffällig ist, trotz aller gesetzlichen Maßnahmen, das Ansteigen der Homosexualität unter den Jugendlichen.“208 Verantwortlich dafür sei, glaubte Friedländer, dass man Mädchen und Jungen in der Hitlerjugend voneinander mehr und mehr separiere, weshalb sich das sexuelle Erwachen junger Menschen keinen anderen Weg bahnen könne. Fälle, die der Gegenpropaganda dienten, griff man im Ausland und Exil bereitwillig auf. Sensationslüstern wurden sie ausgeschmückt. Die Missbrauchsfälle, Gerüchte und Skandale waren zwar nicht die Ursache für die Verfolgung Homosexueller durch das Regime. Sie trugen aber zur Radikalisierung der RJF und zu einem verschärften Vorgehen bei. Die Gestapo in Magdeburg berichtete im Januar 1936 über einen beispielhaften Fall: Ein DJ-Unterführer sei aufgrund „widernatürlicher Unzucht“ festgenommen worden und in Haft geständig. Er habe „mit Jungen seines Fähnleins, deren Vorgesetzter er war, zu onanieren“ versucht; in Chemnitz, seinem alten Wohnort, habe er „mit verschiedenen Jungen vom dortigen Jungvolk dasselbe getan“.209 In Köln hatte es im Frühjahr 1935 ebenfalls Festnahmen gegeben. Sämtlich handelte es sich um Jungen im Alter zwischen 10 und 15 Jahre. Während einige die Vorwürfe zugaben, sagten andere aus, dass sie missbraucht worden seien. Ein 15-jähriger Jungzugführer, dem man Verfehlungen anlastete, verteidigte sich, indem er auf die fragwürdige Moral in seinem Stadtteil verwies; er habe mehrfach bei seinen Vorgesetzten darum ersucht, eine andere Formation leiten zu dürfen. Die Polizei erstattete der Gebietsführung Meldung und die RJF sollte darüber unterrichtet werden, weil das Vertrauen in die örtliche Hitlerjugend untergraben zu sein schien. Laut Gestapo hatte sich bei Vernehmungen herausgestellt, „dass mehrere Pimpfe der gleichen Verführungen anheimgefallen waren“.210 Ein „erschütterndes Bild sittlicher Verfehlungen“ habe sich gezeigt.211
208 Friedländer, Deutsche Jugend, unveröffentlichtes Manuskript, S. 169. 209 Anlage zum Lagebericht für den Monat Januar 1936. In: Rupieper/Sperk (Hg.), Lageberichte der Geheimen Staatspolizei zur Provinz Sachsen, Band I, S. 146. 210 Lagebericht der Gestapostelle Köln für August 1935 vom 3.9.1935. In: Faust/Rusinek/ Dietz (Hg.), Lageberichte rheinischer Gestapostellen, Band II/2, S. 950–967, hier 962. Zum Vorgang vgl. den Aktenbestand und den Bericht der Staatspolizeistelle für den Regierungsbezirk Köln an den Oberpräsidenten der Rheinprovinz in Koblenz vom 27.8.1935 (LHA Koblenz, 403, 16757). 211 Lagebericht der Gestapostelle Köln für August 1935.
178
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Es war kein Ausnahmefall. Die Kölner Sicherheitsorgane machten Wochen später zum Thema, dass sich erneut „starke sittliche Verfehlungen in den Reihen der Pimpfe und HJ-Mitglieder“ ereignet hätten, was – und hier lag die Problematik – den „Eltern nicht unbekannt“ geblieben sei.212 Seit 1935 mehrten sich die Ermittlungsverfahren. In Köln kam es zu Dutzenden Verhaftungen von Unterführern.213 In Sachsen wiederum wurde ein örtlicher DJ-Führer 1935 von der politischen Polizei in „Schutzhaft“ verschleppt, weil er „mit den ihm unterstellten Jungens fortgesetzt unzüchtige Handlungen vorgenommen“ hatte.214 Im Frühjahr 1935 kam es in Hessen-Nassau nach der Verhaftung des Gebietsführers Kramer zu einer massiven Verfolgungswelle, in deren Zuge etliche Unterführer angeklagt wurden.215 Bei einer Aktion der Gestapo in Frankfurt 1939 wurden 70 Personen festgenommen, die der Homosexualität bezichtigt wurden – darunter auch „etwa 50 Jugendliche“.216 Und in einer Kleinstadt an der Mosel hatte man neun Jugendliche, darunter Hitlerjungen, festgesetzt. Angeblich hatten sie „mit zwei Juden gleichgeschlechtlich verkehrt“, wodurch, meinte man, „wieder die HJ in Mitleidenschaft gezogen“ worden sei.217 Durchaus nicht bei allen Sittlichkeitsdelikten kam es zu Verurteilungen durch die Jugendgerichte, oder gar zur „Schutzhaft“ oder auch nur zur disziplinarischen Sanktion seitens der Hitlerjugend; das Alter, der Führerrang und die Schwere des Deliktes fielen ins Gewicht.218 Seit 1936 unterschied man in der HJ-Gerichtsbarkeit zwischen mehr oder weniger harmlosen „Pubertätsentgleistungen“ einerseits, die nicht automatisch zum Ausschluss der Betroffenen führen sollten, sowie den homosexuell Veranlagten und „homosexuellen Verführern“ andererseits, gegen die hart eingeschritten werden soll-
212 Lagebericht der Gestapostelle Köln für September 1935 vom 18.10.1935. In: Faust/ Rusinek/Dietz (Hg.), Lageberichte der rheinischen Gestapostellen, Band II/2, S. 1072– 1091, hier 1087. 213 Thomas Roth, „Verbrechensbekämpfung“ und soziale Ausgrenzung im nationalsozialistischen Köln. Kriminalpolizei, Strafjustiz und abweichendes Verhalten zwischen Macht übernahme und Kriegsende, Köln 2010, S. 154. 214 Gestapo, Innerpol. Abwehr. Übersicht über die politische und wirtschaftliche Lage und über die Stimmung der Bevölkerung im Lande Sachsen, o. D., S. 42 (BArch Berlin, R58, 3885, Bl. 96–106). 215 Vgl. Zinn, „Aus dem Volkskörper entfernt“, S. 273–275. 216 Lagebericht der Oberstaatsanwaltschaft, Limburg/Lahn vom 16.11.1939. In: Klein/Uthe (Hg.), Lageberichte der Justiz in Hessen, S. 643–647, hier 644. 217 Lagebericht der Gestapostelle Trier für August 1935 vom 5.9.1935. In: Faust/Rusinek/ Dietz (Hg.), Lageberichte rheinischer Gestapostellen, Band II/2, S. 986–995, hier 993. 218 Tetzlaff, Homosexualität und Jugend, S. 4: „Die neue Vorschrift [Abs. 2, §175, 28.6.1935] erstreckt sich […] auch auf Verfehlungen, wie sie erfahrungsgemäß zwischen Schülern […] zuweilen vorkommen, und die […] in der Regel keinen dauernden Schaden bei den Betroffenen hervorrufen. Solche Fälle bedürfen der Aburteilung durch den Strafrichter meist nicht; um letzteres zu vermeiden, ist […] dem Gericht die Möglichkeit gegeben, bei Beteiligten, die zur Zeit der Tat noch nicht 21 Jahre alt waren, in besonders leichten Fällen von Strafe abzusehen. Wenn sich Minderjährige zu beischlafähnlichen Handlungen mit anderen männlichen Minderjährigen oder gar Volljährigen entwürdigen, wird diese Milderungsvorschrift in der Regel nicht zur Anwendung kommen können.“
Die prekäre Hitlerjugend
179
te.219 Ein Beispiel: In einem saarländischen Dorf standen 1942 fünf Jugendliche von 14 und 15 Jahren wegen „widernatürlicher Unzucht“ vor der internen HJ-Gerichtsbarkeit. Sie hatten wohl einvernehmlich gehandelt, aber die Strafen fielen sehr unterschiedlich aus: Drei erhielten eine Beförderungssperre sowie einen Verweis durch das HJ-Gericht, ihr gleichaltriger Führer wurde aber aufgrund seines Rangs unehrenhaft aus der HJ ausgeschlossen.220 Manchmal, wie bei einem Bannführer in Bielefeld, der 1934 in Verdacht geriet, Beziehungen mit Kameraden zu unterhalten, ließen sich Verstöße gegen Paragraf 175 zwar nicht beweisen. In der Regel wurden die Unterführer jedoch auch bei Verdacht umgehend aus der Organisation entfernt.221 Gegen sittliche Verfehlungen der Führer – gleich welchen Alters – sollte vorgegangen werden, weil sie – wie es in einem Gerichtsurteil lautete – „zur schwersten Erschütterung des Vertrauens in den Wert der nationalsozialistischen Erziehungsarbeit“ beitrugen.222 Tatsächlich war das keine unbegründete Sorge. In einigen Kleinstädten traten offenbar junge HJ-Führer 1935 mit Dementis bezüglich vermeintlich um sich greifender Homosexualität in der Parteijugend an die Öffentlichkeit. Sie wollten auf diese Weise jene Gerüchte zurückweisen, die besagten, es würden HJ-Führer massenhaft verhaftet. Das Regime wies die Presse an, dass die Dementis aus lokalen Dienststellen und von jungen Unterführern nicht aufzugreifen sowie entsprechende Fälle nicht zu thematisieren seien.223 Die Potsdamer Gestapo konstatierte in einem Lagebericht, der mehrere Beispiele von Sittlichkeitsdelikten in der HJ anführte: „Aus Kreisen der Eltern hört man immer wieder die Befürchtung, dass die homosexuellen Vorgänge in der HJ schlimmere Formen annehmen könnten. – Manche Eltern haben deshalb […] ihre Söhne abgemeldet.“224 Für die Auslandspresse war dies dankbare politische Munition. In der Hitlerjugend seien „erschreckende Zustände“ am Werk, agitierte die Sozialdemokratie seit Mitte 1934 aus dem Exil: „Abertausende Gruppen sind Schulen der Homosexualität“.225 Ein 18-jähriger Unterführer aus Chemnitz, der sich angeblich an Jungen vergangen hatte, diente im Februar 1935 als Beleg für „homosexuelle und sadistische Exzesse“, die keine Seltenheit seien.226 Die „Pariser Zeitung“ wusste Ende 1938 über Vorwürfe gegen Erich Kronacher, Adjutant des 219 Ebd., S. 5 f. 220 Vgl. Bestrafungen. In: GB: Westmark, K19/42 vom 11.11.1942. 221 Bericht der Staatspolizeistelle Bielefeld an das Geheime Staatspolizeiamt Berlin vom 12.3.1934 (LA NRW, Abtl. Ostwestfalen-Lippe, M1 I P 613, Bl. 263–406, insb. 40). 222 Zit. aus der Personalakte eines Gefangenen nach Carola von Bülow, Der Umgang der nationalsozialistischen Justiz mit Homosexuellen, Oldenburg 2000 (Diss.), S. 214. 223 Vgl. Presseanweisung ZSg. 101/6/7/1440 vom 8.7.1935. In: Gabriele Toepser-Ziegert (Bearb.), NS-Presseanweisungen der Vorkriegszeit. Edition und Dokumentation, Band 3/I: 1935, München 1987, S. 412. 224 Lagebericht der Staatspolizeistelle Potsdam für Februar 1934, o. D. In: Ribbe (Hg.), Lageberichte über die Provinz Brandenburg und die Reichshauptstadt, S. 223–234, hier 231. 225 Wenn Hitler säubert. In: Der Neue Vorwärts vom 8.7.1934. 226 Bericht aus Sachsen, A 60. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 2 (1935), S. 218.
180
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
s ächsischen Gauleiters Martin Mutschmann, zu berichten. Der 19-Jährige habe sich, wie es hieß, an Jüngeren vergangen; nicht weniger als 15 Anzeigen lägen der Dresdner Staatsanwaltschaft mittlerweile vor. Der Gauleiter soll jedoch versucht haben, was angesichts der rigiden Verfolgung Homosexueller innerhalb der Partei und ihren Gliederungen recht unwahrscheinlich erscheint, den Fall zu vertuschen und vor einem Parteigericht versanden zu lassen.227 Die Auslandspresse griff Ende 1934 weitere Vorkommnisse auf. In Berlin waren angeblich rund 40 HJ-Führer in unteren und mittleren Positionen verhaftet worden.228 Laut den zweifelhaften Berichten hatte man die HJ-Führer bei Razzien in Bars und Lokalen festgesetzt, was – wie die Exilpresse betonte – „ein bezeichnendes Licht auf die Qualität der Hitlerjugendführer“ warf.229 Fälle und Berichte, die sich zur Agitation lohnten, fand man immer wieder. Auf den Schriftsteller Heinrich Eichen – nach 1945 trat er mit erotischer Lyrik, einer Kulturgeschichte der Homosexualität, aber auch als zweifelhafter Akteur der Pädophilen-Bewegung in Erscheinung – wurde man in den 1930er-Jahren im Ausland aufmerksam. Der 1905 geborene Eichen, ein „Bündischer“, war 1933 zur HJ gewechselt. Im September 1935 berichtete die Exilpresse, Eichen sei gerichtlich verurteilt worden. Ein Paradebeispiel dafür, dass sich die RJF in ihrer Paranoia, die HJ könne durch bündische Jugendführer homosexuell unterwandert werden, gelegentlich bestätigt sah. Homoerotische Ideen vom Männerbund, wie sie der bekannte jugendbewegte und weit rechts stehende Skandalautor Hans Blüher vor und nach dem Ersten Weltkrieg publiziert hatte, waren für die RJF geradewegs ein Horrorszenario.230 Die Sozialdemokraten witterten eine Gelegenheit zur Stimmungsmache. Der Vorfall aus der ostpreußischen Stadt Elbing leitete zum Großangriff auf die Hitlerjugend über: „Zahlreiche Burschen wurden durch ihn zur Homosexualität verführt“, wurde über HJ-Führer Eichen behauptet, „und das Gericht verurteilte den Angeklagten zu 2½ Jahren Zuchthaus und 3 Jahren Ehrverlust. In der [deutschen] Presse wird vorsichtig hinzugefügt, es sei erschwerend ins Gewicht gefallen, dass er ‚die Verfehlungen als Führer eines Jugendbundes begangen hatte‘. – Eines Jugendbundes? Das heißt: der Hitlerjugend.“ Ein „nationalsozialistischer Jugendverführer“ sei nun ertappt worden, aber „viele hundert Gleichgearteter“ seien in Amt und Würden. Die „Klagen der Eltern mehren sich.“231 227 Vgl. Aus der Hitlerjugend. In: Pariser Tageszeitung vom 11./12.12.1938. 228 Vgl. auch Alexander Zinn, Die soziale Konstruktion des homosexuellen Nationalsozialisten. Zu Genese und Etablierung eines Stereotyps, Berlin 1997, S. 130. 229 Zit. nach ebd., S. 142. 230 Vgl. die Werke von Hans Blüher, Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft, 2. Bände, Jena 1917/19; ders., Die Wandervogelbewegung als erotisches Phänomen, Berlin 1912. Im Zusammenhang vgl. Daniela Rastetter, Sexualität und Herrschaft in Organisationen. In: Ursula Müller/Birgit Riegraf/Sylvia Wilz (Hg.), Geschlecht und Organisation, Wiesbaden 2013, S. 355–387, hier 375 f. 231 Kinder werden vergiftet. In: Der Neue Vorwärts vom 8.9.1935. Seine Verurteilung im Jahr 1935 ist bislang offenbar nicht thematisiert worden. Zum Werdegang nach 1945 vgl. kurze Hinweise bei Sven Reiß, „Renaissance des Eros paidikos“. Erotisch-sexu-
Die prekäre Hitlerjugend
181
Vieles wurden noch nach Kriegsbeginn aktenkundig – wie in Mainz 1941, als zwei Jungbannmitarbeiter aufgrund vermeintlich sexueller Übergriffe zu Gefängnis verurteilt wurden.232 Seit geraumer Zeit schaltete die RJF nun den eigenen SRD gegen „gleichgeschlechtliche und andere Sittlichkeitsvergehen […] mit äußerster Strenge“ ein, wobei es diesem ausdrücklich verboten werden musste, vermeintlich Homosexuelle mittels Lockvögeln zu überführen.233 Besonders wiederum auf „ältere Verführer“ sollten sich die jungen Streifengänger konzentrieren.234 Entsprechend wurden sie in erster Linie in Großstädten aktiv. In ländlich geprägten Regionen war Homosexualität – wie auch Sittlichkeitsdelikte im Allgemeinen – in den lokalen SRD-Berichten selten, wenn überhaupt ein Thema.235 Vereinzelt, wie am Hamburger Hauptbahnhof, hatte man schon in den 1930er-Jahren HJ-Wachen zur Observierung von Treffpunkten angeblicher Homosexueller und sogenannter Stricherjungen eingesetzt.236 Delikte, welche die Hitlerjugend betrafen, besaßen in den 1930er-Jahren mehr politische Sprengkraft als in der späteren Kriegszeit, weil im Ausland über sie berichtet wurde und Fälle im Inland aufgegriffen werden konnten. Sie stellten die Fundamente der Hitlerjugend infrage. In einer problematischen Analyse der Jugendkriminalität in München 1937 beschwor ein Jurist die Gefahr der homosexuellen Unterwanderung der Staatsjugend: „Nicht selten verschafften sich […] solche Jungen Eintritt in die Jugendorganisationen, gelangten infolge ihrer Fähigkeiten zu Führerstellungen und benutzten dann die ihnen dadurch gegebene Befehlsgewalt über jüngere Kameraden zur Befriedigung ihres Triebes. Der […] angerichtete Schaden ist, abgesehen von der Gefahr einer oft seuchenmäßigen Verbreitung derartiger Zustände, bei der seelischen Labilität […] der verführten Jungen oft nicht wieder gut zu machen.“237 Stark zugenommen hätten, wie der Jurist hervorhob, „Verbrechen mit Kindern unter 14 Jahren“
elle Leitbilder und Alltagspraxen in der deutschen Jugendbewegung. In: Karl Braun/ Felix Linzner/John Khairi-Taraki (Hg.), Avantgarden der Biopolitik, Göttingen 2017, S. 61–76, hier 71. Ende November kam es zur Verhaftung drei weiterer ostpreußischer HJ-Führer, darunter zwei in hauptamtlicher Funktion. Vgl. Zinn, „Aus dem Volkskörper entfernt“, S. 273. 232 Vgl. Bericht des Oberlandesgerichts Darmstadt vom 10.5.1941. In: Klein/Uthe (Hg.), Lageberichte der Justiz aus Hessen, S. 320–325, hier 321. 233 Reichsjugendführung (Hg.), Die Überwachung der Gefährdung der Jugend. Einsatzbefehl für den HJ-Streifendienst (SRD) vom 1. Juni 1940 (vertraulich!), S. 25 (HStA Stuttgart, E 151/09, Bü. 402). 234 Vgl. auch Runderlass des Reichsbahnministeriums vom 10.7.1940, über die Zusammenarbeit zwischen Bahnschutzpolizei und Streifendienst der HJ (StA Freiburg, B719/1, 5018, unpag.). 235 In den recht umfangreich erhaltenen Überwachungsberichten des SRD aus zwei Bannen im Gebiet Schwaben für die Kriegsjahre fehlt jeglicher Hinweis auf die Verfolgung Homosexueller. Vgl. StA Augsburg, HJ-Gebiet Schwaben, 56: SRD Bann Memmingen und 44: SRD Bann Wertingen. 236 Vgl. Bernhard Rosenkranz/Gottfried Lorenz, Hamburg auf anderen Wegen. Die Geschichte des schwulen Lebens in der Hansestadt, Hamburg 2006, S. 46. 237 Seibert, Die Jugendkriminalität Münchens, S. 25.
182
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
nach Paragraf 176.238 Hier ging es allerdings nicht allein um die „Jugendverführer“ oder um Kindesmissbrauch: „An der Begehung dieses Delikts waren alle Altersstufen ziemlich gleichmäßig vertreten. Der körperlich völlig entwickelte Siebzehnjährige fehlte ebenso wenig wie der schmächtige unterernährte Vierzehnjährige. […] Auch bei der Art der Ausführung waren sämtliche Spielarten vertreten. Völlig normal entwickelte, geistig und körperlich gesunde Jugendliche standen neben schwer pathologisch Abnormen. Bei keinem anderen Reat waren unter den Tätern derart gegensätzliche Typen zu beobachten wie gerade hier.“239 Zwischen Verführung, Missbrauch oder Einvernehmlichkeit wurde selten klar differenziert. Besonders die Exilpresse warf alles in einen Topf. Im August 1936 hieß es im „Vorwärts“, dass junge Unterführer inzwischen schärfer bestraft würden, weil sie rechtlich mit Erziehern gleichgesetzt worden waren. Anstatt darin einen Akt der Repression einer sexuellen Minderheit zu sehen, zog man dies in der Exilpresse sogleich als Beweis dafür heran, dass die Parteijugend zunehmend korrumpiert sei: „Inzwischen hat die sittliche Gefährdung der deutschen ‚Pimpfe‘ einen solchen Umfang angenommen, dass verschiedene Geistliche beider Konfessionen sich bereits zu heftigen Protesten veranlasst sahen. Vor Gericht pflegen die ‚Führer der Jugend‘ sich hinter dem Argument zu verschanzen, sie seien noch zu jung, um als voll verantwortlich zu gelten. […] Selbst den Herren Reichsgerichtsräten scheinen nachgerade die Haare zu Berge zu stehen. Aber jedermann weiß, dass es nur in den seltensten Fällen zu einem Prozess kommt. […] Die Verderber der Jugend bleiben weiter am Werk.“240 Was oppositionelle Kreise aufgriffen, war häufig aufgebauscht und manchmal frei erfunden. Die Parteijugend schien alle nur denkbaren Arten unsittlichen Verhaltens zu begünstigen. Ebenso wie bei Vandalismus, Bettelei und Betrug hatte dies dem Anschein nach einen plausiblen Kern: Wo junge Menschen sich selbst überlassen blieben, ihren Alltag mehr oder weniger autonom gestalteten, schien ohne hinreichende Aufsicht durch Erwachsene die Gefahr der „Verwahrlosung“ um sich zu greifen. Das sah man in Partei- und Sicherheitskreisen im Übrigen nicht anders. Die Gestapo in Aachen äußerte sich im Sommer 1935 positiv darüber, dass nun immer häufiger Lehrkräfte mit der Führung von Formationen betraut würden: „Wie sehr eine zielbewusste Führung […] nötig ist, beweist wieder ein Vorfall, bei dem 16 Angehörige der HJ aus Schlich im Kreise Düren im […] Schützenheim genächtigt und durch Selbstbefriedigung sittliche Verfehlungen begangen haben.“241 In einem Kölner Bericht für September 1934 hieß es, in der Bevölkerung sei bekannt, dass „Unterführer wegen des Verdachts der Päderastie festgenommen“ würden; das trage „naturgemäß nicht zu einer
238 Ebd., S. 26. 239 Ebd. 240 Verseuchte Hitlerjugend. Selbst dem Reichsgericht wird es zu bunt. In: Der Neue Vorwärts vom 2.8.1936. 241 Lagebericht für Juni 1935 vom 5.7.1935. In: Vollmer, Volksopposition im Polizeistaat, S. 237–254, hier 253.
Die prekäre Hitlerjugend
183
Stärkung des Vertrauens“ in die Parteijugend bei.242 Und die Gestapo beispielsweise aus Münster kam etwa zeitgleich zu einer ähnlichen Einschätzung: „Bei der jetzigen Konzentrierung der Jugend in Verbänden und Vereinen ist es in Anbetracht der immer wieder vorkommenden Abnormität des Geschlechtslebens einzelner Personen nicht ausgeblieben, dass Straftaten […] von Mitgliedern des Jungvolks, der Hitlerjugend und anderer Formationen begangen werden.“243 Dass sich dies nicht nur auf homosexuelle „Jugendverführer“ und Unterführer, sondern auf Sittlichkeitsdelikte allgemein bezog, zeigt der Umstand, dass man eine Separierung von BDM und HJ empfahl. Verfehlungen würden „auf Wanderungen, während der nächtlichen Ruhe in […] Unterkunftsräumen und vereinzelt in den Diensträumen der Formationen begangen“, weshalb auch die „Ausflüge der Formationen nach Geschlechtern getrennt ausgeführt werden“ müssten.244 Die Geschlechtertrennung hatte man inzwischen zwar längst fixiert, aber in der Praxis vor Ort war sie häufig noch nicht realisiert. Verstöße gegen gesellschaftliche Sittlichkeitsvorstellungen blieben für die RJF ein Problem von politischer Tragweite. Man musste fürchten, dass Fälle vor Ort bekannt wurden oder als Agitationsmittel für die Gegner dienten. „In den Städten herrschen unter der ‚Staatsjugend‘ katastrophale moralische Zustände. Jungen und Mädchen von 14 bis 20 Jahren sind oft moralisch vollkommen defekt“, gab ein Berichterstatter aufgebauschte Eindrücke an Emigranten im Ausland weiter.245 Die „moralische Verwilderung in der Hitlerjugend“ lasse sich vor Eltern und Lehrern kaum verbergen. Auch der BDM genieße seinen schlechten Ruf zu Recht: „Baldur von Schirach hat nämlich verfügt, dass Mädchen in Zukunft nicht mehr in Zeltlagern untergebracht werden dürfen. Bis Mitte Juni [1937] hat es ungefähr 452 BDM-Zeltlager mit etwa 100 000 Insassinnen gegeben. Die Eingeweihten glauben allerdings nicht daran, dass die Mädchen in den braunen Jugendherbergen, die ihnen weiter offen stehen, weniger verdorben werden.“246 Tatsächlich wurden Mädchen die Zeltlager und das Übernachten in Scheunen, was in der Fachliteratur wenig thematisiert wurde, 1937 verboten; sicher nicht, weil es massenhaft zu Eskapaden gekommen wäre, sondern weil man Gerüchten, die gerade aus kirchlichen Kreisen gestreut wurden, entgegensteuerte. Die Zeltlager, wie sie eine Zeitzeugin schilderte, weckten Fantasien: „Wir wurden auf große Rundzelte verteilt; und zwar kamen so viele Mädchen in ein Zelt, dass der Platz knapp wurde. Wir lagen mit den Füßen zur Zeltmitte, und da gab’s dann schon Gerangel.“247 Ein Jungmädel schrieb 1934: „Alles 242 Lagebericht der Gestapostelle Köln für September 1934 vom 1.10.1934. In: Faust/Rusinek/Dietz (Hg.), Lageberichte rheinischer Gestapostellen, Band I, S. 410–435, hier 426. 243 Gestapostelle Münster an das Geheime Staatspolizeiamt Berlin vom 8.2.1935 (LA NRW, Abt. Westfalen, K 091, 2). 244 Ebd. 245 Bericht aus Rheinland-Westfalen. In: Der Neue Vorwärts vom 4.8.1935. 246 Es geht auch ohne Katholiken. In: ebd. vom 22.8.1937. 247 Zeitzeugenbericht von Gisela Richter, geboren 1924 in Bremen (DHM, Lebendiges Mu seum Online, https://www.dhm.de/lemo/zeitzeugen/gisela-richter-das-bdm-maedchen- gisela.html; 16.9.2019).
184
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
f reute sich aufs Strohquartier, für viele war das etwas vollkommen Neues. Zuerst gings ans Aus- besser gesagt Anziehen. Licht gab es in unserer Scheune nicht, wenige Mädels hatten Taschenlampen mit und so musste nun die Umzieherei in Dunkelheit vor sich gehen.“248 Das Verbot der Mädchenlager kam abrupt – und selbst für die BDM-Führung offenbar überraschend, denn kurz zuvor hatte man noch ein großes Sonderheft über die Organisation, Schulung und Arbeit im Zeltlager für Mädchen herausgegeben.249 Was nach 1938 bei Jungmädeln und im BDM als „Lager“ firmierte, waren mehrheitlich Unterkünfte in Herbergen; und anders als die HJ-Angehörigen, die auf Fahrt einigermaßen frei kampieren durften, mussten Mädchen ein festes, genehmigtes Quartier beziehen.250 Derartige Kursanpassungen erklären sich nicht allein aus der Hitlerjugendideologie. Sie besaßen auch einen reaktiven Charakter. Die RJF sah sich durch die Gerüchte, Spekulationen und Kritik zwischenzeitlich stark unter Druck gesetzt: „Es gibt […] im Dritten Reich viele besorgte Eltern“, hieß es im „Neuen Vorwärts“ 1936, „die allen Grund haben, der neudeutschen Mädchenerziehung gründlich zu misstrauen. Als Ergebnis der Aktivität ihrer halbwüchsigen Töchter im BDM haben sie frühe Schwangerschaften und unerwartete Enkelfreuden erleben müssen“ – ein Zitat aus dem Tagebuch eines BDM-Mädchens über das entzückende Zusammentreffen mit Hitlerjungen während einer Ausflugsfahrt diente als erotischer Beleg.251 In Buer, einer westfälischen Kleinstadt, seien 17 Mädchen wegen Schwangerschaften aus dem BDM ausgeschlossen worden, so meinte ein weiterer Bericht: „Vor allem die Mütter sind verzweifelt über die sittlich ungehemmte Art ihrer Kinder. Die immer wieder auch der Jugend in plumper Art zu Gehör gebrachte Propaganda vom rassereinen Nachwuchs ist zu ungezügelter Sexualität entartet.“252 In Schlesien ging das Gerücht um, zwei HJ-Angehörige hätten ein Mädchen in einer Jugendherberge vergewaltigt; im Allgemeinen, folgerte der Berichterstatter, sei die sexuelle Verrohung der Jugend inzwischen für jedermann sichtbar geworden.253 In Emden sollten etwa zeitgleich in einem HJ-Heim, nach sexuellen Aufklärungsvorträgen eines 17-jährigen Unterführers, angeblich Orgien stattgefunden haben.254 Ein Berliner Arzt, auf den sich die Widerstandsgruppe „Neu
248 Nachtlager in der Scheune. In: Bann 24 der HJ (Hg.), HJ im Vormarsch, (1934) 12, S. 3. 249 Vgl. das Heft „Mädel im Lager“, Ausgabe von Die Mädelschaft. Blätter für Heimabendgestaltung im Bund Deutscher Mädel, (1937) 6. 250 Vgl. entsprechende Vorgaben in Reichsjugendführung (Hg.), Der Jungmädeldienst. Übersicht über Wesen, Form und Arbeit des Jungmädelbundes in der HJ (Dienstvorschrift der Hitler-Jugend), Berlin 1940, S. 19 f. Im DJ gab es allerdings ähnliche Veränderungen insofern, als dass zur obligatorischen „Pimpfenprobe“ ab 1939 keine Übernachtung, sondern nur noch eine eintägige Fahrt Voraussetzung sein sollte; wiederum führte man „gesundheitliche“ Gründe an. Vgl. Änderungen der Pimpfenprobe. In: GB: Nordsee, A5/39 vom 15.6.1939. 251 Jungmädelfreuden zur Nacht. In: Der Neue Vorwärts vom 9.8.1936. 252 Bericht aus Rheinland-Westfalen. In: ebd. vom 4.8.1935. 253 Vgl. Bericht aus Schlesien, A 79. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 3 (1936), S. 1317. 254 Vgl. Bericht aus Nordwestdeutschland, A 79–A 80. In: ebd., S. 1317 f.
Die prekäre Hitlerjugend
185
Beginnen“ im Jahr 1934 berief, behauptete, durch die HJ würden Geschlechtskrankheiten verbreitet.255 Und eine Fürsorgerin brachte die unwahrscheinliche Geschichte eines Kinderbordells in Umlauf, das von einer HJ-Einheit in Berlin-Schöneberg betrieben und von der Polizei ausgehoben worden sei.256 Das sind nur einige Beispiele, die sich ergänzen ließen. Die Debatte um den vermeintlich moralischen Verfall der Jugend, die bereits in den 1920er-Jahren in Deutschland intensiv geführt worden war, setzte sich im „Dritten Reich“ fort, aber schloss nun – mindestens hinter vorgehaltener Hand – die Parteijugend mit ein.257 Hartnäckig, bis weit in die Historiografie und Belletristik der Gegenwart, erwies sich eine zeitgenössische Legende. Nach dem Reichsparteitag 1936 seien angeblich 900 Mädchen – an mancher Stelle wird mit noch höheren Zahlen gehandelt – schwanger aus Nürnberg zurückgekehrt.258 Es ist offenbar nicht mehr aufzuklären, wer diese aberwitzige Geschichte um die Massenschwangerschaften der BDM-Mädchen zuerst in die Welt setzte; sie wird bis heute immer wieder kolportiert, obgleich jeder Beleg für ihren Wahrheitsgehalt fehlt. Oppositionelle Kreise bedienten sich solcher und ähnlicher Geschichten, aber auch realer Übergriffe, die vor Gerichten verhandelt wurden, um die Hitlerjugend in ein verwerfliches Licht zu rücken: „Die Bevölkerung weiß, dass auch in der […] Systemzeit hie und da ein Kind zur Mutter wurde, dass sich aber diese allzu junge Mutter auf den Willen des Führers berief, der diese Geschehen gutheiße, war noch nie da.“259 Nicht zuletzt Pfarrer auf dem Land, die sich gegen Angriffe von jungen HJ-Führern zur Wehr setzten, förderten die Gerüchte vereinzelt. Sie wiesen auf Missstände hin, um die Eltern zu warnen. Die Mädchenuniformen und die lockere Sportkleidung wurden als aufreizend kritisiert. Mädchen würden im BDM gar gezielt geschwängert.260 Es seien die „ungeheuerlichsten Gerüchte“ im Umlauf, urteilte treffend die Gestapo in Trier 1935.261 Offiziell hielt sich die katholische Kirche indes zurück. Kardinal Michael von Faulhaber schrieb Reichskirchenminister Hans Kerrl Ende 1936, um sich zu verteidigen, aber mit unverkennbar drohender Tonlage: In Hirtenbriefen habe man die Gläubigen bislang noch nicht auf jene Vorkommisse hingewiesen, bei
255 Vgl. Bericht über die Lage in Deutschland, Nr. 10 vom 10./11.1934. In: Stöver (Hg.), Die Meldungen der Gruppe Neu Beginnen aus dem Dritten Reich 1933–1936, S. 272–328, hier 319. 256 Vgl. Bericht, Nr. 11 vom 12.1934/1.1935. In: ebd., S. 329–380, hier 369. 257 Zum Diskurs in der Weimarer Republik vgl. Heidi Sack, Moderne Jugend vor Gericht. Sensationsprozesse, „Sexualtragödien“ und die Krise der Jugend in der Weimarer Republik, Bielefeld 2016. 258 Zur Legende vgl. die Hintergründe knapp erläutert bei Martin Kipp/Gisela Miller-Kipp, Erkundungen im Halbdunkel. Einundzwanzig Studien zur Berufserziehung und Pädagogik im Nationalsozialismus, Frankfurt a. M. 1995, S. 185 f. 259 Bericht aus Bayern, A 80. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 3 (1936), S. 1318. 260 Vgl. Die Neue Ausländerei. In: Der Neue Vorwärts vom 31.10.1937, wo es hieß, „Pfarrer [würden] dauernd über die hohe Zahl der geschwängerten BDM-Mädchen klagen“. 261 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Juli 1935 vom 5.8.1935. In: Faust/Rusinek/ Dietz (Hg.), Lageberichte rheinischer Gestapostellen, Band II/2, S. 873–883, hier 881.
186
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
denen „gesunde und unverdorbene junge Menschen von Jugendführern der HJ sittlich verdorben“ worden seien.262 Kerrl wertete das Schreiben als Affront. In seiner Antwort brachte er seinerseits den sexuellen Missbrauch von Kindern innerhalb der katholischen Kirche ins Spiel.263 Obgleich Geistliche Zurückhaltung übten, viele die offene Auseinandersetzung scheuten, wurden Fälle in Predigten angesprochen. Den Missbrauchsprozessen gegen einige Geistliche, die in den 1930er-Jahren im Sinne des Regimes ausgeschlachtet wurden, konnte man auf diese Weise etwas entgegensetzen.264 Der Journalist Friedrich Tetens, der 1934 ins Ausland geflohen war, unterstrich daher: „Vonseiten der katholischen und protestantischen Kirche wird laut über die zunehmende sittliche Verwahrlosung der Jugendlichen Klage geführt.“265 Die RJF, die das Wachstum ihrer Partei- und Staatsjugend im Blick hatte, musste diese Stimmen als Gefahr werten. Einzelfälle, die Teile der deutschen Öffentlichkeit aufwühlten, kamen immer wieder vor, wurden dramatisiert und zu einem Problem der Organisation insgesamt stilisiert: In Sachsen, wo es zu einem Erlahmen der Beitrittswilligkeit in dieser Zeit tatsächlich kam, würden Eltern ihre Kinder kaum noch anmelden, da sie „mehr oder minder die sexuelle Verwahrlosung in der Hitler-Jugend und im Bund deutscher Mädchen“ fürchteten, begründete ein Berichterstatter der SPD im Sommer 1935.266 Der Tenor eines Gestapo-Lageberichts aus Magdeburg vom Mai desselben Jahres fiel ähnlich aus: „In sittlicher Beziehung“ hätten sich in der zurückliegenden Zeit einige „sehr bedauerliche Vorkommnisse ereignet“, daher würden selbst alte Parteigenossen „ihre Kinder diesen Verbänden nicht anvertrauen“.267 Durch das Schweigen der Presse würden die „Gerüchte über vorgekommene Verfehlungen unkontrollierbar weiterwandern und […] vielfach stark vergröbert werden.“268 Hinzu kam, dass unter jungen Menschen unreife Verballhornungen kursierten: „Bubi drück mich“, „Bedarfsartikel deutscher Männer“ oder „Bund deutscher Matratzen“ nannte man den BDM im städtischen Straßenjargon.269 Über anrüchiges Verhalten oder derbe Zoten von
262 Faulhaber an Kerrl vom 29.12.1936. In: Ludwig Volk (Hg.), Akten Kardinal Michael von Faulhabers 1917–1945, Band 2: 1935–1945, Mainz 1978, S. 256–260, hier 257. 263 Vgl. Kerrl an Faulhaber vom 28.1.1936. In: ebd., S. 284–286, hier 285. 264 Charakteristisch für die Berichterstattung: Wieder zwei Klosterbrüder als Jugendverführer. In: Deutsches Nachrichtenbüro vom 8.5.1937; Umfassender zum Thema Wolfgang Dierker, „Planmäßige Ausschlachtung der Sittlichkeitsprozesse“. Die Kampagne gegen katholische Ordensangehörige und Priester 1936/37. In: zur Nieden (Hg.), Homosexualität und Staatsräson, S. 281–293. 265 Friedrich Tete H. Tetens, Christentum, Hitlerismus, Bolschewismus, Buenos Aires 1937, S. 62. 266 Bericht aus Sachsen, A 8–A 9. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 2 (1935), S. 659. 267 Oberpräsident der Provinz Sachsen an den Preußischen Ministerpräsidenten vom 10.5.1935. In: Rupieper/Sperk (Hg.), Lageberichte der Geheimen Staatspolizei zur Provinz Sachsen, Band 2, S. 406–409, hier 409. 268 Ebd. 269 Stefan Maiwald/Gerd Mischler, Sexualität unter dem Hakenkreuz. Manipulation und Vernichtung der Intimsphäre im NS-Staat, München 1999, S. 112 f.
Die prekäre Hitlerjugend
187
HJ-Führern führte selbst der BDM gelegentlich Klage.270 Erika Mann griff im Exil, nicht unähnlich zu Hans Siemsen oder Otto Friedländer, einige Gerüchte um die Hitlerjugend auf. Sie brachte die Behauptung vor, dass es die Parteiund Staatsjugend – mit ihren Fahrten, Lagern und abenteuerlichen Übernachtungen im Stall – strukturell und gezielt auf uneheliche Schwangerschaften schon 14-jähriger Mädchen anlege. Damit versuche das Regime die Geburtenrate zu steigern.271 Die RJF, die um das Ansehen ihrer Organisation bemüht war, versuchte im konservativ-bürgerlichen Milieu nicht weiter abzuschrecken. „Ich selbst habe den BDM nie gern im Zelt und im Stroh gesehen“, ging Hartmann Lauterbacher in seinen Memoiren beiläufig darüber hinweg, „weil keine noch so gute und ausgeklügelte Organisation beispielsweise die hygienischen Bedingungen herstellen konnte. Als Stabsführer habe ich […] BDM-Zeltlager verboten.“272 Die Geschlechterpolarität, welche die Erziehung in der Hitlerjugend bekanntermaßen kennzeichnete, war nicht von Anfang gegeben. In der „Kampfzeit“ hatten sich Mädchen und junge Frauen als Aktivistinnen durchaus betätigt; wenn auch nicht in großer Zahl. Die belletristischen Schriften aus der Frühzeit des BDM liefern Zeugnis. Der 1933 publizierte Schmöker „Ulla“ handelte von zwei kämpferischen Mädchen, die in einer Kleinstadt eine BDM-Gruppe aufbauen und die Bewohner gegen die finsteren Machenschaften jüdischer Geschäftsleute aufhetzen.273 Marga Möckel publizierte noch 1935 ein ähnliches Jugendbuch unter dem Titel „Hitlermädel kämpfen um Berlin“, das von einem aggressiven Impetus und einem aktivistischen Frauenbild gekennzeichnet war.274 Das Idealbild waren, zumindest zu Beginn, nicht die „Stubenhocker oder artige kleine Mädchen – sondern die Jungmädel des Bundes“.275 Der RJF-Propagandachef Willi Körber blies im März 1933 in dasselbe Horn: „Wir Jungens sind stolz, dass wir im BDM solche Kameraden zur Seite haben.“276 Im sächsischen Pirna riet 1935 die Obergauführerin Rosemarie Brüß ihren Mädchen, was Eltern in der Lokalzeitung nachlesen konnten, getreu dem Ausspruch zu handeln: „Treue leben – todtrotzend kämpfen – lachend sterben!“277
270 Vgl. beispielsweise Verhalten von HJ-Führern gegenüber BDM-Führerinnen. In: GB: Thüringen, 7/35 vom 4.6.1935. 271 Vgl. Erika Mann, School for Barbarians. Education under the Nazis, New York 1938, S. 135–143. 272 Lauterbacher, Erlebt und mitgestaltet, S. 81. 273 Helga Knöpke-Joest, Ulla, ein Hitlermädel, Leipzig 1933. 274 Marga Möckel, Hitlermädel kämpfen um Berlin. Eine Erzählung aus der Kampfzeit, Stuttgart 1935. 275 Die Jungmädelschaft, Wir Jungmädel (Blätter für die Heimabendgestaltung der Jungmädel im BDM), (1934) 1, S. 5. 276 Geleitwort von Willi Körber zur Gauführerinnentagung des BDM in Weimar. In: Das Deutsche Mädel, (1933) 3, S. 3. 277 Bericht über das Untergautreffen des Pirnaer BDM. In: Pirnaer Anzeiger vom 8.7.1935.
188
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Das Mädchen- und Frauenbild in der Hitlerjugend änderte sich nach 1933 aber Zug um Zug gravierend. Ein in Hinblick auf die Partizipation der Frauen sowie weiblicher Körperlichkeit gewissermaßen moderner BDM wäre in der Breite der Bevölkerung nicht anschlussfähig gewesen. Bis Kriegsende stand die Hitlerjugend zu Unrecht in Verruf, es werde die weibliche Sexualität dort besonders freizügig gehandhabt. Die RJF setzte spätestens ab Mitte der 1930er-Jahre auf eine konventionelle Mädchenerziehung. Der BDM wurde konservativer und war weniger vom Aktivismus der frühen Jahre geprägt. Die erste BDM-Haushaltungsschule entstand 1934; im November 1940, als sie mit den staatlichen Schulen gleichgestellt wurden, existierten 25.278 Jungen Frauen wurden neben der Weltanschauung vor allen in Fragen von Familien- und Haushaltsführung unterrichtet. Die BDM-Zeitschriften zeichneten nun das bekannte Idealbild der deutschen Frau als Mutter und Hüterin des Heimes. Sexuelle Aufklärung jenseits der Rassenideologie sparte man aus und wurde – anders als vieles andere – als Aufgabe an die Eltern zurückverwiesen.279 Rassistisch getränkte Aufklärungsschriften wie jene von Karl und Gretel Blome, 1940 vom Rassenpolitischen Amt der NSDAP vertrieben, hatten eher junge Erwachsene und frisch vermählte Ehepaare zum Ziel, fanden in der Hitlerjugendorganisation hingegen kaum Verwendung.280 Während der BDM in ländlichen Regionen weiterhin Mädchen und jungen Frauen neue Möglichkeiten der außerhäuslichen und außerkirchlichen Aktivitäten bot, und insofern durch bloße Existenz anziehend wirken konnte, büßte er in Städten an Attraktivität zum Teil ein: Sophie Scholl bot der enge, konservative Rahmen der Ulmer Hitlerjugend keine Genugtuung. 1937 hatte sie Fritz Hartnagel auf einer Tanzveranstaltung, die im BDM nun als undeutsch verpönt waren, kennengelernt und sich verliebt. Die spätere Widerstandskämpferin war wegen unprätentiöser Eigenmächtigkeiten ihrer BDM-Führungsfunktionen bereits enthoben worden und begann, Abstand zur Hitlerjugend zu nehmen.281 Konventionelle Rollenbilder einerseits und die urbane Alltagsrealität andererseits – gerade in Arbeitervierteln der größeren Städte, wo junge Menschen in beengten Wohnverhältnissen schnell aufgeklärt wurden – klafften bisweilen auseinander. In den Berichten selbst der begeisterten und vom BDM eingenom278 Vgl. Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, Betrifft Errichtung von Haushaltungsschulen (Berufsfachschulen) durch den Bund Deutscher Mädel vom 8.11.1940 (HStA Dresden, 11125, 23138, Bl. 17). Die 25 BDM-Haushaltungsschulen befanden sich in Arnau, Bönnigheim, Bühl, Cham, Düsseldorf, Geldern, Godesberg, Heiligenberg, Herzberg, Hohenstadt, Karlsruhe, Klötze, Koblenz, Köln-Marienburg, Neuzelle, Orlau, Ottendorf, Passenheim, Reichenhall, Rothalmünster, Stauffen, Stuttgart-Berg, Tiefenthal, Varenholz, Warnin. 279 Vgl. Rosenbaum, Kinderalltag im Nationalsozialismus, S. 232. 280 Karl Blome/Greta Blome, Ein Wort an junge Kameradinnen, Berlin 1940. Zum Verbot sexueller Aufklärung in der Hitlerjugend vgl. auch Rosenbaum, Kinderalltag im Nationalsozialismus, S. 232. 281 Vgl. Gustav Keller, Die Gewissensentwicklung der Geschwister Scholl. Eine moralpsychologische Betrachtung, Herbholzheim 2014, S. 40.
Die prekäre Hitlerjugend
189
menen Mädchen blitzt manchmal die andere, modernere Welt der jungen Altersgenossinnen auf: „Mit vielen Klassenkameradinnen konnte man plötzlich nicht mehr richtig reden. Sie hatten so viele Dinge im Kopf, die mich gar nicht interessierten. Sie sangen Schlager, die ich blöde fand, und sie sammelten Bilder von Filmstars. Mir gaben sie immer wieder zu verstehen, ich sei doch recht kindisch. Da war es gut, dass es den Dienst gab. Da galt ich etwas.“282 Die Sittlichkeitsdiskurse in den 1930er-Jahren um die Hitlerjugend – insbesondere in Bezug auf Homosexualität, Jugendverführung und weibliche Sexualität – besaßen zwei Seiten. Auf der einen Seite wirkten sie von außerhalb auf die Hitlerjugend ein: Einzelne Fälle wurden in der Partei und im Sicherheitsapparat aktenkundig oder oppositionelle Kreise nutzten sie, bewusst dramatisiert, für Angriffe auf die RJF und die Hitlerjugend. Insbesondere in den Diskursen um Homosexualität spielte hier im Grunde weniger ein Ressentiment gegen Homosexuelle eine Rolle als vielmehr die Tatsache, dass es sich bei den Betroffenen um Kinder und Jugendliche handelte. In der Hitlerjugend schienen sie, wie einzelne Fälle belegten, vor Verführung, sittlicher Demoralisierung oder gar sexuellen Übergriffen nicht ausreichend geschützt. Ebenso wie dem Regime – was heute seltener thematisiert wird – dienten zeitgenössische Sittlichkeits- und Moralvorstellungen auch einer vermeintlich progressiven Linken als Agitationsmittel. Friedländer, der in Prag die zeitgenössischen Berichte 1938 zusammentrug, konstatierte: „Die Spannungen [zwischen Elternhaus und Hitlerjugend] erhöhen sich durch die ausgesprochene sittliche Verwahrlosung, die in zahlreichen Fällen wahrzunehmen ist. Wir wollen nicht übertreiben und wollen auch nicht verschweigen, dass das sexuelle Problem […] zu Missständen auch in der freien Jugendbewegung der früheren Tage geführt hat. Aber was früher Einzelfall war, ist jetzt Massenerscheinung geworden.“283 Übergriffe und Missbrauch wurden häufig mit deviantem Verhalten in eins gesetzt. Heute fällt deshalb die Unterscheidung schwer, ob man es im Aktenmaterial jeweils mit realen Verfehlungen und Missbrauch oder eher harmlosen und pubertären Experimenten zu tun hat. Beides wurde von Zeitgenossen und dem Regime vermischt.284 Eine Untersuchung zum sexuellen Missbrauch an Kindern steht, wie erwähnt, noch immer aus. Die andere Seite der Diskurse wirkte ins Innere der Parteijugend zurück. Die RJF reagierte mit Kursanpassungen ebenso wie mit verschärfter Verfolgung. Fälle, die immer wieder vorkamen, rührten an den Grundfesten der Organisation: Das Ideal, dass sich die Jugend selbst führen und erziehen solle, schien infrage gestellt. Die Hitlerjugend schien Übergriffe auf Schutzbefohlene sogar institutionell zu begünstigen. Die Statistik bildete die verschärfte Verfolgungssituation ab: 1937 wurden in elf deutschen Großstädten immerhin 546 mehr Fälle von jugendlichen Sexualdelikten gerichtlich verhandelt als 1932.285 282 Renate Finckh, Sie versprachen uns die Zukunft. Eine Jugend im Nationalsozialismus, Tübingen 2002, S. 134. 283 Otto Friedländer, Die deutsche Jugend, unveröffentlichtes Manuskript, S. 277. 284 Vgl. Grau, Homosexualität in der NS-Zeit, S. 276–279. 285 Vgl. Hepp, Die Kriminalstatistik widerlegt eine zählebige Legende, S. 259.
190
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
„Kameraden, die Schweinereien erzählen, machen und dulden, können niemals zu meinem engeren Freundes- und Kameradenkreis gehören“, strich der Landjahrführer Walter Hermannsen heraus, der den Diskurs perfide umlenkte: „So werdet ihr, indem ihr derartige gemeine Straßencliquen meidet […] mit eingreifen in den Kampf um die deutsche Seele, um ihre Säuberung von dem fürchterlichen Schmutz […], den Marxisten und Juden bewusst in die Herzen der Jugend und des Volkes hineingeschüttet haben.“286 Obgleich diverse Vorfälle – von unterschiedlichen Akteuren, mit je eigener Intention – aufgegriffen wurden, waren sie sicherlich kein Massenphänomen; die Hitlerjugend weder ein Zuhause für Päderasten, wie sie Siemsen skandalträchtig schilderte, noch die institutionelle Brutstätte einer allgemeinen sittliche Nivellierung. Aber das Zusammentreffen von realen Vorfällen mit Kritik aus dem Sicherheitsapparat, von aufgebauschten Gerüchten und politischen Kampagnen der Gegner, rührte gravierend am Selbstbild der Hitlerjugend und wirkte insofern in erheblichem Maße radikalisierend.
2.
Schulung und Antisemitismus
2.1
Schulungen an der Basis
Am 1. April 1933 setzten die Nationalsozialisten mit dem landesweiten Boykott jüdischer Geschäfte ihre antisemitische Ideologie zum ersten Mal in staatliche Politik um. „Ungeheure Massen in der Stadt, überall Posten“, schrieb der Dresdner Hitlerjunge Franz Schall am Abend in sein Tagebuch: „Viele Juden sollen gefasst sein, die samt Koffer und Moneten per Bahn aus Deutschland fliehen wollten. Sie sind, es heißt 250 an der Zahl, im Volkshaus kaserniert und dürfen u. a. Treppen scheuern.“287 Franz Schall hatte durch annähernd vier Jahre HJ-Engagement sowohl die völkische Ideologie als auch den Judenhass tief verinnerlicht. An diesem Tag zwar nur in der Beobachterrolle, hielt er den drei Tage andauernden „Judenboykott“ für eine gerechtfertigte Maßnahme, ja sogar für den vitalen Ausdruck einer angeblichen Volkserhebung. Prototypisch scheint dieser junge Mann damit für jene breite Masse an Jugendlichen und jungen Männern zu stehen, die nach der „Machtergreifung“ das Unrecht rechtfertigten und die Diktatur trugen. Das Regime ließ verlautbaren, der Boykott werde von „angeschlossenen Organisationen […] ohne jede Gesetzesverletzung“ durchgeführt; niemand werde „tätlich bedroht“, „kein Unschuldiger getroffen“.288 In Wahrheit wurden Menschen gedemütigt, verhaftet, mit Schildern behängt wie Verbrecher durch Straßen getrieben. Zeitgleich war die RJF aber mit Anderem 286 Walter Hermannsen, Ein Wort an 14-jährige Jungen. In: ders. (Hg.), Geschlechtliche Jugenderziehung. Ziel und Weg, Leipzig 1938, S. 22–33, hier 29. 287 Postert, Hitlerjunge Schall, S. 255. 288 Zit. aus dem Artikel „Drei Tage Bewährungsfrist für die Gräuelhetzer. Jede Disziplinlosigkeit wird bestraft“. In: Hamburger Nachrichten vom 1.4.1933, Ausgabe A.
Schulung und Antisemitismus
191
befasst: In Berlin ließ Schirach am selben Tag die Geschäftsstelle des RddJ besetzen, in den Großstädten wie Hamburg oder Köln ging die HJ-Führung gegen Regionalstellen des Verbands sowie gegen die linke Konkurrenz und Jugendhäuser aus der Arbeiterbewegung vor. Die Durchführung des „Judenboykotts“ lag überwiegend in der Hand von SA und Partei und war keine Angelegenheit der Hitlerjugend. Doch in einzelnen Fällen – besonders in Großstädten wie Köln, Hamburg und Berlin – hatten Hitlerjungen neben den SA-Männern mit vorgedruckten Plakaten vor Geschäften, Arztpraxen oder Anwaltskanzleien Posten bezogen, um die Menschen am Betreten oder Kauf zu hindern.289 Fotografen setzten die Kinder oft mit Absicht in die Bildmitte, wohl um die Szenen weniger gespenstisch erscheinen zu lassen. Günther Roos, geboren 1929 in Brühl und später ein begeisterter Hitlerjunge, kam während des Boykotts an jene Plaketten, die damals der „Stürmer“-Verlag in Umlauf brachte: „Wer beim Juden kauft, ist ein Volksverräter“. Morgens auf dem Schulweg, wie er sich erinnerte, habe er sie an die Schaufenster jüdischer Geschäfte geklebt: „Das machte Spaß, so was. Gerade die Jugend kann man dafür ja schnell kriegen.“290 Der Auftakt zur staatlichen Judenverfolgung war eine Vorausschau auf die Rolle, die junge Menschen im November 1938 in erheblich größerem Maß übernahmen. Der Judenhass war kein Unikum der Hitlerjugend. Tagebücher, Schüleraufsätze oder die Fahrtenbücher aus den bündischen und konfessionellen Gruppen der Jugendbewegung zeugen – meist eher beiläufig – davon, wie weit der Antisemitismus gesellschaftlich verbreitet war. Sie „beherbergte diesmal furchtbar viel Juden, sogar eine jüdische Jugendgruppe“, heißt es im Fahrtenbericht e iner katholischen ND-Gruppe aus Berlin über den Besuch einer Jugendherberge im Jahr 1934: „Wir machen es uns trotzdem gemütlich.“291 Im Unterschied zu vielen anderen Gruppen oder Bünden der Jugendbewegung hatte die Hitlerjugend den Antisemitismus jedoch früh zum radikalen Erziehungsprogramm erhoben. Kurt Gruber, der Gründer der Hitlerjugend, hatte ein „arisches Rassebewusstsein“ zum „Baustein ihres Wesens“ gezählt.292 Die sogenannte rassenpolitische Erziehung führte am Ende zur unverhohlenen Rechtfertigung des Massenmords. „Der Parasit unter den Völkern ist der Jude“, behauptete ein BDM-Schulungsheft aus Sachsen Anfang 1944: „Er kann einzelne Menschen, ganze Völker, ja sogar die ganze Menschheit als Weltparasit befallen. Die Beispiele aus der Natur aber lehren uns, dass wir keine andere Möglichkeit haben, als ihn mit allen Kräften zu bekämpfen und schließlich zu vernichten.“293 289 Vgl. Avraham Barkai, Vom Boykott zur „Entjudung“. Der wirtschaftliche Existenzkampf der Juden im Dritten Reich 1933–1943, Frankfurt a. M. 1998, S. 28. 290 Zit. nach Martin Rüther, „Macht will ich haben“. Die Erziehung des Hitlerjungen Günther Roos zum Nationalsozialisten, Bonn 2017, S. 74. 291 Zit. aus dem Fotoalbum der Berliner ND-Gruppe „St. Canisius“ zur Schwedenfahrt 1934, ohne Seite (Digitalisat in: EzG, jugend1918-1945.de; 16.7.2020). 292 Kurt Gruber, Begleitworte. In: Hitler-Jugend, (1926) 9, S. 2; Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 69 f. 293 Zit. aus dem Abschnitt: Wir erzählen: Das Judentum – der Parasit unter den Völkern. In: Gebiet Sachsen (Hg.), Mädelführerinnendienst, Ausgabe: Februar 1944, S. 30.
192
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Die Radikalisierung erfolgte in Etappen. Aus Sicht der HJ-Führer 1933 mussten die junge Mitglieder zu Nationalsozialisten erst noch erzogen werden: „Ungeheuer war in den letzten Wochen der Zustrom der Jungen und Mädels zur […] Hitler-Jugend“, so ein rheinisches Kampfblatt im Mai 1933: „Da galt es nun und gilt es noch, diese Neuen, die einen durcheinandergewürfelten lockeren Haufen bilden, zu einer […] im nationalsozialistischen Geiste geschulten […] und innerlich gefestigten Masse zusammenzufügen.“294 Noch schien die Millionenmasse der Neulinge weder gefestigt noch weltanschaulich zuverlässig. Wenn ein BDM-Mädchen, so befand Eberhard Otto, ein Bannführer in Nordwest-Sachsen, im Herbst 1934, sich „zusammen mit einer gepuderten und angemalten Jüdin vor ein Hotel setzt und Zigaretten raucht, so weiß man im ersten Augenblick nicht, ob man es hier mit einer bewundernswerten Naivität oder mit einer bodenlosen Unverschämtheit und Disziplinlosigkeit zu tun“ habe.295 Junge Menschen wurden nach 1933 zu Beobachtern, Teilnehmern und sogar zu willigen Tätern. „Sobald sie der Hitlerjugend beitraten, durften sie keinen Kontakt mehr mit Juden haben, mit mir oder anderen“, berichtete Jacob Wiener, 1919 in Bremen geboren. Seine Schulklasse hatte ihn nach 1933 schnell in die Rolle des geächteten Außenseiters gedrängt.296 Guy Stern, der in Hildesheim aufwuchs, schilderte die gespenstische Wandlung eines einstigen Schulkameraden. Die jüdischen Kinder habe er gegen Schmähungen anfangs noch verteidigt. Doch bald eingetreten in die HJ, sei er dort umgedreht und ein Eiferer geworden: „Er wurde zu unserem schlimmsten Peiniger.“297 Die spätere SPD-Politikerin Elfriede Eilers, geboren in einer sozialdemokratischen Bielefelder Familie, berichtete über die soziale Anpassung und das verbreitete Schweigen. Bei Hitlers Machtantritt war sie 12 Jahre alt. Zum BDM blieb sie immer auf Abstand: „Ich entwickelte […] einen Sinn dafür, worüber man in der Öffentlichkeit sprach und was man besser für sich behielt. Viele Freunde und Geschäftspartner meines Vaters waren Juden, mein Großvater genoss in den jüdischen Kaufhäusern ein hohes Ansehen. Wir hatten regemäßig Besuch von jüdischen Freunden, und ich wusste genau, dass man nicht darüber sprach, wer das war.“298 Neben dem staatlichen Schulbetrieb, der nach 1933 sukzessive zum Hort antisemitischer Hetze verkam, sollte die „Judenpolitik“ vor allem über die Parteijugend vermittelt werden. Deren Schulung wirkte in zwei – miteinander verschränkten, aber unterschiedlichen – Feldern. Schulungseinrichtungen, die
294 Zit. aus dem Artikel „Unser Vormarsch“. In: Die Fanfare. Kampfschrift der Hitler-Jugend im Gebiet Westfalen-Niederrhein, (1933) 2, Sondernummer, S. 6. 295 Eberhard Otto, Haltung. In: HJ im Vormarsch, (1934) 5, S. 4. 296 Interview mit J. Wiener, Transkript, S. 2 (USHHM, Oral History Collection, RG50.030.0249). 297 Interview mit Guy Stern, Transkript, S. 2. (ebd., RG-50.030.0223). 298 Elfriede Eilers, „In die Jugendarbeit bin ich hineingeboren …“. In: Werner Kersting (Hg.), Jugend vor einer Welt in Trümmern: Erfahrungen und Verhältnisse der Jugend zwischen Hitler- und Nachkriegsdeutschland, München 1998, S. 131–139, hier 133.
Schulung und Antisemitismus
193
vermehrt ab dem Sommer 1933 entstanden, bildeten einen professionell aufgebauten Komplex. Jeder Bann betrieb eine solche Schule, jedes Gebiet eine oder mehrere Führerschulen, die für aussichtsreiche, körperlich und geistig taugliche Jugendliche gedacht waren; für die Mädchen gab es analog Untergau- und Gauschulen. Bis 1937 wurden 75 Gebietsschulen in Betrieb genommen.299 Die jungen Unterführer – manchmal erst 13 Jahre alt – durchliefen mehrtätige Kurse, um sich Verwaltungswissen, sportliches Geschick sowie ideologisches Rüstzeug anzueignen.300 In Baden waren im Frühsommer 1933 die ersten Schulen in Betrieb genommen worden. Man war optimistisch: Es sei möglich, in nur sechs Monaten „sämtliche Unterführer“ einzubeziehen. Nach weiteren acht Monaten werde sich „diese Schulung […] auf die gesamte nationalsozialistische Jugend […] praktisch ausgewirkt haben“.301 Zwei HJ-Reichsführerschulen in Potsdam und Remagen sowie fünf BDM-Schulen bildeten die höhere Ebene. Die RJF baute bis 1939 außerdem eine Akademie für Jugendführung in Braunschweig auf, die zur Weiterbildung des höheren, älteren Führerkorps dienen sollte. Mit Kriegsbeginn kam der Lehrbetrieb dort jedoch beinahe sofort zum Erliegen.302 Wer die Kurse an den mittleren Gebietsführerschulen durchlaufen hatte, konnte sich des Weiteren in der Jugendburg Storkow bei Berlin im dreiwöchigen Kurs zum „selbstständigen und brauchbaren Schulungsredner“ – mit Aussicht auf hauptamtliche Anstellung – ausbilden lassen.303 Die dortigen Kurse sollten der „einheitlichen Ausrichtung“ jener dienen, die in der weltanschaulichen Schulungsarbeit der Parteijugend standen.304 Schon 1934 hatten angeblich rund 21 000 HJ-Führer und BDM-Führerinnen einen Lehrgang an den Gebietsschulen durchlaufen. Nach Berechnungen der RJF mussten mindestens 400 000 Jugendliche irgendeine der Schulen besuchen, um alle Einheiten mit einem geschulten Unterführer zu versorgen. Rassenkunde gewann erst in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts Bedeutung. Die Banne bzw. Untergaue mussten eine
299 Vgl. Zentralverlag der NSDAP (Hg.), Hitler-Jugend 1933–1943. Die Chronik eines Jahrzehnts. Mit einem Geleitwort des Reichsjugendführers Artur Axmann, Berlin 1943, S. 18. 300 Vgl. beispielhaft Beschickung der Gebietsführerschulen. In: GB: Mark Brandenburg, A6/39 vom 1.4.1939. 301 Badischer Landeskommissar, Freiburg, an die Landräte über die Förderung der Hitlerjugend zur Errichtung einer Führerschule in Freiburg i. Brsg. vom 10.8.1933 (StA Freiburg, B719/1, 5018, unpag.). Zur Aufgabe der Gebietsführerschulen und Musterung durch Schulungskandidaten vgl. z. B. Untersuchung zur Einberufung auf Führerschulen. In: GB: Saarpfalz, A16/37 vom 1.12.1937. 302 Vgl. Benno Hafenegger, Jugendarbeit als Beruf. Geschichte einer Profession in Deutschland, Opladen 1992, S. 91–102; Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 312 f.; Lauterbacher, Erlebt und mitgestaltet, S. 128–130. 303 Lehrgänge für weltanschauliche Schulung. In: GB: Pommern, 16/42 K vom 9.1942; Rassenpolitischer Lehrgang für Mädel. In: GB: Oberschlesien, 3/43 K vom 10.6.1943; Lehrgänge der Reichsjugendführung in Storkow/Mark. In: GB: Hessen-Nassau, B13/37 vom 29.4.1937. 304 Storkower Lehrgänge des Amtes WS [Weltanschauliche Schulung]. In: GB: Kurmark, A6/37 vom 12.4.1937.
194
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
vorgegebene Anzahl an Teilnehmern für spezielle Kurse entsenden. HJ-Führer, die in die „rassenpolitische“ Schulungsarbeit gelangten, wurden vom Rassenpolitischen Amt der NSDAP in der Reichsschule Babelsberg ausgebildet.305 Von einem weltanschaulichen, „rassepolitischen“ Referenten in hauptamtlicher Funktion wurde verlangt, dass er möglichst vor 1933 zur Bewegung gehört hatte, um eine „Garantie für seine Zuverlässigkeit“ zu erhalten.306 Das zweite Feld – für die breite Mehrheit junger Menschen – war mit diesem institutionellen Komplex zwar aufs engste verschränkt, aber bezog sich auf den von Autonomie geprägten Alltag der Formationen. Gerade hier sollte die kontinuierliche Massenschulung an der Basis stattfinden: Heimabend, Zeltlager, Diskussionsrunden und Besuch der NSDAP-Veranstaltungen. Dies leisteten vor allem junge Unterführer im Alltag der Einheiten.307 Franz Köppe, ein HJ-Führer, der Ende des Jahrzehnts im Propagandaministerium eingesetzt wurde, forderte 1934, dass sich die HJ „mit fanatischem Eifer in die deutsche Rassenkunde vertiefen“ müsse.308 Mithilfe von diversen Lehrmaterialien, Propagandafilmen, Schulungsheften oder allerlei Prüfungen – welche Großveranstaltungen wie den Reichsberufswettkampf rahmten oder beim Aufstieg in der Rangordnung zu absolvieren waren – sollten Mitglieder Schritt für Schritt geformt und überprüft werden. Diese Schulung erfolgte 1937 zum ersten Mal jahrgangsweise und reichseinheitlich. Für das zweite HJ-Jahr, also die 15- und 16-Jährigen, war das rassistische Thementableau – Vererbungslehre, Eugenik, Rassengesetze – laut dem Schulungsplan der RJF vorgesehen. Diesen Plan umzusetzen, war indes nicht immer leicht. Eine Inspektion im Gebiet Westmark Anfang 1938 ergab, dass „viele Führer […] den Jahrgangsschulungsplan nicht kennen“.309 Zur Erringung des HJ-Leistungsabzeichens mussten Jugendliche ab 1938 nicht nur – das ist allgemein bekannt – Hitlers Lebensweg aufsagen können, sondern auch Antworten auf die Frage formulieren, welche „Maßnahmen […] das Dritte Reich zum Schutz der Reinhaltung des deutschen Blutes getroffen“
305 Vgl. NSDAP (Hg.), Chronik eines Jahrzehnts, S. 18; Kölnische Zeitung, Zur Führerschulung der HJ, 1935. In: Jahnke (Hg.), Eine Dokumentation, S. 104–106; Rassenkundliche Schulung der Führerinnenschaft. In: Gebiets- und Obergaubefehl: Westfalen, K20/41 vom 10.1941; Lehrgänge des Rassenpolitischen Amtes in Babelsberg. In: GB: Kurmark, A3/39 vom 15.2.1939. 306 Besetzung der WS-Stellen in den Bannen und Jungbannen. In: GB: Kurmark, 12/36 vom 24.6.1936. 307 Eigene Referenten aufzustellen, wurde der Basis sogar verboten. Vgl. Schulungsleiter in den unteren Einheiten. In: GB: Franken, 2/36, o. D.: „Aus gegebener Veranlassung weisen wir darauf hin, dass die Schulungsarbeit in den unteren Einheiten vom Führer der Einheit selbst durchzuführen ist und in Gefolgschaften und Unterbannen, Fähnlein und Stämmen ‚Schulungsreferenten‘ nicht aufgestellt werden dürfen. Lediglich bei Bannen und Jungbannen sind WS-Stellen errichtet.“ 308 Köppe, Die Hitler-Jugend als politisch-soldatische Erziehungsgemeinschaft, S. 114. Vgl. zu Köppe auch Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 332. 309 Kritik der Gebietsführung mit erneutem Abdruck des Jahrgangsschulungsplans. In: GB: Westmark, A9/38 vom 15.5.1938.
Schulung und Antisemitismus
195
habe. Beispiele für „ererbte und erworbene Eigenschaften des Menschen“ sollten dargelegt werden.310 Und beim Leistungswettkampf der Mädchen 1943/44 hatten die Teilnehmerinnen über die Rolle der Juden im Krieg zu schreiben.311 Die Materialien zur Heimabend-Gestaltung waren von antisemitischen Codes durchzogen. Sie zeugten vielfach von dumpfem Hass: „Nehmt euch die Hetzer und Wühler von Emigranten unter die Lupe“, beschrieb z. B. die Thüringer HJ-Führung 1934 die ideale Gestaltung eines politischen Heimabends: „Ihr kommt dann sicher auf Fragen über Judentum, Marxismus und Bolschewismus zu sprechen. Dann könnt ihr allgemein […] Rassefragen anschneiden und euch über das Verhältnis von Rasse, Volk und Staat Klarheit verschaffen.“312 Die Lehrgänge an den Bann- und Gebietsführerschulen zur Auslese der mittleren Führerschaft vertieften diese rassenideologischen Inhalte. Aber die Heim abende der Formationen, die ab 1937 in allen Gliederungen auf Scharebene stattfanden, wurden von den jungen Unterführern selbst ausgestaltet, weshalb die Überprüfung dort nicht leicht war.313 Im Idealfall sollten jene, die die Lehrgänge im Schulungsbetrieb durchlaufen hatten, alles dort Gelernte sowie die Inhalte der Schulungspläne an die Kameraden weitergeben. Dass Jugendliche einander wie Lehrer waren, sollte der Vorzug der Hitlerjugend sowie Ausweis ihrer revolutionär neuen Pädagogik sein. Auf das Selbstführungsgebot, das nicht – wie oft behauptet – pure demagogische Illusion war, sondern den Alltag tatsächlich prägte, verzichtete man selbst im Schulungskomplex nicht.314 Einerseits trug das Prinzip „Jugend führt Jugend“ wahrscheinlich in vielen Fällen Erhebliches zur Radikalisierung bei. Der Gefolgschaftsführer, heißt es z. B. in der Chronik einer HJ-Einheit aus Essen über eine Veranstaltung im Herbst 1937, habe über die Nürnberger Rassengesetze referiert: „Meyer charakterisierte den Juden in seiner Wühlarbeit, indem der Jude die […] Rassenreinheit verdirbt und
310 Der gesamte Fragenkatalog (Stufe A bis C) für HJ und Jungvolk u. a. abgedruckt in: GB: Thüringen, A5/38 vom 30.4.1938. 311 Vgl. Welche Rolle spielt der Jude im Krieg? In: GB: Niederdonau, Sonderdruck III: Reichsleistungswettkampf der Jungmädel- und Mädelgruppen 1943/44 vom 3.12.1943. 312 Kurt Müller, Politische Schulung. In: Der Thüringer Sturmtrupp, (1934) 2, S. 13. 313 Zum Stellenwert der Schulungstypen und ihrer Aufgaben – Lehrschar, Wochenendschulung, Führerring, Gebietsführerschule – vgl. z. B. Erklärungen im GB: Düsseldorf, Sonderdruck 1/38: Schulung vom 15.10.1938; vgl. auch Heimabende der Scharen. In: GB: Westmark, 5/37 vom 18.4.1937. 314 Die Hitlerjugend kennzeichnete zwar ein hierarchisches Gefolgschaftsverhältnis – von der RJF bis hinunter in die einzelnen Formationen – gleichzeitig blieb aber der Großteil des Alltags, ganz dem Topos der Selbstführung gemäß, während der 1930er-Jahre in der Hand der Jugendlichen. Vgl. auch Gisela Miller-Kipp, „Totale Erfassung“ – aber wie? Die Hitler-Jugend: Politische Funktion, psychosoziales Funktionieren und Momente des Widerstands. In: Stefanie Becker/Christoph Studt (Hg.), „Und sie werden nicht mehr frei sein ihr ganzes Leben“. Funktion und Stellenwert der NSDAP, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände im „Dritten Reich“, Münster 2012, S. 87–104, hier 97: „Der jugendliche Gestus der Gesamtorganisation bestand […] zu Recht. Ebenso kam dem Selbstführungsanspruch aus subjektiver Perspektive Realität zu. Selbstführung war Alltagserfahrung in der HJ.“
196
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
damit ein Volk vernichtet.“315 Aber gerade weil die Heimabende und viele andere Veranstaltungen von jungen Menschen selbst organisiert wurden, zudem die Überprüfung für höhere Dienststellen selten möglich war, liegt andererseits die Frage nahe: Folgte die Schulung überall einer vorgegebenen Linie? Es mag erstaunen, dass ein gewichtiger Teil der Zeitzeugen bestritt, in der Hitlerjugend überhaupt indoktriniert worden zu sein. „Wir haben viel Sport gemacht, sind draußen gewesen“, erzählte Werner M., der bei Dresden Anfang 1937 zum Jungvolk kam: „Von Schulung habe ich überhaupt nichts mitbekommen.“316 Frieda S., geboren 1930 in München, meinte über die Jungmädel: „Wir wurden […] nicht wie bei der HJ gegen Juden aufgehetzt.“317 Zeitzeugen, die revisionistischer Motive unverdächtig sind, haben mit gleichem Tenor zurückgeblickt. Historiker Arno Klönne, der in Bochum und Paderborn aufwuchs, wies dem Alltagsrassismus der deutschen Gesellschaft sowie dem schulischen Lehrstoff einen höheren Einfluss zu: „Wenn ich mich an die Hitler-Jugend oder das Jungvolk erinnere, so ist dort ideologische Schulung auch meiner Erfahrung nach wenig vorgekommen“.318 Hans Mommsen, 1930 in Marburg geboren, schätzte die Gemengelage ähnlich ein. Seine Jugendjahre seien von einem erheblichen Maß an Unwissenheit geprägt gewesen. Zwar sei man in der Hitlerjugend mit Antisemitismus konfrontiert gewesen, aber das Judentum habe man irgendwo anders verortet, im bolschewistischen Moskau möglicherweise, aber eben nicht in Deutschland.319 Welchen Reim soll man sich auf derlei Rückblenden machen? Sind es bloß entlastende Nachkriegslegenden, wie es sie so zahlreich gegeben hat? Verdrängungs- oder Rechtfertigungseffekte mögen ein Teil der Antwort sein, auch Erinnerungslücken manches erklären. Für eine Geschichte der Hitlerjugend stellen sie dennoch eine Herausforderung dar. Hinweise im Quellenmaterial stützen diese Schilderungen nicht pauschal, erlauben aber ihre Einordnung. Dabei gilt es umso mehr zu betonen: die häufig unbewusste und perfide Wirkung eines Schulungsbetriebs, in dem aus Kindern Claqueure oder sogar Mittäter wurden, bleibt hier unbestritten. Doch um den Hitlerjugendalltag zu verstehen und Widersprüche zwischen den Erinnerungsberichten aufzuklären, ist es wichtig, die breiten Handlungsspielräume zu erkunden, die junge Menschen tatsächlich besaßen. 315 Chronik der Gefolgschaft „Wasserturm“, Essen, über Kurzkursus am 2./3. Oktober 1937, S. 25 (Digitalisat in: EzG, jugend1918-1945.de; 16.7.2020). 316 Interview des Verfassers. Name des Interviewten pseudonymisiert (Tonaufnahme, Archiv des HAIT). 317 Zeitzeugeninterview mit Frieda S., Städtisches Heinrich-Heine-Gymnasium München. In: Franz Schiermeier, Jugend im Nationalsozialismus, München 2012, S. 28-35, hier 31. 318 Interview mit Arno Klönne zit. nach Gehling/Gehling/Hofmann/Nickel/Rüther (Hg.), Paderborner Zeitzeugen berichten, S. 32. Die auf persönliche Erfahrung gegründete Einschätzung hat er von der Gesamtbewertung der Hitlerjugendschulung getrennt: „Der eliminatorische Antisemitismus war obligatorischer und offener Bestandteil der weltanschaulichen Schulung in der Staatsjugendorganisation des Dritten Reiches.“ Klönne, Jugend im Dritten Reich, S. 202. 319 Interview mit Hans Mommsen, Transkript, S. 8 und 19 (USHHM, RG-50.030.0407).
Schulung und Antisemitismus
197
Dass sich ein Teil der Mitglieder an rassistische Schulung wie auch an politische Indoktrination im Allgemeinen – am ehesten durch Gesang und Lieder – heute kaum erinnert, mag damit zusammenhängen, dass die Schulungen für junge Menschen vielfach nicht attraktiv waren.320 Sedimente der weltanschaulichen Basisarbeit blieben haften, aber das Gros des Alltags geriet in Vergessenheit. Die Attraktivität der Hitlerjugend für die Masse der Neulinge ergab sich nach 1933 aus ihren breiten Sport- und Freizeitangeboten. Sie lag weniger in der Aneignung und Vermittlung eines weltanschaulichen Programms. „Ich bin […] ins kalte Wasser geworfen worden. Ich hatte keine Lehrerqualitäten, ich hatte auch keine Qualitäten, Weltanschauung zu vermitteln“, glaubte Max Esser, der als 15-Jähriger im Frühjahr 1939 in Köln zum Jungzugführer wurde.321 Und Gerhard Laue, der in Erfurt aufwuchs, erinnerte sich an jene Heimabende zurück, die der Rassenthematik gewidmet waren: „So richtig haben das unsere Vorgesetzten auch nicht erklären können. Sie waren ja selbst noch Kinder. Sie haben uns ihr Wissen so weitergegeben, wie sie es selbst verstanden haben. Kindlich und einfach.“322 Die Mehrheit jener, die mit Führungsverantwortung betraut worden war, besaß weder eine pädagogische Eignung noch eine besondere biografische Nähe zur NS-Bewegung. Die wenigsten hatten – wie Franz Schall – ein frühes Engagement vorzuweisen; was für männliche und weibliche Angehörige gleichermaßen gilt. Das konnte ein Vorteil für die Vermittlung von Ideologie sein, aber ebenso ein Nachteil. Melita Maschmann befand, dass BDM-Heimabende oft von einer „fatalen Inhaltslosigkeit“ geprägt gewesen seien: „Die Zeit wurde mit dem Einkassieren der Beiträge, mit dem Führen unzähliger Listen und dem Einpauken von Liedertexten totgeschlagen […]. Aussprachen über politische Texte – etwa aus ‚Mein Kampf‘ – endeten schnell in einem allgemeinen Verstummen.“323 In der Provinz in den Anfangsjahren ein weiterer Faktor hinzutrat: Da die Hitlerjugend sich vielfach im Aufbau befand, auch gesetzliche Zwangsinstrumente fehlten, setzten Unterführer weniger auf die Wirkung ihrer Weltanschauung, sondern auf Sport und Kulturarbeit – Musik, Tanz, Theater –, um zu wachsen. In den technischen Sonderformationen wie der Nachrichten- oder Motor-HJ stand die weltanschauliche Arbeit nicht an prioritärer Stelle.324 In Dienstbefehlen der Parteijugend ebenso wie im Berichts320 Charakteristisch der Bericht aus Berlin, A 86. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 5 (1938), S. 1391: „Die Schulungsabende in der HJ sind langweilig. Man hört sich zwar die Reden an, aber man beantwortet die Fragen der Leiter nur, wenn es gar nicht anders geht.“ 321 Interview mit Max Esser, geb. 1923 in Köln (NSDOK Köln, EzG, jugend1918-1945.de; 16.7.2020) 322 Laue, Meine Jugend in Erfurt unter Hitler 1933–1945, S. 31. 323 Maschmann, Fazit, S. 17. 324 Bestätigt werden die Aussagen diverser Zeitzeugen über den vergleichsweise geringeren ideologischen Druck in den technischen Sonderformationen auch in Materialien der Gebietsführungen, die immer wieder um Abhilfe bemüht waren. Vgl. z. B. Weltanschauliche Schulung der Sonderformationen. In: GB: Kurmark, 17/36 vom 15.10.1935: „Mit Rücksicht auf die Tatsache, dass den Sonderformationen auf technischem Gebiete
198
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
wesen der Staatsorgane wurde der Mangel an „weltanschaulicher Festigung“ hervorgehoben – die Klagen seien zu bekannt, lautete es lapidar aus Erfurt 1935, „als dass […] besonders darauf hingewiesen werden“ müsse.325 Analog begründete ein Berichterstatter der Exil-SPD 1936, dass in der HJ ein großer Führermangel beklagt werde: „In der überwiegenden Mehrheit sind die Führer schlecht. Wo sie gut sind, stammen sie meist aus der alten Bündischen Jugend.“326 Nach dem Frühjahr 1933 waren Töchter und Söhne aus dem Arbeitermilieu oder aus christlichen Elternhäusern aus unterschiedlichsten Motiven zu Millionen in die Parteijugend geströmt. Manche trugen nun als Unterführer im Alltag Verantwortung. Das blieb wiederum nicht ohne Auswirkungen, wie die Heimabende oder kurze politische Schulungen mit Inhalt gefüllt wurden. Im Gebiet Brandenburg z. B. setzte man zur „Belebung der Heimabende“ sogenannte Stoßtrupps ein, die sich aus HJ-Einheiten der Städte rekrutierten. Sie wurden aufs Land geschickt, um dort die politische Schulung zu fördern.327 In den Gestapo-Berichten blieb ein Dauerthema, dass oft „ein oder zwei Stunden gespielt [werde], und dann sei der Dienst aus […], ohne dass etwas von der Bewegung und dem Ziel der NSDAP gelernt“ würde.328 Gerade die kritischen Lageberichte der Überwachungsorgane darf man nicht für bare Münze nehmen: Die Kritik an der Jugend erfolgte hier immer aus einer ideologisch geschärften Linse. Indoktrination fand nach 1933 zumal dort intensiver statt, wo – weil es an geeigneten jungen Unterführern fehlte – loyale Lehrer oder erfahrene SA-Männer die Formationen überantwortet bekamen. Die Schulung der Hitlerjugend sollte man sich dennoch nicht so vorstellen, als seien überall gleichermaßen trainierte Demagogen am Werk gewesen. Sie war gerade nicht, wie es in einer jener typisch rechtsextremen Apologien lautet, „wohlgeeignetes Bildungszentrum, in dem Theorie und Praxis sich wechselseitig ergänzten“.329 Klönne bilanzierte treffend: In der HJ hätten „15- bis 18-Jährige eine Befehlsgewalt“ erhalten, „der sie in diesem jugendlichen Alter vielfach nicht gerecht
besondere Aufgaben gestellt sind, müssen die Formationsführer sich trotzdem darüber klar sein, dass die ihnen unterstellten Jungen in erster Linie Hitlerjungen sind. […] Den WS-Stellenleitern der Banne und Jungbanne mache ich die Schulung […] der Sonderformationen zur besonderen Aufgabe.“ 325 Bericht Oberpräsident der Provinz Sachsen an den Preußischen Ministerpräsidenten vom 10.5.1935. In: Rupieper/Sperk (Hg.), Lageberichte der Geheimen Staatspolizeizur Provinz Sachsen, Band 3, S. 214–217, hier 216. Die HJ-Führer würden, hieß es auch im katholischen Aachen, nicht „weltanschaulich zu überzeugen“ wissen, „mehr schaden als nutzen“. Lagebericht vom 13.6.1935. In: Vollmer, Volksopposition im Polizeistaat, S. 228–236, hier 234. 326 Bericht aus Schlesien, A 75. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 3 (1936), S. 1313. 327 Stosstrupparbeit auf dem Lande. In: GB: Kurmark 17/36 vom 3.10.1936. 328 Lagebericht der Gestapostelle Koblenz für Dezember 1935. In: Faust/Rusinek/Dietz (Hg.), Lageberichte rheinischer Gestapostellen, Band II/2, S. 1530–1553, hier 1549. 329 Gottfried Griesmayr, Idee und Gestalt der Hitlerjugend, 2. Auflage, Druffel 1979, S. 208.
Schulung und Antisemitismus
199
zu werden vermochten“.330 Aus der Sicht höherer Dienststellen schien stets der Vorwurf im Raum zu schweben, es sei auf die Organisation als Erziehungsinstrument kein Verlass. Die Kritik musste die RJF umso mehr schmerzen, weil ihr Totalitätsanspruch nicht nur eine Konkurrenz mit dem staatlichen Bildungsbetrieb implizierte, sondern viel weiter reichte. Für Partei und Staat sollte die Hitlerjugend das einzige legitime Nachwuchsreservoir stellen. Die Inspektionen in den Einheiten, durchgeführt von übergeordneten Dienststellen, nahmen an Zahl kontinuierlich zu. Nicht zuletzt mit Handreichungen, Themenheften und konkreten Vorgaben versuchte die RJF seit Mitte des Jahrzehnts die jungen Mitglieder auf ihr ideologisches Programm zu verpflichten: „Auf die regelmäßige Durchführung der Heimabende […] ist besonderer Wert aus diesem Grunde zu legen. Politische Berichte, weltanschauliche Erziehung und Dienstunterricht sind der Inhalt der Heimabende.“331 Doch bestand ein gewisser Spielraum für eine Führerschaft, die überwiegend im Jugendalter stand und oft sich selbst überlassen blieb. Vielfältige Anweisungen – in Bezug auf Lektüre oder zu behandelnde Themen – wurden nicht überall umgesetzt. „Ich weiß ja nicht, wie es andernorts war, aber bei uns gab es keine fanatische, keine passionierte, keine heftige Jugend Hitlers“, meinte Peter Wapnewski, 1922 in Kiel geboren und später anerkannter Mediävist: „Sie alle machten eben mit, lustlos einige, lustvoll andere, gleichgültig viele.“332 Die Befehlsblätter aus dem HJ-Innendienst können solche Aussagen zum Teil stützen. Inspektionen der Dienststellen förderten gelegentlich zutage, dass – wie in Brandenburg 1937 – „nicht alle Heimabende nach den […] Richtlinien durchgeführt“ würden.333 Manchmal ließen junge Unterführer das Schulungsmaterial bewusst beiseite, weil sie die Jüngsten nicht überfordern oder langweilen wollten. So erklärt sich, dass ein Stammführer aus Ulm 1935 seinen jüngeren Unterführern empfahl, beim Heimabend „nicht auf politische Einzelheiten einzugehen, da die Jungen […] doch nichts mitbekommen“.334 Kurz darauf empörte sich die höhere Ulmer HJ-Führung, es sei „unmöglich, dass an einem Heimabend […] Geländespiele gemacht“ würden.335 Außerdem war im Sommer 1936 weiter Thema, dass die örtlichen Unterführer alte bündische Literatur, statt neue nationalsozialistische Schriften nutzten.336
330 Arno Klönne, Jugendprotest und Jugendopposition. Von der HJ-Erziehung zum Cliquenwesen der Kriegszeit. In: Martin Broszart/Elke Fröhlich/Anton Grossmann (Hg.), Bayern in der NS-Zeit. Herrschaft und Gesellschaft im Konflikt, Band 4, Teil C, München 1981, S. 527–620, hier 537. 331 Durchführung der Heimabende. In: GB: Mecklenburg, 1/K vom 15.10.1939. 332 Peter Wapnewski, Meine Schulzeit im Dritten Reich. In: Reich-Ranicki (Hg.), Meine Schulzeit im Dritten Reich, S. 91–102, hier 94. 333 Themen der Heimabende. In: GB: Kurmark, A16/37 vom 11.12.1937. 334 Führer des Stammes Ulm-West an die Fähnleinführer, Anordnungen für den Stamm vom 23.10.1935 (StadtA Ulm, NL Lauser, 29, Bl. 10). 335 Stammbefehl 1/35 vom 1.11.1935 (ebd., 27, Bl. 6). 336 Vgl. Stammbefehl 2/36 vom 27.6.1936 (ebd., Bl. 15).
200
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Der mangelhafte Unterricht an der Basis schien, jedenfalls aus Sicht des Führerkorps, auf die weltanschauliche Schulung insgesamt negativ zurückzufallen. Der Abteilungsleiter für Weltanschauung in Düsseldorf, der im Mai 1939 bestandene Fragebögen aus einer Jungvolkprüfung durchsah, zeigte sich erbost: Wiederholt habe er festgestellt, „dass die gegebenen Antworten oft kaum, oft aber auch gar nicht den Anforderungen der Prüfung entsprachen“. In Zukunft werde man auf Nachprüfungen bestehen.337 Zum Reichsberufswettkampf 1937 waren vielerorts Stichproben genommen worden. Man hatte Fragebögen verteilt, bevor es zur Prüfung kam, um das Erlernte früh abzufragen sowie Disziplinierungseffekte zu erzielen.338 Eine Statistik aus Hamburg mag ebenfalls als Indiz dafür gelten, dass die weltanschaulichen Prüfungen kaum von einer breiten Mitgliedermasse als echter Ansporn zur Leistung empfunden wurden: Ende 1937 hatten in Hamburg nur 2,6 Prozent der Jungvolk- und HJ-Mitglieder das Leistungsabzeichen errungen. Ein Jahr später konnten 6,7 Prozent damit aufwarten. Die bürgerlichen Stadtteile waren im Schnitt besser repräsentiert, die Arbeiterviertel fielen stark ab. Im HJ-Bann Hamburg-Hafen hatte lediglich knapp über ein Prozent die weltanschauliche Prüfung, die zur Verleihung notwendig war, erfolgreich absolviert.339 Umso erstaunlicher sind die Zahlen, da diese Prüfung ja nicht zuerst „die nationalsozialistische Gesinnung erforschen“, vielmehr die „Überprüfung des politischen Grundwissens“ leisten sollte, also idealerweise das Leistungsabzeichen der Organisation möglichst viele junge Menschen erhalten sollten.340 Hamburg war kein Einzelfall. Im ländlich bis kleinstädtischen Gebiet Westmark legte man offen, dass 1938 nur 13 Prozent der DJ- und HJ-Mitglieder, die für das Abzeichen infrage kamen, dieses auch errungen hatten.341 Beide Statistiken unterstreichen, dass die Prüfung keine – wie manche Studien behaupteten – „kaum zu umgehende Pflicht“ darstellte; die Zahlen deuten das genaue Gegenteil an.342 Klagen über das angebliche Desin-
337 Abnahme der weltanschaulichen Prüfung. In: GB: Düsseldorf, A8/39 vom 31.5.1939. 338 Vgl. beispielsweise Stichprüfung für die weltanschauliche Schulung beim RBWK [Reichsberufswettkampf]. In: GB: Pommern, A13/37 vom 1.12.1937. 339 Vgl. die seltene Aufstellung über verliehene HJ- und DJ-Leistungsabzeichen, Stand vom 31.12.1937 und 31.12.1938. In: GB: Hamburg, A1/39 vom 15.1.1939. DJ-Jungbann und HJ-Bann 76 im bürgerlichen Westen schnitten mit 12,8 bzw. 26,4 % am besten ab. Hamburg-Süd lag mit 8 bzw. 17,7 % an zweiter Stelle. 340 Die Abnahme der weltanschaulichen Prüfung für das HJ-Leistungsabzeichen. In: GB: Wien, A1/39 vom 1.3.1939; GB: Kurmark, A1/39 vom 15.1.1939. 341 Gesamtzahl der Leistungsabzeichen in den einzelnen Bannen des Gebiets bis 31. Dezember 1938, unter Angabe der Prozentzahlen. In: GB: Westmark, A2/39 vom 1.2.1939. 342 Einschätzung zit. nach Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 234. Es handelte sich eher um eine in der HJ sehr typische Formulierung, die aber nicht unbedingt die Tatsachen an der Basis spiegelte. Vgl. z. B. bei Leistungsabzeichen und Bestätigung der weltanschaulichen Schulung. In: BB: Kurmark, 1/36 vom 10.1.1936: „Der Erwerb des HJ-Leistungsabzeichens wird den Einheiten 100-prozentig zur Pflicht gemacht! Der Erwerb des Leistungsabzeichens ist das Ziel einer mindestens 8–10monatigen gründlichen Ausbildung in allen geforderten Zweigen.“
Schulung und Antisemitismus
201
teresse junger Menschen blieben vielfach weiter bestehen. Was an Unkenntnis vorhanden sei, zeige sich, so ein SD-Lagebericht im Kriegsjahr 1942, „wenn ‚Bismarck als Feldherr des 17. Jahrhunderts‘, ‚Hindenburg als der berühmteste Jagdflieger des Weltkrieges‘ oder ‚Mendel als asiatischer Mönch‘“ benannt würden, „wenn beispielsweise selbst Angehörige des BDM den Namen der Reichsfrauenführerin nicht kennen, […] die Namen der wichtigsten Reichsminister hinsichtlich ihrer Ämter verwechselt werden, […] selbst das Wort Nationalsozialismus nicht richtig geschrieben“ würde.343 Beim Reichsberufswettkampf, in dessen Zuge junge Menschen ebenfalls ideologische Prüfungen zu absolvieren hatten, urteilte der SD in Koblenz 1944 gänzlich vernichtend: „Die HJ hat versagt. Es waren HJ-Führer eingesetzt, die nicht das weltanschauliche Rüstzeug hatten, um andere prüfen zu können. In einzelnen Wettkämpfen sind die vorher als Prüfer angekündigten HJ-Führer einfach nicht erschienen.“344 Eine Reihe von Befehlen innerhalb der Parteijugend, die sich mit diesen Problemen der Schulungsarbeit befassten, spiegeln die von außen geübte Kritik.345 Die weltanschauliche Schulung hatte – zumindest in der HJ, teils im DJ, weniger in den weiblichen Gliederungen – nach Kriegsbeginn sukzessive an Bedeutung eingebüßt. Wehrertüchtigung und militärische Ausbildung wurden gerade in der HJ wichtiger. Im Gebiet Franken meinte die HJ-Führung im August 1943 sogar, dass „der Propagandamarsch […] für den schaffenden Volksgenossen und für den Fronturlauber mehr bedeutet als der Schulungsvortrag“.346 Der Dienst sämtlicher Einheiten sei nunmehr als Marsch zu gestalten, mindestens zwei Stunden in der Woche in den Städten – also ein Großteil der Dienstzeit.347 Die Frage ist zu stellen, ob Studien es sich nicht etwas zu einfach machten, indem sie die Hitlerjugend pauschal als einheitliche, ideologisch getrimmte Indoktrinationsmaschine und ein „gewaltiges Beeinflussungssystem“ – mit nahezu totalem Durchgriff auf sämtliche ihrer Mitglieder – charakterisierten.348
343 Meldung Nr. 346 vom 29.12.1942. In: Heinz Boberach (Hg.), Meldungen aus dem Reich. Die geheimen Lageberichte des Sicherheitsdienstes der SS 1938–1945, Band 12, Berlin 1984, S. 4597–4616, hier 4604. 344 Bericht des SD-Abschnitts Koblenz vom 27.4.1944. In: Peter Brommer (Hg.), Die Partei hört mit. Lageberichte und andere Meldungen des Sicherheitsdienstes der SS aus dem Großraum Koblenz 1937–1941, Band 2/2, Koblenz 1992, S. 649–254, hier 651. Zur Auswahl der WS-Prüfer vgl. beispielsweise Anordnungen zur Abnahme durch die Gruppe Weltanschauung. In: GB: Saarpfalz, A1/39 vom 26.1.1939. 345 Vgl. z. B. Anordnung zur Besetzung der WS-Stellen der Banne und Jungbanne. In: BB: Kurmark, 2/36 vom 24.1.1936: „Es hat sich leider herausgestellt, dass viele Bann- und Jungbannführer die Besetzung der WS-Stellen nicht mit der nötigen Sorgfalt und in einigen Fällen sogar überhaupt nicht vorgenommen haben. Die Beschickung der Arbeits tagung der Abteilung in Cottbus war schlecht. Von einigen Bannen war nicht einmal eine Mitteilung über die Nichtbeschickung da. Das ist ein unmöglicher Zustand.“ 346 Marsch als Dienst. In: GB: Franken, 6/43 vom 8.1943. 347 Vgl. ebd. 348 Zit. aus Klaus, Mädchen im 3. Reich, S. 70.
202 2.2
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Desinteressierte, Mitläufer, Radikale
Aus Sicht des Regimes begegnete ein Teil der jungen Menschen sogar der antisemitischen Politik – was zumal aus dem Rückblick irritiert – mit Desinteresse. Zu gedankenlos würden, behaupteten die Funktionäre, viele Heranwachsende mit der jüdischen Bevölkerung verkehren. Einerseits hatte man die Disziplinierung der Mitglieder und ihre Verpflichtung auf die Rassenideologie zum Ziel, gerade indem man vermeintliche Verfehlungen in eigenen Befehlsblättern dauernd thematisierte. Doch entsprangen die dort aufgeführten Beispiele andererseits nicht purer Fantasie: Es seien, konstatierte die Hitlerjugend 1938, „wiederholt Fälle bekannt geworden, in denen Angehörige der HJ und des BDM Lehrstellen und Arbeitsverhältnisse in jüdischen Geschäften annehmen, ohne sich vorher darüber zu unterrichten, ob der Inhaber des Geschäftes Jude ist“.349 Die Gefolg schaftsführer seien angehalten, politische Aufklärung zu betreiben, und sollten die „Judenfrage“ stärker thematisieren, um Verhaltensänderungen zu bewirken. Jugendliche seien verpflichtet, sich vorab zu informieren, ob ihr Arbeitgeber möglicherweise ein Jude sei.350 Dass man aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage war, alle Einheiten mit Materialien zu versorgen, beklagten die Ideologen besonders. 1940 musste man etwa in Bayern aufgrund von Papierengpässen empfehlen, für die Ausgestaltung von Heimabenden auf Artikel der Tagespresse zurückzugreifen.351 Doch nicht nur vermeintliche Mitläufer und gleichgeschaltete Neulinge fielen auf, weil sie gegen den rassistischen Verhaltenskodex verstießen. Der Mitarbeiter eines Banns in Recklinghausen beispielsweise, der Anfang 1933 aus dem bündischen Lager übergewechselt war, absolvierte – ungeachtet seiner gehobenen Stellung – bis 1935 eine Lehre in einem Kaufhaus, das als in jüdischer Hand befindlich galt; ein Umstand, der in der lokalen HJ-Führung für Denunziation und Konflikte sorgte.352 Auf Initiative der RJF, die auf Umsetzung der Rassenpolitik drängte, heizte die Hitlerjugend mit ihrem Verhaltenskatalog Radikalisierung und Ausgrenzung an. Gelegentlich ergänzten eigene Einschätzungen regionaler Funktionäre die allgemeinen Klagen über die mangelnde Disziplin in der „Judenfrage“.353 In Berlin wurden im August 1935 HJ-Mitglieder aufgefordert, einerseits Eltern „vom Kauf in jüdischen Geschäften ab[zu]halten, andererseits ihre Kameraden
349 Beschäftigung von Angehörigen der HJ und des BDM in jüdischen Geschäften. In: GB: Thüringen, A 3/38 vom 1.3.1938. 350 Vgl. ebd. 351 So dokumentiert beispielsweise in der Anweisung über Schulungsmaterial und zur tagespolitischen Schulung. In: GB: Hochland, K6/1 vom 15.1.1940. 352 Vgl. Vogt, Vestische Hitlerjugend, S. 191. 353 Vgl. Beschäftigung von Angehörigen der HJ und des BDM in jüdischen Geschäften. In: GB: Pommern, A3/38 vom 1.3.1938; sowie ähnlich in: GB: Thüringen, A3/38 vom 1.3.1938; und GB: Berlin, A5/38 vom 1.5.1938, wo es hieß, dass diese „Feststellung […] auch seitens der Sozialabteilung des Gebietes Berlin und der Gaujugendabteilung der DAF getroffen [bestätigt] werden“ könne.
Schulung und Antisemitismus
203
in der Schule entsprechend [zu] beeinflussen.“354 Unter Konfirmanden würden jüdische Händler hier erfolgreich „eine rührige Propaganda“ treiben.355 In den Dienststellen Berlins wurden zur gleichen Zeit Schilder mit der Aufschrift „Die Juden sind unser Unglück“ angebracht.356 Insbesondere in den Frühjahrs- und Sommermonaten kam es in den Großstädten zu Konflikten um Eisdielen, deren Besitzer angeblich Juden waren. In Berlin hatten HJ-Angehörige, vereinzelt wohl auch zusammen mit SA-Männern, im Sommer 1935 im Zuge mehrwöchiger Boykottaktionen vor den Eisdielen Posten bezogen. Sie versuchten, Gleichaltrige vom Kauf abzuhalten.357 Offenbar kam es vereinzelt zu vorübergehenden Verhaftungen, weil HJ und Jungvolk gegen Passanten pöbelten. Im Juni 1937 erregten wiederum Jungvolk und HJ-Angehörige das Missfallen ihrer höheren Dienststellen. Diese wiederum hatten trotz der Boykottaktionen und Anweisungen angeblich „jüdische“ Eisdielen wiederholt besucht. Die Beschwerden waren aus Parteikreisen beim Stab des Gebiets vorgebracht worden. Für die Zukunft drohte das Berliner Führerkorps Strafen an. Der HJ-Streifendienst wurde angewiesen, die Orte zu observieren: „Es hat sich jeder Junge vor Betreten eines jeden Geschäftes zu vergewissern, ob der Besitzer Nichtarier ist oder nicht.“358 Solche Anweisungen, die zur rassistischen Aufwieglungspraxis gehörten, trugen wahrscheinlich dazu bei, dass Gruppen vor den Eisdielen immer wieder aufmarschierten und andere als „Judenknechte“ beschimpften, die dort auftauchten. Die Inhaber wurden bedroht, Fassaden mit Parolen beschmiert.359 Im „Stürmer“ waren die jüdischen Eisdielen schon 1935 ein Thema; man erweckte aber den Eindruck, nur jüdische Kinder und Jugendliche würden hier kaufen.360 Seit Mitte der 1930er-Jahre fanden diverse Warnschilder – wie „Achtung, Judenladen!“ – flächendeckend Verbreitung. Diese Schilder richteten sich gerade an junge Menschen, die man davon abbringen wollte, die Geschäfte zu betreten; viel sei auf die Unkenntnis örtlicher Verhältnisse zurückzuführen, meinte zur Begründung die Gestapo in Düsseldorf im August 1935, denn für auswärtige Jugendliche seien die „Judengeschäfte“ nicht sofort zu erkennen.361
354 Kauf in jüdischen Geschäften. In: BB: Berlin, 82/35 vom 15.4.1935. 355 Ebd. 356 Judenboykottierung. In: BB: Berlin, 92/35 vom 16.8.1935. 357 Vgl. diverse Berichte über „Juden-Aktionen“ in Berlin, insbesondere in Bezug auf Hitlerjugend vor Eisdielen, unter: Bericht über die Lage in Deutschland, Nr. 16 vom 7.1935. In: Stöver (Hg.), Die Meldungen der Gruppe Neu Beginnen aus dem Dritten Reich 1933–1936, S. 557–600, hier 567 f. 358 Besuch von Eisdielen. In: GB: Berlin, A11/38 vom 15.6.1937. 359 Vgl. Bericht der Stapostelle Landespolizeibezirk Berlin für Juli 1935. In: Otto Dov Kulka/Eberhard Jäckel (Hg.), Die Juden in den geheimen NS-Stimmungsberichten 1933–1945, Düsseldorf 2004, S. 146–148. 360 Vgl. Jüdische Eisdielen in Berlin. In: Der Stürmer, Nr. 28 vom 7.1935. 361 Gesamtübersicht über die politische Lage der Gestapostelle Düsseldorf für August 1935. In: Faust/Rusinek/Dietz (Hg.), Lageberichte rheinischer Gestapostellen, Band II/2, S. 884–931, hier 923.
204
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Jugendliche, die aus Familien stammten, in denen Vorbehalte weiter vorherrschten, machte die Hitlerjugend-Schulung nicht zwangsläufig zu eisernen und aufgehetzten Jung-Nationalsozialisten. In Metropolen wie Hamburg und Berlin, wo man schnell miteinander in Kontakt kam, beklagte die Hitlerjugend Erstaunliches. Dort war z. B. mehrfach die Teilnahme von Ausländern im HJDienst aufgefallen. Trotz des Verbots hatten manche Jugendliche offenbar ihre flüchtigen Bekanntschaften mitgenommen.362 Und aus dem mittelhessischen Kirchhain – wieder ein völlig anders gelagerter Fall – berichtete die Gestapo im Mai 1938 über eine Gruppe, die ausländische Radiosender hörte. Dem Juden, der die konspirative Gruppe angeblich leitete, sei es gelungen, „sogar […] 4 HJ-Angehörige zur Teilnahme […] an den Diskussionen zu gewinnen“.363 So erstaunlich, wie die Beamten den Anschein erweckten, war dieser Umstand nicht: Die Hitlerjugend hatte sich längst zum indirekten Zwangssystem gewandelt, in das durch sozialen Anpassungsdruck auch jene hineingepfercht wurden, die wenig Begeisterung für Schulungsinhalte oder weltanschaulichen Unterricht aufbrachten. Verschiedene Hinweise bekräftigen, dass die Aussagen einzelner Berichte nicht völlig aus der Luft gegriffen sind. Heinz Beck aus Cannstatt bei Stuttgart, damals 13 Jahre alt, glaubte, dass er über den Umgang mit der jüdischen Bevölkerung kaum nachgedacht habe: „Da sind wir in der Hitlerjugend-Uniform rein“, meinte er über ein Kaufhaus in der Innenstadt, das als jüdisch galt, „und haben […] Schulhefte oder sonst was gekauft.“364 Die Tagebücher eines Schülers aus Neu-Isenburg, dessen Familie mit jüdischen Bekannten verkehrte, unterstreichen zugleich auf bedrückende Weise, dass solches Verhalten Gefahren barg. „Unser Name“, schrieb der Jungvolk-Angehörige wie nebenbei über seine Familie ins Tagebuch, „ist in […] dem Isenburger Kampfblatt verewigt, da wir 1938 noch bei Juden kauften.“365 Und die Untergrundgruppe „Neu Beginnen“ berichtete im September 1936 über einen 14-Jährigen aus einem ostpreußischen Dorf, der von Kameraden verprügelt worden war, weil dessen Mutter bei Juden kaufte.366 Ausschlüsse aus der Parteijugend nur wegen des Umgangs mit Juden waren hingegen selten. Wenige Fälle sind in der RJF-Warnkartei
362 Vgl. z. B. Ausländerbesuch auf Heimabenden. In: GB: Berlin, A1/38 vom 1.2.1938; Führung von Ausländern durch Veranstaltungen und Einrichtungen der HJ. In: GB: Hamburg, A12/39 vom 15.7.1939. 363 Bericht der Gestapo II A 2 für April 1938. In: Kulka/Jäckel (Hg.), Die Juden in den geheimen NS-Stimmungsberichten, S. 269. 364 Interview mit Herrn Heinz Beck, Transkript, S. 3 (USHHM, Oral History Collection, RG-50.486.0029). 365 Tagebuchpassage zum 25.11.1938 des Schülers Hermann Bremser. In: Dieter Rebentisch/Angelika Raab (Hg.), Neu-Isenburg zwischen Anpassung und Widerstand. Dokumente über Lebensbedingungen und politisches Verhalten 1933–1945, Neu-Isenburg 1978, S. 178–181, hier 181. 366 Vgl. Bericht über die Lage in Deutschland, Nr. 21 vom 9.1936. In: Stöver (Hg.), Die Meldungen der Gruppe Neu Beginnen aus dem Dritten Reich 1933–1936, S. 694–732, hier 721.
Schulung und Antisemitismus
205
überliefert.367 Zu verallgemeinern sind die genannten Beispiele einerseits sicher nicht, aber andererseits auch nicht aus dem Blick zu verlieren. Selten vermochten Freundschaften oder familiäre Bande jene Kluft dauerhaft zu überbrücken, welche die Ideologie aufriss. Elfriede Roth aus Lauterbach in Hessen, 1925 in einem sozialdemokratischen Elternhaus geboren, erinnerte sich an die jüdische Familie Weinsberg, die in der Nachbarschaft lebte. Mit ihren Berichten hat sie Jahre später Zweifel streuen wollen, ob die Hitlerjugend-Erziehung alle gleich erfasste. Kontakte zwischen den Familien, wie sie im Rückblick schilderte, seien nach 1933 nicht abgebrochen. Die Verfolgung und Ausgrenzung der Familie sei ihr zwar nicht entgangen, doch an Nachmittagen habe sie als Haushaltshilfe dort oft etwas hinzuverdient. In die Synagoge sei sie bis zu den Pogromen im November 1938 gar mehrfach mitgenommen worden. „Da war ich schon bei den sogenannten Jungmädeln, und da hatten wir so blaue Röcke und weiße Blusen und so einen schwarzen Knoten an, […] und da bin ich in dieser Kluft [zu den Weinsbergs] gegangen.“ Dass ihre Besuche bei der Familie, noch dazu in Uniform, für die Hitlerjugend ein Problem darstellte, darüber habe sie sich keine Gedanken gemacht. Den Argwohn ihres Vaters gegenüber der Hitlerjugend habe sie als 13-Jährige genauso wenig verstehen können wie den Umstand, dass der jüngere Sohn der Familie nicht habe mitspielen dürfen.368 Solche Berichte sind aufseiten der Verfolgten ebenfalls vorgelegt worden, obgleich sie viel seltener sind. Eric Sonnemann, in Neustadt an der Hardt 1910 geboren, hatte in den 1930er-Jahren den Bund Deutsch-jüdischer Jugend in Mannheim geleitet – ab Juli 1935 war dem Bund, wie anderen jüdischen und vielen konfessionellen Jugendgruppen, jede Betätigung de facto verboten.369 Die Familie war arriviert, der Vater liberaler Politiker und Mitherausgeber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ gewesen. Sonnemann erzählte von seinem Jugendfreund Karl. Der sei frühzeitig begeisterter Nationalsozialist gewesen, zunächst in der Hitlerjugend, dann als Parteimitglied. Karl habe ihm dennoch, trotz aller Spannungen und Differenzen, während der Pogrome des Novembers 1938 geholfen: Ihn in der Nacht zum 10. November warnend, dass etwas gegen die Juden vorbereit werde, habe er alles von Wert sowie einige Akten des Bunds versteckt. Später habe er sie zurückgegeben. Jahrzehnte danach zeigte Eric Sonnemann sich verwundert über das Verhalten seines Jugendfreundes, den er danach nie wiedergesehen hatte. Die Familie emigrierte 1939.370 367 Vgl. Kathrin Kollmeier, „Hinaus mit allen Störenfrieden!“. Der disziplinarrechtliche Ausschluss aus der Hitler-Jugend als Ausgrenzung aus der NS-Volksgemeinschaft. In: Alain Chatriot (Hg.), Figurationen des Staates in Deutschland und Frankreich: 1870– 1945, München 2006, S. 161–184, hier 172. 368 Zit. nach Monika Felsing, Das Schabbesmädchen. Elfriede Roth – eine NS-Zeitzeugin aus Lauterbach (http://www.monikafelsing.de/images/elfriede_roth.pdf; 16.7.2020). Vgl. ähnlich Oliver Hack, Licht entzündet in dunkler Zeit. Die Lauterbacherin Elfriede Roth. In: Lauterbacher Anzeiger vom 21.7.2018. 369 Vgl. Anweisung des Reichsinnenministers zur weiteren Einschränkung der Tätigkeit jüdischer Jugendverbände vom 10.7.1935. In: Jahnke (Hg.), Eine Dokumentation, S. 94. 370 Video-Interview mit Eric Otto Sonnemann (USHHM, Oral History Collection, RG50.767.0001).
206
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Sicherlich handelte es sich hier um Ausnahmefälle. Den Antisemitismus unter jungen Menschen fest zu verankern, war eine vordringliche Aufgabe, die sich die Hitlerjugend setzte: Im ersten Halbjahr 1937 hatte die RJF sogenannte Rassenschulung für alle Angehörigen für verbindlich erklärt. „Diese Schulung“, betonten die Stäbe der Gebiete, „hat in den Einheiten solange durchgeführt zu werden, bis diese Dinge, die die Grundlage für jedes […] Verständnis bilden, restlos sitzen. Sonderinteressen in der Ausrichtungsarbeit haben nun endgültig zu unterbleiben.“371 Der Judenhass sollte nicht nur bei genuin „rassenpolitischen“ Heimabenden verbreitet werden. Er spielte in diversen Themenfeldern eine Rolle. Zu den „10 Gesetzen der Gesundheit“ beispielsweise, die den Hitlerjugend-Angehörigen eingeimpft wurden, zählte neben der Warnung vor Alkohol und Tabak: „Halte Dich von den Einflüssen nichtdeutscher Menschen fern. Sie verderben Dich an Leib und Seele.“372 Besonders bei Jungmädeln und im BDM fielen der diffuse Dunstkreis um Familienpolitik und „Volkshygiene“ mit Rassismus häufig zusammen.373 So erläuterten Handreichungen, die der BDM im Gebiet Schwaben 1942 nutzen sollte: „Der Jude ist eine Mischung von vorderasiatischem und orientalischem Blut. Seine Heimat ist Palästina. Dort nahm er auch nordisches […] Blut und Negerblut in sich auf. Aus dieser […] Rassenmischung ist der heute bekannte Jude entstanden, der uns wesensfremd ist und auch in seinem Erscheinungsbild von jedem von uns gleich erkannt wird.“374 Kinder und Jugendliche kamen in der Jugendorganisation mit derartigen Inhalten immer häufiger in Berührung. Den jungen Unterführern war für ihre Heimabende indes nur ein Rahmen als „verbindlich für sämtliche Einheiten“ vorgegeben. Pläne mit konkreten Inhalten galten formal als Empfehlungen.375 Im März 1937 stellten die Themenhefte der RJF zur HJ-Heimabendgestaltung erstmals die „Judenfrage“ ausgiebig in den Mittelpunkt. Unter dem Titel „Brandstifter Jude“ wies diese Ausgabe durch das bekannte völkische Szenario einer jüdischen Weltverschwörung: „Wir wollen an diesem Heimabend sehen […], dass der Jude die Welt erobern will und dass das Ziel des Juden, die Welt zu beherrschen, […] schon Jahrtausende alt ist.“376 In Zeltlagern, wie z. B. unweit von Köln, kam das Heft zum Einsatz. An einem Tag des zweiwöchigen Lagers widmeten sich die Teilnehmer den antisemitischen Texten.377 In welchem 371 Einheitliche Schulung. In: GB: Thüringen, A4/37 vom 1.3.1937. 372 10 Gesetze der Gesundheit, u. a. angedruckt in: BB: Mainfranken, 3/43K vom 3.1943. 373 Birgit Jürgens, Zur Geschichte des BDM (Bund Deutscher Mädel) von 1923 bis 1939, Frankfurt a. M. 1994, S. 127–145. Vgl. auch Merksätze zur Rassenpflege. In: Obergaubefehl: Schlesien, A5/40 vom 15.10.1940: „10. Die Reinhaltung des Blutes liegt im Interesse aller wertvollen Rassen.“ 374 Gestaltung eines Heimabends. In: BDM-Führerinnendienst, Gebiet Schwaben vom 1.1942. In: Miller-Kipp (Hg.), „Auch Du gehörst dem Führer“, S. 261. 375 Vorgaben zur Ausgestaltung eines Heimabends. In: Reichsjugendführung (Hg.), Die Kameradschaft. Blätter für Heimabendgestaltung der Hitler-Jugend, (1936) 7, S. 4. 376 Kameraden! In: ebd., (1937) 4, S. 3. 377 Hinweis zu finden im Lagerbefehl II/37 des weltanschaulichen Schulungslagers des HJ-Gebietes Mittelrhein vom 8.7.1937. In: Jahnke (Hg.), Eine Dokumentation, S. 136– 138, hier 137.
Schulung und Antisemitismus
207
Maße diese Materialien im Alltag der Einheiten genutzt wurden, blieb aber der Entscheidung der Jugendlichen überlassen. Um die Heimabende professionell zu begleiten, hatte die RJF 1934 eine Radiosendung gestartet: die „Stunde der jungen Nation“ – der Versuch, das jugendliche Selbstführungsprinzip mit offiziellen Schulungsplänen zu koppeln. Motivierend sollte wirken, dass Jugendliche auf die Sendung Einfluss nehmen konnten. Der Erfolg war aber begrenzt. Die HJ-Einheiten besaßen nur selten Radioempfänger; eine Aktion zur Beschaffung, die im Mai 1935 anlief, mündete in immerhin rund 35 000 Geräten bis 1938. Ob die Unterführerinnen und Unterführer die Sendungen anhörten, ließ sich aber nur bedingt kontrollieren.378 Im Januar 1937 schuf die RJF eine gesonderte Abteilung zur Inspektion. Deren Aufgabe war die Überwachung des Schulungswesens sowie der Heimabendgestaltung.379 Ein 18-jähriger Gefolgschaftsführer aus dem süddeutschen Raum berichtete der Exil-SPD im Sommer 1937 über seine Beobachtungen. Der junge Mann stammte aus der Arbeiterbewegung. Er präsentierte sich als jemand, der in der Hitlerjugend – wie gezeigt, das war durchaus kein Einzelfall – im Chaos der Gleichschaltung Unterschlupf gefunden hatte. Einheiten mit rund 150 Jungen habe er mittlerweile unter sich. Es gebe die Streber einerseits sowie Unwillige und Drückeberger andererseits. Die Masse dazwischen nehme alles bereitwillig hin: „In der nationalpolitischen Stunde sind sie ohne Kritik […] und lassen sich einreden, dass die Juden an allem Unglück der Welt Schuld sind. Aus ihnen entwickelt sich das Material, das der Nationalsozialismus für die Erhaltung seines Staates sucht. Jedoch habe ich den Eindruck, dass diese Jugend mit der gleichen Selbstverständlichkeit die Lehrmeinungen des Bolschewismus in sich aufnehmen würde, wenn […] die Roten in Deutschland an der Macht wären. In der nationalpolitischen Stunde hat es seit 7 Monaten keine Diskussion über irgendeinen Punkt gegeben.“380 Er gab zu bedenken, vielleicht gebe es weitere, die anders seien, die sich aber bewusst zurückhielten, „weil ich ja in meiner Stellung […] ihnen besonders gefährlich erscheinen muss“.381 Indoktrination außerhalb von Lagern und Schulungseinrichtungen folgte im Alltag nicht immer einer einheitlichen, von oben vorgegebenen Linie. Es gab Unterschiede je nach Formation; abhängig davon, unter wem und mit wem junge Menschen Dienst taten. In Kreisen des höheren Führerkorps war zudem selten eindeutig umrissen worden, mit welchen Mitteln die „Judenfrage“ konkret thematisiert werden sollte. Anhand von Beispielen lässt sich zeigen, dass die gesamte „rassenpolitische“ Schulung der Hitlerjugend
378 Vgl. Umfragebogen des Deutschen Gemeindetags zur Rundfunkbeschaffungsaktion der HJ vom 20.4.1936 (StadtA Weimar, 16, 100-06, 5, unpag.). Zur Mitwirkung von Einheiten im HJ-Funk vgl. die Rubriken „Rundfunk“ in den GB. Vgl. auch Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 122 f. 379 Inspektion. In: GB: Mittelelbe, 1/3 vom 16.1.1937. 380 Bericht eines Gefolgschaftsführers, A 83–A 86. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 4 (1937), S. 842–845, hier 844. 381 Ebd.
208
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
weniger ausschließlich von Dienststellen dirigiert wurde als vielmehr einer Eigendynamik unterlag. Sie folgte divergierenden lokalen Realitäten. 2.3
Vorgaben und Wirklichkeit an der Basis
Ein Beispiel für die Frage nach der antisemitischen Durchdringung der Hitlerjugend ist „Der Stürmer“, das berüchtigte Hetzblatt des mittelfränkischen Gauleiters Julius Streichers. In der Hitlerjugend war es nicht überall zugelassen. Die BDM-Führerin Jutta Rüdiger hat später behauptet, 1933 habe Reichsjugendführer Schirach die Lektüre für die Jugendorganisation umgehend verboten. „Das Judenproblem“, so Rüdiger lapidar, „war in der HJ keine Frage und kein Gesprächsthema; es wurde keine Judenhetze betrieben. Schirach hat z. B. das Lesen des ‚Stürmer‘ für die Hitlerjugend verboten.“382 Von pathologischen Bemühungen um eine Rehabilitierung der Hitlerjugend-Erziehung getrieben, blieb sie einen Beleg schuldig. Die Geschichtswissenschaft wies ihre Behauptung umgehend als Märchen zurück; was geboten war, weil Schirach zu jenen gehörte, die eine Ausgabe der Zeitschrift – im Jahr der Pogrome 1938 – mit einer Grußadresse versahen. Verdienst des Hetzblattes sei es, schrieb Schirach, „in volkstümlicher Form über die jüdische Weltgefahr aufgeklärt“ zu haben.383 Tatsächlich hatten weder Schirach noch die RJF zum Umgang mit dem antisemitischen Hetzblatt in der Hitlerjugend je eine eindeutige Weisung gegeben. Wie mit dem „Stürmer“ umgegangen wurde, konnte sich je nach Region stark unterscheiden. Ein undatiertes Foto aus der ostfriesischen Kleinstadt Wittmund zeigt die lokale Hitlerjugend – dort wurde sie vergleichsweise spät, erst Anfang 1934 aufgebaut – mit den Führern der NSDAP-Ortsgruppe. Man posiert gemeinsam vor großen „Stürmer“-Schaukästen, hält einige Ausgaben des Hetzblatts dem Fotografen demonstrativ entgegen.384 Solche Bilder haben nicht nur ikonografische Bedeutung. Ein pauschales Verbot, wie sie Rüdiger anführte, hatte es nicht gegeben. Im Gegenteil: Das Hetzblatt wurde sogar durch „Pimpfe“ verkauft sowie in Zeltlagern der Hitlerjugend prominent platziert, wovon ein Propagandatext aus dem Rheinland vom September 1935 zeugt: „In ein richtiges Zeltlager gehört auch ein Stürmerkasten. Ganz klar! […] Er versteht sich ganz besonders gut auf die Judenfrage.“385 Eine HJ-Einheit in Köln hängte den
382 Zit. aus den Interview-Aufzeichnungen von Martin Klaus mit Jutta Rüdiger, April 1980/ Februar 1981. In: Jutta Rüdiger, Der Bund deutscher Mädel. BDM. Eine Richtigstellung, Lindhorst 1984, S. 64–86, hier 82. 383 Der Reichsjugendführer Baldur von Schirach schreibt. In: Der Stürmer, Nr. 10 vom 3.1938. 384 Vgl. Johannes Mennen, Hitlerjugend in Wittmund 1933–1939, Wittmund 2000, S. 9. 385 Der Stürmerkasten im Zeltlager. In: Die Fanfare. Hitlerjugend-Zeitung für das Gebiet Westmark, (1935) 9, S. 5. Vgl. auch Lagebericht der Gestapostelle Köln für Februar 1935 vom 4.2.1935. In: Faust/Rusinek/Dietz (Hg.), Lageberichte rheinischer Gestapos-
Schulung und Antisemitismus
209
„Stürmer“ auf ihrer öffentlichen Tafel aus. Der junge Einheitenführer schrieb der Redaktion, dass es ihm eine Freude sei, „den Parasit am deutschen Volke zu bekämpfen“.386 Zugleich war die Zeitschrift aber umstritten, sogar manchem Parteigenossen peinlich. Die reißerischen Karikaturen stießen in den Dienststellen auf ein geteiltes Echo – insofern entbehrte Rüdigers Rückblende nicht völlig der Grundlage. Zur rassenpolitischen Erziehung schien das Blatt nicht allen geeignet. Die grotesken Fratzen jagten Kindern manchmal Angst ein, und auch Teile der Bevölkerung sahen die Zeitschrift mit Vorbehalten. „Als ich einmal auf solch einen Kasten [mit dem ,Stürmer‘] schaute, was da für Bilder hingen, zog mich meine Mutter entsetzt weg“, berichtete beispielsweise der spätere Verleger Kasimir Katz.387 Derlei Bedenken der Eltern musste die Hitlerjugend noch weit mehr als andere NSDAP-Gliederungen berücksichtigen. Für Thüringen ist dies auf erstaunliche Weise belegbar. Dort nämlich untersagte man die Nutzung des Blattes im Herbst 1935, während man es im Rheinland zur gleichen Zeit für die Zeltlager nutzte.388 Statt des zur Erziehung „untauglichen“ Blattes sei, wenn man sich über solche „Fragen“ informieren wolle, das HJ-Schrifttum zu verwenden, lautete die Anweisung der Thüringer Gebietsführung. Dieses „Stürmer“-Verbot, das – soweit anhand der Befehlsblätter feststellbar – nie zurückgenommen wurde, war möglicherweise kein Ausnahmefall; die lückenhafte Überlieferung erschwert aber den Nachweis für andere Regionen. So entstand die paradoxe Situation, dass Kinder in einem Teil Deutschlands an „Stürmerkästen“ bastelten, die man im Zeltlager platzieren wollte, während anderswo das Lesen derselben Hetzschrift untersagt wurde. Das zeigt, wie heterogen die Organisation agierte und wie unterschiedlich Ideologievermittlung in der Praxis aussah. Wie ist das Verbot in der Thüringer Hitlerjugend zu bewerten? Es stellt sich die Frage, ob es wirkte. Durch die Werbe- und Schaukästen war das Hetzblatt vielerorts für Heranwachsende problemlos greifbar. Vor Parteizentralen, Arbeitsämtern oder Rathäusern lag es aus. In Thüringen waren Schaukästen u. a. in Mühlhausen,
tellen, Band II/1, S. 76–99, hier 95: „Für den Verkauf der Jugendzeitung ‚Die Fanfare‘ hat man durchaus Verständnis, nicht aber dafür, dass ‚Der Stürmer‘ ebenfalls von kleinsten Pimpfen kolportiert wird.“ 386 Hitlerjugend in der Front. In: Der Stürmer, Nr. 28 vom 7.1935. 387 Casimir Katz, Jeder sah es anders. Erinnerungen an meine Kindheit und Jugend im Dritten Reich, Gernsbach 2000, S. 37. 388 Vgl. „Stürmer“. In: GB: Thüringen, 11/35 vom 10.10.1935: „In den Heimabenden […] ist die Benutzung der Wochenschrift ‚Der Stürmer‘, Erscheinungsort Nürnberg, nicht gestattet, da die Abfassung mancher Artikel zur Schulung für die Jugend nicht geeignet ist. Wer über aktuelle Fragen auf diesem Gebiet unterrichtet sein will, der benutze unsere HJ-Zeitschriften.“ Die bei Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 72 vorgelegte Einschätzung, es handele sich bloß um eine Legende, dass der „Stürmer“ in der HJ nicht gelesen werden sollte – es sei „in den überlieferten Unterlagen nicht nachweisbar“ – ist als unzutreffend anzusehen.
210
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Weimar und Römhild demonstrativ nahe den Geschäften jüdischer Bürger angebracht worden.389 Typischerweise heißt es in Erinnerungsberichten, man sei daran vorbeigegangen, habe dem Blatt kaum Beachtung geschenkt. Allgemeingültig sind solche Rückblenden aber nicht. „Viele Kinder“, bilanzierte Daniel Roos, der die Geschichte des „Stürmers“ durchleuchtete, „unternahmen an den großen Überschriften und den fett gedruckten Bildertexten […] ihre ersten Leseversuche.“390 Es kam vor, dass Hitlerjungen das Blatt öffentlich verteilten, was zu Beschwerden aus der Bevölkerung führen konnte. Provokativ gingen Hitlerjungen im bayerischen Penzberg im Mai 1935 vor. Dort reichten sie auf dem Marktplatz Exemplare herum, um gegen die jüdischen Händler vor Ort Stimmung zu schüren.391 Einzelne Formationen hatten das Blatt sogar in ihrem HJ-Schaukasten ausgestellt – was dem Ziel der RJF zuwiderlief, nur „alles Positive und propagandistisch Wertvolle der Öffentlichkeit zu zeigen“.392 Nicht zuletzt der Leserbrief eines Hamburger BDM-Mädchens, das 1935 der Redaktion berichtete, in ihrer Oberrealschule würden „viele deutsche Mädel mit diesen Jüdinnen eng befreundet“ sein, zeugt von der Verbreitung des Blattes in Teilen der Hitlerjugend: „Ich halte solche Freundschaften für sehr gefährlich“, heißt es im Brief der jungen BDM-Führerin, „denn die Jüdinnen zersetzen […] unmerklich, aber sicher die Seele des Mädchens.“393 Häufig wird das Hetzblatt in den Berichten jener Zeitzeugen thematisiert, die aus der Hitlerjugend ausgestoßen worden waren oder in illegalen Gruppen und sogenannten Cliquen tätig wurden. Während des Krieges entlud sich in Großstädten an „Stürmer“-Auslagen immer öfter ein Widerstand im Kleinformat. Ein früherer „Edelweißpirat“ aus dem Rheinland berichtete von nächtlichen Spaziergängen, die um 1943 immer mal wieder vor Schaukästen endeten. Bewaffnet, etwas verwahrlost sei die Jugendopposition damals gewesen. Ein Freund, der später von der Gestapo verhaftet worden sei, habe sich bei diesen Spaziergängen mit seinem Totschläger als besonders mutig erwiesen: „Bei unseren nächtlichen Streifen durch unsere Heimatstadt schlug er damit gerne die Schaukästen […] ein, in denen meist der ‚Stürmer‘ […] ausgehängt war. Da wir Angst hatten, darauf zu schießen, andererseits aber noch ein Zeichen hinterlassen wollten, wurde dann noch kräftig
389 Vgl. Carsten Liesenberg, „Wir täuschen uns nicht über die Schwere der Zeit …“. Verfolgung und Vernichtung der Juden. In: Detlev Heiden/Gunther Mai (Hg.), Nationalsozialismus in Thüringen, Weimar 1995, S. 443–462. 390 Daniel Roos, Julius Streicher und „Der Stürmer“ 1923–1945, Würzburg 2013, S. 443. 391 Vgl. Klönne, Jugendprotest und Jugendopposition, S. 542. Vgl. auch beispielhaften Lagebericht für Januar 1935 der Staatspolizeistelle Aachen. In: Vollmer, Volksopposition im Polizeistaat, S. 151–164, hier 159: „Insbesondere bringt man [aus der Bevölkerung] vor, dass der ‚Stürmer‘ häufig an die niedrigsten Instinkte der Menschen appelliere und durch seinen häufigen öffentlichen Aushang eine Gefahr für die Jugend bilde.“ 392 Zit. aus Anweisungen zur Veröffentlichung von Dienstbefehlen in der Presse/im Schaukasten. In: GB: Thüringen, A2/37 vom 31.1.1937. 393 Brief eines BDM Mädel aus Hamburg. In: Der Stürmer, Nr. 17 vom 4.1935. Weitere Beispiele bei Fred Hahn, Lieber Stürmer! Leserbriefe an das NS-Kampfblatt 1924 bis 1945. Eine Dokumentation aus dem Leo-Baeck-Institut New York, Stuttgart 1978.
Schulung und Antisemitismus
211
hineingespuckt.“394 Der „Stürmer“ fand unter Jugendlichen ebenso wie bei Eltern nicht nur Leser und Fürsprecher, sondern auch Kritiker und Gegner. Weisungen, die auf Verhinderung des Blattes zielten, wie es sie in Thüringen gab, blieben aber im Zweifelsfall Papiertiger. Wenn ein Verbot für die Hitlerjugend ausgesprochen wurde, hieß das nicht unbedingt, dass Einheiten es beachteten. In diesen Zusammenhang gehört auch, dass die RJF zwei Gesangsbücher mit Liedern aus dem Verkehr zog, die kaum anders als Mordaufrufe zu verstehen waren. Eines der beiden Kompendien – „Blut und Ehre“, das zunächst als Teil des HJ-Liedguts galt – hatte Schirach 1933 selbst herausgeben. Es enthielt u. a. die Zeile „Juda den Tod“, die zu einem frühen SA-Kampflied gehörte. Auch diverse andere Lieder mit antisemitischen – bei gleichzeitig häufig kirchenfeindlichen – Inhalten boten in der katholischen Geistlichkeit immer wieder Anlass zur Kritik. Ein Pfarrer aus Baden zitierte aus Schirachs Liedersammlung bei einer Predigt 1935 und zog den Unmut der Überwachungsorgane auf sich.395 Zwei Jahre später wurde das umstrittene Buch in der Hitlerjugend verboten und sollte aussortiert werden.396 Für eine amtliche Liedersammlung, die man ab 1939 publizierte, hatte das Kulturamt der RJF auf den Abdruck vulgärster Texte verzichtet. Und in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts waren sie aus den verbreiteten Liederblättern ebenfalls verschwunden. Im gleichen Zuge wurde den Formationen verboten, eigene Liedsammlungen zu veröffentlichen. Verse, die auf antisemitische Verschwörungsszenarien Bezug nahmen, blieben zwar in Schriften erhalten – gerade das „Wiener Jungarbeiterlied“, das aus der HJ Ö sterreichs von 1926 stammte; in der letzten Zeile kündete es von „Judas Thron“, der ins Wanken geriet.397 Aber das „kleine Nazi-Liederbuch“, das mehrere judenfeindliche Spottlieder enthalten und vor 1933 mehrere Auflagen erlebt hatte, vertrieb man nach 1933 ebenfalls nicht weiter.398 Die RJF betrieb nach der „Machtergreifung“ dem Anschein nach eine Bereinigung ihres kulturellen Unterbaus; gleichzeitig förderte man mittels Musik- und
394 Bericht von Hans K. Kötting, Oberamtsrat im Auswärtigen Dienst a. D., vom 2.7.1990, S. 5 (Archiv des IfZ München, 2492, Bd. 1). 395 Vgl. Dokumente unter 3740-PS. In: International Military Tribunal (Hg.), Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, Band XXXIII: Documents and other Material in Evidence. Numbers 3729-PS to 3993-PS, Nürnberg 1949, S. 55–63, hier 61. 396 Vgl. etwa Anordnung: Liederbuch „Blut und Ehre“. In: GB: Berlin, A18/37 vom 1.12.1937: „Falls irgendeine Einheit noch im Besitz des Buches sein sollte, so ist es sofort zu entfernen.“ Vgl. zum Komplex Heinz Schreckenberg, Erziehung, Lebenswelt und Kriegseinsatz der deutschen Jugend unter Hitler. Anmerkungen zur Literatur, Münster 2001, S. 260 f. 397 Reichsjugendführung (Hg.), Unser Liederbuch. Lieder der Hitler-Jugend, 2. Auflage, Berlin 1939. Vgl. auch die erhaltene Liederblatt-Sammlung, hg. vom Kulturamt der RJF, in der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) Leipzig. 398 Von Paul Arendt (Hg.), Deutschland erwache! Das kleine Nazi-Liederbuch, existieren mehrere Varianten und Ausgaben. Die erste Auflage erschien mutmaßlich Ende der 1920er-Jahre; es enthielt – neben üblichen Kampfliedern – ein vulgäres antisemitisches
212
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
ultureinheiten – durch Einverleibung von Orchestern oder Musikschulen K und in Zusammenarbeit mit dem Rundfunk – ein geschultes Musikwesen, mit dem man in der Bevölkerung für die Partei warb.399 In Weimar versuchte die Thüringer Gebietsführung in Kooperation mit Gauleitung und Volksbildungsministerium eine eigene HJ-Musikschule zu etablieren, um an der dortigen Staatlichen Hochschule für Musik alle 10- bis 18-Jährigen zusammenfassen und sie für die Hitlerjugend einspannen zu können.400 Auf der Suche nach geeignetem Liedgut erwiesen sich die Verantwortlichen zunächst selbst nicht immer als kundig: Das Obergebiet West gab 1933 ein Kompendium heraus, das ein Lied von Hugo Zuckermann enthielt, einem österreichischen Juden – worauf die Auslandspresse süffisant hinwies.401 Die Streichung von allzu vulgär-antisemitischen Texten nach 1933 ist, um das zu betonen, auf opportunistische Erwägungen zurückzuführen. Die Besserung ihrer Reputation war das Ziel der Parteijugend, indem sie sich der aggressivsten und besonders gewaltverherrlichenden antisemitischer Texte entledigte. Dass dies wenig über die Praxis vor Ort aussagt, haben Studien über den Kindheitsalltag im „Dritten Reich“ aufzeigen können.402 Die kulturellen Vorgaben beeinflussten die soziale Wirklichkeit nur begrenzt. Gesungen wurden antisemitische Lieder weiterhin; unabhängig davon, ob sie aus dem Kanon getilgt oder umgeschrieben worden waren. Vulgäre Spottlieder gehörten oft zum lokalen Gemeingut, obgleich sie in den offiziellen Gesangsbüchern nicht zu finden sind. Bleibt zu erwähnen, dass das Liedgut aus der Jugendbewegung oder NS-Kampflieder, die mit Pathos Heimat und Volkstum beschworen, in manchen Situationen eine rassistische Konnotation erhielten – so bei antisemitischen Boykottaktionen.403 Es kam darauf an, wer die Einheiten führte, den Alltag der Kinder gestaltete, Anweisungen erteilte oder Ideologie vermittel-
Spottlied angeblich eines Mitglieds des NS-Schülerbunds. In der HJ wurden weder Buch noch Lied nach 1933 offiziell beworben. 399 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 168 f.; sowie die kritische Rezension des Werks von Dagmar Reese in: Birthe Kundrus/Beate Meyer (Hg.), Die Deportation der Juden aus Deutschland. Pläne – Praxis – Reaktionen 1938–1945, 2. Auflage, Göttingen 2005, S. 224–227, die herausstellt, die RJF habe sich musikalische Institutionen einverleibt, auf musikpädagogische Vorarbeiten anderer zurückgegriffen, aber ein eigenes musikalisches Profil kaum ausgebildet. 400 Vgl. Entwurf zum Aufbau der „HJ-Musikschule an der Staatlichen Hochschule für Musik“ in Weimar, o. D. (StadtA Weimar, 16, 100-06, 5, unpag.). 401 Vgl. Nazis singen Zuckermann-Lieder. In: Gerechtigkeit, (1934) 39, S. 2. 402 Vgl. beispielsweise Heinz Schreckenberg, Der Antisemitismus der Hitlerjugendführer und die „Endlösung der Judenfrage in Europa“. In: Folker Siegert (Hg.), Grenzgänge. Menschen und Schicksale zwischen jüdischer, christlicher und deutscher Identität. Festschrift für Diethard Aschoff, Münster 2002, S. 270–306, hier 277–283. 403 Zum gesamten Themenkomplex Liedgut und Singen vgl. ausführlich Karin Stoverock, Musik in der Hitlerjugend. Organisation, Entwicklung, Kontexte, 2 Bände, Uelvesbüll 2013. Mehrere Erinnerungsberichte über antisemitische Lieder finden sich abgedruckt bei Norbert Jänecke/Rolf Potthoff (Hg.), 1933 – Das Ruhrgebiet unterm Hakenkreuz. Erinnerungen, Essen 2008, S. 27–45.
Schulung und Antisemitismus
213
te. Das Umfeld entschied damit maßgeblich, welche Lieder Kinder sangen und wie sie diese Verse deuteten. Zwei Lieder, die auch in der Erinnerungsliteratur häufiger zur Sprache kommen, sind speziell zu erwähnen. Der Geistlichkeit dienten diese Liedtexte zu Recht als Beleg für die infamen, gefährlichen und inhumanen Erziehungsmethoden, auf denen die Jugendorganisation fußte. Das berüchtigte „Lied vom Sturmsoldaten“ – dessen letzte Zeile von spritzendem „Judenblut“ an Messern handelte – war eine in rechtsextremen Kreisen und Freikorps nach 1918 verbreitete Variante des noch älteren „Heckerlieds“, das aus der Epoche des Vormärz stammte. Ein katholischer Pfarrer wies im Herbst 1934 auf die Verbreitung dieses Lieds auch bei der Hitlerjugend hin. Das Lied zeige, wie man dort den Hass gegen die Juden in die Herzen der Jüngsten pflanze.404 Ein anderes Lied, das Schulkinder sangen, beinhaltete eine Stelle über die biblische Geschichte der Juden, die auf ihrem Exodus aus Ägypten durch das Rote Meer ziehen. Nicht das ägyptische Verfolgerheer, sondern die fliehenden Juden werden darin von einbrechenden Wellen erschlagen. Unter allen antisemitischen Liedern war es wohl das bekannteste. „Das gehörte so dazu, das hat man einfach mitgesungen. Sicherlich haben wir dieses Lied nicht aufgrund einer bewussten antisemitischen Überzeugung gesungen“, meinte Arno Klönne, „aber wir hatten auch keine innere Abwehr dagegen.“405 Die meisten der Erinnerungsberichte ähneln einander: Man habe über die antisemitischen Verse nicht nachgedacht oder den Inhalt nicht verstanden. Tatsächlich darf man annehmen, dass sie ihre perfide Wirkung im Unterbewussten entfalteten.406 Wiederum andere Zeitzeugen beharrten aber darauf, dass sie solche Lieder nie gelernt hätten. Als unglaubwürdig sollte man auch diese Schilderungen nicht abqualifizieren. „Antisemitismus spielte im Jungmädelbund kaum eine Rolle“, glaubte Eva Sternheim-Peters. Aus ihrer Kindheit waren ihr derlei Liedtexte angeblich nicht geläufig. Überrascht stellte sie fest, als sie sich später auf Suche begab, dass man den Judenhass in den offiziellen Liedsammlungen selten oder auch gar nicht fand – „vielleicht allerdings nur deshalb nicht, weil er sich von selbst verstand“.407 Der Antisemitismus gehörte zum Ideologiegerüst der Hitlerjugend genauso wie die Ausgrenzung der Juden die rassistische „Volksgemeinschaft“ insgesamt konstituierte. Aber der Alltag kannte Ausnahmen von der Regel ebenso wie Lücken, die den Gestaltungsspielraum Einzelner und
404 Vgl. Bericht der Gendarmerie Bad Neustadt vom 24.10.1934. In: Kulka/Jäckel (Hg.), Die Juden in den geheimen NS-Stimmungsberichten, S. 90. Vgl. Michael Kohlstruck/ Simone Scheffler, Das „Heckerlied“ und seine antisemitische Variante. Zu Geschichte und Bedeutungswandel eines Liedes. In: Michael Kohlstruck/Andreas Klärner (Hg.), Ausschluss und Feindschaft. Studien zu Antisemitismus und Rechtsextremismus. Festschrift für Rainer Erb, Berlin 2011, S. 135–158. 405 Zit. nach Gehling/Gehling/Hofmann/Nickel/Rüther (Hg.), Paderborner Zeitzeugen berichten, S. 36. 406 Vgl. Rosenbaum, Kinderalltag im Nationalsozialismus, S. 170 f. 407 Eva Sternheim-Peters, Die Zeit der großen Täuschungen. Eine Jugend im Nationalsozialismus, Bielefeld 1992, S. 122.
214
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
selbst junger Menschen in der Diktatur aufzeigen. Umso deutlicher tritt deshalb die individuelle Verantwortung hervor. Manche Jugendliche und Jugendführer gingen in ihrer Aneignung von Ideologie und Rassismus sogar weit über das hinaus, was die RJF vorgegeben hatte oder für zulässig erachtete. Um eine moderate Haltung der Organisation belegen zu wollen, wie es Apologeten versuchen, taugen Beispiele wie das – vielleicht nur zeitweilige – „Stürmer“-Verbot in Thüringen oder Versuche der RJF, vulgär-antisemitische Lieder aus der Hitlerjugend zu verbannen, keineswegs. Es ging den Funktionären allein um ihr Ansehen, gerade in Hinblick auf Elternhäuser oder katholisch gefestigte Regionen, wo die Vorbehalte gegenüber der Staatsjugend in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts durchaus noch immer verbreitet waren; um ein Ansehen, das Schiffbruch litt, wenn junge Menschen sich als Aufwiegler hervortaten: „Für unerwünscht halte ich auch die Art und Weise, in der sich Kinder an der antisemitischen Propaganda beteiligten“, meinte beispielsweise das Regierungspräsidium von Trier im Frühjahr 1935. Man befürchtete eine Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch das aggressive Auftreten von Teilen der Hitlerjugend.408 Die antisemitische Politik stand allerdings nie grundsätzlich infrage.
3.
Die Hitlerjugend und die Judenverfolgung
3.1
Antisemitische Praxis
Der Antisemitismus hatte für die Hitlerjugend konstituierenden Charakter. Junge Menschen, die nach nationalsozialistischer Auffassung nicht „arisch“ waren, blieb die Parteijugend von Anfang an verschlossen, obgleich viele durchaus eintreten wollten. Paul Wolff, 1929 in Hamburg geboren, blickte Jahrzehnte später zurück: „Ich war neun Jahre alt. Ich erinnere mich, wütend gewesen zu sein auf meinen Vater, weil der mir nicht erlaubte, in die Hitlerjugend zu gehen, die Ausflüge machte und Zeltlager ähnlich den Pfadfindern. Natürlich hätten sie mich als Juden sowieso nicht genommen.“409 Thea Wolffsohn schilderte, dass Jungmädel und BDM attraktiv gewesen seien. Der im Juni 1934 eingeführte Staatsjugendtag habe die Möglichkeit für schulfreie Zeit geboten, was jüdische Kinder natürlich gern genutzt hätten. Die Hitlerjugend mit ihren Liedern oder Uniformen sei nicht ungewöhnlich oder beängstigend gewesen: „Machen wir uns nichts vor: Auch Nichtnazikinder, auch wir Juden, fanden die Aktivitäten
408 Bericht des Regierungspräsidenten Trier für April und Mai 1935 vom 6.6.1935. In: Kulka/Jäckel (Hg.), Die Juden in den geheimen NS-Stimmungsberichten, S. 139. Vgl. Frank Bajohr, Die Deutschen und die Judenverfolgung im Spiegel von Geheimberichten. In: Rainer Hering (Hg.), Die „Reichskristallnacht“ in Schleswig-Holstein. Der Novemberpogrom im historischen Kontext, Hamburg 2016, S. 191–212, hier 196. 409 Interview mit Paul Mark John Wolff, frei aus dem Englischen übersetzt, Transkript, S. 3 (USHHM, Oral History Collection, RG-50.030.0599).
Die Hitlerjugend und die Judenverfolgung
215
von BDM und HJ faszinierend. […] Ich erlebte nur Mitläufer. Und wenn Hitler & Co. die Juden nicht verfolgt hätten, wären ihnen die meisten von uns gefolgt.“410 Für die Parteijugend galten die Regularien der NSDAP. Nur derjenige konnte Mitglied der Hitlerjugend werden, dem „Vorfahren farbigen oder jüdischen Blutes nicht nachzuweisen“ waren. Die höheren Dienststellen wiesen die Unterführer auf diese Richtlinien beharrlich hin. Sie betonten, im Zweifelsfall müsse die „Forschung der Ahnenreihe bis zu den Vorfahren durchgeführt werden, die ab 1.1.1800 gelebt haben“.411 Ab November 1938 waren bei Eheschließungen von Unterführern die „Deutschblütigkeit“ des Partners nachzuweisen sowie die Genehmigung der Personalabteilung einzuholen; die Genehmigungspflicht wurde 1940 wieder zurückgenommen, um die HJ-Bürokratie zu entlasten.412 Das alles war für die wenigsten leicht zu leisten. Im Sommer 1936 hatte die RJF die Abstammungsdefinition für die Mitglieder der Jugendorganisation beiderlei Geschlechts festgeschrieben.413 Erschwerend kam hinzu, dass – ab dem Rang des HJ-Gefolgschafts- bzw. DJ-Fähnleinführers – seit dem 1. Oktober 1937 ein Ariernachweis, also von Zehntausenden, die diese mittlere Stellung erlangt hatten, vorgelegt werden musste. Man stellte Ahnentafeln bereit, die den Abstammungsnachweis erleichtern sollten. Zwingend war der Ahnenpass, der amtlich beglaubigt sein musste.414 Für die Nachweise mussten Dokumente aus den Pfarr- und Standesämtern eingeholt werden. Jugendliche waren zum Teil heillos überfordert. „Bei der Durchsicht aller Beförderungsanträge“, lautete es aus der Gebietsführung Westfalen Ende 1938, „musste ich feststellen, dass der größte Teil unbearbeitet gelassen werden musste, da die primitivsten Voraussetzungen nicht erfüllt waren.“ Bedenklich sei, dass „fast für alle zur Beförderung vorgeschlagenen Führer der Nachweis der arischen Abstammung fehlte“. Man wisse um die Tatsache, wie schwer die Beschaffung sei, auch dass die Erstellung erhebliche Zeit in Anspruch nehme; deshalb solle jeder Jugendliche, der eine
410 Zit. nach Michael Wolffsohn, Deutschjüdische Glückskinder. Eine Weltgeschichte meiner Familie, München 2016, S. 79. 411 Zit. aus Arierbestimmung für die Hitler-Jugend. In: GB: Franken, IV/1 vom 1.1.1936. 412 Vgl. beispielsweise Ausführungsbestimmungen der Verlobungs- und Heiratsgenehmigungen. In: GB: Düsseldorf, A2/39 vom 8.2.1939; Heiratsgenehmigungen. In: GB: Nordsee, A3/39 vom 18.3.1939. 413 Vgl. Nachweis der arischen Abstammung mit Durchführungsbestimmungen. In: GB: Westfalen, 4/36 vom 1.9.1936; VOBl. RJF IV/7 vom 31.7.1936, über die Aufnahme von Mischlingen in die Stamm-HJ, abgedruckt in: Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 3: Mitgliedschaft, S. 195; Durchführungsbestimmungen des Personalamtes der RJF zum Arier-Nachweis für die HJ-Führerschaft. In: ebd., IV/16 vom 17.7.1936. Zur Rücknahme der Genehmigungspflicht siehe Heiratsgenehmigungen. In: GB: Nordsee, A1/40K vom 1.3.1940. 414 Vgl. Arischer Nachweis bei Beförderungen. In: GB: Franken, 1/38 vom 2.1938; Nachweis der arischen Abstammung. In: GB: Hessen-Nassau, A9/37 vom 10.8.1937. Zunächst hatte gegolten, dass der „Ariernachweis“ nur von Mitarbeitern des Gebietsstabes sowie von Jungbann- und Bannführern sowie deren Stellvertretern zu erbringen war. Vgl. Nachweis der arischen Abstammung. In: GB: Kurmark A6/37 vom 12.4.1937.
216
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Führerstellung anstrebe, frühzeitig an die Arbeit gehen.415 Waren die Tafeln und Pässe eingegangen, fielen – so die Gebietsführung Franken –„stets die gleichen Mängel auf, deren Ursache in der Unkenntnis der bestehenden Anordnungen zu suchen“ sei. Gründe wurden angeführt, warum die Nachforschungen nicht möglich oder nicht erfolgreich waren. Urkunden fehlten häufig. Die Beschaffung, meinte man im Führerkorps, sei aber von den Jugendlichen „in vielen Fällen […] nicht mit dem nötigen Nachdruck betrieben“ worden.416 In dieser Situation und unmittelbar nach der „Machtergreifung“ kam es vor, dass Kinder und Jugendliche, die als Juden oder „Mischlinge“ galten, der Parteijugend angehörten. Anlässlich der Neuaufnahme des Geburtsjahrgangs 1927 in das DJ mahnte das mittlere Führerkorps, es dürften Kindern, deren reine „arische Abstammung“ nicht feststehe, keine falschen Versprechungen gemacht werden.417 In letzter Zeit, hieß es in Sachsen, würden sich Anfragen häufen, ob „Jungen und Mädel, deren arische Abstammung in irgendeiner Weise in Zweifel“ stehe, dennoch „aufgenommen werden können“.418 Einige gingen gezielt hinein. Deren Motive liegen meist im Dunklen. Sie wurden ausgeschlossen, sobald ihre Herkunft entdeckt wurde. In Berlin wurden im Herbst 1934 insgesamt 66 HJ-Angehörige aus der Parteijugend geworfen – die meisten wegen kleinkrimineller Delikte, aber bei einem Brüderpaar war vermerkt: „Nichtarier“.419 Zwei Monate später gab man in Berlin den Ausschluss eines „Volljuden“ bekannt.420 Die Gebietsführung von Brandenburg bestand 1936 auf die Einhaltung des Dienstweges. Es kam vor, dass Kinder und Jugendliche, die von ihrer „nichtarischen Abstammung“ erfuhren, „von Formationsführern einfach ausgeschlossen“ wurden. Doch über „Ausschlüsse, gleich welcher Art“ habe nur die RJF zu entscheiden.421 Fast zeitgleich verkündete die Personalabteilung, man habe die Mitgliedschaft eines Jugendlichen für nichtig erklärt – Grund: „Halbjude“.422 Wolf-Herrmann Eckhold aus Dresden erinnerte sich an einen Fall: „Zuerst war bei uns auch noch ein Halbjude als Angehöriger eingebunden. Er musste später jedoch die Hitlerjugend verlassen. Heimlich hieß es dann manchmal: hat
415 Arischer Nachweis. In: GB: Westfalen, A19/38 vom 1.12.1938. 416 Nachweis der arischen Abstammung für HJ-Führer. In: GB: Franken, 3/38 vom 4.1938. 417 Arische Abstammung. In: GB: Thüringen, A 8/37 vom 15.5.1937; selbiger Wortlaut in GB: Nordsee, A10/37 vom 23.6.1937. 418 Aufnahme in die HJ. In: GB: Sachsen, 7/36 vom 29.8.1936. 419 Ausschlüsse, Gebiet Berlin. In: BB: Berlin, 55/34 vom 14.9.1934. 420 Vgl. Ausschlüsse, Gebiet Berlin. In: ebd., 62/34 vom 2.11.1934. 421 Ausschlüsse. In: BB: Kurmark, 5/36 vom 7.3.1936. 422 Nichtigkeitserklärung. In: GB: Kurmark, 12/36 vom 24.6.1936. Eine solche „Nichtigkeitserklärung“ traf immer in solchen Fällen zu, in denen der Betroffene zwar schon über eine Mitgliedsnummer, aber noch nicht über einen HJ-Reichsausweis verfügte; deren Anteil war bis Ende der 1930er-Jahre erstaunlich hoch. Solche „Nichtigkeitserklärungen“ konnten durch die Personalabteilung des Gebietes, nicht nur durch die RJF erfolgen; vgl. auch Austritt. In: ebd.
Die Hitlerjugend und die Judenverfolgung
217
der es gut.“423 Auch Lebensberichte Betroffener liegen vor. Gerhard Langer, der mit seiner Familie im August 1939 in die USA emigrierte, ist ein Beispiel. 1934 war er an der Seite von Schulfreunden zum Jungvolk in Jena gestoßen. Seine Rückblende auf seine Hitlerjugendzeit ist in mehrerer Hinsicht hoch spannend. Mit Politik und Weltanschauung, wie er Jahrzehnte später meinte, sei er in der Jugendorganisation kaum in Berührung gekommen. Alltag und Ideologie klafften auseinander, Disziplin sei bloß eine hohle Phrase der Führerschaft gewesen. Unter der strengen Aufsicht von Erwachsenen habe man im Jungvolk eigentlich nie gestanden: „Wir hatten eine Anleitung, die man befolgen sollte, aber der demokratische Konsens bei uns war, dass wir entschieden, was uns gefiel. Und den Rest ließen wir aus.“424 Wenige Jahre später wurde Langer in die Nachrichten-HJ überführt – eine Sondereinheit, die beliebt war, weil sie als weniger kräftezehrend galt. Probleme habe er als „Mischling“ dort nicht gehabt. Manchmal verkündeten die Stäbe der Gebiete stolz, wenn sie – wie einen 17-Jährigen aus Altona, den man im Herbst 1939 öffentlich an den Pranger stellte – jemanden „aufgrund seiner nichtarischen Abstammung“ ausgestoßen hatten.425 Und im April 1939 rief die BDM-Führung im Gebiet Niederdonau dazu auf, dass „sofort jedes Mädel mit nichtdeutscher Abstammung zu melden“ sei, wobei auf die Möglichkeit eines „Gnadengesuchs“ für sogenannte Viertel- und Achtel-Jüdinnen hingewiesen wurde.426 Bis zu diesem Zeitpunkt hatte man die meisten aber schon herausgedrängt. Für Günther Lack, der 1929 als Gymnasialschüler zur HJ gekommen war, hatten bereits vier Jahre später alle Gewissheiten geendet: „Es war ein Tiefschlag“, erinnerte er sich. 1933 war ihm offenbart worden, dass seine Mutter nicht seine leibliche, er adoptiert und angeblich „Halbjude“ war. „Ich habe geheult und geheult, den ganzen Nachmittag lang.“427 Eine Weile fiel er in den Reihen der Gleichaltrigen nicht auf. Doch als sich seine wahre Herkunft nur noch mit großer Mühe weiter verbergen ließ, tauchte er ab. Die Einführung der Jugenddienstpflicht im März 1939 – darüber im nächsten Kapitel mehr – stand paradoxerweise im Gegensatz zur rassistischen Aufnahme- und Ausgrenzungspraxis. Die Dienstpflicht – bis dahin nur ein Ideal, welches den Mitgliedern vorgehalten wurde – bekam nun ein gesetzliches Fundament. Die Totalität der Hitlerjugend wurde nach Kriegsbeginn erzwungen. Jene, die unter dem Regime als „Mischlinge 2. Grades“ galten, sahen sich
423 Lebenserinnerungen von Wolf-Herrmann Eckhold, geboren 27.4.1927 in Dresden, S. 14 (Archiv des HAIT). 424 Frei übersetzt aus Gerhard Langer, Memoirs: 1923–1939. A Jewish Survivor of Nazi Germany, S. 14 (Leo-Baeck-Institute, New York, ME 1527, unpag.); darin enthalten auch Fotos von Langner in Jungvolkuniform und an der Seite von Gleichaltrigen. 425 Entlassung. In: GB: Hamburg, A15/39 vom 1.9.1939. 426 Aufnahme von 1/4- und 1/8-Jüdinnen in den BDM. In: Obergaubefehl: Niederdonau, A4/39 vom 20.4.1939. 427 Zit. nach Peter Hartl (Hg.), Belogen, betrogen und umerzogen. Kinderschicksale im 20. Jahrhundert, München 2007, S. 127.
218
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
seitdem wieder dem Zugriff der Partei- und Staatsjugend ausgesetzt. In den Kriegsjahren erfasst, wies man sie der sogenannte Pflicht-HJ zu.428 Dort als „Mischlinge“ stigmatisiert, wurden einige wegen gewalttätiger Auseinandersetzungen mit Gleichaltrigen oder gar wegen Widerstandstätigkeit, die sie in der HJ angeblich trieben, aktenkundig. Anderes galt für „Mischlinge 1. Grades“. Sie sollten zwar ebenfalls erfasst, aber nur „bereitgestellt“ werden. „Bereitstellung“ hieß, dass sie im Kriegsalltag keinen aktiven Dienst leisten mussten. Bezeichnenderweise führte die RJF hier nicht rassistische Regularien als Erklärung an. Es stünde nicht ausreichend Personal zur Verfügung, um die Umsetzung ihrer Dienstpflicht in der Praxis zu gewährleisten.429 Sowohl die RJF als auch die untergeordneten Stäbe der Gebiete besaßen ab Mitte des Jahrzehnts rassenpolitische Abteilungen, zu deren Aufgaben es gehörte, die Rassenideologie in Schulungsmaterialien zu übersetzen, die für junge Menschen tauglich schienen.430 Allein der BDM verfügte im Herbst 1937 bereits über 700 „Rassereferentinnen“, die Lehrgänge an jenen Schulungseinrichtungen organisierten, die der Ägide der Hitlerjugend unterstanden.431 Zur Intensivierung verstärkte die RJF ab 1935 die Bande sowohl zur SS als auch zum Rassenpolitischen Amt der NSDAP.432 Als Agitatoren auf HJ-Veranstaltungen sollten, wie im Rheinland 1938, bekannte Radau-Antisemiten wie Wilhelm Börger oder Otto Hofmann, später der Chef des Rasse- und Siedlungshauptamtes, geladen werden.433 Im Gebiet Westmark griff die Hitlerjugend 1938 zusätzlich auf 74 Schulungsredner aus dem Rassenpolitischen Amt zurück, die bei Wochenendkursen, Lagern oder Lehrgängen auftraten; überwiegend handelte es sich hierbei um Lehrer und Ärzte.434 Die rassistischen Schulungspläne und Heimabendmaterialien, welche die RJF oder Gebiete zur Verfügung stellten, wurden mit der Zeit durchweg radikaler. Die Themenhefte der Gebietsführungen besaßen Titel wie: „Der Führer bricht die jüdische Weltherrschaft“, „Ju428 Vgl. vertraulicher, nicht veröffentlichter Erlass des JFdDtR [Jugendführer des Deutschen Reiches], I J 2167 vom 18.10.1941. In: Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 2: Mitgliedschaft, S. 124 f. 429 Zu diesem Abschnitt vgl. auch Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 284; Kollmeier, Ordnung und Ausgrenzung, S. 200–202; Jakob Benecke, Between exclusion and compulsory service. The treatment of the Jewish „Mischlinge“ as an example for social inequality creation in the Hitler-Jugend. In: Policy Futures in Education, 17 (2019) 2, S. 222–225; vgl. außerdem Franz Baaden, Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, Berlin 1943, S. 48–51. 430 Vgl. umfassend Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 71–80. 431 Vgl. Michael Buddrus, „Wir fahren zum Juden Geld holen“. Hitlerjugend, Antisemitismus, Reichskristallnacht. In: Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung, 18 (1993–98), S. 13–156, hier 35. 432 Vgl. bei Jahnke (Hg.), Jugend unter der NS-Diktatur, S. 156 abgedrucktes Dokument über Vereinbarungen der RJF mit dem Rassenpolitischen Amt der NSDAP vom 7.10.1938. 433 Vgl. Die Schulung der Führerschaft. Vorschlags- und Rednerliste. In: GB: Düsseldorf, Sonderdruck 1/38 vom 15.10.1938. 434 Vgl. Aufstellung mit allen Rassenpolitischen Schulungsrednern für einzelne Banne. In: GB: Westmark, A6/38 vom 1.4.1938.
Die Hitlerjugend und die Judenverfolgung
219
den und Lords Hand in Hand“ oder „Deutschland überwindet das Judentum“ – Titel auch eines Bildbands bzw. Schmalfilms, der zum Einsatz kam.435 Infame Nachkriegslegenden wie jene der BDM-Reichsreferentin Rüdiger, „Hass gegenüber Juden oder Anstiftung dazu“ würde man „im Schulungsmaterial der Hitler-Jugend […] nicht finden“, sind apologetischer Natur.436 Zu oft, so heißt es im drastischen BDM-Schulungsmaterial aus Sachsen von 1944, das ziemlich unverhohlen auf den Völkermord anspielte, hätten die deutschen „Volksgenossen geglaubt, ein gutes Wort für die Juden einlegen zu müssen. Wer das tut, beweist, dass er sich nie die Mühe gemacht hat, das wahre Wesen des Juden kennenzulernen. Er ist nichts als ein gefährlicher Parasit, von dem wir Deutsche uns befreien mussten. […] Nicht Mitleid gegenüber den Juden, sondern Dank gegenüber dem Führer […] ist das einzige Gefühl, das jeden Deutschen erfüllen muss.“437 Die Rassenpädagogik mündete – obgleich nicht notwendigerweise, so doch folgerichtig – in Verrohung und Selbstermächtigung, führte zu Ausschreitungen und Gewalt. Junge Menschen waren vielfach beteiligt. Wo Gleichaltrige diffamiert wurden, am häufigsten auf Schulhöfen und im Klassenzimmer, kam es zahlreich zu Übergriffen. Trotz allem sei seine Schulzeit schön gewesen, blickte aber der 1918 geborene Historiker Herbert Strauss zurück. Bis 1935 hatte er ein Gymnasium in Würzburg besucht. Übergriffe habe er dort zwar nicht erlebt. Als Opfer habe er sich im Grunde nie gefühlt: „Ich erinnere mich [aber] an manchen Vorfall auf der Straße oder auf Ausflügen, bei dem ich auf antisemitische Beleidigungen, die ein paar Kinder oder HJ-Gruppen mir an den Kopf warfen, […] heftig reagierte.“438 Die Anzahl jüdischer Kinder an staatlichen Schulen brach – aufgrund der Ausgrenzung, Emigration sowie der erzwungenen Eröffnung rein jüdischer Schulen – rasant ein. Ende November 1938 wurde den Letzten der Besuch einer staatlichen Schule per Gesetz verboten. Etwa 14 000 Mädchen und Jungen waren um 1935 der Hetze durch die Mitschüler und Lehrer an Volksschulen noch ausgeliefert.439 „Sie haben uns zusammengeschlagen“, berichtete Walter Thalheimer über die rohe Gewalt, die durch uniformierte Hitlerjungen auf die Straßen getragen wurde.440 Viel seltener sind sie,
435 Vgl. Dienstplan. In: Gebiet Sachsen (Hg.), BDM-Führerinnendienst, vom 2.1944, S. 6; sowie die Schulungsmaterialien zum Heimabend „Deutschland überwindet das Judentum“. In: ebd., S. 5. Vgl. auch eine Auflistung verschiedener antisemitischer Schulungsmaterialien. In: GB: Düsseldorf, Sonderdruck 1/1938 vom 15.10.1938. 436 Rüdiger, Richtigstellung, S. 118. 437 Zit. aus dem Abschnitt „Der Jude ist und bleibt unser größter Feind“. In: Gebiet Sachsen (Hg.), BDM-Führerinnendienst vom 2.1944, S. 18. 438 Herbert A. Strauss, Über dem Abgrund. Eine jüdische Jugend in Deutschland 1918– 1943, Frankfurt a. M. 1997, S. 59. 439 Vgl. Scholem Adler-Rudel, Jüdische Selbsthilfe unter dem Naziregime. Im Spiegel der Berichte der Reichsvertretung der Juden in Deutschland, Tübingen 1974, S. 26. 440 Toninterview mit Walter Thalheimer (USHHM, Oral History Collection, RG50.031.0073).
220
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
aber umso verstörender, lauten die Berichte von der anderen Seite. Einen Klassenkameraden habe er getreten, nur weil der Jude war, gestand ein vormaliger Hitlerjunge, der in Königsberg aufwuchs. Es seien besonders Lehrer gewesen, die ihn und Kameraden gegen die Mitschüler aufhetzten: „Wir wussten, das war ein Judenbengel.“441 Zunehmende Gewalt und Ausschreitungen, gerade von HJ-Angehörigen in Dienstkluft, führten in den 1930er-Jahren – zumindest in einigen Fällen – zur Intervention höherer Dienststellen. Einmal mehr ging es darum, was im öffentlichen Raum zulässig war, geduldet werden konnte oder dem Ansehen der Jugendorganisation Schaden zufügte. Teile des Führerkorps sahen sich genötigt, sogenannte Einzelaktionen gegen Juden zu untersagen – obwohl sie die Spirale der Gewalt mit ihren Schulungen selbst antrieben und den Nährboden für die Verfolgung und Ausgrenzung bereiteten. Für Berlin ist dies beispielsweise umfassend dokumentiert. Die Auseinandersetzungen um den Besuch von Eisdielen sind zuvor thematisiert worden. Ab Anfang 1935 nahmen Ausschreitungen gegen jüdische Inhaber zu. Der Höhepunkt wurde Mitte Juli erreicht, als der „Judenboykott“ in Berlin in Gewalt und Vandalismus gipfelte, gegen welche die Polizei nur zögerlich vorging. Der jüngst eingesetzte Polizeipräsident und SA-Führer Wolf-Heinrich von Helldorf ließ acht Tage verstreichen, bevor er Ende des Monats ankündigte, gegen die Angriffe vorzugehen.442 Auch in München hatten sich seit Mai 1935 die Vorfälle gehäuft. Wieder waren unter den Tätern zahlreiche Hitlerjugend-Angehörige.443 Die höheren Dienststellen reagierten mit Verboten. Axmann, in der Funktion des Gebietsführers von Berlin, untersagte im August die „Judenboykottierung durch Ansammlungen und einseitige Eingriffe […] strengstens in der gesamten Hitlerjugend“. Zum eigenmächtigen Vorgehen sei kein Unterführer oder einfacher Hitlerjunge berechtigt. Möglicherweise war die Kritik nicht nur aus der Bevölkerung, sondern auch vonseiten der Polizei laut geworden.444 Die Gewalt nahm zu: Friedhöfe wurden geschändet, Bürger auf der Straße attackiert, Läden beschmiert und Scheiben eingeschlagen. Die Trierer Gestapo berichtete 1935, dass in „einer Reihe von Fällen […] eine völlige Disziplinlosigkeit […] in der Frage der Judenbekämpfung“ geherrscht habe. Gegen mehrere „verdiente“ HJ-Mitglieder seien Strafverfahren wegen verschiedener Übergriffe auf Juden anhängig. Dienststellen sollten daher auf „Unterlassung von Einzelmaßnahmen“ intensiver drängen, als das bislang geschehen sei.445 In Springe
441 Interview mit Edgar Krämer, Transkript, S. 45 (ebd., RG-50.486.0007). 442 Vgl. Wolf Gruner, Die Verfolgung der Juden und die Reaktionen der Berliner Bevölkerung. In: Michael Wildt/Christoph Kreutzmüller (Hg.), Berlin 1933–1945, München 2012, S. 311–325, hier 313; Hans Mommsen, Die Pogromnacht und ihre Folgen. In: Gewerkschaftliche Monatshefte, (1988) 11, S. 591–604, hier 593 f. 443 Vgl. Buddrus, „Wir fahren zum Juden Geld holen“, S. 26. 444 Judenboykottierung. In: BB: Gebiet Berlin, 9/35 vom 16.8.1935. 445 Lagebericht der Gestapostelle Trier für August 1935. In: Faust/Rusinek/Dietz (Hg.), Lageberichte rheinischer Gestapostellen, Band II/2, S. 986–995, hier 992.
Die Hitlerjugend und die Judenverfolgung
221
bei Hannover hatten mehrere Jungvolk-Angehörige Ende 1935 die Scheunen zweier jüdischer Getreidehändler aufgebrochen und verwüstet, was laut Lagebericht „in weiten Teilen der Bevölkerung Empörung hervorgerufen“ hatte, wahrscheinlich – wie meist bei derartig gelagerten Fällen – wegen Geschäftsbeziehungen mit den angegriffenen Händlern. Als Rädelsführer dieser „Einzelaktion“ wurde der 13-jährige Sohn eines DAF-Ortsgruppenleiters ermittelt.446 In derartigen Fällen ließen es Polizei und höhere HJ-Dienststellen üblicherweise mit Verwarnungen bewenden. Meist ging es, sofern überhaupt eingeschritten oder ermittelt wurde, nicht um das Unrecht gegenüber der jüdischen Bevölkerung. In erster Linie befürchtete man, dass ein etwaiger Ansehensverlust für die Partei durch Gewaltanwendung die Folge sein könnte. Die sogenannten Einzelaktionen – ein Euphemismus, der stets Gewalt verdeckte – waren ein zweischneidiges Schwert. Je offener und militanter zur Schau getragen, schienen sie die öffentliche Ordnung zu gefährden, Kritik an der Partei zu begünstigen und die „Rassenpolitik“ zu delegitimieren. Als Einzelaktion galt nach einem Erlass des Innenministeriums in Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium und Rudolf Hess seit Sommer 1935 jede Maßnahme, „die nicht auf einer ausdrücklichen Anordnung der Reichsregierung und der Reichsleitung der NSDAP“ beruhte.447 Obgleich verboten, wurden die Ausschreitungen dennoch toleriert. In einer Reihe von Regionen sind derlei Anweisungen in der Hitlerjugend überliefert. Man kann und sollte hinterfragen, wie ernst sie gemeint waren. „Ich muss nochmals darauf hinweisen, dass Einzelaktionen gegen Nichtarier usw. strengstens zu unterbleiben haben. Andernfalls muss gegen die betreffenden […] vonseiten der Hitler-Jugend disziplinarisch vorgegangen werden“, ermahnte die Personalabteilung im Gebiet „Mittelelbe“ im Februar 1937.448 Ein Jahr später – nur wenige Monate vor den Novemberpogromen – untersagte dieselbe Gebietsführung erneut alle „selbstständigen Vergeltungsmaßnahmen“, was sich hier auf angeblich jüdische „Gräuelpropaganda“ des Auslands bezog, sowie sämtliche „Aktionen, welche dazu geeignet sind, das Ansehen der gesamten Hitler-Jugend stark zu schädigen“.449 Das war stets die eigentliche Motivation, die derlei Anordnungen und disziplinarischen Strafandrohungen zugrunde lag: Es ging, wie in anderen NSDAP-Gliederungen, wo vergleichbare Maßgaben existierten, nicht um die Gewaltaktionen gegen die Juden als solche, die man nicht im Grundsatz missbilligte, sondern um das Ansehen der Bewegung, das man – in Teilen der Bevölkerung – zu verlieren fürchtete. 446 Bericht der Stapostelle Regierungsbezirk Hannover für Oktober 1935. In: Kulka/Jäckel (Hg.), Die Juden in den geheimen NS-Stimmungsberichten, S. 168 f. 447 Einzelaktion. In: GB: Franken, IV/2 vom 1.2.1936. 448 Rubrik „Personalabteilung“. In: GB: Mittelelbe, 2/1937 vom 2.2.1937. Eine solche Anweisung für die örtliche HJ-Führung auch bei Elisabeth Sternberg-Siebert, Jüdisches Leben im Hünfelder Land. Juden in Burghaun, 2. Auflage, Petersberg 2008, S. 125. 449 Selbstständige Vergeltungsmaßnahmen. In: GB: Mittelelbe A3/38 vom 15.2.1938. Weitere Beispiele bei Wolfgang Gippert, Kindheit und Jugend in Danzig 1920 bis 1945. Identitätsbildung im sozialistischen und im konservativen Milieu, Essen 2005, S. 190– 195.
222 3.2
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Die Hitlerjugend und die Novemberpogrome
Dieses Muster prägte selbst die Pogromtage des Novembers 1938. Goebbels, der den Terror angetrieben hatte, rechtfertigte die Verbrechen wenige Tage später als „Reaktionen auf eine Infektion, die sich in den deutschen Volkskörper einschleichen“ wolle.450 Welche Rolle spielte die Hitlerjugend in den Tagen der antisemitischen Straßengewalt? Viele der Jüngsten erlebten die gewalttätigen Ausschreitungen, die in der Nacht auf den 10. November organisiert begannen, als ein unheimliches, rätselhaftes Schauspiel. „Wir Kinder gingen oft dorthin und drückten uns die Nasen an den großen Schaufenstern platt“, berichtete ein Augenzeuge über ein Spielwarengeschäft in Köln, das geplündert und zerstört wurde: „Auch dort, in unserem Paradies, hatte man die Scheiben eingeschlagen, die Tür war eingetreten, und die Spielwaren lagen auf der Straße verstreut, teils noch heil, teils zerbrochen.“451 Jean Jülich, geboren 1929, der hier sein kindliches Entsetzen schilderte, war Sohn eines KPD-Politikers. Den November 1938 beschrieb er als Erweckungserlebnis. Zur Hitlerjugend habe er danach immer Abstand gehalten; er fand während der Kriegsjahre zu den Kölner „Edelweißpiraten“. Ähnlich zeichnen es andere Erinnerungsberichte nach. Niemand habe den Kindern erklärt, heißt es dort üblicherweise, warum Synagogen und Schulen in Flammen standen, Fenster eingeschmissen, Geschäfte überfallen oder Menschen von der Straße und aus ihren Wohnungen heraus verhaftet wurden. Doch seit Langem ist bekannt, dass Hitlerjugend-Angehörige vielerorts an Ausschreitungen der SA und SS direkt beteiligt waren. In einzelnen Fällen war die Hitlerjugend sogar federführend.452 „Als sie die Synagoge ansteckten“, berichtete eine Zeitzeugin über den Pogrom in Bad Hersfeld, „komme ich [dort] hin, und sie jubelten und sangen, die Hitlerjugend, [der] BDM und ein himmelgroßes Feuer“ habe man lodern sehen.453 Kinder und Jugendliche wurden – manchmal, wie an der Synagoge in Euskirchen, zählten sie mit zu den Ersten am Tatort – zu erregten Schaulustigen oder zu jungen Mittätern.454 In Kassel hatten uniformierte Jugendliche schon am 5. November versucht, in die Synagoge einzudringen und Feuer zu legen. Sie wurden zunächst von der Polizei verscheucht, brachen aber tags darauf die Tür zum Gemeindehaus auf.455 „Wilde 450 Zit. aus dem Artikel „Die deutsche Auffassung über die Judenfrage. Unterredung Dr. Goebbels mit einem Reutervertreter“. In: Deutsches Nachrichtenbüro vom 14.11.1938. 451 Jean Jülich, Kohldampf, Knast un Kamelle: Ein Edelweißpirat erzählt sein Leben, Köln 2003, S. 32 f. 452 Vgl. Hermann Graml, Reichskristallnacht. Antisemitismus und Judenverfolgung in Deutschland, 1988, S. 17, 32 f. 453 Interview von Friedhelm Röder mit Frau B. aus Rotenburg, Jg. 1913, über den Novemberpogrom in Bad Hersfeld. In: Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (Hg.), 75 Jahre Novemberpogrom, Teil B: Dokumente und Texte von Zeitzeugen, Kassel 2013, S. 21. 454 Vgl. Hans-Dieter Arntz, „Reichskristallnacht“. Der Novemberpogrom 1938 auf dem Lande. Gerichtsakten und Zeitzeugenaussagen am Beispiel der Eifel und Voreifel, Aachen 2008, S. 57 und 81. 455 Bericht „Zur Spontanität der Aktion des 10. November“ (Wiener Library for the Study of the Holocaust & Genocide, digitales Archiv: Testimonies from „Kristallnacht“,
Die Hitlerjugend und die Judenverfolgung
223
Horden“, so Hans Reichmann, der kurz darauf in das KZ Sachsenhausen verschleppt wurde, „drangen […] ein, zerschlugen Mobiliar, warfen Gemeindeakten auf den Hof und beschädigten Synagoge und Gemeindehaus so schwer, dass die Polizei beide Gebäude in weitem Umkreis abriegeln musste.“456 Der Terror sei durch die Partei schon lange vorbereitet gewesen, wie Reichmann durch diesen frühen Angriff bestätigt sah. In Danzig waren Hitlerjungen ebenfalls Anfang September randalierend in eine Synagoge eingedrungen.457 In Offenburg und Dorsten sollen verschiedene HJ-Angehörige am 9. November an der Zerstörung der Synagogen aktiv mitgewirkt haben.458 Im badischen Kippenheim demolierten die Teilnehmer aus einer HJ-Gebietsführerschule – offenbar auf Anweisung des Kreisleiters hin – den Betsaal einer Synagoge. Sie warfen Inventar auf die Straßen und attackierten jüdische Bürger.459 In Leipzig überfielen Hitlerjungen sogar ein jüdisches Altenheim unter Gejohle: „Juda verrecke!“460 Die Berichte über die Beteiligung von jungen Menschen sind für zahlreiche Groß- und Kleinstädte überliefert. Hitlerjungen liefen den Gewaltzügen der Älteren – Brüdern, Vätern, Vorbildern – hinterher; man sieht sie vereinzelt mit ihren Uniformen oder Abzeichen auf seltenen Fotografien, wie sie im Tross jüdische Bürger durch die Straßen treiben. „Ich war erst 9“, schilderte Karl Burkhof, der 1938 ins Berliner Jungvolk kam, „als ich zusammen mit den laut grölenden Schlägertrupps der SA und SS […] durch die Straßen Berlins zog und die Fenster der jüdischen Geschäfte einschlug. Natürlich hatte ich meine Pimpfen-Uniform an und konnte zum ersten Mal beweisen, wozu ein kleiner Hitler-Junge fähig war.“461 Auch in Düsseldorf und anderen rheinländischen Städten hatten sich Passanten und Gruppen aus Hitlerjungen dem Zug der SA angeschlossen.462 Andere wurden mit ihren Unterführern auf eigene Faust tätig. Männliche Jugendliche stellten die breite Mehrheit, doch in Einzelfällen – wie am Stadtrand von Heidelberg beim Einbruch in eine Villa – waren BDM-Mädchen beteiligt. Egon Trachtenberg berichtete aus Wien, dass die Reaktion der christlichen Bevölkerung zwar unterschiedlich gewesen sei. Viele wandten sich ab, manche halfen. Doch insbesondere „Jugendliche von 16–17 Jahren“ B 333). Dieser und hier im Folgenden zitierte Berichte ediert bei Ben Barkow/Raphael Gross/Michael Lenarz (Hg.), Novemberpogrom 1938. Die Augenzeugenberichte der Wiener Library, London, Frankfurt a. M. 2008. 456 Vgl. Hans Reichmann, Deutscher Bürger und verfolgter Jude. Novemberpogrom und KZ Sachsenhausen 1937–1939, bearbeitet von Michael Wildt, München 1998, S. 109. 457 Hitlerjugend plündert Danziger Synagoge. In: Pariser Tageszeitung vom 2.9.1938. 458 Nach Bericht von Wilhelm Winkler, abgedruckt bei Martin Ruch, Das Novemberpo grom 1938 und der „Synagogenprozess“ 1948 in Offenburg. Verfolgte berichten, Täter stehen vor Gericht, Norderstedt 2008, S. 66. 459 Vgl. Dieter Obst, „Reichskristallnacht“. Ursachen und Verlauf des antisemitischen Po groms im November 1938, Frankfurt a. M. 1991, S. 265. 460 Daniel Ristau, Bruch|Stücke. Die Novemberpogrome in Sachsen, Leipzig 2018, S. 82. 461 Karl A. Burkhof, Erinnerungen eines Hitler-Jungen, Norderstedt 2003, S. 34. 462 Vgl. Bastian Fleermann, Der Beginn der Pogrome in Düsseldorf. In: ders./Angela Genger (Hg.), Novemberpogrom 1938 in Düsseldorf, Essen 2008, S. 107–124, hier 110, 121. Weitere Berichte bei Obst, „Reichskristallnacht“, S. 263–270.
224
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
ätten „begeistert mitgetan“.463 Wieder aus Berlin hieß es, dass „am Morgen des h 10. November alle Fensterscheiben und Schaufenster […] eingeschlagen waren. Im Laufe des Tages wurden die Geschäfte vollkommen demoliert und beraubt. Die Schutzleute standen dabei und haben nicht eingegriffen. Schuljugend, Jugendliche und SA in Mänteln waren mit dem Zerstörungswerk beschäftigt.“464 Einige der Berichte hielten fest, es würde beispielsweise in den Betrieben auffallen, dass junge Lehrlinge nicht erschienen, weil sie frühmorgens in Pogromstimmung gewesen waren.465 Ein Amsterdamer Geschäftsmann, der in Berlin weilte, betonte: „Kinder von zwölf Jahren haben geholfen, die Läden zu plündern.“466 Kindliche Begeisterung thematisierte der verstörende Bericht eines Brühler SAManns, der die Pogrome mitorganisierte. Hier schrieb er über Plünderungen: „Die Kinder waren ganz außer Rand und Band. Wir waren kaum in der Lage, die Kerlchen zu bändigen. Sie waren im Gegensatz zu den Erwachsenen mit Leib und Seele dabei. Ich glaube, sie werden an diesen Tag noch denken, wenn sie selbst schon Großväter geworden sind.“467 Ein anderer Augenzeuge erneut aus Wien schilderte, dass 60 „HJ-Kinder“ lärmend durch die Straßen gezogen seien. Sie hätten Firmenschilder heruntergeschlagen und Schaufenster mit Steinen eingeschmissen: „Viele Leute, die zusahen, machten folgende Äußerungen: ‚wie kann man solche 13–16 jährige Buben das machen lassen, das werden doch erwachsene Leute auf anderem Wege zu Stande bringen‘.“468 Derartige Aussprüche sind im Besonderen bedenkenswert. Sie zeigen, dass eine Problematik für die Jugendorganisation durchaus bestand. Die Sicherheitsorgane dokumentierten solche Äußerungen ebenfalls. In Bielefeld, wo es bis zum 10. November zu Plünderungen und Diebstählen kam, habe – laut Lagebericht der Gestapo – „das Ansehen der Bewegung“ gelitten, weil „an vielen Stellen Jugendliche für die Durchführung der Aktion angesetzt“ worden seien.469 Mancherorts wurden die Jugendlichen gezielt von SA-Männern instruiert, meist wohl um Wohnungsräumungen auszuführen. Mehrheitlich traten die Jugendlichen dabei in „Räuberzivil“, also nicht in Uniform, aber doch in Grüppchen auf, was einen gewissen Grad an Organisation und Vorbereitung andeutete. Einzelne Augenzeugen konnten sich folglich an die Beteiligung ihrer HJ-Kameraden gut erinnern. Denen sei die Gewaltnacht, meinte einer im Rück-
463 Bericht von Egon Trachtenberg/Oskar Hirschfeld, Wien (Wiener Library, B 190). 464 Bericht von Kurt Wachtel, Berlin (ebd., B 191). 465 Vgl. Bericht aus Berlin, A35. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 5 (1938), S. 1194. 466 Anonymer Bericht (Wiener Library, B 36). 467 Die Lage der Judenaktion in Brühl und seine Folgen, erzählt von einem aktiven Teilnehmer, S. 3 (StadtA Brühl, 576; Digitalisat online in EzG: Dokumentation Günther Roos, Zusatzmaterialien). 468 Bericht von Robert Steiner, Wien (Wiener Library, B 130). Vgl. ebd. auch den Bericht B 95, der Einbrüche in Geschäfte durch 14- bis 18-jährige Hitlerjungen erwähnt. 469 Stapostelle Bielefeld zur Protestaktion gegen Juden am 10.11.1938. In: Kulka/Jäckel (Hg.), Die Juden in den geheimen NS-Stimmungsberichten, S. 322–324, hier 324.
Die Hitlerjugend und die Judenverfolgung
225
blick, vielleicht ein Abenteuer gewesen und habe Spaß bereitet.470 Günther Roos, den als begeisterten Brühler Hitlerjungen am Nachmittag des 10. November das verbrecherische Spektakel in Begleitung seiner Mutter auf die Straßen lockte, wurde zum Zeuge der Taten seiner Kameraden: Unter Leitung eines ihm gut bekannten HJ-Gefolgschaftsführers hätten die Jungen ein Möbelgeschäft demoliert.471 Jugendliche wurden außerdem in etlichen Fällen im Klassenverband aktiv. Lehrer, gerade wenn sie als HJ- oder SA-Führer fungierten, rekrutierten junge Menschen direkt aus den Schulen. Weil die Ausschreitungen vielerorts am Frühmorgen zeitgleich zu den Unterrichtsstunden begannen, fiel den Lehrerinnen und Lehrern eine Schlüsselrolle zu. Manche gaben schulfrei oder entließen die Kinder früher aus dem Unterricht, damit sie dem vermeintlichen Racheakt beiwohnen konnten.472 Wo die Lehrer oder Direktoren nicht in diesem Sinne entschieden, blieben die Schulkinder eher ferne oder nahe Beobachter: „Wir hatten […] Unterricht wie normal, wie wenn nichts los wäre“, berichtete ein Zeitzeuge aus Freiburg: „Man konnte vom Klassenzimmer rausschauen auf die Synagoge […]. Wir haben alle geguckt, schwarzer Rauch stieg auf, Flammen schlugen aus dem Dach. Wir wussten nicht, wieso keine Feuerwehr kommt.“473 Ein Dokument aus der Jugendorganisation, das einen Aufruf von höchster Ebene zur Beteiligung an den Pogromen enthält, ist bislang nicht gefunden worden.474 Eine derartige Weisung wäre nicht erforderlich gewesen. Etliche Unterführer wurden eigenmächtig tätig. Ein besonderer Fall mit Nachspiel lag bei der Gebietsführung „Hochland“ vor. Der 37-jährige Führer der Hitlerjugend in Bayern, Emil Klein, hatte am Abend des 9. November im Alten Rathaus von München der Hetzrede Goebbels beigewohnt. In seiner Auffassung bestärkt, es müsse eine gewaltige „Sühneaktion“ durchgeführt werden, wies er in der Nacht seine Vertrauten an: „Die Juden hätten […] keine Schonung zu erwarten und könnten geschädigt werden“, gab ein HJ-Führer über die Anweisung Kleins wenige Wochen später zu Protokoll.475 Nicht nur zwang man den Opfern sogenanntes Sühnegeld ab; darunter der Familie Bernheimer, die das Münchner Kunst rundbesitz haus gleichen Namens führte. Manche wurden genötigt, ihren G notariell der Hitlerjugend zu überschreiben; diese Schecks und Unterschriften
470 Vgl. Gabriele Rosenthal, „… wenn alles in Scherben fällt …“ Von Leben und Sinnwelt der Kriegsgeneration. Typen biographischer Wandlungen, Opladen 1987, S. 255. 471 Vgl. Rüther, „Macht will ich haben“, S. 84 f. 472 Vgl. Sven Felix Kellerhoff, Ein ganz normales Pogrom: November 1938 in einem deutschen Dorf, Stuttgart 2018, S. 111–115; Michael Weinbecker, Schulfrei zur Reichspo gromnacht. Ein Überblick über die Judenverfolgung in Mainz 1933–1945. In: Tribüne. Zeitschrift zum Verständnis des Judentums, (1992) 121, S. 203–210. 473 Interview mit Alexander Romeike. In: Bernd Hainmüller, Erst die Fehde – dann der Krieg. Jugend unterm Hakenkreuz. Freiburgs Hitler-Jugend, Freiburg 1998, S. 78–94, hier 89. Zu anders gelagerten Fällen, bei denen Jugendliche auf Anweisung von Lehrkörpern aktiv wurden, vgl. Obst, „Reichskristallnacht“, S. 263–278. 474 Vgl. auch Einschätzungen bei Nolzen, Der Streifendienst, S. 36 f. 475 Vernehmungsprotokoll Waldmann, zit. nach Buddrus, „Wir fahren zum Juden Geld holen“, S. 86.
226
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
wurden kurz darauf aber für ungültig erklärt. Man kam nicht umhin, die Erpressungen aufzuklären. Gebietsführer Klein und seine Gruppe aus HJ-Führern – keine Jugendlichen, sondern allesamt Mitte Zwanzig oder älter – sollten sich vor einem HJ-Obergericht verantworten. Die bestellten Richter und Schöffen, ebenfalls HJ-Funktionäre, waren Emil Klein in der Hierarchie der Jugendorganisation allerdings nachgeordnet. Das brisante Verfahren wurde Anfang Dezember deshalb an das Oberste Parteigericht der NSDAP weitergereicht. Wie zu erwarten bei einer Gerichtsbarkeit, die sich stets nur für die zugrundeliegende Motivation einer Tat interessierte, aber nicht eigentlich juristische Fragen von Recht oder Unrecht zu klären suchte, ging das Parteiverfahren in kürzester Zeit zugunsten Kleins und seiner 12 mitangeklagten hauptamtlichen HJ-Führer aus: „Da es sich lediglich um falsche und zu missbilligende Methoden gehandelt hat, den Handlungen aber unanständige Beweggründe nicht zugrunde liegen, war das Verfahren gegen sämtliche Angeschuldigte einzustellen“.476 Es ist der einzige gut dokumentierte und zweifelsfrei nachweisbare Fall einer Weisung und Beteiligung aus den obersten Etagen der HJ-Führung.477 Die Einschätzungen der Geschichtswissenschaft über den Grad der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an den Pogromen weichen in Nuancen voneinander ab. Da sich diese Frage mit Zahlen und Prozentangaben nicht beantworten lässt, geht es letztlich um die Gewichtung der Berichte, Aktenfunde und Fälle. Wurden die Tage des Terrors in älteren Hitlerjugend-Studien stets nur am Rande oder überhaupt nicht zur Sprache gebracht, erhielt die Jugendorganisation an anderer Stelle mehr Aufmerksamkeit. Alan E. Steinweis hat der Jugend insgesamt und der Hitlerjugend im Besonderen eine „zentrale Rolle“ in den Pogromen zugewiesen. Er stellte in seiner 2009 erschienenen Studie über die „Reichskristallnacht“ zugleich heraus, dass die Beteiligung junger Menschen mehrheitlich spontan erfolgt sei.478 Armin Nolzen schrieb hingegen, dass der antisemitische Terror durch die Hitlerjugend, anders als im Falle der SA, von oben angeordnet und zentral geplant worden sei.479 Dietmar Süß kam zu dem Schluss, dass „insbesondere junge Leute – mobilisiert durch die Hitler- 476 Beschluss des Oberstes Parteigerichts der NSDAP vom 10.2.1939, abgedruckt in: ebd., S. 148 f. Vgl. auch Dokumente abgedruckt bei Jahnke (Hg.), Eine Dokumentation, S. 148–153; sowie Donald M. McKale, The Nazi Party Courts. Hitler’s Management of Conflict in his Movement 1921–1935, Kansas 1975, S. 19–23; Marita Krauss, Rechte Karrieren in München. Von der Weimarer Zeit bis in die Nachkriegsjahre, S. 143 f.; Kollmeier, Ordnung und Ausgrenzung, S. 147. 477 Vgl. zum Fall auch Andreas Heusler/Tobias Wagner, „Kristallnacht“. Gewalt gegen die Münchner Juden im November 1938, München 1998, S. 95–111. 478 Alan E. Steinweis, Kristallnacht 1938, London 2009, S. 80–87, hier vor allem S. 82. Vgl. auch ders., The Perpetrators of the November 1938 Pogrom through German-Jewish Eyes. In: Thomas Pegelow Kaplan/Jürgen Matthäus/Mark W. Hornburg (Hg.), Beyond ,Ordinary Men‘. Cristopher R. Browning and Holocaust Historiography, Paderborn 2019, S. 56–68. 479 Armin Nolzen, The Nazi Party and its Violence Against the Jews 1933–1939. Violence as a Historiographical Concept. In: Yad Vashem Studies, 31 (2003), S. 245–285, hier 266.
Die Hitlerjugend und die Judenverfolgung
227
Jugend – mit dabei“ gewesen seien. Die Gruppe derer, die sich beteiligten, sei erheblich größer gewesen, als angenommen.480 Wolf Gruner führte den besonders verheerenden Terror in Berlin auf „SA, SS und HJ“ gleichermaßen zurück; beteiligte Jugendliche seien männlich, überwiegend zwischen 16 bis 18 Jahre alt gewesen und hätten wohl eine lange HJ-Schulungssozialisation hinter sich gehabt.481 Michael Kater hat eine etwas andere Interpretation und Gewichtung vorgelegt. Zwar sah auch Kater die Hitlerjugend in die Gewalt aktiv involviert. Doch die große Mehrheit der jungen Menschen habe die Rolle von Zuschauern eingenommen, welche „die Erlebnisse verarbeiten und die verlangten rassistischen Schlussfolgerungen […] ziehen“ sollten.482 Die verschiedenen Sichtweisen, welche die Akzente unterschiedlich setzen, verweisen auf die Schwierigkeiten bei der Interpretation. Sie schließen einander aber nicht unbedingt aus. Jugendliche waren in einer erheblichen Größenordnung, aber nicht überall und nicht in der Mehrheit in die Gewalt unmittelbar einbezogen. Die Verantwortung der Hitlerjugend soll damit nicht kleingeredet werden. 3.3
Apologien der Funktionäre
Sogenannte Einzelaktionen galten, wie mehrfach betont, offiziell als verboten. Gerade die Jugendorganisation musste – weit mehr als andere Parteiorganisationen – auf diese Anweisungen Wert legen. Die Hitlerjugend durfte nicht als gewalttätig erscheinen, weil das den Rückhalt der Eltern zu gefährden drohte. Die Berichterstatter der Gestapo oder kommunale Stellen schrieben ebenfalls in verdunkelnder Absicht meist von „jungen Leuten“, wenn sie eigentlich HJ-Führer und Hitlerjungen meinten.483 Der Oberbürgermeister von Schweinfurt, Ludwig Pösl, behauptete in einem Bericht, den er aufgrund von Beschwerden eines Parteigenossen verfasste, der sich über die „Kulturschande“ empört hatte: „Die Hitlerjugend war nicht unterwegs. Dass sich derartigen Demonstrationen Jugend anschließt, ist [aber] selbstverständlich und nicht ohne weiteres zu
480 Dietmar Süß, Die deutsche Gesellschaft im Dritten Reich, München 2017, S. 159; ähnlich Raphael Gross, November 1938: Die Katastrophe vor der Katastrophe, München 2013, S. 54. 481 Gruner, Die Verfolgung der Juden und die Reaktionen der Berliner, S. 315; ders., Die Berliner und die NS-Judenverfolgung. Eine mikrohistorische Studie individueller Handlungen und sozialer Beziehungen. In: Rüdiger Hachtmann/Thomas Schaarschmidt/ Winfried Süß (Hg.), Berlin im Nationalsozialismus. Politik und Gesellschaft 1933–1945, Göttingen 2011, S. 57–87, hier 62 f. 482 Kater, Hitler-Jugend, S. 58. 483 Bajohr, Die Deutschen und die Judenverfolgung im Spiegel von Geheimberichten, S. 192. Vgl. Berichte u. a. bei Irene Diekmann, Boykott – Entrechtung – Pogrom – Deportation. Die „Arisierung“ jüdischen Eigentums während der NS-Diktatur. In: Dietrich Eichholtz (Hg.), Verfolgung. Alltag. Widerstand. Brandenburg in der NS-Zeit. Studien und Dokumente, Berlin 1993, S. 217 f.
228
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
nterbinden.“484 Die Hitlerjugend fungierte als institutionelles Gehäuse, das die u Gewalt legitimierte. In der Diktatur lag die Selbstermächtigung gegen „Volksfeinde“ im Rahmen des Tolerablen – selbst, wenn sie von der Hand junger Menschen ausgeübt wurde; ungeachtet auch dessen, dass höhere Dienststellen sie als wenig förderlich bewerteten. Die Involvierung von Kindern und Jugendlichen erfolgte, anders als der Pogrom insgesamt, der von der Partei und SA organisiert war, unmittelbar im Zuge des Terrors – oft nach Demonstrationen, die der Gewalt vorausgingen, aus den Schulen oder auf zeitnahe Instruktion aus der Partei oder SA. Wo die Hitlerjungen beispielsweise Demonstrationen mit Trommelgeschmetter anheizten, sah man sie beim Gewaltmarsch durch die Straßen oft ebenfalls. In Karlsbad hatten die HJ-Mitglieder sogar mit Fanfaren zum Auftakt für die Pogrome geblasen, sich „wie Besessene“, schilderte ein Augenzeuge, auch an der Verfolgung und den Übergriffen auf die jüdische Bevölkerung beteiligt.485 Aus Berichten, die unmittelbar nach den Tagen des 9. und 10. November aufgeschrieben wurden, wird ersichtlich, dass es schwer fiel, zwischen jungen SA-Männern und jüngeren HJ-Mitgliedern zu unterscheiden: „Die Teilnehmer waren nach den Aussagen der dort wohnenden Juden SA-Leute, die in Zivil waren“, heißt es von einem Berichterstatter aus Köln, der eine Szenerie mit Blutlachen auf den Straßen skizzierte: „Sehr zahlreich beteiligten sich aber auch Jugendliche, auch in Zivil, an den Pogromen. Sie gingen in […] Trupps von ca. 10 Mann durch die Straßen. Die Bevölkerung beteiligte sich daran überhaupt nicht, nur selten als Neugierige […], sondern mit entsetzter Miene.“486 Aus dem Ruhrgebiet wurde über die Tätergruppen vermutet, es handele sich um „größtenteils Jugendliche anfangs der 20“; ein Augenzeuge aus Wien identifizierte eine Masse von „SA- und SS-Verfügungstruppen und jungen Burschen in Zivil“.487 Außenstehende, Schaulustige und Beobachter versuchten sich selbst einen Reim darauf zu machen, welche Rolle junge Menschen übernahmen und ob sie angewiesen oder organisiert worden waren. Das Hitlerjugend-Führerkorps billigte die Beteiligung junger Menschen im Nachhinein. Disziplinarische Sanktionen oder gar Ausschlüsse sind weder dokumentiert noch sonderlich wahrscheinlich – Jutta Rüdiger allerdings behauptete, es habe fünf Ausschlüsse von Jugendlichen wegen einer Beteiligung an den Ausschreitungen des Novembers gegeben.488 Während die Pogrome in den Befehlsblättern der Hitlerjugend 484 Stellungnahme des Oberbürgermeisters Pösl gegenüber der Stapostelle Würzburg, 7.12.1938. In: Uwe Müller (Hg.), Dokumente jüdischen Lebens in Schweinfurt, Schweinfurt 1990, S. 57. 485 Vgl. Bericht aus dem Sudetenland, A 35. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 5 (1938), S. 1194 f.; vgl. Jörg Osterloh, Nationalsozialistische Judenverfolgung im Reichsgau Sudetenland 1938–1945, München 2006, S. 207 f. 486 Bericht von Walter Singer, Köln (Wiener Library, B 134). 487 Bericht aus Duisburg (ebd., B 114); Bericht von Carl Löwenstein (ebd., B 143). 488 Vgl. Rüdiger, Ein Leben für die Jugend, S. 71. Interessanterweise wies die Gebietsführung Pommern Anfang Dezember an: „In letzter Zeit bekannt gewordene Fälle“ böten Veranlassung zu bekräftigen, dass Jugendliche „gegen die ein HJ-Disziplinarverfahren
Die Hitlerjugend und die Judenverfolgung
229
danach nicht zur Sprache kamen, wurden sie im RJF-Leitorgan beiläufig als „Demonstrationen, die […] in Deutschland stattfanden“, beschönigt.489 Dass Unterführer und einfache HJ-Angehörige an der Verfolgung und Gewalt Anteil nahmen, ist jedoch nicht auf eine Anweisung aus höheren Dienststellen oder aus der RJF zurückzuführen. Für die Apologien der Funktionärsclique war dies nach 1945 von Bedeutung. Ihrer Argumentation sollte man sich stellen. Melita Maschmann, die sonst kritisch mit ihrer BDM-Vergangenheit zu Gericht ging, mag als Beispiel dienen. Auf ihrem Weg in die Berliner Zentrale der RJF habe sie, heißt es in ihren Erinnerungen, die zerschlagenen Schaufenster bemerkt sowie Reste des Mobiliars, das man aus den Wohnungen geholt hatte. Es habe eine beklommene Stimmung geherrscht: „Aber fast gleichzeitig schaltete ich darauf um, das Geschehene als vollendete Tatsachen zu akzeptieren und nicht mehr kritisch zu bedenken. Ich sagte mir: Die Juden sind die Feinde des neuen Deutschland. […] Mit diesen und ähnlichen Gedanken konstruierte ich mir eine Rechtfertigung des Pogroms. Im Übrigen verdrängte ich die Erinnerung daran möglichst schnell aus meinem Bewusstsein.“490 Gleichgültigkeit, Passivität und Verdrängung thematisieren zahlreiche Erinnerungsberichte. Ein ehemaliger Jungvolkführer aus Dresden – aufgewachsen, wie sein Nachlass dokumentiert, in einer durch und durch braunen Familie – schrieb Jahrzehnte später, die Pogrome hätten in seinem direkten Umfeld überall Zustimmung gefunden: „Wir hier in der Südvorstadt hörten erst am nächsten Tag davon – und es war allen klar, die Juden sind unser Unglück und sollen verschwinden.“491 Aber symptomatisch für die Memoiren gerade des höheren HJ-Kaders war, dass sie zwischen der Hitlerjugend als Gesamtorganisation und den Pogromen keine direkte Verbindungslinie zogen. Axmann behauptete: „Die Hitlerjugend hatte an diesen Ausschreitungen nicht teilgenommen.“ Und mehr: „Nie hatte ich damit gerechnet, dass die antijüdische Einstellung zu Vorkommnissen wie in der Reichskristallnacht führen könnte.“492 Man präsentierte die Gewalt stets als ein eruptives Ereignis, das der positiven Erziehungsleistung der Hitlerjugend entrückt schien. Nicht zuletzt mit Hinweis auf jene Anweisungen, welche die Mitglieder zum Gewaltverzicht anhielten, behaupteten die Funktionäre im Nachhinein, dass man von aller Schuld und Verantwortung für den Terror frei sei. Was konnte man der Hitlerjugend denn anlasten, waren doch die sogenannten Einzelaktionen immer wieder verboten worden. Axmann, Rüdiger oder Luise Michel, nach 1939 Leiterin in der Akademie der Jugendführung in Braunschweig, haben in dieser Weise argumentiert. Die „Untaten“ seien ohne anhängig gemacht worden ist, auf keinen Fall in eine Gliederung der Partei überwiesen werden dürfen. Es ist stets der Abschluss des Verfahrens abzuwarten.“ Vgl. HJ-Disziplinarverfahren. In: GB: Pommern, A10/38 vom 1.12.1938. 489 Wolfgang Diewerge, Heuchelei um einen Mörder. In: Wille und Macht, (1939) 1. 490 Maschmann, Fazit, S. 58. 491 Aus den Erinnerungen von Siegfried B., S. 10, privater Nachlass, Album 1 (Archiv des HAIT). 492 Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 220 und 225.
230
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Wissen oder Billigung der RJF durch allzu radikale Elemente der Partei angetrieben worden.493 „Was immer geplant war“, behauptete nicht zuletzt Baldur von Schirach in seinen Memoiren, „die Hitler-Jugend wollte ich aus diesem undurchsichtigen Komplott heraushalten. […] Wir waren uns sofort einig, was zu unternehmen sei. Rundspruch an alle Gebietsführer – die HJ darf sich an keinerlei Aktionen der Partei und der SA gegen Juden beteiligen.“494 Die Argumentation hatte Schirach bei den ersten Verhören in Nürnberg im Oktober 1945 bereits vertreten, obgleich er die Beteiligung einzelner von der SA instruierter Jugendlicher nicht anzweifelte.495 Die Verbotsorder, auf die er sich berief, ist nicht überliefert. Die Gebiete gaben unmittelbar nach den Pogromen auch keine derartige Anweisung der RJF nach unten weiter. Apologeten vertreten ungeachtet dessen bis heute die Ansicht, sie sei schriftlich nachgewiesen.496 Schirach, der nie einen Zweifel daran ließ, dass er die Juden für „Volksschädlinge“ hielt, meinte in seinen Memoiren, dass er auf „anständige Weise“ Antisemit habe sein wollen.497 Nähme man hypothetisch an, dass es seine Novemberanweisung tatsächlich gegeben hat – immerhin, sie stünde ja durchaus in einer Kontinuität zu anderen Weisungen und Gewaltverboten ähnlichen Inhalts: Sein Einfluss auf die Masse der Unterführer und ihrer Formationen war dann offenbar nicht groß genug, um nach dem 9. November überhaupt mäßigend wirken zu können. Die Hitlerjugend war nicht das hierarchisch geführte Gebilde, das die RJF zu kontrollieren vorgab. Obendrein war der Gewaltverzicht, auf den man öffentlich und intern beharrte, im Zweifelsfall eben kaum mehr als ein Lippenbekenntnis. Nicht einmal die skandalösen Taten des HJ-Gebietsführers Klein, der in München die Aktionen angetrieben hatte, bildeten für Schirach einen Grund, um dessen Entlassung zu betreiben; das Parteiverfahren, das gegen Klein im Dezember 1938 anlief, offenbart, dass er von einem Verbot, das Schirach durchgegeben haben wollte, entweder nicht wusste oder aber sich nicht daran gebunden fühlte.498
493 So Luise Michel im Interview mit Martin Klaus, 28.2.1981, abgedruckt bei Rüdiger, Richtigstellung, S. 87–100, hier 98: „Ich hielt die Angriffe und Ausschreitungen für Untaten, die von einzelnen radikalen Elementen der Partei […] durchgeführt worden waren. Die Hitler-Jugend war nicht daran beteiligt und verurteilte sie.“ 494 Baldur von Schirach, Ich glaubte an Hitler, Hamburg 1967, S. 244. 495 Vgl. Aussagen Schirachs zum Novemberpogrom 1938 beim Verhör in Nürnberg durch Col. Thomas S. Hinkel vom 11.10.1945, S. 18 f. (NARA, M1270, 647749, unpag.). 496 Vgl. beispielsweise in der geschichtsrevisionistischen Publikation von Heinrich Wendig (Hg.), Richtigstellungen zur Zeitgeschichte, Nr. 15, Tübingen 2003, darin der Artikel „Lügen über die Hitler-Jugend“, S. 13 f., der Zitate eines Beschwerdebriefs von Günther Kaufmann, dem ehemaligen Pressechef der RJF, an das ZDF enthält. Zu diesem Brief vgl. auch dessen eigene Publikation: Günther Kaufmann, Ein anderes Drittes Reich, Berg 2001, S. 117–123. 497 Schirach, Ich glaubte an Hitler, S. 244. 498 Vgl. Buddrus, „Wir fahren zum Juden Geld holen“, S. 66 und 70 f.
Die Hitlerjugend und die Judenverfolgung
231
Schirachs Verteidigung beim Nürnberger Prozess, wo er im Mai 1946 ähnlich argumentierte, die Hitlerjugend als Gesamtorganisation sei in die „Aktionstage“ nicht involviert gewesen, konnte die Realität deshalb nicht ansatzweise treffend und nur apologetisch beschreiben.499 Was durch rassenideologischen Eifer und ein ungeschriebenes Recht zur Selbstermächtigung legitimiert schien, lag jenseits von staatlicher Rechtssetzung und juristischen Normen. Die „Volksgemeinschaft“ konstituierte sich über Verfolgung und Exklusion des vermeintlich Gemeinschaftsfremden, über eine Dynamik der Gewalt, die auf Selbstermächtigung vieler „Volksgenossen“ – sogar unter Einschluss der Kinder und Jugendlichen – beruhte.500 Im Fall der Hitlerjugend tritt aber noch die Besonderheit des Prinzips „Jugend führt Jugend“, das die RJF aus ideologischen Motiven soweit wie möglich aus der „Kampfzeit“ bis in den Krieg hinüberzuretten versuchte. Und das konnte für die soziale Praxis vor Ort bedeuten: Unterführer, darunter sogar Kinder und Jugendliche im Alter von nicht einmal 15 oder 16 Jahren, setzten aus eigenem Antrieb und manchmal im eigenen Ermessen um, was sie von oben, durch einen angeblichen „Führerwillen“ oder ihre neue Weltanschauung gedeckt sahen – ungeachtet dessen, was die Anweisungen auf dem Papier Gegenteiliges besagten oder wenigstens bislang besagt hatten. Ein beispielhafter Fall beschäftigte die Staatsanwaltschaft in Frankfurt 1940: „Neun Jungen im Alter von 15–17 Jahren begehen unter Führung eines 18-jährigen planmäßig Straßenraub an Juden unter Ausnützung der Dunkelheit und unter Verteilung der Rollen. 5 Fälle wurden nachgewiesen.“501 Der Dresdner Sozialpsychologe Peter Brückner traf im Rückblick auf seine Hitlerjugend-Zeit mit einem knappen Satz viel Wahrheit: „Individuen durften noch zerstörerisch sein auf eigene Faust.“502 Die Dynamik und das Wechselspiel aus Selbstermächtigung, Gewalt und Rechtsbrüchen legte der Novemberterror 1938 endgültig offen: „Traurig ist das Los der wenigen Juden, die jetzt noch in den Städten leben“, schrieb ein Sozialdemokrat aus dem Saarland über die Tage, die auf die Pogrome folgten: 499 „Es ist die Hitler-Jugend als größte nationalsozialistische Organisation überhaupt nicht eingesetzt worden bei diesen Judenpogromen des 9., 10., 11. November 1938. […] Das einzige, was ich gehört habe, war, dass hier und da einzelne Jungens oder Gruppen von Jungens durch örtliche Stellen, nicht der HJ, auf die Straße gerufen wurden. Sie sind aber von den Jugendführern in den meisten Fällen wieder nach Hause geschickt worden. Ein Einsatz der Organisation hat nicht stattgefunden.“ Vernehmung Schirachs im Nürnberger Prozess, Hauptverhandlungen, Tag 138, 24.5.1946; Internationaler Militärgerichtshof Nürnberg (Hg.), Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Gerichtshof Nürnberg, Bd. 14, Nürnberg 1947, S. 461–495, hier 464. 500 Vgl. Michael Wildt, Volksgemeinschaft als Selbstermächtigung. Gewalt gegen Juden in der deutschen Provinz 1919 bis 1939, Hamburg 2007, S. 281 und 374; sowie Beiträge bei Detlef Schmiechen-Ackermann/Marlis Buchholz/Bianca Roitsch/Christiane Schöder (Hg.), Der Ort der „Volksgemeinschaft“ in der deutschen Gesellschaftsgeschichte, Paderborn 2018. 501 Generalstaatsanwalt, Anlage: Ein Bericht des Jugendamtes nach dem Stand vom Juli 1940 vom 3.8.1940. In: Klein/Uthe (Hg.), Lageberichte der Justiz aus Hessen, S. 157– 162, hier 160. 502 Peter Brückner, Das Abseits als sicherer Ort, Berlin 1980, S. 15.
232
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
„Sie können sich […] nicht mehr blicken lassen. Sobald sich einer blicken lässt, laufen ihm Scharen von Kindern nach, spucken nach ihm, werfen mit Dreck und Steinen oder bringen ihn durch das ‚Einhaken‘ der Beine mit gebogenen Stöcken zu Fall. Der […] Jude darf kein Wort sagen, sonst gilt das als Bedrohung der Kinder. Die Eltern haben nicht den Mut, die Kinder zurückzuhalten, weil sie Schwierigkeiten befürchten.“503 Noch mindestens zwei weitere Male – zunächst Mitte 1940 und schließlich erneut im Mai 1941 – gab Reichsjugendführer Axmann, Schirachs Nachfolger, und die RJF per Rundschreiben die Anweisung: Allen „Angehörigen der HitlerJugend [ist] verboten worden, an irgendwelchen Maßnahmen der sogenannten Volksjustiz teilzunehmen, und zwar auch dann, wenn ihre Beteiligung von anderen Dienststellen gefordert wird. […] Die Führer der Gebiete sind für die Einhaltung in ihrem Befehlsbereich persönlich verantwortlich.“504 Zu Unrecht haben historische Studien über die Hitlerjugend oder die Novemberpogrome derlei Anweisungen übergangen. Ihre Aussagekraft ist erheblich – einerseits in Hinblick auf den realen Einfluss der RJF, der an der Basis immer wieder schnell an Grenzen stieß; andererseits in Hinblick auf die ideologische Schizophrenie, welche die NS-Diktatur bisweilen prägte. Die Verrohung, welche die Hitler jugend-Pädagogik selbst förderte, war für höhere Dienststellen unmöglich zu kanalisieren. Im Ernstfall blieben die Anweisungen des Führerkorps wirkungslos. In einem verbrecherischen System, dessen integraler Bestandteil die Hitler jugend war, waren Verbote über die Anwendung von Gewalt inkonsequent. Weil die Hitlerjugend mit ihrem Selbstführungsprinzip auf den Handlungen von jungen Menschen ruhte, darüber hinaus ihre organisatorischen Strukturen vielerorts und in den Kriegsjahren fragil blieben, konnte die Spannbreite im Alltag dennoch weit ausfallen. Wenn Hitlerjugend-Angehörige am antisemitischen Terror keinen unmittelbaren Anteil nahmen, nur Beobachter blieben oder sich der Eskalation gar verweigerten, dann gewiss nicht zuerst deshalb, weil etwa Ausschreitungen offiziell untersagt gewesen wären. Auch diese Jugendlichen handelten im eigenen Ermessen. Helmut Schwarz, als „Halbjude“ im Oktober 1942 seines Gymnasiums in Freiburg verwiesen, hatte seine Schulfreunde – die der Jugendorganisation allesamt angehörten – deshalb in guter Erinnerung: „Doch die ganze Klasse begleitete mich auf dem Rückweg durch die Stadt, vorbei am Zeitungsverkäufer, der das Naziblatt ‚Der Alemanne‘ anbot. Einige brachten mich bis an die Haustür. […] Auf diese Freundschaften war Verlass.“505
503 Bericht aus Saarpfalz, A 31. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 5 (1938), S. 1190. 504 Zit. aus dem Gebietsrundschreiben RJF 14/41 vom 6.5.1941, das wiederum auf ein Rundschreiben der RJF, Nr. 63/40, mit selbigem Inhalt verweist, abgedruckt in: Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 8: Allgemeines Verhalten, S. 638. 505 Interview mit Helmut Schwarz von David Weigend. In: Fudder. Neuigkeiten aus Freiburg vom 10.11.2009 (http://fudder.de/reichspogromnacht-in-freiburg-ein-augenzeuge- erinnert-sich; 11.7.2019). Vgl. im Zusammenhang auch Bernd Spitzmüller (Hg.), „Aber das Leben war unvorstellbar schwer.“ Die Geschichte der Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen in Freiburg während des Zweiten Weltkriegs, Freiburg 2004.
Die Hitlerjugend und die Judenverfolgung
233
Die Hitlerjugend stellte einen von Ideologie und Rassismus geprägten Sozialisationsraum dar, aber sie war keine homogene oder überall durch die RJF straff gelenkte Massenorganisation. Ihre Mitglieder waren nach 1933 ebenso freiwillig und begeistert wie durch Gleichschaltung und Anpassungsdruck hineingekommen: Töchter und Söhne aus christlichen oder linken Elternhäusern, einige darunter ehemalige Gegner, Überläufer, Fahnenflüchtige, die ihre eigenen und mitunter konfusen Vorstellungen mitbrachten, wie diese angeblich revolutionäre Jugendbewegung aussehen sollte. Manche der ehemaligen Gegner trugen sogar Führungsverantwortung im Alltag. Es gab die Radikalen, die früh in der Hitler-Bewegung gestanden hatten oder die durch Schulungen mit der Zeit geformt wurden. Aber auch Mitläufer, Gelangweilte und Desinteressierte, die den Dienst mitsamt Schulungen für ein notwendiges Übel hielten, waren zahlreich. Ihr Anteil stieg in den 1930er-Jahren eher, als dass er abnahm, weil die RJF bei der rigiden Durchsetzung ihres Totalitätsanspruchs auf sogenannte Selektion und Siebung notwendigerweise verzichten musste. Eine Millionenorganisation, deren Unterführer weder alle gleich dachten noch gleich handelten, mit einem erratischen Führerkorps in der Mitte und an der Spitze, das Anweisungen durchgab, die vor der Wirklichkeit selten Bestand hatten. Wie sich dieses Gebilde, das einen gewissen Grad an Fragilität besaß und Widersprüche aufzeigte, dennoch in die Logik des Systems einzupassen vermochte, erscheint als das eigentlich Merkwürdige, das einer Erklärung bedarf. Lange ist vom „Dritten Reich“ als einem „Führerstaat“ gesprochen worden. Damit war assoziativ gemeint, dass fast alles durch die Partei angewiesen, gar von Hitler dirigiert oder zumindest auf ihn rückbezogen worden sei. Die Diktatur ist zutreffender als eine rassistische Willkürherrschaft beschrieben. Auf der einen Seite eröffnete sie Möglichkeiten und schuf das Potenzial und die Räume für Selbstermächtigung.506 Die soziale Praxis auf der anderen Seite war stets von Widersprüchen gekennzeichnet, legte Ambivalenzen ebenso wie breite individuelle Handlungsoptionen offen. „Die Forschung der letzten 20 Jahre“, so Wolf Gruner, „hat gezeigt, dass mehr Spielräume für individuelles Handeln in fast jedem gesellschaftlichen Bereich bis in den Krieg hinein bestanden, als sich unsere Schulweisheit hatte träumen lassen. Diese Handlungsspielräume stellten einen wichtigen Faktor für die Radikalisierung und Effizienz des NS-Regimes, aber auch für die Widersprüchlichkeit und Komplexität seiner Politik dar.“507 Die Diktatur konstituierte sich nicht nur über und in Hierarchien, sondern sie war manchmal gerade durch die Abwesenheit von Ordnung, Rechtssetzung und staatlicher Lenkung gekennzeichnet. Auch die Hitlerjugend sollte zwar eine homogene, ideologisch und rassistisch getrimmte Verfügungsmasse für den Staat bilden, aber womöglich war sie eine der am wenigsten durchherrschten, gelenkten und in Hinblick auf ihre Mitglieder homogenen Massenorganisation der Diktatur. 506 Vgl. Wildt, Volksgemeinschaft als Selbstermächtigung, S. 375 f. 507 Wolf Gruner, Das Dogma der „Volksgemeinschaft“ und die Mikrogeschichte der NS-Gesellschaft. In: Schmiechen-Ackermann/Buchholz/Roitsch/Schröder (Hg.), Der Ort der „Volksgemeinschaft“, S. 71–92, hier 83.
234
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
4.
Die Heimbeschaffung
4.1
Die Situation der ersten Jahre
Kaum ein anderes Thema trieb die Organisation in den 1930er-Jahren so sehr um wie die Aktion zur Heimbeschaffung. Offiziell rief die RJF sie Anfang 1937 aus. Zur Mitte des Jahrzehnts war die Parteijugend, vor allem auf dem Land, wo sich ihre Strukturen weiter im Aufbau befanden, und selbst in Metropolen, mehr eine Baracken- und Scheunenjugend, deren Dienststuben selten Glanz ausstrahlten. „Der Keller mit Kerzenbeleuchtung“, berichtete Günter de Bruyn über den ersten Jungvolkheimabend, den er in Berlin 1938 besuchte, „hatte außer gekreuzten Reitersäbeln nichts Preußisches, obwohl der ‚Stamm‘ nach Friedrich dem Großen hieß.“508 Und Wilhelm Tröndle, der in Freiburg 1936 zur HJ stieß, tat seinen ersten Dienst in der Lagerhalle eines Güterbahnhofs.509 Von miefigen Kellern, Bahnwagons und anderen wenig präsentablen Orten war in der Propaganda selten zu lesen. Im günstigen Fall konnten Formationen auf Räumlichkeiten in Gaststätten, Klassenzimmern oder von der Partei zurückgreifen, aber der Dienst in Kasernen, Lagerhallen, Scheunen oder Kellern war keine Seltenheit. In einem Dorf unweit von Sinsheim hatte man die Hitlerjugend – entgegen allen offiziellen Vorschriften über das Rauchen – in einer stillgelegten Zigarettenfabrik einquartiert.510 In Lippe bot 1934 ein Teil einer Konservenfabrik Obdach.511 Im Ruhrgebiet 1938 nutzen mehrere Einheiten Garagen für ihre Heimabende.512 Zu einer Kleinstadt im Erzgebirge hieß es Mitte 1938: „Jungen und Mädels hausen in einem von Modergeruch erfüllten schmalen, alten Fabrikraum. […] Der Zustand ist für über 11 000 Angehörige der Hitlerjugend auch auf kürzere Zeit nicht mehr tragbar.“513 Über eigene Bauten, oder gar monumentale Zentralen, verfügte die Parteijugend nur in Großstädten. Fälle wie in Altenburg, wo man bereits im Oktober 1931 ein „KurtGruber-Heim“ feierlich eingeweiht hatte, waren die Ausnahme.514 Die höheren
508 Bruyn, Zwischenbilanz, S. 87. 509 Interview mit Wilhelm Tröndle, „Ich durfte zweimal leben …“. In: Hainmüller, Freiburgs Hitler-Jugend, S. 69–78, hier 69. 510 Vgl. Mitteilung des Bürgermeisters von Eschelbach an das Badische Bezirksamt Sinsheim vom 12.5.1938 (GLA Karlsruhe, 465c, 23587, unpag.). 511 Zum Heimbau in Lippe vgl. Pahmeyer/Spankeren, Die Hitlerjugend in Lippe S. 130– 155. 512 Vgl. Vertragswesen. In: GB: Westfalen, 10/38 vom 1.7.1938. 513 Der Bezirksverband der Amtshauptmannstadt Schwarzenberg an die Sächsische Staatskanzlei, betrifft Grenzlandfonds 1938 vom 1.6.1938 (StA Chemnitz, 30049, 1389, Bl. 1). Vgl. auch Amtshauptmann an die Gebietsführung der HJ Sachsen vom 29.8.1938: „Die Zustände […] in Eibenstock sind dem Gebiet zur Genüge bekannt. Sie spotten tatsächlich aller Beschreibung und beeinträchtigen ernstlich den Fortgang der Hitlerjugend-Arbeit in dieser Stadt.“ Ebd., Bl. 8. 514 Vgl. Postert, Hitlerjunge Schall, S. 83.
Die Heimbeschaffung
235
HJ-Dienststellen befanden sich mehrheitlich in Gebäuden, die 1933 besetzt worden waren. In Solingen beispielsweise hatten sich HJ- und SA-Führung in einem katholischen Jugendhaus einquartiert. Im August 1935 überfielen katholische Sturmscharangehörige dieses Gebäude. Die Tische, Bänke und Stühle waren zertrümmert und eine Gedenktafel, die an ermordete Hitlerjungen erinnerte, zerstört worden. „Wir nehmen Rache, die Sturmschar“, hatten die Eindringlinge an die Wände geschrieben.515 Solche Provisorien wie Keller, Klassenzimmer und Scheunen konnten der RJF auf Dauer nicht ausreichen. Die schwierige Situation sollte ab 1937 durch ein halbstaatliches Heimbauprogramm bereinigt werden: „Es werden […] Jugendheime im wahrsten Sinne des Wortes, in denen sich besonders der Jungarbeiter“ heimisch fühle, so RJF-Stabsführer Lauterbacher Anfang 1936 bei einer Tagung in Hamburg.516 Die zu schaffenden Heime sollten zu wahren Stätten nationalsozialistischer Erziehung und Schulung werden. Ein Architekt aus der RJF umriss das Ziel: „Durch die Räume der Jugend gehen unsere Jungen und Mädel in ihrem empfänglichsten Alter. Acht Jahre erfüllen sie den Dienst […] Was sie in dieser Zeit denken und empfinden, bestimmt später einmal ihr Handeln. Nicht in engen kitschüberladenen Wohnungen, sondern in weiten und lichten Räumen, die den Geist einer unbedingten Klarheit und Ehrlichkeit atmen, kann der Mensch frei, stolz und aufrecht heranwachsen und die notwendige Kraft für die Formung seines Inneren schöpfen.“517 Der Anspruch, den die Hitlerjugend formulierte, war riesig: Wie es in jedem Stadtteil Schulen gab, welche die Jugend für das Leben erzogen, sollte in ferner Zukunft jeder Stadtteil über ein Heim für die Erziehung durch die Hitlerjugend verfügen. Der Anfang sah allerdings ganz anders und vielmehr kläglich aus. Nach 1933 hatte die Hitlerjugend versucht, aus der Not eine Tugend zu machen. An ein größeres Heimbauprogramm war noch nicht zu denken. Die Kinder und Jugendlichen sollten ihre Unterkünfte mithin selbst herrichten. In Recklinghausen z. B., wo man im Frühjahr 1933 ein Jugendhaus der verbotenen SAJ okkupiert hatte, war man nicht wählerisch. Man ging mit Idealismus an die Aufgabe heran. Durch das Wachstum der Parteijugend während der Gleichschaltung 1933/34 stieg zugleich der Bedarf an Räumlichkeiten rasant an. Der ließ sich mit dem ehemaligen SAJ-Heim allein aber nicht decken. Keine schlüsselfertigen Komfortheime benötige man, selbst irgendein unbenutzter Raum erfülle sämtliche Wünsche, denn der Ausbau der Unterkünfte werde zur Leistung und Aufgabe der HJ-Mitglieder, so tat man nach außen kund.518 Das war lediglich Propaganda. Die Hitlerjugenddienststellen gingen früh dazu über, von den Kommunen und Jugendämtern Unterstützung bei der Beschaffung von Räumlichkeiten einzufordern. Mal zeitigte das mehr, meist
515 HJ-Heim verwüstet. In: Hamburger Anzeiger vom 6.8.1935. 516 Stellvertreter des Reichsjugendführers in Hamburg. In: Altonaer Nachrichten vom 15.1.1936. 517 Walter Paelke, Die Räume der Jugend. In: Innendekoration, (1939) 8, S. 249. 518 Vgl. Vogt, Vestische Hitlerjugend, S. 295.
236
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
eniger Erfolg. In Weimar hatte die Hitlerjugend im Sommer 1933 versucht, w über den Umweg des gleichgeschalteten RddJ an Räumlichkeiten zu kommen. Man war rücksichtlos genug, um einen größeren Teil der Messhalle zu fordern, der in den Wintermonaten eigentlich für die Unterbringung von Obdachlosen vorgesehen war; es sei aber „viel wesentlicher, und vor allem auch wertvoller, den Weimarer Jugendverbänden Räumlichkeiten in entsprechender Anzahl […] zur Verfügung zu stellen“.519 Das Ausüben von Druck auf die Stadtverwaltungen und Bürgermeister gehörte zum typischen Vorgehen der Dienststellen. Für eine BDM-Führertagung verschiedener mitteldeutscher Gaue, zu der man mit der Anreise von rund 1 000 Führerinnen rechnete, sollte die Stadt Weimar im Mai 1934 weit über 40 Quartiere kostenlos zur Verfügung stellen; gelinge das nicht, sei dies ein „Armutszeugnis und würde uns veranlassen, unsere Jugendkundgebungen in gastfreundlichere Städte zu verlegen“.520 Die Hitlerjugend schlug stets einen drohenden Tonfall an, wenn sie Räume für irgendeinen Zweck, Übungsplätze, finanzielle Zuschüsse oder neue Dienststellen beanspruchte. Die Thüringer Gebietsführung, deren Diensträume für HJ und BDM im Frühjahr 1934 noch immer über halb Weimar verstreut waren, forderte gegenüber dem Bürgermeister den räumlichen Ausbau ihrer Dienststelle – ebenfalls ein zuvor besetztes Jugendhaus – sowie den Anbau eines weiteren Gebäudes, das an das Grundstück grenzte; würde die Stadt einen Zuschuss von 150 000 Reichsmark nicht zahlen, müsste die Gebietsführung ihren Sitz gezwungenermaßen in eine andere Stadt verlegen, die angeblich schon ein gutes Angebot unterbreitet hätte.521 Wie in anderen Fällen, versuchte auch diese Kommune dem Druck, den die Hitlerjugend ausübte, nicht nachzugeben; man unterbreitete Gegenangebote, schlug die Nutzung anderer Räumlichkeiten vor, wies außerdem auf die Gesetzeslage hin, die es unmöglich mache, solche Summen zu zahlen. Tatsächlich stand das Reichsministerium des Innern per Verfügung vom 3. März 1934 auf dem Standpunkt, dass „die Gewährung von geldlicher Unterstützung von Gliederungen der Partei nicht zu den Aufgaben der Gemeinden gehört und daher zu unterbleiben“ habe.522 Die Hitlerjugend sah sich meist vor verschlossenen Türen, zumal sich in der städtischen Bürokratie herumgesprochen hatte, wie HJ-Formationen mit fremdem Eigentum umgingen, und weil Kommunen nicht bereit waren, große Finanzmittel für die Belange einer Par teigliederung – das Hitlerjugend-Gesetz von 1936 war Zukunftsmusik – zur Verfügung zu stellen. In Weimar teilte die Stadtgemeinde der Hitlerjugend im
519 Ortsausschuss Weimar der deutschen Jugendverbände, Vorsitzender f. W. Emil Schatz, an die Stadtverwaltung, vom 11.6.1933 (StadtA Weimar, 16, 100-06, 5, unpag.). Vgl weitere Dokumente um den Bau oder die Anmietung von Räumen, ebd. (12, 7-73-45, unpag.). 520 Eingabe mit dem Titel Freiquartiere für den BDM!, ungezeichnet vom 4.5.1934 (ebd.). 521 Vgl. Gebietsführer von Thüringen an den Bürgermeister von Weimar vom 12.7.1934 (ebd.). 522 Zum speziellen Fall und zit. aus der genannten Verfügung siehe Stadtvorstand Weimar an die Hitler-Jugend, Gebiet 17 vom 6.9.1934 (ebd.).
Die Heimbeschaffung
237
Sommer 1934 folglich mit, dass man „mit Rücksicht auf die ministeriellen Verfügungen nicht in der Lage [sei], einen Zuschuss zu gewähren“.523 Die ablehnende Haltung der Weimarer Stadtverwaltung war keine Ausnahme. Darüber hinaus gab es fortwährend Auseinandersetzungen um Mieten, Unterhalt und Einrichtung. Die Führung in Württemberg beispielsweise intervenierte im Oktober 1936 beim Bürgermeister einer Kleinstadt, weil die ihr zugeteilten Räumlichkeiten angeblich nicht eingerichtet worden waren und deshalb für die Jugend völlig unbenutzbar seien: „Der HJ selbst ist es unmöglich, aus eigenen Mitteln diese Dinge zu beschaffen und auch vonseiten der Gebietsführung stehen zur Heimeinrichtung und zum Heimbau keine Mittel zur Verfügung. Es ist nun einmal Sache des [betreffenden] Bürgermeisters, […] für geeignete Heime zu sorgen, genauso, wie es Sache einer Stadt ist, Schulen oder Kirchen und so weiter zu bauen.“524 Ob die Jugendorganisation bei der Beschaffung von Dienststellen, Sportplätzen und Räumen für ihre Formationen Erfolge vorweisen konnte, hing vom Kooperationswillen der Kommunen und des jeweiligen Bürgermeisters ab. War es, wie in der Kleinstadt Barth in Vorpommern, wo 1936 ein „Hans-MallonHeim“ – der Name eines in der Weimarer Republik getöteten Hitlerjungen – eingeweiht wurde, zu Neubauten gekommen, standen meist persönliche Bande, eifrige Parteisoldaten in der Stadtverwaltung oder aber charismatische HJ-Führer im Hintergrund. Manchmal spielten auch besondere Motive eine Rolle. In Cuxhaven unterstützte die Stadtverwaltung 1937 den Bau eines zweiten Hitlerjugendheims eigens für die Marine-HJ, weil gerade diese Sonderformation an einem Standort an der Nordsee besonders gefördert gehöre. In der Kommunalverwaltung sah man das Projekt als Prestigeangelegenheit, mit der sich werben ließ. Und nahe Düren, wo die NSDAP zeitgleich auf eine Jagdgenossenschaft eingewirkt hatte, konnte die Hitlerjugend von den Pachteinkünften der Landwirte, die das Bauprojekt unterstützten, Profit schlagen.525 Eine Grundlage, um die Hitlerjugend mit Neubauten überall in Deutschland zu versorgen, boten aber allein persönliche Bande und die Unterstützung durch die Partei und einzelne Kommunen nicht. Es traf kaum die Realität, wenn die RJF 1943 behauptete, ungeheuer viele Gemeinden hätten sich vor 1937 mit „ihrem Hitler-Jugend-Heim ein Denkmal der nationalsozialistischen Gesinnung gesetzt“.526 Dafür bedurfte es staatlicher Rückendeckung in Form eines Gesetzes, wie es 1939 in Kraft trat.
523 Aus der Sitzungsniederschrift des Grundbesitzausschusses vom 20.8.1934 (ebd.). 524 Hitler-Jugend Gebiet Württemberg an das Bürgermeisteramt der Stadt Besingen vom 22.10.1936 (StA Ludwigsburg, PL 509, Bü 25, unpag.). 525 Hinweise entnommen bei Franz Wegener, Barth im Nationalsozialismus, Selbstverlag 2016, S. 111. Vgl. im Zusammenhang auch Cuxhaven. Ein weiteres HJ-Heim. In: Hamburger Nachrichten vom 16.4.1937; sowie HJ-Heim aus Jagdpachtanteilen. In: Die Fanfare. Hitler-Jugend-Zeitung für das Gebiet Mittelrhein, (1937) 3, S. 4. 526 Heimbeschaffung. In: Das Junge Deutschland, (1943) 38, S. 29.
238
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Viele Beispiele zeigen, dass sich die Hitlerjugend erstaunlich schroffe Absagen seitens der Kommunen einhandelte.527 Der Bürgermeister einer Kleinstadt in Baden zeigte sich im Mai 1936 gegenüber der Hitlerjugend besonders angriffslustig. Noch sei hier kein Heim errichtet worden, wie er dem Bezirksamt mitteilte. Man dürfe auch in Zukunft nicht mit dem Bau eines HJ-Heims rechnen. Unverkennbar, dass es nicht nur um die Finanzierung ging. Von der Parteijugend hielt der Bürgermeister wenig: „Die HJ war bis vor ungefähr einem Jahr im früheren Amtsgefängnis untergebracht. Durch ihr ungebührliches Verhalten und Sachbeschädigung war es nicht mehr möglich, ihnen dieses Gebäude zur Verfügung zu stellen. [Zur Zeit] hält die HJ ihre Heimabende im Zeichensaal der Gewerbeschule ab.“528 Die Situation gestaltete sich je nach Ort und Lage sehr unterschiedlich. Das Gebiet Westfalen zog gegenüber den Bürgermeistern 1935 ebenfalls eine kritische Bilanz: Würde man eine Statistik über die Heime der Jugend veröffentlichen, würde diese „für viele Gemeinden ein geradezu niederschmetterndes Ergebnis zeigen“.529 Aus Sicht der Jugendorganisation war es ein unmöglicher Zustand, wenn es beispielsweise in den Aufzeichnungen eines Jungmädels aus Hameln 1935 lautet: „Wir mussten am Heim antreten. Eigentlich ist es gar kein Heim. Wir haben wohl ein paar Stühle und einen Tisch, auch haben wir Bilder und einen kleinen Schrank drin, aber es regnet durch. Wir haben auch keinen Ofen, dass wir Feuer anmachen können, dann ist es immer fürchterlich kalt.“530 Für die Hitlerjugend war die Heimbeschaffung nicht nur eine Prestigefrage, die ihre Stellung im „Dritten Reich“ berührte. Sie war insbesondere deshalb zu lösen, weil die Organisation weiter wachsen und Erfolge absichern musste: „Viele Angehörige gerade des Jungvolks sind […] im Winter wieder zu den konfessionellen Jugendverbänden zurückgekehrt und viele haben während des Winters deshalb noch nicht zur Hitlerjugend gefunden“, hatte die Gestapo in Aachen im März 1934 festgestellt, „weil die konfessionellen Jugendverbände über bessere […] Heime, insbesondere die Pfarrheime, verfügen.“531 Eine solche Lage durfte nicht wieder eintreten. Die Heimbeschaffung und der Status der Hitlerjugend als Staatsjugend hingen direkt zusammen.
527 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 997. Vgl. auch Karl-Werner Goldhammer, Katholische Jugend Frankens im Dritten Reich: Die Situation der katholischen Jugendarbeit unter besonderer Berücksichtigung Unterfrankens und seiner Hauptstadt Würzburg, Münster 1987, S. 90–105. 528 Der Bürgermeister von Eppingen an das Badische Bezirksamt vom 5.5.1938 (GLA Karlsruhe, 465c, 23587, unpag.). 529 Vorhandene und notwendige Heime. In: Unsere Fahne. Zeitschrift der westfälischen HJ, Sonderausgabe: Schafft Heime, Dortmund 1935, S. 14. 530 Heimbuch der Jungmädelschaften I und II der Jungmädelgruppe Hameln (1935–1938), Teil 2, S. 5 (NSDOK Köln, EzG, jugend1918-1945.de; 12.2.2017). 531 Lagebericht der Gestapo Aachen an das Geheime Staatspolizeiamt Berlin vom 5.3.1934. In: Vollmer, Volksopposition im Polizeistaat, S. 32.
Die Heimbeschaffung
4.2
239
Die Hitlerjugend im Konflikt mit Gemeinden
Am 1. September 1936 hatte die RJF nach monatelangen Vorbereitungen einen „Arbeitsausschuss für die Hitlerjugend-Heimbeschaffung“ eingerichtet. Neben Schirachs Stellvertreter Lauterbacher gehörten zur Ausschuss-Leitung: der Vertreter des Reichsschatzmeisters, Willy Damson, und Georg Usadel vom Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung sowie je ein Vertreter des Deutschen Gemeindetags und des Innen- und Propagandaministeriums. Der Ausschuss trug die Verantwortung für das gesamte HJ-Heimbauprogramm.532 Auf Gebietsebene wurden Beauftragte ernannt sowie Heimbau-Arbeitsgemeinschaften eingerichtet, welche die HJ-Führer vor Ort mit Vertretern aus Partei, Staat und Gemeinden zusammenführten. Zu Vorbereitungen, wie der politischen Schulung von Architekten oder den konkreten Planungen für neue Bauten, die auf regionaler Ebene seit Längerem vorangetrieben wurden, hielt man sich nach außen bedeckt, bis die RJF mit ihrem Plan an die Öffentlichkeit trat.533 Zunächst mussten die Dienststellen auf Ebene der Gebiete einen Überblick bekommen. Die jugendlichen Unterführer wurden mittels Fragebögen aufgefordert, spezifische Angaben über die Unterkünfte zu machen, selbst „wenn es sich nur um eine Scheune, einen Keller oder eine Waschküche handelt“.534 Mitte Januar waren die Vorbereitungen soweit gediehen, dass Schirach die Aktion offiziell ausrufen konnte. Nun stand auch das Jahr 1937 wieder unter einer Parole: Es sollte für die Hitlerjugend das „Jahr der Heimbeschaffung“ sein. Schirach gab das Ziel aus, „mindestens so viele Heime zu errichten, als zur Sicherung der Durchführung eines ordnungsmäßigen Heimabends in der Hitler-Jugend notwendig“ seien.535 Für ihr Mammutvorhaben hatte sich die RJF die Unterstützung durch den Reichsfinanzminister gesichert. Johann Ludwig Schwerin von Krosigk ließ Anfang 1937 wissen: Er sei einverstanden, dass „die in den Haushaltsplänen […] für Jugendpflege oder ähnliche Zwecke eingesetzten Mittel auch zur Gewährung von Zuschüssen für die Heimbeschaffung verwandt werden“ könnten.536 Die Kommunen wurden gewahr, dass sich die Gewichte zwischen Parteibelangen und Gemeindeinteressen zu ihren Ungunsten zu verlagern begannen. Der Bewegungsspielraum aufseiten der Reichsregierung zur
532 Vgl. Verordnungsblatt. Reichsjugendführung der NSDAP, Sonderdruck 1/37: Arbeitsrichtlinien des Arbeitsausschusses für HJ-Heimbeschaffung vom 7.1.1937; Einladungsschreiben Schirachs an Reichsleiter Fiehler zum Eintritt in den Arbeitsausschuss vom 6.3.1936 (StadtA München, BUR 452, 13, unpag.). 533 Vgl. Heimbeschaffungsaktion. In: GB: Sachsen, 12/36 vom 5.12.1936: „Alle Veröffentlichungen, die die Heimbeschaffung betreffen, sind bis dahin zurückzustellen, um dieser Aktion den notwendigen Erfolg zu sichern.“ Zur politischen Schulung von Architekten im Zuge Heimbeschaffung vgl. Architekten. In: GB: Thüringen, 8/36 vom 18.8.1936. 534 Fragebogen zur Heimbeschaffung. In: GB: Mittelrhein, 13/36 vom 5.12.1936. 535 Baldur von Schirach zur Heimbeschaffungsaktion der HJ. In: Deutsches Nachrichtenbüro vom 16.1.1937. 536 Nachrichtendienst des Deutschen Gemeindetages vom 21.3.1937.
240
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
eigenen finanziellen Förderung der Heimbeschaffung war durch die Konzentration auf die Rüstung indes gering.537 Die Gemeinden, denen die Finanzierung mehr und mehr zugeschoben wurde, traf die Belastung schwer. Allein in Thüringen ging es um die Summe von drei Millionen Reichsmark.538 Bei rund 20 000 Einwohnern, lautete die RJF-Rechnung, bestünde ein Bedarf von drei Heimen, ungefähr 16 Scharräumen. Landgemeinden mit bis zu 5 000 Einwohner sollten über ein Gebäude mit etwa sechs Scharzimmern plus Gemeinschaftsraum verfügen. Für Städte mit dichter Besiedlung, wo Anreisewege nicht weit seien, kämen größere zentrale Anlagen infrage.539 Die Prestigebauten wurden von der RJF besonders herausgestellt – wie jene in Pößneck im Saalekreis, eine riesige Anlage, oder ein sogenanntes Großheim in Weida, ein kasernenartiger Komplex mitsamt Sportgelände und Freibad. Beide Bauten konnten bis in den Krieg hinein nur teilweise realisiert werden.540 Ihnen fiel in erster Linie eine propa gandistische Bedeutung zu. In Wahrheit ging es jedoch um eine Vielzahl kleinerer Projekte in ländlichen Gemeinden und Kleinstädten. Dort benötigte die Hitlerjugend sie dringend. Die Führung des Gebiets Nordsee plante 1937 über 100 Neubauten.541 Das Gebiet Mittelland verkündete im Sommer 1938, für 24 neue Hitlerjugend-Heime sei der Grundstein gelegt.542 In Berlin sollten 149 Neubauten entstehen; 22 waren vom Magistrat 1936 genehmigt worden.543 Am 3. Mai 1937 hatte man die Heimbeschaffung mit einer Propagandaaktion eingeleitet: In 549 Gemeinden traten Einheiten der Hitlerjugend an, um die Grundsteinlegung für ihr Jugendheim zu feiern. Zur gleichen Zeit übertrug man die Rede Schirachs, der den Baubeginn des – zu damaliger Zeit gewaltigen – „Jugendgroßheims“ in Leipzig eröffnete; nach massiven Verzögerungen und explodierenden Kosten wurde es allerdings 537 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 996, der konstatiert, dass „die Baukosten der bis in die Kriegszeit hinein weiträumig geplanten HJ-Heimbauten nicht zu decken waren“ und 1937 „nur einige wenige Heime eingeweiht“ wurden, diese „aber mit großem propagandistischem Aufwand.“ 538 Vgl. Führertagung des Gebietes Thüringen der HJ. Die Heimbeschaffung geht in Thüringen in das zweite Stadium über. In: Allgemeine Thüringische Landeszeitung Deutschland vom 10.3.1937 (Zeitungsausschnitt aus StadtA Weimar, 16, 100-06, 17, unpag.). 539 Vgl. die Materialien und Skizzen bei Gottfried Feder, Die neue Stadt. Versuch der Begründung einer neuen Stadtplanungskunst aus der sozialen Struktur der Bevölkerung, Berlin 1939, S. 194 f.; sowie Ausführungen zu Größenverhältnissen. In: Verordnungsblatt der Reichsjugendführung, Sonderdruck 1/37 vom 7.1.1937. 540 Vgl. Reichsjugendführung (Hg.), Der Heimbau im Gebiet Thüringen, Berlin 1939. 541 Vgl. Ingo Sommer, Die Stadt der 500 000. NS-Stadtplanung und Architektur in Wilhelmshaven, Wiesbaden 1993, S. 276. 542 Vgl. Heinrich Hartmann, HJ-Heimbau. Aufgabe der Bewegung, Zeitungsausschnitt vom 16.6.1938 (StadtA Halle, Diemitz, 100, Bd. 1, unpag.). Demnach wurden Heimbauten in folgenden Orten begonnen: Alsleben, Großörner, Berga, Questenberg, Kelbra, Bret leben, Bottendorf, Lauchstädt, Schlettau, Prittitz, Löberitz, Spergau, Theissen, Büschdorf, Landsberg, Ramsin, Rösa, Zschornewitz, Krina, Schwemsal, Görschlitz, Dommitzsch, Jessen, Bockwitz. 543 Vgl. Matthias Donath, Architektur in Berlin 1933–1945. Ein Stadtführer, 2. Auflage, Berlin 2007, S. 41.
Die Heimbeschaffung
241
erst 1940 eröffnet. Schirach versprach, es würden bis Jahresende 1937 weitere 1 000 Bauten in Angriff genommen werden.544 Im Frühjahr 1938 hatte man angeblich 543 Neubauten fertiggestellt, Mitte Juni wurde die Grundsteinlegung für weitere 578 Heime gefeiert. Die meisten Jugendhäuser sollten im Fachwerkstil gebaut werden; auf eine verbindliche architektonische Vorgabe wollte man sich in der RJF allerdings nicht festlegen. 1 174 Bauscheine wurden bis Anfang 1939 ausgegeben – und nicht weniger als 50 000 Heime im Reichsgebiet für jedes Dorf und jede Stadt sollten in naher Zukunft noch entstehen.545 Somit würden die „Unterkünfte, die […] in Schulen oder Gasthäusern oder gar in alten Scheunen sind“, endgültig der Vergangenheit angehören.546 Die Entwürfe für ein HJ-Heim sollten Gemeinden und die Hitlerjugend gemeinsam erarbeiten. Danach mussten sie dem Arbeitsausschuss für Heimbeschaffung in Berlin vorgelegt werden. Zum Reichsarchitekten der RJF, der die letzte Entscheidung fällte, wurde Hanns Dustmann auserkoren, ein Verwandter Schirachs, der 1938 auch im Büro Speer tätig wurde. 4.3
Heimbauprojekte: Anspruch und Realität
Erst am 30. Januar 1939 mündeten die Anstrengungen der RJF in das „Gesetz zur Förderung der HJ-Heimbeschaffung“, mit dem das Heimbauprojekt eine staatliche Absegnung erhielt. Es kam mit erheblicher Verzögerung, nahm nun aber die Kommunen in die Pflicht. Die Verspätung begründete Schirach übrigens damit, dass die Heimbeschaffung durch „manche andere Planung“ im Zuge der Annexion Österreichs und der sudetendeutschen Gebiete habe zurückstehen müssen.547 Demgegenüber verkündete Theodor Steimle, der Hauptreferent in der RJF für die Heimfrage: „Im nationalsozialistischen Staate ist die Tat immer den Worten vorangegangen. So war es auch beim HJ-Heimbau. […] In allen Gauen des Reiches sind zahlreiche stattliche Heime entstanden. Die beteiligten Kreise gerade auch in der Gemeindeverwaltung können somit heute bereits auf eine gewisse Erfahrung […] und im Ganzen auf wirklich beachtenswerte
544 Vgl. Grundsteinlegung für 549 Hitlerjugend-Heime. In: Deutsches Nachrichtenbüro vom 4.5.1937. Zum Leipziger Heim vgl. Lange, Leipziger Jugendgruppen im Dritten Reich, S. 72. 545 Vgl. hier und im Folgenden Sommer, Stadt der 500 000, S. 276–280. Die Zahlenangabe 50 000 stammt aus dem Aufruf des Reichsinnenministers zur Wiederholung der Heimbeschaffungsaktion 1938, vgl. auch Neue Werbeaktion für die Heimbeschaffung der HJ. In: GB: Sachsen, A7/38 vom 15.4.1938; sowie Grundsteinlegung für 578 HJ-Heime. In: Deutsches Nachrichtenbüro vom 13.3.1938. 546 Fritz Abt, Jugend baut Heime. In: Die Jungmädelschaft. Blätter für Heimabendgestaltung der Jungmädel, Sonderheft: Wir bauen für den Führer vom 23.1.1939, S. 4 f. 547 Zit. nach Schirach und Frick über HJ-Heimbeschaffung. In: Deutsches Nachrichtenbüro vom 23.1.1939. Zur ersten Ankündigung, der Gesetzentwurf werde „in den nächsten Tagen“ der Reichsregierung vorgelegt. Propagandaaktion für die HJ-Heimbeschaffung. In: ebd. vom 2.3.1938.
242
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Leistungen zurückblicken. Das Gesetz bestätigt also, wie es Art nationalsozialistischer Staatsführung und Gesetzgebung entspricht, zunächst einen bereits bestehenden Zustand.“548 Das war Schönredner-Rhetorik. Denn ohne gesetzliche Grundlage, welche die Kommunen verpflichtete, war die Realisierung des riesigen Bauprogramms kaum möglich. Von den bereits errichteten HJ-Heimen waren einige, wie das Berliner „Musterheim“, ab Juni 1937 am Volkspark Rehberge verwirklicht, Prestigeprojekte der RJF.549 Von einer flächendeckenden Versorgung in ländlichen Gemeinden, was die RJF als Fernziel ausgegeben hatte, war man trotz Erfolgen weit entfernt. Kleinere Gemeinden verwiesen gegenüber der Hitlerjugend auf ihre Finanzlage sowie verschiedene Anordnungen, die sie zum Sparen und zur Entschuldung verpflichteten.550 In Baden hatte darum Gebietsführer Kemper 1938 auf die Unterstützung des Reichstatthalters gehofft, da „die Heimbeschaffung der Jugend nicht in dem Maße vorwärtsgeht, wie es wünschenswert“ sei.551 Schirach versprach, es werde nun der „Schaffung einfacher und würdiger Heime auf dem flachen Lande, wie sie unserer Jugend geziemen, ein neuer Auftrieb gegeben“.552 Die lokalen HJ-Führer warfen oft sogar ein Auge auf jüdischen Besitz. Man wollte die „Arisierungen“ zum Vorteil nutzen. Im Gebiet Saarpfalz machte der Beauftragte für die Heimbeschaffung, Ernst Aly, kurz nach den Pogromen vom November 1938 deutlich: „Bei der Überführung jüdischen Besitzes bietet sich die Möglichkeit, Häuser und Grundstücke für Heime und Dienststellen zu erwerben.“ Die entsprechenden Immobilien seien auf dem Dienstweg zu melden.553 In Albersweiler in der Pfalz wurde nach den Pogromen 1938 die Synagoge abgerissen. Die Hitlerjugend spekulierte auf das Gelände und hoffte, dort ein HJ-Heim errichten zu können, wozu es aber nicht kam.554 Besonders in Kleinstädten fehlte es nach wie vor an Jugendhäusern. Nicht untypisch die Mitteilung des Bezirksamtes Sinsheim in Baden. Über den Stand 1938 wurde berichtet: „Grundsätzlich ist zu sagen, dass bei jeder Gemeinde der Wille vorhanden ist, im Laufe der nächsten Jahre ein HJ-Heim zu erstellen. Es fehlt aber, wie aus den Berichten der Bürgermeister hervorgeht, viel-
548 Theodor Steimle, Das Hitlerjugendheim als Gemeindeaufgabe. In: NS-Gemeinde, (1939) 9, S. 321. 549 Vgl. Matthias Donath, Bunker, Banken, Reichskanzlei: Architekturführer Berlin 1933– 1945, 2. Auflage, Berlin 2008, S. 44. 550 Die Hitlerjugend stellte Argumente zusammen, welche im Rahmen der Heimbeschaffung gegenüber den Bürgermeistern, die auf ihre Haushaltslage verwiesen, in Stellung gebracht werden sollten. Vgl. Etataufstellung in den Gemeinden. In: GB: Saarpfalz, A4/37 vom 7.3.1937. 551 Der Reichstatthalter in Baden an die Bürgermeister des Landes Baden durch das Badische Ministerium des Innern vom 24.1.1938 (GLA Karlsruhe, 465c, 23587, unpag.). 552 Schirach zit. nach Deutsches Nachrichtenbüro vom 23.1.1939. 553 Übernahme von Gebäuden und Grundstücken aus jüdischem Besitz. In: GB: Saarpfalz, A11/38 vom 25.11.1938. 554 Vgl. Bericht für Oktober 1938 des Regierungspräsidiums der Pfalz vom 9.11.1938. In: Kulka/Jäckel (Hg.), Die Juden in geheimen Stimmungsberichten, S. 301–303, hier 301.
Die Heimbeschaffung
243
fach an den hierzu notwendigen Mitteln. Die Gemeinden des hiesigen Bezirks tragen ausschließlich ländlichen Charakter und sind infolgedessen von dem Wirtschaftsaufschwung nicht so begünstigt worden wie die Gemeinden in Industriebezirken. […] Es wird den betreffenden Gemeinden […] in nächster Zeit nicht möglich sein, noch Gelder für die Erstellung neuer, den Anforderungen der HJ entsprechender Heime flüssig zu machen.“555 Das Heimbau-Gesetz sollte den Dauerstreit zwischen der Hitlerjugend einerseits und den Gemeinden andererseits um Bau- und Unterhaltskosten beenden. Den Kommunen wurde per Gesetz zur Pflicht gemacht, für die „Errichtung und Unterhaltung der Heime“ Sorge zu tragen, wobei der Schatzmeister der NSDAP und die Landkreise „an den Baukosten nach Maßgabe der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel“ Beteiligung zusagten. Den Gemeinden wurde trotz allem eine Last aufgebürdet. Waren deren Haushalte zu klamm, um den Neubau zu stemmen, sollten sie Rücklagen bilden; die NSDAP sagte die Förderung eines Bauprojekts über die Hälfte jener Summe zu, welche die Landkreise ihrerseits stemmten. Die Lastenverteilung fiel unter dem Strich zwar zuungunsten der Kommunen aus, sollte aber deren Blockade aufbrechen helfen.556 In Wahrheit hielten weiter viele Gemeindevertreter das Gesetz unter „den gegebenen Umständen […] für undurchführbar“.557 Damit sei nicht gesagt, dass die Gemeinden gegen die Partei gearbeitet hätten. Doch von einem „symbiotischen Verhältnis“ zwischen Partei und Gemeinden, wie sie die historische Forschung seit geraumer Zeit herausarbeitet, kann – zumindest in der Frage der Heimbaufinanzierung – nur schwerlich die Rede sein.558 Die Hitlerjugendheime waren dem Ideal nach weit mehr als bloß renovierte Gebäude, die man für die Jugendorganisation und den Dienst ihrer Formationen in Beschlag nahm. Man unterstrich dies schon in begrifflicher Hinsicht: Hitlerjugendheim durfte nach 1937 eigentlich nur genannt werden, was mit einem Bauschein der RJF ausgestattet war. Alles andere, um den provisorischen Charakter der Nutzung zu unterstreichen, sollte „HJ-Unterkunft“ heißen. Die große Mehrheit in der Hitlerjugend verrichtete demnach in Unterkünften aber, eben nicht in Heimen ihren Dienst. Etwa 40 000, „die nicht in jeder Weise b efriedigen“,
555 Bezirksamt Sinsheim an den Minister das Innenministerium Karlsruhe vom 23.5.1938 (GLA Karlsruhe, 465c, 23587, unpag.). 556 Vgl. Gesetz zur Förderung der HJ-Heimbeschaffung. In: NS-Gemeinde, (1939) 8, S. 299; Förderung der HJ-Heimbeschaffung, Landgem. C vom 16.3.1939, S. 110 (StadtA Kamenz, 13472). 557 Vierteljahreslagebericht 1939 des Sicherheitshauptamtes. In: Boberach (Hg.), Meldungen aus dem Reich, Band 2, S. 215–330, hier 314. Vgl. auch den Bericht zur innenpolitischen Lage, 1939, Nr. 8 vom 25.10.1939. In: ebd., S. 390–399, hier 394: „In diesem Zusammenhang soll ein Rundschreiben des Beauftragten für HJ-Heimbeschaffung bei der Gebietsführung Westfalen an die Landräte und Oberbürgermeister bei diesen große Verärgerung hervorgerufen haben, weil darin in ungewöhnlichem Ton auf die Sicherstellung der Rücklagen für die HJ-Heimbauten hingewiesen worden sei.“ 558 Vgl. Sabine Mecking/Andreas Wirsching, Stadtverwaltung im Nationalsozialismus. Systemstabilisierende Dimensionen kommunaler Herrschaft, Paderborn 2005, S. 18.
244
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
gab es noch immer im Jahr 1943.559 In lokalgeschichtlichen Studien wird diese Unterscheidung oft nicht beachtet, obwohl sie bedeutsam ist; was damit zu tun hat, dass es im finanziellen und politischen Interesse der Gemeinden lag, manch ein Provisorium als HJ-Heim zu deklarieren, und deshalb die Differenzierung nicht immer leicht ist. Die RJF verbot Anfang 1938 jede Berichterstattung über die Provisorien und Unterkünfte. Nur jene mit „Heimschein“ ausgestatteten Gebäude durften in der Presse erwähnt und bebildert werden. Über die tatsächliche Lage sollte möglichst wenig publik werden.560 Die Lage war nach wie vor schlecht. In Hamburg – eine ganze Reihe von Bauprojekten war in der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre hier angelaufen – konnte die Hitlerjugend 1942 auf weit über 60 Örtlichkeiten für ihren Dienst zugreifen. Davon hatten zwar immerhin 24 den Status eines HJ-Heims, die anderen galten aber als HJ-Unterkünfte. Vielfach handelte es sich um Räume in den Dienststellen der Partei oder in Schulen.561 Ein echtes HJ-Heim sollte zu Stein gewordene Weltanschauung sein: Durch architektonische Klarheit sollte sich allen Ernstes „nordische Seelenhaltung“ und „alte rassische Gesetze der Raumgestaltung wirksam“ widerspiegeln.562 Schirach betonte 1939 zur Jahrestagung des Arbeitsausschusses in der Berliner Krolloper, sie sollten „die Urzellen einer in wenigen Jahren schon zu verspürenden einheitlichen kulturellen Gesinnung sein“. Zum Jugendheim gehörte nicht nur architektonische Konsistenz, das HJ-Symbol über der Pforte oder die zur Schulung notwendige Ausstattung, sondern auch Sportplatz, Spielwiese, Schießstand, Schwimmbad, damit auf einem ganz und gar neuartigen Jugendgelände die „Weltanschauung des Führers zum totalen politischen und künstlerischen Erlebnis einer ganzen Generation“ werden könne. In Zukunft gelte es, wie Schirach gleichzeitig betonte, speziell Klein- und Kleinstheime gerade für die Landbevölkerung zu verwirklichen.563 Allein im Januar 1939 vergab die RJF 43 weitere Bauscheine an Landgemeinden zur Errichtung neuer Heime, allesamt für Kleinstädte und Dörfer vorgesehen, wo der Mangel an guten Unterkünften offen zutage trat. Die meisten
559 Bauscheine. In: Reichsjugendführung. Arbeitsausschuss für HJ-Heimbeschaffung (Hg.), Grüner Dienst, 1938, Folge 3. Zahl der „unbefriedigenden“ Unterkünfte genannt bei Hitler-Jugend 1933-43. In: Das junge Deutschland, (1943) 1, S. 2–41, hier 30. 560 Vgl. Pressemeldungen über HJ-Unterkünfte. In: GB: Berlin, A6/38 vom 25.6.1938, nach Anordnung aus dem Reichsbefehl, 14/III: „Andere als diese dürfen in der Presse weder genannt noch sonst irgendwie propagandistisch ausgewertet werden.“ Ebd. 561 Vgl. Auflistung von Örtlichkeiten. In: GB: Hamburg, B 13/41 vom 23.6.1941; Auflistung der Orte für Erfassungsappelle, unterteilt nach HJ-Heimen und sonstigen Stellen. In: ebd., 2/42K: Sonderbefehl: Erfassung der Jahrgänge 1924–1929 und der Jahrgänge 1931/32 in der Hitler-Jugend, März 1942. 562 Fritz Winter (Arbeitsausschuss für HJ-Heimbeschaffung), Haltung und Gestaltung unserer Heimbauten. In: Das deutsche Mädel, Ausgabe Niedersachsen, (1937) 1, S. 6–8. 563 Aus der Rede des Reichsjugendführers am 27. Januar 1939, 17 Uhr, im Römersaal der Krolloper zur Jahrestagung des Arbeitsausschusses für HJ-Heimbeschaffung, abgedruckt in: Reichsjugendführung. Arbeitsausschuss für HJ-Heimbeschaffung (Hg.), Grüner Dienst, 1939, 6. Folge.
Die Heimbeschaffung
245
Genehmigungen gingen nach Westfalen, Pommern und das Gebiet Nordsee.564 In den Grenzgebieten Ostland, Pommern, Kurmark und Schlesien waren bis Ende 1938 weitere 520 Kleinheime in Angriff genommen worden.565 Etwa zur gleichen Zeit startete die RJF eine Kampagne mit der Losung „Helft der Jugend Heime bauen“, bei der um Spenden geworben wurde. Eine Wanderausstellung zog durch Deutschland, um die Modelle von geplanten und verwirklichten Bauten zu präsentieren. Bei den Vertretern der Städte, Gemeinden und nicht zuletzt den Hoheitsträgern der Partei galt es für die Heimbeschaffung zu werben. Flugblätter, Spruchbänder, Lichtbilder für Dia-Abende und rund 300 000 Plakate wurden den Gebieten zur Verfügung gestellt: „Baracken und Kellerlöcher können und dürfen keine Heime für die Hitlerjugend sein“, lautete die Botschaft des HJ-Führerkorps in Baden.566 Unter den Vorhaben, für die erst jetzt eine Genehmigung erfolgte, mussten die meisten aber Luftschlösser bleiben. Vielfach wurden die Projekte nicht oder erst so spät verwirklicht, dass die Hitlerjugend vor Kriegsende kaum noch davon profitierte. Pläne blieben reihenweise in den Schubladen liegen. In Recklinghausen, wo eine „Jugendburg“ mit neun Scharräumen und mehreren Büros entstehen sollte, erwies sich das Vorhaben als derart überzogen, dass es nicht zu finanzieren war; die Stadt gab stattdessen an, mit über 60 HJ-Heimen sei sie ohnehin führend im Westen des Reiches, wobei ein Blick auf wechselnde Anschriften zeigt, dass die wenigsten HJ-Heime im Sinne der RJF waren. Die meisten waren nach wie vor Unterkünfte mit provisorischem Charakter.567 Auch das prächtige Hitlerjugendheim in Wien, das die Reichshauptstadt Berlin der österreichischen Bruderstadt zum Geschenk machen wollte und großspurig angekündigt wurde, blieb eine Chimäre: Zwar erfolgte am 14. März 1939 die Grundsteinlegung, doch zur Fertigstellung kam es nicht.568 Im Gegenteil, die Situation in Wien nach dem „Anschluss“ 1938 blieb unbefriedigend. Man stand ganz am Anfang. Trotz der „besonders schwierigen Lage“, hieß es in der Wiener HJ im Oktober 1939, müsse dafür gesorgt werden, dass „jede Gefolgschaft und jedes Fähnlein […] einen einigermaßen ordentlichen und erträglichen Raum“ erhalte.569 Auch Anfang 1941 war die Wiener Hitlerjugend
564 Vgl. Bereits 65 Bauscheine für HJ-Heime auf dem Lande zu Beginn des Jahres. In: NS-Gemeinde, (1939) 6, S. 221. 565 Nach Angabe bei Reichsjugendführung (Hg.), Heime der Hitler-Jugend. Ein Überblick über die HJ-Heimbeschaffung, Berlin 1940, S. 13. 566 Vgl. gesammeltes Propagandamaterial. In: GB: Baden, Sonderdrucke zur Heimbeschaffungsaktion vom 15. bis 24. Januar (StA Freiburg, B719/1: Bezirksamt Lörrach, unpag.); Wanderausstellung „Schafft Heime für die Hitler-Jugend“. In: GB: Thüringen, A17/37 vom 30.10.1937. 567 Vgl. Vogt, Vestische Hitlerjugend, S. 306–309. 568 Vgl. Jan Tabor, … Und sie folgten ihm. Österreichische Künstler und Architekten nach dem „Anschluss“ 1938. Eine Reportage. In: Historisches Museum der Stadt Wien (Hg.), Wien 1938, Wien 1988, S. 398–430, S. 423. 569 Mitteilung des Gebietsführers. In: GB: Wien, A7/39 vom 31.10.1939; Erfassung sämt licher Heimräume durch die Stadt. In: ebd.
246
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
noch immer auf die Bereitstellung von Schulräumen angewiesen.570 Beispiele für nicht verwirklichte Bauprojekte – etwa 1 460 sollen sich 1941 in der Planung befunden haben – sind in den Archiven zuhauf überliefert.571 Ein Heim in der sächsischen Kleinstadt Kamenz – keine jener repräsentativen Anlagen, wie sie Schirach gern vorzeigte, sondern ein sogenanntes Kleinheim – gehörte in die lange Reihe von Bauvorhaben, deren Fertigstellung zwar noch erfolgen konnte, die aber während des Krieges lange Zeit stockte. Es ist ein exemplarisches Beispiel.572 Der Bau war Anfang 1937 angelaufen; Mädchen und Jungen waren bis dahin für ihren Dienst in Klassenzimmern und im Trakt einer Kaserne untergebracht. Im April 1939 feierte die Hitlerjugend mit Beteiligung von Partei und Bürgermeister das Richtfest. Das Heim, lautete es in der Lokalpresse, versprach zur „mustergültigen Anlage zu werden“.573 Doch der Kriegsbeginn stoppte den Abschluss der Bauarbeiten vorerst. Am 18. April 1940 war die Stilllegung nicht kriegswichtiger Bauvorhaben angeordnet worden. Die Kommission für den Landkreis Kamenz kam zu dem Urteil, dass der Bau des HJ-Heims derart fortgeschritten sei, dass letzte Arbeiten im Innern doch erledigt werden durften; im Gegensatz zu weit über 600 Rohbauten, die nach Kriegsbeginn 1939 und aufgrund von Lieferengpässen stillgelegt wurden.574 In der Folge hatte man jedoch immer wieder mit knapper Rohstofflage zu tun. Im Sommer 1940 fehlte Zement, im September fehlten Leim und Farbe. Die Gemeinde bat um die Beurlaubung eines Handwerkers, der zum Wehrdienst eingezogen worden war, um das Heim vor dem Winter fertigstellen zu können. Die Wehrmacht lehnte ab. Und der Hitlerjugend, obwohl sie darauf drängte, wurde seitens der Kommune nicht gestattet, das unfertige Heim im Winter zu beziehen. Im April 1941 kam man zu der Ansicht, ein Tischlermeister würde die „Ausführung der […] übertragenen Arbeiten […] trotz der gebotenen Eile unter verschiedenen wahrheitswidrigen Einwänden immer weiter hinausschieben“. Die Handwerker hatten es verständlicherweise nicht eilig. Ihnen drohte nach Bauabschluss der Fronteinsatz. Im November 1941 war das Heim für die rund 587 Jungen und 605 Mädchen endlich fertiggestellt.575 Weil es an Kohle zum Heizen fehlte, konnte die Jugendorganisation aber erst im Frühsommer 1942 einziehen. Vom Baubeginn bis zum Bezug hatte es im Falle dieses Kleinheims ganze fünf Jahre gedauert.
570 Vgl. Ansuchen um Überlassung von Schulräumen für HJ-Dienste. In: ebd., K1/41 vom 1.2.1941. 571 Vgl. Regina Prinz, Hitlerjugend- und Parteiheime. In: Winfried Nedinger (Hg.), Bauen im Nationalsozialismus. Bayern 1933–1945, München 1993, S. 146–178, hier 156. 572 Folgende Darstellung basiert auf Dokumenten und Schreiben zum HJ-Heimbau in Kamenz (StadtA Kamenz, Signaturen: A4, 13471; 13472; 13473; 13475). 573 Das Kamenzer Jugendheim gerichtet. Eine Erziehungsstätte des nationalsozialistischen Deutschlands. In: Kamenzer Tageblatt vom 4.4.1939. 574 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 1002. 575 Zur Stärke der Hitlerjugend vgl. die Aufschlüsselung im Brief des Banns Kamenz an die Stadtverwaltung, Jugendamt vom 23.10.1942 (StadtA Kamenz, A 4, 13472, Bl. 195).
Die Heimbeschaffung
247
Andere Projekte in Gemeinden von vergleichbarer Größe wurden nie verwirklicht oder nach Kriegsbeginn rasch stillgelegt. Nach 1945 stand das Kamenzer Heim, das zwischenzeitlich als Lazarett gedient hatte, als „Stalin-Heim“ benannt wieder der kleinstädtischen Jugend offen.576 In zahlreichen Fällen waren die HJ-Heime in der letzten Kriegsphase beschlagnahmt worden, um Lazarette einzurichten oder für die Belange der Wehrmacht; auch die Bürgermeister konnten über die Mit- und Fremdnutzung entscheiden.577 Gelegentlich besaßen, wie Anweisungen aus der Hitlerjugend zeigen, nicht einmal die höhere Dienststellen Kenntnis davon, welche Gebäude gerade noch in Gebrauch waren. Es sei, befahl man im Herbst 1942 im Gebiet Hessen-Nassau, durch die nachgeordneten Stellen mitzuteilen, welche Heime und Unterkünfte „durch Beschlagnahmung usw. entzogen sind. […] Es ist dabei genau anzugeben, durch wen die Beschlagnahmung erfolgte und welchem Verwendungszweck diese Räume nun dienen.“578 Wo die HJ-Heime errichtet wurden, konnten sie die Faszination junger Menschen für die Staatsjugend beleben. Im Idealfall sollten sie die Kulminationspunkte für jugendliches Leben und Alltag im „Dritten Reich“ werden. Ein HJHeim, gut ausgestattet, prächtig geschmückt, das Gelegenheiten zu Sport und Spiel bot, sollte nicht nur das Äquivalent zur Schulerziehung oder der Kirche bilden, sondern ein zweites Elternhaus werden.579 Doch Konflikte beherrschten vielfach den Alltag. In der Hitlerjugend zogen nicht alle Beteiligten an einem Strang. Vor Ort wurde um die Bauten oft heftig gerungen. Zwischen den Unterführern und -führerinnen, zwischen Gliederungen der Hitlerjugend sowie denen der Partei, die ein Auge auf begehrte Räumlichkeiten warfen, gab es Zwist um Bau und Nutzung. Meist ging es um Vorrechte: Wer würde welche Räume erhalten, wer hatte Anspruch worauf? In München, wo sich die NS-Frauenschaft nach Kriegsbeginn in HJ-Heimen einzuquartieren begann, fürchtete man, dass anderen Parteigliederungen dadurch Tür und Tor geöffnet würde. Das werde, so das Stadtjugendamt, „nach und nach zu einer absoluten Verdrängung der HJ-Einheiten aus ihren bisherigen Heimen führen“.580 In vielen Orten herrsche eine „restlose Unklarheit“ über alle Fragen der Heimbeschaffung, platzte Hugo Neupert, dem Heimbau-Beauftragten der Gebietsführung in Düsseldorf, 576 Ein weiterer beispielhafter Fall eines Kleinheims, das wegen der Versorgungslage nach 1939 nicht mehr umgesetzt wurde, ist dokumentiert im StadtA Halle, Diemitz 100, Bd. 1. 577 Vgl. Mitbenutzung der HJ-Heime für fremde Zwecke, RdErl. [Runderlass] des RMdI [Reichsministeriums des Innern] vom 6.8.1940. In: MBliv. [Ministerialblatt für die preußische Innere Verwaltung], S. 1607, sowie vom 17.5.1943. In: MBliv, S. 835 (entnommen dem Verzeichnis der auf die Bürgermeister übertragenen Zuständigkeiten, o. D.; HStA Stuttgart, E 151/09, Bü 169, Bl. 14). 578 Heime und Unterkünfte der Hitler-Jugend. In: GB: Hessen-Nassau, 7-9/42K vom 7.9.1942. 579 Vgl. Norbert Götz, Ungleiche Geschwister: die Konstruktion von nationalsozialistischer Volksgemeinschaft und schwedischem Volksheim, Baden-Baden 2001, S. 300–315. 580 Stadtjugendamt München an das Büro des Herrn Oberbürgermeisters vom 24.2.1942 (StadtA München, Bur 452, 13, unpag.).
248
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
nfang 1939 nach Zwistigkeiten der Kragen. Im Umland von Düsseldorf war es A bei der Planung von einigen Bauprojekten zu Reibereien gekommen. Sie seien „der Beweis für eine vollkommene Unfähigkeit nicht nur der örtlichen HJ-Führung, sondern auch der nächsthöheren Dienststellenführung“. Es könne nicht angehen, dass, wenn der Grundstein lange gelegt sei, die Bauarbeiten durch dauernde Intervention bei den Bürgermeistern verzögert oder infrage gestellt würden.581 Worum es hier ging, ist nicht dokumentiert. In einem anderen Fall in Thüringen wies die Gebietsführung einer lokalen BDM-Leitung 1937 die Schuld an dauernden Konflikten zu. Der BDM hatte gegenüber der Gemeinde auf die Planung zum Bau eines zweiten Heims, diesmal exklusiv für BDM-Mädchen, gedrängt. Die lokalen Führerinnen hielten es für nicht statthaft, Mädchen und Jungen in einem Haus gemeinsam unterzubringen, legten Einspruch ein und verschleppten das Verfahren. Eine solche Geschlechtertrennung in der Frage der Heimbeschaffung hatte in der RJF indes nie zur Debatte gestanden.582 Die Nutzung der Häuser war durch die höheren Dienststellen zunehmend reglementiert. In einem Fall empörte man sich etwa über die Anbringung von Kruzifixen, aber auch das Bildnis Kaiser Wilhelms II. mussten die jungen Unterführer abhängen.583 Jugend und Freiheit atmeten diese Räume nicht. Seit Anfang 1937 wurden sie von eingesetzten Referenten der Gebiete und Banne inspiziert sowie vom Streifendienst überwacht.584 Außerdem wurden HJ-Heimwarte eingesetzt; sie besaßen gelegentlich ein Zimmer im Heim als Unterkunft. Deren Aufgabe sollte es beispielsweise sein, auf die Einhaltung von Anweisungen zu achten, das Rauchen zu untersagen, Sachbeschädigung oder die Nutzung durch Dritte und ausgelassene Feiern zu verhindern sowie Streitigkeiten um die Räumlichkeiten zu schlichten.585 Aus dem Leipziger „Hermann-Göring-Heim“, dessen Baubeginn Schirach 1937 zum Propagandaauftakt gewählt hatte, sandte der Heimwart im März 1942 einen Bericht. Die Räume, Plätze und Flure seien mittlerweile verwaist: „Am Anfang, nach Betriebsbeginn im Januar 1940, war der Besuch […] sehr stark, hat aber im Verlaufe der Zeit sehr nachgelassen, was wohl eine Kriegserscheinung ist. Beim Jungvolk ist das weniger der Fall, umso mehr aber bei der HJ. Der Grund ist darin zu suchen, dass die jungen Menschen heute sehr in den Produktionsprozess eingespannt sind. Nicht zuletzt aber ist er auch eine Frage des Führermangels. Bei den Mädels liegen die Dinge so,
581 Unterrichtung der Führer und Führerinnen über die Heimbauten. In: GB: Düsseldorf, A2/39 vom 8.2.1939. 582 Vgl. Errichtung von Heimen. In: GB: Düsseldorf, A15/37 vom 24.9.1937. 583 Vgl. Raumgestaltung der Heime. In: GB: Thüringen, A4/37 vom 1.3.1937. 584 Vgl. Überwachung der HJ-Heime, als Ausführungsbestimmung für die Überwachung der Heime nach Anordnung des Stabsführers vom 7.2.1937. In: GB: Saarpfalz, A9/37 vom 22.6.1937. 585 Vgl. Muster für eine Benutzungsordnung der HJ-Heime für die Einheitsführer. In: GB: Thüringen, A6/38 vom 21.5.1938; Musteranweisung für HJ-Heimwarte. In: ebd.
Millionen im Gleichschritt
249
dass die älteren Mädel […] in ganz geringem Umfang Dienst leisten, während die Jungmädel wie beim Jungvolk noch verhältnismäßig stark vertreten sind.“586 Die RJF hatte in den 1930er-Jahren bei der Heimbeschaffung zwar propagandistisch wertvolle Erfolge erzielt: In einer langen Reihe von Städten und kleineren Gemeinden waren bis Ende des Jahrzehnts insgesamt etwas mehr als 1 000 Jugendhäuser entstanden. Einige sind bis heute erhalten.587 Der kritische Maßstab für eine Bewertung sollte aber der Anspruch sein, den die RJF formuliert hatte: „Der Heimbau […] ist mit das größte Bauprojekt des Reiches. Die Heime sind Zeugen der gewaltigen Organisation einer neuen Jugendbewegung und bleibende Denkmäler dieser großen Zeit.“588 Daran gemessen war die Heimbeschaffung vollends gescheitert. Weder ließen sich die großen Planungen auch nur annähernd verwirklichen noch war der Dienstbetrieb der Hitlerjugend in der Breite und im Alltag je aus dem Provisorischen herausgeführt worden.
5.
Millionen im Gleichschritt?
5.1
Freiwilligkeit und Verpflichtung
Kinder und Jugendliche, die bis zum Ende der 1930er-Jahre in der Hitlerjugend Dienst versahen, taten dies formal freiwillig. Man kann diesen Umstand nicht genug unterstreichen. Viele Zeitzeugen äußern fast gewohnheitsmäßig, es habe keine Wahl oder Alternative gegeben. Weil der kollektive Druck zur Anpassung nach 1933 kontinuierlich wuchs, besitzen derlei Schilderungen subjektiv Plausibilität. Formal verfügte die RJF bis 1939 aber über kein gesetzliches Instrumentarium, um junge Menschen in die Hitlerjugend zu zwingen. Man bestand sogar darauf, die Freiwilligkeit beizubehalten. Ebenso wie das Selbstführungsprinzip war sie ein Ideal, das sich aus der „Kampfzeit“ der Weimarer Jahre speiste: Nur wer freiwillig in die Reihen der Hitlerjugend kam, schien die Ideale der Bewegung aufnehmen und die neue Zeit verkörpern zu können. Zur jungen, revolutionären Speerspitze der Bewegung zu stoßen, hieß einer künftigen Elite anzugehören – dies aber konnte nur freiwillig, nicht durch eine aufgezwungene Entscheidung geschehen. Freiwilligkeit war mehr als nur Floskel, die der Ummantelung des Totalitären diente.589 Das Führerkorps meinte es ernst.
586 Zit. nach Alexander Lange, Jungkommunisten – Meuten – Broadway-Cliquen. Drei Jugendgenerationen zwischen Resistenz und Widerstand in Leipzig. In: Heydemann/ Schulte/Weil (Hg.), Sachsen und der Nationalsozialismus, S. 319–335, hier 331. 587 Vgl. Auflistung von beispielhaften HJ-Heimen und Jugendherbergen bei Helmut Weihsmann, Bauen unterm Hakenkreuz. Architektur des Untergangs, Wien 1998, S. 84–94. 588 Gustav Memminger, Hitlerjugend. Das Erlebnis einer großen Kameradschaft, München 1942, S. 283. 589 Eine leicht entgegengesetzte Lesart und Argumentation findet sich beispielsweise bei Reese, Zum Stellenwert der Freiwilligkeit, S. 63–83.
250
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Die Aufgabe des Freiwilligkeitsprinzips ging mit dem Wandel der Hitlerjugend zur totalitären Massenorganisation dennoch notwendigerweise einher. Diesen Weg hatten die meisten HJ-Führer zu Beginn nicht intendiert. Die Ideologie der NS-Jugendbewegung war alles andere als konsistent gewesen: Die alleinige Jugendorganisation sollte die Hitlerjugend nach 1933 zwar werden, aber im gleichen Zuge sollte sie eine elitäre Auslese fanatischer Kämpfer betreiben. Sie sollte zwar alle jungen Menschen in Deutschland erfassen, dies aber auf Basis einer autonomen und freiwilligen Entscheidung. Ohne Freiwilligkeit, hieß es, gebe es keine wahre Gefolgschaft. Nach der „Machtergreifung“ bemühte sich die RJF, solche ideologischen Widersprüche aufzulösen. Innerhalb der RJF existierten Planungen für einen weiteren großen Jugendverband, der neben der Hitlerjugend gestanden hätte. Von der Forschung ist dieses Projekt lange kaum beachtet worden. Erst Michael Buddrus hat die Planungen im Detail nachgezeichnet.590 Man ging rückschauend davon aus, allein die Hitlerjugend sei zur Durchsetzung des nationalsozialistischen Totalitätsanspruchs vorgesehen gewesen; was nicht zuletzt durch die Reden der NS-Größen gut belegt schien.591 Die Überlegungen in der RJF und in den zuständigen Ministerien waren jedoch wesentlich komplexer. Gemeinsam mit dem Chef der Reichskanzlei Hans Heinrich Lammers konzipierte Schirach 1935 eine Gesetzesvorlage. Sie sah eine Teilung vor: Die HJ sollte die junge Elite ausbilden, um sie zukünftig der Partei zuzuführen. Daneben sollte eine „Reichsjugend“ entstehen. Hier wären junge Menschen auf gesetzlicher Basis erfasst und militärisch ausgebildet worden. So hätte der Auslesegedanke in der Hitlerjugend weiterhin einen Sinn ergeben: Sofern sie besondere Leistungen erbrachten, wären Kinder von der „Reichsjugend“ in die HJ gewissermaßen aufgestiegen. Schirach verkündete auf einer Führertagung in Baden Anfang 1936, man arbeite auf den „Aufbau der künftigen Großorganisation der Reichsjugend“ zu, welche „die gesamte junge Generation umfassen […] und deren Grundlage das deutsche Jungvolk“ bilden sollte.592 Neben Schirach verfolgten auch Erziehungsminister Rust und Kriegsminister Werner von Blomberg zeitgleich Pläne. Eine gesetzliche Staatsjugend sollte den Interessen ihrer jeweiligen Ressorts Rechnung tragen. Jedes Ministerium versuchte, Einfluss auf die Zukunft der Jugendarbeit zu nehmen. Selbst in der RJF konkurrierten Ideen miteinander, wie diese Reichsjugend genau aufgebaut werden sollte. Mit den Kriegsvorbereitungen mussten die Pläne allesamt verworfen werden. Finanzmi-
590 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 250–264. 591 Vgl. beispielhaft Martin Mutschmann, Der Reichsstatthalter an die Jugend. Mahnende Worte zum Werbefeldzug. In: Der Freiheitskampf vom 26.4.1935: „Die HJ hat die Aufgabe, die gesamte deutsche Jugend zu erfassen, um die Einheit des Staates und die Schlagkraft der Partei für alle Zukunft zu sichern. […] Die Pflicht, die der Führer jedem jungen Menschen auferlegt, und den Dienst, den auch von den Jugendlichen für sein Volk fordert, kann […] nur in der HJ erfüllt werden.“ 592 Die Führertagung der badischen Hitler-Jugend. Reichsjugendführer Baldur von Schirach spricht. In: Heidelberger Neueste Nachrichten vom 3.2.1936.
Millionen im Gleichschritt
251
nister Schwerin von Krosigk wandte überzeugend ein, dass Aufbau und Unterhaltung einer weiteren Mammutorganisation den Staat mit jährlich rund 98 Millionen Reichsmark belasten würden. Das Projekt wurde Ende 1936 beerdigt.593 Im Bestreben, das eigene Hoheitsgebiet nicht an das konkurrierende Erziehungsministerium oder an die Wehrmacht zu verlieren, sowie im Wissen, dass die „Reichsjugend“ nicht zu realisieren war, hatte Schirach 1936 Fakten geschaffen: Durch einen riesigen Propaganda- und Werbeaufwand sollte der Geburtsjahrgang 1926 geschlossen in der Parteijugend erfasst werden. Anfang November konnte Schirach Hitler melden, über 90 Prozent der Jugend sei bereits in die Organisation eingetreten. Hitler, urteilt Buddrus, habe aufgrund dieser vagen Formulierung annehmen müssen, es sei die gesamte Jugend gemeint, nicht nur die Neuaufnahme der Zehnjährigen.594 Angesichts derartiger Dimensionen schien das kaum zu stemmende Reichsjugendprojekt überflüssig. Am 1. Dezember 1936 billigte Hitlers Kabinett das „Gesetz über die Hitlerjugend“. Es stellte fest, dass die „gesamte deutsche Jugend innerhalb des Reichsgebietes […] in der Hitler-Jugend zusammengefasst“ sei.595 Ihre Aufgabe und Stellung war nun festgeschrieben: Kinder und Jugendliche sollten „körperlich, geistig und sittlich im Geiste des Nationalsozialismus zum Dienst am Volk und in der Volksgemeinschaft“ erzogen werden.596 Vor 1933 und noch nach der „Machtergreifung“ hatte sich die Hitlerjugend stets als junge Speerspitze der Hitler-Bewegung verstanden. Ungeachtet ihres rasanten Wachstums sollte sie eine Kaderschmiede für die Partei sein. Nun rückte sie tatsächlich erstmals in die Nähe einer Staatsjugendorganisation. Das HJ-Gesetz schuf zwar noch immer keine Grundlage zur Zwangserfassung von Kindern und Jugendlichen, aber ihr Totalitätsanspruch war jetzt bestätigt. Schirach hatte seinen Zuständigkeitsbereich behauptet, dafür allerdings ideologische Eckpfeiler der Hitlerjugend als einer von Freiwilligkeit getragenen Elitenorganisation opfern müssen.597 Obwohl das Reichsjugend-Projekt 1936 also bereits verworfen und der Weg der Hitlerjugend zur Staatsjugend vorgezeichnet war, hielt Schirach weiterhin an überkommenen Botschaften fest. Dies war nicht nur eine Konzession an die „alten Kämpfer“, welche die Entwicklung der Bewegung hin zur Staatsjugend kritisch beäugten. Zu Recht fürchtete die RJF – die eine Jugendbewegung und nicht bürokratischer Apparat sein wollte –, dass sie an Attraktivität verlieren würde, sollte sie zu Zwangsmitteln greifen. Die Jugend, wie Schirach deshalb
593 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 250–264; vgl. auch Anja Hilgers, Struktur und Funktion der Hitlerjugend. In: Werner Helsper/Christian Hillbrandt/Thomas Schwarz (Hg.), Schule und Bildung im Wandel, Wiesbaden 2009, S. 53–73, hier 63 f. 594 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 264 f. 595 RGBl., (1936) 113, Teil 1 , S. 993, betr. allg. Bestimmungen. 596 Ebd. 597 Um das zu erwartende Anwachsen der HJ in kontrollierte Bahnen zu überführen, erließ die RJF bis zum 20. April 1937 eine Mitgliedersperre; vgl. Mitgliedersperre für die HJ. In: Unsere HJ, (1936) 7, S. 9; sowie Mitgliedersperre der HJ, gez. Berger. In: Reichsbefehl, 11/II vom 19.3.1937.
252
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Ende 1936 erklärte, sei während des Kampfes gegen die Republik „aus freiwilligem Entschluss, aus Begeisterung und echtem sozialistischen Gefühl zur HJ gestoßen. […] Ich sehe es […] als meine Aufgabe an, das Prinzip der Freiwilligkeit auch unter den veränderten Verhältnissen nach Verkündung des Gesetzes in einer mir bereits klar vorschwebenden Form aufrechtzuerhalten.“598 Der Entwicklung der Parteijugend hinkten Teile des Führerkorps ebenso wie die RJF offenkundig mental hinterher. Schirach gab vor, dass er den Auslesecharakter beibehalten könne: Neben die vergrößerte allgemeine HJ sollte in Zukunft die „Stamm-HJ“ für langjährige, verdiente oder aufgrund besonderer Leistungen aufsteigende Mitglieder treten. Im Grunde war es die alte Idee der Reichs jugend – bloß viel weniger ambitioniert und konsequent vorgetragen. Zunächst blieb das Prinzip der Freiwilligkeit erhalten. Mithilfe großangelegter Propagandaaktionen bei gleichzeitigem sozialen Druck in Schulen, auf Elternhäuser und die unabhängigen katholischen Jugendverbände sollten alle Zehnjährigen zum Eintritt bewegt werden. Die sächsische Hitlerjugend stellte in einer Pressedarstellung fest, es werde „der Grundsatz der Freiwilligkeit aufrechterhalten, obwohl aufgrund der gesetzlichen Vorschriften eine zwangsweise Einreihung der Jungen und Mädel ohne weiteres möglich wäre. […] Angesichts der Freude und Begeisterung […] bedarf es jedoch keines irgendwie gearteten Druckmittels.“599 Weiterhin glaubten Funktionäre, dass die „freiwillige Erziehungsgemeinschaft“ der Parteijugend „alle deutsche Jugend“ zum Staat bekehren würde.600 Zu Recht haben Historikerinnen und Historiker betont, dass die Rede von der freiwilligen Entscheidung zum Beitritt spätestens nach Einführung des Hitlerjugend-Gesetzes 1936 zur Demagogie verkam: Angesichts der Diffamierung von jungen Menschen, die nicht eintraten, oder den Nachteilen beispielsweise bei der Suche nach Lehrstellen kann von einer echten Wahlfreiheit nicht gesprochen werden.601 Wer abseits stand oder die Töchter und Söhne von der Staatsjugend fernhielt, musste mit sozialer und staatlicher Ächtung rechnen. Für die retrospektive Bewertung ist jedoch die Feststellung wichtig, dass auch nach Einführung des HJ-Gesetzes zunächst keine grundsätzlich veränderte Lage eintrat: Die Erfassung der gesamten deutschen Jugend innerhalb der Hitlerjugend war in der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre noch immer nicht voll verwirklicht, auch ein gesetzliches Instrumentarium zur Zwangserfassung war nicht geschaffen. Wer in die Jugendorganisation eintrat, tat dies formal freiwillig. Vor der letzten Konsequenz einer totalitären Massenorganisation schreckte die RJF noch immer zurück. Die Einsicht, dass Totalität und Verfügungsgewalt mit einem Freiwilligkeitsprinzip nicht zu erreichen waren, reifte überraschend 598 Der Jugendführer des Deutschen Reiches, gez. Baldur von Schirach. In: Reichsbefehl, 43/I vom 4.12.1936. Vgl. auch, wenngleich apologetisch Schirach, Ich glaubte an Hitler, S. 232. 599 Die Zehnjährigen reihen sich ein. In: Der Freiheitskampf vom 11.3.1938. 600 Vgl. Gesetz über die Hitler-Jugend. Ein Aufruf Baldur v. Schirachs. In: ebd. vom 2.12.1936. 601 Vgl. Klönne, Jugend im Dritten Reich, S. 30 f.
Millionen im Gleichschritt
253
langsam heran. Die mentalen Altlasten der „Kampfzeit“ hielten sich hartnäckig in den Köpfen. Die Realität musste die Widersprüche erst aufzeigen, bevor die Hitlerjugend endgültig zum Käfig werden konnte. 5.2
Zur Erfassung durch die Hitlerjugend um 1936
Das sächsische Bildungsministerium meldete nach den groß angelegten Werbeaktionen 1936, dass von den Zehnjährigen nunmehr „fast sämtliche Schüler und Schülerinnen […] in das Deutsche Jungvolk und die Deutsche Jungmädelschar“ eingetreten seien.602 Mitte der 1930er-Jahre war die Hitlerjugend von der Erfassung aller Kinder und Jugendlichen dennoch – entgegen dem, was Regime, Behörden und RJF suggerierten – weit entfernt. Ein erheblicher Prozentsatz junger Menschen stand nach wie vor abseits. Insbesondere in katholischen Hochburgen hatten die antiklerikalen Angriffe seitens der Hitlerjugend mutmaßlich einen nachteiligen Effekt. Im Paderborner Land beispielsweise wurden im Juli 1935 zahlreiche Austritte beklagt.603 Doch selbst aus dem protestantischen Mitteldeutschland wurde über einen Mangel an Beitrittsfreude von jungen Menschen berichtet. Aus Magdeburg erläuterte die Gestapo im Frühjahr 1935, der BDM habe gar „bis zu 70 [Prozent] seines Bestandes verloren“, was man auf die intensive Mädchenarbeit der Kirche zurückführte.604 „Hitlerjugend, BDM und Jungvolk marschierten im geschlossenen Zuge zu den Feuerplätzen“, lautete es aus Erfurt zum „Fest der Jugend“ Mitte 1935: „Die diesen Verbänden nicht angeschlossene Jugend wurde in den Schulen gesammelt und geschlossen zum Feuerplatze geführt.“ Man habe jedoch beobachtet, „dass noch [immer] ein erheblicher Teil von Jugendlichen durch die HJ usw. nicht erfasst worden“ sei.605 Ein genaueres Lagebild über die Erfassung junger Menschen in Deutschland erlaubt eine Statistik, welche die RJF 1936 für den Innendienst zusammenstellen ließ. Im Regelfall war man bemüht, dass solche Zahlen nicht nach außen drangen.606 Die Broschüre, gedacht für hauptamtliche Führerinnen und Führer 602 Ministerium für Volksbildung an die höheren Schulen und die höheren Handelslehranstalten, gez. Jörschke vom 5.5.1936, Abschrift (StadtA Kamenz, A4, 2, 689, Bl. 70). 603 Vgl. Markus Köster, Jugend, Wohlfahrtsstaat und Gesellschaft im Wandel. Westfalen zwischen Kaiserreich und Bundesrepublik, Paderborn 2001, S. 255–265. 604 Lagebericht der Staatspolizeistelle Magdeburg für April 1935 vom 6.5.1935. In: Rupieper/Sperk (Hg.), Lageberichte der Geheimen Staatspolizei zur Provinz Sachsen, Band 1, S. 177–191, hier 185. 605 Lagebericht der Staatspolizeistelle Erfurt für Juni 1935 vom 3.7.1935. In: ebd., Band 3, S. 242–262, hier 244. 606 Vgl. Mitgliederzahlen. In: Reichsbefehl, 9/I vom 6.3.1936: „Es besteht Veranlassung, noch einmal darauf hinzuweisen, dass Mitgliederziffern […] außer an die Gauleiter, Kreisleiter und Ortsgruppenleiter der NSDAP nicht abgegeben werden dürfen. Gliederungen der NSDAP und Verbände, Staatsstellen usw. sind darauf hinzuweisen, dass die Berechtigung zur Abgabe von Mitgliederzahlen nicht vorliegt und sind an die Reichsjugendführung zu verweisen.“ Vgl. auch Richtlinien für die Durchführung von statistischen Erhebungen. In: ebd., 36/I vom 16.10.1936.
254
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
höherer Dienststellen, schlüsselte die Zahlen der Gebiete und Gaue im Detail auf; vermutlich sollte die Konkurrenz unter den Gebieten befeuert werden. Die Statistik zeigt, wie erstaunlich uneinheitlich die Hitlerjugend im März 1936 aufgestellt war. Im Falle der Vierzehn- bis Achtzehnjährigen rechnete die RJF mit einer durchschnittlichen Erfassung von 40–50 Prozent. Bei den Zehn- bis Vierzehnjährigen sah es mit 80–90 Prozent weit besser aus. Mit Ausnahme des katholisch-ländlichen Münsterlandes, wo man nicht recht Fuß fasste, erreichten Gebiete im Westen des Reiches die höchsten Erfassungswerte. In Teilen Bayerns, in Sachsen – was überrascht, da die Hitlerjugend hier gegründet worden war – sowie in Schlesien und Ostpreußen lag man unter dem Durchschnitt.607 Die Daten scheinen zu bestätigen, was eine NS-Studentenzeitung 1935 in überzeichneter Dramatik schilderte: „Die Predigten im Dorf sind offen oder versteckt auf Kampf […] abgestimmt; die Hitler-Jugend wird auf den Dörfern gerade von diesen Kreisen mit zäher Bosheit bekämpft. […] Der Druck der Dorfreaktion ist im Osten Deutschlands jedenfalls ein außerordentlich starker. […] Das Dorf wird zu einem ernsten Problem, dem wir uns nicht mehr entziehen können.“608 Die Entwicklung der Mitgliederstärken war auch regional von großen Unterschieden gekennzeichnet: Im Falle des Jungvolks rangierten die westdeutschen Gebiete Ruhr-Niederrhein und Saarpfalz mit einer Zunahme im Vergleich zum Vorjahr von etwa 30 Prozent spektakulär an der Spitze, die Gebiete Niedersachsen und Berlin hingegen mussten Verluste von 10 bzw. 20 Prozent hinnehmen. Insbesondere der Erfassungsgrad bei Mädchen und jungen Frauen war aus Sicht der RJF enttäuschend: Der JMB erreichte zwar 50–60 Prozent der 10- bis 14-Jährigen, was eine positive Entwicklung nahelegte, aber der BDM lag bei nur 10 bis 20 Prozent. Obwohl sich der NS-Staat nach Kräften bemühte, war es Anfang der zweiten Hälfte des Jahrzehnts nicht gelungen, die Gliederungen der Partei neben häuslicher und schulischer Erziehung junger Frauen annähernd gleichwertig zu entwickeln. Mit demografischen Fluktuationen ließ sich zudem die unterschiedliche Entwicklung in den Gebieten nicht hinreichend begründen. Die Hitlerjugend hatte gewiss sehr viel erreicht, aber sie war in einigen Landstrichen an die Grenzen ihrer Möglichkeit zur Mobilisierung gestoßen. In Brandenburg, wo die HJ bis Anfang 1936 etwa die Hälfte der Jugendlichen erfasste, hatte ein Gestapo-Beamter kritisch vermerkt: Aus „HJ-Kreisen wird mir über zahlreiche Austritte […] berichtet. Als Grund hierfür wurde mir allgemeine Interesselosigkeit angeführt. Neben der wohl nicht zu unterschätzenden Einwirkung des [evangelischen] Kirchenstreits dürfte aber auch die Unfähigkeit vieler Unterführer […] Grund zu den Austritten geben.“ Die zahlreichen Austritte müssten als „schwere Misserfolge gewertet werden“, die eine „eingehen-
607 Vgl. Reichsjugendführung (Hg.), Statistik der Jugend, A, 1, S. 5 (BArch, NS 26, 359). 608 So sieht es noch beim Großgrundbesitz aus! In: Der Heidelberger Student. Kampfblatt Nationalsozialistischen deutschen Studentenbundes, Hochschulgruppe Heidelberg, (1935) 8, S. 4.
Millionen im Gleichschritt
255
de Untersuchung verlangten“.609 In Berlin – bei Mädchen und Jungen sowie in allen Altersgruppen – sah die Lage geradezu verheerend aus. Hier kam die Hitlerjugend im Vergleich zu anderen Gebieten am schwersten voran. Die Gaue Westmark und Baden standen dagegen an der Spitze.610 Nicht nur die RJF fertigte 1936 solche statistischen Broschüren an, sondern auch die Gebiete, die wiederum den Konkurrenztrieb ihrer untergeordneten Formationen anfeuern wollten. Nur ein Exemplar der „Statistik der Jugend“ für das Gebiet Sachsen konnte bislang aufgefunden werden. Insgesamt rangierte Sachsen in Hinblick auf die Erfassungsquoten unter dem reichsweiten Durschnitt: Etwa 20 bis 30 Prozent hatte man in der HJ erfasst, 60 bis 70 Prozent beim Jungvolk, 40 bis 50 bei den Jungmädeln und 10 bis 20 Prozent beim BDM.611 Entgegen historiografischer Thesen über die Anfälligkeit des Protestantismus gegenüber der NS-Bewegung stellte Sachsen ein vergleichsweise schwieriges Rekrutierungsterrain für die Hitlerjugend dar. Die Gebietsbroschüre zeigt, wo die Hochburgen lagen: Chemnitz und Leipzig hatten zahlenmäßig die höchsten Mitgliederstärken vorzuweisen, es folgten Dresden und Zwickau. Zwar schlüsselt die regionale Zusammenstellung nicht auf, wie die Quoten in Bezug auf die Jahrgänge insgesamt ausfielen, aber immerhin wie sich die Stärken von 1934 bis 1936 zahlenmäßig entwickelten. Von einem kontinuierlichen Wachstum konnte keine Rede sein. Ende 1935 musste man erstmals Verluste hinnehmen. Die HJ im Umland von Dresden legte mit einem Mitgliederschwund von fast 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr einen Negativrekord hin.612 In allen Bannen und Untergauen gewann sie kaum bedeutend hinzu. Besonders trat die fragile Situation in der linken Hochburg Leipzig zutage. Hier verlor das DJ bis Dezember 1935 rund 24 Prozent seiner Vorjahresstärke. Ähnlich, aber nicht ganz so dramatisch, waren die Einbußen in Zwickau. Im Erzgebirge (minus 25 Prozent) sowie in ländlichen Landstrichen wie Dippoldiswalde (minus 16 Prozent) trat man auf der Stelle.613 Allein bei den Mädchen – die Ausgangsstärke war weit niedriger, daher das Rekrutierungspotenzial größer – konnten Zuwächse verzeichnet werden. Bei 10- bis 14-Jährigen gab es gleichwohl Orte, wo der JMB erneut einbrach: in Plauen (minus 58 Prozent), Dresden-Land (minus 39 Prozent) und Leipzig (minus 30 Prozent) hatten wahrscheinlich die steten Angriffe der Hitlerjugend auf die evangelische Jugendarbeit Spuren hinterlassen.614 Die Angaben decken sich mit manchem staatlichen Lagebericht, die den
609 Lagebericht der Staatspolizeistelle Potsdam für Juni 1935, o. D. In: Ribbe (Hg.), Lage berichte über die Provinz Brandenburg und die Reichshauptstadt, S. 285–300, hier 291. 610 Vgl. die kartografische Aufschlüsselung in: Reichsjugendführung (Hg.), Statistik der Jugend, A, Teil 2, S. 6–15. 611 Ebd., S. 5–7. 612 Vgl. Gebiet Sachsen (Hg.), Statistik der Hitlerjugend in Sachsen, Dresden 1936, S. 22– 39, hier 33. 613 Vgl. ebd., S. 34. 614 Vgl. ebd., S. 38.
256
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Durchmarsch der Parteijugend infrage stellten. Auch in Köln hatte sich die HJ Ende 1935, wie die Überwachungsorgane meldeten, „nicht vergrößert, sondern immer mehr verkleinert“, was man mit Gerüchten um eine Überbeanspruchung der Kinder, der antiklerikalen Agitation in katholischen Regionen sowie „sittlichen Verfehlungen“ begründete.615 1936 allerdings kehrte sich der Trend zugunsten der Hitlerjugend dramatisch um. Die Werbekampagnen, der staatliche Druck auf Eltern, die unermüdlichen Eintrittsaufforderungen auf Transparenten, im Radio, in Zeitungen oder Schaukästen, nicht zuletzt die wachsende Präsenz der Hitlerjugend in Schulen führten zum rapiden Anschwellen. Auch in Sachsen gewann die Parteijugend nun kräftig hinzu – sowohl auf dem Land als auch in den Städten und Industriezentren. Im Dezember 1936 verzeichneten die HJ-Banne Dresden, Zwickau, Kamenz und Zittau ein beachtliches Mitgliederwachstum von teils über 40 Prozent. DJ und JMB wuchsen ebenfalls schier schwindelerregend. Die veränderte Taktik der Kirchen, die auf informellem Weg um die Parteijugend warb sowie vermehrt auf Kooperation im Alltag setzten, spielte sicher eine Rolle: Der sächsische BDM wuchs 1936 im Durchschnitt um 40 bis 50 Prozent, auch zum JMB strömten überall erneut Zehntausende. Zum Teil wuchsen die weiblichen Gliederungen in nur wenigen Monaten oft auf mehr als die doppelte Stärke an.616 Dieses Wachstum war allerdings ein künstlich forciertes. Anders gesagt: Es war ein genuin anderer Zustrom als jener der Jahre 1933/34. In der Phase der „Machtergreifung“ hatten Hunderttausende, ungeachtet der repressiven Auflösung der bürgerlichen Konkurrenz und der Zerschlagung der Arbeiterjugend, aus freiem Entschluss und mit Begeisterung zur Parteijugend gefunden. Der neue Aufschwung 1936, nach einer Phase der Stagnation, war auf den massiven Druck des Regimes zurückzuführen. Kinder und Jugendliche kamen in die Hitlerjugend, weil es an Wahlmöglichkeiten fehlte, der Raum enger und die Repression spürbarer wurde. Manche Eltern schickten Kinder in die Hitlerjugend, weil sie Denunziationen oder Schwierigkeiten für den Nachwuchs in Schulen oder Betrieben fürchten mussten. Sicher konnte die RJF das Jahr 1936, das im Dezember im Hitlerjugend-Gesetz mündete, als einen beachtlichen Großerfolg verbuchen. Allerdings war dies ein Erfolg, der auf Zwang und erheblich gestiegenem Anpassungsdruck – nicht nur auf revolutionärer Begeisterung – ruhte. Ein polizeilicher Lagebericht hatte Ende 1935 hellsichtig auf diese Entwicklung hingewiesen: „Man darf allerdings das zahlenmäßige Fortschreiten der Hitlerjugend in seiner Bedeutung nicht überschätzen. Einmal gehört ein Teil 615 Lagebericht der Gestapostelle Köln für September 1935 vom 18.10.1935. In: Faust/ Rusinek/Dietz (Hg.), Lageberichte rheinischer Gestapostellen, Band II/2, S. 1072– 1091, hier 1087. Vgl. Lagebericht der Staatspolizeistelle Magdeburg für April 1935 vom 6.5.1935. In: Rupieper/Sperk (Hg.), Lageberichte der Geheimen Staatspolizei zur Provinz Sachsen, Band 1, S. 177–191, hier 185: „Nach Mitteilung des Kreisjugendpflegers des Kreises Calbe hat in einzelnen Ortschaften der BDM bis zu 70 % seines Bestandes verloren. Die HJ versucht nunmehr, durch Feierabendveranstaltungen das verlorene Terrain [gegenüber der evangelischen Kirche] wieder zurückzuerobern.“ 616 Vgl. Gebiet Sachsen (Hg.), Statistik in Sachsen, S. 39 f.
Millionen im Gleichschritt
257
der Mitglieder der HJ und des BDM gleichzeitig auch noch […] konfessionellen Organisationen an, und zum anderen muss bezweifelt werden, ob in allen Fällen der Beitritt aus eigenem Antrieb und freier Überzeugung erfolgt ist.“617 Unausgesprochen schwang mit: Massig junge Menschen waren nun in der Organisation erfasst, die sich im Alltag überhaupt nicht beteiligten. Eine Reihe von Problemen ging mit dieser Art von Wachstum einher. Weil es an Instrumenten fehlte, um die Beteiligung der Neulinge am Dienst zu erzwingen, bestand die Millionenorganisation zu einem wachsenden Anteil aus inaktiven Mitgliedern. 5.3
Massenorganisation der Karteileichen?
Dienstverweigerung in der Hitlerjugend war aus Sicht der lokalen Dienststellen und staatlichen Organe seit Längerem ein massives Problem. „Leider mehren sich die Berichte“, hieß es beispielhaft in Aachen 1935 „dass es innerhalb der Gliederungen der Staatsjugend vielfach an erforderlicher Dienstfreudigkeit fehlt. Es hat den Anschein, als ob zahlreiche Jugendliche, insbesondere auch die Schüler höherer Lehranstalten, durch das, was ihnen in der Hitlerjugend geboten wird, nicht recht befriedigt werden.“618 Die Hitlerjugend verfügte zwar über disziplinarische Sanktionen, um den Nachwuchs zur Beteiligung zu bewegen. Im Ernstfall blieb ihr dann jedoch nur der Ausschluss oder die Streichung von hartnäckig Desinteressierten; ein Mittel, das im Zeitverlauf immer weniger zur Anwendung kam, da die RJF am Anspruch einer totalen Staatsjugend nicht rütteln wollte. Stabsführer Hartmann Lauterbacher ermahnte, dass die „Dienstbeteiligung der HJ und des Jungvolkes allein durch die Leistung der Einheiten garantiert“ werden müsse. Strafandrohungen oder Streichungen beispielsweise bei Fernbleiben vom Dienst würden „auf die Dauer […] das Ansehen […] der Führung der HJ allgemein“ schaden.619 Der neuerliche Mitgliederzustrom des Jahres 1936 ging mit einer Verschärfung der Probleme einher. „Die Gebiete meldeten fast ausnahmslos eine 90–95-prozentige Erfassung. […] Die Praxis aber zeigt, dass dies nicht den Tatsachen entspricht“, konstatierte die RJF. Ein Großteil der Erfassten besaß nicht einmal einen Ausweis.620 Das Regime beeindruckte mit hohen Eintritts- und Mitgliedszahlen. Im Alltag zeigte sich manchmal ein völlig anderes Bild. Der Exil-SPD schrieb ein Beobachter: „Anfänglich hatte man geglaubt, dass aufgrund dieses Gesetzes alle Jugendlichen moralisch gezwungen sein würden, in der HJ mitzuarbeiten. Das hat sich als ein Irrtum 617 Lagebericht der Gestapostelle Aachen für November 1935 vom 9.12.1935. In: Faust/ Rusinek/Dietz (Hg.), Lageberichte rheinischer Gestapostellen, Band II/2, S. 1303– 1338, hier 1305. 618 Lagebricht der Staatspolizeistelle, Regierungsbezirk Aachen, für den Juli 1935 vom 7.8.1935. In: Vollmer, Volksopposition im Polizeistaat , S. 255–267, hier 266. 619 Dienstbefehle an HJ-Angehörige, gez. Lauterbacher. In: Reichsbefehl, 11/II vom 19.3.1937. 620 Ausstellung von Mitgliedsausweisen. In: ebd., 36/11 vom 22.10.1937.
258
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
herausgestellt. Durch das Gesetz ist eine Belebung der Tätigkeit in den Jugendgruppen nicht eingetreten. Soweit die Jugendlichen überhaupt zu einer Arbeit zu gebrauchen waren, hatte man sie schon vorher durch alle möglichen Druckmittel eingespannt. Durch das Gesetz sind es daher nicht mehr geworden.“621 Die jungen Unterführer übten nur hinter vorgehaltener Hand an ihren höheren Dienststellen Kritik. Immerhin fiel schon in älteren Studien über die Hitlerjugend auf, dass es „für die gewöhnlichen Jungmädel oder BDM-Mädchen nicht allzu schwer und risikoreich war, den Dienst zu schwänzen oder sich überhaupt zu drücken“.622 Die Wege und Möglichkeiten hierzu waren vielseitig. Dass es an der Basis rumorte, zeigt der Brief eines bayerischen HJ-Oberscharführers. Aus der Kleinstadt Wertingen schrieb Viktor Brandl im November 1938 an den Münchner Ratsherren und NSDAP-Politiker Ulrich Graf, einen „alten Kämpfer“ und Weggefährten Hitlers. Mit naiver Geradheit klagte der junge Mann über die schwache Dienstbeteiligung in der Staatsjugend. Die Antrittsstärke sei sehr gering, wie er meinte, und die Disziplin der Mitglieder lasse zu wünschen übrig. Viele Mitglieder seien nur als Karteikarten in Dienststellen bekannt: „Es gibt auf dem Land fast keine HJ mehr“, spitzte Brandl zu: „Unser Bann ist nun noch einer der Besten im ganzen Gebiet. In anderen Bereichen sieht es viel verheerender aus. Das Verhältnis in der Großstadt ist nicht anders. Die Millionen, die heute noch karteimäßig erfasst sind, existieren nur auf dem Papier. Rein aktiven Dienst machen vielleicht […] 20 [Prozent] der gesamten männlichen Jugend – bei den Mädeln ist es vielleicht noch schlechter. Man täuscht sich gewaltig, wenn man in dem Aufgebot, das alljährlich am Reichsparteitag steht oder bei sonstigen Paradeanlässen marschiert, ein Abbild der gesamten Jugend sehen will.“623
Um seine Behauptung zu belegen, fügte er dem Brief eine spannende Auflistung bei. Die Liste hatte er zuvor seiner vorgesetzten Dienststelle in Augsburg überreicht. Dort war er mit seinen Klagen allerdings nicht durchgedrungen. Aus den 26 Landgemeinden, die zum Einzugsbereich seiner Gefolgschaft gehörten, waren demnach 213 männliche Jugendliche durch die HJ erfasst, was lediglich 31 Prozent der Sollstärke darstellte. Beim Jungvolk seien immerhin 61, beim BDM jedoch nur 19 Prozent und im JMB etwa rund die Hälfte karteimäßig erfasst, rechnete der HJ-Führer vor. Er wisse aus zahlreichen Gesprächen, unterstrich
621 Bericht aus Bayern, A 57–A 59. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 5 (1938), S. 1363. 622 Margarete Dörr, „Wer die Zeit nicht miterlebt hat ...“. Frauenerfahrungen im Zweiten Weltkrieg und in den Jahren danach, Band 3: Das Verhältnis zum Nationalsozialismus und zum Krieg, Frankfurt a. M. 2008, S. 227. Vgl. auch Anja Pannewitz, Beobachtung und Ausschluss jugendlicher Swingtänzer im Dritten Reich. Folgen einer Konsensfiktion, Hamburg 2011, S. 48–52. 623 Viktor Brandl an Ulrich Graf vom 19.11.1938 (NARA, M1946, 129: Graf, Ulrich: Eingehende Korrespondenz, 1914–1936). Brandls Hinweis auf das Spektakel in Nürnberg war nicht unberechtigt: Für das Gebiet Westmark, um ein Beispiel zu nennen, war für den Reichsparteitag 1937 ein Kontingent von 900 HJ- und DJ-Angehörigen vorgegeben; nur 55 Teilnehmer gingen den propagandistisch aufgezogenen Adolf-Hitler-Marsch. Vgl. Reichsparteitag 1937. In: GB: Westmark, A11/37 vom 1.8.1937.
Millionen im Gleichschritt
259
Brandl, dass die Lage in anderen Regionen Bayerns recht ähnlich sei. Bei den Zahlen handele es sich ohnehin „vielfach um Papierstärken“, da bei Weitem nicht alle jungen Menschen tatsächlich erschienen. „Diese Zahlen sind verheerend, aber sie stimmen“, bekräftigte Brandl.624 Der bayerische HJ-Führer hatte erkannt, dass das Totalitäts- und Freiwilligkeitsprinzip nicht miteinander in Einklang zu bringen waren. Um Kinder und Jugendliche zum Dienst zu bewegen, bedurfte es im Ernstfall der Strafmaßnahmen. Brandl folgerte: „Als das Gesetz über die HJ kam, haben wir aufgeatmet, glaubten wir doch, dass nun die einzig richtige Lösung, nämlich die pflichtmäßige Erfassung der Jugendlichen kommen würde. Daraus wurde nichts und seit Anfang 1937 geht es rapid abwärts.“ Da der Staat es sich nicht leisten könne, gab Brandl zu bedenken, „nur 20 [Prozent] seiner Jugend im nationalsozialistischen Sinne zu erziehen“, müsse „zur Behebung der völlig ungesunden Verhältnisse […] trotz allem Freiwilligkeitsprinzip“ die Heranziehung der Jugend mit gesetzlichen Instrumente erzwungen werden. Dafür solle Graf, bat der junge HJ-Führer, sich als Parteigenosse bei Hitler einsetzen.625 Derartig kritische Eingaben waren nicht die Regel. Aber sie kamen häufig genug vor, weshalb die Gebietsführer ihre Stellen ermahnten, Schriftverkehr nur noch auf dem Dienstweg abzuwickeln.626 Allmählich musste es der RJF dämmern, dass mit einem Beharren auf Freiwilligkeit eine totalitäre Massenorganisation nicht zu realisieren war. Weil das HJ-Gesetz vom Dezember 1936 zwar die staatliche Monopolstellung der Organisation festgeschrieben, der jungen Führerschaft aber keine Instrumente an die Hand gegeben hatte, war die Lage unverändert: Zehntausende wurden als Mitglieder geworben und erfasst. Zum Dienst erschienen aber nur jene, die sich für den Dienst begeisterten. „Aus den Kreisen der HJ kommen immer mehr Klagen“, lautete ein Bericht aus Sachsen im Oktober 1936. Die Heimabende seien schlecht besucht, vielerorts würde mit Maßnahmen gegen Drückeberger gedroht. Es sei aber „auffallend, wie groß die Zahl derer ist, die sich aus irgendeinem Grund vom Dienste beurlauben lassen und am Samstag lieber in die Schule gehen als mit der HJ herumzustrolchen. In der Mitgliederliste stehen also vielerorts die Schüler mit 100 [Prozent] bei der HJ. In der Praxis […] nehmen höchstens 50 [Prozent] aktiv teil.“627 Brandl war mit seiner Kritik kein Einzelgänger. Das unterstreicht auch ein Bericht der Koblenzer Gestapo aus dem Jahr 1938, in dem es hieß: „Immer wieder taucht die Klage auf, dass die HJ nur da bestehe, wo die hauptamtlichen Stellen sich befinden. Je weiter man sich von diesen entferne, umso geringer sei die Erfassung.“ Die Unterführer, die sich um Besserung bemühten, stünden oft 624 Viktor Brandl, Führer der Gefolgschaft 23/338 an Hitlerjugend, Bann 338 Augsburg vom 26.10.1938 (ebd.). 625 Brandl an Graf vom 19.11.1938 (ebd.). 626 Vgl. beispielsweise Schriftverkehr zum Führer. In: GB: Thüringen, 12/36 vom 16.12.1936. 627 Bericht aus Sachsen, A 88. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 3 (1936), S. 1325; ähnliche Gewichtungen in einer Reihe von Berichten, u. a. aus Bayern, A 87. In: ebd., 4 (1937), S. 846.
260
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
auf verlorenem Posten. „Die Folge war und ist auch gegenwärtig noch“, so die Einschätzung der Beamten, „dass die Unterführer missmutig werden und alle Lust verlieren. Ist der Stand erreicht, dass dieser zu einer anderen Formation übertritt oder seinen Posten niederlegt, so ist damit meistens auch das Urteil für die Einheit gesprochen.“628 An alldem hatte das Hitlerjugend-Gesetz von Ende 1936 wenig geändert. Aus Bickenbach im Umland von Koblenz berichtete z. B. ein V-Mann des SD im Juli 1938, dass die örtliche Hitlerjugend seit rund einem Jahr keinen Dienst mehr getan habe.629 Die Überführung der 14-Jährigen in HJ und BDM bereitete, wie Brandl ebenfalls ansprach, weitere Probleme. „Erfahrungsgemäß sind […] in jedem Bann einige hundert Jungen verloren gegangen“, wurde das Problem in Hinblick auf die Überweisungen durch die Personalabteilung im Gebiet Pommern 1937 bestätigt. Man erklärte sich das wie folgt: „Jetzt kommt er in die HJ, er kennt seinen HJ-Führer nicht; der HJ-Führer kennt ihn nicht, deshalb zieht er sich zurück und bleibt dem Dienst fern. Der Pimpf verlässt die Schule und tritt in ein Lehrverhältnis. Die ungewohnte Körperarbeit macht ihn müde, und er ist froh, wenn er abends schlafen gehen kann. Darüber hinaus gilt der erste Monat als Probe- und Bewährungszeit, und er muss sich besonders zusammennehmen. Hat er diese schwere Zeit überstanden, dann hat er vielleicht die Bindung zur HJ verloren, oder er meint sich nicht für die versäumte Dienstzeit verantworten zu können. Er bleibt fern. Der Junge kommt in die Entwicklungszeit und empfindet den Dienst irgendwie als Zwang, und die Überführung ist ihm die beste Gelegenheit, jetzt sich aus unserem Leben fortzustehlen. Die Folgen kann er noch nicht ermessen.“630
Lücken bei der Überführung, Naivität von Unterführern oder fehlende Abstimmung zwischen den Stellen konnte man nutzen, um vom Radar zu verschwinden. „Mit 14 Jahren sollte ich in die Hitlerjugend. Ich fand einen Ausweg“, erinnerte sich Wilfried G. aus Pirna zurück. Die höheren Gymnasialschüler seien um 1936 schon fast ohne Ausnahme Jungvolkführer gewesen: „Ich ging [nun] davon aus, dass man bei der Hitlerjugend denken würde, auch ich sei Jungvolkführer. Diese Annahme erwies sich als richtig, denn nie wurde ich zum HJ-Dienst aufgefordert. An den Tagen, an denen man in der Schule das Braunhemd tragen musste, zog ich die HJ-Uniform an, zum Dienst ging ich nicht.“631 Dass die hohe Erfassung wenig über die Antrittsstärke aussagte, auch keinesfalls die gesamte Jugend im Gleichschritt marschierte, galt für die männli628 Lagebericht für den Monat November 1938 vom 25.11.1938. In: Brommer (Hg.), Die Partei hört mit, Band 1, S. 155–165, hier 162. Vgl. ähnlich kritische Einschätzungen im Lagebericht für das Jahr 1937 vom 13.12.1937. In: ebd., S. 51–78, hier 72. 629 V-Mann K. aus Bickenbach an die SD-Außenstelle Koblenz vom 2.7.1938. In: ebd., S. 449 f. 630 Zur Überführung des Jahrganges 1923 in die HJ. In: GB: Pommern, 4/37, Ausgabe A vom 6.4.1937. 631 Wilfried G., Es wechseln die Zeiten. Ungesicherte Erfahrungen. Lebenserinnerungen, unveröffentlichtes Manuskript, S. 60 f. (StadtA Pirna, ohne Signatur). Vgl. beispielhaft auch Streichungen. In: GB: Saarpfalz, A11/38 vom 25.11.1938: „Ich konnte wiederholt feststellen, dass zahlreiche Streichungen wegen Interesselosigkeit am Dienst vorgenommen werden. Bei näherer Untersuchung stellt sich oft heraus, dass es seitens wenig befähigter Unterführer an einer richtigen Dienstgestaltung mangelt. Ich werde künftig die […] Unterführer zur Rechenschaft ziehen.“
Millionen im Gleichschritt
261
chen wie weiblichen Gliederungen gleichermaßen. Begeisterten Zeitzeugen stehen jene gegenüber, die den Alltag der Hitlerjugend als mühselig beschreiben. Elisabeth Franken, 1919 in Essen geboren, fand aus der katholischen Jugend etwa Mitte der 1930er-Jahre zum BDM. „Ich hatte einfach keine Lust mehr“, erklärte sie über ihre Entscheidung, den Dienst zu quittieren, „bin nicht mehr hingegangen; habe mich auch nicht abgemeldet.“632 Und ein Hitlerjunge aus Baden erinnerte sich ähnlich an seinen Eintritt in die Hitlerjugend zurück: „Die Gymnasiasten hatten den freiwilligen Zwang zur HJ zu gehen. […] Man ging zu den ersten Gruppenstunden und kam dann später nicht mehr.“633 Die Dienststellen bedrängten ihre Unterführer, die enttäuschend niedrige Dienstbeteiligung unter keinen Umständen öffentlich zu thematisieren. Es sei selbstverständlich, dass jedes Hitlerjugendmitglied zum Dienst erscheine: „Wenn diese Selbstverständlichkeit hier und da noch nicht […] Wirklichkeit geworden sein sollte, so bringen wir diese peinliche Tatsache selbstverständlich nicht in die Zeitung.“634 Junge Menschen, die durch die Hitlerjugend erfasst waren, aber dem Dienst fernblieben, bildeten zumal in Großstädten jene informellen Gruppen, die das Regime als „bündisch“ oder „verwahrlost“ stigmatisierte. Zur Definition einer sogenannten Clique zählte man nicht grundlos „Interesselosigkeit gegenüber den Pflichten der Volksgemeinschaft“.635 Das Gros der Dienstverweigerung war freilich nicht auf Opposition, sondern auf profane Alltagsmotive zurückzuführen: Schule, Ausbildung, bäuerliche Höfe oder familiäre Verpflichtungen spannten zu sehr ein, um die Ansprüche der Staatsjugend befriedigen zu können. Historiker Alfons Kenkmann strich heraus, dass überwiegend bürgerliche Mittelschichten und höhere Schüler die Organisation trugen – nicht die Arbeiterkinder und Lehrlinge, die weniger Zeit für die Hitlerjugend aufbringen konnten. Das Fernbleiben vom Dienst sei zum Teil auf negative Erfahrungen zurückzuführen. Solidarität und Kameradschaft waren Floskeln. Das Selbstführungsprinzip brachte mit sich, dass Gleichaltrige Befehle erteilten – und das konnte, je nachdem, wie sie ihre Macht nutzten, in Machtmissbrauch münden.636 Indes waren nicht sämtliche Unterführer so eifrig bei der Arbeit wie Viktor Brandl. Mancherorts wurde der Dienst lasch gehandhabt, was den Ärger hoher Dienststellen schürte. Einige Unterführer erlaubten Freiräume oder schufen durch Gleichgültigkeit selbst Schlupflöcher. Die Gebietsführung in Düsseldorf klagte im Sommer 1939 darüber, dass manchmal „ein Gefolgschaftsführer, der drei
632 Zeitzeugeninterview mit Elisabeth Franken (NSDOK Köln, EzG, jugend1918-1945.de; 12.4.2018). 633 Zeitzeugenbericht von Raimar Wieser, zit. nach Otto Wolkerstorfer, Baden 1939. Das Tor zur Zerstörung. Der Alltag im Nationalsozialismus, Baden 1999, S. 47. 634 Form der Dienstbefehle. In: GB: Nordsee, 4/37 vom 4.3.1937. 635 Bericht der Leipziger Gestapo über Erscheinungen der Opposition und des Widerstandes unter der Leipziger Jugend vom 9.5.1938. In: Jahnke (Hg.), Eine Dokumentation, S. 334–337. Vgl. zudem Steinacker, Der Staat als Erzieher, S. 541. 636 Vgl. Kenkmann, Wilde Jugend, S. 72 f.
262
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Wochen in Ferien fährt, für seine Einheit den Dienst einfach drei Wochen ausfallen“ lasse. Das sei unmöglich und habe nichts mit Dienstauffassung zu tun.637 Das Schwänzen des Dienstes an zwei Tagen der Woche hieß nicht, dass ansonsten attraktive Freizeitangebote nicht genutzt worden wären. Mit Ferien- und Zeltlagern sollte die Begeisterung für die Massenorganisation geweckt werden. Die Hitlerjugend organisierte im Jahr 1935 bereits 1 789 Lager; nach offiziellen Angaben zwei Jahre später 1 977 Lager mit einer Belegstärke von angeblich mehr als einer halben Million junger Menschen.638 Mitte des Jahrzehnts war eines der größten Lager das HJ-Reichsführerlager in Weimar, das 1938 eine geplante Belegstärke von 1 650 Teilnehmern hatte.639 Demgegenüber scheiterten – wie im Gebiet Westmark 1937 – manch kleineres, propagandistisch weniger bedeutsames Lager „wegen der großen finanziellen Schwierigkeiten“ schon in der Planungsphase.640 Sogenannte Großfahrten – mit rund eintausend Beteiligten – führten per Sonderzüge in Erholungsgebiete. Solche Fahrten wurden von der Staatspropaganda natürlich bevorzugt begleitet. Ab Mai 1934 nahm in Sachsen das dort neueingerichtete HJ-Fahrtenamt seine Tätigkeiten auf. Ab dem Spätsommer konnte man bereits Tausenden eine Fahrt nach Ostpreußen, zur Nordsee oder in die bayerischen Berge ermöglichen. Die Parteijugend warb mit Freizeit, Ernährung, Sport und dem Erlebnis einer kameradschaftlichen Gemeinschaft.641 Mehrere Hitlerjungen aus Dresden, die im Folgejahr begeistert an einer Fahrt zur Nordsee teilnahmen, ließen sich in ihrem Fahrtenbuch jedoch kritisch über den militärischen Befehlston aus: „Ehe man die Augen überhaupt aufgemacht hatte, wurde zum Antreten gepfiffen. Da konnte man sich nicht wie zu Hause beim Weckerklingeln noch eine Minute auf die andere Seite legen. […] Oh nein, hier hieß es nichts wie raus. Dann ‚wanderten‘ wir […] im Laufschritt zum Strand. Dort wurde gewaschen. Man konnte sich nicht einmal ganz waschen, schon wurde wieder gepfiffen. Wenn am ganzen Lager [sonst auch] nichts auszusetzen war, hier muss getadelt werden.“642 Das opulente Bildmaterial, das in den Lagern zur Propaganda entstand, hat sich tief in die kollektive Erinnerung eingebrannt. Zeitgenössische Jugendbücher machten diese Ausflüge mit der Hitlerjugend zum Thema.643 Die Gebiets-
637 Einholung von Urlaub. In: GB: Düsseldorf, A11/39 vom 16.7.1939. 638 Vgl. NSDAP (Hg.), Chronik eines Jahrzehnts, S. 23; Vogt, Vestische Hitlerjugend, S. 111. 639 Vgl. die entsprechende Überlieferung zur Organisation des Reichsführerlagers der HJ 1937 und 1938, insbesondere Protokoll einer Besprechung u. a. zwischen dem Oberbürgermeister und dem Oberbannführer von Weimar vom 2.5.1938 (StadtA Weimar, 16, 100-06, 16, unpag.). 640 Zeltlageraktion 1937. In: GB: Westmark, A10/37 vom 15.7.1937. 641 Vgl. HJ erlebt Deutschland. Die Großfahrten der sächsischen Hitlerjugend, Leipzig 1935. 642 Fahrtenbericht der Dresdner HJ-Kameradschaft 7/13/100, S. 19 (Digitalisat im Archiv des HAIT, NL Irmgard Kemper). 643 So z. B. Martin Jank, Großfahrt: Fahrtenerlebnisse eines Hitlerjungen, Berlin 1934.
Millionen im Gleichschritt
263
führungen warben mit bildgewaltigen Broschüren – unter Titeln wie „Wir waren am Meer!“644 Tatsächlich bildeten solche Riesenlager aber die Ausnahme. Nur 1,5 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Sachsen hatte 1936 eines jener großen Ferienlager außerhalb des Gebiets besucht; mit 92,5 Prozent war die überwältigende Mehrheit an kleineren Wochenendlagern mit 50 bis 300 Personen beteiligt.645 In Thüringen verbrachte die Mehrheit aus BDM und JMB die Sommerferien 1938 in kleinen, einwöchigen Lagern.646 Das Gros der Fahrten, die in den Sommermonaten unternommen wurden, hatten mit Lagern ohnehin wenig zu tun: Sie fanden zwar ebenfalls unter dem Dach der Hitlerjugend statt, indem man Urlaub anmeldete, die Fahrt dokumentierte, in staatlichen Jugendherbergen nächtigte oder kleinere finanzielle Unterstützung erhielt.647 Jenseits der Hitlerjugend war nur das Wandern im Klassenverband Ende der 1930er-Jahre nicht verboten.648 Diese Fahrten – Wanderungen durften sie, weil es an den älteren Wandervogel erinnerte, nicht heißen – organisierten die Jugendlichen mit ihren Unterführern mehrheitlich selbst. Fahrtenbücher, die zu Dokumentationszwecken angefertigt werden sollten, zeigen: Je mehr die Einheiten abseits der offiziellen Großfahrten und Zeltlager auf sich selbst gestellt blieben, desto weniger spielten natürlich militärischer Drill oder weltanschauliche Schulung eine Rolle. Eine Jungmädelgruppe aus Leipzig, die im August 1938 für eine Woche in der Sächsischen Schweiz ungezwungene Tage erlebte, betitelte ihr Tagebuch als eine „Großfahrt“ – die offiziellen Sprachregelungen hatten die Mädchen wohl nicht verinnerlicht.649 Derlei Fahrten in Klein- und Kleinstgruppen fanden offiziell im Rahmen der Hitlerjugend statt, unterlagen aber kaum der Kontrolle ihrer Dienststellen: „Ich treffe laufend Fahrtengruppen von fünf oder sechs Mann in Zivil an“, wütete der Gebietsführer in Düsseldorf 1939 über Hitlerjungen, die ohne Uniform unterwegs waren: „Ich verbiete nochmals ausdrücklich die Durchführung von Fahrten in Zivil.“650
644 Gebiet Saarpfalz der Hitlerjugend (Hg.), Wir waren am Meer! 900 saarpfälzische Hitlerjungen erlebten Tage gemeinsamer Erholung in Cuxhaven. Ein Bildbericht von Elsbeth Burmann, Neustadt an der Weinstraße 1939. 645 Vgl. Gebiet Sachsen der Hitlerjugend (Hg.), Statistik in Sachsen, S. 41–49 (DNB Leipzig). 646 Vgl. Sommerlager und Fahrten des Thüringer BDM. Orte, Termine, Anfahrtswege. Zur Orientierung für unsere Gäste, o. D. (StadtA Weimar, 16, 100-06, 5, unpag.). 647 Vgl. zur Anmeldepraxis Fahrtenmeldungen. In: GB: Hamburg, A2/39 vom 1.2.1939; über „Großfahrten“ und Hauptfahrtengebiete, ebd.; zur Unterscheidung verschiedener Lager- und Fahrtentypen vgl. umfangreich Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 6: Lager und Fahrt, S. 459–543. 648 Vgl. Wandernde Hitlerjugend, VOB1. RJF II/38 vom 4.10.1935. In: Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 6: Lager und Fahrt, S. 543. 649 Vgl. Großfahrt einer Leipziger Jungmädelgruppe vom 7.7.38–15.8.38 nach der Sächsischen Schweiz (Digitalisat im Archiv des HAIT, privater NL Isolde G.). 650 Fahrten von HJ-Angehörigen in Zivil. In: GB: Düsseldorf, A12/39 vom 3.8.1939.
264
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Ähnlich führte die Hitlerjugend im Gebiet Hessen-Nassau Beschwerde. Man treffe laufend „eine ganze Anzahl HJ-Angehörige in Zivil auf Fahrt“ an. Die Betroffenen hätten vom Verbot der Zivilfahrten offenbar keinerlei Kenntnis.651 Die Jugendherbergen, die seit März 1933 der RJF unterstellt waren, wurden gelegentlich gemieden. Jugendliche, die im Rahmen der Hitlerjugend auf Wanderschaft gingen, vermuteten teils zu Recht, dass sie dort überwacht würden. Die Folge: leere Schlafsäle, wie zumindest ein Berichterstatter aus Bayern erklärte: „Es ist ja auch nicht schön in diesen Jugendherbergen. Einer traut dem anderen nicht.“652 Ein Abflauen der Unternehmungslust konstatierten manchmal sogar die HJ-Dienststellen. In „fast allen Bannen und Jungbannen“ lasse das Fahrtenwesen „sehr zu wünschen übrig“, hieß es in Thüringen 1937. Ein angemeldeter Ausflug pro Monat sei von den Einheiten gefordert. Die Fahrten seien ein geeignetes Mittel, das zur Kameradschaft und Gemeinschaft hinführe, aber von den Einheitenführern eben entsprechend genutzt werden müsse.653 Ebenso wie in anderen Belangen des Hitlerjugendalltags stehen die Aussagen der Zeitzeugen zueinander häufig in Widerspruch: Während sich manche an die Zeltlager und Großfahrten begeistert zurückerinnern, betonen andere, das Militärische, der Drill und die Durchorganisation des Tagesablaufs hätten sie abgeschreckt. Die Gebietsführung von Sachsen zeigte sich stolz, dass fast die Hälfte aller jungen Menschen an irgendeinem Urlaubsangebot, das 1936 unter ihrem Dach firmierte, teilgenommen hatte. Die verschiedenen Ferienangebote – sowohl die Lager selbst als auch die autonomen Wanderfahrten – litten sicherlich weniger unter Drückebergerei als der ermüdende Dienstalltag. Wer mit Mitschülern und Gleichaltrigen eine Fahrt unternehmen wollte, konnte das in den 1930er-Jahren oft nur noch unter dem Dach der Hitlerjugend. Die Funktionäre wussten um die Wichtigkeit ihres Freizeit- und Ferienprogramms; man organisierte vereinzelt sogar Lager, die sich dezidiert an Nicht-Mitglieder richteten, um sie dort von den Vorzügen der Hitlerjugend zu überzeugen. Der Thüringer BDM organisierte im Sommer 1938 zehn solcher Lager für je 30 Mädchen, die der Organisation bislang nicht angehörten.654 Die Frage, von welchen sozialen Gruppen die Angebote genutzt wurden, lässt sich pauschal schwer beantworten. Die RJF behauptete 1936, dass sich in „Großstädten mit sogenannten bes651 Zivil-Verbot für Fahrten und Einzelwandern. In: GB: Hessen-Nassau, A6/39 vom 15.6.1939. 652 2. Bericht aus Bayern, A 37. In: Deutschland-Berichte der Sopade, 3 (1936), S. 186. Die Hamburger Gebietsführung wiederum beklagte 1939, „dass aktive Einheitenführer bei den einzelnen Herbergsleitern die DJH [Deutschen Jugendherbergen] für bestimmte Tage belegen und dann einfach nicht erscheinen. Es ist klar, dass der Herbergsleiter die Plätze für die angemeldete Zeit freihält, und wenn die betreffende Gruppe dann nicht erscheint, ihm ein finanzieller Schaden entsteht“. Belegung von Jugendherbergen. In: GB: Hamburg, A6/39 vom 1.4.1939; mit ähnlichem Tenor: Vorbestellung von Jugendherbergen. In: GB: Mittelrhein 12/36 vom 20.11.1936. 653 Fahrtenbetrieb. In: GB: Thüringen, A7/37 vom 1.5.1937. 654 Vgl. Sommerlager und Fahrten des Thüringer BDM, S. 1 f. (StadtA Weimar, 16, 100-06, 5, unpag.).
Millionen im Gleichschritt
265
seren Vierteln“ – also aus dem bürgerlichen Milieu – die Anträge der Eltern auf Befreiung ihrer Kinder vom Fahrten- und Lagerbetrieb häuften. Die Statistik aus Sachsen legt aber wiederum anderes nahe: Trotz Finanzhilfen von rund 120 000 Reichsmark waren die Arbeiterkinder in Zeltlagern unterpräsentiert und auffallend wenige Landkinder nahmen teil.655 Für sie bemühte sich die Hitlerjugend um Schaffung sogenannter Jungarbeiterzeltlager sowie um Durchsetzung ihres Urlaubsanspruchs gegenüber den Arbeitgebern.656 Die disparate soziale Zusammensetzung verstärkte sich wohl zusätzlich dadurch, dass den örtlichen Stellen stets eine bestimmte Zahl von Teilnehmern vorgegeben war, die ins Lager verschickt werden konnten. Die Unterführer wählten jene aus, die sie kannten; wem sie vertrauten oder die demselben Milieu angehörten. Auslandsfahrten wurden in den 1930er-Jahren immer seltener und aus außenpolitischen Erwägungen reglementiert. Immer wieder hatte es diesbezüglich Probleme gegeben. „Dummes und ungeschicktes“ Verhalten der HJ-Reisenden in Österreich hätten „die Reichsjugendführung und damit die gesamte HJ in außerordentliche Schwierigkeiten gebracht“, hieß es während der angespannten Lage mit dem austrofaschistischen Nachbarland 1937.657 Man fürchtete, dass diese „Grenzgänger“ im Ausland von Spitzeln und Emigranten ausgehorcht würden, dann unfreiwillig Informationen preisgaben oder – wie im Sudetenland – den deutschen „Volksgenossen“ jenseits der Grenzen zur Belastung wurden.658 Jugendliche und Einheiten übertraten dennoch immer wieder ohne Genehmigung die Grenzen.659 Als im Frühjahr 1939 mehrere HJ-Einheiten nach illegalen Grenzübertritten – vermutlich bei Dänemark – vorübergehend verhaftet worden waren, erließ die RJF eine 10-Kilometersperre entlang der deutschen Grenzen.660 Nach Kriegsbeginn wurde schließlich der Fahrten- und Lagerbetrieb im gesamten Deutschen Reich massiv reduziert. Die „Großfahrten“ wurden eingestellt, Zeltlager durften ab 1940 nur wenige Hundert Beteiligte umfassen.661 655 Beteiligung an Zeltlagern. In: VOBl. RJF IV/14 vom 19.6.1936. In: Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 6: Lager und Fahrt, S. 517; Hitlerjugend Sachsen, Statistik der Jugend, S. 45–47. Vgl. zur folgenden Passage auch vorgegebene Kontingente für die Banne bzw. Untergaue zur Verschickung in Zeltlager durchgehend in den GB und BB, z. B. bei Kontingente für das Kurmarklager 1938. In: GB: Kurmark, A3/38 vom 25.2.1938. 656 Vgl. beispielhaft Urlaubsaktion 1937 für Jungarbeiter. In: GB: Westmark, A12/37 vom 15.8.1937. 657 Veröffentlichungen [und Äußerungen] über Österreich. In: ebd., A6/3 vom 1.5.1937; Durchführung einer Auslandsfahrt. In: ebd., A12/37 vom 15.8.1937. 658 Vgl. die Anweisung bezüglich der Grenzgänger im Sonderrundschreiben des Gaugeschäftsführers der NSDAP Sachsen an die Kreisleiter, HJ, SA und SS des Gaues vom 28.2.1936 (KreisA Pirna, Gemeinde Lichtenhain, 109, Bl. 23 f.). 659 Vgl. Auslandsfahrten. In: GB: Westmark, 3/37 vom 15.3.1937: „Ich habe festgestellt, dass immer noch trotz der ganz klaren Anordnung […] einzelne Angehörige der HJ und auch ganze Gruppen ohne jede Genehmigung und ohne Berücksichtigung der notwendigen Voraussetzungen die Grenzen zu größeren Auslandsfahrten übertreten.“ 660 Vgl. Achtung Grenze! In: GB: Nordsee, A6/39 vom 28.7.1939. 661 Vgl. Anordnung der Hauptabteilung I über Zeltlager und Fahrten. In: GB: Pommern, A1/40K vom 4.3.1940.
266
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Wandern in Kleingruppen bedurften der Genehmigung des Einheitenführers. 1943 kamen Erlaubnisscheine hinzu, welche die Banndienststellen quittierten. Ohne derartige Papiere waren schon die kleinsten Ausflüge illegal.662 Seit Anfang 1940 durften sich Einheiten nicht außerhalb des eigenen Gaus bewegen; für Berlin, Wien und Hamburg galten noch Ausnahmen, damit es für die Jugend dort überhaupt eine legale Möglichkeit gab, in die Natur zu gehen. Aufgrund alliierter Fliegerangriffe wurde ab 1941 „die Durchführung jeder Fahrt“ westlich der Linie von Lübeck über Hamburg bis Karlsruhe verboten.663 Oft – wie in Mainfranken ab 1942 – konnten Ausflüge nicht mehr stattfinden, weil aus Herbergen nun Lager der Kinderlandverschickung wurden.664 War die Hitlerjugend aber eine Massenorganisation aus Karteileichen, wie der Brandbrief des bayerischen HJ-Unterführers Brandl Glauben machen wollte? Zwischen Dienstalltag einerseits und den Freizeitprogrammen der Hitlerjugend andererseits wird man unterscheiden müssen. Verallgemeinern wird man Brandls Lagebericht zudem kaum können, weil diese Art der Grundsatzkritik auch das Motiv der Profilierung beinhaltete. Möglicherweise war der Bericht stark überzeichnet. Doch die Zahl der Säumigen dürfte in der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre erheblich größer gewesen sein, als es Studien bisher thematisiert haben.665 Griffige Formeln wie jener von der „Generation im Gleichschritt“ waren nach 1945 von Nutzen für jene, die ihre eigene Begeisterung einzuordnen und verständlicherweise zu mildern versuchten. „Außerdem gab es eine kleine Minderheit von Jugendlichen“, legte etwa eine Rückblende auf die eigene Hitlerjugendzeit dieses hintergründige Motiv der Rechtfertigung typisch offen, „die sich abseits […] hielt, zumeist bindungslose, arbeitsscheue und abseitige. Ich selbst hatte keinen Kontakt zu ‚Außenstehenden‘.“666 Karteileichen, passive Mitglieder, Dienstverweigerer und sogenannte Interessenlose gab es in der Millionenorganisation nahezu überall und sowohl unter den Jungen als auch unter den Mädchen. Die Möglichkeiten, Freiräume oder Lücken zu nutzen, waren dabei oft von äußeren Faktoren abhängig: der Hitlerjugend vor Ort, ob es sich um eine Einheit in der Provinz oder in der Stadt handelte. Entscheidend konnte sein, wie die jungen Unterführer agierten, wie regel662 Vgl. Geheime Staatspolizei Köln an die Landräte des Bezirks, Fahrtenerlaubnisscheine vom 6.10.1943. In: Klönne, Jugendliche Opposition im „Dritten Reich“, S. 83. 663 Fahrtensperre in luftgefährdeten Gebieten, RB. RJF 33/41 vom 5.9.1941. In: Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 6: Lager und Fahrt, S. 548. 664 Vgl. Fahrten. In: BB: Gebiet Mainfranken, 5/42K vom 5.1942. 665 Vgl. die Einschätzung auch bei Alfons Kenkmann, Im Visier von HJ, Partei und Gestapo – die „bündische Jugend“. In: Anselm Faust (Hg.), Verfolgung und Widerstand im Rheinland und Westfalen 1933–1945, Köln 1992, S. 175–185, hier 178: „Die hohen Zahlen […] sagen aber noch nichts über das tatsächliche Engagement und den tatsächlichen Zuspruch der Jugendlichen zur Staatsjugend aus. Die Zahl enthält die Vielzahl begeisterter […] Jugendlicher. Ebenso sind in ihr aber auch die vielen Heranwachsenden enthalten, die zwar als Mitglieder geführt wurden, aber den Dienst nur selten besuchten bzw. bloße ‚Karteileichen‘ waren.“ 666 Hugo Fett, Erlebte Hitler-Ära. Hoffnung, Enttäuschung, Terror, Norderstedt 2010, S. 25.
Millionen im Gleichschritt
267
getreu sie den Dienstalltag gestalteten. Für die Entwicklung der Hitlerjugend hin zur totalitären Massenorganisation war aber die Tatsache von Bedeutung, dass die Beteiligung insgesamt weit unter den Erwartungen rangierte. Was nutzte es, wenn man zwar Millionen in die Staatsjugend geholt hatte, deren Bindung an das Regime dann aber nicht gewährleistet schien? Der junge HJ-Führer Brandl und viele andere eifrige Unterführer an der Basis forderten Konsequenzen: Die RJF sollte das Freiwilligkeitsprinzip, das man aus der frühen „Kampfzeit“ hinüberzuretten versucht hatte, opfern und damit den Weg zum staatlichen Pflichtdienst ebnen. Die Funktionäre taten sich mit dieser Schlussfolgerung jedoch weiterhin schwer. In Brandenburg musste man gegenüber den Unterführern und nachgeordneten Dienststellen im Februar 1937 eigens betonen, dass man alle Jungen und Mädchen weiterhin auf freiwilliger Basis für die Staatsjugend zu werben versuche. Der Gebietsjungvolkführer verbot sogar „ausdrücklich, dass im Laufe der Werbeaktion überhaupt von einer ‚Jugenddienstpflicht‘ gesprochen wird“.667 Nach der Unterzeichnung des Hitlerjugend-Gesetzes Ende 1936 verstrichen noch mehr als zwei Jahre, bis diese gesetzliche Jugenddienstpflicht schließlich aber doch kam. 5.4
Die Jugenddienstpflicht
Erst mit der sogenannten zweiten Durchführungsverordnung zum Hitlerjugend-Gesetz am 25. März 1939 wurde die Jugenddienstpflicht, auf die sich die RJF seit drei Jahren zubewegt hatte, eingeführt: „Alle Jugendlichen vom 10. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind verpflichtet, in der Hitler-Jugend Dienst zu tun“, besagte Paragraf 1 der Verordnung.668 Qua Verordnung wurde die Hitlerjugend jetzt mit dem Wehr- und Reichsarbeitsdienst gleichgestellt. RJF-Stabsführer Lauterbacher bekräftigte bei einem HJ-Führertreffen in Duisburg im Mai 1940, dass der „Grundstein für die totale HJ“ gelegt sei.669 Ein Austritt aufgrund von „Interesselosigkeit“ war nicht mehr möglich.670 Die Preisgabe des Freiwilligkeitsprinzips – in der sozialen Praxis war es gewiss längst ausgehöhlt – kann im Wesentlichen auf drei Motive zurückgeführt werden: Aus Sicht des Regimes war im Zuge der Kriegsvorbereitungen die vormilitärische Ausbildung der gesamten Jugend zwingend notwendig geworden; und da, in Anbetracht der zunehmenden Diffamierung von Nicht-Mitgliedern, der Rekurs auf Freiwilligkeit
667 Aufnahme des Jahrganges 1927. In: GB: Kurmark, 3/37 vom 20.2.1937. 668 Zweite Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Hitler-Jugend (Jugenddienstverordnung), § 1. In: Vorschriftenhandbuch der Hitlerjugend, Gruppe 2: Die Jugenddienstpflicht, S. 87–89, hier 87. 669 Der Grundstein für die totale HJ. Hartmann Lauterbacher zur Durchführung der Jugenddienstpflicht. In: Der Freiheitskampf vom 3.5.1940. 670 Austrittserklärungen. In: GB: Mecklenburg, A1/39 vom 15.2.1939: „In Zukunft haben nur noch Austrittserklärungen Gültigkeit, die aufgrund von Dienstuntauglichkeit gestellt werden. […] Austrittserklärungen wegen Interesselosigkeit gibt es nicht mehr.“
268
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
seit 1936 immer mehr zur reinen Rhetorik verkam, ließ sich zweitens die faktische Entwicklung nun umso einfacher festschreiben; drittens, und dieser Faktor ist nicht zu unterschätzen, hatte die RJF 1939 die Einsicht gewonnen, dass zwar ein enormes Wachstum gelungen war, aber auf Basis von Freiwilligkeit allein ihr absolutes Totalitätsgebot nicht eingelöst werden konnte.671 Da sich die hauptamtlichen Führer und Führerinnen weiterhin als Vertreter einer Jugendbewegung begriffen, nicht nur als besoldete Funktionäre des Staatsapparats, fiel es schwer, die Ideale der „Kampfzeit“ gänzlich aufzugeben.672 Von Mal zu Mal diffuser gerieten Bemühungen, die neue Dienstpflicht mit althergebrachtem Freiwilligkeitsprinzip argumentativ – und aller Logik zum Trotz – in Einklang zu bringen. Pressereferent Günter Kaufmann bemerkte in einem Kommentar zur Durchführungsverordnung, dass „die Jungen und Mädel […] in erster Linie durch das persönliche Vorbild ihrer Führer und Führerinnen zur Erkenntnis der Notwendigkeit ihres Dienstes und zur freudigen Erfüllung ihrer Pflichten kommen. Innerer freiwilliger Antrieb und Überzeugung sind Mittel der Führung und Erziehung.“673 Nicht nur würde die Hitlerjugend ihre Mitglieder zur freiwilligen Pflichtausübung anleiten, auch der Auslesegedanke sollte trotz Jugenddienstpflicht noch immer zur Geltung kommen. Die durch Schirach zuvor angekündigte Unterteilung der HJ in eine Stamm- und eine Pflicht-HJ ermögliche, dass Hitlerjungen „bei Erfüllung der blutsmäßigen Anforderungen der Partei […] nach einjähriger Dienstzeit […] aufgrund eines freiwilligen Entschlusses in die Auslesegemeinschaft der Stamm-HJ und damit in die Gliederung der NSDAP aufgenommen“ würden.674 Die Unterscheidung galt allerdings nur für die männlichen Jugendlichen ab 14 Jahren, nicht für DJ, JMB oder den BDM.675 Bereits 1938 hatte man die Aufnahme eines Jahrgangs erstmals nicht nach dem Kalendergeburtsjahr, sondern nach dem Schuljahrgang vollzogen; wer bis Ostern 1934 eingeschult worden war und nun ins fünfte Schuljahr kam, 671 Vgl. hierzu und im Folgenden umfassend Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 270– 285. 672 Vgl. Edgar Randel, Die Jugenddienstpflicht (Sonderveröffentlichung: Das junge Deutschland), Berlin 1943, S. 48 f.: „Wenn § 1 der Zweiten Durchführungsverordnung […] nunmehr bestimmt, dass alle Jugendlichen von 10 bis 18 Jahren verpflichtet sind, in der Hitler-Jugend Dienst zu tun, so kann dies nur heißen, dass sie in dieser Jugendbewegung Dienst tun sollen […]. Die Erfüllung der sich hieraus ergebenden Gemeinschaftspflichten ist der Ehrendienst.“ 673 Günter Kaufmann, Erläuterungen zur ersten und zweiten Durchführungsverordnung des Führers zum Gesetz über die Hitler-Jugend vom 1. Dezember 1936. In: Das Junge Deutschland, (1939) 5, S. 195–248, hier 220. Vgl. auch die Anweisungen zur Jugenddienstpflicht. In: GB: Niederdonau, 2/43K vom 2.2.1942: „Die Hitler-Jugend betrachtet es auch weiterhin als eine ihrer Hauptaufgaben, die Teilnahme am Dienst nach den Grundsätzen der Partei durchzuführen, d. h. nach dem Prinzip der Freiwilligkeit. Der Dienst ist daher so zu gestalten, dass die in den Jugendlichen ruhenden Kräfte geweckt und gefördert werden, sodass er gern am Dienst teilnimmt.“ 674 Ebd., S. 213. 675 Vgl. Dienstanweisung zur Durchführung der Jugenddienstpflicht, Richtlinien und Ergänzungen zum Erlass des JFdDtR. vom 20.4.1939. In: Vorschriftenhandbuch der Hitler- Jugend, Gruppe 2: Jugenddienstpflicht, S. 90–95.
Millionen im Gleichschritt
269
wurde von der Hitlerjugend registriert. Die Erfassung von Mitgliedern war auf diese Weise leichter zu bewerkstelligen, da sie kollektiv über die Schulen erfolgte.676 Bei der Heranziehung und Registrierung für die Jugenddienstpflicht bekamen Erfassungslisten, die in Schulen oder von den Gemeinden erstellt wurden, Bedeutung. Kinder bzw. ihre Eltern erhielten über ihre Schule die Nachricht, dass sie zu Aufnahmeappellen erscheinen mussten.677 Dort hatten Mitglieder ebenso wie Nicht-Mitglieder, Kinder genauso wie ältere Jugendliche anzutreten. Eine Rede, welche die RJF als Muster für die Appelle empfahl, stellte einen Zusammenhang von Freiwilligkeit und Pflichtdienst her: „Ich begrüße euch alle, die ihr pflichtgemäß dem Aufruf gefolgt seid und an diesem Appell teilnehmt. Ganz besonders begrüße ich meine Kameraden der Hitler-Jugend. Ihr gehört unserer großen Jugendbewegung bereits an. Ihr seid zu uns gekommen […] aufgrund eines persönlichen Entschlusses, weil ihr am Aufbau des Volkes in der nationalsozialistischen Jugendbewegung mitarbeiten wolltet. […] Ihr übrigen Jugendgenossen, die ihr bis heute der Hitler-Jugend nicht angehörtet und nun als Jugenddienstpflichtige in unsere Reihen eintretet, werdet deswegen nicht weniger willkommen sein. […] Wir erwarten von euch, dass ihr euren Pflichten so nachkommt, als wäret ihr freiwillig gekommen.“678
Im August 1940 war Artur Axmann Schirachs Nachfolger geworden. Aus seiner Sicht galt es, die Jugenddienstpflichtigen vormilitärisch auszubilden, während den Angehörigen der Stamm-HJ darüber hinaus eine vielseitigere, insbesondere auch politisch-ideologische Schulung zuteilwerden sollte. Freiwilligkeit und Auslese, letztere insbesondere im Hinblick auf eine Überführung der 18-Jährigen in die NSDAP, wären so zumindest indirekt aufrechterhalten worden.679 Die Mitarbeiter der Banndienststellen machten sich umgehend daran, vorhandene Mitglieder und Karteien zu sichten, um die Jugendlichen später von den neuen Pflichtmitgliedern unterscheiden zu können.680 Die Einführung der Jugenddienstpflicht bereitete aber gleich zu Beginn logistische Probleme: Die Verordnung war zu spät erlassen worden, um sie bereits am 20. April 1939 für alle Kinder und Jugendlichen in der Praxis realisieren zu können. Dienststellen, die mit Einberufungsappellen an die Öffentlichkeit gingen, musste die RJF zur Ordnung rufen; nicht zum ersten Mal, denn HJ-Führer waren geübt darin, die Anweisungen eigensinnig auszulegen.681 Weil die RJF die Dienstpflicht jedoch 676 Vgl. Neuaufnahmen Jahrgang 1927/1928. In: GB: Thüringen, A3/38 vom 1.3.1937. 677 Vgl. Aufnahme des Jahrgangs 1931/32 zum Dienst in der Hitler-Jugend. In: GB: Pommern, 4/42K vom 4.1942; als Beispiel eine Erfassungsliste für weibliche und männliche Jugendliche der Jg. 1925–1926 vom 9.10.1941 (StadtA Worms, Abt. 231, 167, unpag.). 678 Beispiel einer Rede des Führers des Bannes auf dem Erfassungsappell. In: Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 2: Jugenddienstpflicht, S. 97. 679 Vgl. Thilo Ramm, Familienrecht. Verfassung. Geschichte. Reform, Tübingen 1969, S. 186. 680 Vgl. Aufruf zur Meldung an Dienststellgen zwecks Aufteilung in Stamm-HJ und PflichtHJ in Niederberg, Bann 230, abgedruckt in: Rheinisches Volksblatt vom 5.9.1940. 681 Vgl. Durchführung der Richtlinien zur Aufnahme des Jahrganges 1927 durch die unteren Dienststellen, gez. Gebietsführer Berger und Oberbannführer Kley. In: Reichsbefehl, 10/II vom 12.3.1937: „Seitens der Chefs beider Ämter wurde […] eindeutig festgestellt, dass einzelne Gebiete und Obergaue die herausgegebenen Anordnungen
270
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
einheitlich und für sämtliche Kinder gleichermaßen einführen wollte, mussten die Einberufungen zurückgenommen werden. „Ich weise darauf hin“, lautete es aus der Führungsebene des Gebiets Nordsee, „dass es bis zum tatsächlichen Inkrafttreten […] auf jeden Fall dabei bleiben muss, dass wir in der bisherigen Form weiterarbeiten. […] Wenn mir entgegengehalten wird, dass die erfassten Nicht-HJ-Angehörigen ohne gesetzlichen Zwang nicht restlos gehalten werden können, so muss ich dem entgegenhalten, dass es daher umso notwendiger ist, um jeden einzelnen dieser Jungen einen Kampf zu führen, wie wir das auch in früheren Jahren getan haben.“682 Das Führerkorps im Gebiet Saarpfalz betonte: „Bis auf weiteres ändert sich an dem augenblicklichen Dienstbetrieb nicht das Geringste.“ Über irgendwelche neuen Möglichkeiten oder Rechte für die Unterführer, die sich aus der Verordnung ergäben, dürfe nicht debattiert und nicht geschrieben werden.683 Jede weitere Kommentierung untersagte die RJF. 1939 blieb die Jugenddienstpflicht also noch immer ein Papiertiger. Und ein Jahr später war dies nicht viel anders. Schirach hatte Hitler stolz verkündet, dass 95 Prozent der Jugendführer inzwischen bei der Truppe stünden.684 Tatsächlich befand sich ein erheblicher Teil der Jugendlichen bereits im Wehrdienst und war deshalb für den Hitlerjugendalltag nicht mehr verfügbar. Daher wandte man die Dienstpflicht im April 1940 lediglich auf die 1923 Geborenen an – also auf jene Siebzehnjährigen, die nun selbst kurz vor dem Kriegseinsatz standen. Erst 1941 sah die RJF die Voraussetzungen gegeben, um alle Zehnjährigen heranzuziehen. „Ihr Mädel und Jungen“, sollten die Unterführer und Unterführerinnen in Pommern jetzt feierlich die Neulinge begrüßen, „steht heute am Vormittage des Geburtstages unseres Führers das erste Mal in unseren Reihen und mit euch alle 10-Jährigen im ganzen Deutschen Reich. Ihr alle wollt in unserer Gemeinschaft zu tüchtigen, deutschen Menschen heranwachsen. Und darum sollt ihr mit uns beweisen, dass wir es wert sind, dass der Führer […] uns seinen Namen schenkte.“685 Seitdem fanden im Reichsgebiet jedes Jahr große Einberufungsappelle statt. Die Gemeinden und Schulen mussten im Spätherbst des Vorjahres Kinder und Jugendliche bei den Banndienststellen melden.686 Da die Volkskartei, die auf Basis der Volkszählung von 1939 erstellt werden sollte,
[…] eigenmächtig in organisatorischer oder verwaltungsmäßiger Hinsicht abgeändert haben. Ausgearbeitete reichseinheitliche Richtlinien sind jedoch von allen beteiligten unteren Dienststellen durchzuführen. Diese Selbstverständlichkeit ist jedoch noch nicht in allen Gebieten bekannt, sodass hierdurch letztmalig auf die entsprechenden Anordnungen der beteiligten Ämter hingewiesen wird. Im Falle einer weiteren Nichtbeachtung unserer Vorschriften erscheinen durchgreifende Maßnahmen am Platze.“ 682 Jugenddienstpflicht. In: GB: Nordsee, A1/40K vom 1.3.1940. 683 Ausführungsbestimmungen zum HJ-Gesetz. In: GB: Saarpfalz, A4/39 vom 27.4.1939. 684 Vgl. Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 245. 685 Der Jungvolkführer spricht. Feierfolge zur Aufnahme des Jahrgangs 1931/32 in die Hitler-Jugend am 19. April 1942. In: GB: Pommern, 4/42K vom 4.1942. 686 Vgl. Gemeinde Hamm an die Hitlerjugend betreffend Erfassung der Jugendlichen des Jgs. [Jahrgangs] 1924, 1925, und 1926 zur H.J. vom 9.10.1941 (StadtA Worms, Abtl. 231, 1675, unpag.).
Millionen im Gleichschritt
271
nicht lückenlos vorlag, blieb im Regelfall diese enge Kooperation mit den örtlichen Schulen entscheidend.687 Die Unterführer und -führerinnen gaben die Erfassungslisten an die Schulleitungen. Sie wurden sodann von den Lehrkräften ausgefüllt und mussten danach an die Hitlerjugend zurückgegeben werden.688 Vor Schwierigkeiten stand die Organisation während der Kriegsjahre insbesondere dort, wo im Rahmen der Kinderlandverschickung zehntausende evakuierte Heranwachsende aus bombengefährdeten Städten untergebracht waren. Weil die Personendaten oft nicht vorlagen oder schwer zu greifen waren, kam mit der NSV ein zusätzlicher Akteur hinzu, mit dem man kooperieren und sich koordinieren musste. Spät begann die Jugendorganisation ihr Karteisystem – basierend auf Dienstkarten und Stammblättern – mit den Meldelisten aus Schulen, Gemeinden oder der NSV zu einem engen Erfassungssystem zusammenzuführen. Sofern sich die verschiedenen Stellen miteinander ausreichend abstimmten, was nicht immer der Fall war, führten die Erfassungslisten Namen und Anschriften aller Kinder auf, die im Rahmen von Aufnahmeappellen einberufen werden sollten. Ab 1942 galt die Jugenddienstpflicht außerdem nicht mehr nur für Zehnjährige, sondern für alle Jahrgänge. Der Gebietsführer von „Mittelland“ in Halle frohlockte: „Alle 10- bis 18-jährigen Jungen und Mädel werden […] künftig in unseren Reihen marschieren“ – und gab auf diese Weise unfreiwillig zu, dass dies bislang gar nicht der Fall gewesen war.689 Das Grundproblem – zumindest bei Jungvolk und HJ – bestand weiter und verschärfte sich im Verlauf des Krieges: Junge Unterführer waren im Kriegseinsatz, oder standen kurz davor, und konnten kaum ausreichend für den HJ-Alltag genutzt werden. Ältere HJ-Führer, die beruflich in einem Beamtenverhältnis standen, mussten zudem in den Kriegsjahren immer häufiger versetzt werden. Dies erschwerte die Arbeit in den HJ-Dienststellen zusätzlich.690 687 Vgl. Erfassung und Aufnahme des Jahrgangs 1930/31 zum Dienst in der Hitler-Jugend. In: GB: Oberdonau, A K/2/41 vom 10.2.1941: „Da noch keine Volkskartei besteht, sind die Listen aufgrund der von den Gemeinden angelegten Karteien oder, und das ist das einfachste und sicherste in Zusammenarbeit mit den Schulen, die Erfassungslisten zu erstellen. […] Bei Ausfüllung der Erfassungslisten durch die Schulen werden die Meldescheine an die Jugendlichen abgegeben und sind bei der Anmeldung von den zu Erfassenden auf der HJ.-Meldestelle ausgefüllt wieder abzugeben.“ 688 Vgl. Anweisung zur Mitarbeit bei der Erfassung des Jahrgangs 1930/31 des Regierungspräsidenten Trier an die Schulräte. In: GB: Moselland, Sonderdruck: Erfassung vom 15.1.1941, Anhänge. 689 Der K-Führer des Gebietes, Kameraden und Kameradinnen! In: GB: Mittelelbe, Sonderbefehl: Erfassung und Aufnahme der Jahrgänge 1924–1929, und 1931/32 zum Dienst vom 2.12.1941. 690 Vgl. Versetzung von Beamten, die Führer der Hitler-Jugend sind. In: GB: Mark Brandenburg, 2/43K vom 10.4.1943: „Die Erfüllung der kriegswichtigen Aufgaben ist umso schwieriger, als bekanntlich der größte Teil der HJ-Führer zur Wehrmacht eingezogen ist. Die Hitler-Jugend ist deshalb in besonderem Maße auf alle Führer angewiesen, die ihr zurzeit noch zur Verfügung stehen. Unter diesen sind sehr viele Beamte. Der Einsatz der Beamten wird jedoch dadurch erschwert, dass sie mit kurzer Frist versetzt werden können und dass dadurch die notwendige Beständigkeit in der Arbeit der Hitler-Jugend gefährdet wird.“
272
Anspruch und Realität der Hitlerjugend
Die RJF hatte daher die Entscheidung darüber, ob in einem Gebiet die Strukturen genügten, um die Dienstpflicht umzusetzen, an ihre Gebietsführer delegiert. Nur dort, wo sich genug Personal fand, sollte 1942 eine Einberufung erfolgen.691 Axmann betonte in seinen Memoiren: Die Erfassung habe nur dort stattfinden sollen, „wo es durch das Vorhandensein geeigneter HJ-Führer möglich war. Man wird sich vorstellen können, unter welchen Belastungen nun alle Aufgaben zu erfüllen waren.“692 Aber wer wollte sich ernsthaft nachsagen lassen, man sei den Anforderungen nicht gewachsen oder stünde hinter den Leistungen anderer Regionen zurück? Ab Ende 1942 traten sämtliche Gebiete mit Einberufungsappellen an die Öffentlichkeit. In Österreich liefen sie erst Ende 1943 an; im Gebiet Niederdonau beispielsweise waren die zwischen 1926 bis 1934 geborenen männlichen Jugendlichen und die zwischen 1923 bis 1925 geborenen Mädchen zur Erfassung aufgerufen.693 Von der Möglichkeit der Einschränkung, wie sie die RJF eröffnete, wurde nur zurückhaltend Gebrauch gemacht. Hamburg ist ein dokumentierter Ausnahmefall. Dort rief das Gebiet im Frühjahr 1942 zwar sämtliche Jahrgänge zur Erfassung auf. Zum Dienst heranziehen wollte man vorläufig jedoch nur die nach dem 1. Juli 1928 Geborenen. Die Entscheidung über die Heranziehung der Älteren delegierte das Gebiet an die nachgeordneten Stellen in den Stadtbezirken ab. Vor Ort sollte also „nach den kriegsbedingten Möglichkeiten einer ordnungsgemäßen Führung der Jugendlichen […] auf Antrag des Bannführers“ entschieden werden.694 In Hamburg betraf dies 57 805 männliche und 53 662 weibliche Jugendliche, für welche die Jugenddienstpflicht vorläufig nur unter Vorbehalt wirksam wurde. 85 989 männliche bzw. 80 809 weibliche Kinder, die vor dem 30. Juni 1932 geboren waren, sollten erfasst und auf Basis des Gesetzes zum Dienst herangezogen werden.695 Ein Flickenteppich war die Folge: Obgleich eingeführt, blieb die Praxis der Jugenddienstpflicht von den vorhandenen Kapazitäten und organisatorischen Möglichkeiten vor Ort abhängig. Dort, wo man junge Menschen zum Dienst heranzog, bedeutete dies nicht zwangsläufig, dass deren Dienstbeteiligung wirklich gewährleistet war. Die Kontrollen waren selten lückenlos. Es existierten zudem Schlupflöcher, die man im Kriegsverlauf zu schließen versuchte.
691 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 282 f. 692 Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 251. 693 Vgl. umfassend GB: Niederdonau, Sonderdruck IV: Der erste Jugendappell am 6.12.1943, mit Aufruf des Reichstatthalters in Niederdonau vom 20.11.1943: „Der erste Jugendappell dient der totalen Erfassung aller Jugendlichen für die Jugenddienstpflicht und für den Dienst im BDM-Werk ‚Glaube und Schönheit‘. Die Durchführung der Jugendappelle und die Einführung des Erfassungswesens soll bis 1.2.44 abgeschlossen sein.“ 694 Die Heranziehung zum Dienst. In: GB: Hamburg 2/42, Sonderbefehl: Erfassung der Jahrgänge 1924–1929 und der Jahrgänge 1931/32 in der Hitler-Jugend vom 3.1942. 695 Vgl. Statistik zur Erfassung und Heranziehung im Gebiet Hamburg, gegliedert nach Bannen. In: ebd.
Millionen im Gleichschritt
273
Die Einführung der Jugenddienstpflicht und ihre schrittweise Umsetzung in den ersten Kriegsjahren stand am Ende einer grundsätzlichen Transformation der Hitlerjugend: von einer revolutionären, aktivistischen Bewegung über eine Parteijugend mit Monopolstellung in vielen Bereichen des jugendlichen Alltags hin zu einer totalitären, auf Pflicht gegründeten Staatsjugend. Die Jugenddienstpflicht lag in der Logik ihres Totalitäts- und Monopolanspruchs, war aber mindestens auf gleiche Weise ein spätes Eingeständnis dafür, dass die alten und der Jugendbewegung entnommenen Ideale aus der „Kampfzeit“ – Freiwilligkeit, Selbstführung und jugendliche Autonomie – mit einer totalitären Diktatur nicht in Einklang zu bringen waren. Am Ende dieser Häutung, die eine strukturelle ebenso wie eine mentale war, musste als Konsequenz die Gewalt gegen jene stehen, die sich ihrem Verfügungsanspruch dennoch weiter verweigerten.
III. Massenmobilisierung 1.
Mobilisierung in Permanenz
1.1
Die Erfassungsappelle
Auf die 1939 eingeführte Jugenddienstpflicht folgte eine verordnete Massenmobilisierung der deutschen Jugend in bislang nie gekanntem Ausmaß. Wochen im Vorhinein wurden die Eltern auf anstehende Appelle hingewiesen: Plakate, Presseartikel, nicht zuletzt Briefe drohten Strafen an, sollten Kinder nicht erscheinen und zur Hitlerjugend angemeldet werden. „Zuwiderhandlungen gegen die Jugenddienstpflicht werden nach den bestehenden Bestimmungen geahndet“, lautete der Satz, den die Eltern jetzt regelmäßig lasen.1 Ab 1941 wurden HJ-Meldestellen meist in Schulgebäuden, aber auch in Gastwirtschaften oder Stadthallen eingerichtet.2 Die Heranwachsenden mussten dort erscheinen und sich registrieren lassen. Mit vorliegenden Erfassungslisten wurden die Meldungen abgeglichen, sodass schnell auffiel, wenn jemand nicht erschienen war. Wer auf der Meldestelle registriert wurde, bekam dort gleich einen Zuweisungsschein für die entsprechende Einheit. Beim erstmaligen Dienstantritt erhielten die Kinder den Ausweis und später die Dienstkarte – eine vierteilige Klappkarte, die auf Basis der Jugendstammblätter sämtliche Informationen enthielt und die älteren Ausweise ersetzte.3 Nach 1942 traten auch Jugendliche, die längst erfasst waren, erneut zum Appell an. Damit wollte man die Disziplin auf die Probe stellen. Die jungen Menschen wurden beim Appell in drei Gruppen eingeteilt: erstens Hitlerjugendangehörige, zweitens Nicht-Angehörige und drittens Ehemalige. Erstere durften, nachdem ihr Erscheinen festgestellt worden war, sofort wieder gehen. Nicht überraschend, dass sich manche Zeitzeugen dieser Routine als ermüdend erinnerten. Die zweite Gruppe, um die es eigentlich ging, unterlag der Musterung und wurde zum Pflichtdienst registriert. Der dritten Gruppe der Ehemaligen stand eine schikanöse Prozedur bevor: „Nachdem 1
2 3
Beispielhaft die Bekanntmachungen des Landrats und Bannführers zur Erfassung der Jahrgänge 1932/33 und Aufnahme in die HJ, Bernburg vom 27.1.1943 (LHASA, DE, KB BBG, 1487, Bl. 34); sowie die Bekanntmachung für die Stadt Essen vom 19.9.1940 (StadtA Essen, Rep. 102, Abtl. XIV, 23, Bl. 10). Vgl. beispielhaft der Aufruf des Landrates Cloppenburg und der HJ-Bannführung zur Teilnahme am Jugendappell mit Anschriften der Meldestellen für verschiedene Ortsgruppenbereiche vom 15.12.1943 (StA Oldenburg, Dep 20 CLP 348, 1276, unpag.). Vgl. Erfassungswesen der Hitler-Jugend. In: GB: Westmark, Sonderdruck: Aufruf für das Erfassungswesen, 23/43K vom 30.11.1943. Die Jugendstammblätter waren zuletzt die wichtigsten Mitgliederunterlagen, die das Mitgliederbuch, die Erfassungsliste und bisherige Meldescheine ersetzten, außerdem die einzige Personalunterlage auf Ebene der Gefolgschaften, Fähnlein, JM und BDM-Gruppen wurden in den betreffenden Einheiten und beim Bann geführt. In den Bannen existierte außerdem eine Mitgliederkartei, die alle personellen Angaben der Zugewiesenen bzw. Erfassten enthielt.
276
Massenmobilisierung
bei den Erfassungsappellen die Angehörigen der Hitlerjugend überprüft und entlassen worden sind, werden die ehemaligen Angehörigen der Hitler-Jugend nach dem Grund ihres Ausscheidens befragt. Jugendliche, bei denen sich herausstellt, dass sie wegen Interesselosigkeit aus der Hitler-Jugend ausgeschieden sind, müssen zum Dienst herangezogen werden.“4 Junge Menschen, die nicht erfasst waren, ihren Austritt erklärt hatten oder aus disziplinarischen Gründen hinausgeworfen worden waren, sahen sich nicht mehr nur im eigenen sozialen und beruflichen Umfeld mit unangenehmen Fragen konfrontiert. Jetzt galten sie als zwangsverpflichtet und waren in der Hitlerjugend gebrandmarkt. Die Hitlerjugend unterschied, wie erwähnt, nach Kriegsbeginn zwischen einer Stamm-HJ und einer allgemeinen HJ bzw. der Pflicht-HJ. Gesonderte Einheiten für die Pflicht-HJ wurden ab dem Frühjahr 1941 vereinzelt aufgestellt – offenbar aber nur in Metropolen, wo es eine nennenswerte Zahl von Nicht-Organisierten noch gegeben hatte. In mittel- und kleinstädtischen Regionen, wo sie eine verschwindende Minderheit stellten, existierte die Pflicht-HJ meist nur auf dem Papier.5 Die Jugendlichen taten in überwältigender Mehrheit gemeinsam Dienst. Erschienen Jugendliche jedoch nicht zum Dienst, hoben es deren Unterführer gern gesondert hervor, wenn es sich um Pflichtmitglieder handelte.6 In größeren Städten wurden vereinzelt gesonderte Einheiten für die Pflicht-HJ gegründet. Hier leisteten die zwangserfassten männlichen Jugendlichen ab 14 Jahren Dienst. Im Volksmund nannte man diese Einheiten „Straf-HJ“ – ein Begriff, der im offiziellen Schrifttum und in der archivalischen Überlieferung allerdings nirgends auftaucht. In Hamburg wurde, wie Zeitzeugen schilderten, in solche Einheiten überwiesen, wem disziplinarische Verfehlungen, eine Beteiligung an subkulturellen Cliquen und Banden oder kleinkriminelle Delikte zum Vorwurf gemacht wurden.7 In Dresden, schilderte ein Ehemaliger, habe sich die „StrafHJ“ mit der regulären Stamm-HJ auf den Wiesen am Elbufer Schlägereien geliefert.8 „In meiner HJ-Zeit […] war es mir gelungen, mich erfolgreich zu drücken“, berichtete ein anderer Ehemaliger über die Pflicht-HJ. Irgendwann 1942 sei in
4 5
6 7
8
Arbeitsrichtlinien. In: GB: Oberdonau, Sonderdruck IV/41: Arbeitsrichtlinien und Erlässe zur Durchführung der Jugenddienstpflicht vom 15.9.1941. Vgl. beispielsweise Neueinteilung des Bannes in Heilbronn. In: Bannbefehl Unterland, 1/42 vom 18.2.1942 (StA Ludwigsburg, PL 509, Bü. 7, unpag.): „Alle Angehörigen […] sind zum Dienst in den Einheiten der Hitler-Jugend heranzuziehen, ohne Unterscheidung zwischen Stamm- und Pflicht-Hitler-Jugend. Damit sind alle Jahrgänge zum Dienst in der Hitler-Jugend erfasst.“ Kollmeier meinte, es habe die Pflicht-HJ als gesonderte Einheit grundsätzlich nicht gegeben. Vgl. Kollmeier, Ordnung und Ausgrenzung, S. 199. Vgl. Meldung von säumigen Pflicht-HJ-Mitgliedern durch einen Gefolgschaftsführer in Heilbronn an das Bürgermeisteramt Abstatt vom 7.5.1941 (ebd.). Erwähnungen einer „Straf-HJ“ in einzelnen Erinnerungsberichten oder bei Publikationen, die auf Zeitzeugeninterviews beruhen, beispielsweise bei Gerold Schneider, Vergangenheit, die nicht vergehen will, Leipzig 1998, S. 6–8; Jörg Ueberall, Swing-Kids, 2. Auflage, Berlin 2015, S. 92. Vgl. Interview von André Postert mit Klaus F. vom 11.5.2015 (Tonaufnahme im Archiv des HAIT).
Mobilisierung in Permanenz
277
seinem schlesischen Heimatort Laubau ein Erfassungsappell angesetzt worden. Dort habe man ihn als Säumigen überführt und folglich in eine Einheit überwiesen, „die man die ‚Straf-HJ‘ nannte. Die meisten in dieser Einheit waren Lehrlinge bei der Stadtkapelle […], die dann meistens während der HJ-Dienst-Stunden, an denen ich nun teilnehmen musste, verpönte Jazz-Musik spielten.“9 Häufig tauchten junge Menschen nicht in den HJ-Meldestellen auf. Im Regelfall – wenn die Erfassungslisten korrekt waren – fiel das schnell auf. Es konnten polizeiliche Vernehmungen der Eltern folgen. Deren Begründungen für die Säumigkeit der Kinder fielen ähnlich aus: Man habe die Aufrufe in der Zeitung nicht gelesen, das Kind sei erkrankt, das Wetter war widrig, man habe es vergessen oder sei zum falschen Ort gegangen.10 Anders als in den 1930er-Jahren, als die Kritik an der Hitlerjugend selbst in der Partei verbreitet war, hielt man sich jetzt mit Einwänden politischer, religiöser oder grundsätzlicher Art zurück. Geldstrafen wurden verhängt, wenn die Ausflüchte fadenscheinig schienen. Die Gebietsführung in Wien vereinbarte mit der Polizei Mitte 1943 folgendes Vorgehen: Die „Listen der nichtangemeldeten Jungen und Mädel werden […] den zuständigen Polizeiämtern zur Bearbeitung übergeben. Die Polizeiämter veranlassen […] eine Verständigung der Eltern […] und fordern dieselben zur erneuten Anmeldung […] auf. Der Bann hat dafür zu sorgen, dass die Jungen und Mädel sofort der zuständigen Einheit zugewiesen werden. Ist diese Anmeldung abgeschlossen, so hat der Bann sofort listenmäßig festzustellen, wer der neuerlichen Anmeldung wieder nicht nachgekommen ist. Diese Liste ist dem Polizeiamt […] mit der Bitte um erneute polizeiliche Vorladung zur Verhandlung zu übersenden. An dieser Verhandlung sollen wo möglich die Kreisleiter, Führer der Banne bzw. Mädelführerinnen der Banne, Leiter der Bezirksjugendämter und Ortsgruppenleiter teilnehmen. Der amtshandelnde Polizeirichter entscheidet […], ob eine Geldstrafe, Haft oder Verweis auszusprechen ist.“11
Die Appelle bedeuteten einen enormen organisatorischen Aufwand, wie beispielhaft eine Terminübersicht aus Bayern von 1943 zeigt. Bis zum 20. Februar mussten die Erfassungslisten vorliegen, binnen acht Tagen folgte die Festlegung der Meldestellen sowie Presseaufrufe; am 1. bis 15. März fanden die Appelle samt Listenprüfung, Entgegennahme von Zurückstellungsanträgen sowie Zuteilung der Zuweisungsscheine statt; bis zum 1. April sollten die Jugenddienstpflichtigen ihren ersten aktiven Dienst getan haben. Am 15. April gaben die Banne ihre Bilanz samt Stärkemeldung ab.12 Die Appelle bildeten das wichtigste Instrument beim Zugriff auf die Kinder und Jugendlichen. Sie waren jedoch
9 Hans-Joachim Haude, Kindheit im Nazistaat. In: Laubaner Gemeindebrief, (2017) 1, S. 15. 10 Vgl. die gut dokumentierten Berichte u. a. der Polizeibehörde Löningen, Kreis Cloppenburg an den Landrat vom 23.4.1943 (StA Oldenburg, Dep 20 CLP 348, 1276, unpag.). 11 Erzwingung der Jugenddienstpflicht. In: GB: Wien, 7/43K vom 1.7.1943. 12 Vgl. Erfassung und Aufnahme des Jahrganges 1932/33 zum Dienst in der Hitler-Jugend. In: GB: Hochland, K3/43, Sonderdruck vom 16.2.1943.
278
Massenmobilisierung
längst nicht das einzige Werkzeug, über das die Hitlerjugend verfügte. Zeitgleich stand in jedem Frühjahr die Überweisung der 14-Jährigen zu HJ und zum BDM an. Traditionell bislang als „Feiern der Lebenswende“ benannt, mit dem Treuegelöbnis auf Führer und Fahne, musikalischer Begleitung sowie festlichen Reden der örtlichen Parteigranden, firmierte der Tag ab 1942 als „Verpflichtung der Jugend“.13 Oft fanden sie nicht mehr zu Hitlers Geburtstag statt, wie in den 1930er-Jahren, sondern Ende März etwa zeitgleich zur Schulentlassung. Indem die schulischen Feiern mit den Feiern der Hitlerjugend einhergingen, schien das Netz um eine zusätzliche Masche enger gewoben. Die Schulleitungen mussten hierzu erneut Listen an die Dienststellen der Hitlerjugend einreichen.14 In bewusster Konkurrenz zu Konfirmation und Firmung wurde der Akt möglichst festlich gerahmt – mit Gesang, Ansprachen, Fahnen, Kapellen sowie unter Beteiligung der Eltern, Lehrer und Ortsgruppenleiter der Partei. Zugleich lastete auf den Familien ein erheblicher Druck zur Anpassung: „Die Eltern sollen nicht nur dazu geführt werden, […] teilzunehmen, sie sollen vor allen Dingen auch dazu angeregt werden, den Tag der Verpflichtung im Familienkreis für ihren Jungen oder Mädel festlich auszugestalten. Der Vorbereitung […] dient ein Besuch des Hoheitsträgers in der Familie zusammen mit dem HJ-Führer bzw. der BDM-Führerin, der im Februar erfolgt. Dabei sollen die Eltern dazu angeregt werden, dass sie ihren Jungen und Mädeln aus Anlass der Verpflichtung der Jugend kleine Geschenke machen, dass sie den Tag durch ein etwas festliches Mittagessen, durch eine Einladung von Verwandten und Bekannten für die Jungen und Mädel auch zu Hause zu einem kleinen Fest gestalten.“15
Weder die Verpflichtungsfeiern noch die Erfassungsappelle verliefen durchweg zufriedenstellend. Da die Zahl der zu registrierenden Kinder durch die Dienstverpflichtung weiterer Jahrgänge von Mal zu Mal kräftig anstieg, war Überforderung die Folge. Die Listen wiesen Lücken auf oder die Registrierungen bei der Erfassung verliefen chaotisch. 1940, als erstmals die 17-Jährigen zum Appell aufgerufen wurden, beklagte das Gebiet Hamburg nach einer Überprüfung ihrer Listen eine Fehlerquote von immerhin rund 30 Prozent.16 Und im Gebiet Moselland wirkte sich 1941 die dünne Personaldecke offenbar negativ auf die Erfassungen aus. Über mehrere Monate hinweg und „trotz viermaliger Mahnung“, wie die Gebietsführung anprangerte, waren „noch immer nicht von allen Bannen“ die Berichte und Stärkemeldungen eingegangen.17 Der Versuch, 13 Vgl. Jugend wie der blühende Tag. Die Vierzehnjährigen erlebten überall die Feiern der Lebenswende. In: Der Freiheitskampf vom 31.3.1941; Verpflichtung von 9 000 Vierzehnjährigen. Würdig ausgestaltete Feiern in allen Ortsgruppen des Kreises Dresden. In: ebd. vom 1.4.1941. 14 Vgl. GB: Mittelelbe, Sonderbefehl: Richtlinien zur Verpflichtung der Jugend am 22. März 1942 vom 9.2.1942; Verpflichtung der Jugend. In: BB: Sachsen, 2/43 vom 1.3.1943. Vgl. hier und im Folgenden Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 292–300. 15 GB: Mittelelbe, Sonderbefehl: Richtlinien zur Verpflichtung der Jugend am 22. März 1942 vom 9.2.1942. 16 Vgl. Erfassung des Jahrgangs 1923. Abschlussbericht (StA Hamburg, 354-5 II: 21007.56), nach Schmidt, Hamburger Schulen, S. 445. 17 Stärkemeldungen. In: GB: Moselland, A K/2/41 vom 10.2.1941.
Mobilisierung in Permanenz
279
auf alle jungen Menschen geradezu katalogartig zuzugreifen, kam einer Mammutaufgabe gleich. Erst spät – wenn überhaupt – konnte man sie bewältigen. Michael Buddrus schätzte, der RJF sei 1943/44 zwar gelungen, fast alle jungen Menschen auf irgendeine Weise zu erfassen und für den Dienst zu registrieren – doch unter Zuhilfenahme perfidester Mittel wie der Koppelung von Lebensmitteln oder die Ausgabe von Kleidung an HJ-Dienstausweise.18 Dass die Probleme, die sich aus fehlerhaften Listen, chronischer Unterbesetzung oder den Tücken bei der Musterung ergaben, bis zum Schluss nicht völlig abgestellt werden konnten, deuten die Pläne der RJF vom Herbst 1944 an. Nur Monate vor der Kapitulation sollte das gesamte Erfassungswesen reorganisiert werden. Mit einem „zentral gesteuerten Einberufungswesen“ wollte die RJF die Arbeit ihrer Dienststellen besser koordinieren helfen. Auf Gebietsebene sollten als „Erfassung und Einberufung“ betitelte Abteilungen aufgebaut werden. Drei separate Arbeitsbereiche waren vorgesehen: 1. Geschäfts- und Karteiführung, 2. Einberufung, 3. Erarbeitung und Überwachung des Erfassungswesens in den Bannen.19 Diese Koordinationsstellen kamen wahrscheinlich nirgends mehr zum Einsatz. Die Umsetzung der Dienstpflicht im Alltag blieb die eigentliche Herausforderung. Der Hitlerjugendapparat wurde nach 1939 zunehmend fragil: Die HJ-Führer standen im Kriegseinsatz, die Infrastruktur in den Großstädten wurde im Zuge des Bombenkriegs massiv zerstört und der reguläre Dienst wich in den letzten Kriegsjahren vermehrt Not- und Hilfseinsätzen. Die Begeisterung junger Menschen – vor allem in der HJ und im DJ – schmolz durch die wachsende Inanspruchnahme durch Hilfseinsätze zusehends dahin. Sobald sich eine Gelegenheit fand, entzogen sich viele Jugendliche, während das Führerkorps aber mehr denn je darauf angewiesen war, dass der organisatorische Apparat an der Basis funktionierte. Im Einzelfall ließ sich das schwer nachprüfen: „Wenn du in Zukunft nicht mehr so unter Dienstaufsicht stehst wie bisher, weil deine vorgesetzten Dienststellen nur noch kriegsmäßig besetzt sind“, mahnte man die Unterführer im Jahr 1940, „beweise, dass du ein junger, wahrer Nationalsozialist bist, dem […] Gehorsam und Pflichterfüllung oberstes Gebot sind.“20
18 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 291. 19 Vgl. Aufbau einer Abteilung Erfassung und Einberufung. In: GB: Pommern, 12/44K vom 7.1944. 20 Jungführer! In: Junger Wille. Führerdienst der HJ: Sachsen, (1940) 3, Ausgabe HJ, S. 4. Vgl. auch Organisation der Hitler-Jugend im Kriege. In: GB: Nordsee, K1/39 vom 12.10.1939: „Die Pflicht zur stärkeren Zusammenfassung aller Kräfte und die Tatsache, dass die Mehrzahl der Mitarbeiter in den Stäben zum Kriegsdienst einberufen sind, machte eine Zusammenlegung von Arbeitsgebieten […] in den Gebiets- und Bannführungen notwendig.“
280
Massenmobilisierung
1.2 Die Grundlagen der Jugenddienstpflicht Mädchen und Jungen waren nunmehr verpflichtet, „regelmäßig und pünktlich anzutreten und nach besten Kräften in der Gemeinschaft […] mitzuarbeiten“.21 Unentschuldigtes Fehlen war unzulässig, Urlaub musste beantragt, Krankheit per Attest nachgewiesen werden.22 Wer den Dienst mehrfach versäumte, hatte mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen: „Wer im Kriege den Jugenddienst verweigert, kann mit dem Kriegsdienstverweigerer verglichen werden. Er schwächt die Wehrkraft des deutschen Volkes.“23 Der Druck auf die Familien wuchs weiter, denn polizeiliche Maßnahmen zur Sicherung der Jugenddienstpflicht richteten sich nicht nur gegen die jungen Menschen selbst, sondern auch gegen deren Eltern.24 Am Ende konnte zumindest in Härtefällen eine Einstufung als familiäre „Verwahrlosung“ erfolgen. Dienststellen der Hitlerjugend arbeiteten mit Ortspolizeibehörden und Kriminalpolizei Maßnahmen für „vorbeugende Verbrechensbekämpfung“ aus.25 Hierdurch wurde die Dienstverweigerung in einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Jugendkriminalität gestellt. Arbeitgeber durften ihre Lehrlinge nicht vom Hitlerjugenddienst abhalten; taten sie es doch, drohte ein Strafantrag wegen „böswilligen Fernhaltens […] vom Dienst“, und dies selbst in den letzten Kriegswochen.26 Der Jugenddienstarrest – der „Wochenendkarzer“ bei „Wasser und Brot“ – drohte nach Anweisungen aus der RJF und des Justizministeriums ab September 1940 jenen männlichen Jugendlichen im Alter ab 14 Jahren, die den Dienst verweigerten, „in grober Weise gegen die Zucht und Disziplin“ der Partei- und Staatsjugend verstießen, oder sich die Anwendung „anderer Ehrenstrafen als erfolglos“ erwiesen hatte.27 Der Regierungspräsident von Düsseldorf, Eggert Reeder, bezeichnete den Arrest als „Beugemittel gegen jugendlichen Starrsinn“, der dringend angewandt werden müsse.28 Jugendliche saßen ihre Strafen meist an Wochenenden ab, sollten aber nicht aus dem Elternhaus und Betrieb herausgerissen werden. Dauerarrest von 21 Reichsjugendführung (Hg.), Dienstvorschrift der Hitler-Jugend. Der Jungmädeldienst. Übersicht über Wesen, Form und Arbeit des Jungmädelbundes in der HJ, Berlin 1940, S. 20. 22 Vgl. ebd., S. 21. 23 Der Gebietsführer gibt bekannt. In: BB: Gebiet Hamburg, 2/41 vom 9.1941. 24 Vgl. Runderlass des RFSS [Reichsführer SS] und ChdDtPol. Über die Erzwingung der Jugenddienstpflicht vom 20.10.1942. In: RMBliV, 1942, S. 2 037 f. Im Erlass des JFdDtR zur polizeilichen Erzwingung der Jugenddienstpflicht vom 26.3.1940, war davon noch keine Rede gewesen. Vgl. Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 2: Jugenddienstpflicht, S. 116. Zur sukzessiven Verschärfung umfassender Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 283. 25 Vgl. ebd. 26 Diesbezüglich Strafantrag und Verfahren gegen Eltern und Lehrmeister eines Mädchens aus Reutlingen vom Oktober 1944 bis Februar 1945 (HStA Stuttgart, E 151/09, Bü 169, Bl. 1 f. und 29). 27 Jugenddienstarrest. In: GB: Franken, 9/41 vom 12.1941. 28 Der Regierungspräsident Düsseldorf an die Landräte, Oberbürgermeister und Polizeipräsidenten des Bezirks vom 31.5.1941 (StadtA Essen, Rep. 102 Abtl. XIV, 23, unpag.).
Mobilisierung in Permanenz
281
einer Woche bis zu einem Monat war schweren Fälle vorbehalten.29 Ausschlüsse aus der Hitlerjugend nach mehrmaligen Verstößen und Arrest wurden aufgrund der angestrebten Massenmobilisierung nur zurückhaltend verhängt. Viele Ausgeschlossene kamen aus größeren Städten; im Gebiet Franken z. B. gut zwei Drittel aus Nürnberg und Fürth.30 Im März 1940 hatte Reichsjugendführer Axmann verfügt, dass gegen säumige Jugendliche polizeiliche Zwangshaft angewandt werden könne. Diese Anordnung warf aber juristische Probleme auf, da sich polizeiliche Maßnahmen an der Gesetzeslage der Länder zu orientieren hatten. Das Justizministerium von Anhalt beispielsweise argumentierte gegenüber einem HJ-Bannführer, der auf polizeiliche Maßnahmen gegen säumige Jugendliche beharrte, dass eine „derartige Bestimmung […] in der Landesgesetzgebung […] leider nicht vorgesehen“ sei. Die Landesgesetzgebung lasse bis dato „nur polizeiliche Zwangsmittel zu, wenn durch die Handlung oder Unterlassung ein Strafgesetz übertreten“ sei. Aufgrund von Dienstverweigerung in der Hitlerjugend könne man niemanden in Haft nehmen.31 Mit einem neuen Erlass besserte die RJF im September 1940 nach. Himmler hatte sich bereit erklärt, einen Jugenddienstarrest durch die Polizeibehörden vollstrecken zu lassen. Über diese Wochenendhaft bestimmten HJ-Gerichte. Sie konnte bis zu drei Mal hintereinander angeordnet werden, dann folgte die Inhaftierung für drei bis acht (später zehn) Tage. Demjenigen Jugendlichen, der weiterhin uneinsichtig blieb, drohten danach härtere Konsequenzen. Von den rund 800 Fällen des sogenannten Jugenddienstarrests, die innerhalb des ersten Jahres im gesamten Deutschen Reich verhängt wurden, begründeten sich 61 Prozent aus Verletzungen der Jugenddienstpflicht.32 Zu Beginn waren sich nicht einmal die örtlichen HJ-Führer über die Bestimmungen vollends im Klaren. In Essen beispielsweise teilte der HJ-Führer dem Polizeipräsidium 1940 mit, die Zwangshaft sei durch die Gestapo zu vollstrecken, was so nicht stimmte und zu einer lang anhaltenden, verwirrten Korrespondenz der Beteiligten führte.33 Bei rund 100 Fällen – von 5 419 Personen des Jahrgangs 1923 – verlangte die städtische Hitlerjugend ein polizeiliches Einschreiten, weil sie selbst nicht in der Lage sei, diese Jungen zur Einsicht zu bewegen. Die Polizei, die sich um ihr Ansehen sorgte und zunächst ein Eingreifen ablehnte, bezweifelte aber, dass die Hitlerjugend schon „mit ihren Maßnahmen
29 Vgl. Der Reichsminister der Justiz an die Generalstaatsanwälte über den Vollzug des Jugendarrests vom 2.9.1940 (GLA Karlsruhe, Abt. 240, 1987/53, 689, Bl. 67 f.). 30 Vgl. überlieferte Ausschlüsse/Ausscheiden in den Ausgaben des GB: Franken. Vgl. in diesem Zusammenhang außerdem Kollmeier, Ordnung und Ausgrenzung, S. 219–260. 31 Schreiben an den K-Bannführer von Anhalt-Dessau der HJ vom 2.11.1940 (LHASA, DE, Z 141, 651, Bl. 4). 32 Vgl. Kollmeier, Ordnung und Ausgrenzung, S. 226; Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 485. 33 Vgl. Schreiben des HJ-Standortes Essen an das Polizeipräsidium über die polizeilichen Maßnahmen zur Erfüllung der Jugenddienstpflicht vom 25.11.1940 (StadtA Essen, Rep. 102 Abtl. XIV, 23, Bl. 12 f.).
282
Massenmobilisierung
[…] am Ende“ sei.34 Sanktionierung war im Regelfall zunächst niedrigschwellig. Um nicht gleich die Polizei einschalten zu müssen, stand es den Bannführern beispielsweise frei, einen Säumigen zunächst durch den SRD vorführen und vernehmen zu lassen.35 Arrest sollte nur in angeblichen Härtefällen verhängt werden. Bußgelder in Kombination mit Strafandrohungen waren demgegenüber ein Massenphänomen. Die RJF setzte neue Sonderbeauftragte in den Gebietsführungen ein. Jene stellten zur Vollstreckung von Strafmaßnahmen Anträge bei den Gestapo-Stellen. Diese Sonderbeauftragten kamen offenbar überwiegend in Metropolen oder mittelgroßen Städten zum Einsatz, weil die RJF hier die größten disziplinarischen Mängel und Probleme mit der Dienstpflicht vermutete: Berlin, Hamburg, Köln, Halle, Augsburg und Klagenfurt.36 Ließen sich aufgrund von personellen Engpässen keine Sonderbeauftragten einsetzen, sollten die Banndienststellen deren Aufgaben und Verantwortung übernehmen. Ab 1942 waren die Gebietsführer und HJ-Richter zuständig.37 Zudem ging die Vollstreckung nun auf die Justizverwaltungen über.38 Im Gebiet Düsseldorf hatte man schon Sommer 1939 festgestellt, dass Hitlerjugendeinheiten zum Teil wochenlang keinen Dienst taten, auch weil die unterste Führerschaft oft ohne Abmeldung in die Ferien gegangen war und man keinen Ersatz gefunden hatte.39 Derlei Probleme existierten in den Kriegsjahren und trotz der Jugenddienstpflicht weiter. „Ich habe meine Zeit dort größtenteils negativ erlebt, weil mir die meisten Aktivitäten keinen Spaß gemacht haben“, berichtete das Jungmädel Frieda S., die 1940 zur Hitlerjugend kam: „Das ständige Marschieren und Antreten fand ich viel zu anstrengend. […] Auch das Singen und Auswendiglernen von Liedern hat mir überhaupt nicht gefallen. Irgendwann haben sich diese negativen Gefühle […] in Gleichgültigkeit umgewandelt, weil es keine Chance gab, sich dem BDM zu entziehen.“40 Manchmal jedoch gab es Chancen. Nicht immer traten alle an. Über eine Kleinstadt nahe Leipzig urteilte der SD mit Blick auf die eisige Winterkälte Anfang 1940 fast lapidar: „Oschatz hat ungefähr 200 HJ-Angehörige. Es treten in der augenblicklichen Zeit ungefähr 50 Jugendliche zum Dienst an.“41 Der Reichsstatthalter für Braun-
34 Notiz über die Unterredung mit der Standortführung der HJ Essen vom 28.11.1940 (ebd.). 35 Vgl. Durchführung der Jugenddienstpflicht. Disziplinarmaßnahmen. In: GB: Niederdonau, Sonderdruck: Durchführung der Jugenddienstpflicht, 6/43K vom 22.5.1943. 36 Vgl. Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern an die ausserpreussischen Landesregierungen, betrifft: Arrest als Dienststrafe der Hitlerjugend vom 25.7.1940 (StA Freiburg, B719/1, 5018, unpag.). 37 Vgl. Kollmeier, Ordnung und Ausgrenzung, S. 227. 38 Vgl. im Zusammenhang Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 486. 39 Vgl. Einholung von Urlaub. In: GB: Düsseldorf, A 10/39 vom 5.7.1939. 40 Zeitzeugeninterview mit Frieda S. In: Schiermeier, Jugend im Nationalsozialismus, München 2012, S. 28–35, hier 32. 41 Bericht der SD-Außenstelle Oschatz des SD-Abschnitts Leipzig vom 31.1.1940 (IWM Duxford, Morale Documents, Captain Branney; Digitalisate der Lageberichte im Archiv des HAIT, unpag.).
Mobilisierung in Permanenz
283
schweig und Anhalt, Rudolf Jordan, wies wiederum Ende 1941 auf die „schlechte Dienstauffassung einzelner Kreise von Jugenddienstpflichtigen“ hin. Er forderte die Zusammenarbeit aller Kräfte, um die „schärfste Handhabung der der Polizei zustehenden Maßnahmen“ zu gewährleisten. Höhere Zwangsgelder – üblich waren etwa 15 Reichsmark – seien nach Antrag zulässig. „Besonders renitente Jugendliche“, hieß es, seien „zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten zu zwingen“.42 Die Hitlerjugend in Essen zeigte sich in einem Brief an die Polizei vom Mai 1941 fast hilflos. Die Lage sei so, „dass sich die Dienstbeteiligung […] bis auf nahezu 50 [Prozent] gesenkt“ habe. Die polizeilichen Maßnahmen, erklärte die Hitlerjugend, seien nicht ausreichend oder griffen ungenügend.43 Lag die Zahl der verhängten Jugenddienstarreste zu Beginn niedrig, steigerte sie sich im Zeitverlauf erheblich: 2 140 Fälle registrierte man im zweiten Jahr, 3 178 Fälle im dritten.44 Stellt man in Rechnung, dass diese Zahlen für das gesamte Staatsgebiet galten, lagen sie keinesfalls sonderlich hoch. Die Masse der Bußgelder lässt sich allerdings kaum abschätzen; in regionalen und städtischen Archiven füllen sie zum Teil dicke Aktenbündel. Manchen örtlichen HJ-Stellen schien die Verhängung der Bußgelder im Übrigen problematisch. Da diese überwiegend die Eltern trafen, nicht aber die säumigen Jugendlichen, würde das eigentliche Ziel verfehlt, so meinte jedenfalls die Essener HJ-Führung, „polizeilicher Zwang soll den Dienstpflichtigen selbst erfassen“.45 Polizeiliche Vorführung, Bußgeld und Dienstarrest sollten aus Sicht der Hitlerjugend nicht nur den Delinquenten selbst bestrafen, sondern zur Abschreckung dienen. War ein Jugendlicher der Säumigkeit überführt, herangezogen, bestraft oder inhaftiert worden, wurde dies in seiner Einheit – und manchmal darüber hinaus – verkündet, um die anderen Mitglieder zur Disziplin zu mahnen.46 Die gesetzlichen Bestimmungen über den Jugendarrest wurden außerdem auf Heimabenden von den jeweiligen Unterführern verlesen.47 In Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf 42 Reichsstatthalter Braunschweig und Anhalt (Regierung Anhalt, Inneres), an die Kreispolizeibehörden und den Oberbürgermeister Dessau vom 6.12.1941 (LHASA, DE, Z 141, 652, Bl. 48 f.). 43 Schreiben des Bannführers Essen (173) an die Ortspolizeibehörde vom 6.5.1941 (StadtA Essen, Rep. 102, Abtl. XIV, 23, Bl. 40 f.). 44 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 486. 45 Hitlerjugend, Standort Essen an den Oberbürgermeister als Ortspolizeibehörde vom 30.11.1940 (StadtA Essen, Rep. 102, Abtl. XIV, 23, Bl. 18–21). 46 Vgl. umfassender Kollmeier, Ordnung und Ausgrenzung, S. 230; vgl.auch die Notiz über Unterredung mit dem HJ-Standortführer der Stadt Essen vom 6.12.1940 (StadtA Essen, Rep. 102, Abtl. XIV, 23, Bl. 24–26): „Anscheinend habe man in Berlin unterschätzt und nicht erwartet, dass zahlenmäßig so viele Fälle von säumigen Jugenddienstpflichtigen zusammenkommen würden. Er riet deshalb dazu, ähnlich wie man in Oberhausen verfahren habe, zunächst einige der hartnäckigsten Fälle polizeilich durchzuführen. Dieses würde sich dann bei der HJ herumsprechen und die anderen säumigen Jugenddienstpflichtigen abschrecken. Nach seiner Meinung könne man in solchen Fällen auch sofort mit dieser Zwangsmaßnahme der polizeilichen Vorführung anfangen und [es] sei eine vorherige schriftliche Androhung nicht notwendig.“ 47 Vgl. Jugenddienstarrest, zum Verlesen vor der angetretenen Einheit. In: GB: Ruhr- Niederrhein, 18K vom 1.3.1941.
284
Massenmobilisierung
oder in annektierten Gebieten gingen höhere Dienststellen zur Abschreckung besonders diffamierend vor. Über die Dienstbefehle und Rundschreiben wurden hier nicht nur – wie auch andernorts üblich – Name und Wohnort des Bestraften genannt, sondern auch sein Geburtsdatum, die Anschrift sowie der genaue Arrestgrund. Der Hitlerjugend vor Ort, die über den Säumigen im Einzelfall entscheiden musste, stellte die RJF ein Beispiel parat: „Der 17-jährige A. wurde im Herbst 1940 im Rahmen der Jugenddienstpflicht zur Dienstleistung in der Hitler-Jugend erfasst. Er besucht jedoch grundsätzlich keinen Hitler-Jugend-Dienst. So blieb er trotz vorheriger Verständigung und Ermahnung […] unentschuldigt fern. Im Übrigen lehnte sich A. in provozierender Weise gegen die Hitler-Jugend-Führer seines Standortes auf und beleidigte sie öffentlich. […] Nachdem A. bewiesen hat, dass er durch Aufforderungen, Ermahnungen und selbst durch eine polizeiliche Vorführung nicht dazu gebracht werden kann, […] seine Pflicht zu erfüllen, ist die Anordnung einer empfindlichen Dienststrafe erforderlich. Es kann nicht geduldet werden, dass einzelne renitente Elemente die Disziplin und Ordnung eines ganzen Standortes zu untergraben versuchen und sich gegenüber Hitler-Jugend-Führern unverschämt benehmen.“48
Ob ein Mädchen oder Junge sich am Dienst in der Jugendorganisation aktiv beteiligte, konnte nur vor Ort und von den jungen Führungskräften der Einheiten und Formationen festgestellt werden. Der Dienstalltag unterlag im Regelfall noch immer der Aufsicht ehrenamtlich tätiger Jugendlicher. Das gesamte Meldesystem für die Dienstpflichtverstöße basierte in letzter Konsequenz auf der Entscheidung der Unterführer an der Basis. Im Dienstkontrollbuch wurde der Alltag einer Formation dokumentiert. Anwesenheitslisten, Personaldaten und Protokolle waren hier ebenso eingeheftet wie erläuternde Erklärungen und Übersichten zur Organisation.49 Fehltage, Krankschreibungen und genehmigte Beurlaubungen mussten im Kontrollbuch akribisch festgehalten werden. Selbst die Dienstpflichtverstöße der Kameraden wurden hier dokumentiert. Die RJF unterstrich folglich die Bedeutung dieser Unterlagen: „Grundlage für alle polizeilichen Maßnahmen ist […] das Dienstkontrollbuch und seine Eintragungen. Bei unentschuldigtem Fehlen erhält der säumige Jugendliche eine schriftliche Aufforderung zum Dienst. Fehlt er ein zweites Mal, so wird auch der gesetzliche Vertreter benachrichtigt. Nach dem dritten unentschuldigten Dienstversäumnis kann der Führer des Bannes polizeiliche Maßnahmen beantragen.“50
48 Pflichtdienstverweigerung. In: Der Hitler-Jugend-Richter. Schulungsblatt des Amtes Gerichtsbarkeit der Reichsjugendführung, (1941) 4, S. 8. 49 Vgl. Reichsjugendführung (Hg.), Dienstkontrollbuch für Jungenschafts- und Jungzugführer, Berlin 1940 (Archiv des HAIT). 50 Franz Baaden, Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, Leipzig 1943, S. 119. Vgl. zum Verfahren umfassend Polizeiliche Maßnahmen zur Erfüllung der Jugenddienstpflicht (Erlass des Jugendführers des Deutschen Reiches vom 26.3.1940). In: GB: Oberdonau, Sonderdruck IV/41: Arbeitsrichtlinien und Erlässe zur Durchführung der Jugenddienstpflicht vom 15.9.1941: „Das Erscheinen zum Dienst wird anhand des in der Schar […] zu führenden Dienstkontrollbuches genau und regelmäßig überprüft. Es ist Aufgabe der vorgesetzten Dienststelle [Gefolgschaft], die sorgfältige Führung und Auf-
Mobilisierung in Permanenz
285
Als amtliche Unterlage für die Heranziehung zur Jugenddienstpflicht überführte das Dienstkontrollbuch säumige Kameraden, dokumentierte Fehltage, und wurde so zum juristischen Dokument.51 Umso erstaunlicher, dass die Formationen nicht überall mit den Dienstbüchern versorgt werden konnten. In Bayern musste die Gebietsführung kurz vor der Einführung der Jugenddienstpflicht Ende 1939 Beschaffungsprobleme melden.52 Und im Gebiet Oberdonau standen die Unterlagen 1941 noch immer nicht überall zur Verfügung.53 Zumindest gemessen an Maßstäben der Herrschaftseffizienz war es für eine totalitäre Organisation ein seltsames Verfahren. Es setzte die Gewissenhaftigkeit jugendlicher Unterführer voraus. Jugendliche, die das Dienstbuch führten, waren im Ideal- und Regelfall – sofern nicht Lehrer oder Parteiangehörige die Führung vor Ort übernommen hatten – unwesentlich älter als die ihnen Untergebenen. Schulungen sollten eine Gewähr dafür bieten, dass sie nach den Vorgaben handelten: Um die Handhabung zu gewährleisten, fanden auf Bannebene regelmäßig Kurse statt. Jugendliche sollten im Umgang mit dem Dienstbuch geschult, ermahnt und auf die Regeln verpflichtet werden.54 Die Formationsführer auf Gefolgschafts- und Stammführerebene sollten regelmäßig eine Überprüfung dieser Bücher vornehmen.55 Hinzu traten immer wieder Kontrollen vor Ort. Die Bannführer hatten nach oben zu berichten in „welchem Umfang und durch wen […] systematische Heimabendkontrollen durchgeführt“ worden waren.56 Wo die Kontrollen stattfanden, traten manchmal Defizite zutage. Der bayerische Oberbannführer Josef Kremers schrieb im April 1941: „Wie ich mich durch verschiedene Stichproben überzeugen konnte, ist das von der Reichsjugendführung eingeführte Dienstbuch […] nur in sehr geringem Maße bisher verwendet worden. […] Ohne Dienstkontrollbücher ist eine ordentliche Führung einer Einheit nicht möglich. Ohne das Dienstkontrollbuch fehlt jede Unterlage über die Dienstleistung eines Jungen. […] Ich verlange von jedem Einheitsführer, dass ab sofort die Dienstkontrolllisten in den Dienstbüchern genauestens geführt werden.“57
51 52 53 54 55
56 57
bewahrung der Dienstkontrollbücher in den Scharen ständig zu überprüfen. Die Eintragungen […] bilden die Grundlage für alle zu treffenden polizeilichen Maßnahmen. Die gleiche Grundlage für die Einleitung polizeilicher Maßnahmen bildet die regelmäßige und sorgfältige Benachrichtigung des Dienstpflichtigen über Ort und Zeit des Dienstes.“ Vgl. Dienstkontrollbücher. In: GB: Baden, 39/K vom 15.1.1943. Vgl. Dienstbücher. In: GB: Hochland, A9/39 vom 1.7.1939. Vgl. Dienstbücher. In: GB: Oberdonau, A K6/41 vom 10.6.1941. Vgl. Dienstkontrollbücher. In: Rundschreiben des Gebietes Osthannover, 47/43 vom 26.10.1943 (StA Hannover, Hann. 130, 1070: Zusammenarbeit mit der HJ, unpag.). Vgl. Durchführung der Jugenddienstpflicht. In: GB: Berlin, 2/43 K, Sonderdruck vom 15.2.1943: „Die Führer der Gefolgschaften (Fähnlein) haben sich in kurzen Zeitabständen durch Vorlage der Dienstkontrollbücher von deren ordnungsmäßiger Führung zu überzeugen. Die Überprüfung ist durch Namensunterschrift unter Beifügung des Datums im Dienstkontrollbuch ersichtlich zu machen.“ Arbeitsberichte. In: GB: Düsseldorf, 47/K vom 15.7.1941. Dienstkontrollbuch. In: GB: Hochland, K6/41 vom 1.4.1941.
286
Massenmobilisierung
In Anbetracht der spürbaren Kriegsauswirkungen und der engen Personaldecke nahm im Laufe der Zeit die Wahrscheinlichkeit immer weiter ab, dass derartige Kontrollen in der Breite durchgeführt werden konnten. Letztlich lag also viel an den Heranwachsenden selbst – wie sie sich verhielten, ob sie die Anweisungen strikt umsetzten, ob sie den Dienst als Bereicherung oder Schikane empfanden. Die jungen Unterführer besaßen Spielräume, die sie höchst unterschiedlich nutzten. In Brandenburg monierte die Gebietsführung 1941 lange Drohschreiben, welche die Einheitenführer verschickt hatten. Die Drohbriefe gegenüber den Eltern seien „weder im Ton noch im Inhalt“ angemessen und würden „unnötige Verärgerungen“ provozieren.58 Die einen legten Übereifer an den Tag, andere wiederum blieben untätig oder waren desinteressiert. Im Gebiet Mittelelbe beklagte man Ende 1942, dass „der Dienst der Einheiten je nach Belieben des einzelnen Führers und der einzelnen Führerin örtlich festgesetzt“ werde.59 Eine Sicherheit, dass die Dienstbücher richtig geführt wurden, gab es nicht. Die Unterlagen gingen zudem auch häufig verloren.60 Manchmal wurden sie nur fehlerhaft oder mit Nachlässigkeit geführt. Das Meldewesen, mit dessen Hilfe die Dienstpflichtverstöße geahndet wurden, mündete konsequenterweise in Willkür und basierte auf Zufällen. Hinzu kamen äußere Faktoren: Weil es in den kalten Kriegswintern oft an Heizmöglichkeiten fehlte, fiel mancherorts der Dienst aus. Im Winter 1942/43 geschah dies zum ersten Mal auch in Großstädten, da dort „die Brennstoffzuteilung für Heime und Unterkünfte […] in zahlreichen Fällen ungenügend oder ganz unterblieben“ war.61 Eltern reichten Beschwerde ein und Führer der Einheiten ließen den Dienst wegen der Kälte ruhen. Während die Jugenddienstpflicht in manchen Orten zeitweise nur auf dem Papier bestand, wurde sie andernorts mithilfe der Polizei erzwungen. Äußere Umstände, die organisatorische Lage sowie individuelle Entscheidungen junger Unterführer bestimmten, wie wirksam die Dienstpflicht war, ob junge Menschen bestraft wurden oder durch Schlupflöcher entweichen konnten. Von Ort zu Ort variierte die Situation erheblich. Manchmal wurden die Säumigen von ihren Unterführern massenhaft gemeldet und dann Polizeibehörden aktiv, während andernorts Jugendliche unbehelligt blieben. Im Gebiet Baden verhängte man im Winter 1941/42 in wenigen Wochen 29 Arreststrafen. Allein 18 ent-
58 Benachrichtigung der Eltern säumiger Jugenddienstpflichtiger. In: GB: Mark Brandenburg, 24K vom 20.9.1941. 59 Verantwortungsbewusstsein der Führer- und Führerinnenschaft. In: GB: Mittelelbe, 10/ K42 vom 10.12.1942; Heimabende am Mittwoch. In: GB: Niederdonau, A4/49 vom 1.4.1939. 60 Daher plante die RJF vor Kriegsbeginn die Einführung von Meldetaschen. Aufgrund des Rohstoffmangels wurde die Fertigung abgebrochen. Vgl. Meldetasche. In: GB: Baden, A 7/39 vom 27.6.1939. 61 Zuteilung von Brennstoffen für Heime und Unterkünfte der Hitler-Jugend, RdErl. d. RMdI vom 15.2.1943; Der Reichswirtschaftsminister. RdErl. Nr. 20/43 (GLA Karlsruhe, 465c, 23587, unpag.). Vgl. auch Dienst der Hitler-Jugend: Kälteschutz. In: GB: Oberdonau, K/1/43 vom 1.1.1943.
Mobilisierung in Permanenz
287
fielen auf den Bann Karlsruhe.62 Bis Mai 1942 wurden in Hessen-Nassau 65 Jugendliche in Arrest genommen – die allermeisten in Frankfurt am Main und Mainz.63 Die Fälle nahmen an Häufigkeit zu. Verfolgungsschwerpunkt bildeten meist die Städte. Von Juni bis September 1942 meldete man in Hessen 59 Arrestfälle; Mainz hatte mit 18 Inhaftierten sogar Frankfurt am Main überholt.64 Nur den wenigsten jungen Menschen wird bewusst gewesen sein, wie viel Einfluss und welche Handlungsspielräume sie im Kleinen des Alltags besaßen. Zeitzeugenberichte spiegeln die Unterschiede in der Verfolgungspraxis: Während mancher von Strafandrohungen oder Polizeibesuchen berichtet, bestehen andere darauf, dass sie auch bei seltenem Erscheinen oder völliger Abwesenheit nie Konsequenzen erlebt hätten. „Es fehlten natürlich immer jede Menge“, erinnerte sich Helmut G. an die Kriegsjahre, damals ein junger Gefolgschaftsführer im Dresdner Umland. Vollzählig seien weder die jüngeren „Pimpfe“ noch die ihm selbst unterstellten Hitlerjungen zu den Appellen und Dienststunden angetreten: „Wer nicht da war, bekam eine Postkarte. Aber gemeldet habe ich nie jemanden. Die immer gefehlt haben, waren meistens die Bauernsöhne. Die hatten schließlich etwas anderes zu tun. Wahrscheinlich hätte unser Dorfpolizist gesagt: Du hast einen Vogel! Den hole ich nicht!“65 In ländlichen Regionen – wo Menschen einander persönlich kennen und die relative Weite des Raums logistische Probleme bereitete – fand der Dienst durchaus nicht immer nach Vorschrift statt.66 Auch Pflichtverstöße kamen im Allgemeinen seltener zur Meldung.67 Wilma M., geboren 1924, war in den Kriegsjahren als BDM-Ringführerin in Göttingen tätig. In ihren Verantwortungsbereich fielen Mädchen und junge Frauen vorwiegend aus dem kleinstädtischen Raum. Besprechungen und Versammlungen, Sport und Tanz musste sie organisieren und Schulungsmaterialien austeilen. Das habe sie sehr wohl begeistert getan, gestand sie rück blickend, und gelegentlich habe sie sich wohl geärgert, wenn etwa nur die Hälfte der Bauerntöchter zu ihrem BDM-Dienst erschienen sei. Aber jemanden angeschwärzt oder nach oben gemeldet habe sie nicht. Um den Mädchen aus den verstreuten Dörfern das Erscheinen zu erleichtern, habe sie den Versammlungsort ständig gewechselt. Nach und nach sei damit für jedes Mädchen ein kurzer Anfahrtsweg möglich gewesen, wobei sie jene Mädchen, die jeweils die weiteste Anreise zu bewältigen hatten, vom BDM-Dienst entschuldigt habe.68 62 Vgl. Jugenddienstarreste. In: GB: Baden, 29/K vom 20.3.1943. 63 Vgl. Bestrafung mit Jugenddienstarrest. In: GB: Hessen-Nassau, 5/6/42K vom 5.–6.1942. 64 Vgl. Bestrafung mit Jugenddienstarrest. In: ebd., 7–9/42K vom 7.–9.1942. 65 Interview von André Postert mit Helmut G. vom 26.11.2014 (Tonaufnahme im Archiv des HAIT). 66 Vgl. in diesem Zusammenhang die bei Klönne, Jugendprotest und Jugendopposition, S. 551–553 zitierten Archivalien über die Unterschiede in der Praxis der Jugenddienstpflicht in Bayern. 67 Lokale Beispiele für Dienstversäumnisse bzw. Maßnahmen zur Erzwingung der Dienstpflicht auch überliefert im StA Augsburg, NSDAP Gau Schwaben und Gliederungen, HJ-Bann Günzburg, 13. 68 Vgl. Video-Interview von Martin Rüther mit Wilma Muetzel (NSDOK Köln, EzG, jugend1918-1945.de; 12.3.2018).
288
Massenmobilisierung
Viele bäuerliche Familien sträubten sich, die Töchter und Söhne, die man auf den Höfen benötigte, zum Dienst gehen zu lassen; besonders, wenn schon die älteren Söhne zur Wehrmacht eingezogen waren. Margret Aull-Fürstenberg, die als 11-Jährige nach dem „Anschluss“ 1938 mit der Familie nach Österreich gezogen war, berichtete über die Situation auf dem Land: Dort sei „gar nichts“ gewesen, „bis ins Dorf war die Staatsjugend noch nicht vorgedrungen“. Hatte sie das erste Jahr als Jungmädel in Deutschland in schlechter Erinnerung behalten, beschrieb sie den österreichischen BDM anders: „In der ‚Ostmark‘ war die Jugendbewegung noch im Pionierstadium, also frisch und voller Schwung.“69 In ländlichen Regionen blieb der bürokratische Apparat weniger entwickelt. Wie in dieser Schilderung, konnte dies positiv erlebt werden. Für die Umsetzung der Jugenddienstpflicht bedeuteten die fragilen Strukturen eine Herausforderung. Im Gebiet Franken war man sich über die Schwierigkeit im Klaren, weshalb im Sommer 1942 alle Landeinheiten nur einen einzigen Dienstappell mit Geländesport sowie einen Heimabend pro Monat abhalten sollten. In Städten lag die zeitliche Beanspruchung durch DJ und HJ zeitgleich erheblich höher.70 Reichsjugendführer Axmann gestand ein, dass „die Streulage unserer Bauernhöfe, […] Verkehrsverhältnisse der ländlichen Bezirke, die ungeheure Arbeitsanspannung der ländlichen Jugend […] und die nicht ausreichende Zahl dörflicher Führer und Führerinnen als erschwerende Hemmungen“ der Durchsetzung der Dienstpflicht entgegenstünden. Es sollten, versprach Axmann Anfang 1943, die „entsprechenden Mittel und Wege zur Überwindung dieser Schwierigkeiten“ bald gefunden sein, um die ländliche Jugend „in vollem Umfang an der Gemeinschaftserziehung und [dem] Gemeinschaftserlebnis“ teilhaben zu lassen.71 1.3 Die Alltagspraxis der Jugenddienstpflicht Strafverfahren gerade in ländlichen Regionen oder Kleinstädten wurden oft frühzeitig eingestellt oder nicht weiterverfolgt, weil die Polizeibeamten triftige Gründe für Dienstversäumnisse anerkannten. In Cloppenburg teilte die Gendarmerie über die Vernehmung eines Mädchens mit, man habe sie zwar angehalten, „sich künftig doch mehr am BDM-Dienst zu beteiligen“. Sie verfüge neben der Landwirtschaft aber kaum über freie Zeit. Es sei auch nicht ratsam „ihr den Weg vom BDM-Dienst demnächst bei der Dunkelheit allein gehen zu lassen“.72 Dass der Zapfenstreich oft erst um 22 Uhr oder teils später erfolgte, 69 Margret Aull-Fürstenberg, Lebenslüge Hitler-Jugend. Aus dem Tagebuch eines BDM-Mädchens. Mit einem Nachwort von Erika Weinzierl, Wien 2001, S. 35. 70 Vgl. Dienst in der Hitler-Jugend in den Monaten Juni, Juli, August 1942. In: GB: Franken, 6/42 vom 6.1942. 71 Aufruf des Reichsjugendführers. Die Arbeit an der ländlichen Jugend. In: BB: Mainfranken, 11/43 K vom 11.1943. 72 Meister der Gendarmerie Cloppenburg an den Landrat über die Vernehmung eines Mädchens vom 25.9.1943 (StA Oldenburg, Dep 20 CLP 348, 1276, unpag.).
Mobilisierung in Permanenz
289
hielten selbst die Beamten für schwer zumutbar.73 Die Dienststunden waren ein gängiges Argument vor allem der Eltern. Oder man verwies auf die Gefahr von Tieffliegerangriffen – so eine Mutter aus einem Dorf nahe Cloppenburg. Die Polizei, die dieses Argument hätte zurückweisen können, notierte zur Einstellung des Verfahrens: „Geschlossen mit dem Hinzufügen, dass es zutrifft, dass der Dienst der Jugendlichen allgemein viel zu spät abgehalten wird. Vielfach wird dann auch beim Nachhauseweg mit den Taschenlampen Unfug betrieben, was eine Gefahr für die Öffentlichkeit bedeutet.“74 Die Verfolgung von Dienstpflichtverstößen blieb aus Sicht des hauptamtlichen Führerkorps gelegentlich so mangelhaft, dass man – wie der Bannführer von Zerbst bei Magdeburg – das „Jugenddienstpflichtgesetz zur Lächerlichkeit“ herabgesetzt sah.75 Dass die Hitlerjugend mit ihren Forderungen gegenüber der Polizei manchmal nicht durchdrang, belegt ein weiteres Schreiben derselben Banndienststelle vom März 1944. Die Bestrafungen gingen zu langsam voran, würden auch nicht in ausreichender Zahl durchgeführt und seien derart harmlos, dass „sich die Jugendlichen über das Geringe des Strafmaßes lächerlich“ machten. Die Polizei in Dessau, wie der Bannführer meinte, liefere ein Vorbild. Dort seien härtere Strafen üblich. Denn nur mit Härte sei Besserung zu erreichen.76 Um die Beteiligung der Jugend in höherem Maße zu gewährleisten, führten die Gebiete seit Anfang 1940 unregelmäßig – idealerweise einmal im Monat – größere Gefolgschaftsappelle durch. Auf Anweisung des Gefolgschaftsführers sollten Einheiten geschlossen aufmarschieren; gelegentlich wurden sie dabei von Mitarbeitern der Gebietsführung gemustert. Die Appelle dienten der Vollzähligkeitskontrolle. Es wurden Beförderungen oder Tadel ausgesprochen, Uniformen und Dienstkarten überprüft sowie neue Befehle bekanntgegeben. Lühr Hogrefe, Führer des Gebiets Nordsee, hoffte, dass er auch die Nicht-Organisierten einbeziehen könne, um sie im Rahmen der Appelle für Schieß- und Geländeausbildung registrieren zu können.77 Solche Appelle fanden im Herbst 1940 zum ersten Mal u. a. in Sachsen, Thüringen und im Gebiet Nordsee statt, in anderen Regionen erst mit einigen Monaten Verzögerung. Im Warthegau wurden sie seit Frühsommer stgebieten 1941 durchgeführt.78 Für die „Volksdeutschen“ in den besetzten O
73 Zu späten Dienststunden siehe bspw. Dienstzeit und Dienstschluss. In: GB: Pommern, A1/40K vom 4.3.1940 oder Dienstbeendigung für HJ-Einheiten. In: GB: Niederdonau, A4/39 vom 1.4.1939. 74 Meister der Gendarmerie Essen, Kreis Cloppenburg über die Vernehmung einer Mutter aus Hengelage vom 16.11.1943 (StA Oldenburg, Dep 20 CLP 348, 1276, unpag.). 75 Der K-Bannführer der HJ an den Landrat, Kreis Zerbst, vom 12.12.1941 (LHASA, DE, KD ZE, 125, unpag.). 76 Der K-Bannführer an den Landrat und die Ortspolizeibehörde, Kreis Zerbst, vom 13.3.1944 (ebd.). 77 Vgl. Erfassung der Nichtorganisierten. In: GB: Nordsee, K1/39 vom 12.10.1939; Die Dienstappelle. In: GB: Mark Brandenburg, 23/K vom 15.9.1941. 78 Vgl. beispielhaft zur Auswahl: Dienstplangestaltung. In: Junger Wille. Führerdienst der HJ: Sachsen, Ausgabe DJ, (1940) 8, S. 7; Gefolgschafts- und Fähnleinappelle. In: GB: Nordsee, A1/40K vom 1.3.1940; Dienstappelle der Hitler-Jugend. In: GB: Ober-
290
Massenmobilisierung
wurde die Jugenddienstpflicht erst ab Ende 1943 gültig. Der Apparat der Hitlerjugend befand sich dort in den Anfängen. Für den „Aufbau in den Ostgebieten“ hatte die RJF bereits bei Kriegsbeginn geworben, insbesondere unter jungen Lehrkräften, die sich in der HJ engagierten.79 Die RJF setzte für den Aufbau in den annektierten Gebieten erneut auf die Zusammenarbeit mit Schulen sowie auf die Einrichtung von sogenannten Landdienstlagern, wodurch ältere Hitlerjungen und BDM-Mädchen aus dem Reichsgebiet unmittelbar eingespannt wurden.80 Man trieb außerdem den Aufbau der Kulturarbeit beispielsweise mittels HJ-Spielscharen voran, von denen jene Werbewirkung ausgehen sollte, welche die Hitlerjugend in den 1930er-Jahren angeblich gekennzeichnet hatte.81 Die Hitlerjungen und BDM-Mädchen aus dem Reich unterlagen in den besetzten Gebieten den Regelungen der Jugenddienstpflicht. Die Führung klagte jedoch, diese Jugendlichen hielten es dort „nicht für notwendig, sich [an] ergangene Vorschriften zu halten“.82 Überall, wo die Gefolgschaftsappelle während des Krieges eingeführt wurden, eben sogar in okkupierten Gebieten, stellten sie eine Reaktion auf vermeintliche oder echte Defizite dar. Die Massenappelle waren mehr Symptom, weniger Lösung. Arno Klönne, Mitglied einer bündischen Gruppe im katholischen Paderborner Umland, berichtete, dass er den DJ-Dienst in der Kriegszeit nie besucht habe: „Das, was aber tatsächlich stattfand, war, wenn aus einer übergeordneten Dienststelle jemand das Gefühl hatte, ‚Du musst nachweisen, dass da etwas stattfindet‘. Dann wurde ein Appell angesetzt zum Antreten und es wurden Dienstränge verliehen, damit auf dem Papier alles seine Ordnung hatte.“83 Der Versuch höherer Dienststellen, den ländlichen Organisationsapparat zu stärken, sei in den Anfängen steckengeblieben; nur bei den Mädchen habe man im Allgemeinen mehr Erfolge gehabt. Die Dienstpflicht sei für ihn persönlich aber nie konkret geworden.84 „Die Unterschiede in der Dichte und Härte dieser nationalsozialistischen Erfassung […] hingen sicherlich auch von örtlichen Zufällen ab, und davon, ob diejenigen, die eine Gruppe anzuführen hatten, nette oder absolut unangenehme Menschen waren. Für die Paderborner Verhältnisse war es typisch, dass es neben der Hitler-Jugend immer eine heimliche Struktur von anderen Jugend-
79 80 81 82 83 84
donau, A K/2/41 vom 10.2.1941; Aufruf zu ländlichen Gefolgschaftsappellen durch den Gebietsführer, Kameraden! In: BB: Gebiet Mittelfranken, 11/43 K vom 11.1943; Dienstappelle der Hitler-Jugend. In: GB: Wartheland, 6/41/K vom 5.5.1941. Vgl. auch Kriegsdienstplan der Hitlerjugend für 1940 vom 3.2.1940. In: Jahnke (Hg.), Eine Dokumentation, S. 383–386. HJ-Führer und Lehrer für den Aufbau in den Ostgebieten. In: GB: Wien, A8/39 vom 30.11.1939. Im größeren Zusammenhang vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 769–775. Vgl. Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 263. Vgl. ebd. Die Jugenddienstpflicht der Hitler-Jugend. In: GB: Wartheland, 10/41/K vom 7.7.1941. Video-Interview mit Arno Klönne (NSDOK Köln, EzG, jugend1918-1945.de; 17.7.2020). Vgl. ebd.
Mobilisierung in Permanenz
291
gruppen, vor allem kirchlichen Ursprungs gab“, konstatierte Klönne. Freilich solle man sich nichts vormachen: Echter Widerstand sei dies selten gewesen.85 Die Dienstpflicht in ländlichen Gegenden durchzusetzen, stellte zweifellos eine größere Herausforderung dar als in Städten. Mancherorts war man aber in der Lage, die Leerstellen zu identifizieren und Lücken zu schließen. Wo Defizite zutage traten, wurden junge Unterführer manchmal durch SA-Männer oder Parteifunktionäre ersetzt. Die Bannführung in Heilbronn etwa informierte eine Ortsgemeinde im April 1941: „Ihre Gemeinde gehört zur Gefolgschaft 44/121. Der Dienstbetrieb in dieser Gefolgschaft ist wegen Unzulänglichkeit der Führer ein unbefriedigender gewesen. Ich habe daher den seitherigen Führer entlastet und den SA-Scharführer Ernst Schäfer in Schwaigern mit der Führung […] betraut. Ich bitte, dafür zu sorgen, dass die gesamte HJ und das Jungvolk am nächsten Sonntag […] in Massenbach beim Rathaus zum Dienst antritt. Wer unentschuldigt fehlt, wird bestraft werden.“86 Die Realität der Jugenddienstpflicht sah im Einzelfall sehr verschieden aus, genauso wie es im Übrigen bei der Bekämpfung der sogenannten mangelnden Arbeitsdisziplin unter Lehrlingen der Fall war.87 Letztere war für das Regime ein vordringliches Anliegen. Das Justizministerium in Karlsruhe erklärte Anfang Februar 1942 über die strafrechtliche Verfolgung, dass „verhältnismäßig wenige Fälle von Anträgen auf Bestrafung Jugendlicher wegen Vergehen gegen die Arbeitsdisziplin“ gestellt würden, zumal „in ländlichen Bezirken teils gar keine, teils so wenige Fälle, […] dass allgemeingültige Erfahrungen nicht“ mitgeteilt werden könnten.88 Selbst in Ballungszentren war es jungen Menschen möglich, den Dienst in der Hitlerjugend zu umgehen. Im Ruhrgebiet konstatierte eine HJ-Bannführung im Mai 1941 bezüglich der eingeleiteten Erfassung des Jahrgangs 1923, dass den gemeldeten Fällen von Dienstpflichtverstößen eine große Dunkelziffer gegenüberstünde. Von einem Großteil der Säumigen würde man gar nicht erst Kenntnis erhalten, weil die jungen Unterführer „wegen des geringen Erfolges und der […] Hilflosigkeit weitere Meldungen“ schlicht unterließen. Polizeiliche Maßnahmen seien zu verschärfen.89 In Industriezentren und Großstädten 85 Zit. nach Gehling/Gehling/Hofmann/Holger/Rüther (Hg.), Paderborner Zeitzeugen berichten, S. 63. 86 K-Bannführer Bann Unterland an die Herren Bürgermeister der Gemeinden Massenbachhausen, Massenbach und Schluchtern vom 2.4.1941 (StA Ludwigsburg, PL 509, Bü 7, unpag.). 87 Vgl. Der Reichsarbeitsminister über die Bekämpfung mangelnder Arbeitsdisziplin vom 9.12.1941 (GLA Karlsruhe, Abtl. 240, 1987-53, 689, Bl. 305). Vgl. auch die entsprechenden Erlasse vom 24.10.1941 (4210-IIa2-2601/41) und vom 3.12.1941 (421ß-IIa2-2966/41). Zur Disziplinierung jugendlicher Arbeiter, die im Rahmen dieses Buches nicht ausführlich behandelt werden kann; vgl. umfassend an Beispielen Kenkmann, Wilde Jugend, S. 133–148. 88 Der Oberlandesgerichtspräsident an den Reichsminister der Justiz, betrifft: Vergehen Jugendlicher gegen die Arbeitsdisziplin vom 7.2.1942 (GLA Karlsruhe, Abt. 240, 198753, 689, Bl. 317–319). 89 Bannführung in Essen an den Oberbürgermeister als Ortspolizeibehörde über polizei liche Maßnahmen vom 6.5.1941 (StadtA Essen, Rep. 102, Abtl. XIV, 23, Bl. 60 f.).
292
Massenmobilisierung
urden seit 1942/43 willfährige Arbeitgeber eingespannt, um die Dienststellen w der Hitlerjugend zu unterstützen, und neue Betriebsausweise kamen in Umlauf, auf den die jungen Lehrlinge ihre Dienstbeteiligung mittels Stempelungen nachzuweisen hatten. Die Arbeitgeber sollten auf diese Weise den Einsatz ihrer Lehrlinge bei der Hitlerjugend überprüfen.90 Unausweichlich war die Jugenddienstpflicht aber auch diesbezüglich nicht. Gerhard S., geboren 1924, aufgewachsen in Dresden, erinnerte sich: Durch die Ausbildung bei den örtlichen Verkehrsbetrieben zu sehr in Anspruch genommen, kam ein regelmäßiger Besuch des HJDiensts nicht infrage. Ein befreundeter Nachbarssohn, der ein HJ-Unterführer gewesen sei, habe ihm die Marken und Stempel beschafft, um gegenüber dem Arbeitgeber seine Anwesenheit bei der Hitlerjugend nachzuweisen. Obwohl er im HJ-Dienst nicht gewesen sei, habe er auf diese Weise seine Dienstbeflissenheit nachweisen können. Bei seinem Arbeitgeber, glaubte er rückblickend, habe aber eigentlich sowieso niemand nachgefragt, nicht einmal die eisernen Parteisoldaten. Viel Zeit für die HJ hätte kaum einer aufbringen können und von seinen Kollegen seien mehrere nicht zum Dienst gegangen.91 Vorwände oder gute Beziehungen ließen sich nutzen, um auf verschiedensten Wegen Freistellungen vom Dienst zu erwirken. Für kurze Dauer galten sie als berechtigt, wenn beispielsweise eine körperliche Beeinträchtigung vorlag, die schulischen Leistungen nachweislich litten, außerdem bei Krankheit, Umschulung, Vorbereitung auf das Abitur oder sofern – eine elastische Formulierung – „andere dringende Gründe“ vorlagen.92 Eine Befreiung wurde seit April 1942 zudem möglich, wenn Lehrlinge aufgrund „kriegsbedingter beruflicher Mehrarbeit“ im Betrieb in Anspruch genommen wurden. Für Mädchen galt, dass sie auch bei betrieblicher Inanspruchnahme wenigstens an einem Monatsappell der Hitlerjugend teilnehmen sollten.93 Die diversen Regelungen begünstigten die eigensinnige Auslegung. Man musste lediglich in der Schule, im Betrieb, beim Arzt vor Ort oder in der Hitlerjugend einen wohlgesinnten Fürsprecher finden. Die extremen Fälle fielen in den höheren Dienststellen am ehesten auf. Im Gebiet Pommern versuchten 1940 gleich mehrere HJ- und DJ-Einheiten von ihren Schuldirektoren Beurlaubungen zu erwirken, um keinen Dienst abhalten zu müssen. Die Gebietsführung sah sich veranlasst, gegen die Freistellungspraxis der Direktoren einzuschreiten.94 Die DJ-Unterführer 90 Vgl. Ausweise der Betriebe über geleisteten HJ-Dienst. In: BB: Hamburg, 1/42 vom 2.1942. 91 Vgl. Interview von André Postert mit Gerhard S., geboren 1924, vom 2.6.2015 (Tonaufnahme im Archiv des HAIT). 92 Baaden, Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, S. 82–86, hier insbesondere 84. 93 Vgl. Sommerarbeit der Hitler-Jugend; hier: Befreiung Jugenddienstpflichtiger vom Dienst in der Hitler-Jugend auf Grund kriegsbedingter beruflicher Mehrheit (Erlass des JFdDtR, 19.4.1942). In: GB: Niederdonau, 7/42K vom 18.7.1942. 94 Vgl. Beurlaubungen. In: GB: Pommern, A 7/40K vom 5.11.1940. Künftig sollten die Schulverwaltungen entsprechenden Anträgen nur noch stattgeben, wenn eine Bescheinigung des Bannes bzw. Untergaues beigefügt wurde: „Beurlaubungsanträge von unteren Einheiten sind grundsätzlich verboten und werden von den Schulleitern nicht berücksichtigt.“
Mobilisierung in Permanenz
293
stellten ihre „Pimpfe“ zudem vom Dienst frei, da sie angeblich nicht über eine angemessene Dienstkleidung verfügten. Weil in den Kriegsjahren immer mehr Kinder zur Hitlerjugend kamen, deren Familien kein Geld für die Kinderuniformen besaßen, untersagte man in Bayern die großzügige Freistellungspraxis der Unterführer.95 Im Gebiet Baden entschied man 1942, dass für jene, die mangels Bekleidung nicht an Geländeübungen teilnehmen konnten, weltanschaulicher Unterricht anzusetzen sei.96 Angehende Abiturienten wiederum durften nun nicht mehr – wie es die RJF Ende 1938 erlaubt hatte – generell Urlaub erhalten, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Nur, wenn die Zeugnisse nachweislich mangelhaft waren, durfte eine Freistellung zur Prüfungsvorbereitung erfolgen.97 Die BDM-Unterführerinnen im Gebiet Hessen-Nassau mussten im April 1942 ermahnt werden, dass die Jugenddienstpflicht auch für weibliche Hitlerjugendangehörige gelte. Beurlaubungen dürften nicht mehr wie früher für jede Kleinigkeit oder längere Zeiträume ausgestellt werden.98 Schritt für Schritt versuchten die Dienststellen die vorhandenen Lücken zu schließen. Ein verbreitetes Ärgernis aus Sicht der RJF: Die Jugenddienstpflicht endete formal mit einer Entlassungsfeier für den gesamten Jahrgang der 18-Jährigen. Weil die jungen Unterführer und -führerinnen dies entweder nicht wussten oder nicht beachteten, schieden in Wirklichkeit viele Jugendliche bereits Monate früher aus, nämlich mit dem Erreichen ihres 18. Geburtstags.99 Auch die Überweisung der 14-Jährigen vom DJ in die HJ bzw. vom JMB in den BDM bereitete der Hitlerjugendbürokratie nach wie vor Probleme.100 Ein Jugendlicher, der im Umfeld der Kieler Swing-Jugend von der Polizei aufgegriffen wurde, gab 1942 bei einem Verhör zu Protokoll: „Im Herbst 1939 bekam ich eine Überweisung in die HJ, obwohl ich diesen ordnungsgemäß abgegeben hatte, hörte ich nichts von der Übernahme in die HJ. Im Frühjahr 1940 gab ich erneut einen Überweisungsschein […] ab und wurde daraufhin […] aufgenommen. Bis zum Herbst 1940 nahm ich am HJ-Dienst teil, ließ mich dann aber zur Vorbereitung auf meine kommende Schulprüfung beurlauben. Ostern 1941, als ich die
95 Vgl. Zivilkleider im Dienst. In: GB: Hochland, K2/41 vom 1.11.1941. 96 Vgl. Durchführung des Hitler-Jugenddienstes in Hinblick auf den Mangel an Schuhwerk und Bekleidung. In: GB: Baden, 28/K vom 20.2.1942. 97 Vgl. Beurlaubung von Abiturienten. In: GB: Baden, 14/K vom 10.1.1941. 98 Vgl. Beurlaubungen vom BDM-Dienst. In: GB: Hessen-Nassau, 4/42K vom 4.1942. 99 Vgl. Polizeiliche Maßnahmen gegen Achtzehnjährige. In: GB: Hochland, 4/42 K vom 1.1942; Zeitpunkt der Beendigung der Jugenddienstpflicht. In: Amtliches Nachrichtenblatt der RJF, (1940) 15, zit. nach Abdruck im Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 2: Jugenddienstpflicht, S. 115. 100 Vgl. beispielhaft Neuaufnahme und Überweisung. In: GB: Nordsee, A1/40K vom 1.3.1940: „Durch verschiedene Schwierigkeiten war es einzelnen Einheiten nicht immer möglich, […] die Anordnungen für die Neuaufnahmen und Überweisungen innezuhalten. Trotz der Schwierigkeiten muss ich jedoch ersuchen, dass nunmehr alle rückständigen Arbeiten sofort aufgeholt werden, damit wirklich alle infrage kommenden Pimpfe […] erfasst werden und damit bei den Überweisungen vom DJ zur HJ keine Verluste eintreten.“
294
Massenmobilisierung
Schulzeit beendet hatte, ließ ich mich erneut beurlauben, weil ich die Absicht hatte, die […] Abendschule zu besuchen. Dazu ist es aber nicht gekommen. Tatsache ist, dass ich seit etwa einem Jahr keinen HJ-Dienst mehr gemacht habe.“101
Diese Fälle waren nicht selten und für die RJF vor dem Hintergrund des Hitlerjugend-Gesetzes problematisch, weil sie die Legitimation der Jugenddienstpflicht infrage stellten. Um die Probleme aus der Welt zu schaffen, suchten die Führungskräfte ihr Heil in einem Mehr an Bürokratie. Ab 1943 wurden vermehrt HJ-Standorte eingerichtet. Sogenannte Standortbeauftragte gab es seit Langem, besonders in Städten, aber nun baute man deren Stellen systematisch aus und erweiterte ihre Kompetenzen.102 Die Standorte sollten die Kommunikation von Einheit zu Einheit, zwischen Gliederungen wie HJ und BDM sowie zu Stellen des Staates verbessern: „Die sich steigernden Kriegseinsatzaufgaben und erhöhten Anforderungen zur Durchführung der Jugenddienstpflicht erfordern heute mehr denn je eine straffe örtliche Zusammenfassung aller Untergliederungen der Hitler-Jugend und ihre einheitliche Betreuung gegenüber den Dienststellen des Staates, der Partei, der Wehrmacht und der Wirtschaft. […] Standorte sind in allen Bannen zu errichten und sollen eine örtliche Zusammenfassung und Vertretung aller Untergliederungen der Hitler-Jugend sein.“103 Den Standortbeauftragten fiel die Aufgabe der „Mitgliedersicherung“ zu, beispielsweise durch Kontrolle von Unterlagen wie Dienstbüchern und Stammblättern. Hamburg besaß Anfang 1943 24 Standorte. Die meisten befanden sich im Bann Bergedorf, wo ausländische Zwangsarbeiter in erheblicher Zahl eingesetzt wurden, und im Vorort Wandsbek.104 Im Großraum Berlin hatte man neue Standorte im Oktober 1943 geschaffen.105 In Wien verteilten sich im März 1943 23 Standorte auf neun HJ-Banne fast über das gesamte Stadtgebiet. Offenbar hatte man die Mehrheit in jenen Stadtteilen konzentriert, wo die Führung organisatorische Defizite sah.106 Die Hitlerjugend unterschied Standortbeauftragte von sogenannten Standortführern. Erstere waren die jeweils ranghöchsten HJ-Führer vor Ort, Letztere als eigenständige Posten meist nur in Großstädten vorhanden. Wie die HJ-Streifen mit ihren Ausweiskontrollen und Straßenpatrouillen machten sich
101 Verhörprotokoll durch die Gestapo Kiel vom 5.9.1941, zit. nach Kurz, „Swinging Democracy“, S. 83. 102 Zu Standorten in den 1930er-Jahren vgl. u. a. Standortführer und Standortbeauftragter. In: GB: Franken, 3/37 vom 1.3.1937; oder Standortbeauftragte. In: GB: Kurmark, A8/38 vom 21.5.1938: „Der Standortbeauftragte ist der alleinige Vertreter der HJ (des DJ, BDM oder JM) einschließlich der Sondereinheiten gegenüber den Dienststellen der Partei und des Staates. […] Der Standortbeauftragte hat Befehlsgewalt über die Einheiten in allen HJ-Angelegenheiten, die den ganzen Standort bzw. den Bereich des Beauftragten umfassen. […] Er überwacht die Aufnahme der Zehnjährigen, die Überweisung der Vierzehnjährigen und die Nachwuchsstellung für SA, SS, NSKK [Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps] und Partei.“ 103 Errichtung von Standorten. In: GB: Wien, 1/43 vom 1.3.1943. 104 Vgl. Standorte und Standortbeauftragte. In: GB: Hamburg, 1/43 K vom 1.1943. 105 Vgl. Einrichtung und Aufgabe der Standorte. In: GB: Berlin, 5/43 K vom 10.1943. 106 Vgl. Errichtung von Standorten. In: GB: Wien, 3/43 vom 1.3.1943.
Mobilisierung in Permanenz
295
gelegentlich auch die kontrollierenden Standortbeauftragten und Standortführer unter den Mitgliedern und an der Basis schnell unbeliebt.107 Die Einrichtung von Standorten ist als eine Reaktion auf eine Vielzahl logistischer und organisatorischer Mängel zu sehen, die in den ersten Kriegsjahren und bei der Umsetzung der Jugenddienstpflicht zutage traten. Insbesondere zwischen höheren Dienststellen in Städten und kleinen Einheiten auf dem Land fand nicht immer hinreichend Kommunikation statt. Zog beispielsweise eine Familie vom Dorf in die Stadt, stellte der vormalige Unterführer oft keine Dienst- oder Abmeldenachricht durch. Weil die Hitlerjugend am neuen Wohnort somit keine Informationen erhielt, verschwanden Jungen und Mädchen vom Radar, sofern sie sich nicht selbst wieder anmeldeten: „Ich habe festgestellt, dass die Jungen von Landstandorten […] keinen Überstellungsschein ausgestellt bekommen. Die Jungen verlieren jede Bindung zur Hitler-Jugend und machen deshalb auch in der Stadt keinen Dienst mit. Es ist klar, dass dieses ‚Selbstständig-sein‘ für unsere Jungen eine große Gefahr bedeutet, besonders deshalb, weil ihnen die Stadt neu ist und sie selbst die Gefahren nicht erkennen“, meinte die Führung im Gebiet „Oberdonau“, die offenbar ein Erstarken von jugendoppositionellen Cliquen durch unkontrollierte Landflucht befürchtete.108 Wolfgang Haaßengier, der im Alter von 16 Jahren im Oktober 1944 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und aus der HJ ausgeschlossen wurde, war auf diese Weise dem Netz der Staatsjugend entwichen. Nachdem er mit der Familie vom Land nach Weimar umgezogen war, meldete er sich bei der örtlichen HJ nicht an. Keinem fiel das auf, über zwei Jahre tat er keinen Dienst. Er habe, urteilte das HJ-Gericht, „das Band zwischen sich und der anständigen deutschen Jugend selbst zerschnitten“.109 Im November 1943 hatte die RJF eine ergänzende Meldepflicht erlassen. Jugendliche mussten binnen acht Tagen nach einem Wohnortwechsel bei der Hitlerjugend angemeldet werden. Und ohne Abmeldung durfte sich niemand länger als jene acht Tage an einem anderen Ort aufhalten. Zeitgleich wurden neue Dienstkarten verteilt, die eine Durchleuchtung erlauben sollten: Personen daten, Angaben über die Erfassung in der Hitlerjugend, Schule, Arbeitgeber oder eben Angaben zu Wohnortwechseln. Kontrollstempel wiesen darüber hinaus die regelmäßige Teilnahme an Appellen nach.110 Ein Verstoß gegen das Meldegebot sollte außerdem strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen. Ab jetzt erfolgte die Ausgabe von Essen oder Kleidung nur gegen Vorzeigen eben solcher
107 Vgl. Befehlsverweigerung gegenüber Standortführern. In: GB: Oberschlesien, K4/41 vom 15.8.1941; vgl. auch Standortführer und Standortbeauftragte. In: GB: Franken, 3/37 vom 1.3.1937. 108 Überstellung. In: GB: Oberdonau, A K7/41 vom 10.8.1941; Umzug von HJ-Führern. In: GB: Wartheland, 9/41/K vom 10.6.1941. 109 Der K-Leitung [Kriegs-Leitung] des HJ-Gerichts, Gebiet Thüringen, zum Strafbescheid gegen Wolfgang Haaßengier vom 13.10.1944 (NARA, T1021, 581096, 549, Bl. 206). 110 Vgl. Muster: Dienstkarte der Hitler-Jugend (Anlage 2 zu Neue Dienstkarte der Hitler-Jugend). In: GB: Wien, 1/44K vom 1.1.1944.
296
Massenmobilisierung
Bescheinigungen in Form der Ausweise oder Dienstkarten. Ende A ugust 1943 war die RJF mit dem Reichslandwirtschaftsministerium entsprechend übereingekommen. Nun gelang der RJF erstmals eine nahezu hundertprozentige Erfassung. Junge Menschen meldeten sich freilich nicht primär deshalb, weil sie unbedingt zum HJ-Dienst wollten, sondern weil sie auf die Hilfsgüter angewiesen waren.111 Die RJF war bereit, Zwang einzusetzen, wo die Begeisterung schwand. Dennoch hingen alle Regelungen letztlich von der Zuverlässigkeit des jungen Personals an der Basis ab. Symptomatisch war der folgende Fall: Ein Jugendlicher gab bei seiner Vernehmung an, dass er nie irgendeine Aufforderung von seinem HJ-Führer erhalten habe, dass er zum Dienst erscheinen müsse. Ein solches Mahnschreiben bildete aber die Voraussetzung für polizeiliche Maßnahmen. Als die Beamten an die Überprüfung gingen, stellten sie fest, dass die fragliche HJ-Einheit weder über eigene Unterlagen, Protokolle noch sonstige Dienstnachweise verfügte. Das Verfahren gegen den säumigen Jugendlichen musste eingestellt werden.112 In Düsseldorf gestand sich die Hitlerjugend im Sommer 1942 selbst ein: „Die Kriegsverhältnisse haben leider einen ständigen Führer- und Führerinnenwechsel […] zur Folge. Die neueingesetzten Führer und Führerinnen erhalten zum größten Teil keine Kenntnis von den bislang herausgegebenen Verfügungen und Anordnungen, sodass diese mehrfach nicht eingehalten werden.“113 In Niedersachsen klagte eine Bannführung im Juni 1943, dass „50 [Prozent] der Einheiten“ seit Monaten nicht einmal einen Dienstplan eingereicht hätten.114 Um Missstände zu beheben, hatte die RJF im Mai 1943 Meldeblöcke für HJ und BDM eingeführt; drei Monate später ebenso für das DJ und den JMB. Die Unterführer auf Gefolgschaftsebene sollten auf diesen neuen
111 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 291; sowie Meldepflicht der Jugenddienstpflichtigen (Erlass des RFdDR [Reichsführer des Deutschen Reiches] v. [vom] 9.8.1943). In: GB: Berlin, 5/43K vom 10.1943. Vgl. auch Die Hitler-Jugend-Anmeldekarte. In: ebd., 2/44 K vom 3.1944: „Von der ordnungsgemäßen Abgabe der ausgefüllten [Hitler-Jugend-Anmelde]Karte hängt die Anmeldung zur Lebensmittelversorgung ab. Also bis zur Anmeldung gut aufbewahren und sorgfältig ausfüllen!“; Muster: Dienstkarte der Hitler-Jugend (Anlage 2, Neue Dienstkarte der Hitler-Jugend). In: Gebietsbefehl: Wien, 1/44K vom 1.1.1944. 112 Vgl. Verhandlungsprotokoll vom 14.2.1941 (LHASA, DE, Z 141, 651, unpag.): „Es ist richtig, dass ich dem Dienst unentschuldigt ferngeblieben bin. […] Das Fehlen beim Dienst geschah dadurch und geschieht auch heute noch, weil ich zu keinem Dienst bestellt werde. Bemerken möchte ich, dass, wenn ich bestellt werde, auch zum Dienst erscheine.“ 113 Der K-Gebietsführer/Die Gebietsmädelführerin. In: GB: Düsseldorf, Sonderbefehl: Hinweis auf das Sammelverbot, Führung „schwarzer Kassen“ und weitere Anordnungen, 5a/42 K vom 17.6.1942; Dienstbücher. In: GB: Pommern, A 1/40 K vom 4.3.1940: „Der häufige Wechsel in der Führerschaft macht es notwendig, dass die Dienstbücher peinlich genau geführt werden. Es genügt nicht allein die Eintragungen von Ort und Zeit […] und die Festlegung der am Dienst teilnehmenden Jgg., sondern für einen später eintretenden Führer ist es notwendig, dass auch die […] Ausbildungsthemen festgelegt werden, damit sich im Dienstbetrieb nicht ständig Wiederholungen ergeben.“ 114 Dienstpläne. In: Rundschreiben des Banns Aue, Gebiet Niedersachsen, 3/43 vom 30.6.1943.
Mobilisierung in Permanenz
297
Blöcken akribisch ihre Tätigkeiten und den Ablauf des Dienstes protokollieren. In der Bannführung sollten danach diese Protokolle überprüft werden. Die Auslieferung der Blöcke kam offenkundig nur sehr stockend voran. In Wien kamen sie erst Anfang 1944 in den männlichen Gliederungen und im BDM-Werk an. Beim JMB und im BDM wurden sie bis Kriegsende offenbar gar nicht mehr eingesetzt.115 Der Nachlässigkeit der Einen stand der Übereifer der Anderen gegenüber. Zahlreiche gemeldete Dienstpflichtverstöße stellten sich im Nachhinein als Falschmeldungen heraus. In der sächsischen Kleinstadt Kochstedt ermittelte die Polizei im Frühjahr 1943 tagelang gegen einen Hitlerjungen, der nicht zum HJ-Dienst erschienen war. Dann stellte sich jedoch heraus, dass sich der fragliche Junge in einem Wehrertüchtigungslager befand. Die Verärgerung der Beamten war groß: Ein derartiges Verfahren, schrieb man der Hitlerjugend, sei „nicht im Interesse des Ansehens einer Polizeibehörde“, bedeute „während des totalen Krieges […] unnütze Verwaltungsarbeit“ sowie die „Verärgerung der betroffenen Volksgenossen“.116 Während die Landbevölkerung die Jugenddienstpflicht vereinzelt als Bevormundung sah, wurde die Verfolgung von Säumigen den Polizeibeamten gelegentlich lästig. Der Regierungspräsident in Düsseldorf konstatierte im März 1941, dass „in verschiedenen Städten erhebliche Schwierigkeiten bei der Mitwirkung der Polizei“ bestünden.117 In den Polizeibehörden kamen Unlust und Unverständnis zusammen. So wurde von Beamten argumentiert, dass die Dienstpflicht mit dem 19. Lebensjahr erlösche, weshalb man keine Maßnahmen gegen Jugendliche anwenden könne, die ihren 18. Geburtstag erreicht hatten. Ein Erlass der RJF vom Oktober 1930 stellte dagegen klar, dass die Dienstpflicht erst mit der offiziellen Entlassungsfeier aus der Hitlerjugend endete.118 Im Gebiet Westfalen klagte die Führung Ende 1941, dass sie dauernd damit kämpfe, dass vom „Gesetz über die Hitler-Jugend sowie der Ausführungsvorschriften […] den nachgeordneten Dienststellen und staatlichen Stellen“ zu wenig bekannt sei.119 Das Innenministerium in Stuttgart bilanzierte Ende November 1944, es sei zwar „eine größere Anzahl von Fällen gemeldet“ worden, doch man hege Zweifel, ob bei diesen Familien überhaupt ein „böswilliges Fernhalten vom Dienst“ vorliege. Triftige Gründe zur strafrechtlichen Verfolgung sehe man nicht. Ohnehin seien Akten inzwischen verbrannt.120 In 115 Vgl. Meldeblocks der Gefolgschaften. In: GB: Düsseldorf, 7/43 K, o. D.; Einführung des Meldeblocks. In: GB: Wien, 6/43 vom 1.6.1943; Einführung des Meldeblocks der Gefolgschaften, Fähnlein, Jungmädel, Mädel-BDM-Werk-Gruppen. In: ebd., 1/44K vom 1.1.1944. 116 Die Polizeibehörde Kochstedt an den HJ-Oberbannführer Meyer in Dessau vom 27.3.1943 (LHASA, DE, Z 141, 653, Bl. 146 f.). 117 Der Regierungspräsident, Düsseldorf, an die Oberbürgermeister und Bürgermeister als Ortspolizeiverwalter vom 11.3.1941 (StadtA Essen, Rep. 102, Abtl. XIV, 23). 118 Vgl. Polizeiliche Maßnahme gegen 18-Jährige. In: GB: Hessen-Nassau, 1-2/42K vom 1.1942. 119 Gesetz über die Hitlerjugend. In: GB: Westfalen, K22/41 vom 28.11.1941. 120 Das Württembergische Innenministerium an den HJ-Bann 425, Rottweil, über die Bestrafung der gesetzlichen Vertreter wegen Nichterscheinens bei den Erfassungsappellen vom 24.11.1944 (HStA Stuttgart, E 151/09, Bü 169, Bl. 22).
296
Massenmobilisierung
Archiven sind die Verfahren zu Dienstpflichtverstößen haufenweise überliefert – für Klein- und Großstädte ebenso wie für ländliche Regionen. Wo die Strukturen der Hitlerjugend schwach oder ihr Personal nachlässig blieb, ist eine Überlieferung einerseits nicht zu erwarten. Akten können andererseits schlicht verloren gegangen sein. Vergleiche zwischen Regionen und Gebieten sind deshalb nur schwer zu leisten. Die Handlungsspielräume und Unterschiede lassen sich aber erkunden. Verwarnungen genügten meist, um die Familien oder die Jugendlichen zum Einlenken zu bewegen. Diese Mahnschreiben standen am Anfang eines Verfahrens. In Meißen erhielt Theodor S. im Herbst 1944 ein typisches Schreiben seines Jungenschaftsführers zugestellt. Dabei sei er eigentlich kein Drückeberger gewesen, meinte er rückblickend. Manchmal, wenn die Lust am Exerzieren und Marschieren fehlte, habe er sich wohl mit anderen in die Büsche geschlagen. Zum Dienst sei er, wie alle anderen, regelmäßig gegangen. Nur dieses eine Mal hatte er am Appell nicht teilgenommen. Das Mahnschreiben, adressiert an seine Eltern, drohte Geldstrafe an. Sollte ihr Junge wieder nicht erscheinen, würde die Polizei eingeschaltet.121 Oft gerieten diese Schreiben derart selbstherrlich im Ton, dass die RJF 1941 auf Behutsamkeit drängte und ein vorgeschriebenes Muster einführte.122 Nahmen junge Menschen „seit langem nicht mehr [am] Dienst“ teil oder war eine Verweigerung in „gröbster Weise“ erkennbar, setzten sich die örtlichen Dienststellen danach mit der Polizei oder der Stadtverwaltung in Verbindung. Unterführer, die Säumige gemeldet hatten, traten dabei manchmal als Zeugen auf. Aus den Banndienststellen kam vor der Vernehmung manchmal sogar eine Empfehlung, welches Strafmaß – Bußgeld oder Arrest – die Polizei aus Sicht der Hitlerjugend anwenden sollte.123 Im Gebiet Baden überschritt eine Dienststelle allerdings zulässige Grenzen. Man hatte die Jugendlichen vor der polizeilichen Vernehmung genötigt, vorgefertigte Aussagen zu unterschreiben, die sie so im Wortlaut allerdings nie getätigt hatten. Die Gebietsführung musste ihre nachgeordneten Stellen ermahnen, weil wahrscheinlich seitens der Polizei eine Beschwerde eingereicht worden war. Ein solches Vorgehen sei unstatthaft, ermahnte die Gebietsführung ihre nachgeordneten Stellen, und füge dem Anliegen der Dienstpflicht insgesamt Schaden zu.124 Die polizeilichen Vernehmungen selbst verliefen in vielen Fällen durchaus sogar zugunsten der Beschuldigten. Ende 1940 hatte die Essener Polizei die Eltern von 20 Säumigen vernommen. Nur in zwei oder drei Fällen hielten die
121 Vgl. Schreiben des Oberjungenschaftsführer P., Bann 208: Meißen, an Theodor S. vom 25.4.1944 (Digitalisat im Archiv des HAIT). 122 Benachrichtigung der Eltern säumiger Jugenddienstpflichtiger. In: Reichsbefehl, 33/41K und u. a. GB: Pommern, 11/41K vom 11.1941; GB: Moselland, K10/41 vom 1.10.1941. 123 Entsprechende Befunde und Verfahren aus den Jahren 1942/43 u. a. dokumentiert im StadtA Halle, Ammendorf, Nr. 130, Bd. 1. Vgl. auch das Muster „Dienststrafvorschlag“ für die Bannführer. In: Reichsbefehl, 23/41K vom 29.5.1941, Anhang (GLA Karlsruhe, Abtl. 240, 1987-53, 689, Bl. 159). 124 Vgl. Einvernahme bei Dienststrafen. In: GB: Baden, 32/K vom 15.6.1942.
Mobilisierung in Permanenz
299
Beamten die Anzeigen aus der Hitlerjugend für berechtigt.125 Dieses erstaunliche Missverhältnis kennzeichnete die Vernehmungen auch in der Folgezeit.126 Andernorts jedoch bauten die Beamten zusammen mit der Hitlerjugend eine beachtliche Drohkulisse auf. Eltern, die von der örtlichen Polizei und der HJ stark unter Druck gesetzt wurden, beschuldigten sich manchmal gegenseitig, an der „Verwahrlosung“ ihres Kindes Schuld zu tragen.127 Kamen aus einer Familie mehrere Kinder nicht zum Dienst, fiel dies negativ ins Gewicht. Ein HJ-Unterführer in Löningen bei Cloppenburg bezichtigte einen Vater, dessen zwei Söhne nicht am Dienst teilgenommen hatten, der „groben Gleichgültigkeit […], wenn nicht sogar böswilligen Absicht“.128 Eine Bestrafung der Jungen sei unerlässlich. Vom jeweiligen Beamten hing es dann ab, wie sich das Verfahren entwickelte, ob etwas Nachteiliges über die Betroffenen bekannt war oder ob sie – wie es in einem anderen Fall lautete – „in der Gemeinde allgemein gut beleumundet“ wurden.129 Viele Familien traten allerdings erstaunlich mutig gegenüber den Vertretern der HJ und der Polizei auf. Spielräume wurden erkannt. Konfrontiert mit der Staatsmacht, stellte den Sinn der Jugenddienstpflicht zwar kaum jemand ernsthaft infrage. Doch Argumente gegen die geltende Gesetzeslage wurden in vielen Fällen angeführt: so etwa die schon erwähnte frühe Dunkelheit im Winter oder lange Anfahrts- und Laufwege, aber auch Luftalarm, mitunter gar die schlechte Disziplin der Einheiten, das berüchtigte „Schleifen“ beim Drill, nicht zuletzt – besonders auf dem Land – Arbeitsüberlastung durch den Wehrdienst der Männer. Eltern traten gegenüber der Polizei mit guten Rechtfertigungen auf: „Wir sind dafür, dass die Jungen im nationalsozialistischen Sinne erzogen werden“, wandten mehrere Eltern aus Dessau ein, aber „unter den […] Verhältnissen, die dort [bei der Hitlerjugend] herrschen, haben wir es für richtig gehalten, die Jungens nicht zum Dienst zu schicken. Darauf sind wir […] als Väter selbst zum Hitlerheim gegangen, um uns zu überzeugen; wir haben eine Weile draußen gestanden, es herrschte im Raum ein ungeheurer Lärm. Wir gingen hinein, und sahen uns die Radauszenen an. Eine Führung war nicht anwesend. […] Dann auf dem Nachhausewege […] vollführten die Jungens allerhand Unfug, wie gegen die Torwege und Fensterläden schlagen, sodass ein ruhestörender Lärm entstand. […] Zeugen stehen auf Anforderung zur Verfügung.“130
125 Vgl. Zusammenfassende Beurteilung der Ortspolizeibehörde von Vernehmungen von Jugendlichen des Banns 173 und 239 in Essen vom 27.11.1940 (StadtA Essen, Rep. 102, Abtl. XIV, 23, Bl. 33). 126 Vgl. die Beurteilungen für die folgenden Monate in ebd. 127 Vgl. Verfahren gegen Eltern berichtet an den Herrn Landrat des Saalkreises vom 19.8.1943 (StadtA Halle, Ammendorf, Nr. 130, Bd. 1). 128 Stammführer Löningen an den Landrat des Landkreises Cloppenburg vom 5.7.1943 (StA Oldenburg, Dep 20 CLP 348, 1276, unpag.). 129 Gendarmerie-Posten Großsteinberg, Kreis Grimma, an die Oberstaatsanwaltschaft beim Landgericht Leipzig vom 16.11.1943 (StA Leipzig, AG Grimma, 135, Bl. 9). 130 Ein Vater an den Bürgermeister von Mildensee vom 27.2.1942 (LHASA, DE, Z 141, 651, Bl. 176).
300
Massenmobilisierung
Das Bußgeldverfahren, das wegen des Dienstversäumnisses von mehreren Kindern und Jugendlichen eingeleitet worden war, stellte die Polizei aufgrund der Sammelbeschwerde ein. In manchen Kreisen wurden Geldstrafen allerdings in einem so hohen Maße verhängt, dass sie – obwohl meist nur kürzeste Zeiträume überliefert sind – ganze Aktenmappen mit langen Listen füllen. Durch die „Einwirkung auf die Eltern“ sowie mit „Belehrung und Verwarnung durch die Polizei“ wollte die Hitlerjugend Besserung erzwingen.131 Ab fünf Reichsmark aufwärts richteten sich die Bußgelder nach der Zahlungsfähigkeit der Familien oder der Lehrlinge – nur in Ausnahmen, bei sogenannten Härtefällen, lagen sie höher. Die polizeilichen Verfahren trafen bürgerliche Städter, Arbeiter und ländliche Bevölkerung ohne Unterschied. Gefährlich wurde die Situation für männliche Jugendliche, die in Arrest kamen, weil die Bußgelder nicht gezahlt wurden oder sie dem sogenannten Ehrendienst trotz Verwarnung weiterhin nicht nachkamen. Hier nahm man an, dass die Verweigerung aus politischer Überzeugung herrührte. Oder es stand gleich die „soziale Brauchbarkeit der Sippe“ – mit anderen Worten die Erziehungsfähigkeit der Eltern – infrage. Dieser harte Kern der Verweigerer fiel meist jenseits der Staatsjugend ebenfalls auf – primär in Städten, wo in den Kriegsjahren junge Menschen Anschluss an neue subkulturelle Milieus fanden. Obgleich die Verfahren mehrheitlich zugunsten der Betroffenen ausgingen, es meistens mit Bußgeld getan war, schwebte darüber immer das Damoklesschwert weiterer Sanktionen: Arrest, Fürsorgeerziehung, Umerziehungslager oder gar KZ. Reichsjugendführer Axmann drohte im Sommer 1942: „Wer gegen die Gesetze unserer Organisation verstößt, wird als Unwürdiger die ganze Härte einer Bestrafung verspüren. […] Allen Führerinnen und Führern der Hitler-Jugend mache ich zur Pflicht, mit unerbittlicher Schärfe gegen diejenigen vorzugehen, die gegen diese Grundforderungen der Hitler-Jugend verstoßen.“132 Die RJF war fortan bereit, gegen die Verweigerer notfalls brutal vorzugehen – das endgültige Ende der Hitlerjugend als Jugendbewegung. 1.4 Ein Überblick: Die Hitlerjugend im Kriegsdienst Die Einführung der Jugenddienstpflicht war der Einsicht geschuldet, dass sich das Freiwilligkeitsprinzip und der Totalitätsanspruch der Hitlerjugend unmöglich vertrugen. Gewiss lag ihr auch die Rationalität der Kriegszeit zugrunde: Die Mobilisierung der Jugend für die „Heimatfront“ war ebenso geboten wie die Vorbereitung der männlichen Jugendlichen auf ihren Fronteinsatz. Der Krieg veränderte den Hitlerjugendalltag im Grundsatz und bedeutete zugleich eine organisatorische Herausforderung für die RJF und höhere Dienststellen. 131 Polizeiliche Maßnahmen zur Erzwingung der Jugenddienstpflicht. In: GB: Baden, 32/K vom 15.7.1942. 132 Artur Axmann, Höflichkeit der Jugend. In: BB: Gebiet Franken, 4/42 vom 7.1942.
Mobilisierung in Permanenz
301
Im Folgenden ist ein knapper Überblick über die Kriegsdienste zu skizzieren; jeder einzelne Aspekt würde im Grunde eine eigenständige Darstellung verdienen. Der veränderte Charakter der Hitlerjugend hilft zu erklären, warum junge Menschen nach Wegen suchten und Möglichkeiten fanden, um ihrem Zugriff zu entgehen. Dem Staat und der Partei unterworfen, sollte die Hitlerjugend ihre Mitglieder „für besondere Zwecke anfordern und zum Einsatz bringen“. Dienststellen hatten den Weisungen aus Partei, Wehrmacht und Staatsbürokratie Folge zu leisten, wobei „die Verantwortung für die Führung der Einheiten der Hitler-Jugend […] in der Hand ihrer Einheitenführer“ verbleiben sollte.133 Die sogenannten Einsatzdienste – gemeint waren hier diverse Notdienste im Staats- und Parteiauftrag wie Ernte- oder Werkeinsätze, Sammlungen, Kurierund Verladedienste oder im Luftschutz – gingen „in jedem Falle […] dem regelmäßigen HJ-Dienst vor“, zumal die RJF im Kriegsverlauf feststellen musste, dass „in besonders gefährdeten Gebieten oder in Operationsgebieten […] eine normale Dienstdurchführung so gut wie unmöglich“ wurde.134 Nach 1939 war die Hitlerjugend noch mehr als zuvor dezentral organisiert. Über ihren Einsatz ließ sich meist nur vor Ort entscheiden. Den höheren Dienststellen fehlte außerdem vielfach Personal. Ende 1939 teilte die RJF mit, dass ihre Anordnungen in der Zukunft als „Rahmenbefehl“ zu verstehen seien. Denn „durch die Verschiedenartigkeit der örtlichen Anforderungen“ seien die Vorgaben je entsprechend „der örtlichen Erfordernisse […] abzuwandeln und anzupassen“.135 Die regulären Dienstnachmittage fielen im weiteren Kriegsverlauf immer häufiger aus. Stattdessen schoben sich Hilfsdienste – von Partei oder staatlichen Stellen koordiniert – sowie die vormilitärische Ausbildung in den Vordergrund. Bereits kurz nach Kriegsbeginn zählte für die 16- bis 18-Jährigen eine zwölfmonatige Ausbildung im Kleinkaliberschießen mitsamt Geländedienst hinzu. HJ-Einheiten erhielten einen „Schießwart“, der die Ausbildung leitete.136 Schwere Unfälle nahmen, wie zuvor erwähnt, zu: Im Sommer 1942 wurde ein Unterführer in Oberschlesien zu vier Wochen Jugendarrest verurteilt, weil unter seiner Aufsicht ein Junge erschossen wurde; in Tilsit töteten zeitgleich zwei Vierzehnjährige einen Kameraden im Dienst; in Hildesheim wurde ein HJ-Führer zu neun Monaten Haft verurteilt, weil er eine „wilde Schießerei“ zweier Einheiten organisiert hatte, bei der ein Junge ums Leben gekommen war.137 An den „Reichsschießschulen“ – die wichtigste befand sich in Suhl – oder in Reichsausbildungslagern wurden Schießwarte ausgebildet. Anfang 1943 senkte man das Mindestalter für einen HJ-Schießwart auf gerade einmal 16,5 Jahre 133 Zusammenarbeit mit Dienststellen der Partei, des Staates und der Wehrmacht. In: Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 7: Einsatz, S. 557. 134 Ebd. 135 Dienstvorschrift für die Hitler-Jugend im Kriege. In: Reichsbefehl, 1/K vom 20.9.1939, auch abgedruckt in Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 1: Organisation der Hitler-Jugend, S. 79. 136 Vgl. KK.[Kleinkaliber]-Schießen. In: GB: Pommern, 4/42K vom 4.1942. 137 Rundschreiben der Reichsjugendführung, 21/42 vom 27.8.1942, zur Ahndung unvorsichtigen Umgehens mit Schusswaffen. In: GB: Moselland, 8/42 vom 15.9.1942.
302
Massenmobilisierung
ab.138 Die RJF setzte sich zur Aufgabe, dass Landgemeinden mit Schießständen, Patronen, Waffen und Ausbildern bevorzugt versorgt werden sollten.139 Schießabzeichen spornten ebenso an wie die Reichsschießwettkämpfe, bei denen die jeweiligen Banne eines Gebiets als Mannschaft gegeneinander wetteiferten.140 Man versuchte, der vormilitärischen Ausbildung einen sportlichen Charakter zu erhalten. Noch zu Kriegsbeginn waren die höheren Dienststellen der Hitlerjugend bemüht gewesen, die Ausbilder möglichst aus der Hitlerjugend selbst zu rekrutieren. Das stellte sich als unmögliches Unterfangen heraus. Die Lehrgänge kamen nur schleppend in Gang. Wie der SD in Leipzig Ende 1939 meldete, weigerten sich Betriebe und Schulen, Jugendliche für militärische Lehrgänge zu beurlauben. Dafür konnten sie sich auf die unterschiedlichsten Vorschriften berufen. Aufsässige Arbeitgeber, die nicht auf Lehrlinge verzichten wollten, erklärten der Hitlerjugend, man würde es im Konfliktfall „darauf ankommen lassen“. Nur 10 Prozent derer, die für Lehrgänge eingeplant waren, erhielten in Sachsen Ende 1939 die Freistellung. „Trotz weitgehendster Bemühungen“, so der Lagebericht aus Leipzig, „war [die] Freigabe von befähigten Jugendlichen in ausreichender Zahl nicht möglich. Beispiel: Von 27 gemeldeten HJ-Angehörigen eines Bannes […] standen nur 4 Mann sofort zur Verfügung, nach langen persönlichen Bemühungen […] weitere 3 Mann; nur mit Mühe konnten 5 Ersatzleute (nicht nur zweiter, sondern dritter ‚Garnitur‘) gestellt werden.“141 Der Einfluss der Wehrmacht nahm kontinuierlich zu.142 Deren Ausbilder wurden unverzichtbar, weil die Staatsjugend aus den eigenen Reihen nur wenige gewann. Anstelle von Spiel setzten diese jedoch militärischen Drill. Der RJF blieb nur, den stark veränderten Charakter des Dienstes zu verschleiern. Im Januar 1941 verfügte Axmann, dass nicht mehr von „vormilitärischer Ausbildung“, stattdessen von „Wehrertüchtigung“ zu sprechen sei.143 In Sondereinheiten – der Marine-, Flieger-, Motor- oder Nachrichten-HJ – wurde der Alltag härter: „Im Gegensatz zur Friedenszeit“, so die Führung in Hessen-Nassau 1943, „werden […] die Jungen der Nachrichten-Hitler-Jugend nunmehr durch Soldaten der Nachrichtentruppe unterwiesen. Soldaten der Kriegsmarine bilden die Marine-Hitler-Jugend in Kurzlehrgängen fachlich aus.“144 Auf die Be138 Vgl. Mindestalter für Hitler-Jugend-Schießwarte. In: GB: Oberdonau, K1/43 vom 1.1.1943. 139 Vgl. Materialbeschaffung. In: GB: Wartheland, 6/41/K vom 5.5.1941. 140 Vgl. Ausschreibung zum 5. Reichsschiesswettkampf der Banne um den Ehrenpreis des Reichsjugendführers. In: ebd. 141 Reichsführer SS, Bericht des SD-Abschnitts Leipzig, vom 8.11.1939 (IWM Duxford, Morale Documents, Captain Branney; Digitalisat des Bestands im Archiv des HAIT, unpag.). 142 Vgl. beispielsweise Befehl des Wehrkreiskommandos VII zur Beteiligung der Wehrmacht an der vormilitärischen Ausbildung der HJ, München vom 12.4.1941. In: Jahnke (Hg.), Eine Dokumentation, S. 403 f. 143 Anordnung des Reichsjugendführers Artur Axmann zur Forcierung der Wehrertüchtigung vom 15.1.1941. In: ebd., S. 400 f. 144 WE [Wehrertüchtigungs]-Arbeit im Gebiet Hessen-Nassau. In: Gebiet Hessen-Nassau (Hg.), Feldpost-Brief der Hitler-Jugend, Nr. 9–11 vom 11.1943, S. 17–20, hier 17.
Mobilisierung in Permanenz
303
hauptung legte man Wert, dass trotzdem „in erster Linie […] das eigene lebhafte Interesse der Jungen für ihre vormilitärische Ausbildung […] zur Erweiterung unserer Wehrertüchtigungsarbeit“ geführt habe.145 Weil die Stärke der Sonderformationen oft nicht ausreichend schien, um den Bedarf der Wehrmacht an Nachwuchs zu decken, wurden in einigen Gebieten Jugendliche in Sonderformationen zwangsüberwiesen. Sondereinheiten stampfte man geradezu aus dem Boden. Vereinzelt – wie in Mecklenburg schon Anfang 1939 – wurden reguläre HJ- und DJ-Einheiten komplett zu Sonderformationen umgewandelt.146 Seit März 1942 richtete man die sogenannten Wehrertüchtigungslager (WEL) ein. Die RJF gab sich zufrieden, da ihr eine „weitere bedeutsame und kriegswichtige Aufgabe“ übertragen schien. In Zukunft werde sich „jeder Junge […] freudigen Herzens der Ausbildung unterziehen“.147 In jedem Gebiet existierten mindestens zwei, manchmal – wie in Pommern oder Hessen-Nassau – drei und in Regionen wie Westfalen oder Köln-Aachen vier oder fünf WEL. Sachsen, das – von Leipzig abgesehen – von Luftangriffen lange verschont blieb, verfügte am Ende sogar über neun Ausbildungslager. Ende 1944 wies die RJF an, für das „Dritte Aufgebot des Deutschen Volkssturms“ weitere Lager einzurichten; speziell für die Geburtsjahrgänge 1928/29. Einberufungen erfolgten zuletzt anhand der Karteien für Lebensmittelkarten in den Gemeinden, „mit größter Schnelligkeit ohne bürokratische Bedenken und Hemmungen“.148 Insgesamt existierten bei Kriegsende rund 40 WEL, einige speziell für Sonderformationen; die Motor-HJ etwa in Lichtenstein in Sachsen, die Marine-HJ in Lauben, Köge und Attersee.149 Die Hitlerjugend als solche hatte in den WEL praktisch wenig zu sagen, obgleich sie so tat.150 Die praktische Ausbildung leiteten Unteroffiziere, die an der Front verwundet oder von dort abgezogen worden waren. Die RJF konzipierte Schulungen, um die Ausbilder für den Umgang mit jungen Menschen zu sensibilisieren. Die WEL waren strapaziös, die Einberufung gefürchtet.
145 Ebd. 146 Vgl. Verstärkung der Sondereinheiten. In: GB: Mecklenburg, A1/39 vom 15.2.1939. 147 Der Reichsjugendführer hat folgenden Aufruf erlassen: Wehrertüchtigungslager der Hitler-Jugend. In: BB: Sachsen, 4/42 vom 1.4.1942. 148 Der Jugendführer des Deutschen Reichs an die nachgeordneten staatlichen Dienststellen, betrifft: Erweiterte Wehrhaftmachung der deutschen Jugend im Rahmen des Volkssturms, vom 1.11.1944 (HStA Stuttgart, E 151/09, Bü 169, Bl. 23). 149 Vgl. u. a. die Auflistung „Annex Part Five“ in: Supreme Headquarters Allied Expedi tionary Force [SHAEF]. Evaluation and Dissemination Section, G-2 (Counter Intelligence Sub-Division), Basic Handbook: The Hitler Jugend (The Hitler Youth Organisation), Washington 1945, ohne Seitenangabe; vgl. außerdem Hilgers, Struktur und Funktion, S. 66–70. 150 Zur Außendarstellung durch die RJF vgl. Gerhard Hein, Was leisten die Wehrertüchtigungslager? Bericht eines Inspekteurs. In: Das Junge Deutschland, (1943) 3, S. 86–71.
304
Massenmobilisierung
„Unsere Ausbilder waren fronterfahrene Offiziere und Unteroffiziere“, berichtete Gerhard Laue, der 1942 in Bad Berka ausgebildet wurde: „Die sind mit uns genauso umgegangen, wie sie das mit Rekruten getan haben. Damit meine ich auch den rauen Kasernenhofton. [… Der] Sportplatz wurde zum regelrechten Schleifplatz. Hier haben wir so richtig leiden müssen!“151 Junge Menschen versuchten durchaus, sich den Einberufungen zu entziehen. Im Gebiet Niederdonau etwa musste man im September 1942 mehrere Unterführer scharf zurechtweisen. Sie hatten ihren Kameraden Bestätigungen geschrieben, dass sie an WEL angeblich nicht teilzunehmen bräuchten. „Abgesehen davon“, kritisierten die Funktionäre angesichts dieser Fälle, „dass diese Bestätigungen keine Gültigkeit haben und nicht anerkannt worden sind, möchte ich nochmals auf die Ungehörigkeit hinweisen. Eine vom Gebiet durchgeführte Einberufung kann nicht von einem Gefolgschaftsführer außer Kraft gesetzt werden.“152 In der letzten Kriegsphase wurden einige Jugendliche und junge Männer aus den WEL zu Tätern und Tathelfern – wie Martin Winter zuletzt eindrucksvoll aufgezeigt hat: Jugendliche, die aus den Lagern dazu abkommandiert worden waren, verscharrten die Leichen von KZ-Häftlingen, durchsuchten Häuser und Bauernhöfe nach Entflohenen. Manche der HJ-Angehörigen beteiligten sich auf Befehl ihrer HJ-Jugendführer an der Erschießung von Häftlingen, die aus den Lagern im Osten – von der SS auf erbarmungslose Todesmärsche geschickt – die Grenzen zu Deutschland überschritten hatten.153 Unter vielen jungen Menschen noch gefürchteter als die WEL waren die sogenannten Schanzarbeiten. Auf Basis der „Verordnung über die Heranziehung der deutschen Jugend zur Erfüllung von Kriegsaufgaben“ vom 2. Dezember 1943 mussten Jugendliche bei Kriegsende Gräben gegen die Alliierten ausheben.154 Der „Grenzeinsatz“ war ein Teil der Jugenddienstpflicht. Wieder trug die Hitlerjugend formal Verantwortung. Ihre örtlichen Dienststellen rekrutierten, indem sie Gestellungsbefehle an die Familien verschickten: Jungen ab 15, Mädchen ab 16 Jahren. „Und dann fand ich einen Befehl vom BDM vor, mich morgen beim Bann zu melden“, schrieb Ursula Lindemann im Herbst 1944 in ihr Tagebuch: „Wir Schülerinnen haben keine Schule mehr, sondern sollen an den Westwall kommen. Näheres sollen wir dann morgen erfahren. Mein Gott, sind die verrückt geworden, sollen nun etwa wir 16-jährigen Mädchen schanzen?“155
151 Laue, Meine Jugend in Erfurt unter Hitler 1933–1945, S. 57. 152 Einberufung. In: GB: Niederdonau, 9/42K vom 15.9.1942. 153 Martin Clemens Winter, Gewalt und Erinnerung im ländlichen Raum. Die deutsche Bevölkerung und die Todesmärsche, Berlin 2018, S. 123–131. 154 Der Reichsminister des Innern an die Reichsverteidigungskommissare über den Grenz einsatz der Hitler-Jugend vom 16.9.1944 (StA Freiburg, B726/1, 5569, unpag.; HStA Stuttgart, E 151/09, Bü 169, Bl. 6). 155 Tagebuch von Ursula Lindemann, Eintrag vom 3.9.1944 (NSDOK Köln, EzG, jugend 1918-1945.de; 17.7.2020).
Mobilisierung in Permanenz
305
Das Nicht-Erscheinen wurde auf Basis der Jugenddienstpflicht und durch die Hitlerjugend sanktioniert. Das „Schanzen“ in der Praxis koordinierte allerdings die Wehrmacht, die auch die Befehlsgewalt über die eingesetzten Jugendlichen besaß. Auf den Alltag in den Lagern nahe der Front hatte die Hitlerjugend wenig Einfluss; war allenfalls für die Versorgung durch HJ-Ärzte zuständig.156 Ende 1944 zog man nicht mehr nur die 15- und 16-Jährigen, sondern vielfach sogar Jüngere für die Verteidigung ein. Die Zustände in den Lagern, notdürftigen Schlafstätten und Baracken am „Westwall“ müssen überwiegend katastrophal gewesen sein. In dem Versuch, seinen Sohn nach Hause zu holen, reichte ein Vater im Oktober 1944 beim Wirtschaftsministerium in Stuttgart leidenschaftlich Beschwerde ein: „Seit dieser Zeit schlafen nun diese Kinder, denn um solche handelt es sich mit 14 und 15 Jahren noch, in der Arbeitskleidung, ohne Möglichkeit, diese zu wechseln, auf Stroh. In der Zwischenzeit ist im Unterbringungsraum Scharlach ausgebrochen. […] Da […] dieser ganze Einsatz gegen den Willen unseres Führers von der HJ-Führung aus befohlen wurde, so ersuche ich [meinen Sohn] sofort nach Hause entlassen zu wollen. Auf der Banndienststelle in Leonberg wurde den Eltern gesagt, dass die Bannführung nicht wüsste, wo die Jungens überhaupt sich befänden! […] Wir Eltern wissen jedenfalls, dass die Jungens in Membrechtshofen im Saale des Gasthauses […] liegen und sind hinsichtlich dieser Aktion […] allesamt ein und derselben eindeutigen Ansicht.“157
Für die Jugendlichen sei alles Erdenkliche getan worden, rechtfertigte sich daraufhin die HJ-Führung. Der Gesundheitszustand unter den Eingesetzten sei „sehr ordentlich“, wenn auch bei „10 000 im Einsatz befindlichen Jungen“ Einzelfälle von Scharlach wohl vorgekommen sein mögen. Die Gebietsführung betonte, auf Briefzensur drängend, dass es „aus Geheimhaltungsgründen“ den Jungen verboten sei, etwas über ihren Einsatz nach Hause zu berichten.158 Wer zu diesem „Schanzen“ eingesetzt wurde, beschrieb das dort Erlebte Jahre später oft als eine traumatisierende Erfahrung. Die halbwegs akzeptable Unterbringung war in den meisten Fällen nicht gegeben, manchmal regierte nackte Angst unter den Jugendlichen, viele gingen stiften. Ein Kölner Hitlerjunge notierte im Herbst 1944 in sein Tagebuch, dass die Jahrgänge 1926 bis 1930 kürzlich einberufen worden seien. In Köln liefen seitdem „andauernd HJ-Streifen herum, die diejenigen abschnappen, die vom Westwall laufen gegangen sind“.159 Die Hitlerjugend half dort, wo Arbeitskräfte fehlten: Botengänge für Partei und Behörden, im Einsatz bei der Reichspost und der Feuerwehr, beim Transport von Kohle sowie im Gesundheitsdienst oder Verkehrswesen. Kinder ab zehn Jahren führten alle Arten von Sammlung durch, etwa von Altmetall und 156 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 46 f. 157 Brief an das Württembergische Wirtschaftsministerium, Landesgewerbeamt vom 6.10.1944 (HStA Stuttgart, E 151/09, Bü 169, Bl. 9); Unterstreichungen im Original hier nicht berücksichtigt. 158 Gebietsführung Württemberg, Beauftragter für den Stellungsbau, an den Württembergischen Innenminister Dr. Jonathan Schmid vom 16.10.1944 (ebd., Bl. 8). 159 Zit. aus dem Transkript des Tagebuchs von Helmut Stuckert, einleitende Notiz zum Jahr 1944 (NSDOK Köln, EzG, jugend1918-1945.de; 17.7.2020).
306
Massenmobilisierung
Kleidungsstücken, Heilkräutern zur Herstellung von Medizin und Tees: „Alle Wiesen sind Apotheken“, lautete es in der BDM-Zeitschrift „Das deutsche Mädel“.160 Für das Kriegswinterhilfswerk zogen Kinder durch die Straßen, um Spenden zu sammeln. Hitlerjungen, die das 16. Lebensjahr überschritten hatten, fanden bei der Polizei Verwendung, um Beamte zu unterstützten. Eine Beteiligung an „unmittelbar gefährlichen Suchaktionen“, beispielsweise nach flüchtigen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen, sollte vielerorts dem SRD vorbehalten sein.161 Im Gebiet Moselland allerdings stellte die Führung im Juni 1942 – nach Vereinbarung mit dem Stammlager XII D Koblenz mit Sitz in Trier – Jugendliche zur Suche nach Geflohenen ab. Die Gauleitung hatte der Hitlerjugend „das Recht und die Pflicht“ erteilt, „die Gefangenen zu kontrollieren und die Ausweise abzuverlangen“, um mögliche Flüchtige zu stellen.162 Höhere Dienststellen zeichneten mit Vorliebe die „einfachen“ Mitglieder aus, darunter zum Teil sogar Mädchen, wenn sie einzeln oder auch geschlossen als Einheit einen flüchtigen Gefangenen gejagt, gestellt und der Polizei oder SS übergeben hatten; derartige Fälle gab es recht häufig.163 Mädchen, die das 17. Lebensjahr erreichten und über eine Berufsausbildung verfügten, eine „einwandfreie […] politische Einstellung“ sowie eine „Abstammung aus erbgesunder Familie“ nachwiesen, wurden außerdem als Nachrichtenhelferinnen für die Wehrmacht oder Waffen-SS eingesetzt.164 Mädchen jüngeren Alters halfen in der Nachbarschaftshilfe, bei Koch- und Nähabenden sowie in der BDM-Werkarbeit, bei der Betreuung von Kleinkindern im Rahmen der NSV oder – was jetzt Kulturarbeit genannt wurde – der verwundeten Soldaten in Lazaretten. Letzteres avancierte ab 1942 zu einer der Hauptaufgaben des BDM. Die Betreuung von Angehörigen, Fronturlaubern und Versehrten, die mit Musik oder Spiel unterhalten werden sollten, sowie die Feldpost zählten zum Aufgabenkatalog. Das Gebiet Wien zog Ende 1943 dennoch kritisch Bilanz. Die Kriegsdienste seien „erst zum Teil arbeitsmäßig aufgegriffen worden“ und müssten „in Zukunft in weit stärkerem Maß bearbeitet werden“.165 Zunehmend sollten auch die Spielscharen an Bedeutung gewinnen und einen Rest behaglicher Nestwärme in der „Volksgemeinschaft“ bieten: Laienschauspiel, Gesang oder Orchesterarbeit fiel in deren Aufgabenbereich, auf Parteiveranstaltungen 160 Alle Wiesen sind Apotheken. In: Das Deutsche Mädel, (1942) 8, S. 10 f.; Einsatz der Hitler-Jugend beim Kohletransport. In: GB: Moselland, K1/42 vom 15.1.1942. 161 Einsatz bei der Polizei. Kriegsaushilfsdienst. In: GB: Pommern, 9/43 K vom 5.1943. 162 Fahndung und Wiederergreifung von geflüchteten Kriegsgefangenen. In: GB: Moselland, K6a/42 vom 15.6.1942; Maßnahmen gegen die Flucht französischer Kriegsgefangener. In: ebd., K12/42 vom 1.12.1942. 163 Vgl. die Belobigungen in sämtlichen Gebietsbefehlen zur Gefangennahme von Kriegsgefangenen oder geflüchteten „Ostarbeitern“, beispielhaft in: BB: Moselland, 4/42 vom 15.5.1942; oder ebd., K12/42 vom 1.12.1942; GB: Hochland, 10/44K vom 15.10.1944; GB: Westmark, 16/43Kvom 23.8.1943. 164 Nachrichtenhelferinnen des Heeres und der Waffen-SS. In: GB: Hochland, K17/42 vom 25.11.1942. 165 Kriegsbetreuungsdienst. In: GB: Wien, 13/43 vom 1.11.1943.
Mobilisierung in Permanenz
307
oder bei Festen sorgten Spieleinheiten für Unterhaltung. „Pimpfe“ und Jungmädel, die sich in Schulorchestern als talentiert erwiesen hatten, sowie Musikstudenten wurden rekrutiert. Jugendchöre wie die Regensburger Domspatzen und der Leipziger Thomanerchor waren in die Spielarbeit ebenfalls eingebunden.166 Außerhalb der Metropolen gelang es jedoch selten, diese Sondereinheiten aufzubauen, und die Gebietsspielscharen der Großstädte ließen sich in der Provinz wiederum kaum einsetzen. Überwiegend in den Gauhauptstädten tätig, traten sie zuletzt auch weniger für Theater und Musikdarbietungen auf, umso mehr aber für Totengedenkfeiern oder in Lazaretten – eine hohe psychologische Belastung, wie sich Gisela P. erinnerte, damals Gebietsspielscharmädchen in Dresden.167 Gerade bei der Betreuung im Lazarett kamen Spielscharangehörige mit dem Grauen der Kriegswirklichkeit in Berührung. Doris Sauer, als BDM-Musikreferentin tätig, blickte auf diese Art des Einsatzes zurück. Sie skizzierte die Gefahren, die aus Sicht der RJF hier drohten: „Die Soldaten […] sollten zwar von ihren Fronterlebnissen keinem Menschen etwas Negatives berichten. Viele von ihnen sind aber verzweifelt und haben niemanden, der sie besucht; von diesen erfahren wir, ohne zu fragen, vieles, was in keiner Tonfilmwochenschau zu sehen und in keiner Zeitung zu lesen ist, und wir sind oft sehr bedrückt und erschüttert, wenn wir vom Lazaretteinsatz heimfahren.“168 Mit fortschreitender Kriegsdauer ließen sich die Aufgaben der Spielscharen in schwindendem Umfang realisieren. In Berlin hatte man die Obergauspielschar, immerhin die wichtigste der BDM-Hierarchie, bereits 1941 für die Erntehilfe in Oberschlesien eingesetzt.169 Obwohl sich die Hitlerjugend nach Kräften bemühte, blieben die Erfolge zudem meist begrenzt. In Osthannover gab man Ende 1943 zu, dass „abgesehen von der Gebietsspielschar in Celle […] die Spielschararbeit in andern Bannen des Gebietes in unzulänglichen Anfängen steckengeblieben“ sei.170 In Wien zog man im März 1944 die Bilanz, dass die Gebietsspielschar weiterhin zu willkürlich eingesetzt und auch daher keine „wirklich planmäßige Arbeit“ betrieben werde.171 Zu einem wichtigen Bestandteil des Alltags avancierte die Werkarbeit. Sie war in den 1930er-Jahren bereits vielfach betrieben worden, insbesondere im BDM und in Haushaltungsschulen. Da die Industrie für die Rüstung in Beschlag genommen worden war, arbeitete die Hitlerjugend nach 1939 zunehmend an Gütern des täglichen Bedarfs. Der Spielzeugbau besaß für die Hitlerjugend in 166 Vgl. Rainer Sieb, Der Zugriff der NSDAP auf die Musik. Zum Aufbau von Organisa tionsstrukturen für die Musikarbeit in den Gliederungen der Partei, Osnabrück 2007, S. 166–194. 167 Vgl. Interview von André Postert mit Gisela P. vom 18.11.2014 (Tonaufnahme im Archiv des HAIT). 168 Doris Sauer, Erinnerungen. Karl Haiding und die Forschungsstelle „Spiel und Spruch“, Wien 1993, S. 65. 169 Vgl. ebd., S. 66. 170 Errichtung von Spielscharen. In: Rundschreiben des Gebietes Osthannover, (1943) 46, S. 3. 171 Spielschareinsätze. In: GB: Wien, 4/44K vom 15.3.1944.
308
Massenmobilisierung
den Kriegsjahren eher propagandistische Bedeutung. Was die Industrie nicht mehr leistete, fiel in ungeschulte Kinderhände: Soldatenkinder sollten durch Hitlerjugend und NSV an Weihnachten reich beschenkt werden. Tausendfach schnitzten und bemalten DJ- und JMB-Einheiten in der Vorweihnachtszeit Spielzeug; zum Einsatz kamen primär 10- bis 14-Jährige. Muster, die jeden Handstreich erklärten, stellte man den lokalen Einheiten zur Verfügung. Im Winter 1942/43 gelang es auf diese Weise, der NSV 8,5 Millionen Spielsachen zu übergeben.172 Selbstzeugnisse und Erinnerungen zeichnen häufig ein positives Bild dieser Werkarbeit. Wolfhilde von König aus München, die 1936 in die Hitlerjugend gekommen und vom BDM begeistert war, schrieb 1941 in ihr Tagebuch: „Was waren das für aufregende Wochen für uns. Ein richtiges Wettschaffen war es geworden. Unsere Gruppe fertigte einen Zug nach dem anderen, nebenan wurden Wiegen und Küchen hergestellt. War das ein Wogen und Treiben in der Werkausstellung, doch war auf unserem Weihnachtsmarkt ein noch größeres Gedränge.“173 In den letzten zwei Kriegswintern fertigten Kinder zunehmend Alltagsgüter wie Besteck oder Teller. Die RJF hatte sukzessive und de facto Kinderarbeit organisiert. Volkswirtschaftlich von weit mehr Bedeutung waren die Ernteeinsätze. In der Agrarwirtschaft hatte sich das Einrücken zehntausender Männer bemerkbar gemacht. Um Engpässen entgegenzuwirken, sollte erneut die Staatsjugend eingespannt werden. Schulklassen – wie bei Leipzig – hatte man im Herbst 1939 unter der Leitung von Lehrern angeblich zu 100 Prozent zum Ernteeinsatz gebracht, wobei die enge Zusammenarbeit zwischen der Hitlerjugend und den Schulen von großer Bedeutung war.174 Im Frühjahr 1940 kamen Einheiten für die Aussaat auf den Feldern zum Einsatz. Anfangs stellte man Unterführer zahlreich ab, was – so ein weiterer Bericht aus Sachsen – zu Folgeproblemen führte. Regulärer Dienst fand kaum mehr statt: „Als Ergebnis […] lässt sich unschwer für die nächsten Wochen voraussagen, dass eine geregelte politische Schulung wie auch eine vormilitärische Ausbildung […] nicht durchgeführt werden können, weil die Führer anderweitig eingesetzt sind, während [fünf Sechstel] der restlichen Jugend lediglich auf den Straßen herumlungern.“175 Landwirtschaftliche Hilfseinsätze machten zumal auf dem Land einen Großteil des Hitlerjugendalltags aus. Im Sommer 1942 ließ Axmann wissen: „Der Ernteeinsatz sei Euer Ehrendienst im Kriegseinsatz der Heimatfront. Damit leistet Ihr einen entscheidenden Beitrag zum größten Sieg, den die deutsche Geschichte 172 Vgl. z. B. Aufruf des Reichsjugendführers zum Spielzeugwerk der Hitler-Jugend 1943; sowie Arbeitsanweisungen zur Durchführung des „Spielzeugwerkes der Hitler-Jugend 1943“ für die Jugend in den Betrieben. In: GB: Wien, 13/43 vom 1.11.1943. Muster und Handreichungen sind in sämtlichen GB der Kriegszeit fast durchgehend auffindbar. 173 Sven Keller (Hg.), Kriegstagebuch einer jungen Nationalsozialistin. Aufzeichnungen Wolfhilde von Königs 1939–1946, Göttingen 2015, Eintrag vom 24.12.1941, S. 100. 174 Vgl. Bericht der Außenstelle Oschatz des SD-Abschnitts Leipzig vom 5.12.1939 (IWM Duxford, Documents Captain Branney, Digitalisate der Lageberichte im Archiv des HAIT, unpag.). 175 Reichsführer SS, Bericht des SD-Abschnitts Leipzig vom 27.9.1939 (ebd.).
Mobilisierung in Permanenz
309
kennen wird.“176 Verantwortlich zeichnete sich das Reichserziehungsministerium, praktisch organisiert wurden die Einsätze aus den Schulen heraus – auch weil die Hitlerjugend personell dazu überwiegend nicht imstande war. Klassengemeinschaften mit Schülern im Alter von 10 bis 14 Jahren durften für kurze Zeit, ältere Schüler für einen längeren Zeitraum eingesetzt werden, um Bauern bei der Bestellung der Felder, bei der Ernte oder Weinlese zu unterstützen. Für jüngere Schüler waren prinzipiell einfache, aber körperlich nicht minder belastende Hilfsdienste vorgesehen: Ährenlese, Schädlings- und Unkrautbekämpfung, Forstarbeiten, Heilkräuter- oder Früchtesammlungen sowie Nachrichtenund Verpflegungsdienste. Obgleich die Hitlerjugend bei der Auswahl und dem Einsatz der Klassen beteiligt wurde, war ihr Einfluss auch hier beschränkt. Für die Zeit der Schulferien konnten die Dienststellen ihre Zuständigkeit gerade so behaupten, während der Unterrichtszeit trugen aber die Schulbehörden die Verantwortung.177 Ernteeinsätze wurden meist von Lehrern geleitet. Die Höfe wiederum bestimmten die örtlichen Bauernführer der NSDAP.178 So wie die Hitlerjugend den Bereich der vormilitärischen Ausbildung an die Wehrmacht abgab, verlor sie die Schirmherrschaft über Kriegsnot- und Hilfseinsätze an andere Stellen aus Partei und Staat. Im Gebiet Wartheland, wo sich die Strukturen der Jugendorganisation noch im Aufbau befanden, hieß es 1941, dass im Zweifelsfall „auch jeglicher anderer Dienst ausfallen“ könne.179 Wo es an Unterführern fehlte, versuchten die Stäbe der Gebiete gelegentlich Personal aus anderen Regionen abzuziehen. Man war auf die Zustimmung der eigenen Kreisleiter, Arbeitsämter und der Kreisbauernschaft angewiesen.180 Die Bauern wussten mit den jungen Erntehelfern, die aus Städten herangekarrt wurden, selten viel anzufangen. Stadtkindern konnte die Landarbeit naturgemäß nicht vertraut sein. Statt die Bauern zu entlasten, bedeuteten sie manchmal sogar Mehrarbeit. In Sachsen hatten Bauern die Schülerinnen und Schüler daher im Herbst 1939 sogar einfach wieder nach Hause geschickt – ein „völliger Fehlschlag“ und „organisatorischer Missgriff“, urteilte schonungslos ein SD-Bericht.181 Die Landjugend zeigte wiederum wenig Lust, die Ferienzeit für Arbeiten auf fremden Gütern zu opfern. Die Mädchen waren aufgerufen, „einen Teil ihres Urlaubes zu opfern, um der Bäuerin bei ihrer schweren Arbeit zu helfen. Nicht durch Zwang, sondern gern und freudig sollt ihr diese Arbeit tun, 176 Der Reichsjugendführer hat folgenden Aufruf erlassen: Über den Ernteeinsatz der Deutschen Jugend. In: BB: Sachsen, 7/42 vom 1.7.1942. 177 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 2, S. 685. 178 Vgl. Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an die Unterrichtsverwaltungen der Länder bezüglich Kriegseinsatz der Jugend zur Sicherung der Ernährung des deutschen Volkes vom 11.5.1943 (LHASA, DE, KB BBG, 1494, Bl. 7 f.). 179 Ernteeinsatz. In: GB: Wartheland, 11/41/K vom 17.8.1941. 180 Vgl. Ernteeinsatz. In: GB: Pommern, 9/43 K, Sonderdruck: Kriegseinsatz der pommerschen Hitler-Jugend vom 5.1943. 181 Bericht des SD-Abschnitts Leipzig vom 27.9.1939 (IWM Duxford, Documents Captain Branney, Digitalisate im Archiv des HAIT, unpag.).
310
Massenmobilisierung
in dem Bewusstsein, mithelfen zu können, die deutsche Ernte zu bergen.“182 Das Landratsamt in Bernburg bestätigte der Landesregierung – auf Basis eines Berichts der Hitlerjugend – im Dezember 1941 jedoch „starke Unlust der Landschulkinder und ihrer Eltern, sich auf dem Felde einzusetzen. […] Es wurde mir von einigen Schulen mitgeteilt, dass die Kinder zumeist auf dem eigenen Acker gearbeitet, aber keine Lust gezeigt hätten, im Interesse des allgemeinen Wohls sich auch auf den großen Gütern zu beteiligen. Es muss ein Weg gesucht werden, dass im nächsten Jahre auch die Landschulkinder sich stärker am Feldeinsatz beteiligen.“183 Die Hitlerjugend suchte die Schuld in der fehlenden Unterstützung an den Schulen. Und die Schulleitungen ihrerseits schoben die Verantwortung wieder auf die Hitlerjugend ab – wie z. B. eine Volksschule bei Bernburg: „Es geht […] auf keinen Fall, dass die hiesige HJ, der übrigens genügend Disziplinarmittel zur Verfügung stehen, ihre scheinbare Unfähigkeit mit einer Beschwerde über die Schule […] decken will.“184 Dieser Hinweis auf etwaige disziplinarische Sanktionen leitete allerdings in die Irre. Die Erntehilfsdienste waren aus Mangel an verfügbaren HJ-Führungskräften von den Bestimmungen der Jugenddienstpflicht ausgenommen, also auch von etwaigen Straf- und Sanktionsmaßnahmen – freilich nicht, weil die Hitlerjugend diese Instrumente nicht prinzipiell gewünscht und zur Anwendung gebracht hätte, sondern weil sie schlicht nicht über die Mittel verfügte, sie praktisch durchzusetzen.185 Partei und Behörden, die sich gegenseitig beschuldigten, beklagten Probleme mit jungen Menschen beim Landeinsatz. Den Höhepunkt erreichte das Regime 1943 dank massiven Drucks in Schulen und auf Eltern. Angeblich rund 360 000 Jugendliche aus ländlichen Regionen und 722 000 aus Städten ließen sich in die „Erzeugungsschlacht“ einspannen; die Zahlen sind indes kaum überprüfbar.186 Die Land- und Erntehilfe machte im zweiten und dritten Kriegsjahr in Hinblick auf die Zahl der eingesetzten Jugendlichen wie auch bezüglich Arbeitsstunden aber zweifellos den größten Teil der Kriegsdienste aus. Ihr Nutzen bleibt fraglich. Die Landwirtschaft im Krieg wurde in wachsender Zahl von Zwangsarbeitskräften und Kriegsgefangenen getragen.187 Hier rückte die Hitlerjugend übrigens in allernächste Nähe zu Unrecht und Verbrechen. Da eingesetzte Schüler zumal aus den Städten für die Landarbeit kaum zu gebrauchen waren, wurden sie eher zur Beaufsichtigung der verschleppten Zwangsarbeiter eingesetzt. Man182 Die Gebietsmädelführerin gibt bekannt. In: BB: Mittelland, 2/42 vom 5.1942. 183 Der Landrat an den Reichsstatthalter in Braunschweig und Anhalt, Landesregierung Anhalt, Abteilung Volksbildung, zum Ernteeinsatz der Schuljugend im Herbst vom 17.12.1941 (LHASA, DE, KB BBG, 1494, Bl. 113). 184 Volksschule Sandersleben an den Landrat Bernburg vom 9.10.1941 (ebd.). 185 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 2, S. 686–687. 186 Aufruf des Reichsjugendführers. Die Arbeit an der ländlichen Jugend. In: BB: Main-Franken, 11/43 K vom 11.1943. 187 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 2, S. 688–690; Klönne, Jugend im Dritten Reich, S. 37; vgl. auch Statistische Zusammenstellung über die Kriegseinsätze des BDM, Stand 1944 (BArch Berlin NS 26/359). In: Miller-Kipp (Hg.), „Auch Du gehörst dem Führer“, S. 222–230.
Mobilisierung in Permanenz
311
che erwiesen sich als herzlose Bewacher. Josef König, ein Hitlerjunge aus dem HJ-Bann Meschede, wurde im Sommer 1944 durch die RJF belobigt. Er erhielt die Beförderung zum HJ-Kameradschaftsführer sowie von Gauleiter Albert Hoffmann eine Auszeichnung. Er hatte zwei flüchtige Zwangsarbeiter erschossen sowie fünf andere verwundet. Ihn würdigte die RJF als leuchtendes Vorbild: „In einem Abstand von zwei Metern machte Josef König von der Schusswaffe Gebrauch und tötete beide durch Kopfschuss. Einen Tag später stellte der Junge gemeinsam mit seinem Vater 5 weitere flüchtige fremdvölkische Arbeiter, die sämtlich nach Arm- und Schulterschüssen verhaftet werden konnten. Die Anerkennung des Reichsjugendführers wird Josef König gewiss Ansporn zu weiterer steter Pflichterfüllung sein. Er hat sich inzwischen zur Waffen-SS gemeldet.“188 Ein eindrückliches und erschreckendes Beispiel für die Grausamkeit von HJ-Angehörigen gegenüber Gefangenen und Zwangsarbeitern sind auch jene sechs Hitlerjungen, die in den letzten Kriegstagen unter Leitung ihres Bannführers Alfred Weber einen Massenmord begingen. Ende März 1945 trieb die Gruppe, offenbar auf Webers Weisung, an der Seite eines SS-Mannes im Burgenland in Österreich etwa 60 ungarische Landarbeiter zu einer Waldlichtung. Sie wurden erschossen und in einem Massengrab verscharrt.189 Müde Gesichter, glasige Augen und ausgezehrte Körper in Lumpen weckten mitunter aber auch Mitleid und Zutrauen. Diverse Zeitzeugen erinnerten sich, dass sie als Kinder wie selbstverständlich mit Zwangsarbeitern umgegangen wären, man zusammen gegessen, gescherzt oder sogar geschlafen habe.190 Das HJ-Führerkorps mahnte, dass junge Menschen „immer Gefahren […] durch den Einbruch fremden Blutes“ vor Augen haben sollten.191 Das war offenkundig nicht immer der Fall. „Es wurde mir gemeldet“, klagte empört Walter Kröcher, der Führer des Gebiets Westmark im Juli 1942, „dass einzelne Kriegsgefangenenunterkünfte häufig von Jugendlichen im HJ-Alter umlagert werden, die neugierig und undiszipliniert mit den Gefangenen Gespräche führen – ja ihnen sogar teilweise Zigaretten und sonstige Dinge zustecken wollten.“192 Der 16-jährige Wolfgang Haaßengier aus Weimar, der mit zehn Jahren 1938 in die Staatsjugend eingetreten war, wurde 1944 zu acht Monaten Jugendgefängnis verurteilt sowie aus der HJ ausgeschlossen, weil er sich – so das HJ-Gericht – „staatsabträgliche Ansichten zu eigen gemacht“ und sie in „französischen Sprechbrocken“
188 Die wackere Tat des Hitlerjungen Josef König. In: Ruhrmark. Mitteilungsdienst der Hitler-Jugend. Gebiet Westfalen-Süd, (1944) 7, S. 29. 189 Vgl. Eleonora Lappin-Eppel, Ungarisch-Jüdische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen in Österreich 1944/45. Arbeitseinsatz. Todesmärsche. Folgen, Wien 2010, S. 315–319. 190 Vgl. das Beispiel von Kurt Strohmeyer, Knochenarbeit im Gaswerk. In: Jürgen Kleindienst (Hg.), Gebrannte Kinder. Kindheit in Deutschland 1939–1945, Band 1, Berlin 1998, S. 104–109. 191 Verhalten gegenüber Ausländern und Kriegsgefangenen. In: BB: Franken, 5/42 vom 8.1942. 192 Umgang mit Kriegsgefangenen. In: GB: Westmark, K13/42 vom 24.7.1942.
312
Massenmobilisierung
gegenüber ausländischen Arbeitern geäußert habe.193 Gerade für die im Erntedienst tätigen Jugendlichen existierten strenge Verhaltensregeln. Am 5. April 1940 hatte die RJF klargestellt, dass „in jeder Beziehung größter Abstand“ zu „ausländischen Arbeitskräften zu wahren“ sei: „Sie sind auch, wenn sie gedemütigt und geschlagen, harmlos erscheinen, unsere Feinde. […] Hitlerjungen und BDM-Mädel sind es ihrer Ehre als Angehörige der Hitler-Jugend und als Deutsche schuldig, jeden Umgang mit Feinden zu meiden.“ Wer dagegen verstieß, sollte „rücksichtslos mit Schimpf und Schande aus unserer Gemeinschaft gejagt und einer […] harten Strafe zugeführt“ werden.194 Junge Menschen wurden umso eindringlich gewarnt, je weniger der Kontakt sich unterbinden ließ: „Gerade Kriegsgefangenen gegenüber ziehen wir eine klare Grenze zwischen ihrer und unserer Nationalgemeinschaft. Die nationalsozialistische Führung hat scharfe Strafen gegen jeden erlassen, der hier gegen das Nationalbewusstsein verstößt.“195 Sorgen bereitete der Partei und der RJF vor allem der Kontakt von Mädchen und jungen Frauen mit Zwangs- und Ostarbeitern sowie Kriegsgefangenen. Auf Bauernhöfen oder in Kleinbetrieben ließen sie sich nicht so streng separieren wie in der Industrie. Immer wieder kam es – wie Ende 1940 am Bodensee, wo drei 16- bis 17-jährige Mädchen wegen sexuellen Kontakts mit polnischen Arbeitern zu Gefängnis verurteilt wurden – zu derlei Fällen.196 „Der unerlaubte Verkehr“, urteilte das mit dem Fall befasste Amtsgericht, „ist leider keine Seltenheit. Der unerlaubte Verkehr findet nicht nur mit polnischen Kriegsgefangenen, sondern auch mit den gerade auf dem Land vorhandenen polnischen Zivilarbeitern statt.“197 Erfahrungsgemäß würden die Mädchen und jungen Frauen, wie in diesem Fall, nach Verbüßung ihrer Strafe in ein KZ verbracht. Dies, so zumindest die Justizbeamten vor Ort, halte man nicht für angebracht: „Es ist vor allem nicht jugendgemäß.“198 Doch die Justiz, selbst wenn sie die Verschleppung der Jugendlichen missbilligte, besaß – wie hier – wenig Handhabe, um sie zu verhindern. Jutta Rüdiger predigte nach Kriegsbeginn umso mehr und unermüdlich die Ehr- und Treueverpflichtung der deutschen Mädchen und das stets mit Blick auf die Agrarwirtschaft.199
193 Der K-Leitung des HJ-Gerichts, Gebiet Thüringen, zum Strafbescheid gegen Wolfgang Haaßengier vom 13.10.1944 (NARA, T1021, 581096, 549, Bl. 206). 194 Verhalten gegenüber Polen und Kriegsgefangenen. In: Rundbrief der RJF 35/K vom 5.4.1940; sowie Anordnung A 33/40 des Stellvertreters des Führers, abgedruckt in: Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 8: Allgemeines Verhalten, S. 664–666. 195 Verhalten gegenüber Ausländern und Kriegsgefangenen. In: BB der Mädelführerin Sachsen, 10/42 vom 1.10.1942. 196 Vgl. Urteil mit Urteilsbegründung, Amtsgerichts Radolfzell vom 27.5.1942 (GLA Karlsruhe, Abt. 240, 1987-53, 689, Bl. 191 f.); Sachbericht des Amtsgerichts Radolfzell vom 17.11.1942 (ebd., Bl. 187 f.). 197 Das Amtsgericht Radolfzell über die Einweisung von Jugendlichen in die Konzentra tionslager vom 28.8.1941 (ebd., Bl. 141–143). 198 Ebd. 199 Vgl. Kollmeier, Ordnung und Ausgrenzung, S. 263 f.
Mobilisierung in Permanenz
313
Die Realität geriet immer wieder in Konflikt mit der ideologischen Erwartungshaltung. Im Umland von Leipzig hatte man im Mai 1941 eine Reihe von Fällen festgestellt, bei denen Mädchen „die Gesellschaft von […] Franzosen“ suchten; man wusste auch über ein „intimes Verhältnis mit einem Tschechen“ zu berichten oder davon, dass sich die „untergebrachten polnischen Zivilisten immer wieder um deutsche Frauen bemühten“ und dass „diese Annäherungsversuche […] von der weiblichen Seite aus“ bestätigt würden.200 Die RJF ihrerseits suchte Kontakt mit der Reichsfrauenführung sowie dem Reichsnährstand. Es sollten Arbeitsgemeinschaften gegründet werden, die Hausfrauen und Bäuerinnen im „Jugendschutz“ schulten.201 Auf dem Land trat die Hitlerjugend mit Drohungen und Mahnungen an Mitglieder heran. Im Gau Koblenz-Trier etwa lautete es im April 1943: „In vielen Betrieben und Bauernhöfen haben heute Jungen und Mädel ihre Arbeitsplätze neben Kriegsgefangenen, Ostarbeitern oder ausländischen Zivilarbeitern. So gut die Haltung der Mehrzahl unserer Kameraden und Kameradinnen ist, so traurig und ehrlos ist der ein oder andere Fall, der mir zur Bestrafung gemeldet wurde. […] Wir sehen in jedem polnischen Kriegsgefangenen den Angehörigen einer Mördernation, die an einem Tage zehntausende von deutschen Frauen und Kindern zu Tode gemartert hat.“202 Aufgehetzte HJ-Angehörige wurden häufig übergriffig – etwa wie im April 1943 bei Dessau. Eine Gruppe von 15- bis 17-jährigen Hitlerjungen drang nachts in die Unterkünfte polnischer Arbeiterinnen ein, um die Frauen zu schikanieren und die Räume auf eigene Faust nach versteckten Männern zu durchsuchen. Die örtliche Polizei bemühte sich um Einleitung eines Verfahrens wegen Amtsanmaßung.203 Empathie und Brutalität konnten oft nah beieinander liegen. Am Zeller Blauen im Schwarzwald – ein Beispiel für höchst gegenläufiges Verhalten junger Menschen – mussten polnische Zwangsarbeiter zusammen mit im Rahmen des „Volkssturms“ eingesetzten Hitlerjungen in den letzten Kriegswochen Erdbunker ausheben. Gemeinsam untergebracht, entstand nach und nach ein Vertrauensverhältnis zwischen Jugendlichen und den sogenannten Ostarbeitern. Einige Hitlerjungen ließen die Flucht zweier Polen zu; angeblich hatten sie auf die Fluchtmöglichkeiten eigens hingewiesen. Der befehlshabende HJ-Bannführer Kurt Rahäuser ließ die meisten eingesetzten HJ-Angehörigen entwaffnen. Andere, um deren ideologische Standfestigkeit er wusste, erschossen auf seinen Befehl schließlich mehrere Arbeiter als Akt der Strafe.204 200 Ausländische Arbeitskräfte. Sittliche Gefährdung des weiblichen Geschlechts [Anhang eines nicht zugeordneten Stimmungsberichts des SD Leipzig] vom 3.5.1941 (IWM Duxford, Documents Captain Branney, Digitalisate der Berichte im Archiv des HAIT, unpag.). 201 Vgl. Mädel im land- und hauswirtschaftlichen Einsatz. In: GB: Düsseldorf, 6/42K vom 16.7.1942. 202 Haltung gegenüber Kriegsgefangenen. In: BB: Moselland, 4/43 vom 4.1943. 203 Vgl. Gendarmerieposten Gröbzig, Kreis Dessau Köthen an den Landrat Innere Verwaltung, Köthen vom 22.4.1943 (LHASA, DE, Z 141, 653, Bl. 168). 204 Vgl. Sven Keller, Volksgemeinschaft am Ende. Gesellschaft und Gewalt 1944/45, München 2013, S. 173–175.
314
Massenmobilisierung
Mit den Bauern- und Ernteeinsätzen darf der HJ-Landdienst nicht verwechselt werden. Seine Keimzelle lag in der radikalen völkischen Artamenen-Bewegung, die sich in der Zeit der Weimarer Republik die Gesundung des Volkes durch Arbeit auf dem Acker und einen Kampf gegen die Landflucht auf die Fahnen geschrieben hatte. Als eine der wenigen 1934 in die Hitlerjugend eingegliederten Gruppen war ihren Angehörigen das Tragen des alten Abzeichens – blaues Schild mit Rune und Siebengestirn – gestattet. Der „Vernichtungskrieg“ veränderte den HJ-Landdienst fundamental. Das Jahr 1942 stellte die RJF unter die Parole „Landdienst und Osteinsatz“. In den Bannen wurden Mitarbeiterstellen geschaffen, die sich für „Werbung, Musterung und Einstellung der Jungen und Mädel“ einsetzten.205 Die geworbenen Jugendlichen sollten „das Land bebauen […], das unsere älteren Kameraden als Soldaten heute erobern und mit ihrem Blut erkämpfen“. Auf Lehrhöfen – bei Kriegsende existierten etwa 17 – sollten die BDM-Führerinnen und HJ-Führer zu „deutschen Wehrbauern“ als „Garanten des Reiches“ ausgebildet werden.206 Verschiedene Berufe wie Tierarzt, Fischer, Rechnungsführer, Imker oder Geflügelzüchter könne man auf den Höfen erlernen. Die Mädchen waren z. B. als Kindergärtnerinnen, für die Schulen und den Aufbau landwirtschaftlicher Güter vorgesehen.207 Die Gebiete im Deutschen Reich erhielten bestimmte Regionen im eroberten Osten zugewiesen, für die sie zuständig sein und junge Menschen werben sollten: Düsseldorf beispielsweise, wo man für das Einsatzjahr 1941 immerhin 382 Jugendliche anwerben konnte, schickte die jungen Menschen nach Lask und Litzmannstadt-Land im Warthegau sowie nach Zichenau in Süd-Ostpreußen. Dieser „Osteinsatz“ in den Landdienstlagern dauerte für Schülerinnen und Schüler vier bis sechs Wochen; für junge Frauen nach dem Schulabschluss 12 Monate im Rahmen ihres Pflichtjahrs.208 „Die größte Aufgabe für unsere Mädel“, schrieb die BDM-Reichsreferentin Rüdiger 1942, sei, „das Land im Osten, das uns der Führer durch das Schwert zurückgewann, mit kräftigem deutschen Leben zu erfüllen.“209 Der HJ-Landdienst war ein Teil der rassistischen Germanisierungspolitik. Die jungen Helferinnen und Helfer arbeiteten auf Feldern, die den deutschen „Neubauern“ im besetzten Polen zugeteilt worden waren. „60 [Kilometer] von 205 Bauerntum und Landdienst: Mitarbeiterstellen in den Bannen. In: GB: Wien, 6/42 vom 1.4.1942. 206 Der Landdienst. In: GB: Hochland, 11/43K vom 5.1943. Vgl. auch die Liste im Annex B, „Land-Lager (Farm Service Camps)“. In: SHAEF, Evaluation and Sissemination Section (Hg)., Handbook: The Hitler-Jugend, ohne Seitenangabe. 207 Vgl. Werbung für den Landdienst der Hitler-Jugend. In: BB: Mainfranken, 2/41 vom 11.1941. Vgl. im Zusammenhang Osteinsatz des BDM, 1942. In: Miller-Kipp (Hg.), „Auch Du gehörst dem Führer“, S. 214. 208 Vgl. Osteinsatz. In: Gebietsbefehl: Düsseldorf, 2/42K vom 16.3.1942; vgl. auch Bauerntum und Landdienst. In: ebd., Sonderbefehl: Düsseldorf: Landdienstwerbung für das Einsatzjahr 1942/43, 53K vom 7.10.1941. 209 Jutta Rüdiger, Osteinsatz des BDM. In: Das Junge Deutschland, (1942) 36, hier zit. nach Miller-Kipp (Hg.), „Auch Du gehörst dem Führer“, S. 214.
Mobilisierung in Permanenz
315
Posen entfernt liegt unser Dorf“, schrieb ein Mädchen 1941 in einem Brief in die Heimat: „23 deutsche Umsiedler und 48 Polakenfamilien wohnen hier. Inmitten der Bauernhäuser steht die ehemalige polnische Schule, welche unser Quartier ist.“210 Junge Menschen wurden in die Vertreibungen der einheimischen polnischen Bevölkerung involviert. Das BDM-Mädel Inge Volkmer schrieb aus dem Lager „Kalivsland“ in ihre Heimat, dass sie zusammen mit der SS in der Nacht die Polen vertreiben würden: „Uns fällt nachher die Aufgabe zu, die Häuser zu säubern und die Wirtschaften so lange zu versorgen, bis die Siedler kommen.“211 Reichsjugendführer Axmann verkündete 1943, dass für den kurzfristigen Landdiensteinsatz etwa 18 000 Jugendliche mobilisiert, zudem 300 Wohnheime und Lager errichtet worden seien. Insgesamt 30 000 junge Menschen hätten sich für den HJ-Landdienst gemeldet; ein Beweis dafür, dass es möglich sei, „die gesunde Stadtjugend wieder sesshaft zu machen und mit dem Boden zu verbinden“.212 Nur ein Bruchteil war tatsächlich im Osten eingesetzt. Hinter den enormen Zahlen stand ein gewaltiger propagandistischer Kraftakt. Für ihre Gebietsführungen gab die RJF jedes Jahr Kontingente vor. Die Mindestzahlen für Teilnehmer wurden sukzessive und teils drastisch erhöht, was mit aggressiven Kampagnen und steigendem Druck auf Jugendliche und deren Eltern einherging.213 Im Raum Koblenz zeigte sich die Führung Anfang 1941 gleichwohl enttäuscht: „Obwohl allen Führern Werbebroschüren und Handzettel zugegangen sind, konnte bisher kein Erfolg festgestellt werden.“214 Probleme entstanden zudem bei der Einrichtung von Lehrhöfen für potenzielle Landdienstführerinnen und -führer. Das Gebiet Baden war 1942/43 „aufgrund verschiedener Schwierigkeiten“, wie man vage angab, außerstande, ein Ausbildungslager in Betrieb zu nehmen.215 Junge Freiwillige mussten auf andere Höfe verteilt werden. Dort wiederum zeigte man sich über die Auszubildenden in vielen Fällen recht dankbar. Ein Landdienstlehrhof in Otterbach beispielsweise gab an, dass sich die freien Plätze „aus den eigenen Reihen […] noch nicht voll andfrauenschule in belegen“ ließen.216 Der BDM in Düsseldorf warb für die L 210 Brief von Annemarie an Siegfried B. vom 4.7.1941, Album 3: Lebenserinnerungen (Nachlass von Siegfried B. als Digitalisat im Archiv des HAIT). 211 Landdienst der Hitlerjugend. In: Jugend und Bauerntum. Führerblätter des sächsischen Landdienstes, (1943) 3, S. 10. 212 Ein Tatbekenntnis der Jugend im Osten. Neujahrsbotschaft des Reichsjugendführers. Leistungen des Landdienstes. In: Litzmannstädter Zeitung vom 2.1.1943. 213 Vgl. Landdienstwerbung. In: Gebietsbefehl: Wien, 4/43 vom 1.4.1943: „Das Werbekontingent für Landdienstfreiwillige wurde Seitens der Reichsjugendführung für das Gebiet Wien bedeutend erhöht. Es ist daher notwendig, dass sich auch die Banne in die Werbearbeit für den Landdienst […] einschalten. Bei Dienstbesprechungen, Elternabenden und Heimabenden soll die Werbung für den Landdienst einsetzen. Bisher wurde auf die Kontingentstellung seitens der Banne für den Landdienst […] verzichtet.“ 214 Werbung für den Landdienst der HJ. In: GB: Koblenz-Trier, K2/41 vom 1.2.1941. 215 Landdienstlehrhof des Gebietes Baden. In: GB: Baden, 31/K vom 18.5.1942. 216 Auswahl der Führeranwärter(innen) für den Landdienstlehrhof Otterbach, Ausbildungsjahr 1943/44. In: GB: Oberdonau, Sonderdruck VIII/42: Landdienstwerbung für das Einsatzjahr 1943/44 vom 1.11.1942.
316
Massenmobilisierung
Tiefenthal am Rhein; dort „seien noch einige Plätze frei“.217 Bei Leipzig musste ein Lager, das für das Pflichtjahr der Mädchen vorgesehen war, Anfang 1940 aufgelöst werden. Zu wenig Frauen hatten sich gemeldet. Die Stimmung der ansässigen Bauern gegenüber dem Lager sei schlecht, erläuterte der SD.218 Ausreichend ausgebildete Freiwillige für den Landdienst standen aus Sicht der Hitlerjugendfunktionäre nie zur Verfügung.219 In Sachsen legte man 1942 offen: „Die von der Reichsjugendführung gestellten Kontingente liegen […] höher als im vergangenen Jahr, sodass dadurch ein erhöhter Werbeeinsatz nötig ist. Dies trifft vor allem auf das Jungenkontingent zu, da dieses im letzten Jahr nicht erfüllt werden konnte.“220 Zahlen bezüglich der Freiwilligen, die sich für den Landdienst oder die Erntehilfen gemeldet hatten, wurden Ende desselben Jahres gesperrt und deren Veröffentlichung verboten.221 Mit dem Vorrücken der Roten Armee sackte der Landdienst naturgemäß in sich zusammen. Bei Kriegsende stand man wieder am Anfang: bei einem Hilfsdienst in der heimischen Landwirtschaft. Die Hitlerjugend betonte, dass „wegen Heranziehung aller Männer zum Volkssturm“ die Agrarwirtschaft mittlerweile am Boden lag. Noch im März 1945, von der Niederlange unbekümmert, wollte die Staatsjugend weitere Freiwillige rekrutieren.222 Vom „Neubauerntum“ im Osten konnten nicht einmal die Verblendetsten zu diesem Zeitpunkt noch träumen. Eingebrannt in das kollektive Gedächtnis hat sich aber vor allem der Einsatz Jugendlicher im Luftschutz. Seit 1942 wurden Schüler ab 15 Jahren auf Basis der Notdienstverordnung klassenweise zur Abwehr alliierter Fliegerangriffe massenhaft eingezogen. Gemeinhin ist von einer „Generation der Flakhelfer“ die Rede gewesen. Ab Dezember 1944 sollten auch junge Frauen von 18 bis 21 Jahren eingesetzt werden. Insgesamt 135 000 Luftwaffenhelferinnen wollte das Regime bis Mitte Januar 1945 in Kontingenten heranziehen.223 Die Flakhelfer galten rechtlich als Angehörige der Luftwaffe. Im September 1943 hatte die RJF durchgesetzt, dass sie offiziell als „Luftwaffenhelfer (HJ)“ bezeichnet werden mussten. Man beharrte umso mehr auf die Bezeichnung, weil die HJ ihren Einfluss wiederum nur scheinbar behauptete. Die Flakhelfer trugen zwar die HJ-Armbinde und wiesen sich während und außerhalb des Dienstes mit Papie-
217 Landfrauenschule Tiefenthal. In: GB: Düsseldorf, 2/42K vom 16.3.1942. 218 Bericht der Außenstelle Oschatz des SD-Abschnitts Leipzig vom 31.1.1940 (IWM Duxford, Documents Captain Branney, Digitalisate im Archiv des HAIT, unpag.); siehe auch ähnlich gelagerten Bericht des SD-Abschnitts Leipzig vom 26.8.1941 (ebd.). 219 Vgl. umfassender Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 721–739. 220 Werbung für das Landdiensteinsatzjahr 1943/44. In: GB: Sachsen, 5/42 vom 13.7.1942. 221 Vgl. Zahlenangaben in Presseveröffentlichungen. In: GB: Düsseldorf 9/42 vom 10.11.1942. 222 Landdienst der Hitlerjugend. In: GB: Baden-Elsass, 1/45K vom 1.3.1945. 223 Vgl. BDM-Reichsreferentin Jutta Rüdiger an die Mädelführerinnen der Gebiete, betrifft: Luftwaffenhelferinnen (1944). In: Miller-Kipp (Hg.), „Auch Du gehörst dem Führer“, S. 33 f.
Mobilisierung in Permanenz
317
ren der Hitlerjugend aus.224 Der Flakeinsatz sowie der Kasernenalltag unterlagen jedoch dem Kommando der Militärs. Die Jugendlichen fühlten sich als Soldaten und wollten vielfach als solche gesehen und auch behandelt werden. Verweigerung gegenüber dem regulären HJ-Dienst – dort, wo er noch stattfand – war häufig. Manche stellten sich sogar offen gegen ihre HJ-Führer.225 Die Staatsjugend ihrerseits gab teilweise den Anspruch auf Führung bereitwillig preis: „Die Freizeitgestaltung der Jungen und ihre […] Betreuung durch die HJ ist gleich Null“, urteilte der SD Koblenz im Mai 1944: „Die HJ kümmert sich so gut wie gar nicht um die Luftwaffenhelfer.“226 Ehemalige Flakhelfer betonten in erstaunlicher Zahl, dass sie der Staatsjugend mit Missbilligung gegenübergestanden hätten. Beispielsweise Friedrich Hütte, geboren 1927 in Paderborn, der jenen Zynismus beschrieb, den Luftwaffenhelfer gegenüber ihrer Organisation häufig an den Tag gelegt hätten: „Eines Tages tauchte ein HJ-Führer in unserer Flakstellung auf und wollte mit uns HJ-Dienst machen. Wir erklärten ihm, er möge nachts, wenn wir an den Geschützen Feuerbereitschaft hatten, wiederkommen und dann HJ-Dienst machen. Wir haben den HJ-Führer nicht wiedergesehen.“227 In einem der wichtigsten DDR-Jugendromane – „Die Abenteuer des Werner Holt“ von Dieter Noll, 1964 mit autobiografischen Elementen erschienen – spielt ein junger Flakhelfer die Hauptrolle. Zum HJ-Dienst geht der junge Mann längst nicht mehr. Die Androhung von Dienstpflicht und Jugendarrest schwebt zwar immer, jedoch nur vage im Raum. Über die örtliche HJ-Bannführung macht man sich unter den Kameraden lustig. Noll ließ seinen Protagonisten, der einem verruchten Mädchen imponieren will, erzählen, dass er sich für die HJ seit Langem nicht mehr interessiere. Freilich bleibt der Luftwaffenhelfer fast bis zum Schluss seiner Illusion vom heldenhaften Krieg erlegen.228 Rolf Schörken, ein weiterer ehemaliger Flakhelfer, entwickelte aus solchen und ähnlichen Berichten, wie auch persönlicher Erfahrung, eine historiografische These. Die Flakhelfer hätten sich weniger über die HJ-Mitgliedschaft definiert, meinte Schörken, sondern ihr eigentlicher Bezugspunkt sei das Militär gewesen. Die Hitlerjugend habe an Legitimität und Einfluss – auch ideologisch – derart verloren, dass die eingesetzten Männer nach 1945 vergleichsweise schnell alte politisch-ideologische Überzeugungen hätten abstreifen können.229 224 Vgl. Luftwaffenhelfer der Hitlerjugend. In: Rundschreiben des Gebietes Niedersachsen, 19/43 vom 18.6.1943: „Es ist bei allen Berichten, Aufsätzen, Reden usw. darauf zu achten, dass nicht von Luftwaffenhelfern, sondern nur von Luftwaffenhelfern der Hitler-Jugend gesprochen wird.“ 225 Vgl. auch Schmidt, Hamburger Schulen, S. 447. 226 Bericht des SD-Abschnitts Koblenz vom 22.5.1944. In: Brommer (Hg.), Die Partei hört mit, Band 2, S. 676–682, hier 679. 227 Aussage von Friedrich Hütte. In: Gehling/Gehling/Hofmann/Nickel/Rüther (Hg.), Paderborner Zeitzeugen, S. 68. 228 Dieter Noll, Die Abenteuer des Werner Holt, Berlin 1973, S. 26 und 68. 229 Vgl. beispielhaft das Interview mit Rolf Schörken. In: Thomas Sandkühler (Hg.), Historisches Lernen denken. Gespräche mit Geschichtsdidaktikern der Jahrgänge 1928–1947. Mit einer Dokumentation zum Historikertag 1976, Göttingen 2014, S. 37–60, hier
318
Massenmobilisierung
Die These erfüllte die Funktion einer generationellen Entlastung. Distanz bleibt geboten. Schörken zeigte jedoch die Problematik zutreffend auf, mit der die Hitlerjugend zu tun hatte: Ihre Werbekraft ließ mehr und mehr nach, weil sie junge Menschen in Dienst stellte, ohne zugleich attraktive Angebote weiter aufrechterhalten zu können. Die HJ war durch die Inanspruchnahme seitens Partei und Wehrmacht im Besonderen getroffen. Das Jungvolk und der JMB als Gliederungen für die Jüngeren änderten ihren Charakter nach 1939 ebenfalls gravierend. Selbst die Kinder sollten als Hilfskräfte eingesetzt werden, sogar für den Luftschutz. Zu den „zehn Geboten über luftschutzmäßiges Verhalten“ zählte das Bergen abgeworfener Feindpropaganda, die Schulung der Bevölkerung im Umgang mit der Volksgasmaske oder die Unterstützung des Luftschutzwartes der Partei.230 Jungen und Mädchen bis 14 Jahren wurden zu kleinen Sanitätern ausgebildet. Im Dienst musste ab 1943 die Behandlung von Brandwunden, Verletzungen, Schlagaderblutungen, Vergiftungen und Knochenbrüche thematisiert werden.231 Im Rahmen von Dienstappellen fanden Kurse zur Unterweisung im Luftschutz statt. Jungen ab 13 Jahren sowie 13- bis 21-jährige Mädchen sollten zu Pflichtdienst von je zwei Doppelstunden antreten: Bekämpfung von Brandbomben, Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie der Umgang mit Gasmasken waren Schulungsthemen.232 Regulärer Dienst fand demgegenüber kaum statt, auch das Sportprogramm schrumpfte weiter zusammen. Dafür nahm vor allem in den Großstädten die Zahl der Hilfseinsätze zu. Bannführer und Gauführerinnen gehörten den Befehlsstäben der NSDAP-Kreisleiter an. Dort entschied man spontan, wie und wo Jungen und Mädchen eingesetzt werden sollten. Bedarf sah man in den letzten zwei Kriegsjahren überall: bei Nachrichtendiensten, für den Einsatz in Verpflegungsstellen oder beim Abtransport von Möbeln im Zuge von Evakuierungen und Aufräumarbeiten. Besonders die Löscheinsätze nach Bombenabwurf waren lebensgefährlich. Anders als die HJ-Feuerwehrscharen, die wenigstens fachlich einigermaßen geschult wurden, besaßen die neu aufgestellten HJ-Einsatzgruppen – gebildet aus je 10 Jungen ab 14 Jahren – keine vorbereitende Ausbildung. Diese willkürlich zusammengewürfelten Gruppen waren ein Produkt der Not: „Die Großangriffe haben gezeigt, dass die Feuerschutzpolizei mit der Bekämpfung der Großbrände und der kriegswichtigen Industrie in erster Linie beschäftigt ist. Die Kräfte des Selbstschutzes wiederum werden zur Bekämpfung der kleinen Brände (Häuser- und Dachstuhlbrände)
S. 38 f.; vgl. auch Rolf Schörken, Luftwaffenhelfer und Drittes Reich. Die Entstehung eines politischen Bewusstseins, Stuttgart 1983; ders., Die Niederlage als Generationserfahrung. Jugendliche nach dem Zusammenbruch der NS-Herrschaft, Weinheim 2004. 230 Luftschutzmerkblatt für die Hitlerjugend. In: GB: Wien, 9/43 vom 1.9.1943. 231 Vgl. Merkblatt für die Erste Hilfe bei Luftangriffen. In: ebd. 232 Vgl. Luftschutzunterweisung der Hitler-Jugend als Dienstappell. In: GB: Oberschlesien, K 4/44, Sonderbefehl: Einsatz der Hitler-Jugend bei Luftangriffen vom 5.3.1944; Luftschutz-Unterweisung für 13–14jährige Pimpfe. In: GB: Mark Brandenburg, 1/43K vom 1.2.1943.
Mobilisierung in Permanenz
319
nicht ausreichen. Daher ist der Beteiligung von Feuerlöschgruppen der HJ, denen die Bezeichnung ‚Hitler-Jugend-Stoßtrupp‘ zuzulegen ist, besondere Beachtung zu schenken.“233 Die erweiterte KLV muss abschließend noch erwähnt sein; auch dies ein Arbeitsfeld der Hitlerjugend, das ein eigenes Buch füllen kann und andere Studien beschäftigt hat. Bei der Kinderlandverschickung handelte es sich ursprünglich um ein Urlaubs- und Erholungsprogramm bei Pflegefamilien auf freiwilliger Basis, für das die Parteijugend in den 1930er-Jahren zu werben geholfen hatte.234 Die Hitlerjugend organisierte die KLV ab 1941 gemeinsam mit der NSV und dem Bildungsministerium. Verschickung hieß jetzt aber euphemistisch die gewaltige Evakuierung von Schülerinnen und Schülern aus Großstädten aufgrund der Bombardierungen und der schlechten Versorgungslage. Schirach, der Beauftragte für die KLV, richtete eine Reichsdienststelle ein, die der RJF angebunden war; Stabsleiter Helmut Möckel als Vertreter Schirachs hielt die organisatorischen Fäden in der Hand.235 Die KLV wurde – wie in den 1930er-Jahren – weiterhin als ein Ferienvergnügen inszeniert. Klassen und ganze Schulen wurden aus urbanen Zentren in die weniger luftkriegsgefährdeten Gebiete gebracht – meist also in ländliche Regionen nach Mittel-, Süd- und Ostdeutschland. Die Teilnahme sollte, hieß es zumindest, freiwillig sein. Doch das war mehr eine hohle Phrase. Kinder, die sich nicht beteiligten, konnten in großer Zahl keinen Unterricht erhalten, weil ihre Klassen geschlossen verschickt worden waren. Teils drohte man den Daheimgebliebenen – wie für Dortmund belegt – sogar mit dem Entzug von Lebensmittelkarten.236 Familien mussten sich für die KLV in den Hitlerjugenddienststellen anmelden. In der Ruinenstadt Köln versprach der Gebietsführer Anfang 1944: „Ihr werdet diesen Schritt niemals bereuen, denn die Zeit in der KLV wird die schönste Eures Lebens sein.“237 Noch im Jahr 1992 blickte die ehemalige BDM-Reichsreferentin Rüdiger mit apologetischer Absicht und ähnlichem Tenor auf die Evakuierungen zurück: „Im Sommer 1941 habe ich Mädel aus Norddeutschland in einem KLV-Lager am Wolfgangsee besucht, deren Eltern ihnen niemals einen Aufenthalt in so schöner Natur hätten 233 Feuerlöschgruppen. In: ebd. 234 Unter Verteilung der Gebietsbefehle. In: GB: Westmark, 4/37 vom 1.4.1937, wurde der „geringe Erfolg“ bei der Werbung für die KLV auf schlechte Kommunikation in den eigenen Dienststellen zurückgeführt; wahrscheinlicher dürfte es fehlendes Interesse seitens der Elternhäuser gewesen sein. Unter Freistellenwerbung für die Kinderlandverschickung. In: ebd., A6/37 vom 1.5.1937, hieß es: Im Gebiet seien durch „die HJ nur 18,5 v. H. [von Hundert] und [durch] das Jungvolk sogar nur 7,6 v. H. der zu werbenden Stellen“ tatsächlich eingeworben worden. 235 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 2, S. 889. 236 Vgl. Max Liedtke, Einleitung. In: ders. (Hg.), Für Hitler erzogen? Briefe und Notizen des Edgar Winzen aus der Kinderlandverschickung Leutenberg/Thüringen 1944/45, Münster 1999, S. 7–23, hier 16. Vgl. im Zusammenhang zum Thema Katja Klee, Im „Luftschutzkeller des Dritten Reiches“. Evakuierte in Bayern 1939–1953: Politik, soziale Lage, Erfahrungen, München 1999, S. 37–43. 237 Der K-Führer des Gebietes, Pimpfe und Jungmädel des Gebietes Köln-Aachen. In: BB: Köln-Aachen, 1/44 vom 3.1944.
320
Massenmobilisierung
bieten können.“238 Die Forschung geht heute von Teilnehmerzahlen um die ein bis zwei Millionen aus. Nur für wenige Großstädte liegen jedoch verlässliche Zahlen vor. Von rund 43 000 Schulkindern in Düsseldorf waren im Juni 1944 etwa acht Prozent in der KLV, weitere 43 Prozent anderweitig aufs Land verschickt, 45 Prozent waren geblieben.239 Aus Essen hatte man im selben Zeitraum 30 000 Kinder verschickt, rund 60 000 Kinder waren anderweitig bei ihren eigenen Verwandten untergebracht worden. Die Zurückgebliebenen erhielten meist keinen Unterricht, weil Schulen geschlossen waren.240 Untergebracht wurde das Gros der Kinder und Jugendlichen, die über die KLV verschickt wurden, bei Gastfamilien, welche die NSV vermittelte, oder – allerdings nur bei Kindern im Alter ab zehn Jahren – in Lagern, welche die Hitlerjugend organisierte. Zu diesem Zweck wurden oft Quartiere oder Güter – zum Unmut der Eigentümer – beschlagnahmt.241 Die Verschickung sollte in der Regel ein halbes Jahr dauern. In KLV-Lagern hatten sogenannte Mannschaftsführer bzw. -führerinnen, die sich aus HJ und BDM rekrutierten, das Sagen. Aus der Lehrerschaft kamen die Lagerleiter, welche die Versorgung und Verwaltung übernahmen. Die jungen Führungskräfte der Lager wurden in zehntägigen Schnellkursen auf ihren Einsatz vorbereitet. Eigens geschaffene „Reichsschulen-KLV“ befanden sich in Harrasdorf im Riesengebirge, Bad Podiebrad nahe Prag und bei Steinau an der Oder. Meist wurden diese Mannschaftsführer von den Hitlerjugenddienststellen und den Schulleitungen direkt aus den Klassenzimmern rekrutiert.242 „Mir ist bis heute noch nicht klar, nach welchen Kriterien wir ausgewählt wurden“, blickte Hans Josef Horchem zurück. Einen Rang in der HJ hatte er nie inne gehabt.243 Weil es der Staatsjugend mehr und mehr an jungem Personal fehlte, war tatsächlich nicht mehr ausschlaggebend, ob sich die Jugendlichen in der Organisation bereits mit besonderem Engagement hervorgetan hatten. Entscheidend war, ob die Lehrer oder Lehrerinnen eine Empfehlung aussprachen. Von der Idee, fern der Heimat als Mannschaftsführer in einem Lager zu arbeiten, waren nicht alle begeistert. Von den 14 Teilnehmern einer Schulung in Steinau, hob Horchem hervor, seien am Ende nur acht verwendet worden; der Rest hatte sich krankschreiben lassen.244 Die KLV-Lager
238 Rüdiger, Ein Leben für die Jugend, S. 101. 239 Vgl. Bericht des Schulverwaltungsamtes über die KLV, 1944 (StadtA Düsseldorf, XXIII, 535). In: Pädagogisches Institut Düsseldorf (Hg.), Dokumentation, S. 346–351, hier 349; vgl. abweichende Zahlenangaben zu Düsseldorf bei Liedtke, Einleitung, S. 16. 240 Bericht des Schulamtes Essen über den Stand der KLV, undatiert. In: Gerhard Dabel, KLV. Die erweiterte Kinder-Land-Verschickung. KLV-Lager 1940–1945. Dokumentation über den „Größten Soziologischen Versuch aller Zeiten“, Freiburg i. Brsg., 1981, S. 197. 241 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 891; Klee, Im „Luftschutzkeller des Dritten Reiches“, S. 68. 242 Vgl. Führerinnen für KLV-Lager. In: BB: Obergau Sudetenland, 2/41 vom 11.1941. Vgl. auch Michael, Schule und Erziehung im Griff des totalitären Staates, S. 10–19. 243 Horchem, Kinder im Krieg, S. 130. 244 Vgl. ebd., S. 132.
Mobilisierung in Permanenz
321
scheinen zu den wenigen Arbeitsfeldern zu gehören, bei denen die Hitlerjugend keinen deutlichen Einflussverlust gegenüber anderen Institutionen verbuchen musste. Denn in KLV-Lagern waren Kinder ihrem Zugriff nahezu vollständig ausgeliefert. Regelrecht militärische Pläne regelten den gesamten Tagesablauf, vom Fahnenappell am Morgen über das Mittag- und Abendessen bis zu den Schulstunden, begleitet von Drill. In den KLV-Lagern griff damit die Jugenddienstpflicht umfänglich. Der spätere Politiker Alfred Preußner erinnerte sich an seine sechsmonatige KLV-Zeit ebenso wie viele andere wohlwollend zurück.245 Die Situation in den Lagern beispielsweise in Bezug auf Religionsausübung, HJ-Dienst, Drangsalierungen, sanitäre Anlagen oder die Versorgungslage konnte aber von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Die negativ gefärbten Erinnerungsberichte stehen den positiven gegenüber.246 Horchem, der 1942 im Schwarzwald eingesetzt worden war, berichtete Jahrzehnte später, das Heimweh der Kinder habe sich durch Bettnässen bemerkbar gemacht. Jungen aus vermeintlich „sozialproblematischen“ Vierteln Kölns seien vielfach jähzornig geworden, während der Leiter Paul Muders, zuvor der Direktor einer Anstalt für schwererziehbare Jungen, sein Lager mit harter Hand regiert habe.247 Die Kinder und Jugendlichen trugen ihre mitunter negativen Erfahrungen nach dem Ende der Aktion den Eltern und Freunden zu. Zwar als großes Ferienvergnügen inszeniert, war die KLV weder in Städten, aus denen die Kinder verschickt wurden, noch in den Aufnahmeregionen durchweg beliebt. Viele Lehrkräfte beteiligten sich kaum mit Enthusiasmus, meist nur, weil sie dazu abkommandiert worden waren.248 Über die KLV in Leipzig lautete es 1944: „Während anfangs unter dem Druck der Terrorangriffe die Eltern verhältnismäßig willig mitgegangen sind, haben sie im Laufe des Jahres eine immer stärkere Zurückhaltung gezeigt. Trotz Aufklärung und planmäßiger Werbung durch Schulleiter, Lehrerschaft und Hitler-Jugend hält die rückläufige Bewegung an.“249 Möglicherweise ist dies auf die mitunter schwierigen Zustände in 245 Vgl. Alfred Preußner, Erfolg ist nicht ohne Schatten, Norderstedt 2008, S. 32–45. 246 Diverse und zum Teil unterschiedliche Berichte gesammelt bei Dabel, KLV, besonders S. 132–142 und 169–174; Thomas Gießmann/Rudolf Marcianiak, „Fast sämtliche Kinder sind jetzt weg.“ Quellen und Zeitzeugenberichte zur Kinderlandverschickung aus Rheine 1941–1945, Münster 2001. Vgl. auch den Bericht von Wolfgang Brezinka, Vom Erziehen zur Kritik der Pädagogik. Erfahrungen aus Deutschland und Österreich, Wien 2019, S. 33 f. und 38 f. über ein KLV-Lager in Oberschlesien, in dem er im Alter von 14 Jahren – weil es an Personal mangelte – als Lagermannschaftsführer eingesetzt wurde sowie über ein Lager in Kärnten mit „verwahrlosten“ Jungen, die Einbrüche im Umland begingen. 247 Vgl. Horchem, Kinder im Krieg, S. 135–141. 248 Vgl. Katja Klee, „Nie wieder Aufnahme von Kindern“. Anspruch und Wirklichkeit der KLV in den Aufnahmegauen. In: Martin Rüther (Hg.), „Zu Hause könnten sie es nicht schöner haben!“. Kinderlandverschickung aus Köln und Umgebung 1941–1945, Köln 2000, S. 161–209. Vgl. kritische Einschätzungen zur KLV bei Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 896–905. 249 „Männer des Rates der Reichsmessestadt! Arbeitskameraden!“, o. D. (StadtA Leipzig, Kap 6, 68, Bd. 11, Bl. 36 f.).
322
Massenmobilisierung
den Lagern oder in den Gastfamilien zurückführen. Ein Bannpropagandaleiter sprach in einem Inspektionsbericht über acht KLV-Lager der Wiener Hitlerjugend Anfang 1945 Probleme an. Ein HJ-Mannschaftsführer sei ohne Führereignung, hieß es da, und werde von den ihm unterstellten Jungen „überspielt“. Es gebe noch keine Beleuchtung in der Dunkelheit, die Kontrolle der Kinder falle der Lagerleitung schwer. Leichte Erkrankungen würden sich ausbreiten und die Zähne der Kinder faulen. Im Großen und Ganzen sei die Lage dennoch befriedigend. Ein KLV-Lager habe man allerdings schließen müssen.250 Ein Erfolg war die KLV für die Hitlerjugend nur bedingt. Mancherorts konnten die Lager unter der Ägide der Staatsjugend nicht eingerichtet werden, weil – wie für Göttingen belegt – Kommunen überfordert waren. Über die NSV wurden Kinder und Jugendliche daher in wachsender Zahl nicht in Lager gebracht, sondern an Gastfamilien vermittelt. Ein erheblicher Teil der KLV führte somit nicht in die Hitlerjugendlager, sondern in die Familienbetreuung entweder privat oder eben vermittelt über die NSV. Ein Beispiel: Von rund 260 000 evakuierten Volks-, Mittel- und Hauptschülern aus Berlin waren im September 1943 nur 32 000 über die NSV oder die Hitlerjugend verschickt. Der Großteil war also bei Verwandten untergebracht. Etwa 85 000 Schulkinder waren geblieben. Bei rund 65 000 Fällen hatten die Eltern eine Verschickung in Gänze verweigert.251 In den Lagern befand sich nur der kleinste Teil der Evakuierten. Gerade Kinder, die bei Verwandten oder in KLV-Gastfamilien untergebracht waren, ließen sich für die Jugendorganisation noch schwer erreichen.252 Das Heimweh griff natürlich bei dieser Art der Unterbringung ebenfalls um sich. Durch „unvernünftige Schreibereien“ der Eltern, meinte der SD bei Leipzig 1941, würden die Kinder schwer belastet. Ihr brieflicher Kontakt zu den Eltern solle daher nach Möglichkeit unterbunden werden. Die Lageberichte machten viele weitere Problembereiche zum Thema: Bauern, die sich der NSV als Gasteltern zur Verfügung gestellt hatten, würden die Kinder oft als kostenlose Arbeitskräfte missbrauchen. Und die Jugendlichen aus den Großstädten verhielten sich gegenüber der Landbevölkerung in vielen Fällen arrogant. Angeblich waren viele Jugendliche wie „Schmarotzer im Gastgau“ unterwegs.253 Auch Diebstähle seien gehäuft aufgetreten, hieß es im Bezirk Döbeln Mitte 1941. Die 1 650 Kinder aus angeblich verrufenen Kölner Stadtteilen seien ein enormes Problem, weshalb die Gasteltern ohne Rücksprache mit der KLV versucht
250 Auszüge aus einem Inspektionsbericht über den Besuch von acht Lagern der Wiener Kinderlandverschickung durch den Propagandaleiter des Kreises X und Bannstellenleiter des Bannes 509. In: Die Jugendlage. Berichte über die Jugend im Reichsgau Wien, (1945) 3, S. 6 f. 251 Vgl. Aufstellung nach Laurenz Demps (Hg.), Luftangriffe auf Berlin. Die Berichte der Hauptluftschutzstelle 1940–1945, Berlin 2012, S. 79 f. 252 Vgl. Michael, Schule und Erziehung im Griff des totalitären Staates, S. 163. 253 Bericht der Außenstelle Oschatz des SD-Abschnitts Leipzigs vom 19.8.1941 (IWM Duxford, Documents Captain Branney, Digitalisate im Archiv des HAIT, unpag.).
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
323
hätten, die Kinder wieder loszuwerden.254 Ein gravierendes Problem tat sich durch die KLV für die großstädtische Hitlerjugend auf, weil sie ihre prekäre Situation zusätzlich verstärkte. Mit den Evakuierungen wurden nämlich junge Unterführer aus den Städten abgezogen, wodurch in Ballungsgebieten weiteres Personal an der Hitlerjugendbasis fehlte. Im Besonderen traf dies für Köln, Hamburg und Berlin zu – im Übrigen genau jene Orte, wo subkulturelle Jugendmilieus während des Krieges an Stärke hinzugewannen. Für Jugendliche taten sich damit in den Großstädten und urbanen Zentren plötzlich ungeahnte Freiräume zur Entfaltung auf.
2.
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
2.1
Gegenkulturen, Unangepasste, Widerständler
Die Historiografie zur Hitlerjugend und ihren Mitgliedern hat meist mit drei Idealtypen operiert. Die erste Gruppe ist die der euphorisch Beteiligten. Sie haben die propagierten Ideale internalisiert und glauben an das System mit Inbrunst. Sie sind gewissermaßen die Verkörperung der nationalsozialistischen Propaganda. Zur zweiten Gruppe wird die Masse der mitlaufenden „Durchmogler“ gerechnet, deren Verhältnis zur Organisation von Eigeninteressen bestimmt ist. Viele hätten, konstatierte Rolf Schörken, in der Zeit der Diktatur eine „unauffällige Normalität“ gelebt; womit keiner Verharmlosung das Wort geredet sei, da „das Schreckliche […] nebenbei geschehen konnte“.255 Junge Menschen lavierten sich durch den Dienst, traten weder kritisch in Erscheinung noch zeigten sie sich als ausgesprochen fanatisch. „Dann kam die Zeit, in der alle Jugendlichen in der ‚HJ‘ sein mussten“, so ein ehemaliger Unterführer: „Ich wurde Scharführer und bekam eine Schar von Unlustigen – 36 Rabauken, die entweder nicht zum Dienst kamen, oder mit beiden Händen in der Hosentasche und einer Zigarette schief und provozierend im Mund.“256 Manche der „Durchmogler“ taten nur das Nötigste und standen zu Ideal und Anspruch im prekären Verhältnis. Der dritte Idealtyp tritt im Grunde erst mit der Einführung der Jugenddienstpflicht ab 1939 und durch die Zwangserfassung hinzu. Diese Gruppe verweigerte und entzog sich bewusst. Junge Menschen lehnten den Alltag in der Staatsjugend vehement ab und teils begannen sie auch, die Hitlerjugend aktiv zu bekämpfen.257 Für wie groß die jeweilige Gruppe gehalten wird, hängt nicht
254 Vgl. Bericht über die Erweiterte Kinderlandverschickung, SD-Abschnitt Leipzig vom 19.8.1941 (ebd.). 255 Rolf Schörken, Jugend 1945. Politisches Denken und Lebensgeschichte, Frankfurt a. M. 1994, S. 22. 256 Walter Diesing, Mit Zuversicht durch Dick und Dünn, Norderstedt 2010, S. 28. 257 Vgl. Benecke, Soziale Ungleichheit und Hitler-Jugend, S. 229 f.
324
Massenmobilisierung
nur von der historischen Entwicklungsphase ab, ob sie im Jahr 1933 oder in der Kriegszeit betrachtet wird, sondern auch von den Prämissen der Forschenden. Verallgemeinernd ließe sich der historiografische Tenor wie folgt fassen: Verweigerung, Ablehnung und Auflehnung waren unter den älteren Jahrgängen, nicht bei „Pimpfen“ und Jungmädeln anzutreffen. Widerstand betrieb nur eine Minderheit, die aber – aus Sicht jener, die sich mit diesen Gruppen befassen – nicht marginal gewesen sei. Mädchen und jungen Frauen fiel es im Regelfall leichter, die Ideale der Hitlerjugend anzunehmen. Verweigerung sei im BDM wenig verbreitet gewesen, glauben Studien – ohne zu berücksichtigen, dass der Unterschied eher im niedrigeren Grad der Verfolgung und Sanktionierung lag. Die Widerstandsforschung hat ihre eigenen Idealtypen, zudem ein Portfolio verschiedener Begriffe, die der Binnendifferenzierung widerständigen Verhaltens dienen.258 Grob zusammengefasst sind vier Stufen zu unterscheiden: Unten rangiert das abweichende Verhalten, das durch staatliche Sanktion zwar bedroht ist, meist allerdings im Privaten, nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Ein politischer Witz, den man äußert, ohne deshalb gezielt Systemkritik zu betreiben. Freilich konnte selbst ein Witz mit staatlicher Sanktion einhergehen.259 Die Verweigerung ist mehr, weil sie öffentlich vollzogen und reflektiert wird. Individuen oder Gruppen verweigern sich dem Staat, indem sie gegen dessen Maß- und Vorgaben verstoßen, weshalb sie verfolgt, sanktioniert und belangt werden. Der 18-jährige Franz G. aus Wien ist ein solcher Fall. Als er im Juni 1942 polizeilich vorgeladen wurde, antwortete er „in frechster Weise, er besuche den Hitler-Jugend-Dienst wegen Interesselosigkeit nicht und […] es sei ihm gleichgültig, wenn er aus der Gemeinschaft […] ausscheiden müsste“.260 Über die Verweigerung hinaus reicht der Protest, der öffentlich sichtbar mit Worten, Schriften oder Symbolik vollzogen wird. Der Protest ist mit der Opposition verschwistert. Aktiver Widerstand schließlich setzt Handlungen voraus. Widerstand ist Opposition notfalls unter Einsatz des Lebens. Vereinfacht gesagt: Abweichendes Verhalten war in den Kriegsjahren recht verbreitet – zumindest mehr, als man lange annahm. Protest oder Widerstand hingegen war das Geschäft einer kleinen Minderheit.261 Die Widerstands- und Jugendforschung stehen bisweilen im angespannten Verhältnis. Das skizzierte Stufenmo-
258 Ein weiter unübertroffen komprimierter Überblick bei Michael Kißener, Das Dritte Reich (Kontroversen um die Geschichte), Darmstadt 2005, S. 82–101. 259 Vgl. Meike Wöhlert, Der politische Witz in der NS-Zeit am Beispiel ausgesuchter SD-Berichte und Gestapo-Akten, Frankfurt a. M. 1997. 260 Jugenddienstarrest, Abteilung Hitler-Jugend-Gericht. In: GB: Wien, 9/42 vom 1.7.1942. 261 Vgl. Alfons Kenkmann, Zwischen Nonkonformität und Widerstand. In: Dietmar Süß/ Winfried Süß (Hg.), Das „Dritte Reich“. Eine Einführung, München 2008, S. 143–165. Vgl. ähnliche Skala bei Wilfried Breyvogel, Jugendwiderstand im Nationalsozialismus. Ein Überblick. In: Splitter. Beiträge aus Pädagogik und Jugendforschung, (1994) 2, S. 143–148; ders., Resistenz, Widersinn und Opposition. Jugendwiderstand im Nationalsozialismus. In: ders. (Hg.), Piraten, Swings und Junge Garde. Jugendwiderstand im Nationalsozialismus, Bonn 1991, S. 9–16.
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
325
dell berücksichtigt nämlich nicht die unterschiedlichen Möglichkeiten von Akteuren. Politisches Bewusstsein, Reflexionsvermögen und Handlungsoptionen sind nicht nur individuell verschieden, sondern auch abhängig vom Lebensalter und den Entwicklungsphasen. Bei Kindern und Jugendlichen, die im „Dritten Reich“ aufwuchsen und nach 1933 sozialisiert wurden, einen aktiven oder konspirativen politischen Widerstand zu erwarten, ist natürlich wenig realistisch. Die Geschwister Scholl, die mit der Hitlerjugend in der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre gebrochen hatten, sind das berühmteste Beispiel des sogenannten Jugendwiderstands. Ihr außergewöhnlicher Mut hat ihnen in der kollektiven Erinnerung einen Sonderstatus gesichert. Ferner ist die „Rote Kapelle“ zu nennen, in deren Umfeld sich neben Hanno Günther, der 1936 als 16-Jähriger nach zwei Jahren HJ-Mitgliedschaft ausgetreten war, weitere junge Widerständler bewegten.262 Die Scholl-Geschwister befanden sich während des Krieges schon in ihren Studienjahren. Auch Hanno Günther hatte das 20. Lebensjahr überschritten. Im HJ-Alter war also keiner von ihnen. Die Jüngsten sind an Zahl so rar, dass ihre Geschichten umso mehr beeindrucken. Das 17-jährige HJ-Mitglied Helmuth Hübener hatte mit zwei Freunden – auf Basis von „Feindfunk“-Botschaften – Flugblätter in einem Hamburger Arbeiterviertel verteilt. Außerdem schrieb er gegen die Jugenddienstpflicht an: „Euch in der HJ nimmt man besonders vor, und nicht ohne Grund. ‚Ihr seid die Zukunft Deutschlands!‘ Und so werdet ihr tyrannisiert und bestraft, wie es kein zweites Beispiel gibt.“263 1942 wurde Hübener verhaftet, verurteilt und hingerichtet. Die Gutachter der Hitlerjugend wussten beim Prozess nicht viel Schlechtes über den Jugendlichen zu sagen: Pflichtbewusst, ein guter Kamerad sei er gewesen, auch immer zum Dienst erschienen – was die Hitlerjugend nicht davon abhielt, das Todesurteil zu fordern.264 Ausländische Radiosender schienen auch den 16-jährigen Münchner Katholiken Walter Klingenbeck beeinflusst zu haben. Klingenbeck gehörte seit Ende 1936 ebenfalls der Hitlerjugend an und war zuletzt aus der sogenannten Pflicht-HJ in die Stamm-HJ übernommen worden. Zusammen mit Freunden funkte er illegal über Radiowellen, beschrieb Häuserwände und versuchte, Flugblätter herzustellen. 1943 wurde er denunziert, verhaftet und später hingerichtet.265 Typischer für die Widerstandsaktionen jugendlicher Gruppen ist aber 262 Vgl. Volker Hoffmann, Hanno Günther, ein Hitler-Gegner. Geschichte eines unvollendeten Kampfes 1921–1942, Berlin 1992, S. 43. 263 Flugblatt Hübeners von Januar 1942. In: Ursel Hochmuth/Gertrud Meyer, Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand 1933–1945, Frankfurt a. M. 1980, S. 534 f. 264 Vgl. die Dokumente zum Prozess und zur Hinrichtung bei Ulrich Sander, Jugendwiderstand im Krieg. Die Helmuth-Hübener-Gruppe 1941/1942, Bonn 2000, S. 111–205. 265 Vgl. Bericht des Oberstaatsanwalts München bezüglich Walter Hermann Klingenbeck und 3 Andere vom 7.3.1942, S. 4; sowie Todesurteil vom 24.9.42, S. 2, abgedruckt u. a. bei Klaus Bäumler (Hg.), Walter Klingenbeck. Zum 60. Todestag. 5. August 1943– 5. August 2003, 4. Auflage, München 2003; sowie Digitalisate der Dokumente einsehbar unter www.was-konnten-sie-tun.de (26.8.2019); Jürgen Zarusky, „… nur eine Wachstumskrankheit“? Jugendwiderstand in Hamburg und München. In: Dachauer Hefte, (1991) 7: Solidarität und Widerstand, S. 210–229.
326
Massenmobilisierung
eher ein Fall aus Hessen vom März 1943. Katholische Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren drangen in ein HJ-Heim – einst ein Jugendhaus im kirchlichen Besitz – ein. Sie warfen Steine in Fensterscheiben, rissen Hakenkreuzfahnen runter und beschmierten Mobiliar mit katholischer Symbolik.266 Die Einschätzung darüber, was Widerstand ist und wer dazu zählt, kann sich mit der Zeit ändern. Das unterstreicht der Fall der „Edelweißpiraten“, die bekannteste jugendliche Subkultur, die sich überwiegend aus der Arbeiterschaft und dem Kleinbürgertum rekrutierte. Lange wurden sie nicht dem Widerstand zugeordnet. Nach 1945 galten sie schlicht als Kriminelle. In der Mehrheit waren es junge Menschen, die dem Netz, das die Jugenddienstpflicht spannte, entweichen konnten, die sich in Gruppen jenseits der Hitlerjugend organisierten, mit eigenem Stil und Symbolik. Das Rhein- und Ruhrgebiet war ein Schwerpunkt – besonders Köln, Essen, Duisburg, Düsseldorf und Oberhausen.267 Eine wachsende, aber schwer zu beziffernde Zahl junger Menschen fand sich in Ballungsgebieten nach 1939 in sogenannten Banden oder Cliquen zusammen. Das war kein neues Phänomen. Im Gegenteil, die Polizei hatte das jugendliche Cliquenwesen in Arbeitervierteln der Großstädte wie Berlin bereits in den Weimarer Jahren im Blick gehabt.268 Nun setzten sie sich mit ihren begrenzten Mitteln gegen den Verfügungsanspruch der Diktatur zur Wehr. Die Namen, die staatliche Organe den Gruppen zuwiesen, waren verschieden. Gestapo, Polizei und SD sahen speziell bei den „Edelweißpiraten“ im Westen Deutschlands mutwillige Zerstörungswut als Triebfeder. Beispielsweise würden Plakate von Litfaßsäulen abgerissen – aus purer „Lust am Zerreißen mit Händen, Stöcken oder Messern“, glaubte man in der HJ-Gebietsführung von Düsseldorf.269 Entlang von Rhein und Ruhr kamen junge Menschen überwiegend im Alter von 15 bis 20 Jahren in Parks oder auf Waldlichtungen zusammen. Mädchen und Jungen, die in den Arbeitervierteln in den 1930er-Jahren zumindest mehr oder minder in Distanz zur Staatsjugend aufgewachsen waren, machten den Kern der Cliquen aus. Klaus Everwyn, geboren 1930 in Köln, berichtet von seinen Spielgefährten: „Eigentlich verstand ich nicht, warum nur ich so versessen auf Uniformen und Auszeichnungen war, meine Straßenfreunde dagegen nicht. Sie liefen lieber Rollschuh oder fuhren Roller, während ich in Uniform zum HJHeim unterwegs war, um mir das Schießabzeichen zu erschießen. […] Meine Straßenfreunde juxten herum, als ich ihnen berichten musste, dass es mit dem angekündigten Schießabzeichen wohl nichts werden würde. Sie hetzten ein
266 Vgl. Der Generalstaatsanwalt, Frankfurt: Bericht über Strafsachen vom 30.5.1941. In: Klein/Uthe (Hg.), Lageberichte der Justiz aus Hessen, S. 185–188, hier 187. 267 Vgl. Kenkmann, Wilde Jugend, S. 171–183. 268 Vgl. Jonas Kleindienst, Die Wilden Cliquen Berlins. „Wild und frei“ trotz Krieg und Krise. Geschichte einer Jugendkultur, Frankfurt a. M. 2011, S. 102–114. 269 Mutwilliges Beschädigen von Anschlagplakaten. In: GB: Düsseldorf, 5/42 K vom 10.6.1942; Abreißen und Beschädigung von Plakaten an den ordentlichen Anschlagstellen durch Jugendliche. In: GB: Moselland, K3a/41 vom 15.3.1941.
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
327
Mädchen auf, mich zu umarmen und zu küssen, weil ich ihnen gesagt hatte, in Uniform sei Knutschen einem Jungvolkjungen nicht erlaubt.“270 Aktive Hitlerjungen und BDM-Mädchen stießen hinzu, weil sie deren alternativen Lebensstil attraktiv fanden. Als „Edelweißpiraten“ – ein Name, den die Sicherheitsorgane offenbar zuerst nutzten, bevor die jungen Menschen ihn als Selbstbeschreibung stolz übernahmen – wurden die diversen Cliquen im Rheinland und Ruhrgebiet observiert. Walter Meyer, geboren 1926 in Kassel, aufgewachsen in Düsseldorf, stieß um 1943 hinzu.271 Um einem Schwimmverein anzugehören, war er „Pimpf“ geworden. Mit 14 Jahren hatte man ihn in die HJ überführt. Doch zum Dienst sei er kaum gegangen, stattdessen mit Freunden sozusagen verwildert: Man überfiel HJ-Streifen, stahl deren Ausweise und Abzeichen, wagte sich in die Nähe französischer Zwangsarbeiter. Mit 16 Jahren wurde Meyer festgenommen, verhört und als vermeintlicher „Rädelsführer“ der Düsseldorfer Edelweißpiraten bis 1944 eingesperrt. Danach war er im KZ Sachsenhausen, anschließend im Männerlager von Ravensbrück interniert. Seine Jugend wolle er nicht glorifizieren, betonte er in einem Interview Jahrzehnte später. Widerstand habe er nicht getrieben, gegen Hitler nicht kämpfen wollen, von Politik kaum etwas verstanden – anderes zu sagen, wäre Lüge: „Wir waren nur eine Bande, und wie jede Bande haben wir […] die Polizei und die Autorität abgelehnt; ich lehnte Autorität ab, für mich war Autorität etwas Negatives.“272 Die Verfolgung der Edelweißpiraten soll in der Hinrichtung von 13 Angehörigen einer Köln-Ehrenfelder Gruppe am 10. November 1944 gegipfelt haben.273 Doch mit dieser Einordnung taten sich Forschung und Öffentlichkeit schwer. Denn die Ehrenfelder Gruppe hatte nicht nur Verfolgten, darunter Juden und Zwangsarbeiten, geholfen, sondern mehrere Einbrüche verübt und konspirativ Schusswaffen gehortet. Infolge einer Polizei-Razzia war es zur Schießerei mit drei Toten, darunter einem HJ-Streifendienstführer, sowie einer Verfolgungsjagd gekommen. Lange nach 1945 dominierte die skeptische Deutung, dass die Ehrenfelder Gruppe eine kriminelle Bande gewesen sei. Die Westalliierten sahen in den Großstadt-Cliquen unmittelbar nach Kriegsende schlichte Provokateure. Erst seit den 1970er-Jahren wurde den Edelweißpiraten ein Platz im öffentlichen Gedenken allmählich eingeräumt.274 Die Auseinandersetzung um die Ehrenfelder Gruppe mit ihrem 270 Klaus Ewert Everwyn, Als ich noch ein (kleiner) Nazi war. In: Karlhans Frank (Hg.), Menschen sind Menschen. Überall. P.E.N.-Autoren schreiben gegen Gewalt, München 2002, S. 16. 271 Vgl. im Folgenden Interview mit Walter Meyer, Transkript S. 16 und 21–23 (USHMM, Oral History Archives, RG-50.030.0371). 272 Ebd., S. 25 273 Vgl. Matthias von Hellfeld, Edelweißpiraten in Köln. Jugendrebellion gegen das 3. Reich: das Beispiel Köln-Ehrenfeld, Köln 1983, S. 7–12 und 30–40; Simone Dittmar, „Wir wollen frei von Hitler sein“. Jugendwiderstand im Dritten Reich am Beispiel von drei Kölner Edelweißpiraten, Bern 2011. 274 Vgl. Kurt Schilde, Jugendopposition 1933–1945, Berlin 2007, S. 25–28 und 140 f.; Martin Rüther, „Senkrecht stehen bleiben“. Wolfgang Ritzer und die Edelweißpiraten.
328
Massenmobilisierung
bekanntesten Mitglied – Bartholomäus Schink, 1927 geboren, im November 1944 gehängt – ist bis weit in die 1990er-Jahre mit recht harten Bandagen geführt worden. Periodisch flammt die Debatte um die Ehrenfelder Gruppe immer wieder auf. Bernd-A. Rusinek wandte sich 1987 gegen die Klassifizierung des Schink-Kreises als Widerstand, was in Köln und gerade unter lebenden Zeitzeugen auf Unverständnis stieß.275 Die chaotischen Lebensverhältnisse in der zerstörten Rheinmetropole, so Rusinek, seien ausschlaggebend gewesen, nicht vermeintlich politische Motive der Akteure.276 Die als „Kölner Kontroverse“ bekannte Debatte hat Winfried Seibert 2014 mit Akribie nachgezeichnet. Auch Seibert bezog in der Auseinandersetzung eine späte Position. Die Ehrenfelder Gruppe habe kaum Kontakte zu anderen Edelweißpiraten gehabt. Ihre Zuordnung zur jugendlichen Subkultur des Rhein- und Ruhrgebiets sei als Legendenbildung einzuordnen, die in Entschädigungsprozessen der Nachkriegszeit und in geschichtspolitischen Interessen ihre Wurzeln habe.277 Die Edelweißpiraten besaßen, das wäre ein Gegenargument, indes nie eine feste Organisation. Als jugendliche Gegenkultur zur Hitlerjugend gilt ferner die Swing-Szene in Hamburg, Frankfurt am Main und Berlin. Man tauschte Platten, organisierte illegale Konzerte, tanzte, rauchte, trug lange Haare.278 Konzentriert primär in den Metropolen, erfasste die Swing-Begeisterung viele weitere Städte. Jüngst hat sich der Blick auf sogenannte Broadway-Cliquen in Mitteldeutschland gerichtet. Diese Jugendlichen waren von amerikanischer Musik und westlichem Lebensstil ebenfalls stark beeinflusst. Die Cliquen sind als eine Subkultur gedeutet worden, deren Motivation nicht der politische Protest war, obgleich Einzelne – durch Verfolgung und Sanktion radikalisiert – zum Widerstand fanden. „Wir werfen keine Steine“, schrieb Autor Uwe Storjohann über das Swing- Milieu in Hamburg, das in den Kriegsjahren aufblühte, „legen keine Bomben,
Unangepasstes Jugendverhalten im Nationalsozialismus und dessen späte Verarbeitung, Köln 2015, S. 142–144. Einen Überblick zur Auseinandersetzung und eine Einordnung bietet kompakt Barbara Manthe, Zwischen jugendlichem Freizeitverhalten, Subkultur und Opposition. Unangepasste Jugendliche im nationalsozialistischen Köln. In: Geschichte im Westen, 22 (2007), S. 89–112. 275 Vgl. Bernd-A. Rusinek, Köln-Ehrenfeld 1944 (Teilvorabdruck aus einer Dissertation über die ‚Edelweißpiraten‘ im Rahmen des Forschungsauftrages des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen über ‚Formen des Jugendwiderstandes im Dritten Reich unter besonderer Berücksichtigung der Kölner Verhältnisse‘ an den Lehrstuhl für Neueste Geschichte der Universität Düsseldorf, Prof. Dr. P. Hüttenberger), Düsseldorf 1987. 276 Vgl. auch ders., Desintegration und gesteigerter Zwang: die Chaotisierung der Lebensverhältnisse in den Großstädten 1944/45 und der Mythos der Ehrenfelder Gruppe. In: Wilfried Breyvogel (Hg.), Piraten, Swings und Junge Garde. Jugendwiderstand im Nationalsozialismus, Bonn 1991, S. 271–294. 277 Vgl. Winfried Seibert, Die Kölner Kontroverse. Legenden und Fakten um die NS-Verbrechen in Köln-Ehrenfeld, Essen 2014. 278 Vgl. Kopie aus den Akten des Reichsjustizministeriums „Wilde Jugendgruppen – Edelweißpiraten“, 1942 (BArch R22/1177, Bl. 1–8); auch bei Klönne, Jugendprotest und Jugendopposition, S. 603.
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
329
verteilen keine Flugblätter, wir hören nur Musik. Wir rufen nicht nach Bürgerrechten, wollen kein System beseitigen – und doch fühlt sich das System von uns bedroht.“279 Regime und Hitlerjugend bemühten sich, die Grenzlinien zwischen Verweigerungsakten einerseits und politischer Opposition andererseits zu verwischen. Resistenz sollte im Keim erstickt werden. In den höheren Dienststellen der Hitlerjugend, wie etwa für das Gebiet Westmark dokumentiert, existierten „Mob-Beauftragte“, die sich um die Benennung der „Rädelsführer“ bemühten; gerade, wenn man es mutmaßlich mit HJ-Angehörigen zu tun hatte.280 Aus Sicht des Führerkorps war jeder, der sich dem Totalitätsanspruch der Partei- und Staatsjugend nicht unterwarf, ein „Gemeinschaftsfremder“. Ob die Edelweiß-Protagonisten mit einer mehr oder weniger konsistenten Anlehnung an die ältere deutsche Jugendbewegung aus der Weimarer Zeit waren oder eben junge Menschen, die sich an amerikanischer Kultur orientierten – das war dem Regime gleichgültig. „In größeren Städten“, lautet es pauschal in Anweisungen der RJF an den SRD 1940, „sind neuartige Gruppenbildungen männlicher und weiblicher Jugendlicher außerhalb der HJ auf staatsfeindlicher oder krimineller Grundlage festgestellt worden. […] Diese Gruppen bilden eine erhebliche Gefahr für die Jugend und für die Erziehungsarbeit der HJ und sind daher vom SRD in engster Zusammenarbeit mit der Polizei schärfstens zu bekämpfen.“281 Die Verweigerer fielen oft dadurch auf, dass sie gegen die Dienstpflicht verstießen, sich anders kleideten oder nicht nach Vorschrift grüßten. Abweichendes Verhalten resultierte aus Eigensinn, jugendlicher Selbstfindung, und war eher ein Aufbegehren gegen Alltagsautoritäten als im strengeren Sinne politisch motiviert. „Da gab es die Raudies und Halbstarken“, meinte ein ehemaliger Hitlerjunge, der in Görlitz aufwuchs, „die hatten ihre Treffpunkte, sind nie zum Dienst gegangen.“282 Die SRD-Kontrollen seien häufig in Schlägereien gegipfelt. Pubertäres Territorialverhalten und Gegnerschaft lagen nah beieinander. Die Sicherheitsorgane und HJ-Stellen sprachen – erwartungsgemäß undifferenziert – von jungen Kriminellen, Asozialen oder Unerziehbaren. In Städten wurden Hauswände oder Sitzbänke beschmiert. Es kam zu Diebstählen, in der späteren Kriegsphase zu Plünderungen, die man solchen jugendlichen „Banden“ anlastete. Die einsetzende staatliche Verfolgung förderte zugleich die Politisierung etlicher Gruppen. Der Ortsgruppenleiter von Grafenberg, einem Stadtteil am Rand Düsseldorfs, schrieb im Juli 1943:
279 Uwe Storjohann, Ohne Tritt im Lotterschritt. In: Franz Ritter (Hg.), Heinrich Himmler und die Liebe zum Swing, Leipzig 1994, S. 109; Michael H. Kater, Gewagtes Spiel. Jazz im Nationalsozialismus, Köln 1995, S. 298. 280 Vgl. Meldung und Fahndungen des „Mob“-Beauftragen. In: GB: Westmark, 19/43K vom 25.10.1943. 281 Reichsjugendführung (Hg.), Die Überwachung der Gefährdung der Jugend. Einsatzbefehl für den HJ-Streifendienst (SRD) vom 1. Juni 1940 (vertraulich!), S. 16 (HStA Stuttgart, E 151/09, Bü. 402). 282 Interview von André Postert mit Heinz F. vom 20.1.2015 (Tonaufnahme im Archiv des HAIT).
330
Massenmobilisierung
„Mir wird gemeldet, dass sich […] Ansammlungen Jugendlicher in der Ostparkanlage stärker denn je bemerkbar machen. Diese Jugendlichen von 12–17 Jahren flegeln sich bis in die späten Abendstunden mit Musikinstrumenten und weiblichen Jugendlichen hier herum. Da dieses Gesindel zum großen Teil außerhalb der HJ steht und eine ablehnende Haltung zu dieser Gliederung einnimmt, bilden diese eine Gefahr für die übrige Jugend. […] Es besteht der Verdacht, dass diese Jugendlichen diejenigen sind, welche die Wände […] beschreiben mit ‚Nieder mit Hitler‘ [….] ‚Nieder mit der Nazi-Bestie‘ usw. Diese Anschriften können so oft beseitigt werden, wie man will, innerhalb weniger Tage sind die Wände wieder neu beschrieben.“283
Ein Großteil der jungen Leute gehörte formal der Hitlerjugend an, einige taten auch weiter Dienst, um Sanktionen oder Strafen zu entgehen. Einzelne traten nach außen als tadellose Hitlerjungen und BDM-Mädchen auf, aber hatten Kontakte in die subkulturellen Gruppen. Eine scharfe Trennlinie zwischen der Hitlerjugend einerseits und ihren Gegnern andererseits gab es im Alltag selten. In Essen wurden im Frühjahr 1941 drei Jugendliche festgenommen, die im Verdacht standen, einer „kriminellen Bande“ anzugehören. Die Polizei zeigte sich erstaunt, denn die Festgenommenen trugen „sämtlich das verbotene Edelweißabzeichen der bündischen Jugend“, aber „außerdem das HJ-Abzeichen“. Die Überprüfung ergab, dass sie in der HJ erfasst waren.284 Im Zuge eines Prozesses in Düsseldorf wurden etwa 50 bis 70 Personen benannt, die „meist Angehörige der HJ“ waren, aber in verschiedenen oppositionellen Gruppen tätig seien. Zumindest unregelmäßig seien sie auch am HJ-Dienst beteiligt. Insgesamt zähle die Stadt, was jedoch als weit untertrieben anzusehen ist, etwa „die doppelte Zahl, wenn man die Mitläufer mitrechnet“.285 In Krefeld lautete eine Einschätzung der Sicherheitsorgane vom April 1944, dass gar mindestens „30 Prozent […] geheime Edelweiß-Mitglieder“ in den Reihen der Hitlerjugend stünden.286 Peter Jonas, der seit 1942 Lehrling bei Rheinmetall war, berichtete später über seinen Weg von der HJ in das Umfeld der subkulturellen Cliquen: „Bevor ich bei Rheinmetall den Lehrvertrag bekam, musste ich Mitglied in der Hitler-Jugend […] werden. Das mussten alle, die in Großfirmen ausgebildet werden wollten. Für die meisten war dies kein Hindernis. War es doch ganz normal, in der HJ zu sein.“287 In der Hitlerjugend ebenso wie im Betrieb habe er Gewalt von Führern und Vorgesetzten erlebt. Mehrfach habe er Prügel kassiert: 283 Zit. nach Falk Wiesemann, „Erziehung in Deutschland“. Nationalsozialistische Staatsjugend in Düsseldorf. In: Erika Welkerling/Falk Wiesemann (Hg.), Unerwünschte Jugend im Nationalsozialismus. „Jugendpflege“ und Hilfsschule im Rheinland 1933–1945, Essen 2005, S. 21–51, hier 48. 284 Meldung der Polizei Essen über den Verdacht der bündischen Betätigung Jugendlicher an die Gestapo vom 8.5.1941, und einige weitere Fälle (HStA Düsseldorf, RW 58, 58023; 3421, zit. nach Online-Dokumentation des NSDOK Köln, EzG, jugend1918-1945.de; 13.5.2019). 285 Urteilsverkündung gegen die Edelweißpiraten wegen Betätigung für die bündische Jugend, o. D. In: Pädagogisches Institut Düsseldorf (Hg.), Dokumentation, S. 240 f. 286 Hans Rothfels, Zur 25. Wiederkehr des 20. Juli 1944. In: VfZ, 17 (1969) 3, S. 237–254, hier 245. 287 Bericht Peter Jonas, Lehre in einem Düsseldorfer Werk. In: Pädagogisches Institut Düsseldorf (Hg.), Dokumentation, S. 184–186.
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
331
„Ich glaube, aus dieser Erkenntnis heraus, dass dies alles nicht richtig sein konnte […], bildete sich dann ein wahrer Freundeskreis. Ganz zaghaft erst, dann offener, tauschten wir unsere Erfahrungen aus. […] Wir versuchten bei unseren Zusammenkünften, die fast täglich stattfanden, die ‚Geknickten‘ wiederaufzurichten und ihnen Mut zu machen. Außerdem trafen wir uns zu Hilfsaktionen nach Bombenangriffen. Verschiedentlich sangen wir bei unseren Treffen in Parkanlagen, am Rheinufer oder anderswo, von Gitarren begleitet, Heimatlieder. […] Zuerst verboten uns Polizei und SA-Streifen weitere Zusammenkünfte. Als wir uns daran nicht hielten, wurden wir mit zur Wache genommen und dort unangenehmen Verhören ausgesetzt.“288
Hans Kötting, geboren 1927, hatte ebenfalls der Hitlerjugend und vor Kriegsbeginn dem katholischen Bund Neudeutschland angehört. Der Letztere war durch das Regime 1939 allerdings verboten worden. Man traf sich gleichwohl im Siegener Umland. „Schon 1942 kursierten unter uns Gerüchte über Jugendbanden“, erinnerte sich Kötting, der zu dieser Zeit noch einen unteren Führerrang im DJ bekleidete.289 Auf diese Weise habe er von den Kölner Edelweißpiraten erfahren. Durch dauernde Zusammenstöße mit dem HJ-Streifendienst seien er und seine Freunde radikaler geworden: „Ich glaube, wir fingen an zu verwildern, oder wie sonst soll ich es bezeichnen?“ An die Jungenschaftsblusen hefteten sie sich nun das Edelweiß. Zusammen gingen sie auf verbotene Fahrt. Auf diesen Wanderungen durch die Natur seien sie häufig auf andere getroffen: „Langhaarträger, Tangojünglinge und sonstige im damaligen Sinne Undisziplinierte.“290 Irgendwann vom SRD erwischt, habe man ihn auf der Banndienststelle zur Rede gestellt, seines Rangs degradiert und zur Disziplinierung aus dem Jungvolk in die HJ überwiesen. Die Luftangriffe auf Köln und Düsseldorf seit Mai 1942 und die Verschickung von jungen Menschen durch die KLV gingen mit einer steigenden Zahl „Entwurzelter“ einher. Die Größe der verschiedenen Cliquen ist schwer zu beziffern. Immerhin versetzten sie die Überwachungsorgane in Sorge. Im Herbst 1942 hatten die Kölner Edelweißpiraten und „Navajos“ Dienstgebäude mit Protestparolen beschmiert: die Gestapo-Zentrale, das Gericht sowie den Sitz der Kriminalpolizei. Vereinzelt fanden Flugzettel beispielsweise mit dem Aufruf „Kommt zurück – Jugend erwache“ Verbreitung.291 Das RheinRuhr-Gebiet gilt zwar als das Zentrum dieser subkulturellen Bewegungen. Im Verlauf der Kriegsjahre breitete sich das Edelweiß als Erkennungsmerkmal jedoch in andere Teile des Deutschen Reiches aus. Gruppen mit dem Edelweiß traten in Berlin und auch in Weimar auf. Die Evakuierungen im Zuge der KLV trugen zur Verbreitung bei. Subkulturelle Symbolik drang bis in die ländliche Fläche vor. Zuletzt war das Edelweiß-Symbol auch dort zu finden, wo sich
288 Ebd. 289 Hans K. Kötting an Rudolf Pithan vom 2.7.1990 (Archiv des IfZ München, ZS 2492, Bd. 1). 290 Ebd. 291 Vgl. Rüther, Wolfgang Ritzer und die Edelweißpiraten, S. 38–45 und 72 f.
332
Massenmobilisierung
Gruppen nicht, wie entlang von Rhein und Ruhr, als Protestbewegung offen formierten. Die Gebietsführung Mittelland in Halle stellte Anfang 1944 wohl mit einigem Erstaunen fest: „In letzter Zeit wurden von Jungen und Mädeln im erheblichen Umfange Edelweißabzeichen und Kofferanhänger […] in der Öffentlichkeit getragen. Häufig auch zur Uniform. Ich verbiete für das gesamte Gebiet das Tragen solcher Abzeichen. […] Verstöße gegen diesen Befehl werden in Zukunft bestraft werden.“292 In Leipzig wurden in der Kriegszeit ebenfalls Cliquen vorwiegend aus der Arbeiterjugend aktiv. Diese sogenannten Meuten rekrutierten allerdings auch im konfessionellen Milieu. Freiräume hatten sich aufgetan, weil es der Hitlerjugend an Unterführern und SRD-Angehörigen fehlte, zudem regulärer Dienst immer häufiger ausfiel. Das ungezwungene, lässige Auftreten solcher Gruppen strahlte wiederum auf die Hitlerjugendangehörigen ab – trotz heftiger Auseinandersetzung insbesondere mit dem SRD.293 In Berlin und Hamburg wurde der Besuch von Lokalitäten verboten, wo man in Kontakt mit Cliquen kommen konnte; in erster Linie rund um das Rotlichtmilieu, auch in proletarischen Stadtteilen wie Hamburg-Altona, eine Hochburg der unangepassten Jugend. Das Führerkorps streute wilde Geschichten von jungen Räuberbanden, die gestohlenes Geld angeblich in Bordellbesuche investierten.294 Der Hamburger SRD war bis 1942 in sechs Trupps aufgeteilt worden: Zwei Dienststreifen sowie ergänzende Kino-, Lokal-, Ermittlungs- und Zivilstreife; die letztere bestand aus SRD-Führern, die älter als 18 Jahre waren und deshalb an Orten eingesetzt werden konnten, an denen regulären Streifen es nicht durften.295 Mitte 1942 standen fast 80 Orte auf der „roten Liste“, deren Besuch „mit der ganzen Strenge der zur Verfügung stehenden Disziplinarmittel bestraft“ werden sollte.296 Cliquen gab man Bezeichnungen je nach Treffpunkt oder Erscheinungsbild: Totenkopf- oder Bismarckbande, sogenannte Ultras und Zetkas.297 Dem SRD wurden für Kontrollen in den Lokalen Polizeibeamte zur Seite gestellt. Weil die Gebietsführung um die Abgründe des SRD wusste, betonte man: „Erziehungsgedanke maßgebend, nicht die Strafandrohung!“298 Der SRD übertrat dennoch dauernd seine Kompetenzen, was zu Beschwerden aus der Polizei
292 Verbot des Tragens von Abzeichen. In: GB: Mittelelbe, 3/44K vom 4.1944. Zum Edelweiß als Symbol verschiedener Jugendgruppen in den 1930er-Jahren vgl. Kenkmann, Wilde Jugend, S. 83–99; zur Verbreitung in Thüringen durch die KLV Hinweise bei Benecke, Soziale Ungleichheit und Hitler-Jugend, S. 232. 293 Vgl. Lange, Leipziger Jugendgruppen im Dritten Reich, S. 278–310. 294 Vgl. Kater, Hitler-Jugend, S. 117. 295 Vgl. den Sonderdruck: Arbeitsanweisungen für den HJ-Streifendienst im Gebiet Hamburg. In: GB: Hamburg, 8/42K vom 8.1942. 296 Vgl. z. B. Verbotene Straßen und Lokale. In: GB: Hamburg, 7/42K vom 8.1942. 297 Vgl. Sascha Lange, Meuten, Swings und Edelweißpiraten. Jugendkultur und Opposition im Nationalsozialismus, 2. Auflage, Mainz 2018, S. 124 f. 298 Sonderdruck: Arbeitsanweisung für den HJ-Streifendienst im Gebiet Hamburg, GB: Hamburg, 8/41K vom 8.1942.
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
333
führte.299 Hinzu kam, dass der SRD oft verdeckt in Zivil patrouillierte, um Jugendliche abzufangen, die sich den Lokalen oder Treffpunkten näherten.300 Die Staatsmacht schritt in den ersten Kriegsjahren gegen die Hamburger Swing-Jugend zunächst aber eher zögerlich ein. Auch die Hitlerjugendführung hatte sich – trotz rabiater Töne – Zurückhaltung auferlegt, um nicht weitere junge Menschen zu verprellen. Die oft bürgerlichen Kinder und Jugendlichen, darunter viele Schüler höherer Schulen, orientierten sich an westlicher Musik und jugendlichem Stil aus Großbritannien oder den USA und passten sich dem äußerlich an. Männliche Jugendliche trugen Trenchcoat, den Hut schief und zum Teil ins Gesicht gezogen. Mädchen forderten mit viel Schminke das Idealbild des BDM heraus. Man trug wallendes Haar oder westliche Kleidung. Die meisten rauchten. Gelegentlich war aus subkulturellen Kontexten der Schritt hin zum Protest möglich.301 Im Juni 1941 klagte der Hamburger Gebietsführer Kohlmeyer: „Hitler-Jungen werden des Öfteren mit den Händen in den Hosentaschen, mit unsauberem Dienstanzug und schlechtem Haarschnitt, und selbst Zigaretten rauchend auf der Straße angetroffen. Außerdem wird die Grußpflicht nicht eingehalten und der Gruß nur mäßig ausgeführt.“302 Die Swing-Szene strahlte in die Staatsjugend hinein. Michael Kater – sonst die Hitlerjugend bisweilen überschätzend – schrieb, sie habe „um ihr Überleben als monopolistische Organisation“ aus gutem Grund fürchten müssen.303 Reichsjugendführer Axmann forderte am 8. Januar 1942 von Himmler die „sofortige Unterbringung dieser Menschen in ein Arbeitslager“.304 Noch in seinen Memoiren sprach Axmann vom einem „bestimmten Prozentsatz von asozialen Elementen“, die sich schädlich auf die „gesunde Gemeinschaft“ ausgewirkt hätten.305 Damals sei er überzeugt gewesen, es könne „nicht sein, dass die Soldaten an der Front jeden Tag ihr Leben einsetzen, während zu Hause Cliquen durch ihr Verhalten sich zu den Gegnern bekennen. Dann sollten sie wenigstens arbeiten“.306
299 Vgl. Arbeitsrichtlinie für den Streifendienst, 8/42K. In: GB: Hamburg, 12/42K vom 12.1942: „Vonseiten der Kripo wurde wiederholt darüber Klage geführt, dass die Streifendienstführer die eigenen Richtlinien nicht beachten. Zukünftig werden deshalb die betreffenden Einheitenführer zur Verantwortung gezogen und ihnen gegebenenfalls die Streifendienstbefugnis aberkannt.“ 300 Vgl. Reichsjugendführung, Die Überwachung der Gefährdung der Jugend. Einsatzbefehl für den HJ-Streifendienst (SRD) vom 1. Juni 1940 (vertraulich!), S. 14 f. (HStA Stuttgart, E 151/09, Bü. 402). 301 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 467. 302 Auftreten in der Öffentlichkeit. In: GB: Hamburg, 11/41 vom 7.6.1941. 303 Kater, Gewagtes Spiel, S. 288. 304 Schreiben von Reichsjugendführer Artur Axmann an den Reichsführer SS vom 8.1.1942. In: Jahnke (Hg.), Eine Dokumentation, S. 420 f. 305 Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 253. 306 Ebd., S. 380.
334
Massenmobilisierung
Himmler reagierte sofort und wies Reinhard Heydrich einige Tage später an, dass „das ganze Übel radikal ausgerottet werden“ müsse. Prügel seien zunächst auszuteilen, es müsse exerziert werden, und für die „Rädelsführer“ habe der „Aufenthalt im Konzentrationslager […] ein längerer, 2–3 Jahre“ zu sein.307 Hamburg, Bremen und Kiel gelten zwar als das norddeutsche Epizentrum der Swing-Begeisterung. Ebenso observierten aber Berliner Polizeibeamte zusammen mit dem SRD illegale Musik- und Tanzveranstaltungen. In Wien fand derweil die Selbstbezeichnung „Schlurfs“ Verbreitung. Der Schriftsteller Ernst Jandl erinnerte sich an einen einprägsamen Fall, der gleich zu Kriegsbeginn in seiner Schulklasse für einige Aufmerksamkeit gesorgt hatte: Ein „Junge, der zuerst als strammes HJ-Mitglied in die Schule kommt und dann über den Sommer eine große Wandlung vollzieht. Mit langen Haaren kommt. Überlanges Sacco. Das war weinrot und reichte bis fast zum Knie.“308 Edelweiß-Symbol und die Swing-Kultur sind bis heute die geläufigsten subkulturellen Chiffren aus der unangepassten Jugend. Die meisten Gruppen, die im Auge der Sicherheitsorgane standen, sind schwer eindeutig zuzuordnen. In Duisburg wurde eine „Stadtpark-Gruppe“ verfolgt, eine „Schlangenkompanie“ traf sich in Karlsbad, während im bayerischen Kaufbeuren von einem „Stöpsel-Klub“ die Rede war. Selbst aus Königsberg gingen Berichte über Cliquenbildungen ein.309 Viele der Beteiligten gehörten der Staatsjugend an, gingen manchmal zum Dienst, aber entzogen sich bei jeder Gelegenheit. Ein Rundschreiben Himmlers, der während der letzten Kriegsmonate die Zerschlagung der Jugendopposition verlangte, deutete im Herbst 1944 darauf hin: „Der Hitler-Jugend gehören [die Anführer der Cliquen] nur selten an. Sind sie aber in der Hitler-Jugend, so versehen sie ihren Dienst dort nicht oder nur unlustig oder sind bereits wegen irgendwelcher Verfehlungen oder Interesselosigkeit aus der Hitler-Jugend ausgeschieden worden. Es sind jedoch auch Fälle bekannt, in denen der Hitler-Jugend-Dienst tadellos abgeleistet wurde, um nach außen hin keinen Verdacht zu erregen.“310 Für das Rhein- und Ruhrgebiet ließ sich belegen, dass Cliquen zu etwa 80 Prozent aus HJ- und BDM-Angehörigen bestanden; nur 15,5 Prozent der Festgesetzten besaßen keinen Ausweis der Hitlerjugend.311 Eine Berliner Clique, gegen die die Polizei 1943 einschritt, weil sie über Schusswaffen verfügte, hatte 307 Anweisung des Reichsführers SS Heinrich Himmler an den Chef der Sicherheitspolizei und des SD Reinhard Heydrich vom 26.1.1942. In: Jahnke (Hg.), Eine Dokumentation, S. 421 f. Originale abgedruckt bei Karl-Heinz Huber, Jugend unterm Hakenkreuz, Frankfurt a. M. 1982, S. 296–298. 308 Ernst Jandl, Das Wort Jazz. Interview. In: Bernd Polster (Hg.), Swing Heil. Jazz im Nationalsozialismus, Berlin 1989, S. 153–156, hier 154. 309 Vgl. Huber, Jugend unterm Hakenkreuz, S. 270–275; Kater, Hitler-Jugend, S. 116–128. 310 Rundschreiben des Reichsführers SS vom 15.10.1944. In: Klönne, Jugendliche Opposition im „Dritten Reich“, S. 84–86. 311 Vgl. Kenkmann, Wilde Jugend, S. 228–232, hier 229 sowie Zitat auf S. 132. „Die verschärfte Krise der HJ-Arbeit widerlegt die herrschende Vorstellung, die auch oft die der Fachliteratur ist, die HJ habe bis Kriegsende ihre Organisationsstrukturen aufrechterhalten und den ihr von der Partei erteilten Auftrag erfüllen können.“
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
335
sich in einem Wehrertüchtigungslager gebildet. Es schien als hätten sich die vermeintlichen „Rädelsführer“ dort kennengelernt.312 Die Mehrheit bewegte sich in diesen Subkulturen wohl nicht in erster Linie aus widerständigen Motiven. Individualität, Begeisterung für Musik und alternative Lebensstile, vielleicht auch das Aufbegehren gegen Autoritäten führten junge Menschen zusammen. Mit einem Modell, das nach politischem Widerstand fahndet, und dort, wo man diesen politischen Widerstand nicht findet, automatisch ein Mitläufertum vermutet, wird man diesem jugendlichen Leben und seinen Gefahren nicht gerecht. Im „Dritten Reich“ war nonkonformes Verhalten genuin politisch. 2.2
Disziplinarische Probleme und Jugendkriminalität
In der Unterwanderung der Hitlerjugend sahen die höheren Dienststellen die größte Gefahr für ihre Organisation. Man hielt das eigensinnige und nonkonformistische Verhalten junger Menschen gewissermaßen für ansteckend.313 In einer Handreichung für den SRD 1940 hieß es, dass diese „Gruppen auch in erlaubten und sogar nationalsozialistischen Organisationen und Verbänden Unterschlupf gefunden“ hätten und dort „zersetzend wirken“ würden.314 Die RJF erhielt frühzeitig Berichte wie jenen des SD aus Königsberg, der am 15. März 1939 über einige gefasste Jugendliche mit HJ-Hintergrund meldete: „Formationsentfremdung und allgemeine Verwahrlosung scheinen oft parallel zu laufen.“315 Das Erstarken der subkulturellen Cliquen erklärte man sich damit, dass die Disziplin durch fehlende Aufsicht Schaden erlitten hätte.316 Die Pflichtbeflissenheit stand gerade beim Umgang mit der Dienstpflicht zur Disposition: Kontrollbücher wurden nicht richtig geführt, Beurlaubungen zu häufig gewährt, Dienst fiel aus oder entsprach nicht den Richtlinien. Eigensinniges Verhalten war innerhalb der Hitlerjugend verbreiteter als allgemein angenommen. Ausländische Radiosender einzuschalten war den Einheiten und Formationen streng verboten. 1943 im Alter von 14 Jahren habe bei ihm langsam ein Umdenken eingesetzt, erinnerte sich Gerhard Laue aus Erfurt: „Wo immer das auch möglich war, habe ich mir Informationen eingeholt. Eine
312 Vgl. Eva Balz, Erfahrungshorizonte Berliner Jugendlicher im Nationalsozialismus. In: Wildt/Kreuzmüller (Hg.), Berlin 1933–1945, S. 145–158. 313 Vgl. Benecke, Soziale Ungleichheit und Hitler-Jugend, S. 232. 314 Reichsjugendführung, Die Überwachung der Gefährdung der Jugend. Einsatzbefehl für den HJ-Streifendienst (SRD) vom 1. Juni 1940 (vertraulich!), S. 17 (HStA Stuttgart, E 151/09, Bü. 402). 315 Jugendführer des Deutschen Reiches (Hg.), Kriminalität und Gefährdung der Jugend. Lagebericht bis zum Stande vom 1. Januar 1941 (Streng vertraulich! Nur für den Dienstgebrauch!), Berlin 1941, S. 188. 316 Vgl. Reichsjugendführung, Gebietsrundschreiben: Auftreten in der Öffentlichkeit vom 26.5.1941. In: Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 8: Allgemeines Verhalten, S. 632.
336
Massenmobilisierung
wichtige Quelle waren für mich die englischen Sender ‚BBC‘ [British Broadcasting Corporation] und ‚Radio London‘.“317 Gemeinsam mit seinen Klassenkameraden von der örtlichen Handelsschule tauschte er sich über die ausländischen Botschaften aus; mehrere der Freunde, die auch über die HJ-Mitgliedschaft verfügten, wurden später wegen Widerstandstätigkeit verhaftet.318 Die RJF warnte folglich vor einem Missbrauch der Geräte. Das Abhören von „Feindfunk“ durch Kameraden solle unverzüglich gemeldet werden. Die Hitlerjugend drohte Unterführern sogar mit der Todesstrafe.319 Es handele sich, so die Gebietsführung von Westfalen, häufig nicht um „böswillige, sondern […] nur um gedankenlose Menschen […], die zufällig an einen ausländischen Sender hingerieten und sich diesen dann aus Neugierde anhörten, ohne sich der Verwerflichkeit ihrer Handlung voll bewusst zu sein.“320 Neugierde schütze jedoch nicht vor Strafe. Radiogeräte, die für den HJ-Dienst vorgesehen waren, wurden ab 1941 mit Hinweis- und Warnzetteln beklebt, um sowohl das Abhören des Feindfunks als auch das verbreitete Schwarzsenden durch Jugendliche zu unterbinden.321 In der Hitlerjugend seien ausländische Sender dennoch gehört worden, behaupten zumindest Zeitzeugen. Irmgard Nagel, damals BDM-Mädelringführerin in Lippstadt, hatte eine Versammlung der Führerschaft im örtlichen HJ-Heim vor Augen. Der Jungbannführer – ein Freund, der sie manchmal ins Kino ausführte, wo sie Filme sah, die sie nicht sehen durfte, – habe das Radio eingestellt, um eine Ansprache von Thomas Mann zu empfangen. Der Literat sprach seit 1940 für die BBC zu seinen Landsleuten in Deutschland. Das habe er nicht getan, weil er mit Thomas Mann sympathisierte, sondern um die Versammelten vom angeblichen Vaterlandsverrat eines deutschen Literaten zu überzeugen. Auf den Gedanken aber, dies könne eine Straftat sein, sei keiner gekommen, selbst der Jungbannführer sei sich dessen wahrscheinlich nicht bewusst gewesen.322 Ein anderes Beispiel ist die Gebietsfeldschereinheit von Frankfurt am Main. Bei den Feldschern handelte es sich um eine Sondereinheit in der HJ, die die medizinische Ausbildung – zunächst mit Blick auf eine Arztlaufbahn, später für die Lazarette der Wehrmacht – leisten sollte. In Frankfurt stand die Gebietsfeldschereinheit unter der Leitung von Jörgen Schmidt-Voigt, einem Mediziner, 1917 geboren, der aus der Pfadfinderschaft stammte. 1933 war er in die HJ übergetreten. Mehrere Zeitzeugen schilderten, dass er während des Krieges bevorzugt junge Abweichler, die Probleme mit der HJ bekommen hatten, für seine Feldschereinheit ausgewählt habe, um sie vor weiterer Verfolgung zu schützen. 317 Laue, Meine Jugend in Erfurt unter Hitler 1933–1945, S. 99. 318 Vgl. den Nachdruck der Dokumente bei ebd., S. 153–164. 319 Vgl. hier als Auswahl Gerüchte. In: BB: Gebiet Kurhessen, 4/43 vom 25.5.1943; Schwarzsenden. In: GB: Franken, 3/42 vom 3.1942; Klebe-Zettel für Radio-Apparate. In: ebd., 6/41K vom 9.1941. 320 Klebezettel für Radiogeräte. In: GB: Franken, 6/41K vom 9.1941. 321 Vgl. ebd.; Hitler-Jugend und jugendliches Schwarzsenden. In: GB: Moselland, K7/42 vom 1.7.1942. 322 Vgl. Video-Interview mit Irmgard Nagel (NSDOK Köln, EzG, jugend1918-1945.de; 12.4.2018).
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
337
„In Wahrheit ging es diesem Gebietsarzt um weit mehr“, behauptete der Schriftsteller Richard Hey, der in seine Sondereinheit aufgenommen worden war: „Die Feldscher-Einheit war Oberfläche, Tarnung. Zwar wurden wir gründlich unterrichtet […]. Aber indem wir uns beim Lernen auch selbst besser kennen lernten, kamen wir dahinter, dass viele von uns Schwierigkeiten in ihrer HJ-Vergangenheit gehabt hatten.“323 Wem der junge Mediziner nicht vertraute, sei wieder vor die Tür gesetzt worden. Ein Kreis junger Menschen sei nach und nach gewachsen, dessen Angehörige mit der Hitlerjugend wenig gemein gehabt hätten. Abgeschirmte, politisch bedenkliche Vorträge in der Dienststelle der Bannführung habe Schmidt-Voigt organisiert. Über verfemte jüdische Musiker oder Künstler sei dabei offen diskutiert worden, auch von Verbrechen an den Juden habe man über den jungen HJ-Mediziner erfahren.324 Dokumente belegen, dass der junge Mediziner von seinen Vorgesetzten zunehmend kritisch beäugt wurde und nach 1945 sagten im Zuge des Entnazifizierungsverfahrens auch Entlastungszeugen für ihn aus. Wie weit er mit seiner Einheit wirklich ging, ist aber anhand schriftlicher Quellen – wie so häufig in derartigen Fällen – nicht zu klären. Die Erinnerungen der Zeitzeugen mögen trügen oder es mag auch Wunschdenken im Spiel sein. Berichte über Opposition oder Eigensinn sind mit Blick auf den HJ-Alltag an der Basis keine Ausnahme. Ein ehemaliger Fähnleinführer, der ebenfalls aus Frankfurt stammte, erinnerte sich an einen HJ-Spielmannszug in seinem Bann während der Kriegsjahre: „Einige, später bekannte Jazzmusiker waren dabei. Diese packten nach Dienstschluss ihre Jazzbesen aus, die Landsknechtstrommeln wurden als Schlagzeug umfunktioniert. Es wurden Wachen vor dem HJHeim aufgestellt, der HJ-Streifendienst musste das ja nicht unbedingt mitbekommen.“325 Solche und ähnliche Geschichten sind letztlich schwer überprüfbar. Immerhin können sie Plausibilität beanspruchen, denn Spielräume für eigensinnige Handlungen hatten sich in der überforderten Hitlerjugend nach 1939 bisweilen sogar noch mehr aufgetan als in den 1930er-Jahren. Die höheren Dienststellen deuteten Disziplinlosigkeiten als Gefahr für ihren Verfügungs- und Totalitätsanspruch. Mal war der Haarschnitt nicht korrekt, mal saß die Uniform schlecht. Die Stiefel wurden kritisch beäugt und penibel wurde auf die Einhaltung der Grußpflicht geachtet. In Pommern setzte die Gebietsführung 1941 eigens große „Herbstappelle“ an, weil sich „ein Großteil unserer HJ-Angehörigen, ganz gleich welchen Alters sie sind, ihre […] angehende Männlichkeit durch […] Künstlermähnen unter Beweis stellen wollen.“ Dienstbücher 323 Richard Hey, Die schlafende Schöne in Formalin, Berlin 2003, S. 61. 324 Vgl. ebd., S. 61–67. Vgl. auch die Recherchen und gesammelten Berichte von Zeitzeugen, zusammengestellt im Auftrag der Stadt Frankfurt a. M. von Snejanka Bauer (Hg.), Jörgen Schmidt-Voigt. Mediziner, Musiker, Mäzen (1917–2004), Frankfurt a. M. 2010, insbesondere die Berichte und Ergebnisse von Manfred Capellmann (S. 37–46) und Hans Böckler (S. 47–71). 325 Erinnerungen von Heinz Städtler. In: Hans Böckler (Hg.), Schule in der Kriegszeit 1939 bis 1945. Dokumentarbericht und Erinnerungen von Zeitzeugen der ehemaligen Falk-Mittelschule Frankfurt/Main-Borkenheim. 100 Jahre Falkschule, Frankfurt a. M. 2005, S. 47.
338
Massenmobilisierung
und Ausweise wurden inspiziert.326 Inakzeptabel schien, wenn sich Jungen und Mädchen einander näherten, während sie Uniform trugen. Eine irritierende Kontrollwut beherrschte die Staatsjugend in zunehmendem Maße. Der SRD sollte gegen „das Rauchen schärfstens vorgehen“, den „soldatischen Haarschnitt […] restlos durchsetzen“, Trampen „energisch bekämpfen“ oder gegen „Sittlichkeitsvergehen […] mit äußerster Strenge“ einschreiten.327 Unterführer wandten auch zunehmend Gewalt gegen Jüngere an. Die Dienststellen mussten, weil sich die Beschwerden häuften, betonen, dass das „Schlagen von Hitler-Jungen im Dienst strengstens verboten“ sei. Ein Unterführer dürfe sich keineswegs und nicht ausnahmsweise „dazu hinreißen lassen, einen Jungen zu schlagen“.328 Das Propaganda- und Idealbild, das die Staatsjugend vom aufrechten und folgsamen Mädchen und Jungen zeichnete, forderten junge Menschen mitunter bewusst heraus. Der Gebietsführer von Oberschlesien machte seinem Ärger Luft, dass die „Repräsentanten des Deutschtums […] im allgemeinen äußeren Erscheinungsbild einen furchtbar schlechten Eindruck“ machten.329 Der Hauptbannführer in Dresden, Wilhelm Gause, wetterte Anfang 1943 über „Meckerer und Miesmacher“ und „alle Halben und Lauen“, gegen welche die Hitlerjugend schärfsten Kampf führe.330 Wer ihrem Tugendkatalog nicht entsprach, wurde sanktioniert. Häufig drängte man auf diese Weise junge Menschen in subkulturelle Milieus jedoch erst hinein. Weil Dienststellen, SRD, Polizei und HJ-Gerichte selbst bei kleinsten Bagatellen oft mit Härte reagierten, leisteten sie dem Phänomen, das sie zu bekämpfen vorgaben, manchmal sogar Vorschub.331 Nicht alles, was die höheren Dienststellen beklagten, war auf aufkeimenden Oppositionsgeist zurückzuführen oder eine reale Gefahr ihres Verfügungsanspruchs. „Mit der Disziplin war es aber nicht mehr weit her“, erläuterte beispielhaft ein ehemaliges Kriegskind: „1944 […] gehorchten die ‚Pimpfe‘ ihren Jungvolkführern nicht mehr.“ Unnachgiebig seien insbesondere „Söhne von vermeintlich
326 Herbstappelle. In: GB: Pommern, K5/41 vom 15.10.1941. 327 Übertretung des Rauchverbots für Jugendliche. In: GB: Oberschlesien, K2/42 vom 20.4.1942; Soldatischer Haarschnitt. In: GB: Moselland, 4/42 vom 15.5.1942; Überwachung der Gefährdung der Jugend gemäß den Arbeitsrichtlinien der Hitler-Jugend AR. 8/30 vom 1.6.1940, und den Richtlinien für den HJ-Streifendienst vom 1.6.1938. In: Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 11: Streifendienst und Überwachung, S. 936–953, hier 942 und 946. 328 Schlagen von Hitler-Jungen. In: GB: Westmark, 6/44K vom 26.4.1944. 329 Grußpflicht. In: GB: Oberschlesien, K2/41 vom 19.5.1941. 330 Die Hitler-Jugend duldet keine Außenseiter. Führerappell anlässlich des Führerwechsels im Bann Dresden. In: Der Freiheitskampf vom 17.1.1943. „Kampf allem Halben und Lauen“ war Anfang 1942 zudem eine Parole für die HJ-Schaukästen. Im Gebiet Niederdonau zeigte man sich mit der Aktion zufrieden, merkte aber zugleich an, dass „sich bedauerlicherweise nicht alle Banne daran beteiligt“ hätten. Schaukastenwettbewerb. In: GB: Niederdonau, 5/42K vom 20.4.1942. 331 Vgl. Einschätzung bei Köster, Jugend, Wohlfahrtsstaat und Gesellschaft im Wandel, S. 358–361.
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
339
oppositionellen Eltern“ verfolgt und über den Sportplatz gehetzt worden.332 In Hamburg-Altona trat die Hitlerjugend 1940 mit einem Rundbrief an die Eltern heran; das Gebiet reichte das Schreiben anderen Stadtteilen als mustergültig weiter. Man warb um Verständnis für die Probleme mit den Unterführern: „Zu Beginn des Krieges wurden die […] bewährten Kräfte der HJ-Führerschaft eingezogen, um als Soldaten in der grauen Armee ihre Pflicht zu erfüllen. Wir mussten auf jüngere Führer zurückgreifen, die in den vergangenen Monaten sich bemüht haben, mit den neuen größeren Aufgaben […] zu wachsen, um sie richtig erfüllen zu können. Dass die Einsetzung verschiedener Jungen und neuer Führer kleine Missverständnisse oder Reibungen mit sich gebracht hat, wird Sie bei der Lage der Dinge nicht überraschen. […] Jungen im Alter von 14 bis 15 Jahren sind keine Musterknaben und es werden ihnen selbst dann, wenn sie in der HJ mit einer Führungsaufgabe betraut werden, dann und wann Fehler unterlaufen, die einem erfahrenen HJ-Führer nicht passieren würden.“333
Diverse Probleme setzten sich in stärkerem Maße fort, die man aus früheren Jahren kannte. Junge Leute lärmten nach Dienstschluss auf dem Heimweg, Klassenzimmer oder Gebäude, in denen Dienst stattfand, wurden beschädigt, Sachen entwendet, Türen aufgebrochen, Plakate heruntergerissen. Manche Schulakten enthalten die Berichte der Lehrerschaft oder Direktoren und ihre Klagen. Kleinstdelikte kamen, anders als in den 1930er-Jahren, gewiss seltener zur Anzeige, da die Schulen im Regelfall scheuten, sich mit der örtlichen Hitlerjugend und Partei anzulegen.334 Kinder und Jugendliche behinderten den Straßenverkehr, es wurde an Bahngleisen gespielt. In Köln drangen im Herbst 1942 mehrere Hitlerjungen in leerstehende Gebäude und Befestigungsanlagen der Wehrmacht ein und richteten Schäden an. Dienststellen drohten mit „empfindlichen Bestrafungen“.335 Selbst aus ländlichen Regionen kamen solcherlei Berichte: Entlang von Wanderrouten seien die Schilder abgeschlagen oder Hütten beschädigt worden. Die jungen Unterführer sollten im Dienst Warnungen verlesen und Bericht erstatten, sobald sich ihre Kameraden solcher Taten rühmten.336 Sogenannte Kinderbrandstiftungen thematisierte die RJF 1941: „Es
332 Gerhard Rabe, Jugend unterm Hakenkreuz. Deutsches Jungvolk „DJ“ in der Hitlerjugend in Menninghüffen. Eine fragmentarische Privat-Dokumentation, S. 18 (http:// www.zellentrakt.de/downloads/materialien/Gerhard_Rabe.pdf; 15.7.2020). 333 Elternrundbrief. In: GB: Hamburg, Ausgabe B: 2/40, o. D. 334 Vgl. Konstantin Hermann, Tolerierte Devianz? Jugendpolitik und Jugendkriminalität in Sachsen. In: Mike Schmeitzner/Clemens Vollnhals/Francesca Weil (Hg.), Von Stalingrad zur SBZ. Sachsen 1943 bis 1949, Göttingen 2016, S. 407–425, hier 412 f.; als Beispiel vgl. Abreißen von Plakaten. In: GB: Moselland, K3a/41 vom 15.3.1941: „Es wird darauf hingewiesen, dass in der letzten Zeit die Beschädigung von Plakaten an den öffentlichen Anschlagstellen einen großen Umfang angenommen haben.“ 335 Beschädigungen in Festungsanlagen der Wehrmacht. In: GB: Köln-Aachen, K5/42 vom 1.9.1942. 336 Vgl. folgende knappe Auswahl: Beschädigung und Diebstahl. In: BB: Sachsen, 4/43 vom 1.5.1943; HJ-Gerichtsbarkeit. In: GB: Gebiet Hochland, K3/11 vom 15.11.1939; Unwürdiges oder das Ansehen der Hitler-Jugend schädigendes Verhalten. In: BB: Gebiet
340
Massenmobilisierung
ist […] mitgeteilt worden, dass die Kinderbrandstiftungen besonders auf dem Lande wieder erheblich zunehmen. Hierdurch gehen wertvolle unersetzliche Erntevorräte und andere Lebensmittel für die Volksernährung verloren.“337 Das Regime machte insbesondere junge KLV-Verschickte für die gefährlichen Zündeleien verantwortlich.338 Weil die HJ-Führer zehntausendfach an der Front standen, befanden sich HJ- und Jungvolk noch weniger unter Aufsicht als bislang. Zuletzt wurden selbst unter überzeugten Parteisoldaten und hohen Staatsführern Zweifel an den Fähigkeiten der Hitlerjugend laut. Lina Heydrich, Witwe des in Prag 1942 getöteten ehemaligen Chefs des Reichssicherheitshauptamtes, ist ein Beispiel aus der höheren Riege. Sie schrieb Heinrich Himmler im Sommer 1944 einen bemerkenswerten Brief, in dem sie bat, dass ihr Sohn vom DVJ-Dienst freigestellt werden möge. Die Prager Hitlerjugend müsse momentan mit vielen Unterführern Vorlieb nehmen, die „nicht immer geeignet sind, das kostbare Gut der Familie, die Kinder, so zu leiten, wie wir es uns wünschen“.339 Nicht mehr unter Aufsicht, irrten sie uniformiert in Prag umher, täten keinen Dienst. Der Gebietsführer liege wegen eines Zusammenbruchs im Krankenhaus und sei nicht in der Lage, die Hitlerjugend zu führen. In einem Ferienlager, das ihr Sohn zu Pfingsten besucht habe, sei die Versorgungslage lediglich für zwei Tage gewährleistet gewesen. Schonungslos offen, zudem völlig unbeeindruckt davon, wie die Klagen auf Himmler möglicherweise wirken konnten, schilderte die Witwe Heydrich desaströse Zustände. Himmler, mit der Vormundschaft des Jungen betraut, widersprach nicht einmal. Die Teilnahme des Jungen „am HJ-Dienst für die Dauer des Krieges“ könne er „nicht verantworten“, schrieb er zurück. Der Zehnjährige wurde freigestellt.340 Die HJ-Dienststellen kämpften dabei nicht nur gegen imaginierte oder selbstgeschaffene Disziplinlosigkeit an. Von 1939 bis 1943 stieg die Zahl gerichtlich verurteilter Jugendlicher auf fast 60 000, eine Steigerung zur Vorkriegszeit um mehr als 130 Prozent. Den Großteil machten Eigentumsdelikte aus.341 Das Regime sah die Gründe – teils zutreffend – in verringerten Möglichkeiten zur Aufsicht durch die Hitlerjugend. Bis Mitte 1942 waren rund 7 500 HJ-Führer an der
Mittelfranken, 1/41 vom 19.10.1941; Beim HJ-Dienst zu verlesen. In: GB: Moselland, K10a/41 vom 15.10.1941; Mehr Achtung vor fremdem Eigentum. In: BB: Gebiet Hochland, 1/44 vom 13.11.1944. 337 RdErl d. RMfWEV [Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung], 6.9.1941, Verhütung von Kinderbrandstiftungen. In: Vorschriftenhandbuch der HitlerJugend, Gruppe 8: Allgemeines Verhalten, S. 662. 338 Vgl. Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 378. 339 Lina Heydrich an Reichsführer SS, Heinrich Himmler vom 11.7.1944. In: Helmut Heiber (Hg.), Reichsführer! Briefe an und von Himmler, Stuttgart 1968, S. 340 f. 340 Heinrich Himmler an Lina Heydrich vom 20.7.1944. In: ebd., S. 342. 341 Vgl. Statistische Übersicht zur Jugendkriminalität (BArch Berlin, R 22/1165, Bl. 106– 110); vgl. im Zusammenhang Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 403–410.
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
341
Front getötet worden. Immer mehr junge Männer rückten nach.342 Die Kriegssituation begünstigte Kriminalität, besonders die „Massenbewegungen“ etwa im Zuge von Evakuierungen, der KLV oder den sogenannten Umsiedlungsaktionen. Die nächtliche „Verdunkelung“ in den Großstädten schaffte Gelegenheiten, um sich unbemerkt durch Straßen und Gassen zu bewegen. Dem Regime galt darüber hinaus der Einsatz von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern als begünstigender Faktor für kriminelle Handlungen. Der Kontakt Jugendlicher – primär in der Agrarwirtschaft – mit sogenannten Fremdvölkischen ließ sich nicht in Gänze unterbinden.343 Das macht deutlich: Von Jugendkriminalität kann ohne Differenzierung schwer gesprochen werden. Die von der Staatsmacht Verfolgten und von Gerichten Abgeurteilten waren mindestens zum Teil politische Gegner oder junge Menschen, die sich nicht in die „Volksgemeinschaft“ einordneten. Was als kriminell verfolgt wurde, ist also – nach rechtsstaatlichem Verständnis – deshalb nicht automatisch auf kriminelle Delikte oder echte Straftatbestände zurückzuführen. Andererseits hat es die „konventionelle“ Kriminalität – also jene Straftaten, die in liberalen Rechtsordnungen genauso geahndet werden – in der NS-Herrschaft selbstverständlich ebenfalls gegeben. In Einzelfällen fällt es heute schwer, politische Verfolgung und konventionelle Kriminalitätsbekämpfung voneinander zu trennen. Beides fiel oft zusammen.344 Mit Kriegsbeginn begann die RJF, Daten zur jugendlichen Schwerstkriminalität auszuwerten. Man wollte sich einerseits über die Entwicklung im Bilde halten, andererseits Aussagen über die Kriegsauswirkungen auf die Hitlerjugend ableiten. Neben Raub, Diebstahl, Urkundenfälschung oder Körperverletzung ermittelte man auch „Sittlichkeitsdelikte“, insbesondere in Hinblick auf Homosexualität oder den Kontakt mit sogenannten Fremdvölkischen. Ihre Analysen stellte die RJF für den Dienstgebrauch Ende des folgenden Jahres bereit. Den Daten und Schlussfolgerungen ist nicht durchweg zu trauen, zumal die RJF alles tat, um den positiven Einfluss der Hitlerjugend herauszustellen. Ergiebiges birgt das Material dennoch. In Berlin nahmen die Delikte im ersten Halbjahr 1940 mit einer Steigerung von 142 Prozent massiv zu. Westfalen, Niedersachsen, Mecklenburg, Thüringen und die Steiermark wiesen sehr unterschiedliche, eher moderate Steigerungsraten von vier bis 46 Prozent auf. In einzelnen urbanen Regionen wie Düsseldorf, Köln-Aachen und Ruhr-Niederrhein war zunächst wenig an Veränderung zu sehen. Bei den Großstädten lagen Berlin und 342 Vgl. Bericht des Stabsführers der Reichsjugendführung Helmut Möckel über die Tätigkeit der HJ während des Krieges vom 18.5.1942. In: Jahnke (Hg.), Eine Dokumentation, S. 426–428. 343 Vgl. Georg Erbersbach, Die Jugend nach vier Jahren Krieg. In: Das Junge Deutschland, (1943) 37, S. 198–208; vgl. beispielhaft Anweisungen der Generalstaatsanwaltschaft am Oberlandesgericht Dresden u. a. an Landesgerichtspräsidenten und Richter über Strafverfahren gegen Jugendliche wegen Verkehrs mit Fremdvölkischen vom 20.4.1943 (HStA Dresden, 11065, 329, unpag.). 344 Eine Auseinandersetzung mit Problemen der historischen Kriminalitätsstatistik umfangreich bei Frank Kebbedies, Außer Kontrolle. Jugendkriminalpolitik in der NS-Zeit und der frühen Nachkriegszeit, Essen 2000, S. 146–162.
342
Massenmobilisierung
Hamburg hinsichtlich der Zahl der Straftaten kaum überraschend vorn; es folgten Köln, Leipzig, Essen, Breslau, Frankfurt am Main, Dortmund, Hannover, Duisburg und Stuttgart. Die RJF wollte wissen, zu welchem Anteil die straffällig gewordenen Jugendlichen der Hitlerjugend angehörten. Diese Daten wiederum basierten auf den Überwachungskarteien des SRD sowie den Meldungen von Polizeibehörden. Von 17 173 auf diese Weise erfassten Straftätern unter 18 Jahren waren 6 216 nicht durch die Hitlerjugend erfasst. Die Mehrheit besaß also die Mitgliedschaft, viele taten vermutlich Dienst. Die RJF verwies sogleich darauf, dass die Daten keine verlässliche Vergleichsgrundlage für die „Kriminalitätsbelastung“ von Mitgliedern gegenüber Nicht-Mitgliedern böten. Aber der Befund widersprach der eigenen propagandistischen Außendarstellung, wonach Straftaten eben nur von „asozialen“ Jugendlichen verübt wurden, die sich gänzlich außerhalb jedes Einflusses der Hitlerjugend bewegten.345 Diese Daten erhob die RJF nach 1940 offenbar weiterhin, allerdings wurden keine Statistiken mehr für den Dienstgebrauch zusammengestellt. Sie hätten wahrlich kein gutes Licht auf die Hitlerjugend geworfen. Die Jugendkriminalität nahm zu.346 Insbesondere in größeren Städten wurde nach 1939 das sogenannte Organisieren zum Alltag. Der Begriff ist seit Langem vor allem unter Militärs geläufig. Was man nicht bezahlen konnte, in Läden fehlte oder worauf man ein Auge geworfen hatte, beschaffte man sich auf Umwegen oder durch Diebstahl. Weil man es gemeinsam als Gruppe, zum Nutzen der Einheit oder Formation tat, hieß es, dass man sich Dinge „organisiere“. Die Gebietsführung in Bayern sprach das Phänomen mit Blick auf München Anfang 1941 an: „Es ist notwendig, einmal klar herauszustellen, dass Diebstahl, Diebstahl bleibt, auch wenn er für die Hitler-Jugend vorgenommen und dann mit ‚Organisieren‘ bezeichnet wird.“347 Das „Sammeln“ oder eben „Organisieren“ hatte es in der Parteijugend schon in den 1930er-Jahren gegeben; darauf ist hier schon hingewiesen worden. Ein Junge, der 1934 einige Tage in einem Zeltlager verbrachte, ließ den Begriff im Tagebuch beiläufig fallen: Man habe sich gemeinsam Feuerwerkskörper „organisiert“. Einer der Jungen sei erwischt worden, habe beim Bannführer antreten müssen: „Ist aber weiter nichts los.“348 Es blieb nun nicht mehr bei derartigen Jugendstreichen, denn die Kriegssituation hatte die Lage massiv verändert.
345 Vgl. Jugendführer, Kriminalität und Gefährdung, S. 38–43, hier 39. 346 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 481; Martin Bormann an die Reichs- und Gauleiter über den Stand und die Entwicklung der Jugendkriminalität vom 29.8.1944. In: Jahnke (Hg.), Eine Dokumentation, S. 468–470, hier 471: „Die Jugendkriminalität stieg auch im ersten Halbjahr 1944 an, ohne dass dies etwa durch eine erhöhte Straffälligkeit der Ausländer bedingt war.“ 347 „Organisieren“. In: GB: Hochland, K3/41 vom 15.2.1941. 348 Gruppenbuch des Sturmvogel Berlin (1932–1937), Eintrag vom 20.5.1934 (NSDOK Köln, EzG, jugend1918-1945.de; 4.1.2021).
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
343
Das Ausmaß des sogenannten Organisierens nahm nach Kriegsbeginn zu. „Es ist so weit gekommen“, hieß es im Gebiet Westmark, „dass Dinge, die auf unrechtmäßige Art und Weise besorgt wurden, ob nun für die Gemeinschaft oder für den Einzelnen […] mit dem Begriff des ‚Organisierens‘ gedeckt worden sind.“349 In Großstädten wie München, Berlin, Hamburg, Köln oder Frankfurt am Main war der Diebstahl durch die Hitlerjugend offenbar durchaus verbreitet. Konstantin Hermann hat bei seiner Analyse der Jugendkriminalität für den Raum Sachsen den wichtigen Hinweis gemacht, dass die Hitlerjugend „willkommene Strukturen für Jugendkriminalität, vor allem im Bereich der Gruppenkriminalität“ geboten habe.350 Einerseits nämlich entzog die Hitlerjugend junge Menschen der Aufsicht durch ihre Eltern, andererseits standen bei Weitem nicht genügend personelle Ressourcen zur Verfügung, um junge Menschen andauernd zu beaufsichtigen. Der kämpferische Impetus der Hitlerjugend ließ zudem illegale Handlungen als Abenteuer und revolutionären Akt erscheinen. Mancher Unterführer tarnte das Stehlen möglicherweise sogar als eine Bewährungsprobe für sich und die Kameraden. Jugendliche kamen gelegentlich an Geld, indem sie uniformiert, wodurch es häufig nicht auffiel, „Spenden“ auf den Straßen sammelten – und dies dann oft für fiktive Zwecke.351 In Hamburg nahmen die Straftaten 1940 im Vergleich zum Vorjahr bereits stark zu. Fast 38 Prozent der dort Verurteilten unter 18 Jahren taten in HJ oder im BDM Dienst.352 Polizei, Justiz und zuständige Stellen suchten nach Erklärungen: „Endlich darf auch die Einberufung der HJ-Führer zur Wehrmacht nicht unerwähnt bleiben, was auch in der HJ eine Lockerung der Disziplin bewirkt hat. Die Verringerung der Beaufsichtigung der Jugendlichen in Verbindung mit einer zu starken Betonung der Bedeutung der Jugend […] führt vielfach zu einem übertriebenen Selbstgefühl der Jugendlichen. […] Bei den Eigentumsdelikten wirkt sich der Krieg auch insofern aus, als die Jugendlichen heute immer damit rechnen können, dass sich die gestohlenen Gegenstände leicht wieder absetzen lassen.“353 Delikte begründeten sich vielfach aus der Notsituation, die in den letzten Kriegsjahren vermehrt – nicht mehr nur in Städten – spürbar wurde. Die Jugendkriminalität nahm im Zweiten Weltkrieg nicht nur in Deutschland, sondern beispielsweise auch in Großbritannien zu. Die Nationalsozialisten bereiteten aber oft selbst den Boden für Kriminalität. Gerade Außenseiter wurden in die Beschaffungskriminalität genötigt, denn ab Herbst 1943 erfolgte die Ausgabe von Lebensmitteln und Sachgütern – wie zuvor bereits erwähnt – über die
349 Begriff des „Organisierens“. In: GB: Westmark, 13/43 vom 9.7.1943. 350 Hermann, Tolerierte Devianz?, S. 411. 351 Aus der Vielzahl ein Beispiel: Sammelverbot. In: BB: Gebiet Ostpreußen, 2/42 vom 5.1942. 352 Vgl. Helmut Flemming, Die Jugendkriminalität in Hamburg im Jahr 1941 unter besonderer Berücksichtigung der Verordnung zur Ergänzung des Jugendstrafrechts vom 4. Oktober 1940, Hamburg 1943, S. 19. 353 Ebd., S. 78.
344
Massenmobilisierung
HJ-Registrierung. In Hamburg stand bereits 1941 in der Liste von Jugendstraftaten der Diebstahl von Nahrungsmitteln quantitativ an dritter Stelle. Ein Doktorand, der das Phänomen in der Hansestadt analysierte, erkannte zutreffend, dass „die betreffenden Jungen keine Lebensmittelkarten“ besaßen. Sie waren daher „schon fast darauf angewiesen, zu stehlen“.354 Wer weder Karte noch regelmäßige Dienstnachweise besaß, weil er sich der Hitlerjugend verweigerte oder ausgeschlossen worden war, musste andere Wege finden. Manche Einbrüche sowie ein Anstieg im Bereich der Urkundenfälschung standen ebenfalls damit im Zusammenhang. In Hamburg wurde 1942 in mehrere Dienststellen der Hitlerjugend eingebrochen.355 Neben Sachschäden oder aufgebrochenen Kassen beklagte man nach Einbrüchen häufig die Entwendung von Dienststempeln und Testaten. Problematisch wurde es, wenn die Siegel einer lokalen oder höheren Dienststelle verloren gingen.356 Mit ihnen ließ sich die Teilnahme an der Hitlerjugend vortäuschen. Ebenso konnten Fälschungen von Ausweisen angefertigt werden. Manche Unterführer nutzen ihre Stellung aus, um aus der Not anderer ihren Vorteil zu ziehen. Fälschern mit „gewinnbringender Absicht“ hatte die Hitlerjugend schon 1937 eine Zuchthausstrafe von nicht unter drei Monaten angedroht.357 In Baden sah sich das Führerkorps nach 1939 wiederholt veranlasst, zu betonen, dass „die selbstständige Anfertigung von Dienstsiegeln und Dienststempeln […] streng untersagt“ und nur für höhere Dienststellen zulässig sei.358 Gegen Zahlung oder als Freundschaftsdienst wurden die Stempel und Urkunden gehandelt – ein Problem, das besonders die HJ betraf. Manfred Omankowsky, in einem sozialdemokratischen Elternhaus 1927 geboren, berichtete über seine Jugendzeit in der Swing-Szene Berlins. Im Jungvolk und in der HJ sei er zu keiner Zeit aktiv gewesen. In seinem nahen persönlichen Umfeld habe es außerdem nur wenige gegeben, die eine Uniform trugen – nur in der Schule, wenn es für einen feierlichen Anlass erwartet wurde: „Ich hatte nur einen Freund, der in der HJ war, sogar als Führer, dem nahm ich das aber nicht übel. Denn man konnte damals nur in einen Sportverein eintreten, wenn man regelmäßig nachwies, dass man zum HJ-Dienst ging. […] Mein Freund hatte uns anderen dann immer die Nachweisstempel von der HJ besorgt.“359
354 Flemming, Die Jugendkriminalität in Hamburg im Jahr 1941, S. 19. 355 Vgl. Meldung von Einbrüchen und Diebstählen in Dienststellen der Hitler-Jugend. In: GB: Hamburg, 4/42K vom 4.1942; Mehr Achtung vor fremdem Eigentum. In: BB: Hochland, 1/44 vom 13.11.1944. 356 Vgl. Dienstsiegelverlust. In: GB: Wartheland, 2/41/K vom 1.3.1941. Bei Verlust oder im Falle von Diebstahl musste sofort Meldung beim Gebiet und der Polizei erstattet werden; Dienstsiegel, Dienststempel. In: GB: Wien, 15/43 vom 15.11.1943. Umfangreiche Warnung vor einem „Schwindler“ mit entwendetem Bann-Dienstsiegel beispielhaft in: GB: Thüringen, 12/36 vom 16.12.1936. 357 Mitgliedsausweise. In: GB: Franken, 3/37 vom 1.3.1937. 358 Anfertigung von Dienstsiegeln und Dienststempeln. In: GB: Baden, 16/K vom 1.3.1941. 359 Interview mit Manfred Omankowsky. In: Lange, Meuten, Swings und Edelweißpiraten, S. 160–166, hier 160.
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
345
In größeren Städten entstand eine Art Schattenmarkt für Stempel und Nachweise. Die einschlägige Historiografie zur Hitlerjugend hat sich diesem verbreiteten Phänomen erstaunlicherweise bislang kaum gewidmet. Manche Unterführer bestellten die Dienststempel mehrfach und mit dem Ziel, damit Handel zu treiben.360 Schon im ersten Halbjahr 1940 hatten Urkundenfälschung und Betrug nach Diebstählen sowie „Sittlichkeitsdelikten“ an dritter Stelle der Straftaten von Jugendlichen gestanden.361 In Wien verurteilte man im Sommer 1942 einen Jugendlichen zu Arrest, weil er überführt worden war, wie er bei einem Hersteller unter Angabe eines falschen Namens die Anfertigung eines Dienstsiegels in Auftrag gab, da er sich und seine Freunde wahrscheinlich mit illegalen Dokumenten versorgen wollte.362 In Österreich wurde auf einen weiteren, ähnlich gelagerten Fall hingewiesen. Bei einem Jugendlichen, der aus der Hitlerjugend ausgeschlossen worden war, hatten es die örtlichen Dienststellen versäumt, seinen Ausweis einzuziehen. Diesen Ausweis gab er dann einem Freund, der in der HJ nicht erfasst war. Dieser radierte den Namen aus und setzte nun den eigenen hinein. Damit konnte er sich durchlavieren, bevor er am Ende aber doch auffiel.363 Die kleinen und größeren Ausweisfälscher könnten – warnte die RJF – zu „Verbrecherkarrieren“ heranwachsen: Ein HJ-Kameradschaftsführer, der sich in einem Landjahrlager im Sauerland als Helfer betätigte, fiel auf, weil er illegal Papiere anfertigte und verbreitete. Der junge Mann, so ein Bericht 1942, sei „flüchtig und wird von der Staatsanwaltschaft Hannover gesucht. Bereits bei einer früheren Flucht war [er] an die Gebietsführung in Königsberg herangetreten, um als Hauptstammführer in einem Bann eingesetzt zu werden. Es ist zu erwarten, dass [er] sich wiederum an Dienststellen der Hitler-Jugend, eventuell mit gefälschten Ausweisen oder unter falschem Namen, heranmacht.“364 Die Motive der kleineren und größeren Fälscher sind kaum noch aufzuklären. Kriminelle Energie spielte im Einzelfall sicher eine Rolle, manches war auf Verweigerung zurückzuführen, vereinzelt kam ein politisches Motiv hinzu. Im Regelfall fielen Jugendliche nur auf, wenn sie illegale Papiere wie Dienstkarten mit ungültigen Stempeln oder Ausweise mit falschem Geburtsdatum bei sich führten. In solchen Angelegenheiten wurden die HJ-Gerichte tätig, die mit disziplinarischen Maßnahmen wie Jugenddienstarrest – dem „Wochenendkarzer“ für mehrere Tage – ahndeten. Wenn Diebstahl, „Bandenbildung“, Raub,
360 Vgl. Stempelbeschaffung. In: GB: Baden, 2/39 vom 18.2.1939. 361 Vgl. Jugendführer, Kriminalität und Gefährdung, S. 40. 362 Vgl. Jugenddienstarrest. In: GB: Wien, 9/42K vom 1.7.1942. 363 Vgl. Mitgliedsausweise. In: GB: Niederdonau, A4/39 vom 1.4.1939; wiederum Warnungen aufgeführt in: ebd., A6/39 vom 20.4.1939. Ein weiteres Problem bestand darin, dass Ausweise nach Beendigung der Hitlerjugendzeit mit dem 18. Lebensjahr nicht eingezogen wurden. Prinzipiell war es erlaubt, einen Ausweis als „Andenken“ zu behalten. Er musste lediglich mit einem Stempel „als Personalausweis ungültig“ erklärt werden. Dazu kam es offenbar aus Nachlässigkeit in zahlreichen Fällen nicht; vgl. Ausscheiden aus der Hitler-Jugend. In: GB: Saarpfalz, A8/39 vom 29.8.1939. 364 Warnung vor [Anonymisiert]. In: GB: Baden-Elsass, K/11/42 vom 1.11.1942.
346
Massenmobilisierung
„ Rundfunkverbrechen“ oder Körperverletzung hinzukamen, erfolgte in der Regel justizielle Ahndung und der Ausschluss aus der Hitlerjugend.365 Das Phänomen der Urkundenfälschung war nicht neu. Ähnlich wie beim „Organisieren“, das man aus der Phase der „Machtergreifung“ kannte, hatte es den Handel mit illegalen Papieren und Stempeln bereits in den 1930er-Jahren gegeben. Während des Krieges nahmen diese Delikte aber eine neue Dimension an. Hinzu kam, dass amtliche Dokumente durch Unachtsamkeit und Leichtfertigkeit verlorengingen und in fremde Hände fielen. Schon 1937 hatte man im Gebiet Hessen-Nassau geklagt, dass Stempel und Testate „in unerhört leichtfertiger Weise aufbewahrt“ würden.366 In Ballungsgebieten mussten nun regelmäßig Dienststempel für ungültig erklärt werden; neue Zweit- oder Dritt ausfertigungen enthielten den Zusatz „b“ oder „c“ als Kennzeichen, was die Verwirrung für SRD-Kontrolleure eher verstärkte als beseitigte.367 Fälschungen waren im Krieg derart verbreitet, dass der HJ-Streifendienst im Zweifelsfall gleich alle Papiere einzog. In Hamburg klagte die Gebietsführung, dass vom SRD massenhaft einkassierte Ausweise „wochenlang […] auf Dienststellen herumliegen und niemand weiß, wo sie hingehören und was mit ihnen los ist, während der Betreffende, dem dieser Ausweis gehört, keinen Nachweis für seine Zugehörigkeit zur Hitler-Jugend in seinem Besitz“ habe.368 Auch Schlamperei war in den örtlichen Dienststellen offenkundig an der Tagesordnung. In Pommern stellte die Führung Mitte 1944 fest, dass sich diese Tatsache „Schwindler jeden Alters“ zunutze machten: „Sie tarnen ihre verbrecherischen, unsittlichen oder landesverräterischen Absichten, indem sie sich als Hitler-Jugend-Führer bis zu höchsten Dienstgraden ausgeben. […] Andere Schwindler geben sich als Bombengeschädigte aus, um Lebensmittelmarken, Geld, Ausweise usw. zu erlangen. […] Finanzielle oder sonstige Unterstützungen und Ausweisausstellung an Unbekannte sind verboten. Zuwiderhandelnde Hitler-Jugend-Führer sind für entsprechende Schäden persönlich haftbar.“369 Wenige Wochen später unterstrich man erneut, dass – „wie mehrere krasse Fälle […] in einigen Gebieten“ zeigten – sich die jugendlichen Ausweisfälscher auf die grobe „Leichtgläubigkeit und Fahrlässigkeit der Führer von Einheiten und Dienststellenleiter“ verließen.370 Die Kriegsjahre gingen mit einer Zunahme im Bereich des Vandalismus einher, vor allem in größeren Städten. In einzelnen Fällen verwiesen sie auf die anwachsende Opposition in der Jugend: Häuser, Sitzbänke oder Mauern
365 Vgl. Beispiele für Ausweisfälschungen mit Jugenddienstarrest fast durchgängig in den GB: Baden-Elsass. 366 Vgl. Anweisungen zu Dienststempeln sowie zum Verlust von Dienststempeln. In: GB: Hessen-Nassau, A9/37 vom 10.8.1937. 367 Vgl. zur Verbreitung illegal hergestellter Stempel in den ersten Jahren der Diktatur beispielhaft: Warnung! In: BB: Berlin, 58/34 vom 21.9.1934. 368 Ausweisfälschungen. In: GB: Hamburg, 12/42K vom 12.1942. 369 Warnung vor Schwindlern. In: GB: Pommern, 10/44K vom 6.1944. 370 Uniform-, Ordensschwindler und Ausweisfälscher. In: ebd., 17/44K vom 9.1944.
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
347
wurden mit Symbolen aus der bündischen, katholischen oder sozialistischen Jugend verziert. Hinzu kamen pubertäre Schmierereien an und in HJ-Heimen.371 Ein politisches Motiv war in der Mehrzahl der Fälle aber wohl nicht gegeben. Vandalismus ging nicht nur von reinen Außenseitern, sondern auch von der Hitlerjugend selbst aus. Ein Lagebericht aus Koblenz 1944 führte beispielhaft auf, dass ein Jugendheim durch HJ-Angehörige derart beschädigt worden sei, dass man es der örtlichen Hitlerjugend habe wegnehmen müssen. Schlösser würden aufgebrochen, die elektrische Ortsbeleuchtung demoliert, ein Schwimmbad habe man schließen müssen. In den meisten Fällen sei man der Täter nicht habhaft geworden. Die Schäden könne man kriegsbedingt kaum reparieren.372 Reinhard Heydrich wiederum klagte 1942 über Anschläge auf die Reichspost durch Jugendliche. In der Mehrzahl hatte man HJ-Mitglieder festgesetzt.373 Nahe München wurden im Sommer 1944 entlang der Bahngleise Schäden festgestellt: „Es ist wiederholt vorgekommen, dass auf verschiedenen Bahnlinien des Bezirkes […] die Fernsprechbuden längs der freien Strecke erbrochen und beschädigt oder beraubt worden sind. Als Täter konnten in mehreren Fällen Jugendliche ermittelt werden.“374 Von der Staatsanwaltschaft Frankfurt wurde gemeldet, dass „in ländlichen Gegenden eine ernste Gefahr für die Nachrichtenübermittlung“ durch die Gewaltakte seitens Jugendlicher entstünde. Eine „Belehrung durch die HJ“ habe kaum Besserung gebracht.375 In Großstädten waren Jugendliche immer wieder auch in Einbrüche involviert. Verdunkelungen, die vor Luftangriffen schützen sollten, schirmten im gleichen Zuge junge Straftäter ab. Wiederum in München hatte die Justiz zu Kriegsbeginn bemerkt, dass „die verdunkelte nächtliche Großstadt für die halbwüchsige Jugend der Schauplatz romantischer, nächtlicher Streifzüge wird, die sehr leicht einen kriminellen Charakter annehmen“. Statistische Angaben habe man zwar nicht vorliegen, aber „alle auf diesem Gebiet tätigen Stellen“ würden übereinstimmen, dass „diese Zunahme der Kriminalität eine unbestreitbare Tatsache“ sei.376 In Leipzig
371 Vgl. Verbot des Beschmierens. In: GB: Mittelelbe, 1/K43 vom 12.1.1943. 372 Vgl. Bericht des SD-Abschnitts Koblenz über die Verwahrlosung der Jugend vom 15.6.1944. In: Brommer (Hg.), Die Partei hört mit, Band 2/2, S. 719–721; vgl. auch die Mitteilung der Kriminalpolizei Koblenz über Vandalismus im Rahmen einer Schrottsammelaktion der HJ. In: GB: Koblenz, K4/41 vom 1.4.1941. 373 Vgl. Beschädigung von Fernmeldeanlagen durch Jugendliche. In: GB: Pommern, 4/42K vom 4.1942. 374 Beschädigung und Beraubung von Fernsprechbuden. In: GB: Hochland, K7/44 vom 15.6.1944. 375 Bericht der Generalstaatsanwaltschaft (30.9.1943). In: Klein (Hg.), Lageberichte der Justiz aus Hessen, S. 255–258, hier 257. 376 Oberstaatsanwaltschaft München an das Reichsjustizministerium vom 7.12.1939 (BArch Koblenz, R22/1189), zit. nach Manuela Neugebauer, Der Weg in das Jugendschutzlager Moringen. Eine entwicklungspolitische Analyse nationalsozialistischer Jugendpolitik, Mönchengladbach 1997, S. 63. Weitere Beispiele aus Bayern, hier aber vor allem mit politischer Motivlage, bei Klönne, Jugendprotest und Jugendopposition, S. 607–620.
348
Massenmobilisierung
meldeten verschiedene Sicherheitsorgane Ende 1939 sehr unterschiedlich Befunde. Eine SD-Außenstelle in einem ländlichen Bezirk gab sich in Hinblick auf die Haltung der Jugend zuversichtlich. Die Disziplin sei „noch als gut anzusprechen“ und Fälle „sittlicher und moralischer Verwahrlosung“ seien nicht nennenswert vorgekommen.377 Im Stadtgebiet zeichnete man zeitgleich ein diametral anderes Lagebild. Durch die Verdunkelung sei „ein starkes Aufflammen der oppositionellen Jugend“ zu verzeichnen. Gruppen zögen mit „eintretender Dunkelheit johlend und grölend vor allem durch die Vororte“. Dabei würden Passanten belästigt und der BDM von jungen Männern angriffen. Die Sandsäcke vor Luftschutzkellern seien aufgeschnitten worden.378 Den Problemen wurde man nicht völlig Herr. Die Leipziger HJ teilte mit, dass Ende 1942 „jugendliche Schädlinge zu Gefängnis von unbestimmter Dauer verurteilt“ und aus der Staatsjugend ausgeschlossen worden seien – die mit dem Urteil zusammenhängende „Verordnung gegen Volksschädlinge“ war bereits am 5. September 1939 erlassen worden. Unter bewusster „Ausnutzung der zur Abwehr von Fliegergefahr getroffenen Maßnahmen“ hätten diese Jugendlichen „schwere Bandendiebstähle begangen“.379 In den Meldungen verquickte sich angebliche Jugendopposition immer wieder mit klein- und schwerstkriminellen Delikten. Meist ist es selbst heute und im Einzelfall schwer, zwischen politischer Motivation, Verfolgung und Kriminalität zu unterscheiden. Typisch lautete es in Anordnungen der RJF zur Überwachung: „Diese Gruppen, ob politisch oder unpolitisch, betätigen sich zumeist auch auf kleinkriminellem Gebiete: Diebstähle, liederlicher Lebenswandel, Belästigungen der Bevölkerung. […] Das zügellose Treiben dieser Gruppen hat bereits zu zahlreichen sittlichen und kriminellen Verfehlungen geführt. Durch das anstößige und undisziplinierte Auftreten dieser Jugendlichen wird das Ansehen der HJ erheblich geschädigt.“380 Die Probleme verschärften sich bei Kriegsende. Durch die Verwüstung Berlins und vor dem Hintergrund der Entwurzelung trat die Verrohung Jugendlicher eklatant zutage. Im Oktober 1944 konstatierte die Staatsanwaltschaft, dass seit Monaten „Bandendiebstähle Jugendlicher stärker als bisher in Erscheinung getreten“ seien. Ferner käme es zur Gewalt zwischen rivalisierenden Gruppen, meist in der Dunkelheit, und ebenso zu Übergriffen von Mitgliedern verschiedener „Horden“ auf Hitlerjungen – angeblich eine Folge von Rauflust sowie fehlender Erziehung.381 In Hamburg waren 1943, nach 377 Bericht der Außenstelle Oschatz des SD-Abschnitts Leipzig vom 5.12.1939 (IWM Duxford, Documents Captain Branney, Digitalisate im Archiv des HAIT, unpag.). 378 Inlandsbericht des SD-Abschnitts Leipzig vom 2.10.1939 (ebd.). 379 Dienststrafen der Hitler-Jugend. In: BB: Sachsen, 3/43 vom 1.4.1943. 380 Reichsjugendführung, Die Überwachung der Gefährdung der Jugend. Einsatzbefehl für den HJ-Streifendienst (SRD) vom 1.6.1940 (vertraulich!), S. 17 (HStA Stuttgart, E 151/09, Bü. 402). 381 Bericht des Staatsanwaltes beim Kammergericht Berlin vom 1.10.1944, zit. nach Siegfried Heimann, Das Überleben organisieren: Berliner Jugend und Berliner Jugendbanden in den vierziger Jahren. In: Christa Jancik/Berliner Geschichtswerkstatt (Hg.), Vom Lagerfeuer zur Musikbox: Jugendkulturen 1900–1960, Berlin 1985, S. 105–136, hier 114.
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
349
Bombardierungen und „Feuersturm“, jugendliche Cliquen durch Trümmer gezogen – auf der Suche nach Lebensmitteln, Kleidung und Verwertbarem, das auf dem Schwarzmarkt verkauft werden konnte. Partei und staatliche Stellen in anderen Regionen sahen sich daher veranlasst, vorbereitende Planungen anzugehen. Der sächsische Gauleiter Martin Mutschmann erwog Ende 1943 die Einrichtung von Sammellagern. Umherziehende Jugendliche, die der Hitlerjugend angeblich fernstünden, sollten nach Luftangriffen dort zur Vorbeugung eingewiesen werden.382 RJF und Staatsjugend sahen sich außerdem vermehrt Kritik ausgesetzt. Straftaten von jungen Menschen fielen auf ihre Leistungen zurück. Das macht eine Besprechung in Essen im Mai 1941 deutlich, die im Beisein der örtlichen HJ-Führung stattfand. Die Jugendkriminalität auf der einen Seite und die Staatsjugend auf der anderen Seite stellten die Beteiligten, jedenfalls in der Hinterzimmerprivatsphäre, in engen Zusammenhang. Der Kreisleiter drängte auf Razzien. Sie seien notwendig, um „Klarheit über die Drahtzieher und die tiefen Hintergründe der Disziplinlosigkeiten bzw. kriminellen Straftaten der HJ zu erhalten“. Man dürfe die vielen Vorkommnisse nicht bagatellisieren. Der Bannführer widersprach nicht, brachte sogar seinerseits Beispiele zur Sprache, um die Kommunalpolitiker zu überzeugen, dass nur ein hartes Vorgehen weiterhelfen werde.383 Das Regime reagierte mit einem Bündel aus Maßnahmen und strafrechtlichen Instrumenten. Verstöße gegen die Disziplinarordnung der Hitlerjugend unterlagen der Klärung von HJ-Gerichten, die beispielsweise über die Herabstufung in der Rangordnung oder – im Härtefall – Ausschlüsse befanden. Straftaten kamen gleichzeitig vor staatliche Jugendgerichte. Letztere waren auch zuständig, wenn die HJ-Dienststellen Arrest verhängen wollten. Die enge Zusammenarbeit beider Seiten sollte gewährleisten, dass die Jugendrichter im Idealfall zuvor als HJ-Richter tätig gewesen waren. Der Hitlerjunge Reimer Schaar – ein Beispiel unter vielen – hatte aufgrund langer Haare und „schlaffer“ Körperhaltung, so sah dies zumindest sein HJ-Führer, das Ansehen der Parteijugend schwer beschädigt. Im Sommer 1944 sollte er mit Jugendarrest bestraft werden. Der Einspruch des Vaters beim Amtsgericht Rendsburg scheiterte. Die Gebietsführung bestand gegenüber dem Jugendrichter mit Nachdruck auf Ahndung. Der entschied schließlich im Sinne der Hitlerjugend, geriet aber trotzdem unter Rechtfertigungsdruck. Weil er den Strafbescheid kurzfristig ausgesetzt hatte, bezichtigte die Hitlerjugend ihn der Verschleppung des Verfahrens. Der Richter versuchte gegenüber seinen Vorgesetzten die Vorwürfe auszuräumen, indem er sein langjähriges und freundschaftliches Verhältnis mit der Bannführung hervorhob. Zahlreichen Einladungen zu HJ-Veranstaltungen habe er regelmäßig
382 Vgl. Hermann, Tolerierte Devianz?, S. 414. 383 Protokoll einer Unterredung zwischen Kreisleiter, Stadtrat, Stadtrechtsrat, Stadtamtmann und Bannführer der HJ vom 13.3.1941 (StadtA Essen, Rep. 102, Abtl. XIV, 23 Bl. 60–63).
350
Massenmobilisierung
angenommen. Auch sonst seien sämtliche Vollstreckungsersuche, welche die HJ gestellt habe, stets unverzüglich und anstandslos erledigt worden.384 Das Strafrecht selbst wurde Zug um Zug verschärft. Im Oktober 1939 wurde die „Verordnung zum Schutz gegen jugendliche Schwerverbrecher“ erlassen, in deren Zuge Jugendliche nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden konnten. Hinzu trat die Verordnung des Ministerialrats für die Reichsverteidigung vom 4. Oktober bzw. 28. November 1940. Sie erlaubte den Jugendarrest per richterlicher oder polizeilicher Verfügung für die Dauer von bis zu einem Monat. Am 10. September 1941 gipfelte die Entwicklung in der Einführung der „unbestimmten Verurteilung“. Jugendliche Straftäter konnten demnach zu Gefängnis von unbestimmter Dauer, das hieß maximal vier Jahre, verurteilt werden, wenn aufgrund von allgemeinen „schädlichen Neigungen“ nicht absehbar schien, ob eine Wiedereingliederung in die „Volksgemeinschaft“ möglich sei. So konnten auch minderschwere Taten unabhängig vom Strafrahmen, der für die Tat rechtlich vorgesehen war, zu langem Gefängnisaufenthalt führen. Entscheidend sollten charakterliche Veranlagung und Entwicklungsprognose sein.385 Die Verfolgung oppositioneller Jugendlicher wurde von der staatlichen Justiz ohnehin zunehmend abgekoppelt. Die ab 1940 eingerichteten „Jugendschutzlager“ – die im folgenden Kapitel Thema sein werden – unterstanden direkt der Kriminalpolizei. In den Lagern Moringen bei Göttingen für Jungen und in Ravensbrück für Mädchen wurden nicht nur konventionelle Straftäter eingewiesen, sondern auf Antrag der Jugendämter – später auf Wunsch weiterer Stellen – all jene, die „besonders […] gefährdet“ schienen; wenn Erziehungsmaßnahmen bereits versagt hatten oder deren Anwendung angeblich „von vornherein erfolglos“ schien.386
384 Vgl. zum Fall Neugebauer, Moringen, S. 128; vgl. auch Helmut Möckel, Der Jugendrichter. In: Deutsches Jugendrecht, (1941) 1, S. 19–22, hier 22: „Ich erwarte, dass der Nachwuchs an Jugendrichtern in Zukunft mehr und mehr aus den Reihen der Hitler-Jugend hervorgehen wird und dadurch auch die praktische Jugendrechtspflege noch stärker Ausfluss des Geistes der Jugend wird, die an der Gesetzgebung des Jugendrechts bereits seit langem fördernd und gestaltend mitwirkt.“ 385 Vgl. die Vorträge u. a. von Staatssekretär Freisler und Ministerialrat Eichler in der Mappe „Zur Einführung der unbestimmten Verurteilung Jugendlicher. Referate gehalten auf der Reichsrichtertagung am 30. Oktober 1941 im Reichsjustizministerium“, o. D. (GLA Karlsruhe, Abt. 240, 1987-35, 689, Bl. 219–271); Unbestimmte Verurteilung Jugendlicher. In: Deutsche Justiz, 1942, B, Nr. 3, S. 8–12; vgl. auch Petra Götte, Jugendstrafvollzug im „Dritten Reich“ diskutiert und realisiert – erlebt und erinnert, Bad Heilbrunn 2003, S. 97. 386 Einweisung in das Jugendschutzlager Moringen, Runderlass d. RMdJ [Reichsministerium der Justiz] vom 3.10.1941. In: RMBliV, 1941, S. 1773; Unterbringung Jugendlicher in die polizeilichen Jugendschutzlager, Erlass des JFdDtR vom 5.5.1944. In: ebd., S. 439–441; Reichssicherheitshauptamt an die Leiter der Staatlichen Kriminalpolizei und Kriminalpolizeistellen über Anträge auf Unterbringung krimineller und asozialer Minderjähriger in Jugendschutzlager vom 8.11.1940 (LHASA, DE, KD ZE, 124, Bl. 254).
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
2.3
351
Die Polizeiverordnung und die „Jugendverwahrlosung“
Zur Kriminalisierung der Jugendlichen während des Krieges trug wesentlich die „Polizeiverordnung zum Schutz der Jugend“ bei; allerdings stand sie – anders als die Jugenddienstpflicht von 1939 – nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Hitlerjugend. Heinrich Himmler hatte sie im März 1940 erlassen. Vorausgegangen waren einige Monate zuvor u. a. eine Verordnung über die Fernhaltung Jugendlicher von Tanzlustbarkeiten oder öffentlichen Spieleinrichtungen.387 Vergleichbare Maßnahmen hatte es schon in der Zeit des Ersten Weltkrieges gegeben, um – letztlich erfolglos – zu verhindern, dass sich Jugendliche an Kundgebungen beteiligten, Proteste organisierten oder in Cliquen und Banden angeblich die öffentliche Ordnung gefährdeten. Ihr Zweck bestand nicht – hier täuscht der Begriff mit Absicht – im Jugendschutz. Kinder und Jugendliche sollten kontrollierbar gemacht und ihr Alltag, wie man formulierte, an die „durch den Krieg bedingten veränderten Lebensverhältnisse“ angepasst werden.388 Die „sittlich-moralische Haltung vor allem der unorganisierten Jugendlichen“, so der SD bereits im Oktober 1939, sei gerade in den Großstädten bedenklich schlecht. Allerlei Tanzveranstaltungen würden „sehr stark von Jugendlichen beiderlei Geschlechts besucht. In den Gasthäusern, vor allem auch auf dem Lande und in Kleinstädten, lassen sie durch übermäßigen Alkoholkonsum, Zigarettenrauchen und Kartenspiel jedes Gefühl für die Gegenwartslage vermissen.“389 Der Gefährdung der moralischen, sittlichen und politischen Ordnung durch die Einwirkungen des Krieges sollte frühzeitig präventiv entgegengesteuert werden. Der Bewegungsradius junger Menschen wurde enger gezogen. Zugleich bildete die Polizeiverordnung ein wirksames Vehikel zur Kriminalisierung abweichenden Verhaltens.390 Der Hitlerjugend galt sie als die ideale Ergänzung zur Jugenddienstpflicht: Letztere war zwar die gesetzliche Voraussetzung zur Heranziehung junger Menschen zum Dienst, aber nur Erstere schien eine verlässliche Gewähr dafür zu bieten, dass Freiräume und Alternativen zur Hitlerjugend gar nicht erst entstanden. „Die Polizeiverordnung zum Schutz der Jugend ist eine Kriegsmaßnahme des Staates. […] Ihre Bestimmungen richten sich nicht gegen diejenigen, die sich in der Öffentlichkeit diszipliniert verhalten, sondern stellen ungebührliches Verhalten Jugendlicher unter Strafe“, begründete das
387 Vgl. Polizeiverordnung über die Fernhaltung Jugendlicher von öffentlichen Schieß- oder Spieleinrichtungen vom 24.10.1939, sowie Polizeiverordnung über die Fernhaltung Jugendlicher von öffentlichen Tanzlustbarkeiten vom 29.11.1939, vielfach abgedruckt, u. a. in: GB: Hessen-Nassau, Sonderdruck: Polizeiverordnungen vom 4.1940. 388 Polizeiverordnung zum Schutz der Jugend vom 9.3.1940, zit. nach ebd. Vgl. im Zusammenhang Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 418–425. 389 Bericht zur innenpolitischen Lage, 1939, Nr. 11 vom 3.10.1939. In: Boberach (Hg.), Meldungen aus dem Reich, Band 2, S. 414–420, hier 416. 390 Vgl. Heinrich Muth, Jugendopposition im Dritten Reich. In: VfZ, 30 (1982) 3, S. 370– 417, hier 394.
352
Massenmobilisierung
HJ-Führerkorps ihre Notwendigkeit.391 Über die neuen Bestimmungen informierten vor Ort meist die Lokalzeitungen, außerdem hingen sie in HJ-Schaukästen oder auf Gemeindetafeln aus. In den BDM- und HJ-Einheiten sollten sie zudem beim Dienst regelmäßig verlesen werden.392 Die Verordnung untersagte u. a.: „Herumtreiben auf öffentlichen Straßen und Plätzen während der Dunkelheit“, „Aufenthalt in Gaststätten aller Art“ ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten, „Besuch von Tanzveranstaltungen“, Genuss von Alkohol und Tabak für Jugendliche unter 16 Jahren sowie den „Besuch von Kinos, Varietés und Kabarettveranstaltungen nach 21 Uhr“ ohne Begleitung. Gegen Jugendliche konnten Geldstrafen – meist zwischen 5 bis 15 Reichsmark – oder Jugendarrest verhängt werden. Erziehungsberechtigte, die sich der Verletzung ihrer Aufsichtspflicht schuldig machten, drohte Haft bis zu sechs Wochen. Überwiegend wurde auf Abschreckung durch Geldstrafen gesetzt.393 Bei den Polizeiämtern sollte in der späten Kriegsphase in „Jugendlichen-Karteien“ eingetragen werden, wer im Zuge von Kontrollen auffällig geworden oder Beamten ins Netz gegangen war.394 Um die Verordnung durchzusetzen, schaltete die Hitlerjugend den SRD ein. Laut Aktennotiz Himmlers besaß dieser im November 1940 rund 50 000 Angehörige; kaum genug, um die Verordnung in sämtlichen Winkeln der Großstädte durchzusetzen. Parkanlagen, Kinos oder Gaststätten sollten immerhin durchgängig kontrolliert werden.395 Aufrechte Hitlerjungen und BDM-Mädchen schienen dort sittlich gefährdet und dem Einfluss von angeblichen Kriminellen ausgesetzt.396 Die HJ-Streifen dienten seit 1938, wie bereits zuvor erwähnt, als Rekrutierungs- und Nachwuchsformation für die SS und den SD. In diversen Lehrgängen – an der SS-Kraftfahrschule Wien, der SS-Verwaltungsschule Dachau, der SS-Nachrichtenabteilung Goslar, der SS-Leibstandarte „Adolf Hitler“ – wurden junge Män-
391 Vgl. Polizeiverordnung zum Schutz der Jugend. In: BB: Franken, 4/42 vom 7.1942. Zur vollständigen Verordnung vgl. Der Reichsminister des Innern, in Vertretung H. Himmler, Polizeiverordnung zum Schutze der Jugend (93/43) vom 10.6.1943. In: RGBl., (1943) 58, Teil1, S. 349. 392 Vgl. Die neue Polizeiverordnung. In: BB: Mittelfranken, 7/43 vom 7.1943. 393 Zur abschreckenden Wirkung der Geldstrafen vgl. die Erörterungen im Bericht des Oberlandesgerichts, Darmstadt vom 5.3.1941. In: Klein (Hg.), Lageberichte der Justiz aus Hessen, S. 313–318. Vgl. auch die vollständige Liste mit verhängten Geldstrafen in rund 130 Fällen im Kreis Dessau-Köthen zwischen 4.4.1941 und 25.9.1941, o. D. (LHASA, DE, Z 141, 652, Bl. 30 f.). 394 Die Polizei im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Gesichtspunkte der Vorbeugung und Erziehung. Umfassende Anweisung des Reichsführers SS. In: Der Neue Tag. Die große Kölner Morgenzeitung vom 8.3.1944. 395 Vgl. Aktennotiz Heinrich Himmlers über eine Unterredung mit Reichsjugendführer Artur Axmann über die Zusammenarbeit von HJ und SS vom 20.11.1940 (BArch Berlin, NS 19, 314), nach Kenkmann, Wilde Jugend, S. 168; zur Observierung vgl. beispielhaft Überwachung der Lichtspielhäuser und Kontrolle der Filmtheater durch den SRD. In: GB: Niederdonau, 9/42K vom 15.9.1942. 396 Vgl. Jugendführer, Kriminalität und Gefährdung, S. 204–208, hier 204.
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
353
ner in Überwachungstätigkeit geschult.397 Die RJF hatte ihren Hilfspolizisten weitreichende Befugnisse „übertragen über sämtliche männliche und weibliche Jugendliche vom 10. bis 18. Lebensjahr sowie sämtliche Angehörige der Hitler-Jugend“.398 Allerdings durften nur jene SRD-Angehörige und SRD-Führer patrouillieren, die das 18. Lebensjahr schon überschritten hatten; die Jüngeren und die Anwärter durften es hingegen nicht, da die Jugendschutzverordnung sie ja nicht ausnahm. Durch die neuen Bestimmungen rückten gerade Mädchen und junge Frauen verstärkt in den Fokus der staatlichen Überwachung. Die Observierung von jugendlichen Cliquen, die sich außerhalb oder in Opposition zur Hitlerjugend formierten, konzentrierte sich meist auf männliche Jugendliche, da man – vielfach zu Unrecht – Mädchen solche Unangepasstheit nicht zutraute.399 Die RJF wusste zwar um die Tatsache, dass im Umfeld der Cliquen Mädchen keinesfalls in geringer Zahl aufgegriffen worden waren, man glaubte aber, dass Mädchen bloß „zum Anlocken weiterer Mitglieder“ dienten.400 Immerhin jede zehnte polizeiliche Vernehmung, die Alfons Kenkmann für die Zeit nach 1939 analysiert hat, betraf eine weibliche Person.401 Die Polizeiverordnung hatte den Druck auf sie erheblich verstärkt. Verstöße gegen die Ausgangssperre sollten vom SRD an die Polizei gemeldet werden, die daraufhin strafrechtlich tätig wurden. Weil Mädchen und junge Frauen angeblich häufig die Nähe der Soldaten suchten, schien die „Reinhaltung der weiblichen Jugend“ gefährdet. Aber auch das Fehlverhalten von Wehrmachtsangehörigen sah man begünstigt. Eine Verfügung des Oberkommandos der Wehrmacht vom 10. Juni 1941 verbot Soldaten die Begleitung Jugendlicher nach den Bestimmungen der Jugendschutzverordnung. HJ-Streifen wurden angewiesen „Soldaten in verbotener Begleitung von weiblichen Jugendlichen wegen Ungehorsams zur Bestrafung zu melden“.402 Der BDM aus Schwaben berichtete im Juni 1940, dass „Eltern in geradezu erschütternder Weise dem Treiben ihrer Töchter zusehen oder es sogar begünstigen“ würden. Manche Mütter seien „geradezu stolz darauf, wenn ihre Töchter bei den Soldaten Erfolg haben“.403 Hierzu ein Alltagsbeispiel: Im Zuge einer
397 Vgl. Streifendienst: Lehrgänge. In: GB: Oberdonau, K/2/42 vom 10.2.1942; Umorganisation des Streifendienstes als SS-Nachwuchsorganisation. In: GB: Mittelrhein, A 10/38 vom 15.11.1938. 398 Aufgaben des HJ-Streifendienstes bei der Überwachung. In: GB: Hochland, 9/42K vom 6.1942. 399 Vgl. Kenkmann, Wilde Jugend, S. 176; Michael Löffelsender, Strafjustiz an der Heimatfront. Die strafrechtliche Verfolgung von Frauen und Jugendlichen im Oberlandes gerichtsbezirk Köln 1939–1945, Tübingen 2012, S. 65–69. 400 Reichsjugendführung, Die Überwachung der Gefährdung der Jugend. Einsatzbefehl für den HJ-Streifendienst (SRD) vom 1. Juni 1940 (vertraulich!), S. 17 (HStA Stuttgart, E 151/09, Bü. 402). 401 Vgl. ebd. 402 Stellv. Generalkommando XI. A.k.[Armeekorps], Wehrkreiskommando XI, betrifft: Schutz der Jugend vom 10.7.1941 (LHASA, DE, Z 141, 652, Bl. 11–13, hier 11). 403 Zit. nach Jugendführer, Kriminalität und Gefährdung, S. 193.
354
Massenmobilisierung
traßenkontrolle in der schwäbischen Kleinstadt Memmingen wurde im März S 1941 eine 17-Jährige in einem Lokal aufgegriffen. Sie befand sich in Begleitung eines Feldwebels, den der SRD zur Bestrafung meldete. Der Aufforderung zum Verlassen des Lokals habe sich das Mädchen widersetzt. Tage zuvor hatte der SRD dasselbe Mädchen nach Einbruch der Dunkelheit auf der Straße angetroffen, wo sie über ihr Alter eine falsche Angabe gemacht hatte. Der Bericht der jungen Kontrolleure aus der Kleinstadt führte für den März 1941 immerhin 24 ähnliche Fälle auf; mehr als ein Drittel betraf weibliche Jugendliche.404 Über jene Mädchen, die kontinuierlich bei Kontrollgängen ins Netz gingen, trug man so im Verlauf der Zeit reichlich Material zusammen. Hatte man sie schließlich gar wegen Diebstahl, Unterschlagung, Öffnung von Feldpost oder Urkundenfälschung belangt, verfügten Polizei und Jugendgerichte dank der Hitlerjugend über eine lange Liste, die eine „allgemeine Verwahrlosung“ oder „unmoralische Haltung“ dokumentierten.405 Heinrich Muth sprach in seiner Analyse Wuppertaler Gestapo-Akten treffend von einer „penetranten Polizeistaatlichkeit“. Durch die Kontrollen des SRD, Festnahmen sowie Polizeiverhöre wurde eine Drohkulisse aufgebaut, die mindestens einschüchtern sollte, aber vielfach auch mit gravierenden Konsequenzen einherging.406 Die Überwachung konnte indes nie eine lückenlose sein. Die Hitlerjugend sei, lautete es aus dem Oberlandespräsidium in Kassel 1943, „infolge des anderweitigen Einsatzes der älteren Jahrgänge augenscheinlich nicht mehr in der Lage durchzugreifen“.407 Die Möglichkeiten speziell des SRD erwiesen sich als zum Teil äußerst begrenzt und die dünne Personaldecke machte sich nach Kriegsbeginn umgehend bemerkbar; Michael Buddrus unterstrich, dass der SRD nach 1939 fast „außer Gefecht gesetzt“ worden sei.408 „Ein Großteil der SRD-Anwärter ist eingerückt“, so klagte z. B. eine Bannführung in Schwaben im Herbst 1940 recht typisch, wo nicht einmal mehr ein SRD-Beauftragter existierte: „Wir müssen deshalb mit der Arbeit auf diesem Gebiet neu beginnen.“409 Traut man einer Reihe von Zeitzeugen, so war auf die noch verbliebenen jungen Hilfspolizisten auch nicht immer Verlass. Statt die Jüngeren zu überprüfen, erzählte beispielsweise ein ehemaliger Streifengänger, habe er die Kontrollen der Lichtspielhäuser lieber zum Anlass genommen, sich die fraglichen Filme selbst anzuschauen. Als SRD-Angehöriger privilegiert, habe er kostenlos Zutritt gehabt.410 Bestätigung 404 Vgl. Kontrollen durch den HJ-Streifendienst, Bericht des K-Bannführers vom 19.3.1941 (StA Augsburg, HJ-Gebiet Schwaben, 56: SRD: Memmingen, Bl. 15–17). 405 Vgl. Beispiele zu Ausschlüssen aus HJ und BDM in: GB: Baden, 10/43K vom 1.11.1943. 406 Muth, Jugendopposition im Dritten Reich, S. 400–420. 407 Bericht des Oberlandespräsidenten, Kassel vom 31.3.1943. In: Klein (Hg.), Lageberichte der Justiz aus Hessen, S. 86–93, hier 90. 408 Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 374. Zur Überforderung des SRD in den Kriegsjahren vgl. auch Nolzen, Der Streifendienst, S. 30–34. 409 SRD-Meldung des Bannes Wertach an das Gebiet Schwaben vom 31.10.1940 (StA Augsburg, HJ-Gebiet Schwaben, 44: SRD: Wertach, Bl. 12). 410 Vgl. Erinnerungen von Heinrich Wild, Begleitmaterial zu seinen Tagebüchern (NSDOK Köln, EzG, jugend1918-1945.de; 11.3.2018).
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
355
finden derlei Aussagen zum Teil auch in Polizeiakten. So warfen SRD-Mitglieder einander gelegentlich staatsfeindliche Aktivitäten vor und mancher junge Hilfspolizist wurde sogar bei Razzien selbst festgesetzt.411 Der SRD entfernte sich im Verlauf der Kriegsjahre de facto immer mehr von seinem Anspruch, eine junge Eliteformation der Hitlerjugend zu sein. In den apologetischen Memoiren eines Unverbesserlichen stößt man wie beiläufig auf eine erstaunliche Behauptung: „Eines Tages hatte ich die Mitteilung erhalten, dass ich ab sofort der Gefolgschaft des HJ-Streifendienstes […] angehöre und künftig dort meinen Dienst antreten müsse. Wie es dazu gekommen ist, blieb mir bis heute unklar.“412 Tatsächlich standen zu keinem Zeitpunkt ausreichend Freiwillige zur Verfügung, um die alltägliche Überwachungsarbeit zu schultern. Spätestens ab 1941 wurden deshalb immer häufiger derartige Überweisungen aus regulären HJ-Formationen nötig. „Kleinliche Sonderinteressen der Einheitsführer bitte ich dringend zurückzustellen“, drängte die HJ-Führung in Bayern im März 1941: „Es ist vielmehr darauf zu dringen, dass von jedem Standort eine entsprechende Anzahl, die vom Bannführer festgelegt wird, in den Streifendienst überwiesen wird.“413 In Westfalen sollte einem Antrag auf Aufnahme in den SRD ab 1942 sogar grundsätzlich, also ohne spezielle Überprüfung der Eignung und Fähigkeiten, stattgegeben werden.414 Im Übrigen war es umgekehrt genauso der Fall: Weil die HJ-Feuerwehrscharen, die zur unterstützenden Brandbekämpfung dienten, völlig unterbesetzt waren, rekrutierte man nach 1941 aus den HJ-Streifen die junge Hilfsfeuerwehr.415 Ein neues Reichsausbildungslager des SRD in Freusburg bei Kirchen an der Sieg wurde im Mai 1943 eröffnet. Die ersten fünf Lehrgänge bis Mitte September richteten sich an SRD-Führer verschiedener Ränge. Ende 1944 fanden dort die letzten Kurse statt.416 411 Beispiele bei Kenkmann, Wilde Jugend, S. 169 f. 412 Klaus-Rainer Woche, Gestern war’s noch besser. Rückblick und Ausblick eines Deutschen vom Jahrgang 1927, Starnberger See 1997, S. 101. 413 Überweisungen in den Streifendienst (SRD-Gefolgschaft). In: Gebietsbefehl Hochland, K4/41 vom 1.3.1941; Einsatz des HJ-Streifendienstes. In: GB: Baden, 30/K vom 18.4.1942: „Der Überwachungseinsatz muss unter allen Umständen durchgeführt werden und ist zu verstärken. Wo Streifendienst nicht vorhanden ist, erhält der Führer des Bannes im Ausnahmefall die Berechtigung, auf Vorschlag des Streifendienstführers geeignete und besonders ausgesuchte Hitler-Jugend-Führer anderer Einheiten mit der zeitweisen Wahrnehmung streifendienstlicher Überwachungsaufgaben zu beauftragen. […] Diese Ausnahmeanordnung gilt nur für die Dauer des Krieges.“ 414 Vgl. Überweisung in eine SRD-Einheit. In: GB: Westfalen, K4/42 vom 15.5.1942. 415 Vgl. Stärkenachweisung der zu bildenden Hitlerjugend-Feuerwehrscharen im SRD in den Bannen. In: GB: Mittelelbe, 6/K 41 vom 15.10.1941; Nachwuchs für Feuerwehrscharen. In: GB: Westfalen, K1/41 vom 12.2.1942, wo man feststellte, dass durch „eine Reihe von Abgängen […] die Feuerwehrscharen zum Teil nicht mehr einsatzfähig“ seien. Dass in die HJ-Feuerwehr aus dem SRD überwiesen wurde, zeigen u. a. Anweisungen. In: ebd., 25/43K vom 16.12.1943: „Die Erhöhung ist mit streifendiensttauglichen Junggenossen des Jahrgangs 1928 vorzunehmen. Den Bannen gehen vom Gebietsinspekteur des SRD Listen […] zu.“ 416 Vgl. Reichsausbildungslager des Streifendienstes in Freusburg/Sieg. In: GB: Westmark, 10/43K vom 15.5.1935; Streifendienstlehrgänge. In: GB: Westmark, 1/44K vom
356
Massenmobilisierung
Die Qualität und Zuverlässigkeit des SRD wurde durch die massenhaften Überweisungen und Rekrutierungen im späten Kriegsverlauf trotz intensivierter Schulung gewiss nicht besser – ein Leipziger SRD-Angehöriger, um ein Beispiel zu nennen, wurde 1943 zu Gefängnis verurteilt und aus der HJ ausgeschlossen, weil er Gelder veruntreut hatte.417 Es kam auch vermehrt zur Gewaltausübung. In Pirna zog ein junger SRD-Kontrolleur 1943 sein Messer, als er zwei Jungen stoppte, die in Zivil mit dem Fahrrad unterwegs waren. Bei der Auseinandersetzung kam es zu leichten Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft sah mit Zustimmung des Jugendrichters von einer Anklage ab, was bezeichnend und gewiss typisch war; der übergriffige Streifengänger kam mit einem disziplinarischen Verweis seitens des HJ-Gerichts davon.418 HJ-Inspekteure mussten die mangelnden Fähigkeiten der Streifen andauernd tadeln. Ganze SRD-Einheiten wurden kritisiert. Sie hatten etwa Kontrollgänge oder Razzien ungeschickterweise im Vorhinein über die Lokalpresse angekündigt, wohl um den Jugendlichen zu drohen.419 Der SRD war außerdem gerade in Kleinstädten oft nicht in der Lage, die eigenen Angehörige kontinuierlich zu den SS-Schulungslehrgängen zu schicken. Die Fluktuationen durch die Einberufungen zum Militär waren schlicht zu hoch und die Strukturen fragil. Nicht einmal kurzfristige Planung war noch möglich, da die Streifengänger – wie in einer schwäbischen Kleinstadt Ende 1942 – „sämtlich […] zum Heer einberufen wurden“.420 Im April 1944 hieß es von dort, dass inzwischen keine SRD-Einheiten mehr existieren würden.421 Die Durchsetzung der Polizeiverordnung bereitete daher in vielerlei Hinsicht enorme Probleme. Die Freiräume junger Menschen weiter beschneidend, war sie – zumindest an der Basis der Organisation – bald ähnlich unbeliebt wie die Dienstpflicht. Junge Menschen fanden Möglichkeiten und entwickelten Strategien, die Regeln in der Polizeiverordnung zu umgehen. Gefälschte Ausweise oder Dienstkarten mit illegalen Stempeln fanden bis in die letzte Kriegsphase hohe Verbreitung. Das Jugendschutzgesetz verstärkte dies noch. Auf legalen Papieren wurden die Geburtsdaten gefälscht, um sich nach Einbruch der Dunkelheit, gerade im Winter, draußen aufhalten oder Lokale besuchen zu können.422
28.2.1944. Weitere wichtige SRD-Ausbildungslager befanden sich während der Kriegsjahre in Appeldorn (Niederlande), Eipel (Böhmen), Birgsau (Allgäu) und Krauth (Millstätter-See). 417 Vgl. Ausschlüsse aus der Hitler-Jugend. In: BB: Gebiet Sachsen, 4/43 vom 1.5.1943. 418 Zum Fall vgl. sämtliche Dokumente insbesondere mit Aussagen der Beteiligten vom 26.4.1943–28.7.1943 (StadtA Pirna, B-III-XXX-IX, 2709, Bl. 1–8). 419 Vgl. K-Gebietsinspekteur für HJ-Streifendienst an den Bann Wertach vom 12.6.1941 (StA Augsburg, HJ-Gebiet Schwaben, 44: SRD-Wertach, Bl. 18). 420 SRD-Führer des Banns an den K-Gebietsinspekteur des HJ-Streifendienstes vom 9.10.1942 (ebd., Bl. 54.) 421 Vgl. Schreiben eines K-Hauptstammführers an den K-Gebietsinspekteur vom 4.4.1944 (ebd., Bl. 59). 422 Vgl. beispielhaft Änderung in den Ausweisen. In: GB: Franken, 2/42 vom 2.1942: „In letzter Zeit mehren sich die Fälle, dass Jungvolk- und Hitler-Jugend-Angehörige ihr Geburtsdatum in den Ausweisen (Mitgliedsausweis, Führerausweis, Gesundheitspass)
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
357
„Die Urkundenfälschung erfordert schon eine größere Intelligenz“, urteilte ein Jurist 1940 über erste Fälle in Hamburg: „So ist es kein Wunder, dass dieses Delikt vornehmlich von den Sechzehn- und Siebzehnjährigen begangen wurde. Die Anzahl der Fälle scheint […] sehr hoch.“423 Dienstpapiere enthielten, wie man in Nürnberg kritisierte, häufig keine Lichtbilder mehr, was die Fälschung erheblich erleichterte – entweder aus Materialmangel, weil keine Fotografen gefunden werden konnten oder untere Dienststellen nicht eifrig genug arbeiteten.424 Mancher Zeitzeuge erinnerte sich, wie leicht es fiel, den Ausweis zu manipulieren. HJ-Streifen ließen sich häufig täuschen. In Wien fiel das schon in den ersten Wochen auf: „Da derlei Fälschungen […] einen immer größeren Umfang annehmen, haben die Einheitenführer […] die Hitler-Jugend-Angehörigen vor Begehung derartiger Fälschungen eindringlich zu warnen.“ Bei Zuwiderhandlung drohten Landgericht und Staatsanwaltschaft mit Gefängnisstrafen.425 Die Meldungen erreichten die RJF ab Sommer 1940 aus zahlreichen Städten. Sie warnte folglich, dass sich junge Leute „dem Zugriff der Polizei durch Fälschen der Altersangaben“ zu entziehen versuchten.426 Im Gebiet Oberschlesien nahm dies offenbar ein dramatisches Ausmaß an, denn die Gebietsführung wies in besonderer Weise auf das Phänomen hin. Der SD führte Ende 1943 vermehrt Razzien durch und das HJ-Führerkorps trat an die örtlichen Dienststellen warnend heran: „In Zusammenarbeit mit der Sicherheitspolizei stattgefundene Razzien haben ergeben, dass HJ-Angehörige […] Fälschungen von Ausweisen aller Art vornehmen, die sich in der Abänderung des Geburtsjahres äußern. Es ist mit einem verstärkten […] Polizeieinsatz zu rechnen.“427 Die Ausweise aller Mitglieder in sämtlichen Einheiten sollten nun inspiziert werden, um etwaige Manipulationen und die Betrüger aufzudecken. Sogar die jugendlichen Unterführer wurden durchleuchtet, weil man auch ihnen offenbar nicht traute: „Um die Unantastbarkeit eines öffentlichen Ausweises […] klarzumachen, haben dieselben strengste Erziehungsmaßnahmen (Jugenddienstarrest) zu erwarten. Sämtliche HJ-Angehörigen sind zu belehren, dass sie aufgrund der […] polizeilichen Fahndungen zu jeder Zeit einen Ausweis mit sich zu führen haben.“428 In der Praxis fiel es schwer, die Manipulationen aufzudecken und Mitglieder zu kontrollieren. Erwachsene Passanten sprangen Jugendlichen bei Kontrollen bei, manche gaben sich spontan als Erziehungsberechtigte aus, während die Eltern wiederum Falschangaben deckten, da – wie die RJF lamentierte – sie
eigenmächtig abändern. Sie wollen damit erreichen, dass sie nicht mehr nach den Bestimmungen der Polizeiverordnung […] behandelt werden. […] Jugenddienstarrest oder Jugendarrest ist in diesem Falle zu gewärtigen.“ 423 Flemming, Die Jugendkriminalität in Hamburg im Jahr 1941, S. 15. 424 Vgl. Lichtbildbeschaffung für Dienstkarten. In: GB: Franken, 2/44 vom 2.1944. 425 Fälschungen von Hitler-Jugend- bzw. Schülerausweisen. In: GB: Wien, 8/43 vom 1.8.1943. 426 Jugendführer, Kriminalität und Gefährdung, S. 157. 427 Ausweisfälschung und -Ausfertigung. In: GB: Oberschlesien, K 6/43 vom 25.11.1943. 428 Jugendführer, Kriminalität und Gefährdung, S. 157.
358
Massenmobilisierung
offenbar „Bestrafungen als schikanöse Härte“ empfanden. Gastwirte und Lokalbetreiber fragten häufig nicht nach, weil sie mit den jungen Gästen ihr Geld verdienten.429 Ein Kinobetreiber in Kaufbeuren setzte einige SRD-Angehörige im Mai 1940 vor die Tür, als sie eine Patrouille durchführen wollten; die Polizei sprang dem Kinobesitzer später bei, anstatt Partei für die Hitlerjugend zu ergreifen, die sich über das Vorgehen des Betreibers und der Polizei entsprechend beschwerte.430 Aus der Kleinstadt Dornburg wiederum wurde gemeldet, dass sich junge Leute „bis in die Nacht […] in den Gastwirtschaften herumtreiben und dort auch geduldet“ würden. Man brachte diese jungen Leute mit illegalen Aktionen in Verbindung. Angeblich handelte es sich um dieselben Jugendlichen, die in der Dunkelheit Parteiplakate abrissen.431 Die Gebietsführung Schwaben ihrerseits hatte eine Reihe von Sportvereinen in Verdacht. Diese böten in „nicht öffentlichen Clubräumen, Bootshäusern und dergleichen“ Gelegenheit für nächtliche Feiern. Erneut vermutete man, dass diese Jugendlichen „oppositionell zur HJ eingestellt“ seien, „der Hitler-Jugend nicht angehören und durch die Zugehörigkeit zum Sportverband getarnt“ seien.432 Junge Menschen ließen sich von ihrem Vergnügen allerdings nur bedingt abhalten. Einige Treffpunkte waren sowohl der Polizei und Gestapo als auch den Dienststellen der Hitlerjugend bekannt. In Frankfurt am Main und Wiesbaden kannte die Polizei seit Anfang 1940 u. a. einen „Cotton“-, „Ohio“- und „Harlem“-Club, wo sich Jugendliche für Swing-Musik und „nervöse Zuckungen des Niggertanzes“ begeisterten.433 Einige aktive HJ-Mitglieder befanden sich offenbar unter den Festgenommenen, die man abends in Kneipen und Lokalen aufgegriffen hatte.434 In Leipzig fanden 1942/43 Prozesse gegen selbsternannte „Broadway-Gangster“ statt. Die Aussagen vor Gericht förderten zutage, dass sich in deren Gaststätten „eine große Menge Jugendlicher, unter ihnen auch solche mit HJ-Abzeichen“ befunden hätten.435 Die Sicherheits- und Überwachungsorgane glaubten, dass einige Anzeichen für „Verwahrlosung“ besonders in der weiblichen Jugend zu erkennen seien. 1941 begann man, dies zu untersuchen: „Die Leiterin der weiblichen
429 Ebd., S. 158. 430 Vgl. Bericht des SRD-Führers des Bannes über die Kinokontrolle des SRD in Kaufbeuren vom 7.5.1940 (StA Augsburg, HJ-Gebiet Schwaben, 44: SRD-Wertach, Bl. 9). 431 SD-Abschnitt Dessau an den Landrat, Kreise Zerbst vom 9.4.1941 (LHASA, DE, KD ZE, 125, Bl. 158). 432 Hitlerjugend Gebiet Schwaben an die SRD-Führer des Bannes 312, 315, 320, 338, 455, 475, 476, 477, 478 vom 5.8.1940. In: Jahnke (Hg.), Eine Dokumentation, S. 393. 433 Gestapo-Bericht abgedruckt bei Renate Knigge-Tesche/Axel Ulrich (Hg.), Verfolgung und Widerstand in Hessen 1933–1945, Frankfurt a. M. 1996, S. 396. Vgl. auch Bericht des Generalstaatsanwalts Frankfurt vom 3.6.1943. In: Klein (Hg.), Lageberichte der Justiz aus Hessen, S. 250–253, hier 251. 434 Vgl. Detlev J. Peukert, Die Edelweißpiraten. Protestbewegung jugendlicher Arbeiter im „Dritten Reich. Eine Dokumentation, Köln 1988, S. 201–219; Kenkmann, Wilde Jugend, S. 297 f. 435 Urteilsschrift vom 26.11.1943, zit. nach Abdruck bei Lange, Die Leipziger Meuten, S. 23 f.
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
359
Kriminalpolizei erklärte […], dass in diesem Jahr in Leipzig bisher bereits einige hundert Fälle mehr erfasst worden sind als im Vorjahr.“ Schließlich habe man im Zuge der Ermittlungen feststellen müssen, dass „einige dieser Mädels dem Jungmädelbund oder dem Bund deutscher Mädels angehören. Die Beurteilungen der zuständigen Einheitsführerinnen gingen dahinaus, dass diese Mädel den Dienst entweder gar nicht oder nur sehr selten noch besuchen. Die Androhung von Jugendarrest, ganz gleich ob fürs Wochenende oder längere Zeit, macht oftmals keinerlei Eindruck, sondern die Mädels sagten sogar: sie freuen sich darauf, weil sie sich einmal ausruhen könnten.“436 Andernorts gelangte man schon früh zu der Erkenntnis, dass Betroffene zumindest mehr oder weniger der Hitlerjugend aktiv angehörten. Keinesfalls handelte es sich ausschließlich um „Nicht-Organisierte“, wie die Außenstehenden im HJ-Schrifttum tituliert wurden. In Frankfurt am Main hatte die Kriminalpolizei 1940 im Zeitraum von gut drei Monaten 187 Jugendliche festgesetzt, die sich nach Einbruch der Dunkelheit draußen oder in Lokalen aufgehalten hatten. Darunter waren 116 Mädchen. Die Gebietsführung unterstützte die Ermittlung wegen „bestehender oder drohender Jugendgefährdung“ in den eigenen Reihen.437 In Hamburg beobachtete man 1940 ebenfalls, dass doppelt so viele Mädchen und junge Frauen gegen die Polizeiverordnung verstießen: „Dies ist ein Anzeichen für die stärkere Verwahrlosung der weiblichen Jugend, die sich auch aus allen Berichten der Fürsorgerinnen ergibt. Bei den Mädchen handelt es sich meistens darum, dass sie nach 21 Uhr ohne Begleitung […] in Tanzlokalen angetroffen wurden. Oft trieben sie sich aber auch nach Anbruch der Dunkelheit auf der Straße herum und wurden deshalb bestraft. Gerade unter diesen Fällen befanden sich sehr viele Mädchen, die trotz ihrer Jugend schon ein regelrechtes Dirnenleben führten.“438 Die Polizeiverordnung erfuhr übrigens am 10. Juni 1943 bezüglich der Ausgangssperren noch einmal eine leichte Verschärfung.439 Vorwiegend in den Großstädten entstand ein engmaschiger Kontrollapparat, der zwar nie lückenlos war, aber doch jugendlichen Alltag einzugrenzen und unangepasste Gruppen zu unterdrücken half.440 In Leipzig waren 1941 insgesamt 732 Zuwiderhandlungen zur Meldung gekommen.441 In der Rheinprovinz hatte man von Anfang Mai bis Ende Oktober 1940 rund 16 000 Fälle registriert. Die meisten Jugendlichen kamen mit milden Strafen oder Verwarnungen davon, nur in seltenen Fällen schienen „einschneidende Erziehungsmaßnahmen“ erforderlich. Der Bericht des Landesjugendamtes, auf Basis von Meldungen aus 97
436 Bericht des SD-Abschnitts Leipzig vom 26.8.1941 (IWM Duxford, Documents Captain Branney, Digitalisate im Archiv des HAIT, unpag.). 437 Sitzungsprotokoll des Jugendamtes in Frankfurt a. M. vom 25.10.1940 (StadtA Frankfurt a. M., Mag. Az. 5520, 1). Vgl. Kurz, Swinging Democracy, S. 133. 438 Flemming, Die Jugendkriminalität in Hamburg im Jahr 1941, S. 29. 439 Vgl. Polizeiverordnung zum Schutze der Jugend. In: BB: Sachsen, 8/43 vom 1.10.1943. 440 Vgl. Kurz, Swinging Democracy, S. 133. 441 Vgl. Lange, Leipziger Jugendgruppen im Dritten Reich, S. 280.
360
Massenmobilisierung
Jugendämtern erstellt, legt nahe, dass die Verordnung regional in unterschiedlicher Intensität durchgesetzt worden ist, mutmaßlich am strengsten in Köln und entlang des Rheins. Verstöße gegen das Aufenthaltsverbot auf öffentlichen Plätzen machte rund die Hälfte der Fälle aus, danach folgten unerlaubte Lokalund Kinobesuche.442 Die sogenannte Jugendverwahrlosung schien im Zeitverlauf zuzunehmen. In den ersten Kriegsmonaten hatten verschiedene Behörden etwa in Westfalen unterschiedliches berichtet. Vor allem aus ländlichen Regionen kamen eher zuversichtliche Meldungen.443 Auch das Oberlandesgericht Düsseldorf vermerkte Ende 1940 über die allgemeine Stimmung: Sie sei in „der Beamtenschaft […] zuversichtlich und fest, während sich in der Bevölkerung infolge der fortwährenden nächtlichen Fliegerangriffe […] einige Erregung zu verbreiten scheint und das zuchtlose Verhalten eines Teils der halbwüchsigen Jugend Grund zu ernster Sorge gibt“.444 Im November 1942 hatte der Bericht eine dramatische Tonlage angenommen. Zunehmend mache sich die „Verwahrlosung“ junger Menschen bemerkbar: „Ein mir vor einigen Monaten vorgelegter ernster Bericht […] ergab, dass die Zersetzungserscheinungen auch die Hitler-Jugend selbst erfasst und auch auf die Stadt Düsseldorf übergegriffen hatten, wie auffallend häufige Straßenansammlungen von Jugendlichen bestätigen. In jüngerer Zeit sind […] in Düsseldorf und Wuppertal zahlreiche Strafverfahren gegen bündische Jugendliche eingeleitet worden.“445 In Dresden wurden im Mai 1940 – dem „Ernst der Zeit entsprechend“, wie man erklärte – sämtliche Tanzveranstaltungen über die Pfingsttage hinaus verboten. Um die Bestimmung sowie die Jugendschutzverordnung durchzusetzen, rückten die Sicherheitsorgane – Polizei und SRD – gemeinsam zum dreitätigen „Großeinsatz“ aus. Die Zahlen, welche die RJF zusammenstellte, bestätigen den Befund. 1 715 Jugendliche waren in Gewahrsam genommen worden. 450 Angehörige der Hitlerjugend hatte man in Uniform festgenommen, weitere 329 Hitlerjungen und 100 BDM-Mädchen hatte man in Zivil aufgegriffen. 738 junge Menschen ordnete man „wilden“ Gruppen zu. Sie gehörten der Hitlerjugend offenbar nicht an, weil sie abseits geblieben oder ausgeschlossen worden
442 Vgl. Auswirkungen der Reichspolizeiverordnung zum Schutz der Jugend in der RP [Rheinprovinz] vom 9.3.1940 und 1.11.1940 (Archiv des Landschaftsverbandes Rheinland, 14130, unpag.); M. Beurmann, Die Auswirkungen der Reichspolizeiverordnung zum Schutz der Jugend vom 9. März 1940 in der Rheinprovinz in der Zeit vom 1. Mai bis 31. Oktober 1940 nach Berichten rheinischer Jugendämter. In: Die Rheinprovinz, 17 (1941) 1, S. 16–35. Vgl. in größerem Zusammenhang Löffelsender, Strafjustiz an der Heimatfront, S. 74–145. 443 Vgl. umfassend Köster, Jugend, Wohlfahrtsstaat und Gesellschaft im Wandel, S. 365– 370. 444 Der Oberlandesgerichtspräsident an den Reichsminister der Justiz vom 31.12.1940 (BArch Berlin, R22, 3363). In: Pädagogisches Institut Düsseldorf (Hg.), Dokumentation, S. 354. 445 Der Oberlandesgerichtspräsident an den Reichsminister der Justiz vom 2.9.1942. In: ebd., S. 356.
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
361
waren.446 Die Presse schwieg sich über die Massenkontrollen aus. Stattdessen berichtete man über volle Säle anlässlich einer „Versammlung der Jugend“, über HJ-Sportwettkämpfe oder darüber, dass die Jugend angeblich durch „Verzicht auf Leckereien und billige Unterhaltung […], durch Selbstdisziplin, Anspruchslosigkeit und Zielstrebigkeit zum deutschen Sieg“ überall beitrüge.447 Ein Jahr später hatte sich die Lage in Dresden nicht wesentlich gebessert. Eine massive „Zusammenrottung“ Jugendlicher im Alter von 15 bis 19 Jahren in sogenannten Mobs habe man festgestellt. Meist seien es Gruppen aus jeweils 20 bis 40 Personen, die „durch disziplinloses, flegelhaftes Benehmen“ auffallen würden. Neben „haltungsmäßigen Verfehlungen“ sei die Zunahme von Diebstählen, sogenannten Sittlichkeitsverbrechen sowie der Arbeitsbummelei auffallend. Die Polizeiverordnung griff nach wie vor nur sehr ungenügend: „Führt die Polizei in einem Stadtgebiet straffe Kontrollen durch, wechselt man sofort in ein anderes über.“448 Die Häufung von Rangeleien mit HJ-Streifen geriet ebenfalls in den Blick. Das Reichsjustizministerium wies am 21. August 1942 auf Überfälle von Banden auf die Hitlerjugend hin, die sich überwiegend in Hamburg, Erfurt, Wien und Krefeld ereigneten. Sie waren offenkundig infolge von intensivierten SRD-Kontrollen verübt worden. Mit Gefängnis und Zuchtmitteln, hieß es, habe man durchgegriffen.449 Über ein „verstärktes Auftreten jugendlicher Cliquen und Banden“ und eine Notwendigkeit zur „nachdrücklichen Bekämpfung dieses Unwesens“ wurden die Generalstaatsanwaltschaften Ende März 1943 neuerlich informiert.450 Das Überwachungsnetz konnte in Ballungszentren, wo die Verstöße gegen die Polizeiverordnung schneller sichtbar wurden, möglicherweise ein Stück weit effektiver als in ländlichen Regionen sein. In Dörfern oder Kleinstädten verfügte die Hitlerjugend seltener über SRD-Gruppen, weshalb die Durchsetzung der Verordnung dort Polizei und Kommunalverwaltung oblagen, die das Problem offenbar unterschiedlich handhabten. Dass in der ländlichen Fläche teils weniger oder keinerlei Verstöße geahndet wurden, kann jedenfalls nicht bedeuten, dass sich junge Menschen dort grundsätzlich anders verhielten. Die RJF trug die verschiedenen Meldungen von Behörden, Polizeidienststellen und Ministerien zusammen, um sich ein Lagebild zu verschaffen. Das stellte sich regional und von Fall zu Fall sehr unterschiedlich dar. Der Reichsstatthalter von
446 Vgl. Jugendführer, Kriminalität und Gefährdung, S. 187; Keine Tanzveranstaltungen! In: Der Freiheitskampf vom 11.5.1940. 447 Jugend für den Führer. In: Der Freiheitskampf vom 23.5.1940. 448 Bericht der Reichsjugendführung über Cliquen und Bandenbildung unter Jugendlichen vom 9.1942 (Barch Berlin, R22, 1177). In: Peukert, Die Edelweißpiraten, S. 160–229; vgl. auch Klönne, Jugendprotest und Jugendopposition, S. 605. 449 Vgl. Der Reichsminister der Justiz, Führerinformation, 1942, Nr. 114 vom 21.8.1942. In: Jahnke (Hg.), Eine Dokumentation, S. 431. 450 Der Reichsminister der Justiz an die Generalstaatsanwälte bei den Oberlandesgerichten über die Bekämpfung jugendlicher Cliquen und Banden vom 25.3.1943 (HstA Dresden, 11065, 329, unpag.).
362
Massenmobilisierung
Hessen meldete im September 1940, dass in Städten „aufgrund einer intensiven Überwachung“ die Verstöße rückläufig seien, während sich „in vielen Landkreisen die Beschwerden über zunehmendes Herumtreiben“ häuften.451 Der SD berichtete aus Dornburg 1943, es würden sich junge Leute bis in die Nacht in den Wirtschaften herumtreiben, wo man sie dulde. Es sei festgestellt worden, dass die Jugendlichen „auch Versammlungs- und Veranstaltungsankündigungen der Partei und deren Gliederungen“ abrissen.452 Aus Mecklenburg lautete es im Oktober 1940, dass in „größeren Städten keineswegs in prozentual höherem Maße gegen die Polizeiverordnung“ verstoßen werde als in kleineren Orten, „vielmehr scheine das Gegenteil der Fall zu sein“.453 Wiederum andere Berichte zeichneten ein komplett gegenteiliges Bild. In Dörfern sei eine Strafverfolgung nicht nötig und die Landjugend für „Verwahrlosung“ offenbar weit weniger anfällig. Pauschale Bilanz zu ziehen gestalte sich schwer, gab die RJF zu.454 Der Bewegungsradius und Spielraum junger Menschen wurde nicht nur im Alltag vor Ort eingeschränkt. Aus unterschiedlichen Gründen, die an anderer Stelle hier zum Teil bereits angesprochen wurden, gab es Urlaubs- und Ferienfahrten im Rahmen der Staatsjugend nach 1939 nur noch selten: „Durch […] Einschränkungen ist es nicht möglich, Fahrten in bisherigen Umfange durchzuführen, sodass diese auf ein Mindestmaß beschränkt werden müssen und sich den Umständen entsprechend anzupassen haben“, hieß es beispielsweise im Sommer 1940 in Sachsen.455 Während Ferienfahrten und Zeltlager unter dem Dach der Hitlerjugend seltener wurden, griff das Regime regulierend in die Freizeit und die Ferien junger Menschen ein. Am Ende wurde sogar jeder Ausflug per Fahrrad und in Zivilkleidung verboten: „Zahlreiche Beschwerden lassen aber erkennen, dass dieses Verbot nicht genügend beachtet wird“, hieß es aus dem Reichsinnenministerium Anfang September 1942.456 Die Folge der Einschränkungen: Verschiedene staatliche Stellen beobachteten das unkontrollierte und illegale Wandern in autonomen Kleingruppen. Polizei, Gestapo und SRD versuchten, die jungen Menschen zu überwachen: „Die Fahrt ist eines der Haupterziehungsmittel der Hitler-Jugend. Die Säuberung des Jugendfahrtenwesens ist daher eine der wichtigsten Aufgaben […], die ebenfalls in engster Zusammenarbeit mit der Polizei durchzuführen ist.“457 Es werde, bemerkte die Gestapo in Köln Anfang 1943, „häufiger beobachtet, dass Jugendliche außer451 Meldung zit. nach Jugendführer, Kriminalität und Gefährdung, S. 156. 452 SD-Abschnitt Dessau an den Landrat im Kreis Zerbst über Herumtreiben Jugendlicher in Dornburg vom 9.4.1941 (LHASA, DE, KD, ZE, 125, Bl. 158). 453 Jugendführer, Kriminalität und Gefährdung, S. 156. 454 Vgl. ebd. 455 Diszipliniertes Verhalten der Einheiten im Freien. In: Junger Wille. Führerdienst der HJ: Sachsen, (1940) 5, S. 5. 456 Minister des Innern an die Landräte, Polizeipräsidenten und Polizeidirektoren vom 1.9.1942 (GLA Karlsruhe, 465c, 23587, unpag.). 457 Die allgemeine Überwachung. 10. Überwachung des Jugendfahrtenwesens. In: Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 11: Streifendienst und Überwachung, S. 941.
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
363
halb der Hitlerjugend geschlossene Wanderungen und Wanderfahrten“ ausführten. Man glaubte, es handele sich dabei mehrheitlich um Jugendliche und junge Männer, die „aus verschiedenen Gründen gegnerisch gegen die HJ eingestellt“ seien.458 Aus Sicht der RJF waren dies „wilde“ oder – wenn angeblich bündischer, konfessioneller oder subkultureller Hintergrund hinzutrat – illegale Fahrten, die einen „Gefahrenherd für die Verwahrlosung der Jugend“ bildeten: „Durch die Einberufung vieler Erziehungsberechtigter sowie Hitler-Jugend-Führer zur Wehrmacht ist heute den Jugendlichen mehr denn je die Möglichkeit gegeben, in wilden Gruppen sich von ihren Heimatorten zu entfernen. Eine ständige Kontrolle […] ist daher notwendig.“459 Um das wilde Umherstreifen zu unterbinden, sollten in ländlichen Regionen die Höfe der Bauern, in Städten die Bahnhöfe und andere neuralgische Knotenpunkte überwacht werden.460 Während der Ferienzeit und im Sommer organisierte der SRD mehrwöchige „Großaktionen“ zur Überwachung in Urlaubs- und Ferienregionen an der Nord- und Ostsee sowie in den Alpen und entlang der Flüsse. Sogenannte feste, also stationäre, und fliegende, also mobile, SRD-Kontrollgruppen, ausgerüstet mit Fahrrad, Fotoapparat und Landkarte, sollten die möglichst lückenlose Kontrolle gewährleisten. Die Banndienststellen mussten in den Stoßzeiten eigens sogenannte Zentralbefehlsstellen einrichten. Sie koordinierten die SRD-Mitglieder und nahmen bei deren Meldungen Verbindung mit der Polizei auf.461 Im Rheinland wurden jugendliche Gruppen, die man dem katholischen Milieu zuordnete, observiert. Sie führten, berichtete die Gestapo aus Düsseldorf, „Abzeichen, Wimpel und Speere“ mit sich und sangen bündische Lieder.462 Junge Menschen aus „staatsfeindlichen Organisationen“, lautete es im Sommer 1942, würden bei illegalen Ausflügen vermehrt aufgegriffen: „Am Wochenende fahren diese Jugendlichen mit jungen Mädchen außerhalb Düsseldorfs und zelten, wodurch sittliche Verwahrlosung eintritt. Als Zeichen der Zusammengehörigkeit tragen die jungen Leute verschiedene Kleidung und Abzeichen, die einer Uniformierung“ gleichkomme.463 In einem Bann in Schwaben setzte der SRD im Sommer 1940 eine Reihe junger Leute fest, die auf ihren Ausflügen rote Halstücher trugen.464 Sogenannte wilde Fahrten betrieben, anders als in 458 Geheime Staatspolizei Köln an die Landräte des Bezirks vom 27.1.1943. In: Jahnke (Hg.), Eine Dokumentation, S. 592. 459 Aufgaben des HJ-Streifendienstes bei der Überwachung des Jugendfahrtenwesens. In: GB: Hochland, 9/42K vom 6.1942. 460 Vgl. Die Aufgaben der allgemeinen Überwachung, AR 8/40 II. In: Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 11: Streifendienst und Überwachung, S. 938–950, hier 942. 461 Vgl. ebd., S. 948–951. 462 Geheime Staatspolizei Düsseldorf an die Außendienststellen und die Grenzkommissariate und die Herren Landräte sowie Bürgermeister und Polizeiverwaltungen in Neuß und Viersen vom 22.9.1942 (HstA Düsseldorf, RW 18, 26, 2, unpag.). 463 Staatliche Kriminalpolizei Düsseldorf an die Gestapo Düsseldorf vom 25.6.1942. In: Pädagogisches Institut Düsseldorf (Hg.), Dokumentation, S. 239. 464 Vgl. Arbeitsbericht des SRD im Bann Mittelschwaben für August 1940 (StA Augsburg, HJ-Gebiet Schwaben, 56: SRD: Memmingen, Bl. 9).
364
Massenmobilisierung
diesem Fall und an anderen Stellen oft behauptet wurde, nicht nur die oppositionellen Außenseiter. Sie waren ein Teil der Hitlerjugend selbst. Die RJF stellte die Berichte ihrer nachgeordneten Stellen zusammen: „Die Berichte […] erstrecken sich im Wesentlichen auf die Monate Mai bis September 1940 als der Hauptwanderzeit. Sie lassen auch den Anteil der Hitler-Jugend an wilden Fahrten erkennen, der anscheinend sehr verschieden ist.“465 Das Gebiet Mittelelbe meldete, dass 75 Prozent der Festgesetzten nicht in der Hitlerjugend erfasst seien. Gruppen bestünden aus zwei bis drei Mann, meist solche, die länger keinen Dienst mehr täten. In Mecklenburg war man gegenteiliger Ansicht. Etwa 70 Prozent seien Hitlerjugendangehörige, die in Zivil und ohne Fahrtengenehmigung unterwegs seien: „Diese Fahrtengruppen stammten insbesondere aus […] Hamburg, Nordmark, Niedersachsen und Berlin.“466 Nur einzelne „bündische“ Gruppen habe man wegen ihrer Kleidung klar erkennen können. Die Jugendlichen seien der Polizei gemeldet worden, um ihre sofortige Rückführung in die Heimat zu veranlassen. Auch die Führung in Hessen-Nassau berichtete, dass „besonders das Wandern von HJ-Angehörigen in Zivil aufgefallen“ sei.467 Verstörend mussten mehrere Einzelfälle wirken. So informierten manche Berichte über „wilde“ HJ-Gruppen, die auf Bauernhöfen stahlen, einige hatten sich mit Kleinkaliberpistolen bewaffnet und „Geldspenden“ eingefordert: „Besonders unerfreulich ist in dieser Hinsicht eine Mitteilung der Gauleitung Mecklenburg vom 29. August 1940, die von einem ‚heuschreckenartigen‘ Auftreten der Großstadtjugend in Hitler-Jugend-Uniform spricht.“468 Die Anweisungen für den SRD enthielten daher immer häufiger den Hinweis, dass die Kontrollen dem „Schutz des deutschen Volksvermögens vor fahrlässiger Gefährdung“ dienten.469 Griff man Jugendliche auf, die „mittel-, erwerbs- oder ziellos umherstreifen“, sollten die Polizei und Fürsorgebehörden eingeschaltet werden, um eine „Einleitung von Erziehungs- und Fürsorgemaßnahmen“ zu ermöglichen.470 Spannende Selbstzeugnisse dokumentieren, dass durchaus viele junge Menschen zumindest in den ersten Kriegsjahren ihre Freizeit noch fern der Hitlerjugend verbrachten. Ein originelles Zeugnis, das darüber berichtet, stammt von Günter Schmeitzner, 1925 in Dresden geboren. Im Juli 1941 ging er mit zwei Freunden auf dreiwöchige Ferienfahrt entlang der Ostsee nach Stralsund. Das bebilderte Fahrtentagebuch, das er nach der Heimkehr auf Basis von Notizen anfertigte, erzählt von Freiheitsdrang und Spontanität inmitten von Krieg und Diktatur. Bemerkenswert ist schon das Vorwort: „Fahrtenbericht ist für die heutige Jugend ein Begriff, der fast gezwungenermaßen zum täglichen Leben 465 Jugendführer, Kriminalität und Gefährdung, S. 173. 466 Ebd. 467 Ebd. 468 Ebd. 469 Hitlerjugend: Bann 93. Streifendienst an Kripostelle, Gestapostelle und SD-Abschnitt Dessau vom 19.5.1941 (LHASA, DE, Z 141, 652, Bl. 8). 470 Aufgaben des HJ-Streifendienstes bei der Überwachung des Jugendfahrtenwesens. In: GB: Hochland, 9/42K vom 6.1942.
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
365
gehört. Wer hat nicht schon ein Lager oder eine Fahrt mit der HJ mitmachen und hinterher Berichte schreiben müssen? Ja, schon darin sieht man den Unterschied zwischen einer HJ- und einer Privatfahrt. Hinter der ersteren steckt das ‚Muss‘. In der letzteren das freiwillige ‚Wollen‘. Nachfolgender Bericht […] beschreibt eine Privatfahrt und ist […] freiwillig geschrieben.“471 Der Gymnasialschüler, der hier über eine romantische Fahrradtour berichtet, stammte aus bürgerlichem Elternhaus. Weder gibt er sich in seinem Tagebuch als Oppositioneller zu erkennen noch entspricht er dem Idealtyp des durch und durch fanatischen Hitlerjungen, obgleich er – ebenso wie seine Altersgenossen – in den Reihen der Jugendorganisation stand. Am Anfang dieser Fahrt dreier Freunde steht die Beurlaubung durch den Gefolgschaftsführer. Den Urlaubsschein und seinen HJ-Ausweis trägt der junge Mann die ganze Zeit bei sich. Da sie keinen der speziellen Ausweise für die Nutzung von Jugendherbergen besitzen, benötigen sie ihren HJ-Ausweis, um einen Schlafplatz zu erhalten. Solange sie während der Reise gen Norden auf eine Übernachtung in Herbergen angewiesen sind, halten sie sich an die polizeiliche Nachtstunde, die die Jugendschutzverordnung vorgab. Am Strand an der Ostsee schlagen sie ihre Zelte auf. Sie gesellen sich dort zu einer Gruppe von BDM-Mädchen. Man schäkert miteinander. Uniform trägt drei Wochen lang keiner der drei Jungen. Ihr Haarschnitt ist einigermaßen lässig, fast kraus, entspricht also weder dem Idealbild noch den strengen Regeln der Hitlerjugend. Sie rauchen und trinken Alkohol am Strand. Ihr Ausflug bewegt sich immer am Rande der Legalität, obwohl es an subkulturellem oder bündischem Hintergrund scheinbar fehlt. Ab und an nimmt diese Reise den Charakter einer „wilden“ Fahrt an. Die drei Freunde sind sich über den schmalen Grat bewusst. Die kleinste Übertretung der roten Linie wird zum Wagnis. „Ah, da sind ja auch unsere ‚Freunde‘ von der HJ“, schreibt er über ein unwillkürliches Zusammentreffen mit den Angehörigen des HJ-Streifendienstes. Nach einem Augenduell werden Papiere eingefordert und kontrolliert. Überall am Strand kampieren weitere Jugendliche mit ihren Zelten – es ist ein „Großkampftag“ für den SRD, kommentiert er ironisch. Mehrmals kommt es zu Kontrollen durch die Streifen: „Nach einer Weile kommt […] ein junger Mann, der sich als HJ-Führer ausgibt und unsere Ausweise verlangt. Nach kurzem heftigem Wortwechsel zieht er einen Bleistift und notiert unsere Namen. Auch will er unseren Zeltschein sehen, doch […] besitzen wir ja keinen. Zum Schluss sagt uns der ‚HJ-Boy‘ noch, dass wir näheres durch die Polizei erfahren werden. Hinterher stellt sich heraus, dass alles nur Bluff war.“472 Kontakt mit der Polizei gibt es schließlich doch. In Stettin wird aufgrund der Polizeiverordnung vom 7. August 1940 drei Reichsmark Zwangsgeld gegen sie verhängt – weil sie unerlaubt von einer Terrasse die Umgebung fotografierten. Den Strafbescheid klebt er sich stolz ins Fahrtenbuch. Aufschlussreich ist der Urlaubsbericht vielleicht gerade deshalb, weil er über weite Strecken fast gewöhnlich scheint: Die 471 Günter Schmeitzner, Fahrtentagebuch 1941, S. 2 (Digitalisat im Archiv des HAIT). 472 Ebd., S. 12.
366
Massenmobilisierung
Diktatur taucht in konkreter Gestalt des SRD oder in Form von Verordnungen nur am Rande auf – als etwas Lästiges, dem man möglichst aus dem Wege geht. Zunächst hatte man in der RJF, in Analogie zu Diskursen des Ersten Weltkrieges, von drohender „Verwahrlosung“ der Jugend selbst gesprochen. Ende August 1941 forderte sie ihre nachgeordneten Dienststellen jedoch zur umsichtigen Anwendung dieser Begrifflichkeit auf. Von Jugendverwahrlosung dürfe nicht geredet werden. Es entspreche zum einen nicht den Tatsachen, zum anderen könnten daraus – das war entscheidend – „Vorwürfe gegen die Hitler-Jugend und ihre Erziehungsarbeit“ abgeleitet werden.473 Die Gebiete gaben die Anweisung an ihre Unterführer weiter und betonten, die Formulierung sei außenpolitisch unangebracht; man forderte, sie solle auch von staatlichen Stellen nicht verwendet werden.474 Die Straße drohte die Propaganda zu entzaubern. Möglichst wenig sollte über abweichendes Verhalten in die Öffentlichkeit dringen. Besser sei von „Jugendgefährdung“ zu sprechen, teilte die RJF auf Anregung der Parteikanzlei im Sommer 1942 ihren nachgeordneten Stellen mit.475 Im Apparat der Hitlerjugend setzte ein Umdenken indes nur langsam ein. Das mittlere Führerkorps behielt den Begriff bis 1945 mehrheitlich bei, ohne sich von den Vorgaben ihrer Zentrale irritieren zu lassen. Selbst Vorhaben, die propagandistisch offenkundig kontraproduktiv waren, kamen auf und mussten dann unterbunden werden. Das Gebiet Baden z. B. beabsichtigte im Frühjahr 1942 die Erarbeitung einer „wissenschaftlichen Abhandlung“ über „Jugendkriminalität und Jugendverwahrlosung“, die vom Ersten Weltkrieg bis in die Gegenwart reichen sollte. Zu diesem Zweck forderte die Organisationsabteilung statistische Materialien sowie Lage- und Erfahrungsberichte u. a. vom Oberlandesgericht in Karlsruhe an. Das offenkundig brisante Projekt musste gestoppt werden. Den staatlichen Stellen schien nämlich die „Mitteilung der gewünschten Angaben wegen der Kriegsverhältnisse […] nicht möglich“ – und wahrscheinlich auch nicht ratsam. Selbst der eigene HJ-Gebietsrechtsreferent votierte gegen die Verarbeitung und Veröffentlichung des Materials.476 Die Verstöße gegen die Polizeiverordnung machten es aus Sicht der Hitlerjugend notwendig, intensiver als bislang auf Eltern und Arbeitgeber einzuwirken. Seit Ende Oktober 1941 existierte eine „Reichsarbeitsgemeinschaft für Jugendbetreuung“, die führende Vertreter jugendpolitischer Stellen aus Staat und Partei zusammenführte. Ende des folgenden Jahres kamen die ihr unterge-
473 Gebietsrundschreiben vom 26.8.1941, Jugendverwahrlosung. In: Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Gruppe 11: Streifendienst und Überwachung, S. 937. 474 Vgl. „Jugendverwahrlosung“. In: GB: Mark Brandenburg, 24/K vom 20.9.1941. 475 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 440. 476 Vgl. Schriftverkehr zwischen der HJ-Gebietsführung Baden und dem Oberlandesgericht vom April 1942, insbesondere das Schreiben des Oberlandesgerichtspräsidenten zur Kriminalität und Verwahrlosung der Jugend vom 14.4.1942 (GLA Karlsruhe, Abt. 240, 1987-53, 689, Bl. 353 f.).
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
367
ordneten „Gauarbeitsgemeinschaften“ in den Ländern zur Gründung.477 Diese Stellen sollten wiederum für die Bildung von Arbeitsgruppen auf Ebene der Bezirke sorgen. HJ-Führer, Jugendrichter, Ärzte, Lehrer sowie Vertreter der Jugendämter sollten sich zusammensetzen und über das beste Vorgehen beraten. In Baden und Elsass beispielsweise trat die Gauarbeitsgemeinschaft im Oktober 1942 zusammen. Als Aufgabe war ihr gestellt, „alle Jugendbetreuungsfragen mit den öffentlichen Stellen zu besprechen und die Zusammenarbeit mit der Erziehungsarbeit der HJ zu sichern. Die Arbeitsgemeinschaft nimmt sich ferner der sittlichen und moralischen Haltung der Jugendlichen an, die im Kriege viel eher eine Stütze und einer bewussten Lenkung bedarf als in Friedenszeiten.“478 Der HJ-Obergebietsführer und Leiter der Gauarbeitsgemeinschaft in Baden, Friedhelm Kemper, hielt „die unbedingte Erhaltung der Disziplin der Jugend“ für das vordringliche Ziel. Der HJ-Oberbannführer Heinz Boldt, später Adjutant Axmanns, forderte, es müsse in der Öffentlichkeit „die Verantwortung für die moralische, charakterliche und gesundheitliche Betreuung der Jugend“ betont werden, um mehr Verständnis für die Anwendung des Jugendarrests zu wecken. Mit Arrest würden momentan „zwei Drittel aller Vergehen Jugendlicher geahndet“.479 Jugendrichter sollten etwa als Redner auf Elternversammlungen die drohenden Gefährdungen für junge Menschen aus ihrer Praxis schildern. Das diente sicherlich auch der Einschüchterung.480 Die Hitlerjugend, deren Interesse vor allem in der Durchsetzung der Jugenddienstpflicht lag, flankierte derlei Aufklärungsarbeit mit eigenen Aktionen – beispielsweise, indem Unterführer aus lokalen Dienststellen sogenannte Familienbesuche unternahmen. Nur „wenn eine Mutter oder ein Vater überzeugt ist, dass der HJ-Führer sich um ihren Jungen kümmert, für ihn nur Gutes will, wird dieser Vater oder diese Mutter auch dafür sorgen, dass der Junge zum Dienst erscheint“.481 Die Gauarbeitsgemeinschaften nahmen zum Jahresende 1942 ihre Arbeit auf. Deren Hauptbetätigung lag in der Koordination und Kommunikation zwischen den verschiedenen Stellen von Partei, Sicherheitsapparat, Justiz und Hitlerjugend.482 Ob sie auf Bezirksebene
477 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 435–437; sowie Bericht über die Gründung der Reichsarbeitsgemeinschaft für Jugendbetreuung vom 27.10.1941. In: Jahnke (Hg.), Eine Dokumentation, S. 412 f. 478 Zit. nach einem Zeitungsartikel aus der Badischen Presse vom 12.10.1942, über die Arbeitsgemeinschaft für Jugendbetreuung (GLA Karlsruhe, Abt. 240, 1987-53-689, 4, Bl. 415). 479 Ebd. Vgl. zu Boldt auch Erinnerungen von Armin D. Lehmann, Der letzte Befehl. Als Hitlers Botenjunge im Führerbunker, Bergisch Gladbach 2005, S. 313, 319, 356 f. 480 Vgl. Oberlandesgerichtspräsident in Karlsruhe an die Landgerichtspräsidenten und Oberstaatsanwälte über die Benennung von Richtern und Staatsanwälte als Redner für Elternversammlungen vom 16.10.1942 (GLA Karlsruhe, Abt. 240, 1987-53-689, 4, Bl. 417). Vgl. auch die Liste der Redner aus dem Bereich der Justizverwaltung für Elternversammlungen vom 25.11.1942 (ebd., Bl. 421). 481 Elternbesuche. In: GB: Hochland, 11/34K vom 5.1943. 482 Vgl. Kollmeier, Ordnung und Ausgrenzung, S. 241; Löffelsender, Strafjustiz an der Heimatfront, S. 64.
368
Massenmobilisierung
arbeitsfähig wurden oder viel bewirken konnten, scheint überaus zweifelhaft. Im Übrigen gilt gleiches für den Versuch, mithilfe jugendlicher Unterführer auf die Eltern einzuwirken. Mancherorts kam es zwar zu Veranstaltungen in einem nennenswerten Maße. Andernorts erlahmten die Aktivitäten jedoch schnell. Für den Bezirk Koblenz ist nachgewiesen, dass es nur eine einzige Veranstaltung gab. Nur wenige Juristen meldeten sich als Redner.483 Weil man davon ausging, dass die Verstöße gegen die Polizeiverordnung mit disziplinarischen Problemen innerhalb der Hitlerjugend zu tun hatten, bedurfte es aus Sicht der RJF verbesserter Informationsbeschaffung. Die Dienststellen nämlich erhielten Benachrichtigungen über die Verstöße überwiegend von eigenen HJ-Streifen. Auch mit Jugendämtern und NSV arbeitete man zusammen. Ansonsten musste die Hitlerjugend, wie es z. B. ein Bannführer in Lörrach tat, an die Polizei oder die Landräte „mit der Bitte um Zusendung […] der polizeilichen Meldungen über Vergehen“ herantreten.484 Die staatlichen Stellen erstatteten der Hitlerjugend jedoch nicht immer von sich aus Meldung. In einer Reihe von Fällen teilte auch die Polizei ihre Informationen nicht oder nur zögerlich mit. Daher ordnete Reichsjugendführer Axmann im Herbst 1941 an, dass eine Unterrichtung der Hitlerjugend durch die Polizei automatisch erfolgen müsse. Sämtliche Verfehlungen gegen die Polizeiverordnung sollte in den eigenen Mitgliederkarteien festgehalten werden. Im Landkreis Dessau-Köthen beispielsweise wurde den Ortspolizeibehörden daraufhin umgehend erläutert, dass das Mitteilungsgebot erforderlich sei, da zur „Bestrafung sowohl von der HJ als auch von der Staatlichen Kriminalpolizei (Unterbringung in ein Jugendlager)“ beide Seiten zusammenarbeiten müssten.485 Die Dienststellen erhielten im Idealfall Mitteilungslisten von der Polizei oder aus den Jugendämtern mit den Namen der Delinquenten samt verhängter Strafen: Geldbußen oder Jugendarrest meist wegen „Herumtreiben“ in der Dunkelheit oder des Besuchs von Lokalen. Wie bei der Jugenddienstpflicht existierten hier erhebliche regionale und lokale Unterschiede in der Verfolgungspraxis und -härte. Polizeibehörden vorwiegend in Kleinstädten oder auf dem Land meldeten auffallend häufig „Fehlanzeige“, „Fehlbericht“ oder dass „im hiesigen Polizeibezirk im letzten Vierteljahr keine Verstöße gegen die bestehenden Bestimmungen bekannt geworden“ seien.486 Das Netz der Überwachung war eng, aber nicht lückenlos. Die Hitlerjugend eignete sich im Zuge der Reglementierung junger Menschen immer neue Kompetenzen an und schaltete sich intensiv in die Strafverfolgung ein. Weil
483 Vgl. Matthias Herbers, Organisationen im Krieg. Die Justizverwaltung im Oberlandesgerichtsbezirk Köln 1939–1945, Tübingen 2012, S. 344. 484 K-Bannführer Lörrach an das Landratsamt zwecks Strafaburteilung vom 27.11.1940 (StA Freiburg, B719/1, 5018, unpag.). 485 Der Landrat an die Ortspolizeibehörden zur Durchführung der Polizeiverordnung zum Schutze der Jugend vom 28.10.1941 (LHASA, DE, Z 141, 652, Bl. 19). 486 Sammlung von mehreren lokalen Meldungen bezüglich der Polizeiverordnung für das dritte Vierteljahr 1941 zwischen 30.12.1941–10.1.1942 (ebd., KB BBG, 224, Bl. 109– 120).
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
369
die Jugendorganisation mit ihrem SRD und den Maßnahmen im Rahmen der Jugenddienstpflicht selbst Repressionsmittel in der Hand hielt, wollte sie auch konkret mitbestimmen, welche jungen Menschen als „asozial“, „gemeinschaftsfremd“, „politisch unzuverlässig“, „verwahrlost“ oder „unerziehbar“ einzustufen waren.487 Das Regime machte es sich gelegentlich allzu leicht, wie Himmlers Runderlass vom 20. Oktober 1942 zeigt: „Unerziehbarkeit (Verwahrlosung) wird in vielen Fällen dann anzunehmen sein, wenn auch die Verhängung von Jugenddienstarrest ohne Erfolg geblieben ist.“488 Die HJ-Gerichte drohten bei disziplinarischen Verfahren gelegentlich mit der Einweisung in die sogenannten Jugendschutzlager – auch dann, wenn nur leichte Übertretungen der Verordnung vorlagen oder die Jugendämter keine sonstigen Hinweise auf „Verwahrlosung“ aufzuzeigen wussten. Zur Einweisung von Minderjährigen in „Jugendschutzlager“ durfte die Hitlerjugend gegenüber der politischen Polizei Stellungnahmen abgeben. Am 5. Mai 1944 wies Axmann allerding auf eine wichtige neue Regelung hin. Die Initiative zur Einweisung durfte in Zukunft nicht nur von der Polizei, sondern auch durch die HJ-Gebietsführungen ergriffen werden. Seit Längerem gab die Hitlerjugend schon individuelle Stellungnahmen ab, so wenn Vormundschaftsrichter etwa die Einweisung eines „erbgesunden, normal begabten, erziehungsgefährdeten Minderjährigen“, älter als zehn Jahre, in eine der NSV-Jugendheimstätten verfügten – von denen existierten im Deutschen Reich 1943 rund 130 mit etwa 8 000 Plätzen.489 Die Hitlerjugend ging in diesem Zuge immer härter gegen die eigenen Mitglieder vor, denen sie nach der Einführung der Jugenddienstpflicht zudem immer seltener über den Weg traute. Ab November 1942 schloss man innerhalb eines Jahres 2 725 männliche und 1 107 weibliche – durchschnittlich elf Personen pro Tag – aus der Hitlerjugend aus, ein Zuwachs von über 200 Prozent im Vergleich zu den ersten beiden Kriegsjahren.490 Dem Anschein nach eine geringe Zahl, aber gleichwohl eindrucksvoll vor dem Hintergrund des Hitlerjugend-Gesetzes von 1936 und der Tatsache, dass die RJF mit ihrem Totalitäts- und Verfügungsanspruch prinzipiell bestrebt war, möglichst alle jungen Menschen in ihren Reihen zu halten.
487 Vgl. Muth, Jugendopposition, S. 392 f.; Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 488–494. 488 Runderlass des RF SS u. Ch. D. Dt. Pol. im RM vom 20.10.1942. In: GB: Niederdonau, 1/43K vom 12.1.1943. 489 Vgl. Muster: Antrag auf Unterbringung in einer Jugendheimstätte der NSV. In: NSDAP. Gauleitung Schleswig-Holstein. Amt für Volkswohlfahrt (Hg.), Helferanweisung für die NSV.-Jugendhilfe, Kiel 1940, S. 52–55; sowie Runderlass des Reichsministers des Innern. In: RMBliv, 1943, S. 1387; abgedruckt in: Herwart Vorländer (Hg.), Die NSV. Darstellung und Dokumentation einer nationalsozialistischen Organisation, Oldenbourg 1996, S. 511 f. 490 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 397.
370 2.4
Massenmobilisierung
Das Beispiel einer Clique aus Dresden
Im April 1944 nahm die Polizei in Dresden eine Gruppe junger Menschen fest: 16 Männer und eine Frau, die sich – wie es in der folgenden Anklage lautete – einer „ablehnenden Haltung gegenüber Arbeit, Kriegseinsatz und HJ“ schuldig gemacht hatten.491 Die Clique stammte aus dem Arbeiterviertel Löbtau und war nicht die einzige, die die staatlichen Organe in Dresden im Visier hatten. Aber es sollte, weil man die Jugendlichen als „Rädelsführer“ identifizierte, ein Exempel statuiert werden: „Bei den Zusammenkünften kamen in der Regel 15 bis 20 Jugendliche beiderlei Geschlechts […] zusammen. Wenn die Jugendlichen auch gelegentlich wechselten, äußerlich kein ausgesprochen fester Zusammenhalt bestand und von einer straffen Unterordnung unter bestimmte Führer nicht ohne weiteres gesprochen werden kann, so steht doch […] fest, dass die Beschuldigten diejenigen sind, die […] fast stets dabei waren, sich in irgendeiner Form hervortaten und als die Aktivsten der Bande anzusprechen sind.“492 Dass sie andere junge Menschen negativ beeinflussten und von der Staatsjugend fernhielten, versuchte insbesondere die Hitlerjugend im Rahmen eines Gerichtsverfahrens zu belegen. Eine BDM-Führerin, die gegen die Gruppe des Viertels aussagte, hatte nachzuweisen, dass sich „das Treiben der Clique […] nachteilig auf die Antrittsstärke zum BDM-Dienst ausgewirkt“ habe. Vermutlich hatten sich einige andere Mädchen des Viertels im Umfeld dieser Gruppe bewegt, wie die Ermittlungen nahelegten; doch der BDM versuchte zu zeigen, dass die mangelnde Beteiligung beim Dienst auf „üble Belästigungen“ der Mädchen zurückzuführen sei.493 Die Auseinandersetzungen zwischen der Hitlerjugend und den angeklagten Jugendlichen, die meist bei Einbruch der Dunkelheit angeblich die Straßen unsicher machten, hätten sich seit Sommer 1944 über mehrere Monate hingezogen. Die Polizei, wie eine junge BDM-Angehörige aussagte, habe die Dinge zu lange laufen lassen, nicht rechtzeitig eingegriffen.494 Drei weitere lokale HJ-Führer sowie drei BDM-Führerinnen traten als Zeugen auf. Als Vertreter der Gebietsführung war der Leiter des sächsischen HJ-Gerichts als Sachverständiger beteiligt.495 Den Angeklagten wurden zwar im Einzelfall unterschiedliche Delikte vorgehalten, darunter unsittliche Übergriffe auf BDM-Mädchen, der Vorwurf der sogenannten Bandenbildung, Arbeitsbummelei und Verweigerung gegenüber der HJ betraf sie dagegen alle: „Die Beschuldigten trieben sich regelmäßig […] in der Dunkelheit sowie in Gaststätten
491 Anklageschrift der Oberstaatsanwaltschaft vom 15.12.1944, S. 5 (HStA Dresden, 11120, 580, Bl. 44–54). Vgl. zum Fall weitere, hier im Folgenden nicht im Einzelnen zitierte Dokumente der Akte. 492 Ebd. 493 NSDAP Hitlerjugend, Gebiet Sachsen, an den Oberstaatsanwalt beim Landgericht Dresden vom 8.12.1944 (ebd., Bl. 6). 494 NSDAP Hitlerjugend, Gebiet Sachsen, Vernehmungsprotokoll Elfriede Z. vom 2.12.1944 (ebd., Bl. 5). 495 Vgl. Anklageschrift vom 15.12.1944, S. 2 f. (ebd., Bl. 44–54).
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
371
[…] herum, wobei sie in Abwesenheit der Erziehungsberechtigten Bier tranken, regelmäßig bis nach 21 Uhr verweilten und in der Öffentlichkeit rauchten. Teilweise besuchten sie auch jugendverbotene Filme.“496 Mitte April 1945 fielen die Urteile: elf Beteiligte erhielten Gefängnis von mehreren Monaten, fünf gar für ein Jahr.497 In einem Fall wurde später Haftentlassung angewiesen, da der Vater in den letzten Kriegstagen einen Einberufungsbefehl der Wehrmacht für seinen Sohn vorlegte.498 Alle anderen saßen ihre Strafen wahrscheinlich über die Kapitulation hinaus ab. Am Beispiel der Dresdner Löbtau-Clique, die in vielerlei Hinsicht für die letzte Kriegsphase als typisch anzusehen ist, können einige Fragen diskutiert werden, die für den Zusammenhang von Hitlerjugend und Jugendopposition von Bedeutung sind: Aus welchen Milieus stammten die jungen Menschen und welche Motive besaßen sie, sich jenseits der Staatsjugend zusammenzufinden? Handelte es sich um subkulturell organisierte Jugendliche, die gar politischen Widerstand leisteten, oder um kriminelle Außenseiter, wie die RJF diese jungen Menschen titulierte? Waren Angehörige der Staatsjugend unter den Verurteilten? Die sächsischen Behörden kannten derartige Cliquen als „Broadway-Gangster“ und sogenannte Meuten; zeitgleich wurden ähnliche Gruppen junger Menschen in Leipzig unter selben Namen verfolgt.499 Die Löbtau-Clique hörte, worauf sowohl die Beamten als auch die Hitlerjugend im Verlauf des Prozesses hinwiesen, angeblich Swing-Musik. Sie hatten sich, wie für ihre Szene typisch, die Haare lang wachsen lassen. Während des Prozesses wurden diffamierende Fotografien der jungen Häftlinge – man wühlte durch ihre Haare – angefertigt, die dem Gericht beweisen sollten, wie verwahrlost die Jugendlichen aussahen, wenn sie sich außerhalb der Hitlerjugend in ihren Kneipen trafen.500 Alle Festgenommenen gehörten den Jahrgängen 1927 bis 1929 an. Sie waren dementsprechend im HJ- bzw. BDM-Alter und bei Kriegsende in der Hitlerjugend tatsächlich formal registriert und erfasst. Unter den „Rädelsführern“ befand sich lediglich eine junge Frau, die 17-jährige Christa L., BDM-Mitglied, der man „Arbeitsbummelei“ vorwarf. Gemeinsam mit einigen anderen Cliquen-Angehörigen hatte sie sich angeblich selbst Verletzungen zugefügt, um nicht zur Arbeit erscheinen zu müssen; sie sollte im Rahmen eines separaten Prozesses abgeurteilt werden.501
496 Ebd., S. 5. 497 Vgl. Urteil im Namen des Deutschen Volkes, o. D. (N170/44, 10 K Ls 6/44 jug.); sowie die kumulierte überlieferte Urteilsbegründung für alle Einzelfälle vom 14.4.1945 (ebd., Bl. 3 und 130–144). 498 Vgl. Beschluss des Landgerichts Dresden im Fall Max B. G. S. vom 19.4.1945 (ebd., Bl. 24 f.). 499 Zum Themenkomplex mit diversen Beispielen, Interviews und Dokumenten vgl. Lange, Die Leipziger Meuten, S. 76–89; ders., Leipziger Jugendgruppen im Dritten Reich, S. 160–320. 500 Vgl. Urteilsbegründung vom 14.4.1945, S. 8 f. (HStA Dresden, 11120, 580, Bl. 130– 144). 501 Vgl. Anklageschrift vom 15.12.1944, S. 10 (ebd., Bl. 44–54).
372
Massenmobilisierung
Wie allen Beteiligten wurde dem Schlosserlehrling Richard B. die Bildung eines „Mobs“ sowie Wehrkraftzersetzung zur Last gelegt. Als uneheliches Kind stammte er, wie das Jugendamt meinte, aus schwierigen Verhältnissen. Mehrere Pflegestellen hatte er durchlaufen. Erst im Alter von zehn Jahren nahm ihn die Mutter wieder zu sich. Die Jugendgerichtshilfe charakterisierte ihn als undiszipliniert. Der 15-Jährige habe in der Lehre sowie in der Hitlerjugend einen erheblichen „Mangel an Einfügungswillen“ gezeigt; er neige zur Gewalt, begehe Dummheiten, sei überaus unreif und benötige straffe Zucht und Erziehung. Die „Einsicht in die Gefährlichkeit staatsfeindlicher Bandenbildung“ sei bei ihm allerdings nicht gegeben, womit die Gutachterin ihm immerhin keine politischen Motive, sondern eher eine allgemeine Verwahrlosung bescheinigte: „Im Kreise der […] HJ war er durch seinen frühen HJ-Dienst gut bekannt, angeblich wegen der täglichen langen Arbeitszeit geht er nicht mehr zum Dienst.“502 Der Empfehlung der Gutachter, der Junge sei in Fürsorgeerziehung am besten aufgehoben, folgte das Gericht letztlich nicht. Weitere Angeklagte, wie der Lehrling Max S., der in Haft geständig war und sich einsichtig zeigte, als „Glied der Volksgemeinschaft“ versagt zu haben, kamen ebenfalls aus schwierigen Kontexten.503 Zunächst schien sich zu bestätigen, was das Regime behauptete: Cliquenbildungen seien auf Kriegsfolgen zurückzuführen und in erster Linie würden sich dort vermeintlich asoziale oder verwahrloste „Volksschädlinge“ betätigten. Werner F., der dem Jugendamt seit Längerem als „belastet bekannt“ war, beurteilte man als besonderen „Schädling und Störenfried“. In der Vergangenheit war er in einem Kinderheim untergebracht gewesen, da die Eltern an der Erziehung des Sohns wenig interessiert schienen. Seit dem Frühjahr 1939 wurde er immer wieder polizeilich auffällig. In einem Winterlager der HJ in Nassau 1943 war er beim Stehlen von Essensmarken erwischt worden. Während seine ehemalige Schule nur Negatives zu berichten wusste, sprach sich sein Lehrherr zur Überraschung der Gutachterin positiv für ihn aus: Der Junge sei tadellos, mache seine Arbeit und werde im Übrigen im Betrieb benötigt. In Untersuchungshaft bestritt er, Mitglied der Clique gewesen zu sein. Die Polizei hatte ihn jedoch, wie Akte und Urteilsspruch am Rande vermerken, in Besitz eines Sowjetsterns angetroffen. Angeblich hatte er den Stern einem russischen Kriegsgefangenen abgenommen. Die Gerichtshilfe empfahl zunächst eine Gefängnisstrafe. Das Gericht identifizierte Werner F. außerdem noch als den Urheber von Zetteln, auf denen – im Namen einer „Prottwee-Bande“, was wohl Broadway heißen sollte – der HJ-Unterbann sowie der Streifendienst beleidigt wurden. Aus diesen Gründen, und weil er einem BDM-Mädchen nachgestellt hatte, erhielt er unter den Angeklagten die höchste Strafe: Gefängnis auf unbestimmte Dauer.504
502 Bericht der Jugendgerichtshilfe Dresden über Richard B. vom 5.12.1944 (ebd., Bl. 22 f.). 503 Bericht der Jugendgerichtshilfe Dresden über Max. B. S. vom 4.12.1944 (ebd., Bl. 24 f.). 504 Bericht der Jugendgerichtshilfe Dresden über Werner E. F. vom 5.12.1944; Urteil und Urteilsbegründung vom 14.4.1945, S. 17 und 25 (ebd., Bl. 28 f. und 130–144).
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
373
Der 16-jährige Harry K. galt ebenfalls als familiär vorbelastet: Er hatte angeblich „nie ein normales Familienleben kennengelernt“, musste „Zeit seines Lebens auf Führung […] verzichten“. Dennoch sei die „Abwärtsentwicklung des Jungen erst die böse Frucht des letzten Jahres“, wie das Gutachten glaubte, und auf schlechten Umgang mit anderen zurückzuführen. Anstatt Gefängnis, so die Empfehlung des Jugendamtes, sei vielleicht besser ein Arbeitserziehungslager in Betracht zu ziehen.505 Einig waren sich alle Beteiligten hingegen bei Rudolf F., einem 17-Jährigen, der wegen Urkundenfälschung Anfang 1944 schon eine dreiwöchige Arreststrafe verbüßt hatte. Wohl hoffend, dies würde sich positiv auf das Strafmaß auswirken, hatte er sich für ein HJ-Landdienstlager gemeldet. Die harte Arbeit auf dem Bauernhof hielt er aber nur wenige Tage aus. Als Polizeiangestellter beim Dresdner Luftschutzleiter war er zudem wegen Unterschlagung entlassen worden. Auch sein Vorgesetzter in der HJ, ein Dresdner Gefolgschaftsführer, fällte ein vernichtendes Urteil: „F. ist ein charakterschwacher Mensch. […] Als Führer [in der HJ] war F. unermüdlich, zeigte aber einen ausgesprochenen Hang zum […] Schikanieren. Er hat ein starkes Geltungsbedürfnis, ist ein Angeber durch und durch.“506 Wie der junge Mann zur Clique kam und welche Rolle er dort spielte, ließ sich im Verlauf der eiligen Ermittlungen nicht klären. Die Mutter, der man nicht über den Weg traute, behauptete, ihr Sohn sei durch andere Jugendliche auf die schiefe Bahn geraten. Angehörige der Clique sagten hingegen das Gegenteil aus: Rudolf habe, um sich einen Spaß zu machen, ihnen Briefe mit dem Siegel des Polizeipräsidiums geschickt und ihnen darin Strafen angedroht.507 Mit einer Clique im Sinne einer freundschaftlich eng verschworenen Bande hatte es das Gericht hier offenkundig nicht zu tun. Im Gegenteil: Die Hintergründe und Biografien der Beteiligten waren einander noch dazu sehr verschieden. Albin S., ebenfalls Arbeiterkind, war aus Sicht von Jugendamt und Gericht ein besonders schwerer Fall: Hinter dem 16-Jährigen lag eine langjährige Anstaltskarriere als Fürsorgezögling. Der Vater galt als geisteskrank, war entmündigt worden, und die Mutter litt unter Depressionen. Albin brachte, wie es hieß, ein „ungünstiges Erbbild“ mit. Seine Festnahme schien somit die logische Konsequenz eines vorgezeichneten Lebenswegs. Selbst seine bevorzugte Bettlektüre ließ sich in das negative Bild einordnen: „Der Jugendliche ist Kriminalromanleser, treibt sich in seiner Freizeit mit ungünstigen Elementen auf der Straße herum. […] Es ist geradezu folgerichtig, dass der Junge nun das Bild des typischen Bummelanten bietet, der in schlechten Umgang gerät und allen üblen Einflüssen zugängig ist.“508 Die Überwachungsabteilung der HJ-Gebietsführung Sachsen
505 Bericht der Jugendgerichtshilfe Dresden über Harry E. K. vom 9.12.1944 (ebd., Bl. 36 f.). 506 Zit. nach Bericht der Jugendgerichtshilfe Dresden über Rudolf F. vom 12.12.1944 (ebd., Bl. 38 f.). 507 Vgl. ebd. 508 Bericht der Jugendgerichtshilfe Dresden über Albin S. vom 5.12.1944 (ebd., Bl. 20 f.).
374
Massenmobilisierung
konnte dem Gericht zusätzlich Belastendes über Albin S. mitteilen. Hintergrund war ein Zufall: Ein Jugendlicher, der wegen anderer Delikte zeitgleich mit ihm eine Zelle geteilt hatte, war nach der Entlassung auf den Landesjugendhof Wachau als Fürsorgefall in die Obhut der Hitlerjugend übergeben worden. Dort informierte er die HJ-Führung über Gespräche, die er angeblich mit Albin S. in der Zelle geführt hatte: „Nachdem man S. die langen Haare abgeschnitten hatte, war es bei ihm aus, und er schimpfte in einem fort. Er sagte, dass er, wenn er wieder herauskäme und ihm eine HJ-Streife in die Finger komme, er sich rächen und diesen die Haare genauso abscheren wolle. Zum HJ-Dienst wollten sie alle zusammen nicht mehr gehen, da könne man sie suchen. Als die Rede auf den Oberstammführer M. kam, […] sagte dieser, dass er M., wenn er einen Revolver hätte, im Dunklen umlegen würde“.509 Albin S. habe Schusswaffen erwähnt, die von den Mitgliedern der Clique in Löbtau angeblich versteckt worden waren. Gegen die HJ habe Albin S. dauernd gewettert und sogar gehofft, dass die Engländer bald kämen, um ihn und die anderen zu befreien.510 Ob diese Unterhaltung nur ansatzweise so stattgefunden hat, ließ sich natürlich nicht klären. Das Gebiet Sachsen leitete aber die Aussagen dem Gericht umgehend zu. Von allen Angehörigen der Clique erhielt Albin S. im April 1944 wenig überraschend die zweithöchste Gefängnisstrafe.511 Die Gutachter des Jugendamtes begründeten die negative Entwicklung einzelner Jugendlicher und deren vermeintlichen Hang zur Bandenbildung aber nicht durchgehend mit einer schwierigen familiären Lage oder mit – wie es im zeitgenössischen Jargon lautete – charakterlicher Asozialität. Siegfried P., Spitzname „Hardie“, war ein anderer Fall. Er stammte, wie betont wurde, aus gutem, mittelständischem Elternhaus; allerdings war der Vater früh verstorben, die gutmütige Mutter hatte es angeblich an Strenge vermissen lassen. Der Bruder machte keine Schwierigkeiten, war in der HJ nicht negativ aufgefallen und stand mittlerweile im Kriegseinsatz; eine sogenannte erbliche Belastung wurde daher ausgeschlossen. Trotzdem hatte sich „Hardie“ früh den Ruf des „Sorgenkinds“ erworben: Im Mai 1942 war er zum ersten Mal polizeilich aufgefallen, weil er mit anderen Jugendlichen in Keller eingebrochen war. Seine schulische und berufliche Entwicklung wurde als schwach bewertet. Er sei ein „verträumter, gleichgültiger Junge“, der es an „Fleiß und Aufmerksamkeit“ vermissen ließ.512 Auch Gerhard B. kam aus geordneten Verhältnissen. In der Schule sei er fleißig gewesen. In der Lehre als Modelltischler mache er sich ausgezeichnet und leiste ohne Murren Überstunden. In der HJ habe er viel Einsatzfreude gezeigt, sei Sportwart und habe es bis zum Kameradschaftsführer gebracht. Die Jugendge-
509 NSDAP Hitlerjugend, Gebiet Sachsen, Überwachung, Niederschrift über Unterredung mit L. P. vom 8.12.1944 (ebd., Bl. 6). 510 Vgl. ebd. 511 Vgl. Urteil im Namen des deutschen Volkes (ebd., Bl. 3). 512 Bericht der Jugendgerichtshilfe Dresden über S. H. P. vom 1.12.1944 (ebd., Bl. 30 f.).
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
375
richtshilfe zeigte sich in ihrem Gutachten entsprechend ratlos: „Langjährig im Jungvolk und HJ […], hervorragende Einsatzbereitschaft, die schwer in Einklang zu bringen ist mit Teilnahme an HJ-feindlichen Ausschreitungen. Vermutlich ist letzteres dem Bedürfnis entsprungen, bei allem dabei sein zu müssen, nicht nein sagen zu können und sich an körperlichen Auseinandersetzungen zu beteiligen.“513 Unbeeindruckt vom milden Bescheid der eigenen Mitarbeiterin, sprach sich das Jugendamt – wie in allen anderen Fällen – gegenüber der Staatsanwaltschaft dennoch für strengste Verurteilung aus.514 Nach dem verheerenden Bombenangriff auf Dresden gelang dem jungen Häftling im Chaos die Flucht. Er sei, wie sein Lehrherr dem Gericht im März 1945 meldete, bei ihm untergekommen, habe sich außerdem nach der Bombardierung durch „tatkräftiges Helfen Bombengeschädigter und Bergung wertvollen Gutes bewährt“. Der Arbeitgeber bat darum, dass man dem Jungen positiv begegnen solle, denn er sei derzeit bei ihm unter guter Aufsicht.515 Die Fürsprache des Meisters half nicht. Das Gericht verurteilte Gerhard B. zu zehn Monaten Gefängnis.516 Auch bei Gerhard S., der in der Obhut der Großmutter aufwuchs, stellte das Gutachten eine geordnete Situation, aber gleichwohl einen rasanten Absturz im Verlauf nur eines Jahres fest: Zuvor fleißig, unproblematisch, sei er im Betrieb und in der HJ, in der sein Arbeitgeber ihn geschickt habe, undiszipliniert und aufmüpfig geworden: „Am HJ-Dienst nahm [er] natürlich ebenfalls nicht teil, obgleich er früher selbst Jungenschaftsführer war. Für die Wehrmacht ist [er] begeistert. Er hat sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet, wurde jedoch bis Dezember 1944 zurückgestellt.“517 Die Angriffe auf andere Hitlerjugendangehörige im Rahmen der Clique stritt der Jugendliche in Untersuchungshaft zwar nicht ab. Allerdings weigerte er sich, seinen Handlungen als staatsfeindliche Umtriebe anzuerkennen.518 Noch immer aktives Mitglied der Hitlerjugend war auch der 15-jährige Harry S., ein eher unauffälliger, angeblich etwas schwerfälliger, aber doch fleißiger Junge aus einer Arbeiterfamilie. Er steht geradezu idealtypisch für Fälle, die die RJF als kriegsbedingte Verwahrlosung fürchtete. Nicht ausreichend unter elterlicher Aufsicht, schien dieser Junge zur Clique des Viertels nur durch ungünstige Umstände gekommen zu sein: „Der Jugendliche ist früher selbst Jungvolkführer gewesen“, erklärte die Jugendgerichtshilfe: „Nach Auflösung der Schnellkommando-Gefolgschaft wurde er in die Motor-HJ überwiesen. Er nahm erst neulich an einer Unterführerschulung teil. Die HJ-Führer sind ihm alle gut bekannt, auch die Streifendienstangehörigen. Er gibt an, selbst einmal
513 Bericht der Jugendgerichtshilfe über Gerhard Herbert B. vom 11.12.1944 (ebd., Bl. 39 f.). 514 Vgl. Stadt-Jugendamt, Erziehungshilfe, an die Oberstaatsanwaltschaft Dresden vom 12.12.1944 (ebd., Bl. 40). 515 Modellbauer Willy K. an das Landgericht Dresden vom 6.3.1945 (ebd., Bl. 175). 516 Vgl. Urteil im Namen des Deutschen Volkes (ebd., Bl. 3). 517 Bericht der Jugendgerichtshilfe über Gerhard Kurt S. vom 4.12.1944 (ebd., Bl. 34 f.). 518 Vgl. ebd.
376
Massenmobilisierung
die Absicht gehabt zu haben, zum HJ-Streifendienst zu gehen.“519 Der Vater, ein Parteimitglied und Blockwart, sei allgemein gut beleumundet, habe jedoch zur Erziehung des Sohns kaum ausreichend Zeit. Der Junge sei von seiner Festnahme und der Untersuchungshaft schwer beeindruckt. Er gelobe nun Besserung.520 Die Staatsanwaltschaft argumentierte allerdings mit Erfolg, die Eltern und sein Lehrherr seien lediglich „über das wahre Treiben des Beschuldigten“ zu lange im Dunkeln geblieben.521 Harry erhielt vier Monate Jugendgefängnis. Am Beispiel der Löbtau-Clique bestätigt sich zunächst, was allgemein für jugendliche Sozialisation und Vergemeinschaftung jenseits der Hitlerjugend während des Krieges gilt: Gruppenbildend wirkte stets ein subkultureller Kontext, ohne den die Verweigerung gegenüber der Hitlerjugend kaum die Folge gewesen wäre. Die großstädtischen Jugendgruppen sind unter verschiedenen Bezeichnungen geläufig – Swing-Kids im Hamburg, Frankfurt am Main oder Berlin, Edelweißpiraten und Navajos im Rheinland, Meuten in Mitteldeutschland, Schlurfs im Süden –, doch soziologisch betrachtet waren sie sich ähnlich: lange Haare, Schminke, Begeisterung für verbotene Lieder, lässige Kleidung oder eine Art der sichtbaren Grenzziehung nach außen mittels Kleidung und Symbolik. Auch die Dresdner Staatsorgane hoben die subkulturellen Kontexte hervor, um die vermeintlich kriminelle Energie der Beteiligten aufzuzeigen: „Diese jungen Burschen pflegten […] in betont lässiger Weise herumzustehen und herumzuschlendern. Sie lärmten, sangen Filmlieder, trieben allerhand Unfug, besuchten für Jugendliche nicht zugelassene Filmvorführungen, hielten sich verbotenerweise nach Eintritt der Dunkelheit auf den Straßen und […] in Gaststätten auf und rauchten in der Öffentlichkeit.“522 Zurecht stellte das Regime zwischen abweichendem Verhalten und der Hitlerjugendverweigerung stets einen engen Zusammenhang her. Das war auch in diesem speziellen Fall aus Dresden nicht anders: „Dabei trugen sie ein undeutsches Wesen zur Schau. […] Ihre Gegnerschaft zur HJ betonten sie äußerlich zum Teil dadurch, dass sie in Ablehnung des […] üblichen kurzen Haarschnitts sich lange Haarmähnen wachsen ließen. Ihr Hauptbetätigungsfeld war die Kesselsdorfer Straße. Dieser gaben sie die Bezeichnung ‚Broadway‘, und sich selbst den Namen ‚Brodway-Gangster‘ [sic!], was ihre Hinneigung zu anglo-amerikanischen Gewohnheiten und Anschauungen und ihre Abkehr von dem Wesen, das heute einem Deutschen eigen ist, erkennen lässt.“523 Die Clique sei nach Zahl ihrer Mitglieder nicht begrenzt, sondern gebe sich vielmehr offen für jeden, der hinzustoße, und sie sei zudem größer, als die Zahl der festgenommenen „Rädelsführer“. Auch war die Clique nicht ausschließlich männlich; griff die Polizei Mädchen auf, interessierten sich die Behörden für diese jedoch weit weniger. Dass, wie man im Urteil 519 Bericht der Jugendgerichtshilfe Dresden über Harry Erich S. vom 11.12.1944 (ebd., Bl. 40 f.). 520 Vgl. ebd. 521 Anklageschrift vom 15.12.1944 (ebd., Bl. 44–54). 522 Urteilsbegründung vom 14.4.1945, S. 10 (ebd., Bl. 130–144). 523 Ebd., S. 11.
Hitlerjugend als Zwangsgemeinschaft
377
gegen die Löbtauer Clique befand, die Angehörigen von einem „Gefühl einer festen Zusammengehörigkeit erfüllt“ gewesen seien, traf außerdem nur bedingt zu; die Ermittlungen zeigten durchaus sogar Gegenteiliges auf. Aus politischen und ideologischen Gründen waren aber die Behörden ebenso wie die Hitlerjugend bestrebt, in den meist losen und informellen Gruppen gleichwohl „einen organisatorischen Zusammenhalt“ auszumachen, der sie „bewusst in Gegensatz zur HJ“ stellte.524 Anders als die RJF vorgab, waren die Großstadt-Cliquen kein Phänomen ausschließlich der Unterschicht oder von asozialen „Volksschädlingen“, die sich grundsätzlich außerhalb der „Volksgemeinschaft“ bewegten. Einige kamen tatsächlich aus schwierigen familiären Verhältnissen, andere aus geordneter Umgebung. Die Cliquen waren einigermaßen sozial durchmischt. Im Fall dieser speziellen Clique, die sich in einem Arbeiterviertel angeblich um 1942 gebildet hatte, waren es insbesondere Lehrlinge in handwerklichen Berufen. Aber auch ein Gymnasialschüler war unter den Festgenommenen. In anderer Hinsicht hatte die RJF mit ihrer Diagnose nicht ganz Unrecht: Die Auswirkungen der Kriegslage, die Abwesenheit von Eltern oder Geschwistern, auch die labilen Strukturen der Hitlerjugend führten dazu, dass junge Menschen aufsässiger, auch kleinkriminell auffällig oder sogar gewalttätig wurden. Das Regime förderte die Radikalisierung allerdings selbst und betrieb die Kriminalisierung Jugendlicher, weil subkulturelle Freiräume immer weiter unterbunden wurden. Diebstähle, gewaltsame Aktionen gegenüber dem SRD oder das rüpelhafte Nachstellen von BDM-Mädchen waren in diesem Fall gewiss nicht frei erfunden – das Strafmaß stand allerdings in keinem angemessenen Verhältnis zu den Delikten. Vom subkulturellen Kontext abgesehen, bleibt die Frage nach der politischen Einordnung relevant: Gründeten Diebstahl oder Urkundenfälschung ausschließlich in krimineller Energie oder handelte es sich um einen alltäglichen politischen Widerstand im Kleinen? Wie bei ähnlich gelagerten Fällen, etwa den Edelweißpiraten im Rheinland, bei denen man sich nach 1945 mit der Deutung schwertat, sind die Cliquen nicht leicht einzuordnen. Widerstandsmotive im engeren Sinne besaß sicherlich keiner der jungen Beteiligten. Immerhin Indizien für eine schleichende Politisierung der Gruppenmitglieder sind den Akten zu entnehmen. In Rechnung zu stellen ist, dass sich sowohl die Hitlerjugend als auch das Landgericht bemühten, abweichendes Verhalten und Verweigerungsakte gegenüber der Hitlerjugend als politisch relevante Gefährdung herauszuheben. Das Landgericht wertete die Attacken auf den SRD sogar dezidiert als „Widerstandshandlungen“ gegen die Staatsmacht. Dementsprechend wurde dann auch geurteilt: Die Jugendlichen hätten sich „bewusst und absichtlich in Gegensatz zu den Einrichtungen und Maßnahmen der Staatsführung gestellt […], deren Einhaltung und Durchführung besonders im jetzigen totalen Krieg unbedingt gewährleistet sein“ müsse.525 524 Ebd., S. 12. 525 Ebd., S. 24 und 21.
378
Massenmobilisierung
Für die Geschichte der Hitlerjugend sind derart gut dokumentierte Beispiele von Bedeutung. Sie zeigen, dass es die strenge Dichotomie zwischen Hitlerjugend einerseits und Jugendopposition andererseits in der Realität im Grunde kaum gegeben hat. Sie lag im Interesse des Regimes, weil sie der Diffamierung der Beteiligten diente, und entsprach außerdem dem erzählerischen Bedürfnis der Historiografie nach 1945, die sich in ihrer Deutung um klare Grenzziehungen und weniger um die Grautöne der „Volksgemeinschaft“ bemühte. Jugendlicher Alltag jenseits und innerhalb der Hitlerjugend stand jedoch im wechselseitigen Austausch. Es handelte sich kaum um einander abgeschiedene Lebenswelten. Keiner in der Löbtau-Clique stand außerhalb der Hitlerjugend oder war von Bindungen an die Staatsjugend vollkommen frei; die meisten hatten in der Vergangenheit Dienst getan, einige hatten einen niederen Führungsrang inne, mancher hob zur Entlastung sogar seine übrigen HJ-Freundschaften hervor. Einer der Jugendlichen arbeitete, was die Ermittler im Besonderen verstörte, auf einer HJ-Dienststelle im Viertel: „Das hinderte ihn jedoch nicht“, wie es in der Urteilsbegründung hieß, sich „an den Straßenansammlungen der Bande zu beteiligen und gegen die HJ zu hetzen.“526 Verweigerung oder, wenn man so will, Opposition gegen die Staatsjugend fand nicht außerhalb, sondern in Abhängigkeit und in der Organisation selbst statt.
3.
Aussonderung und Umerziehung
3.1
Die Selektion junger Menschen
Den ideologischen Großentwürfen des 20. Jahrhunderts wohnte ein Element der Enttäuschung inne. Historiker Jörg Baberowski hat auf den Umstand hingewiesen, dass der Anspruch einer totalitären Diktatur nicht mit ihrer Wirklichkeit zu verwechseln sei: „Man muss sich von der Vorstellung freimachen, die Essenz der totalitären Diktaturen sei die Übereinstimmung von Inszenierungen und Praktiken gewesen. Sie waren vielmehr Diktaturen mit totalitären Ansprüchen, die ihre Gewalttätigkeit gerade dadurch entfalteten, dass sie ihre politischen und sozialen Entwürfe nicht verwirklichen konnten.“527 Was sich nicht in das rassistische und ideologische Ideal- und Wahnbild des Regimes einfügen ließ, sollte ausgesondert werden. Junge Menschen, die aus der „Volksgemeinschaft“ herausfielen, weil sie sich der Hitlerjugend verweigerten oder aus diversen Gründen für unerziehbar gehalten wurden, drohte im extremen Fall die Verschleppung in sogenannte Jugendschutzlager. Wieder einmal liegt dem Begriff eine Täuschungsabsicht zugrunde: Nicht der Schutz der Eingewiesenen war gemeint, sondern – im Sinne des Regimes – der Schutz aller übrigen, der angepassten und ideologisch konformen jungen Menschen. Von ihnen sollten die sogenannten Unerziehbaren oder Verwahrlosten möglichst separiert werden. 526 Ebd., S. 13. 527 Baberowski, Nationalsozialismus, Stalinismus und die Totalitarismustheorie, S. 55.
Aussonderung und Umerziehung
379
Die Jugendschutzlager waren dem Reichskriminalpolizeiamt im Reichssicherheitshauptamt zugeordnet. Administrativ bildeten sie de facto einen Bestandteil des größeren KZ-Systems. Männliche Jugendliche wurden ab August 1940 in das Lager in Moringen bei Göttingen eingewiesen. Bis Kriegsende waren hier etwa 1 400 Jungen inhaftiert worden. Das Mädchenlager „Uckermark“ mit rund 1 000 Insassinnen bei Kriegsende hatte man im Juni 1942 als Teil des KZ Ravensbrück eröffnet. Ein sogenanntes „Jugendverwahrlager“ befand sich im Ghetto Litzmannstadt in Polen. Dorthin konnten ab Dezember 1942 auf Antrag von Kriminalpolizeistellen „kriminelle oder sonst verwahrloste“ Kinder „polnischen Volkstums“ beiderlei Geschlechts im Alter von 8 bis 16 Jahren – in der Praxis allerdings sogar Jüngere – eingewiesen werden. Unter katastrophalen Bedingungen spannte man diese Kinder in das System der Zwangsarbeit ein. Vom SS-Rasse- und Siedlungshauptamt fanden im Lager außerdem Überprüfungen und Selektionen zur „Eindeutschungsfähigkeit der Polenkinder“ statt.528 Man geht heute von bis zu 20 000 inhaftierten Kindern aus. Anders als im Falle dieses „Jugendverwahrlagers“ waren zumindest ein Teil der Inhaftierten in Ravenbrück und Moringen – jedenfalls nach den Rassekriterien des Reichsbürgergesetzes – Mitglieder der deutschen „Volksgemeinschaft“. Die beiden Jugendschutzlager dienten der sogenannten Vorbeugehaft von solchen Personen, „die kriminell besonders gefährlich oder gefährdet sind und bei denen die Betreuung durch die Jugendhilfe, insbesondere auch Schutzaufsicht und Fürsorgeerziehung, versagt [haben] oder von vornherein erfolglos erscheint“.529 Es waren keine dezidierten Vernichtungsstätten: Nicht die physische Auslöschung oder Ermordung der jungen Häftlinge war das Ziel, sondern „die noch Gemeinschaftsfähigen“ von den „Unerziehbaren“ gewissermaßen zu scheiden. Die Ersteren galt es in die „Volksgemeinschaft“ zurückzuholen, während die Letzteren „unter Ausnutzung ihrer Arbeitskraft“ – was Tötung meinte – an andere Orte gebracht werden sollten.530 Die Einweisungsgründe konnten variieren: Homosexualität, Arbeitsbummelei, Abhören von Feindfunk, Widerstandsakte wie Sabotage oder die Herstellung von Flugschriften, „Verwahrlosung“ durch sexuelle Kontakte zu „Fremdvölkischen“ und Zwangsarbeitern – im Besonderen bei den internierten Mädchen – sowie dauernde Verstöße gegen die Jugenddienstpflicht oder eine Betätigung in Cliquen und Banden, zumal gepaart mit Kleinkriminalität. Die Gründe überlagerten sich aber auch vielfach.531 528 Reichssicherheitshauptamt, V A 3, Nr. 3050/42, an den Leiter der Kriminalpolizeileitstelle Dessau, Abschrift bezüglich der Einweisung von verwahrlosten Kindern und Jugendlichen polnischen Volkstums in das Polen-Jugendverwahrlager Litzmannstadt vom 28.11.1942 (LHASA, DE, Z 141, 652, Bl. 53 f.). 529 Anweisung: Einweisung in das Jugendschutzlager Moringen, RdERl. d. M.d.J. vom 3.10.1941 (StA Freiburg, B719/1, 5018, unpag.). 530 Ebd. 531 Vgl. Martin Guse, „Gemeinschaftsfremder“. Ausgrenzung und Haft von Jugendlichen im Jugend-KZ Moringen. In: Dietmar Sedlaczek/Thomas Lutz/Ulrike Puvogel/ Ingrid Tomkowiak (Hg.), „minderwertig“ und „asozial“ – Stationen der Verfolgung gesellschaftlicher Außenseiter, Zürich 2005, S. 127–153; ders., Die Jugendschutzla-
380
Massenmobilisierung
Das höhere Führerkorps der Hitlerjugend konnte ab 1944, wie zuvor erwähnt, an der Seite von Polizei, Justiz, Jugendämtern und NSV die Einweisung anordnen. Wie oft Gebietsführungen von dieser Möglichkeit Gebrauch machten, ist bislang nicht geklärt. Schon vor 1944 hatte die Hitlerjugend jedoch gutachterliche Beurteilungen zur Einweisung von jungen Menschen erstellt, welche etwa auf Meldungen des SRD und ihren eigenen Karteien basierten. Für das KZ-Lagerpersonal rekrutierte die RJF zudem ältere HJ-Führer ab 25 Jahren.532 Erst 1970 wurden die beiden Jugendschutzlager in der Bundesrepublik als „KZ-ähnliche Lager“ anerkannt; in der DDR zwei Jahre später als Konzen trationslager.533 Die verschiedenen Begriffe stehen oft mit etwas Verlegenheit nebeneinander. Der Vorwurf entweder von Verharmlosung oder vom Vergleich des Unvergleichlichen scheint im Raum zu stehen. Die Jugendschutzlager waren weder Vernichtungslager noch Fürsorge- und Erziehungsanstalten, sondern sie vereinten auf zynische Weise beides. In Baracken-Blöcken nach dem Grad ihrer vermeintlichen „Erziehbarkeit“ aufgeteilt, wurden Jugendliche zur Arbeit gezwungen, begutachtet, selektiert und – im Falle eines negativen Entwicklungsurteils – der Ermordung preisgegeben. Die französische Widerstandskämpferin Germaine Tillich hat das Jugendschutzlager „Uckermark“ als „ein der Vernichtung vorgeschaltetes Zwischenlager“ charakterisiert.534 Im Komplex der Selektion bildeten sie die Endstation. In den Kriegsjahren existierte nämlich ein institutionell weitläufiges Geflecht staatlicher Einrichtungen, die der Begutachtung, Siebung und Umerziehung von jungen Menschen dienten. Moringen und „Uckermark“ waren diverse Fürsorge- und Erziehungsanstalten gewissermaßen vorgeschaltet. Die Hitlerjugend betrieb in der zweiten Kriegsphase sogar selbst Einrichtungen, um sich auf diese Weise an der Selektion zu beteiligen. Per Runderlass aus dem Reichsinnenministerium wurde im August 1943 erneut festgeschrieben: Zu unterscheiden sei zwischen „erbgesunden, normal begabten“ Minderjährigen auf der einen Seite. Hier könne „Verwahrlosung“ durch ein ungünstiges familiäres oder soziales Umfeld um sich greifen. Auf der anderen Seite habe man es mit Kindern und Jugendlichen rassischer oder geistig Minderwertigkeit zu tun. Während die Letzteren in geschlossenen Heimen von der Gesellschaft abgesondert werden sollten, waren die Ersteren bevorzugt in NSV-Jugendheimstätten unterzubringen, um dort ihre Wiedereingliederung
ger Moringen und Uckermark. In: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Band 9, München 2009, S. 101–114; Katja Limbächer/Maike Merten, Die Einweisungspraxis der Kriminalpolizei in das Jugendschutzlager Uckermark. In: Katja Limbächer/Maike Merten/ Bettina Pfefferle (Hg.), Das Mädchenkonzentrationslager Uckermark, 2. Auflage, Münster 2005, S. 99–114. 532 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 493 f. 533 Vgl. Katja Limbächer/Maike Merten/Bettina Pfefferle, Einleitung. In: Limbächer/Merten/Pfefferle (Hg.), Uckermark, S. 7–15. 534 Simone Erpel, Das „Jugendschutzlager“ Uckermark als Vernichtungslager. In: ebd., S. 215–234, hier 226.
Aussonderung und Umerziehung
381
in die „Volksgemeinschaft“ zu betreiben.535 Beides galt nur im Falle von Kindern und Jugendlichen, die nicht straffällig und schon ein Fall für die Jugendgerichte geworden waren. Die Fürsorgeerziehung hatte noch bis in die 1930er-Jahre eigentlich einen Kernbereich der kirchlichen Arbeit dargestellt. Nach 1933 war zunächst keine grundsätzliche Änderung eingetreten. Allerdings versuchte das Regime, in die kirchliche Heimerziehung ideologisch und personell einzudringen. Partei, NSV und Hitlerjugend bemühten sich, die Fürsorgeerziehung unter ihre je eigene Kontrolle zu bringen. Die RJF trieb dabei ein Geltungsbedürfnis ebenso wie Eigeninteresse: Erstens sah sich das HJ-Führerkorps dank des Hitlerjugend-Gesetzes von 1936 für alle Fragen der Jugenderziehung und Betreuung als mit- oder hauptverantwortlich an, manchmal in Konkurrenz zu anderen Gliederungen oder der staatlichen Bürokratie. Zu nennen wäre hier die „Schutz aufsicht“ über Jugendliche, die von den Jugendämtern organisiert wurde, auf die allerdings die Hitlerjugend Einfluss zu erhalten versuchte.536 Zweitens betraf nach 1939 die kriegsbedingte „Verwahrlosung“ gerade jene, die zu erfassen, heranzuziehen und auszubilden der Staatsjugend als Aufgabe gestellt war. Die der NSV-Jugendhilfe und den Jugendämtern unterstehenden Fürsorgeeinrichtungen waren mehrheitlich offene Heime, wo junge Menschen halbtags verkehrten. Die NSV richtete ihr Hauptaugenmerk auf die Vorbeugung von „Erziehungsnotständen“. Dezidiert nicht zu ihren Aufgaben zählten „Kinder und Jugendliche, bei denen […] keine Aussicht“ zu bestehen schien, dass man sie „zu brauchbaren und nützlichen Mitgliedern der Volksgemeinschaft“ erziehen konnte.537 Auch die Hitlerjugend richtete ihr Augenmerk stets nur auf jene Kinder, die als gesund, rassisch wertvoll oder potenziell nützlich galten. Für alle anderen interessierte sie sich nicht. Die Gebietsführung von Thüringen, um ein Beispiel zu nennen, untersagte ihren Dienststellen und Unterführern Mitte 1937 das Eingreifen in schwebende Verfahren zur Sterilisation. Hintergrund war ein Fall, bei dem eine örtliche HJ-Führung ein Gutachten zur Frage einer drohenden Sterilisation erstellt hatte.538 An den Fürsorgeheimen und Jugendheimstätten zeigte das HJ-Führerkorps nur deshalb ein gesteigertes Interesse, weil es hier um junge Menschen ging, die man für resozialisierbar hielt und als Mitglieder der „Volksgemeinschaft“ erachtete. Die Untergebrachten verfügten meist über Freigang, vielleicht standen sie im Lehrverhältnis oder waren nur tageweise in Betreuung. Im Rheinland hatten vor 1936 zwei sogenannte 535 Vgl. Friederike Wapler, Kinderrechte und Kindeswohl. Eine Untersuchung zum Status des Kindes im Öffentlichen Recht, Tübingen 2015, S. 57. 536 Vgl. Schutzaufsicht über Angehörige der HJ-Gliederungen. In: GB: Sachsen, 5/36 vom 12.5.1936; vgl. auch Erziehungsanstalten im Bannbereich. In: ebd.; vgl. ferner Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 162–164; Karl Peters, Jugendgerichtsgesetz vom 16. Februar 1923 mit ergänzenden Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften auf dem Gebiete des Jugendstrafrechts, Berlin 1942, S. 148. 537 Vereinbarung zwischen dem Reichsminister des Innern und dem Leiter der Partei-Kanzlei betr. Übertragung von Geschäften des Jugendamtes auf die NSV-Jugendhilfe vom 27.8./21.9.1941. In: Vorländer (Hg.), Die NSV, S. 469. 538 Vgl. Betrifft: Sterilisation. In: GB: Thüringen, A6/37 vom 15.4.1937.
382
Massenmobilisierung
ameradschaftsheime in Düsseldorf und Mühlheim an der Ruhr existiert. 1937 K kamen ein Heim für Mädchen in Düsseldorf und zwei NSV-Jugendheimstätten für „erbgesunde“ und „erziehungsfähige“ Jugendliche in Wuppertal und Niederbreisig bei Koblenz hinzu. HJ-Unterführer als „Heimscharführer“ sowie junge BDM-Führerinnen wurden in diesen Heimen als Erzieher eingesetzt.539 Als Mustergau galt Pommern mit sechs solcher Einrichtungen im Jahr 1937.540 Die Kooperation zwischen NSV und Hitlerjugend erhielt 1936 eine formale Basis. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Bannebene sollten durch die NSV „vor asozialen und erbbiologisch minderwertigen Jugendlichen“ gewarnt werden. Der Hitlerjugend sollten außerdem „erbgesunde und erziehbare Jugendliche“, die der Organisation bislang nicht angehörten, aus den Heimen zugeführt werden.541 Mit Kriegsbeginn wurden weitere Heime geschaffen, die der NSV unterstanden und in denen HJ- oder BDM-Personal tätig wurde. Im August 1943 belief sich die Zahl dieser Heime laut Reichsinnenministerium auf etwa 130.542 Das Heimkonzept ist einem Antrag der NSV im sächsischen Kreis Freiberg beispielhaft zu entnehmen. Hier betrieb man 1939 den Aufbau eines „Burschenheims“ für Lehrlinge: „Der Grundgedanke […] geht davon aus, Jugendliche, die gefährdet sind, oder bei denen Verwahrlosungserscheinungen vorliegen, unter Belassung in einem Arbeits- oder Lehrverhältnis […] in ihrer Freizeit in dem Heim unterzubringen. Es handelt sich hierbei um Jugendliche, bei denen Verwahrlosungserscheinungen geringeren Grades aufgetreten [sind]. Die Erfahrung hat gelehrt, dass es eine größere Anzahl Jugendlicher gibt, bei denen trotz annehmbar guter Erbanlagen ein Verbleiben in der Familie oder sonstigen Umgebung nicht ohne Gefahr für ihre weitere Entwicklung zu verantworten ist.“543
Es sei nicht ratsam, Jugendliche aus ihrer Umgebung völlig herauszureißen, weil das die Situation nur verschlimmere, außerdem für den Staat höchst unproduktiv sei. Die neuen Jugendheimstätten seien das Vorbild. Am frühen Morgen nehme man gemeinsam Mahlzeiten ein, dann ginge jeder seiner Arbeit nach, bevor man den Abend und die Nacht wieder im Heim verbringe. Zur Beaufsichtigung und Schulung sei die Zusammenarbeit mit der Hitlerjugend geboten: „Die Erziehungsarbeit wird in engster Zusammenarbeit mit der HJ durchgeführt.“544 539 Vgl. Andreas Henkelmann/Uwe Kaminsky, Die Entstehung der Fürsorgeerziehung im Rheinland (1878–1945). In: Landschaftsverband Rheinland (Hg.), Verspätete Modernisierung. Öffentliche Erziehung im Rheinland – Geschichte der Heimerziehung in Verantwortung des Landesjugendamtes (1945–1972), Essen 2011, S. 23–40, hier 36. 540 Vgl. Peter Hammerschmidt, Die Wohlfahrtsverbände im NS-Staat. Die NSV und die konfessionellen Verbände Caritas und Innere Mission im Gefüge der Wohlfahrtspflege des Nationalsozialismus, Wiesbaden 1999, S. 545. 541 Vereinbarung zwischen dem Hauptamt für Volkswohlfahrt und der Reichsjugendführung vom 4.2.1936. In: Vorländer (Hg.), Die NSV, S. 338 f. 542 Vgl. Hammerschmidt, Die Volkswohlfahrtsverbände im NS-Staat, S. 548; Christa Hasenclever, Jugendhilfe und Jugendgesetzgebung seit 1900, Göttingen 1978, S. 134. 543 NSDAP, Amt für Volkswohlfahrt des Kreises Freiberg an den Oberbürgermeister Freiberg, Jugendamt vom 7.7.1939 (HStA Dresden, 10756, 6087, unpag.). 544 Ebd.
Aussonderung und Umerziehung
383
Soweit sie über genügend personelle Ressourcen verfügte, was gerade nach 1939 immer seltener der Fall war, lag die Zusammenarbeit im Eigeninteresse der Hitlerjugend. Mit der Jugenddienstpflicht hatte sie sich die Aufgabe gestellt, junge Menschen in den Dienstalltag umfassend zu integrieren. Und die Heimerziehung bot eben diese Möglichkeit – gerade im Falle jener, die unter Umständen der Hitlerjugend verlorenzugehen drohten. Engagement in der Fürsorgeerziehung stellte auf diese Weise eine Prävention gegen subkulturelle Gruppenbildung und drohende „Verwahrlosung“ dar. Neben solchen offenen Erziehungsheimen ging die Hitlerjugend ab 1942 teilweise aber auch wieder in geschlossene Anstaltseinrichtungen. Hier knüpfte man an die ersten Ansätze in den frühen 1930er-Jahren an; im März 1939 hatte die RJF für alle Fürsorge zöglinge zunächst eine Mitgliedschaft in der Hitlerjugend verboten. In den 1930er-Jahren waren in geschlossenen Anstalten in einigen Fällen Hitlerjugendeinheiten gegründet worden. Gewissermaßen als Gratifikation sollten Zöglinge in die Organisation aufgenommen werden, die sich aus Sicht der jeweiligen Heimleiter günstig entwickelten.545 Wie sehr sich die RJF für das Thema gerade vor dem Hintergrund der Kriegssituation interessierte, machen aber insbesondere ihre Initiativen zur Gründung eigener Institutionen deutlich. Neben der staatlichen Jugendfürsorge wollte die RJF nämlich ein eigenes Fürsorgewesen etablieren, das auf Kriminalitätsvorbeugung und Umerziehung zielte, jedoch gleichzeitig zur Selektion und Aussonderung der vermeintlich „Unerziehbaren“ diente. Die sogenannten Landesjugendhöfe waren ein genuin der Hitlerjugend unterstelltes Heimwesen, das als Pilotprojekt in Sachsen in den späten Kriegsjahren aufgebaut wurde und – die letzte Kriegsphase macht die Pläne zunichte – als ein Vorbild für weitere Heimgründungen im „Dritten Reich“ hätte dienen sollen. 3.2 Spätes HJ-Pilotprojekt: die Landesjugendhöfe Zentrale Erziehungsanstalt in Sachsen war bis in die 1930er-Jahre die Landesanstalt in Chemnitz. 1861 auf Privatinitiative als Erziehungsinstitut für Blinde gegründet, hatte man sie mit der Landeserziehungsanstalt für schwachsinnige Kinder zusammengelegt. Neben Blinden und sogenannten Schwachsinnigen wurden in die Anstalt junge Menschen eingewiesen, die aus verschiedensten Gründen als „Ballastexistenzen“ galten. Nachdem im Verlauf des Zweiten Weltkrieges die Landesanstalt als Großlazarett durch die Wehrmacht beansprucht worden war, musste die Fürsorgeerziehung vermehrt ausgegliedert und dezentral organisiert werden. Die Landesjugendhöfe der Hitlerjugend entstanden ab Ende 1942. Zum Teil handelte es sich um Heime, die vormals in kirchlicher 545 Vgl. Sven Steinacker, „... fachlich sauber und im Geist des Nationalsozialismus …“. Volksgemeinschaftsideologie und Fürsorgeerziehung nach 1933. In: Neue Praxis, (2008) 5, S. 459–477, hier 467 f.
384
Massenmobilisierung
Hand gewesen waren.546 Die Landesjugendhöfe lagen in Moritzburg, Lotzdorf, Berthelsdorf, Sohland, Niederrödern, Börnichen und Glauchau. Stabsführer Helmut Möckel, Stellvertreter des Reichsjugendführers und selbst aus Sachsen stammend, hatte die Initiative für das Pilotprojekt ergriffen. Gauleiter und Reichsstatthalter Martin Mutschmann segnete es ab.547 Die Landesjugendhöfe unterstanden formal dem Landesjugendamt, was aus ihnen staatliche Einrichtungen machte. In Moritzburg existierte eine Verwaltungsstelle des Landesjugendamtes, die technische Angelegenheiten wie beispielsweise Besoldung und Einstellung von Personal oder den Austausch mit den Ämtern regelte.548 In der Praxis wurden die Höfe aber durch die Jugendorganisation betrieben und geführt. Die meisten Höfe unterstanden direkt der Leitung von HJ-Funktionären, die sich in mittleren Führungspositionen zuvor Verdienste erworben hatten. Nur auf den Höfen in Lotzdorf und Glauchau, wo junge Mädchen untergebracht waren, nahmen staatliche Schwestern die Leitung wahr.549 Mitte 1943 entfiel ein Drittel der Belegungsstärke der Höfe auf Mädchen, zwei Drittel auf Jungen.550 Das Konzept gab sich auf den ersten Blick reformerisch: Im Gegensatz zur traditionellen und überholten staatlichen Fürsorgeerziehung, umriss ein Artikel im RJF-Organ „Das Junge Deutschland“, stehe der Mensch und seine Bildung im Mittelpunkt. Alle überflüssigen und der Erziehung abträglichen Dinge seien abgeschafft: Die Prügelstrafe existiere nicht, es gebe auf den Höfen weder Mauern noch Zäune, auch keinen Stacheldraht, „Zucht und Ordnung“ seien auf Einsicht und Bereitschaft der Jugendlichen gegründet. Im Mittelpunkt stehe die Förderung von Eigenverantwortung durch individuelle Bewährungsproben. Junge „Arbeitsbummelanten“ würden in Werkstätten, auf Bauernhöfen, im Sägewerk, in Wäschereien und Bäckereien, im Wehrertüchtigungslager oder bei der Kinderlandverschickung eingesetzt, um wieder einen Sinn für Gemeinschaft und Leistung zu entwickeln. Schien die Entwicklung eines Jugendlichen am Ende auf gute Bahnen gelenkt, ließ sich die erfolgreiche Resozialisierung durch die (Wieder-)Aufnahme in die Hitlerjugend krönen.551 Insgesamt acht
546 Vgl. Sächsischer Minister des Innern, Landesjugendamt, an die Landräte, Kreise und Jugendämter über die Landeserziehungsanstalt Chemnitz vom 30.9.1942 (NARA, T1021, 707, Bd. 19, Bl. 125188). 547 Vgl. August Härtel, Neugestaltung der Fürsorgeerziehung. Landesjugendhöfe für sozialauffällige Jugendliche. In: Das Junge Deutschland, (1944) 4, S. 61–68. 548 Vgl. die Personalakten zu den Landesjugendhöfen im HStA Dresden unter im Folgenden angegebenen Signaturen. Die „Hauptverwaltung der staatlichen Erziehungsheime des Landes Sachsen. Sitz Moritzburg“ unterstand der Leitung eines Regierungsoberinspektors Pönisch. Vermutlich Ende März 1945 wurde die Stelle aufgelöst und Pönisch am 1.4.1945 an die Staatliche Lungenheilanstalt Hainberg abgeordnet. 549 Vgl. Sächsischer Minister des Innern, Landesjugendamt, an die Kanzlei des Führers, z. H. [zu Händen] Oberbannführer Gabriel vom 28.1.1943 (NARA, T1021, 707, Bd. 19, Bl. 128085–128087). 550 Vgl. Sachsens Landesjugendhöfe. Eine neue Erziehungsaufgabe der Hitler-Jugend. In: Der Freiheitskampf vom 29.7.1943. 551 Vgl. Härtel, Neugestaltung der Fürsorgeerziehung, S. 62–65.
Aussonderung und Umerziehung
385
Höfe sollten jeweils Plätze für einige wenige hundert Mädchen und Jungen schaffen. Auf jeden Einzelfall wolle man gesondert eingehen. Nur hier auf dem bäuerlichen Land – nicht auf dem „Asphaltboden der Großstadt“ – schien gewährleistet, dass die „abartigen gefährdeten Jugendlichen“ über die „lebensgesetzliche biologische Einordnung in die Natur“ zu gemeinschaftsfähigen Subjekten heranreiften. Herabwürdigende Bezeichnungen wie „Zögling“ würden auf den Jugendhöfen vermieden: „Nachdem es den Landesjugendhöfen gelungen ist, […] die diffamierenden Erscheinungen der bisherigen Fürsorgeerziehung zu überwinden, ist der öffentlichen Erziehung das erzieherische Ethos wiedergegeben. Erst unter diesen Vorzeichen kann eine Rückführung sozial belasteter Jugendlicher in die Volksgemeinschaft erfolgen.“552 Der RJF ging es erkennbar um Personen, die dem Einfluss der Staatsjugend zu entgleiten drohten. Im Mittelpunkt stand der Landesjugendhof Moritzburg, der sich aus Sicht der für die Fürsorgeerziehung zuständigen Stellen zum mustergültigen Vorzeigeheim entwickeln sollte. Anfang 1944 trafen sich Experten aus Reichsinnenministerium, Reichskriminalpolizei, Hauptamt für Kommunalpolitik, vom Deutschen Gemeindetag sowie aus den Landesjugendämtern und der Hitlerjugend auf einer Tagung in Dresden. Hintergrund bildete die von Reichsjugendführer Axmann angeregte und durch das Reichsinnenministerium beschlossene Trennung der Landesjugendämter von den Wohlfahrtsämtern, wodurch erstere die Zuständigkeit über die gesamte Jugendpflege zugesprochen erhielten.553 Auf der Arbeitstagung stand die Erörterung von neuen „Maßnahmen […] auf dem Gebiete der Fürsorgeerziehung“ im Mittelpunkt, wobei „insbesondere die erforderliche enge Zusammenarbeit der zuständigen Stellen des Staates und der Hitler-Jugend unterstrichen“ wurde. Die Hitlerjugend hoffte, dass sie in Zukunft ihren Einfluss auf die Fürsorgeerziehung ausbauen könne. RJF-Stabsführer Möckel führte die Experten auf eine Exkursion zum Landesjugendhof in Moritzburg. Als „erste Einrichtung dieser Art“ habe der Hof den Beweis erbracht, dass „auf der Grundlage der hier in Anwendung gebrachten Erziehungsgrundsätze der Hitler-Jugend und auf dem Wege einer differenzierten Auslese ein wesentlicher Teil von sozial auffälligen Jugendlichen wieder vollwertig in die Volksgemeinschaft zurückgeführt“ werden könne.554 Ein Arbeitskreis, gebildet aus Vertretern von Jugendämtern und Hitlerjugend, sollte die „positiven Erfahrungen und Erziehungserfolge“ auswerten, um Richtlinien sowie ein Konzept zur Neuordnung des Fürsorgewesens in Deutschland zu entwickeln.555 Die Landesjugendhöfe stellten, über das Experimentierfeld in Sachsen hinaus, ein Pilotprojekt dar, von dem sich die RJF-Funktionäre mehr Mitsprache erhofften.
552 Ebd. 553 Vgl. Möckel über Erziehungsfragen. Arbeitstagung von Leitern der Gau- und Landesjugendämter. In: Der Freiheitskampf vom 8.2.1944. 554 Ebd. 555 Vgl. ebd.
386
Massenmobilisierung
Vor dem Hintergrund einer desaströsen Situation in der Fürsorgeerziehung wohnte dem Konzept der RJF tatsächlich ein reformerischer Impuls und Anspruch inne; man knüpfte sogar programmatisch an reformpädagogische Ideen der Weimarer Zeit an. Die Erzieher – einige Lehrer, meist aber Wehrversehrte, die von der Sozialabteilung der Hitlerjugend für ihre Aufgaben neun Monate geschult worden waren – konnten behaupten, dass im Gegensatz zur älteren Anstaltsverwahrung hier tatsächlich beim Potenzial des Einzelnen angesetzt, also individuelle Entwicklung und Fähigkeiten ernstgenommen würden. Tatsächlich ging es dem Regime gerade in der zweiten Kriegsphase jedoch darum, mit ihrem Konzept problematische Kinder und Jugendliche als Arbeitskräfte oder zukünftige Soldaten zu aktivieren. In einer Zeitungsreportage wurde daher folgendermaßen berichtet: „Die Hitler-Jugend wurde mit der Erziehung der schwer erziehbaren Kinder betraut. […] Oberstes Ziel ist es, das gestrauchelte Kind für die Familie und die Volksgemeinschaft zurückzugewinnen, ganz gleich, ob das Kind durch elterlichen Antrag freiwillig, oder auf vormundschaftliche oder gerichtliche Anordnung hin in öffentliche Erziehung genommen wurde. Über die Aufnahme entscheiden […] nicht mehr Sammelsurien von Aktennotizen, sondern auf diesem Spezialsektor gewissenhaft geschulte Wissenschaftler. Der Erfolg dieser neuen Erziehung ist wider Erwarten unerhört groß. Es sei nur am Rande erwähnt, dass bereits einige sogenannte schwer erziehbare Jungen als Unteroffiziere dienen und das Eiserne Kreuz 1. und 2. Klasse tragen.“556
Die Neuordnung, wie sie die Hitlerjugend zu ihren Gunsten anstrebte, war mit dem Selektionsprinzip der rassistischen Diktatur eng verknüpft: Auf der einen Seite standen die Landesjugendhöfe mit einer nach Außen sozusagen reformpädagogischen Programmatik, auf der anderen Seite standen Euthanasie und die Jugendschutzlager. Beides war institutionell wie ideologisch miteinander verschränkt. Als Dacheinrichtung, die den Höfen übergeordnet war, diente in Moritzburg ein sogenanntes Aufnahmeheim. Man hatte die Station im Gebäude der ehemaligen evangelischen Brüderanstalt untergebracht – nach 1912 war diese Brüderanstalt zunächst ein konfessionell-kirchliches Heim für schwer erziehbare Jugendliche gewesen, Ende der 1930er-Jahre war sie in ein staatliches Fürsorgeheim umgewandelt worden. Die Leitung der Aufnahmestation übernahm ein junger Erzieher namens Hans Thomae, der sich als promovierter Psychologe und gleichzeitiger HJ-Führer für diese Aufgabe besonders zu eignen schien. Das Heim fungierte für den gesamten Gau Sachsen als „Sichtungs- und Aufnahmestation“.557 Kinder und Jugendliche wurden eingewiesen, weil sich die Eltern und speziell die Mütter, deren Ehemänner als Soldaten an
556 Sachsens Landesjugendhöfe. Eine neue Erziehungsaufgabe der Hitler-Jugend. In: Der Freiheitskampf vom 29.7.1943. 557 Vgl. hierzu und im Folgenden André Postert/Christoph Hanzig, „Wir haben dafür zu sorgen, dass die Aussonderung differenziert geschieht.“ Hans Thomae und die Begutachtung junger Menschen während des Zweiten Weltkriegs. In: Psychosozial, 39 (2016) 4, S. 83–95.
Aussonderung und Umerziehung
387
der Front standen, überfordert zeigten. Oder es erfolgten Zwangseinweisungen durch Jugendämter, wenn die Betroffenen polizeilich aufgefallen waren, durch die NSV-Jugendhilfe oder in der Hitlerjugend als Problemfälle identifiziert wurden. Der Moritzburger Aufnahmestation fiel dann die Aufgabe zu, die Betroffenen auf ihre Erziehbarkeit hin zu prüfen, zu bewerten und zu selektieren. Für die Begutachtung sollten ebenso charakterliche, strafrechtliche wie auch „erbbiologische“ Kriterien eine Rolle spielen. Wenn die Begutachtung positiv ausfiel, hatte man – je nach Schwere des erzieherischen Notstands – einen neuen Fall für die Landesjugendhöfe. Die einzelnen Höfe spezialisierten sich auf die Erziehung entweder von schwer oder leicht belasteter Klientel. Wer jedoch nach mehrwöchiger Begutachtung aus „erbgesundheitlichen“, psychologischen oder strafrechtlichen Gründen aussortiert wurde, sollte beispielweise in psychiatrische Kliniken oder in andere geschlossene Heime für Schwersterziehbare verbracht werden. Besonders schwere Fälle wie Straffällige ohne eine Aussicht auf Resozialisierung oder angebliche „Verwahrloste“, die als Bedrohung für die „Volksgemeinschaft“ galten, sollten in die Jugendschutzlager abgeschoben werden: „In den neuen Landeserziehungsheimen werden nur erziehbare und bildungsfähige Jugendliche aufgenommen. Unerziehbare Jugendliche werden, soweit sie kriminell besonders gefährlich und gefährdet sind, den Jugendschutzlagern zugeführt, und soweit sie an erheblichen geistigen oder seelischen Regelwidrigkeiten leiden, an die Landesheilanstalten überstellt.“558 Hans Thomae, später in der Bundesrepublik ein akademisch geehrter Entwicklungspsychologe, erinnerte sich in einem Interview 1996 an seine Zeit in der sächsischen Fürsorgeerziehung zurück. Der junge Akademiker war 1937 in die NSDAP eingetreten, hatte 1940 als Assistent an der Universität Leipzig beim Psychologen Philipp Lersch gearbeitet, einem Verfechter des Euthanasieprogramms, und 1942 seine Habilitation eingereicht. Danach kam er in leitender Stellung nach Moritzburg. Er war für diese Arbeit dienstverpflichtet worden. Die Absicht sei gewesen, „eine differenzierte Fürsorgeerziehung […] nach dem Grad der Erziehungsfähigkeit“ zu treiben, wobei es „die sozial auffälligen Jugendlichen [zu] untersuchen“ galt.559 Nach eigenem Bekunden hatte er dort Interessen weiterverfolgt, die sich aus Kontakten zu Paul Schröder entwickelt hatten; ein Jugendpsychiater, ab 1934 Richter am Erbgesundheitsgericht und Hochschullehrer, dessen wissenschaftliches Oeuvre sich eng mit der Eugenik verband, indem seine Verbindung von Heilspädagogik und Charakterkunde ein fundiertes Urteil über Förderungswürdigkeit und Unwürdigkeit junger Menschen erlauben sollte.560 Gegenüber der RJF hatte Schröder 1941 für 558 Der Sächsische Minister des Innern, Landesjugendamt, an die Kanzlei des Führers, z. H. Oberbannführer Gabriel vom 28.1.1943 (NARA, T1021, 707, Bd. 19, Bl. 128085– 128087). 559 Das Individuum und seine Welt im Spiegel der Zeit: Hans Thomae im Gespräch mit Jürgen Straub. In: Journal für Psychologie, (1997) 2, S. 65–77, hier 70. 560 Vgl. Jan Nedoschill, Aufbruch im Zwielicht – die Entwicklung der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Zeit von Zwangssterilisation und Kindereuthanasie. In: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychatrie, 58 (2009) 7, S. 504–517.
388
Massenmobilisierung
seine jugendpsychiatrischen Konzepte geworben. Sie böten eine Möglichkeit, um beispielsweise den Ausleseprozess von jungen Führeranwärtern innerhalb der Hitlerjugend fachwissenschaftlich zu unterstützen, wobei die Eingliederung „geschädigter und nicht vollwertiger Kinder […] unter stetiger sachkundiger Auswahl der Wertvollen und Erziehungsfähigen, mit ebenso strengem und zielbewusstem Verzicht auf die als überwiegend wertlos und unerziehbar Erkannten“ erfolgen sollte.561 Thomae erklärte später nebulös, er sei in der Aufnahmestation eigentlich „nicht mit Erziehungsaufgaben betraut“ gewesen. Stattdessen habe er sich dort „allein auf die Verhaltensbeobachtung konzentrieren“ können: „In diesem Zusammenhang hatte ich Zugang zu gut dokumentierten, objektiv fixierten Biografien. Akten von Jugendämtern, Materialien, die sich beim Gericht angesammelt hatten, standen mir zur Verfügung. Heraus kam eine […] im Jahre 1953 gedruckte Publikation über Daseinstechniken sozial auffälliger Jugendlicher.“562 Die charakterologischen Studien publizierte er 1957 in zweiter Auflage als Leitfaden zur Schülerbeurteilung. Das Ziel war auch hier erklärtermaßen, „bestimmte Erfahrungen der wissenschaftlichen Jugendkunde mit den Erfordernissen der Praxis in Einklang zu“ bringen.563 Thomae verschwieg, dass seine frühere Gutachtertätigkeit im Wesentlichen der Selektion gedient hatte. Die Symptomatologie ordnete Verhalten in Kategorien von je neun Stufen. Diese Charakterurteile entschieden in der Aufnahmestation der Landesjugendhöfe über das Schicksal junger Menschen. Es wurde unterschieden in Hinblick auf Antrieb (von antriebslahm bis umtriebig), Anregbarkeit (stumpf bis interessierbar), Mitschwingungsfähigkeit (störbar bis lebhaft), Angepasstheit (rücksichtlos und unangepasst über bemüht bis versiert und wach), Steuerung (unbeherrscht über beherrscht bis verkrampft) und Verfestigung (labil über sicher bis starr und borniert).564 Die Urteile sollten erlauben, sogenannte Erziehungsunfähige von den Erziehungsfähigen zu trennen, vermeintlich Wertvolle von Wertlosen zu scheiden. Thomae hatte diese Aufgabe in der Reportage der Gauzeitung Ende Juli 1943 bestätigt. Die Fälle der Schwererziehbaren dürften nicht über einen Kamm geschert werden. Jeder Fall müsse für sich betrachtet werden. Es gelte, die Gefährdeten zurückzugewinnen – allerdings: „Wir haben nur dafür zu sorgen, dass die Aussonderung differenziert geschieht.“565 Der junge Wissenschaftler war aus Sicht der RJF für die Aufgabe bestens geeignet. Er besaß einen akademischen Hintergrund und gute Kontakte. Zu-
561 Paul Schröder, Kinderpsychiatrie und Heilpädagogik. In: Zeitschrift für Kinderforschung, (1943) 1, S. 9–14, hier 11. Vgl. auch Wolfram Schäfer, Fürsorgeerziehung und Jugendpsychiatrie im Nationalsozialismus. In: Jugendhilfe, 42 (2004) 4, S. 184–192, hier 189. 562 Hans Thomae im Gespräch mit Jürgen Straub, S. 70. 563 Hans Thomae, Beobachtung und Beurteilung von Kindern und Jugendlichen. Vorwort zur 2. Auflage, Basel 1957, S. 4. 564 Vgl. ebd., S. 66–70. 565 Zitat von Thomae nach Sachsens Landesjugendhöfe. Eine neue Erziehungsaufgabe der Hitler-Jugend. In: Der Freiheitskampf vom 29.7.1943.
Aussonderung und Umerziehung
389
dem hatte er sich als HJ-Führer betätigt und war der RJF verbunden. Thomae hatte diverse Artikel für das Hitlerjugendorgan „Wille und Macht“ verfasst.566 Damit schien er nicht nur wissenschaftliches Profil zu besitzen, sondern gleichzeitig die Interessen und Ambitionen der Jugendorganisation in der staatlichen Fürsorgeerziehung vertreten zu können. In der Rückschau Jahrzehnte später verschwieg Thomae diesen Umstand genauso wie die Tatsache, dass er in seiner Position als Leiter der Aufnahmestation ganz wesentlich über das Schicksal junger Menschen entscheiden sollte: Kein Wort darüber, dass sich die „Frage der Erziehbarkeit“, die in der Station zu prüfen war, an rassistische und ideologische Erwartungen knüpfte. Schweigen auch dazu, dass ein negatives Charakter urteil entweder die Zuführung des Mädchen oder Jungen in eines der Jugendschutzlager bedeuten konnte oder – im Falle von „erheblichen geistigen oder seelischen Regelwidrigkeiten“ – die Überstellung in eine Landesheilanstalt.567 Da die rund eintausend Betten, die zur Verfügung standen, schon gleich nach Eröffnung belegt waren, erschien aus pragmatischen Erwägungen eine strengere Selektion notwendig. Die Kreisanstalt in Schwarzenberg etwa, die nicht in das institutionelle Netz der Hitlerjugend eingespannt war, bemängelte Ende 1943, dass sie wegen „des außerordentlichen Raummangels“ auf den Höfen weitere 120 schwersterziehbare Jugendliche bekommen habe, die „für Landesjugendhöfe […] nicht tragbar“ seien. Zur „Vermeidung ungünstiger Einflüsse auf die Schuljugend“ müsse man das eigene Heim nun auf geschlossene Erziehung umstellen.568 Die organisatorische Situation auf den Landesjugendhöfen spitzte sich in den letzten zwei Kriegsjahren weiter zu. Erzieher wurden zur Wehrmacht einberufen, darunter der HJ-Oberbannführer Härtel, der bis ins Frühjahr 1944 den größten Landesjugendhof in Moritzburg geleitet hatte. Als letzte Reserve reaktivierte man einen greisen Lehrer, der seit 1933 wegen SPD-Mitgliedschaft im Ruhestand gewesen war. Hinzu kam, dass auch Zöglinge untergebracht werden mussten, die man aus den Ostgebieten nach Sachsen evakuiert hatte.569 Die Gesamtzahl der jungen Menschen, die aus Sicht der Hitlerjugend für die eigenen Höfe bis Anfang 1945 als nicht erziehungsfähig eingestuft wurden, lässt sich nicht mehr ermitteln; an einer zuverlässigen Aktengrundlage fehlt es. Möglicherweise handelte es sich um Hunderte bis Tausend. Dass die Höfe mit der Euthanasie verschränkt waren, ist naheliegend. Jene, die als unerziehbar ausgelesen wurden, waren in der Konsequenz der Eugenik und NS-Ideologie „wertloses“ Leben, das nicht mehr verwendbar schien. Die Ermordung
566 Vgl. persönliche Aufstellung von Literatur, vermutlich 1941 (Universitätsarchiv Leipzig, Personalakte und Habilitationsverfahren Hans Thomae). 567 Sächsischer Minister des Innern, Landesjugendamt, an die Kanzlei des Führers, z. H. Oberbannführer Gabriel vom 28.1.1943 (NARA, T1021, 707, Bd. 19, Bl. 128085– 128087). 568 Landesjugendamt an die Staatskanzlei vom 22.12.1943 (HStA Dresden, 13859, 8437, Personalakte Bezirksschulrat Schurig, unpag.). 569 Vgl. die in verschiedenen Personalakten überlieferten Dokumente. In: ebd., 6123; 3569; 8437.
390
Massenmobilisierung
von minderjährigen psychisch Kranken sowie Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung fand in Sachsen u. a. in der „Kinderfachabteilung“ der Landesanstalt Großschweidnitz statt. Über 550 Kinder wurden dort bis Kriegsende durch Verabreichung von Medikamenten oder gezielte Unterversorgung getötet. Anhand von Patientenakten sind immerhin neun Schicksalswege nachzuvollziehen, die von der Aufnahmestation zur Ermordung führten; ab Mitte 1944 dann sogar direkt, also ohne Umweg über andere Einrichtungen. Während HJ-Führer Thomae in Moritzburg die wissenschaftliche Beobachtung übernahm, verfasste seine Mitarbeiterin Anna Leiter die Gutachten, auf deren Basis die anderweitige Unterbringung in Anstalten oder Kliniken erfolgen sollte. Die promovierte Schülerin Paul Schröders hatte die Kinder- und Jugendpsychiatrische Abteilung an der Poliklinik in Leipzig geleitet. Schon Ende der 1930er-Jahre hatte sie sich mit einer Palette dubioser Themen befasst. So studierte sie z. B. die „Vererbung von asozialen Eigenschaften“, wobei sie dafür plädierte, dem „Schicksal dieser Kinder nachzugehen“, um „auf Basis dieser so gewonnenen breiteren Grundlage ihre Eigenschaften im Erbgang zu verfolgen“. Zweck des Unterfangens war, die „soziale Brauchbarkeit der Sippe“ zu prüfen und herauszufinden, „ob den aktiv Antisozialen gleichsinnige Charakterzüge“ über die Vererbungslehre nachweisbar schienen.570 Ihr akademischer Lehrer Schröder lobte sie 1941 und stellte fest, dass alle Instrumente der „notwendigen charakterkundlichen Frühdiagnostik“ zur Verfügung stünden, um jene als „überwiegend wertlos und unerziehbar Erkannten“ auszuwählen und – so seine Wortwahl – auf sie zu „verzichten“; eine verklausulierte Anweisung zum medizinischen Verbrechen.571 Thomae und Leiter hatten sich über Schröder in Leipzig Ende der 1930er-Jahre kennengelernt. In Moritzburg übernahm sie die Leitung der medizinisch-fachlichen Bewertung. Über einen 9,5-jährigen Jungen, der fast sein ganzes Leben in Anstalten zugebracht hatte, Ende 1943 in Moritzburg untergebracht war und dort für die Jugendhöfe als untauglich angesehen wurde, hieß es immerhin, „bei intensiver Förderung“ sei er „zu einem sozial brauchbaren Menschen“ zu entwickeln. Zwei Verlegungen folgten, aber der Zustand des Jungen verschlechterte sich weiter. Über seinen Tod in der „Kinderfachabteilung“ Ende Januar 1945 lautete es: „Sein Ende bedeutete […] eine Erlösung von einem hoffnungslosen Leiden, dass ihn nie rechte Freude an seinem Dasein hätte gewinnen lassen.“572 Mord und Verbrechen waren die Konsequenz dessen, was Selektion und „Aussonderung“ euphemistisch meinten. Die Hitlerjugend hatte sich bereitwillig in die Euthanasie eingeschaltet.
570 Anna Leiter, Zur Vererbung von asozialen Charaktereigenschaften. In: Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, (1939) 167, S. 157–160, hier 158. Vgl. auch Rolf Castell, Geschichte der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland in den Jahren 1937 bis 1961, Göttingen 2003, S. 60–65. 571 Schröder, Kinderpsychiatrie und Heilpädagogik, S. 14. 572 Patientenakte M 5035 (HStA Dresden, 10822, 9675, unpag.).
Aussonderung und Umerziehung
391
Hans Heinze, Direktor der Tötungsanstalt Brandenburg-Görden, forderte 1942 ebenfalls eine Neugestaltung des Anstaltswesens. Drei Gruppen wollte Heinze unterschieden wissen: Nerven- und Geisteskranke, bildungsfähige und bildungsunfähige Schwachsinnige sowie Schwererziehbare. Letztere seien wiederum in „vorwiegend Umweltgeschädigte“ und „vorwiegend charakterlich Abartige“ einzuteilen. Sie galten als Fälle für staatliche Sondererziehungsanstalten. Dort müsse die „Früherfassung anlagebedingter Asozialität auf dem Boden erblicher charakterlicher Abartigkeit“ erfolgen, womit „unnütze erzieherische Versuche am untauglichen Objekt“ vermieden würden. Um allen Beteiligten „erzieherische Enttäuschungen zu ersparen“ seien die „Unerziehbaren […] rechtzeitig auszumerzen“ – die inhumane Konsequenz einer biologistischen Ideologie, die das Individuum auf einen wie auch immer begründeten Nutzen für die „Volksgemeinschaft“ reduzierte und jegliches Abweichen von vorgegebenen Normen als krank, intolerabel und „lebensunwürdig“ deklarierte.573 Kaum Sachverstand und Sozialpädagogik, dafür umso mehr bösartige Stigmatisierung spricht aus diversen Patientenakten, insbesondere bei Kindern – etwa wenn von „krankhafter“ Neigung zum Weglaufen, „krankhaft“ asozialem Verhalten, „krankhafter“ Impulsivität oder „krankhaftem“ Umhertreiben die Rede ist.574 Unter den aus Moritzburg nach Großschweidnitz verlegten Patienten befand sich ein Junge aus Leipzig, der der Hitlerjugend angehört hatte. Otto Albrecht, geboren 1926, war wegen krimineller Delikte vorbestraft und hatte eine Gefängnisstrafe verbüßt. Albrecht fand sich nicht in erster Linie aus rassistisch-eugenischen Gründen in Moritzburg wieder. Er galt als „verwahrlost“, als „frecher, ungezogener, verlogener Junge, der sich nirgends einordnen will, er begeht ständig Rüpeleien, ist […] halsstarrig, verfügt über großes Geltungsbedürfnis, tritt anderen in […] großmäuliger Weise entgegen“.575 Den HJ-Dienst besuchte er unregelmäßig. Die HJ-Dienstkarte lag der Patientenakte bei. In Leipzig sei er, statt zum Dienst zu gehen, in „schlechteste Gesellschaft“ geraten. Er sei in bandenmäßigen Diebstahl involviert gewesen und habe Betrügereien begangen. Der Jugendliche wohne in einem „Häuserblock, der nicht gut beleumundet“ sei, wo er „durch Altersgenossen ständig gefährdet“ werde. Er rauche, falle in der Schule und im Betrieb negativ auf. Auch beeinflusse er andere Kinder ungünstig.576 Der Landesjugendhof Moritzburg hatte ihn als Rehabilitationsfall aufgenommen. Jedoch schien er sich auch nach Wochen nicht einzufügen. Er habe sich „periodischer Tätlichkeiten gegen seine Erzieher“ schuldig gemacht und weise „keine wesentlichen Fortschritte in Führung und Haltung“ auf. Deshalb überwies der Landesjugendhof Albrecht Ende November 1944 als Fall eines
573 Hans Heinze, Vorschläge für eine zukünftige Neugestaltung jugend-psychiatrischer Anstalten vom 6.2.1942 (NARA, T1021, 707, Bd. 19, Bl. 126595–126600). 574 Vgl. Matthias Zaft, Der erzählte Zögling. Narrative in den Akten der deutschen Fürsorgeerziehung, Bielefeld 2011. 575 Patientenakte M 8484 (HStA Dresden, 10822, 9675, unpag.). 576 Ebd.
392
Massenmobilisierung
„Unerziehbaren“ nach Großschweidnitz.577 Dort beschied man auf eine „genuine“ Epilepsie – eine Diagnose, die in keiner der vorherigen Begutachtungen gestellt worden war, und die auf Tötungsabsicht hindeutet. Die Ärzte konstatierten, dass „eine Entlassung aus der Anstalt nicht infrage“ komme. Eine „Unfruchtbarmachung“ sei, wie man schrieb, „nicht als dringend zu bezeichnen.“578 Das weitere Schicksal dieses Jungen ist nicht mehr nachzuvollziehen. Das HJ-Führerkorps zeigte an der Neuordnung des Fürsorgewesens erhebliches Interesse, sofern es um junge Menschen ging, die als resozialisierbar und für die „Volksgemeinschaft“ verwendbar galten. Die Funktionäre erhofften sich von der Wissenschaft wohl auch einen Erkenntnisgewinn darüber, wie sich der in Kriegszeiten vermeintlich drohenden „Verwahrlosung“ der Jugend begegnen ließ. Fachwissen, das der Umprägung von Persönlichkeiten diente, schien hier von Nutzen zu sein. Die Ambitionen werden nachvollziehbar, vergegenwärtigt man sich, dass der Hitlerjugend seit Kriegsbeginn die Kontrolle über die täglichen Lebensroutinen junger Menschen im großstädtischen Raum zu entgleiten drohte. Auch in anderen Regionen, sogar in den annektierten Gebieten, verfolgte man ähnliche Ziele. In Schöndorf bei Kalisch im Wartheland etwa richtete die Gauselbstverwaltung im Frühjahr 1941 ein NSV-Jugendheim für „erbbiologisch wertvolle, aber erzieherisch gefährdete“ Kinder im Alter von zwei bis vierzehn Jahren ein. Insbesondere volksdeutsche Kinder aus sozial schwachen Familien, die irgendeine Art von Gefährdung aufwiesen, sollten aufgenommen werden; nur keine – wie die HJ-Gebietsführung betonte – „idiotischen oder geistig minderwertigen Kinder“.579 Die Hitlerjugend blieb in diesem Fall im Hintergrund, suchte aber nach Möglichkeiten zur Mitwirkung. Unterführer und lokale Dienststellen wies man darauf hin, dass sie Kameraden oder Kinder, die ihnen auffielen, zur Unterbringung melden könnten. Die Auswahl trafen dann die Jugendämter. Die Hitlerjugend erklärte sich bereit, dem NSV-Heim Zöglinge ab zehn Jahren zuzuführen. Mitteilungen von Unterführern über problematische Kinder wollte die Gebietsführung an die NSV weiterreichen. Das Führerkorps hielt zudem Kontakte in das neue NSV-Heim aufrecht, um sich über die weitere Entwicklung der Kinder im Bilde zu halten.580 In diesem Fall verschmolz die rassistisch motivierte „Germanisierungspolitik“ mit Präventivüberlegungen. Eine enge Verschränkung zwischen der NSV, Hitlerjugend und den Jugendämtern blieb in der Praxis allerdings die Ausnahme. In Österreich beispielsweise war 1940 durch die „Verordnung über Jugendwohlfahrt in der Ostmark“ die strukturelle und ideologische Anpassung in der Fürsorgepolitik an die reichsdeutschen Verhältnisse erfolgt. Gaujugendamt und Gesundheits-
577 Gutachten des Landesjugendhofs Moritzburg vom 22.9.1944 (HStA Dresden, 10822, 9675, unpag.). 578 Anstaltsdirektor an das Erbgesundheitsgericht Dresden vom 5.12.1944 (ebd.). 579 Heimunterbringung erbbiologisch wertvoller aber erzieherisch gefährdeter Jugendlicher im Alter von 2–14 Jahren. In: GB: Wartheland, 2/41/K vom 1.3.1941. 580 Vgl. ebd.
Die letzten Parteigenossen
393
ämter verständigten sich darauf, dass sie Anliegen von NSV und Hitlerjugend berücksichtigen wollten. Die Gebietsführungen sollten bei Problemen, die ihre Mitglieder tatsächlich oder scheinbar betrafen, eingeschaltet werden. Die österreichischen Stellen gingen gegen junge Abweichler, Kriminelle und vermeintlich „Verwahrloste“ im Übrigen rigoros vor: Mit 202 eingewiesenen Jugendlichen in das Jugendschutzlager Moringen bis zum Februar 1941 lagen die „Alpen- und Donaureichsgaue“ an der Spitze. Es folgten Sachsen mit 97 und Bayern mit 63 Einweisungen.581 Der Einfluss der Hitlerjugend auf die Einweisungen hielt sich in Österreich aber offenbar in Grenzen. Die zentrale Tötungsanstalt für Kinder im Wiener Raum war die Anstalt „Am Spiegelgrund“, für die nach aktuellem wissenschaftlichen Stand 789 Morde angenommen werden. Historische Studien zum Anstaltskomplex in Österreich haben allerdings keine besondere Rolle der Hitlerjugend für die Euthanasie aufzeigen können.582 Mit dem Pilotprojekt in Sachsen befand sich die RJF in Hinblick auf die anvisierte Neugestaltung der Fürsorgeerziehung offenkundig im Anfangsstadium. Für den Aufbau weiterer Höfe standen in der letzten Kriegsphase geeignete HJ-Führer nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung.
4.
Die letzten Parteigenossen
4.1
Eine späte erinnerungspolitische Debatte
Eine Debatte um die Hitlerjugend, die über Jahre anhielt, wurde kurz nach der Jahrtausendwende in den deutschen Feuilletons ausgefochten. Eine Reihe von Persönlichkeiten, die den Kultur- und Wissenschaftsbetrieb der Bundesrepublik geprägt hatten, wurden plötzlich als ehemalige NSDAP-Mitglieder geoutet. Der Historiker Martin Broszat, die Autoren Martin Walser und Siegfried Lenz, der Kabarettist Dieter Hildebrandt, sie einte, dass sie bei Kriegsende 17 oder 18 Jahre alt gewesen waren. Angeblich hatten sie keinen Antrag zur Aufnahme in die NSDAP gestellt. Sie seien ohne eigenes Zutun von der Hitlerjugend in die Partei übernommen worden. Insbesondere Walser und Lenz verteidigten öffentlich ihre Position, dass sie der Partei nie wissentlich beigetreten seien. Eine renommierte Minderheit – wie die Historiker Hans-Ulrich Wehler und Norbert Frei sowie der Publizist Hans-Martin Lohmann – sprangen für die Betroffenen
581 Vgl. Peter Maline, Verfolgte Kindheit. Die Kinder vom „Spiegelgrund“ und ihre „Erzieher“. In: Alois Kaufmann (Hg.), Totenwagen. Kindheit am Spiegelgrund, Wien 1991, S. 94–118; Herwig Czech, Der „Spiegelgrund“ als zentrale Institution der Wiener Jugendfürsorge zwischen 1940 und 1945. In: Eberhard Gabriel/Wolfgang Neugebauer (Hg.), Von der Zwangssterilisierung zur Ermordung. Zur Geschichte der NS-Euthanasie in Wien, Teil 2, Wien 2002, S. 165–189, hier 178. 582 Vgl. ebd., S. 178. Vgl. auch die Sammlung von Beiträgen im Band von Ernst Berger/Else Rieger (Hg.), Verfolgte Kindheit. Kinder und Jugendliche als Opfer der NS-Sozialverwaltung, Wien 2007.
394
Massenmobilisierung
in die Bresche und vertraten die These, dass kollektive Überführungen aus der Hitlerjugend in die NSDAP ohne Wissen und Zustimmung möglich gewesen seien.583 Die akademische Mehrheit wies dies zurück. Zu akkurat, penibel und eindeutig erschienen die Vorgaben und die Praxis der Partei: Ein Eintritt in die NSDAP ohne Unterschrift galt als ausgeschlossen, demnach auch eine Überführung ohne Wissen und eigenes Zutun als unmöglich. Die Betroffenen sahen sich als scheinbar verirrte Nationalsozialisten diffamiert und bloßgestellt, obgleich niemand einen persönlichen Vorwurf aus der Parteimitgliedschaft ableitete. Die Auseinandersetzung ist jüngst abgeflaut und scheint erledigt zu sein. Es sollen an dieser Stelle die geführten Debatten nicht im Grundsatz neu aufgerollt oder die erzielten Ergebnisse der Forschung umgeworfen werden. Gleichwohl berühren sie die Frage danach, in welchem Verhältnis die Hitlerjugend während des Krieges zur Masse ihrer Mitglieder stand, wie die Organisation ihnen gegenüber agierte und welche Rolle der Zwang spielte. Die Hintergründe sollen im Folgenden knapp beleuchtet werden. Nicht in erster Linie unter dem Gesichtspunkt, wie die Partei selbst ihre Aufnahmepraxis und Mitgliedschaften handhabte, sondern wie die Überführungen in der Hitlerjugend in den letzten zwei bis drei Kriegsjahren aussahen. Während die formalen Vorgaben aus der Parteikanzlei nämlich eindeutig zu sein scheinen, herrschte in der Hitlerjugend und an der Basis – so die These der folgenden Ausführungen – erhebliche Konfusion darüber, wie sie auszulegen und vor Ort zu handhaben waren. Höhere und mittlere Dienststellen der Hitlerjugend gaben widersprüchliche Signale an die unteren Einheiten und Formationen weiter. Zudem wurden gerade in der letzten Kriegsphase übliche Regeln und Vorgaben mehr und mehr aufgeweicht. Das war mit ein Grund dafür, dass man schon nach Kriegsende nicht genau einzuordnen wusste, wie man mit den jungen Parteigenossen verfahren sollte. Ein Beispiel: In Salzburg hatte sich ein ehemaliger Gefolgschaftsführer und Parteianwärter 1946 an Wahlen beteiligt. Ehemalige NSDAP-Mitglieder waren zur Wahl aber nicht zugelassen. Der 22-Jährige, der deshalb angeklagt wurde, sagte aus, dass er von seiner Parteimitgliedschaft lange nichts gewusst hätte. Er sei zuletzt zum Militär eingezogen worden. Und erst nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft habe ihm ein HJ-Führer berichtet, „dass er zur NSDAP überstellt worden und Parteianwärter“ sei. Aus diesem Grunde habe er im Fragebogen alle Angaben über die Zugehörigkeit zur NSDAP verneint.584 Sicherlich gab es nicht wenige, die nun mit allen möglichen Ausreden versuchten, ihre braune Vergangenheit abzustreifen und zu verleugnen. Tatsächlich aber standen viele HJ-Mitglieder, die in die Partei aufgenommen werden sollten, zuletzt im Kriegsdienst. Die Propagandaberichte verdeckten die Tatsache vielfach. Im 583 Vgl. zur Auseinandersetzung Hans-Martin Lohmann, Eine Generation unter Verdacht. Jahrgang 1926/27. Erinnerungen an die Jahre unterm Hakenkreuz. In: Die Zeit vom 30.12.2007. Materialreich und gesättigt an Interviews, Biografie und weiteren – mehr oder minder – prominenten Beispielen: Malte Herwig, Die Flakhelfer. Wie aus Hitlers jüngsten Parteimitgliedern Deutschlands führende Demokraten wurden, Stuttgart 2013. 584 Vgl. Ein Anwärter. In: Salzburger Tagblatt vom 21.8.1946
Die letzten Parteigenossen
395
Wiener Konzerthaussaal feierte man, unter Beteiligung Schirachs, am 27. Februar 1944 die Aufnahme von rund 1 500 Mädchen und Jungen als „bisher größte Parteiaufnahme des Gaues“.585 In Berlin oder anderen größeren Gauhauptstädten fanden in den letzten beiden Kriegsjahren ebenfalls noch größere Überweisungsfeiern statt, über die in den Zeitungen propagandistisch berichtet wurde. In Kleinstädten fanden sie üblicherweise – in überschaubarem Rahmen – in Rat- oder Gemeindehäusern sowie in Schulen und Lichtspielhäusern statt. Zu Aufnahmefeiern konnten nach 1943 aber immer nur ein Teil der Parteianwärter vor Ort sein. Die Aushändigung von Parteibuch und Mitgliedskarte blieb zwar die Voraussetzung für den formalen Abschluss der Parteiaufnahme, aber in vielen Fällen konnte dies eben nur nachträglich geschehen. Über eine Feier in einer Kleinstadt Kärntens im Februar 1944 hieß es beispielsweise: Der Bannführer habe dem Gauleiter „50 Parteianwärter“ gemeldet, „von denen 16 bereits an der Front“ stünden; es habe „der Kreisleiter die Vereidigung der jungen Parteigenossen“ vorgenommen.586 Einige Tage zuvor hatte das Regime gesondert darauf hingewiesen, dass „junge Parteigenossen […], soweit sie nicht […] anwesend sein können, Geschenkbuch und später auch Parteiausweis und Parteiabzeichen mit einem Handschreiben des Hoheitsträgers übersandt“ bekämen. Die Namen der Abwesenden seien auf der Feier zu verlesen.587 In einem Bezirk am Rande Dresdens nahm man Ende Februar 1944 über einhundert 17-Jährige feierlich in die NSDAP auf. Von diesen habe sich jedoch „ein Teil bereits im Reichsarbeitsdienst oder bei der Wehrmacht“ befunden; und auch hier wurden die Namen der Abwesenden verlesen.588 Darauf konnten und wollten sich viele nach 1945 berufen. Angeblich sei ihnen nie etwas mitgeteilt oder ein Parteiausweis mitsamt Abzeichen nicht zugestellt worden. Unabhängig von jener Frage, die zuletzt intensiv diskutiert wurde, ob sie ihre Anträge überhaupt selbst unterschrieben hatten: Unter jenen, die im Frühjahr 1944 oder 1945 als junge Parteianwärter galten, wussten möglicherweise tatsächlich einige junge Männer nicht, dass ihre Parteiaufnahme auf dem Wege oder vollzogen war. Die Frage, ob Parteieintritte unfreiwillig erfolgen konnten oder HJ-Angehörige in die NSDAP gar kollektiv – ohne eigenes Wissen und Zutun – überwiesen wurden, steht auf einem anderen Blatt. Die Diskussion nach der Jahrtausendwende war wiederum nicht neu. Im Gegenteil, sie wurde nach 1945 intensiv geführt. „Schließlich beschäftigt sich eine Reihe von Anfragen mit dem Schicksal von Mitgliedern der Hitlerjugend, die zum Teil ohne ihr Zutun in die NSDAP überführt wurden“, gab eine österreichische Zeitung im März 1946 über jüngste Regelungen zur Entnazifizierung Auskunft: „Zweifellos gibt es solche Fälle:
585 Neue Kämpfer der Partei. In: Neues Wiener Tageblatt vom 28.2.1944. 586 Kärntens beste Jugend für die NSDAP. In: Alpenländische Rundschau vom 4.3.1944. 587 Der Nachwuchs der Partei. In: Hamburger Anzeiger vom 19/20.2.1944; Jugend tritt zur Partei. In: Der Freiheitskampf vom 19.2.1944. 588 „Wir tragen das Vaterland in unserem Herzen“. Geburtsjahrgänge 1926/27 wurden in die Partei aufgenommen. In: Der Freiheitskampf vom 26.2.1944.
396
Massenmobilisierung
Wenn man jedoch die Bestimmungen für die einfachen Mitglieder der NSDAP eingehend prüft, wird man feststellen, dass diese jungen Menschen im Wesentlichen mit der gewiss nicht sehr hohen Sühnesteuer davongekommen sind, da sich fast alle übrigen Maßnahmen auf Berufstätige in einflussreichen Stellungen beziehen.“589 Dass unfreiwillige Überführungen in die NSDAP eine Möglichkeit darstellten, hielt nach 1945 kaum jemand für abwegig. Das hatte mit Unwissen über die Parteibürokratie ebenso zu tun wie mit verständlicher Verdrängung. Den Zeitgenossen erschien die These von der unfreiwilligen Überführung zudem einleuchtend. Freiwilligkeit war, obwohl die RJF den Anschein aufrechtzuerhalten versuchte, spätestens ab 1939 zur inhaltsleeren Phrase verkommen – und warum sollten die Überführungen in die NSDAP nicht ebenfalls auf Zwangsbasis stattgefunden haben? Man hätte es besser wissen können. Die Hitlerjugend hob bis in die Kriegsjahre gegenüber ihren Angehörigen explizit hervor, ein Jugendlicher müsse durch eigenhändige Unterschrift bestätigen, „dass er den Wunsch hat, freiwillig in die Partei einzutreten“.590 Insofern bildeten sich nach Kriegsende Legenden und Mythen heraus. Sie waren von Selbstschutz ebenso wie von Verleugnung motiviert. Gerade den Parteianwärtern aus der HJ sollte mit Blick auf ihr Alter und im Zuge der Entnazifizierung milde begegnet werden. Der Rektor der Universität Innsbruck, Franz Gschnitzer, beispielsweise argumentierte 1947 mit übertriebenen Zahlen. Man werde rund 80 Prozent der Studenten von den Universitäten ausschließen müssen, würde man entsprechend hart mit jenen verfahren, „die zwangsweise im jugendlichen Alter in die Partei überführt“ worden seien.591 In West- wie Ostdeutschland griff die These von kollektiven und unfreiwilligen NSDAP-Überführungen schnell um sich, gerade in staatlichen Institutionen, die vor dem Hintergrund der Entnazifizierung um Personal und Nachwuchskräfte besorgt sein mussten. Die Landesverwaltung in Sachsen stellte z. B. in einer Verordnung am 13. Oktober 1945 fest: Jugendliche und junge Männer seien „im Rahmen der Überführung ganzer Jugendverbände in die Partei überwiesen“ worden. Dadurch sollte deutlich gemacht werden, dass viele Betroffene vermeintlich ohne ihr Zutun NSDAP-Angehörige wurden. Sie seien deshalb in Zukunft nicht mehr als Parteigenossen zu behandeln.592 Die sächsische Schulverwaltung interessierte sich Mitte Oktober 1946 für Geschichtslehrer, die aufgrund dieser Verordnung wieder an öffentlichen Schulen unterrichteten. Abermals hob man hier hervor, dass diese Personen bei Kriegsende „zwangsläufig
589 Die Regelung der Nazifrage. Zur Beseitigung einiger Missverständnisse. In: Neues Österreich. Organ der demokratischen Einigung vom 31.3.1946. 590 Parteiüberweisungen. In: GB: Berlin, 1/39 vom 6.2.1939. 591 Hochbetrieb im Parlament. Weitere sieben Gesetze verabschiedet. In: Wiener Zeitung vom 4.7.1947. 592 Verordnung über die Behandlung ehemaliger Mitglieder der NSDAP. In: Amtliche Nachrichten der Landesverwaltung Sachsen vom 21.11.1945. Vgl. auch Hermann, Tolerierte Devianz?, S. 416.
Die letzten Parteigenossen
397
in die ehemalige NSDAP überführt“ worden seien.593 Und im Ministerium für Staatssicherheit gelangte man noch in den 1980er-Jahren, als im Westen die nationalsozialistische Vergangenheit von DDR-Funktionären zum Thema gemacht wurde, zu der Einschätzung: Junge Männer, die im Kriegsdienst standen, hätten von ihrer Parteiaufnahme aller Wahrscheinlichkeit nach nicht durchweg Kenntnis gehabt. Denn bei jahrgangsmäßigen Überweisungen sei wohl zum Teil auf die individuelle Antragstellung, die sonst verbindlich gegolten habe, verzichtet worden. Beweise für die kollektive Übernahme von HJ oder BDM in die NSDAP – bei Verzicht auf individuelle Antragsstellung – besaß man aber auch in der DDR nicht.594 Hans Modrow, Jahrgang 1928, ließ im Bundesarchiv noch in den 1990er-Jahren überprüfen, ob eine Karteikarte auf seinen Namen vorlag. „Wir wissen inzwischen“, behauptete Hans Modrow felsenfest, „dass die NSDAP […] in den letzten Kriegsjahren massenhaft und ungefragt Angehörige von Nazi-Organisationen in die Partei“ übernommen hätte. Als Angehöriger des Geburtsjahrgangs 1928 habe er lediglich Glück gehabt, nicht mehr zwangsüberführt worden zu sein.595 Aus der potenziellen Möglichkeit, dass der Parteieintritt vereinzelt möglicherweise doch durch Nötigung zustande gekommen war, wurde in der Nachkriegszeit auf diese Weise ein Persilschein für alle, die zuletzt als junges Blut die Kräfte der Partei noch einmal hatten revitalisieren sollen. Kollektivüberführungen in dem Sinne, dass ein ganzer Jahrgang geschlossen in die Partei überführt worden wäre, hat es nie gegeben. Derlei Mythen musste übrigens nicht erst die Geschichtswissenschaft ausräumen. Der US-amerikanischen Besatzungsmacht waren Details zur Überführungspraxis bereits unmittelbar nach Kriegsende gut bekannt.596 Die eigenhändige Unterschrift blieb bis zuletzt die formale Voraussetzung zur Aufnahme in die Partei; nichts deutet darauf hin, dass davon abgewichen worden wäre. Demnach hätte jeder, sofern die Erinnerung es zuließ, eine Situation vor Augen haben müssen, in welcher man die Unterschrift geleistet hatte. „Auch den Parteianwärter, der ich mit 18 Jahren geworden war, gab ich zu“, berichtete Bogislav von Heyden, der nach Kriegsende in die Sowjetunion verschleppt worden war: „Die Überlegung war, dass diese Angaben […] nachprüfbar seien, denn die Amerikaner hatten ja zumindest in
593 Landesverwaltung Sachsen. Volksbildung Abteilung Sachsen an die Kreisschulräte und Kreisschulämter, betrifft „Ehemalige Angehörige der HJ als Geschichtslehrer“ vom 17.10.1946 (StadtA Pirna, B-IV-XXIV-101: Rat der Stadt Pirna, Schul- und Kulturamt, unpag.). 594 Vgl. Herwig, Die Flakhelfer, S. 158–162. 595 Interview mit Hans Modrow bei Oliver Dürkop/Michael Gehler, Verantwortung. Hans Modrow und der deutsche Umbruch 1989/90, Innsbruck 2018, S. 99. 596 Vgl. „Good“ Nazis. In: Military government weekly information bulletin, (1946) 37, S. 17: „There were no admission fees and no Fragebogen required for candidates from the HJ and the BDM; but application had to be voluntary. The ,pressure‘ here of course was moral; the entire education of these young people had been with Party membership as a shining goal.“
398
Massenmobilisierung
München […] alle Unterlagen unversehrt bekommen. Sicher war das übertriebene Ehrlichkeit, denn ich weiß von anderen, die dies nicht angaben.“597 Die Debatte, wie sie ab dem Jahr 2003 geführt wurde, zeigte, wie schwer es Betroffenen teils bis heute fiel und fällt, das eigene Verhältnis zum Regime offenzulegen. Allerdings – und hier haben manche Historikerinnen und Historiker blauäugig argumentiert – konnte der Zwang eben doch eine erhebliche Rolle spielen, zumal in den letzten zwei Kriegsjahren. Armin Nolzen hat zwar einerseits zutreffend betont, dass die „zuständigen Dienststellen […] weit repressiver [vorgingen] als in den Jahren zuvor“. Doch sei andererseits das Prinzip der Freiwilligkeit formal gewahrt geblieben. Jeder habe die Aufnahme in die NSDAP verweigern und sich entziehen können.598 Es ist ein merkwürdiges Verständnis von „Freiwilligkeit“, das hier durchscheint, umso mehr, weil von 17-Jährigen die Rede ist. Ist deren Unterschrift bereits ausreichend, um einen Akt als freiwillig zu bezeichnen? In welcher Situation befanden sie sich, als sie eine Unterschrift leisteten? Konnten sie sich der Tragweite bewusst sein? Wenige, wie Dagmar Reese, hielten entgegen, dass in den letzten zwei bis drei Jahren des Krieges kaum ein Akt in der Millionenorganisation noch wirklich freiwillig war, vielmehr Freiwilligkeit zum rhetorischen Deckmantel verkam.599 4.2
Wie „freiwillig“ waren die letzten Parteieintritte?
Unterführer der Hitlerjugend und Ortsgruppenleiter der Partei standen in der letzten Kriegsphase massiv unter Druck, junge Menschen in ausreichender Zahl als Nachwuchs zu gewinnen. Pragmatische genauso wie ideologische Gründe waren ausschlaggebend dafür, dass junge Männer in die Partei geholt werden sollten: „Wenn in diesem Jahre“, hieß es 1944 bezeichnenderweise, „erstmalig schon die 17-Jährigen in die Partei aufgenommen werden, dann deshalb, weil die Jungen schon in Kürze […] als Soldaten an der Front stehen werden. Sie werden als politische Kämpfer den grauen Rock anziehen und deshalb bessere Soldaten sein als die Söldner der westlichen Demokratien und die Roboter der Kreml-Juden.“600 Zudem benötigte die Partei die Hitlerjugend, um ihren Personalbedarf – mitunter in Konkurrenz zur Wehrmacht und SS, die ebenfalls in der Jugend rekrutierten – zu decken.601 Gewiss empfanden es viele Hitlerjun597 Bogislav von Heyden, Meine Erinnerungen an Haft und Zwangsarbeit in der Sowjetunion von 1946 bis 1949. In: Ernst Helmut Segschneider (Hg.), Gefangenschaft im Kaukasus 1946–1950. Drei Zeitzeugen erinnern sich, Münster 2002, S. 17–103, hier 25. 598 Armin Nolzen, Vom „Jugendgenossen“ zum „Parteigenossen“. Die Aufnahme von Angehörigen der Hitler-Jugend in die NSDAP. In: Wolfgang Benz (Hg.), Wie wurde man Parteigenosse? Die NSDAP und ihre Mitglieder, Frankfurt a. M. 2009, S. 123–150, hier 144 und 147 f. 599 Vgl. Reese, Zum Stellenwert der Freiwilligkeit, S. 77 f. 600 Kampferprobt und ewig jung. Die jüngsten Parteigenossen. In: Der Freiheitskampf vom 26.2.1944. 601 Vgl. Nolzen, Vom „Jugendgenossen“ zum „Parteigenossen“, S. 135.
Die letzten Parteigenossen
399
gen als Ehre, in die Reihen der Parteigenossen zu stoßen. Wie der 18-jährige Günther Roos, der am 30. September 1942 freudig in sein Tagebuch schrieb: „Augenblicklich habe ich auch wieder die HJ-Uniform an, denn heute werde ich in die NSDAP aufgenommen. Dann bin ich Pg. [Parteigenosse]. Ich freue mich, dass ich das noch eher wurde, als ich zur Wehrmacht einrücke.“602 Derweil urteilten Staatsinstanzen über die Rekrutierungsbemühungen nicht immer positiv. Die Auslese der Parteianwärter verlaufe „uneinheitlich und vielfach unbefriedigend“, heißt es in einem SD-Bericht vom Juni 1943. Meldungen über ausgelesene Parteianwärter seien nicht „immer einwandfrei und rechtzeitig“ erfolgt.603 Zudem würden in einigen Fällen taugliche Jugendliche aussortiert, während konfessionell gebundene oder angeblich unwürdige HJ-Führer zum Vorschlag kämen. Auch die Teilnahme der Bevölkerung an den Aufnahmefeiern sei bisweilen mangelhaft.604 Für 1941 hatten Parteikanzlei und RJF erstmals Kontingente festgelegt: 30 Prozent der männlichen und fünf Prozent der weiblichen Angehörigen sollten überführt werden. Die Rekrutierungszahlen durften von HJ- und BDM-Führungen in Maßen überschritten, sollten aber tunlichst nicht unterschritten werden.605 Jedes Gebiet hatte sich demnach an Zahlen zu orientieren, welche die Parteikanzlei vorgegeben hatte; sie waren gewiss nicht bindend oder gesetzlich fixiert, aber erzeugten einen Erwartungsdruck, der an der Basis von Partei und Hitlerjugend als bindend empfunden werden konnte. Ob Parteieintritte freiwillig oder unfreiwillig zustande kamen, bleibt eine entscheidende Frage. Nicht zuerst für ein moralisches Urteil über jene, die während des Krieges als Jugendliche und junge Männer in die NSDAP eingetreten waren: Ihnen ist kaum ein Vorwurf zu machen, weil die Mitgliedschaft allein kaum etwas Genaueres besagt, zumal sich viele Betroffene später um Demokratie und Wiederaufbau zweifelsfrei verdient machten. Die Frage berührt vielmehr die Art und Weise, wie die Hitlerjugend gegenüber ihren jungen Angehörigen zunehmend agierte. Immer wieder ist in der Debatte um die „unfreiwilligen“ Überführungen das Argument geltend gemacht worden, es sei denkbar, dass einzelne HJ-Führer die Unterschriften gefälscht hätten. Martin Walser hat dies für sich in Anspruch genommen: „Unser Standortführer hat sicher gedacht, wenn er eine ganze Handvoll hinüberschicken kann, dann macht er sich beim Gauleiter beliebt.“606 Historikerinnen und Historiker, die das zurückweisen, scheinen die Fakten auf ihrer 602 Tagebücher von Günther Roos, Eintrag vom 30.9.1942 (NSDOK Köln, EzG, roos. jugend1918-1945.de; 17.7.2020). 603 SD-Berichte zu Inlandsfragen vom 17.6.1943. In: Boberach (Hg.), Meldungen aus dem Reich, Band 14, S. 5360–5367, hier 5365. 604 Vgl. ebd., S. 5363 f. 605 Nolzen, Vom „Jugendgenossen“ zum „Parteigenossen“, S. 137. Vgl. auch Anordnung der Parteikanzlei A37/41 vom 3.9.1941, u. a. abgedruckt in: GB: Mark Brandenburg, 24/K vom 30.9.1941. 606 Zit. nach Joachim Güntner, Die unbekannte NSDAP-Mitgliedschaft. In: Neue Zürcher Zeitung, Online-Ausgabe vom 2.7.2007 (https://www.nzz.ch/die_unbekannte_nsdapmitgliedschaft-1.521695; 4.1.2021).
400
Massenmobilisierung
Seite zu haben: Keinen einzigen Fall hat man nachweisen können. E hrlicherweise wäre zu ergänzen, dass ein Dokument, das die Fälschung einer Unterschrift nachweisen könnte, heute nahezu unmöglich aufzufinden sein dürfte. Der einstige Leiter des Mitgliedschaftsamtes, Anton Lingg, sagte im Internierungslager in Regensburg 1947, dass zu keinem Zeitpunkt Personen in die NSDAP aufgenommen worden seien, ohne dass ein Einzelantrag vorgelegen habe. Fälle von Urkundenfälschungen schloss er aber nicht aus.607 Selbst wenn man das für möglich hält, kann es sich nicht um ein Massenphänomen gehandelt haben. Historikerinnen und Historiker folgerten daraus mehr, als es besagt: „Der Zeitpunkt der Unterschriftsleistung konnte auch einen Augenblick der Freiheit bedeuten“, meinte Armin Nolzen, „zu unterschreiben – oder aber eben auch nicht.“608 In der Debatte scheint dies die gegenläufige Zuspitzung, die zu hinterfragen erlaubt sein muss. War die freie Entscheidung für oder gegen die Unterschrift und den Beitritt in die Partei tatsächlich zweifelsfrei gegeben? Die Überführungen auf Grundlage von Sollzahlen schließt die Möglichkeit der Nötigung und Repression mit ein. Die Situation 1940/41 lag noch einmal anders als die 1943 und 1944. Dokumente aus dem Innendienst der Hitlerjugend zeigen dies. Die Voraussetzung zur Überführung eines Jugendlichen in die NSDAP wurden sukzessive abgesenkt. Vier Jahre hatte man der Hitlerjugend bislang eigentlich angehören müssen. 1941 wurde die Mindestzeit für österreichische Jugendliche auf drei Jahre abgesenkt; in einigen Regionen galten darüber hinaus Ausnahmebestimmungen, sodass schon bei zweijähriger Dienstzeit eine Aufnahme in die NSDAP stattfinden konnte.609 Der eigenhändig unterschriebene Antrag blieb aber Voraussetzung. Er war bei der Ortsgruppe einzureichen. Der jeweilige Bannführer, der über den vorgeschlagenen Parteianwärter entschied, bescheinigte die „Würdigkeit für die Aufnahme in die NSDAP“. Man hob abermals hervor: „Die Aufnahme erfolgt freiwillig“.610 Am 27. Februar 1944 wurden reichsweit Jugendliche im Rahmen von Monatsappellen in die Partei aufgenommen. Sie sollten, so Reichsjugendführer Axmann, „als jüngste Parteigenossen und Parteigenossinnen in ihrer neuen Heimat der Partei die begeisterten Künder der nationalsozialistischen Weltanschauung sein.“611 Die Aufnahme des Jahrgangs 1926 begründete Walter Biege, ein Kreisamtsleiter der NSV aus Mecklenburg: „Die Besten aus den Reihen der Jugend des Führers nimmt die Partei in ihre Obhut. […] Durch diesen alljährlichen Nachwuchs aus der HJ wird die Partei stets verjüngt und immer ein starkes und kampfkräftiges Instrument in der Hand des Führers sein.“612 Der Druck zum 607 Vgl. Befragung Anton Lingg vom Januar 1947 (BArch, BDC 377, 1, Bl. 71 f.). 608 Nolzen, Vom „Jugendgenossen“ zum „Parteigenossen“, S. 150. 609 Vgl. Aufnahme in die NSDAP. In: GB: Oberdonau, A K/6 vom 1.5.1941. Die Ausnahmen galten im Gebiet Oberdonau für die HJ-Banne Kaplitz und Krummau. 610 Aufnahme in die NSDAP. In: GB: Düsseldorf, A10/39 vom 5.7.1939. 611 Die Partei, Heimat der Jugend. In: Hamburger Anzeiger vom 28.2.1944. 612 Begleitwort. In: Gau Mecklenburg der NSDAP (Hg.), Die Heimat schreibt der Front. Feldpostzeitung des Gaues Mecklenburg der NSDAP, (1944) 1, S. 16.
Die letzten Parteigenossen
401
Beitritt war bis dahin kontinuierlich angewachsen. Im Gebiet Pommern beispielsweise wurden im Januar 1943 HJ-Führer und BDM-Führerinnen niederer Ränge, die das 18. Lebensjahr bereits erreicht oder überschritten hatten, aber bislang keine Parteimitgliedschaft besaßen, vom Gebiet aufgefordert, „sich sofort persönlich oder schriftlich auf der Banndienststelle“ unter Angabe aller relevanten Daten für die Parteiaufnahme zu melden.613 Seit Anfang des Jahres waren die Organisationsabteilungen in Gebieten und Bannen verantwortlich für alle Belange, die Überweisungen in die NSDAP und ihre Gliederungen wie die SA oder die NS-Frauenschaft betrafen.614 Deren Mitarbeiter waren bestrebt, eine möglichst hohe Zahl junger Unterführerinnen und Unterführer für die Partei zu gewinnen. Die Gebiete forderten von ihren nachgeordneten Bannen statistische Angaben ein, inwieweit die Kontingente erfüllt wurden. Prozentual mussten die Mitarbeiter vor Ort ausrechnen, wie viele weibliche und männliche Jugendliche in die NSDAP überwiesen worden waren und wie viele davon einen Führerrang innehatten.615 Weil die Kontingente in lokalen Dienststellen demnach gut bekannt waren, mussten die statistischen Aufstellungen dort als Überprüfung der eigenen Arbeitsleistung und Fähigkeiten verstanden werden. Für die Parteiaufnahmen im Frühjahr 1944 war man, wie erwähnt, von den üblichen Regeln abgewichen. Nunmehr sollten „für die Dauer des Krieges“ Jugendliche bereits „mit Vollendung des 17. Lebensjahres“ für die NSDAP infrage kommen. Zur Auslese der Parteianwärter, die im Frühjahr 1945 aufgenommen werden sollten, mussten den Banndienststellen, wie üblich, die Stammblätter der Jugendlichen zur Entscheidung vorgelegt werden. Bis zum 15. Januar 1945, so plante es die Hitlerjugend in Bayern, sollten die Anträge mit Dienstzeitbescheinigung an die zuständige Ortsgruppe der NSDAP abgeliefert werden. Am 10. Februar schließlich sollten die Banne Meldung an ihre Gebietsführer erstatten, wie viele Jugendliche sie zur Aufnahme in die Partei gewonnen hatten.616 Die Vorbereitungen begannen früh. Der Führer des Gebiets „Moselland“ betonte Ende Juli 1944, dass Unterführer mit „bestem Gewissen […] in der Auslese prüfen und jeden […] vorgeschlagenen Jungen und jedes Mädel vor dem Hoheitsträger verantworten“ sollten. Zwischen Bann und NSDAP-Kreisleiter sollte über die Anwärter einvernehmlich entschieden werden. Zugleich wurde erheblicher Druck auf untere Stellen aufgebaut. Die Gebietsführung unterstrich ihre Erwartung, dass möglichst viele junge Menschen für die Partei rekrutiert werden sollten: „Die Leiter der Jugendappelle können mit dem örtlich zuständigen 613 Parteiaufnahme. In: GB: Pommern, 1/43 K vom 1.1943. 614 Vgl. Erfassungswesen. In: GB: Oberschlesien, 2/43 vom 1.4.1943: „Der Reichsjugendführer hat angeordnet, dass das Erfassungswesen und Mitgliedswesen ab sofort durch die Organisationsabteilung des Gebietes zu bearbeiten ist. […] Außerdem wird von dieser Abteilung die Kommandierung für den Kriegseinsatz, die Durchführung der Überweisungen und Überführungen in die NSDAP, ihre Gliederungen und angeschlossenen Verbände und Entlassung aus der Jugenddienstpflicht bearbeitet.“ 615 Aufnahme des Jahrgangs 1925 in die Partei. In: GB: Pommern, 6/43 K vom 4.1943. 616 Aufnahme in die NSDAP. Überweisung in die Gliederungen, Überführungen in das BDM-Werk. In: GB: Hochland, 10/44 K vom 15.10.1944.
402
Massenmobilisierung
Hoheitsträger auch über die Kontingentzahlen hinaus noch mehr Jugendliche auslesen, sofern diese Jugendlichen für würdig gehalten werden.“617 Dass die Vorgaben unterschritten werden durften, wurde nicht eigens betont. Das Gebiet mahnte an, es sollten rechtzeitig vor den Appellen die Ausleselisten zusammengestellt und mit der Ortsgruppe beraten werden.618 Das hieß konsequenterweise, dass die Jugendlichen auf Listen zur Aufnahme in die Partei gelangten, wahrscheinlich noch bevor sie ihre Zustimmung signalisiert oder gar eine Unterschrift unter einen Antrag geleistet hatten. Die Unterschrift wurde immer mehr zur Formsache. Eine erhebliche Veränderung setzte auf diese Weise ein. Bis dahin war die Überweisung junger Menschen von der Hitlerjugend in eine Gliederung der NSDAP wie der SA „im Gegensatz zur Parteiaufnahme […] rein listenmäßig“ erfolgt.619 Anders als bei einer Überweisung in eine NSDAP-Gliederung war aber für den Parteieintritt die freiwillige Meldung ausschlaggebend gewesen. Deshalb lautete es, wie in folgender Anweisung 1942, dass die „Jungen und Mädel […] sich zur Aufnahme in die Partei melden“ sollten und der „Aufnahmeantrag gewissenhaft auszufüllen“ sei.620 In Wien hieß es Anfang 1941: „Hitler-Jugend-Angehörige, die sich […] als Führer bewährt haben, können bei der Wohnsitz-Ortsgruppe den Antrag um Aufnahme in die NSDAP stellen.“621 Ab Ende 1943 wurde dies von höheren Dienststellen kaum gesondert hervorgehoben. Im Gegenteil: Die Hitlerjugend war im Angesicht der Kriegslage bemüht, eine wachsende Zahl junger Menschen der NSDAP zu übergeben. Aus diesem Grund gewannen die Vorschlagslisten, die die Unterführer mit den Ortsgruppenleitern zusammenstellten, an Bedeutung.622 Es ist nicht richtig, dass es solche Listen nicht gegeben habe. Die Hitlerjugend übrigens rekrutierte Nachwuchs zuletzt selbst an Orten, die eine freiwillige Entscheidung im Sinne einer individuellen Abwägung reichlich unwahrscheinlich erscheinen lassen. Noch am 1. März 1945 gab die Personalabteilung in Baden folgende Mitteilung heraus: „Die Führer […] der Banne, WE-Lager-Führer und Schulführer legen auf die Auslese der Jungen, welche als kommende Hitler-Jugend und Partei-Führer in Frage kommen, größten Wert. Es können Jugendliche […] sofort gemeldet werden. Der Obergebietsführer verlangt, dass jeweils zu Monatsende die Meldungen erstattet werden. Besonders günstig für die Auslese scheinen die Bannausbildungslager zu sein.“623 Denkbar ist es, dass man jun-
617 Aufnahme von Angehörigen der Hitler-Jugend in die NSDAP. In: BB: Moselland, 6/44 vom 27.7.1944. 618 Vgl. ebd. 619 Überweisung des Jahrgangs 1925 in die Gliederungen der Partei. In: GB: Pommern, 5/43K vom 4.1943. 620 Aufnahme des Jahrganges 1924 der Hitler-Jugend in die Partei. In: GB: Wartheland 3/42K vom 1.5.1942. 621 Vgl. Aufnahme von Hitler-Jugend Führern in die NSDAP des Jahrgangs 1921 oder älter. In: GB: Wien, 1/42 vom 1.1.1942. 622 Vgl. Erfassung des Geburtsjahrganges 1928. In: GB: Wien 2/44K vom 1.2.1944. 623 Führernachwuchs der NSDAP. Hitler-Jugend. In: GB: Baden, 1/45K vom 1.3.1945.
Die letzten Parteigenossen
403
gen Menschen, die auf den Listen geführt wurden, im Lager quasi im Vorbeigehen die Unterschrift unter die Anträge abnahm. So berichtet auch Philosoph Hermann Lübbe, Jahrgang 1926: „In meinem eigenen Fall gelingt mir allenfalls eine vage Erinnerung an meine Matrosenzeit als Seeoffiziersschüler, in der eine Unterrichtsstunde meiner Crew mit dem Aufruf schloss, sich in ernster Zeit umso fester um den Oberbefehlshaber zu scharen. Ob es dabei auch zu Unterschriften unter Parteibeitrittsgesuche kam, weiß ich nicht. Ich habe inzwischen beim Bundesarchiv um die entsprechende Auskunft gebeten. Wie immer die Auskunft ausfallen wird – eine autobiografische Bedeutung hätte das nicht.“624 Merkwürdig erscheint das intensive Bemühen noch Ende 1944 speziell aufgrund einer Anweisung, die am 30. September Reichsschatzmeister Franz Xaver Schwarz durchgab. Auf Basis des Führererlasses vom 25. Juni über den totalen Kriegseinsatz sollte die Aufnahme der Hitlerjugend-Angehörigen des Jahrgangs 1928 in die NSDAP eingestellt werden.625 „Dank dieser Anordnung“, so Heinz Fehlauer, „blieb vielen jungen Menschen der spätere Makel einer NSDAP-Mitgliedschaft erspart“.626 Warum betrieb die Hitlerjugend trotzdem die Auslese der Anwärter mühevoll im letzten Kriegswinter? Einerseits drang die Botschaft mancherorts vielleicht gar nicht mehr durch. Andererseits wollten die Funktionäre die Erfassung für die Zeit nach dem illusorischen „Endsieg“ schon vorbereiten. Man stellte also weiterhin die Anwärterlisten zusammen.627 Nur wenige der Listen scheinen erhalten geblieben zu sein. Eine Liste mit Parteianwärtern aus der Kleinstadt Nordheim in Württemberg vom 12. Februar 1945 soll im Folgenden als Beispiel dienen. Der Gefolgschaftsführer, ein SA-Obertruppführer, hatte sich mit dem Ortsgruppenleiter zusammengesetzt. Man beriet, wer von den 17-jährigen HJ-Angehörigen für die Aufnahme in die Partei infrage käme. Sie einigten sich auf sieben Jugendliche, darunter drei Rottenführer, je ein Fähnlein-, Jungenschafts- und Kameradschaftsführer sowie ein einfacher Hitlerjunge. Damit hatte man etwas mehr als ein Drittel des Jahrgangs 1928 aus der Gefolgschaft der Kleinstadt für die Parteiaufnahme vorgeschlagen – etwa die Größenordnung, die das Regime für männliche Jugendliche vorgegeben hatte. Man agierte vor Ort, als sei diese Zahl unbedingt
624 Hermann Lübbe, Verdrängte oder historisierte Vergangenheit? Über alt gewordene Parteijunggenossen. In: Alfred Neven DuMont (Hg.), Jahrgang 1926/27. Erinnerungen an die Jahre unter dem Hakenkreuz, Köln 2007, S. 221–229, hier 226. 625 Vgl. Anweisung des Reichsschatzmeisters vom 30.9.1944, bezüglich Vereinfachungsmaßnahmen im Mitgliedschaftswesen, betrifft Aufnahmesperre, u. a. abgedruckt in: GB: Nordsee, 10/44 vom 11.1944. 626 Heinz Fehlauer, NS-Unterlagen aus dem Berlin Document Center und die Debatte um ehemalige NSDAP-Mitgliedschaften. In: Historical Social Research, 35 (2010) 3, S. 22– 35, hier 34. 627 Vgl. Ergänzende Anmerkungen der Gebietsführung zur Aufnahme des Jahrgangs 1928 in die NSDAP. In: GB: Nordsee, 10/44 vom 11.1944: „Hierzu wird angeordnet, dass ab sofort die Auslese der Parteianwärter [des Jahrganges 1928] planmäßig durchgeführt wird. […] Die genannten Jungen und Mädel sollen durch die Ortsgruppen jetzt schon wie ‚Parteianwärter‘ betreut und geführt werden.“
404
Massenmobilisierung
zu erreichen, weshalb sogar ein Jugendlicher auf die Liste kam, der keinerlei Rang bekleidete. Die sogenannte Würdigkeit, die man bislang hervorgehoben hatte, verkam zur Phrase. In mehreren Bannen hatte man, wie gut belegt ist, den Richtwert zeitweise gar massiv überschritten. Die Ansicht, es sei stets nur eine elitäre Minderheit vorgeschlagen worden, trifft für die letzten zwei Kriegsjahre nicht mehr zu.628 Ob man die sieben Jugendlichen, die dem Bann in Heilbronn als Parteianwärter gemeldet wurden, überhaupt informierte, dass sie auf der Liste standen, wann und unter welchen Umständen sie ihren Antrag eventuell unterschrieben hatten, geht aus der Liste nicht hervor.629 Legt man die Termine aus anderen Gebieten zugrunde, kam der Brief verspätet. Über die Anwärter musste noch der Bannführer entscheiden, danach wären wahrscheinlich erst die Unterschriften einzuholen gewesen.630 Einer der Hitlerjungen, der auf dieser Liste stand und als Zeitzeuge Auskunft geben konnte, erinnert sich weder an einen Antrag noch an seine Parteianwärterschaft. Seine Aussagen lauten nicht anders, als die der prominenten Persönlichkeiten, an denen sich die späte Debatte um die „unfreiwilligen“ NSDAP-Mitglieder entzündete. Er habe nie eine Unterschrift geleistet, sei nicht informiert worden, dass man ihn in Betracht gezogen habe. Parteibuch oder Karte habe er nicht erhalten.631 Die Überprüfung im Bundesarchiv hat ergeben, dass für die sieben Jugendlichen tatsächlich keine Karten mehr angelegt wurden – was aufgrund der erwähnten Anweisung der Parteikanzlei und in Anbetracht der Kriegsphase nicht zu erwarten war.632 Es ist nicht auszuschließen, dass man sie nie darüber informiert hatte, dass sie als potenzielle Anwärter gemeldet worden waren. In den NSDAP-Mitgliederkarteien finden sich zwar nicht viele, aber doch einige Karten für den Jahrgang 1928. Manchmal ist der Eintritt für den 20. April 1943 oder 1944 vermerkt worden – die Aufnahme wurde also entweder rückdatiert oder das Geburtsjahr falsch eingetragen. In mindestens einem Fall weist sogar ein Fragezeichen neben dem Geburtsdatum auf den etwaigen Fehler der Sachbearbeiter hin; in einem anderen Fall wurde dort, wo das Datum des Antrags einzutragen war, die unmögliche Zeitangabe 11. Januar 1949 eingefügt.633 628 Vgl. Buddrus, Totale Erziehung, Band 1, S. 304. 629 Vgl. NSDAP Hitlerjugend, Gefolgschaft 50/121 Nordheim an den Bann Unterland, Heilbronn vom 12.2.1945 (StA Ludwigsburg, PL 509, Bü 7, unpag.). 630 Vgl. Terminübersicht des Gebiets Hochland zur Aufnahme des Jahrgangs 1928 in die NSDAP. In: GB: Hochland 10/44K vom 15.10.1944. Demnach sollte im Herbst 1944 die Auslese erfolgen, am 1.12.1944 hätte eine Entscheidung über die Parteianwärter durch den Bannführer getroffen werden müssen, am 15.1.1945 waren die Parteiaufnahmeanträge an die Ortsgruppen der NSDAP zu schicken, am 10.2.1945 sollten die zahlenmäßigen Meldungen an das Gebiet gegeben werden. 631 Vgl. Telefoninterview von André Postert mit Zeitzeuge, der anonym bleiben möchte, vom 6.3.2015 (Protokoll, Archiv des HAIT). 632 Vgl. Recherche des Verfassers im Bundesarchiv Berlin vom 14.5.2019. 633 Jede 50. Karteikarte ist in einer Datenbank indexiert, wodurch es möglich wird, einen geringen Anteil der Karteikarten nach Geburtsjahrgängen zu filtern. Unter den Ergebnissen sind – Indexierungsstand 14.5.2019 – in der Gaukartei sechs Karten auf den Jg.
Die letzten Parteigenossen
405
Die Eintragungen auf den Karten fallen für die letzten Kriegsjahre darüber hinaus oft spärlich aus; mehr als Name, Geburtsdatum, Mitgliedsnummer und Wohnort ist vielfach nicht mehr angegeben. Gerade für die Kriegsjahrgänge der Hitlerjugend sind die Karteikarten keinesfalls über jeden Zweifel erhaben. Warum manch ein Historiker behauptet, die Bürokratie und Aufnahmepraxis habe bis zuletzt reibungslos und fehlerfrei funktioniert, bleibt dessen Geheimnis. Auch der Fall aus Nordheim kann nicht belegen, dass auf Unterschriften je verzichtet wurde. Aber er zeigt, dass untere Dienststellen die Kontingentvorgaben zu erfüllen versuchten. Man nahm offenkundig sogar Abstriche bei der Auswahl vor, um die Vorgaben zu erreichen. Umso mehr bleibt zu bedenken, in welcher Situation diese Jugendlichen geworben wurden. Manche Karteikarten geben nicht nur Wohnort, sondern außerdem den letzten bekannten Aufenthaltsort der jungen Parteimitglieder an: Baracke, Westwall oder Luftwaffe steht in etlichen Fällen eingetragen. Es ist nicht unmöglich, sich vorzustellen, dass dort Druck ausgeübt wurde, Überredungskunst oder perfide Mittel im Spiel waren, um die Unterschriften zu erhalten. Im Dienst sollten, wie Martin Bormann Ende 1942 hervorhob, „die beiden jeweils ältesten Jahrgänge (ab 16. Lebensjahr) von den Hoheitsträgern der Partei und deren Beauftragten durch monatliche Vorträge“ zur Auslese gewonnen werden. Unter „verständnisvoller kameradschaftlicher Anleitung“ sollten dann jene, die sich für die NSDAP zu eignen schienen, „frühzeitig in die politische Arbeit“ eingeführt werden. Je näher man den Jugendlichen käme, desto leichter seien sie zu gewinnen. Bormann unterstrich: Hoheitsträger der Partei sollten in enger Zusammenarbeit mit der HJ „alles daransetzen, die charakterlich und weltanschaulich Besten aus der Jugend […] zu ermitteln, zu fördern und für die Bewegung zu gewinnen“.634 Die Gebietsführung in Sachsen reichte die Anweisungen bezüglich der Aufnahme des Jahrgangs 1925 im Januar 1943 an ihre Dienststellen weiter – allerdings mit einer irritierenden Bemerkung: „Alle Unterführer und Unterführerinnen werden hiermit verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen die Kameraden namhaft zu machen, die der Partei angehören dürfen und müssen.“635 Müssen? Die Anweisungen betonten doch gerade die Freiwilligkeit, die durch die Unterschrift zu belegen sei. Aber die Gebietsführung in Sachsen gab eine Interpretation der Kontingente nach unten weiter, die an der Basis eben nicht als Kann-, sondern als Muss-Regelung zu verstehen war. Im Gebiet Franken betonte man im April 1942, dass die Aufnahme in die Partei „selbstverständlich freiwillig“ sei. Gleichzeitig machte man jedoch deutlich: „Es ist unter allen Umständen zu erreichen, dass die […] genannten Prozentsätze unbedingt
1928 ausgestellt. Eine sehr geringe Zahl (zum Vergleich: die Filterung nach Jg. 1927 liefert 2 323 Ergebnisse allein für die Gaukartei), aber die tatsächliche Zahl dürfte wegen des geringen Indexierungsstands weit höher liegen. 634 Anordnung A82/42, Reichsverfügungsblatt 72/42. In: GB: Sachsen, 1/43 vom 1.1.1943. 635 Vgl. Anweisung 2/43, Nachwuchs für die Partei. In: ebd.
406
Massenmobilisierung
erfüllt werden.“636 Man hatte sich ein Vorgehen ausgedacht, das dem Freiwilligkeitsprinzip spottete: Jugendliche, die man als Anwärter auf die Listen gesetzt hatte, sollten zu einem gesonderten Heimabend zusammengerufen werden. Der Ortgruppenleiter hielt eine Ansprache über den „Orden der Partei“, sogleich händigte man Formulare aus. „Bei dieser Gelegenheit wird den Jungen und Mädeln […] der Aufnahmeschein, der durch den Ortsgruppenleiter zu beziehen ist, übergeben und an Ort und Stelle ausgefüllt und unterschrieben.“637 Spätestens nach 1943 herrschte in der Hitlerjugend zunehmende Irritation darüber, wie man die widersprüchlichen Signale aus der Parteikanzlei und der RJF deuten sollte. Manche Unterführer und die Mitarbeiter sahen die Kontingente als Pflichtvorgabe. Vom Prinzip des freiwilligen Eintritts entfernte man sich im Kriegsverlauf immer mehr. Hinzu kam, dass der Dienst in den letzten zwei Kriegsjahren vielerorts kaum noch im obligatorischen Rahmen stattfand, weil die Zerstörung der Städte sowie Not- und Hilfsdienste dies weitgehend unmöglich machten. Die Hitlerjugend und NSDAP-Ortsgruppen knüpften die Vorbereitungen für die Erfassung und Überweisungen zu Gliederungen der NSDAP wie der SA oder in die Partei selbst immer häufiger an Appelle, wo zusätzlich ein Gruppendruck herrschte. Die Anordnung der Gebietsführung in Koblenz vom Juli 1944 zeigt dies. Dort wies man auf die Bedeutung der Appelle hin. Im ersten Schritt sollten die Listen zusammengestellt werden. Am 1. Oktober hatten die Appelle stattzufinden, bei denen die Unterführer ihre Anwärter vom Eintritt überzeugen sollten. Am 1. November, lautete die Planung der Gebietsführung, waren die Parteianwärter dem Bann zur Entscheidung mitzuteilen. Von „Auslese“ und „Vorgeschlagenen“ war in dieser Anweisung die Rede, aber bezeichnenderweise nirgends mehr von freiwilligen Meldungen.638 Der Hinweis: „Setzt euch rechtzeitig vor dem Jugendappell […] mit dem Hoheitsträger in Verbindung“,639 zeigt, dass Personen auf Listen gelangten, ohne darüber informiert zu werden. Auch das Gebiet Niederdonau warb die letzten Parteianwärter 1944 mittels der Jugendappelle. In den ausführlichen Anweisungen zur Auslese des Jahrgangs 1928 wurde das Freiwilligkeitsgebot an keiner Stelle gesondert hervorgehoben. Der Bann habe über die Anwärter zu entscheiden, hieß es, und es sei „ein Aufnahmeantrag, abgezeichnet vom Ortsgruppenleiter und Gefolgschaftsführer“ beizulegen.640 Nicht einmal erwähnt wurde, dass die Anwärter ihre An636 Anweisungen des Gebietes Franken (18) für die Aufnahme von Angehörigen der Hitler-Jugend und des Bundes Deutscher Mädel in die NSDAP – Jahrgang 1924. In: GB: Franken, Sonderdruck vom 4.1942; selbiger Wortlaut bei Aufnahme in die NSDAP, Jahrgang 1925. In: ebd., 1/43 vom 1.1943. 637 Ebd. 638 Vgl. Aufnahme von Angehörigen der Hitler-Jugend in die NSDAP. In: BB: Moselland, 6/44 vom 27.7.1944. 639 Ebd. 640 Aufnahme in die NSDAP und Überweisung in ihre Gliederungen (Sonderdruck), hier die Abschnitte „Erfassungsvorgang“ und „Vorbereitung der Parteiaufnahme“. In: GB: Niederdonau, 9/44K vom 15.9.1944.
Die letzten Parteigenossen
407
träge unterschreiben sollten. Im Rahmen der Appelle, die nicht der Aufklärung, sondern der Überredung dienten, konnte man die Unterschriften rasch oder gar beiläufig einholen. Selbst in den KLV-Lagern wurde der Nachwuchs rekrutiert. Fern des eigenen Elternhauses lastete erheblicher Anpassungsdruck auf den jungen Menschen. Einer, der in einem Lager in Einsiedl bei Marienbad ein Tagebuch anfertigte, hatte dort seine Unterschrift unter einen Antrag gesetzt. Wie wenig ihn sein Parteieintritt begeisterte, zeigt seine spannende Notiz von Ende Februar 1944: „Parteiaufnahme der 18-Jährigen. Feier im Rathaus. […] 36 Mann haben Ausgangsverbot, die den Wisch unterschrieben haben. Ich leider auch.“641 Ein Parteieintritt aus Überzeugung würde sich gewiss anders lesen. Anfang 1945 erreichte diese Entwicklung ihren Zenit. Das Gebiet Nordsee z. B. wies im Januar an, dass zur Auslese des Jahrgangs 1928 alle gemeldeten Jugendlichen von ihren Bannführungen zu gesonderten Ausbildungslagern zusammenzuziehen seien. Dort sollte in einem achttägigen Schnellkurs „die Auslese und die weltanschauliche Schulung für Parteianwärter“ stattfinden.642 Das alles heißt nicht, dass die Unterschriften nicht formal die Voraussetzung zur Aufnahme in die NSDAP blieben. Historikerinnen und Historiker haben Recht, wenn sie darauf verweisen, dass der Parteieintritt bis zuletzt verweigert werden konnte. Dafür gibt es auch dokumentierte Beispiele, auf die verschiedentlich verwiesen worden ist. Der SD zitierte im August 1943 aus einem Bericht. Die „meisten Jungen und Mädel“ hätten „gar kein Interesse daran“ aufgenommen zu werden: „Alle Aufrüttelungsversuche der zuständigen Stellen sind vergeblich gewesen.“ In einem weiteren Bericht, auf den sich der SD berief, lautete es: „Es ist zu bemerken, dass […] Jugendliche oft genug die Aufnahme in die Partei ablehnen, sie haben kein Interesse und wollen nicht.“643 Im Gebiet Westfalen hatte die HJ-Führung bereits 1940 Klage geführt, da es sich an vielen Fällen gezeigt habe, dass von der Möglichkeit zum Parteieintritt sowohl von männlichen als auch weiblichen Jugendlichen „nur sehr wenig Gebrauch gemacht“ werde. Man empfahl den Ortsgruppenleitern, „persönliche Rücksprache“ mit jungen Menschen zu halten und eine „Aufforderung zum Übertritt in die Partei“ offensiv zu vertreten.644 Man mag diese Tatsache als Beleg für das Vorhandensein individueller Wahlfreiheit lesen. Ebenso gut ließe sich daraus ableiten, warum die unteren Dienststellen mehr und mehr Druck anwenden und möglicherweise zu repressiven Mitteln greifen mussten, um die Kontingentzahlen zu erreichen.
641 KLV-Tagebuch Helmut Stuckert, Band 2, 5.12.1943–4.5.1944, hier Eintrag vom 27.2.1944 (NSDOK Köln, EzG, jugend1918-1945.de; 17.7.2020). 642 Aufnahme des Jahrganges 1928 in die NSDAP (Durch Gebietsrundschreiben 1/45 voraus). In: GB: Nordsee, 1/44 vom 1.1944. 643 Bericht des Sicherheitsdienstes der SS zur Loyalität der Jugend gegenüber der NSDAP vom 12.8.1934. In: Benecke (Hg.), Hitler-Jugend 1933–1945, S. 372–374, hier 373. 644 Überführung der 18-jährigen Hitler-Jungen bzw. BDM-Mädel in die Partei. In: Gebietsund Obergaubefehl: Westfalen, K14/40 vom 18.4.1940.
408
Massenmobilisierung
Ob die Möglichkeit, eine Unterschrift zu verweigern, dem Einzelnen voll zu Bewusstsein kommen konnte? Und wenn dem nicht so ist, stellt dann die Unterschrift überhaupt noch ein valides Kriterium dar, um die Aufnahmepraxis als freiwillig zu bezeichnen? Welchen Aufschluss über Motive bieten Anträge und Karteikarten? Pauschal lässt sich dies weder in dem einen noch dem anderen Fall sagen, ohne Biografien und Kontexte zu kennen. Die Hitlerjugend warb vor Ort aggressiv und wohl auch mit perfiden Mitteln. Man erzeugte Druck auf junge Menschen. „Die Bannführung teilt mir schriftlich mit“, so Eckhardt Mesch, Jahrgang 1927 aus Weimar: „Du hast der Jugenddienstpflicht genügt, im Jungvolk, in der Hitlerjugend, als Luftwaffenhelfer. Du hast damit das Recht erworben, in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei aufgenommen zu werden. Fülle also beiliegendes Aufnahmeformular aus. – Irgendetwas warnt mich, ich antworte der Bannführung nicht. Manche aus meiner Schulklasse tun das, werden Mitglied der NSDAP. Später macht man diesen schwere Vorwürfe. Andere, Nichtmitglieder, betonten nachträglich stolz, wie standhaft sie sich geweigert haben. Viel Zufall war dabei im Spiel, viel Einfluss von außen.“645
645 Zeitzeugenbericht von Eckhardt Mensch. In: Benecke (Hg.), Hitler-Jugend 1933–1945, S. 221–230, hier 230.
Bilanz Mit der Hitlerjugend verschwand 1945 die größte Jugendorganisation, die es in der deutschen Geschichte je gegeben hatte, sang- und klanglos von der Bildfläche. Als sie am 10. Oktober durch das Kontrollratsgesetz der Alliierten samt aller übrigen NSDAP-Gliederungen und angeschlossenen Verbände verboten wurde, war sie schon längst implodiert und in den Trümmerruinen Deutschlands unsichtbar geworden. Jugendliche in West wie Ost hatte man mit Kriegsende zahlreich in Gefangenschaft genommen, einige auch vorbeugend interniert, weil die Alliierten „Werwölfe“ fürchteten. Jugendliche Terroristen hinter feindlichen Linien waren jedoch eher die Legende der deutschen Verzweiflungspropaganda als ein Massenphänomen der letzten Kriegswochen. Das Tagebuch des 16-jährigen Klaus Everwyn aus Köln, der bei Kriegsende als Fronthelfer eingezogen worden war, zeigt die Sinnkrisen und Verwirrung junger Menschen eindrucksvoll auf. Anfang Mai 1945 äußerte er sich zornig über die „Parteibonzen“, die Deutschland in den Abgrund geführt hatten. „Ich hasste als Deutscher jeden Amerikaner, aber jetzt lernte ich sie kennen und erkannte, dass ich nicht sie hassen musste, sondern die Kriegstreiber. […] Es lebe ein freieres Deutschland!“1 Nur Wochen später verfiel der junge Mann in Altbekanntes. Bonn biete ein „ekelhaftes Bild“, notierte er im Sommer 1945: „Deutsche Mädchen und Frauen liefen dort mit Negern Arm in Arm herum, liebkosten sich öffentlich und taten so, als wenn es gar nichts wäre. […] Früher war ich stolz ein Deutscher zu sein, heute müsste man sich bis in den Grund schämen!“2 Die implodierte Hitlerjugend geisterte weiterhin herum. Jugendliche – ahnungslos über die Zukunft, verhaftet mit der Vergangenheit – gingen noch immer zu den HJ-Heimen, wo man Wochen zuvor als Hitlerjugend zusammengesessen hatte. Viele der Jüngeren grüßten weiter mit erhobenem Arm einen ehemaligen Unterführer auf der Straße, wie man es vorher tun musste. Ein früherer HJ-Unterführer und drei Gesinnungsfreunde wurden im Sommer 1946 vom britischen Geheimdienst verhaftet, weil sie einen Anschlag auf die Kölner Rheinbrücke geplant hatten.3 Die sowjetische Militärgerichtsbarkeit verurteilte im selben Jahr Horst Schulz, früher ein stellvertretender HJ-Unterbannführer aus Berlin, zum Tod durch Erschießen sowie weitere Jugendliche, die bei Kriegsende im „Volkssturm“ eingesetzt waren, zu langen Haftstrafen. Sie hatten nach Kriegsende angeblich Waffen und Munition gehortet, antisowjetische Propaganda verbreitet, Terrorakte geplant und einen Überfall auf Soldaten der Roten Armee verübt. Sogenannte Werwölfe, die bei Kriegsende gegen die Alliierten gekämpft hatten, und junge Männer, die im Verdacht standen, dass sie Terrorakte gegen die Besatzer planten, wurden vor Militärgerichte ge1 2 3
Zit. aus dem Tagebuch von Klaus Everwyn, Eintrag vom 29.4.–1.5.1945, S. 47 (NSDOK Köln, EzG, jugend 1918–1945.de; 27.10.2020). Ebd.,Eintrag vom 20.7.1945, S. 96. Vgl. HJ-Führer will Rheinbrücke sprengen. In: Neues Deutschland vom 4.7.1946; Werwolf mit „Sprengstofffabrik“. In: Berliner Zeitung vom 5.7.1946.
410
Bilanz
stellt; einige zu Unrecht verurteilt. Die Hitlerjugend schien verschwunden und war für viele Kinder und Jugendliche bereits Vergangenheit, aber auch Unverbesserliche und junge Rechtsterroristen hat es gegeben.4 Die Westalliierten hatten 1944 mit der berüchtigten SS-Panzer-Division „Hitlerjugend“ nachhaltige Erfahrungen gemacht: Die für ihren Kriegseinsatz ausgebildeten Jugendlichen, überwiegend aus dem Jahrgang 1926, galten als fanatische, indoktrinierte und ruchlose Kämpfer. Während ihres Einsatzes in der französischen Normandie und im Zuge des Rückzugs in den letzten Kriegsmonaten verübten die Angehörigen der Division – deren Kommandeure zu zwei Drittel aus der SS-Leibstandarte kamen – mehrere Kriegsverbrechen, darunter die Ermordung kanadischer Kriegsgefangener sowie Massaker an französischen Zivilisten.5 Diese SS-Division, welche die Hitlerjugend in ihrem Namen trug, wurde zum Symbol für den ideologischen Verseuchungsgrad in der deutschen Jugend. Nicht zuletzt der zähe und militärisch sinnlose Widerstand, den verzweifelte HJ-Angehörige den einrückenden Alliierten in Deutschland entgegensetzten, nährte die Vorbehalte für die Zukunft; ebenso die erwähnten Terrorund der Sabotageakte. Zu Recht musste man sich fragen, wie mit einer solchen Jugend umgegangen werden sollte. Hinzu kam die Not der unmittelbaren Nachkriegszeit, die katastrophale Versorgungslage und, damit zusammenhängend, die ansteigende Jugendkriminalität. Norman Himes, ein Soziologe und Mitarbeiter der US-amerikanischen Militärregierung in Schul- und Erziehungsangelegenheiten, meinte im März 1947: Man werde sich auf die Suche nach einem „kreativen Ersatz für die Hitlerjugend“ begeben müssen – womit gemeint war, dass man an den „Geist junger Menschen“ herankommen müsse, um sie zur Demokratie zu erziehen.6 Doch der beste Ersatz für die Hitlerjugend war, dass es einer Nachfolgerin nicht bedurfte. In den westlichen Besatzungszonen wurde das jugendliche Leben erstaunlich rasch wieder geöffnet. In Bremen, um ein Beispiel zu nennen, waren Anfang April 1948 bereits 36 Organisationen mit rund 8 700 weiblichen und 14 300 männlichen Mitgliedern wieder zugelassen. Mit weitem Abstand rangierte hier die Gewerkschaftsjugend an der Spitze, gefolgt von evangelischen und katholischen Vereinen. Alle Gruppen, die zuvor in die Illegalität gedrängt und verfolgt worden waren, lebten auf: Kinderfreunde, Falken, Pfadfinder und diverse Jugendbünde. Sogar die Swing-Jugend besaß 4
5
6
Zu diesem Beispiel vgl. den Artikel Gericht über die Terrorgruppe „Schwarze Hand“. In: Neues Deutschland vom 17.9.1946. Vgl. im Zusammenhang Andreas Weigelt, Fallgruppenübersicht und Erschließungsregister. Leitfaden für die biographische Dokumentation. In: Ders./Klaus-Dieter Müller/Thomas Schaarschmidt/Mike Schmeitzner (Hg.), Todesurteile sowjetischer Militärtribunale gegen Deutsche. Eine historisch-biographische Studie, Göttingen 2015, S. 159–416. Vgl. Peter Lieb, Konventioneller Krieg oder Weltanschauungskrieg? Kriegführung und Partisanenbekämpfung in Frankreich 1943/44, München 2007, S. 114; Jens Westemeier, Himmlers Krieger. Joachim Peiper und die Waffen-SS in Kriegs- und Nachkriegszeit, 2. Auflage Paderborn 1998, S. 299 f. Zit. und übersetzt nach Battle of the German Mind. In: Military government (Hg.), Weekly information bulletin, (1947) 86, S. 23 f., hier 24.
Bilanz
411
in Bremen nun einen offiziell registrierten Verein mit immerhin 51 Personen.7 Regionale Besonderheiten, welche die RJF in den 1930er-Jahren einzuebnen bemüht gewesen war, kamen rasch erneut zur Geltung. In Bayern waren Ende 1947 rund 40 Prozent der Organisierten in katholischen Vereinen aktiv, gefolgt von Turn- und Sportvereinen sowie – mit 12 Prozent – der linken Gewerkschaftsjugend.8 Die Zahl der organisierten jungen Menschen stieg bis Anfang 1948 auf 1,2 Millionen allein in der US-amerikanischen Zone. Rund 10 000 Vereine, Organisationen und Gruppen waren dort wieder aktiv.9 Um den Wiederaufbau der Jugendarbeit zu unterstützen, hatte man im US-amerikanischen Sektor im August 1946 eine Jugendamnestie verfügt. Diese Amnestie, die in anderen Besatzungszonen ihr Pendant fand, machte möglich, dass ehemalige Unterführerinnen und -führer der Hitlerjugend wieder in der Jugendarbeit aktiv werden konnten. Die Besatzer gingen damit ein Risiko ein, setzten aber darauf, dass es sich mittelfristig auszahlen würde.10 Himes warnte, dass es damit aber nicht getan sei. Die Hitlerjugend habe den Idealismus, der jungen Menschen eigen sei, für inhumane und falsche Zwecke missbraucht. Die Massenorganisation habe gleichwohl ein starkes Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl erzeugen können. Es sei daher nicht ausreichend, den Wiederaufbau allein materiell und finanziell zu fördern. Vielmehr müsse das Verständnis für Demokratie, Freiheit, Pluralismus und Minderheitenschutz geweckt werden. Die Führer der Jugend und ihre neuen Vereine seien ideell zu begleiten, der Anteil der Frauen zu erhöhen, die Arbeit der Gewerkschaften zu unterstützen, Kontakte ins Ausland zu ermöglichen und geeignete Jugendliteratur aus der westlichen Welt ins Deutsche zu übersetzen.11 Verschiedene Ideen wurden entworfen, von denen manche im Kontext der Nachkriegsnot nur schwer umsetzbar waren, die aber konzeptionell einen Weg wiesen – wie jene auf dem Land angesiedelten Kinderdörfer, die der jüdische Psychologe Curt Bondy 1946 empfahl und die gewissermaßen als Schutzrefugien für liberal-demokratische Erziehung und jugendliche Selbstverwaltung ebenso wie zur vorbeugenden Bekämpfung der Jugendkriminalität dienen sollten.12 Das alles könne man nicht gleich und über Nacht erreichen, meinte der in der US-Militärregierung für Erziehung und Kultur verantwortliche Alonzo G. Grace 1949. Allerdings gewinne er doch mehr und mehr den Eindruck, dass ein Großteil 7 Vgl. Membership of 36 Youth Organizations in the City of Bremen (1.4.1948) In: Office of Military Government. Education and Cultural Relations Division (Hg.), German youth between yesterday and tomorrow, Berlin 1948, S. 36. 8 Vgl. Distribution of Youth Groups in Bavaria by type as of 31 December 1947. In: ebd., S. 40. 9 Vgl. German Youth Organizations. In: ebd., S. 11. 10 Vgl. Headquarters United States Army (Hg.), The U. S. armed forces German youth activities program 1945–1955, Wiesbaden 1965, S. 13. 11 Vgl. Norman E. Himes, Re-educating German Youth. In: Military government (Hg.), Weekly information bulletin, (1947) 96, S. 9–12. 12 Vgl. Curt Bondy, The Youth Village: A Plan for the Reeducation of the Uprooted. In: The Journal of Criminal Law and Criminology, 38 (1946) 1, S. 49–57.
412
Bilanz
der jungen Menschen – trotz der Hitler-Zeit – nunmehr bereit sei, einen Beitrag zum moralischen Wiederaufbau zu leisten.13 Während den Jugendverbänden langsam neues Leben eingehaucht wurde, wuchs zeitgleich der Mythos von der allumfassenden Hitlerjugend heran. Je mehr die Vergangenheit in Misskredit geriet, die Verbrechen ans Tageslicht gebracht und der moralische Irrweg der NS-Gesellschaft sichtbar wurde, desto mächtiger schien die Hitlerjugend im Rückblick zu werden. Die Metaphern und Begriffe sind in die kollektive Erinnerung tief eingebrannt, auf Buchtiteln und Covern zu finden, werden in Fernsehdokumentationen und Spielfilmen auf je eigene Weise aufgegriffen: Man spricht von einer Jugend im Gleichschritt, der gleichgeschalteten Generation, und sieht Verführte, in Reih und Glied braun Uniformierte, dem Regime willig ergebene, indoktrinierte junge Menschen. Die Propaganda des Regimes wurde mitunter fortgeschrieben. Erst in den letzten Jahren haben zeithistorische Ausstellungen sowie historisch-politische Bildungsprojekte verhalten ein Fragezeichen hinter die bekannten Überschriften gesetzt. Dem Hitlerjugendmythos lag ein verbreitetes Bedürfnis wie auch ein psychologisches Motiv zugrunde. Je monumentaler und größer sie wurde, desto kleiner war man ja selbst gewesen. Je mehr sie den Alltag beherrschte, desto weniger schien es wahrscheinlich, dass man ihr hätte entweichen können. Je mehr ihrer Verführungskraft ebenfalls anheimgefallen waren, desto normaler wurde das eigene Handeln und Denken. Eva Sternheim-Peters autobiografische Reflexionen wurden 2016 unter dem Titel „Habe ich denn allein gejubelt?“ erneut aufgelegt. Der Titel war eine rhetorische Frage, die Antwort naheliegend: Gejubelt hatten Millionen. Die Claqueure des Regimes waren nicht allein gewesen, und bis zuletzt trugen sie Mitverantwortung, dass das Unrecht und die Verbrechen möglich wurden. Andere nahmen die Hybris der 1930er-Jahre und das Lob auf Fleiß und Disziplin nach 1945 mit in die beginnende Wirtschaftswunderzeit des Westens: Tüchtigkeit, Kameradschaft und Pflichterfüllung habe man in der Hitlerjugend gelernt, heißt es in solchen Erzählungen, und davon habe auch die Bundesrepublik noch lange profitiert. Dem Kollektiv kommt zugleich eine entlastende Funktion zu. Es verdeckt die individuellen Handlungsoptionen, alternative Entscheidungen und gegensätzliche Lebenswege. Jene – und keinesfalls eine verschwindende Minderheit – geraten aus dem Blick, die sich nicht begeistert eingereiht hatten. Das vorliegende Buch hat eine andere Geschichte der Hitlerjugend in den Vordergrund gerückt. Hier wurde der Versuch unternommen, jene Menschen in die Geschichte der Organisation zurückzuholen, die mehr als eine willfährige
13 Vgl. Alonzo G. Grace, The Coming Generations. In: ebd., (1949) 166, S. 3 f. Vgl. im Zusammenhang auch Herbert B. Lupescu, Denazification. An inventory seven years after Potsdam, Madison 1953, S. 95: „The realization of this objective lies heavily with the generation who need no legal denazification at all: the German youth.“ Einen Wandel vom Vorbehalt zur Rehabilitierung streicht im Kapitel 4 heraus: Petra Goedde, GIs and Germans. Culture, Gender, and Foreign Relations 1945–1949, Yale 2003.
Bilanz
413
Bewegungsmasse gewesen sind. Desinteressierte, Karteileichen, willige und unwillige Mitläufer, Abweichler und an den Rand Gedrängte, politisch Verfolgte, aber eben auch junge Fanatiker, Korrupte, Randalierer und Gewalttäter sind gleichberechtigte Teile dieser Geschichte. Sie waren allesamt Angehörige einund derselben Staatsjugend, aber agierten je nach Ort, Zeit und Situation auf andere Weise. Wie war das möglich in einer totalitären Massenorganisation, die angeblich – mit perfider Strategie und Verführungskraft – junge Menschen lenkte und an sich band? Eine Reihe solcher Fragen hat am Anfang dieser Arbeit gestanden. Was für eine Art von Organisation war die Hitlerjugend gewesen: radikale Jugendbewegung oder Apparat, Partei- oder Staatsjugendorganisation? Die vier Begriffe haben alle ihren Sinn. Die Hitlerjugend durchlief im Verlauf der 1930er-Jahre einen gewaltigen Wandlungsprozess, der aber nicht intendiert oder vorgezeichnet war. Eine radikalisierte Jugendbewegung, die Anfang der 1930er-Jahre vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise erheblich Zulauf – nicht nur aus dem völkisch-nationalen Spektrum – gefunden hatte, wuchs 1933 innerhalb weniger Monate zur Millionenorganisation. Ein großer Teil der deutschen Jungen und Mädchen strömte begeistert, von den Parolen der Hitler-Bewegung eingenommen und aus freien Stücken in die Parteijugend. Dieses gewaltige Wachstum der Hitlerjugend beruhte bei Weitem nicht nur auf der Zerschlagung ihrer Konkurrenz. Radikal in Anspruch und Auftreten, profitierte sie nach 1933 von der Desillusionierung junger Menschen, die sich von der vermeintlich alten Ordnung befreien wollten. Die Parteijugend, die anfangs den Charakter einer revolutionären Jugendbewegung aufwies, entwickelte sich im Verlauf der 1930er-Jahre zur Staatsjugend. Und dies nicht nur insofern, dass sie zunehmend – und Ende 1936 per Gesetz – institutionell in den Staat eingebaut wurde, sondern auch indem sie sich immer weiter bürokratisierte. Viele, die als „alte Kämpfer“ in den 1920er-Jahren zur Hitlerjugend gefunden hatten, musste dieser Prozess, wie gezeigt, erheblich schmerzen. Die Parteijugend sollte aus ihren Augen eine revolutionäre Bewegung sein und bleiben; eine Spannung, die sich nicht auflösen ließ. Dass die Hitlerjugend zur Staatsjugend wurde, haben Historikerinnen und Historiker als folgerichtig angesehen. Sie musste, sagt diese Interpretation, zwangsläufig zum totalitären Apparat werden, weil die Hitlerjugend eben in einen totalitären Staat eingebaut war, ihm diente, ihn stützte und die NS-Politik legitimierte. So richtig dies sein mag, so wenig befriedigt diese alleinige Deutung, denn die Institutionalisierung und Bürokratisierung der Hitlerjugend war eben nicht allein die Konsequenz ihres Totalitätsanspruchs, sondern zugleich Folge ihrer Defizite und Widersprüche. Am Ende stand das bürokratische Ungetüm, das mit hunderten Verhaltensvorschriften das Leben junger Menschen zu reglementieren versuchte – ein Apparat, der nicht vor brutaler Verfolgung der eigenen Mitglieder zurückschreckte und am Ende sogar Einrichtungen schuf, die auf eine Umerziehung junger Menschen oder deren sogenannte Aussonderung zielte.
414
Bilanz
Das wirft die zweite Frage auf: Welchen Einfluss auf das Denken, Handeln und die individuellen Lebenswege besaß sie wirklich? In der kollektiven Erinnerung ist sie als perfides Instrument der Indoktrination verankert, das, einmal mit ihr in Berührung gekommen, gewissermaßen den jungen Geist mit ideologischem Wahnsinn sogleich vergiftete. Ebenso wenig wie man ihren Einfluss negieren darf, sollte man ihn überschätzen. Das hat der Blick auf lokale Räume, Selbstzeugnisse wie Tagebücher und Briefe sowie Lebensgeschichten gezeigt. Die Alltagsrealität der Organisation unterschied sich je nach Ort, Milieu und den Beteiligten erheblich, gerade weil auf das jugendliche Selbstführungsprinzip – trotz aller Reglementierung – nie in Gänze verzichtet wurde. Der Alltag, die weltanschauliche Schulung, Aktivitäten und Attraktionen in der Hitlerjugend sind auch von Zeitzeugen sehr unterschiedlich geschildert worden. Man braucht den Blick nicht nur auf die Gruppe der jungen Abweichler zu richten, um die Durchdringungskraft der Hitlerjugend in Zweifel zu ziehen: Unter ihren Mitgliedern fand sich ein recht hoher Prozentsatz von Desinteressierten, Gelangweilten und Mitläufern, die sich – weil der erhebliche Anpassungsdruck sie hineingeführt hatte – scheinbar jeder Gelegenheiten bedienten, um ihr sogleich wieder zu entgehen. Unterführer, lokale Dienststellen und Sicherheitsorgane nannten verschiedene Zahlen: 20 oder gar 50 Prozent der jungen Mitglieder stünden nur auf dem Papier. Bis in die Kriegsjahre verfügte die RJF nicht über ein gesetzliches Instrumentarium, um junge Menschen zur Beteiligung zu zwingen. Man blieb bemüht, die Dienstbeteiligung ohne eine Anwendung von Zwang herbeizuführen – weil die Hitlerjugend eine Freiwilligenbewegung, nicht einen Zwangsapparat darstellen sollte. Es gab Begeisterte ebenso wie Fanatiker ohne irgendeinen Zweifel. Der Anteil der Karteileichen und Passiven blieb bis zum Ende der 1930er-Jahre dennoch beachtlich. Erst als man ein Einsehen hatte, dass der Totalitätsanspruch des Regimes in einem unauflöslichen Widerspruch zum Freiwilligkeitsprinzip der Jugendorganisation stand, war die RJF ab 1939 bereit, mit der Jugenddienstpflicht die Konsequenz zu ziehen. Möglicherweise kommt man der Hitlerjugend und ihrer Bedeutung für die Diktatur näher, wenn man sie nicht zuerst als ein durch das Regime geschickt angewandtes und straff geführtes Herrschaftsinstrument begreift. Sie war ein volatiles Gehäuse, das Handlungsoptionen für Individuen und Gruppen eröffnete. Handlungen von jungen Menschen in der Hitlerjugend deckten sich durchaus nicht immer mit Anweisungen von oben. Die Hitlerjugend ermöglichte und förderte sogar Selbstermächtigung: Angriffe auf konfessionelle Jugendverbände wurden zwar mehrfach untersagt, fanden aber gleichwohl ständig statt. Die sogenannten Einzelaktionen gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger wurden der Hitlerjugend zwar verboten. Kam es jedoch zur Gewalt und zu Übergriffen auf jüdische Deutsche, wurde kaum oder nur unwillig dagegen vorgegangen. Die Unterführer bedrängten Bürgermeister und Lehrer, die sie für Gegner hielten, und schossen in ihrem Radikalismus immer wieder über jene Vorgaben hinaus, welche die regionalen Dienststellen oder die RJF für die Parteijugend formuliert hatten. Die Hitlerjugend als Jugendbewegung barg ein radikales Potenzial.
Bilanz
415
Sie konnte als ideologischer Verstärker für junge Menschen wirken, die sich der Freiheit zur Selbstermächtigung bedienten. Aber die Handlungsräume, welche die Parteijugend zahlreich schuf, gerade weil sie einen prekären Rahmen darstellte, wurden auch anderweitig eigensinnig genutzt: Während ehemalige Gegner nach 1933 im Rahmen der wachsenden Hitlerjugend Unterschlupf suchten, um unbehelligt zu bleiben, bedienten sich ihr wiederum andere zur persönlichen Bereicherung. Korruption, Diebstahl und Unterschlagung waren keine Seltenheit. Andere lebten ihre Machtgefühle aus – gegen Jüngere oder angebliche Gegner – und zogen ihre neue Weltanschauung als Rechtfertigung heran. Die verschiedenen Probleme wuchsen, je mehr junge Menschen für die Parteijugend geworben wurden. Gegen undiszipliniertes, unerwünschtes oder illegales Verhalten versuchten die Dienststellen vorzugehen, da sie Eltern und Schulen nicht verschrecken wollten. Dieses reaktive Moment trug dazu bei, dass sich aus einer Jugendbewegung eine bürokratisierte Staatsjugend formierte. Ihr Zugriff auf den Einzelnen wurde dennoch nie totalitär in einem Sinne, dass für Individualität oder individuelle Verantwortung kein Raum mehr vorhanden gewesen wäre. Völlig abseits zu bleiben, wurde im Verlauf der 1930er-Jahre zwar immer schwieriger. Massive Konsequenzen für den weiteren Lebensweg waren zu fürchten. Dass durch sie aber alle Kinder und Jugendlichen gleichermaßen eingenommen oder verführt worden sind, ist eine Legende, die gerade jene zum Selbstschutz formulierten, die nach 1945 Lebensläufe und eigene Verblendung zu rechtfertigen versuchten. Sogenannte Kriminelle, Abweichler und Verwahrloste, die innerhalb der Hitlerjugend verfolgt worden waren, besaßen nach 1945 zudem kaum Möglichkeiten, ihre anders gelagerten Erfahrungen zu artikulieren. Die Masse der jungen Mitläufer, die den Alltag in der Hitlerjugend als Notwendigkeit hinnahmen, blieb stumm oder wurde nur unzureichend befragt. Artur Axmann schätzte die Zahl der Säumigen und derjenigen, die nicht im „Gleichklang“ mit dem Staat gewesen seien, für die Kriegsjahre auf etwa 20 Prozent.14 Möglicherweise waren es eher einige Prozentpunkte mehr als weniger. Ist das nun viel oder wenig? Beachtlich ist er in jedem Fall. Forschungen, welche die jugendlichen Sub- und Gegenkulturen intensiver als früher in den Blick nahmen, haben das geläufige Narrativ von der totalen Durchdringungskraft der Staatsjugend völlig zu Recht infrage gestellt. Die Hitlerjugend war ihrem Anspruch und ihrer Zielsetzung nach totalitär. Ihr Alltag ist aber nicht mit ihrer öffentlichen Inszenierung oder der Propagandakulisse des Reichsparteitags zu verwechseln. Die Lageberichte der Sicherheitsorgane ebenso wie die Exilpresse, nicht zuletzt Materialien aus dem Innendienst der Massenorganisation machten aus den zahlreichen Konflikten sowie vermeintlichen oder tatsächlichen Defiziten keinen Hehl: Manche, wie Übergriffe, Gewalt und Vandalismus waren real, andere, wie im Bereich der
14 Vgl. Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 375 f.
416
Bilanz
sogenannten sittlichen Verwahrlosung, dramatisiert. Reale und imaginierte Probleme schürten Vorbehalte, beeinflussten und radikalisierten das Handeln und die Konzepte der RJF. Dass die Jugend von Jugend geführt werden müsse, war eine der zentralen ideologischen Grundannahmen in der Hitlerjugend. Sie speiste sich mental aus der Jugendbewegung und aus der nationalsozialistischen „Kampfzeit“. Doch das Prinzip „Jugend wird von Jugend geführt“ kollidierte mit dem Herrschaftsanspruch des Regimes und warf Probleme auf. Im Gegensatz zum Freiwilligkeitsprinzip, das die RJF am Ende preiszugeben bereit war, ist – sofern möglich – auf Selbstführung der Basis nicht verzichtet worden. Man hielt sie bis in den Krieg aufrecht, weil sie ein Element der Attraktion beinhalten sollte. Ohne Selbstführung hätte die Hitlerjugend nach 1933 kaum derart rasant wachsen können und wäre sicher weniger erfolgreich gewesen. Manche Zeitzeugen haben retrospektiv geschildert, dass aus ihrer Sicht diese Organisation im Grunde fast demokratisch gewesen sei. Als Alltagserfahrung konnte das subjektiv richtig sein. Wo junge Führerinnen und Führer mit Charme, Raffinesse und Überzeugungskraft durch den Dienst leiteten, entfaltete die Parteijugend ihre Anziehungskraft. Dies war längst nicht überall der Fall. Mit einem totalen Herrschaftsanspruch war die Basisautonomie außerdem schwer in Einklang zu bringen. Dass Lücken nie völlig geschlossen wurden und es immer wieder einigen Menschen mit Erfolg gelang, der gesetzlichen Dienstpflicht und dem Zugriff zu entweichen, hatte viel mit diesem Selbstführungsprinzip zu tun. Der Blick auf lokale Räume und Schilderungen der Zeitzeugen unterstreicht, dass Handlungsoptionen für junge Menschen sehr wohl existierten. Sie konnten nicht jedem voll bewusst sein – einem Kind bei den Jungmädeln oder im Jungvolk weniger als einem älteren Jugendlichen innerhalb der HJ oder im BDM. Die Spielräume wurden im Verlauf der 1930er-Jahre zudem enger. Die Jugenddienstpflicht nach 1939 hatte je nach Ort, Einheit und Akteuren unterschiedliche Folgen für Kinder und Jugendliche: Kam es an einem Ort oder in einer Stadt zur polizeilichen Verfolgung, zu Verhören oder gar zum Arrest, existierte die Dienstpflicht an anderen Orten nur auf dem Papier. Jugendliche schwärzten ihre Kameradinnen und Kameraden an; oder sie taten das Gegenteil. Lücken ließen sich finden, Freundschaften zum Vorteil nutzen. Die Dienstpflicht mündete somit in ein Willkürsystem, in dem Jugendliche – bewusst oder unbewusst – oft über das Schicksal Gleichaltriger verfügten. Ohne die perfide Beteiligung junger Menschen hätte der Apparat der Staatsjugend nicht funktioniert; und wo er tatsächlich nicht funktionierte, hatten junge Menschen Anweisungen missachtet. Der Charakter des Dienstes variierte im Alltag der Formationen erheblich. Manche Einheitenführer trugen weltanschauliche Inhalte an die Jüngeren aggressiv weiter. Andere nutzten die ideologischen Materialien, die ihnen zur Verfügung gestellt wurden, kaum oder gar nicht. Klagen darüber, dass der Dienst nicht ordnungsgemäß stattfinde, wurden bis in die Kriegsjahre von höheren Stellen immer wieder vorgebracht. Damit soll nicht gesagt sein, dass junge Menschen in der Diktatur nicht ideologisch beeinflusst und im Sinne des Regimes sozialisiert worden wären. Zu selbstbewussten Kritikern wuchsen natürlich die wenigsten
Bilanz
417
heran. Im Geflecht der verschiedenen Sozialisationsinstanzen – Schule, Elternhaus, soziales Milieu, Freundeskreis, Betrieb oder eben Staatsjugend – spielte die Massenorganisation aber nicht jene absolut entscheidende Rolle, die ihr beharrlich zugeschrieben wurde. Die Perspektive auf solche Handlungsoptionen – darin mag ein Gewinn auch für die politische Bildungsarbeit liegen – unterstreicht die individuelle Verantwortung, die auch ein totalitäres System nicht völlig außer Kraft setzen kann. Die Propaganda einer totalitären Diktatur ist nicht mit ihrer gesellschaftlichen Wirklichkeit gleichzusetzen. Zur Repression und staatlichen Gewalt, gerade auch gegen eigene Mitglieder, griffen die Funktionäre deshalb, weil die Utopie einer homogenen, der Führung ergebenen, opferbereiten Jugend durch die alltägliche Wirklichkeit jugendlichen Lebens dauernd herausgefordert wurde. Die Ideale der Bewegung verkamen immer mehr zu inhaltsleeren Phrasen. Indem man zu repressiven Instrumenten griff, um junge Menschen zu disziplinieren, förderte man zum Teil erst jene Abwehr, die man zu bekämpfen vorgab. Das Aufblühen jugendlicher Subkulturen während des Krieges ist damit zu erklären. Üblicherweise wird ein Gegensatz aufgemacht: Die Hitlerjugend steht auf der einen Seite und ihre Gegner auf der anderen. Ein Anliegen dieser Studie war es, die Dichotomie aufzubrechen. Die Staatsjugend einerseits und die Abweichler andererseits standen in enger Wechselbeziehung. Viele der politisch Verfolgten oder als „Asoziale“ Gebrandmarkten gehörten der Hitlerjugend formal an. Aber sie wehrten sich gegen deren wachsende Inanspruchnahme. Die Generalstaatsanwaltschaft von Frankfurt am Main schrieb Mitte 1943, dass ein in „wachsendem Maße“ jugendliches „Rowdytum“ festzustellen sei: „Offenbar ist unbändiger Freiheitsdrang als Triebfeder anzusehen“, urteilte man über die Beteiligten.15 Die jugendliche Rebellion, die Verweigerung und der Protest gehören in die Geschichte der Hitlerjugend unbedingt hinein. Die große Mehrheit der jungen Menschen hatte nach 1945 mit der erlernten Ideologie und einer fraglich gewordenen Erziehung zu kämpfen. Andere, die mit der Staatsjugend aufwuchsen, gelang die Abnabelung demgegenüber verblüffend leicht. „Alles, was jetzt an den Tag kommt, was wir Deutschen verbrochen haben, ist so unsäglich entsetzlich und nicht vorstellbar, dass man es nicht glauben will“, schrieb die 17-jährige Kölnerin Ursula Lindemann in einem Brief im Sommer 1945 an eine Freundin: Aber „es ist wahr und das kann man nie wiedergutmachen. Das wird uns immer belasten und man schämt sich Deutscher zu sein.“16 Die Rückgewinnung der Zehn- bis Zwanzigjährigen, die während des Krieges durch die Hitlerjugend gegangen waren, sahen die US-Amerikaner als eine ihrer vordringlichen Aufgaben an. Davon schien der Erfolg oder Misserfolg aller Bemühungen um die „Reeducation“ der deutschen Gesellschaft
15 Der Generalstaatsanwalt Frankfurt a. M. vom 3.6.1943. In: Klein (Hg.), Lageberichte der Justiz aus Hessen, S. 250–253, hier 251. 16 Ursula Lindemann, Brief an eine Freundin vom 9.7.1945 (NSDOK Köln, EzG, jugend 1918–1945.de; 27.10.2020).
418
Bilanz
sowie die Stabilisierung der Nachkriegsordnung wesentlich abzuhängen.17 Die Bemühungen um Entnazifizierung rief unter jungen Menschen in etlichen Fällen durchaus Abwehr hervor. Verantwortung wurde, wie in der Gesellschaft insgesamt, häufig allein der Staatsführung zugeschoben, eigene Beteiligung abgewiesen oder abgestritten. In der Nachkriegszeit angefertigte Schüleraufsätze zeugen auf der einen Seite vom konfliktträchtigen Bewältigungsprozess, dem früh Verleugnung eigen war. Auf der anderen Seite zeigen diese Texte, dass sich kaum ein Jugendlicher mit der verschwundenen Parteijugend und ihren Prämissen noch in Gänze identifizierte.18 Umfragen aus der frühen Nachkriegszeit deuten an, dass die Zustimmung zum NS-Staat bei den Jüngeren zudem weit höher ausfiel als bei älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen.19 Die Westalliierten und die US-Militäradministration begannen schon vor der Gründung der Bundesrepublik eine Korrektur jenes Bildes, das sie im Krieg gezeichnet hatten. Junge Menschen hätten, so Lucius D. Clay in einem Interview 1946, die Hitlerjugend wegen der Freizeitangebote genutzt. Für Drill und Schulung habe sich kaum jemand begeistert.20 Die Besatzer gelangten nicht ohne Kalkül zu verhaltenen, aber erstaunlich positiven Einschätzungen. Die britische Besatzungsmacht betraute sogenannte Jugendoffiziere mit dem Aufbau eines Freizeit- und Kulturangebots, das Gymnasiasten und Studenten anvisierte.21 Im amerikanischen Sektor bemühte man sich im Mai 1946 um ein genaueres Lagebild und die Erhebung erster Ergebnisse. 134 junge Personen, überwiegend aus bürgerlichem Milieu, die bei Kriegsende im Hitlerjugendalter gewesen waren, ließ man mehrseitige Essays schreiben. Rund 50 Personen musste man aufgrund ihrer Aussagen als Nationalsozialisten einstufen. 24 Schüler hatten nationalistische oder chauvinistische Ansichten geäußert, ohne sich zum Nationalsozialismus zu bekennen. 16 wurden als Sozialisten, zwei weitere als Kommunisten eingestuft. 24 Personen legten ein klares Bekenntnis zur Demokratie vor. Die Kinder hätten, zog man Bilanz, insgesamt kaum Feindseligkeit gegenüber der Besatzung geäußert. Die Jüngeren um 14 Jahre würden optimistischer in die Zukunft blicken als die 16-Jährigen.22
17 Vgl. beispielsweise Susanne Charlotte Engelmann, German Education and Re-Education, New York 1945, S. 138 f. 18 Vgl. Beate Müller, „Es war nicht richtig, daß Hitler die Juden ausstieß“. Judenverfolgung im Spiegel Nürnberger Schüleraufsätze von 1946. In: Francesca Weil/André Postert/ Alfons Kenkmann (Hg.), Kindheiten im Zweiten Weltkrieg, Halle 2018, S. 318–336. 19 Vgl. Erwin K. Scheuch, Der Umbruch nach 1945 im Spiegel der Umfragen. In: Ute Gerhardt/Ekkehard Mochmann (Hg.), Gesellschaftlicher Umbruch 1945–1990. Re-Demokratisierung und Lebensverhältnisse, München 1992, S. 9–26, hier 11. 20 Vgl. Interview unter dem Titel „Fanatical“ Nazi Youth secretly laughed at Hitler. In: Stars and Stripes. Southern Germany vom 24.4.1946. 21 Vgl. auch Kater, Hitler Youth, S. 250–265. 22 Vgl. Youth – The Big Problem in Germany. In: Military government (Hg.), Weekly Information Bulletin, (1946) 40, S. 12–14.
Bilanz
419
Man sah Gründe, um skeptisch zu bleiben, aber strich zugleich die Lichtblicke heraus. Robert C. Hall, verantwortlich für die Jugend im amerikanischen Sektor, beklagte Ende 1948 den angeblichen Unwillen junger Menschen, sich in neu gegründeten Organisationen zu betätigen. Seinen Eindruck, den die Zahlen allerdings nur bedingt unterfütterten, wendete er sofort ins Positive. Die jungen Leute hätten die Hitlerjugend noch zu gut vor Augen; sie blieben bewusst auf Abstand, weil sie ihre Lehren gezogen hätten.23 Gewiss darf und sollte man kein Wunschbild malen. Frühere Funktionäre wie Artur Axmann oder Jutta Rüdiger gingen nach 1945 gleich daran, eine Apologie der Hitlerjugenderziehung zu entwickeln. Viele, die ihre Kindheitserinnerungen nicht hinterfragen wollten, nahmen die Apologien bereitwillig an. Die 1950 in Westdeutschland gegründete Reichsjugend, Vorläuferin der später ebenfalls verbotenen Wiking-Jugend, stellte sich in die rechtsextreme Tradition der Hitlerjugend und der NS-Zeit. Zur bedeutenden Größe wurde sie nicht. Die Uneinsichtigen bildeten nicht die Mehrheit ab. Es war die „HJ-Generation“, die ihre Lehren zog und im Westen die Demokratie festigen half, trotz aller Konflikte.24 Vollends drehte sich das Bild, das sich die britische und amerikanische Besatzungsmacht von der vermeintlich indoktrinierten deutschen Jugend machte, etwa am Anfang der 1950er-Jahre.25 Eine US-amerikanische Broschüre mit dem Titel „Young Germany“ von 1951 sparte Problematisches nicht aus. Auf die prekäre ökonomische Lebenssituation derjenigen jungen Deutschen wurde hingewiesen, denen der Krieg eine ordentliche berufliche oder schulische Ausbildung geraubt hatte. Doch eine Wiederbelebung der NS-Ideologie wurde nicht mehr befürchtet. Stattdessen malte man im beginnenden Kalten Krieg die Gefahr des Kommunismus an die Wand. Von der Hitlerjugend war nun kaum mehr die Rede.26 Drohend konnte man zugleich auf die Entwicklungen im Osten hinweisen. Dort schien mit der Freien Deutschen Jugend (FDJ) eine kommunistische Jugendorganisation die Nachfolge der Hitlerjugend anzustreben. Dort gebe es, hieß es, genau wie in der NS-Zeit kaum eine andere Wahl, als dieser neuen Monopolorganisation beizutreten.27 Die FDJ sei, agitierte man früh aus dem Westen, eine „schäbige Wiederbelebung der Hitlerjugend mit kommunistischen Parolen und kommunistischen Helden“.28 Damit tat man ihrem Ursprung und dem Idealismus ihrer Gründer erheblich Unrecht, aber nahm doch vorausschauend ihre Entwicklung vorweg. 23 Vgl. Robert C. Hall, Armed Forces Assistance to German Youth Activities. In: Information bulletin. Magazine of US military government in Germany, (1948) 149, S. 19. 24 Vgl. Elizabeth Fox, Rebuilding Germany’s Children: The Nazi Indoctrination and Postwar Reeducation of the Hitler Youth. In: Furman Humanities Review, 27 (2016), S. 31–59. 25 Vgl. auch Köster, Westfalen zwischen Kaiserreich und Bundesrepublik, S. 430–440. 26 Vgl. United States. Dept. of State. Bureau of Public Affairs (Hg.), Young Germany. Apprentice to democracy, S. 1–6 und S. 76–78. 27 Vgl. Youth under Communism. In: Office of the US High Commissioner for Germany Office of Public Affairs (Hg.), Information bulletin, (1950) 5, S. 21–24, hier 21. 28 Hayned Mahoney, New Accent on Youth. In: Information bulletin, November 1950, S. 3.
420
Bilanz
In der Tat sollte es zu denken geben, wie rasch im Osten die Transformation von einer Partei- und Staatsjugend in die nächste gelang. Es sei ein Leichtes gewesen, urteilte Gösta Eriksson, die „von der Nazibewegung enttäuschte Hitlerjugend für die Sache des Kommunismus zu gewinnen“.29 Nicht nur äußerlich – mit Uniformen, Fahnen- und Fackelparaden – glich sie ihrer Vorgängerin zum Verwechseln. Man hatte oft Gebäude und Inventar der Hitlerjugend übernommen. Selbst personell und konzeptionell ließen sich Kontinuitäten ausmachen. Das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ brachte im März 1951 eine lange Reportage, welche die FDJ in die Tradition der Hitlerjugend stellte. Anlass bildete ein Treffen ehemaliger HJ-Führer aus Westdeutschland mit FDJ-Funktionären in Berlin. Es hatte am 30. Januar 1951 mit Billigung der DDR-Führung stattgefunden. Margot Honecker, Sekretärin des FDJ-Zentralrats, verbuchte den Westbesuch als Erfolg. Die einstigen HJ-Führer – u. a. Wilhelm Jurzek, früher Oberbannführer aus Hamburg, der das Treffen angeleitet hatte – seien von der neuen DDR-Jugendarbeit angetan gewesen.30 Die Fühlungnahme resultierte aus Bemühungen um Kontaktaufbau im Westen. Dort allerdings diente das Treffen eher als Beweis für die Doppelmoral des DDR-Antifaschismus. Biografien schienen die Kontinuitäten zu unterstreichen: Sonja Klinsch, früher Kulturreferentin der RJF, arbeitete nun in gleicher Funktion bei der FDJ; Dieter Schmotz, früher ein HJ-Stammführer, hatte sich in den FDJ-Zentralrat ebenfalls hochgearbeitet.31 Das „Berliner Treffen“ blieb eine Episode im beginnenden Kalten Krieg. Es ist eine Episode, die sich ähnlich zu jener im Westen lesen lässt – wenn auch unter anderen Vorzeichen. Jungen und Mädchen, die mit der Hitlerjugend aufgewachsen waren, setzten im Osten unter den neuen Fahnen von FDJ und bei den Pionieren fort, was sie im „Dritten Reich“ attraktiv gefunden hatten. Gisela P., die in der HJ-Gebietsspielschar in Dresden aktiv gewesen war, erinnerte sich Jahrzehnte später. Der Übertritt zur FDJ sei ihr nicht schwergefallen. Hier wie dort habe sie ja praktisch fast dasselbe getan. Um den Antifaschismus, wie sie im Rückblick unterstrich, sei es ihr und anderen ernst gewesen. Ihr privates, ausgeschmücktes Fotoalbum zeigt verblüffend, wie aus einem 14-jährigen BDM-Mädchen in Uniform in nur wenigen Wochen das FDJ-Mitglied wurde, das inmitten
29 Gösta A. Eriksson, DDR, Stasi und Schweden, Berlin 2003, S. 35. 30 Vgl. Michael Lemke, Einheit oder Sozialismus? Die Deutschlandpolitik der SED 1949– 1961, Köln 2001, S. 138. Vgl. auch Wilhelm Jurzek, Von der Hitlerjugend zum „Berliner Gespräch“. Meine Erinnerungen als Politologe und Zeitzeuge. In: Franz-Werner Kersting (Hg.), Jugend vor einer Welt in Trümmern. Erfahrungen und Verhältnisse der Jugend zwischen Hitler- und Nachkriegsdeutschland, Weinheim 1998, S. 151–160 sowie im Kontext Michael Buddrus, Das „Berliner Gespräch“ 1951. In: ebd., S. 161–190. 31 Das Gute übernommen. In: Der Spiegel, (1951) 13, S. 6–8 . Im größeren Kontext: Peter Skyba, Die FDJ im Kreislauf von Krise und Reform. Jugendpolitik als Konfliktfeld von Herrschaft und Gesellschaft in der DDR. In: Totalitarismus und Demokratie, 12 (2015) 2, S. 269–287; ders., Vom Hoffnungsträger zum Sicherheitsrisiko. Jugend in der DDR und Jugendpolitik der SED 1949–1961, Köln 2000; Ulrich Mählert, Die Freie Deutsche Jugend 1945–1949, Paderborn 1995.
Bilanz
421
von Dresdner Trümmerruinen strahlend rote Fahnen schwenkte. Aus der „Jugendgenossin“ wurde nunmehr die „Jugendfreundin“ der FDJ.32 Wie war das möglich, mag man sich fragen, hatte die Hitlerjugend doch angeblich eine Generation im eisernen Griff ihrer Ideologie gefangen? Konrad Ziegler, geboren 1926, erinnerte sich ähnlich. „Ja, die gab’s ohne Frage. Das Grundprinzip war gleich“, so über die Parallelen zwischen den Organisationen: „Meine Arbeit erstreckte sich auf kulturellem Gebiet. Wir haben dort keine politische Arbeit geleistet, sondern haben sehr schöne Programme erarbeitet.“33 Eine Studie, welche die rasante Transformation nach 1945 genauer in den Blick nimmt und einen Vergleich zwischen beiden Organisationen wagt, steht noch aus. Möglicherweise käme sie aus einem anderen Blickwinkel zu einem ähnlich skeptischen Urteil über den vermeintlich unausweichlichen Einfluss der totalitären Jugendorganisationen auf junge und heranwachsende Menschen. Durch die Hitlerjugend ging eine Generation. Aber was soll das eigentlich heißen? Die Massenorganisation beinhaltet Lebensgeschichten über Verblendung ebenso wie radikale Selbstermächtigung, Geschichten über Fanatismus, Gewalt, fiebrigen Hass und individuelle Verirrungen. Aber sie enthält ebenso die Geschichten der Drückeberger und Gelangweilten, tragische, manchmal überraschende und sogar ermutigende Biografien, die von Verfolgung, Repression und Freiheitsdrang berichten. Eine uniforme Jugend war die Hitlerjugend zu keinem Zeitpunkt gewesen und ihre kolossale Propaganda nicht ihre soziale Alltagswirklichkeit. Nie, ja nicht einmal zuletzt, hatte sie tatsächlich alle jungen Menschen unterschiedslos erfasst oder sich gefügig machen können. Sie war kein eiserner Käfig, aus dem die Flucht nicht möglich gewesen wäre.
32 Interview von André Postert mit Gisela P. vom 18.11.2014 und Materialien (Archiv des HAIT). 33 Interview mit Konrad Ziegler. In: Werkstatt für Schulgeschichte Leipzig (Hg.), Kinder in Uniform, S. 138–161, hier 158.
Anhang 1. Abkürzungsverzeichnis A. k. Armeekorps Barch Bundesarchiv BB Befehlsblätter BBC British Broadcasting Corporation Bund Deutscher Mädel BDM betr. betreffend BK Bekennende Kirche ChdDtPol Chef der Deutschen Polizei DC Deutsche Christen DDR Deutsche Demokratische Republik DHM Deutsches Historisches Museum DHV Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband DJ Deutsches Jungvolk dj. 1.11 Deutsche Jungenschaft vom 1. November 1929 DJH Deutsche Jugendherbergen DNB Deutsche Nationalbibliothek DNVP Deutschnationale Volkspartei DT Deutsche Turnerschaft ev. evangelisch evang. evangelisch evg. evangelisch EzG Editionen zur Geschichte FDJ Freie Deutsche Jugend GB Gebietsbefehl GDB Großdeutscher Bund Gestapa Geheimes Staatspolizeiamt Gestapo Geheime Staatspolizei gez. gezeichnet GLA Generallandesarchiv HJ Hitlerjugend HJL HJ-Leistungsabzeichen IfZ Institut für Zeitgeschichte IWM Imperial War Museum JFdDtR Jugendführer des Deutschen Reiches Jg. Jahrgang Jgg. Jugendgenossen JMB Jungmädelbund K- KriegsKJMV Katholischer Jungmännerverband KJVD Kommunistischer Jugendverband Deutschlands KK. Kleinkaliber KLV Kinderlandverschickung kom. kommissarisch
424
Anhang
KPD Kommunistische Partei Deutschlands KreisA Kreisarchiv KZ Konzentrationslager LA NRW Landesarchiv Nordrhein-Westfalen LHA Landeshauptarchiv LHASA Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt LKA Landeskirchenamt luth. lutherisch m Meter MBliv. Ministerialblatt für die preußische Innere Verwaltung NAPOLA Nationalpolitische Erziehungsanstalten NARA National Archives and Records Administration ND Neues Deutschland NS Nationalsozialismus, nationalsozialistisch NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSDOK NS-Dokumentationszentrum NSKK Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps NSLB Nationalsozialistischer Lehrerbund NSV Nationalsozialistischer Volkswohlfahrt Pg. Parteigenosse RAD Reichsarbeitsdienst RBWK Reichsberufswettkampf RddJ Reichsausschuss der deutschen Jugendverbände RdErl. Runderlass RFdDR Reichsführer des Deutschen Reiches RFSS Reichsführer SS RGBl. Reichsgesetzblatt RJF Reichsjugendführung RM Reichsmark RMBliV Reichsministerialblatt der inneren Verwaltung RMdI Reichsministerium des Innern RMdJ Reichsministerium der Justiz Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und RMfWEV Volksbildung SA Sturmabteilung SAJ Sozialistische Arbeiterjugend SD Sicherheitsdienst SHAEF Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands SRD HJ-Streifendienst SS Schutzstaffel StA Staatsarchiv StadtA Stadtarchiv stat. statistisch Universum-Film Aktiengesellschaft Ufa/UfA USHMM United States Holocaust Memorial Museum VfZ Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte VOBl. Verordnungsblatt
Abkürzungsverzeichnis WE Wehrertüchtigung WEL Wehrertüchtigungslager WS Weltanschauliche Schulung württ. württembergisch z. H. zu Händen
425
Quellenverzeichnis
427
2. Quellenverzeichnis Archivmaterial Archiv des IfZ München, ZS 3058, 1 (Dr. jur. Waldemar Epp); 244, 52 (Gotthart Ammerlahn); 2492, 1 (Hans K. Kötting). Archiv des Landschaftsverbandes Rheinland, 14130 (Landesjugendamt, Fürsorgeerziehung). Archiv des HAIT, Nachlässe und Digitalisate aus Privatbesitz. Archiv des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln, verschiedene Nachlässe und Digitalisate aus Privatbesitz („Editionen der Geschichte“, https:// jugend1918-1945.de/portal/ARCHIV/). BArch, R58 (Reichssicherheitshauptamt), 3731, 3731, 3733, 3751 und 3885; R1507 (Reichskommissar für Überwachung der öffentlichen Ordnung), 2072; R72 (Stahlhelm), 1891, 1892, 479, 481, 1 und 482, 2; Research (ehemals BDC, 377, 1) O. 377, I; NS 26 (Hauptarchiv der NSDAP), 359; R22 (Reichsjustizministerium), 1165. BArch Berlin, Bildarchiv. DHM, Lebendiges Museum Online (Zeitzeugenberichte, https://www.dhm.de/ lemo/zeitzeugen/). GLA Karlsruhe, 465c (Document Center), 23587; 235 (Badisches Kultusministerium), 35688; 240 (Oberlandesgericht Karlsruhe), 1987-53, 689. HStA Dresden, 10789 (Polizeipräsidium Dresden), 722; 10736 (Ministerium des Innern), 22522; 11125 (Ministerium des Kultus und öffentlichen Unterrichts), 23138; 11065 (Amtsgericht Königstein), 329; 11120 (Staatsanwaltschaft beim Landgericht Dresden), 580; 10756 (Amtshauptmannschaft Freiberg), 6087; 13859 (Reichsstatthalter), 8437; 10822 (Heilanstalt Großschweidnitz), 9675. HStA Düsseldorf, RW 18 (Außendienststellen der Stapoleitstelle Düsseldorf), 26, 2. HStA Hannover, Hann. 130 (Höhere Lehranstalten für Jungen), 1070. HStA Stuttgart, E 151/09 (Württembergisches Innenministerium, Geschäftsteil IX: Wohlfahrtspflege), Bü. 169 und Bü 402; Q3/68 (ill. Bündische Jugend), Bü. 577. IWM Duxford, Captain Branney, Morale Documents (Digitalisate der Lageberichte im Archiv des HAIT). KreisA Pirna, Best. Gemeinde Lichtenhain, 109; Best. Gemeinde Hohenstein, 50314, 227; Best. Gemeinde Hinterhermsdorf, 158. LA NRW, Abt. Ostwestfalen-Lippe, M1 I P (Regierung Minden, Polizeiwesen), 613; K 001 (Oberpräsidium Münster), 2. LHA (Landeshauptachiv) Koblenz, 403 (Oberpräsidium Rheinprovinz), 16775. LHA Sachsen-Anhalt, Abtl. DE, Z 141 (Kreisdirektion Dessau-Köthen), 651, 652 und 653; KD ZE (Kreisdirektion Zerbst), 125; KB BBG (Kreisbehörden Bernburg), 347, 224, 1487 und 1494; Z 117-7 (Finanzdirektion Dessau), X Nr. 247. Leo Baeck Institute New York, ME 1527 (NL Gerhard Langer). LKA Dresden, 5 (Kirchenkampfsammlung), 274, 1 und 5, 274, 1 sowie 5, 274, 2; 36 (Kirchenkampfdokumentation der Bekennenden Ev.Luth. Kirche Sachsens), 66. LKA Stuttgart, K24 (Ev. Jugendwerk in Württemberg), 1255, 18 und 44; D 42 (Nachlass Otto Gruber). NARA, M1270 (Interrogation Records Prepared for War Crimes Proceedings at Nuernberg), 647749; M1946 (Records Concerning the Central Collecting
428
Anhang
Points), 129; T1021 (German documents predating May 8, 1945, found among the War Crimes Records of the U.S. Judge Advocate Division, Europe), 707, 19 und T1021, 581096, 549. StA Augsburg, Bezirksamt Kempten, 221, 1; HJ-Gebiet Schwaben, 56: SRD: Memmingen u. 44: SRD Bann Wertingen; HJ-Bann Günzburg 13. StA Chemnitz, 30071 (Zuchthaus Zwickau), 19804; 30049 (Amtshauptmannschaft Schwarzenberg), 1389. StA Freiburg, B719/1 (Landratsamt Lörrach), 5018; B719/1 (Bezirksamt Lörrach), 5018; B726/1 (Landratsamt Neustadt), 5569. StA Leipzig, 20192 (Bezirksschulamt Rochlitz), 0042, 01.07; AG Grimma (Amtsgericht Grimma), 135. StA Ludwigsburg, PL 704 (NL Oskar Riegraf), Bü 1; PL 509 (Angelegenheiten der HJ), Bü 5, Bü 7, Bü 16, Bü 21 und Bü 25; PL 510 (Angelegenheiten des BDM), Bü. 4, Bü 10, Bü 15 und Bü 19. StA Sigmaringen, Ho 235 T 26-28 (Schulwesen), 1049; Dep. 1 T 6-7 (NL Franz Keller), 135. StA Oldenburg, Dep 20 CLP 348 (Angelegenheiten der Hitlerjugend), 1276. StadtA Brühl, 576 [Digitalisat https://roos.jugend1918-1945.de, Zusatzmaterialien]. StadtA Essen, Rep 102 Abtl. XIV (Stadtamt I: Polizeiamt), 23. StadtA Halle, 556, 1; Best. Wörmlitz-Böllberg, 100, 3; Best. Diemitz, 642 und 100, 1; Best. Ammendorf, 130, 1. StadtA Kamenz, A4, 2, 689, Bl. 14, StadtA Kamenz, 13472; StadtA Kamenz, Signaturen: A4, 13471; 13472; 13473; 13475; StadtA Kamenz, A 4, 13472, Bl. 195; StadtA Kamenz, A4, 2, 689, Bl. 70; A4/2, 689, Bl. 1–3. StadtA Leipzig, Kap 6, 68, Bd. 11. StadtA München, BuR 452 (Fiehler), 13. StadtA Pirna, B-III-XXX-IX (Polizeiamt); 2709 und 2658; B-IV-XXIV (Rat der Stadt Pirna, Schul- und Kulturamt), 101. StadtA Plauen, Sondersammlung, 68. StadtA Ulm, NL Götz Lauser, 29 und 34b. StadtA Weimar, 12, 7-73-45 (HJ-Heimbeschaffung) StadtA Weimar, 16, 100-06, 5 (HJ und BDM) u. 16 (Reichsführerlager) u. 17 (HJHeimbeschaffung) StadtA Worms, Abt. 231 (Gemeindearchiv Hamm), 1675. Swedish Labour Movement’s Archives and Library, Stockholm, Nachlass: Otto Friedländer (Friedländer, Otto [unter Pseudonym Otto Friedrich]: Die deutsche Jugend. Im Auftrag der „Union für Recht und Freiheit“ verfasst auf Grund von Materialien und Dokumente [unveröffentlichtes Manuskript], Prag 1938). USHMM, Oral History Archives. Universitätsarchiv Leipzig, Personalakte und Habilitationsverfahren Hans Thomae. The Wiener Library for the Study of the Holocaust and Genocide, Testimonies: B 36, B 95, B 130, B 134, B 143, B 190 und B 191.
Quellenverzeichnis
429
Befehlsblätter (BB) und Gebietsbefehle (GB) der Hitlerjugend (überwiegend aus der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig, vereinzelt auch aus Archivbeständen. Angegeben sind hier nur die im Text selbst zitierten Jahrgänge.) BB: Bann Aue, 1943 BB: Berlin, 1934–1936 BB: Franken, 1942 BB: Hamburg, 1942 BB: Köln-Aachen, 1944 BB: Main-Franken, 1941–1943 BB: Mittelfranken, 1941 BB: Mittelland, 1942 BB: Moselland, 1942–1944 BB: Obergau Sudetenland, 1941 BB: Ostpreußen, 1942 BB: Sachsen, 1942–1943 GB: Baden, 1939–1945 GB: Baden-Elsass, 1945 GB: Berlin, 1934–1944 GB: Brandenburg, 1939–1941 GB: Düsseldorf: 1937–1943 GB: Franken, 1936–1944 GB: Hamburg, 1937–1943 GB: Hessen-Nassau, 1937–1942 GB: Hochland, 1939–1944 GB: Köln-Aachen: 1941–1942 GB: Koblenz-Trier, 1941 GB: Kurhessen, 1943 GB: Kurmark, 1935–1939 GB: Mainfranken, 1942 GB: Mecklenburg, 1939 GB: Mittelelbe, 1937–1943 GB: Mittelrhein, 1936 GB: Mark Brandenburg, 1943 GB: Moselland, 1941–1943 GB: Niederdonau, 1939–1944 GB: Niedersachsen, 1943 GB: Nordmark, 1936 GB: Nordsee, 1937–1944 GB: Oberdonau, 1939–1943 GB: Oberschlesien, 1941–1944 GB: Osthannover, 1943 GB: Pommern, 1937–1944 GB: Ruhr-Niederrhein, 1941 GB: Saarpfalz, 1935–1939 GB: Sachsen, 1934–1943 GB: Schlesien, 1940 GB: Thüringen, 1935–1938
430
Anhang
GB: Wartheland, 1941 GB: Westfalen, 1935–1943 GB: Westmark, 1935–1944 GB: Wien 1939–1944 Reichsbefehl der Reichsjugendführung der NSDAP: 1936–1943
Zitierte Periodika Allgemeiner Tiroler Anzeiger, 1936. Alpenländische Rundschau, 1944. Altonaer Nachrichten, 1933, 1936. Amtliche Nachrichten der Landesverwaltung Sachsen, 1945. Arbeiterzeitung. Zentralorgan der Sozialdemokratie Deutschösterreichs, 1933. Badener Zeitung, 1933. Berliner Zeitung, 1946. BDM-Führerinnendienst, 1942. Das deutsche Mädel. Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel, 1933, 1935, 1937, 1942. Das Junge Deutschland (Überbündische Zeitschrift des Reichsausschusses der Deutschen Jugendverbände, nach 1933 teils ohne Untertitel u. schließlich Amtliches Organ des Jugendführers des Deutschen Reiches), 1930, 1933, 1939, 1943, 1944. Der Freiheitskampf. Amtliche Tageszeitung der NSDAP im Gau Sachsen, 1930– 1938, 1940, 1941, 1943, 1944. Der Heidelberger Student. Kampfblatt des Nationalsozialistischen deutschen Studentenbundes, Hochschulgruppe Heidelberg, 1935. Der HJ-Richter. Schulungsblatt der HJ-Gerichtsbarkeit (auch unter dem Titel: Der Hitler-Jugend-Richter. Schulungsblatt des Amtes Gerichtsbarkeit der Reichsjugendführung), 1941, 1942. Der junge Tag. Evangelische Jugendzeitschrift Deutschlands, 1934. Der Neue Vorwärts, 1933–1937. Der Stürmer. Deutsches Wochenblatt zum Kampfe um die Wahrheit, 1935, 1938. Der Thüringer Sturmtrupp. Kampfblatt der deutschen Jugend, 1931, 1933, 1934. Der Vorwärts, 1931. Deutsches Jugendrecht. Beiträge für die Praxis und Neugestaltung des Jugendrechts, 1941. Deutsches Nachrichtenbüro, 1937, 1938. Die Fanfare (auch unter dem Untertitel: Kampfschrift der Hitler-Jugend im Obergebiet West), 1933–1935. Die Gefolgschaft, 1934, 1935. Die Gerechtigkeit. Gegen Rassenhass und Menschennot (Wien), 1934. Die Heimat schreibt der Front. Feldpostzeitung des Gaues Mecklenburg der NSDAP, 1944. Die HJ. Das Kampfblatt der Hitler-Jugend, 1936. Die Jugendlage. Berichte über die Jugend im Reichsgau Wien, 1945. Die Jungmädelschaft. Blätter für Heimabendgestaltung der Jungmädel, 1939. Die Kameradschaft. Blätter für Heimabendgestaltung der Hitler-Jugend, 1936. Die Mädelschaft. Blätter für Heimabendgestaltung im Bund Deutscher Mädel, 1937. Die Nationalsozialistische Gemeinde, 1939.
Quellenverzeichnis
431
Die Neue Weltbühne, 1934. Die Rheinprovinz, 1941. Die Stunde (Wien), 1933. Essener Nationalzeitung. Organ der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, 1933. Feldpost-Brief der Hitler-Jugend, 1943. Führerdienst. Neue Folge der Rundschau für evangelische Jugendführung und Jungmännermission, 1935. Hamburger Anzeiger, 1933, 1935, 1944. Hamburgischer Correspondent, 1933. Hamburger Nachrichten, 1933, 1936, 1937. Heidelberger Neueste Nachrichten, 1936. HJ im Vormarsch, 1934. Information Bulletin. Magazine of US Military Government in Germany, 1948. Office of the US High Commissioner for Germany Office of Public Affairs (Hg.): Information bulletin, 1950. Jugend und Bauerntum. Führerblätter des sächsisches Landdienstes, 1943. Junger Wille. Führerdienst der HJ: Sachsen, Ausgabe DJ und HJ, 1940. Jungvolk. Deutsche Jugendblätter, 1932. Kamenzer Tageblatt, 1939. Litzmannstädter Zeitung, 1943. Gebiet Sachsen (Hg.): Mädelführerinnendienst, 1944. Mittelrhein-Dienst. Nachrichtenblatt der HJ Mittelrhein, 1936. Nachrichtenblatt für das Evangelische Jugendwerk, 1936. Neues Deutschland. Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 1946. Neues Österreich. Organ der demokratischen Einigung, 1946. Neues Wiener Journal, 1934. Neues Wiener Tageblatt, 1944. Niederdeutscher Beobachter, 1933. Nationalsozialistische Monatshefte. Wissenschaftliche Zeitschrift der NSDAP, 1930. Pariser Tageblatt, 1935. Pariser Tageszeitung, 1936, 1938. Pirnaer Anzeiger, 1935. Reichsjugendführung. Arbeitsausschuss für die Heimbeschaffung (Hg.): Grüner Dienst, 1937, 1938. Rheinisches Volksblatt, 1940. Ruf der Jungen. Führerblatt der westdeutschen Hitler-Jugend, 1934. Ruhrmark. Mitteilungsdienst der Hitler-Jugend. Gebiet Westfalen-Süd, 1944. Stars and Stripes. Southern Germany, 1946. Sturmjugend. Kampfblatt schaffender Jugend, 1930. Tagblatt. Organ für die Interessen des werktätigen Volkes, 1931. Unsere Fahne. Zeitschrift der westfälischen HJ, 1935. Weekly information bulletin, hrsg. von Military government, 1946, 1947. Westdeutscher Beobachter. Amtliches Organ der NSDAP und sämtlicher Behörden. Stadt Köln, 1933. Wiener Zeitung, 1947. Wille und Macht. Führerorgan der nationalsozialistischen Jugend, 1937.
432
Anhang
Zitierte Editionen und Quellensammlungen Aull-Fürstenberg, Margret: Lebenslüge Hitler-Jugend. Aus dem Tagebuch eines BDM-Mädchens. Mit einem Nachwort von Erika Weinzierl, Wien 2001. Barkow, Ben/Gross, Raphael/Lenarz, Michael (Hg.): Novemberpogrom 1938. Die Augenzeugenberichte der Wiener Library, London, Frankfurt a. M. 2008. Behnken, Klaus (Hg.): Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934–1940, 7 Bände, 4. Auflage, Frankfurt a. M. 1980. Benecke, Jakob (Hg.): Die Hitler-Jugend 1933–1945. Programmatik, Alltag, Erinnerungen. Eine Dokumentation, Weinheim 2013. Boberach, Heinz (Hg.): Meldungen aus dem Reich. Die geheimen Lageberichte des Sicherheitsdienstes der SS 1938–1945, 17 Bände, Berlin 1984. Brommer, Peter (Hg.): Die Partei hört mit. Lageberichte und andere Meldungen des Sicherheitsdienstes der SS aus dem Großraum Koblenz 1937–1941, 2 Bände, Koblenz 1988/1992. Dabel, Gerhard: KLV. Die erweiterte Kinder-Land-Verschickung. KLV-Lager 1940– 1945. Dokumentation über den „Größten Soziologischen Versuch aller Zeiten“, Freiburg 1981. Demps, Laurenz (Hg.): Luftangriffe auf Berlin. Die Berichte der Hauptluftschutzstelle 1940–1945, Berlin 2012. Ebeling, Hans/Hespers, Dieter (Hg.): Jugend contra Nationalsozialismus. „Rundbriefe“ und „Sonderinformationen deutscher Jugend“, 2. Auflage, Frechen 1968. Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (Hg.): 75 Jahre Novemberpogrom, Teil B: Dokumente und Texte von Zeitzeugen, Kassel 2013. Faulhaber, Michael von: Tagebücher (Kritische Online-Edition, www.faulhaberedition.de; 16.7.2020). Faust, Anselm/Rusinek, Bernd A./Dietz, Burkhard (Hg.): Lageberichte rheinischer Gestapostellen, 3 Bände, Düsseldorf 2012–2016. Grau, Günter (Hg.): Homosexualität in der NS-Zeit. Dokumente einer Diskriminierung und Verfolgung, Frankfurt a. M. 1993. Gießmann, Thomas/Marcianiak, Rudolf: „Fast sämtliche Kinder sind jetzt weg.“ Quellen und Zeitzeugenberichte zur Kinderlandverschickung aus Rheine 1941– 1945, Münster 2001. Hahn, Fred (Hg.): Lieber Stürmer! Leserbriefe an das NS-Kampfblatt 1924 bis 1945. Eine Dokumentation aus dem Leo-Baeck-Institut New York, Stuttgart 1978. Heiber, Helmut (Hg.): Reichsführer! Briefe an und von Himmler, Stuttgart 1968. International Military Tribunal (Hg.): Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, Band XXXIII: Documents and other Material in Evidence. Numbers 3729-PS to 3993-PS, Nürnberg 1949. Jahnke, Karl-Heinz (Hg.): Jugend unter der NS-Diktatur 1933–1945. Eine Dokumentation, Rostock 2003. Keller, Sven (Hg.): Kriegstagebuch einer jungen Nationalsozialistin. Aufzeichnungen Wolfhilde von Königs 1939–1946, Göttingen 2015. Kißener, Michael: Das Dritte Reich (Kontroversen um die Geschichte), Darmstadt 2005. Klein, Thomas/Uthe, Oliver (Hg.): Die Lageberichte der Justiz aus Hessen 1940– 1945, Darmstadt 1999.
Quellenverzeichnis
433
Klönne, Arno: Jugend im Dritten Reich. Die Hitler-Jugend und ihre Gegner. Dokumente und Analysen, Düsseldorf 1982. Kulka, Otto Dov/Jäckel, Eberhard (Hg.): Die Juden in den geheimen NS-Stimmungsberichten 1933–1945, Düsseldorf 2004. Liedtke, Max (Hg.): Für Hitler erzogen? Briefe und Notizen des Edgar Winzen aus der Kinderlandverschickung Leutenberg/Thüringen 1944/45, Münster 1999. Miller-Kipp, Gisela (Hg.): „Auch du gehörst dem Führer“. Die Geschichte des Bundes Deutscher Mädel (BDM) in Quellen und Dokumenten, Weinheim 2011. Müller, Uwe (Hg.): Dokumente jüdischen Lebens in Schweinfurt, Schweinfurt 1990. Pädagogisches Institut der Landeshauptstadt Düsseldorf (Hg.): Dokumentation zur Geschichte der Stadt Düsseldorf, Band 4: 1935–1945, Düsseldorf 1983. Peukert, Detlev J.: Die Edelweißpiraten. Protestbewegung jugendlicher Arbeiter im „Dritten Reich. Eine Dokumentation, Köln 1988. Postert, André (Hg.): Hitlerjunge Schall. Die Tagebücher eines jungen Nationalsozialisten, München 2016. Reichmann, Hans: Deutscher Bürger und verfolgter Jude. Novemberpogrom und KZ Sachsenhausen 1937–1939, bearbeitet von Michael Wildt, München 1998. Ribbe, Wolfgang (Hg.): Die Lageberichte der Geheimen Staatspolizei über die Provinz Brandenburg und die Reichshauptstadt Berlin 1933 bis 1936, Köln 1998. Rupieper, Hermann-J./Sperk, Alexander (Hg.): Lageberichte der Geheimen Staatspolizei zur Provinz Sachsen 1933–1936, 3 Bände, Leipzig 2003/2004. Stöver, Bernd (Hg.): Berichte über die Lage in Deutschland: Die Meldungen der Gruppe Neu Beginnen aus dem Dritten Reich 1933–1936, Bonn 1996. Toepser-Ziegert, Gabriele (Bearb.), NS-Presseanweisungen der Vorkriegszeit. Edition und Dokumentation, 19 Teilbände in 7 Jahresbänden, München 1984–2000. Volk, Ludwig (Hg.): Akten Kardinal Michael von Faulhabers 1917–1945, 2 Bände, Mainz 1975/1978. Vorländer, Herwart: (Hg.): Die NSV. Darstellung und Dokumentation einer na tionalsozialistischen Organisation, München 1996 und Boppard am Rhein 1988. Wöhlert, Meike: Der politische Witz in der NS-Zeit am Beispiel ausgesuchter SD- Berichte und Gestapo-Akten, Frankfurt a. M. 1997.
Weitere Quellen Abschrift: Reichsjugendführung. Amt für Jugendverbände, Bündische Jugend. Entwicklung der dj.1.11 (geheim, Exemplar Nr. 021), hg. am 1.2.1936. Arendt, Paul (Hg.): Deutschland erwache! Das kleine Nazi-Liederbuch, SulbachOberpfalz (Selbstverlag) ca. 1931. Baaden, Franz: Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, Leipzig 1943. Bondy, Curt: The Youth Village: A Plan for the Reeducation of the Uprooted. In: The Journal of Criminal Law and Criminology, (1946) 1, S. 49–57. Der Führer der Brigade 31, Oberführer Walch, grüßt den Bann 278. In: Das Gesicht der Hitler-Jugend. Den Freunden der Schöneberger Jugend zum 1-jährigen Bestehen des Bannes 278, Berlin 1934. Engelmann, Susanne Charlotte: German Education and Re Education, New York 1945.
434
Anhang
Flemming, Helmut: Die Jugendkriminalität in Hamburg im Jahr 1941 unter besonderer Berücksichtigung der Verordnung zur Ergänzung des Jugendstrafrechts vom 4. Oktober 1940 (Diss.), Hamburg 1943. Gebiet Saarpfalz der Hitlerjugend (Hg.): Wir waren am Meer! 900 saarpfälzische Hitlerjungen erlebten Tage gemeinsamer Erholfung in Cuxhaven. Ein Bildbericht von Elbeth Burmann, Neustadt an der Weinstraße 1939. Gebiet Sachsen (Hg.): Wir rufen: Junge, zu uns!, Leipzig 1936 (DNB Leipzig). Gebiet Sachsen (Hg.): Unsere Arbeit zur Dienstgestaltung der Einheiten im Monat April, Dresden 1936 (DNB Leipzig). Gebiet Sachsen (Hg.): Statistik der Hitlerjugend in Sachsen, Dresden 1936 (DNB Leipzig). Glaser, Franz: Schar 6. HJ in Kampf und Spionage, Breslau 1935. Glashagen, Heinz: Die Geschichte der Danziger Hitlerjugend. In: Hitlerjugend Danzig (Hg.): Hitler-Jugend-Tag, Bann Danzig, 23.–24. September 1933, Danzig 1933. Goebbels, Magda: Geleitwort. In: Wisser, Eva Maria: Kämpfen und Glauben. Aus dem Leben eines Hitlermädels, Potsdam 1933. Grace, Alonzo G.: The Coming Generations. In: The Journal of Criminal Law and Criminology, 38 (1946) 1, S. 49–57. Görz, Heinz/Wrede, Franz-Otto: Unsterbliche Gefolgschaft, Berlin 1936. Headquarters United States Army (Hg.): The U. S. armed forces German youth activities program 1945–1955, Wiesbaden 1965. Hempel, Georg: Die Kieler Hitler-Jugend. Chronik, Geschichten und Aufsätze ihrer Kampfzeit, Kiel 1938. Hermannsen, Walter: Ein Wort an 14-jährige Jungen. In: ders. (Hg.): Geschlechtliche Jugenderziehung. Ziel und Weg, Leipzig 1938. Heyne, Gerhard: Werner Gebhard. Ein Vermächtnis an die Zukunft. Um Auftrage der Gebietsführung Mittelland der Hitler-Jugend, Halle, o. D. (vermutlich 1934). Hitlerjugend. Gebiet Hochland (Hg.): Unser Hochland, München 1939. Hitler-Jugend Gebiet Mittelland (Hg.): Werden. Sein. Wollen, Halle 1934. Hohoff, Heinz: Turnen und Sport. Ein Teil der Gesamterziehungsarbeit. In: HJ im Vormarsch, 1934. Jank, Martin: Großfahrt: Fahrtenerlebnisse eines Hitlerjungen, Berlin 1934. Jugendführer des Deutschen Reiches (Hg.): Kriminalität und Gefährdung der Jugend. Lagebericht bis zum Stande vom 1. Januar 1941 (Streng vertraulich! Nur für den Dienstgebrauch!), Berlin 1941. Kaufmann, Günter: Das kommende Deutschland. Die Erziehung der Jugend im Reich Adolf Hitlers, Berlin 1940. Kemper, Friedrich: Jugendführer des Landes Baden, Richtlinien für die Jugendarbeit des Landes Baden, 12.8.1933. Klemer, Gerhard: Die Erzwingung der Jugenddienstpflicht. In: Jugendführer des Deutschen Reiches (Hg.): Deutsches Jugendrecht, Berlin 1943, S. 58–70. Kluge, Hans-Joachim: Das Lager. In: Jungen, Eure Welt! Jahrbuch der Hitler-Jugend, 4 (1941). Knöpke-Joest, Helga: Ulla, ein Hitlermädel, Leipzig 1933. Köppe, Franz: Die Hitler-Jugend als politisch-soldatische Erziehungsgemeinschaft im neuen Deutschland. In: Die deutsche Schule, (1934) 3, S. 111–114.
Quellenverzeichnis
435
Leiter, Anna: Zur Vererbung von asozialen Charaktereigenschaften. In: Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, (1939) 167 (Kongressbeiträge zur 1. Sitzung Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater am 26. März 1939), S. 157–160. Lupescu, Herbert B.: Denazification. An inventory seven years after Potsdam, Madison 1953. Mann, Erika: School for Barbarians. Education under the Nazis, New York 1938. Maßmann, Kurt: Hitlerjugend – Neue Jugend! Vom Wege der Jugend in die deutsche Zukunft, Breslau 1933. Membership of 36 Youth Organizations in the City of Bremen (1.4.1948). In: Office of Military Government. Education and Cultural Relations Division (Hg.): German youth between yesterday and tomorrow, Berlin 1948. Memminger, Gustav: Hitlerjugend. Das Erlebnis einer großen Kameradschaft, München 1942. Möckel, Helmut (Hg.): Hitlerjugend kämpft, Sonderdruck „Junger Wille“ zum Führerappell und Gebietssportfest in Leipzig am 13./14.10.1934, Dresden 1934. Möckel, Marga: Hitlermädel kämpfen um Berlin. Eine Erzählung aus der Kampfzeit, Stuttgart 1935. NSDAP. Gauleitung Schleswig-Holstein. Amt für Volkswohlfahrt (Hg.): Helferanweisung für die NSV.-Jugendhilfe, Kiel 1940. Office of Military Government. Education and Cultural Relations Division (Hg.): German youth between yesterday and tomorrow, Berlin 1948. Organisationsamt der Reichsjugendführung (Hg.): Statistik der Jugend, Ausgabe A, Teil 2, Berlin 1936. o. V.: Aus der Zeit der Gründung der Oberbarnimer Hitler-Jugend. Zur Chronik des HJ-Bannes 196. In: Oberbarnimer Kreiskalender. Ein Heimatbuch für Stadt und Land für das Jahr 1939, Eberswalde 1939, S. 44–47. Pädagogisches Institut der Landeshauptstadt Düsseldorf (Hg.): Dokumentation zur Geschichte der Stadt Düsseldorf, Band 4: 1935–1945, Düsseldorf 1983. Peters, Karl: Jugendgerichtsgesetz vom 16. Februar 1923 mit ergänzenden Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften auf dem Gebiete des Jugendstrafrechts, Berlin 1942. Quednow, Fritz: Ein Jahr nationalsozialistische Erziehung. In: Das Gesicht der Hitler-Jugend. Randel, Edgar: Die Jugenddienstpflicht (Sonderveröffentlichung: Das junge Deutschland), Berlin 1943. Reichsjugendführung (Hg.): Der Jungmädeldienst. Übersicht über Wesen, Form und Arbeit des Jungmädelbundes in der HJ (Dienstvorschrift der Hitler-Jugend), Berlin 1940. –: Der Jungvolkdienst. Übersicht über Wesen, Form und Arbeit des Deutschen Jungvolks in der HJ (Dienstvorschrift der Hitler-Jugend), Berlin 1940. –: Dienstkontrollbuch für Jungenschafts- und Jungzugführer, Berlin 1940. –: HJ. im Dienst. Ausbildungsvorschrift für die Ertüchtigung der deutschen Jugend, Berlin 1935. –: Statistik der Jugend, A, 2, Berlin 1936, S. 6 f. (BArch Berlin, BDC 32.40). –: Unser Liederbuch. Lieder der Hitler-Jugend, 2. Auflage, Berlin 1939. –: Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend. 1. Ausgabe vom 1. Januar 1943, Band II, Gruppe 1–14, Berlin 1943.
436
Anhang
Ruder, Willi: Hitler-Jugend. In: Vesper (Hg.): Deutsche Jugend, S. 188–201. Runderlass des RFSS und ChdDtPol. Über die Erzwingung der Jugenddienstpflicht, 20.10.1942. In: Reichsministerialblatt der inneren Verwaltung (RMBliV), 1942, S. 2037. Scheller, Thilo: Volksgemeinschaft. In: Turnerjugend. Blätter vom jungen Leben in der Deutschen Turnerschaft, (1934) 3, Ausgabe A, S. 23. –: Werden und Wesen der deutschen Turn- und Sportjugend. In: Vesper (Hg.): Deutsche Jugend, S. 322–332. Schirach, Baldur von: Der politische Weg der HJ. In: ders., Revolution der Erziehung. Reden aus den Jahren des Aufbaus, 3. Auflage, München 1942, S. 37–44. –: Die Hitlerjugend. Idee und Gestalt, Berlin 1934. –: Vorwort. In: Kamlow, Rudolf: Herbert Norkus? – Hier! Von Opfer und Sieg der Hitler-Jugend, Stuttgart 1933, S. 3–5. Schmid, Lisl: Lehrerin und weibliche Hitlerjugend. In: Reber-Gruber, Auguste (Hg.): Weibliche Erziehung im NSLB. Vorträge der Ersten Erzieherinnentagung des NSLB in Alexisbad am 1., 2., und 3. Juni 1934, Leipzig 1934, S. 110–119. Schröder, Paul: Kinderpsychiatrie und Heilpädagogik. In: Zeitschrift für Kinderforschung, (1943) 1, S. 9–14. Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force. Evaluation and Dissemination Section, G-2 (Counter Intelligence Sub-Division), Basic Handbook: The Hitler Jugend (The Hitler Youth Organisation), Washington 1945. Tetens, Friedrich Tete H.: Christentum, Hitlerismus, Bolschewismus, Buenos Aires 1937. United States. Dept. of State. Bureau of Public Affairs (Hg.): Young Germany. Apprentice to Democracy, Washington 1951. Usadel, Georg: Entwicklung und Bedeutung der nationalsozialistischen Jugendbewegung Bielefeld 1934. Verordnungsblatt der Reichsjugendführung, Sonderdruck 1/37, 7.1.1937. Zahn, Karl Friedrich: Kirche und Hitlerjugend, Berlin 1934. Zeitpunkt der Beendigung der Jugenddienstpflicht. In: Amtliches Nachrichtenblatt der RJF vom 14.11.1940. Zentralverlag der NSDAP (Hg.): Die Organisation der Hitler-Jugend. Amtliche Gliederung der Reichsjugendführung der NSDAP. Stand am 1. August 1937, München 1937. –: Hitler-Jugend 1933–1943. Die Chronik eines Jahrzehnts. Mit einem Geleitwort des Reichsjugendführers Artur Axmann, Berlin 1943.
Literaturverzeichnis
437
3. Literaturverzeichnis Adler-Rudel, Salomon: Jüdische Selbsthilfe unter dem Naziregime. Im Spiegel der Berichte der Reichsvertretung der Juden in Deutschland, Tübingen 1974. Ahrens, Rüdiger: Bündische Jugend: Eine neue Geschichte 1918–1933, Göttingen 2015. Arntz, Hans-Dieter: „Reichskristallnacht“. Der Novemberpogrom 1938 auf dem Lande. Gerichtsakten und Zeitzeugenaussagen am Beispiel der Eifel und Voreifel, Aachen 2008. Axmann, Artur: Das kann doch nicht das Ende sein. Hitlers letzter Reichsjugendführer erinnert sich, Koblenz 1995. Ayass, Wolfgang: „Asoziale“ im Nationalsozialismus, Essen 1995. Baberowski, Jörg: Nationalsozialismus, Stalinismus und die Totalitarismustheorie. In: Sabrow, Martin/Danvel, Jürgen/Kirsch, Jan-Holger (Hg.): 50 Klassiker der Zeitgeschichte, Göttingen 2013, S. 52–57. Bach, Maurizio/Breuer, Stefan: Faschismus als Bewegung und Regime. Italien und Deutschland im Vergleich, Wiesbaden 2010. Bajohr, Frank: Die Deutschen und die Judenverfolgung im Spiegel von Geheimberichten. In: Hering, Rainer (Hg.): Die „Reichskristallnacht“ in Schleswig-Holstein. Der Novemberpogrom im historischen Kontext, Hamburg 2016, S. 191– 212. Balz, Eva: Erfahrungshorizonte Berliner Jugendlicher im Nationalsozialismus. In: Michael Wildt/Christoph Kreuzmüller (Hg.): Berlin 1933–1945, S. 145–158. Barkai, Avraham: Vom Boykott zur „Entjudung“. Der wirtschaftliche Existenzkampf der Juden im Dritten Reich 1933–1943, Frankfurt a. M. 1998. Bastian, Alexander/Stagge, Christian: Forschungsbericht zur Geschichte des heutigen Bundeslandes Sachsen-Anhalt im Nationalsozialismus. In: Schmiechen-Ackermann, Detlef/Kaltenborn, Steffi (Hg.): Stadtgeschichte in der NSZeit. Fallstudien aus Sachsen-Anhalt und vergleichende Perspektiven, Münster 2005, S. 150–179. Bauer, Snejanka (Hg.): Jörgen Schmidt-Voigt. Mediziner, Musiker, Mäzen (1917– 2004), Frankfurt a. M. 2010. Bäumler, Klaus (Hg.): Walter Klingenbeck. Zum 60. Todestag. 5. August 1943– 5. August 2003, 4. Auflage, München 2003. Bender, Hans: Willst Du nicht beitreten? In: Reich-Ranicki (Hg.): Meine Schulzeit im Dritten Reich, S. 31–39. Benecke, Jakob: Between exclusion and compulsory service. The treatment of the Jewish „ Mischlinge“ as an example for social inequality creation in the Hitler-Jugend. In: Policy Futures in Education, 17 (2019) 2, S. 222–225. –: Soziale Ungleichheit und Hitler-Jugend. Zur Systematisierung sozialer Differenz in der nationalsozialistischen Jugendorganisation, Weinheim 2015. Berger, Ernst/Rieger, Else (Hg.): Verfolgte Kindheit. Kinder und Jugendliche als Opfer der NS-Sozialverwaltung, Wien 2007. Beuys, Barbara: Sophie Scholl. Biographie, 3. Auflage, München 2012. Blunk, Manfred: Memi. Kindheitserinnerungen an Korswandt, Norderstedt 2009. Böckler, Hans (Hg.): Schule in der Kriegszeit 1939 bis 1945. Dokumentarbericht und Erinnerungen von Zeitzeugen der ehemaligen Falk-Mittelschule Frankfurt/ Main-Borkenheim. 100 Jahre Falkschule, Frankfurt a. M. 2005.
438
Anhang
Bormann, Martin: Vom Reichsführer in Feldafing zum Missionar im Kongo. In: Leeb, Johannes: „Wir waren Hitlers Eliteschüler“. Ehemalige Zöglinge der NS-Ausleseschulen brechen ihr Schweigen, Hamburg 1998, S. 106–119. Bothien, Horst-Pierre: Das braune Bonn. Personen und Ereignisse. 1935–1939, Essen 2005. –: Die Jovy-Gruppe. Eine historisch-soziologische Lokalstudie über nonkonforme Jugendliche im „Dritten Reich“, Münster 1995. Brakelmann, Günter: Evangelische Kirche in Bochum 1933. Zustimmung und Widerstand, Norderstedt 2013. –: Kreuz und Hakenkreuz. Christliche Pfadfinderschaft und Nationalsozialismus in den Jahren 1933/1934, Kamen 2013. Brandenburg, Hans Christian: Die Geschichte der HJ. Wege und Irrwege einer Generation, Köln 1968. Breyvogel, Wilfried: Jugendwiderstand im Nationalsozialismus. Ein Überblick. In: Splitter. Beiträge aus Pädagogik und Jugendforschung, 1994, S. 143–148. –: Resistenz, Widersinn und Opposition. Jugendwiderstand im Nationalsozialismus. In: ders. (Hg.): Jugendwiderstand im Nationalsozialismus, S. 9–16. Brezinka, Wolfgang: Vom Erziehen zur Kritik der Pädagogik. Erfahrungen aus Deutschland und Österreich, Wien 2019. Brückner, Peter: Das Abseits als sicherer Ort, Berlin 1980. Bruyn, Günter de: Zwischenbilanz. Eine Jugend in Berlin, Frankfurt a. M. 1992. Buddrus, Michael: Das „Berliner Gespräch“ 1951. In: Kersting (Hg.), Jugend vor einer Welt in Trümmern, S. 161–190. –: Totale Erziehung für den totalen Krieg. Hitlerjugend und nationalsozialistische Jugendpolitik, 2 Bände, München 2003. –: „Wir fahren zum Juden Geld holen“. Hitlerjugend, Antisemitismus, Reichskristallnacht. In: Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung, 18 (1993– 1998), S. 13–156. Bülow, Carola von: Der Umgang der nationalsozialistischen Justiz mit Homosexuellen, Oldenburg 2000. Burkhof, Karl A.: Erinnerungen eines Hitler-Jungen, Norderstedt 2003. Burleigh, Michael: Die Zeit des Nationalsozialismus. Eine Gesamtdarstellung, Frankfurt a. M. 2000. Castell, Rolf: Geschichte der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland in den Jahren 1937 bis 1961, Göttingen 2003. Crüger, Herbert: Verschwiegene Zeiten. Vom geheimen Apparat der KPD ins Gefängnis der Staatssicherheit, Berlin 1990. Czech, Herwig: Der „Spiegelgrund“ als zentrale Institution der Wiener Jugendfürsorge zwischen 1940 und 1945. In: Gabriel, Eberhard/Neugebauer, Wolfgang (Hg.): Von der Zwangssterilisierung zur Ermordung. Zur Geschichte der NS-Euthanasie in Wien, Teil 2, Wien 2002, S. 165–189. Das Individuum und seine Welt im Spiegel der Zeit: Hans Thomae im Gespräch mit Jürgen Straub. In: Journal für Psychologie, (1997) 2, S. 65–77. Dick, Lutz van (Hg.): Lehreropposition im NS-Staat. Biographische Berichte über den „aufrechten Gang“, Weinheim 1988. Diekmann, Irene: Boykott – Entrechtung – Pogrom – Deportation. Die „Arisierung“ jüdischen Eigentums während der NS-Diktatur. In: Eichholtz, Dietrich (Hg.): Verfolgung. Alltag. Widerstand. Brandenburg in der NS-Zeit. Studien und Dokumente, Berlin 1993.
Literaturverzeichnis
439
Dierker, Wolfgang: „Planmäßige Ausschlachtung der Sittlichkeitsprozesse“. Die Kampagne gegen katholische Ordensangehörige und Priester 1936/37. In: zur Nieden, Susanne (Hg.): Homosexualität und Staatsräson, Homophobie und Politik in Deutschland 1900–1945, Frankfurt a. M. 2005, S. 281–293. Diesing, Walter: Mit Zuversicht durch Dick und Dünn, Norderstedt 2010. Dittmar, Simone: „Wir wollen frei von Hitler sein“. Jugendwiderstand im Dritten Reich am Beispiel von drei Kölner Edelweißpiraten, Bern 2011. Dolata, Werner: Chronik einer Jugend. Katholische Jugend im Bistum Berlin 1936– 1949, Hildesheim 1988. Donath, Matthias: Architektur in Berlin 1933–1945. Ein Stadtführer, 2. Auflage, Berlin 2007. –: Bunker, Banken, Reichskanzlei: Architekturführer Berlin 1933–1945, 2. Auflage, Berlin 2008. Dürkop, Oliver/Gehler, Michael (Hg.): Verantwortung. Hans Modrow und der deutsche Umbruch 1989/90, Innsbruck 2018. Eckert, Rainer: Gestapo-Berichte. Abbildungen der Realität oder reine Spekulation? In: Paul, Gerhard/Mallmann, Klaus-Michael (Hg.): Die Gestapo. Mythos und Realität, Darmstadt 2003, S. 200–215. Eilers, Elfriede: „In die Jugendarbeit bin ich hineingeboren …“. In: Kersting (Hg.), Jugend vor einer Welt in Trümmern, S. 131–1938. Erb, Dirk (Hg.): Gleichgeschaltet. Der Nazi-Terror gegen Gewerkschaften und Berufsverbände. Eine Dokumentation, Göttingen 2001. Eriksson, Gösta A.: DDR, Stasi und Schweden, Berlin 2003. Everwyn, Klaus Ewert: Als ich noch ein (kleiner) Nazi war. In: Frank, Karlhans (Hg.): Menschen sind Menschen. Überall. P.E.N.-Autoren schreiben gegen Gewalt, München 2002, S. 16. Fehlauer, Heinz: NS-Unterlagen aus dem Berlin Document Center und die Debatte um ehemalige NSDAP-Mitgliedschaften. In: Historical Social Research, 35 (2010) 3, S. 22–35. Felsing, Monika: Das Schabbesmädchen. Elfriede Roth – eine NS-Zeitzeugin aus Lauterbach (http://www.monikafelsing.de/images/elfriede_roth.pdf; 16.7.2020). Fett, Hugo: Erlebte Hitler-Ära. Hoffnung, Enttäuschung, Terror, Norderstedt 2010. Fleermann, Bastian: Der Beginn der Pogrome in Düsseldorf. In: Genger, Angela (Hg.): Novemberpogrom 1938 in Düsseldorf, Essen 2008, S. 107–124. Fliege, Paul: Erinnerungen an die Auseinandersetzungen zwischen der katholischen Sturmschar und der Hitlerjugend im Frühjahr 1934. In: Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck und Dorsten e.V., (1995) 54, S. 52–57. Fichter, Tilman: SDS und SPD. Parteilichkeit jenseits der Partei, Opladen 1988. Finckh, Renate: Sie versprachen uns die Zukunft. Eine Jugend im Nationalsozialismus, Tübingen 2002. Fox, Elizabeth: Rebuilding Germany 's Children: The Nazi Indoctrination and Postwar Reeducation of the Hitler Youth. In: Furman Humanities Review, 27 (2016), S. 31–59. Fricke, Wera/Szepansky, Gerda: Frauen leisten Widerstand. 1933–1945. Lebensgeschichten nach Interviews und Dokumenten, Berlin 1983. Friederich, Christine: Sophies Schwester: Inge Scholl und die Weiße Rose, München 2013.
440
Anhang
Gand, Helena: Ideologie und Inszenierung zwischen Kontinuität und Kooperation. Das 15. Deutsche Turnfest 1933 als erstes Massensportereignis im Nationalsozialismus. In: Becker, Frank/Schäfer, Ralf (Hg.): Sport und Nationalsozialismus, Göttingen 2016, S. 107–124. Gast, Holger/Leugers, Antonia/Leugers-Scherzberg, August H./Sandfuchs, Uwe: Katholische Missionsschulen in Deutschland 1887–1940, Bad Heilbrunn 2013. Gehling, Dominik/Gehling, Volker/Hofmann, Jonas/Nickel, Holger/Rüther, Christopher (Hg.): „Das müssen Sie mir alles aufschreiben.“ Paderborner Zeitzeugen berichten 1933–1948, Paderborn 2005. Gehmacher, Johanna: Jugend ohne Zukunft. Hitlerjugend und Bund Deutscher Mädel in Österreich vor 1938, Wien 1994. Geschichtsverein Heiligenhaus (Hg.): Cis Hilinciweg. Geschichte, Geschichten und Gedichte aus und über Heiligenhaus, Heiligenhaus 1996. Gestrich, Andreas: Geschichte der Familie im 19. und 20. Jahrhundert, 3. Auflage, München 2013. Gippert, Wolfgang: Kindheit und Jugend in Danzig 1920 bis 1945. Identitätsbildung im sozialistischen und im konservativen Milieu, Essen 2005. Gloy, Thomas: Im Dienst der Gemeinschaft. Zur Ordnung der Moral in der Hitler-Jugend, Göttingen 2018Goedde, Petra: GIs and Germans. Culture, Gender, and Foreign Relations 1945–1949, Yale 2003. Götte, Petra: Jugendstrafvollzug im „Dritten Reich“ diskutiert und realisiert – erlebt und erinnert, Bad Heilbrunn 2003. Götz, Norbert: Ungleiche Geschwister: die Konstruktion von nationalsozialistischer Volksgemeinschaft und schwedischem Volksheim, Baden-Baden 2001. Graml, Hermann: Integration und Entfremdung. Inanspruchnahme durch Staatsjugend und Dienstpflicht. In: Benz, Ute/Benz, Wolfgang (Hg.): Sozialisation und Traumatisierung. Kinder in der Zeit des Nationalsozialismus, Frankfurt a. M.in 1992, S. 70–79. –: Reichskristallnacht. Antisemitismus und Judenverfolgung in Deutschland, 1988. Griesmayr, Gottfried: Idee und Gestalt der Hitlerjugend, 2. Auflage, Druffel 1979. Gross, Raphael: November 1938: Die Katastrophe vor der Katastrophe, München 2013. Gruner, Wolf: Die Berliner und die NS-Judenverfolgung. Eine mikrohistorische Studie individueller Handlungen und sozialer Beziehungen. In: Hachtmann, Rüdiger/Schaarschmidt, Thomas/Süß, Winfried (Hg.): Berlin im Nationalsozialismus. Politik und Gesellschaft 1933–1945, Göttingen 2011, S. 57–87. –: Die Verfolgung der Juden und die Reaktionen der Berliner Bevölkerung. In: Wildt, Michael/Kreutzmüller, Christoph (Hg.): Berlin 1933–1945, München 2012, S. 311–325. Guse, Martin: Die Jugendschutzlager Moringen und Uckermark. In: Benz, Wolfgang/Distel, Barbara (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Band 9, München 2009, S. 101–114. –: „Gemeinschaftsfremder“. Ausgrenzung und Haft von Jugendlichen im Jugend-KZ Moringen. In: Sedlaczek, Dietmar/Lutz, Thomas/Puvogel, Ulrike/Tomkowiak, Ingrid (Hg.): „minderwertig“ und „asozial“ – Stationen der Verfolgung gesellschaftlicher Außenseiter, Zürich 2005, S. 127–153.
Literaturverzeichnis
441
Güntner, Joachim: Die unbekannte NSDAP-Mitgliedschaft. In: Neue Zürcher Zeitung, Online-Ausgabe vom 2.7.2007 (https://www.nzz.ch/die_unbekannte_nsd ap-mitgliedschaft-1.521695; 15.7.2020). Hack, Oliver: Licht entzündet in dunkler Zeit. Die Lauterbacherin Elfriede Roth. In: Lauterbacher Anzeiger vom 21.7.2018 (https://www.lauterbacher-anzeiger. de/lokales/lauterbach/elfriede-roth-aus-lauterbach-unterstutzte-bis-1939-die- judische-familie-weinberg-als-schabbesmadchen_18934391; 16.7.2020). Hafenegger, Benno: Jugendarbeit als Beruf. Geschichte einer Profession in Deutschland, Opladen 1992. Hainmüller, Bernd: Erst die Fehde – dann der Krieg. Jugend unterm Hakenkreuz. Freiburgs Hitler-Jugend, Freiburg 1998. Hammerschmidt, Peter: Die Wohlfahrtsverbände im NS-Staat. Die NSV und die konfessionellen Verbände Caritas und Innere Mission im Gefüge der Wohlfahrtspflege des Nationalsozialismus, Wiesbaden 1999. Harpprecht, Klaus: Schräges: Licht. Erinnerungen ans Überleben und Leben, Frankfurt a. M. 2014. Hartl, Peter (Hg.): Belogen, betrogen und umerzogen. Kinderschicksale im 20. Jahrhundert, München 2007. Hasenclever, Christa: Jugendhilfe und Jugendgesetzgebung seit 1900, Göttingen 1978. Haude, Hans-Joachim: Kindheit im Nazistaat. In: Laubaner Gemeindebrief, (2017) 1, S. 15. Heimann, Siegfried: Das Überleben organisieren: Berliner Jugend und Berliner Jugendbanden in den vierziger Jahren. In: Jancik, Christa/Berliner Geschichtswerkstatt (Hg.): Vom Lagerfeuer zur Musikbox: Jugendkulturen 1900–1960, Berlin 1985, S. 105–136. Hellfeld, Matthias von: Bündische Jugend und Hitlerjugend. Zur Geschichte von Anpassung und Widerstand 1930–1939, Köln 1987. –: Edelweißpiraten in Köln. Jugendrebellion gegen das 3. Reich: das Beispiel Köln-Ehrenfeld, Köln 1983. Henkelmann, Andreas/Kaminsky, Uwe: Die Entstehung der Fürsorgeerziehung im Rheinland (1878–1945). In: Landschaftsverband Rheinland (Hg.): Verspätete Modernisierung. Öffentliche Erziehung im Rheinland – Geschichte der Heimerziehung in Verantwortung des Landesjugendamtes (1945–1972), Essen 2011, S. 23–40. Hepp, Michael: „Bei Adolf wäre das nicht passiert“? Die Kriminalstatistik widerlegt eine zählebige Legende. In: Zeitschrift für Rechtspolitik, 32 (1999) 6, S. 253–260. Herbers, Matthias: Organisationen im Krieg. Die Justizverwaltung im Oberlandesgerichtsbezirk Köln 1939–1945, Tübingen 2012. Hermann, Dirk: Am „Born des Jugendmutes und der Jugendlust“ in der Provinz. Bürgerliche Jugendbewegung in Zittau und Umgebung 1910–1933. In: Mieth, Katja M./Ulbricht, Justus H./Werner, Elvira (Hg.): „Vom fröhlichen Wandern“. Sächsische Jugendbewegung im Zeitalter der Extreme 1900–1945: Bürgerliche Jugendbewegung in Sachsen, Dresden 2016, S. 261–268. Hermann, Konstantin: Tolerierte Devianz? Jugendpolitik und Jugendkriminalität in Sachsen 1943 bis 1949. In: Schmeitzner, Mike/Vollnhals, Clemens/Weil, Francesca (Hg.): Von Stalingrad zur SBZ. Sachsen 1943 bis 1949, Göttingen 2016, S. 407–425.
442
Anhang
Herrlitz, Hans-Georg: Von der wilhelminischen Nationalerziehung zur demokratischen Bildungsreform. Eine Auswahl aus 90 Jahren „Die deutsche Schule“, Frankfurt a. M. 1987. Herwig, Malte: Die Flakhelfer. Wie aus Hitlers jüngsten Parteimitgliedern Deutschlands führende Demokraten wurden, Stuttgart 2013. Hess, Wolfgang: Der Günther-Wolff-Verlag in Plauen und die bündische Jugend im III. Reich, Plauen 1993. Hetzer, Gerhard: Die Industriestadt Augsburg. Eine Sozialgeschichte der Arbeiteropposition. In: Broszat, Martin/Fröhlich, Elke/Grossmann, Anton (Hg.): Bayern in der NS-Zeit III: Herrschaft und Gesellschaft im Konflikt, Teil B, München 1981, S. 1–234. Heusler, Andreas/Wagner, Tobias: „Kristallnacht“. Gewalt gegen die Münchner Juden im November 1938, München 1998. Hey, Richard: Die schlafende Schöne in Formalin, Berlin 2003. Heyden, Bogislav von: Meine Erinnerungen an Haft und Zwangsarbeit in der Sowjetunion von 1946 bis 1946. In: Segschneider, Ernst Helmut (Hg.): Gefangenschaft im Kaukasus 1946–1950. Drei Zeitzeugen erinnern sich, Münster 2002, S. 17–103. Hilgers, Anja: Geschichte, Struktur und Funktion der Hitlerjugend. In: Werner Helsper/Christian Hillbrandt/Thomas Schwarz (Hg.): Schule und Bildung im Wandel. Anthologie historischer und aktueller Perspektiven, Wiesbaden 2009, S. 53–73. Hochmuth, Ursel/Meyer, Gertrud: Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand 1933–1945, Frankfurt a. M. 1980. Hoffmann, Volker: Hanno Günther, ein Hitler-Gegner. Geschichte eines unvollendeten Kampfes 1921–1942, Berlin 1992. Horchem, Hans Josef: Kinder im Krieg. Kindheit und Jugend im Dritten Reich, Hamburg 2000. Hövelmans, Friederike: Die Sächsische Jungenschaft – Abenteurer, Aufrührer, Angepasste? Die Jugendbewegung in Sachsen zwischen den beiden Weltkriegen am Beispiel einer Jugendgruppe. In: Mieth, Katja M./Ulbricht, Justus H./Werner, Elvira (Hg.): „Vom fröhlichen Wandern“. Sächsische Jugendbewegung im Zeitalter der Extreme 1900–1945, Dresden 2016, S. 133–151. –: Zwischen Weimarer Republik und Zweitem Weltkrieg. Die bürgerliche Jugend in Sachsen am Beispiel der Sächsischen Jungenschaft. In: Heydemann/Schulte/ Weil (Hg.): Sachsen und der Nationalsozialismus, S. 319–335. Holler, Eckard: Linke Strömungen in der freien bürgerlichen Jugendbewegung. In: Botsch, Gideon/Haverkamp, Josef (Hg.): Jugendbewegung, Antisemitismus und rechtsradikale Politik, Berlin 2014, S. 165–194. Huber, Karl-Heinz: Jugend unterm Hakenkreuz, Frankfurt a. M. 1982. Hühne, Annemarie/Sedlaczek, Dietmar: Nachruf auf Anna Pröll. In: Dokumente. Rundbrief der Lagergemeinschaft und Gedenkstätte KZ Moringen e. V., (2006) 24, S. 25 f. Jahnke, Karl-Heinz: Hitlers letztes Aufgebot. Deutsche Jugend im sechsten Kriegsjahr 1944/45, Essen 1993. Jellonnek, Burkhard: Homosexuelle unter dem Hakenkreuz: die Verfolgung von Homosexuellen im Dritten Reich, Paderborn 1990. Jungkommunisten im Widerstandskampf gegen den Hitlerfaschismus, Berlin 1977.
Literaturverzeichnis
443
Jülich, Jean: Kohldampf, Knast un Kamelle: Ein Edelweißpirat erzählt sein Leben, Köln 2003. Jürgens, Birgit: Zur Geschichte des BDM (Bund Deutscher Mädel) von 1923 bis 1939, Frankfurt a. M. 1994. Kaiser, Hans: Kempen unterm Hakenkreuz: Band 1: Eine niederrheinische Kreisstadt im Nationalsozialismus, Viersen 2013. Kaißling, Paul: Unter der Willkür der Macht. Erlebnisse eines Zeitzeugen von 1930 bis 1953, Norderstedt 2006. Kasper, Walter (Hg.): Lexikon für Theologie und Kirche, Band 5, Freiburg 1996. Kater, Michael H.: Gewagtes Spiel. Jazz im Nationalsozialismus, Köln 1995. –: Hitlerjugend und Schulen im Dritten Reich. In: Historische Zeitschrift, (1979) 228, S. 572–623. –: Hitler-Jugend, Darmstadt 2005 (Hitler Youth, Harvard 2006). Katz, Casimir: Jeder sah es anders. Erinnerungen an meine Kindheit und Jugend im Dritten Reich, Gernsbach 2000. Kaufmann, Günther: Ein anderes Drittes Reich, Berg 2001. Kebbedies, Frank: Außer Kontrolle. Jugendkriminalpolitik in der NS-Zeit und der frühen Nachkriegszeit, Essen 2000. Keller, Gustav: Die Gewissensentwicklung der Geschwister Scholl. Eine moralpsychologische Betrachtung, Herbholzheim 2014. Keller, Sven: Volksgemeinschaft am Ende. Gesellschaft und Gewalt 1944/45, München 2013. Kellerhoff, Sven Felix: Ein ganz normales Pogrom: November 1938 in einem deutschen Dorf, Stuttgart 2018. Kenkmann, Alfons: Beispiele jugendbewegten Eigensinns im Zeitkäfig der NSZeit. In: Stambolis, Barbara (Hg.): Die Jugendbewegung und ihre Wirkungen. Prägungen, Vernetzungen, gesellschaftliche Einflussnahmen, Göttingen 2015, S. 233–250. –: Bilddokumente jugendliche Devianz unter der NS-Herrschaft. In: Stambolis, Barbara/Köster, Markus (Hg.): Jugend im Fokus von Film und Fotografie. Zur visuellen Geschichte von Jugendkulturen im 20. Jahrhundert, Göttingen 2016, S. 233–252. –: Im Visier von HJ, Partei und Gestapo – die „bündische Jugend“. In: Faust, Anselm (Hg.): Verfolgung und Widerstand im Rheinland und Westfalen 1933–1945, Köln 1992, S. 175–185. –: Wilde Jugend. Lebenswelt großstädtischer Jugendlicher zwischen Weltwirtschaftskrise, Nationalsozialismus und Währungsreform, 2. Auflage, Essen 2002. –: Zwischen Nonkonformität und Widerstand. In: Süß, Dietmar/Süß, Winfried (Hg.): Das „Dritte Reich“. Eine Einführung, München 2008, S. 143–165. Kershaw, Ian: „Volksgemeinschaft. Potenzial und Grenzen eines neuen Forschungskonzepts. In: VfZ, 59 (2011) 1, S. 1–17. Kersting, Franz-Werner (Hg.): Jugend vor einer Welt in Trümmern. Erfahrungen und Verhältnisse der Jugend zwischen Hitler- und Nachkriegsdeutschland, Weinheim 1998. Kindt, Werner: Die deutsche Jugendbewegung 1920 bis 1933. Die bündische Zeit. Quellenschriften, Köln 1974.
444
Anhang
Kipp, Martin/Miller-Kipp, Gisela: Erkundungen im Halbdunkel. Einundzwanzig Studien zur Berufserziehung und Pädagogik im Nationalsozialismus, Frankfurt a. M. 1995. Klaus, Martin: Mädchen im 3. Reich. Der Bund Deutscher Mädel, Köln 1998. Klee, Ernst: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945, Frankfurt a. M. 2005. Klee, Katja: Im „Luftschutzkeller des Dritten Reiches“. Evakuierte in Bayern 1939– 1953: Politik, soziale Lage, Erfahrungen, München 1999. –: „Nie wieder Aufnahme von Kindern“. Anspruch und Wirklichkeit der KLV in den Aufnahmegauen. In: Martin Rüther (Hg.): „Zu Hause könnten sie es nicht schöner haben!“. Kinderlandverschickung aus Köln und Umgebung 1941–1945, Köln 2000. Kleindienst, Jonas: Die Wilden Cliquen Berlins. „Wild und frei“ trotz Krieg und Krise. Geschichte einer Jugendkultur, Frankfurt a. M. 2011. Klönne, Arno: Ein Leben aus dem Widerspruch. Michael Jovy (1920–1984). In: Jahrbuch des Archivs der Jugendbewegung, 15 (1984/85), S. 373–378. –: Hitlerjugend. Die Jugend und ihre Organisation im Dritten Reich (Dissertation), Hannover 1955. –: Jugendbündische Gegenkultur in Zeiten der Staatsjugend. In: Knoll, Joachim H. /Schoeps, Julius H. (Hg.): Typisch deutsch. Die Jugendbewegung, Wiesbaden 1988, S. 177–190. –: Jugendliche Opposition im „Dritten Reich“, Erfurt 1996 (Sonderausgabe der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen, Dresden 2005). –: Jugendprotest und Jugendopposition. In: Broszart, Martin/Fröhlich, Elke/Grossmann, Anton (Hg.): Bayern in der NS-Zeit, Band III: Herrschaft und Gesellschaft im Konflikt, Teil B, München 1981, S. 527–620. Knigge-Tesche, Renate/Ulrich, Axel (Hg.): Verfolgung und Widerstand in Hessen 1933–1945, Frankfurt a. M. 1996. Kollmeier, Kathrin: „Hinaus mit allen Störenfrieden!“. Der disziplinarrechtliche Ausschluss aus der Hitler-Jugend als Ausgrenzung aus der NS-Volksgemeinschaft. In: Chatriot, Alain (Hg.): Figurationen des Staates in Deutschland und Frankreich: 1870–1945, München 2006, S. 161–184. –: Ordnung und Ausgrenzung. Die Disziplinarpolitik der Hitler-Jugend, Göttingen 2007. Köster, Markus: Jugend, Wohlfahrtsstaat und Gesellschaft im Wandel. Westfalen zwischen Kaiserreich und Bundesrepublik, Paderborn 2001. Kösters, Christoph: Katholische Verbände und moderne Gesellschaft. Organisationsgeschichte und Vereinskultur im Bistum Münster 1918 bis 1945, Paderborn 1995. Krabbe, Wolfgang: Die gescheiterte Zukunft der ersten Republik. Jugendorganisationen bürgerlicher Parteien im Weimarer Staat, Opladen 1995. Kraus, Eva: Das Deutsche Jugendherbergswerk 1909–1933. Programm. Personen. Gleichschaltung, Berlin 2013. Krauss, Marita (Hg.): Rechte Karrieren in München. Von der Weimarer Zeit bis in die Nachkriegsjahre, Berlin 2010. Krehwinkel, Franz-Josef: Sturmschar unter dem NS-Regime. In: Börger, Bernd/ Schroer, Hans (Hg.): Sie hielten stand. Sturmschar und Katholischer Jungmännerverband Deutschlands, Düsseldorf 1989, S. 95–117.
Literaturverzeichnis
445
Krolle, Stefan: „Bündische Umtriebe“. Geschichte des Nerother Wandervogels vor und unter dem NS-Staat. Ein Jugendbund zwischen Konformität und Widerstand, Münster 1986. Kuropka, Joachim: Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Münster. Neuere Forschungen zu einigen Problemfeldern. In: Westfälische Zeitschrift. Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde, (1987) 138, S. 159–182. Kurz, Jan: „Swinging Democracy“. Jugendprotest im 3. Reich, Münster 1995. Lange, Alexander: Jungkommunisten – Meuten – Broadway-Cliquen. Drei Jugendgenerationen zwischen Resistenz und Widerstand in Leipzig. In: Weil/Heydemann/Schulte (Hg.): Sachsen und der Nationalsozialismus, S. 335–348. –: Meuten – Broadway-Cliquen – Junge Garde. Leipziger Jugendgruppen im Dritten Reich, Köln 2010. Lange, Sascha: Die Leipziger Meuten. Jugendopposition im Nationalsozialismus. 3. Auflage, Leipzig 2012. –: Meuten, Swings & Edelweißpiraten. Jugendkultur und Opposition im Nationalsozialismus, 2. Auflage, Mainz 2018. Langer, Hermann: „Im gleichen Schritt und Tritt“. Die Geschichte der Hitlerjugend in Mecklenburg von den Anfängen bis 1945, Rostock 2001. Lappin-Eppel, Eleonora: Ungarisch-Jüdische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen in Österreich 1944/45. Arbeitseinsatz. Todesmärsche. Folgen, Wien 2010. Laue, Gerhard: Meine Jugend in Erfurt unter Hitler 1933–1945. Ein Zeitzeuge erzählt, Bad Langensalza 2016. Lauterbacher, Hartmann: Erlebt und mitgestaltet. Kronzeuge einer Epoche 1923– 1945. Zu neuen Ufern nach Kriegsende, Preußisch Oldendorf 1984. Lehmann, Armin D.: Der letzte Befehl. Als Hitlers Botenjunge im Führerbunker, Bergisch Gladbach 2005. Lemke, Michael: Einheit oder Sozialismus? Die Deutschlandpolitik der SED 1949– 1961, Köln 2001. Lersner, Dieter von: Die Evangelischen Jugendverbände Württembergs und die Hitler-Jugend 1933/34, Göttingen 1958. Lieb, Peter: Konventioneller Krieg oder Weltanschauungskrieg? Kriegführung und Partisanenbekämpfung in Frankreich 1943/44, München 2007. Liedtke, Max: Einleitung. In: ders. (Hg.): Für Hitler erzogen? Briefe und Notizen des Edgar Winzen aus der Kinderlandverschickung Leutenberg/Thüringen 1944/45, Münster 1999" ist unter "Editionen und Quellensammlungen. Liesenberg, Carsten: „Wir täuschen uns nicht über die Schwere der Zeit …“. Verfolgung und Vernichtung der Juden. In: Detlev Heiden/Gunther Mai (Hg.): Nationalsozialismus in Thüringen, Weimar 1995, S. 443–462. Limbächer, Katja/Merten, Maike/Pfefferle, Bettina (Hg.): Das Mädchenkonzentrationslager Uckermark, 2. Auflage, Münster 2005, S. 99–114. Lindenberger, Thomas (Hg.): Herrschaft und Eigen-Sinn in der Diktatur, Köln 1999 Linse, Ulrich: Der Wandervogel. In: François, Etienne/Schulze, Hagen (Hg.): Deutsche Erinnerungsorte, Band 3, München 2001, S. 531–548. Lob, Brigitte: Albert Schmitt O.S.B. Abt in Grüssau und Wimpfen. Sein kirchenpolitisches Handeln in der Weimarer Republik und im Dritten Reich, Köln 2000 Lohmann, Hans-Martin: Eine Generation unter Verdacht. Jahrgang 1926/27. Erinnerungen an die Jahre unterm Hakenkreuz. In: Die Zeit vom 30.12.2007.
446
Anhang
Löffelsender, Michael: Strafjustiz an der Heimatfront. Die strafrechtliche Verfolgung von Frauen und Jugendlichen im Oberlandesgerichtsbezirk Köln 1939– 1945, Tübingen 2012. Lucks, Günter/Stutte, Harald: Der rote Hitlerjunge. Meine Kindheit zwischen Kommunismus und Hakenkreuz, Hamburg 2015. Lübbe, Hermann: Verdrängte oder historisierte Vergangenheit? Über alt gewordene Parteijunggenossen. In: Neven DuMont, Alfred (Hg.): Jahrgang 1926/27. Erinnerungen an die Jahre unter dem Hakenkreuz, Köln 2007, S. 221–229. Lüdtke, Alf: Eigen-Sinn. Fabrikalltag, Arbeitererfahrungen und Politik vom Kaiserreich bis in den Faschismus, Hamburg 1993. Mählert, Ulrich: Die Freie Deutsche Jugend 1945–1949, Paderborn 1995. Maiwald, Stefan/Mischler, Gerd: Sexualität unter dem Hakenkreuz. Manipulation und Vernichtung der Intimsphäre im NS-Staat, München 1999. Maline, Peter: Verfolgte Kindheit. Die Kinder vom „Spiegelgrund“ und ihre „Erzieher“. In: Kaufmann, Alois (Hg.): Totenwagen. Kindheit am Spielgrund, Wien 1991, S. 94–118. Manthe, Barbara: Zwischen jugendlichem Freizeitverhalten, Subkultur und Opposition. Unangepasste Jugendliche im nationalsozialistischen Köln. In: Geschichte im Westen, 22 (2007), S. 89–112. Marßolek, Inge/Ott, René: Bremen im Dritten Reich. Anpassung – Widerstand – Verfolgung, Bremen 1986. Maschmann, Melita: Fazit. Mein Weg in die Hitler-Jugend, 2. Auflage, München 1979. McKale, Donald M.: The Nazi Party Courts. Hitler’s Management of Conflict in his Movement 1921–1935, Kansas 1975. Mecking, Sabine/Wirsching, Andreas: Stadtverwaltung im Nationalsozialismus. Systemstabilisierende Dimensionen kommunaler Herrschaft, Paderborn 2005. Mennen, Johannes: Hitlerjugend in Wittmund 1933–1939, Wittmund 2000. Michael, Berthold: Schule und Erziehung im Griff des totalitären Staates. Die Göttinger Schulen in der nationalsozialistischen Zeit von 1933 bis 1945, Göttingen 1994. Miller-Kipp, Gisela: „Totale Erfassung“ – aber wie? Die Hitler-Jugend: Politische Funktion, psychosoziales Funktionieren und Momente des Widerstands. In: Becker, Stefanie/Studt, Christoph (Hg.): „Und sie werden nicht mehr frei sein ihr ganzes Leben“. Funktion und Stellenwert der NSDAP, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände im „Dritten Reich“, Münster 2012, S. 87–104. Mommsen, Hans: Die Pogromnacht und ihre Folgen. In: Gewerkschaftliche Monatshefte, (1988) 11, S. 591–604. –: Nationalsozialismus als vorgetäuschte Modernisierung. In: Pehle, Walther H. (Hg.): Der historische Ort des Nationalsozialismus. Annäherungen, Frankfurt a. M. 1990, S. 31–46. Mosse, George L.: Die deutsche Rechte und die Juden. In: Mosse, Werner E. (Hg.): Entscheidungsjahr 1932. Zur Judenfrage in der Endphase der Weimarer Repu blik, 2. Auflage, Tübingen 1966, S. 183–249. Müller, Beate: „Es war nicht richtig, daß Hitler die Juden ausstieß“. Judenverfolgung im Spiegel Nürnberger Schüleraufsätze von 1946. In: Weil, Francesca/Postert, André/Kenkmann, Alfons (Hg.): Kindheiten im Zweiten Weltkrieg, Halle 2018, S. 318–336.
Literaturverzeichnis
447
Muth, Heinrich: Jugendopposition im Dritten Reich. In: VfZ, 30 (1982) 3, S. 370–417. Nedoschill, Jan: Aufbruch im Zwielicht – die Entwicklung der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Zeit von Zwangssterilisation und Kindereuthanasie. In: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychatrie, 58 (2009) 7, S. 504–517. Negwer, Dorothea: Das Leben und ich: eine Jugend in Berlin und anderswo, Norderstedt 2004. Neugebauer, Manuela: Der Weg in das Jugendschutzlager Moringen. Eine entwicklungspolitische Analyse nationalsozialistischer Jugendpolitik, Mönchengladbach 1997. Niemeyer, Christian: Die dunklen Seiten der Jugendbewegung. Vom Wandervogel zur Hitlerjugend, 2. Auflage, Tübingen 2013. Noll, Dieter: Die Abenteuer des Werner Holt, Berlin 1973. Nolzen, Armin: Der Streifendienst der Hitler-Jugend (HJ) und die „Überwachung der Jugend“, 1934–1945. Forschungsprobleme und Fragestellungen. In: Gerlach, Christian (Hg.): Durchschnittstäter. Handeln und Motive, Berlin 2000, S. 13–52. –: „Streng vertraulich!“. Die Bekämpfung „gleichgeschlechtlicher Verfehlungen“ in der Hitlerjugend. In: zur Nieden, Susanne (Hg.): Homosexualität und Staatsräson. Männlichkeit, Homophobie und Politik in Deutschland 1900–1945, Frankfurt a. M. 2005, S. 253–281. –: Vom „Jugendgenossen“ zum „Parteigenossen“. Die Aufnahme von Angehörigen der Hitler-Jugend in die NSDAP. In: Wolfgang Benz (Hg.): Wie wurde man Par teigenosse? Die NSDAP und ihre Mitglieder, Frankfurt a. M. 2009, S. 123–150. Obst, Dieter: „Reichskristallnacht“. Ursachen und Verlauf des antisemitischen Pogroms im November 1938, Frankfurt a. M. 1991. Osterloh, Jörg: Nationalsozialistische Judenverfolgung im Reichsgau Sudetenland 1938–1945, München 2006. Osterrath, Franz: Sozialistische Arbeiterjugend. In: Kindt (Hg.), Die deutsche Jugendbewegung 1920–1933, S. 101 f. o. V.: Das Gute übernommen. In: Der Spiegel vom 27.3.1951. Pahlke, Georg: Trotz verbot nicht tot. Katholische Jugend in ihrer Zeit 1933–1945, Paderborn 1995. Pahmeyer, Peter/Spankeren, Lutz van: Die Hitlerjugend in Lippe (1933–1939). Totalitäre Erziehung zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Bielefeld 1998. Pallaske, Christoph: Die Hitlerjugend der Freien Stadt Danzig 1926–1939, Münster 1990. Pannewitz, Anja: Beobachtung und Ausschluss jugendlicher Swingtänzer im Dritten Reich. Folgen einer Konsensfiktion, Hamburg 2011. Paul, Gerhard/Mallmann, Klaus-Michael: Milieus und Widerstand. Eine Verhaltensgeschichte der Gesellschaft im Nationalsozialismus, Bonn 1995. Peschel, Andreas (Hg.): Die SA in Sachsen vor der „Machtübernahme“. Nachgelassenes von Heinrich Bennecke (1902–1972), Beucha 2012. Pfeiffer, Lorenz: „Auf zur Gefolgschaft und zur Tat!“ Deutsche Turnerschaft und Nationalsozialismus. Zwischen Selbstgleichschaltung und Selbstbehauptung? In: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, (1999) 4, S. 530–548. Polster, Bernd (Hg.): Swing Heil. Jazz im Nationalsozialismus, Berlin 1989. Popp, Wolfgang: Männerliebe. Homosexualität und Literatur, Stuttgart 1992.
448
Anhang
Postert, André: Von der Kritik der Parteien zur außerparlamentarischen Opposition. Die jungkonservative Klub-Bewegung in der Weimarer Republik und ihre Auflösung im Nationalsozialismus, Baden-Baden 2014. –/ Hanzig, Christoph: „Wir haben dafür zu sorgen, dass die Aussonderung differenziert geschieht.“ Hans Thomae und die Begutachtung junger Menschen während des Zweiten Weltkriegs. In: Psychosozial, 39 (2016) 4, S. 83–95. Preußner, Alfred: Erfolg ist nicht ohne Schatten, Norderstedt 2008. Rabe, Gerhard: Jugend unterm Hakenkreuz. Deutsches Jungvolk „DJ“ in der Hitlerjugend in Menninghüffen. Eine fragmentarische Privat-Dokumentation, S. 18 (http:// www.zellentrakt.de/downloads/materialien/Gerhard_Rabe.pdf; 15.7.2020). Ramm, Thilo: Familienrecht. Verfassung. Geschichte. Reform, Tübingen 1969. Rastetter, Daniela: Sexualität und Herrschaft in Organisationen. In: Müller, Ursula/ Riegraf, Birgit/Wilz, Sylvia (Hg.): Geschlecht und Organisation, Wiesbaden 2013. Rauschenbach, Thomas: Jugendverbände im Spiegel der Statistik. In: ders./Gängler, Hans/Böhnisch, Lothar (Hg.): Handbuch Jugendverbände. Eine Ortsbestimmung der Jugendverbandsarbeit in Analysen und Selbstdarstellungen, Weinheim 1991, S. 115–131. Rebentisch, Dieter/Raab, Angelika (Hg.): Neu-Isenburg zwischen Anpassung und Widerstand. Dokumente über Lebensbedingungen und politisches Verhalten 1933–1945, Neu-Isenburg 1978. Reese, Dagmar (Hg.): Die BDM-Generation. Weibliche Jugendliche in Deutschland und Österreich im Nationalsozialismus, Berlin 2007. –: Zum Stellenwert der Freiwilligkeit. Hitler-Jugend und NSDAP-Mitgliedschaft. In: Mittelweg 36, 19 (2010) 3, S. 63–83. –: Rezension in: Kundrus, Birthe/Meyer, Beate (Hg.): Die Deportation der Juden aus Deutschland. Pläne – Praxis – Reaktionen 1938–1945, 2. Auflage, Göttingen 2005. Reiß, Sven: „Renaissance des Eros paidikos“. Erotisch-sexuelle Leitbilder und Alltagspraxen in der deutschen Jugendbewegung. In: Braun, Karl/Linzner, Felix/ Khairi-Taraki, John (Hg.): Avantgarden der Biopolitik, Göttingen 2017, S. 61–76. Rendtorff, Rolf: Kontinuität im Widerspruch. Autobiographische Reflexionen, Göttingen 2007. Renger, Gustav: Meine Berge und Täler, Autobiographie, 2. Auflage, Braunschweig 2014. Retzlaff, Birgit/Lechner, Jörg-Johannes: Bund Deutscher Mädel in der Hitlerjugend. Fakultative Eintrittsgründe von Mädchen und jungen Frauen in den BDM, Hamburg 2008. Reyer, Herbert: Aurich im Nationalsozialismus, Aurich 1989. Riedel, Heinrich: Kampf und die Jugend. Evangelische Jugendarbeit 1933–1945, München 1976. Ristau, Daniel: Bruch|Stücke. Die Novemberpogrome in Sachsen, Leipzig 2018. Roegele, Otto B.: Gestapo gegen Schüler. Die Gruppe „Christopher“ in Bruchsal, Konstanz 1994. Rohkrämer, Thomas: Die fatale Attraktion des Nationalsozialismus. Über die Popularität eines Unrechtsregimes, Paderborn 2013. Roos, Daniel: Julius Streicher und „Der Stürmer“ 1923–1945, Würzburg 2013. Rosenbaum, Heide: „Und trotzdem war’s ne schöne Zeit“. Kinderalltag im Nationalsozialismus, Frankfurt a. M. 2014.
Literaturverzeichnis
449
Rosenkranz, Bernhard/Lorenz, Gottfried: Hamburg auf anderen Wegen. Die Geschichte des schwulen Lebens in der Hansestadt, Hamburg 2006. Rosenthal, Gabriele: „…wenn alles in Scherben fällt…“ Von Leben und Sinnwelt der Kriegsgeneration. Typen biographischer Wandlungen, Opladen 1987. Roth, Thomas: „Verbrechensbekämpfung“ und soziale Ausgrenzung im nationalsozialistischen Köln. Kriminalpolizei, Strafjustiz und abweichendes Verhalten zwischen Machtübernahme und Kriegsende, Köln 2010. Rothfels, Hans: Zur 25. Wiederkehr des 20. Juli 1944. In: VfZ, 17 (1969) 3, S. 237–254. Ruch, Martin: Das Novemberpogrom 1938 und der „Synagogenprozess“ 1948 in Offenburg. Verfolgte berichten, Täter stehen vor Gericht, Norderstedt 2008. Rüdiger, Jutta: Die Hitler-Jugend und ihr Selbstverständnis im Spiegel ihrer Aufgabengebiete, Studienausgabe, Lindhorst 1983. –: Ein Leben für die Jugend. Mädelführerin im Dritten Reich. Das Wirken der Reichsreferentin des BDM, Oldendorf 1999. Rusinek, Bernd-A.: Desintegration und gesteigerter Zwang: die Chaotisierung der Lebensverhältnisse in den Großstädten 1944/45 und der Mythos der Ehrenfelder Gruppe. In: Breyvogel (Hg.): Jugendwiderstand im Nationalsozialismus, S. 271–294. –: Köln-Ehrenfeld 1944 (Teilvorabdruck aus einer Dissertation über die ‚Edelweißpiraten‘ im Rahmen des Forschungsauftrages des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen über ‚Formen des Jugendwiderstandes im Dritten Reich unter besonderer Berücksichtigung der Kölner Verhältnisse‘ an den Lehrstuhl für Neueste Geschichte der Universität Düsseldorf, Prof. Dr. P. Hüttenberger), Düsseldorf 1987. Rüther, Martin: „Macht will ich haben“. Die Erziehung des Hitlerjungen Günther Roos zum Nationalsozialisten, Bonn 2017. –: „Senkrecht stehen bleiben“. Wolfgang Ritzer und die Edelweißpiraten. Unangepasstes Jugendverhalten im Nationalsozialismus und dessen späte Verarbeitung, Köln 2015. Sack, Heidi: Moderne Jugend vor Gericht. Sensationsprozesse, „Sexualtragödien“ und die Krise der Jugend in der Weimarer Republik, Bielefeld 2016. Sander, Ulrich: Jugendwiderstand im Krieg. Die Helmuth-Hübener-Gruppe 1941/1942, Bonn 2000. Sandkühler, Thomas (Hg.): Historisches Lernen denken. Gespräche mit Geschichtsdidaktikern der Jahrgänge 1928–1947. Mit einer Dokumentation zum Historikertag 1976, Göttingen 2014. Sauer, Doris: Erinnerungen. Karl Haiding und die Forschungsstelle „Spiel und Spruch“, Wien 1993. Schäfer, Franz Josef: Willi Graf und der Graue Orden. Jugendliche zwischen Kreuz und Hakenkreuz, Sankt Ingbert 2017. Schäfer, Wolfram: Fürsorgeerziehung und Jugendpsychiatrie im Nationalsozialismus. In: Jugendhilfe, 42 (2004) 4, S. 184–192. Schellenberger, Barbara: Katholische Jugend und Drittes Reich. Eine Geschichte des Katholischen Jungmännerverbandes 1933–1939 unter besonderer Berücksichtigung der Rheinprovinz, Mainz 1975.
450
Anhang
Scheuch, Erwin K.: Der Umbrach nach 1945 im Spiegel der Umfragen. In: Gerhardt, Ute/Mochmann, Ekkehard (Hg.): Gesellschaftlicher Umbruch 1945– 1990. Re-Demokratisierung und Lebensverhältnisse, München 1992, S. 9–26. Schiermeier, Franz: Jugend im Nationalsozialismus, München 2012. Schilde, Kurt: Jugendopposition 1933–1945, Berlin 2007. Schiller, Dieter: Der Traum von Hitlers Sturz: Studien zur deutschen Exilliteratur 1933–1945, Frankfurt a. M. 2010. Schirach, Baldur von: Ich glaubte an Hitler, Hamburg 1967. Schmidt, Uwe: Hamburger Schulen im „Dritten Reich“, Band 1, Hamburg 2010. Schmiechen-Ackermann, Detlef/Buchholz, Marlis/Roitsch, Bianca/Schröder, Christiane (Hg.): Der Ort der „Volksgemeinschaft“ in der deutschen Gesellschaftsgeschichte, Paderborn 2018. Schmuhl, Hans-Walter: Halle in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. In: Freitag, Werner/Minner, Katrin (Hg.): Geschichte der Stadt Halle. Band 2: Halle im 19. und 20. Jahrhundert, Halle 2006, S. 237–302. Schneider, Gerold: Vergangenheit, die nicht vergehen will, Leipzig 1998. Schneider, Michael: Unterm Hakenkreuz: Arbeiter und Arbeiterbewegung, 1933 bis 1939, Bonn 1999. Schoppmann, Claudia: Nationalsozialistische Sexualpolitik und weibliche Homosexualität, 2. Auflage, Pfaffenweiler 1997. Schörken, Rolf: Die Niederlage als Generationserfahrung. Jugendliche nach dem Zusammenbruch der NS-Herrschaft, Weinheim 2004. –: Jugend 1945. Politisches Denken und Lebensgeschichte, Frankfurt a. M. 1994. –: Luftwaffenhelfer und Drittes Reich. Die Entstehung eines politischen Bewusstseins, Stuttgart 1983. Schreckenberg, Heinz: Erziehung, Lebenswelt und Kriegseinsatz der deutschen Jugend unter Hitler. Anmerkungen zur Literatur, Münster 2001. –: Ideologie und Alltag im Dritten Reich, Frankfurt a. M. 2003. Schubert-Weller, Christoph: Hitlerjugend. Vom „Jungsturm Adolf Hitler“ zur Staatsjugend des Dritten Reiches, Weinheim 1993. Seibert, Winfried: Die Kölner Kontroverse. Legenden und Fakten um die NS-Verbrechen in Köln-Ehrenfeld, Essen 2014. Seidelmann, Kurt: Die Pfadfinder in der deutschen Jugendgeschichte, Teil 2.1: Quellen und Dokumente aus der Zeit bis 1945, Hannover 1980. Sieb, Rainer: Der Zugriff der NSDAP auf die Musik. Zum Aufbau von Organisationsstrukturen für die Musikarbeit in den Gliederungen der Partei (Diss.), Osnabrück 2007. Siemsen, Hans: Die Geschichte des Hitlerjungen Adolf Goers, Düsseldorf 1947. Skyba, Peter: Die FDJ im Kreislauf von Krise und Reform. Jugendpolitik als Konfliktfeld von Herrschaft und Gesellschaft in der DDR. In: Totalitarismus und Demokratie, 12 (2015) 2, S. 269–287. –: Vom Hoffnungsträger zum Sicherheitsrisiko. Jugend in der DDR und Jugendpolitik der SED 1949–1961, Köln 2000. Speitkamp, Winfried: Jugend in der Neuzeit. Deutschland vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, Göttingen 1998. Stambolis, Barbara: „Fest soll mein Taufbund immer stehn“. Jugendliche im katholischen Milieu oder die Grenzen der Gleichschaltung – Lebensweltlich geprägte
Literaturverzeichnis
451
Resistenzräume im Dritten Reich. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, (2000) 3, S. 157–172. Steinacker, Sven: „… fachlich sauber und im Geist des Nationalsozialismus …“. Volksgemeinschaftsideologie und Fürsorgeerziehung nach 1933. In: Neue Praxis, (2008) 5, S. 459–477. Steinlein, Rüdiger: Der nationalsozialistische Jugendfilm. Der Autor und Regisseur Alfred Weidemann als Hoffnungsträger der nationalsozialistischen Kulturpolitik. In: Köppen, Manuel/Schütz, Erhard (Hg.): Kunst und Propaganda. Der Film im Dritten Reich, 2. Auflage, Berlin 2008. S. 217–246. Steinweis, Alan E. Kristallnacht 1938, London 2009. Sternberg-Siebert, Elisabeth: Jüdisches Leben im Hünfelder Land. Juden in Burghaun, 2. Auflage, Petersberg 2008. Sternheim-Peters, Eva: Die Zeit der großen Täuschungen. Eine Jugend im Nationalsozialismus, Bielefeld 1992. Storjohann, Uwe: Ohne Tritt im Lotterschritt. In: Ritter, Franz (Hg.): Heinrich Himmler und die Liebe zum Swing, Leipzig 1994, S. 109. Stoverock, Karin: Musik in der Hitlerjugend. Organisation, Entwicklung, Kontexte, 2 Bände, Uelvesbüll 2013. Strohmeyer, Kurt: Knochenarbeit im Gaswerk. In: Jürgen Kleindienst (Hg.): Gebrannte Kinder. Kindheit in Deutschland 1939–1945, Band 1, Berlin 1998, S. 104–109. Süß, Dietmar: Die deutsche Gesellschaft im Dritten Reich, München 2017 Tabor, Jan: … Und sie folgten ihm. Österreichische Künstler und Architekten nach dem „Anschluss“ 1938. Eine Reportage. In: Historisches Museum der Stadt Wien (Hg.): Wien 1938, Wien 1988, S. 398–430. Tautz, Joachim: Militaristische Jugendpolitik in der Weimarer Republik. Die Jugendorganisationen des Stahlhelms, Bund der Frontsoldaten: Jungstahlhelm und Scharnhorst, Bund deutscher Jungmannen, Regensburg 1998. Thoma, Matthias: Das Zusammenspiel von Hitlerjugend und Vereinen am Beispiel Eintracht Frankfurt. In: Herzog, Markwart (Hg): Fußball zur Zeit des Nationalsozialismus. Alltag. Medien. Künste. Stars, Stuttgart 2008. Thomae, Hans: Beobachtung und Beurteilung von Kindern und Jugendlichen, Basel 1957. Trost, Ralph: Eine gänzlich zerstörte Stadt. Nationalsozialismus, Krieg und Kriegsende in Xanten, Band 1, Münster 2004. Ueberall, Jörg: Swing-Kids, 2. Auflage, Berlin 2015. Uellenberg-van Dawen, Wolfgang: Gegen Faschismus und Krieg. Die Auseinandersetzungen sozialdemokratischer Jugendorganisationen mit dem Nationalsozialismus, Essen 2014. Ulrich, Bernd (Hg.): Mann für Mann. Biographisches Lexikon zur Geschichte von Freundesliebe und mannmännlicher Sexualität im deutschsprachigen Raum, Teilband 2, Berlin 2010. Vollmer, Bernhard: Volksopposition im Polizeistaat. Gestapo- und Regierungsberichte 1934–1936, Stuttgart 1957. Vollnhals, Clemens: Der bündische Widerstandskreis um Karl Otto Paetel. Nationalrevolutionäre Ideologie und Politik aus dem Exil. In: Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte, 15 (1986), S. 399–430.
452
Anhang
Wachsmann, Nikolaus: Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, München 2015. Wagner, Georg: Nationalsozialismus in Erwitte und der kirchliche Widerstand unter Pfarrer Eberhard Klausenberg. In: Westfälische Zeitschrift, (1983) 133, S. 337–384. Wapler, Friederike: Kinderrechte und Kindeswohl. Eine Untersuchung zum Status des Kindes im Öffentlichen Recht, Tübingen 2015. Weigelt, Andreas: Fallgruppenübersicht und Erschließungsregister. Leitfaden für die biographische Dokumentation. In: ders./Müller, Klaus-Dieter/Schaarschmidt, Thomas/Schmeitzner, Mike (Hg.): Todesurteile sowjetischer Militärtribunale gegen Deutsche. Eine historisch-biographische Studie, Göttingen 2015, S. 159–416. Weihsmann, Helmut: Bauen unterm Hakenkreuz. Architektur des Untergangs, Wien 1998. Weil, Francesca/Heydemann, Günther/Schulte, Jan Erik (Hg.): Sachsen und der Nationalsozialismus, Göttingen 2014. Weinbecker, Michael: Schulfrei zur Reichspogromnacht. Ein Überblick über die Judenverfolgung in Mainz 1933–1945. In: Tribüne, (1992) 121, S. 203–210. Werkstatt für Schulgeschichte Leipzig (Hg.): Kinder in Uniform. Generationen im Gespräch über Kindheit und Jugend in zwei deutschen Diktaturen, Leipzig 2008. Werner, Robert: Der Jungdeutsche Orden im Widerstand. 1933–1945, München 1980. Westemeier, Jens: Himmlers Krieger. Joachim Peiper und die Waffen-SS in Kriegsund Nachkriegszeit, 2. Auflage, Paderborn 1998. Wiesemann, Falk: „Erziehung in Deutschland“. Nationalsozialistische Staatsjugend in Düsseldorf. In: Erika Welkerling/Falk Wiesemann (Hg.): Unerwünschte Jugend im Nationalsozialismus. „Jugendpflege“ und Hilfsschule im Rheinland 1933–1945, Essen 2005, S. 21–51. Wildt, Michael: „Volksgemeinschaft“. Eine Antwort auf Ian Kershaw. In: Zeithistorische Forschungen, (2011) 8, S. 102–109. Winter, Martin Clemens: Gewalt und Erinnerung im ländlichen Raum. Die deutsche Bevölkerung und die Todesmärsche, Berlin 2018. Woche, Klaus-Rainer: Gestern war’s noch besser. Rückblick und Ausblick eines Deutschen vom Jahrgang 1927, Starnberger See 1997. Wolf, Hans: Geschichte des Archivs der deutschen Jugendbewegung. In: Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung, 2 (1970), S. 115–128. Wolffsohn, Michael: Deutschjüdische Glückskinder. Eine Weltgeschichte meiner Familie, München 2016. Wolkerstorfer, Otto: Baden 1939. Das Tor zur Zerstörung. Der Alltag im Nationalsozialismus, Baden 1999. Wolter, Stefanie: Lebenssituationen und Repressionen von LSBTI im Nationalsozialismus. Desiderate und Perspektiven der Forschung. In: Schwartz, Michael (Hg.): Homosexuelle im Nationalsozialismus. Neue Forschungsperspektiven zu Lebenssituationen von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen Menschen 1933 bis 1945, München 2014, S. 43–52. Zarusky, Jürgen: „… nur eine Wachstumskrankheit“? Jugendwiderstand in Hamburg und München. In: Dachauer Hefte, (1991) 7: Solidarität und Widerstand, S. 210–229.
Literaturverzeichnis
453
Zehnter, Anette: Widerstand und Verfolgung in Bochum und Wattenscheid 1933– 1945, Essen 1992. Zinn, Alexander: „Aus dem Volkskörper entfernt“? Homosexuelle Männer im Nationalsozialismus, Frankfurt 2018. –: Die soziale Konstruktion des homosexuellen Nationalsozialisten. Zu Genese und Etablierung eines Stereotyps, Berlin 1997.
Personenverzeichnis
4.
455
Personenverzeichnis
Seitenangaben mit Asteriskus beziehen sich auf Fußnoten. Albrecht, Otto 391 Aly, Ernst 242 Ammerlahn, Gotthart 57, 130 Aull-Fürstenberg, Margret 288 Axmann, Artur 15, 36, 121, 136, 142, 220, 229, 232, 269, 272, 281, 288, 300, 302, 308, 315, 333, 368 f, 385, 400, 415, 419 Baberowski, Jörg 378 Beck, Heinz 204 Bender, Hans 109, 111 Benecke, Jacob 24 Bennecke, Heinrich 36 Bersch, Hans-Jürgen 112 Biege, Walter 400 Bienert, Hannes 110 Birner, Adam 103 Blomberg, Werner von 250 Blome, Gretel 188 Blome, Karl 188 Blüher, Hans 180 Bondy, Curt 411 Börger, Wilhelm 218 Bormann, Martin 21, 405 Bormann, Martin (junior) 21 Brakelmann, Günter 69 Brandenburg, Hans C. 16 Brandl, Victor 258–261, 266 f. Bremser, Hermann 204 Broszat, Martin 393 Bruyn, Günter de 158, 234 Brückner, Peter 231 Brüß, Rosemarie 187 Buddrus, Michael 16, 25, 250 f., 279, 354 Burkhof, Karl 223 Busch, Willhelm 96 Clay, Lucius D. 418 Coch, Friedrich 75
Dähnhardt, Heinz 47 Dames, Günther 135 Damson, Willi 239 Deinert, Heinz 135 Dickhaut, Walter 176 Dustmann, Hanns 241 Eckhold, Wolf-Herrmann 216 Eichen, Heinrich 180 Eilers, Elfriede 192 Epp, Waldemar 134 Eriksson , Gösta 420 Esser, Max 197 Euchner, Willi 56* Everwyn, Klaus 326, 409 Faulhaber, Michael von 62, 185 Fehlauer, Heinz 403 Fliege, Paul 63 Franken, Elisabeth 261 Frei, Norbert 393 Freund, Werner 73 Friedländer, Otto 9–13, 100, 114, 118, 128 f., 162, 177, 187, 189 Fuchs, Friedhelm 81 Gerhardt, Werner 37 Glashagen, Heinz 35 Gloy, Thomas 16 Goebbels, Joseph 222, 225 Goebbels, Magda 33 Goers, Adolf 176 Göring, Hermann 150 Grace, Alonzo G. 411 Graf, Ulrich 258 f. Graf, Willi 60 Graml, Hermann 11, 15 Grube, Ernst 87 Gruber, Kurt 31–34, 139, 191 Gruner, Wolf 227, 233 Gschnitzer, Franz 396 Gugel, Rudolf 164 Günther, Hanno 325
456 Haaßengier, Wolfgang 295, 311 Hall, Robert C. 419 Happe, Konrad 112 Härtel, August 389 Hartnagel, Fritz 188 Hauer, Jacob 84 Heinze, Hans 391 Helldorf, Wolf-Heinrich von 220 Hemme, Hans 43 Hermann, Konstantin 343 Hermannsen, Walter 190 Hess, Rudolf 221 Hey, Richard 337 Heyden, Bogislav von 397 Heydrich, Reinhard 134, 334, 347 Heydrich, Lina 340 Hildebrandt, Friedrich 53 Hildebrandt, Dieter 393 Himes, Norman 410 f. Himmler, Heinrich 281, 333 f., 340, 351 f., 369 Hitler, Adolf 11, 13, 32 f., 38–41, 47, 51, 56, 68, 88, 100, 131 f., 134, 168, 215, 233, 251, 259, 270, 327, 330 Hoffmann, Albert 311 Hofmann, Otto 218 Hogrefe, Lühr 289 Hohloch, Hugo 75 Hohoff, Heinz 89 f. Homburg, Walter 50* Honecker, Margot 420 Horchem, Hans Josef 83, 320 f. Hübener, Helmut 325 Hütte, Friedrich 317 Jahn, Erich 121, 135 Jahnke, Karl Heinz 15 Jandl, Ernst 334 Jonas, Peter 330 Jordan, Rudolf 283 Jovy, Michael 60 Jülich, Jean 222 Jurzek, Wilhelm 420 Kaißling, Paul 98 Kalla, Theodor 155 Kater, Michael 15, 118, 227, 333
Anhang Katz, Kasimir 209 Kaufmann, Günther 268, 496* Kemper, Friedrich 62, 242 Kemper, Friedhelm 367 Kenkmann, Alfons 18, 261, 353 Kerrl, Hans 185 f. Kindt, Werner 52 Kittel, Helmut 51 Klein, Emil 86, 225 f., 230 Klingenbeck, Walter 325 Klinsch, Sonja 420 Klönne, Arno 18, 80, 196, 198, 213, 290 f. Koebel, Eberhardt 52 f. Kohlmeyer, Wilhelm 41, 47, 52, 333 König, Josef 311 König, Wolfhilde von 308 Köppe, Franz 102, 194 Köpper, Georg 111 Körber, Willi 187 Kösters, Christoph 66 Kötting, Hans 331 Kramer, Walter 58, 142, 178 Krebs, Alfred 47 Krebs, Wolfgang 118 Kremers, Josef 285 Kröcher, Walter 171, 311 Kronacher, Erich 179 Kügler, Hermann 51 Lack, Günther 217 Lämmermann, Karl 133, 173 Lammers, Hans Heinrich 250 Lange, Sascha 18 Langer, Gerhard 217 Laue, Gerhard 85, 197, 304, 335 Lauser, Götz 56* Lauterbacher, Hartmann 130, 142, 187, 235, 239, 257, 267 Leffler, Siegfried 131 Leiter, Anna 390 Lenz, Siegfried 393 Lersch, Phillipp 387 Leutheuser, Julius 131 Liebs, Ludwig 52 Lindemann, Ursula 304, 417 Lindenburger, Hermann 67 Lingg, Anton 400
Personenverzeichnis Linke, Karl 76 Lohmann, Hans-Martin 393 Loose, Alfred 142 Lübbe, Hermann 403 Lucks, Günter 112 Lüdtke, Alf 17 Ludwig, Martin 132 f., 173 Maaß, Hermann 40, Mahraun, Artur 46 Mann, Klaus 176 Mann, Erika 187 Mann, Thomas 336 Maschmann, Melita 48, 129, 197, 229 Mesch, Eckhardt 408 Meyer, (Gefolgschaftsführer Essen) 195 Meyer, Walter 327 Mezger, Helmut 72 Michel, Luise 229 Möckel, Marga 187 Möckel, Helmut 319, 384 f. Modrow, Hans 397 Mommsen, Hans 196 Mork, Werner 42 Muders, Paul 321 Müller, Ludwig 69–72 Müller, Hans 120 Muth, Heinrich 354 Mutschmann, Martin 180, 349, 384 Nabersberg, Karl 39 Nagel, Irmgard 336 Negwer, Dorothea 162 Neuendorff, Edmund 88 f. Neupert, Hugo 247 Niemeyer, Christian 16, 49 Noll, Dieter 317 Nolzen, Armin 226, 398, 400 Norkus, Herbert 37 Ollenhauer, Erich 42 Omankowsky, Manfred 344 Otto, Eberhardt 192 Paetel, Karl Otto 120 Papen, Franz von 47
457
Pöhler, Konrad 65 Pohlmann, Erich 43 Pösl, Ludwig 227 Pötschke, Kurt 90 Preußner, Alfred 321 Pröll, Anna 43 Quednow, Fritz 117 Queitzsch, Hans 37 Rahäuser, Kurt 313 Ratzenberger, Karl 155 Raupach, Hans 51 Reckewerth, Richard 81 Rede, Ernst 56* Reeder, Eggert 280 Reese, Dagmar 24, 318, 398 Reichmann, Hans 223 Rendtorff, Rolf 82 Renteln, Theodor Adrian von 33 Riedt, Theodor 56, 58 Riegels, Friedrich 73 Riegraf, Oskar 131 Riethmüller, Otto 71 Röhm, Ernst 134 Roos, Günther 191, 225, 399 Roos, Daniel 210 Roth, Elfriede 205 Ruder, Willi 36 Rüdiger, Jutta 23, 92, 95, 208 f., 219, 228 f., 312, 314, 319, 419 Rust, Bernhard 102, 110, 250 Ruth, Karl 55 f. Rüther, Martin 28 Sauer, Doris 307 Schaar, Reimer 349 Schäfer, Ernst 291 Schall, Franz 33–35, 49, 101, 132, 137, 190, 197 Schapke, Richard 120 Scheller, Thilo 90 Schirach, Baldur von 9, 11, 15, 33, 37, 39–41, 51–53, 63 f., 66, 69 f., 83, 85, 89–91, 94, 96, 101 f., 113, 121, 123, 128-130, 136 f., 139, 142, 156 f., 159*, 161, 176, 183, 191, 208, 211, 230–232, 239–242,
458 244, 246, 248, 250–252, 268–270, 319, 395 Schleicher, Kurt von 47 Schmidt, Lisl 99 Schmidt-Voigt, Jörgen 336 f. Schmeitzner, Günter 364 Schmotz, Dieter 420 Schnaedter, Franz August 132 f., 173 Scholl, Hans 20, 56, 325 Scholl, Sophie 20, 162, 188, 325 Scholl, Inge 162 Schörken, Rolf 317 f., 323 Schröder, Paul 387, 390 Schröter, Rudolf 37 Schroth, Hansgeorg 68 Schubert-Weller, Christoph 51 Schulz, Horst 409 Schwarz, Helmut 232 Schwarz, Franz Xaver 403 Schwerin von Krosigk, Johann Ludwig 239, 251 Seldte, Franz 45 Siemsen, Hans 176 f., 187, 190 Sonnemann, Eric 205 Spieß, Heinz 131 Stambolis, Barbara 65 Stange, Erich 70 Steimle, Theodor 241 Steinweis, Alan E. 226 Stern, Guy 192 Sternheim-Peter, Eva 213, 412 Storjohann, Uwe 328 Strasser, Otto 120 Strasser, Gregor 120 Strauss, Herbert 219 Süß, Dietmar 226
Anhang Teichmann, Gerhard 124 Tetens, Friedrich 186 Thalheimer, Walter 219 Thomae, Hans 386–390 Tillich, Germaine 380 Trachtenberg, Egon 223 Tröndle, Wilhelm 234 Trotha, Adolf von 51 f. Tschammer und Osten, Hans von 88 Usadel, Georg 239 Vogt, Ludwig 40 Volkmer, Inge 315 Walser, Martin 393, 399 Wapnewski, Peter 199 Weber, Alfred 311 Wehler, Hans-Ulrich 393 Weiland, Eduard 87 f. Weimar, Viktor 44 Wiener, Jacob 192 Winter, Simon 47 Winter, Martin 304 Wolff, Günther 55 Wolff, Paul Mark John 214 Wolker, Ludwig 64 Zahn, Karl Friedrich 70 f. Ziegler, Hermann 45 f. Ziegler, Konrad 421 Zinn, Alexander 175 Zuckermann, Hugo 212

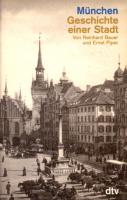

![Chicago. Die Geschichte einer Wunderstadt [2 ed.]](https://dokumen.pub/img/200x200/chicago-die-geschichte-einer-wunderstadt-2nbsped.jpg)
![Stradivari: Die Geschichte einer Legende [1 ed.]
9783205212065, 9783205212041](https://dokumen.pub/img/200x200/stradivari-die-geschichte-einer-legende-1nbsped-9783205212065-9783205212041.jpg)





![Die Hitlerjugend: Geschichte einer überforderten Massenorganisation [1 ed.]
9783666360985, 9783525360989](https://dokumen.pub/img/200x200/die-hitlerjugend-geschichte-einer-berforderten-massenorganisation-1nbsped-9783666360985-9783525360989.jpg)