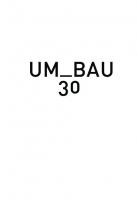Die Fakultät für Architektur und Raumplanung 9783205202271, 9783205201199
149 19 8MB
German Pages [187] Year 2015
Polecaj historie
Citation preview
Technik für Menschen 200 Jahre Technische Universität Wien, herausgegeben von Sabine Seidler Band 7
Rudolf Scheuvens (Hg.)
DIE FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR UND RAUMPLANUNG THE FACULT Y OF ARCHITECTURE AND PLANNING
2016 BÖHLAU VERLAG WIEN · KÖLN · WEIMAR
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://portal.dnb.de abrufbar. Umschlagabbildung: © Daniel Dutkowski © 2016 by Böhlau Verlag Ges.m.b.H & Co.KG, Wien Köln Weimar Wiesingerstraße 1, 1010 Wien, www.boehlau-verlag.com Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig. Übersetzung: Word Up!, LLC Korrektorat: Kathrin Wojtowicz, Wien Graphisches Konzept: Büro mit Aussicht Umschlaggestaltung: Michael Haderer, Wien Satz: Michael Rauscher, Wien Druck und Bindung: Theiss, St. Stefan Gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papier Printed in the EU ISBN 978-3-205-20119-9
INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENT VORWORT DER REKTORIN FOREWORD FROM THE RECTOR
9
Christoph Luchsinger STÄDTEBAU URBAN DESIGN
39
VORWORT DES DEKANS FOREWORD FROM THE DEAN
10
Richard Stiles, Norbert Trolf, Peter Kurz, Gisa Ruland LANDSCHAFTSARCHITEKTUR AN DER
Entwurf und Design Drafting and Design
TU WIEN LANDSCAPE ARCHITECTURE AT THE TU WIEN 43
Christian Kühn NUTZERORIENTIERTE ARCHITEKTUR USER-ORIENTED ARCHITECTURE
Ein weiter Horizont – spannende Schnittstellen! Broad Horizons – Exciting Interfaces!
Paul Rajakovics, Helmut Schramm HERAUSFORDERUNG WOHNEN THE HOUSING CHALLENGE
13
17
Marina Döring-Williams ARCHITEKTUR UND RAUMPLANUNG: FORSCHUNG UND LEHRE ARCHITECTURE AND PLANNING: RESEARCH AND TEACHING
Françoise-Hélène Jourda † WAS ZEICHNET DAS ARCHITEKTUR-STUDIUM IN WIEN BESONDERS AUS? WHAT IS SPECIAL ABOUT STUDYING ARCHITECTURE IN VIENNA? 23 Astrid Staufer, Thomas Hasler FORSCHENDES ENTWERFEN RESEARCH-BASED DESIGN
25
Gerhard Steixner DIE MÖGLICHKEIT EINER INSEL THE POSSIBILITY OF AN ISLAND
29
András Pálffy RETROPERSPEKTIVE. ANMERKUNGEN ZU EINER ARCHITEKTONISCHEN PRAXIS RETRO-PERSPECTIVE. NOTES ON AN ARCHITECTURAL PRACTICE
33
49
Nott Caviezel DENKMALPFLEGE ALS THEORIE DER PRAXIS HISTORIC PRESERVATION AS THEORY OF PRACTICE 53 Robert Stalla LEHRKANZEL KUNSTGESCHICHTE: GESTERN – HEUTE – MORGEN THE CHAIR OF ART HISTORY: YESTERDAY – TODAY – TOMORROW
59
Georg Franck-Oberaspach AUCH „PEER-TO-PEER“ UND „OPEN SOURCE“ GEHÖREN ZUR DIGITALEN KULTUR DIGITAL CULTURE INCLUDES “PEER-TO-PEER” AND “OPEN SOURCE” 65
Inhaltsverzeichnis | 5
Wolfgang Winter, Alireza Fadai TRAGWERK UND ARCHITEKTUR: ÜBER LOGISCHE STRUKTUREN UND RESSOURCENEFFIZIENTE MATERIALISIERUNG. ZU DEN KOMPLEXEN BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEM, WAS TRÄGT, UND DEM, WAS GETRAGEN WIRD STRUCTURAL DESIGN AND ARCHITECTURE: ON LOGICAL STRUCTURES AND RESOURCE EFFICIENT MATERIALISATION – THE COMPLEX INTERACTION BETWEEN THAT WHICH SUPPORTS AND THAT WHICH IS SUPPORTED 69 Ardeshir Mahdavi ÜBER DEN WACHSENDEN HORIZONT DER BAUPHYSIK ON THE EXPANDING HORIZON OF BUILDING PHYSICS 75 Dörte Kuhlmann KRITISCHE ARCHITEKTURTHEORIE CRITICAL ARCHITECTURAL THEORY Karin Harather, Otto Mittmannsgruber DAS SURPLUS DER KUNST IN DER ARCHITEKTURAUSBILDUNG THE SURPLUS OF ART IN ARCHITECTURE TRAINING
79
85
Christian Kern ENTWICKLUNG UND ERSCHLIESSUNG DER KÜNSTE AN DER TU WIEN THE ADVANCEMENT AND APPRECIATION OF THE ARTS AT THE TU WIEN 91
Raumplanung im Spannungsfeld der Disziplinen Spatial Planning Between the Disciplines Michael Getzner VON DER UNMÖGLICHKEIT, IN DER RAUMPLANUNG AUF EINEN LETZTGÜLTIGEN GRÜNEN ZWEIG ZU KOMMEN ON THE IMPOSSIBILITY OF ARRIVING AT A FINAL SOLUTION IN SPATIAL PLANNING 99 Franz Zehetner RECHTSWISSENSCHAFTEN AN EINER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT? LEGAL SCIENCES AT A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY?
Rudolf Giffinger TERRITORIALES KAPITAL ALS GRUNDLAGE UND MOTOR RÄUMLICHER ENTWICKLUNG TERRITORIAL CAPITAL AS THE FOUNDATION AND MOTOR OF SPATIAL DEVELOPMENT 113 Johann Bröthaler, Michael Getzner ÖKONOMISCHE PERSPEKTIVEN DER RAUMPLANUNG ECONOMIC PERSPECTIVES OF SPATIAL PLANNING
119
Andreas Voigt ÖRTLICHE RAUMPLANUNG – RAUM GESTALTEN LOCAL PLANNING – SHAPING SPACE
123
Martin Berger, Georg Hauger, Bardo Hörl, Michael Klamer VERKEHRSSYSTEMPLANUNG ALS POLYTECHNIK TRAFFIC SYSTEM PLANNING AS POLYTECHNOLOGY
6 | Inhaltsverzeichnis
107
129
Stefanie Simic (Fachschaft Raumplanung) RAUS AUS DEM SCHATTEN!
Jens S. Dangschat GESELLSCHAFTLICHE ASPEKTE DER RAUMPLANUNG, DES STÄDTEBAUS UND DER ARCHITEKTUR SOCIAL ASPECTS OF SPATIAL PLANNING, URBAN DESIGN, AND ARCHITECTURE
135
Team Regionalplanung und Regionalentwicklung 11 POSITIONEN ZUR REGION 11 REGIONAL APPROACHES
141
OUT OF THE SHADOWS!
171
Rudolf Giffinger, Martin Berger EVIDENZBASIERTE STEUERUNGSANSÄTZE FÜR EINE ENERGIEEFFIZIENTE RAUMENTWICKLUNG EVIDENCE-BASED STEERING APPROACHES TO ENERGY-EFFICIENT SPATIAL DEVELOPMENT
175
Oliver Frey FASZINATION URBANISTIK FASCINATING URBANITY, FASCINATING URBANISM
147
Claudia Yamu, Andreas Voigt WEGE IN DIE STADT DER ZUKUNFT PATHS TO THE CITY OF THE FUTURE
155
Rudolf Scheuvens, Anna Kokalanova FUTURE.LAB: PLATTFORM FÜR EXPERIMENTELLE UND INTERDISZIPLINÄRE LEHRE UND FORSCHUNG FUTURE.LAB: PLATFORM FOR EXPERIMENTAL AND INTERDISCIPLINARY TEACHING AND RESEARCH 179
159
VERZEICHNIS DER AUTORINNEN UND AUTOREN INDEX OF AUTHORS
184
BILDNACHWEIS PHOTO CREDITS
186
Sabine Knierbein STADTKULTUR UND ÖFFENTLICHER RAUM URBAN CULTURE AND PUBLIC SPACE Zwei Studienrichtungen unter einem Dach Two Fields of Study Under One Roof Daniela Markova, Bojan Ikic, Simon Sellner (fachschaft::architekTUr) 200 JAHRE – WIDERSTAND, FREIHEIT UND SCHWEIGEN 200 YEARS – RESISTANCE, FREEDOM, AND SILENCE
165
Inhaltsverzeichnis | 7
VORWORT DER REKTORIN FOREWORD FROM THE RECTOR Die Technische Universität Wien, gegründet am 6. November 1815 als k. k. Polytechnisches Institut, feiert ihren 200. Geburtstag. Ihre institutionellen Wurzeln liegen im Bereich der militärischen und gewerblich-technischen Fachschulen, die in ganz Europa seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts entstanden. Hintergrund dieser Neugründungen war ein wachsender Bedarf der staatlichen Verwaltungen, des Militärs und der Wirtschaft an Fachkräften mit technisch-naturwissenschaftlicher Ausbildung. Heute sind wir eine moderne Forschungsuniversität. Mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, forschen und lehren an Österreichs größter naturwissenschaftlich-technischer Forschungs- und Bildungseinrichtung. Voraussetzung für eine weiterhin erfolgreiche Weiterentwicklung der TU im Spannungsfeld von Forschung, Lehre und Innovation ist ein Forschungsumfeld, das qualitativ hochwertige Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung gleichermaßen fördert. Diese Ausgewogenheit, fokussiert in fünf Forschungsschwerpunkten, ist aktuell unser Erfolgsrezept. Die Fakultät für Architektur und Raumplanung zählt zu den ältesten Architekturschulen Österreichs. Ursprünglich eng mit dem Bauingenieurwesen, zeitweise auch in einer gemeinsamen Fakultät, verbunden, definiert sich die Fakultät heute über die Kombination von Architektur und Raumplanung unter einem gemeinsamen Dach. Dies und der gelungene Spagat zwischen forschungsgeleiteter Lehre und praxisbezogener Ausbildung sind für das hervorragende nationale und internationale Renommee der Fakultät verantwortlich. Sabine Seidler
The TU Wien, founded on 6 November 1815 as the k.k. polytechnisches Institut (Imperial Royal Polytechnic Institute), is celebrating its 200th anniversary. The roots of the institution are the military and commercial-technical vocational schools that have existed across Europe since the beginning of the 18th century. These schools were founded to address the growing need in public administration, the military, and economics for skilled workers with an educational background in technology and the natural sciences. Today, the TU Wien is a modern research university. More than 4,500 employees work, research, and teach at Austria’s largest institution for research and education in the natural sciences and engineering. A prerequisite for the continued success of the TU Wien’s further development in the fields of research, teaching, and innovation is a research environment that equally encourages high-quality fundamental and application-oriented research. This balance, focused in five main research areas, is our current recipe for success. The Faculty for Architecture and Planning is one of the oldest architectural schools in Austria. It was originally closely tied to the field of civil engineering, for a time even sharing a faculty. Today, the faculty defines itself through a combination of architecture and spatial planning, brought together under one roof. Together with the successful bridging of research-led teaching and practice-oriented training, this is responsible for the excellent national and international reputation of the faculty. Sabine Seidler Vienna, September 2015
Wien, im September 2015
Vorwort der Rektorin | 9
VORWORT DES DEKANS FOREWORD FROM THE DEAN Die Technische Universität Wien feiert ihr 200-jähriges Bestehen! Ein solches Jubiläum ist immer Anlass, Bilanz zu ziehen und das Erreichte gebührend zu feiern. Aber wie es sich bei Jubiläen gehört, sind sie immer auch Herausforderung, den Blick nach vorn, in die Zukunft zu richten, darauf, was wir erwarten, wo wir uns hin entwickeln und wie wir unser Profil schärfen wollen. Diese Auseinandersetzung mit der heutigen Situation, vor allem aber mit den Zukunftsperspektiven, war Anlass und ist Gegenstand dieser Publikation der Fakultät für Architektur und Raumplanung: Eben kein Statusbericht und keine Leistungsschau einzelner Fachgebiete, keine Jubelschrift unserer Fakultät. Es geht vielmehr um das Herausarbeiten von Positionen zur Architektur und zur Raumplanung, um die Auseinandersetzung mit Perspektiven in Lehre und Forschung, um die Beschäftigung mit dem Verhältnis von Theorie und Praxis. Vorgelegt wird ein Sammelband zu Positionen aus der Perspektive der einzelnen Fachgebiete und Abteilungen, aus Arbeits- und Forschungsbereichen wie aus der studentischen Sicht. Explizit knüpfen wir dabei an den Wissenschaftstag 2012 unserer Fakultät zum Thema „MEHR-WERT Architektur und Raumplanung“ an. Hierbei ging es ebenso um die Diskussion der MEHR-WERTE, die Architektur und Raumplanung für das Gemeinwohl und die gesellschaftliche Entwicklung zu erbringen imstande sind, wie darum, welche MEHR-WERTE über Architektur und Raumplanung als kulturschaffende Faktoren für die Baukultur, die gebaute Umwelt, die Stadt- und Regionalentwicklung geschaffen werden können. Grundlegend muss die vielfältige disziplinäre Struktur als eine der besonderen Stärken der Fakultät für Architektur und Raumplanung angesehen werden. Sie befähigt und verpflichtet uns, zum öffentlichen Diskurs in der Entwicklung der Umwelt aus künstlerisch-architektonischer und strategisch-planerischer Perspektive bei-
10 | Vorwort des Dekans
The Technical University of Vienna is celebrating its bicentennial! Such an anniversary always provides a great occasion to take stock and celebrate achievements. However, it is also in the nature of anniversaries that they challenge us to look forward into the future, to evaluate our expectations, and to think about the path we want to take and the ways in which we want to sharpen our profile. The wish to take stock of our present situation, but also to assess our future perspectives, is the reason behind and the subject of this publication by the Faculty of Architecture and Planning: it is not a status report, nor a display of the performance of individual fields of expertise, nor a celebration of our faculty’s success. Rather, we aim to elaborate on our positions regarding architecture and planning, to examine approaches to research and teaching, and to address the relationship between theory and practice. What is presented here is an anthology of positions from the perspectives of our individual departments and institutes, from fields of work and research as well as from the students’ point of view. We explicitly follow up on our faculty’s Science Day 2012 on the subject of “MEHR-WERT Architektur und Raumplanung” (Added Value in Architecture and Planning), which focussed on discussing the added value that architecture and planning can bring to public welfare and social development, and the added value that architecture and planning can invest in building culture as factors of cultural creation, the built environment, and urban and regional development. Our diverse disciplinary structure can be seen as one of the particular strengths of the Faculty of Planning and Architecture. It enables and obliges us to contribute to the public discourse on the development of our environment from an artistic, architectural, and also strategic planning perspective. In my view, the combination of architecture and planning in a single faculty is a unique
zutragen. Aus meiner Perspektive stellt die Kombination von Architektur und Raumplanung in einer Fakultät eine besondere Herausforderung dar, der wir uns künftig verstärkt über gemeinsame Projekte in Lehre und Forschung widmen müssen: fachbereichs- und disziplinenübergreifend, offen und experimentell, mit großer (wissenschaftlicher) Neugierde und Verantwortungsbewusstsein. Die in dieser Publikation dokumentierten Beiträge belegen das besondere Spektrum unserer Fakultät. Sie sind Ausdruck eines verantwortungsvollen Umgangs mit vielfältigen Herausforderungen und Zugängen, die hineinwirken in den gebauten und gelebten Raum und mit denen wir uns in einer inter- und transdisziplinären Praxis von Forschung und Lehre befassen wollen. Ich wünsche eine spannende Lektüre!
challenge which we need to address more in the future: through joint projects in research and teaching that are interdepartmental and interdisciplinary, open and experimental, and infused with intense (scientific) curiosity and a sense of responsibility. The contributions documented in this publication are proof of the outstanding spectrum of our faculty. They reflect a responsible treatment of diverse challenges and approaches that interact within the built and lived space, and which we aim to address through inter- and transdisciplinary research and teaching practices. I wish you a stimulating read! Vienna, September 2015 Rudolf Scheuvens Dean of the Faculty for Architecture and Planning
Wien, im September 2015 Rudolf Scheuvens Dekan der Fakultät für Architektur und Raumplanung
Vorwort des Dekans | 11
ENTWURF UND DESIGN DRAFTING AND DESIGN Im weiten Feld der Transformation, von der freien Landschaft bis hin zum dichten, urbanen Gewebe, vom architektonischen Raum bis zum gestalteten Volumen operiert jene Vielfalt an Angeboten und Sichtweisen, die unsere Studienrichtung der Architektur und die Forschungsbereiche der Abteilungen auszeichnet. Trotz knapper Ressourcen und prekärer Arbeitsbedingungen für Studierende und Lehrende wird in den folgenden Positionen erkennbar, dass eine breite und doch konsistente Annäherung an den Entwurf sowie eine theoretisch und historisch fundierte Schule des reflektierenden Sehens und Gestaltens angeboten wird. The diversity of opportunities and points of view that can be found in the architectural study programme and in the research areas of its departments are characterised by a broad field of transformation ranging from open landscapes all the way to dense urban fabrics, from architectural spaces to volumes designed in greatest detail. Despite limited resources and precarious working conditions for students and teachers alike, the following opinions make it clear that a broad yet still coherent approach to design is offered here, along with a theoretically and historically established school of reflective seeing and designing.
Christian Kühn
NUTZERORIENTIERTE ARCHITEKTUR USER-ORIENTED ARCHITECTURE
Gebäudelehre befasst sich traditionell mit dem Verhältnis von Funktion und Form in der Architektur. Die Dynamik dieser Beziehung hat in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen: Heute ändern sich Funktionen weit rascher als die Bausubstanz, in der sie untergebracht sind. Viele Bauwerke dienen mehr als einer Funktion, womit sich die ausdifferenzierte Ordnung der Bautypen in Richtung Hybridisierung aufzulösen beginnt; schließlich kommt mit zunehmender urbaner Dichte auch der statische Gebäudebegriff selbst unter Druck, da sich urbanes Bauen heute besser als kontinuierliche Veränderung vernetzter Strukturen beschreiben lässt, denn als Arbeit am klar umgrenzten Objekt.
“Gebäudelehre” is traditionally about the relationship between form and function in architecture. The dynamics of this relationship have accelerated significantly in recent decades: today, functions change much faster than the built structures in which they are housed. Many buildings serve more than one function, which hybridises formerly well-differentiated building typologies. Finally, increased urban density challenges even the notion of a building as something static: urban construction today might be more precisely described as a continuous transformation of networked structures than as the activity of designing clearly delimited objects.
Die Abteilung für Gebäudelehre und Planungsmethodik befasst sich in Lehre und Forschung mit diesen Entwicklungen und ihren Konsequenzen. Architektonische Innovation setzt präzise Analyse und Theoriebildung voraus, entsteht aber letztlich immer im konkreten Projekt, weshalb der Entwurf von zentraler Bedeutung ist. Im universitären Kontext muss dieser sich einem akademischen Diskurs aussetzen und damit als Forschung qualifizieren. Voraussetzung dafür ist ein Forschungsprogramm, das langfristig und auf kontinuierliche Reflexion hin angelegt ist. Die Abteilung kann dabei auf eine experimentelle Tradition aufbauen, die mit Karl Schwanzer und Günther Feuerstein in den 1960er-Jahren beginnt. Schwanzers Werk war methodisch vom Funktionalismus geprägt, zeigte aber immer eine expressive Eigenständigkeit, die aus der Konstruktion heraus entwickelt war. Als Professor am damaligen Institut für Gebäudelehre vermittelte
In its teaching and research, the Department of Building Theory and Planning Methodology (“Gebäudelehre”) addresses these developments and their consequences. Architectural innovation requires a precise analysis and formation of theories; however, ultimately, it is always generated in the concrete project. This is why design is of pivotal importance. In a university context, it needs to expose itself to an academic discourse and thus qualify as research. The condition for this is a research programme which aims for long-term and continuous reflection. The department can build on a tradition of experimentation that began in the 1960s with Karl Schwanzer and Günther Feuerstein. Methodically, Schwanzer’s oeuvre was informed by functionalism, but demonstrated an expressive independence that evolved from the construction itself. As a professor at the former Institute of Building Theory, Schwanzer taught his students a ba-
Nutzerorientierte Architektur | 13
Schwanzer den Studierenden eine auf Funktionalität ausgerichtete Grundhaltung, ließ jedoch große Freiräume für radikale Entwurfsansätze. Günther Feuerstein, der wichtigste Mitarbeiter Schwanzers in den Jahren 1961 bis 1968, nutzte diesen Spielraum, um Avantgardegruppen wie Coop Himmelb(l)au (Wolf D. Prix, Helmut Swiczinsky) oder Haus-Rucker-Co (Günther Zamp Kelp, Laurids Ortner, Klaus Pinter) zu fördern. Feuersteins Studien zur Psychologie und Kulturgeschichte der Architektur führten ihn zur Theorie einer „Visionären Architektur“, die einen wichtigen Beitrag zur Überwindung trivial-funktionalistischer Ansätze darstellt.1 Schwanzers Nachfolger am Institut für Gebäudelehre, Anton Schweighofer, verstand Architektur als soziale Kunst mit starken Verbindungen zu anderen künstlerischen und wissenschaftlichen Disziplinen.2 Zu den wesentlichen Beiträgen seiner Zeit als Professor in den Jahren von 1977 bis 1998 gehört neben der Entwurfslehre die Erschließung der anonymen Architektur als Forschungsfeld und Inspiration, die Aufnahme von Kontakten zur Architekturszene des ehemaligen Ostblocks sowie die Forschung zu zentralen Figuren der österreichischen Moderne, insbesondere Adolf Loos und Josef Frank.3 Mit der Berufung von Manfred Wolff-Plottegg im Jahr 2001 verstärkte die Abteilung für Gebäudelehre ihre interdisziplinäre Ausrichtung, wobei die bereits davor begonnene Bearbeitung von Forschungsfeldern aus dem Bereich des Computer Aided Design4 ins Zentrum rückte. Der Computer wurde dabei auf sein Potential als Entwurfswerkzeug hin untersucht, wobei der Fokus dezidiert nicht auf der Generierung von Form lag, sondern auf dem Entwurfsprozess selbst.5 Randomisierte Methoden kamen dabei ebenso zum Einsatz wie topologische Grammatiken6 und generative Algorithmen. Die dabei entstandenen Werkzeuge der algorithmischen Planung und Analyse lieferten eine Testumgebung zur Erprobung nutzerorientierter Entwurfsprozesse. Das langfristige Forschungsziel ist dabei, durch die Simulation menschlichen Verhaltens Beziehungen zwischen „Bewegungsform“ und „Formbewegung“ zu untersuchen und
14 | Christian Kühn
sic philosophy oriented toward functionality, but left ample space for radical design approaches. Günther Feuerstein, Schwanzer’s most important collaborator in the years from 1961 to 1968, used this leeway to encourage avant-garde groups like Coop Himmelb(l)au (Wolf D. Prix and Helmut Swiczinsky) and Haus-Rucker-Co (Günther Zamp Kelp, Laurids Ortner, and Klaus Pinter). Feuerstein’s studies on the psychology and cultural history of architecture led to his theory of visionary architecture, which decisively contributed to overcoming trivial functionalist approaches.1 Anton Schweighofer, Schwanzer’s successor at the Institute of Building Theory, saw architecture as a social art with strong links to other artistic and scientific disciplines.2 Some of his main contributions during his time as a professor from 1977 to 1998, in addition to design theory, are the development of anonymous architecture as a field of research and inspiration, the establishment of contacts with the architecture scene of the former Eastern block, and research on the key figures of Austrian Modernism, in particular Adolf Loos and Josef Frank.3 By appointing Manfred Wolff-Plottegg in 2001, the Department of Building Theory strengthened its interdisciplinary orientation, with work now centring on research fields in the area of Computer Aided Design,4 an emphasis that had already been initiated earlier. Exploration began on the potential of computers as a design tool, with the focus of the work not on generating form, but on the design process itself.5 Randomised methods, topological grammars,6 and generative algorithms were employed. The resulting algorithmic planning and analysis tools provided a test environment for examining user-oriented design processes. The longterm research goal is to explore relationships between the “form of movement” and the “movement of form” by simulating human behaviour, and to harness them for architectural design.7 One research field the department has addressed at length since 2007 is the planning of educational institutions. The paradigm change towards individualisation and inclusion that is currently emerging
für den architektonischen Entwurf nutzbar zu machen.7 Ein Forschungsfeld, mit dem sich die Abteilung seit 2007 intensiv befasst hat, ist das Planen von Bildungseinrichtungen. Der Paradigmenwechsel, der sich derzeit in der Pädagogik in Richtung Individualisierung und Inklusion abzeichnet, macht diesen Bereich besonders ergiebig für die Erforschung typologischer Innovationen.8 Als durchgängiges, seit den 1960er-Jahren über drei Generationen von Lehrenden bearbeitetes Thema der Abteilung lässt sich die Auseinandersetzung mit einer „Architektur ohne Architekten“ identifizieren, wie sie seit den frühen 1960er-Jahren von Bernard Rudofsky – einem Absolventen der TH in Wien – systematisch entwickelt worden war. In der Ära Schwanzer und Feuerstein ging es dabei um das Unbewusste und Archetypische als Triebfeder des architektonischen Denkens und Handelns, das den Weg ins Utopische und Visionäre öffnet und dort nicht mehr an die Figur eines individuellen Architekten gekoppelt ist. Für Anton Schweighofer war die anonyme, handwerkliche Tradition von zentraler Bedeutung für eine „humanistische“ Architektur. Er knüpfte dabei an den Diskursstrang an, den Adolf Loos und Josef Frank in ihrer Auseinandersetzung mit der klassischen Moderne bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts angelegt hatten. Exemplarisch dafür steht Adolf Loos’ polemische Aussage, die Menschen von den Geschmacklosigkeiten der Wiener Werkstätten zu befreien und ihnen „Mut zu den eigenen Geschmacklosigkeiten“9 zu machen. Mit dem Ansatz, bewusst oder unbewusst ablaufende „Architektur-Algorithmen“ als die eigentlichen Akteure des Entwerfens zu identifizieren, setzte Manfred Wolff-Plottegg die Demontage des Architektur-Demiurgen fort. Die Beschäftigung mit Fragen von Autorschaft und Authentizität, von Handschrift und Stil ist für die aktuelle Architekturentwicklung nach wie vor von hoher Aktualität. Parallel dazu befasst sich die Abteilung in zahlreichen Projekten der forschungsgeleiteten Lehre mit jenem Bereich der alltäglichen Architekturproduktion, die ohne architektonischen Anspruch entsteht, aber bei genauerer
in education means that this field is particularly productive for the exploration of typological innovation.8 We can identify one problem that has been addressed continuously since the 1960s, through three generations of teachers in the department: the discussion of “architecture without architects”, in the sense systematically developed by Bernard Rudofsky – a graduate of the TH in Vienna – since the early 1960s. In the era of Schwanzer and Feuerstein, it was about the unconscious and the archetypical as driving forces of architectural thought and practice, which clear the path to the utopian and visionary, where architecture is no longer linked to the figure of an individual architect. For Anton Schweighofer, the anonymous, manual tradition was the key factor of a “humanistic” architecture. He connected to the strand of discourse that Adolf Loos and Josef Frank had already initiated in their confrontation with classical Modernism in the early 20th century. The perfect example for this discussion is Adolf Loos’ polemic statement that he wanted to free people from the insipidity of the Wiener Werkstätten and to “encourage their own insipidities”.9 With his approach of identifying conscious and unconscious processes of “architectural algorithms” as the real agents of design, Manfred Wolff-Plottegg continued to dismantle the demiurge of architecture. The examination of problems of authorship and authenticity, of signature and style continue to be highly topical in the current development of architecture. In a number of research-led teaching projects, the department additionally addresses the field of day-to-day architectural production that emerges without claiming to be architecture, but which, on closer inspection, often reveals a high degree of functional and structural originality. In the sense of Rudofsky, this is “non-pedigreed architecture”, a phenomenon the department has provided analyses of in publications on the tourism infrastructure in Benidorm or on British football stadiums.10 In a current project on the architecture of parliamentarianism, it became clear that, even in this building type generally attributed to high architecture, a global review shows that it is not the
Nutzerorientierte Architektur | 15
Betrachtung oft hohe Originalität in funktioneller oder struktureller Sicht aufweist. Auch sie ist im Sinne Rudofskys eine „Architektur ohne Stammbaum“, der die Abteilung mit Publikationen über die touristische Infrastruktur von Benidorm oder britische Fußballstadien eine analytische Bearbeitung gewidmet hat.10 In einem aktuellen Projekt zur Architektur des Parlamentarismus hat sich herausgestellt, dass selbst bei diesem, allgemein der Hocharchitektur zugeordneten Bautyp, global betrachtet nicht der wohlkonzipierte architektonische Entwurf, sondern Mimikry, Unordnung und Zufall das Ergebnis bestimmen.11 Dieses durchgehende Interesse der Abteilung an einer „Architektur ohne Architekten“ wurde mit der Berufung von Tina Gregoric auf den Lehrstuhl für Gebäudelehre im Jahr 2014 ergänzt durch einen partizipatorischen Anspruch im Sinne der Aufforderung Yona Friedmans, Architektur „mit den Menschen, durch die Menschen, für die Menschen“12 zu entwickeln. Damit ist nicht nur eine präzise, nahe an den realen Lebensverhältnissen operierende Architektur der flexiblen „Micro-Environments“ gemeint, sondern auch die Vorstellung von Architektur als Infrastruktur, die diese Environments erst ermöglicht. Die prinzipielle „Formlosigkeit“ der Infrastruktur gibt dabei den entscheidenden Impuls für eine Neuverhandlung des Verhältnisses zwischen Funktion und Form in der Architektur.
well-conceived architectural design, but mimicry, disorder, and chance that determine results.11 This ongoing interest of the department in “architecture without architects” was supplemented by a participatory position when Tina Gregoric was appointed to the Chair for Building Theory in 2014, in the vein of Yona Friedman’s challenge to develop architecture “with the people, by the people, for the people”.12 This implies not only a precise architecture of flexible “micro-environments” operating in close proximity to real living conditions, but also the idea of architecture as an infrastructure that makes these environments possible in the first place. The basic “formlessness” of infrastructure acts as a decisive impulse for the renegotiation of the relationship between function and form in architecture.
Anmerkungen/Notes 1 Günther Feuerstein, Visionäre Architektur Wien 1958/1988, Berlin 1988. 2 Christian Kühn (Hg.), Anton Schweighofer – Der Stille Radikale, Wien u. a. 2000. 3 Anton Schweighofer (Hg.), Adolf Loos – Entwürfe für den öffentlichen Bau, Wien u. a. 2002. 4 Christian Kühn, Stilverzicht – Typologie und CAAD als Werkzeuge einer autonomen Architektur, Braunschweig/Wiesbaden 1997. 5 Manfred Wolff-Plottegg, ARCHITEKTUR ALGORITHMEN, Wien 1996. 6 Thomas Grasl, On Shapes and Topologies, Diss. TU Wien 2013. 7 Harald Trapp, Dichte Distanz, Diss. TU Wien 2013. 8 Christian Kühn, Cluster und Lernstraße statt Gang und Klassenzimmer, in: Merkur – Deutsche Zeitschrift für Europäisches Denken, 67 (2013), 3, 245–250. 9 Burkhardt Rukschcio/Roland Schachel, Adolf Loos. Leben und Werk, Salzburg/Wien 1982, 41. 10 Institut für Architektur und Entwerfen, Abteilung für Gebäudelehre und Entwerfen, Benidorm XXXL, Lukas Burzin/Florian Sammer (Red.), Wien 2011. 11 Christian Kühn (Hg.), Plenum. Places of Power, Basel 2014. 12 Maria Ines Rodriguez, Architecture with the People, by the People, for the People: Yona Friedman (Coleccion Arte Arquitectura AA MUSAC), Barcelona 2011.
16 | Christian Kühn
Paul Rajakovics, Helmut Schramm
HERAUSFORDERUNG WOHNEN THE HOUSING CHALLENGE
Die Abteilung Wohnbau und Entwerfen versteht sich als offener Ort eines universitären Lehrens, Forschens und Experimentierens, an dem Unterrichtende, Studierende, Gäste und Außenstehende gleichberechtigt an der Herstellung eines Wissens pools zum Thema Architektur und Wohnen mitwirken. Der soziale Wohnbau steht gerade in Bezug zu den derzeitigen gesellschaftlichen Entwicklungen an einem Punkt größter Herausforderungen. Die Schere zwischen Arm und Reich und ihre Folgen in Form von Obdachlosigkeit und Migration fordern eine dringende Erneuerung unserer tradierten Konzepte. Dafür werden an unserer Abteilung vielfältige Zugänge, Themen, Inhalte und Methoden erarbeitet und bezugnehmende, aktuelle Inhalte diskutiert und evaluiert.
The Department of Housing and Design considers itself as an open space of university teaching, research and experimentation where instructors, students, guests and visitors participate on an equal level in the production of knowledge on architecture and housing. Today, social housing is confronted with the biggest challenges resulting from the current societal changes. The gap between rich and poor and its consequences in the form of homelessness and migration call for an urgent reform of conventional concepts. For this purpose, in our department, we develop a variety of approaches, topics, contents, and methods in order to discuss and evaluate relevant issues.
Wohnkonzepte in der Lehre
The department is dedicated to a conceptual design that devises programmes for future conditions of architecture and housing. With a carefully selected range of topics and diverse instructors, the aim of instruction is to offer the broadest possible contemporary spectrum of subjects and methods. Projects, assigned twice during the academic year, offer students a pool of different approaches to the topic of dwelling and all subjects tangential to housing. These range from partnerships and cooperations with housing companies and developers in projects programmed by agencies, the municipality of the City of Vienna, and other cities, to experimental projects, exchange projects with universities abroad, such as the École d’Architecture de Versailles in Paris and the Tokyo Institute of Technology, as well as in the realization of projects at a 1:1 scale.
Die Abteilung sieht ihre Hauptaufgabe im Bereich des konzeptionellen Entwurfs, der Programme für zukünftige Bedingungen von Architektur und Wohnen erarbeitet. Über eine präzise Auswahl an Themen und eine Vielfalt an Lehrenden soll auch ein möglichst großes und aktuelles Spektrum an Inhalten und Methoden vermittelt werden. Die halbjährlich neu gestellten Aufgaben bieten den Studierenden einen Pool unterschiedlicher Zugänge zum Thema Wohnen und allen Randbereichen des Wohnens, sei es über Kooperationen mit Bauträgern, über Aufgabenstellungen, die von Einrichtungen der Stadt Wien und anderen Gemeinden gestellt werden, über experimentelle Projekte, über Austauschprojekte mit ausländischen Universitäten, wie etwa der École d’Archi-
Teaching Housing Strategies
Herausforderung Wohnen | 17
tecture de Versailles in Paris und dem Tokyo Institute of Technology oder über Direktumsetzungen in Form von 1:1-Projekten. Auch das Studio Wohnbau, welches im 4. Semester die Grundlagen des Verständnisses von Wohnbau vermittelt, versteht sich als kontextuell anspruchsvoller Entwurf, der Inhalt und Form als synthetisches Ganzes betrachtet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im ständigen Austausch mit Architekturschaffenden durch Gastprofessuren und Gastkritiker, wie derzeit mit Herwig Spiegl von AllesWirdGut. Auch im neu konzipierten Modul „Wohnen im Kontext“ werden in den Ringvorlesungen die unterschiedlichen Aspekte durch Architektinnen und Architekten und Landschaftsplanerinnen und -planer in einem direkten Austausch praxisbezogen vermittelt. Durch den jährlichen Wechsel der Vortragenden können fast alle aktuell relevanten Positionen des praktischen Wohnbaudiskurses hier für die TU Wien gewonnen werden. Das „Konzept Wohnen“ – eine hybride Herausforderung der Zukunft In Projekten mit dem Schwerpunkt Wohnbau ist der Bezug zu Personen und Institutionen, die an der Realisierung von Architektur beteiligt sind, bedeutend. Dabei werden sowohl die Folgen der demographischen Veränderungen für den Wohnbau der nächsten Jahrzehnte als auch die materialtechnischen Anforderungen hinsichtlich der ökologischen und energietechnischen Herausforderungen diskutiert und bearbeitet. So gilt es, einerseits der höheren Lebenserwartung mit der Suche nach qualitätsvollen Wohnsituationen für die ältere Generation zu begegnen. Dabei werden oft Wohnformen bevorzugt, die jenseits der tradierten Muster liegen, besonders wenn man bedenkt, dass diese Generation vor über 40 Jahren zahlreiche Kommunen gegründet hat, um zu neuen Formen des Zusammenlebens zu finden. Auf der anderen Seite müssen tradierte Wohnformen anderer kultureller Herkunft durch den Zuzug von Migrantinnen und Migranten analysiert und umformuliert werden. Viele, die derzeit aus Syrien oder dem nördlichen Afrika traumatisiert nach Österreich
18 | Paul Rajakovics, Helmut Schramm
The housing design studio, which teaches the fundamentals of residential buildings during the fourth semester of the programme, is conceived as a contextually challenging project that treats form and content as a synthetic whole. A further focus of the programme is an ongoing exchange with architecture practitioners through visiting professorships and guest critics, such as the current one with Herwig Spiegl of AllesWirdGut. In the lecture series of the newly developed module on “Housing in Context”, various aspects of housing are taught by architects and landscape designers in a direct dialogue on practice. With a new set of lecturers invited each year, nearly all currently relevant concepts of the professional discourse on housing are offered to the students in the curriculum of the TU Wien. “Concept Housing” – A Hybrid Challenge for the Future In projects focusing on housing, contacts to individuals and institutions involved in the realisation of architecture are significant. The effects of demographic change on housing in the coming decades, as well as the material and technological requirements with respect to environmental and energy use challenges are discussed and studied. Part of these issues addresses topics such as managing longer life expectancies and the search for high quality living situations for the elder generation. The preference here is for housing typologies that go beyond conventional forms, especially considering that, over 40 years ago, this same generation founded a multitude of communes in search of new forms of collective living. On the other hand, given the influx of migrants, typical housing typologies from different cultural backgrounds must be analysed and reformulated. Many people who arrive in Austria from Syria or northern Africa are traumatised and must adjust to changes in climate, as well as to the loss of their own culture of living. These simple examples already begin to show how the subject of dwelling requires a nuanced approach. Only with our profound knowledge of the concepts of floor plan de-
kommen, müssen sowohl mit den klimatischen Veränderungen zurechtkommen als auch mit dem Verlust ihrer eigenen Wohnkultur. Schon diese einfachen Beispiele zeigen, wie differenziert das Thema Wohnen heute betrachtet werden muss. Nur mit unserem profunden Wissen um die Konzepte der Grundrissentwicklung seit der Moderne und der Offenheit hinsichtlich des Unorthodoxen können hier neue Raumökonomien gedacht werden. Zudem steht in Mitteleuropa der soziale Wohnbau vor seiner größten Zerreißprobe zwischen exponentiell steigenden Anforderungen und ökonomischen Realitäten. Überreglementierung durch Normen und energetische Anforderungen und Luxuskonzepte, wie etwa die der Smart City, würden unser Scheitern unausweichlich machen, würden wir nicht eine Koppelung zwischen Wohnbauforschung und experimentellen Zugängen im Gespräch mit den Förderstellen und Wohnbauträgern suchen. Hier liegt eine wesentliche Herausforderung für unsere Abteilung in den nächsten Jahren. Konkret werden schon jetzt in experimentellen Projekten Aufgabenstellungen abstrakt bearbeitet, um so über das Austesten von neuen Methoden, Materialien oder Medien zu neuen räumlichen, sozialen oder programmatischen Ergebnissen zu kommen. Forschung und Experiment Natürlich gibt es derzeit an der Abteilung für Wohnbau und Entwerfen auch ganz konkrete Forschungsprojekte, welche in der interdisziplinären Erforschung der Alltagsarchitektur, der integralen Planungsprozesse für Neubau und Bestand und der Methodik und Architekturwissenschaft angesiedelt sind. Die kürzlich abgeschlossenen Forschungsprojekte belegen dies eindrucksvoll: Resource Conserving Renovation (Re_Co_Re) beschäftigt sich mit der Entwicklung von integralen, langfristigen und lebenszyklusorientierten Modernisierungsszenarien für spezifische Gebäudebestände. Die Machbarkeitsstudie über die Durchführung einer Internationalen Bauausstellung in Wien, IBA Wien (IBAVIE) verfolgt das programmatische Ziel, experimentelle und
signs from Modernism onwards, as well as openness to the unorthodox, can we conceive of new spatial economies. Moreover, in Central Europe, social housing is facing its toughest tests, arising from exponentially increasing demand and an unfavourable economic reality. Excessive regulations in the form of standards, energy use requirements, and luxury concepts such as the Smart City would make failure inevitable, if we didn’t seek a connection between housing design research and experimental approaches together with financial sponsors and housing developers. This will be a major challenge for our department in the coming years. To be specific, in experimental projects, abstract programme requirements are already being developed so that the testing of new methods, materials, and media can lead to new spatial, social, and programmatic outcomes. Research and Experimentation Of course, at present, very concrete research projects are being carried out in the Department of Housing Construction and Design. These are situated in the interdisciplinary study of everyday architecture, the integral design process for new and existing construction, methodologies, and architectural science. Recently completed research projects demonstrate this impressively: Resource Conserving Renovation (Re_Co_Re) is engaged in the design of integral, long-term, and life- cycle-oriented modernisation scenarios for specific building types. The programmatic goal of the feasibility study on mounting the International Building Exhibition in Vienna, IBA Wien (IBAVIE), is to find experimental and innovative solutions for contemporary urban structural problems and to initiate sustainable, innovative processes in the field of housing and urban redevelopment. In addition to research and conceptual experimental projects, the Design-Build Studio, which has been building projects at the 1:1 scale since the year 2000, is strongly characteristic of the department. There, students have the opportunity to complete all phases of
Herausforderung Wohnen | 19
innovative Lösungen für die gegenwärtigen strukturellen Probleme der Stadt zu finden und zukunftsfähige, innovative Prozesse in den Bereichen Wohnbau und Stadt erneuerung zu initiieren. Neben Forschung und konzeptionell-experimentellen Projekten stellt seit dem Jahr 2000 das Design-Build Studio mit der Realisierung von Projekten im Maßstab 1:1 einen charakteristischen Schwerpunkt des Fachbereichs dar. Dabei haben Studierende die Möglichkeit, sämtliche Phasen eines kleinen, aber realen Architekturprojekts zu durchlaufen: von der ersten Entwurfsskizze über die Entwicklung von Modellen und Detailplänen, der Kommunikation mit Bauherrinnen und Bauherren, Nutzerinnen und Nutzern, Behörden, Fachplanerinnen und -planern, Handwerksbetrieben, Herstellern, Förderstellen und Sponsoren, bis hin zur eigenhändigen Ausführung der Bauarbeiten.
20 | Paul Rajakovics, Helmut Schramm
Abb. 1: Design Build-Projekt ADD ON. 20 Höhenmeter, Wallensteinplatz, 1200 Wien, Sommer 2005. Fig. 1: Design Build Project ADD ON. Altitude 20m, Wallensteinplatz, 1200 Vienna, Summer 2005.
a small but realistic architectural project: from the first preliminary sketches to the development of models and detail drawings, communicating with clients, builders, users, government officials, shop designers, custom manufacturers, funding agencies, and sponsors, up to the individual execution of construction work. Students work in collaboration, as a large team, and jointly take on the responsibilities and consequences of their activity. They learn how to work with small budgets, tight schedules, and unexpected problems, and are confronted by the friction and resistance that generally arises when concepts are offered to the students.
Die Studierenden arbeiten dabei kollaborativ, als großes Team, und tragen kollektiv die Verantwortungen und Konsequenzen ihres Handelns. Sie lernen mit kleinen Budgets, engen Zeitplänen und unerwarteten Problemen umzugehen, und sie werden mit dem Reibungswiderstand konfrontiert, der in der Regel auftritt, wenn man Pläne in die gebaute Wirklichkeit übersetzt. Das Spektrum der Planungs- und Bauaufgaben des Design-Build Studios reicht von begeh- und benutzbaren Installationen im urbanen öffentlichen Raum bis hin zu permanenten Gebäuden für gemeinnützige, soziale Einrichtungen in Südafrika, Indonesien und Österreich. Mit der seit dem Jahr 2000 jährlich stattfindenden Sommerschule in Motovun in Istrien wurde gemeinsam mit Sasa Bradic ein „Außendepartment“ geschaffen, das über einen intensiv betreuten einwöchigen Workshop für Studierende aus Wien, Zagreb und anderen europä-
Abb. 2: Internationale Bauausstellung Hamburg, 2013. Fig. 2: International Building Exhibition Hamburg, 2013.
The spectrum of design and construction assignments in the Design-Build Studio ranges from accessible and usable installations in urban public space to permanent structures for non-profit community services in South Africa, Indonesia, and Austria. The Summer School in Motovun, which has been taking place in Istria since 2000, created an “External Department” together with Sasa Bradic that broadened the platform of the department into a site of international exchange between architects, artists, instructors, and students, based upon an intensive, supervised oneweek workshop for students from Vienna, Zagreb, and other European cities. The school’s discourse has delved
Herausforderung Wohnen | 21
Abb.3: Wohnbauführung Arch. Richard Manahl, 2011, Fig. 3: Residential Housing Tour with Arch. Richard Manahl, 2011.
into a number of subjects, such as the topic of utopia, a long-time theme of the department. Jan Tabor first presented the idea of Urbo Kune1, the real capital of Europe, at Motovun in 2013. The recently released book entitled Researching Utopia2 can certainly be regarded as an international overview of the subject of utopia in architecture and housing. It shows different positions in the current discourse on the topic that are of great relevance, especially for the urgent questions discussed above. As a conceptual notion, the theme of dwelling has now become one of the greatest global challenges encompassing sociology and aesthetics, or more specifically, massive social change and architecture. We are ready!
Anmerkungen/Notes ischen Städten die Plattform des Departments zu einem Ort internationalen Austauschs zwischen Architektinnen und Architekten, Künstlerinnen und Künstlern, Lehrenden und Studierenden erweitert hat. So manches Thema wurde hier schon diskursiv weitergetragen, wie etwa das in dieser Abteilung schon lange verfolgte Thema der Utopie. So hat Jan Tabor 2013 erstmals in Motovun die Idee von Urbo Kune,1 der wirklichen Hauptstadt Europas kommuniziert. Das gerade erschienene Buch, Researching Utopia,2 kann sicherlich als internationale Momentaufnahme des Themas Utopie in Architektur und Wohnbau gesehen werden. Es zeigt das Thema in den unterschiedlichsten Perspektiven aktueller Diskurse, die nicht zuletzt auch für die eingangs erwähnten, dringenden, anstehenden Fragestellungen von großer Relevanz sind. Das Thema Wohnen in seiner konzeptuellen Erfassung ist nunmehr zu einer der größten globalen Herausforderungen zwischen Soziologie und Ästhetik oder noch konkreter zwischen den massiven gesellschaftlichen Veränderungen und der Architektur geworden. Wir sind bereit!
22 | Paul Rajakovics, Helmut Schramm
1 Vgl. Jan Tabor in: Re-searching Utopia, hrsg. v. Cuno Brullmann mit der Abteilung für Wohnbau und Entwerfen, Zürich 2014, 138. 2 Brullmann, Re-searching Utopia, 2014.
Françoise-Hélène Jourda †
WAS ZEICHNET DAS ARCHITEKTUR-STUDIUM IN WIEN BESONDERS AUS? WHAT IS SPECIAL ABOUT STUDYING ARCHITECTURE IN VIENNA?1 Der geschichtliche Hintergrund der Stadt Wien und ihre geografische Lage im Zentrum Europas verleihen dem Studium eine besondere Qualität. Eine große Zahl internationaler Studentinnen und Studenten lernen derzeit in Wien, viele von ihnen haben türkische Wurzeln. Dies lässt einen unglaublich vielfältigen Austausch entstehen, den wir in unseren Vorlesungen und Übungen erleben. Die Bereitschaft der Studentinnen und Studenten, von Wien und von der Wiener Kultur zu lernen, bereichert diesen Austausch. Die Lehre an unserer Abteilung am Institut für Architektur und Entwerfen konzentriert sich auf Raumgestaltung wie auf den Aspekt der Nachhaltigkeit. Raumgestaltung arbeitet mit Raum, Licht und Material. Sie befasst sich mit dem Raumgefühl wie auch mit der Empfindung, die dieses erzeugen kann. Die Lehre der Nachhaltigkeit integriert auch Raumgestaltung. Umgekehrt beinhaltet die Raumgestaltung das Problem der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit befasst sich nicht nur mit den technischen Mitteln wie Wärmebrücken, Solarkollektoren oder der technischen Gebäudeausrüstung. Auch andere grundlegende Prinzipien müssen in der Architektur berücksichtigt werden, angefangen mit der ersten Skizze bis zum letzten Detail. Dies ist eine Form des kulturellen Austausches. Die architektonischen Probleme haben immer auch mit Nachhaltigkeit zu tun; die Wahl des Masterplans, der Bauvorgaben und des Materials für die Struktur, die Qualität der Materialien, die verwendet werden, besonders
The historical background of Vienna and its geographic location at the centre of Europe make studying here a specific experience. A great number of international students are currently studying in Vienna, many of them of Turkish origin. This creates an incredible atmosphere of exchange, which we experience in our lectures and exercises. The willingness of students to learn from Vienna and from the Viennese culture enriches this exchange. Teaching at our department focuses on spatial design and sustainability. Spatial design involves space, light, and material. It concerns the feel of space and the emotions it can create. When we teach sustainability, we integrate spatial design. When we teach spatial design, we integrate sustainability. Sustainability is not only a matter of technical devices such as heat bridges, solar panels, and building services. Other main principles must also be incorporated in the architecture, beginning with the first sketch and going right up to the last detail. This is a form of cultural exchange. All parts of the architecture have to do with sustainability; the choice of the master plan, of the brief, and of the material for the structure, the quality and type of materials to be used, especially the insulation. This includes the approach to construction, to prefabricate or not, and the design of the details. The changes that will occur in a building after a short period of time or after a hundred years must also be considered, along with how it will be maintained and, above all, the quantity of equivalent CO2 emissions it will produce.
Was zeichnet das Architektur-Studium in Wien besonders aus? | 23
die Isolierung. Der Ansatz zum Bau, egal, ob es sich um eine Vorfertigung handelt oder nicht, oder das Design der Details. Die Veränderungen, die ein Gebäude nach einer kurzen Zeitspanne oder nach einhundert Jahren unterläuft, wie es erhalten werden sollte und vor allem die Menge der entsprechenden CO2-Emissionen, die es produzieren wird. Diese Ansätze definieren die Gestaltung der Projekte völlig neu. Noch immer gilt es, viele neue Entwicklungen vorzunehmen. Projekte werden in verschiedenen Größenordnungen durchgeführt, für unterschiedliche Standorte und Bewohnerinnen und Bewohner. Abhängig von den örtlichen Ressourcen und Umständen werden spezifische Antworten entwickelt, jedoch unter Beibehaltung der gleichen Philosophie. Ein weiteres wichtiges Element unserer Lehre ist die Multidisziplinarität und der Multikulturalismus. Seit über vierzehn Jahren hat unser Design-Programm building in the south mehr als 50 Studierende pro Jahr in die Lage versetzt, Länder wie Frankreich, Marokko, Tunesien, Italien, Griechenland, die Türkei, Albanien, Jordanien und den Iran zu besuchen und dort zu arbeiten. Unsere Abteilung erhält sehr viele Bewerbungen für Doktoratsstudien. Die meisten davon kommen aus dem Ausland. Dies zeigt, dass unser nachhaltiger und zweckmäßiger Ansatz zur Architektur bei europäischen Universitäten nicht weit verbreitet ist. Wien hat das Potenzial, auf diesen Fähigkeiten und Interessen aufzubauen und sich zu einem wichtigen Player im Feld der architektonischen Nachhaltigkeit und Innovation zu entwickeln. In Wien konnte ein international und regional sehr anerkanntes Forschungszentrum etabliert werden. Dies ist ein Zentrum für Innovation, das sowohl österreichischen wie internationalen Studierenden offen steht, die zusammen an der Entwicklung von Lösungen arbeiten. Diese Lösungen sind naturgemäß nicht global, sondern lokal. Unsere Vision besteht darin, zu einem europäischen Zentrum für Nachhaltigkeit im Feld der Architektur zu werden und dabei aus dem geschichtlichen Hintergrund der Stadt Nutzen zu ziehen, aus ihrer internationalen Position und aus den Themen, die wir den Master- und Doktoratsstudentinnen und -studenten nahebringen.
24 | Françoise-Hélène Jourda †
These approaches totally redefine the designing of projects. There are still many new developments to be made. Projects are done on different scales, for different types of sites, and for different inhabitants. Depending on the local resources and circumstances, specific answers are developed, yet the philosophy remains the same. Another strong point of our teaching is multidisciplinarity and multiculturalism. For more than fourteen years, our building in the south design programme has enabled over fifty students per year to visit and work in countries like France, Morocco, Tunisia, Italy, Greece, Turkey, Albania, Jordan, and Iran. We have a great number of applications for PhD studies at the department. Most of them come from foreign countries. This shows that our sustainable and sensible approach towards architecture is not widely available at other European universities. Vienna has the potential to build on these capacities and interests and develop into an important player in the field of architectural sustainability and innovation. In Vienna, a renowned international and regional research centre could and should be established. A centre for innovation, open to Austrian and international students working together on developing solutions that are not global, but local in nature. Our vision is to become a European centre for sustainability in the field of architecture, taking benefit of the historical background of the city, its international position, and the subjects we teach to master’s degree and PhD students. Anmerkung/Note 1 Frau Prof. Hélène-Françoise Jourda ist am 31. 5. 2015 verstorben. http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/9506/
Astrid Staufer, Thomas Hasler
FORSCHENDES ENTWERFEN RESEARCH-BASED DESIGN Die Lehre der Architektur steht im Spannungsfeld zwischen der Entwicklung von Kreativität und dem Aneignen von überliefertem Wissen. Da die Abteilung Hochbau und Entwerfen aufgrund des Lehrplanes einen starken Fokus auf die Grundausbildung des Architekturstudiums legt, setzt sich das pädagogische Konzept wesentlich mit diesen beiden Polen auseinander. Vergegenwärtigt man sich, dass Jahr für Jahr an die 700 junge Menschen ihre ersten Eindrücke, Prägungen, Urteile und auch Vorurteile beim Studienanfang recht rasch gewinnen, so ist es uns ein großes Anliegen, dass dieser „erste Eindruck“ von Architektur ein positiver – und auch ein realistischer wird. Das Lehrgebäude, das vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung laufend in Entwicklung begriffen ist, orientiert sich entlang der drei Tätigkeiten Wahrnehmen – Erkennen – Schaffen. Im Idealfall ordnen sich diese Aspekte in einem dreipoligen und gleichgewichtigen System an und befruchten sich gegenseitig. Die Entwicklung der Architektur hat seit je einen trägen Charakter, was vom Wesen des Hauses als ein aufwendiges und dauerhaftes Artefakt herrührt. Es gab immer wieder Versuche, diese Trägheit zu überlisten und dem Aspekt des Neuen mehr Dynamik zu verleihen. Durch spontane Genialität tradierte Fesseln zu durchbrechen, ist eine bekannte Verlockung, die auch heute viele Ausbildungsmethoden prägt. Wahrnehmen – Erkennen – Schaffen Das Lehrprojekt unserer Abteilung will diese Spontanität nicht unterbinden, ganz im Gegenteil. Es will den Schaf-
In architectural education, teaching gravitates between the nurturing of creativity and the internalisation of traditional knowledge. The Department of Building Construction and Design puts a strong emphasis on basic training in the curriculum of its architecture programme, and the pedagogical approach deals essentially with these two poles. Bearing in mind that year after year, 700 young people acquire first impressions, influences, opinions, and even prejudices at a rapid pace, our chief concern is that the “first impression” of architecture is positive – and also realistic. In light of this objective, the main doctrine is understood as constantly evolving and is oriented towards three activities: perceiving – comprehending – creating. Ideally, these three are organised into a balanced, tri-polar system and mutually enrich one another. The evolution of architecture has always been sluggish, a characteristic that stems from the fact that buildings are costly and lasting artefacts. There have been repeated attempts to circumvent this inertia and endow the new with a greater dynamism. The familiar allure of breaking free from the shackles of convention in a moment of genius still characterises many teaching approaches today. Perceiving – Comprehending – Creating In our department, the project of teaching is not intended to prohibit such spontaneity. On the contrary, it aims to support the creative impulses of budding architects by embedding them in the flow of information, of both traditional and current knowledge. This is not only to allow new design work to emerge that respects the past,
Forschendes Entwerfen | 25
fensdrang angehender Architektinnen und Architekten fördern, indem es ihn einbettet in den Strom von Kenntnissen, von tradiertem und gegenwärtigem Wissen. Dies nicht nur, um das Neugeschaffene mit Respekt vor dem Alten entstehen zu lassen, sondern auch, um es besser zu verankern und den entstehenden Entwürfen eine realistische Chance zu geben, über das Papier hinaus Einfluss auf die Wirklichkeit zu nehmen. Der Dreiklang Wahrnehmen – Erkennen – Schaffen ist ein Rezept gegen die Beliebigkeit und Unverbindlichkeit. Es werden Lehrgefäße entworfen, die auf möglichst unkomplizierte Weise in der Lage sind, einen Reichtum an Kenntnissen zu vermitteln. Dazu dient unter anderem der Aufbau der Vorlesungsreihen. Sie liefern neben dem Material und der Sprache der Architektur die Erkenntnis des Baugedankens. Ein Entwurf entsteht ja nicht nur aus dem Erfüllen aller gestellten Anforderungen, sondern vor allem aus dem Verständnis heraus, dass die entstehende Form immer in einem Verhältnis zum übergeordneten, leitenden Baugedanken steht. Vorgefundenes und Verwandlung Die Lehre der Baukonstruktion als rein technische Disziplin, das Lösen von baulichen Details ohne ideellen Hintergrund, muss zwangsläufig scheitern. Es sind beide Aspekte, die sich hier stets die Waage halten. In der Architektur seien sehr wenige Erfindungen gemacht worden, sagte Aldo Rossi zu seinen Schülern.1 Ganz ähnlich Alvaro Siza, der konstatierte, dass die Architekten nichts erfänden, sondern lediglich die Wirklichkeit verwandelten.2 Fasst man die beiden Sätze dieser Persönlichkeiten zusammen, so wird schnell klar, dass ohne die Wirklichkeit, ohne vorgefundenes Material auch nichts verwandelt und nichts Neues zusammengefügt werden kann. Daher begründet sich unser dringender Wunsch, die Lehre gemeinsam entlang dem beschriebenen Dreiklang aufzubauen, anstatt zu früh eine spontane Genialität auf schwachen Füßen zu fördern. Vorlesungen und Übungen sind daher stark referenziell geprägt. Das Lehrprojekt besteht im Aufbau einer baumeisterlichen Bibliothek
26 | Astrid Staufer, Thomas Hasler
but also to better anchor it and give the new projects a realistic chance of having an effect on reality beyond the paper that they are drawn on. The triad of perceiving, comprehending, and creating is a prescription for warding off arbitrary and vague work. Lecture courses are designed to convey a wealth of knowledge in the least complicated way possible. The structure of the lecture courses serves this purpose. In addition to the substance and language of architecture, they also convey an understanding of the design concept. A design is not only derived from the fulfilment of all programmatic requirements; it also stems from the understanding that the form created is always related to the overall design concept. Context and Transformation Teaching structural design as a purely technical subject, where construction details are solved without a conceptual basis, is bound to result in failure. Both aspects must always be balanced. Very few inventions have been made in architecture, as Aldo Rossi told his students.1 Alvaro Siza similarly asserted that architects invent nothing; they simply transform reality.2 Distil these two mens’ statements and it quickly becomes clear that without the real world, without a given material context, nothing can change and nothing new can be assembled. Hence our fervent desire to construct the programme based on the triad articulated here, rather than to prematurely encourage creative genius from a weak foundation. The nature of lectures and assignments is therefore strongly referential. The project of teaching consists of building an architectural library in the mind of each and every architecture student. This is not done so that the design process of transforming familiar materials into a project happens by itself, but so that it follows sound guidelines. The notion of architectural design research becomes clearer in this context. Research mediates between targeted searches of already existing investigations and research-based design of new connections.
im Kopf eines jeden Architekturstudierenden. Nicht dass der anschließende Schaffensprozess, die Umformung des bekannten Materials in einen Entwurf, dann von selbst geschieht, aber er gewinnt dadurch immerhin robuste Leitplanken. In diesem Zusammenhang wird auch der Forschungsbegriff in der Architektur klarer. Die forschende Tätigkeit steht im Verhältnis zwischen gezielter Suche nach schon Erforschtem und dem forschenden Entwerfen neuer Verknüpfungen. Der Baugedanke Das aktuell aufzubauende Projekt besteht aus einem Vorlesungszyklus, der den Schaffensprozess, also das Entwerfen, weiter stärken soll: Es ist das Erkennen eines Baugedankens – eine zwingende Voraussetzung, um adäquate Entwurfsentscheide fällen zu können. Welche Energie ein Baugedanke freisetzen kann, lässt sich am Beispiel der Gotik exemplarisch aufzeigen. Mit der Wahl alter Konstruktionen scheint es uns nebenbei auch äußerst wertvoll, dass heutige Studenteninnen und Studenten Bauweisen vergangener Epochen lesen lernen. Und so lernen sie etwa in der Gotik den Transformationsprozess vom Baugedanken zur Baukonstruktion kennen. Wenn also Abt Suger von St. Denis das verkürzte Bibelzitat „Gott ist Licht“ in den Mund gelegt wird, womit er die Baumeister zu der konstruktiven Höchstleistung anspornte, die romanische Wand zu zerschlagen, um dann den lichten Skelettbau herbeizuführen, dann kann dieses Beispiel durchaus auch andere, sogar konträre Form ideale zum Leben erwecken. Wenn es nun darum geht, eine Wandkonstruktion oder einen Dachrand konstruktiv zu erklären, dann ist es zweifellos sinnvoll, auch hier den Baugedanken zu kennen. So ertragen denn etwa dahinterliegende kubistische Ideale auch nicht alle naheliegenden technischen Lösungen, und es ist interessant zu verfolgen, unter welchen formalen und konstruktiven Zwängen schon die einschlägig bekannten Vertreter der Moderne gelitten haben.
Abb. 1: Paulo Mendes da Rocha, Pavillon für Brasilien an der Expo 70 in Osaka. Figure 1: Paulo Mendes da Rocha, Brazilian pavilion at Expo 70 in Osaka.
The Design Concept The project currently being developed consists of a lecture series intended to further strengthen the creative process, i.e., design. It is the recognition of a design concept – a necessary prerequisite for making competent design decisions. The kind of energy a design concept is able to release is illustrated by the example of Gothic architecture. Incidentally, in the selection of older buildings, we find it extremely valuable for today’s students
Forschendes Entwerfen | 27
Erfahrung und Erfindung Der Schlüssel ist das Lernen von den Erfahrungen anderer, gepaart mit der Gewissheit, dass nicht jeder Strich eine geniale Neuerfindung ist, sondern dass er sich einreiht in eine kollektive Tätigkeit, die eine mehr oder weniger bekannte Vergangenheit und eine zu erforschende Zukunft hat. Denn die Bauweisen wandeln sich, selbst bei konstantem Baugedanken. „L’architecture est l’art d’organiser l’espace. C’est par la construction qu’il s’exprime“3 Nimmt man diesen Satz von Auguste Perret wörtlich, so wird schnell klar, dass durch die technische Wandlung stets auch die Ausdrucksfähigkeit der Bauglieder neu überprüft werden muss. Raum schaffen durch Entwerfen, Gestalt herstellen durch Konstruktion – unter diesem Leitgedanken arbeiten wir an der Weiterentwicklung der Lehrgefäße.
Anmerkungen/Notes 1 Gemäß dem Bericht von Heinrich Helfenstein, 1972–1974 Assistent von Gastprofessor Aldo Rossi an der ETH Zürich. 2 Zitiert nach: Kenneth Frampton, Grundlagen der Architektur. Studien zur Kultur des Tektonischen, München 1993, 29. 3 Auguste Perret, Contribution à une théorie de l’architecture, in: Das Werk, 1947, Heft 2, 54.
28 | Astrid Staufer, Thomas Hasler
to learn how to interpret the design methods of past eras. Thus, through studying Gothic architecture, they become acquainted with the transformation process from the design concept to the built structure. When the abbreviated Bible quotation “God is light” is attributed to Abbot Suger of St. Denis, who used it to spur on the Master Builders to the feat of demolishing the ancient Roman wall and create a thin structural frame, then this example can certainly bring to life other, even contrasting formal ideals. When the task is to explain the construction of a wall or a roof parapet, then it is doubtless useful to know the design concept involved. The underlying Cubist ideal may not support all obvious technical solutions, and it is interesting to examine under what formal and structural constraints the well-known protagonists of Modernism suffered. Experience and Invention The key is learning from the experiences of others, accompanied by the certainty that not every stroke is a brilliant reinvention, but is instead a component of a collective activity whose past is more or less known and whose future is to be explored. After all, construction methods change, even when design concepts remain constant. “L’architecture est l’art d’organiser l’espace. C’est par la construction qu’il s’exprime.”3 Taking Auguste Perret’s statement literally, it’s easy to grasp how technological change makes it necessary to continually re-examine the expressive capacity of structural elements. Creating space through design, making form from structure: these principles guide our efforts to improve the architectural programme.
Gerhard Steixner
DIE MÖGLICHKEIT EINER INSEL THE POSSIBILITY OF AN ISLAND1 Die Gesamtperformance einer Gesellschaft kann daran gemessen werden, in welchem Maße sie zu einem gerecht verteilten wirtschaftlichen Wohlstand und zu einer lebensgerechten Umwelt fähig ist. Wir befinden uns derzeit am Scheitelpunkt einer Entwicklung, die die sozialen und kulturellen Errungenschaften in Europa seit den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts radikal in Frage stellt. Die Gestaltung unseres Lebensraumes darf nicht nur kurzfristigen Kapital- und Wirtschaftsinteressen folgen, sondern muss auch und zumindest gleich gewichtet als soziale und kulturelle Aufgabenstellung begriffen werden. In Wahrnehmung dieser Agenden gerät die Architektin, der Architekt als Generalistin oder Generalist und meist wirtschaftlich schwächstes Glied zunehmend unter Druck. Wirtschaft und Recht verzeichnen im immer hemmungsloser geführten Kampf um Ressourcen wachsende Bedeutung, die mit dem Anschwellen der Flut von Regeln, Vorschriften und Normen eng korreliert. Der stetig zunehmende Anteil der Gebäudetechnik an den Baukosten und die zu tätigenden Aufwendungen im Namen der „Sicherheit“ bleiben weitgehend ohne erkennbaren Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer. Die aktuell geführte Diskussion um die Leistbarkeit verweist auf ein drohendes Systemversagen. Ein Reset ist notwendig, ein neuerlicher Anlauf, es wäre nun der dritte nach den zwanziger und siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, in Richtung Demokratisierung und Ökologisierung von Architektur und Städtebau. Breite Bildung und Ausbildung sind Grundlagen für eine qualifizierte Teilnahme an demokratischen Pro-
We can measure a society’s overall performance by the extent to which it is capable of an equitable distribution of economic wealth and providing a liveable environment. Currently, we are at the cusp of a development that radically questions the social and cultural progress achieved since the 1920s. The organisation of our living environment must not obey only short-term capital and economic interests, but must also be seen – with at least equal importance – as a social and cultural task. Addressing these agendas, architects have come under increasing pressure as generalists and, in most cases, as the weakest economic link. In a struggle for resources that is waged with less and less restraint, the gain in importance of economy and law correlates closely to a surge of rules, codes, and norms. A steadily increasing share of building technology in construction costs and necessary expenditures in the name of “safety” have, in most cases, no recognisable added value for the users. The current discussion regarding affordability highlights the threat of a system failure. A reset is needed, a new beginning; it would already be the third following those of the 1920s and the 1970s, one towards a democratisation and ecological awareness of architecture and urban planning. Broad-based education and training provide the foundation necessary for the qualified participation in democratic processes. The Faculty of Architecture at the TU Wien, with nearly 6,000 students, is one of the largest in Europe. We are therefore in the happy position of being able to confront a large part of the future generation with essential problems regarding the built environment and the one that will be built – aiming to furnish them with knowledge
Die Möglichkeit einer Insel | 29
Abb. 2: Einführung Studio Hochbau, Insel der Seligen, 560 Studierende, Audi Max der TU Wien, am 2. 10. 2014. Figure 2: Introduction to Building Construction, The Isle of the Blessed, 560 students, Audi Max,TU Wien, October 2, 2014.
Abb. 1: Umsatzverteilung Architekten Fig.1. Turnover distribution of architects
zessen. Die Architekturfakultät an der TU Wien ist mit fast 6000 Studierenden eine der größten in Europa. Wir sind daher in der erfreulichen Lage, einen großen Teil der kommenden Generation mit wesentlichen Fragestellungen in Bezug auf die gebaute und zu bauende Umwelt zu befassen – im Bestreben, sie mit jenem Wissen auszustatten, das sie befähigt, am Prozess fortschreitenden Stadt-Werdens aktiv und auf Augenhöhe teilzunehmen. Stets vor dem Hintergrund der Ressourcenfrage ist das Ziel dabei nicht nur die Vermittlung von fachlichen und methodischen Kenntnissen zu Themen des Hochbaus, sondern auch die Sensibilisierung für kultur-, gesellschafts- und sozialpolitische Dimensionen des Architekturschaffens. Der Blick zurück zu hervorragenden Beispielen in Architektur und Städtebau, gedacht und gebaut in den sechziger und siebziger Jahren in Europa und außerhalb, zeigt uns eine Zeit, in der Innovation und Vielfalt bei hoher Qualität und das Bauen für die große Zahl kein Widerspruch war. „Das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl“ (Jeremy Bentham) war
30 | Gerhard Steixner
enabling them to engage in the process of progressive urbanisation actively and at eye level. Always seen against the backdrop of the resource problem, our goal is to not only teach the professional and methodological knowledge necessary for issues of structural engineering, but also to sensitise our students to the cultural, social, and political dimensions of architectural creation. Looking back on the outstanding examples of architecture and urban planning that have been conceived and built in Europe and beyond during the 1960s and 1970s reveals a time in which high-quality innovation and diversity, and building for large numbers were not a contradiction. “The greatest happiness for the greatest number,” as Jeremy Bentham said, was not just a saying but also a lived practice. In our research project on the Evaluation of Milestones of European and Non-European Post-War Modernism 1958–78, we examine this phenomenon with the goal of raising awareness for what is actually possible.
nicht nur Zitat, sondern gelebte Praxis. Mit unserem Forschungsprojekt Evaluierung Meilensteine europäischer und außereuropäischer Nachkriegsmoderne 1958–78 untersuchen wir dieses Phänomen mit dem Ziel, Bewusstsein für das Mögliche zu wecken.
Anmerkung/Note 1 Michel Houellebecq, Die Möglichkeit einer Insel, Köln 2005.
Die Möglichkeit einer Insel | 31
András Pálffy
RETROPERSPEKTIVE. ANMERKUNGEN ZU EINER ARCHITEKTONISCHEN PRAXIS RETRO-PERSPECTIVE. NOTES ON AN ARCHITECTURAL PRACTICE
Die Vielfalt architektonischer Konzepte und Praktiken war wohl im Laufe der Geschichte der Disziplin selten so manifest wie heute. Was aus einer kulturpessimistischen Außenperspektive als Orientierungslosigkeit erscheinen mag, bildet in Wirklichkeit auch in der Zukunft die Antriebsfeder und das Zentrum architektonischen Handelns.
In the course of the discipline’s history, the diversity of architectural concepts and practices was rarely as manifest as it is today. What, seen from a cultural pessimistic perspective, might be regarded as a lack of orientation, will in fact remain the mainspring and centre of architectural practice in the future.
Statt monomanischer Programme, die sich in der Sicherheit von Klarheit und festen Zielen wiegen, herrscht heute Einsicht in die Notwendigkeit, die Pluralität der möglichen Positionen zu einem stringenten architektonischen Handeln zu verdichten. Konflikte sind den dynamischen Prozessen, die hier zum Tragen kommen, immanent, auch wenn sich die verschiedenen Positionen punktuell zu einer Gesamtheit zusammenfinden müssen. Die Dichotomien, zwischen denen hier vermittelt werden muss, sind zahlreich: Neue gesellschaftliche Anforderungen, die sich in immer neuen theoretischen Konzepten niederschlagen, stehen der Beachtung des Handwerklichen mit all seiner Tradition, aber auch seinen neuen Möglichkeiten gegenüber; der Wunsch nach dem Erfinden neuer Konzepte und Formen konkurriert mit dem Fortschreiben bereits vorhandener Bauweisen und Ideen. Letztendlich muss sich Architektur heute der Einsicht stellen, dass sowohl ihre Autonomie als auch ihre Auflösung unhaltbare Konzepte sind und der Weg jenseits dieser Punkte entlangführen muss. Gleichzeitig dürfen diese Widersprüchlichkeiten nicht in ungeordnete Beliebigkeit münden, sondern müssen sichtbar und
Instead of pursuing monomaniacal programmes that draw a false sense of security from clarity and fixed goals, today we are aware of the necessity of condensing the plurality of possible positions into a rigorous architectural practice. Conflicts are immanent to the dynamic processes at play here, even though different positions need to come together as a whole at some point. The dichotomies that we need to compromise are manifold: New social requirements influencing continuously renewed theoretical concepts are confronted with attention to skilled manual work and its traditions as well as its novel possibilities; a wish to invent new concepts and forms is up against the continuation of existing building modes and ideas. Ultimately, architecture needs to face up to the insight that its autonomy as well as its dissolution are untenable concepts, and that the way forward needs to transcend these extremes. At the same time, these contradictions may not lead to disorderly arbitrariness, but must instead remain visible and transparent and lead to concrete perspectives and requirements. Architecture can neither be mere function nor mere sculpture but has to continue to redefine and reposition itself
Retroperspektive. Anmerkungen zu einer architektonischen Praxis | 33
nachvollziehbar bleiben und in konkrete Perspektiven und Anforderungen münden. Architektur kann weder bloße Funktion noch bloße Skulptur sein, sondern muss sich in den verschiedenen Spannungsfeldern des kulturellen Diskurses auch in Zukunft permanent neu definieren und positionieren. Ein Ort, an dem sämtliche Aspekte dieser Dynamik zusammentreffen, ist die universitäre Lehre. Die Spannungen, Brüche und oft auch Widersprüche machen die Lebendigkeit dieser Lehre aus. Eine statische Herangehensweise, die mit fixen Regeln und Zielen operiert, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Neue Versuchsanordnungen definieren Architektur nicht von einem Zentrum her, sondern von den Rändern und stellen die Frage nach ihrem Anfang und Ende. Die so ausgeloteten architektonischen Programme und Verfahren müssen sich in einem permanenten Wechselspiel an außerarchitektonischen, nicht zuletzt politischen, Gegebenheiten reiben. So entsteht eine weitere Ebene, die das fixe Einschreiben eindeutiger Strukturen einmal
34 | András Pálffy
Abb. 1: „Archivio Jodice“. Ausstellung Neapel, 2011, Sala Meridiana, Archäologisches Museum Neapel: Studentenarbeiten – Institut für Gestaltungslehre und Entwerfen. Fig. 1: „Archivio Jodice“. Exhibition Naples, 2011, Sala Meridiana, Archaeological Museum Naples: Students‘ works, Institute of Architecture and Design.
within the various tensions of the cultural discourse. One place where all aspects of these dynamics converge is in academic teaching. Tensions, breaks, and often even contradictions constitute the lifeblood of such teaching. A static approach, operating with fixed rules and goals, is doomed to fail. New experimental set-ups define architecture not from a centre, but from the margins, and question its beginning and its end. The architectural programmes and processes thus explored have to rub against non-architectural, often political, factors in permanent interaction. This generates another level that once more precludes a fixed inscription of defined structures. These dynamics also give rise to the role of teaching in architecture. Even
mehr unmöglich macht. Aus dieser Dynamik ergibt sich auch die Rolle der Lehre in der Architektur. Noch viel weniger als in anderen Disziplinen ist sie von der Praxis als einer permanenten Auslotung ihrer Bedingungen trennbar. Obwohl die Lehre in einem gewissen Sinne vor dem Bauen liegt, ist sie diesem auch nachgeordnet und besetzt so einen Platz im Zentrum des architektonischen Denkens. Aus der Praxis kommend, ist sie der Versuch, das Wissen über das Fach und alle umgebenden Bereiche umzusetzen und damit permanent zu erweitern. Eine Architekturlehre darf sich daher nicht nur auf die unmittelbaren architektonischen Mittel beschränken, sondern muss ein umfassenderes Verständnis auf einer allgemeinen epistemologischen Ebene vermitteln. Die Unauflöslichkeiten, die architektonisches Denken und Handeln bestimmen, lassen sich so auf eine generelle Ebene übertragen und dort besser formulieren. Die Normativität, zu der eine Lehre sich üblicherweise berufen fühlt, muss unter diesen Voraussetzungen aufgegeben werden. Aus der Sphäre der Rationalität kommend, de-
Abb. 2: Projektpräsentation Institut für Gestaltungslehre und Entwerfen, 2010: Präsentationsmodelle, Seminarraum am Institut für Gestaltungslehre und Entwerfen, Technische Universität Wien. Fig. 2: Presentation of projects, 2010: Models for presentation, Class room at the Institute of Architecture and Design, TU Wien.
less than in other disciplines, it can be separated from its practice as a permanent exploration of its conditions. Although teaching, in a sense, precedes building, it is also subordinate to it, and thus occupies a place in the centre of architectural thought. Coming from practice, it is the attempt to implement professional knowledge including all its adjacent fields, and thus to permanently expand it. Teaching architecture must therefore not limit itself to the immediate tools of architecture, but also needs to teach a more comprehensive understanding on a general, epistemological level. The irresolvable issues defining architectural thought and practice can thus be translated to and formulated on a general level. Under these circumstances, the normativity teaching usually feels com-
Retroperspektive. Anmerkungen zu einer architektonischen Praxis | 35
finiert sie sich als Produkt stets in Veränderung befindlicher sozialer und kultureller Praktiken immer auch durch das Irrationale. Regeln in der Architektur zu etablieren, gründet nicht nur auf der Notwendigkeit, die Materie dem Anlass entsprechend zu strukturieren und damit den Bedürfnissen nach existentiellen Sicherheiten zu entsprechen, sondern sie entsteht auch aus der Notwendigkeit einer immanenten symbolischen Sprache des architektonischen Denkens und seiner Strukturierung. Im Spannungsfeld zwischen Rationalismus und Empirismus stellt sich für die Lehre die Frage nach dem Beginn, nach den Mustern oder Regularitäten, von denen unsere Erfahrung ausgeht. Der ausgeprägte Bezug zum Umfeld wird damit aber auch zur wesentlichen Grundlage, zum Ausgangspunkt des architektonischen Handelns, das sich so in klar definierte Existenzen einfügt und erst innerhalb dieser Tatsache mit all ihren Reibungs-
36 | András Pálffy
Abb. 3: Schlusskritik „Dorftexturen“ , Studentenarbeiten, Institut für Gestaltungslehre und Entwerfen 2013. Aufbaulabor, Technische Universität Wien. Fig 3: Final Critique “Village textures”. Students’ Wotks. Institute of Architecture and Design 2013. TU Wen.
pelled to conform to must be abandoned. As a product of permanently changing social and cultural practices in the sphere of rationality, it is always also defined by the irrational. The establishment of rules in architecture is not only founded in the necessity to structure matter according to the occasion, and thus to conform to the need for existential certainty, but also in the necessity of an immanent, symbolic language of architectural thought and its structures. In the tension between rationalism and empiricism, teaching needs to address the problem of the begin-
flächen und Widerständen seine Bedeutung erfährt. Damit steht nicht mehr die objekthafte Präsenz eines isolierten Designwertes im Zentrum der Wahrnehmung, sondern vielmehr das tatsächliche Potential eines architektonischen Eingriffes in die Umgebung. Das Ergebnis dieser Bemühungen bildet sich in einer eigenständigen Charakteristik ab, die nur mit großen Einschränkungen wiederholbar ist. Deutlich wird damit aber auch, dass an dieser Schnittstelle einmalige komplexe Wirklichkeiten von hoher räumlicher Qualität entstehen können. Ein wesentlicher Aspekt der Lehre muss daher sein, zur Entwicklung typologisch klarer, jedoch hochspezifischer Lösungen innerhalb eines Kontextes anzuleiten und so das räumliche Potential einer spezifischen Aufgabenstellung aufs Äußerste zu entfalten. Die Präzision im Verhältnis von Inhalt, architektonischer Form und ihrer Materialität wird so in der Summe zur bestimmenden Referenz für grundlegende Aussagen, unabhängig vom Format der jeweiligen Handlung. Auf dieser Grundlage verdichten sich Programm, räumliche Qualität und konstruktive Logik zu einer Sprache, die in der Zusammenführung dieser sie bedingenden Parameter eine weitgehende Autonomie anstrebt. Das praktische Verständnis dieser Zusammenhänge ist auch in Zukunft ein essentielles Moment unserer Architekturausbildung.
ning, of patterns and regularities presupposed by our experiences. However, its clear relation to its surroundings becomes an essential basis, a starting point of architectural practice, which thus inserts itself into clearly defined existences and gains significance by this fact only, with all its frictions and resistances. Its focus is not the concrete objective presence of an isolated design value, but rather the actual potential of an architectural intervention into the environment. These efforts result in an individual flavour that can be reproduced to a limited extent only. However, we can also see that complex realities with extreme spatial qualities can develop within this interface. One fundamental aspect of teaching must therefore be the instruction of students in the development of typologically clear yet highly specific solutions within a context, and thus to develop the potential of a specific task to the maximum. The combination of precision in relation to content, of architectural form and its materiality therefore constitutes the key reference for fundamental statements, regardless of the format of the respective practice. On this basis, the programme, spatial quality, and constructive logic are condensed into a language that strives for considerable autonomy in combining these conditioning parameters. A practical understanding of these interactions will continue to remain an essential element of our architectural education in the future.
Retroperspektive. Anmerkungen zu einer architektonischen Praxis | 37
Christoph Luchsinger
STÄDTEBAU URBAN DESIGN „Das Denken nimmt in der Stadt Gestalt an, aber die Stadtgestalt ihrerseits bedingt das Denken“1 (Lewis Mumford, 1938) Die Frage, wie Stadt kulturelle Praxis bestimmt, und umgekehrt, wie sich Theorie in der Stadt manifestiert, ist eines der zentralen Themen der Aktivitäten im Fachbereich Städtebau. Alle städtebaulichen Planungen und alle dazugehörenden wissenschaftlichen Unterbauten erwachsen aus einer Dialektik des Findens und Erfindens, das heißt die Reflexionen und die Ideen sind gleichermaßen Bestandteile des städtebaulichen Metiers. Der Fachbereich vertritt dabei keine unité de doctrine, sondern eine Vielfalt von Zugängen aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln und Motivationen. Experimentierfreudigkeit und methodische Prägnanz ist allen diesen Ansätzen gemeinsam und letztlich die Substanz universitärer Auseinandersetzung. Deshalb suchen wir bewusst alle möglichen (und oft unmöglichen) thematischen und situativen Herausforderungen, um daraus neuartige Zugangsweisen zu entwickeln und unvorhergesehene Kenntnisse herauszuarbeiten. Universität und Stadt möglichst innig miteinander zu verweben, liegt ohne Zweifel im Interesse beider Seiten. Aus Sicht der Universität – und insbesondere der Disziplin Städtebau – geht es darum, die akademische Sichtweise am Habitus des jeweiligen städtischen Umfelds zu messen und auch auszurichten. Aus Sicht der Stadt geht es darum, von der Abstraktionsfähigkeit universitärer Auseinandersetzung zu profitieren, um die eigenen Verhaltensmuster kritisch zu hinterfragen. Wir suchen sehr bewusst das praktische Engagement, weil
“Mind takes form in the city; and in turn, urban forms condition mind.”1 (Lewis Mumford, 1938) The question of how cities condition cultural practice and, vice versa, how theory becomes manifest in the city, is one of the key issues at stake at the Department of Urban Design. All urban planning and the associated scientific foundations arise from a dialectics of finding and inventing, i.e. reflection and ideas alike are part of the professional practice of urban design. The department does not present any unité de doctrine but multiple approaches from a variety of angles and motivations. Experimentation and methodological rigour are shared by all these approaches, and form an essential and inherent part of academic discourse. Therefore, we deliberately seek out all kinds of possible (and often impossible) thematic and situational challenges to develop novel approaches and to elaborate unexpected insights. Without a doubt, it is in both their interests that university and city interweave as intimately as possible. From the point of view of the university – and in particular of the discipline of urban design – this is about matching its academic perspective against the habitus of its respective urban environment, but also about coordinating with it. From the city’s perspective, it is about benefiting from the abstractive abilities of academic debate in order to question its own patterns of behaviour. We deliberately seek out practical commitment, because it is only through practical commitment that theory becomes reality.
Städtebau | 39
nur im praktischen Engagement Theorien wirklich werden. Städtebau ist allerdings längst keine einheitliche, aus Geometer-, Ingenieur- und Architekturwesen erwachsene Disziplin mehr (wenn sie es überhaupt je war), sondern ein Bündel von Strategien zur Einschätzung, Besetzung und Veränderung des Raums. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund verfolgen die Aktivitäten des Fachbereichs Städtebau immer wiederkehrende Themenstränge wie Stadterneuerung, Festivalisierung, Stadtmorphologie, ungeplante Stadtentwicklung, Tourismus, Hochhauskonzepte, usw., aber auch internationale Bildungs- und Ausbildungsoffensiven. Anstatt die Themen auseinanderzudividieren, versuchen wir, sie zu überlagern und methodische und strategische Gemeinsamkeiten herauszufiltern. Dies bedeutet grundsätzlich eine absichtliche Erhöhung der Komplexität mit dem Ziel, erst zu dem Zeitpunkt klar zu sehen, an dem die „Verwirrung“ sehr groß ist. In diesem Sinne widerspricht die städtebauliche Angangsweise einer klassisch naturwissenschaftlichen, die die Dinge möglichst exakt zerteilt, um sie möglichst genau beschreiben und instrumentieren zu können. Diese Vorstellung universitären Denkens ist im städtebaulichen Diskurs nicht zielführend. Städtebauliche Problemstellungen sind hervorragend geeignet, solche Vielschichtigkeiten auszukosten. Wir leben und erleben dies in jeder einzelnen Lehrveranstaltung, in jedem einzelnen Forschungsprojekt, in jeder einzelnen Zusammenarbeit im interuniversitären Bereich und in Zusammenarbeiten mit der Stadtpolitik und der Stadtadministration. Der Fachbereich Städtebau sucht mit seinen Aktivitäten deshalb immer den direkten Kontakt zur städtebaulichen Realität. Keine unserer Lehr- und Forschungsaktivitäten bewegt sich im abstrakten Raum, alle sind sehr konkret angelegt. Unabhängig davon, ob wir uns in Wien, in der Ukraine, in Südamerika, auf den Philippinen, in Heidelberg, Zürich, Valencia, Matera oder in Skopje befinden – alle unsere Interessen orientieren sich an den jeweiligen Problemlagen. Wir beziehen daraus unsere eigenen methodischen Vorgehensweisen und stellen dann fest, dass unsere methodischen Grund-
40 | Christoph Luchsinger
Urban design has long ceased to be a uniform discipline emerged from the fields of geometry, engineering, and architecture (if it ever was), but has instead turned into a cluster of strategies to assess, occupy, and transform space. Against this backdrop, the activities of the Department of Urban Design pursue ever-recurring issues such as urban regeneration, festivalisation, urban morphology, unplanned urban development, tourism, high-rise concepts, etc., but also international education and training programmes. Instead of treating these issues separately, we attempt to layer them and to filter out their methodical and strategic common ground. This essentially means to purposefully increase complexity, in order to delay the moment of clarity to a point when “confusion” is at its height. Insofar, an urban design approach contravenes the traditional scientific strategy that strives for an exact division of things in order to be able to describe and objectify them in as much detail as possible. This concept of academic thinking is not productive in the urban design discourse. Urban design problems are eminently suited to savouring such complexities. We live and experience them in every single class, in every single research project, in every cooperation between universities, and in each collaboration with urban politicians and the city’s administration. In all its activities, therefore, the Department of Urban Design strives for direct contact with urban reality. None of our teaching or research activities operate in abstract space, they all have a very concrete orientation. Whether we are in the Ukraine, in South America, on the Philippines, in Heidelberg, Zurich, Valencia, Matera, or Skopje – our interest is focussed on their specific problems. Our strategies are derived from the city itself; however, we have come to realise that our methodological basis always proves to be immediately comparable and mutually fruitful, even though the staff of our department approach from very different angles and work on extremely diverse questions. This methodological and intellectual convergence is based on a fortunate tradition in the Department of Urban Design, but also, and essentially, in a tolerant
lagen sich immer wieder sehr direkt vergleichen lassen und auch gegenseitig befruchten, obwohl die Mitarbeitenden an unserem Fachbereich aus sehr unterschiedlichen Richtungen kommen und sehr unterschiedliche Themen bearbeiten. Diese methodische und intellektuelle Konvergenz basiert auf einer günstigen Tradition des Fachbereichs Städtebau, aber wesentlich auch auf einer toleranten Arbeitskultur und dem permanenten Versuch, neue Erfahrungen, Unerwartetes und Überraschendes in ein klar umrissenes Format zu bringen – anders gesagt: Probleme unter ästhetischen Aspekten zu ordnen. Es geht hierbei weniger um die letztlich in Erscheinung tretende, sichtbare, kommunizierbare Form, als um die Art und Weise, wie Form als Instrument in der Lage ist, komplexe Probleme aufzulösen. Form ist nicht das Ziel, sondern der Weg zu einer nächsthöheren, genauer beschreibbaren Problemstellung, von der aus wiederum Form weiterführt. Vermutlich ist jede intellektuelle Arbeit eine Art von Formfindung, die Frage ist lediglich, wie bewusst oder offensiv Form eingesetzt wird. Städtebau ist eine wunderbare Disziplin. Sie umfasst alle Aktivitäten und Anliegen einer städtisch organisierten Gesellschaft, lernt deren innerste Anliegen kennen und schätzen, schlägt Lösungen für deren räumliche und strukturelle Organisation vor und darf noch deren Lebensumfeld verschönern. Städtebau ist aber auch eine verwundbare Disziplin, gerade weil sie so mächtige Zusammenhänge organisiert. Städtebau ist, genau weil diese Widersprüchlichkeit dieser Disziplin inhärent ist, eine unbedingt universitäre Angelegenheit. Nur an der Universität kann der Diskurs über die Stadt unabhängig von den sie Steuernden, den sie Beeinflussenden und auch den sie Unterlaufenden geführt werden – allerdings immer in voller Kenntnis und Einschätzung dieser Kräfte.
working culture and the permanent attempt to fit new experiences, the unexpected and the surprising, into a clearly defined format – or, put differently: to order problems according to aesthetic aspects. This is less about the final visible, communicable form than about the manner in which form as a tool is able to resolve complex problems. Form is not the goal, but the way to another problem that can be described in more detail, where it is again form that determines the way forward. Any intellectual work is probably a kind of form finding, it is only a question of how consciously or aggressively form is used. Urban design is a marvellous discipline. It covers all activities and concerns of urban society, gets to know and to appreciate its innermost concerns, proffers solutions for its spatial and structural organisation and even has the privilege of embellishing its living environment. However, urban design is also a marvellous discipline because it organises such powerful contexts. Because these contradictions are inherent to the discipline, urban design is an implicitly academic matter. Only a university is able to engage in the discourse about the city without depending on those who govern it, those who influence it, and even those who subvert it – however, it always needs to be fully aware of and to appreciate these forces. Anmerkung/Note 1 Lewis Mumford: The Culture of Cities, New York 1938, 5.
Städtebau | 41
Richard Stiles, Norbert Trolf, Peter Kurz, Gisa Ruland
LANDSCHAFTSARCHITEKTUR AN DER TU WIEN LANDSCAPE ARCHITECTURE AT THE TU WIEN Zunehmend werden viele Probleme, Chancen und Herausforderungen der menschlichen Umwelt als Fragestellungen von Landschaft und Freiraum erkannt und neu formuliert. Fragen der Lebensqualität, Klimaanpassung, Identität, Zersiedlung, Nachhaltigkeit und der sozialen Gerechtigkeit beinhalten stets eine landschaftliche Dimension.
More and more problems, opportunities and challenges associated with the human environment are being recognised and understood as landscape issues. These range from the quality of life, climate change adaptation, identity and urban sprawl to sustainability and social justice, all of which have a strong landscape dimension.
Landschaft als globale Herausforderung
Landscape as a Global Challenge
Die Bedeutung dieser Zusammenhänge spiegelt sich nicht zuletzt in der Europäischen Landschaftskonvention – dem ersten internationalen Abkommen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft in Europa aus 2004 – wider. In der Forschung werden landschaftsorientierte Ansätze zur Bewältigung raumbezogener Herausforderungen forciert: Das erste interdisziplinäre Science Policy Briefing der European Science Foundation Landscape in a Changing World wurde 2010 veröffentlicht. In einer Gesellschaft, in der die öffentliche Hand zunehmend an Durchsetzungskraft verliert, in der gleichzeitig eine selbstbewusste Bürgerschaft an der Gestaltung unserer Umwelt teilhaben will, stoßen die bisherige Ordnungsplanung und ihre Instrumente an ihre Grenzen. Die Anforderung an die Planung, komplexe Fragestellungen zu beantworten, führt dazu, dass die etablierten Berufsbilder der Architektin/des Architekten und der Raumplanerin/des Raumplaners und deren Selbstverständnis die Fragen nur mehr unzureichend beantworten werden können. Interdisziplinäre und integrative Planungsansätze sollen helfen, den umfassenden Anforderungen besser gerecht zu werden. In diesem Kontext hat die Landschaftsarchitektur als querschnittsorientierte Disziplin vor allem im Diskurs
The significance of this new awareness is reflected in the European Landscape Convention – which came into force in 2004 – the first international treaty devoted specifically to the protection, management and planning of the European landscape. In the field of research, this growing understanding of the importance of landscape-orientated approaches to dealing with spatial challenges has been recognised in the European Science Foundation’s first interdisciplinary Science Policy Briefing: “Landscape in a Changing World”, published in 2010. In a society in which the public sector is seemingly less and less willing to intervene in shaping the environment, while at the same time civil society is growing in self-confidence and increasingly asserting its right to participate in decision making, traditional approaches to planning are coming up against their limits. The need to find answers to complex problems means that traditional professional roles of architects and planners are no longer well suited to provide satisfactory answers. Instead interdisciplinary and integrative planning approaches are often better suited to respond to challenges of growing complexity. In this context, landscape architecture, with its cross-disciplinary approach, is becoming increasingly
Landschaftsarchitektur an der TU Wien | 43
um eine nachhaltige räumliche Entwicklung an Bedeutung gewonnen. Die Landschaft formt – in physischer, sozialer, politischer Dimension – den gemeinsamen Ort der Kommunikation und Verständigung zwischen den Disziplinen. Nicht nur in der Raumplanung, sondern vor allem im Überlappungsbereich zwischen Architektur und Raumplanung, im Diskurs um die Lebensqualität unserer Städte werden Fragen aufgeworfen, die uns zu einer intensiven Auseinandersetzung mit ökologischen, sozialen, ökonomischen, aber auch mit gestalterischen Aspekten zwingen. Landschaftsarchitektur leistet hier sowohl auf theoretisch-konzeptioneller als auch auf praktisch-angewandter Ebene wesentliche Beiträge. Landschaftsarchitektur an technischen Universitäten An der TU Wien wird diesem Umstand in Forschung und Lehre bereits seit 1971 Rechnung getragen. Die jüngsten Positionierungen der Landschaftsarchitektur als Institut bzw. Professur an der Technischen Universität in Graz und der Universität Innsbruck zeigen, dass die Bedeutung der Landschaftsarchitektur nicht nur in der Raumplanung, sondern auch in der Architekturausbildung an Bedeutung gewonnen hat. Die Fakultät für Architektur und Raumplanung an der TU Wien zeichnet sich vor allem durch die Vielzahl von Fachbereichen aus, die sich seit vielen Jahren aktiv in Lehre und Forschung einbringen. Der fakultätsinterne Diskurs um die Positionierung und Profilierung unserer Hochschule im internationalen Vergleich führt, bei allen unterschiedlichen Positionen, immer zum Ergebnis, dass ein Ausbildungsprofil der TU in der Breite, nicht aber in der Spezialisierung und Konzentration zu finden sein wird. Tatsächlich verfügt die TU Wien mit ihren Kompetenzen wie keine andere österreichische/europäische Universität über das Potential, komplexe, planungsrelevante Fragestellungen kompetent beantworten zu können. Ein breites Kompetenzfeld ist zwar Voraussetzung, aber keine Garantie für eine integrative Forschungs- und
44 | Richard Stiles, Norbert Trolf, Peter Kurz, Gisa Ruland
important, in particular in the context of the search for more sustainable forms of development. Landscape, with its physical, social and political dimensions, shapes the common realm of communication and understanding between the disciplines. The developing discourse about the quality of life in towns and cities is making it necessary to find solutions to a wide range of ecological, social and economic problems, but also to address design issues. These exist, not just in the context of urban and regional planning, but also at the interface between the architecture and planning disciplines. Here, landscape architecture can provide an important contribution to solutions, both at a theoretical and conceptual level as well as from a practical-applied point of view. Landscape Architecture at Universities of Technology The TU Wien has recognised the importance of landscape in its teaching and research since 1971. The much more recent establishment of the discipline at the smaller Austrian technical universities of Graz and Innsbruck, through the creation of a new department and a chair respectively, is an indication of a growing awareness of the importance of landscape architecture, not only in the education of urban and regional planners, but also for architects. The Faculty of Architecture and Planning at the TU Wien is characterised by its wide range of departments, which have been contributing actively in the fields of teaching and research for many years. Despite the varied positions of the actors concerned, the internal discourse within the faculty regarding the position of the university in the international context, has always confirmed that the educational profile offered should continue to be a broad one, rather than be characterised by specialisation or a narrowing of focus. As a result of this diversity, the TU Wien, like no other Austrian or indeed European University, has the potential to provide appropriate answers to a wide range of complex planning problems. A broad range of competences is an important pre-
Lehrkultur. Einige wenige Fachbereiche – unter anderem auch das Institut für Landschaftsplanung und Gartenkunst – versuchen seit vielen Jahren kontinuierlich interdisziplinäre Ansätze in die Forschung und Lehre einzubringen. An aktuellen Aufgaben und Themen mangelt es nicht: Das Spektrum reicht von Kulturlandschaftsentwicklung, Landschaft und Tourismus, Landschaftswandel, Landwirtschaft in der Stadt, Wohnen und Wohnumfeld, soziale (Frei-)Räume bis zum öffentlichen Raum. In der Lehre sieht der Fachbereich seine Aufgabe in der integrativen und transdisziplinären Vermittlung landschaftsplanerischer bzw. landschaftsgestalterischer Grundkompetenzen sowie der Möglichkeit zur fachlichen Vertiefung entlang der Architektur- und Raumplanungsausbildung im Masterstudium. Die Forschung am Fachbereich wird im Wesent lichen vom wissenschaftlichen Personal und dessen Forschungsschwerpunkten in den Bereichen der Landschaftsentwicklung sowie vom Themenfeld Landschaft und Stadt und der Gartenkunst getragen. Perspektiven für eine künftige Entwicklung des Fachbereiches Der Fachbereich sieht für eine zukunftsweisende Entwicklung nicht nur des Fachbereiches, sondern auch der Fakultät an der TU Wien folgende Rahmenbedingungen als unabdingbar an: Um eine zukunftsorientierte Lehre und Forschung gewährleisten zu können, muss die Kommunikation zwischen den Studienrichtungen (Lehrende und Studierende), zwischen den Fachbereichen und innerhalb der Fakultäten, gefördert, müssen hierarchische Strukturen aufgelöst und fachübergreifende Lehr- und Forschungsprojekte gezielt gefördert werden. Eine kontinuierliche Betreuung und Entwicklung fachlicher Schwerpunkte sowie eine wachsende Nachfrage nach transdisziplinären Ansätzen und Konzepten stellt für die Fakultät eine erhebliche Herausforderung dar, die nur mit entsprechenden Ressourcen fachkompetent bewältigt werden kann. Die wachsenden Risiken im Umweltbereich, wie globaler (Klima-)Wandel, Bevölkerungs-
condition for an integrated culture of teaching and research. Over the years, only a limited number of departments have attempted to develop such a culture – one of which has been the Department of Landscape Architecture. There continues to be no lack of challenges to address: the spectrum ranges from the sustainable development of cultural landscapes, through landscape and tourism, landscape change, climate resilience and urban open space, the residential environment, social (open) spaces to the public realm. In its teaching, the department sees its role in providing an integrating and trans-disciplinary introduction to basic landscape planning and landscape design competences, as well as providing opportunities for a degree of specialisation within the context of the master’s programmes in architecture and urban and regional planning. Research in the department depends to a large degree on the specialised interests of the academic staff, and in reflection of the broad scope of teaching required, ranges across the fields of landscape development and urban open space to garden history. Perspectives for the Future Development of the Department The following provisions are seen as being vital to the establishment of a framework necessary for the forward- looking development of teaching and research, not only from the point of view of the department but for the faculty as a whole. Better communication between the two study programmes (on the part of both teachers and students) and between the different departments within the faculty must be encouraged, hierarchical structures broken down and the establishment of interdisciplinary teaching and research groups supported. The continuing development of specialised areas of teaching and research and a growing demand for trans-disciplinary approaches and specialisms represents a considerable challenge for the faculty, which can only be met effectively through the provision of the necessary resourc-
Landschaftsarchitektur an der TU Wien | 45
wachstum, Ernährung und Migration, werden künftig alle Planungsdisziplinen maßgeblich beeinflussen. Der landschaftlichen Perspektive kommt dabei eine zentrale Stellung zu, die verstärkt in Forschung und Lehre zu vertreten sein wird. In diesem Sinne leistet der Fachbereich durch seine internationale Vernetzung bereits einen wichtigen Beitrag (vgl. die Netzwerke ECLAS, Le Notre). Durch die steigende Mobilität im Lehr- und Wissenschaftsbereich ist die Nachfrage nach qualifizierten postgradualen Forschungs- und Studienplätzen aus dem Ausland groß. Nach dem Vorbild vergleichbarer europäischer Universitäten, wie der TU München, TU Berlin, ETH Zürich oder der TU Delft, die den Bologna-Prozess genutzt haben, um Masterstudiengänge mit landschaftsrelevanten Schwerpunkten zu installieren, sind auch an der TU Wien Master- und PhD-Studiengänge zu entwickeln, um international nicht an Attraktivität zu verlieren. Durch die Sicherung bzw. Schaffung der genannten offenen und durchlässigen universitären Strukturen können aktuelle und künftige fachspezifische Herausforderungen überzeugend angenommen und vorhandene Kompetenzen weiterentwickelt werden.
46 | Richard Stiles, Norbert Trolf, Peter Kurz, Gisa Ruland
es. The growing environmental threats (global climate change, population growth, urbanisation, food security and migration) will be important future influences on all planning disciplines. Landscape perspectives on these issues are already becoming more important and will need to be incorporated more widely throughout all teaching and research. From this perspective the department already plays an important role through its the international networks it has been instrumental in establishing (in particular ECLAS and Le Notre). As a result of increased mobility in the field of higher education there is increasing demand for high quality postgraduate studies and research abroad. Following the example of comparable European universities such as the TU Munich, TU Berlin, ETH Zurich and the TU Delft, which have taken advantage of the Bologna Process to implement landscape architecture master’s and PhD programmes, the TU Wien needs to follow suit if it is not to lose its international attractiveness. Through the creation of open and transparent university structures as outlined above, it will be possible to provide a convincing response to current and future academic challenges and to further develop and build on our existing competences.
Marina Döring-Williams
ARCHITEKTUR UND RAUMPLANUNG: FORSCHUNG UND LEHRE ARCHITECTURE AND PLANNING: RESEARCH AND TEACHING „Technik für Menschen. Durch unsere Forschung entwickeln wir wissenschaftliche Exzellenz, durch die Lehre vermitteln wir umfassende Kompetenz.“ So präsentiert sich die TU Wien und unterstreicht damit an erster Stelle ihren Forschungsauftrag. Betrachtet man in den entsprechenden Publikationsdatenbanken den Forschungs-Output der Fakultät für Architektur und Raumplanung, ist zu bemerken, dass sie hier nur mit Mühe mithalten kann. Grund dafür ist sicherlich einerseits die extreme Heterogenität der einzelnen Institute. So kann die Fakultät zwar auch mit einigen TU-Slogan-konformen Fächern in den technisch (und auch den naturwissenschaftlich) orientierten Abteilungen aufwarten, hier sind aber auch viele Disziplinen angesiedelt, deren Aufgabengebiete im geisteswissenschaftlichen und kreativ-künstlerischen Bereich liegen. Mit diesen kann die Fakultät zwangsläufig nur ansatzweise die Förderungsschwerpunkte der TU Wien treffen und liegt damit gleichzeitig auch meist außerhalb eines vordergründig wirtschaftlich begründeten Interesses. Anderseits darf bei der Betrachtung der Forschungsleistung in der Architektur und Raumplanung nicht außer Acht gelassen werden, dass diese unsere Fakultät sowohl mit den mit Abstand höchsten Studierendenzahlen im TU-Vergleich als auch mit massiver Unterkapazität bei den Lehrenden zu kämpfen hat. Baugeschichte und Bauforschung zwischen Geisteswissenschaft und Technik _ IST Diese Diskrepanzen in Forschung und Lehre sind auch in der Abteilung Baugeschichte :: Bauforschung zu spüren.
“Technology for people. We develop scientific excellence through research and enhance comprehensive competence through teaching.” This is how the TU Wien presents itself, emphasising its research focus in first place. When checking the research output of the Faculty for Architecture and Planning in publication databases, we notice that it is hard put to keep up. One reason for this is the extreme heterogeneity of its individual institutes. While some of the faculty’s subjects are in departments with a technological (and also scientific) orientation and thus compatible with the TU slogan, there are also many disciplines whose activities are situated in the humanities and the creative artistic sphere. There, the faculty inevitably only marginally conforms to the research emphasis of the TU Wien, and in most cases, its work takes it beyond primarily economic interests. On the other hand, in considering the research performance of the Faculty of Architecture and Spatial Planning, the fact that our faculty struggles with the highest student enrolment numbers by far in the TU and with the massive understaffing of its teaching team may not be underestimated. Architectural History and Research between the Humanities and Technology _ WHAT IS These discrepancies in research and teaching are also noticeable in the Architectural History :: Architectural Research department. It deals with buildings and building in history, spanning the complexity of the field – documentation and analysis, examination of architectural and semantic historical context, and discussions on possibil-
Architektur und Raumplanung: Forschung und Lehre | 49
Sie beschäftigt sich mit Bauten und dem Bauen im historischen Bestand in der ganzen Komplexität des Themenbereichs – angefangen bei der Dokumentation und der Analyse über die Betrachtung des architektur- und bedeutungsgeschichtlichen Kontextes bis hin zur Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten einer bestandsadäquaten Um- oder Neunutzung der betreffenden Architektur. Die Baugeschichte, traditionell zu den Grundlagenfächern der Studienrichtung zählend, arbeitet an der TU Wien in Lehre und Forschung epochenübergreifend mit dem bereits geschaffenen Raum von der Antike bis zur Gegenwart, im europäischen sowie im außereuropäischen Bereich. Speziell die Aufnahme- und Untersuchungsmethoden der Historischen Bauforschung ermöglichen den Studierenden dabei die Auseinandersetzung mit Architektur im Maßstab 1 : 1 – so praxisnah und intensiv wie sonst kaum innerhalb des Architekturstudiums. Sie ist dabei naturgemäß auf kompetenzübergreifende Zusammenarbeit konditioniert. Ein dichtes Kooperationsnetz innerhalb der eigenen Fakultät, aber auch mit den Fakultäten für Bauingenieurwesen, für Informatik, für Mathematik und Geoinformation und mit der Fakultät für Physik (Atominstitut) an der TU Wien sowie mit den österreichischen Forschungsinstitutionen in den Bereichen Denkmalpflege, Restaurierung, Materialanalyse, Archäologie, Kultur- und Sozialanthropologie etc. und nicht zuletzt auch mit zahlreichen Universitäten und Forschungsstätten auf nationaler und internationaler Ebene ermöglicht es, sich dem Gebilde „Architektur im Kontext“ in seiner ganzen Komplexität transdisziplinär anzunähern. Aber auch in der Baugeschichte und Bauforschung ist ganz deutlich zu bemerken, dass das Interesse an Forschungsförderung – sowohl innerhalb der TU Wien als auch bei den Partnerinstitutionen – genau dort steigt, wo die technischen Kompetenzen der Abteilung (innovative Aufnahmetechniken, 3D-Laserscanning, Optimierungsverfahren im Postprocessing, GIS-Projekte etc.) im Vordergrund stehen. Die geisteswissenschaftlich orien tierte Seite der Abteilung hingegen muss meist mit extremem bürokratischen (und auch Zeit-) Aufwand um die nötigsten Zuwendungen kämpfen.
50 | Marina Döring-Williams
ities for the adequate conversion or adaptation of such architecture. In its teaching and research, Architectural History at the TU Wien, traditionally one of the basic subjects of the discipline, focuses on spaces that have been created throughout the ages, from Antiquity to the present, in Europe and beyond. In particular, the methods for recording and examining historic buildings enable students to engage with architecture on a 1:1 scale – in a manner so close to practice and so intensive that it is hardly equalled elsewhere in their architectural studies. Naturally, research is conditioned for cross-competence collaboration. A close-knit network of cooperation within our own faculty, but also with the Faculties of Civil Engineering, Informatics, Mathematics and Geoinformation, and the Faculty of Physics (Institute of Atomic and Subatomic Physics) at the TU Wien. This goes on to include Austrian research institutions in the fields of monument preservation, restoration, materials analysis, archaeology, art and social anthropology, etc., as well as a number of national and international universities and research centres. All this allows us to approach the construct of “architecture in context” in all of its complexity in a trans-disciplinary manner. However, in the field of architectural history and research, we also are confronted with the fact that interest in providing research funding – from the TU Wien as well as from partner institutions – increases in exactly those fields in which the technical competences of the department (innovative recording technologies, 3D laser scanning, post-processing optimisation procedures, GIS projects, etc.) are at the forefront. The humanities-oriented part of the department, on the other hand, must often invest extreme bureaucratic (and time) efforts in fighting for even the most necessary of funding. Centre of Excellence for the Built Environment _ WHAT COULD BE Currently, more than 70 % of all architecture investment in Austria goes into existing buildings. Thus, issues like examination, conversion, and conservation of historic
Exzellenzzentrum „Gebaute Umwelt“ _ KÖNNTE Aktuell werden in Österreich mehr als 70 % aller Investitionen, betreffend Architektur, im Bereich bestehender Bauten getätigt. Somit sind Themen wie Untersuchung, Umbau und Erhaltung historischer Bausubstanz allmählich und zunehmend auch in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Die Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien kann auf diesem Gebiet – und zwar gerade aufgrund der Breite ihrer zur Verfügung stehenden fachspezifischen Instrumente – mit sämtlichen Forschungs-, Analyse-, Planungs- und Umsetzungskompetenzen aufwarten. Hinzu kommt Wien als Stätte des UNESCO-Weltkulturerbes, mit seinem Pool an historisch bedeutender Architektur, die einen Bogen von der Antike bis in die Gegenwart spannt, aber auch mit der Vielzahl themennah arbeitender Institutionen (Museen, Ämter, Forschungsinstitute etc.). Die Fakultät für Architektur und Raumplanung ist hier – nicht zuletzt auch aufgrund der fakultätsübergreifenden Verknüpfungsmöglichkeiten – geradezu prädestiniert, Standort eines Exzellenzzentrums für die großen Themenkomplexe Gebaute Umwelt, Baudokumentation und -Analyse, Entwerfen im historischen Kontext sowie für Wert erhaltende/steigernde Baumaßnahmen im Bestand usw. zu sein. Was die Baugeschichte und Bauforschung seit Jahren im Kleinen – will sagen: mit Einzelprojekten, ausgewählten Forschungsthemen und in Lehrveranstaltungen mit dem Fokus „Forschung in der Lehre“ – umsetzt, hätte das Potential, auf Fakultätsebene und im Schulterschluss mit den Partnerfakultäten ein bisher einzigartiger Anziehungspunkt für das gezielte Studium und die ausgewählte Forschung in Wien und speziell an der TU Wien zu werden. Die Studierenden könnten hier Kompetenzen erlernen, die ihnen später in der Berufsrealität mit den damit verbundenen Nöten im heutigen Wettbewerbs- und Vergabegebaren auch im internationalen Vergleich einen klaren Vorteil verschaffen würden.
buildings have slowly come to the fore in public awareness. In this field, the Faculty of Architecture and Planning at the TU Wien boasts competences spanning research, analysis, planning, and implementation – precisely because of the great breadth of specific tools at its disposal. Add to this that Vienna is a UNESCO World Heritage Site, with a pool of historically important architecture originating from all eras from Antiquity to the present, but also with a large number of institutions working in the field (museums, administrative bodies, research institutes, etc.). Not only because of its potential for cross-faculty cooperation, the Faculty of Architecture and Planning is virtually predestined to be the location of a centre of excellence for the broad fields of built environment, building documentation and analysis, design in historical contexts, value conserving/value adding building measures to existing buildings, etc. What the Department of Architectural History and Research has been doing in a small way for years – i.e. through individual projects, chosen research topics and in courses highlighting research in teaching – has the potential to become, within the faculty and in close cooperation with partner faculties, a unique centre of attraction for focused study and selective research in Vienna in general, and at the TU Wien in particular. Students would be able to acquire competences here that would give them a clear advantage in their professional lives, enabling them to prevail over the problems caused by the current prevalence of competitions and awards, nationally and abroad. Added Value Through “Increased Appreciation” _ WHAT SHOULD BE Beyond this, we need to rethink the past and current focus on monuments and “outstanding” architecture that has been practiced in architectural history so far, and increasingly address the issues of cultural landscapes, Hausforschung, and vernacular architecture in research and teaching. The goal would be to strengthen references between Historic Building Research and daily life,
Architektur und Raumplanung: Forschung und Lehre | 51
Mehrwert durch „Mehr Wertschätzung“ _ SOLLTE Darüber hinaus gilt es, in der Architekturgeschichte den bisher praktizierten Fokus auf Denkmale und „herausragende“ Architektur neu zu überdenken und dafür in Forschung und Lehre vermehrt auch auf die Themen Kulturlandschaft, Hausforschung bzw. vernakuläre Architektur einzugehen. Ziel wäre dabei auch ein stärkerer Bezug der Historischen Bauforschung auf das Alltagsleben, um dadurch die Intensivierung der Kenntnisse des kulturellen und sozialen Kontexts zu ermöglichen. Zwangsläufig könnten damit auch der Blick auf die gesellschaftspolitischen Ausbildungsaufgaben des Faches und auf das momentan kontrovers diskutierte Sujet „Konzepte des Social Design“ gelenkt werden – ein nicht unbedeutender Berührungspunkt zwischen wissenschaftlicher Analyse und Entwurf, zwischen Entwerfer und Nutzer. Gerade durch die respektvolle und ihre Anliegen und Bedürfnisse ernst nehmende Einbindung der Nutzer in die Prozesse der Architekturforschung und des Architekturschaffens, d. h. in der Kommunikation zwischen den Architekten/Raumplanern und den Betroffenen kann Mehrwert, und zwar schlicht durch mehr Wertschätzung, erzielt werden. So eine rücksichtsvolle Kommunikation könnte bereits in den Schulen beginnen. Eine Einführung der Schulkinder in die Werte ihrer gebauten Umwelt, ihres architektonischen Erbes, von dem sie auf Schritt und Tritt umgeben sind, die Vermittlung eines Instrumentariums zur kritischen Bewertung von Architektur und Raum würde auch bei den Erwachsenen Interesse und entsprechende Kenntnisse bewirken. Spannend wäre hier ein Programm, das interessierten Schulen die Möglichkeit gibt, solche Informationen durch Studierende der TU Wien an ihre Schülerinnen und Schüler vermitteln zu lassen. Und außerdem: Die Lehrenden lernen immer am meisten!
52 | Marina Döring-Williams
thus enhancing insight into cultural and social contexts. Inevitably, this would also mean shifting emphasis from the task of socio-political education in the field to the currently hotly debated and controversial subject of “concepts of social design” – a not insignificant meeting ground between scientific analysis and design, between designers and users. In particular, the respectful inclusion of users, i.e. taking their concerns and needs seriously, into the processes of architectural research and creation and into the communication between architects/planners and stakeholders allows for added value to be created simply by increasing mutual appreciation. This type of considerate communication could even begin in schools. Introducing school children to the values of their built environment and their architectural heritage – which they are surrounded with at every turn – and giving them the tools to critically evaluate architecture and space, would also awaken interest and create knowledge in adults. A programme providing interested schools the option to invite TU Wien students to teach this knowledge to their students would be extremely interesting. And don’t forget: the teachers are always the ones who learn the most!
Nott Caviezel
DENKMALPFLEGE ALS THEORIE DER PRAXIS HISTORIC PRESERVATION AS THEORY OF PRACTICE Die Pflege des stets in mehrfacher Weise wertvollen historischen Baubestands hat sich aufgrund eines über Jahrhunderte herangebildeten Konsenses als unverzichtbares gesellschaftliches Anliegen konsolidiert. Denkmalpflege war schon immer sinnstiftend und nachhaltig, als traditionell interdisziplinäres Fach ist sie deshalb ebenso in der Architektur wie in den Geisteswissenschaften begründet. Die Vorgeschichte der heute institutionell und gesetzlich verankerten Denkmalpflege gibt einen aufschlussreichen Einblick in die Beweggründe, welche zu unterschiedlichen Zeiten der Menschheitsgeschichte zum Schutz des überkommenen baulichen Erbes geführt haben.1 Die Motive sind von der Antike bis zum späten Mittelalter vielfältig und werden ebenso in historischen Begründungen und ästhetisch-künstlerischen Bedürfnissen wie in der politischen Bedeutung und religiösen Symbolik greifbar. Erst an der Schwelle zur Neuzeit wird die Denkmalpflege allmählich mit einem wissenschaftlichen Interesse verquickt, das gleichermaßen in den architekturtheoretischen Auseinandersetzungen wie in den denkmalpflegerischen Leistungen anschaulich wird. Von Werten zum Mehrwert Wie mit den baulichen Zeugen der Geschichte umzugehen sei, verkürzte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zu diametral entgegengesetzten und für den Bestand folgenreichen Positionen. Erst an der Schwelle zum 20. Jahrhundert erfuhren diese widersprüchlichen Ansätze in einer grundlegenden internationalen Debatte eine erste Klärung. Im Laufe des letzten Jahrhunderts verständigte man sich schließlich auf international anerkannte
Founded on a consensus that has formed over the centuries, the care of multiply valuable historic buildings has come to be an essential concern of society. As a traditionally interdisciplinary subject rooted equally in architecture and the humanities, historic preservation has always been meaningful and enduring. The pre-history of what is today institutionally and legally required preservation offers a revealing insight into the motivations that have led to the protection of historic architectural landmarks at various periods of human history.1 From Antiquity to the late Middle Ages, the motives are as varied and tangible in terms of historic impulse and aesthetic and artistic desire as they are in political meaning and religious symbolism. Not until the eve of the modern era did preservation become intertwined with academic interests, however, which is equally evident in the discourse of architecture theory as it is in the pursuit of the project of preservation. From Value to Added Value During the 19th century, the question of how to deal with the architectural witnesses of the past was reduced to diametrically opposed positions that were often fateful for the built fabric. These contrasting approaches first became clarified in a coherent international debate at the turn of the 20th century. During the past century, there was agreement about internationally recognised tenets and principles that was not able to avoid protracted discussion and examination. That the preservation of monuments and heritage buildings in general was always – and therefore avant la lettre – sustainable and remains
Denkmalpflege als Theorie der Praxis | 53
denkmalpflegerische Grundsätze und Prinzipien, die sich freilich nicht einer fortgesetzten Diskussion und Prüfung entziehen dürfen. Dass die Pflege der Denkmäler und ganz allgemein des baulichen Bestands seit je – und deshalb avant la lettre – nachhaltig war und es auch heute noch ist, liegt auf der Hand. Ebenso einsichtig ist, dass Denkmalpflege als Mittel und Weg zur Bewahrung eines sowohl für die Individuen wie für die Gemeinschaft wertvollen Patrimoniums einen eminenten kulturellen und sozialen Stellenwert besitzt. Das angemessene Handeln an Denkmälern und am wertvollen baulichen Bestand ist nur dann glaubwürdig, wenn die unterschiedlichen Werte, die ihnen eine Gesellschaft zuspricht, ermittelt, benannt und dargestellt werden können. Überdies verknüpft sich die Auflage eines denkmalpflegerisch verantwortlichen Umgangs mit dem Bestand mit den Ansprüchen, die heute unter
54 | Nott Caviezel
Abbildung 1: Porto, Kloster Monchique, oberer Hof. Figure 1: Porto, Monchique Monastery, upper court.
so today is plain to see. Equally clear is that as a means and method of conservation of patrimony valuable to individuals and the community alike, historic preservation occupies a prominent place in culture and society. The appropriate treatment of monuments and valuable buildings can therefore be deemed authentic only if the various values granted them by society can be determined, named, and represented. Furthermore, the requirements of a responsible preservation approach to buildings are connected to the interests that are today subsumed under the notion of building culture. It is also at these tangent points, where the new meets the old and where the new
dem Begriff Baukultur subsumiert werden. An diesen Berührungspunkten, wo das Neue auf das Alte trifft, wo im wünschbaren Fall das Neue im Alten und das Alte im Neuen aufgehoben ist, wird der im übertragenen Sinn geführte Dialog auch konkret. Weil in unseren Breitengraden schon länger weit mehr als die Hälfte des Bauaufkommens den Bestand betrifft und ein gewisser Anteil dieses Bestands – auch ohne rechtlich geschützt zu sein – denkmalpflegerische Sorge beansprucht, sind spezifische Kenntnisse im Bereich der Denkmalpflege auch und gerade für Studierende der Architektur von zentraler Bedeutung. Die Ermittlung der komplexen Denkmalwerte, die sich selbstverständlich auch auf nicht denkmalgeschützte historische Bauten beziehen lassen, gehört mit zu den schwierigen Unterfangen in der Beurteilung des Bestands. Vorgängig und parallel dazu durchgeführte Analysen vor Ort und am
Abbildung 2: Porto, Kloster Monchique: Erste Begenung mit dem ehemaligen Refektorium. Figure 2: Porto, Monchique Monastery: First encounter with the former refectory.
is ideally elevated by the old and the old by the new that in a figurative sense the so called dialogue between the old and the new can become concrete. Because in our part of the world, more than half of future construction will affect existing buildings, and a certain portion of these buildings will require careful preservation – even without being protected under heritage law – specialised knowledge of preservation is of critical importance, particularly for students of architecture. The determination of complex preservation values, which of course also apply to non-listed historic buildings, belongs among the difficult undertakings in
Denkmalpflege als Theorie der Praxis | 55
Bau, Archivrecherchen und der Einbezug einer ganzen Reihe anderer geisteswissenschaftlicher, naturwissenschaftlicher und technischer Disziplinen im Sinne von Hilfswissenschaften vermag im Idealfall zur kongenial begründeten Einschätzung des Bestands führen. Erst diese Basis erlaubt, Strategien und Maßnahmen im Sinne eines denkmalpflegerisch verträglichen und gleichzeitig architektonisch qualitätsvollen Konzepts zu formulieren. Schließlich bleibt es ein gesellschaftspolitisches Gebot, das öffentliche Interesse am Bewahren des wertvollen Baubestands mit anderen öffentlichen Interessen in Abwägung zu bringen und zu entscheiden, in welchem Maß mehrfach vorhandene Denkmalwerte einen ebenso vielschichtigen Mehrwert der Architektur und der Baukultur darstellen.
assessing the built fabric. Preliminary and parallel site analyses and building surveys, archival research, and the inclusion of a whole series of other intellectual, scientific, and technical disciplines as supplemental studies, will ideally lead to a well-substantiated appraisal. Only this sort of foundation can facilitate the formulation of strategies and measures that comprise a concept compatible with preservation as well as architectural quality. In the end, it is a socio-political imperative to weigh the public interest in the preservation of valuable buildings against other public interests and to decide the extent to which multiple heritage values represent equally multifaceted values of architecture and building culture.
Denkmalpflege als Baukultur
As many different connotations as preservation may have, and as disparately it is understood as an institution, discipline, and field, it nevertheless always embodies the conscious and deliberate treatment of a historic monument. The strategies derived from transdisciplinary expertise must be followed when implementing a concept and executing concrete measures. The latter task, which rightly falls under the authority of architects, cannot be achieved successfully without extensive knowledge of the history and theory of preservation as indicated above. Just as the theory of preservation is not in itself historic preservation, neither is the architectural intervention. Only when both are present, when theory and practice merge into a “theory of practice”, will the concern for the careful handling of existing buildings be convincing and lasting. Teaching and research are committed to the same motto at the Department of Monument Preservation and Building in existing structures, which aims to treat the wealth of the layers of time in the built fabric properly, with suitably comprehensive teaching methods. Courses in historic preservation range from lectures, seminars, and projects, to field trips, and also require academic work in the traditional sense. And because conservation and the need for change are not mutually exclusive, and
So unterschiedlich Denkmalpflege auch konnotiert sein mag, so ungleich sie als Institution, Disziplin und Fach wahrgenommen wird, verkörpert sie doch stets das bewusste und wohlüberlegte Handeln am Denkmal. Der in transdisziplinärer Kompetenz ermittelten Strategie, haben die Umsetzung eines Konzeptes und die konkreten Maßnahmen zu folgen. Letztere, genuin in die Zuständigkeit der Architektinnen und Architekten fallende Aufgabe lässt sich ohne umfassende Kenntnisse der oben angedeuteten Geschichte und Theorie der Denkmalpflege nicht erfolgreich lösen. So wie die Theorie der Denkmalpflege für sich allein, ist auch der architektonische Eingriff für sich allein noch keine Denkmalpflege. Erst im gemeinsamen Auftritt, wenn Theorie und Praxis zur „Theorie der Praxis“ verschmelzen, wird die Sorge um einen pfleglichen Umgang mit dem Bestand überzeugend und nachhaltig wirken. Derselben Devise ist die Lehre und die Forschung in der Abteilung Denkmalpflege und Bauen im Bestand verpflichtet, die dem Reichtum der Zeitschichten im Bestand mit entsprechend reichhaltigen Unterrichtsformen gerecht werden möchte. Denkmalkundliche Lehrveranstaltungen reichen von Vorlesungen über Semi-
56 | Nott Caviezel
Historic Preservation as Building Culture
nare und Übungen bis zu Exkursionen und erfordern wissenschaftliches Arbeiten im herkömmlichen Sinn. Und weil das Bewahren und das Bedürfnis nach Veränderung sich nicht ausschließen, Denkmalpflege nicht in der Erstarrung und Musealisierung enden darf, werden in jedem Semester auch spezielle Entwerfen angeboten. Hier erfolgt die Probe aufs Exempel, ob die angestrebte Theorie der Praxis Früchte trägt. So wie die Baukunst beansprucht auch die Denkmalpflege, zur nachhaltigen Gestaltung unseres Lebensraums einen wesentlichen Anteil beizutragen – manchmal auch im Gegensatz zu Entwicklern und Promotoren, dann nämlich, wenn das Bewahren und Entwickeln sich widerborstig aneinander reiben, wenn der drohende Verlust historischer Sub
Abbildung 3: Porto, Kloster Monchique: Auskundschaften im unteren Hof. Figure 3: Porto, Monchique Monastery: Exploring the lower court.
preservation does not have to end in ossification and musealisation, special design projects are assigned each semester. This is where the theory of practice is put to the test in terms of its potential. Just as with architecture, preservation can also make a key contribution to the sustainable design of our living environment – sometimes even in contradiction to developers and promoters – namely, when conservation and new development rub
Denkmalpflege als Theorie der Praxis | 57
stanz und ihrer angereicherten Stimmungen in keinem Verhältnis zum verheißenden Gewinn des Neuen steht. Unsere Abteilung hat sich der Erarbeitung und Vermittlung der Grundlagen der Denkmalpflege verschrieben. Sie setzt die Lehre und Forschung im Bereich der Technikgeschichte und der spezialisierten Industriedenkmalpflege fort, für die sie traditionell eine tiefreichende Kompetenz anbieten kann und beschäftigt sich seit drei Jahren verstärkt mit den denkmalpflegerischen Problemen, die sich im Umgang mit den baulichen Zeugen der Nachkriegsmoderne stellen. Hier liegt unseres Erachtens eine der großen Herausforderungen, denen sich die Denkmalpflege – Geisteswissenschaften und Architektur gemeinsam – einmal mehr in Erfüllung des Leitgedankens der „Theorie der Praxis“ zu stellen hat. Anmerkung/Note 1 Wolfgang Götz, Beiträge zur Vorgeschichte der Denkmalpflege. Die Entwicklung der Denkmalpflege in Deutschland vor 1800, Diss. Leipzig 1956. Auf CD-ROM erschienen in: Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH Zürich 20, 1999.
58 | Nott Caviezel
each other the wrong way, when the threatened loss of historic fabric and its enhanced atmosphere are disproportionate to projected profits. Our department is dedicated to the development and teaching of the fundamentals of preservation. It continues to teach and research in the field of the history of technology and specialised industrial heritage conservation, for which it is able to offer traditional and profound expertise. For three years, it has been deeply engaged in problems of preservation that arise in relation to the architectural witnesses of post-war Modernism. This is in our opinion one of the greatest challenges that preservation – the humanities and architecture – must once again face together, consistent with the notion of a “theory of practice”.
Robert Stalla
LEHRKANZEL KUNSTGESCHICHTE: GESTERN – HEUTE – MORGEN THE CHAIR OF ART HISTORY: YESTERDAY – TODAY – TOMORROW „[…] wir sind interessiert am Lernen von der Geschichte bei gleichzeitiger Fortentwicklung. Wir wollen die Geschichte nicht wiederbeleben, aber diese Brücke zwischen gestern und heute bauen.“1 Dieses Statement, das David Chipperfield – einer der renommiertesten Vertreter der internationalen Architekturszene – am 12. Oktober 2007 in Wien abgab, verweist mit großer Deutlichkeit auf den hohen Stellenwert der „Kunstgeschichte“ an einer technischen Universität: Sie bildet die Basis für eine zeitgemäße Architekturausbildung. Das Fach stellt die Werke der Vergangenheit und der Gegenwart in die historische Tradition und liefert Grundlagen für den Entwurfsprozess wie für architektonische und künstlerische Innovation. Zugleich lenkt es den Blick auf die besonderen historischen, kulturellen, politischen und sozialen Aufgaben und Funktionen von Architektur und bildender Kunst und entwickelt Fragestellungen und Perspektiven für die Zukunft. Gestern Bereits im Erstentwurf für die Organisation des Polytechnischen Instituts von 1810 war die Kunstgeschichte, die als akademisches Fach an europäischen Universitäten noch kaum etabliert war, als ordentlicher Lehrgegenstand vorgesehen.2 Erste Kunstgeschichte-Vorlesungen für das Studium der Baukunst hielt hier ab 1849 Rudolf von Eitelberger – Jahre vor Gründung des Kunsthistorischen Institutes an der Universität Wien.3 1867 wurde schließlich die außerordentliche Professur am Polytech-
“[…] we are eager to learn from history as we advance. We do not wish to resuscitate history, but rather to build a bridge between yesterday and today.”1 This statement, made by David Chipperfield – one of the most renowned figures of the international architecture scene – in Vienna on 12 October 2007, very clearly indicates how important art history is to a technical university: indeed, it forms the basis of today’s architectural education. The subject situates the works of the past and the present within the historic tradition, and provides a foundation for the design process, as well as for architectural and artistic innovation. At the same time, it draws attention to the special historical, cultural, political, and social objectives and tasks of architecture and the fine arts, and generates the issues and perspectives of the future. Yesterday As early as in 1810, at a time when it was barely established as an academic subject at European universities, art history was envisioned as a regular course of study in the first draft for the organisation of the Polytechnic Institute.2 Rudolf von Eitelberger held the first art history lecture for the architecture programme in 1849 – years before the Institute of Art History was founded at the University of Vienna.3 The position of Associate Professor was set up at the Polytechnic Institute in 1867, followed by a Professorship of Art History at the Technische Hochschule in Vienna in 1882, held by Karl von Lützow, who was succeeded by Joseph Neuwirth,
Lehrkanzel Kunstgeschichte: Gestern – Heute – Morgen | 59
nischen Institut, 1882 das Ordinariat für Kunstgeschichte an der TH in Wien eingerichtet, auf das Karl von Lützow und nachfolgend Joseph Neuwirth, Moritz Dreger, Karl Ginhart, Walter Frodl und Gerold Weber berufen wurden. Forschung und Lehre zielten von Anfang an – grundlegend für das Selbstverständnis der „Wiener Schule“ für Kunstgeschichte – auf die Verbindung von Theorie und Praxis. Im Zentrum des Unterrichts stand die Architekturgeschichte, die um Ausblicke auf Quellenschriften zur Architekturgeschichte sowie ausgewählte Beispiele der Malerei und Plastik ergänzt wurde. Während des Historismus bestand die Aufgabe des Fachs zuvorderst in der Bereitstellung einer verbindlichen Mustersammlung von Formen, Motiven, Typen und Strukturen, deren Kenntnisse während dieser Zeit für Architekten unabdingbar waren. Die Analyse der behandelten Gegenstände wurde fruchtbar gemacht, etwa in Hinblick auf den Erhalt von Denkmälern, den Umgang mit künstlerischen Zeugnissen im musealen Kontext oder den Austausch mit zeitgenössischen Architektur- und Kunstschaffenden. Dies führte auch zu einer engen Wechselwirkung zwischen architektur- und kunsthistorischer Forschung und architektonischer und künstlerischer Praxis. Heute Die Anforderungen an die Kunstgeschichte, die sich an technischen Universitäten weiterhin Fragen der Architektur im breiten künstlerischen Kontext zuwendet, haben sich über die letzten Jahrzehnte im Zuge von Inter- und Transdisziplinarität sowie des rasanten Wandels des Architektenberufs grundsätzlich verändert. Heute ist das Fach nicht nur eine feste Größe im Bildungskanon der Architekturschaffenden, sondern auch etwa im Entwurfsprozess. Im Zentrum steht aber die Verantwortung, die Architektur kritisch zu reflektieren und den qualitativen Fortschritt sowie den Wandel ästhetischer Erscheinungsformen im Kontext von Theorie und Geschichte, von kulturellen, politischen, historischen und sozialen Faktoren offenzulegen. Das Fach erforscht die Wissensbestände von Architektur und Kunst, die Entwicklung des architektonischen
60 | Robert Stalla
Moritz Dreger, Karl Ginhart, Walter Frodl, and Gerold Weber. From the start, research and teaching were geared towards linking theory and practice, a fundamental aspect of the identity of the “Vienna School” of art history. Architectural history was at the heart of the courses, supplemented by readings of architectural history sources and selected examples of painting and sculpture. During the period of Historicism, the field aimed first and foremost to provide a collection of precedents for shapes, themes, types, and patterns, knowledge of which was essential for architects of the era. The analysis of these objects was beneficial to, for instance, the preservation of monuments, the care of artistic artefacts in museums, and the discourse with contemporary practitioners of architecture and art. This also led to a close interplay between architectural and art historical research, and architectural and artistic practice. Today The demands on art history that continues to turn issues of architecture at technical universities toward the broader artistic context have changed radically over the past decades, in response to the rise of interdisciplinarity and transdisciplinarity as well as to the rapid transformation of the architect’s profession. Today, the field of art history is not only a staple feature of the educational canon of practicing architects but also of the design process. However, the responsibility to reflect architecture critically, and to uncover qualitative progress as well as shifts in aesthetic production in the context of theory and history, including cultural, political, historical, and social factors, is a central issue. Art history explores architecture and art as bodies of knowledge and the development of the architectonic and artistic vocabulary. It illuminates the increasing differentiation of the functional requirements of buildings. And it examines the multiplicity of operative conventions that underlie everything conceived, engaged, utilised, or received by architecture and art. The awareness
Abbildung 1: Abteilung Kunstgeschichte in Kooperation mit der Akademie der bildenden Künste Wien; Blick in die Ausstellung „Theophil Hansen. Architekt und Designer“, xhibit, 20. September bis 10. November 2013. Im Vordergrund Architekturmodelle im 3D-Druck-Verfahren, die von der Abt. Kunstgeschichte konzipiert wurden; im Hintergrund Planzeichnungen aus dem Nachlass Hansens. Figure 1: The Department of Art History in cooperation with the Vienna Academy of Fine Arts; view of the exhibition, “Theophil Hansen: Architect and Designer“, 20 September to 10 November 2013. In the foreground, architectural models made by a 3D printer, designed by the Department of Art History; in the background, architectural drawings from the Hansen archive at the Vienna Academy of Fine Arts.
und künstlerischen Vokabulars. Es beleuchtet die zunehmende Ausdifferenzierung funktionaler Anforderungen der Bauwerke. Und es untersucht die Vielfalt von Handlungskonventionen, denen alle unterliegen, die Architektur und Kunst konzipieren, beauftragen, nutzen oder rezipieren. Ganz wesentlich ist hierbei das Bewusstsein, dass architektonischer und künstlerischer Entwurf nie ex nihilo entstehen, sondern stets das Ergebnis eines komplexen Geflechts zeitgenössischer und historischer Erfahrungsmuster und Brüche darstellen. Neben der Förderung des ästhetischen Verständnisses wird eine weitere Aufgabe darin gesehen, die historiographischen und hermeneutischen Analysen mit der Kenntnis wissenschaftlicher Methoden – Stilkritik, Strukturanalyse, Ikonographie, Ikonologie, Rezeptionsästhetik, Gender Studies, Cultural Studies etc. – zu verbinden. Fragen an das weite Spektrum des architektonischen und künstlerischen Denkens von den Anfängen bis zur Gegenwart zielen dabei immer auch auf Antworten, die die Positionen des aktuellen Architektur- und Kunstdiskurses näher bestimmen und begreifbar machen. Die Konfrontation mit der Geschichte schafft ein Verständnis für die historische Verortung der eigenen architektonischen Tätigkeit. Die Abteilung Kunstgeschichte der TU Wien – seit 2004 gemeinsam mit den Abteilungen Baugeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege in einem Institut zusammengefasst – stellt sich diesem veränderten Aufgabenprofil durch eine internationale und interdisziplinäre
that architectural and artistic design never arise ex nihilo, but rather are always the result of a complex interplay of contemporary and historical patterns of experience and rupture is an essential feature. In addition to the promotion of aesthetic understanding, a further objective is to unite historiographic and hermeneutic analyses with a knowledge of scholarly methodologies – stylistic criticism, structural analysis, iconography, iconology, reception theory, gender studies, cultural studies, and the like. Questions on the broader spectrum of architectural and artistic thought, from its origins to the present, always strive for responses that define and make contemporary positions in the discourse in architecture and art comprehensible. Direct engagement with history creates an understanding of the work of individual architects that is firmly situated in context. The Department of Art History at the TU Wien – combined with the Departments of Architecture History, Building Archaeology, and Restoration into a shared institute in 2004 – takes on this new profile with an international and interdisciplinary orientation. The wide spectrum of courses, partly offered jointly with other universities in Vienna (most recently coveringSpatial Concepts of the Early Renaissance, The Architecture of World Expositions, Questions of Style in Modernism, and Pioneers of Architecture History), is tailored to the dialogue between theoretical and practical problems. In the academic year of 2012/2013, a module on Architec-
Lehrkanzel Kunstgeschichte: Gestern – Heute – Morgen | 61
Ausrichtung des Faches. Das breite Spektrum an Lehrveranstaltungen, die unter anderem in Kooperation mit anderen Wiener Universitäten abgehalten werden (zuletzt Raumkonzepte in der Malerei der Frührenaissance, Welt ausstellungsarchitekturen, Stilfragen der Moderne und wegweisende Einzelpersönlichkeiten der Architekturgeschichte), zielt mit den weiten inhaltlichen Horizonten auf den Dialog zwischen theoretischen und praktischen Fragestellungen. 2012/13 stand im Modul „Architekturund Kunstgeschichte“ die Vorbereitung, Organisation und Durchführung der in der Akademie der bildenden Künste Wien gezeigten Ausstellung „Theophil Hansen. Architekt und Designer“4 im Zentrum. 2014/15 gilt dem Themenkomplex „Architektur und Kunst/Architektur als Kunst“, der in Kooperation mit Ottmann Architekten München, dem Stadtbauamt München und dem Diözesanbauamt München untersucht werden soll. Entsprechend vielseitig zeigen sich auch die Forschungsschwerpunkte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von Fragen zur Architektur, Malerei und Plastik vom Mittelalter bis zur Neuzeit reichen und u. a. den barocken Concetto, aber auch Wohn- und Nutzbauten des 20. und 21. Jahrhunderts mit einbeziehen. Morgen Die Kunstgeschichte wird auch in Zukunft den weiteren Veränderungen und zunehmenden Komplexitäten des Architektenberufs sowie den Umwälzungen im Bauwesen Rechnung tragen und diese kritisch mitgestalten. Drei Aspekten könnte aus heutiger Sicht besondere Bedeutung zukommen: Dem Fach kommt eine Schlüsselfunktion bei den Bewertungsfragen der gesamten Baukultur zu – und zwar nicht nur der historischen, sondern zunehmend auch der der jüngeren und jüngsten Vergangenheit. Dies wird gerade dadurch unterstrichen, dass historische Bauten einen zunehmend größeren Stellenwert im architektonischen Aufgabenfeld ausmachen und die Zeitspanne zwischen Fertigstellung und konstatiertem Kultstatus immer kürzer wird.
62 | Robert Stalla
ture History and Art History focused on the preparation, organisation, and execution of an exhibition titled “Theophil Hansen: Architect and Designer” at the Vienna Academy of Fine Arts.4 The module topic for 2014/2015 is “Architecture and Art/ Architecture as Art” exploringthis field in collaboration with Ottmann Architekten München, the Office of Planning and Construction of the City of Munich, and the Diocese of Munich Building Authority. Accordingly, research by staff members is diverse, with foci ranging from issues in architecture, painting, and sculpture from the Middle Ages to the present, including, among others, the Baroque concetto and residential and functional buildings of the 20th and 21st centuries. Tomorrow In the future, art history will take account of the changes and increasing complexity of the architect’s profession and the fluctuations of the construction industry, and will help to shape them critically. Three aspects are of particular importance today: Art history needs to assume a key role in assessing issues of the entire culture of building – and not only historical ones, but also those in the recent and very recent past. This is underscored by the fact that historical structures have an increasingly larger significance in architectural practice, and the span of time between their completion and establishment as cultural objects is becoming shorter and shorter. Art history must, furthermore, continue to function as a mediator between the architecture profession and the broad public, whose response to renovations and new construction projects is gaining interest, sensitivity, and a critical outlook. At last, the establishment of a postgraduate degree programme in architectural history in cooperation with several universities would be especially desirable in Vienna – a renowned centre of architectural history and architectural research. In light of the trend of recent
Abbildung 2: Workshop „Architektur und Kunst im Diskurs“ der Abt. Kunstgeschichte in München, 11. bis 15. November 2014, in Kooperation mit dem Stadtbauamt, dem Diözesanbauamt und mit Ottmann Architekten München/Berlin unter Beteiligung von Dr. Rudolf Herz, Univ. Prof. Dr. Andres Lepik, Andreas Neumeister u.a. Figure 2: The workshop “The Discourse of Architecture and Art” in Munich, 11-15 November 2014, sponsored by the Department of Art History together with the Office of Planning and Construction of the City of Munich, the Diocese of Munich Building Authority, Ottmann Architekten München/Berlin, with Dr. Rudolf Herz, Prof. Andres Lepik, Andreas Neumeister, and others.
Das Fach wird forthin verstärkt seine Brückenfunktion bei der Vermittlungsarbeit zwischen Architektenschaft und breiterer Öffentlichkeit wahrnehmen müssen, die zunehmend interessierter, sensibler und kritischer auf Um- und Neubauprojekte reagiert. Wünschenswert wäre gerade in Wien – diesem prominenten Zentrum der Architekturgeschichte und der Architekturforschung – die Etablierung eines postgradualen interuniversitären Studiengangs für Architekturgeschichte; dies insbesondere auch angesichts der jüngeren Entwicklung, dass Architekturgeschichte – eine alte Kernkompetenz des Faches Kunstgeschichte – seit Jahren an Universitäten, etwa zugunsten der neuen Bildwissenschaften, preisgegeben wird.
years to somewhat neglect architecture history in favour of visual studies, this issue seems particularly essential. Anmerkungen/Notes 1 Brücken zwischen gestern und heute: David Chipperfield im Interview, in: Der Standard, 08.10.2007. 2 Joseph Neuwirth, Die k.k. Technische Hochschule in Wien 1815 – 1915, Wien 1915, 532. 3 Vgl. ebd. 4 Cornelia Reiter/Robert Stalla (Hg.), Theophil Hansen. Architekt und Designer, Weitra 2013.
Lehrkanzel Kunstgeschichte: Gestern – Heute – Morgen | 63
Georg Franck-Oberaspach
AUCH „PEER-TO-PEER“ UND „OPEN SOURCE“ GEHÖREN ZUR DIGITALEN KULTUR DIGITAL CULTURE INCLUDES “PEER-TO-PEER” AND “OPEN SOURCE” Digitale Medien sind Standard in der architektonischen Produktion. Die großen Hoffnungen, die sich von Rechnerleistung und automatischer Informationsverarbeitung einst erwarteten, die Architektur aus dem Stand einer intuitiven Kunst in den einer rationalen, sich selbst transparenten Umsetzung wissenschaftlicher Vorgaben zu heben, sind verflogen. In den 30 Jahren, seit denen sich der Computer als Arbeitsmedium in den Architekturbüros durchgesetzt hat, hat sich die Architektur zwar entwickelt, nur in den Ausnahmefällen der dem Fahr- und Flugzeugbau entnommenen Formensprachen ist der Architektur aber anzusehen, dass sie aus dem Computer kommt. Der Computer erledigt im Hintergrund die einst händisch erledigte Routine und er verspricht, die architektonische Produktion weiter zu rationalisieren, er verändert aber nichts am intuitiven Charakter des ästhetischen Augenmaßes und Spürsinns, welche es ausmachen, dass sich die Architektur vom einfachen Bauen unterscheidet. Weil es Standard ist und bis auf weiteres bleiben wird, gehört die solide Ausbildung im digitalen Medium zur beruflichen Qualifikation im Fach Architektur. Solid heißt bei der Ausbildung künftiger Architektinnen und Architekten mehr als nur Beherrschung des eingeführten Standards. Dieser Standard ist an allen Fronten – angefangen bei Entwurfshilfen der räumlichen Organisation und den B(uilding) I(nformation) M(odels) über die Werkzeuge des parametrischen Modellierens und der digitalen Produktion bis hin zur Automation des Bauprozesses – in heftiger Entwicklung. Es gehört zur zeitge-
Using digital media is now the standard in architectural production. However, the great hopes that computer and automatic information processing once raised – of turning architecture from an intuitive art into a rational, intellectually self-transparent, scienfic guided design – have vanished. In the thirty years since the computer was put through as the general work tool in architectural firms, architecture has evolved indeed. The role of the computer, hoever, is not so clear when disregarding the cases where a vocabulary of shapes is borrowed from the design of vehicles and aircraft. In the background, computers perform routine work once done by hand, and promise to further rationalise labour-intensive architectural production, but do not change the intuitive nature of the aesthetic flair and sense of quality that differentiate architecture from mere building. Because it is the standard and will remain so for the foreseeable future, a solid background in digital media is now one of the qualifications required to enter the architecture profession. In terms of the education of future architects, a “solid background” means more than just having a command of the established standards. These standards are rapidly evolving on all fronts – from design aids for spatial ordering and B(uilding) I(nformation) M(odel)s, tools for parametric modelling and digital production, to automation of the construction process. Research-oriented teaching about this development is an integral part of the contemporary education of architects.
Auch „Peer-to-Peer“ und „Open Source“ gehören zur digitalen Kultur | 65
mäßen Ausbildung der Architektin, des Architekten, dass sie forschungsnahe Lehre zu diesen Entwicklungen im Angebot hat. Zur Forschung und dann auch zu diesem Lehrangebot gehört das insistente Nachfragen nach Schieflagen und Fehlentwicklungen in den Produktionsbedingungen. Charakteristisch für die Architektur ist ihre doppelte Aufgabe, erstens Innenräume zu umhüllen und zweitens Außenräume zu definieren. Was die letztere Aufgabe betrifft, ist sie keine solistische Disziplin, sondern eine des Ensemblespiels. Sie ist auf die Mitwirkung anderer Architekturen angewiesen und setzt die Fähigkeit zur Kooperation voraus. Die Aufforderung zu einer kooperativen Architektur steht quer zur beruflichen Situation praktizierender Architektinnen und Architekten. Charakteristisch für diese ist, dass Architekturschaffende zweierlei Märkte bedienen: den Markt, auf dem Dienstleistungen gegen Bezahlung nach Honorarordnung, und den Markt, auf dem Erwähnungen und Rezensionen gegen die Aufmerksamkeit eines interessierten Publikums gehandelt werden. Um erfolgreich zu sein, müssen sie auf beiden Märkten reüssieren. Sie müssen Bauherren finden, die die Baukunst finanzieren, und sie müssen Resonanz in den Medien der Fachöffentlichkeit finden. Diese Resonanz mag in früheren Zeiten sekundär gewesen sein, inzwischen ist sie für ehrgeizige Architektinnen und Architekten die Hauptsache. In der jüngsten „Kölner Erklärung zur Städtebau-Ausbildung“ lesen wir: Europa (im Original: Deutschland) „war noch nie so wohlhabend, seine Stadträume aber noch nie so armselig. Die Planungssysteme waren noch nie so ausgefeilt, die Bürger aber erhielten noch nie so wenig städtebauliche Qualität.“1 Liegt es vielleicht daran, dass die spektakuläre Architektur, nach der die mediale Öffentlichkeit giert, zu dem kooperativen Zusammenspiel nicht in der Lage ist, aus dem die Innenwände urbaner Außenräume entstehen? Belohnt der Markt, auf dem es Reputation, Renommee, Prominenz zu verdienen gibt, so einseitig die Solitäre, die nur auf sich selbst bezogen sind, dass es sich nicht mehr lohnt, die Kunst des Spielens im Ensemble zu üben?
66 | Georg Franck-Oberaspach
Part of research and then also of the curriculum has to be the asking after imbalances and maldevelopments in production conditions. Architecture characteristically has a dual objective: 1. to enclose interior spaces, and 2. to define exterior spaces. The latter task is not a solistic, but rather an ensemble performance. It is dependent on the participation of other architectures and necessitates cooperation on either part. However, the call for cooperative architecture is at cross-purposes to the professional situation of practicing architects. Professional architects generally serve two markets: the market where services are exchanged for money, and the market in which publicity and reviews are traded for the attention of an interested public. In order to be successful, architects must excel in both markets. They must seek clients who finance architecture, and they must find resonance in the specialty media. While this resonance may have been a secondary concern for ambitious architects in the past, it has now become essential. The most recent “Cologne Declaration on Urban Design Education” states that Europe (in the original version Germany), “has never been so prosperous, yet its urban spaces were never so squalid. Never before were the systems of design so sophisticated, but never have city dwellers been given so little in terms of high quality urban design.”1 Is this perhaps because the architecture of spectacle, for which the media public longs, is not able to engage in the cooperative teamwork that creates the walls enclosing quality urban spaces? Does the market where reputation, fame, and prominence are earned so disproportionately reward stand-alone buildings that only reference themselves, that practicing the art of ensemble performance is no longer worthwhile? The high status of pre-modern urban design, which we now recognise in hindsight, relies on convention. It was part of the architect’s profession to know how architecture should behave in the company of other architectures, to keep the company agreeable. Modernism put a stop to conventions and conformity. However, we don’t want to go back to the days before Modernism. And besides, trying to reanimate dead conventions is hopeless.
Der hohe Rang des vormodernen Städtebaus, den wir im Rückblick erkennen, beruhte auf Konvention. Es gehörte zum Metier des Architekten, zu wissen, wie sich die Architektur in der Gesellschaft anderer Architekturen zu verhalten hat, damit die Gesellschaft angenehm wird. Die Moderne hat mit den Konventionen und der Konformität Schluss gemacht. Wir wollen aber nicht hinter die Moderne zurück. Im Übrigen ist es hoffnungslos, verblichene Konventionen reanimieren zu wollen. Hoffnungslos auch, die Wiederbelebung des Städtebaus von einer Rückkehr zu konventionellen Formensprachen zu erwarten. Das Spiel im Ensemble setzt kein bestimmtes Vokabular, sondern ein bestimmtes Ethos seitens der Spieler voraus. So ein Ethos kehrt nur wieder, wenn es sich an zeitgemäßen Vorbildern aufrichten kann. Also gilt es, wenn man an eine Neuerfindung des Städtebaus denkt, das zeitgenössische Äquivalent zu derjenigen Einstellung herauszufinden, die einst das gekonnte Ensemblespiel getragen hat. Gibt es ein solches Äquivalent? Entstehen heute noch wertvolle Dinge so, wie einst die Qualität der urbanen Außenräume entstand? Durchaus! Das für unsere Zeit charakteristische Beispiel für die gemeinschaftliche Arbeit an Werken, die höchste Ansprüche an Findigkeit und fachliches Können stellen, kommt der „Architektur in Gesellschaft“ sogar recht nahe. Es ist: die „Free Software Production.“ Free Software entsteht in einer Szene von Produzentinnen und Produzenten, die im Modus von “Open Source“ und “Peer-to-Peer“ zusammenarbeiten. Open Source meint, dass der Code vom Autor, von der Autorin nicht als Eigentum privatisiert, sondern weitergereicht wird zur Überarbeitung und Fortentwicklung durch„Peers“, das sind freiwillige und so auch gleichberechtigte Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen. Auch die Architektur von Straßen- und Platzwänden beruht auf freiwilliger und gleichberechtigter Mitarbeit. In der Gestaltung der Außenräume kommt es darauf an, dass die beteiligten Architekturen ein dichtes und fein gesponnenes Geflecht von Beziehungen – sei es der Fortführung oder des Kontrasts – spinnen. Nur so entsteht ein kohärentes Ganzes, das sich zwanglos aus einzelnen Beiträgen fügt.
It is also hopeless to expect a return to conventional formal languages to resuscitate urban design. An ensemble performance doesn’t require a particular vocabulary, but rather a certain ethos on the part of the players. Such an ethos can only return if it can stand up to contemporary models. When thinking about the reinvention of urban design, we are called to discover the contemporary equivalent to the mind-set that once supported the skilled ensemble. Is there such an equivalent? Are valuable things still produced today in the same way that quality urban space was once made? Absolutely! The example of collaborative work on projects that demand the greatest ingenuity and technical ability that is most typical for our time actually comes quite close to “social architecture”. It is free software production. Free software is created within a scenario of producers working together in the “open source” and “peer-to-peer” collaborative mode. Open source means that the code is not privatised by the author, but instead is passed on for review and further development by “peers”, who work voluntarily and are thus equal partners. The architecture that encloses streets and squares is based on voluntary and equal participation. In designing exterior space, it is important that the architectures involved create a dense and finely spun web of relationships – whether as continuity or contrast. This is the only way a coherent whole is created that can easily incorporate individual contributions. A coherent whole that easily incorporates individual contributions is also what is achieved by free software production – such as Gnu, Linux, or Wikipedia. The strength of open source and peer-to-peer work lies in its unique division of labour for complex problem-solving. The problem is not a whole broken up into parts that are then centrally delegated to individual collaborators, but rather, proposals for partial solutions, if they seem interesting to the authors of other partial solutions, are incorporated and developed further towards solving the complex whole, in a spirit of synthesis. Conversely, work in progress is passed on to others with promising abilities to review and further refine it. The
Auch „Peer-to-Peer“ und „Open Source“ gehören zur digitalen Kultur | 67
Ein kohärentes Ganzes, das sich zwanglos aus einzelnen Beiträgen fügt, ist auch, was die Free Software Production – Stichworte: Gnu, Linux, Wikipedia – zuwege bringt. Die Stärke von Open Source und Peer-to-Peer liegt in der anderen Art von Arbeitsteilung bei der Lösung komplexer Probleme. Das Problem wird nicht zentral in Komponenten zerlegt, deren Lösung dann an einzelne Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter delegiert wird, vielmehr werden Angebote von Teillösungen, wenn sie den Autoren/Autorinnen anderer Teillösungen interessant erscheinen, aufgenommen und im Sinn einer Synthese zur Lösung des komplexen Problems fortentwickelt. Umgekehrt reichen sie anderen, von deren Können sie sich etwas versprechen, ihre Arbeitsstände zur Überarbeitung und Fortentwicklung weiter. Welche Linie sich schließlich durchsetzt, entscheidet die Gruppendynamik der Peers untereinander. Die Mitarbeit ist freiwillig und unentgeltlich. Man arbeitet mit, weil man mit Herzblut bei der Sache ist. Die Belohnung besteht in dem schönen Gefühl, etwas zu einer bedeutenden Gemeinschaftsleistung beizutragen – und freilich in der Anerkennung seitens derer, die von der Sache etwas verstehen. Die Architektur wartet darauf, im Modus von Open Source und Peer-to-Peer (p2p) praktiziert zu werden, nicht als Ersatz der herkömmlichen Dienstleistung nach Honorarordnung (auch die p2p-Szene lebt schließlich von Dienstleistungen rund um die Nutzung der Software), sondern als Ergänzung. Dasselbe Ethos, das die Free Software Production trägt, müssen Entwerferinnen und Entwerfer entwickeln, wenn eine Ensembleleistung jenseits der Objektarchitektur gelingen soll. Zusammen mit dem Institut für Städtebau hat die Abteilung für Digitale Architektur und Raumplanung deshalb das Format der Lehrveranstaltung „Peer-to-Peer“ eingeführt, das nach einem ersten gelungenen Experiment nun auf Fortentwicklung und Verfeinerung wartet.
68 | Georg Franck-Oberaspach
question of which version ultimately prevails is decided by the members of the peer group among themselves. This collaborative work is voluntary and unpaid. People work together because they are passionate about the work. Their reward is the wonderful feeling of contributing to an important joint effort – and certainly also recognition from those who understand. Architecture is waiting to be practiced in the open source and peer-to-peer (p2p) mode, not as a substitute for conventional fee-for-service work (the p2p scene actually survives on services provided for the use of the software), but rather as a supplement. If an ensemble performance is to succeed over object architecture, then designers need to nurture the same ethos that underlies free software. For this reason, the Department of Digital Architecture and Spatial Planning, working with the Institute of Urban Design, has introduced peer-to-peer to the course programme, and after a first successful experiment, it is now awaiting further development and refinement. Anmerkung/Note 1 http://www.stadtbaukunst.tu-dortmund.de/cms/de/Veranstaltungen/Koelner-Erklaerung/index.html (03. 08. 2015).
Wolfgang Winter, Alireza Fadai
TRAGWERK UND ARCHITEKTUR: ÜBER LOGISCHE STRUKTUREN UND RESSOURCENEFFIZIENTE MATERIALISIERUNG. ZU DEN KOMPLEXEN BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEM, WAS TRÄGT, UND DEM, WAS GETRAGEN WIRD STRUCTURAL DESIGN AND ARCHITECTURE: ON LOGICAL STRUCTURES AND RESOURCE EFFICIENT MATERIALISATION – THE COMPLEX INTERACTION BETWEEN THAT WHICH SUPPORTS AND THAT WHICH IS SUPPORTED Das Bauwesen ist in allen Zivilisationen seit jeher ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft und ein Spiegel gesellschaftlicher Organisationsstrukturen und Wertesysteme. Das Gebaute und die Prozesse, die dazu geführt haben, gehören zu den zentralen Manifestationen von Kultur. Bauen heißt immer auch Bewegen von Materie, Umformen zu Bauteilen, diese im Raum anordnen und Maßnahmen und Strategien entwickeln, um unerwünschte Bewegungen zu verhindern. Teile des Bauwerkes werden dadurch zum Tragwerk. Bauplanung ist immer auch Tragwerksplanung, aber Bauen ist nicht immer Architektur, das Schaffen von Architektur geht über das Bauen hinaus.
In all civilisations, construction has always been an important part of the economy and a mirror of societal organisational structures and values. The built environment and the processes that lead to it are amongst the key manifestations of a culture. Building always implies the movement of matter, shaping it into components of construction, arranging these in space, and developing procedures and strategies to avoid undesirable movement. Parts of the building become its supporting structure, and construction planning always also involves the planning of the supporting structure. However, building alone is not automatically architecture: The creation of architecture transcends building.
Gerade beim Tragwerk treffen die „weichen“ Seiten der Architektur – künstlerische Ambitionen oder gesellschaftliches Engagement – auf die „harten“ Facts der Ingenieurwissenschaften, auf die Erfassung der Naturphänomene wie Schwerkraft, Erdbeben, Wind oder Brand einerseits und auf finanzielle und organisatorische Zusammenhänge und Zwänge andrerseits. Die Suche nach Ausgleich, nach Lösungen, die den einzelnen Bauaufgaben angemessenen sind, kennzeichnet die Zusammenarbeit zwischen Architektur und Bauingenieurwesen in der Praxis.
In supporting structures, the “soft” sides of architecture – artistic ambition and social commitment – meet with the “hard” facts of engineering science, natural phenomena like gravity, earthquakes, wind, and fire on the one hand, and financial and organisational interactions and constraints on the other hand. The quest for balance, for adequate solutions to individual building tasks is characteristic of the applied cooperation of architecture and civil engineering. In structural engineering at schools of architecture, engineers with a sensitivity for architecture and technology-
Tragwerk und Architektur | 69
Im Rahmen der Tragwerkslehre an Architekturschulen versuchen architektursensibilisierte Ingenieurinnen und Ingenieure und technikaffine Architektinnen und Architekten sowohl die technischen Grundlagen der Tragwerkskonzeption und deren Materialisierung als auch das Verständnis der komplexen Beziehungen „zwischen dem, was trägt und dem, was getragen wird“1 zu vermitteln. Ziel der gemeinsamen Anstrengungen ist ein Bauen mit Mehrwert, das Schaffen von Räumen durch „Flechten von Netzen aus Licht und Materie“2 und ein Nachdenken über die Herkunft von Energie und Materie und deren schonenden Einsatz. Dabei muss der Blick über das zu entwerfende und zu realisierende Einzelobjekt hinausgehen und die Stadt als Organismus und die gesamte Region als Ressourcenbasis wahrnehmen. Das Gleiche gilt für die Weiterentwicklung des Bauens durch Forschung und Innovation. Gesamtheitliches Einbeziehen aller Seiten, das heißt die Verknüpfung von ingenieurmäßiger Deduktion und Modellbildung mit gemeinsamem induktiven Weiterdenken, angereichert mit individueller Intuition und Kreativität, sind zusammen die Schlüssel zur Entwicklung nachhaltiger, architektonischer Lösungen für qualitätsvolle Bauten als Basis für zukunftsfähige Städte im Einklang mit der Regionalentwicklung und der natürlichen Umwelt. Entwicklung der Baufakultäten und Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren und Architekten an der TU Wien Bis ins beginnende 19. Jahrhundert war das Bauen eine rein empirische Disziplin mit starker Verankerung im Handwerk. Die Bezeichnung Architekt beschrieb die Funktionen des „obersten Handwerkers, Baukünstlers, Baumeisters, der sich gleichzeitig mit der technischen, wirtschaftlichen, funktionalen und gestalterischen Planung von Gebäuden befasst“.3 Die Wissensvermittlung beruhte auf Erfahrung. Eine formale Unterscheidung in Architekt und Ingenieur gab es nicht, de facto entwickelten jedoch die „Baumeister“, die überwiegend
70 | Wolfgang Winter, Alireza Fadai
Abbildung 1: Tragwerk und Architektur: Zum Verständnis der komplexen Beziehungen zwischen „dem, was trägt und dem, was getragen wird“, unter Verwendung der Skulptur „Wire Circus“ von Alexander Calder (1929). Figure 1: Supporting structure and architecture: understanding the complex relations between “that which supports and that which is supported”, using Alexander Calder’s sculpture “Wire Circus” (1929)
savvy architects aim to teach the basics of structural design conception and materialisation, as well as an understanding of the complex interaction between “that which supports and that which is supported.”1 The goal of these collective efforts is to build with added value, to create spaces by “weaving nets of light and matter”2, and to think about the origins of energy and matter and their responsible use, while making sure that this perspective also transcends the actual building to be designed and realised, that the city is seen as an organism, and the whole region as a resource base.
Abbildung 2: Das Schaffen von Architektur im Spannungsfeld von Idee und Nachweis, von Ausdenken und Nachdenken, von Entwerfen und Konstruieren, von Bestehendem und Neuem, von Verbesserung und Schädigung, von Kunst und Wissenschaft. Figure 2: Creating Architecture between idea and proof, conceiving and pondering, design and construction, tradition and the new, improving and impairing, Art and Science.
Nutzbauten wie Brücken oder Wasserleitungen errichteten, ein auf Erfahrung beruhendes „Ingenieurwissen“, während die Kollegen, die repräsentative Gebäude errichteten, sich stärker mit den bildenden Künsten auseinandersetzten. In diesem Bereich gab es auch die ersten Ausbildungsstätten (1772 Gründung der Akademie der bildenden Künste in Wien mit Klassen für Baukünstler). Die technische Seite des Bauens wurde ab 1795 zuerst an der Pariser École polytechnique gelehrt, allerdings
The same holds true for the development of construction through research and innovation. A holistic participation of all sides and the deduction and modelling of engineering combined with collective, inductive thought enhanced by individual intuition and creativity are the keys to developing sustainable architectural solutions resulting in high-quality buildings that provide a basis for sustainable cities that harmonise with regional development and the natural environment. Development of the Building Faculties and Cooperation between Engineers and Architects at the TU Wien Until the early 19th century, building was a purely empirical discipline, strongly anchored in craftsmanship. The term architect described the functions of the “top crafts-
Tragwerk und Architektur | 71
mit Schwerpunkt auf militärischen Bauwerken und dann ab 1815 in Wien am Polytechnischen Institut, allerdings ohne militärische Ausrichtung und mit dem Ziel der „Förderung der Bürgerkünste, des Gewerbefleißes und des Handels“. 160 Jahre lang, bis 1975, war die Ausbildung in den künstlerischen und technischen Baufächern mehr oder weniger stark vernetzt. Zeitweise gab es eine übergreifende Baufakultät, die Studienpläne waren teilweise überlappend und einzelne Abteilungen unterrichteten sowohl Architektur- bzw. Hochbaustudierende als auch Ingenieur- bzw. Tiefbaustudierende. 1971 wurde dann eine eigene Fachrichtung für Raumplanung gegründet und 1975 trennte sich die Fachrichtung Bauingenieurwesen endgültig von der Architektur und der Raumplanung. Die jetzige Abteilung Tragwerksplanung und Ingenieurholzbau ging aus dem Institut für Tragwerkslehre und Baukonstruktionen des Stahl- und Holzbaus hervor. Dieses Institut hatte bis zur Trennung der Fakultäten als Institut für Statik des Hochbaus und Baukonstruktionen des Holz- und Stahlbaus (bis 1972), danach als Institut für Tragwerkslehre und Baukonstruktionen des Holzund Stahlbaus, parallel Bauingenieure und Architekten betreut. Es stand von 1962 bis 1977 unter der Leitung von Ernst Schischka, sein Nachfolger war Georg Kattinger (1978–1992). Die Lehre für Architekturstudierende war stark berechnungsorientiert und 90 % der betreuenden Assistenten waren Bauingenieure. Wolfgang Winter, der ab 1994 an der Spitze des Instituts stand, erhöhte den Anteil an Assistentinnen und Assistenten mit Architekturausbildung und Praxiserfahrung, und das Institut betreute eigene Entwurfsthemen mit konstruktiven Schwerpunkten. Mit der Einführung der Masterstudien bot das Institut eigene Mastermodule zu den Themen Logik der Struktur und Ressourceneffiziente Materialisierung an. Gleichzeitig wurden Bauingenieurstudierende im Pflichtfach Holzbau betreut, dazu kamen trotz aller Schwierigkeiten mit nicht kompatiblen Studienplänen gemeinsame Lehrveranstaltungen für Architektur- und Bauingenieurstudierende.
72 | Wolfgang Winter, Alireza Fadai
man, building artist, or master builder, who simultaneously dealt with the technical, economic, functional, and design planning of buildings”.3 Transfer of knowledge was based on experience. There was no formal distinction between architects and engineers; de facto, however, the “master builders,” who mainly constructed industrial structures like bridges or aqueducts, developed an experience-based “engineering knowledge”, while their colleagues, who built representative buildings, engaged more with the fine arts. It was this field in which the first schools were established (the Academy of Fine Arts in Vienna was founded in 1772, with classes for architects, or “building artists”). The technical side of building was first taught at the Paris École polytechnique from 1795, though with a focus on military structures, and started in 1815 in Vienna at the Polytechnic Institute, which did not have a military orientation and instead aimed to “promote the civic arts, the efforts of industry, and trade”. For 160 years, until 1975, training in the artistic and the technical building subjects was more or less linked. Sometimes, the building faculty was cross-faculty, with curricula overlapping in parts, and individual departments teaching architecture and structural engineering students as well as engineering and civil engineering students. In 1971, Spatial Planning was founded as an autonomous discipline and, in 1975, the discipline of Civil Engineering finally separated from architecture and spatial planning. The current department of Structural Design and Timber Engineering evolved from the Institute of Structural Design and Building Construction in Steel and Timber Construction. This institute had trained both civil engineers and architects until the faculty’s separation, under the name Institute of Statics of Building Constructions of Timber and Steel Construction (until 1972), and later as the Institute of Structural Design and Building Construction in Wood and Steel Construction. Between 1962 and 1977, it was directed by Ernst Schischka, who was succeeded by Georg Kattinger (1978–1992). The teaching of architecture students was strongly calculation-oriented, and 90% of assistant professors were civil engineers.
Das Ziel, Architektur- und Bauingenieurstudierende zusammenzuführen und die Ausbildung zu internationalisieren, führte ab 2010 zur Einrichtung eines postgradualen Masterprogramms Urban Wood für Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit abgeschlossener Ingenieur- oder Architekturausbildung, das zusammen mit der TU Dresden und dem Politecnico de Milano in englischer Sprache durchgeführt wurde. Ziele und Visionen Das Engagement der Abteilung im Masterstudium Architektur bei Entwerfen und Modulen sowie die konstruktionsorientierte Lehre im Bereich Architektur im Stahl- und Holzbau (die auch für den Bereich Bauingenieurwesen angeboten wird) sollen dazu genutzt werden, die Einsatzmöglichkeiten nachwachsender Rohstoffe in Kombination mit optimierten synthetischen Werkstoffen speziell für das urbane, verdichtete Bauen in der Lehre und Forschung zu untersuchen und in Pilotprojekten umzusetzen. Dazu konnte 2013 eine Laufbahnstelle eingerichtet werden, die das neue Fachgebiet Resource Efficient Structural Design vorantreiben soll. Eine erste Serie entsprechender Entwicklungen von Mischbauprodukten konnte gestartet werden (Holz-Glas, Holz-Blech, Holz-Leichtbeton, etc.). Dahinter steht das Mehrfachziel der Ressourceneffizienz, der Nachhaltigkeit und der architektonisch-konstruktiven Logik. Vielversprechende internationale Kooperationen konnten aufgebaut werden und für 2016 wurde der Abteilung zusammen mit dem Institut für Raumgestaltung und nachhaltiges Entwerfen und dem Bauingenieurinstitut für Mechanik der Werkstoffe und Strukturen die Ausrichtung der alle zwei Jahre stattfindenden World Conference on Timber Engineering übertragen. Die Abteilung sieht sich als Brückenkopf für eine Wiederbelebung der Zusammenarbeit zwischen den Fachrichtungen Architektur, Bauingenieurwesen und Raumplanung im Bereich innovatives, nachhaltiges und ressourcenorientiertes Planen und Bauen. Entsprechende interdisziplinäre Anträge zu Doktoratskollegs und
Wolfgang Winter, who headed the Institute from 1994 onwards, increased the share of assistant professors with architectural training and practical experience, and the institute began supervising its own design theses with a constructive focus. When master’s programmes were introduced, the institute offered separate master’s modules on the subjects Logics of Structure and Resource-efficient Materialisation. At the same time, civil engineering students were trained in the compulsory subject of Timber Construction. In spite of difficulties with incompatible curricula, joint courses for students of architecture and of civil engineering were also taught. The goal of joining students of architecture and of civil engineering, and to internationalise their training, led to the 2010 establishment of the postgraduate master’s programme Urban Wood, for participants with degrees in engineering or architecture. This programme is taught in English and held in cooperation with TU Dresden and Politecnico de Milano. Goals and Visions The involvement of the department in the master’s programme for architecture, in teaching design, and in modules of construction-oriented teaching in the field of architecture in steel and timber construction (which is also offered to civil engineering students) aims to examine the use of renewable materials in combination with optimised synthetic materials – in particular for urban densification – in research and teaching, and to implement this in pilot projects. In 2013, we were able to establish a permanent position with the task of promoting the new subject of Resource Efficient Structural Design. An initial series of developments in composite construction products was started (timber-glass, timber- sheet metal, timber-lightweight concrete, etc.), based on the goals of resource efficiency, sustainability, and constructive architectural logic. We were able to establish promising international collaborations, and in 2016, the department will host the biannual World Conference on Timber Engineering in collaboration with the Depart-
Tragwerk und Architektur | 73
Forschungskooperationen wurden bereits gestellt und sollen weiterhin forciert werden. Im Bereich Lehre wünscht sich die Abteilung eine Verstärkung kooperativer Lehrveranstaltungen und kann sich gut die Einrichtung von gemeinsamen Studienabschnitten, sei es am Studienbeginn oder im Bereich der spezialisierten Masterprogramme, vorstellen. Anmerkungen/Notes 1 Alexander Calder (1898–1976) spricht vom Bauen als einer komplexen Beziehung zwischen dem, was trägt und dem, was getragen wird. 2 Christopher Alexander/Sara Ishikawa/Murray Silverstein u. a., A Pattern Language. Towns, Buildings, Construction, New York 1977. 3 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Architekt.
74 | Wolfgang Winter, Alireza Fadai
ment of Spatial and Sustainable Design and the Institute for Mechanics of Materials and Structures of the Faculty of Civil Engineering. The department sees itself as a bridgehead for the revitalisation of collaboration between the disciplines of architecture, civil engineering, and spatial planning in the field of innovative, sustainable, and resource-oriented planning and building. It has already submitted proposals for corresponding doctoral programmes and research collaboration, which will be further promoted in the future. In the field of teaching, the department would like to see an increase of cooperative courses, and readily envisages the establishment of joint cycles of study, whether at the beginning of studies or in the area of specialised master’s programmes.
Ardeshir Mahdavi
ÜBER DEN WACHSENDEN HORIZONT DER BAUPHYSIK ON THE EXPANDING HORIZON OF BUILDING PHYSICS Die Disziplin der Bauphysik erfährt gegenwärtig eine Erweiterung ihres Horizontes. In einem immer komplexeren sozialen und umweltbezogenen Kontext tauchen neue Herausforderungen auf. Hierzu denken wir an drei sukzessive breiter werdende Themenbereiche der Bauphysik: das „konventionelle“ Kerngebiet, die externen und internen Randbedingungen und der größere umweltbezogene und soziale Kontext. Bis vor kurzem ging man davon aus, dass sich die Bauphysik nur mit der physikalischen Performance von Baukonstruktionen und einzelnen Gebäuden beschäftigt. Klarerweise beschäftigt sich die Bauphysik mit Baukonstruktionen und ganzen Gebäuden in Bezug auf ihr energetisches und thermisches Verhalten, ihre visuelle und akustische Qualität, ihre bauliche Struktur und ihr Brandschutzverhalten. Dennoch zielen die aktuellen Aktivitäten der Bauphysik bezüglich Forschung, Entwicklung und Ausbildung auf einen wesentlich weiteren thematischen Horizont. Der Prozess der technologischen Verbesserungen und Innovationen in den Kerngebieten der Gebäudeerrichtung und -steuerung schreitet voran, mehr Aufmerksamkeit wird jedoch den unmittelbaren internen (Nutzungsabläufen) und externen (mikroklimatischen und urbanen) Randbedingungen geschenkt. Wie auch in vielen anderen Fachgebieten stellen globale, gesellschaftliche und umweltbezogene Entwicklungen die Bauphysiker und Bauphysikerinnen vor eine Anzahl von fundamentalen Herausforderungen (ökologische Nachhaltigkeit, soziale Ausgewogenheit, kulturelle Werte). Diese können innerhalb der konventionell eng gesteckten Grenzen der Bauphysik nicht optimal behandelt werden.
The discipline of Building Physics is currently experiencing a widening of its horizon. New challenges are emerging in an increasingly complex environmental and social context. We reflect on this circumstance in terms of three successively broader thematic circles: the “conventional” core, the external and internal boundary conditions, and the larger environmental and social context. Until recently, Building Physics was believed to be only concerned with the physical performance of construction details or individual buildings. Building Physics does, of course, address building details and whole buildings in view of their energy and thermal performance, visual and acoustic qualities, construction integrity, and fire safety. However, current activities of Building Physicists in research, development, and education point to a much broader thematic horizon. The process of technological refinement and innovation in the core areas of building construction and operation continues, but more attention is being paid to the immediate internal (occupancy processes) and external (microclimatic and urban) boundary conditions of building performance. Moreover, as with many other fields, global societal and environmental developments are confronting Building Physics professionals with a number of fundamental challenges such as ecological sustainability, social equanimity, and cultural values, which cannot be optimally addressed from within the discipline’s narrow conventional boundaries.
Über den wachsenden Horizont der Bauphysik | 75
Entwicklungen in den konventionellen Kerngebieten Der technische Standard der Gebäude ist in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. Eine Richtung des Fortschritts betrifft die Entwicklung der baulichen Energieeffizienz, von konventionellen über Niedrigenergiezu Nullenergie-Gebäuden. Ausgestattet mit Kollektoren und Turbinen zur Gewinnung erneuerbarer Energie (Sonne, Wind, etc.) könnten Gebäude in absehbarer Zeit sogar eine positive Energiebilanz aufweisen. Eine andere Schiene des Fortschritts bezieht sich auf die Entwicklungen in Materialwissenschaft und Bautechnologie, die Produkte wie PCM (Materialien, die ihren Zustand temperaturbedingt verändern), VIP (Vakuum Dämmpanele) und auf Aerogel basierte Bauelemente hervorgebracht haben. Eine weitere Entwicklungslinie beinhaltet die Anwendung von ICT (Informations- und Kommunikationstechnologie) in der Gebäudeplanung, zum Beispiel durch den Einsatz von Gebäude-Informationsmodellen und numerischen Simulationstechniken und im Gebäudebetrieb mittels Monitoring, Diagnose und Automatisierung. Externe und interne Randbedingungen Bis vor kurzem basierte die bauphysikalische Performance- Bewertung auf grob vereinfachten Repräsentationen der externen und internen Randbedingungen. Beispielsweise wurden die für die Durchführung von thermischen Performance-Analysen benötigten äußeren klimatischen Randbedingungen durch eine begrenzte Anzahl einfacher Kennwerte ausgedrückt. Heute nutzen wir detaillierte dynamische Repräsentationen mikroklimatischer Randbedingungen (Wetterdateien). Zudem werden, aufgrund der steigenden Erkenntnisse bezüglich Klimawandel und urbanem Mikroklima, immer anspruchsvollere Ansätze entwickelt, die eine realistischere Betrachtung der städtischen und mikroklimatischen Einflüsse auf die Gebäudeperformance ermöglichen. Die Darstellung der internen Prozesse bezüglich Anwesenheit und Verhalten
76 | Ardeshir Mahdavi
Developments in the Conventional Core In the last decades, the technical sophistication of buildings has continuously increased. One line of progress pertains to the evolution of energy efficiency; from conventional, to low-energy, and to near-zero energy buildings. Equipped with renewable energy harvesting devices and collectors (solar, wind, etc.), buildings could conceivably exhibit a positive energy balance. Another line of progress is related to material science and construction technology and is resulting in products such as PCM (phase changing materials), VIP (vacuum insulation panels), and aerogel-based components. Yet another line of development involves the use of ICT (information and communication technology) both in the building design (via deployment of building information modeling and numeric simulation techniques) and operation phases (via building monitoring, diagnostics, and automation). External and Internal Boundary Conditions Until recently, performance assessment in Building Physics was based on rather simplistic representations of buildings’ external and internal boundary conditions. For instance, while conducting thermal performance analyses, outdoor climatic conditions were expressed in terms of a limited number of aggregate variables. Today, we instead employ detailed dynamic representations of the microclimatic boundary conditions of a building (weather files). Moreover, recognizing the importance of climate change and urban microclimates, increasingly sophisticated approaches are being developed to facilitate a more realistic observation of urban settings and microclimatic influences on building performance. Likewise, the representation of internal processes concerning occupancy presence and behaviour in buildings has been commonly based on simplistic assumptions such as fixed schedules. A more differentiated approach is now emerging in this area. The probabilistic nature of occupancy processes and their impact on the internal condi-
Abb. 1 bis 3: Meteorologische und strahlungstechnische Beobachtungsstation der Abteilung für Bauphysik und Bauökologie der TU Wien. Fig. 1 to 3: Meteorological and radiation observatory of the Department of Building Physics and Building Ecology, TU Wien.
der Gebäudenutzerinnen und -nutzer basierte ebenfalls auf vereinfachten Annahmen (wie etwa fixen Zeitplänen). In diesem Bereich ist ein differenzierterer Ansatz im Entstehen. Die Vorhersage nutzungsbezogener Prozesse (Anwesenheit und Aktivitäten in Gebäuden) und deren Auswirkungen auf das Innenklima und die ökologische Performance von Gebäuden hat sich zu einem aktiven Forschungsbereich entwickelt, ebenso die Auswirkung von Langzeiteffekten des Nutzungsverhaltens auf die Gebäudeperformance (z. B. der fallweise nach Gebäudesanierungen auftretende „Rebound-Effekt“). Der größere ökologische und soziale Kontext Errichtung und Betrieb von Gebäuden haben zusammen mit der Industrie und dem Transportwesen zu massivem globalem Ressourcenverbrauch, Umweltemissionen
tions and environmental performance of buildings have become an active area of inquiry, along with occupants’ long-term attitudinal and behavioural characteristics and their relevance for building performance – for instance with regard to the post building retrofit “rebound effect”.
Über den wachsenden Horizont der Bauphysik | 77
und Abfallaufkommen geführt. Wenn wir den Begriff „Nachhaltiges Bauen“ ernst nehmen, müssen wir nicht nur enge Fragestellungen der technischen Qualität der einzelnen Gebäude, sondern auch die breiten Auswirkungen von Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Entwicklung des Lebensstils, Sozialpolitik, Priorisierung der Investitionen und Gestaltung der Städte berücksichtigen. Wie andere Expertinnen und Experten, die in Gebäudeerstellung und -betrieb involviert sind, stehen die Bauphysiker und -Physikerinnen hinsichtlich der Nachhaltigkeitsdebatte einer zweifachen Herausforderung gegenüber. Im engen beruflichen Sinn sollten sie natürlich jede Anstrengung unternehmen, um die Gebäudeperformance durch optimierten Entwurf und effizienten Betrieb zu verbessern. Aber auch die besten Bemühungen in dieser Richtung nutzen wenig, wenn Bauphysiker erst dann konsultiert werden, nachdem bereits eine Reihe kritischer Projektentscheidungen getroffen wurden (z. B. Neubau versus Renovierung, Lage und allgemeine formale und materielle Eigenschaften des Gebäudes). Daher müssen Bauphysikerinnen und -Physiker in ihrer Rolle als verantwortungsbewusste Bürgerinnen und Bürger ehestmöglich in den Nachhaltigkeitsdiskurs einsteigen, sobald Prozesse initiiert und Entscheidungen getroffen werden, die die Bewohnbarkeit und Nachhaltigkeit der gebauten Umwelt entscheidend beeinflussen.
78 | Ardeshir Mahdavi
The Larger Environmental and Social Context Building construction and operation, along with industry and transportation, has resulted in massive global resource depletion, environmental emissions, and waste generation. If the notion of “sustainable building” is to be taken seriously, we must address not only narrow issues of the technical quality of individual buildings, but also the broader ramifications of climate change, population growth, lifestyle evolution, social policies, investment priorities, and urban planning. As with other professionals involved in building construction and operation, Building Physicists have a two-fold position regarding the sustainability challenge. In a narrowly conceived professional sense, they should, of course, make every attempt to target better performance by supporting effective building design decisions and optimal building operations. However, even the best of such efforts yields limited benefits. The role of Building Physicists in projects typically starts only after a number of critical decisions have been made (e.g., new building versus retrofit, building’s general formal and material characteristics, and location). This circumstance severely limits the potential Building Physicists have to meaningfully contribute to sustainability. Hence, in their role as responsible citizens, Building Physicists need to enter the sustainability discourse at the earliest opportunity, when processes are being initiated and decisions made that fundamentally influence the habitability and sustainability of the built environment.
Dörte Kuhlmann
KRITISCHE ARCHITEKTURTHEORIE CRITICAL ARCHITECTURAL THEORY „Die Vermassung des Studienbetriebs an den Hochschulen macht das Gespräch unmöglich. Wesentliche Fragen der Gegenwartsarchitektur können nicht erörtert werden“,1 schrieb Günther Feuerstein schon in den 1960er Jahren und artikulierte damit ein zentrales Problem, das sich bis heute nicht verbessert hat. An der Technischen Hochschule in Wien war Feuerstein von 1961 bis 1968 Assistent bei Karl Schwanzer am Institut für Gebäudelehre und Entwerfen und gleichzeitig der Initiator für die Lehre der Architekturtheorie. In seinem berühmt-berüchtigten „Klubseminar der Architekturstudenten“ wurden avantgardistische Ideen und internationale Strömungen lebhaft diskutiert und in den studentischen Experimentalgruppen wie Coop Himmelb(l)au, Haus-Rucker-Co oder Zünd-up weiterentwickelt. Begleitet von Skandalen wurden neue Leitbilder für die visionäre Stadt von Morgen entwickelt, alles im Rahmen einer noch jungen, kritischen Architekturtheorie, die alles Alte hinterfragte und ganz neue Wege suchte. Durch seine unorthodoxen Lehrveranstaltungen und seine wichtige Rolle als „Architekturvermittler“ wurde Günther Feuerstein quasi zum Katalysator der progressiven Weiterentwicklung der Wiener Architektur. Die Nähe zur damaligen durchaus radikalen Künstlerszene brachte ihm allerdings auch heftigen Ärger ein, denn im Rahmen seiner Vorlesungen zur Gegenwartsarchitektur lud er Gäste ein, ohne diese zuvor im Dekanat der TH genehmigen zu lassen. Ein Gastvortrag des Wiener Aktionisten Otto Muehl ging der TH zu weit und so kam es zu einer zeitweiligen Entlassung Feuersteins. Die Abteilung für Architekturtheorie sieht sich dem Erbe dieser künstlerisch extrem reichhaltigen Jahre verpflichtet und bemüht sich daher, die stetige Auseinan-
“The sheer dimensions of the study programmes in colleges make discussion impossible. Significant questions of contemporary architecture cannot be debated”,1 Günther Feuerstein wrote as early as the 1960s, articulating a central problem that has not improved to this day. Feuerstein was Assistant to Karl Schwanzer at the Institute for Building Theory and Design at the Technische Hochschule in Vienna from 1961 to 1968 and initiated, at this time, the teaching of Architectural Theory. In his renowned yet infamous “Seminar Club of Architecture Students”, avant-garde ideas and international trends were discussed in a lively fashion and refined in experimental student groups such as Coop Himmelb(l)au, Haus-Rucker-Co, and Zünd-up. Accompanied by scandals, new mission statements for the visionary city of tomorrow were developed, all within a still young and critical architectural theory that questioned all that was old while seeking an entirely new path. Through his unorthodox lectures and his important role as an “Architectural Mediator”, Günther Feuerstein acted as a catalyst for the progressive development of Viennese architecture. However, his proximity to what was at the time a very radical art scene also brought great aggravation against him. For one, because he invited guests without allowing them to first be approved by the Office of the Dean of the TH in the course of his lectures on contemporary architecture. A guest lecture by Vienna Actionist Otto Muehl went too far for the TH and thus led to Feuerstein’s temporary release. The Department of Architectural Theory sees itself as obligated to the inheritance of these artistically very rich years, and therefore strives to encourage the ongoing
Kritische Architekturtheorie | 79
dersetzung mit experimentellen und gesellschaftskritischen Ansätzen des Architekturdiskurses zu fördern.
discussion of experimental and socially critical concepts within the architectural discourse.
Schwerpunktsetzungen
Priorities
Die Kerngebiete unserer Forschung betreffen Architekturtheorie und Architekturvermittlung. Wir verstehen die Architekturtheorie als Möglichkeit, gesellschaftsrelevante Themen aufzugreifen und in den Architekturdiskurs hineinzutragen. Unsere aktuellen Schwerpunktsetzungen betreffen daher die noch relativ jungen Diskussionen zu Genderstudien in Architektur, Film und neuen Medien, eine aufgeschlossene Thematisierung der Visionären Nachhaltigkeit in Architektur und Urbanismus, die kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit Technikphilosophie und Techniktheorie in Architektur und Urbanistik, experimentelle Medienarchitektur und die Berufsfeldforschung. Die Forschungsschwerpunkte korrespondieren mit den Schwerpunkten in der Lehre und dem Modul Meta:Architektur für das Masterstudium.
The core areas of our research concern architectural theory and architectural mediation. We see architectural theory as a possibility for taking socially relevant themes and bringing them into the architectural discourse. Our current priorities therefore include still relatively young discussions about gender studies in architecture, film, and new media, an open exploration of visionary sustainability in architecture and urbanism, a critical and reflexive discussion of technical philosophy and technical theory in architecture and urbanism, experimental media architecture, and occupational field research. Our core research areas correspond with our teaching priorities and with the Meta:Architecture master’s programme module. Interface Potential
Schnittstellenpotenziale Als Disziplin, die traditionellerweise zwischen diversen Diskursen operiert, ist für die Architekturtheorie interdisziplinäre Zusammenarbeit von hoher Bedeutung. Auf Fakultätsebene findet eine Zusammenarbeit mit diversen Instituten der Architektur und Raumplanung in Forschung und Lehre statt, zu nennen seien etwa Städtebau, Hochbau, Soziologie und das Institut für EDV-gestützte Methoden. Darüber hinaus spielen fachübergreifende Kooperationen innerhalb der TU eine wichtige Rolle, vor allem im Rahmen von Forschungsprojekten, die gemeinsam mit der Computertechnologie, Elektrotechnik, Automationstechnik, Informatik und der Raumplanung entwickelt werden.
As a discipline that traditionally operates amongst various discourses, interdisciplinary cooperation is of utmost importance to architectural theory. On the faculty level, research and teaching collaborations with various institutes of architecture and spatial planning are in place, for example in Urban Development, Building Construction, Sociology, and the Institute for Computer-aided Methods. Furthermore, interdisciplinary collaborations within the TU also play an important role, above all within various research projects developed together with the fields of Computer Technology, Electrical Engineering, Automation Technology, Computer Science, and Spatial Planning. Internationalisation
Internationalisierung Von Anfang an setzte die Abteilung in der Forschung auf Internationalität und langfristige Beziehungen zu aus-
80 | Dörte Kuhlmann
From the very beginning, the department oriented itself towards international research and long-term connections with foreign partners and international networks.
Abb. 1: Publikationen des Fachbereiches aus den Jahren 2010 bis 2013. Fig. 1: Publications from the Department, 2010 to 2013.
Kritische Architekturtheorie | 81
ländischen Partnern und auf internationale Netzwerke. Der Schwerpunkt unserer internationalen Zusammenarbeit liegt bei deutschen und amerikanischen Universitäten, aber wir kooperieren auch mit Institutionen in anderen Ländern, wie der ETH Zürich, der UBT Prishtina, der Tampere University of Technology, dem MIT Boston, der Bauhaus Universität Weimar, dem KIT Karlsruhe, dem IES Vienna und der IUAV Venedig. In diesen Netzwerken arbeiten wir an einer Reihe von Forschungsprojekten, unter anderem „Autonomes Fahren“, „Robotik in der Architektur“, „Smart City und Big Data in Architektur und Urbanistik“ und einer Reihe von Genderforschungsprojekten in Architektur und Stadtplanung.
The emphasis of our international cooperation is on German and U.S. universities, but we also cooperate with institutions in other countries, such as the ETH Zurich, UBT Prishtina, the Tampere University of Technology, MIT Boston, the Bauhaus Universität Weimar, KIT Karlsruhe, IES Vienna, and the IUAV Venice. We work on numerous research projects within these networks, including ones on Autonomous Driving, Robotics in Architecture, Smart City and Big Data in Architecture and Urbanism, and a series of gender research projects in architecture and city planning.
Zukunftsperspektiven
From an international vantage point, we also place great emphasis on teaching. The Meta:Architecture module on architectural mediation is being developed into the first complete English language faculty module and will thus be particularly attractive to many domestic students and foreign guest students alike. The research focus, on the historical analysis of the Austrian Post-War Avant-garde period, is under development. In the core research and teaching area on technical theory, which consists of the Autonomous Driving and Smart City and Robotics projects, the topic of humanoids is explored through interdisciplinary expansion and research applications. The core research and teaching area on architectural mediation is further deepened in collaborations and through the expansion of the curriculum. The Construction of Architecture module, a part of the master’s programme covering the advanced synthesis of architectural concepts with drafting and design, is in preparation for the start of the 2016/17 academic year.
Auf eine internationale Ausrichtung legen wir auch im Rahmen der Lehre großen Wert. Das Modul „Meta:Architektur“ zur Architekturvermittlung wird zum ersten vollständig englischsprachigen Modul der Fakultät entwickelt und bietet damit für viele inländische Studierende und ausländische Gast-Studierende ein besonders attraktives Angebot. Der Forschungsschwerpunkt zu einer historisch-kritischen Analyse der Avantgarde der österreichischen Nachkriegsmoderne ist im Aufbau begriffen. Im Forschungs- und Lehrschwerpunkt der Techniktheorie, bestehend aus den Projekten Autonomes Fahren und Smart City und Robotik, wird der Aspekt Humanoide durch interdisziplinäre Erweiterungen und Forschungsanträge vertieft. Der Forschungs- und Lehrschwerpunkt Architekturvermittlung wird durch Kooperationen und Erweiterung des Angebotes weiter vertieft. Das Modul Construction of Architecture, in dem für das Masterstudium die vertiefende Synthese von Architekturkonzept mit Entwurf und Design angeboten werden wird, ist in Vorbereitung für den Start im Studienjahr 2016/17. Mehr-Wert Architektur und Raumplanung Unser Anliegen ist die stete kritische Reflexion von scheinbar einfachen Begriffsinhalten wie Nützlichkeit,
82 | Dörte Kuhlmann
Perspectives on the Future
Added Value Architecture and Spatial Planning Our concern is the ongoing critical reflection on apparently simple notions in the contemporary architectural discourse such as usefulness, function, practicality, sustainability, appropriateness, and aesthetics. It is therefore important that the sheer usefulness of architecture
Funktion, Zweckmäßigkeit, Nachhaltigkeit, Angemessenheit oder auch Ästhetik in den zeitgenössischen Diskursen. Entscheidend ist dabei, dass die bloße Nützlichkeit von Architektur mit etwas verbunden werden muss, das einen Wert in der jeweiligen Kultur oder Lebenswelt hat, in der diese Architektur zum Tragen kommt. Das bedeutet – entgegen einem weitverbreiteten Missverständnis – nicht, dass Architektur lediglich die existierenden Wertesysteme wiedergibt. Vielmehr ist es die kulturelle
Abb. 2: Team am Fachbereich Architekturtheorie im Sommer 2013. Fig. 2: Team of the Department of Architectural Theory, summer 2013.
must be bound with something that has value in our present-day culture and lifestyle in which the building comes to fruition. Contrary to a widespread misunderstanding, this does not mean that architecture merely reflects existing systems of value. Rather, it is the cultural function
Kritische Architekturtheorie | 83
Funktion der Architektur, insbesondere die der Architekturtheorie, selber kulturelle Werte zu hinterfragen oder neue zu erzeugen. Natürlich können in den Werken der Architektur diese neuen Werte im Widerspruch zu jenen Werten stehen, die lediglich reduktionistisch oder utilitaristisch orientiert sind und jenseits von Zweckorientierung wirken. Aber diese Konfrontation zu suchen, ist genau die Aufgabe der Architekturtheorie. Anmerkung/Note 1 Dimitris Manikas, Beiträge zur Baukunst 1968–2006, edited by Universität für Angewandte Kunst Wien, Wien 2006, 12.
84 | Dörte Kuhlmann
of architecture, in particular that of architectural theory, to question cultural values and/or to create new ones. Naturally, in works of architecture, these new values can stand in opposition to certain values that are merely reductionist or utilitarian, and can operate according to more than mere functionality. However, it is the task of architectural theory to seek this confrontation.
Karin Harather, Otto Mittmannsgruber
DAS SURPLUS DER KUNST IN DER ARCHITEKTURAUSBILDUNG THE SURPLUS OF ART IN ARCHITECTURE TRAINING Spricht man von (zeitgenössischer) Kunst im architektonischen bzw. urbanen Kontext, so wird diese unserer Erfahrung nach sowohl von Planungsverantwortlichen als auch von Stadtnutzern immer noch primär in ihrer klassischen Rolle – nämlich als „ästhetisierendes“ Beiwerk – wahrgenommen: als aufwändig repräsentativ gestaltetes oder auch nur schlicht behübschendes (Stadt-)Accessoire. Jene Facetten des aktuellen Kunstschaffens, die über ihren ästhetischen Anspruch hinaus die Initiierung von, aktive Teilhabe an oder kritische Positionierung zu planerischen (oder auch anderen, unmittelbar gesellschaftsbezogenen) Prozessen thematisieren, stehen zwar im facheinschlägigen Diskurs hoch im Kurs, scheinen in der alltäglichen Praxis jedoch bislang von nur marginaler Bedeutung zu sein. Dieses „Randständige“ der Kunst spiegelt sich auch in der Ambivalenz unseres Daseins als Kunstinstitut an einer technischen Universität wider. Weg von der Anschauung, hin zur Analyse Traditionelle „dienende“ Aufgabenbereiche, wie die unmittelbar praxisbezogene Unterweisung der angehenden Architekten und Architektinnen in der räumlichen Darstellung werden im Rahmen der Grundlehre zwar weiter abgedeckt, die Schwerpunktsetzung hat sich jedoch verlagert: Nicht das Produzieren von „schönen Abbildern“, sondern das gezielte Wahrnehmen und Erfassen von Strukturen, Proportionen und Formverläufen mittels genauem Beobachten und adäquater zeichnerischer Umsetzung ist wesentlich. Ebenso wichtig ist es uns, den Studierenden gleich zu Beginn ihrer Ausbildung darstellerische Ausdrucksmittel zu eröffnen, die
When speaking of (contemporary) art in architectural and urban contexts, it is our experience that city users and people responsible for planning still primarily perceive this in its classical role, namely, as an “aestheticized” accessory: lavish representative design, or simply a prettified (urban) accessory. Those facets of current artistic creation that address the initiation of, active participation in, or pose critical positioning to planning (or other directly societal) processes based upon claims that go beyond the aesthetic, are of high standing in specialist discourse. However, so far they appear to be of only marginal significance in everyday practice. This “marginalisation” of art is also reflected in the ambivalence of our existence as an art institute at a technical university. Away From Perception, Towards Analysis Traditional “serving” fields of activity, such as the directly practical training of budding architects in spatial representation, are indeed still covered as part of basic education. The focus, however, has shifted: It is no longer the production of “beautiful images” that is essential, but the targeted perception and comprehension of structures, proportions, and shape sequences through exact observation and tidy draughtsmanship. It is equally important for us to provide students with options for representational expression right at the beginning of their training, enabling them to generate individual and imaginative freehand illustrations. When considering the central question of what the “function” of art is/should/could/might be in an architectural context and in urban development
Das Surplus der Kunst in der Architekturausbildung | 85
ihnen das Generieren individueller, fantasiegeleiteter Freihanddarstellungen ermöglichen. Bei der zentralen Fragestellung, was denn nun die „Funktion“ von Kunst im architektonischen Kontext und in städtebaulichen Entwicklungsprozessen sein kann/ soll/muss/darf, liegt der Fokus unserer Forschung und Lehre auf jenen künstlerischen Herangehensweisen, die darauf abzielen, einen Mehrwert zu generieren: Dabei geht es um einen Mehrwert, der sich dem direkt quantifizierbaren monetären Mehrwert widersetzt und der ein Plädoyer führt für das „Extra“, das – wenn von Kunst die Rede ist – immer noch oft als „nichtleistbarer Luxus“ abqualifiziert wird.1 Urbanes Milieu als experimentelles Feld der Gegenwartskunst Aufgeworfen werden Probleme, die aus der raschen Veränderung urbaner Sphären kommen. Während in den bedingten Gestaltungsprozessen Architekten und Ar-
86 | Karin Harather, Otto Mittmannsgruber
Abb. 1: Zeichnen im Eisenbahnmuseum Strasshof, Strasshof. Fig. 1: Drawing at the Railway Museum Strasshof.
processes, our research and teaching focuses on artistic approaches that aim to generate added value: This is about a kind of added value that defies definition as a directly quantifiable monetary value, and makes a plea for the “something extra” that, when it comes to art, is still often dismissed as an “unaffordable luxury”.1 The Urban Environment as an Experimental Field for Contemporary Art Problems rise up that stem from the rapid change of urban spheres. While architects are contractors in the related design processes, artists also act on their own behalf in this field of action. They are accustomed to addressing issues that rarely come up in the normal construction process. Because they act as individuals, and like to see their subjective claims fulfilled, the decision-making
chitektinnen in der Regel Auftragnehmer sind, agieren Künstler und Künstlerinnen in diesem Aktionsfeld auch in eigenem Auftrag. Sie sind es gewohnt, Themen zu formulieren, die in der üblichen Bauabwicklung kaum vorkommen. Weil sie als Individuen agieren, die gerne subjektive Ansprüche erfüllt sehen, werden die Entscheidungsstrukturen in der Stadtentwicklung gewisser maßen mit Ideen von Querdenkern und Querdenkerinnen befruchtet. Wie die Geschichte zeigt, sind gerade die individualistischen Ansätze, die zuerst in kleinen Maßstäben exerziert werden, geeignet, die alten Dogmen „über den Haufen“ zu werfen. Wer die Initiative ergreift und dabei eigene Anliegen hervorbringt, ist resistenter gegen das autoritäre Konstrukt eines Auftrages. Als Institut gehen wir von einer Transfersituation aus, verbunden mit dem Ziel, den traditionellen Maßnahmenkatalog des architektonischen Gestaltungsprozesses zu hinterfragen oder auch zu bereichern. Erprobt werden neue Modelle der Partizipation, der Organisation und des Informationsflusses, wie sie sich aus dem aktuellen Kunstschaffen ableiten lassen. Wir stellen Perspektivenwechsel her und lenken den Blick auf verdeckte oder neue Problemstellungen. Realisierungen vor Ort und das Intervenieren in eine konkrete Situation schärfen die Ideen an der Wirklichkeit. Oft zwingen die beschränkten Ressourcen alternative Handlungsmodelle auf, die eine effiziente Einbringung von Ideen in das Zielmilieu ermöglichen. Eine Reihe von Lehrveranstaltungen wurde so um dieses Themenfeld angelegt, dass in jährlich wechselnden Schwerpunkten jeweils unterschiedliche Zugänge zu den Problemfeldern des städtischen Zusammenlebens ermöglicht werden. Auseinandersetzungen können – um das eigentliche Potential von Orten zu ergründen – anhand konkreter Planungsgebiete lokal und ortsspezifisch verankert sein (Seestadt Aspern, Nordwestbahnhof, Neuer Hauptbahnhof), oder sie sind themenspezifisch strukturiert und nehmen dabei globale Phänomene und internationale Entwicklungen etwa zu Fragen von Verkehr, Stadtakustik, Medienpräsenz und -verfügbarkeit, Selbstorganisation, Schaffung von Freiräumen, etc. ins Visier.
Abb. 2: hdksaar, „Fallen, S_A_R Projektbüro“, Völklingen. Fig. 2: hdksaar, „Fallen, S_A_R Projektbüro“, Völklingen.
structures in urban development are inseminated with the ideas of creative thinkers. As history shows, individualistic approaches that are first exercised on a small scale can be well suited to throwing old dogmas overboard. A person who takes the initiative to bring in his or her own concerns is more resistant against the authoritarian construct of a contracted order. As an institute, we expect a transfer situation, combined with the aim of questioning the traditional catalogue of measures of the architectural design process and also enriching it. We are experimenting with the new models of participation, of organisation, and of information flows that can be derived from current artistic creation. We create changes of perspective and draw attention to hidden and new problems. Creating art on
Das Surplus der Kunst in der Architekturausbildung | 87
Abb.3: Plakataktion in der Karlspassage, 2013 Fig.3: Poster Campaign in the Karlspassage, 2013
Die Liste der praxisorientierten Fähigkeiten wird in regelmäßigen Intervallen an den Wandel des Architekturberufes angepasst, wodurch die Erlangung eines eigenen Urteils in Sachen Visualisierung, aber auch die Grundlage für eine spätere Spezialisierung in einer visuellen Darstellungsdisziplin gewährleistet ist. Innerhalb der letzten Dekade wurde etwa im Bereich der Fotografie und der Videoproduktion aufgerüstet: Mit Basiswissen für Aufnahmetechniken und der digitalen Postproduktion werden zeitgenössische und architekturrelevante Bildthemen vermittelt. Neue Medien und neue Kommunikationsformen Zusätzliche Bedeutung erlangen in der Lehre des Institutes auch die Methoden und Techniken der Kommunikation. Überzeugende Präsentationen bei Wettbewerben oder im Ausstellungsbetrieb benötigen ein umfangreiches Cross-over-Wissen aus den Bereichen Typografie, Layout, Illustration, 3D-Visualisierung, Datenvisualisierung, Fotomontage, Plandarstellung und Ikonografie. Entwurf, Anwendung von Programmen und Präsentationstechniken verschmelzen in Eines, sodass es für den Einzelnen zur Voraussetzung wird, sich in diesen Pro-
88 | Karin Harather, Otto Mittmannsgruber
site and intervening in specific situations hones ideas by introducing them to reality. Often, limited resources force alternative models of action, allowing for the efficient introduction of ideas into the target environment. A series of courses have been created around this topic that, by annually changing focus, allow different approaches to problematic areas of urban coexistence. In order to fathom the true potential of a site, examinations are anchored locally and site-specifically in concrete planning areas (Aspern Urban Lakeside, Nordwestbahnhof, and Vienna Hauptbahnhof), or they are structured around specific topics, focussing on global phenomena and international developments such as transport issues, urban acoustics, media presence and availability, self-organisation, creation of open space, etc. The list of practical skills is adjusted at regular intervals to changes in the architecture profession, thereby obtaining a personal judgment of visualisation, but also ensuring the basis for a later specialisation in a visual representation discipline. For example, over the last decade, the field of photography and video production has been updated: now contemporary and architectural aesthetics are taught along with recording techniques and digital post-production. New Media and New Forms of Communication Communication methods and techniques have also gained additional importance in teaching at the institute. Compelling competition and exhibition presentations require extensive crossover knowledge in the fields of typography, layout, illustration, 3D visualisation, data visualisation, photomontage, plan drafting, and iconography. Design, programme application, and presentation techniques merge into one, so it necessary for each individual to position themselves in the processes. We consider graphic design, contemporary art, and communication technologies to be the right cultural techniques to promote identity creation. Likewise, the development of new media skills and the use of new media tools have both become indis-
zessen zu positionieren. Grafikdesign, zeitgenössische Kunst und Kommunikationstechnik erachten wir als die adäquaten Kulturtechniken, um Identitäten zu fördern. Ebenso sind die Erschließung neuer Medien und die Verwendung neuer Medientools unverzichtbar geworden. Unter anderem werden mithilfe spezifischer Programmiertools individualisierte Webpräsenzen erstellt, wobei eines der Kriterien darin liegt, die heterogenen Inhalte auf die Rezeption im Internet abzustimmen. Bei der Einbeziehung von sozialen Plattformen in die Lehre und Architekturvermittlung haben die Studierenden dem akademischen Betrieb wohl einiges voraus; hier gilt es, vor allem kritisch auf die damit einhergehenden Problematiken hinzuweisen. Weil auch gute Ideen richtig promotet werden müssen, finden die Techniken der Werbung und der zielgerichteten Kommunikation Eingang in die Lehre. In Semesterthemen wie „Portfolio“ oder „Campaigning“ werden mediale Vermittlungsstrategien erprobt und vernetztes oder aktivistisches Arbeiten gefördert. Obwohl beträchtliche Ressourcen für die Grundlehre und die oben aufgeführten Arbeitsschwerpunkte aufgebracht werden, nehmen die Forschungs- und Publikationstätigkeiten in den letzten Jahren stetig zu. Mit dem Fachbereich Visuelle Kultur verfügt das Institut über ein Vehikel zur internationalen Positionierung in diesem kulturwissenschaftlichen Forschungsfeld. Damit ist auch gewährleistet, dass der Output der Theorieproduktion bei den Studierenden ankommt. Aktuelle Forschungsprojekte wie „Other Markets“ (www.othermarkets.org) hinterfragen die Dynamiken informeller Raumproduktion anhand von informellen Marktplätzen und suchen nach Möglichkeiten größerer Chancengleichheit in einer zunehmend nach ökonomischen Gesichtspunkten geordneten Welt. „Planning Unplanned“ wiederum ist ein Forschungsprojekt an der Schnittstelle von Kunst und Urbanismus und stellt die Frage, welche Funktion Kunst im Kontext von Stadtentwicklung hat. Als wesentliches Element des Forschungsprojektes wurde die Website www.urban-matters.org, die internationale, kontextspezifische Projekte versammelt und analysiert, installiert.
Abb. 4: Seestadt Aspern, „Trockengarten“, Aspern. Fig. 4: Aspern Urban Lakeside, „Dry Garden“.
pensable. Among other things, individualised internet presences are created using specific programming tools, whereby one of the criteria is to harmonise heterogeneous content to the reception on the web. In terms of including social platforms into the teaching of architecture, students are probably well in advance of academic practice. On this issue, it is especially critical to point out the problems this could bring along. Because even good ideas must be promoted properly, the techniques of advertising and targeted communication are included in teaching. In semester-long topics such as “Portfolio” or “Campaigning”, media placement strategies are tested and networked, or activist work is supported.
Das Surplus der Kunst in der Architekturausbildung | 89
Abb. 5: Eröffnung Popup-Lokal Schnirchgasse, Wien. Fig. 5: Opening of a Popup-location in Vienna, Schnirchgasse.
Für die Zukunft der Architekturausbildung muss eine Balance zwischen Konstanten und Variablen gefunden werden, wobei die Frage, was es zu bewahren gilt, und welche Werte anzupassen sind, nur durch den Abgleich mit den unterschiedlichen Instanzen des Architekturgeschehens (Lehre, Forschung, Praxis) beantwortet werden kann. Anmerkung/Note 1 http://kunst1.tuwien.ac.at/de/kunstforschung/forschungsprojekte/symposium-planning-unplanned/ (Letzter Zugriff: 14. 08. 2014).
90 | Karin Harather, Otto Mittmannsgruber
Although considerable resources are applied to the key activities and basic education as listed above, research and publication activities in recent years have steadily increased. With the Research Group for Visual Culture, the institute has a vehicle for international positioning in the cultural research field. This also ensures that production theory output is conveyed to the students. Current research projects such as “Other Markets” (www.othermarkets.org) scrutinise the dynamics of informal space production on the basis of informal marketplaces, and look for possible greater opportunities in an increasingly ordered world based on economic aspects. “Planning Unplanned” is a research project at the interface of art and urbanism that raises the question of what the functions of art are in the context of urban development. An essential part of this research project was the establishment of the www.urban-matters.org website, which gathers and analyses international context-specific projects. For the future of architectural education, a balance between constants and variables must be found. The question of what must be preserved and which values need to be adjusted can only be answered by aligning the different fields of architectural activity (teaching, research, and practice).
Christian Kern
ENTWICKLUNG UND ERSCHLIESSUNG DER KÜNSTE AN DER TU WIEN THE ADVANCEMENT AND APPRECIATION OF THE ARTS AT THE TU WIEN Der Begriff „Entwicklung und Erschließung der Künste“ findet sich in der aktuellen Satzung der TU Wien, dem Universitätsgesetz und Positionspapieren der österreichischen Hochschulkonferenz sowie des österreichischen Wissenschaftsrates. An der TU Wien bezieht sich dieser Begriff auf die Fakultät für Architektur und Raumplanung. Welche Bedeutung hat dieser Begriff für die Position und Entwicklung der Fakultät?
The term “advancement and appreciation of the arts” appears in the current by-laws of the TU Wien, in the University Act, and in position papers of the Austrian University Conference and the Austrian Science Council. At the TU Wien, this term is connected to the Faculty of Architecture and Planning. What does it mean for the position and development of the Faculty? The Concept of “Appreciation of the Arts”
Der Begriff „Erschließung der Künste“ Der Begriff „Erschließung“ impliziert, dass man etwas Vorhandenes zugänglich macht. Da er das unbekannte Neue und den Weg dahin nicht enthält, wird der Begriff vielfach um die „Entwicklung“ ergänzt: zur „Entwicklung und Erschließung der Künste“ (z. B. an der KUG, der Kunstuniversität Graz). Neue Relevanz hat diese Bezeichnung mit der Veränderung des institutionellen Hochschulstatus der österreichischen Kunstuniversitäten im Jahr 1998, die eine Definition der Forschungsleistungen forderte, erlangt. In diesem Zusammenhang wurde die Gleichwertigkeit von wissenschaftlicher Forschung und Entwicklung und Erschließung der Künste normiert (siehe § 1 des Universitätsgesetzes, BGBl. I Nr. 120/2002). Die Erschließung der Künste an einer technischen Universität Welche Bedeutung hat dieser Begriff nun für eine Architekturfakultät an einer technischen Universität? Eine technische Universität bildet vorwiegend Ingenieurin-
The word “appreciation” implies making something accessible that already exists. As it does not contain the unknown new, or the path to it, the word “advancement” is frequently added, forming the phrase “advancement and appreciation of the arts” (as at the KUG, the Kunstuniversität Graz). In 1998, changes to the institutional status of art programmes at Austrian universities required research objectives to be defined, and the phrase gained new currency. Within this framework, the advancement and appreciation of the arts was put on par with scholarly research (see Section 1 of the University Act, BGBl. I No. 120/2002). Appreciation of the Arts at a Technical University What significance does this term have for a faculty of architecture at a technical university? A technical university primarily trains engineers and generally conducts research in technical fields. The curricular objectives of the engineering sciences can be verified relatively objectively. Using established standards, even research
Entwicklung und Erschließung der Künste an der TU Wien | 91
nen und Ingenieure aus, sie forscht in erster Linie in den technischen Disziplinen. In der Lehre sind die Lehrziele der Ingenieurswissenschaften relativ objektiv überprüfbar. Auch die Forschungsleistungen sind anhand von etablierten Standards gut bewertbar. Die Architektur, in der man nicht nur als Ingenieurin oder Ingenieur ausgebildet wird und handelt, sondern – im Sinne einer Baukunst – auch in künstlerischer Hinsicht tätig ist, nimmt hier eine Sonderstellung ein. Ohne eine Auseinandersetzung mit Kunst und eine damit verbundene Ausein andersetzung mit gesellschaftlichen Gegebenheiten und Entwicklungen würde sie ihre kulturelle Relevanz verlieren. Diese steht außer Frage, denn die Architektur prägt die Umwelt und damit wesentlich unsere Kultur. Eine Auseinandersetzung mit künstlerischen Methoden des Erkenntnisgewinns in der Architektur ist also notwendig. Wie die Ingenieurwissenschaften sind sie ein integraler Teil der Architektur. Sie entziehen sich jedoch in einem erheblichen Umfang den inzwischen in Ingenieur-, Geistes- oder Naturwissenschaften üblichen Evaluierungssystemen. Die Wissensbilanz und der Formelsatz, die für die quantitative und qualitative Bewertung anderer universitärer Disziplinen entwickelt wurden, greifen hier zu kurz. Allerdings können Fächer an einer Architekturfakultät, die sich nicht primär mit der Erschließung der Künste auseinandersetzen, durchaus mit etablierten wissenschaftlichen Methoden arbeiten, z. B. die Bauforschung, die bautechnischen Fächer wie Bauphysik, Technischer Ausbau und Tragwerkslehre und die Bereiche, die geisteswissenschaftliche Methoden verwenden. Man erkennt also bereits das Spannungsfeld, in dem sich eine Architekturfakultät innerhalb ihrer eigenen Bereiche, aber auch innerhalb einer technischen Universität bewegt. Zum einen wird die Erschließung der Künste in diesem Umfeld geschätzt, weil sie oftmals mit Interventionen außerhalb der Universität, Ausstellungen und Veröffentlichungen in Populärmedien sichtbarer ist als das rein Technische. Sie gilt als bereichernd und kreativ, als Ideengeber. Zum anderen wird dieser Gestaltungsteil als unbequemer Fremdkörper, der sich mit den
92 | Christian Kern
output can be easily evaluated. Architecture, a field in which one is not only educated as and functions as an engineer, but also works – in the sense of the art of building – with aesthetics, occupies a special place in this regard. Without comprehending art in conjunction with an exploration of social conditions and developments, it would lose its cultural relevance. This is beyond a doubt, as architecture shapes the environment and is consequently crucial to our culture. An analysis of knowledge production through artistic methods in architecture is therefore necessary. They are an integral part of architecture, as are the engineering sciences. However, to a considerable extent, architecture eludes the evaluative systems that have become the norm in engineering, the humanities, and the natural sciences. Here, intellectual capital and the formulas developed to quantitatively and qualitatively assess other university disciplines fall short. Of course, courses taught at an architecture faculty that are not directly concerned with the appreciation of the arts, such as building research, the technical subjects such as physics, building systems, and structural design, and those that employ scholarly methods from the humanities, do indeed work with established scientific methods. The source of conflict, where an architecture faculty operates within its own domains, but also within the space of the technical university, is thus immediately apparent. For one thing, in this context, the appreciation of the arts is highly valued because, thanks to interventions outside of the university, exhibitions and publications in popular media, it is often more visible than purely technical subjects. It is regarded as rewarding and creative, as a wellspring of ideas. At the same time, this design component is also viewed as an awkward foreign body that is difficult to evaluate and manage using existing approaches. Worse still, it is not taken seriously on an academic level, because the advancement and appreciation of the arts (“arts-based research”) is not perceived or valued as equivalent to scientific research.
gegebenen Strukturen nur schwer bewerten und steuern lässt, gesehen. Schlimmer noch, man nimmt ihn auf akademischer Ebene nicht ernst, weil die Entwicklung und Erschließung der Künste (arts based research) in der Wahrnehmung und Bewertung nicht als gleichwertig zur wissenschaftlichen Forschung (scientific research) gesehen wird. Die Bewertung der „Entwicklung und Erschließung der Künste“ Die künstlerische Forschung ist aber, wie oben erwähnt, nach § 1 des UG 2002 der wissenschaftlichen Forschung gleichgestellt. Mehr noch, zu den leitenden Grundsätzen dieses Gesetzes zählt die Verbindung von Wissenschaft und Kunst. Die Bewertung der Ergebnisse aus diesen Leistungen ist schwierig. Sie braucht, wie die Erfahrung zeigt, andere Instrumente als eine Publikationsdatenbank. Da sich jede Kunst im Kunstwerk äußert, zählen neben Ausstellungen und Symposien vor allem auch Publikationen zu den gebräuchlichen Formaten. Publikationen jedoch, die in fachbezogenen und in von Fachkreisen respektierten Zeitschriften und Buchreihen erscheinen, sind im Bereich der Entwicklung und Erschließung der Künste in der Regel nicht „peer reviewed“ und damit für die Ressourcenverteilung gegenwärtig weniger wert. Gleiches gilt für Ausstellungen und Symposien. Ganz grundsätzlich birgt künstlerische Forschung die besondere Schwierigkeit, zwei zunächst schwer vereinbare Dinge zusammenzubringen: die individuelle, subjektive künstlerische Arbeit selbst und die Begleitung dieser Arbeit zur intersubjektiven Aufarbeitung ihrer Ergebnisse, Methoden und Erkenntnisse. Dies stellt einen Aufwand dar, der einerseits aus der Sicht der Kunst, andererseits aus der der Wissenschaften ungewöhnlich hoch erscheint, da der Blick jeweils nur auf einen Teil gerichtet ist. Die Verteilung von Ressourcen nach den aktuellen Bewertungsschlüsseln berücksichtigt das nicht und birgt die Gefahr, den für die Architektur wichtigen Beitrag, die
Abb. 1: Der Künstler TOMAK wird mit einem Laserscanner digitalisiert, die Daten bilden die Grundlage für die Skulpturenserie Phantomak. Fig. 1: The artist TOMAK is digitised with a laser scanner, the data forming the basis for the sculpture series „Phantomak“.
Evaluating the Advancement and Appreciation of the Arts However, as mentioned, Section 1 of the UG 2002 does put arts-based research on equal terms with scientific research. Furthermore, the principles underlying the law include the connection of science and art. But it is difficult to assess the performance of these pursuits. Experience shows that tools other than a database of publications are required. Since all art expresses itself in works of art, in addition to exhibitions and symposia, publications rank particularly high among the conventional formats. However, in the advancement and appreciation
Entwicklung und Erschließung der Künste an der TU Wien | 93
Abb. 2: Industrieroboter, Kameras und elektronische Bildverarbeitung ermöglichen die Verschränkung digitaler und physischer Designmethoden, Kathrin Dörfler, Romana Rust, Florian Rist. Fig. 2: Industrial robots, cameras, and electronic image processing enable the combination of digital und physical design methods: Kathrin Dörfler, Romana Rust, Florian Rist.
Erschließung der Künste, nicht mehr leisten zu können. Unsere Forschungsaktivitäten in diesem Bereich lassen sich im Moment auch nur schlecht über Forschungsanträge finanzieren, da sie häufig für wissenschaftlich/ technische Programme zu künstlerisch, für die Kunstförderung zu technisch sind. Die eigentlich hervorragende Ausgangssituation, gerade an der spannenden Schnittstelle zwischen Technik/Naturwissenschaft und Kunst zu sitzen, scheint sich hier sogar negativ auszuwirken.
94 | Christian Kern
of the arts, publications in professionally-oriented and respected journals and book series are generally not “peer reviewed”, and thus of lesser value in terms of the allocation of resources. The same is true of exhibitions and symposia. Arts-based research fundamentally involves the special challenge of uniting two things that are initially difficult to join together: individual, subjective artistic work itself, and the task of moving this work toward intersubjective appraisal of its results, methods, and findings. As only one portion can be reviewed at a time, the effort is unusually taxing, both from the perspective of art and that of the sciences. The allocation of resources according to current performance indicators does not take this into account, and runs the risk of no longer being able to support the appreciation of art, which is so important to architecture.
Abb. 3: Modellbau im Modul Form und Design, Nicky Nikousokhan-Tayar, Riana Sulic. Fig. 3: Model building during the module “form and design”: Nicky Nikousokhan-Tayar, Riana Sulic.
Die Entwicklung und Erschließung der Künste im Studienplan Die Erschließung der Künste ist in den Studienplänen im Fachbereich Architektur verankert und wird über Beauftragungen von Lehrveranstaltungen unterschiedlicher Gewichtung in Praxis und Theorie von Lehrveranstaltungsleitern gelehrt. Ihre Position ist jedoch besonders im Bachelorstudium in Gefahr. Eine Gefahr, die genauso viele andere Lehrinhalte betrifft. Per Definition ist der Bachelortitel berufsqualifizierend, gleichzeitig wird er jedoch als erster Abschluss eines mehrstufigen Studienmodells gesehen. In diesen beiden Definitionen ist bereits eine Problematik im Sinne eines Widerspruchs enthalten. Wenn der Bachelortitel bereits berufsqualifizierend ist, müssen alle relevanten Inhalte für eine spätere Tätigkeit enthalten sein. Bei der Architektur als ganzheitliche Disziplin ist das sehr viel. Die zur Verfügung stehende Zeit ist jedoch begrenzt auf acht Semester, in Österreich in der Regel auf sechs. Dies ist für eine universitäre Architekturausbildung, die ohne Persönlichkeitsentwicklung nicht gedacht werden kann, definitiv zu kurz. Das führt zu einer Überfrachtung der Studienpläne, die nicht nur Studierende überfordert, sondern auch die Lehrenden. Ein Verknüpfen und Vertiefen von Wissen wird so behindert. Es entstehen temporäre Wissensinseln, die abgeprüft werden und deren inhaltliche Relevanz man viel zu spät erfährt.
At present, our research activity in this area is difficult to finance via research contracts, as it is frequently too artistic for scientific and technical programmes, yet too technical for arts funding. Thus, what is at the outset actually an excellent position, being right at the exciting intersection of technology/science and art, appears to have a rather negative impact. The Advancement and Appreciation of the Arts in the Curriculum The appreciation of the arts is anchored in the curricula of the Faculty of Architecture, and is taught across courses by instructors that vary in their emphasis on practice and theory. In the undergraduate programme, however, its position is particularly at risk – a danger that also affects many other kinds of course content. By definition, the bachelor’s degree is a professional qualification, but in a multi-stage model of education, it is also viewed as the first degree. Inherent to these two definitions is a paradox. If the bachelor’s degree is a professional designation, then it must cover all content relevant to eventual practice. For a holistic discipline such as architecture, that’s a great deal of material. However, the programme is limited to eight semesters, and generally as few as six in Austria. This is decidedly too brief for a university education in architecture, which is inconceivable without personal growth. The result is an overloaded curriculum
Entwicklung und Erschließung der Künste an der TU Wien | 95
Der Widerspruch liegt nun darin, dass zum einen fast niemand im Umfeld der Architekturpraxis annimmt, der Bachelortitel sei für die Tätigkeit als Architekt ausreichend. Erste, nicht repräsentative Rückmeldungen aus der Praxis scheinen diese Annahme zu bestätigen. Andererseits ist aber jedes Fach im Bachelorprogramm vertreten, zum Teil, weil es dort positioniert wurde, aber durchaus auch, weil es sonst um seine Relevanz fürchten muss. Eine ganz andere Situation als in den vergangenen Diplomstudiengängen der Architektur, wo viele Fächer gar nicht in der Grundausbildung vertreten waren, weil sie bei einem höheren Kenntnisstand der Studierenden ansetzen wollten. Hier unterliegt die Erschließung der Künste, wie schon angedeutet, der gleichen Problematik wie andere Gestaltungsübungen. Eine gestalterisch-künstlerische Übung im Bachelorprogramm kann nur noch verschult angeboten werden, weil eine freie Herangehensweise mit unterschiedlichen Entwicklungssprüngen und Geschwindigkeiten wegen der vielen anderen zu absolvierenden Fächer für die Studierenden nicht mehr möglich ist. Die in der künstlerischen Ausbildung notwendige, direkte Auseinandersetzung zwischen Lehrenden und Lernenden kann so nur begrenzt stattfinden. Eine Lösung kann nur in einer grundlegenden Reform und einer Neupositionierung des Bachelorstudienplans liegen. Freiräume Künstlerische Forschung oder die Entwicklung und Erschließung der Künste kann auch an einer Architekturfakultät mit ihren wissenschaftlich forschenden, technischen und geisteswissenschaftlichen Bereichen weder mit den Instrumenten wissenschaftlicher Qualitätssicherung noch in Bezug auf ihre direkte wirtschaftliche Verwertbarkeit beurteilt werden. Sie braucht Freiräume, in denen aus künstlerischen Motivationen heraus eigene, selbst beauftragte Projekte entstehen können. Dazu gehören Infrastruktur, finanzielle Ausstattung und die Möglichkeit, künstlerisches Personal auch außerhalb von Dissertationen zu qualifizieren und hochqualifizierte Mit-
96 | Christian Kern
that equally overwhelms instructors and students, and hinders the latter from connecting and developing the lessons learned. Instead, islands of knowledge, the relevance of whose content is discovered far too late, form temporarily for testing. A contradiction arises from the fact that practically no one in the architecture profession accepts that a bachelor’s degree is sufficient for practicing as an architect. Non-representative feedback from the profession appears to confirm this assumption. On the other hand, however, all professional subjects are represented in the undergraduate programme, in part because it was placed there, but also very much because the programme would risk losing relevance otherwise. Things were different in the graduate degree programmes of the past, where many subjects were left out of the basic curriculum because students were thought to start out with a higher level of knowledge. The appreciation of the arts, as already suggested, faces the same problem as other work in design. In an undergraduate programme, an artistic design studio can only be offered with encumbrances, because a free approach allowing different developmental steps and speeds is no longer possible due to the many other subjects students must complete. As a result, the direct exchange between teachers and students necessary to artistic education only takes place to a limited extent. The only solution is fundamental reform and repositioning of the undergraduate curriculum. Space to Move Furthermore, at an architecture faculty, with its scholarly research and technical and humanities courses, artsbased research and appreciation of the arts cannot be assessed either with the instruments of academic quality control or in direct terms of economic value. They need to allow space and time for individual, self-directed creative projects. This includes providing a support infrastructure, funding, and the opportunity for artistic staff to be qualified with or without dissertations, and
arbeiterinnen und Mitarbeiter mit geeigneten Angeboten an die Universität zu binden. Eine erfolgreiche Architekturlehre erfordert Studienpläne, die eine individuelle, vertiefende, gestalterisch/künstlerische Auseinandersetzung ermöglichen, sie muss die dazu notwendigen zeitlichen Freiräume anbieten.
to attract highly skilled employees to the university with appropriate offers. A successful architecture programme demands a curriculum that permits individual, in-depth, and creative work to be done; for this, it must offer the necessary space and time.
Entwicklung und Erschließung der Künste an der TU Wien | 97
RAUMPLANUNG IM SPANNUNGSFELD DER DISZIPLINEN SPATIAL PLANNING BETWEEN THE DISCIPLINES Betrachtung des Raums in seinen vielfältigen Dimensionen, Interdisziplinarität, Kooperation, Praxisbezug auf theoretisch sicheren Fundamenten und Entwicklung von Planungswissen gemeinsam mit den betroffenen Anspruchsgruppen – dies sind einige wichtige Charakteristika des Departments für Raumplanung in Forschung, Planung und Lehre. Die vielfältigen Ansprüche äußern sich auch in den vielen fachlichen Disziplinen, die am Department für Raumplanung vertreten sind: Neben den „klassischen“ Planungsbereichen (Lokal- und Regionalplanung und -entwicklung) sind auch die raumund technikbezogenen Rechts-, Sozial-, Wirtschafts-, Informatik- und Kulturwissenschaften vertreten. The observation of space and its diverse dimensions, interdisciplinarity, cooperations, applications based on a theoretically sound foundation, and development of planning knowledge together with the affected stakeholders – these are just a few of the important research, planning, and teaching characteristics of the Department of Spatial Planning. The great variety of demands in the field become visible in the many specialised disciplines represented by the Department of Spatial Planning: in addition to the “classic” fields of spatial planning (local and regional planning and development), spatial and technological legal, social, economic, computer, and cultural sciences are also represented.
Michael Getzner
VON DER UNMÖGLICHKEIT, IN DER RAUMPLANUNG AUF EINEN LETZTGÜLTIGEN GRÜNEN ZWEIG ZU KOMMEN ON THE IMPOSSIBILITY OF ARRIVING AT A FINAL SOLUTION IN SPATIAL PLANNING Die Nutzungsansprüche an die und die Nutzungskonflikte innerhalb der absolut begrenzten nutz baren Flächen und der vorhandenen Räume im weiteren Sinn entwickeln sich auf allen Maßstabsebenen (lokal bis global) äußerst dynamisch und nehmen teils erheblich zu, bei gleichzeitig starken politischen Zielen einer signifikanten Beschränkung des Flächenverbrauchs und der Bodenversiegelung im Sinne der Nachhaltigkeit und der Effizienz (für Österreich z. B. in der Österreichischen Nachhaltig keitsstrategie sowie dem Österreichischen Raum entwicklungskonzept). Neben dem naturwissenschaftlich-physischen Raumbegriff ist der „Raum“ hierbei auch in seinen kulturellen, sozialen und ökonomischen Dimensionen und als gesellschaftlich produzierter Raum zu verstehen.
The demand for and conflicts within the absolutely limited usable areas and existing spaces are, in the broadest sense, developing dynamically on all scales (from local to global); the appropriation of land for residential, commercial and infrastructure purposes is increasing dramatically, despite strong political goals to significantly limit the use of land and sealing of the soil surface for the sake of sustainability and efficiency (for Austria, this includes the Austrian Sustainability Strategy as well as the Austrian Spatial Development Programme). The concept of “space” is in this context not only used in the scientific and physical sense but also to describe the cultural, social and economic perspectives on land and space, and may be understood as the societal production of space.
Aufgaben und Herausforderungen für die Raumplanung
The Tasks and Challenges of Spatial Development
Raumplanung übernimmt die essentielle Aufgabe, die räumliche Entwicklung nach fachlichen und politischen Zielen zu analysieren und zu versuchen, einer nicht nachhaltigen Entwicklung entgegen zu steuern. Die Rolle der Raumplanung hat sich jedoch geschichtlich und vor allem in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt: Neben den traditionellen Aufgaben des „Steuermanns“ ist die Funktion der Prozesssteuerung unter Einbeziehung von unterschiedlichen Interessen deutlich stärker geworden (Ergänzung von „Government“ durch „Governance“). Neben diesen methodischen und prozessorientierten Veränderungen ergeben sich wesentliche neue Anforde-
Spatial development takes on the essential task of analysing the development of spaces and assigning and defining specific forms of land use, keeping an eye on professional and political aims while preventing non-sustainable development. However, the role of spatial development has changed significantly, particularly in the last few decades. In addition to the traditional task of being the “helmsman”, the task of controlling processes whilst taking into account the different interests has become increasingly important (“government” is supplemented by “governance”). These methodological and process-oriented changes create markedly new requirements for spatial development caused by increas-
Von der Unmöglichkeit, in der Raumplanung auf einen letztgültigen grünen Zweig zu kommen | 99
rungen an die Raumplanung aus den Ursachen der Flächeninanspruchnahme. Zu den bekannten Treibern des Bodenverbrauchs – u. a. wirtschaftliches Wachstum, Zunahme der Bevölkerungszahl, zunehmender Wohlstand, ausdifferenzierende Lebensstile, Planung neuer Siedlungs- und Gewerbeflächen sowie Infrastrukturen – treten zusätzliche neue Anforderungen, beispielsweise die Erschließung neuer Energiequellen durch den Anbau erneuerbarer Energieträger, eine Ausdehnung der für den Naturschutz vorgesehenen Flächen und eine Zunahme der flächenintensiveren biologischen Landwirtschaft. Die Herausforderungen einer ökologisch nachhaltigen und ökonomisch effizienten Nutzung der Ressource Boden haben jedoch auch signifikante soziale Auswirkungen, beispielsweise für den Zugang zu Erholungsräumen, die Erreichbarkeit sozialer Infrastruktur sowie von Arbeitsplätzen und Bildungseinrichtungen. Darüber hinaus führt die enge internationale Verflechtung der wirtschaftlichen Beziehungen dazu, dass Planungshandeln und viele räumlich wirksame Entscheidungen massive Auswirkungen auf die Flächennutzung und Raumproduktion in anderen Erdteilen haben können (z. B. „land grabbing“ in Entwicklungsländern für den Anbau von Energiepflanzen und Nahrungsmitteln für die Industriestaaten). Dies stellt die Raumplanung, verstanden als multidisziplinäre Auseinandersetzung mit dem Raum in seinen vielfältigen Facetten und Sichtweisen, vor enorme Herausforderungen: •• aus Sicht der Praxis, weil eine flächen- und ressourcensparende Raumplanung mit ihren klassischen Instrumenten wie Flächenwidmungsplänen oder innovativen Instrumenten wie städtebaulichen Verträgen im Rahmen zunehmend partizipativer, handlungsorientierter und inklusiver Entscheidungsprozesse effizient und effektiv im Sinne der Nachhaltigkeit umgesetzt werden soll •• aus Sicht der Forschung, weil sowohl die neuen Planungsinstrumente hinsichtlich ihrer Wirkungen, als auch die Ursachen der Nutzungskonflikte durch eine breite Methodenvielfalt bewertet werden sollen •• aus Sicht der Lehre, weil Raumplanerinnen und -planer einerseits Expertise für räumliche Entwicklungen
100 | Michael Getzner
ing land use and appropriation. Known driving forces of land consumption – such as economic growth, growing population size, increasing wealth, lifestyle differentiation, and the planning of new residential spaces, industrial areas, and infrastructures – are complemented by new challenges, for example, the development of new energy sources such as renewables, an expansion of areas designated for nature conservation, and an increase in areas farmed organically. The challenges of an ecologically sustainable and economically more efficient use of land resources also have significant social implications, for example, access to recreational spaces and the accessibility of social infrastructure such as workplaces and educational facilities. Furthermore, significant international interdependence of economic relations mean that development policies and many development decisions can have a significant impact on the utilisation and production of space in other parts of the world (e.g. “land grabbing” in developing nations for the farming of energy crops and food for the industrial nations). This presents significant challenges to spatial development if it is understood as a multidisciplinary engagement with the space and its many facets and viewpoints: •• The practical viewpoint, because space and resource-conserving spatial development should be implemented using classical instruments such as planning schemes or innovative instruments such as urban development contracts in the framework of implementing increasingly more participative, action-oriented and inclusive decision-making processes which are efficient and sustainable; •• The research viewpoint, because both the new planning instruments and the causes of utilisation conflicts need to be analysed regarding their efficacy using a large variety of methods; •• The teaching viewpoint, because spatial developers must have expert knowledge for spatial development as well as be able to design a variety of decision-making processes. In order to do this, they must possess both technical planning knowledge and diverse social and intercultural competencies.
besitzen und Fachmeinungen zu entwickeln und zu vertreten haben, andererseits aber auch vielfältige Entscheidungsprozesse gestalten sollten. Dazu müssen sie sowohl über technisch-planerisches Wissen als auch über vielfältige soziale und interkulturelle Kompetenzen verfügen. Raumplanung als Konfliktlöser Die aktuelle Raumplanung befasst sich zwar weiterhin mit Flächen und Räumen in vielfältigen Perspektiven, sie hat sich dabei aber den Herausforderungen dynamischer Prozesse (z. B. soziale und wirtschaftliche Entwicklungen, technische Neuerungen, ökologische Veränderungen, Änderungen von Einstellungen, Präferenzen und Lebensstilen) zu stellen und verlangt zunehmend die Kompetenz, diese Zielkonflikte zu lösen oder zumindest entsprechende Entscheidungen fachlich vorzubereiten. Diese Veränderungen betreffen die unterschiedlichen Räume in unterschiedlicher, oftmals polarisierender Weise. Der Schrumpfung und Peripherisierung vieler Regionen steht das Wachstum und die Verdichtung größerer Städte gegenüber (wobei selbst innerhalb wachsender Städte unterschiedliche Wachstums- und Schrumpfungsprozesse zu beobachten sind). Die zusätzliche Nachfrage nach erneuerbaren Energieträgern trifft auf nicht nachhaltige Flächeninanspruchnahme für diese Energieträger. Die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und des Wirtschaftswachstums als wichtiges Ziel der österreichischen Raumentwicklungsstrategie spießt sich mit dem damit verbundenen zusätzlichen und nicht nachhaltigen Flächenverbrauch und kann einer sozialen Kohäsion und Integration entgegenwirken. Die Raumplanung soll entscheidend mithelfen, alle diese Konflikte möglichst kooperativ zu bearbeiten und zu lösen, auch wenn viele davon struktureller und politischer Natur sind und durch Fachplanungen allein nicht gelöst werden können. Die Kooperation der einzelnen Akteurinnen und Akteure kann jedoch, wie die Praxis zeigt, aufgrund sehr unterschiedlicher Interessenslagen häufig nicht ohne weiteres hergestellt werden. Beispiels-
Spatial Development as a Problem-solver Modern spatial development continues to deal with the many facets of areas and spaces, but it also has to address the challenges of dynamic processes (e.g. social and economic developments, technical innovations, ecological changes, and changes in attitudes, preferences, and lifestyles). More and more, spatial planning means solving conflicts between different objectives or, at a minimum, professionally preparing relevant decisions. These changes affect the different spaces in different and often polarising ways. The shrinking and marginalisation of some regions is contrasted by the growth and concentration of many larger cities (although even within growing cities, many different growth and shrinkage processes can be observed). The new demand for renewable energy sources is faced with the unsustainable land use these energy sources require. Increasing competitiveness and economic growth are important aims of the Austrian Spatial Development Perspective. The additional and non-sustainable land use associated with this often works against social cohesion and integration. Spatial development aims to significantly aid the processing and solving of all these types of conflicts in the most cooperative manner possible, even if many conflicts are of a structural and political nature and cannot be solved by professional planning alone. However, the cooperation of individual parties can be difficult due to different interests, as has often been demonstrated in practice. For example, cooperation to create more efficient land use and to reduce regional disparities is often opposed by the targeted growth of economic competitiveness of regions and an increase of competitive federalism. The interplay between “competition” and “cooperation”, which is an important goal of European regional development (“strengthening strengths”), can have very different effects, depending on the level being taken into consideration (regional vs. local).
Von der Unmöglichkeit, in der Raumplanung auf einen letztgültigen grünen Zweig zu kommen | 101
weise stehen einer Kooperation zugunsten einer effizienteren Flächennutzung und eines Ausgleichs zwischen den Regionen meist die Ausrichtung auf die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit von Regionen und die Verstärkung des Wettbewerbsföderalismus entgegen. Das Wechselspiel von „Konkurrenz“ und „Kooperation“, welches ein dezidiertes Ziel europäischer Regionalentwicklung ist („Stärken stärken“) wirkt sich – je nach Ebene der Betrachtung (regional vs. lokal) – oft sehr unterschiedlich aus. Grundsätzliche Widersprüche innerhalb der Raumplanung Somit ist die Raumplanung auch mit grundsätzlichen Widersprüchen innerhalb der eigenen Profession und oft mit konträren, normativ aufgeladenen Zielsetzungen konfrontiert. Sie kann daher nur bedingt – sowohl die Raumplanungsausbildung als auch die Forschung – fertige und eindeutige Konzepte zur Lösung dieser Widersprüche bieten. Sie hat daher in den letzten Jahrzehnten vielfältige Methoden und Verfahren zur Beurteilung und zum Umgang mit diesen Widersprüchen entwickelt – von der Entwicklung von Szenarien und computergestützten Modellrechnungen über Beteiligungsverfahren bis zur fuzzy logic. Raumplanung liefert daher wichtige Hilfestellungen zu politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen raumrelevanten Entscheidungen. Wichtige Strategieelemente des Umgangs mit diesen Phänomenen bestehen einerseits in einer Ausweitung von fachlichen Zugängen, Paradigmen und Methoden sowie einer Intensivierung der nicht immer einfachen und in akademischen Kreisen manchmal skeptisch betrachteten inter- und multidisziplinären Auseinandersetzung zwischen ihren Grundlagenfächern andererseits. Dies wirkt sich auch in der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fachbereichen des Departments für Raumplanung aus und trägt zu einem intensiveren Austausch bei. Die engere interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb des Departments für Raumplanung ist auch die Voraussetzung dafür, dass neue inhaltliche und interdis-
102 | Michael Getzner
Fundamental Contradictions in Spatial Development Spatial development is confronted with fundamental contradictions within its own profession as well as contradictory, normatively charged goals. Therefore, both spatial development training and research can only provide incomplete and non-definitive concepts for solving these contradictions. Over the last few decades, many methods and procedures for analysing and dealing with these contradictions have been developed – from the establishment of scenarios and computer-supported model calculations to participation processes and fuzzy logic. This enables spatial development to help make political, economic, and civic space related decisions. Important strategic elements on how to deal with these phenomena include an extension of professional approaches, paradigms, and methods on the one hand, but also an intensification of the inter- and multidisciplinary discussion between its basic subjects, which is not always easy and is often met with scepticism in academic circles. This also affects the cooperation between different centers at the Department of Spatial Planning and leads to a more vigorous exchange. A closer interdisciplinary cooperation within the Department of Spatial Planning is a prerequisite for setting new issues and focussing interdisciplinary collaboration, e.g. in the area of energy-related spatial development of the ENUR research programme and the EWARD and URBEM doctoral programmes,1 in the field of simulation and visuali sation, or for the space-related cultural sciences focusing on urban culture, public space, and urbanism. It is therefore necessary that spatial development training and research not only includes classical methods and questions in the sense of a positivistic understanding of science (e.g. analysis, model building, and hypotheses testing with an emphasis on quantitative methods) but also integrates qualitative aspects that are often connected with normative statements about the change of spatial qualities. Of course, the integration of planning and engineering methods and approaches on
Abb. 1: „Die unsichtbaren Städte“ von Italo Calvino, Visualisierung von Friedrich Moser (2001). Fig. 1: „The invisible cities” by Italo Calvino, visualisation by Friedrich Moser (2001).
Von der Unmöglichkeit, in der Raumplanung auf einen letztgültigen grünen Zweig zu kommen | 103
ziplinär zu bearbeitende Schwerpunkte gesetzt werden können, z. B. im Bereich der Energieraumplanung des ENUR-Forschungsschwerpunkts und der EWARD- und URBEM-Doktoratskollegs1 sowie im Feld der Simulation und Visualisierung oder bei kulturwissenschaftlichen Schwerpunkten, wie Stadtkultur, öffentlicher Raum und Urbanistik. Die raumplanerische Ausbildung und Forschung erfordert daher neben den klassischen Methoden und Fragestellungen im Sinne eines positivistischen Wissenschaftsverständnisses (z. B. Analyse, Modellbildung, Hypothesenüberprüfung mit dem Schwerpunkt auf quantitative Methoden) eine Integration auch qualitativer Ansätze, die meist mit normativen Aussagen über den Wandel von räumlichen Qualitäten verbunden sind. Die Integration planungs- und ingenieurwissenschaftlicher Methoden und Zugänge einerseits und regional-, sozial-, wirtschafts- und kulturwissenschaftlicher Methoden und Zugänge anderseits ist zwar herausfordernd, aber jedenfalls zukunftsweisend und wird verstärkt auch die traditionellen natur- und technikwissenschaftlichen Fächer umfassen. Eine weitere fakultätsspezifische Tradition besteht darin, auch künstlerisch-gestalterische Zugänge zu integrieren. Die „Wiener Schule der Raumplanung“? Die internationale Zusammenarbeit und der Austausch mit anderen Planungsschulen waren und sind ein wichtiges Anliegen der Wiener Schule der Raumplanung – die TU Wien ist beispielsweise Gründungsmitglied des europäischen Netzwerkes AESOP (Association of European Schools of Planning). Die aktuelle Bedeutung hat sich beispielsweise darin gezeigt, dass es im Mai 2014 bei der einwöchigen internationalen Konferenz „Pioneers of Planning Thought“ gelungen ist, die weltweit wichtigsten Theoretikerinnen und Theoretiker der Raumplanung erstmalig an einem Ort über die künftigen Herausforderungen der Raumplanung (teilweise mit Studierenden) reflektieren zu lassen. Neben vielfältigen internationalen Aktivitäten wie der Beteiligung an internationalen
104 | Michael Getzner
the one hand and regional, social, economic, and cultural science methods and approaches on the other hand is challenging. Yet this approach is also groundbreaking and trendsetting, and will increasingly include traditional science and technology research fields. Another faculty-specific tradition is the integration of artistic and design approaches. The “Vienna School of Spatial Development”? The international cooperation and exchange with different planning schools was and is an important concern of the Vienna School of Spatial Development – for example, the TU Wien is a founding member of the European AESOP Network (Association of European Schools of Planning). Its current significance was demonstrated during the one week international Pioneers of Planning Thought conference in May 2014 which, for the first time, gathered the most important theoreticians from all over the world in one place to reflect on future challenges for spatial development (also including students). In addition to many international activities such as the participation in international research projects and programmes, and the publication of papers in top professional journals, the participation and organisation of international conferences (at the TU, e.g. Public Space and the Challenges of Urban Transformation in Europe, 2010, and the European Urban Research Association, 2012), exchange programmes and summer schools and the international IDK doctoral programme,2 the main task will be to deepen and extend existing cooperations, particularly with Eastern European universities, planning schools, and institutions. This international exchange is essential for the future development of the field of spatial planning: whilst the Department of Spatial Planning appreciates the enormous usefulness of practical and region-specific planning projects, empirical, methodological, and contextual research and planning results should be presented to a broader international expert audience by attending more international scientific conferences in addition to
Forschungsprojekten und -programmen, Publikationen von Beiträgen in hochrangigen internationalen Fachzeitschriften, die Beteiligung an und die Ausrichtung von internationalen Konferenzen (an der TU z. B. „Public Space and the Challenges of Urban Transformation in Europe“, 2010; „European Urban Research Association“, 2012), Austauschprogrammen und Summer Schools, und dem internationalen Doktoratskolleg IDK2 wird es vor allem die Aufgabe sein, die bestehende Zusammenarbeit mit insbesondere osteuropäischen Universitäten, Planungsschulen und -institutionen zu vertiefen und auszubauen. Für die zukünftige Entwicklung der Disziplin Raumplanung ist dieser internationale Austausch essentiell: Bei aller Wertschätzung für den enormen Nutzen von praxis- und regionsbezogenen Planungsprojekten am Department für Raumplanung sollten die empirisch-methodischen und inhaltlichen Forschungs- und Planungsergebnisse einer breiteren internationalen Fachöffentlichkeit durch eine verstärkte Teilnahme an internationalen wissenschaftlichen Konferenzen sowie durch die Publikation in begutachteten Fachzeitschriften vorgestellt werden. Erst durch diese Einbindung in die international führenden Diskurse wird es möglich sein, in einer effizienten, effektiven und sozial sensiblen Weise mit der Raumplanungsanalyse und -praxis zu einer nachhaltigen Flächennutzung nicht nur in Österreich, sondern in vielen anderen europäischen und außereuropäischen Ländern beizutragen.
publishing in peer-reviewed research journals. A more efficient, effective, and socially sensitive spatial development analysis and practice for a more sustainable use of land not only in Austria but in many other European and non-European countries will only be possible through involvement in the international debate. Anmerkungen/Notes 1 ENUR = Energie im urbanen Raum: enur.project.tuwien.ac.at; EWARD = Energy and Resource Awareness in Urban and Regional Development: raum.tuwien.ac.at/eward; URBEM = Urbanes Energie- und Mobilitätssystem: urbem.tuwien.ac.at (alle: 20. 01. 2015). 2 IDK = Internationales Forschungslabor Raum: www.forschungslabor-raum.info (20. 01. 2015).
Von der Unmöglichkeit, in der Raumplanung auf einen letztgültigen grünen Zweig zu kommen | 105
Franz Zehetner
RECHTSWISSENSCHAFTEN AN EINER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT? LEGAL SCIENCES AT A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY? Das ist eine oft gestellte Frage, die in den 200 Jahren seit der Gründung des Polytechnischen Instituts für den Rechts- und Funktionsnachfolger Technische Universität Wien stets bejaht werden konnte,1 jedoch in inhaltlicher2 und organisatorischer Hinsicht unterschiedlich beantwortet werden musste. Obwohl allgemein bekannt ist, dass Architekten ohne Grundkenntnisse des Baurechts und Raumplaner ohne Grundkenntnisse des Boden- und Raumplanungsrechts scheitern werden und Informatiker den rechtlichen Rahmen des Daten- und Informatikrechts zu beachten haben, wird gerne ausgeblendet, dass es an technischen Universitäten im Allgemeinen und an der Technischen Universität Wien im Besonderen keine Studienrichtungen gibt, die ohne Rechtsfächer in ihren Studienplänen auskommen. Die laufende Weiterentwicklung der Rechtsordnungen auf internationaler, europäischer und innerstaatlicher Ebene (letztere noch verkompliziert durch eine in vielen Bereichen nicht mehr zeitgemäße Kompetenzverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden) als Folge neuer technischer Entwicklungen (z. B. Internet) und Anforderungen (z. B. Klimaschutzmaßnahmen) bringt neue Herausforderungen für den Fachbereich Rechtswissenschaften in Bezug auf Lehre, Forschung und Organisation.
In the 200 years since the founding of the Polytechnic Institute, this is a question that has been frequently posed to the TU Wien, its legal and functional successor1 and that has been consistently answered with yes, but nevertheless in different variations with regards to its content2 and organisation. Although, in general, it is known that architects will fail without a solid knowledge of building laws, that spatial planners will flounder without a fundamental understanding of property and urban planning ordinances, and that computer scientists must observe the legal framework of data and information laws, it often remains unknown that, in technical universities in general and at the TU Wien in particular, there are no courses of study that exist without legal subjects incorporated in their curricula. The continued development of law on an international, European, and domestic level (the last further complicated through a division of jurisdictions between federal, regional, and municipal governments that is no longer up-to-date in many areas) as a result of new technological advances (for example, the internet) and requirements (for example, climate protection measures) brings new challenges to the teaching, research, and organisation of the Center of Legal Sciences. Teaching
Lehre Die vom Fachbereich Rechtswissenschaften anzubietende Lehre wird auch künftig nicht primär das Ziel ver-
In the future, the goal of teaching at the Center of Legal Sciences will continue to not primarily be the training of legal experts. First and foremost, special legal lectures
Rechtswissenschaften an einer technischen Universität? | 107
folgen, Rechtsexperten auszubilden. Auch im Bereich der rechtlichen Spezialvorlesungen (z. B. Baurecht, Daten- und Informatikrecht, Patentrecht, Planungsrecht, Umweltschutzrecht, Urheberrecht usw.) wird es in erster Linie darum gehen, die Studierenden für Rechtsfragen, deren Dynamik und Interdisziplinarität zu sensibilisieren. Natürlich sind auch „Stoff“ und Basiswissen zu vermitteln, um sich im jeweiligen Fachgebiet orientieren und bei Bedarf an die Rechtsexperten die richtigen und fallweise konstruktiv kritischen Fragen stellen zu können. Diese Anforderungen an die rechtswissenschaftliche Lehre an der TU Wien können sehr gut mit Beispielen belegt werden, die sowohl die Fakultät für Architektur und Raumplanung als auch andere an der TU Wien eingerichtete Fakultäten betreffen: Zunächst sehen sich die Raumplaner mit dem historisch-politischen Phänomen konfrontiert, dass es im räumlich und von der Bewohnerzahl her durchaus überschaubaren Österreich neun verschiedene Raumplanungs- bzw. Raumordnungsgesetze gibt. In diesen Gesetzen gibt es wiederum auf den ersten Blick gleichlautende rechtliche Begriffe (z. B. bei den Widmungskategorien), die aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Begriffsinhalte aufweisen. Das bedeutet etwa für die Lehre, dass es weder zweckmäßig ist, den Studierenden die Details aller Raumplanungs- und Raumordnungsgesetze zu vermitteln, noch sinnvoll ist, sich ausschließlich dem Raumplanungs- oder Raumordnungsgesetz eines bestimmten Bundeslandes zu widmen. Die Lehre wird sich daher in erster Linie an den gemeinsamen Regelungsproblemen und den dazu in den verschiedenen Rechtsordnungen realisierten Lösungsansätzen zu orientieren haben: Dabei wird sie auch die immanente Interdisziplinarität des Raumplanungsstudiums in der Weise zu vermitteln haben, indem die Auswirkungen der Planungen auf andere Rechtsgebiete und die Auswirkungen anderer Rechtsgebiete auf die Raumplanung sichtbar gemacht werden (z. B. die Auswirkungen der Steuergesetzgebung in Bezug auf die Besteuerung von Grund und Boden bzw. der Liegenschaftstransaktionen).
108 | Franz Zehetner
(for example, on building law, data and IT law, patent law, planning law, environmental protection law, copyright law, etc.) will seek mainly to sensitise students to the dynamics and interdisciplinarity of legal questions. Naturally, “content” and a basic knowledge must also be taught in order for students to be able to navigate within their respective areas of study and to be able to pose correct, constructive, critical, case-specific questions as necessary. These requirements for the teaching of Legal Sciences at the TU Wien can be described very well by using examples from the Faculty for Architecture and Spatial Planning as well as from other faculties at the TU. First, the spatial planner is confronted with the historical and political development that there are nine different sets of spatial planning and zoning laws in the nine different states of Austria, a country well regulated with regards to space and population. At first glance, it appears that many of the legal concepts in these laws (e.g., zoning categories) are identical, however, the terminology has very different connotations from state to state. This means, for example, that when teaching it is neither useful to teach students the details of all spatial planning and zoning laws, nor sensible to apply oneself to memorising the spatial planning and zoning laws of a specific state. Teaching must therefore be primarily oriented towards general regulatory problems and the solutions proposed by the approaches realised in various legal systems. It must also convey the intrinsic interdisciplinarity of spatial planning studies in such a way that the effects of planning on other areas of law and the effects of other areas of law on spatial planning are made apparent (for example, the effects of tax legislation in connection with the taxation of property and property transactions). These types of considerations are almost even more crucial for architectural training: in addition to the nine different spatial planning and zoning laws, there are nine different building law regulations with differences in technical details that cannot always be foreseen and that describe the scope of planning each in their own way. For example, if they didn’t know better, architects looking at fire safety regulations from state to state might get
Die vorstehenden Überlegungen gelten fast noch ausgeprägter für die Architekturausbildung: Zu den neun unterschiedlichen Raumplanungs- und Raumordnungsgesetzen kommen noch neun verschiedene Baurechtsordnungen mit teilweise nicht nachvollziehbaren Unterschiedlichkeiten in technischen Fragen, die den Planungsspielraum der Architektinnen und Architekten in unterschiedlicher Weise beschreiben. Wenn man es nicht besser wüsste, so könnten die Architekturschaffenden als Anwender der z. B. dort enthaltenen feuerpolizeilichen Vorschriften tatsächlich den Eindruck gewinnen, dass Feuer von Bundesland zu Bundesland anders brennt. Harmonisierungstendenzen gehen von der Europäischen Union aus: Die innerstaatliche Umsetzung von europäischen Richtlinien (z. B. bezüglich Bauprodukte, Energieeffizienz usw.) betrifft neben den Architektinnen und Architekten auch die Bauingenieurinnen und Bauingenieure und erfordert bei den Studierenden ein fachspezifisch geprägtes Verständnis für den Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts vor allen Ebenen des innerstaatlichen Rechts. Im Bereich der Informatik kann der enorme technische Fortschritt als Treiber für die rasante Entwicklung des Daten- und Informatikrechts sowie der damit in Verbindung stehenden Rechtsgebiete (privates Wirtschaftsrecht, Strafrecht, Menschenrechte) genannt werden, der in der Lehre – z. T. mit neuen didaktischen Methoden (z. B. E-Learning) – entsprechend abzubilden ist. Forschung Die technikorientierte rechtswissenschaftliche Forschung bezieht ihre Aufgabenstellungen aus allen an der TU Wien vertretenen Disziplinen mit einem Schwerpunkt in den Bereichen Raumordnung und Raumplanung sowie Informatik. Einerseits sind thematisch sehr eng begrenzte rechtliche Spezialfragen de lege lata und de lege ferenda abzuklären, andererseits sind auch umfassende Projekte hinsichtlich aller denkbaren rechtlichen Fragestellungen und rechtlichen Auswirkungen zu beleuchten. Als Beispiel darf die Forschung im Bereich von Public-Pri-
the impression that fire burns differently in each place! However, tendencies towards a certain harmonisation are arriving through the European Union. The domestic implementation of European regulations (for example, in connection with construction products, energy efficiency, etc.) concerns building engineers as well as architects and demands of students a highly specific understanding for the primacy of application of common regulations on all levels of domestic law. In the area of Computer Science, enormous technological progress, shown in part through new didactic methods in teaching (such as e-Learning), is a driver for the fast development of data and IT laws as well as the legal domains connected to these (private economic law, criminal law, and human rights). Research Technologically oriented research in Legal Sciences draws its tasks from all the disciplines represented by the TU Wien, with a special focus on the fields of Spatial Planning and Zoning as well as on Information Technology. On the one hand, special legal questions de lege lata and de lege ferenda that are thematically very close must be clarified, while on the other hand, comprehensive projects must illuminate all possible legal issues and repercussions. Research in the area of public-private-partnership projects, which poses complex and complicated legal questions (for example, planning law, eminent domain, procurement law, contract law, and liability law) about technical, business, and economic claims (for example, the effects of the Maastricht criteria) in the area of technical infrastructure (for example, highways and tolling) and welfare services (for example, the building and operation of hospitals), may be named as an example. Opportunities for cooperative in-house research ventures are seized to the fullest, yet should be further expanded, because only in this way can opportunities be created from the technical, economic, and legal expertise available at the TU Wien.
Rechtswissenschaften an einer technischen Universität? | 109
vate-Partnership-Vorhaben genannt werden, die im Bereich der technischen Infrastruktur (z. B. Autobahnen einschließlich Bemautung) und Daseinsvorsorge (z. B. Bau und Betrieb von Krankenanstalten) komplexe und komplizierte rechtliche Fragestellungen (z. B. Planungsrecht, Enteignungsrecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Haftungsrecht) unter Berücksichtigung technischer, betriebswirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Ansprüche (z. B. Auswirkungen auf die Maastricht-Kriterien) aufweisen. Die Möglichkeiten der hausinternen Forschungskooperationen werden zwar in Anspruch genommen, sollten aber weiter ausgebaut werden, weil erst dadurch die Chancen aus der Tatsache genutzt werden können, dass alle technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Kompetenzen an der TU Wien vorhanden sind. Organisation Der Fachbereich Rechtswissenschaften ist derzeit organisatorisch als Fachbereich im Department Raumplanung, d. h. an der Fakultät für Architektur und Raumplanung, eingerichtet. Das entspricht grundsätzlich den Überlegungen anlässlich der Implementierung des UOG 1993.3 Es erscheint allerdings legitim, beim Eintritt ins dritte Jahrhundert der TU Wien kritisch zu fragen, ob die interne Organisation der TU Wien mit ihren acht Fakultäten und der gemischten Zuordnung der sogenannten integrativwissenschaftlichen Lehr- und Forschungseinheiten noch zeitgemäß ist. Mission Der Fachbereich Rechtswissenschaften soll sich künftig darauf fokussieren, •• technikrelevante Rechtsentwicklungen auf internationaler, europäischer und innerstaatlicher Ebene laufend zu beobachten, zu bewerten und allenfalls auch rechtspolitisch zu beeinflussen •• rechtliche Strukturen und Zusammenhänge mit Blick auf alle an der TU Wien vertretenen technischen Diszi plinen zu erforschen
110 | Franz Zehetner
Organisation The Center of Legal Sciences is currently a subunit of the Department of Spatial Planning of the Faculty for Architecture and Spatial Planning. This is fundamentally compliant with the implementation of the UOG 1993. However, as the TU Wien enters its third century of existence, it seems legitimate to ask critically if, with its eight faculties and mixed allocation of the so-called “integrative scientific teaching and research units”, the internal organisation of the TU Wien is still up-to-date. Mission In the future, the Center of Legal Sciences aims to focus on: •• The ongoing observation, evaluation, and legally influencing of technically relevant legal developments on the international, European, and domestic levels; •• fostering legal structures and ties with a view towards all technical disciplines represented by the TU Vienna; •• pointing out concrete legal problems and developing innovative legal solutions and legal recommendations; •• offering motivating and practical legal training for technological studies with didactic methods that are new in part, with the goal of prompting the legal system to see these not as a threat, but rather as an overall opportunity; •• collaborating with numerous research facilities (within and outside of the TU) and government establishments (particularly in the area of technical infrastructure), with the economy, and with relevant interest groups; •• striving to optimise the legal framework for technology and the economy in spite of significant societal headwinds (“hostility to technology”); and – last but not least •• serving the peaceful cohabitation of the bodies of the TU Wien and its teachers, researchers, students, and administrators with legal counsel.
•• konkrete Rechtsprobleme aufzuzeigen und innovative, gesetzeskonforme Lösungen auszuarbeiten bzw. rechtspolitische Vorschläge zu entwickeln •• mit teilweise neuen didaktischen Methoden eine motivierende und praxisnahe rechtliche Ausbildung für Technikstudierende mit dem Ziel anzubieten, dass diese die Rechtsordnung in ihrer Gesamtheit nicht als Bedrohung, sondern als Chance begreifen •• mit zahlreichen Forschungseinrichtungen (TU-intern und extern), staatlichen Einrichtungen (speziell im Bereich der technischen Infrastruktur), der Wirtschaft sowie einschlägigen Interessenvertretungen zu kooperieren •• sich – trotz erheblichen gesellschaftlichen Gegenwinds („Technikfeindlichkeit“) – um eine laufende Optimierung der rechtlichen Rahmenbedingungen für Technik und Wirtschaft zu bemühen; sowie – last, but not least – •• mit rechtlicher Beratung dem friedlichen Zusammenleben der Organe der Technischen Universität Wien und der hier tätigen Lehrenden, Forschenden, Studierenden und in der Administration tätigen Personen zu dienen.
Anmerkungen/Notes 1 Josef Kühne, Historische Wurzeln des Instituts für Rechtswissenschaften, in: Manfred Straube/Franz Zehetner (Hg.), 25 Jahre Institut für Rechtswissenschaften an der Technischen Universität Wien, Wien 1998, 9ff. 2 Martin Lendi, Rechtsunterricht an Technischen Universitäten, neue Anforderungen an den Unterricht, in: Straube/Zehetner, 25 Jahre, 30ff. 3 Franz Zehetner, Das Institut für Rechtswissenschaften an der Fakultät für Raumplanung und Architektur, in: Straube/Zehetner, 25 Jahre, 17ff.
Rechtswissenschaften an einer technischen Universität? | 111
Rudolf Giffinger
TERRITORIALES KAPITAL ALS GRUNDLAGE UND MOTOR RÄUMLICHER ENTWICKLUNG TERRITORIAL CAPITAL AS THE FOUNDATION AND MOTOR OF SPATIAL DEVELOPMENT Räumliche Entwicklung ist zwar ein in der Raumplanung sehr oft verwendeter, aber zugleich ein inhaltloser Begriff. Je nach Erkenntnisinteresse fokussieren präzisere Beschreibungen auf ökonomische, soziodemographische, umweltbezogene oder siedlungs- und baustrukturelle Trends und Transformationen (wie z. B. Wachstum, Schrumpfung, Gentrifikation, Erosion, etc.) im Raum bzw. in bestimmten Gebieten. Raumplanung – mit dem Anspruch zur Beeinflussung/Steuerung räumlicher Entwicklungen – wird dabei traditionellerweise als koordinierende und Konflikt minimierende Aufgabe gesehen. Sie versucht, angesichts der sich verschärfenden Anforderungen durch Klimawandel, sozialräumliche Polarisierung und zahlreicher anderer problematischer Trends ihre Aufgaben heute zwar auf verschiedenen Maßstabsebenen mithilfe sogenannter harter und weicher Instrumente in einem Prozessverständnis zu lösen. Allerdings leidet die Raumplanung meines Erachtens nach wie vor an einem unzureichenden integrativen Verständnis zu Fragen der „Raum-Entwicklung“.
Spatial development is an often used, but also rather meaningless term in urban and regional planning. More precise descriptions would focus on economic, socio-demographic, and environmental aspects, or elaborate specific trends and transformations such as growth and shrinkage, or gentrification and segregation, etc. in distinct areas of wider territories and depend on specific interests. The task of urban and regional planning is to steer spatial development and to coordinate and minimise conflicts. Due to problems of sustainable development in terms of economic crises, lack of socio-spatial cohesion or increasing emissions, urban and regional planning attempts to solve its tasks on different scales using so-called hard and soft instruments. However, in my opinion, urban and regional planning continues to suffer from an insufficiently integrated understanding of the problems of “space development”.
Raumplanung als zentraler Teil regionaler Assets
In any case, the following thoughts lay no claim to being a new “theory of spatial planning”, but are at most an attempt to sketch a terminological framework for understanding the development of space. At the same time, I want to show that when aspiring to plan, we need to consider an often contradictory understanding of space. We do not necessarily have to overcome this, but we at
Meine folgenden Überlegungen erheben jedenfalls nicht den Anspruch auf eine neue „Theorie der Raumplanung“, sondern versuchen bestenfalls, einen terminologischen Rahmen zum Verständnis von Raumentwicklung zu geben. Gleichzeitig soll gezeigt werden, dass in dem
Urban and Regional Planning as a Key Aspect of Regional Assets
Territoriales Kapital als Grundlage und Motor räumlicher Entwicklung | 113
Anspruch der Planung ein oft widersprüchliches Raumverständnis zu berücksichtigen ist, welches nicht überwunden, aber zumindest bewusst gemacht werden soll. Der Begriff „Territorium“ spielt dabei – wie zu zeigen ist – eine zentrale Rolle. Vor etwa 15 Jahren wurde der Begriff „territoriales Kapital“ angesichts der sehr unterschiedlichen Bedingungen zur Stadt- und Regionalentwicklung und zu Integrationsfragen der ehemaligen osteuropäischen Länder von der OECD eingeführt. Darunter wird jene Kombination von territorialen Eigenheiten/Komponenten verstanden, die letztendlich dafür verantwortlich sind, dass Investitionen zur Aktivierung von bestimmten Potentialen sehr unterschiedliche Effekte zeigen. Aus analytischer Sicht bedeutet dies, dass offenbar die ‚angebotsseitigen Bedingungen‘ zentralen Einfluss nehmen.1 In der Diskussion um die zentralen Faktoren, die zur Entwicklung beitragen, wird zunehmend zwischen tangiblen und intangiblen Assets unterschieden, die relative bzw. absolute gebietsspezifische Vorteile vermitteln. Zu den tangiblen Assets (im Sinne von Vermögen) zählen insbesondere solche Komponenten der räumlichen Entwicklung, die sich teilen lassen, relativ schnell herstellbar oder mobil sind und somit rasch in andere Gebiete transportiert werden können. Intangible Assets sind hingegen solche unteilbaren Vermögenseigenschaften in einem Gebiet, die gezielt ausgebaut oder auch zerstört, aber nicht geteilt werden können. Sie sind auch nicht schnell in andere Gebiete transferierbar. Entscheidend für die gebietliche Entwicklung ist dabei die richtige Kombination von funktionalen und relationalen Vermögenseigenschaften. Darunter sind einerseits naturräumliche Eigenschaften sowie materielle und immaterielle infrastrukturelle, kulturelle, technische oder soziale Errungenschaften sowie andererseits relationale Eigenschaften, wie gemeinsame Bräuche, informelle Regeln und (Alltags-)Praktiken sowie gegenseitiges Vertrauen und ein gemeinsames Verständnis von Entwicklungsvorstellungen zu verstehen. Patsy Healey hatte schon Ende des 20. Jahrhunderts auf die enorme Bedeutung des Zusammenspiels von kognitivem, sozialem, kulturellem
114 | Rudolf Giffinger
least need to be aware of it. As I shall demonstrate, the term territory plays a key role in this process. Given the very different conditions of urban and regional development and difficulties integrating former Eastern European countries, the OECD introduced the term territorial capital about 15 years ago. It designates territorial features that in combination explain why investments in local potentials have vastly different effects. From an analytical point of view, this means that “supply-side factors” are of particular importance.1 When discussing the key factors contributing to development, one increasingly distinguishes between tangible and intangible assets, which provide relative or absolute, area based advantages. Tangible assets are specific components of spatial development that can be shared, produced at a relatively rapid rate, or are mobile and can therefore be quickly transported to other regions. Intangible assets, on the other hand, are the indivisible resource characteristics of a region that can be strengthened or destroyed in a targeted manner, but neither shared nor quickly transferred to another region. What is decisive for a region’s development, therefore, is the proper combination of functional and relational characteristics. These are physio-geographical characteristics like material and immaterial infrastructural, cultural, technological, or social achievements (e.g., shared customs, informal rules and everyday practices) as well as mutual trust and a shared understanding of development visions. At the end of the 20th century, Patsy Healy was already emphasising the enormous importance of the interplay between cognitive, social, cultural, and institutional capital.2 Urban and regional planning that not only strives to fulfil the traditional tasks of infrastructure development and zoning, but also to build cooperative approaches that activate potential, produces such intangible assets and is thus also a part of them. These components of territorial capital as a precondition and motor of spatial development are mostly considered in terms of the competitiveness of cities and regions. In the majority of cases, the main question is which country can prove itself as most attractive in global
und institutionellem Kapital hingewiesen.2 Raumplanung, die sich nicht nur den traditionellen Aufgaben des Infrastrukturausbaus und der Flächenwidmung, sondern auch dem Aufbau kooperativer Ansätze zur Aktivierung von Potentialen bemüht, erzeugt somit solche Assets und ist gleichzeitig selbst Teil davon. Diese Komponenten des territorialen Kapitals als Voraussetzung und Motor der räumlichen Entwicklung werden insbesondere unter dem Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit von Städten und Regionen geführt. Dabei steht zumeist die Frage im Vordergrund, welcher Staat sich als attraktiver im globalen Wettbewerb erweist. Dies soll hier keinesfalls gemeint sein, da diese Diskussion ausschließlich einer neo-liberalen Wirtschaftsgesinnung Vorschub leisten würde und den Staat, und damit jede Art kollektiver Initiativen, gegenüber den Marktdynamiken als unnötig, weil behindernd, sehen würde. Demgegenüber ist die Wettbewerbsfähigkeit von Städten/Regionen insofern bei zunehmender Globalisierung von Bedeutung, weil sie ja auch als jene Voraussetzung verstanden werden kann (und unter integrativ-planerischer Sichtweise verstanden werden soll), die eine nachhaltige Entfaltung und Entwicklung, ausgehend von den bestehenden Strukturen, gewährleistet und damit massive wirtschaftliche und soziale Verdrängungs- und Polarisierungsprozesse unterbindet/verhindert. Der Begriff Territorium ist dabei gleichzeitig von Vorund von Nachteil: Er verweist darauf, dass ein Gebiet aus mehreren Städten und Regionen besteht und daher nicht nur die Entwicklung einer Stadt oder Region isoliert betrachtet werden soll. Dadurch entsteht ein wesentlich erweitertes Muster zur Erklärung von Stadtsystemen oder Regionen, da ein Wechsel der Maßstabsebene explizit verlangt wird und relationale Assets (im Sinne von wechselseitigem Vertrauen, Fähigkeit und Bereitschaft zur Kooperation) sowohl innerhalb des Territoriums (zwischen Städten und Regionen) wie auch nach außen hin (in übergeordnete hierarchisierte Bezugsräume) berücksichtigt werden können. Die Mehr-Ebenen-Analyse oder der analytische Rahmen von Mikro-, Meso- und Makroraum im Sinne von
competition. This is by no means what I wish to express here, as this discussion would only promote a neoliberal attitude to economy, which considers the state, and thus any kind of collective initiative, as unnecessary – if not even a handicap. In contrast, the competitiveness of cities and regions is important in the context of increasing globalisation. It can also be understood (and, from an integrated planning perspective, should be understood) as a precondition for a sustainable expansion and development that is based on existing structures, and which therefore prevents and/or deters the massive economic and social processes of displacement and polarisation. Besides, the term territory is both an advantage and a disadvantage: it indicates that an area consists of more than one city and region, and that we therefore need to avoid the isolated examination of a single city or region. This leads to the creation of a fundamentally expanded explanatory model for urban systems or regions, as it explicitly demands a change in scale: It allows us to take relational assets into account (in the sense of mutual trust, ability, and willingness to cooperate) within the territory (between cities and regions) as well as beyond it (into superior hierarchical reference spaces). An analysis on several levels, or the analytical framework of micro-, meso-, and macro-space according to Läpple,3 therefore allows for much more powerful methodologies of empirical spatial research than other approaches that are narrow and focus spatially on a single city or region. At the same time, territorial capital refers to the development of assets, i.e. not only the identification of potentials but its activation and transformation into an asset as a driving force of future development. Activation, however, presupposes perception and evaluation, the conscious decision for a coordinated initiative, and the targeted use of potentials. Here, the efforts creating intangible assets are brought into focus because of their great and often neglected importance. And strategies that follow the precepts of cooperative planning action, intangible assets themselves, therefore become centrally important for sustainable spatial development.
Territoriales Kapital als Grundlage und Motor räumlicher Entwicklung | 115
Läpple3 erlauben daher wesentlich mächtigere Methodologien der empirischen Raumforschung als dies in oft fachlich eingeengten und räumlich auf Stadt oder Region fokussierten Ansätzen der Fall ist. Gleichzeitig verweist die Klassifikation des territorialen Kapitals auf die Entwicklung von Assets, also die Transformation von Potentialen in entsprechendes Vermögen, welches Voraussetzung und Motor der zukünftigen Entwicklung sein muss. Die Aktivierung setzt aber die Wahrnehmung und Bewertung, die bewusste Entscheidung zur koordinierten Initiative und zielorientierten Nutzung des Potentials voraus. Dabei rücken Fragen der intangiblen Assets wegen ihrer hohen und oft vernachlässigten Bedeutung ins Blickfeld. Und Strategien im Sinne planerisch-kooperativen Handelns, welche intangible Assets darstellen, bekommen daher zentrale Bedeutung für die nachhaltige räumliche Entwicklung. Raumplanung braucht ein integratives und Potential aktivierendes Verständnis Ohne hier weitere Details und Implikationen des integrativen Verständnisses von räumlicher Entwicklung über die Komponenten des territorialen Kapitals auszuführen, stellen sich für mich folgende Anforderungen zu einem veränderten, modernen Verständnis von Raumplanung: •• In strategischen Ansätzen sind die Materialität des Raumes und ihre sozialen Wertigkeiten (u. a. in den Strategien explizit gemacht) nicht trennbar: Raumplanung muss daher immer den Diskurs zu Entwicklungsvorstellungen auf Basis umfassender Evidenz zu naturräumlichen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in einem Gebiet führen. Rein perzeptiv-diskursive Ansätze zur Konstruktion von Raum und seinen Wertigkeiten sind dann zum Scheitern verurteilt, wenn die materiellen Eigenheiten im Raum nicht in einer Mehr-Ebenen-Perspektive berücksichtigt werden. •• Angesichts der Nutzungsvielfalt, der unterschiedlichen Interessen und der unterschiedlichen Mittel und Bedingungen zur Interessendurchsetzung ist Raum in physisch-funktionaler wie auch relationaler und sozialer
116 | Rudolf Giffinger
Urban and Regional Planning Needs an Integrated Understanding aiming at the Activation of Potentials Without wanting to go into more detail on the implications of an integrated understanding of spatial development and the components of territorial capital, I would like to identify the following challenges for a transformed, modern understanding of urban and regional planning: •• In strategic approaches, the materiality of space and its social values (made explicit in strategies, for instance) cannot be separated: urban and regional planning therefore always needs to participate in the discussion on development concepts based on comprehensive evidence of the physio-geographical, economic and social situation in an area. Perceptive-discursive approaches to constructing space and its values are doomed to fail if this entity of the material characteristics and its socio-cultural meaning within that space are not taken into account in a multi-level perspective. •• In view of a diversity of uses, assorted interests, and varied means and conditions of asserting interests, space needs to be understood from a physical and functional perspective as well as from a relational and social one. These three approaches provide greatly different opportunities for evidencing spatial developments, and therefore also for planning interventions in a collective sense, and for the promotion of sustainable development. As a consequence of these two conclusions, we need to increase our efforts to develop a theory of urban and regional planning that is not beholden only to a single paradigm (objectivism vs. constructivism), and for a curriculum educating spatial planners who are experts of “space-development”.
Sicht zu verstehen. Die drei Zugänge bieten in territorialer Hinsicht völlig unterschiedliche Möglichkeiten zur Evidenz in räumlichen Entwicklungen und daher auch zur planerischen Intervention im gemeinschaftlichen Sinn und zur Forcierung nachhaltiger Entwicklung. Konsequenz aus diesen beiden Schlussfolgerungen bzw. Forderungen muss das verstärkte Bemühen erstens um eine Theorie der Raumplanung sein, die sich nicht ausschließlich einem Paradigma (Objektivismus versus Konstruktivismus) verhaftet, und zweitens um ein Curriculum, das Raumplanerinnen und Raumplaner zu Expertinnen und Experten der Raumentwicklung ausbildet.
Anmerkungen/Notes 1 S. Camagni, R. Capello, Territorial capital and regional development, in: Handbook of Regional Growth and Development Theories, edited by R. Capello and P. Nijkamp. Northampton, Mass. 2009, 118-132. 2 Healey, P., Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies. London 1997. 3 Läpple, D., Essay über den Raum. In: Stadt und Raum. Soziologische Analysen, hrsg. v. H. Häußermann/D. Ipsen/T. Kramer-Badani, Pfaffenweiler 1991, 157–207.
Territoriales Kapital als Grundlage und Motor räumlicher Entwicklung | 117
Johann Bröthaler, Michael Getzner
ÖKONOMISCHE PERSPEKTIVEN DER RAUMPLANUNG ECONOMIC PERSPECTIVES OF SPATIAL PLANNING Bestimmend für die (Raum-)Planung ist, dass diese entweder unmittelbar im öffentlichen Sektor stattfindet, von Institutionen des öffentlichen Sektors beauftragt wird oder im engen Zusammenhang mit öffentlichen Rahmenbedingungen (Organisationen, Rechts- und Finanzrahmen) stattfindet. Der Fachbereich Finanzwissenschaft und Infrastrukturpolitik (IFIP) verfolgt hierbei die Ziele, thematische und methodische Kenntnisse über Bestimmungsgrößen der Entscheidungen im öffentlichen Sektor und deren räumliche Wirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt zu vermitteln (Lehrziel) und diese Kenntnisse durch theoretische, methodische und empirische Forschung zu vertiefen (Forschungsziel).
A decisive characteristic of (spatial) planning is that it either happens directly in the public sector, or is commissioned by institutions of the public sector and/or in close interaction with public frameworks (organisations, legal and financial frameworks). The Centre of Public Finance and Infrastructure Policy (IFIP) aims to teach thematic and methodological knowledge on the decision-making parameters of the public sector and their spatial effects on the economy, society, and the environment (teaching goal), and to expand this knowledge through theoretical, methodological, and empirical research (research goal).
Gesellschaftliche Wohlfahrt
We focus on theories about the provision of public goods and regulatory state intervention in the economy and society. They are based on the analysis of positive and negative external effects and, finally, of macroeconomic costs and benefits of private and public activities. Our main goal is to increase social welfare while protecting the environment. This is a teleological perspective, aimed at optimising the use of state instruments, in particular planning, for the best possible (or second best when compromise is called for) achievement of certain objectives for the common good of society. From the perspective of public decisions, political and bureaucratic decision makers pursue their own ends, in particular, for the maximisation of votes, budgets, and political administrative power.
Theorien der Bereitstellung öffentlicher Güter und regelnder Eingriffe des Staates in Wirtschaft und Gesellschaft stehen im Mittelpunkt. Dies wird fundiert durch die Analyse positiver und negativer externer Effekte und letztlich gesamtwirtschaftlicher Kosten und Nutzen privater und öffentlicher Aktivitäten. Die Erhöhung der gesellschaftlichen Wohlfahrt bei gleichzeitiger Schonung der Umwelt ist hierbei das wichtigste Ziel. Dies ist eine teleologische Sichtweise, die auf Optimierung des Einsatzes staatlicher Instrumente, insbesondere der Planung zur bestmöglichen (oder, kompromissbedingt, zweitbesten) Erreichung bestimmter Ziele zugunsten der Bevölkerung gerichtet ist. In einer anderen Sichtweise auf staatliche Entscheidungen zielen politische oder bürokratische Entscheidungsträgerinnen und -träger darauf ab, ihre eigenen Ziele zu verfolgen,
Social Welfare
Ökonomische Perspektiven der Raumplanung | 119
insbesondere die Maximierung von Wählerstimmen, Budgets oder politisch-administrativer Macht. Funktionsanalyse öffentlicher Aufgabenerfüllung Im IFIP werden auf Basis beider Sichtweisen die verschiedenen Arten des Markt- und Staatsversagens und die sich daraus ergebenden Erfordernisse, Chancen und Risiken des Einsatzes staatlicher Instrumente und vor allem deren voraussichtliche Wirkungen analysiert und prognostiziert. Daraus folgt die wissenschaftliche Beschäftigung mit •• der Festlegung öffentlicher Aufgaben unter Beachtung der verschiedenen Arten staatlicher Verantwortung (z. B. Leistungs-, Gewährleistungs- und Regulierungsverantwortung) und des föderalen Aufbaus des Gemeinwesens •• den Instrumenten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (z. B. Rechtsnormen, öffentliche Dienstleistungen, Staatseinnahmen und -ausgaben) und deren (räumlichen) Wirkungen •• den Möglichkeiten und vor allem Grenzen der Privatisierung bislang öffentlicher Aktivitäten sowie von Regulierungsreformen •• der gruppenspezifischen Verteilung des Nutzens und der Finanzierungslasten öffentlicher Güter •• den Methoden der Erarbeitung, Bewertung und Auswahl von alternativen Projekten und den daraus resultierenden Gütern und Dienstleistungen (z. B. Kosten-Nutzen-Analyse und Nutzwertanalyse) sowie •• den Wirkungen des Einsatzes staatlicher Instrumente hinsichtlich ökonomischer Effizienz, ökologischer Verträglichkeit sowie sozialer Gerechtigkeit und Fairness (Nachhaltigkeit). Die angeführten Punkte bilden die Elemente der vom IFIP schrittweise weiterentwickelten „Funktionsanalyse öffentlicher Aufgabenerfüllung“. Die Beschäftigung mit diesen Themen wird gerechtfertigt durch die große Menge an Ressourcen, die vom öffentlichen Sektor (der Planung) in Anspruch genommen wird, und durch die hohe Relevanz der Bereitstellung öffentlicher Güter für Niveau und Verteilung der Wohlfahrt einer Gesellschaft.
120 | Johann Bröthaler, Michael Getzner
Functional Analysis of Public Task Fulfilment At IFIP, we analyse and predict different kinds of market and governmental failures and the resulting requirements, opportunities, and risks of applying public instruments, and above all the expected effects of this. Therefore, our research focus is as follows: •• The analysis of public tasks taking into account the different types of governmental responsibilities (e.g. performance, guarantee, and regulation responsibilities); •• Defining instruments to fulfil public tasks (e.g. legal norms, public services, and government revenues and expenditures); •• Exploring opportunities for and in particular limitations of privatisation of hitherto public activities and regulatory reforms; •• Group-specific distribution of benefits and financial burdens of public goods; •• Methods of developing, evaluating, and selecting alternative projects and the resulting goods and services (e.g. cost-benefit analysis and multidimensional decision aid frameworks); and •• Effects of the use of state instruments to attain economic efficiency, environmental compatibility, and social justice (sustainability). These points are the elements of the Functional Analysis of Public Task Fulfilment developed and gradually refined by the IFIP. Our interest in these issues is justified by the large amount of resources absorbed by the public sector, and by the high impact of providing public goods on the fair distribution of welfare in a society. Core Research Areas The centre’s main research and teaching topics are basically derived from an economic perspective: •• Public finance: public budgets, fiscal federalism, revenue sharing systems, theories of market and state failure, incentive mechanisms;
Forschungsschwerpunkte Die Schwerpunkte der Forschung und Lehre am Fachbereich leiten sich grundsätzlich von einer ökonomischen Perspektive ab: •• Finanzwissenschaft: öffentliche Haushalte, Föderalismus, Finanzausgleich, Theorie des Markt- und Staatsversagens, Förderungsinstrumente •• Infrastrukturökonomie und -politik: Marktanalyse und -regulierung in den Bereichen Verkehr, Wasser, Abwasser, Abfall, Energie, Telekommunikation, Sozial- und Gesundheitsdienste •• Ökologische Ökonomik, Ressourcen- und Umweltökonomie: ökonomische Beurteilung der Nutzung natürlicher Ressourcen und der ökologischen Dimensionen wirtschaftlicher Prozesse •• Stadt- und Regionalökonomie: regionale und kommunale Wirtschaftsanalyse und -politik, räumliche Verteilung wirtschaftlicher Aktivitäten •• Boden- und Immobilienökonomie: ökonomische Analyse immobilienwirtschaftlicher Aktivitäten mit stadt-, regional- oder volkswirtschaftlichen Dimensionen •• Entwicklung von Modellen, Methoden, Software und Informationssystemen im Bereich öffentlicher Finanzen und einzelner Infrastrukturbereiche im Kontext von E-Government. Raum(planungs)bezogene Finanzwissenschaft und Infrastrukturökonomie Eine wesentliche Voraussetzung der Weiterentwicklung der Forschung ist die Zusammenarbeit des Fachbereichs mit den anderen Fachbereichen der Fakultät für Architektur und Raumplanung, sowohl die wissenschaftlichen Schwerpunkte betreffend als auch hinsichtlich des Studienplans und der Praxis der Raumplanung. Die bestehenden Forschungsschwerpunkte des Fachbereichs Finanzwissenschaft und Infrastrukturpolitik sollen insbesondere mit Kernbereichen der Ökologischen Ökonomik verknüpft und der Raum- und Siedlungsbezug soll noch weiter verstärkt werden. Somit besteht die zukünftige
•• Infrastructure policy and economics: market analysis and regulation in the fields of transport, water provision, sewage, waste disposal, energy, telecommunication, and social and health services; •• Ecological economics, resource and environmental economics: economic (e)valuation of the use of natural resources and the ecological dimensions of economic processes; •• Urban and regional economics: regional and local economic analysis and politicies, regional distribution of economic activity; •• Land and real estate economics: economic analysis of real estate projects in the urban, regional, and national economies; •• Development of models, methods, software, and information systems in the field of public finance and individual fields of infrastructure in the context of e-government. Spatial [Planning] Economics and Infrastructure Economics An essential precondition for the further development of research is our centre’s cooperation with the other departments of the Faculty of Architecture and Planning, in terms of our main research as well as our curriculum and the practice of spatial planning. We aim to link the existing research of the Centre of Public Finance and Infrastructure Policy to core fields of ecological economics and to continue to strengthen its spatial and residential references. Our future perspective is therefore to develop an even stronger emphasis on interdisciplinary space, planning and sustainability-related economics, and infrastructure planning and policy. This focus influences content as well as methodology: Regarding content, our strategy aims to expand and concentrate our present research fields. This leads to the need to further integrate the spatial and residential aspects of (public finance) scientific research. This is based on an understanding of sustainability that considers economic development and therefore also the activities
Ökonomische Perspektiven der Raumplanung | 121
Perspektive zur Weiterentwicklung in einer noch stärkeren Betonung einer interdisziplinär ausgerichteten, raum-, planungs- und nachhaltigkeitsbezogenen Finanzwissenschaft und Infrastrukturökonomie. Diese Ausrichtung ist sowohl inhaltlich als auch methodisch zu verstehen: Inhaltlich bedeutet diese Strategie eine Erweiterung bzw. Konzentration der bisherigen Teilbereiche der Forschungsschwerpunkte. Daraus ergibt sich ein Anspruch, die räumlichen und siedlungsstrukturellen Aspekte in der (finanz-)wissenschaftlichen Forschung weiter zu integrieren. Zugrunde liegt ein Verständnis von Nachhaltigkeit, das einerseits die wirtschaftliche Entwicklung und damit auch die Tätigkeit des öffentlichen Sektors als grundsätzlich beschränkt durch die vorhandenen Ressourcen (Boden/Land/Flächen, natürliche Ressourcen, Produktionsfaktoren) auffasst. Andererseits ergibt sich aus diesem Verständnis auch eine Mehrdimensionalität staatlichen Handelns, welches abgesehen von der Effizienz und Effektivität der staatlichen Aufgabenerfüllung auch Aspekte der sozialen Gerechtigkeit, der ökologischen Tragfähigkeit, der Partizipation und Mitgestaltung in finanzpolitischen und infrastrukturellen Entscheidungen insbesondere auf lokaler und regionaler Ebene berücksichtigt. Methodenpluralismus Methodisch bedeutet die Ausrichtung auf den Raumund Siedlungsbezug in einer nachhaltigen Finanzwissenschaft und Infrastrukturökonomie grundsätzlich einen laufend weiter zu entwickelnden Methodenpluralismus, neben den am Fachbereich angewandten, klassischen ökonomischen Methoden, etwa partizipative, deliberative Bewertung (regionaler) öffentlicher Güter, die verstärkte Anwendung räumlich-ökonometrischer Analysen, Methoden der Analyse und Gestaltung einer längerfristig ausgerichteten (lokalen und regionalen) Finanzpolitik bis hin zu Methoden der semantischen Vernetzung von Budgetdaten mit räumlichen Wirkungsanalysen im Kontext von wirkungsorientierter Haushaltsführung, Open (Budget) Data und E-Government.
122 | Johann Bröthaler, Michael Getzner
of the public sector as fundamentally limited by existing resources (earth/land/surface area, natural resources, and production factors). On the other hand, this understanding leads to a multi-dimensionality of governmental action, which, besides the efficiency and effectiveness of public task fulfilment, also takes aspects of social justice, environmental sustainability, participation, and empowerment in public finance and infrastructure decisions into consideration, in particular on the local and regional levels. Pluralism of Methods Methodically, this orientation on the spatial and residential references in sustainable public finance and infrastructure economics essentially demands a pluralism of methods that must be continuously developed, in addition to the traditional economic methodology used at the centre, such as participative, deliberative evaluation of (regional) public goods, an increased use of spatial-econometric analyses, methods of analysis and design of a (local and regional) public finance politics built on a longer-term vision, up to methods of semantic linking of budget data to spatial impact analyses in the context of impact-oriented budgeting, open (budget) data and e-government.
Andreas Voigt
ÖRTLICHE RAUMPLANUNG1 – RAUM GESTALTEN LOCAL PLANNING1 – SHAPING SPACE Die dauerhafte Sicherung der Existenz unserer Siedlungsräume, verbunden mit ihrer zukunftsfähigen Gestaltung, ist zentrale Herausforderung für Raumplanung und Raumentwicklung. „Alles Leben ist Problemlösen“2 – diese grundlegende Erkenntnis gilt in besonderer Weise für Raumplanung und Politik: Zu den zentralen, brennenden Herausforderungen unserer Zeit zählen die Erhaltung der produktiven und reproduktiven Raumfunktionen (vor allem der Schutz des Bodens, die Sicherung der Natur- und Erholungsräume, die Gewährleistung der Versorgung mit differenzierten Bildungsangeboten, Dienstleistungen und Gütern, die Bereitstellung von Nahrungsmitteln und Erholungsmöglichkeiten auf kurzen Wegen), die dauerhafte Sicherung der Energieversorgung und die Gestaltung der Mobilität. All diese Herausforderungen stellen sich vor dem Hintergrund dynamischer, teils dramatischer Veränderungen der Systemumwelten unserer Siedlungssysteme, wie Klimawandel, demographischer Wandel, rasante technische und wirtschaftliche Entwicklungen oder unerwartete Veränderungen in den politischen Systemen und Gegebenheiten. Die Konzeption von geeigneten problembasierten und lösungsorientierten Strategien der Raumentwicklung, die bei der Begründung von Entscheidungen hilfreich sind und Handlungen leiten, ist verstärkt gefordert. Dazu zählen die Innenentwicklung des Siedlungssystems und die Gestaltung der KoEvolution von Infrastruktur-, Siedlungs- und Raum entwicklung.
Safeguarding the enduring existence of our settlements, and designing them for future sustainability, are key challenges for spatial planning and development. “All Life is Problem Solving”2 – This fundamental insight is particularly true of spatial planning and politics: maintaining the productive and reproductive functions of space (in particular soil protection; safeguarding natural and recreational spaces; ensuring access to diverse opportunities for education, services, and goods; and the provision of food and nearby recreational options), ensuring a sustainable energy supply, and designing mobility are amongst the most pressing challenges of our time. All these challenges arrive against a backdrop of dynamic and sometimes even dramatic changes in the systemic environments of our settlement systems, such as climate change, demographic change, rapid technological and economic development, and unexpected changes in political systems and conditions. There is a growing demand for the development of suitable problem-based and solution-oriented spatial development strategies that help justify decisions and guide action. This includes the internal development of the settlement system and organising the co-evolution of the development of infrastructure, settlement, and space. Taking Initiative The key assumptions of spatial planning are based on limited and economically scarce resources combined with the increasingly diverse demands of society regarding the use of space and time. These limitations
Örtliche Raumplanung – Raum gestalten | 123
Initiativen ergreifen Die zentralen Kernannahmen der Raumplanung gründen auf beschränkten und ökonomisch knappen Ressourcen im Zusammenhang mit zunehmend vielfältigen und steigenden Nutzungsansprüchen der Gesellschaften – bezogen auf Raum und Zeit. Diese Beschränkungen betreffen auch die Gestaltung von Planungsprozessen: Zeit, Budget und vor allem Menschen, die sich um Raumplanung und -entwicklung kümmern können. Diese Randbedingungen erfordern eine besonders behutsame, ressourcenschonende und strategische Vorgehensweise bei der Bearbeitung der schwierigen, teils existenzbedrohenden Problemstellungen. Dies kann nur gelingen, wenn planungskulturelle Voraussetzungen auf hohem Niveau vorliegen und gepflegt werden und die Brücke zur Baukultur ausgebaut wird. Dazu zählen die Lernfähig-
124 | Andreas Voigt
Abb. 1: „Wo willst du hin, meine Donaustadt – Strategieplan für das Zielgebiet U2“, 2013, Rudolf Scheuvens, René Ziegler, Philip Krassnitzer. Stadt Wien, MA 21 Stadtteilplanung und Flächennutzung, Wien 2013. Figure 1: “Where are you going, my Danube City – Planning strategy for the U2 Target Area”, 2013, Rudolf Scheuvens, René Ziegler, Philip Krassnitzer. City of Vienna, MA 21 Neighbourhood Planning and Land Use, Vienna 2013.
also influence the organisation of planning processes: time, budget, and above all people to take care of spatial planning and development. These conditions call for a particularly cautious, resource-conserving and strategic approach when addressing these difficult problems, some of which threaten our very existence. We can only succeed if we have a sophisticated planning culture in place, and if the latter is cultivated and the connection to building culture strongly developed. Aspects of this
keit der Akteurinnen und Akteure der Raumentwicklung, die Bereitschaft zum dauerhaften Dialog, der gegenseitige Respekt, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und Initiativen zu ergreifen.
culture include the stakeholders’ capacity to learn, their willingness to commit to sustained dialogue, mutual respect, and a willingness to accept responsibility and take initiative.
Forschungsgegenstand und Handlungsfelder
Research Focus and Fields of Action
Forschungsgegenstand des Fachbereichs Örtliche Raum-
The Centre for Local Planning’s research focuses on municipalities3. Despite their varying complexity and structure, their size, situation in space and different spatial contexts, these municipalities are the centre’s “research labs”. Their diverse spatial contexts (e.g. urban and rural, Alpine and extra-Alpine spaces confronted with growth or shrinkage) and different inter-communal and regional references lead to a particular differentiation of the issue. Local planning covers the following (sometimes thematically overlapping) fields of action, in combination with the respective theoretical and methodological planning basis: local authority development planning, municipal planning, urban planning and urban development planning, local development, village and urban regeneration, district and neighbourhood planning, master planning, zoning and land-use planning, municipal design planning and urban design, spatial planning design, and inter-communal spatial design and development.
planung sind die Gemeinden.3 Diese sind, unbeschadet ihrer vielfältigen räumlichen Komplexität und Struktur, ihrer Größe, Lage im Raum und ihrer verschiedenartigen räumlichen Kontexte, die „Forschungslabore“ des Fachbereichs. Die vielfältigen räumlichen Kontexte (z. B. städtisch wie ländlich geprägte, alpine wie außeralpine, mit Wachstum oder Schrumpfung konfrontierte Räume) und ihre vielfältigen interkommunalen und regionalen Bezüge differenzieren die Fragestellungen in besonderer Weise. Örtliche Raumplanung umfasst beispielhaft folgende – teils thematisch überlappende – Handlungsfelder im Verbund mit der entsprechenden planungstheoretischen und -methodischen Fundierung: Kommunale Entwicklungsplanung, Gemeindeplanung, Stadtplanung und Stadtentwicklungsplanung, Ortsplanung und Orts entwicklung, Dorf- und Stadterneuerung, Stadtteil- und Quartiersplanung, Masterplanung, Flächenwidmungsbzw. Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung bzw. Bauleitplanung, Kommunale Gestaltungsplanung und Stadtgestaltung, raumplanerisches Entwerfen, Interkommunale Raumplanung und -entwicklung. Forschung und Lehre Für universitäre Lehre in Raumplanung und Raumordnung ergeben sich damit folgende Grundsätze: forschungsgeleitete Lehre, die möglichst realitätsnahe Simulation der Planungswirklichkeit, das Projektstudium anhand konkreter „Laborräume“, verbunden mit Exkursionen in diese Räume und konstruktiver Auseinandersetzung mit politischen Entscheidungsträgern, Bürgerinnen und Bürgern. Darüber hinaus: der institutionalisierte Dialog der Akteure der Planungstheorie und Planungspra-
Research and Teaching For academic teaching in Spatial Planning and Spatial Development, we can thus extrapolate the following principles: research-led teaching, simulated planning that is as realistic as possible, a project-based approach using concrete “laboratory spaces” in combination with excursions to these spaces, and a constructive debate with political decision-makers and citizens. Alongside these is the institutionalised dialogue between planning theoreticians and practitioners, the world of planning and everyday life, universities and their host cities, and regional authorities and planning levels.
Örtliche Raumplanung – Raum gestalten | 125
40 Years of Local Planning at the TU Wien
Abb. 2: „Transformation. Perspektive Stadt 2030. Brettldorf Brigittenau Wien“ – Werkstatt im Rahmen des Studierendenprojekts 2009/10. Figure 2: “Transformation. A Perspective for the City in 2030. Brettl dorf Brigittenau Vienna” – Student Project Workshop 2009/10.
xis, der Planungs- und Alltagswelt, der Universitäten und ihrer gastgebenden Städte, der Gebietskörperschaften und Planungsebenen. 40 Jahre Örtliche Raumplanung TU Wien Das Institut für Örtliche Raumplanung wurde 1974 gegründet und ist als gleichnamiger Fachbereich seit 2004 integraler Bestandteil des Departments für Raumplanung der Fakultät für Architektur und Raumplanung der Technischen Universität Wien. Aus gegebenem Anlass werden zentrale Themen und Handlungsfelder für Forschung und Lehre beleuchtet und diskutiert, eine Festveranstaltung und die Reihe Zukunft Stadt4 sollen den Diskussionsprozess vertiefen und beschleunigen. Die Innenentwicklung der Siedlungssysteme – verbunden mit einer umfassenden, integrierten Energieraumplanung – soll im Verbund mit der tragenden räumlichen Infrastruktur die Erneuerung und Transformation der Bestände und somit eine radikale Abkehr von einer Siedlungsentwicklung nach außen ermöglichen. Lebensräume können als „Transformationslandschaften“5 verstanden werden. Dies erfordert Schwerpunktsetzungen
126 | Andreas Voigt
The Institute of Local Planning was founded in 1974, and since 2004, a centre of the same name has been an integral part of the Department of Spatial Planning in the Faculty of Architecture and Planning at the TU Wien. We therefore have occasion to highlight and discuss key issues and fields of action in research and teaching. An official event and the future city4 discussion series aim to develop and accelerate the debate. The interior development of settlement systems – in combination with comprehensive, integrated energy planning and together with the supporting spatial infrastructure – aims to allow for the regeneration and transformation of existing structures, and thus for a radical shift away from external settlement development. Living spaces are understood as “landscapes of transformation”.5 This necessitates a focus on planning culture and strategic planning; on energy, landscape, and open space planning; on the design of public space; on the cultivation of mobility: on the key qualities of spaces; on differentiated concepts for urban and rural spaces; and on their development in the spatial assembly. To achieve this, a more in-depth exchange with thematically neighbouring research fields is indispensable. Planning processes are always problem-based, and need to be seen as solution-oriented processes of learning and qualification. In this context, we need to cultivate, to innovatively develop, and to differentiate practice-oriented planning methods, instruments, and processes. In a functional combination of informal preliminary processes and formal planning processes, we aim to guarantee administrative and legal validity. In an interlocking process, organisation and planning of processes must be efficient and effective. A further integration of a visual spatial modelling and simulation can and should contribute to a further sense of space, to an expansion of the spectrum of possible solutions, and to improved decision-making processes. We will continue to focus, in particular, on the organisation of platforms for dialogue, of networking between
in der Planungskultur und der strategischen Planung, in der Energie-, Landschafts- und Freiraumplanung, bei der Gestaltung öffentlicher Räume, die Kultivierung der Mobilität, die Fokussierung auf räumliche Schlüsselqualitäten, differenzierte Konzeptionen für städtische und ländliche Räume und deren Entwicklung im räumlichen Verbund. Der vertiefte Austausch mit thematisch benachbarten Forschungsfeldern ist dazu unerlässlich. Planungsprozesse sind stets problembasiert als lösungsorientierte Lern- und Qualifizierungsprozesse zu konzipieren. In diesem Zusammenhang bedarf es der Kultivierung, innovativen Entwicklung und Differenzierung praxisorientierter Planungsmethoden, -instrumente und -prozesse. In zweckmäßiger Verbindung von informellen Vorverfahren und formellen Planungsprozessen sollen Verwaltungsverbindlichkeit und Rechtsver-
Abb. 3: Wissensplattform Stadtentwicklung – Stadt und Universität im Dialog, 2012, Rudolf Scheuvens, René Ziegler, Philip Krassnitzer. Werkstattbericht zur Stadtentwicklung Nr. 137 der Stadt Wien, MA 18 Stadtentwicklung und Stadtplanung, Wien 2013. Figure 3: Urban development knowledge platform – City and university in dialogue, 2012, Rudolf Scheuvens, René Ziegler, Philip Krassnitzer. Workshop Report on Urban Development No. 137 of the City of Vienna, MA 18 Urban Development and Planning, Vienna 2013.
the stakeholders of spatial development6, and on increased public education and participation.
Örtliche Raumplanung – Raum gestalten | 127
bindlichkeit gewährleistet werden. Korrespondierend ist die Organisation der Planung und der Verfahren effektiv und effizient zu gestalten. Die weitere Integration anschaulicher, raumbezogener Modellbildung und Simulation kann und soll zu einem vertieften Raumverständnis, zur Erweiterung des Spektrums an Lösungsmöglichkeiten und zu verbesserter Entscheidungsfindung beitragen. Besonderes Augenmerk soll weiterhin auf der Gestaltung von Plattformen des Dialoges, der Vernetzung der Akteure der Raumentwicklung6 und einer intensivierten Information und Beteiligung der Öffentlichkeit liegen.
128 | Andreas Voigt
Anmerkungen 1 www.ifoer.tuwien.ac.at (20. 01. 2015). 2 Karl Popper, Alles Leben ist Problemlösen. Über Erkenntnis, Geschichte und Politik, Darmstadt 1994. 3 Vgl. Österreichische Bundesverfassung, Art. 118, Ziffer 9: „Örtliche Raumplanung“. 4 Vgl. www.ifoer.at/zukunftstadt bzw. www.facebook.com/zukunftstadt (beide 20. 01. 2015). 5 Vgl. Internationales Doktorandenkolleg Forschungslabor Raum: Urbane Transformationslandschaften / Transformation of Cities and Landscapes, „Curriculum 2013–2016“, www.forschungslabor-raum. info (20. 01. 2015). 6 Vgl. Netzwerk Raumplanung, www.netzwerk-raumplanung.at (20. 01. 2015).
Martin Berger, Georg Hauger, Bardo Hörl, Michael Klamer
VERKEHRSSYSTEMPLANUNG ALS POLYTECHNIK TRAFFIC SYSTEM PLANNING AS POLYTECHNOLOGY Als vor 200 Jahren das polytechnische Institut gegründet wurde, war das schnellste Verkehrsmittel, wie auch schon Tausende Jahre davor, das galoppierende Pferd, und dies sowohl für den Personenals auch für den Güterverkehr. Schneller war nur im Bereich der Informationstechnologie die Brieftaube im Sturzflug. Verkehrliche und räumliche Strukturen hatten sehr lange Zeit, sich gemeinsam zu entwickeln. Mit der industriellen Revolution setzte eine bis dahin unbekannte Beschleunigung ein, die sich vor allem in Produktions-, aber auch Transporttechnologien und dadurch in weiterer Folge in der Raumnutzung manifestierte. Nun stehen wir vor einer neuen, für die Verkehrssystemplanung unglaublich spannenden digitalen und energetischen Revolution. Was sind die Rahmenbedingungen und Trends, denen wir uns im Bereich Verkehr im Sinne einer Erforschung, Planung und Entwicklung einer nachhaltigen Mobilität gegenübersehen? Die Verkehrsnachfrage verändert sich: Kollektive Rhythmen beginnen sich aufgrund der demographischen Entwicklung, der Ausdifferenzierung von Lebensstilen und der räumlichen Verteilung von Personen, Standorten und Märkten aufzulösen. Diese Individualisierung und Erreichbarkeitserhöhung hat unglaubliche Fortschritte und auch Wohlstand für große Teile der Gesellschaft gebracht. Erst dieses Wohlstandsniveau „erlaubt“ den luxuriösen Blick der Gesunden, Wohlgenährten auf früher „nebensächliche“ Probleme wie Umweltschutz, deren ärgste Auswüchse (vgl. 19. Jahrhundert) schon längst, synchron mit der Wohlstandsentwicklung, verschwunden sind. Allerdings steht der Trend zur Individualisierung sowohl im Personenver-
Two hundred years ago, when the Polytechnic Institute was first founded, the fastest means of transport was still a galloping horse, as it had been the case for thousands of years. This held true for passenger and goods transport alike. In the field of information technology, the only faster method was a swooping carrier pigeon. Traffic and spatial structures had ample time to develop together. The Industrial Revolution meant the beginning of a hitherto unknown acceleration that became manifest mainly in production as well as in transport technologies and later, in the use of space. Today, we are facing another revolution, a digital and energetic one, which is incredibly exciting for traffic system planning. What is the framework, what transport trends are we facing, where is the study, planning, and development of sustainable mobility headed? Transportation demands are changing: collective rhythms are starting to dissolve due to demographic trends, the differentiation of lifestyles, and the spatial distribution of individuals, facilities, and markets. Individualisation and increased accessibility have brought incredible progress and wealth to large sections of our society. Only this level of wealth “permits” the healthy and well-fed luxury of scrutinising formerly “negligible” problems like pollution, the worst forms of which (especially in the 19th century) have long vanished with the rise of prosperity. However, the trend towards individualisation in passenger transport and logistics often conflicts with current socio-political goals, such as climate protection, traffic safety, resource conservation, inclusion, etc. On the other hand,
Verkehrssystemplanung als Polytechnik | 129
kehr, aber auch in der Logistik häufig im Widerspruch zu aktuellen gesellschaftspolitischen Zielvorstellungen, wie etwa Klimaschutz, Verkehrssicherheit, Ressourcenschutz, Inklusion etc. Im Gegenzug ermöglicht die zunehmende Verbreitung des „Internets der Dinge“ eine bessere Organisation, Beeinflussung und Steuerung von Mobilität und Verkehr. So gelingt zum Beispiel im Bereich der Logistik eine immer genauere und aktuellere Kontrolle bzw. Überwachung von Transportwegen und -zeiten. Damit wird man auch dem zunehmenden Trend nach E-Commerce gerecht. Es ist anzunehmen, dass etwa im Bereich der Logistik die Bestellmengen und damit die Sendungsgrößen pro Bestellvorgang tendenziell kleiner werden, da einerseits Bestellungen immer kurzfristiger und oft automatisiert erfolgen und Produkte nicht auf Vorrat gehalten werden müssen. Dies wird auch die Performance der eingesetzten Güterverkehrsmittel beeinflussen und auch bei deren Einsatz mehr Automatisierung auslösen. Mittels Mikroprozessoren, Sensoren und einer Funkverbindung auf den Transportbehältern werden in den logistischen Prozessen Pakete in der Lage sein, sich die geeigneten Transportrouten nach definierten Kriterien selbst zu suchen. Gleichzeitig drohen die ordnenden Eingriffsmöglichkeiten durch hoheitliche Planung zu schwinden, da klassische verkehrsplanerische Maßnahmen („Pull-undPush-Ansatz“) etwa aufgrund steigender Widerstände in der Bevölkerung („Wutbürger“) und abnehmender finanzieller Mittel der öffentlichen Hand immer weniger greifen. Zahlreiche Kommunen sind beispielsweise in ihren finanziellen Möglichkeiten extrem beschränkt bis völlig unbeweglich. Auch kann angeführt werden, dass etwa der öffentliche Verkehr in Zeiten und Räumen schwacher Nachfrage kaum kompetitiv ist. Individualisierung und Digitalisierung eröffnen allerdings die Chance für neue Verkehrsangebote, die jedoch weniger Ergebnis vorausschauender Planung sind als vielmehr häufig auf privatwirtschaftlichen Geschäftsmodellen beruhen und, das ist das Erstaunliche, zu funktionieren scheinen: allerdings nur für ein bestimmtes Bevölkerungssegment und in bestimmten Räumen, somit sind sie nicht unbedingt
130 | Martin Berger, Georg Hauger, Bardo Hörl, Michael Klamer
the growing prevalence of the “Internet of Things” allows for a better organisation, manipulation, and control of mobility and traffic. In the area of logistics, for instance, we are able to achieve an increasingly exact and up-to-date control and surveillance of transport routes and times. This also enables us to satisfy the growing trend towards e-commerce. For example, in the field of logistics, it is probable that order sizes and consequently shipment sizes, will tend to decrease, as orders will be increasingly short-term and often automated, wich will lead to products no longer being kept in stock. This will also influence the performance of the mode of transport used and trigger an increase in automation. By means of microprocessors, sensors, and radio communication with freight containers, packages will be able to “choose” their transport routes themselves in logistic processes, which were defined according to specific parameters. At the same time, the possibility of intervention by government could disappear, as traditional traffic planning measures (“push-pull approach”) are becoming less successful due to popular resistance (the German “Wutbürger”, or angry citizen) and declining public finances. Many municipalities, for instance, are extremely restricted or even completely inflexible in their financial options. We can also cite that public transport is hardly competitive in times and areas of low demand. Individualisation and digitalisation offer opportunities for new transport services that are less the result of forward planning, but are based on commercial business models, and which, amazingly, seem to work. However, they only work for a certain segment of the population and in certain spaces, and therefore, they are not necessarily compatible with general interest goals (e.g. affordable mobility for all). This was also triggered by the nearly paradoxical economic fact we might refer to as “private wealth and public debt”. At the same time, fossil energy’s life cycle seems to be headed south, and we are not only witnesses, but also agents of an energy revolution which promises interesting future problems for traffic system planning.
kompatibel mit Zielen der Allgemeinheit (z. B. leistbare Mobilität für alle). Ausgelöst ist dies auch durch den fast paradoxen ökonomischen Umstand, den man kurz als „privater Wohlstand und öffentliche Schulden“ fassen kann. Parallel dazu dürfte der Lifecycle der fossilen Energie am absteigenden Ast sein und wir sind nicht nur Zeitzeugen, sondern auch Akteure der Energiewende, die der Verkehrssystemplanung spannende Aufgaben verspricht. Methoden der Verkehrssystemplanung sind aufgrund der Komplexitätszunahme der Planungsaufgaben mit hohen Anforderungen konfrontiert. Um die Qualität der Planung zu sichern und zu verbessern, benötigt die Verkehrssystemplanung ein sehr breites Methodenrepertoire, das sowohl den wissenschaftlichen als auch den planungspraktischen Ansprüchen etwa an Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Objektivität, Genauigkeit, Realitätsnähe, Anschaulichkeit und Aufwand genügt. Beispielsweise wird bei der Umsetzung einer Parkraumbewirtschaftung oder der Neugestaltung eines Straßenraumes in einem Stadtviertel von der lokalen Politik erwartet, dass zum einen die verkehrlichen Wirkungen exakt erhoben und prognostiziert werden und genauso wie vorhergesagt eintreten. Zum anderen besteht der Anspruch, dass die Menschen, die vor Ort den Planungsprozess aktiv und umfassend mitgestalten, anschaulich verstehen können, worum es geht und was auf sie zukommt: Wer profitiert oder verliert wie stark von einer Maßnahme? Was ist der langfristige Nutzen der Maßnahme, was sind die Kosten? Neben den klassischen (raum-) planerischen Methodensets der Visualisierung und Kommunikation verfügt die Verkehrssystemplanung in der Analyse auch über sehr spezifische Ansätze: Wesentlicher Kern der Methoden der Verkehrssystemplanung ist es, (Netto-)Wirkungen z. B. von neuen Mobilitätsangeboten zu überprüfen, zu prognostizieren und zu bewerten. Ein Schlüssel ist dabei, die Verhaltensänderungen der Menschen in ihrer Mobilität – z. B. aufgrund von neuen Verkehrsangeboten, steigenden Treibstoffpreisen, attraktiven Einkaufsmöglichkeiten im Wohnumfeld – zu analysieren und möglichst breit in der Öffentlichkeit
Due to the increased complexity of planning tasks, methods of traffic system planning are confronted with great challenges. In order to ensure and improve planning quality, traffic system planning needs to apply a broad repertoire of methods which will meet scientific as well as practical planning requirements, such as transparency, traceability, objectivity, exactitude, accuracy, descriptiveness, and cost. In implementing parking space management or redesigning streets in an urban quarter, for example, local policy is expected to exactly survey and predict traffic impacts, and they are expected to occur as predicted. On the other hand, it is expected that local residents who actively and importantly influence the planning process be able to clearly understand the issue and what they are facing: Which advantages and disadvantages a specific measure brings and to whom? What are the long-term benefits of a measure and what are the costs? Besides traditional (urban) planning tools and methods of visualisation and communication, traffic system planning also has very specific approaches to analysis. An essential element of methods of traffic system planning is to test, to forecast, and to evaluate (net) impacts of, e.g., new mobility services. The key here is to analyse the behavioural change in individual mobility – which can be caused by the new transport services, rising fuel prices, or attractive shopping facilities in the neighbourhood, for example – and to raise the public’s awareness for them. The fact that complex, multi-faceted mobility behaviour is too imprecise, too sketchy, and not well enough understood represents one of our greatest challenges. The question of how often is one on the road, when, where to is he/she headed, by what means, where, how far, with whom and in particular why remains hard to measure and thus to model, as the memories and subjective perceptions of respondents are in themselves limiting factors, and high quantity and quality empirical data would be necessary to achieve these aims. The dynamic development in the field of information and communication technologies (ICT) offers new opportunities for mobility research, e.g. in collecting more current, detailed, and cheaper data
Verkehrssystemplanung als Polytechnik | 131
bewusst zu machen. Hier liegt eine große Herausforderung: Das komplexe, facettenreiche Mobilitätsverhalten ist zu wenig präzise, stark lückenhaft und kaum umfassend bekannt. Wer, wie oft, wann, wohin, womit, wo, wie weit, mit wem und vor allem warum unterwegs ist, bleibt schwierig zu messen und damit zu modellieren, da hier vor allem das Erinnerungsvermögen und die subjektiven Wahrnehmungen der Befragten selbst limitieren und hierfür empirische Daten hoher Qualität und Quantität erforderlich sind. Gerade die dynamische Entwicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) bietet eine neue Chance für die Mobilitätsforschung, etwa durch Sensoren bzw. Crowdsourcing aktuellere, detailliertere und kostengünstigere Daten zu gewinnen. Zudem werden innovative Mobilitätslösungen, wie z. B. Carsharing, durch IKT unterstützt, in dem das Informieren, Buchen, Finden und Bezahlen für die Nutzer erleichtert wird. Neue Mobilitätslösungen sowie neue Formen der Infrastrukturbewirtschaftung (Planung, Vorfinanzierung, Kostenanlastung an die Nutzer nach unterschiedlichen Kriterien), welche die unterschiedlichen Stoßrichtungen der Verkehrspolitik widerspiegeln können, gehen einher mit Veränderungen der sozialen Praxis (und umgekehrt). Folglich erfordern zeitgemäße Mobilitätsangebote von der Verkehrssystemplanung neben technologischen Aspekten auch fundierte Informationen zu Bedürfnissen, Akzeptanz und Nutzung dieser Mobilitätslösungen. Die Mobilitätsforschung braucht dabei neben dem klassischen Methodenset einen stärkeren experimentellen Zugang, der auch das Lernen aus Fehlern und Scheitern einschließt. Beispielsweise erscheint das Forschen in sogenannten Living Labs auch im Bereich der Mobilitätsforschung mit einem breiten Methodenset zukunftsweisend. Living Labs eröffnen folgende Chancen: •• Mobilitätslösungen in der Realwelt gemeinsam mit den Nutzern und Stakeholdern entwickeln, gestalten, testen und demonstrieren und dabei das Ausprobieren in den gewohnten Alltag und die Lebensumgebung der Menschen integrieren, um individuelles Mobilitätsverhalten mit seinen Routinen, Handlungsspielräumen etc.
132 | Martin Berger, Georg Hauger, Bardo Hörl, Michael Klamer
with sensors and crowdsourcing. In addition, innovative mobility solutions, such as car sharing, are supported by ICT, which makes information, booking, finding, and payment easier for their users. New mobility solutions, like new forms of infrastructure management (planning, pre-financing, and cost allocation to users according to different criteria), may reflect different strategic courses of transport policy and coincide with changes in social practice (and vice versa). In addition to technological aspects, modern mobility services require well-founded information regarding the needs, acceptance, and use of these mobility solutions in traffic system planning. Beside the traditional set of methods, therefore, mobility research needs to pursue a more experimental approach, a process that includes learning from mistakes and failures. For example, research in so-called living labs with a broad set of methods appears to be a promising way in the field of mobility research. Living labs provide access to the following opportunities: •• development, design, testing, and demonstration of mobility solutions in the real world, in collaboration with users and stakeholders, and the integration of trial into the everyday lives of individuals in order to analyse their mobility behaviour and routines, room for manoeuvring, etc., and the adaptation of mobility solutions based on these results, •• linking of research from different disciplines with administration, politics, and business; and in particular with the practical and local knowledge of local residents and users in order to achieve collaborative learning, •• encouraging people to reflect upon their own mobility behaviour through evidence-based research. This is how traffic system planning can also, in addition to its core task of mobility planning – while conforming to the spirit of “polytechnology” – contribute to successful processes of change in society, leading to better climate and resource conservation and inclusion in the field of mobility.
zu analysieren und darauf aufbauend die Mobilitätslösungen anpassen zu können •• Forschung auch aus unterschiedlichen Teildisziplinen mit Beteiligung von Verwaltung, Politik und Unternehmen, besonders aber die Menschen vor Ort mit ihrem praktischen, lokalen Wissen vernetzen, um ein gemeinsames Lernen zu erreichen •• Reflexion des eigenen Mobilitätsverhaltens in den Köpfen der Menschen durch evidenzbasierte Forschung anzuregen. Dadurch kann die Verkehrssystemplanung neben der eigentlichen Aufgabe der Mobilitätsplanung – ganz im Sinne von ‚Polytechnik‘ – auch einen Beitrag zum Gelingen von Veränderungsprozessen in der Gesellschaft für mehr Klimaschutz, Ressourcenschonung und Inklusion im Bereich der Mobilität leisten.
Verkehrssystemplanung als Polytechnik | 133
Jens S. Dangschat
GESELLSCHAFTLICHE ASPEKTE DER RAUMPLANUNG, DES STÄDTEBAUS UND DER ARCHITEKTUR SOCIAL ASPECTS OF SPATIAL PLANNING, URBAN DESIGN, AND ARCHITECTURE Raumplanung, Städtebau und Architektur sind nicht möglich, ohne über die Gesellschaft und ihren Wandel zu reflektieren. Dabei geht es im ersten Schritt darum, sich zu vergegenwärtigen, wer den gebauten Raum später nutzen wird. Dazu ist es für den Anfang notwendig, zu analysieren, wie Menschen in ihrer sozialen Differenzierung auf den gebauten Raum reagieren (Mikro-Ebene). Weiterhin ist es wichtig, wie Menschen sich in Gruppen organisieren, insbesondere dann, wenn es um den gemeinsam genutzten Raum geht, wie beispielsweise bei der Nachbarschaft, dem Einzugsbereich von sozialer Infrastruktur oder der Nutzung von Verkehrsmitteln (Meso-Ebene). Schließlich sind Raumplanung, Städtebau und Architektur in Ordnungssysteme, Verordnungen, Gesetzgebung – allgemein – in Government- und Governance-Strukturen und -Prozesse (Makro-Ebene) eingebunden. Der Fachbereich Soziologie (ISRA) wurde im Februar 1998 als Abteilung innerhalb des damaligen Instituts für Stadt- und Regionalforschung (srf) gegründet.1 Damals gab es keineswegs eine einhellige Zustimmung zur Sinnhaftigkeit von Sozialwissenschaften in einer Architektur- und Raumplanungsschule oder gar an einer technischen Universität. Bis heute trifft man auf Kolleginnen und Kollegen, die überrascht darüber sind, dass es „so etwas“ an einer TU resp. im Rahmen von Raumplanung und Architektur gibt. Umgekehrt bezweifelt heute unter den Lehrenden und den Studierenden der Fakultät kaum jemand mehr, dass es einen sozialwissenschaftlichen Zu-
Spatial planning, urban design, and architecture are not possible without reflecting on society and its changes. Therefore, the first step is to visualise the people who will use the spaces after construction. From the start, it is necessary to analyse how diverse groups of people in society respond to the spaces (micro-level). Furthermore, it is important to observe how people begin forming social groups, especially with regard to the use of shared spaces, such as in the case of neighbourhoods, urban action spaces, and the use of transportation (meso-level). Finally, spatial planning, urban design, and architecture are integrated aspects of administrative systems, regulations, and with legislation in general through government and governance structures and processes (macro-level). The Centre of Sociology (ISRA) was founded in February 1998 as a division of the Institute for Urban and Regional Research (srf).1 At this time, there was by no means unanimous agreement regarding the relevance of the social sciences within schools of architecture and urban planning or even within technical universities. Even today, some colleagues are still surprised that “something like social science” is offered within the framework of the Spatial Planning and Architecture curricula and respectively within the academic offerings of a technical university. In contrast, the professors, instructors, and students of the faculty themselves rarely doubt that the social sciences are just as necessary to the reflection and
Gesellschaftliche Aspekte der Raumplanung, des Städtebaus und der Architektur | 135
gang zur Reflexion der Raumproduktion ebenso braucht wie zur Entwicklung von Technologien. Auch wenn die Einrichtung und Etablierung des ISRA den damaligen Veränderungen der Raumplanungskultur und der planungspolitischen Governance entsprach, so stand und steht das sozialwissenschaftliche Denken noch immer im Widerspruch zu den „Eindeutigkeiten“ eines ingenieurwissenschaftlichen Verständnisses von Raumplanung oder gar von Technik- und Naturwissenschaften. Sozialwissenschaftliches Denken steht aber auch im Widerspruch zu einem künstlerischen Verständnis von Provokation oder von „künstlerischer Freiheit der Entwerfenden“, ohne die gesellschaftlichen Auswirkungen zu reflektieren.
consideration of spatial production as they are to the development of technologies. Even though the formation and establishment of the ISRA corresponded to changes in spatial planning culture and zoning governance of that time, viewpoints gained from the social sciences stood and still stand in contrast to the “clarity” of the understanding which is developed from engineering approaches to spatial planning and even to technology and the natural sciences. Moreover, social science perspectives also run contrary to the artistic approach of provocation or of the “artistic freedom of design”, which are created and formed without consideration of the social impact. How It All Began
Wie alles begann Ursprünglich wurde „die Soziologie“ in der Raumplanung etabliert, um zum einen die rationalen Erklärungsmodelle zu verbessern, damit der „Unsicherheitsfaktor Mensch“ mikrosoziologisch vermessen wird. Zum anderen wurde Soziologie mit Sozialarbeit gleichgesetzt, weil die Rolle der Soziologie im „Kleinarbeiten“ sozialer Konflikten gesehen wurde. Beides ist eine Fehleinschätzung resp. eine Engführung von Sozialwissenschaften. Die Notwendigkeit und Möglichkeit der Entwicklung des ISRA war damit vorgegeben: Zum einen das sozialwissenschaftliche Wissen auf die Herausforderungen der „raumproduzierenden“ Fächer zuzuspitzen und zum anderen die Trends der „neuen Planungskultur“ im Lehrprogramm einzuführen und zu kanonisieren. Für das erste Ziel war es vor allem notwendig, das prinzipiell „unräumliche“ Denken der Sozialwissenschaften über die Spezialisierung auf Siedlungssoziologie, Stadt- und Regionalsoziologie sowie Raumsoziologie stärker auf sozialräumliche Phänomene zu beziehen. Dabei ist es wichtig, zu verstehen, dass sich soziale Phänomene aufgrund sozial selektiver Entscheidungen (Wohnstandortwahl, Mobilität, Bewegung im Raum, symbolische „Besetzung“ durch Architektur und Städtebau) kleinräumig stark voneinander unterscheiden, woraus sich unterschiedliche Interessens-
136 | Jens S. Dangschat
Originally, “the Sociology Division” was established as a field of spatial planning to improve rational explanations of the “Human Instability Factor”, which can be measured sociologically on a micro-level. On the other hand, sociology became synonymous with social work, its role seen from the perspective of the “small concerns” of social conflicts. Both interpretations are misjudgements and lead to a restriction of what the social sciences are. The necessity and possibility of developing the ISRA had two purposes; on the one hand, development was intended to integrate knowledge from the social sciences regarding the challenges of the spatial production disciplines and, on the other, to introduce and canonise the trends of the “new planning culture” into the teaching programmes. As for the first goal, this mainly meant that the largely “non-spatial” thinking of the social sciences was correlated to the specialisations of Settlement Sociology, Urban and Regional Sociology, and Spatial Sociology while focusing more on social spatial phenomena. It is important to understand that social phenomena that occur due to socially selective decisions (housing location, mobility, spatial movement, symbolic “occupation” through architecture and urban design) greatly differ from each other within small distances, whereby differ-
lagen und Artikulationen ableiten, was wiederum unterschiedliche planerische Entscheidungen zur Folge hat. Das ISRA beschäftigt sich neben demographisch definierten, sozialen Kategorien (Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, Migrantinnen und Migranten, unterschiedliche Haushaltsformen) vor allem mit Kategorien sozialer Ungleichheit (Klasse, Schicht, soziales Milieu) hinsichtlich des raumrelevanten Verhaltens (Wohnstandortwahl mit der Folge für Segregation, Gentrification, Migration und Integration; Mobilität und Aktionsräume, Nutzung des öffentlichen Raumes). Darüber hinaus sind Kategorien wie Lebensstil, Kreativität, Technikaffinität, Energiekonsum ebenso relevant wie die Veränderung der Verwaltung und Politik (from government to governance), in welche die Diskurse um nachhaltige Entwicklung und die Smart City eingebunden sind. Aufgrund des sozialen Wandels wird deutlich, dass die traditionellen Strukturmerkmale aus der Amtlichen Statistik wenig darüber aussagen, welche sozialen Konstellationen vor Ort tatsächlich wirksam sind. Das wie derum hat massive Folgen für die Sinnhaftigkeit der darauf beruhenden politischen Rückschlüsse (beispielsweise über Ausländeranteile und soziale Kohäsion), der graphischen Darstellungen (egal ob GIS-basiert oder im 3-D-Format) und der Modellierungen des raumbezogenen Verhaltens.
ent interests and articulations are derived that in turn lead to different and distinct planning decisions. In addition to demographically defined social categories (children, young adults, older people, migrants, various forms of household), the ISRA is engaged in particular categories of social inequality (class, stratification, and social milieu) and spatially relevant behaviour (housing location choices that result in segregation, gentrification, migration, and integration; mobility and activity space; use of public space). In addition, categories such as lifestyle, creativity, technological affinity, and energy consumption are just as relevant as changes to management and policy (from government to governance) in which cases the discourses on sustainable development and “smart cities” become intrinsically linked. As a result of social change, it is clear that the traditional structural features listed in official statistics provide little insight into which social constellations are actually effective in the field. In turn, this has massive consequences on the meaningfulness of political inferences (for example, on immigration percentages and social cohesion), on graphic representations (whether GIS-based or in 3D), and on the modelling of spatial behaviour.
Wie Soziologie das Spektrum der Raumplanung erweiterte
The second objective of the “new planning culture” was implemented by the ISRA by introducing the concepts of participatory processes, qualitative social research, professional communication as process control, governance, and sustainable spatial development for the first time into the academic programme. The widespread discussion of the current curricula for bachelor’s and master’s degrees in 2011 and 2012 ultimately led to these aspects being integrated and firmly anchored within curriculum design and ultimately espoused by most departments. Social sciences have a broad spectrum of methodologies – this is both strength and weakness at the same time. On the one hand, it fails to provide clarity, while
Das zweite Ziel der „neuen Planungskultur“ wurde vom ISRA umgesetzt, indem in der Lehre Aspekte der Beteiligungsverfahren, der qualitativen Sozialforschung, der professionellen Kommunikation als Prozesssteuerung, der Governance und der nachhaltigen Raumentwicklung erstmalig eingeführt wurden. Die breite Diskussion über die aktuellen Studienpläne für Bachelor und Master im Jahr 2011 bzw. 2012 hat letztlich dazu geführt, dass diese Aspekte akzeptiert, im Studienplan fest verankert und letztlich heute auch von den meisten Fachbereichen mit getragen werden.
How Sociology Expanded the Spectrum of Spatial Planning
Gesellschaftliche Aspekte der Raumplanung, des Städtebaus und der Architektur | 137
Sozialwissenschaften haben ein breites Methoden spektrum – das ist eine Stärke und Schwäche zugleich: Zum einen fehlt es an Eindeutigkeit, zum anderen erleichtert es, inter- und transdisziplinäre Zugänge zu wählen. Im Kontext eines sich ingenieurwissenschaftlich verstehenden Faches bedeutet dies jedoch eine Provokation, weil es die Eindeutigkeiten von (mathematischer) Logik infrage und beispielsweise die Subjektivität der Konstruktion von „Realitäten“ dem gegenüberstellt. Der methodischen Bandbreite entspricht eine große (und widersprüchliche) Paradigmenvielfalt. Es gibt in diesem Zusammenhang zwei bedeutsame Unterschiede der Sozialwissenschaften gegenüber den Technikund Naturwissenschaften: Zum einen sind soziale Phänomene immer von Ort und Zeit abhängig, was eine Herausforderung für die Generalisierbarkeit ist und enorme Folgen für einheitliche Rahmensetzungen hat. Zum Zweiten sind Forschende immer Bestandteil des Forschungsgegenstandes – von daher ist ein Objektivitätsanspruch fragwürdig und es sind überindividuelle Aussagen notwendig. Dies wirkt sich insbesondere in der theoretischen Durchdringung des „Raumes“ aus: Ein administrativ eindeutig definierter Raum ist für die hoheitliche Aufgabe der Raumplanung zentral, er kann typologisiert und verwaltet werden. Soziale und wirtschaftliche Prozesse orientieren sich jedoch an relationalen Räumen, an Prozessen und Strömen und daher an einem subjektiven Raumverständnis. Beide Sichtweisen stehen in ihren grundsätzlichen Annahmen von Menschenbildern und Handlungsspielräumen im Widerspruch. Es ist daher eine Herausforderung, in Lehre und Forschung dieses Wechselverhältnis im Rahmen einer Raumgestaltung fruchtbar zu machen. Besonders wichtig wird dieses Spannungsverhältnis in der Analyse der Raumnutzung und in deren Steuerung im Mobilitätsbereich. Hier stoßen klassische technische Systembetrachtungen und deren „Optimierung“ (rational und eindeutig) auf den Blickwinkel der Nutzenden, denen es darum geht, den Alltag und die daraus abgeleiteten Erfordernisse an die Mobilität aus ihrer Sicht optimal zu gestalten.
138 | Jens S. Dangschat
on the other, it makes it easier to choose interdisciplinary and trans-disciplinary approaches. Within the context of an academic discipline that sees itself as a field of engineering, this is a source of provocation. The ambiguity calls (mathematical) logic into question, confronting instead, for example, the subjectivity of “reality construction”. The methodological range within these fields corresponds to a vast (and contradictory) diversity of para digms. There are two significant differences that exist between social sciences and engineering and natural sciences in this context: Firstly, social phenomena are always dependent upon place and time, which is a great challenge to generalisation and has enormous consequences for the development of common frameworks. Secondly, researchers themselves are always part of the research subject; therefore, a claim to objectivity is questionable at best and explanations that supersede individual perspectives become necessary. This is particularly important for theoretical interpretations of space: An administratively well-defined space is central to the sovereign task of spatial planning and can therefore be typologised and managed. However, social and economic processes are based on relational spaces, on processes and flows, and therefore on a subjective understanding of space. Both views are contradictory in their fundamental assumptions about images of humanity and the scope of perspective. It is, therefore, a challenge to make this interaction fruitful within teaching and research of spatial design. This contrast between fields is particularly important for the analysis of space utilisation and the steering thereof in the field of mobility. In this field, classical technological system considerations and their “optimisation” clash (rationally and clearly) with the perception of those individuals and groups utilising the spaces, whose aim is to optimally organise their everyday lives and mobility needs from their own subjective point of view. The next step for the integration of the ISRA into the TU Wien was the inclusion of two doctoral programmes (URBEM and EWARD). In completing this step, the con-
Der nächste Schritt zur Integration des ISRA in die TU Wien wurde durch das Einbeziehen in den Energie-Schwerpunkt über zwei Doktoratsprogramme (URBEM-DK und EWARD) gegangen. Hier werden die Widersprüche zwischen sozialwissenschaftlichen Paradigmen, Methoden und einem Wissenschaftsverständnis zum „hauseigenen Mainstream“ noch offensichtlicher. Die Herausforderung besteht nun darin, dieses Spannungsverhältnis für innovative Forschung und Lehre nutzbar zu machen – insofern kann eine wettbewerbsorientierte technische Universität auf diese Herausforderung nicht (mehr) verzichten. Wohin geht die Gesellschaft? Eine große Herausforderung ist es, den zunehmend dynamischen sozialen Wandel analytisch, d. h. theoretisch und methodisch, „in den Griff“ zu bekommen. Die zunehmende Verbreitung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK) in den Alltag der Menschen verändert u. a. die Zeitmuster und Raumnutzung, die sozialen Kontakte und die Mobilität. Dabei geht es nicht ausschließlich um eine kritische Annäherung an Big Data und einen wachsenden digital divide, sondern es geht auch darum, diesen technologischen Wandel in seinen mehrfach widersprüchlichen und ambivalenten Auswirkungen auf die Gesellschaft zu erfassen und einzuordnen. In dieser Rolle wäre die Kompetenz des ISRA unerlässlich für eine Reihe von natur- und technikwissenschaftlichen Entwicklungen, insbesondere vor dem Hintergrund, das Mission Statement der TU Wien – „Technik für Menschen“ – nach sozialen Gruppen sinnvoll differenziert zu betrachten.
tradictions between social science paradigms, its methods and understanding of science are clearer to the “inhouse academic mainstream”. The challenge now is to harness this tension for innovative research and teaching – a challenge a competitive technical university cannot forgo. Where is Society Headed? It is a major challenge to ensure that increasingly dynamic social change remains “under control” analytically, i.e. theoretically and methodically. The advent of information and communication technologies (ICT) in the daily life of the public has changed “among many other things” patterns of time and space, social contacts, and mobility. This not only involves a critical approach to “big data” and a growing “digital divide”, it also is becoming more important to capture and to classify this technological change with regards to its multiple, conflicting, and ambivalent impacts on society. In this role, the competence of the ISRA would be essential for a number of scientific and technological developments, particularly in the application of the TU Wien’s mission statement – “Technology for People” – so that social groups may be sensibly perceived as part of a differentiated approach.
Anmerkung/Note 1 Im Jahr 2002 wurde „die Soziologie“ aus dem srf ausgegliedert und als „Institut der Soziologie für Raumplanung und Architektur“ (ISRA) etabliert. Mit Beginn des Jahres 2005 wurde das Department für Raumentwicklung, Infrastruktur- und Umweltplanung gegründet und das ISRA wurde fortan als „Fachbereich Soziologie“ geführt. Auch wenn der Name suggeriert, es handele sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausschließlich um Soziologinnen und Soziologen, spiegelt der ‚staff‘ eine breite sozialwissenschaftliche Kompetenz aus Soziologie, Raumplanung, Ökonomie, Geographie, Urbanismus, Ethnologie und Architektur wider. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist, dass niemand im ISRA an der TU Wien studiert hat (Vielfalt der Ausbildung als Anreiz für Interdisziplinarität und innovative Ansätze in der Raumplanung und Architektur).
Gesellschaftliche Aspekte der Raumplanung, des Städtebaus und der Architektur | 139
Team Regionalplanung und Regionalentwicklung
11 POSITIONEN ZUR REGION 11 REGIONAL APPROACHES Der Fachbereich Regionalplanung und Regionalentwicklung im Department für Raumplanung befasst sich mit Methoden, Prozessgestaltung, Umsetzung und Evaluierung der regionalen Raumplanung und Regionalentwicklung. In Dissertationen, Forschungsarbeiten, Auftragsprojekten, Diplomarbei ten und praxisnahmen Lehrveranstaltungen werden Gemeinde-, Länder- und Staatsgrenzen überschreitende Raumentwicklungsprozesse und -instrumente studiert, konzipiert und in der Umsetzung begleitet. Das Team Regionalplanung und Regionalentwicklung besteht aus Angela Albrecht-Plessl, Chiara Andreotta, Andreas Dillinger, Thomas Dillinger, Hartmut Dumke, Beatrix Haselsberger, Petra Hirschler, Robert Kolerovic, Gabriel Neuner, Pia Kronberger-Nabielek, David Schwab, Nina Svanda und Sibylla Zech. Gemeinsam wurden für die vorliegende Festschrift 11 spannende „Positionen zur Region“ verfasst. Wechselnde Geometrien Politisch-administrative Grenzen definieren Planungsräume. Unser Lebens- und Wirtschaftsraum jedoch ist von funktionalen Zusammenhängen – Einzugsbereichen, Alltagsmobilität und räumlichen Identitäten – geprägt. Regionen müssen nicht einmal flächig zusammenhängen. Zehn Gemeinden, die in unterschiedlichen Bundesländern liegen, sind dabei, eine „Region, die Zukunft heißt“ zu gründen. Das Konsulat www.zukunftsorte.at in Wien ist schon eröffnet. In der regionalen Entwicklungsplanung haben wir die Region als Gegenstand der Planung immer wieder neu zu definieren und im Beteiligungsprozess zu kommunizieren. Der Begriff „Region“ ist „fuzzy“,
The Regional Planning and Development Research Group in the Department of Spatial Planning works with methods, process design, implementation, and evaluation of regional land use planning and development. Processes and tools of spatial development that supersede municipal, provincial, and national boundaries are studied, designed, and supported through their implementation. The Regional Planning and Development Team members are Angela Albrecht-Plessl, Chiara Andreotta, Andreas Dillinger, Thomas Dillinger, Hartmut Dumke, Beatrix Haselsberger, Petra Hirschler, Robert Kolerovic, Gabriel Neuner, Pia Kronberger-Nabielek, David Schwab, Nina Svanda and Sibylla Zech. Together, they have composed the following 11 exciting regional approaches for the volume in your hands. Changing Geometries Political and administrative borders define planning areas. Our living and economic environment, however, is shaped by functional relationships – catchment areas, everyday mobility, and spatial identities. Regions do not even have to adjoin each other. Ten municipalities located in different provinces are currently founding a “Region Called the Future”. There is already a consulate for www.zukunftsorte.at in Vienna. In regional development planning, we must continually redefine the region and convey it in the participation process as the focus of planning. The term region is “fuzzy” and requires specific design alternatives depending on the task at hand. MetrALPolis – the concept of one region made up by the Alpine region and the Central European metropolitan
11 Positionen zur Region | 141
je nach Aufgabe braucht es spezifische Gestaltungsmöglichkeiten. MetrALPolis – die Idee einer Region, die den Alpenraum und die mitteleuropäischen Metropolregionen umfasst – spielt mit dem Gedanken variabler Geometrien mit wechselnden strategischen Koalitionen. Regions Are Not Static Spatial Compartments They are constantly in flux. Regional planning has to reak away from the shackles of pre-existing “container b thinking” and the taken-for-granted “borders of comfort”. Regional planners must understand that perfect territorial enclosures do not exist for everything and, moreover, that we live in an intertwined network of spaces. Mut zur Lücke! Recherchieren, Varianten entwickeln, aushandeln und schließlich verbindlich verankern – Raumplanung braucht Zeit. Angesichts von Zerstörungen durch Naturkatastrophen und Kriege braucht es aber eine Raumplanung, die im Kontext mit Wiederaufbauaktivitäten rasch und strategisch erfolgt. Langwierige Verfahren führen dazu, dass die Pläne schon vor ihrem Inkrafttreten von der Realität überholt werden. Planungsmethoden mit Mut zur Lücke und Flexibilität können hingegen zu einer geordneten Entwicklung von Gebieten mit schwach ausgebildeten oder fehlenden Planungsstrukturen beitragen. Smart Sharing – Gemeinsames Nutzen und Teilen statt Besitzen als Planungskonzept Das Time Magazin listet Sharing als eine der zehn großen Ideen, die die Welt verändern werden.1 Globale Internetplattformen und lokale Vereine laden zum privaten Teilen ein – von der Couch über Zimmer und Apartments, Büros, Lagerräume, Sporthallen bis hin zu Parkplätzen, Gartenbeeten und Autos. Sharing ist ein smarter Weg, Ressourcen und Raum zu sparen. Räume und Fahrzeuge gemeinschaftlich zu nutzen verändert unsere Bezugsräume. Die Nachbarschaft – das Quartier – gewinnt an
142 | Team Regionalplanung und Regionalentwicklung
regions – experiments with the notion of variable geometries with changing strategic coalitions. Regions Are Not Static Spatial Compartments They are constantly in flux. Regional planning has to break away from the shackles of pre-existing “container thinking” and the taken-for-granted “borders of comfort”. Regional planners must understand that perfect territorial enclosures do not exist for everything and, moreover, that we live in an intertwined network of spaces. The Courage to Leave Gaps! Researching and designing alternatives, negotiating, and ultimately making binding decisions – spatial planning takes time. Given the destruction of natural catastrophes and wars, however, we often need quick and strategic regional planning. Lengthy procedures mean that plans are already outstripped by reality before they go into effect. Planning methods with flexibility and the courage to leave gaps, on the other hand, can help bring orderly development to areas with poorly developed or no planning structures at all. Smart Sharing – A Planning Concept for Shared Use Instead of Ownership Time Magazine lists sharing as one of the ten great ideas that will change the world.1 Global internet platforms and local groups invite people to share privately – from sofas, rooms, and apartments, offices, warehouses, and sports complexes up to parking lots, gardens, and cars. Sharing is a smart way to conserve resources and space. The collective use of spaces and vehicles changes our spatial references. The neighbourhood – the district – grows in significance, and the relevance of municipal boundaries recedes in a region where the best locations are used and shared.
Bedeutung, die Gemeindegrenzen verlieren an Alltagsrelevanz in einer Region, wo der jeweils beste Standort genutzt / „ge-shared“ wird.
Abb.1. MetrALPolis – wechselnde Geometrien im Europa der Regionen Figure 1: MetrALPolis – Changing geometries in a Europe of Regions.
Die Regionalplanung nach ihren künstlerischen Grundsätzen
Regional Planning According to Artistic Principles
Es ist schon eine Kunst, wie periphere Regionen bis jetzt überlebt haben, Regionen, die in den letzten Jahrzehnten ihre wirtschaftliche Basis, ihre Jugend und damit ihre Zukunft an die Städte und Agglomerationen verloren haben. Wie kann die Daseinsvorsorge für mehr Bevölkerung auf der einen Seite gewährleistet und anderenorts für immer weniger Menschen aufrechterhalten werden? Straßen, Stromleitungen, Wasserversorgung, Kanal, Ärz-
It is truly an art, the way peripheral regions have survived until now, regions that have lost their economic base, their youth, and thus their future to cities and agglomerations. How can essential services be provided for a growing population in one area, and still maintained for fewer and fewer people elsewhere? Streets, power lines, water, sewers, doctors, schools, and grocery stores. As patient, the “land” is almost clinically dead, and the “city” is ailing. Drive through the countryside – you’ll find
11 Positionen zur Region | 143
te und Ärztinnen, Schule, Lebensmittelgeschäfte. Der Patient „Land“ ist klinisch fast schon tot, der Patient „Stadt“ kränkelt vor sich hin. Fahre durch das Land – du findest die Patienten in Österreich, wo kostspielige Intensivmedizin das Überleben sichert. Fahre weiter nach Ost- und Südosteuropa – da ist der ländliche Raum schon ausgestorben. Daher: Die Region mit ihren Städten und Gemeinden als Gesamtsystem begreifen und planen. Die Lösung vieler Probleme der Stadt liegt in der Peripherie und umgekehrt. Le nuove regioni Siamo ormai giunti nel 2051, ora sono lontane le prime caotiche decadi del 2000. All’epoca la crisi finanziaria soffocava i ceti meno abbienti, mentre i crescenti nazionalismi nutrivano movimenti anti-europeisti. Sorprendentemente quel processo non portò allo sgretolamento dell’Unione Europea, ma alla realizzazione di un tessuto interregionale. L’investimento all’epoca fatto sulla ‘generazione Erasmus’ ha così portato ottimi risultati in termini di accessibilità di territori e di cooperazione interregionale. Quello che rimane da capire è se, a differenza delle ormai obsolete nazioni, le nuove regioni abbiano veramente implementato il benessere sociale piuttosto che generato isolati ceti tradizionalisti. Verbindlichkeits- und Raumwirksamkeitsforschung tut not! Das Methoden-Potpourri der Raumplanung – qualitative und quantitative Zugänge der räumlichen Analyse, des Entwurfs und der Kommunikation – ist bunt wie nie zuvor. Das räumliche WAS war noch nie gründlicher erklärbar. Dies gilt noch nicht für das WIE – nämlich die Verbindlichkeitsmechanismen und ihre Raumbezüge. Ganz besonders „untersteuert“ sind schwach institutionalisierte Raumebenen: Stadt- und Ortsteile, aber auch (Stadt-) Regionen. Nachverdichtung, Funktionsmischung, kurze Wege, faire und leistbare Daseinsvorsorge brauchen ein
144 | Team Regionalplanung und Regionalentwicklung
the patients in Austria, with costly intensive medical care ensuring their survival. Go further east, towards Eastern and Southeastern Europe – and the rural environment is already extinct. We need to understand and plan the region with its cities and towns as an overall system. The periphery is the key to solving many problems of the city, and vice versa. The Current Regions We have now reached 2051, and the first chaotic decades of the 21st century are far away. At that time, the financial crisis choked the lower and middle classes, while the growing nationalisms fed the anti-European movements. Surprisingly, the process did not cause Europe to crumble, instead leading to the implementation of an interregional “fabric”. The big great investments of the “Erasmus generation” are today bringing optimum results in terms of accessibility of spaces, and territorial cooperation. It must be understood that, differently from the now-obsolete nations, the current regions are implementing social wellbeing rather than generating small, isolated traditionalist groups. Research on Civility and Spatial Impact Is Essential! The potpourri method of planning – qualitative and quantitative approaches of spatial analysis, design, and communication – is more varied than ever. The WHAT of space has never been explained more thoroughly. However, this is not yet true for the HOW – namely, binding mechanisms and their spatial relationships. Weakly institutionalised levels of space in particular are “undermanaged”: cities and districts, as well as (urban) regions. Densification, mixed-use development, short travel routes, and fair and affordable public services need a set of generally applicable management instruments, especially for existing structures – because these (and not new construction) comprise 95% of the spatial fabric.
Set an allgemein anwendbaren Steuerungsinstrumenten insbesondere für bestehende Strukturen – denn diese (und nicht der Neubau) stellen 95% der Raumsubstanz. Zu viel evaluiert und zu wenig gelernt! Innovationsorientierte Regionalentwicklung hat die Weiterentwicklung der Region gemeinsam mit den Menschen vor Ort zum Ziel. Evaluierungen dürfen daher nicht Selbstzweck sein. Sie sollen vielmehr das praxistaugliche und lösungsorientierte Lernen der Trägerinnen und Träger der Entwicklung vor Ort sowie der Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wissenschaft ermöglichen und fördern. Регионы без границ В Европейском Союзe государственные границы и границы федеральных земель теряют все больше значение. Вместо этого нужно было бы создавать лучше одну Европу, которая функционирует на региональном уровне. Новые (старые) региональные понятия как Альпийская Адриатика, Рейн – Боденское озеро, Южная Богемия, Долинa-Дунай, Южная Моравия и Западая Паннония указывают другую точку зрения на сотрудничающую Европу.
Too Much Evaluation, Not Enough Education! The goal of innovative regional development is the advancement of the region together with the people living there. Evaluations must thus not be an end in themselves. Instead, they should facilitate and promote practicable and solution-oriented learning among drivers of development as well as political and academic representatives. Regions without borders In the European Union, national and provincial borders are becoming less important. It would be better to create a Europe that functions on the regional level. New (old) terms for regions such as the Alpenadria, RheinLake Constance, South Bohemian Danube Valley, South Moravia, and West Pannonia point to different ways of looking at a cooperative Europe. A Region Needs Democratic Legitimation The regional sphere needs to be infused with competence and expertise. Potential models for this are district and local authorities, municipal incorporation, and direct regional democracies.
A Region Needs Democratic Legitimation Regions Are Defined by People, Not Boundaries The regional sphere needs to be infused with competence and expertise. Potential models for this are district and local authorities, municipal incorporation, and direct regional democracies. Die Region braucht demokratische Legitimation Es gilt die regionale Ebene handlungsfähig zu machen und mit Fachkompetenz auszustatten. Modelle dafür wären beispielsweise die Gebiets- oder Verbandsgemeinde, die Gemeindefusion und regionale direkte Demokratie.
It is the people who traverse, develop, and consume a region. Regions are areas that unify biophysical and social space. Many challenges of the 21st century, such as climate change, energy revolution, eco-efficient urbanisation, and green transport management, require an integrated and unbounded approach. For this reason, regions will become even more important to spatial planning in the future.
11 Positionen zur Region | 145
Mensen en niet grenzen maken een regio Mensen en niet grenzen maken een regio. Ze reizen er rond, bouwen en consumeren. Regio´s zijn gebieden die het bio-fysische met het sociale domein verbinden. Veel uitdagingen van de 21ste eeuw zoals klimaatverandering, energietransitie, eco-efficiënte verstedelijking en milieuvriendelijk verkeersmanagement vragen om een integrale en grensoverschrijdende aanpak. Dit is waarom regio´s in de toekomst nog hoger op de planningsagenda´s moeten staan.
146 | Team Regionalplanung und Regionalentwicklung
Anmerkung/Note 1 Bryan Walsh, “Today‘s Smart Choice: Don‘t Own. Share”, Time, Thursday 17 March 2011, http://content.time.com/time/specials/ packages/article/0,28804,2059521_2059717_2059710,00.html (19.3.2015).
Oliver Frey
FASZINATION URBANISTIK FASCINATING URBANITY, FASCINATING URBANISM Viele Wege führen in die Stadt. Städte besitzen Anziehungskraft und sind für viele Menschen, Unternehmen, kulturelle Institutionen, politische Organisationen, aber auch für Werthaltungen und Ideen ein kreativer Nährboden. Mal ähnelt ihre Struktur einem Labyrinth ohne klares Zentrum, mal zeigt sie eingeschriebene, anarchische, unkontrollierbare Lebensweisen, mal bilden Städte übergeordnete Knotenpunkte mit herausragender architektonischer Gestaltung. Mitten im widerspruchsvollen Kräftefeld zwischen räumlichen, sozialen, materiellen, kulturellen Bedingungen ist Stadtplanung der Einflussnahme von Interessengruppen ausgesetzt und muss um Ausgewogenheit und Unabhängigkeit ihrer Steuerungskompetenz und den damit verbundenen Zielsetzungen ringen. Hier kommt die wissenschaftliche Urbanistik ins Spiel: Sie versucht, stadträumliche Prozesse und Strukturen zu systematisieren, zu verstehen und zu erklären. Das weite Feld der Urbanistik umfasst die Disziplinen Stadtsoziologie, Stadtgeographie, Städtebau und Stadtplanung. Die Urbanistik untersucht soziale Strukturen der Stadtgesellschaft, urbane Lebensstile, Stadtentwicklungsprozesse, architektonische und städtebauliche Gestaltungen sowie steuernde Zielsetzungen der Stadtplanung.1 Die Komplexität der Aufgabenstellung des Arbeitsbereichs Urbanistik führt zu einer interdisziplinären Arbeitsweise, die sich im Zusammenspiel einer wissenschaftlichen Analyse mit praktischem Gestaltungswissen und räumlichen Steuerungstheorien äußert.
Many roads lead to the city. Cities are attractive and offer a fertile and creative breeding ground to many people, enterprises, cultural institutions, and political organisations, as well as to values and ideas. Their structure may sometimes resemble a labyrinth with no clear centre, may sometimes reveal engrained anarchic and uncontrollable lifestyles, and sometimes may be superordinate hubs of outstanding architectural design. In the midst of a contradictory field of forces between spatial, social, material, and cultural conditions, urban planning is exposed to the influence of stakeholders and must fight for balance and the independence of its steering competence and related goals. This is where scientific urbanism enters the picture: It tries to systematise, understand, and explain processes and structures in urban space. The broad field of urban studies spans the disciplines of urban sociology, urban geography, urban development, and urban planning. We study within the Centre of Urbanism social structures of urban society, urban lifestyles and mentalities, urban development processes, architectural and urban identities as well as the steering goals of urban planning.1 The complex tasks of Urbanism result in an interdisciplinary approach, which is manifest in the interplay of scientific analysis, practical design knowledge, and spatial steering theories. The City as a Space of Experience – Urbanism as a Field of Work First, you have to walk your feet to shreds in the city: go out into the urban field, sample the air in restaurants
Faszination Urbanistik | 147
Stadt als Erfahrungsraum – Urbanistik als Arbeitsbereich Man muss sich erst die Füße in der Stadt wund laufen: Hinausgehen ins urbanistische Feld, schnuppern in den Gastwirtschaften, sich in unterschiedlichen sozialen Milieus bewegen, Lebensstile und Lebensweisen erkunden und Stadtpolitik intensiv und kritisch verfolgen. Nicht unbedingt reine wissenschaftliche Tätigkeiten: „Walks on the Wild Side“2 – damit beginnt die Geschichte der Stadtforschung für Rolf Lindner, der die Grundlagen der Stadtforschung in Form einer Reportage beschreibt. Stadtplanung sollte man dort studieren, wo ein reichhaltiger Erfahrungsschatz über die Stadtgesellschaft zur Verfügung steht – so jedenfalls lauten oftmals Empfehlungen in internationalen Studienratgebern. Der Arbeitsbereich Urbanistik bezieht sich daher in seinen fachlichen Analysen und Konzeptionen in Lehre, Forschung und Beratungstätigkeit sehr stark auf die Erfahrungswelt der Stadtgesellschaft. Für die Reflexion über wissen-
148 | Oliver Frey
Abb.1: Stadtsilhouette: Die TU Wien am Karlsplatz im sich wandelnden Stadtraum verbildlicht Wechselwirkungen zwischen Stadtgesellschaft und Wissenschaft. Figure 1: Urban silhouette: The TU Wien at Karlsplatz in a changing urban space epitomises the reciprocity of urban society and science.
and bars, move in different social circles, explore lifestyles and ways of life, and acutely and critically follow city politics. These are not necessarily purely scientific activities: “Walks on the Wild Side”2 – this is where the history of urban research begins for Rolf Lindner, who describes the foundations of urban research in a kind of reportage. Urban planning should be studied where there is a wealth of experience of urban society available – or at least that is what the international study guides often recommend. Through expert analyses and concepts, the Interdisciplinary Centre of Urbanism therefore draws this wealth of urban society experience into its teaching, research, and consulting. In order to reflect on scientific urban theory and its practice-oriented development, ob-
schaftliche urbane Theorien und deren praxisorientierte Entwicklung spielen Beobachtungen von Randgruppen der Stadtgesellschaft oder auch das informelle Gespräch mit Entscheidungsträgern bedeutsame Rollen: Die Faszination Urbanistik entsteht auch aus Verknüpfung urbaner Themen „von unten“ mit wissenschaftlich fundierten Theorien und Modellen akademischer Stadtforschung.3 Im Folgenden werden aus den Themenfeldern der wissenschaftlichen Urbanistik vier Schwerpunktsetzungen des Arbeitsbereiches Urbanistik im Rahmen von Forschung und Lehre an der TU Wien kurz skizziert.4 Typisch Stadt – Charakter der Stadt – städtische Kulturformen Was das Wesen der Stadt sei, ist eine alte philosophische, städtebauliche, aber auch stadtplanerische Frage. Die Rolle sozialräumlicher Identitätskonstruktionen ist mehr als nur eine Suche nach einem Stadtslogan für die Marketing- und Imageabteilung einer Stadt. So lässt sich das
Abb. 2: Zacherl-Fabrik in Wien-Döbling: Begegnungen zwischen Orient und Okzident schon vor 150 Jahren transformieren vorhandene städtische Identitäten und lassen neue Ortsidentitäten manifest werden. Figure 2: Zacherl factory in the Vienna Döbling district: Encounters between the Orient and the Occident transformed existing urban identities as much as 150 years ago, allowing new local identities to manifest.
servations of marginal groups of urban society and informal discussions with decision-makers are important: the fascination with urbanity also arises from the correlation of urban issues “from below” with established scientific theories and models of academic urban research.3 Below, we will sketch four focal points of the Centre of Urbanism arising from the thematic fields of scientific urban research and teaching at the TU Wien.4 Typically Urban – Characters of the City Finding the true essence of a city is an age-old philosophical question of urban development and urban
Faszination Urbanistik | 149
Abb.3: Ankerbrot-Fabrik in Wien-Favoriten: Kreative Räume auch für soziale Stadtentwicklung durch die Einbettung in benachteiligte Quartiere und Öffnung für sozial benachteiligte Jugendliche. Figure 3: Ankerbrot Factory in Vienna’s Favoriten district: Creative spaces for social urban development by embedding in disadvantaged neighbourhoods and opening to socially disadvantaged youth.
Wesen einer bestimmten Stadt nie zureichend bestimmen, denn die Konstruktionsprozesse städtischer Identitäten verlaufen in jeder Stadt anders. Sie tradieren sich in Mentalitäten, sie manifestieren sich im Gebauten oder transformieren sich in Diskursen, Umbauten oder Unausgesprochenem. Dadurch entstehen Sinn- und Kulturformen einer Stadt, die sowohl Differenzierungen innerhalb einer Stadt als auch zwischen Städten hervorbringen und dabei im Sinne von Inklusions- und Exklusionsprozessen innerhalb einer Stadtgesellschaft wirksam werden.
planning. The role of socio-spatial identity construction is more than simply the search for a city slogan by its marketing and image department. Thus, the essence of a particular city can never be sufficiently defined, for the processes of constructing urban identities are different for every city. These processes are passed along through mentalities, manifest themselves in the built heritage, and are transformed by discourse, conversions, and the unexpressed. This leads to the formation of forms of sense and a culture of a city that generate differentiations both within a city and between cities, thus becoming effective within urban society through processes of inclusion and exclusion. Creativity and Urban Culture Cities are fertile ground for creative ideas, innovative enterprises, technical innovation, specific values, but also for problem solutions off the beaten track, in economy as well as in civil society. The field of Creative Cities examines the increase in the importance of creative knowledge, technological innovation, and cultural re-valuation for urban society and its development. Our Centre discusses the “realisation of value” of creative resources for the city and its development beyond markets and the state, with a focus on those areas of creative and cultural economy that function as a new motor for the urban development of creative milieus operating at a distance from the markets.
Kreativität und Kultur der Stadt “Low-potential” Urban Spaces Städte sind ein Nährboden für kreative Ideen, innovative Unternehmungen, technische Innovationen, spezifische Werthaltungen, aber auch für Problemlösungen jenseits traditioneller Pfade sowohl in der Ökonomie als auch in der Zivilgesellschaft. Unter dem Themenfeld Kreative Stadt wird die Zunahme der Bedeutungen von kreativem Wissen, technischen Innovationen und kulturellem Wertewandel für die Stadtgesellschaft und deren Entwicklung untersucht. Im Arbeitsbereich wird die „In-Wert-Setzung“ von kreativen Ressourcen jenseits von Markt und
150 | Oliver Frey
Urban exploration in disadvantaged urban quarters often shakes people’s faith in the predominant economic promises of growth. Growing economic and spatial polarities, increasingly fierce competition for resources, and the loss of city government’s ability to steer challenge the validity of purely growth-oriented concepts. The Centre of Urbanism focus on “low-potential urban spaces” aims to accommodate future-oriented, strategic basic research marked by a comprehensive change
Staat für die Stadt und die Stadtentwicklung diskutiert. Dabei ist der Blick auf jene Bereiche der Kreativ- und Kulturwirtschaft gerichtet, welche als neuer Motor von Stadtentwicklung eher marktferner, kreativer Milieus fungieren. Potentialarme Stadträume Stadterkundungen in benachteiligten Stadtquartieren erschüttern oft den Glauben an die vorherrschenden ökonomischen Wachstumsversprechungen. Die zunehmenden ökonomisch-räumlichen Polaritäten, heftiger werdende Verteilungskämpfe sowie der hoheitliche Steuerungsverlust in vielen Städten stellen zunehmend die reine Wachstumsorientierung in Frage. Die Schwerpunktsetzung des Arbeitsbereiches Urbanistik zu „potentialarmen Stadträumen“ soll eine vorausschauende, strategisch konzipierte Grundlagenforschung aufnehmen, welche durch einen umfassenden Perspektivenwechsel geprägt ist: Nicht durch einen Blick „von außen“, sondern durch eine endogene Betrachtung werden nicht genutzte Ressourcen baulicher, sozialer, kultureller oder auch ökonomischer Art in den Vordergrund gerückt. Mit dieser Perspektive „von innen“ kann eher eine „In-WertSetzung“ in den Quartieren selbst erfolgen. Diese in vielen kleinen Projekten zutage tretende, hoffnungsvolle Strömung eines „Urbanismus von unten“ trägt zur Neuformulierung rechtlicher wie planerischer Instrumente der Stadtplanung wesentlich bei. Soziale Stadt Das Modell der Europäischen Stadt5 war stets mit dem Leitbild einer sozial-integrativen Stadtentwicklung und mit Urbanität fördernden Strukturen verbunden. Durch Gentrification, Neo-Liberalismus und politische Steuerungsschwäche werden die Innenstädte jedoch vermehrt zu exklusiven Orten für einkommensstarke Haushalte umgebaut. Aus diesem Grund stellt sich die Frage der Sozialen Stadt neu: Welche Stadt für welche Bevölkerung werden wir in Zukunft haben bzw. bauen?
Abb.4: Zacherl-Fabrik in Wien Döbling: In-Wert Setzung eines alten Fabrikgeländes für Kunst und Kultur Figure 4: Zacherl factory in the Vienna Döbling district: Re-valuation of an old factory grounds for art and culture.
of perspective: Unused resources, whether built, social, cultural, or economic, are brought to the forefront not by an “external” view, but by endogenous perspectives. This “internal” perspective is more likely to result in a “realisation of value” within these neighbourhoods. This promising current of “urbanism from below” surfaces in many small projects and offers an essential contribution to reframing the legal as well as the planning tools of urban planning. Socially smart City The European city model5 has always been connected to the concept of socially integrative urban development and structures supporting urbanity. Gentrification, neoliberalism, and weak political steering, however, has increasingly recast inner cities as exclusive sites for high-income households. Therefore, the question of the Social City must be reformulated: In the future, what kind of city are we going to build and for which inhabitants? In this thematic field at the Centre of Urbanism aspects of social housing policy relate to the guiding principles and programmes of the Social City are key aspects: How can, for example, large housing estates be established and maintained as an integral and necessary element of fair housing supply in a metropolis? Particularly in light
Faszination Urbanistik | 151
of the current growth spurts of many cities, the problem of the future viability and role of large housing estates for the entire city is relevant once more. Centre of Urbanism as a platform
Abb. 5: Alt-Erlaa: Großsiedlungen weiterbauen! Figure 5. Alt-Erlaa: Continue building large housing estates!
In diesem Themenfeld des Arbeitsbereiches Urbanistik spielen Aspekte der Sozialen Wohnungspolitik im Hinblick auf das Leitbild und die Programme der Sozialen Stadt eine zentrale Rolle: Wie können z. B. auch Großwohnsiedlungen als integraler und notwendiger Teil einer sozial gerechten, großstädtischen Wohnungsversorgung aufgebaut und erhalten werden? Insbesondere anlässlich der gegenwärtigen Wachstumsschübe vieler Städte stellt sich die Zukunftsfähigkeit und Bedeutung der Großwohnsiedlungen für die Gesamtstadt neu. Wohin geht die Urbanistik? Der Arbeitsbereich Urbanistik will von seiner „Heimat“ aus – dem Departement für Raumplanung – weitere Streifzüge
152 | Oliver Frey
The Centre of Urbanism wants to continue its exploratory outings – based out of its “home”, the Department of Planning – and expand its field of action: this scientific exchange is facilitated by participating in (virtual) expert networks.6 This is aimed at the further internationalisation of the centre, which intensifies the description of differences and harmonies in the “triad” (of urban development, urban planning, and urban society). Our goal is to apply insights gleaned from the international context to local situations in Vienna, and to be at the forefront of new problems, research approaches, and methods. It will definitely be true for future (and sometimes virtual) explorations: Urbanism will move with the times and, in the race for new insight, it will sometimes even manage to be a step ahead. Another gaze is directed inwards, towards the profile of the Faculty. The Centre of Urban Studies continues to be committed to the 2004 conceptual redesign of our Department: the horizontal organisation of the work groups aims to create research structures that enable us to increasingly prioritise tasks that require an interdisciplinary approach. At our faculty, urbanism is an open field of cooperation between different academic approaches. Through voluntary associations of colleagues, we are able not only to promote transdisciplinary research and teaching within the field of Spatial Planning, but also to develop a specific new culture of research and an innovative understanding of teaching. Since 2004, many narrow departmental dynamics have been pried open – it is hard to imagine today how much conviction and patience was necessary for this “opening up of closed institutional systems” – and expansion has moved into new “soft” fields of learning that go beyond a strongly technology- and reason-oriented view of teaching. However, even today, the increased opening of science to-
Abb.6: Gursky-Montparnasse: Welches Modell der Europäischen Stadt für die Zukunft? Figure 6: Gursky-Montparnasse: Which is the model for the European city of the future? Abb.7: Foto-Realismus von Christopher Krzizek in New York: Die Stadt, ein Stillleben. Figure 7: Photo-realism by Christopher Krzizek in New York: The City, a Still Life.
unternehmen, um sein Aktionsfeld zu erweitern: Diesen wissenschaftlichen Austausch ermöglicht die Teilnahme an (virtuellen) fachlich orientierten Netzwerken.6 Es wird damit eine weitere Internationalisierung des Arbeitsbereiches angestrebt, um dann verstärkt Unterschiede und Harmonien im „Dreiklang“ (Stadtentwicklung, Stadtplanung und Stadtgesellschaft) beschreiben zu können. Ziel ist es, diese international gewonnenen Erkenntnisse auch auf die lokale Situation in Wien umzulegen und mit neuen Themen, Forschungsansätzen und Methoden an vorderster Front zu stehen. Wobei für diese künftigen (u. a. virtuellen) Erkundungstouren sicher gilt: Die Urbanistik geht mit der Zeit, und im Wettlauf um die rechte Erkenntnis ist sie ihr manchmal sogar um eine Nasenlänge voraus. Ein weiterer Blick ist nach innen gerichtet, auf das Profil der Fakultät: Der Arbeitsbereich Urbanistik fühlt
wards practice and civil society and the communication of research results to an interested public remain tough but necessary tasks.7 The Centre of Urbanism will have a function as a scientific interface between urban development, urban sociology, and urban planning, and remain an open platform for interested persons. Following the aims of modern science communication, the centre should also provide consulting services for urban politics and administrations. It should also offer a stage for urban policy movements, urban activities, subcultural initi-
Faszination Urbanistik | 153
sich weiterhin der konzeptionellen Neugestaltung des Departments im Jahr 2004 verpflichtet. Mit horizontal institutionell verankerten Arbeitsbereichen sollten Strukturen geschaffen werden, um sich in der Forschung verstärkt Aufgaben widmen zu können, die interdisziplinäre Ansätze zur Voraussetzung haben. Die Urbanistik ist ein offenes Feld der Kooperation unterschiedlicher wissenschaftlicher Zugänge an unserer Fakultät. Durch freiwilligen Zusammenschluss von Kolleginnen und Kollegen kann nach wie vor nicht nur die transdisziplinäre Forschung und Lehre innerhalb der Raumplanung gefördert, sondern auch eine spezifische neue Forschungskultur und innovatives Lehrverständnis weiterentwickelt werden. Zwar sind seit 2004 viele enge Fachbereichslogiken aufgebrochen worden – wie viel Überzeugungskraft und Ausdauer dieses „Öffnen von geschlossenen Institutssystemen“ und die Erweiterung durch neue „weiche“ Lehrfelder jenseits einer stark technisch-rational orientierten Lehrauffassung erforderte, kann man sich heute nur noch schwer vorstellen. Doch auch gegenwärtig bleibt die verstärkte Öffnung der Wissenschaft zu Praxis und Zivilgesellschaft sowie die Vermittlung wissenschaftlicher Ergebnisse an die interessierte Öffentlichkeit eine mühsame, aber notwendige Aufgabe.7 Der Arbeitsbereich Urbanistik möchte weiterhin seinen Beitrag als wissenschaftliche Schnittstelle zwischen Städtebau, Stadtsoziologie und Stadtplanung leisten und sich für alle Interessierten als Plattform öffnen. Im Sinne moderner Wissenschaftskommunikation soll der Arbeitsbereich auch als Beratungsgremium für Stadtpolitik und Stadtverwaltung zur Verfügung stehen. Auch für stadtpolitische Bewegungen, urbane Aktivitäten oder subkulturelle Initiativen soll er zum Austausch von Ideen und Visionen über die Stadt eine Bühne bieten. Die Faszination der Urbanistik wird so bestehen bleiben und weiterwachsen und sich für alle Interessierten als Plattform anbieten.
154 | Oliver Frey
atives, for the exchange of ideas, and visions of the city. This will maintain and increase the fascination for urbanism, and its platform will remain open to all stakeholders. Anmerkungen/Notes 1 Oliver Frey/Florian Koch (Hg.), Positionen zur Urbanistik II. Gesellschaft, Governance, Gestaltung, in der Reihe: Stadt- und Raumplanung/Urban and Spatial Planning Bd. 9, Wien 2011. 2 Rolf Lindner, Walks on the Wild Side. Eine Geschichte der Stadtforschung, Frankfurt/M./ New York 2004. 3 Oliver Frey/Florian Koch (Hg.), Positionen zur Urbanistik I. Stadtkultur und neue Methoden der Stadtforschung, Berlin-Münster-Wien-Zürich-London 2011. 4 Siehe auch http://info.tuwien.ac.at/urbanistik/ (03. 08. 2015). 5 Oliver Frey/ Florian Koch (Hg.), Die Zukunft der europäischen Stadt. Stadtpolitik, Stadtplanung und Stadtgesellschaft im Wandel, Wiesbaden 2011. 6 Netzwerke wie Research Committee 21, AESOP, Akademie für Raumplanung ARL, Sektion Stadtsoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, RT9 Sociologie de l’urbain et des territoires der AFS. 7 Siehe z. B. Oliver Frey, Zukunft der Stadt, in: Spektrum der Wissenschaft, Mai 2015 (i. Ersch.).
Claudia Yamu, Andreas Voigt
WEGE IN DIE STADT DER ZUKUNFT PATHS TO THE CITY OF THE FUTURE „[…] Jedenfalls bin ich überzeugt, daß der nicht würfelt.“1 Digitale Modelle und Simulationen unterstützen Planung und Planungsprozesse in unterschiedlichsten Phasen und Fragestellungen. Sie ermöglichen sowohl eine Übersicht über als auch eine Einsicht in komplexe räumliche und damit zusammenhängende Fragestellungen (z. B. begrenzte Zeitressourcen und unterschiedlichste Sichtweisen von Entscheidungsträgern), welche gelöst werden wollen. Die entwickelten Planungsstrategien auf verschiedensten Maßstabsebenen dienen als „Richtschnüre in die Zukunft“.2 Raumbezogene Modellbildung und Simulation sind für sämtliche Planungs- und Gestaltungsprozesse in Raumplanung, Architektur und benachbarten Disziplinen wichtige Hilfsmittel.
“[…] I, for one, at any rate am convinced he does not play dice.”1 Digital models and simulations support planning and planning processes at different stages and for diverse problems. They allow for an overview as well as for insights in complex spatial and associated issues (e.g. limited time resources and the different points of view of decision-makers) that need to be solved. The various planning strategies that have been developed on different scales serve as “guidelines to the future”.2 Space-related model formation and simulation are important tools for all planning and design processes in spatial planning, architecture, and associated fields. Multi-scale Transdisciplinary Strategies
Multiskalare, transdisziplinäre Strategien In diesem Kontext entwickelt, forscht und arbeitet der Arbeitsbereich Räumliche Simulation und Modellbildung mit dem Stadtraum-Simulationslabor. Die Auslotung von disziplinären Grenzen sehen wir als Herausforderung, um mit visionären Konzepten und neuen Modellen zu Raum und Stadt3 – oszillierend zwischen Vergangenheit und Zukunft im Sinne eines evolutionären Ansatzes – künftige Stadträume experimentell zu konzipieren und in konkreten Projekten zur Diskussion zu stellen sowie ihre räumlichen Auswirkungen zu erkunden. Gerade 3D-Modelle unterstützen eine individuelle Informationskommunikation zwischen unterschiedlichen Interessensträgerinnen und -trägern, können Inkonsistenz im Planungs- und Entwurfsprozess vermeiden und unterstützen Entscheidungsprozesse.4 Aus diesem Grund
This is the context of the Interdisciplinary Centre of Spatial Simulation and Modelling’s research, development, and work with the Urban Spatial Simulation Lab. We regard exploring the limits of disciplinary boundaries as a challenge that allows us to evolve visionary concepts and new models of space and cities3 – while remaining committed to an evolutionary approach oscillating between the past and the future – and thereby to experimentally draft future urban spaces, to discuss them based on concrete projects, and to explore their spatial ramifications. 3D models in particular support a tailored communication of information between different stakeholders, and they may help to avoid inconsistencies in the planning and design process, as well as supporting decision-making processes.4 For this reason, the Urban Space Simulation Laboratory is equipped with a 3D VR-rear projection
Wege in die Stadt der Zukunft | 155
ist das Stadtraum-Simulationslabor inter alia mit einer 3D-VR-Rückprojektionsumgebung und einer Oculus Rift ausgestattet. Digitale Modelle können als virtuelle Realität (VR) in jedem beliebigen Maßstab – „multiskalar“5 – bis hin zum Maßstab 1:1 stereoskopisch-dreidimensional mittels Echtzeitsimulation und vielfältiger Blickwinkel dargestellt und erlebt werden. Die Forschungsfelder des Stadtraum-Simulationslabors (SimLab) orientieren sich an heutigen und zukünftigen Erfordernissen, Herausforderungen und Problemstellungen. Unsere praxisorientierte Forschung ist darauf ausgelegt, eine gute Relation zwischen Einsatz und Nutzen zu ermöglichen. In Verknüpfung mit unserer gesellschaftlichen Verantwortung bildet dies die Grundlage für unsere Forschungsfokusse: •• Klimawandel •• Resilienz •• Energie-Raumplanung •• Hoch effiziente Siedlungs- und Bebauungsstrukturen der Zukunft
156 | Claudia Yamu, Andreas Voigt
Abb. 1: Areal des ehemaligen Flughafens Tempelhof, Berlin: Szenario, das sich auf die Anbindung zwischen Straßennetzwerk und dem öffentlichen Raum bezieht. Tägliche und wöchentliche Dienstleistungen und Gewerbe sowie Haltestellen des öffentlichen Verkehrs sind in der Planungssimulation berücksichtigt. Figure 1: Former Tempelhof airport in Berlin: Scenario showing the connection between the street network and public space. Daily and weekly services and businesses, as well as public transport stops, are taken into account in the planning simulation
environment and an Oculus Rift, among other technology. Digital models can be displayed and experienced as virtual reality (VR) on any scale up to 1:1 – i.e. “multi-scale”5, in a stereoscopic, three-dimensional projection with real-time simulation and multiple perspectives. The research fields of the Urban Spatial Simulation Lab (SimLab) are aligned towards current and future needs, challenges, and problems. Our practice-oriented research is geared towards enabling a favourable relationship between input and benefits. Our social responsibility dictates our research foci, which are based on:
•• Adaptive Systeme und evolutionärer Ansatz •• Allometrie: die Beziehung zwischen Form und Funktion •• Systemtheorie. Derzeitige Doktoratskollegs in Partnerschaft mit SimLab sind: •• URBEM: Urbanes Energie und Mobilitätssystem (Public-private-Partnership mit WienEnergie) •• EWARD: Energiebewusste Stadt- und Regionalentwicklung (TU Wien Förderung). Das Stadtraum-Simulationslabor dient unter anderem als interdisziplinäre Plattform für eine verstärkte Integration von Modellbildung und Simulation aus den Bereichen Raumplanung und Architektur sowie aus den verwandten Wissenschaften des Bauingenieurwesens oder der Geodäsie, aber z. B. auch aus der Physik, Biologie, Informatik, Mathematik oder dem Maschinenbau. Gerade an den Wissensrändern des eigenen Feldes mit Überschneidungen zu anderen Wissensgebieten entsteht ein Mehrwert, der wiederum in die raumbezogene Modellbildung und Simulation einfließt und Innovationen schafft. Gezielte Kooperationen innerhalb der Technischen Universität Wien und international mit anderen Universitäten ermöglichen eine progressive, dynamische Entwicklung der Forschungsinhalte. Danksagung Wir danken unserem gesamten Team für die unermüdliche Bereitschaft, sich immer neuen Herausforderungen und Grenzüberschreitungen zu stellen. Weiters sind wir Kolleginnen und Kollegen im Haus sowie im internationalen Fachumfeld für den regen wissenschaftlichen Austausch und die gemeinsame erfolgreiche Arbeit weit über die disziplinären Grenzen hinaus zu Dank verpflichtet. Diese sind, um nur einige zu nennen: Bernd Scholl (ETH Zürich, CH), Elisabete Silva (University of Cambridge, UK), Mike Batty (University College London, UK), Anna Geppert (Université Paris-Sorbonne, F), Gert de Roo (University of Groningen, NL), Nikos Salingaros (Uni-
Abb. 2: Urbane Struktur und soziale Aktivität: Space Syntax Analyse von Greater Kyoto. Figure 2: Urban structure and social activity: Space Syntax Analysis of Greater Kyoto.
•• Climate change •• Resilience •• Energetic spatial planning •• Highly efficient settlement and development structures of the future •• Adaptive systems and evolutionary approach •• Allometry: the relationship between form and function •• Systems theory. Current doctoral programmes partnering with SimLab are: •• URBEM: Urban Energy and Mobility System (Public Private Partnership with WienEnergie)
Wege in die Stadt der Zukunft | 157
•• EWARD: Energy-conscious urban and regional development (TU Wien funding).
Abb. 3: Partizipation am Puls der Zeit: SimLab entwickelte eine mobile Einheit, um Bürgerinnen und Bürger direkt in die praxisorientierte Forschungsarbeit miteinbeziehen zu können. Figure 3: Participation at the forefront of progress: SimLab developed a mobile unit in order to directly involve citizens in practice-oriented research.
versity of Texas at San Antonio, USA), Walter Schönwandt (Universität Stuttgart, D), Pierre Frankhauser (Université de Franche-Comté, F), Judith Stilgenbauer (University of Hawaii at Manoa, USA), Anna Rose (Space Syntax Ltd. London, UK), Işin Can (Izmir Institute of Technology, TR), Uwe Wössner (HLRS Stuttgart, Universität Stuttgart, D) und Joachim Kieferle (Hochschule RheinMain, D). Anmerkungen/Notes 1 Albert Einstein, Hedwig und Max Born: Briefwechsel 1916–1955, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1972, 97f. 2 Bernd Scholl, „Strategische Planung“, in: Handwörterbuch der Raumplanung, Hannover: ARL 2005, 1122–1129. 3 Claudia Yamu/Andreas Voigt/Pierre Frankhauser, Spatial Simulation and the Real Word. Digital methods and techniques in the context of strategic planning, in: The Routledge Handbook of Planning Research Methods, hg. v. Elisabete Silva/Patsy Healey/ Neil Harris/Pieter van den Broeck, New York/London: Routledge 2015, 348–363. 4 Susan Pietsch, Computer Visualisation in the Design Control of Urban Environments: A Literature Review, in: Environment and Planning B: Planning and Design 27 (2000), 521–536. 5 Claudia Yamu/Pierre Frankhauser, Managing Urban Sprawl: Spatial Accessibility to Amenities and Green Areas/Spaces Using a Multiscale, Multifractal Simulation Model for Planning, in: Environment and Planning B: Planning and Design (angenommen, i. Ersch.).
158 | Claudia Yamu, Andreas Voigt
The Urban Spatial Simulation Lab also serves as an interdisciplinary platform for the improved integration of model formation and simulation from the fields of spatial planning and architecture with the related fields of civil engineering and geodesy, but also from physics, biology, informatics, mathematics, or mechanical engineering, for example. It is, in fact, the margins of knowledge of one’s own field of expertise intersecting with other fields of knowledge that creates added value, which is then integrated into spatial model formation and simulation and begets innovation. Targeted cooperation within the TU Wien and with other international universities allows us to progressively and dynamically develop our research. Acknowledgements We would like to thank all of our team for their indefatigable commitment to facing ever-new challenges and transgressions. We owe particular thanks to our colleagues at the TU Wien and internationally for their participation in lively scientific exchange and successful collaboration going far beyond disciplinary borders. These include, to name but a few: Bernd Scholl (ETH Zürich, CH), Elisabete Silva (University of Cambridge, UK), Mike Batty (University College London, UK), Anna Geppert (Université Paris-Sorbonne, F), Gert de Roo (University of Groningen, NL), Nikos Salingaros (University of Texas at San Antonio, USA), Walter Schönwandt (Universität Stuttgart, D), Pierre Frankhauser (Université de Franche-Comté, F), Judith Stilgenbauer (University of Hawaii at Manoa, USA), Anna Rose (Space Syntax Ltd. London, UK), Işin Can (Izmir Institute of Technology, TR), Uwe Wössner (HLRS Stuttgart, Universität Stuttgart, D), and Joachim Kieferle (Hochschule RheinMain, D).
Sabine Knierbein
STADTKULTUR UND ÖFFENTLICHER RAUM URBAN CULTURE AND PUBLIC SPACE In Städtebau, Architektur und Stadtplanung versucht man gegenwärtig, Bezüge zwischen gebauten Strukturen und dem Alltagsleben in der Stadt wieder herzustellen. Diese galten als durch den modernen Städtebau und die fordistisch-funktionale Stadtplanung gesprengt. Wo sozialräumliches Denken in der postfordistischen Stadtplanung schon seit den 1990er-Jahren Einzug gehalten, und damit Veränderungen in den planerischen Raumkonzeptionen bewirkt hat, durchleben der nachmoderne Städtebau und die Architektur derzeit einen ähnlichen Wandel. Die zeitgenössische Stadtforschung hinterfragt die vielfältigen Ursachen, Mechanismen und Wirkungen derartiger Veränderungen disziplinären Denkens mit Bezug zur gebauten Sozialwelt wie auch die räumlichen Phänomene an sich. Sie versteht den gebauten Raum als analytisches Eingangsfenster für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der gelebten Stadt. Beitrag zu den gesellschaftspolitischen Nuancen der zeitgenössischen Stadtentwicklung Der Arbeitsbereich Stadtkultur und öffentlicher Raum arbeitet als offene, dialogische und sozial innovative Teamstruktur, die Beziehungen zwischen sozialwissenschaftlichen, künstlerischen und technischen Strängen in Form eines dynamischen Ansatzes der kombinierten Stadtforschung, Stadtgestaltung und Stadtplanung ergründet. Für uns erscheint weder eine aus der Geschichte der Fakultät resultierende Abgrenzung zwischen Architektur und Raumplanung zielführend, noch die Wiederbelebung alter Grabenkämpfe zwischen Theorie und Praxis. Derartige Diskussionen verunmöglichen die
Urban development, architecture, and urban planning are currently witnessing attempts to re-establish relationships between built structures and everyday life in the city. Modern urban development and functional Fordist urban planning are thought to have disrupted such relationships. While socio-spatial thought in post-Fordist urban planning entered the scene in the 1990s, and thus led to changes in the spatial concepts of planning, post-modern urban design and architecture are now experiencing a similar transformation. Current urban research questions the multiple causes, mechanisms, and effects of such changes in disciplinary thought in relationship to the built social world as well as the spatial phenomena themselves. It understands built space as an analytical entrance window to an scientific exploration of the lived city. Contribution to the Socio-political Nuances of Current Urban Development The Interdisciplinary Centre for Urban Culture and Public Space has an open, dialogue-oriented, and socially innovative team structure that explores relationships between socio-scientific, artistic, and technological strands in a dynamic approach combining urban research, urban design, and urban planning. In our opinion, neither the demarcation of architecture and spatial planning that has arisen over the course of the faculty’s history, nor a resurrection of old turf wars between theory and practice are expedient. Such debates preclude a very necessary engagement with the social, cultural, and constructive complexity of spaces of public life in the city, on the aca
Stadtkultur und öffentlicher Raum | 159
dringende fach- und gesellschaftspolitische Beschäftigung mit der sozialen, kulturellen und baulichen Komplexität der Orte des öffentlichen Lebens in der Stadt. Wir stehen für einen Ansatz der Kombination aus KnowWhy (Urbane Theorie) und Know-How (Urbane Praxis), der eine Brücke zwischen sozialräumlichem Handeln und gebauter Materialität schlägt. Es geht hier um einen disziplinen- und kulturübergreifenden Beitrag zu den gesellschaftlichen Nuancen von Stadtentwicklung, der selbstreflexiv-kritisch und zukunftsweisend ist. Dabei werden strukturelle Dilemmata und Chancen ebenso wie handlungsbezogene Forderungen erörtert. Vor dem Hintergrund zunehmender sozialer Disparitäten und Ausgrenzungstendenzen in Städten in und über Europa hinaus und einer lauter werdenden Kritik am traditionellen Modell der technokratischen Verwertung von Boden und Raum beschäftigen wir uns mit alternativen Modellen der räumlichen Entwicklung: mit Prozessen kollektiver Wertschöpfung, mit neuen Formen staatlicher Regulierung und darüber hinaus mit den Möglichkeiten einer systematischen Einbindung zivilgesellschaftlicher Beiträge in die Stadtentwicklung. Stadtkultur und öffentlicher Raum als Lern- und Forschungsfelder Der urbanistische Ansatz der Stadtkultur steht für die Wissensfelder überspannende Forschung zum Wandel der Räume der Alltagskultur in der Stadt. Es geht um eine raumtheoretische Auseinandersetzung mit Differenz in der Stadt und in der akademischen Bildung von städtischen Expertinnen und Experten. Mit Stadtkultur werden auch symbolische Einschreibungen in die Stadtgestalt und in die urbane Praxis erfasst – die urbane Patina individueller, kollektiver und öffentlicher Bedeutungszuschreibungen, Werthaltungen, Rituale, geprägt von Lebensstilen und Zugehörigkeitsmustern. Urbanistische Herangehensweisen an öffentliche Räume erfordern eine qualitativ-orientierte, über disziplinäre Korsetts hinweg aufgestellte, gesellschaftswissenschaftliche Stadtforschung zum Wandel des öffent-
160 | Sabine Knierbein
demic-political and the socio-political levels. We stand for an approach that combines know why (urban theory) and know how (urban practice) to bridge socio-spatial action and built materiality. This is about making a contribution to the social nuances of urban development across disciplines and cultures that is self-reflective, critical, and future-oriented. It is about debating structural dilemmas and opportunities as well as demands for action. Against the backdrop of growing social disparity and exclusion tendencies in European cities and beyond, and an increasingly articulate criticism of the traditional model of technocratic exploitation of land and space, we look into alternative models of spatial development: processes of collective value creation, new forms of state regulation, and the potential of the systematic inclusion of the contributions civil society can make to urban development. Urban Culture and Public Space as Fields of Learning and Research An urban studies approach to urban culture means researching the transformation of spaces of everyday life in the city in a way that is not limited to a single field of knowledge. It is about a spatial and theoretical discussion of differences in the city and in the academic education of urban professionals. Urban culture also records symbolic inscriptions in the Gestalt of the city and in urban practice – the urban patina of individual, collective, and public attributions of meaning, values, and rituals that is marked by lifestyles and patterns of belonging. Urbanistic approaches to public space presuppose qualitative, social sciences-based urban research that does away with disciplinary constraints, and addresses the transformation of public life and urban places where public life eventually unfolds. It is about a spatial, theoretical, and epistemic exploration of openness in the ideal typical city that promises social progress, social justice, and opportunities for emancipation. At the same time, spatial practices in actual public space are understood as a key starting point of a theoretical abstraction
lichen Lebens und der urbanen Orte, an denen sich öffentliches Leben entfaltet. Es geht um eine raum- wie erkenntnistheoretische Ergründung von Offenheit in der idealtypischen Stadt, die gesellschaftlichen Fortschritt, soziale Gerechtigkeit und Chancen auf Emanzipation verspricht. Gleichzeitig wird die räumliche Praxis in den real gelebten öffentlichen Räumen als zentraler Ausgangspunkt der theoretischen Abstraktion verstanden, um einen transdisziplinären Ansatz im Dialog oder auch im produktiven Streitgespräch mit weiteren Akteuren und Akteurinnen zu entwickeln. Auf der praktischen Ebene der Planung und Gestaltung geht es beim Lernfeld Stadtkultur um eine alltagstaugliche Ästhetik, sowie um das Gestalten von inklusiven Prozessen, die Differenz und Vielfalt als grundlegende Faktoren von sozialer Innovation begreifen, ohne schönzufärben. Im Lernfeld „Öffentlicher Raum“ arbeiten wir mit einer verhandelten Ästhetik, die im Idealfall in einen, in allen Planungs- und Bauphasen sozialräumlich gestützten, Entwurf mündet, bei dem lokales Wissen und am Gemeinwohl orientierte Interessen durch zivilgesellschaftliche Organisationen ebenso eingebunden werden wie neue Formen staatlicher Verantwortung.
Abb. 1: Wissensgenese im Spannungsfeld zwischen Stadtkultur und Baukultur an der Schnittstelle zwischen Know Why (Urban Theory) und Know How (Urban Praxis). Im Bild: Gastprofessorin Prof. Dr. Sophie Watson, während des European February Symposiums 2012. Figure 1: Knowledge generation in the tension between urban culture and building culture at the interface between know why (urban theory) and know how (urban practice). In the picture: visiting professor Prof. Dr. Sophie Watson during the European february Symposium 2012.
aimed at developing a transdisciplinary approach in dialogue, or in productive dissent, with other agents. On the practical levels of planning and design, the learning field of Urban Culture is about an aesthetic of everyday use, as well as about framing inclusive processes that understand difference and diversity as basic factors of social innovation without painting it as only a pretty picture. In the learning field of Public Space, we work with a negotiated aesthetics that ideally leads to designs that are socio-spatially supported at all stages of planning and construction, and that involves local knowledge and public welfare-oriented interests through civil society organisations as well as new forms of government responsibility.
Stadtkultur und öffentlicher Raum | 161
Democratic Baselines in Planning and Urban Design
Abb. 2: Relationale Sozialraumproduktion und temporäre Materialität in sozial innovativen Architekturprojekten. Lesezeichen Salbke, Magdeburg. Die Kontroverse um die sich wandelnden Nutzungen der Open-Air-Bibliothek prägte die Debatte zu öffentlichen Räumen in der deutschsprachigen Planungswelt in der Bauwelt 30/2011. Figure 2: Relational production of social space and temporary materiality in socially innovative projects of architecture. Lesezeichen Salbke, Magdeburg. The controversial discussion of the changing uses of this open-air library shaped the debates on public space in the German planning community in Bauwelt 30/2011.
The foundations of democratic urban development are, to begin with, transparent urban policy decision-making processes, and then the possibility of correcting them through the formation of a critical (expert) public. It is of core relevance to recognise, to understand, and to promote the spatial needs, appropriations, and interests of minority society as well, even when ignored or neglected by the majority society. Our disciplines are able to contribute to social life and to keeping (relative) urban peace, as they must: It is the real estate markets we helped develop, large-scale projects and infrastructure constructions we designed, which, once realised, inscribed social, cultural, political, economic, and ecological fissures into the built space of the material environment of people. We must contribute to providing the city with the material foundations of peaceful coexistence, a role that tends to be forgotten in post-political governance approaches. Professional and Socio-political Positioning of Our Graduates?
Demokratische Grundlinien in der Planung und Gestaltung der Stadt Die Transparenz stadtpolitischer Entscheidungsfindungen im Vorfeld und die Möglichkeit ihrer Korrektur durch Formierung kritischer (Fach-)Öffentlichkeiten sind Grundlagen einer demokratischen Stadtentwicklung. Es gilt, auch jene räumlichen Bedürfnisse, Aneignungen und Interessen der Minderheitsgesellschaft zu erkennen, zu verstehen und zu fördern, die von der Mehrheitsgesellschaft ignoriert oder vernachlässigt werden. Denn unsere Disziplinen können und müssen einen gesellschaftlichen Beitrag zur Bewahrung des (relativen) städtischen Friedens leisten: Es sind von uns mitentwickelte Immobilienmärkte, von uns kommentierte Politikprogramme, von uns konzipierte Großprojekte und Infrastrukturbauwerke, durch deren Realisierung erst soziale, kulturelle, politische, ökonomische und ökolo-
162 | Sabine Knierbein
How can a student of architecture or a planning graduate learn to explore his or her own position when problems of professional and social policy, the tensions between academic disciplines and society are only touched upon superficially, and not sounded out in depth and in methodical reflection in academic education? How can research and teaching staff take on public tasks of knowledge generation, communication, and use regarding relevant and urgent phenomena, problems, and knowledge gaps without acknowledging the progressive global expansion of our graduates’ future employment markets? These issues not only demand different educational and research ethics and educational as well as cognitive strategies, but also a broad consideration of much more distant and complex realities of life in unknown places, the exploration of which is currently not particularly present in our curricula.
gische Spaltungen baulich-räumlich in die materielle Lebensumwelt der Menschen eingemeißelt werden. Wir haben hier eine Rolle bei der Versorgung der Stadt mit den materiellen Grundlagen des friedlichen Zusammenlebens zu spielen, die im Rahmen postpolitischer Ansätze zunehmend in Vergessenheit gerät. Fach- und gesellschaftspolitische Positionierung unserer Absolventinnen und Absolventen? Wie kann eine Architekturstudentin oder ein Planungsabsolvent in der globalen Bau- und Planungswelt die eigene Position ausloten lernen, wenn fach- und gesellschaftspolitische Fragen, wenn die Spannungsfelder zwischen akademischen Disziplinen und Gesellschaft nur oberflächlich angerissen, nicht aber in der notwendigen Tiefe und methodisch-reflexiv im Zuge der universitären Bildung bearbeitet werden? Wie können Lehrende und Forschende öffentliche Aufgaben der Wissensgenese, -vermittlung und -anwendung hinsichtlich relevanter und drängender Phänomene, Fragen und Wissenslücken in der Stadtentwicklung wahrnehmen, ohne die voranschreitende, globale Erweiterung der zukünftigen Arbeitsmärkte unserer Absolventinnen und Absolventen anzuerkennen? Dies erfordert nicht nur andere bildungs- und forschungsethische Grundhaltungen und Vermittlungsstrategien, sondern ebenso eine intensive Berücksichtigung wesentlich fernerer und komplexerer Lebensrealitäten an unbekannten Orten, deren Erkundung derzeit in unseren Lehrplänen keinen allzu großen Stellenwert einnimmt. Mittels der Einführung disziplinen- und kulturübergreifender Lehre und Forschung in Architektur und Raumplanung, die den relational-materiellen Charakter von Stadtkulturen und öffentlichen Räumen in den Mittelpunkt der kontextspezifischen Auseinandersetzung mit der Stadt als gelebtem, gedachtem und materialisiertem Raum setzen, können und möchten wir uns diesen Herausforderungen nicht erst für die zukünftige, sondern bereits für die gegenwärtige Stadtentwicklung kollektiv stellen.
Abb. 3: Neue Herausforderungen für die akademische Bildung der zukünftigen Planenden und Gestaltenden. Öffentliche Räume und Stadtkulturen stellen Querschnittsthemen einer lokal wie global verantwortlichen Auseinandersetzung mit den materiellen Bedingungen der städtischen Lebenswelt dar. Figure 3: New challenges for the academic education of future planners and designers. Public space and urban culture are issues of the locally and globally responsible engagement with the material conditions of urban life.
By introducing types of teaching and research into architecture and planning that cross disciplinary and cultural borders, that focus their context-specific analysis of the city as a lived, thought, and materialised space on the relational and material character of urban culture and public space, we can collectively face these challenges, not only for future urban development, but for the present; and this we are ready to do.
Stadtkultur und öffentlicher Raum | 163
ZWEI STUDIENRICHTUNGEN UNTER EINEM DACH TWO FIELDS OF STUDY UNDER ONE ROOF Architektur und Raumplanung bilden zwei Studienrichtungen, die ihre jeweiligen Profile bewusst im Sinne ihrer eigenständigen Kompetenzen schärfen. Gleichzeitig aber weisen sie zahlreiche Schnittmengen auf, die bei entsprechender Zusammenarbeit enorme Synergien freisetzen können. Gemeinsame Forschungsaktivitäten, ein studien richtungsübergreifendes Doktoratskolleg und das future.lab stehen für solch neue Kooperationsmodelle und Arbeitsformen. Architecture and spatial planning are two fields of study that consciously sharpen their profiles to define their individual competencies. At the same time, they manifest numerous intersections that can release tremendous synergetic potential when properly coordinated. Shared research activities, a transdisciplinary doctoral programme, and the future.lab are just some of these new cooperative models and work methods.
Daniela Markova, Bojan Ikic, Simon Sellner (fachschaft::architekTUr)
200 JAHRE – WIDERSTAND, FREIHEIT UND SCHWEIGEN 200 YEARS – RESISTANCE, FREEDOM, AND SILENCE So wie unsere Disziplin standen die Universitäten schon immer in einem Spannungsfeld zwischen der Freiheit der Lehre und dem öffentlichen, politischen und auch zunehmend privaten Interesse. In diesem Kontext hat unsere Institution im Laufe der Zeit unterschiedliche Entwicklungen durchgemacht, die gesellschaftliche Auswirkungen weit über den täglichen Universitätsbetrieb hinaus hatten. Damit bekräftigte sie ihre Relevanz als Austragungsort von architekturrelevanten und politischen Konflikten. In einer Retrospektive möchten wir auf die Dynamik, die aus diesen gesellschaftlichen Zusammenhängen entsteht, eingehen, und darauffolgend die Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit der TU Wien dem gegenüberstellen. Eine Retrospektive Die in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts an der TU Wien entstandene Kultur der studentischen Arbeitsräume, die das Potential der kollektiven Tätigkeit und des Lernens von den Erfahrungen anderer aufs Äußerste entfaltet hat, spiegelt sich heute noch in der zeitgenössischen österreichischen Architekturszene wieder. Zahlreiche Wiener Büros hatten ihre Anfänge in unseren Zeichensälen1 und entwickeln die Gedanken, mit denen sie in der Studienzeit konfrontiert wurden, durch ihren Schaffensprozess in die Wirklichkeit. Themen wie gemeinsames Wohnen, Lernen, Arbeiten, Gemeinschaft und die räumlichen Anforderungen dafür sind in den theoretischen Konzepten und Bauwerken präsenter denn je. In der produktiven Stimmung, welche in den Zeichensälen spürbar war, entstand die Motivation, auch inner-
Just like our discipline, universities have always been caught in the tensions between the freedom of teaching and public, political, and – increasingly – private interests. Our institution has experienced a variety of developments in this context that have had social consequences reaching far beyond everyday academia. This affirmed the relevance of the field as a scene of conflicts relevant to architecture and politics. In retrospect, we would like to address the dynamics arising from these social contexts, followed by a contrasting reflection on developments in recent years. A Retrospective The culture of student workspaces that developed at the TU Wien in the 1970s contributed to the unfolding of the potential of collective activities and learning from the experiences of others to the utmost, and is still reflected in the current architectural scene in Austria. Many Viennese offices originated in our design rooms,1 creatively evolving the thoughts they were confronted with during their studies into reality. Issues such as communal living, learning, working, community, and the spatial requirements for these concepts are present more than ever, in theoretical concepts as well as buildings. The productive atmosphere of the design rooms provided motivation to consider different paths in teaching, too. A result of this is a successful tutorial project that not only promotes exchange between students but also contributes to the improved orientation of first-term students. A growing demand for academic education meant that the number of academic and artistic staff in teach-
200 Jahre – Widerstand, Freiheit und Schweigen | 165
halb der Lehre andere Wege zu gehen. Unter anderem ist daraus auch das erfolgreiche Tutoriumsprojekt entstanden, das nicht nur einen Austausch zwischen Studierenden fördert, sondern auch zu einer besseren Orientierung der Studienanfängerinnen und Studienanfänger beiträgt. Die wachsende Nachfrage nach akademischer Bildung hatte zur Folge, dass innerhalb des Lehrkörpers das wissenschaftliche und künstlerische Personal stark ausgebaut werden musste. Durch die Konzentration von unterschiedlichen Positionen und Praktiken an der TU Wien war es möglich, für längere Zeit einen diversen wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern und zu sichern. Für alle diese Entwicklungen brauchte es Raum zum Experimentieren, Schaffen und Scheitern. Tendenz Seit der Einführung des Bologna-Prozesses und der damit einhergehenden Verlagerung des universitären Auftrages „weg von der ,allgemeinen Menschenbildung durch Wissenschaft‘, hin zur Berufsausbildung“,2 begleitet von der äußerst schwierigen finanziellen Lage und dem zunehmenden Wachstum von (privat-)wirtschaftlichen Interessen in der Forschung und Lehre,3 sinkt der gesellschaftliche Stellenwert einer unabhängigen Forschung und Lehre, und die Universitäten sind gezwungen, sich neben den Einsparungen auch andere Wege der Finanzierung zu überlegen. Die Forderung seitens der Lehrenden, Forschenden und Studierenden nach mehr Mitbestimmung, Freiheit und nur halbwegs erträglichen Bedingungen steht oft in Konkurrenz zu dem Drang nach Einnahmen und ökonomischer Verwertbarkeit seitens der Universitätsleitung und der Gebäudeverwaltung. Unter den nach der Änderung des Universitätsgesetzes 2002 eingetretenen Machtverhältnissen und Bedingungen kann es leicht geschehen, dass die primären Leistungen und Ziele einer Universität – die Förderung von wissenschaftlichem Nachwuchs sowie die akademische Weiterbildung – den Möglichkeiten der Geldeinnahmen weichen müssen.
166 | Daniela Markova, Bojan Ikic, Simon Sellner (fachschaft::architekTUr)
ing was increased significantly. The resulting concentration of different positions and practices enabled the TU Wien to demand and guarantee a diversified new generation of academics in the long-term. All of these developments were grounded in the availability of space for experimentation, creation, and failure. Tendencies Since the introduction of the Bologna Process and the resulting shift of focus of the university’s task “away from a ‘general education of the human character through science’ towards professional training”2, accompanied by an extremely difficult financial situation and the growing influence of (private) economic interests on research and teaching,3 the societal status of independent research and teaching has declined, and universities are forced to consider other funding options besides retrenchment. The demands of teaching staff, researchers, and students for more participation, freedom, and at least halfway decent working conditions often compete with a push for income and economic exploitability on the part of the university administration and building management. Under the power relations established by the amendments of the 2002 University Act, it can easily occur that the primary activities and goals of a university – the promotion of young researchers and academic education – must give way to opportunities of income generation. The mechanisms of room allocation are an example of this. For some years now, a concept developed by the Department of Building, Construction, and Technology (GuT), which was approved by the Rectorate, has applied to the premises of the Kuppelsaal and Prechtlsaal in the main building of the TU Wien. Its consequence is a preference for external organisations and thus a prevention of the use of these premises for regular teaching. Student workspaces, which are scarce in any case, are then used as an alternative premise for classes. Also, due to the strategy of campus concentration and the subsequent abandonment of some university
Beispielhaft für dieses Verhalten sind einige Mechanismen innerhalb der Raumvergabe. So wird seit mehreren Semestern ein von der GuT (Gebäude und Technik) erarbeitetes Konzept für die Raumreservierungsverwaltung mit der Zustimmung des Rektorates auf die Räumlichkeiten Kuppelsaal und Prechtlsaal im Hauptgebäude der TU Wien angewendet. Die Konsequenz daraus ist die Bevorzugung von externen Organisationen und somit eine Verhinderung der Raumnutzung für regelmäßig organisierte Lehrveranstaltungen. Als Ersatzräumlichkeiten werden die ohnehin schon wenigen studentischen Arbeitsräume durch Lehrveranstaltungen belegt. Auch dank der Strategie von Konzentration und darauffolgender Abschaffung einiger Universitätsstandorte wird die Übersiedlung der einzelnen Fakultäten und Institute realisiert, jedoch ohne auf den tatsächlichen Raumbedarf4 und die Kapazitäten Rücksicht zu nehmen. Als Erstes fallen die studentischen Arbeitsräume der neuen Struktur zum Opfer, die als treibende Kraft den Diskurs und den Austausch im Studium ermöglicht haben. Ein weiteres Problem entsteht dadurch, dass die Kapazität des größten Hörsaals der Universität, trotz steigender Studierendenzahlen, im Rahmen der Umbauarbeiten gesunken ist und für viele Studierende dadurch die Teilnahme an der Vorlesung verhindert wird. Demzufolge wird eine direkte Einbindung des oder der Vortragenden mit allen Studierenden verhindert und somit der Diskurs weiter eingeschränkt. Neben der Raumknappheit haben Studierende und Lehrende jedoch auch mit anderen (Frei-)Raumeinschränkungen täglich zu kämpfen.
locations, a relocation of individual faculties and institutes was carried out, however, this was done without taking into account real spatial needs4 and capacities. The first to fall victim to this new structure were the students’ workspaces, which had been a driving force in facilitating discourse and exchange between students. A further problem was created by the fact that the capacity of the university’s largest lecture hall was decreased after a reconstruction was carried out, and this in spite of growing numbers of students, a situation that led to many students being unable to attend lectures. This hindered the direct interaction of the teachers with the students, thus further limiting discourse. However, lack of space was not the only limitation of (free) space students and teachers had to contend with on a daily basis. The abolition of one-third parity, the introduction and expansion of the authority of the University Council, and the weakening of the highest democratically legitimated collegiate body (the Senate) were all steps towards the de-democratisation of universities. In combination with the room allocation policy of the time, this led to intolerable conditions in the students’ daily lives, as well as in teaching and research. Parallel to the rising administrative expenses and stagnating labour in teaching and research, there was also a noticeable reduction of contracted working hours. These precarious employment situations led to a systematic overworking of scientific and artistic staff, and, along with minimal opportunities for advancement due to fixed-term contracts with no options for renewal, prevented the university from retaining young academ-
200 Jahre – Widerstand, Freiheit und Schweigen | 167
Die Abschaffung der Drittelparität, die Einführung und Erweiterung der Kompetenzen des Unirates sowie die Schwächung der Position des obersten, demokratisch legitimierten Kollegialorgans (Senat) bedeuten nur weitere Schritte zur Entdemokratisierung der Hochschulen. Diese hat zusammen mit der Tendenz der aktuellen Raumpolitik unerträgliche Bedingungen im Studierendenalltag sowie im Lehr- und Forschungsbereich zur Folge. Parallel zum steigenden Verwaltungsaufwand und stagnierenden Arbeitsaufwand in der Lehre und Forschung ist die Verringerung des Stundenausmaßes in den Arbeitsverträgen erkennbar. Diese prekären Arbeitsverhältnisse führen zur systematischen Überlastung des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals und verhindern es, gemeinsam mit geringen Aufstiegschancen, infolge der befristeten Arbeitsverträge ohne Möglichkeit auf Verlängerung, wissenschaftlichen Nachwuchs an der Universität zu halten. Auf die Studierenden hingegen wird mit zusätzlichen Einschränkungen Druck ausgeübt, ihren akademischen Weg möglichst zeiteffektiv zu absolvieren – ohne die Erfahrungen und die Qualität ihrer Leistungen zu berücksichtigen. Gelingt dies nicht in der vorgeschriebenen Zeit, führt es zur Verschlechterung der finanziellen Lage der Studierenden. Was dadurch leider oft auf der Strecke bleibt, sind eine intensive Auseinandersetzung mit unserer Disziplin, exzellente Leistungen und das kritische Beobachten der eigenen Ziele und Aufgaben. Und das an einer Universität, welche die Zukunft der Technik gestalten möchte.5 Ausblick Bei der Reflexion über diese Entwicklungen und die Vergangenheit stellen wir uns mehrere Fragen: •• Wird die Bildung noch immer den gleichen Stellenwert haben, wenn seitens der Universitätsleitung und der Politik den Studierenden schon während des Studiums klargemacht wird, dass akademische Weiterbildung, Austausch, Schaffen, Experimentieren und Forschen
168 | Daniela Markova, Bojan Ikic, Simon Sellner (fachschaft::architekTUr)
ics. The students, on the other hand, were pressured through additional limitations to successfully complete their academic path in as little time as possible – without taking into account the benefits of experience or the quality of their performance. If the students did not succeed within the prescribed timeframe, their financial situation deteriorated. Unfortunately, this often meant that an intense dedication to our discipline, to excellent achievements, and to the critical observation of one’s own goals and tasks were left behind. And this at a university that aims to shape the future of technology!5 Outlook After reflecting upon these developments and the past, we ask ourselves a number of questions: •• Will education still have the same status when university management and politics already make it clear to students that the values of academic education, exchange, creation, experimentation, and research do not compare to a purely economic approach to studying – when academic education deteriorates into nothing more than training? •• Is the university going to use the potential arising from its size and diversity, and attempt to decide its future by itself, or is it going to become an appendage of neo-liberal politics? •• Which problems will creative architects of coming decades address in their practice and theory, which goals will they have, if the university does not offer opportunities for experimentation, exchange, etc.? •• What implications do these decisions have for our future and for the built environment? Finally, there is really only one question that remains, which we must ask ourselves now – and later again: What have we done to stop these trends?
keinen Wert mehr im Vergleich zu einer rein wirtschaftlichen Betrachtungsweise des Studiums haben – wenn universitäre Bildung rein zur Ausbildung verkommt? •• Wird die Universität ihre Potentiale, die aus ihrer Größe und Vielfalt entstehen, nützen, und versuchen, über ihre Zukunft selbst zu entscheiden, oder wird sie zum Anhängsel der neoliberalen wirtschaftsorientierten Politik? •• Welche Themen werden die Architekturschaffenden der nächsten Jahrzehnte in ihrer Praxis und Theorie behandeln und welche Ziele werden sie verfolgen, wenn die Universität nicht die Möglichkeit zum Experimentieren, Austausch, etc. bietet? •• Welche Auswirkungen werden diese Entscheidungen für die Zukunft und die gebaute Umwelt haben?
Anmerkungen/Notes 1 Zeichensäle – etablierter Begriff für studentische, selbstverwaltete Arbeitsräume (siehe auch https://zeichensaele.wordpress.com/ studentische-arbeitsraume/ , 08. 04. 2015). 2 http://www.zeit.de/2012/12/Studium-Ausbildung/komplettansicht (08. 4. 2015). 3 Siehe „Lissabon-Strategie“ bzw. der Nachfolger „Europa 2020“ der Europäischen Union. 4 Bedarfserhebung, ausgearbeitet von der Struktur- und Raumkommission an der Fakultät für Architektur und Raumplanung nach internationalen Richtlinien. 5 Siehe: Mission Statement der TU Wien: http://www.tuwien. ac.at/wir_ueber_uns/mission/ (20. 01. 2015).
Letztendlich bleibt uns allerdings nur eine Frage über, die wir uns jetzt – aber auch später stellen müssen: Was haben wir gegen diese Tendenzen gemacht?
200 Jahre – Widerstand, Freiheit und Schweigen | 169
Stefanie Simic (Fachschaft Raumplanung)
RAUS AUS DEM SCHATTEN! OUT OF THE SHADOWS! Es ist an der Zeit, Position zu beziehen. Es ist höchste Zeit, die Rolle der Raumplanung für uns selbst schärfer zu zeichnen und sie so nach außen zu tragen. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir müssen aber selbstbewusster werden. Die Fakultät für Architektur und Raumplanung organisiert unter einem Dach zwei eigenständige, aber artverwandte Disziplinen. In den letzten Jahrzehnten hat man großen Wert darauf gelegt, die Unterschiede der beiden herauszuarbeiten und in der Gestaltung der Curricula die jeweilige Lehre zu festigen. Besonders wichtig war dies für die Raumplanung, da sie die jüngere der beiden Disziplinen ist. Sie musste sich ihre Existenzberechtigung erst verdienen. Sie musste sich von der Architektur abkoppeln. Eine gemeinsame Fakultät birgt Potentiale für beide Studienrichtungen. Heute können wir, zumindest innerhalb dieser, eine klare Linie ziehen. Die Architektur zeichnet sich durch ihre künstlerisch-architektonische Ausrichtung aus. Die Raumplanung beleuchtet ihre Arbeit aus einer strategisch-planerischen Perspektive. Diese beiden Studienrichtungen unterscheiden sich in ihrer grundlegenden Herangehensweise an ihre Arbeit. Es ist wichtig, das zu betonen. Unterscheidungen unterstützen die Disziplinen dahingehend, sich selbstständig entwickeln zu können, ihre Stärken besser zu definieren, ihre Handlungsspielräume abzustecken und dadurch bewusst Position beziehen zu können. Beschäftigt man sich mit der Raumplanung, so beschäftigt man sich mit vielen Dingen auf einmal. Raumplaner und Raumplanerinnen bringen Akteure und Akteurinnen an einen Tisch, heißt es. Sie vermitteln, vergleichen und koordinieren. Ausgezeichnet sind sie
It’s time to take a stand. It is high time to define the role of spatial planning more clearly for ourselves and to thus take it to the world. We do not need to hide; we need to become more self-confident! The Faculty of Architecture and Planning hosts two independent but related disciplines. Over the last decades, their differences were emphasised and strengthened through the design of the curricula of each field. This was particularly important for Planning, as it is the younger of the two disciplines. It had to earn its right to exist. It had to disconnect from architecture. A joint faculty holds potential for both fields of study. Today, we are able to draw a clear line between them, at least internally. Architecture is characterised by its artistic and architectural orientation. Spatial Planning considers its tasks from a strategic planning perspective. The two fields of study differ in their basic approach to their tasks. This needs to be emphasised. Differences help the disciplines to develop independently, to define their strengths more clearly, to stake their claims, and thus to consciously position themselves. In spatial planning, we deal with a number of things at the same time. It is said that spatial planners bring stakeholders together. They mediate, compare, and coordinate. They are brilliant at identifying strengths, weaknesses, opportunities, and risks. They are problem and future-oriented. They are consensus-oriented. They are apolitical and don’t express opinions. All too often, we retreat from the opportunity to take a stand. We balk at the necessity to do so. Let us become aware of the fact that planning must express an opinion. Not the developer’s opinion, not the opinion of prevalent politics, but its own, professionally
Raus aus dem Schatten! | 171
im Finden von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Sie sind problem- und zukunftsorientiert. Sie sind konsensorientiert. Sie sind unpolitisch und meinungsfrei. Wir entziehen uns zu oft der Möglichkeit, Position zu beziehen. Wir entziehen uns der Notwendigkeit, das zu tun. Werden wir uns dessen bewusst, dass Planung eine Meinung vertreten muss. Nicht die Meinung der Bauherren und Bauherrinnen, nicht die Meinung der vorherrschenden Politik, sondern eine eigene fachlich fundierte Meinung, die man auch zu vertreten bereit ist. Diese Fähigkeit muss während des Studiums geübt und aus jedem und jeder Einzelnen herausgekitzelt werden. Gestalten wir Lehrveranstaltungen, in denen nicht nur Aufgaben abgehandelt werden, sondern in denen man sich kreativ und praxisnah mit Fragestellungen zu aktuellen, brisanten Themen auseinandersetzt. Schaffen wir Räume, in denen unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen. Diskutieren wir sie und lernen wir, sie zu vertreten. Gestalten wir eine Lehre, die kritische Planer und Planerinnen hervorbringt. Die Raumplanung kann es sich leisten, selbstbewusst nach außen zu treten. Sie kann sich innerhalb der Fakultät mit der Architektur messen. Das bedeutet nicht, dass die Raumplanung besser oder schlechter als die Architektur ist. Beide Disziplinen haben ihre volle Berechtigung. Wir müssen endlich beginnen, die Vorzüge aneinander zu schätzen und stärker miteinander zu arbeiten. Die Planung definiert sich nicht durch die Architektur. Planung kann nicht von Architekten und Architektinnen nebenbei erledigt werden. Planung existiert nicht im Vergleich oder im Unterschied zur Architektur. Erkennen wir an, dass wir nicht alleine Städte bauen können, sondern nur gemeinsam. Trauen wir uns, wieder enger zusammenzurücken und einander als vollwertig anzusehen. Vereinen wir uns wieder, indem wir unsere gegenseitigen Stärken anerkennen, sie kombinieren und voneinander lernen, statt zu rivalisieren. Beide Disziplinen sind in ständigem Wandel. Die Raumplanung befindet sich immer im Wechselspiel von
172 | Stefanie Simic (Fachschaft Raumplanung)
grounded opinion. One that we are willing to stand up for. This ability needs to be practised in the course of our studies, and to be brought out in each and every individual. Let us design courses that do not exclusively consist of dealing with tasks, but in which students engage with questions regarding controversial current problems in a practice-oriented and creative way. Let us create spaces in which different opinions can clash. Let us debate and let us learn to speak up for our opinions. Let us create teaching that generates critical planners. Spatial planning can afford to meet the outside world confidently. Within the faculty, it can measure up against architecture. We do not mean to say that spatial planning is better or worse than architecture. Both disciplines are completely valid in themselves. We finally need to begin to appreciate each other’s merits and to cooperate with each other more. Planning does not define itself through architecture. Planning cannot be done as a sideline of architects. Planning does not exist in comparison or in contrast to architecture. Let us acknowledge that neither of us can build cities alone, we can only do it together. Let us dare to close ranks again, and to see each other as valid professions. Let us reunite by acknowledging each other’s strengths, by combining them, and by learning from one another instead of competing. Both disciplines are in a process of continuous change. Spatial planning is always situated in the interplay between politics and society. It takes time for its toolkit to adjust to reality. We therefore need more movement and a more dynamic change within academic educational institutions in order to initiate and to test novel developments. Embracing up-to-date information and communication technologies and a didactic reorientation in knowledge transfer should not lead to filling students with knowledge like some container, but instead to communicating abilities with which they can shape future planning. We have come a long way from the “Godfather model” of omniscient planners. Now it is
Politik und Gesellschaft. Doch nur langsam justiert sich das entsprechende Instrumentarium in der Realität. Es braucht in der universitären Ausbildung stärkere Bewegung und dynamischere Veränderungen, um neuartige Entwicklungen anzustoßen und zu erproben. Das Einbeziehen von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien sowie eine didaktische Neuausrichtung bei der Wissensvermittlung sollen nicht nur dazu führen, Studierende wie einen Behälter mit Wissen zu füllen, sondern ihnen Fähigkeiten mitgeben, mit denen sie die zukünftige Planung gestalten werden. Wir haben uns vom „Gottvater-Modell“ der allwissenden Planenden vor langer Zeit verabschiedet. Nun ist es an der Zeit, sich auch von belehrenden hierarchischen Strukturen der Lehre zu verabschieden. Professoren, Professorinnen und Lehrende können ebenso von Studierenden zu neuem Denken angestoßen werden. Sie können lernen, obwohl sie andere lehren. Wenn schon wir, innerhalb der Universität, uns nicht auf Augenhöhe begegnen, wie sollen dann künftige Planer und Planerinnen der Bevölkerung entgegentreten? Wir dürfen uns auf kein Podest stellen, dass uns unsere höhere Bildung eingebracht hat. Gehen wir nach draußen und begegnen den Menschen, die wir so gerne in unsere Planung miteinbeziehen möchten. In der aktuellen Planungsausbildung gibt es Ansätze, die dazu anregen, über administrative Grenzziehungen hinwegzusehen. Wir beschäftigen uns neben der klassischen örtlichen auch mit der regionalen Planung, verlassen dabei auch schon mal das österreichische Territorium. Forciert wird dieses Vorhaben durch angebotene Exkursionen ins Ausland, in denen das Toolkit der Raumplanung ausgetestet werden kann. Stärken wir diese praktischen Berührungspunkte und verstecken wir uns nicht hinter dem universitären Gemäuer. Tragen wir unsere Planungsprozesse sichtbar nach draußen. Laden wir intensiver zu Mitgestaltung ein. Am meisten können wir von den Menschen lernen, die die Räume beleben, die wir zu planen versuchen. Die Raumplanung ist an der TU Wien längst etabliert. Als Disziplin wird sie in Zukunft an Bedeutung gewinnen; sie darf sich nicht scheuen, ihr Entwicklungspotential
time to give up on patronising hierarchical structures in teaching as well. Professors and teaching staff can also get food for new thought from students. They can still learn despite teaching others. If not even we here at the university can meet at eye level, how are future planners supposed to meet the public? It is not permissible to raise ourselves onto a pedestal supposedly earned by our higher education. Let us go out and meet the people we would like so much to involve in our planning. In current planning education, there are approaches that encourage us to transcend administrative borders. Besides traditional local planning, we also engage in regional planning, and sometimes we even leave Austrian territory while doing so. This undertaking is encouraged by excursions abroad, in which our planning toolkit can be tested. Let us strengthen these practical points of contact; let us not hide within the walls of academia. Let us make planning processes visible to the outside world. Let us invite participation in a more convincing way. We can learn most from those people who inhabit the spaces we are trying to plan. Spatial planning has long been well-established at the TU Wien. As a discipline, it will gain in importance in the future, but it may not shy away from keeping an eye on its potential. Successful planning is not a matter for individuals in walled-off offices. In the same way, a successful education in planning may not take place in the shadows of academic lecture rooms. We are fortunate enough to have a versatile location at our disposal. However, we can also choose our teaching and learning venues at will, and become part of our own planning. In the end, it is not about listing possibilities – without a doubt, spatial planning has ample potential. It is about having the courage to realise it in the future.
Raus aus dem Schatten! | 173
stetig im Auge zu behalten. Erfolgreiche Planung findet nicht von Einzelpersonen in abgeschotteten Büros statt. So kann auch eine erfolgreiche Planungsausbildung nicht im Schatten universitärer Seminarräume vollführt werden. Wir genießen einen Standort, der zu so vielem fähig ist. Wir haben aber auch die Möglichkeit, unsere Lehr- und Lernräume beliebig zu wählen und Teil unserer Planung zu werden. Es geht also im Endeffekt nicht darum, Potentiale, die die Raumplanung zweifelsohne hat, aufzuzählen. Es geht darum, sie in Zukunft mutig umzusetzen.
174 | Stefanie Simic (Fachschaft Raumplanung)
Rudolf Giffinger, Martin Berger
EVIDENZBASIERTE STEUERUNGSANSÄTZE FÜR EINE ENERGIEEFFIZIENTE RAUMENTWICKLUNG EVIDENCE-BASED STEERING APPROACHES TO ENERGYEFFICIENT SPATIAL DEVELOPMENT Startpunkt war die Ölkrise 1973. Es war ein Schock für die Bewohnerinnen und Bewohner der Industriestaaten, als die OPEC vor über 40 Jahren den Ölhahn zudrehte. Keine freie Fahrt für freie Bürgerinnen, sondern mit Tempo 100 statt 210 auf der Autobahn. Erstmals verschob sich das Bewusstsein der Öffentlichkeit: Schneller und mehr zu wachsen und dabei immer mehr Energie zu verbrauchen, wurde als falsche Strategie erkannt, da Ressourcen wie Erdöl, Erdgas etc. nicht unendlich zur Verfügung stehen werden. Der zweite Wendepunkt war die Konferenz von Rio de Janeiro im Jahr 1992 mit einer anderen Herausforderung – dem Klimaschutz. Klar wurde, dass wir als Gesellschaft weder nachhaltig leben noch wirtschaften, wie der ökologische Fußabdruck, den wir in Städten, Regionen und hochentwickelten Ländern hinterlassen, anschaulich zeigt. Nach wie vor steigen die Emissionen (Treibhausgase) an und tragen so unmittelbar zum nicht mehr bestreitbaren Klimawandel bei, der Österreich aufgrund der Binnenlage besonders hart mit Extremwetterereignissen wie Stürmen oder Hitzewellen und den damit verbundenen Folgen für Gesundheit, Tourismus etc. trifft.
It started with the oil crisis of 1973. It was a shock to the citizens of industrialised nations when OPEC shut off the oil supply fourty years ago. No more free passage for free citizens, but a speed limit of 100 instead of 210 on the motorway. For the first time, public awareness shifted: an ever-faster and ever-increasing growth using more and more energy was recognised as the wrong strategy, as resources such as oil, natural gas, and the like will not be endlessly available. The second turning point was the Conference of Rio de Janeiro in 1992, addressing another challenge – climate protection. It became clear that neither the way we live nor the way we do business is sustainable, as shown by the evidence of our ecological footprints in cities, regions, and highly developed countries. Emissions (greenhouse gases) continue to increase, and directly contribute to a now undeniable climate change. This particularly affects Austria because of its continental situation, with extreme weather events like storms or heat waves, and the consequences these bring for our health, tourism, etc.
Die wichtige Rolle der Raumplanung
In spite of rapid technological progress, the reduction of climate gases has seen only limited success. On the one hand, technological progress (in the form of innovative combustion and filter technologies, new materials, and better traffic and communication systems) has improved our quality of life and the environment, also permitting a
Trotz des rasanten technologischen Fortschritts sind die Reduktionserfolge bei den Klimagasen gering. Einerseits verbessert der technologische Fortschritt durch innovative Verbrennungs- und Filtertechniken, neue Materialien,
The Importance of Spatial Planning
Evidenzbasierte Steuerungsansätze für eine energieeffiziente Raumentwicklung | 175
bessere Verkehrs- und Kommunikationssysteme sowohl die Lebens- als auch die Umweltqualität, wodurch sich auch der Energieverbrauch reduzieren lässt. Andererseits sind die Effekte auf globaler Ebene in Summe der Länder, über Kontinente hinweg, alles andere als ermutigend. Die Globalisierung hat weltweit zu einem Anstieg des Energiebedarfs geführt: Dies passiert einerseits in den schnell wachsenden Staaten (BRICS, etc.), in denen die entsprechenden Technologien noch nicht dem aktuellen Standard entsprechen und wo im Zuge der Industrialisierung Millionen von Menschen aus der ländlichen Peripherie in die verstädterten Gebiete drängen. Dies passiert aber auch in den hochentwickelten Ländern, aus zwei Gründen: Einerseits behindern Lock-In-Effekte die energieeffiziente Modernisierung von bestehender Infrastruktur. Andererseits tragen Rebound-Effekte zu verändertem Verhalten offenbar in so großem Ausmaß bei, dass trotz aller technischen Innovationen der Energiekonsum weiterhin steigt. Werden nur die hochentwickelten Länder betrachtet, dann bedeutet dies, dass Lock-In-Effekte und Rebound-Effekte die bisherigen Bemühungen zum Einsparen von Energie und Reduzieren der Emissionen zunichtegemacht haben. Offenbar lassen sich im Sinne von Lock-In-Effekten bestehende Infrastrukturen (inklusive der gebauten Umwelt) nicht ausreichend effektiv (rasch und weitverbreitet) modernisieren, was deutliche Einsparungseffekte zeigen würde. Und offenbar münden manche Einsparungserfolge durch technische Innovationen in Rebound-Effekte, die diese konterkarieren. Daraus lässt sich schließen, dass das Thema der Energieeffizienz nicht ausschließlich eine technologische Herausforderung sein kann, sondern dass dabei andere Bereiche, wie das Verhalten der verschiedensten Akteursgruppen sowie die Strukturen unserer gebauten Umwelt und institutionelle und soziokulturelle Strukturen zur verbesserten Steuerung mindestens genauso wichtig sind. Raumplanung im Sinne von umfassender Strategieplanung bis hin zu lokalen Planungs- und Steuerungsinitiativen beansprucht nun schon lange, dass sie die nachhaltige räumliche Entwicklung unterstützt. Tut sie dies
176 | Rudolf Giffinger, Martin Berger
reduction of energy consumption. However, the global impact of this progress across all countries and continents is far from encouraging. Globalisation has led to a worldwide increase in energy demand: this is taking place in rapidly growing countries (BRICS, etc.), where technologies are not yet up to date, and where industrialisation means millions of people from the rural periphery crowding in urbanised regions. For two reasons, this also holds true for highly developed countries: on the one hand, lock-in effects hamper the energy-efficient modernisation of existing infrastructure. On the other hand, rebound effects are such an important factor of behavioural change that in spite of all technological innovation, energy consumption is still increasing. Just looking at highly developed countries, it appears that lock-in and rebound effects have so far frustrated all attempts to save energy and to reduce emissions: Lock-in effects hinder significant modernisation of existing infrastructure (including the built environment) in anefficient (rapid and widespread) way. And some savings achieved by technological innovation entail rebound effects that counteract them. We may conclude that the problem of energy efficiency may not exclusively be treated as a technological challenge, but other areas, such as the behaviour of various stakeholders, the structures of our built environment, and institutional and socio-cultural structures are at least as important to improved steering. Spatial planning, from comprehensive strategic planning down to local planning activities and initiatives, has long claimed to support sustainable spatial development. But does it really? Aren’t these approaches rather insignificant proclamations in a disciplinary discourse, distracting our attention from their low efficiency and insufficient effectiveness? In view of this problem, spatial planning faces a dual challenge: It is required to expand its understanding of the energy-efficient development of spaces by addressing questions of urban innovation in a more targeted manner. This could be achieved via the implementation of solutions in urban development, understood as an integrated urban innovation being result of the interaction of social, economic, and in par-
aber wirklich? Stellen diese Ansätze nicht eher bedeutungslose Proklamationen in Fachdiskursen dar, die von der geringen Effizienz und der unzureichenden Effektivität ablenken? Angesichts dieser Problematik steht die Raumplanung vor einer zweifachen Herausforderung: Sie ist einerseits gefordert, ihr Verständnis zur energieeffizienten Raumentwicklung zu erweitern, indem sie sich gezielter mit Fragen der urbanen Innovation beschäftigt und deren Umsetzung in der Stadtentwicklung forciert. Urbane Innovationen werden dabei als integratives Ergebnis aus dem Zusammenwirken von sozialen, ökonomischen und insbesondere technischen Entwicklungen bzw. Neuerungen verstanden. Auf der anderen Seite ist es notwendig, dass die Raumplanung ihre Effektivität von Strategien, Programmen, Projekten etc. präziser und nachvollziehbarer als bisher herausarbeitet. Dies würde nicht nur zu einer schnelleren (Nach-)Justierung solcher Ansätze beitragen, sondern auch die Möglichkeiten und Perspektiven ihrer gesellschaftlichen Legitimation erhöhen. Diese Defizite bzw. Forderungen zur energieeffizienten Stadtentwicklung lassen sich klar an den beiden wichtigen städtischen Entwicklungsbereichen, nämlich erstens der thermischen Qualität in bestehenden Baustrukturen sowie zweitens der Mobilität erkennen. So ist zum ersten Thema anzumerken, dass zwar die Komponenten Gebäudematerialien, Heiztechnik und Sanierungszustand als sehr wichtig erachtet werden, jedoch keine integrative Sichtweise zwischen Struktur – Verhalten – Technik entwickelt worden ist. Ähnliches gilt für den Bereich der Mobilität, da die CO2-Emissionen weiterhin weltweit ansteigen. Neben einer stärkeren technischen und organisatorischen Integration von Mobilität (wie z. B. durch Erweiterung der Verkehrsbünde zu Mobilitätsverbünden, multimodale Verkehrsinformationssysteme, Partizipation der Bürgerinnen und Bürger, Peer-2-Peer-Carsharing) sollte vor allem die Veränderung des Mobilitätsverhaltens der Menschen im Mittelpunkt stehen – aber wie? Weiter ist zu beachten: Strategische Ansätze konzentrieren sich auf die einzelnen Sektoren und vernachlässigen damit positive wie negative syner-
ticular technological innovations. On the other hand, spatial planning needs to present the effectiveness of its strategies, programmes, projects, etc. in a more precise and comprehensible manner than ever before. This would not only contribute to the faster alignment of such approaches, but also increase the possibilities and prospects of their social legitimation. These deficits and demands of energy-efficient urban development are clearly visible in the two main areas of urban development, i.e. the thermic quality of existing buildings and mobility. Regarding the first issue, we may note that while the aspects of building materials, heating technology, and building state have been deemed highly important, an integrated perspective on the interplay of structure – behaviour – technology has not yet been developed. The same applies to the field of mobility, as global CO2 emissions continue to increase. Besides a stronger technological and organisational integration of mobility (such as the expansion of transport associations into mobility associations, multi-modal traffic information systems, participation of citizens, and peer-2-peer car sharing), it is mainly the mobility behaviour of people that should be in focus – but how? Also, we need to consider the following: Strategic approaches focus on individual sectors and thus neglect positive as well as negative synergetic steering effects. Target achievement remains practically unaddressed, as sufficient information is often not available for baseline analysis or for the identification of any change to social and spatial developments that occur. Therefore, even in programmatic approaches, so far we have only seen low effectiveness. Apparently, targeted new and altered efforts are needed. In view of these findings, we can derive several goals: •• Spatial planning must develop an evidence-based, integrated understanding of steering in cooperation with traffic planning. It should increase its efforts to integrate the areas of structure, behaviour, and technology. •• Integrated approaches intending to steer energy-efficient urban, regional, and traffic development need improved empirical evidence of reciprocal effects between
Evidenzbasierte Steuerungsansätze für eine energieeffiziente Raumentwicklung | 177
getische Effekte der Steuerung. Eine Zielerreichung wird de facto nicht angesprochen, da ausreichende Informationen oft weder zur Analyse der Ausgangssituation noch zur Kennzeichnung veränderter sozialer und räumlicher Entwicklungen sowie auftretender Interaktionen verfügbar sind. Daher ist auch in den programmatischen Ansätzen bislang nur geringe Effektivität zu beobachten. Es benötigt offenbar gezielt neue und veränderte Anstrengungen. Angesichts dieser Befunde lassen sich verschiedene Forderungen ableiten: •• Raumplanung muss im Verein mit der Verkehrsplanung ein evidenzbasiertes, integratives Steuerungsverständnis entwickeln. Sie sollte sich daher verstärkt um die Integration der Bereiche Struktur, Verhalten und Technik bemühen. •• Integrierte Steuerungsansätze zur energieeffizienten Stadt-, Regional- und Verkehrsentwicklung bedürfen verbesserter empirischer Evidenz zu den Wechselwirkungen zwischen diesen Bereichen. Verbesserte Grundlagenforschung ist hierzu notwendig. •• Raumplanung muss sich stark an den gesellschaftlichen Herausforderungen orientieren, ein Wissen über wünschenswerte Zukunftsszenarien aufbauen und eindeutig operationalisierbare Ziele formulieren. •• Raumplanung sollte sich nicht nur auf das Erstellen von Strategien bzw. Konzepten beschränken, sondern stärker in Richtung der Vorbereitung und Begleitung konkreter Umsetzungen agieren und aufzeigen, wie Veränderungspfade aussehen könnten.
178 | Rudolf Giffinger, Martin Berger
these fields. We need improved basic research on this issue. •• Spatial planning must be strongly oriented towards social challenges, establish knowledge about desirable scenarios for future developments, and formulate clear operational targets. •• Spatial planning must not limit itself to providing strategies and concepts, but instead needs to act more in the direction of preparing and accompanying concrete implementation, and to demonstrate possible paths of change.
Rudolf Scheuvens, Anna Kokalanova
FUTURE.LAB: PLATTFORM FÜR EXPERIMENTELLE UND INTERDISZIPLINÄRE LEHRE UND FORSCHUNG FUTURE.LAB: PLATFORM FOR EXPERIMENTAL AND INTERDISCIPLINARY TEACHING AND RESEARCH Basierend auf den Ergebnissen des Wissenschaftstages 2012 zum Thema „Mehr-Wert Architektur und Raumplanung“ wurde im März 2014 das future.lab der Fakultät für Architektur und Raumplanung gegründet. Im Sinne einer Plattform für experimentelle und transdisziplinäre Lehre und Forschung sollen darüber Gelegenheiten geschaffen und Vorhaben gefördert werden, die Forschung, Lehre und Praxis gezielt zu einem offenen Austausch anregen und profilbildend stärken. Grundlegend für das future.lab sind der studienrichtungsübergreifende und transdisziplinäre Anspruch sowie das offene Format, in dem methodische, soziale und persönliche Kompetenzen in der Auseinandersetzung mit Raum und Architektur gefordert und gefördert werden. Über die Projekte des future.labs sollen abstrakte Themen der Raumentwicklung sichtbar und damit diskutierbar werden. So setzt sich die Plattform das Ziel, den Diskurs um Herausforderungen in der Architektur wie in der Planung zu bereichern und zu intensivieren. Angelegt auf einen begrenzten Zeitraum, soll sie als Labor agieren und mögliche Wege in der Architektur und Raumentwicklung aufzeigen.
Based on the results of the 2012 Science Day on the subject of Added Value Architecture and Planning, the future.lab of the Faculty of Architecture and Planning was founded in March 2014. A platform for experimental and transdisciplinary teaching and research, it aims to create opportunities and promote projects that specifically stimulate research, teaching, and practice to engage in open exchange and to strengthen profiles. Basic approaches of the future.lab are its cross- and transdisciplinary aims as well as its open format that challenges and promotes methodological, social, and personal skills in addressing space and architecture. The projects of the future.lab aim to render abstract issues related to the development of space visible and thus open them up for discussion. The platform’s goal is to enhance and to intensify the discourse on challenges within architecture and planning. Intentionally established for only a limited time period, it is to act as a laboratory for identifying options for the future development of architecture and spatial development. Interface between Technology and Society
Schnittstelle zwischen Technologie und Gesellschaft Die Projekte des future.labs spielen an den Schnittstellen von Technologie und Gesellschaft, von Wissenschaft und Praxis, von experimenteller Neugier und konkretem Handlungsbezug. Die Projekte und Vorhaben erweitern
The projects of the future.lab are set at the interface of technology and society, between science and practice, between experimental curiosity and concrete action. Projects and planned projects broaden the traditional formats and methods of research and teaching. Scientific expertise and the ambition to network are comple-
future.lab: Plattform für experimentelle und interdisziplinäre Lehre und Forschung | 179
die herkömmlichen Formate und Methoden von Forschung und Lehre. Wissenschaftliche Kompetenz und Vernetzungswille gehen einher mit dem Anspruch einer offenen und stimulierenden Kommunikation und der Vermittlung gewonnener Erkenntnisse. Ausstellungen, öffentliche Vortragsreihen, internationale Symposien sowie Publikationen werden zu Plattformen der Kommunikation und Wissensvermittlung. Damit will das future.lab einen wesentlichen Beitrag zum Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis und zwischen Technik und Gesellschaft leisten. Darüber hinaus dient es explizit der Entwicklung und Erprobung innovativer Lehr- und Lernmethoden. Mit einem verstärkt experimentellen Anspruch richtet sich die Plattform an all jene, die den Link zur Forschung und Lehre an der TU Wien suchen. Durch den Transfer zwischen Universität und Praxis sollen der wissenschaftliche und der gesellschaftliche Diskurs um Zukunftsfragen in der Entwicklung der Städte bereichert und intensiviert werden. Zusammenfassend steht das future.lab der Fakultät für Architektur und Raumplanung für: •• die Fokussierung auf besondere Schwerpunktthemen in Forschung und Lehre •• die Einwerbung und Vergabe von Stipendien an Studierende (Diplom/Doktorat), die sich thematisch/methodisch mit den jeweiligen Schwerpunktthemen auseinandersetzen •• die Finanzierung von Gastprofessuren zu den jeweiligen Schwerpunktthemen •• die Durchführung öffentlicher Vortragsreihen und Kolloquien zu Zukunftsfragen von Architektur, Stadt und Gesellschaft •• die Vernetzung der unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure aus Forschung, Wissenschaft und Praxis •• die gebündelte und zielgerichtete Kommunikation der Projekte und Leistungen aus Forschung und Lehre Themenschwerpunkt „urbane energien“ Der verantwortungsbewusste Umgang mit Energie ist zentral für die smarte, die intelligente Stadt von morgen. Dazu gehören sowohl die konsequente Senkung von
180 | Rudolf Scheuvens, Anna Kokalanova
mented with the goal of facilitating open and stimulating interaction and the communication of new insights. Exhibitions, public lecture series, international symposia, and publications become platforms for communication and knowledge transfer. The future.lab aims to contribute to the transfer of knowledge between research and practice, and between technology and society. In addition, it explicitly aims to develop and test innovative methods of teaching and learning. With its strong experimental orientation, the platform targets all those who are looking to connect to research and teaching at the TU Wien. By facilitating transfer between university and practice, it aims to enhance and intensify the academic and social discourse on the future problems of urban development. In summary, the future.lab of the Faculty for Architecture and Planning stands for: •• focusing on specific priorities in research and teaching; •• recruiting grants for students (diploma/PhD) who address the respective priority issues thematically or methodologically; •• funding guest professorships on the respective priorities; •• organising public lecture series and colloquia on future issues of architecture, cities, and society; •• networking with different stakeholders in research, science, and practice; •• a focused and targeted communication of our projects and performance in research and teaching. Thematic Focus on “Urban Energies” The responsible handling of energy will be a key challenge for the smart cities of tomorrow. It will involve a consistent decrease in energy consumption and emissions as well as the promotion of energy concepts oriented towards the use of renewable energy sources, intelligent mobility concepts, and activating social and cultural resources for urban development. It is obvious that European cities in particular have a special sig-
Energieverbrauch und Emissionen, die Forcierung auf Konzepte im Einsatz erneuerbarer Energieträger, intelligente Mobilitätskonzepte als auch die Aktivierung sozialer und kultureller Ressourcen im Kontext der Stadtentwicklung. Es liegt auf der Hand, dass hier gerade den europäischen Städten aufgrund ihrer meist kompakten Strukturen, vor allem jedoch aufgrund der tief in ihnen verwurzelten gesellschaftlichen Verantwortung, eine besondere Bedeutung zukommt. Die städtebauliche und stadtplanerische Praxis muss auf die neuen Herausforderungen vorbereitet werden. Dazu bedarf es erheblicher Anstrengungen, die breite Öffentlichkeit für notwendige Strategien, Handlungsansätze und Entscheidungen zu sensibilisieren und zu einem verantwortlichen Tun zu bewegen. Grundlegend besteht dabei die Herausforderung, enge fachliche und/oder sektorale oder auch institutionelle Grenzen zu überschreiten, delegierte Zuständigkeiten zu überwinden und integrierte Ansätze in
Abb. 1: Das Mobile Stadtlabor (MSL) ist Hörsaal, Arbeits-, Seminarund Ausstellungsraum zugleich. Fig. 1: The Mobile Urban Lab serves at the same time as lecture room, working room, seminar and exhibition room.
nificance for this, not only because of their generally compact structures, but above all because of the social responsibility deeply engrained in their culture. The practice of urban development and urban planning needs to be prepared for new challenges. This demands considerable efforts to sensitise the broad public to necessary strategies and models for action and decisions, as well as persuading people to act responsibly. Our fundamental challenge is to push beyond narrow disciplinary and/ or sectoral or institutional limits, to overcome delegated accountabilities, and to establish integrated approaches in the development of the city and of urban space. We need new alliances in order to jointly address the
future.lab: Plattform für experimentelle und interdisziplinäre Lehre und Forschung | 181
der Entwicklung der Stadt und des städtischen Raumes zu etablieren. Benötigt werden neue Bündnisse, um die Herausforderungen des energetischen Umbaus der Gebäude und Quartiere, der Implementierung neuer Infrastrukturen wie neuer Formen der Mobilität und die Frage nach der gerechten Verteilung gemeinsam anzugehen.1 Forschung und Wissenschaft sind dazu herausgefordert, sich dessen anzunehmen, Wissen zu generieren, Erfahrungen zu vermitteln und weiter zu verbreiten.2 Dies impliziert die Stärkung vermehrt inter- und transdisziplinär angelegter sowie praxisorientierter Forschungsprojekte ebenso wie eine fachübergreifende, stimulierende und individuelle Neugierde weckende Ausbildung. Die mit dem Themen- und Arbeitsfeld „urbane energien“ verknüpften Zugänge und Herausforderungen erfordern unterschiedliche Kompetenzen und Erfahrungen in der Architektur wie in der Stadt- und Raumentwicklung, die sich kaum in einem Fachgebiet verankern, geschweige denn in einem sektoralen Zugang bewältigen lassen. Hier setzt das future.lab an, das, bezogen auf den Schwerpunkt, zu einer Plattform in der Initiierung, Organisation und Dokumentation spezifischer Veranstaltungen einer forschungsgeleiteten Lehre an der Fakultät für Architektur und Raumplanung wird. Im Rahmen eines Calls im Themenfeld „urbane energien“ wurden konkrete Vorhaben ausgewählt, die im Rahmen der Plattform besonders gefördert werden. Die Vorhaben verorten sich jeweils an den Schnittstellen von Architektur, Städtebau und Raumplanung. Ringvorlesungen und Kolloquien, Projekte und Seminare schaffen außergewöhnliche Angebote, die unterschiedliche Kompetenzen bündeln und vernetzen. Genau hier zeigt sich die Bedeutung dieser Plattform bezogen auf die Innen-Außen-Wirkung der Fakultät ebenso wie auf die Ansätze zur Profilschärfung in wichtigen Forschungsfeldern. Weitere Themenschwerpunkte Basierend auf den Erfahrungen des Schwerpunktes „urbane energien“ hat der Prozess zur Auswahl weiterer Themenschwerpunkte längst begonnen. Über ein
182 | Rudolf Scheuvens, Anna Kokalanova
challenges of energetically reorganising buildings and neighbourhoods, of implementing new infrastructure and new forms of mobility, and the problems of equitably distributing resources.1 Research and science are called upon to address these issues, to generate knowledge, to communicate, and to share experiences.2 This implies a strengthening of increasingly interdisciplinary, transdisciplinary, and practice-oriented research projects as well as providing stimulating, cross-disciplinary training that inspires individual curiosity. The approaches and challenges linked to the “urban energies” thematic focus and field of work demand a wide range of skills and experiences in architecture and in urban and regional planning that can hardly be pinned down to one subject, not to mention negotiated with a sectoral approach. This is where the future.lab comes in, a platform that initiates, organises, and documents specific events for focusing on research-led teaching at the Faculty for Architecture and Planning. A call for projects in the field of urban energies was used to select concrete project proposals that are now supported by the platform. All projects are situated at the interface of architecture, urban development, and spatial planning. Team-taught lecture series, colloquia, projects, and seminars create an exceptional programme, focusing and linking different skills. This is where the importance of the platform becomes evident, with regard to the internal and external impact of the faculty as well as to profile enhancing approaches in important research fields. Further Focal Points Based on experiences within the topic of urban energies, we have long since initiated the process of selecting further thematic foci. With a “parliament of questions”, we have now started a process to identify research initiatives that the future.lab platform will promote and support over the coming years.
„Parlament der Fragen“ wurde mittlerweile ein Prozess gestartet, über den Forschungsinitiativen identifiziert werden sollen, die in den kommenden Jahren über die Plattform des future.lab gefördert und unterstützt werden können. Das Mobile Stadtlabor Im Rahmen des Mobilen Stadtlabors findet das future. lab seinen besonderen Ort der Begegnung, der Ausein andersetzung, des Dialogs, des Lernens und des Forschens. Derzeit noch am Standort Karlsplatz, geht das Mobile Stadtlabor künftig auf Reisen. Es wird immer dort Präsenz zeigen, wo sich besondere Herausforderungen der Stadtentwicklung im Kontext von Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung abzeichnen: ein Gebäude auf Wanderschaft, als sichtbares Zeichen für den inhaltlichen Anspruch der Plattform future.lab. Anmerkungen/Notes 1 Peter Zlonicky, Bündnisse für eine nachhaltige Stadt, in: Städtische Energien, Dokumentation des Kongresses vom 11./12. Oktober 2012 in Berlin, hg. vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung, Berlin/Bonn 2013, 22. 2 Michael Krautzberger, Klimaschutz und historische Städte, in: Urbane Energien, Positionen des Kuratoriums zur Nationalen Stadtentwicklungspolitik 2012, hg. vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Berlin 2012, 23.
Abb. 2: Arbeiten im Mobilen Stadtlabor. Fig. 2: Working in the Mobile Urban Lab.
The Mobile Urban Lab The mobile urban lab provides a framework and special place for the future.lab to meet, discuss, create dialogue, learn, and research. Currently still located at Karlsplatz, however, the mobile urban lab will go travelling in the future. It will situate itself in places where particular challenges of urban development are becoming apparent in society, science, and research: a building on tour, a visible sign of the high standards of the future.lab platform.
future.lab: Plattform für experimentelle und interdisziplinäre Lehre und Forschung | 183
VERZEICHNIS DER AUTORINNEN UND AUTOREN INDEX OF AUTHORS Martin Berger, Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr.-Ing. E280 – Department für Raumplanung
Karin Harather, Ass. Prof. Mag. art. Dr. phil. E264 – Institut für Kunst und Gestaltung
Johann Bröthaler, Ass. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. E280 – Department für Raumplanung
Thomas Hasler, Univ. Prof. Dr. sc. techn. E253 – Institut für Architektur und Entwerfen
Nott Caviezel, Univ. Prof. Dr. phil. E251 – Institut für Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege
Georg Hauger, A. o. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. E280 – Department für Raumplanung
Jens S. Dangschat, O. Univ. Prof. Mag. rer. soc. oec. Dr. phil. E280 – Department für Raumplanung
Bardo Hörl, Ass. Prof., Dipl.-Ing. Dr. techn. E280 – Department für Raumplanung Bojan Ikic, Stud. Ass. Fachschaft::architekTUr
Marina Döring-Williams, Univ. Prof. Dr.-Ing. E251 – Institut für Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege
Françoise-Hélène Jourda †, Univ. Prof. Mag. arch. E253 – Institut für Architektur und Entwerfen
Alireza Fadai, Ass. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. E259 – Institut für Architekturwissenschaften
Christian Kern, Univ. Prof. Arch. Dipl.-Ing. E264 – Institut für Kunst und Gestaltung
Georg Franck-Oberaspach, O. Univ.- Prof. Dipl.-Ing. Dr. phil. E259 – Institut für Architekturwissenschaften
Michael Klamer, Ass. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. E280 – Department für Raumplanung
Oliver Frey, Univ. Ass. Dipl.-Ing. Mag. rer. soc. oec. Dr. rer. soc. oec. E280 – Department für Raumplanung
Sabine Knierbein, Ass. Prof. Dipl.-Ing. (FH) Dr. techn. E280 – Department für Raumplanung Anna Dimitrova Kokalanova, Univ. Ass. MSc E401 – Dekanatszentrum Karlsplatz 1
Michael Getzner, Univ. Prof. Mag. rer. soc. oec. Dr. rer. soc. oec. E280 – Department für Raumplanung
Christian Kühn, A. o. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. E253 – Institut für Architektur und Entwerfen
Rudolf Giffinger, Univ. Prof. Mag. rer. nat. Dr. techn. E280 – Department für Raumplanung
Dörte Kuhlmann, A. o. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr.-Ing. E259 – Institut für Architekturwissenschaften
184 | Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
Christoph Luchsinger, Univ. Prof. Dipl.-Arch. E260 – Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen Ardeshir Mahdavi, Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. E259 – Institut für Architekturwissenschaften Daniela Markova Fachschaft::architekTUr Otto Mittmannsgruber, Senior Artist Mag. arch. Dr. phil. E264 – Institut für Kunst und Gestaltung
Andreas Voigt, A. o. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. E280 – Department für Raumplanung Wolfgang Winter, O. Univ. Prof. Dipl.-Ing. E259 – Institut für Architekturwissenschaften Claudia Yamu, Univ. Ass. Dipl.-Ing. Dr. techn. PhD E280 – Department für Raumplanung Franz Zehetner, O. Univ. Prof. Dr. iur. E280 – Department für Raumplanung
András Pálffy, Univ. Prof. Dipl.-Ing. E253 – Institut für Architektur und Entwerfen Paulus Rajakovics, Univ. Ass. Dipl.-Ing. Dr. techn. E253 – Institut für Architektur und Entwerfen Helmut Schramm, A. o. Univ. Prof. Dipl. -Ing. Dr. techn. E253 – Institut für Architektur und Entwerfen Simon Sellner Fachschaft::architekTUr Stefanie Simic Fachschaft Raumplanung Robert Stalla, Univ. Prof. Dr. phil. Mag. art. E251 – Institut für Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege Astrid Staufer, Univ. Prof. Dipl.-Arch. E253 – Institut für Architektur und Entwerfen Richard Stiles, O. Univ. Prof. Dipl.-Ing. E260 – Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen Gerhard Steixner, Univ. Prof. Mag. arch. E253 – Institut für Architektur und Entwerfen
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren | 185
BILDNACHWEIS PHOTO CREDITS COVER Foto: © Daniel Dutkowski
TRAGWERK UND ARCHITEKTUR Abb.1:ITI/TU Wien (nach A. Calder); Abb.2: ITI/TU Wien
VORWORT DER REKTORIN Foto S. Seidler: © Raimund Appel
ÜBER DEN WACHSENDEN HORIZONT DER BAUPHYSIK Abb. 1, 2, 3: TU Wien, Abteilung für Bauphysik und Bauökologie
ENTWURF UND DESIGN Auftaktseite: Foto Markus Tomaselli HERAUSFORDERUNG WOHNEN Abb. 1: Florian Haydn; Abb. 2, 3: Helmut Schramm FORSCHENDES ENTWERFEN Abb. 1: Foto: Fujita Gumi, aus: Annette Spiro, Paulo Mendes da Rocha, Niggli-Verlag, Sulgen 2002, 105 DIE MÖGLICHKEIT EINER INSEL Abb. 1: Grafik aus: „Der Plan“ (2014), Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland; Abb. 2: Foto: Michael Seidel RETROPERSPEKTIVE – ANMERKUNGEN ZU EINER ARCHITEKTONISCHEN PRAXIS Abb. 1: © E253.6; Abb. 2: Foto: Herta Hurnaus; Abb. 3: Foto: Norbert Prommer EIN WEITER HORIZONT – SPANNENDE SCHNITTSTELLEN Auftaktseite: Foto: Markus Gesierich DENKMALPFLEGE ALS THEORIE DER PRAXIS Abb.1, 3: Elena Mali; Abb. 2: Elin Hirsch LEHRKANZEL KUNSTGESCHICHTE: GESTERN – HEUTE – MORGEN Abb.1: Foto: Lisa Rastl, © Akademie der bildenden Künste Wien; Abb. 2: Foto: Markus Gesierich
186 | Bildnachweis
KRITISCHE ARCHITEKTURTHEORIE Abb. 1: Dominik Fill/Clemens Rauber 2: Christian Vhladek DAS SURPLUS DER KUNST IN DER ARCHITEKTENAUSBILDUNG Abb. 1, 2, 3, 5: C. Hohenbüchler; Abb. 4: O. Mittmannsgruber ENTWICKLUNG UND ERSCHLIESSUNG DER KÜNSTE AN DER TU WIEN Abb. 1: Foto: Alek Kawka; Abb. 2, 3: Florian Rist RAUMPLANUNG IM SPANNUNGSFELD DER DISZIPLINEN Auftaktseite: Foto: F. Dembski, 2013 VON DER UNMÖGLICHKEIT, IN DER RAUMPLANUNG AUF EINEN LETZTGÜLTIGEN, GRÜNEN ZWEIG ZU KOMMEN Abb. 1: Abdruck mit freundlicher Erlaubnis von Friedrich Moser ÖRTLICHE RAUMPLANUNG – RAUM GESTALTEN Abb. 1: TU Wien, Fachbereich Örtliche Raumplanung; Abb. 2: Norbert Erlach; Abb. 3: © Daniel Dutkowski 11 POSITIONEN ZUR REGION Abb. 1: TU Wien, Fachbereich Örtliche Raumplanung
FASZINATION URBANISTIK Abb. 1, 2, 4, 5, 6, 7: Oliver Frey; Abb.3: Georg Irsa WEGE IN DIE STADT DER ZUKUNFT Abb.1: C. Yamu und T. Muraki, 2014; 2: SimLab, 2013; Abb. 3: C. Yamu 2011 STADTKULTUR UND ÖFFENTLICHER RAUM Abb. 1. Peter Gezik; Abb. 2: Karo* Architekten; Abb. 3: Sabine Knierbein ZWEI STUDIENRICHTUNGEN UNTER EINEM DACH Auftaktseite: © S. Schubert 200 JAHRE – WIDERSTAND, FREIHEIT UND SCHWEIGEN Abb.1: fachschaft::architektur FUTURE.LAB – PLATTFORM FÜR EXPERIMENTELLE UND INTERDISZIPLINÄRE LEHRE UND FORSCHUNG Abb. 1: © S. Schubert; Abb. 2: © P. Fattinger
Bildnachweis | 187