Der Produktionsfaktor Umwelt für die Erzeugung von Pflanzen: Ein betriebswirtschaftlicher Ansatz dargestellt am Beispiel der knappen natürlichen Ressource Wasser [1 ed.] 9783428495443, 9783428095445
Wasser ist essentiell - nicht nur für die Erzeugung von Pflanzen und Pflanzenteilen. Umweltbewußtsein, agrar- und umwelt
128 38 36MB
German Pages 452 Year 1999
Polecaj historie
Citation preview
ULRICH ORTH
Der Produktionsfaktor Umwelt für die Erzeugung von Pflanzen
Studien zu Umweltökonomie und Umweltpolitik Band 4
Der Produktionsfaktor Umwelt für die Erzeugung von Pflanzen Ein betriebswirtschaftlicher Ansatz dargestellt am Beispiel der knappen natürlichen Ressource Wasser
Von
Ulrich Orth
Duncker & Humblot . Berlin
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Orth, Ulrich: Der Produktions faktor Umwelt für die Erzeugung von Pflanzen: ein betriebswirtschaftlicher Ansatz dargestellt am Beispiel der knappen natürlichen Ressource Wasser I von Ulrich Orth. - Berlin : Duncker und Humblot, 1999 (Studien zu Umweltökonomie und Umweltpolitik ; Bd. 4) Zugl.: München, Techn. Univ., Habil.-Schr., 1998 ISBN 3-428-09544-8
Alle Rechte vorbehalten
© 1999 Duncker & Humblot GmbH, Berlin
Fotoprint: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin Printed in Germany ISSN 1435-0238 ISBN 3-428-09544-8 Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 97060
Vorwort Die vorliegende Arbeit behandelt ein Thema, das im betriebs wirtschaftlichen Schrifttum bisher weniger beachtet ist. Wasser ist zwar für die Erzeugung von Pflanzen oder Pflanzenteilen (wie Früchten, Blüten, Sprossen, etc.) ein unverzichtbarer Produktivfaktor, erschien jedoch im agrar-ökonomischen Bereich wegen bisher relativ niedriger Wasserpreise und vergleichsweise geringer betrieblicher Wasserkostenanteile betriebswirtschaftlich nur mäßig interessant. Eingesetztes Wasser, das nicht als Bestandteil in gärtnerische oder landwirtschaftliche Produkte eingeht, wird zum Teil Abwasser und mit enthaltenen Pflanzenbehandlungsstoffen und Abbauprodukten für weitere Verwendungszwecke oftmals ungeeignet. So ist die Frage der betrieblichen Wasserwirtschaft nicht nur auf der nachfragenden Seite unmittelbar mit dem Problem konkurrierender Verwendungszwecke verknüpft. Wachsendes Umweltbewußtsein, deutliche agrar- und umweltpolitische Restriktionen und regional bereits auftretende physische Knappheit machen die Ressource somit gerade auch für die Urproduktion zum ökonomisch relevanten Gegenstand. Somit konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf für Theorie und Praxis gleichermaßen bedeutende Sachverhalte und Fragestellungen betrieblicher Umweltökonomie und macht sie zum Objekt einer umfassenden Analyse, an die die Entwicklung einer neuen Methodik anknüpft. Mein Dank gilt allen, die mich während der Erstellung dieser Arbeit unterstützt haben. Insbesondere möchte ich meinem akademischen Lehrer und Mentor Herrn Univ. Prof. Dr. Werner Rothenburger (Technische Universität München in Freising-Weihenstephan) für seine vielfältigen Hinweise und die fürsorgliche Betreuung während der ganzen Zeit danken. Auf seine Anregung geht die Arbeit schließlich zurück. Weiterhin gilt mein Dank Herrn Univ. Prof. Dr. A. Heißenhuber (TU München) und Univ. Prof. Dr. E. Berg (Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn), die beide als Gutachter wertvolle Gedanken in das Werk einbrachten, sowie Herrn Univ. Prof. Dr. W. v. Urff (TU München) für die Übernahme des Vorsitzes.
6
Vorwort
Hervorheben möchte ich außerdem den Beitrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG, deren 9-monatiges Ausbildungsstipendium in den USA den Grundstein für die Arbeit legte. Am Department of Agricultural Economies der Michigan State University lieferten vor allem Prof. S. B. Harsh und Prof. S. C. Swinton "Baumaterial" sowie am Department of Natural Resources Prof. L. Leefers und Prof. E. Alocilja vom Department of Agricultural Engineering. Herzlich danken möchte ich schließlich den Mitarbeitern am Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Gartenbaues, hier vor allem Herrn Dip!. Ing. (FH) Gerhard Seidl, der unschätzbare Dienste bei allen Fragen der Soft- und Hardware leistete, und Frau Maria Ziegltrum für mehrfache aufmerksame Korrekturen des Manuskripts. Ein letzter, besonders inniger Dank ist zuletzt an meine Frau Juliane gerichtet, die mich geduldig und einfühlsam durch alle Höhen und Tiefen des Entstehens begleitete und dabei immer eine zuverlässige Stütze war.
Freising, im Dezember 1998
Ulrich Orth
Inhaltsverzeichnis Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19
A.
Problemstellung, Zielsetzung und Vorgehensweise ....................... 25
B.
Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut ........................... 29 I.
11.
III.
IV.
V. C.
Wasser für die Erzeugung von Pflanzen ............................ 29 1. Die Input-Seite: Wasser als essentielle Voraussetzung für die Erzeugung von Pflanzen .............................................. 29 a) Grundsätze der Beziehungen zwischen Pflanze, Wasser und Substrat 30 b) Produktionsfaktoren und Produktionsfunktionen ............... 32 2. Die Output-Seite: Auswirkungen auf die Wasserressource ........... 35 a) Wasser als Medium zum Transport von Schadstoffen ............ 35 b) Einwirkende Faktoren .................................... 36 c) Betroffene Bereiche ...................................... 37 d) Gartenbauliche Erzeugung: Punkt- oder diffuse Schadstoffquelle? .. 38 Der Wettbewerb um die natürliche Ressource ........................ 40 1. Wettbewerber .............................................. 41 2. Wettbewerbsregeln und Politikansätze .......................... 44 a) Externalitäten ........................................... 45 b) Ausgewählte Rechtsnormen zur Wassernutzung ................ 45 c) Optionen der Umwelt- und Landwirtschaftspolitik .............. 49 d) Evaluierung politischer Ansätze zum Wasserschutz ............. 54 e) Effekte staatlicher Regulierung auf pflanzenerzeugende Unternehmen ............................................... 56 Ökonomische Werte der Wasserressource ........................... 58 1. Wertekonzept .............................................. 58 a) Eine Definition von "Nutzung" ............................. 59 b) Ökonomischer Wert ...................................... 60 c) Besondere Wassereigenschaften mit Einfluß auf die Wertbestimmung .............................................. 61 d) Kategorien und Arten von Werten ........................... 64 2. Wertermittlungsansätze für Wasser ............................. 68 3. Studien zur Wertermittlung von Wasser ......................... 69 Wasserqualität ................................................ 72 1. Wasserqualität in der Pflanzenerzeugung ......................... 72 2. Umweltqualitätsziele ........................................ 74 3. Weitere Wasserqualitätsparameter .............................. 75 4. Ein problemadäquater Maßstab zur Beurteilung der Wasserqualität .... 77 Zwischenergebnis Kapitel B...................................... 79
Der Produktionsfaktor Wasser: Sein Einsatz als Entscheidungsproblem unter mehrfachen Zielsetzungen ...................................... 81 I.
Unternehmerische Zielsysteme .............. . ...... . ............. 81
8
Inhaltsverzeichnis I. Der Zielkatalog eines Unternehmens ........... , ................ 81 2. Entwicklung des Umweltschutzes in Unternehmen ................. 87 3. Ursachen, Gründe und Rahmenbedingungen der Etablierung des Umweltschutzes ............................................... 91 a) Umweltqualitätsziele und -standards ......................... 91 b) Ansätze zur Umsetzung von Umweltqualitätszielen ............. 92 11. Entscheidungstheoretische Grundlagen ............................. 98 I. Allgemeines ............................................... 98 2. Die Rolle sozialer Normen, individueller Präferenzen und Werte ..... 101 a) Präferenzen und Auswahlvorgänge ......................... 101 b) Motivierende Faktoren .................................. 103 3. Kritikpunkte an dem traditionellen Paradigma der Entscheidungstheorie 105 4. Elemente und Grundsätze mehrfaktorieller Entscheidungstheorie . . . . . 107 a) Attribute .............................................. 107 b) Ziele ................................................. 108 c) Restriktionen ..... . .................................... 109 d) Zielgrößen ............................................ 109 e) Kriterien .............................................. 110 t) Pareto Opti mali tät ...................................... I I I 5. Lösungsansätze mehrfaktorieller Entscheidungsprobleme .... . ...... 112 a) Zielorientierte Ansätze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 12 b) Nutzenbasierte Methoden ................................ 114 c) Eignung der Lösungsansätze zur Optimierung der Ressourcennutzung .............................................. 114 111. Entscheidungselemente bei der Nutzung von Wasser ................. 118 I. Kriterien, Ziele und Restriktionen der Wassernutzung ............. 119 a) Ertrag......................................... . ...... 120 b) Produktqualität ........................................ 121 c) Ansehen in der Öffentlichkeit ....... . ..................... 123 d) Wasserangebot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 e) Angebotene Wasserqualität ............................... 126 t) Mengen und Qualitäten eingesetzter Produktionsfaktoren ....... 128 aa) Wasser ........................................... 129 bb) Arbeit ............................................ 130 cc) Kapital .... . ...... . ... . ... . ...... . ... . .. . .... . .... 131 g) Kosten ............................................... 132 h) Zusatznutzen .......................................... 134 aa) Öffentliche Förderung von Ressourcenschutzmaßnahmen ... 134 bb) Synergien mit verschiedenen Betriebsmitteln ............. 135 2. Bedeutung der Entscheidungselemente ......................... 136 IV. Handlungsalternativen bei Wasserknappheit .................. . ..... 137 I. Neue Wasserquellen ....................................... 138 2. Verbesserung von Bewässerungssystemen und -praktiken .......... 140 a) Wassernutzungseffizienz ................................. 140 b) Verteilungsgenauigkeit .................................. 142 c) Bewässerungssysteme und -praktiken ....................... 142 d) Überlegungen zur Auswahl geeigneter Bewässerungssysteme .... 147 3. Verbesserungen in Speicher- und Verteilungssystemen ............ 147 4. Wiederverwendung von Rücklauf-/ Sickerwasser ................. 148 5. Technologien zur Belastungsminderung ........................ 149 6. Alternativen in der Erzeugungstechnik ......................... 150 7. Veränderung des angebauten Sortiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 8. Management-Optionen ..................................... 152 V. Wassernutzung unter mehrfachen Zielsetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Inhaltsverzeichnis
I. Vorhandene Lösungsansätze bei ähnlichen Problemstellungen ....... a) Simulation............................................ b) Lineare Programmierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. c) Dynamische Programmierung ............................. d) Goal Programming (GP) .................. : .............. e) Compromise Programming (CP) ........................... f) Interaktive Entscheidungsansätze bei mehrfachen Zielsetzungen (IMCDM) ............................................ g) Parametrische Programmierung ...................... . ..... 2. Grundzüge einer problemadäquaten Entscheidungstechnik .......... a) Beurteilung der vorgestellten Ansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. b) Lastenkatalog der zu entwickelnden Methode ................. VI. Fazit Kapitel C .............................................. D.
153 154 156 159 161 165 166 167 169 169 175 177
Entscheidungsunterstützung durch Umwelt-Management-Systeme .... . ..... 181 I.
Grundlagen des Umweltmanagements und -Controlling ............... I. Begriffsabgrenzungen ...................................... 2. Aufgaben, Zielsetzungen und Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Anforderungen an ein Umwelt-Controlling-System ............ b) Beobachtungsfelder und Anspruchsgruppen ............ . ..... c) Systemansatz eines Umwelt-Controlling ..................... 3. Umweltmanagement und -Controlling im Führungssystem .......... a) Normatives Umweltmanagement ........................... b) Strategisches Umweltmanagement ......................... c) Operatives Umweltmanagement ............................ II . Instrumente und Konzepte zur Gewinnung und Bewertung entscheidungsrelevanter Umwelt-Informationen ................................ 1. Instrumente .............................................. a) Umwelt-"Kennzahlen" ................... . ........... . ... b) Produktlinienanalyse und Produktbilanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . .. c) Öko-Bilanzen .......................................... d) Kosten-Nutzwert-Methode ............................... 2. Konzepte ................................................ a) Betriebliche Umweltinformationssysteme (BUIS) .............. b) Bewertung der Informationen nach ökologischen Gesichtspunkten c) Öko-Audit ............................................ 3. Umweltberichterstattung .................................... a) Umweltberichte ........................................ b) Umwelterklärungen ..................................... 4. Vergleich und Beurteilung der vorgestellten Ansätze .............. III. Fazit Kapitel D .............................................. E.
9
181 182 184 184 186 188 190 190 191 192 197 198 198 199 201 203 206 206 209 212 215 215 218 219 221
Umwelt-Controlling mit der Ressourcen-Nutzungs-Analyse RNA .......... 223 I.
Festlegung wichtiger Strukturmerkmale ........................... 1. Beschränkung auf das Umweltkompartiment Wasser ........ . ..... 2. Verankerung im Zielsystem der Unternehmung .................. a) Zugrundeliegender Stoffkreislauf .......................... b) Grundnutzen des Wassereinsatzes .......................... c) Mengen und Qualitäten eingesetzter Produktionsfaktoren ....... d) Kosten ........................................ . ...... e) Zusatznutzen der Ressourcenverwendung .................... f) Image der Wassernutzung ................................
223 223 224 225 226 226 228 229 229
10
Inhaltsverzeichnis 3. Herleitung aus bekannten Ansätzen ............................ 11. Ergänzung durch eine Image-Komponente ......................... I. Grundstruktur der Beurteilungstheorie ......................... a) Problemstellung ........................................ b) Image-Konzept ........................................ aa) Reale Ausprägungen der objektiven Merkmale - Faktische Ressourcennutzung ................................. bb) Wahrgenommene Ausprägungen - Image der Ressourcennutzung ........................................... cc) Idealausprägungen .................................. dd) Unzufriedenheit: Abweichung zwischen wahrgenommener und Idealausprägung ................................ ee) Segmentierung der imagegebenden Öffentlichkeit .......... 2. Messung der (Un)Zufriedenheit - Das Idealpunkt-Modell ........... a) Meßmethode .......................................... b) Skalierung der Merkmale ................................. c) Empirischer Einsatz der (Un)Zufriedenheitsanalyse ............ d) Ergebnisdarstellung in der Ressourcen-Nutzungs-Matrix ........ III. Bilanzierungsansatz ........................................... 1. Mengengerüst ............................................ a) Physischer Wasserfluß ................................... b) Grundnutzen .......................................... c) Faktoreinsatz .................... . ..................... 2. Wertgerüst ............................................... 3. Imageanalyse ............................................. a) Imageattribute, Indikatoren und Skalen ...................... b) Vorgehensweise ........................................ c) DatenquelIen .......................................... d) Erhebungsorte ......................................... e) Erhebungszeitpunkt ..................................... f) Fragebogenaufbau ...................................... g) Stichprobe ............................................ IV. Steuerungsansatz ............................................. I. Drei tragende Säulen ....................................... a) Das Prinzip der Zufriedenheit (satisfaction) .................. b) Das Prinzip der Durchführbarkeit (feasibility) ................ c) Das Konzept Pareto-optimaler Lösungen (pareto Optimality) .... 2. Ansatzpunkte zur Verbesserung der Ressourcen-Nutzung .......... a) Parametrischer Algorithmus zur Bestimmung einer zufriedenstelIenden und erreichbaren Lösung ........................ aa) Vorgehensweise .................................... bb) Definition von Aspirationsniveaus ...................... cc) Ungleichheiten zwischen angestrebten und erreichten Werten dd) Potentiale und Restriktionen für Verbesserungen .......... ee) Zufriedenstellende Lösungen .......................... ff) Sensitivitätsanalyse und Trade-offs ..................... 3. Strategieentwicklung ....................................... a) Identifizierung von Abweichungsursachen ................... b) Aufgabenadäquate Zielformulierung ........................ c) Ansatzpunkt "Reale Objektmerkmale" - Veränderung der Ressourcennutzung ............................................ d) Ansatzpunkt "Wahrnehmung der Merkmalsausprägungen" - Die RNA als Grundlage umwelt-orientierter Öffentlichkeitsarbeit .... aa) Strategien zur Imagebildung und -pflege .................
230 233 233 233 234 234 235 239 240 241 244 244 246 248 250 251 251 252 254 255 258 259 259 260 260 262 262 262 263 264 264 264 266 268 269 269 270 272 273 275 277 278 278 278 280 281 284 284
Inhaltsverzeichnis
11
bb) Ökologische Orientierung der Kommunikationspolitik ...... 287 e) Abschließende Bemerkung ............................... 293 F.
Simulationsmodell zur RNA ................................ . .. . ... 295 Modellbausteine .............................................. I. Das Modul "Pflanze" ....................................... 2. Das Modul "Technik" ...................................... 3. Das Modul "Management" ................... . ....... . .. . ... 4. Das Modul "Wasser" ....................................... 5. Die .. Sozio-Ökonomische Umwelt" ............................ 11. Gleichungen ................................................. I. Menge und Qualität der Erzeugung ............................ a) Einfluß der applizierten Wassermenge ...................... b) Einfluß der zugeführten Wasserqualität ...................... c) Allgemeine Ertragsgleichung .............................. 2. Wasser .................................................. a) Input ..................................... . .......... b) Output ............................................... 3. Arbeit ................................................... a) Wasserbezogener Arbeitsbedarf einer Kultur ................. b) Wasserbezogener Arbeitsbedarf eines Unternehmens ........... 4. Kapital .................................................. a) Wasserbezogener Kapitalbedarf einer Kultur ................. b) Wasserbezogener Kapitalbedarf eines Unternehmens ........... 5. Kosten .................................................. a) Input-Kosten der Wassernutzung ..... . .................... b) Kosten der Wasserfreisetzung ............................. 6. Zusatznutzen ............................................. a) Staatliche Förderungen .................................. b) Einsparung an Betriebsmitteln ............................. 7. Image ................................................... 8. Formalisierte Ressourcen-Nutzungs-Matrix ..................... III. Vereinfachtes Beispiel ......................................... I. Ausgangssituation ............................. . ........ a) Beispielsmodul "Pflanze" ................................ b) Beispielsmodul "Technik" ................................ c) Beispielsmodul "Wasser" ....................... . ........ d) Bilanzierung der gegenwärtigen Ressourcennutzung ........... 2. Auswirkungen veränderter Rahmenbedingungen ................. a) Preisanstieg bei Leitungswasser ........................... b) Einführung einer Grundwasseremnahmegebühr ............... c) Erhebung einer Wasser-Output-Abgabe ..................... d) Quotierung der Wasserentnahmemengen .................... 3. Handlungsmöglichkeiten zur Verringerung der Unzufriedenheit ..... a) PR-Kampagne zur Verbesserung des Wasser-Nutzungs-Images ... b) Veränderung des Erzeugungsprogrammes .................... c) Veränderung der Bewässerungstechnik ...................... d) Erschließung einer zusätzlichen Wasserquelle ................ I.
G.
295 296 296 299 299 300 302 302 303 305 306 307 307 310 312 313 313 313 314 315 3 16 316 317 320 320 321 322 324 325 325 326 328 329 329 333 334 334 334 335 336 337 338 339 341
Fallstudien... .................... . ... . ....................... 344 I.
Umweltcontrolling im Einzelbetrieb . . . .......... . ................ 344 I. Betriebsbeschreibung ....................................... 345
12
Inhaltsverzeichnis 2. Wassernutzung im Untersuchungsbetrieb ....................... a) Physischer Wasserfluß .................. . ... . ... . .. . . .... b) Grundnutzen ............................. . ...... . ..... c) Faktoreinsatz .......................................... d) Kosten ............................................... e) Zusatznutzen .......... . ... . ... . ...... . ................ t) Image .......................................... . ..... g) Wassernutzungsmatrix ................................... 3. Zusammenfassung des ersten Fallbeispiels ...................... H. Anwendung der RNA in einem geschlossenen Anbaugebiet ............ I. Problemstellung ........................................... a) Allgemeines ............................ . .............. b) Geologische und hydrologische Verhältnisse ................. c) Wettbewerb um die Ressourcennutzung ..................... d) Probleme im Zusammenhang mit der bestehenden Wassernutzung 2. Zielsetzung und Vorgehensweise .............................. 3. Gegenwärtige Wassernutzung (Ist-Situation) .. . ................. a) Physischer Wasserfluß ............................. . ..... b) Grundnutzen .......................................... c) Faktoreinsatz .......................................... d) Kosten ............................................... e) Image .............................. . ........... . ..... f) Wassernutzungsmatrix ................................... 4. Geplante Wassernutzung (Alternative A s) ....................... a) Physischer Wasserfluß ................................... b) Grundnutzen .......... . .......... . .............. . ..... c) Faktoreinsatz .......................................... d) Kosten ............................................... e) Zusatznutzen einer Umstellung ............................ f) Image .............................. . ................. g) Wassernutzungsmatrix .......... . ... . .............. . ..... 5. Vergleich und Folgenabschätzung ............................. a) Verbandsebene ........................................ aa) Voraussichtliche wirtschaftliche Folgen ................. bb) Einflußfaktoren und Einsparungspotentiale ............... b) Ebene eines Mitgliedsbetriebes ............................ 6. Zusammenfassung des zweiten Fallbeispiels ......................
347 347 348 349 353 353 355 357 359 360 361 361 361 363 363 364 365 365 367 368 371 372 376 378 379 381 381 386 388 389 390 391 392 392 395 396 401
Zusammenfassung und Ausblick ........................................ 404 Literaturverzeichnis .................................................. 411 Stichwortverzeichnis . ................................................ 449
Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Tabelle 2: Tabelle 3: Tabelle 4:
Merkmale der natürlichen Ressource Wasser ..................... 22 Wasserbedarf ausgewählter gärtnerischer Kulturen ................ 31 Ausgewählte Untersuchungen zum Produktionsfaktor Wasser ....... 34 Auswirkungen verschiedener Belastungsfaktoren auf die Wasserressource ................................................. 37 Nutzungsarten der Ressource ................................. 42 Tabelle 5: Tabelle 6: Konkurrenzverhältnisse bei der Wassernutzung ................... 43 Arten der Nutzung von Wasserressourcen ....................... 44 Tabelle 7: Ausgewählte Rechtsnormen zur Wassernutzung nach GeltungsTabelle 8: bereichen ................................................ 47 Ansatzpunkte und Wirkungsmechanismen umweltpolitischer MaßTabelle 9: nahmen .................................................. 50 Tabelle 10: Ausgewählte Studien über die Anwendung ökonomischer Anreizinstrumente zum Schutz der Wasserressource .................... 51 Tabelle 11: Ausgewählte Kriterien zur Evaluierung politischer Ansätze zum Wasserschutz ............................................. 55 Tabelle 12: Ausgewählte Instrumente der Landwirtschafts- und Umweltpolitik .... 56 Tabelle 13: Ausgewählte Wertermittlungssätze für Wasser .................... 68 Tabelle 14: Ausgewählte Studien zur Wertermittlung bei Wasser ..... . ... . .... 70 Tabelle 15: Richtwerte zur Beurteilung der Wasserqualität ................... 74 Tabelle 16: Wasserqualitätsparameter, -indizes und -indikatoren ............... 76 Tabelle 17: Maßstab zur Beurteilung der Wasserqualität ..................... 78 Tabelle 18: Ausgewählte betriebswirtschaftliche Studien unternehmerischer Zielsysteme .................................................. 82 Tabelle 19: Ausgewählte agrarökonomische Studien unternehmerischer Zielsysteme 83 Tabelle 20: Stellung des Umweltschutzes im Zielsystem bayerischer Zierpflanzenbaubetriebe ............................................... 84 Tabelle 21: Zielkatalog der Unternehmung. . . . .. . ........................ 86 Tabelle 22: Entwicklungsgeschichte der Umweltorientierung von Unternehmen ... 89 Tabelle 23: Relevanz des Umweltschutzes in Unternehmen ................... 90 Tabelle 24: Rahmenbedingungen für Umweltqualitätsziele ..... . ... . ......... 94 Tabelle 25: Gründe einer ökologischen Unternehmenspolitik .................. 96 Tabelle 26: Vorgehensweisen zur Entscheidungsfindung ..................... 99 Tabelle 27: Qualitätsmerkmale von Zierpflanzen .......................... 123 Tabelle 28: Betroffenheit der Unternehmen durch umweltschutzbezogene Forderungen verschiedener Anspruchsgruppen ....................... 124 Tabelle 29: Tolerierbare Höchstgehalte im Gießwasser ..................... 127 Tabelle 30: Ausgewählte Studien zu den Kosten einer Wassernutzung ......... 133 Tabelle 31: Ausgewählte Studien zu Handlungsalternativen bei Wasserknappheit . 138 Tabelle 32: Wassernutzungseffizienzen (WNE) verschiedener Kulturen ........ 141 Tabelle 33: Bewässerungssysteme unter Glas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 143 Tabelle 34: Bewässerungssysteme im Freiland ............................ 146 Tabelle 35: Handlungsmöglichkeiten bei Wasserknappheit .................. 153 Tabelle 36: Ausgewählte Lösungsansätze für Entscheidungsprobleme unter mehrfacher Zielsetzung .................................... 154 Tabelle 37: Eignung der vorgestellten Ansätze bezüglich der Zielsetzung der Arbeit .................................................. 174
14 Tabelle 38: Tabelle 39: Tabelle 40: Tabelle 41: Tabelle 42: Tabelle 43: Tabelle 44: Tabelle 45: Tabelle 46: Tabelle 47: Tabelle 48: Tabelle 49: Tabelle 50: Tabelle 51: Tabelle 52: Tabelle 53: Tabelle 54: Tabelle 55: Tabelle 56: Tabelle 57: Tabelle 58: Tabelle 59: Tabelle 60: Tabelle 61: Tabelle 62: Tabelle 63: Tabelle 64: Tabelle 65: Tabelle 66: Tabelle 67: Tabelle 68: Tabelle 69: Tabelle 70: Tabelle 71: Tabelle 72: Tabelle 73: Tabelle 74: Tabelle 75: Tabelle 76: Tabelle 77: Tabelle 78: Tabelle 79: Tabelle 80: Tabelle 81: Tabelle 82: Tabelle 83: Tabelle 84: Tabelle 85: Tabelle 86: Tabelle 87:
Tabellenverzeichnis Wassernutzung als mehrfaktorielles Entscheidungsproblem ........ Anforderungen an das zu entwickelnde eigene Modell ............ Maßnahmen umweltorientierter Leistungserstellung .............. Maßnahmen umweltorientierter Öffentlichkeitsarbeit ............. Wasser- und Abwasserkennzahlen ............................ Matrix der Entscheidungsschichten für die Kosten-NutzwertMethode ................................................ Kosten-Nutzwert-Matrix für den Pflanzenschutz bei Möhren ....... Chancen und Risiken des Einsatzes von BUIS ................... Bestandteile eines Öko-Audit und ihre Einbindung in ein BUIS ..... Vergleich verschiedener Konzepte und Instrumente .............. Einteilung unternehmerischer Ziele ........................... Entscheidungsschicht "Faktoreinsatz" ......................... Entscheidungsschicht "Kosten" ........ . ... . .. . ........... . .. Entscheidungsschicht "Zusatznutzen" ......................... Entscheidungsschicht "Image" ............................... Matrix der Ressourcen-Nutzungs-Analyse ...................... Checkliste Grundnutzen ................................. . .. Checkliste Wassermengen .................................. Checkliste Faktor Arbeit .................................... Checkliste Faktor Kapital ................................... Checkliste Zusatznutzen .................................... Checkliste Wertgerüst ...................................... Merkmale, Meßniveaus und Frageformen .................. . ... Detailfragen für eine Imageanalyse (Beispiele) .................. Beispiele für Strategien zur Erhöhung der Zufriedenheit mit dem Grundnutzen ............................................. Beispiele für Strategien zur Erhöhung der Zufriedenheit mit dem Faktoreinsatz ............................................ Beispiele für angestrebte Wettbewerbspositionen ................ Variablen und Konstanten des Moduls "Pflanze" ................ Variablen und Konstanten des Moduls "Technik" ................ Wassernutzungseffizienzen ................................. Variablen des Moduls "Wasser" .............................. Variablen des Moduls "Sozio-Ökonomische Umwelt" .... . ....... Formalisierte Wassernutzungsmatrix .......................... Beispiels-Werte im Modul "Pflanze" .......................... Beispiels-Werte im Modul "Technik" - Teil 1: Bewässerungstechnik . Beispiels-Werte im Modul "Technik" - Teil 2: Distributionstechnik .. Beispiels-Werte im Modul "Technik" - Teil 3: Quelltechnik ........ Beispiels-Werte im Modul "Wasser" .......................... Wasserbedarf im Modellbetrieb .............................. Wasserbezogener Arbeitsbedarf im Modellbetrieb ................ Wasserbezogener Kapitaleinsatz im Modellbetrieb ............ . .. Kosten der Wassernutzung im Modellbetrieb .................... Auswirkungen verschiedener Handlungsmöglichkeiten ............ Betriebsspiegel ........................................... Grundnutzen des Faktoreinsatzes (Stand: 1996) .............. . .. Einsatz des Faktors Wasser (Stand: 1996) ........... . ... . ...... Einsatz des Faktors Arbeit (Stand: 1996) ....................... Einsatz des Faktors Kapital (Stand: 1996) ...................... Jährliche Teilkosten der Wassernutzung (nur Input, Stand: 1996) .... Zusatznutzen des Wassereinsatzes (Stand: 1996) .................
179 179 195 196 198 204 205 209 213 220 226 227 228 229 230 232 254 256 257 257 258 259 260 263 281 283 285 296 297 298 300 301 324 327 328 328 329 329 330 331 331 332 343 346 349 350 351 352 353 355
Tabellenverzeichnis Tabelle 88: Tabelle 89: Tabelle 90: Tabelle 91: Tabelle 92: Tabelle 93: Tabelle 94: Tabelle 95: Tabelle 96: Tabelle 97: Tabelle 98: Tabelle 99: Tabelle 100: Tabelle 101: Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle
102: 103: 104: 105: 106: 107: 108: 109: 110: 111: 112:
Tabelle 113: Tabelle 114: Tabelle 115:
Verfahrensvergleich: Umstellung aufrezirkulierendes System bei Pelargonium zonale ................................... . ... Image der Wassernutzung (Stand: 1996) .................... . .. Wassernutzungsmatrix 1996 des Untersuchungsbetriebs ......... Struktur des Wasserverbandes Knoblauchsland (Stand: 1996) ...... Grundnutzen des Faktoreinsatzes (Ist-Situation) ................. Einsatz des Faktors Wasser (Ist-Situation) ...................... Entwicklung des Wasserverbrauchs in den Jahren 1983-1993 ....... Nitratwerte 1996 (Ist-Situation) .............................. Einsatz des Faktors Arbeit (Ist-Situation) ....................... Einsatz des Faktors Kapital (Ist-Situation) ...................... Kosten der Wassernutzung 1995 ............................. Repräsentanz der Stichprobe zur Imageanalyse .................. Informationsquellen der relevanten Gruppen .................... Bedeutung eines schonenden bzw. sparsamen Umgangs mit der natürlichen Ressource Wasser für die Befragten ................. Wassernutzungsmatrix 1995 ............................... Grundnutzen des Faktoreinsatzes (Alternative As - optimistisch) .... Wasserqualität - Ergebnisse des Kurzzeit-Pumpversuchs .......... Einsatz des Faktors Arbeit (Alternative As - pessimistisch) ......... Einsatz des Faktors Kapital (Alternative As) .................... Kosten der Wassernutzung (Alternative As) ..................... Zusatznutzen des Wassereinsatzes (Alternative As) ............... Wassernutzungsmatrix Asop'inus'isch ........................... Wassernutzungsmatrix AsJ>Cssimistisch .......................... Wirtschaftliche Folgen auf Verbandsebene ..................... Wesentliche Einflußfaktoren der Folgenabschätzung und ihre Berücksichtigung in den bei den Varianten der Alternative As ....... Betriebswirtschaftliche Folgen in den beiden Varianten der Alternative As ....................................... . .... Wasserkosten der Jahre 1990 bis 1995 ......................... Betriebswirtschaftliche Folgen auf Kulturebene ..................
15 356 357 358 361 367 368 368 369 370 371 372 373 374 375 377 381 383 384 385 386 388 390 391 394 395 398 399 400
Abbildungsverzeichnis Abbildung I: Abbildung 2: Abbildung 3: Abbildung 4: Abbildung 5: Abbildung 6: Abbildung 7: Abbildung 8: Abbildung 9: Abbildung 10: Abbildung 11: Abbildung 12: Abbildung 13: Abbildung 14: Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung
15: 16: 17: 18:
Abbildung 19: Abbildung 20: Abbildung 21: Abbildung 22: Abbildung 23: Abbildung 24: Abbildung 25: Abbildung 26: Abbildung 27: Abbildung 28: Abbildung 29: Abbildung 30: Abbildung 31: Abbildung 32: Abbildung 33: Abbildung 34: Abbildung 35: Abbildung 36: Abbildung 37:
Der natürliche Wasserkreislauf der Erde ......... . ...... . ...... 19 Entwicklung der Wasserpreise in Deutschland .................. 24 Hauptkomponenten des Systems Pflanze - Boden .. . ...... . ...... 32 Instrumente der Umweltpolitik .............................. 49 Wertermittlungsmethoden .................................. 67 Bedeutung verschiedener Image-Attribute für Konsumenten (n=168) . 85 Entwicklung des Umweltbewußtseins in Westdeutschland ......... 88 Ableitung von Umweltqualitätszielen ......................... 91 Mögliche GrundeinsteIlungen zu Rechtsnormen ................ 103 Entscheidungselemente ................................... 111 Relativer Ertrag in Abhängigkeit von zugeführter Wassermenge und -qualität bei Zea mays ................................. 121 Sickerwasserbildung in Abhängigkeit von zugeführter Wassermenge und -qualität bei Zea mays ................................. 130 Bedeutung verschiedener Kriterien der Wassernutzung in bayerischen Gartenbauunternehmen ............................. 137 Dimensionen der Entscheidungen zur Wassernutzung für einen Unternehmensbereich (z.B. Produktion) ...................... 178 Anthropogene und natürliche Umwelt der Unternehmung ........ 182 Umwelt-Controlling als System ............................. 189 Ergebnisprofil einer Produktlinienanalyse ..................... 200 Funktionen und Adressaten betrieblicher Umweltinformationssysteme ................................................ 208 Nutzen eines Öko-Audits bei verschiedenen Zielgruppen ......... 214 Ziele und Grundsätze von Umweltberichten ................... 216 Zielgruppen und Nutzen von Umweltberichten ................. 217 Wasserverwendung in Unternehmen mit Pflanzenerzeugung ...... 225 Attribute eines Unternehmensimages ......................... 236 Bedeutung verschiedener Imageattribute bei der Wahl von Einkaufsstätten (n=220) ...................................... 237 Operationalisierung der Image-Schicht ....................... 238 Einfache Vorlage zur Ermittlung eines Eigenschaftsprofils ........ 248 (Un)Zufriedenheitsprofil eines Unternehmens (fiktiv) ............ 250 Modellhafter Wasserfluß im Unternehmen .................... 253 Vorgehensweise zur Imageanalyse ........................... 261 Aspirationsniveaus in einem Ressourcen-Nutzungs-Profil ........ 265 Reduktion des Entscheidungsraums durch das Prinzip der Durchführbarkeit ............................................. 267 Algorithmus zur Bestimmung einer zufriedenstelIenden Lösung .... 271 Controlling-Ansatz der Ressourcen-Nutzungs-Analyse ........... 272 Prioritäten-Portfolio für Soll-Ist-Abweichungen ................ 274 Reihenfolge zur Abarbeitung/Untersuchung von Handlungsmöglichkeiten .............................................. 276 Beurteilungsrahmen ressourcenschonender Maßnahmen .......... 277 Positionierung eines Unternehmens in einem zweidimensionalen Ziel system als umweltschonender Anbieter ho her Produktqualität .. 286
Abbildungsverzeichnis Abbildung 38: Abbildung 39: Abbildung 40: Abbildung 41: Abbildung 42: Abbildung 43: Abbildung 44: Abbildung 45: Abbildung 46: Abbildung 47: Abbildung 48: Abbildung 49: Abbildung 50: Abbildung 51: Abbildung 52: Abbildung 53: Abbildung 54: Abbildung 55: Abbildung 56: Abbildung 57: Abbildung 58:
2 Orth
Bausteine des Simulationsmodells ........................... Strategien zur Veränderung der Ressourcennutzung ............. Ertrag in Abhängigkeit von der applizierten Wassermenge ........ Einfluß von applizierter Wassermenge und Entwicklungszustand auf den Ertrag ........................................... Einfluß der zugeführten Wasserqualität auf die Ertragshöhe ....... Verlauf der Kosten zur Reduzierung unerwünschter Ist-SollAbweichungen des Ressourcen-Nutzungs-Images ............... Aufbau der Excel-Arbeitsmappe mit dem Simulationsmodell ...... Wasserflußschema im Modellbetrieb ......................... Wasserströme im Modellbetrieb ............................ Ergebnis der modellhaften Imageanalyse ...................... Wasser-Nutzungs-Matrix im Modellbetrieb (Ausgangssituation) ... Wasserstrom im Modellbetrieb nach Einführung einer Trinkwasserquote ................................................. Wasser-Nutzungs-Matrix II im Modellbetrieb .................. Wasserstrom im Modellbetrieb nach Ersatz der Schnitt-Chrysanthemen ................... . ............................ Wasser-Nutzungs-Matrix III im Modellbetrieb ................. Wasserstrom im Modellbetrieb bei veränderter Bewässerungstechnik ................................................ Wasser-Nutzungs-Matrix bei Realisierung aller Handlungsmöglichkeiten .............................................. Physischer Wasserfluß im Unternehmen (Stand: 1996) .. . ........ Modellhafter Wasserfluß der Ist-Situation ..................... Wassernutzungs-Image des Knoblauchslandes ................. Modellhafter Wasserfluß der Alternative As ...................
17 295 300 304 304 306 323 326 327 330 332 333 336 337 339 340 341 342 348 366 376 380
Abkürzungsverzeichnis AbwAG AFP ASAE B.A.U.M BayStMLU ber. BGBI BSB CP d d.G. FAO et al. f. ff. GfK GP IMCDM KOM KTBL LAWA LGP LP MADM MODM OECD PflSchG PLA PÖW RNA SFB SRU TrinkWV UBA UIG UmweltHG UVP WGP WHG ZVG
Abwasserabgabengesetz Autorenkürzel American Society of Agricultural Engineers Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewußtes Management e. V. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen berichtigt Bundesgesetzblatt Biologischer Sauerstoffbedarf Compromise Programming dies (Tag) durch Gesetz Food and Agriculture Organisation of the United Nations et alies (und andere) folgende Seite folgende Seiten Gesellschaft für Konsumforschung, Nürnberg Goal Programming Interactive Multiple Criteria Decision Making Kommission (der Europäischen Union) Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft Länderarbeitsgruppe Wasser Lexicographic Goal Programming Linear Programming Multiple Attribute Decision Making Multiple Objective Decision Making Organisation for Economic Cooperation and Development Pflanzenschutzgesetz Produktlinienanalyse Projektgruppe Ökologische Wirtschaft Ressourcen-Nutzungs- Analyse Sonderforschungsbereich Sachverständigenrat für Umweltfragen Trinkwasserverordnung UmweItbundesamt Umweltinformationsgesetz Umwelthaftungsgesetz Umweltverträglichkei tsprüfung Weighted Goal Programming Wasserhaushalts gesetz Zentral verband Gartenbau e. V.
Einleitung "Water is the quintessential multiattribute good. It supports fish and birds, humans drink it, cleanse with it, grow food with it, recreate on it, maintain landscaping with it, and generate electricity from its flow. Decisions have been made from the time of recorded history about how water should appear, when it should appear, and how it should be used." (Carsonl Martin 1991, S.389) Ein wesentliches Konzept zum Verständnis der folgenden Ausführungen ist der Wasserkreislauf der Erde (siehe Abbildung 1).
r 1
~t~
t
-----.;
~
EvaporatlOn~
Oberflächen abfluß
kapillarer Aufstieg Sickel'VVasser
I
ce
'"'PO"'""''''"" ,...
_no' Uferfiltration
1
Grundwasserabfluß
Grundwasserneubildung
Grundwas\erltrom
Grundwasser
Quelle: verändert nach FAO 1994, S.235
Abb. 1: Der natürliche Wasserkreislauf der Erde
Er stellt eine Verknüpfung aller Erscheinungsformen der Ressource von der Dampf-, über die flüssige bis hin zur festen Phase dar und ist unverzichtbar bei der Betrachtung der Wassernutzung zur Erzeugung von Pflanzen. 2"
20
Einleitung
Grundbestandteile des Wasserkreislaufs sind Niederschläge, Evaporation, Transpiration, Infiltration, Tiefenversickerung (Perkolation), Oberflächenabfluß und Lagerung. Niederschläge bringen Wasser in flüssiger (Regen, Tau) oder fester Form (Schnee, Rauhreif, Hagel) aus der Atmosphäre auf die Erdoberfläche. In der Regel durch Evaporationsprozesse wird Wasser dann von der flüssigen in seine gasförmige Form überführt. Es verdunstet dabei aus den Weltmeeren, aus Seen, Flüssen, von der Erdoberfläche oder anderen Oberflächen. Transpiration bezeichnet den Prozeß, bei dem Wasser vom Wurzel system der Pflanzen aufgenommen wird, den Pflanzenkörper passiert und dann in die Atmosphäre abgegeben wird. Aufgesaugt oder absorbiert wird Wasser von den oberen Bodenschichten durch den Prozeß der Infiltration. Tiefenversickerung nennt man die weiter abwärts gerichtete Wasserbewegung durch den Boden oder durchlässige Gesteinsschichten bis zum Grundwasserleiter. Oberflächenabfluß entsteht dagegen als Differenz zwischen Niederschlägen oder Bewässerung (Input) und dem Output durch Evapotranspiration und Versickerung dar. Er ist die schwerkraftgeleitete Bewegung von Überschußmengen in Oberflächenkanälen. An verschiedenen Stellen des Kreislaufs wird Wasser gespeichert, zum Beispiel in den Ozeanen, Seen, Flüssen, Staubecken, Grundwasser-Aquiferen, der Atmosphäre, in Pflanzenzellen, Wolken oder auch im Boden. Wegen der ungeheuren Wassennengen, die von lebenden Pflanzen aufgenommen, weitergeleitet und wieder abgegeben werden, sind Pflanzen eine wesentliche Komponente in diesem Wasserkreislauf. Sterben sie ab, kehrt das in ihnen enthaltene Wasser über Verdunstung in den Kreislauf zurück. Werden landwirtschaftliche oder gärtnerische Kulturen geerntet, kehrt das enthaltene Wasser ebenfalls in den Kreislauf zurück; diesmal entweder durch Dehydrierung/ Evaporation, Verarbeitungs- oder Verzehrsrückstände. Eine ausführlichere, sehr detaillierte und auf die Pflanzenerzeugung bezogene Beschreibung des Wasserkreislaufs findet sich darüber hinaus zum Beispiel bei Cervinka (1989, S.144ff.). Von allen natürlichen Ressourcen, die für die menschliche Gesundheit und Zivilisation notwendig sind, ist Wasser eine der wichtigsten. Dabei ist die Bundesrepublik Deutschland ein sehr wasserreiches Land (vgl. Winje et al. 1991, S. 5; FAO 1994, S.237ff.). Auf ihre Fläche fallen jährlich ca. 837 rnrn Niederschlagswasser, wovon etwa 511 rnrn verdunsten und ca. 326 rnrn als Grund- und Oberflächenwasser abfließen (Keller 1979, S.289). Weitere Wassermengen fließen der Bundesrepublik aus den Nachbarländern zu. Die Wasserförderung
Einleitung
21
(Trinkwasserqualität) nimmt sich dagegen mit ca. 3 % der insgesamt abfließenden Wassermenge (Winje et. al. 1991, S.5) sehr bescheiden aus. Deutschland kann also als vergleichsweise wasserreiche Nation angesehen werden (eine Wasserbilanz für den Freistaat Bayern findet sich bei BayStMLU 1994, S.7). Trotzdem nehmen Konflikte über die natürliche Ressource Wasser Z'J (siehe auch später Kapitel B. I. 2.). Eine ausreichende Verfügbarkeit wird als selbstverständlich hingenommen, solang Wasser im Überschuß vorhanden ist. Es wird jedoch zunehmend zum Gegenstand von Kontroversen, da sich herausstellt, daß die Versorgung den Ansprüchen in vielen Regionen des Landes nicht mehr gerecht werden kann (vgl. z.B. Bergmann! Kortenkamp 1988 oder auch Pethig 1988). Wachstum von Bevölkerung und Industrie, die in steigendem Wasserbedarf resultieren, sind eine Seite des Problems. Eine andere Seite ist eine tatsächliche physische Knappheit der Ressource in manchen Regionen wie z.B. dem Hessischen Ried (vgl. Wolff 1993, S.ll). Auf den ersten Blick scheinen die Bedingungen einer ökonomischen Knappheit in Deutschland nicht vorzuliegen: es gibt genug Wasser, um die Ansprüche der Gesellschaft zu befriedigen, Anreize für eine sparsame und schonende Verwendung der Ressource oder für eine effiziente Verteilung zwischen konkurrierenden Nutzern fehlen jedoch weitgehend. Die gegenwärtigen Konflikte um Wasser sind vielfältig. Sie umfassen konkurrierende Verwendungszwecke, konkurrierende geografische Regionen, die unterschiedlich vom Wasser begünstigt sind, sowie Konflikte zwischen der Wasserwirtschaft und anderen natürlichen Ressourcen, welche durch deren Weiterentwicklung verloren gehen. Es ist offensichtlich, daß Wasser von hervorragender Qualität nicht länger allen, die es nutzen wollen im Überschuß zur freien Verfügung stehen kann. Das schwierige Problem einer Wasserverteilung unter dem neuen Paradigma einer ökonomischen Knappheit gewinnt als politisches und gesellschaftliches Problem der kommenden Jahre an großer Bedeutung. Unter natürlichen Ressourcen versteht Siebert (1983, S.2) die "von der Natur bereitgestellten Güter zur direkten und indirekten Erfüllung menschlicher Wünsche". Diese Definition hebt zum einen die Nützlichkeit als wesentliches Merkmal hervor (Erfüllung von Wünschen), zum anderen betont sie die Rolle als Konsumgüter (direkt) und auch als Produktionsfaktoren. Berg (1993, S.4) nennt
22
Einleitung
als zweites wesentliches Merkmal zur weiteren Einteilung natürlicher Ressourcen die Regenerationsfunktion. Nachfolgende Tabelle 1 gibt die Stellung der Ressource Wasser nach der von Siebert (1983) verwendeten Gliederung wieder. Zur Ordnung von Ressourcen siehe weiterhin Schefold (1992, S.160 ff.). Grundprinzipien des Umweltschutzes wie Vorsorge, Verursacher, Gemeinlast und Kooperation behandelt dagegen z.B. Kloepfer (1989, S.74 ff.) näher. Tabelle 1
Merkmale der natürlichen Ressource Wasser Natürliche Ressource Wasser Produktionsweise in der Natur
Ausschließbarkeit
Verwendung
erneuerbare Ressource nicht erneuerbare Ressource
privates Gut öffentliches Gut
Konsumgut Produktionsfaktor
Quelle: verändert nach Siebert 1983, S.3
Wegen der zugrundeliegenden unterschiedlichen ökonomischen Grundkonzeption erhält die Unterscheidung zwischen Konsumgut (Nachfragefunktionen) und Produktionsmittel (Produktionsfunktion) damit besondere Bedeutung (vgl. Berg 1993, SA).
Die vorliegende Untersuchung gilt vor allem Betrieben mit intensiver Pflanzenerzeugung. Gartenbaubetriebe nutzen - wie andere Unternehmen auch zahlreiche Ressourcen als Input zur Produktion von Gütern und Dienstleitungen. Im Unterschied zu anderen Wirtschaftszweigen hat jedoch Wasser eine essentielle Bedeutung für die Pflanzenerzeugung. Die Bedeutung der Bewässerung zur Pflanzenerzeugung weist dabei je nach Kontinent, Land und Region teilweise erhebliche Unterschiede auf (vgl. OECD 1987, S.89 f.). Pimentel faßt dies in den Satz: "Next to sunlight, water is the single most important limiting factor for crop production worldwide." (Pimentel 1989, S.18) Weiterhin stellt der Gartenbau und hier besonders der geschützte Anbau in Gewächshäusern die intensivste Form der Pflanzenerzeugung dar. Bei dem Einsatz von Ressourcen, für die private Verfügungsrechte bestehen (z.B. Energie oder Arbeit) existieren Preise, Unternehmen haben dafür mit Kosten zu rechnen. Öffentliche Ressourcen dagegen wie Wasser werden genauso
Einleitung
23
genutzt, für ihren Einsatz werden jedoch bis heute keine adäquaten Preise kalkuliert (vgl. z.B. Hopfenbeck 1990, S.61, Schreiner 1991, S.l59). Aus dieser Sicht ist es verständlich, daß Unternehmen versuchen, teuere private Ressourcen so weit möglich durch günstigere öffentliche Ressourcen zu substituieren (vgl. z.B. Staehle 1992, S.69 und zum Thema Umwelt als Produktionsfaktor Schreiner 1991, S.17ff.). Dies gilt vor allem und besonders für pflanzenerzeugende Unternehmen, die stark von Wasser abhängig sind. Konsequenterweise haben natürliche Ressourcen (die mehrheitlich als öffentliche Ressourcen betrachtet werden) eine zunehmende Last zu tragen: ihre ursprüngliche Menge und Qualität werden knapper (vgl. Leipert 1989, S.28). An Stelle des jeweiligen Wassernutzers (Unternehmen) wird die Gesellschaft als Ganzes mit den Kosten für diesen Faktoreinsatz konfrontiert und zahlt sie auch. I Als Beispiel seien nur die ansteigenden Kosten für die Trinkwassergewinnung genannt, die Leipert (1992, S .123 f.) für die Bundesrepublik auf über 7 Mrd. DM schätzt (vgl. auch Winje et al. 1991). Von einem ökonomischen Standpunkt aus trägt also die Gesellschaft die externen Effekte der Nutzung eines Umweltbestandteils durch einzelne Unternehmen (zu Externalitäten siehe Abschnitt B. 11. 5. a». Unternehmer in Gartenbau und Landwirtschaft sehen sich nun zunehmend mit wachsenden Umweltbedenken und ansteigenden Kosten für umweltschonendes Wirtschaften konfrontiert. Sie suchen nach Erzeugungsmethoden, die sowohl ökologisch unbedenklich als auch ökonomisch tragbar sind. Letztendlich sind sie auf der Suche nach einer Form des nachhaltigen Wirtschaftens (zum "sustainable development" siehe z.B. Rentz 1994, Haber 1994, Heins 1994, Klemmer 1994 und SRU 1996, S.50 aber auch Kapitel D. I. 1. sowie speziell zum "sustainable water use" FAO 1994, S.286ff.). Manche Anbauer werden auch dadurch motiviert, daß sie das Gefühl haben, unverzichtbare Produktionsfaktoren wie Wasser könnten in Zukunft nicht mehr verfügbar (Menge), nicht mehr brauchbar (Qualität) oder zu teuer sein (zur Entwicklung der Wasserpreise siehe Abbildung 2).
I Zu den Kosten des unterlassenen Umweltschutzes siehe z.B. Endres et al. (1991. S.6 t1), die ab S.22 auch auf Internalisierungsstrategien eingehen (Verhandlungen. PigouSteuer, Haftungsrecht), soweit diese die Funktion der Monetarisierung erfüllen (vgl. auch Leipert 1989, S.180 ff und zu Kostenarten S.188).
24
Einleitung
Indexwert: 1985 175
= 100
I
150
125
75
50
..- ..r
,..r'
....... ;:-
--
.- t-'"'
l,...r' I.-
~
...,.;
....... ...:r'
".,... ~
~
,..,V
V
I I
I
".r
!
!
1 I
25 1970
vi
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
Jahr
Quelle: Orthl Junge 1996, S.3 Abb. 2: Entwicklung der Wasserpreise in Deutschland
Die These einer spürbaren Wasserpreissteigerung als motivierender Faktor wird seit 1976 gestützt durch die Arbeit von Struckmaierl Schulz, die damals eine Preiserhöhung für einzelne Abnehmergruppen, in Spitzenzeiten und nach Gesamtvolumen vorschlugen. Andere Pflanzenerzeuger wiederum beziehen ihre Motivation aus dem Bestreben, die natürlichen Grundlagen ihres Wirtschaftens (Boden und Wasser) langfristig zu sichern und zu schützen. Wieder andere erkennen die unbedingte Notwendigkeit, auf gesellschaftliche Bedenken hinsichtlich möglicher negativer Einflüsse der Pflanzenerzeugung auf die Umwelt zu reagieren (vgl z.B. Albrecht 1993). Die Suche nach nachhaltigen Wirtschaftsformen konzentriert sich gegenwärtig darauf, Gärtnern und Landwirten dabei zu helfen, mit vorhandener Technologie möglichst ökologisch und ökonomisch tragbare Anbausysteme zu realisieren, während für die Zukunft noch umweltschonendere und dabei aber rentablere Alternativen gesucht werden. Der Schwerpunkt liegt auf dem Ersatz externer Inputfaktoren wie Schädlingsbe-kämpfungs-, Düngemittel und Wasser durch interne, also im Betrieb verfügbare Faktoren, speziell Management, Boden und Arbeitskraft. Dabei wird jedoch in der Regel nicht ausreichend berücksichtigt, was Stoll 1981 feststellte: "Mensch und Natur sind also die originären produktiven Kräfte jeder Produktion." (Stoll 1981, S.69)
A. Problemstellung, Zielsetzung und Vorgehensweise Was Rothenburger 1993 als Gartenbauökonom folgendermaßen formulierte: "Aus heutiger Sicht wird deutlich, daß früher relativ gering bewertete Güter wie zum Beispiel Wasser jetzt für das Leben immer wichtiger sind." (Rothenburger 1993, S.44) faßten die Ressourcenökonomen Smithl Krutilla einige Jahre früher in die Worte "The whole range of common property resources has been omitted from our system of accounts. Among these are important elements of the basic life support system, some of which are renewable, albeit not necessarily augmentable, and some of which are neither renewable nor augmentable, and hence subject to resource depletion in a manner that paralleis many of the privat property resources" (Smithl Krutilla 1979, S.396) Die genannten Autoren drücken damit die grundsätzliche Erkenntnis aus, daß bei öffentlichen Ressourcen wie Wasser andere als die primären Nutzer die Kosten für diese Benutzung tragen. Diverse Veröffentlichungen verschiedener anderer Umweltökonomen (so z.B. BaumoI1972; Shortle/ Dunn 1986; Baumol/ Oates 1988) empfehlen zumindest sechs verschiedene prinzipielle Ansätze um diese sogenannten Externalitäten zu korrigieren. Entsprechende Vorschläge enthalten (1) Gebühren (oder Steuern nach Pigou), die eine direkte Belastung des freige-
setzten Schadstoffes enthalten, der die Externalität verursacht, (2) Input-Steuern (z.B. auf Stickstoff-Düngemittel), (3) Standards, die zulässige Umweltqualitäten repräsentieren, (4) Kontrollen, die Richtlinien zur Anwendung bestimmter Verfahren beinhalten (z.B. kein Grünlandumbruch) oder die bestimmte Verfahren (wie z.B. die Verwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln) verbieten, (5) Kostenbeteiligungsanreize, bei denen die öffentliche Hand einen Kostenanteil für Maßnahmen zur Belastungsvermeidung übernimmt und
26
A. Problemstellung, Zielsetzung und Vorgehensweise
(6) übertragbare Verschmutzungszertifikate, die frei oder zum höchsten Gebot handelbar sind. Allgemein versuchen diese Instrumente die Anwendung von Marktmechanismen oder Preisen auf Umweltgüter wie Wasser. Gemeinsamer Gedanke ist, einige oder sogar alle der negativen Effekte des Wirtschaftens einzelner Unternehmen in die Kostenrechnung der Verursacher zurückzuführen, also zu internalisieren. Auch das Verhältnis von pflanzenerzeugenden Unternehmen und der Verschmutzung der Wasserressource war und ist noch Gegenstand vieler agrar- und umweltökonomischer Untersuchungen. Zur Reduktion der Komplexität konzentrieren sich diese Arbeiten oft auf bestimmte Dünge- oder Pflanzenschutzmittel. Andere verbreitete Annahmen sind Fallstudien für begrenzte Regionen oder Serien, die nur für bestimmte Typen von Betrieben gültig sind. In Abhängigkeit von den Arbeitsschwerpunkten der Autoren betrachtet jeder Ansatz unterschiedliche und meist sehr begrenzte Teile eines Unternehmens, in der Regel mit dem Ziel, Reaktionen der Entscheider auf umweltpolitische Maßnahmen vorherzusagen. Wenig Aufmerksamkeit wurde dagegen einer umfassenden und integrierenden Betrachtung der Bedeutung von Wasser für die Pflanzenerzeugung als Input- und als Outputfaktor geschenkt. Keine der bekannten Studien beschäftigt sich mit einem Entscheidungsmodell auf einzelbetrieblicher Ebene. Umweltpolitische Maßnahmen können sich daher auch nicht auf Kosten-Nutzen-Untersuchungen in bestehenden Betrieben stützen. Bradenl Lovejoy (1990, S.2) beschreiben diese Situation folgendennaßen: "Environmental problems associated with farming are special in a number of ways, both practical and political. The problems are widespread - not confined to just a few, easily identified polluters. Moreover, the polluters are independent: some of the pollutants running off one farmer's field may actually originate on other fields further upslope. Under these circumstances, it is almost impossible to keep track of the polluters or to separate their responsibilities. There is little accountability, and this undermines many forms of public policies. " Landwirte und Gärtner stehen derzeit regelrecht unter öffentlicher Beobachtung, wie sie Wasser benutzen bzw. mißbrauchen. In der Bundesrepublik Deutschland ist die politische Landschaft auf Ebene der Städte, Gemeinden und
A. Problemstellung, Zielsetzung und Vorgehensweise
27
Kreise jedoch zunehmend von Personen dominiert, die keinen unmittelbaren Bezug mehr zu Höfen und der Landwirtschaft haben. In der Folge geraten Pt1anzenerzeuger zunehmend auch unter politischen Druck. Daly (1984) empfiehlt zur Lösung des Problems eine Strategie, die zwischen einem, wie er es nennt, "Ökonomischen Imperialismus" (Ein Preisschild an alles hängen) und "Ökologischer Reduktion" (eine monistisch auf Energie beruhende Werttheorie, die keine Wertquelle anerkennt, solange sie sich nicht auf Energie zurückführen läßt). Das Wirtschaftsgefüge als ein Sub-System des Öko-Systems ist eine Sichtweise, die eher auf einer dualistischen, als auf einer monistischen Philosophie beruht. Es wird dabei nicht bedingungslos versucht, Bedeutung auf Energie zurückzuführen oder umgekehrt. Jedes zählt für sich. Ökonomie mißt Tauschwerte quantitativ, aber Ökologie, obwohl inzwischen teilweise durch quantitativ meßbare Material- und Energieströme charakterisiert, ist primär qualitativ. Als Folge sind die bei den Systeme weitgehend nicht vergleichbar. Vom Standpunkt der Rechnungslegung aus, werden biologische Probleme gegenwärtig in ökonomische Konsequenzen übersetzt, mit einem in DM-Beträgen ausgedrückten Ergebnis. Der umgekehrte Prozeß findet ebenso statt: eine politische Maßnahme oder Aktion muß oft in eine biologische Antwort übersetzt werden. Ein direktes Zusammenspiel der bei den ist bisher kaum definiert. Es bleibt der interessierten Öffentlichkeit oder Managern zur Integrierung durch diffuse soziale und individuelle Beurteilungen überlassen. Ungeachtet der Probleme inkompatibler Maßeinheiten besteht ein großer Bedarf nach einem ökonomisch und ökologisch nachvollziehbaren Beurteilungssystem, das die Evaluierung vorgeschlagener Programme erlaubt, unter der Berücksichtigung der Wechselwirkungen bei der Systeme. Grundsätzlich läßt sich das beschriebene Problem so zusammenfassen: Externalitäten sind als Problem erkannt und es existieren Ansätze, um sie zu internalisieren. Es fehlen jedoch Bilanzierungs- und Planungs instrumente für Unternehmen, die es erlauben würden, das Verhalten der Entscheidungsträger zu einem relativ frühen Zeitpunkt und damit zu noch geringen Kosten zu beeinflussen. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich daher auf das Problem der Entwicklung betriebswirtschaftlicher Entscheidungshilfen zur Bestandsaufnahme, Beurteilung und Evaluierung der Wassernutzung in einem erweiterten Zusammenhang gartenbaulicher, sozialer, technischer, ökonomischer und ökologischer Aspekte.
28
A. Problemstellung, Zielsetzung und Vorgehensweise
Den Anfang hierzu stellt in Kapitel B eine Beschreibung der Bedeutungen von Wasser für die Erzeugung von Pflanzen und für konkurrierende Nutzungsarten dar. Auch eine Darstellung wesentlicher Politikansätze zur Regulierung des Wettbewerbs um die Ressource sowie eine eingehendere Betrachtung verschiedener Aspekte der Wasserqualität finden sich in diesem Eingangskapitel. Das zweite Kapitel beschreibt den Einsatz des Produktionsfaktors Wasser als betriebswirtschaftliches Entscheidungsproblem unter mehrfacher Zielsetzung. Ausgehend von unternehmerischen Zielsystemen und Grundlagen der Entscheidungstheorie liegt der Schwerpunkt auf der Identifizierung von Entscheidungselementen, die bei der Nutzung von Wasser eine wesentliche Rolle spielen. Eine Untersuchung von Handlungsalternativen bei Wasserknappheit sowie ein Literaturrückblick zu Studien mit verwandter Problemstellung runden Kapitel C ab. Inhalt des dritten Kapitels D der Arbeit sind aktuelle Umweltmanagementsysteme und ihre Möglichkeiten zur Entscheidungsunterstützung hinsichtlich der beschriebenen Problemstellung. Einer knappen Darstellung entsprechender Grundlagen schließt sich eine Beschreibung und Beurteilung verschiedener Instrumente und Konzepte an. Das vierte Kapitel E ist dann der Zusammen führung der vorhergehenden drei Kapitel gewidmet, die in die Entwicklung einer eigenen Entscheidungshilfe mündet. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Ressourcen-Nutzungs-Analyse RNA, die u.a. Strukturelemente aus Kosten-Nutzwert-Analyse und Öko-Bilanz enthält und auf Prinzip und Zielrichtung eines Öko-Audits aufbaut. Neu ist dabei vor allem die Ergänzung durch eine Image-Komponente, die einen Zusammenhang zwischen Umweltverhalten und Unternehmensimage herstellt. Aufgeteilt in je einen Bilanzierungs- und einen Steuerungsansatz dient die RNA als Instrument eines effizienten Umwelt-Controllings. Das folgende fünfte Kapitel F stellt eine systemtheoretische Betrachtung der RNA mit Modellbausteinen und Gleichungen dar. Ein vereinfachtes Beispiel dient der Erklärung und der Simulation veränderter Rahmenbedingungen. Fallstudien aus einem Zierpflanzenbetrieb und für ein geschlossenes GemüseAnbaugebiet verdeutlichen Praktikabilität und Nutzen des entwickelten Instrumentes im abschließenden Kapitel G.
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut I. Wasser für die Erzeugung von Pflanzen Schon im Altertum wurde in der Landwirtschaft bewässert, aber erst in den letzten Jahren wurden die bewässerbaren Flächen weltweit von 94 auf 250 Mio. ha (oder 17% der landwirtschaftlichen Nutzfläche) massiv ausgeweitet. Damit hat die Bewässerungslandwirtschaft weltweit gesehen den größten Anteil (etwa 67% oder 2.200 Mio. m3 ) am Wasserverbrauch (Wolffl Hübenerl Stein 1994, S.5) In den meisten Pflanzenorganen hat Wasser den größten Gewichtsanteil. Früchte enthalten 85 % oder mehr Wasser, und selbst im Holz von Obstbäumen liegt der Wassergehalt in der Größenordnung von 50 % (Winter et al. 1981, S.55, vgl. auch Ziegler 1983, S.31O). Aus ökonomischer Sicht sind bei der Betrachtung des Wassereinsatzes für die Erzeugung von Pflanzen oder Pflanzenteilen drei Hauptkomponenten zu beachten: (I) die Nachfrage nach Wasser (Menge und Qualität),
(2) das Angebot von Wasser (Menge und Qualitäten), sowie (3) Einrichtungen, die Einfluß auf die Bereitstellung von Wasser (Menge und Qualität) haben und im Falle von Differenzen regelnd eingreifen. Wissenslücken existieren für alle drei Bereiche, jedoch werden wichtige Aspekte - soweit sie bekannt sind - auf den folgenden Seiten kurz vorgestellt und beschrieben. 1. Die Input-Seite: Wasser als essentielle Voraussetzung für die Erzeugung von Pflanzen "Das Wasser ist ein für den gärtnerischen Betrieb so wichtiges, wie notwendiges Betriebsmittel. (... ) Ohne Wasser ist eine Pflanzenkultur unmöglich ( ... ). Bei der Anlage einer Gärtnerei ist die Wasserfrage deshalb stets mit in den Vordergrund zu stellen." (Bode 1926, S.88)
30
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
a) Grundsätze der Beziehungen zwischen Pflanze, Wasser und Substrat Vier andere Autoren fassen die facettenreiche Bedeutung der natürlichen Ressource Wasser für die pflanzliche Erzeugung in folgenden Sätzen zusammen (vgl. zum Kern dieser Aussage auch Fritz 1989, S.34ff. und Ziegler S.312ff.): "Water is essential for plant growth. Water is needed for seeds to germinate, seedlings to emerge, and for many plant growth functions. Water prevents the dehydration of plants, and water pro vi des the transport mechanism for plant nutrients and the products of photosynthesis." (JensenJ HarrisonJ KorvenJ Robinson 1983, S.15) Nähere Einblicke in die Notwendigkeit einer ausreichenden Versorgung von Pflanzen mit Wasser geben zum Beispiel Jordan (1983), Winter at al. (1981, S.56) und Fritzl Venter (1994, S.404). Andere positive Wirkungen von Wasser auf Samenreife, Regelung der Pflanzentemperatur, Frostschutz, Nährstoffhaushalt oder Staubunterdrückung beschreiben BurmanJ NixonJ WrightJ Pruitt (1983, S.215ff.) näher. Die Komplexität der metabolischen und physiologischen Konsequenzen eines Wasserdefizits wird dagegen beleuchtet von Hsiaol Bradford (1983, 256): "Virtually all aspects of the plant' s economy are aitered, including metabolism of substrates, growth regulators, and macromolecules; transport of ions and solutes and development of cells, leaves, and roots; and responses to the environment (stomatal behavior)." Eine sehr spezifische Abhandlung der pflanzeninternen Wassertransport und -balancevorgänge bietet Wenkert (1983). Im folgenden soll anhand einiger ausgewählter Beispiele die Bedeutung einer ausreichenden Wasserversorgung für die Erzeugung gärtnerischer Kulturen verdeutlicht werden (siehe Tabelle 2). Der Wasserbedarf der Arten ist dabei von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Relativ früh wurde erkannt, daß einfache Pflanze-Wasser-Modelle nicht ausreichen, die komplexen Zusammenhänge wasserbezogener Ertragsschwankungen zu beschreiben. Der Boden bzw. das jeweilige Substrat muß als dritte Komponente in die Betrachtung aufgenommen werden. Flinn (1971) bietet als einer
I. Wasser für die Erzeugung von Pflanzen
31
Tabelle 2 Wasserbedarf ausgewählter gärtnerischer Kulturen Produkt
Wasserbedarf
Quelle
Pelargonium zonaleHybriden
I1 1/ Pflanze
Röber/Fischer/Fritzsche 1982
Chrysanthemum indicumHybriden (Topfchrysanthemen)
42 mI/ d Topf (3 Pflanzen)
Haas/ Röber 1988a
Sinningia-Hybriden
25-30 mI/ d und Pflanze
Röber/ Haas 1989
Schnittchrysanthemen (10-Wo.-Microsanthen)
1,4 - 1,5 1 pro Pflanze
Leinfelder/ Röber 1989
9,0 - 9,5 I pro Pflanze
Leinfelder/ Röber 1991 a
Cyclamen
3,65 1/ Pflanze
Haas 1994
Euphorbia pulcherrima
5-6 I/Pflanze
Röber/ Horn 1993
Sellerieknollen
60l/kg
Müller/ Schnitzler 1994
Freiland-Tomaten
33-1471/kg
Salman 1994, S.64
Gewächshaus-Tomaten
52 -78 1/ kg
Salman 1994, S.64
Gemüse allgemein
441/ kg
Krug (1986, S.24)
Apfelbäume
550-6301/Baum a
Navara/ Masarovicova 1995
Chrysanthemum indicumHybriden (Dünnschichtkultur mit Tropfschläuchen)
Quelle: eigene Zusammenstellung
der ersten ein erweitertes Modell in diesem Kontext zur Beschreibung der Hauptkomponenten, die Qualität und Quantität pflanzlicher Erträge beeinflussen (siehe Abbildung 3). 1985 beschreiben Letey/ Dinar/ Knapp sowie darauf aufbauend 1990 Letey/ Dinar die Entwicklung eines Modells für jahreszeitabhängige Produktionsfunktionen. Es beinhaltet die Beziehungen zwischen Ertrag, Evapotranspiration, Salz Salzgehalt in der Wurzel zone und Sickerwasser. Diese Ansätze sind noch statisch, wurden jedoch 1990 von Knapp/ Stevens/ Letey/ Oster zu einer dynami-
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
32
Qualität und Quantität Ertrag
Dauer und Schwere Feuchtigkeitsstress (E., < E,)
Potentielle Transpiration (E,)
Physiologisches Stadium der Pflanzenentwicklung Aktuelle Transpiration (E,,)
kein Feuchtigkeitsstress (E., = E,) Wasserentzug Pflanze Durchwurzeltes Volumen
Physiologisches Stadium der
Bodenart
Erbanlagen
Quelle: nach Ainn 1971. S.128
Abb. 3: Hauptkomponenten des Systems Pflanze - Boden
schen Analyse verbessert und 1991 von Letey zur Simulation von Ertrags- und Auswaschungsfunktionen unter der Annahme verschiedener Bewässerungs.strategien angewandt. b) Produktionsfaktoren und Produktionsfunktionen
Als Produktionsfaktoren faßt man heute Güter und Leistungen auf, die von Unternehmungen als Inputs in der Produktion eingesetzt werden (Issing 1988, S. 142). Die Lehre von den Produktionsfaktoren entstand zunächst in der Nationalökonomie und fand von hier aus dann Eingang in die "Betriebsökonomie" (vgl. Weber 1985, S.I13). Eine weite Verbreitung hat das von Gutenberg vorgeschlagene System mit den produktiven Faktoren menschliche Arbeitsleistung, Betriebsmittel, Wertstoffe, Leitung, Planung und Organisation gefunden. Vor allem in jüngster Zeit sind in der Betriebswirtschaftslehre weitere Faktorsysteme vorgestellt worden, die um natürliche Güter erweitert sind (vgl. z.B. Weber 1985,
I. Wasser für die Erzeugung von Pflanzen
33
S.117 f.). Damit setzte sich die Erkenntnis durch, die bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts Naturkräfte als Wirtschaftsgrundlage sah (vgl. z.B. v.d.Goltz 1912, S.12). Für den Bereich der Pflanzenerzeugung hat im Jahr 1937 Steffen in seinen "Grundlagen der gärtnerischen Betriebsführung" die Bedeutung solcher "Rohstoffe" erkannt (S.7). "Diese für den Besitzer (gemeint ist der Unternehmer, Anm. d.A.) kostenlose Herbeischaffung einiger Betriebsstoffe aus gewissermaßen öffentlichen QueIlen steIlt etwas ganz Eigenartiges innerhalb der Betriebswirtschaft dar, (... )." Sein Zeitgenosse Laur (1930, S.5l) schlußfolgert: "Die bessere Ausnutzung des Wassers ist ein gewaltiges Mittel zur Förderung der Produktivität des ErdbaIls. " Die Quantifizierung der Zusammenhänge zwischen Wasserangebot und dem Ertrag von Kulturpflanzen waren bzw. sind Gegenstand vieler Untersuchungen (siehe TabeIle 3). Produktionstheoretische Grundlagen sind darüber hinaus umfangreich dargestellt von Fehl/ Oberender (1990 S. 73-110) oder auch von Wöhe (1986, S.441 ff.). Zum aktueIlen Stand der Produktionstheorie in landwirtschaftlichen Betrieben siehe z.B. Steinhauser/ Langbehn/ Peters (1992 S.28 ff. u. S.72-154). Wegen der vielen verschiedenen Faktoren, die den Zusammenhang zwischen Wasser und Pflanzenertrag beeinflussen, vertreten manche Wissenschaftler die Meinung, daß aIle bisher gefundenen Einzelbeziehungen nur wenig Unterstützung bei Entscheidungen in der Praxis bieten können (vgl. Biere/ Worman 1983). Diese Autoren heben besonders die Bedeutung der Unsicherheit von Pflanzenreaktionen gegenüber der Wassernutzung hervor. Dementsprechende Betrachtungen gehen jedoch über den Umfang dieses Kapitels und dieser Arbeit hinaus. Jüngere Studien zu den Effekten von Wasserdefiziten in der gartenbaulichen Pflanzenerzeugung beschäftigen sich mit Wachstumsdepressionen bei Einlegegurken (Engelkes/ Widders/ Price 1990), Wachstumsstockungen bei Schlangen gurken (Janoudi/ Widders 1993) und einer reduzierten Photosyntheserate in Gurkenblättern (Janoudi/ Widders/ Flore 1993). Große Beachtung im Zierpflanzenbau fanden auch die Ergebnisse von Yelanichl Biernbaum (1993 u. 1994), die fests teIlten, daß ohne Überschußwasser und mit geringen Düngerkonzentrationen 3 Orth
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
34
Tabelle 3 Ausgewählte Untersuchungen zum Produktionsfaktor Wasser
Quelle
Modell
Schwerpunkt
Hanway (1963)
bio-physikalisch
Ertrag in Abhängig vom Bodenwasser
Heinen (1972)
bio-physikalisch
Mehrproduktbetrieb und Mehrstufigkeit des Produktions prozesses
Hanks (1974)
bio-physikalisch
Pflanzenwachstum in Abhängigkeit von Evapotranspiration und Bodenwasser
Hili! Hanks! Keller! Rasmussen (1974)
bio-physikalisch
Ertrag je nach Niederschlagsgebiet und Bewässerungsgabe
Kanemasu/ Stone/ Powers (1976)
bio-physikalisch
Ertrag bzw. Deckungsbeitrag pro ha, je nach Berechnungshäufigkeit und -menge
Childs/ Gilley/ Splinter (1977)
bio-physikalisch
Ertrag in Abhängig von Boden- und Blattwasserpotentialen
Kanemasu/ Rasmussenl Bagley (1978)
bio-physikalisch
Ertrag in Abhängigkeit vom Bodenwasser
Doorenbos/ Kassam (1979)
bio-physikalisch
Ertragseinbußen je nach Wasserdefiziten
Morgan/ Biere/ Kanemasu (1980)
bio-physikalisch
generelle Zusammenhänge Ertrag-Bewässerung
Ritchie (1983)
bio-physikalisch
Schätzung von Evapotranspiration und Biomasseproduktion
Vauxl Pruitt (1983)
Produktionsfunktion
Eintluß von Wachstumsstadien
Hiler/ Howell (1983)
bio-physikalisch
Emptindlichkeiten Kulturpflanzen und SOl (stress day index)-Konzept
Henze (1987)
bio-physikalisch
Nachfrage des Produktionsfaktors als abgeleitete Nachfrage
I. Wasser für die Erzeugung von Pflanzen
35
FehV Oberender (1990)
bio-physikalisch
freie Güter als Produktionsfaktoren
Bailey/ Minhinick (1993)
quantitativ
Wasserbedarf pflanzenerzeugender Firmen
Plaut/ Meiri (1994)
bio-physikalisch
Wassergabentiming
Rawitzl Hadas (1994)
bio-physikalisch
Ertrag in Abhängigkeit von multiplen Inputfaktoren
Quelle: eigene Zusammenstellung
kultivierte Poinsettien von gleicher oder sogar besserer Qualität waren, als solche, die mit einem Wasserüberschuß und höheren Düngerkonzentrationen erzeugt wurden.
2. Die Output-Seite: Auswirkungen auf die Wasserressource In der breiten Öffentlichkeit wächst die Besorgnis über die Unbedenklichkeit der Nahrungsmittel sowie den Einfluß landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Erzeugung auf die Qualität unserer Umwelt (diese These wird in den verschiedenen Abschnitten des zweiten Kapitels näher erläutert und mit Quellen belegt). In der Folge sieht sich der Agrarsektor gezwungen, seine Erzeugungsverfahren zu modifizieren, was eine wesentliche Herausforderung für alle beteiligten Forschungseinrichtungen darstellt (vgl. Leel Lovejoy 1991). Die folgenden Abschnitte geben hierzu einen genaueren Überblick über Formen und Wirkungsmechanismen von Belastungen der Wasserressource durch die Pflanzenerzeugung.
a) Wasser als Medium zum Transport von Schadstoffen Wasserbewegung ist der Schlüsselmechanismus für den Transport von Schadstoffen aller Art vom Ort der Pflanzenerzeugung zu den Gewässern als Empfängern. Wasser transportiert Schadstoffe in folgenden drei Prozessen: (1) Oberflächenabfluß, (2) Versickerung und (3) Bewässerungl Verdunstung.
36
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
Zahlreiche Probleme der menschlichen Gesundheit und der Umweltqualität sind mit den im Wasser enthaltenen Stoffen in Verbindung gebracht worden. Wasser ist ein primäres Schadstoffliefer- und transportmedium. Die kombinierten Effekte hydrologischer Prozesse und Praktiken der Pflanzenerzeugung führen zu einer Anzahl wesentlicher Fragen der Wassernutzung, die Entscheidungen zur Allokation der Ressource erschweren. b) Einwirkende Faktoren
Ayers/ Westcot (1985) formulieren das Problem sehr drastisch: "Agricultural subsurface drainage presents the single greatest threat to water quality." Die Generierung von Rückständen oder Nebenprodukten bei der Herstellung von Produkten läßt sich in der Regel nicht vermeiden. Dessen ungeachtet können Produktionsprozesse, die mehr Schadstoffe produzieren, als die natürliche Umwelt ohne größere Beeinträchtigung aufnehmen kann, auf Dauer nicht bestehen (Libby/ Boggess 1990). Rückstände aus der Pflanzenerzeugung lassen sich grundsätzlich in sechs Kategorien einteilen (z.B. nach Christensen 1983; Gilley/ Jensen 1983; Menzel 1983; Libby/ Boggess 1990, S. II oder Tanji/ Enos 1994): (1) Bodenpartikel, (2) Nährstoffe, (3) Pflanzenschutzmittel, (4) Mineralsalze, (5) Schwermetalle und (6) Krankheitserreger. Quellenangaben mit einer ausführlicheren Beschreibung entsprechender Belastungen enthält Tabelle 4 (vgl. zur Belastung von Wasserressourcen auch FAO 1994, S.24If.). Das Durchspülen des Bodens zur Auswaschung von Salzen war lange Zeit übliche Praxis, vor allem bei gärtnerischen Langzeitkulturen (Kaminski/ Hendriks 1994, S.1744; Molitor 1994, S.1752). In diesen Zusammenhang fügt sich auch folgende Empfehlung von Ayers/ Westcot aus dem Jahr 1985 ein: "When the build-up of soluble salts in the soil becomes or is expected to become excessive, the salts can be leached by applying more water than that needed by the crop during the growing season. This extra water moves at least a portion of the salts below the root zone by deep percolation (leaching). Leaching is the key factor in controlling soluble salts brought in by the irrigation water." (Ayers/ Westcot 1985, S.23)
I. Wasser für die Erzeugung von Pflanzen
37
Tabelle 4 Auswirkungen verschiedener Belastungsfaktoren auf die Wasserressource Belastender Faktor
Auswirkung
Verlandung, veränderte Zusammensetzung/ Floral Fauna, erhöhte WassergewinBodenpotential nungskosten, verminderter Freizeitwert, Verlagerung absorbierter Pflanzenschutzmittel u.
Quelle
Duttweilerl Nichols (1983)
Nährstoffe Nährstoffe
Pflanzenschutzmittel
Bewässerung
Eutrophierung, Reduzierung Sauerstoffgehalt, Korrodierung
OECD (1986) UBA (1991) OECD (1986) Winje et al.
abschließendes und fundiertes Urteil fehlt
(1991 ) Miranowski (1983)
Reduzierung Artenvielfalt, Einschränkung Freizeit-I Erholungswert, Pegelabsenkung
Miranowsi (1983)
Quelle: eigene Zusammenstellung
Gilley/ Jensen schließen sich dieser Meinung an: "Implicit in the on-farm water balance is the concept that some deep percolation is needed to maintain a favorable salt balance in the plant root zone. Excess salts must be leached out of the root zone if crop productivity is to be maintained. The fraction of deep percolation needed to displace salts below the root zone, called the leaching requirement, must be considered an integral part of the irrigation water requirement." (Gilley/ Jensen 1983, S.24) c) Betroffene Bereiche
Auf der Outputseite kann Pflanzenproduktion prinzipiell Oberflächengewässer und Grundwasser belasten. (vgl. z.B. SRU 1996; UBA 1991, S.9) In der Literatur (z.B. Libby/ Boggess 1990, S.15) werden drei grundsätzliche Formen der Belastung von Obeiflächengewässern durch Ptlanzenerzeugung unterschieden:
38
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
(1) Sedimentablagerung aufgrund von Bodenerosion, (2) Eutrophierung bzw. Nährstoffanreicherung durch Nitrat und Phosphate und (3) Kontamination durch toxische Substanzen wie Herbizide, Insektizide oder Mikroorganismen. Pflanzenerzeugung kann neben Oberflächen wasser- auch schwerwiegenden Grundwasserbelastungen hervorbringen. (SRU 1985, S.235; Rudolph 1989, S.13; UBA 1994, S.163ff.) Als mögliche Ursachen kommen sowohl Punkt- als auch Aächeneinträge in Frage. Die potentielle Kontamination von Grundwasser hängt maßgeblich vom Transportmechanismus und dem jeweiligen Zustand der darüberliegenden Oberfläche ab. Der Kern ist die Frage, ob die Schadstoffe mit dem Wasser durch gesättigte und ungesättigte Zonen wandern. Die Effekte einer Grundwasserkontamination sind denen von Nährstoffen, Pflanzenschutzmitteln und Mineralsalzen außerhalb der Gewässer ähnlich. Sie beziehen sich wie diese auf gesundheitliche Bedenken bei Trinkwasser, Korrosionsprobleme und andere chemische Reaktionen bei der Wassernutzung in Haushalten und Industrie (vgl. Gibbons 1986, S.58). Der Nitrateintrag ist vor allem in landwirtschaftlich genutzten Gebieten problematisch und dort besonders auf sandigen Böden, wo Bewässerung aus pflanzenbaulicher Sicht unverzichtbar ist (Beispiel Knoblauchsland). Ein verwandtes Problem ist, daß die Kontamination von Grundwasser besonders lange anhält und nicht kurzfristig zu beseitigen ist. Verglichen mit Oberflächengewässern fließt Grundwasser extrem langsam. Gelangt ein Schadstoff erst einmal in einen Grundwasserleiter (Aquifer), dauert es lange bis zu seiner Entdeckung und Ausspülung. Gerade das Aufspüren der Belastung ist schwierig, wegen der langen Zeit die vergehen kann, bis der Schadstoff die Meßstelle erreicht.
d) Gartenbauliehe Erzeugung: Punkt- oder diffuse Schadstoffquelle ? Quellen für Umweltbelastungen lassen sich grundSätzlich in zwei Kategorien einteilen, Punktquellen und diffuse Quellen. Erstgenannte haben ihren Namen davon, daß die Einleitungspunkte an denen Schadstoffe in die Wasserressource gelangen, identifizierbar und räumlich festgelegt sind, anders als bei Oberflächenabfluß oder Niederschlägen über größeren Gebieten. Schadstoffe aus Punktquellen bestehen in der Mehrzahl aus flüssigen Industrie- oder Haushaltsabfällen
I. Wasser für die Erzeugung von Pflanzen
39
sowie dem Abfluß aus Kläranlagen. (vgl. Gibbons 1986, S.58) Libby/ Boggess definieren Schadstoffe aus Punktquellen als ,,( ... ) those that can be traced to a precise source defined as 'discernable, confined, and disconcrete conveyance', such as pipe, ditch, weil, or container." (Libby/ Boggess 1990, S.13f.) In der landwirtschaftlichen Pflanzenerzeugung finden sich demnach relativ wenige Punktquellen für Wasserverschmutzung. Diffuse Quellen haben eine umfangreichere räumliche Ausdehnung und sind demzufolge schwieriger zu ihren Ursprüngen zurüchzuverfolgen, als Punktquellen. Die Mehrzahl der landwirtschaftlichen Wasserbelastungen wird den diffusen Quellen zugeordnet, die folgende Kriterien erfüllen (vgl. Bailey/ Swank 1983): (1) diffuse Abflüsse in Form von Oberflächenabfluß oder Versickerung
(2) stochastische und dynamische Wasserbelastung in mehreren Dimensionen (dynamisch in der Bedeutung, daß die Landnutzung sich im Zeitablauf verändert und damit sowohl die Zusammensetzung der Schadstoffe, als auch das räumliche und zeitliche Auftreten beeinflußt) (3) die Einleitung mancher Substanzen kann zunächst durchaus ohne negative Effekte auf das unmitlelbarempfangende Medium sein (Anlaß für Bedenken sind dann der Weitertransport in andere Medien zusammen mit dem Auftreten von Abbauprodukten). Es besteht grundsätzlich Übereinstimmung darüber (vgl. dazu später folgende Abschnitte in B. 11. 2.) daß garten bauliche Pflanzenerzeugung grundsätzlich sowohl punkt- als auch diffuse Quellen der Wasserbelastung beinhaltet. Während Gewächshausanlagen und kleinere Freilandflächen als Punktquellen gelten können, zeigt die großflächige Freilanderzeugung typische Merkmale diffuser Quellen. Jedoch stellen auch hier moderne Produktionsmethoden Ausnahmen dar (z.B. im Gemüsebau oder in Baumschulen), wenn Trockenzonen unterhalb der Wurzelzone oder Containersysteme den Standort gegenüber tieferen Bodenschichten und dem Grundwasser versiegeln. In der Tat tritt auf solchen Standorten keine Tiefenversickerung auf und sie können als Punktquellen betrachtet werden, solange Schadstoffe den Standort an einem eindeutig bestimmbaren Punkt verlassen. Nach Meinung von Libby/ Bogges erfüllen jedoch intensive gärtnerische Erzeugungsmethoden wie Freilandberegnung mit Überlaufkanälen
40
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
und Gewächshausanlagen die Kriterien, um als Punktquellen der Wasserbelastung betrachtet zu werden. Andere Gartenbaustandorte können sogar ganz aus der Liste von Wasserbelastungsquellen gestrichen werden, wenn sie 'geschlossene' oder 'rezirkuIierende' Bewässerungssysteme aufweisen, die das ganze Wasser (mit Ausnahme der verdunstenden Menge) innerhalb des Systems zurückhalten.
11. Der Wettbewerb um die natürliche Ressource Wasser ist eine endliche Ressource, die essentiell für alles Leben ist. Das meiste Wasser in der Hydrosphäre ist salzig und ein großer Anteil des Frischwassers liegt in gefrorener Form vor. Darüber hinaus ist Wasser weder zeitlich noch räumlich gleichmäßig verteilt. In der Folge wird Frischwasser in vielen Ländern und auf einigen Kontinenten zunehmend knapper. Auch im vergleichsweise niederschlagsreichen Deutschland mahnt eine Studie des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag mehr Vorsorge der "erheblich bedrohten" Trinkwasserversorgung an (AFP 1994). Rudolph (1989, S.16ff.) unterscheidet dabei eine quantitative, eine qualitative, eine intertemporale sowie eine regionale Dimension. Er wird in folgendem Zitat bestätigt: "In summary, competition for water exists in a variety of forms and under varying conditions. Timing, location, quantity, and quality each affect the degree of competition." (Easter/ Leitch/ Scott 1983, S.152) Eine Vielzahl von Autoren (von Minc 1976; Karl 1986, S.23; Bergmann! Kortenkamp 1988; Pethig 1988; Schliephake/ Hacker 1988, S.27; Henze/ Nicklis 1989; Rudolph 1989, S.4ft.; Tanji/ Enos 1994, S.22 bis zu Wolff/ Hübener/ Stein 1994, S.13) sieht diesen zunehmenden Wettbewerb verschiedener gesellschaftlicher Gruppen nicht nur um Mengen, sondern auch um Qualitäten der natürliche Ressource. Auf Unternehmen der Pflanzenerzeugung zugeschnitten ist folgende Feststellung: "Increases in water demand from nonagricultural sectors suggests a possible reallocation of water from agricultural to nonagricultural uses and a priority within agriculture for improved water use." (Bryant/ Mjelde/ Lacewell 1993, S.1021 )
11. Der Wettbewerb um die natürliche Ressource
41
In einer Prognose, die auch den Bereich Landwirtschaft und Gartenbau berücksichtigt, stellt Rohmeier 1986 fest, daß mit einem Rückgang des Bewässerungsbedarfs nicht mehr zu rechnen ist, weil die technischen Substitutionsmöglichkeiten ausgeschöpft seien. Er hält auch eine Bedarfszunahme in Zukunft für nicht ausgeschlossen (S.124, vgl. hierzu auch Winjel Igelhart 1983, S.131). Traditionell wird Knappheit bei natürlichen Ressourcen im Sinne schwindender Maßeinheiten wie Kubikmeter Wasser, Tiefe des fruchtbaren Bodens, Barrels Erdöl interpretiert. In zunehmendem Maße wird jedoch offensichtlich, daß Wasserknappheit weitestgehend eine Funktion der Qualität ist: "Quantity of water, for example, may be abundant or even superfluous, but there may not be sufficient water of a particular quality to satisfy a specific use or demand." (Timmons 1983, S.190) Tanjil Enos ergänzen: "Because water can be stretched only so far, agriculture will be increasingly challenged to use water more beneficially and efficiently." (Tanjil Enos 1994, S.22) Zusätzlich erschwert wird die Situation durch die abnehmende Bedeutung der Landwirtschaft in den Industrienationen: "Agricultural uses ranked high in the past because a higher percentage of the population lived on farms and the economy was heaviliy dependent on agriculture. This priority is changing ( ... ). The number of people living on farms is now quite smalI, and the relative importance of agriculture has declined." (Easterl Leitchl Scott 1983, S.140)
1. Wettbewerber Der Wettbewerb um Wasser tritt in einer Reihe verschiedener Formen auf. In der Literatur sind mehrere Formen des Wettstreits um Wassermengen und -qualitäten beschrieben. Easterl Leitchl Scott (1983) unterscheiden zunächst Konkurrenz zwischen Nutzern des gleichen Verwendungszweckes (z.B. der Bewässerung) sowie Konkurrenz zwischen Verwendungszwecken (z.B. zwischen Bewässerung und Energieerzeugung oder zwischen Erholung und Schiffahrt). Daneben sehen sie noch eine zeitliche Konkurrenz nach der z.B. die Ausbeutung eines Grundwasservorkommens in der Gegenwart mit zukünftigen Verwendungen konkurriert. Die aktuelle Brisanz diese Themas illustriert z.B. Dachs (1997) am Beispiel des Kampfes ethnischer Gruppen um die Ressource im Nahen Osten.
42
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
Eine detailliertere Betrachtungsweise identifiziert Fischerei, Wasserkraft, Erholung, Schiffahrt, kommunale und industrielle Einheiten als Konkurrenten um die Wasserverwendung zur Pflanzenerzeugung. (vgl. Whittlesey 1994) Dieser Einteilung schließt sich die Mehrzahl von Autoren an. (Easter/ Leitchl Scott 1983, S.136) Freeman (1982) identifiziert zusätzlich noch Existenz- und abgeleitete Werte von Wasser. Ähnlich gehen Libby/ Boggess (1990) vor, wenn sie zwischennutzende Verwendungen (wie z. B. Bewässerung, industrielle Nutzung und gewerbliche Fischerei) und Endnutzungen (wie Trinkwasser und Erholung) unterscheiden. Eine andere gängige Einteilung betrifft die Wassernutzung "im Strom" (ohne Entnahme) und außerhalb des natürlichen Kreislaufs dem die Ressource zumindest zeitweise entzogen wird. Zusätzlich existiert noch eine Unterscheidung nach konsumptiven und nicht-konsumptiven Verwendungszwecken. Nicht alle Verwendungszwecke konkurrieren notwendigerweise miteinander. Eine theoretische Untersuchung von Interdependenzen und Konkurrenzbeziehungen zwischen einzelnen oder mehreren Nutzungsarten einschließlich intertemporaler Modellanalysen liegt seit 1988 von Pethig vor. Gray/ Young kommentieren diese universelle Verwendbarkeit von Wasser wie folgt: "In contrast to other resources, water is relatively unique in that its use for one purpose at a given time and location does not necessarily preclude its use elsewhere, at a later time, for the same or different purposes. (00') A specific water use, in most cases, cannot be viewed in isolation from potential alternative utilizations." (Gray/ Young 1984, S.l64) Tabelle 5
Nutzungsarten der Ressource Aspekt
Kriterium
Gebrauch Gebrauch
Verbrauch
Existenz
Verwendungszweck
Freizeit + Erholung Gewerbe Kommunen
Landwirtschaft Industrie Gewerbe Ä.\·rlrerik Erweiterte Erhulung um Wasser Erweiterter Landschaftsgenuß Okosy,\'tem Erweiterte Unterstützung der Erhulung Erweiterte Unterstülzung der Ökosysteme Gemeinwohl NahesIehende Personen Andere Personen TreuhClflll,\'chaft Objektbezogen Vermächtnis
Quelle: verändert nach Carsonl Martin 1991
Beispiel
Fischen. Schwimmen. BfKltfahren. Wasserski Fischen. Schiffahrt
Trinkwasser
Bewässerung. Düngung. Pflanzenschutz. Reinigung Pruduktionsprozesse. Abfallbeseiligung Produktionsprozesse. Abfa1lbeseitigung Wamlern. Picknicken. Fotografieren Ausblick (privat. Büro). Pendeln Jagen. Angeln Nahrungsmiuelkeue Verwandte. Freunde. Bekannt. Allgemeinheil Naturschutz. Feuchtgebiete. Landschaftsschutz Familie. Kinder. zukünftige Generationen
11. Der Wettbewerb um die natürliche Ressource
43
Tabelle 5 gibt einen nach Nutzungsaspekten und -kriterien gegliederten Überblick über verschiedene Verwendungszwecke, auf die in den folgenden Abschnitten kurz näher eingegangen wird, da sie Grundlage für das Verständnis des später entwickelten Qualitätsbegriffes sind. Tabelle 6 gibt einen Überblick über die sich hieraus ergebenden Konkurrenzverhältnisse. Tabelle 6
Konkurrenzverhältnisse bei der Wassernutzung Verwendungszweck
Konkurrenten
Quelle
kommunal/ industriell
Haushalte, öffentliche Hand, Fertigungsindustrie
Easter/ Leitch/ Scott (1983, S.140)
Freizeit! Erholung
Erholungssuchende
Tanjil Enos (1994, S.15)
Schiffahrt
Personen- und Gütertransporte
Easter/ Leitch/ Scott (1983, S.150)
Energieerzeugung
Kohlebergbau, Dampf-. Wasser-, Nuklearkraftwerke
Easter/ Leitch/ Scott (1983, S.142)
Abfallentsorgung
Emittenten von Nitraten. Phosphaten, Bakterien, Viren, Schwermetallen, organische Substanzen, Salzen und Wärme
Gibbons (1986)
Bewässerung
Unternehmen des Agrarsektors
Tanjil Enos (1994)
Quelle: eigene Zusammenstellung
Die folgende Tabelle 7 faßt verschiedene Nutzungsmöglichkeiten von Wasserressourcen, gegliedert nach den beiden Kriterien "konsumptiv/ produktiv" sowie "Entnahme/ Nichtentnahme", noch einmal zusammen und schließt damit den Abschnitt ab.
44
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
Tabelle 7
Arten der Nutzung von Wasserressourcen Merkmale der Nutzung
konsumptiv
produktiv
Wasserentnahme qualitativ
ohne Wasserentnahme qualitativ
*
Trinkwasserkonsum
*
Transportmittel für
*
Konsumabfallaufnahme
Konsumabfalle
*
Sport- und Freizeitaktivitäten
*
Hobbyverwendungen (z.B. in Gärten)
*
Ästhetik der Natur
*
Trinkwassergewinnung und -nutzung
*
Produktionsabfallaufnahme
*
landwirtschaftliche Bewässerung
*
W asserkraftgewi nnung
*
Fischfang
*
Transportmittel für Produktionsabfälle inklusive Kühlmittel
*
Aquakultur
*
Schiffahrt
Quelle: nach Pethig 1988, S.201
2. Wettbewerbsregeln und Politikansätze Mit steigenden Ansprüchen der Gesellschaft an die Verfügbarkeit qualitativ hochwertigen Wassers ist zu erwarten, daß die Bewässerung landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Kulturen zunehmend reguliert wird. So fordert beispielsweise Greenpeace in einer eigenen Studie öffentlichkeitswirksam, ganz Deutschland als flächendeckendes Wasserschutzgebiet mit restriktiven Schutzbedingungen auszuweisen (Kluge 1990). Ein weiteres Beispiel geben die Vereinigten Staaten von Amerika, in denen 1972 der Kongreß den Weg frei machte für den sogenannten "Clean Water Act", das erste Gesetz zur Festlegung einer nationalen Strategie der Reduzierung von Wasserbelastungen. Ziel des Erlasses war die Wiederherstellung und Beibehaltung der chemischen, physikalischen und biologischen Unversehrtheit der amerikanischen Gewässer. Zu zukünftigen Regelungen in den USA, die damit eine Vorreiterrolle auf diesem Gebiet einnehmen, meinen TanjiJ Enos: "In the future, it is likely that agricultural exemptions from the Clean Water Act will be revoked. ( ... )." Tanji/ Enos (1994, S.16)
H. Der Wettbewerb um die natürliche Ressource
45
a) Externalitäten V or einer Betrachtung umweltpolitischer Maßnahmen und Instrumente soll an dieser Stelle kurz auf das Konzept der Externalitäten eingegangen werden, da hierauf weitere Ansätze aufbauen. (vgl. z.B. Frey 1992, S,44ff.) Möglicherweise profitiert ein Nutzer von einer natürlichen Ressource, verlagertjedoch die Kosten hierfür auf andere, indem er Wasser verbraucht (Mengeneffekt) oder belastet (Qualitätseffekt). Hätte dieser Nutzer alle Kosten der Ressourcennutzung selbst zu tragen, bestünde ein Anreiz für ihn, Wasser in Übereinstimmung mit den Ansprüchen anderer zu verwenden. Auf der anderen Seite könnte ein Wassernutzer in der Position sein, daß er eine Wasserbehandlungseinrichtung (z.B. eine Kläranlage) baut, um Wassermenge oder -qualität beizubehalten oder zu verbessern, eine solchen Anlage jedoch in erster Linie nachgelagerten Benutzern und nicht dem Betreiber selbst zugute kommt. Könnte prinzipiell auch der Erstnutzer von der Anlage profitieren, würde er motiviert, solche Anlagen zu errichten und damit die Wasserqualität im Anschluß an seine eigene Nutzung zu verbessern. Solche Verschiebungen von Kosten und Nutzen definieren Externalitäten: "Such terms as 'side effects', 'spillovers' , 'fallout', or 'free-rider', termed externalities by economists, have been applied to such shifts of costs and benefits." (Timmons, 1983) Einige Autoren (so z.B. Rausserl Foster 1991) merken hierzu noch an, daß die Menge der Externalität bzw. der Umweltbelastung nur durch Veränderungen auf der Input-Seite reduziert werden kann, da Wasser (wie die meisten anderen Produktionsfaktoren in der Pflanzenerzeugung) nur in Kombinationen eingesetzt werden kann in dem Sinn, daß es wertvolle und unerwünschte Effekte gleichzeitig verursacht. Hintergrund der folgenden Ausführungen ist die zunehmende Anwendung des "polluter-pays-principle" (Verursachungsprinzip) in der die Rahmenbedingungen gestaltenden Umweltpolitik. (vgl. Meiler 1990, S.296) b) Ausgewählte Rechtsnormen zur Wassernutzung Zum Abschluß der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro betonte die Staatengemeinschaften den hohen Stellenwert des Umweltschutzes. Im Hinblick auf die Nutzung der Res-
46
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
source Wasser gelten der in der Erklärung von Rio festgelegte Vorsorgegrundsatz sowie das Prinzip der Nachhaltigkeit. Tabelle 8 gibt einen Überblick über ausgewählte Rechtsnormen, die bei der Wassernutzung für die Erzeugung von Pflanzen zu berücksichtigen sind. Ihre Inhalte und Anwendungsgrundsätze sind in den folgenden Abschnitten näher ausgeführt. Auf Ebene der Europäischen Union zielt die EU-Richtlinie (RL 9116761EWG) zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen vom 12. Dezember 1991 auf eine Verringerung von durch Nitrat verursachten Gewässerverunreinigungen ab. Auf Bundesebene ergeben sich weitere Vorschriften aus den einzelnen Paragraphen des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) vom 23.09.1986 (BGB\. I S. 1529, ber. S. 1654), geändert d. G. vom 12.02.1990 (BGB\. I S. 205), dessen § 3 Wassernutzungen definiert (u.a. Entnehmen von Wasser aus ober- und unterirdischen Gewässern, Einbringen und Einleiten von Stoffen) und dessen § 18a die Abwasserbeseitigung regelt. Bis zum Jahr 1957 war in der Bundesrepublik Deutschland das Recht zur Wassernutzung weitgehend an das Grundeigentum gebunden. Das preußische Wassergesetz regelte lediglich den Vorrang älterer Nutzungen bei einer Nutzensänderung (vg\. Blankart 1988, S.53). Mit dem Wasserhaushaltsgesetz von 1957 wurde das Wasserrecht Bestandteil des öffentlichen Rechts. § la WHG bestimmt, daß das Grundeigentum kein Recht auf Gewässerbenutzung einschließt. Eine Wasserbenutzung wird in § 2 WHG von einer Erlaubnis oder Bewilligung abhängig gemacht, die nach § 32 WHG in ein Wasserbuch einzutragen ist. Die ErlaubnislBewilligung ist zu versagen (§ 6 WHG) bzw. die Bewilligung ist zu widerrufen (§ 12 Abs. I WHG), wenn das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die öffentliche Wasserversorgung gefährdet ist. Nach Bergmann! Kortenkamp (1988, S.163) gilt dies auch für eine Eigennutzung durch einzelne Unternehmen, die zu untersagen ist, wenn sie in Konkurrenz zur öffentlichen Wasserversorgung tritt. Weiterhin regelt § 19 WHG z.B. die Ausweisung von Wasserschutzgebieten und in diesen die Zulässigkeit bestimmter Handlungen. Diese Bestimmung bietet sehr weitgehende Eingriffsmöglichkeiten in die Pflanzenerzeugung bis hin zu einem Produktionsverbot (vg\. z.B. Burmann 1989).
11. Der Wettbewerb um die natürliche Ressource
47
Tabelle 8
Ausgewählte Rechtsnormen zur Wassernutzung nach Geltungsbereichen
Geltungsbereich Europäische Union Deutschland
Bayern Landwirtschaft
Rechtsnorm Richtlinie zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) Trinkwasserverordnung (TrinkWV) Abwasserabgabengesetz (Abw AG) Gesetz zur Bekämpfung der Umweltkriminalität Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG) Umweltinformationsgesetz (VIG) Verfassung Bayerisches Wassergesetz Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) Düngeverordnung
Quelle: eigene Darstellung
Zweck der Trinkwasserverordnung (TrinkWV) vom 22.05.1986 (BGBI. I S. 760), i.d.F. vom 05.12.1990 (BGBI. I S. 2612, ber. 1991 S. 227) ist es, einer Beeinträchtigung des Trinkwassers vorzubeugen und dem Verbraucher eine einwandfreie Beschaffenheit des Trinkwasser zu garantieren. Das Abwasser-
abgabengesetz (AbwAG) vom 05.03.1987 (BGBI. I S. 880), Ld.F. vom 06.11.1990 (BGBI. I S. 2432) stellt eine Ergänzung zum WHG dar. Mittels der Abwasserabgabe, deren Höhe sich an der Schädlichkeit des Abwassers orientiert, soll ein Anreiz zur Verbesserung der Wasserqualität geschaffen werden. Sie wird für das Einleiten von Abwasser in ein Gewässer erhoben (§ 1). Seit dem 1. Juli 1980 bildet das Umweltstrafrecht einen eigenen Abschnitt im Strafgesetzbuch. Darin werden Verhaltensweisen, die Menschen, Gewässer, die Luft, Natur und Landschaft oder den Boden schädigen oder gefährden können, zusammengefaßt und unter Strafe gestellt. § 324 des Gesetzes zur Bekämpfung
der Umweltkriminalität vom 01.07.1987 i.d.B. der Neufassung des Strafgesetzbuches (StGB) vom 10.03.1987 (BGBI. I S. 945), zul. geändert d. G. vom 20.08.1990 (BGBI. I S. 1764) besagt, wer unbefugt ein Gewässer verunreinigt
48
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
oder dessen Eigenschaften nachhaltig verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Weiterhin zu erwähnen sind die §§ 329 (Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete) und 330 (schwere Umweltgefährdung). Ziel des UmwelthaJtungsgesetzes (UmweltHG) vom 10.12.1990 (BGBI. I S. 2634) ist es, bei Schäden an Natur und Umwelt die Verursacher in die Verantwortung zu nehmen. Kloepfer (1989) gibt einen umfangreichen Überblick über das Umweltrecht und kommentiert auch sehr ausführlich die vorstehend erwähnten Regelungen des Gewässerschutzes (S.594 ff.). Am 16. Juli 1994 ist außerdem das Umweltinformationsgesetz (UIG) in Kraft getreten, das der Umsetzung der EU-Richtlinie 90/3131EWG dient (vgl. SRU 1996, S.105 ff). Es regelt die Freigabe von umweltrelevanten Informationen aus Unternehmen, gibt Bürgern, Firmen und Verbänden das Recht auf Auskunft und verpflichtet die Behörden z.B. auch wasserbezogene Daten mitzuteilen. Neben dem Wasserhaushaltsgesetz als Rahmengesetz beinhalten Wassergesetze der einzelnen Bundesländer zusätzliche Rechtsnormen. In Bayern bildet das Bayerische Wassergesetz die entsprechende Rechtsgrundlage, die u.a. Rechte und Pflichten der Wassernutzer in und außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten regeln (vgl. Art. 23 BayWG). Im Freistaat wird bereits seit 1984 der besonderen Bedeutung des Umweltschutzes auch in der Verfassung Rechnung getragen. Artikel 3, Absatz 2 sowie Artikel 131, Absatz 2 und Artikel 141 der Verfassung verdeutlichen den hohen Stellenwert des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen. Eine zusätzlich zu berücksichtigende Gruppe sind die landwirtschaftlichen Fachgesetze. Gemäß § 15 Ab. 1 Nr. 3 des PflSchG dürfen Pflanzenschutzmittel nur dann zugelassen werden, wenn die Prüfung u.a. ergibt, daß sie keine schädlichen Auswirkungen auf das Grundwasser haben. Ob das Erreichen der Grenzwerte der TrinkWV eine "schädliche Grundwasserbeeinträchtigung" darstellt, ist strittig (Leymann 1989, S.21). Weitere Vorschriften enthält die Verordnung über die Grundsätze der guten fachlichen Praxis beim Düngen (Düngeverordnung) vom 26. Januar 1996.
11. Der Wettbewerb um die natürliche Ressource
49
c) Optionen der Umwelt- und Landwirtschaftspolitik
Zur Reduzierung der negativen Auswirkungen der Pflanzenproduktion auf die Wasserressource wird eine Anzahl von Politikansätzen diskutiert. Zum Begriff der "ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung" im Sinn des Gewässerschutzes siehe z.B. Heißenhuber et al. (1994) oder Bruckhausl Berg (1990). In dieser Arbeit sollen relevante Ansätze kurz dargelegt werden. Die ökonomische Theorie, welche regulierenden Umweltmaßnahmen zugrundeliegt und ein Vergleich von Anreiz- und Regelungsansätzen ist näher beschrieben bei Andersonl De Bossul Kuch (1990). Rechtsgrundlagen der Instrumente staatlich vorgegebenen Umweltschutzes beschreibt Z.B. Kloepfer (1989, S.97 ff.) tiefergehend. Nach Ablerl Shortle (1991) kann staatliche Wasserschutzpolitik auf vier Maßnahmen- und Instrumentegruppen zurückgreifen: (1) Moralische Überzeugung und Erziehung, (2) Design Standards, (3) Durchführungsstandards und (4) Ökonomische Anreize. Andersonl De Bossul Kuch (1990, S.65) nennen zusätzlich noch (5) Quoten und Nutzungseinschränkungen, (6) Lizenzen und Registrierung, (7) Erlaubnisscheine und Managementpläne sowie (8) Mischformen. Abbildung 4 gibt einen Überblick über verschiedene umweltpolitische Instrumente, die in den folgenden Abschnitten kurz näher erläutert werden.
Instrumente
Quelle: nach Hopfenbeck 1990, S.34
Abb. 4: Instrumente der Umweltpolitik 40rth
50
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
Diese Ausführungen gehen neben den vorstehend genannten Autoren auf Endres (1985, S.25ff.), Ahrens (1987), Frey (1992, S.llOff.) und Terhart (1986, S.28ff.) zurück und sind gegebenenfalls durch zusätzlich genannte Quellen ergänzt. Eine für die Bundesrepublik Deutschland richtungsweisende Arbeit in bezug auf die Wasserressource ist außerdem noch die Studie von Bergmann! Kortenkamp (1988), die neben einer ausführlichen Herleitung der Knappheitsthese verschiedene Vorschläge zur Verbesserung der Allokation mittels marktanaloger Lenkungsstrategien enthält. Tabelle 9 enthält eine Darstellung der Wirkungsmechanismen verschiedener umweltpolitischer Instrumente. Tabelle 9
Ansatzpunkte und Wirkungsmechanismen umweItpolitischer Maßnahmen Maßnahme
Mechanismus
Moralische Überzeugung und Er-
Verhaltenssteuerung durch rechtzeitige Übermittlung ex-
ziehung
akter !verwendbarer Informationen
Quelle Libby! Boggess (1990)
Design Standard
direkte Vorgabe einsetzbarer Technologien in Erzeugung und Umweltschutz
Raucher (1986)
Durchführungstandard
Direkte Festsetzung maximal ausstoßbarer, meßbarer Schadstoffmengen
Andersonl De Bossu! Kuch (1990)
Ökonomischer Anreiz
indirekte Beeinflussung der Ressourcenallokation durch Anreize
Töpfer (1992)
Quoten
Rationalisierung von Produktionsfaktoren und Produkten
Timmons (1983)
Nutzungsbeschränkungen
temporäre Verbote! Reduzierungen des Einsatzes einer Technologie! eines Produktionsfaktors
Scherer! Pätsch (1988) Kar! (1986)
Lizenzen
für Substanzen, Ausrüstungsgegenstände, Technologien
Erlaubnisscheine
für Unternehmen! Aktivitäten
"Öko" -Leasing
temporäre Überlassung von Ressourcen zum Gebrauch
Quelle: eigene Zusammenstellung
Zundel (1994)
11. Der Wettbewerb um die natürliche Ressource
51
Die Anwendung ökonomischer Anreizinstrumente (Grundsätzliche Optionen hierbei sind Abgaben auf belastende Input-Faktoren, Abgaben auf freigesetzte Stoffe, Mischformen und Zuschüsse zu Vermeidungsstrategien) zur Kontrolle der Wasserverschmutzung wird in einer ganzen Reihe von Untersuchungen diskutiert. Tabelle 10 gibt einen dementsprechenden Überblick. Tabelle 10
Ausgewählte Studien über die Anwendung ökonomischer Anreizinstrumente zum Schutz der Wasserressource Quelle
Instrument
Schwerpunkt
Hansmeyer (1976)
Abwasserabgabe
Verursachungsprinzip
Rincke (1976)
Abwasserabgabe
Optimierung aus Sicht der Wasserwirtschaft
Siebert (1976)
Abgaben
Erfolgsbedingungen
Pethig (1979)
Emissionssteuern
ökonomische Theorie
ATV (1988)
Abwasserabgabe
Wirksamkeit
Bergmann! Kortenkamp (1988)
divers
Vergleich zur Verbesserung der Allokation
Bergmann! Werry (1989)
Wasserentnahmegebühr
CaswelV Lichtenberg! Zilberman (1990)
Ausgestaltung
Steuern
Wasserpreis
Segerson (1990)
divers
Vor- und Nachteile
Frey (1992)
Umweltsteuern
Wirkung
Antle/ Capaibo (1993)
Subventionen
Effekte einer Preisstützung
Dinar/ Letey (1994)
Steuern. Subventionen
Effekte auf Wasserqualität
Quelle: eigene Zusammenstellung
Die Förderung einer umweltverträglichen Landnutzung beispielsweise durch Abgaben bzw. Honorierungslösungen ist detaillierter beschrieben im Umweltgutachten 1996 (SRU, S.400 ff.). Im Bereich der Wasserressource haben Umweltsteuern (..effluent charges") ihre beachtliche Wirkung schon in vielen Bereichen praktisch bewiesen (vgl. Frey 1992. S .149 f.) 4*
52
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
Die mittlerweile von einigen Bundesländern eingeführte Wasserentnahmeabgabe (in Baden-Württemberg der Wasserpfennig, in Hessen die Grundwasserentnahmegebühr) hat nachträgliche Rechtfertigung gefunden in der Arbeit von Bergmann! Werry (1989), die wiederum eine Weiterführung der Untersuchung von Bergmann! Kortenkamp (1988) darstellt. Sie enthält u.a. Aussagen zu den voraussichtlichen Auswirkungen einer solchen Abgabe auf wichtige Wirtschaftszweige und plädiert für eine regionale Differenzierung je nach Knappheitsgrad (S.l66). Bei der Einführung von Umweltabgaben geht es genauer betrachtet um Umweltsteuern und Sonderabgaben (Schadstoffabgaben). Als Vorteile von Umweltsteuern sieht Laistner (1986, S.l86) vor allem sinkende Reparaturkosten für Umweltschäden und das Gesundheitswesen, aber auch ein Ansteigen der Erzeugung langlebiger, reparaturfreundlicher Wirtschaftsgüter. Simonis (1990, S.44) nennt zusätzlich noch die Förderung von Rationalisierungsinvestitionen, die zu einer Reduzierung von Emissionen und des Ressourceneinsatzes pro Produkteinheit und zu einer prinzipiellen Förderung des Recyclings führen. Das Abwasserabgabengesetz hat sich nach Meinung von Simonis (1990, S.44) bisher jedoch nicht bewährt, da die Intensität dieser Maßnahme nicht groß genug ist, um die erforderlichen Anpassungsprozesse schnell und auf breiter Front in Gang zu setzen. Als neues Instrument schlägt Mohr (1990) daher die Einführung einer Umweltrente vor, die nach Höhe der erbrachten Umweltleistung zu differenzieren und mit Erträgen auf Produktivkapital vergleichbar wäre. Einen breiten Überblick über produktbezogene Maßnahmen zum Ressourcenund Umweltschutz wie Preisstützung, Erzeugungskontrollen etc. erstellen Antlel Just (1991). Gemeinsames Merkmal der ökonomischen Instrumente - Kompensationsmodell, Zertifikatmodell, Umweltabgaben, Umwelthaftung - ist, daß dem Betroffenen ein gewisser Entscheidungsspielraum in bezug auf das "Ob" und "Wie" eines vom Staat angestrebten Verhaltens eingeräumt wird (vgl. Kloepfer 1990, S.257). Caswelll Lichtenbergl Zilberman (1990) untersuchten die relativen Effekte angehobener Wasserpreise, Übernahme von wassersparender Bewässerungstechnologie und Umweltsteuern auf Erträge, Wassernutzung, Profitabilität und die freigesetzte Wassermenge bei der Pflanzenerzeugung. Ihr Modell basiert auf
11. Der Wettbewerb um die natürliche Ressource
53
einem gewinn maximierenden Verhalten der Unternehmer. Die gewonnenen Ergebnisse legen es nahe, daß umweltbezogene Überlegungen ein Hauptanreiz für die Übernahme wassersparender und -schonender Bewässerungstechnologien werden könnten. Kurzgefaßt vermindert die Einführung von Umweltsteuern Wassernutzung und -belastung durch (1) Reduzierung des Wassergebrauchs und der Belastung in pflanzenerzeugen-
den Unternehmen mit herkömmlichen Bewässerungsmethoden, (2) Anstöße zur Übernahme weniger wasserbelastender Technologien und (3) Ermutigung zur Herausnahme von Flächen geringerer Qualität aus der Produktion. Da die zu Bewässerungszwecken zugeführte Wassermenge erheblich größer ist, als die dadurch verursachten Sickerwassermengen, hat eine Wasserpreiserhöhung um I DM einen viel stärkeren Effekt (Wechsel zu wasserschonender Bewässerungstechnologie), als eine Erhöhung einer Sickerwassergebühr um I DM. Daraus schlußfolgern die Autoren, daß der Wasserpreis der ausschlaggebende Faktor zur Beeinflussung sowohl des Wasser-Inputs als auch des Wasser-Outputs eines Unternehmens ist. In engem Zusammenhang mit Genehmigungen ist die Umwelthaftung zu sehen. Geplant ist, entsprechende Umwelthaftungstatbestände in einem einheitlichen Gesetz zusammenzufassen. So soll etwa §22 Wasserhaushaltsgesetz aufgehoben und als Haftungstatbestand in das neue Gesetz überführt werden. Ähnliches gilt für § 14 Bundes-Immissionschutzgesetz. Fleckenstein (1990, S.223f.) weist in diesem Zusammenhang besonders auf folgende Punkte hin, die wesentlich für die Wassernutzung sind: (1) Einführung verschuldensunabhängiger Gefährdungshaftung (2) Gefährdungshaftung für den Betrieb bestimmter (z.B. auch wassergefährdender) Anlagen (3) Einbeziehung auch des Normalbetriebs in die Gefährdungshaftung (4) Orientierung der Gefährdungshaftung an dem traditionellen Schadensbegriff (ersetzt werden dann alle Schäden, die durch Verletzungen von Körper, Gesundheit oder Eigentum entstehen)
54
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
(5) Beweiserleichterung für den Geschädigten zum Nachweis der Kausalität einer Umwelteinwirkung (die Tatsache, daß eine bestimmte Anlage einen bestimmten Schaden verursacht hat, wird bereits dann unterstellt, wenn sie geeignet ist, den Schaden zu verursachen) d) Evaluierung politischer Ansätze zum Wasserschutz Ökonomen haben sich in der Politikberatung gestritten, welche Lenkungsinstrumente der Umweltpolitik effizienter seien (Simonis 1990, S.43). Konsens scheint jedoch darüber zu bestehen, daß die Politik umweltfreundliche Erzeugung begünstigen und umweltbelastende Verhaltensweisen verteuern soli. Den politischen Entscheidungsträgern stellen sich hierbei im einzelnen folgende Fragen: (1) Welche Kosten sind mit einem spezifischen Erlaß (z.B. Richtlinie, Gesetz,
Verordnung) verbunden? (2) Welchen Nutzen bietet solch ein Erlaß? und (3) Wie effektiv sind entsprechende Instrumente? Aus ökonomischer Sicht gibt es nicht den richtigen Ansatz. Wirtschaftswissenschaftler streiten über das Problem wie mit dem Problem der landwirtschaftlichen Wasserverschmutzung umgegangen werden soll so sehr wie jede andere Gruppe. (vgi. Shogren 1993) Libby/ Boggess bringen dies auf den Punkt: "In the final analysis, good policy is acceptable policy, and standards of acceptability vary with demographics, problem urgency, information, and even the persuasiveness of a few individuals." Libby/ Boggess (1990, S.28) Regulierende Ansätze zur Vermeidung von Wasserbelastungen gehen grundsätzlich davon aus, daß das Recht zur Wassernutzung bei Verwendungszwecken, die seine Eignung für andere Nutzer einschränken von dem eigentlichen Wassernutzer auf die öffentliche Hand übergeht, die zum Wohle der anderen Nutzer handelt. In diesem Fall werden Privilegien durch Verpflichtungen ersetzt. Implizit wird damit unterstellt, daß Nachteile für die wasserbelastende Partei mehr als wettgemacht werden durch Verbesserungen für Gesundheit und Sicherheit anderer Wassernutzer mit einem resultierenden Gesamtnutzen. Soll eine entsprechende staatliche Regulierung vernünftig sein, muß klar nachgewiesen werden, daß Nutzungseinschränkungen für den Erstnutzer tatsächliche Ver-
II. Der Wettbewerb um die natürliche Ressource
55
besserungen für nachgelagerte Nutzer erbringen und daß die öffentliche Gesundheit und Sicherheit wirklich gefährdet sind. Solche Regulierungen dürfen nicht wiIIkürlich sein und müssen konsequent angewendet werden. So läßt sich mit den Worten von Libby/ Boggess feststeIlen: "Most experience with environmental regulation applies to specific point-source contaminants, such as underground storage tanks, waste disposal sites, and toxie substances, that may enter the water at some time. Nonpoint agricultural sources are less susceptible to regulation because the economic and technical link between the transfer of property rights and desired change in water quality is difficult to establish. Further, acceptable nonpoint regulations are difficult to implement because those who gain are often separated in time and distance from those whose water use is apparently creating the problem." (Libby/ Boggess 1990, S.2S) Gewöhnlich wird bei Studien, die die Auswirkungen umweltpolitischer Maßnahmen auf das Verhalten der betroffenen Unternehmen untersuchen, ein vereinfachtes ModeIl gewinnmaximierenden Verhaltens verwendet. (so z.B. von Andersonl De Bossu/ Kuch 1990) Ein Pionier auf diesem Gebiet ist Zilberman (1984), der die Bedeutung einer zusammenhängenden Betrachtung landwirtschaftspolitischer Maßnahmen und technologischen Fortschritts am Beispiel des Problems eines effizienten Wassermanagements iIIustrierte. TabeIle 11 führt ausgewählte Evaluationskriterien zum Wasserschutz auf. Tabelle J J Ausgewählte Kriterien zur Evaluierung politischer Ansätze zum Wasserschutz Kriterium
Quelle
Kosten (Wasserbelastung, -vermeidung)
Raucher (1983)
Nutzen (Veränderung des Schadens)
Raucher (1983), Freeman (1982)
Zuständigkeiten
Sharp/ Bromley (1979)
Durchführbarkeit
Griffinl Bromley (1982) Hatchettl Horner/ Howell (1991)
ökonomische Effizienz
Ablerl Shortle (1991 ) Segerson (1990)
Gerechtigkeit (gesellschaftliche Gruppen)
Bartel (1993)
politische Durchführbarkeit
Bartel (1993), Nellinger (1993)
Quelle: eigene Zusammenstellung
56
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
Wie aus einer empirischen Untersuchung von Henzel Teuscher (1993) hervorgeht, bestehen zudem Unterschiede zwischen den instrumentellen Präferenzen verschiedener umweltpolitischer Akteure. Pflanzenerzeugende Unternehmer sehen nach dem Ergebnis dieser Studie Subventionen in Form von Ausgleichszahlungen für Nutzungsbeschränkungen als gerechtfertigt an. Vertreter der Wasserwirtschaft halten dagegen Emissionsgrenzwerte für am besten geeignet potentiellen Belastungen der natürlichen Ressource vorzubeugen. Tabelle 12 faßt Vor- und Nachteile der bisher vorgestellten Instrumente noch einmal im Überblick zusammen. Tabelle 12 Ausgewählte Instrumente der Landwirtschafts- und Umweltpolitik
Instrument
Moralische Überzeugung! Erziehung
Mechanismus
Informierender Appell
Vorteile
Nachteile
Auflagen Design- und
Steuern,
Vergabe von
Durchfüh-
Agabe, Gebühr, Zu-
Input-/
rungsstandards
geringer adrelati ve siministrativer chere BeseiAufwand; gute tigung der RegionalisierBelastung barkeit unsicherer Erfolg
ÖkonomiRationierung sche Anreize
schüsse
Output-Quoten
Zerti fikate
Vergaben von Lizenzen
dynamische Anreizwirkung; ökonomische Effizienz
Steuerbarkeit
Bezugsgröhoher adßenproblem; hohe Kosten mini strati ver MittelbereitAufwand stellung
gute Regionalisierbarkeit Wettbewerbspolitisc he Nachteile
Quelle: eigene Darstellung
e) Effekte staatlicher Regulierung auf pjlanzenerzeugende Unternehmen Mit der Belastung eines Unternehmens durch einen Durchführungsstandard wird gleichzeitig eine zusätzliche Beschränkung in das Zielsystem des Entscheiders eingeführt. Dabei wird unterstellt, daß die Wasserfreisetzung eines Unternehmens eine Funktion der Intensität seiner Inputfaktoren, seiner Vermeidungs-
11. Der Wettbewerb um die natürliche Ressource
57
technologie und der Produktionstechnik ist. Nimmt man an, daß das Unternehmen den Durchführungsstandard erfüllen will, ergibt sich das Entscheidungsproblem, Inputfaktoren, Vermeidungsanlagen und Technologie so auszuwählen, daß andere Ziele noch optimal erreicht werden. Daraus geht hervor, daß betroffene Unternehmen zur Einhaltung eines solchen Standards noch einen Ermessensspielraum haben. Es kann seine Produktionstechnik oder den Faktoreinsatz verändern oder in Vermeidungstechnologie investieren. Die Auflage von Abwassergebühren verursacht dagegen Anpassungen der Produktion durch veränderte Sortimente und Fruchtfolgen. Dies fand Horner (1975) durch eine Anwendung des Baumol-Oates-Ansatzes heraus. Bei einem Design Standard sieht sich das Unternehmen nicht mit einer Beschränkung freigesetzten Wassers konfrontiert, sondern mit einer eingeschränkten Auswahl an Erzeugungstechnik oder es kann sich gezwungen sehen, eine bestimmte Vermeidungstechnologie zu übernehmen. Obwohl Design Standards auf die Auswahl entsprechender Technologien abzielen, beeinflussen sie dessenungeachtet auch die Auswahl bzw. Effizienz der Produktionsfaktoren. Legt man einem Unternehmen eindrücklich nahe, eine bestimmte Vermeidungstechnologie zu nutzen, wird dies für die Betroffenen teuer, da die Anzahl von Alternativen reduziert ist.
Quoten und Nutzungsrestriktionen haben ähnliche Effekte in den Unternehmen wie Design Standards, da sie die Anzahl frei wählbarer Alternativen ebenfalls einschränken. Vorbild für den weiteren Fortgang der Arbeit ist eine Studie von DinanJ Salassi/ Simons (1991), die nicht wie die Mehrzahl ähnlicher Arbeiten zur Abschätzung der Folgen umweltpolitischer Vorgaben ein aggregiertes Niveau betrachtet. Statt dessen begibt sie sich auf die Ebene eines einzelnen Unternehmens, was zusätzliche Einblicke in Verteilungseffekte erlaubt. In der betriebswirtschaftlichen Literatur wird übereinstimmend die Auffassung vertreten, daß Unternehmen auf staatliche Umweltschutzmaßnahmen überwiegend mit Investitionen in sogenannte "end-of-pipe-Technologien" (EOP), also nachgeschaltete Reinigungsanlagen reagieren. (vgl. Steger 1991, S.34) Dies geht darauf zurück, daß bei der staatlichen Auflagenpolitik - dem vorherrschenden Instrument des Umweltschutzes - Grenzwerte festgesetzt werden, die von den Unternehmen einzuhalten sind. Eine Unterschreitung wird nicht honoriert. Unter
58
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
diesen Bedingungen ist es für die Unternehmen - zumindest kurzfristig - rational, die billigste Technologie zu wählen, also diejenige, die mit dem geringsten Aufwand die gleichen Werte erreicht. Bei den Wahlmöglichkeiten zwischen der Standardtechnologie mit EOP und integrierten Umweltschutztechnologien ist davon auszugehen, daß bei der integrierten Technologie die Akquisitionskosten in Form von Lern- und Umstellungskosten höher sind. Ökonomisch bedeutet dies, daß die Rentabilität sinkt, da nun mit einer größeren Kapitalmenge der gleiche Output erzeugt wird. Außerdem entstehen laufende Betriebskosten und oftmals werden ökologische Probleme nur verlagert (Klärschlämme aus Abwasser-Reinigungsanlagen verursachen ein erhöhtes Aufkommen an Sonderabfällen). Normativ ist daher von den Unternehmen eher zu fordern, in integrierte Technologien zu investieren, bei denen Wasserbelastungen gar nicht erst entstehen und die von daher auch geringere Investitionen und Betriebskosten verursachen. Grundlagen und Merkmale des Integrierten Umweltschutzes IU beschreibt ausführlicher z.B. Strebel (1991, S.4ff.).
IH. Ökonomische Werte der Wasserressource "Es genügt nicht, daß nur eine der Größe des Betriebes entsprechende Wassermenge zur Verfügung steht, auch die Beschaffenheit des Wassers selbst, und damit seine Gebrauchsfähigkeit für diese oder jene Kultur, ist vor allen Dingen in Betracht zu ziehen. Davon hängt dann auch der Wert des vorhandenen Wassers ab." (Bode 1926, S.50 f.) An dieser Stelle erscheinen einige Überlegungen über den ökonomischen Wert von Wasser angebracht. Diese sollen helfen (1) wertgebende Eigenschaften der Wasserressource nicht nur für pflanzenerzeugende Unternehmen zu identifizieren und (2) einen Betrachtungsrahmen für entscheidungsrelevante Kriterien der Wassernutzung innerhalb pflanzenerzeugender Unternehmen zu entwickeln. 1. Wertekonzept Heller (1989) gibt einen Überblick über die Rolle bzw. den Wert der Natur in der ökonomischen Dogmengeschichte. Sein systematischer Ansatz geht dabei von
III. Ökonomische Werte der Wasserressource
59
der These aus, daß sich eine Umwertung über drei Stufen von der reinen Naturproduktivität über eine Relativierung und Marginalisierung bis zur Knappheit der Natur vollzieht (S.12 ff.). Nach Aristoteles ist es die Produktivität der natürlichen Ressourcen, die ausschließlich für die ökonomische Wertschöpfung verantwortlich ist (vgl. Heller 1989, S.17). Quesnay, als wichtigster Vertreter der physiologischen Lehre (Naturherrschaft) unterscheidet dann präziser zwischen der ausschließlichen Produktivität der Natur (v.a. Boden) und der (landwirtschaftlichen) Arbeit (S.19). Die einzigartige Stellung von Pettys Lehre besteht aus umweltökonomischer Sicht darin, daß er Natur und Arbeit gleichberechtigt sieht und sie als Komplementärfaktoren auffaßt (S.25). Noch stärker relativiert Locke die Naturproduktivität: Natur, die nicht durch Arbeit angeeignet ist, hat keinen ökonomischen Wert (S.26 ff.). Die bis dato gültige Sonderstellung des Bodens hebt Ricardo zugunsten einer allgemeinen "natürlichen Voraussetzung" auf, die aller Produktion, nicht nur der Urproduktion zugrunde legt. Mit dem Konzept der Differentialrente legt er darüber hinaus ein theoretisches Fundament zur Erfassung der Knappheit aller Naturgüter (S.35). Zur neueren Theorie natürlicher Wertentstehung siehe weiter z.B. Immler (1985 u. 1989).
a) Eine Definition von "Nutzung" Es ist daher zu fordern, daß eine geeignete Variable zur Darstellung und Beschreibung der Wassernutzung sowohl Art und Ausmaß physikalischer und ökonomischer Zusammenhänge beinhaltet, als auch die Perspektive des Entscheidungsträgers. Außerdem soll eine Definition von Nutzung ausgewählt werden, die nicht nur auf den verbrauchenden Verwendungs zweck pflanzlicher Erzeugung sondern auch auf gebrauchende Nutzungsarten anderer Wettbewerber angewendet werden kann. Daher erscheint es angemessen, eine eher grundsätzliche Definition zu wählen. Folgende Definition von Gray/ Young erfüllt diese Anforderungen: "Any alteration in quantity, quality, time, or location for economic benefit constitutes 'use' for which an appropriate economic value may need to be derived." (Gray/ Young 1984, S.166)
60
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut b) Ökonomischer Wert
Unter Ökonomen besteht weitgehend Konsens darüber, daß Nutzen objektiv nicht direkt meßbar ist. Dies gilt systemübergreifend sogar für Vertreter aus Staaten mit sozialistischer Planwirtschaft (vgl. z.B. Minc 1976, S.42, 81 u. 122). Es stellt sich die Frage, wie das monetäre Äquivalent für die Nutzung einer knappen natürlichen Ressource zu bestimmen ist. Präferenzbezogene Werteansätze oder Paradigmen basieren auf menschlicher Präferenz. Brown (1984, S.232) unterscheidet drei solcher Paradigmen: das konzeptbezogene, das verhältnisbezogene und das objektbezogene Paradigma. Konzeptbezogene Denkansätze befassen sich mit den Ursprüngen von Präferenz, verhältnisbezogene Ansätze mit dem Vorgang der Präferierung und objektbezogene Ansätze mit dem Ergebnis einer Präferierung. Die Entscheidungsprozeduren in Kapitel B. sollen in erster Linie ökonomische Wertmaßstäbe anwenden; diese Anwendung soll jedoch mit vollem Verständnis der Hintergründe entsprechender Wertmaßstäbe geschehen. Ressourcen erhalten ökonomischen Wert immer wenn sie knapp sind (also wenn Nutzer bereit wären, lieber einen Preis für die Benutzung zu zahlen, als ohne die Ressource auszukommen). Eine vergleichende Darstellung der Preisbildung natürlicher Ressourcen auf Grundlage der Ricardo- bzw. HotellingParadigmen stammt z.B. von Siebert 1986. Im Falle vollkommener Märkte dienen Werte der Ressource am Markt (Preise) der Verteilung von Ressourcen und Gütern auf solche Nutzungen, die den höchsten Ertrag oder die höchste Konsumentenzufriedenheit hervorbringen. Üblicherweise arbeiten Märkte jedoch nicht effizient; daher kann die Allokationsentscheidung die Verwendung unterschiedlicher Wertbestimmungsmethoden erforderlich machen. In jedem Fall sind Ressourcenwerte abhängig von den verfolgten Zielen und werden an ihrem Beitrag zur Zielerreichung gemessen: "In either case, resource value has meaning only in relation to some explicit objective or set of objectives. Value is then measured as the resource's contribution to the stated objective(s)." (Gray/ Young 1984, S.158) Zu den Gesichtspunkten des Ressourceneinsatzes in Unternehmen merkt Constanza an: "Quantitative valuation of natural resources is a critical prerequisite to their effective management. The valuation issue cannot be ignored, since all management decisions concerning natural resources embody either implicit or explicit valuations. Improved accuracy can only come from attempts to incorpora-
III. Ökonomische Werte der Wasserressource
61
te alI available information into explicit, quantitative valuation." (Constanza 1984, S.7) Und Smith fügt im Hinblick auf den Handlungsbedarf hinzu: "Environmental resourses are increasingly recognized as assets providing services that are no longer readily available. Indeed, demands to measure their values and incorporate them into our decisions is precisely what we would expect as their scarcity increases." (Smith 1993, S.I) Loomis/ Hanemannl Kanninen (1991, S .412f.) schließlich unterscheiden fünf Einzelkomponenten, die den gesamten ökonomischen Wert einer knappen natürlichen Ressource ausmachen: (1) Erholungswert der Ressource vor Ort, (2) kommerzielle Nutzung der Ressource, (3) Option, die Ressource auch in der Zukunft noch zu besuchen, (4) ein existentieller Wertanteil, der sich einfach aus der Kenntnis ableitet, daß die Ressource in einem bewahrten Zustand vorhanden ist und (5) ein treuhänderischer Wertanteil, der sich aus dem Wissen von Individuen ableitet, daß es auch zukünftigen Generationen möglich sein wird, die Existenz oder auch die Nutzung dieser Ressource zu genießen. Vor einer näheren Diskussion dieser Komponenten soll zunächst auf besondere Eigenschaften der Wasserressource einzugehen, die ihren Wert maßgeblich beeinflussen. c) Besondere Wassereigenschaften mit Einfluß auf die Wertbestimmung
Mengenaspekte, auf denen ansonsten ökonomische Überlegungen aufbauen, sind nur eine Komponente im Gesamtbild der Wassernutzung. Wasserangebot und -verwendung variieren sowohl zeitlich als auch räumlich. Ort und Zeit der Ressourcenverfügbarkeit sind somit als zwei weitere Dimensionen der Bedeutung von Wasser offensichtlich. Darüber hinaus hat der Qualitätsaspekt wichtige Folgen für Nutz- und Gebrauchswert von Wasser. Gray/ Young (1984) schlußfolgern, daß diese vier Dimensionen (Menge, Qualität, Zeit und Ort) einen wesentlichen Bestandteil der Wasserbewertung ausmachen.
62
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
Die ökonomische Theorie besagt: Würde es sich um einen konventionellen Inputfaktor handeln, der auf vollkommenen Märkten zur Erzeugung verschiedener Güter und Dienstleistungen eingesetzt wird, könnte man davon ausgehen, daß der Wert des Faktors in allen Verwendungszwecken derselbe ist. Dem stehen in der Realität jedoch diverse Verzerrungen entgegen. Im Falle von Wasser kann der ermittelte Wert je nach Verwendungszweck weit variieren. Dafür ist eine Anzahl von Gründen verantwortlich. Zunächst einmal existiert kein einheitlicher Marktfür Wasser, nicht einmal auf nationaler Ebene. In Fällen, in denen überhaupt ein Markt existiert, ist er oft unvollkommen, enthält Subventionen und gilt regional oder lokal für nur einen Verwendungszweck (z.B. ein Markt für Wasseranteile in einem Bewässerungsverband). Zweitens variiert der Wert von Wasser je nach Ort, Qualität und Zeitpunkt in dem es verfügbar ist. Eine ausführliche Diskussion natürlicher Ressourcen unter diesem Gesichtspunkt öffentliche, Club- oder privater Güter bietet Zimmer (1993). Zu den ökonomischen Grundkonzepten natürlicher Güter siehe auch Hampicke (1991, S.70 ff.). Wassergesetze und Institutionen machen es demzufolge schwierig und in manchen Fällen auch unmöglich, Wasser zwischen verschiedenen Verwendungszwecken zu übertragen.
Nicht-konsumierende Wassernutzungen und der mögliche Zukunftswert von Grundwasserleitern machen es zusätzlich schwierig, Wasser einen Wert zuzuteilen. Viele Nutzungsarten schließen andere nicht von der Nutzung aus. So mindern beispielsweise wassergebundene Erholung und Freizeit flußaufwärts in der Regel nicht den Wert der Ressource für Transport und Erholung weiter flußabwärts, da sie entsprechende Qualitätsparameter (siehe hierzu den später folgenden Abschnitt A. IV. in diesem Kapitel) nicht wesentlich verändern. Hinzu kommt noch, daß auch Teile des für Bewässerungszwecke entnommenen Wassers weiter flußabwärts wieder verfügbar sind. Daraus ergibt sich, daß Wasser in einigen Fällen wie jedes andere private Gut zu bewerten ist, in anderen Fällen jedoch der Wert in anderen Nutzungen wie bei öffentlichen Gütern hinzugezählt werden muß. (vgl. Easter/Leitchl Scott 1983, S.136) Gray/ Young (1984, S.l66f.) geben ausführlichere Erklärungen, wie Standort und Verwendungszweck den Produktionswert von Wasser beeinflussen. Zwei Aspekte ihrer Ausführungen erscheinen interessant: Dies ist zum einen der
III. Ökonomische Werte der Wasserressource
63
Nutzen für den Verbraucher (ökonomischer Wert des Endprodukts zu dessen Herstellung das Wasserangebot dient) und zum anderen die physikalische Produktivität der Ressource bei der Erzeugung eines Gutes. Beide Konzepte sind analog zu dem Konzept des Produktpreises und dem Konzept der physikalischen Grenzproduktivität in der Betriebswirtschaftslehre zu sehen. Mit Ausnahme des Entzugs für den Verbrauch in privaten Haushalten und der in-Strom-Nutzung zu Erholungszwecken stellt Wasser ein intermediäres Gut zur Erzeugung anderer Güter dar. In der Mehrzahl der Fälle werden in jeder anderen Nutzungsart mehrere Endprodukte erzeugt, jedes mit einem anderen Preis und einer anderen Produktivität. Demzufolge würde man innerhalb jeder Nutzungsart viele verschiedene Schätzwerte für den Wert von Wasser erwarten, von denen jeder auf einen anderen Ertrag des jeweiligen Produkts zurückgeht. Der zweite Aspekt unterschiedlicher Standortproduktivitäten befaßt sich mit Einflußfaktoren der physischen Produktivität verschiedener Nutzungsarten an ein und demselben Standort. Solche Faktoren sind zum Beispiel Boden- und Klimaeigenschaften, die Produktivität von Bewässerungswasser beeinflussen oder auch ästhetische Charakteristika, die den Erholungswert beeinflussen. Außerdem hängt die Produktivität des Wassereinsatzes auch von Investitionen in andere Ressourcen ab, die im Zusammenhang mit Wasser genutzt werden. Dementsprechende Beispiele sind der Ausbau von Rastplätzen an Gewässern und Investitionen in effizientere Bewässerungstechnologie. Eine weitere wichtige physikalische Eigenart von Wasser ist, daß es ein relativ sperriges Gut ist, dessen Transportkosten im Vergleich zu seinem Wert am Nutzungsort relativ hoch sind. Gray/ Young schlußfolgern daraus: "This implies that water values will vary with location much more than will the values of less bulky goods." (Gray/ Young 1984, S.l68) Auch muß Wasser vor seiner Nutzung häufig einen oder mehrere Verarbeitungs- oder Aujbereitungsprozesse durchlaufen (Filtration, Chlorierung, Druckerhöhung, pH-Werteinstellung, Entkalkung, etc.). In der Folge ergeben sich Wertunterschiede zwischen dem rohen (unbearbeiteten) und dem aufbereiteten Wasser. Autoren wie die beiden genannten (vgl. Gray/ Young 1984) halten es daher für sinnvoll, zwei Konzepte eines ökonomischen Wertes von Wasser zu unterscheiden: ein Wert am Standort und ein Wert in Wasserläufen. Bei letzterem
64
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
Konzept sind für Entzugszwecke Verarbeitungs- und Transportkosten vom Wert am Standort abzuziehen, um vergleichbare Werte zu erhalten. Während also manche Ökonomen die Möglichkeit sehen, nicht greifbaren Werten monetäre Meßeinheiten zuzuweisen, erscheinen Zweifel an dieser Vorgehensweise aus zwei Gründen angebracht. Erstens tendiert diese Art von "Währungs-Gymnastik" dazu, unglaublich hohe Werte zu liefern. Die Empfehlung beispielsweise, der ökonomische Wert einer Spezies oder einer ästhetisch ansprechenden Landschaft sei 300 Mio US$ ist eine verwirrende und umstrittene Vorstellung. (vgl. Kellert 1984, S.360) Zweitens ignorieren monetäre Wertmaßstäbe weitgehend subjektive Beurteilungen betroffener Individuen und deren Positionen im sozio-ökonomischen Umfeld. Wegen solcher erheblicher Zweifel an der Durchführbarkeit mancher dieser monetären Wertbestimmungsmethoden fordert Kellert eine universell einsetzbare Werteinheit: " ... a universal value unit is needed to facilitate some kind of additive numerical evaluation." (Kellert 1984, S.360) Dies kann so ausschließlich für die vorliegende Arbeit nicht übernommen werden. Unter Berücksichtigung der anderen Quellen ist ergänzend die Bedingung einzuführen, lokale oder regionale Variationen zuzulassen.
d) Kategorien und Arten von Werten Folgt man vorliegender Literatur, sind bei der Ermittlung ökonomischer Werte der Wasserressource drei Arten von Nutzen zu berücksichtigen: ökologischer, sozial-psychologischer und ökonomischer Nutzen. Bei einer detaillierteren Betrachtung schließen diese Kategorien mindestens sechs unterschiedliche Aspekte ein (zur Wertermittlung siehe anschließend Abschnitt B. III. 2.). Diese sind: (1) Naturalistische Werte von Freizeit und Erholung im Grünen - z. B. der
anerkannte Nutzen im Zusammenhang mit direktem Kontakt und Erfahrung naturbelassener Umgebung (Campen, Rucksackwandern, Jagen, Angeln, Vogelbeobachtung, etc.).
III. Ökonomische Werte der Wasserressource
65
(2) Ökologische Werte - z. B. die Bedeutung einzelner Lebensgemeinschaften für das Weiterbestehen miteinander verflochtener Flora und Fauna. (3) Existenz- oder moralische Werte - z.B. die Bedeutung einzelner Ökosysteme oder Arten als wertvolle Schutzgüter, die unabhängig von ihrer gegenwärtigen Nützlichkeit bewahrt werden müssen. (4) Nutzwerte - z.B. das gegenwärtige und zukünftige Potential von Bestandteilen der natürlichen Umwelt als Quellen materiellen Nutzens für Individuen und die Gesellschaft. (5) Ästhetische Werte - z.B. die physische Attraktion und künstlerische Anmutung von belebter und unbelebter Umwelt. (6) Kulturelle, symbolische und historische Werte - z.B. die Bedeutung naturbelassener Gebiete oder Arten als Spiegelbild einzigartiger Sozialgebilde und spezieller Beziehungsgeflechte; in diesem Zusammenhang auch humanistische Werte genannt - z.B. starke emotionale Bindung an einzelne Objekte der belebten oder unbelebten Umwelt. Außerdem sind prinzipiell zwei Klassen von Wertansätzen zu unterscheiden: Nutzwerte und Existenzwerte. Diese Werte wurden zuerst von Krutilla (1967) identifiziert. Die immer noch aktuelle Bedeutung von Existenzwerten bestätigt eine Reihe neuerer Untersuchungen zu diesem Thema, z.B. von Smith (1993). Nutzwerte bestehen nach Carsonl Martin (1991, S.393) aus allen gegenwärtigen und direkten und indirekten Arten auf die ein Agent physischen Gebrauch von Wasserqualität macht. Das Auftreten dieser Werte ist darauf zurückzuführen, daß Wasser eine essentielle Komponente ist oder weil es ästhetischen Genuß bereitet. Im Gegensatz zu Nutzwerten verkörpern Existenz-Werte die Feststellung, daß eine Person einen Standort nicht persönlich zu besuchen oder Dienstleistungen von diesem Standort zu genießen braucht, um Nutzen aus seiner Bewahrung oder Verbesserung zu ziehen. (vgl. Carsonl Martin 1991, S.393) Bishop/ Welsh (1992,
SA02) verwenden den Ausdruck" resource existence values" mit der Bedeutung " va lues for natural resources that are motivated from sources within the individual's utility function other than personal use . .. Eine stark anthroposophisch gefärbte Betrachtung der Wasserressource erarbeitete 1988 Winkler. Interessierte 5 Orlh
66
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
Leser finden dort eine Ergänzung des in der vorliegenden Arbeit gezeigten Wertverständnisses um eine philosophische Komponente. Nutzwerte setzen nach diesem Verständnis entweder unmittelbaren Kontakt mit der fraglichen Ressource oder den persönlichen Verbrauch von Produkten voraus, die aus der Ressource abgeleitet sind. Existenzwerte setzen dagegen keinen dieser beiden Kriterien voraus. Intrinsische Nutzen oder solcher aus einem nicht stattfindenden Gebrauch der Ressource beziehen sich auf Werte, die eine Gesellschaft dem Wasserschutz unabhängig von dem gegenwärtigen Nutzungswert oder kurzfristigen Kosten einer Verunreinigung zumißt. Nach Raucher (1983, S.323) sind die grundsätzlich relevanten Komponenten intrinsischer Nutzwerte, zu denen umfangreiche Literatur vorliegt, Optionswert, Existenzwert und Vermächtniswert. Bishop/ Welsh setzen die Bedeutung von Existenzwerten dabei sehr hoch an: "To ignore existence values would be to court the equally damning criticism of making a thinly masket value judgement in favor of use values as the only true economic value." (Bishop/ Welsh 1983, S.323) Vorstehende Ausführungen zeigen, daß die Vielfalt der Wassereigenschaften und Bedeutungen zu einer Reihe unterschiedlicher Wertermittlungsansätze führt. Mehrere Techniken wurden entwickelt, um entsprechende Werte zu bestimmen (siehe Abbildung 5). Nur solche Techniken, die für das neu vorzustellende Modell (vgl. Kapitel E.) von grundlegender Bedeutung sind, sollen auf den nächsten Seiten kurz vorgestellt werden.
~
Quelle: Rudolpf 1989, S.27
Abb. 5: Wertermittlungsmethoden
0-.I
~
~
~
CI>
~
~
:E
~
0-
(>
~
~
~
2.
o
;:::
0: ~ ::J
-
B. Wasser: Mehr als HzO - ein einzigartiges Gut
68
2. Wertermittlungsansätze für Wasser Tabelle 13 enthält Vor- und Nachteile verschiedener Ansätze. Tabelle 13 Ausgewählte Wertermittlungssätze für Wasser Methode Beobachtung von Transaktionen Ableitung von Schätzwerten aus Produktionsfunktionen Residuelle Zuschreibung Veränderung
Vorteil leichte Durchführbarkeit
Gray/ Young (1984) Heller (1989) Hexeml Heady (1978) Gray/ Young (1984)
Problem der Aufschlüsselung des Gesamtwertes
Heady (1952) Gray/ Young (1984)
optimale Res-
Gray/ Young (1984)
sehr zielstrebiges Verfahren soziale Komponente
AIternativKosten-Methode
praktikabel und standortspezi fi sch
Contingent Valuation
Einflüsse anderer Ressourcen nicht eindeutig zu quantifizieren
Quelle
Klassischer Ankein Ausschluß satz: Bestimmung des Auftretens von der Nachfragefunk- Teilnutzen ohne die ti on Ressource
Netto-Einkommen
Reise- KostenMethode
Nachteil
nachfrageorientiert
Orientierung an Präferenz
Quelle: eigene Zusammenstellung
sourcenallokation Schlichtheit
Vermittelbarkeit und Bezugsgrößenproblem
hypothetische Natur der Fragen, strategisches Antwortverhalten
Gray/ Young (1984) ClawsonlKnetsch (1966), Bouwes/ Schneider (1979), Miranowski (1983), Smith (1993) Feenbergl Mills (1980), Carson/ Martin (1991), Hanemann (1991 ), Opaluch/ Segerson (1989), Weaver (1989), Heller (1989)
III. Ökonomische Werte der Wasserressource
69
Befragungen zur Wertermittlung VOn Wasser kommen bisher vor allem zum Einsatz, wenn weder Verbrauch noch Gebrauch der Wasserressource vorliegen.
Solche Fälle sind gewöhnlich mit Freizeit und Erholung bzw. dem ästhetischen Genuß von Wasser in natürlicher Umgebung verbunden. Reisekosten-Ansatz und Contingent-Valuation sind die beiden Haupt-Entwicklungsrichtungen in dieser Kategorie. Besonders ist in diesem Zusammenhang noch auf die Kohortenanalyse nach v. Alvensleben sowie das GfK-Panel als Formen wiederholter Befragung (dynamischer Ansatz) zu verweisen. Weiterentwicklungen der Reisekosten-Methode wie Produktionsfunktionsmodelle für Privathaushalte und Hedonic Pricing sollen an dieser Stelle nicht weiter behandelt werden, da in dieser Arbeit das Unternehmen im Mittelpunkt der Betrachtung stehen soll. Eine Vertiefung zum Thema HPF-Modelle bietet jedoch z.B. Smith (1993), und zum Hedonic Pricing Adelmanl Griliches (1961), Ridker/ Henning (1967) sowie Rosen 1974 und Palmquist 1989. Am schärfsten formuliert Sagoff seine grundsätzliche Kritik an direkten Benutzerumfragen zur Wertermittlung: "What people say On surveys invites more speculation about its meaning than a short story by Kafka. By invoking 'existence values' whatever story suggests the 'right' kind of preferences: the story of ethical commitment, psychic income, guilt, strategie behavior, band wagon effects. Who knows whether people contribute to the conservancy for ideological reasons, to obtain a warm glow, to please the neighbor who asks them, or just because it comes to mind as a tax deduction? You can tell any story you want, which is why these values are now so central to the science of resource economists ... (Sagoff 1994, S.140)
3. Studien zur Wertermittlung von Wasser Besonders in der englischsprachigen Literatur wurde eine ganze Reihe von Schätzungen von Wasserwerten veröffentlicht. Ein Vergleich mit Werten, die Wasser in der Verwendung für Bewässerungszwecke zugeschrieben werden, ergibt jedoch teils deutliche Unterschiede. (vgl. Gray/ Young 1984, S.I77ff.) Der hauptsächliche Grund für diese Tatsache liegt in der beschriebenen Vielfalt unterschiedlicher Wertermittlungsansätze, von denen jede~ unter bestimmten Umständen der angemessene Ansatz sein kann.
70
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
Verfahren der Residuellen Zu schreibung genießen die häufigste Anwendung bei der Schätzung des Wertes von Wasser zu Bewässerungszwecken. Die Alternativ-Kosten-Methode hat nicht sehr viel Aufmerksamkeit erlangt, obwohl es erscheint, als wären mit ihr in Einzelfällen durchaus interessante Erkenntnisse gewonnen worden. Tabelle 14 gibt einen Überblick über ausgewählte Studien zur Ermittlung von Wasserwerten. Tabelle 14
Ausgewählte Studien zur Wertermittlung bei Wasser Bewerteter Aspekt
Quelle
Bewässerung zur Pflanzenerzeugung
Fox! Rollins (1969) FrankJ Beattie (1979) Madariaga/ McConell (1984)
Wasserfluß (Menge)
DaubertJ Young (1981)
Wasserqualität
Bouwes/ Schneider (I 979) Greenley/ Walsh/ Young (1982) Sutherlandl Walsh (1985) Smith/ Desvousges (1986) Carsonl Mitchell (1988)
Freizeit und Erholung
McConnell (1977) Hanemann (1978)
Ökosystem-Schutz
HammackJ Brown (1974) Bishop/ Boyle (1985) Walsh/ Sanders/ Loomis (1985)
Natürliche Vorzüge
Blomquist (1983)
Toxische Belastung
Hanemannl Kanninenl Loomis (1990)
Quelle: eigene Zusammenstellung
Drei Studien, die sich mit dem Wert von Wasser in der Pflanzenerzeugung befassen, sollen an dieser Stelle kurz näher vorgestellt werden: Madariaga und McConell (1984, S.91) berechneten den Grenznutzen (Wert) von Bewässerungswasser über eine Produktionsfunktion mit dem Gesamtwert der Erzeugung. Dabei verwendeten sie spartenübergreifende Beobachtungen zu dem Wert landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und Produkte, die sie in Beziehung zu den hierfür aufgewendeten Wassermengen setzten. Die Anwendung von
III. Ökonomische Werte der Wasserressource
71
Regressions- und Kovarianzmodellen ergab schließlich Wasserwerte von 80 354 US$ pro Quadratfuß. Diese Schätzwerte sind Grenzwerte des applizierten Bewässerungswassers, jedoch keine Grenzwerte für das gesamte in der Pflanzenerzeugung aufgewendete Wasser (z.B. Bewässerung plus Niederschlag). Bereits einige Jahre vorher hatten Frank und Beattie (1979) die Ridge-Regression zur Wertenruttlung von Wasser angewandt. Wegen der im Westen der USA gewöhnlich applizierten größeren Wassermengen gelangten sie zu Werten von 210 US$ pro Quadratfuß. Noch früher schätzten Fox und Rollins (1969) Grenzwerte für Bewässerungswasser in vier verschiedenen Varianten, die sich hinsichtlich Ertragshöhe (Durchschnitt, hoher Ertrag) und Marktbeschränkungen (absetzbare Mengen am gegenwärtigen Markt und an einem zukünftigen Markt) unterschieden. Die Studie basierte auf empirischen Daten über die Reaktion von Kulturen auf unterschiedlich hohe Wassergaben. Ziel war es zu ermitteln, welche Preise pflanzenerzeugende Unternehmen für Wasser prinzipiell zahlen könnten. Durch stufenweises Anheben der Wasserpreise in der Produktion von Verarbeitungsgemüse und Kartoffeln errechneten die Autoren Wasserwerte von 6 - 12 US$ pro Quadratinch. Mit der Erhöhung des Wasserpreises wurden in der optimalen Lösung wasserbedürftige Kulturen mehr und mehr durch Kulturen ohne Zusatzbewässerung verdrängt bis zu einem Preis, an dem keine bewässerten Kulturen mehr angebaut wurden. Wie erwartet zeigte sich, daß Wasser in der hohen Ertragsstufe wertvoller war, als bei Durchschnittserträgen. Zusammenfassend kann man sich im Grunde der Meinung von Gibbons anschließen: "Water values for plant production can be either marginal values or average values, crop-specific or calculated for a mixture of crops; and they can be short-run or long-run. In addition, some values discussed in the literature are 'onsite' values, while others are comparable to instream water values. The basic methodologies for estimating water values are crop-water production function analyses and farm crop budget analyses (including linear programming)." (Gibbons 1986, S.28) Zum Vergleich der Werte von Wasser in verschiedenen Nutzungsarten stellt Whittlesey außerdem fest: "In general, the value of water as published in research and market information are shown to be lower for agriculture than for hydropo-
72
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
wer, municipal or industrial uses, but comparable to uses for fisheries, recreation, navigation, or wetland uses." (Whittlesey 1994, S.278) Das eigene Vorgehen wird in Kapitel E. eingehend dargestellt. Für den dabei verwendeten Wertansatz spielen sowohl Wasserpreise, als auch die Möglichkeiten konkurrierender Nutzungszwecke, ausgedrückt in der Beurteilung verwendeter und freigesetzter Wasserqualitäten eine wesentliche Rolle. Weiterhin finden Einkommensveränderungen aufgrund veränderter Erzeugungsprogramme, sowie Kosten (und Kapital- sowie Arbeitsbedarf) von Alternativen Eingang. Befragungen spielen im Hinblick auf das öffentliche Ansehen eines Unternehmens in bezug auf die Wassernutzung eine Rolle.
IV. Wasserqualität 1. Wasserqualität in der Pflanzenerzeugung
In dem Maße in dem die Erzeugung von Pflanzen von ausreichenden Wassermengen abhängt (siehe Abschnitt B. I. I.), setzt sie auch eine ausreichende Qualität dieses Faktors voraus. Grundsätzlich richtet sich eine Beurteilung der Eignung einer Wasserquelle für die Pflanzenerzeugung nach dem Salzgehalt, dem pH-Wert, sowie dem Gehalt bestimmter lone und toxischer organischer Substanzen. Wichtigster Qualitätsparameter zum Salzgehalt ist dabei die Summe aller gelösten Salze, in der Regel ausgedrückt als TDS-Wert (total dissolved solids) oder elektrische Leitfähigkeit. Beide Maßstäbe sind mit dem Pflanzenwachstum korreliert. Der Einfluß der Salinität auf das Pflanzen wachstum geht hauptsächlich auf die gelösten Salze zurück: Ein osmotischer Effekt belastet die meisten Kulturen, da er das extern vorhandene Wasserpotential reduziert und so Wasser weniger leicht für die Pflanze verfügbar macht. Wird das osmotische Potential der Wurzelumgebung niedriger, als das der Pflanzenzellen, erleiden die Gewächse eine osmotische Welke. Bei längerem Anhalten geht diese einher mit einem verlangsamten Wachstum, sowie mit einer Vergrößerung und Vermehrung von Metaboliten und Strukturelementen der Zellen (vgl. z.B. Schraderl Scharpf 1994). Auf einen Nenner gebracht läßt sich feststellen: Die Verwendung von salzhaitigern Wasser resultiert in niedrigen Erträgen und in der Unmöglichkeit,
IV. Wasserqualität
73
salzempfindliche Kulturen erfolgreich anzubauen. (vgl hierzu Tanji/ Enos 1994, S.16ff; Hoffmannl Ayers/ Doeringl McNeal 1983 oder Cervinka 1989, S.155ff.) Die Azidität-Alkalinität eines Wassers, gemessen als sein pH-Wert, hat in der Regel wenig direkten Einfluß auf die Pflanzen, solange die Bewässerung über die Bodenoberfläche erfolgt. Gewöhnlich puffert der Boden Extremwerte ab. Dessenungeachtet kann jedoch ein ungeeigneter pH-Wert Kulturen über den Blattkontakt beschädigen. In sauren Böden, deren Pufferkapazität für Wasser mit niedrigem pH-Wert beschränkt ist, kann außerdem noch ein weiterer Effekt auftreten: Wasser mit einem pH < 4,5 erhöht die Löslichkeit von Eisen-, Aluminium- oder Manganionen bis zu Konzentrationen, die toxisch für das Pflanzen wachstum sind. Die Ernährung von Kulturpflanzen kann weiterhin durch ein unausgeglichenes Vorkommen gewöhnlicher Nährsubstanzen in Wasser und Bodenlösung beeinträchtigt werden, wenn diese Konstellation eine ungünstige Umgebung für das Wachstum darstellt. Ionen wie Calcium, Magnesium oder Natrium, die ansonsten essentiell für das Pflanzenwachstum sind, können dieses verlangsamen oder sogar verhindern, wenn ihre gesamte oder relative Konzentration unausgewogen ist. Manche Pflanzen reagieren auch empfindlich auf die Anwesenheit mäßiger oder sogar sehr niedriger Konzentrationen bestimmter Ionen im Gieß wasser. Selbst eine geringe Konzentration von Elektrolythen wie Na+, Ca 2+, CI - oder S042- kann in solchen Fällen das Wachstum bremsen oder Schäden verursachen. Spurenelemente und organische toxische Chemikalien sind Mikroverunreinigungen, die in zahlreichen Quellen und Brunnen als Resultat von Niederschlägen oder exogen eingetragen auftreten. Toxische Substanzen können von Kulturpflanzen aus einer Wasserquelle direkt über Blattkontakt oder indirekt über den Boden und das Wurzel system aufgenommen werden. Toleranzgrenzen für organo-toxische Substanzen sind bei Pflanzen weitgehend unbekannt. In der entsprechenden Fachliteratur mehrfach berichtet werden Übertragungs-Effekte von Herbiziden von einer Kulturpflanze auf die andere. (V gl. z.B. Yaronl Frenkel 1994, S.26ff.) Tabelle 15 enthält zusammenfassend Richtwerte zur Beurteilung der Wasserqualität für moderne geschlossene Bewässerungssysteme.
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
74
Tabelle 15
Richtwerte zur Beurteilung der Wasserqualität Kriterium Leitfahigkeit HCOrGehalt Natrium (Na) Chlorid (CI) Calcium (Ca) Zink (Zn) Kupfer (Cu) Nitrat-N
Wert
< IOOIlS < 5-10 mmoVI
< 0,5 mmoVI (= 11 mg/I) < 0,5 mmoVI (= 17 mg/I) < 2,5 mmoVI (= 100 mg/I) < 7,5 IlmoVI (= 0,5 mg/I) < 4 IlmoVI (= 0,26 mg/I)
ab 1-2 mmoVI (14-28 mg/I) bei N-Düngung berücksichtigen
Quelle: Molitor 1994, S.1754
Ayers/ Westcot (1985, S.3ff.) fassen wasserbezogene Probleme der Pflanzenerzeugung zusammen: (1) Prinzipiell reduzieren höhere Salzkonzentrationen im Gießwasser die Verfügbarkeit für die Pflanzen bis zur Ertragsdepression. (2) Relativ hohe Natrium oder niedrige Calcium-Konzentrationen verringern die Rate mit der Gießwasser in den Boden eintritt bis zu einem Grad, an dem nicht genug Wasser in den Boden eindringt, um die Kultur ausreichend von einer Wassergabe bis zur nächsten zu versorgen. (3) Bestimmte Ionen wie Natrium, Chlorid oder Bor im Gießwasser können sich in der Pflanze soweit anreichern, daß Schäden und Mindererträge auftreten
(spezifische Iontoxizität). (4) Nährstoffe im Überschuß mindern Ertrag und! oder Qualität.
(5) Salzablagerungen auf Früchten oder Blättern mindern die Vermarktbarkeit. (6) Beschleunigte Korrosion der verwendeten Maschinen und Geräte verursacht
einen höheren Wartungs- und Reparaturaufwand.
2. Umweltqualitätsziele Der Begriff "Umweltqualität" ist eine Übertragung aus dem amerikanischen "Environmental Quality". Eine allgemein anerkannte Definition gibt es nach Fürst (1992, S.9) nicht. Konsens besteht lediglich darüber, daß der Begriff wis-
IV. Wasserqualität
75
senschaftliche Informationen mit gesellschaftlichen Zielen und Wertvorstellungen verbindet und somit inhaltlich einem permanenten Wandel unterliegt. Wasserqualität ist dabei jedoch nicht nur eine Frage des Umwelt- und Gesundheitsschutzes, sondern auch ein soziales und politisches Problem. Wie eingangs dargestellt (vgl. Abschnitt B. 11.) hat jeder Nachfrager nach Wasser ganz spezifische Ansprüche an dessen Qualität: "Usable water has a collection of attributes inc1uding chemical, biological, and physical factors. Demand for water by various users is responsive to the quality dimension." (Libby/ Boggess 1990, S.I 0) Nach dem Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU 1988, S.87) sind "Umweltqualitätsziele" für die Ressource Wasser u.a. dadurch charakterisiert, daß sie (1) an Rezeptoren oder Betroffenen, nicht aber an Verursachern orientiert sind,
(2) sich immer auf Ausschnitte der Umwelt beziehen, weil eine Gesamtqualität in einem Ziel operational nicht abbildbar ist, (3) sich auf die konkrete Situation beziehen und dadurch nicht direkt auf andere Fälle übertragbar sind. Die Europäische Kommission hat dazu im Sommer 1994 einen Richtlinienvorschlag vorgelegt, der Normen und Qualitätsziele für Oberflächengewässer und einen Rahmen für Maßnahmen zu deren Einhaltung festlegen soll (KOM (93) 680 endg., AbI. 1994 Nr. 222, S. 6, vgl. auch SRU 1996, Tz. 249; siehe außerdem zum gegenwärtigen Stand Gregor (1994)).
3. Weitere Wasserqualitätsparameter Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (vgl. SRU 1978) unterscheidet im einzelnen fünf Belastungsgruppen bzw. Wasserqualitätsindikatoren: (1) leicht abbaubare organische Stoffe (z.B. aus Abwässern der Haushalte),
(2) schwer abbaubare organische Stoffe (z.B. Huminsäuren), (3) Salzbelastungen, (4) Schwermetalle und (5) Kühlwassereinleitungen.
76
B. Wasser: Mehr als HzO - ein einzigartiges Gut
In der Literatur finden sich jedoch weit mehr und detailliertere Beschreibungen von Parametern der Wasserqualität. Tabelle 16 enthält dementsprechend eine umfangreichere Aufstellung verschiedener Kriterien die aus Sicht von Ökologen die Wasserqualität beschreiben. Tabelle 16
Wasserqualitätsparameter, -indizes und -indikatoren Parameter-Gruppe quantitativ-physikalische P. qualitativ-physikalische P. qualitativ-chemische anorganische P. qualitativ-organische P. biologische P. und Indizes hygienische/bakteriologische P. Lebensraumbezogene und strukturelle P. und Indikatoren
Beispiele Mindestabtluß, Fließgeschwindigkeit, Wassertiefe Temperatur, Leitfähigkeit, pH-Wert, Redoxzustand Sauerstoffgehalt, BSB, Biomasse, ges. org. geb. Kohlenstoff Schädlingsbekämpfungsmittel und peB Zeigerorganismen wie Steintliegenlarven fakalkoliforme Bakterien Trophiegrad
Quelle: nach Fürst 1992, S.49 ff. und BStMLU 1996
Die meisten bekannten ökonomischen Ansätze zur Messung der Wasserqualität basieren auf physikalischen Parametern abhängig vom gewählten Verwendungszweck. Ein Beispiel hierfür ist das Maß/ die Konzentration an gelöstem Sauerstoff zur Beurteilung der Eignung für Freizeit und Erholung (vgl. Kneese/ Bower 1968). Stevens (1966) stellte die Hypothese auf, daß der Erholungswert (Angeln) eine Funktion des Angelerfolges pro Einheit unternommener Bemühung ist, die wiederum die Wasserqualität widerspiegelt. Andere Autoren (z.B. Reiling/ Gibbs/ Stoevener 1973) entwickelten Faktoren der Nutzungsintensität bezogen auf Schwimmen, Angeln und Wasserskifahren als Näherungswerte eines Maßstabes für Wasserqualität. Der hauptsächliche Nachteil dieser Untersuchungen liegt darin, daß die Ansätze keine systematische Beziehung zwischen den ermittelten Indizes als Näherungen und physikalisch meßbaren Parametern der Wasserqualität benutzen. Wichti-
IV. Wasserqualität
77
ger vielleicht noch ist, wie von Bouwes/ Schneider (1979, S.536) festgestellt, die Tatsache, daß diese Indizes die von Nutzern subjektiv empfundene Wasserqualität nicht wiedergeben. Eine Reihe weiterer Untersuchungen identifiziert technische Parameter der Wasserqualität ohne jedoch Qualitätsmaßstäbe vorzuschlagen, die für einen direkten Vergleich alternativer Verwendungszwecke/ Projekte brauchbar sind. Für ein Fischereiprojekt definieren Zisonl Haven/ Mills (1977) beispielsweise Wasserqualität in Form eines Oll-Index. Dieser basiert auf Schwellenwerten für Sedimentfracht (200 mg/I), Phosphat 0,2 mg/I) und Nitrat (2,0 mg/I). Die Problematik dieser Messung von Wasserqualität ausschließlich in Form technischer Parameter wurde bereits früh erkannt: "The specification of water quality only in terms of technical parameters is compatible with a regulatory approach that does not recognize the variability of both the costs and benefits of uniformly meeting fixed standards. Defining water quality in terms of impaired uses recognizes the variability in non-point source pollution problems and the differences in costs and benefits associated with alternative solutions." (Christensen 1983, S.39) Zu den weiteren Schwierigkeiten der Auswahl und Einbeziehung geeigneter Parameter in ökonomische Modelle allgemein siehe im Detail v.a. Loucks (1987). 4. Ein problem adäquater Maßstab zur Beurteilung der Wasserqualität Bei der Betrachtung des Wassereinsatzes zu Bewässerungszwecken stellt sich die Frage, wie ein angemessener Maßstab für die Wasserqualität zu definieren ist, der nicht nur auf der Input-Seite (wo er sich relativ einfach aus den Bedürfnissen der erzeugten Pflanzen ableiten ließe), sondern auch auf der Output-Seite angewendet werden kann. Als Alternative bietet sich an, Wasserqualität nach der Eignung der Ressource für verschiedene Verwendungszwecke zu definieren, z.B. Bewässerung, kommunale und industrielle Verwendung, Freizeit und Erholung, Ökosystemschutz, Energieerzeugung, Hochwasserschutz, Trinkwasserversorgung und Ästhetik: "Water quality is defined by its relation to specific use." (Yaronl Frenkel 1994, S.25)
78
B. Wasser: Mehr als H20 - ein einzigartiges Gut
Ein dementsprechender Qualitätsmaßstab ist in Tabelle 17 in Form einer Wasser-Qualitäts-Leiter dargestellt, die 1981 von Vaughan entwickelt und 1984 von Kneese für die Ermittlung der Zahlungsbereitschaft von Auskunftspersonen angewendet wurde. Die Spitze einer Zehner-Skala definiert hierbei eine bestmögliche Wasserqualität, das untere Ende die schlechteste denkbare Wasserqualität. Tabelle 17
Maßstab zur Beurteilung der Wasserqualität Verwendungszweck
Arlder
Kriterien
NulzunE men.~hllcher
KOIL''Um
ErhnluRJt
WasserqualitätsmalJstab
beste Qualität 10 ~
Entzug imWa....~rlaur
Schwil1UTCn. BootfahrCIi
Indu.'1rtelle NutzUß)t
EUl:lug
je noch Produkt
- ....
Pf1Hnzm~rzeugung
Entzug
je flach Kultur
- ...
folsche und Wassertle~
- ..
je Ilach Spezies
Öknsy"'1emt:rtlldt kunununale Nutzung
schlechteste Qualität
7654321
Entzug
Volumen
im Wasserlauf
je nach Spezies
Exl~tenz
ästhetische Werte
Ä>theUk Ahr"ldeponle
imWas.~liWr
Kapazität
Hodawawrrecullcrulll
imWa.....~lauf
Sicherheit
En~lftruulUn&
imWa....'lCl'iiWf
Volumcn
SdlllTohrt
imWas..'ieI'lauf
VoluJD!ß
- ..
-.
- ..
- .. - ...
Quelle: verändert nach Vaughan 1981
Dazwischen steigt die Qualität, unterschieden nach den Verwendungszwecken Trinkwasser, Schwimmen, Fischen und Bootfahren in fünf Schritten an. (Kneese 1984, S.99) Auf der untersten Stufe 1 eignet sich die Wasserressource nicht einmal mehr, um darauf Bootzufahren. Dies ist erst ab Stufe 2 möglich. Ab Stufe 2 genügt die Wasserqualität auch den Ansprüchen von Nutzfischen, die darin leben und gefangen werden können. Noch besser wird die Qualität ab Stufe 8, auf der man in dem Wasser schwimmen kann. In der besten Stufe 10 schließlich ist Trinkwasserqualität erreicht. Die Definition von Qualitätsstufen nach der Eignung der Ressource für verschiedene Verwendungszwecke kann als geeigneter Qualitätsmaßstab auch für die Wassernutzung zur Pflanzenerzeugung gesehen werden. Dabei erscheint es jedoch nicht unbedingt als notwendig, den einzelnen Qualitätsstufen mehr oder weniger willkürlich einen numerischen Wert zuzuweisen. Sowohl auf der Inputseite als auch auf der Outputseite kann dagegen die Wasserqualität, bezogen auf die Nutzung zur Pflanzenerzeugung, durch Betrach-
v. Zwischenergebnis Kapitel B
79
tung anderer Verwendungszwecke definiert werden. Auf der Inputseite ist festzustellen, für welche weiteren interessierten Nutzer die Qualität des in Gartenbaubetrieben eingesetzten Wassers ebenfalls attraktiv bzw. ausreichend ist. Nach dieser Definition hätte dann beispielsweise Uferfiltrat, das neben der Bewässerung auch zur Trinkwasserversorgung und zur industriellen Produktion dient einen höheren Wert, als Überschußwasser aus einem Überlaufbehälter, das zwar ursprünglich der Trinkwasserversorgung dient, jedoch anstelle eines ungenutzten Versickerns noch der pflanzlichen Erzeugung zugeführt wird. Auf der Outputseite ist nach dieser Definition zu untersuchen, inwieweit das aus einem Unternehmen freigesetzte Wasser andere Nutzungszwecke beeinträchtigt. Seine Qualität würde dabei mit zunehmender Anzahl beeinträchtigter anderer Verwender abnehmen.
V. Zwischenergebnis Kapitel B Zum Abschluß dieses ersten und einleitenden Kapitels sollen die bisher entwickelten Gedanken und Erkenntnisse noch einmal kurz rekapituliert werden. Diese Vorgehensweise findet in den sich anschließenden Kapiteln dann in Form jeweils eines Fazits am Kapitelende ihre Fortsetzung. Landwirtschaft und Gartenbau haben auf der Input-Seite Bedarf für hochwertiges Wasser. Es ist unter Mengen- und Qualitätsaspekten essentiell für die Erzeugung zufriedenstelIender Produktmengen in verkaufsfähigen Qualitäten. Defizite in der Versorgung haben in der Regel irreversible Auswirkungen auf Ertrag und Produktqualität. Im Gegensatz zum Boden besteht jedoch aus einzelbetrieblicher Sicht nicht unbedingt ein Eigeninteresse an einem sparsamen und schonendem Umgang zur langfristigen Sicherung der eigenen Existenzgrundlage. Auf der Output-Seite beeinträchtigt landwirtschaftliche/ gartenbauliehe Leistungserstellung daher Verfügbarkeit und Qualität der natürlichen Ressource unter Umständen erheblich. Durch eine Anzahl konkurrierender Nutzungs- und Verwendungs zwecke wird gerade qualitativ hochwertiges Wasser auch im niederschlagsreichen Mitteleuropa zunehmend knapp. Eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser genießt höchste Priorität. Für die Erzeugung von Pflanzen und Pflanzenteilen ergibt sich dabei unter zweifacher Hinsicht Handlungsbedarf.
80
B. Wasser: Mehr als HzO - ein einzigartiges GUt
Unternehmen mit Pflanzenerzeugung stehen auf der Input-Seite in einem Wettbewerb vor allem um Wasserqualitäten: Eine gegebene Menge der Ressource in der Qualität X eignet sich für mehrere Verwendungszwecke an einem bestimmten Standort. Ein nahegeleger Gartenbaubetrieb kann somit einen anderen benachbarten Gartenbaubetrieb, einen Industriebetrieb oder auch ein Wasserwerk als Konkurrenten um das kostbare Naß haben. Ob der Gartenbaubetrieb auch auf der Output-Seite im Wettbewerb um die natürliche Ressource steht, hängt weitgehend von drei Faktoren ab: (I) der freigesetzten Wassermenge,
(2) der freigesetzten Wasserqualität und (3) von dem Vorhandensein möglicherweise betroffener anderer Wassernutzer. In dieser Situation ist es für das Unternehmen vorteilhaft, geringe Wassermengen in vergleichsweise guter Qualität freizusetzen und wenige oder keine anderen Nutzer zu haben. Bei jeder der beschriebenen Wassernutzungen ist in der Zukunft ein Ansteigen des Bedarfs zu erwarten. Aus dieser zunehmenden qualitativen und quantitativen Knappheit ergibt sich unmittelbar eine weitere Verschärfung des Wettbewerbs um die natürliche Ressource auch in Mitteleuropa. Instrumente und Maßnahmen der Umweltpolitik können drei Auswirkungen auf pflanzenerzeugende Unternehmen haben: (I) Verschärfung des Wettbewerbs um Wasser auf der Input-Seite durch Ver-
knappung der verfügbaren Mengen, (2) Beschränkungen auf der Output-Seite und (3) direkte Beeinflussung von Entscheidungen des Managements betreffend die Wasserverwendung. Für den Fortgang dieser Arbeit ist festzuhalten, daß Wasserpreisveränderungen, Quoten, Steuern, Gebühren und Zuschüsse (für Investitionen in Technologien, die Verunreinigungen vermeiden, wassersparend oder zur Wiederverwendung sind) die wichtigsten Politikansätze für weitere Betrachtungen sind. Als Maßstab zur Beurteilung der Wasserqualität für Unternehmen mit Pflanzenerzeugung sowohl auf der Input- als auch auf der Outputseite finden Art und Anzahl konkurrierender Verwendungszwecke Verwendung.
c. Der Produktionsfaktor Wasser: Sein Einsatz als Entscheidungsproblem unter mehrfachen Zielsetzungen I. Unternehmerische Zielsysteme 1. Der Zielkatalog eines Unternehmens
Wirtschaftliche Leistungserstellung unterliegt komplexen und durchaus unterschiedlichen Zielsetzungen. Mit Wirtschaften als einer Spielart planenden Handelns gewinnen Handlungsziele zentrale Bedeutung als Steuerungsinstrumente des unternehmerischen Geschehens. Die Unternehmensziele sind dabei nach Heinen (1978, S.45) als Vorstellung über den ,,( ... ) zukünftigen Zustand der Unternehmung, der als erstrebenswert angesehen wird, (... )", die eigentliche Bestimmungsgröße des Unternehmensverhaltens. Wesentlich ist dabei die Feststellung, daß Ziele der Beurteilung und Bewertung von Handlungsalternativen dienen. (vgl. Heinen 1966, S.49ff.) Dabei ist zunächst offen, welchen Inhalt diese Unternehmensziele haben (z.B. Sachziele gegenüber Formalzielen), wie hoch der Grad ihrer Präzision ist, in welchem Ausmaß sie angestrebt werden oder auf welchen Zeithorizont sie sich erstrecken. Offen ist ebenfalls, in welchem Umfang die mit Zielsetzungen verbundene Steuerungsabsicht tatsächlich wirkt. (vgl. Raffee 1991, S. 731) Zahlreiche empirische Untersuchungen v.a. zu Industrieunternehmen belegen, daß der Zielkatalog eines Unternehmens in der Realität nicht hinreichend beschrieben ist, wenn man ausschließlich Gewinnorientierung unterstellt (siehe Tabelle 18). Für den Bereich der Landwirtschaft stellte jedoch noch 1991 Knauer fest: "Bei der bisherigen Entwicklung der Landwirtschaft haben ökologische Ziele und Begrenzungen mit dem Ziel einer umweltgerechten Produktion keine Rolle gespielt." (Knauer 1991, S.7) 6 Orth
82
C. Der Produktionsfaktor Wasser
Tabelle 18
Ausgewählte betriebswirtschaftliche Studien unternehmerischer Zielsysteme Quelle
inhaltlicher Schwerpunkt
Kaplan! Dislaml Lanzilotti (1958)
Hintergründe der Preispolitik von US-Firmen
Baumol (1959)
oligopolistische Anbieter
Gutenberg (1959)
Industrieunternehmen
Meffert (1986a)
Integration von Umweltschutzzielen in Planung
Raffee/ Förster/ Krupp (1988)
Integration von Umweltschutzzielen in Planung
Fritz et al. (1988)
Veränderungen im Zeitablauf
Meffertl Kirchgeorg (1989)
Integration von Umweltschut7.zielen in Planung
Meffert (1990)
Rang des Zieles Umweltschutz
Steger (1990)
Ziel beziehungen
Wagner (1990)
schonender Umgang mit natürlicher Umwelt
Langbehn (1991)
schonender Umgang mit natürlicher Umwelt
Schreiner (1991)
schonender Umgang mit natürlicher Umwelt
Umweltbundesamt (1991)
schonender Umgang mit natürlicher Umwelt
Raffce (1991)
Branchenabhängigkeit, Mehrdimensionalität
Raffee/ Förster/ Fritz (1992)
Umweltschutz
v. Rosenstiel (1992)
Ziele neben Gewinnorientierung
Schmitt (1996)
Zusammenarbeit Umweltschutzorganisationen
Quelle: eigene Zusammenstellung
Dies liegt sicherlich mit daran, daß die Berücksichtigung bisher vernachlässigter ökologischer Belange im unternehmerischen Zielsystem zwangsläufig mit der Einengung des Spielraums für die Organisation der Produktion nach technischökonomischen Gesichtspunkten verbunden ist (vgl. Weinschenkl Gebhard 1985, S.32). Was die Miteinbeziehung der natürlichen Umwelt in Unternehmensziele der Pflanzenproduktion betrifft, bleiben die bisher vorliegenden Arbeiten beinahe ausnahmslos auf der Ebene eindimensionaler Zielsysteme stehen (siehe auch die Studien in Tabelle 19). Entsprechende Modelle versuchen entweder den Ertrag zu
I. Unternehmerische Zielsysteme
83
maximieren (z.B. Lambertl Doty/ Quisenberry 1981) oder den Gewinn (z.B. Boggess/ Jones/ Swaney/ Lynne 1981; siehe auch die im Abschnitt B. 11. 5. vorgestellten Untersuchungen). Tabelle 19
Ausgewählte agrarökonomische Studien unternehmerischer Zielsysteme Quelle Gasson (1973) Hinken (1974) Wheelerl Russell (1977) Harperl Eastman (1980) Flinnl Jayasuriyal Knight (1980) HaITisl Mapp (1980) Schoneyl Massiel May (1981)
Hammondl CampbelV Threadgill (1981) Rhoadesl Corwinl Haffman (1981)
inhaltlicher Schwerpunkt Beweggründe zur Landwirtschaft Ziele von Gartenbauunternehmen Ziele pflanzenerzeugender Unternehmen Zielhierarchie landwirtschaftlicher Familienbetriebe Zielsystem landwirtschaftlicher Familienunternehmen Gewinnmaximierung mit Wassermengenrestriktion Ertragsmaximierung und Wasserverbrauchsminimierung Maximierung Evapotranspiration und Wasserverbrauchsminimierung Wasserbewahrung ohne Ertragsverluste
Quelle: eigene Zusammenstellung
Die gefundenen Ziele stehen in drei Beziehungstypen miteinander in Verbindung: indifferent, komplementär und konkurrierend (vgl. Heinen 1966, S.94ff.). Während man zunächst davon ausging, daß ökonomische und ökologische Ziele miteinander konkurrieren, setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, daß teilweise sogar Komplementaritätsbeziehungen bestehen. Diese Erkenntnis hat wesentlich zur Etablierung des Umweltschutzes im Ziel system der Unternehmen beigetragen und ist in Abschnitt C. I. 3. ausführlicher beschrieben. Es ist bekannt, daß auch die Mehrzahl der pflanzenerzeugenden Unternehmen nicht ausschließlich dem klassischen Ziel der Gewinnmaximierung folgt. (vgl. z.B. Gasson 1973, Harper/ Eastman 1980 oder auch Hinken 1974) Dies gilt besonders für Unternehmen aus Landwirtschaft und Gartenbau, die zur Erzeugung von Pflanzen und Pflanzenteilen auf natürliche Ressourcen (Wasser, Boden) in ausreichender Qualität und Menge angewiesen sind. (vgl. Keeler 1991)
6'
84
C. Der Produktionsfaktor Wasser
Folgerichtig messen Gärtner und Landwirte dem Schutz der natürlichen Umwelt mit den Kompartimenten Wasser, Boden, Luft und umgebende Biosphäre einen vergleichsweise hohen Stellenwert zu (siehe Tabelle 20). Auf dem vierten Platz rangiert dieses Unternehmensziel zwar nach traditionellen Zielen wie langfristiger Gewinnerzielung, Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterzufriedenheit, jedoch noch vor Kostenreduzierung, Marktanteil und Image. Obwohl diese Ergebnisse erst noch in umfangreicheren Untersuchungen zu bestätigen sind, geben sie die Richtung der zu erwartenden Aussagen an. Begründen läßt sich die hohe Wertschätzung mit der vorstehend bereits beschriebenen Erkenntnis, daß eine hohe Qualität vor allem der Kompartimente Wasser und Boden eine wesentliche Voraussetzung für die Erzeugung von Pflanzen ist. Tabelle 20 Stellung des Umweltschutzes im Zielsystem bayerischer Zierpflanzenbaubetriebe (n=19, Expertenbefragung)
Rang
Ziel
I
langfristige Gewinnerzielung
2
Kundenzufriedenheit
3
Mitarbeiterzufriedenheit
4
Schutz der natürlichen Umwelt 4.1
5
Wasser
4.2
Boden
4.3
Luft
4.4
Biosphäre
Kostenreduzierung
6
Marktanteil
7
Image
...
...
13
Freizeit
Quelle: Zuckschwerdtl Orth 1996. S.7
Verläßt man für einen Moment den Standpunkt des Unternehmers und wendet sich den Konsumenten zu, so zeigt sich als Ergebnis einer Vielzahl von Studien, daß auch die Abnehmer gartenbaulicher Produkte Wert auf eine umweltschonende Erzeugung legen. Dies gilt mittlerweile auch für Produkte, die nicht der Ernäh-
85
I. Unternehmerische Zielsysteme
rung dienen, wie z.B. Zierpflanzen. Ergebnisse einer relativ umfangreichen Befragung von Passanten und Kunden einer direktabsetzenden Zierpflanzengärtnerei belegen, daß die Auskunftspersonen, zumindest im untersuchten Fall, umweltschonende Erzeugung neben Merkmalen wie Preis-Qualitäts-Verhältnis oder Service & Beratung als Auswahlkriterium bei der Wahl ihrer Einkaufsstätte heranziehen (Abbildung 20).
~ 5 'fi 'i
-y--------
i
-t--------..,..~-
.. 11
4
- ------
III
-!'fi 3 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j 'i
:=.!::!
i
.=
2+-----------
-+-Stammkunden ---Kunden -.. 'Passanten
i:= 1 + - - - - - , - - - - - - - , - - - - - - - - r - - - - - - - , - - - - - , - - - - - - - - - - 1
-..
... ]
:;
.c
~
,
f2 und
J: ~ Q
wobei z (die abhängige Variable, gewöhnlich definiert als Direktkostenfreie Leistung) ein Skalarprodukt von ~ und ~ ist. ~ ist ein Vektor von Entscheidungsvariablen wie z.B. anzubauende Salatfläche und ~ ist ein Vektor, der den Beitrag dieser Variablen zur Zielfunktion beschreibt. Der Vektor 12 repräsentiert physikalische, institutionelle und persönliche Beschränkungen, welche die Umwelt der zu treffenden Entscheidung definieren. A hingegen stellt die technischen Zusammenhänge zwischen den Variablen und den Beschränkungen dar. Für eine weitaus ausführlichere Erläuterung grundsätzlicher Aspekte und Annahmen der Linearen Programmierung wie Proportionalität, Addier- und Teilbarkeit siehe z.B. Paris (1991, S.25). Christensen! Morlen! Heady untersuchten 1981 mögliche Auswirkungen einer Wasserpreiserhöhung auf die US-amerikanische Landwirtschaft. Ihr Modell minimiert hierzu die Kosten der Produktion bei vorgegebenen Produktionsumfang und Faktorverfügbarkeit. Die Autoren unterscheiden zwischen dem Preis für Grund- und Oberflächen wasser und sagen Anpassungsstrategien des Agrarsektors auf nationalem und regionalem Niveau voraus. 1982 stellten Yaron/ Dinar einen systemanalytischen Ansatz vor, der die Allokation knapper Wasserressourcen auf verschiedene Kulturen in Spitzen bedarfszeiten untersuchte. Basis hierfür waren kulturspezifische Reaktionsfunktionen auf wechselnde Bodenfeuchtigkeit. Das Modell enthält zunächst einen LPTeil, der auf die Maximierung des Einkommens der Landwirte abzielt. Zusätzlich ist ein dynamischer Programmierungsansatz integriert, der auf den Schattenpreisen als Ergebnis der LP-Lösungen aufbaut und als Reaktion darauf neue Bewässerungspläne generiert. Yaron und Bresler veröffentlichten 1983 eine ökonomische Analyse der Bewässerung in landwirtschaftlichen Unternehmen, die auf kulturspezifischen Funktionen aufbaute. Die Autoren entwickelten für eine Feldfrucht eine Produktionsfunktion und integrierten diese Funktion in Planungen des Erzeugungsprogrammes und der Bewässerung. Ziel der Untersuchung war es, mittels kombinierter Betrachtung zweier Subsysteme (zum einen Bodenfeuchte als bewässerungsrelevante Variable und zum anderen Bodenfeuchte, klimatische Bedingungen und Pflanzenertrag) Entscheidungsregeln zur Bewässerungsplanung für einzelne Kulturen und gesamte Betriebe zu gewinnen.
158
C. Der Produktionsfaktor Wasser
Ein LP-Modell zur Auswahl der Anbauflächen verschiedener Kulturen, der Bewässerungsintensität und dem entsprechenden Bewässerungssystem mit der Ziel funktion Gewinnmaximierung wurde 1983 von Jones vorgestellt. Im Rahmen einer gesamtbetrieblichen Analyse suchen Finck/ Haase (1987) nach kostenminimalen Anpassungsmöglichkeiten an eine geforderte Grundwasserqualität ebenfalls mit der Ziel funktion Gewinnmaximierung. 1992 unterzogen Taylor, Adams und Miller ökonomische Anreizinstrumente und andere Mechanismen zur Vermeidung landwirtschaftlicher Wasserbelastungen einer näheren Betrachtung. Sie verwendeten biophysikalische Simulationen zur Abschätzung der technischen Zusammenhänge und verbanden diese mit LPModellen. Am Beispiel repräsentativ ausgewählter Betriebe in der WillametteRegion Oregons betrachteten sie als Output optimale (gewinnmaximierende) Anbauprogramme und damit zusammenhängende Umweltbelastungen unter alternativen Wasserschutzstrategien. Unterschiede in Gewinn, Anbauprogramm und Wasserbelastung zwischen unbeschränkten (nicht regulierten) Betrieben in der Ausgangssituation und Betrieben mit Auflagen dienten als Maßstab zur Beurteilung der Effektivität unterschiedlicher Schutzmaßnahmen und der von den Unternehmen hierfür zu tragenden Kosten (Gewinnreduzierung). 1994 untersuchte Salman die Auswirkungen einer effizienteren Wassernutzung auf verschiedene Betriebstypen im Jordantal. Mit einem LP-Modell kommt er zu dem Schluß, daß der Obst- und Zitronenfruchtanbau sowie der Freilandgemüsebau bei steigendem Wasserpreis durch Gewächshauskulturen abgelöst wird, da diese eine vergleichsweise höhere Wasserproduktivität aufweisen. Bereits eine Studie von Boggess et al. (1980, S.107f.) illustriert einen mehrfaktoriellen Ansatz zur Entscheidungsunterstützung bezogen auf Wasser- und Bodenressourcen. Diese Untersuchung variiert die relativen Gewichte einzelner Komponenten der Zielfunktion und verbindet diese Gewichtung mit den umweltbezogenen Auswirkungen einer Sedimentfracht des Wassers. Als Ergebnis liegen Quantifizierungen der Wechselwirkungen zwischen Umweltschäden durch Sediment auf der einen Seite und produktionskostenbezogenen Unternehmenszielen auf der anderen Seite vor. Daraus werden dann die Grenzkosten einer Sediment-Kontroll-Strategie abgeleitet.
v. Wassernutzung unter mehrfachen Zielsetzungen
159
Die Wahl eines LP-Ansatz mit multiplen Zielsetzungen begründeten die Autoren mit folgenden Eigenschaften: (I) Realisierbarkeit und Effizienz der Berechnung, (2) explizite Quantifizierung der Grenzaustauschraten zwischen Zielen und (3) Gewinnung hinreichend genauer Informationen zur verbesserten Entscheidungsfindung. Zur Feststellung der Auswirkung einer Integration von Aspekten der Umweltqualität in das unternehmerische Zielsystem wurden in der Ausgangssituation das Anbauprogramm (Output) beibehalten und versucht, die gewichtete Summe der Produktionskosten und der Sedimentverluste zu minimieren. Die gewonnenen Ergebnisse stellen Optionen für den Landwirt dar, Bodenverluste unter Beibehaltung seines Erzeugungsumfanges zu reduzieren. Zusätzlich verdeutlichen die Ergebnisse die relativen Kosten verschiedener Intensitätsstufen zur Reduzierung von Sedimenteinträgen. Aus Anwendung und Ergebnissen des Modells ziehen die Autoren den Schluß "Multiple goal analysis can provide decision makers with information concerning the tradeoffs among alternative goals and concerning the sensitivity of results." (Boggess et al. 1980, S.112) Aus dem Rahmen fällt das Modell von Betge (1991). Es beinhaltet ökonomische und technische Eigenschaften von Produktionsanlagen und dient der Quantifizierung externer Effekte unter Einbeziehung rationaler Verhaltensweisen privatwirtschaftlich operierender Technologieanwender mit Hilfe mathematischer Optimierungsmodelle. Zu weiteren grundsätzlichen Schwächen und Problemen dieser Methode wie der Linearitätsforderung, Unabhängigkeit der Aktivitäten, Teilbarkeit der Faktoren, etc. siehe Scholzl Baersch (1978, S.82ff.) c) Dynamische Programmierung
Mehrere Autoren formulieren Zielfunktionen zur Maximierung des Ertrags pro Flächeneinheit unter Bedingungen der Wasserknappheit. Zur Lösung dieser Probleme verwenden sie Techniken der Dynamischen Programmierung, mit folgender mathematischer Grundform (vgl. Jensenl Howell 1975):
160
C. Der Produktionsfaktor Wasser
Max (Y / Yo)
n
rr
;=1
A
(ET / ETo)/
wobei y
=
Ertrag (kg/ ha) Ertrag (kg/ ha) ohne Wasser als begrenzenden Wachstumsfaktor
ET =
Evapotranspiration (mm) Evaporation ohne Wasser als begrenzenden Wachstumsfaktor Empfindlichkeit des Ertrags gegenüber Wasserdefiziten während des Entwicklungsstadiums i, und
II
=
Anzahl der betrachteten Wachstumsperioden
Nach entsprechenden Umformulierungen enthält diese Gleichung als Zielvariable eine Maximierung des Netto-Gewinnes: n
Max Pnet
[V Yo
TI
;=1
n
(ET / ET/ i
-
L eil) ;=1
wobei Nettogewinn (DM/ ha)
v =
Wert einer Einheit Kulturertrag (DM/ kg) Kosten einer zum Entwicklungsstadium i applizierten Wassereinheit (DM/ mm ha), und zum Entwicklungsstadium i applizierte Wassermenge (mrn! ha)
Weitere Charakteristika von Problemen Dynamischer Programmierung sind beschrieben von Jones (1983, S.512). Die gemeinsame Vorgehensweise ist jedoch, daß komplexere Gesamtprobleme in Teilschritte zerlegt werden und jeder weitere Schritt bereits Teilentscheidungen erfordert. Solche Teilentscheidungen verändern den Systemzustand allmählich und verändern den Wert, den eine Zielfunktion zu einem bestimmten Zeitpunkt im Problemlösungsprozeß annimmt.
v. Wassernutzung unter mehrfachen Zielsetzungen
161
An einem bestimmten Entscheidungsschritt hängt die optimale Vorgehensweise für alle verbleibenden Schritte nur vom gegenwärtigen Zustand des Systems ab, unabhängig von allen in vorangegangenen Schritten getroffenen Entscheidungen. Antle und Hatchett entwickelten 1986 eine ökonometrische Methode zur Schätzung Dynamischer Programmierungs modelle mit sequentiellen intermediären Input-Entscheidungen. Ihre Erkenntnisse demonstrieren die Anwendbarkeit solcher Modelle für kulturspezifische Entscheidungen auf Ebene ganzer Betriebe. Entscheidender Nachteil solcher Ansätze ist, daß die für entsprechend komplizierte Modelle erforderlichen detaillierten Produktionsdaten oft nicht existieren oder eine Gewinnung mit hohen Kosten verbunden ist. In den Jahren 1991 und 1993 integrierten Antlel CapaIbo physikalische und ökonomische Modelle und entwickelten damit Beurteilungsmaßstäbe zur Abschätzung der Umweltwirkungen des Einsatzes von Agrochemikalien. Ihr Hauptaugenmerk lag auf ökonomischen Modellen mit dem Ziel einer Gewinnmaximierung als Ausgangspunkt sowie langfristigen dynamischen Investitionsmodellen. Als wichtigste Erkenntnis fanden beide Autoren, daß Kosten-Nutzen-Analysen die besten Voraussetzungen zur Entwicklung eines Ansatzes bieten, der sowohl die hochgradig disaggregierte Ressourcennutzung in Unternehmen, als auch eine höher aggregierte Ebene des Einsatzes umweltpolitischer Instrumente ermöglicht. 1993 schließlich stellten Bryant/ Mjeldel Lacewell eine gemeinsame Methode zur Ableitung von Entscheidungsregeln über eine optimale Allokation von Beregnungswasser auf konkurrierende Kulturen vor. Ihr Modell geht von einer über die Saison grundsätzlich ausreichenden Wasserversorgung aus, wobei es jedoch in Zeiten des Spitzenbedarfs zu Versorgungsengpässen kommt. In solchen Fällen erhält diejenige Kultur zuerst Wasser, die daraus den höchsten Produktionsgrenzwert erzielt.
d) Goal Programming (GP)
Ungeachtet seiner vergleichsweise weiten Verbreitung in der Agrarökonomie leidet die Lineare Programmierung unter mehreren Unzulänglichkeiten. Dazu zählen die Annahme zugrundeliegender ausschließlich linearer Zusammenhänge, einzelner Erwartungswerte für verschiedene Parameter und die Berücksichtigung nur eines Kriteriums bei der Auswahl von Handlungsalternativen. 110rth
162
C. Der Produktionsfaktor Wasser
Beachtliche Fortschritte wurden bei Bemühungen erzielt, die Schwierigkeiten aufgrund der Linearität und - in geringerem Maße - auch das Problem einzelner Erwartungswerte zu überwinden. (vgl. Romero/ Rehman 1984, S.178) Häufig ist ein Entscheidungsträger daran interessiert, in bezug auf eine Reihe von Kriterien, von denen einige miteinander konkurrieren können, einen optimalen Kompromiß zu finden, als nur ein einzelnes Kriterium zu optimieren. Hinzu kommt, daß in der Realität die Verfügbarkeit einzelner Ressourcen nicht so rigide beschränkt ist, daß dies eine Behandlung als Restriktionen gerechtfertigen würde, die niemals und unter keinen Umständen verletzt werden dürfen, so wie dies in der konventionellen LP der Fall ist. Der Bedarf, eine Balance zwischen mehrfachen Zielsetzungen in der Theorie der Unternehmung zu finden, ist mittlerweile fest etabliert. (vgl. Abschnitt C. 1.) In der Betriebswirtschaftslehre wurde hierzu eine Reihe von Ansätzen entwickelt, um mit dem Problem einer Entscheidungsfindung unter Berücksichtigung mehrfacher (multipler) Zielsetzungen umzugehen. (vgl. Abschnitt C. 11. 5. oder auch Han-Lin 1986) Goal Programming (GP) hat dabei einen breiten Anwendungsbereich gefunden. Anwendungen bezogen aufPlanungsanstrengungen für Unternehmen aus Gartenbau und Landwirtschaft sind darunter jedoch bisher selten zu finden. (Eine Ausnahme stellt die Arbeit von Barnettl Blake/ McCarl 1982 dar.) Es existieren zwei Ansätze mathematischer Programmierung, die für eine Lösung von Entscheidungsproblemen unter mehrfachen Zielsetzungen grundsätzlich geeignet sind: Multiobjective Programming (MOP) und Goal Programming (GP). Eine kurze Unterscheidung zwischen beiden Methoden erscheint an dieser Stelle angebracht. MOP geht von mehreren Zielen aus, die von einer Anzahl Restriktionen (gewöhnlich linear) begrenzt werden und versucht eine Anzahl nicht-dominierter Lösungen anstatt nach einem Optimum zu suchen. Elemente solcher nicht-dominierten Lösungen sind realisierbare Lösungen, die dadurch charakterisiert sind, daß es keine anderen realisierbaren Lösungen gibt, die bezogen auf die relevanten Ziele mindestens gleich gute Ergebnisse und eine bessere Lösung in bezug auf mindestens ein Ziel aufweisen. (Romero/ Rehman 1984, S.180) Die Schwierigkeiten bei der Bestimmung einer optimalen Lösung aus allen nicht-dominierten Alternativen beschreiben die beiden Wissenschaftler ein Jahr später wie folgt:
V. Wassernutzung unter mehrfachen Zielsetzungen
163
"Multiobjective, or goal programming is an optimization theory incorporating multiple objective functions. MOP techniques tackle simultaneous optimisation of several objectives subject to a set of constraints, usually linear. As an optimum solution cannot be defined for several simultaneous objectives, MOP seeks the set containing efficient (nondominated or Pareto optimal) solutions rather than locate the single optimum solution." (Romero/ Rehman 1985, S.I72) MOP beinhaltet grundsätzlich eine zusammengesetzte Zielfunktion. Ausgangsgedanke ist eine Minimierung der Abweichungen von festgelegten Zielerreichungsniveaus. Die zusammengesetzte Zielfunktion wird in der Regel nach einer der beiden folgenden Vorgehensweisen festgestellt: (1) Die Befriedigung der Ziele geschieht in einer festgelegten Reihenfolge: erst Ziel A, dann Ziel B, dann Ziel C - eine Ordnung nach lexikografischem Nutzen, oder (2) Einzelne Zielbefriedigungen können ausgetauscht werden indem man entsprechende Abweichungen von den Zielerreichungsniveaus vergleichend gewichtet - ein Ansatz über Indifferenzen des Entscheidungsträgers. Beide Vorgehensweisen unterscheiden sich auch darin, daß der lexikografische Ansatz einen modifizierten Simplex-Code erfordert, während der Indifferenzkurvenansatz vom traditionellen Simplex-Algorithmus Gebrauch macht. Abweichungsvariablen messen auftretende Abweichungen von den Ziel größen. Ein Ziel kann in der Folge nicht zugleich über- und untererfüllt sein. Folglich ist mindestens eine dieser Abweichungsvariablen jedes Zieles gleich Null. Wird eine Zielgröße exakt erreicht, sind beide, positive und negative Abweichungsvariable gleich Null. Diese Methode ist für die vorliegende Problemstellung aus mehreren Gründen abzulehnen. Dies gründet sich - wie für alle Modelle der mathematischen Programmierung - zunächst auf die Forderung, alle Ziele numerisch abbilden zu können. Eine weitere Schwäche liegt in der Zusammensetzung der Zielfunktion, die erheblich Anforderungen an das Urteilsvermögen des Entscheiders stellt (zur weiteren Beurteilung der einzelnen Ansätze siehe auch Abschnitt C. V. 2. a». Ein wesentlicher Fortschritt in der Entscheidungstheorie mehrfacher Zielsetzung gelang mit der Entwicklung des Goal Programming (GP) durch Charnes und Cooper 1961. Danach trugen Ijiri (1965), Lee (1972) und Ignizio (1976) wesentlich zur Weiterentwicklung dieser Methode bei, deren Grundgedanke es ist, Abweichungen zwischen angestrebten und tatsächlich erreichten Zielen zu 11"
164
C. Der Produktionsfaktor Wasser
minimieren: "The aim of GP is to minimise the deviations between the achievement of the goals and their aspiration levels" (Romero/ Rehman 1984, S.181) Ziele werden in die Modelle durch die Umformung von Ungleichungen und die Addition positiver und negativer Abweichungsvariablen eingearbeitet, die eine Nicht-bzw. Übererfüllung jeden Zieles ausdrücken. Der Minimierungsprozeß geschieht über die Einführung von unterschiedlichen Ziel gewichten in der Regel durch den Entscheidungsträger. Je nach Zeitpunkt der Zielgewichtung im Ablauf des Prozesses unterscheidet man Lexikografische Programmierung (LGP) und Gewichtete Programmierung (WGP). Auch die Lexikografische Programmierung wurde 1961 von Charnes und Cooper eingeführt. Diese Methode setzt voraus, daß ein Entscheidungsträger explizit alle für eine bestimmte Planungssituation relevanten Ziele definieren kann. Außerdem wird angenommen, daß er diesen Zielen Prioritäten zuordnen kann und zwar vor Beginn des Minimierungsprozesses. Anders ausgedrückt, die Erfüllung von Zielen mit einer spezifischen Priorität Qi wird der Erfüllung aller anderen Ziele der niedrigeren Priorität Qj vorgezogen. In der LPG werden also Ziele höherer Priorität zuerst erfüllt. Erst danach kommt eine Erfüllung niedriger Zielprioritäten in Betracht. Diese lexikografischen Ordnung verleiht dem Ansatz seinen Namen. 1980 bezogen Flinnl Jayasuriya/ Knight mehrfache Zielsetzungen kleiner und mittelständischer Landwirte in Planungs modelle mit ein und verwendeten zur Lösung ein LGP-Modell. Ziele, Rangfolgen der Ziele und Zielerreichungsgrade basierten dabei auf den Ergebnissen von Befragungen. Sie bestätigten die grundsätzliche Eignung dieses Ansatzes zur Identifizierung von Zielen, Zielprioritäten und Grenzaustauschraten. Zusätzlich betonten sie jedoch die Notwendigkeit, nicht nur Ober- sondern auch genauer spezifizierte Unterziele für Planungszwecke miteinzubeziehen. Auch der LGP-Ansatz ist jedoch nicht frei von Schwächen. Romero/ Rehman räumen ein ,,( ... ) some of the assumptions on which LGP is based and is other methodological weaknesses can produce misleading results." (Romero/ Rehman 1985, S.180). Methodische Nachteile sind vor allem: ( 1) unendlich hohe Austauschraten zwischen Zielen unterschiedlicher Priorität, (2) Anfälligkeit für die Erzeugung nicht-effizienter optimaler Lösungen und (3) theoretische Vieldeutigkeit, was nun genau das LPG-Modell optimiert.
V. Wassernutzung unter mehrfachen Zielsetzungen
165
(4) An diese Liste läßt sich der Fallstrick naiver Bevorzugung einzelner Ziele noch anfügen. Die Methode der gewichteten Zielprogrammierung (WGP) betrachtet alle Ziele gleichzeitig in einer zusammengesetzten Zielfunktion, welche die Summe aller Abweichungen zwischen Zielgrößen und deren Erreichung minimiert. Dazu werden die Abweichungen ja nach ihrer relativen Bedeutung für den Entscheidungsträger gewichtet. Eine numerische Spezifikation von LP-Problemen gestaltet sich oft schwierig. Hinzu kommt, daß MOP-Modelle zusätzliche Parameter, Zielgewichte und andere Vorgaben benötigen. Idealerweise sollten diese vom Entscheidungsträger bereitgestellt werden, aber die Spezifizierung ihrer Werte kann kompliziert werden. (vgl. Barnettl Blake! McCarl 1982, S.721) Kurz gesagt besteht das Problem darin, erstens Zielgewichte und zweitens Zielgrößen überhaupt und ihre Messung zu bestimmen. Zeleny stellte im gleichen Jahr noch eine weitere Technik zur Entscheidungsfindung bei mehrfachen Zielsetzungen vor, Multigoal Programming (MGP) genannt. Er entwickelte dabei die Idee der "Zufriedenstellung" und die Grundidee einer Suche nach effizienten Lösungen aus dem MOP-Ansatz weiter. MGP arbeitet nach einer Minimierung der Abweichungsvariablen wie in der Vektoroptimierung, jedoch nicht in einer lexikografischen Reihenfolge. (vgl. z.B. Yakomitz 1995) Da es keine grundsätzlich neuen Gesichtspunkte enthält, wird auf eine nähere Beschreibung an dieser Stelle verzichtet. Wegen des thematischen Bezuges ist noch die Untersuchung von McGregor! Dent (1993) zu erwähnen, die Konflikte um begrenzt verfügbare Wasserressourcen mit einer MOP-Methode zu lösen versucht. Den Hauptnutzen der Methode sehen die Autoren dabei in der Möglichkeit, Trade-offs zwischen den Alternativen zu identifizieren (S.365). e) Compromise Programming (CP)
In den weiteren Ausführungen wird der Begriff "Kompromiß" in Anlehnung an Zeleny (1982, S.3l5) definiert als "eine Anstrengung, sich einer idealen Lösung möglichst weit anzunähern". (im Original: "Compromise programming is (... ) an effort to approach or emulate the ideal solution as ciosely as possible.")
166
C. Der Produktionsfaktor Wasser
Diese Methode hat zum Ziel, aus einer Anzahl effizienter Lösungen die optimale Lösung herauszufinden. Sie beginnt damit, einen Idealpunkt festzustellen, dessen Koordinaten durch optimale Werte der verschiedenen vom Entscheidungsträger vorgegebenen Ziele bestimmt sind. In der Regel ist dieser Idealpunkt nicht realisierbar; ist er es doch, enthält das verwendete Zielsystem keine konkurrierenden Elemente. Ist der Idealpunkt nicht realisierbar, stellt die optimale oder Kompromißlösungjene effiziente Lösung dar, die dem Idealpunkt am nächsten liegt. Je nach verwendetem Entfernungsmaßstab läßt sich so in der Theorie eine Anzahl kompromißfähiger Lösungen identifizieren. CP unterscheidet sich somit von GP-Ansätzen in mehrfacher Hinsicht. Besonders hervorzuheben ist, daß CP seine Ziele intern durch Berechnungen ermittelt und keine vorher abzufragenden Gewichte benötigt. Außerdem bezieht es eine große Vielzahl von Entfernungsfunktionen für diese Ziele in die Lösungsansätze mit ein. Eine jüngere Anwendung der Methode zum Management von Wasser-Reservoirs geht auf Opricovic (1993) zurück. Dieser bleibt dabei jedoch weitgehend auf der ingenieur-technischen Ebene stehen und schließt Fragen der Akzeptanz durch bzw. Zufriedenheit des Entscheidungsträgers aus. f) Interaktive Entscheidungsansätze bei mehrfachen ZieLsetzungen (IMCDM)
Interaktive und iterative Methoden zur eine fortschreitende Artikulation von Präferenzinformationen haben in der angewandten Entscheidungstheorie zunehmende Aufmerksamkeit gefunden. Sogenannte IMCDM-Methoden implizieren eine schrittweise fortschreitende Definition der Präferenzen eines Entscheidungsträgers durch Interaktion zwischen ihm und dem Modell. Diese Interaktion nimmt die Form eines Dialogs an, in dem das Modell auf zunächst vorgegebene Präferenzen oder Austauschraten des Entscheidungsträgers antwortet und nach einer Prüfung dieser Antwort wieder einen neuen Präferenzsatz anbietet usw. Demzufolge schreitet der Prozeß in einer interaktiven und iterativen Weise fort bis der Entscheidungsträger eine zufriedenstellende Lösung gefunden hat. Dieser interaktive Ansatz kann sowohl auf Entscheidungsprobleme angewandt werden, die multiple Ziele beinhalten, als
V. Wassernutzung unter mehrfachen Zielsetzungen
167
auch auf solche mit multiplen Zielgrößen. Im erstgenannten Fall versucht die Interaktion, eine Optimallösung (den besten Komprorniß) zu finden, wenn der Entscheider seine relativen Präferenzen bezogen auf die ihm präsentierten effizienten Lösungen angibt. In einer ähnlichen Weise versucht die zweite Variante, dem Entscheider die Werte wichtiger Parameter eines GP-Modells (wie z.B. Zielgrößen, Gewichte, Rangfolgen, etc.) zu entlocken indem sie über wiederholte Simulationsläufe eine Interaktion aufbaut. (vgl. Romero/ Rehman 1989, S.107) Eine interessante Beispielsanwendung interaktiver Methoden auf Planungsprobleme landwirtschaftlicher Unternehmen stellt die Arbeit von Pease (1986) dar. Er entwickelte eine PC-gestützte Entscheidungshilfe mit den bei den Zielen "höchstmöglicher erwarteter Nettoertrag" und "niedrigstmöglicher Risikomix der Erzeugungsverfahren". In einer jüngeren Anwendung entwickelten und verwendeten Kobrich und Rehman (1995) ein CP-Modell. Es berücksichtigt sowohl privatwirtschaftliche Kriterien, als auch öffentliche Aspekte wie ökonomische Durchführbarkeit, ökologische Verträglichkeit und soziale Akzeptanz der Landwirtschaft in Chile. Auch Berbell Gallego/ Sagues (1991) lösen ein mehrfaktorielles Entscheidungsproblem (Profit- und Marktziele) mit dieser Methode. Ihre Schlußfolgerung besagt, daß die implementierte Technik einfach, flexibel und leistungsfähig ist, wenn man lediglich zwei Ziele betrachtet. g) Parametrische Programmierung
Pararnetrische Programmierung nimmt im Vergleich zu den bisher vorgestellten Methoden eine Sonderstellung ein. Sie läßt sich als konsequente Fortführung der Analyse suboptimaler Lösungen auffassen und ermittelt die Auswirkungen einer schrittweisen Veränderung von Modellparametern auf eine optimale Lösung. (vgl. Scholz! Baersch 1978, S.66ff.; Taha 1992, S.167 und Paris 1991, S.180) Wie bei verwandten Sensitivitätsanalysen sind die folgenden Typen von Parametervariationen denkbar: (1) Variation von Ziel größen C, (2) Variation von Inputgrößen w, (3) Variation von Restriktionen gU) sowie (4) gleichzeitige Veränderungen mehrerer Parametertypen.
168
C. Der Produktionsfaktor Wasser
In der ursprünglichen Form untersucht die Parametrische Programmierung Parameter, die eine Variation der Zielgrößen erlauben, z.B. t. Der erste Schritt ist die Ermittlung einer optimalen Lösung bei t = O. Dem folgt unter Heranziehung von Optimalitäts- und Durchführbarkeitsbedingungen die Feststellung des Bereiches von t, in dem die Lösung für t = 0 optimal bleibt, z.B. (0, t)). Das bedeutet, daß jede Parametervariation von t über t) hinaus eine nicht zulässige oder suboptimale Lösung generiert. Anschließend folgt die Ermittlung einer neuen Lösung für t = t), die optimal und zulässig bleibt im Bereich von t = t ) bis t = t l wobei t2 > t). Danach wiederholt sich der Prozeß für t = t2 und wieder eine neue Lösung und so fort, bis auf der Skala von t ein Punkt erreicht ist, nach dem keine zulässige oder optimale Lösung mehr gefunden wird. Dort endet die Parametrische Optimierung. Ausgangspunkt für jede Entscheidungsvorbereitung ist eme Analyse der Entscheidungssituation. Betrachtet man die Wassernutzung in Unternehmen, die Pflanzen erzeugen, sollte die Anwendung gleich welcher Art von Entscheidungsunterstützungstechnik dazu beitragen, Wege zu finden, die Ausgangssituation zu verbessern und darüber hinaus gegebenenfalls noch zu bestimmen, wie eine optimale Lösung möglicherweise aussieht. Veränderungen in bezug auf das unternehmerische Ziel system beeinflussen in der Regel die Optimalität bisheriger Lösungen. Dies ist dann der Fall, wenn Ziel kriterien C ihre Bedeutung verändern, neue Kriterien hinzukommen oder traditionelle Kriterien an Bedeutung verlieren. C(t) stellt dann einen parametrisierten Ziel vektor als Funktion der Zeit dar. Neue und zufriedenstellendere Lösungen lassen sich durch schrittweise Veränderungen einer oder mehrerer Entscheidungsvariablen ermitteln, also durch Parametrische Programmierung. Ein weiterer Anwendungsbereich ergibt sich aus der Möglichkeit, eine veränderte Verfügbarkeit von Inputgrößen zu modellieren. Im Kontext dieser Arbeit ist dies besonders für zunehmende Wasserknappheit und Kapitalverfügbarkeit interessant. Repräsentiert w(t) den parametrisierten Inputvektor der rechten Seite als Funktion von t, beeinträchtigen Veränderungen dieses Vektors w die Zulässigkeit von Lösungen. Ähnliches wie für die Faktoren Wasser und Kapital gilt für den Faktor Arbeit. Letztendlich zielt die vorliegende Arbeit darauf ab, ein Entscheidungsunterstützungssystem zu entwickeln, das es den Entscheidungsträgern erlaubt. Optio-
V. Wassernutzung unter mehrfachen Zielsetzungen
169
nen zu identifizieren und zu evaluieren, die sich bei veränderten Zielgrößen, Inputfaktoren oder Restriktionen ergeben. Unterstellt man, daß g(j) der Vektor in der optimalen Lösung bei t = 0 ist, der die Restriktionen abbildet, so beeinflussen Veränderungen dieses Vektors die Optimalität der Lösung. Unter diesen Gesichtspunkten bietet sich die Vorgehensweise einer Parametrischen Optimierung als ein Baustein für eine Lösung der vorliegenden Problemstellung an. Ihre grundSätzliche Vorgehensweise wird daher in Kapitel E., Abschnitt IV. 4. aufgegriffen und weiterverfolgt.
2. Grundzüge einer problemadäquaten Entscheidungstechnik a) Beurteilung der vorgestellten Ansätze Nach der Vorstellung und Beschreibung verschiedener Techniken und Methoden mehrfaktorieller Entscheidungstheorie sollen individuelle Vor- und Nachteile abschließend noch einmal kurz im Licht verschiedener Kriterien dargestellt werden, die für die eigene Arbeit wichtig erscheinen. Dies geschieht unter Berücksichtigung der jeweils bei der Methodenvorstellung aufgeführten Quellen sowie mit der Veröffentlichung von Romerol Rehman (1989, S.103ff.) als Leitfaden (siehe abschließend dann auch Tabelle 37). Mit fortschreitender Entwicklung von Entscheidungsmethoden und -techniken wenden sich Umweltökonomen mehr und mehr Simulations- und! oder mathematischen Programmierungsmodellen zu, um die Folgen alternativer Umweltschutzmaßnahmen zu schätzen. Neben anderen Aspekten spielt dabei vor allem eine Rolle, daß diese Instrumente es nicht nur erlauben, eine breite Spannweite von Zielen und Rahmenbedingungen abzubilden, sondern auch eine realitätsnahe Wiedergabe der Natur pflanzlicher Erzeugung mit z.T. stochastischen Einflüssen. Ellisl Hughesl Butcher drücken dies aus wie folgt: "Lacking the luxury of an actuallaboratory to test proposed policies, the analyst turns to the computer as his or her tool of empirical investigation" (Ellisl Hughesl Butcher 1991, S.98ff.) Die Anwendung von Methoden der mathematischen Programmierung auf landwirtschaftliche Managementprobleme hat dagegen eine längere und gut dokumentierte Geschichte. Dabei überwiegen LP-Studien, in erster Linie wohl
170
C. Der Produktions faktor Wasser
wegen ihrer leichten Implementierung und ihrer relativen Flexibilität in der Abbildung einer Spannweite wirtschaftlicher Bedingungen. Ebenso fanden MOPund MGP-techniken Anwendung. Bei der Beurteilung der Eignung mathematischer Programmierungsmethoden spielt zunächst einmal der ZeitauJwand eine RoHe, der für die Anwendung einzelner Techniken notwendig ist. In dieser Hinsicht erscheint Goal Programming am effizientesten, da es lediglich einen einzigen Computerlauf benötigt. (vgl. auch PiechI Rehman 1993, S.3l7) Wird zusätzlich noch eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, steigt dieser Bedarf entsprechend an. In jedem FaH setzt Multiple Objective Programming mehr Berechnungen voraus. Die Anzahl erforderlicher Rechendurchgänge ist dabei eine Exponentialfunktion der Anzahl betrachteter Ziele. Diese beträchtlichen Aufwendungen lassen sich bei Anwendung eines CPModeHs deutlich reduzieren. Hierfür ist es lediglich erforderlich, zwei LP-Probleme für jedes Gewichtungsset zu lösen (je eines für LI und Lex,)' Genau das steHt jedoch eine potentieHe SchwachsteHe dieses Ansatzes dar: Informationen über Austauschraten zwischen den einzelnen Zielen können verlorengehen. Beurteilt man die vorgesteHten Techniken nach Menge und Genauigkeit der Informationen, die sie vom Entscheidungsträger verlangen, steHt sich Goal Programming wohl als schwierigster Ansatz dar. Der Entscheidungsträger hat nicht nur präzise Ziel vorgaben zu machen, sondern er muß darüber hinaus auch jeder Abweichungsvariablen Gewichte zuweisen, von Beginn an Präferenzen klarsteHen und so fort. Romero/ Rehman (1989, S.l 04) sind sogar der Meinung, daß genau dies die Art an Informationen ist, die ein EntscheidungsunterstützungsmodeH bereitsteHen soHte anstatt sie als Input zu verlangen. Multiple Objective Programming steHt unter dem Gesichtspunkt der vom Entscheider verlangten Informationen das entgegengesetzte Ende der Skala dar. Zum Aufbau eines MOP-ModeHs ist es absolut nicht notwendig, irgend etwas über die Präferenzen des Entscheidungsträgers zu wissen. Es reicht zunächst aus, die betrachteten Ziele mathematisch auszudrücken. Beim Compromise Programming ist es dagegen notwendig, die relativen Präferenzen des Entscheiders für aHe Ziele zu wissen, um damit die Kompromißlösungen für die verschiedenen Maßstäbe näherungs weise festzusteHen. Als
V. Wassernutzung unter mehrfachen Zielsetzungen
171
Nachteil dieser Methode beschreiben PiechI Rehman (1993, S.318) den hohen Rechenaufwand und die Möglichkeit zu vieler Lösungen für eine bewußte Auswahl. Was nun die Informationen betrifft, die das Modell für den Entscheider zur Verfügung stellt, ist Goal Programming den beiden anderen Techniken deutlich unterlegen. Es bietet lediglich eine einzige Lösung an: die Konstellation von Entscheidungsvariablen, welche die bestmögliche Befriedigung der einzelnen Ziele erlaubt. Die durch MOP-Ansätze generierten effizienten Lösungen statten den Entscheider dagegen mit wertvollen Informationen für seine Entscheidung aus. Sie beinhalten vor allem auch Austauschraten zu den enthaltenen Zielen, was im Hinblick auf die Evaluierung verschiedener Handlungsalternativen vor einer Auswahl als essentiell angesehen werden kann. Compromise Programming bietet diese Informationen ebenfalls an, indem es die Grenzen derjenigen effizienten Lösungen identifiziert, die dem Idealpunkt am nächsten kommen. Es ist mit vorhandenen Softwarelösungen auch vergleichsweise einfach zu rechnen (piechI Rehman 1993, S.318). Trotzdem regte sich schon frühzeitig grundSätzliche Kritik an den diversen Modellen mathematischer Programmierung (hier von Dentl Anderson 1971, S. 7): "The rigid framework of the mathematical programming model generally defies the incorporation of much biological and economical detail. Without this detail, the defined model may be a poor representation of reality." Mathematische Programmierung repräsentiert also einen sehr präzisen Ansatz der Entscheidungstheorie, aber genau diese Präzision erscheint irreführend. Sollten entsprechende Modelle für die vorliegende Arbeit Berücksichtigung finden, müßten folgende Aspekte sorgfältig abgewogen werden (vgl. Dentl Blackie 1979, S.10f.): (1) Der festgelegte Rahmen solcher Modelle hat eine rigide (also starre, un-
flexible) Modellstruktur zur Folge. (2) Die Aufnahme detaillierter interaktiver Daten wie Zielgewichte oder Präferenzen des Entscheidungsträgers in solche Modelle gestaltet sich oft mühsam. (3) Mathematische Programmierungsmodelle werden in bezug auf ein bestimmtes Kriterium gelöst. Modelle mit multiplen Zielsetzungen sind schwierig zu
172
C. Der Produktions faktor Wasser
entwickeln und zeitaufwendig in ihrer Anwendung, sofern es nicht gelingt, jene Kriterien als lineare Kombinationen auszudrücken. (4) Stochastische und dynamische Elemente sind in mathematische Programmierungsmodelle wegen der exponentiell steigenden Komplexität und des Rechenaufwandes kaum zu integrieren. Als Alternative zur mathematischen Programmierung bieten sich Simulationsmodelle an, die in der Systemanalyse als Standardprozedur weite Verbreitung gefunden haben. Innerhalb des Gartenbaus und der Landwirtschaft greifen Disziplinen von der Planung natürlicher Ressourcen über pflanzenphysiologische Systeme bis hin zu biochemischen und Zellsystemen auf sie zurück. Diese weite Verbreitung spiegelt eine Zahl spezifischer Vorteile von Simulationsansätzen wider: (1) Sie erlauben die Untersuchung von Systemen bei denen Experimente unter
realen Bedingungen entweder unmöglich, zu kostspielig oder von schädlichen Folgen wären. (2) Eine Synthetisierung von Systemen in Modellform gestattet die Exploration auch noch nicht bestehender Systeme. (3) Simulationen ermöglichen die Studie von Langzeiteffekten, da der Zeithorizont innerhalb dessen modellierte Vorgänge ablaufen der Kontrolle des Modellentwicklers überlassen bleibt. (4) Entwickler und Erbauer von Simulationsmodellen sind gezwungen, das System objektiv und konsequent einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Dieser Prozeß führt oft zu überraschenden Einsichten. Jedoch sind auch Simulationsmodelle nicht ohne Schwierigkeiten und Nachteile. Von diesen nennen DentJ Blackie (1979, S.II): (I) Auch Simulationen tendieren dazu zeitraubend zu sein. Analyse, Datensammlung und -aufbereitung, Modellentwicklung und -überprüfung verbrauchen mit zunehmender Komplexität immer mehr Zeit. (2) Häufig sind Daten und Wissen über die grundlegende Struktur eines Systems nicht ohne weiteres verfügbar. Fast immer ist es notwendig, vereinfachende Annahmen zu treffen, und es sind Kompromisse einzugehen, was die Ver-
V. Wassernutzung unter mehrfachen Zielsetzungen
173
wendung von Daten aus uneinheitlichen Quellen und damit die Interpretation der neu gewonnenen Informationen betrifft. (3) Zuletzt ergeben sich Probleme aus der Prüfung und Validierung eines Modells. Es wird nie vollständig möglich sein, ein Simulations modell als korrekte Prognoseinstrument zu beurteilen. Es mag unentdeckte Schwachstellen enthalten, unbefriedigende Datentransformationen oder unabsichtlich durch den Entwickler geschaffene Widersprüche. All dies kann die Gültigkeit und Aussagekraft der von dem Modell zur Verfügung gestellten Informationen ernsthaft beeinträchtigen. Im allgemeinen verwendet die Simulation beschreibende Modelle, um Entscheidungsprobleme zu untersuchen. Das Modell beschreibt nur das Verhalten des Systems unter bestimmten Annahmen; trotzdem lassen sich durch Experimentieren mit ihm näherungsweise Lösungen erhalten. (vgl. Wright 1971, S.22) Tabelle 37 gibt einen zusammenfassenden Überblick über Vor- und Nachteile der vorgestellten Methoden hinsichtlich der eigenen Zielsetzung in dieser Arbeit. Generell ist noch anzumerken, daß Entscheidungsanalytiker in der Regel spontan versuchen, die Präferenzvorstellungen des Entscheidungsträgers mit Hilfe eines einzigen Kriteriums darzustellen. Diese Nutzen, Wert- oder Zielfunktion stellt dann wieder eine Ein-Kriterien-Funktion dar. Eine solche Vorgehensweise verleitet dann zur Ermittlung eines Optimums. Roy (1980, S.469f.) führt als Unzulänglichkeiten dieses Optimierungsansatzes an: (I) die Annahme vorab existierender, widerspruchsfreier und im Zeitablauf unveränderlicher Präferenzvorstellungen mit dem Ausschluß der Möglichkeit einer Unvergleichbarkeit von Aktionen, (2) Instrumentelle Verzerrungen (besondere Gewichtung derjenigen Eigenschaften, für die zuverlässige und objektive Daten beschaftbar sind bei gleichzeitiger Unterschätzung unvollständiger oder subjektiver Daten), (3) das Fehlen der Möglichkeit, Anregungen in den Entscheidungsprozeß einzubeziehen und (4) das übermäßige Anwachsen der Rechentechnik, deren Genauigkeit vielfach in keinem Verhältnis mehr zu der Bedeutung der Daten und der Gültigkeit der Modellannahmen steht.
174
C. Der Produktionsfaktor Wasser
Tabelle 37
Eignung der vorgestellten Ansätze bezüglich der Zielsetzung der Arbeit Methode
Vorteil(e)
Quantifizierung von Tradeoffs; Realiserbarkeit; auch nichtSimulation numerische Ziele; auch nichtlineare Zusammenhänge
Linear Programming LP
Nachteil( e) Sensitivitätsanalyse aufwendig; Datenbedarf; nur günstige Lösungen
nur numerische Ziele; Annahme ausschließlich linearer ZusammenQuantitifizierung von Trade- hänge; multiple Ziele nur in Form offs, Realisierbarkeit, Rechenef- von Restriktionen; Erwartungswerte fizienz, Sensitivitätsanalyse für Parameter; nur ein Kriterium für Alternativenwahl; Rigidität der Restriktionen
Dynamic P. Multiple Objective P. MOP
Quantifizierung von Tradeoffs; Recheneffizienz
nur numerische Ziele; detaillierter Datenbedarf komplexer Modelle
mathematische Zielformulie-
Zusammensetzung der Ziel funktion; nur numerische Ziele; hoher Rechenaufwand; Möglichkeit zu vieler Lösungen
rung ohne Entscheider; generiert effiziente Lösungen mit Austauschraten
numerische Problemformulie-
Lexicogra phic Goal P. LGP
Weighted Goal P. WGP
Identifikation von Zielen, Zielprioritäten und Trade-offs; relativ geringer Zeitaufwand
Identifikation von Zielen, Ziel prioritäten und Trade-offs; relativ geringer Zeitaufwand
rung oft schwierig; benötigt Definition aller relevanten Ziele durch Entscheider mit Zuordnung von Prioritäten; unendlich hohe Austauschraten möglich; Erzeugung nicht-effizienter optimaler Lösungen möglich; theoretische Vieldeutigkeit der Maximierungsvariablen; naive Bevorzugung einzelner Ziele; nur eine Lösung numerische Problemformulierung schwierig; Bestimmung von Zielgewichten, Zielgrößen und Messung durch Entscheider schwierig; nur eine Lösung
V. Wassernutzung unter mehrfachen Zielsetzungen Identifikation einer optimalen Lösung aus effizienten Lösungen; keine abzufragenden GeComprowichte benötigt; Vielzahl von mise P. CP Entfernungsfunktionen berücksichtigt; relativ geringer Rechenaufwand Interactive Multiple Criteria Decision Making IMCDM
gute Akzeptanz bei Entscheider durch Dialog
175
Informationsverlust zu Tradeoffs möglich; benötigt relative Präferenzen des Entscheiders
Entscheider stark beansprucht; flexibel und leistungsfähig nur bei wenigen Zielen
Quelle: eigene Darstellung
Als Lösung schlägt der Autor vor (Roy 1980, S.472, vgl. auch Ozernoy 1987), eine möglichst kleine Teilmenge zufriedenstelIender Aktionen vorab auszuwählen, Aktionen zu sortieren und bestimmten Kategorien zuzuordnen sowie die Entscheidung durch Ordnen der Aktionen je nach Übereinstimmung mit den Vorstellungen des Entscheidungsträgers vorzubereiten. Diese Anregung wird in Kapitel E. bei der Entwicklung des eigenen Ansatzes wieder aufgegriffen. b) Lastenkatalog der zu entwickelnden Methode Die Auswahl einer mehrfaktoriellen Technik zur Unterstützung von Entscheidungen bezogen auf den Einsatz der Ressource Wasser zur Erzeugung von Pflanzen stellt sich selbst als Entscheidungsproblem unter mehrfachen Zielsetzungen dar. Die gewählte Technik sollte mindestens folgenden methodischen Forderungen genügen: (I) Strukturierung und Präzisierung des Entscheidungsproblems zur Identifizie-
rung von Handlungsalternativen. (2) Verdeutlichung der Auswirkung von Präferenzen des Entscheiders auf Entscheidungsalternativen und deren Ergebnisse.
176
C. Der Produktionsfaktor Wasser
(3) Ermittlung einer Anzahl grundsätzlich denkbarer Alternativen sowie Unterstützung einer Anzahl realisierbarer Lösungen, aus denen der Entscheidungsträger dann eine günstige Lösung identifizieren kann. Zweifellos existiert die Tendenz, denjenigen Teil des Modells, für den relevante Daten verfügbar sind, auf Kosten anderer Teile zu erweitern, für die ein Mangel an brauchbaren Daten herrscht. Dieser Weg führt nicht zum gewünschten Erfolg. Statt dessen erscheint es angebracht, ein Subsystem, dessen Funktion das Ergebnis des Gesamtmodells stark beeinflußt, detaillierter zu modellieren, als eines, dessen Funktion geringe Effekte auf den Output hat. (vgl. hierzu Dent! Anderson 1971, S.9) Weiterhin sind als Erkenntnis aus der Betrachtung der vorgestellten Methoden folgende Elemente wichtig, was die Auswahl oder Entwicklung einer geeigneten Methode zur Unterstützung von Entscheidungen zum Wassereinsatz betrifft: (1) Anzahl modelIierbarer Ziele, Genauigkeit und Bedeutung der Informationen, (2) Zielgrößen oder -niveaus, (3) Daten-Input, (4) Informations-Output. Risikoüberlegungen bleiben von der weiteren Betrachtung ausgeklammert, da sie den Umfang der Arbeit unvertretbar stark ausweiten würden. Zur Abschätzung der Effekte eingesetzter Produktionsfaktoren auf die Wahrscheinlichkeitsverteilung des erzielten Outputs siehe z.B. Just! Pope (1979). Neben den erwähnten Aspekten sollten bei der Auswahl einer Methode für das Problem des Wassereinsatzes in Unternehmen mit Pflanzenerzeugung noch folgende weitere Gesichtspunkte berücksichtigt werden, deren Bedeutung auch Ellis/ Hughes/ Butcher (1991, S.10l) hervorheben: (1) Eignung für unterschiedliche Kulturen (das Modell sollte flexibel sein, was Art und Kombination der zu analysierenden Kulturen betrifft), (2) Orientierung an Kulturen (wobei das Modell kulturorientiert, aber nicht kulturspezifisch sein sollte), (3) Übertragbarkeit (das Modell muß auf andere Regionen, eventuell sogar auf andere Wirtschaftsbereiche übertragbar sein),
VI. Fazit Kapitel C
177
(4) mehrperiodischer Zeithorizont (Eignung für kurz- bis längerfristige Planungen), (5) unterschiedliche Betriebsgrößen, (6) verfügbares Management. Die Verwendung mikroökonomischer Produktionssysteme zur Betrachtung wasserbezogener Externalitäten der Pflanzen erzeugung empfiehlt auch lust (1991). Er wendete ein entsprechendes Modell zur Verknüpfung landwirtschaftlicher Produktionsfunktionen mit Umweltproblemen an. Jones (1983, S.508) betont in diesem Zusammenhang noch einmal die Bedeutung der Phase der Problemformulierung. Er empfiehlt folgende vier Schritte (1) Definition des zu betrachtenden Systems, (2) Bestimmung der Ziele, (3) Identifizierung und Quantifizierung der Entscheidungsvariablen und (4) Festlegung der Restriktionen. Dieser Vorgehensweise folgen im Prinzip die weiteren Kapitel.
VI. Fazit Kapitel C Ziel dieses Kapitels war es, ein Fundament entscheidungstheoretischer Grundlagen für die Entwicklung einer eigenen Methodik zu legen. Das begann mit der Einordnung des Problems in den größeren Zusammenhang unternehmerischer Zielsysteme. Abbildung 14 zeigt, wie sich das Problem einer günstigen Wassernutzung in Unternehmen diesbezüglich darstellt: Verschiedene Anspruchsgruppen artikulieren wasserbezogene Umweltschutzforderungen unterschiedlicher Intensität von denen ein oder mehrere Unternehmensbereiche betroffen sein können. Der Handlungsdruck für den Entscheidungsträger wächst dabei mit der Anzahl der Anspruchsgruppen, der Intensität der ökologischen Ansprüche und der Anzahl möglicher Sanktionsmöglichkeiten. Dieser Einordnung folgt eine detaillierte Charakterisierung des Entscheidungsproblems eines günstigen Wassereinsatzes für die Erzeugung von Pflanzen in Unternehmen. Tabelle 38 faßt die als relevant identifizierten Entscheidungselemente noch einmal zusammen. Ob es sich dabei im Einzelfall um Ziele, Kriterien oder Restriktionen handelt, hängt wesentlich von der Situation des betrachteten Unternehmens sowie von den Präferenzen und Werten der maßgeblichen Entscheidungsträger ab. 120nh
C. Der Produktionsfaktor Wasser
178
Intensität ökulugischcr Ansllrüchc_____
'I
, +.
I
hm:h
I
I
'"
Illiliel
Ökologischc Anspruchsgruppcn
gc nng
Um"cltschutlbcwgcnc Problem bereiche
Quelle: eigene Darslellung
Abb. 14: Dimensionen der Entscheidungen zur Wassernutzung für einen Unternehmensbereich (z.B. Produktion)
Zur Unterstützung mehrfaktorieller Entscheidungen steht eine Reihe verschiedener Methoden zur Verfügung. Unter Zuhilfenahme ausgewählter Anwendungen werden Vor- und Nachteile dieser Methoden bezüglich der eigenen Zielsetzung diskutiert. Als Ergebnis zeigt sich, daß keiner der bestehenden Ansätze uneingeschränkt zur Lösung der Problemstellung in Frage kommt. Interessante Teilaspekte sollen jedoch in dem eigenen Modell weiterverwendet werden und finden hierzu Eingang in einen Lastenkatalog. Tabelle 39 faßt die bisher aus diesen Erkenntnissen gewonnenen Anforderungen an das neu zu entwickelnde Modell noch einmal im Überblick zusammen.
VI. Fazit Kapitel C
179
Tabelle 38 Wassernutzung als mehrfaktorielles Entscheidungsproblem Kriterium
angestrebter Zustand (Beispiel)
Ertrag der Kulturen
ausreichendes Niveau
Produktqualität
Verkaufsfahigkeit
Ansehen des Unternehmens
gesellschaftliche Akzeptanz
Wasserinput
verfügbare Mengen und Qualitäten
Wasseroutput
tolerierte Mengen und Qualitäten
Arbeit
Gesamtbedarf minimieren, Kapazitäten auslasten
Kapital
Verfügbarkeit für Wassernutzungstechnik
Kosten
minimieren
Staatliche Förderungen
maximieren
Pflanzenbehandlungsmittel
Einsatz minimieren
Energie
Einsatz minimieren
Quelle: eigene Darstellung
Tabelle 39 Anforderungen an das zu entwickelnde eigene Modell Anforderung strukturierte und hinreichend genaue Abbildung des Entscheidungsproblems Generierung und Identifizierung einer Anzahl möglicher Handlungsalternativen Darstellung der Auswirkung von Präferenzverschiebungen des Entscheidungsträgers auf die Vorzüglichkeit von Handlungsalternativen Unterstützung der Auswahl einer günstigen Lösung durch den Entscheidungsträger mittels Bereitstellung relevanter Informationen Darstellung der Auswirkung von Veränderungen externer Rahmenbedingungen auf die betriebliche Entscheidungssituation Berücksichtigung der realen (nicht nur numenschenJ Ziele der Entscheidungsträger Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Managementkapazitäten Verhältnismäßigkeit bei Datenerfassung und Rechenaufwand hohe Flexibilität bezüglich Struktur, Produktionsprogramm. Größe und Standort (Region) der zu unterstützenden Wirtschaftsobjekte Quelle: eigene Zusammenstellung
12*
180
C. Der Produktionsfaktor Wasser
Damit ist das Kapitel C mit dem Schwerpunkt der Entscheidungstheorie in den Unternehmen abgeschlossen. Es folgt in Kapitel D eine Untersuchung, ob und in welchem Umfang Instrumente und Methoden aus dem Gebiet UmweltManagement zur Entwicklung des eigenen Modells unter Berücksichtigung der formulierten Anforderungen beitragen können.
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwelt-Management-Systeme I. Grundlagen des Umweltmanagements und -Controlling In der betriebswirtschaftlichen Literatur wird erst relativ spät realisiert, daß die Kapazität der Umwelt als Reservoir natürlicher Ressourcen und als Aufnahmemedium für anthropogene Abfälle beschränkt ist und daß Kapazitätsgrenzen fühlbar werden. (vgl. Boulding 1966, Binswanger 1972, Meadows 1972, Krupp 1989 sowie Strebel 1980) Erst zu Beginn der 70er Jahre wandte sich die Betriebswirtschaftslehre, angeregt durch Diskussion, Entwurf und Publikation des Umweltprogramms der Bundesregierung 1971, dem Problem der Umweltbelastung durch wirtschaftliche Aktivitäten zu. (vgl. Strebel 1980, S.14) In den Jahren danach findet sich zunehmend die Forderung, den Umweltschäden mehr Aufmerksamkeit zu widmen, und der Versuch, Produktions methoden nach dem Ausmaß der Umweltbelastung zu unterscheiden. Für die Akzeptanz umweltorientierter Forschungsrichtungen in den 90er Jahren ist folgende Aussage von Thielemann (1990, S.43) charakteristisch: "Ökologische Betriebswirtschaftslehre ist nicht mehr nur etwas für Idealisten." Winter (1991, S.715f.) meint sogar, der Gedanke umweltorientierter Unternehmensführung berühre grundsätzlich die Unternehmensphilosophie in den Bereichen Qualität, Kreativität, Humanität, Rentabilität, Kontinuität und Loyalität. In den letzten Jahren stehen angesichts aktueller Umweltprobleme verstärkt Konzeptionen und Instrumente einer ökologisch orientierten Unternehmensführung im Mittelpunkt der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion. (vgl. z.B. Strebel 1991) Die Forschungsaktivitäten konzentrieren sich zum einen auf einzelne sehr spezifische umweltschutzbezogene Problemstellungen des Unternehmens (z.B. Müller-Wenk 1978, Jahnke 1986 oder Stahlmann 1988) und zum anderen auf die Voraussetzungen und Möglichkeiten der Umsetzung eines integrierten, funktionsübergreifenden Umweltmanagements (z.B. Strebel 1980, Seidel! Menn 1988 oder Steger 1988). Zu den rechtlichen Grundlagen siehe ergänzend auch Behrens (1995).
182
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwelt-Management-Systeme
Zum Ausdruck bringt dieses erweiterte Systemverständnis Abbildung 15.
--/
/
/'
-
---
echnologische Sphäre
/
'""
""
ökonomische Sphäre
/
/
-
~atürliche Umweit -......
'" "'-
,
'\
\
soziale Sphäre
/
\
Staat
Arbeitnehmer
\ \
I I
\ \
\
;
\
/
\ \
\
"'-
Kapitalgeber
)
'\
/
Konkurrenten
". ~~'" - '_. --
/
/ /'
/
Quelle: nach Ulrich 1978. S.67
Abb. 15: Anthropogene und natürliche Umwelt der Unternehmung
1. Begriffsabgrenzungen Seit der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro macht der Begriff des "sustainable developmenr' in der internationalen wie auch in der deutschen Diskussion die Runde. (vgl. z.B. Rentz 1994; SRU 1996, S.50) Schmidheiny (1992, S.32) hat als Sprecher des im Zusammenhang mit der Konferenz gegründeten Business Council for Sustainable Development auf die globalen iikologischen Aufgaben der Unternehmen und auf die Notwendigkeit einer
I. Grundlagen des Umwelt managements und -Controlling
183
entsprechenden Umsteuerung hingewiesen. Dabei geht es um die Form von Fortschritt, die Bedürfnisse der Gegenwart deckt, ohne zukünftigen Generationen die Grundlage für deren Bedürfnisbefriedigung zu nehmen. Sustainable development heißt demnach nachhaltige und dauerhafte Entwicklung. Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen gab danach seinem Umweltgutachten 1996 folgerichtig den Untertitel "zur Umsetzung einer dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung". Um eine umweltorientierte Unternehmensführung im Sinne dieses integrierten ganzheitlichen Konzeptes zu betreiben, umfaßt ein daraus abgeleitetes Umweltmanagement die Planung, Steuerung und Kontrolle aller betrieblichen Umweltschutzaktivitäten (HopfenbeckJ Jasch/ Jasch 1996, S.425). Rück (1993, S.38f.) sieht hierbei eine ökologieorientierte Unternehmenspolitik als notwendige Voraussetzung eines "Öko-Controllings". Im modernen Controlling-Verständnis wird Controlling somit als spezialisierter Fall der Unterstützungsfunktion (Rück 1993, S.49f.), als Sub- oder Servicefunktion (HopfenbeckJ Jasch/ Jasch 1996, S.267) der Führungsaufgabe interpretiert, um das Unternehmen an Veränderungen im Umfeld ziel orientiert anzupassen. Von HopfenbeckJ Jasch/ Jasch (1996, S.269) stammt folgende Definition des Umwelt-Controlling (die Autoren verwenden den synonym zu verstehenden Begriff "Öko"-Controlling): "Öko-Controlling ist der Soll-Ist-Vergleich umweltbezogener Fakten und Zustände eines Unternehmens auf Basis der Iststandserhebung über die Mengenbilanzierung und ökologische Bewertung ( ... ). Als unternehmens interne Schwachstellenanalyse und systematische Dokumentation der Auswirkungen von Unternehmensaktivitäten auf die Umwelt dient es als Grundlage für präventive und langfristige strategische Entscheidungen seitens des Managements. Aus dem Öko-Controlling werden Maßnahmenpakete abgeleitet. " Bundesumweltmmtsterium und Umweltbundesamt geben dem Begriff "Umwelt-Controlling" den Vorzug, der auch in dieser Arbeit verwendet wird. (vgl. Schulz 1994, S.7)
184
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwelt-Management-Systeme
2. Aufgaben, Zielsetzungen und Funktionen a) Anforderungen an ein Umwelt-Controlling-System Für Hallay/ Pfriem (1992, S.33ff.) übernimmt das Umwelt-Controllingsystem die Funktionen (1) Informationsbeschaffung, (2) Bereitstellung von Analyse- und Verarbeitungsverfahren und (3) die Unterstützung der Planung und Steuerung der betrieblichen Abläufe. Die Funktion der Informationsbeschaffung gliedert sich dabei zur internen und externen Erfassung und Verarbeitung unternehmensbezogener Umweltinformationen noch einmal in vier Informationsaufgaben: (1) Erfassung von Stoff- und Energieflußinformationen zu unternehmensinternen Aktivitäten, (2) Bereitstellung von Stoff- und Energieflußinformationen aus dem Produktlebenszyklus, (3) Beschaffung von Informationen zur ökologischen Beurteilung der Stoff- und Energieströme und (4) Bereitstellung von Informationen zur Analyse der ökonomisch-ökologischen Restriktionen. Bei den Beurteilungsinstrumenten konkurrieren derzeit mehrere verschiedene Systeme wie der Ansatz zur Monetarisierung von Umweltwirkungen, quantifizierbare Ökobilanzen und qualitativ orientierte Verfahren bei denen eine Handlungsorientierung im Vordergrund steht. (siehe Abschnitt D. 11. 5., Hopfenbeck/ Jasch/ Jasch 1996, S.269) Das Umwelt-Controlling übernimmt auf den verschiedenen Ebenen (normativ, strategisch und operativ) unterschiedliche Steuerungsaufgaben zur Umsetzung der jeweiligen Ziele in konkrete Planungen und Handlungen. (vgl. auch Schulz 1994, S.3f.) Geiger (1996, S.13) nennt als Aufgabe eines Umwelt-Controllings außerdem, ökologische Ziele in unternehmenspolitische Entscheidungsprozesse
I. Grundlagen des Umweltmanagements und -Controlling
185
und betriebliche Abläufe dauerhaft zu integrieren. Die Grundfunktionen eines Umwelt-Controllings bestehen also kurzgefaßt (nach Rück 1993, S.53ff.) in: (1) der Koordinationsfunktion (Ziel system, Organisation, Personal, Information,
Planung und Kontrolle), (2) der Reaktionsfunktion (sowohl Vorauskoordination als auch Koordination durch Rückkopplung) und (3) der Adaptions- und Antizipationsfunktion (vgl. hierzu auch Abbildung 16). Die Zielsetzungen des Umwelt-Controlling in bezug auf diese Reaktions-, Adaptions- und Koordinationsfähigkeit beschreibt Pölzl (1992) folgendermaßen: (1) Verbesserung der inner- und außerbetrieblichen Koordinationsfähigkeit
unter ökologischen Aspekten, (2) Verbesserung der Reaktionsfähigkeit auf umweltrelevante Störungen und Ineffizienzen der Stoff- und Energieflüsse, (3) Förderung der Mitarbeitermotivation für umweltschonendes Verhalten, sowie (4) Verbesserung der Anpassungsfähigkeit an durch Umweltaspekte bedingte Änderungen im Unternehmensumfeld. Schulz (1994, S.9) spricht in diesem Zusammenhang auch von Beobachtungsfeldern (Politik und Verwaltung, Gewerkschaften, Kammern und Verbände, Wissenschaft und Forschung, Bildung, Beratung, Technische Indikatoren, Bürgerbefragungen und -initiativen, Medien, Markt), die ein ökosozialer Frühwarndienst abdecken muß. Durch den Führungswandel in Richtung eines ganzheitlichen Denkens gewinnen neben quantitativen Aspekten "weiche", qualitative Dimensionen immer mehr an Bedeutung. "Controlling ist keinesfalls ausschließlich vergangenheitsorientiert und damit auf eine Kontrollfunktion beschränkt, vielmehr ist es auf eine zukunftsgerichtete Steuerung des Entscheidens und Handeins gerichtet. Dabei erfolgt eine Erweiterung der Zieldimensionen von einer bisher quantitativen, gewinnorientierten Unternehmungsführung zu einer qualitativen, sozial und ökologisch orientierten Unternehmensführung." (Brunner 1991, S.267)
186
D. Emscheidungsunterstützung durch Umwe1t-Management-Systeme
b) Beobachtungsfelder und Anspruchsgruppen Durch die Ausrichtung eines Umwelt-Controllingsystems auf die Zukunft stellt sich die Frage wichtiger Beobachtungsfelder im Sinne eines ökosozialen Frühwarndienstes (vgl. Schulz 1994, S.9). Auf der anderen Seite sind diese Beobachtungsfelder gleichzeitig als Zielgruppe für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu sehen. Für die Planung und Kontrolle dementsprechender Entscheidungen bereitet wiederum das Umwelt-Controlling geeignete Informationen vor (siehe Abschnitt D. 11. 2. a) Betriebliche Umweltinformationssysteme), so daß sich im Idealfall ein geschlossener Regelkreis ergibt.
Politik und Verwaltung in der Europäischen Union, auf Bundes- und Länderebene beschließen bzw. setzen um umweltrelevante Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften und deren Änderung (siehe auch Kapitel B., Abschnitt I. 2. b) Wettbewerbsregeln und Politikansätze). Gesetzesinitiativen sind hierbei eng mit der Programmatik der Parteien verknüpft. Die Bedeutung dieses Beobachtungsfeldes liegt in der Notwendigkeit, stets die Mindestanforderungen des Umweltrechts zu erfüllen. Hinsichtlich des Absatzmarktes haben Bürgerbefragungen zum Thema UmweItbewußtsein in Deutschland inzwischen Tradition (vgl. Schulz 1994, S.16 und Abschnitt C. I. 2)). Wichtige Meinungsbildner sind vor allem auch zahlreiche Bürgerinitiativen. Fanden sich in den ersten Verzeichnissen nichtstaatlicher Umweltschutzorganisationen und Bürgerinitiativen überwiegend die kleinen, vor Ort tätigen Gruppen, so wandelt sich das Bild in den letzten Jahren erheblich. Heute sind es große, überregional tätige Verbände, welche die Umweltdiskussion in Deutschland bestimmen. (vgl. Umweltbundesamt 1993) Eine wichtige Aufgabe des Umwelt-Controllings besteht darin, im Rahmen einer absatzmarktorientierten Strategie Maßnahmen und Entscheidungen zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit zu planen und die Durchführung zu kontrollieren. Dahinter steht die Erkenntnis, daß bei vielen Konsumenten heute eine hohe Bereitschaft vorhanden ist. sowohl bei der Wahl ihrer Einkaufsstätte als auch bei der Kaufentscheidung Umweltschutzaspekte miteinzubeziehen. Die Beobachtung des Marktes in bezug auf Verbrauchereinstellungen zum Umweltschutz sollte deshalb ein wichtiger Baustein des Umwelt-Controllings sein.
I. Grundlagen des Umweltmanagements und -Controlling
187
Auf dem Beschajfuflgsmarkf unterliegen Zulieferer verschiedener Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe bei der Herstellung und dem Vertrieb selbst den Anforderungen von Gesellschaft und Politik. Eine umweltorientierte Beschaffung hat ihren Schwerpunkt im Bereich des Bezuges aller Materialien und Betriebsmittel. Im Produktionsbereich wird versucht, einen umweltbewußten Umgang beim Einsatz von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen zu erreichen (Hopfenbeck 1990, S.154). Wie bedeutsam die Beobachtung von Veränderungen auf dem Beschaffungsmarkt ist, läßt sich anhand von zwei Beispielen darstellen. Zum einen erschütterte ein deutlicher Rückgang der Anzahl zugelassener Pflanzenschutzmittel von ca. 1.900 auf ca. 900 Präparate den Gemüsebau in der Bundesrepublik Anfang der 90er-Jahre (vgl. Merz 1990, S.8). In der Folge waren kurzfristige Alternativen zu entwickeln. Ein damit zusammenhängendes zweites Beispiel liegt für den Bereich Zierpflanzen vor und berührt ebenfalls den Pflanzenschutz. Hier nutzen Gartenbaubetriebe mit Direktabsatz in einer Art Imagetransfer das positive Ansehen zugekaufter Nutzorganismen in der Bevölkerung zur eigenen Profilierung (vgl. Orth et al. 1996, S.30ff.). Bei dem umweltpolitischen Gesetzgebungsprozeß spielen Fachkollegen und Verbände (z.B. in Gewerkschaften, Kammern und Verbände) eine wichtige Rolle. Beispielsweise verfügt der Zentral verband Gartenbau ZVG über einen eigenen Umweltreferenten. Dieser unterstützt die Bemühungen der Unternehmen, Führungsinstrumente auf dem Gebiet des betrieblichen Umweltschutzes fortzuentwickeln. Das unter dem Punkt Absatzmarkt beschriebene Kundenverhalten gilt auch für die Nachbarn. Die unmittelbare Lage nahe dem Unternehmen bedingt jedoch die Besonderheit einer höheren Kontakthäufigkeit und damit in der Regel einer besseren Informiertheit über das entsprechende Umweltverhalten. Lautwerdende Kritik oder sogar Beschwerden von Anwohnern sollten dabei im Sinne einer Strategie der Früherkennung nicht ausschließlich negativ gesehen werden. Solche Außerungen stellen vielmehr ein wertvolles Potential von Frühindikatoren dar, das es verdient, zumindest auf Stichhaltigkeit und Übertragbarkeit auf andere Anspruchsgruppen geprüft zu werden. Medien spielen im Rahmen der Früherkennung eine bedeutende Rolle. Häufig findet man dort für Umweltfragen ein Verbreitungsmuster, das Schulz (1994, S.19) wie folgt charakterisiert: (I) Lange Vorlaufzeit (erste Berichte, Außensei-
188
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwelt-Management-Systeme
termeinungen), (2) steiler Interesseanstieg (Tagespresse, Behördenreaktionen, Kundenanfragen, etc.), (3) Verharren auf hohem Niveau (Regierung kündigt Maßnahmen an) und (4) Absacken der Aufmerksamkeit (Problemlösung in Angriff genommen). Die Rolle der eigenen Mitarbeiter für das Umweltcontrolling in Unternehmen mit Pflanzenerzeugung liegt zum einen in ihrem detaillierten Wissen über Betriebsinterna und zum anderen in ihrer Mittler- bzw. Multiplikatorfunktion gegenüber Dritten (Kunden, Nachbarn, etc.). Analog zu den Nachbarn, allerdings unter Berücksichtigung dieser tieferen Betriebskenntnisse, sollten auch Meinungsäußerungen dieser Gruppe für Verbesserungen des Umweltverhaltens in Unternehmen genutzt werden. Neben den Universitäten veröffentlichten Instanzen aus Wissenschaft und Beratung (vor allem das Umweltbundesamt UBA 1994) wissenschaftliche Erkenntnisse und Daten beispielsweise über aktuelle Umweltbelastungen, den Stand der U mwelttechnik oder die Wirkung von Schadstoffen auf Mensch und Umwelt. Eine besondere Bedeutung kommt dem von der Bundesregierung eingerichteten Rat von Sachverständigen für Umweltfragen zu. (vgl. z.B. SRU 1996) Er sieht die Schwerpunkte seiner Arbeit insbesondere in Handlungsempfehlungen im Rahmen der wissenschaftlichen Politikberatung für den nationalen Bereich, aber auch für den Bereich der Europäischen Union. c) Systemansatz eines Umwelt-Controlling
Am Anfang des Umwelt-Controlling-Prozesses (siehe Abbildung 16) steht die Bildung von Zielen im Zusammenhang mit dem Unternehmensleitbild und ökologischen Problembereichen. In der zweiten Phase erfolgt dann die Erfassung der Material-, Stoff- und Energieströme im Betrieb, wobei die Erhebungstiefe nach Hopfenbeckl JaschI Jasch (1996, S.270) auf die betrieblichen Anforderungen abgestimmt sein muß. Das Schema für die Datenaufbereitung entspricht dabei der Input-OutputSystematik. Über diese Ist-Analyse solle dann eine Status-quo Dokumentation erstellt werden. Mittels der Datenerhebung und -auswertung werden anschließend Schwachstellen offengelegt, deren Beseitigung und Maßnahmenplanung auch größeren Forschungsbedarf erfordern kann.
I. Grundlagen des Umweltmanagements und -Controlling
-
Definition umweltorientierter Unternehmensziele
I--
Analyse Erfassung ökologischer Schwachstellen
(z.B. Produktbilanzen, Prozeßbilanzen, Checklisten, Öko-Bilanzen)
Kontrolle & Regelung Soll-Ist-Ken nzah lenvergleich Umweltberichterstattung Öko-Bilanz Umweltinformationssystem
Bewertung nach Beurteilungskriterien Verdichtung zu Problemfeldern
Durchsetzung & Regelung Aufbereitung für Managemententscheidungen
Ergänzungen durch Wirtschaftlichkeitsrechnungen
Treffen in Umweltausschüssen Unterstützung Umweltbeauftragter Weisungen durch Führungsspitze
(z.B. Portfolioanalysen etc.)
,-J
Planung & Koordination Organisationsentwicklung
(z.B. Umweltbeauftragter)
-
Ableitung von strategischen Maßnahmen
(z.B. Verfahrensänderungen, Sort i mentsberei n igu ngen) Ableitung operativer Maßnahmen
(z.B. Substitution) Zielvorgabe für Bereiche
Quelle: verändert nach Geiger 1996, S.32
Abb. 16: Umwelt-Controlling als System
f-
189
190
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwe1t-Management-Systeme
Abgeschlossen wird der Prozeß dann mit der Umsetzung und der Kontrolle der ausgewählten Maßnahmen. Nur dadurch läßt es sich gewährleisten, daß es nach der Isterhebung auch tatsächlich zu einer Entlastung der Umwelt kommt. Wie das, zumindest in Deutschland noch recht junge, betriebswirtschaftliche Controlling sollte auch das Umwelt-Controlling nicht mit einer einmaligen Bilanzierung abgeschlossen sein. Vielmehr sollte es in einen Kreislauf münden, der effizient und weitestgehend standardisiert eine laufende Kontrolle der betrieblichen Aktivitäten ermöglicht. Über die Maßnahmenkontrolle mittels Abweichungsanalyse und die neuerliche Zieldefinition und Bestandsaufnahme wird der Kreis zu einem laufenden Umwelt-Controlling geschlossen. In dieser Form entspricht der Controllingkreislauf dem Umweltmanagementkreislauf nach ISO 14.001.
3. Umweltmanagement und -Controlling im Führungssystem Die Führungsaufgabe des Controlling ist nicht auf eine bestimmte Managementebene beschränkt, sondern besteht primär in der Entwicklung managementorientierter Informationssysteme zur Wahrnehmung der U nternehmens- und Umweltvorgänge sowie in der Koordination und Steuerung der Managementaktivitäten. Controlling stellt aber nicht nur Informationen zielorientiert und funktionsübergreifend zur Entscheidungsfindung bereit, sondern unterstützt auch bei der Umsetzung von Entscheidungen. Die gezielte Umsetzung von Entscheidungen wird durch das Controlling begleitet, indem es mit regelmäßigen Steuerungsinformationen die Grundlage für Schwachstellenanalyse und Maßnahmenplanung schafft. (vgl. Hopfenbeck/ Jasch/ Jasch 1996, S.267) Schnittstellen des Umwelt-Controlling zu anderen Elementen des Führungssystems bestehen in den Bereichen Organisation, Planung- und Kontrolle sowie Information. (Rück 1993, S.62ff.)
a) Normatives Umweltmanagement Auf Basis eines umweltorientierten normativen Managements erfolgt in Unternehmen eine Neuausrichtung von Zielen, Handlungsrahmen und operativen Maßnahmen (Schmitt 1996, S.108). Die für ein Unternehmen relevanten Ziele und Strategien werden hierbei durch das überlagerte normative Management
I. Grundlagen des Umweltmanagements und -Controlling
191
bestimmt, der Sinnbestimmung des unternehmerischen Tuns (Hoffmann 1991, S.14), die sich in den Einstellungen, Überzeugungen und Werthaltungen der Entscheidungsträger, der Unternehmensphilosophie, widerspiegeln. Nach Meffert et al. (1986b, S.146) kann eine ökologisch orientierte Unternehmensphilosophie folgende Kriterien beinhalten: (1) Einhaltung einer umweltbezogenen Rationalität bei der Nutzung von Roh-
stoffen und sonstigen lebenswichtigen Ressourcen und (2) Verantwortungsbewußtsein für die Lebensbedingungen zukünftiger Generationen. Erst wenn der Umweltschutz bei den Entscheidungsträgern einen wichtigen Stellenwert einnimmt, halten die bei den Autoren eine ökologische Ausrichtung des Unternehmens für möglich. Eine umweltorientierte Unternehmensphilosophie drückt sich in der Formulierung von Unternehmensgrundsätzen aus. Sie sind schriftlich fixierte Grundhaltungen eines Unternehmens und dienen als Grundlage für die Zielformulierung. Beispiele von Grundsätzen der Firmen Ciba-Geigy, Hoechst, IBM, Elida Gibbs und BP sind dargestellt von Hopfenbeck (1990, S.131ff.). Die Anstöße für die Formulierung ökologieorientierter Unternehmensgrundsätze kommen in der Regel von außen. Durch eine Einbeziehung des Umweltschutzes in die Unternehmensphilosophie wird Umweltschutz neben den bisherigen Oberzielen wie z.B. der Existenzsicherung oder Gewinnerreichung zum weiteren Oberziel des Unternehmens (vgl. Kapitel c., Abschnitt 11. I.). Die Zielerreichung sowie die Vermeidung von Ziel konflikten ist Aufgabe des strategischen Managements.
b) Strategisches Umweltmanagement In Abhängigkeit von den Ursachen und Gründen für eine Umweltorientierung und einem sich ändernden normativen Management stehen einem Unternehmen verschiedene Strategien offen, sich veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Vorab hat das Unternehmen Informationsgrundlagen zu schaffen, auf deren Basis strategische Entscheidungen gefällt werden. Die Analyse der gegenwärtigen Umweltnutzung und der damit verbundenen Stärken und Schwächen des
192
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwelt-Management-Systeme
Unternehmens dient der Sensibilisierung, der Problemanalyse, der Alternativenbewertung und der Kontrolle und Steuerung im Rahmen des Umweltmanagements. (MeffertJ Kirchgeorg 1989, S.62) Grundsätzlich kann ein Unternehmen, abhängig von den Ergebnissen der Chancen-Risiken- und Stärken-SchwächenAnalyse aktiv, neutral oder passiv auf ökologische Probleme eingehen. Eine Integrierung umweltorientierter Managementmaßnahmen mittels Beratungen in das strategische Management der Unternehmen, versucht zum Beispiel der Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umweltbewußtes Management e.V. (B.A.U.M. 1995). Der Arbeitskreis setzt hierfür z.B. Seminare, Kongresse, Checklisten, Schulungen, Informationsaustausch u.a. ein. (vgl. B.A.U.M. 1995) Wegen der großen Nachfrage nach praktischer Hilfe bei der Einführung einer umweltorientierten Unternehmensführung wurde 1991 die B.A.U.M.-Consult GmbH gegründet, die in Kooperation mit einer professionellen Unternehmens beratung die Aufgabe hat, im Rahmen konkreter Beratungsprojekte Unternehmen und Institutionen im Bereich Umweltschutz zu beraten. Die besondere Bedeutung des Entwurfs eines integrierenden Zielsystems sowie der Festlegung situationsadäquater Strategien heben Hopfenbeck/ JaschI Jasch (1996, S.425) hervor. c) Operatives Umweltmanagement
Normatives und strategisches Management eines Unternehmens bestimmen operative Entscheidungen. Die konkret von den Unternehmen ergriffenen umweltrelevanten Maßnahmen in den Funktionsbereichen der Leitung, der Leistungserstellung und des Marketings stellen die Operationalisierung vorher festgelegter Ziele und Strategien dar. Nach Meyer (1992, S.26) beinhaltet die Leitung eines Unternehmens die Koordination, die Organisation, die verantwortliche Entscheidung für die Einzelwirtschaft und die Vertretung nach außen gegenüber der Öffentlichkeit. Synonyme für den Begriff der Leitung sind die Begriffe Führung, Unternehmensführung, Management. Zu der Leitung eines Unternehmens gehören nach Ansicht von Hopfenbeck (1992, S.419) die zielorientierte Beeinflussung der Mitarbeiter und die zielorientierte Gestaltung und Steuerung von Teilsystemen und Prozessen. Die Festlegung des oben bereits beschriebenen operativen und strategischen Manage-
I. Grundlagen des Umweltmanagements und -Controlling
193
ments ist ebenfalls Element der Leitungsfunktion. Eine ökologieorientierte Leitung hat die Einbeziehung des Umweltschutzziels bei der Gestaltung und Steuerung des Unternehmens zum Ziel. Mögliche Maßnahmen im operativen Management spiegeln sich in der ökologieorientierten Gestaltung der Managementfunktionen Konzeption, Planung, Durchführung und Kontrolle in allen Unternehmensbereichen wider. Zentrale Aufgaben der Leitung sind die Mitarbeiterführung und die Festlegung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Zur zielorientierten Beeinflussung der Mitarbeiter ist es Aufgabe der Leitung, Motive und Ziele der Umweltorientierung den Mitarbeitern zu vermitteln. Die Grundsätze müssen den Mitarbeitern bekannt gemacht werden, um eine umweltfreundliche Kultur im Unternehmen zu schaffen. Erreichbar ist das zum Beispiel durch die Integration des Umweltschutzgedankens in die betriebliche Aus- und Weiterbildung und durch materielle und immaterielle Anreizsysteme. (vgl. z.B. Hopfenbeck 1990, S.128f. u. S.398) Eine weitere zentrale Aufgabe der Leitung ist die Verankerung des Umweltschutzes in der Aufbau- und Ablauforganisation. (vgl. hierzu Matzel 1994) In der Aufbauorganisation werden Stellen oder Abteilungen definiert, die den Umweltschutz wahrnehmen und die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungsbereiche der Stellen festlegt. Neben der freiwillig von Unternehmen geschaffenen Stelle eines Umweltschutzbeauftragten, dessen Tätigkeitsbereiche und Kompetenzen das gesamte Umweltmanagement des Unternehmens beinhalten soll, gibt es teilweise eine gesetzliche Ernennungspflicht für den Betriebsbeauftragen für Umweltschutz (Immissionsschutzbeauftragte BIMSchG §§ 53 ff, Gewässerschutzbeauftragte WHG § 21 a ff, Betriebsbeauftragte für Abfall AfG § 11 ff.), dessen Aufgabengebiete überwiegend im technischen Bereich liegen. (Hopfenbeck 1990, S.383) Als Vorbild kann die bereits länger eingeführte Zuständigkeit des Sicherheitsbeauftragten geIten. Im Rahmen der Ablauforganisation besteht in den Unternehmen das Ziel, die anfallenden Umweltschutzaktivitäten soweit wie möglich zu standardisieren. (Wicke et al. 1992, S.91) Der Ablauf, die zeitliche Neben- und Hintereinanderfolge der notwendigen Arbeiten im Bereich Umweltschutz, muß festgelegt und mit anderen Unternehmens bereichen abgestimmt werden. 13 Orth
194
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwelt-Management-Systeme
Pflanzenerzeugende Unternehmen unterliegen im Bereich der LeistungsersteIlung sehr stark (am stärksten: Chemiefirmen) den Anforderungen der Umweltpolitik. Die Festlegung von Immissions- und Emissionsgrenzwerten, Auflagen für Produktionsverfahren und Produktionsanlagen, das Verbot des Einsatzes von umweltschädlichen Stoffen oder das sich verschärfende Umwelthaftungsrecht (vgl. Sailer 1992) stellen für die Unternehmen eine unabdingbare Beeinflussung der Leistungserstellung dar (ausführlicher wurden umweltpolitische Instrumente bereits in Kapitel B., Abschnitt 11.2. c) dargestellt, ergänzend siehe auch Wicke 1993, S.169ff.). Aus diesem Grund kann sich kein Unternehmen der Forderung einer umweltorientierten Leistungserstellung völlig entziehen. Lediglich die Entscheidung, wie stark die Ökologieorientierung sein soll, ob nur die gesetzlichen Minimalanforderungen erfüllt werden oder die Unternehmen sich zum Ziel setzen, so umweltfreundlich wie möglich zu produzieren, ist abhängig von den intern verfolgten Umweltschutzzielen. Rentz (1991, S.808) fordert zum Beispiel als AufgabensteIlung für ein umweltorientiertes Produktionsmanagement, das System so zu ändern, daß (1) der Ressourcenverbrauch minimiert wird,
(2) die (bewerteten) Emissionen minimiert werden (bei gegebener Nachfrage), (3) die Investitionen kleiner werden und (4) die Kosten ebenfalls gesenkt werden. Grundsätzlich mögliche Maßnahmen einer umweltorientierten LeistungsersteIlung sind in Tabelle 40 aufgeführt. Werden für ein Unternehmen aufgrund einer sich verändernden Umwelt ökologische Anpassungsmaßnahmen notwendig, spiegelt sich dies auch im Marketing wider. Während die Leistungserstellung in erster Linie aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Umweltschutzmaßnahmen integriert, bezieht sich das "Öko-Marketing" schwerpunktmäßig auf die Erfüllung veränderter Zielgruppenansprüche des Unternehmens (Schmitt 1995, S.116). Durch den Einsatz ökologieorientierter Marketingmaßnahmen versuchen Unternehmen, bei ihren Zielgruppen und in der Öffentlichkeit Vertrauen zu schaffen. Vor allem die Öffentlichkeitsarbeit hat nach Schineis (1992, S.108) in diesem Zusammenhang die Aufgabe, das Unternehmen als Ganzes in der Öffentlichkeit,
I. Grundlagen des Umweltmanagements und -Controlling
195
also der gesamten gesellschaftlichen, politischen, kulturellen, sozialen und privaten Umgebung darzustellen und dadurch das Vertrauen gesellschaftlich relevanter Gruppen zu gewinnen. Tabelle 40
Maßnahmen umweltorientierter Leistungserstellung Bereich
Maßnahme
Forschung + Entwicklung
Entwicklung umweltfreundlicher Verfahrens- oder Recyclingtechniken je nach aktuellem Kenntnisstand im Bereich Umwelttechnik
Verfahrens änderungen
Optimierung des bestehenden Produktions verfahrens bzw. -prozesses mit dem Ziel schadstoffarmer, rohstoffund energiesparender Produktionsverfahren
Einsatz neuer Verfahren
Ersatz bestehender Produktions verfahren durch umweltfreundlichere Alternativen
Erweiterung von Produktions verfahren
Erweiterung des bisherigen Produktions verfahrens um vor- und nachgeschaltete (end of pipe) Umweltschutzmaßnahmen, z.B. Abwasseraufbereitung
Änderung der Stoffund Energieströme
Recycling, Rückgewinnung und Wiedereinsatz unerwünschter Kuppelprodukte oder von Endprodukten in der gleichen oder in einer anderen Produktlinie mit dem Ziel einer Kreislaufwirtst;haft
Quelle: verändert nach Wicke et al. 1992, S.167ff.
Zielsetzung der umweltorientierten Unternehmensführung ist es, durch Öffentlichkeitsarbeit ein positives Image für die Nutzung der Umwelt durch das Unternehmen aufzubauen. Tabelle 41 stellt mögliche Maßnahmen hierzu vor. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit hat sich in den letzten Jahren auch das Umweltsponsoring als Kommunikationsinstrument vor allem mittelständischer und größerer Unternehmen weiterentwickelt (vgl. Bruhn 1990, Ha1cour 1992 oder Schmitt 1996). Sponsoring beinhaltet dabei "die Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten, die mit der Bereitstellung von Geld-/Sachmitteln oder Dienstleistungen durch Unternehmen für Personen und Organisationen im sportlichen, kulturellen oder sozialen Bereich zur Er-
13"
196
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwelt-Management-Systeme
reichung unternehmerischer Marketing- und Kommunikationsziele verbunden sind." (Bruhn 1990, S.2) Tabelle 41 Maßnahmen umweltorientierter Öffentlichkeitsarbeit Pressekonferenzen, Presseveröffentlichungen zu Umweltmanagement Vorträge, Umweltseminare, Wettbewerbe Geschäftsbericht, Sozialbilanz, Öko-Bilanz eigene Umweltberichte, Umweltmitteilungen, Umweltberichte in Firmenund Werkszeitung Betriebsbesichtigung, Tag der offenen Tür Umwelttelefon UmweIt-, Naturstiftungen umweltorientierte Verbandsarbeit Quelle: Hopfenbeck 1990, S.340
An dieser Stelle ist auf die besondere Bedeutung von kommunikationspolitischen Maßnahmen im Rahmen der Nutzung natürlicher Ressourcen hinzuweisen (vgl. Abschnitt C. III. 1. c)). Auf entsprechende Instrumente und Konzepte wird dann im folgenden Abschnitt näher eingegangen, da an dieser Stelle noch das Führungssystem im Vordergrund der Betrachtungen steht. Umweltschutzmaßnahmen von Unternehmen im Bereich Absatz finden sich in der Vorbereitung, der Anbahnung, des Abschlusses und der Realisierung. Im Rahmen der Marktforschung steht das Konsumentenverhalten im Mittelpunkt. Aber auch Umweltschutzaktivitäten des Handels als "Gate-Keeper" sind für indirekt absetzende Unternehmen wichtig, wie die Auslistung phosphathaItiger Waschmittel bei Tengelmann zeigte. Die Analyse der Konkurrentenaktivitäten ist ebenfalls wichtiger Bestand einer umweltorientierten Marktforschung. Marketingmanager sehen Umweltschutz als zentralen Werbeinhalt der Zukunft. (Lorenz 1991, S.39, Merten 1993, S.39 und Meffert 1990b, S.149) Probleme ergeben sich, wenn Unternehmen im Rahmen der Kommunikation eine Umweltorientierung herausstellen, diese aber in den Unternehmensbereichen nicht durchsetzen. MeffertJ Kirchgeorg (S.203) bezeichnen dies als "Pseudo-Öko-Marketing", bei dem die Glaubwürdigkeit aufs Spiel gesetzt wird.
11. Gewinnung und Bewertung relevanter Umwelt-Informationen
197
Die Kontrolle von Umweltschutzaktivitäten ist die abschließende Funktion im Umweltmanagement, auf deren Basis neue strategische Entscheidungen gefällt werden. Der Einsatz ökologischer Kontrollrnaßnahmen wird von den Unternehmen im Vergleich zu anderen Maßnahmenbereichen eher weniger eingesetzt. Kontrollmöglichkeiten gibt es viele. Sie werden durch den gesetzlichen Druck für Unternehmen immer wichtiger. Eine mögliche Maßnahme ist die Erstellung einer Öko-Bilanz (siehe später Abschnitt D. 11. 1. c)), bei der "kontinuierlich, umfassend und nach verbindlichen Verfahrensvorschriften eine ökologische Bilanzierung" erfolgt, bei der durch Input-, Output-, Prozeß-, Produkt- und Substanzbilanzen die vom Unternehmen ausgehenden Wirkungen auf die Umwelt erfaßt und bewertet werden. (Hopfenbeck 1990, S.493)
11. Instrumente und Konzepte zur Gewinnung und Bewertung entscheidungs relevanter Umwelt-Informationen Nach Hallay/ Pfriem (1992, S.33ff.) ist die Informationsbeschaffung eine wesentliche Funktion jedes Umwelt-Controllingsystems. Im deutschsprachigen Raum hat sich das Umweltmanagement-Instrumentarium in den vergangenen Jahren unter den Begriffen Ökobilanz und Umweltcontrolling etabliert, während der anglo-amerikanische Raum mehr mit den Begriffen des Managementsystems und seiner Auditierung operiert (vgl. Hopfenbeckl JaschI Jasch 1996, S.426). Rück (1993, S.116ff.; vgl. auch Steger 1988b, S.24) unterscheidet detaillierter vier instrumentale Gruppen eines Umwelt-Controlling-Systems: (l) umweltschutzbezogene Planungs- und Informationsinstrumente inklusive
eines Früherkennungssystems, (2) Technologiefolgenabschätzung, (3) Umweltverträglichkeitsprüfung UVP und (4) Rechnungswesen, erweitert zur ökologischen Buchhaltung und Ökobilanz. Den institutionellen Aspekt eines Umwelt-Controllings kann in größeren Unternehmen eine Fachkraft (Umweltschutzbeauftragter) bis zu einem Team darstellen. (vgl. Rück 1993, S.173) In kleineren Betrieben sollte dies jedoch Chefsache sein.
198
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwelt-Management-Systeme
Die prinzipielle Notwendigkeit zur Integration ökologischer Aspekte (Umweltverbrauch und -belastung) in mikroökonomische Entscheidungsinstrumente ist mittlerweile anerkannt. (vgl. z.B. Picot 1977, Hopfenbeck 1990 oder auch Kreikebaum 1992) Beispiele für Instrumente zur Einbeziehung ökonomischer, technischer und naturwissenschaftlicher Untersuchungen sind Produktlinienanalyse und Ökobilanz. Zu beachten ist jedoch, daß diese Methoden in der Regel versuchen, objektive Wahrheiten nach außen darzustellen und nicht in erster Linie der innerbetrieblichen Entscheidungsfindung dienen. Dies gilt in gleichem Maße für noch zu entwickelnde Instrumente, die zur Umsetzung der EG-Öko-Audit-Verordnung gedacht sind. Außerdem ist zu beachten, daß die Aufnahme einer ökologischen Dimension in den ohnehin schon mehrdimensionalen Entscheidungsraum der Unternehmungen ein weiteres Anwachsen der Komplexität der Entscheidungen zur Folge hat. (Meffert et al. 1986b, S.143)
1. Instrumente a) Umwelt-" Kennzahlen "
Eine Anzahl von Autoren (z.B. Goldmann 1995; IHK 1995, S.55f.; Seidel 1995; Seidell Goldmannl Weber 1996, S.216) beschreiben Umweltkennzahlen als wichtiges Instrument im Rahmen eines Umwelt-Controllings. Für die Beurteilung der betrieblichen Wassernutzung schlagen sie die in Tabelle 42 enthaltenen Wasser- und Abwasserkennzahlen vor. Tabelle 42
Wasser- und Abwasserkennzahlen Input-Seite
Output.Seite
Gesamtwassereinsatz
Gesamt-Abwassermengen
Anteil Wasserart an Gesamtwassereinsatz
Abwasseranteile
Wassereinsatzquoten je Produkteinheit
Abwasserquoten je Produkteinheit
Wasserintensität (Produktionsprozeß bzw. Betrieb)
Quelle: nach SeldeV GoldmannJ Weber 1996, S.216ff.
11. Gewinnung und Bewertung relevanter Umwelt-Informationen
199
Ein neuerer Kennzahlen-Ansatz aus dem landwirtschaftlichen Bereich, der jedoch mit der hier behandelten Thematik kaum Überschneidungen aufweist, liegt vor von Reitmayr (1995). Zum produktmengenbezogenen (spezifischen) Betriebswasserbedarf siehe auch Möhlel Hoppe (1984, S.28). Huber (1991, S.l48) geht über diese begründeten Vorschläge noch hinaus und stel1t fest: "So, wie man von einer Arbeits- oder Kapital- oder Bodenproduktivität spricht, läßt sich folglich auch von einer Umweltproduktivität sprechen, speziel1 auch von einer Umwelteffizienz bzw. einer Umweltrentabilität." Nach seiner Meinung wird man künftig also nicht mehr nur der Kapital- und Arbeitsproduktivität Aufmerksamkeit schenken, sondern auch der UmweItproduktivität als dem Verhältnis von Ressourcen- und Umweltmedieneinsatz zum Betriebsergebnis. Dies sol1 sowohl für die technische (Effizienz), als auch für die monetäre Seite (Rentabilität) gelten. (vgl. Haasis 1992, S.122) Eine empirische Studie zu Wasserproduktivitätskennzahlen für Gemüse-, Obst- und landwirtschaftliche Kulturen liegt vor von Salman (1994). b) Produktlinienanalyse und Produktbilanzen Einen ersten Beitrag zur umweltorientierten Produktbewertung von der Rohstoffgewinnung bis hin zur Entsorgung leistet die von Zahrnt 1986 konzipierte und von der Projektgruppe Ökologische Wirtschaft (PÖW 1987) weiterentwikkelte Produktlinienanalyse PLA. Wesentliche Merkmale dieses Instruments sind (Sekuli Sieler 1995, S.417): (1) Diskussion alternativer Formen der Bedürfnisbefriedigung an Stelle eng definierter Produkte (Bedürfnisreflexion), (2) Orientierung am ökologischen Lebenszyklus im Rahmen einer Horizontalbetrachtung (Produktlinie ), (3) möglichst vollständige Betrachtung der ökologischen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen von Produkten bei der Vertikal betrachtung sowie (4) das Fehlen von starr festgelegten Bewertungs- bzw. Aggregationsmechanismen (Bewertungsoffenheit). Im Gegensatz zu gebräuchlichen Ökobilanzen (siehe Abschnitt D. 11. 1. c» untersucht die Produktlinienanalyse auch die sozialen und ökonomischen Aus-
200
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwelt-Management-Systeme
wirkungen eines Produkts in der Horizontalbetrachtung. Erst, wenn der Betrachter die Dimensionen Natur, Gesellschaft und Wirtschaft in verschiedene Kriterien aufgeschlüsselt hat, lassen sich produktinduzierte Folgewirkungen adäquat erfassen. Die PLA verzichtet auf eine numerische Bewertung und aggregiert Gesamturteile. Interessant und charakteristisch für die PLA ist ihre weitgehende Bewertungsoffenheit; Bewertungsgrundsätze und Aggregationsmechanismen sind nicht apriori fixiert. Der Bewertende beurteilt die Alternativen nicht nach einem streng vorgegebenen Raster, vielmehr werden die Bewertungskategorien vor dem Hintergrund aktueller Werte und Ziele reflektiert. Damit bleibt dieses Instrument flexibel gegenüber neuen Erkenntnissen und sich ändernden individuellen Wertvorstellungen. Hinsichtlich ökologischer Indikatoren geht es lediglich darum, Konfliktfelder innerhalb des Lebenszyklus eines Produkts durch eine einfache Plus-Minus-Bewertung sichtbar zu machen. (vgl. Stahlmann 1995, S.121) Das Ergebnis der vertikalen Aggregation kann schließlich, wie in Abbildung 17 dargestellt, in einem Bewertungsprofil festgehalten werden. In dem vorgestellten Beispiel werden die horizontalen Kriterienausprägungen der untersuchten (Produkt-)Alternativen mit einer einfachen Plus-Minus-Bewertung versehen und in einem Polaritäts profil grafisch veranschaulicht. Problembereiche und nicht akzeptable ökologische, soziale und wirtschaftliche (Produkt-)Auswirkungen bleiben dann für den Entscheidungsträger transparent.
Kriterien
sehr verbesserungswürdig
--
Natur
* Rohstoffverbrauch * Energieverbrauch * Abfallaufkommen * Schadstoffeintrag
hervorragend gelöst
-
0
--
~
(.,..-- ...........
Gesellschaft
* Arbeitszufriedenheit * Arbeitssicherheit
r-
Wirtschaft
* Produktqualität * Preis
-("-
-- --
+
++
1) -~)
--~)
Cf'- ,~
;t -'
--Variante I
Quelle: nach Karsch 1996, S.9
Abb. 17: Ergebnisprofil einer Produktlinienanalyse
-
-
Variante 2
11. Gewinnung und Bewertung relevanter Umwelt-Informationen
201
Vor allem bei der Vorbereitung von Innovations- oder Modifikationsentscheidungen ist die PLA somit geeignet, die Komplexität der Auswirkungen umfassend aufzuzeigen und den Untersuchungsgegenstand zu strukturieren. Ein neuerer Ansatz zu einer solchen Bilanzierung der Umweltverträglichkeit verschiedener bodenunabhängiger Kulturverfahren im Gemüsebau stammt von Herbold (1 994a u. 1994b). Er klammert die Ressource Wasser jedoch von seinen Betrachtungen aus. c) Öko-Bilanzen
Öko-Bilanzen haben sich - durch die methodisch fundierten Arbeiten der letzten Jahre (v.a. Müller-Wenk 1988 u. 1991; Ahbe/ Braunschweigl MüllerWenk 1990) - fortentwickelt von Marketinginstrumenten mit dem anrüchigen Image "der Auftraggeber bestimmt das Ergebnis" hin zu Entscheidungshilfen für Unternehmen und öffentliche Stellen sowie zur Erkennung von Schwachstellen und Optimierungsstrategien (v gl. Brede et al. 1994, S.l; Troge 1993, S.l6) Grundsätzlich wird ein auf die natürliche Umwelt erweitertes Rechnungswesen (welcher Form auch immer) als wichtiger instrumentaler Aspekt eines Umwelt-Controlling-Systems gesehen. (vgl. z.B. Rück 1993, S.144) In der Literatur ist jedoch noch kein allgemein akzeptierter und praktikabler Ansatz für eine Öko- oder Umweltbilanz zu finden. (Pfriem 1986, S.218) Eine knappe, jedoch sehr übersichtliche Abgrenzung verschiedener Ansätze einer Ökobilanz (z.B. Umweltbundesamt, IÖW, BUWAL) nimmt Kirchgäßner 1995, S.86ff.) vor. Nach Küpper/ Weber (1995, S.323) zielen Umweltbilanzen ,,( ... ) darauf ab, betriebliche Umweltwirkungen transparent zu machen, um über die Offenlegung von Chancen und Risiken für Umwelt und Unternehmen zu Ansatzpunkten für Verbesserungen zu gelangen." Zur Quantifizierung der Umweltbelastung erscheinen Umweltbilanzen erforderlich. Sie messen die einzelnen Kategorien der vom Unternehmen ausgehenden Einwirkungen separat in den entsprechenden physikalischen Einheiten wie Gewicht, Volumen, Energiemenge. Mit Hilfe der in Rechnungseinheiten ausgedrückten Gesamteinwirkungen pro Abrechnungszeitraum soll es möglich sein, die gesamten Umweltwirkungen verschiedener Unternehmen miteinander zu vergleichen oder bei einem speziellen Unternehmen die Entwicklung der gesamten Umweltwirkung von Jahr zu Jahr zu verfolgen. (Müller-Wenk 1978, S.17)
202
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwelt-Management-Systeme
Interessant erscheint auch der weiterentwickelte Ansatz des Fraunhofer-Insti tuts für Angewandte Materialforschung (Brede et al. 1994). Er untergliedert den Prozeß in drei Schritte: Eine Sachbilanz (technisch-physikalisch bestimmte Stoff- und Energieflüsse) zählt alle Umweltwirkungen wie z.B. Ressourcenentnahmen auf. Darauf folgt als zweiter Schritt die Erstellung einer Wirkbilanz (Einordnung der Wirkungen der Gesamt-Stoff-Flüsse auf die Umwelt), welche die zahlreichen Einzeldaten einer Sachbilanz zu einer handhabbaren Menge ökologisch relevanter Kenngrößen aggregiert. Bei der abschließenden Bilanzbewertung sind keine objektiven Vorgehensweisen mehr zu definieren. Sie erfolgt verbal-argumentativ und knüpft an individuelle Fragestellungen des Betriebes an. Ihre Basis bleiben jedoch die sehr gut formulierten und auch normierbaren Sachund Wirkbilanzen. Durch diese Art der ökologischen Bilanzierung wird der Unternehmens leitung eine Richtschnur für ein umweltverträglicheres Verhalten gegeben. Nach Steger (1988, S.205) läuft es bei einer derartig komplizierten Umweltbilanz darauf hinaus, daß eine staatliche Instanz nach normativen Vorgaben die Äquivalenzkoeffizienten und damit die Knappheiten bestimmt, was lediglich eine Verlagerung, nicht aber eine Lösung des Problems bedeutet. Diese Kritik an der Umweltbilanz führt zu der Frage, ob es überhaupt konsensfähige Antworten gibt, vergleichende Aussagen über die Umweltrelevanz verschiedener Produktionsverfahren und über die Belastbarkeit verschiedener Ökosysteme zu treffen. (vgl. Bechmann 1985, S.52; Troge 1993, S.16) Eine Befragung von Experten bestätigt jedoch, daß einheitliche, nachvollziehbare Umweltbilanzen eine unabdingbare Voraussetzung für ökologisch glaubhafte Marketingstrategien sind. (Halcour 1992, S.42) Auch Kirchgäßner (1995, S.104f.) kommt zu dem Fazit, daß Öko-Bilanzen je nach Auftraggeber, Ermessensspielraum und Datenaggregation als Ansatz zur Reduzierung des Glaubwürdigkeitsproblems brauchbar sind. Nach der Aufstellung von Umweltbilanzen lassen sich in einer ABC-Klassifizierung auch besonders dringliche (rot), weniger akute (gelb) und untergeordnete Belastungsindikationen festlegen. (vgl Hopfenbeck/ Jasch/ Jasch 1996, S.9) Die grundsätzliche Eignung dieses Instrumentes zur Umsetzung eines integrierten Umweltschutzes bestätigen Rex/ Kühl (1996, S.390). Eine aktuellere Wasserbilanz für Unternehmen der Ernährungsindustrie erstellt Borgeest (1995). Im Bereich der Pflanzenerzeugung diskutiert Rothenburger
11. Gewinnung und Bewertung relevanter Umwelt-Informationen
203
bereits 1988 die Zweckmäßigkeit von Umweltbilanzen in der Gartenbauwirtschaft. Eine Input-Output-Analyse als Wegbereiter wurde von demselben Autor bereits 1976 aufgestellt. Sie ergibt, daß die Gartenbauwirtschaft insgesamt mehr für Leistung für Schutz und Erhalt der natürlichen Umwelt aufbringt, als daß sie schädigend wirkt. Als Vorreiter erster Anwendungen neuerer Öko-Bilanzen im Gemüsebau kann Gysi (l993a und 1993b) gelten. Cansier (1993, S.288ff.) nennt als weitere Instrumente des Umweltmanagements außerdem noch Chancen-Risiken-Analyse, Stärken-Schwächen-Analyse, Portfolioanalyse und Szenariotechnik. Diese Techniken treten in ihrer Bedeutung jedoch gegenüber den vorher angesprochenen Instrumenten zurück bzw. sind teilweise in diese integriert und sollen daher nicht weiter behandelt werden. d) Kosten-Nutzwert-Methode
Aus betriebs-, aber auch volkswirtschaftlichen Vorbildern wie der Nutzwertanalyse (Zangemeister 1973) und der Kosten-Nutzen-Analyse (Schmidt 1981) leitet sich die von Rothenburger (1993, S.269 und 1995) vorgestellte KostenNutzwert-Methode ab. Sie stellt eine gut übersehbare, transparente, subjektive und objektivierbare methodische Entscheidungshilfe sowohl für Analysen, Planungen als auch für Erfolgskontrollen unter Berücksichtigung mehrerer klassischer (Pflanzenbau, Technik, Betriebswirtschafts- und Marktlehre) und neuer Disziplinen (Betriebliche Umweltökonomie) dar. Basis der Methode ist eine schichtförmige Matrix (siehe Tabelle 43). Die Spalten enthalten Alternativen gegenüber einem gegebenen Ist-Zustand. Aus Gründen einer besseren Übersichtlichkeit dürfen es jedoch nur wenige Alternativen sein. Zeilen enthalten zusammengefaßte Teilergebnisse aus den jeweiligen Schichten mit den jeweils zugrundeliegenden Daten. Für die Entscheidungshilfe ergeben sich drei Schritte: Der erste Schritt ist die Auswahl und Zusammenstellung vergleichbarer Teile mit einerseits Werthöhen, Z.B. ökonomischen Daten, technischen Koeffizienten, Befragungsergebnissen und ähnlichen, also kardinalen Ziffern. Andererseits können auch ordinale Werte gebildet werden, die Rangfolgen charakterisieren, z.B. besser-schlechter oder 1., 2 .... Platz. Der zweite Schritt addiert die Daten in den Blöcken, um Präferenzen zu bilden. Aus dieser zunächst unverknüpften
204
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwelt-Management-Systeme
Matrix hat dann in einem dritten Schritt eine Bündelung oder Amalgamierung zu erfolgen. Eine eindeutig günstige Lösung ergibt sich, wenn eine Alternative in allen Bereichen am vorteilhaftesten abschneidet. Tabelle 43
Matrix der Entscheidungsschichten für die Kosten-Nutzwert-Methode Teile mit gleichwertigen Koeffizienten Ist-Zustand 1. Schicht mit Unterteilungen
Ao
Entscheidungsalternativen 1 2 n A ln All All
A Ol
A lil
A 02
A I12
...
...
A o;
All;
ROl
Rll
Rll
Rln
A 2l
A 22
A 2n
Rll
R22
R2n
m. Schicht
A ml
A m2
A mn
m. Rangfolge
Rml
Rm2
Rmn
Rl
R2
Rn
1. Rangfolge
2. Schicht mit Unterteilungen
Am A 2l2
...
A 2l ;
2. Rangfolge
Gesamte Rangfolge
R02
Rom
L
Quelle: Rothenburger 1995, S.198
Nach bisherigen Erfahrungen bei der Anwendung für Gartenschauen (Rothenburger 1993, S.269), Erzeugungsverfahren (Rothenburger 1995, S.199 und Orth 1993 S.140ff., siehe Tabelle 44) und Landnutzungsstrategien (Rosatol Stellin 1993) sind für Entscheidungen durch nur einen Entscheidungsträger nicht nur kardinale Daten, sondern auch subjektive Wertschätzungen sehr entscheidend für das Ergebnis. Bei Gruppenentscheidungen hat Expertenwissen ein großes Gewicht, oder es sind demokratische Entscheidungsregeln zur Mehrheitsbildung
H. Gewinnung und Bewertung relevanter Umwelt-Informationen
205
anzuwenden. Es ist denkbar, daß z.B. zwischen ökonomischen und ökologischen Grenzbereichen Entscheidungen keine optimalen Lösungen, sondern eher Kompromisse bis hin zu Ausschließungslösungen ergeben. Auch in diesem Fall legt die Kosten-Nutzwert-Methode jedoch zumindest Probleme strukturiert offen. 1993 wendet Kurzbuch eine reine Nutzwertanalyse zur ökonomischen und ökologischen Beurteilung verschiedener Kultursysteme für Containerware in Baumschulen an. Ein Kriterium der Umweltverträglichkeit ist dabei der Wasserverbrauch. Die ähnliche jedoch wesentlich ältere ELECTRE-Methode nach Benayoun et al. (1966) und Roy (1971) basiert noch stärker auf der Zufriedenheit des Entscheidungsträgers. Wegen ihrer geringen praktischen Relevanz für die hier behandelte Problemstellung entfällt eine weitere Darstellung. Ebenso soll auf die von Witte (1993) vorgeschlagene Integration von Kosten-Nutzen- und Nutzwertanalyse zur Umrechnung in ausschließlich monetäre Werte wegen des noch ungelösten "Wechselkurs"-Problems (siehe Witte 1993, S.121) nicht näher eingegangen werden. Tabelle 44
Kosten-Nutzenwert-Matrix für den Pflanzenschutz bei Möhren Pnanzenschutz-Variante,.-_ _.....:.A.:......_ _---,......::::.......--_ _ _::.D_ _ _-. Schicht
Kurzbeschreibußa: Abtlammen S + Huckbürste + Handjäte + Kultur-
Kriterium
iikonnmisch quanüfizierbare Schicht· MengengerOst
Arbeitszeitbedarf Fest-AK
Arbeitszeitbedarf Saison-AK
schutznetz
Abflummen S + Reihenfräse + Häufeln + Kulturschutznetz
5.X Akh 27.7 Akh
6.5 Akh 3.6 Akh
394 DM 977 DM
412 DM 1.031 DM
WertgefÜst
Pflan7.enschutzkosten (ohne AK-Kosten) endeJbarer Erlös ... bezogen auf 1.000 ml 1. Ran ~i""e qualitativer Mengeneinsalz Betriebsmittelbedarf
4.
I.
Propan gas
4.
Propangas KulturNchutznetz 45 PS Geräteträger Abtlammgerät Heckanbau Häufelptlug Reihenfrä."Ie 5.
1.9 I.
3.
Kulturschutznetz
Bedarf an Maschinen und Geräten
2. Ran ~f'ol 't Noten und Urteile Veränderung des Produktionsrisiko!j Veränderung der Qualittit des Erntegutes Benotung der UmweltvenrJ. 'Iichkeit 3. Ran ~fol't
45 PS Geräteträger
Abtlummgerllt Heckanbuu Hackbürste
Endgültige ."regierte Rangfolge 1 ...._ _ _...;4;:..._ _ _-'-...;.::.;."--11_ _ _-'-'1._ _ _-'
Quelle: Orth 1993, S.142f.
206
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwelt-Management-Systeme
2. Konzepte a) Betriebliche Umweltinformationssysteme (BUlS) Eine umweltorientierte Unternehmensführung ist in erhöhtem Maße auf Informationen zur Vorbereitung und Fundierung ihrer Entscheidungen angewiesen. (Cansier 1993, S.301) Die herkömmlichen betrieblichen Informationssysteme wie das interne Rechnungswesen können die notwendigen Daten aber nicht liefern. Eine Erweiterung des betrieblichen Informationssystems ist daher angebracht. (vgl. auch Steffen/ Zell er 1987) BUIS haben die Zielsetzung, die Vielzahl von umweltrelevanten Informationen, die für ein effizientes Umwelt-Controlling benötigt werden zugänglich und verarbeitbar zu machen. (Lörcher 1994, S.3) Die Fülle von Daten und Informationen ist dabei ohne den Einsatz von EDV kaum noch mit vertretbarem Zeit- und Kostenaufwand zu meistern. Gemeinhin anerkannt sind als zukünftige unverzichtbare Funktions-, bzw. Anwendungsbereiche von BillS (vgl. Binder-KisseI1994, S.6, Kramer 1994, S.2, Lörcher 1994, S.3): (1) die Erstellung von Umweltbilanzen,
(2) Unterstützung des Umwelt-Controlling, (3) Simulation, Prognose und Optimierung unter ökologischen Gesichtspunkten, sowie (4) Teilnahme am EG-Öko-Audit-System. Schaltzentrale eines praxisbezogenen Umwelt-Controllingssystems ist damit ein betriebliches Umweltinformationssystem BillS. Es stellt quasi die Infrastruktur für die genannten Führungsaufgaben dar. Seine Aufgabe ist u.a. die Gewinnung von Daten für eine betriebsbezogene Umweltbewertung. Eine neue Dimension gewinnt diese Aufgabe mit der Einführung der Gefährdungshaftung im Umwelthaftungsrecht. Ein BUIS muß die ökologischen Problemfelder erfassen und beschreiben, die Zusammenhänge dieser Problemfelder mit den Aktivitäten der Unternehmung zeigen und mögliche Umsetzungsmechanismen innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen oder Restriktionen aufzeigen. (vgl. Hopfenbeck/
11. Gewinnung und Bewertung relevanter Umwelt-Informationen
207
Jasch/ Jasch 1996, S.418) Durch die Einbeziehung umweltorientierter Komponenten kann ein BUIS als Erweiterung des traditionellen Rechnungslegungssystems betrachtet werden. Als Arbeitsgrundlage eines Umwelt-Controllingsystems muß ein BUIS vor allem zwei Arten von Informationen gewinnen und verdichten (vgl. Lörcher 1994, S.4): (1) Informationen zu Stoffströmen (Produkte, Ressourcen, Schadstoffe) und
(2) Informationen über Verknüpfungen von Stoffströmen (Input-Output, Umweltkosten-Beschaffungskosten, Stoffströme-Umweltauswirkungen). Im Rahmen einer Erhebung der Mengenströme werden die Betriebsinputs an Rohstoffen und Energie dem Betriebsoutput an Produkten, Abfällen und Emissionen gegenübergestellt. Danach erfolgt eine Bewertung nach der Umweltrelevanz. So bildet ein Umweltinformationssystem die Grundlage für umweltorientiertes Management. Ein anderer Bereich der betrieblichen Umweltinformation ist die Erfassung von Daten, welche die normativen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Betriebes bestimmen. Informationen über alle umweltrelevanten Vorgänge im Unternehmen sind unerläßliche Voraussetzungen für jeden Umweltschutz. Aufgabe der Unternehmensführung ist es, externe Austauschbeziehungen und interne Prozesse entsprechend der unternehmensspezifischen Zielsetzungen durch Maßnahmen zu gestalten und zu lenken. Dafür werden Informationen über vergangene, gegenwärtige und zukünftige Vorgänge benötigt. Zur Beschaffung dieser Informationen verwendet das Unternehmen ein institutionalisiertes Informationssystem, nämlich das betriebliche Rechnungswesen und Kennzahlen. Die Regelung betrieblicher Prozesse (wobei nach Rentz 1991 dabei vor allem Stoff- und Energieströme im Vordergrund stehen) stellt sich damit wieder als ein Informationsproblem dar. (vgl. Hopfenbeck/ Jasch/ Jasch 1996, S.268) Funktionen und Adressaten eines BUIS sind in Abbildung 18 zusammenfassend dargestellt. Rex/ Kühl (1996, S.390) plädieren ausdrücklich für den Einsatz solcher Systeme in bezug auf eine Nutzung der natürlichen Ressource Wasser. Sie werden in dieser Meinung aus dem Agrarbereich unterstützt von Scheide/ Röll/ Doluschitz (1994).
208
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwelt-Management-Systeme
Für ein Umwelt-Controlling sind zunächst also Informationen über die Ressourcenverbräuche, die Ressourcenknappheit, Gefahrenpotentiale und Ersatzstoffe sowie über Emissionen zu beschaffen. An der Schnittstelle zu bereits vorhandenen betrieblichen Informationssystemen ergibt sich somit die Notwendigkeit, die Unternehmensleitung zusätzlich mit Informationen zur Inanspruchnahme der natürlichen Umwelt zu versorgen. (Rück 1993, S.87) Gerade die letztgenannten Aufgabenbereiche erfordern zwingend die Abkehr von isolierten Insellösungen, um die umweltrelevanten Unternehmensdaten vollständig und schnell zur Verfügung stellen zu können. (vgl. Kramer 1994, S.3)
Betriebliche Umweltinformationssysteme Erfassung, Quantifizierung und Bewertung des Einflusses unternehmerischer Tätigkeit auf die natürliche Umwelt
~
~
Externe Funktion
Interne Funktion
Umweltbezogene Kommunikation zwischen Unternehmen und Umfeld
Umweltorientierte Planung, Entwicklung, Steuerung und Kontrolle
Adressaten
Adressaten
* Kunden und Verbraucher
* Lieferanten und Abnehmer * Invbestoren * Versicherungen * Behörden
* Unternehmensführung * Abteilungen
* Umweltschutzbeauftragte * Mitarbeiter
* Öffentlichkeit
Quelle: nach Osterod 1988. S.41
Abb. 18: Funktionen und Adressaten betrieblicher Umweltinformationssysteme
Abschließend sind Chancen und Risiken eines Einsatzes von BUIS in nachfolgender Tabelle 45 aufgeführt:
11. Gewinnung und Bewertung relevanter Umwelt-Informationen
209
Tabelle 45 Chancen und Risiken des Einsatzes von BUIS
Chancen
Risiken
Rechtssicherheit
Einsatz zu komplexer Systeme, die nur zum Teil genutzt werden
Kosteneinsparung durch Abnahme zeitraubender Routinetätigkeit
Erstellungs- und Implementierungsaufwand
Kosteneinsparung durch Kenntnis umweltrelevanter Kostenfaktoren
Aufwand zur vollständigen und korrekten Datenerhebung
Erkennen strategischer Potentiale durch Kenntnis umweltrelevanter Betriebsdaten
übertriebene Erwartungen (keine Abnahme von Entscheidungen)
Quelle: nach Binder-Kissel 1994, S.17f.
b) Bewertung der Informationen nach ökologischen Gesichtspunkten
Wie sich bereits bei der Darstellung verschiedener Instrumente gezeigt hat, liegt nach der reinen Informationsgewinnung in der Bewertung der Daten eine wesentliche Funktion des betrieblichen Umwelt-Controlling. In diesem Bereich gibt es jedoch zur Zeit noch größere Defizite. (Rudolph 1989, S.25) MaierRigaud (1992, S.39) kritisiert dies sogar als Kernübel der Umweltökonomie und stellt diesen als selbstverständlich und unreflektiert akzeptierten Anspruch, die Umwelt in das Schema von relativen Preisen und Präferenzen, von Kosten und Nutzen zu integrieren, ihr also einen Preis zu geben, grundsätzlich in Frage. Strebel (1980) definiert als einen ersten Ansatz für eine Bewertung ökologische Kriterien in Form von Emissionen bzw. - sofern zu ermitteln - Immissionen und die ihnen entsprechende Wasser-, Boden- und Luftbelastung durch Schadstoffe. Zur Umsetzung dieser Kriterien in Beurteilungskalküle führt derselbe Autor (1980, S.133ff.) neben Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Umweltschutzinvestitionen Checklisten und Merkmalsprofile, Rechnungen mit Umweltindikatoren, Rechnungen auf Grundlage des Konzepts der ökologischen Buchhaltung, Entropieansatzrechnungen sowie Kosten-Nutzen-Untersuchungen an. (vgl. Stahlmann 1995, S.119ff., siehe auch Schreiner 1991. S.257ff.; Hutner 1995. S.II ff.) Eine Anzahl von Autoren gliedert diese Bewertungsmethoden in 140rth
210
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwelt-Management-Systeme
(1) verbal-argumentative Verfahren,
(2) kostenorientierte Bewertungsverfahren, (3) naturwissenschaftlich orientierte Bewertungsmethoden und (4) relativ-abstufende Methoden. Zu den verbal-argumentativen Veifahren zählen Umweltberichte, bei denen quantitative und qualitative Daten anhand ausgewählter Umweltkriterien ökologisch bewertet werden. Eine systematische Bewertungsgrundlage fehlt hier jedoch. Auch bei Umwelt-Checklisten steht diese Art der Bewertung im Vordergrund. Sie enthalten umweltrelevante Informationen des Betriebes, verzichten aber meist auf eine numerische Abstufung. Wegen der nicht systematisch festgelegten Bewertungskriterien besteht bei verbal-argumentativen Verfahren prinzipiell die Gefahr einer subjektiven Beurteilung mit der Folge, daß umweItbezogene Schwachstellen nicht erkannt werden.
Kostenorientierte Bewertungsveifahren versuchen, die betrieblichen Umwelteinflüsse in Geldeinheiten auszudrücken, sie zu monetarisieren. Als Maßstab dienen Geldwerte, die zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen aufgebracht werden müssen, Sanierungskosten für auftretende Umweltschäden und Kosten, die durch eine Schädigung der natürlichen Lebensgrundlagen entstehen. Eine erweiterte Betrachtungsweise berücksichtigt zusätzlich noch Ausweichkosten, Planungs- und Überwachungskosten sowie Vermeidungs- und Beseitigungskosten. Die entscheidende Hürde dieses Bewertungsansatzes sind Schwierigkeiten bei der Ermittlung dieser Kosten. Zur Kritik an Verfahren der monetären Bewertung siehe auch Endres et al. (\991, S.39ff.). Eine bekannte naturwissenschaftlich orientierte Bewertungsmethode, die ökologische Buchhaltung nach Müller-Wenk, ist dadurch charakterisiert, daß sie ökologische Knappheiten mit Hilfe von Öko-Faktoren berechnet. Ökologische Knappheit wird dabei als Relation zwischen Belastbarkeit einer Umweltressource und der heutigen Belastung definiert (vgl. Ahbe/ Braunschweig/ Müller-Wenk 1990, S.6). Solche Ökofaktoren berechnen sich somit aus der Umweltwirkung in einem bestimmten Gebiet und der dort tolerierten maximalen Belastung (Immission oder Verbrauch). Durch Multiplikation mit den Umweltwirkungen eines einzelnen Betriebes lassen sich aus den Ökofaktoren Ökopunkte ermitteln. So soll dieses Bewertungsverfahren einen relativ leichten Vergleich von Produkten,
11. Gewinnung und Bewertung relevanter Umwelt-Informationen
211
Verfahren und Betrieben ermöglichen. Auf der anderen Seite bringt es sehr unterschiedliche Umwelteinflüsse auf einen Nenner und vergleicht sie dann, was als sehr problematisch gilt (vgl. Pfriem 1983, S.178ff.). Als weitere Schwachstelle naturwissenschaftlich ausgerichteter Verfahren sieht Stahlmann (1995, S.123), daß die Formeln ökologischer Knappheit oft auf strittigen Grenzwerten mit teilweise erheblichen Bandbreiten basieren, so daß die Quantifizierung und absolute Bewertung mit Umweltbelastungspunkten eine naturwissenschaftliche Exaktheit nur vortäuscht. Dazu kommt, daß der Ansatz stark emissionslastig ist und andere Beeinträchtigungen wie Rohstofferschöpfung ausklammert. Nicht zuletzt bleiben Produktlinien, also der Erzeugung vor- und nachgelagerte Bereiche weitgehend unberücksichtigt. Die vierte Kategorie ökologischer Bewertungsverfahren ist der Einsatz relativabstufender Methoden. Beispiel hierfür sind Nutzwertanalyse und ABC-Methode. Die Nutzwertanalyse bewertet die Umweltindikatoren nach einem bestimmten Werteraster, dem Zielerfüllungsgrad. Die einzelnen Indikatoren werden gemäß ihrer Bedeutung nach Gewichtungsfaktoren eingestuft. Dieses Verfahren ermöglicht sowohl eine Aggregation, als auch eine Gesamtbewertung. Eine modifizierte Form der relativen Abstufung stellt die ABC-Analyse dar. Umweltrelevante Stoff- und Energieströme eines Unternehmens werden hinsichtlich ihres Belastungspotentials beurteilt und in verschiedene Klassen eingeteilt. Die Klassifizierung erfolgt auch nach der Dringlichkeit des Handlungsbedarfs. Auf eine in diesem Bereich problematische rein numerische Bewertung wird verzichtet. Dosis-Wirkungs-Zusammenhänge für Effekte, die ausgehend von Wasserqualitätsänderungen in ökologische Wirkungsbeziehungen eingreifen, sind schwer zu erfassen. Hier stellt sich die Frage, inwieweit solche Zusammenhänge in eine ökonomische Nutzenanalyse einbezogen werden sollen. Vertreter von Mehrkriterien-Verfahren und offene Bewertung sehen den Vorteil dieser Verfahren darin, daß die Erfassung der umweltspezifischen Effekte abseits von ökonomischen Analyseteil erfolgen kann (vgl. Pflügner 1988, S.56). Umweltrelevante Tatbestände sollen dabei nicht unbedingt in Form eines "Summenindex" (wie bspw. einem DM-Wert) zusammengefaßt werden, sondern in erster Linie Kriterien für den Ausschluß von Alternativen erkennen lassen. Dafür wird eine möglichst genaue, quantitative Erfassung der Wirkungen im Ökosystemzusammenhang verlangt, die weit über die unmittelbare ökonomische Relevanz hinaus wirken kann. 14'
212
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwelt-Management-Systeme
Der Entropieansatz (vgl. Georgescu-Roegen 1971; Stephan 1992) konzentriert sich auf den Energieeinsatz, woraus sich Recyclingmaßnahmen als wünschenswert ableiten (StrebeI1980, S.141f.). Mit dieser beschränkten Definition fällt der Ansatz jedoch nach Meinung von Pfriem (1983, S .181) von sich aus hinter die naturwissenschaftliche Einsicht, daß eine Trennung von Masse und Energie nicht haltbar ist. c) Öko-Audit
Über den gesamten Umfang des Inhaltes eines Umwelt-Audits gehen die Meinungen auseinander. Das Wort "Audit" bedeutet in der klassischen Übersetzung aus dem Englischen "Rechnungsprüfung". Im Begriff "Umwelt-Audit" spiegelt sich der Charakter der Prüfung (Fehler-Fahndung) wider, jedoch ist der zu prüfende Bereich längst nicht so eng begrenzt wie der der Rechnungsprüfung selbst. Dies liegt am weitläufigen Begriff "Umwelt". (vgl. Niemeyer/ Sartorius 1992, S.317) Adams (vgl. Adams/ Wolf 1990) versteht unter "Audit" in anderem Zusammenhang die Überprüfung der Wirksamkeit von festgelegten Maßnahmen innerhalb eines Systems mittels Soll-Ist-Vergleich. Dazu gehört nach seiner Meinung außerdem die Dokumentation des Geschehens und die Auswertung inklusive Einbindung der gewonnenen Erfahrungen in das auditierte System. Andere Autoren (z.B. Sietz/ Sondermann 1990) verstehen unter dem eigentlichen Audit ausschließlich den Soll-Ist-Abgleich der realisierten, betrieblichen Umweltstandards, die Darlegung der umweltbezogenen Stärken und Schwächen des Betriebes sowie die Abschätzung des Einflusses anstehender gesetzlicher Maßnahmen. Hierbei werden der Abschlußbericht und angeordnete Maßnahmen ebensowenig zum Audit gerechnet wie die Vorbereitungsarbeiten, also die Erhebung des umwelttechnischen Ist-Zustandes. Als Basis der vorliegenden Arbeit soll im weiteren die daraus entwickelte Definition von Niemeyer/ Sartorius (1992, S.318) Verwendung finden: "Unter einem Umwelt-Audit wird die Wirksamkeit organisatorischer und technischer Umweltschutzmaßnahmen innerhalb eines Unternehmens mittels Soll-Ist-Vergleich mit der dazugehörigen Dokumentation und der Auswertung inklusive Einbindung der gewonnen Erfahrungen in das auditierte System verstanden."
11. Gewinnung und Bewertung relevanter Umwelt-Informationen
213
Mit der EG-Verordnung über die freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung vom 23. Juni 1993, der "Öko-Audit-Verordnung" wurde ein Schritt hin zur Vereinheitlichung und Verbesserung der Organisation des betrieblichen Umweltschutzes getan. (vgl. Behrens 1995, S.53; SRU 1996, S.99) Zwar ist die Beteiligung an dem Auditverfahren grundsätzlich freiwillig, entschließt sich jedoch ein Unternehmen zur Mitwirkung, ist es verpflichtet, alle in der Verordnung festgelegten Verfahren einzuhalten (Art.3, Abs.l). Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen legt jedoch wegen der Beschränkung auf die Einrichtung und Bewertung eines Umwelt-Managementsysterns und der nur unzureichenden Erfassung und Bewertung der eigentlichen Umweltbelastungen durch die Unternehmen eine Ergänzung durch (Betriebs-)Umwelt-Bilanzen dringend nahe (SRU 1996, S.99). Tabelle 46
Bestandteile eines Öko-Audit und ihre Einbindung in ein BUIS
Erste Umweltprüfung
Registrierung und Bewertung aller umweltrelevanten Aktivitäten am Standort z.B. anhand einer Bilanz
Umweltpolitik
Dokumentation umweltpolitischer Vorgaben
Umweltziele und -programm
Dokumentation, Planung und Kontrolle konkreter Ziele z.B. anhand von Kennzahlen
Umweltmanagementsystem
Unterstützung der Dokumentation
Umweltbetriebsprüfung
Abdeckung von Routineaufgaben
Umwelterklärung
Automatisierung insbesondere des regelmäßig zu erstellenden Datenteils
Quelle: verändert nach Lörcher 1994, S.5
Einen ausführlichen Überblick von der Entstehungsgeschichte bis zur Durchführung dieser Umwelt-Audit-Verordnung gibt Schumacher (1996). Nähere Informationen zu Vorteilen, Teilnahmevoraussetzungen, dem Verfahren selbst und Förderungsmöglichkeiten geben zum BeispielInformationsschriften und ein Leitfaden des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen (1 995a, 1995b; vgl. auch Sietz 1991; Niemeyer/ Sartorius 1992,
214
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwelt-Management-Systeme
S.320; Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten 1995, S.45ff.). Wesentliches Modul des EU-Öko-Audits als Instrument ökologischer Risiko-Vorsorge, wie es Steger (1990, S.53) sieht, ist die Öko-Bilanz (vgl. Günther 1991, S.61; Kirchgäßner 1995, S.105ff.). Daneben hat das EG-ÖkoAudit verschiedene andere Bestandteile, die in unterschiedlicher Art und Weise von einem BUIS profitieren können (Tabelle 46). Wie bereits in den Abschnitten C. III. 1. c) und C. III. 2. dargestellt, legen auch Unternehmen mit Pflanzenerzeugung großen Wert darauf, ein positives Bild in der Öffentlichkeit abzugeben. Aus dieser Perspektive erscheint der primäre Nutzen eines Öko-Audits bezogen auf verschiedene Zielgruppen (siehe Abbildung 19), nämlich Vertrauen zu schaffen und ein grundsätzlich umweltschonendes Verhalten des Unternehmens zu signalisieren, besonders interessant. Dieser Ansatz wird daher im folgenden Kapitel E., Abschnitt IV. 2. bei der Vorstellung der eigenen Methodik wieder aufgegriffen.
Öffentlichkeit
Kunden
Nutzen des Öko-Audits: Vertrauensbildende Maßnahmen
Wirt.chaftlichkeit
Versicherungen
Quelle: nach Karsch 1996, S.9
Abb. 19: Nutzen eines Öko-Audits bei verschiedenen Zielgruppen
Die Möglichkeiten und Probleme eines speziellen Agrar-Öko-Audits werden von Fachleuten und interessierten Praktikern derzeit heftig und kontrovers diskutiert. (vgl. ZVG 1997, S.67) Auf der einen Seite stehen Vertreter, die eine Einbeziehung der Pflanzenerzeugung vor allem wegen der personellen Struktur
11. Gewinnung und Bewertung relevanter Umwelt-Informationen
215
(meist FamiIienbetriebe) nicht für sinnvoll halten, da dies gleichbedeutend mit einem Mehr an Arbeitsbelastung wäre. (vgl. z.B. Brinkjans 1996, Menzel 1996) Die Gegenseite sieht in erster Linie das Öko-Audit als eine Chance zur weiteren Profilierung umweltschonender Produktion (ZVG 1996, S.596). Sie geht davon aus, daß mittelfristig der Großteil der Betriebe in einen Marktzwang der Teilnahme gerät, da sich ein Dominoeffekt aus einer Teilnahme von Unternehmen der Nahrungsmittelverarbeitung und Ernährungswirtschaft ergibt. (vgl. z.B. Reinthai 1996, S.866) Selbst für nicht der Ernährung dienende gartenbau liehe Produkte entstand in der Folge unter Federführung der Lehr- und Versuchsanstalt Heidelberg eine Richtlinie zur Betriebsanerkennung .. Umweltgerechter kontrollierter Zierpflanzenbau". Sie zielt auf die Anerkennung ganzer Betriebe und enthält Wasser/ Bewässerung als explizit zu auditierenden Bereich (WilhelmI Bahnmüller 1996). Auf die besondere Bedeutung betrieblicher UmweItinformationssysteme zur Bereitstellung umweltrelevanter Betriebsdaten für die Durchführung eines ÖkoAudits weisen noch einmal Binder-Kissel (1994, S.4) hin. Zum Stand der Normung entsprechender Verfahren siehe C1ausen (1994).
3. Umweltberichterstattung a) Umweltberichte RWE legte 1985 nach eigenen Angaben als erstes Unternehmen der Öffentlichkeit eine ..Umweltbilanz" vor, die der Jahresbilanz beilag. In den letzten Jahren hat die Veröffentlichung von eigenständigen Umweltberichten sehr stark zugenommen. In Deutschland publizieren zum Beispiel BASF, Bayer, Beiersdorf, Daimler-Benz, Henkel, Kraft Jacobs Suchard, Lufthansa, Rewe, Roche und Siemens (die entsprechenden Berichte liegen dem Autor vor). Ziele und Grundsätze solcher Umweltberichten zeigt Abbildung 20 auf. Die Ziele der Umweltberichterstattung fassen Hopfenback/ J asch! J asch (1996, S .390) folgendermaßen zusammen: (I) Interne / externe Bezugsgruppen erhalten jeweils die gewünschten Informationen zu den Umweltaktivitäten, -wirkungen und -zielen der Unternehmung.
216
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwelt-Management-Systeme
(2) Durch die Öffnung (im Sinne von Transparenz) der Unternehmung in ihrer Kommunikationspolitik wird das z.T. gestörte Vertrauensverhältnis verbessert. Ziele
*' Transparenz
• Nachprüfbarkeit
* Kontinuierliche Verbesserung
Kommunikationsgrundsätze • Dialogorientierung • Glaubwürdigkeit * Zielgruppengerechtigkeit * Verfügbarkeit
! ......
Umwel tberichterstattung
* Integration in
Unternehmenskommunikation
!
Darstellungsgrundsätze
~
• Wahrheit • Vollständigkeit • Klarheit * Kontinuität • Vergleichbarkei t • Vorsicht
Durchruhrungshedingungen • Machbarkeit • Nützlichkeit
Quelle: Clausenl Fichter 1996, S.I13
Abb. 20: Ziele und Grundsätze von Umweltberichten
Auch Kirchgäßner (1995, S.IIO) sieht diese positive Signalwirkung und zusätzlich eine Erhöhung der Glaubwürdigkeit in der Veröffentlichung ökologieorientierter Informationen, vor allem dann, wenn diese - wie im Öko-Auditverfahren vorgesehen - durch ein unabhängiges Testat belegt sind. In Ihrem Anspruchsgruppenmodell führen Clausen/ Fichter (1995, S.20) Zielgruppen von Umweltberichten und der von ihnen zu erwartende Nutzen auf (siehe Abbildung 21). Vergleichbare Zielgruppen und ähnlich geartete Nutzensvorstellungen hat auch Wicke (1988, S.21) in seinem Plädoyer für ein offensives, gewinnorientiertes Umweltmanagement im Sinn (siehe auch Pfriem 1995, S.9). Noch ausführlicher zur Umweltberichterstattung siehe z.B. Fichter (1995). Als Kriterien für eine effiziente und erfolgreiche Umweltberichterstattung nennen Hopfenbeckl JaschI Jasch (1996, S.390) Zielgruppengerechtigkeit, Mög-
11. Gewinnung und Bewertung relevanter Umwelt-Informationen
217
lichkeit zum Feedback, Regelmäßigkeit, Ziel orientierung, Benchmarking (Vergleich mit den Besten), Quantifizierung der Aussagen, Maßzahlen für eine Umweltperformance, Standortbezug und externe Testierungl Verifizierung.
Umweltbehörden Vertrauen, Information
Nachbarn Störfallinformation
Banken Versicherungen Vertrauen, Konditionen
Verbände Vertrauen, Information Il
~
~
..
Medien Wirkung, Image
.;t
Kunden Interesse, Nachfrageerhöhung
~
Schulen Wissenschaft
Umweltbericht Umwelterklärung
,.
Beschäftigte Motivation, Einbindung in VerbesserungsjJrozeß
~
"
Teilnahme an einem Audit Vertrauensbildung
\
Lieferanten Zusammenarbeit Entwicklung und Qualitätssicherung Information
Quelle: Clausenl Fichter 1996, S.24
Abb. 21: Zielgruppen und Nutzen von Umweltberichten Hallay/ Pfriem (1992, S.169f.) fordern hierzu sieben Bestandteile: (1) Darstellung des Unternehmens,
(2) Darstellung des Leistungsangebots, (3) Darstellung der Stoff- und Energieaustauschbeziehungen, (4) Ökologische Beurteilung, (5) Darstellung der Veränderung gegenüber der Vorperiode,
218
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwe1t-Management-Systeme
(6) Darstellung des Umweltprogramms, (7) Darstellung der Methode und ihrer Grenzen. Daraus ergeben sich auch die generellen Schwächen der meisten Berichte wie (1) zu wenig quantitatives Material, (2) zu wenig meßbare Zielangaben, (3) Darstellung nur des Guten unter Weglassung des Schlechten, (4) keine externe Testierung, (5) zu wenig Feedback. Je nach Auftraggeber, Ermessensspielraum und Datenaggregation hält deshalb z.B. Kirchgäßner (1995, S.104f.) die einzelnen Ansätze zur Reduktion des Glaubwürdigkeitsproblems durch Umweltberichterstattung für mehr oder weniger brauchbar. b) Umwelterklärungen
Vom Umweltbericht zu unterscheiden sind standortspezifische Umwelterklärungen, für die es verbindliche Inhalte gibt und die extern überprüft werden. Noch gibt es in Deutschland keine gesetzliche Verpflichtung, interne Umweltdaten zu veröffentlichen. Demzufolge entscheidet jedes Unternehmen selbst, wie welche Themen in welchem Umfang angesprochen und erläutert werden und worüber nicht berichtet wird. Im Entwurf des Allgemeinen Teils eines Umweltgesetzbuches ist eine umweltbezogene Publizitätspflicht, beschränkt auf Großunternehmen (in Form einer Aktiengesellschaft) vorgesehen. (Hopfenbeckl Jasch/ Jasch 1996, S.391). Nach Artikel 5, Verordnung EWG 1836/93 ist eine Umwelterklärung für die Öffentlichkeit verfaßt und enthält in knapper und verständlicher Form Angaben (vgl. Karsch 1996, S.5) zu: (I) der Tätigkeit am Standort, (2) Beurteilung wichtiger tätigkeits bezogener Umweltfragen, (3) Zusammenfassung der Zahlenangaben über Schadstoffemission, Rohstoff-, Wasserverbrauch, etc.
11. Gewinnung und Bewertung relevanter Umwelt-Informationen
219
(4) Darstellung von Unternehmenspolitik, -programmen und Managementsystem, (5) Termin der nächsten Umwelterklärung, (6) UmweItgutachter. Hinsichtlich erwartetem Nutzen und Zielgruppen von Umwelterklärungen können die zu UmweItberichten angeführten Punkte übernommen werden (vgl. Abschnitt D. 11. 3. a». Wie bereits beim Öko-Audit erwähnt, ist auch im Zusammenhang mit Umweltberichten und Umwelterklärungen an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich auf die Bedeutung dieser Konzepte als spätere Grundlage für das eigene Modell (Kapitel E., Abschnitt IV. 2.) hinzuweisen. Wesentlich erscheint dabei eine präzise Ansprache der Zielgruppen, die Übermittlung ausgewählter Informationen über das tatsächliche Umweltverhalten eines Unternehmens sowie der Nutzen vor allem in Form eines Vertrauenszuwachses.
4. Vergleich und Beurteilung der vorgestellten Ansätze Darüber, daß Unternehmen umweltrelevante Informationen erheben sollen besteht weitgehend Konsens. Art und Umfang der notwendigen Erhebungen können dabei jedoch nach Wirtschaftsbereich und individuellem Unternehmen teilweise stark variieren. Grundsätzlich läßt sich feststellen, daß wenige Unternehmen der Pflanzenerzeugung bereits formale Instrumente zur Gewinnung entscheidungsrelevanter Umwelt-Informationen nutzen. Die überwiegende Mehrzahl der vorgestellten Konzepte wurde darüber hinaus von Betriebswirtschaftlern entwickelt. Sie sind deshalb zum einen nur vorsichtig auf Unternehmen aus Landwirtschaft und Gartenbau anzuwenden und bedürfen zum anderen einer gezieIten Anpassung auf die dort vorliegenden besonderen Gegebenheiten (siehe hierzu auch das Fazit des aktuellen Kapitels). Über die Art und Weise, wie man dem Problem der ökologischen Bewertung gerecht werden soll, finden sich in der Literatur noch keine einheitlichen Lösungsvorschläge (siehe Abschnitt D. 11. 2. b». Bechmann (1985, S.75ff.) schlägt eine stofflich-energetische Bilanzierung vor, bei der durch Verknüpfung von Daten des Betriebes mit Wissen über deren ökologische Auswirkungen Planungs-
220
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwelt-Management-Systeme
aussagen getroffen werden sollen. Durch die vorsorgeorientierte Anwendung stofflich-energetisch ansetzender Konzepte sollen in frühzeitigen Planungsstadien die möglichen Umweltauswirkungen von Prozessen abgeschätzt und Lösungen gesucht werden. Pfriem (1986, S .218) kritisiert diesen Ansatz, da die Frage, wie man direkt auf der unternehmenspolitischen Ebene durch Stoff- und Energiebilanzen eine andere Entscheidungsqualität implementieren soll, nicht befriedigend gelöst wird. Tabelle 47 gibt eine zusammenfassenden Überblick über die vorgestellten verschiedene Instrumente des Umweltcontrollings an hand ausgewählter Merkmale wie zugrundeliegende Intention, Daten, Art der ökologischen Bewertung, umweltrechtlicher Bedeutung sowie Eignung zur Umweltberichterstattung bzw. Veröffentlichung.
Tabelle 47
Vergleich verschiedener Konzepte und Instrumente Instrument Merkmal
Intention
Umwehbericht
Darstellung umweltpoütischer Aktivitä-
Produkt linienanlyse Profile sollen dem
Verbraucher beim
ten, Erfolge und Vergleich von ProZielvorstellungen des dukten heUen Unternehmens
Datengrundlage
ökologische Bewertung
umwehrechtliche Bedeutung
geeignet 7.ur Umweltberichterstattun ' VerOffentlichung
Öko-Bilanz Ökologisierung des gesamten Unternehmens durch
Erstellen eines MaHnahn~nkatalogs
anhand einer Schwachstellenanalyse Ist-Analysen, Stoffsystematische Inputbeliebige Auswahl und Energiebilanzen; Output-Analyse und produkt- oder unProdukt lebenswegtemehmensbezogener produkt- oder analyse umfaßt das produktgruppenbeDaten anze Unternehmen zo~ene Daten keine noch nicht einheitlich z.B. ABC-Bewerdefiniert. PLA enthük tungsschema darilber hin-aus S07:iale und Ukonomische Fakkeine absehbar, Normierung Überprüfung und in Bearbeitung Einhaltung umweltrechtlicher Vorschriften im geswnten Unternehmen nein für die breite Offentlichkeit bestinullt (kundenorientiert)
nein für den Verbraucher. Anwender, Kunden; soll auf dem Produkt abgedruckt sein
Quelle: verändert nach Geiger 1996, S.38f.
ja
Konzept Umwek-Controllin~
Planung, Steuerung und Kontrolle des Unternehmens unter ökologischen Aspekten
Öko-Audit Verbesserung des betrieblichen Umweltschul7.eS durch Autbau eines UInweltmanagen-.entsystems und regel-
mü1\ige UmwehbetriebsprUfun ' umfaßt da.'i gesamte Ist-Analyse be7.ogen Unternehmen auf der auf den Datengrundlage einer Betriebsstand()rt Öko-Bilanz vgl. Öko-Bilanz
keine Bewertungsmaßstäbe vorgesehen
vgl. Öko-Bilanz
EU -Verordnung
ja
Ergebnisse suwie jährlicher Bericht für die Öffentlichkeit Katalog der Umweltschut7.maßnahvorgesehen men werden i.d.R. Oll" Kurzfassung veröffentlicht
ja 'ährlich aktualisierte Umweherklärung (unter Berucksichtigung des Betriebsgeheill1ßis.~s) wie es die EU-Verordnung
III. Fazit Kapitel D
221
IH. Fazit Kapitel D Nach ausführlicher Darlegung der Entscheidungssituation in Kapitel C baut das soeben abgeschlossene Kapitel D in Richtung Entscheidungsunterstützung auf den gewonnenen Erkenntnissen auf. Dies geschieht zunächst durch eine Einordnung der Thematik in den Bereich des Umweltmanagements bzw., enger gefaßt, in das Umwelt-Controlling. Dabei zeigt sich, daß der Systemansatz des Umwelt-Controlling mit seinen Grundfunktionen (Koordination, Reaktion, Adaption und Antizipation) ideal auf das Problem der Wassernutzung zur Pflanzenerzeugung zugeschnitten ist. Relevante Zielsetzungen sind dabei vor allem eine Verbesserung der Reaktionsfähigkeit auf ineffiziente Ressourcennutzung sowie eine Verbesserung der Anpassungsfähigkeit an durch Umweltaspekte bedingte Veränderungen im Unternehmensumfeld. Die bisher mehrmals betonte wichtige Rolle des öffentlichen Ansehens im Zusammenhang mit der Ressourcennutzung findet ihre Wiedergabe in einer Ausrichtung des Controllingsystems auf verschiedene gesellschaftliche Gruppen als wichtige Beobachtungsfelder. Zur Unterstützung unternehmerischer Entscheidungen existiert eine Reihe von Instrumenten und Konzepten, die eine Gewinnung und Bewertung entscheidungsrelevanter Umwelt-Informationen beinhalten. Bedeutung für die im folgenden Kapitel vorgestellte Ressourcen-Nutzungs-Analyse haben dabei vor allem die Kosten-Nutzwert-Methode, die zum einen durch ihre Überschaubarkeit und Transparenz sowie zum anderen durch ihre Möglichkeit subjektiver, jedoch objektivierbarer Entscheidungshilfe besticht. Zusätzlich weist die neu zu entwikkelnde Methodik Komponenten aus Produktlinienanalyse (Fehlen starr vorgegebener Bewertungs- bzw. Aggregationsmechanismen und möglichst vollständige Betrachtung der ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien) bzw. Öko-Bilanzen (Offenlegung betrieblicher Umweltwirkungen in einer Sachbilanz) auf. Aufgrund der starken Ausrichtung auf ökologische Anspruchsgruppen rückt auch der Öko-Audit mit Umwelterklärung bzw. Umweltbericht in den Vordergrund. Für die aktuelle Problemstellung interessant ist hier vor allem die positive Signalwirkung und eine Erhöhung der Glaubwürdigkeit durch die Veröffentlichung wassernutzungsbezogener Informationen.
222
D. Entscheidungsunterstützung durch Umwelt-Management-Systeme
Insgesamt ist also die im folgenden Kapitel E vorgestellte RessourcenNutzungs-Analyse als Umwelt-Controlling-Instrument einzuordnen. Dabei steht auf der einen Seite der Bilanzierungs- und Steuerungsansatz für eine ökologisch orientierte Unternehmensführung im Vordergrund; auf der anderen Seite erhält sie zusätzliches Gewicht durch die Möglichkeit einer sachlichen und informativen Umwelterklärung. Im sich nun anschließenden Kapitel E soll eine methodische Hilfe für Ent-
scheidungen, Planungen und Kontrolle, mit besonderer Berücksichtigung unterschiedlicher Zielsetzungen und Zielgewichtungen wirtschaftlicher Leistungserstellung, vorgestellt werden. Es handelt sich hierbei um die so benannte Ressourcen-Nutzungs-Analyse RNA, eine zum Umwelt-Controlling-Instrument weiterentwickelte Form der Kosten-Nutzwert-Analyse. Als ihr gewichtigster Vorteil ist anzusehen, daß sie für Entscheidungsträger relevante Kriterien der betrieblichen Ressourcen- bzw. Umwelt-Nutzung explizit vorsieht und demnach transparent macht (vgl. hierzu Heinen 1966, S .49ff.).
E. Umwelt-Controlling mit der Ressourcen-Nutzungs-Analyse RNA I. Festlegung wichtiger Strukturmerkmale Aus der beschriebenen Problemstellung (siehe dort) lassen sich in Verbindung mit den entscheidungstheoretischen Überlegungen aus Kapitel C und den Anforderungen an ein effizientes Umwelt-Controlling-Instrument aus Kapitel D eine Reihe von Strukturmerkmalen für das zu entwickelnde Managementinstrument ableiten. Dies sind vor allem: (1) Beschränkung auf nur ein Umweltkompartiment, nämlich die Ressource
Wasser, (2) Verankerung im Zielsystem der Unternehmung und (3) Herleitung aus bereits bekannten Ansätzen.
1. Beschränkung auf das Umweltkompartiment Wasser Von seiner Grundstruktur her soll das Instrument der Ressourcen-NutzungsAnalyse nicht auf die Anwendung auf nur ein Umweltkompartiment beschränkt bleiben. In der vorliegenden Arbeit steht jedoch für die folgenden Betrachtungen weiterhin das Umweltkompartiment Wasser im Vordergrund. Wie in Kapitel B., Abschnitt I. 2. dargelegt (siehe dort) wird durch eine Anzahl konkurrierender Nutzungs- und Verwendungs zwecke gerade qualitativ hochwertiges Wasser auch im niederschlagsreichen Mitteleuropa zunehmend knapp. Eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser höchster Reinheit genießt jedoch größte Priorität. Für die Erzeugung von Pflanzen und Pflanzenteilen ergibt sich dabei in zweifacher Hinsicht Handlungsbedarf. Landwirtschaft und Gartenbau haben auf der Input-Seite ebenfalls Bedarf für hochwertiges Wasser. Es ist essentiell für die Erzeugung von Pflanzen und Pflanzenteilen. Im Gegensatz zur Ressource Boden besteht jedoch aus einzelbetrieblicher Sicht nicht unbedingt ein Eigeninteresse an einem sparsamen und schonendem Umgang mit Wasser zur
224
E. Umwelt-Controlling mit der RNA
langfristigen Sicherung der eigenen Existenzgrundlage. Auf der Output-Seite beeinträchtigt garten bauliche/ landwirtschaftliche Leistungserstellung daher Verfügbarkeit und Qualität der natürlichen Ressource, vor allem für Trinkwasserzwecke, unter Umständen erheblich.
2. Verankerung im Zielsystem der Unternehmung Die prinzipielle Notwendigkeit zur Integration ökologischer Aspekte (Umweltverbrauch und -belastung) in mikroökonomische Entscheidungsprozesse ist mittlerweile anerkannt (vgl. Kapitel D). Beispiele für erste Ansätze zur Einbeziehung ökonomischer, technischer und naturwissenschaftlicher Untersuchungen sind Produktlinienanalyse und Ökobilanz. Zu beachten ist jedoch, daß diese Methoden in der Regel versuchen, objektive Wahrheiten nach außen darzustellen, und nicht in erster Linie der innerbetrieblichen Entscheidungsfindung dienen. Dies gilt in gleichem Maße für noch zu entwickelnde Instrumente, die zur Umsetzung der EG-Öko-Audit-Verordnung gedacht sind. Ziel der Überlegungen ist deshalb die Vorstellung einer Methodik zur Kontrolle und Planung einer sparsamen und belastungsarmen Wasserverwendung in Unternehmen. Wegen seiner mengenmäßig überragenden Bedeutung für die Pflanzenerzeugung (vgl. Orth 1995, S.51) liegt der Schwerpunkt dabei auf dem Verwendungszweck Bewässerung. Der Ressourcen-Nutzungs-Analyse, kurz RNA genannt, liegt dabei der in Abbildung 22 dargestellte Stoffkreislauf zugrunde. Drei Schritte des Ge- und Verbrauchs von Wasser sind hierbei hervorzuheben: Auf der Input-Seite können Unternehmen grundsätzlich ihren Wasserbedarf aus eigenen Brunnen, dem kommunalen Leitungsnetz, aus Oberflächengewässern oder durch Sammlung von Niederschlägen decken. Innerhalb der Unternehmen wird der Rohstoff dann zur Bewässerung, zur Düngung, als Medium im Pflanzenschutz sowie zur Reinigung von Produkten, Maschinen und Anlagen verwendet. Auf der Output-Seite schließlich entläßt das Unternehmen die natürliche Ressource nach der Nutzung auf dem Weg der Versickerung, der Verdunstung, als Oberflächenabfluß oder als Bestandteil von Produkten und Nebenprodukten.
I. Festlegung wichtiger Strukturmerkmale
I
Brunnen
+
I
Bewässerung
I I
I
Kommunales Leitungsnetz
+
Input
I
• •
Obernächengewässer
Unternehmen
II
225
Niederschlagssammelanlagen
.--------""'\.J r--------., r--------.., 1________ .J
JI IL ________ Düngung
I
Pflanzenschutz
I
I I________ Reinigung
Maßnahmen Ycrfahrcns()plimicrung zur Belastungs .. Konlmlltcchnikcn minderung Abwol.'\scrbchwuJlung
Maßnahmen Mchrfill.:hvcrwcndung zur Einsparung Rezirkulicrcmlc Systeme FaktorsuhsliIUli()ß Vcrluslminimicrung
Output
,
Natürliche Umwelt
?
Verdunstung Lurt
Produkt", Kompost Biosphäre
I
Versickerung
Obernächenabnuß
I
~ Tidenversickerung
Niederschlag
Wasserressource
I
f--
Quelle: eigene Darstellung
Abb. 22: Wasserverwendung in Unternehmen mit Pflanzenerzeugung
a) Zugrundeliegender Stoffkreislauf Entlang des in Abbildung 22 dargestellten Weges von Wasser durch ein pflanzenerzeugendes Unternehmen sind eine Vielzahl unternehmerischer Entscheidungen zu treffen. Diese werden in der RNA nach Entscheidungsschichten strukturiert dargestellt. In ihrem Aufbau basiert diese Matrix auf der von Heinen bereits 1966 (S.114) vorgenommenen Einteilung unternehmerischer Ziele (Tabelle 48).
150nh
226
E. Umwelt-Controlling mit der RNA
Tabelle 48
Einteilung unternehmerischer Ziele Ziele
Zuordnung
quantifizierbar
Leitzahlen
Charakterisierung in Gelddimensionen erfaßbar in Mengendimensionen erfaßbar
nicht quantifizierbar
Leitsätze
verbal formulierbar
Leitbilder
nicht oder nur schwer verbal formulierbar
Quelle: nach Heinen 1966, S.114
In der vorgestellten Form stellt die RNA-Matrix sicher, daß alle mit der Wassernutzung verbundenen Ziele und Kriterien erfaßt werden. Die Art der Ziel beziehung (indifferent, komplementär oder konkurrierend) oder die Richtung einer gewünschten Veränderung (Wachstum, Erhalt, Schrumpfung) ist dabei zunächst von untergeordneter Bedeutung. b) Grundnutzen des Wassereinsatzes Aus Sicht der Unternehmensführung stellt die Erzeugung hochwertiger Produkte den Grundnutzen allen Faktoreinsatzes dar. Applizierte Wassermenge und -qualität bestimmen Menge und Qualität der erzeugten Pflanzen und Pflanzenteile. (vgl. Kapitel C., Abschnitte III. I. d) und III. I. e) Sowohl Überschuß als auch Defizite in Wassermenge und -qualität ziehen Ertrags- und Qualitätsminderungen der Produkte nach sich. Damit kann der Grundnutzen des Wassereinsatzes als erste Entscheidungsschicht mit den Komponenten Produktmenge und Produktqualität festgehalten werden. c) Mengen und Qualitäten eingesetzter Produktionsfaktoren
Eine zweite Entscheidungsschicht beinhaltet Mengen- und dazugehörige Qualitätskriterien eingesetzter Produktionsfaktoren, soweit diese an die Wassernutzung gekoppelt sind. Zunächst sind Menge und Qualität sowohl des ein- als auch des freigesetzten Wassers festzuhalten. Als genereller Maßstab für die Wasserqualität kann dabei die in Kapitel B., Abschnitt IV. vorgestellte Qualitäts-Leiter herangezogen Wer-
I. Fest\egung wichtiger Strukturmerkmale
227
den. Die Wasserqualität richtet sich hierbei nach den Möglichkeiten, die Ressource für andere Zwecke zu verwenden, und ist urnso höher, je vielfältiger die Nutzungsmöglichkeiten sind. Auf den unteren Stufen der Leiter dagegen verbleiben dagegen wenige oder keine Verwendungszwecke mehr. Zwischen Wasser und den klassischen Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital sind mehrfach Substitutionsbeziehungen nachgewiesen. (vgl. Kapitel c., Ab-
schnitt ill. 1. f») Um ein vollständiges Gesamtbild des Wassereinsatzes zu gewinnen, sind daher diese beiden Faktoren ebenfalls zu berücksichtigen. Unterschiede in Verfügbarkeit und Entlohnung der Mitarbeiter lassen es zweckmäßig erscheinen, das I 301 (305 bzw. 390)
9 4 7 10 10 6 2
Quelle: WasseIWirtschaftsamt Nümberg
Verschärft wird die Situation im Knoblauchsland durch die zusätzliche Wasserentnahme aus 350 privaten Brunnen und die Hefefabrik die ebenfalls einen hohen jährlichen Wasserbedarf hat. Tabelle 96 enthält eine Zusammenstellung der wassernutzungsgebundenden Arbeit im Verband, unterschieden nach der Qualifikation der für ihre Ausführung benötigten Arbeitskräfte. Ausgegangen wird dabei von 26 Wochen jährlicher Beregnungszeit und einem ebenso langen Zeitraum, in dem die Bewässerungsanlagen zwar stillgelegt sind, jedoch trotzdem wöchentlich kontrolliert werden. Jeder der 25 Speicherbecken- (SA) und 25 Direktförderanlagen (DA) ist ein Abteilungsvorsteher (V entspricht Managementebene) und ein Regenwart (W entspricht Ebene der Fachkraft) zugeteilt. Außerdem sind in der Tabelle als zusätzliche Qualifikationsstufe noch Hilfskräfte (H) unterschieden. 24 ül1h
370
G. Fallstudien Tabelle 96
Einsatz des Faktors Arbeit (Ist-Situation) Tätigkeit
Anzahl AK I3
Qualifikation AK I3
Dauer
Akh l4 p.a.
Inbetriebnahme SA
I
W
3 h p.a., 25 Becken
75
Außerbetriebnahme SA
I
W
3 h p.a., 25 Becken
75
I
W
2 h p.a., 25 Anlagen
50
I
W
2 h p.a., 25 Anlagen
50
I
W
0,5 h * 26 Wo+ I,Oh*26 Wo 0,25 h * 26 Wo +0,5 h * 26 Wo
Inbetriebnahme DA Außerbetriebnahme DA Kontrollgänge SA
975
Kontrollgänge DA
I
W
Zählerablesung
I
W
Zählerablesung
I
V
Mäharbeiten SA
4
H
3 h * 25 An!., 2 mal p.a.
600
Mäharbeiten DA
2
H
2 h * 25 An\., 2 mal p.a.
200
Reinigung Speicherbecken
4
H
5 h * 25 An!., 1,5 mal p.a.
750
4,0 h * 50 An!. 4,0 h * 50 An!.
487,5 200 200
Summe
3.663
Summe (gerundet)
3.700
Quelle: eigene Erhebungen
13
AK = Arbeitskraft
14
Akh = Arbeitskraftstunden
11. Anwendung der RNA in einem geschlossenen Anbaugebiet
371
Für die genannten Zahlen zum Arbeitsbedarf liegen Aussagen bzw. Unterlagen des Wasserverbandes vor, so daß nicht auf Normdaten zurückgegriffen werden mußte. In der Summe ergibt sich somit ein durchschnittlicher jährlicher Arbeitsbedarf von rund 3.700 Akh, der auf die Wassernutzung zurückgeht. Für die Gewinnung, Verteilung, Lagerung und Ausbringung der Wasserressource ist Kapital in Form von Brunnen, Pumpen, Becken, Leitungen etc. gebunden. Tabelle 97 enthält eine Aufstellung entsprechender Objekte im Untersuchungsgebiet. Tabelle 97
Einsatz des Faktors Kapital (Ist-Situation) Objekt
Beschreibung
25 Oirektförderanlagen
25 15kW-Unterwasserpumpen 25 Brunnen (Ergiebigkeit 10-45 m3/h) 25 Oruckwindkessel Leitungslänge 300-1.500m je Anlage
25 Speicherbeckenanl.
25 Beton-Hügel-Becken (Fassungsvermögen 1.000-1.500 m3) 32 Brunnen 247,5 kW-Pumpen 815 kW-Pumpen
50 Pumpenhäuser
gesamte installierte Leistung: 1.400 kW gesamte erdverlegte Leitungslänge: 60 km PVC ON 80-150
Quelle: Wasserwirtschaftsamt Nürnberg
Aufgrund fehlender Unterlagen sind keine Aussagen zum wasserbezogenen Gesamt-Kapitaleinsatz möglich. Zum Zweck einer Abschätzung der wirtschaftlichen Folgen einer Umstellung der Wassernutzung reicht jedoch eine entsprechende Auflistung des für eine Wasserbeileitung notwendigen Kapitaleinsatzes in der noch zu entwickelnden Alternative (vgl. Abschnitt G. 11. 4.) aus. d) Kosten
Mit der Wasserbereitstellung verbunden sind vor allem Energiekosten für den Betrieb der Pumpen, aber auch Treib- und Schmiermittelkosten, Lohnkosten für den Anlagendienst (nur soweit die Arbeit nicht ehrenamtlich geleistet und damit 24"
372
G. Fallstudien
in Tabelle 96 aufgeführt ist) sowie weitere Betriebs- und Unterhaltskosten. Hierzu kommen Kosten für Bodenproben, die in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Der Freistaat Bayern übernimmt hiervon derzeit 50%, die in der entsprechenden Position bereits nicht mehr berücksichtigt sind. Eine Zusammenstellung der verschiedenen Kostenpositionen für das Jahr 1995 ist in Tabelle 98 wiedergegeben. Ihnen liegt ein Wasserverbrauch von 1.029.363 m3 zugrunde. Berücksichtigt sind ausschließlich Kostenpositionen, die direkt mit der gegenwärtigen Art und Weise der Wassernutzung zusammenhängen. Sonstige Kostenpositionen, die hiervon weitgehend unabhängig sind (wie zum Beispiel die Lohnkosten der Bürokräfte) sind separat aufgeführt, da sie bei einer Umstellung der Wassernutzung voraussichtlich gleichbleiben. Die jährlichen Kosten der Wassernutzung belaufen sich demnach im Wasserverband 1995 auf rund 809 IDM. Tabelle 98 Kosten der Wassernutzung 1995
Kostenart
Kosten (DM)
Strom (833.431 kWh)
338.379
Betriebskostenl Anlagendienst
14.362
Lohnkostenl Anlagendienst
165.266
Unterhaltung allgemeine Anlagen
87.167
Brunnensanierung
200.000
Grundwasserschutz (Bodenproben)
1.321
Öffentlichkeitsarbeit
2.399
Summe
808.894
Sonstige (z.B. Bürokosten)
103.639
Quelle: Wasserwirtschaftsamt Nümberg
e)/mage
Wichtige externe gesellschaftliche Gruppen im Zusammenhang mit der Wassernutzung sind für den Wasserverband Kunden, Vertreter der Wasserwirtschaft, Anwohner, politische Entscheidungsträger der umliegenden Städte und Ge-
H. Anwendung der RNA in einem geschlossenen Anbaugebiet
373
meinden, des Landtags und der zuständigen Ministerien (Staatsministerien für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bzw. Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen mit den untergeordneten Ämtern und Anstalten) sowie Fachkollegen in berufs ständischen Organisationen (Gemüseerzeugerverband Knoblauchsland, Bayerischer Bauernverband). Innerhalb des Verbandes sind darüber hinaus Meinungen und Urteile der Mitarbeiter und ihrer Familien zur Art und Weise der Verwendung der natürlichen Ressource zu beachten. Zur Erhebung des Wassernutzungs-Images der Gemüseerzeugung im Knoblauchsland wurde deshalb im Frühjahr 1997 eine Befragung in den Städten Nürnberg, Fürth und Erlangen durchgeführt. Interviewer verteilten an zwei Tagen in den Fußgängerzonen der drei Städte insgesamt 500 zweiseitige Fragebögen mit Schreibunterlagen und nahmen sie von den Auskunftspersonen nach dem Ausfüllen wieder entgegen. Als Verfahren fand eine Quotenauswahl nach den Merkmalen Alter und Geschlecht Anwendung. Insgesamt wurden 478 auswertbare Fragebögen abgegeben. Tabelle 99 beschreibt die Repräsentanz der Stichprobe bezüglich der beiden Merkmale Alter und Geschlecht. Tabelle 99 Repräsentanz der Stichprobe zur Imageanalyse
Altersgruppe
Anteil Frauen (%) Stichprobe (Bevölkerung)
Anteil Männer (%) Stichprobe (Bevölkerung)
15-18 Jahre
2 (2)
2 (2)
19-25 Jahre
10 (5)
5 (5)
26-45 Jahre
26 (20)
21 (19)
46-60 Jahre
10 (12)
12 (11)
61-65 Jahre
3 (3)
1 (3)
über 65 Jahre
3 (7)
4 (12)
Quelle: Wasserwirtschafts amt Nümberg
Wenngleich die Untersuchung somit keinen Anspruch auf vollständige Repräsentanz erheben kann (Abweichungen v.a. bei den jüngeren Frauen und älteren Männern), ist dennoch die Mehrzahl der Gruppen für die weiteren Zwekke der Untersuchung zufriedenstellend vertreten. Die Ergebnisse der Imageanalyse sehen aus wie folgt:
G. Fallstudien
374
Mehr als 92% aller Befragten gaben an, das Knoblauchsland als Gemüseanbaugebiet zu kennen. Dieser hohe Bekanntheitsgrad stellt eine gute Voraussetzung zur Beurteilung der Wassernutzung dar. Nicht nur Auskunftspersonen, die von außerhalb des Untersuchungsgebietes kommen, sondern auch solche, die angeben das Knoblauchsland nicht zu kennen, bleiben von den weiteren Betrachtungen ausgeklammert. Tabelle 100 gibt einen Überblick über Informationsquellen, aus denen gesellschaftliche Gruppen wie Gärtner/ Landwirte, Konsumenten, politische Entscheidungsträger, Entscheidungsträger in Banken und Versicherungen sowie Lieferanten ihr Wissen über das Knoblauchsland beziehen. Tabelle 100
Informationsquellen der relevanten Gruppen Konsument (n=332)
Gärtner/ Landwirt (n=15)
politischer ET (n=9)
ETin Bank! Versicherung (n=12)
Zulieferer (n=5)
Tageszeitung
64%
60%
44%
92%
25%
Erzeuger
27%
53%
67%
33%
-
Fernsehen
23%
13%
11%
25%
40%
8%
-
-
-
Hörfunk
15%
20%
22%
Tag "Offene Tür"
13%
13%
11%
Quelle: Wasserwirtschaftsamt Nürnberg
Damit kann die besondere Bedeutung der Tageszeitung als Informationsquelle vor allem für Konsumenten festgehalten werden. Bei der Auswahl von Medien für kommunikationspolitische Maßnahmen ist weiterhin die unterschiedlich häufige Nutzung dieser Medien durch die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu berücksichtigen. Kernpunkt der Befragung zum WassernutzungsImage des Knoblauchslandes waren Fragen zur Bedeutung der Wasserressource (Mengen- und Qualitätsaspekt) für die Auskunftsperson sowie zur Unzufriedenheit (vgl. Abschnitt E. 11. 2. b) und Gleichung 3) mit der gegenwärtigen Wasser-
11. Anwendung der RNA in einem geschlossenen Anbaugebiet
375
nutzung durch die Gemüseerzeuger. Die Bedeutung der Merkmale sparsame bzw. schonende Wassernutzung wird von allen Befragten als sehr hoch eingestuft (Tabelle 101). Tabelle 101
Bedeutung eines schonenden bzw. sparsamen Umgangs mit der natürlichen Ressource Wasser für die Befragten überhaupt nicht wichtig
nicht wichtig
teils teils
wichtig
sehr wichtig
"schonend" (Qualitätsaspekt)
2%
2%
9%
19%
68%
"sparsam" (Mengenaspekt)
2%
3%
15%
22%
58 %
Quelle: eigene Erhebung, n=40 I
Abbildung 57 gibt das in der Analyse ermittelte Image der Wassernutzung im Knoblauchsland wieder. Die Skalierung ergibt sich aus der verwendeten Skala (vgl. Abschnitt E. 11. 2.). Theoretisch liegt dabei das schlechtest mögliche Image (die höchste Unzufriedenheit der gesellschaftlich relevanten Gruppen) bei einem Wert von 40. Dieser ergibt sich aus der verwendeten Gleichung 3 bei der Codierung für höchste Wichtigkeit (5) sowie für Mengen- und Qualitätsaspekt der jeweils größtmöglichen Abweichung von Ideal- und wahrgenommener Ausprägung (4). Das entgegengesetzte Ende der Skala - ein sehr gutes Image bzw. vollkommene Zufriedenheit der Auskunftspersonen mit der Ressourcennutzung ist erreicht, wenn die Abweichung zwischen Ideal- und wahrgenommener Ausprägung jeweils gleich Null ist. Die Gewichtungen der Merkmale "schonender" bzw. "sparsamer" Umgang mit Wasser sind dabei ohne Relevanz. Eine Interpretation der Abbildung 58 in diesem Sinn führt somit zu dem Ergebnis, daß die Auskunftspersonen mehrheitlich der Meinung sind, die Gemüseerzeuger im Knoblauchsland könnten schonender bzw. sparsamer mit der Ressource Wasser umgehen. Dabei bestehen jedoch Unterschiede zwischen den
376
G. Fallstudien
betrachteten Gruppen. Trotz der geringen Anzahl an befragten politischen Entscheidungsträgern stimmt es bedenklich, daß gerade die Vertreter dieser wichtigen Gruppe das schlechteste Bild von den Unternehmen haben. Jedoch soIlten auch die Aussagen der übrigen Befragten Anlaß zu Überlegungen sein, wie das Image zu verbessern ist, da auch sie noch von sehr guten Werten entfernt sind.
Konsumenten
Fachkollegen
Politische ET
ET Bank! Versicherung
Zulieferer
sehr gut
Image der Wassemutzung
sehr schlecht
Quelle: eigene Erhebung Abb. 57: Wassernutzungsimage des Knoblauchslandes
f) Wassernutzungsmatrix
TabeIle 102 faßt die Ergebnisse der Bestandsaufnahme der Wassernutzung im Verband in einer Wassernutzungsmatrix zusammen. In der vorgesteIlten Form beschreibt die Matrix die gegenwärtige Art und Weise der Wassernutzung im Knoblauchsland. Sie bilanziert relevante Kriterien der Ressourcennutzung, strukturiert nach verschiedenen Betrachtungsschichten. Basis sind vor aIlem Daten und Informationen aus dem Wasserverband, die, wo nötig, durch zusätzliche Fakten und Angaben des zuständigen Wasserwirtschaftsamtes ergänzt wurden. Insgesamt charakterisiert die Wassernutzungsmatrix den Verband als ein Unternehmen, das seine Mitgliedsbetriebe relativ preisgünstig mit dem kostbaren Naß versorgt. Problematisch hierbei ist, daß es nicht immer nachfragegerecht und
11. Anwendung der RNA in einem geschlossenen Anbaugebiet
377
termingemäß ausreichende Mengen der Ressource zur Verfügung stellen kann und daß die Qualität des Rohstoffes problembehaftet ist. Das eigentliche Problem besteht jedoch in den externen Effekten dieser Wassernutzung, die sich ansatzweise in dem beschriebenen Image darstellen. Eine Fortführung der Wasserversorgung in der bestehenden Form erscheint daher unwahrscheinlich. Tabelle 102
Wassernutzungsmatrix 1995 Schicht Grundnutzen
Kriterium Produkt
Kumpunente I ()() ha Spargel
350 ha Freiland-GemOse 30 ha Unter-Glas-Gemüse 80 ha Tabak
Faktoreinsatz
0,86 Mio m' aus 48 Aachbrunnen (mit duochschniUlich 160 mg Nitrat)
Wasser -Input
0.29 Mio ml aus 8 Tietbr. «50 mg Nitrat/I) Versickerung, Nitratff'dcht 153 t N p.a.
Wasser - Output
Arbeitsbedouf
I .550 Akh Hilfskräfte 1.913 Akh Regenwan 200 Akh Abteilungsvorsteher
Kosten
Kapituleinsatz Bewässerung Wasser - Input
? 809TDM
Image
Konsumenten Fachkollegen Politische ET ET Bank! Versicherung Zulieferer
~
I
~
I
~
I
r
I
0
5
I
10
sehr gut
15
20
Image
2S
30
3S
I
40
sehr schlecht
Quelle: eigene Zusammenstellung
Veränderungen mit der Absicht die momentane Wassernutzung im Verbandsgebiet zu verbessern, werden von zwei Seiten initiiert. Zum einen sind die Mitgliedsbetriebe selbst mit der gegenwärtigen Situation unzufrieden. Zum anderen wurden extern Vorgaben gemacht (Fördermöglichkeit verbunden mit Auflagen). Um Veränderungen zu bewirken bzw. um eine verbesserte Wassernutzung zu erreichen, stehen dem Wasserverband prinzipiell vier Möglichkeiten offen. Diese bestehen
378
G. Fallstudien
(I) in einer Veränderung des Erzeugungsprogrammes (z.B. Verzicht auf Kultu-
ren mit einem hohen Wasserbedarf, (2) in der Aufnahme neuer Kulturen in das Sortiment), (3) in einer Veränderung der Wassernutzungstechnik (Umstellung der Wassernutzungstechnik) und (4) in Maßnahmen der Kommunikationspolitik (vor allem Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung des Images). Restriktionen können hierbei die Erfordernis einer kontinuierlichen Marktbelieferung oder einer kompletten Angebotspalette, die begrenzte Verfügbarkeit von Technologie oder Kapital sowie Fähigkeiten des Kultivateurs sein. Maßnahmen, die grundsätzlich eine Verbesserung der Situation erwarten lassen, sind deshalb genau auf ihre Realisierbarkeit und mögliche weitere Auswirkungen zu prüfen. Zielsetzung der vorliegenden empirischen Studie ist es, die voraussichtlichen Auswirkungen einer grundSätzlich denkbaren Alternative abzuschätzen. Diese eine Alternative wird näher betrachtet, weil die Wasserwirtschaft als Instanz mit umfassend technischen und wasserbezogenen Wissen sie aus mehreren - zunächst jedoch nicht wirtschaftlichen Gründen - präferiert. Analog zur Vorgehensweise bei der Erstellung der Wasser-Nutzungs-Matrix 1995 enthält der nächste Abschnitt die Entwicklung einer entsprechenden Matrix für diese Alternative, genannt A s. 4. Geplante Wassernutzung (Alternative As) Ein geeigneter Lösungsansatz zur Verbesserung der beschriebenen Ist-Situation basiert auf (I) einer Einstellung der Beregnung aus dem Grundwasser im Knoblauchsland und dem Schließen der 8 Tiefbrunnen, (2) der Gewinnung von ausreichend Wasser entsprechender Qualität im Regnitztal und Verteilung im Knoblauchsland sowie (3) einer Verringerung des Nitrataustrages in das Grundwasser durch Anwendung eines neuen Nitratkonzeptes.
11. Anwendung der RNA in einem geschlossenen Anbaugebiet
379
In den folgenden Abschnitten wird eine umfassende Vorschätzung der voraussichtlichen Folgen dieser geänderten Wassernutzung im Untersuchungsgebiet bei Realisierung der Wasserbeileitung vorgenommen. Gegenstand der Betrachtung ist hierbei wiederum nicht nur die Ressource selbst, sondern die Gesamtheit der mit ihrer Nutzung verbundenen Aspekte. Aufgrund der Unsicherheit der exakten Auswirkungen der Alternative erfolgt in den Schichten Grundnutzen, Faktoreinsatz, Kosten und Zusatznutzen die Darstellung je einer optimistischen und einer pessimistischen Variante. Die optimistische Variante unterstellt einen Eintritt der für den Verband günstigsten Konstellation, während die pessimistische Variante den denkbar ungünstigsten Fall abbildet. Beide Varianten werden aus begründeten Annahmen entwickelt, in der Realität jedoch voraussichtlich nicht genau so eintreten. Sie zeigen vielmehr den Raum grundsätzlich möglicher Entwicklungsrichtungen auf in dem sich die tatsächlichen Konsequenzen der Alternative A s nach einer Realisierung später wiederfinden. a) Physischer Wasserfluß Abbildung 58 zeigt schematisiert den physischen Wasserfluß im Wasserverband nach Umsetzung der geplanten Wasserbeileitung (vgl. auch noch einmal Abbildung G. 11. I.). Hier sind zwei verschiedene Arten von Bezugsquellen verfügbar: Uferfiltrat aus einer Brunnengalerie (15 Brunnen, 10-20 m tief) nahe der Regnitz sowie falls diese Quelle nicht ausreichen sollte - ersatzweise auch eine direkte Entnahme von Flußwasser. Das zur Verfügung stehende Jahreskontingent von 1,9 Mio Kubikmetern wird in diesem Falle auch nutzbar sein, da nach der Fertigstellung des Rhein-Main-Donau-Kanals die Regnitz im Bereich der geplanten Wassergewinnung einen Abfluß von ca. 20 m3/s nicht mehr unterschreitet. Vorgesehen sind zudem Spitzenförderungsmengen, die an 30 Tagen im Jahr (zeitweise Entleerung des Rohrleitungssystems) bis zu 45.000 Kubikmeter pro Tag garantieren. Eine UV -Entkeimungsanlage ist ebenfalls auf die Bewältigung dieser Spitzenlast ausgelegt. Von einem Hauptpumpwerk läuft eine 10,2 km lange Hauptdruckleitung (DN 600) quer durch das Verbandsgebiet. An ihrem Ende befindet sich ein Hochbehälter, der bis zu 10.000 Kubikmeter Wasser speichern kann. Das gesamte Verbandsgebiet ist in 6 jeweils ca. 150 ha große Unter-Einheiten aufgeteilt, in denen Druckerhöhungspumpwerke die Verteilung zu den Be-
380
G. Fallstudien
wässerungsanlagen übernehmen. Jedem DPW ist zum Ausgleich von Verbrauchsunterschieden und Spitzenlasten noch ein 5.000m3-Speicherbecken zugeordnet. In der Summe stellt dieses Speichervolumen (30.000 m3) einen Tagesbedarf dar. Die Applikation erfolgt über bereits bestehende Beregnungsanlagen, deren Zahl noch erhöht werden kann, so daß Kulturen auf einer Gesamtfläche von bis zu 800 ha mit Wasser versorgt werden können. Quellen Brunnengalerie zur Gewinnung von Uferfiltrat der Regnitz ersatzweise direkte Flußwasserentnahme 1,9 Mio m3 p.a. Jahreskontingent, Spitzenförderung: 400 l/s = 1.440 m3/h bzw. 30.000 m3/d (an 30 Tagen im Jahr: 600 l/s =2.160 m31h bzw. 45.000 m3/d)
+
Aufbereitung Anlage zur UV -Entkeimung, Durchsatz maximal 600 l/s
1
Überführung Hauptpumpwerk (HPW) mit Schaltwarte, 10,2 km Druckleitung DN600
•
Lae:erune: lO.ooom3 -Hochbehälter und 6 abgedeckte Speicherbecken (je 5.ooom3 )
+
Distribution
6 Druckerhöhungspumpwerke (DPW),
Druck-I Verbindungsleitungen DN100-300
~
Applikation mindestens 50 Beregnungsanlagen für bis zu 800 ha
(
I
Freiland
LI L
Aufnahme durch Pflanzen
Versickerung
I
\
Oberflächenabfluß
Unter Glas
~
I
Verdunstung
Quelle: eigene Darstellung
Abb. 58: Modellhafter Wassertluß der Alternative A s
)
11. Anwendung der RNA in einem geschlossenen Anbaugebiet
381
b) Grundnutzen Eine Veränderung des angebauten Sortiments an Gemüse, Spargel und Tabak ist in der beschriebenen Alternative A 5 zunächst nicht vorgesehen. Die Wasserbeileitung erlaubt jedoch eine Ausweitung der beregenbaren Fläche um 43% von derzeit 560 ha auf bis zu 800 ha. Die optimistische Annahme geht davon aus, daß sich die neu bewässerbare Fläche im gleichen Verhältnis auf die genannten Kulturen aufteilt wie die derzeitigen Flächen. So ergibt sich der in Tabelle 103 dargestellte Grundnutzen. Tabelle J03
Grundnutzen des Faktoreinsatzes (Alternative As • optimistisch) ca. 800 ha
Spargel, Gemüseanbau im Freiland (v.a. Kopfsalat, Rettich, Radies, Kohlrabi, Blumenkohl, Kopfkohl, Zucchini, Möhren, Sellerie, Lauch), Gemüseanbau unter Glas (v.a. Rettich, Radies, Kohlrabi, Tomaten, Gurken, Stangenbohnen), Tabak
Quelle: eigene Zusammenstellung
Dem Verband liegt bereits eine Anzahl von Anträgen zur Neuanmeldung zusätzlicher Flächen in einer Größenordnung von knapp 200 ha vor. Dies entspricht einer Ausweitung der bisher beregenbaren Verbandsfläche um 36% und bestätigt die Annahme in der optimistischen Variante der Alternative. Unter pessimistischen Annahmen bleibt der in der Ist-Situation beschriebene Grundnutzen unverändert.
c) Faktoreinsatz Analog zur Betrachtung der Wassernutzung in der Ist-Situation enthält dieser Abschnitt eine Abschätzung des voraussichtlichen Einsatzes der Faktoren Wasser, Arbeit und Kapital für die Alternative A 5 • Im Rahmen der Wasserbeileitung aus dem Regnitztal steht dem Wasserverband jährlich ein Kontingent von 1,9 Mio Kubikmetern Wasser zur Verfügung. Gegenüber der aktuellen Wasserversorgung bietet die Alternative den Vorteil einer höheren Spitzenlast von 400l/s (= 1.440 m3/h , entspricht 30.000 m3/d), die an 30 Tagen im Jahr noch einmal auf
382
G. Fallstudien
600l/s (= 2.160 m3/h, entspricht 45.000 m3/d) gesteigert werden kann. Dies entspricht 20 mm boden verfügbarem Beregnungswasser auf die Gesamtfläche innerhalb eines 4-Tages-Zyklus, wobei für Spitzenbedarf ein Sicherheitszuschlag von 50% berücksichtigt ist. Nach einem ersten Pumpversuch Ende 1995 steht fest, daß die Qualität des so gewonnenen Beregnungswassers mit Einschränkungen für den Anbau von Gemüse und Spargel am Standort brauchbar ist (siehe Tabelle 104). Die aufgeführten Richtwerte geiten ausschließlich bei einer direkten Entnahme für landwirtschaftliche und gärtnerische Freilandkulturen mit einer durchschnittlichen maximalen Jahresberegnungsgabe von 300 mm. Sie gelten wegen des bedeutend höhreren Wasserbedarfs nicht für Gewächshauskulturen und auch nicht für Gemüse- oder Zierpflanzenarten mit geringer Salzverträglichkeit. Festgestellt wurde weiterhin in einem Kurzzeit-Pumpversuch, daß die Mineralisation des Wassers je Fördertag im Untersuchungszeitraum von 30 Tagen von ursprünglich 6.000 IlS!cm um ca. 100 IlS/cm abnahm. So besteht begründete Hoffnung, daß nach dem Einstellen einer Gleichgewichtssituation auch die verbleibenden Wasserqualitätsparameter in einen für den Pflanzenbau günstigen Bereich zu liegen kommen. Eine zusätzliche Unterscheidung zwischen optimistischer und pessimistischer Erwartung erscheint beim Einsatz des Faktors Wasser nicht angebracht, da davon auszugehen ist, daß das Jahreskontingent von 1,9 Mio m3 für die Bewässerung von 800 ha ausreicht. Der mit der Wassernutzung verbundene Einsatz des Faktors Arbeit stellt sich in der Alternative A s dar wie in Tabelle 105 wiedergegeben. Ausgegangen wird dabei wiederum von 26 Wochen jährlicher Beregnungszeit und einem ebenso langen Zeitraum, in dem die Bewässerungsanlagen zwar stillgelegt sind, jedoch trotzdem wöchentlich kontrolliert werden. Jedem Druckerhöhungspumpwerk ist ein Abteilungsvorsteher (V) und ein Regenwart (W) zugeteilt. Außerdem sind in der Tabelle als zusätzliche Qualifikationsstufe noch Hilfskräfte (H) unterschieden. Die Überwachung und Kontrolle des Hauptpumpwerkes (HPW) erfolgt durch einen Abteilungsvorsteher. Dieses pessimistische Szenario ergibt sich, wenn man für Überwachung und Kontrolle des Hauptpumpwerkes einen Wochendienst annimmt, der im Beregnungszeitraum (26 Wo) halbtags an 7 Wochentagen arbeitet.
11. Anwendung der RNA in einem geschlossenen Anbaugebiet
383
Tabelle 104 Wasserqualität • Ergebnisse des Kurzzeit-Pumpversuehs Parameter
Einheit
Meßwert (Tendenz)
Rieht wert
Beurteilung lS
Säure
mH
6,5
5,0-8,5
ok
Leitfahigkeit
J.lS/cm
4.000
1.000 16
Ammonium
mg/I
3,3
-
Arsen
mg/I
![Die Aufgabe der Zusammenschlußkontrolle: dargestellt am Beispiel der Sanierungsfusion [1 ed.]
9783428448951, 9783428048953](https://dokumen.pub/img/200x200/die-aufgabe-der-zusammenschlukontrolle-dargestellt-am-beispiel-der-sanierungsfusion-1nbsped-9783428448951-9783428048953.jpg)
![Die verfassungsrechtliche Belastungsgrenze der Unternehmen,: dargestellt am Beispiel der Personalzusatzkosten [1 ed.]
9783428487400, 9783428087402](https://dokumen.pub/img/200x200/die-verfassungsrechtliche-belastungsgrenze-der-unternehmen-dargestellt-am-beispiel-der-personalzusatzkosten-1nbsped-9783428487400-9783428087402.jpg)
![Die rechtliche Beurteilung von Gerüchen: Dargestellt am Beispiel von Geruchsimmissionen aus der Schweinehaltung [1 ed.]
9783428524280, 9783428124282](https://dokumen.pub/img/200x200/die-rechtliche-beurteilung-von-gerchen-dargestellt-am-beispiel-von-geruchsimmissionen-aus-der-schweinehaltung-1nbsped-9783428524280-9783428124282.jpg)
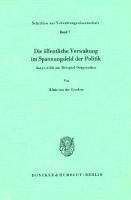


![Die Vermietung von Immobilien als Problem der Tatbestandsverwirklichung im System der Ertragsteuern: Ein wertorientierter Ansatz zur Konkretisierung des Gewerbetatbestandes am Beispiel der Abgrenzung von Sonder- und Nebenleistungen [1 ed.]
9783428586752, 9783428186754](https://dokumen.pub/img/200x200/die-vermietung-von-immobilien-als-problem-der-tatbestandsverwirklichung-im-system-der-ertragsteuern-ein-wertorientierter-ansatz-zur-konkretisierung-des-gewerbetatbestandes-am-beispiel-der-abgrenzung-von-sonder-und-nebenleistungen-1nbsped-9783428586752-9783428186754.jpg)
![Vertragsfreiheit als Verfassungsproblem: Dargestellt am Beispiel der Allgemeinen Geschäftsbedingungen [1 ed.]
9783428430833, 9783428030835](https://dokumen.pub/img/200x200/vertragsfreiheit-als-verfassungsproblem-dargestellt-am-beispiel-der-allgemeinen-geschftsbedingungen-1nbsped-9783428430833-9783428030835.jpg)

![Probleme der Zweckbindung öffentlicher Einnahmen: Dargestellt am Beispiel der Spezialisierung von Kraftverkehrsabgaben für die öffentlichen Ausgaben im Straßenwesen [1 ed.]
9783428403912, 9783428003914](https://dokumen.pub/img/200x200/probleme-der-zweckbindung-ffentlicher-einnahmen-dargestellt-am-beispiel-der-spezialisierung-von-kraftverkehrsabgaben-fr-die-ffentlichen-ausgaben-im-straenwesen-1nbsped-9783428403912-9783428003914.jpg)
![Der Produktionsfaktor Umwelt für die Erzeugung von Pflanzen: Ein betriebswirtschaftlicher Ansatz dargestellt am Beispiel der knappen natürlichen Ressource Wasser [1 ed.]
9783428495443, 9783428095445](https://dokumen.pub/img/200x200/der-produktionsfaktor-umwelt-fr-die-erzeugung-von-pflanzen-ein-betriebswirtschaftlicher-ansatz-dargestellt-am-beispiel-der-knappen-natrlichen-ressource-wasser-1nbsped-9783428495443-9783428095445.jpg)