Probleme der Zweckbindung öffentlicher Einnahmen: Dargestellt am Beispiel der Spezialisierung von Kraftverkehrsabgaben für die öffentlichen Ausgaben im Straßenwesen [1 ed.] 9783428403912, 9783428003914
115 24 21MB
German Pages 179 Year 1963
Polecaj historie
Citation preview
Frankfurter Wirtschaftsund Sozialwissenschaftliche Studien
Band 9
Probleme der Zweckbindung öffentlicher Einnahmen Dargestellt am Beispiel der Spezialisierung von Kraftverkehrsabgaben für die öffentlichen Ausgaben im Straßenwesen
Von
Hans Fecher
Duncker & Humblot · Berlin
FRANKFURTER
WIRTSCHAFTS-
UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHE
STUDIEN
Heft 9
Herausgegeben von der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
Probleme der Zweckbindung öffentlicher Einnahmen Dargestellt am Beispiel der Spezialisierung von Kraftverkehrsabgaben für die öffentlichen Ausgaben i m Straßenwesen
Von Dr.
D Ü N C K E R
&
Hans
H U M
Fecher
B.
L O T / B E R L I N
Alle Rechte vorbehalten © 1963 Duncker & Humblot, Berlin Gedruckt 1963 bei Berliner Buchdruckerei Union GmbH., Berlin 61 Printed i n Germany
Vorwort Die Anregung zu der hier vorgelegten Studie gab mein verehrter Lehrer, Herr Prof. Dr. Dr. h. c. Fritz Neumark. Sein Urteil, seine K r i t i k , aber auch seine Geduld, haben m i r über viele Schwierigkeiten hinweggeholfen. I h m vor allem gebührt mein aufrichtiger Dank. Für viele wertvolle kritische Hinweise bin ich gleichfalls Herrn Prof. Dr. Richard Herzog und Herrn Prof. Dr. Horst Jecht dankbar, dessen A n regungen mich zu einer Auseinandersetzung m i t den grundsätzlichen Fragen der Zweckbindung öffentlicher Einnahmen bewogen haben. Ebenso b i n ich Herrn Priv.-Doz. Dr. Herbert Geyer für K r i t i k und Anregung, insbesondere bei der mathematischen Formulierung i m zweiten Teil dieser Studie, verbunden. Einige Argumente zur Rechtfertigung und Zweckbindung von Kraftverkehrsabgaben gehen auf eine kleine Untersuchung von m i r zurück, die unter dem Titel „ Z u r Problematik der Zweckbindung von Kraftverkehrsabgaben und ihre Erhebung nach dem Prinzip der Eigenwirtschaftlichkeit" i m Jahre 1960 vom Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, München, als Manuskript vervielfältigt wurde. Die Studie wurde i m Sommer 1961 abgeschlossen. München, i m Mai 1962 Hans Fecher
Inhalt Einleitung und Problemstellung
11
Erster Teil: Der Grundsatz der Unzulässigkeit von Bindungen öffentlicher Einnahmen an bestimmte Verwendungszwecke
14
I . Abgrenzungsprobleme I I . Entwicklungslinien des Nonafïektationsprinzips I I I . Durchbrechungen des Nonaffektationsprinzips 1. Begriff u n d A r t e n der Zweckbindung öffentlicher Einnahmen a) Abgrenzung u n d Unterscheidungskriterien b) Formen ein- u n d mehrstufiger Zweckbindung c) Die Technik der Zweckzuwendung v o n Staatseinnahmen d) Zweckbindungsmotive 2. Die Bedeutung des Nonaffektationsgrundsatzes für Haushaltführ u n g u n d Finanzpolitik a) Zweckbindungen, parlamentarische Budgetbewilligung u n d Verstöße gegen statische Budgetprinzipien b) Zusammenhänge zwischen zweckgebundenen öffentlichen E i n nahmen u n d ausgesonderten Staatsausgaben c) Einflüsse von Zweckbindungen i m öffentlichen Haushalt auf Haushaltführung u n d interventionistische Maßnahmen der Budgetpolitik
14 16 22 22 22 25 37 39 42 46 49 77
I V . Der außerbudgetäre Zusammenhang von öffentlichen Einnahmen u n d Ausgaben als Zweckbindungsanlaß 95 Zweiter Teil: Die Zweckbindung von öffentlichen Abgaben des Kraftverkehrs 103 I. Einleitung u n d Abgrenzung
103
1. Das Problem 103 2. Straßenbau, Straßenverwaltung u n d -Unterhaltung als öffentliche Aufgabe 103 3. Die Sonderabgaben des Kraftverkehrs 107 4. Steuerüberwälzungs- u n d Steuervermeidungsvorgänge 110 I I . Nationale Formen der öffentlichen Belastung des Kraftverkehrs 1. 2. 3. 4.
Deutsches Reich u n d Bundesrepublik Deutschland Frankreich Großbritannien Vereinigte Staaten v o n A m e r i k a
114 114 117 119 120
8
Abkürzungen
I I I . Formelle Bedingungen der Zweckbindung der Sonderabgaben des Kraftverkehrs 123 1. Hechtfertigung durch das Leistungsfähigkeitsprinzip 2. Spezielle Rechtfertigungsgründe a) Das Vorteilsprinzip b) Das Kostendeckungsprinzip 3. Der Beitragscharakter der Kraftverkehrsabgaben
123 126 126 128 129
I V . Materielle Bedingungen der Zweckbindung der Kraftverkehrsabgaben 132 1. Ungelöste Probleme des Kostendeckungsprinzips 132 2. Der außerbudgetäre Zusammenhang von öffentlichen Einnahmen u n d Ausgaben f ü r das Straßenwesen 141 Zusammenfassung und Ergebnisse I . Einzelergebnisse
161 161
I I . Folgerungen f ü r die Gestaltung der Kraftverkehrsabgaben u n d der Finanzierung der öffentlichen Ausgaben f ü r das Straßenwesen 164 Literaturverzeichnis
170
Abkürzungen AER AO BGBl Bulletin
= = = =
DIW Ec.Jl. EStG FAG F A . (N. F.) FAZ Finanzwiss. F o r schungsarb. N. F.
= = = = = =
The American Economic Review Abgabeordnung Bundesgesetzblatt B u l l e t i n des Presse- u n d Informationsamtes der Bundesregierung Deutsches I n s t i t u t f ü r Wirtschaftsforsi The Economic Journal Einkommensteuergesetz Finanzausgleichsgesetz Finanzarchiv (Neue Folge) F r a n k f u r t e r Allgemeine Zeitung
= Finanzwissenschaftliche Forschungsarbeiten Forschungsarb Neue Folge GG = Grundgesetz HdF. = Handbuch der Finanzwissenschaft HdS. = Handwörterbuch der Sozialwissensch« HdSt. = Handwörterbuch, der Staatswissenscha: Joint Ec. Comm. = Joint Economic Committee Jl. of Pol. Ec. = The Journal of Political Economy JZ = Juristen-Zeitung LAG = Lastenausgleichsgesetz LStDV = Lohnsteuer Durchführungsverordnung MinöStG = Mineralölsteuergesetz
Abkürzungen NJW Pol. Sc. Quart. Pubi. Fin. QJE. RGBl RHO Rivista d i dir. e sc. delle fin. R. S. L . F. Sehr. d. Ver. f. Socpol. Schw. Arch. f. Verkehrswiss. u. Verkehrspol. VAHL VBRO VStG WBdVW. WiSta. N. F. WWA. Ztschr. f. d. ges. Staatswiss. ZfhF. Ztschr. f. V e r kehrswiss.
Neue Juristische Wochenschrift Political Science Quarterly Public Finance The Quarterly Journal of Economics Reichsgesetzblatt Reichshaushaltsordnung Rivista d i D i r i t t o Finanziario e Scienca delle Finanze Revue de science et de législation financières Schriften des Vereins f ü r Socialpolitik
Schweizerisches A r c h i v f ü r Verkehrswissenschaft u n d Verkehrspolitik Erste Anweisung zum Vollzug des Reichshaushaltsrechts i n den Ländern Buchführungs- u n d Rechnungslegungsordnung für das Vermögen des Bundes Vermögensteuergesetz Wörterbuch der Volkswirtschaft Wirtschaft u n d Statistik, Neue Folge Weltwirtschaftliches A r c h i v Zeitschrift f ü r die gesamte Staatswissenschaft Zeitschrift f ü r handelswissenschaftliche Forschung Zeitschrift f ü r Verkehrswissenschaft
Einleitung und Problemstellung Seit mehr als drei Jahrzehnten ist das Problem der Bindung öffentlicher Einnahmen an bestimmte Staatsausgaben aus der finanztheoretischen Diskussion fast verschwunden. Anerkannt blieb die Auffassung, Zweckbindung sei eine formal-budgetäre Kategorie, bedinge keinen sachlichen Zusammenhang zwischen Einnahme- und Ausgabezweck und übe daher keinen Einfluß auf die Gestaltung der ihr zugrunde liegenden Einnahme aus. So wurde das Zweckbindungsproblem, nachdem die Reste der alten Fonds w i r tschaft nahezu völlig aus dem „ordentlichen" Teil des Staatshaushalts beseitigt waren, namentlich i n Hinsicht auf Budgetrecht und -kontrolle betrachtet. Wie sehr der Schein einer Übereinstimmung der Ansichten zum Nonaffektationsgrundsatz trog, zeigte sich, als man sich auf die Versuche äquivalenztheoretischer Begründung der Kraftverkehrsabgaben besann. Anlaß war die Schwierigkeit, den Straßenbau so zu fördern, daß er ohne wesentlich stärkere Reglementierung des Kraftverkehrs dessen Sicherheit und Funktionsfähigkeit gewährleistete. Die Auseinandersetzungen über Maßnahmen zur Beseitigung des Straßenengpasses waren weitläufig und wurden vom Gruppeninteresse mitgeprägt. Sie haben seit Beginn nicht an A k t u a l i tät verloren, obgleich Zweckbindung der Mineralölsteuererträge und konjunkturelle Entwicklung beschwichtigten. Aus diesen Diskussionen über die Möglichkeiten, den Straßenbau der Ausdehnung des Kraftverkehrs anzupassen, lassen sich zwei für die Zweckbindung der Kraftverkehrsabgaben relevante Thesen erkennen: Die eine behauptet, das Straßenfinanzierungsproblem sei durch Bindung der Erträge aus den öffentlichen Abgaben des Kraftverkehrs an die Staatsausgaben i m Straßenwesen zu lösen. Die Antithese stützt sich auf den Nonaffektationsgrundsatz. Überdies meinen die Gegner der Zweckbindung, jede Spezialisierung öffentlicher Einnahmen sei einer konjunkturpolitischen Ausrichtung der staatlichen A k t i v i t ä t hinderlich. Aber sowohl die erste wie die zweite These scheint trotz ihrer Verbreitung wesentliche Unklarheiten zu enthalten. Sie verbergen Absichten und Ansichten, die einesteils nicht exakt voneinander abgegrenzt sind, andernteils auf unvollständigen Schlußfolgerungen beruhen. Die Zweckbindungsthese impliziert einen sachlichen, außerbudgetären Zusammenhang von Ausgabe und Einnahme, wo sie nicht
12
Einleitung und Problemstellung
bloß ein politisches Mißtrauen zum Ausdruck bringt. Sie zeigt damit eine A r t deterministischer Auffassung und enthält i m Grunde die A n wendung der preistheoretischen Konzeption auf einen Teilbereich der öffentlichen Wirtschaft: Denn dessen Leistungen werden m i t der Entwicklung des Kraftverkehrs zu einem immer geringer werdenden A n teil „passiv konsumiert", und die Besteuerung des Kraftverkehrs stellt — pointiert — einen Ersatz für Preisforderungen dar 1 . Wäre also der außerbudgetäre Zusammenhang von Einnahme und Ausgabe vollkommen, so wäre das Straßenwesen eine „sich selbst tragende Einrichtung". Die Antithese orientiert sich ausschließlich an haushaltrechtlichen Normen und bekämpft die Zweckbindung, indem sie dem Nonaifektationsgrundsatz Dominanz zuspricht, ohne indessen die erste These eingehend zu untersuchen. Aus diesen (grob gezeichneten) Andeutungen geht die Problemstellung bereits hervor. U m den Einfluß der Zweckbindung auf die Gestaltung spezifischer Einnahmen und Ausgaben zu untersuchen, ist es angezeigt, zunächst den Nonaffektationsgrundsatz zu betrachten, seine materiellen Auswirkungen festzustellen und zu fragen, ob es öffentliche Zwangsabgaben gibt, die i n ihrer Begründung bereits eine Durchbrechung des Zweckbindungsverbots enthalten. Gibt es solche A b gaben, so sind die Bedingungen ihrer Ausgestaltung zu ermitteln, die erfüllt sein müssen, damit die m i t der Abgabeerhebung verbundene Absicht des Gesetzgebers verwirklicht wird. A u f der Grundlage dieser überwiegend induktiv gewonnenen Überlegungen w i r d die öffentliche Belastung des Kraftverkehrs geprüft. Somit sind zwei verschiedene Aspekte der folgenden Darstellung ersichtlich: Zunächst dient die A n wendung der Kraftverkehrsabgaben auf die Aussagen des allgemeinen Teils als dessen Illustration und Überprüfung. Sodann lassen sich für die Zweckbindung der Kraftverkehrsabgaben — freilich unter überwiegend finanztheoretischen Aspekten — bestimmte Bedingungen formulieren, die eine sinnvolle Anwendung dieses Instituts zulassen. Das Hauptgewicht der Fragestellung liegt m i t h i n auf dem Gebiet der Finanztheorie; verkehrswissenschaftliche Überlegungen gelten als Daten für finanztheoretische Folgerungen. Daß innerhalb der folgenden Ausführungen das aktuelle Konkurrenzproblem Schiene-Straße nur angedeutet wird, beruht auf bewußter Vernachlässigung, da es einerseits kein essentiell finanzwissenschaftliches Erkenntnisobjekt darstellt, 1 Vgl. Margit Cassel: Die Gemeinwirtschaft. I h r e Stellung u n d Notwendigkeit i n der Tauschwirtschaft, Leipzig u n d Erlangen 1925, S. 57, 89 f.; s.a. J. M. Clark: The Economics of Overhead Costs, Chicago 1923, S. 312 ff.
Einleitung und Problemstellung
andererseits ein bestimmtes Werturteil enthält, dessen Behandlung die Grenzen dieser Untersuchung überschritte. Auch das Finanzierungsproblem, welches dadurch entsteht, daß die Träger der Straßenbaulast nicht zugleich Träger der Ertragshoheit der Kraftverkehrsabgaben sind, w i r d nicht explizit behandelt, sondern nur dann erwähnt, wenn an i h m die Verwirklichung bestimmter Belastungs- und Verausgabungsprinzipien scheitert.
Erster
Teil
Der Grundsatz der Unzulässigkeit von Bindungen öffentlicher Einnahmen an bestimmte Verwendungszwecke I. Abgrenzungsprobleme Der Grundsatz der Unzulässigkeit von Bindungen budgetärer Einnahmen an bestimmte Verwendungszwecke, zumeist — obzwar nicht sehr präzise — als „Zweckbindungsverbot" bezeichnet, ist, wie angedeutet, nicht nur für Gestaltung und Vollzug des Staatshaushaltplans bedeutungsvoll, sondern auch für die Wirksamkeit solcher Maßnahmen, die i m Rahmen der Fiscal Policy zur Verwirklichung gewisser Zielsetzungen m i t Hilfe interventionistischer Maßnahmen als notwendig erachtet werden. Dieser Grundsatz besagt i n aller Kürze, daß der Ertrag bestimmter öffentlicher Einnahmen nicht zur Deckung bestimmter öffentlicher Ausgaben verwendet werden darf 1 . Zweckbindungen, also Durchbrechungen jenes Prinzips, bestehen dann, wenn der Ertrag einer Staatseinnahme „ . . . nicht zur Bestreitung allgemeiner Ausgaben dient, sondern auf bestimmte individuelle Ausgaben »angewiesen', vielleicht gar: für sie »verpfändet 4 ist" 2 . I n der Befolgung dieses Grundsatzes w i r d das „Prinzip der Nonaffektation" 3 verwirklicht, das zugleich als „Zentralisationsprinzip" bezeichnet zu werden pflegt: Die Gesamtheit der Staatseinnahmen soll einem einheitlichen Fonds zufließen, dem die Mittel, die zur Finanzierung der Staatsaufgaben i m Haushaltgesetz vorgesehen sind, ohne Rücksicht auf ihre Herkunft entnommen werden 4 . Daraus ist zu erkennen, daß dem Nonaffektationsprinzip nicht nur 1
Z u r Definition des „Nonaffektationsprinzips" vgl.: Jèze-Neumark: Allgemeine Theorie des Budgets, Tübingen 1927, S. 103 f.; Fritz Neumark: Der Reichshaushaltplan. E i n Beitrag zur Lehre v o m öffentlichen Haushalt, Jena 1929, S. 162 f.; ders.: A r t : Steuer (I), Theorie der Besteuerung, HdS., Bd. 10, Stuttgart, Tübingen u n d Göttingen 1959; außerdem: M. Gény: La Règle de la non-Affectation des Recettes aux Dépenses Publiques dans le Budget de l'Etat, R . S . L . F . , Vol. X X X , 1932, S. 175 ff.; Julius Hatschek: Deutsches u n d preußisches Staatsrecht, Bd. I I , B e r l i n 1923, S. 273; Friedrich K a r l Viaion: Haushaltsrecht-Haushaltspraxis, 2. Aufl., B e r l i n u n d F r a n k f u r t / M . 1959, S. 43 f., 547 ff. 2 Neumark: Reichshaushaltplan, a.a.O., S. 163. 3 Z u r Entstehung u n d Verwendung dieses Terminus vgl. Neumark: Reichshaushaltplan, a.a.O., S. 162 f. (Anmerkg. 2). Der Ausdruck „assignation" w i r d von den französischen A u t o r e n synonym gebraucht; vgl. a. JèzeNeumark: a.a.O., S. 103 (Anmerkg. 2). 4 Jèze-Neumark: a.a.O., S. 103; Neumark: Reichshaushaltplan, a.a.O., S. 163.
I. Abgrenzungsprobleme
15
eine budgetäre, sondern darüber hinaus eine kassenmäßige Bedeutung zukommt 5 , wobei durch den entsprechenden Terminus „Prinzip der fiskalischen Kasseneinheit", als „ . . . mindestens rechnungsmäßiger Vereinigung aller Ein- und Ausgänge eines öffentlichen, insbesondere des Staatshaushaltes i n einer Kasse, bez. Rechnung" 6 , allerdings nur ein Teilaspekt des Nonaffektationsprinzips, besser: eine der Voraussetzungen seiner Realisierbarkeit zum Ausdruck kommt 7 . Denn das Prinzip der fiskalischen Kasseneinheit ist auch dann verwirklicht, wenn die bestimmten Zwecken appropriierten Staatseinnahmen i m allgemeinen Staatshaushalt erscheinen. Ohne daß bereits an dieser Stelle auf den i n der Finanzgeschichte nicht unwesentlichen Fall einer Orientierung am Kasseneinheitsgrundsatz bei gleichzeitiger Assignation aller oder einiger öffentlicher Einnahmen eingegangen werden müßte, ist ersichtlich, daß jener Grundsatz und das Prinzip der Nonaffektation zwei völlig verschiedene Kategorien darstellen. Weiterhin erhebt sich die Frage, ob der Nonaffektationsgrundsatz i n den Budgetprinzipien 8 implizite enthalten ist und durch diesen Umstand seine begriffliche Selbständigkeit verliert. Derartige Subsumierungen, insbesondere unter die Grundsätze der Budgetvollständigkeit und -einheit, finden sich sowohl bei den älteren Autoren 9 wie auch bei s Vgl. hierzu vor allem Viaion: a.a.O., S. 547; M a x v. Heckel: Das Budget, Leipzig 1898, S. 205; s.a. Günter Schmölders: Finanzpolitik, Berlin, Göttingen u n d Heidelberg 1955, S. 59 f. β A d o l p h Wagner: L e h r - u n d Handbuch der politischen Ökonomie, I V Hauptabteilung: Finanzwissenschaft, 1. Teil, 3. Aufl., Leipzig 1883, S. 237; zur Definition s.a. K u r t Heinig: Das Budget, Tübingen 1948—1951, Bd. I I , S. 486 sowie die weiter unten angegebene Literatur. 7 Vgl. außer Wagner: a.a.O., S. 237 ff., W i l h e l m Gerloff: Die öffentliche Finanzwirtschaft, 2. Aufl., Bd. I I , F r a n k f u r t / M . 1950, S. 160; Walther Lötz: Finanzwissenschaft, Tübingen 1917, insbes. S. 125; Jens Jessen: Deutsche Finanzwirtschaft, Hamburg 1937, S. 30. — Eine Trennung des „Prinzips der fiskalischen Kasseneinheit" v o m Prinzip der Nonaffektion w i r d i n der angeführten L i t e r a t u r oft nicht — zumindest nicht expressis verbis — v o r genommen. Das Prinzip der fiskalischen Kasseneinheit gehört ebenfalls i n den Bereich der materiellen Finanzpolitik; ohne seine V e r w i r k l i c h u n g ist das Prinzip der Nonaffektation unrealisierbar. S. F r i t z Neumark: Theorie u n d Praxis der Budgetgestaltung, HdF., 2. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u. F. Neumark, Bd. I, Tübingen 1952, S. 574, 578. 8 Aus den zahlreichen Publikationen s.: Neumark: Theorie u n d Praxis der Budgetgestaltung, a.a.O., S. 572 ff.; ders.: Reichshaushaltplan, a.a.O., S. 122 ff.; G. Ardant: Fondements économiques et sociaux des principes budgétaires, R. S . L . F . , Vol. X L I , 1949, S. 406 ff.; J . W . Sundelson: Budgetary Principles, Pol. Sc. Q., Vol. 50, 1935, S. 236 ff., s.a. Paul Senf: A r t . : Budget, HdS., Bd. 2, Stuttgart, Tübingen und Göttingen 1959; sowie Schmölders: a.a.O., S. 52 ff. » E. Masè-Dari: Sul Bilancio dello Stato, Torino 1899; Dubois de VEstang: A r t . : Budget, Nouveau Dictionnaire d'Economie Politique, Bd. I, hrsg. v. Say und Chailley , Paris 1891; Edgar Allix: Traité élémentaire de science des finances et de législation financière française, 5. éd., Paris 1927, S. 46 ff., insbes. 49 f.; letzterer behandelt dieses Prinzip als eine der „consequences pratiques d u principe de l'universalité".
16
1. Teil: Das Prinzip der Nonafïektation
den modernen 10 . Eine Klarstellung dieser Zusammenhänge kann nur unter Hinweis auf die Methoden der Zweckzuwendung öffentlicher Einnahmen erfolgen. Sobald Durchbrechungen des Nonaffektationsgrundsatzes derart vorgenommen werden, daß gewissen staatlichen Sonderfonds die Befugnis einer selbständigen Haushaltführung (in Form sog. „Partikularetats") erteilt wird, treten klare Verstöße gegen das Prinzip der Budgeteinheit 1 1 und, falls diese Sonderbudgets nicht i m Staatsbudget i n irgendeiner Form nachgewiesen sind, auch gegen den Grundsatz der Budgetvollständigkeit, u. U. sogar gegen das Prinzip der Öffentlichkeit des Staatshaushalts auf. Solche Fälle mögen, da sie das Budget als eine öffentliche Institution berühren, „ . . . i m Rahmen der Prinzipien der Budgetvollständigkeit und - e i n h e i t . . . " 1 2 behandelt werden. Die Unmöglichkeit, den Grundsatz der Nonafïektation gleichsam als ein Epiphänomen der genannten Budgetprinzipien zu bezeichnen, zeigt sich, wenn man den Tatbestand der Argumentation einbezieht, der (weiter oben) für die Diskussion des Kasseneinheitsgrundsatzes herangezogen wurde: Es sind Formen der Zweckbindung denkbar und i n der Realität anzutreffen, die durch die Isolation gewisser Einnahmen von den allgemeinen Deckungsmitteln gekennzeichnet sind, ohne daß ihr budgetmäßiger Nachweis umgangen würde. I I . Entwicklungslinien des Nonaffektationsprinzips Eine umfassende Darstellung der historischen Entwicklungslinien des Nonaffektationsgrundsatzes müßte nicht nur einen umfassenden Teil der Finanzgeschichte, insbesondere der europäischen Staaten, behandeln, sondern zugleich alle Strömungen aufzeigen, die den Wandel von Staatsauffassung und Regierungsform widerspiegeln. Dies liegt indes dem Zweck der Untersuchung fern. Hierfür scheint es wichtig zu sein, nach den Gründen zu suchen, die einerseits den Nonaffektationsgrundsatz i n historisch-politischer Hinsicht erklären und andererseits bereits einen Ausgangspunkt für die Diskussion seiner Durchbrechung bilden, für die sich unmittelbar weder politische noch fiskalische Zweckmäßigkeitserwägungen anführen lassen. Die früheste Zeit, für die es sinnvoll ist, nach Äußerungen über den Nonaffektationsgrundsatz zu suchen, ist zweifellos die, i n welcher sich Ansätze zur Vereinheitlichung der Partikularetats finden. Damit ist nicht gesagt, daß eine Konstatierung des Nonaffektationsgrundsatzes m i t dem der „unité" notwendig koinzidiere (e.v.v.). Denn die Entwick10 Friedrich K a r l Viaion: Haushaltsrecht, 1. Aufl., B e r l i n u n d F r a n k f u r t / M . 1953, S. 139, s.a. ders.: a.a.O., 2. Aufl., S. 79 u n d Schmölders: a.a.O., S. 59 f. 11 s. Neumark: Reichshaushaltplan, a.a.O., S. 195 f. 12 Ders.: Theorie u n d Praxis etc., a.a.O., S. 574.
I I . Entwicklungslinien des Nonaffektationsprinzips
17
lung vom Fondsprinzip zum Etatprinzip, bzw. vom Zweckkassensystem zur Kasseneinheit und zur Bildung eines „fonds commun" kennt als Zwischenstufe eine A r t „aggregierten Fonds" — ähnlich, aber nicht gleich dem frühen britischen „Aggregate Fund" —, welcher die Einnahmen aller Einzelfonds aufnahm und aus dem alle Ausgaben geleistet wurden, ohne daß jedoch die Bindung der Einzeleinnahme an die Einzelausgabe geschwunden wäre. Weder i m Bereich der Haushaltsführung noch i m Bereich der Kassenführung fand der Nonaffektations- bzw. der Kasseneinheitsgrundsatz spontane Anerkennimg. Der letzte war überdies schon lange verwirklicht, ehe man sich auf die fiskalischen Nachteile der Einnahmeassignation besann. I m Rahmen dieser langsamen, von nicht unerheblichen „Rückschlägen" unterbrochenen Entwicklung, die erst schwach m i t dem Niedergang des Partikularismus begann, herrschten, insbesondere i n der preußischen Haushalt- und Kassenführung 1 , zeitweise Etat- und Fondsprinzip nebeneinander. I n der jungen englischen Demokratie vollzog sich dieser Wandel rascher als i n den absoluten Monarchien. Beide Staatsformen aber strebten nach der finanziellen Zentralisation: hier unter dem Leitgedanken „alle Macht dem Parlament", dort als Folge des „Willens zur zentralistischen Finanzherrschaft" (Heinig 2). I n England zeigten sich bereits i m frühen 18. Jahrhundert Bestrebungen zur Konsolidierung der bestehenden Partikularfonds, die unmittelbar auf die Zwangssituation zurückgeführt werden können, welcher sich der englische Staat i m Hinblick auf den Staatsschuldendienst gegenübersah 3 . 1715 wurden sechs Sonderfonds i m „Aggregate Fund" vereinigt, dem später noch der „General Fund" und der „South Sea Fund" einbezogen wurden. D e m „Aggregate F u n d " w a r e n die Erträge der Haus- u n d Fenstersteuer u n d ein T e i l der Z o l l - u n d Akzisenerträge überlassen, während die E i n nahmen des „General F u n d " aus dem A u f k o m m e n der Landtax, den E r trägen der Post u n d einem A n t e i l aus den Z o l l - u n d Akzisenerträgen bestanden. Die Einnahmeüberschüsse dieser Fonds bildeten zusammen m i t den Erträgen gewisser relativ unbedeutender Steuern die Einnahmen des „ S i n k i n g Fund", dem ausschließlich Verzinsung u n d T i l g u n g der englischen Staatsschuld oblag 4 . Lange Zeit waren die Einnahmen aller Fonds zur Fundierung der öffentlichen Schuld verpfändet.
Unter dem jüngeren Pitt vereinigte man diese Fonds zum sog. „Consolidated Fund", dem 1816 noch der irische Fonds angegliedert wurde 5 . I n dieser Form besteht der Consolidated Fund noch gegenwärtig. 1 Franz Schneider: Geschichte der formellen Staatswirtschaft von B r a n denburg-Preußen, Schriften der Forschungsstelle für Staats- u n d K o m m u nalwirtschaft e. V., Wiesbaden, N. F. (Berlin) 1952. 2 Heinig: a.a.O., Bd. I I , S. 487. s v. Heckel: a.a.O., S. 203. 4 Ders.: ebenda, S. 204. 5 Z u r Entwicklung des Consolidated F u n d u n d zum Wesen dieser I n s t i -
2 Fecher
18
1. Teil: Das Prinzip der Nonafïektation
Der Consolidated F u n d sieht, ohne daß es — w i e bei den sog. „Supply Services" — einer jährlichen Votierung bedürfte, die feststehenden Zahlungen der Zivilliste, die Zahlungen zur Bedienung der öffentlichen Schuld, Zuweisungen an den „Road Fund", die Bezüge des Speakers, der Richter u. a. als sog. „Consolidated F u n d Service" vor. D e m Fonds fließen, von geringen Ausnahmen abgesehen, alle Staatseinnahmen zu 6 .
Ohne daß des näheren auf die Aufgaben dieses Fonds und deren Vollzug einzugehen wäre, sei angedeutet, daß das britische System der Trennung jährlich votierter Ausgaben von solchen, die durch das Parlamentsgesetz fixiert sind, ein Musterbeispiel für die Zusammenlegung einzelner Fonds darstellt, durch die das Kasseneinheitsprinzip nicht nur aus fiskalischen Vorsichtserwägungen realisiert w i r d 7 , sondern vorwiegend i n der Absicht, die parlamentarische Kontrolle zu stärken. Darauf deutet bereits eine Resolution aus dem Jahre 1848 hin. " . . , that this House cannot be effectual guardian of the Revenues of the State unless the whole amount of the taxes and of various sources of income received for the Public Account be either paid i n or accounted for the Exchequer" 8 .
Obgleich i n Frankreich Bestrebungen zur Vereinheitlichung der Finanzkassen, wenn auch aus Motiven der Stärkung der absolutistischen Herrschaft, schon ziemlich frühzeitig (Sully, Necker) aufkamen, setzte sich das Zentralisationsprinzip doch erst nach der Revolution durch. Aber noch i m 19. Jahrhundert stieß die Integration der Partikularetats auf großen Widerstand: „ L a centralisation des écritures publiques avait soulevé... d'assez vives protestations parmi les directeurs des comptabilités des divers ministères; les vieux routiniers voulaient, selon le mot du compte de Villèle: ,Conserver leurs fromages 4 " 9 . Erst 1862 wurde der Grundsatz der fiskalischen Kasseneinheit durch Gesetzesvorschriften verankert 1 0 , die später auf das Nonafïektationsprinzip ausgedehnt w u r den. I n der Begründung zum Gesetzentwurf über die direkten Abgaben t u t i o n vgl. v. Heckel: a.a.O., S. 204; Redlich: Recht u n d Technik des englischen Parlamentarismus, Leipzig 1905, S. 672 ff., 680 f.; Hatschek: a.a.O., Bd. I, S. 477 ff.; Lötz: a.a.O., S. 115, 117 f.; Heinig: a.a.O., Bd. I I , S. 434 ff. u n d die dort angegebene L i t e r a t u r . β Insbes. Heinig: a.a.O., Bd. I I , S. 433 ff. 7 Das Prinzip der fiskalischen Kasseneinheit ist dadurch v e r w i r k l i c h t , daß der Consolidated Fund bei der Bank von England gehalten w i r d u n d diese dem Comptroller General täglich über den Kontostand berichtet. Hierzu außer Heinig: a.a.O., Bd. I I , S. 437, Ursula K . Hicks: Public Finance, 2nd. ed., 1958, insbes. S. 48 u n d A l a n T. Peacock : Das Finanz- u n d Steuersystem Großbritanniens, HdF., 2. Aufl., Bd. I I I , Tübingen 1958, S. 231. 8 Entnommen: Heinig: a.a.O., Bd. I I , S. 435. 9 G. Lachapelle: Les finances de la I I I e république, Paris 1937, zitiert bei Heinig: a.a.O., Bd. I , S. 449. 10 Jèze-Neumark : a.a.O., S. 104.
I I . Entwicklungslinien des Nonaffektationsprinzips
19
und gleichgestellten Steuern von 1893 findet sich eine Stelle die darüber Aufschluß erteilt: „ W e n n m a n unter dem Vorwande der Entsprechung (,Corrélation 4 ) gewisser Einnahmen u n d gewisser Ausgaben des Staates i n diesen E i n nahmen u n d diesen Ausgaben n u r durchlaufende Posten (,comptes d'ordre') sehen w i l l , so verliert m a n den obersten Grundsatz aus dem Auge, daß nämlich (ab hier i m Original gesperrt) jede budgetmäßige E i n nahme, gleichviel welcher A r t , nicht diesem oder jenem besonderen Zweck zugehört, sondern dem Budget als Ganzem. Der französische Staat darf keine besondere Zweckbindung (,affectation 4 ) von Steuern annehmen. A l l e Staatseinkünfte, gleichviel welchen Ursprungs, müssen der Aufrechterhaltung der Gesamtheit der öffentlichen Dienstzweige dienen" 1 1 .
Die Entwicklung des Budget- und Kassenwesens i n Deutschland, insbesondere i n Preußen, bis zur gesetzlichen Verankerung sowohl des Kasseneinheitsgrundsatzes als auch des Nonaffektationsprinzips kann als Beispiel dafür gelten, daß sich eine nur allmähliche Veränderung vom partikularistischen Zweckkassenprinzip zur fiskalischen Kasseneinheit vollzog, die, speziell von landesherrlichen (ζ. T. Privat-) Interessen durchbrochen, lange Zeit ein Nebeneinander von Sonder- und Zentralkassen gestattete. Unter der absoluten Herrschaft des Großen Kurfürsten wurde das strenge Fondssystem des ständischen Staates bereits gelockert, indem einesteils gewissen Zweckkassen die Immediatstellung entzogen wurde, andernteils Übertragungen von Barmitteln von Kasse zu Kasse immer häufiger auftraten 1 2 . Hier bahnte sich bereits eine A r t „Koexistenz" von Zweck- und Zentralkasse an. Unter Friedrich Wilhelm I. verloren alle Nebenkassen ihre Selbständigkeit. Gleichzeitig vollzog sich eine Neuerung des Etatwesens. Wie bisher war unter Friedrich I I . der Etat Generaldomänen- und Generalkriegsetat; das Assignationsprinzip wurde aber beibehalten 13 . Die Neuerungen des Vorgängers wurden vom Souverän durch die Einrichtung einer „Königlichen Dispositionskasse 14 , 11 Z i t i e r t nach Jèze-Neumark: a.a.O., S. 104; vgl. f ü r diesen Zusammenhang auch die E r k l ä r u n g der K a m m e r v o m 26. Februar u n d 17. November 1910 u n d v o m 6. Februar 1911: R. S. L . F. 1910, S. 84 ff. u n d R. S . L . F . 1911, S.83 ff. 12 Ζ. B. verlor die Hofstaatsrentei ihre Immediatstellung u n d w a r auf die Hofrentei angewiesen; die K a m m e r („Schatulle") büßte zugunsten einer Handgeldkasse, die ihrerseits aus der Generaldomänenkasse gespeist wurde, ihre Selbständigkeit ein. Später w u r d e dann auch die Hofrentei beseitigt. Schneider: a.a.O., S. 86. 13 Schneider: a.a.O., S. 104. 14 Als Einnahme flössen i h r die Erträge der Tabakregie, der Lotterie, der Fabriksteuer, der Transitzölle, die Überschüsse aus den Provinzen Schlesien u n d Ostfriesland u n d der Provinzialkriegs- u n d Domänenkassen, sowie die Mehreinnahmen der Bergwerks- u n d H ü t t e n Verwaltung, der Forst Verwaltung, des Salz- u n d des Postwesens, die Erträge der Stempel- u n d K a r t e n abgabe u n d die gesamten Chargengelder zu. Schneider: a.a.O., S. 107.
2*
20
1. Teil: Das Prinzip der Nonafïektation
eine Maßnahme zur Verschleierung der Staatsrevenuen, zunichte gemacht. Es ist einsichtig, daß die Institution jener Dispositionskasse nicht allein die Entwicklung des Kassenwesens hemmen mußte, sondern auch die Budgetaufstellung an die Person des Souveräns band. Niemand anders als er kannte die Einnahmequellen, welche seiner Dispositionskasse zur Verfügung standen, noch war jemand über die Höhe der Einund Auszahlungen unterrichtet 1 5 . Friedrich Wilhelm II. behielt diese Kasse, allerdings zur Bestreitung persönlicher Ausgaben bei 1 6 . Neben die Dispositionskasse trat eine weitere Geheimkassse, die „Chatulle", welche dem König zur zusätzlichen Bestreitung privater Ausgaben zur Verfügung stand. Ihre Einnahmen waren die Erträge sog. „Chatuligüter". Erst der Nachfolger nahm der Dispositionskasse i h r Geheimnis und stellte sie gleichrangig neben Generalkriegs- und Generaldomänenkasse. Noch wurde zwar das Zweckkassensystem nicht beseitigt, doch insoweit durchbrochen, als Überweisungen der Generalkassen an die Unterkassen zugelassen waren 1 7 . Erst i m beginnenden 19. Jahrhundert gewann das Zentralisationsprinzip an Bedeutung: Das „Publikandum vom 16. Dezember 1808 betreffend die veränderte Verfassung der obersten Staatsbehörden i n Beziehung auf die innere Landes- und Finanzverwaltung" brachte m i t der Errichtung einer Generalstaatskasse die Proklamation des Kasseneinheitsprinzips. Durch „Allerhöchste Kabinettsordre, betr. den Staatshaushalt und das Staatsschuldenwesen" vom 17. Januar 1820 wurde faktisch das noch bestehende Fondssystem durch das Etatsystem ersetzt 18 . Nach diesem abrupten Übergang zum Zentralisationsprinzip n i m m t es nicht Wunder, daß sich die betreffenden Gesetze und Verordnungen infolge der i n nicht wenigen Fällen erforderlichen Durchbrechungen als unrealistische Vorsätze erwiesen. Wenigstens aber waren sowohl Kasseneinheitsprinzip als auch einige Budgetgrundsätze m i t der preußischen Verfassung und dem Oberrechnungskammergesetz vom 27. März 1872 gesetzlich garantiert. Erst das Komptabilitätsgesetz vom 11. Mai 1898 brachte die Kodifizierung 15 Nichtsdestoweniger gewann unter Friedrich I I . der preußische Staatsetat bereits ein festes Gefüge, das i h n u n d seinen Nachfolger i n die Lage v e r setzte, persönliche Genehmigungen auf neue Ausgaben zu beschränken. Schneider: ebenda. 16 Friedrich W i l h e l m I I . besaß i m Gegensatz zu seinem Vergänger keinerlei Überblick über A u s - u n d Eingänge der Dispositionskasse. D a m i t erstreckte das ursprüngliche Instrument der Verschleierung der Staatsfinanzen seine Wirksamkeit auch auf den Souverän. Diesem Umstand w i r d es zugeschrieben, daß der preußische Staat einen Schuldenstand von 25 M i l l . Thalern aufzuweisen hatte u n d nicht einen Schatz v o n 54 M i l l . Thalern, w i e das zehn Jahre vorher noch der F a l l war. Schneider: a.a.O., S. 121. 17 Schneider: a.a.O., S. 1 2 9 1 18 Ders.: ebenda, S. 156.
I I . Entwicklungslinien des Nonaffektationsprinzips
21
des Nonaffektationsgrundsatzes. Freilich bestanden die staatlichen Nebenfonds fort. Zwar verlangten die vorher gesetzlich verankerten Grundsätze der Vollständigkeit und Einheit des Budgets eine Etatisierung der unselbständigen Sondervermögen. I m preußischen Staatshaushaltsgesetz von 1898 w i r d dies auch tatsächlich bestimmt, gleichzeitig aber (§ 16, Abs. 2) ihre Zweckbindung aufrechterhalten: „Die Einnahmen der i n § 2 unter Nr. 4 bezeichneten Fonds sind n u r für Zwecke der letzteren zu v e r w e n d e n " 1 9 .
Das Nonaffektationsprinzip findet seinen endgültigen Ausdruck i n den Vorschriften des § 29 Reichshaushaltsordnung vom 31. Dezember 1922. Hier ist i m ersten Absatz bestimmt: „ A l l e Einnahmen dienen als Deckungsmittel f ü r den gesamten Ausgabebedarf des Reichs, soweit nicht i m Haushaltplan oder i n besonderen Gesetzen etwas anderes bestimmt ist".
Unter Berücksichtigung dieser Bestimmung gilt für die Bundesrepublik Deutschland folgendes: I m Bonner Grundgesetz ist die zitierte Vorschrift der Reichshaushaltsordnung zwar nicht explizit enthalten, aber auch i n keiner Weise durchbrochen. Die Reichshaushaltsordnung vom 31. Dezember 1922 i n der seit dem 30. A p r i l 1938 geltenden Fassung ist nach A r t . 123 ff. GG unmittelbares Bundesrecht 20 . Die Fortgeltung der Vorschriften der Reichshaushaltsordnung ergibt sich auch aus der Tatsache, daß die Legislative noch keine entgegenstehenden Gesetze beschlossen hat. Hinzu kommt, daß i m § 2 des Gesetzes über Errichtung und Aufgabe des Bundesrechnungshofes vom 27. November 195021 die Vorschriften der Reichshaushaltsordnung ausdrücklich als geltendes Recht bezeichnet werden. Auch für die Bundesländer gilt das Gesetz m i t einigen für diese Untersuchung jedoch unerheblichen Einschränkungen 22 . Der so gesetzlich festgelegte Nonaffektationsgrundsatz erfaßt gleichermaßen Staatsbetriebe, für welche die Voraussetzungen des § 15 RHO zutreffen, wie alle öffentlichen Sonderverwaltungen. Keine dieser Einrichtungen, auch Bundesmittel verwaltende Behörden, ist befugt, ohne haushaltgesetzliche Ermächtigung Einnahmen zur Deckung des eigenen Ausgabenbedarfs zurückzuhalten. 19
Z i t i e r t nach Neumark: Reichshaushaltplan, a.a.O., S. 165 f. Vgl. Viaion: Haushaltsrecht, 2. Aufl., a.a.O., S. 293. B G B l I 1950, S. 765; s. a. Viaion: a.a.O., S. 293. 22 Die einzige f ü r die Länder bedeutsame Änderung des §29 RHO i n Ziff. 8 1. V A H L (Erste Anweisung z u m Vollzug des Reichshaushaltsrechts i n den Ländern v o m 5. M a i 1939) erfaßt n u r den zweiten Absatz dieser V o r schrift, welcher sich auf die Zweckbindung der Erträge aus Grundstücksveräußerungen bezieht. Diese F o r m der Zweckbindung w i r d i m Rahmen der folgenden Untersuchung n u r als Beispiel erwähnt. 29
21
22
1. Teil: Das Prinzip der Nonafïektation
I I I . Durchbrechungen des Nonaffektationsprinzips 1. B e g r i f f u n d A r t e n d e r Z w e c k b i n d u n g öffentlicher Einnahmen a) Abgrenzung
und Unterscheidungskriterien
Das Prinzip der Unzulässigkeit von Bindungen öffentlicher Einnahmen an spezielle Verwendungszwecke besitzt — wie angedeutet — sowohl eine haushaltrechtlich-fiskalische als auch eine finanzpolitische Motivierung. Das Nonaffektationsprinzip ist jedoch nicht allein Ausdruck gewisser fiskalischer und finanzpolitischer Zweckmäßigkeitserwägungen, sondern zugleich auch eine notwendige Voraussetzung der politischen Willensbildung. Es läßt sich indessen nicht auf die parlamentarisch-demokratische Staatsform beschränken, sondern trifft gleichermaßen für den Fall der zentralistisch-absolutistischen Staatsführung zu. Die Behauptung, daß alle Verstöße gegen den Nonaffektationsgrundsatz rudimentäre Erscheinungen aus der Zeit der Fondswirtschaft des ancien régime darstellten, ist keineswegs berechtigt. Dank der i n fast allen Haushaltordnungen des In- und Auslandes zugelassenen Ausnahmen gibt es i n der Realität eine bedeutende Anzahl solcher Durchbrechungen, die es als angezeigt erscheinen lassen, des Näheren auf sie einzugehen. Bereits i n den Bemerkungen zur Abgrenzung des Terminus „Nonaffektationsprinzip" wurde darauf hingewiesen, daß Durchbrechungen dieses Grundsatzes durch sog. „Zweck-" oder „Ertragsbindungen", „Affektationen", „Assignationen", „Appropriationen" oder „Zweckzuwendungen von Steuererträgen" (Bräuer 1) stattfinden. Üblicherweise gelten diese Begriffe als synonym 2 . Sie charakterisieren den Tatbestand* der — wie bereits erwähnt — durch gesetzlich vorgeschriebene Zuordnung von bestimmten Staatseinnahmen und -ausgaben gekennzeichnet ist. Nach dieser Abgrenzung stellt sich die Zweckbindung prima facie als eine ausschließlich budgetäre Angelegenheit dar, die es als völlig gleichgültig erscheinen läßt, welche Staatseinnahme von einer solchen Bestimmung erfaßt w i r d 3 . Damit könnte der Bräuerschen A n sicht beigepflichtet werden, derzufolge die Zweckzuwendungen von Steuererträgen „das innere Wesen einer Steuer, ihren Charakter, ihren 1 K a r l Bräuer: Finanzsteuern, Zwecksteuern u n d Zweckzuwendung von Steuererträgen. Eine flnanztheoretische u n d finanzpolitische Studie, Sehr. d. Ver. f. Socpol., 174. Bd., München u n d Leipzig 1928. 2 Die angelsächsische Fachliteratur hat bislang keinen eigenen Fachterminus geprägt. Sie umschreibt entweder den Tatbestand, bedient sich des französischen Begriffes „assignation" oder des drastischeren Wortes „earm a r k i n g " ; vgl. z.B. P h i l i p E. Taylor: The Economics of Public Finance, rev. ed., New Y o r k 1953, S. 27 f. 3 Bräuer: a.a.O., S. 20.
II.
ungen des Nonaffektationsprinzips
23
Aufbau nicht berührt" 4 . U m aber diese These beurteilen zu können, ist es geraten, zunächst die wichtigsten Fälle von Zweckzuwendungen zu untersuchen und festzustellen, wann der Gesetzgeber eine Durchbrechung des Nonaffektationsgrundsatzes für zulässig hält. Erst dann können Aussagen über die Effekte von Zwecksonderungen und über die Bedeutung des Zweckbindungsverbotes für Haushaltführung und Finanzpolitik gemacht werden. Von Zweckbindungen läßt sich nach dem Gesagten dann sprechen, wenn „ . . . die Leistung der Ausgabe von dem tatsächlichen Aufkommen einer oder mehrerer bestimmter Einnahmen abhängig gemacht wird, die Leistung also nur insoweit erfolgt, wie M i t t e l aus i m einzelnen bezeichneten Einnahmen zur Verfügung stehen" 5 . Der Fall einer Ausgabenerhöhung infolge neuer oder umfangreicher Staatsausgaben und davon abhängiger Heranziehung neuer oder intensivierte Ausschöpfung vorhandener Steuerquellen, läßt sich deswegen nicht als Zweckbindung bezeichnen 6 , weil weder die Einrichtung eines Sonderfonds notwendig ist, welchem die Finanzierung der zusätzlichen Staatsaufgaben obliegt, noch überhaupt eine budgetmäßige Zuordnung der zusätzlichen Ausgaben und Einnahmen vorgenommen werden muß. Streng von diesem Fall sind Einnahmespezialisierungen zu unterscheiden, bei welchen Staatsausgaben für bestimmte Zwecke nur insoweit vorgenommen werden, als es die Erträge einer für diese Zwecke bestimmten zusätzlichen Einnahme oder die zusätzlichen („Mehr-")Erträge einer vorhandenen gestatten (wie das ζ. B. i m Straßenbaufinanzierungsgesetz vom 28. März 1960 vorgeschrieben ist). Vom Begriffsinhalt der Zweckbindung zu trennen, sind auch die sog. „festen Ansätze", wie sie beispielsweise i n Großbritannien die „Charges on the Consolidated Fund" und i n der Bundesrepublik die festen Ansätze nach dem Kriegsfolgenund dem ersten und zweiten Wohnungsbaugesetz darstellen 7 . Solche ständigen Bewilligungen (sog. „permanent appropriations") hemmen sicherlich die Beweglichkeit der Budgetgestaltung. Sie stellen insofern jedoch eine relativ schwache Beschränkung der parlamentarischen Entscheidungsgewalt dar, als ihre Höhe i n bestimmten Fällen durch haushaltgesetzliche Bestimmung jeweils für die Dauer eines Haushaltjähr es herabgesetzt werden kann 8 . Da derartige ständige Bewilligungen keine Spezialisierung von Einnahmen erfordern, liegen sie außerhalb dieser Betrachtungen. Obgleich man i n der Literatur oft von der Zweckbindung, zumal i n ablehnenden Äußerungen, als von einer Kategorie sui generis spricht, 4
Der s.: ebenda, S. 3. Neumark: Reichshaushaltplan etc., a.a.O., S. 164. 6 Ders.: ebenda. 7 Vgl. Viaion: a.a.O., S. 549. 8 Ders.: ebenda. 5
24
1. Teil: Das Prinzip der Nonafektation
lassen sich trotzdem mannigfache Typen unterscheiden. Zunächst kann die Anzahl der Budgetstufen, welche eine Einnahme durchläuft bis sie für den vorgeschriebenen Zweck verausgabt wird, als Unterscheidungsmerkmal dienen. Demgemäß läßt sich von ein- und mehrstufiger Zweckbindung („Zweckbindung höheren Grades" — Neumark) sprechen. So wäre i m Fall einer Appropriation der Einnahmen aus der Rennwettsteuer an die Subventionierung staatlicher Pferdezuchtanstalten die Form einer mehrstufigen Zweckbindung gegeben; dasselbe gilt, wenn spezialisierte Einnahmen i m Sinne sog. „Überweisungssteuern" nachgeordneten Gebietskörperschaften m i t verpflichtender Zweckbindung überwiesen werden. Weiterhin kann die Zweckbindung direkt oder indirekt erfolgen 9 . I m ersten Fall ist entweder i n der Verfassung, einem speziellen Einnahme- oder Finanzierungsgesetz oder i m Haushaltgesetz die Assignation einer Staatseinnahme i n der Weise geregelt, daß die Ausgabe einer Gebietskörperschaft ohne Umweg über die Haushalte nachgeordneter Verbände i n der durch den Ertrag der spezialisierten Einnahme bestimmten Höhe erfolgt. Dieser Tatbestand pflegt gemeinhin als „die Zweckbindung" bezeichnet zu werden. Beim indirekten Verfahren der Zweckzuwendung 10 werden von einem Oberverband Überweisungen an nachgeordnete Gebietskörperschaften m i t der Auflage vorgenommen, die Einnahmen aus diesen Überweisungen einem bestimmten Zweck zuzuführen. Solche Überweisungen können beim Oberverband aus allgemeinen Deckungsmitteln (einstufig-indirekte Zweckbindung) oder aus spezialisierten Einnahmen (mehrstufigindirekte Zweckbindung 11 ) erfolgen. Für die Beschreibung der Zweckbindung kommt als weiteres Merkmal der Spezialisierungs- oder Zuweisungsmodus i n Betracht. Hier kann es sich einmal darum handeln, daß eine Staatseinnahme i n voller Höhe Jahr für Jahr einem bestimmten Zweck zugeführt wird, zum andern ist ein Verfahren üblich, welches die Spezialisierung entweder eines relativen Anteils vorsieht oder alle Einnahmen appropriiert, die einen bestimmten („Sockel-") Betrag überschreiten. Als letztes Globalmerkmal kann die Absicht des Gesetzgebers angeführt werden, die er m i t der Einnahmenspezialisierung verfolgt: sei es, daß er eine Einnahme nach oben oder unten zu begrenzen trachtet, sei es, daß er sich durch die Spezialisierung die Sicherstellung einer Staatsausgabe verspricht. Aus dem Gesagten ist ersichtlich, daß mannigfache Kombinationen der so unterschiedenen Zweckbindungsformen als denkbar, aber nicht alle als sinnvoll erscheinen. Ohne Berücksichtigung zusätzlicher Bedin® Bräuer: a.a.O., S. 57 ff. 10 Ders.: ebenda, S. 61 ff. 11 Bräuer: (a.a.O., S. 57, 61) bezeichnet n u r diesen F a l l als „ i n d i r e k t e Zweckbindung"; zur genaueren Charakterisierung dieses Verfahrens s. A b schnitt b.
II.
ungen des Nonaffektationsprinzips
25
gungen aus dem praktisch-fiskalischen Bereich kann nicht entschieden werden, ob beispielsweise eine — prima vista als völlig unzweckmäßig erscheinende — mehrstufige Zweckbindung nicht doch gewisse Vorteile für den m i t verpflichtender Zweckbindung überweisenden Oberverband m i t sich bringt. Es ist m i t h i n angezeigt, solche Kombinationsmöglichkeiten einzelner Zweckbindungskriterien erst nach der Erörterung einiger praktischer Beispiele, insbesondere aus der Haushaltgeschichte des Deutschen Reichs und der Bundesrepublik, zu diskutieren. Die drei Globalkriterien Form, Technik und Motivierung der Zweckzuwendung öffentlicher Einnahmen bilden die Prämissen, aufgrund derer die Beurteilung des Instituts der Zweckbindung vorgenommen werden kann. b) Formen ein- und mehrstufiger
Zweckbindung
Die Formen der einstufigen Zweckbindung enthalten nicht nur alle Varianten des „direkten", sondern auch alle A r t e n des „indirekten Verfahrens" der Ertragsbindung (Bräuer), und sie beschränken sich nicht auf solche Haushalteinnahmen, die den Grundsätzen der Einheit, V o l l ständigkeit und Klarheit des Budgets genügen, indes total oder partiell an einen bestimmten Verwendungszweck gebunden sind, sondern erfassen gleichwohl auch Gebarungen, welche nicht i m Haushalt einer Gebietskörperschaft i n Erscheinung treten. Die direkte Zweckzuwendung von Einnahmen des ordentlichen Haushalts stellt die Form der Zweckbindung dar, welche man landläufig als die Zweckbindung bezeichnet. Hier handelt es sich darum, daß die abgabenerhebende Gebietskörperschaft die Erträge jener Abgaben selbst verwaltet und nach Maßgabe gesetzlicher Vorschriften für spezialisierte Zwecke verausgabt. Dies ist zumeist dann der Fall, wenn eine über die Ertragshoheit gewisser Einnahmen verfügende Gebietskörperschaft Ausgaben zur Finanzierung einer öffentlichen Aufgabe leistet, die — kraft verfassungsmäßiger Vorschriften oder infolge Delegation von einer übergeordneten Gebietskörperschaft — nur ihrem Kompetenzbereich angehört. Die öffentliche Einnahme und die öffentliche Ausgabe erscheinen i m Budget. Solcherart spezialisierte Abgaben stellen zumeist sog. „Zwecksteuern" oder Beiträge dar. Allerdings kann es sich auch u m solche Abgaben handeln, deren Erhebungszweck zwar nicht m i t der Wahrnehmung einer spezifischen Staatsaufgabe gekoppelt ist, deren Erträge indessen (nach Einführung der Abgabe) aus fiskalischen oder finanzpolitischen Erwägungen einem fest abgegrenzten Ausgabenzweck appropriiert sind. Für den Fall der direkten Zweckbindung ist selbstverständlich, daß die Erträge einer Staatseinnahme für mehrere bestimmte Staatsausgaben spezialisiert sein können.
26
1. Teil: Das Prinzip der Nonafektation
So sah das Branntweinmonopolgesetz v o m 26. J u l i 1918 12 die Spezialisier u n g der Monopoleinnahmen sowohl zur Bekämpfung der Trunksucht als auch zur Erforschung u n d Förderung des Kartoffelbaus, w i e schließlich auch zur Unterstützung der Produktion alkoholhaltiger Arzneien vor. I n späteren Fassungen dieses Gesetzes traten Bindungen von Ertragsteilen zugunsten der Bekämpfung von Tuberkulose u n d Geschlechtskrankheiten, sowie Subventionierungen des Alkohols, der i n öffentlichen Gesundheitsanstalten v e r braucht wurde, hinzu. Das Biersteuergesetz v o m 26. J u l i 1918 13 spezialisierte Ertragsteile f ü r die Förderung der Brauwissenschaft, später w u r d e n die Zweckzuwendungen auf die Ausgaben zur Förderung des braugewerblichen Mittelstandes ausgedehnt 1 4 .
Die folgenden Beispiele für die direkte Zweckbindung verzichten auf die Darstellung von Abgaben, welche einer Zweckbindung vor Einführung des Prinzips der fiskalischen Kasseneinheit und des Nonaffektationsgrundsatzes unterlagen (so ζ. B. die Abgaben anläßlich der „drei großen Lehen", die poor rate, der Römermonat etc.). Solche Beispiele finden sich i n unüberbietbarer Ausführlichkeit i n der älteren europäischen Fachliteratur namentlich aus der Ära des deutschen Historismus. Z u den zweckgebundenen deutschen Abgaben gehört der Wehrbeitrag v o m 3. J u l i 1913, welcher „zur Deckung der Kosten der Wehrvorlage" als einmalige Vermögen- u n d Einkommensteuer erhoben w u r d e 1 5 . Die Erträge der Brotversorgungsabgabe v o m 23. J u n i 1923 16 dienten der Subventionierung der B r o t - u n d Milchpreise. Innerhalb der kurzen Dauer ihrer Existenz w u r d e die Weinsteuer v o m 10. Aug. 1925 17 teilweise zur Förderung des Winzerstandes verwendet. Die Zölle auf die E i n f u h r von Rohkautschuk v o m 13. M a i 1937 waren der Förderung der inländischen Bunaerzeugung gewidmet. Als Beispiel für die älteren ausländischen Ertragsspezialisierungen sei n u r die französische Abgabe von den Rennwetteinsätzen erwähnt, die z.T. den Ausgaben zur Förderung der Trinkwasserversorgung appropiiert w a r 1 8 . Neueren Datums sind i n Deutschland das Notopfer Berlin, welches zwar keiner verpflichtenden, jedenfalls aber einer „moralisch bedingten" Zwecksonderung unterlag, die seit 1. Januar 1960 weggefallene Kohlenabgabe nach dem Gesetz zur Förderung des Bergarbeiterwohnungsbaus und die M i n e r a l ölsteuer, die nach den Vorschriften des Straßenbaufinanzierungsgesetzes v o m 28. März 1960 bis auf einen „Abgeltungsbetrag" von 600 M i l l . D M u n d einigen anderen Absetzungen der Straßenbaufinanzierung zufließt 1 9 . Aus dem Bereich der Länderfinanzen sind die Zuschüsse zum Lastenausgleichsfonds i n Höhe von 25 v H des Vermögensteueraufkommens 2 0 u n d von zwei D r i t t e l n des Unterschiedsbetrags zwischen 2550 M i l l . D M f ü r das 12
R G B l I 1918, S. 948. 13 R G B l I 1918, S. 883. Gesetz betr. Erhöhung einzelner Verbrauchsteuern; Anlage 7 zum Gesetz über Änderungen i m Finanzwesen v o m 8. A p r i l 1922, R G B l I, S. 382. 15 Boleslav Fux: Die Vermögensteuer, HdF., 1. Aufl., Bd. I I , Tübingen 1927, S. 153 f. ie R G B l I 1923, S. 410; s. a. V O v o m 23. 10. 1923, R G B l I , S. 1039; Neumark: Reichshaushaltplan etc., a.a.O., S. 184 f. 17 Gesetz zur Änderung der Verbrauchsteuern v o m 10. August 1925, R G B l I, S. 248. 18 Jèze-Neumark : a.a.O., S. 110. 19 Vgl. u. a. Viaion: a.a.O., S. 548 f. 20 § 6, Abs. 2 L A G , i. d. Fassung v o m 26. J u l i 1957, B G B l I, S. 809. 14
II.
ungen des Nonaffektationsprinzips
27
Rechnungsjahr 1960 u n d 2500 M i l l . D M f ü r das Rechnungsjahr 1961 und dem Gesamtaufkommen der Lastenausgleichsabgaben i n Relation zum jeweiligen A u f k o m m e n der Vermögensteuer 2 1 besonders bemerkenswert 2 2 . Der F r e i staat Bayern stellt den kommunalen Trägern der Straßenbaulast i n F o r m zweckgebundener Überweisungen 30 v H der i m Verbundzeitraum (1. Januar bis 30. September 1959) anfallenden Kraftfahrzeugsteuererträge zur V e r fügung 2 3 . Die Einnahmen aus der Totalisatorsteuer werden zu 96 v H den Rennvereinen zugewiesen 2 4 , u n d das A u f k o m m e n der Feuerschutzsteuer ist ζ. T. dem Feuerschutzwesen, ζ. T. f ü r Wasserversorgung u n d dem Bau u n d der Unterhaltung v o n Wasserversorgungsanlagen appropriiert 2 5 . Z u den Beispielen der Zweckbindung nichtsteuerlicher Einnahmen des ordentlichen Haushalts gehören insbesondere die Erträge aus den G r u n d stücksveräußerungen der öffentlichen H a n d (§ 29, Abs. 2 RHO), sofern diese den Betrag von 10 000 D M überschreiten, sowie die Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen (§ 17 Wohnungsbaugesetz), die zur Förderung des Wohnungsbaus verwendet werden müssen 2 6 . A l s weiterer F a l l der direkten-einstufigen Zweckbindung i m ordentl i c h e n H a u s h a l t u n d z u g l e i c h als e i n e k l a t a n t e r V e r s t o ß gegen d i e statischen B u d g e t g r u n d s ä t z e g e h ö r t das I n s t i t u t der sog. „ R ü c k e i n n a h m e n " i n diese B e t r a c h t u n g : n ä m l i c h eine d u r c h d e n V e r m e r k „ d i e E i n n a h m e n fließen d e n M i t t e l n z u " g e n e h m i g t e V e r w e n d u n g v o n E i n n a h m e n e i n e r B e h ö r d e oder D i e n s s t e l l e f ü r solche A u s g a b e n , die i n e i n e m Zusammenhang m i t der Bewirtschaftung der Einnahmen stehen27. Solche R ü c k e i n n a h m e n ( „ S e l b s t e i n n a h m e n " ) s t e l l e n j e d e n f a l l s i n s o f e r n eines d e r a m w e n i g s t e n v e r f ä l s c h t e n fiskalischen Ü b e r b l e i b s e l aus d e r Z e i t d e r F o n d s w i r t s c h a f t dar, als sie n i c h t entsprechend d e n sog. „ a p p r o p r i a t i o n s i n a i d " m i t i h r e r m u t m a ß l i c h e n H ö h e a u f die entsprechend e n B u d g e t k r e d i t e v e r r e c h n e t w e r d e n . R ü c k e i n n a h m e n t r e t e n beispielsweise i n f o l g e des V e r k a u f s v o n b e h ö r d l i c h e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n , V e r ä u ß e r u n g v o n b e h ö r d e n e i g e n e m G e r ä t u s w . selbst b e i ausschließlich a d m i n i s t r a t i v e n D i e n s t s t e l l e n auf. Die Bedeutung sog. „Rückeinnahmen" ist auch i m Bundeshaushaltplan von 1960 keineswegs gering. So sind i m Einzelplan 06 (Bundesminister des 21 § 6, Abs. 1 u n d 2 L A G , a.a.O. Die beiden erwähnten Beispiele gelten gleichermaßen f ü r die indirektemehrstufige Zweckbindung, w e n n m a n die Kette von der ursprünglichen E i n nahme bis zur endgültigen Verausgabung betrachtet. 2 3 §§ 13 u n d 14 F A G i. d. Fassung des Änderungsgesetzes von 1960. Vgl. a. Haushaltspläne des Freistaates Bayern f ü r die Rechnungsjahre 1960 u n d 1961, Bd. I I , Kap. 1303, T i t . 605 u. 606. 24 Bayer. Haushaltpläne 1960 u. 1961, Kap. 1301, T i t . 601. 2 5 3,9 M i l l . D M u n d 60 v H des Mehraufkommens dienen zur Deckung der Ausgaben des Feuerschutzwesens, m i t 40 v H des Mehraufkommens w e r den Ausgaben f ü r die Wasserversorgung bestritten. Vgl. Bayer. Haushaltpläne 1960 u. 1961, Erläuterungen zu Kap. 1301, T i t . 61. 26 Viaion: a.a.O., S. 549 f.; vgl. a. Neumark: Reichshaushaltplan etc., a.a.O., S. 171; ders.: Theorie u n d Praxis der Budgetgestaltung, a.a.O., S. 579. 27 Vgl. §§ 7 u n d 70 R H O ; hierzu Neumark: Reichshaushaltplan etc., a.a.O., S. 141 f., 191 f.; ders.: Theorie u n d Praxis etc., a.a.O., S. 575 f.; Viaion: a.a.O., S. 339 f.; zur historischen E n t w i c k l u n g der Rückeinnahmen s. insbes. Heinig: a.a.O., Bd. I, S. 456 ff. 22
28
1. Teil: Das Prinzip der Nonafektation
Innern) etwa 10 Hückeinnahmevermerke festzustellen, i m Einzelplan 11 (Bundesminister f ü r A r b e i t u n d Sozialordnung) deren 22, i m Einzelplan 12 (Bundesminister f ü r Verkehr) 46 u n d i m Einzelplan 14 (Bundesminister f ü r Verteidigung) gar mehr als 50. T r e t e n Verstöße gegen d e n G r u n d s a t z N o n a f f e k t a t i o n i m sog. „ o r d e n t l i c h e n H a u s h a l t " r e l a t i v selten auf, so b e d e u t e t f ü r d e n „außerordentlichen Haushalt" d e r V e r s t o ß gegen d i e N o n a f f e k t a t i o n s r e g e l f a k t i s c h d i e N o r m . H i e r b e i i s t z u t r e n n e n zwischen der z w e i f e l l o s gebräuchlicher e n A s s i g n a t i o n oder E i n n a h m e n aus d e m ö f f e n t l i c h e n K r e d i t (§ 3, A b s . 2 R H O ) u n d d e r „ V e r p f ä n d u n g " gewisser E i n n a h m e q u e l l e n z u g u n s t e n des Schuldendienstes. I n der Reihe der Verpfändungen, die gegenwärtig, v o n einigen Ausnahmen (ζ. B. der des französischen Amortisationsfonds) abgesehen, k a u m noch als üblich bezeichnet werden können, gehörte die A p p r o p r i a t i o n der Zolleinnahmen, der Erträge der Tabak-, B i e r - u n d Zuckersteuer, sowie der Nettoeinnahmen aus dem Spiritusmonopol zur Sicherung des Schuldendienstes f ü r die Daw es-Anleihe. Auch die Koppelung der Amortisation der KreugerAnleihe an die Einnahmen des Zündholzmonopols 2 8 u n d das Reichsnotopfer, dessen Erträge ursprünglich zur „Verminderung der Reichsschuld" bestimmt w a r e n 2 9 , u n d endlich die B i n d u n g des Beförderungsteueraufkommens, sowie bestimmter Erträge aus den Einnahmen der Reichsbahngesellschaft 30 , stellen Beispiele derartiger Verpfändungen dar. Eine noch gegenwärtig gültige A u s nahme von der üblichen Fundierung der öffentlichen Schuld bildet w e n i g stens f o r m e l l die „Caisse autonome d'Amortissement" Frankreichs. I h r waren seit ihrer Gründung 1926 zum Zwecke der Schuldentilgung die E r träge des Tabakmonopols, der Grundstücksumsatzsteuer u n d der Nachlaßsteuer zugewiesen. Außerdem erhielt sie garantierte Uberweisungen aus den M i t t e l n des allgemeinen Budgets, sofern u n d soweit die genannten Einnahmen eine bestimmte Grenze unterschritten. M i t t e der vierziger Jahre w u r d e n die Monopolerträge dem Trésor überlassen u n d die Überschüsse der A m o r t i sationskasse f ü r die Verstärkung der allgemeinen Deckungsmittel herangezogen, welchen seit 1946 noch zusätzlich die Erträge der Erbschaftsteuer zufließen 3 1 . Was d e n F a l l d e r A s s i g n a t i o n d e r E i n n a h m e n aus ö f f e n t l i c h e n A n l e i h e n a n l a n g t , so s t e h t u n d f ä l l t d i e K o n s t a t i e r u n g e i n e r Z w e c k b i n d u n g — w o r a u f Neumark 32 bereits v o r m e h r als d r e i ß i g J a h r e n h i n g e w i e s e n h a t — f r e i l i c h m i t der A u f h e b u n g j e n e r insbesondere i m R a h m e n der neueren Diskussion der Haushaltreform f ü r unzulänglich angesehenen m a t e r i e l l e n u n d f o r m e l l e n T r e n n u n g v o n o r d e n t l i c h e m 28 Vgl. W i l h e l m Dieben u n d K u r t Ebert: Die Technik des öffentlichen Kredits, HdF., 2. Aufl., Bd. I I I , Tübingen 1958, S. 61. 29 Fux: a.a.O., S. 154; allerdings w u r d e die erwähnte B i n d u n g nie realisiert; vgl. dazu Neumark: Reichshaushaltplan etc., a.a.O., S. 184, A n m . 1. 30 Neumark: Reichshaushaltplan etc., a.a.O., S. 179 ί ϊ . 31 P. Coulbois: Staatshaushalt u n d Finanzsystem Frankreichs, HdF., 2. Aufl., Bd. I I I , a.a.O., S. 263. Weitere Beispiele bei Heinig: a.a.O., Bd. I I , S. 487 f. 32 Reichshaushaltplan etc., a.a.O., S. 170; vgl. a. ders.: Theorie u n d Praxis etc., a.a.O., S. 599 f.
II.
ungen des Nonaffektationsprinzips
29
und außerordentlichem Budget. Eine solche Spezialisierung i m außerordentlichen Haushalt unterscheidet sich wesentlich von solchen Arten der Zweckbindung, welchen man den oben erwähnten „landläufigen" Begriffsinhalt zugrunde legt. Zwar kann hierbei die Zuordnung von bestimmten Einnahmen und Ausgaben des Extraordinariums fehlen, doch bewirkt die Trennimg des Gesamtbudgets i n einen ordentlichen und einen außerordentlichen Teil, daß der Gesamthaushalt nicht mehr dem Einheitsgrundsatz entspricht und freilich auch insofern zu Verstößen gegen das Nonaffektationsprinzip führt, als i m Sinne der herrschenden Deckungsgrundsätze „außerordentliche Einnahmen" nur auf „außerordentliche Ausgaben" angewiesen sind. Ein dritter Fall von Zweckbindungen i m Rahmen außerordentlicher Gebarungen bildet die Bestimmung des § 75 RHO, nach welcher Einnahmeüberschüsse entweder der Verminderung des „Anleihebedarfs" dienen oder (spätestens i m zweitnächsten Rechnungsjahr) der Schuldentilgung zugeführt werden müssen. Diese Bestimmung hat eine eindeutige Zweckbindung von (ordentlichen) Haushaltsmitteln für (eventuelle oder tatsächliche) Ausgaben des Extraordinariums zur Folge 3 3 . Eine weitere Form der Durchbrechung des Nonaffektationsprinzips, die i n der fiskalischen Praxis keine untergeordnete Rolle spielt, stellen sog. „Üb erw eisung ssteuern Zi dar. Hierbei handelt es sich nicht u m solche Überweisungen, die zu Haushalteinnahmen einer nachgeordneten Gebietskörperschaft m i t verpflichtender Zweckbindung werden (vgl. „indirekte Zweckbindung"), als vielmehr u m gesetzlich festgelegte 35 oder gar m i t Verfassungsrang gesicherte 36 Partizipationen über-, nachoder gleichgeordneter Gebietskörperschaften an den Erträgen gewisser Einnahmen. Da von vornherein entweder eine Mindestüberweisungshöhe (sog. „Überweisungsgarantie") oder der Ertragsanteil feststeht, gilt, daß solche Haushalteinnahmen oder doch Teile derselben der 33 Vgl. außer Neumark: Reichshaushaltplan etc., a.a.O., S. 188 ff. u n d Viaion: a.a.O., S. 910 ff., Denkschrift u n d Bemerkungen zur Reichshaushaltsrechnung, Drucksache Nr. 4045, Reichstag I I I . Wahlperiode 1924—1928. 34 Der K r i t i k Popitz 9 (Art.: Finanzausgleich, HdSt., 4. Aufl., Bd. I I I , Jena 1926) am Begriff „Überweisungsteuer" k a n n nicht beigepflichtet werden. Popitz w i l l diesen n u r angewandt wissen, w e n n eine Gebietskörperschaft Finanzzuweisungen aus der Gesamtheit aller Steuererträge leistet. E i n solcher Tatbestand würde sich bestenfalls m i t dem t r i v i a l e n Terminus „Steuerertragsüberweisungen" beschreiben lassen. Der Begriff „ Ü b e r w e i sungsteuern" bringt dagegen den oben behandelten Sachverhalt m i t h i n reichender Schärfe zum Ausdruck. Z u m Tatbestand, der unter dem überwiegend akzeptierten Begriff „Überweisungsteuer" zusammengefaßt ist, vgl. W i l h e l m Bickel: Der Finanzausgleich, HdF., 2. Aufl., Bd. I I , Tübingen 1956, S. 751 f., sowie K j e l d Philip: Intergovernmental Fiscal Relations, Inst, for Ec. and Hist., Kopenhagen 1954, S. 108 f. 35 ζ . B. nach dem Finanzausgleichsgesetz i. d. Fassg. v o m 27. A p r i l 1926, R G B l I, S. 203 ff. 3β Ζ. B. nach A r t . 106, Abs. 3 GG.
30
1. Teil: Das Prinzip der Nonafektation
unmittelbaren Votierung 3 7 entzogen und damit per definitionem einer Zweckbindung unterworfen sind 3 8 . Als Beispiel f ü r diese Zweckbindungsform können die Finanzausgleichsregelungen aus der Zeit der Weimarer R e p u b l i k 3 9 u n d die gegenwärtige A u f t e i l u n g der E i n k o m m e n - und Körperschaftsteuererträge der Bundesr e p u b l i k 4 0 angeführt werden. Sah die Finanzverfassung der Weimarer Repub l i k die Uberweisung von Anteilen an den Erträgen gewisser Reichssteuern (der Einkommen- u n d Körperschaftssteuer, der Umsatzsteuer, der Grunderwerbsteuer, bis 1924 auch der Erbschaftsteuer) m i t i m Laufe der Zeit v e r änderten Belastungs- u n d Zuweisungsraten 4 1 an die Länder vor, so ist f ü r die Bundesrepublik Deutschland durch Verfassungsvorschrift gesichert, daß von den jeweiligen Erträgen der der konkurrierenden Gesetzgebung u n t e r liegenden E i n k o m m e n - u n d Körperschaftsteuer (seit dem 1. A p r i l 1958) 42 Uberweisungen von 35 v H des Aufkommens dieser Steuern an den B u n d vorgenommen werden.
Auch die sog. „Beiträge Dritter" gehören als Beispiel für die als einstufig bezeichneten Formen der direkten Zweckbindung von Haushaltmitteln für zumeist ordentliche, zuweilen außerordentliche Ausgaben i n diese Betrachtung. Solche Beiträge sind i n den Vorschriften des § 9 RHO ausdrücklich als zu etatisierende Posten erwähnt. Bei ihnen handelt es sich nur um Entgelte natürlicher oder juristischer Personen des 37 Von „unmittelbarer Votierung" w i r d deswegen gesprochen, w e i l solche Regelungen des Finanzausgleichs — w i e die jeder anderen F o r m der Zweckbindung — der parlamentarischen Willensbildung nicht endgültig entzogen sind. Der Zuweisungsmodus ist zwar für eine bestimmte Dauer garantiert, u m so mehr als er nicht i m Rahmen eines jährlichen Haushaltgesetzes oder einer „Finance A c t " votiert w i r d . Das g i l t namentlich für die Bundesrepublik, da A r t . 107, Abs. 1 G G dem Parlament die Möglichkeit einräumt, ohne V e r fassungsänderung die i n A r t . 106, Abs. 3 GG festgelegten Anteile durch Bundesgesetz zu ändern. 38 Vgl. außer Neumark: Reichshaushaltplan etc., a.a.O., S. 175 f. u n d Heinig: a.a.O., Bd. I I , S. 489 f., J. W. Sundelson; Budgetary Methods i n National and State Governments, Special Report of the State T a x Commission, A l b a n y 1938, S. 213. 39 Neumark: Reichshaushaltplan etc., a.a.O., S. 46, 175 ff.; Hans-Erich Hornschu: Die E n t w i c k l u n g des Finanzausgleichs i m Deutschen Reich u n d i n Preußen von 1919 bis 1944, Kieler Studien, Forschungsberichte d. Inst. f. Weltwirtsch. a. d. Univ. Kiel, hrsg. v. Fritz Baade, K i e l 1950, S. 14 ff.; s. a. Finanzverwaltung u n d Finanzausgleich i n der Weimarer Republik, Inst. „Finanzen u n d Steuern", H. 42, Bonn 1956, S. 47 ff. 40 F r i t z Terhalle: Das Finanz- u n d Steuersystem der Bundesrepublik Deutschland, HdF., 2. Aufl., Bd. I I I , Tübingen 1958, S. 172 f.; Gerhard Wacke: Das Finanzwesen der Bundesrepublik, Beihefte zur Deutschen Rechtszeitschr. 13, Tübingen 1950, S. 42 ff.; s. a. Finanzausgleich, Beiträge zur Frage des Finanzausgleichs u n d der Organisation der Finanzverwaltung, Inst. „Finanzen u n d Steuern", H. 17, Bonn o. J., S. 20. 41 So wurde ζ. B. 1925 der Länderanteil am A u f k o m m e n der E i n k o m m e n u n d Körperschaftsteuer von 90 auf 75 v H herabgesetzt, gleichzeitig aber der Ertragsanteil der Länder an der Umsatzsteuer von 20 auf 35 v H erhöht: Finanzausgleichsgesetz v o m 10. August 1925, R G B l I, S. 254. 42 A r t . 106, Abs. 3 G G i. d. Fassg. des Gesetzes zur Änderung u n d Ergänzung der Finanzverfassung (Finanzverfassungsgesetz) v o m 23. Dezember 1955, B G B l I , S. 817.
II.
ungen des Nonaffektationsprinzips
31
privaten Rechts für spezielle Staatsleistungen (ζ. B. Anliegerbeiträge), sondern auch um zweckgebundene Zuweisungen der öffentlichen Gebietskörperschaften untereinander, wie das beispielsweise für die sog. „Bauleitungsmittel", welche vom Bund den Landesverwaltungen zwecks Unterhaltung von Bundeseigentum überwiesen werden, zutrifft 4 3 . Letzterer Fall gehört freilich insofern der Kategorie der „indirekten Zweckbindung" an, als diese Beiträge nur bei der empfangenen Gebietsköperschaft einer Zweckbindung unterliegen, von dem überweisenden Verband indessen aus allgemeinen Deckungsmitteln geleistet werden. Als ein letztes Beispiel für die Form der „einstufigen Zweckbindung" sind die staatlichen Sondervermögen, die Fonds i m ursprünglichen Sinne also, und die verselbständigten Dienstzweige anzuführen. Hier sollen solche Formen separierter Fonds nicht erwähnt werden, die entweder mangels eigener Rechtspersönlichkeit oder kraft besonderer Gesetzesvorschriften von einem übergeordneten Verband Zuweisungen aus allgemeinen Deckungsmitteln m i t verpflichtender Zweckbindung erhalten 4 4 , sondern solche Einrichtungen, denen eigene Einnahmequellen zur Wahrnehmung spezieller Aufgaben delegiert sind. Dazu gehören neben der Bundespost und der Bundesbahn das ERP-Sondervermögen, rechtlich selbständige öffentliche Unternehmen (§ 15, Abs. 1 RHO), das ehemalige Investitionshilfe-Sondervermögen, aber auch jene parafiskalischen Institutionen, die m i t der Wahrnehmung vornehmlich sozialpolitischer Staatsaufgaben betraut sind, und schließlich die sog. „personifizierten Dienstzweige" (Jèze), namentlich der Kultus- und Unterrichtsverwaltung. Man begegnet, abgesehen von ζ. T. sicherlich erforderlichen und zweckmäßig angelegten öffentlichen Vermögensmassen, i n jenen Sonderfonds nicht nur einer Durchbrechung des Nonaffektationsgrundsatzes schlechthin, sondern nicht selten zugleich auch den schroffsten Verstößen gegen die Prinzipien der Vollständigkeit, Einheit und Klarheit des Budgets. Zumindest für die nicht-rechtsfähigen Vermögensmassen besteht i n der Bundesrepublik keine einheitliche, sondern höchst komplizierte Praxis. Vielfach handelt es sich u m eine vom Haushalt einer öffentlichen Gebietskörperschaft weitgehend abgetrennte öffentliche Veranstaltung, wobei der einzige Zusammenhang zwischen dem Haushalt (des Bundes beispielsweise) einerseits, seiner „statio fisci" andererseits i n den Ablieferungen der nicht Betriebsergebnis darstellenden Erträgnisse zu erblicken ist. Da i m allgemeinen keine Verpflichtung eines budgetmäßigen Nachweises aller Zu43 F ü r die „Beiträge D r i t t e r " vgl. Neumark: Reichshaushaltplan etc., a.a.O., S. 190 f.; Viaion: a.a.O., S. 255 u n d passim. 44 Vgl. den Abschnitt über die Formen der „ i n d i r e k t e n Zweckbindung". Das sog. „Zweckvermögen" bleibt innerhalb dieser Betrachtungen unberücksichtigt, w e i l es lediglich die Folge einer bestimmten Ausgabetechnik darstellt, durch welche der Oberverband nicht verpflichtet w i r d .
32
1. Teil: Das Prinzip der Nonafektation
und Abflüsse besteht, vollziehen sich die Ausgabe- und Einnahmegebarungen jener Sondervermögen — wie erwähnt — außerhalb des Etats. Entsprechend der weiter oben angeführten Unterscheidung ist nunmehr die Form der „indirekten Zweckbindung" zu betrachten. Wie bereits angedeutet, lassen sich hierbei einstufige von mehrstufigen Formen trennen. Von einer mehrstufigen Zweckbindung kann nur dann gesprochen werden, wenn zugleich das indirekte Verfahren der Ertragsspezialisierung angewendet wird. Daraus ist zu ersehen, daß diese Unterscheidung direkter und indirekter Formen der Zweckbindung von der Brätierschen Unterscheidung abweicht. U m diese Abweichungen näher zu erklären, werden die obigen Andeutungen i m folgenden weiter ausgeführt. Während bei der direkten Methode der Zweckzuwendung der Haushalt lediglich einer Gebietskörperschaft Einnahmespezialisierungen aufweist, sind bei der indirekten Methode der Zweckbindung die Budgets von mindestens zwei Körperschaften durch spezialisierte Einnahmen verbunden. Grundsätzlich können drei Fälle unterschieden werden: Erstens kann der Oberverband Überweisungen aus für diese Zwecke gebundenen Einahmen (ζ. B. „Überweisungsteuern, s. o.) vornehmen, wobei diese Überweisungen als allgemeine Deckungsmittel bei der nachgeordneten Gebietskörperschaft etatisiert werden (Finanzzuweisungen). Zweitens ist denkbar, daß der Oberverband aus allgemeinen Deckungsmitteln Überweisungen macht, die beim Unterverband als zweckgebundene Einnahmen erscheinen („Subventionen" i. e. S.). D r i t tens können bereits beim Oberverband für Überweisungen an Unterverbände zweckgebundene Einnahmen an letztere m i t verpflichtender Zweckzuwendung abgeführt werden. Während i m Fall der sog. „Überweisungsteuer" eine einstufig-direkte Zweckbindung vorliegt, da nur der Oberverband verpflichtet ist, aus bestimmten Einnahmen Überweisungen i n einer vorgeschriebenen Höhe an Unterverbände zu vollziehen, besteht i m zweiten Fall insofern eine einstufig-indirekte Zweckbindung, als der Oberverband, obzwar dieser keine zweckgebundenen Einnahmen abführt, den Unterverband anweist, die überwiesenen Beträge für bestimmte Zwecke zu verausgaben. I n diesem Falle bedient sich der Oberverband des Unterverbandes als einer „statio fìsci". Bei der mehrstufig-indirekten Zweckbindung handelt es sich schließlich materiell u m einen zwei öffentliche Haushalte „durchlaufenden Posten". Solche Zweckbindungsformen sind bei gesetzlich vorgeschriebenen Er^> tragspartizipationen anzutreffen, die auch beim Unterverband nur auf bestimmte Ausgaben angewiesen werden dürfen. A l l e i n diesen Fall hatte Bräuer i m Auge, wenn er m i t dem Terminus „indirekte Zweckbindung" den Tatbestand erfassen wollte, daß der Oberverband „ . . . die
II.
ungen des Nonaffektationsprinzips
33
Ertragsanteile 45 einem anderen öffentlichen Gemeinwesen m i t verpflichtender Zweckzuwendung überweist." 4 6 Die haushaltmäßige Verbundenheit mehrerer Gebietskörperschaften stellt bei Bräuer m i t h i n eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Erfüllung des Tatbestandes dar, welchen er unter dem Terminus „indirekte Zweckbindung" begreift. I m Gegensatz dazu bedeutet die haushaltmäßige Verkettung mehrerer Gebietkörperschaften notwendige und hinreichende Bedingung für die Erfüllung des Tatbestandes der indirekten Zweckbindung i m hier verwendeten Sinn, sofern nur die Zweckbindimg i m Haushalt des Unterverbandes vorliegt. Der i m Rahmen dieser Ausführungen verwendete Begriff der „indirekten Zweckbindung" erfaßt m i t hin eine Variante mehr als der Bräuersche. Aus diesem Grund ist die weitere Unterscheidung nötig, die zum Ausdruck bringt, auf wieviel „Budgetstufen" eine Zweckbindung erfolgt. Jede A r t der indirekten Zweckbindung stellt nichts als die Folge jener Hierarchie von Gebietskörperschaften und Institutionen dar, derer sich der Staat zum Vollzug seiner Aufgaben bedient. Aber auch hierbei ist wieder eine Unterscheidung zu treffen, die beweisen mag, welche Schwierigkeiten es bereitet, Fakten und Prinzipien der öffentlichen Haushaltführung nach Gemeinsamkeiten zu gliedern. Sowohl bei der einstufig-indirekten Form der Zweckbindung als auch bei der mehrstufig-indirekten Form werden Überweisungen vom Oberverband vollzogen, an die eine Verpflichtung des empfangenden Unterverbandes geknüpft ist. Dabei kann es sich u m Zweckzuweisungen (Zuweisungen also, die nicht Finanzzuweisungen darstellen), u m Beiträge, Zuschüsse47, „durchlaufende Posten" wie endlich auch um solche „Überweisungsteuern handeln, die auch i m Etat des Unterverbandes einer Zwecksonderung unterliegen. Erhält beispielsweise ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen, wie der Lastenausgleichsfonds, die Erträge einer bestimmten Abgabe, welche das Budget des Oberverbandes (des Bundes ζ. B.) „durchlaufen", so bedeutet diese Regelung offensichtlich etwas ganz anderes, als der Fall mehrstufig zweckgebundener Überweisungsteuern, obzwar i n beiden Fällen formell kein Unterschied besteht. I m ersten Fall geht es darum, durch die Ausgliederung (vorübergehend) eine Behörde zur Wahrnehmung einer ihrer Natur nach völlig „unklassischen" Staatsaufgabe zu schaffen, die eine sc. „bankenartige" A b wicklung erfordert. I m zweiten Fall — wie freilich auch bei der indirekten Zweckbindung der vom Oberverband aus allgemeinen Deckungs45 Diese „Ertragsanteile" sind gesetzlich fixiert, nicht etwa lediglich durch eine haushaltgesetzliche Bestimmung vorgeschrieben. 46 Bräuer: a.a.O., S. 57, ähnl. a. S. 61. 47 Der i n der finanzwissenschaftlichen L i t e r a t u r f ü r diese Regelungen des Finanzausgleichs verwendete Begriff „Subventionen", sei hier u n d i m folgenden wegen seines ambivalenten Inhaltes vermieden.
3 Fecher
34
1. Teil: Das Prinzip der Nonafektation
mittein vollzogenen Überweisungen — handelt es sich dagegen offenbar um eine Regelung des vertikalen Finanzausgleichs 48 . Hierbei gilt — anders als bei dem oben erwähnten System von Überweisungsteuern, wie sie i n der Zeit der Weimarer Republik vorgefunden werden —, daß sich der Oberverband (oder Unterverband) an vorübergehenden oder ständigen Aufgaben des Unterverbandes (Oberverbandes) durch Zuschüsse beteiligt, wenn die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe i m Kompetenzbereich einer anderen Gebietskörperschaft gelegen ist, durch Beiträge dagegen dann, wenn eine Körperschaft als Kostenträger fungiert und (nachgeordnete) Verbände zur finanziellen Beihilfe verpflichtet. Daraus ist ersichtlich, ohne daß die Problematik des Finanzausgleichs einer näheren Erläuterung bedarf, daß der Nonaffektationsgrundsatz allein durch die finanziellen Verknüpfungen von Verbänden und Sondervermögen und durch bestimmte Formen des vertikalen Finanzausgleichs durchbrochen werden kann. Einstufig-indirekte Formen der Zweckbindung von Staatseinnahmen sind kaum weniger häufig anzutreffen als direkte Ertragsspezialisierungen. Die Darstellung der folgenden Beispiele, die insbesondere der deutschen Haushaltpraxis entnommen sind, erhebt ebensowenig A n spruch auf Vollständigkeit, wie die Erörterung derjenigen aus dem Bereich der direkten Zweckbindung. Einstufig-indirekte Zweckbindungen stellen ζ. B. Zuweisungen an selbständigen Tilgungs- u n d Amortisationskassen dar. Solche Kassen sind f ü r die Gebarung des französischen Trésorerie noch heutzutage bedeutungsvoll, insbesondere der Fonds f ü r Modernisierung u n d Ausstattung (FME), der allein der Durchführung des Monnet- Planes diente 4 9 . Diesem Sondervermögen waren u. a. zunächst die Mehreinnahmen aus der Erhöhung bestimmter Steuern u n d die Einnahmen aus der amerikanischen Wirtschaftshilfe überlassen. A u c h die Wiedergutmachung von Kriegsschäden w i r d i n Frankreich von einer Sonderkasse finanziert („Caisse autonome de la Reconstruction"), welche, gleich dem Modernisierungsfonds, durch die Vorschüsse des Trésors unterhalten w i r d . Beide Kassen sind m i t dem E x t r a o r d i n a r i u m verbunden 5 0 . Ä h n l i c h verhält es sich auch m i t dem außerhalb des belgischen Staatsbudgets geführten „budget des recettes et des dépenses pour o r d r e " 5 1 .
Diese Beispiele zeigen, daß bestimmten staatlichen Institutionen keine „Zweckbindungstypen zugeordnet werden können. Vielmehr besteht die Möglichkeit, daß gewisse Sonderfonds Einnahmen erhalten, deren Zweckbindungsformen völlig verschieden sind. 4
« Daß diese Maßnahmen infolge besonderer Ausgestaltung des Zuweisungsschlüssels „horizontale Effekte" auslösen können, bleibe unberücksichtigt, da es hier auf die Darstellung rein formaler Zusammenhänge ankommt. 49 F ü r die neuere E n t w i c k l u n g (Ablösung des 3. Plans) vgl. Informationsdienst zur Finanzpolitik des Auslands, hrsg. v. Bundesministerium der Finanzen, Nr. 30 v. 15. J u n i 1960, S. 6 f. 59 Coulbois: a.a.O., S. 245 f. 51 A . Magain u n d G. Coppée: Staatshaushalt u n d Finanzsystem Belgiens, HdF., 2. Aufl., Bd. I I I , a.a.O., S. 272.
II.
ungen des Nonaffektationsprinzips
35
F ü r die als einstufig-indirekt bezeichnete F o r m der Zweckbindung sind f ü r die Bundesrepublik die nicht unbeträchtlichen Zuschüsse des Bundes an die Träger der Sozialversicherung, der Kriegsopferversorgung etc. zu nennen, über deren E n t w i c k l u n g die folgende Tabelle Aufschluß erteilt. Tabelle
1
Entwicklung der Sozialleistungen des Bundes ohne die Abführung der Lastenausgleichsabgabe und die Leistungen an ehemalige politische Häftlinge und Kriegsgefangene 1957 bis 1960 (einschl. Verwaltungsaufwand) in Mill. D M Zuschußempfänger Kriegsopferversorgung Sozialversicherung Kriegsfolgenhilfe Arbeitslosenhilfe Lastenausgleichsfonds Umsiedlung u n d Auswanderung Betriebliche Altersfürsorge
|
..
insgesamt davon Verwaltungsaufwand . .
1957
1958
1959
1960
3 602 4717 756 411 343
3 463 5 099 768 370 233
3 336 5 207 700 368 406
4171 6 193 708 254 380
30 4
21 3
20 4
19 3
9 863
9957
10 041
11 728
23
18
16
11
Quelle: A l l g e m e i n e V o r b e m e r k u n g e n z u m B u n d e s h a u s h a l t s p l a n f ü r das R e c h n u n g s j a h r 1960, S. 228.
Der Katalog derartig zweckgebundener Überweisungen u n d Zuschüsse, w i e sie nicht allein Sonderfonds u n d Anstalten des öffentlichen Rechts 5 2 , sondern auch ausgegliederte („personifizierte") Dienstzweige erhalten, ließe sich i n nicht zweckdienlicher Weise ins Uferlose erweitern. D i e z w e i t e A r t der i n d i r e k t e n Z w e c k b i n d u n g erfaßt d e r e n m e h r stufige F o r m , die v o n Bräuer als das „ i n d i r e k t e V e r f a h r e n d e r Z w e c k z u w e n d u n g " bezeichnet w i r d . W i e e r w ä h n t , h a n d e l t es sich — i m G e gensatz z u r einstufigen A r t d e r i n d i r e k t e n Z w e c k b i n d u n g — d a r u m , daß f ü r die Z w e c k e der Ü b e r w e i s u n g an nachgeordnete G e b i e t s k ö r p e r schaften i m O b e r v e r b a n d spezialisierte E i n n a h m e n auch i m U n t e r v e r b a n d der F i n a n z i e r u n g ausgesonderter A u f g a b e n v o r b e h a l t e n sind. 52 Hierzu gehören z.B. Forschungsinstitute der Universitäten, die von Bund, Ländern u n d Gemeinden Zuschüsse erhalten, auch w e n n diese den Charakter von Dotationen besitzen. Nicht i n diese Gruppe gehören F o r schungsinstitute, die zwar der Gemeinnützigkeitsverordnung unterliegen u n d Pauschal- oder Einzelzuschüsse von den öffentlichen Gebietskörperschaften erhalten, aber sog. „hochschulfreie Institutionen" darstellen. Vgl. K u r t Pfuhl: Das Königsteiner Staatsabkommen, Der öffentliche Haushalt, A r c h i v f. Finanzkontrolle, Jg. 5, 4. V j . 1958/III, 1960, H. 5/6, S. 200 if. — Von nicht geringer Bedeutung sind auch die i n Kap. 3607 des Bundeshaushaltplans v o n 1960 veranschlagten Ausgaben für „zivile Notstandsmaßnahmen auf dem Gebiet des Verkehrs", soweit sie f ü r die Deutsche Bundesbahn i n Betracht kommen.
*
36
1. Teil: Das Prinzip der Nonafektation
Als Beispiele für die mehrstufigen Formen der indirekten Zweckbindung — namentlich aus der Zeit der Weimarer Republik — können die bereits erwähnten Bindungen der Reichsbahneinnahmen an den Reparationsfonds u n d die Überweisungen der Kraftfahrzeugsteuererträge an die Wegebaufonds (die Kraftfahrzeugsteuer w a r auch i n den Budgets der Oberverbände spezialisiert) gelten, wobei als hervorhebenswert erscheint, daß solche Uberweisungen aus den Kraftverkehrsabgaben insbesondere i n Großbritannien gebräuchlich waren. Auch die vor kurzem noch gültige B i n d u n g eines Teils der französischen Mineralöl- u n d Alkoholsteuereinnahmen an die A l t e r s versorgungskasse gehört i n diese Betrachtung. Jene Regelung geht auf einen Regierungsentwurf zurück, der am 17. Nov. 1955 i n erster Lesung von der Nationalversammlung einstimmig angenommen wurde. Die Erhöhung der Altersrenten („allocation aux vieux travailleurs salariés" sowie die „allocat i o n spéciale") i m Rahmen der Reform der französischen Altersversicherung, welche die damalige Regierung Faure durchführte, wurde aus dem M e h r aufkommen der genannten Abgaben gedeckt, deren Sätze gleichzeitig angehoben w u r d e n 5 3 . Auch der Lastenausgleichsfonds ist i m Zusammenhang m i t der mehrstufigindirekten Zweckbindung zu erwähnen. Seine Ausgaben u n d Einnahmen werden — anders als bei der früheren Regelung i n einem Anhangbudget — neuerdings i m Bundeshaushalt nachgewiesen. A l s beachtenswert erscheint, daß die „Kosten der Durchführung dieses Gesetzes . . . aus dem Ausgleichsfonds nicht bestritten werden" dürfen (§ 5 Abs. 2 L A G ) . Die Einnahmen des Lastenausgleichsfonds (Lastenausgleichsabgaben, Säumniszuschläge, Geldstrafen etc.) sind i m Einzelplan 60, „Allgemeine Finanz Verwaltung" (Kap. 6001, Tit. St. 40 bis 42), nachgewiesen. I h r e Zweckbindung ist durch Vermerk gesichert: „Die Einnahmen der T i t . St. 40 bis 42 dienen ausschließlich zur Deckung der Ausgaben bei Kap. 4005 Tit. 300". Beilage 3 zum Vermögensnachweis des Ausgleichsfonds enthält Vermögen u n d Schulden i n Einzelaufgliederung. Als ein letztes Beispiel aus der Vielzahl derer, die bereits nach einem kurzen Blick i n den Bundeshaushaltplan aufgefunden werden können, seien neben den Zuschüssen des Bundes (und der Länder) an E i n richtungen der Wissenschaft, Erziehung, K u n s t u n d Volksbildung die spezialisierten Zuschüsse, Betriebsbeihilfen u n d Darlehen f ü r die Deutsche Bundesbahn erwähnt, w i e sie sich u. a. aus dem Verkehrsfinanzgesetz vom 6. A p r i l 1955, sowie aus den Vorschriften über die Verwendung des ERPSondervermögens ergeben 5 4 .
Von den beiden genannten Formen der indirekten Zweckbindung kann eine dritte unterschieden werden, die freilich eine Mischform zwischen direktem und indirektem Verfahren darstellt: Die Zweckbindung der einzelstaatlichen Kraftfahrzeugsteuererträge w i r d in den USA seit 1934 durch den Kongreß derart erzwungen, daß dieser die „Grants i n A i d " unverzüglich um ein Drittel für den Staat reduziert, der das Aufkommen aus den Kraftverkehrsabgaben zu anderen Zwecken als solchen der Straßenbaufinanzierung verausgabt 55 . 53 Journal Officiel, A v i s et Rapports du Conseil Economique, No. 6, 16. März 1955. 54 Vgl. Erläuterungen zu Kap. 1202, T i t . 510 des Bundeshaushaltplanes von 1960. 55 A l f r e d G. Buehler: Public Finance, New Y o r k and London 1940, S. 144.
II. c) Die Technik
ungen des Nonaffektationsprinzips der Zweckzuwendung
von
37
Staatseinnahmen
Wurde i m vorigen Abschnitt gefragt, wo Verstöße gegen den Grundsatz der Unzulässigkeit von Zweckzuwendungen öffentlicher Einnahmen i n der finanzwirtschaftlichen Realität auftreten, so soll jetzt untersucht werden, von welchen Kriterien bei der Messung eines unmittelbaren Zusammenhangs von Staatseinnahme und Staatsausgabe auszugehen ist. Die Technik der Zweckzuwendung sagt also über die Intensität jenes Zusammenhanges aus; es bedarf daher keiner Berücksichtigung der A r t der Staatseinnahme, die Spezialisierungsvorschriften unterworfen ist. Je nachdem ob die gesamten Erträge einer öffentlichen Einnahme auf eine ausgesonderte Ausgabe angewiesen sind oder ob derselben nur Ertragsanteile zufließen 56 , läßt sich zwischen totaler und partieller Zweckbindung unterscheiden. Der letztere Zweckbindungsmodus kann seinerseits unterteilt werden i n einen absolut und einen relativ-anteilsmäßigen. Desweiteren ist eine pauschale Zuweisung ausgesonderter Staatseinnahmen denkbar, obgleich dieser Modus der Zweckzuwendung faktisch m i t den „permanent appropriations" identisch ist. Schließlich kann eine partielle Zweckbindung derart auftreten, daß zu einer bereits bestehenden Abgabe von irgendeiner öffentlichen Gebietskörperschaft sog. zweckgebundene Zuschläge erhoben werden. Die einfachste Form der Spezialisierungstechnik ist die der totalen Zweckzuwendung, die — sofern sie keiner zusätzlichen Bedingung unterliegt — bewirkt, daß die zur Erfüllung einer ausgesonderten Staatsaufgabe bestimmten Staatsausgaben i n Ausmaß und Rhythmus den spezialisierten Staatseinnahmen folgen. Bei der partiellen Ertragsbindung kann es sich einmal darum handeln, daß die einen vorher festgesetzten Betrag (als „Sockel-", zuweilen auch als „Abgeltungsbetrag" bezeichnet), welcher auf die allgemeinen Deckungsmittel angewiesen wird, überschreitenden Einnahmen einer spezialisierten Ausgabe zugeführt werden 3 7 . Zum anderen kann — wie angedeutet — bestimmt sein, daß ein festgesetzter relativer Anteil an einer öffentlichen Einnahme auf eine bestimmte Ausgabe angewiesen wird. Während i m ersten Fall — zeitliche Verzögerungen der Ertragsverwendung ausgeschlossen — die Entwicklung der spezialisierten Ausgabe dem Verlauf der zweckgebundenen Einnahme u m einen konstanten Betrag vermindert folgt, sind i m zweiten Fall (ζ. B. bei sog. „Überweisungsteuern") die Bewegungen der ausgesonderten Staatsausgabe gedämpfter als die 56 Hierzu Neumark: Reichshaushaltplan etc., a.a.O., S. 164 f.; Bräuer: a.a.O., S. 26 ff. 57 Dies ist, w i e erwähnt, bei der Spezialisierung des Mineralölsteueraufkommens der Bundesrepublik für die Zwecke der Straßenbaufinanzierung der Fall.
38
1. Teil: Das Prinzip der Nonafektation
der Staatseinnahme, wenn als realistisch unterstellt wird, daß der Zweckbindungskoeffizient größer als N u l l und kleiner als Eins ist. I n den folgenden Zeichnungen, die diese Zusammenhänge veranschaulichen, w i r d zunächst synchroner Verlauf der spezialisierten Einnahmen und Ausgaben über die Zeit, sodann eine einperiodige Ausgabenverzögerung angenommen. Die Gestalt der Ertragsfunktion ist w i l l kürlich gewählt.
Figur 1 a Totale Zweckbindung
Figur 1 b Partielle Zweckbindung absolut
Legende: s — E r t r a g der spezialisierten Staatseinnahme a — ausgesonderte Staatsausgabe t — Haushaltperiode α — Zweckbindungskoeffizient
(0
dt
T
36 w i e leicht einzusehen ist, enthält (3.4) alle weiter oben behandelten Zusammenhänge. Bei synchronem Verlauf v o n a t u n d s t ist f(t) = 0, bei konstantem „ t i m e lag" ist f(t) = c. 37 Bei Verzicht auf vollständige zeitliche Anpassung betragen die Kassendefizite insgesamt: , l
M- olo t - t
tr.
dt
T
die Kassenüberschüsse: °
0 t
tt-tT
„e
tra dt
I I I . Durchbrechungen des Nonaffektationsprinzips
69
F ü r den realistischeren F a l l der diskontinuierlichen Einnahme- u n d A u s gabenentwicklung ist die Höhe der jeweiligen Vorauszahlungen bzw. Stundungen zu bestimmen. Es sei (wie bei Fig. 3) unterstellt, daß der Ausgangsw e r t der geplanten Ausgabe größer sei als derjenige der zweckgebundenen Einnahme.
α/s·
î°o-so bJa-l,
Isî
0
CL . .
1. Gleichmäßige Verteilung g i l t f ü r f(t) = 1. Z u m Boldrinischen Maß vgl. Slawtscho Sagoroff: Die Paretosche u n d die Lorenzsche k u m u l a t i v e Verteilungskurve der individuellen E i n k o m men, Mitteilungsblatt f ü r mathematische Statistik, Jg. 4, 1952, H. 2/3, S. 155 f.
150
2. Teil: Die Zweckbindung von Kraftverkehrsabgaben
Maß oder gar nicht beeinflußt wird. Da die Einrichtung von Straßen m i t schweren Decken höhere Ausgaben erfordert als der Bau von Straßen m i t leichten Decken, sinken notwendig die Unterhaltungsausgaben m i t steigenden Investitionen. Aber auch für den Kapazitätseffekt der Straßeninvestitionen lassen sich ähnliche Überlegungen anstellen. M i t der Ausdehnung des Straßennetzes steigt bei konstantem Fahrzeugbestand der Grad der Verkehrssicherheit und die Funktionsfähigkeit der Straßenverkehrswege: die durchschnittliche Straßennutzung sinkt, d. h. die dem Einzelfahrzeug i m Durchschnitt zur Verfügung stehende Strecke steigt. M i t großer Wahrscheinlichkeit vermindern sich infolgedessen die Aufwendungen für Polizeidienste, Nachrichteneinrichtungen und sonstige, allein durch die Verkehrsdichte bedingten Sicherheitsvorkehrungen, die nicht durch straßenverkehrsrechtliche Vorschriften geschaffen werden können. Wenn i m folgenden zunächst von den Preiseinflüssen abstrahiert, also das „Mengengerüst" der Straßenkosten diskutiert wird, kann die Kostenfunktion i. S. der vorstehenden Überlegungen angeschrieben werden als: (6. 4)
K
m
=
&i
Z + qR , 0 < q < 1 ,
wo q für den Koeffizienten des ruhenden Verschleißes steht. Stellt man sich vor, daß i n ai alle technischen Verschleißfaktoren Vi enthalten sind, die von Kraftwagengröße, Gewicht, Achslast, Motorstärke usw. abhängen, so sinkt, wie angedeutet, a\ m i t steigendem R (I s > 0). Daraus folgt, daß die Straßenkosten konstant bleiben, wenn die Straßeninvestitionen eine ganz bestimmte Größe erreichen. Setzt man (6.5)
a, = - L 1 bR'
wo b > 0 irgendeine angenommene parametrische Konstante ist, so geht (6.4) über in: K (6. 6) m = Z bV + q R Hieraus folgt, daß es eine bestimmte Zuordnung von R und Ζ gibt, für die die Gesamtstraßenkosten und damit auch der durchschnittliche Abgabesatz ρ minimal sind 2 5 : (6. 7) 25
Ζ = R2qb.
Der partielle Differentialquotient
θΖ zeigt, daß für K gegen verläuft K
m m
=
1
"bR
i n Abhängigkeit von Ζ kein E x t r e m w e r t existiert. Daüber R parabolisch:
Setzt man diesen partiellen Differentialquotienten gleich N u l l u n d expliziert
I .
elle Bedingungen der Zweckbindung v Kraftverkehrsabgaben 151
Die für die kostenminimale R/Z-Kombination dargestellte Gleichung (6.7) zeigt, daß der Staat durch permanente Neufestsetzung des Abgabesatzes ρ die Belastung des Kraftverkehrs für jeden beliebigen Fahrzeugbestand minimieren kann, sofern er seine Investitionen an dieser Bedingung ausrichtet 20 . Beschränkt der Staat aber das i m Straßenwesen investierte Kapital auf ein bestimmtes Niveau, so gibt es nur einen minimalen Abgabesatz bei einer bestimmten Größe des Fahrzeugbestands. Dieser Abgabesatz ist u m so niedriger und der i h m zugeordnete Fahrzeugbestand um so größer, je höher das jeweils konstante Kapitalniveau ist 2 7 . Die vorgetragenen Überlegungen abstrahieren von einer institutionell gesetzten oberen Grenze für den Ausnutzungsgrad des Straßennetzes. Wenn Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Straßenverkehrs weitgehend vom jeweiligen Ausnutzungsgrad abhängen, so gibt es eine obere Grenze, jenseits der kapazitätserweiternde Investitionen erforderlich werden (ζ. B. § 3 Bundesfernstraßengesetz, der allerdings mannigfache Auslegungsmöglichkeiten bietet). Eine untere Grenze für den Ausnutzungsgrad ist nicht exakt zu bestimmen. Sie liegt möglicherweise dort, wo eine weitere Ausdehnung des Straßennetzes i m Hinblick auf die Erfüllung anderer gemein wirtschaftlicher Ziele als abträglich angesehen wird. Beide Grenzen können nicht zusammenfallen. Bei der Berücksichtigung jener oberen Grenze für den Ausnutzungsgrad des Straßennetzes kommt es vornehmlich auf den Kapazitätseffekt der Straßeninvestitionen an. Da aber unter den genannten Voraussetzungen aus jeder Straßeninvestition auch ein Rationalisierungseffekt resultiert, muß die Orientierung der staatlichen Investitionen für das nach Z, so erhält m a n die Bedingungsgleichung (6.7). Die hinreichende Bedingung dafür, daß diese Gleichung die Kosten- u n d Satzminima beschreibt, ist erfüllt, da: 92Km _
82Km
9zis
isaz
9
2
Τ x
s
26
m „ ^
1
bR" ' X
bR4
Die Investitionen, die dieser Bedingung genügen, sind gegeben durch: s
2
K
2
_
2j/z|/qb·
7 F ü r jedes Ζ gibt es beliebig viele R, wobei Ζ =f= R 2 q b , es gibt 2 R für jedes Ζ u n d feste K m > Min., u n d es gibt n u r ein Ζ = R 2 q b , für das K m = M i n . Da bei gegebenem K m alle Z, die die Gleichung (6. 7) erfüllen, M a x i m a darstellen u n d f ü r Ζ = 0 K m = q R ^ qR 2 , . . . , folgt, daß (6. 6) i n der ZOR-Ebene graphisch dargestellt, eine Schar von Isoquanten bildet, die konkav zur K u r v e der kostenminimalen R/Z-Kombinationen verläuft, w ä h rend die Niveaulinien der Abgabesätze konvex zu dieser K u r v e verlaufen.
152
2. Teil: Die Zweckbindung von Kraftverkehrsabgaben
Straßenwesen an dieser Grenze notwendig auch zu Satzvariationen führen. Die Nebenbedingung für die maximal zulässige Straßenausnutzung lautet Ζ (6.8a)
• jT = Max.
bzw. als Reziprokum L
(6. 8b)
= Min.
wo (6.8 b) das fixierte M i n i m u m der dem Einzelfahrzeug durchschnittlich zur Verfügung stehenden Strecke darstellt 2 8 . Ist R = L · p, so gilt für die dem Einzelfahrzeug i m Durchschnitt zur Verfügung stehende Wegstrecke, wenn die staatlichen Investitionen an der Absicht der Abgabesatzminimierung orientiert sind: (6- 9 >
m
im>0i
1
bqZp2
Da m m i t wachsendem Fahrzeugbestand sinkt — ρ sei der Einfachheit halber gleich Eins gesetzt —, liegt die satzminimale R/Z-Zuordnung nur bis zu einem bestimmten Ausmaß des Fahrzeugbestandes innerhalb des durch Sicherheitsvorschriften begrenzten Bereichs zulässiger R/ZKombinationen 2 9 . Diese Bereichsgrenze kann definiert werden als (7-0)
m
m i n
= ^ = c,.
Die obere (im Z/R-System lineare) Bereichsgrenze des Ausnutzungsgrades fällt nun m i t der kosten- bzw. satzminimalen Z/R-Kombination zusammen, sobald: (7.1)
r = -J— = c1 qb
R;
Ζ =
c ι qb
= Ζ,
ρ = 1 .
Hier stellt ci eine parametrische Konstante dar, die das Verhältnis von Bestandsentwicklung und öffentlichen Investitionen i m Straßenwesen für die obere Bereichsgrenze des Ausnutzungsgrades ausdrückt. Die Existenz einer solchen Bereichsgrenze führt zu einigen Einschränkungen der eingangs dargestellten Ableitungen. 28 Als Verkehrsdichte w i r d zuweilen — fälschlich — die Länge der klassifizierten Straßen j e K r a f t w a g e n i n Metern bezeichnet. So ζ. B. H e l m u t Schmidt: Gegenwartsprobleme der Straßenwirtschaft i n der Bundesrepublik, Handbuch der Öffentlichen Wirtschaft, hrsg. v. d. Gewerkschaft öffentliche Dienste, Stuttgart 1960, S. 253. Sie betrug i m Jahre 1956 i n der Bundesrepublik 60 m, i n Frankreich 150, i n Dänemark 165, i n I t a l i e n 160, i n der Schweiz 145 u n d i n Belgien 80 m. s. Schmidt: ebenda. 29 (6. 9) läßt freilich jene Fahrzeuge unberücksichtigt, die der K r a f t v e r kehrsabgabe nicht unterliegen. Eine weitere Einschränkung bedeutet die Annahme konstanter Kilometerleistung je Kraftfahrzeug.
I .
elle Bedingungen der Zweckbindung v Kraftverkehrsabgaben 153
Zunächst kann der Staat i m Intervall 0 ^ Zi Zi zutreffen mag, so sinken die Abgabesätze zwar unter der Geltung des Kostendeckungsprinzips noch weiter, doch weniger stark als i m Intervall 0 Zi 2 auf 3 0 . Da für die kosten-bzw. satzminimale Z/R-Zuordnung (8.1) die dem Einzelfahrzeug zur Verfügung stehende Strecke (8. 2) beträgt, ist die exogene Nebenbindung für die obere Grenze des Ausnutzungsgrades i m Fall λ = 2 bei gleichzeitiger Abgabesatzminimierung entweder permanent oder nie erfüllt. Für den Fall, daß dieser gesetzte Ausnutzungsgrad kleiner ist als die satzminimale R/Z-Zuordnung 3 1 , entscheiden andere Erwägungen als solche aus diesem Bereich der staatlichen A k t i v i t ä t darüber, ob Kostenminimierung verwirklicht werden soll oder nicht. Zur Diskussion des Falls 4 i m vorstehenden Schema mag der Hinweis genügen, daß es sich bei i h m u m die Umkehrung des weiter oben ausführlich besprochenen Falls 2 (und i m Grunde auch des Falls 1) handelt. Die Möglichkeit einer Selbstregulierung von Straßeneinnahmen und Ausgaben bei gegebenem Abgabesatz w i r d endlich praktisch dadurch zunichte gemacht, daß die Preise für Leistungen i m Straßenbau, die Löhne für ständig beschäftigte Bedienstete und die Beamtengehälter usw. nicht als konstant vorausgesetzt werden können, wie das in den vorangegangenen Ausführungen aus Vereinfachungsgründen geschah. Setzt man i n die Gleichung (6. 6) außer den Realgrößen den Durchschnittspreis für Tiefbauleistungen und 30 Überdies k a n n insbesondere der F a l l 1 als unrealistisch bezeichnet werden, da hierbei f ü r die Höhe des Straßenkapitals eine obere Grenze bei einem endlichen Fahrzeugbestand existiert. 31 Die Änderung der dem Einzelfahrzeug zur Verfügung stehende Straßenlänge i n bezug auf (infinitesimal kleine) Änderungen des Fahrzeugbestands beträgt f ü r die allgemeine kostenminimale Z / R - K o m b i n a t i o n
158
2. Teil: Die Zweckbindung von Kraftverkehrsabgaben
den Durchschnittslohnsatz für i m Sektor Straßenbau öffentlich Bedienstete als Funktion der Zeit, so gilt: 32
(8.3)
K t = Z ( t ) ^ - + qLp(t)
und für den durchschnittlichen Abgabesatz Somit ist die für eine Zweckbindung erwünschte Konstanz des A b gabesatzes dann und nur dann erreicht, wenn (8.5)
z'(t)-z(t)> wenn sich also die marginalen Wachstumsraten des Durchschnittspreises für Bauleistungen usw. und des Fahrzeugbestandes zueinander verhalten wie ihre zeitlichen Entwicklungsreihen. Das bedeutet hier aber nichts anderes, als daß die Wachstumsraten beider Zeitreihen gleich sein müssen. Setzt m a n (entsprechend den Ausführungen des Kapitels I I I , Abschn. 2b) f ü r Zi(t) (8.6)
Zt=Z
0
e
z t
u n d f ü r die E n t w i c k l u n g des Baukostenindex pj(t) Pt=PoeFpt
(8.7) so ist wegen (8. 5) (8
8)
Zo Po
e
t(rz~rp)
=
Zo Po
r
e
t(rz -
rp)
p
also (8.9) rp = rz. Die Unterschiedlichkeit der Ausgangswerte (für t = 0) k a n n durch Maßnahmen der einmaligen Einnahme- oder Ausgabenverzögerung, bzw. Beschleunigung (im weiter oben beschriebenen Sinne) beseitigt werden.
Eine zusammenfassende Darstellung der wesentlichen Beziehungen von Straßenkosten und den Einnahmen aus den „Beitragsteuern" des Kraftverkehrs zeigt Fig. 8 3 3 . Die Einnahmen aus den Abgaben des Kraftverkehrs hängen ab von den Abgabesätzen und Q Wi der Anzahl der Kraftfahrzeuge Z\ und dem durchschnittlichen Treibstoffverbrauch 32
Es sei aj der F u n k t i o n (6.4) gleich avj, w o a eine parametrische K o n stante darstellt. Dann ist a { unter Verwendung von ρ gleich p/bR. R k a n n ausgedrückt werden als Produkt aus ρ u n d L. 33 Die Methode der Regelkreisdarstellung, die weiter oben (Fig. 7) angewandt wurde, ist hier beibehalten worden. Diagonal durchstrichene Blöcke stellen sog. „Komparatoren" dar, die mehrere Signal- oder Informationsflüsse vereinigen. A l l e Größen lassen sich — i m Gegensatz zu jenen der Fig. 7 — i n einem System von Identitätsgleichungen (Stromgrößen) u n d Funktionsgleichungen (Signalströme) zusammenfassen.
I .
elle Bedingungen der Zweckbindung v Kraftverkehrsabgaben 159
9K
aus ally. od. Λα HcuahaämitUln
E Bimahmtncm \ Kft.-Abga- \ Strafiznkosttn
co variable tosten
Figur 8 Zusammenhänge von Kraftverkehrsabgaben u n d Straßenkosten
ω. Diese Einnahmen werden aufgeteilt zur Finanzierung des ruhenden Verschleißes (qR) und der variablen Kosten. Beide Kostengrößen determinieren zusammen m i t dem jeweiligen Fahrzeugbestand die Abgabensätze, die ihrerseits die Anzahl der Fahrzeuge und die Höhe des durchschnittlichen Treibstoffverbrauchs (mit-)bestimmen 34 . Die Straßenkosten hängen unmittelbar („variable Kosten") und mittelbar vom Fahrzeugbestand ab (Kosten des ruhenden Verschleißes). Insofern gilt die Einteilung i n bestandsabhängige und bestandsunabhängige Straßenkosten nur i m Rahmen einer kurzfristigen Betrachtungsweise, die eine Änderung des Kapitalstocks ausschließt. Weitere Einflüsse auf die Kostenhöhe gehen von Veränderungen des Durchschnittspreises ρ bei Konstanz der technischen Verschleißfaktoren vi aus. Da dieser Index nicht endogen bestimmt ist, bleibt eine immanente Bestimmbarkeit des gesamten Systems ausgeschlossen. Aus allem folgt, daß es keinen konstanten A b gabesatz (keine konstanten Abgabesätze) gibt, der (die) als Ausdruck 34
Ä h n l i c h dem mikroökonomischen Gleichgewichtspreis läßt sich ein „Gleichgewichtssteuersatz" darstellen. V o n der Bedeutung des Substitutionsbereichs, aus dem die K r ü m m u n g der Satzfunktion i n Abhängigkeit von Ζ folgt, hängt es ab, ob dieser Gleichgewichtssatz eine stabile oder eine labile Gleichgewichtssituation beschreibt, da u. U. zwei Schnittpunkte der Bestandsf u n k t i o n i n Abhängigkeit v o m Abgabesatz m i t der Satzfunktion zustande kommen können.
160
2. Teil: Die Zweckbindung von Kraftverkehrsabgaben
eines außerbudgetären, materiellen Zusammenhangs von spezialisierter Einnahme und ausgesonderter Ausgabe angesehen werden könnte(n). Solange die oben erwähnten Zusammenhänge eine praktische Bedeutung besitzen, gibt es für die staatliche Planung der Straßenausgaben keine Verhaltensmaxime, die eine konfliktfreie Entscheidung gewährleistet. Konstanz der Abgabesätze verbietet sich von vornherein, da die Belastung des Kraftverkehrs gemäß ihrer Begründung den Vollzug einer realen Staatsleistung ermöglichen soll. Insoweit Kompensationen eventueller Veränderungen der Baukosten und Lohnsätze durch entsprechende Straßeninvestitionen innerhalb des durch die maximal zulässige Verkehrsdichte begrenzten Substitutionsbereiches möglich sind, hat der Staat die Wahl, die Steuersätze, die überdies relativ hoch sein müssen, bei hohen Investitionen konstant zu halten oder die Steuersatzkonstanz zugunsten autonomer Investitionsplanung aufzugeben. Legislative und Exekutive als Instanzen, die letzten Endes für Satzänderungen und die Höhe der periodischen Investitionsausgaben verantwortlich sind, können erfahrungsgemäß nicht als Glieder innerhalb einer mechanistisch erklärbaren Sequenz verstanden werden. Soll aber das Kostendeckungsprinzip gewahrt, die Begründung der Kraftverkehrsabgaben nicht vom Gesetzgeber selbst ad absurdum geführt werden, ist die Realisierung der Zusammenhänge zwischen Straßenkosten und Kraftverkehrsabgaben ohne irgendeine Einschränkung geboten. Das bedeutet, daß der Abgabesatz (u. a.) einer permanenten Abstimmung auf die jeweilige Höhe der erwähnten Preise und Löhne unterliegt. Eine praktische Lösungsmöglichkeit besteht darin, daß man eine zentrale Institution schafft, welcher Planung und Vollzug der Straßenausgaben und die Festsetzung der Abgabensätze delegiert sind. Sie könnte i n Form einer Anstalt betrieben werden, deren finanzielle Gebarungen mithilfe eines separierten Fonds vollzogen werden. Da solche Anstalten und Sondervermögen i m Straßenwesen (Highway Trust Fund, Road Improvement Fund, fonds routière) durchaus nicht zu den Seltenheiten zählen, werden die Möglichkeiten der praktischen Ausgestaltung am Schluß dieser Untersuchung nur erwähnt.
Zusammenfassung und Ergebnisse I. Einzelergebnisse 1. Die eingangs gestellte Frage, unter welchen Bedingungen eine Zweckbindung öffentlicher Einnahmen zulässig sei, erforderte eine Darstellung ihrer Erscheinungsformen, Arten und der Zielsetzungen, die durch solchen Besonderungen zugrunde liegende Einnahmen und Ausgaben verwirklicht werden sollen, auf Grund einer Anzahl empirischer Beispiele. Es zeigte sich, daß die Zweckbindung nur dann ihren Zielen gerecht wird, wenn sie als ein formal-budgetärer Ausdruck eines materiellen, außerbudgetären Zusammenhanges zwischen Ziel und M i t t e l begriffen werden kann. Die Möglichkeiten einer Abstimmung von Ziel und M i t t e l durch administrative Maßnahmen des „ t i m i n g " bzw. „retiming" sind begrenzt. Auch permanente Satzanpassungen können namentlich dann einen fehlenden Zusammenhang nicht ersetzen, wenn die Staatsausgabe auf den Vollzug einer Geldleistung gerichtet ist. Som i t gilt, daß eine direkte, einstufige Zweckbindung bestimmter öffentlicher Einnahmen an bestimmte nominelle Staatsleistungen nur dann sinnvoll ist, wenn der Vollzug präkonzipierter Ausgabenpläne des Staates nicht durch Ertragsschwankungen zweckgebundener Einnahmen behindert wird. Notwendigerweise können die Ausgabenvoranschläge keine Vollzugsverbindlichkeit für die Exekutive besitzen. Die Verausgabung der Isteinn ahmen für den festgelegten Zweck ist dagegen vollzugsverbindlich. Somit ist der außerbudgetäre, materielle Zusammenhang von zweckgebundener Einnahme und ausgesonderter Ausgabe notwendige Bedingung für die Durchbrechung des Nonaffektationsgrundsatzes, soweit die Staatsausgabe auf den Vollzug einer nominellen Leistung gerichtet ist. Als Antithese gilt der Zusammenhang von Einnahmen und Ausgaben, die auf den Vollzug einer realen Staatsleistung gerichtet sind. Das Beispiel der Finanzierung von Straßenausgaben zeigte, daß jener für die nominelle Staatsleistung gültige Zusammenhang, der i n Steuersatzkonstanz zum Ausdruck kommt, bei der Finanzierung realer Staatsleistungen durchbrochen werden kann. Somit gilt, daß hier der außerbudgetäre Zusammenhang von Einnahme- und Ausgabezweck durch permanente Satzanpassungen gewahrt wird. Hierbei entstehen Schwierigkeiten insbesondere deshalb, weil das Parlament i n aller Regel solche Satzvariationen zu genehmigen hat und infolgedessen m i t zeit11 F e c h e r
162
Zusammenfassung u n d Ergebnisse
liehen Verzögerungen, den Einflüssen von Strategien i m vorparlamentarischen Raum, mangelnder Information usw. zu rechnen ist. 2. Einwendungen gegen Durchbrechungen des Nonaffektationsgrundsatzes können nicht generalisiert werden. Da nicht jede Zweckbindung die Budgetprinzipien und den Grundsatz der fiskalischen Kasseneinheit verletzt und überdies nicht notwendig zu Liquiditätsbeschränkungen der Staatskasse führt, muß sich jedes Urteil über Zweckbindungen auf die jeweils zugrunde liegende Form, A r t und das Motiv beschränken. Es ist nicht als bedeutsamer Nachteil anzusehen, daß zweckgebundene M i t t e l nicht zum Ausgleich etwaiger Fehlbeträge i m Staatshaushalt herangezogen werden können. 3. Einwendungen, die sich an einer „parallelpolitischen Erstarrung" des Budgets durch Zweckbindungsmaßnahmen orientieren, dürfen ebenfalls nicht generalisiert werden. Es gibt A r t e n der Zweckbindung, die neben ihrem Finanzierungszweck m i t Erfolg den Zielen einer antizyklischen Budgetpolitik durch ihre automatisch stabilisierenden W i r kungen dienen können, andere, die gerade aus konjunkturpolitischen Erwägungen geschaffen wurden. 4. W i r d die „cynical rule of taxation" als Begründung von Einzelsteuern abgelehnt, so dominiert die Zielsetzung der direkten oder indirekten Erfassung steuerlicher Leistungsfähigkeit als ein Prinzip, dem alle steuerlichen Abgaben untergeordnet sind. Abgaben, die nicht dem Leistungsfähigkeitsprinzip genügen, bedürfen einer Sonderrechtfertigung. Solche Sonderrechtfertigungen können nur i m Abgabezweck, als einem Spezialzweck, erblickt werden. Das als Sonderbegründung ausgeschlossene Leistungsfähigkeitsprinzip kann die Bedeutung eines Zahllastverteilungsmodus erlangen. A l l e i n entscheidend ist für derartige Abgaben jedoch nur die Adäquanz von Ziel und Mittel. Sie sind Zweckabgaben. Zweckabgaben, die nicht einem außerfiskalischen Ziel dienen, also Finanzzweckabgaben darstellen, können nur erhoben werden, u m einen „Ausgleich von Vorteilen und Lasten" herbeizuführen. Das ist die hinreichende Bedingung für die Spezialisierung öffentlicher Einnahmen. I h r sind alle ausgesonderten Staatsausgaben unterworfen, ob sie einer nominellen Staatsleistung oder einer Realleistung des Staates dienen. Finanzzweckabgaben, die einer Sonderrechtfertigung unterliegen, sind Gebühren und Beiträge. Sie verlieren ihren nichtsteuerlichen Charakter nicht, wenn der Gesetzgeber zu ihrer Kennzeichnung den Begriff „Steuern" verwendet. 5. Sollte die Zweckbindung der Kraftverkehrsabgaben als Beispiel für die allgemeinen grundlegenden Ausführungen dienen, so mußten ihre Eigenarten dargestellt und daraufhin geprüft werden, ob sie die erwähnten Bedingungen erfüllen. Eine Betrachtung nationaler Formen
I . Einzelergebnisse
163
der Kraftverkehrsbesteuerung zeigte, daß ihre Zweckbindung aus ihren Charakteristiken kaum wegzudenken ist. 6. Die Untersuchung der Kraftverkehrsabgaben, die i n Form von Kraftfahrzeugsteuern und Abgaben vom Mineralölverbrauch erhoben werden, bestätigte, daß i n den modernen Finanzsystemen die öffentliche Belastung des Kraftverkehrs überwiegend durch das Motiv eines „Ausgleichs von Vorteilen und Lasten" begründet wird. Zweckmäßigkeitserwägungen (Unmöglichkeit, den immateriellen Straßennutzen steuerlich zu erfassen, Vergleichbarkeit der „Benefits", Vermeidung des Problems der „legacy from the past" usw.) führen zum sog. Kostendeckungsprinzip als einzigem Rechtfertigungsgrund. Damit sind die Abgaben des Kraftverkehrs beitragsartige Zweckabgaben. Die für ihre Zweckbindung hinreichende Bedingung ist also erfüllt. 7. Die Belastung des Kraftverkehrs nach dem Kostendeckungsprinzip stößt auf bedeutende Schwierigkeiten. Eine statistische Überprüfung der Ausgaben i m Straßenwesen und der Erträge der Kraftverkehrsabgaben und endlich des sog. „Sollaufwandes" zeigte, daß das Kostendeckungsprinzip nur zeitweilig und zufällig erfüllt wurde. Sie bestätigt außerdem, daß m i t einer Zweckbindung der Kraftverkehrsabgaben Engpaßsituationen i n der Neubaufinanzierung nicht beseitigt werden können. Eine wesentliche Schwierigkeit, das Kostendeckungsprinzip zu verwirklichen, besteht i n der Uneinigkeit darüber, welche Straßenkosten (und zu welchem Anteil) diesem Deckungsprinzip zu unterwerfen sind. Das Verzinsungsproblem, um das es sich vornehmlich handelt, w i r d m i t Werturteilen gestützt, die sich der finanzwissenschaftlichen Argumentation entziehen. Da die Gesamtausgaben i m Straßenwesen durch A n leihefinanzierung der Neubauten um den Betrag der Anleiheverzinsung steigen, erscheint die Belastung des Kraftverkehrs m i t tatsächlichen oder „imputierten" Zinskosten als nicht abwegig. 8. Das Kostendeckungsprinzip ist ebenfalls solange nicht zu verwirklichen, als es nicht gelingt, für jede Fahrzeugklasse bestimmte technische Verschleißfaktoren zu berechnen und den Abgabentarif nach Maßgabe dieser Verschleißfaktoren zu staffeln. Über die Veränderung des durch die einzelnen Wagenklassen verursachten Straßenverschleißes i n Bezug auf Bauweise, klimatische und geologische Bedingungen muß weitestgehende Information bestehen, damit diese Einflüsse i m A b gabentarif berücksichtigt und von Fall zu Fall zu Tarifänderungen herangezogen werden können. Eine Belastung nach Maßgabe des tatsächlichen Verschleißes (unter Einschluß von Fixkostenelementen usw.) muß i m Interesse der Kostendeckung auf Begünstigungen (Diskriminierungen) bestimmter Fahrzeugklassen verzichten, da die Reaktionen der Abgabepflichtigen auf Satzvariationen nicht m i t hinreichender Sicher11*
164
Zusammenfassung u n d Ergebnisse
heit vorausgeschätzt werden können. Änderungen der Struktur des Kraftwagenbestandes wirken sich auf Kostenhöhe und gleichermaßen auf die Erträge der Kraftverkehrsabgaben aus. 9. Das Kostendeckungsprinzip ist andererseits selbst dann v e r w i r k licht, wenn auf Grund eines unzureichenden Straßennetzes die Kosten des laufenden Verschleißes sprunghaft ansteigen und der Kraftverkehr diese Kosten durch entsprechende Abgaben trägt. Die Höhe der jeweiligen Straßenkosten hängt von Größe und Struktur des Fahrzeugbestandes, von der Ausnutzung des jeweiligen Straßennetzes und der Bauweise der Einzelstraßen ab. Durch Rationalisierungsund Kapazitätseffekte öffentlicher Investitionen i m Straßenwesen können somit die Straßenkosten beeinflußt werden. Da alternative Möglichkeiten der Investitionsplanung bei gleichen Straßenkosten und unverändertem Fahrzeugbestand bestehen, gibt es für den Staat keine zwingende Verhaltensmaxime in Bezug auf die Festsetzung jeweiliger Investitionsausgaben. Solche Maximen lassen sich allenfalls unter Berücksichtigung nicht-systemimmanenter Tatbestände erkennen. Setzt der Staat die Investitionen i m Straßenwesen fest, ist die Veränderung der Abgabensätze i n Bezug auf die Bestandsentwicklung determiniert. Fixiert dagegen der Staat den Steuersatz oder dessen Entwicklung i n bezug auf Veränderungen des Kraftwagenbestandes, ,so entscheidet er uno actu über die Entwicklung der Investitionsausgaben. Das gilt ohne die Nebenbedingung eines maximal zulässigen Ausnutzungsgrades. Existiert eine solche Vorschrift, müssen die öffentlichen Investitionen mindestens so hoch sein, daß der gesetzlich festgelegte Ausnutzungsgrad nicht überschritten wird. Somit sind die Entscheidungen des Staates über Höhe von Investitionen und Abgabesatz durch die Existenz jener Nebenbedingung stark begrenzt. Konstanz des Abgabensatzes bedeutet, daß der Kapitalbestand i m Straßenwesen bis zu einem bestimmten Fahrzeugbestand immer größer ist als es die Größe des maximalen Ausnutzungsgrades erforderte. Aus den Kraftverkehrsabgaben fallen bis zur erwähnten Grenze Überschüsse an. Werden die Abgabensätze an der Grenze des kritischen Fahrzeugbestandes (0 ^ Z\ Zi) nicht erhöht, so dienen die vorher erzielten Überschüsse der Deckung von nunmehr entstehenden Kassendefiziten. Defizite aber können nur temporär vermieden werden. Werden die Abgabensätze an der kritischen Grenze sofort erhöht, fallen weiterhin Überschüsse an. Die Entwicklung dieser Überschüsse i n Bezug auf die Entwicklung des Fahrzeugbestandes zeigt eine sinusoidale Form. Somit w i r d de facto das i m Straßenwesen investierte Kapital verzinst. 10. Die wichtigste Bedingung, die an die Verwirklichung des Kostendeckungsprinzips geknüpft ist, stellt die Tatsache dar, daß die Ände-
I. Einzelergebnisse
165
rungen der Preise für Bauleistungen und der Löhne der Bediensteten durch Änderungen des Abgabesatzes berücksichtigt werden. Der A b gabesatz bleibt nur dann von diesen Veränderungen unbeeinflußt, wenn die V/achstumsraten der Preis- und Lohnindices gleich der Wachstumsrate des Fahrzeugbestandes ist. Dieser F a l l ist so wirklichkeitsfremd, daß er kaum näher betrachtet zu werden braucht. Die Möglichkeiten, diesen Einfluß durch Verlegung von Einnahme- und/oder Verausgabungstermine zu eliminieren, sind gering. Ob und inwieweit der Lohmann-Ruchti-Effekt zu einer Dämpfung der Veränderungen von A b gabesätzen i n Bezug auf Änderungen der Preis- und Lohnindices führt, hängt u. a. von der Teilbarkeit der Straßenanlagen und ihrer Lebensdauer ab. Beide bestimmen die maximal zulässige Ausgabenverzögerung. Ist diese zulässige Verzögerung gering und werden die Einnahmen aus den Kraftverkehrsabgaben zweckfremd verausgabt, können die Straßenkosten selbst bei Konstanz der erwähnten Indices und des Fahrzeugbestandes progressiv ansteigen, so daß der (verzögert) verausgabte Betrag nicht mehr ausreicht, u m die erforderliche Reinvestition zu finanzieren. 11. Den Reaktionen der Fahrzeuhalter auf Abgabesatzschwankungen kann, insbesondere angesichts der gegenwärtigen Entwicklung des Straßenverkehrs, kein bedeutendes Gewicht beigemessen werden. Belastungsänderungen beeinflussen eher die Struktur des Fahrzeugbestandes, als daß die seine Entwicklung stark beeinflußten. Keine noch so subtile Statistik w i r d jemals als Grundlage von ex ante-Aussagen über jene Reaktionen dienen können. Sie zeichnet nur ein B i l d vergangener Reaktionen. Nichts spricht für ihre Wiederholung. Für die Verwirklichung des Kostendeckungsprinzips sind die Reaktionen der Fahrzeughalter auf Abgabesatzvariationen unerheblich, wenn nur die Bestimmung des Abgabesatzes die weiter oben erwähnten Voraussetzungen erfüllt. 12. Die Bedenken gegen die Möglichkeit einer den Straßenkosten adäquaten Belastung des Kraftverkehrs werden durch die Berücksichtigung der Inhomogenität des Straßennetzes, der Verteilung der Straßenbaulasten auf die einzelnen Gebietskörperschaften und der lokalen Unterschiede der Unterhaltungssätze verschärft. Zunächst verhindert der Einfluß, der von der jeweils angewendeten Straßenbauweise auf die Höhe der Straßenkosten ausgeht, eine der Kostenverursachung entsprechende Einzelbelastung. Die Abgabensätze können deshalb allenfalls Durchschnittssätze für jede Kraftwagenklasse darstellen. Eine starke Streuung der effektiven Straßenkosten u m diese Durchschnittswerte stellt dann die Anwendbarkeit des Kostendeckungsprinzips i n Frage. Andererseits ist der Verzicht auf adäquate Einzel-
Zusammenfassung u n d Ergebnisse
166
belastung jedoch aus Gründen der Gleichbehandlung geboten. Die „kostengerechte" Einzelbelastung kann dazu führen, daß gleiche Fahrzeuge unterschiedlich belastet würden, sobald Unterschiede i n den Bauweisen der vorzugsweise befahrenen Straßen bestehen. Gegen eine gleiche Belastung sprechen allerdings lokale Kostendifferenzen 1 . Geht man endlich davon aus, daß die Mineralölsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer Träger verschiedener Funktionen i m System der Straßenbaufinanzierung darstellen, aber die Faktoren, welche die Kosten der öffentlichen Straßen aller Klassen bestimmen, etwa gleichartig sind, so ist die Trennung der Ertragshoheit beider Abgaben angesichts der Verschiedenheit der m i t den beiden Abgaben verfolgten Zwecke wenig sinnvoll. 13. Vorausgesetzt, jene Probleme seien praktisch lösbar, so müßte, u m „Selbststeuerung" der Straßenbaufinanzierung zu gewährleisten, die Legislative dem Zwang einer bestimmten Verhaltensmaxime unterworfen sein, m i t der Konsequenz, daß Anpassungen der Abgabesätze bei gegebenem Ausnutzungsgrad des Straßensystems an die Entwicklung der Preise für Straßenbauleistungen und der Löhne für Bedienstete permanent vorgenommen werden. 14. K o n j u n k t u r poli tische Zielsetzungen können die Finanzierung des Straßenbaus der Bundesrepublik nur i n bescheidenem Ausmaß beeinflussen. Jede Verminderung der Straßenausgaben, i n der Absicht, boomartige Entwicklungen zu bremsen, führt namentlich dann zur Durchbrechung des Kostendeckungsprinzips, wenn die Unterhaltungsausgaben über einen größeren Zeitraum verzögert werden, da der reale Verschleiß sprunghaft ansteigt und diese Bewegung durch die Entwicklung der Preise und Löhne potenziert wird. Eine Verringerung der öffentlichen Investitionen i m Straßenwesen reduziert Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Straßenverkehrs und führt i n the long run zu strukturellen Disproportionalitäten. Eine solche Maßnahme bewirkt darüber hinaus eine Steigerung der Unterhaltungskosten, so daß sie, sofern nur die entsprechenden Unterhaltungskosten geleistet werden, insgesamt das Gegenteil dessen bewirken kann, was m i t ihr erreicht werden sollte. Der Vollzug der notwendigen Investitionen i m Straßenwesen bei gleichzeitiger antizyklischer Orientierung kann sonach durch Vergabe von Straßenbauaufträgen an ausländische Unternehmen aufrechterhalten werden. Die Aufträge für Straßenbauten der Bundesrepublik sollten m i t h i n nicht auf deutsche Unternehmungen beschränkt sein, sondern das Vergabeverfahren sollte zumindest die Unternehmen der Staaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft einschließen. 1
Vgl. Adamek:
a.a.O., S. 40.
I I . Folgerungen für Kraftverkehrsabgaben und Straßenfinanzierung
167
II. Folgerungen für die Gestaltung der Kraftverkehrsabgaben und die Finanzierung der öffentlichen Ausgaben für das Straßenwesen 1. Die Kraftfahrzeugabgaben, insbesondere der Bundesrepublik, sind infolge ihrer technischen Ausgestaltung nicht geeignet, das — überwiegend akzeptierte — Kostendeckungsprinzip zu verwirklichen. Sowohl die Kraftfahrzeugsteuer der Länder als auch die Mineralölsteuer des Bundes sollen beide die vom investierten Kapital und die von der effektiven Straßenbenutzung abhängigen Straßenkosten decken. Wenn aber i. S. des Kostendeckungsprinzips die Summe der periodischen Straßeneinnahmen gleich den periodischen Straßenkosten sein soll, so ist der Kraftfahrzeugsteuersatz — außer von den bereits erwähnten Größen — auch von der Höhe der Mineralölsteuer, also — bei unveränderter Konstruktionsweise der Kraftwagen und Konstanz der Struktur des Kraftwagenbestandes — von der durchschnittlichen Gesamtfahrleistung und dem Mineralölsteuersatz abhängig 2 . A l l e i n aus dieser Tatsache resultieren erhebliche Bedenken gegen die Möglichkeit einer praktischen Verwirklichung des Kostendeckungsprinzips. Deswegen liegt es nahe, beide Abgabearten ihrer Ausgestaltung gemäß für die Finanzierung der Straßenausgaben einzusetzen, d. h. die Kraftfahrzeugsteuer zur Finanzierung der Kosten des ruhenden Verschleißes, die Mineralölsteuer dagegen zur Deckung der durch die Benutzung der Straßen verursachten Kosten zu verwenden 3 . Sofern die entsprechenden Belastungskoeffizienten für die Mineralölsteuer einmal ermittelt sind, werden (ceteris paribus) die benutzungsabhängigen Straßenkosten automatisch durch die Erträge der verbrauchsabhängigen Mineralölabgabe gedeckt. Der Kraftfahrzeugsteuersatz kann dagegen so festgesetzt werden, daß die Kraftfahrzeugsteuererträge mindestens die Kosten des ruhenden Verschleißes eines Straßennetzes ersetzen, welches der Bedingung einer maximal zulässigen Verkehrsdichte genügt. Eine derartige Konstruktion der Kraftverkehrsabgaben macht freilich A n passungen der Abgabensätze nicht überflüssig. 2
Wenn entsprechend (7. 7) f ü r die Straßenkosten bR
u n d f ü r den Mineralölsteuerertrag S M = Qo>
ω Ζ
gesetzt w i r d , folgt f ü r den durchschnittlichen Kraftfahrzeugsteuersatz der Bedingung der Kostendeckung:
3
F ü r diese K o n s t r u k t i o n vgl. o. Gig. (7. 8).
unter
168
Zusammenfassung u n d Ergebnisse
2. Ausgestaltung und Verwendung der Kraftfahrzeugabgaben i n der skizzierten A r t erfordern einen institutionellen Umbau des gegenwärtigen Straßenbaufinanzierungssystems, der eine dem Kostendeckungsprinzip entsprechende Verteilung der Einnahmen aus beiden wesensverschiedenen Abgaben auf die einzelnen Straßen des Netzes ermöglicht. Somit ist eine Änderung der speziellen Regelungen des Finanzausgleichs unerläßlich. 3. Eine Lösungsmöglichkeit bietet die Zentralisierung aller Straßeneinnahmen und -ausgaben 4 i n einem separierten Fonds 5 . I h m obliegt die periodische Revision und Neufestsetzung der Abgabesätze auf der Grundlage einer detaillierten Straßenkostenstatistik (diese kann durch periodische Direkterhebung in Kooperation m i t dem Kraftfahrzeugbundesamt erstellt werden). Dem Finanzierungsfonds fließen die Erträge der Mineralöl- und der Kraftfahrzeugsteuer zu. Diese Einnahmen stellen in den Bundes- und Länderetats durchlaufende Posten dar. Die zentrale Planung der Realinvestitionen erfolgt durch die Fondsverwaltung unter M i t w i r k u n g der Gebietskörperschaften, die bislang als Baulastträger fungierten und welchen die M i t t e l zur Unterhaltung und Investition durch den Fonds zugewiesen werden 6 . Die M i t t e l zur Finanzierung der Investitionen werden durch zusätzliche Umlagen aufgebracht, bei deren Festsetzung sowohl die lokale Verkehrsdichte als auch die jeweilige Finanzkraft Berücksichtigung findet. Ihre Verteilung erfolgt dann nach Maßgabe der jeweiligen Verkehrsdichte i m Vergleich zur maximal zulässigen Verkehrsdichte. Um die Finanzierung, insbesondere die der Investitionsausgaben, möglichst elastisch zu gestalten, besitzt der Fonds die Befugnis, M i t t e l auf dem Anleiheweg zu beschaffen und die Kraftverkehrsabgaben (permanent entsprechend der Verschuldungsgrenze) um die Verzinsung dieser Anleihen zu erhöhen. Auf diese Weise ist es möglich, finanzschwachen Körperschaften mit großer Verkehrsdichte die Umlage zinslos zu kreditieren, soweit dies über 4
Theoretisch wäre eine verstärkte Dezentralisierung ebenfalls als Lösung denkbar, indem von den Ländern alle diejenigen Leistungen für Bundesstraßen übernommen werden, die durch den ruhenden Verschleiß erforderlich werden. Gleichzeitig müßte der B u n d alle Ausgaben aus dem A u f kommen der Mineralölsteuer leisten, die durch die Straßennutzung bedingt sind. Da eine solche K o n s t r u k t i o n den ohnedies reichlich komplizierten Finanzausgleich der Bundesrepublik nicht unerheblich belasten u n d zudem das Koordinationsproblem i m Straßenbau nicht lösen würde, k a n n von dieser Möglichkeit abgesehen werden. 5 A u f eine detaillierte Darstellung der Möglichkeiten seiner technischen K o n s t r u k t i o n muß weitgehend verzichtet werden. Auch die mannigfachen staatsrechtlichen Einwände, die sich i n diesem Zusammenhang erheben, können schon deswegen nicht berücksichtigt werden, da sich jene Ausführungen auf eine isolierte Betrachtung beschränken. 6 Die bestehende Straßenklassifikation ist ggf. nach gänzlich neuen Gesichtspunkten aufzubauen. Zumindest haben die Landstraßen zweiter O r d nung innerhalb des erläuterten Finanzierungssystems keinen Platz.
I I . Folgerungen f ü r Kraftverkehrsabgaben u n d Straßenfinanzierung
169
den durch den Fonds ausgeübten horizontalen und vertikalen Ausgleich erforderlich wird. Die Tilgung der einzelnen Gebietskörperschaften kreditierten Umlagen erfolgt, wie die Aufbringung der Umlage selbst, aus allgemeinen Deckungsmitteln, die vorübergehend durch Abzweigungen aus dem Aufkommen der Kraftfahrzeugabgaben verstärkt werden können. Darüber hinaus ist der Fonds befugt, Rücklagen zu bilden oder aufzulösen und die i h m zufließenden M i t t e l zeitlich und in bestimmten Grenzen auch sachlich zu übertragen. Dieser Rücklage sollten u. a. alle M i t t e l zugeführt werden, die den gesamten Investitionsbedarf, der zur Aufrechterhaltung der zulässigen Verkehrsdichte erforderlich ist, übersteigen. Solche M i t t e l können dann unschwer zur fiskalpolitischen Verfügung des Finanzministers gehalten werden, mit der Einschränkung, daß dieser den Verausgabungszeitpunkt und den Verausgabungszweck nur i m Rahmen der „normalen" Fondsgebarungen festsetzen kann. Hierdurch werden Abzweigungen verhindert. 4. Von diesem Finanzierungssystem sind alle Innerortsstraßen auszunehmen. Da diese Straßen essentiell lokalen Erfordernissen dienen und der Anteil der Sondernutzung dieser Straßen durch den Kraftverkehr gegenüber den übrigen Straßen gering ist, können solche Verkehrswege weiterhin aus allgemeinen Deckungsmitteln der lokalen Gebietskörperschaften, aus Anliegerbeiträgen und darüber hinaus durch Zuschläge zur Kraftfahrzeugsteuer (deren Höhe sich nach der Wagengröße und der Achslast richten kann) finanziert werden. Für Umgehungs- und Durchgangsstraßen des Fernverkehrs kann der Fonds Zweckzuweisungen gewähren.
Literaturverzeichnis 1. Namentliche Veröffentlichungen Adamek, Robert: Straßenbestand u n d - a u f w a n d 1951—1955, Forschungsarb. aus dem Straßenwesen N. F., H. 35, Bielefeld 1958. — A r t . Straßen, HdS., 10. Bd., Stuttgart, Tübingen u n d Göttingen 1959. — u n d Saake, Friedrich: Die Straßenkosten u n d ihre Finanzierung, F o r schungsarb. aus dem Straßenwesen N. F., H. 8, Bielefeld 1952. Albers, W i l l i : Die Bedeutung der Finanzpolitik i n der Bundesrepublik für die allgemeine k o n j u n k t u r e l l e Entwicklung, Beihefte der K o n j u n k t u r p o l i t i k , Ztschr. f. angew. Konjunkturforschung, H. 2, B e r l i n 1957. — A r t . Erwerbseinkünfte, öffentliche, HdS., 30. Lfg., 1960. Allix, Edgar: Traité élémentaire de science des finances et de législation financière française, 5. éd., Paris 1927. Amonn, A l f r e d : Grundsätze der Finanzwissenschaft, I, Bern 1947. — Gerechtigkeit u n d Zweckmäßigkeit i n der Besteuerung, Probleme der öffentlichen Finanzen u n d der Währung, Festgabe f ü r E. Großmann, Zürich 1949. Ardant, G.: Fondements économiques et sociaux des principes budgétaires, R. S. L. F., Vol. 41, 1949. Bane, F r a n k : Financing the State's Share of the H i g h w a y System, Financing Highways, hrsg. v. T a x Institute, Princeton 1957. Barr ère, A l a i n : L a problématique de l'équilibre budgétaire, Pubi. Fin., Vol. 5, 1950. Berkenkopf, Paul: Z u r Frage der A u f b r i n g u n g der Straßenkosten, Ztschr. f. Verkehrswiss., 25. Jg. 1954. — Der Verkehr i n der Marktwirtschaft, Ztschr. f. Verkehrswiss., 25. Jg. 1954. Bickel, W i l h e l m : Der Finanzausgleich, HdF., 2. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Neumark, Bd. I I , Tübingen 1956. van der Borght, R.: Das Verkehrswesen, 3. Aufl., Leipzig 1925. Bräuer, K a r l : A r t . Kraftfahrzeugsteuer, HdSt., 4. Aufl., Bd. 5, Jena 1923. — Finanzsteuern, Zwecksteuern u n d Zweckzuwendung von Steuererträgen. Eine finanztheoretische u n d finanzpolitische Studie, Sehr. d. Ver. f. Socpol., 174. Bd., München u n d Leipzig 1928. Brownlee, O. H. and Allen, E d w a r d D.: Economics of Public Finance, 2nd. ed., Englewood Cliffs 1956. Brownlee, O. H. and Heller, W. W.: H i g h w a y Development Financing, AER., Vol. 46, 1956. Buchanan, J. M . : The Pricing of H i g h w a y Services, Nat. Tax JL, Vol. 5, 1952. Büchner, Richard: Beiträge, HdF., 2. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Neumark, Bd. I I , Tübingen 1956. Buehler, A l f r e d G.: Public Finance, N e w Y o r k and London 1940. Burkhead, Jesse: The Balanced Budget, QJE., Vol. 68, 1954. Cassel, M a r g i t : Die Gemeinwirtschaft. I h r e Stellung u n d Notwendigkeit i n der Tauschwirtschaft, Leipzig u n d Erlangen 1925. Clark, J. M.: The Economics of Overhead Costs, Chicago 1923.
Literaturverzeichnis
171
Colm, Gerhard: Volkswirtschaftliche Theorie der Staatsausgaben. E i n Beitrag zur Finanztheorie, Tübingen 1927. — Haushaltplanung, Staatsbudget, Finanzplan u n d Nationalbudget, HdF., 2. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Neumark, Bd. I, Tübingen 1952. — The Corporation and the Corporate Income Tax, i n : Essays i n Public Finance and Fiscal Policy, New Y o r k 1955. Cosciani, C. : Staatshaushalt u n d Finanzsystem Italiens, HdF., 2. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Neumark, Bd. I I I , Tübingen 1958. Coulbois, P.: Staatshaushalt u n d Finanzsystem Frankreichs, ebenda. Dalton, H u g h : Principles of Public Finance, 4th. ed., 22nd. impr., London 1957. Department of Commerce: The Federal H i g h w a y A c t of 1956 and the Federal A i d A i r p o r t Program, i n : Federal Expenditure Policy for Economic G r o w t h and Stability (Papers), Joint Ec. Comm., Washington, D. C., 1957. Dieben, W i l h e l m u n d Ebert, K u r t : Die Technik des öffentlichen Kredits, HdF., 2. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Neumark, Bd. I I I , Tübingen 1958. Dubois de l'Estang: A r t . Budget, Nouveau Dictionnaire d'Economie Politique, Bd. I, hrsg. v. Say u n d Chailley, Paris 1891. Due, John F.: The Federal H i g h w a y Program, i n : Federal Expenditure Policy for Economic G r o w t h and Stability (Papers), Joint Ec. Comm., Washington, D. C., 1957. — i n : Federal Expenditure Policy for Economic G r o w t h and Stability (Hearings), Joint Ec. Comm., Washington, D. C., 1958. — Government Finance. A n Economic Analysis, rev. ed., Homewood, 111., 1959. Durgeloh , Heinz: Die Wegekosten des Kraftverkehrs. Versuch einer volkswirtschaftlichen Straßenkostenrechnung, Düsseldorf 1959. v. Eheberg, K a r l Theodor: A r t . Zwecksteuern, HdSt., 4. Aufl., Bd. 8, Jena 1928. Eichhoff, Erich: Die Aufgaben der Bundesanstalt für den Güterfernverkehr, Ztschr. f. Verkehrswiss., 27. Jg., 1956. Fick, Harald: Finanzwirtschaft u n d K o n j u n k t u r , Jena 1932. Föhl, Carl: Volkswirtschaftliche Regelkreise höherer Ordnung, V o l k s w i r t schaftliche Regelungsvorgänge i m Vergleich zu Regelungsvorgängen der Technik, hrsg. v. H. Geyer u n d W. Oppelt, München 1957. Formery, F.: Les impôts en France, t. 2, Paris 1946. Fux, Boleslav: Die \^ermögensteuer, HdF., 1. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Meisel, Bd. I I , Tübingen 1927. Gawronski, V i t a l : Krisenbekämpfung u n d Arbeitsbeschaffung i n der Schweiz. E i n Beitrag zur Frage der Vorbereitung u n d Finanzierung krisenverhütender Maßnahmen, Inst. „Finanzen u n d Steuern", H. 34, Bonn o. J. Gény, M. : L a Règle de la non-Affectation des Recettes aux Dépenses Publiques dans le Budget de l'Etat, R. S. L. F., Vol. 30, 1932. Gerloff, W i l h e l m : Die öffentliche Finanzwirtschaft, 2. Aufl., Bd. I I , F r a n k f u r t a. M., 1950. — Vorschläge zur Reform der deutschen Kraftfahrzeugbesteuerung, F A . N. F., Bd. 15, 1953/54. — Steuerwirtschaftslehre, HdF., 2. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Neumark, Bd. I I , Tübingen 1956. — Die Gebühren, ebenda. Großmann, Eugen: Der Verkehr als Steuerobjekt, Schweiz. Arch. f. Verkehrswiss. u. Verkehrspol., Jg. 3, 1948. Groves , H a r o l d M.: Financing Government, 5th. ed., New Y o r k 1959. Haavelmo, Trygve: M u l t i p l i e r Effects of a Balanced Budget, Readings i n Fiscal Policy, London 1955.
172
Literaturverzeichnis
Haensel, S.: Der Staatshaushalt u n d das Finanzsystem Großbritanniens, HdF., 1. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Meisel, Bd. I I I , Tübingen 1929. Haller, Heinz: Finanzpolitik. Grundlagen u n d Hauptprobleme, 2. Aufl., T ü b i n gen u n d Zürich 1961. — Die Bedeutung des Äquivalenzprinzips für die öffentliche F i n a n z w i r t schaft, F A . N. F., Bd. 21, 1961/62. Hamm, Walter: Schiene u n d Straße. Das Ordnungsproblem i m Güterverkehr zu Lande, Heidelberg 1954. Harriss, L o w e l l C.: Das Finanz- u n d Steuersystem der Vereinigten Staaten von Amerika, HdF., 2. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Neumark, Bd. I I I , Tübingen 1958. Hatschek, Julius: Deutsches u n d preußisches Staatsrecht, Bd. I I , B e r l i n 1923. Hax, K a r l : Abschreibung u n d Finanzierung, ZfhF. N. F., 7. Jg., 1955. v. Heckel, M a x : Das Budget, Leipzig 1898. Heidermann, Horst u n d Schieb, B r i g i t t a : Das Problem des Kapitaldienstes für K a p i t a l der öffentlichen Hand, Sehr. d. Forschungsstätte f. öffentl. U n ternehmen, hrsg. v. A . Spitaler u n d G. Weisser, Bd. 2, Göttingen 1959. Heinig, K u r t : Das Budget, 3 Bde., Tübingen 1948—1951. — Amerikanisches Budgetwesen i n bundesdeutscher Perspektive, F A . N. F., Bd. 16, 1955/56. Helmert, Otto: Die Vermögensrechnung des Bundes, K o m m e n t a r zur Buchführungs- u n d Rechnungslegungsverordnung für das Vermögen des B u n des (VBRO), (Guttentagsche Sammig. Deutscher Gesetze Nr. 241), B e r l i n 1954. Hicks, J. R.: The Problem of Budgetary Reform, Oxford 1948. Hicks, Ursula K . : Public Finance, 2nd. ed., 1958. — The Terminology of T a x Analysis, Readings i n the Economics of Taxation, London 1959. Hornschu, Hans-Erich: Die E n t w i c k l u n g des Finanzausgleichs i m Deutschen Reich u n d i n Preußen von 1919 bis 1944, Kieler Studien, Forschungsberichte d. Inst. f. Weltwirtschaft a. d. U n i v . Kiel, (Kiel) 1950. Houthakker: How to Provide the Roads for which are Users W i l l i n g to Pay, i n : Federal Expenditure Policy for Economic G r o w t h and Stability (Papers), Joint Ec. Comm., Washington, D. C., 1957. Huber, Ernst-Rudolf: Wegekosten u n d Kraftverkehr, Gießen 1954. Institut „Finanzen und Steuern": Grüner Brief Nr. 10, Nov. 1955, Anlage. Ito, Hanya : Staatshaushalt u n d Finanzsystem Japans, HdF., 2. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Neumark, Bd. I I I , Tübingen 1958. Jessen, Jens: Deutsche Finanzwirtschaft, H a m b u r g 1937. Jèze-Neumark: Allgemeine Theorie des Budgets, Tübingen 1927. Johnson, H. G. : A Note on the Effect of Income Redistribution on Aggregate Consumption w i t h Interdependent Consumer Preferences, Economica, N. S., Vol. 18, 1951. Kapp, Κ . W i l l i a m : Volkswirtschaftliche Kosten der Privatwirtschaft, Deutsch v. B. Frisch, H a n d - u n d Lehrbücher aus dem Gebiet der Sozialwiss., hrsg. v. E. Salin, G. Schmölders u n d A . Spiethoff, Tübingen u n d Zürich 1958. Kauer, E. : Z u m Problem der Straßenrechnung, Schweiz. Arch. f. Verkehrswiss. u. Verkehrspol., 4. Jg., 1949. Keller, Theo: Die Eigenwirtschaftlichkeit öffentlicher Gemeinwesen, HdF., 2. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Neumark, Bd. I I , Tübingen 1956. Kittel, Theodor: Entstaatlichung der Straßen? Eine Stellungnahme zu zwei Rechtsgutachten zur Wegekostenfrage, Ztschr. f. Verkehrswiss., 26. Jg., 1955. Klein, Friedrich: Verkehrsteuern, HdF., 2. Aufl.,hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Neumark, Bd. I I , Tübingen 1956.
Literaturverzeichnis
173
— Grundgesetz u n d Steuerreform, Probleme der Steuertheorie u n d der Steuerpolitik, Festgabe für F. Terhalle, FA. N. F., Bd. 20, H. 1, 1959. — Die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts i n Finanzu n d Steuerfragen, Inst. „Finanzen u n d Steuern", H. 58, Bonn 1959. Kleinmann: Der Fehlbetrag i m Staatshaushalt, Der öffentliche Haushalt, Arch, f. Finanzkontrolle, Jg. 1, 1954. Kor ff, H.: A k t u e l l e Probleme der Straßenbaufinanzierung, Finanzpol. M i t t e i lungen, Nr. 108/9903, B u l l e t i n v. 15. J u n i 1955. Krengel, Rolf: Anlagevermögen, Produktion u n d Beschäftigung der Industrie i m Gebiet der Bundesrepublik von 1924 bis 1956, D I W , Sonderhefte N. F., Nr. 42 (Reihe A : Forschung), B e r l i n 1958. Krüger, Herbert: Gegen eine Entstaatlichung der öffentlichen Wege, Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft Güterfernverkehr, H. 1, Bielefeld 1954. Kullmer, Lore: Z e i t w a h l u n d administrativer Vollzug als Probleme einer k o n junkturorientierten Finanzpolitik, FA.N.F., Bd. 20, 1960. Lachapelle, G.: Les finances de la I I I e république, Paris 1937. Lampe, A d o l f : Z u r Problematik der Kraftfahrzeugbesteuerung, FA., Jg. 1930. — A r t . Gebühren, Beiträge u n d Taxen, WBdVW., 4. Aufl., Bd. 2, Jena 1932. — A r t . Mineralölsteuer, ebenda. — A r t . Transportmittelbesteuerung, WBdVW., 4. Aufl., Bd. 3, Jena 1933. — A r t . Zwecksteuern, ebenda. Landmann, Julius: Geschichte des öffentlichen Kredits, HdF., 2. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Neumark, Bd. I I I , Tübingen 1958. Leibbrand, K u r t : Die anteiligen Fahrbahnkosten des Straßenverkehrs, Schweiz. Arch. f. Verkehrswiss u. Verkehrspol., 6. Jg., 1951. Littmann, K a r l - K o n r a d : Z u r Problematik konjunkturgestaltender Zielsetzungen der Steuerpolitik, FA.N.F., Bd. 14, 1953/54. Littmann, Konrad: A r t . Kraftfahrzeugsteuer, HdS., Bd. 6, Stuttgart, T ü b i n gen u n d Göttingen 1959. — Raumwirtschaftliche A u s w i r k u n g e n der Finanzpolitik FA.N.F., Bd. 19, 1958/59. Lötz, Walther: Finanzwissenschaft, Tübingen 1917. Lübbeke: Die E r m i t t l u n g der Wegekosten als Grundlage einer betriebswirtschaftlichen Vollkostenrechnung für den Gesamtstraßenverkehr, Teil I V , Stuttgart 1954—1956. Lutz, E d w a r d Α.: Effects of New Federal A i d H i g h w a y A c t on Federal-State Relations, Financing Highways, hrsg. v. T a x Institute, Princeton 1957. Magain, A. u n d Coppée, G. : Staatshaushalt u n d Finanzsystem Belgiens, HdF., 2. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff und F. Neumark, Bd. I I I , Tübingen 1958. v. Malchus, C. A. : Handbuch der Finanzwissenschaft u n d Finanzverwaltung, Stuttgart u n d Tübingen 1830. Marbach, F.: L u x u s u n d Luxussteuer, Bern 1948. Masè-Dari: Sul Bilancio dello Stato, Torino 1899. Masoin, M.: Die öffentlichen Ausgaben, HdF., 2. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Neumark, Bd. I I , Tübingen 1956. Maxwell, James Α.: Federal Grants and the Business Cycle, National Bureau of Economic Research, New Y o r k 1952. McGuire, Joseph W.: The Foundations of Highway-User Taxation, Publ.Fin., Vol. 13, 1958. Meckle, K a r l : Der Fehlbetrag i m Staatshaushalt, Der öffentliche Haushalt, Arch. f. Finanzkontrolle, Jg. 1, 1954. Meilicke, Heinz: Der Steuererfindungsgeist von B u n d u n d Ländern seit I n krafttreten des Grundgesetzes — seine verfassungsrechtlichen Grenzen,
174
Literaturverzeichnis
Probleme des Finanz- u n d Steuerrechts, Festschr. f. O. Bühler, hrsg. v. A. Spitaler, K ö l n 1954. Melichar, E r w i n : öffentlicher Haushalt u n d Finanzsystem Österreichs, HdF., 2. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Neumark, Bd. I I I , Tübingen 1958. v. Mering, Otto: Die Steuerüberwälzung, Jena 1928. Meyer, Hans Reinhard: Das Problem Schiene-Straße, Schweiz. Beiträge zur Verkehrswissenschaft, H. 2, Bern 1940. — Die kostengerechte Fiskalbelastung des Motorfahrzeugverkehrs — ein aktuelles verkehrswissenschaftliches Problem, Schweiz. A r c h i v f. V e r kehrswiss. u. Verkehrspol., 5. Jg., 1950. Mülhaupt, L u d w i g : Die institutionelle Verankerung v o n M i t t e l n der K o n j u n k t u r p o l i t i k i n Schweden, WWA., Bd. 77, 1956 (II). Musgrave, Richard Α.: On Incidence, Jl. of Pol. Ec., Vol. 61, 1953. — Theorie der öffentlichen Schuld, HdF., 2. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Neumark, Bd. I I I , Tübingen 1958. — The Theory of Public Finance. A Study i n Public Economy, New York, Toronto, London 1959. Napp-Zinn, A n t o n F e l i x : Binnenschiffahrt u n d Eisenbahn, K ö l n e r w i r t schafts- u n d sozialwiss. Studien, 2. Folge, H. 3, Leipzig 1928. — Z u r Verzinsung des Verkehrswege-Kapitals, Ztschr. f. Verkehrswiss., 26. Jg., 1955. Nasse, Walther: Der Rhein als Wasserstraße, Die Schiffahrt der deutschen Ströme, 3. Bd., Sehr. d. Ver. f. Socpol., Leipzig 1905. Neumann, Friedrich Julius: Die progressive Einkommensteuer i m Staatsu n d Gemeindehaushalt, Sehr. d. Ver. f. Socpol., Bd. 8, 1874. Neumark, F r i t z : Der Reichshaushaltplan. E i n Beitrag zur Lehre v o m öffentlichen Haushalt, Jena 1929. — Z u r Verkehrspolitik i m Interventionsstaat der Gegenwart, Schweiz. Arch, f. Verkehrswiss. u. Verkehrspol., 3. Jg., 1948. — Sul problema della classificazione delle pubbliche entrate, Rivista d i dir. e se. delle fin., I, 1950. — Grundsätze u n d A r t e n der Haushaltführung u n d Finanzbedarfsdeckung, HdF., 2. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Neumark, Bd. I, Tübingen 1952. — Theorie u n d Praxis der Budgetgestaltung, ebenda. — V o m Wesen der Besteuerung, Beiträge zur Finanzwissenschaft u n d zur Geldtheorie, Festschrift f. R. Stucken, hrsg. v. F. Voigt, Göttingen 1953. — A k t u e l l e Fragen der Finanz- u n d Steuerpolitik, Schriftenreihe der I n dustrie- u n d Handelskammer F r a n k f u r t a. M., Nr. 11, 1957. — Die Bedeutung der staatlichen Finanzpolitik i n einer stetig wachsenden Wirtschaft, Beihefte der K o n j u n k t u r p o l i t i k , Ztschr. f. angew. K o n j u n k t u r forschung, H. 2, B e r l i n 1957. — Schleichende Inflation u n d Fiskalpolitik, Kieler Vorträge, K i e l 1959. — A r t . Steuer (I), Theorie der Besteuerung, HdS., Bd. 10, Stuttgart, Tübingen u n d Göttingen 1959. — Finanzpolitik i n der Hochkonjunktur, Die Deutsche Wirtschaft an der Jahreswende 1960 '61, Der V o l k s w i r t , Nr. 52/53 v. 24. Dez. 1960. — Möglichkeiten antizyklischer Finanzpolitik, Der V o l k s w i r t , 14. Jg., Nr. 9 v. 27. Febr. 1960. Otto, Heinz u n d Krause, Rudolf: Verkehrs- u n d finanzpolitische Aspekte zur fiskalischen Belastung von Kraftfahrzeugen u n d Kraftverkehr, D I W , Sonderhefte N. F., Nr. 45 (Reihe A : Forschung), B e r l i n 1959. Pancoast, D. F. : Allocation of H i g h w a y Costs i n Ohio by the Incremental Method, Columbus 1953.
Literaturverzeichnis
175
Paulich , H.: Der Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung — sein I n halt u n d seine Grenzen, Probleme des Finanz- u n d Steuerrechts, Festschr. f. O. Bühler, hrsg. v. A. Spitaler, K ö l n 1954. Peacock , A l a n T.: Neuere Entwicklungen i n der Theorie der „Fiscal Policy", FA. N. F., Bd. 16, 1955/56. — A Note on the Balanced Budget Theorem, Ec. Jl., Vol. 66, 1956. — Das Finanz- u n d Steuersystem Großbritanniens, HdF., 2. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Neumark, Bd. I I I , Tübingen 1958. Peters, M a x : Schiffahrtsabgaben, Sehr. d. Ver. f. Socpol., 115. Bd., T. 2 u. 3, Leipzig 1908. Pfleiderer, Otto: Die Staatswirtschaft u n d das Sozialprodukt, Jena 1930. Pfuhl, K u r t : Das Königsteiner Staatsabkommen, Der öffentliche Haushalt, Arch. f. Finanzkontrolle, Jg. 5, 4. V j . , 1958/III, 1960, H. 5/6. Philip, K j e l d : Intergovernmental Fiscal Relations, Institute for Economics and History, Kopenhagen 1954. Pigou, A. C. : The Interdependence of Different Sources of Demand and Supply i n a Market, Ec. Jl., Vol. 23, 1913. Pistorius, Theodor: Rücksichtssteuer u n d Zwecksteuer, Zeitschr. f. d. ges. Staatswiss., Bd. 83, 1927. Plank, E . H . : Public Finance, Homewood, III., 1953. Popitz, Johannes: A r t . Finanzausgleich, HdSt., 4. Aufl., Bd. I I I , Jena 1926. Poschmann, Lore: Die Ordnungssteuer. E i n Beitrag zur Systematik der Steuerformen, F A . N. F., Bd. 13, 1951/52. Precht, Georg M a x : E r m i t t l u n g u n d A u f b r i n g u n g der Kosten der Verkehrswege, München 1954. Predöhl, Andreas: Gedanken zum Problem Schiene-Straße, Veröffentlichungen der volkswirtschaftlichen Gesellschaft, Darmstadt 1954. — Verkehrspolitik, Göttingen 1958. Puviani, Amilcare: Die Illusionen i n der öffentlichen Finanzwirtschaft, Deutsch v. M. H a r t m a n n u n d F. Rexhausen, Finanzwiss. Forschungsarb. N. F., hrsg. v. G. Schmölders, H. 22, B e r l i n 1960. Recktenwald, Horst Claus: Steuerinzidenzlehre, Grundlagen u n d Probleme, volksw. Schriften, H. 35, B e r l i n 1958. Redlich: Recht u n d Technik des englischen Parlamentarismus, Leipzig 1905. Rehlen, W i l t r u d : Der Staat i n der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung für die Bundesrepublik Deutschland, hrsg. v. W. Krelle, B e r l i n 1960. Ritsehl, Hans: Die Deckung der Straßenkosten u n d der Wettbewerb der V e r kehrsmittel, B e r l i n u n d K ö l n 1956. Röpke, W i l h e l m : Finanzwissenschaft, B e r l i n u n d Wien 1929. Ross, W i l l i a m D.: The Incremental Method of Allocation H i g h w a y Costs as a Basis for Motor Vehicle Taxation, Nat. T a x Jl., Vol. 8, 1955. Ruckli, Robert: Der Einfluß der Verkehrsursachen auf die Straßenkosten, Schweiz. Arch. f. Verkehrswiss. u. Verkehrspol., 5. Jg., 1950. Sagoroff, Slawtscho: Die Paretosche u n d die Lorenzsche k u m u l a t i v e Verteilungskurve der individuellen Einkommen, Mitteilungsblatt f ü r mathematische Statistik, Jg. 4, H. 2/3, 1952. Sax, E m i l : Die Verkehrsmittel i n Volks- u n d Staatswirtschaft, 2. Aufl., 1. Bd. (Allgemeine Verkehrslehre), B e r l i n 1918. v. Schanz, Georg: Die Reichsfinanzreform, FA., Jg. 1906. Schmidt, H e l m u t : Gegenwartsprobleme der Straßenwirtschaft i n der Bundesrepublik, Handbuch der öffentlichen Wirtschaft, hrsg. v. d. Gewerkschaft öffentliche Dienste. Stuttgart 1960.
176
Literaturverzeichnis
Schmitt, Alfons: Verkehrsordnung durch Wettbewerb oder Zwang? Ordo, 3. Bd., 1950. — Systemgerechte Sonderbesteuerung des Kraftverkehrs — ein Beitrag zu marktkonformer Verkehrspolitik, Ztschr. f. Verkehrswiss., 25. Jg., 1954. — Z u r Neuordnung der deutschen Kraftfahrzeugbesteuerung, F A . N. F., Bd. 15, 1954/55. — Straßenkosten u n d Verkehrsordnung, Schriftenreihe d. Bundesmin. f. V e r kehr, H. 7, Bielefeld 1955. Schmölders, Günter: Die Beförderungsteuer i m Steuersystem, F A . N. F., Bd. 15, 1954/55. — Finanzpolitik, Berlin, Göttingen u n d Heidelberg 1955. — Das Verbrauch- u n d Aufwandsteuersystem, HdF., 2. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Neumark, Bd. I I , Tübingen 1956. — Das Irrationale i n der öffentlichen Finanzwirtschaft (Rowohlts deutsche Enzyklopädie), H a m b u r g 1960. Schneider, Erich: E i n f ü h r u n g i n die Wirtschaftstheorie, Bd. I I I , 5. Aufl., Tübingen 1959. Schneider, Franz: Geschichte der formellen Staatswirtschaft von Brandenburg-Preußen, Schriften der Forschungsstelle für Staats- u n d K o m m u n a l wirtschaft e. V., Wiesbaden, N. F. (Berlin) 1952, Schneider, W. L. u n d Petersen, J. P. : Z u r Frage der Verzinsung von V e r kehrswegen, Schriftenreihe d. Ifo-Inst. f. Wirtschaftsforschung, Nr. 25, B e r l i n u n d München 1954. Schulte, Friedrich: Die Rheinschiffahrt u n d die Eisenbahnen, Die Schiffahrt der deutschen Ströme, 3. Bd., Sehr. d. Ver. f. Socpol., Leipzig 1905. Schulze, Rudolf u n d Wagner, Erich: Reichshaushaltsordnung v o m 31. Dezember 1922 m i t Erläuterungen, 3. Aufl., B e r l i n 1934. Schumacher, H.: Über die finanzielle Behandlung der Binnenwasserstraßen, Verhandlungen des Ver. f. Socpol., Sehr. d. Ver. f. Socpol., 116. Bd., Leipzig 1906. Senf, Paul: A r t . Budget, HdS., Bd. 2, Stuttgart, Tübingen u n d Göttingen 1959. Shelton, John P.: A T a x Incentive for Stabilizing Business Investment, Nat. T a x Jl., Vol. 9, 1956. — u n d Ohlin, Β.: A Swedish T a x Provision for Stabilizing Business Investment, AER., Vol. 42, 1952. Shultz, W i l l i a m J. and Harriss, C. L o w e l l : American Public Finance, 7th. ed., Englewood Cliffs 1959. Siegert, Erich: Getränkesteuern, HdF., 1. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Meisel, Bd. I I , Tübingen 1927. Slichter, Sumner H.: The Economics of Public Works, Readings i n Fiscal Policy, London 1955. Smith, A d a m : A n I n q u i r y into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, hrsg. v. J. R. M'Culloch, Edinburgh (Adam and Charles Black) 1863. Spengler, E d w i n H.: The Increment T a x versus Special Assessments, V i e w points on Public Finance, ed. H. M. Groves, New Y o r k 1950. Sprung, Rudolf: Die W i r k u n g e n eines sich i m Umfang ändernden, ausgeglichenen Budgets auf den ökonomischen Kreislauf, F A . N. F., Bd. 20, 1960. Strommenger, Gottfried: Kraftfahrzeugbesteuerung u n d Wegekosten, Düsseldorf 1953. Studenski, Paul and Kroos, H e r m a n E.: Financial History of the United States, New York, Toronto, London 1952.
Literaturverzeichnis
177
Sundelson: J. W.: Budgetary Principles, Pol. Sc. Quart., Vol. 50, 1936. — Budgetary Methods i n National and State Governments, Special Report of the State Tax Commission, A l b a n y 1938. Tautscher, A n t o n : Staatswirtschaftslehre des Merkantilismus, Bern 1947. Taylor, P h i l i p E.: The Economics of Public Finance, rev. ed., New Y o r k 1953. Terhalle, F r i t z : Finanzwissenschaft, Jena 1930. — Die Finanzwirtschaft des Staates u n d der Gemeinden, B e r l i n 1948. — Das Finanz- u n d Steuersystem der Bundesrepublik Deutschland, HdF., 2. Aufl., hrsg. v. W. Gerloff u n d F. Neumark, Bd. I I I , Tübingen 1958. Timm, Herbert: Bemerkungen zum m u l t i p l i k a t i v e n Effekt eines wachsenden, ausgeglichenen Budgets, F A . N. F., Bd. 18, 1957/58. — Replik, FA. N. F., Bd. 20, 1960. United Nations: National and International Measures for F u l l Employment, 1949. Vetter, Günter: Investitionslenkung. Möglichkeiten u n d Grenzen staatlicher Eingriffe i n den A u f b a u der Produktion, Veröffentlichungen d. Forschungsinst. f. Wirtschaftspol. a. d. U n i v . Mainz, hrsg. v. E. Welter, Bd. 5, Heidelberg 1956. Viaion, Friedrich K a r l : Haushaltsrecht — Haushaltspraxis, 2. Aufl., B e r l i n u n d F r a n k f u r t a. M. 1959 (1. A u f l . 1953). De Viti de Marco , Α.: Grundlehren der Finanzwirtschaft, hrsg. v. O. Morgenstern, Tübingen 1932. Wacke, Gerhard: Das Finanzwesen der Bundesrepublik, Beihefte zur Deutschen Rechtszeitschrift, 13, Tübingen 1950. Wagner, A d o l p h : L e h r - u n d Handbuch der politischen Ökonomie, I V . H a u p t abteilung: Finanzwissenschaft, 1. Teil, 3. Aufl., Leipzig 1883. Weise, Herbert: Die Steuer i m Vereinigten Königreich, Kieler Studien, F o r schungsberichte des Inst. f. Weltwirtschaft a. d. Univ. K i e l , Nr. 41, (Kiel) 1957. Wirminghaus, Α.: Z u r Frage der Wiedereinführung von Rheinschiffahrtsabgaben, Die Schiffahrt der deutschen Ströme, 3. Bd., Sehr. d. Ver. f. Socpol., Leipzig 1905. — Über die finanzielle Behandlung der Binnenwasserstraßen, Verhandlungen des Ver. f. Socpol., 116. Bd., Leipzig 1906. Zahnd, Roger: Z u r Methode der Straßenrechnung i n der Schweiz, Schweiz. Arch. f. Verkehrswiss. u. Verkehrspol., 10. Jg., 1955. Zeller, W i l l y : Die fiskalische Belastung des Motorfahrzeugverkehrs m i t besonderer Berücksichtigung der Schweiz, W i n t e r t h u r 1954.
I I . Amtliche Veröffentlichungen, Berichte, Denkschriften, Gutachten Bundesgesetzblatt, T e i l I. Bundeshaushaltspläne für die Rechnungsjahre 1957, 1958, 1960, nebst Haushaltsgesetzen u n d Allgemeinen Vorbemerkungen. Central Statistical Office: National Income and Expenditure: 1960 (Her Majesty's Stationary Office), London 1960. Denkschrift u n d Bemerkungen zur Reichshaushaltsrechnung, Drucksache Nr. 4045, Reichstag I I I . Wahlperiode 1924—1928. Die Einnahmen von Bund, Ländern u n d Gemeinden i m Rechnungsjahr 1957 (mit vorläufigen Gesamtzahlen f ü r 1958), WiSta., 11. Jg. N. F., 1959. Finanzausgleich, Beiträge zur Frage des Finanzausgleichs u n d der Organisation der Finanzverwaltung, I n s t i t u t „Finanzen u n d Steuern", H. 17, Bonn o. J.
178
Literaturverzeichnis
Finanzbericht Nr. 12: Wirtschaftslage, Haushaltsgebarung u n d Steuersysteme i n den Partnerstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft i m Zeitp u n k t der ersten EWG-Zollsenkung, hrsg. v. Bundesministerium der F i n a n zen, Bonn, A p r i l 1959. Grundlagen u n d Möglichkeiten einer organischen Finanz- u n d Steuerreform, Denkschrift d. Instituts „Finanzen u n d Steuern" e. V., Bonn 1954. Grundsätze für die A u f b r i n g u n g der Kosten der Verkehrswege, Gutachten der Gruppe Verkehrswirtschaft des Wissenschaftlichen Beirats, Schriftenreihe des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesverkehrsministerium, H. 3, Bielefeld 1954. Haushaltspläne des Freistaates Bayern f ü r die Rechnungsjahre 1960 u n d 1961. Informationsdienst zur Finanzpolitik des Auslands, hrsg. v. Bundesministerium der Finanzen, Bonn. Journal Officiel, A v i s et Rapports d u Conseil Economique. Die kommunalen Finanzen i m Rechnungsjahr 1956, Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 216, 1959. Die kommunalen Finanzen i m Rechnungsjahr 1957, Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 236, 1960. Ministère des Finances: Statistiques et Etudes Financières, Suppl. (La fiscalité des pays d u Marché commun), 127, 11° ann., J u l i 1959. Z u r gegenwärtigen Problematik der Gemeindefinanzen, Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen v o m i i . J u l i 1959. Reichsgesetzblatt, T e i l I. Reichsministerialblatt. Die staatlichen Finanzen i m Rechnungsjahr 1955, Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 192, 1958. Die staatlichen Finanzen i m Rechnungsjahr 1956, Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 217, 1959. Die staatlichen Finanzen i m Rechnungsjahr 1957, Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 237, 1960. Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1941/42. Statistische Jahrbücher für die Bundesrepublik Deutschland: 1952 bis 1960. U.S. Bureau of the Census: Statistical Abstract for the United States: 1959, 80th. ann. ed., Washington, D. C., 1959. Die Verkehrspolitik i n der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis 1953; ein Bericht des Bundesministers f ü r Verkehr, D o r t m u n d 1953. Wirtschaft u n d Statistik N. F., hrsg. v. Statistischen Bundesamt, Stuttgart.
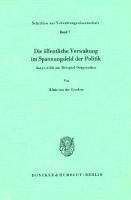
![Die Aufgabe der Zusammenschlußkontrolle: dargestellt am Beispiel der Sanierungsfusion [1 ed.]
9783428448951, 9783428048953](https://dokumen.pub/img/200x200/die-aufgabe-der-zusammenschlukontrolle-dargestellt-am-beispiel-der-sanierungsfusion-1nbsped-9783428448951-9783428048953.jpg)
![Die verfassungsrechtliche Belastungsgrenze der Unternehmen,: dargestellt am Beispiel der Personalzusatzkosten [1 ed.]
9783428487400, 9783428087402](https://dokumen.pub/img/200x200/die-verfassungsrechtliche-belastungsgrenze-der-unternehmen-dargestellt-am-beispiel-der-personalzusatzkosten-1nbsped-9783428487400-9783428087402.jpg)
![Die rechtliche Beurteilung von Gerüchen: Dargestellt am Beispiel von Geruchsimmissionen aus der Schweinehaltung [1 ed.]
9783428524280, 9783428124282](https://dokumen.pub/img/200x200/die-rechtliche-beurteilung-von-gerchen-dargestellt-am-beispiel-von-geruchsimmissionen-aus-der-schweinehaltung-1nbsped-9783428524280-9783428124282.jpg)
![Die Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung: Eine empirische Analyse am Beispiel der Allgemeinen Ortskrankenkassen [1 ed.]
9783428470556, 9783428070558](https://dokumen.pub/img/200x200/die-ausgaben-in-der-gesetzlichen-krankenversicherung-eine-empirische-analyse-am-beispiel-der-allgemeinen-ortskrankenkassen-1nbsped-9783428470556-9783428070558.jpg)
![Methodische Wertung im Recht: Dargestellt am Beispiel der formlosen Hoferbenbestimmung [1 ed.]
9783428431700, 9783428031702](https://dokumen.pub/img/200x200/methodische-wertung-im-recht-dargestellt-am-beispiel-der-formlosen-hoferbenbestimmung-1nbsped-9783428431700-9783428031702.jpg)
![Die Passivlegitimation im Amtshaftungsrecht bei Handeln auf Weisung: Dargestellt am Beispiel der Bundesauftragsverwaltung [1 ed.]
9783428555512, 9783428155514](https://dokumen.pub/img/200x200/die-passivlegitimation-im-amtshaftungsrecht-bei-handeln-auf-weisung-dargestellt-am-beispiel-der-bundesauftragsverwaltung-1nbsped-9783428555512-9783428155514.jpg)

![Öffentlichkeitsarbeit der Regierung im Rechtsstaat: Dargestellt am Beispiel des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung [1 ed.]
9783428409044, 9783428009046](https://dokumen.pub/img/200x200/ffentlichkeitsarbeit-der-regierung-im-rechtsstaat-dargestellt-am-beispiel-des-presse-und-informationsamtes-der-bundesregierung-1nbsped-9783428409044-9783428009046.jpg)

![Probleme der Zweckbindung öffentlicher Einnahmen: Dargestellt am Beispiel der Spezialisierung von Kraftverkehrsabgaben für die öffentlichen Ausgaben im Straßenwesen [1 ed.]
9783428403912, 9783428003914](https://dokumen.pub/img/200x200/probleme-der-zweckbindung-ffentlicher-einnahmen-dargestellt-am-beispiel-der-spezialisierung-von-kraftverkehrsabgaben-fr-die-ffentlichen-ausgaben-im-straenwesen-1nbsped-9783428403912-9783428003914.jpg)