Annäherungen: Sieben Essays zu W.G.Sebald [1 ed.] 9783412513832, 9783412513818
141 22 7MB
German Pages [277] Year 2019
Polecaj historie
Citation preview
Uwe Schütte
ANNÄHERUNGEN Sieben Essays zu W. G. Sebald
BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar. © 2019 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Lindenstraße 14, D-50674 Köln Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Cover: W. G. Sebald in der Old Rectory © Marc Volk, Berlin Lektorat: Christoph Steker, Köln Umschlaggestaltung: Guido Klütsch, Köln Satz und Layout: Bettina Waringer, Wien
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com ISBN 978-3-412-51383-2
»Je mehr die Entfernung wächst, desto klarer wird die Sicht.« W. G. Sebald, Die Ringe des Saturn
Inhalt 1
Heimat
2
Großvater
41
3
Bäume
77
4
Universität
105
5
Tiere
145
6
Feuer
179
7
Nachruhm
219
9
Nachwort
269
Postscriptum
271
Anhang
272
7
1 Heimat
H
eimat, was heißt das? Übersetzen im eigentlichen Sinne kann man dieses Wort bekanntlich nicht. Heimat, das ist zunächst und ureigentlich die Sprache, in der wir die Welt erfassen, wenn wir heimisch werden in ihr als Kinder. Deswegen ist umgekehrt auch der Inbegriff von Fremde überall dort zu finden, wo man nichts oder zumindest nicht alles versteht: wo eine Fremd-Sprache gesprochen wird. Sebalds erste Sprache war der Dialekt, die Umgangssprache seines Dorfes. Wertach im Allgäu. »Einen abgelegeneren Ort, als es dieses Kaff Wertach damals gewesen ist« (G 59), könne man sich nur schwerlich vorstellen, erklärte er einmal einem Interviewer. Schaut man sich die nebenstehende Postkarte aus den fünfziger Jahren an, versteht man das sofort. Das Dorf, so hat es Sebald später formuliert, lag in einer Art Zeitwellental, das der generelle Fortschritt hinter sich gelassen hatte. Die Ungleichzeitigkeit der Zeit. »Stellen Sie sich einen Ort wie Wertach vor, abgelegen von allen Verkehrswegen. In meiner Kindheit gab es da keine Maschinen«, sagte Sebald über seinen »Kindheitsort, der sich in meinen Gefühlshaushalt deutlich eingeprägt hat, wie in einem Einweckglas.« (G 87) Sebald trug die Heimat so immer in sich. Noch auf Korsika fühlt er sich in einer Schlucht geradezu »niedergedrückt von dem vor Jahrmillionen aufgeworfenen Gestein, zumal es mich erinnerte an die finstern Täler mei-
10
1 Heimat
ner alpenländischen Kindheit, über denen im Winter die Sonne nur um die Mittagszeit eine Weile als ein blaues Trugbild erschien.« (KP 192) Manches Jahr lag der Schnee in Wertach über fünf Monate lang. Eine ungeheuerliche Stille muß geherrscht haben damals. Nicht einmal ein Radio war zu hören. Umso vernehmlicher daher die Sprache der Natur, in deren Grammatik ihn der Großvater einführte. Der Geruch getrockneter Kräuter. Das Fraßbild des Borkenkäfers. Die Zeichensprache der Wolken. Und das Summen der Bienen. Am Horizont stets die Alpenzüge an der Grenze zu Tirol. Richtiges Deutsch mußte der kleine Winfried erst auf der Schule erlernen. Sebald erinnert sich, »daß für mich das Hochdeutsche von Anfang an eine Fremdsprache gewesen ist, die ich mir aneignen mußte in meiner späteren Kindheit. So kam ich mir selbst beim Eintritt in die Universität vor wie ein Amhares vom Lande, der nicht genau weiß, wie man das Deutsche spricht oder schreibt.« (G 254) Und wenn er es sprach, das Hochdeutsche, mit seiner sonoren Stimme, dann klang der Tonfall des Dialekts unverkennbar mit. Die erste Fremdsprache Hochdeutsch hatte sich nur sozusagen darübergelegt. Selbst wenn er auf Englisch redete, blieb das Allgäuische stets als Grundbaß präsent. Und damit die Heimat. Auch erhielt sich die Heimat, indem Sebalds Texte voller dialektaler, oberdeutscher Ausdrücke waren: Staubzucker etwa, Kukuruzfeld oder der Hosensack samt Sacktuch, und so weiter. Desgleichen war sein Faible für Autoren, die wie er aus der Peripherie stammten, ein bezeichnendes Zugehörigkeitssignal. Sprache als portable Heimat. Sein Lieblingsaustriazismus sei ›Prosekturkarren‹, verriet er mir einmal. In der Tat waren es vor allem österreichische Schriftsteller wie Thomas Bernhard, Peter Handke und Ernst Herbeck, die ihn faszinierten. Hinzu kamen alemannische Autoren wie die Schweizer Gottfried Keller und Robert Walser wie auch solche schwäbischen
1 Heimat
11
Schriftsteller wie der arme Hölderlin und der Kalendergeschichtenautor Johann Peter Hebel. Und nicht zu vergessen: der bayerische Anarchist Herbert Achternbusch. Sie alle waren Identifikationsfiguren für ihn, weil sie oftmals am Leben und an der Literatur verzweifelten. Identifikationsfiguren aber auch, weil die Autoren sich schreibend aus den Fesseln einer inferioren, provinziellen Abstammung befreiten vermittels der bürgerlichen Institution der Literatur. So wie er selbst es geschafft hatte, schreibend den »Weg zur Überwindung der eigenen Namenlosigkeit« (UH 15) zu gehen. Den Weg also vom Dorfkind zum Intellektuellen und schließlich zum Schriftsteller, der fernab von der Heimat, überall dort zumindest, wo man Englisch spricht, als bedeutendster Autor deutscher Sprache des späten zwanzigsten Jahrhunderts gilt. Ein merkwürdiger Lebenslauf: von der Allgäuer Peripherie führte er zu einem ehemaligen Zentrum, dem der Industrialisierung, Manchester also, und von dort wieder in die Peripherie East Anglias. Poringland hieß das Dorf am Ende seiner Lebensreise. »Where I am now is very much out in the sticks. And I do feel that I’m better there than I am elsewhere in the center of things. I do like to be on the margins if possible« (EM 50), erklärte er einer amerika nischen Interviewerin. Heute hat man das Randständige ja allenthalben wieder als positiv konnotierten Gegenraum zur urbanen Hektik des einundzwanzigsten Jahrhunderts entdeckt. Das hat angesichts der »wirtschaftlichen Kolonisierung der zurückgebliebenen Regionen«, die Sebald beklagte, etwas übel Verlogenes an sich. Existieren doch Rückzugsräume nunmehr überhaupt nicht mehr, da Zivilisation und Digitaltechnik bis in die abgelegensten Ecken vorgedrungen sind. Damit ist auch die Heimat verschwunden. Doch Sebald war selbstverständlich bewußt, daß Heimat stets eine Art positive, mit Wehmut besetzte Selbsttäuschung ist, die man sich aus großer zeitlicher wie räumlicher Distanz konstruiert:
12
1 Heimat
»Es gibt diese Halbträume, die man im Kopf herumträgt, die einem manchmal in der Nacht kommen und auch manchmal untertags, daß man also wirklich sich sehnt nach dem Ort beziehungsweise nach der Gegend, die man verlassen hat. Aber man sehnt sich – und das weiß man, glaube ich, sehr genau – nach einer Schimäre, weil man ja sehr oft genug eigentlich in der Heimat zurück gewesen ist, um zu sehen, wie groß das Ausmaß der Verschandelung geworden ist.« (G 225) Ebenso hat er nie verklärt, wie geistlos die Provinz damals während seiner Kinderjahre war: »There was scarcely any reading material about. There was no bookshop; there was not even a local lending library or anything of that kind; you grew up without reading. And you grew up without listening to music. Nobody had a gramo phone; there was scarcely a radio.« (CB 140/41) Heutzutage natürlich unvorstellbar – eine Kindheit ohne Medien und ohne das gesamte Archiv der Kultur digital direkt verfügbar. Im Verlauf eines Lebens hat Sebald gleichsam den zivilisatorischen Quantensprung von naturbestimmter Dorfkindheit zu hypermodernem Urbanismus durchmessen. Wenn er, nicht lang vor seinem Tod, im New Yorker Goethe-Institut vor der dortigen Kulturschickeria auftrat, wie in seinem englischen Gedicht October Heat Wave beschrieben, kam er in der Tat »weit von wo« (AW 83), wie eine markante Wendung besagt, die in seinem Werk ebenso auf Englisch auftaucht: »It makes me feel that I am a long way away, though I never quite know from where.« (AW 129) Ja, weit von wo – aber um den Abstand zwischen zwei Punkten bestimmen zu können, braucht es einen fixen Startpunkt, von dem aus das Gegenwärtige zu messen ist. Was aber, wenn dieser Startpunkt, die Heimat, sich entzieht, weil es sie nicht mehr gibt? »Immer jedenfalls war man, wie der Paul unter diese Fotografie geschrieben hat, zirka 2000 km Luftlinie weit entfernt – aber von wo?« (AW 82/83), sinniert der Erzähler in der Geschichte über Sebalds Dorfschullehrer, der darin Paul Bereyter heißt.
Rückkehr in die Heimat. Engelwirt & Chestnut Grove
13
Die Irrealitätserfahrung aber, sich stets ›weit von wo‹ in einem »englischen Asyl« (AW 266) zu befinden, war eine Grunderfahrung von Sebald. Seine Kunstfigur Austerlitz läßt er die eigene Erfahrung des Fremdheitsgefühls über den »mir nicht vertrauten, sondern – trotz der vielen seit meiner Ankunft in England vergangenen Jahre – fremd und unheimlich gebliebenen« (A 57) Anblick des Gastlandes aussprechen. Sich als ein ›Auswärtiger‹ zu fühlen, war die Einsicht, die Sebald in England aushalten mußte. Daß fortwährend und trotz aller Vertrautheit mit der neuen Umgebung ein bitterer Rest blieb, nämlich »das Jeden-Tag-von-neuem-Begreifenmüssen, daß ich nicht mehr zu Hause war, sondern sehr weit auswärts.« (A 70) Zu einer neuen Heimat konnte England daher nie werden, trotz aller gleichzeitigen großen Sympathie für das Land. Unterwegs in der Fremde, als er während einer Italienreise Logis bezieht in einem Hotel, einem transitorischen Ort par excellance, überfällt den Erzähler ein Gefühl des Mitleids, in dem, so denke ich, das nagende Gefühl permanenter Dislozierung bei Sebald exemplarisch aufscheint: »Die armen Reisenden, ging es mir durch den Kopf, und ich nahm mich dabei selber nicht aus. Immer anderwärts.« (SG 125)
RÜCKKEHR IN DIE HEIMAT. ENGELWIRT & CHESTNUT GROVE Das Sehen erlernen müssen, die falsche Bildwelt, Heimat als Trugbild. Dahinter blickt man nur, wenn man sie verläßt und gegen die Fremde eintauscht. Eine neue Sicht gewinnt und das Unverständliche zu begreifen lernt. Erst von außen wird das Vertraute kenntlich, dabei aber zugleich un-heimlich. Für Sebald waren es vor allem die Verbrechen der Nationalsozialisten, von denen er später erfuhr.
14
1 Heimat
»Und was man natürlich aus der Distanz heraus auch weiß und was man nicht wußte, wenigstens was ich nicht wußte, als ich dort war als Heranwachsender, das waren die Schrecken, die assoziiert waren mit diesen Orten und die man dann wirklich erst im nachhinein, sozusagen aus dem historischen Studium heraus, begreifen lernt. Die ersten Jahre meines Lebens habe ich nicht darüber nachgedacht, was mit meiner engeren Heimat beziehungsweise was mit Deutschland assoziiert war.« (G 226) Eine solche Erfahrung kann nicht ohne Folgen für den Heimkehrenden bleiben. Unter dem Titel Il ritorno in patria schildert Sebald im letzten Teil von Schwindel. Gefühle., was passiert, wenn man nach drei Jahrzehnten erstmals wieder an seinen Kindheitsort zurückkehrt. Natürlich hat sich das alles nicht wirklich so zugetragen, wie es im Buch berichtet wird. Vielmehr hat Sebald immer wieder mal, etwa wenn er auf Besuch bei Allgäuer Verwandten oder Freunden war, Abstecher in den Heimatort unternommen. Wohl um nachzusehen, was noch übrig geblieben war vom Wertach seiner Kindheit. Eines wird er immer wieder bemerkt haben: zurückgekommen, als Fremder in der eigenen Heimat, ist man ein seltsam Unzugehöriger. Literarischer Ausdruck dessen ist die Episode, in der geschildert wird, wie der heimkehrende Erzähler, sich als englischer Auslandskorrespondent ausgebend, im Engelwirt absteigt, über dem seine Familie früher gewohnt hat. Seltsam befremdet muß er feststellen, daß »sich das mir angewiesene Zimmer an derselben Stelle befand, an der unser Wohnzimmer gewesen war.« (SG 210) Dessen kleinbürgerlich-spießige Einrichtung wird von Sebald so evokativ wie detailgetreu aus der Erinnerung beschrieben, um anzufügen: »Von alldem war das Gastzimmer, durch dessen Fenster ich jetzt auf die untere Gasse hinabsah, denkbar weit, ich selber allerdings durch nichts als einen Atemzug entfernt, und hätte die Wohnzimmeruhr in meinem Schlaf hinein geschlagen, es hätte mich nicht im geringsten gewundert.« (SG 212)
Rückkehr in die Heimat. Engelwirt & Chestnut Grove
15
Eine schöne Erfindung. Einen Gasthof Engel gibt es tatsächlich in Wertach: Er stammt von Ende des neunzehnten Jahrhunderts, gebaut nach dem großen Brand, der damals fast das ganze Dorf in Schutt und Asche gelegt hat. Nun aber wird er abgerissen. Das alteingesessene Gebäude fällt einem Erneuerungsplan für das Zen trum Wertachs zum Opfer. Auch unser Dorf soll schöner werden! Die Familie Sebald indes hat nie in dem Haus gelebt. Vielmehr hatte sie von 1947 bis zum Umzug nach Sonthofen im Dezember 1952 eine Wohnung im ersten Stock der um die Ecke gelegenen Weinstube Steinlehner bezogen. Die Engelwirt-Episode war also nicht völlig frei erfunden. Unter anderen Umständen als den realen Gegebenheiten (die freilich nur das Resultat von Zufällen sind), wäre es durchaus vorstellbar, nach Jahrzehnten als Gast im eigenen Wohnzimmer zu übernachten. Wie nah er damit an einer möglichen Wirklichkeit lag, realisierte ich erst, als ich selbst nach rund fünfzehn Jahren erstmals zurückkehrte nach Norwich, dem Ort meines Studiums an der University of East Anglia. Zu meinem nicht geringen Erstaunen fand ich das Haus, in dem ich als Sebalds Student mit meiner Freundin sechs Jahre lang in einer geräumigen Dachwohnung gelebt hatte, in ein B&B Guesthouse namens ›Chestnut Grove‹ verwandelt. Unsere damalige Vermieterin, eine freundliche ältere Lady, die gegenüber ihren jungen deutschen Mietern nie ihre jüdische Abstammung erwähnte, so erfuhr ich, war nicht allzu lange nach unserem Auszug in Richtung London gestorben. Ihre Erben wiederum hatten die Liegenschaft an ein unsympathisches Ehepaar verkauft, das früher ein Norfolker seaside hotel betrieben, sich dann aber aufs Altenteil zurückgezogen hatte. Von der Bewirtung und Beherbergung zahlender Gäste, so schien es, konnten Maureen und Trevor aber nicht lassen. Dabei leitete weniger eine prinzipiell gastfreundliche Disposition ihr Verhalten als vielmehr der auf finanziellen Vorteil abzielende merkantile Zug der
16
1 Heimat
britischen middle class. Dementsprechend besaßen sie nur geringes Interesse an meinen Erzählungen darüber, wie Haus und Garten in den neunziger Jahren aussahen und um welche Art von Person es sich bei unserer Vermieterin, Mrs Speculand, gehandelt hatte. Maureen war vielmehr erpicht darauf, möglichst schnell den Obolus für die Übernachtung einzutreiben. Das paßte ganz zu dem Eindruck, man sei weniger Gast als mißtrauisch beäugter Eindringling. Dann insistierte sie, an der Grenze zur Unhöflichkeit, mir ihr full English breakfast aufzudrängen, bei dem es sich nach ihrer fixen Überzeugung um das Beste der Britischen Inseln handele. Ich blieb jedoch hart in meiner Ablehnung. Trevor, der das Haus mit seiner umfangreichen Sammlung von naval memorabilia auf das Geschmackloseste vollgestopft hatte, interessierte sich ohnehin nur für das nachmittägliche Fernsehprogramm. Mir war es recht so. Lieber ging ich zwei Stockwerke hoch in unsere alte Wohnung, langsam Schritt für Schritt über die altvertrauten Stufen. Und wie von Sebald anhand des Engelwirts beschrieben, fand ich mich auf einmal – umgeben von scheußlichen Kriegsschiffmodellen – in unserer alten Wohnung wieder. Sogar der gemütliche Sessel im Korridor stand noch unverrückt am selben Platz. Maureen hatte mir den Schlüssel zu Zimmer zwei mitgegeben. Die Türen waren zwar nicht mehr dieselben, doch die Zahl prangte just dort, wo es in unser ehemaliges Wohnzimmer ging. Dort, wo ich über mehrere Jahre meine von Sebald betreute Doktorarbeit geschrieben hatte – denkbar weit entfernt von meinem früheren Leben, und doch durch nichts als einen Atemzug von ihm getrennt.
FRAGWÜRDIGKEIT VON HEIMATKUNST Als Sebalds Erzähler in die Gaststube des Engelwirts geht, um sich – vorgeblich zeitunglesend – unter die biertrinkenden Bauern des
Fragwürdigkeit von Heimatkunst
17
Dorfes zu mischen, die früher einmal seine Schulkameraden waren, entdeckt er ein vertrautes Gemälde: »Das Bild, das schon im alten Engelwirt an demselben Platz gehangen hatte, war inzwischen so dunkel geworden, daß man nicht gleich wußte, was es eigentlich darstellen sollte. Erst nach längerem Hinsehen traten aus der Bildfläche die Phantome der Holzknechte hervor. Sie waren beim Abrinden und Verkrampen der gefällten Stämme und gemalt in den gewaltig ausgreifenden und ausholenden Posen, die für die Heroisierung der Arbeit und des Krieges kennzeichnend sind.« (SG 223) Der Künstler ist ihm bekannt: Josef Hengge. Sebald war vertraut mit dessen Wandmalereien und Bildern, die allenthalben in Wertach und Umgebung zu sehen waren. Und noch immer sind. Auch auf dem Haus, in dem Sebald geboren wurde und aufgewachsen ist, sind solche Wandmalereien zu sehen, die jedoch nicht von Hengge stammen. Zwei martialische Heldendarstellungen befinden sich dort seltsam isoliert auf der Fassade: zunächst eine Rückenansicht des Götz von Berlichingen, der eine Kanone abfeuert, vor der drei Kanonenkugeln liegen. Rechts daneben zu sehen ist eine Frontalansicht von Jörg Schmid, auch Knopf von Leubas genannt, Bauernanführer während des Aufstandes von 1525. Entsprechend kämpferisch hält er einen Hammer in der linken Hand, während seine Rechte jene Fahne ergreift, unter der sich der sogenannte Allgäuer Haufen einstmals versammelt hatte. Auch dies ein militaristisches Motiv, das von Hengge hätte stammen können. »Alle diese Henggebilder hatten für mich etwas äußerst Beunruhigendes« (SG 225), erinnert sich Sebald an seine Dorfkindheit. Wie zum Beweis, bildet er in Schwindel. Gefühle. das Hengge-Bild ab, das an der Wertacher Raiffeisenbank angebracht ist. Das Fresko zeigt eine »hochaufgerichtete Schnitterin, die dasteht vor einem Feld zur Ernte, das mir immer wie ein entsetzliches Schlachtfeld vorgekommen ist.« (SG 226) In der Tat wirkt es selbst in der verkleinerten schwarz-weißen Reproduktion äußerst beunruhigend.
18
1 Heimat
Heimat ist nicht nur, was man hört und riecht, es ist auch, was man von früh auf sieht. Heimat, das ist die erste Form, die Welt zu betrachten. Bis alsbald aus der kindlichen Vertrautheit das immer stärkere Moment der Bedrohung aufscheint und die Heimat, das Urvertraute, irgendwann unheimlich wird. So erging es Sebald jedenfalls mit den Bildern, die er als Kind im heimatlichen Allgäu sah. Fatalerweise sind »diese Henggebilder, abgesehen von denen in der Pfarrkirche, so ziemlich die einzigen Bilder gewesen, die ich bis zu meinem siebten oder achten Lebensjahr gesehen habe«, realisierte Sebald im Rückblick, um anzufügen, daß sie insgesamt »einen vernichtenden Eindruck« (SG 227) auf ihn als Kind gemacht hätten. In der Tat: eine ungute Mischung, der Katholikenkitsch in den Kirchen und Kapellen und die volkstümelnde Kunstmalerei des Josef Hengge. Hengge begann zwar als Schüler von Franz von Stuck, blieb aber leider nicht im künstlerischen Fahrwasser seines Lehrers. Er durchlief vielmehr eine Karriere der Anpassung an die Herrschenden. Seine guten Kontakte zur bayerischen Königsfamilie brachten ihm lukrative öffentliche Aufträge ein; unter anderem malte er König Ludwig III. Später schuf er zwei Portraits des sogenannten Führers, von denen eines 1938 zu sehen war in der Münchner Städtischen Galerie am Lenbachplatz beim Wettbewerb um den von den Nazis ausgelobten Lenbach-Preis. Bekannt war Hengge aber insbesondere für seine rustikal-kämpferischen Darstellungen von Holzarbeitern und Bauern, dem Blut und Boden der deutschen Volksseele, die er in zumeist exorbitantem Format malte. »Er hat sogar nach dem Krieg, als seine Monumentalwerke aus verschiedenen Gründen nicht mehr sehr hoch im Kurs standen, nicht davon abgelassen« (SG 227), konstatiert Sebald. Dergestalt benennt er eine ungute deutsche Kontinuitätslinie, die in Provinzgegenden wie dem Allgäu unangefochten von den Veränderungen, die Sebalds Generationsgenossen in den spä-
Katholische Heimatliteratur?
19
ten sechziger Jahren erzwangen, sich weit in die Bundesrepublik fortschreiben konnte. Als Sebald 1990 mit Schwindel. Gefühle. sein eigentliches Debüt als Prosaautor vorlegte, erinnerte die heimattümelnde Zeitschrift Das schöne Allgäu unter dem vielsagenden Titel »Er hörte den Herzschlag der Erde« an den hundertsten Geburtstag von Josef Hengge, der erst zwanzig Jahre zuvor gestorben war. Ob Sebald wußte, daß Hengge nach der Ausbombung seiner Münchner Wohnung 1945 nach Wertach gezogen war, von wo aus er 1950, also zwei Jahre bevor auch die Familie Sebald das Dorf verließ, in seinen Geburtsort Kempten zurückkehrte? Der Kunstmaler war insofern nicht nur in Form seiner grausigen, dem kleinen Winfried Furcht einflößenden Bilder eine Präsenz in dessen Kinderjahren. Daß sie sich nicht wenigstens einmal begegnet sind – sei es auf den Straßen des Dorfes oder bei der Wanderung auf den Feldwegen außerhalb – ist bei einem Kaff wie Wertach schlichtweg nicht vorstellbar. In Schwindel. Gefühle. notierte der erwachsene Sebald dann, daß ihm »das Beispiel des Kunstmalers Hengge und die Fragwürdigkeit der Kunstmalerei überhaupt immer warnend vor Augen« (SG 229) gestanden seien, als er selbst damit begonnen hat, sich in der Kunst des Schreibens zu versuchen. Literarisches Kunsthandwerk jedenfalls hat er nie betrieben. Mag sein aber, daß seine Entscheidung, sich wiederholt im Genre der Ekphrasis zu erproben sowie mehr verwirrendes als illustrierendes Bildmaterial in seine Texte mitaufzunehmen, auch eine kompensatorische Reaktion war auf die frühe Konfrontation mit den Bildern des Nazimalers Josef Hengge.
KATHOLISCHE HEIMATLITERATUR? Sebald war antiklerikal. In seinen Schriften findet sich nirgends aber irgendein Hinweis auf eine bestimmte Erfahrung oder ein
20
1 Heimat
prägendes Erlebnis, das erklären würde, warum ihm die römisch- katholische Kirche so nachhaltig verlitten war. Genauso wenig übrigens wie das Geständnis, in jungen Jahren ein durchaus begeisterter Katholik gewesen zu sein. Im privaten Gespräch berichtete er hingegen über die Tätigkeit als Ministrant, die für ihn damals eindrucksvolle Wallfahrt nach Maria Taferl im österreichischen Waldviertel und sogar über seinen frühen Berufswunsch Pfarrer. Die zwei Jahre am katholischen Gymnasium Maria Stern in Immenstadt zu Mitte der fünfziger Jahre waren dann allerdings eher ernüchternd für ihn und dürften für seine Distanznahme zur katholischen Kirche verantwortlich sein. Von einem »krankhaften Katholizismus« (AW 69) spricht Sebald in der Paul Bereyter-Geschichte über seinen Volksschullehrer, über den »das mir lange Zeit unverständliche Gerücht ging, daß er gottgläubig sei«, was den Erzähler umso mehr verwundert, als dem Pädagogen »nichts derart zuwider war wie die katholische Salbaderei.« (AW 53) Auch empfahl er mir, nachdem ich ihm von dem einen Jahr erzählte, das ich am katholischen Walpurgisgymnasium unter der Ägide von Oberin Virginia verbrachte, die Lektüre der vielen österreichischen Romane, in denen autobiografisch von den Qualen und Erniedrigungen der Autoren in Klosterschulen berichtet wird. Darüber, daß den Prägungen des Katholizismus nicht wirklich zu entkommen ist, selbst wenn man mit der Amtskirche als durch und durch verlogener Institution bricht, brauchen hier keine großen Worte verloren zu werden. In Sebalds Texten erscheint der Katholizismus stets als rotes Tuch. So beschreibt er in Die Ringe des Saturn in aller Drastik etwa die unmenschlichen Massaker, welche die faschistische kroatische Miliz im Verlauf des Zweiten Weltkriegs, »im Rücken gestärkt von der Wehrmacht und in der Seele von der katholischen Kirche« (RS 121), begangen hat. Und während die Hinwendung der Familie Swinburne zum römisch-katholischen Glauben von Sebald als »ein erstes Anzei-
Katholische Heimatliteratur?
21
chen der Dekadenz« (RS 195) gewertet wird, kam es im (fiktionalen) Clan der Fitzpatricks zu einem Schisma: In jeder Generation, so Austerlitz, ist mit bezeichnender Konsistenz »einer der jeweils zwei Söhne dem Katholizismus abtrünnig und Naturforscher geworden.« (A 127) Was Sebald am katholischen Gymnasium in Immenstadt erlebte, hat er womöglich literarisch umgesetzt im autobiografischen Teil des Prosagedichts Nach der Natur. Dort bezeichnet ein faschistoider Kaplan im Unterricht den Sieg Alexanders über Darius III. als vom lieben Gott gelenkten Glücksfall: »Er sei, / sagte er, eine Demonstration / der notwendigen Vernichtung aller / aus dem Osten heraufkommenden Horden / und also ein Beitrag zur Geschichte des Heils.« (NN 98) Das Gegenbild zu diesem Diener Gottes und seiner Form der Heilsgeschichtsschreibung ist die Mathild, die im Wertacher Café Alpenrose logiert, wo der Großvater sie regelmäßig besuchte: »Oft begleitete ich den Großvater in die Alpenrose, wie ich ihn ja fast überallhin begleitete, und saß mit einem Himbeerwasser dabei, wenn die Karten gemischt, abgehoben, ausgeteilt, ausgespielt, zur Seite gelegt, gezählt und von neuem gemischt wurden.« (SG 239) Erst lange nach ihrem Tod findet der Erzähler heraus, daß die im Dorf als ›rote Betschwester‹ verschriene Mathild vor Ende des Ersten Weltkriegs das Regensburger Kloster der Englischen Fräulein unter rätselhaften Umständen verlassen hat, um einige Zeit im München der Räterevolution zu verbringen. Von dort wiederum war »sie in einem arg derangierten und fast sprachlosen Zustand nach Hause nach W. zurückgekehrt.« (SG 246) Ausweis des außenseiterischen Status unter den von ihr verachteten Dorfbewohnern ist ihre nachgelassene Bibliothek, in der es »zahlreiche religiöse Werke spekulativen Charakters gab, Gebetbücher aus dem 17. und frühen 18. Jahrhundert mit zum Teil drastischen Abschilderungen der uns alle erwartenden Pein. Zum anderen fanden sich zu meinem Erstaunen mit den geistigen Schriften
22
1 Heimat
vermischt mehrere Traktate von Bakunin, Fourier, Bebel, Eisner, Landauer sowie der autobiographische Roman der Lily von Braun.« (SG 244/46) In Form der (wohl fiktiven) Mathild scheint eine andere Verhaltensweise zur christlich dominierten Dorfstruktur auf: eine Haltung, die vom Konservatismus zum Widerstand, zur unbekümmerten Nonkonformität führt. Eine Entwicklungslinie, die Sebald sympathisch war. Das Gegenteil wiederum galt für jene, die zum Katholizismus konvertierten. Sebald hat sie für diesen Schritt verachtet. Beispielsweise Autoren wie Carl Sternheim und Alfred Döblin, denen er in seinen literaturkritischen Schriften die Abkehr von ihren jüdischen Wurzeln als politisch-moralischen Verrat vorwarf. Große Abneigung besaß er ebenso für dezidiert katholische Schriftsteller, denen er so etwas wie Untreue an den Idealen der Literatur unterstellte. Als ich auf der Suche nach einem geeigneten Dissertationsthema war, schlug er mir nachdrücklich Gertrud Fussenegger vor – nämlich aufgrund ihrer Parteinahme für den Faschismus bei gleichzeitigem Glaubenseifer für die römisch-katholische Sache. Eine ungute Kombination. Die Fussenegger hatte damals, ich meine 1993, den Jean-Paul-Preis des Freistaats Bayern bekommen. Für Sebald ein ungeheuerlicher Skandal. Womit er völlig Recht hatte. Für eine Dissertation, so erklärte mir Sebald, sei es eine gute Strategie, sich einen Autor zu suchen, den man verachte; dies nämlich gebe Energie, sich der lustvollen Demontage von dessen Werk zu widmen. Ich habe seinen Rat bedacht, bin ihm aber nicht gefolgt. Seiner kategorischen Ablehnung aller Autoren der katholischen Seitenlinie der deutschsprachigen Literatur konnte ich als ehemaliger Altardiener der Gemeinde St. Thomas und St. Stephan jedoch vorbehaltlos folgen. Für Sebald bestand kaum ein Unterschied zwischen jenen Autorinnen und Autoren, die ihr Schreiben in den Dienst der Kirche stellten, und jenen, die behaupteten, für Heimat und Volk und
Katholische Heimatliteratur?
23
Führer zu schreiben. Wie der von ihm verehrte Thomas Bernhard hat er keinen markanten Unterschied zwischen Nationalsozialismus und Katholizismus gesehen. Das ist zwar keine sonderlich differenzierte Sicht der Dinge, ergab sich aber bei beiden Autoren offenkundig aus der eigenen Lebenserfahrung. Betrachtet man die Gruppe der sogenannten Heimatdichter, also solch exemplarische Namen wie »Josef Weinheber, Guido Kolbenheyer, Hermann Burte, Wilhelm Schäfer und andere Hüter des deutschen Erbes, die glaubten, ihr Jargon sei unmittelbar aus der Sprache des Volks entsprungen« (LH 12), erkennt man die christliche Verbrämung nationalistischer Positionen als ein rekurrentes Muster. Dementgegen sah Sebald etwa in Johann Peter Hebel einen Heimatdichter, der keinen Verrat an der Literatur begeht, wenn er über seine Heimat schreibt. Deshalb hebt er auch ausdrücklich »die Fürsprache der jüdischen Autoren der zehner und zwanziger Jahre« (LH 11) für Hebel hervor – womit er Kafka, Bloch und Benjamin meint –, denn im Fall von Hebel ist die Heimatliebe nicht mit dem Haß auf Fremdes verbunden. Dem verehrten Gelehrten Gershom Scholem gegenüber stellte sich der junge Sebald brieflich so vor: »Ich bin 1944 in Südbayern geboren und habe dort eine katholizistische Kindheit und Jugend durchgemacht, weshalb ich mit der Praxis der Orthodoxie und dem Wunsch ihr zu entkommen in gewisser Weise zumindest vertraut bin.« Das war vielsagend genug. Mit siebzehn Jahren soll Sebald aus der katholischen Kirche ausgetreten sein. Zu dieser Zeit, noch deutlich vor Erlangung der Volljährigkeit wie vor dem Beginn des gesellschaftlichen Wandels zu Ende der sechziger Jahre, ein sicher wagemutiger, selbstbestimmter Schritt. Zugleich war das Aufgeben des katholischen Glaubens sicherlich eine Verlusterfahrung – ein prägender Erfahrungsraum der Kindheit verschwand. Und bei aller Opposition gegen die autoritären Strukturen der Amtskirche und das Brimborium des Katho-
24
1 Heimat
lizismus hat sich Sebald keineswegs vom Glauben an Transzendenz und Metaphysik abgewandt. Ja, er hat sich eine privatistische Form der Spiritualität bewahrt, in der ein wenig vom Katholizismus der Kindheit überlebte. Dazu gehörte wohl die Furcht vor göttlicher Strafe für menschliche Verfehlungen, welche der Katholizismus in den Kinderseelen verankert. Die Schuldgefühle für angebliche Sünden mag man als Erwachsener überwinden, nicht aber die existentielle Furcht davor, ergriffen zu werden »von der in uns allen bisweilen sich rührenden Angst, ausgebürgert zu werden aus unserem eigenen Leben von einer uns übergeordneten, anonymen Gewalt.« (KP 168) Wenn Sebald zum einen die opulenten Bahnhöfe des neunzehnten Jahrhunderts als neue Kathedralen erkennt und zum anderen immer wieder in verschiedensten Kontexten auf christliche wie säkulare Engel zu sprechen kommt, sind darin Residuen der kindlichen Prägung zu erkennen. Überhaupt, ziemlich viele Heilige durchwirken die literarischen Schriften Sebalds; mehr als ein gänzlich Gottloser sich erlaubt hätte. Und ebenso fällt auf, wie oft er immer wieder, gleichsam sanft insistierend, sakrale Malerei und Kirchenkunst eindrucksvoll beschreibt. Dies freilich in der ihm eigenen Weise: Die Kunstwerke sind gelöst aus ihren religiös-theologischen Zusammenhängen, aber dennoch nicht völlig säkularisiert. Die Engel, die bei Giotto klagend über unserem Unheil schweben, werden abgebildet und bewundert; der eigentliche Bildinhalt, weiter unten, die Beweinung Christi, bleibt abgeschnitten. Dieses Manöver kann stellvertretend für Sebalds antiklerikale Haltung stehen: Die Anbetung Jesu, der Katechismus und die damit verbundenen Diskurse sind für ihn irrelevant geworden. Die entscheidende Frage aber nach Erlösung von seelischem Leid und der Transzendenz unserer materiellen Existenz stellt er umso dringlicher. Die Abwendung von der Kirche war insofern ein wichtiger Emanzipationsschritt, um zu einem kritischen und eigenwilligen
Die Heimat, zerstört
25
Denker zu werden. Jedoch starb dabei ein Teil von dem, was einstmals Heimat war.
DIE HEIMAT, ZERSTÖRT Seine Geburt hat Sebald in Nach der Natur so verklärt: »Als ich am Christi Himmelfahrtstag / des Vierundvierzigerjahrs auf die Welt kam, / zog gerade die Flurumgangsprozession / unter den Klängen der Feuerwehrkapelle / an unserem Haus vorbei in die blühenden / Maifelder hinaus.« (NN 76) Das beschauliche Bild trügt aber. Die Heimat ist kein Hort ungetrübten Glücks, denn »über den Bergen / stand schon das Unwetter, das bald darauf / die Bittgänger zersprengte und einen / der vier Baldachinträger erschlug.« Ebenso will diese Legende illustrieren, daß etwas Schreckliches seinerzeit unausgesprochen im Hintergrund stand. Er sei, »dem anderwärts furchtbaren Zeitlauf zum Trotz, / am Nordrand der Alpen, wie mir heut scheint, / aufgewachsen ohne einen Begriff der Zerstörung.« (NN 76) Natürlich ist das die Perspektive des Erwachsenen, der um die Verheerungen und Monstrositäten weiß, die sich zugetragen haben, zumal in den beiden letzten Kriegsjahren: »Als ich 44 im idyllischen, damals vom Krieg unberührten Allgäu geboren worden bin, sind gerade die Juden von Korfu dort deportiert worden nach Auschwitz.« (G 101) Oder an anderer Stelle: »Ich empfinde es, vom jetzigen Zeitpunkt aus gesehen, als eine Ungerechtigkeit, sozusagen, daß ich damals in diesem windstillen Tal aufwachsen durfte; und weiß also nicht so recht, womit ich das verdient habe, sozusagen.« (G 138) Aber man darf diese Ignoranz über die Zerstörungen nicht allein auf den Holocaust reduzieren. Eine kindliche Ahnung von den Feuerstürmen, welche die deutschen Städte in jenen Kriegstagen verwüsteten, klingt nämlich an in »dem tosenden Feuer, das eines Nachts, / kurz vor meiner Einschulung ist es gewesen, / ein unweit
26
1 Heimat
gelegenes Sägewerk verschlang / und die ganze Talschaft erhellte.« (NN 76) Da das Wertacher Sägewerk nie abgebrannt ist, hat man das Feuer als Erfindung Sebalds abgetan. Er bezog sich aber auf ein authentisches Vorkommnis, nämlich den um 1950 stattgefundenen Brand einer Sägemühle im Nachbarort Haslach. Als Kind schon, berichtet er in Nach der Natur, sei ihm daher von »früh auf die Vorstellung / von einer lautlosen Katastrophe, die sich / ohne ein Aufhebens vor dem Betrachter vollzieht« (NN 77), gekommen. Eine lautlose Katastrophe als Dauerzustand, die Ruinen als stumme Zeugen der Zerstörung. »Heute weiß ich«, so Sebald in Luftkrieg und Literatur, »daß damals, als ich auf dem Altan des Seefelderhauses in dem sogenannten Stubenwagen lag und hinaufblinzelte in den weißblauen Himmel, überall in Europa Rauchschwaden in der Luft hingen, über den Rückzugsschlachten im Osten und im Westen, über den Ruinen der deutschen Städte und über den Lagern, in denen man die Ungezählten verbrannte.« (LL 78) Ebenso in Luftkrieg und Literatur zitiert er einen vielsagenden Satz aus einer 1963 erschienenen Broschüre: »Viel hat uns der Krieg genommen, doch uns blieb, unberührt und blühend wie eh und je, unsere herrliche Heimatlandschaft.« (LL 78) Nein, beim erinnernden Rückblick auf die Heimat erscheint für Sebald die Idylle keineswegs mehr als unberührt, denn auch sie trägt die Spuren der Destruktion, welche der Faschismus in ganz Europa angerichtet hat: »Lese ich diesen Satz, so verschwimmen vor meinen Augen Bilder von Feldwegen, Flußauen und Bergwiesen mit den Bildern der Zerstörung, und es sind die letzteren, perverserweise, und nicht die ganz irreal gewordenen frühkindlichen Idyllen, die so etwas wie ein Heimatgefühl in mir heraufrufen, vielleicht weil sie die mächtigere, übergeordnete Wirklichkeit meiner ersten Lebensjahre repräsentieren.« (LL 78) Ruinen gab es in Wertach freilich keine. Sebald hat sie erst anderswo kennengelernt. »Meine ersten Eindrücke der großen
Die Heimat, zerstört
27
Zerstörung gehen ungefähr auf das Jahr 1949 zurück«, nämlich als er mit Vater und Schwester eine Reise nach Niederbayern unternommen hatte. An anderer Stelle datiert er seine erste Reise auf das »48er Jahr«, als er von Wertach »aus zu den Großeltern in Plattling, mit dem gerade aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrten Vater« gefahren sei. »Die Mutter hatte mir einen grünen Janker geschneidert und ein Rucksäckchen aus kariertem Stoff. Wir reisten, glaube ich, in einem Abteil dritter Klasse.« (CS 180) In München jedenfalls gab es eine mehrstündige Wartezeit auf den Anschlußzug. »Wir gingen vom Hauptbahnhof zum Marienplatz, und ich entsinne mich, daß diese ganze Strecke am Stachus vorbei durch Trümmergebirge führte und daß diese Schuttberge sehr hoch waren, jedenfalls aus der Perspektive eines kleinen Kindes – und daß weder mein Vater noch sonst jemand ein Wort darüber verloren hat. So habe ich das für eine naturgeschichtliche Gegebenheit größerer Städte gehalten. Das ist eine Vorstellung gewesen, die mir, da ich ansonsten bis zu meinem zehnten Lebensjahr kaum je in Städten war, lange geblieben ist. Ich hatte immer diese Vorstellung, Städte seien Orte, in denen es große Schuttberge gibt.« (G 177) Aber man mußte nicht nach München reisen, um die Auswirkungen des Kriegs zu sehen. Auch in den Allgäuer Kleinstädten hatten die Bombardierungen Spuren hinterlassen. So etwa in Sont hofen, wohin Sebald als Achtjähriger mit seinen Eltern zog. Die Alliierten hatten »den an sich vollkommen unbedeutenden Marktflecken« (LL 80) noch gegen Ende April 1945 angegriffen, wohl weil es dort Militärstützpunkte und eine der drei sogenannten Ordensburgen gab, auf denen das NS-Regime die Elite für die Zeit nach dem Endsieg heranzüchten wollte. An die hundert Zivilisten starben. Die Ruinengrundstücke dort standen noch bis in die sechziger Jahre hinein. Für das Kind aus dem Dorf war daher nichts anderes »so eindeutig mit dem Wort
28
1 Heimat
Stadt verbunden wie Schutthalden, Brandmauern und Fenster löcher, durch die man die leere Luft sehen konnte.« (AW 46) In Luftkrieg und Literatur beschreibt Sebald seine Erinnerung an ein bombardiertes Grundstück, auf dem einstmals eine Villa stand, von der aber nichts mehr übriggeblieben war als ein paar Bäume, der gußeiserne Gartenzaun und das Kellergeschoß. Es war, so Sebald, »in den fünfziger Jahren bereits völlig zugewachsen, und wir sind als Kinder oft nachmittagelang in dieser durch den Krieg mitten im Ort entstandenen Wildnis gewesen. Ich entsinne mich, daß es mir nie recht geheuer war, über die Treppe in die Kellerräume hinabzusteigen. Es roch dort faulig und feucht, und ich fürchtete immer, auf einen Tierkadaver zu stoßen oder auf eine Menschenleiche. Ein paar Jahre später ist auf dem Grundstück dann ein Selbstbedienungsladen eröffnet worden, in einem ebenerdigen, fensterlosen, scheußlichen Bau, und der einstmals schöne Garten der Villa verschwand endgültig unter einem geteerten Parkplatz. Das ist, auf den niedrigsten Nenner gebracht, das Hauptkapitel in der Geschichte der deutschen Nachkriegszeit.« (LL 82) So lief es, will Sebald hier nahelegen, nicht nur in metaphorischer Hinsicht. Auch die realen Leichen im Keller wurden zubetoniert, die Erinnerung an die grauenhaften Verbrechen der Nazizeit wie an die Leiden unschuldiger Zivilisten im bedingungslosen Bombenkrieg wurden verdrängt, um das neue Staatswesen zu errichten. Opfer waren erforderlich dazu. Opfer, wie der Philologe Walter Burkert nachgewiesen hat, die schon zu Urzeiten der menschlichen Gesellschaftsentwicklung gebracht werden mußten, um die Gemeinschaft zu stabilisieren in Zeiten von Bedrohung und Chaos.
MIT AMÉRY: HEIMAT ALS FLUCH Heimat ist das, was einen nicht mehr entläßt – egal wie weit man sich räumlich und geistig von ihr absetzt. Die Heimat hat Sebald
Mit Améry: Heimat als Fluch
29
nicht mehr losgelassen, zeitlebens. Als er im Jahr 1996 auf einem Ausflugsdampfer auf die Île de Saint-Pierre übersetzt, befinden sich darauf »auch die buntkostümierten Mitglieder eines Männergesangsvereins«, die frohgemut ihre Lieder »anstimmten, einzig und allein, wie es mir schien, um mich mit den seltsam gepreßten, kehlköpfigen Klängen, die sie miteinander hervorbrachten, daran zu erinnern, wie weit ich inzwischen vom Ort meiner Herkunft entfernt war.« (LH 46/47) Bald darauf ist es eine unverhofft auf ihn gekommene Postkarte, die eine zehnköpfige Gruppe von Oberstdorfer Trachtlern in ihrer Sebald wohlvertrauten alpenländischen Montur aus Gamsbärten, Hahnenfedern, Hirschgrandeln, Silbertalern und Edelweißranken zeigt, die ihn – wie ein Fluch – auf unheimliche W eise an seine Heimat erinnert. In seiner »vaterländischen Vorgeschichte«, so Sebald, habe »ja das Trachtlerische keine unbedeutende Rolle gespielt«, weshalb er befürchtet, daß er ihr »nie würde entkommen können.« (CS 226) Was man verdrängen möchte, verfolgt einen noch bis in die hinterste Ecke, weshalb es zur unheimlichen Qualität dieser Karte gehört, daß er uns zwei Versionen ihrer Provenienz auftischt. In seiner Rede zur Eröffnung der Münchner Opernfestspiele 2001 behauptet Sebald, sie bei einem Straßenhändler im Ostlondoner Stadtteil Bethnal Green erworben zu haben, während er in den nachgelassenen Aufzeichnungen aus Korsika angibt, die fragliche Postkarte sei »mir unlängst in einem Trödlerladen in Norwich zwischen die Finger geraten, ganz als hätten die Trachtler dort auf mich gelauert seit Jahr & Tag.« (KP 177) Der leichte Zug in Paranoische gehört zur Unheimlichkeit, mit welcher die Heimat einem immer und überall auf den Versen ist. Am Flughafen von Calvi auf Korsika etwa findet Sebald sich zu seinem großen Schrecken wieder unter lauter Deutschen, »Strandurlaubern & Bergwanderern, die, wie ich mit Schrecken feststellte, fast ausnahmslos in meiner heimatlichen Mundart redeten.« (KP 177)
30
1 Heimat
Gerade die vertraute Mundart ist es, die Sebald so peinlich berührt. In ihr verkörpert sich nicht nur seine niedere Herkunft (samt der Emanzipation davon), sondern desgleichen die in einen anderen Sprachraum führende Auswanderung. »Schwaben, Franken und Bayern hörte ich die unsäglichsten Dinge untereinander reden, und waren mir diese, auf das ungenierteste sich breitmachenden Dialekte schon zuwider, so war es mir geradezu eine Pein, die lauthals vorgebrachten Meinungen und witzigen Aussprüche einer Gruppe junger Männer aus meiner unmittelbaren Heimat mit anhören zu müssen.« (SG 107) Aber warum lösen diese Allgäuer mit ihrem dummen Gerede einen solchen Unwillen aus? Als kosmopolitischer Intellektueller könnte Sebald durchaus mit Genugtuung auf sie herabblicken, hatte er es doch erheblich weiter gebracht als die in ihren provinziellen Zusammenhängen gefangen gebliebenen Landsleute. Stattdessen aber empfindet er eine Pein, für die es keine klar erkennbaren Gründe gibt. Außer vielleicht die Vermutung, daß diese Männer ihn daran erinnern, was aus ihm hätte werden können, hätte er nicht den Absprung aus der Heimat gewagt. Und geschafft. Heimat als Fluch. Ein Kennzeichen für das Verfluchtsein ist die Insistenz, mit der man, gegen jede Wahrscheinlichkeit, an das gemahnt wird, was man loswerden will. An einer anderen Stelle legt Sebald offen, warum ihm die Konfrontation mit dem heimatlichen Dialekt, zumal an weit vom Allgäu entfernten Orten, so überaus unangenehm ist – er fühlt sich schuldig, die Heimat durch seine Auswanderung gewissermaßen verraten zu haben. So notiert er einmal: »Immer wieder begegnen mir, wenn ich unterwegs bin, Reisegruppen aus dem Allgäu. In London ist mir das mehrmals bereits passiert, vor dem Parlamentsgebäude, auf der Mall & in der U-Bahn, & auch in Paris & in Pisa & Potsdam, & immer bin ich dann, obgleich das ja keineswegs verwunderlich ist, eine zeitlang auf das unangenehmste berührt & ganz aus meiner Fassung gebracht, etwa so, habe ich mir öfters dabei schon
Mit Améry: Heimat als Fluch
31
gedacht, wie ein Landesverräter, der plötzlich fürchten muß, daß man ihm auf die Schliche gekommen ist.« (KP 177) Solche unheimlichen Vorkommnisse schlagen die bei Sebald so entscheidende Brücke zu dem, was man je nach Präferenz entweder Exil, Expatriation oder Wahlheimat nennen könnte. Seine Virulenz bezieht der Begriff der Heimat bei Sebald gerade daraus, daß es für ihn aus der Heimat geradewegs in ihr Gegenteil geht, nämlich die Fremde. In eine Form des Fremd-Seins mithin, in ein peinigendes Aushäusigsein. Der irre Schmerz der Entfernung. Eben immer ›weit von wo‹ zu sein und nur eine »provisorische Existenz« führen zu können, so wie etwa der Kafka’sche Jäger Gracchus, der unerlöst durch Schwindel. Gefühle. spukt. Oder Austerlitz, der immer im Bewußtsein lebt, eine Art von Doppelgänger zu besitzen und daher nie ›ganz‹ sein zu können. Wie es kommt und was es heißt, die Heimat endgültig verloren zu haben, das zeigt Sebald in seinen literarischen Texten, in denen es oft, aber keineswegs immer um jüdische Verfolgungs- und Exilschicksale geht. Nicht bleiben zu können, wo man herkommt und sich zuhause fühlt, das hat Sebald als eine Art Signatur der Moderne, als ein Kennzeichen des zwanzigsten Jahrhunderts erkannt: Ökonomie und Politik, Armut und Haß führen zu freiwilligem wie gewaltsamem Verlust der Heimat. Bevor er darüber literarisch geschrieben hat, ist er am Beispiel der österreichischen Literatur als feinfühliger Leser dem Komplex der Heimat nachgegangen in den Essays, die 1991 unter dem Titel Unheimliche Heimat erschienen sind. Er zeigt, wie unter anderem Franz Innerhofer oder Josef Winkler, aber ebenso Thomas Bernhard und Peter Handke die Heimat beschrieben haben: als einen Ort des Schreckens und der Beklemmung. Nach der Flucht aus den Fesseln ihrer Herkunft jedoch ergeht es ihnen keineswegs besser. Die Heimat bleibt unseliger Fluch, egal wohin es einen verschlägt. Auf die berühmte Formel »Das Fette,
32
1 Heimat
an dem ich würge: Österreich« hat Handke dies gebracht. Das gilt insbesondere dann, wie Sebald beispielhaft an Jean Améry zeigt, wenn die Heimat sich als der Ort erweist, an dem jene Menschen leben, die einen ermorden wollen. »Améry definiert Heimat als das, was man umso weniger braucht, als man es hat«, so Sebald in seinem dem österreichischen Exilautor gewidmeten Essay Verlorenes Land, »was wiederum heißt, daß alle positiven Verlautbarungen zu diesem Thema fast von vornherein verdächtig sind und daß man das, was Heimat einem bedeutet oder hätte bedeuten können, nur ex negativo, im Exil erfahren kann.« (UH 134) Diese Haltung Amérys teilte Sebald. Im Vorwort des Essaybandes hält er fest: »Der Begriff steht, wie das nicht selten der Fall ist, in reziprokem Verhältnis zu dem, worauf er sich bezieht. Je mehr von Heimat die Rede ist, desto weniger gibt es sie.« (UH 12) Schon gegen Ende des neunzehnten, spätestens jedoch seit der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts ist so etwas wie Heimat zur Unmöglichkeit geworden. Nicht nur aufgrund dessen, was der Faschismus dem Begriff der Heimat angetan hat. Sebald bezeichnet den Naziverfolgten Améry als einen »gelernten Heimatlosen«, und das darf man ruhig, trotz aller kategorialer Unterschiede zwischen den beiden, auf Sebald selber beziehen. Überhaupt ist Améry eine Identifikationsfigur. In ihm, in seinen Texten, fand Sebald eine Erfahrung vor, die eine Resonanz aufwies mit seiner Erfahrung als freiwillig Ausgewanderter. Wohl deshalb schreckte Sebald nicht davor zurück, seine Biografie in Austerlitz auf problematische Weise mit Améry zu verknüpfen, indem sein Erzähler die Folterkammern von Breendonk betritt. Den Ort also, an dem Améry jene unbeschreibliche Tortur erlitt, die er gleichwohl später auf das Genaueste und Einsichtigste beschrieb. Kaum begibt sich der Erzähler an den Ort der Folter, »hob sich aus der Untiefe das Bild unseres Waschhauses in W. empor und zugleich, hervorgerufen von dem eisernen Haken, der an einem
Mit Améry: Heimat als Fluch
33
Strick von der Decke hing, das der Metzgerei, an der ich immer vorbeimußte auf dem Weg in die Schule und wo man am Mittag oft den Benedikt sah in einem Gummischurz, wie er die Kacheln abspritze mit einem dicken Schlauch.« (A 41) Folterkammer und Fleischhauerei, gedanklich werden sie einander angenähert über die Gewalt und das Blut, das in ihnen fließt. Daß die Qualen von Améry in Breendonk nicht einmal ansatzweise vergleichbar sind mit den kindlichen Körperreinigungsritualen, die Sebalds Vater dem kleinen Winfried aufnötigte durch seine hygienischen Übergriffe, versteht sich von selbst. Gleichwohl stellt Sebald die Verbindung her: »Aber ich weiß noch, daß mir damals in der Kasematte von Breendonk ein ekelhafter Schmierseifengeruch in die Nase stieg, daß dieser Geruch sich, an einer irren Stelle in meinem Kopf, mit dem mir immer zuwider gewesenen und vom Vater mit Vorliebe gebrauchten Wort ›Wurzelbürste‹ verband, daß ein schwarzes Gestrichel mir vor Augen zu zittern begann und ich gezwungen war, mit der Stirn mich anzulehnen an die von bläulichen Flecken unterlaufene, griesige und, wie mir vorkam, von kalten Schweißperlen überzogene Wand.« (A 41) Man muß, so denke ich, den autobiografischen Brückenschlag, den Sebald zu Amérys Foltererfahrungen herstellt, stehenlassen und aushalten. Auf jeden Fall stellt die Verknüpfung eine Provokation dar. Mir erscheint die Verbindungsziehung weder komplett ungehörig noch komplett unproblematisch. Es mag mehr dahinterstehen, als Sebald wagte niederzuschreiben. Daß er ausgerechnet an dieser Stelle auf traumatisch empfundene Kindheitserinnerungen zurückkommt, weist die Heimat erneut als einen Hort von Schrecken und Angst aus. Und er hat recht: »Genau kann niemand erklären, was in uns geschieht, wenn die Türe aufgerissen wird, hinter der die Schrecken der Kindheit verborgen sind.« (A 41) Jean Améry ist mit Sebald zudem auf eine wesentliche Art verbunden, die bisher nicht genügend gewürdigt wird. Ich meine Sebalds bemerkenswerte Renitenz, seinen querköpfigen Wider-
34
1 Heimat
spruchs- und Angriffsgeist gegen die Nachkriegsliteratur wie die Disziplin der Germanistik, seinen Hang zur Polemik. Bei Améry findet er dito eine konfrontative, ressentimentgeladene Haltung vor, die er gleichwohl nicht auf dessen traumatische Erfahrungen von Verfolgung und Folter zurückführt. Vielmehr waren, glaubt Sebald, das Exil und Amérys Bewußtsein der Heimatlosigkeit dafür verantwortlich. Dieses nämlich »steigerte er noch in der Extraterritorialität einer radikalen intellektuellen Position. Amérys moralische Kompromißlosigkeit, sein Festhalten an seinen begründeten Ressentiments, hatte etwas mit seinem Stolz und dieser etwas mit dem Willen zum Widerstand zu tun.« (UH 142) All das dürfte dem in der Extraterritorialität der britischen Insel an seinen Polemiken schreibenden Sebald nicht unvertraut gewesen sein. Wie Améry war er ein radikaler Intellektueller, dessen Eigensinn darin bestand, mit unablässiger Widerspenstigkeit als Angreifer und Ankläger aufzutreten. »Nicht die Beilegung des Konflikts steht also zur Debatte, sondern seine Eröffnung. Der Stachel des Ressentiments, den Améry in seiner Polemik an uns weitergibt, verlangt die Anerkennung des Rechts auf Ressentiment.« (CS 161) Und dieses Recht beanspruchte Sebald ebenfalls für sich.
ENGLAND ALS PROVISORIUM »Die Heimat ist das Kindheits- und Jugendland«, schreibt Améry in Jenseits von Schuld und Sühne. »Wer sie verloren hat, bleibt ein Verlorener, und habe er auch gelernt, in der Fremde nicht mehr wie betrunken umherzutaumeln.« (CS 164) Sebald zitiert diese Sätze nicht zuletzt deshalb, weil sie seine eigene Erfahrung betreffen. Zwar gelang es ihm in England Fuß zu fassen, doch anders etwa als bei seinem engen Freund, dem Lyriker und Übersetzer Michael Hamburger, wurde ihm die Insel nicht zu einer neuen Heimat.
England als Provisorium
35
In seiner Antrittsrede vor der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung – die ihm den verdienten Büchner-Preis verweigerte, weil sich immer jemand fand im Gremium, der sich an seinen literaturkritischen Schriften störte – erklärte Sebald, sich in England nur »gastweise zuhause« zu fühlen, denn er schwanke ständig »zwischen Gefühlen der Vertrautheit und der Dislokation.« (CS 250) Ebenso in Deutschland: Dort sei er gleichfalls nicht mehr heimisch. »Einerseits gehöre ich dazu, durch die Sprache, durch die Herkunft, durch den Paß, durch die Tatsache, daß ich in diesem Land gearbeitet habe, aber andererseits laufe ich herum als ein irgendwie Hereingeschneiter.« (G 91) Es ist dies die Position, die man treffend mit dem Idiom ›zwischen zwei Stühlen sitzend‹ bezeichnet: zwischen Deutschland und England, zwischen Germanistik und Literatur, zwischen Vergötterung und Ablehnung. Und natürlich zwischen den beiden Sprachen: Anders als Michael Hamburger mit seiner Frau, der Lyrikerin Anne Beresford, sprach Sebald zuhause nicht Englisch, sondern unterhielt sich in der Muttersprache mit seiner Frau und Tochter. Ebenso blieb er starrköpfig beim Deutschen als Sprache seiner Literatur. Es gehört zu den Ironien, die das gängige Bild bestimmen, das von Sebald gezeichnet wird, daß er in seiner letzten Publikation, die wenige Tage vor seinem Tod erschien und somit sein literarisches Vermächtnis darstellt, tatsächlich damit begonnen hatte, auf Englisch zu schreiben, oder vielmehr: zu dichten. Die im Gedichtband For Years Now versammelten Mikropoeme sind zudem so etwas wie der maximale Gegensatz zum ganz und gar nicht perfekten Roman Austerlitz, in dessen Schatten sie stehen: enigmatische Wortballungen voller intertextueller Anspielungen und poetischer Verdichtungen. Das dezidierte Gegenmodell zum großen Romanwerk und ein radikaler Neuansatz. Seine Entscheidung, anders als etwa Hamburger, Nabokov oder Conrad nicht ins Englische zu wechseln, begründete Sebald einmal wie folgt: »I don’t in the least feel at home in it. I use it but it
36
1 Heimat
sounds quite alien to me.« (CB 148) Wieder also der ursächliche Zusammenhang von Sprache und Heimat – wirklich heimisch fühlen kann man sich dort, wo nicht die eigene Sprache gesprochen wird, nur schwerlich. Typisch für Sebald jedoch ebenso, daß er gegenüber dem englischen Gesprächspartner die Fremdheitsgefühle (über)betont. Ebenso will er sich abgrenzen von jenen assimilierungswütigen Deutschen in Großbritannien, die sich mit Leib und Seele, Marmite und Ale, Barbour-Jacke und Oxford Brogues englischen Klischees angleichen. Gegenüber Uwe Pralle äußert sich Sebald in einem posthum veröffentlichten Interview differenzierter, was England betrifft. Er habe sich »dort zwar nicht zuhause gefühlt, aber wohltoleriert als Gast. Dieser Zustand hat sich bis heute nicht geändert. Ich betrachte mich immer noch als Gast in diesem Land und bilde mir nicht ein, daß ich jetzt sozusagen naturalisiert oder anständig assimiliert wäre. In dieser Art von provisorischer Existenz fühle ich mich einigermaßen gut aufgehoben.« (G 253)
FREMDE HEIMAT DEUTSCHLAND Sebalds Heimatland kommt in Interviews wie in seinen erzählerischen Texten nie gut weg. So kritisiert er etwa die Homogenität des Landes, in dem es keine Zonen einer Ungleichzeitigkeit der Zeit mehr gebe wie noch in der Provinz seiner Kindheit. »Es gibt keine Industriebrachen wie in England, nichts Darniederliegendes, keine Überreste von früher. Das Land hat kein Gefälle mehr. Das Ergebnis ist deprimierend. Alle deutschen Städte sind gleich, man kann sich nach nichts orientieren. Oldenburg, Braunschweig, Paderborn – alles gleich. Trostlos.« (G 83) Diese Vereinheitlichungstendenz führte Sebald nicht nur auf die Technisierung zurück, sondern ebenso darauf, daß Deutsch-
Fremde Heimat Deutschland
37
land »als Sozialgefüge durch die Faschismuserfahrung total homogenisiert worden ist.« (G 91) Gerade diese Homogenisierung der Kulturlandschaft und der Ortschaften sticht ihm negativ ins Auge. Seiner Romanfigur legte er diese Suada in den Mund: »Wohin ich auch blickte, sagte Austerlitz, überall sah ich saubere Ortschaften und Dörfer, aufgeräumte Fabrik- und Bauhöfe, liebevoll gehegte Gärten, unter den Vordächern ordentlich aufgeschichtetes Brennholz, gleichmäßig geteerte Fuhrwege quer durch die Wiesengründe, Straßen, auf denen bunte Autos mit großer Geschwindigkeit dahinschnurrten, wohlgenutzte Waldparzellen, regulierte Bachläufe und neue Bahnhofsgebäude, vor die offenbar kein Vorstand mehr hinaustreten mußte.« (A 320) Die Ausbrüche in den literarischen Texten gegen das »bis in den letzten Winkel aufgeräumte und begradigte deutsche Land« mit den gemäß amtlicher »Bebauungspläne Jahr für Jahr weiter sich ausdehnenden Kolonien der Reihen- und Einfamilienhäuser hinter ihren Jägerzäunen und Ligusterhecken« (SG 277) umfaßte also mehr als nur eine Kritik der eintönigen Flurgestaltung. Vielmehr verstand Sebald das äußere Bild, das Deutschland darbot, als Symptom eines inneren, sozialpsychologischen Defekts im Gefolge des Faschismus. Was wiederum Folgen sogar für die Physiognomie der Einwohner hat: Deutschland, so urteilt wiederum die Figur des Max Aurach in der gleichnamigen Erzählung, »erscheint mir als ein zurückgebliebenes, zerstörtes, extraterritoriales Land, bevölkert von Menschen, deren Gesichter wunderschön sowohl als furchtbar verbacken sind.« (AW 267) In Schwindel. Gefühle. läßt Sebald seinen Erzähler sagen: »Tatsächlich wünschte ich mir in diesen schlaflosen Stunden nichts sehnlicher, als einer anderen, oder besser noch, gar keiner Nation anzugehören.« (SG 107) Aber dergleichen muß Wunschdenken bleiben. Die einzig praktikable Lösung vielleicht ist zu akzeptieren, daß die Heimat verloren ist und wir sie uns allenfalls mit den Mitteln der Kunst wieder-
38
1 Heimat
herstellen können. Einen gehörigen Eindruck auf Sebald gemacht hat daher das Heimat-Projekt von Edgar Reitz, über das wir uns lange unterhalten haben. 1992 war Die zweite Heimat – Chronik einer Jugend gezeigt worden, die in München spielte, von wo ich im Herbst des Jahres nach Norwich gekommen war. Da dieser Teil des Projekts zugleich im Studentenmilieu der sechziger Jahre spielte, konnte sich Sebald mit dem Gezeigten identifizieren und seine Generation darin in vielem wiedererkennen. Rückblickend frage ich mich, ob dieser filmische Blick auf Heimat, oszillierend zwischen Dokumentation und Fiktion, teilweise ein Modell abgegeben haben mag für das nie vollendete Weltkriegs-Projekt, an dem Sebald zum Zeitpunkt seines Todes gearbeitet hat. Doch das ist alles Spekulation. Und mehr zum Weltkriegs-Projekt an späterer Stelle. Zumindest angeschnitten sei hier noch abschließend, daß sich der Heimat-Begriff für Sebald keineswegs auf die regionale Herkunft und die gesellschaftliche Ebene beschränkte. Er weitete ihn auch stammesgeschichtlich aus, indem er die Natur als die eigentliche Heimat der Gattung Mensch betrachtete. Diese Heimat freilich haben wir durch den Zivilisationsprozeß längst schon verloren, in einem Vorgriff quasi auf die Diskreditierung alles Heimatlichen im zwanzigsten Jahrhundert. Beide Zerstörungsprozesse betrachtete Sebald als miteinander verknüpft. Eigentlich müßten wir alles daran setzen, »das zu erretten, was wir, über alles, als unsere wahre Heimat begreifen« (UH 16), unsere natürliche Umwelt also. Doch die Spezies Mensch, so Sebald, scheint wie besessen von einer vor nichts Halt machenden Zerstörungssucht, die im Grunde schon durch eine naturgeschichtliche Unausweichlichkeit gekennzeichnet ist. Wir alle sind, insofern und in doppelter Hinsicht, Heimatvertriebene.
Ausblick, erhöht: Ein Hotel in der Schweiz
39
AUSBLICK, ERHÖHT: EIN HOTEL IN DER SCHWEIZ Über den von ihm hochgeschätzten Nabokov schreibt Sebald, dieser habe »seit dem Zeitpunkt seiner Exilierung nirgendwo auf der Erde mehr einen richtigen Wohnsitz gehabt, weder während der englischen noch während der Berliner Jahre, noch auch in Ithaca, wo er bekanntlich nur zur Miete wohnte und in einem fort umgezogen ist.« Seine letzte Residenz in Montreux, »wo er von seinem Logenplatz im obersten Stock des Palace Hotels über jedes irdische Hindernis hinweg hineinsehen konnte in die Wolken und die über dem See untergehende Sonne, ist ihm sicher die angemessenste und liebste Behausung gewesen.« (CS 191) Dieses Idealbild einer in mancher Hinsicht abgehobenen Schriftstellerexistenz hat sich Sebald zu eigen gemacht. Hotels als exemplarische Orte des Transitorischen waren schon zu Lebzeiten seine liebsten Fluchtorte. Gerne zog er sich beispielsweise ins etwas heruntergekommene Victoria Inn Hotel nahe dem Landsitz Holkham Hall zurück. Zum Alleinsein, Nachdenken und Schreiben. Aber das war stets temporär. Sich möglichst vorzeitig zur Ruhe zu setzen in einem Schweizer Hotel war eine Art Phantasma des Ausstiegs aus allen Zwängen, das er in Interviews, aber auch privaten Gesprächen immer mit einer Mischung aus leichter Resignation und utopischem Wunschdenken ansprach. So auch in einem Interview für den Guardian, als man ihn 2001 fragte, inwieweit er sich in England zuhause fühle. Sebald sagte: »›The longer I’ve stayed here, the less I feel at home. In Germany, they think I’m a native, but I feel at least as distant there. My ideal station‹, he half smiles, ›is possibly a hotel in Switzerland.‹« Sich diesen Wunschtraum zu erfüllen aber war Sebald nicht vergönnt. Es wäre ein Ort jenseits jeder Heimat gewesen.
2 Großvater
D
rei Jahre hat man Sebald als Kind damit gequält, das Zitherspielen erlernen zu müssen. »Das Zitherspielen ist für mich eine schlimme Plage gewesen und die Zither selbst eine Art Folterbank, an der man sich vergebens verrenkte und die einem die Finger krumm werden ließ, von der Lachhaftigkeit der für die Zither geschriebenen Stückchen ganz zu schweigen.« (CS 227) Nur einmal hat er das »verhaßte Instrument freiwillig aus seinem Kasten genommen, als der von mir über alles geliebte Großvater während des ersten Föhnsturms nach dem sibirischen Winter sechsundfünfzig im Sterben lag und ich ihm, der schon halb hin übergedämmert war, die paar Sachen vorspielte, die mir nicht von Grund auf zuwider gewesen sind, zuletzt, wie ich noch weiß, einen langsamen Ländler in C-Dur, der mir beim Spielen bereits, so will es mir jetzt in der Erinnerung erscheinen, so zeitlupenhaft zerdehnt vorgekommen ist, als dürfe er nie ein Ende nehmen.« (CS 227/28) Musik als Protest gegen die Ungerechtigkeit des Todes. Als letzter Dienst am Großvater, in der schrecklichen Grauzone zwischen Leben und Tod. Verzweifelter Versuch, das Unaufhaltsame aufzuhalten. Vergebens, natürlich. Das »innerste Geheimnis der Musik«, so vermutet Sebald in Anschluß an eine These von Freud, sei es, daß »wir Musik machen, um uns zur Wehr zu setzen gegen die Überflutung durch die Schrecken der Wirklichkeit.« (CS 228) So wie im Moment des Sterbens von Josef Egelhofer, der das Kind
42
2 Großvater
überforderte und fürs Leben zeichnete. »My grandfather’s death when I was 12 wasn’t something I ever quite got over. It brought an early awareness of mortality and that the other side of life is something horrendously empty«, erklärte Sebald – kurz vorm eigenen Tod – dem Guardian. Der Weggang des Großvaters ist der archimedische Punkt im Leben des W.G. Sebald. Das schreckliche Erlebnis, von dem alles sich herschreibt. Der Grund, warum sich zeitlebens ein Schatten über sein Leben legte. Der »von mir nie verwundene Tod« (LH 137) des Großvaters markiert die schreckliche Urszene Sebalds und führte zu jener, wie er glaubte, ihm »wahrscheinlich nicht umsonst aufgebürdeten Trauerlast.« (CS 35) (Daß die falschen Verehrer und Verklärer Sebalds den Holocaust als sein eigentliches Trauma ausmachten, ist schlichtweg falsch.)
SCHREIBEN ALS TOTENBESCHWÖRUNG Unter den deutschsprachigen Mikrogedichten, die zwei Jahre nach Sebalds Tod im Bildband Unerzählt erschienen und mit Radierungen seines Freundes Jan Peter Tripp kombiniert wurden, fand sich auch dieses diminutive Poem: Das Schreibpapier riecht wie die Hobelspäne im Sarg (U 63)
Auf der gegenüberliegenden Seite ist eine Radierung der Augenpartie von Jasper Johns zu sehen. Eine merkwürdige, verquere Paarung. Der amerikanische Künstler und Wegbereiter der Pop-Art
Schreiben als Totenbeschwörung
43
besitzt weder einen persönlichen noch künstlerischen Bezug zu Sebald und seinem Schreiben. Zu verknüpfen wären Maler und Schriftsteller allenfalls über ihr Interesse an Landkarten. (Oder man erkennt einfach an, daß das Prinzip, mit dem Tripp in Unerzählt die Texte Sebalds mit seinen Radierungen paart, meistenteils das der völligen Beliebigkeit ist.) Der wahre Bezugspunkt des Gedichts wird erst erkennbar, liest man das englischsprachige Pendant aus For Years Now, dem ohnehin gelungeneren Band: The smell of my writing paper puts me in mind of the woodshavings in my grandfather’s coffin (FYN 42)
Offenkundig vermochte Sebald den geheimen Glutkern erst in der Fremdsprache offen auszusprechen. Wie er überhaupt lange brauchte, um über das Trauma seines Verlustes sprechen. Erst in seinen späteren Jahren erzählt er öffentlich, etwa bei Reden, vom geliebten Großvater und kommt in seinen essayistischen Schriften wiederholt auf den nie überwundenen Tod zu sprechen. Ebenso ist er nun in Interviews bereit, seine literarische Obsession mit dem Tod auf die schockartige Erfahrung des Todes zurückzuführen: »My interest in the departed, which has been fairly constant, comes from that moment of losing someone you couldn’t really afford to lose.« (EM 171) Eine psychosomatische Reaktion stellte sich bald nach dem Weggang des Großvaters ein, nämlich ein hartnäckiger Hautausschlag, an dem Sebald bis in seine Studentenzeit laborierte.
44
2 Großvater
Es gehört zu den nie ganz begreiflichen seelischen Mechanismen, daß wir auf Verlusterfahrungen mit Schuldgefühlen reagieren. Ganz so wie es beim überwältigten Enkel der Fall war: »Ich entsinne mich sehr wohl, wie ich als Kind zum ersten Mal an einem offenen Sarg gestanden bin mit dem dumpfen Gefühl in der Brust, daß dem Großvater, der da auf den Hobelspänen lag, ein schandbares, von keinem von uns Überlebenden mehr gutzumachendes Unrecht geschehen sei.« (CS 35) Dieses englische Gedicht macht klar: Sebalds Schreiben ist aufs engste zurückgebunden an den Tod Josef Egelhofers. Ein Foto von ihm stand immer auf dem Schreibtisch in seinem Büro. Schreiben war memoria, Erinnerungsdienst an den Toten. Trauerritual und Totenklage. Heiner Müller hat seine Poetik auf den einfachen Nenner gebracht: Drama heißt Dialog mit den Toten. Doch diese Formel stellt zugleich eine gewaltige Forderung an den Dramatiker, nämlich sich nicht nur den individuellen Verlusterfahrungen zu stellen, sondern ebenso künstlerische Verantwortung zu übernehmen für alle Toten, die der Gewaltgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts zum Opfer gefallen sind. Und in diesem doppelten Sinne erinnert sich Sebald an die prägende, erste Begegnung mit dem Tod: Das schandbare, von keinem Überlebenden wieder gutzumachende Unrecht gilt nicht nur den irrationalen Schuldgefühlen, einen geliebten Menschen überlebt zu haben, das Sebald dann anhand solcher (semi)authentischer Erzählfiguren wie Paul Bereyter oder Ambros Adelwarth literarisch gestalten wird. Sebald hat auch die spätere, als Jugendlicher erfolgte Konfrontation mit den unsäglichen Verbrechen des Nazi-Regimes – nicht zuletzt aufgrund der unvorbereiteten Weise, wie sie sich vollzog – als schockierende Erfahrung erlebt: »Irgendwann im Geschichtsunterricht, so mit siebzehn oder achtzehn, wurden einem diese Leichen auf die Schulbank geschoben. Der englische Bergen-Bel-
Schreiben als Totenbeschwörung
45
sen-Film wurde uns gezeigt – ohne Kommentar, als moralische Pflichtübung.« (G 82) Eine Vermutung drängt sich auf: Könnte die verstörende Konfrontation mit dem Holocaust als Jugendlicher vielleicht das konstituieren, was man eine ›Deckerinnerung‹ an den niemals zu bewältigenden Schmerz über den Tod des Großvaters nennen würde? Daß also die Auseinandersetzung mit den Schrecken des Holocaust, der zweiten Traumatisierung, teilweise ein Weg war, sich mit dem viel zu starken, existentiellen Schmerz über den Verlust von Egelhofer als erster Traumatisierung hinwegzuhelfen? Die literarische Trauerarbeit, die Sebald in der Tat konsequent geleistet hat und für die er sehr zu Recht von seiner Leserschaft wie der akademischen Forschung bewundert und gerühmt wurde, geht – so bin ich überzeugt – nicht zurück auf Auschwitz, sondern auf jenen vierzehnten April 1956, an dem Egelhofer im offenen Sarg auf jenen Hobelspänen lag, deren an Schreibpapier erinnernder Geruch Sebald sein Leben lang verfolgt hat. In einem im Januar 2001 geführten öffentlichen Gespräch an der University of East Anglia in Norwich, also jener Universität, an der Sebald seit 1970 arbeitete, sprach er mit seinem Kollegen Chris Bigsby über die Simultanität seiner glücklichen, sorglosen Existenz als Kleinkind und der grauenhaften, genozidalen Vorgänge in Europa, die ihm ziemlich unbegreiflich erschien. »I know now that these things cast a very long shadow over my life. While I don’t feel any responsibility, I do feel a sense of shame.« (CB 144) Der letzte Satz ist klar genug, was Sebalds Haltung zu seiner Schuld an den Verbrechen der Nationalsozialisten betrifft. Ebenso präzise benennt der Satz genau jene Konstellation, die er am Totenbett des Großvaters empfand: schandhafte Schuld über den Tod, für den er doch keinerlei Verantwortung trug. An dem er sich jedoch zeitlebens abarbeitete.
46
2 Großvater
JOSEF EGELHOFER, EINE VITA Wer war Josef Egelhofer? Die deutsche Germanistik verkennt unverändert seine zentrale Rolle für das Verständnis von Sebalds literarischen Schriften, nicht zuletzt, weil biografische Forschung verpönt ist in einem intellektuellen Umfeld, in dem man lieber wechselnden Theoriemoden hinterherläuft anstatt faktische Grundlagen zu sichern. Josef Egelhofer wurde 1872 in Binnroth in Schwaben in eine Kleinbauernfamilie geboren. Wie von Sebald in Nach der Natur beschrieben, heiratete er seine Frau Theresia im Jahr 1905. Zusammen wohnten sie in Klosterlechfeld, wo er als Gendarm arbeitete. Als Egelhofer 1912 eine Anstellung als Dorfpolizist im rund neunzig Kilometer südlich gelegenen Wertach fand, zog er mit seiner Frau in das Dorf. Fotos zeigen einen großgewachsenen, hageren Mann, der fesch aussieht in seiner Uniform. Der Enkel erinnerte ihn als einen Leptosomen mit Schmiedepranken; wenn der Großvater damit zupackte, ging nichts mehr. Dies war wichtig in seinem Beruf, mußte er doch mit Autorität für Ordnung sorgen, vornehmlich indem er die Papiere der Landstreicher kontrollierte oder die betrunkenen Bauern von Schlägereien abhielt. Seine Haupttätigkeit war das Vazieren – umhergehen und Präsenz zeigen im Dorf. Zusammen mit Bürgermeister, Pfarrer und Lehrer gehörte Egelhofer zur Gruppe von Personen, die geachtet wurden, weil sie eine wichtige soziale Rolle innehatten. Seinen Beruf übte er bis zur Pensionierung aus. Er schien ihn zu schätzen. In Abwesenheit von Sebalds Vater, der zuerst ein Jahr im Krieg kämpfte, dann Kriegsgefangener war und später einige Jahre als Pendler arbeitete, kümmerte sich Egelhofer in vielerlei Hinsicht um den kleinen Winfried. So erlernte er das Lesen noch vor der Schule, indem sein Großvater ihm immer wieder dieselben Geschichten aus Bauernkalendern vorlas, und zwar so lange, bis
Josef Egelhofer, eine Vita
47
das Kind sie auswendig kannte, so daß es sie nun auch selber lesen konnte. Die volkstümlichen Kalendergeschichten waren daher Sebalds erste Schritte in die Welt der Literatur. Egelhofer gab auch als Pensionist seine regelmäßigen, stundenlangen Spaziergänge nicht auf – und nahm seine zwei Enkel, Sebald und seine ältere Schwester Gertrud, dabei mit. Diese Wanderungen über Feld und Wiesen waren zugleich naturkundliche Exkursionen: Egelhofer zeigte dem Enkel die Vielfalt der Natur und brachte ihm die Namen von heimischen Pflanzen und Tieren bei. Ebenso klärte er die Kinder über die Heilwirkung von Kräutern und sonstige pflanzliche Heilbehandlungen auf. Diese Einführung in die Mysterien der Natur war für Sebald eine lebenslang prägende Lehre. Gemeinsam sammelten Enkel und Großvater die entsprechenden Kräuter und trockneten und bewahrten sie in beschrifteten Gläsern in der Küche auf. Gemäß der in Egelhofers Rezeptbuch notierten Anleitungen wurden dann die in Krankheitsfällen benötigten Medizinen hergestellt. Das hatte natürlich nicht unbedingt mit einem Glauben an alternative Medizin zu tun, sondern war vielmehr eine Notwendigkeit angesichts mangelnder medizinischer Versorgung auf dem Dorf. Auf diese Weise wurden über den Großvater ein Denksystem und ein Wissen an Sebald weitergetragen, das zwar vorwissenschaftlich war, zugleich aber auf empirischer Beobachtung und Erprobung beruhte. Dasselbe gilt für die meteorologische Kunst, das Wetter vorherzusagen, die Sebald von Egelhofer erlernte. Diese Fertigkeit betraf sowohl die Beobachtung atmosphärischer Veränderungen wie die Kenntnis der sogenannten Bauernregeln, also gereimter Sprüche, die einen kausalen Zusammenhang herstellen zwischen aktuellen Wetterphänomenen und späteren Folgen für die Landwirtschaft. Sind die Hundstage heiß, bleibt’s im Winter lange weiß. An solche Bauernweisheiten glaubte auch mein slowenischer Großvater noch. Wir bemühen heute lieber die Wetter-App, um meteorolo-
48
2 Großvater
gische Auskünfte zu gewinnen. Sebald hingegen lebte noch in einer Schwellenzeit: Egelhofer führte ihn ein in über Jahrhunderte von Generation zu Generation weitergegebenes Volkswissen, das im zwanzigsten Jahrhundert entwertet und disqualifiziert wurde durch den wissenschaftlichen Fortschritt. (Daß man es heute wieder teilweise rehabilitiert hat, ist eine andere, ironische Sache.) Wenn Sebald als Student zu Mitte der sechziger Jahre im Keller der Universitätsbibliothek von Manchester in den Schriften des Paracelsus las, wie er in Nach der Natur berichtet, so war dies nicht primär einem rein historischen Interesse geschuldet. Vielmehr setzte er so nur fort, in anderer Weise, was Egelhofer ihm beigebracht hatte. Wie so vieles in seinem Leben war es ein Erinnerungsdienst am Großvater. Später wird er dann, auch dies eine Hommage an den Großvater, wiederholt Paracelsus-Zitate verdeckt in sein Werk einschmuggeln. Die Faszination für die Schriften von Thomas Browne, die Sebald Mitte der achtziger Jahre entdeckte, erklärt sich ebenso daraus, daß sie einem Denksystem des ›Dazwischen‹ angehören: »From the first page, I was absolutely mesmerized by the quality of his writing and this very, very curious mixture of scientific enquiry carried out by someone still half held by medieval magic.« (CB 159) Für Browne, der im siebzehnten Jahrhundert in Norwich lebte, war das Metaphysische noch eine valide Kategorie. So wie für Sebald im zwanzigsten Jahrhundert: »Certainly, one of the things that has interested me most is the much-despised discipline of metaphy sics, which was relegated from philosophy proper generations ago. I always thought that metaphysics was by far the most interesting branch of philosophy and anything to do with it always held my attention.« (CB 159) So erklärt sich namentlich die bereits angesprochene besondere Rolle, welche Engel in seinem Werk spielen, vom schwermütigen Engel auf Dürers Stich Melencholia über den vielbemühten Engel der Geschichte bis zu den schwerelos schwebenden Engeln, die Giotto gemalt hat.
Der Großvater-Komplex
49
Ebenso fühlte Sebald eine besondere Geistesverwandtschaft zu modernen Schriftstellern, die offen waren für die Metaphysik, so wie Kafka. Störrisch verteidigte er das Metaphysische, weil es ein wertvolles Erbe der Weltsicht war, die ihm der Großvater vermittelt hatte. So nimmt er etwa Peter Handke passioniert vor dessen Kritikern in Schutz und rühmt die in den »Büchern Handkes entwickelte Metaphysik, die das Gesehene und Wahrgenommene übertragen will in die Schrift.« (UH 163) Sein glühendes Plädoyer für dessen Roman Die Wiederholung ist eine der denkwürdigsten Stellen seines literaturkritischen Werks. Sebald schreibt: »Es gibt offensichtlich heutzutage kein Diskursverfahren mehr, in dem Metaphysik noch einen Platz beanspruchen dürfte. Und doch hat Kunst, wo und wann immer sie sich ereignet, zum Bereich der Metaphysik den engsten Bezug. Um diese Proximität zu erkunden, bedarf der Schriftsteller einer nicht zu unterschätzenden Tapferkeit, während es natürlich für die Kritik und Wissenschaft, die die Metaphysik nur mehr als eine Art Rumpelkammer ansehen, ein leichtes ist, mit dem allgemeinen Verweis sich zu begnügen, daß in höheren Regionen die Luft dünn und die Absturzgefahr groß ist.« (UH 163/64) Die Apotheose des Großvaters ist bei solchen Sätzen immer mitzu(be)denken.
DER GROSSVATER-KOMPLEX Egelhofers Bedeutung für ein tieferes Verständnis von Sebald darf also nicht unterschätzt werden, nur weil die Germanistik dies tut. Nehmen wir etwa seine Vorliebe für österreichische Autoren wie Thomas Bernhard, Peter Handke und Gerhard Roth. Bei ihnen allen spielten die Großväter eine bedeutsamere Rolle als die Väter und waren prägend für ihr späteres Schreiben. »Die Großväter sind immer die Lehrer«, hat Bernhard im autobiografischen Band Ein Kind geschrieben. Dieses Zitat hat es nicht von ungefähr zum Titel
50
2 Großvater
eines Buches gebracht, in dem die immense Rolle von Johannes Freumbichler für Bernhards Werk diskutiert wird. Was Bernhard weiter schreibt, wird Sebald wiedererkannt haben: Die Großväter »reißen immer den Vorhang auf, den die anderen fortwährend zuziehen. Wir sehen, sind wir mit ihnen zusammen, was wirklich ist.« Auch bei Peter Handke und Gerhard Roth übernahmen die jeweiligen Großväter die eigentliche Vaterrolle, denn – genau wie bei Sebald – sind sie nicht anfällig für den faschistischen Zeitgeist, auf den die Väter bereitwillig aufspringen oder von dem sie zumindest als angepaßte Mitläufer zu profitieren suchen. Der Tod des geliebten Großvaters ist daher bei den vorgenannten Schriftstellern ein wesentliches Thema. In seinem Exemplar von Bernhards Debüt Frost, es lagert heute mit Sebalds restlicher Bibliothek im Deutschen Literaturarchiv in Marbach, unterstrich er diesen Satz doppelt: »Aber die Kindheit war ihm am grauenhaftesten an dem Tag, an welchem er hinter seinen Eltern seine Großeltern nicht mehr hatte. Er war so allein, daß er oft in fremden Höfen auf einem Treppenstein saß und vor Übelkeit glaubte sterben zu müssen.« Und so wie sein Wahlverwandter Bernhard im Typus des radikal denkenden, zugleich aber elendig in eine Pferdehaardecke gehüllten und seine Familie terrorisierenden ›Geistesmenschen‹ Freumbichler ein literarisches Denkmal gesetzt hat, so findet sich im Werk Sebalds immer wieder die Konstellation der tiefen Freundschaft oder Zuneigung zu einem wesentlich älteren Mann. (Gefundenes Fressen für diejenigen, die verzweifelt versuchen, solches Sehnen als homoerotisch zu dekuvrieren, obgleich hier nichts ferner liegen könnte.) So läßt sich in der Henry Selwyn-Geschichte die Gestalt des Schweizer Bergführers Naegeli, der »auf dem Weg von der Oberaarhütte nach Oberaar verunglückt und seither verschollen« ist, als eine Figuration des Großvaters erkennen, des Wandergefährten und Führers durch die Natur. Er »habe sich nie in seinem Leben,
Der Großvater-Komplex
51
weder zuvor noch später, derart wohl gefühlt wie damals in der Gesellschaft dieses Mannes« (AW 24), bekennt Selwyn gegenüber dem Erzähler. Daß die Überreste des Bergführers »nach 72 Jahren vom Ober aargletscher wieder zutage gebracht worden waren« (AW 36), wie Sebald durch eine abgebildete Zeitungsmeldung am Ende der Erzählung belegt, ist eine wundersame, an Johann Peter Hebels Kalendergeschichte vom Unverhofften Wiedersehen erinnernde Wendung, in der man freilich zugleich und zuvörderst Sebalds phantasmagorischen Wunsch nach einem Wiedersehen mit dem Großvater erkennen könnte. Unverkennbar eine Hommage an Josef Egelhofer ist die Figur des naturkundlichen Alphonso in Austerlitz. »Immer in einer abgeklärten Stimmung, hielt er sich die meiste Zeit über im Freien auf, machte weitschweifige Exkursionen sogar bei schlechtestem Wetter oder saß, wenn es schön war, in seinem weißen Kittel und mit dem Strohhut auf dem Kopf, irgendwo in der Umgegend des Hauses auf einem Feldstühlchen und aquarellierte.« (A 132) Alphonso ist es, der Austerlitz »in die geheimnisvolle Welt der Motten« einführt, »eines der ältesten und bewundernswertesten Geschlechter in der ganzen Geschichte der Natur.« (A 135) Weil er durch die entomologische Schule von Alphonso gegangen ist, gewinnt Austerlitz ein empathisches Verhältnis zu diesen niederen Tieren, »und noch heute bringe ich ihnen unter allen Kreaturen die größte Ehrfurcht entgegen.« (A 140) Dasselbe galt für Sebald. Ihn störende Insekten vertrieb er durchs Fenster aus seinem Büro anstatt sie totzuschlagen. Auf dem Campus unterbrach er auch mal ein Gespräch, um kurz einen Vogel anzusprechen, der in einem Beet neben uns gelandet war und uns zwei Menschen neugierig-mißtrauisch beäugte. Daß ich zuvor darauf hinwies, daß Sebald erst in seinen späteren Jahren offen über den Großvater schrieb, ist zwar korrekt, muß allerdings qualifiziert werden. Egelhofer taucht nämlich deutlich
52
2 Großvater
erkennbar schon im allerersten Prosatext auf, den Sebald je geschrieben hat, seinem unpublizierten Jugendroman. Das Manuskript dieses Romans liegt – auch wenn sich das unter vermeintlichen Sebald-Experten offenkundig noch nicht herumgesprochen hat – in zwei Fassungen im Marbacher Archiv. Er habe die Arbeit daran aufgegeben, nachdem er seiner Frau daraus vorgelesen habe, diese aber dabei stets eingeschlafen sei, erzählte mir Sebald einmal. Der autobiografische Protagonist des titellosen Romanfragments trägt denselben Namen wie der Großvater, nämlich Josef. Noch als Student hat dieser immer ein ›Rezeptbuch‹ des Großvaters bei sich, in dem auch getrocknete Pflanzen und Kräuter kleben. Offenkundig besitzt es eine Fetischfunktion und dient als Erinnerungsstück an den wenige Jahre zuvor verlorenen Großvater. In seinem Hebel-Essay aus den neunziger Jahren bildet Sebald einige Notizen in der Handschrift Egelhofers aus dessen Bauernkalender ab. Dazu schreibt er: »Was mich stets zu Hebel zurückkehren läßt, das ist auch die ganz beiläufige Tatsache, daß mein Großvater, dessen Sprachgebrauch in vielem an den des Hausfreunds erinnerte, die Gewohnheit hatte, auf jeden Jahreswechsel einen Kempter Calender zu kaufen, in welchem er dann die Namensfeste seiner Anverwandten und Freunde, den ersten Frost, den ersten Schneefall, den Einbruch des Föhns, Gewitter, Hagelschlag und ähnliches mehr mit dem Tintenblei vermerkte, sowie, auf den Notizseiten, gelegentlich auch ein Rezept zur Herstellung von Wermuth oder Enzianschnaps.« (LH 13/14) Gegen Ende des zweiten Kapitels des Jugendromans findet sich eine berührende Schilderung, wie Josef den Tod seines geliebten Großvaters erlebt hat. Es ist dies die erste literarische Manifestation der Sebald’schen Urszene, der er sich dann erst wieder kurz vor seinem eigenen Tod zuwenden sollte. Aber schon im Jugendroman werden die symbolisch so stark aufgeladenen Hobelspäne im Sarg erwähnt, ebenso wie das (reale oder allegorisch zu verstehende) nächtliche Gewitter mit Hagel kurz nach seinem Tod. Ein anderes
Der Großvater-Komplex
53
Erinnerungsdetail, das noch im Jugendroman vorkommt, fehlt jedoch in späteren Texten, nämlich der goldene Ohrring von Egelhofer. Die Schilderung eines mit der Mutter unternommenen Besuchs am Grab des Großvaters gibt Josef die Gelegenheit, sich an ihn zu erinnern. So beispielsweise den Umstand, daß dessen Amt als Dorfgendarm mit sich brachte, dass er alle Bauern gut kannte, weshalb die Familie nach dem Krieg stets was zu Essen hatte. Ebenso rekapituliert Josef die Gewohnheit des Großvaters, gemeinsam mit dem Enkel Heilkräuter zu sammeln, um sie auf Packpapier ausgebreitet in die Sonne zum Trocknen zu legen, sowie die dazugehörigen Rezepte in seiner altertümlichen, verschlungenen Schrift voller Schnörkel, Haken und Häubchen ins Notizbuch einzutragen. Ganz so, wie in der Handschrift auf den Faksimiles im Hebel-Essay zu besichtigen. Es waren aber nicht nur Hebel und dessen Kalendergeschichten, zu denen der Großvater seinem Enkel den Weg bahnte. Den Tonfall, das Vokabular und den Duktus der Sprache Egelhofers fand Sebald auch in den Texten solcher Autoren wie Adalbert Stifter, Gottfried Keller oder Eduard Mörike wieder. Sie zu lesen war stets eine Form des Dialogs mit den Toten und dem einen Toten, der vor allen anderen für Sebald zählte. Merkwürdige, für Sebald sinnfällige Verbindungen über Zeit und Raum hinweg ergaben sich ebenso mit Autoren aus dem zwanzigsten Jahrhundert. Etwa im Fall von Jean Améry und dessen Selbstmord durch Einnahme einer Überdosis von Schlaftabletten im Oktober 1978 in einem Salzburger Hotelzimmer. Als Sebald im Januar 1984 durch einen Anruf seiner Mutter vom Selbstmord seines ehemaligen Volksschullehrers Armin Müller erfuhr (und später von dessen zeitweiliger Verfolgung unter den Nazis), machte ihn die Parallele zum Tod von Améry betroffen. Das Resultat war die Arbeit an der Erzählung Paul Bereyter, welche er beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb des Jahres 1990 in Klagenfurt vorlas (um dann ohne Preis heimzukehren).
54
2 Großvater
Über Améry, wir wissen es, hatte Sebald bereits ab Mitte der achtziger Jahre einfühlsame Essays veröffentlicht. Angesichts des Schuldgefühls, das Sebald seit dem Tod des Großvaters in sich trug, kann es kaum erstaunen, daß er sich für das vom deutsch-amerikanischen Psychoanalytiker William Niederland so bezeichnete ›Überlebenden-Syndrom‹ bei Verfolgten des Nationalsozialismus interessierte. Niederland war darauf gestoßen, daß sehr viele Davongekommene sich nach Kriegsende zwar äußerlich erfolgreich wieder in die Gesellschaft eingliedern konnten, im Alter aber ihre posttraumatische Belastungsstörung durchbrach und vielfach – so wie bei Améry oder Primo Levi – zum Suizid führen konnte. Dieses psychologische Muster sah Sebald ebenso bei seinem Volksschullehrer am Werk. Der auf dem exilierten Maler Frank Auerbach basierenden Figur des Max Aurach legt Sebald Worte in den Mund, in denen das verspätete Aufbrechen der traumatischen Wunde beschrieben wird: »Das Unglück meines jugendlichen Noviziats hatte so tief Wurzel gefaßt in mir, daß es später doch wieder aufschießen, böse Blüten treiben und das giftige Blätterdach über mir aufwölben konnte, das meine letzten Jahre so sehr überschattet und verdunkelt hat.« (AW 282) Und so wie die semifiktive Figur des Paul Bereyter den Tod seiner von den Nazis ermordeten Geliebten Helen Hollaender nie verwinden konnte, weshalb er ihr Jahrzehnte später vermutlich freiwillig in den Tod nachfolgt, so begeht auch die auf einem entfernten Verwandten Sebalds basierende Figur des Ambros Adelwarth eine ähnliche Form des Selbstmords: Er läßt sich aus eigenem, selbstzerstörerischem Willen einweisen in die Klinik, in der sein geliebter Dienstherr Cosmo Solomon durch brachiale Elektroschockbehandlungen zu einem katatonisch erstarrten Wrack geworden ist. Warum hat sich Sebald mit solcher Konsequenz, im essayistischen wie im literarischen Schreibmodus, dieser realen wie (semi)fiktionalen Schicksale angenommen? Die Schuldgefühle über den Großvatertod stellen sicherlich eine Verbindung her, aber das allein reicht
Egelhofer in Walser (& umgekehrt)
55
als Erklärung nicht aus. Vielmehr ist auf eine Aussage Sebalds in einem seiner letzten Interviews zu verweisen, in der er seine Überzeugung erläutert, daß es so etwas wie ›Zufälle‹ nicht gebe. Er sagte: »Wenn ich über die österreichisch-schweizer Grenze gefahren bin, kam ich immer durch Hohenems. Ich wußte, daß mein Großvater oft in Hohenems war und dort öfters bei einem Viehhändler eingekehrt ist. Ich wußte aber nicht, wer dieser Viehhändler war – und der Großvater Amérys war, glaube ich, Viehhändler in Hohenems. Es handelt sich um eine dieser Koinzidenzen, an denen einem schlagartig aufgeht, daß alles mit allem zusammenhängt und daß man sich deshalb um die Dinge kümmern muß.« (G 232/33) Hier ist exemplarisch die Essenz des Sebald’schen Schreibens aufzufinden: die vor dem Hintergrund der eigenen Biografie sinnstiftende Koinzidenz als metaphysischer Fingerzeig, gekoppelt an einen ethischen Imperativ, die Literatur zu einem Instrument der Restitution geschehenen Unrechts zu machen in Hinblick auf die Gewaltgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts, zugleich aber das Schreiben als Erinnerungsdienst am Großvater und als kompensatorische Reaktion auf die traumatische Verlusterfahrung zu betreiben.
EGELHOFER IN WALSER (& UMGEKEHRT) Der feste Glaube an den tieferen Sinn von Koinzidenzen war eine Gewißheit Sebalds, die er mir in verschiedenen Gesprächen immer wieder darlegte. Sie beeindruckte, aber überzeugte mich damals nicht. Vielleicht ist das heute anders. Insbesondere in Schwindel. Gefühle. – aber nicht nur dort – hat er die unheimliche Macht, die Koinzidenzen erzeugen, literarisch fruchtbar gemacht. Besonders zwingend waren für ihn vor allem die Parallelen, die seinen Allgäuer Großvater mit dem Schweizer Schriftsteller Robert Walser verbanden. Für Logis in einem Landhaus, seinen Sammelband zur alemannischen Literatur, schrieb Sebald einen vierzigseitigen Essay über
56
2 Großvater
Walser, der zu seinen literarischen Glanzleistungen zählt. Literaturkritik und Autobiografie werden darin zu einer Fusion gebracht, die das, was er mit seinen literarischen Texten etwa über Schriftsteller wie Stendhal oder Kafka, die in Schwindel. Gefühle. eingingen, an dieser Stelle fortführte und ästhetisch potenzierte durch das autobiografische Element. Ähnlich wie im Essay über Hebel merkt man jeder Seite, jedem Paragraphen und jedem Satz an, daß Sebald hier mit einer Passion schreibt, die vom innigen Bezug zum Großvater herrührt. »Vielleicht«, so Sebald, »sehe ich darum den Großvater heute, wenn ich zurückdenke an seinen von mir nie verwundenen Tod, immer auf dem Hörnerschlitten liegen, auf dem man den Leichnam Walsers, nachdem er im Schnee gefunden und fotografiert worden war, zurückführte in die Anstalt. Was bedeuten solche Ähnlichkeiten, Überschneidungen und Korrespondenzen? Handelt es sich nur um Vexierbilder der Erinnerung, um Selbst- oder Sinnestäuschungen oder um die in das Chaos der menschlichen Beziehungen einprogrammierten, über Lebendige und Tote gleichermaßen sich erstreckenden Schemata einer uns unbegreiflichen Ordnung?« (LH 137/38) Was Sebald auszeichnet, ist gerade, daß er keine einfachen (und ebenso keine komplizierten) Antworten lieferte, sondern stattdessen auf der Virulenz solcher Fragen für unsere von Vernunft, Wissenschaft und Technik beherrschte Existenz insistierte. Und natürlich spricht es für ihn, daß er zuerst selbstkritisch die Möglichkeit eigenverschuldeter Sinneskonstruktionen zur Disposition stellt, obwohl er natürlich an einen tieferen Hintersinn, eine höhere Ordnung und verborgene Muster glaubte. Die Beschäftigung mit Robert Walser war insofern auch ein Versuch, das existentielle Rätsel des Lebens zu enträtseln, mit dem Großvater an der Hand. Über die erhalten gebliebenen Fotos von Walser schreibt er: »Am vertrautesten sind mir die Bilder aus der Herisauer Zeit, die Walser als Spaziergänger zeigen, denn wie der
Egelhofer in Walser (& umgekehrt)
57
längst aus dem Schreibdienst getretene Dichter da in der Landschaft steht, das erinnert mich unwillkürlich immer an meinen Großvater Josef Egelhofer, mit dem ich als Kind während derselben Jahre stundenlang oft durch eine dem Appenzell in vielem verwandte Gegend gewandert bin. Doch nicht nur äußerlich, auch in ihrem Habitus waren der Großvater und Walser sich ähnlich, etwa in der Art, wie sie den Hut neben sich hertrugen.« (LH 134/37 Diese verbindende Geste des Hut-in-der-Hand-Haltens bringt noch eine weitere Person ins Spiel, eine Art lebenden Doppelgänger zu Walser, nämlich den schizophrenen Dichter Ernst Herbeck. Sebald war mit Herbeck persönlich bekannt, ja, man möchte ›befreundet‹ sagen, wäre es nicht ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, eine tiefere Beziehung zu dem psychisch gestörten Anstaltsinsassen herzustellen. Zu sehr war Herbeck gefangen in seiner eigenen Welt, ein lebenslanger Häftling seiner Krankheit. In der Erzählung All’estero aus Schwindel. Gefühle. berichtet Sebald, wie er Herbeck zu einer gemeinsamen Wanderung abholt aus dem Pensionistenheim, in das dieser, »probeweise aus der Krankheit in den Ruhestand versetzt« (SG 45), um 1980 herum einzog, bevor er wieder in seine eigentliche Heimstatt zurückkehrte, das Haus der Künstler in der Niederösterreichischen Landesklinik für Psychiatrie, wo ihn Primar Leo Navratil unter seinen Patienten entdeckt und gefördert hatte. Als Sebalds Erzähler zum vereinbarten Zeitpunkt am Pensionistenheim eintrifft, erwartet ihn Herbeck bereits, gekleidet in einen Glencheckanzug mit einem Wanderzeichen am Revers. »Auf dem Kopf hatte er einen kleinen Hut, eine Art Trilby, den er später, als es ihm zu warm wurde, abnahm und neben sich hertrug, genauso wie mein Großvater das beim sommerlichen Spazierengehen oft getan hatte.« (SG 46) Das Requisit des Hutes spielt auch bei der Verabschiedung nach dem Ende der gemeinsamen Wanderung eine Rolle: »Bis zum Agnesheim war es nicht mehr weit. Beim Abschiednehmen lüfte-
58
2 Großvater
te Ernst seinen Hut und machte, auf den Fußspitzen stehend und leicht vornübergebeugt, eine gezirkelte Bewegung, um im Abgang den Hut wieder aufzusetzen, das Ganze ein Kinderspiel und schweres Kunststück in einem.« (SG 57) Man bekommt diesen in der Hand gehaltenen Hut auch zu sehen, zumindest vermeintlich, denn Sebald hat in seinen Text ein auf Kopfhöhe abgeschnittenes Foto von Robert Walser aufgenommen. Der Schriftsteller ist daher zwar nicht als solcher zu erkennen. Da es sich jedoch um eines seiner bekannteren Portraits handelt, vermag jeder Leser, der sich für Walser interessiert, diesen sofort zu identifizieren. (Wie wichtig Herbeck auch ansonsten für Sebald war, hat die Germanistin Melissa Etzler gezeigt, indem sie den vielfältigen Spuren nachgegangen ist, die Herbeck im Werk von Sebald hinterlassen hat.) Der Kreis zwischen Egelhofer und Walser schließt sich erst gegen Ende der neunziger Jahre, als Sebald in seinem Walser-Essay festhält, er brauche nur Aufnahmen von Walser zu seiner Anstaltszeit betrachten, »dann glaube ich jedesmal, den Großvater vor mir zu haben.« (LH 136) Wie zum Beweis stellt er daher auf einer Doppelseite mehrere Fotografien gegenüber, die Walser und Egelhofer zeigen. Auf allen fünf Aufnahmen trägt das Doppelgängerpaar, sicher nicht von ungefähr, einen Hut. Ihre Ähnlichkeit erweist sich in der Tat als beachtlich. »Lange bildete ich mir sogar ein, der Großvater habe wie Walser die Gewohnheit gehabt, den obersten Knopf an der Weste nicht zuzuknöpfen. Mag das nun so gewesen sein oder nicht, unzweifelhaft ist, daß beide gestorben sind im selben Jahr, 1956, Walser bekanntlich auf einem Spaziergang am 25. Dezember und der Großvater am 14. April, in der Nacht auf Walsers letzten Geburtstag, in der es noch einmal geschneit hat mitten in den schon angebrochenen Frühling hinein.« (LH 137) Zwar ist die behauptete Koinzidenz von Schneefall und Ableben Egelhofers wohl eine poetische Wahrheit, steht doch Kälte meta-
Egelhofer in Walser (& umgekehrt)
59
phorisch für Tod. Zugleich stellt der Schneefall eine Verbindung zum Sterben Walsers her, dessen Leichnam man im Schnee gefunden hat, gilt es doch nicht zuletzt zu »begreifen, daß es sonderbare, von keiner Kausallogik zu ergründende Zusammenhänge gibt.« (CS 247) Glaubt man der bereits erwähnten Schilderung aus dem Jugendroman, so ereignete sich nach dem Tod des Großvaters ein Gewitter mit Hagelschlag, welcher ja grob gesprochen auch eine Art von ›Schneefall‹ darstellt. Es ist gleichsam Sebalds Meteorologie der Metaphysik, in welcher der Schnee für den Tod steht. An der Übereinstimmung beider Todesjahre besteht jedenfalls kein Zweifel, wenngleich eher rational veranlagte Menschen dies sicher als allzu lose Verbindungsziehung belächeln mögen. Es mußte daher zur Paarung von Walser und Egelhofer vielleicht noch ein dritter Todesfall hinzukommen, um die von Sebald behauptete Seelenverwandtschaft zu erhärten: nämlich sein eigener Tod an einem vierzehnten Dezember, was den Todestag des Großvaters mit dem Todesmonat des Schweizer Schriftstellers auf eine derart zwingende Weise verkoppelt, daß sie kaum mehr zufällig erscheint. Doch damit nicht genug. Sebald berichtet im Walser-Essay von einem unheimlichen Zufall, der ihm »unlängst widerfuhr beim Lesen des Räuberromans« von Walser, nämlich von der darin gemachten Entdeckung des Wortes ›Trauerlaufbahn‹, das er selbst in Die Ausgewanderten verwendet hatte und »von dem ich, als ich es seinerzeit niederschrieb, geglaubt habe, daß es noch keinem eingefallen war außer mir. Ich habe immer versucht, in meiner eigenen Arbeit denjenigen meine Achtung zu erweisen, von denen ich mich angezogen fühlte, gewissermaßen den Hut zu lüften vor ihnen, indem ich ein schönes Bild oder ein paar besondere Worte von ihnen entlehnte, doch es ist eine Sache, wenn man einem dahingegangenen Kollegen zum Angedenken ein Zeichen setzt, und eine andere, wenn man das Gefühl nicht loswird, daß einem zugewinkt wird von der anderen Seite.« (LH 138/39)
60
2 Großvater
Kann das bloßer Zufall sein? Ich weiß es nicht. Immerhin handelt es sich bei dem Begriff ›Trauerlaufbahn‹ nicht nur um einen schönen Neologismus, sondern um eine Metapher, die – zumal angesichts der Fusion von Egelhofer und Walser – vielleicht wie keine andere für das melancholische Vorzeichen steht, unter dem Sebalds Lebenslauf seit dem Tod des Großvaters stand. Ganz in diesem Sinne notierte er einmal: »Verborgen in der Topographie der Kindheit ist schon der gesamte Kataster des späteren, aus lauter Verlustgeschäften sich zusammensetzenden Lebens.« (KP 146)
NACHFOLGE & GEISTERGLAUBE: GROSSVATER-WERDEN Es gibt ein anrührendes Familienfoto, das den sechsjährigen Winfried am Tag seiner Einschulung zeigt, rundum glücklich in die Kamera lächelnd. Wer schon hätte es damals für möglich gehalten, daß dieses Dorfkind in Lederhosen einmal Professor an einer englischen Universität werden würde, und ein international gefeierter Schriftsteller dazu? Im Walser-Essay sieht man gleich zwei Fotos, die den kleinen Winfried im selben Alter an der Hand von Großvater Egelhofer zeigen. Kindheit als Utopie. Szenen einer symbiotischen Verbundenheit. Der Tod hat diese Verbindung zerrissen. Willentlich und wohl auch unwillentlich hat Sebald sein Leben lang versucht, sie wiederherzustellen, irgendwie. Beispielsweise, indem er äußerlich in die Nachfolge des Großvaters eingetreten ist. Ein Zeichen dafür war sein Schnurrbart, den er in Imitation Egelhofers schon ab Anfang der sechziger Jahre zu tragen begann. Ferner führte Sebald lange Zeit eine Bartbürste bei sich, die einst Egelhofer gehört hatte. Weniger ein Andenken als ein Fetisch.
Nachfolge & Geisterglaube: Großvater-Werden
61
Unwillkürlich, oder nicht, wird er auch manche Verhaltensweisen des Großvaters nachgeahmt haben. In Il ritorno in patria trifft der Erzähler auf seinen früheren Nachbarn Lukas, der sich überrascht zeigt von dieser Begegnung: »Wenn er es sich jetzt recht überlege, sei es natürlich nicht das Kind gewesen, an das ich ihn erinnert habe, sondern der Großvater, der denselben Gang gehabt habe wie ich und beim Herauskommen aus einer Haustür gerade so wie ich zuerst stehengeblieben sei, um nach dem Wetter zu schauen.« (SG 229) Der Wunsch nach einer Kommunion mit den Verstorbenen ist eine uralte, anthropologische Verhaltensweise. Sebald ist ihr etwa anhand der Texte Herbert Achternbuschs in solchen Dramen wie Ella oder Gust nachgegangen. Die Kunst der Verwandlung ist sein Essay über Achternbusch betitelt. Wenn sich in Ella die Hauptfigur Josef »den Kopfputz aus Hühnerfedern aufsetzt, um die schwere Rolle seiner Mutter Ella zu übernehmen«, befindet Sebald, »ist das ein großartiger theatralischer Augenblick der Transformation.« Weiters schreibt er, daß durch den Akt der Verwandlung in einen Verwandten »ein Ritual der Wiederholung eingeleitet wird, in welchem, ganz so wie Lévi-Strauss das für die Trauerriten sogenannter primitiver Völkerschaften ausgeführt hat, ein lebender Mensch einen Ahnen personifiziert, um so die Transsubstantiation eines Menschen, der zu leben aufgehört hat, in einem Ahnen sicherzustellen. Es geht bei dergleichen komplexen reziproken Prozessen um eine Gemeinschaftsaktion der Lebenden und der Toten, um die Aufhebung der Gegensätze zwischen Diachronie und Synchronie, zwischen reversibler und irreversibler Zeit.« Nichts anderes als sich in diese archaische Praxis einzufügen, um zu einer Form der Gemeinschaft mit Egelhofer zurückzufinden, hat Sebald getan. Bei dieser Gemeinschaft ging es ihm wohl in erster Linie um jene »Verwandlung der Trauer in den Trost«, die immer wieder als Wunschformel in seinem Werk vorkommt. (Entlehnt hat er sie übrigens aus dem Schlußsatz von Adornos Kierkegaard-Studie.)
62
2 Großvater
So heißt es beispielsweise im Aufsatz zu Handkes Lehre der Sainte-Victoire, daß vermittels der Kunst »der Schritt aus der Trauer in den Trost nicht der größte, sondern der kleinste« (BU 183) sei. Daß sich »die Trauer verwandelt in Trost« (LH 88) war für Sebald insofern nicht nur eine kunsttheoretische Angelegenheit, sondern ein biografisches Anliegen. Bei seinen Reisen auf die Insel Korsika interessierten ihn folglich besonders die bis in die Gegenwart virulenten abergläubischen Gebräuche der Inselbewohner. Die Korsen nämlich – ganz wie er selbst – räumen den Toten einen Platz im Alltag der Überlebenden ein: »Fünf Jahre & länger wurde Trauer getragen nach dem Tod eines nahen Verwandten« (KP 139), notiert Sebald über die korsischen Trauerrituale. Eine solche Haltung kam ganz der seinen entgegen, vom trauernden Angedenken an Großvater nicht loszu lassen. Aus Freuds Totem und Tabu exzerpierte er sich einmal allein diesen Satz: »Die Trauer liebt es vielmehr, sich mit dem Verstorbenen zu beschäftigen, sein Andenken auszuarbeiten und für möglichst lange Zeit zu erhalten.« Ganz wie auf Korsika: »Das Andenken an die Toten nahm eigentlich niemals ein Ende. Sie wurden nicht betrachtet als solche, die für immer in der sicheren Entfernung des Jenseits sind, sondern als nach wie vor anwesende Verwandte, die sich lediglich in einem besonderen Zustand befanden.« (CS 31/32) Es ist dies der Zustand des Gespenstes. Eine geisterhafte Präsenz, die aber nichts Schreckliches, eher etwas Tröstendes an sich hat. »Je mehr einer, aus was für einem Grund immer, zu tragen hat an der der menschlichen Art aufgebürdeten Trauerlast, desto öfter begegnen ihm Gespenster.« (CS 35) Kein Wunder also, daß Sebald ein veritabler ghost-writer war. Allerdings erklärte er in seinem Todesjahr zugleich, daß im Gegensatz zu landläufigen Vorstellungen Schreiben in dieser Hinsicht nicht als Therapie tauge. Zumindest nicht unbedingt für ihn:
Wunschfigur Rudolf Egelhofer
63
»I believe the more you turn your mind towards things the more difficult it gets. From book to book it gets harder to look at the determinants of your life again… I don’t think that writing helps to exorcise the ghosts.« (CB 145/46) Der »Verdacht, daß die Grenze zwischen dem Tod und dem Leben durchlässiger ist, als wir gemeinhin glauben« (A 401) und daß uns nur ein Geringes trennt »von der nächsten Welt« (A 84), gehört jedenfalls zu den Grundüberzeugungen von Austerlitz wie von Sebald. Einem seiner frühesten Interviewer erklärte er: »In my work there is an unproblematic transition between the living and the dead. I can say with even greater conviction that the dead inte rest me more than the living.« (SM 354) Auch das darf man als Kommentar seines die Grenzen verwischenden Verhältnisses zum Großvater verstehen.
WUNSCHFIGUR RUDOLF EGELHOFER In Verbindung mit dem Verlust von Josef Egelhofer steht noch ein anderer gewichtiger Aspekt. Man könnte ihn, einen Begriff des von Sebald hochgeschätzten Peter Weiss entlehnend, als ›Wunsch autobiografie‹ bezeichnen: Sebald war fasziniert von der Namensgleichheit zwischen seinem Großvater und dem Kommandanten der ›Roten Armee‹ während der Münchner Räterepublik, Rudolf Egelhofer, welcher 1919 von der Reaktion erschossen wurde. Denn hier tat sich eine Gelegenheit auf, über den Großvater eine politisch revolutionäre Familientradition zu konstruieren. Diese hätte sich scharf abgegrenzt von der väterlichen Linie, die in den Augen von Sebald für militärische Gehorsamkeit, kleinbürgerliche Staatstreue und opportunistisches Mitläufertum im Nationalsozialismus stand. Das war zwar nicht ganz gerecht. Doch für Sebald hatte der Lebenslauf des 1911 in einer katholischen Arbeiterfamilie geborenen Vaters den Generationskonflikt vorprogram-
64
2 Großvater
miert: Georg Sebald trat 1929, als die Weltwirtschaftskrise die ohnehin schlechte ökonomische Situation der Weimarer Republik noch verschlimmerte, ins Reichsheer ein und stieg als Berufssoldat bis zum Rang eines Hauptmanns in der Wehrmacht auf. Er nahm an Feldzügen in Polen, der Sowjetunion und Frankreich teil. 1945 geriet er in französische Kriegsgefangenschaft, aus der er erst im Januar 1947 zurückkehrte. Nach seiner Rückkehr arbeitete er kurz als Schlosser in Wertach, dann bei der Landpolizei in Sont hofen, ehe er im März 1956 in die Bundeswehr eintrat. Stationiert in Sonthofen, dem Standort der ehemaligen Nazi-Ordensburg, brachte er es bis zum Oberstleutnant. Ende 1969 ging er in den Ruhestand. Damit endete eine Militärlaufbahn in drei Armeen. Daß Georg Sebald Mitglied der SPD und als durchaus kritischer Kopf in der Sonthofener Lokalpolitik aktiv war, änderte nichts an Sebalds grundsätzlich negativer Haltung. Gegen die Vita eines Anpassers, wie Sebald den Vater primär sah, wäre eine mütterliche Linie, die einen von der Reaktion ermordeten Revolutionär aufzuweisen hat, keine geringe Genugtuung gewesen. Ein Abwehrzauber. Mitte der achtziger Jahre versuchte Sebald durch genealogische Recherchen im Bayerischen Staatsarchiv seine Verwandtschaft mit Rudolf Egelhofer nachzuweisen. Jedoch erfolglos. Das allerdings hielt ihn nicht davon ab, den Kommunisten, quasi mit poetischer Freiheit, dennoch seiner Verwandtschaft einzugemeinden. In einem 1987 entstandenen Stipendienantrag an den Deutschen Literaturfonds umreißt er sein geplantes Erzählprojekt, »Lebensläufe und Geschichten, in denen die Entwicklung des Sozialismus in Süddeutschland aufgegriffen wird«, literarisch zu bearbeiten, wobei auch Rudolf Egelhofer behandelt werden sollte. Gegen besseres Wissen behauptete Sebald: »Er war, soweit ich bisher eruieren konnte, ein Neffe meines Großvaters. 1919 ist er in München erschlagen worden. Es kann sich niemand in der Familie erinnern an ihn, aber die Freikorpskämpfer sind im Gedächtnis der Onkel und Tanten erstaunlich gut aufgehoben.«
Wunschfigur Rudolf Egelhofer
65
Die hartnäckig aufrechterhaltene Mär von der gesicherten Verwandtschaft mit dem kommunistischen Stadtkommandanten von München wiederholt er nochmals in einem 2000 gestellten Stipendienantrag an den ›National Endowment for Science, Technology and the Arts‹ (NESTA): »Several of my forebears will pass review, among them Rudolf Egelhofer, commander of the Red Army at the time of the Munich Soviet, who was murdered in 1919 by the rightwing free corps.« (SM 257) Offenkundig sollte dieses zwar begonnene, aber durch den Tod Sebalds nie vollendete Weltkriegs-Projekt einer Art Exorzierung des politisch kompromittierten väterlichen Erbes dienen, an dessen Stelle eine über Rudolf Egelhofer konstruierte revolutionäre Familienlinie treten sollte. In Die Ausgewanderten, innerhalb des Berichts der Luisa Lanzberg, macht Sebald einmal eine versteckte Anspielung auf den Wunschverwandten: »In München war Revolution. In Bamberg sammelten sich die Freikorpssoldaten. Der Anton Arco Valley verübte das Attentat auf den Eisner. München wurde zurückerobert. Es herrschte das Standrecht. Der Landauer wurde erschlagen, der junge Egelhofer und der Leviné erschossen und der Toller in die Festung gesperrt.« (AW 320) Die revolutionäre Linie der Familie Sebald begann daher sozusagen erst mit Sebald, der insofern ganz Kind seiner Zeit – will sagen: seiner Generation – war, selbst wenn er ›Achtundsechzig‹ nicht vor Ort in Deutschland erlebte und seine Rebellion sich stattdessen in einer aggressiven, autoritätsfeindlichen Literaturkritik ausdrückte. Zwangsläufig jedenfalls mußte ein familiärer Konflikt entstehen, wenn Sebald, zu Recht oder zu Unrecht, auch im politischen Bereich auf seinen Überzeugungen beharrte. »I always try to explain to my parents that there is no difference between passive resistance and passive collaboration – it’s the same thing. But they cannot understand that.« (EM 67) Sebald beklagte, daß in seinem Elternhaus nicht offen über die Verbrechen des Nationalsozialismus und das Verhalten seiner Eltern
66
2 Großvater
in dieser Zeit gesprochen wurde. Unterdessen vermochte er, zumindest retrospektiv, anzuerkennen, daß dies zum Teil gute Gründe hatte: »Your parents never told you anything about their experiences because there was at the least a great deal of shame attached to these experiences. So one kept them under lock and seal.« (EM 85) Zu bedenken wäre ebenso, daß Georg Sebald angesichts der Konkurrenz von Egelhofer nur schwer eine Beziehung zu seinem Sohn aufbauen konnte. Daß er wegen seines Kriegsdienstes und seiner Kriegsgefangenschaft während der entscheidenden ersten drei Lebensjahre nicht da war für seinen Sohn, war kaum seine Schuld. Ungünstig waren sicher auch die späteren regelmäßigen Abwesenheiten als Pendler, die dem ökomischen Zwang geschuldet waren, die Familie zu ernähren, aber in einem absenten Vater resultierten. Eine Bindung zu seinem Sohn aufzubauen, war zudem schwer, da Georg Sebald keine körperliche Nähe oder gar Zärtlichkeit zuließ, wahrscheinlich als Resultat einer entsprechenden eigenen Erziehung. Auch konnten die Eltern den Affront kaum übersehen, der darin lag, daß sich ihr Winfried Georg der von ihnen ausgesuchten Vornamen entledigte, indem er sich in einem eigenmächtigen Befreiungsakt in Max umbenannte. Schwierige Verhältnisse also. Die enge emotionale Bindung an den Großvater, über dessen Tod hinaus, war ein zusätzlicher Faktor, der die Beziehung zu den Eltern störte. Und es war womöglich ein großväterliches Erbe, das Sebald selbst das Leben kosten sollte, nämlich Josef Egelhofers Herzdefekt. Die Herzschwäche des Großvaters verhinderte, daß dieser im Ersten Weltkrieg kämpfen mußte; ein weiterer Umstand, der den Gegensatz zwischen dem Sohn und dem Militär-Vater verstärkt haben dürfte. Gegen Ende der neunziger Jahre jedenfalls hat Sebald gegenüber Freunden immer wieder vom Bewußtsein gesprochen, daß ihm nurmehr wenig Zeit bliebe. Nicht gerade eine nachvollziehbare
Aberglaube: die andere Ordnung des Wissens
67
Befürchtung bei einem Mann von Mitte fünfzig. Zu dieser Zeit schreibt er an Austerlitz, dessen Titelfigur wiederholt psychische Anfälle erleidet, von dem Gedanken durchzuckt, »ich werde jetzt sterben müssen an diesem schwachen Herzen, das ich geerbt habe, ich weiß nicht, von wem.« (A 382) Sebald hingegen wußte genau, von wem er sein schwaches Herz geerbt hatte, als er diesen wahrlich gespenstischen Satz niederschrieb. Es war auch keineswegs das erste Mal, daß Sebald sein eigenes Ende literarisch imaginierte. Im Gedicht Etwas im Ohr lautet eine Strophe: Beim Aufwachen winkt mir der Herztod von der anderen Seite des Abgrunds (LW 39)
ABERGLAUBE: DIE ANDERE ORDNUNG DES WISSENS Am Ende des wundervollen Essays über Gerhard Roths Landläufiger Tod, der mich wesentlich dazu bewog, bei Sebald über dessen grandiosen Zyklus Die Archive des Schweigens zu promovieren, findet sich ein enthusiastisches Plädoyer für den Aberglauben. Man solle ihn sich keinesfalls nehmen lassen, ermahnt Sebald seine Leser, ist doch im Aberglauben »nicht weniger Wissen als Glaubwürdigkeit an der Wissenschaft. So ist auch der Verfasser dieses Essays, der in seiner Kindheit noch seinen Großvater den Hut vor einem Hollerbuschen hat ziehen sehen und der es sich hier noch einmal erlaubt, mit Jean Paul zu reden, ›für seine Person froh, daß er auf einem Dorfe jung gewesen und also in einigem Aberglauben
68
2 Großvater
erzogen worden, mit dessen Erinnerung er sich jetzo behilft‹.« (UH 161) Eine der Spuren, die Josef Egelhofer in Sebalds Werk hinterlassen hat, ohne daß die Literaturwissenschaft dies bisher sonderlich ernstgenommen hätte, ist die Treue zum Aberglauben und zu verwandten Denkweisen. Das erklärt Sebalds besondere Vorliebe für Exzentriker, Sonderlinge und Obskuranten, aber ebenso für Amateure und Dilettanten, die häretische oder sonst wie ketzerische Sichtweisen vertreten, die sich nicht in ein streng wissenschaftliches Weltverständnis einpassen lassen. Zwar können solche für Sebald wichtigen Namen wie beispielsweise Paracelsus, Thomas Browne und Franz von Baader, wie überhaupt die Vertreter der deutschen Frühromantik, noch problemlos als Bezugspunkte in einen literaturwissenschaftlichen Diskurs über Sebald eingebaut werden – doch damit beginnen schon die Mißverständnisse. Was dabei durch die verengte Sichtweise der Germanistik übersehen wird, ist, daß er deren Schriften ernst genommen hat als Erkenntnisquellen und Referenzpunkte seiner literaturkritischen wie literarischen Schriften. Schließlich liegt im abergläubischen Denken, so könnte man das obige Zitat paraphrasieren, nicht mehr oder weniger Wahres begründet als in den Schriften poststrukturalistischer Theoriegötter wie Derrida oder Lacan, auf die sich die Literaturwissenschaft gerne beruft (und die teils selbst schon, jetzt wo sich das Theoriekarussell in Richtung neuer Moden wie ›Queer Studies‹ oder ›Kritische Weißseinsforschung‹ weiter gedreht hat, historisch geworden sind). Eklatantes Unverständnis hingegen hat die konventionelle Sebald-Forschung demonstriert bei solchen Bezugspunkten Sebalds wie dem bayerischen ›Waldpropheten‹ Mühlhiasl aus dem achtzehnten oder dem Hellseher Alois Irlmaier aus dem zwanzigsten Jahrhundert, deren katastrophische Vorhersagen unmarkiert in die frühe Lyrik und Nach der Natur eingingen. In einem frühen Kaf-
Aberglaube: die andere Ordnung des Wissens
69
ka-Essay von 1972 über Das Schloß wiederum zitiert Sebald mehrfach aus dem Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, um den rätselhaften Text in seine eigenwillige, durchaus bestechende, allerdings nicht unbedingt überzeugende Interpretation einzupassen. Neben seinem von Egelhofer inspirierten Faible für Volksglauben und abergläubisches Denken zeigt sich Sebald in seinen Schriften fasziniert von mantischen Praktiken wie etwa der Astrologie. Gleichermaßen beeinflußt haben ihn religiöse Strömungen wie der Zoroastrismus, die Gnosis und die jüdische Mystik sowie protowissenschaftliche Denktraditionen wie die Alchimie. Evident wird all dies vorzugsweise in der frühen Lyrik, von wo aus es dann teilweise bis zu den eigentlichen Anfängen des literarischen Werks mit Nach der Natur weitergetragen wird. Dort kommt etwa der »Aschaffenburger / Hofastrologe Johann Indagine« (NN 27) vor, und zahlreiche kaschierte Zitate aus den Schriften des Paracelsus samt Referenzen auf die Lehren der »Alchimia« (NN 67) sind zu finden. Im frühen Gedicht Merkzettel wird gleich ein ganzes Programm abergläubisch-mantischer Praktiken versammelt: Feuer legen und Rauch für die Zukunft deuten Asche hinaustragen dann über den Kopf werfen Ja nicht dabei sich umschaun Kunst der Verwandlung probieren Gesicht mit Zinnober bemalen Zum Zeichen der Trauer (LW 42)
70
2 Großvater
Ob Sebald hier wieder vom Großvater spricht aufgrund des Schlüsselwortes ›Trauer‹, auf das die Liste hinausläuft? Im 1975 publizierten Unerschlossen zumindest heißt es in der ersten Strophe: »Der Urgroßvater / im bunten Rock / erstellt er ein Horoskop.« (LW 32) Man darf im lyrischen Urgroßvater, der das Gewand eines Magus trägt, getrost eine Figuration von Egelhofer erkennen. Bezeichnenderweise wird im späteren Gedicht Trigometrie der Sphären der explizit als »Großvater« bezeichnete Verwandte mit Astromantie in Verbindung gebracht. Es lautet: Mit einem messignen Fernrohr erforscht er dafür jetzt die Zirkelpfade des Himmels Sein Logbuch vermerkt einen geschweiften Kometen und den kategorischen Satz der Mond sei ein Kunstwerk der Erde (LW 56)
Allerdings stammt der ›kategorische Satz‹ nicht von Egelhofer, sondern dem Frühromantiker Johann Wilhelm Ritter, der in seinen Fragmenten aus dem Nachlasse eines jungen Physikers (1810) festhält: »Der Mond ist ein Kunstwerk der Erde. Die Geschichte der Kunst auf Erden ist die Geschichte des Mondes, den die Erde sich setzt, oder der Reihe solcher Monde.« Diese Stelle liefert zugleich ein Beispiel dafür, wie der Großvater für den zum Akademiker gereiften Enkel sozusagen eine Türöffnerfunktion besaß. Der durch dessen naturkundliche Schule gegangene Sebald bewahrte sich zeitlebens ein Interesse an Autoren jenseits des wissenschaftlichen und akademischen Mainstreams.
Aberglaube: die andere Ordnung des Wissens
71
Autodidakten, Dilettanten, Amateure und mavericks jeder Art waren für Sebald grundsätzlich von Belang, weil er den Verdacht hegte, daß ihre vom offiziellen Diskurs disqualifizierten Thesen und Theorien ein ungenutztes Erkenntnispotential böten. Bereits in seiner Dissertation von 1973 bekräftigte er programmatisch: »It is precisely the aprofessional dilettantism which sometimes affords a prospect undreamed of by professional criticism.« Bei der Arbeit an meiner Dissertation über Gerhard Roth wiederum riet er zu, mich mit dem steirischen Bauern Franz Gsellmann und dessen ›Weltmaschine‹ zu beschäftigen, einem aus den verschiedensten technischen Bauteilen, Schrott und Spielzeug, odds and ends wild zusammengebastelten Werk der Art brut par excellence. Dieses nämlich repräsentiere ein aufschlußreiches Parallelprojekt zum literarischen Vorgehen von Roth, der für den Landläufigen Tod ebenfalls alle möglichen ›Fundstücke‹ aus dem steirischen Provinzleben zu einem Romanwerk zusammengefügt habe und so eine literarische ›Weltmaschine‹ erzeuge. Ein anderes Exempel für Anregungen außerhalb der anerkannten Wissenschaft liefert der belgische Amateurhistoriker Alfonse Huyghens. Dieser vertritt, so erläutert Sebald, die Außenseiter these, daß »sämtliche von dem Franzosenkaiser in den europäischen Ländern und Reichen bewirkten Umwälzungen auf nichts anderes zurückzuführen waren als auf dessen Farbenblindheit, die ihn Rot nicht unterscheiden ließ von Grün. Je mehr das Blut floß auf dem Schlachtfeld, so sagte der belgische Napoleonforscher zu mir, desto frischer schien ihm das Gras zu sprießen.« (CS 17) Dies war insofern gelogen, als er niemals persönlich auf Huyghens getroffen war; was wiederum wohl daran gelegen haben dürfte, daß Huyghens höchstwahrscheinlich eine Erfindung Sebalds ist. Jedenfalls ›übersetzte‹ er die These in ein spätes Mikro poem:
72
2 Großvater
Es heißt daß Napoleon farbenblind war & Blut für ihn so grün wie Gras (U 49)
Nicht nur in den literarischen, auch in den literaturkritischen Schriften bezieht sich Sebald des öfteren auf Randfiguren und Außenseiter des Wissenschaftsbetriebs. Figuren wie den Paläoanthropologen Rudolf Bilz, von dem noch später die Rede sein wird. Immer wieder verweist Sebald in seinen Essays auf Theoriemodelle, die er zwar korrekt als »Konjekturen« kennzeichnet, damit aber keineswegs disqualifizieren will. So etwa, wenn er sich auf die parawissenschaftlichen Schriften von Gregory Bateson zum Konzept der Beziehungsmuster bezieht, das wesentliche Aufschlüsse zur Koinzidenzpoetik liefert, da sie den Zufällen ihre Zufälligkeit abspricht, um vielmehr einen tieferen Sinn in ihnen zu erkennen: »Wenn sich bestürzende Koinzidenzen ergeben, hat man immer das Gefühl, daß sie doch etwas bedeuten müssen. Aber man weiß nicht, was.« (G 74) Ein wesentlicher Impetus im Schreiben Sebalds war die versuchsweise tastende Rekonstruktion und Deutung der undurchschaubaren »Verbindungslinien zwischen weit auseinanderliegenden Ereignissen, die mir derselben Ordnung anzugehören schienen.« (SG 107) Sven Meyer hat daher völlig zu Recht die »Eskamotierung unliebsamer Elemente« aus dem Werk Sebalds beklagt und dies am Fallbeispiel des häretischen Naturwissenschaftlers Rupert Sheldrake nachgewiesen, der – wie Sebald selbst konzediert – einen wesentlichen Einflußfaktor auf sein Denken darstellt.
Aberglaube: die andere Ordnung des Wissens
73
Sheldrakes von der scientific community als Esoterik geächtete Theorie vom morphogenetischen Feld vermag durchaus schlüssig zu erklären, was Sebald in seinem Essay über Robert Walser als ganz entscheidende Frage aufwirft, nämlich, »wie über den Raum und die Zeiten hinweg alles miteinander verbunden ist, das Leben des preußischen Schriftstellers Kleist mit dem eines Schweizer Prosadichters, der behauptet, Aktienbrauereiangestellter gewesen zu sein in Thun, das Echo eines Pistolenschusses über dem Wannsee mit dem Blick aus einem Fenster der Heilanstalt Herisau, die Spaziergänge Walsers mit meinen eigenen Ausflügen, die Geburtsdaten mit denen des Todes, das Glück mit dem Unglück, die Geschichte der Natur mit der unserer Industrie, die der Heimat mit der des Exils.« (LH 162/63) Offenkundig läßt sich so eine Linie ziehen von der vom Großvater übernommenen Neigung zu Volkswissen und Aberglauben über Sebalds Präferenz für wissenschaftliche und literarische Dilettanten bis hin zu seiner eigenen Randstellung als Auslandsgermanist, der sich durch seine stets steilen, mal überzeichneten und mal höchst zutreffenden Thesen ebenso in eine literaturwissenschaftliche Außenseiterposition manövriert hatte. Von einer solchen Kontinuität aber will man in der überbordenden Sebald-Philologie nichts wissen; Offenkundigkeiten wie Benjamin und Adorno werden ad nauseam als Bezugspunkte erforscht, und auch, daß Lévi-Strauss mit seinem Konzept der bricolage entscheidend war für Sebald, hat sich von Doktorand bis Professorin längst rumgesprochen. Die vorgenannten Namen aber fehlen. Warum? Vielleicht, weil die Klärung ihrer Bedeutung das vorherrschende Bild von Sebald verändern würde. Sicherlich spielt auch eine Rolle, daß sie als Außenseiterfiguren als irrelevant betrachtet werden. Oder einfach unbekannt sind. Die Aufmerksamkeit Sebalds für disqualifizierte Positionen besitzt nicht zuletzt eine moralische und ethische Dimension. Im zuvor schon zitierten Essay über Roths Landläufigen Tod würdigt Sebald ausdrücklich, daß sein österreichischer Autorenkollege in
74
2 Großvater
diesem wundervollen Romanwerk »der Kunst des Schreibens viel von ihrer Würde zurückgibt, einer Würde, die damit zu tun hat, daß man standhaft an verlorenen Positionen festhält und sich seinen Aberglauben nicht nehmen läßt.« (UH 161)
DA CAPO: TROST & TRAUERMARSCH Auf Korsika, genauer gesagt: in Piana, begibt Sebald sich abends auf den Hof der verwahrlosten Schule, la cour de l’ancienne école, wo der Zirkus seine Station macht. Daß er Zirkusvorführungen, und je unprofessioneller desto besser, sehr geliebt hat, erzählte mir Sebald, als wir einmal über die Erzählung Circus Saluti von Gerhard Roth sprachen. Er hielt sie, ganz Kind noch insofern, für magische Orte. Der Zirkus von Piana hat seine Vorliebe fürs Circensische ganz und gar bestätigt. Sebald wird Zeuge faszinierender Darbietungen, voller Eleganz und doch rührend in ihrer Schlichtheit. Tränen fließen. Irgendwann tritt dann eine ramponierte Musikgruppe mit kaum weniger heruntergekommenen Instrumenten auf, »einer riesigen, mit schwarzem Isolierband geflickten Baßgeige, einer Ziehharmonika, einer Blechpfeife, einer verbeulten Tuba & einem Xylophon.« (KP 185) Als die leicht schäbige Truppe zu spielen beginnt, ereignet sich etwas Wundersames: »Bereits beim ersten Stück war mir, als hörte ich etwas seit langem Verklungenes & mir dennoch zutiefst Vertrautes, eine Art Dorfmusik, wie sie entsteht, wenn keiner der Spielenden die Notenschrift kennt & die Instrumente ein bißchen verstimmt & aus dem Leim gegangen sind. Die Akkorde & Töne, die sie aneinanderreihten, hatten eigenartige Farben, halb aus Afrika, schien es mir, & halb aus dem Alpenland. Manchmal glaubte ich, ein Kirchenlied zu hören oder die Drehung eines Walzers, dann wieder die schleppenden Takte eines Trauermarsches, wo die im
Da Capo: Trost & Trauermarsch
75
letzten Geleit Gehenden bei jedem Schritt den Fuß, eh sie ihn aufsetzen, kaum merklich einhalten in der Luft. Jedenfalls war es, als klänge diese seltsame Serenade zu uns herüber aus einer um vieles langsameren Welt & als bringe sie einen Trost, von dem fast niemand mehr weiß.« (KP 185/87) Man geht, so denke ich, nicht fehl, wenn man aus dieser Musik, von der Sebald sagt, sie klinge geradezu »wie ein Abgesang auf das ganze Leben« (KP 187), einen Widerhall heraushört jener Zithermusik, mit welcher der kleine Winfried damals seinen Großvater, gleichsam als Psychopompos, in jene andere Heimat des Menschen geleitete, die der Tod ist.
3 Bäume
»I
ch fühle mich den Bäumen verbunden«, so zitiert der Erzähler der Ringe des Saturn aus den Memoiren des Grafen von Chateaubriand. »Wie Kinder kenne ich sie alle bei ihren Namen und wünsche mir nur, daß ich einmal sterben darf unter ihnen.« (RS 312) Wie stets bei Sebald, reflektiert das, was die herbeizitierten Gewährsmänner sagen, die eigene Haltung. Ein solch schöner Tod war ihm freilich nicht vergönnt. Sebald fühlte sich wie Chateaubriand den Bäumen verbunden. Sie waren für ihn so etwas wie Freunde und Partner. Mehr noch: Schicksalsgenossen, für die er Mitleid empfand. Denn für Sebald verband sich mit ihnen eine Form der Genossenschaft, in seinen Augen spiegelte sich im Schicksal der Bäume das Schicksal unserer Spezies. Die Rücksichtslosigkeit, mit welcher der Mensch gegen sie vorgeht, um sie dem Fortschritt zu opfern, hat ihn tief geschmerzt. Bäume können sich nicht wehren. Seine Besorgnis verband ihn mit anderen Geistesbrüdern, die gleich Chateaubriand ausgeprägte Arbophile waren. So wie Michael Hamburger, dem Sebald in den Ringen des Saturn ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Beide Freunde sorgten sich ernsthaft um die »endgültig der Zerstörung überantwortete Welt der höheren Pflanzenarten: der grünen Bäume, denen Michael, nicht nur als Repräsentanten ihrer jeweiligen Spezies, sondern sozusagen als beseelten Individuen einige seiner schönsten Gedichte gewidmet
78
3 Bäume
hat. Es gibt eine Fotografie, auf der Michael zu sehen ist vor einem mächtigen Maulbeerbaum in seinem Garten. Bald nachdem diese Aufnahme gemacht worden war, wurde der Baum in einer Sturmnacht zu Boden gedrückt, hielt aber jahrelang noch aus gegen den Tod. ›Besser sehen wir jetzt‹, schreibt Michael, ›was bleibt. Weniger als der gewesene Baum und mehr doch durch die Verminderung, an die Erde gelegt, gebettet ins Gras, bei Mohn und bei saftdunklem Balsam, dort, wo der Schatten war, den größeres Gedeihen einst warf.‹« (SM 344) Bleiben wir daher bei Baumfotos mit Schriftstellern: An einer emblematischen Stelle in Die Ringe des Saturn ist Sebald selbst zu sehen, wie er, Anfang vierzig, in weißem Sommerhemd und heller Hose vor einem mächtigen Baumstamm steht. »Diese Aufnahme wurde vor zirka zehn Jahren in Ditchingham gemacht«, erklärt er, und beklagt weiter: »Die libanesische Zeder, an die ich, in Unkenntnis der unguten Dinge, die seither geschehen sind, gelehnt stehe, ist einer der bei der Anlage des Parks gepflanzten Bäume, von denen so viele sonst schon verschwunden sind. Etwa seit der Mitte der siebziger Jahre hat das Abnehmen der Bäume sich zusehends beschleunigt, und insbesondere unter den in England häufigsten Baumarten ist es zu schweren Einbrüchen, ja in einem Fall sogar zu einer so gut wie völligen Ausrottung gekommen.« (RS 312/13) Gemeint ist die »von der Südküste ausgehende holländische Ulmenkrankheit«, welche zur Mitte der siebziger Jahre seine heimatliche Grafschaft Norfolk erreichte, »und kaum waren zwei, drei Sommer vergangen, gab es in unserem Umkreis bald keine lebende Ulme mehr.« (RS 313) Sebald wird dabei auch unausgesprochen an den wohl schönsten Teil von Norwich gedacht haben, nämlich die mittelalterliche Straße Elm Hill, in der sich das noch zu Tudorzeiten erbaute Britons Arms befindet, ein wunderbar altmodischer tea room. Der einen Hügel hinaufziehende Straßenzug trägt seinen Namen wegen der Ulmen, die seit Anfang des sechzehnten Jahrhunderts stets auf dem kleinen Platz vor dem tea room standen.
3 Bäume
79
Doch der letzte Vertreter dieser vormals illustren Reihe wurde ebenfalls von der Dutch elm disease hinweggerafft. Auch in Deutschland stand Ende der siebziger Jahre das Thema Waldsterben hoch im ökologischen Kurs, wobei es jedoch eher um den ›sauren Regen‹ ging. So oder so: Bäume verschwanden. Und Sebald sah dies als das letzte Kapitel der Jahrtausende währenden Auseinandersetzung zwischen dem Recht der Bäume auf Existenz und den Ansprüchen der Menschen, sie abzuholzen im Namen des Fortschritts: »Der Degradationsprozeß der am höchsten ent wickelten Pflanzenarten begann bekanntlich im Umkreis der sogenannten Wiege unserer Zivilisation. Die dereinst bis an die dalmatinischen, iberischen und nordafrikanischen Meeresufer reichenden Hochwälder wurden größtenteils schon am Anfang unserer Zeitrechnung geschlagen.« (CS 39) In Schwindel. Gefühle. läßt Sebald die Figur des Salvatore fragen: »Wissen Sie auch, daß man zur Zeit Scipios von Ägypten bis nach Marokko noch im Schatten der Bäume wandern konnte? Im Schatten der Bäume!« (SG 150) Im Interview mit Joseph Cuomo erklärte er: »Organic nature is going to vanish. We see it vanishing by the yard. Once you have an eye for it, if you go to the Mediterranean you can see that there used to be forests all along the Dalmatian coast. The whole of the Iberian Peninsula was wooded; you could walk from the Atlas Mountains to Cairo in the shade at the time of Scipio.« (EM 102) Zivilisation, das ist Baumfällen. Und was von den Wäldern zu Beginn der Industrialisierung noch übrig geblieben war, wurde hemmungslos weiter dem Profitstreben geopfert. In einem Gottfried Keller gewidmeten Essay zitiert Sebald eine Aussage des Titelhelden aus dem 1886 ersterschienenen Keller-Roman Martin Salander, der angesichts der Abholzung einer ganzen Kolonie von Bäumen empört ausruft: »Das sind ja wahre Lumpen, die sich selbst das Klima verhunzen.« Sebald kommentiert dies mit den Worten: »Fast könnte man meinen, man läse einen Bericht aus der gestri-
80
3 Bäume
gen Zeitung. Es ist nicht das geringste Verdienst Kellers, daß er so früh die oft irreparablen Schäden erkannte, die die Proliferation des Kapitals zwangsläufig auslöst in der Natur, in der Gesellschaft und im Gefühlsleben der Menschen.« (LH 104) Wohin die ›Proliferation des Kapitals‹ geführt hat, zeigt sich exemplarisch anhand der Metropole New York, über die Heiner Müller einmal bemerkte: »Bevor man stirbt, sollte man New York gesehen haben, einen der großen Irrtümer der Menschheit.« Anfang Oktober 1997 hat Sebald sich davon überzeugt. Er mußte in den USA eine Lesetournee zur Bewerbung der englischen Übersetzung von Die Ausgewanderten absolvieren. (Solche schriftstellerischen Amtshandlungen hat er mir gegenüber als ihn stark belastende Verpflichtungen geschildert; vor allem wegen der klischeehaften Fragen, die man ihm nach den Lesungen immerfort stellte.) Seine Erinnerungen an die Lesung im New Yorker Goethe-Institut hat er in einem seiner entfernt erschienenen englischen Gedichte festgehalten. Mit großem Bedauern betrachtet dort das lyrische Ich »the / crippled tree / that grew in a / tub in the yard.« Ausgesiedelt in sein Plastikeimerexil erregt das nahezu blattlose Bäumchen sein Mitleid: »Practically defoliated / it was / of an uncertain / species, its trunk / & its branches / wound round with / strings of tiny / electric bulbs.« Erniedrigt dazu, bloß als Aufhängung einer bunten Lichterkette zu dienen, repräsentiert diese erbärmliche Mischung aus Natur und Technik die Schrumpfform der Präsenz der Bäume in unserem der Natur entfremdeten Leben.
URWALD ALS HEIMAT (MIT RUDOLF BILZ) Sebald war kein Baumumarmer. Der auch menschenfeindliche Charakter der Natur war ihm wohlbewußt. So etwa verspürte er in den dichten Wäldern Korsikas noch deutlich »wie die Angst vor der Verlorenheit in der Welt sich einem ums Herz legt & wird über-
Urwald als Heimat (mit Rudolf Bilz)
81
wältigt von der Ahnung, daß man gegen die fremde Natur nicht das geringste vermag.« (KP 141) Sein eigensinniger Blick auf die Welt gilt stets der anthropologischen Dimension unserer Existenz. Gattungstypologisch betrachtet, sind die einst allgegenwärtigen Urwälder der ursprüngliche Lebensraum der menschlichen Spezies gewesen. Der Auszug aus den Wäldern markiert insofern den Punkt unserer Entzweiung von der Natur als der ersten Heimat der menschlichen Rasse. Ein mittlerweile in Vergessenheit geratener Wissenschaftler, der Mediziner und Anthropologe Rudolf Bilz, ist Sebalds wichtigster Gewährsmann für diese Sicht gewesen. Die Schriften von Bilz haben eine Vielzahl von Spuren in seinem Werk hinterlassen, denen bislang nicht wirklich nachgegangen wurde. Vielleicht, weil man sie gar nicht erst erkannt hat. Vielleicht, weil der Name dieses grenzgängerischen Außenseiters des Wissenschaftsbetriebs in den Geisteswissenschaften nie einen größeren Bekanntheitsgrad erlangen konnte. (Bezeichnenderweise sucht man bislang etwa auf Wikipedia vergebens nach einem Eintrag zu Bilz.) Wie beispielsweise bei Freuds These vom mythischen Mord am Urvater fand Sebald in Bilz’ paläoanthropologischen Schriften ein Erklärungsmodell, das in spekulativer Manier weit über das empirisch Belegbare hinausgreift, um objektive Wissenschaft mit subjektiver Konjektur zu verbinden. Auf den unorthodox denkenden Sebald, der gerade das spekulative Wissen der Frühromantik wertschätzte, wirkte dergleichen sehr anziehend. Ebenso ahmte Sebald ein Muster nach, das Walter Benjamin geprägt hatte, indem dieser die Schriften des Schweizer Matriarchatsforschers Johann Jakob Bachofen ernstnahm, die seinerzeit als spekulativer Unfug verlacht wurden. Sebald hatte sich, wie man im heutigen Wissenschaftsdenglisch sagen würde, bereits als Post-Doc mit den Theorien von Bilz beschäftigt und dessen im Suhrkamp Verlag erschienene Werke gelesen. Sich auf Bilz’ Theorien zur Paläanthropologie beziehend,
82
3 Bäume
ohne aber seinen Namen zu nennen, schreibt er in dem im Herbst 1974 verfaßten Aufsatz zu Peter Handkes Sprechstück Kaspar: »Die Anthropologie mutmaßt, daß das Ausgesetztsein in eine Situation der Baumlosigkeit, in der jede Flucht nach oben abgeschnitten war, zur Erdichtung der Mythologeme führte. Kafkas in die menschliche Gesellschaft verschleppter Affe erläutert sehr ähnliche Zusammenhänge in seinem Bericht für eine Akademie. Es war die Ausweglosigkeit, die ihn, der ›doch so viele Auswege bisher gehabt‹, dazu zwang, selber zum Menschen zu werden.« (CS 60) Im Achternbusch-Essay Die Kunst der Verwandlung folgt Sebald der von Bilz geäußerten Ansicht, daß der in der Vorgeschichte des Menschen vollzogene Auszug aus den Wäldern in die Steppe einer erzwungenen »Exilierung in die Baumlosigkeit« gleichgekommen sei, die als eine eminente, ja katastrophale Verlusterfahrung empfunden wurde. Die Spezies sei so aus dem Gleichgewicht geraten. Bilz zufolge löste dies die Erfindung der sogenannten Mythologeme aus, mit denen der Verlust kompensiert werden sollte. Diese Mythologeme nahmen zunächst die Form wahnhafter Vorstellungen an, wie insbesondere den Glauben an Götter. Über die Jahrtausende der Evolution geronnen sie schließlich zu allgemein anerkannten, nichtsdestoweniger aber wahnhaften Überzeugungen, die nunmehr etwa als philosophische Konzepte wie Ewigkeit, Gerechtigkeit oder Wahrheit firmieren. Die Kunst samt deren Erlösungsanspruch rechnete Sebald ebenso zu den Mythologemen. Denn sie gehört zu den Kategorien, die uns in einer kontingenten Welt Halt geben; auf individueller Ebene, aber auch, was unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt betrifft. Kehren wir dies eingedenk zurück in eine primordiale Wildnis, wie sie die urtümlichen Wälder auf Korsika heutzutage noch halbwegs repräsentieren, kommt dieses stammesgeschichtlich verschüttete Erbe wieder hoch. Die Rückkehr an den Ausgangspunkt unserer Spezies verursacht existentielle Angst.
Wälder in England & auf Korsika
83
In der fulminanten Schlußpassage der Aufzeichnungen zur ›Natur- und Menschenkunde der Insel Korsika‹ faßt Sebald diese Einsicht mit unverkennbarem Anklang an Bilz zusammen: »Vieles spricht dafür, daß wir nun Fremde sind in den Wäldern, daß wir im Grunde unseres Herzens nichts so sehr fürchten wie das ewige Grün, & wahrhaft zuhause uns nur da wissen, wo es brennt, wo wir ein Feuer legen können & den Rauch in den Nüstern spüren. Bezeichnender als jede andere Eigenschaft ist für unsere Art von Anfang an die Pyromanie. Nur vermittels des Feuers konnten wir vorgehen gegen die Wildnis, in der auch wir einmal wohnten & aus der wir durch einen in eine heillos defizitäre Existenz uns stürzenden Entwicklungsschub verbannt worden sind.« (KP 209) Was sich an diesem Zitat zeigt, ist nicht nur, daß Sebald frühe Lektüren wissenschaftlicher Texte für sein späteres literarisches Schreiben fruchtbar machte. Es unterstreicht auch, daß er sich nie wirklich von den prägenden Einflüssen, welchen er als Nachwuchsgermanist ausgesetzt war, hat emanzipieren können. Sein späteres Werk ist eher eine große, variantenreiche Ausfaltung denn eine Weiterentwicklung seiner Anfänge. Weshalb es umso wichtiger ist, seine frühen Lektüren – jenseits der auf der Hand liegenden Bezugnahmen auf Benjamin et al. – zu (er)kennen.
WÄLDER IN ENGLAND & AUF KORSIKA In England, zumal in East Anglia, wo Sebald »in einer meist grau überwölkten Grafschaft« (SG 39) lebte, gibt es keine Wälder mehr. Zumindest keine Wälder, die diesen Namen verdienen. Mögen die Deutschen etwa den Sherwood Forest wegen Robin-Hood-Verfilmungen für ein legendär-urtümliches Waldgebiet halten, erweist dieser sich bei einem Besuch als nicht mehr als ein überall von Straßen, Wanderwegen und Naturlehrpfaden durchzogener, vergleichsweise kümmerlicher Forst.
84
3 Bäume
Oder man denke an den Thetford Forest in Suffolk, das Sebalds Wohnort nächstgelegene Waldgebiet, welches an deutschen Wald-Standards gemessen kaum mehr als einen Witz darstellt. Solche englischen Wälder, sie sind nur kümmerliche Reste, die heute übriggeblieben sind nach »der über viele Jahrhunderte, ja über Millennien fortschreitenden Zurückdrängung und Zerstörung der dichten Wälder, die nach der letzten Eiszeit sich ausgebreitet haben über das gesamte Gebiet der britischen Inseln. In Norfolk und Suffolk sind es hauptsächlich Eichen und Ulmen gewesen, die über die Ebenen und in ununterbrochenen Wellen über die leichten Anhöhen und durch die Senken gingen bis an das Ufer des Meers.« (RS 201) Neben den Siedlern, die damit begannen, die Waldgebiete zurückzudrängen durch Brandrodung zur Gewinnung von Ackerland, gab es in England viel später noch zwei Gründe dafür, radikal abzuholzen: Man benötigte Holz als Material für den Schiffsbau, war doch das große Britannien eine seafaring nation. Der imperiale Anspruch wurde nicht zuletzt um den Preis der Wälder erkauft. Die Industrialisierung bedeutete dann den nächsten Kahlschlag: Die beständig laufenden Dampfmaschinen der Fabriken brauchten Holzkohle, um das »wahrhaftig / grenzenlose Wachstum / der Industrie« (NN 83) zu befeuern. Daher die fehlenden Wälder. Diese Erfahrung weitreichender Baumlosigkeit gilt es zu bedenken bei Sebald, der sein Erwachsenenleben weitgehend in der flachen, von vereinzelten Kanälen durchzogenen Marschlandschaft von East Anglia verbrachte. Das, was ›Wald‹ eigentlich bedeutet, konnte für ihn nur fortbestehen als »Erinnerungsbild an einen Wald im Innerfern, durch den ich als Kind einmal mit dem Großvater gegangen bin.« (CS 40) Das änderte sich, als er im September 1995 – und im Jahr darauf nochmals – nach Korsika reiste. Offenkundig war seine Absicht, nach dem Muster der »englischen Wallfahrt«, wie es im Untertitel von Die Ringe des Saturn heißt, ein essayistisches Reisebuch über
Wälder in England & auf Korsika
85
die Mittelmeerinsel vorzubereiten. In den folgenden Monaten trug Sebald »allerhand Zeug zusammen zur Natur- und Menschenkunde der Insel Korsika«, wie er 1996 an den befreundeten Übersetzer Wolfgang Schlüter schrieb. Nach anderthalb Jahren Arbeit und einem zweiten Besuch auf der Mittelmeerinsel erklärte er das Vorhaben jedoch für gescheitert: »Je mehr ich daran herumbastelte, desto minder kam es mir vor. Jetzt muß ich etwas neues anfangen & hoffe, daß es mir nicht noch mal so geht«, so erneut in einem Schreiben an Schlüter. Die Fragmente dieser für gewöhnlich als Korsika-Projekt bezeichneten Aufzeichnungen konnten daher erst aus dem Nachlaß erscheinen. Sie sind zu finden im Katalog zur Sebald-Ausstellung Wandernde Schatten, die das Deutsche Literaturarchiv in Marbach im Winter 2008/09 zeigte. Einzelne Teile daraus erschienen aber bereits 2003 im von Sven Meyer herausgegebenen Sammelband Campo Santo. In Sebalds Werk nimmt das Korsika-Projekt eine eigentümliche Stellung ein – wie ein Platzhalter verweist es auf die Richtung, in welche es sich hätte fortentwickeln können, wäre er während der Arbeit am Korsika-Buch nicht in eine Krise geraten. Eine Krise, aus der er sich zunächst befreite, indem er 1998 den Essayband Logis in einem Landhaus zur alemannischen Literatur als gleichsam erste Lieferung an seinen neuen Verlag zusammenstellte. Mit Austerlitz lieferte Sebald 2001 seinem deutschen Verlag wie dem amerikanischen Agenten den von ihm erwarteten, gut vermarktbaren Roman, der sich jedoch in doppelt tragischer Weise als Endpunkt seines Werks erwies. Der experimentell zwischen Autobiografie, Literatur und Literaturkritik oszillierende Band Logis in einem Landhaus hingegen enthält mehrere Essays, die man in jeder Hinsicht seinen besten Erzählungen an die Seite stellen kann. Teils übertreffen sie sogar – wie beim berührenden Aufsatz über Robert Walser – manche seiner rein literarischen Texte. Wie dieser Essayband und genauso das Korsika-Projekt demonstrieren,
86
3 Bäume
hätte sich sein Werk also auch in ganz andere Richtungen weiterentwickeln können als der ›Endpunkt‹ Austerlitz zunächst vermuten läßt. Warum aber Korsika? Sebalds Interesse an Napoleon, den er – übrigens in Übereinstimmung mit Elias Canetti – als entscheidenden Vorläufer von Hitler (und anderen blutrünstigen Machthabern des zwanzigsten Jahrhunderts) betrachtet hat, scheint in seinen literarischen Texten immer wieder durch. Für Sebald markiert das napoleonische Zeitalter jenen Punkt, an dem die ›abschüssige Bahn‹ der europäischen Unglücksgeschichte seit der Ära der Aufklärung ihren Ausgang nahm. Auch im Korsika-Projekt spielt der empereur eine Rolle. In Kleine Exkursion nach Ajaccio schildert Sebald seinen Besuch im Musée Fesch, das dem verklärenden Andenken an Napoleon gewidmet ist. Es liefert ein Musterbeispiel für die Glorifizierung des Monumentalen und Heroischen, wie sie typisch ist für die traditionelle Geschichtsschreibung. Die Idolisierung eines Massenmörders. Ungleich wichtiger aber ist für Sebald die Natur Korsikas. Seit jeher steht Korsika für die Erhaltung einer reichhaltigen Fauna und Flora, die den kontinentaleuropäischen Naturzerstörungen getrotzt hat. Die Insel bedeutete für Sebald eines der Zeitwellentäler, die ihn besonders anzogen. Angeregt haben werden ihn die Reiseberichte aus dem neunzehnten Jahrhundert, so etwa Edward Lears Journal of a Landscape Painter in Corsica von 1870 oder das Buch Corsica. Aus meiner Wanderschaft im Sommer 1852 von Ferdinand Gregorovius. Sie gehören in die Reihe der historisch noch weiter zurückreichenden Berichte über die korsische Naturlandschaft, aus denen sich vor allem die Vision eines fast schon vorzivilisatorischen Urzustands undurchdringlicher Wälder herausbildet. Kein Wunder insofern, daß Sebalds eigener Bericht über die Waldnatur Korsikas signalhaft mit der Märchenformel anhebt (und mit einem Kopfnicken an Bilz schließt): »Es war einmal eine Zeit, da war Korsika ganz von Wald überzogen. Stockwerk um Stock-
Wälder in England & auf Korsika
87
werk wuchs er Jahrtausende hindurch im Wettstreit mit sich selber bis in eine Höhe von fünfzig Metern und mehr, und wer weiß, vielleicht hätten sich größere und größere Arten herausgebildet, Bäume bis in den Himmel hinein, wären die ersten Siedler nicht aufgetreten und hätten sie nicht, mit der für ihr Geschlecht bezeichnenden Angst vor dem Ort ihrer Herkunft, den Wald stets weiter zurückgedrängt.« (CS 39) Das Feuer, von dem in einem nachfolgenden Essay die Rede noch ausführlicher wird sein müssen, war das zerstörerische Instrument des Menschen im Kampf gegen den Wald: »Ungefähr vor viereinhalbtausend Jahren, einer kurzen Frist, wenn man die Entwicklungszeiten der höheren Vegetationsformen bedenkt, wurden die ersten Waldstücke über den Küstensäumen der Insel durch Brand gerodet, & seither hörten die Feuer nicht auf. Die wunderbaren korsischen Macchienwälder, in denen Erdbeer-, Weihrauch& Wacholderbäume, Zypressen, Ginster, Stechpalmen, Oleander, Erikastauden, Rosmarin & Sonnenrosen, Geißblatt & Clematis ein undurchdringliches, von einzelnen weitausladenden Sternkiefern, Steineichen & Kastanien galerieartig überragtes Gebüsch bilden, sind selber bereits die erste, den ursprünglichen Hochwald ab lösende Stufe der Degradation.« (KP 207) Von den Tannen, die »in ihrem mehr als ein Millennium dauernden Leben beinahe sechzig Meter hoch geworden waren« (CS 40), schien bald aber keine Spur mehr auffindbar auf der Insel. Allenfalls die Baumbestände in den unzugänglichsten Gegenden wie etwa dem Wald von Bavella vermittelten noch eine gewisse Zeit lang einen Eindruck von der Mächtigkeit der korsischen Wälder. Bewohnt waren diese von einer Tierwelt sondergleichen; frühere Reisende berichten von einem nachgerade unfaßbaren Reichtum an Wild: »Ungemein zahlreich sind hier einst die Steinböcke gewesen, über den Felsstürzen kreisten Adler und Geier, Zeisige und Finken sprangen zu Hunderten auf dem Walddach herum,
88
3 Bäume
Wachteln und Rebhühner nisteten unter den niedrigen Stauden, und Tagfalter taumelten um einen her.« (CS 42) Von all dieser Pracht der Fauna und Flora kann Sebald gegen Ende des zwanzigsten Jahrhunderts nicht mehr viel ausmachen. Der Wald von Bavella etwa wirkt nur noch auf den ersten Blick wie von den Reisenden des neunzehnten Jahrhunderts gepriesen. Bei näherer Betrachtung findet Sebald vor allem »schmächtiges Nadelholz, von dem man nicht denken kann, daß es ein Menschenleben überdauert, geschweige denn Dutzende von Generationen.« (CS 42) Die Insel liefert so ein Paradigma für den allgegenwärtigen Destruktionsprozeß, den nicht nur die Geschichte der Industrialisierung zu verantworten hat, sondern der, ungleich länger schon, die Historie der aus den Wäldern ausgewanderten Menschheit prägt. Vereinzelt stößt Sebald aber noch auf einige Überbleibsel einer von naturbelassener Schönheit geprägten Welt. Staunenden Auges erblickt er »die in den Beschreibungen Korsikas immer wieder gerühmten Schwarzkiefernbestände, Relikte aus einer längst vorübergegangenen Zeit, mit einem aus prachtvollen Wipfelsträußen gebildeten Dach, das von vollkommen geraden, vierzig bis fünfzig Meter hohen Stämmen getragen wird, wie ich ein paar Tage später selber gesehen habe, als ich so seltsam verlangsamt wie ein Taucher auf dem Boden des Meers, durch die Waldungen von Aïtone gewandert bin unter dem leisen Rauschen der weit droben sich regenden Kronen.« (KP 175). Die poetische Metapher des Tauchers im Laubmeer ist eigentümlich, eine typisch Sebald’sche Vorstellung. Und ein wunderschönes Bild obendrein. In der zweiten Nachlaßfassung nimmt er es wieder auf: »Das stille Strömen in den Zweigen & Nadeln hoch über mir war wie das Rauschen in einer Muschel, & ich selber kam mir vor wie ein Taucher, der sich mit halb schwebenden Schritten bewegt über den Boden des Meers. Fast konnte ich durch das Glas meines Tiefseehelms die Luftblasen aufsteigen sehen, & wenn auf
Wälder in England & auf Korsika
89
einmal der Kiel eines Ozeandampfers durch die gleich riesigen Wasserpflanzen hin- & herwogenden Bäume geglitten wäre, ich glaube, es hätte mich nicht gewundert. Von einem seltsamen Fließen umgeben war ich in einer anderen, gewissermaßen submarinen Zeit, in der alles viel langsamer sich abspielte, ohne Anstrengung, mit einer im wirklichen Leben nie zu erreichenden Leichtigkeit.« (KP 193) Nicht nur an die in Austerlitz präsenten, wundervollen Schilderungen subaquatischen Lebens läßt diese Passage denken. Sie gehört namentlich in die Reihe der Beschreibungen – oder soll man besser sagen: Beschwörungen – einer Erlösung von den Bedrückungen profaner Existenz in jenen transzendenten Momenten, die Sebald sonst nur in der Literatur verortet: Momenten, in denen wir von einer Leichtigkeit erfaßt werden angesichts von Kunst, die das befreiende Ideal der Transparenz erfüllt, eine völlige Schwerelosigkeit oder Luftigkeit zu erzeugen. Als Modell einer solchen Kunst benannte er gegenüber Sarah Katafou das Wespennest: »It weighs nothing. For me a wasp’s nest is a kind of ideal vision; an object that is extremely complicated and intricate, made out of something that hardly exists.« Literarische Zauberei mit Worten. Was Sebald seinem Geistesbruder Robert Walser zuschrieb, war sein eigener, tiefster Wunsch: »Sein Ideal war die Überwindung der Gravitation, die Verwandlung von etwas sehr Schwerem in etwas beinahe Gewichtsloses.« (LH 141) Verbunden mit dem wieder und wieder auftauchenden Motiv der Levitation ist die erhöhte Sicht aus der Vogelperspektive. Eine Aussicht, die es ermöglicht – wie es etwa in Nach der Natur heißt – »jene Seite des Lebens zu sehen, / die man vorher nicht sah.« (NN 98) Denn, so eine an der Höhenflugprosa von Thomas Browne geschulte Einsicht: »Je mehr die Entfernung wächst, desto klarer wird die Sicht.« (RS 30) Und noch ein Drittes tritt bei Sebald hinzu, wenn es um Levitation und Höhensicht geht: die Erfahrung einer Verlangsamung
90
3 Bäume
der Zeit, wie er sie bei seinen Wanderungen im urtümlichen Wald von Aïtone erlebt. Diese Retardierung, ein Komplement des wundersamen Gefühls der Levitation, vermag nämlich das Joch der Sterblichkeit von uns zu nehmen. Denn zumindest vorübergehend wird das Mahlwerk der Zeit aufgehalten.
LITERARISCHES ARBORETUM Bäume also. Sebalds Bücher sind gleichsam durchwachsen von ihnen. Und dies nicht nur, weil Holz den wichtigsten Rohstoff liefert für das Papier, aus dem sie bestehen. Bevor überhaupt der erste Satz in Die Ausgewanderten fällt, prangt dort die Fotografie eines Rasenfriedhofs mit einem ausladenden Baum. Diese Aufnahme, so insinuiert der Erzähler, soll aus dem Dorf Hingham stammen. Das aber ist nur eine Finte Sebalds, um zu verbergen, daß das erste Domizil, das er bei seinem Umzug nach East Anglia fand, vielmehr im malerischen Dorf Wymondham lag. Angesichts einiger englischer Absonderlichkeiten, die ich bei der Wohnungssuche in Norwich erlebte, erzählte mir Sebald von seinen eigenen Erfahrungen bei der Wohnungssuche, die sich mit den in der Henry Selwyn-Geschichte geschilderten Vorfällen deckten. Selbst das erste Treffen mit Selwyn, der in Wirklichkeit natürlich anders hieß, hat sich tatsächlich so zugetragen: man fand ihn liegend im Gras vor, ruhend im hortus conclusus seines verwilderten Gartens. »I was counting the blades of grass, sagte er zur Entschuldigung für seine Gedankenverlorenheit. It’s a sort of pastime of mine. Rather irritating, I am afraid.« (AW 11) Die Fahrt nach Hingham unternimmt der Erzähler »unter ausladenden Eichen hindurch.« (AW 7) Hinter dem ungepflegten Garten von Selwyn mit einer Reihe Früchte tragenden Apfelbäumen liegt »ein Park mit einzeln stehenden Linden, Ulmen und immergrünen Eichen.« (AW 9) Beherrschender Baum seines Gar-
Literarisches Arboretum
91
tens aber ist eine »hohe Zeder in der südwestlichen Ecke« (AW 10). Jene nach England importierte Baumart also, vor der sich Sebald im Park von Ditchingham Lodge hat fotografieren lassen. Vielleicht repräsentiert die Zeder so etwas wie das geheime Wasserzeichen der Schriften Sebalds, denn sie taucht in eigentlich allen Landschaften, Parks und Gärten auf, die er aus eigener Anschauung schildert. So etwa dem Veroneser Giardino Giusti, in dem sich sein Erzähler in den »frühen Nachmittagsstunden auf einer steinernen Bank unter einer Zeder« (SG 80) ausruht. Im Park von Somerleyton wiederum erblickt er eine Gruppe bewunderungswürdiger Zedern, die »ihr Astwerk über nahezu einen Viertelmorgen ausbreiteten.« (RS 51) Zedern befinden sich desgleichen im Waldgarten von Ithaca, wo einige der Bäume »bis zu vierzig Meter« (AW 160) hoch sind, sowie unweit der Andromeda Lodge, wo Austerlitz unter den »einem grünen Hügelland gleichenden Wipfeln der Bäume« (A 142) neben Schirmpinien ebenfalls Zedern entdeckt. Wie kein anderer Baum ist die importierte Lebanon cedar typisch für englische Parks und Gärten. Erste Exemplare wurden im siebzehnten Jahrhundert gepflanzt und bis ins achtzehnte Jahrhundert herrschte eine veritable Zedern-Begeisterung unter Landschaftsgärtnern und Gutsherren. 1761 ließ der Duke of Richmond beispielsweise tausend Zedern im Park seines Landsitzes Goodwood House pflanzen. Das aber war in solcher Stückzahl erst möglich, nachdem man nahezu neunzig Jahre gewartet hatte, bis der erste der importierten Bäume eigene Samen produzierte. Einige der damals im Zuge der Zedern-Verrücktheit der Engländer gepflanzten Bäume stehen heute noch an Ort und Stelle; das älteste Exemplar unter ihnen stammt wohl von 1642, während die mächtigste englische Zeder im Park von Poltimore House bei Exeter steht und eine Höhe von über fünfunddreißig Metern erreicht hat. Die baumbestandenen Parks der stately homes gehören mitsamt den Naturschutzgebieten wie dem Peak District oder dem
92
3 Bäume
Dartmoor zweifellos zum Schönsten, was England zu bieten hat. (Das sollte an dieser Stelle vielleicht betont werden, ist doch sonst sehr vieles im Verschwinden begriffen, was die Attraktivität dieses Landes noch vor zwanzig Jahren ausmachte.) Was sich an der Kulturgeschichte der Zeder ablesen läßt und für Sebald große Bedeutung erlangt, ist die beträchtliche Länge der Zeiträume, in denen sich das Leben der Bäume vollzieht. Als er beispielsweise den Giardino Giusti besucht, fallen ihm die »schönen Zypressen auf, von denen die eine oder andere vielleicht an die zweihundert Jahre schon gestanden hatte an ihrem Platz.« (SG 80) Beeindruckend sind ebenfalls die dortigen Eiben: »Auf einen Zoll Eibenholz kommen nicht selten über hundert Jahresringe, und es soll Bäume geben, die gut ein Millennium überdauert und anscheinend das Sterben vergessen haben.« (SG 81) Hier wird erkennbar, weshalb Sebald den Bäumen ein eigenes Existenzrecht zuweist: sie überdauern die Zeiten. Es handelt sich um eine Frage der Ethik: Welches Recht haben wir, Lebewesen, die nicht nur schutzlos sind, sondern uns zugleich um Längen überleben, einfach zu vernichten? Müßten wir nicht vielmehr Respekt haben vor den Bäumen? Sebald jedenfalls empfand diese besondere Ehrfurcht. Seine Bewunderung zollte er ihnen in Form seiner Literatur. Man darf sein Schreiben über die Bäume durchaus als Ausdruck einer Sehnsucht sehen, nämlich des utopischen Wunsches, mit ihnen zu verschmelzen. So zumindest verstehe ich jene Passage, die davon berichtet, wie das Ehepaar bei den Selwyns ausgezogen ist, nachdem man eine neue, eigene Wohnstätte gefunden hatte: »Wir vermißten in der ersten Zeit die weite Aussicht, dafür aber bewegten sich jetzt vor unseren Fenstern die grünen und grauen Lanzetten zweier Weiden selbst an windstillen Tagen fast ohne Unterlaß. Die Bäume standen kaum fünfzehn Meter vom Haus entfernt, und das Blätterspiel war einem so nah, daß man manches Mal beim Hinausschauen glaubte, hineinzugehören.« (AW 29/30)
Im literarischen Gewächshaus: Prosa & Gurken
93
IM LITERARISCHEN GEWÄCHSHAUS: PROSA & GURKEN Doch dieses baumumstandene Haus blieb Zwischenstation. 1976 erwarben die Sebalds die etwas heruntergekommene Old Rectory, welche am Rand des Dorfes Poringland südlich von Norwich liegt. Liebevoll restaurierte man das Gebäude über Jahre hinweg und richtete es geschmackvoll mit zusammengesuchten Fundstücken aus lokalen Versteigerungen und von Flohmärkten ein. Ein in mancher Hinsicht ein exemplarisches englisches Domizil. Zu dem Anwesen gehörte ein parkähnlicher Garten von etwa einem Morgen Größe, auf dem neben einem Küchengarten, einigem Gebüsch und einem Teich ebenso ein beachtlicher Baumbestand seinen Platz fand. In den malerischen Garten mußten auch viele Jahre der Arbeit investiert werden, bis er seine endgültige Form erreicht hatte, wobei man etwa alte Nähmaschinen und anderen Müll aus dem Teich herausgefischt hatte. (Als das Haus im Juli 2014 für über eine Million Pfund zum Verkauf angeboten wurde, lobpreiste die Maklergesellschaft allein die eher scheußlichen Umbauarbeiten des neuen Besitzers, während der Umstand, daß Sebald dort vormals gelebt hatte, keinerlei Erwähnung fand.) Sebald arbeitete gerne und oft in dem Garten. Und das ganz im Sinne der Buchstellen, in denen er seinen Erzählfiguren die körperlich wie vor allem seelisch wohltuende Wirkung von Gartenarbeit zuschrieb. So berichtet Mme. Landau über Paul Bereyter, er habe »viel Zeit mit der Gartenarbeit verbracht, die er liebte wie vielleicht nichts sonst.« Dementsprechend sein Erfolg: »Die jungen Bäume, die Blumen, die Blatt- und Kletterpflanzen, die schattigen Efeubeete, die Rhododendren, die Rosensträucher, die Stauden und Boschen – es war alles am Wachsen, und nirgends gab es eine kahle Stelle mehr.« (AW 85) Auch Austerlitz findet nach seinem psychischen Zusammenbruch seelische Stärkung, indem er eine Tätigkeit in einer »Zier-
94
3 Bäume
gärtnerei am Rand eines weitläufigen Parks« aufnimmt und gar nicht mehr zu sagen vermag, was genau daran so therapeutisch auf ihn wirkt: »der sanfte, die gesamte Atmosphäre erfüllende Moosbodengeruch, die Geradlinigkeit der dem Auge sich darbietenden Muster oder das Stetige der Arbeit selber, das vorsichtige Pikieren und Umtopfen der Setzlinge, das Ausbringen der größer gewordenen Pflanzen, die Versorgung der Frühbeete und das Gießen mit der feinen Rosette, das mir von allen Geschäften vielleicht das liebste gewesen ist.« (A 335) Mir selbst, als ich nach dem Abschluß der Magisterarbeit meinen Plan einer Promotion erwähnte, riet Sebald dringend vor diesem Schritt in eine englische Universitätskarriere ab. Anstelle einer Promotion möge ich doch lieber die Tätigkeit eines Landvermessers erwägen, sagte er mit verschmitztem Lächeln (und offenkundiger Anspielung auf die Figur des K. in Das Schloß). Dieser Berufszweig nämlich habe den unübertrefflichen Vorteil, daß man – ähnlich wie ein Landschaftsgärtner – sein Leben nicht im Büro mit Formularausfüllen oder dergleichen fristen müsse, sondern an der frischen Luft in der freien Natur verbringen k önne. Das war natürlich auf seine zunehmend ungeliebte Tätigkeit an der Universität gemünzt, über die noch ausführlicher zu berichten sein wird. Es gehört zu den von Sebald beklagten bitteren Ironien, daß gerade das Schreiben von Literatur, das ihm zunächst einen Freiraum jenseits der Universität eröffnete, sich aufgrund seines Erfolgs mit der Zeit als eine neue Form der Fron erwies, nämlich die der Prosaverfertigung. Eine hervorragende Alternative zum literarischen Schreiben sei daher die gärtnerische Tätigkeit, wie er einem Interview halb im Scherz, halb ernstgemeint sagte: »Ich kann genausogut im Treibhaus arbeiten, Gurken züchten. Das hat den Vorteil: Wenn Sie eine anständige Gurke haben, dann gibt’s da keine Diskussion drüber.« (G 103)
Im literarischen Gewächshaus: Prosa & Gurken
95
Wenn Austerlitz darüber grübelt, ob er sich bei seiner Arbeit im »Bibliothekssaal auf der Insel der Seligen oder, im Gegenteil, in einer Strafkolonie befand« (A 372), so gilt diese Ambivalenz auch für Sebald. Sein Schreibplatz befand sich im ersten Stock der Old Rectory, in einem schmalen, fensterlosen Raum, in dem er hinter geschlossener Türe schrieb. Stundenlang plagte er sich mit seinen per Hand wieder und wieder umgearbeiteten Sätzen. So lange, bis alles stimmte. Weil nun die richtigen Wörter am richtigen Platz waren, Rhythmus und Satzbau perfekt saßen. Wenn Sebald am Exempel solcher Autoren wie Robert Walser oder Peter Weiss die Qualen des Schriftstellerdaseins beschwor, und zwar in wundersam schönen Worten, so gelang dies nur, weil er genau wußte, wovon er sprach. Betreffs einer poetischen Stelle in Handkes Die Wiederholung stellt er fest: »Ich wüßte nicht, daß das insbesondere für die literarische Kunst so bezeichnende Zwangsverhältnis von schwerer Fron und luftigem Zauber je schöner gefaßt worden wäre.« (UH 177) Im Essayband über die alemannischen Schriftsteller wiederum schickt Sebald seinen Aufsätzen summarisch die Feststellung voraus, daß »die in ihrer Wörterwelt gefangenen armen Schriftsteller uns doch manchmal Ausblicke von solcher Schönheit und Intensität bieten, wie sie das Leben selber kaum liefern kann.« (LH 7) Es sind just solche, aus empathischer Identifikation gewonnenen Sätze, die den Abstand markieren zur regulären Form der Literaturkritik und seine Essays zum Teil des literarischen Werks werden lassen.
96
3 Bäume
RÜCKZUGSRAUM GARTEN Auch wenn Sebalds literarisches Schreiben selbstverständlich ebenso auf Reisen in Cafés, Archiven, Hotelzimmern, Wartehallen und sonst wo stattfand, wählte er in seinen englischen Interviews wiederholt die bezeichnende Metapher des ›potting shed‹: »You start doing something about which nobody knows. You go into your potting shed«, erklärte er etwa gegenüber Eleanor Wachtel. »So the privacy which that ensured for me was something that I treasured a great deal, and it isn’t so now. So my instinct is now to abandon it all again until people have forgotten about it, and then perhaps I can regain that position where I can work again in my potting shed, undisturbed.« (EM 61) Die Metapher des Gewächshauses scheint mir bedeutsam, weil sie nicht nur eine treffende Analogie zur Entstehung seiner literarischen Texte bietet, die langsam wachsen mußten, der Hege und Pflege bedurften, bevor man sie sozusagen umtopfte, will sagen: durch Publikation in die Öffentlichkeit entließ. Entscheidend kommt hinzu, daß Sebald neben solcher Metaphorik auch die Utopie des einsiedlerischen Arbeitens in einem Garten aufruft. Das schlägt eine Brücke zu beispielshalber Henry Selwyn, der bescheiden von sich sagt, er sei »nur ein Bewohner des Gartens, a kind of ornamental hermit.« (AW 11) Auch der angebliche Nachbar mit dem kuriosen Namen Major George Wyndham Le Strange lebt zurückgezogen auf einem Gut, dessen »Gartenanlagen und Park zusehends verwilderten und verfielen.« Unbestätigten Gerüchten zufolge soll er »in seinem Garten eine Höhle ausgehoben haben, in der er dann tage- und nächtelang gesessen sei gleich dem heiligen Hieronymus in der Wüste.« (RS 82/83) Die Gärten, zumal die mehr oder weniger verfallenen, werden bei Sebald zu selbstgewählten Rückzugsräumen, in deren Isolation man sich vor den Ansprüchen der Gesellschaft flüchtet. So bezieht
Rückzugsraum Garten
97
Cosmo Solomon während des Ersten Weltkriegs »ein entlegenes Gartenhaus, die sogenannte Sommervilla.« (AW 138) Ein anderes Beispiel liefert der extravagante Schriftsteller Edward FitzGerald, der im neunzehnten Jahrhundert in Boulge Hall unweit von Sebalds Haus in East Anglia lebte. Anstelle des standesgemäßen Herrenhauses bevorzugte FitzGerald »ein winziges Cottage am Rande des Parks«, wo er »eine seine späteren exzentrischen Gewohnheiten in vielem schon vorwegnehmende Junggesellenwirtschaft führte.« (RS 237) Was er dort betrieb, wird Sebald als Idealvorstellung einer der Literatur gewidmeten Tätigkeit vorgeschwebt sein: »Meistenteils beschäftigte er sich in dieser Eremitage mit seiner in die verschiedensten Sprachen ausschweifenden Lektüre, mit dem Schreiben unzähliger Briefe, mit Notizen zu einem Lexikon der Gemeinplätze, mit dem Zusammentragen von Worten und Phrasen für ein komplettes Glossarium der Sprache der Seefahrt und des Seelebens sowie mit der Zusammenstellung von scrap-books jeder nur erdenklichen Art.« (RS 237) Der Architekturkritiker Austerlitz plädiert einmal passioniert für jene Bauwerke, »die unter dem Normalmaß der domestischen Architektur rangieren«, da sie »wenigstens einen Abglanz des Friedens uns versprechen.« Dabei bezieht er sich auf solche peripheren, zumeist in der Natur befindlichen Behausungen wie »die Feldhütte, die Eremitage, das Häuschen des Schleusenwärters, der Aussichtspavillon, die Kindervilla im Garten.« (A 31) Immer wieder erscheinen insbesondere Gartenhäuschen als ideale Plätze einer peripher-eremitischen Existenz. Die Natur als Reservat vor der von Technologie beherrschten Zivilisation beschäftigte Sebald bereits in Nach der Natur, wo sich der Reisende Georg Wilhelm Steller gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts auf die Halbinsel Kamtschatka flüchtet, um das zu tun, was Sebald mit seinem Großvater tat: Er »sammelt botanisches Material, / füllt getrocknete Samen in Tütchen, / beschreibt, rub-
98
3 Bäume
riziert, zeichnet, / zum erstenmal glücklich in seinem Leben.« (NN 64) Doch auch dort, am Ende der Welt, ist das Schicksal der Natur schon besiegelt, denn das Vordringen der Zivilisation noch in die entferntesten Winkel ist nicht aufzuhalten. Sebald kann daher nicht anders als die Natur pessimistisch zu perspektivieren: Zu Zeiten der kindlichen Exkursionen an der Seite des Großvaters schien sie noch unangreifbar, unendlich; nun aber erweist sie sich als schrumpfend, bedroht und verschwindend. Seine Klage darüber legt er etwa im Korsika-Projekt der Figur des Gerald Ashman in den Mund, der sich erinnert: »Immer hätte man bei den Uferwasen die schönste Brunnenkresse brocken können, & in dem Gehölz, durch das wir eben gegangen sind, sagte Gerald, wo der Waldboden heute bedeckt ist mit nichts als totem Geäst & trockenem Moder, wuchsen in der Zeit meiner Kindheit & Jugend Farne & Moose, blaue Hyazinthen, Buschwindrosen, Bärlauch, Salomonssiegel, Akeleien & die seltensten Pilze.« (KP 160) Selbst dort, wo der Mensch die Natur kultiviert, wird sie mittlerweile immer weiter verdrängt, »da in den meisten Parks nur noch ein Dritteil der damals gesetzten Bäume steht und wo jedes Jahr mehr an Überalterung und aus vielen anderen Ursachen zugrunde gehen.« (RS 312) Alles ist am Schwinden. Alles. Eine melancholische Einsicht, die ebenso gilt für unser persönliches Schicksal. Denn mit jedem Lebensjahr reduzieren sich die Möglichkeiten, so wie auch die lange Geschichte der Natur die Chronik eines zunehmenden Verlustes ist. »Alles aber«, bestätigt der Erzbischof Theophon gegenüber Steller, »ändert sich in das Alter, / weniger wird das Leben, / alles nimmt ab, / die Proliferation / der Arten ist bloß / eine Illusion, und niemand / weiß, wo es hinausgeht.« (NN 43)
Genozid der Bäume
99
GENOZID DER BÄUME Zu dem, was Sebald als ›Naturgeschichte der Zerstörung‹ betrachtet und in mannigfaltiger Form und vielfacher Hinsicht am Werke sieht in dem, was wir Historie nennen, gehört neben der Zerstörung der Natur durch den Menschen auch die Zerstörung der Natur durch sich selbst. Es ist die Dialektik, mit der sich die Natur eben nicht als jene lebensschöpfende Kraft darstellt, zu der wir sie gerne verklären, sondern sich vielmehr als reine, absichtslose Destruktion erweist. So wie Steller sie während der Bering’schen Nordmeerexpedition in aller Konsequenz erlebt: »Graufarbig / richtungslos war alles, ohne oben und unten, / die Natur in einem Prozeß / der Zerstörung, in einem Zustand der reinen / Demenz.« (NN 56) Exemplarisch dafür ist der »in der furchtbaren Orkannacht vom 16. auf den 17. Oktober 1987 größenteils zu Bruchholz geschlagene Wald von Rendelsham« (RS 272), wobei Sebald an dieser Textstelle ein furchterregendes Bild zerborstener Baumstämme und niedergedrückter Baumkronen in den Text montiert. Ein transatlantischer Orkan durchquerte damals England, wobei Windgeschwindigkeiten von mehr als einhundert Meilen pro Stunde gemessen wurden. Die immense Kraft des Windes entwurzelte in Großbritannien rund fünfzehn Millionen Bäume und achtzehn Menschen fanden den Tod. Auch Sebalds Ortschaft war betroffen: »Ganze Waldstücke sind wie Kornfelder niedergedrückt worden. Die über hundertjährigen Bäume, die den Spazierweg gesäumt hatten, der am Nordrand des Parks entlangführte, lagen alle, wie in einer Ohnmacht niedergesunken, am Boden, und unter den riesigen türkischen und englischen Eichen, Eschen, Platanen, Buchen und Linden war zerfetzt und zerbrochen das niedrigere Gehölz, das in ihrem Schatten gestanden hatte, die Thujen und Eiben, die Hasel- und Lorbeerstauden, Stechpalmen und Rhododendren.« (RS 317)
100
3 Bäume
Krankheitserscheinungen wie die »vom Krebs angefressenen Kastanien« (KP 152) oder Seuchen wie die holländische Ulmenkrankheit erwiesen sich so retrospektiv als unheilvolle Vorboten der völligen Zerstörung der Bäume im Herbst 1987: »Die sechs Ulmen, die den Teich in unserem Garten überschatteten, sind im Juni 1978, nachdem sie noch einmal ihr wunderbar helles Grün entfaltet hatten, innerhalb weniger Wochen verdorrt.« (RS 313) Auffällig, wie Sebald das Leiden und Sterben der Bäume beschreibt, als ob es sich um Menschen handelt. Die Ulmen werden dahingerafft, weil die Viren eine »Verengung der Kapillargefäße auslösten, die in kürzester Frist zum Verdursten der Bäume führte.« (RS 314) Diese Diagnose ist zwar grundsätzlich zutreffend. Bei Bäumen aber müßte man biologisch korrekt von Tracheen (anstelle von Kapillaren) sprechen, so wie auch das Wort ›verdursten‹ deutlich menschlich konnotiert ist. Ebenso über den Kontext des Baumsterbens hinausweisend, ist mit Bezug auf die Ulmenkrankheit die Rede von einer »völligen Ausrottung« dieser Baumart. Das aber ist ein Begriff, in dem in der deutschen Sprache mehr mitschwingt als nur das Verschwinden einer bestimmten Art von Bäumen. Auffällig außerdem, daß Sebald versucht, den Eindruck einer Kettenreaktion zu erwecken, was das Aussterben der Bäume betrifft: Das Sterben der Ulmen scheint geradezu unaufhaltsam um sich zu greifen, weitere Baumarten erfassend: »Um dieselbe Zeit begann ich zu bemerken, daß die Kronen der Eschen sich mehr und mehr lichteten und daß das Eichenlaub schütter wurde und seltsame Mutationsformen zeigte. Die Bäume selbst fingen zugleich an, direkt aus dem harten Astholz heraus Blätter zu treiben und im Sommer schon massenhaft steinharte, verkrüppelte und mit einem klebrigen Stoff überzogene Eicheln abzuwerfen.« (RS 314)
Genozid der Bäume
101
Auch die Buchenbestände sind in Mitleidenschaft gezogen, in diesem Fall allerdings durch die lange und extreme Trockenheit: »Die Blätter hatten nur noch die Hälfte ihrer normalen Größe, die Bucheckern waren fast ausnahmslos taub.« Und schließlich noch die Pappeln. »Eine nach der andern gingen die Pappeln ein auf der Weide. Die toten Stämme stehen teilweise noch aufrecht, teilweise liegen sie zerbrochen und vom Wetter gebleicht im Gras.« (RS 315) Das alles bleibt nicht ohne Folgen für die restliche Natur. Fortan, so Sebald, wirkt es, »als lebe man am Rand einer Steppe. Wo vor kurzer Zeit noch bei Anbruch des Tages die Vögel so zahlreich und lauthals gesungen hatten, daß man manchmal die Schlafzimmerfenster zumachen mußte, wo die Lerchen am Vormittag über die Felder gestiegen waren und wo man in den Abendstunden bisweilen sogar eine Nachtigall aus dem Dickicht hörte, da vernahm man jetzt kaum noch einen lebendigen Laut.« (RS 318/19) So also prozessiert die Natur gegen sich selbst. Sebald erzählt die Geschichte einer umfassenden Auslöschung, eines massenhaften Baumsterbens. Fürchterliche Krönung ist dann der vernichtende Orkan vom Oktober 1987: Frühmorgens vom wilden Tosen des Sturms und der – meteorologisch belegten – anormalen Temperaturerhöhung aufgeweckt, bietet sich Sebald beim Blick durch das vom Wind »bis zum Zerspringen angespannte Glas« der Fenster ein verstörender Anblick des Grauens: Dort, »wo zuvor die Luftwogen an der schwarzen Masse der Bäume aufgelaufen waren, sah man nur mehr den fahlbeleuchteten, leeren Horizont.« (RS 316) Seine Freunde, die Bäume, stehen nicht mehr: »Es schien mir, als hätte jemand einen Vorhang beiseite gezogen und als starrte ich nun hinein in eine gestaltlose, in die Unterwelt übergehende Szene. Im selben Moment, in dem ich die ungewohnte Nachthelle über dem Park wahrnahm, wußte ich, daß dort drunten alles zerstört war.« (RS 316) Der Ausdruck des Schocks und die symbolische Überdeterminierung der Szenerie zeigen an, daß hier mehr im
102
3 Bäume
Spiel ist als eine – im Vergleich zu anderen Gegenden der Welt – vergleichsweise glimpfliche Naturkatastrophe. Sie findet jedoch, im wörtlichen Sinne, vor der Haustür statt: »Es war im Morgengrauen, als der Sturm etwas nachgelassen hatte, daß ich mich hinaustraute in den Garten. Mit zugeschnürter Kehle stand ich lang inmitten der Verheerung« (RS 317), erinnert sich Sebald. Und in diesem Blick auf die Zerstörung schwingt mit der Blick von Benjamins ›Engel der Geschichte‹ auf die Trümmerlandschaft der Geschichte: »Dieser Sturm treibt den Engel unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.« Der Sturm, der den Baumbestand der Old Rectory hinwegraffte, so daß die Bäume, niedergedrückt von der Sturmwand, nun wie Leichen auf dem Boden lagen, war zweifellos ein Trauma für Sebald. Das zeigt sich in der Insistenz, mit der er immer wieder darauf zu sprechen kommt. Mehr noch aber daran, wie er darüber spricht: »Ich weiß nicht, wie ich den ersten Tag nach dem Sturm überstanden habe, entsinne mich jedoch, daß ich mitten in der Nacht, zweifelnd an dem, was ich mit eigenen Augen erblickt hatte, nochmals durch den Park gegangen bin.« (RS 317) Eine Zwangshandlung. Wie jemand, der gezwungen wurde, ein Zerstörungswerk mitanzusehen, das über seine Begriffe hinausgeht und dessen Konsequenzen kaum einzuordnen sind. Das schlägt eine wichtige Brücke. Nämlich die zu dem kommentarlosen, eine ganze Doppelseite füllenden Foto, das rund zweihundertfünfzig Seiten vorher in Die Ringe des Saturn zu sehen ist. Es zeigt Leichen, auf die der vorerwähnte Major Le Strange unvorbereitet stieß – so unvorbereitet wie wir als Leser beim Umblättern – als er mit seiner Einheit das Konzentrationslager
Genozid der Bäume
103
Bergen-Belsen befreite. Leichen, die wir auf dem einzigen Bild vom Holocaust sehen, das Sebald in seine Bücher eingefügt hat. Leichen, die zugedeckt in einem Waldstück liegen inmitten von Bäumen.
4 Universität
»J
a, also ich mag meinen Beruf gerne. Ich mag gerne den Kontakt mit den Leuten, mit den Studenten, und es ist ein sehr ehrlich verdientes Geld« (G 103), erklärte Sebald 1993 zu seiner Tätigkeit als Universitätsdozent. Das war spürbar, wenn man mit ihm als akademischem Kollegen oder, wie ich, als Student zu tun hatte. Sebald war unter den anderen Dozenten beliebt aufgrund seines Humors und seiner Kollegialität. Von den Hochschullehrern, die ich während meiner Studentenjahre am überlaufenen germanistischen Institut der Universität München erlebt hatte, war er meilenweit entfernt. In jeder Hinsicht. Der Berufstyp des Lehrers nun unterscheidet sich bekanntlich von den meisten Karrierewegen dadurch, daß man sein ganzes Leben lang einer Sache verhaftet bleibt, die schon in der frühen Kindheit einen beachtlichen Raum einnimmt: dem Lehren und Lernen als Prinzip der Schule. Oder im speziellen im Fall eines Germanisten wie Sebald könnte man eher sagen: dem Lesen und Lernen. Über Elias Canetti schreibt er einmal, dieser habe sich nach dem großen Debütroman Die Blendung mit voller Absicht auf solche minderen literarischen Formen wie die »des Exkurses, des Kommentars und des Fragments« konzentriert und sich dem Ideal »des Lehrers verschrieben, dessen Glück es ausmacht, daß das Lernen nicht endet, denn der Lernende ist stets auf der Reise.« (BU 101)
106
4 Universität
Auf eine solche ›Reise‹, die nichts mit der bildungspolitischen Ideologie des lifelong learning gemein hat, begab sich auch Sebald. Als er die Oberrealschule in Sonthofen im Juli 1963 mit dem Abitur verließ, um im Herbst sein Universitätsstudium in Freiburg aufzunehmen, wird er kaum geahnt haben, wohin sie ihn einmal führen sollte. Daß es Sebald weit hinauszog, lag an seinem Freiheitsdrang und seiner Neugierde auf die Welt. Es ging darum, Grenzen zu überschreiten, vor-geschriebene Modelle zu sprengen. Seine Mutter wäre völlig glücklich gewesen, erzählte er später, hätte er als einfacher Studienrat in Kempten sein Leben in der Allgäuer Provinz verbracht. Aber Sebald wollte sich nicht einengen lassen. Oder konventionelle Rollenmodelle erfüllen. Daher war auch sein Schreiben – zunächst im Bereich der Literaturkritik, später im Kontext der Literatur – immer darauf gerichtet, die Grenzen des jeweiligen Schreibmodus zu überschreiten. Oftmals ging er dabei zu weit in der literaturkritischen Anklage gegen Schriftsteller, die ihm mißfielen. Allerdings legte Sebald erst auf diese Weise offen, was anderen Literaturwissenschaftlern nie aufgefallen war. Ebenso sein literarisches Schreiben: mancher Gedanke, manche Verbindungsziehung mag unverständlich erscheinen oder nach konventionellen Vorstellungen unstatthaft sein. Entscheidend aber war, was er einmal als Schlußsatz seines Stipendienantrags an den NESTA notierte: »I was always determined to find my own way.«
UNIVERSITÄT FREIBURG: VERSCHWIEGENE VERGANGENHEIT Als sich Sebald zum Herbstsemester 1963 an der Universität Freiburg immatrikulierte, war das nur drei Jahrzehnte, nachdem Martin Heidegger dort zum Rektor berufen wurde, um im Mai 1933 seine berüchtigte Rede zu halten, in der er Größe und Herrlichkeit des nationalsozialistischen Aufbruchs beschwor. Heidegger, von
Universität Freiburg: verschwiegene Vergangenheit
107
Sebald geschmäht als »Freiburger Rektor mit dem Hitlerbärtchen« (SM 344), ist neben Ernst Jünger zeitlebens eine negative Bezugsgröße geblieben. Die Allianz von intellektuellem Geist und faschistisch-militärischem Denken, so jedenfalls sah Sebald beide Figuren, war für ihn inakzeptabel und unverzeihlich. Seine Zeit in Freiburg koinzidierte mit den vom Dezember 1963 bis August 1965 geführten Frankfurter Auschwitz-Prozessen, in denen – erstmals und viel zu spät – das ganze Grauen der Konzentrationslager öffentlich gemacht wurde. Für Sebald waren die Gerichtsverhandlungen ein entscheidender Wendepunkt, ähnlich wie der bereits erwähnte Film über die Befreiung von Bergen-Belsen, den man dem Schüler eines Nachmittags kommentarlos in der Schule gezeigt hatte. Vor dem Hintergrund der Auschwitz-Prozesse erschienen ihm die Zustände an der Freiburger Universität als paradigmatisch für die deutsche Nachkriegsgesellschaft: Das Bestreben vieler Professoren, ihre personellen Verwicklungen in den Nationalsozialismus zu verschweigen, war eine Verlängerung dessen, was den bundesdeutschen Staat in seiner verqueren Gemengelage von historischer Schuld, geleugneter Verantwortung und perfider personeller Kontinuität kennzeichnete. Als Lehrer, im Sinne einer über die reine Vermittlung von Wissen hinausgehenden Auffassung von umfassender Pädagogik, taugten seine Professoren nicht. So ist die Feststellung des Erzählers in Austerlitz zu verstehen: »Austerlitz ist ja für mich, der ich zu Beginn meines Studiums in Deutschland von den seinerzeit fort amtierenden, größtenteils in den dreißiger und vierziger Jahren in ihrer akademischen Laufbahn vorangerückten und immer noch in ihren Machtphantasien befangenen Geisteswissenschaftlern so gut wie gar nichts gelernt hatte, seit meiner Volksschulzeit der erste Lehrer, dem ich zuhören konnte.« (A 51/52) In derselben Stoßrichtung äußerte sich Sebald auch in Interviews über seine Studienzeit in Freiburg: »All my teachers had got-
108
4 Universität
ten jobs during the Brownshirt years and were therefore compromised, either because they had actually supported the regime or had been fellow travellers or otherwise been silent«, erklärte er gegenüber James Atlas. Da die Germanistik mittlerweile die Verwicklung ihrer Disziplin in den Nationalsozialismus weitgehend aufgearbeitet hat, wissen wir, daß Sebalds Pauschalurteil, wie oftmals, überzogen ist. Dennoch hatte er nicht völlig unrecht. In seinem akademischen Gesellenstück über Carl Sternheim attackierte Sebald bei jeder sich bietenden Gelegenheit den renommierten Berliner Ordinarius Wilhelm Emrich auf das Entschiedenste. Denn er hatte einen Verdacht: Die enthusiastische Parteinahme des Professors für einen jüdischen Autor, der in Sebalds Augen ein literarischer Versager war, könne eigentlich nur eine kompensatorische Wiedergutmachung für politische Vergehen während der Nazizeit sein. Das schien weit hergeholt und wird von Sebald vorsichtigerweise auch nur in einer Fußnote angedeutet. Was er damals nicht wissen konnte: Er hatte damit absolut recht. Der Adorno-Schüler Emrich war ursprünglich Mitglied des Roten Studentenbundes gewesen, paßte sich ab 1933 aber opportunistisch den neuen Machthabern an. Bereits 1935 war er der NSDAP beigetreten, der er u.a. als Zellenleiter und Blockwart diente. Er arbeitete schließlich von 1942 bis 1944 unter Goebbels als Referent am Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda, wo er vorübergehend das Hauptreferat ›Staatsfeindliches Schrifttum‹ leitete. Aufgrund seiner Verstrickungen in den Naziapparat nahmen die US-Behörden Emrich im Herbst 1945 im Rahmen der Entnazifizierung acht Monate lang in Internierungshaft. Durch eine mit erheblichem Aufwand geführte Verteidigungsstrategie konnte er sich jedoch beim nachfolgenden Verfahren vor einer Spruchkammer der Verantwortung entziehen und wurde im April 1948 von den Richtern gar als ›unbelastet‹ eingestuft. Emrich hatte das Kunststück vollbracht, seine opportunistische Kooperation mit den Nazis rückwirkend als ›stille Gegnerschaft‹, ja gar als
Universität Freiburg: verschwiegene Vergangenheit
109
verdeckten Widerstand erscheinen zu lassen. Auf seine spätere steile Karriere hatte das braune Sündenregister daher keinen Einfluß. (Übrigens war Rudolf Bilz ebenfalls in den Naziapparat involviert und hat darüber wie Emrich zeitlebens geschwiegen.) Sebald jedenfalls hat sich andere Lehrer gesucht. Und gefunden. Im Brief an Gershom Scholem erläuterte er dem Gelehrten: »Zugang zur deutschen Literatur aber fand ich, wo überhaupt, nicht vermittels der Universitätsgermanistik, sondern durch die Schriften Benjamins und Adornos, und also ist mir der landläufige literaturwissenschaftliche Parteienverkehr, der die Literatur mir fast verleidet hätte, eine eher suspekte Angelegenheit.« Adorno schrieb er Ende der sechziger Jahre einen Brief, in dem er seinem Idol erklärte, daß diese Kontaktaufnahme nicht erfolgt wäre, »wenn ich nicht auf dem Umweg über Ihre Bücher ein so großes Zutrauen zu Ihnen gefaßt hätte.« Zwar beantwortete Adorno den Brief kurz und höflich, doch die von Sebald in einem späteren Schreiben vorgebrachte Bitte um ein Gutachten erfüllte er nicht. Sebald mußte seinen Platz im akademischen Betrieb ohne die Protektion eines einflußreichen Mentors finden. Ebenso konnte er nicht auf Unterstützung von Netzwerken oder Stiftungen oder sonstigen Förderungsinstitutionen bauen. Alles war selbst und beschwerlich erkämpft. Beschwerlich und frustrierend war auch das Studium, denn von dem Erkenntnisgewinn, den sich Sebald vom Besuch der Freiburger Universität erhoffte, war nicht viel zu spüren: »Auch an der Universität erfuhr ich so gut wie nichts über die jüngste deutsche Geschichte.« (CS 249) Dazu paßte, daß es die bevorzugte Methode der Nachkriegsgermanistik war, durch werkimmanente Interpretationen alles Historische aus dem Literarischen zu exorzieren. Auch dies empfand er als unbefriedigend, weil ihm klar war, daß dies teilweise ein Reflex der Dozenten auf die eigene braune Vergangenheit war, die man lieber verdrängen und vergessen wollte. In Anspielung auf E. T. A. Hoffmanns Erzählung Der goldne Topf
110
4 Universität
beklagte er daher in seiner Antrittsrede vor dem Kollegium der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung: »Die Germanistik ist ja in jenen Jahren eine mit beinahe vorsätzlicher Blindheit geschlagene Wissenschaft gewesen. Ein ganzes Wintersemester lang rührten wir in einem Proseminar im Goldenen Topf, ohne daß auch nur ein einziges Mal die Rede auf das Verhältnis gekommen wäre, in dem diese sonderbare Erzählung stand zu den Realien der ihr unmittelbar voraufgegangenen Zeit, zu den Leichenfeldern vor Dresden und zu dem Hunger und den Seuchen, die damals herrschten in der Elbestadt.« (CS 249) Während der Freiburger Zeit lebte Sebald in einem Studentenwohnheim in der Maxstraße. (Da er in den sechziger Jahren begann, sich von Freunden ›Max‹ rufen zu lassen, mag hier ein Zusammenhang bestehen.) Er mischte in der studentischen Theatertruppe mit, die sowohl Shakespeare wie zeitgenössische amerikanische Stücke aufführte. Ebenso arbeitete er, wie schon im Gymnasium bei der Schülerzeitung, ein Jahr lang an der Freiburger Studentenzeitung mit, wo siebzehn Beiträge von ihm erschienen; neben Rezensionen auch Gedichte und kleine Prosastücke. Was einmal aus Sebald werden würde, war daraus noch nicht zu erkennen. Ein Anfang aber war gemacht. Ein Befund über seine Studienjahre deckt sich mit den Erinnerungen anderer Freiburger Kommilitonen (darunter übrigens Klaus Theweleit): »German universities in the 1960s were vastly overcrowded places, completely overrun, under sourced. You would sit in lectures with 1200 other people and never talk to your teachers.« Ganz wörtlich sollte man diese Beschreibung dennoch nicht nehmen. Jedenfalls zog Sebald seine Konsequenzen: »I decided to go to Switzerland where the conditions were much better.« Zwar blieb er nur vergleichsweise kurz in der Schweiz, eignete sich dabei die französische Sprache aber schnell und dauerhaft an. Im intellektuellen Gepäck hatte er die Kritische Theorie. Die einschlägigen Schriften hatte er in Freiburg für sich entdeckt. In einer
Zwischenspiel in Fribourg
111
Reminiszenz an seine Studienzeit hielt Sebald in Logis in einem Landhaus fest: »Nicht selten habe ich mich gefragt, wie trüb und verlogen unser Literaturverständnis wohl geblieben wäre, hätten uns die damals nach und nach erschienenen Schriften Benjamins und der Frankfurter Schule nicht andere Perspektiven eröffnet.« (LH 12)
ZWISCHENSPIEL IN FRIBOURG Die Wahl von Fribourg in der französischen Schweiz hatte einen praktischen Hintergrund: Sebalds ältere Schwester wohnte ganz in der Nähe der Universität und er konnte bei den Verwandten umsonst unterkommen. An der ›Universität zu Freiburg im Üechtland‹, wo die Germanistik auf Deutsch unterrichtet wurde, konnte man sein Studium in nur drei statt vier Jahren abschließen. Die Semester in Deutschland wurden Sebald angerechnet. Er hatte es offenkundig eilig, weil er wußte, was er zu sagen hatte. Daß Sebald in Fribourg auf internationale Professoren traf, deren politischer Leumund über jeden Zweifel erhaben war, machte einen bedeutenden Unterschied für ihn. Darunter befanden sich der Schweizer Mediävist Eduard Studer und der Anglist James Smith, ein ausgewiesener Shakespeare-Spezialist. Am wichtigsten für Sebald aber war der aus Österreich stammende Ernst Alker, ein Gegner der Nazis, der in den Jahren 1934 bis 1942 im Exil in Schweden gelebt hatte. Man muß jedoch präzisieren, daß Alkers Feindschaft mit dem Nationalsozialismus wohl aus seiner stark klerikal ausgerichteten Weltanschauung resultierte, weshalb er durchaus für den Austrofaschismus offen gewesen war. Alkers Interesse an Autoren wie Adalbert Stifter, Arthur Schnitzler, Robert Musil, Karl Kraus oder Franz Kafka dürfte jedenfalls auf Sebald abgefärbt haben, da sein Schüler ein bleibendes Interesse an österreichischer Literatur herausbildete.
112
4 Universität
Sein Studium hatte Sebald zum Wintersemester 1965/66 angetreten. Bereits im März 1966 reichte der Studienabbrecher aus Deutschland seine Carl Sternheim. Kritischer Versuch einer Orientierung über einen umstrittenen Autor betitelte Lizenziatsarbeit ein. Dafür bekam er im Herbst 1966 den Grad einer licence ès lettres mit dem Prädikat summa cum laude verliehen. Sternheim erlebte damals eine beachtliche Renaissance auf den Theaterbühnen, was ihn für Sebald verdächtig machte. Die Schriften der Frankfurter Schule lieferten Sebald das intellektuelle Rüst zeug, um den Wilhelminischen Dramatiker ordentlich in die kritische Zange zu nehmen. Allerdings tat er ihm in manchen Aspekten gehörig unrecht. Doch der kämpferische Ton, der Sebalds literaturkritische Texte der nächsten zehn Jahre (und darüber hinaus) prägen sollte, war erstmals angeschlagen. Daß die Prüfer ihm für seine Arbeit eine hervorragende Note gaben, wird er als Bestätigung seines Ansatzes und seiner kritischen Haltung aufgefaßt haben. Damit hatte Sebald seine erste akademische Qualifikation errungen. Auf zu neuen Ufern! Bereits an der Universität in Freiburg im Breisgau war er dem britischen Germanisten Ronald Peacock begegnet, der dort während Sebalds letztem Studiensemester eine Vertretungsprofessur übernommen hatte. Das dürfte seine Entscheidung wesentlich beeinflußt haben, als frischgebackener Germanist sein weiteres Glück in Groß britannien zu suchen. Britischen akademischen Gepflogenheiten folgend, praktizierte Peacock einen persönlichen Stil im Umgang mit den Studenten. Ebenso betrieb er eine Auseinandersetzung mit Literatur, die eher freier und essayistischer war, ganz wie es dem angelsächsischen literary criticism entspricht, der nicht mit dem hehren Anspruch der Germanistik auftritt, eine tatsächliche ›Wissenschaft‹ darzustellen. Das muß Sebald beeindruckt haben. Seine nächste Station sollte Manchester sein. Auf das, was ihn dort erwartete, war er freilich nicht im Geringsten eingestellt.
Erster Aufenthalt in Manchester
113
ERSTER AUFENTHALT IN MANCHESTER (SAMT ZWISCHENSPIEL IN ST. GALLEN) Wie schockhaft die unvorbereitete Begegnung mit der postindustriellen Brache war, welcher der Moloch Manchester damals in weiten Teilen glich, hat Sebald in seinen literarischen Schriften festgehalten. So in Nach der Natur, wo sich die Industriemetropole als veritable Totenstadt und eindringlicher Schauplatz allgegenwärtiger Zerstörung erweist: »Viel bin ich damals / über die brachen elysäischen / Felder gegangen und habe das Werk / der Zerstörung bestaunt, die schwarzen / Mühlen und Schiffahrtskanäle, / die aufgelassenen Viadukte / und Lagerhäuser, die Abermillionen / von Ziegeln, die Spuren des Rauchs, / des Teers und der Schwefelsäure, / bin lange gestanden an den Ufern / des Irk und des Irwell, jener / jetzt toten mythischen Flüsse, / die schillernd zu besseren Zeiten / geleuchtet haben azurblau, / karminrot und giftig grün, / spiegelnd in ihrem Glanz / die Baumwollwolken, die weißen, / in die aufgegangen war ohne ein Wort / der Atem ganzer Legionen von Menschen.« (NN 83/84) An der Verkommenheit von Manchester hatte Sebald schwer zu knabbern. Vor allem seelisch. Dennoch erwies sich die Emigration als richtige Entscheidung für den Nachwuchsgermanisten. Zu dieser Zeit, Jahrzehnte vor dem neoliberalen Imperativ ›internationaler Mobilität‹, war der Schritt, an eine englische Universität zu gehen, eine höchst ungewöhnliche Entscheidung für einen deutschen Studenten. Doch Sebald wollte sein Thema Sternheim weiterverfolgen. Und da er sich als Neuankömmling in Großbritannien nicht gleich eine Doktorarbeit auf Englisch zutraute, lag es nur nahe, seine deutschsprachige mémoire zunächst zu einer auf Deutsch verfaßten Magisterarbeit auszubauen. Im letzten Lebensjahr erinnerte sich Sebald an die Lage, die er damals an der University of Manchester vorgefunden hatte: »England had so much to offer in those days to aspiring young
114
4 Universität
scholars, things which to me were quite out of the ordinary. I had a heated office. I could go to the library at any time and pretty much all the books that I wanted were there. At the university there wasn’t anything that resembled an authoritarian structure. For someone who had grown up in a system of this sort and who, by nature, has perhaps something of an anarchist streak, this really felt like freedom. The freedom to follow my own designs was an extremely positive aspect.« (CB 149/50) Und gerade für diese Freiheit, die man damals noch im ganzen Sinnumfang des Begriffs als ›akademische Freiheit‹ bezeichnen konnte, war Sebald bereit, die Nachteile des Lebens in Manchester in Kauf zu nehmen. Während er Sprachunterricht gab, entstand im liberalen Klima des German Department die nun Carl Sternheim und sein Werk im Verhältnis zur Ideologie der spätbürgerlichen Zeit betitelte Magisterarbeit. Diese wurde erfolgreich angenommen. Im Juli 1968 erhielt Sebald den Grad eines Master of Arts with distinction. Der nächste Schritt war nun, diese Arbeit als Buch zu veröffentlichen. Dazu ging er in die Schweiz zurück, geriet aber vom Regen in die Traufe. Im Herbst 1968, während in Berlin, Frankfurt und anderswo die Studentenproteste wüteten und die kämpferische Parole »Schlagt die Germanistik tot, macht die blaue Blume rot!« kursierte, trat Sebald eine Stelle als Oberstufenlehrer für Deutsch und Englisch an. Sein Dienstort war das idyllisch auf einem Hügel am Stadtrand von St. Gallen gelegene ›Institut auf dem Rosenberg‹, eine der ältesten, bekanntesten und teuersten privaten Lehranstalten der Schweiz. Die Zeit dort war ihm unerträglich. Während die Schule exorbitante Gebühren von extrem reichen Eltern verlangte, die ihre Kinder mit dem Porsche zur Schule chauffierten, wurden die Lehrer wie billiger Abschaum behandelt, empfand Sebald. Die Verpflegung sei grauenhaft gewesen, die Unterbringung auch, das Lehrdeputat hingegen immens. Der Schulleiter sei ein Mafioso
Interventionen. Literaturkritik als Widerspruch
115
gewesen. »Ich habe den Lehrerberuf ganz gern gemacht, aber die Verhältnisse an der Schule waren eine einzige Katastrophe.« (G 146) Die herabwürdigenden Zustände erinnerten ihn einerseits an die Lage solcher Dichter wie Hölderlin oder Lenz, die sich gleichfalls als ausgebeutete ›Hofmeister‹ bei reichen Bürgerfamilien durchschlagen mußten, und andererseits an die von Robert Walser beschriebenen erniedrigenden Zustände in der Dienerschule im Roman Jakob von Gunten. In den zurückhaltenden Worten des Erzählers der Ausgewanderten formulierte er dann neutraler, es habe ihn »in der Schweiz aus verschiedenen, teils mit der schweizerischen Lebensauffassung, teils mit meinem Lehrerdasein zusammenhängenden Gründen nicht lange gelitten.« (AW 260) Kein Wunder jedenfalls angesichts der empörenden Umstände im Eliteinternat, daß die Endfassung seiner Arbeit über Sternheim, die der Kohlhammer Verlag im Oktober 1969 unter dem Titel Carl Sternheim: Kritiker und Opfer der Wilhelminischen Ära ausliefert, einen noch gesteigert aggressiven Ton anschlägt. Die Studie war eine vollumfängliche Kampfansage an jene Institution, der er mit Veröffentlichung des Buches sozusagen offiziell beitrat. »Es ist der Zweck der vorliegenden Arbeit, das von der germanistischen Forschung in Zirkulation gebrachte Sternheim-Bild zu revidieren«, kündigt ein offenkundig zorniger junger Mann im ersten Satz an, um weiter anzudrohen, daß »es sich bei dieser Revision vorwiegend um eine Destruktion handelt.«
INTERVENTIONEN. LITERATURKRITIK ALS WIDERSPRUCH Sebald steuerte somit von seinem ersten Buch an einen konsequenten, eigensinnigen Gegenkurs zur eigenen Zunft. Die Arbeit über Sternheim wie die spätere Doktorarbeit über Alfred Döblin waren
116
4 Universität
nicht nur Versuche der Revision allgemein anerkannter Autoren. Sie richteten sich ebenso gegen die Germanistik, so wie sie von jener Professorenschaft gehandhabt wurde, die Sebald unter den Generalverdacht stellte, durch ihre Vergangenheit kompromittiert zu sein. Zugleich waren es Interventionen aus dem Ausland, die gleichsam im Einklang mit dem Zeitgeist der späten sechziger Jahre versuchten, literaturkritische Brandsätze zu werfen. Manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Erfolg. Bevor Sebald sich später auf das Verfassen von Aufsätzen verlegte, die stets mehr Essay als Fachartikel waren, schrieb er, noch als Doktorand, eine ganze Reihe durchweg kritischer, teils vernichtender Rezensionen von Forschungspublikationen für die an der University of East Anglia beheimatete Fachzeitschrift Journal of European Studies. Kein Professor konnte bestehen vor dem kritischen Auge des Nachwuchsgermanisten, dessen Rezensionen die rezensierten Studien gerne mit herablassender Ironie oder groben Generalisierungen abfertigen. So heißt es etwa angesichts der elaborierten Untergliederung einer Arbeit, »that only a bureaucratic mind will derive any pleasure from reading it.« Aber auch englische Kollegen, so wie Michael Butler und dessen Einführung The Novels of Max Frisch, werden angegriffen: »It is a pity that Dr Butler’s study does not probe a little deeper«, bemängelt Sebald, und moniert desweiteren die Vielzahl jener »notorious catch-phrases of the professional philologist in which Dr Butler’s book unfortunately abounds.« Doch das waren Nebengefechte. Nach seiner Promotion plante Sebald zunächst die Arbeit an einer Essaysammlung mit dem Arbeitstitel Reflexionen der Geschichte der jüdischen Assimilation in der deutschen Literatur. Der Band kam zwar nie zustande, hätte aber die Beschäftigung Sebalds mit der Frage, wie es in Deutschland zum Holocaust hatte kommen können, welche er bereits in den Qualifikationsschriften über Sternheim und Döblin angeschnitten hatte, konsequent fortgeführt.
Interventionen. Literaturkritik als Widerspruch
117
Einmal abgesehen davon, daß Sebald in den Büchern über die beiden deutsch-jüdischen Autoren extrem holzschnittartig operierte, und ebenso abgesehen davon, daß er, wie Jakob Hessing detailliert gezeigt hat, von jüdischer Kultur keine tiefere Ahnung hatte, war sein Interesse am kulturell-religiösen Hintergrund der Autoren zugleich höchst bemerkenswert. Denn Sebalds Beschäftigung mit jüdischen Dingen, wie etwa der Geschichte der Assimilation aber auch der Mystik, war eine absolute Ausnahme in der deutschen Germanistik damals. Betrachtet man sein literaturkritisches Werk ab den achtziger Jahren, so fallen eine ganze Reihe bezeichnender Merkmale auf, die Sebalds Dissidenz zu dem markieren, was man ›Inlandsgermanistik‹ nennen könnte. So beispielsweise sein Desinteresse an Klassikern, seien es nun Lessing, Goethe und Schiller oder moderne Autoren wie Bert Brecht und Thomas Mann. (Kafka bleibt die große Ausnahme.) Stattdessen sind so unterschiedliche Schriftsteller wie Peter Weiss, Alexander Kluge oder Herbert Achternbusch wichtig für ihn gewesen. Auffällig ist seine Präferenz für österreichische und alemannische Schriftsteller, an denen er quasi aufgrund seiner Allgäuer Herkunft, im Sinne kultureller Vertrautheit, ›näher‹ dran war. Dies gilt – in zeitlicher Hinsicht – genauso für seine Bevorzugung von Gegenwartsautoren. Sebald schrieb eigentlich nur über das, was ihn selber betraf und was ihn persönlich betroffen machte. Seine Essays erweisen sich als klar zweigeteilt, fallen sie doch entweder deutlich polemisch aus oder sind extrem empathisch. Jene neutrale Position, die eine der Objektivität verpflichtete Literaturwissenschaft einfordert, bleibt eine Seltenheit bei ihm. Sebalds Aufsätze sind vielmehr darauf aus, die behandelten Autoren (Frauen sind gleichermaßen eine Absenz!) entweder zu diskreditieren aufgrund moralisch-politischer Schwächen oder sich geradezu kämpferisch mit ihnen zu solidarisieren, da sie Außenseiter oder Randfiguren darstellen.
118
4 Universität
Im Fall von Robert Walser konnte das gar so weit gehen, daß Sebald richtiggehende Hagiografie betrieb: Der Schweizer Schriftsteller wird verklärt als eine »nach wie vor singuläre, unerklärte Gestalt« (LH 131), die als Legende oder besser gesagt: als ein apokrypher Heiliger der Literaturgeschichte erscheint. Nach welchem Muster die Heiligenlegenden gestrickt sind, konnte er dabei in seinem Exemplar des Lexikons der Heiligen nachlesen, das zu seiner Handbibliothek gehörte. Zudem verknüpft Sebald ihn qua biografischer Koinzidenzen mit seinem Großvater und beansprucht eine tiefere Verbindung, ja Verschmelzung mit Walser: »Ich brauche bloß einmal aussetzen mit der täglichen Arbeit, dann sehe ich ihn irgendwo abseits stehen, die unverkennbare Figur des einsamen Wanderers, der sich gerade ein wenig umschaut in der Umgegend. Und manchmal denke ich mir, ich sehe mit seinen Augen.« (LH 163) Konventionelle Literaturwissenschaft sieht anders aus. Desweiteren kommt hinzu, daß Sebald die Methodendiskussionen der Germanistik nie mitgemacht hat, ihm also die in den achtziger und neunziger Jahren jeweils modischen Theoretiker gänzlich fremd blieben. Wie überhaupt jeder Ansatz, der Theorie vor den Text stellte. Als Paradigma für die »zünftigen Germanisten, deren verbohrte Untersuchungen regelmäßig umschlagen in eine Travestie von Wissenschaft«, erschien ihm das Gros der Kafka-Forscher, denn – so polemisiert er – »es ist beinahe unglaublich, wieviel Staub und Schimmel die existentialistisch, theologisch, psychoanalytisch, strukturalistisch, poststrukturalistisch, rezeptionsästhetisch oder systemkritisch inspirierten Sekundärwerke bereits angesetzt haben.« (CS 195) Sebalds bevorzugte Methode hingegen galt und gilt in der Literaturwissenschaft als verpönt: der Biografismus. Stets suchte er die Literatur als Ausdruck der Lebensumstände des Autors und seines gesellschaftlichen Umfelds zu verstehen. Und dies durchaus mit einigem Recht. Problematisch wurde es meist, wenn er – wie im
Interventionen. Literaturkritik als Widerspruch
119
Fall Adalbert Stifter – aus den Texten gewagte Rückschlüsse aufs Leben zog. Doch selbst das ermöglichte interessante Perspektiven, so man es eben als essayistische Suchbewegung verstand. Bereits für die erste Fassung der Sternheim-Arbeit hatte er von Walter Benjamin die Überzeugung eines ursächlichen Konnexes zwischen Ethik und Ästhetik übernommen. »Es geht im Bereich der Ästhetik letzten Endes immer um ethische Fragen« (UH 115), stellt er in einem anderen Zusammenhang fest und macht die Überzeugung, daß es »so etwas wie eine Moralität des Ästhetischen« (SM 344) gibt zu einem Axiom seines literaturkritischen Urteils, an dem er hartnäckig, um nicht zu sagen: starrköpfig festhielt. In einem Interviewstatement, das ein nicht geringes Maß an affektiver Besetzung des Themas belegt, gestand er: »Ich hasse den deutschen Nachkriegsroman wie die Pest, er ist geschmacklos und verlogen, was mich in meiner Intuition stärkt, daß Ästhetik und Ethik sich gegenseitig bedingen.« (G 77/78) Unverstellt tritt hier der wunde Punkt seiner Literaturkritik hervor, nämlich der apodiktische Ton und die Pauschalität des wertenden Urteils. (Andererseits soll es gesund sein, ab und zu auch mal etwas Dampf abzulassen.) Als Sebald dieses Bekenntnis ablegte, hatte er gerade seinen sehr polemischen Essay über Alfred Andersch geschrieben, auf den er sich hier unausgesprochen bezieht. Daß sich Andersch, neben anderen unerquicklichen Dingen, von seiner jüdischen Frau getrennt hatte, um Mitglied der Reichsschrifttumskammer werden zu können, nahm Sebald zum Anlaß für eine aggressive Generalabrechnung mit dem bis dato als Lichtgestalt der deutschen Literatur geltenden Autor. Es war der Sturz eines Säulenheiligen. Roman für Roman zerpflückte Sebald mit moralischem Furor das Werk von Andersch und warf einen fundamental kritischen Blick auf den Zusammenhang von Leben und Werk des Schriftstellers. Dafür erntete Sebald viel Schelte von der Germanistik – Biografismus, Moralismus, Iko-
120
4 Universität
noklasmus lauteten vereinfacht gesagt die Kernpunkte der Gegenanklage. Und in der Tat waren manche der Urteile unfair, unzutreffend und überzogen. Zugleich hatte er überaus korrekt den Finger in die Wunde gelegt und eine kontroverse Diskussion ausgelöst, in deren Verlauf weitere Beweise für die literarische Klitterung einer moralisch kompromittierten Biografie ans Tageslicht kamen. Das revidierte Bild, das heute von Andersch gezeichnet werden muß, ist Sebalds Erfolg und Verdienst. Man mag sich vielleicht zurecht über seine Methoden beschweren, verwerfen kann man deren Ergebnisse nicht. Beachtenswert erscheint der Umstand, daß Sebald nach den beiden Qualifikationsarbeiten zu Beginn seiner Karriere nie wieder geschrieben hat, was man mit dem Fachbegriff ›Monografie‹ bezeichnet, also eine durchgängige Studie, die sich einem bestimmten Thema widmet. Stattdessen publizierte er nur noch Sammelbände, die disparat erschienene Essays bündelten. Ein Vorgehen in Form von Fallstudien also, anstelle des Anspruchs, das definitive wissenschaftliche Wort über ein Thema zu sprechen, wie es eine Monografie anstrebt. Oder wie Sebald im Vorwort zu Die Beschreibung des Unglücks, seiner ersten Essaysammlung zur österreichischen Literatur, festhielt: »Mit den in diesem Buch vorgelegten Arbeiten soll weder eine neue Panoramaaussicht auf die österreichische Literatur eröffnet werden, noch geht es darum, möglichst ausnahmslos alles über irgendeinen kritischen Kamm zu scheren. Vielmehr sollen in mehreren Exkursen einige jener spezifischen Komplexionen ins Blickfeld gebracht werden, die in der österreichischen Literatur – wenn es eine solche überhaupt gibt – konstitutiv zu sein scheinen.« (BU 9) Dementsprechend annonciert Sebald ein »fallweises Verfahren, das je nach den vor ihm auftauchenden Schwierigkeiten ohne viel Skrupel seine analytische Methode wechselt« (BU 9), womit sich der exegetische Diskurs an den als vorgängig betrachteten Text anpaßt. Eine mimetische Hermeneutik mithin, die in der Litera-
Von Manchester nach Norwich
121
turwissenschaft, ebenso wie der Biografismus, weitgehend verpönt ist. Augenfällig nun die Parallele, daß auch die literarischen Bücher Sebalds das erzählerische Äquivalent der Monografie – den Roman also – scheuen. Stattdessen schrieb er durchweg ›Erzählungen‹ im eigentlichen Sinne, in denen – gleich dem Biografismus der Essays in den Sammelbänden – verschiedene (semifiktionale) Biografien versammelt sind. Das gilt für die drei Teile von Nach der Natur wie die beiden Erzählungsbände; selbst Die Ringe des Saturn besteht letztlich aus zehn separaten Texten, die durch den Rahmen der Rundwanderung (die Sebald freilich als solche niemals unternommen hat) zusammengehalten werden. Offenkundig lag ihm also das ›fallweise Verfahren‹ erheblich näher als der ›große Wurf‹ – und die strukturellen Probleme von Austerlitz belegen dies auch. (Doch dazu später mehr.)
VON MANCHESTER NACH NORWICH Eine Rückkehr ins deutsche Universitätssystem hat Sebald theoretisch durchaus in Erwägung gezogen. Denn das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Einmal wäre es sogar möglich gewesen: Auf Initiative seines Freiburger Studienfreunds Dietrich Schwanitz erhielt er 1997 ein auf ihn zugeschnittenes Angebot, an die Universität Hamburg zu wechseln. Er hätte dort ein Institut für Kreatives Schreiben gründen sollen. Damit verbunden war zwar eine Professur, die allerdings in der akademischen Hierarchie eher nachgeordnet gewesen wäre und zunächst wohl nur befristet zur Verfügung gestanden hätte. Immerhin erwog Sebald die Option mehr als ein halbes Jahr lang. Um dann abzulehnen. Vielleicht weil bei genauerer Betrachtung das Gras nicht wirklich grüner ist an deutschen Universitäten:
122
4 Universität
»A lot has changed but some of the old attitudes are still in place. The hierarchies in German universities are still very pronounced. In German institutions there is a great deal of intrigue and one-upmanship, a vice which is now beginning to grow in British universities also« (CB 150), urteilte er 2001. Einen Ausbruchsversuch, als er bereits eine feste Unistelle in England hatte, wagte Sebald dennoch. Denn ganz hat er sich in England nie beheimatet gefühlt. In Die Ausgewanderten spricht der Erzähler von einem »fehlgeschlagenen Versuch, in München, in einem deutschen Kulturinstitut, Fuß zu fassen.« (AW 266) Gemeint war das Goethe-Institut, in dessen Zentrale in München sich Sebald 1976 zu einem zertifizierten Deutschlehrer ausbilden ließ, wobei er als eigentliches Ziel wohl anstrebte, in die Verwaltung der Organisation einzutreten und Beamtenstatus zu erlangen, um sich so eine gesicherte Existenz in Deutschland aufbauen zu können. Er lebte während der ersten Jahreshälfte 1976 im Olympischen Dorf. Doch er war unglücklich in München. Danach ging es weiter zum Praktikum nach Schwäbisch Hall. Dort war es noch schlimmer. Als sich dann herausstellte, daß Sebald nach Abschluß der Ausbildung nach Afrika, also wirklich weit von wo, geschickt werden sollte, brach er alles ab. Auf diesen Ausbruchsversuch wird auch in Austerlitz angespielt: Der Erzähler berichtet, wie er »Ende 1975 nach Deutschland zurückging mit der Absicht, dort, in der mir nach einer neunjährigen Abwesenheit fremd gewordenen Heimat, auf die Dauer mich niederzulassen«, sich dann aber »kaum ein Jahr später entschloß, ein zweitesmal auszuwandern und wieder zurückzukehren auf die Insel.« (A 53/54) Für Sebald bedeutete dieser Umzug im Herbst 1976 die endgültige Rückkehr nach England. Doch wir greifen vor. Zurück zum gescheiterten Intermezzo in St. Gallen zu Ende der sechziger Jahre. Im Herbst 1969 ging Sebald aus der Schweiz erneut zurück an die Universität Manchester, seine erste akademische Heimat in
Von Manchester nach Norwich
123
England. Nach dem kontinuierlichen Ausbau der Sternheim-Arbeit zu einem Buch war die Promotion der logische nächste Schritt. In Manchester begann er, neben dem Sprachunterricht, mit der Arbeit an seiner Dissertation über Alfred Döblin, welche auf Englisch verfaßt werden mußte, weil die Regularien der britischen Universitäten dies so vorsahen. Nun liefen die Dinge besser für ihn. Seine im März 1970 erfolgte Bewerbung auf eine Dozentenstelle in Norwich führte zu einem erfolgreichen Bewerbungsgespräch Ende Mai. Im Oktober 1970 trat Sebald seine Stelle an der University of East Anglia (UEA) an. Es war seine erste ›richtige‹ Stelle, und dieser Erfolg bestätigte rückwirkend das nicht geringe Wagnis, der deutschen Germanistik den Rücken gekehrt zu haben. Ob Sebald wohl gewußt oder geahnt hat, daß er den Rest seines Berufslebens an der UEA verbringen würde? Die 1963 im Rahmen der Bildungsexpansion gegründete Universität befindet sich idyllisch gelegen am Stadtrand auf einem ehemaligen Golfplatz. Errichtet wurde sie in modernistischer Stufenpyramidenbauweise, was für einen markanten Kontrast zwischen der Wiesenlandschaft und der abweisenden Sichtbetonkonstruktion sorgt. Verantwortlich für die brutalistische Architektur der UEA war Denys Lasdun, der auch das Betonungetüm des National Theatres am südlichen Themseufer in London sowie mehrere andere Universitätsbauten entworfen hat. Nicht unbedingt ein schöner Anblick. Die Büros der Dozenten spiegelten das architektonische Design prinzip des Minimalismus und bestanden aus unverputzten Zementziegelwänden. Mir hat die etwas futuristische Architektur der UEA durchaus gefallen. Sebald arbeitete lieber zuhause. Ich verstand die Betonarchitektur als zwar leicht mißglücktes, aber gutgemeintes Statement modernistischen Stilwillens. Die Atmosphäre auf dem Campus unterschied sich wohltuend vom Münchner Massenbetrieb und ich fühlte mich dort sehr wohl. Man bekam schnell das Gefühl, Mitglied einer community von
124
4 Universität
Lehrenden und Lernenden zu sein. Im Gegensatz zu München war das Verhältnis der Kommilitonen untereinander weniger von Konkurrenz als von Solidarität bestimmt, wobei der engere Kontakt zu den Dozenten dazu führte, daß die kleinen und großen Skandale am Institut als gossip bis an meine Ohren drangen. Weitverbreitet unter den Akademikern der UEA war vor allem eine dezidierte Neigung zum Alkohol. Es gab ebenso interessante Fälle anderer menschlicher Schwächen an der Grenze zum Pathologischen wie etwa dem kompulsiven Kauf von Immobilien. Als Student befremdete und amüsierte mich all das noch gleichermaßen. Heute, nachdem ich selber eine akademische Karriere im Vereinigten Königreich durchlaufen habe, ist mir vieles verständlicher. Wie in England üblich, gab es auf dem Campus eine aktive Student Union, die viele Konzerte organisierte. Das war wunderbar, weil ich nicht zuletzt wegen der britischen Pop-Musik nach England gegangen war. Bands wie Kraftwerk, Radiohead, Pulp, Spiritualized oder The Fall haben dort gespielt. Es gab Geschäfte für die Studenten, Bankfilialen, eine gute Auswahl an Verpflegungsstätten und immer wieder interessante extrakurrikulare Veranstaltungen. Ein wunderbarer Ort, um in die britische Kultur einzutauchen. Personell gehörte Sebald zur ›School of Modern Languages and European History‹ (EUR), einem von Aufbruchsstimmung, Interdisziplinarität und liberalem Management geprägten Department aus zumeist jungen Akademikern. Die School war im sogenannten ›Teaching Wall‹ untergebracht war, den man auf dem einleitenden Foto am hinteren Ende erkennen kann. Zu Beginn der siebziger Jahre herrschten an der UEA ideale Bedingungen. Zumal für den querdenkenden Sebald, der dort seine Dissertation über Döblin im August 1973 einreichte und im darauffolgenden Sommer seinen Doktortitel erhielt. Die Prüfer hatten zwar teils Bedenken gegen die Art und Weise, in der Sebald in einigen Aspekten von den akademischen Konventionen abwich, ließen aber die Arbeit passieren.
Von Manchester nach Norwich
125
Einer Universitätskarriere stand so nichts mehr im Weg. Zu Beginn der achtziger Jahre wendete sich dann vieles in Großbritannien zum Unguten. Das hatte auch für das Universitätsleben spürbare Konsequenzen. »Conditions in British universities were absolutely ideal in the Sixties and Seventies. Then the so-called reforms began and life became very unpleasant«, erinnerte sich Sebald später an die Machtübernahme des Neoliberalismus, da nun die Krämerstochter Thatcher die politischen Geschicke des Landes leitete. In der UEA trat an die Stelle der optimistischen Experimentierfreude die zunehmend bedrückende Atmosphäre eines konstanten Rechtfertigungsbedarfs gegenüber der übermächtigen Verwaltung, die beständige Reformen verordnete. The golden days were over. Und zwar für immer: Was damals ins Werk gesetzt wurde, hat sich bis heute mit immer größerer Konsequenz und Radikalität als eine ökonomische Gleichschaltung ins britische Hochschulwesen eingefressen. Branding, Marktideologie, Privatisierung und gnadenloser Konkurrenzdruck, um nur einige Auswüchse zu nennen, sind die akzeptierte Realität in einer administrativ gegängelten Hochschullandschaft. Sebald paßte sich zunächst an: Von 1978 bis 1981 versuchte er als admissions officer durch viele Anstrengungen bei der Rekrutierung von Studenten das mit den Studentenzahlen verknüpfte Einkommen der School zu stabilisieren, um so dem Rationalisierungsdruck entgegenzuwirken. Auch engagierte er sich in anderen Bereichen universitärer Selbstverwaltung. So leistete er eine mehrjährige Dienstperiode im Senat der UEA ab und stand einer Arbeitsgruppe zur Rationalisierung der Unterrichtsangebote vor. Die wenigen Schlupflöcher, die es noch gab, nutzte er. So beantragte er etwa Gelder bei der British Academy, um in den Semesterferien vorgeblich Forschungsreisen durchzuführen, obgleich er vielmehr Material für seine literarischen Texte sammelte.
126
4 Universität
Sebald hat das neoliberale Regime an den Universitäten gerne als ›stalinistisch‹ verdammt. Ganz falsch lag er damit nicht. Er begann schließlich damit, mit nicht selten starrköpfiger Verweigerung auf die aufgezwungenen Reformen zu reagieren, die einer Entmündigung der Dozenten gleichkamen. Beispielsweise verwies er Inspektoren, die im Rahmen eines Teaching Quality Assessment seinen Unterricht evaluieren wollten, kurzerhand des Seminarraums. Ein mutiger Akt von Zivilcourage, der freilich unabdingbar negative Folgen für das Department hatte. In die achtziger Jahre fiel Sebalds kumulative Habilitation an der Universität Hamburg, bei der er seinen frischerschienenen Essayband Die Beschreibung des Unglücks zu Ende 1985 als Habilitationsschrift einreichte. Mit Dietrich Schwanitz und Jörg Schönert gehörten zwei Professoren der Kommission an, mit denen Sebald persönlich bekannt war. Schwanitz, der eine Professur für Englische Literatur in Hamburg innehatte, war befreundet mit ihm aus der gemeinsamen Studienzeit in Freiburg. Der Kontakt zum Germanisten Schönert kam zustande über das gemeinsame Engagement in der Sternheim-Forschung, über die bei einem ersten Treffen in München in den siebziger Jahren gemeinsam diskutiert wurde. Als Schönert von 1980 bis 1983 eine Professur in Aachen innehatte, wurden dort die persönlichen Begegnungen fortgesetzt und dabei die Möglichkeit einer externen Habilitation Sebalds erörtert. Nachdem Schönert nach Hamburg gewechselt war, konnte der Plan unter Mithilfe von Schwanitz in die Tat umgesetzt werden. Schönert leitete das Verfahren im Fachbereich ein und führte den Vorsitz der Kommission, welcher u.a. noch Hartmut Böhme und Marianne Schuller angehörten. Da seinerzeit der Hamburger Fachbereich ›Sprache und Literatur‹ von einem breiten Spektrum fachlicher Orientierungen bestimmt war und auch unkonventionelle Einstellungen toleriert wurden, verlief das Habilitationsverfahren ohne Probleme. Dank des reichlich unorthodoxen Essaybandes wurde Sebald im April 1986 zum Dr. phil. habil. erhoben. Der erste und einzige
Von Manchester nach Norwich
127
akademische Titel, den er sich in Deutschland erworben hatte. Er diente ihm als eine Art Rückversicherung, da man ja nie weiß. Genutzt, um sich für ausgeschriebene Professuren zu bewerben, hat Sebald seine Habilitation jedoch nie. Die achtziger Jahre markierten zugleich die Phase seiner akademischen Erfolge an der UEA. Nachdem er mehr als zehn Jahre als einfacher lecturer, wie die erste Hierarchiestufe an britischen Universitäten heißt, ausgehalten hatte, ging es schließlich schnell nach oben: Ende 1985 wurde Sebald zum senior lecturer befördert, im Oktober 1987 folgte schon die Erhebung zum reader, was in etwa einer Privatdozentur entspricht. Nur ein Jahr später ernannte man ihn zum Professor of European Literature. Die neunziger Jahre waren ein Zeitraum starker Veränderungen in Sebalds Department. Die Historiker bekamen 1993 ihr eigenes Department, weshalb man die ›School of Modern Languages and European History‹ umbenannte in ›School of Modern Languages and European Studies‹. Das bis heute beständig nachlassende Interesse junger Briten an europäischer Literatur und Deutsch als Fremdsprache wurde immer spürbarer. Weil das Studienprogramm ›German Language and Literature‹ schließlich nicht genug Studenten rekrutierte, mußte es geschlossen werden. Begleitend versuchte man die Finanzsituation der School zu Mitte der neunziger Jahre zu entspannen, indem sechs Dozenten erfolgreich überredet wurden, sich frühpensionieren zu lassen. Zwar bestanden einzelne Unterrichtsmodule, in denen es um Literatur ging, als Teil von Kombinationsstudiengängen weiter fort, sie wurden jedoch von den Studenten ebenfalls immer weniger nachgefragt. Um dem absehbaren Ende entgegenzuwirken, ließen sich daher die drei Literaturprofessoren der School – Clive Scott (French), Michael Robinson (Drama) und Sebald – gegen Ende des Jahrzehnts in die ›School of English and American Studies‹ (EAS) versetzen. Sebald mußte als erwiesenermaßen begabter Schriftsteller ab 2000 den Studenten an der EAS nun auch Creative Writing bei-
128
4 Universität
bringen. Er tat dies zunächst unter gewissen Vorbehalten, denn das literarische Schreiben schien ihm nur bedingt unterrichtsfähig. Vor allem in der Weise, wie er es betrieb, war es eine zu persönliche Angelegenheit, als daß er seinen eigenen Stil und seine Techniken als Modell nehmen konnte (oder vorgeben wollte). Zusätzlich bestand eine Hürde darin, daß er sich nicht unbedingt für befugt hielt, die Texte englischer Muttersprachler sprachlich zu kritisieren. Der Unterricht machte ihm dann aber doch Spaß. Auch die durchweg positiven Erinnerungen seiner Studenten belegen dies. Neue Literaturstars sind gleichwohl keine aus ihnen geworden. Die erste Hälfte der achtziger Jahre ist dann der Zeitraum, in dem Sebald beginnt, sich nach einer Ausbruchsstrategie aus dem akademischen Käfig umzusehen. Er findet sie im Schreiben: »I was looking for a way to re-establish myself in a different form simply as a counterweight to the daily bother in the institution«, erklärte er 1998 dem Observer. Das funktionierte zunächst ganz so, wie er es sich erhofft hatte: ein kreativer Freiraum, in dem er machen konnte, was er wollte. Das Schreiben von Literatur als eine Form ›innerer Emigration‹. Keiner wußte, was er allein an seinem Schreibtisch trieb. Zumindest für einige Zeit am Anfang. Den Verlust dieser ursprünglichen Freiheit hat er später in Interviews immer wieder beklagt. Indem seine Texte an eine größere Öffentlichkeit gerieten, kam unabwendbar der Erfolg. Dieser legte ihm neue Fesseln an. Ja, man kann sagen, Sebald fand sich unerwartet doppelt gefangen: in der Tretmühle der Universität und der selbstgewählten Falle der Literatur. Sein Leben sah nun so aus: »Donnerstagabend kam ich nach Hause, habe nur ferngesehen, um wegzukriegen, was in der Uni war. Und freitags, samstags und sonntags habe ich mich hingesetzt und jeweils zehn Stunden geschrieben. Selbst der Hund findet das eigenartig – da sitzt der Typ da oben und unter der Tür qualmt es heraus. Irgendwann kriecht man ramponiert zum Abendessen her-
Das letzte Jahrzehnt
129
vor. Dann ist mir schon mal die Frage gestellt worden: Why do you do that?« (G 79) Eine wohlberechtigte Frage. Sinnbild dafür, »daß wir uns nur eingespannt in die von uns erfundenen Maschinen auf der Erde zu erhalten vermögen« (RS 334), war der Webstuhl aus dem achtzehnten Jahrhundert, den Sebald in Die Ringe des Saturn abbildete. Denn die Weber ähneln den Gelehrten und Schriftstellern darin, daß ihre Arbeit sie gleichfalls »zwingt zu beständigem krummem Sitzen, zu andauernd scharfem Nachdenken und zu endlosem Überrechnen weitläufiger Muster. Man macht sich, glaube ich, nicht leicht einen Begriff davon, in welche Ausweglosigkeiten und Abgründe das ewige, auch am sogenannten Feierabend nicht aufhörende Nachsinnen, das bis in die Träume hineindringende Gefühl, den falschen Faden erwischt zu haben, einen bisweilen treiben kann.« (RS 335) Die mühevolle, lebenskraftzehrende Verfertigung von Literatur charakterisierte Sebald mit Blick auf Rousseau als eine »stets weiter sich forttreibende Zwangshandlung, die beweist, daß der Schriftsteller von allen am Denken erkrankten Subjekten vielleicht das unheilbarste ist.« (LH 62) Liest man solche Sätze, so wird klar, daß Sebald sich durchaus immer selbst mitmeint, wenn er anhand anderer Autoren die Schriftstellerei als zunehmende Qual charakterisiert und vom »selbstzerstörerischen Geschäft des Schreibens« (LH 64) spricht. Er hat es am eigenen Leibe erfahren.
DAS LETZTE JAHRZEHNT Am Anfang der Ringe des Saturn kommt Sebald auf den frühzeitigen Tod zweier Kollegen zu Beginn der neunziger Jahre zu sprechen, Michael Parkinson und Janine Dakyns. Beide hatten ihre Büros im selben Korridor wie er. »Die Einschläge kommen immer näher«, sagte er damals zu mir, in sichtlich düsterer Stimmung. Ich
130
4 Universität
nahm das nicht so ernst. Rückblickend erscheint es mir gespenstisch, da auch er viel zu vorzeitig gestorben ist. An das chaotische Büro von Janine Dakyns, dessen Papierlandschaften Sebald so unnachahmlich treffend beschreibt, kann ich mich noch gut erinnern, da sie zumeist die Tür weit offenstehen ließ. Gesprochen habe ich sie nie. Michael Parkinson, gleichfalls aus der französischen Abteilung, habe ich nur noch schemenhaft in Erinnerung. Wohl weil er in der Tat so unscheinbar war, wie Sebald ihn beschreibt: Michael »war Ende Vierzig, Junggeselle und, wie ich glaube, einer der unschuldigsten Menschen, die mir jemals begegnet sind.« (RS 14) Für Sebald bestand dabei kein Zweifel daran, daß diese Tode in Zusammenhang standen mit den sich beständig verschlechternden Arbeitsbedingungen an der UEA. Nichts, so schreibt er im Hinblick auf die bürokratischen Zusatzbelastungen infolge der Reformen, »kümmerte Michael so sehr wie die aufgrund der seit einiger Zeit herrschenden Verhältnisse immer schwieriger werdende Erfüllung seiner Pflicht.« (RS 14) Offiziell kann keine Ursache für seinen Tod festgestellt werden: »Die gerichtliche Untersuchung ergab that he had died of unknown causes, ein Urteil, dem ich für mich selber hinzusetzte: in the dark and deep part of the night.« (RS 15) Das mag man, zumal aufgrund des düsteren Nachsatzes, für Sebald’sche Schwarzmalerei halten. Er stand allerdings nicht allein mit der Vermutung, das sich beständig verschlimmernde Arbeitsklima für den Tod des Gelehrten verantwortlich zu machen. In einem Nachruf, der in der Fachzeitschrift French Studies erschien, befand ein enger Kollege von Parkinson: »He frequently overworked, sometimes to the point of exhaustion; had he lived, one cannot but be aware of how irksome, intolerable even, he would have found the pressures under which university teachers are increasingly being expected to work.« Auch im Nachruf auf Janine Dakyns, den ihr UEA-Kollege Clive Scott verfaßt hat, wird der Tod der Dozentin in einen ursächli-
Das letzte Jahrzehnt
131
chen Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen an der Universität gebracht. Trotz der von ihr – ganz wie von Sebald beschrieben – mit Passion betriebenen Flaubert-Forschung, beteiligte sie sich mit großem Einsatz an dem, was auf Deutsch ›universitäre Selbstverwaltung‹ heißt. Oder wie Scott im obituary schreibt: Dakyns »had given herself no respite from her involvement in the daily affairs of the School of Modern Languages.« Sein Nachruf bringt mit britischem Understatement zur Sprache, wie auch Dakyns unter den hier in der Managementsprache gefaßten Reformen als Bedrohung akademischer Kultur litt: »Her students were able to draw sustenance not only from her vast learning, but also from her combative and tenacious commitment to the civilizing values of literary study, much to the be prized at a time when ›codes of practice‹, ›quality controls‹ and ›assessment systems‹ threaten to monopolize university discourse.« Idealistische Initiativen, die Mehrarbeit bereiten, bleiben in einem solch bedrückenden Klima eher aus. Dennoch gründete Sebald im Jahr 1989 an der UEA das ›British Centre for Literary Translation‹ (BCLT). Die Institution versuchte ausländischen Autoren eine Chance auf dem notorisch desinteressierten britischen Buchmarkt zu verschaffen. Darüber hinaus wollte sie eine Stärkung des von chronischer Selbstausbeutung gekennzeichneten Berufszweigs der literarischen Übersetzer erreichen. Und nicht zuletzt war das BCLT eine Anstrengung, der ab den achtziger Jahren immer stärker werdenden Europhobie im Vereinigten Königreich entgegenzuwirken. Um das literarische Übersetzungszentrum tiefer an der UEA zu verankern, wurde 1993 ein Magisterstudiengang in Literary Translation eingeführt. Außerdem galt es Konferenzen und Workshops zu organisieren, was für Sebald eine wesentliche Zusatzbelastung bedeutete. Das Programm konnte sich jedoch sehen lassen: Eminente Figuren wie George Steiner und Michael Hamburger waren als Gäste des BCLT an der UEA zu erleben. Sebalds späterer
132
4 Universität
bersetzer, Michael Hulse, war wiederum einer der ersten StipenÜ diaten. Anerkannt wurden Sebalds Mühen nicht: Das Universitäts management torpedierte die Einführung eines innovativen Promotionsstudiengangs in Literary Translation, dessen Studiengebühren die Finanzierung des BCLT langfristig gesichert hätten. Nach Ablauf seiner ersten Dienstzeit 1995 verzichtete ein frustrierter Sebald darauf, die Leitung der Institution weiter zu übernehmen. Es ist daher vielleicht bezeichnend, daß weder Sebalds Name noch die Existenz des BCLT in der 2001 erschienenen umfangreichen History of the University of East Anglia, Norwich, die Michael Sanderson im Auftrag der UEA-Oberen geschrieben hat, Erwähnung finden. In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre ließ nicht nur der gesundheitliche Zustand Sebalds deutlich nach, sondern auch seine Resistenz gegen die bürokratischen Daumenschrauben, die das durchökonomisierte Universitätswesen mit nie erlahmendem Erfindungsreichtum hervorbringt. Ebenso veränderte sich die Studentenschaft. Der Einfluß des neoliberalen Zeitgeistes auf die Studierenden, die heutzutage nahezu völlig entpolitisiert und marktideologiekonform sind, war damals bereits spürbar und trübte zusehends seine Freude am Unterrichten. In einem Ende November 1999 geführten Interview mit der Irish Times bedauerte Sebald mit Achselzucken die verschwindende intellektuelle Neugier und die zunehmend mangelnde Schulbildung seiner Studenten: »They are also less educated. Now they leave college at 21 as professional consumers who are barely literate.« Sebald spricht daher durch den Akademiker Austerlitz, wenn dieser dem Erzähler erklärt, er sei in den Ruhestand gegangen »wegen der auch an den Hochschulen, wie Sie sicher selber wissen, immer weiter um sich greifenden Dummheit.« (A 178) Einer wundersamen Rettung gleich kam daher das Sebald im Oktober 2000 zuerkannte Stipendium des NESTA in Höhe von dreiundsiebzigtausend Pfund. Er hatte den Brief, in dem ihm die
Ein Lehrer
133
frohe Botschaft mitgeteilt wurde, zunächst in den Mistkübel geworden, da er ihn für eine Werbesendung der Firma Nestlé gehalten hatte. Seine Frau fischte ihn dort heraus. Die mit dem Stipendium verbundene Geldsumme hätte ihm ermöglicht, bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2004 jeweils nur ein Semester pro Jahr unterrichten zu müssen. Den Rest der Zeit hätte er zum Schreiben nutzen können. Doch so weit sollte es nicht mehr kommen.
EIN LEHRER Als ich im Herbst 1992 in Norwich und damit an der UEA ankam, waren mir der eigenwillige Campus und die schöne Kleinstadt nur flüchtig von einer länger zurückliegenden Englandrundreise vertraut. Sebalds Namen kannte ich von seinem ersten Essayband über österreichische Schriftsteller, den ich gekauft hatte, weil mich, auch aus biografischen Gründen, Autoren aus Österreich besonders interessierten. Bei der Lektüre wurde mir schnell klar, daß Sebald eine Form der Literaturwissenschaft betrieb, die ich als ungleich relevanter empfand als das meiste von dem, was mir bisher in München begegnet war. Erst als dann feststand, daß es klappen würde mit dem selbstorganisierten Transfer an die UEA, besorgte ich mir sein Prosadebüt Schwindel. Gefühle.; es war damals in der limitierten Erstauflage noch überall zu kaufen in Münchner Buchläden. Sebald lernte ich zuerst durch seine Briefe kennen. Im Vorfeld hatten wir, um allfällige Fragen zu meinem Magisterkurs zu klären, eine kleine Korrespondenz geführt. Verfaßt waren die Briefe in schön lesbarer Handschrift und unter Verwendung überholt klingender Formulierungen. Ganz so wie in seiner Prosa. Auch der persönliche, teils ironische Ton machte deutlich, daß er einem anderen Typus von Professor angehörte als jene beamteten Hochschullehrer, denen ich zuvor begegnet war.
134
4 Universität
Zum verabredeten Zeitpunkt wartete ich überpünktlich vor seiner Bürotür. Und ich war sehr nervös. Schließlich kam Sebald mit einer Tasse Tee den Gang entlang. Er war sofort ausnehmend nett und freundlich. He made me feel welcome. Man hatte nie den Eindruck, ihm zur Last zu fallen. Ich mochte ihn sofort. Wie sich herausstellte, war ich sein einziger postgraduate student. Niemand sonst nämlich machte damals den Magister oder Doktor bei ihm. Und dabei sollte es auch die nächsten Jahre bleiben. Mein Vorgänger als postgrad hatte seine Dissertation über Thomas Bernhard abgeschlossen, kurz bevor ich eintraf. Magisterstudenten, die, genau wie das heutzutage im deutschen System der Fall ist, sozusagen ein einjähriges Aufbaustudium nach dem Bachelor machten, hatte er schon länger keine gehabt. Undergrads, die ihn als Dozenten aus ihrem dreijährigen Studium doch gut kennen mußten, waren offenkundig nicht interessiert daran, bei ihm weiterzumachen. Vielleicht hat Sebald daher gefallen, daß jemand – so wie er selbst – aus Bayern nach England ging, weil ihm die Zustände an einem überlaufenen Institut nicht wirklich zusagten und die Germanistik als Disziplin sich eher als unbefriedigend herausgestellt hatte. Beim Kennenlernen vereinbarten wir wöchentliche Treffen, zu denen ich jeweils ein vorher festgelegtes Buch gelesen und vorbereitet haben sollte. Den Text für die erste Sitzung gab er vor: Hans Erich Nossacks Bericht Der Untergang. Brav, ganz so wie ich es in München gelernt hatte, hielt ich sieben Tage später ein kleines, zweifellos naives Referat über Nossacks Bericht von der Zerstörung Hamburgs durch die Bombardierungen von 1943. Sebald hörte sich das in Ruhe an, lächelte dann in seiner bübischen Art und sagte so etwas wie: »Ja, so kann man das sehen.« Dann begann er mir seine Perspektive auf den Text zu geben. Und seine Sicht auf die Problematik der literarischen Behandlung des Luftkriegs in der deutschen Nachkriegsliteratur. Zwar hatte ich in München eine Vorlesung und ein Seminar zur Nachkriegs-
Ein Lehrer
135
literatur besucht, doch dort war dieser Aspekt nicht vorgekommen. Wie vielleicht nicht weiter erläutert werden muß, hatte ich in unserer ersten Sitzung so etwas wie eine Vorschau auf seine späteren Zürcher Poetikvorlesungen über Luftkrieg und Literatur erlebt. Als wir uns am Ende verabschiedeten, bot er mir das ›Du‹ an, weil »das alles einfacher macht.« Und er bat mich, ihn fortan Max zu n ennen. Ein Literaturstudium an der UEA war damals eine aufregende Sache, denn die UEA war so etwas wie ein Zentrum der englischsprachigen Literatur. Die Creative-Writing-Kurse, die der Autor Malcolm Bradbury im Jahr 1970 nach amerikanischem Modell begründet hatte, brachten viele heute bedeutende Autoren hervor. Gleich der ersten Studentenkohorte gehörte Ian McEwan an; der Nobelpreisträger Kazuo Ishiguro graduierte 1980, und wichtige Autorinnen wie Anne Enright oder Rose Tremain erlernten ihr Handwerk ebenfalls an der UEA. Die Dozenten an der ›School of English and American Studies‹ waren oft selbst als Autoren literarischer Werke hervorgetreten. So etwa Lorna Sage oder Janet Todd, die wundervolle Bücher im Grenzbereich von Historie, Memoiren und Fiktion geschrieben haben. Regelmäßig wurden Literaturfestivals veranstaltet. Während meiner Jahre dort konnte ich solche Schriftsteller wie Salman Rushdie, Arthur Miller, William Golding oder Susan Sontag bei Lesungen erleben, um nur die wichtigsten Namen zu nennen. Aus dieser sehr starken Präsenz der Literatur an der UEA mag sich erklären, warum Sebald großen Wert darauf legte, daß seine englischen Kollegen keine Notiz von seinen Büchern nahmen. Er nutzte die Diskretion, welche das Schreiben in einer Fremdsprache gewährt. Hinzu kam, daß ihm »die peinlichen Fälle von Selbstverehrung« in der Profession der Schriftstellerei als auch unter schreibenden Akademikern zutiefst suspekt waren. Die Gründung des BCLT muß vor dem Hintergrund der großen Anziehungskraft der Creative-Writing-Kurse gesehen werden.
136
4 Universität
Sebald stellte der Vormachtstellung anglo-amerikanischer Literatur an der UEA gleichsam ein kontinentaleuropäisches Gegengewicht zur Seite, mit dem die Aktivitäten der EAS-Dozenten ergänzt wurden. Kaum in Norwich angekommen, fand schon im Dezember 1992 ein ›European Writers’ Forum‹ statt, an dem u.a. Hans Magnus Enzensberger, Lars Gustafsson, Cees Nooteboom, Ryszard Kapuściński und Gianni Celati teilnahmen. Sie lasen jeweils in ihrer Muttersprache, gefolgt von einer englischen Übersetzung. Auch waren immer wieder prominente Autoren, Übersetzer und Intellektuelle für Vorträge am BCLT zu Gast, wie etwa der bereits erwähnte George Steiner. Es war jedenfalls merkwürdig, als neuangekommener Student von Sebald gleich mitgenommen zu werden zu einem nichtöffentlichen Empfang, den das BCLT veranstaltete. Ich sollte nämlich Enzensberger kennenlernen. Als Zivildienstleistender hatte ich längere Zeit in unmittelbarer Nähe von dessen Schwabinger Wohnung gelebt und als taxifahrender Student einmal seinen (von Sebald sehr geschätzten) Bruder Christian zum Münchner Hauptbahnhof befördert. Nun begegnete ich HME persönlich in Norwich, vorgestellt von Sebald. Außer etwas smalltalk und höflichen Worten hatten wir uns freilich nichts zu sagen. Als Enzensberger später seine Ansprache zur Eröffnung des ›European Writers’ Forum‹ hielt, wunderte ich mich über die Platitüden, die er darin ausbreitete. Wie überhaupt über das gespreizt kosmopolitische Gehabe, das er in seinem Vortrag eitel zur Schau stellte. Als Enzensberger mit seiner Rede fertig war, kam plötzlich Sebald zu mir und flüsterte: »Siehst du, Uwe, auch große Geister können manchmal einen ganz schönen Scheiß erzählen!« Das war zwar vollumfänglich korrekt angesichts des soeben Gehörten. Jedoch erstaunte es mich nicht wenig, daß Sebald seine Meinung ausgerechnet einem Studenten, den er noch keine zwei Monate kannte, in solch direkten Worten anvertraute. Zumal es
Ein Lehrer
137
sich bei Enzensberger ja um einen Förderer handelte, der Sebald in die von ihm verantwortete ›Andere Bibliothek‹ aufgenommen und damit erst bekannt gemacht hatte. Ich war auch erst ein paar Wochen in Norwich, als Sebald mir einen schmalen Papierstapel in die Hand drückte mit der Bitte, sich das ›Geschreibsel‹ mal durchzulesen und ihm zu sagen, was ich davon halten würde. Er sei sich nämlich nicht sicher, ob man das so veröffentlichen könne. Dieser Wunsch überraschte mich. Daß Professoren ihre Studenten um Rat baten, schien mir nicht der Regelfall zu sein; eher doch andersherum. Der auf Sebalds ausgeleierter Schreibmaschine mit ihren wellenlinigen Zeilen und behelfsmäßig konstruierten Umlauten geschriebene Essay entpuppte sich als jene Intervention in das Verklärungsgeschäft der Germanistik, mit der er eine nicht unwesentliche Kontroverse auslöste, nämlich sein oben bereits erwähnter polemischer Aufsatz über Alfred Andersch, in dem er diesem scheinheiligen Säulenheiligen der Nachkriegsliteratur insbesondere dessen Verhalten im Nationalsozialismus vorhielt (samt der verklärenden ›Umschrift‹ desselben in seiner Literatur). Der Essay, der in seinem moralischen Furor in manchen Aspekten zwar übers Ziel hinausschoß, grundsätzlich aber die überfällige Revision der Bewertung von Andersch vornahm, war aufgrund seiner ketzerischen Stoßrichtung von mehreren Redaktionen abgelehnt worden, bevor ihn schließlich die Zeitschrift Lettre International annahm und im Frühjahr 1993 druckte. Die Zurückweisung durch etablierte Organe des Literaturbetriebs (die sich übrigens wiederholte, als ich um 2009 herum zunächst vergeblich versuchte, alle einschlägigen Zeitschriften für den Abdruck von Sebalds polemischer Abrechnung mit den Romanen von Jurek Becker zu interessieren), muß ihn so verunsichert haben, daß er die Meinung eines Studenten einholte. Meine enthusiastische Zustimmung zum Andersch-Essay schien ihm aber wichtig als Bestätigung, daß die Polemik ihre Berechti-
138
4 Universität
gung hatte. Rückblickend erscheint mir daher bemerkenswert, daß hinter den Polemiken, die Sebald mit energischer Bestimmtheit und polternder Überzeugung vortrug, doch auch ein gewisses Maß an Unsicherheit steckte. Die Sorge vielleicht, die er bei seiner Vorstellungsrede vor dem Kollegium der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung ausdrückte in der Bemerkung, im Traum einmal »als Landesverräter und Hochstapler entlarvt« (CS 250) worden zu sein. Meine Anerkennung für den Andersch-Essay jedenfalls nahm er fast verschämt an; es schien Sebald genuin ein wenig peinlich zu sein, belobigt zu werden, was wiederum zurückweist auf seine große Bescheidenheit und den gänzlichen Mangel an Eitelkeit. Selbst wenn dieses Lob nur von einem Studenten stammte. Lebhaft in Erinnerung ist mir ebenso der Moment, als wir uns zufällig auf dem Unikorridor begegneten, nachdem ich gerade Die Ringe des Saturn gelesen hatte, die er mir mit Widmung ins Fach gelegt hatte. Ich war völlig begeistert von seinem Meisterwerk; Sebald aber wirkte sehr unsicher, ob das Buch wirklich gelungen sei, freute sich jedoch erkennbar über mein Lob. Überhaupt ging es ihm stets stark darum, was er für wahr und richtig erachtete, auch auszusprechen. So hielt ihn von der Abrechnung mit Andersch keineswegs ab, daß seine Polemik bei Enzensberger zwangsläufig auf wenig Gegenliebe stieß, war dieser doch als junger Mann von Andersch gefördert worden. Doch dergleichen Verhaltensweisen waren typisch für Sebald. Ich schätzte das sehr an ihm – die Wahrheit zu benennen, jenseits opportunistischer Erwägungen, persönlicher Verpflichtungen oder politischer Korrektheit. Etwa, was die Problematik des vielgelobten Romans Jakob der Lügner von Jurek Becker betrifft, den Sebald als »melodramatischen Genreroman« verwarf. Daß das humorvolle Buch, urteilte er, »dem deutschen Durchschnittsleser das Getto kommensurabel machte, ist das Maß seines Mißlingens.«
Ein Lehrer
139
Oder seine treffende Charakterisierung des sogenannten Literaturpapsts, der im Literarischen Quartett erhebliche Vorbehalte gegen Die Ausgewanderten zum Ausdruck brachte. Als Sebald dazu vom Journalisten Sven Boedecker befragt wurde, antwortete er: »Der Mann ist ein armer Wurschtl, ein Hohlkopf, der sich halt noch nie mit so etwas beschäftigt hat. Im Grunde beuten die Medien ihn in seiner Rolle aus, er muß immer den Deppen machen.« In seinem letzten deutschsprachigen Interview wiederum zog Sebald, in der ihm eigenen Weise, eine direkte Linie von aktuell- lokalen Vorfällen zum Grundsätzlichen; in diesem Fall von den ›Kohorten-Keulungen‹ von rund vier Millionen britischen Rindern samt Verbrennung von deren Kadavern im Rahmen des BSE-Skandals zum Holocaust, dem er dabei die Singularitätsthese absprach, die sich seit dem Historikerstreit in der linksliberalen Öffentlichkeit als Diskursvorschrift durchgesetzt hatte. Sebald sagte: »Wenn man zum Beispiel in den letzten Monaten erlebt hat, daß in England unter den grauenhaftesten Umständen Hekatomben von Rindern hingerichtet wurden, weil es hieß, daß der Markt nicht mit Rindern fertig werden kann, die von einer irgendwann einmal relativ harmlosen Krankheit infiziert waren, dann kann man sehen, wie diese Dinge fortwährend unser Leben bestimmen. Ich sehe die von den Deutschen angerichtete Katas trophe, grauenvoll wie sie war, durchaus nicht als ein Unikum an – sie hat sich mit einer gewissen Folgerichtigkeit herausentwickelt aus der europäischen Geschichte und sich dann, aus diesem Grunde auch, hineingefressen in die europäische Geschichte. Deshalb sind die Spuren dieser Katastrophe in ganz Europa ablesbar, ob sie nun im Norden von Schottland sind, oder auf Korsika oder auf Korfu.« (G 260) Bezeichnend für Sebald war auch seine Empörung darüber, durch neumodische Kommunikationsformen erreichbar zu sein. »Jetzt fangen plötzlich alle an, mir Emails zu schicken, da kommt dann so ein Arschloch aus der Registry und bringt mir die Dinger
140
4 Universität
ausgedruckt vorbei«, erklärte er mir genervt Anfang der neunziger Jahre. Auf der Website der Universität war seine Emailadresse nämlich nicht zu finden, sondern man vermerkte seine Erreichbarkeit als »by pigeon-hole only«. Ebenso mokierte er sich über die Benutzer von Handys, die versunken in ihr Telefonat in das Gerät sprachen, wenn sie an ihm vorübergingen. In der zunehmenden Digitalisierung vermutete Sebald einen Vorboten für den Untergang der ums Medium Buch zentrierten Schriftkultur; heute wissen wir, daß er nicht ganz Unrecht hatte. Sebald hatte sich als einziger Dozent der Universität geweigert, einen Computer in seinem Büro installieren zu lassen. Bleistift, Schreibmaschine und Telefon blieben für ihn bis ins einundzwanzigste Jahrhundert die einzigen Werkzeuge, derer er sich bediente. Bis zuletzt erreichten mich ausschließlich handschriftliche Botschaften, oftmals auf der Rückseite von Bild- und Ansichtspostkarten, die Sebald zu Korrespondenzzwecken sammelte. (Warum ich so dumm war, diese Autografen weitenteils wegzuwerfen, kann ich mir nicht erklären.) Seine einzelgängerischen, auf Autonomie bedachten Verhaltensweisen an der Universität orientierten sich, bewußt oder nicht, an einem anderen deutschsprachigen Außenseiter des englischen Universitätsbetriebs, nämlich Ludwig Wittgenstein. Für den exzentrischen Philosophen aus Cambridge besaß Sebald eine besondere Sympathie, denn Wittgenstein war in akademischen, ästhetischen und moralischen Fragen für seine Kompromißlosigkeit bekannt und berüchtigt. Darin erkannte sich Sebald wieder. Über dessen Schriften sagte Sebald, und dies nur halb scherzhaft, daß sie ohnehin niemand verstehe. Seine Faszination galt dem Leben Wittgensteins, der im Zentrum des englischen Universitätssystems wirkte ohne jedoch ein Teil davon zu sein. Die merkwürdige Koinzidenz, daß sich die drei Initialen Sebalds in den drei Silben des Philosophennamens wiederfanden, wird ein Übriges
Ein Lehrer
141
getan haben, in Wittgenstein einen Geistesverwandten über Raum und Zeit zu sehen. Einzufangen versucht hatte Sebald diese anziehende Wirkung in dem zu Mitte der achtziger Jahre entstandenen experimentellen Filmdrehbuch Leben W.s, das ebensowenig in einen Film umgesetzt wurde wie ein zuvor entstandenes Skript über das Leben und Sterben von Immanuel Kant. Für dessen Verfilmung in Zusammenarbeit mit dem Berliner Filmemacher Jan Franksen waren 1983 bereits Finanzmittel bereitgestellt worden, die dann aber kurzfristig zurückgezogen wurden. Fast hätte Sebald also im Bereich des experimentellen Fernsehfilms, in dem er damals eine zeitgemäße Alternative und Fortführung der Form des Essays sah, sein Debüt als literarischer Autor gemacht. Und wer weiß, wie anders sein Werk sich dann entwickelt hätte. Das Skript über Kant verschwand in der Schublade (und wurde erst 2015 als Hörspiel des WDR produziert), während das Leben Wittgensteins in vielfältiger Weise in Sebalds Prosatexte einging. Dies vor allem in der Figur von Paul Bereyter, in dem Sebald biografische Anteile von Wittgenstein mit der Person seines hochgeachteten Wertacher Lehrers Armin Müller verschmolz, der sich – weitgehend wie in Die Ausgewanderten beschrieben – im Alter umbrachte. Naheliegend ist die Vermutung, daß Sebalds Erfahrung, durch die ›Schule‹ der schülerzugewandten Pädagogik von Müller/Bereyter gegangen zu sein, sich auf seine spätere Haltung als Universitätslehrer auswirkte. Benötigte ich als Student Hilfe welcher Art auch immer, nahm sich Sebald stets Zeit und machte sich teils nicht unerhebliche Mühe. Da das erste Kapitel meiner Dissertation allzu konventionell ausfiel und den behandelten Text, Gerhard Roths Essayband Eine Reise in das Innere von Wien, nicht wirklich in seiner literarischen Spezifizität erfaßte, gab er mir bei der Feedbacksitzung zwei Schreibblockseiten mit Stichworten mit und sagte dazu: »Vielleicht probierst Du es mal auf diese Weise, das erscheint mir besser.«
142
4 Universität
Etwas beschämt machte ich mich ans Werk und schrieb das Kapitel komplett um. Mich entlanghangelnd an den kargen Stichworten und zunächst oft kryptischen Verweisen, erlernte ich quasi eine andere Art und Weise, sich einem Text zu nähern. Was man sich etwa unter einer ›Versteinerung der Macht bei Canetti‹ vorzustellen hatte, war mir zunächst nicht klar. Dann aber las ich es in Masse und Macht nach und begriff sofort, wie das auf Roth anzuwenden war. So wurde das Umschreiben zu einem Lernprozeß, der mir ermöglichte, auch die restlichen Kapitel der Doktorarbeit erfolgreich anzugehen. Ob Sebald die Neufassung des Kapitels dann mit der von ihm oft benutzten Formel »Das kann man so lossegeln lassen« bedachte, kann ich mich nicht erinnern. Er ermunterte mich jedenfalls, eine gekürzte Version als Essay an die Grazer Literaturzeitschrift Manuskripte zu senden. Auf eine solche Idee wäre ich selbst nie gekommen. Die renommierte Zeitschrift schien mir damals allein für die Essays solcher Kapazitäten wie Sebald reserviert. Als Kind eines Arbeiters und einer Geflüchteten, beide ohne Schulabschluß, war ich nicht mit dem Horizont aufgewachsen, daß Literaturzeitschriften auf Beiträge von mir warteten. Mein Text wurde sofort angenommen. Das war ein großes Erfolgserlebnis, das mein Selbstvertrauen stärkte. Schüler von Sebald zu sein hieß somit auch, zu lernen, daß man sich – angesichts der Voraussetzungen, die wir beide mitbrachten – seinen Platz im Germanistikbetrieb mit Fleiß erarbeiten und mit Mühe erkämpfen mußte. Wer kein soziales Startkapital besaß und nicht auf Förderung durch volksdeutsche Studienstiftungen bauen konnte, muß viel arbeiten und braucht viel Glück. Auf Sebalds Hilfe konnte ich mich immer verlassen, etwa wenn es um die Formulierung von Bewerbungsschreiben oder das Ausfüllen von Anträgen ging. Als ich mich nach dem BAföG-finanzierten Magisterkurs für eine Promotion bei ihm entschied, war das angesichts der horrenden englischen Studiengebühren ein
Ein Lehrer
143
finanzielles Wagnis. Meine Eltern hätten die Kosten für drei Jahre nicht schultern können. Ein Antrag an die British Academy zur Übernahme der tuition fees in Höhe von umgerechnet rund viertausend Euro jährlich war daher unabdingbar. Vor dem auf das englische Hochschulsystem zugeschnittenen Formular stand ich weitgehend hilflos. Sebald aber nahm sich die Zeit, mir seitenlang die für solche Zwecke nötigen Phrasen niederzuschreiben. Obgleich ihm als Philologen die hohle Managementsprache verhaßt war, die Akademikern immer mehr aufgenötigt wurde, konnte er sie bei Bedarf replizieren, um meinem Antrag die nötigen Erfolgsaussichten zu geben. Nur bei einem Punkt, nämlich der Frage, inwieweit der Antragsteller die angestrebte Promotion zu Zwecken des ›self-improvements‹ nutzen würde, platzte ihm der Kragen. Er schrieb: »The point of self-improvement troubles me somewhat. It seems strangely puritanical to me. My interest is to join a self-motivating profession, not one which makes statements about self-improvement.« Ob ich seiner Empfehlung folgte, weiß ich nicht mehr sicher. Ich glaube aber, ich riskierte es. Vermutlich dachte ich mir, daß eine ›freche‹ Antwort zumindest auffällig wäre, und nicht als Insubordination, sondern vielmehr als Evidenz eines kritischen Denkens ausgelegt würde. Das Stipendium habe ich jedenfalls bekommen. Damit war der Weg frei für die Promotion bei Sebald. Von meinem Doktorvater habe ich so die Haltung übernommen, daß man sich nicht permanent anpassen und nicht noch den letzten Rest an Selbstbestimmung und persönlicher Würde der Unterordnung an die herrschenden Verhältnisse opfern sollte. Doch das war bei weitem nicht das einzige, was er mir mit auf den Weg gab. Max Sebald war ein Lehrer.
5 Tiere
V
on allen Tiergeschichten in Sebalds Werk hat mich die Episode mit der Schweineherde aus Die Ringe des Saturn am meisten angerührt. Das auch, weil die Landschaft von East Anglia markant von den allerorten unter freiem Himmel auf Matschfeldern sich suhlenden Schweineherden geprägt ist. Dieser Anblick war mir zuvor aus Deutschland unvertraut. Ebenso wie die auffallenden Blechhütten, in denen die Tiere wie in einem Kleinhangar hausen: eine irgendwie absonderliche Mischung aus halbierten Riesenmetallfässern und retro-futuristischen Domizilen. Der also entlang der Agrarflächen nahe Benacre Broad umherwandernde Erzähler übersteigt die elektrisch gesicherte Umzäunung eines Feldes, auf dem eine an die hundert Tiere zählende Schweineherde ihr Lager hat. »Ich näherte mich einem der schweren, bewegungslos schlafenden Tiere. Langsam öffnete es, als ich mich niederbeugte zu ihm, sein kleines, von hellen Wimpern umsäumtes Auge und blickte mich fragend an. Ich fuhr ihm mit der Hand über den staubbedeckten, unter der ungewohnten Berührung erschaudernden Rücken, strich ihm über den Rüssel und das Gesicht und kraulte ihm die Kuhle hinter dem Ohr, bis es aufseufzte wie ein von endlosem Leiden geplagter Mensch. Als ich mich wieder erhob, machte es mit einem Ausdruck tiefster Ergebenheit das Auge wieder zu.« (RS 85)
146
5 Tiere
Es ist dies das Bild einer wundervollen, überaus zärtlichen Nähe zwischen Mensch und Tier. Aber es kommt etwas Entscheidendes hinzu. Just das Schwein ist es, das unter uns Menschen herhalten muß, das zu verkörpern, was als ablehnungswürdig gilt: sexuelle Freizügigkeit, moralisches Fehlverhalten, mangelnde Bereitschaft zur Sauberkeit. Schweine gelten im Allgemeinen als schmutzig. Daß sie tatsächlich so intelligent wie Hunde sind und über erstaunliche soziale Fähigkeiten verfügen, verdrängen oder ignorieren wir. Die empathische Begegnung mit dem Schwein läßt Sebald an die verquere Bibelgeschichte vom wahnsinnigen Gadarener denken. Wie der Evangelist Markus berichtet, verfügte der besessene Tobsüchtige über eine solch ungeheure Kraft, daß niemand ihn zu bändigen vermochte. Auf »der Totenstätte in den Bergen schrie und heulte und hieb er auf sich ein mit Steinen. Nach seinem Namen befragt, antwortete er: Legion heiße ich, denn wir sind unser viele und bitten, treibt uns nicht aus aus dieser Gegend. Der Herr aber befiehlt den bösen Geistern hineinzufahren in die Sauherde, die daselbst auf der Weide ist. Und die Säue, von denen der Evangelist sagt, daß es an die zweitausend gewesen sind, stürzen sich vom Abhang hinab und ersaufen in der Flut.« (RS 86) Eine fürwahr fürchterliche Geschichte. Sebald fällt dazu als erstes die spöttische Frage ein, ob nicht »unserem Herrn bei der Heilung des Gadareners ein böser Kunstfehler unterlaufen ist?« Zutreffend ist seine Vermutung, daß wir hier »eine von dem Evangelisten bloß erfundene Parabel über den Ursprung der angeblichen Unsauberkeit der Schweine vor uns haben, die, wenn man es recht bedenkt, darauf hinausläuft, daß wir unseren kranken Menschenverstand immer wieder auslassen müssen an einer anderen, von uns für niedriger gehaltenen und für nichts als zerstörenswert erachteten Art.« (RS 86) Die angebliche Unreinheit, die den intelligenten Tieren per ›Wort Gottes‹ zugeschrieben wird, ist insbesondere ein Merkmal der jüdischen und muslimischen Religion. Sebald verzichtet darauf, dies
5 Tiere
147
eigens auszusprechen. Aber jedem verständigen Leser sollte das klar sein. Im christlichen Kontext kommt noch die Perfidie hinzu, daß der Mensch das Schwein kulturell degradiert, um es ökonomisch als Nahrungsmittel auszubeuten, und dies unter oftmals unsäglichen Bedingungen. Die im Freien lebenden Herden in East Anglia sind insofern zu beneiden, weil sie ihr Leben nicht zusammengezwängt in Zuchtfabriken verbringen müssen. Das gewaltsame Ende zum Zwecke, den Frühstücksspeck für das full English breakfast zu liefern, teilen sie jedenfalls mit ihren Leidensgenossen, die früher oder später in die Schlachthöfe deportiert werden. So berichtet der Erzähler in Schwindel. Gefühle. die gespenstische Episode einer Wartepause bei der Brenner-Überquerung mit dem Zug: »Der Regen geht über in Schnee. Und eine schwere Stille liegt über dem Areal, durchbrochen allein vom Brüllen namenloser, auf irgendeinem Abstellgleis im Dunkeln ihren Weitertransport erwartenden Tiere.« (SG 93) Aus diesen Worten ist ein Anklang zu vernehmen, der die industrielle Aufzucht und Tötung der Tiere dem industriell organisierten Genozid am europäischen Judentum annähert. Ganz explizit macht Sebald seine Haltung dazu an anderer Stelle: »Thomas Bernhards polemische Konjektur, daß das Schwein heute schon menschlicher sei als der Mensch, der mehr und mehr zum Schwein geworden sei in den letzten hundert Jahren, ist als ein ethisches Verdikt nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen, zumindest insofern nicht als das Schicksal der Schweine, das Ende in der Todesfabrik, tatsächlich unser eignes ist«, heißt es im Aufsatz Die weiße Adlerfeder am Kopf. Versuch über den Indianer Herbert Achternbusch. Dem fügt Sebald an: »Auschwitz und die Konzentrationslager für Tiere haben als gemeinsamen Nenner die Ausbeutung der Natur.« Eine unter den herrschenden Diskursregeln unstatthafte, ja: ungeheuerliche Analogie, die auch wiederholt zur Rüge durch die Diskurspolizei geführt hat. Das erste Mal benutzte Sebald die geächtete Analogie in seiner Döblin-Dissertation von 1973. Bei der Dis-
148
5 Tiere
kussion des berühmten Schlachthaus-Kapitels in Berlin Alexanderplatz lobt er Döblin, was selten genug in seiner Dissertation vorkommt: nämlich für den angesichts des Holocaust prophetischen Charakter seiner Beschreibung des durchorganisierten Logistik- und Verwertungssystems, mit dem die Tiere dort ermordet werden. Und in der Tat sollte Sebald, wie wir sehen werden, immer wieder auf die Ähnlichkeit zwischen Holocaust und Schlachthofsterben zurückkommen. Dabei geht es ihm freilich nie darum, den Genozid am europäischen Judentum irgendwie zu relativieren. Vielmehr wollte er unseren herzlosen Umgang mit Tieren aufs Schärfste verurteilen: »Rational gesprochen sehe ich nicht ein, warum ein anderes Wesen, das auf diesem Planeten herumirrt, weniger Lebensrecht haben sollte als wir.« (G 73) Die Frequenz, mit der Sebald den Zusammenhang herstellt zwischen dem Holocaust und der industriellen Verwertungslogik, mit der wir der Tierwelt begegnen, ist Ausweis der Tiefe seiner Überzeugung davon, daß der problematische Vergleich gerechtfertigt ist. Dergleichen wird nicht allen Lesern gefallen. Und muß es auch nicht. Es ist ein störrischer Nachweis für Sebalds Eigensinn.
CAVE CANEM Sebalds tiefe Zuneigung zu Tieren – zu denen er so etwas wie eine Artgenossenschaft empfand, die wir später noch genauer bestimmen müssen – äußerte sich in vielfacher Weise. Sie ist ein Vermächtnis, so wird man vermuten dürfen, des Großvaters und seiner Naturethik, die nicht nur Flora, sondern auch Fauna umfaßte. In seiner Jugend interessierte sich Sebald insbesondere für Pferde und ritt öfters im Allgäu aus. Selbstverständlich war er, aus ethischen Gründen, zum Vegetarier geworden. Er machte mich in diesem Zusammenhang auf die
Cave Canem
149
für ihn wichtigen Schriften von Elias Canetti aufmerksam, welcher den Verdauungsvorgang als »zentralsten, wenn auch verborgensten Vorgang der Macht« bezeichnet hat. Obgleich sich der Mensch wie seine äffischen Vorfahren rein vegetarisch ernähren könnte, töten und essen wir Tiere. »Der Kot, der von allem übrigbleibt«, so Canetti in Masse und Macht, »ist mit unserer ganzen Blutschuld beladen. An ihm läßt sich erkennen, was wir gemordet haben. Er ist die zusammengepreßte Summe sämtlicher Indizien gegen uns. Als unsere tägliche, fortgesetzte, als unsere nie unterbrochene Sünde stinkt und schreit er zum Himmel.« Zur Familie gehörte bei Sebald auch ein Hund, mit dem er nach Möglichkeit jeden Tag über die Felder und Dörfer der Umgebung ging. Diese Fußmärsche waren für ihn der dringend benötigte Ausgleich zu den Belastungen durch die Universität und später durch seine Schreibarbeit. Die Hundehaltung galt Sebald außerdem als Antidoton gegen die Schwermut. Den ersten Familienhund, einen Labrador namens Jodok, hatte man sich in den siebziger Jahren angeschafft. Sein Tod hat Sebald tief getroffen. Es dauerte daher einige Zeit, bis ein neuer Hund in den Haushalt kam. Anfang der neunziger Jahre aber war es soweit: ein schwarzer Labrador namens Maurice wurde als Nachfolger Jodoks in den Kreis der Familie aufgenommen. Der Welpe ist oben zu sehen auf dem Schnappschuß, der einen nachdenklichen Sebald neben ihm auf dem Sofa zeigt. Abgebildet ist die Kopfpartie von Maurice auch im Bildtextband Unerzählt, wo die Radierung mit einem Mikrogedicht gepaart wird, das ein abgewandeltes Zitat aus einem Brief von Bettine von Arnim an Wilhelm Grimm vom März 1839 darstellt, in dem sie von ihrem Plan berichtet, ein Portrait von sich malen zu lassen. Vor der recht enthusiastischen Begrüßung durch Maurice, sobald man in die Old Rectory eintrat, hatte ich immer etwas Angst. Unnötigerweise natürlich. Als ich Sebald einmal zuhause besuchte, um über meine Dissertation zu sprechen, schien der Hund nicht da zu
150
5 Tiere
sein. Dann passierte etwas Komisches: Urplötzlich war unter mir, wie aus den tiefsten Tiefen der Verzweiflung, ein elendiges Stöhnen zu hören, das mich in überraschtes Erschrecken versetzte. Es dauerte eine Paniksekunde, bis ich realisierte, daß unter der Chaiselongue, auf der ich Platz genommen hatte, Maurice schlief. Der vermeintlich menschliche Elendsseufzer stammte von ihm. Sebald und ich brachen in lautes Lachen über meine Schreckreaktion aus. Dann sagte er: »Der arme Hund wird wohl von einem saftigen Knochen geträumt haben, denn bei uns bekommt er nur vegetarisches Futter.« Die Hundehaltung war gleichsam das Komplement zu Sebalds intellektueller Beschäftigung mit der Tierart. Wiederholt sind Hunde in seiner Erzählprosa anzutreffen, so etwa jenes herrenlose Tier, das den Erzähler ein Stück weit durch Verona begleitet: »Blieb ich stehen, so hielt auch er ein und schaute versonnen auf das fließende Wasser. Ging ich weiter, so machte auch er sich wieder auf den Weg. Als ich aber am Castelvecchio den Corso Cavour überquerte, blieb er an der Bordsteinkante zurück, und ich wäre, weil ich mitten auf dem Corso mich umwandte nach ihm, um ein Haar überfahren worden.« (SG 139) Hunde spielen insbesondere in den literaturkritischen Schriften eine bedeutende Rolle. Wichtig für Sebald war in Anlehnung an Benjamins Trauerspiel-Buch »das alte Melancholiesymbol des Hundes«, auf das er bereits in seiner Dissertation verwies. In einem kritischen Essay über Günter Grass hielt er fest: »Das Ausfindigmachen der Wahrheit ist ausgewiesen als das Geschäft des von Benjamin als das Wappentier der Melancholie beschriebenen Hundes.« (CS 112) Schwarze Hunde, so wie Maurice, waren von alters her, ebenso wie die schwarze Galle, ein Symbol der schwermütigen Disposition. In Interviews hat Sebald seine dem Zufall einen bedeutsamen Platz einräumende Arbeitsweise mit der unsystematischen Spurensuche eines Hundes verglichen: »Auf diese Art und Weise fin-
Jäger & andere Raubtiere
151
det man immer sehr eigenartige Dinge, mit denen man nie gerechnet hat, ja, die Sie auf eine rationale Weise nie vorfinden können, das heißt, wenn Sie recherchieren, so wie Sie es an der Universität gelernt haben, immer geradeaus, rechts, links, rechte Winkel und so weiter. Man muß auf eine diffuse Weise recherchieren. Es soll ein Fund sein, also genau wie ein Hund sucht, hin und her, rauf und runter, manchmal langsam und manchmal schnell. Das hat jeder von uns schon gesehen, wie die Hunde das machen beim Feldlaufen, und ich habe das Gefühl, wenn ich sie betrachte, das sind meine Brüder.« (G 214)
JÄGER & ANDERE RAUBTIERE Eine Brüderschaft empfand Sebald aber nicht nur zu Hunden, sondern zu allen Tieren. Zeitweilig lebte in der Old Rectory sogar eine kleine Tiergemeinde, aus der man fast die Bremer Stadtmusikanten hätte nachbauen können: Neben einem Pony, das in einem Stall hinter dem Haus untergebracht war, gab es noch eine Katze. Diese verstand sich nicht nur gut mit dem Hund, sondern auch mit dem zahmen Hahn, der bereits als Küken zu den Sebalds gekommen war. Wie Renate Just in einer Reportage über ihren Besuch in der Old Rectory berichtet, bedrückte und entsetzte Sebald der auf englischen Provinzstraßen allgegenwärtige Anblick des durch den Autoverkehr verursachten Tiermassakers. Häufig sah man auf den engen Heckenwegen überfahrene, zerquetschte und zerdrückte Feder- oder Fellbündel, weil es den Tieren nicht gelang, sich vor den schnell fahrenden Autos zu retten. Sebald, so berichtet es Just, erwog sogar, die vielen Formen dieses massenhaften ›Zerquetscht seins‹ mit der Kamera zu dokumentieren. Metzgereien waren Sebald nicht minder von jeher ein Graus. »So entsinne ich mich jetzt«, schreibt er im Korsika-Projekt, »wie
152
5 Tiere
ich auf meinem Schulweg einmal am Hof des Metzgers Wohlfahrt vorbeigekommen bin an einem frostigen Herbstmorgen, als gerade ein Dutzend Hirschkühe von einem Karren abgeladen und auf das Pflaster geworfen wurde.« Ein offenkundig traumatisierendes Erlebnis: »Ich vermochte mich lang nicht von der Stelle zu rühren, derart gebannt war ich vom Anblick der getöteten Tiere.« (CS 45) Insbesondere die englischen Metzgereien der Provinz betrachtete Sebald als fürchterlich. Zur Anlockung von Kundschaft hängt man dort gerne am Hals aufgeknüpfte Fasane und frisch geschossene Hasen vor den Geschäften auf. Gewöhnungsbedürftig sind ebenso die Fleischtheken, in denen Stapel von Schweinsfüßen und allerlei Innereien zu finden sind, während Schweinehälften an Metallhaken von der Decke baumeln. Zu den Eigenarten englischer butcher gehört desweiteren, die feilgebotenen Fleischstücke ungekühlt auf billigen Plastikwannen zu drapieren, verziert mit kleinen immergrünen Plastikblättern. Diese soll man wohl als Platzhalter interpretieren, welche vorgaukeln, die Tiere kämen direkt und frisch aus Wald und Natur, anstatt aus den Produktionsanlagen der Schlachthöfe. Dazu paßt denn auch »das Wesen, das die Jäger um das Tannengrün machen«, das Sebald von jeher »irgendwie verdächtig vorgekommen« (CS 45) ist. Die Plastikdekorationen erscheinen ihm daher als Ausdruck des Schuldbewußtseins, das der Mensch immer noch zuinnerst empfindet, wenn er Fleisch ißt: »Die unabweisbare Einsicht, daß dieser Plastikzierat irgendwo fabrikmäßig hergestellt werden mußte zu dem einzigen Zweck, unsere Schuldgefühle zu lindern angesichts des vergossenen Bluts, war mir, gerade in ihrer völligen Absurdität, ein Zeichen dafür, wie stark der Wunsch nach Versöhnung in uns ist und wie billig wir uns sie von jeher erkauften.« (CS 46)
Jäger & andere Raubtiere
153
Dem möchte man noch ein Interviewstatement anfügen, in dem Sebald ein bekanntes Wort von Nietzsche abwandelt: »Es ist tatsächlich der Mensch eine perverse Spezies, eine um ihren gesunden Tierverstand gekommene Spezies.« (G 151) Wie nun kaum erstaunen dürfte, empfand Sebald wenig Sympathie für Menschen, die sich als hemmungslose Fleischfresser erwiesen. Menschen wie der Schriftsteller Adalbert Stifter, der, seinem krankhaften Freßzwang folgend, eine selbstzerstörerische Völlerei sondergleichen betrieb. Sebald vermutet, daß »die kontinuierliche Einverleibung gewaltiger Mengen tierischer Nahrungsmittel für Stifter ein Mittel zur Akkreditierung in der besseren Gesellschaft gewesen ist«, wobei die Hekatomben der tierischen Opfer »als schlechtes Gewissen in ihm fortrumorten.« (BU 172) Die Selbstzeugnisse des Dichters über seinen wahrlich abenteuerlichen Fleischgenuß zitiert Sebald, so bekommt man den Eindruck, vornehmlich zur Abschreckung: »Das Register dessen, was er sich noch in einer Zeit, in der er sich häufig schon am Rand des Grabes wähnt, systematisch einverleibt, ist tatsächlich schauerlich: ›Rindfleisch, geback. Kizl, gebrat. Huhn, Haselhuhn, Taube, Kalbsbraten, Schinken, saure Leber, Schweinsbraten, Sardinen, Paprika-Huhn, geback. Lämmernes und Rebhuhn, viel Rindfleisch (hartes) gegessen, Nudelsuppe, etwas Rindfleisch u. Schöpsernes, dann Reisauflauf, Hirn mit sauren Rüben, eingemachtes Kälbernes, Schnitzel mit Sardellensoß, Jause Tee mit Haselhuhn, Jause Tee Huhn (reichlich), Jause Tee mit Schinken, Jause mit viel Huhn usw.‹« (BU 170) Nichts als Verachtung besaß Sebald für die Jagd als einen Umgang mit Tieren, der seinem brüderschaftlichen Verhältnis zu ihnen diametral entgegengesetzt war. Das gilt insbesondere für die massenhafte Abschlachtung von Tieren zum aristokratischen Zeitvertreib oder aus billigem Gewinnstreben. Die abgelehnte Erscheinung des Jägers gehört im Denken Sebalds ganz eng zur verachte-
154
5 Tiere
ten Gestalt des Soldaten und Frontkämpfers, wie er sie literarisch in Ernst Jünger verkörpert sah. In seinen Werken gibt es daher nur eine einzige sympathische Jägergestalt: Den »mit seinem Schmetterlingsnetz durch die Wiesen« springenden russischen Knaben, der »aus seiner Botanisiertrommel die schönsten Admirale, Pfauenaugen, Zitronenfalter und Ligusterschwärmer« (AW 317) nach dem Einfangen wieder freiläßt. Denn den jungen Schmetterlingsjäger interessiert nur die Schönheit der Natur, nicht die perverse Befriedigung, die das Töten von Tieren mit sich bringt. Und dieser Knabe ist natürlich niemand geringerer als der Die Ausgewanderten durchspukende butterfly man Nabokov. Negativ ist Sebalds Haltung auch, was den Zusammenhang zwischen wissenschaftlichem Entdeckungsdrang und kommerzieller Ausbeutung der Natur betrifft. Exemplarisch dafür steht das Beispiel von G. W. Steller: »Manuskripte am Ende des Lebens, / geschrieben auf einer Insel im Eismeer, / sein zoologisches Meisterwerk, / de bestiis marinis, / Reiseprogramm für Jäger, / Leitfaden beim Zählen der Pelze, / nein, nicht hoch genug / war der Norden.« (NN 66) Diese Passage bezieht sich auf die nach Steller benannte See kuh, ein zur damaligen Zeit bereits seltenes und zugleich wunderlich schönes Tier, auf das der Forscher während seiner Expedition gestoßen war. Indem Steller seine Entdeckung durch die zoologische Beschreibung mitteilte, weckte er den Profitdurst der Jäger: Die Steller’sche Seekuh avancierte zum Gegenstand intensiver Bejagung und war keine drei Jahrzehnte später ausgerottet. Im Korsika-Projekt wird die auf der Insel endemische, um nicht zu sagen: krankhafte Jagdleidenschaft zum Thema gemacht: »Obgleich das in früherer Zeit so zahlreich in den Inselwäldern wohnende Wild nahezu restlos ausgerottet ist, bricht auf Korsika nach wie vor jeden September das Jagdfieber aus. Es schien, als sei
Jäger & andere Raubtiere
155
die gesamte männliche Bevölkerung beteiligt an einem längst ziellos gewordenen Zerstörungsritual.« (CS 43) Das mörderische Gebaren wird erkennbar als atavistischer Blutrausch: »Unrasiert, mit schweren Gewehren und bedrohlichen Gehabe sehen die Jäger aus wie die kroatischen und serbischen Milizen, die ihre Heimat zugrunde gerichtet haben«, findet Sebald. Dazu paßt, daß »die korsischen Jäger, wenn man sich auf ihr Territorium verirrt, keinen Spaß verstehen. Als ich einen von ihnen fragte, worauf er hier warte, antwortete er bloß sangliers, als müsse das allein genügen, mich zu verscheuchen.« (CS 43/44) In der Neigung zu blutrünstiger Gewalt und im Waffenfetischismus der Korsen zeigt sich eine faschistoide Unterseite der gegenwärtigen Gesellschaft, in der sich fortsetzt, was als sozial akzeptiertes Verhalten bereits im Viktorianismus mit der Niederwildjagd begann: »Männer aus bürgerlichen Verhältnissen, die durch ihre Industrieunternehmungen zu enormem Reichtum gelangt waren, erwarben nun aus dem Bedürfnis nach Legitimierung in der besseren Gesellschaft große Landhäuser und Liegenschaften, auf denen sie die sonst von ihnen hochgehaltenen Grundsätze sinnvoller wirtschaftlicher Nutzung aufgaben zugunsten der an sich völlig nutzlosen, rein aufs Zerstören ausgerichteten, aber anscheinend von niemand als abwegig empfundenen Jägerei.« (RS 265) Der durch die Industrialisierung beschleunigte Raubbau an der Natur wird so ausgeweitet auf die Tierwelt. Der soziale Reputationsgewinn steht dabei in einem direkten Verhältnis zur Zahl der zur Strecke gebrachten Opfer. Das betraf vor allem die in East Anglia bis heute häufig anzutreffenden Fasane: »Sechstausend Fasane wurden manchmal an einem einzigen Tag geschossen, von dem übrigen Geflügel und den Hasen und Kaninchen gar nicht zu reden. Säuberlich sind die schwindelerregenden Zahlen verzeichnet in den Registern der miteinander im Wettbewerb stehenden Häuser.« (RS 267)
156
5 Tiere
Anhand einer solchen Stelle wird deutlich, daß Sebald eine direkte Verbindung zwischen Kapitalismus und Jagdfieber sieht. Beides basiert auf dem Wettbewerbsprinzip sowie rücksichtsloser Ausbeutung und ist der offenbar unwiderstehlichen Logik der ›springenden Zahl‹ verpflichtet, die Canetti wiederum in seinem Essay Hitler, nach Speer als charakteristisch für den Faschismus bestimmt hat. Natürlich muß man sich strengstens davor hüten, die höchst komplexen sozioökonomisch-historischen Faktoren vereinfachen zu wollen, die zum geschichtlichen Desaster des Faschismus in Deutschland geführt haben. Dennoch ist unschwer zu erkennen, daß für Sebald die Massentötungen der wehrlosen Tiere ein Präludium darstellen zum späteren Massenmord an unschuldigen Menschen, der sich ebenfalls in den Bereich schwindelerregender Zahlen hochgeschraubt hat.
SCHOCKSTARRE DER RAUPEN Bei seinen Waldgängen auf Korsika geriet Sebald einmal in ein Kieferngehölz, dessen Baumkronen von weißem, tuchartigem Gewebe durchzogen waren. »Wie ich seither herausgefunden habe, handelt es sich bei den zwischen den Zweigen hängenden sackartigen Gebilden um die Nester der Raupe Bombyx Processionis, die innerhalb weniger Wochen ganze Wälder mit einem Leichentuch überziehen & schwere Verkrüppelungen, ja sogar ein völliges Absterben der von ihr befallenen Bäume verursachen kann.« (KP 193) Zu den merkwürdigen Verhaltensmustern des Prozessionsspinners gehört, so referiert Sebald, daß die Tiere ihre in den Baumkronen gesponnenen Behausungen zum Zwecke der Verpuppung verlassen. In den namensgebenden Prozessionen ziehen sie über den Erdboden zu einem zwei bis drei Kilometer entfernten Ort, an
Schockstarre der Raupen
157
dem sie sich, ganz im Gegensatz zu ihrer luftigen Wohnung zuvor, eingraben und schlußendlich in einen Falter verwandeln. Auf eine solche Prozession, die ihn vielleicht irgendwie an die Flurumgänge seiner Kindheit erinnert haben mag, stößt Sebald nun im korsischen Kiefernwald. »Einer hinter dem andern kommen die flügellosen Vorläufer des Prozessionsspinners die grauen Stämme herab & kriechen über den Nadelboden fort, jeder von ihnen immer unmittelbar hinter dem andern, Kopfende an Hinterteil, in oft fünf Meter langen Zügen wie ein einziges, aus vielen Gliedern zusammengesetztes Schlangenwesen.« Fasziniert beobachtet er, wie dieses komische Kollektivwesen sich in plötzlichen Kehren und schnurgeraden Linien seinen Weg bahnt zum offenkundig genau vorbestimmten Ziel. »Wenn ich ihnen ein Hindernis in den Weg legte, gingen sie ohne Zögern einmal darüber hinweg, das andere mal um es herum, stets im gleichen Marschtempo, das als eine rhythmische Wellenlinie die Reihe der weichen Leiber durchlief ohne Anfang & Ende.« (KP 195) Dann passiert etwas Überraschendes: »Nachdem ich diese absonderlichen Kreaturen eine zeitlang bereits beobachtet hatte, schob ich eine der Raupen aus dem Zug heraus, was zur Folge hatte, daß sie wie tot liegenblieb, offenbar außerstande zurückzukehren an ihren kaum eine Spanne von ihrer jetzigen Position entfernten Platz. Und nicht nur war die aus der Reihe genommene Raupe erstarrt, der ganze Zug rührte sich nicht, machte keine Anstalten, die durch meinen gewaltsamen Eingriff entstandene Lücke zu schließen, sondern hielt einfach nur ein.« (KP 195) Ein gewisser Reverend Barleycorn, der bei einem 1868 unternommenen Spaziergang versehentlich in einen Prozessionszug trat, hat das fatale, widersinnige Verhalten der grasgrünen Raupen erstmals beschrieben: Anstatt die Lücke zu schließen oder in zwei Zügen weiterzumarschieren wie etwa Ameisen verfallen die Tiere reflexartig in eine Schockstarre, die zu ihrem Tod führt. Kein Wun-
158
5 Tiere
der also, daß Sebald – wie er bekennt – »gleichermaßen erstaunt & entsetzt war über das, was ich angerichtet hatte. Doch wie lange ich auch wartete, nichts regte sich mehr.« (KP 195) Es ist dies eine bedeutsame Stelle, nicht zuletzt da der Vorfall ein verstörendes Erlebnis für den Tierliebhaber Sebald war und ihm unauslöschlich »als ein Schreckbild vor Augen« (KP 196) blieb. Daß es sich um vergleichsweise primitive Tiere, Insekten also, gehandelt hatte, machte da keinen Unterschied. Gerade solchen mißachteten, minderen Geschöpfen gehörte seine besondere Aufmerksamkeit. Sebalds Faszination für die Tiere und ihr eigentümliches Verhalten löste hier erst seine unbedachte, folgenreiche Tat aus. Doch die Neugier, was passieren würde, reißt man eines der Tiere aus der Kette – steht sie nicht stellvertretend für den menschlichen Wissensdurst, mehr über die Tierwelt herauszufinden durch Experimente? Und spiegelt sich also nicht in dieser kuriosen Episode die ganze Geschichte und Tragik unseres wissenschaftlichen Zugriffs auf die Natur? Sebald selbst bietet eine andere Vermutung für sein Verhalten an: es stamme »wahrscheinlich aus einer der zerstörerischen Regungen, die die meisten von uns von klein auf in ihrem Herzen tragen.« (KP 195) Das ist eine kritische Selbsterforschung, die aber nicht kurzschlüssig mit einer psychoanalytischen Erklärung im Sinne eines Ausagierens kindlicher Gewaltphantasien verwechselt werden sollte. Vielmehr ist diese Bemerkung stammesgeschichtlich zu lesen: Sie zielt auf die urtümliche Prägung des Menschen, Tiere nicht als Partner, sondern erst als Feind und später als Objekt zu verstehen. Wieder scheint hier Sebalds Verständnis des Konzepts einer tief verankerten Naturgeschichte der Zerstörung auf. Die Aufklärung wollte uns glauben machen, daß wir uns von unseren irrationalen Wurzeln emanzipieren können, um uns dergestalt nicht nur zu Herren der Welt, sondern auch der Geschichte aufzuschwingen.
Im Anblick der Kreatur
159
Die Empirie widerspricht dieser Hoffnung auf Emanzipation. Geschichte läuft nicht »nach irgendeiner Logik« ab, so war sich Sebald sicher, denn es handelt sich beim Gang der Historie »um so etwas wie ein Driften, um Verwehungen, um naturhistorische Muster, um chaotische Dinge, die irgendwann koinzidieren und wieder auseinanderlaufen.« (G 187) Die Prozesse der Geschichte sind nicht wirklich in den Griff zu kriegen. Das aber scheint uns schwer zu akzeptieren. Jede Zeitungslektüre zeigt jedoch, daß die menschliche Hybris selbstzerstörerisch für unseren Planeten ist. Und das erst erhellt, was Sebald über die Todesstarre der Raupen feststellt, nämlich daß es eine »im gesamten Tierreich einmalige & zweifellos gegen jedes Lebensinteresse der Raupen gehende selbstzerstörerische Reaktion« (KP 196) ist. Was auf die Raupen des Prozessionsspinners zutrifft, gilt jedoch genauso für unsere Spezies: beide Arten sind »offenbar zu keinerlei Korrektur ihrer Entwicklungsbahn fähig.« (KP 193) Daß wir wissen, wie destruktiv unser kollektives Handeln ist und wie katastrophal die globalen Folgen für unseren Planeten, ändert nichts daran. Schockstarr gehen wir der eigenen Selbstvernichtung entgegen.
IM ANBLICK DER KREATUR Über eine außergewöhnliche Begegnung zu berichten vermag Sebald auf der einsamen Landzunge von Orford Ness vor Suffolk. Die transzendierende Erfahrung eines tödlichen Schreckens: Ein Hase »mußte unmittelbar vor meinen Füßen, während ich mich annäherte, zusammengekauert und mit rasend klopfendem Herzen an seinem Platz ausgeharrt haben, bis es beinah zu spät war, sein Leben zu retten. Der winzige Augenblick, da die Lähmung, die ihn ergriffen hatte, umschlug in die panische Bewegung der
160
5 Tiere
Flucht, war auch der Augenblick, da seine Angst mich durchdrang. Mit unverminderter, ja mit einer über mein Begriffsvermögen gehenden Deutlichkeit sehe ich nach wie vor, was in diesem, kaum den Bruchteil einer Sekunde ausmachenden Schreckensmoment sich ereignete. Ich sehe den Rand des grauen Asphalts, jeden einzelnen Grashalm, sehe den Hasen, wie er hervorspringt aus seinem Versteck, mit zurückgelegten Ohren und einem vor Entsetzen starren, irgendwie gespaltenen, seltsam menschlichen Gesicht, und ich sehe, in seinem im Fliehen rückwärtsgewandten, vor Furcht fast aus dem Kopf sich herausdrehenden Auge, mich selber, eins geworden mit ihm.« (RS 279/80) Was in dieser Passage beschrieben wird, ist die Ungeheuerlichkeit einer Aufhebung der Trennung von Mensch und Tier. Der so schmale wie tiefe Graben, der uns von den Tieren trennt, ist aber konstitutiv für das Menschsein. Als Austerlitz und Marie de Verneuil den erbärmlichen Zoo im Jardin du Luxembourg besuchen, beklagt sie, »was mir unvergeßlich geblieben ist, daß die eingesperrten Tiere und wir, ihr menschliches Publikum, einander anblickten à travers une brèche d’incomprehension.« (A 376) Sebald legt Marie hier Worte aus John Bergers beeindruckendem Essay Why Look at Animals? in den Mund, nämlich dessen Feststellung, daß Mensch und Tier sich im Zoo hilflos »across a narrow abyss of non-comprehension« betrachten. Auf Orford Ness aber wird dieser Graben in einem epiphanieartigen Vereinigungserlebnis überbrückt. Verantwortlich ist der übermächtige Schrecken, der sich als körperliche Erschütterung vom Hasen auf den Menschen überträgt: »Erst eine halbe Stunde später hörte allmählich das Blut auf, in meinen Adern zu rauschen.« (RS 280) Was Sebald hier beschreibt, ist eine Form des Ausnahmezustands, in dem sich die Dimension des Kreatürlichen auftut. Das Kreatürliche wird zum Schwellenraum, in welchem sich Mensch und Tier aufs engste begegnen, in dem zugleich jedoch die kategorische Unterschiedlichkeit beider Seinsformen deutlich wird.
Im Anblick der Kreatur
161
Angst, Leid und Schmerz verbinden in den Augen von Sebald die in unterschiedlichen Welten existierenden Lebewesen. Er zeigt das ebenso anhand des Terrors, den ein Brand unter den tierischen Bewohnern eines Walds auslöst. Denn »die Panik der Zeisige, deren Nester, noch bevor sie die Flammen erreichen, zu Asche verfallen, die Angst der unter den Blättern verborgenen Nachtfalter, der Nattern, Mäuse & Eidechsen, denen selbst, wenn sie sich ausruhen, das Blut in der Kehle klopft, diese Angst können wir mit keiner Statistik erfassen; sie ist uns so unbegreiflich wie nur unsere eigene es ist, wenn wir in unseren Städten verbrennen.« (KP 154) Kühn wird die Empfindung grenzenloser Angst selbst einer niederen Tierart wie den Faltern zugeschrieben. Genauso wenig zögert Sebald hier, eine Verbindungslinie zu ziehen zu den Feuerstürmen, denen unzählige Menschen im Bombenkrieg zum Opfer fielen. Es geht ihm also um durch Angst und Schmerz ausgelöste existentielle Grenzerfahrungen – wie man sie paradigmatisch dargestellt findet in Form des »panischen Halsknicks, / überall an den in Grünewalds Werk / vorkommenden Subjekten zu sehen, / der die Kehle freigibt und das Gesicht / hineinwendet oft in ein blendendes Licht« (NN 24) – um unserer Kreatürlichkeit gewahr zu werden. Eric L. Santner hat mit On Creaturely Life ein augenöffnendes Buch über Sebald geschrieben, das weit herausragt aus dem, was man ansonsten über sein Werk zu lesen bekommt. Wie Santner darin ausführt, spielt in den philosophischen Diskussionen des Kreatürlichen stets die Kategorie der Erlösung eine bedeutende Rolle. Entsprechender Gewährsmann für Sebald, ein weiteres Mal, ist Canetti, der notierte: »Man muß sich, wie Kafka berichtet, unter das Getier legen, um erlöst zu werden.« Auch Benjamins Schriften waren wie immer eine zentrale Quelle. Was dieser in seinem Essay Der Erzähler als »Fürsprech der Kreatur« bezeichnet, das verkörperte Sebald. Er hat Szenarien einer kreatürlichen Artgenossenschaft zwischen Mensch und Tier immer wieder beschworen, so etwa anhand der utopischen
162
5 Tiere
Gemeinschaft, die Steller mit den Tieren erlebt: »Unverstört näherten sich / Steller die Tiere, schwarze und rote / Füchse, auch Elstern, Häher und Krähen / gingen mit ihm auf dem Weg / über den Strand.« (NN 54) Ambros und Cosmo erleben auf ihrer Reise durch Palästina desgleichen eine solche Einheit zwischen Mensch und Tier in der Oase Ain Jidy westlich des Toten Meers: »Da flüchtete sich, verschreckt vielleicht von dem Sturm über dem See, eine Wachtel in Cosmos Schoß und blieb dort beruhigt, als befinde sie sich an dem eigens ihr gehörigen Platz.« (AW 214) Bis zum Tagesanbruch bleibt sie dort, sicher und behütet im Schutz des Menschen. Das krasse Gegenteil zu dieser paradiesischen Versöhnungs szene begegnet Sebald im Park von Somerleyton Hall. Dort findet er eine Voliere vor, in der »eine einsame chinesische Wachtel zu sehen ist, die – offenbar in einem Zustand der Demenz – in einem fort am rechten Seitengitter ihres Käfigs auf und ab lief und jedesmal, bevor sie kehrtmachte, den Kopf schüttelte, als begreife sie nicht, wie sie in diese aussichtlose Lage geraten sei.« (RS 50) Und wie um zu zeigen, daß sein kreatürliches Mitleid mit dem eingesperrten Tier nicht als wohlfeile Erfindung abgetan werden kann, fügt er seinem Text ein Foto der bedauernswürdigen Wachtel bei. (Wobei aufmerksame Leser das Gitter, hinter dem man das an Hospitalismus leidende Tier sehen kann, an das Bild des Gitters vor dem Fenster von Sebalds Spitalzimmer erinnern dürfte, das am Anfang von Die Ringe des Saturn zu sehen ist.) Was sich hier ausdrückt, ist der mit dem Kreatürlichen verbundene Wunsch nach Befreiung und Erlösung. Das eingesperrte Tier erweist sich bei Sebald stets als Allegorie unserer Existenz. Auf ein anderes Beispiel dafür trifft der Erzähler von Austerlitz im Nocturama von Antwerpen, wo die verschiedensten Tiere »hinter der Verglasung ihr von einem fahlen Mond beschienenes Dämmerleben führten.« (A 10)
Im Anblick der Kreatur
163
Dabei erregt insbesondere ein Waschbär sein Mitleid: Dieser »saß mit ernstem Gesicht bei einem Bächlein und wusch immer wieder denselben Apfelschnitz, als hoffe er, durch dieses, weit über jede vernünftige Gründlichkeit hinausgehende Waschen entkommen zu können aus der falschen Welt, in die er gewissermaßen ohne sein eigenes Zutun geraten war.« (A 11) Wir müssen jedoch zur Begegnung mit dem Hasen zurückkehren, um die ganze Dimension dessen zu ermessen, was Sebalds Plädoyer für einen vom Kreatürlichen geleiteten Umgang mit den Tieren betrifft. Seine Fürsprache für die Kreatur als einem über Leid- und Angsterfahrungen entwickelten ethischen Imperativ richtete sich nicht nur auf wehrlose Tiere, sondern ebenso auf unseren Umgang mit schwachen, hilflosen Menschen. Menschen wie den Psychiatriepatienten Ernst Herbeck zum Beispiel. Über den Hasen auf Orford Ness, wir erinnern uns, heißt es auffälligerweise, er habe ein ›irgendwie gespaltenes, seltsam menschliches Gesicht‹. Sebald kann diese Worte nicht niedergeschrieben haben, ohne dabei an die Kiefer- und Gaumenspalte Herbecks gedacht zu haben, die im Volksmund als ›Hasenscharte‹ bezeichnet wird. Zudem war ihm wohlbewußt, daß der ›mindere Dichter‹ Herbeck in seinen Schriften eine Privatmythologie konstruiert hat, in welcher dem Hasen eine besondere Bedeutung zukommt: »Der Hase ist ohne jeden Zweifel das Totemtier, in dem der Schreiber sich wiedererkennt« (CS 175), wie Sebald in einem 1991 erschienenen Nachruf auf Herbeck zeigt. Sein einfühlsamer Text trägt übrigens den Titel Des Häschens Kind, der kleine Has. Über das Totemtier des Lyrikers Ernst Herbeck. Das Erlebnis auf Orford Ness erzählt so nicht nur von der Überbrückung des Grabens zwischen Mensch und Tier. Zugleich will Sebald hinaus auf einen Brückenschlag zwischen dem, was gemeinhin als ›normal‹ und ›verrückt‹ tituliert wird. Dafür wiederum kann Herbeck exemplarisch dienen, weil in seinen wundersamen Poe-
164
5 Tiere
men nicht selten Tiere als Identifikationsfiguren für das eigene Leiden vorkommen. So schreibt Herbeck im Gedicht Das Nashorn voller Empathie: »Das Nashorn ist im Wald ganz stumm. / Die Nase in der Höh und tut auch / gar so weh / So zackig ist das Nashorn / und doch so schön.« Auch im Vogel, der in einem Käfig eingesperrt ist und von dem erwartet wird, daß er brav singt, scheint Herbeck seine Lage als lebenslang hospitalisierter Dichter offenkundig erkannt zu haben. Sebalds Aufmerksamkeit für das Kreatürliche reicht mithin weit über reine Tierliebe im konventionellen Sinne hinaus. Das Kreatürliche erschafft vielmehr eine Matrix, die das menschliche Verhältnis zum Tier anbelangt, aber auch unser Verhalten gegenüber sozial Schwachen; es betrifft unseren verqueren Umgang mit der Natur, die wir gebrochen und zerstört haben, um nicht selbst von ihr zerstört zu werden, was zur Folge hat, daß sie aufhörte, Heimat zu sein, und wir nun zwangsweise in einem von ihr entfremdeten Exil leben müssen. Nicht zuletzt zeigt sich anhand der Kategorie des Kreatürlichen, daß »unsere beinahe nur aus Kalamitäten bestehende Geschichte« (RS 350), die man einem anderen Worte Sebalds zufolge auch als »Aberration einer Species« (G 259) verstehen kann, aufs engste mit den naturhistorischen und damit kreatürlichen Bedingtheiten des Menschen verbunden ist.
Mindere Tiere I: Motten
165
MINDERE TIERE I: MOTTEN Von Natursendungen, für die ja gerade die BBC weltberühmt ist, hielt Sebald nicht viel. Wenn ich ihn zuhause besuchte, liefen im Fernseher eher Sportsendungen. In den Tierdokumentationen sah er ein Indiz für den entfremdeten Umgang mit Tieren, die man nurmehr durch die Mattscheibe anstarre, also noch distanzierter als durch die Gitter im Zoo. An einer kuriosen Stelle von Die Ringe des Saturn schimpft er: »Zweifellos sieht man in den Nature Watch oder Survival genannten und für besonders lehrreich geltenden Programmen viel eher irgendein Monstrum auf dem Grunde des Baikalsees bei seinem Paarungsgeschäft als eine gewöhnliche Amsel.« (RS 33) Aus dieser Bemerkung dürfte deutlich der Großvater herauszuhören sein, der dem kleinen Winfried die Achtung und Aufmerksamkeit für solch ›einfache‹ Geschöpfe wie Amseln gelehrt hat. Eine von Kindesbeinen an erlernte Ehrfurcht vor der Kreatur drückt sich aus in diesen Worten über die Schwalben: »Schon früher, in der Kindheit, wenn ich in den Abendstunden vom schattigen Talgrund aus diesen Seglern zuschaute, habe ich mir vorgestellt, daß die Welt nur zusammengehalten wird von ihren durch den Luftraum gezogenen Bahnen.« (RS 87) Und kaum von ungefähr machte sich Sebald derlei Gedanken in der Abenddämmerung, denn diese ist der privilegierte Zeitraum für metaphysische Reflexionen. Ebenso ist sie prädestiniert für transzendenten Grenzverkehr wie die Rückkehr der Toten: »Im Abenddämmer kommen sie / und suchen nach dem Leben« (AW 215), lautet das Motto der Max Aurach-Geschichte. Um die Ehrfurcht vor der Kreatur geht es auch in dieser Passage, wenngleich sie im Allgemeinen als weniger ›literaturwürdig‹ geltende Tiere betrifft: »Einmal fielen mir ein paar Hühner auf mitten in einem grünen Feld auf, die sich, obschon es doch noch gar nicht lang zu regnen aufgehört hatte, ein für die winzigen wei-
166
5 Tiere
ßen Tiere, wie mir schien, endloses Stück von dem Haus entfernt hatten, zu dem sie gehörten. Aus einem mir nach wie vor nicht ganz erfindlichen Grund ist mir der Anblick dieser so weit ins offene Feld sich hinauswagenden Hühnerschar damals sehr ans Herz gegangen.« (SG 192) Man darf das ganz und gar als autobiografisch lesen – Sebald hatte für Hühner, insbesondere für kleine Zwergund Zierhühnerrassen, Bantamhühner, kleine Perlhühner und dergleichen diminutives Federvieh eine besondere Vorliebe. Einfachen, ja geringen Tieren galt also sein Interesse. Und seine Achtung. So wurden Mäuse in der Old Rectory nicht mit Schnappfallen getötet, sondern schonend gefangen in Gummistiefeln. Sebalds kreatürliche Verbundenheit und Solidarität erweist sich zumal anhand von Getier, mit dem keine Kommunikation möglich ist. Tieren also, die im Gegensatz etwa zu Hund und Hase keine Gesichtsmuskulatur haben oder, wie Mäuse, durch Lautäußerungen den Graben, der sie vom Menschen trennt, überbrücken können. Weshalb wir ihnen nicht zutrauen, daß sie Emotionen besitzen. Tieren wie beispielsweise den Motten, die in Austerlitz ihren großen Auftritt haben. Kein Wunder, daß ausgerechnet Alphonso es ist, eine Stellvertreterfigur des Großvaters, der Austerlitz »in die geheimnisvolle Welt der Motten« einführt, »eines der ältesten und bewundernswertesten Geschlechter in der ganzen Geschichte der Natur.« (A 135) Der Naturkundler Alphonso schwärmt von dem »ungeheuer empfindlichen Gehör der Motten« (A 138) und spricht so kenntnisreich wie ausführlich »davon, wie jedes dieser extravaganten Geschöpfe seine Eigenart habe« (A 137), so »daß wir beide, Gerald und ich, gar nicht mehr herausgekommen sind aus der Verwunderung über die Mannigfaltigkeit dieser sonst vor unseren Blicken verborgenen wirbellosen Wesen.« (A 136) Typisch für Sebald ist die ausführliche Aufzählung der verschiedenen Mottenarten, die vergleichbare Listen von Pflanzennamen oder anderen Tierarten in seinen Texten spiegelt. Das ist nicht nur
Mindere Tiere I: Motten
167
ein exzentrisches Stilmittel, es führt auch konkret vor, welche natürliche Vielfalt existiert und zeugt zugleich vom Impetus, jeder einzelnen Tier- und Pflanzenart die Gerechtigkeit ihrer Namensnennung zukommen zu lassen. Nahezu so, als ob dies nicht zuletzt eine Frage der Würde sei und eine ethische Verpflichtung erfüllt werde durch diese Listen. Ohnehin braucht nicht betont zu werden, daß in dergleichen Katalogen der Wunsch eingeschlossen ist, zu versammeln, um zu bewahren. Und noch etwas: In den Litaneien der Listen entsteht eine poetische Qualität durch das Zusammenspiel des Wortklangs wie der Bilder, welche die Bezeichnungen evozieren. In Austerlitz kommt hinzu, daß die Namen der Mottenarten, einer Geheimbotschaft gleich, einen subtilen Bezug zur Hauptfigur entwerfen: »Porzellan- und Pergamentspinner vielleicht und spanische Fahnen und schwarze Ordensbänder, Messing- und Ypsiloneulen, Wolfsmilch- und Fledermausschwärmer, Jungfernkinder und alte Damen, Totenköpfe und Geistermotten« (A 136) – ist Austerlitz doch zum Kind einer Jungfer geworden, das später dem Schicksal der Toten nachforscht und Geistern eine Präsenz in der Welt der Lebendigen zubilligt. Austerlitz darf hier als Stellvertreterfigur Sebalds gelesen werden: Da er durch die passionierte entomologische Schule von Alphonso gegangen ist, gewinnt er ein achtungsvolles Verhältnis zu diesen niederen Tieren. Gleiches muss auch über Sebald gesagt werden und zeigt sich in der Literatur im respektvollen Umgang mit den toten Nachtflüglern, die Austerlitz in seinem Haus auffindet. »Manchmal beim Anblick einer solchen in meiner Wohnung zugrunde gegangenen Motte frage ich mich, was für eine Art Angst und Schmerz sie in der Zeit ihrer Verirrung wohl verspüren. Wie er von Alphonso wisse, sagte Austerlitz, gebe es eigentlich keinen Grund, den geringeren Kreaturen ein Seelenleben abzusprechen. Nicht nur wir und die mit unseren Gefühlsregungen seit vielen
168
5 Tiere
Jahrtausenden verbundenen Hunde und anderen Haustiere träumten in der Nacht, sondern auch die kleineren Säugetiere, die Mäuse und Maulwürfe, halten sich schlafend, wie man an ihren Augenbewegungen erkennen kann, in einer einzig in ihrem Inneren existierenden Welt auf, und wer weiß, vielleicht träumen auch die Motten oder der Kopfsalat im Garten, wenn er zum Mond hinaufblickt in der Nacht.« (A 141/42) Die absurde Schlußwendung, mit der noch der Kopfsalat in die Reihe der träumenden Kreaturen aufgenommen wird, überspannt den spekulativen Bogen, ja beschädigt den so schön aufgebauten Gedankengang und die bedenkenswerte Argumentationslinie. Deshalb erscheint mir diese Stelle bezeichnend für Austerlitz: Der Roman ist nicht das Meisterwerk, zu dem ihn seine Lobpreiser verklären, sondern hat ästhetische Mängel. Mängel, die Sebald in den vorangegangenen Büchern nicht unterlaufen sind.
MINDERE TIERE II: SEIDENWÜRMER Doch sei’s vorerst drum. Hier gilt es als nächstes die Seidenwürmer zu betrachten, die in den Ringen des Saturn wichtig werden. So heißt es über die eine rücksichtslose Machtpolitik verfolgende chinesische Kaiserin Tz’u-hsi aus dem späten neunzehnten Jahrhundert: »Unter allen Lebewesen waren es ausschließlich diese wundersamen Insekten, zu denen sie eine tiefe Zuneigung verspürte.« (RS 182) Die Kaiserin liebte insbesondere »das leise, gleichmäßige, ungemein beruhigende Vertilgungsgeräusch, das von den ungezählten, das frische Maulbeerlaub zernagenden Seidenwürmern kam.« (RS 183) Die Seidenwürmer spielen also eine politische Rolle; die Verfügung über sie bedeutet Macht: »Sie erschienen ihr als das ideale Volk, dienstfertig, todesbereit, in kurzer Frist beliebig vermehrbar, ausgerichtet nur auf den einzigen ihnen vorbestimmten Zweck,
Mindere Tiere II: Seidenwürmer
169
völlig das Gegenteil der Menschen, auf die grundsätzlich kein Verlaß war, auf die namenlosen Massen draußen im Reich so wenig wie auf diejenigen, die den innersten Kreis bildeten um sie.« (RS 183) China konnte das eifersüchtig gehütete Monopol auf die Produktion von Seide nicht dauerhaft bewahren; wie Sebald berichtet, gelang zwei persischen Mönchen zur Zeit des byzantinischen Kaisers Justinian, mehrere Eier des Seidenwurms in der hohlen Spitze eines Wanderstabs aus dem Land der Mitte herauszuschmuggeln. Der Seidenbau samt der begleitenden Kultivierung von Maulbeerbäumen konnte sich so schließlich außerhalb Chinas und damit ebenso in Europa ausbreiten. Sebalds Interesse am Seidenbau war durchaus autobiografisch. Im Mittelalter nämlich erlebte Norwich dank der in Ostengland eifrig betriebenen Seidenwirtschaft infolge der Einwanderung hugenottischer Seidenweber eine ökonomische Blüte, die den Ort zur zweitgrößten Stadt Englands machte. Von diesem ökonomischen Boom und der einstigen Größe erhielten sich viele Spuren im heutigen Stadtbild, weshalb die Stadt zu den schönsten und lebenswertesten in England zählt. In Deutschland hielt der Seidenwurm ab dem achtzehnten Jahrhundert Einzug, eine anderen Ländern vergleichbare Seidenindustrie konnte sich aber nie wirklich etablieren. Sie kam daher im neunzehnten Jahrhundert wieder zu erliegen, bis die Nationalsozialisten sie, nach »hundertjähriger Remission, mit der den deutschen Faschisten in allem, was sie verfolgten, eigenen Gründlichkeit wieder aufgriffen« (RS 345), weil der Seidenwirtschaft eine besondere Rolle zukam in den ökonomischen Bestrebungen des Reichs, sich von Exporten unabhängig zu machen. Zu den primär wirtschaftlichen Gründen kamen pädagogische Erwägungen. Die Seidenraupen, so glaubten die Nazis, waren »über ihren offenkundigen Nutzwert hinaus auch ein idealer Gegenstand für den Unterricht.« (RS 347) In einem zeitgenössischen Text konn-
170
5 Tiere
te man lesen: »Bau und Besonderheiten des Insektenkörpers seien aufzuzeigen, desgleichen Domestikationserscheinungen, Verlustmutationen sowie die in der menschlichen Zuchtarbeit notwendigen Grundmaßnahmen der Leistungskontrolle, Auslese und Ausmerzung zur Vermeidung rassischer Entartung.« (RS 348) Die Logik dieser Sprache ist offenkundig genug: In der nur scheinbar harmlosen, weil pragmatischen Zuchtauslese der Seidenraupe spiegelt sich das sozialdarwinistisch-rassistische Prinzip der Selektion und der Vernichtung ›lebensunwerten Lebens‹. Die Seidenraupenzucht als Allegorie auf den Holocaust – überspannt Sebald den Bogen wieder einmal? Ich denke nicht. Sobald die Raupen ihre Aufgabe erfüllt haben, so setzt er fort, entledigt man sich dieser Lebewesen, indem man sie mit heißem Wasserdampf mal trätiert, »bis das ganze Tötungsgeschäft vollendet ist.« (RS 348)
MINDERE TIERE III: HERINGE Und noch eine weitere Facette. Meine aus München stammende Freundin hat während des Studiums an der UEA gern gebacken, deutsche wie englische Sachen. Was übrigblieb oder zuviel war, nahm ich öfters mit für Sebald, weil er gerne Kuchen aß. Besonderes Lob hatte er übrig für ihre Brezen, deren Herstellung nicht ganz ungefährlich war, da sie die dazu erforderliche Lauge selbst zusammenmischen mußte. (Auch ihr, die damals englische Literatur studierte, riet er übrigens dringlich von einer universitären Karriere ab; vielmehr sollte sie eine Bäckerei eröffnen.) War ich mit ihm in der Old Rectory verabredet, gab es im Gegenzug für die Backwaren gelegentlich frische Tomaten oder anderes Gemüse aus seinem Garten. Ich erinnere mich nun, deswegen der kulinarische Exkurs, bei einer dieser ›Tauschaktionen‹ nach dem Fortschritt seiner Schreibarbeiten erkundigt zu haben. Sebald antwortete, daß er gerade etwas über Heringe schreibe und daß ihn
Mindere Tiere III: Heringe
171
das Schicksal dieser Fische sehr interessiere. Es kam mir komisch vor. Wie falsch ich damit lag, verstand ich erst, nachdem er mir mein Widmungsexemplar der Ringe des Saturn ins pigeon-hole gelegt hatte. Der dritte, in weiten Teilen dem Hering gewidmete Teil des Buches gehört zu den bemerkenswertesten literarischen Leistungen Sebalds. Darin behauptet er, eine »1857 in Wien erschienene Naturgeschichte der Nordsee« (RS 71) verwendet zu haben, doch ein solches Buch existiert gar nicht. Es ist eine der vielen falschen Fährten, die er beständig auslegt. (Ich bin ihm damit in einem früheren Buch auf den Leim gegangen.) Der Hering, so holt er in Die Ringe des Saturn aus, war noch zu seiner Schulzeit aufgrund des massenweisen Vorkommens der Musterfall »der staunenswerten Selbstvermehrung und Vervielfältigung des organischen Lebens.« Folglich galt der Heringsfang als »einer der exemplarischen Schauplätze im Kampf des Menschen mit der Übermacht der Natur.« (RS 70) Wie zur Illustration der oftmals »geradezu katastrophalen Heringsschwemmen«, die nachgerade »das erschreckende Bild einer in ihrem eigenen Überfluß erstickenden Natur« (RS 72) bieten, fügt Sebald eine wohl von Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts stammende Postkarte in den Text ein, die mit der Legende ›A Morning catch of Herring, Lowestoft‹ versehen ist. Sie zeigt einige Fischer stolz am Rande eines sich bis an den hinteren Bild rand erstreckenden Leichenberges unzähliger Fischkörper. (Wir kommen darauf noch zurück.) Die Unerschöpflichkeit des Herings machte den Fisch zu »einem besonders beliebten Lehrgegenstand für die unteren Klassen«, so Sebald, der sich noch beruft auf seine Erinnerung an »einen jener von schwarzem Gestrichel durchzitterten Kurzfilme« (RS 70), der in seiner Schule vorgeführt wurde. In Wirklichkeit kann aber von schlechter Bildqualität in dem betreffenden Film keine Rede sein, wie auch Sebald den Film alles andere als zutreffend beschreibt in
172
5 Tiere
seinem Text. Doch geht es hier ja nicht um Akkuratesse, sondern darum, wie er beziehungsweise sein Erzähler sich an den Film erinnert. Korrekt zitiert aus dem Beiheft des 1937 gedrehten Schulfilms über den Heringsfang sind die das zeitgenössische Denken widerspiegelnden Worte, daß am Ende des industriell organisierten Prozesses von Fang und Weiterverarbeitung »die Güterwagen der Eisenbahn den ruhelosen Wanderer des Meers aufnehmen, um ihn an die Stätten zu bringen, wo sich sein Schicksal erfüllen wird.« (RS 71) Durch die Anspielung auf das Motiv des ›ewigen Juden‹ Ahasver als ruhelosem Wanderer vollzieht nun wenig überraschend schon der Text aus den dreißiger Jahren einen eindeutigen Brückenschlag vom Heringsfang zur antisemitischen Raison jener Zeit, welcher rückblickend natürlich als Verbindunglinie zum Holocaust begreifbar wird: Verkörpert der Hering »das Hauptemblem sozusagen für die grundsätzliche Unausrottbarkeit der Natur«, dann entpuppt sich der industriell organisierte Heringsfang – als paradigmatischer Kampfschauplatz gegen die Übermacht der Natur – zu einem Vorspiel der ebenso fabrikmäßig organisierten Ausrottung der Juden und anderer Volksgruppen. Daß die Heringe wie die Menschen in den Gaskammern durch Erstickung sterben, ist dann bei Sebalds Annäherung von Hering und Holocaust nur eine weitere, fast schon nicht mehr erhebliche Analogie zwischen den Ermordungsaktionen: Die Fangnetze »stehen im Wasser gleich einer Wand, gegen die die Fische verzweiflungsvoll anschwimmen, bis sie sich mit den Kiemen in den Maschen verfangen, um dann bei dem an die acht Stunden dauernden Herausziehen und Aufwinden des Netzes erdrosselt zu werden.« (RS 73) Überhaupt erscheint die Kulturgeschichte des Herings, so wie sie Sebald erzählt, als eine vorwegnehmende Variation dessen, was die Nazis später an Menschen durchführten. So etwa sind die
Mindere Tiere III: Heringe
173
abscheulichen Menschenversuche und die ›Verwertung‹ der Leichen antizipiert in den (pseudo)wissenschaftlichen Experimenten, denen der Hering im Zeitalter der Vernunft ausgesetzt war. Beispielsweise versuchte »ein gewisser Noel de Marinière, Inspektor des Fischmarkts von Rouen die Überlebensfähigkeit dieser Fische genauer zu erkunden, indem er ihnen die Flossen abschnitt und sie auf andere Weise verstümmelte.« (RS 74) Sebald schreibt das alles in Wahrheit ab bei dem Lokalhistoriker John Greaves Nall und dessen 1866 in London erschienener Schrift Great Yarmouth and Lowestoft, in der ein knapp zehnseitiges Kapitel zur ›Natural History of the Herring‹ enthalten ist – das wiederum auf der 1847 in Paris erschienenen Histoire naturelle du hareng basiert, die ein gewisser Achille Valenciennes verfaßt hat. Den Namen des Fischmarktoberaufsehers verändert er ein wenig (dieser heißt eigentlich Morinière), doch bedürfen diese Experimente nicht unbedingt faktischer Verifizierung: Selbst wenn sie erfunden wären, bilden sie die Realität des erbarmungslosen Umgangs des Menschen mit den Tieren ab. Und dies erst recht, weil die Lebewesen als Nahrungsmittel dienen. Aber kehren wir nochmals zu den Experimenten des Fisch marktinspektors zurück, die er im neunzehnten Jahrhundert an den Heringen nachweislich unternommen hat: Sebald versteht sie – vielleicht nicht unähnlich seinem unbedachten Eingriff in den Raupenzug der Prozessionsspinner – zunächst als Folge unseres wissenschaftlichen Erkenntnisinteresses: »Eine solche, von unserem Wissensdrang inspirierte Prozedur ist sozusagen die äußerste Zuspitzung der Leidensgeschichte einer ständig von Katastrophen bedrohten Art.« (RS 74) Damit werden erneut Mensch und Tier in das übergeordnete System einer Naturgeschichte der Zerstörung eingeordnet. Die katastrophische Geschichte des Herings nämlich, in welcher der Mensch Protagonist und Gefangener zugleich ist einer »von einem Unglück zum nächsten taumelnden Geschichte.« (RS 305) Der
174
5 Tiere
Mensch führt am Hering quasi nur aus, was die Naturgeschichte für ihn wie das Tier vorbestimmt hat: die Ausrottung. Daher eben die Wichtigkeit dessen, was Bilz Mythologeme nennt: aus der Not gewonnene Erfindungen, die zu Tatsachen erhoben werden, um uns über unangenehme Zusammenhänge hinwegzutäuschen. Wie das geht, führt Sebald vor und unterminiert es zugleich: Man beruhigte sich »mit der Annahme, daß die besondere physiologische Organisation der Fische sie schütze vor der Empfindung der Angst und der Schmerzen, die beim Todeskampf durch die Körper und die Seelen der höher ausgebildeten Tiere gehen. Doch in Wahrheit wissen wir nichts von den Gefühlen des Herings.« (RS 75) Dieser letzte Satz wiederum ruft einen anderen Sebald-Satz auf aus einem Essay über seinen Malerfreund Jan Peter Tripp. Ausgangspunkt des Textes ist Tripps detailgenaue Darstellung einer Makrele. Sebald stellt Überlegungen an, die allesamt so fern nicht sind von den anhand des Herings entwickelten Gedanken. Sie gipfeln in der Vermutung: »Wahrscheinlich sind die Zusammenhänge zwischen dem Leben und Sterben der Menschen und der Makrelen weitaus komplizierter, als wir erahnen.« (CS 212) Ja, das dürften sie in der Tat sein. Sebald erwähnt in den Ringen des Saturn eine andere bizarre Eigenschaft des Herings – nämlich daß, »wenn das Leben aus ihm gewichen ist, sich seine Farben verändern. Der Rücken wird blau, Backen und Kiemen sind rot unterlaufen von Blut« (RS 75) –, um damit eine Brücke zu schlagen zu Major George Wyndham Le Strange, dem Befreier von Bergen-Belsen: Über diesen besteht die »von den Bediensteten des Leichenbestatters in Wrentham ausgegangene Legende, daß die helle Haut des Majors bei seinem Ableben olivgrün, sein gänsegraues Auge tiefdunkel und sein schlohweißes Haar rabenscharz geworden sei.« (RS 83) Was nun soll das, außer daß es sicher kein Zufall ist, wenn innerhalb von weniger als zehn Buchseiten ein solch auffälliger Konnex
Mindere Tiere III: Heringe
175
hergestellt wird? Nicht glaubwürdiger, aber stimmiger wird diese Geschichte einer eindeutig-unklaren Verbindung mit dem Hering dadurch, daß der Major auf seine alten Tage ein Nachfolger des heiligen Franziskus wurde, denn, so kolportiert der Erzähler, »Le Strange, der immer schon einen zahmen Hahn auf seinem Zimmer gehalten hatte, sei nachmals ständig umschwärmt gewesen von allem möglichen Federvieh, von Perlhühnern, Fasanen, Tauben und Wachteln und den verschiedensten Garten- und Singvögeln, die teils am Boden um ihn herumliefen, teils in der Luft ihn umflogen.« (RS 82) Just solche Tiere also, für die Sebald eine besondere Passion besaß, weil sie ihn rührten in ihrer geschäftigen, emsigen Art bei gleichzeitiger Hilflosigkeit. Der zu einer Art Tierheiliger verklärte Le Strange macht seinem sonderbaren Namen daher alle Ehre. Vor allem aber ergibt sich über ihn eine weitere Verknüpfung: jene nämlich zwischen der Postkarte aus Lowestoft, die eine unüberschaubare Zahl toter Heringe darstellt, und jener bereits beschriebenen, kommentarlos eingeschalteten Fotografie mit den Leichen in einem Waldstück. Die Bildaufnahme des Fotografen George Rodger, erstmals im Life-Magazin erschienen, zeigt in der Tat reale Opfer des Konzentrationslagers von Bergen-Belsen, das der fiktive Le Strange (angeblich) am vierzehnten April 1945 mit seinem Panzerregiment befreit hat. (Dieses Datum liegt übrigens auf den Tag genau elf Jahre vor dem Tod von Josef Egelhofer; die tatsächliche Befreiung allerdings fand einen Tag später statt.) Womit wir erneut angekommen wären bei der Sebald’schen Verkettung von Tier und Genozid, Hering und Holocaust. Eine Verkettung, mit der – vermittelt über die kreatürliche Empathie selbst für angeblich gefühllose Lebewesen – ein offiziell unstatthafter, dafür aber umso eigensinnigerer Zusammenhang hergestellt wird.
176
5 Tiere
Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen: Verständlich wird dieser Konnex nur vor dem Hintergrund einer umfassenden Naturgeschichte der Zerstörung, in deren dunklem Denken eine sozusagen entropische, destruktive Tendenz den »blind und taub sich fortwälzenden Prozeß der Geschichte« (LH 17) bestimmt. Oder, wie Sebald einmal feststellt, wieder in Die Ringe des Saturn und in paraphrasierender Anlehnung an seinen Norwicher Gewährsmann Thomas Browne: »Auf jeder neuen Form liegt schon der Schatten der Zerstörung. Es verläuft nämlich die Geschichte jedes einzelnen, die jedes Gemeinwesens und die der ganzen Welt nicht auf einem stets weiter und schöner sich aufschwingenden Bogen, sondern auf einer Bahn, die, nachdem der Meridian erreicht ist, hinunterführt in die Dunkelheit.« (RS 35)
NACHSATZ ÜBER DIE DUNKELHEIT & DAS SCHÖNE Vielleicht muß man ein derart düsteres Weltbild wie Sebald besitzen, um so erst leuchtende Bilder stiller Schönheit erzaubern zu können mit der Bildmacht der Sprache und dem Wohlklang der Worte. Ein Beispiel dafür ist diese poetische Vision, in welcher gerade die Finsternis eine strahlende Vision gebiert: »Die Dunkelheit schien aus dem See aufzusteigen, und einen Augenblick lang tauchte in mir, wie ich so hinabschaute, ein Bild auf, das etwa einer Farbtafel in einem alten Naturkundebuch glich und das, freilich um vieles schöner und genauer als solch ein kolorierter Druck, zahlreiche Seefische zeigte, wie sie schlafend in den tiefen Strömungen standen zwischen den finsteren Wänden des Wassers, hinter- und übereinander, größere und kleinere, Rotaugen und Rotfedern, Elritzen und Lauben, Haseln und Hechte, Saiblinge und Forellen, Welse, Zander und Barben und Schleien und Äschen und Karauschen.« (LH 51)
Nachsatz über die Dunkelheit & das Schöne
177
Anrührend ist diese Evokation einer friedlichen Gemeinschaft der verschiedensten Süßwasserfischarten nicht zuletzt deshalb, weil in ihr der kategoriale Unterschied zwischen Jäger und Beute aufgehoben ist. Dieses wundervolle Bild verkörpert somit die Utopie eines friedlichen Nebeneinanders, jenseits der von natürlicher Veranlagung vorgegebenen Machtbeziehung. Zumindest für die Dauer eines Nachtschlafs.
6 Feuer
D
aß die Wohnungen und Häuser in Großbritannien in den neunziger Jahren noch mit weitenteils funktionierenden Feuerstellen ausgestattet waren, kam mir frisch dort angekommen besonders ›englisch‹ vor. So auch in der Old Rectory. Bei meinen Besuchen brannte der große fireplace des öfteren und sorgte für wohlige Wärme. Aber auch wenn es nicht kalt war, entfachte Sebald dort Feuer. Allerdings zu anderen Zwecken: nämlich um Manuskripte zu verbrennen, die er für mißlungen hielt. Ich erinnere mich insbesondere im Zeitraum, in dem er am Korsika-Projekt arbeitete, immer wieder verbranntes Schreibpapier im Kamin gesehen zu haben. Natürlich sprach ich Sebald darauf an. Er sagte, das Feuer sei das beste Mittel, um Mißlungenes loszuwerden, für immer. Bei Canetti, den er eine Zeitlang regelmäßig in Hampstead besucht hatte, habe er fast immer Überreste derart beseitigter Manuskripte in dessen Kamin gesehen. Deshalb hätten sich beide unterhalten über Kafkas testamentarischen Auftrag, sein unpubliziertes Werk verbrannt zu sehen. Ein Auftrag, den Max Brod bekanntlich nicht ausführte. Zu unserem Glück – aber in eklatanter Illoyalität zu Kafka. Ich bilde mir ein, doch dies mag eine Fehlerinnerung sein, daß ich Sebald bei unserem Gespräch über Canetti, Kafka und das Verbrennen von Manuskripten das erste Mal rauchen sah. Das über-
180
6 Feuer
raschte mich. In der Universität hatte ich ihn nie mit Zigarette erlebt, so wie mir auch nie aufgefallen war, daß es in der Old Rectory nach Qualm gerochen hätte. Dennoch war Sebald zeitlebens ein eifriger Raucher gewesen. Begonnen damit hatte er zu Studentenzeiten. Er bevorzugte die existentialistisch angehauchten Zigarettenmarken, Gauloises und Gitanes also, die zumal in der französischsprachigen Schweiz leicht erhältlich gewesen sein dürften. Später ist er mehr zum Genußraucher geworden. Außer er war mit Schreibarbeiten beschäftigt: Dann rauchte sozusagen der Kopf, während zugleich der Aschenbecher am Schreibtisch beständig qualmte. Eine Zigarette als Stimulanz, um ein paar Sätze voranzukommen. Oder als Belohnung, eine Blockade gebrochen zu haben. Der Alkohol, die andere klassische Schreibstimulanz, war ihm zunehmend verwehrt aufgrund seiner Allergie dagegen. In den neunziger Jahren gab Sebald den Genuß von Schnäpsen und seinem geliebten Calvados schweren Herzens ganz auf. Blieb also nur das Rauchen. Uns beide beeindruckte jenes Notat von Ernst Herbeck, in dem so lapidar wie poetisch treffend der tiefere Sinn dieses Lasters benannt wird: Die Zigarette. ist ein Monopol und muss geraucht werden. Auf Dasssie in Flammen aufgeht.
MOTIVKOMPLEX FEUER Feuer und Flammen, Brände und Asche, Rauch und Pyromanie sind ein Motivbündel, das sich durch das Gesamtwerk zieht, in mannigfaltigen Ausprägungen. Wollte man Sebald in Anlehnung
Motivkomplex Feuer
181
an den Untertitel von Nach der Natur als ›Elementardichter‹ bezeichnen, so wäre das Feuer sein eigentlichstes Element. Dies aber nicht in identifikatorischer Weise, sondern vielmehr als Faszinosum und Obsession. Ebenso als schmerzhafte Brandmarkung. Nämlich im mnemotechnischen Sinne der Bemerkung des (fiktiven) Gärtners von Somerleyton, der dem Erzähler gegenüber im Hinblick auf die Bombardierungen deutscher Städte im Luftkrieg formuliert: »Es hat sich mir eingebrannt.« (RS 53) Die einschlägigen Stichworte zum Motivkomplex des Feuers sind Legion in Sebalds Werk: Man denke, um wahllos umherzuspringen, etwa an die Vulkane, die wie die Postkarte des ausgebrochenen Vesuvs in Schwindel. Gefühle. für die chthonischen Feuer stehen, die eruptiv ausbrechen können; bei Sebalds letztem öffentlichen Auftritt, seiner Rede zur Eröffnung des Literaturhauses in Stuttgart, ruft der Name der S-Bahn-Station Feuersee Assoziationen an den Luftkrieg auf; an Thomas Browne interessiert ihn besonders dessen Schrift Urn burial, bei der es um die »universale Praxis der Ein äscherung« (RS 37) geht, was eine günstige Gelegenheit liefert, die originale Bedeutung des altgriechischen Wortes holókaustos in Erinnerung zu rufen, während im Verweis auf die Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten auf den prophetischen Gehalt von Heinrich Heines vielzitierter Voraussage angespielt wird. Man könnte nahezu beliebig fortfahren: Das Ende von Schwindel. Gefühle. bildet die apokalyptische Vision eines brennenden Londons, die Sebald übernommen und ausgekleidet hat aus Samuel Pepys’ Tagebuchaufzeichnungen über das Great Fire of London im Jahre 1666; aus der Katastrophenchronik seines Heimatorts Wertach erfahren wir, daß Feuersbrünste das Dorf in den Jahren 1530, 1605 und 1893 mehr oder weniger komplett zerstört haben, wie Sebald in der Schule gelernt hat, wozu Fräulein Rauch (!), eine »sanftmütige Lehramtskandidatin«, mit »farbiger Kreide ein brennendes Haus gemalt« (SG 262) hatte.
182
6 Feuer
Der authentische Brand des Opernhauses von Verona im Oktober 1971 wird in Schwindel. Gefühle. leicht literarisiert erwähnt, während er in Austerlitz den Brand des Luzerner Hauptbahnhofs vom Februar 1971 anspricht; wiederholt kommt Sebald auf den »einem Mausoleum gleichenden Magnox-Block des Kraftwerks von Sizewell« (RS 208) zurück, in dem das atomare Feuer der Kernspaltung im Zaum gehalten wird; in den religiösen Kontext wiederum gehört die Drohung des scheinheiligen Geistlichen Elias mit »Feuer und Asche und dem drohenden Ende der Welt« (A75) angesichts der Sündhaftigkeit der Gläubigen bei seinen sonntäglichen Predigten. Das »tosende Feuer, das eines Nachts, / kurz vor meiner Einschulung ist es gewesen, / ein unweit gelegenes Sägewerk verschlang / und die ganze Talschaft erhellte« (NN 76), war eines der prägenden Erlebnisse seiner Kindheit. Es hat sich seiner Erinnerung wahrlich ›eingebrannt‹. Denn verschiedentlich spricht Sebald darüber, wie, »Ende der vierziger Jahre, die Sägemühle im Plätt abgebrannt ist und alles aus den Häusern an den Ortsrand hinauslief und in die Flammengarbe starrte, die hoch hinaufreichte in die schwarze Nacht.« (CS 249) Wie schon eingangs korrigiert, betraf der Brand in Wirklichkeit die Sägemühle im benachbarten Ort Haslach. Nicht der genaue Ort ist bei dieser Erinnerung entscheidend, sondern das unauslöschlich im Gedächtnis gebliebene Bild des schaurig-schönen Schauspiels, welches das Feuer am nächtlichen Himmel bot: In Schwindel. Gefühle. berichtet Sebald, wie man gemeinsam mit Nachbarn und Bekannten damals »zugeschaut hat, wie die riesige Feuergarbe in den Himmel lohte und die weit sich dahinziehende Rauchwolke von unten her erhellte.« (SG 222) Im selben Buch interessiert sich der nach Venedig reisende Erzähler nicht im Geringsten für die typischen Touristenattraktionen dort. Stattdessen unternimmt er mit dem befreundeten Astrophysiker Malachio eine nächtliche Bootsfahrt. »Das Wunder
Motivkomplex Feuer
183
des aus dem Kohlenstoff entstandenen Lebens geht in Flammen auf«, sagt dieser unvermittelt, als sie gemeinsam die nächtliche Lagunenstadt betrachten. Dann fahren sie weiter zum »Inceneritore Comunale auf der der Giudecca westwärts vorgelagerten namenlosen Insel. Ein totenstilles Betongehäuse unter einer weißen Rauchfahne. Auf meine Frage, ob denn hier auch mitten in der Nacht noch gefeuert würde, antwortete Malachio: Sì, di continuo. Brucia continuamente. Fortwährend wird hier verbrannt.« (SG 70) Die Asche, die am Ende aller Verbrennungsprozesse steht, ist für Sebald keine wertlose Substanz. Vielmehr wird das ephemere, unscheinbare Abfallprodukt ästhetisch aufgewertet und gehört für ihn, neben dem Staub, zu den privilegierten ›armen Materialien‹ in seinem Denkkosmos: »I admire ash very much. The very last product of combustion, with no resistance in it. The borderline between being and nothingness. Ash is a redeemed substance, like dust«, erklärte er Sarah Katafou mit Blick auf Robert Walser. Diesem Dichter des Diminutiven ist in Sebalds Meinung das Höchste gelungen, nämlich Staub und Asche vermittels seines Schreibens in große Kunst zu verwandeln. Exemplarisch dafür steht das Prosastück Asche, Nadel, Bleistift und Zündhölzchen: eine literarische Mediation über mindere, »von niemandem sonst beachtete leblose Substanzen und Dinge«, in der Walser allerdings, so urteilt Sebald scharfsichtig, »in Wahrheit über sein eigenes Martyrium schreibt, denn die vier Dinge, um die es ihm geht, sind ja nicht willkürlich aneinandergereiht, sondern die Peinigungs instrumente des Autors beziehungsweise das, was er braucht zur Veranstaltung seiner Selbstverbrennung und was übrigbleibt, wenn das Feuer niedergegangen ist.« (LH 149/50)
184
6 Feuer
DAS GROSSE FEUER VON NÜRNBERG Der Brand Nürnbergs vom achtundzwanzigsten August 1943. In den Annalen des Bombenkriegs verzeichnet sind sechsundfünfzig Tote, knapp vierhundertsechzig zerstörte und über zweitausend beschädigte Häuser. Damit gehört dieser Angriff zu den weniger bedeutenden Luftkriegsattacken auf die Stadt Dürers und der Reichsparteitage. Von August 1940 bis April 1945 war Nürnberg etwas über zwanzig Mal das Ziel alliierter Operationen. Insgesamt starben über fünftausendfünfhundert Menschen; zuletzt, am Nachmittag des elften April 1945, töteten die Bomber der Royal Air Force vierundsiebzig Menschen bei ihrem Angriff auf den Rangierbahnhof und benachbarte Wohngebiete. Der Wahnsinn des Kriegs. Einen zwangsläufig unzureichenden, aber dennoch aussagekräftigen Eindruck von der Katastrophe vermittelt die oben zu sehende Aufnahme, die der Architekt Hermann Weber auf der Karolinenstraße in der Innenstadtgegend südlich der Pegnitz gemacht hat. War dieser Brand Nürnbergs nun so etwas wie eine zweite Urszene für Sebald? Oder überspannt man hier den Freud’schen Bogen? In Nach der Natur läßt sich jedenfalls nachlesen: »In der Nacht auf den 28. flogen / 582 Maschinen einen Angriff / auf Nürnberg. Die Mutter, / die am anderen Morgen / nachhause ins Allgäu / zurückfahren wollte, / ist mit der Bahn bloß / bis nach Fürth gekommen. / Von dort aus sah sie / Nürnberg in Flammen stehn, / weiß aber heut nicht mehr, / wie die brennende Stadt aussah / und was für Gefühle sie / bei ihrem Anblick bewegten.« (NN 73) Zum Zeitpunkt ihrer Augenzeugenschaft war die Mutter nach eigener Aussage gerade schwanger geworden; dies allein schon eine gewagte Behauptung, denn Schwangerschaft im allerfrühesten Stadium kann allenfalls eine Vermutung, keine Gewißheit sein. Das Geburtsdatum Sebalds freilich bestätigt die Vermutung, und somit
Das Große Feuer von Nürnberg
185
wird ihm ein friedliches Foto aus dem Familienalbum zum Beweis des Zeitpunkts und des Orts seiner Zeugung: »Man schreibt den 26. August 1943.« (NN 73) Ein furchtbarer Moment der Geschichte: Der Zweite Weltkrieg, der für die Deutschen bereits verloren ist, hat damals seinen Höhepunkt erreicht. In den letzten Monaten des Kriegs steigt der Blutzoll ins Unermeßliche. Im Osten tobt auf den Schlachtfeldern und in den Konzentrationslagern der gnadenlose Vernichtungskrieg der Nazis, während in den Feuersbrünsten der deutschen Städte die Zivilisten sterben. Das unscheinbare Sommerfoto aus dem Familienalbum zeigt jedoch eine friedliche, geradezu idyllische Parkszenerie, bestehend aus »Ulmen, Rüstern und dichtgrünen / Koniferen im Hintergrund, das kleine / Pagodengebäude, der feine geharkte / Kies, die Hortensien, Schilflilien, / Aloën, der Straußfederfarn und / der riesenblättrige Zierrhabarber. / Erstaunlich für mich auch die Personen, / die zu sehen sind auf dem Bild. / Die Mutter mit einem offenen / Mantel, von einer Unbeschwertheit, / die ihr später abhanden kam; der Vater, / ein wenig abseits, die Hände in den Taschen, / auch er, scheint es, sorglos.« (NN 73) Die Eltern also sind zu sehen bei einem Spaziergang im Botanischen Garten in Bamberg. In der oberfränkischen Stadt war der Soldat Georg Sebald zu dieser Zeit stationiert. Sein Sohn hat die Aufnahme in den neunziger Jahren nochmals im Gedicht In Bamberg beschrieben, das seinem merkwürdigen Gefühl Ausdruck verleiht darüber, wie »der Schorsch / und die Rosa an einem / Augustnachmittag / des dreiundvierziger / Jahrs« (LW 77) dort stehen und er sie nun auf dem Foto betrachten kann. Denn was ihn an diesem Dokument so nachhaltig verstört, ist dessen Charakter als Indiz dafür, daß seine Zeugung sich in der Kaserne abgespielt haben wird. Diesen Umstand muß Sebald, da ist er ganz Kind seiner Generation, als Schande und Last empfunden haben. Das nämlich läßt
186
6 Feuer
sich ablesen daran, wie er in Nach der Natur im Anschluß an die Bildbeschreibung plötzlich umschwenkt zu dem im Kunsthistorischen Museum von Wien ausgestellten Bild von Albrecht Altdorfer, »auf dem Lot dargestellt ist / mit seinen Töchtern. Am Horizont / lodert ein furchtbares Feuer, / das eine große Stadt verdirbt.« (NN 74) Die ungenannte Stadt, wie selbst nicht bibelfeste Leser erkennen dürften, ist Sodom. Das wiederum schlägt für historisch Belesene eine Brücke zur Zerstörung von Hamburg, eine gleichfalls große Stadt, die 1943 dem Feuersturm der Operation Gomorrha zum Opfer fiel, wie der alliierte Codename für den Angriff lautete. »Rauch steigt auf aus der Gegend, / an den Himmel schlagen die Flammen, / und im blutroten Widerschein / sieht man die dunklen / Fassaden der Häuser. / Im Mittelgrund ist ein Stück / grüne idyllische Landschaft, / und dem Beschauer zunächst / wird das neue Geschlecht / der Moabiter gezeugt.« (NN 74) Der inzestuöse Akt, den Lot mit seinen Töchtern begeht, soll offenkundig auf die Zeugung des lyrischen Ichs bezogen werden: als Ungeheuerlichkeit, als Makel. Oder profaner gesagt: Sebald kann seinen Eltern nicht verzeihen, daß sie ihn in einer Kaserne gezeugt und somit während des ›totalen Kriegs‹ in eine Welt grausamster Vernichtung gesetzt haben. Zugleich reklamiert er für sich – muß man fragen: nur rein künstlerisch? –, vom traumatischen Anblick des Brands von Nürnberg, vermittelt durch die Augen der Mutter, bereits als Embryo ›gebrandmarkt‹ worden zu sein: »Als ich dieses Gemälde / im vorvergangenen Jahr / zum erstenmal sah, / war es mir, seltsamerweise, / als hätte ich all das / zuvor schon einmal gesehen.« (NN 74) Schockhaft materialisiert sich so in der ›Zusammenschau‹ von Familienfoto und Altdorfer-Gemälde die Erkenntnis, daß sein Leben gewissermaßen unter dem Zeichen des Feuers steht. Feuer ist das Signum der Geschichte. Im Brand Nürnbergs ereignet sich eine reale Aktualisierung des mythologischen Feuers, das die bib-
Luftkrieg & Literatur & Kreatur
187
lische Stadt dahinrafft. Der Brand der Sägemühle war dann die erste reale Feuersbrunst, der Sebald ansichtig wurde, was erklärt, warum er in seinem Werk immer wieder obsessiv darauf zurückkommt. Er scheint, so seine künstlerische Selbststilisierung, geradezu verdammt dazu, den wiederkehrenden Manifestationen des embryonal aufgenommenen Urbilds des Weltenbrands nachzugehen. Deshalb blieb Sebald zeitlebens ein vom Luftkrieg ›gebranntes Kind‹: »Mir ist es bis heute, wenn ich Photographien oder dokumentarische Filme aus dem Krieg sehe, als stammte ich, sozusagen, von ihm ab und als fiele von dorther, von diesen von mir gar nicht erlebten Schrecknissen, ein Schatten auf mich, unter dem ich nie ganz herauskommen werde.« (LL 77)
LUFTKRIEG & LITERATUR & KREATUR Das Thema meines ersten Tutoriums bei Sebald avancierte zu Ende des Jahrzehnts zu einer der großen erinnerungspolitischen Debatten in der ersten Dekade der Berliner Republik. Seine 1999 erschienene Streitschrift Luftkrieg und Literatur befeuerte nochmal die öffentlichen Diskussionen, die Sebald bereits durch die Zürcher Poetikvorlesungen im Winter 1998/99 ausgelöst hatte. Es ist viel geschrieben worden über diese seine Intervention in die deutsche Erinnerungspolitik, auf Deutsch wie Englisch, darunter viel Dummes und einiges Kluges. In diesem Essay nochmals die Forschungsdiskussionen aufzurollen, scheint mir fehl am Platz. (Am Luftkriegskomplex interessierte Leser mögen meine sicherlich auch nicht letztgültigen Ausführungen dazu an anderer Stelle nachlesen.) Umgehen läßt sich die Auseinandersetzung mit Luftkrieg und Literatur jedoch mitnichten in einem Essay, der versuchen will, der tieferen Bedeutung des Feuers für Sebald nachzugehen.
188
6 Feuer
Was im Verlauf der kontroversen Debatte recht schnell ans Licht kam, war der Umstand, daß der Luftkriegskomplex Sebald schon zu Ende der siebziger Jahre beschäftigt hatte; zwei Jahrzehnte bevor das große Geschrei losging. Im Herbst 1981 interviewte er Lord Zuckerman, einen britischen Primatenforscher jüdischer Abstammung, der von 1969 bis 1974 an der UEA unterrichtet hatte. Zuckerman arbeitete während des Kriegs als ›Scientific Director‹ der ›Bombing Analysis Unit‹ der Royal Air Force, wo er sich hervortat als Kritiker der britischen Flächenbombenstrategie durch Air Marshall Sir Arthur Harris, auch bekannt als ›Butcher Harris‹. Es war Zuckerman, der in seiner Autobiografie From Apes to Warlords davon berichtet, er habe bei der schockierenden Besichtigung der totalen Zerstörung von Köln den (nie verwirklichten) Plan gefaßt, einen Bericht für eine Zeitschrift zu schreiben. Darin wollte er insbesondere aus der Sicht des Biologen und Naturwissenschaftlers die atavistischen Lebensumstände inmitten der Ruinen schildern. Der Arbeitstitel lautete: ›The Natural History of Destruction‹. Das Gespräch mit Solly Zuckerman spielte eine gewichtige Rolle in der Beschäftigung Sebalds mit der weitgehend ausgebliebenen beziehungsweise in vieler Hinsicht mangelhaften Schilderung der Auswirkungen des Bombenkriegs durch deutsche Schriftsteller in Anbetracht der von Sebald diagnostizierten Unfähigkeit, »das, was sie gesehen hatten, aufzuzeichnen und einzubringen in unser Gedächtnis.« (LL 7) Erstes Ergebnis war sein Aufsatz Zwischen Geschichte und Naturgeschichte. Versuch über die literarische Beschreibung totaler Zerstörung mit Anmerkungen zu Kasack, Nossack und Kluge, der 1982 in einer dänischen Fachzeitschrift erschienen war. Daß er sich, als er den Ende der neunziger Jahre von Peter von Matt vermittelten Auftrag zur Zürcher Poetikdozentur annahm, dazu entschloß, die Thematik von Luftkrieg und Literatur erneut aufzugreifen, war nicht motiviert dadurch, sich per Wiederver-
Luftkrieg & Literatur & Kreatur
189
wendung bereits bestehender Überlegungen einfach Arbeit zu ersparen. Vielmehr lag ihm das Thema am Herzen, weil er in den vergangenen Jahrzehnten durch sein Schreiben und Denken in literarischen wie literaturkritischen Texten seine eigene ›Naturgeschichte der Zerstörung‹ in unsystematischer Weise entwickelt hatte. In seinen in Zürich vorgetragenen Ausführungen konnte Sebald nun darlegen, wie sich der Luftkrieg einpaßte in dieses Denkgebäude, er konnte einige seiner Merkmale skizzieren und nicht zuletzt öffentlich seine Reverenz an Zuckerman erweisen, von dem er den markanten Titel entlehnt hatte. (Die posthum erschienene englische Übersetzung von Luftkrieg und Literatur hieß auf Sebalds expliziten Wunsch hin On the Natural History of Destruction.) Zu den Sebald beschäftigenden Aspekten der Naturgeschichte der Zerstörung gehörte die Dimension des Kreatürlichen. Plötzlich in Ruinen zu leben, bedeutete für die Deutschen die gewaltsame Zurückstufung auf eine geradezu kreatürliche Existenzform. Wie ihnen nun allzu spät dämmerte, waren nicht die Juden, wie die Propaganda gern behauptet hatte, sondern »in Wahrheit sie selber das Rattenvolk.« (LL 41) Mustergültig zeigte sich so, was Giorgio Agamben und andere als ein Kennzeichen der Modernität verstanden haben, nämlich die Emergenz des Kreatürlichen durch die biopolitischen Gewalt akte der Moderne: das ›bloße Leben‹ also, wie es die Deutschen in den Trümmern führten; die reine Existenz, wie sie sich am schockierendsten zeigte bei den ihrer ethisch-politischen Menschlichkeit beraubten Häftlingen der nationalsozialistischen Vernichtungslager. Erneut will Sebald selbstverständlich nicht auf eine billige Gleichsetzung oder Relativierung gar des kategorialen Unterschieds zwischen den unschuldigen Opfern des Nazi-Holocaust und den größtenteils am Faschismus mitschuldigen Opfern des Bombenterrors hinaus, sondern auf einen Berührungsraum der Erfahrun-
190
6 Feuer
gen. »Der Bombenkrieg war Krieg in purer, unverhohlener Form« (LL 27), so Sebald, und daher die entsprechende Antwort auf den totalen Krieg, welchen die Nazis zuerst erklärt hatten. Die kreatürliche Dimension des Bombenterrors zeigt sich für ihn aber ebenso anhand der Todesängste und Todesqualen, welche die Tiere im Berliner Zoologischen Garten angesichts der Luftangriffe empfunden haben müssen. Rund viertausend Tiere überlebten beispielsweise den Angriff von Ende März 1943 nicht, welcher den Zoo weitenteils vernichtete. Dabei wurde u.a. »die dreißig Meter lange Krokodilhalle durch eine Luftmine zerstört«, weshalb »unter Zementbrocken, Erdreich, Glasscherben, umgestürzten Palmen und Baumstämmen die vor Schmerz sich windenden Riesenechsen im fußtiefen Wasser lagen.« (LL 98) Der entfesselte Bombenkrieg differenzierte nicht zwischen Nazi und Nazigegner, Mensch und Tier. Schuldig und Unschuldig. Zuletzt noch lenkt Sebald den Fokus auf das »schlagartige Überhandnehmen der an den ungeborgenen Leichen gedeihenden parasitären Kreatur.« (LL 41) Nur mit Flammenwerfern vermochten die Helfer den Weg zu bahnen in die Todeszone der »in den Luftschutzräumen liegenden Leichen, so dicht brausten die Fliegen um sie her und waren die Kellerstiegen und Fußböden bedeckt mit glitschigen, fingerlangen Maden.« (LL 42) Als reinigende Kraft wird hier das Feuer eingesetzt: damit der Mensch wieder Herr werde über die Proliferation der ungewünschten Kreatur. Und über allem thront das Prinzip der feurigen Vernichtung.
EXTREMPHÄNOMEN FEUERSTÜRME Die von Sebald vorgetragene Überzeugung, daß die deutschen Nachkriegsschriftsteller (bis auf wenige Ausnahmen wie Alexander Kluge und andere) darin versagten, den Luftkrieg angemessen zum Gegenstand der Literatur zu machen, erwies sich als zutref-
Extremphänomen Feuerstürme
191
fend. Außer der Wiederentdeckung von Gert Ledigs Vergeltung hat die von ihm ausgelöste Debatte keine bedeutenden literarischen Werke mehr zutage gebracht. Unverändert gilt daher: »Jedenfalls ist die These, daß es uns bisher nicht gelungen ist, die Schrecken des Luftkriegs durch historische oder literarische Darstellungen ins öffentliche Bewußtsein zu heben, nicht leicht zu entkräften.« (LL 100) Das betrifft zumal das Phänomen, das wie kein anderer Gesichtspunkt des Luftkriegs für dessen totale Qualität steht – den Feuersturm. Nicht nur in Hamburg kam es dazu, auch in Kassel und Dresden wurden monströse Feuerstürme entfesselt, mit noch nie erlebten Konsequenzen für die Städte und ihre Bewohner. Die militärisch unbedeutende Provinzstadt Pforzheim etwa wurde in der Nacht zum vierundzwanzigsten Februar 1945 fast völlig vernichtet, mit einem Todeszoll von zwanzigtausend Menschen. Die Feuerstürme waren ein Resultat der neuen Angriffsstrategie der Alliierten: In mehreren koordinierten Angriffswellen warfen die zumeist von East Anglia in der unmittelbaren Nachbarschaft des späteren Wohnorts von Sebald gestarteten Bomber der Royal Air Force und der United States Army Air Force erst Tausende von Luftminen ab, worauf konzentriert nacheinander Spreng-, Phosphor- und Stabbrandbomben folgten. Das perfide Kalkül bestand darin, die Dächer und oberen Stockwerke der Wohnhäuser gleichsam zu öffnen, um dann mit den verschiedenen Brandbombentypen weitreichende Flächenbrände auszulösen. Rollende Angriffswellen mit Splitterbomben dienten dazu, die Bevölkerung in den Luftschutzräumen zu halten; die Feuerbrände sollten sich ungehindert ausbreiten können. Wenn eine ungünstige Wetterlage hinzukam, konnten orkanartige Winde entstehen. Diese fachten die Feuer weiter an, was zu einem Kamineffekt führte, der wiederum die Vereinigung der Flächenbrände zum Feuersturm mit Temperaturen von bis zu achthundert Grad ermöglichte. »Im Zenit des Feuersturms läßt die pure Hitzestrahlung Häuser
192
6 Feuer
sich auf einen Schlag vom Dach bis zum Erdgeschoß wie eine Stichflamme entzünden«, schreibt Jörg Friedrich in Der Brand. Komplett neuartige Erscheinungen bildeten sich im Umfeld der Feuerstürme heraus. So konnten von der Hitze ausgelöste Windgeschwindigkeiten von fünfzehn Meter pro Sekunde in einem Umkreis von vier Kilometern zur Heißluftsäule entstehen. Diese Sturmböen vermochten Passanten niederzuwerfen oder gar schlichtweg mitzureißen ins Innere des Brandherds. Überdies starb man allein schon schnell durch den Sauerstoffentzug aus der glühend heißen, nicht mehr atembaren Luft beziehungsweise an der Atemvergiftung durch Rauch und Qualm, egal ob eingesperrt in den Luftschutzkellern oder beim Versuch der Flucht auf der Straße. So wie Sebalds Wechsel in die Schriftstellerei nicht zuletzt davon motiviert war, der in seinen literaturkritischen Schriften immer wieder ob ihrer Fehler und Versäumnisse angegriffenen Nachkriegsliteratur seine eigene literarische Arbeit entgegenzustellen, um so zu erproben, ob das Deutsche nach seiner Deformierung durch die Nazis noch taugt als Literatursprache, so lieferte er in Luftkrieg und Literatur die wahrlich furiose Beschreibung des Feuersturms, der Hamburg Ende Juli 1943 zerstörte. Daß dieser Angriff, der »die möglichst vollständige Vernichtung und Einäscherung der Stadt« (LL 33) anstrebte, wie bereits erwähnt als Operation Gomorrha in die Geschichte einging, verdeutlicht ebenjenen Vernichtungswillen der Alliierten und zugleich deren Selbsteinsetzung als göttlich strafende Macht. Zuckermans projektierte Studie über die ›Naturgeschichte der Zerstörung‹, so umreißt Sebald, hätte auf jeden Fall »eine wissenschaftliche Beschreibung des bis dahin unbekannten Phänomens der Feuerstürme« (LL 40) enthalten müssen. Er selbst holt dies nun nach, und zwar mit jener Mischung aus »Mitleidenschaft und Indifferenz« (LH 20), die er im Essay über Johann Peter Hebel als primäres Kennzeichen des Chronisten bezeichnet. An anderer Stelle
Extremphänomen Feuerstürme
193
hat er die Gefahr benannt, die bei einer Beschäftigung mit der Beschreibung totaler Zerstörung droht: »Der Feuersturm ist natürlich ein extremes Phänomen. Man kann sich überhaupt mit all diesen Dingen nicht sehr lange beschäftigen, ohne Schaden zu nehmen, auch an der eigenen Gesundheit. Das alles ist letzten Endes einfach inkommensurabel.« (G 186) Sebalds Beschreibung des Hamburger Feuersturms will den darin Umgekommenen Tribut zollen. Er schildert das schreckliche Bild, das sich dem Blick der Strafbrigaden und Lagerhäftlinge darbot, die zur Räumung der inneren Todeszone gezwungen wurden. Sie nämlich sahen Menschen, »die, überwältigt von Monoxydgas, noch an Tischen oder gegen die Wand gelehnt saßen, anderwärts klumpenweise Fleisch und Knochen oder ganze Körperberge gesotten von dem siedenden Wasser, das aus geborstenen Heizkesseln geschossen war. Wieder andere waren in der bis auf tausend Grad und mehr angestiegenen Glut so verkohlt und zu Asche geworden, daß man die Überreste mehrköpfiger Familien in einem einzigen Waschkorb davontragen konnte.« (LL 35/36) Daß er ein moralisches Wagnis einging mit seinem literarischen Experiment, war Sebald wohlbewußt: »Jede Beschäftigung mit den wahren Schreckensszenen des Untergangs hat bis heute etwas Illegitimes, beinahe Voyeuristisches, dem auch diese Notizen nicht entgehen können.« Er verweist darauf, daß die Fotos der »nach dem Feuersturm auf den Straßen herumliegenden Leichen« in der Nachkriegszeit »unter dem Ladentisch eines Hamburger Buchgeschäfts befingert und gehandelt wurden wie sonst nur die Erzeugnisse der Pornografie.« (LL 104) Sebald hatte mit der Schilderung des drei Stunden tobenden Feuersturms mit einer seiner ältesten und tiefsten poetologischen Überzeugungen gebrochen, nämlich sich der Darstellung ultimativen Grauens und roher Grausamkeit zu enthalten. Die nur etwas über drei Seiten umfassende Feuersturmpassage ist in seinem Werk daher singulär als eine dokumentarisch fundierte, zugleich aber
194
6 Feuer
dennoch literarische Evokation eines absolut Katastrophalen und Entsetzlichen. Daher ist von eminenter Bedeutung, daß er dieser Passage ein fürchterliches Foto beistellt, das eine Gruppe von vielleicht fünfzehn toten Körpern inmitten von Trümmern zeigt. Die verkohlten Leichname sind das Emblem des Feuersturms. Sein grauenhaftes Schreckbild. In seiner Beschreibung taucht Sebald mit dem Ton des Historiografen, nachdem er zuerst die Vogelperspektive der Bombercrews eingenommen hat, tief ins todesbringende Herz des Feuersturms ein, um zuerst die beispiellosen Zerstörungsvorgänge zu vergegenwärtigen, die das ungeheure Feuer auslöst: orgelartiges Dröhnen durch den abgesaugten Sauerstoff, umherwirbelnde Dachstühle und entwurzelte Bäume, mächtige Flammenwalzen und blasenwerfender Asphalt; selbst das Wasser in den Kanälen beginnt angesichts der ungeheuren Hitze zu brennen. Das Horrorszenario gipfelt schließlich in den Beschreibungen der Menschenleichen, von denen Sebald an einer anderen Stelle in Luftkrieg und Literatur so polemisch wie zutreffend behauptet, daß sie – egal ob real in den Luftschutzkellern oder rein metaphorisch – in die Grundfesten unseres Staates eingemauert sind: »Überall lagen grauenvoll entstellte Leiber. Auf manchen flackerten noch die bläulichen Phosphorflämmchen, andere waren braun oder purpurfarben gebraten und zusammengeschnurrt auf ein Drittel ihrer natürlichen Größe. Gekrümmt lagen sie in den Lachen ihres eigenen, teilweise schon erkalteten Fetts.« (LL 35) Es sind dies die entsetzlichen Details zu der Aufnahme der Luftkriegstoten, die vom Fotografen Erich Andres stammt. Er hat das Foto quasi direkt vor seiner vom Feuersturm zerstörten Wohnung in Hamburg-Hammerbrook gemacht. Wie kaum betont werden muß, bildet die Abbildung der am Boden liegenden Leichen gleichsam den Revers zur Aufnahme der KZ-Opfer und das Pendant zum Kadaverhaufen toter Heringe in Die Ringe des Saturn.
Feuer als Waffe
195
Doch diesen Zusammenhang muß man selber herstellen. Sebald ist bedacht genug, ihn nicht allzu offenkundig zu machen – obgleich er ihn unübersehbar anlegt. Ob wir reflexartig widersprechen wollen in der Überzeugung, daß die Feuerstürme in den Städten und die rund um die Uhr brennenden Krematorien der Vernichtungslager nicht zusammengehören, liegt bei uns. Sebalds Standpunkt war der einer erweiterten Schau, die nicht nur die Kulturgeschichte, sondern darüber hinaus die Naturgeschichte sowie die vielfältigen Abhängigkeiten zwischen beiden Kategorien zu berücksichtigen trachtete. Und aus solch einer Perspektive entpuppt sich das vernichterische Feuer als Glutkern eines totalitären Machtanspruchs, der dazu führte, daß ein einmal entfesseltes Feuer, ganz so wie in der Natur, nicht mehr einzuhegen ist. Nicht nur ihre Ausbreitung, auch die Gleichgültigkeit, mit welcher die Flammen ihre Opfer verzehren, seien es nun die panischen Tiere beim Waldbrand oder die menschlichen Opfer in dem von Deutschen entfesselten Zweiten Weltkrieg, gehört zu den Eigenschaften des Feuers. Sebald vermochte nicht davon abzusehen, daß zur selben Zeit unschuldige Menschen starben und verbrannten, in den Städten wie in den Lagern. Stets und unverbrüchlich aber gilt seine Identifikation den Opfern. Denn ganz wie Benjamins Engel der Geschichte, auf den er sich am Ende des zweiten Teils von Luftkrieg und Literatur beruft, blickt auch er, in letzter Konsequenz, in der Rückschau auf die Vergangenheit auf »eine einzige Katastrophe«.
FEUER ALS WAFFE In Köln, das Solly Zuckerman noch als Trümmerhaufen besuchte, hielt Sebald 1997 seine Preisrede zur Verleihung des Heinrich-Böll-Preises. Darin gab er zu bedenken: »Blicken wir heute zurück auf die im Nachthimmel auflodernden deutschen Städte,
196
6 Feuer
so können wir erkennen – vorausgesetzt wir sind fähig zu solch ungeheurem Detachement – daß dieses Aufflackern nur eine besonders intensive Phase dessen war, was fortwährend und in immer zunehmenden Maßen geschieht. Vielleicht müssen wir endlich wirklich begreifen lernen, daß der Stoff unserer Zivilisation selber gewoben ist aus Feuer und Rauch.« (SM 341/42) Die gigantischen Flammenmeere, denen Hamburg und andere Städte zum Opfer fielen, erscheinen aus der analogisch denkenden, kulturanthropologischen Perspektive von Sebald als ein Extremfall jener Grundoperation der Ausbreitung von menschlicher Herrschaft, die darin besteht, alles, was zum Feind erklärt wird, einfach zu verbrennen. Seine Grundüberzeugung, daß die menschliche Geschichte mit der Brandrodung der Urwälder begann, haben wir bereits kennengelernt: Zivilisation als der mit Feuer und Flamme geführte Krieg gegen die Natur. Vielleicht stammt die ungeheure, urtümliche Faszination durch das Feuer daher, daß es uns so effektiv half, die Natur um (und in) uns auszulöschen. Der logische nächste Schritt schien daher, es nach unserem Endsieg über die Natur gegen andere Menschen einzusetzen: »Nichts gibt uns so sehr das Gefühl der Sicherheit wie die verbrannte Erde. Darum überziehen wir immer wieder die Länder unserer Feinde mit Feuer. Selbst zu Friedenszeiten ist das Maß unserer Macht, wieviel Feuerkraft wir gefangen halten in unseren Waffenarsenalen & an den Stätten unserer Produktion. Das Feuer ist unsere einzige Hilfe, wenn uns etwas über den Kopf wächst.« (KP 209) Vor diesem Hintergrund gilt es Sebalds Ausführungen in Die Ringe des Saturn zu den militärischen Installationen in Suffolk zu lesen, in denen »halb verborgen hinter schütteren Föhrenplantagen in tarnfarbenen Hangars und grasüberwachsenen Bunkern die Waffen lagern, mit denen – notfalls – ganze Länder und Kontinente in kürzester Frist verwandelt werden können in rauchende Haufen von Stein und Asche.« (RS 271/72) Solche Massenvernichtungs-
Feuer als Waffe
197
waffen sind aktuell etwas aus dem politischen Diskurs wie dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwunden. Was freilich nichts an der unverändert bestehenden Bedrohung ändert, die ihre Existenz in Zeiten eines religiös verbrämten Terrorismus und digitaler Sabotage mehr für die eigene Seite als für den ›Gegner‹ bedeutet. Daran, daß der Unfall der Regelfall in der menschlichen Handhabung übermächtiger Technik ist, erinnert Sebald anhand des (angeblich) verunglückten Tests in Shingle Street, bei dem das britische Militär die Praktikabilität von Petroleumbränden als Abwehrwaffe bei Invasionen erprobt haben soll. »Im Zuge dieser Experimente«, so referiert beziehungsweise kolportiert Sebald, »soll eine ganze Kompanie englischer Pioniere, versehentlich, wenn man so sagen kann, den Tod gefunden haben, und zwar auf die allerentsetzlichste Weise, wie Zeugen berichtet haben, die die schmerzverrenkten, verkohlten Leichen mit eigenen Augen am Strand liegen beziehungsweise draußen auf dem Meer noch in ihren Kähnen hockend gesehen haben wollen.« (RS 276) Die Authentizität dieser Geschichte darf man ruhig anzweifeln, gerade auch deshalb, weil Sebald sie uns als glaubwürdig andrehen will. Bedeutsam aber erscheint mir das fürchterliche Schreckbild der ›schmerzverrenkten, verkohlten Leichen‹. Real oder nicht, es steht stellvertretend für alle Opfer des tödlichen menschlichen Spiels mit dem Feuer, von den Feuerstürmen in den deutschen Städten bis zur Entfesselung des atomaren Feuers in Hiroshima und Nagasaki, wie darüber hinaus. Sebalds berechtigte Sorge war unsere evidente Unfähigkeit zu lernen aus der Geschichte. Daß er an eine Übermacht der Naturgeschichte der Zerstörung glaubte, bedeutete freilich keineswegs, daß er sich einer fatalistischen Schicksalsergebenheit verschrieben hätte. Dazu war er viel zu sehr geprägt durch den Aufbruchsgeist von 1968. Und von Adornos Konzept der Negativen Dialektik wie von Benjamins Idee eines messianischen Materialismus. Man könnte vielleicht sagen, daß er am Rande der Katastrophe einer sozusa-
198
6 Feuer
gen Negativen Hoffnung anhing, daß messianischer Dialektik zufolge die Erlösung nur zum Zeitpunkt der absoluten Katastrophe eintreten kann. Dem Punkt, an dem man bereits alle Hoffnung auf Errettung hat fahren lassen. Die Möglichkeit eines Auswegs bekräftigte Sebald in einem Interview, wo er zu bedenken gab, »daß man – allen absehbaren Katastrophen zum Trotz – immer noch annehmen muß, daß die Zukunft gespalten ist; daß also hinter der nächsten Ecke irgendwelche Wunder sind, mit denen wir nicht gerechnet haben.« (G 150) Angesichts der in England früh spürbaren Auswirkungen des Neoliberalismus nahm mit zunehmendem Alter jedoch seine Ernüchterung zu. Wüßte er um die desolaten Zustände heute in Gesellschaft, Politik, Ökonomie und nicht zuletzt Kultur, er wäre zweifelsohne entsetzt, aber kaum erstaunt. »Auf die eine oder andere Weise entsteht immer ein Feuer« (KP 209), notierte Sebald im Korsika-Projekt. Das bezog sich auf Waldbrände. Es darf aber auch als grundsätzliche Sorge über den von anthropologischer Prägung befeuerten Destruktionstrieb des Menschen verstanden werden. Seinen Abschluß findet das Fragment gebliebene Korsika-Projekt in überaus passender Weise durch eine so ironische wie fordernde Frage, die den Feuer-Komplex nochmal konzentriert auf den Punkt bringt: »Haben wir nicht sogar ganze Völker verbrannt, unsere Städte abbrennen sehen in meilenhohen Feuerstürmen, & haben wir nicht alles wieder aufgebaut, besser & schöner als zuvor, & keinen Schaden genommen an unserer Seele?« (KP 209) Ja, wer wollte ernsthaft behaupten, all das sei ohne Konsequenzen an uns vorübergegangen?
ZIVILISATION: DAS BESTÄNDIGE FEUER Kehren wir nochmals zurück an den Anfang: »Ungefähr vor vier einhalbtausend Jahren, einer kurzen Frist, wenn man die Entwick-
Zivilisation: das beständige Feuer
199
lungszeiten der höheren Vegetationsformen bedenkt, wurden die ersten Waldstücke über den Küstensäumen der Insel durch Brand gerodet, & seither hörten die Feuer nicht auf« (KP 207), schreibt Sebald über Korsika. Die Evidenz ist unübersehbar: »Links & rechts, kilometerweit, verkohltes Holz. In Korsika brennt es seit Jahren.« Verantwortlich dafür sind zumeist Brandstifter: »Was für Motive die Pyromanen haben, weiß man nicht. Von dem Schaden, den sie anrichten, haben wir keinen richtigen Begriff« (KP 154), zumal die »inzwischen jeden Sommer ausbrechenden Wald- & Buschfeuer ein katastrophales Ausmaß« (KP 208) angenommen haben. Auf einer griechischen Insel ist Sebald Augenzeuge eines solchen Feuers geworden. Sichtlich schockiert sein Bericht darüber, »mit welcher Geschwindigkeit die ausgedörrte Vegetation von einem Brand durcheilt wird. Und ich werde niemals vergessen, wie die Wacholderbäume, die dunkel im Widerschein standen, einer um den anderen, kaum daß die ersten Flammenzungen sie berührten, mit einem dumpfen, explosionsartigen Schlag emporlohten, als seien sie aus Zunder, und wie sie gleich darauf in stillem Funkenstieben in sich zusammensanken.« (RS 203) Auch von den Waldbränden in Brasilien, deren »Rauchfahnen windabwärts trieben, in Wirklichkeit wohl hundert Kilometer & mehr« (KP 170), geht einmal die Rede im Korsika-Projekt. Und in den Ringen des Saturn hält Sebald fest: »Nicht umsonst verdankt das kaum zu ermessende Land Brasilien seinen Namen dem französischen Wort für Holzkohle.« (RS 202) Dort nennt er die Urwälder von Amazonien und Borneo als gegenwärtige Beispiele für die unverändert praktizierte ›Kulturtechnik‹ der Brandrodung: Fliegt man über diese Wälder und »sieht die riesigen, scheinbar unbeweglichen Rauchgebirge über dem von oben einem sanften Moosgrund gleichenden Dach des Dschungels, dann bekommt man am ehesten eine Vorstellung von den möglichen Auswirkungen solcher manchmal monatelang anhaltenden Brände.« (RS 202)
200
6 Feuer
Es ist dies die destruktive Dialektik, die in die Naturgeschichte der Zerstörung eingeschrieben ist: die Tragik, daß der Mensch durch solche Angriffe auf die Natur nicht nur seine eigene Lebengrundlage auf diesem Planeten zerstört, sondern zudem den in der Natur angelegten Prozeß der Selbstzerstörung beschleunigt. Reinste Pyromanie also – Zivilisation als krankhafte Fehlentwicklung, als Aberration und Defekt. Seine pessimistische Teleologie denkt Sebald dabei konsequent weiter, indem er den Vektor bis in unser Zeitalter der Technologie verlängert. Die nachfolgende Passage, wieder aus Die Ringe des Saturn, scheint mir eine der wichtigsten im ganzen Werk von Sebald zu sein, um dem Eigensinn seiner Denklinie auf die Spur zu kommen: »Die Verkohlung der höheren Pflanzenarten, die unaufhörliche Verbrennung aller brennbaren Substanz ist der Antrieb für unsere Verbreitung über die Erde. Vom ersten Windlicht bis zu den Reverberen des achtzehnten Jahrhunderts und vom Schein der Reverberen bis zum fahlen Glanz der Bogenlampen über den belgischen Autobahnen ist alles Verbrennung, und Verbrennung ist das innerste Prinzip eines jeden von uns hergestellten Gegenstandes.« (RS 202) Diesen Gedanken hat Sebald auch in einem Interview ausgeführt, und zwar am Beispiel des Kühlschranks: »Wir haben unsere Gesellschaft so organisiert, daß wir zu verbrennen drohen. Der Feuertopos in Schwindel. Gefühle. paßt in den Verbrennungsprozeß des Menschen, das hat er gemein mit den Apparaten, deren er sich bedient. Feuer ist am schrecklichsten. Meist sieht man dieses Brennen nicht; wenn man zum Beispiel in seinem Zimmer einen Kühlschrank stehen hat, denkt man natürlich nicht daran, daß sogar der Kühlschrank ständig etwas verbrennt.« (G 73) Aber Sebald begnügt sich eben nicht damit, einen vielleicht nur idiosynkratischen Gedanken auszudeklinieren, er dreht die Denkschraube eine Drehung weiter: »Die Anfertigung eines Angelhakens, die Manufaktur eine Porzellantasse und die Produktion eines
Zivilisation: das beständige Feuer
201
Fernsehprogramms beruhen letzten Endes auf dem gleichen Vorgang der Verbrennung. Die von uns ersonnenen Maschinen haben wie unsere Körper und wie unsere Sehnsucht ein langsam zerglühendes Herz. Die ganze Menschheitszivilisation war von Anfang an nichts als ein von Stunde zu Stunde intensiver werdendes Glosen, von dem niemand weiß, bis auf welchen Grad es zunehmen und wann es allmählich ersterben wird.« (RS 203) Zumindest bei einem Aspekt dieses beständigen Glosens können wir das nahende Ende absehen, nämlich wenn die andere, gleichsam höhere Form des Verbrennens der Wälder unmöglich wird im Augenblickt, an dem es keine Holzkohle oder andere fossile Brennstoffe mehr gibt. Der durch Verbrennungsmotoren und Kohlekraftwerke ausgelöste Klimawandel war für Sebald schon zu Lebzeiten ein Thema. Selbst wenn die wissenschaftliche Debatte über global warming erst in den letzten Jahren zu einem Medienthema wurde, betrachtete Sebald die immer heißeren Sommer in England als ein untrügliches Indiz für eine beständige Aufwärmung der Atmosphäre. In einem Interview aus dem Jahr 1995 erläuterte er: »Diesen Sommer hatten wir zweieinhalb Monate keinen Regen, nicht einen Tropfen. Das heißt, daß die Blätter im August von den Bäumen fielen. Das kommt einem nicht sehr gut vor: Im Mai kommen sie heraus, und im August fallen sie schon wieder herunter. Wenn man schaut, dann sieht man schon, daß irgend etwas nicht mehr so richtig im Lot ist.« (G 119) Das war selbstredend als punktuelle Wahrnehmung eine reichlich unwissenschaftliche Folgerung, wenngleich er damit unwissentlich die beständigen Wärmerekorde der letzten Jahre vorausahnte. Von anekdotischem Belang in diesem Zusammenhang mag der als ›Climategate‹ bekannt gewordene Skandal sein, der von der an der UEA beheimateten ›Climatic Research Unit‹ im November 2009 ausging. Hacker hatten damals umfangreiches Forschungsmaterial und den Mailverkehr der Forschungseinrichtung ins Netz gestellt.
202
6 Feuer
Der dahinterstehende Impetus war, eine Verschwörungstheorie der Leugner des Klimawandels zu belegen: den Klimawandel gibt es nicht! Verschiedenste Untersuchungskommissionen haben im Gefolge des Skandals jedoch den Beweis erbracht, daß die Klimaforscher der UEA sich keinerlei wissenschaftlichen Fehlverhaltens schuldig gemacht haben. Damit wurden zugleich die eine zunehmende Erderwärmung belegenden Ergebnisse der Forscher bestätigt. Wir leben im Anthropozän – nicht nur der rasante Anstieg der klimaerwärmenden Treibhausgase, auch die landschaftlichen Veränderungen durch landwirtschaftliche Monokulturen, die Übersäuerung der Ozeane sowie das fortdauernde Artensterben haben, um nur die wichtigsten Faktoren zu nennen, unseren Planeten mit katastrophalen Folgen verändert. Sebald hat all diese Aspekte frühzeitig wahrgenommen, um sie in Interviews, Essays und literarischen Texten zu beklagen. Eingegangen ist seine Sorge in die (in einem Kafka-Essay geäußerte) Einsicht, daß der »negative Gradient der Naturhistorie vollends auf eine abschüssige Bahn« geraten sei, unter dem Vorzeichen des Feuers. Zivilisation als Kombustion, die Geschichte als ein vom Feuer erleuchtetes Spektakel des Derangements und der Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Natürlich liefert diese extreme Sicht keine adäquate Beschreibung unserer Welt, doch das liegt ohnehin auf der Hand. Zugleich ist sie aber nicht bloß bedenkenswert, wie mir scheint. Sie ist ebenso – und dies in einem nicht nur poetischen oder metaphorischen Sinne – durchaus zutreffend, denkt man etwa an die geistigen und realen Brandstifter, die derzeit allerorten den Selbstzerstörungsprozeß unserer gesellschaftlichen Welt befördern und vorantreiben.
Verdrängung der Finsternis
203
VERDRÄNGUNG DER FINSTERNIS Bedeutsam erscheinen mir Sebalds Überlegungen zur Bedeutung des Feuers, weil man sie leicht mit anderen, eigenen Überlegungen fortsetzen kann. Man braucht nur die Fäden aufnehmen, die er in seinem Werk ausgelegt hat. So etwa, was er einmal als die »unaufhaltsame Verdrängung der Finsternis« (RS 77) bezeichnet hat – die Rückseite also seiner (Un-)Kulturgeschichte des Feuers. Daß Feuer nicht nur wärmt und verbrennt, tröstet und vernichtet, weshalb es aufs engste mit dem Heiligen verbunden ist, sondern auch Licht zu spenden vermag im Dunkel, gehört schließlich zuvörderst zu seinen Eigenschaften. Die Verdrängung der Finsternis ist ein Projekt der Zivilisation, in dem wir als Antriebsmotiv die urmenschliche Furcht vor der Dunkelheit erkennen können. Eine Furcht, die in der kindlichen Angst vorm Dunkel noch als stammesgeschichtliches Erbe erkennbar ist. Die Fackel der Aufklärung hingegen will das Signum sein dafür, daß die Geschichte des Fortschritts wie die Mühewaltungen der Kunst gerichtet sind auf eine beständige »Vermehrung des Lichts« (BU 167) in unserem Leben. In Die Ringe des Saturn erinnert Sebald an eine merkwürdige Besonderheit des Herings: »daß sein toter Körper an der Luft zu leuchten beginnt.« Das seltsame Faktum dieser Biolumineszenz untersucht haben zwei englische Wissenschaftler mit den sprechenden, sprich: erfundenen Namen Herrington und Lightbown. Sie sollen versucht haben, aus einer »von den toten Heringen ausgeschwitzten luminösen Substanz die Formel zur Erzeugung einer organischen, sich fortwährend von selber regenerierenden Lichtessenz« (RS 76) abzuleiten. »Das Scheitern dieses exzentrischen Planes« (RS 76), so referiert der Erzähler die Einschätzung einer nicht näher spezifizierten Geschichte des künstlichen Lichts, war »ein kaum nennenswerter Rückschlag in der sonst unaufhaltsamen Verdrängung der Fins-
204
6 Feuer
ternis.« (RS 77) Das Vorbild dazu lieferte Wolfgang Schivelbuschs Buch Lichtblicke. Zur Geschichte der künstlichen Helligkeit im 19. Jahrhundert, im dem er zahlreiche Beispiele dafür fand, wie zu dieser Zeit »allerorten an Projekten zu einer totalen Illumination unserer Städte gearbeitet« (RS 76) wurde. Ein besonderes Spektakel in diesem Triumphzug des künstlichen Lichts bot damals das Herrenhaus Somerleyton mit seinen von innen beleuchteten Glashäusern: »Ungezählte Argand-Brenner, in deren weißer Flamme leise rauschend das giftige Gas sich verzehrte, verbreiteten mittels ihrer versilberten Reflektoren ein gleichsam mit dem Lebensstrom unserer Erde pulsierendes, ungeheuer helles Licht.« (RS 47) Sebald versieht diese Stelle wie zum Beweis mit einer unwirklich leuchtenden Illustration, auf der das Anwesen freilich eher wie ein Horrorhaus wirkt. Die allseits um uns blinkenden LEDs etwa in den Lichterketten zur Weihnachtszeit, die hochauflösenden Bildschirme der Flachbildfernseher, die gigantischen Werbedisplays in den Städten oder die Displays unserer ›mobilen Endgeräte‹, aber auch das Schauspiel der nächtlich erleuchteten Großstädte, sei es nun aus der Sicht des Flaneurs oder der Vogelperspektive des Flugreisenden, der wie Sebald bei seiner Übersiedelung nach Manchester »das von den südlichsten Bezirken Londons bis weit ins englische Mittelland hinein sich erstreckende Lichternetz« mit seinem »orangefarbenen Sodiumglanz« (AW 218) aus dem Kabinenfenster wahrnimmt – all das ist Evidenz unseres Siegs über die Dunkelheit. Ein Sieg über die primordiale Furcht vor der Finsternis. Auch dies eine Dialektik der Aufklärung, deren Sinnbild nicht von ungefähr die Fackel ist: Wir zerstören die Welt, indem wir sie erhellen und beleuchten. Denn hinter dem bunten Lichterglanz steckt stets das die Natur verzehrende Feuer. Dagegen positioniert Sebald unser eigentliches Bedürfnis nach jener »schöneren Beleuchtung der Welt« (BU 168), wie sie Stifter und Handke beispielsweise in ihren Texten zu erreichen versuchen.
Metaphysik: ›A Legitimate Concern‹
205
Oder um mit Benjamin’scher Terminologie zu sprechen: Sebald suchte nach der ›profanen Erleuchtung‹, in welcher sich Geist und Materie gegenseitig zu durchdringen vermögen in einem trockenen Rauschzustand, wie ihn nicht zuletzt die Kunst ermöglicht. Nicht auf Technologie, sondern auf Transzendenz setzte er seine ganze Hoffnung.
METAPHYSIK: ›A LEGITIMATE CONCERN‹ Wie allumfassend Sebalds Nachdenken über das Feuer war, zeigt sich in seinen metaphysischen Überlegungen. Daß die Metaphysik aus dem Bereich künstlerischer wie geisteswissenschaftlicher Beschäftigung ausgegrenzt wurde, hat er sehr bedauert. Wie wir schon wissen, gehörte metaphysischen Spekulationen seine besondere Passion: »Metaphysik ist etwas, über das heutzutage nicht mehr geredet werden darf. Sie gilt als lächerlich, kraftlos, sinnlos. Trotzdem finde ich metaphysische Themen im weitesten Sinn des Wortes – und ich meine das nicht in religiösem Sinn, das liegt mir fern – interessant. In jedem Lebenslauf gibt es sehr unwahrscheinliche Zufälle, Überlappungen mit dem Leben von anderen, Elemente, die nicht mit dem Verstand zu erklären sind.« (G 74) Gegenüber Joseph Cuomo wiederum erklärte er: »Metaphysics is something that’s always interested me, in the sense that one wants to speculate about these areas that are beyond one’s ken, as it were. I’ve always thought it very regrettable and, in a sense, foolish, that the philosophers decided somewhere in the nineteenth century that metaphysics wasn’t a respectable discipline and had to be thrown overboard. Metaphysics, I think, is a legitimate concern.« (EM 115) Diese durch den Großvater erworbene Offenheit gegenüber dem Transzendenten begründete seine Leidenschaft für Autoren wie Thomas Browne oder Paracelsus. Vornehmlicher Gewährsmann
206
6 Feuer
für Sebalds metaphysische Spekulationen über das Wesen des Feuers aber war Novalis. Dem Essay über Gerhard Roth, in dessen Landläufigem Tod die metaphysische Spekulation keine geringe Rolle spielt, stellte Sebald dieses schöne Novalis-Zitat als Motto voran: »Wenn unser körperliches Leben – ein Verbrennen ist, so ist wohl auch unser geistiges Leben eine Kombustion (oder ist dies gerade umgekehrt?)« (UH 145) Leibliche Existenz wie seelische Aktivität als einen inneren Verbrennungsvorgang zu verstehen ist eine Idee, die sich stimmig einfügt in die Auffassung, daß Zivilisation wie Naturgeschichte vom beständigen Prozeß des Verbrennens beherrscht sind. Auf diese frühromantische Spekulation kommt Sebald in einem feinfühligen Text zurück, den er für den Katalog zu einer Ausstellung der Münchner Künstlerin Anita Albus verfaßt hat. Ausgangspunkt seiner Hypothesen ist der warme Atem. Diesen anzuhalten, glaubt Sebald, erweist sich als Kennzeichen wahrer Kunst, weil man damit den permanenten Verbrennungsvorgang, zumindest vorübergehend, zu sistieren vermag. So jedenfalls versteht er die Kunst der Anita Albus: »Sie wird, meine ich, ehe sie mit der Spitze des Pinsels das Pergament berührt, jedesmal den Atem anhalten müssen. Die Bilder wären also – in einer ins Metaphysische übergehenden Übung – zusammengesetzt aus lauter solchen atem-losen Berührungen, die sich in ihrer Unzähligkeit summieren zu einer Art Vorgriff auf eine Zeit, in der alle Maschinen, auch unsere eignen, die Körper, stillstehen dürfen und in der folglich nichts mehr brennt und nichts mehr verbrannt wird, denn das vom Atem bewegte Leben ist ja, wie Novalis erkannt hat, im Grunde nichts als ein zehrendes Feuer.« Nichts weniger als eine Umkehrung der positiv besetzten Idee von Pneuma als Lebenssubstanz nimmt Sebald also hier vor. Wir sind, wie ebenfalls von Novalis einmal festgehalten, »Kinder des Äthers«. Doch indem wir atmen, brennen wir sanft aber beständig aus.
Entropische Grundlegung der Naturgeschichte der Zerstörung
207
Beachtlich ist der Text über Anita Albus auch deshalb, weil hier schon, und das heißt im Jahre 1990, von einem Gedanken die Rede ist, auf den sich die Sebald-Forschung mit enormem Eifer gestürzt hat: seiner Auffassung von Kunst als einem Versuch der Restitution. So nämlich hat Sebald sein Schreiben in einer vielzitierten Passage am Ende der 2001 gehaltenen Rede zur Eröffnung des Stuttgarter Literaturhauses umrissen: »Es gibt viele Formen des Schreibens; einzig aber in der literarischen geht es, über die Registrierung der Tatsachen und über die Wissenschaft hinaus, um einen Versuch der Restitution.« (CS 248) Beim Katalogtext zu Albus schließen sich unmittelbar an das obige Zitat die nachfolgenden Worte an: »Zu dieser Konjektur stimmt ein anderes Bild, das mir lange schon sehr viel bedeutet. Auf einer kleinen Bauminsel inmitten eines Sees steht ein brennendes Haus. Die Flamme schlägt lodernd aus dem Dach und eine schwere Rauchwolke steigt in den hellen Himmel. Wunderbarerweise ist aber das Spiegelbild des brennenden Hauses drunten im Wasser vom Feuer verschont, unversehrt und somit ein Ausdruck des Wunschs, daß in der Kunst die Restitution gelingen möchte des Zustandes vor der Zerstörung.«
ENTROPISCHE GRUNDLEGUNG DER NATURGESCHICHTE DER ZERSTÖRUNG Nichts vermag zu bleiben wie es ist. Kein Ding hat Bestand auf dieser Welt. Diese melancholische Einsicht erfaßt die Physik im Begriff der Entropie. Das Feuer wiederum, als Inbegriff von Wärme, kann als Hauptmotor der Entropie verstanden werden: Es verwandelt im Prozeß des Verbrennens das Feste ins Gasförmige, also in den Zustand der höchsten Unordnung der Moleküle. Wie wir heute wissen, wird, wenn auch in unausdenklicher Zeit, alle Existenz unabwendbar im Hitzetod unseres Universums enden.
208
6 Feuer
Das im Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik bestimmte Prinzip der Entropie erweist sich insofern als wissenschaftliche Basis der Naturgeschichte der Zerstörung, zumal ›Zerstörung‹ ja nur ein anderer Begriff ist für jene zunehmende ›Unordnung‹, welcher der Kosmos entgegenläuft. Was den Prozeß der Entropie singulär macht unter allen physikalischen Prozessen, ist seine Irreversibilität. Denn Wärme kann nur in eine Richtung wandern, die der Kälte, und nie andersherum. In den literaturkritischen Schriften Sebalds, so etwa im Kafka-Essay Tiere, Menschen, Maschinen, findet sich wiederholt der Hinweis auf »die prinzipielle Tendenz zur Entropie« in der Welt beziehungsweise den vorgegebenen Umstand »fortschreitender Entropie« aller Ordnung. Mit Blick auf Thomas Bernhard spricht Sebald davon, daß dessen frühen Texten ein geradezu autodestruktiver Impuls innewohne, ein »unabwendbar um sich greifender Fäulnis- und Zersetzungsprozeß«, dessen Fluchtpunkt »der endgültige Zustand ist, in dem es weder Form noch Hierarchie, noch irgendeine andere Art der Differenzierung mehr gibt, wo alle Phänomene des natürlichen Lebens gleichwertig werden in der Vollendung ihrer irreversiblen Degradation.« (BU 109) Diese Beschreibung darf und muß vor dem Hintergrund des gnostischen Denkens in Bernhards häretischer Theologie verstanden werden. Das Zitat erfaßt aber genauso treffend die Entropie als leitendes Prinzip der Naturgeschichte der Zerstörung. Wie Sebald eigens hervorhebt, resultiert der »mit erschreckender Konsequenz fortschreitende Verfallsprozeß der natürlichen Welt« (BU 107) in Phänomenen wie der Verwesung als einer der »ekelerregenden Begleiterscheinungen, die der Wärmetod des sich auflösenden Natursystems mit sich bringt.« (BU 109) Der Begriff des Wärmetods bezeichnet dabei den Endpunkt der stetigen Umwandlung gebundener in freie Energie, die am Ende des Universums dazu führt, daß sich ein thermodynamisches Äquilibrium einstellt.
Entropische Grundlegung der Naturgeschichte der Zerstörung
209
Jener Zustand ultimativer Stille und Ruhe mithin, den Bernhards Figuren als begehrenswert anstreben. Es erscheint mir daher lohnend, auf die kosmologischen Ausführungen zu sprechen zu kommen, die sich vereinzelt im Werk Sebalds finden. So bringt er in den Ringen des Saturn die Rede auf die Raumsonde Voyager, die im Namen der Menschheit eine Grußbotschaft des Generalsekretärs der Vereinten Nationen an außerirdische Intelligenzen sendet. Mit gehöriger Häme verschweigt er dessen Namen – natürlich handelt es sich um niemand anderen als den seine Nazi-Vergangenheit später verleugnenden Kriegsverbrecher Kurt Waldheim. In Austerlitz geht es einmal kurz um Kosmologisches, wobei die betreffende Passage auf das Korsika-Projekt zurückweist. Dort sind die Ausführungen deutlich länger und anschaulicher. Bleiben wir daher bei dieser Fassung: Der Erzähler unternimmt einen Nachtflug mit dem befreundeten Piloten Douglas, der ihm von der Entstehung neuer Himmelkörper berichtet: »Dort drüben, siebentausend Lichtjahre von uns entfernt im Sternbild der Schlange sind die Adlernebel.« (KP 169) Diese konstituieren »eine Region dichten interstellaren Gases, die vom ultravioletten Licht eines benachbarten Sterns aufgeheizt würden & dabei teilweise verdampften, genau so wie etwa bei uns die herbstlichen Frühnebel aufgezehrt werden von der zunehmenden Wärme des Tages. Wie drei riesige Finger treten die Ausläufer dieser Nebel hervor, die angeblich die Geburtsstätten oder Krippen neuer Sterne sind, wo das interstellare Gas unter seiner eigenen Schwerkraft sich zu Klumpen zusammenzieht & so den Prozeß der Sterngeburt einleitet.« (KP 169) Sebalds Ausweitung der Perspektive ins Kosmologische ist kohärent mit seiner Strategie, das Werden und Vergehen der Dinge und des Menschen von einem so distanzierten Standpunkt aus wie nur irgend möglich zu betrachten. Zugleich übernimmt er die Überzeugung der Frühromantiker, daß es keinen prinzipiellen Unter-
210
6 Feuer
schied zwischen Mikro- und Makrokosmos gibt. Ein Befund, den die neuere Physik immerhin bestätigt hat. Das Konzept der Naturgeschichte der Zerstörung liefert so eine umfassende Erzählung davon, wie der übergeordnete Gang der kosmischen Entwicklung – vermittelt über die Gesetze der Natur wie den Lauf der Geschichte – sich bis hin zum Individuum auswirkt. Ebenso will Sebald darauf hinaus, daß unsere verengte Perspektive es gar nicht erlaubt, die Welt, so wie sie wirklich ist, zu verstehen. »Von der Erde aus scheint die Sternenwelt leblos, strahlend kalt & außerhalb jeder Evolution«, so Douglas weiter, doch die Aufnahmen, die mit dem Hubble-Teleskop gemacht werden konnten, zeigen etwas anderes: »Diese Fotografien vermitteln uns zum erstenmal einen Einblick in die im Weltraum herrschende Dynamik. Wir wissen ja aus eigener Erfahrung nichts von dem dort draußen in einem sich umwälzenden & weiter entfaltenden Chaos.« (KP 169) Den naturwissenschaftlichen Blick auf die Welt gilt es nach meinem Dafürhalten unbedingt zum besseren Verständnis der Texte Sebalds zu berücksichtigen. So hat man ihm beispielsweise immer wieder ein (für problematisch erachtetes) Faible für das Apokalyptische unterstellt: das Thema des Feuers wird interpretiert als Inszenierung eines (untergangssüchtigen) Weltenbrands. Man denke nur ans Ende von Schwindel. Gefühle. mit der Traumvision des großen Feuers von London. Oder man nehme eine Stelle aus dem Korsika-Projekt, wo es heißt: »Die im Verlauf von Jahrmillionen von Wind, Salznebel und Regen aus dem Granit geschliffenen, dreihundert Meter aus der Tiefe emporragenden monströsen Felsformationen der Calanches leuchteten in feurigem Kupferrot, als stünde das Gestein selber in Flammen und glühe aus seinem Inneren heraus. Manchmal glaubte ich in dem Geflacker die Umrisse brennender Pflanzen und Tiere zu erkennen oder die eines zu einem großen Scheiterhaufen geschichteten Volkes. Sogar das Wasser drunten schien in Flammen zu stehen.« (CS 49)
Entropische Grundlegung der Naturgeschichte der Zerstörung
211
Bezieht man dann noch Sebalds Tendenz zum metaphysischen Denken mit ein, ist schnell der Verdachtsfall eines irrationalen politischen Denkens – wie es zumal die konservative Rechte in Deutschland zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts hervorgebracht hat – zusammengezimmert. Entsprechende Kritik seitens sich stets auf der richtigen politischen Seite verortender Professoren blieb nicht aus. Doch das ist Unfug. Selbstverständlich war Sebald ein konservativer Kulturpessimist. Aber das erscheint mir angesichts der modernen Zeitläufte als ohnehin einzig vertretbare intellektuelle Haltung, für die man sich nicht zu rechtfertigen braucht. Keineswegs war Sebald jedenfalls ein Befürworter der Götterdämmerung oder Prediger des Weltuntergangs in der Nachfolge Oswald Spenglers oder sonstiger Vordenker der konservativen Revolution. Genauso wenig übrigens sollte man ihm angesichts der apokalyptischen Bilder eine identifikatorische Beziehung zum Christentum unterstellen. Denn keineswegs ist seine pessimistische Geschichtsphilosophie auf irgendeine Weise einer religiös gerahmten Teleologie der Apokalypse verpflichtet: keine ambivalente Kopplung von Auslöschung und Wiedergeburt, Aufdeckung und Vernichtung, kataklystischer Bedrohung und millennialistischem Versprechen, menschlicher Sünde und göttlicher Vergebung. Vielmehr gilt es, sein chiliastisches Geschichtsdenken – um wieder beim Ausgangspunkt anzulangen – ausschließlich säkular, ja szientifisch zu begreifen: gleichsam als eine geschichtsphilosophische Ableitung der physikalischen Theorie der Thermodynamik. Dabei zählt weniger, daß Physiker sicherlich berechtigte Einwände erheben oder Fehlinterpretationen wissenschaftlicher Erkenntnisse auf Seiten von Sebald monieren dürften. Was zählt, ist seine produktive Reflexion solcher Phänomene wie der Entropie. So kommt er etwa in einem Vortrag, den er im Januar 1992 bei einem Tübinger Kolloquium gehalten hat, erneut auf das Prinzip der Entropie zu sprechen. Gewährsmann dafür war
212
6 Feuer
ein naturwissenschaftlicher Laie, nämlich der französische Hölderlin-Forscher Pierre Bertaux mit seiner Streitschrift Die Mutation der Menschheit, die im Original 1964 erschienen ist. Ausgehend von der wachsenden Herausbildung von Ballungsräumen in Europa – Sebald nennt als Beispiel die englischen Midlands und das Ruhrgebiet – stellt er fest, daß »eine zunehmende molekulare Verdichtung unserer Spezies« feststellbar sei. Aus dem zu diesem Zeitpunkt fast schon dreißig Jahre alten Buch von Bertaux übernimmt Sebald die These, daß das Parallelphänomen dazu die »Vorstellung einer Masse ist, deren Moleküle durch die Zufuhr von Energie in immer schnellere Bewegung versetzt werden (Mobilität ist ja das neue Zauberwort), bis sie schließlich in einen neuen Aggregatzustand übergehen.« Das Ergebnis sei die von Bertaux befürchtete ›Mutation der Menschheit‹, nämlich als entropischer Prozeß, hier vielsagenderweise unter dem neoliberalen Schlagwort der Mobilität gefaßt. Bedenkt man, daß Sebald die Auflösung traditioneller sozialer Strukturen durch die im neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert einsetzenden Migrationsbewegungen – die Auswanderung aus erst ökomischen Gründen, dann als Folge rassischer Verfolgung – als entscheidendes Signum der Moderne ansah, so wird langsam klar, wie grundlegend das ›Entropische‹ bei ihm verankert ist. Das Ausgeführte nun mag versuchsweise als Beweisführung zum Stichwort Entropie genügen; weitere Exempel ließen sich noch anfügen. Ob Sebald mit all dem tatsächlich Recht hat, ist eine andere Frage. Man braucht ja nur auf die Völkerwanderungsbewegungen des vierten Jahrhunderts verweisen. Doch solche Einsprüche disqualifizierten nicht die Berechtigung seines eigenwilligen Denkens (samt dessen literarischer Umsetzung). Mit dem Anspruch, die großen Rätsel der Menschheit letztgültig gelöst zu haben, ist Sebald ohnehin nie aufgetreten. Nichts hätte ihm ferner gelegen. (Selbst wenn der oftmals apodiktische Ton
Quantenmechanik & das Rätsel der Zeit
213
seiner polemischen Literaturkritik das tatsächlich nicht unbedingt nahelegt.) Was er also im Kontext seiner Thesen zu Luftkrieg und Literatur konzediert, gilt im selben Maße für sein restliches Schreiben und Denken: »Ich bin mir durchaus bewußt, daß meine unsystematischen Notizen der Komplexität des Gegenstands nicht gerecht werden, glaube aber, daß sie selbst in ihrer mangelhaften Form gewisse Einblicke eröffnen.« (LL 84)
QUANTENMECHANIK & DAS RÄTSEL DER ZEIT Und mit diesem tastenden, probierenden, tentativen Impetus scheint es mir hier, am Ende des thematischen Werkdurchgangs, angebracht zu sein, eine von Sebald beim Göttinger Gelehrten Lichtenberg entlehnte, wiederholt adaptierte Formulierung zu übernehmen: Ich möchte mein spekulatives Hauslineal anlegen, um Sebalds Überlegungen zur Entropie zu verlängern in den faszinierenden Bereich der Quantenphysik. Deren Erkenntnisse entziehen sich aller Alltagserfahrung. Insbesondere gilt dies für unsere Vorstellungen von der Zeit. Bereits mit der Relativitätstheorie hatte Einstein korrekt postuliert, daß die Zeit, abhängig von Bewegungsgeschwindigkeit und Ort, verschieden schnell vergehen kann, und so quasi Sebalds These von der ›Ungleichzeitigkeit der Zeit‹ (wenn natürlich in anderer Hinsicht) bestätigt. Doch schon die Vorstellung eines gekrümmten Raum-Zeit-Kontinuums übersteigt beinahe unser am Alltag geschultes Vorstellungsvermögen. Kreist doch beispielsweise die Erde nicht deshalb um die Sonne, weil diese, unserem Schulwissen gemäß, eine Anziehungskraft auf unseren Planeten ausübt – vielmehr biegt die immense Gravitation der Sonne den Raum um sich herum. Unser Planet ›kreist‹ nur deshalb, weil er sich geradlinig in einem gebogenen Raum bewegt.
214
6 Feuer
Wenn Sebald im Robert-Walser-Essay behauptet, er habe schließlich »begreifen gelernt, wie über den Raum und die Zeiten hinweg alles miteinander verbunden ist«, dann sollte man – auch wenn dies nicht als Umsetzung der Einsichten theoretischer Physik gemeint ist – es nicht allein in einem im poetischen Sinne nur wahren Zusammenhang auffassen, daß unter anderem das bereits erwähnte ›Echo eines Pistolenschusses über dem Wannsee mit dem Blick aus einem Fenster der Heilanstalt Herisau, das Glück mit dem Unglück, die Geschichte der Natur mit der unserer Industrie, die der Heimat mit der des Exils‹ tatsächlich in einer unserem Verstande unbegreiflichen Weise miteinander verbunden sind. Wir sind durch unsere begrenzte sensorische Ausstattung schlichtweg nicht in der Lage, die wirklichen Zusammenhänge der physikalischen Welt ›scharf‹ zu sehen. Sebald behauptet die reale Existenz von Verkettungen, weil er analogisch verknüpfte Gemeinsamkeiten erkennt. Oder anders formuliert: Er blickt ›unscharf‹ auf die Gesamtheit des Gegebenen, und genau deshalb vermag er zu sehen, was ansonsten unsichtbar bleibt. Unschärfe ist ebenso ein zentraler Begriff, wenn es um die Charakterisierung der Illustrationen in seinen Erzähltexten geht; deren Bildqualität hat er oftmals bewußt verschlechtert – etwa durch wiederholte Fotokopiervorgänge –, um den Effekt der Unschärfe hervorzurufen. Unschärfe, Verschwimmen, Verschattung werden insofern benutzt als Medium der Wahrheitsfindung, denn das Diffuse erfaßt manchmal mehr als der gezielte, fokussierte Blick. Dazu mag wiederum passen, daß die Quantenmechanik einen ursächlichen Konnex zwischen Zeit und Unschärfe herstellt. Der Quantenphysiker Carlo Rovelli schreibt: »Zeitlichkeit hängt zutiefst mit Unschärfe zusammen. Unschärfe ist die Tatsache, daß wir die mikroskopischen Einzelheiten der Welt nicht kennen. Die Zeit der Physik ist letztlich der Ausdruck unserer Unkenntnis der Welt.« Wie er weiters darlegt, existiert im subatomaren Raum der Quan-
Quantenmechanik & das Rätsel der Zeit
215
tenmechanik die für unsere Erfahrung so elementare Kategorie der Zeit eigentlich gar nicht. Dennoch gibt es sie. Die Zeit ›taucht auf‹. Nämlich als eine Funktion von Energie, genauer gesagt: als Resultat thermodynamischer Prozesse. Oder wissenschaftlich ausgedrückt: Unser Zeitempfinden ist eine Funktion von Entropie. Entropische Prozesse verlaufen stets, unumkehrbar, von einem Zustand höherer Ordnung in einen Zustand höherer Unordnung. Deswegen gilt, so erklärt Rovelli: »Nur wenn Wärme vorhanden ist, gibt es einen Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft. Das wesentliche Phänomen, das die Zukunft von der Vergangenheit unterscheidet, ist das Fließen der Wärme von warm nach kalt.« Darf man dies nun destillieren zu der Vermutung, daß die unter dem existentiellen Vorzeichen des Feuers stehende Kategorie der Leiblichkeit und die unter dem existentiellen Vorzeichen der Zeit stehende Kategorie der Vergänglichkeit des Lebens in einer engeren Verwandtschaftsbeziehung zueinander stehen, als man für gemeinhin glauben würde? Ich weiß es nicht. Unzweifelhaft ist jedenfalls, daß die reale Zeitstruktur des Universums stark vom naiven linearen Bild abweicht, das wir uns im Alltag von ihr machen. Wie komplex die Dinge wirklich im gekrümmten Raumzeitgefüge miteinander verfaltet sind, können wir kaum erahnen. Denn nicht einmal die avanciertesten Quantenphysiker verstehen es wirklich. Umso bestechender sind die Parallelen zwischen den Erkenntnissen der modernen Quantenphysik, etwa über die Existenz nebeneinander existierender Zeitschichten, und den Spekulationen Sebalds, die er in seinen Werken immer wieder anstellt. Nehmen wir beispielsweise Austerlitz: »Es scheint mir nicht, daß wir die Gesetze verstehen, unter denen sich die Wiederkunft der Vergangenheit vollzieht, doch ist es mir immer mehr, als gäbe es überhaupt keine Zeit, sondern nur verschiedene, nach einer höheren Stereometrie ineinander verschachtelte Räume« (A 269), so erläutert
216
6 Feuer
Austerlitz fast auf den Punkt genau die Einsicht der Quantenforscher, daß in der Tat mehrere, ja unendlich viele voneinander unabhängige Raumzeit-Felder existieren. Daher ist die entschiedene Kritik von Austerlitz an der Unzulänglichkeit der konventionellen, metaphorisch aufgeladenen Zeitvorstellungen wissenschaftlich korrekt: »Wenn Newton wirklich gemeint hat, die Zeit sei ein Strom wie die Themse, wo ist dann der Ursprung der Zeit und in welches Meer mündet sie endlich ein? Jeder Strom ist, wie wir wissen, notwendig zu beiden Seiten begrenzt. Was aber wären, so gesehen, die Ufer der Zeit?« (A 150) Was Austerlitz als eine irre beziehungsweise tröstende Hoffnung ausspricht, nämlich daß »sämtliche Zeitmomente gleichzeitig nebeneinander existieren« (A 152), steht durchaus im Einklang mit ähnlich gelagerten Hypothesen der Quantenphysik. Deshalb, und weil es auf der subatomaren Ebene der Elemen tarteilchen keinen linearen Ablauf der Zeit gibt, kann Austerlitz berechtigte Spekulationen über die Möglichkeit eines wechselseitigen ›Parteienverkehrs‹ zwischen den Lebendigen und den Toten anstellen, welche »je nachdem es ihnen zumute ist, hin und her gehen können, und je länger ich es bedenke, desto mehr kommt es mir vor, daß wir, die wir uns noch im Leben befinden, in den Augen der Toten irreale und nur manchmal, unter bestimmten Lichtverhältnissen und atmosphärischen Bedingungen sichtbar werdende Wesen sind.« (A 269) Erneut spielt die Unschärfe hier eine Rolle. Kein Wunder also, daß die Gespenster, von denen in Austerlitz wiederholt die Rede geht, nämlich durch den Schuster Evan, der im Ruf steht ein Geisterseher zu sein, als solche von unscharfer Gestalt beschrieben werden: »Wer ein Auge für sie habe, sagte Evan, der könne sie nicht selten bemerken. Auf den ersten Blick sähen sie aus wie normale Leute, aber wenn man sie genauer anschaute, verwischten sich ihre Gesichter oder flackerten ein wenig an den Rändern.« (A 83)
Quantenmechanik & das Rätsel der Zeit
217
Hören wir nochmals Carlo Rovelli: »Der Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft bezieht sich auf unsere unscharfe Sicht von der Welt.« Menschen wie der Schuster Evan oder der Schriftsteller Sebald blicken nur genauer, oder vielmehr: unscharfer auf die Welt. Und sehen deswegen mehr. Hören wir nochmals Sebald: »Der metaphysische Augen- und Überblick entspringt einer profunden Faszination, in welcher sich eine Zeitlang unser Verhältnis zur Welt verkehrt. Im Schauen spüren wir, wie die Dinge uns ansehn, verstehen, daß wir nicht da sind, um das Universum zu durchdringen, sondern um von ihm durchdrungen zu sein.« (UH 158) ›Konjektur‹ war eines seiner Lieblingswörter. Was uns als Weltsicht vorgegeben wird, hat Sebald zwar zur Kenntnis genommen; er hat es sich aber nicht nehmen lassen, gleichsam neugierig über den Tellerrand zu blicken. »Ich hatte einfach das Gefühl, daß es an der Grenze des absolut Nachweisbaren, wissenschaftlich Nachweisbaren, Dinge gibt, über die man sehr wohl spekulieren müßte« (G 147), erläuterte er eine wichtige Motivation dafür, mit dem Schreiben von Literatur zu beginnen.
7 Nachruhm
I
m Herbst 2016 erschien im renommierten Beck Verlag die aktualisierte Neuauflage einer Geschichte der deutschen Literatur. Deren Umschlagsillustration zeigt vier repräsentative Autorinnen und Autoren des zwanzigsten Jahrhunderts: An erster Stelle steht, naturgemäß, Thomas Mann (warum eigentlich nicht Brecht?); ihm zur Seite gestellt wird Ingeborg Bachmann; mit der Nobelpreisträgerin Herta Müller folgt wohl mehr aus Gründen der Genderparität denn literarischem Verdienst eine weitere Frau. Den Abschluß, und somit das Pendant zu Thomas Mann, bildet Sebald. Bei aller Willkür, die solche Selektionen stets auszeichnet, liefert die Umschlagillustration ein weiteres Indiz für seine immer weiter fortschreitende Kanonisierung. Der kometenhafte, bereits zu Lebzeiten einsetzende Aufstieg Sebalds zum international erfolgreichen Autor überraschte niemanden mehr als ihn selbst, und dies durchaus unangenehm. Nicht nur legte Sebald keinen gesteigerten Wert auf Ruhm, bezeichnete er sein Scheiben mir gegenüber oft geringschätzig als ›Gekritzel‹, ›Geschreibsel‹ oder mit vergleichbar abwertenden Ausdrücken. Über »die Fragwürdigkeit der Schriftstellerei überhaupt« (AW 339) hat er sich mehrfach geäußert, wobei ihm dieses Geschäft umso suspekter erschien, je mehr Erfolg er darin hatte. Im kollegialen Umfeld an der UEA versuchte Sebald seine schriftstellerische Tätigkeit möglichst lange herunterzuspielen. Mit
220
7 Nachruhm
Kollegen sprach er nur ungern über seine literarische Arbeit. Seine Zurückhaltung lag auch daran, daß einigen unter den englischsprachigen Kollegen, die sich ebenfalls als Schriftsteller betätigten – im Gegensatz zu Sebald – das Laster der Eitelkeit nicht fremd war. So etwa was den berühmten poet laureate betraf, den königlichen Hofdichter also, der den Lehrstuhl für Kreatives Schreiben von Malcolm Bradbury übernommen und sein Büro nur wenige Türen entfernt von Sebald hatte. Mit all dem jedenfalls hatte er nichts am Hut.
DURCHBRUCH IM ENGLISCHSPRACHIGEN RAUM Lang genug vermochte Sebald an der UEA unter dem Aufmerksamkeitsradar der Kollegen zu operieren, da seine Bücher auf Deutsch erschienen. Das änderte sich grundlegend, als die führende Buchhandelskette Waterstone’s die im Frühjahr 1996 erschienene Übersetzung von Die Ausgewanderten zum Book of the Month machte. Innerhalb weniger Wochen, so erklärte mir Sebald eher mit Verwunderung als Genugtuung, seien von The Emigrants mehr Exemplare verkauft worden, als von allen seinen bisher erschienenen deutschen Büchern zusammen. Susan Sontags so euphorische wie kurze Lobeshymne im Times Literary Supplement war dabei ein wichtiger Katalysator für den sofortigen Erfolg im englischsprachigen Raum. »The Emigrants is the most extraordinary, thrilling new book I’ve read this year ... indeed, for several years.« Ihre euphorische Eloge schloß mit den Worten: »I know of few books written in our time but this one which attains the sublime.« Das Brimborium, das man im englischsprachigen Raum um ihn und seine Bücher machte, schätze Sebald jedoch keineswegs. Angeblich soll er seine amerikanische Förderin Sontag, als sie im Rahmen einer Veranstaltung in London erstmals auf ihn traf, eine Absage
Durchbruch im englischsprachigen Raum
221
erteilt haben, als sie vorschlug, danach noch einen Kaffee mit ihr zu trinken. Sebald bestand darauf, den nächsten Zug zurück nach Norwich zu nehmen, und war davon auch nicht abzubringen, als Sontag ihn erneut dringlich bat, doch noch zu bleiben. Bereits im Juni 1998 folgte mit The Rings of Saturn ein weiteres herausragendes Buch, das englischsprachige Leser erneut durch die Verwendung der Illustrationen faszinierte. Dergleichen war in der von Sebald gehandhabten Weise in der englischsprachigen Literatur eher unüblich, was zusätzlich zu seinem Nimbus als Ausnahmeschriftsteller beitrug. Schnell war ein Punkt erreicht, an dem ein derart angesehener Autor wie Michael Ondaatje erklären konnte, Sebald sei »the most interesting and ambitious writer working in Britain today«, während der kaum weniger berühmte Paul Auster ihn lobte als »one of the most original voices to have come from Europe in recent years«. Gabriel Josopovici schrieb in seiner Rezension von The Emigrants: »It is not every day one is sent a masterpiece to review (I suppose one is lucky if it happens more than once or twice a lifetime).« Allenthalben im britischen Kulturbetrieb schwärmte man ähnlich enthusiastisch von Sebald. Der auf deutsche Geschichte spezialisierte Historiker Antony Beevor nannte ihn »probably the great est intellect and voice of the late 20th century.« Im Zentralorgan der britischen Intellektuellen, dem Times Literary Supplement (TLS), galt er als »the most significant European writer to have emerged in the last decade.« Von dergleichen Lobpreisungen konnten seine das literarische Schreiben an der UEA unterrichtenden Kollegen nur träumen. Sie galten als so etwas wie das Zentrum der literarischen intelligentsia in England. Doch dann war innerhalb kürzester Zeit der stille, unscheinbare Deutsch-Professor gleichsam aus seiner selbstgewählten Versenkung an ihnen vorbei bis an die Spitze des englischsprachigen Literaturmarkts geschossen.
222
7 Nachruhm
Als Indiz für den endgültigen Durchbruch im britischen Literaturbetrieb zu benennen wäre vermutlich die Parodie von Craig Brown, der Ende 1998 im Satiremagazin Private Eye vorführte – übrigens zur Erheiterung des Karikierten – wie leicht der ›SebaldSound‹ zu imitieren ist. Dazu persiflierte er den sommerlichen Kauf einer Eiscreme am Strand: »The sky loomed over me like a bright blue package containing heavy objects about to fall on the world from a great height. ›Strawberry or orange, mate?‹ said the man. I asked for an ice-lolly and now the salesman in the van was cross-questioning me as to my exact meaning. It was then that I remembered that orange is the colour of the robes that adorn the corpses of women in Delhi who have died hideous deaths, a haunting and melancholy detail I have never been able to shed from my memory when ordering a lolly. ›Orange, please‹, I said mournfully.« Der amerikanische Literaturbetrieb wiederum bejubelte und vergötterte Sebald vor allem in der End- und Nachphase seines Lebens. Der Vorabdruck eines Kapitels aus Austerlitz erschien unmittelbar vor der Publikation des Romans im New Yorker und erreichte weit über eine Million hochgebildete Leser, was eine wichtige Grundlage für den Verkaufserfolg des Buches in den USA legte, zumal man es als sein literarisches Vermächtnis verstand. Der Zuspruch war so groß, daß die Zeitschrift später ebenso einen langen Auszug aus der posthum erschienenen Übersetzung von Luftkrieg und Literatur brachte, wodurch Sebald erneut flächendeckend eine intellektuelle Leserschaft erreichte, unter der sich nun auch viele historisch Interessierte fanden. Ausgerechnet jenes Buch also, das ihm in Deutschland erhebliche Anfeindung, erbitterten Widerspruch und hämische Abqualifikation eingebracht hatte. In Amerika erwies es sich als zentraler Faktor für Sebalds Kanonisierung als bedeutendster deutscher Schriftsteller und Intellektueller. Günter Grass beispielsweise, dessen Im Krebsgang nahezu zeitgleich in Übersetzung erschienen war, kam nicht mehr an gegen den Nimbus, den man Sebald zuschrieb.
Kampf um Anerkennung in Deutschland
223
KAMPF UM ANERKENNUNG IN DEUTSCHLAND Dem sofortigen Ruhm in der englischen Wahlheimat kontrastierte der über viele, lange, ermüdende Jahre geführte Kampf um Veröffentlichungsmöglichkeiten in der vormaligen deutschen Heimat. Verlage, Zeitschriften und Zeitungen waren nur in den wenigsten Fällen bereit zu drucken, was Sebald ihnen einschickte – mal war es zu lang, dann wieder zu kontrovers oder nicht interessant genug. Man sollte einmal aus den vielen Ablehnungsschreiben, damit sie Sebald nicht umsonst aufbewahrt hat, einen Sammelband oder noch besser eine Ausstellung zusammenstellen. Allein um die Publikation seines ersten Essaybandes über die österreichische Literatur zu erreichen, ist er – ähnlich wie zuvor im Fall der Dissertation über Döblin – ganze sechs Jahre von Verlag zu Verlag hausieren gegangen. Es hagelte Absage auf Absage. Flankierend, so dokumentiert der Nachlaß, bemühte er sich um Empfehlungsschreiben oder Vermittlung an Verlage durch Personen, die Einfluß im Kulturbetrieb hatten. Doch alles vergebens. Sebald hielt einfach durch, bis sich schlußendlich ein Verlag bereit fand. Keinen Deut besser lief es bei seinem ›kreativen Schreiben‹. Die erste literarische Publikation Nach der Natur wurde von den Verlagen, die sich rund ein Jahrzehnt später um ihn rissen, durchweg abgelehnt. Eine Journalistin zumindest erkannte sofort die literarische Qualität der Prosalyrik und empfahl sie dem befreundeten Schriftsteller Christoph Ransmayr, der dann die Publikation im kleinen Greno Verlag vermittelte, wo das Buch, unbeachtet vom deutschen Literaturbetrieb, dann schließlich erschien. Auch an die bezeichnende Farce um seinen Auftritt beim Bachmann-Wettbewerb des Jahres 1990 kann nicht oft genug erinnert werden: Dort las er aus der Paul Bereyter-Erzählung vor. Jenem wundervollen Text also über seinen durch Suizid verstorbenen Volksschullehrer, der in den Erzählungsband Die Ausgewanderten einging,
224
7 Nachruhm
dessen englische Übersetzung für den sofortigen internationalen Durchbruch sorgte. Aus Klagenfurt aber kehrte Sebald ohne auch nur einen einzigen der sechs dort vergebenen Preise wieder heim. Daniel Kehlmann hat in einer kleinen Polemik die eminente Fehlleistung der Jury als Skandal gebrandmarkt: »Der Ernstfall, einen Autor von weltliterarischem Rang ganz ohne Stützung durch eine schon etablierte Wertordnung beurteilen und sich selbst danach an diesem Urteil messen lassen zu müssen, blieb der Jury Jahr für Jahr erspart. Außer eben im Jahr 1990: Thomas Mann, Franz Kafka und Joseph Roth waren nicht in Klagenfurt, Sebald aber schon. Eine Herausforderung, vor der der Literaturbetrieb auf ganzer Linie versagte. Um danach zu tun, was er mit seinen Irrtümern eben immer tut: nämlich alles zu vergessen.« Ganz ohne Preise ging es dann für Sebald aber doch nicht ab. Neben dem Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln (1997), dem Joseph Breitbach-Preis (2000) und dem Heine-Preis der Stadt Düsseldorf (2000) erhielt Sebald noch ein paar kleinere Auszeichnungen. Er machte unter Freunden und Kollegen jeweils kein großes Aufheben darum, sondern teilte nur kurz mit, er müsse leider nach Deutschland verreisen. Mir gegenüber klagte er darüber, sich sein Geld bei literaturfernen Sparkassendirektoren oder anderen Funktionären abholen zu müssen. Auf den Fotos der Verleihungszeremonien sieht man ihm sein Unwohlsein deutlich genug an. Eine Anekdote erscheint mir besonders kennzeichnend für sein uneitles, ja geradezu gleichgültiges Verhältnis zu derlei Dekorationen: 1994 wurde Sebald an der Seite von sechs weiteren Autoren der Berliner Literaturpreis zuerkannt, weshalb er danach zu einem Wettlesen unter den Preisträgern um die höhere Ehre der nur zweifach vergebenen Johannes-Bobrowski-Medaille antreten mußte. Auch diesen Wettbewerb gewann er, nachdem er einen Auszug aus Die Ringe des Saturn vorgelesen hatte. Ein doppelter Erfolg also. Allerdings kein ungetrübter: Die Berliner Lokalpresse verortete Sebald allenfalls in einem literarischen
Sebalds englische Kritiker
225
Mittelfeld. Das ›Werkstattgespräch‹, bei dem sich die Autoren gegenseitig der Kritik unterziehen sollten, wie die anderen Modalitäten des Literaturpreises, waren ein Graus für ihn. Dessen mißglückte Konzeption und Vergabe wurde auch allenthalben in der Presse kritisiert. Relativ einhellig herrschte dabei die Überzeugung, daß Sebald den Preis nicht wirklich verdient habe; eine Meinung, der sich selbst der Sprecher der Jury, Reinhard Baumgart, anschloß. Folglich verbuchte Sebald die Fahrt nach Berlin nicht unbedingt als Positivum. Wie er mir bei seiner Rückkehr breit grinsend erzählte, habe er die Medaille, die mit ihren fast vier Kilogramm Gewicht sein Reisegepäck unnötig belastet hätte, daher kurz und schmerzlos bei Kleists Grab am Kleinen Wannsee ins Wasser geworfen, um sich ihrer so zu entledigen.
SEBALDS ENGLISCHE KRITIKER Spätestens ab der Klagenfurter Farce wußte Sebald, was er vom deutschsprachigen Literaturbetrieb zu erwarten hatte. Hinzu kam, daß eine Galionsfigur wie Reich-Ranicki im Literarischen Quartett vom Januar 1993 durch seine ablehnende Haltung zur ›Germanistenprosa‹ das ganze Ausmaß seines literarischen Unverstandes demonstrierte. Von Sprachkraft, so dekretierte er, sei bei Sebald »überhaupt nichts vorhanden« und zur Verwendung der Fotos fiel ihm nur ein, in das ignorante Negativurteil von Barbara Sichtermann einzustimmen: »Ja, das ist furchtbar! Das ist so absurd.« Es war mithin eine schizophrene Situation in den neunziger Jahren: Während Sebald in den englischsprachigen Ländern sowie dank der rasant zunehmenden Zahl von Übersetzungen auch außerhalb dieser quasi über Nacht zum Literaturstar aufgestiegen war, begegneten ihm weite Teile der deutschen Literaturszene sowie die Germanistik mit hartnäckigen Vorbehalten, Mißtrauen und Ablehnung.
226
7 Nachruhm
Das lag insbesondere an Sebalds literaturkritischen Interventionen in deren Verklärungsgeschäft von kompromittierten Autoren wie Alfred Andersch oder seinem Generalangriff gegen die Nachkriegsliteratur in Luftkrieg und Literatur. Seine Polemiken empörten nicht nur viele Germanisten, Kritiker und Publizisten. Ebenso waren einflußreiche Autoren wie Günter Grass oder Uwe Timm gegen Sebald eingestellt. Hier kann allerdings nicht der Ort sein, die Zusammenhänge dieser Rezeptionsgeschichte aufzudröseln, nicht zuletzt da ich dies bereits an anderem Orte getan habe. Interessanter erscheint mir, stattdessen ausführlicher auf die englischsprachigen Kritiker Sebalds zu blicken. Zumal deshalb, weil ihnen die Außenseiterrolle zufällt, der innerhalb des englischsprachigen Literaturbetriebs herrschenden Konsensmeinung über die literarische Genialität Sebalds zu widersprechen. Das wiederum ordnet sie in die widerständige Position ein, die Sebald innerhalb der Germanistik selbst gerne einnahm, wenn er gegen zeitweilig hochgepuschte Autoren wie Carl Sternheim, anerkannte Größen der Literaturgeschichte wie Döblin oder Werke sakrosankter Schriftsteller wie Jurek Becker opponierte. Aus britischer Perspektive lagen die Dinge jedoch ganz anders. Sebalds ketzerische Einmischungen ins Geschäft der Germanistik spielten hier keine Rolle, sondern waren aufgrund der fehlenden Übersetzungen vieler seiner literaturkritischen Werke ohnehin unbekannt. Für die Briten stellte sich eine ganz andere Frage: Wie sollten sie umgehen mit einem deutschen Dozenten aus einer Provinzuniversität, die nicht zum Exzellenznetzwerk der sogenannten ›Russell Group‹ gehörte; einem Deutschen, der nichts mit dem old-boy network der Akademiker aus dem Elitedreieck Oxford – Cambridge – London zu tun hatte und sich zudem weigerte, auf Englisch zu schreiben? Beginnen wir diese kleine Rundschau vielleicht mit Ferdinand Mount. Er ist Kolumnist des konservativen Magazins Spectator, war über ein Jahrzehnt lang Herausgeber des TLS und gehört als
Sebalds englische Kritiker
227
Baronet in dritter Generation zum niederen britischen Adel. Sir Ferdinand also durchlief eine mustergültige Oberklassenerziehung, die ihn von der exklusiven Privatschule Eton ins Christ Church College in Oxford führte und von da geradlinig zur ›Number 10 Policy Unit‹, einer Beratergruppe des Premierministers für politische Strategiebildung. Als deren Leiter unterstützte er Margaret Thatcher an prominenter Stelle beim neoliberalen Umbau von Großbritannien. Da seine Tochter in den neunziger Jahren an der UEA studierte, war er öfters an der Universität anzutreffen. Aufgrund seiner langjährigen Herausgeberschaft der TLS galt er als bedeutender ›Multiplikator‹ im Literaturbetrieb und kannte Malcolm Bradbury und Lorna Sage, die beiden bekanntesten schreibenden Dozenten der englischen Abteilung. Sebald selbst schien er nur aus den Erzählungen von dessen UEA-Kollegen zu kennen, wie indirekt aus seinem 2005 im Spectator erschienenen Artikel A Master Shrouded By Mist hervorgeht. Darin rezensiert Sir Ferdinand, der im übrigen selbst als Verfasser einiger Romane hervorgetreten ist, vordergründig Campo Santo, begreift den Nachlaßband aber als rundum charakteristisch für die Sebald als grundlegende attestierten literarischen Schwächen. Entsprechend zeigt er sich also wenig begeistert von den Prosastücken des Korsika-Projekts: »Something worrying does begin to show through their thin, unvarnished texture. And that something is banality.« Das betrifft insbesondere Sebalds Reflexionen: »Now this might simply be Sebald on an off-day. Such thoughts are liable to swim into one’s head on a hot Corsican afternoon, not to be recognised, then or alas later, as thoughts that other people have thought roughly a million times before. In his political and psychological reflections one cannot help feeling that Sebald is doing little more than recycling (with due acknowledgement) the earlier insights of others, without adding much of his own.«
228
7 Nachruhm
Überhaupt vermag sich Sir Ferdinand grundsätzlich nicht mit dem offen autobiografischen Ton von Sebald anfreunden, den er mit einem bizarren Vergleich zu kennzeichnen versucht: »Sebald’s wanderings sometimes exude, to me at least, a curious off-putting tang, rather like a whiff of disinfectant blowing into a concert hall.« Sebalds fadenscheinige Methode in allen seinen Büchern entlarvt der Kritiker dann am Ende. Der Trick, so glaubt Sir Ferdinand, sei Sebalds »tone, a wistful, misty strangeness which covers the most familiar objects in an alluring fog, making them seem alien, unsettling und unsettled, pregnant with melancholy and memory. Through the mist one seems to see a prophetic figure engaged on some mysterious and significant mission. But when the mist clears one only sees an elderly gentleman with a moustache poking at the brambles with his walking stick.« Ich möchte diese Einschätzungen nicht im Detail abwägen. Allein schon, daß Auszüge aus dem Korsika-Projekt als repräsentativ für das ganze Werk Sebalds behandelt werden, ist angesichts von dessen Nachlaßcharakter unsauber genug. Allerdings wurde durchaus eine (freilich erst aus der Frequenz der Verwendung resultierende) Schwäche von Sebald recht genau erfaßt. Das gilt auch für die kritischen Worte, die der Verriß für Austerlitz übrighat. Was mich aber viel mehr reizt an der Rezension von Sir Ferdinand, wäre eine eher generelle Vermutung zu wagen, warum ihm Sebald insgesamt offenkundig nicht ganz geheuer ist. Ansetzen möchte ich daher beim Befund, es handele sich bei Sebald um »a German who had lived almost all his adult life in England without becoming in the least English.« Genau dies nämlich ist aus Perspektive eines paradigmatischen Vertreters des konservativen establishments die Kardinalsünde Sebalds. Hier dringt ein Außenseiter in den britischen Kulturbetrieb ein, dessen Pfründe die Oberklasse vornehmlich unter sich selbst aufteilt, seien es die einflußreichsten Posten in den Londoner Medien oder die Professuren an den besseren Universitäten. Wer da von außen kommend mitspielen will, wird
Sebalds englische Kritiker
229
durchaus zugelassen, um den meritokratischen Schein zu wahren, muß sich aber anpassen. Was nicht gerade eine Stärke Sebalds war. Auf kritische Stimmen stieß Sebald auch unter den Granden der englischen Literatur, Alan Bennett beispielsweise, der Anfang 2003 in seinem regelmäßig in der London Review of Books erscheinenden Diary notierte: »I persevere with Sebald but the contrivance of it, particularly his unpeopling of the landscape never fails to irritate … Once noticed Sebald’s technique seems almost comic. The fact is, in Sebald nobody is ever about. This may be poetic but it seems to me a short cut to significance.« Womit Bennett völlig recht hatte. Menschenleer ist nicht nur die Geisterstation, durch welche die Londoner U-Bahn in Schwindel. Gefühle. fährt, sondern ebenso sind es die verlassenen Wohnviertel in Manchester, durch die der Erzähler der Ausgewanderten streift oder das desolate Gelände von Orford Ness in Die Ringe des Saturn. Worauf Bennett sich aber hier wohl bezieht, ist die Schilderung der unheimlichen Leere, die der Erzähler von Austerlitz bei seinem Besuch in Terezín, also dem ehemaligen Ghetto Theresienstadt, vorfindet: »Das Auffälligste und mir bis heute Unbegreifliche an diesem Ort war seine Leere.« (A 274) Mit dieser Kritik hatte Bennett seinen Finger auf eine wunde Stelle von Austerlitz gelegt, nämlich die Vielzahl von Wiederholungen bewährter Erzählkniffe, derer sich Sebald auf der unvertrauten Langstrecke bedienen mußte, um eine Romanhandlung zu füllen. Aber auch jüngere Autoren als Bennett haben Kritik angemeldet. Besonders hervorzuheben wäre der 1978 geborene Adam Thirlwell. In seinem polemischen Essay Kitsch and WG Sebald aus dem Jahr 2003 ähnelt er ganz dem kämpferischen Junggermanisten Sebald, der vehement gegen die Hausgötter und Verweser der deutschen Literaturwissenschaft anrennt. Und wie dieser in seinen Attacken, schießt Thirlwell mit der These, daß Sebalds Werke der reine Kitsch seien, weit übers Ziel hinaus, berührt dabei aber immer wieder bedenkenswerte Punkte.
230
7 Nachruhm
Thirlwell stört sich beispielsweise am tiefen Geschichtspessimismus wie an dem Verständnis von Leben als Qual und der markanten Präsenz von Verzweiflung in Sebalds Werk. All dies schmäht er als Kitsch, was natürlich kaum stimmt, ihm als persönliche Meinung aber unbenommen sei. Seine Einschätzung läßt sich ohnehin leicht dadurch erklären, daß der Jungspund Thirlwell als privilegierter Sprößling der britischen Oberschicht, der nach einer teuren Londoner Privatschule problemlos zum Studium nach Oxford wechseln konnte, verständlicherweise eine eher positive Lebenseinstellung besitzt. Bestimmt doch, einem geflügelten Worte zufolge, das Sein das Bewußtsein. Wo Thirlwell allerdings völlig richtig liegt, ist beispielweise beim erkennbaren Problem der Überleitungen: »Kitsch cannot link paragraphs«, dekretiert er apodiktisch, kann aber tatsächlich zeigen, wie unelegant Sebald in Austerlitz öfters vorgeht. Ebenso treffend ist seine Diagnose, daß Sebald auf allzu billige literarische Weise die dramaturgisch notwendigen Wiederbegegnungen zwischen dem Erzähler und der Titelfigur als sinnhafte Zufälle verkauft. So liefert Sebalds Erzähler eine Steilvorlage für Thirlwell, wenn er etwa raunt: »Wenn auch Austerlitz an jenem Junimorgen des Jahres 1967, an dem ich schließlich nach Breendonk hinausgefahren bin, auf dem Antwerpener Handschuhmarkt nicht mehr sich eingefunden hat, so überkreuzten sich unsere Wege doch auf eine mir bis heute unbegreifliche Weise fast auf einer jeden meiner damaligen Exkursionen.« (A 44) Hier kann Thirlwell kommentieren: »But is not hard to understand, the paths of the narrator and Austerlitz keep crossing because this is a novel. They are both characters invented by WG Sebald. The least talented option to make such meetings look like chance is to write an unrealistic plot, in which events occur too conveniently, and then let the narrator be amazed at the luck of it, the coincidence of it. Unfortunately, that is what WG Sebald does.«
Einspruch gegen Austerlitz
231
EINSPRUCH GEGEN AUSTERLITZ Ja, d’accord. Allerdings thematisiert Thirlwell nie, daß nahezu alle Negativbeispiele seiner mehr als zwanzigseitigen Polemik dem letzten Prosabuch Sebalds entnommen sind. Sein Generalangriff ist eigentlich eine ödipal eingefärbte Kritik am gerade in der englischsprachigen Welt über alle Gebühr gelobten Austerlitz. Das aber ist symptomatisch für das falsche Bild, das vielerorts in Germanistik, Literaturkritik und der lesenden Öffentlichkeit von Sebald gezeichnet wird. Wenn man den Nachruhm Sebalds auf ein Wort reduzieren sollte, so müßte man ›Austerlitz‹ sagen. Gegen die affirmative Fehleinschätzung von Austerlitz muß un bedingt Einspruch erhoben werden. Zuvor, in seinen Prosabüchern, hatte Sebald meist stark autobiografisch gearbeitet und im Genre der Erzählung. Auch Die Ringe des Saturn und wohl ebenso das Korsika-Projekt waren konzipiert als Addition einzelner Kapitel, zusammengehalten durch eine der Person Sebalds erkennbar nahe Erzählinstanz. Bei Austerlitz jedoch war die ganze Anlage des Textes anders gelagert und das Zurücktreten der Erzählfigur sorgte für eine reduzierte Konsistenz. Das war Sebald selber klar: »The narrator does figure in a very abstract sort of way, which is one of the difficulties I had with it« (CB 158), konzedierte er bereitwillig. Offen muß die Frage bleiben, inwieweit Sebald sich selbst unter Druck gesetzt hat, einen Roman zu schreiben, oder inwieweit Verlag und Agent ihn womöglich dazu ermunterten, ein Buch zu publizieren, das in Form wie Inhalt eher den Erwartungen und Vermarktungskriterien des Literaturmarkts entspricht. Geschrieben in einer schwierigen Lebensphase und als ein Befreiungsversuch aus der Schreibkrise nach dem Scheitern des Korsika-Projekts, versucht Austerlitz, grundsätzlich gesagt, in thematischer Hinsicht die ›Neuauflage‹ eines bewährten Rezepts, nämlich von Die Ausgewanderten als erstem internationalen Erfolg.
232
7 Nachruhm
Problematisch am Roman ist auch die allzu starke Abhängigkeit der Austerlitz-Figur vom Lebensweg der im April 2018 verstorbenen Susi Bechhöfer. Die unehelich geborene Tochter einer Münchner Jüdin und eines Wehrmachtssoldaten konnte zwar samt ihrer Zwillingsschwester dank eines Kindertransports der Ermordung durch die Nazis entkommen. Die beiden Mädchen landeten aber unglücklicherweise in einem walisischen Predigerhaushalt, wo sie eine sehr harte Kindheit und eine von sexuellem wie seelischem Mißbrauch geprägte Jugend verbrachten. Daß Sebald sich zur Konzeption der Austerlitz-Figur bei zentralen Aspekten der Biografie von Bechhöfer bediente, welche diese in ihrer 1996 erschienenen Autobiografie Rosa’s Child öffentlich gemacht hatte, scheint mir literarisch durchaus erlaubt. Berechtigt aber war die Empörung von Bechhöfer dennoch, die sich überdeutlich im Protagonisten des Romans wiedererkannte und daher um einen Hinweis auf ihre Lebensgeschichte als wesentlichste Vorlage des Romans bat. Zwar standen Sebald und Bechhöfer in brieflichem Kontakt miteinander, in dem er ihr darlegte, mit welcher Absicht er Elemente ihrer Biografie in den Roman übernommen hat. Sein überraschender Tod aber verhinderte bedauerlicherweise, daß er auch öffentlich die Rolle, die Bechhöfers Lebens- und Leidensgeschichte für Austerlitz spielt, würdigen konnte. Stattdessen bleiben nun nur die Interviewaussagen, in denen Sebald sich absichtlich unbestimmt über die Verschmelzung mehrerer ihm bekannter Biografien äußert. »That particular story is based on two and a half real-life stories that I became acquainted with« (CB 162), erklärte er beispielsweise. Und tatsächlich kann man einzelne Aspekte der Biografien von Ludwig Wittgenstein, Saul Friedländer, Franz Wurm und einem Kollegen aus der UEA in der Figur von Austerlitz identifizieren. Allerdings nur in isolierten, punktuellen Details. Keine biografische Vorlage aber ist so markant wiederkennbar wie die von Bechhöfer. Es ist primär ihre Geschichte, die im Roman erzählt wird.
Einspruch gegen Austerlitz
233
Doch die bisher skizzierten Probleme, literarischen Schwachstellen und kritischen Erwägungen halten weder die breite Leserschaft noch die akademischen Textdeuter davon ab, Austerlitz für das bedeutsamste Werk von Sebald zu halten und den Roman zu einem Kultbuch zu hypostasieren. Exemplarisch verdichtet sich das im Glauben, das eindringliche, für nicht wenige Leser als Kauf anreiz dienende Foto des kostümierten Knaben auf dem Umschlag stelle tatsächlich das kindliche Vorbild von Austerlitz dar. Doch das ist genauso ein von Sebald instigierter Mythos wie die Existenz des vermeintlichen Londoner Kollegen selbst, der als Modell gedient haben soll. Manche englischsprachigen Rezensenten hielten das Bild sogar für eine Aufnahme des jungen Sebald – so stark scheint der Wunsch zu sein, den Knaben aus seiner Anonymität zu befreien. Doch die Wahrheit ist, daß wir seine Identität nie erfahren werden. Sebald hat die Postkarte bei einem englischen Trödelhändler gekauft: »Stockport 30p« steht auf der Rückseite der Karte. Wundern darf man sich nicht zuletzt über die Insistenz, mit der sich die Germanistik unverändert und mit offenbar nicht erlahmendem Elan auf den Roman stürzt. Gibt man die Suchworte ›Sebald‹ und ›Austerlitz‹ in eine bibliografische Suchmaschine ein, spuckt diese mehr als zehntausend Treffer in über dreißig Sprachen aus. (Eine analoge Suche mit den Begriffen ›Grass‹ und ›Blechtrommel‹ ergibt übrigens nur knapp über viertausend Treffer.) Nun ist eigentlich kaum erstaunlich, daß gerade das konventionellste aller Bücher Sebalds die potentiell größte Leserschaft erreicht. Es entschuldigt freilich nicht die Blindheit der Germanistik gegenüber den offen zutage liegenden literarischen Schwächen Sebalds, als er sich auf die von ihm noch nicht wirklich beherrschte Form des Romans eingelassen hat. Anstatt sich an Themen wie Erinnerung, Trauma und Holocaust zu erregen, müßte die Literaturwissenschaft, würde sie wirklich objektiv vorgehen, vielmehr die Negativa mit den Stärken des Romans verrechnen.
234
7 Nachruhm
Denn natürlich ist Austerlitz immer noch ein hervorragendes Buch, hält man es gegen die allermeisten Erzeugnisse der Gegenwartsliteratur. Mißt man es hingegen an Sebalds eigenem Anspruch als Erzähler, den er im Gefolge von Die Ausgewanderten formuliert hat, vermag es nicht unbedingt zu bestehen: »Ich habe einen Horror vor allen billigen Formen der Fiktionalisierung. Mein Medium ist die Prosa, nicht der Roman.« (G 85) Im Interview mit dem Spiegel versuchte Sebald Austerlitz als »ein Prosabuch unbestimmter Art« (G 199) zu verkaufen, was insofern recht erfolgreich war, als man diese Klassifizierung allenthalben unkritisch übernahm. Irgendwie als Kommentar zur Problematik von Austerlitz kommt mir daher dieses Zitat aus Die Ringe des Saturn in den Sinn: »Vielleicht verliert ein jeder von uns den Überblick genau in dem Maß, in dem er fortbaut am eigenen Werk, und vielleicht neigen wir aus diesem Grund dazu, die zunehmende Komplexität unserer Geisteskonstruktionen zu verwechseln mit einem Fortschritt an Erkenntnis.« (RS 217) Selbstkritisch schrieb Sebald im Juni 2000 in einem Brief an seine Übersetzerin Anthea Bell: »I fear I still have grave doubts about the book.« Zu bedenken, was Austerlitz betrifft, gilt es gleichermaßen, daß der immense Erfolg, den die Doppelpublikation des Romans auf Deutsch im Frühjahr und auf Englisch im Herbst 2001 auslöste, verantwortlich gewesen sein mag für seinen vorzeitigen Tod. In den zwölf Monaten vor seiner Herzattacke war Sebalds Termin kalender übervoll mit Verpflichtungen aller Art, die eine kaum geringe Streßbelastung ausgelöst haben werden. Anfang Februar 2001 reist er nach Berlin, um an einer viertägigen Übersetzerkonferenz teilzunehmen; sowohl im Februar wie im Oktober fliegt er für insgesamt drei Wochen nach Amerika, um dort hausieren zu gehen für Austerlitz. Hinzu kommt noch eine Lesetournee durch Österreich, Süddeutschland und die Schweiz im April; in London absolviert er Auftritte und Lesungen im April, September, Oktober, November und Dezember. Und zwischen all
Das unvollendete Weltkriegs-Projekt
235
diesen Terminen gibt Sebald noch deutschen, österreichischen, britischen, amerikanischen, niederländischen und belgischen Journalisten und Literaturkritikern Interviews. Vielleicht war all das zuviel.
DAS UNVOLLENDETE WELTKRIEGS-PROJEKT Durch seinen Tod konnte das Nachfolgewerk zu Austerlitz, an dem Sebald bereits gearbeitet hatte, nicht mehr geschrieben werden. Was davon existiert, liegt im Marbacher Nachlaß, ist aber aus Persönlichkeitsgründen bis auf weiteres gesperrt. Soweit bekannt, sollte in dem sogenannten Weltkriegs-Projekt schwerpunktmäßig der Zeitraum von 1900 bis 1950 behandelt werden, das heißt neben den beiden Weltkriegen auch die ersten sechs Lebensjahre Sebalds. In seinem Stipendienantrag an den NESTA faßte er die Ausrichtung des Buches so zusammen: »Several of my forebears will pass review. The éducation sentimentale, under the fascist régime, of the social class to which my parents belonged will be another prominent topic, as will my father’s progress during the war and the postwar years which were the years of my childhood. I should point out that the form this will take is not that of (auto)biography; it will be more like the semi-documentary prose fiction for which I have become known. Accounts of the process of research will also be included as integral parts of the narrative.« (SM 258/59) Mit dem Weltkriegs-Projekt wäre Sebald wieder zurückgekehrt zu einem an der eigenen Familien- und Lebensgeschichte orientierten Erzählen, das durch einen fiktionalen Anteil ergänzt wird. Damit wäre der Zwang entfallen, das zu Erzählende in das Korsett einer Romanhandlung zu zwängen wie bei Austerlitz. Interessant wäre insbesondere gewesen, wie Sebald den Werdegang seines Vaters geschildert hätte. Georg Sebald nämlich ist sicherlich differenzierter zu bewerten, als sein Sohn es in den literarischen Veröffentlichungen getan hat.
236
7 Nachruhm
Wie aus einem Nachruf des renommierten Historiker Richard Evans hervorgeht, der Sebald bei seinen Recherchen unterstützte, sollten im Projekt zwei Frauen eine prominente Rolle spielen, die Sebald aus dem Allgäu kannte. Diese authentischen Vorbilder hätte er dann in eine oder zwei fiktive Figuren verwandelt, wie Evans verrät. Damit hätte es erstmals bei Sebald eine bedeutsame weibliche Protagonistin gegeben, und womöglich sogar zwei. Eine Neuerung wäre ebenso die kompositorische Anlage als deutsch-französische Parallelgeschichte gewesen. Wohl um mit den Mitteln der Literatur der Frage auf die Spur zu kommen, warum die historische Entwicklung in Deutschland zur Komplettkatastrophe des Nationalsozialismus geführt hat, die Geschichte im Nachbarland aber etwas anders verlaufen ist. Als Materialgrundlage dazu wollte Sebald die Tagebücher des Großvaters einer französischen Freundin nutzen. Dieser hat über Jahrzehnte die alltäglichen, trivialen Vorgänge in seinem Provinzdorf verzeichnet, was Sebald eine wundervolle Privatquelle an die Hand gab. Zugleich stellt der Vater eine familiäre Verbindung zu Frankreich her, geriet er doch nach dem Krieg in französische Kriegsgefangenschaft. Sebald wollte aber vor allem der Kriegslaufbahn seines Vaters an den Schauplätzen, die dieser im Osten durchlaufen hatte, nachspüren. Ebenso hatte er bereits Recherchen in Wertach und Sonthofen unternommen, um vergessene oder unbekannte Aspekte seiner Familiengeschichte ans Licht zu bringen. Dazu führte er im Allgäu verschiedene Gespräche mit ehemaligen Mitschülern, alten Freunden und Bekannten. Das ganze Projekt sollte wohl in eine Art von Archäologie seiner eigenen Kindheit münden, da er seine ersten sechs Lebensjahre in die Kontinuität der bis zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts zurückreichenden Genealogie der vier vorangegangenen Sebald-Generationen stellte. »Ich hatte immer den Eindruck und habe den Eindruck in zunehmendem Maße, daß ich aus dieser Zeit stamme. Wenn man von Zeitheimat sprechen könnte, dann sind
Tod, Hommage & Epigonentum
237
es für mich die Jahre zwischen 1944 und 1950, die mich am meisten interessieren.« (G 177) Das Resultat hätte man gerne gelesen, insbesondere als eine nach Austerlitz willkommene Rückkehr zu einer Erzählungsform, die Sebald meisterlich beherrschte. »I am convinced that the book Max was writing when he died would have been his greatest yet«, schließt der in den Rechercheprozeß eingeweihte Richard Evans seinen Nachruf. Doch bedauerlicherweise gehört das Weltkriegs-Projekts nun zu jenen Werken, die durch ihr Fehlen eine schmerzhafte Leerstelle in die Literaturgeschichte einzeichnen. Anspielend auf den von Theodor Mommsen nie verfaßten letzten Band seiner Römischen Geschichte hat Heiner Müller einmal festgestellt: »Der ungeschriebene Text ist eine Wunde / Aus der das Blut geht das kein Nachruhm stillt.«
TOD, HOMMAGE & EPIGONENTUM Was den Kultbuchstatus von Austerlitz betrifft als Symptom für den bemerkenswerten Nachruhm Sebalds, so kann der vorzeitige Tod, knapp nach der Publikation des Buches, nicht davon getrennt werden. Sein Ableben ließ quasi keine andere Wahl als den Roman zum Vermächtnis zu verklären. Außerdem stellte der frühe Tod von Sebald, wie ein amerikanischer Germanist diagnostizierte, ihn in eine »long tradition of authorial deaths: Kleist, Celan, Kafka, Levi.« Drei Selbstmörder, drei Juden, zwei Holocaust-Überlebende umfaßt das als literarische Ahnenreihe aufgezählte Quartett, in das Sebald posthum eingemeindet wurde, der aber keines davon war und sich sicher nicht mit diesen Schriftstellern verglichen hätte in biografischer wie literarischer Hinsicht. Bereits zu Lebzeiten schon hatte ein prominenter US-Kritiker Sebald in der New York Times Book Review, zusammen mit Primo
238
7 Nachruhm
Levi, zum »prime speaker of the Holocaust« eingesetzt. Das unzweifelhaft in ehrender Intention, die allerdings exemplarisch steht für die insbesondere in den USA lange vorherrschende Vereinnahmung als Holocaust-Autor. Gegen eine solche Einordnung aber verwahrte sich Sebald noch zu Lebzeiten vehement. Mit der Holocaust-Industrie wollte er nichts zu tun haben und ihm waren sämtliche einschlägigen Kommerzprodukte verhaßt, seien es nun Spielbergs Film Schindler’s List oder vergleichbare Hervorbringungen. Das half aber nicht viel. Die fromme Mär vom Holocaust-Autor vermochte sich, gekoppelt an den Erfolg von Austerlitz, international als billige Rezeptionsformel verbreiten, wohl gerade weil sie so sehr Klischee und billiges Wunschdenken ist. Man denke nur an die 2015 in Barcelona gezeigte Ausstellung Las variaciones Sebald. Deren spanisch-englischer Katalog enthält nicht nur sachliche Fehler über Leben und Werk, er insinuiert im Klappentext, daß gerade Sebalds angeblich zentrale Beschäftigung mit dem Holocaust seine Relevanz für jene bildenden Künstler ausmache, die in dieser Schau gezeigt wurden: »He left behind a body of work profoundly critical with the history of Europe, with the Nazi holocaust at its centre, of great artistic ambition, which has inspired all kinds of projects in creators of the 21st century.« Die fürchterliche Unbeholfenheit dieses Englisch ist ein sprachliches Pendant des vereinnahmenden Zugriffs. Denn das, was Sebalds schriftstellerisches Werk nicht nur im Bereich der bildenden Künste ausgelöst hat an Hommagen und Inspirationen, ist teilweise wahrlich schauderhaft. Nicht nur wirkt es wie ein Versuch, die eigene, oftmals nur mediokre Kunst aufzuwerten, indem man sich das Label ›Sebald‹ aufklebt, es entwertet vor allem das literarische Werk, das funktionalisiert und reduziert wird zum Stichwortgeber. Paradigmatisch zeigt sich das am Beispiel der Dokumentation Austerlitz des ukrainischen Filmemachers Sergei Loznitsa. Dessen an sich verdienstvoller Film fängt in statischen Aufnahmen die
Tod, Hommage & Epigonentum
239
Besuchermassen in Sachsenhausen, Dachau und anderen ehemaligen Konzentrationslagern ein. In unkommentierten Bildern sieht man Touristen, die an einem Sommertag die Schreckensorte des Holocaust besuchen – so als befänden sie sich an einer Sehenswürdigkeit wie jeder anderen: man lacht, schießt Fotos, checkt seinen Facebook-Feed am Handy, trinkt Cola und trägt T-Shirts mit sexuell anzüglichen Slogans. Zur Erinnerung an den Ausflug dann noch ein nachdenkliches Selfie im Krematorium. Diese Art des Tourismus hat Sebald zwar in einem Interview als pietätlos verdammt, ein genuiner Bezug zum Roman aber ist nicht erkennbar. Der gemeinsame Titel wird lediglich ausgebeutet, um für den belesenen Kinogänger eine tiefere Signifikanz zu erzeugen, während das Buch von Sebald nichts an Bedeutungserweiterung dadurch gewinnt. Das gilt grosso modo auch für viele Adaptionen der Texte Sebalds, sei es als szenisch aufgeführtes, multimediales Hörstück (wie Katie Mitchells 2012 in Köln gezeigte Inszenierung der Ringe des Saturn) oder als eines der verschiedenen Tanz- beziehungsweise Performancestücke, die auf Sebald zurückgehen. Eines der ästhetischen Axiome Sebalds, wie er mir verriet, war seine Überzeugung, man könne gute literarische Texte daran erkennen, daß sie sich nicht verfilmen lassen. Ob das so stimmt oder nicht, darüber mag man trefflich streiten. Jedenfalls drückte sich darin sein gravierender Vorbehalt aus gegen das, was man akademisch als ›transmediale Adaptionen‹ bezeichnen kann. Bei solch komplexen literarischen Texten, wie sie Sebald geschrieben hat, kommt die Übertragung in ein anderes Medium fast zwangsläufig einer Reduktion, Simplifizierung und vielleicht noch Banalisierung gleich. Das wäre der generelle Vorbehalt. Nun ist jedem Künstler selbstverständlich die Wahl des Ausgangsmaterials unbelassen. Das daraus resultierende Kunstwerk aber sollte vermögen, sich von der Vorlage abzusetzen, indem es diese in seinem Aussagepotential erweitert oder neue Perspektiven erzeugt.
240
7 Nachruhm
Was Sebald betrifft, darf man sagen, daß eine künstlerische Reaktion auf seine Texte mustergültig geglückt ist bei Tess Jaray, die in dem Künstlerbuch For Years Now ihre monochromen, minimalistischen Grafiken mit den späten Mikropoemen kombiniert in einer Weise, die dezidiert anti-illustrativ ist. Die unaufgeregten Flächen ihrer Bildwerke komplementieren die enigmatischen Kurztexte Sebalds in einer Art, die einen stillen Dialog entstehen läßt, der zugleich wesentlich auf die aktive ›Mitarbeit‹ des Lesers/Betrachters angewiesen ist. Nehmen wir als mißglücktes Gegenbeispiel hingegen Jane Benson, die für ihr bereits plakativ betiteltes Werk Song for Sebald die englische Übersetzung der Ringe des Saturn als Ausgangspunkt wählte. Aus dem Buch wurde fast der ganze Text getilgt, indem Benson lediglich die zufällig auftauchenden Buchstabenpaare ›do‹, ›re‹, ›mi‹, ›fa‹, ›so‹, ›la‹, ›ti‹ davon übrigließ. Diese fungieren auf den nahezu leeren Buchseiten nun wie Notenschrift, die eine quasi seriell erzeugte Komposition ergeben. Diese wiederum hat die Künstlerin als Choralmusik ausführen lassen, die zugespielt wird über Kopfhörer, welche neben den zu zehn Tafeln zusammengestellten Text-Noten-Buchseiten angebracht sind. Man fragt sich nun, was das soll. Denn dasselbe Prinzip hätte Benson natürlich auf jedes beliebige Buch anwenden und das resultierende Werk auf den Titel Song for [Autorname] taufen können. Der Pressetext spricht von einem »radical encounter with the writer W.G. Sebald’s novel The Rings of Saturn.« Daß der Prosaband kein Roman ist, sei hier geschenkt, denn Benson übernimmt nur die im anglo-amerikanischen Raum verbreitete Unsitte, jedes Erzählwerk als novel zu bezeichnen. Entlarvender ist vielmehr der Anspruch, ihre künstlerische Herangehensweise als ›radikal‹ zu stilisieren. (Mir würde eher ›derivativ‹ einfallen.) Sollte man weitere Beispiele aus dem Feld der Kunst benennen, in denen man sich zwar Sebalds Namen bedient, ein Dialog zwischen Literatur und Kunst aber erst gar nicht entstehen kann, weil
Tod, Hommage & Epigonentum
241
bereits ein verzerrtes Bild seiner Texte die Grundlage der künstlerischen Bemächtigung ist, so wäre auf die im Winter 2013/14 in Edinburgh gezeigte Ausstellung Traces (Influences from W.G. Sebald) zu verweisen. Mit Erstaunen liest man im offiziellen Programmtext der Ausstellung, Sebald habe sich, übersetzt, ›eines holistischen, zwischen Journalismus und Sozialwissenschaft oszillierenden Schreibansatzes‹ bedient, auf welchen die ausgestellten Zeichnungen, Gemälde und Lithografien reagierten. Bemerkenswert, wenngleich nicht aufgrund der gezeigten Kunstwerke, war auch eine im New Museum in New York im Sommer 2008 veranstaltete Ausstellung, deren Titel After Nature lautete. Unter anderem zu sehen war eine sich auf dem Boden windende Frau in Jeans und T-Shirt, die Bestandteil war von Tino Sehgals Installationsarbeit Instead of allowing something to rise up to your face dancing bruce and dan and other things. Bezog sich das auf Sebalds Beschreibungen körperlicher Grenzerfahrungen? Man weiß es nicht. Viel zu sehen gab es jedenfalls: Sechs Meter über dem Boden steckte ein lebensgroßer, präparierter Pferdekörper in einer Wand (eine unbetitelte Arbeit von Maurizio Cattelan). Ein Verweis auf seine jugendliche Passion fürs Reiten? Ebenso war Unacabine zu sehen, eine von Robert Kusmirowski geschaffene exakte Nachbildung der Waldhütte, in welcher sich der sogenannte Unabomber Ted Kaczynski versteckt hielt. Eine Anspielung auf den legendären potting shed? Wer sich also etwas ratlos fragte, wie dies und der Rest vorgeblich mit Sebalds Prosapoem zusammenhing, konnte für fünfundzwanzig Dollar den eingeschweißten Ausstellungskatalog erwerben – um dann festzustellen, daß dieser lediglich aus einem ausfaltbaren Schutzumschlag bestand, auf dem innen die rund neunzig Ausstellungsstücke auflistet waren, sowie ein kurzer Aufsatz des Kurators Massimiliano Gioni. Eigentlicher, und zunächst verdeckter ›Inhalt‹ ist die nur elf Dollar teure Taschenbuchausgabe von After
242
7 Nachruhm
Nature. Man gibt also vergleichsweise viel Geld, vierzehn Dollar, für ein Faltblatt aus. Dafür zumindest bekommt man ein Buch von Sebald, das künstlerisch gehaltvoller sein dürfte als die meisten Exponate dieser Ausstellung. Entsetzt wäre der Internethasser Sebald zweifelsohne, hätte er je erfahren, daß der Schriftsteller Robert Macfarlane im Sommer 2018 eine Twitter Reading Group zu Die Ringe des Saturn gegründet hat, an der sich seine über einhundertzwanzigtausend Follower beteiligen sollten. Macfarlane aber ist ohnehin ein Fall für sich: Er macht keinen Hehl aus dem großen Einfluß, den Sebald auf seine höchst erfolgreichen literarischen Reiseberichte wie The Wild Places (2007) oder The Old Ways: A Journey on Foot (2012) besitzt. In Deutschland gilt er damit als Vorreiter des derzeit trendigen nature writing. Ähnlich Sebald ist Macfarlane in erster Linie eigentlich Akademiker, der literaturkritische Essays schreibt. Sein Beitrag in dem offenkundig als Freundschaftsgabe gedachten Band After Sebald: Essays & Illuminations, der 2014 an der UEA entstand, ist in seinen einleitenden Ausführungen voller peinlicher wie unnötiger Fehler. Sebalds Vorname, deutsche Orte, einfachste Fakten – alles falsch. Macfarlane führt, das ist immer schwer zu entscheiden, damit die Ignoranz oder Arroganz der Angehörigen der britischen Oberklasse vor, die es nicht für nötig halten, zumindest nachzufragen, was Dinge betrifft, die jenseits des englischen Horizonts liegen. Irgendwen wird es in Cambridge doch wohl geben, der den Unterschied zwischen Freiburg und Fribourg kennt! Dame Gillian Beer, King Edward VII Professor of English Literature an der Cambridge University und Andrew Mellon Senior Scholar am Yale Center for British Art, stammt aus niederen Verhältnissen und hat sich ihre akademischen Meriten eigenständig verdient. Doch auch ihr Beitrag enthält eine ganze Reihe faktischer wie linguistischer Fehler. Diese hier zu detaillieren, wäre Platzverschwendung. Übrigens hat man in dem Band alle deutschen Titel
Tod, Hommage & Epigonentum
243
der Bücher Sebalds um ihr Umlaute beraubt. Was erneut die schwer entscheidbare Frage aufwirft, ob seitens der gelehrten Herausgeber nun Ignoranz, Arroganz oder einfach nur Schlampigkeit am Werk waren. Man darf insofern dankbar sein, daß Sebald diese etwas mißglückte ›Festschrift‹ seiner eigenen Universität nicht hat lesen müssen. Wie ihm überhaupt die schlimmsten Appropriationen seiner Person und seines Werks zwischen kultischer Hommage und selbstbeweihräucherndem Opportunistentum erspart geblieben sind. Es ließen sich noch einige Negativbeispiele nennen, wenngleich es durchaus auch gelungene Auseinandersetzungen mit Sebalds Werk gibt, wie etwa die filmische Annäherung an Austerlitz durch den französischen Filmemacher Stan Neumann. So oder so: Faszinierend ist der Enthusiasmus, mit dem man sich international in allen nur denkbaren Kunstsparten mit Sebalds Büchern auseinandersetzt und sich ihrer bemächtigt. Allein dies schon bedeutet ein Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Literatur der Gegenwart. Sebald befindet sich insofern eher in der Klasse von Kafka als in einer Reihe mit solch Altvorderen der Nachkriegsliteratur wie Böll, Grass oder Martin Walser. Höchst bemerkenswert ist ferner das hier bewußt erst gar nicht weiter aufgemachte Faß der literarischen Imitatoren (und Plagiatoren) Sebalds in allen möglichen Sprachen. Teju Cole, Ben Lerner, Frederick Reuss, James Hamilton-Paterson, Starling Lawrence, Marianne Wiggins, Mathias Énard, Ricardo Menéndez Salmón, Benjamín Labatut, Katja Petrowskaja und andere haben sich erkennbar in unterschiedlichem Maße an seinem Stil, seinen Themen und/oder seiner Erzählweise orientiert. Selbst wenn das manche von ihnen bestreiten. Hinzu kommt der wahrhaftige Boom an Büchern aus dem anglo-amerikanischen Raum, die Sebalds Verfahren einer nicht zwangsläufig illustrativen Kombination von Bild und Text übernommen haben für ihre Texte. Sebald hat hier fungiert als Katalysator einer
244
7 Nachruhm
Poetik, die in der deutschen Literatur ja keineswegs eine Seltenheit darstellt. Zwar mögen solche Autoren wie Bernhard Schlink oder Daniel Kehlmann höchst beachtliche Verkaufszahlen im Ausland erreichen, mit denen sie Sebald leicht übertreffen. Es dürfte aber keinen deutschen Schriftsteller seit 1945 geben, der eine derartig breite internationale Wirkung entfalten konnte wie er. Und man geht wohl nicht fehl in der Vorhersage, daß sich dies bis auf weiteres noch fortsetzen dürfte.
ENGLISCHE VEREINNAHMUNGEN Vereinnahmung ist die Kehrseite des Erfolgs. Jeder will plötzlich ein Stück vom Kuchen. Sebald betraf das gegen Ende seines Lebens vor allem in England und den USA. Damit unterschied sich die Lage deutlich von der Situation in Deutschland, wo er immer noch auf erhebliche Vorbehalte stieß, etwa wegen der Debatte um Luftkrieg und Literatur. Zwar galt er bereits als Kandidat für den Literaturnobelpreis, hatte in Deutschland aber beschämenderweise noch nicht mal den verdienten Büchner-Preis bekommen. Stets blieb Sebald very much his own man. Daher etwa lehnte er die Einladung zur Teilnahme am ersten britischen ›Holocaust Memorial Day‹ im Januar 2001 ab. Sei es, weil er um die Perfidität einer in Großbritannien selektiven Erinnerungspolitik wußte, welche die vielen Millionen vom britischen Imperialismus dahingeschlachteten Opfer schlichtweg verdrängt; sei es, weil er einfach seine Ruhe haben wollte oder die Zeit zum Arbeiten brauchte, die lange, anstrengende Reise von der Old Rectory nach London scheuend. Ein für Sebald bedeutsamer Rubikon war überschritten, als seine Bücher nicht nur vereinzelt, sondern immer stärker in den Fokus der Literaturwissenschaft gerieten. Dabei störte ihn insbesondere das teilweise geringe Niveau dessen, was sich langsam als
Englische Vereinnahmungen
245
›Sebald-Sekundärliteratur‹ zu formieren begann. Einen der frühesten Materialienbände zu seinem Werk, entstanden bereits Mitte der neunziger Jahre, überreichte er mir enerviert mit der Bemerkung, wie schmerzhaft für ihn manche Beiträge darin seien. Der literaturkritische Ritterschlag eines jeden Autors, so wußte er natürlich sehr genau, war die erste akademische Konferenz, die man über ihn veranstaltete. Bei Sebald war das posthum der Fall durch das im März 2003 am Davidson College in North Carolina organisierte erste internationale Symposium zu seinem Werk. Drei Tage lang kamen dort über zwanzig Literaturwissenschaftler zusammen. Die Einladung, den Vorträgen zu lauschen und eine Lesung zu geben, lehnte Sebald noch einen Monat vor seinem Tod brieflich ab unter Verweis auf Rückenprobleme. Schon während seiner Universitätslaufbahn hatte er an weit weniger Konferenzen teilgenommen, als dies Germanisten für gewöhnlich tun. Derartige Veranstaltungen mit ihren akademischen Ritualen waren ihm verhaßt. Daß nun er und sein Werk im Zentrum einer solchen Veranstaltung stehen würden, dürfte ihm durchaus ein gewisses Maß an Genugtuung bereitet haben. Doch die bittere Erkenntnis, daß mit der wohlgemeinten Ehrung zugleich unausweichlich der Grundstock dessen gelegt wurde, was später treffend als »Sebald industrial-complex« charakterisiert wurde, war ihm ebenso mit Besorgnis klar. Doch nicht nur die internationale Germanistik bemächtigte sich seiner. Zum Komplex der Vereinnahmung gehört ebenfalls die versuchte Anglisierung, sprich: die Inanspruchnahme für die englische Literatur. Unverständlich erschien vielen britischen und amerikanischen Literaturkundigen, daß Sebald nicht, so wie Vladimir Nabokov oder Joseph Conrad vor ihm, seine Bücher auf Englisch schreibe. Andere wiederum hielten ihn ohnehin kurzschlüssig für einen englischen Schriftsteller, weil er ja in England lebte und seine Bücher auf Englisch erhältlich waren. Dies war sozusagen die kul-
246
7 Nachruhm
turchauvinistische Form der Vereinnahmung, die der dümmlichen Unbekümmertheit entspricht, mit der die keine Bücher lesenden Schichten aus England ihre Sprache im Ausland mit einer Selbstverständlichkeit benutzen, als ob es keine kulturellen Differenzen gäbe auf dieser Welt. Eine weitere Facette der Vereinnahmung ist der Umstand, daß insbesondere von englischsprachiger Seite gerne über eine geheime Abstammung Sebalds gemunkelt wird. Diese Gerüchte drangen bis ans Ohr des Korrespondenten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der im September 2008 an einer an der UEA organisierten Gedenkveranstaltung an Sebald teilnahm. Er konnte daher berichten über die »Legende, von der einige Teilnehmer wissen: daß Sebald selbst jüdischer Herkunft gewesen sei.« Diese Legende scheint sich hartnäckig zu halten, denn auf seinem Grabstein findet man unverändert zahlreiche kleine Steine, die dort nach jüdischer Sitte abgelegt wurden. Diesen Vereinnahmern sei die folgende Aussage gegenüber einem Interviewer der New York Times ins Stammbuch geschrieben: »Sebald insisted, persuasively, that he was not interested in Judaism or in the Jewish people for their own sake. ›I have an interest in them not for philo-Semitic reasons‹, he told me, ›but because they are part of a social history that was obliterated in Germany and I wanted to know what happened.‹« (EM 167) Eine andere Form der eigennützigen Requirierung von Sebald auf beiden Seiten des Atlantiks ist, daß man ihn begierig zum Inbegriff des ›guten Deutschen‹ verklärte. Diese Gestalt ist eine Konkretisierung des germanophilen Wunschbilds der gebildeten Mittelklassen. Ohnehin ist die britische Germanophilie ein so faszinierendes wie komplexes Thema. In allen ihren Schattierungen aber hat sie letztendlich wenig mit Deutschland und sehr viel mit England zu tun. Am Beispiel seines Norwicher Zahnarztes hat mir Sebald einmal eine Variante dieses eigentümlichen Phänomens erklärt. Hin-
Englische Vereinnahmungen
247
ter der Begeisterung, einem Deutschen zu begegnen und diesem gegenüber die deutsche Kultur in den höchsten Tönen zu loben, obwohl man von ihr keine (oder allenfalls punktuelle) Ahnung habe, verstecke sich ein untergründiger, unausgesprochener Neid darauf, daß die Deutschen den Faschismus gewagt haben. Denn darum beneidet man sie insgeheim. Schlüssig erschien mir das erst nicht. Aber einmal sensibilisiert dafür, habe ich seine These in den vielen Jahren, die ich seither unter Briten verbracht habe, wiederholt auf das Genaueste bestätigt gesehen. Eine andere Variante ist die Konstruktion des ›guten Deutschen‹, der bewundert wird für als spezifisch ›deutsch‹ codierte Eigenschaften wie moralische Aufrichtigkeit, melancholische Disposition und das Engagement gegen jede Form von Rassismus. Man könnte auch sagen: Als ›guter Deutscher‹ erscheint, wer stets vor dem Hintergrund der historischen Erblast des Faschismus handelt. Sebald war, aus offenkundigen Gründen, ein geeignetes Objekt dafür, in den Augen seiner anglophonen Bewunderer den ›good German‹ zu verkörpern. Daß dabei Überzeichnungen und Verzerrungen nicht ausblieben, versteht sich von allein. Der perfideste Schachzug in der Vereinnahmung Sebalds war sicherlich, seine Verdienste erst zu preisen, um sie sich dann selber zuschlagen zu können. Der Schriftsteller Will Self hat die englische Doppelstrategie von Idolisierung und Inbesitznahme scharfsichtig auf den Punkt gebracht: »In England, Sebald’s one-time presence among us is registered as further confirmation that we won, and won because of our righteousness, our liberality, our inclusiveness and our tolerance. Where else would the Good German have sprouted so readily, if not from our brown and nutritious soil?« Und noch eine Einschätzung von Self scheint mir zitierwürdig: Im Zusammenhang mit der angeblich bereits getroffenen Vorauswahl Sebalds für den Nobelpreis weist er grundsätzlich darauf hin, wie sehr Auszeichnungen durch hohe Kulturfunktionäre eher diesen selbst und nicht dem Ausgezeichneten gelten, dessen Werk
248
7 Nachruhm
dadurch in seinem widerständigen Gehalt vielmehr neutralisiert wird. Mit Blick nun auf Sebald und die in England beliebten Wettbewerbe, bei denen Hunde und andere Haustiere Preise gewinnen können, fügt Self an: »As I have had cause to remark before: it’s pets that win prizes, and I don’t believe that Sebald was anyone’s pet.«
SEBALD & POP-MUSIK Die übergriffige Tendenz, den deutschen Autor für die englische Kultur zu reklamieren, läßt sich auch anhand des weitgehend mißglückten Films Patience (After Sebald) von 2012 aufzeigen. Rund zwei Dutzend Weggefährten, Experten, Künstler und sonstige Personen mit dem Anspruch, etwas Wesentliches über Sebald sagen zu können, treten darin als talking heads auf. Ein kleines Panorama des britischen Literatur- und Kulturbetriebs. Mal klischeehaft, mal verklärend, aber nur gelegentlich kenntnisreich sprechen sie über einen Autor, den sie zumeist kaum oder nicht kannten, dessen Texte sie nur in Übersetzung lesen können und von dessen Herkunft sie offenkundig nicht die geringste Ahnung haben. Emblematisch dafür ist die wechselnde, aber fast immer falsche Aussprache seines Namens, der doch selbst für britische Zungen zu bewältigen sein sollte. Entsprechend fällt kein einziges deutsches Wort und Sebald ist der einzige Deutsche im Film. Herausragend allerdings, in jeder Hinsicht, ist der Soundtrack. Er stammt von Leyland Kirby alias The Caretaker, der eine bemerkenswerte Klangästhetik im experimentellen Graubereich zwischen Electronica, Ambient und Drone entwickelt hat. Was seine musikalische Ästhetik mit der Literatur von Sebald verbindet, ist zunächst das von Jacques Derrida adaptierte Konzept der Hauntologie, das insbesondere vom Kulturwissenschaftler Mark Fisher auf die Pop-Musik übertragen wurde.
Sebald & Pop-Musik
249
Sebalds Schreiben nun hat nicht nur im Hinblick auf die Präsenz von Gespenstern einen offenkundigen Bezug zum Hauntologischen (das für Derrida, notwendig verkürzt gesagt, die fortdauernde Heimsuchung der neoliberalen Gegenwart durch das ›Gespenst‹ des Kommunismus darstellt, das für das uneingelöste Versprechen auf eine andere, bessere Ordnung der Dinge steht). Hauntologisch sind Sebalds Texte insbesondere deshalb, weil sie wiederholt auf komplementäre Phänomene fokussieren wie Trauma als unfreiwillige Wiederholung von Vergangenem oder Erinnerungsverlust beziehungsweise Erinnerungslücken als gestörte Reaktualisierung von Vergangenem. Das wiederum verbindet sie mit der Musik von Caretaker, dessen Arbeit gleichfalls wesentlich um das Thema Verlust und gestörte Wiederkehr von Erinnerung kreist. So hat er in sechs Alben seines Everywhere At The End Of Time-Projekts, die jeweils im Abstand von sechs Monaten erschienen sind, den sukzessiven Verfall eines dementen Bewußtseins über die Stationen von zunehmender Vergeßlichkeit und vorherrschender Verwirrung bis hin zur kompletten Erinnerungsleere nachzuahmen versucht. Dabei arbeitete Kirby mit alten Schallplatten, deren Rauschen, Knacken und Rillensprünge die Fragilität, Interferenzen und Störungen von Erinnerungen nachahmen und hörbar machen. In Kirbys bewußter Ausstellung der materialen Qualität von Musik ähnelt er Sebald, der gleichfalls die Umstände seiner Recherchen und die Schreibumstände in den Text einbringt. Und so wie Sebald das ›Rohmaterial‹ seiner Biografie, Familiengeschichte und Recherchereisen literarisch bearbeitet in seine Texte transformiert, so benutzt Kirby das ganze Arsenal digitaler Klangbearbeitung, um die originalen Klänge der alten Schallplatten zu dehnen, verzerren, zerhacken, isolieren oder sonstwie zu manipulieren. Deshalb weiß man nie, ob etwa das dichte Rauschen, das den Klang eines Pianos nahezu vollständig überdeckt, um es wie eine fast erloschene Erinnerung klingen zu lassen, dem fragi-
250
7 Nachruhm
len Erhaltungszustand des Tonträgers oder der Studiobearbeitung durch Kirby geschuldet ist. Das Quellenmaterial für den Soundtrack zu Patience war eine knisternde Schellackplatte aus dem Jahr 1927, auf der Franz Schuberts 1827 entstandene Komposition Winterreise zu hören war. Diese Koinzidenz in der Wiederkehr der Jahreszahlen hätte Sebald wohl als bedeutsam empfunden. Die markante Analogie zwischen der melancholischen Wanderung durch eine Winterlandschaft, wie sie im Liedzyklus beschrieben wird, und der melancholischen Wanderung durch Suffolk in Die Ringe des Saturn bedarf sicher keiner weiteren Erläuterung. Kirbys Soundtrack nun sollte am besten isoliert vom Film Patience als musikalischer Kommentar zu Sebalds Text gehört werden. Er dehnt, verlangsamt und erodiert die Samples aus der Winterreise bis nurmehr ein geisterhafter Schatten zu hören ist. Die gespenstischen Pianoklänge stehen im Vordergrund; wenn plötzlich der Gesang auftönt, so sind die Worte kaum zu erkennen hinter dem Nebel an Rauschen, der über allem schwebt. Als Begleitwerk zum Prosabuch darf die Musik nicht zuletzt wegen der sprechenden Tracktitel gelten: When the Dog Days Were Drawing to an End, Everything Is On the Point of Decline oder A Last Glimpse of the Land Being Lost Forever sind Aussagen, die sich leicht auf Die Ringe des Saturn beziehen lassen. Regisseur Grant Gee sieht in der Musik von Kirby vor allem eine Ähnlichkeit zu den Illustrationen des Buches: »Sebald’s images of dust falling, particles and granularity – that’s precisely what you get from Caretaker’s stuff. It’s this gritty, dusty, destroy ed universe.« Sebald dürfte die auf der Winterreise beruhende Musik gefallen haben, denn sein Musikgeschmack lag eindeutig im Bereich der Klassik. Für Schubert besaß er eine besondere Passion. Bei einem Radiointerview wünschte er sich, neben einem Auszug aus Willibald Glucks Oper Orfeo ed Euridice auch Schuberts Klaviersonate
Sebald & Pop-Musik
251
in B-Dur. Und es ist eine sinnige Koinzidenz, daß bei einer Londoner Gedächtnisfeier zum zehnten Todestag im Dezember 2011 der Tenor Ian Bostridge eine gekürzte Fassung der Winterreise in schwermütigem Ton vortrug. Ansonsten mochte Sebald die romantische italienische Oper, beispielsweise Arien aus Werken Bellinis wie Norma oder I Puritani. Bei der Kammermusik oder Symphonik bevorzugte er die langsamen Sätze, während ihm Allegros und insbesondere die großen Finale mit ihrem auftrumpfenden Gestus und den aufgeregten Tuttis gar nicht zusagten. Bezeichnend wohl, daß er sozusagen ›verstimmte‹ Musik schätzte, also etwa Schönbergs Bearbeitungen von Strauß-Walzern. Was Gustav Mahler betrifft, so schreibt er in einem Kafka-Essay: »Tatsächlich sind die schönsten Stellen in seiner Musik für mich diejenigen, wo man die jüdischen Dorfmusikanten noch spielen hört weit in der Ferne. Vor gar nicht langer Zeit habe ich in der Fußgängerzone einer norddeutschen Stadt ein paar litauischen Musikanten gelauscht, die ganz ähnliche Klänge hervorbrachten. Der eine hatte eine Ziehharmonika, der andre eine zerbeulte Tuba und der dritte eine Baßgeige. Indem ich ihnen zuhörte und mich kaum wegwenden konnte, begriff ich, was Wiesengrund einmal über Mahler geschrieben hat, nämlich daß seine Musik das Kardiogramm sei eines brechenden Herzens.« (CS 182) Der Pop- und Rock-Musik stand Sebald weniger kritisch als gleichgültig gegenüber. Lief ein entsprechender Sender im Autoradio, wippte er gerne mal mit. Doch insgesamt ging die Pop-Musik, sowohl ihre ›klassische Phase‹ in den sechziger und siebziger Jahren als auch ihre neueren, künstlerisch avancierten Formen, völlig an ihm vorbei. Tauchen Songs in seinen Texten auf, was ohnehin selten genug der Fall ist, dann ausgerechnet eine Schmalzhymne wie Procol Harums A Whiter Shade of Pale. Pop-Musik bleibt stets im Hintergrund, so wie die Erwähnung der Rolling Stones mit As Tears Go
252
7 Nachruhm
By in Die Ausgewanderten: »Sie spielten Songs aus den sechziger Jahren, die ich in der Union Bar in Manchester ich weiß nicht wie oft gehört hatte. It is the evening of the day.« (AW 178) Die einstmals immense kulturelle Bedeutung der Musik als Medium von Protest und Veränderung spielte für Sebald nie eine Rolle. Das ist umso erstaunlicher, da er ja gerade die magische Blütezeit der Pop-Musik weitenteils in England verbracht hatte. Der rebellische Sound des Rock und die avantgardistischen Quantensprünge des Pop gingen also weitgehend spurlos an ihm vorüber. Dies womöglich deshalb, weil seine Rebellion sich im Medium der Literaturkritik vollzog. Also erst den vernichtenden Rezensionen akademischer Publikationen arrivierter Professoren und später seinen polemischen Aufsätzen. Auch die einfühlsamen Essays, die er über Randfiguren des Literaturkanons schrieb, von denen die offizielle Germanistik nichts wissen wollte, waren eine Form von Protest. Umso verwunderter wäre Sebald daher wohl über die breite Resonanz, auf die er bisher unter Pop-Musikern gestoßen ist. Das Feld reicht dabei von künstlerisch belanglosem name checking, wie wir es bereits im Bereich der Bildenden Kunst gesehen haben, bis hin zu anspruchsvollen Bezugnahmen wie im Fall von Caretaker. Am unteren Ende des Spektrums zu verorten wären Songs wie Sebald des US-Soloprojekts The Gelid Swell, wo über einen dumpf-monotonen Synthie-Rhythmus eher geschmacklose Textzeilen wie »In the crash / Did you look back? / A moment I crave / How did you react?« gesungen werden. Nicht unbedingt besser erscheint der Low-Fi-Rock der Great Grand Suns aus Manchester, die in Song For Max Sebald völlig unverständlich singen, was aber vielleicht zum Besseren ist. Hingegen am oberen Ende des künstlerischen Spektrums anzusiedeln wäre der Experimentalmusiker Christoph Heemann mit seinem 2008 erschienenen Album The Rings of Saturn. In dem im Verlauf von einem Jahrzehnt entstandenen Werk vermischt Hee-
Sebald & Pop-Musik
253
mann verschiedenste Feldaufnahmen mit akustischen und elektronischen Instrumenten, die durch Studioeffekte ergänzt werden, um so zu einer Art ›akustischer Erzählung‹ zu gelangen. Heemann war 1998 durch die Empfehlung eines Freundes auf Sebalds Buch gestoßen, dessen Titel ihn zunächst an eine obskure amerikanische Platte erinnerte, die ihm zehn Jahre vorher untergekommen war, was ein seltsames Echo erzeugte. Hinzu kam, daß Heemann just zu dieser Zeit angefangen hatte, die Schriften von Thomas Browne zu lesen, auf den er dann überraschend auch im Buch stieß. Eine recht Sebaldianische Koinzidenz mithin. Die ihn tief beindruckende Lektüre der Ringe des Saturn löste dann den Impetus aus, mit dem gleichnamig betitelten Album darauf zu reagieren. Heemanns Platte will aber nicht den Text illustrieren, sondern nimmt ihn als Inspiration, um ein eigenständiges Hörwerk zu schaffen, das dennoch mit der literarischen Vorlage verknüpft ist. Das Album setzt beispielsweise um, was Sebald anhand des Panoramas von Waterloo an der nachträglichen Darstellung von geschichtlichen Ereignissen kritisiert: nämlich die »Fälschung der Perspektive.« (RS 152) Die Feldaufnahmen fanden so auch nicht, wie ursprünglich geplant, in East Anglia statt, sondern stammten aus Heemanns Klangarchiv. Heemanns Album unterminiert beständig den Versuch, das Gehörte in eine stimmige Erzählung zu übersetzen. Wenn etwa ein tastendes Basssolo bedächtig stolpernd in eine Aufnahme von Kirchenglocken übergeht, deren Läuten aber sehr viel länger andauert, als man erwarten würde, um dann langsam ausgeblendet zu werden, wird deutlich, daß Heemann hier die Finger an den Reglern hat, um jeglichen Naturalismus zu unterminieren. In Buch wie Hörwerk tritt damit die Kunst an die Stelle der vordergründigen Dokumentation. Und ganz wie Sebalds Reise durch East Anglia eine doppelte ist, nämlich parallel in physischer wie psychischer Hinsicht, so reist man mit Heemann durch akustische Umgebungen, die zugleich
254
7 Nachruhm
natürlich und künstlich sind, wobei die Beziehung zwischen beiden Ebenen nie eindeutig wird. Das drückt sich analog im minimalistisch gehaltenen Albumcover aus, auf dem man eine grüne Landschaft aus Wiese und Bäumen sieht, wobei sich Himmel und Bäume aber in einer großen Pfütze spiegeln, die gewohnte Perspektive überraschend verkehrend. Heemanns insbesondere auf die Aspekte Monotonie und Desolatheit abzielende ›Vertonung‹ des Buches darf insofern als eine gelungene Transposition von Sebalds psychogeografischer Schreibweise in den Bereich der Experimentalmusik gelten. Dies nicht zuletzt deshalb, weil sie nie auf hypnotische Effekte abzielt, sondern den aufmerksamen Zuhörer – ganz wie Sebald die Leser seines Textes – eher zu desorientieren sucht. Wer wiederum jener David Byrne ist, der im Vorwort seiner Bicycle Diaries auf Die Ringe des Saturn als literarisches Vorbild verweist, hätte Sebald kaum gewußt. Wie schade, denn unser Leben wäre ohne die Musik und Konzerte von Byrne doch erheblich ärmer. Vermutlich hätte ihm ebenso der Name Patti Smith nichts gesagt. Daß ausgerechnet sie, die Dichterin, die – wie in ihrer Autobiografie Just Kids beschrieben – mehr aus Zufall von der Poesie in den Punkrock geriet, zur bedeutendsten Fürsprecherin Sebalds aus der popmusikalischen Gegenkultur wurde, erscheint so stimmig wie wundersam. »On Brecht’s birthday, February 10, I held my first poetry reading«, erinnert sich Smith an den entscheidenden Abend des Jahres 1971 in der St. Mark’s Church in der New Yorker Bowery: »Lenny Kaye played the guitar, and I sang ›Mack the Knife‹.« Für Smith existiert keine Trennung zwischen Rockmusik und Lyrik, wie sie es ausdrückt in ihrer Gleichung »poetry + electricity = rock’n’roll«. Die seit den frühen siebziger Jahren beständige Publikation von Gedichtbänden wie Rockalben bestätigt die Grenzgängerrolle von Smith zwischen Lyrik und Rockmusik.
Sebald & Pop-Musik
255
Ende Januar 2011 spielte Smith bei einem After Sebald: Place and Re-Enchantment betitelten Festival in den Snape Maltings (eine ehemalige Mälzerei in East Anglia) ihr Max: A Tribute-Konzert. Sebald reiht sich so ein in eine illustre Reihe von Autoren wie William Blake, Arthur Rimbaud und Bertolt Brecht, denen zu Ehren Smith regelmäßig Konzerte mit Lesungen in kleinem Rahmen gibt. Beim Konzert in den Snape Maltings trug sie abwechselnd Passagen aus After Nature vor und spielte eigene Stücke wie Pissing in a River, Birdland und Ghost Dance, aber auch Coverversionen wie eine berückende Interpretation von Neil Youngs Helpless. Dazwischen erzählte Smith, wie sie auf Empfehlung von Susan Sontag auf Sebald gestoßen war: Nachdem sie zuerst Austerlitz gelesen hatte, weil sie das Bild des kostümierten Jungen wie auch die anderen Abbildungen im Buch faszinierten, las sie dann Die Ringe des Saturn und danach Nach der Natur, dessen Prosalyrik sie besonders ansprach. Nach einigen Songs trug Smith ein Sebald gewidmetes Gedicht vor. Leider bleibt es bis heute unveröffentlicht. Im 2015 erschienenen Prosaband M Train geht sie aber ausführlicher auf ihre Lektüreerfahrungen mit Sebald ein. »What a drug this little book is«, heißt es über Nach der Natur, »to imbibe it is to find oneself presuming his process. I read and feel that same compulsion; the desire to possess what he has written, which can only be subdued by writing something myself. It is not mere envy but a delusional quickening in the blood.« Offensichtlich ist die Nähe zwischen M Train und Die Ringe des Saturn, denn Smith vermischt in freier Weise Autobiografie, Reisebericht und ihre literarischen Begegnungen mit prägenden Autoren mit Träumen oder ihren Memoiren über Verstorbene wie ihren Bruder Todd oder ihren Mann Fred Smith. Schreiben als Dialog mit den Toten. Auch verfügt Smiths Buch über eine ganze Reihe von Fotografien, die sie zwar primär illustrierend einsetzt, die aber zumindest aufgrund ihrer mehr künstlerischen denn dokumenta-
256
7 Nachruhm
rischen Ausrichtung auf Sebalds Umgang mit Bildmaterial ver weisen. Selbst wenn also die subkulturelle Revolution der Popkultur an Sebald vorbeigegangen ist, so nahm doch eine ihrer bedeutendsten Vertreterinnen sein Schreiben zur Kenntnis. Es löst eine Resonanz aus bei anderen Künstlern, die auf seiner Stufe der Meisterschaft operieren, jedoch in ganz anderen Kontexten arbeiten. Auf diese Weise lebt sein Werk anders fort.
VERNACHLÄSSIGTER HUMOR Was heute bleibt von Sebald, ist sein beträchtlicher Nachruhm, bei dem aber oftmals ein Bild des Autors gezeichnet wird, das nicht wirklich den Tatsachen entspricht. So finden sich in der journalistischen Literaturkritik immer wieder eklatante Fehlzuschreibungen und Stilisierungen, ergänzt durch falsche Fakten. Fast muß man schon dankbar sein, daß die von Volker Weidermann in seinem Besteller Lichtjahre aufgestellte Behauptung, die »Universität Norwich« liege in Suffolk, nicht weiterkolportiert wird. Typisch für die professorale Germanistik in Deutschland wiederum ist ein verzerrtes Portrait ihres englischen Kollegen, das zu einem nicht geringen Teil auf Projektionen beruht. Der Umstand, daß Sebald immer wieder ein Lehrstuhl in Neuerer Deutscher Literatur zugeschrieben wird, obgleich dieses Fach in Großbritannien so gar nicht existiert, mag repräsentativ dafür stehen, weil man anscheinend unfähig ist sich vorzustellen, daß die britischen German Studies nicht nach dem deutschem Muster der Germanistik gestrickt sind. Nachdem Sebald in der ›Inlandsgermanistik‹ erst lange Jahre als englischer Irrläufer ignoriert wurde, bevor das rege Interesse von über ihn promovierenden Nachwuchswissenschaftlern zu einer näheren Auseinandersetzung mit ihm zwang, ist in letzter Zeit das
Vernachlässigter Humor
257
Pendel deutlich in Richtung Vereinnahmung ausgeschlagen, indem man ihn sogar zum Gegenstand eines repräsentativen Handbuchs über Leben, Werk und Wirkung gemacht hat. Damit ist die Kanonisierung erstmal gesichert. Und die einseitige Deformation seines Werks zementiert. Denn die Inthronisierung zur Lichtgestalt geht nicht ohne Unterschlagung der widerspenstigen Aspekte ab, die inkompatibel sind mit dem arrivierten Zerrbild. Der polemische, von mir posthum publizierte Essay gegen den Holocaust-Überlebenden Jurek Becker, die Generalattacke auf die Nachkriegsliteratur in Luftkrieg und Literatur oder die englischen Mikrogedichte etwa gilt es mit zu bedenken, wenn man über Austerlitz spricht, doch in diesen übergreifenden Kontext will man den Roman lieber nicht einordnen. Ebenso wünschenswert wäre es, aus dem tautologischen Teufelskreis der immergleichen Themenschwerpunkte, immergleichen Referenzautoren und immergleichen Methodologien auszubrechen. In weiten Teilen ist die Sebald-Philologie zu einer höheren Form des gegenseitigen Abschreibens verkommen, in der von vermeintlichen Autoritäten postulierte Sichtweisen brav nachgeplappert werden, während die von Sebald selbst in die Welt gesetzten Mythen gehorsam übernommen werden. Was seine Literatur aber dringlich braucht, sind ungehorsame Leser. Exemplarisch zeigt sich dies anhand der in Die Ringe des Saturn aufgestellten Behauptung, daß Rembrandt in seinem Gemälde Die Anatomie Dr. Tulp die sezierte Hand des Diebes Aris Kindt in anatomisch falscher Weise gemalt habe. Dies sei ein bewußter Akt der Insubordination des Malers gegenüber den dargestellten Autoritäten und den in ihnen verkörperten Wissensanspruch der Anatomie gewesen, versichert der Erzähler. Nur zu gern ist man dieser ideologiekritischen Darstellung allenthalben gutgläubig gefolgt, mich selbst nicht ausgenommen. Denn schön, allzu schön wirkte diese Entdeckung.
258
7 Nachruhm
Dabei handelt es sich vielmehr um einen höheren Witz Sebalds, der auf Kosten seiner Leser und Exegeten geht. Oder er hat sich schlichtweg getäuscht aus Wunschdenken und glaubte fälschlich, etwas bisher Übersehenes entdeckt zu haben. Wie jedenfalls Adrian Nathan West, nicht zuletzt unter Berufung auf handchirurgische Fachliteratur nachweisen konnte, hat Rembrandt aber keineswegs mit widerständigem Gestus einen bewußten Fehler eingeschmuggelt, sondern vielmehr eine beachtliche anatomische Exaktheit in der malerischen Darstellung der Handmuskulatur unter Beweis gestellt. Daß es höchst unwahrscheinlich ist, zumal für einen anatomischen Laien wie Sebald, etwas Neues an dem weltberühmten Gemälde zu entdecken, was den Scharen an Kunstwissenschaftlern, die das Bild seit Generationen erforscht haben, bisher aus Fahrlässigkeit entgangen war, hätte aber vorher den Verdacht der Literaturwissenschaftler wecken sollen. (So wie man vergleichsweise bald schon entdeckt hatte, daß der auf Seite fünfundsiebzig der Ringe des Saturn abgebildete Fisch nicht, wie von Sebald insinuiert, einen Hering darstellt, sondern einen Dorsch.) Stattdessen knüpfte man allerlei Textinterpretationen und literaturtheoretische Einlassungen an Sebalds vermeintliche Ent deckung, die so auf mehr als wackeligen Beinen stehen. Nicht ganz solide ist auch die schnelle Schubladisierung von Sebald als Melancholiker, obgleich es sich bei der Melancholieforschung um einen beliebten Zweig der internationalen Sebald-Philologie handelt. Die reflektierte Auseinandersetzung mit dem Topos zieht sich durch sein literarisches wie literaturkritisches Werk. Entsprechend ist die Rolle der Schwermut von den professionellen Textdeutern nach allen Regeln ihrer Kunst kommentiert worden in ihren literaturwie kulturgeschichtlichen Zusammenhängen. Sebald, der Chefmelancholiker. Auf diese Kurzformel suchte man ihn von früh auf festzulegen. So beispielsweise, wenn Susan Sontag ihn zum »contemporary master of the literature of lament«
Vernachlässigter Humor
259
erklärte. Sich hinter den Klischees der Literaturkritiker versteckend, spielte Sebald teilweise passiv mit bei der Konstruktion der Mythen um ihn. (So korrigierte er beispielsweise nie die Zuschreibung, sein dritter Vorname laute Maximilian.) Was man bei der Einordung als unverbesserlicher Schwarzseher geflissentlich übersieht, sind Sebalds spezieller Humor und seine große Freude an hintergründiger Satire und Komik. Seine heiteren Charakterzüge werden ignoriert. Oder herabgesetzt als Rückseite der melancholischen Disposition. Deutlich wird: Den Humoristen Sebald darf es nicht geben, weil das nicht zu seiner Stilisierung als literarischer Schmerzensmann paßt. Oder zu seinem traurigen Tod. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Einem solchen Schwarzbild Sebalds aber entsprechen keineswegs die Reminiszenzen seiner Bekannten, Freunde und Studenten, wie auch meine Erinnerungen an ihn. Sein Kollege Michael Robinson hob daher in seinem Nachruf im Independent hervor: »Indeed, readers of his books and those who did not know him well often mistook him for the sombre, sometimes lugubrious-seeming narrator of his novels, but to his friends and many of his students alike, he personified generosity and warmth, all the more engaging for its frequent expression in a profusion of comic anecdotes and wonderfully dry, acerbic asides, which were directed as much at himself as at the fools with whom he had far more patience than he was generally given credit for.« Immer wieder betont man auch in anderen Nachrufen Sebalds »wry sense of humour« oder »dry, sardonic humour«, lobt seine Texte für ihren »mischievous sense of humour« und beschreibt ihn als »wittily humorous and ironic«. Diese Blütenlese exklusiv englischer Charakterisierungen ließe sich noch leicht fortsetzen. Was sich daraus ableiten läßt, ist vielleicht in erster Linie das mangelnde deutsche Sensorium für den englisch geschulten Humor von Sebald. Gelegentlich war er sogar unfreiwillig komisch. Unter den Anekdoten, die seitens der Studenten über ihn kursierten, war mir die-
260
7 Nachruhm
se immer am liebsten: Sebald leitete in den achtziger Jahren einen Kurs über die deutsche Nachkriegsliteratur mit dem für ihn typischen Pauschalurteil ein, daß die nach 1945 geschriebenen Bücher allesamt völliger Mist seien. Daraufhin entstand ein langes Schweigen im Seminarraum, bis sich ein Student getraute zu fragen: ›Why are we studying them then?‹ Als der Literaturkritiker James Wood ihn fragte, was ihm an England besonders gefalle, gab Sebald zur Antwort: »The English sense of humor. Had I ever seen, he asked, any German comedy shows on television? I had not, and I wondered aloud what they were like. ›They are simply … indescribable‹, he said, stretching out the adjective with a heavy Germanic emphasis, and leaving behind an implication, also comic, that his short reply sufficed as a perfectly comprehensive explanation of the relative merits of English and German humor.« Wer Sebald vorbehaltlos begegnete, gewann keineswegs den Eindruck, einem krankhaft Depressiven gegenüberzustehen. »W.G. Sebald ist ein gelassener und fröhlicher Mensch«, schreibt beispielsweise Renate Just 1990 zu Beginn einer Reportage über ihren Besuch in Norwich. Sein langjähriger Kollege Richard Sheppard erinnert sich insbesondere an dessen »tremendous sense of humour involving a range of registers«, darunter »the irreverently anarchic, the absurdist, the sardonic satirical, the iconoclastic, the specialist in-joke and the wittily deadpan.« Gerade auch vom eminenten Humoristen Thomas Bernhard hatte sich Sebald abgeschaut, wie man durch hyperbolische Formulierungen oder komödiantische wie groteske Stilfiguren eine wirkungsvolle Komik erzeugen kann. Mit ernsthafter Miene und zugleich einem Augenzwinkern werden so absurde wie lächerliche Vorfälle erzählerisch zugespitzt, um deren groteske Seltsamkeit kenntlich zu machen. Allzu schwer ist es daher nicht, den Humor aufzufinden in Sebalds Werk. Er reicht von vereinzelten humoristisch-ironischen
Vernachlässigter Humor
261
Bemerkungen bis zu längeren Passagen, in denen langsam aber sicher eine komische Wirkung aufgebaut wird. Man denke etwa an die übertriebene Besorgnis des Erzählers bei seinem Spaziergang durch die Kuranlagen von Bad Kissingen, wo er nur alte Leute in großer Zahl antrifft: »Ich begann zu befürchten, daß ich nun dazu verurteilt sei, den Rest meines Lebens in der Gesellschaft dieser in erster Linie wahrscheinlich um ihre Verdauung besorgten Kissinger Senioren zu verbringen.« (AW 326) Immer wieder trugen sich auf Sebalds Reisen abstruse oder bizarre Dinge zu, deren Humor er dann in der Nacherzählung herausarbeitete. Im persönlichen Gespräch wie in seinen literarischen Texten. Manchmal auch in beidem. So wie seine Begegnung mit der türkischstämmigen Kapitänin des Kissinger Motorboots, das Sebald als einziger Fahrgast zur Mittagszeit bestieg, während »die Kurgäste ihre Diätmahlzeiten zu sich nahmen oder in irgendwelchen dunklen Wirtschaften unbeaufsichtigt der Völlerei frönten.« (AW 333) Die nach Seemannsart gekleidete Fährfrau erweist sich im Gespräch als Person, »die durchaus Bedenkenswertes über den Lauf der Welt zu äußern hatte. Von dieser ihrer kritischen Philosophie gab sie mir einige äußerst eindrucksvolle Proben, die alle in der von ihr mehrmals wiederholten These gipfelten, daß nichts so unendlich und so gefährlich sei wie die Dummheit. Und die Leute in Deutschland, sagte sie, sind genauso dumm wie die Türken, ja vielleicht noch dümmer.« (AW 335) Kein Wunder, daß ihre Ausführungen bei Sebald auf Zustimmung trafen, was nicht nur mit deren Stoßrichtung zusammenhing, sondern ebenso seinem Faible für kritisch denkende ›einfache‹ Menschen. Die amüsante Schilderung des Zusammentreffens endet mit der von Sebald zitierten Feststellung der Bootsführerin, es käme leider selten vor, daß »man mit einem Fahrgast ein Gespräch führen könne, und noch dazu ein verständiges«, weshalb man sich am Ende der Fahrt »mit Handschlag und, wie ich glaube,
262
7 Nachruhm
mit einer gewissen gegenseitigen Hochachtung« (AW 336) vonein ander verabschiedet. Auf einer realen Erfahrung, so erzählte Sebald, beruhte die Geschichte mit dem an Schülerfotos von Kafka erinnernden italienischen Zwillingspaar, dem er auf einer Busreise nach Riva begegnet war. Der Vorfall war deswegen Auslöser dafür, bei seinen Reisen fortan immer eine Kamera mit sich zu führen. Denn zu seinem großen Bedauern habe er kein Foto zum Beweis von deren unheimlicher Ähnlichkeit mit dem Schriftsteller machen können. Und da er »keinerlei Beleg würde vorzuweisen haben über dieses höchst unwahrscheinliche Zusammentreffen« mit dem Knabenpaar als doppelte Wiedergänger von Kafka, bleibt dem Erzähler von Schwindel. Gefühle. keine andere Wahl: Er wendet sich an die Eltern mit der Bitte um Übersendung eines Fotos ihrer Söhne. Die groteske Szene gipfelt daher in der festen Überzeugung des so mißtrauischen wie unkooperativen Ehepaars, »daß es sich bei mir um nichts anderes als um einen zu seinem sogenannten Vergnügen in Italien herumreisenden englischen Päderasten handeln konnte.« (SG 103) Während hier die Komik aus einem grundsätzlich kaum komischen Thema wie der Pädophilie erst ›herausgekitzelt‹ werden muß (wie auch die Begegnung mit der italienischen Familie sich wohl nicht in allen Einzelheiten genau so abgespielt haben dürfte), bietet das für deutsche wie englische Verhältnisse völlig ungewohnte, hektische Treiben vor dem Stehbuffet des Bahnhofs von Venedig Sebald geradezu eine Steilvorlage für eine ironische Schilderung. Liebevoll und präzise beschreibt er den Gastronomiebetrieb, der sich als Quintessenz der italienischen Lebensweise und Kultur erweist: der »wahrhaft höllische Lärm«, der wegen des Geschreis dort herrscht, die über allem »thronenden, nur mit einer Art Schürze bekleideten Frauen«, die »willkürlich, wie mir schien, irgendeinen der von den einander durchdringenden und sich überschlagenden Stimmen vorgebrachten Wünsche herausgriffen, indem
Vernachlässigter Humor
263
sie ihn laut und mit einer allen Zweifel vernichtenden Sicherheit noch einmal über das Getöse hinweg wiederholten, ehe sie den Preis des Verlangten, ganz als handle es sich um einen unumstößlichen Schiedsspruch, hinausriefen in den Raum und, ein wenig sich herabneigend, huldvoll und verächtlich zugleich einem das Zettelchen und das Wechselgeld aushändigten.« (SG 77) Von dort geht es mit dem »inzwischen schon lebenswichtig erscheinenden Billett« zur zweiten Anlaufstation, wo allein Männer »hinter einem kreisförmigen Buffet mit Todesverachtung geradezu dem andrängenden Volk gegenüberstanden. In ihren frischgestärkten, weißen Leinenjacken glich diese kaum sich rührende Kellnerschaft nicht anders als die ihr verwandten Schwestern, Mütter und Töchter hinter den Registrierkassen einer eigenartigen Versammlung höherer Wesen, die hier nach einem dunklen System über ein von endemischer Gier korrumpiertes Geschlecht Gerichtstag hielten.« (SG 77/78) Kaum dringt so ein Element des Bedrohlichen in die genau beobachte Beschreibung der zwischen Chaos und Ordnung oszillierenden Vorgänge ein, wendet Sebald die Stimmung zurück ins Humoristische. Eine komische Schlußpointe liefert den knappen Kontrapunkt zur zweiseitigen Cafeteria-Szene: »Mein Cappuccino wurde serviert, und einen Augenblick lang war mir zumut, als hätte ich mit dieser Auszeichnung den bisher bedeutendsten Sieg meines Lebens errungen.« (SG 78) Authentisch, so erzählte mir Sebald, war die Bemerkung, mit welcher die Vermieterin aus Wymondham in der Henry Selwyn-Geschichte auf die Inspektion des von Sebald und seiner Frau weiß angestrichenen Badezimmers reagierte: »Der für ihre Augen ungewöhnliche Anblick gab ihr den kryptischen Kommentar ein, das Badezimmer, das sie sonst immer an ein altes Treibhaus erinnert habe, erinnere sie nunmehr an einen neuen Taubenkogel, eine Bemerkung, die mir als ein vernichtender Urteilsspruch über die Art, wie wir unser Leben führten, bis heute im Sinn geblieben ist,
264
7 Nachruhm
ohne daß ich es vermocht hätte, an dieser Lebensführung etwas zu ändern.« (AW 15/16) Ein Kabinettstück sarkastischen Humors ist Sebalds Schilderung seines Aufenthalts im Victoria Hotel in Lowestoft, einstmals ein »Promenadenhotel of a superior description«, wo dem einsamen Gast »eine verschreckte junge Frau, nach einigem zwecklosem Herumsuchen im Register der Rezeption, einen mächtigen, an einer hölzernen Birne hängenden Zimmerschlüssel reichte.« (RS 57) Später serviert sie dem Erzähler, der – wie immer – als einziger Gast im Hotelrestaurant sitzt, die Abendmahlzeit: »einen gewiß seit Jahren schon in der Kühltruhe vergrabenen Fisch, an dessen paniertem, vom Grill stellenweise versengten Panzer ich dann die Zinken meiner Gabel verbog. Tatsächlich machte es mir solche Mühe, ins Innere des, wie es sich schließlich zeigte, aus nichts als seiner harten Umwandung bestehenden Gegenstands vorzudringen, daß mein Teller nach dieser Operation einen furchtbaren Anblick bot. Die Sauce Tartare, die ich aus einem Plastiktütchen hatte herausquetschen müssen, war von den rußigen Semmelbröseln gräulich verfärbt, und der Fisch selber, oder das, was ihn vorstellen sollte, lag zur Hälfte zerstört unter den grasgrünen englischen Erbsen und den Überresten der fettig glänzenden Chips.« (RS 58) Wer öfters in England gespeist hat und nicht durch die anglophile Brille auf das dort Kredenzte blickt, wird in dieser Schilderung die Essenz der britischen Form von Gastlichkeit auf das Genaueste wiedererkennen. Die besondere Komik, die daraus resultiert, daß das Hotel ja direkt am Meer in einem Fischereistädtchen liegt, dennoch aber nicht in der Lage, oder genauer gesagt: willens zu sein scheint, seinen Gästen mehr als den unteren Kulinarikstandard samt Plastiksauce, mushy peas and greasy chips zu bieten, ist leider mehr als treffend für die englischen Verhältnisse in gastronomischen Dingen. Daran hat sich bis heute nicht unbedingt viel geändert. Daß das am Kirkley Cliff in Lowestoft gelegene Victoria Hotel in der eng-
Nachsatz über ein elektrisches Wunder
265
lischen Version des Buches in Albion Hotel umbenannt wurde, scheint mir ein Indiz dafür zu sein, daß Sebald sein Mahl dort tatsächlich praktisch wie beschrieben eingenommen hat. Wann immer ich aufgrund äußerer Zwangsumstände nicht umhin komme, eine überteuerte Substandardmahlzeit in einem britischen Restaurationsbetrieb einnehmen zu müssen, denke ich daher gerne zurück an diese Stelle aus Die Ringe des Saturn. Mein humorvoller Doktorvater war sicher nicht der trübsinnige doom and gloom merchant, zu dem man ihn vielerorts macht. Das freilich soll nicht heißen, daß er gleichzeitig nicht selten am Leben, an der Arbeit, an der Gesellschaft sowie anderen Dingen mehr verzweifelte. Und zwar gehörig. Doch nur wenn man seine Person und sein Werk nicht verengt auf vorgefertigte Schablonen, verzerrte Sichtweisen und billige Klischees kann man Sebald gerecht werden.
NACHSATZ ÜBER EIN ELEKTRISCHES WUNDER In Die Ausgewanderten schildert Sebald ein merkwürdiges und zutiefst englisches Kuriosum, eine ›teas-maid‹ (korrekterweise müßte man teasmade schreiben). Dem frisch in Manchester angekommenen Erzähler wird eine derartige Gerätschaft im Hotel Arosa von der merkwürdig-liebenswerten Geschäftsführerin Gracie Irlam überreicht: »Sie brachte mir auf einem Silbertablett offenbar als besondere Willkommensbezeigung ein elektrisches Gerät von mir unbekannter Art. Es war, wie sie mir auseinandersetzte, eine sogenannte teas-maid, Weckeruhr und Teemaschine zugleich. Die auf einer elfenbeinfarbenen Blechkonsole aufgebaute, aus blitzendem rostfreiem Stahl gefertigte Apparatur glich, wenn beim Teekochen der Dampf aus ihr aufstieg, einem Miniaturkraftwerk, und das Zifferblatt der Weckeruhr phosphoreszierte, wie sich in der hereinbrechenden Dämmerung bald zeigte, in einem mir aus der
266
7 Nachruhm
Kindheit vertrauten stillen Lindgrün, von dem ich mich in der Nacht immer auf unerklärliche Weise behütet fühlte.« (AW 224/25) Sebald hat ein solches Gerät tatsächlich besessen, das allerdings erst nach seiner Zeit in Manchester für wenig Geld im Trödel gekauft wurde (und auch in Benutzung war). Die nostalgische Maschine verkörpert stellvertretend Sebalds Aufmerksamkeit für Gerümpel und Plunder, will sagen: den »zwecklosen, aus der Zirkulation geratenen Kram« (RS 48), der vom Fortschrittsprozeß als überholt ausgegliedert wird. In seiner Literatur hat Sebald angestrebt, diese vergessenen Dinge der Geschichte zum Sprechen zu bringen, indem die gleichsam toten Gegenstände durch die literarische Imagination belebt werden. Nicht zuletzt, weil dies einen literarischen Gegenentwurf zur offiziellen, sich am Monumentalen orientierenden Geschichtsschreibung darstellt. Was sich folglich darin ausdrückt, ist eine Ethik, die das Unscheinbare, Kleine und Ephemere zu bewahrten versucht vor dem Vergessen und Verschwinden. Als »Andacht zum Unbedeutenden« hat Benjamin eine solche Haltung bezeichnet. Das Eingedenken und die Versenkung in die ausgegrenzten, für überholt erklärten Gegenstände vergangener Epochen kommt so einer Rettung solcher nomadischer Objekte wie alten Fotografien oder Kuriositäten wie der teas-maid gleich. Das aber gilt auch vice versa: In der Erzählung fungiert dieser anheimelnde Gegenstand wie ein emotionaler Anker während der schweren Stunden in der trostlosen Stadt Manchester und der sich nach und nach als Stundenhotel herausstellenden Beherbergungsstätte. Das Wundergerät besitzt zudem eine metaphysische Dimension, denn die teas-maid wird »von Gracie als an electric miracle« (AW 226) bezeichnet. Bereits beim Betreten des Hotels bemerkte der Erzähler ein Foto von Mrs Irlam, das sie als Mitglied der Heilsarmee, also der Salvation Army ausweist, während ihr Vorname auf Deutsch die Gnade (in einem religiösen Sinne) bedeutet. Heil, Gnade und Rettung sind
Nachsatz über ein elektrisches Wunder
267
so in ihr vereint. Die obskur-bizarre Maschine übernimmt daher für den Erzähler, gleichsam in Stellvertretung der fürsorglichen Mrs Irlam, geradezu die Funktion eines Schutzengels. Sebald nämlich schreibt: Der »Teeapparat, dieses ebenso dienstfertige wie absonderliche Gerät, war es gewesen, das mich durch sein nächtliches Leuchten, sein leises Sprudeln am Morgen und durch sein bloßes Dastehen untertags am Leben festhalten ließ damals, als ich mich, umfangen, wie ich war, von einem mir unbegreiflichen Gefühl der Unverbundenheit, sehr leicht aus dem Leben hätte entfernen können. Very useful, these are, hatte Gracie darum nicht zu Unrecht gesagt.« (AW 225/26) Von launig-ironischem Humor zu existentieller Verzweiflung führt bei Sebald nie ein weiter Weg, ganz so wie sich in der teasmaid Technik und Metaphysik aufs engste begegnen. Seine liebevoll-humorige und zugleich symbolisch höchst aufgeladene Beschreibung der Trost und ein Gefühl von Schutz spendenden Apparatur ergänzt Sebald mit einem Foto seines Geräts. Die Aufnahme sucht so die erfundene Episode seines Aufenthalts im real existierenden Arosa Hotel zu authentifizieren. Sebalds Bücher, wie gesagt, verlangen nach ›ungehorsamen‹ Lesern. Denn sie sind angelegt, unter aufmerksamen Lesern eine solch ungehorsame Lektüre zu provozieren wie zu belohnen. »To read with vigilance is to question authority«, betonte er. Dergleichen Ermutigung zum Widerstand ist vielleicht der wichtigste ethische Aspekt seiner Literatur. (Schade nur, daß viele Leser Sebalds dieses emanzipierende Angebot ausschlagen.) Die teas-maid wiederum verkörpert den anderen zentralen Aspekt: die Metaphysik. Das nostalgische Gerät erscheint mir als treffliche Allegorie auf Sebalds Schreiben, denn die wundervolle Wirkungsweise dieser wahrhaft mirakulösen Apparatur liefert ein wunderbares Sinnbild für das Vermögen der Literatur von W.G. Sebald, die Lasten unserer Existenz wundersam zu transzendieren.
Nachwort
Ü
ber W.G. Sebald ist viel geschrieben worden, Hagiografisches und Abfälliges, ohne daß deshalb die schwierige Schönheit seines Werks zugänglicher geworden wäre. Dieser Band, gedacht als Gabe zum 75. Geburtstag, nimmt vieles auf, was ich in früheren und eher wissenschaftlich ausgerichteten Büchern über Sebald festgehalten habe. Fehler und Irrtümer wurden korrigiert, einiges Neue ist hinzugekommen. Das abschließende Wort über W.G. Sebald kann auch dieser Band nicht sein, sondern allein der Versuch einer erneuten Annäherung. Sieben Schwerpunkte wurden gewählt, die mir geeignet erschienen, den möglichst ›ganzen‹ Sebald exemplarisch zu beleuchten. Ein »fallweises Verfahren« mithin, das sich bewußt an der Herangehensweise Sebalds in seinen Essaybänden orientiert: Anstelle einer umfassenden »Panoramaaussicht« auf Leben, Werk und Wirkung vertraut dieses Buch darauf, daß die »notgedrungene Lückenhaftigkeit aufgewogen wird von Durchblicken«, wie sie nur ein solch thematisch-assoziatives und vor allem dezidiert essayistisches Vorgehen ermöglicht. Von Beginn an war mir eines klar: Ich wollte die offenkundigen Begriffe vermeiden, die von der Sebald-Forschung so übereifrig bearbeitet werden, also solch altbekannte Themen wie Trauma, Exil, Holocaust, Erinnerung, Melancholie und so weiter. Viel zu oft schon ist Sebalds Werk unter diesen Kategorien ausgemessen worden und »wie öde in ihnen auf jeder Seite das Geklapper der Redundanz ist« (CS 196), erweist sich mit jedem Jahr und jeder Neuerscheinung mehr.
270
Nachwort
Andere Stichwörter wären ebenso denkbar gewesen, erschienen mir aber nicht exemplarisch oder repräsentativ genug. ›Macht‹ beispielsweise ist eine der Kategorien, über die Sebald (in Anlehnung an Elias Canetti) viel nachgedacht hat. Stichwörter wie ›Katastrophe‹, ›Geschichte‹ oder ›Naturgeschichte‹ erweisen sich als zu weitläufig, während Begriffe wie ›Gespenster‹, ›Vogelperspektive‹ oder gar ›Wüstenkarawane‹ zu begrenzt gewesen wären. Einen Essay über das metaphorische Gegensatzpaar von ›hell‹ und ›dunkel‹ bei Sebald zu schreiben, habe ich zwar ernstlich erwogen, dann aber verworfen. Dies auch deshalb, weil mir die Zahl von sieben Essays als zwingend erschien. Zuletzt ein noch Wort an jene, die um die kategorialen Unterschiede zwischen Privatperson, Autor und Erzähler wissen und Sebalds Literatur mit der Theorie der Autofiktion traktieren: All diese Gebote sind auch mir wohlbekannt. Nur habe ich mich entschlossen, sie in diesem Band, der sich an eine Leserschaft jenseits der Fachgemeinde richtet, flexibel zu handhaben oder, wo angebracht, geflissentlich zu ignorieren.
Postscriptum
W
hen you grow up promises are held up in front of you. Get your O levels done and your A levels and then everything will be fine. And then you do your BA and your PhD, but the more you are lured along this road, the more is taken away from you, the less the scope becomes. Day by day you leave things behind, ultimately your health, and so loss becomes the most common experience we have. I think somehow this has to be accounted for and as there are few other places where it is accounted for it has to be done by writing. It is quite clear to me that many people can identify with this view of life. It is not necessarily a pessimistic one; it is just a matter of fact that somehow this whole process is one in which you get done out of what you thought was your entitlement. W.G. Sebald, am 12. Januar 2001
Anhang DANKSAGUNG Vieles verdankt man Büchern. In meinem Fall stammen die meisten darunter von W.G. Sebald. Wem oder was aber sich Bücher verdanken, ist da schon eine kompliziertere Angelegenheit. Ich danke zuvörderst Ute Sebald und Renate Just für Auskünfte, Informationen und mehr. Herzlichen Dank als nächstes an Scott Bartsch für sein scharfsichtiges Korrektorat. Erneut hat Christian Wirths überreiche Sebald-Website wertvolle Dienste geleistet. Jörg Schönert hat mir geduldig mit Auskünften zu Sebalds Habilitation geholfen. Wie auch an der UEA im Fall der Personalakte von Sebald geschehen, hat man in Hamburg die betreffenden Archivunterlagen zur Habilitation nicht aufbewahrt. Dieses Buch wäre ohne die Mitarbeit vieler anderer Sebald-Mitstreiter, mit denen ich mich seit Jahren im produktiven Austausch befinde, nicht denkbar gewesen. Sie haben auf indirekte Weise mitgeschrieben. Dafür statte ich meinen Dank ab bei Sven Meyer, Melissa Etzler, Richard Sheppard, Iain Galbraith, Jo Catling, Adrian Nathan West, Peter Oberschelp und Thomas Honickel sowie meinem Lektor Christoph Steker. Last but not least sei den Rechteinhabern der Fotografien gedankt, die in diesem Band zu finden sind. Auch dieses Buch entstand auf Kosten der Zeit mit meiner Familie. Dafür gebührt ihnen zwar zuletzt aber an allererster Stelle mein Dank, der mit Worten nicht wirklich auszudrücken ist. Gewidmet sei dieses Buch, das Max ehren will und dabei zugleich eine Erinnerung ist an unsere gemeinsame Zeit in Norwich, daher Dir, Antje. Valetta, Malta, zum Jahreswechsel 2018/19
Siglen
273
SIGLEN Ich zitiere die Werke von W.G. Sebald nach den im Fischer Verlag erschienenen Taschenbuchausgaben, deren Paginierung teilweise von den gebundenen Originalausgaben abweicht. Die Jahreszahlen der Siglenliste beziehen sich auf die Originalausgaben. Zitate aus entlegen erschienenen Veröffentlichungen oder Interviews werden ohne Siglen wiedergegeben. Im Interesse einer besseren Lesbarkeit werden die Zitate, wo nötig, behutsam angepaßt. Ebenso wird auf die wissenschaftlichen Erfordernisse von eckigen Klammern und Auslassungszeichen bewußt verzichtet.
A
Austerlitz (2001)
AW BU
Die Ausgewanderten. Vier lange Erzählungen (1992) Die Beschreibung des Unglücks. Zur österreichischen Literatur von Stifter bis Handke (1985) In Conversation with W.G. Sebald. In: Writers in Conversation with Christopher Bigsby. Hg. v. Christopher Bigsby, Bd. 2, Norwich 2001, S. 139–65 Campo Santo. Hg. v. Sven Meyer (2003)
CB
CS EM FYN G KP
LH LL LW NN RS SG
The Emergence of Memory. Conversations with W.G. Sebald. Hg. v. Lynne Sharon Schwartz, New York 2007 For Years Now. Poems by W.G. Sebald. Images by Tess Jaray, London 2001 »Auf ungeheuer dünnem Eis«. Gespräche 1971 bis 2001 (2011) Korsika-Projekt. In: Wandernde Schatten. W.G. Sebalds Unterwelt. Hg. v. Ulrich von Bülow / Heike Gfrereis / Ellen Strittmatter, Marbach 2008 Logis in einem Landhaus (1998) Luftkrieg und Literatur (1999) Über das Land und das Wasser. Ausgewählte Gedichte von 1964– 2001. Hg. v. Sven Meyer (2008) Nach der Natur. Ein Elementargedicht (1988) Die Ringe des Saturn. Eine englische Wallfahrt (1995) Schwindel. Gefühle. (1990)
274
Siglen
U UH
Unerzählt (2003) Unheimliche Heimat. Essays zur österreichischen Literatur (1991)
SM
Saturn’s Moons. W.G. Sebald – A Handbook. Hg. v. Jo Catling / Richard Hibbitt, London 2010
FOTONACHWEISE 1 Postkarte Wertach © Privat 2 Josef Egelhofer & 3 Sebald in Ditchingham Park © Estate of W.G. Sebald, Wylie Agency 4 University of East Anglia, Teaching Wall © Paul Evans, Cambridge 5 Sebald mit Hund © Privat 6 Bombardierung Nürnbergs © Stadtarchiv Nürnberg 7 Patti Smith, Snape Maltings © Malcolm Watson, Woodbridge Cover und Frontispiz © Marc Volk, Berlin
ZUM AUTOR Uwe Schütte, geboren 1967 in NRW, aufgewachsen in Bayern 1987–1989 Zivildienst in München 1989–1992 Studium der Neueren Deutschen Literatur, Englischen Literatur und Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität 1992–1993 Magisterstudium bei W.G. Sebald an der University of East Anglia in Norwich mit Abschlußarbeit über »Autobiografische Kindheitstexte in der österreichischen Gegenwartsliteratur« 1993–1996 Promotionsstudiengang bei W.G. Sebald mit Dissertation über Gerhard Roth, publiziert 1997 als Auf der Spur der Vergessenen. Gerhard Roth und seine ›Archive des Schweigens‹ im Böhlau Verlag, Wien 1999 Lecturer in German, seit 2005 Reader an der Aston University, Birmingham 2017 externe Habilitation an der Georg-August-Universität in Göttingen mit Interventionen. Literaturkritik als Widerspruch bei W.G. Sebald Er lebt in Berlin-Kreuzberg. Neben zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen in Fachjournalen und akademischen Sammelbänden sowie literarischen und kulturkritischen Essays in Literaturzeitschriften hat er bisher sieben Herausgeberschaften und fünfzehn Monografien zu Themen der Gegenwartsliteratur und Pop-Musik veröffentlicht. Buchpublikationen zu Sebald: W.G. Sebald. Einführung in Leben & Werk (Göttingen: V&R / UTB) 2011 (Neuauflage 2020 bei De Gruyter) Interventionen. Literaturkritik als Widerspruch bei W.G. Sebald (München: Edition Text & Kritik) 2014 Figurationen. Zum lyrischen Werk von W.G. Sebald (Eggingen: Edition Isele) 2014 Über W.G. Sebald. Beiträge zu einem anderen Bild des Autors (Berlin: De Gruyter) 2016 W.G. Sebald (Liverpool: Liverpool University Press) 2018



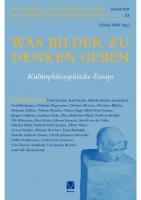




![Sieben Energiewendemärchen?: Eine Vorlesungsreihe für Unzufriedene [1. Aufl.]
9783662619995, 9783662620007](https://dokumen.pub/img/200x200/sieben-energiewendemrchen-eine-vorlesungsreihe-fr-unzufriedene-1-aufl-9783662619995-9783662620007.jpg)

![Annäherungen: Sieben Essays zu W.G.Sebald [1 ed.]
9783412513832, 9783412513818](https://dokumen.pub/img/200x200/annherungen-sieben-essays-zu-wgsebald-1nbsped-9783412513832-9783412513818.jpg)