»Aggregate der Gegenwart«: Entgrenzte Literaturen und Erinnerungskonflikte 9783839464410
Häufig geht es in Literaturdebatten um den Umgang mit Geschichte: Um Erinnerungskonflikte, bei denen die eine Erinnerung
196 18 7MB
German Pages 384 [382] Year 2023
Polecaj historie

- Author / Uploaded
- Hans-Joachim Hahn (editor)
- Hans Kruschwitz (editor)
- Christine Waldschmidt (editor)
Table of contents :
Inhalt
Literarische Gegenwartsanalysen, gegenläufige Gedächtnisse und kontroverse Geschichtspolitik
I. Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Freuds Zuhause
»… out of joint«: Wiedergängerinnen in Rainer Maria Rilkes Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge und Marie NDiayes Autoportrait en vert
»Die Erinnerung an jetzt.« Figuren der Vergegenwärtigung in Ilse Aichingers Kurzprosa
Von den Enden des Ungeschriebenen
II. Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Telegraph der Vergangenheit, Mikroskop der Gegenwart und Fernrohr der Zukunft. Ludwig Börnes Figuren der Aktualität
Gegenwartsarbeit im Material. Kracauers materiale Soziologie und die Politik der kleinen Form
Erinnerung an 1918. Rückblick und Deutung der Exilgegenwart in Anna Seghers’ Die Toten bleiben jung und Alfred Döblins November 1918
Das billige Experiment. Zum historischen Funktionswandel von Hitler-Satiren und -Karikaturen
Der konzentrierte Blick. Zum Werk von Anna Katharina Hahn
III. Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
Beobachter der kranken deutschen Zeit. Das ›Dritte Reich‹ und seine Folgen in den Erinnerungen von Sebastian Haffner und Horst Krüger
Mela Hartwigs postexilischer Roman Inferno (1948/2021)
Die Moderne als Opfer. Andersch und Fühmann blicken auf Barlach
Das Buch, die Kritik und der Markt. Takis Würgers Roman Stella und seine Auswirkungen
Terror & Entertainment. Christopher Roths Baader und die Schwierigkeiten der Erinnerung
IV. Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Wie Rechte Lange lesen. Horst Langes Kriegserzählung Die Leuchtkugeln (1944) im Lektürekanon von Götz Kubitschek
»Dasein heißt keine Rolle spielen.« Liebe, Geschichte und keine Erlösung bei Botho Strauß
Die Gegenwart des literarischen Antisemitismus. Zum religiösen Gefühlswissen seit der Romantik – mit einem Close-Reading von Peter Handkes Text Die Lehre der Saint-Victoire (1980)
»… als was waren Sie dort?« Rostock-Lichtenhagen als Schauplatz jüdischer Selbstermächtigung
»What a brainfuck.« Zum Verhältnis von Geschichte und Erinnerung in der Gegenwart
Autorinnen und Autoren
Citation preview
Hans-Joachim Hahn, Hans Kruschwitz, Christine Waldschmidt (Hg.) »Aggregate der Gegenwart«
Lettre
Hans-Joachim Hahn (PD Dr. phil.) ist Research Fellow am Zentrum für Jüdische Studien der Universität Basel und Privatdozent für Neuere deutsche Literaturwissenschaft am Institut für Germanistische und Allgemeine Literaturwissenschaft der RWTH Aachen. Seine Forschungsschwerpunkte sind u.a. die deutschsprachigjüdische Literatur seit der Aufklärung, historische Antisemitismusforschung und gegenwärtige Erinnerungskultur. Hans Kruschwitz (PD Dr. phil.) ist Privatdozent für Neuere deutsche Literaturwissenschaft am Institut für Germanistische und Allgemeine Literaturwissenschaft der RWTH Aachen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der deutschsprachig-jüdischen Literatur- und Kulturgeschichte und in der Gegenwartsliteratur. Christine Waldschmidt (Dr. phil.) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Germanistische und Allgemeine Literaturwissenschaft der RWTH Aachen. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Literatur der Aufklärung, Kulturgeschichten im 18. Jahrhundert, deutschsprachig-jüdische Literatur sowie Lyrik des 20. Jahrhunderts.
Hans-Joachim Hahn, Hans Kruschwitz, Christine Waldschmidt (Hg.)
»Aggregate der Gegenwart« Entgrenzte Literaturen und Erinnerungskonflikte
Das Buch wurde gedruckt mit freundlicher Unterstützung der RWTH Aachen und der Stiftung Irène Bollag-Herzheimer.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http: //dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2023 transcript Verlag, Bielefeld Alle Rechte vorbehalten. Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen. Umschlaggestaltung: Maria Arndt, Bielefeld Umschlagabbildung: Wolfgang Hildesheimer Der Tod und das Mädchen II (1984); Abdruck mit freundlicher Genehmigung durch Klaus Schweizer Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar https://doi.org/10.14361/9783839464410 Print-ISBN: 978-3-8376-6441-6 PDF-ISBN: 978-3-8394-6441-0 Buchreihen-ISSN: 2703-013X Buchreihen-eISSN: 2703-0148 Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff.
Inhalt
Literarische Gegenwartsanalysen, gegenläufige Gedächtnisse und kontroverse Geschichtspolitik Hans-Joachim Hahn, Hans Kruschwitz und Christine Waldschmidt .......................... 9
I. Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung Freuds Zuhause Liliane Weissberg ......................................................................... 31 »… out of joint«: Wiedergängerinnen in Rainer Maria Rilkes Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge und Marie NDiayes Autoportrait en vert Caroline Torra-Mattenklott................................................................ 55 »Die Erinnerung an jetzt.« Figuren der Vergegenwärtigung in Ilse Aichingers Kurzprosa Vivian Liska.............................................................................. 73 Von den Enden des Ungeschriebenen Birgit R. Erdle ............................................................................ 89
II. Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität Telegraph der Vergangenheit, Mikroskop der Gegenwart und Fernrohr der Zukunft. Ludwig Börnes Figuren der Aktualität Daniel Weidner ...........................................................................107
Gegenwartsarbeit im Material. Kracauers materiale Soziologie und die Politik der kleinen Form Yashar Mohagheghi.......................................................................127 Erinnerung an 1918. Rückblick und Deutung der Exilgegenwart in Anna Seghers’ Die Toten bleiben jung und Alfred Döblins November 1918 Christine Waldschmidt .................................................................. 143 Das billige Experiment. Zum historischen Funktionswandel von Hitler-Satiren und -Karikaturen Carsten Jakobi........................................................................... 161 Der konzentrierte Blick. Zum Werk von Anna Katharina Hahn Jakob Hessing .......................................................................... 183
III. Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945 Beobachter der kranken deutschen Zeit. Das ›Dritte Reich‹ und seine Folgen in den Erinnerungen von Sebastian Haffner und Horst Krüger Nicolas Berg .............................................................................197 Mela Hartwigs postexilischer Roman Inferno (1948/2021) Primus-Heinz Kucher .................................................................... 223 Die Moderne als Opfer. Andersch und Fühmann blicken auf Barlach Nike Thurn .............................................................................. 235 Das Buch, die Kritik und der Markt. Takis Würgers Roman Stella und seine Auswirkungen Alfred Bodenheimer ..................................................................... 249 Terror & Entertainment. Christopher Roths Baader und die Schwierigkeiten der Erinnerung Jörn Ahrens............................................................................. 263
IV. Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität Wie Rechte Lange lesen. Horst Langes Kriegserzählung Die Leuchtkugeln (1944) im Lektürekanon von Götz Kubitschek Jörg Döring ............................................................................. 279 »Dasein heißt keine Rolle spielen.« Liebe, Geschichte und keine Erlösung bei Botho Strauß Hans Kruschwitz ........................................................................ 307 Die Gegenwart des literarischen Antisemitismus. Zum religiösen Gefühlswissen seit der Romantik – mit einem Close-Reading von Peter Handkes Text Die Lehre der Saint-Victoire (1980) Jan Süselbeck ...........................................................................321 »… als was waren Sie dort?« Rostock-Lichtenhagen als Schauplatz jüdischer Selbstermächtigung Matthias N. Lorenz ...................................................................... 337 »What a brainfuck.« Zum Verhältnis von Geschichte und Erinnerung in der Gegenwart Hans-Joachim Hahn ..................................................................... 363 Autorinnen und Autoren ............................................................... 379
Literarische Gegenwartsanalysen, gegenläufige Gedächtnisse und kontroverse Geschichtspolitik Hans-Joachim Hahn, Hans Kruschwitz und Christine Waldschmidt
1. Die wissenschaftliche Untersuchung von Gegenwartsliteratur hat Konjunktur: Breiter denn je interveniert Gegenwartsliteratur in aktuelle Kontroversen, bietet kritische Zeitdiagnosen und eröffnet, indem sie Vergangenheit und Gegenwart im Medium der Narration verknüpft, Möglichkeitsräume zukünftiger Gegenwarten. Gegenwartsliteratur in diesem Sinn erschöpft sich nicht in bloßer Zeitgenossenschaft, sondern basiert auf einem durchaus gesellschaftspolitisch zu nennenden Selbstverständnis literarischer Produktion, das sich in unterschiedlicher Weise auf die zeitgenössische Wirklichkeit bezieht: als Betroffensein, Stellungnahme oder Gegensatz. Oft befragt sie die Gegenwart dabei kritisch auf ihre politischen und sozialen Verhältnisse hin, ihre aktuellen Geltungs- und Legitimationsgründe sowie ihre Abhängigkeiten und Verbindlichkeiten. Sie entwirft teils utopische, teils dystopische Gegenbilder und liefert ›alternative‹ Deutungen vergangener Gegenwarten. Zudem kann in literarischen Texten reflektiert werden, wie sich das Verständnis von Gegenwart allererst konstituiert und Dinge als gegenwärtige erscheinen. Im deutschsprachigen Raum, der zum großen Teil ein postnationalsozialistischer ist (aktuell aufgerufen etwa in Christian Krachts Roman Eurotrash), über dessen toxisches Erbe schon seit Jahrzehnten gestritten wird, geraten dabei insbesondere Kontroversen zu den Widersprüchen des westlichen Liberalismus, nicht zuletzt der ›Identitätspolitik‹ (von Biller bis Thierse), Fragen nach der Bedeutung von postkolonialistischem Denken und postmigrantischen Erfahrungen (u.a. Fatma Aydemir/Hengameh Yaghoobifarah, Mithu Sanyal, Sharon Dodua Otoo), Diskussionen über das Verhältnis von Rassismus und Antisemitismus (MbembeDebatte und folgende; vgl. u.a. Böckmann et al. 2022; Neiman/Wildt 2022) sowie die Folgen neurechter Angriffe auf die gesellschaftliche Vielfalt in den Blick – und mit ihnen kommt auch die ›Erinnerungskultur‹ des seit zwei Jahrzehnten auch offiziell als ›Einwanderungsland‹ bezeichneten Deutschland auf den Prüfstand.
10
»Aggregate der Gegenwart«
Verschärft, unter veränderten Vorzeichen, hat sich dies von Aleida Assmann ([2013] 2020) formulierte »Unbehagen an der Erinnerungskultur« (ebd.) noch einmal seit dem 24. Februar 2022 durch den russischen Krieg gegen die Ukraine und dem damit verbundenen (selbst)kritischen Blick auf die deutsche Russlandpolitik der vergangenen zwei Jahrzehnte. Die Prominenz literarischer und literaturkritischer Stimmen, die sich in diesen Debatten zu Wort melden, unterstreicht ihre Virulenz. Das Spektrum reicht von öffentlichkeitswirksam ausgetragenen politischen Standortbestimmungen inklusive Verlagswechseln (Walser, Maron) und feuilletonistischen Klagen über die Wiederkehr verhängnisvoller romantischer Denkmuster (Malzahn, Diez, Weidermann) bis hin zu Streitgesprächen über die mutmaßliche Hegemonie linker Diskurse (Tellkamp vs. Grünbein) und das umstrittene Phänomen der ›cancel culture‹. Wieder andere Stimmen warnen vor dem Schwund des Politischen (Zeh, Trojanow), verweisen auf die Bedeutung migrantischer Erfahrungen (u.a. Bronsky, Grjasnowa, Salzmann), heben an zu erinnerungspolitischen Kollegenschelten (Stanišić vs. Handke) oder reflektieren, wie Ingo Schulze in seinem Roman Die rechtschaffenen Mörder (2020), die Überlagerung politischer und literarischer Gegenwarten. Zugleich verdeutlicht der instrumentelle Gebrauch von Literatur zu politischen Zwecken, wie ihn exemplarisch Jörg Döring im Band in seiner Analyse einer Literatursendung des neurechten Instituts für Staatspolitik in Schnellroda aufzeigt, dass Literatur in den Deutungskämpfen der Gegenwart keinesfalls ausschließlich zur Verteidigung der ›offenen Gesellschaft‹ genutzt wird. Auffällig oft geht es in den genannten Debatten darum, die ›eine‹ Erinnerung mit ›anderen‹ Erinnerungen zu konfrontieren, die gemeinsame Gegenwart also von unterschiedlichen, wenn nicht entgegengesetzten Orten und Zeiten aus in den Blick zu nehmen. Zugleich werden anhand widerstreitender Gedächtnisse immer wieder Fragen von Zugehörigkeit und Identität verhandelt. Man darf es darum für symptomatisch halten, dass im Frühjahr 2021 die deutsche Übersetzung von Michael Rothbergs Studie Multidirektionale Erinnerung. Holocaustgedenken im Zeitalter der Dekolonisierung (Rothberg [2009] 2021), die sich gerade als Beitrag zur Überwindung der erinnerungspolitischen ›Opferkonkurrenz‹ versteht, eine polarisierte Rezeption erlebt. Die hier exemplarisch zu beobachtende Konvergenz von literarischen Auseinandersetzungen und öffentlich ausgetragenen Konflikten auf ihre literarischen Mittel und normativen Kräfte hin zu untersuchen, bildet die analytische Anstrengung der in diesem Band versammelten Beiträge. Sie untersuchen insbesondere, zu welchen »Aggregate[n] der Gegenwart« (Braese [2001] 2002, 24) sich erinnerungspolitische Standortbestimmungen im literarischen Feld verdichten und was diese Aggregate – aber auch ihre wissenschaftliche Analyse – für ein kritisches Verständnis der Zeit beitragen können. Das Zusammentreffen von literarischer Auseinandersetzung und erinnerungspolitisch gedeuteter Gegenwart ist dabei keine historisch singuläre Erscheinung,
Hahn/Kruschwitz/Waldschmidt: Literarische Gegenwartsanalysen
sie gibt auch den Blick auf vergangene Gegenwartsliteraturen frei: Für das 20. Jahrhundert werden Gegenwartsdeutungen und Erinnerungsdiskurse der Weimarer Zeit und des (Post-)Exils betrachtet, die nicht nur von der Erfahrung des NS-Regimes, von Verfolgung und Flucht, sondern auch von der Frage nach der Relevanz und dem politischen Auftrag von Literatur sowie der oft unabweisbaren Notwendigkeit geprägt wurden, sich ›andere‹ Kollektive und Identitäten erschreiben zu müssen. In ähnlicher Weise lassen sich Debatten über politische Verbindlichkeiten und ausgrenzende nationale Kollektivierungen in der Literatur des Vormärz als erinnerungspolitische Debatten neu beleuchten. Zudem geben die Beiträge vereinzelt, wie etwa im Beitrag von Caroline Torra-Mattenklott, Hinweise darauf, dass all diese Konfliktlinien nicht nur in der deutschsprachigen Literatur ihren Niederschlag finden, sondern ebenso in den Literaturen anderer, europäischer und außereuropäischer Sprachen. Die Relevanz der Verbindung von Erinnerung und eigener Gegenwartsdeutung wird in den Beiträgen immer wieder auch in den Kontext eines spezifischen Zeitund Geschichtsbewusstseins der Moderne gestellt. So wie die Entzifferung historischer Prozesse immer aus der jeweiligen Gegenwart erfolgt und ohne diese nicht möglich wäre, lässt sich ›Gegenwart‹ nicht ohne Kenntnis historischer Prozesse analysieren. Dabei gelten Zeit- und Geschichtsbewusstsein als zentrale Charakteristika für die Unterscheidung von Moderne und Vormoderne. Heine etwa hat 1832 in seiner bekannten Formulierung von der »Geschichtsschreibung der Gegenwart« (Heine [1932] 1970, 32) festgehalten und im Artikel VI seiner Französischen Zustände vorgeführt, was es heißen könnte, den »Schlüssel der lärmenden Tagesräthsel« (Heine [1832] 1980, 129) in der Vergangenheit zu suchen (vgl. Lämke 2000, 237, 239). Die sich seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert ausbreitende »moderne Geschichtlichkeit« gilt als »allumfassend« und als Grundlage für »Pluralismus, Relativismus und Historismus«, während die Einsicht in die historische sowie kulturelle Bedingtheit von Werten und Weltvorstellungen zugleich die in der Moderne wiederkehrenden »Geltungs- und Legitimationskonflikte« hervorbringe (Hühn 2020, 90). Zudem datiert die neuere Forschung während der letzten etwa zweieinhalb Jahrzehnte die Entstehung des als Substantiv verwendeten Begriffs ›Gegenwart‹ und damit einhergehend auch das vertraute Sprachspiel der Trias von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ebenfalls auf das letzte Drittel des 18. Jahrhunderts (vgl. Lehmann 2020, 254). Festzuhalten bleibt der Zusammenhang von Geschichtsbewusstsein und Fragen nach der Gegenwart: Wenn Gegenwart thematisch wird, hat sie ihre Selbstverständlichkeit verloren. Dieses Fragen nach der Bedeutung der eigenen Zeit und Zeitgenossenschaft für die Analyse von Literatur begleitet die germanistische Forschung während der gesamten Moderne. Im Sound der 1950er hörte sich das u.a. so an: »Gegenwart ist immer die noch fragwürdige, das Fragens würdige, noch nicht erledigte Zeit.« (Strich 1960, 9). Was sich verändert, sind die Antworten und die konkreten Perspektivierungen.
11
12
»Aggregate der Gegenwart«
Anknüpfend an neuere Studien zur Gegenwartsliteratur (vgl. u.a. Lehmann/ Stüssel 2020; Ammon/Herrmann 2020), die hier auf die breite kulturwissenschaftliche Forschung zu Erinnerung und Gedächtnis sowie auf den gesamten Zeitraum der Moderne bezogen neue Facetten erhalten, zielt das Erkenntnisinteresse des vorliegenden Bandes ganz explizit auf die Verbindung von Erinnerungspolitik und Zeitdiagnostik in der modernen und spätmodernen Literatur unter dem Blickwinkel der Aushandlung von Zugehörigkeit bzw. kollektiven Selbstverständnissen. Verknüpft wird so eine historische Perspektive mit der gesellschaftspolitischen Frage nach der Relevanz literarischer Darstellungen für gesellschaftliche Selbstaufklärungsprozesse.
2. Die im Band versammelten Beiträge basieren zum überwiegenden Teil auf Vorträgen, die auf der Tagung »Aggregate der Gegenwart« – Entgrenzte Literaturen und gegenläufige Erinnerungen gehalten wurden, die vom 5.–7. Oktober 2021 in Aachen stattfand. Mit der Tagung wurden zwei Jubiläen markiert: zum einen die 30. Jahrfeier der Aachener Ludwig-Strauß-Professur, die ursprünglich als einzige Professur in Deutschland dem Lehr- und Forschungsgebiet der »deutsch-jüdischen Literaturgeschichte« gewidmet war und von 1992 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2009 von Hans Otto Horch bekleidet wurde. Seinem Engagement verdankt sich die Etablierung der Professur. Benannt ist sie nach dem 1892 in Aachen geborenen Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Arieh Ludwig Strauss, der 1935 vom NS vertrieben mit seiner Familie nach Palästina auswanderte. Zum anderen bot der sechzigste Geburtstag von Stephan Braese Anfang des Jahres 2021 einen geeigneten Anlass, an seine Forschung anknüpfend aus einer Vielzahl von Perspektiven über das Verhältnis von Gegenwartsliteratur und Erinnerung nachzudenken. Als Stephan Braese die Ludwig-Strauß-Professur 2009 übernahm, wurde das Lehr- und Forschungsgebiet gleich in zweifacher Weise erweitert und beschäftigt sich seither mit der Europäisch-jüdischen Literaturund Kulturgeschichte. Thematisch an der kulturwissenschaftlichen Wende in den Literaturwissenschaften orientiert und zugleich mit der Übernahme einer europäischen Perspektive sowohl den Sprachraum des Deutschen als auch den immer noch in der Germanistik vielfach Grenzen setzenden Rahmen der Nationalliteratur überschreitend, versteht sich auch die Tätigkeit des neuen Inhabers der Professur. In seiner Studie Eine europäische Sprache. Deutsche Sprachkultur von Juden 1760–1930 (Braese 2010) wird die neue Denomination der Ludwig-Strauß-Professur gewissermaßen paradigmatisch eingeholt, indem sie die »deutsche Sprachkultur von Juden« als eine genuin europäische und das heißt als transnationale Sprache ausweist.
Hahn/Kruschwitz/Waldschmidt: Literarische Gegenwartsanalysen
Ganz in diesem Sinne begründete der jetzige Ludwig-Strauß-Professor u.a. auch die deutsch-französischen Franz Hessel Lectures. Braeses Forschungen setzten in den 1990er Jahren zunächst mit der Thematisierung gegenläufiger Gedächtnisse am Gegenstand der literarischen Auseinandersetzung mit der Shoah ein. Ein zweijähriges Forschungsstipendium des FranzRosenzweig-Forschungszentrums für deutsch-jüdische Literatur und Kulturgeschichte an der Hebräischen Universität in Jerusalem in den Jahren 1995 bis 1997 beförderte entscheidend die Arbeit an seiner Habilitationsschrift. 1996 erschien die Dissertation Das teure Experiment: Satire und NS-Faschismus (Braese 1996). Ebenfalls noch vor der Habilitation veröffentlichte Braese zusammen mit Holger Gehle, dem früh verstorbenen Aachener Kollegen, mit Doron Kiesel und Hanno Loewy 1998 einen grundlegenden Sammelband unter dem Titel Deutsche Nachkriegsliteratur und der Holocaust. Der Band geht zurück auf ein im März 1997 in Arnoldshain veranstaltetes internationales Symposion, dessen Titel im Unterschied zur Buchausgabe noch ein »Gegenüber« vorangestellt war. Das ist programmatisch zu verstehen, denn als Ausgangspunkt der Tagung, so hoben die Herausgeber in ihrer Einleitung hervor, sei »mit Blick auf die deutsche Nachkriegsliteratur von einem objektiven Gegenüber jüdischer und nichtjüdischer Autoren auszugehen« (Braese et al. 1998a, 10). Weil den nichtjüdischen deutschsprachigen Autor:innen ein »eigenes Erfahrungs- und Anschauungskontinuum vom Vernichtungsprozeß« (Braese et al. 1998a, 11) fehle, müsse die analytische Arbeit am Thema auf die Geschichte der Berührungen zwischen den vermittelten Diskursformen mit den literarischen zielen. In seiner Habilitationsschrift, dem Standardwerk Die andere Erinnerung. Jüdische Autoren in der westdeutschen Nachkriegsliteratur (Braese 2001), beleuchtet Braese umfassender die im westdeutschen Literaturbetrieb lange marginalisierte Erinnerung jüdischer Autor:innen deutscher Sprache. Dabei stehen die Werke von Grete Weil, Edgar Hilsenrath und Wolfgang Hildesheimer im Zentrum, deren Texte aus der Erfahrung des Genozids entstehen. Innerhalb der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur bilden sie ein »objektives Gegenüber«, eine »andere Erinnerung«, die in großen, diskursgeschichtlich informierten Lektüren vor dem Hintergrund einer als »Vergangenheitsbewältigung« geschönten Erinnerungskultur rekonstruiert wird. Die »psychischen Grundsachverhalte«, gleichsam die psychischen Dispositionen der deutschen Bevölkerung nach dem Nationalsozialismus, bezeichnet Braese als »Aggregate der Gegenwart des Nationalsozialismus« (Braese [2001] 2002, 24). Die in der Einleitung zur Anderen Erinnerung eingenommene erkenntniskritische Perspektive überschreitet dabei bewusst die Fächergrenzen: Eingeholt werden sollen »jene kritischen« transdisziplinären Bemühungen, die »zuweilen an den Schnittpunkten vitaler aktueller Kontroversen« ansetzten, um genauer zu begreifen, welcher Anteil der NS-Vergangenheit an der sozialen und politischen Gegenwart in der Bundesrepublik zukomme (ebd.). Ein »Signalname« für ein derartiges Bemühen, dem sich Braese verpflichtet weiß, sei der des Historikers Dan Diner. Verortet
13
14
»Aggregate der Gegenwart«
innerhalb der von Maurice Halbwachs begründeten Theoriebildung zur Frage kollektiver Erinnerung, spricht er Diners Analysen »spezifische[r] Gemengelagen gegenläufiger Gedächtnisse« im historischen »Nachraum« des Nationalsozialismus eine herausgehobene Bedeutung zu (Braese [2001] 2002, 24). Dessen Essays aus dem explizit genannten Band Kreisläufe. Nationalsozialismus und Gedächtnis (1995a) fokussieren stark auf die deutsche Vereinigung und die Frage, inwiefern sich das deutsche Kollektiv nach Ablauf der »geborgte[n] Zeit« der alten Bundesrepublik wieder »Rückversicherung im Gedächtniskontext einer sich vornehmlich ethnisch bestimmenden Nation« suchen würde (Diner 1995b, 121). Vor allem aber ist der Einfluss von Klaus Briegleb unverkennbar, dessen Aufsatzsammlung Unmittelbar zur Epoche des NS-Faschismus. Arbeiten zur politischen Philologie 1978–1988 (Briegleb 1989) neben der gemeinsam mit Sigrid Weigel verfassten Geschichte der Gegenwartsliteratur seit 1968 (1992) als maßstabsetzend für die Analyse des Verhältnisses »zwischen NS-Vergangenheit und literarischer Gegenwart« (Braese [2001] 2002, 22) angeführt wird. Briegleb hat seiner Anthologie eine längere Passage aus Walter Benjamins literaturwissenschaftlicher Standortbestimmung von 1931 vorangestellt, aus der hier zwei Abschnitte zitiert seien: Wenn frühere Germanistik die Literatur ihrer Zeit aus dem Kreise ihrer Betrachtung ausschied, so war das nicht, wie man es heute versteht, kluge Vorsicht, sondern die asketische Lebensregel von Forschernaturen, die ihrer Epoche unmittelbar in der ihr adäquaten Durchforschung des Gewesenen dienten [Herv. d. Hg.] […]. An Stelle dieser Haltung ist der Ehrgeiz der Wissenschaft getreten, an Informiertheit es mit jedem hauptstädtischen Mittagsblatt aufnehmen zu können. (Benjamin [1931] 1974, 12f.; zit. in Briegleb 1989, [5]) Der entscheidende Passus, der den Kern der Traditionslinie Benjamin – Briegleb – Braese ausmacht, ist der folgende: Es handelt sich ja nicht darum, die Werke des Schrifttums im Zusammenhang ihrer Zeit darzustellen, sondern in der Zeit, da sie entstanden, die Zeit, die sie erkennt – das ist die unsere – zur Darstellung zu bringen. Damit wird die Literatur ein Organon der Geschichte, und sie dazu – nicht das Schrifttum zum Stoffgebiet der Historie zu machen, ist die Aufgabe der Literaturgeschichte. (Benjamin [1931] 1974, 14; zit. in Briegleb 1989, [5]) Benjamin geht es bei der Beschäftigung mit Geschichte um Zeiterkenntnis oder Zeitdiagnostik, die Literatur erscheint in seiner Philologie als Werkzeug der Erkenntnis. Brieglebs Reformulierung der von Benjamin dargelegten Aufgabenstellung für die Literaturwissenschaft lautet: »Wie aber soll das Werk, das nun seinerseits weitersprechen, erträglich werden will, sich ›einfinden‹ in einer fortschrittlichen Verabredungsgesellschaft, die das Makro-Aeon, die Epoche des
Hahn/Kruschwitz/Waldschmidt: Literarische Gegenwartsanalysen
NS-Faschismus, zwar ganz zu versprachlichen strebt, aber nicht ganz erträgt?« (Briegleb 1989, 43, Herv. i. O.) Die von Benjamin im obigen Zitat angesprochene ›Unmittelbarkeit‹ bezog Briegleb auf sein Verhältnis und das seiner Generationsgenoss:innen zur NS-Vergangenheit: Wir sehen, daß sich die Unmittelbarkeit zur Epoche des NS-Faschismus auf zweierlei Art bekundet. Die eine wird im Diskurs reproduziert, im professionalisierten Meinen, im korrupten Gelaber direkt an den Tatsachen: wie getan, so verschoben, geschützt, geleugnet. Die andere spricht aus den geleugneten Tatsachen selbst; ihre ›Sprechstelle‹ im Diskurs ist der Diskursbruch dort, wo der Zwang der Kontrollen die tragfähige ›Indirektisierung‹ des Geleugneten nicht mehr erzielt. (Briegleb 1989, 39, Herv. i. O.) An späterer Stelle setzt sich Briegleb als Angehöriger des Geburtsjahrgangs 1932 noch deutlicher selbst in Beziehung zum Unmittelbarkeitsparadigma seiner philologischen Perspektivierung: Erst ›1977‹, am Ausgangspunkt dieses Buches, ist mir meine Unmittelbarkeit zur Epoche des NS-Faschismus bewußt geworden. Unterm Schock, daß auch ich die ›unverstandene Entdeckung‹ von 1945 nun zu wiederholen habe und daß sie sich mit der Gewalt einer sich selbst entdeckenden Vergangenheit aufzudrängen schien, öffneten sich Wege der philologischen Erinnerung im kritischen Gegenwartsbezug. (Briegleb 1989, 79) Unmittelbarkeit als Frage des Verhältnisses von individueller Subjektposition (LaCapra) zur NS-Vergangenheit verändert sich mit dem Generationenwechsel. Sie bleibt aber verbunden mit dem Zusammenhang von partikularer Zugehörigkeit und universalistischem Anspruch. Das zehnte Kapitel der Anderen Erinnerung eröffnet daher mit einem Zitat aus Alfred Anderschs Ephraim über das Wort ›Jude‹, um die westdeutsche Diskurspolitik aufzuzeigen, die jüdischen Partikularismus und universelle Geltung literarischer Texte ausschließt. Ein wichtiger Text, den Braese an dieser Stelle analysiert, ist Marcel Reich-Ranickis Rede Im magischen Judenkreis (1970), worin es um das Benennen jüdischer Autorschaft in der Gegenwart geht. Reich-Ranicki suche »zu verdeutlichen, daß gerade wegen der NS-faschistischen Vernichtungspolitik einschließlich ihrer direkten und indirekten Folgen für die deutsche Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur fortgesetzt, genauer: jetzt endlich vom Judentum, von Werken jüdischer Autoren gesprochen werden müsse«. Dass der Nationalsozialismus Bücher und Menschen verbrannt habe, sei dabei nicht lediglich ein »Sachverhalt […] der ›Vergangenheit‹, sondern ›etwas, das in unsere Gegenwart hineinragt und hineinragen muß‹« (Braese [2001] 2002, 489, Herv. i. O.). Am Ende seiner Studie kommt Braese auf das sogenannte Versöhnungsgespräch vom 12. Dezember 1998 zu sprechen, bei dem Martin Walser auf den Kritiker
15
16
»Aggregate der Gegenwart«
seiner »Sonntagsrede«, Ignatz Bubis, den damaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, trifft, in der der Autor seinem jüdischen Widersacher vorhält, er sei bereits »in diesem Feld beschäftigt« gewesen, »da waren Sie noch mit ganz anderen Dingen beschäftigt« (Bubis et al. [1998] 1999, 442). Diese kurze Passage, die Braese aus dem Gespräch wiedergibt, veranschauliche – wie an dieser Stelle resümierend festgehalten wird – im Kern »jene Erinnerungsdifferenz und Erinnerungskonkurrenz, deren paradigmatische Bedeutung für die Stellung jüdischer Autoren deutscher Sprache in der westdeutschen Nachkriegsliteratur im Mittelpunkt« seiner Untersuchung stünde (Braese [2001] 2002, 563). Bei Walser handelt es sich um einen Überbietungsgestus, der auf die Leugnung der »kategoriale[n] Geschiedenheit« (Braese [2001] 2002, 564) hinauslaufe. Mit aller erdenklichen »diskurspolitischen Entschiedenheit« sei hier vorgetragen worden, »daß es für heutige Ansprüche irgend relevante Unterschiede in der Nähe, in der Unmittelbarkeit zur NS-Erfahrung zwischen Juden und Deutschen nicht gibt«, schon gar nicht, »wenn es um den Anspruch einer authentischen und integralen Sprache über und Erinnerung an die Jahre des NS-Regimes« ginge (Braese 2002, 564).
3. Mehr als zwanzig Jahre nach der Veröffentlichung der Anderen Erinnerung scheinen uns, nicht nur auf Grund des weiteren Generationenwechsels, die Diskursregeln und -formationen mit Blick auf die NS-Vergangenheit vielfach verschoben und verändert. Im kritischen Dialog mit Braeses Analysen lassen sich die weiterhin drängenden Fragen auf folgende Weise erneut stellen: Wie verhält sich der literarische Diskurs der Gegenwart zu den aktuellen vergangenheitspolitischen Kontroversen? Welche Erinnerungsdynamiken lassen sich heute beobachten? Wie ist es gegenwärtig um die zeitweilig besonders gerühmte deutsche ›Erinnerungskultur‹ bestellt, die unterdessen von unterschiedlicher Seite Zurückweisung und Kritik erfährt? Hier gilt es nicht zuletzt die Historizität der eigenen Erkenntnisprozesse vor dem Hintergrund der Flüchtigkeit aller Gegenwart zu reflektieren. Die Entstehung dieses Sammelbandes nimmt mit den Vorbereitungen für das Kolloquium an der RWTH Aachen im Herbst 2021 ihren Anfang und findet im Frühjahr 2023 mit der Ausarbeitung dieser Einleitung und der Drucklegung ihren Abschluss. In diesen Zeitraum fällt die Zäsur des 24. Februar 2022, die unsere gegenwartsreflexive Perspektive beeinflusst. Auch wenn, bis auf einen Beitrag, die Aufsätze des Bandes den Krieg nicht zum Thema machen, bestätigt sich im Lichte der Ereignisse die Virulenz unserer Ausgangsfragen. Dabei stehen die vermeintlichen und tatsächlichen Errungenschaften der deutschen Erinnerungskultur nicht erst seit dem (neuerlichen) russischen Angriff auf die Ukraine zur Debatte, sondern werden seit ihrer allmählichen Etablierung seit
Hahn/Kruschwitz/Waldschmidt: Literarische Gegenwartsanalysen
den 1980er Jahren, vor allem aber in der letzten Zeit immer wieder kontrovers diskutiert. So konstatierte z.B. im Frühjahr 2020 der Journalist Christian Staas ein »Ende der Selbstgewissheit«: Ausgehend von den ambivalenten Ergebnissen einer im Auftrag der ZEIT vom Institut policy matters durchgeführten Befragung unter 1044 Bundesbürger:innen ab 14 Jahren zum Verhältnis der deutschen Bevölkerung zu ihrer Geschichte – während 53 Prozent der Befragten einen Schlussstrich unter die NS-Vergangenheit ziehen wollen, halten es z.B. 77 Prozent für ihre Pflicht, Holocaust und Diktatur nicht in Vergessenheit geraten zu lassen1 –, erinnert er an den engen Zusammenhang zwischen der politischen Kultur in Deutschland und der Haltung der Deutschen zur NS-Vergangenheit, wobei er Fragen zum Geschichtsverhältnis pointiert »Identitätsfragen« nennt (Staas 2020, 17). Während Staas vor allem die Angriffe der Neuen Rechten auf die Erinnerungskultur thematisiert, diskutiert Assmann in ihrer als »Intervention« (Assmann [2013] 2020) gekennzeichneten Studie unterschiedliche kritische Forschungsbeiträge zum Umgang mit der NS-Vergangenheit. Gegen Kritiker:innen deutscher Opferidentifikation wendet sie ein, die »emphatische Identifikation mit den Opfern der Deutschen«, vor allem in Folge der im Januar 1979 im deutschen Fernsehen gezeigten Holocaust-Serie, sei nicht als »Irrweg und Skandal der deutschen Erinnerungskultur« anzusehen, sondern bilde vielmehr »deren Voraussetzung und Grundlage« (Assmann [2013] 2020, 63). Dem lässt sich zustimmen, denn ohne die etwa in den öffentlichen erinnerungskulturellen Debatten der 1980er und 1990er Jahre, zum Teil noch gegen starken Widerstand, zum Ausdruck gelangende Fähigkeit zur Perspektivübernahme (etwa Schily 1997 in der Bundestagsdebatte zur zweiten »Wehrmachtsausstellung«; vgl. Reemtsma 2022, 97), ohne sich freilich selbst als Opfer zu imaginieren, kann ein Lernen für die Gegenwart aus den deutschen Gewaltverbrechen wohl kaum gelingen. Ganz ähnlich lässt sich ein Artikel zur Erinnerung an den Rosenstraßen-Protest ab dem 27. Februar 1943 verstehen, worin Eva Menasse mit Bezug auf die Historikerin und Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung Stefanie Schüler-Springorum Erinnerungskultur, präzisiert als fortgesetztes »Studium der NS-Zeit«, als »Demokratieerziehung« deutet (Menasse 2023, 11). Solchen kritischen Verteidiger:innen einer selbstreflexiven Erinnerungskultur, die im Bewusstsein des Bruchs mit der NS-Vergangenheit gegenwartsbezogen argumentieren, stehen Beobachtungen der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek zur Seite, die der extremen Rechten eine Unfähigkeit zur Scham zuschreibt. Diese ›Schamlosigkeit‹ der radikalen Rechten sieht Jelinek mit einer Vorstellung von
1
Der offensichtliche Widerspruch, dass einzelne Befragte zugleich einen Schlussstrich unter die NS-Vergangenheit befürworten und sich trotzdem verpflichtet fühlen, Holocaust und Diktatur nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, wird von Staas explizit thematisiert, wenn er schreibt, die Ergebnisse könnten »widersprüchlicher kaum sein« (Staas 2020, 17).
17
18
»Aggregate der Gegenwart«
Zeit als einem schlichten »Nacheinander des Jetzt« verknüpft, »wo andere, […] Brüche, Eselsohren, Kniffe in die Zeit zu machen versuchen« (Jelinek 2008). Dass sich die Neue Rechte grenzüberschreitend vernetzt, hat Anlass dazu gegeben, bestimmte Erscheinungsformen und Charakteristika extrem rechter Politik und Weltdeutung global miteinander zu vergleichen. So greift etwa der israelische Psychoanalytiker Eran Rolnik in einem aktuellen Essay Jelineks Beobachtungen auf und nutzt diese zur Analyse der aktuellen israelischen Staatskrise Anfang 2023, die durch die sogenannten Justizreformen der extrem rechten Regierungskoalition unter Benjamin Netanjahu entstand. Die Tendenz der politischen Rechten bestünde darin, sich zu jedem beliebigen historischen Moment als »Maßstab des Wahren und […] Inbegriff des Normativen« zu begreifen; deshalb stelle die Gegenwart, darin der Religion ähnlich, für die Rechte keinen »Faktor« dar, der ein Nachdenken erfordere (Rolnik 2023). Mit Blick auf die europäische Rechte wird festgehalten, sie werde den Genozid an den Jüdinnen und Juden Europas niemals als »Zeitenwende« oder »Zivilisationsbruch« begreifen und darin keinen Ausdruck des »moralischen, politischen wie ideologischen Versagens ihres Menschenbildes« erkennen (ebd.).2 Schamlosigkeit verhindert, so lässt sich ein zentraler Punkt aus diesen Überlegungen aufgreifen, sich selbstkritisch in ein Verhältnis zu den historischen Verbrechen der eigenen Gruppe, des eigenen Kollektivs, der Nation etc. zu setzen. Mit Hinweis auf die deutschen Verbrechen, den Holocaust und den Vernichtungskrieg im Osten Europas, nicht aber den erst in den letzten Jahren in den Blick genommenen Völkermord an den Herero, begründete die deutsche Außenpolitik lange Zeit, warum sie angegriffenen Staaten – jenseits der Nato – keine Waffenhilfe zukommen lasse. Noch in den Wochen vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, als bereits 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen waren, erklärte die deutsche Außenministerin Baerbock, die deutsche Regierung »müsse sich wegen der historischen Belastung Deutschlands bei militärischer Zusammenarbeit zurückhalten« (zit.n. Gnauck 2022). In »Wendeereignissen« wie dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine am 24. Februar 2022, den Assmann neben den »Mauersturz« des 9. November 1989 stellt, kulminierten, emble2
Nicht nur, weil Rolnik explizit den von Diner geprägten Ausdruck des »Zivilisationsbruchs« anführt (Diner 1988), liegt es nahe, an dieser Stelle auf dessen Unterscheidung zweier unterschiedlicher Formen des kollektiven Gedächtnisses hinzuweisen. So grenzt Diner das kollektive Gedächtnis eines Gemeinwesens, das primär um dessen Institutionen kreist und darüber die Zugehörigkeit seiner Angehörigen vermittelt, von dem eher restriktiven, durch einen »ethnische[n] Ethnos« (Diner 1995b, 116) bestimmten, seine Zugehörigkeit also vor allem über eine gemeinsame Herkunft begründenden kollektiven Gedächtnis ab. Ganz ähnlich wie Jelinek und Rolnik erscheint auch bei Diner der Gegenwartsbezug im Zusammenhang mit der inklusiveren, also der hier zuerst beschriebenen Form eines kollektiven Gedächtnisses: Dessen »Inhalte […] unterstehen vornehmlich der Geltungsmacht der Gegenwart – dem politischen Prinzip des tagtäglichen Plebiszits« (ebd.).
Hahn/Kruschwitz/Waldschmidt: Literarische Gegenwartsanalysen
matisch zugespitzt, »historische Veränderungen« (Assmann 2023, 253). In diesem Sinne ist auch der von Bundeskanzler Scholz verwendete Begriff der »Zeitenwende« zu verstehen, der Putins Bruch mit dem Völkerrecht als historische Zäsur in der Geschichte Europas und der internationalen Ordnung ausweist (Scholz 2022). Die im Februar 2023 erschienene Anthologie Aus dem Nebel des Krieges (Mishchenko/Raabe 2023) wird in einer Besprechung als »eines dieser Bücher« gerühmt, »die ihre Zeit auf jeder Seite ein[-] und auszuatmen scheinen, als seien sie die Lunge, in der der Sauerstoff unserer Gegenwart verarbeitet wird« (Rühle 2023). Versammelt sind hier aktuelle Texte von vor allem ukrainischen, einer russischen und einigen wenigen deutschen Schriftsteller:innen, Wissenschaftler:innen und Journalist:innen, in denen sich Elemente von Reportage, Tagebuch, wissenschaftlicher Analyse und Kommentar zumeist in Form von Essays verbinden. In einer darin veröffentlichten Reflexion über das Verhalten deutscher Intellektueller, die unmittelbar nach dem russischen Überfall auf die Ukraine dafür eintraten, dem angegriffenen Land keine Waffen zu liefern, schreibt der Osteuropahistoriker Karl Schlögel, der Krieg habe ›uns‹ »den Boden unter den Füßen weggezogen« und mit einer uns bisher erspart gebliebenen Gewalterfahrung konfrontiert: »Er hat uns auf die Höhe der Gegenwart katapultiert und einen Erfahrungsraum geöffnet, auf den wir nicht vorbereitet waren.« Weiter heißt es: »Wir sind in eine Gegenwart eingetreten, in der es keine Sicherheiten mehr gibt und alles, was wir für selbstverständlich gehalten haben, aufgehört hat selbstverständlich zu sein.« (Schlögel 2023, 247). Schlögel geht dabei auch mit der deutschen Vergangenheitsbewältigung scharf ins Gericht. So sei der Verweis auf sie und die »Einzigartigkeit der deutschen Erinnerungskultur […] längst zur Flucht aus der Gegenwart und zum Ersatz für die Bewältigung der Gegenwart geworden« (Schlögel 2023, 248). Bereits im März 2023 hatte der Historiker von einem »Weckruf der Gegenwart« geschrieben und davon, die Deutschen hätten Grund genug, »sich angesichts ihrer Vergangenheit gegenüber den von ihnen geschundenen Völkern besonders verantwortlich zu fühlen«, die sie nicht moralisch belehren, sondern stattdessen im Zweifel auch mit Waffen unterstützen sollten (Schlögel 2022). Auch an dieser Stelle bringt Schlögel das, was er als politisches Versagen von Intellektuellen kritisiert, explizit mit der deutschen Erinnerungskultur in Zusammenhang: »Die […] unter unseren Augen begangenen Verbrechen der russischen Armee« ließen nicht mehr zu, »in einer Erinnerungskultur und Gedenkarbeit zu verharren, die schon seit geraumer Zeit zum Ersatz für die Konfrontation mit der Gegenwart geworden ist« (Schlögel 2022). Mit Marcel Beyer und Alexander Kluge sind es zwei Autoren, die mit ihrer Literatur zur gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus Bedeutendes geleistet haben, die im Frühjahr 2023 in aktuellen Büchern aus entgegensetzten Perspektiven den russischen Krieg gegen die Ukraine kommentieren (Beyer 2023; Kluge 2023). Drei Jahre vor der Uraufführung von Peter Weiss’ Auschwitz-Drama Die Ermittlung polarisierte Kluges Anthologie Lebensläufe
19
20
»Aggregate der Gegenwart«
1962 die deutsche Öffentlichkeit, der er in neun Erzählungen eine Kritik des instrumentellen Rationalismus im NS und der Gegenwart vorlegte. Insbesondere mit der literarischen Konstruktion eines protokollierenden NS-Mediziners beim Menschenversuch in der Erzählung Ein Liebesversuch entwarf der damals gerade Dreißigjährige eine von Kälte und Distanz geprägte Erzählperspektive »zur Darstellung einer entfremdeten Menschheit« (vgl. Hahn 2015, 228 u. 231). Gerade weil sich Beyer und Kluge auf das Genre des »faktualen« Erzählens beziehen – Beyers Buch veröffentlicht seine Vorlesungen der Wuppertaler Poetikdozentur, die Erkundungen dieses Genres gewidmet ist, aus dem September 2022 –, veranschaulichen ihre gegensätzlichen Positionen zum Krieg in der Ukraine wie unter dem Brennglas aktuelle Erinnerungskonflikte mit Blick auf die »Aggregate der Gegenwart des Nationalsozialismus« (Braese [2001] 2002, 24). Selbst so eindeutig erscheinende Formeln wie: »Nie wieder Krieg« und: »Nie wieder Auschwitz« werden für unterschiedliche politische Zwecke herangezogen. Denn ›Lehren‹ aus der Vergangenheit müssen von sich wandelnden Gedächtniskollektiven jeweils neu gelernt werden. Vor allem plurale, offene Gesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass sie unter den Vorzeichen der jeweiligen Gegenwart aushandeln, in welcher Form sie sich auf ihre »multidirektionalen« (Rothberg) Gedächtnisse beziehen wollen. Die Erinnerungskultur ist in Bewegung geraten, unter dem Eindruck der Gegenwart und nicht zuletzt mit Hilfe einer entgrenzten deutschsprachigen Literatur, die, oft genug von Flucht, Exil und Mehrsprachigkeit geprägt, länger schon aus ihrem nationalen Container ausgebrochen ist und ohnehin in globalem Austausch steht (und immer schon stand). Das Grauen des gegenwärtigen Kriegs gegen die Ukraine verstärkt diesen Prozess.
4. Der Band widmet sich nicht nur (für den Zeitraum der Konzeption des Bandes vor Februar 2022) aktuellen »Symptombildungen« (Braese 1998, 333) im Nachraum der deutschen Verbrechen, sondern bezieht sich ebenso auch auf historische Texte und ihren Umgang mit Geschichte. Konsequent beginnt er mit einem Aufsatz zu Sigmund Freud, der die erste der vier Sektionen des Bandes unter dem Titel Vergegenwärtigung, Gespenster und aufblitzende Erinnerung eröffnet. »Anfangen mit Freud« hieß ein im Wendejahr 1989 gehaltener Vortrag des 2020 verstorbenen Berliner Religionsphilosophen Klaus Heinrich, der gegen das Vergessen der Psychoanalyse nach 1945 in Deutschland lehrte und dachte. Heinrich nennt in diesem religionsphilosophischen Schlüsseltext, der eine Perspektive der ersten deutschen Nachkriegsgeneration auf Freud als Aufklärer und Kulturtheoretiker formuliert, »objektive Erinnerung […] gerade die, die subjektiv weiterwirkt« (Heinrich [1992] 1997, 10). Liliane Weissberg untersucht in ihrem, den Band eröffnenden Aufsatz unter dem Titel
Hahn/Kruschwitz/Waldschmidt: Literarische Gegenwartsanalysen
»Freuds Zuhause«, wie sich in den Fotografien von Edmund Engelman, die er im Jahr von Freuds Emigration in dessen Wohnung in der Berggasse 19 in Wien, zunächst ohne das Wissen des Hausherrn, aufnahm, unterschiedliche Memorialinteressen manifestieren. Die folgenden drei Beiträge wenden sich der Vergegenwärtigung zu als Art und Weise, wie literarische Texte Vergangenes, ggf. auch eine verdrängte Vergangenheit, präsent werden lassen und dabei zugleich selbstverständliche Gegenwart irritieren und in Frage stellen. Caroline Torra-Mattenklott geht der narrativen Einbindung dieses Irritationspotenzials, den Leerstellen im Erzählen, nach, indem sie Gespenster und Wiedergängerinnen, unklare Erscheinungen und Wahrnehmungen des gerade nicht Sichtbaren in Rilkes Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910) und in Marie NDiayes Autoportrait en vert (2005) thematisiert. Beide Texte liest sie als Geschichten über Schuld und Trauma, in denen Gespenster ebenso im Sinne Freuds als »Abkömmlinge des Unbewussten« erscheinen, wie sie, mit Aleida Assmann gesprochen, als Metaphern des kulturellen Gedächtnisses auftauchen. Vivian Liskas Beitrag zu Ilse Aichingers späterer Kurzprosa geht den Erinnerungsspuren nach, die Aichingers Texte in die Beschreibungen der Gegenwart hineinlegen, und zeigt, wie dadurch Zeitordnungen aufgelöst und die vergangene Gewaltgeschichte in die Gegenwart eingeschrieben wird – und wie diese als Grundlage einer »Poetik des Widerstands und des Gedenkens« fungiert. Auch Birgit Erdle wendet sich dem Werk Aichingers zu, um nun auch die Erschütterung zeitlicher Kontinua als Gegenstand und Redeweise von Aichingers Texten auszumachen, die ein punktuelles, jenseits der – immer wieder verweigerten – Zusammenhänge sich bewegendes Schreiben konstituieren; im Punktuellen und in den paradoxen Wendungen des Gesagten aber entstehen Augenblicke oder ein Aufleuchten von Erinnerungen, die in den Text hineinholen, was an Vergangenem an der Grenze zum Sagund Tradierbaren liegt und von dem Mitteilung zu machen den Texten dennoch aufgetragen ist. Die zweite Sektion unter dem Titel Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität knüpft daran an, dass (kritische) Gegenwartsdeutungen und ihre Verbindung mit Geschichtsbewusstsein und Erinnerungsdiskursen ein historisch konstantes und gerade die politischen Krisennarrative des 19. und 20. Jahrhunderts begleitendes Phänomen darstellt. Daher wendet sie sich in diesem Sinne der politischen Literatur und ihren Entwürfen von Rückblicken als Zeitdiagnosen der eigenen Gegenwart zu. So prägt die Frage nach dem zeitdiagnostischen Potenzial publizistischen und literarischen Schreibens die Texte von Ludwig Börne, und zwar, wie Daniel Weidner herausarbeitet, indem sie als Selbstverständnis und Anspruch des modernen Zeitschriftstellers auftritt. Weidner zeigt, wie Börnes Texte, insbesondere die Briefe aus Paris, als Schreiben für und von der Gegenwart nicht nur eine eigene Metaphorik des Gegenwärtigen entwickeln, sondern auch einer dezidiert modernen Dynamik und Schnelllebigkeit sowie dem Einbezogensein des eigenen Schreibens in diese Ausdruck verleihen wollen. Der Aufsatz von Yashar Mohagheghi hingegen wendet
21
22
»Aggregate der Gegenwart«
sich Kracauers soziologischen Studien zu, ihrer Vorliebe für kleine Formen und ihrer Analyse eines ideologischen Gehalts, den Kracauer in alltäglichen Erscheinungen, in einer konkreten Materialität der Dinge und Verhältnisse aufspürt. Er führt vor, wie und mit welchen epistemischen Implikationen in solchen Analysen die Gegenwartsbeschreibung zu einem Erfassen gesellschaftlicher Strukturen der Moderne und darin zu Gegenwartskritik werden soll. Nicht nur in Vormärz und Weimarer Republik, auch im Exil wird eine neue Dringlichkeit von gültigen Urteilen über die Gegenwart und von politischen Aufträgen an literarische Gegenwartdeutungen noch einmal formuliert. Der Beitrag von Christine Waldschmidt fragt nach dem Deutungspotenzial des erinnernden Rückblicks, wie es die Exilromane Die Toten bleiben jung (1949) von Anna Seghers und November 1918 (1939/1948–50) von Alfred Döblin in ihrer jeweiligen Auseinandersetzung mit der Novemberrevolution 1918 aufrufen, und danach, wie diese erinnernden Rückblicke eine – wenngleich prekäre – engagierte bzw. kritische Zeitdiagnose noch einmal ermöglichen sollen. Carsten Jakobi zeichnet anhand von Hitler-Karikaturen und -satiren aus den 1920er bis 1930er Jahren sowie ab 1945 nach, wie die Einschätzung der eigenen Gegenwart und ihrer politischen Verhältnisse die Maßstäbe wie die Objektivitätsausweise und die Wirkungsideale der Satiren bestimmt. Ebenfalls von der Satire her kommt die Stuttgarter Autorin Anna-Katharina Hahn, deren zeitdiagnostische, häufig in der baden-württembergischen Landeshauptstadt angesiedelte Erzählprosa, die Jakob Hessing untersucht, sich gegen Geschichtslügen im Kulturbetrieb stellt. In der dritten Sektion vereint der Band – unter dem Titel Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945 – Analysen zur Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit und der Geschichte des Terrors im gesamten Zeitraum der deutschsprachigen Literatur nach 1945. Beginnend mit Nicolas Bergs Relektüren zu den mit teils beträchtlichem zeitlichen Abstand veröffentlichten Erinnerungstexten von Sebastian Haffner und Horst Krüger und Primus-Heinz Kuchers Einzelanalyse des überhaupt erst 2018 veröffentlichten, im Londoner Exil zwischen 1944 und 1948 entstandenen Prosatexts Inferno von Mela Hartwig, zielt die Sektion auf ein Sichtbarmachen divergenter Perspektiven auf den NS und dessen Nachgeschichte in der Literatur. Ausgehend von den jüngeren Diskussionen um den ›Gründungsmythos‹ der documenta 1955, der jungen Bundesrepublik sei nur ein Jahr nach dem ›Wunder von Bern‹ gleichsam ein ästhetisch-kultureller Neubeginn im Zeichen einer nach dem NS zurückgeholten Moderne gelungen, untersucht Nike Thurn die Rolle von Ernst Barlach in zwei Erzähltexten von Alfred Andersch und Franz Fühmann. Der Bildhauer Barlach habe genau dem Typus Künstler entsprochen, der dem NS-verstrickten Gründungsdirektor der documenta, Werner Haftmann, half das Bild eines ›anderen Deutschland‹ zu proklamieren. Während solche, mit der Kunst der Moderne verbundenen Entlastungsfantasien auch in der Nachkriegsliteratur einen Ausdruck fanden, wie Thurn zeigt, nimmt Alfred Bodenheimer den kommerziell erfolgreichen, von der Kritik dagegen weitgehend zurückgewiesenen
Hahn/Kruschwitz/Waldschmidt: Literarische Gegenwartsanalysen
Roman Stella (2019) von Takis Würger in den Blick. Bodenheimer fragt danach, wie viel Abweichung von und Verkürzung der historischen Wirklichkeit des Genozids an den europäischen Juden und Jüdinnen sich eine literarische Fiktion erlauben darf, wenn es, wie es Würger für sein Buch reklamiert, darum geht, den Holocaust in der deutschen Gesellschaft bewusst zu halten. Unter Verweis auf die von Nicola Gess untersuchten »Halbwahrheiten« gelangt Bodenheimer zu einem ernüchternden Urteil über Würgers Roman. Abgeschlossen wird die Sektion von einem Aufsatz, in dem Jörn Ahrens Christopher Roths Film Baader (2002 uraufgeführt) analysiert. Ausgehend von drei kurzen persönlichen Erinnerungen zu Filmaufführungen und Diskussionen über Darstellungen der RAF gelangt Ahrens in Anknüpfung an Lorenz Engell zu einer Auffassung von Geschichte (im Sinne von Geschichtsschreibung und anderen Formen der Geschichtsdarstellung) als »Artefakt«, die immer als Verarbeitungsform des Geschehenen zu deuten sei. Die vierte Sektion Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität wendet sich Erinnerungsdebatten über rechte Gewalt und – in einer noch ganz anderen Dimension von dringlicher Aktualität – den Um-Schreibungen von Erinnerung im Dienste (neu-)rechter Ideologie zu sowie der Flankierung dieser Ideologien durch die literarische Produktion wie die intellektuelle Debatte. Jörg Döring eröffnet die Sektion mit einer exemplarischen Untersuchung neurechter Literaturpolitik am Beispiel des Instituts für Staatspolitik in Schnellroda. Insbesondere drei Strategien neurechter Literaturpolitik – die Simulation einer literarischen Leseöffentlichkeit unter neurechten Vorzeichen, eine neurechte Lesepädagogik sowie die Aneignung bzw. Relektüre des klassischen Lektürekanons, verbunden mit der sozialmedial unterstützten Popularisierung eines Gegenkanons – zeigt Döring auf, bevor er exemplarisch eine im Livestream ausgestrahlte Literatursendung zu Horst Langes Kriegsroman Die Leuchtkugeln (1944) analysiert. In dem anschließenden Beitrag zum Erzählband zu oft umsonst gelächelt (2019) von Botho Strauß, dessen SPIEGEL-Essay Anschwellender Bocksgesang von 1993 einen zentralen Anknüpfungspunkt der neuen Rechten bildet, untersucht Hans Kruschwitz das schillernde Geschichtsverständnis des Autors. Der stellt gegen die »Totalherrschaft der Gegenwart« eine mythische Auffassung von Geschichte, die nicht nur deshalb problematisch erscheint, weil sie den Menschen keinen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte einräumt. Mit der langen Dauer des ›emotionalen Gedächtnisses‹ thematisiert Jan Süselbeck einen zentralen Aspekt des Antisemitismus. In einem vielfach kontextualisierten close reading von Peter Handkes Buch Die Lehre der SaintVictoire (1980) weist Süselbeck dort Deutungsmuster des literarischen Antisemitismus nach. Matthias Lorenz ruft in seinem Aufsatz in Erinnerung, dass angesichts des Pogroms in Rostock 1992 eine Solidarisierung jüdischer Interessenvertreter:innen mit den Betroffenen stattfand, die heute weitgehend in Vergessenheit geriet, wohl aber als Vorläufer von gegenwärtigen Solidarisierungen zwischen den Protagonist:innen des jüdischen Kulturmagazins Jalta mit von Rassismus betroffenen
23
24
»Aggregate der Gegenwart«
Künstler:innen gelten kann. Der den Band abschließende Beitrag von Hans-Joachim Hahn beschäftigt sich mit vergangenheitspolitischen Debatten des Sommers 2021. Ausgehend von der These, dass in Deutschland häufig moralische Entscheidungen mit Blick auf die ›deutsche Vergangenheit‹ der NS-Verbrechen gefällt werden, und der Annahme eines Spannungsverhältnisses zwischen Geschichtsschreibung und kollektivem Gedächtnis werden Maxim Billers Kurzroman Der falsche Gruß (2021) sowie Per Leos Essay Tränen ohne Trauer. Nach der Erinnerungskultur (2021) als gegenwärtiger Ausdruck erinnerungskultureller Dilemmata und Kontroversen diskutiert. Am Zustandekommen dieses Bandes haben verschiedene Personen und Institutionen mitgewirkt, denen wir an dieser Stelle unseren verbindlichsten Dank aussprechen möchten. An erster Stelle danken wir allen Beiträgerinnen und Beiträgern sehr herzlich, von denen die meisten bereits auf dem Kolloquium im Oktober 2021 ihre Vorträge vorgestellt und in der Folge zu Aufsätzen ausgearbeitet haben, für ihre Texte. Ein besonderer Dank gilt Klaus Schweizer, dem Besitzer von Wolfgang Hildesheimers Grafik »Der Tod und das Mädchen II« (1984), für die großzügige Erlaubnis, sie auf dem Cover des Bandes abzubilden. Den Brüdern Thomas und Ralph Engelman, die uns den Abdruck einiger Fotografien ihres Vaters Edmund Engelman im Aufsatz von Liliane Weissberg gestatten, fühlen wir uns zu großem Dank verpflichtet. Für die einmalige Abdruckerlaubnis einzelner Karikaturen danken wir der TitanicRedaktion. Der Autorin Marie NDiaye danken wir dafür, dass wir zwei Fotos aus ihrem Buch Autoportrait en vert abbilden dürfen. Darüber hinaus möchten wir Hans Otto Horch dafür danken, dass er in einem schriftlichen Beitrag für das Kolloquium im Herbst 2021 einen anschaulichen Rückblick auf die ersten beiden Jahrzehnte des Ludwig-Strauß-Lehrstuhls an der RWTH Aachen vermittelte. Schließlich danken wir auch allen, die das Kolloquium und die Drucklegung des Bands durch ihre finanzielle Förderung sowie andere Formen der Unterstützung ermöglichten. Ausdrücklich nennen möchten wir Max Kerner, den Gründer des Projekts »Leonardo«, Caroline Torra-Mattenklott und Monika Fick vom Institut für Germanistische und Allgemeine Literaturwissenschaft, die Stiftung ProRWTH, das Dekanat der Philosophischen Fakultät sowie den Kanzler der RWTH. Ihnen allen gilt unser Dank. Insbesondere danken wir auch der Stiftung Irène Bollag-Herzheimer für die großzügige Förderung des Bandes. Aachen, Basel, Berlin, Freiburg im Frühjahr 2023
Hahn/Kruschwitz/Waldschmidt: Literarische Gegenwartsanalysen
Literatur Ammon, Frieder von/Herrmann, Leonhard (Hg.). Gegenwartsliteraturforschung. Positionen – Probleme – Perspektiven. Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 67.3 (2020). Assmann, Aleida. »Zukunft aus Vergangenheit? Putin, die EU und die Ukraine aus der Perspektive ihrer Erinnerungskulturen«. In: Aus dem Nebel des Krieges. Die Gegenwart der Ukraine. Hg. v. Kateryna Mishchenko/Katharina Raabe. Berlin 2023, 253–268. Assmann, Aleida. Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine Intervention [2013]. München 2020. Benjamin, Walter. »Literaturgeschichte und Literaturwissenschaft«. In: Ders. Der Stratege im Literaturkampf. Zur Literaturwissenschaft. Frankfurt a.M. 1974, 7–14. Beyer, Marcel. Die tonlosen Stimmen beim Anblick der Toten auf den Straßen von Butscha. Wuppertaler Poetikdozentur für faktuales Erzählen. Göttingen 2023. Böckmann, Matthias et al. (Hg.). Jenseits von Mbembe. Geschichte, Erinnerung, Solidarität. Berlin 2022. Braese, Stephan. Eine europäische Sprache. Deutsche Sprachkultur von Juden 1760–1930. Göttingen 2010. Braese, Stephan. Die andere Erinnerung. Jüdische Autoren in der westdeutschen Nachkriegsliteratur [2001]. Berlin/Wien 2 2002. Braese, Stephan. »›… as some of us have experienced it‹. Wolfgang Hildesheimers The End of Fiction«. In: Deutsche Nachkriegsliteratur und der Holocaust. Hg. v. dems. et al. Frankfurt a.M./New York 1998, 331–349. Braese, Stephan. Das teure Experiment: Satire und NS-Faschismus. Opladen 1996. Braese, Stephan et al. (Hg.). Deutsche Nachkriegsliteratur und der Holocaust. Frankfurt a.M./New York 1998. Braese, Stephan et al. »Vorwort«. In: Deutsche Nachkriegsliteratur und der Holocaust. Hg. v. dems. et al. Frankfurt a.M./New York 1998a, 9–16. Briegleb, Klaus. 1968. Literatur in der antiautoritären Bewegung. Frankfurt a.M. 1993. Briegleb, Klaus. Unmittelbar zur Epoche des NS-Faschismus. Arbeiten zur politischen Philologie 1978–1988. Frankfurt a.M. 1989. Bubis, Ignatz et al. »Wir brauchen eine neue Sprache für die Erinnerung. Ein Gespräch« [1998]. In: Die Walser-Bubis-Debatte. Eine Dokumentation. Hg. v. Frank Schirrmacher. Frankfurt a.M. 1999, 438–465. Diner, Dan. Kreisläufe. Nationalsozialismus und Gedächtnis. Berlin 1995a. Diner, Dan. »Gedächtnis und Institution. Über zweierlei Ethnos«. In: Ders. Kreisläufe. Nationalsozialismus und Gedächtnis. Berlin 1995b, 113–121. Diner, Dan (Hg.). Zivilisationsbruch. Denken nach Auschwitz. Frankfurt a.M. 1988.
25
26
»Aggregate der Gegenwart«
Gnauck, Gerhard. »Ist deutsche Geschichte für Ukrainer tödlich?«. In: FAZ (21. 01.2022). https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/konflikt-mit-russland-wie-uk rainische-intellektuelle-um-deutsche-hilfe-bitten-17742313.html (15.04.2023). Hahn, Hans-Joachim. »NS-Mediziner in Peter Weiss’ Die Ermittlung und Alexander Kluges Ein Liebesversuch«. In: NS-Medizin und Öffentlichkeit. Formen der Aufarbeitung nach 1945. Hg. v. Stephan Braese/Dominik Groß. Frankfurt a.M. 2015, 215–232. Heine, Heinrich. »Französische Zustände« [1832]. In: Ders. Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke. Hg. v. Manfred Windfuhr. Bd. 12/1: Französische Maler. Französische Zustände. Über die französische Bühne. Text. Hamburg 1980, 63–226. Heine, Heinrich. »An Friedrich Thiersch in München. Paris d 15 Merz 1832.«. In: Ders. Säkularausgabe. Werke, Briefwechsel, Lebenszeugnisse. Hg. v. den Nationalen Forschungs- u. Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar und dem Centre National de la Recherche Scientifique in Paris. Bd. 21: Briefe 1831–1841. Bearb. v. Fritz H. Eisner. Berlin 1975, 32. Heinrich, Klaus. »Anfangen mit Freud. Die ›wiederentdeckte‹ Psychoanalyse nach dem Krieg« [1992]. In: Ders. Reden und kleine Schriften 1. Frankfurt a.M. 1997, 9–38. Hühn, Helmut. »Gegenwarten. Zur Konfliktgeschichte der Moderne«. In: Gegenwart denken. Diskurse, Medien, Praktiken. Hg. v. Johannes F. Lehmann/Kerstin Stüssel. Hannover 2020, 89–111. Jelinek, Elfriede. »Schamlos: die Zeit« [2008]. https://www.elfriedejelinek.com/fgu denus.html (15.04.2023) Kluge, Alexander. Kriegsfibel 2023. Berlin 2023. Lämke, Ortwin. »Heine ›Geschichtsschreibung der Gegenwart‹. Zu Artikel VI der Französischen Zustände«. In: Heinrich Heine. Neue Wege der Forschung. Hg. v. Christian Liedtke. Darmstadt 2000, 237–252. Lehmann, Johannes F./Stüssel, Kerstin (Hg.). Gegenwart denken. Diskurse, Medien, Praktiken. Hannover 2020. Lehmann, Johannes F. »Sichtbare/Unsichtbare Gegenwart (Polizei und Genie um 1800)«. In: Gegenwart denken. Diskurse, Medien, Praktiken. Hg. v. Johannes F. Lehmann/Kerstin Stüssel. Hannover 2020, 219–240. Menasse, Eva. »Sie riskierten alles für ihre jüdischen Männer«. In: FAZ (11.03.2023), 11. Mishchenko, Kateryna/Raabe, Katharina (Hg.). Aus dem Nebel des Krieges. Die Gegenwart der Ukraine. Berlin 2023. Neiman, Susan/Wildt, Michael (Hg.). Historiker streiten. Gewalt und Holocaust – die Debatte. Berlin 2022. Reemtsma, Jan Philipp. »›Wehrmachtsausstellung‹«. In: Historiker streiten. Gewalt und Holocaust – die Debatte. Hg. v. Susan Neiman/Michael Wildt. Berlin 2022, 75–99.
Hahn/Kruschwitz/Waldschmidt: Literarische Gegenwartsanalysen
Reich-Ranicki, Marcel. »Im magischen Judenkreis« [1970]. In: Der Deutschunterricht 36.4 (1984), 16–26. Rolnik, Eran. »Die Schamhemmung der israelischen Politik«. In: faust-kultur (02.02.2023). https://faustkultur.de/gesellschaft-allgemein/die-schamhemmu ng-der-israelischen-politik/ (15.04.2023) Rothberg, Michael. Multidirektionale Erinnerung. Holocaustgedenken im Zeitalter der Dekolonisierung [2009]. Aus d. Engl. v. Max Henninger. Berlin 2021. Rühle, Axel. »Leben im Krieg. In der Anthologie ›Aus dem Nebel des Krieges‹ erzählen Schriftstellerinnen, Soziologen, Journalisten aus der Ukraine«. In: Süddeutsche Zeitung (08.–10.04.2023), 21. Schlögel, Karl. »Deutschland kommt eine besondere Verantwortung zu«. In: NZZ (19.03.2022). https://www.nzz.ch/meinung/krieg-in-der-ukraine-deutschland -kommt-eine-besondere-verantwortung-zu-ld.1674700?reduced=true (18.04. 2023) Schlögel, Karl. »Wie von einem Blitzstrahl erhellt«. In: Aus dem Nebel des Krieges. Die Gegenwart der Ukraine. Hg. v. Kateryna Mishchenko/Katharina Raabe. Berlin 2023, 245–252. Scholz, Olaf. Reden zur Zeitenwende. Berlin 2022. https://www.bundesregierung.de/ resource/blob/992814/2131062/78d39dda6647d7f835bbe76713d30c31/bundeskan zler-olaf-scholz-reden-zur-zeitenwende-download-bpa-data.pdf (18.04.2023) Schulze, Ingo. Die rechtschaffenen Mörder. Frankfurt a.M. 2020. Staas, Christian. »Das Ende der Selbstgewissheit«. In: Die ZEIT (29.04.2020), 17. Strich, Fritz. Kunst und Leben: Vorträge und Abhandlungen zur deutschen Literatur. München/Bern 1960.
27
I. Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Freuds Zuhause Liliane Weissberg
1. Am Sonntag, dem 16. April 2000, veröffentlichte die New York Times zwei Nachrufe, die auf der gleichen Seite und nebeneinander platziert wurden. Der eine berichtete vom Tod Edward Goreys, den seine Zeichnungen von melancholischen Erwachsenen und vom tragischen Schicksal gezeichneten Kindern, geheimnisvollen viktorianischen Häusern und einsamen, doch vom Schrecken gezeichneten Friedhöfen bekannt gemacht hatten. Er galt als Meister unheimlicher Bilder. (Kelly 2000, 43) Der andere Nachruf betraf einen Ingenieur, der sich zeitweise als Fotograf betätigt hatte, Edmund Engelman. (Saxon 2000, 43) Engelman war durch eine einzige Serie von Bildern bekannt geworden, die sich dazu nur auf ein einziges Haus und dort auf einen einzigen Wohn- und Arbeitsbereich bezogen. Der Mieter dieser Räume wird im Gegensatz zu Goreys Gestalten eher der Moderne zugerechnet und widmete sich Fragen der Aufklärung. Es war Sigmund Freud. An vier Tagen im Mai 1938 besuchte Engelman dessen Praxis und Wohnung in der Berggasse 19, um diese Räume zu fotografieren. Freud wiederum war nicht nur der Begründer der Psychoanalyse und ihr bedeutendster Vertreter, er war auch der Autor eines Aufsatzes über Das Unheimliche, der 1919 erschien und sich gerade mit der Frage des Zuhause-Seins beschäftigte, aber auch mit der Angst und dem Gefühl der Befremdung, die vertraute Räume verursachen können. Tatsächlich beginnt Freuds Aufsatz mit keiner Überlegung zur Fotografie, aber Ausführungen zur Ästhetik, die sich als Lehre von der Wahrnehmung und vom sinnlichen Anschauen versteht. Orientierte sich der Begriff aisthesis zunächst an dem menschlichen Körper und empfangenen Sinnesdaten, so kommt der Ästhetik seit dem späten 18. Jahrhundert eine bestimmte Interpretation zu; sie wird zu einer philosophischen Behandlung der bildenden Kunst und zur Lehre vom Schönen (vgl. Adler 2002). Freud, der sich in seinem Aufsatz auf literarische Beispiele beruft, hatte ein anderes Ziel. Er wollte sich nicht mit dem Schönen, sondern dem Schrecken und dem Gefühl des Unbehagens beschäftigen, das manche Lektüre, aber auch manche Lebenserfahrung in Menschen hervorrufen kann. »Der Psychoanalytiker verspürt nur selten den Antrieb zu ästhetischen Untersuchungen«, schreibt er gleich zu Beginn,
32
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
auch dann nicht, wenn man die Ästhetik nicht auf die Lehre vom Schönen einengt, sondern sie als Lehre von den Qualitäten unseres Fühlens beschreibt […] Hie und da trifft es sich doch, daß er sich für ein bestimmtes Gebiet der Ästhetik interessieren muß, und dann ist dies gewöhnlich ein abseits liegendes, von der ästhetischen Fachliteratur vernachlässigtes. (Freud [1919] 1947, 229) Freud möchte nun die Ursache ermitteln, die bewirkt, dass gewisse Gegenstände oder Ereignisse einer Person unheimlich erscheinen. Wie viele andere seiner Arbeiten beginnt er auch hier mit einer Untersuchung von linguistischen Quellen, wobei er das Paradox entdecken muss, »daß das Wörtchen heimlich unter den mehrfachen Nuancen seiner Bedeutung auch eine zeigt, in der es mit seinem Gegensatz unheimlich zusammenfällt« (Freud [1919] 1947, 235). Das, was an das Zuhause oder Heim gebunden ist, das Heimliche oder Heimische, kann gleichzeitig fremd erscheinen oder das Vertraute befremdlich machen. Dies geschieht beispielsweise bei der Betrachtung von leblosen Objekten, die plötzlich beseelt erscheinen, oder aber, wenn Wiederholungen auftreten, die aber gerade nicht das Gleiche zeigen, sondern auf Differenzen deuten. Doppelgänger oder Dinge, die sich verdoppeln oder wiederholen, erweisen sich als nur scheinbar gleich. Dies ist eine Erfahrung, welche die Literatur beschreibt, aber die man auch im täglichen Leben machen kann. Kehrt jemand nach langer Zeit zu einem vertrauten Ort oder Menschen zurück, so erscheinen Ort und Menschen oft fremd. Aber eine unerwartete Rückkehr des einst Vertrauten kann beängstigend wirken, so als handele es sich da um tote Objekte, die lebendig werden, oder um Revenants und Gespenster. Es ist, als ob das bereits Abgeschlossene, ja Verdrängte zurückkehrt und nun Angst und Schrecken erzeugen kann. Wir fühlen das Unheimliche in der Gegenwart des Todes, aber auch dann, wenn das Unbelebte Leben zurückgewinnt. Erschien Freuds Aufsatz kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Ende des Habsburger Reiches, so wählt er als Beispiel für die letztere Erfahrung eine Erzählung, die er gerade mitten im Krieg in einer englischen Zeitschrift entdeckte. Es war eine Erzählung, die von einem jungen Ehepaar handelte, das eine möblierte Wohnung bezieht, in der sich ein seltsam geformter Tisch mit holzgeschnitzten Krokodilen befindet. Gegen Abend pflegt sich dann ein unerträglicher, charakteristischer Gestank in der Wohnung zu verbreiten, man stolpert im Dunkeln über irgend etwas, man glaubt zu sehen, wie etwas Undefinierbares über die Treppe huscht, kurz, man soll erraten, daß infolge der Anwesenheit dieses Tisches gespenstische Krokodile im Hause spuken, oder daß die hölzernen Scheusale im Dunkeln Leben bekommen oder etwas Ähnliches. Es war eine recht einfältige Geschichte, aber ihre unheimliche Wirkung verspürte man als ganz hervorragend. (Freud [1919] 1947, 258)
Liliane Weissberg: Freuds Zuhause
Freud sah in diesem Aufsatz das bei dem Liebespaar erregte Gefühl noch als Konsequenz einer Verdrängung; dasjenige konnte unheimlich wirken, was eigentlich verborgen bleiben sollte. In seiner späteren Arbeit zu Hemmung, Symptom und Angst, die 1926 erschien, kehrte er dieses Verhältnis um. Die Verdrängung war nun nicht Ursache, sondern Konsequenz einer ganz bestimmten Angst, der Kastrationsangst; der Angst um die Erhaltung der körperlichen Integrität und der Furcht vor Verlust. (Weber 1973, 1110f.) Der Hauptprotagonist in E.T.A. Hoffmanns Geschichte Der Sandmann, die im Zentrum seines frühen Aufsatzes zum Unheimlichen steht, ist männlich und heißt Nathanael. Als Junge hatte er sich hinter einem Vorhang in einem Zimmer der elterlichen Wohnung versteckt, um heimlich seinen Vater zu beobachten. Dieser unternimmt zusammen mit einem fremden Gast seltsame, möglicherweise alchemistische Versuche. Als dabei eine Art Explosion entsteht, wird für den Sohn das einst vertraute Heim zu einem traumatischen Ort. Der fremde Gast entdeckt Nathanael und fasst ihn, will seine Glieder trennen und neu zusammensetzen, als handle es sich bei ihm um eine Puppe, und greift nach dessen Augen. Der Junge fällt in Ohnmacht und glaubt nach seinem Erwachen, in dem Fremden den schrecklichen Sandmann erkannt zu haben, von dem die Mutter ihm bereits erzählt hatte und der Sand in die Augen der Kinder streut.
Abb. 1: E.T.A. Hoffmann: Illustration zur Erzählung Der Sandmann. Berlin 1815. Kopie einer verschollenen Federzeichnung. Staatsbibliothek Bamberg Sign. Bg.o.289.
33
34
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Einige Jahre später scheint Nathanael diesem Fremden in verschiedenen Gestalten wiederzubegegnen, unter dem Namen Coppelius oder Coppola etwa, ein Name, der auf die italienische Bezeichnung der Augenhöhle verweist. Der Fremde und doch Bekannte ist unter anderem nun ein Händler von Brillengläsern und Fernrohren oder Perspektiven. Treibt Nathanael bereits der Gedanke, nichts mehr sehen zu können, oder besser, gerade das Nichts sehen zu können, in den Wahnsinn, tut ein letzter Blick aus einem Perspektiv ein Übriges. Nathanael glaubt, von einem Turm aus den Fremden in der Ferne entdecken zu können und stürzt sich in den Tod. Somit ist Hoffmanns Geschichte auch eine über Wahrnehmungen. Sie betrifft die Augen und das, was Nathanael sieht oder sehen möchte, und setzt sich damit eigentlich auch mit der Ästhetik selbst auseinander.
2. Der Fotograf Engelman interessierte sich weniger für Brillen oder Ferngläser, seine Linsen gehörten zu einer Kamera, mit deren Hilfe er nicht nur seine Umgebung wahrnehmen, sondern auch in Bildern festhalten wollte, die ebenso andere betrachten sollten. Er beobachtete, aber sein Ziel war die Reproduzierbarkeit des Blicks. Und Engelman war keineswegs der erste, der sich mit einer Kamera in die Berggasse 19 begab. Bereits im Winter 1937 dokumentierte die Psychoanalytikerin und ehemalige Patientin Freuds Marie Bonaparte das Freud’sche Domizil mit Hilfe ihrer Filmkamera. Bonaparte war eine leidenschaftliche Amateurfilmerin, die sich bislang allerdings vor allem auf Außenaufnahmen beschränkt hatte, die bessere Lichtverhältnisse boten. So filmte sie bereits zuvor Freuds Familie, Zusammenkünfte mit Freunden, Familienfeiern in den Gärten angemieteter Sommerhäuser und besonders auch Freuds spielenden Hund. In jenem Winter konzentrierte sie sich jedoch auf Freuds Wartezimmer und Freuds Praxis. Sie nahm sich auch selbst auf, in einer Art von Selfie, in der Rolle einer wartenden Patientin, die auf dem Sofa saß und in einer Zeitschrift blätterte. Aber auch Freud wurde von ihr gefilmt; er saß dabei in seinem Arbeitszimmer und versuchte sich für Bonaparte ins rechte Licht zu setzen. Das Speisezimmer erscheint im Film als Mittelpunkt eines bewegten Familienlebens. Schließlich wagte Bonaparte auch einen diskreten Blick in Freuds Schlafzimmer, ohne es jedoch zu betreten. Es war der einzige Raum, der sich in ihrem Film menschenleer zeigt. Engelmans Projekt war dagegen völlig anders beschaffen. Ihm ging es nicht um Personen, menschliche Begegnungen oder zufällige Blicke in einen Privatbereich, sondern um die Herstellung eines umfangreichen Archivs; um eine Bildsammlung unter Beachtung einer gewissen Diskretion – so fotografierte er nicht das Schlafzimmer, aber Freuds sehr privaten Raum, in dem er sich selbst als Patient medizinisch behandeln ließ. Die Bildsammlung sollte so vollständig wie möglich zeigen,
Liliane Weissberg: Freuds Zuhause
wie und wo Freud lebte und arbeitete. Und während Bonaparte, die in Paris wohnte, zu Freuds engerem Freundeskreis gehörte und ihn oft besuchte, kannte der Wiener Engelman Freud nicht. Er war auch nicht von Freud beauftragt oder gar in sein Haus eingeladen worden. Vielmehr verfolgte er ein heimliches Projekt; Freud sollte nicht darüber informiert werden. Sein Plan setzte sogar Freuds Abwesenheit im mehrfachen Sinn voraus.
Abb. 2: Marie Bonaparte, Film Standbild (1937), Freuds Schlafzimmer. Filmkopie Library of Congress, Washington, DC.
Im Mai 1938 war Freud 82 Jahre alt, schwach und gebrechlich. Er litt an Kieferkrebs, der große Schmerzen verursachte, aber auch an den Nebeneffekten der zahlreichen Operationen, denen er sich unterziehen musste, um die Krankheit aufzuhalten. Er konnte nicht mehr deutlich sprechen, verließ kaum noch das Haus und sah nur wenige Personen außerhalb seines Familienkreises. Freud hatte sicherlich andere Prioritäten als die Abbildung seiner Räume. Adolf Hitler hatte Österreich zwei Monate zuvor, am 12. März, annektiert und Freuds Freunde und Familie konnten ihn nun endlich davon überzeugen, das Land zu verlassen. Der Psychoanalytiker, der fast sein ganzes Leben in der Berggasse verbracht hatte, war bis jetzt mit einer Emigration nicht einverstanden gewesen, aber nun dachte er auch an die Zukunft seiner Familie und das Schicksal der Disziplin, die so eng mit seinem Namen verbunden war. Die Psychoanalyse sollte in London ihr neues Zentrum finden. Freuds Umzug von Wien nach London war ein groß angelegtes Unternehmen. Es betraf letztendlich nicht nur ihn und seine Ehefrau Martha, sondern auch 20 wei-
35
36
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
tere Personen, neben Familienmitgliedern zwei seiner Hausangestellten sowie seinen Hausarzt und dessen Familie. Der letztere, Max Schur, musste kurzfristig wegen seiner Blinddarmoperation durch eine andere begleitende Ärztin ersetzt werden und reiste Freud nach London nach. Auch Freuds Hund sollte sich auf die Reise machen; ihn erwartete in England eine sechs Monate lange Quarantäne. Der Abreisetermin der Gruppe wurde auf Anfang Juni festgelegt (vgl. Weissberg 2020a).
Abb. 3: Edmund Engelman, Freuds privates medizinisches Behandlungszimmer, Berggasse 19 (1938).1
Freud und seine Familie waren in der Zeit, in der Engelman seinen Besuch plante, damit beschäftigt, eine Liste ihres Eigentums und ihrer Finanzen zu erstellen, sich Geld für die Ausreisevisen zu verschaffen und Einreisevisen zu beantragen. Diejenigen Gegenstände, die nicht nach London mitgenommen werden sollten, mussten verkauft, verschenkt oder in Aufbewahrung gegeben werden. Zum nicht deklarierten Besitz Freuds gehörten seine ausländischen Bankkonten, mit deren Hilfe er sich und seine Familie in England unterstützen wollte. Weiterhin musste die Wiener Psychoanalytische Vereinigung aufgelöst werden und damit auch ihre 1
Alle hier wiedergegebenen Fotografien Edmund Engelmans sind in seinen Bildbänden enthalten und befinden sich in Abzügen in den Freud Museen in Wien und London.
Liliane Weissberg: Freuds Zuhause
Zeitschrift, ihre Verlagsverpflichtungen und ihr Büro, welches von Freuds Sohn Martin geleitet wurde, und natürlich auch Freuds eigene Praxis und Wohnung. Dies alles war nicht nur eine organisatorische Anstrengung, sondern auch eine diplomatische Affäre, die Politiker in England, den Vereinigten Staaten und Frankreich miteinschloss. Marie Bonaparte als Prinzessin von Griechenland lieh nicht nur Geld, sondern gebrauchte auch ihre Kontakte auf höchster Ebene und der Psychoanalytiker Ernest Jones, der Londons psychoanalytische Vereinigung leitete, wandte sich an Freunde im Britischen Parlament. Als Freud Wien am 4. Juni 1938 endlich verließ, geschah dies gerade noch rechtzeitig. Wenig später wäre eine solche Ausreise unmöglich gewesen (vgl. Kaufhold 2003). Viele der Schüler:innen und Kolleg:innen Freuds waren jüdischer Herkunft und im Mai 1938 hatten fast alle Mitglieder der Psychoanalytischen Vereinigung Wien und das Land bereits verlassen. Einige zogen nach England, viele emigrierten in die Vereinigten Staaten, wo die Psychoanalyse an Popularität gewann. Freud blieb noch zurück. Ein anderer, der blieb, war der Psychoanalytiker August Aichhorn, eines der wenigen nicht-jüdischen Mitglieder der Vereinigung. Er wollte in Wien verbleiben und das psychoanalytische Erbe, so weit wie möglich, bewahren. Die Dokumentation der Freud’schen Praxis- und Wohnräume war seine Idee. Er wollte sie ins Bild bannen, bevor die Umzugsleute Freuds Eigentum in Kisten packten oder die Nationalsozialisten Objekte an sich nehmen konnten (siehe dazu Aichhorn 2003). Zu diesem Zweck traf er sich mit Engelman. Engelman arbeitete in einem fotografischen Studio, Photo City, in der zentral gelegenen Kärtnerstraße. Aichhorn hatte ihn vor kurzem kennengelernt und verabredete sich nun mit ihm zu einem vertraulichen Gespräch, wie in Wien üblich, in einem Caféhaus: dem Café Museum am Karlsplatz. Aichhorn bezeichnete die fotografische Dokumentation der Berggasse 19 als eine Aufgabe von höchster Dringlichkeit (vgl. Werner 2002, 445). Als Begründer der Psychoanalyse wurde Freud von seinen Kolleg:innen und Schüler:innen verehrt, und auch Kritiker mussten seine Bedeutung eingestehen. Freud war, kurz gesagt, einer der berühmtesten Einwohner Wiens. Aichhorn hatte bereits die Freud’sche Familie konsultiert, die mit dem Projekt einer Bilddokumentation der Berggasse 19 einverstanden war, die Freuds Praxis und Wohnung für ein späteres historisches Gedächtnis bewahren sollte. Doch die Familie informierte Freud nicht von diesem Vorhaben. Tatsächlich plante Aichhorn, wie sich Engelman erinnern sollte, mehr als eine Bilddokumentation (vgl. Engelman 1977, 54). Er bereitete sich bereits auf ein Ende des Nazi-Regimes vor und war damit beschäftigt, die Zeit danach zu planen und damit ein Zukunftsprojekt. Engelmans Fotografien sollten als Vorlage für ein Museum dienen, das die Freud’schen Räume rekonstruiert zeigen sollte – allerdings Räume, die auf ihre Bewohner:innen, allen voran Freud selbst, verzichten mussten. Es gab also viele Gründe dafür, Freud hinsichtlich seines Plans im Dunkeln zu lassen. Die Familie wollte ihn nicht stören; Aichhorn befürchtete Freuds Widerspruch. Aber er
37
38
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
rechnete auch nicht nur mit Freuds Emigration, sondern auch mit seinem Ableben. Sein Tod war diesem Projekt eingeschrieben. Engelman sollte einen visuellen Nachruf vorbereiten, der sich nicht an Freuds Publikationen oder therapeutischen Erfolgen, sondern allein an den Räumen festhalten und auch deren Nachleben sichern sollte. Aichhorns Plan einer Neukonstruktion der Wiener Berggasse 19 ähnelte letztendlich dem Bemühen der polnischen Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg, die Hauptstadt Warschau nach ihrer fast vollständigen Zerstörung wieder aufzubauen. Für die Nachkriegsarchitekten und Stadtplaner dienten Canalettos detaillierte Stadtansichten des 18. Jahrhunderts als Richtlinien für den Wiederaufbau des historischen Zentrums (vgl. McCouat 2015). 1938 kam Aichhorns Projekt jedoch einer Zerstörung der Berggasse zuvor, und es war unklar, ob er die Wiedereinrichtung der Räume für den gleichen Ort plante oder gar planen konnte. Aber irgendwie sollte die Berggasse 19 weiterleben und Zeugnis ablegen können. Engelman wurde zu Aichhorns Canaletto, der nun keine Architektur malen, sondern Möbelstücke und Objekte fotografieren sollte.
3. Um die Familie bei ihren täglichen Aktivitäten so wenig wie möglich zu stören und um die Gewohnheiten des Hausherrn zu respektieren, zeichnete Aichhorn bereits im April einen Plan von Wohnung und Praxis. Dieser zeigte leere Räume und bezeichnete ihre Funktion, Engelmans Bilder sollten dann diese Räume anschaulich machen. Aichhorn bestimmte die Choreographie, nach der sich Engelman in Freuds Wohnung bewegen sollte. So sollte er sich von Raum zu Raum begeben und jeweils das Zimmer betreten, welches ein Familienmitglied gerade verlassen oder noch nicht betreten hatte. Aufnahmen von Personen waren nicht eingeplant. Bei seiner Tätigkeit verschrieb sich Engelman jedoch auch einer anderen, ihm eigenen Choreographie, die nicht von Aichhorn vorgegeben wurde. Er ging nicht wie ein Archivar vor, der Räume aufnehmen und katalogisieren wollte, sondern versuchte stattdessen seinen Weg ins Gebäude, die Treppe hinauf und zur Tür hin und in die Praxis hinein in einer Folge aufzunehmen, die der Blickweise eines Patienten entsprach, der sich zu Freud begab – diesmal jedoch nicht zu einer Sprech-, sondern zu einer Sehstunde. Die Fotografien lassen sich in eine filmische Sequenz reihen. Aichhorn beauftragte eine Darstellung stabiler Orte und eine Art Inventar. Der Fotograf führte die Bewegung ein und gab dem Auftrag ein Narrativ.
Liliane Weissberg: Freuds Zuhause
Abb. 4: Engelman, Treppenhaus Berggasse 19 (1938).
Abb. 5: Engelman, Eingangstür zu Freuds Praxisbereich, Berggasse 19 (1938).
39
40
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Daher ging es Engelman nicht allein um eine Dokumentation der Zimmer; er gab die Neugierde des Betrachters wieder. Da er diese Räume zum ersten Mal sah, ist auch sein eigenes Erstaunen in den Bildern spürbar, besonders angesichts der reichen Sammlung von Kunstobjekten. Engelman war ebenfalls jüdisch und wohnte wie Freud im gutbürgerlichen neunten Bezirk. Aber gerade Freuds Praxisräume, bestückt mit orientalischen Teppichen, Antiquitäten und Bildern folgten anderen Vorbildern als denen der jüdischen Mittelklasse: Hier eiferte Freud eher seinem Pariser Lehrer Jean-Martin Charcot nach, der durch seine Heirat ein hochherrschaftliches Wohnhaus beziehen konnte, das Freud 1885 besuchte und bewundernd für Martha beschrieb.2 Oder den Wohnräumen seiner jüdischen Patientin Anna von Lieben, deren Familie zum Adel gehörte und ein Palais auf der Ringstraße besaß.3 Charcot wie von Lieben dekorierten ihren jeweiligen Wohnbereich mit einer mit Kissen bestückten Couch und tiefen Sesseln, und mit Antiquitäten, die in Charcots Fall nicht unbedingt echt waren (vgl. Mayer 1998). Engelman entdeckte nun bei Freud nicht nur das Fremde exotischer Objekte oder das Fremde der psychoanalytischen Praxis, sondern auch dessen großbürgerliche Ambitionen. Seine Fotografien laden heute den Betrachter nicht nur ein, seinen Schritten zu folgen, sondern auch seine Entdeckungen zu teilen.
Abb. 6: Engelman, Freuds Arbeitszimmer, Berggasse 19 (1938).
2 3
Siehe etwa die Briefe Freuds an Martha Bernays vom 5. Dezember 1885 (vgl. Freud [1885] 2019, 308) und Mayer 1998. Anna von Tedesco, verheiratete von Lieben, erscheint in Freuds Fallstudien als »Cäcilie M.« (vgl. Freud/Breuer 1895).
Liliane Weissberg: Freuds Zuhause
Abb. 7: Engelman, Freuds Behandlungszimmer, Berggasse 19 (1938).
Engelman, der Freud nicht stören durfte, hatte jedoch auch andere Gründe, bei seiner Arbeit vorsichtig vorzugehen. Im Mai 1938 hatte ein vor das Haus gestellter Gestapobeamte die Aufgabe, die Freud’sche Familie und ihre Besucher zu kontrollieren und aufzupassen, dass keine Gegenstände aus der Wohnung entfernt wurden, während die Inventarliste hergestellt wurde. Der Eingang des Hauses war bereits von den Hausbesitzern, Lili Peschl und Karl Littmann, mit einem großen Banner mit einer zentralen Swastika dekoriert. Peschl und Littmann waren Nichtjuden, aber alle Bewohner des Hauses, mit Ausnahme der Amerikanerin Dorothy Burlingham, Freuds ehemaliger Patientin und Anna Freuds Kollegin, die mit der Familie emigrieren sollte, waren jüdisch; so etwa der Rechtsanwalt Adolf Mathias, der von Köln nach Wien gezogen war; Emil Humburger, dessen Tochter den Schriftsteller Leo Perutz geheiratet hatte, Rudolf Hauser, ein Textilhändler und seine Familie. Alle hatten bereits versucht, ihre Kinder zur Emigration zu bewegen, und warteten nun selbst auf ein Visum. Wenige Monate nach der Abreise Freuds wurde das Haus nicht arisiert, sondern als sogenanntes Judenhaus deklariert zu einer Sammelunterkunft für Personen, die zur Deportation in die Konzentrationslager bestimmt waren. Engelmann musste seine Tätigkeit vor Freud verheimlichen und er musste der Überwachung durch die Gestapo entgehen. Deshalb musste er sich nicht nur in der Wohnung vor Freud verstecken; er musste bei seiner Arbeit Blitzlicht und eine große Zimmerbeleuchtung vermeiden und konnte sich nur auf das natürliche Licht verlassen. So verwendete Engelman die Technik der Straßenfotografie für Freuds Innenräume. Da sich diese im Mezzanin befanden und auch während des Tages wenig Licht erhielten, zeigen Engelmans heimliche Bilder eigentlich Dunkelkammern.
41
42
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Abb. 8: Engelman, Haus Berggasse 19 mit Swastika über dem Eingang (1938).
4. Engelman erhielt für seinen Auftrag nur vier Tage Zeit. Zunächst ging alles nach Plan. Aber im Verlauf des zweiten oder dritten Tages sollte Engelman Freud, der seine Wohnung kaum mehr verließ, durch Zufall begegnen. Der Fotograf berichtete später von Freuds Schrecken, plötzlich einen Fremden in seiner eigenen Wohnung anzutreffen, der sich dazu anscheinend bereits seit längerem dort versteckt hielt. Zum Glück befand sich Aichhorn in der Nähe. Er stellte Engelman offiziell dem Hausherrn vor und dieser konnte ihm sogar einige der Fotos zeigen, die er bereits gemacht und in der Nacht zuvor entwickelt hatte (vgl. Werner 2002, 446). Engelman überreichte Freud diese Bilder und legte ihm nahe, dass sie ihn nach England begleiten sollten. Damit waren die Fotos nicht mehr für fremde Empfänger gedacht, sondern Souvenirs für den Bewohner der Räume selbst. Freud gefielen die Fotografien und er erlaubte Engelman, mit seiner Arbeit fortzufahren. Doch der Hausherr oder seine Familie schienen nun auch aktiv in das Bildprogramm einzugreifen, die Dokumentation wurde zur Selbstinszenierung. So verschwanden zwei silberne Kidduschbecher, die sich in ersten Aufnahmen noch auf einem Tisch neben der Behandlungscouch befanden, spurlos in späteren Fotografien (vgl. Weissberg 2020b).
Liliane Weissberg: Freuds Zuhause
Abb. 9: Engelman, Freud in seinem Arbeitszimmer (1938).
Abb. 10 und 11: Engelman, Tisch in Freuds Arbeitszimmer (Ausschnitt, 1938).
Engelman agierte im Folgenden noch deutlicher als ein Voyeur, der etwa Freud durch eine offene Tür hindurch an seinem Arbeitsplatz entdecken konnte. Dieses Foto gleicht auf seltsame Weise jener Aufnahme Bonapartes, bei der sie durch eine offene Tür ins Freud’sche Schlafzimmer blickte. Der bislang abwesende Freud begann sich vom dritten Tag des Engelman’schen Unternehmens an in einer gewissen
43
44
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Distanz zu zeigen. Aber der Eindringling, der sich nun zum Gast wandelte, erhielt auch einen zweiten Auftraggeber, nämlich die Freud’sche Familie. So nahm er neben den Fotos für Aichhorn nun Porträts der Familienmitglieder auf, und diese Serie war besonders wichtig: Engelman schuf die Passbilder für die neuen Dokumente, die für die Emigration Freuds und seiner Familie notwendig wurden. Nach der Annexion wurde Österreich zur deutschen Ostmark und Freud sollte Wien mit einem neuen deutschen Pass verlassen. Zum Ende seiner Arbeit gab Freud Engelman eine seiner Porträt-Fotografien mit der Widmung »herzlichen Dank dem Künstler« wieder zurück. So trägt eine Fotografie Engelmans nicht seinen eigenen Namen, sondern Freuds Signatur.
Abb. 12 und 13: Engelman, Freuds Passbild (1938) und Engelman, Freuds Porträt mit Freuds Widmung (1938).
Für Engelman war dieses Bild, das nun ihm selbst gewidmet war, ein Abschiedsgeschenk – nicht nur von Freud, sondern auch von Wien. Engelman gelang es, im Januar 1939 über Frankreich in die Vereinigten Staaten zu fliehen. Dort nahm er seinen alten Beruf als Ingenieur wieder auf, aber eröffnete nach dem Zweiten Weltkrieg ein Fotogeschäft in New York, um dann schließlich als Berater für FotografieTechnik zu arbeiten. Bevor Engelman Wien verließ, gab er Aichhorn die Negative seiner Bilder der Berggasse 19. Für seine Bilder hatte der Fotograf zwei Kameras benützt, eine 35 mm Leica und eine Rolleiflex, und er schuf daher Bilder in zwei unterschiedlichen Formaten. Insgesamt nahm Engelman 106 schwarz-weiß Fotografien auf. Bis auf ein einziges Negativ sind alle bis heute erhalten. Nach Aichhorns Tod im Jahre 1949 gelangten sie nach London in den Besitz von Anna Freud. Engel-
Liliane Weissberg: Freuds Zuhause
man forderte die Negative von ihr zurück und veröffentlichte einige der Bilder 1976 in einem Band, Berggasse 19, Sigmund Freud’s Home and Offices, Vienna 1938, der zuerst in den Vereinigten Staaten erschien. Engelman fügte seiner Publikation auch eine Kopie des Zimmerplans bei, den Aichhorn ihm gegeben hatte, damit sich auch die Leser:innen und Betrachter:innen seines Werkes in Freuds Räumen orientieren konnten. Zu dieser Zeit hatte die Stadt Wien bereits Freuds ehemalige Wohnung und Praxisräume übernommen und den damaligen Mietern geholfen, eine neue Bleibe zu finden. 1971 wurde ein Freud-Museum eröffnet, das zunächst nur die einstigen Praxisräume umfasste, danach wurde Freuds frühere Wohnung dem Museum angeschlossen und die Verbindung zwischen beiden Einheiten wieder geöffnet.4 Das neue Freud-Museum konnte allerdings wenig mehr bieten als leere Zimmer. Freuds letztes Wohnhaus, 20 Maresfield Gardens in London-Hampstead, war fast intakt erhalten geblieben und wurde noch von Anna Freud bewohnt. Zur Feier der Eröffnung des neuen Wiener Museums sandte Anna Freud das Mobiliar des einstigen Wartezimmers zurück nach Wien sowie eine kleine Auswahl von Antiquitäten; auch die Haushälterin der Freud’schen Familie, Paula Fichtl, steuerte ein paar Erinnerungsstücke bei. Andere Familienmitglieder und Freunde folgten, und so erhielt das Museum einen Koffer oder eine Lesebrille. Aber durch den allgemeinen Mangel an Objekten wurde dabei Aichhorns Museumsprojekt auf eine andere Weise Wirklichkeit. Nicht das Arrangement der Gegenstände wurde in der Berggasse 19 wiederhergestellt, sondern die von ihm veranlassten Bilder verwandelten sich selbst in Ausstellungsobjekte. Tatsächlich konnte die erste Dauerausstellung des Wiener Museums kaum andere Objekte zeigen als Engelmans Fotografien, die, stark vergrößert, an den Wänden montiert waren. Sie wurden damit zu Exponaten, welche die Authentizität der Räume verbürgen sollten. Sie sollten keine künstlerischen Aufnahmen sein, sondern Reproduktionen der fehlenden Objekte bieten und ihr Arrangement zeigen. Freuds Räume erschienen als zweidimensionale Bilder, die einen dreidimensionalen Ort füllen mussten. Bei seinem ersten Besuch 1975 beschrieb der britische Historiker John Forrester das Museum folgendermaßen: »It had a derisible atmosphere, perhaps one deliberately induced to remind visitors of yet one more loss that the war had visited on Vienna; but it still prompted the thought a museum of fake souvenirs is a fake museum – a screen museum, the Freudians might say«. (Forrester 1997, 132) Lydia Marinelli, die 1992–2008 für die Forschung im Freud Museum zuständig war, schrieb über die Enttäuschung der Besucher, die ein traditionelles Museum erwarteten und nun frustriert waren, mit der Abwesenheit
4
Zur Geschichte des Museums, siehe Morra 2013.
45
46
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
von materiellen Dingen konfrontiert zu sein. Einige glaubten jedoch auch Objekte in den Räumen zu sehen, die dort nicht mehr existierten (vgl. Marinelli 2009, 164).
Abb. 14: Freuds Behandlungszimmer, Berggasse 19. Erste Dauerausstellung, Freud Museum Wien. Foto: Freud Museum Wien.
Anna Freud starb 1982. Vier Jahre später wurde das Londoner Haus als Museum eröffnet und bot die Mehrzahl der Freud’schen Möbel, Antiquitäten und den Großteil der Bibliothek. In dieser neuen, englischen Umgebung wurde alles aber neu arrangiert und entsprach keineswegs Engelmans Wiener Dokumentation. Die Räume waren groß und hell und gut beleuchtet, und zeigten statt dunklen Tapeten weiße Wände. Statt der Wiener Fin-de-siècle Ästhetik präsentiert sich hier das Haus eines Londoner Vororts mit älterem Emigrantenmobiliar. Aber auch dies blieb nicht konstant; das Londoner Museum versteigerte einen der Freud’schen antiken Teppiche 2016 beim Auktionshaus Bonham’s.5 Dabei gelangte ein Teil des Freud’schen Besitzes schon im Frühjahr 1938 in eine Auktion. Freud hatte einen Teil seiner Bibliothek aussortiert und diese kleine Sammlung wurde 1939 in Wien von seinem Freund, dem Buchhändler Paul Sonnenfeld, versteigert. Im Auktionskatalog wurden die Bücher als Bibliothek eines »berühmten Wiener Wissenschaftlers« angeboten.6 Jacob Shatzky, Bibliothekar des New York State Psychiatric Institutes, erriet die Identität des Besitzers, handelte daher schnell und kaufte die Sammlung für seine Institution (Anon. 1956, 33). Heute befindet sich die 770 Titel umfassende Teilbibliothek als Sondersammlung
5 6
Siehe https://www.bonhams.com/auctions/23749/lot/1150/ (Zugriff September 2021). Die Buchsammlung ist Eigentum des New York State Psychiatric Institute; siehe https://libr ary-archives.cumc.columbia.edu/collections/freud-library (Zugriff September 2021).
Liliane Weissberg: Freuds Zuhause
der Augustus C. Long Health Sciences Library an der Columbia University (New York State Psychiatric Institute, Katalog). Dem Rat des amerikanischen Psychoanalytikers Kurt R. Eisslers folgend, der ebenfalls aus Wien stammte, wurde Freuds schriftlicher und Bild-Nachlass nach dem Ende des Zweiten Weltkrieg aus Sicherheitsgründen in die Vereinigten Staaten gebracht und 1951 der Library of Congress in Washington übergeben. Dieser Nachlass befindet sich daher heute in einem Land, für das Freud selbst nicht viel Sympathie aufbringen konnte.
Abb. 15: Freuds Arbeits- und Behandlungszimmer, Freud Museum London. Foto: Freud Museum London.
Neben Wien und London wurde 2006 dann ein drittes Freud-Museum eröffnet. Es befindet sich in der Zámečnická oder Schlosserstraße 17 in Příbor, dem ehemaligen Freiberg, Freuds Geburtsort, der nun in der Tschechischen Republik liegt. Freuds Eltern bewohnten in diesem Gebäude einst wenige Räume im zweiten Stock; nun ist das ganze Haus ein Freud-Museum, das aber nichts anderes zeigen kann als Fotografien – wenn auch eher historische Bilder Freibergs, die an den Zimmerwänden montiert wurden. Das Touristenbüro der Stadt befindet sich ebenfalls in der Straße des neuen Museums, nun nicht in der Berggasse 19, sondern der Náměstí S. Freuda 19.
47
48
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Abb. 16: Fotografische Installation, Freud Museum Příbor. Foto: Turistické informační centrum Příbor.
Damit hat sich die Zahl der Freud’schen Museen verdreifacht; auch das heute berühmteste Freud’sche Möbelstück, die Behandlungscouch, erhielt in jedem der Museen eine zentrale, wenn auch andere Bedeutung. Das Wiener Original befindet sich in London und unterliegt regelmäßiger kuratorischer Pflege und Restauration. Das Museum in Wien zeigt lediglich den Ort, an dem die Couch stand. In einem anderen Raum befindet sich eine neue, künstlerische Interpretation des Objekts: die Bronzeskulptur einer modernen Liege, geschaffen vom österreichischen Künstler Franz West. Das Museum in Příbor stellte ein gewichtiges Denkmal auf, das die Freud’sche Couch wiedergeben soll. Diese Bronze-Replika befindet sich in keinem Innenraum, sondern vor der Tür des Hauses. Der öffentliche Platz vor dem Haus wird damit zu einem Ort bestimmt, der an die psychoanalytische Therapie erinnern möchte und dabei allen, auch außerhalb des Museums, zugänglich wird. Und das Denkmal trägt eine Inschrift in tschechischer, deutscher und englischer Sprache: »Lass Dich nieder und besinn Dich. Steh auf und handle«.
Liliane Weissberg: Freuds Zuhause
Abb. 17: Freuds Behandlungscouch, Freud Museum London. Foto: Freud Museum London.
Abb. 18: Franz West, Liege, Bronzeskulptur. Freud Museum Wien. Foto: Freud Museum Wien.
49
50
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Abb. 19: Replika von Freuds Couch, Bronzeskulptur. Freud Museum Příbor. Foto: Vít Lang, Turistické informační centrum Příbor.
5. Aichhorn hatte nur ein Freud-Museum geplant. Aber gerade die Häuser in Wien und London treten heute als Doppelgänger-Institutionen auf. Während London das Mobiliar zeigt, ist es die Berggasse 19, die auf ihrem Ruf als Ursprungsort der Psychoanalyse besteht. 2019 wurde dieses Haus grundrenoviert und das ganze Gebäude ging in den Besitz des Museums über. Heute bietet es nun Räume für ein Archiv von Nachlässen von Psychoanalytikern und Psychoanalytikerinnen, für eine Bibliothek sowie für Veranstaltungen. Die Wohn- und Praxisräume stellen nur noch wenige und kleinere Bilder Engelmans aus. Die Wände selbst sollen eine Geschichte erzählen. In archäologischer Manier wurden Tapetenschichten abgetragen, Stuck erforscht, Wandfarben ermittelt, der Platz von Zimmeröfen markiert. Die bei der Forschung entstandenen Öffnungen und Löcher werden ebenso gezeigt wie Nagelspuren an den Wänden. Vitrinen mit Buchpublikationen und vereinzelten Erinnerungsobjekten wurden in die Mitte der Räume gestellt. Statt einer Rekonstruktion der einstigen Räume zeigt das Museum heute einen mehrfachen Verlust: nicht nur den Mangel an Dingen, sondern ebenso die Abwesenheit der Personen, die einst diese Räume und auch das ganze Haus bewohnt hatten. Auch die Psychoanalyse findet heute woanders statt.
Liliane Weissberg: Freuds Zuhause
Abb. 20: Freilegung der Zimmerdecke, Berggasse 19, neue Dauerausstellung (2020), Freud Museum Wien. Foto: Florian Lierzer, Freud Museum Wien.
Abb. 21: Freuds Behandlungszimmer, Berggasse 19, neue Dauerausstellung (2020). Freud Museum Wien. Foto: Florian Lierzer, Freud Museum Wien.
51
52
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Freuds Aufsatz zum Unheimlichen entstand kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Auflösung des Habsburger Reiches. Es war eine Zeit der Verluste, die allerdings durch den Zweiten Weltkrieg für die Freud’sche Familie viel größer werden sollten. Das Wiener Museum zeigt die Berggasse 19 nicht nur als Ort der psychoanalytischen Entdeckungen, sondern gerade dieser persönlichen wie beruflichen Verluste und als ein Zuhause, das als unheimliches Heim verstanden werden muss. Die neue Inkarnation der Berggasse-Räume wurde allerdings wieder fotografisch dokumentiert. Hertha Hurnaus begleitete die Renovierungsarbeiten und schuf nach ihrem Abschluss eine Serie von Bildern, die sich auf Schatten und Licht konzentrieren und jetzt als »erste künstlerische Foto-Edition des Sigmund Freud Museums« zu erwerben sind (Pessler 2021). Die Edition ist auf dreißig Exemplare limitiert und zeigt die noch erhalten gebliebene Garderobe, die Türen zum Eingang des Behandlungsraums und schließlich den Ort, an dem sich einst die Couch befand, während sich die Lichtkunst auf das Spiel zwischen Schatten und Licht konzentriert: »For light — which in its constant state of change, molds and describes the character of architecture — has always been there«. (Pessler 2021) Die drei Fotografien sind keine Dokumentation für ein zukünftiges Museum mehr, sondern bilden eine Mappe mit dem schlichten Titel: What remains, 2020/2021.
Literatur Adler, Hans (Hg.). Aesthetics and Aisthesis: New Perspectives and Rediscoveries. Oxford 2002. Anon. »Jacob Shatzky, Historian, Was 61: Author of Monumental Work on Jews of Warsaw Dies – Editor and Librarian«. In: New York Times (14.06.1956), 33. Aichhorn, Thomas (Hg.). Zur Geschichte der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung. I: 1938–1949. Tübingen 2003. Bonaparte, Marie. Film (1937). https://www.loc.gov/item/2018601153/ (Zugriff September 2021). Bonham’s Auction Catalog. https://www.bonhams.com/auctions/23749/lot/1150/ (Zugriff September 2021). [Engelman, Edmund]. Berggasse 19. Das Wiener Domizil Sigmund Freuds. Zürich 1977. [Engelman, Edmund]. Berggasse 19: Sigmund Freud’s Home and Offices, Vienna 1938. The Photographs of Edmund Engelman. With a Preface by Peter Gay. New York 1976. Forrester, John. Dispatches from the Freud Wars. Psychoanalysis and its Passions. Cambridge 1997. Freud, Sigmund. Brautbriefe in 5 Bden. Bd. 4: Spuren von unserer komplizierten Existenz. Frankfurt a.M. 2019.
Liliane Weissberg: Freuds Zuhause
Freud, Sigmund. »Das Unheimliche« [1919]. In: Ders. Gesammelte Werke, chronologisch geordnet. Bd. 12: Werke aus den Jahren 1917–1920. Hg. v. Anna Freud et al. London 1947, 229–269. Freud, Sigmund. Hemmung, Symptom und Angst. Leipzig 1926. Freud, Sigmund/Josef Breuer. Studien über Hysterie. Leipzig 1895. Kaufhold, Roland. »Spurensuche zur Geschichte der die USA emigrierten Wiener Psychoanalytischen Pädagogen«. In: Luzifer-Amor 16.31 (2003), 37–69. Kelley, Tina. »Edward Gorey, Eery Illustrator And Writer, 75«. In: New York Times (16. April 2000), 43. Marinelli, Lydia. »›Body missing‹ at Berggasse 19«. Übers. v. J. Titheridge. In: American Imago 66 (2009), 161–167. Mayer, Andreas. »›Ein Übermass an Gefälligkeit‹. Der Sammler Jean-Martin Charcot und seine Objekte«. In: »Meine … alten und dreckigen Götter«. Aus Sigmund Freuds Sammlung. Hg. v. Lydia Marinelli. Wien/Frankfurt a.M. 1998, 47–59. McCouat, Philip. »Bernardo Bellotto and the Reconstruction of Warsaw. How a Hidden Cache of 18th Century Artworks Provided a Blueprint for the Resurrection of a Destroyed City«. In: Journal of Art in Society 20 (2015). www.artinsociety.com/bernardo-bellotto-and-the-reconstruction-of-warsaw.html (Zugriff September 2021). Morra, Joanne. »Seemingly Empty: Freud at Berggasse 19, A Conceptual Museum in Vienna«. In: Journal of visual culture 12 (2013), 89–127. New York State Psychiatric Institute, Katalog. https://library-archives.cumc.colum bia.edu/collections/freud-library (Zugriff September 2021). Pessler, Monika. Email-Brief, Verteiler an Freunde des Museums, vom 13. Dezember 2021. Saxon, Wolfgang. »Edmund Engelman, 92, Dies; Took Freud Photos«. In: New York Times (16.04.2000), 43. Weber, Samuel. »The Sideshow, or: Remarks on a Canny Moment«. In: MLN 88 (1973), 1102–1133. Weissberg, Liliane. »The Promised Land: Freud’s Dream of England«. In: Freud and the Émigré. Austrian Émigrés, Exiles, and the Legacy of Psychoanalysis in Britain, 1930s–1970s. Hg. v. Daniela Finzi/Elana Shapira. London 2020a, 35–60. Weissberg, Liliane. »Ein gottloser Jude«. In: Freud, Berggasse 19 – Ursprungsort der Psychoanalyse. Katalog der Dauerausstellung. Hg. v. Monika Pessler/Daniela Finzi. Berlin 2020b, 135–144. Werner, Arnold. »Edmund Engelman: Photographer of Sigmund Freud’s Home and Offices«. In: The International Journal of Psychoanalysis 83.2 (2002), 445–451.
53
»… out of joint«: Wiedergängerinnen in Rainer Maria Rilkes Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge und Marie NDiayes Autoportrait en vert Caroline Torra-Mattenklott
Geschichten über Gespenster sind meistens Geschichten über Schuld und Trauma: Das Verdrängte oder Verschwiegene kehrt wieder in Gestalt von Phantomen oder Wiedergängern (frz. revenants), die erst dann zur Ruhe kommen, wenn die begangene Schuld gesühnt, die Erinnerung an das traumatische Ereignis zugelassen wird. Aus psychoanalytischer Sicht handelt es sich bei den Wiedergängern um Abkömmlinge des Unbewussten, die dem traumatisierten Subjekt in einer charakteristischen, der rationalen Kontrolle entzogenen Dynamik der Wiederholung wie von außen entgegentreten (vgl. Freud [1920] 1989; Kraft 2014). Gespenster sind, wie Aleida Assmann gezeigt hat, auch eine Metapher des kulturellen Gedächtnisses: Sie werden, etwa in Ruth Klügers Autobiographie weiter leben (1992), in individuellen Ritualen der Trauerarbeit beschworen (Assmann [1999] 2006, 176f., 259) oder holen – so Assmann über Heiner Müllers Dramen – »das kollektive Trauma, die von der Gesellschaft verdrängte Schuld […] einer vergangenheits- und ahnenvergessenen Gegenwart […] gewaltsam ins Bewußtsein zurück[]« (Assmann [1999] 2006, 175). In jüngerer Zeit spuken Wiedergänger dieser Art in den Familienromanen von HansUlrich Treichel (1998), Günter Grass (2002) und Stephan Wackwitz (2003), in denen es ähnlich wie bei Heiner Müller und Ruth Klüger um die Verarbeitung des Nationalsozialismus durch die Kriegs- und Nachkriegsgenerationen geht (vgl. Friedrich 2010). Man könnte aber ebenso an Toni Morrisons Roman Beloved (1987) denken, die auf einem historischen Ereignis beruhende Geschichte einer entlaufenen Sklavin zur Zeit des amerikanischen Sezessionskriegs: Noch Jahre nach dem offiziellen Ende der Sklaverei wird die schon lange in Freiheit lebende Sethe vom Geist ihres Babys heimgesucht, das sie als junge Frau getötet hat, um es ihren weißen Verfolgern zu entziehen. Die individuelle Verarbeitung von Schuld und Trauer steht hier im Kontext eines kollektiven Traumas, das nur durch kollektive Erinnerungsarbeit bewältigt werden kann. Die Austreibung des Geistes am Ende des Romans setzt allerdings die pragmatische Einsicht voraus, dass man sich von der erdrückenden
56
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Last der Vergangenheit zuweilen befreien muss, um die Herausforderungen der Gegenwart bewältigen zu können. Gespensterliteratur wie diese ist immer auch politische Literatur; sie zwingt zur Auseinandersetzung mit der Geschichte und reflektiert zugleich die Frage, in welchem Maße die Geister der Vergangenheit dem gegenwärtigen Leben zuträglich sind. In seinem Essay Spectres de Marx (Marx’ Gespenster) von 1993 hat Jacques Derrida diese Frage mit Emphase zugunsten der Gespenster beantwortet: Leben lernen, so Derrida, könne nichts anderes bedeuten, als mit den Gespenstern zu leben, d.h. in Gesellschaft und im Dialog mit dem, was nicht gegenwärtig ist, was jenseits des Lebens ist und sich zwischen Leben und Tod bewegt: Cela ne peut se passer, si cela reste à faire, apprendre à vivre, qu’entre vie et mort. Ni dans la vie ni dans la mort seules. Ce qui se passe entre deux, et entre tous les »deux« qu’on voudra, comme entre vie et mort, cela ne peut que s’entretenir de quelque fantôme. Il faudrait alors apprendre les esprits. Même et surtout si cela, le spectral, n’est pas. Même et surtout si cela, ni substance ni essence ni existence, n’est jamais présent comme tel. Le temps de l’apprendre à vivre«, un temps sans présent tuteur, reviendrait à ceci […]: apprendre à vivre avec les fantômes, dans l’entretien, la compagnie ou le compagnonnage, dans le commerce sans commerce des fantômes. Wenn es das ist, was zu tun bleibt, daß man Leben lernt, dann kann es nur zwischen Leben und Tod geschehen. Weder im Leben noch im Tod allein. Was zwischen zweien passiert, wie zwischen Leben und Tod und zwischen allen anderen »zweien«, die man sich vorstellen mag, das kann sich nur dazwischen halten und nähren dank eines Spuks. Man müßte also die Geister lernen. Sogar und vor allem dann, wenn das da, das Gespenstige, weder Substanz noch Essenz, noch Existenz, niemals als solches präsent ist. Die Zeit des »lernen zu leben«, eine Zeit ohne bevormundendes Präsens, käme auf das zurück […]: Lernen, mit den Gespenstern zu leben, in der Unterhaltung, der Begleitung oder der gemeinsamen Wanderschaft, im umgangslosen Umgang mit den Gespenstern. (Derrida 1993, 10f.; 1995, 14f., Herv. i. O.) Eine Gegenwart, die Umgang mit Gespenstern unterhält, um von ihnen zu lernen, ist eine dezentrierte, mit sich selbst nicht identische Gegenwart, eine Zeit oder Un-Zeit, in der die chronologische Zeitenfolge außer Kraft gesetzt ist, in der das Vergangene zugleich anwesend und abwesend ist und überdies Ansprüche auf die Zukunft erhebt. Die Zeit, in der das Gespenst erscheint – der »Moment spectral«, wie Derrida schreibt (»Gespenstischer Augenblick«, Derrida 1993, 17; 1995, 12), – ist eine Zeit, die »aus den Fugen« ist. »The time is out of joynt: Oh cursed spite,/That ever I was born to set it right!« (Shakespeare, Hamlet, I,5, zit.n. Derrida 1995, 15, vgl. 1993, 19) Der Satz, den Hamlet
Caroline Torra-Mattenklott: »… out of joint«
spricht, nachdem ihm der Geist seines Vaters erschienen ist und ihn dazu aufgefordert hat, den an ihm begangenen Mord zu rächen, ist ein Schlüsselsatz in Derridas »hantologie« oder »logique de la hantise«, (»Hantologie« oder »Logik der Heimsuchung«, Derrida 1993, 31; 1995, 27), und zwar in doppelter Hinsicht: Zum einen bildet er den Ausgangspunkt seiner Überlegungen zum moment spectral, zu jener Ungleichzeitigkeit, Unzeitigkeit oder »Anachronie« (Derrida 1993, 26; 1995, 22), die die Gegenwart in sich trennt, ausrenkt oder aus den Angeln hebt. Zum anderen benennt er den politischen Auftrag, den Hamlet vom Geist seines Vaters empfängt, sein Erbe oder Vermächtnis, das zugleich eine in die Zukunft weisende »Verfügung« ist (»une injonction«, Derrida 1993, 17; 1995, 10, Herv. i. O.): »That ever I was born to set it right!« Das Gespenst, um das es hier geht, ist kein erdrückender Alp, sondern – so unbequem das für den Melancholiker Hamlet sein mag – eine Aufforderung zum Handeln. Mit solchen Gespenstern zu leben, so Derrida, entspricht einer »Politik des Gedächtnisses, des Erbes und der Generationen« (Derrida 1995, 11; vgl. 1993, 15), d.h. einer Politik, die im Namen der Gerechtigkeit das Vergangene ebenso wie das Zukünftige als ein irreduzibel Anderes in sich aufnimmt. Mit seiner fragwürdigen Identität und seinen stets mehrdeutigen, auslegungsbedürftigen Ansprüchen ist das Gespenst bei Derrida eine Figur der différance – eine Figur des Disparaten, des Aufschubs und der Wiederholung. Es steht für eine Auffassung von Dekonstruktion, deren de-totalisierender Gestus einem »ethischen und politischen Imperativ« verpflichtet ist (Derrida 1995, 57, vgl. 1993, 59). Dieser Imperativ, so Derrida, ist nichts anderes als die injonction, die Verfügung, die von den Gespenstern ausgeht. Die beiden Texte, um die es im Folgenden gehen wird, Rilkes Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910) und Marie NDiayes Autoportrait en vert (Selbstporträt in Grün, 2005) sind zumindest prima facie keine politischen Texte. Die Gespenster, von denen sie erzählen, sind keine Opfer von Morden und erteilen keine Aufträge. Christine und Ingeborg Brahe, die beiden Tanten, deren Geister die Familie des jungen Dänen Malte Laurids Brigge heimsuchen, sind im Kindbett bzw. an einer ungenannten Krankheit verstorben; bei den Wiedergängerinnen in NDiayes Autoportrait en vert handelt es sich um Selbstmörderinnen, von denen wir nicht viel mehr erfahren, als dass sie zu Lebzeiten unglückliche Ehefrauen gewesen sind. Was die beiden Texte miteinander und mit Derridas hantologie verbindet, ist ihre Zeitstruktur: Im Malte ebenso wie in NDiayes Autoportrait ist die Zeit »aus den Fugen«, und zwar sowohl auf der Ebene der erzählten Welt als auch auf der Ebene des Erzählens. Das Erscheinen der Wiedergängerinnen impliziert in beiden Texten eine tiefgreifende Irritation des Wirklichkeitsempfindens, die nicht nur, aber auch mit der Durchlässigkeit und Vermischung der Zeiten zusammenhängt. Beide Texte geben zu verstehen, dass das Leben mit den Gespenstern eine unausweichliche, wenn auch schwer erträgliche Notwendigkeit ist. Man kann sich fragen, ob es sich angesichts dieser Eigenschaften um dekonstruktive Texte handelt und ob sie dem von Derrida formulierten ethischen Imperativ genügen – ich werde dazu ein paar Gedanken skizzieren. Zunächst und
57
58
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
vor allem möchte ich aber versuchen zu beschreiben, was in poetologischer Hinsicht das ›spektrale Moment‹ dieser Texte ausmacht: Inwiefern kann man in Bezug auf Rilkes Malte und NDiayes Autoportrait en vert wenn nicht von einer Politik, so von einer Poetik des Spektralen sprechen?
1. Fragmente und Leerstellen: Wiedergängerinnen in Rilkes Malte Laurids Brigge Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge beginnen mit einem Satz über Leben und Tod: »So, also hierher kommen die Leute, um zu leben, ich würde eher meinen, es stürbe sich hier.« (Rilke [1910] 1997, 7) »Hier«, das heißt in Paris, in der Stadt, in der Malte seine Aufzeichnungen verfasst, in der er, wie er schreibt, »sehen« lernt und sich dabei so stark verändert, dass alle Bekannten, denen er Briefe schreiben könnte, ihm wie Fremde vorkommen (Rilke [1910] 1997, 8f.). Maltes Pariser Gegenwart ist eine Gegenwart, in der das Leben von Armut, Krankheit und Tod gezeichnet ist; sehen zu lernen bedeutet für ihn, sich dem Befremdlichen, Beängstigenden dieser Gegenwart auszusetzen und sich selbst darüber fremd zu werden. Das Fremdsein – im Verhältnis zu dem, der man gerade eben noch war, im Verhältnis zum eigenen Körper und im Verhältnis zur Gesellschaft, in der man sich bewegt – ist ein Grundthema des Malte, das zuvorderst in der Auseinandersetzung mit dem Tod und im Bild des Sterbens entfaltet wird. Auch die Kindheitserinnerungen, die im ersten Teil der Aufzeichnungen mit den Paris-Episoden abwechseln, sind zunächst durch das Thema des Todes motiviert: Angesichts der industriellen Formen, die das Sterben in den Pariser Spitälern annimmt, erinnert sich Malte an die Sterberituale der vormodernen ländlichen Aristokratie, aus der er stammt. Dabei erweist sich seine dänische Vergangenheit insofern als ein Spiegel der Pariser Gegenwart, als das Leben auch in den Kindheitsepisoden vom Tode dominiert erscheint. Das Haus, in dem der Geist von Maltes Tante Christine umgeht, ist das Schloss seines Großvaters mütterlicherseits, des Grafen Brahe. »Out of joint«, »aus den Fugen«, ist zuallererst Maltes Erinnerung an dieses Gebäude, das nach dem Tod des Grafen »in fremde Hände« kam (Rilke [1910] 1997, 24), also nur noch als erinnertes zugänglich ist. Das Haus bildet in Maltes Erinnerung kein Ganzes, sondern eine Ansammlung unverbundener, bruchstückhafter Einzelräume: So wie ich es in meiner kindlich gearbeiteten Erinnerung wiederfinde, ist es kein Gebäude; es ist ganz aufgeteilt in mir; da ein Raum, dort ein Raum und hier ein Stück Gang, das diese beiden Räume nicht verbindet, sondern für sich, als Fragment, aufbewahrt ist. In dieser Weise ist alles in mir verstreut, – die Zimmer, die Treppen, die mit so großer Umständlichkeit sich niederließen, und andere enge, rundgebaute Stiegen, in deren Dunkel man ging wie das Blut in den Adern; die
Caroline Torra-Mattenklott: »… out of joint«
Turmzimmer, die hoch aufgehängten Balkone, die unerwarteten Altane, auf die man von einer kleinen Tür hinausgedrängt wurde: – alles das ist noch in mir und wird nie aufhören, in mir zu sein. Es ist, als wäre das Bild dieses Hauses aus unendlicher Höhe in mich hineingestürzt und auf meinem Grunde zerschlagen. (Rilke [1910] 1997, 24f.) »Ganz erhalten« ist in Maltes Erinnerung nur der Saal, in dem sich die Familie jeden Abend zum Essen versammelt (Rilke [1910] 1997, 25). Dieser Raum übt auf den Jungen eine gleichsam hypnotische Wirkung aus; alles Zeitempfinden kommt hier zum Erliegen, die Erinnerung an soeben Erlebtes fällt aus und jegliche innere Regung erlahmt: man vergaß in einigen Minuten die Tageszeit und alles, was man draußen gesehen hatte. Dieser hohe, wie ich vermute, gewölbte Raum war stärker als alles; er saugte mit seiner dunkelnden Höhe, mit seinen niemals ganz aufgeklärten Ecken alle Bilder aus einem heraus, ohne einem einen bestimmten Ersatz dafür zu geben. Man saß da wie aufgelöst; völlig ohne Willen, ohne Besinnung, ohne Lust, ohne Abwehr. Man war wie eine leere Stelle. (Rilke [1910] 1997, 25) Ebenso unverbunden und »unverfugt« wie die Räume des Hauses sind die Mitglieder der Familie, die es bewohnen und sich allabendlich im Speisesaal zusammenfinden (Rilke [1910] 1997, 26–28). Ihre Verwandtschaftsverhältnisse sind entfernt und unbestimmt, und ebenso unklar sind die Gründe, aus denen sie sich im Schloss Urnekloster aufhalten. Was sie teilen, ist ein besonderes Verhältnis zu den Toten: Der Oheim unternimmt alchimistische Versuche und konserviert Leichenteile; Mathilde Brahe, eine entfernte Cousine von Maltes Mutter, korrespondiert mit einem österreichischen Spiritisten; der Knabe Erik pflegt ein freundschaftliches Verhältnis mit der Wiedergängerin Christine und findet selbst einen frühen Tod. »Aus den Fugen« sind aber auch die Gesichter der Familienangehörigen, sei es als Folge, sei es als physiognomischer Ausdruck ihres Verkehrs mit dem Jenseits: Das Gesicht des Oheims weist aufgrund einer Pulverexplosion schwarze Flecken auf, die Augen Mathilde Brahes fließen »beständig über« (Rilke [1910] 1997, 26), und Malte erkennt in ihren Zügen – »auseinandergedrängt, verbogen und nicht mehr in Verbindung miteinander« (Rilke [1910] 1997, 27) – diejenigen seiner verstorbenen Mutter wieder; Erik schielt, und sein unbewegliches Auge bleibt »immer in dieselbe Ecke gerichtet […], als wäre es verkauft und käme nicht mehr in Betracht« (ebd.).1 Maltes Großvater, dessen maskenhaftes Gesicht die abendliche Gesellschaft beherrscht, macht im Umgang mit den Toten am wenigsten Umstände: »Die Zeitfolgen«, erinnert sich Malte, 1
Prisca Pytlik, die vor dem Hintergrund von Rilkes eigenen spiritistischen Interessen und Lektüren eine »spiritistische Lesart« des Malte vorschlägt (Pytlik 2005, 171), hat darauf hingewiesen, dass der Spiritist Carl du Prel, dessen Schriften Rilke kannte, seherisch veranlagten Menschen einen »schielenden Blick« zuschrieb (vgl. Pytlik 2005, 177f., Anm. 41).
59
60
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
»spielten durchaus keine Rolle für ihn, der Tod war ein kleiner Zwischenfall, den er vollkommen ignorierte, Personen, die er einmal in seine Erinnerung aufgenommen hatte, existierten, und daran konnte ihr Absterben nicht das geringste ändern« (Rilke [1910] 1997, 29f.) – eine Haltung, die der Graf nicht weniger selbstverständlich auch dem Zukünftigen entgegenbringt. Der ›spektrale Moment‹ im Malte ist zum einen durch die Suspension der Zeitenfolge, zum anderen durch Leerstellen in der räumlichen Ordnung gekennzeichnet (vgl. hierzu auch Torra-Mattenklott 2016, 341–359). Das Gefühl »wie eine leere Stelle« zu sein, befällt Malte, wann immer er im Speisesaal Platz nimmt. An dem Abend, an dem er erstmals dem Erscheinen der Wiedergängerin Christine beiwohnt, weist der Raum überdies eine weitere Leerstelle auf: Mathilde Brahe fehlt, was umso auffälliger ist, als der kurzsichtige, ebenfalls spiritistisch veranlagte Diener ihre Abwesenheit ignoriert und dem leeren Platz die Schüssel anbietet (Rilke [1910] 1997, 30). Mathildes Ausbleiben wird damit begründet, dass sie »Christinen nicht zu begegnen« wünsche (Rilke [1910] 1997, 30f.), und tatsächlich öffnet sich gegen Ende der Mahlzeit eine Tür, durch die zum Entsetzen der meisten Anwesenden »eine schlanke, hellgekleidete Dame«, der Geist Christine Brahes, den Raum betritt (Rilke [1910] 1997, 31). Eriks Erfahrungen mit der Wiedergängerin bestätigen, dass ihr Erscheinen an eine Leerstelle geknüpft ist, also einer Logik der Substitution gehorcht. Von der Frage umgetrieben, ob sich unter den Ahnenbildern der Brahes ein Portrait Christines findet, schleicht Malte nachts in die Galerie und begegnet dort seinem Cousin: Da Christine Brahe »sich sehen« wolle (Rilke [1910] 1997, 99), hilft Erik ihr bei der Suche nach ihrem Portrait. Man habe das Bild aber offensichtlich fortgestellt, und im Spiegel, den er ihr stattdessen gebracht habe, sei sie ebenfalls »nicht drin« (Rilke [1910] 1997, 100). »Man ist entweder drin«, so Eriks lapidare Erklärung, »dann ist man nicht hier; oder wenn man hier ist, kann man nicht drin sein.« (Ebd.) Die Anwesenheit des Gespensts impliziert nicht nur den Tod der Person, die es war, sondern auch das Fehlen ihres Bildes. Wenn die Gespenster im Malte den Lebenden einen Auftrag erteilen, so können wir an dieser Stelle festhalten, dann ist es der, ihnen ein Bild zu verschaffen, in dem sie sich sehen können und, so muss man Eriks Logik wohl weiterdenken, in dem sie Erlösung finden – eine Aufforderung zur Repräsentation, nicht im politischen, sondern im ästhetischen Sinne. Dies ist der Auftrag, den Malte mit seinen Aufzeichnungen zu erfüllen versucht. Ein Beispiel ist Eriks eigenes Portrait, das letzte, das in die Galerie der Brahes Aufnahme gefunden hat. Zumindest scheint es so: Maltes Beschreibung dieses Portraits erfolgt im Modus des hypothetischen Erzählens, einer zuerst von Judith Ryan untersuchten Erzählform, die für die gesamten Aufzeichnungen charakteristisch ist (Ryan 1971). Die Existenz des Bildes wird auf diese Weise mehr beschworen als behauptet:
Caroline Torra-Mattenklott: »… out of joint«
Ich erinnere mich, daß damals dein Bild gemalt wurde. Der Großvater hatte jemanden kommen lassen, der dich malte. […] Ich kann mich nicht besinnen, wie der Maler aussah, sein Name ist mir entfallen, obwohl Mathilde Brahe ihn jeden Augenblick wiederholte. Ob er dich gesehen hat, wie ich dich seh? Du trugst einen Anzug von heliotropfarbenem Samt. Mathilde Brahe schwärmte für diesen Anzug. Aber das ist nun gleichgültig. Nur ob er dich gesehen hat, möchte ich wissen. Nehmen wir an, daß es ein wirklicher Maler war. Nehmen wir an, daß er nicht daran dachte, daß du sterben könntest, ehe er fertig würde; daß er die Sache gar nicht sentimental ansah; daß er einfach arbeitete. Daß die Ungleichheit deiner beiden braunen Augen ihn entzückte; daß er keinen Moment sich schämte für das unbewegliche; daß er den Takt hatte, nichts hinzuzulegen auf den Tisch zu deiner Hand, die sich vielleicht ein wenig stützte –. Nehmen wir sonst noch alles Nötige an und lassen es gelten: so ist ein Bild da, dein Bild, in der Galerie auf Urnekloster das letzte. (Und wenn man geht, und man hat sie alle gesehen, so ist da noch ein Knabe. Einen Augenblick: wer ist das? Ein Brahe. […] Dieser Knabe ist als Knabe gestorben, gleichviel wann. Kannst du das nicht sehen?) (Rilke [1910] 1997, 101f.) Erzählt wird hier nicht von einem bereits bestehenden Bild, denn es bleibt ungewiss, ob Eriks Portrait tatsächlich je gemalt wurde. Vielmehr bringt Maltes Erzählung das Portrait allererst hervor. Es handelt sich nicht um ein erinnertes, sondern um ein fiktives Bild, das durch den hypothetischen Erzählmodus auch als fiktiv markiert wird. Der Erzähler, der im Präsens von sich sagt, dass er Erik ›sieht‹ (»wie ich dich seh«), stilisiert sich an dieser Stelle – wie auch in anderen Passagen, in denen im hypothetischen Modus erzählt wird – als Dichter-Seher, der den von Erik vorgelebten Dienst an den Toten weiterführt. Es gibt zahlreiche Passagen im Malte, anhand deren man die Verbindung von Geisterseherei und immanenter Poetik weiter analysieren könnte. Ich möchte hier nur noch auf eine Textstelle eingehen: auf die Erzählung von Ingeborg, der zweiten Wiedergängerin, von der in den Aufzeichnungen die Rede ist. Die Erzählung von Ingeborg wird eingeführt durch eine Metareflexion über das Erzählen, in deren Zentrum wiederum eine Leerstelle steht: Damals zuerst fiel mir auf, daß man von einer Frau nichts sagen könne; ich merkte, wenn sie von ihr erzählten, wie sie sie aussparten, wie sie die anderen nannten und beschrieben, die Umgebungen, die Örtlichkeiten, die Gegenstände bis an eine bestimmte Stelle heran, wo das alles aufhörte, sanft und gleichsam vorsichtig aufhörte mit dem leichten, niemals nachgezogenen Kontur, der sie einschloß. Wie war sie? frage ich dann. »Blond, ungefähr wie du«, sagten sie und zählten allerhand auf, was sie sonst noch wußten; aber darüber wurde sie wieder ganz ungenau, und ich konnte mir nichts mehr vorstellen. Sehen eigentlich konnte ich sie
61
62
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
nur, wenn Maman mir die Geschichte erzählte, die ich immer wieder verlangte –. (Rilke [1910] 1997, 73f., Herv. i. O.) Anders als man beim ersten Lesen vielleicht vermuten könnte, liegt das Unzureichende der Erzählungen über Ingeborg – denn von ihr ist hier bereits die Rede – in Maltes Sicht nicht im Aussparen ihrer Person, sondern in den vergeblichen Versuchen, durch die Aufzählung charakteristischer Details ihr Aussehen zu beschreiben. In der einzigen Erzählung nämlich, die es Malte ermöglicht, sich Ingeborg vorzustellen, d.h. sie zu sehen, wird ihre Person ebenfalls vollständig ausgespart. Paradoxerweise tritt Ingeborg in dieser Erzählung auch gar nicht sichtbar in Erscheinung. Sie oder ihr Geist erscheint vielmehr in unsichtbarer Gestalt. Was sichtbar wird, ist lediglich ihr Umriss, nicht in Form eines »nachgezogenen Kontur[s]«, sondern negativ als Grenze, an der ihre Umgebung aufhört. Am Donnerstag nach Ingeborgs Tod sitzt die Familie auf der Terrasse beim Tee. Der Tisch ist so gedeckt worden, dass trotz Ingeborgs Abwesenheit keine Lücke entsteht, und da ihrem Tod eine längere Krankheit vorausgegangen ist, hat die Familie sich an ihr Fernbleiben bereits gewöhnt. Die gespenstische Erscheinung erfolgt in einem Augenblick der allgemeinen Selbstvergessenheit. Früher ist es Ingeborgs Aufgabe gewesen, der Familie die Post an den Teetisch zu bringen. Am Donnerstag nach ihrem Tod wenden sich zur gewohnten Zeit unwillkürlich die Augen aller Anwesenden in die Richtung, aus der sie zu kommen pflegte: Vielleicht war es unsere Schuld; vielleicht haben wir sie gerufen. Denn ich erinnere mich, daß ich auf einmal dasaß und angestrengt war, mich zu besinnen, was denn eigentlich nun anders sei. Es war mir plötzlich nicht möglich zu sagen, was; ich hatte es völlig vergessen. Ich blickte auf und sah alle andern dem Hause zugewendet, nicht etwa auf eine besondere, auffällige Weise, sondern so recht ruhig und alltäglich in ihrer Erwartung. Und da war ich daran […] zu sagen: »Wo bleibt nur –« Da schoß schon Cavalier, wie er immer tat, unter dem Tisch hervor und lief ihr entgegen. Ich hab es gesehen, Malte, ich hab es gesehen. Er lief ihr entgegen, obwohl sie nicht kam; für ihn kam sie. […] Zweimal sah er sich nach uns um, als ob er fragte. Dann raste er auf sie zu, wie immer, […] und erreichte sie; denn er begann rund herum zu springen, Malte, um etwas, was nicht da war, und dann hinauf an ihr, um sie zu lecken, gerade hinauf. […] Aber da heulte es auf einmal, und er drehte sich von seinem eigenen Schwunge in der Luft um und stürzte zurück […] und lag ganz eigentümlich flach da und rührte sich nicht. (Rilke [1910] 1997, 77f., Herv. i. O.) Wie beim Erscheinen Christines ist der moment spectral auch hier durch einen Ausfall des Zeitgefühls und eine Störung der räumlichen Ordnung gekennzeichnet: Das Bestreben der Familie, alles wie gewöhnlich erscheinen zu lassen, ist so erfolgreich, dass sie sich verhält wie in der Zeit vor Ingeborgs Erkrankung. Durch die sorgsame
Caroline Torra-Mattenklott: »… out of joint«
Nutzung des Platzes am Tisch wird die dort verbliebene Leerstelle allerdings nur verschoben. Sie wird umso deutlicher markiert durch die erwartungsvollen Blicke, die sich auf das Haus richten, und durch den Gedankenstrich, mit dem die unausgesprochene Frage von Maltes Mutter abbricht (»Wo bleibt nur –«). Ingeborgs Wiederkehr ist also im wörtlichen Sinne die Wiederkehr von etwas Verdrängtem, und allein dieses Verdrängen oder Vergessen wird von der Mutter als eine Schuld wahrgenommen (»Vielleicht war es unsere Schuld; vielleicht haben wir sie gerufen«). Ob die Geschichte, die dem Zuhörer Malte die unsichtbare Erscheinung vor Augen führt, im Auftrag der Verstorbenen erzählt wird, ist allerdings fraglich: Es ist Malte selbst, der die Geschichte immer wieder hören und am Ende auch aufschreiben will (»Und nun will ich die Geschichte aufschreiben, so wie Maman sie erzählte, wenn ich darum bat«, Rilke [1910] 1997, 77). Das Erzählen ist an dieser Stelle kein karitativer Dienst an der Toten, sondern ein Akt der poetischen Kommunion von Sohn und Mutter. Im Zuge dieser Erzählungen wird das Sehen, zu Beginn des Romans exponiert als Wahrnehmung der Pariser Alltagsrealität, sukzessive zur Geisterseherei und zu einem poetischen Vermögen, das Bilder des Unsichtbaren und Nie-da-Gewesenen hervorbringt. Es ließe sich zeigen – und ist von Judith Ryan auch kritisch angedeutet worden (vgl. Ryan 1971, 349–353, 373) –, dass diese Praxis des visionären Erzählens eine Derealisierung von Maltes Pariser Gegenwart zur Folge hat: Was als soziale Realität und Alterität eingeführt wird, nimmt im Kontext der Geisterseherei einen gespenstischen Charakter an und wird auf diese Weise aus der Sphäre des Handelns in die Sphäre der Fantasie, der Bilder und der Dichtung transferiert. Die Solidarität, die Malte den Randständigen der Pariser Gesellschaft entgegenbringt, ist eine rein imaginäre, und sie bleibt grundiert von seiner panischen Angst, selbst zu den »Fortgeworfenen« zu zählen (Rilke [1910] 1997, 36f.).
2. Frauen in Grün: Wiedergängerinnen in Marie NDiayes Autoportrait en vert Wie die meisten Texte Marie NDiayes ist Autoportrait en vert, 2005 in der Reihe »Traits et portraits« des Verlags Mercure de France erschienen, ein Text über die Familie, und wie Maltes Verwandtschaft auf Schloss Urnekloster ist auch die hier portraitierte Familie »aus den Fugen«, »out of joint«. Der afrikanische Vater der ungefähr 30jährigen Ich-Erzählerin – ihr Name wird nicht genannt; ich nenne sie der Einfachheit halber Marie – hat vier- oder fünfmal geheiratet und mit seinen diversen Frauen zahlreiche Kinder gezeugt; seine aktuelle Frau, mit der er erst ein Restaurant im Pariser Stadtteil Belleville unterhält und später nach Burkina Faso umsiedelt, war zuvor Maries beste Freundin. Passend zu ihrem Alter färbt der Vater sich die grauen Haare schwarz und hat so viel Gewicht verloren, dass er den alten, in seinem Restaurant zur Schau gestellten Fotos gleicht, auf denen er als schmächti-
63
64
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
ger junger Mann zu sehen ist. Maries Mutter hat nach der Trennung zunächst ein zurückgezogenes Leben in der Pariser Banlieue geführt, heiratet dann aber überraschenderweise einen Mann in Maries Alter und bekommt mit ihm ein weiteres Kind. Als Marie von der Geburt ihrer Halbschwester Bella erfährt, erwartet sie selbst bereits ihr fünftes Baby, muss aber feststellen, dass ihre Mutter für die Enkelkinder kein Interesse aufbringt, weil sie mit ihrer eigenen neuen Lebenssituation überfordert ist: Bella wird unter der Woche von einer Pflegefamilie betreut und die Ehe mit Rocco erweist sich nach kurzer Zeit als zerrüttet. Aus den Fugen sind in dieser Familie die ehelichen Verbindungen und die Beziehungen zwischen Eltern, Kindern, Geschwistern und Freundinnen, aus den Fugen ist aber – sehr zum Ärger der IchErzählerin – auch die Ordnung der Generationen und Lebensalter. Die beiden Wiedergängerinnen, die in der Erzählung eine Rolle spielen, gehören nicht zur Familie und treten anders als bei Rilke auch nicht im Familienkreis in Erscheinung. Sie gehören aber ebenso wie die Mutter, die junge Stiefmutter und die Halbschwester Bella zur Serie der Frauen, die von der Ich-Erzählerin als ›Frauen in Grün‹ bezeichnet werden. Die voneinander unabhängigen, nur durch die zentrale Figur der Ich-Erzählerin aufeinander bezogenen Geschichten dieser ›Frauen in Grün‹ bilden in ihrer Aufeinanderfolge das strukturelle Gerüst des Prosatextes. Dabei handelt es sich nicht um eine chronologisch fortlaufende Erzählung, sondern um mehrere zeitlich versetzte, sich teilweise überlappende Handlungsstränge, die – darin dem Malte nicht unähnlich – in Form mehr oder weniger genau datierter Aufzeichnungen präsentiert werden. Sämtliche Datumsangaben beziehen sich auf den Zeitraum zwischen 2000 und Dezember 2003, wobei einige den Zeitpunkt der Niederschrift, andere den Zeitpunkt der erzählten Ereignisse bezeichnen und die Zeitabstände zwischen der Niederschrift und den erzählten Ereignissen variieren. Auf beiden sich immer wieder überschneidenden Zeitebenen wird vorund zurückgesprungen, so dass beim Lesen eher der Eindruck eines diffusen zeitlichen Kontinuums entsteht als der einer klaren Abfolge von Ereignissen. Als Rahmen und zugleich als rhythmisierender Refrain fungiert die tagebuchartig angelegte, in fünf Abschnitte unterteilte Erzählung von einem Garonne-Hochwasser im Dezember 2003, die chronologisch fortschreitet und sich gegen Ende mit einem der übrigen Erzählstränge verbindet (NDiaye 2005, 7f., 29, 39f., 73, 94; 2012, 5, 35f., 47f., 91f., 119). Ob der letzte Teil der Garonne-Sequenz, mit der das Buch endet, zugleich den letzten Punkt auf der Zeitskala der Ereignisse bildet oder chronologisch vor die letzten Familienereignisse fällt, bleibt unklar. Auch das Verhältnis von Erzählzeit und erzählter Zeit ist in Autoportrait en vert also aus den Fugen, »out of joint«. Im Vergleich zu Rilkes Aufzeichnungen, in denen sich die Ebene der Pariser Gegenwart klar von den Kindheitserinnerungen und den im dritten Teil des Romans dominierenden historischen Episoden und Legenden abgrenzen lässt, liegen die verschiedenen Zeitebenen bei NDiaye verwirrend eng beieinander. Desorientierend wirkt hier weniger die Weite der Bezüge als die Un-
Caroline Torra-Mattenklott: »… out of joint«
schärfe, die durch die überpräzise Datierung und die komplexe Anordnung der Einträge entsteht. Dieser Unschärfe entspricht die Realitätswahrnehmung der Ich-Erzählerin, die durchweg von Zweifeln geprägt ist: Fragen wie »Est-ce certain?« (»Ist das wirklich sicher?« NDiaye 2005, 15; 2012, 15), »est-ce réel […]?« (»Ist das real […]?« NDiaye 2005, 24; 2012, 28), »Est-ce bien sûr?« (»Ist das sicher?« NDiaye 2005, 68; 2012, 84) durchziehen den gesamten Text.
Abb. 1: Julie Ganzin: Décrire (1994). Fotografie. Aus: NDiaye 2005, 6.
Unschärfen weist das Buch aber auch im wörtlichen, visuellen Sinne auf. Entsprechend den Vorgaben der Reihe »Traits et Portraits«, die literarische Selbstportraits namhafter Autor:innen, Künstler:innen und Couturiers versammelt, wechselt der Text mit Fotografien ab, die ihn – so der Ankündigungstext der Reihe – wie ein Subtext oder wie das Echo einer zweiten Stimme begleiten. In Autoportrait en vert werden Fotos aus zwei verschiedenen Serien miteinander kombiniert. Die eine Serie besteht aus acht paarig aufeinander bezogenen Bildern der Fotografin Julie Ganzin aus den Jahren 1994 bis 1997, auf denen Landschaften und weibliche Rückenfiguren zu sehen sind. Auf dem allerersten, NDiayes Text vorangestellten Foto – dem einzigen Farbfoto des Bandes (Abb. 1) – ist im Vordergrund eine weibliche, unscharf gezeichnete Figur mit langem blondem Haar und einem grünlichen Kleid zu sehen, deren Haltung – sie hält die linke Hand leicht über dem Kopf erhoben –
65
66
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
darauf schließen lässt, dass sie vom Gegenlicht geblendet in die Landschaft blickt. Auch die grüne Hügellandschaft im Mittel- und Hintergrund ist zum überwiegenden Teil verschwommen, so dass keine Tiefenwirkung entsteht und der Betrachter analog zur geblendeten Betrachterin im Bild die Wahrnehmung der Landschaft als gestört erlebt. Der Buchtitel Autoportrait en vert lädt dazu ein, das Bild als ein Selbstportrait der Autorin zu interpretieren, die sich in der Erzählung wie auf dem Foto als Betrachterin einer unscharfen, leicht unwirklichen Szenerie präsentiert, sich dabei aber selbst nur verschwommen abzeichnet und dem Betrachter ihr Gesicht entzieht. Die andere, anonyme und undatierte Fotoserie besteht aus Frauen- und Landschaftsbildern in zwei Formaten, die ebenfalls Paare bilden (Abb. 2). Die Aufnahmetechnik und die Bildformate erlauben die Vermutung, dass die Bilder um 1900 entstanden sind; die Identität der abgebildeten Personen ist unbekannt. Fünf der sieben Fotos sind Stereoskopien, d.h. Doppelbilder, die gleichzeitig, aber aus leicht verschobener Perspektive aufgenommen wurden, so dass sie, wenn man sie durch ein Stereoskop betrachtet, zu einem dreidimensionalen Bild verschmelzen, eine Technik, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Mode kam und um 1900 auch in der Amateurfotografie verbreitet war.2 Die Stereoskopien in Autoportrait en vert können in zweifacher Hinsicht als Elemente einer Poetik des Spektralen verstanden werden: Zum einen gehören die jeweils fast identischen, nur in der Perspektive geringfügig voneinander abweichenden Fotos, die das im Bild fixierte Hier und Jetzt in sich aufspalten, zu den für das Buch charakteristischen Figuren der Wiederholung und Anachronie. Zum anderen repräsentieren sie ein Verfahren, das – im Unterschied zur Fotografie – bereits im 19. Jahrhundert nicht als Wiedergabe der Wirklichkeit, sondern als Technik der Simulation aufgefasst wurde, da das dreidimensionale Bild erst durch den Wahrnehmungsvorgang aus den beiden Teilbildern konstruiert werden muss (vgl. Stiegler 2001, 56f.). Wie bei der Geisterseherei ist die räumliche Präsenz bei der Stereoskopie eine Illusion, der kein objektiv vorhandener Gegenstand entspricht. Aufgrund der Sujets und der Verteilung der Bilder im Text können die Fotos vage den weiblichen Figuren der Handlung zugeordnet werden; allerdings schließt schon das Alter der Fotografien aus, dass es sich um Portraitaufnahmen der im Text dargestellten Personen handelt. Die Ich-Erzählerin und ihre beiden erwachsenen Schwestern muss man sich – wie die Autorin – als Frauen mit dunkler Hautfarbe vorstellen; auf den Fotos sind ausschließlich Frauen mit heller Hautfarbe abgebildet. Möchte man in den Fotos tatsächlich ein Echo des Textes sehen, so handelt es sich um ein entferntes, verfremdetes und dekoloriertes Echo, das der Stimme, auf die es antwortet, zeitlich vorausgeht und den Wiederholungseffekt des Echos in seinem eigenen Medium repliziert. 2
Nic Leonhardt beschreibt die Stereoskopie als ein Massenmedium des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts (vgl. Leonhardt 2016, 13–15).
Caroline Torra-Mattenklott: »… out of joint«
Abb. 2: Anonyme Fotografie aus privater Sammlung. Aus: NDiaye 2005, 28.
Roland Barthes sah in der Fotografie etwas Gespenstisches am Werk, weil sie einen immer schon vergangenen Moment des Lebens zugleich mortifiziert und lebendig hält (Barthes [1980] 2013, 22–33, 56, 123f.). Gespenstisch in diesem Sinne sind die Fotos in Autoportrait en vert insofern, als sie die Figuren im Text als Wiedergängerinnen unbekannter Personen erscheinen lassen, die angesichts des mutmaßlichen Alters der Fotos mit Sicherheit nicht mehr am Leben sind. Als anonyme Portraits, die zu den im Text beschriebenen Figuren nicht genau passen, versetzen sie die Leserin überdies in einen Zustand der Irritation, in dem sich die unsichere Wahrnehmung der Ich-Erzählerin widerspiegelt. Wie bei alten Fotos in einem Familienalbum oder bei der Foto-Briefmarke, mit der Maries Mutter sie unerwarteterweise über die Geburt ihrer Tochter Bella unterrichtet, handelt es sich um Bilder von Unbekannten, die allein durch ihre Präsenz suggerieren, die auf ihnen abgebildeten Personen müssten bekannt und identifizierbar sein.3 Das Erscheinen der Wiedergängerin Katia Depetiteville, mit der ebenso eine Portraitaufnahme aus der älteren, undatierten Fotoserie assoziiert werden kann (NDiaye 2005, 13; 2012, 13) wie ein Foto aus der Serie Julie Ganzins (NDiaye 2005, 25; 2012, 30), ist sowohl durch Unschärfe als auch durch eine von Wiederholung und
3
Die Ich-Erzählerin selbst stellt die Aussagekraft von Portraitaufnahmen in Frage und verweist sie in den Bereich des Gespenstischen, indem sie sich weigert, die Vervielfältigung ihrer Familienangehörigen im Medium der Fotografie als authentisch anzuerkennen: »Ma mère, Rocco et Bella, où en sont-ils à présent? Je n’écrirai pas, eux non plus, jusqu’au jour où, peut-être, une lettre m’arrivera d’un lieu inconnu, accompagnée de photos d’inconnus qui se trouvent être mes proches à divers degrés – lettre dont, même si elle est signée ›Maman‹, je contesterai l’authenticité« (»Meine Mutter, Rocco und Bella, wie steht es jetzt um sie? Ich werde nicht schreiben, sie auch nicht, bis zu dem Tag, an dem mich, vielleicht, ein Brief von einem unbekannten Ort erreichen wird, zusammen mit Fotos von Unbekannten, die sich als Verwandte verschiedenen Grades erweisen werden – ein Brief, dessen Authentizität ich auch dann bestreiten werde, wenn er mit ›Mama‹ unterschrieben ist«, NDiaye 2005, 72; 2012, 90).
67
68
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Verdopplung geprägte Zeitstruktur gekennzeichnet. Auf dem verlassenen Grundstück eines ehemaligen Bauernhofs, an dem sie jeden Tag mehrmals vorüberfährt, um ihre Kinder zur Schule zu bringen und abzuholen, glaubt Marie neben einem Bananenbaum die sich nur vage von ihrer Umgebung abhebende Silhouette einer grüngekleideten Frau wahrzunehmen: 2002 – Comme je la voyais chaque jour devant sa maison, il m’a été longtemps impossible de distinguer entre cette présence verte et son environnement. Je passais devant chez elle, au volant de ma voiture […] et mon regard tombait à chaque fois sur une forme incertaine qui aussitôt après se confondait dans ma mémoire avec l’arbre unique de l’enclos, un haut et large bananier. Je passais donc devant chez elle quatre fois par jour. Et je la regardais et ne la voyais pas, et cependant une obscure insatisfaction m’obligeait à tourner la tête de ce côté, pourtant je ne remarquais rien, jamais, qu’un beau bananier insolite. Je freinais devant cette maison. Je roulais presque au ralenti et pas une seule fois mes yeux n’ont manqué de se poser sur la silhouette immobile, aux aguets, de la femme en vert debout près du bananier largement plus imposant qu’elle, et cela je le sais sans doute possible. Car j’avais, quatre fois par jour, le cœur étreint par quelque chose d’innommable quoique pas absolument mauvais, dès que j’avais dépassé la ferme au bananier solitaire dans sa cour grillagée […]. 2002 – Da ich sie jeden Tag vor ihrem Haus sah, war es mir lange unmöglich, zwischen dieser grünen Gegenwart und ihrer Umgebung zu unterscheiden. Ich kam am Steuer meines Wagens an ihrem Haus vorbei […] und mein Blick fiel jedes Mal auf einen undeutlichen Umriss, der in meinem Gedächtnis alsbald mit dem einzigen Baum des Grundstücks verschmolz, einer hohen und breiten Bananenstaude. Ich kam also viermal am Tag an ihrem Haus vorbei. Und ich sah sie an und sah sie nicht, und dennoch zwang mich ein dunkles, unbefriedigtes Gefühl, den Kopf in diese Richtung zu wenden, wobei ich nichts anderes bemerkte, niemals, als eine schöne, außergewöhnliche Bananenstaude. Ich bremste vor dem Haus ab. Ich fuhr fast im Schritttempo, und nicht ein einziges Mal haben meine Augen es versäumt, sich auf die reglose, lauernde Gestalt der Frau in Grün zu richten, die da neben der sie weit überragenden Bananenstaude stand, und das weiß ich ohne jeden möglichen Zweifel. Denn ich spürte, wie mein Herz viermal am Tag bedrängt wurde von etwas Unnennbarem, wenn auch nicht absolut Schlechtem, sobald ich an dem Bauernhaus mit der einsamen Bananenstaude in ihrem vergitterten Hof vorbeifuhr […]. (NDiaye 2005, 9; 2012, 7f.) Die Unschärfe der Wahrnehmung überträgt sich hier auf die Sprache und mithin auf den Leser, der trotz oder gerade wegen der wiederholten Erzählung des sich vier-
Caroline Torra-Mattenklott: »… out of joint«
mal täglich wiederholenden Geschehens im Unklaren darüber bleibt, ob die grüngekleidete Frau tatsächlich sichtbar und anwesend ist oder nicht. Während der Beginn des ersten Satzes (»Comme je la voyais chaque jour devant sa maison«) bereits das Bild einer Frau evoziert, löst die Fortsetzung diese Vorstellung in Vagheit auf: Die Rede ist von einer »présence verte«, die für die Betrachterin lange Zeit nicht von ihrer Umwelt zu unterscheiden war. Dasselbe Verhältnis von Erwartung und Auflösung wiederholt sich im zweiten, ungleich längeren Satz. Der vierte, in sich paradoxe Satz (»Et je la regardais et ne la voyais pas«, »je ne remarquais rien, jamais, qu’un beau bananier«) widerspricht überdies dem ersten (»Comme je la voyais chaque jour devant sa maison«). Der sechste Satz behauptet »sans doute possible« die Präsenz einer grüngekleideten Frau, die im siebten Satz wieder zu etwas Unnennbarem verschwimmt (»quelque chose d’innommable«). Der Versuch der Ich-Erzählerin, ihren Zweifel zu beheben, indem sie ihre Kinder nach deren Wahrnehmung fragt, schlägt fehl: Die Kinder sehen keine grüngekleidete Frau, aber Marie, der angesichts dieser Antwort ein Schauer über den Rücken läuft, ist sich nun ganz sicher, sie erstmals genau erkannt zu haben (vgl. NDiaye 2005, 10f.; 2012, 9–11). Dass Katia Depetiteville nach Auskunft der Leute im Dorf bereits seit zehn Jahren tot ist (NDiaye 2005, 27; 2012, 32), hindert Marie nicht daran, sich mit ihr anzufreunden und sie bei sich aufzunehmen, als die Garonne im Jahr darauf Katias Anwesen überschwemmt (NDiaye 2005, 73f.; 2012, 91f.). Das ›spektrale Moment‹ kommt an dieser Stelle durch das Ineinanderspielen differierender Aussagen und Wahrnehmungsqualitäten zustande, die zwischen einem diffusen Unlustgefühl, einer vagen Silhouette und einer klar benennbaren weiblichen Figur in Grün changieren. Die Zusammenfassung der wiederholten Wahrnehmungen zu einer einzigen Erzählung, deren iterativer Modus, wie es häufig bei Proust der Fall ist, durch die Verbform des Imperfekts angedeutet wird, führt zu einer hochgradigen Verdichtung und Tiefenwirkung der Textpassage und zugleich zu einer Aufspaltung, einer inneren Ungleichzeitigkeit und Widersprüchlichkeit des beschriebenen Ereignisses. Der Zeitpunkt des Erscheinens von Katia Depetiteville ist in sich aufgefächert und verschoben, »aus den Fugen«, »out of joint«, und diese gespenstische différance kennzeichnet auch ihre späteren Auftritte. Als Marie am Mittag ohne ihre Kinder zurückkehrt, stürzt sich Katia vor ihren Augen vom Balkon im ersten Stock. Sie verletzt sich kaum, versichert aber, sie habe sich mit ihrem Sprung das Leben nehmen wollen (NDiaye 2005, 24–26; 2012, 28f.). Das Ereignis wiederholt sich auf beinahe identische Weise im darauffolgenden Jahr, als Maries Mann Katia mit einem Boot aus ihrem vom Hochwasser eingeschlossenen Haus befreien will (NDiaye 2005, 73; 2012, 91f.). Man kann annehmen, dass der Suizidversuch ihr ein gutes Jahrzehnt zuvor tatsächlich geglückt ist: Das erste Erscheinen eines Gespensts, schreibt Derrida, ist bereits eine Wiederkehr (vgl. Derrida 1993, 22, 32; 1995, 18, 28).
69
70
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Die »Frauen in Grün«, so erkennt die Ich-Erzählerin am Ende, sind Frauen, die an Orten sind, wo sie nicht hingehören (NDiaye 2005, 94; 2012, 119) – dies gilt für die Wiedergängerinnen ebenso wie für die äußerlich verjüngte Mutter (NDiaye 2005, 64, 68, 72;2012, 78, 85, 90), die beste Freundin, die zur Stiefmutter geworden ist (NDiaye 2005, 30, 84; 2012, 37), die zu spät geborene Halbschwester (NDiaye 2005, 91; 2012, 116) und die Garonne, die über ihre Ufer tritt (NDiaye 2005, 94; 2012, 119). Sie geben aber auch Anlass zu Zweifeln über ihre Identität und ihre Aufrichtigkeit: Ist die Frau in grünen Shorts, der Marie im Dorf begegnet und die sich auf rätselhafte Weise zu verdoppeln scheint, tatsächlich ihre Freundin Cristina oder eine ganz fremde Person (NDiaye 2005, 17–23; 2012, 18–26)? Stammt die scheinbar persönliche Geschichte, die sie erzählt, nicht aus einem Buch, das Marie kürzlich gelesen hat (NDiaye 2005, 23; 2012, 27)? Erscheint es plausibel, dass die 47jährige Mutter ihr plötzlich auf einer unpersönlichen Postkarte die Geburt einer kleinen Tochter annonciert (NDiaye 2005, 66f.; 2012, 81, 83)? Widerspricht der Blick der Mutter nicht ihrem Lächeln (NDiaye 2005, 68; 2012, 84)? Sind die grünen Kontaktlinsen der Stiefmutter nicht ein Zeichen von Falschheit (NDiaye 2005, 30f.; 2012, 37f.)? Das Gespenstische überträgt sich wie das Grün von einer Frau auf die nächste; es umgibt die gesamte Erzählung mit einer Atmosphäre des Fragwürdigen und Unwirklichen, ohne dass sie deshalb ins Fantastische überginge. In der Figur einer IchErzählerin, die mit ihr etliche biographische Züge teilt, ohne mit ihr identisch zu sein, entwirft Marie NDiaye von sich das Bild einer neugierigen, von lebhaften Sympathien und Antipathien getriebenen Beobachterin und Zuhörerin, die über Wiedergängerinnen nicht in deren Auftrag schreibt, sondern aus einem eigenen vitalen, nicht zuletzt narzisstischen Bedürfnis heraus. Nachdem die Wiedergängerin Katia Depetiteville bei einem gemeinsamen Ausflug zu Maries Schwestern in der Pariser Banlieue verschwunden ist, heißt es über die Frauen in Grün: Car je pense à ma mère, à la femme d’Ivan, à ma belle-mère, et je redoute de me considérer moi-même comme un être insensé si toutes ces femmes en vert disparaissent l’une après l’autre, me laissant dans l’impossibilité de prouver leur existence, ma propre originalité. Je me demande alors, dans la cuisine proprette de mes sœurs, comment trouver supportable une vie dénuée de femmes en vert découpant en arrière-plan leur silhouette équivoque. Il me faut, pour traverser calmement ces moments d’hébétude, d’ennui profond, de langueur désemparante, me rappeler qu’elles ornent mes pensées, ma vie souterraine, qu’elles sont là, à la fois êtres réels et figures littéraires sans lesquelles l’âpreté de l’existence me semble racler peau et chair jusqu’à l’os. Denn ich denke an meine Mutter, an Ivans Frau, an meine Stiefmutter, und ich habe Angst, mich selbst als verrückt ansehen zu müssen, wenn all diese Frauen in Grün eine nach der anderen verschwänden und mich ohne jede Möglichkeit
Caroline Torra-Mattenklott: »… out of joint«
zurückließen, ihre Existenz und damit meine eigene Originalität zu beweisen. In der blitzsauberen Küche meiner Schwestern sitzend, frage ich mich, wie ein Leben ohne Frauen in Grün zu ertragen wäre, ohne ihre vieldeutige Gestalt im Hintergrund. Ich brauche, um jene Momente der Benommenheit, der tiefen Langeweile, der verstörenden Trägheit ruhig durchzustehen, die Erinnerung daran, dass sie meine Gedanken, mein unterschwelliges Leben bevölkern, dass sie da sind, reale Menschen und literarische Figuren zugleich, ohne die mir die Rauheit des Lebens Haut und Fleisch abschürfen würde bis auf die Knochen. (NDiaye 2005, 77; 2012, 96f.) Der Trauer über das Verschwinden der Gespenster lässt sich deren Präsenz in den Gedanken entgegensetzen, vor allem aber ihr Überdauern in der Literatur, in der ihr Erscheinen sich immer neu und zum ersten Mal wiederholt. In dieser Form der lebendigen Konservierung zeigt sich, wie NDiaye schreibt, die Originalität der Autorin. Der Text Autoportrait en vert demonstriert in einer Art persönlicher Schöpfungsmythologie, wie der individuelle Blick auf die Wirklichkeit Metaphern, Wiederholungsstrukturen und fiktive Gestalten hervorbringt, die die Alltagsrealität verfremden und in literarische Form überführen. Die Wiedergängerinnen fungieren dabei als Katalysatoren und Reflexionsfiguren: Sie setzen Prozesse der Derealisierung in Gang und dienen als Anschauungsmodelle, die dazu verhelfen, das Wiedergängerhafte im Wirklichen wahrzunehmen. So führt der Weg der Lektüre von der Zeitstruktur des moment spectral zur gestörten Generationenfolge der Familie und von der Unzeitigkeit des Gespensts zu den regressiven und selbstdestruktiven Zügen des Vaters, dem fehlgeschlagenen Neuanfang der Mutter. Die vom Gespenst ausgehende Derealisierung impliziert einen Erkenntnisprozess, eine Schärfung des Blicks für das Unscharfe und Unbehagliche, der zugleich einen analytischen Zugang zur Realität eröffnet. So gesehen weisen die Gespenster Rilkes und NDiayes in entgegengesetzte Richtungen. Während Rilkes Protagonist die Gespenster einer untergegangenen ländlichen Aristokratie in eine moderne Großstadt projiziert, von der er selbst sich überfordert sieht, weisen die ländlichen Wiedergängerinnen Marie NDiayes ihrem Alter ego den Weg zur Analyse eines von Migration und Globalisierung geprägten Familienaggregats der Gegenwart. Unglücklichen Ehefrauen eröffnen sich in dieser Welt überraschende, mitunter verstörende und nicht unbedingt beglückende Alternativen zum Suizid. Die Ruhelosigkeit der Wiedergängerin verlagert sich ins Leben vor dem Tod. So missmutig die Ich-Erzählerin auf diese unübersichtliche, vermeintlich natürliche Ordnungen außer Kraft setzende Dynamik und die aus ihr hervorgehenden Paare und Kinder reagiert, beweist sie doch, dass sie in Derridas Sinne mit den Gespenstern zu leben, ja sie als Dimension der eigenen Identität und notwendige Quelle der Kreativität zu identifizieren vermag.
71
72
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Literatur Assmann, Aleida. Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kollektiven Gedächtnisses [1999]. München 5 2010. Barthes, Roland. La chambre claire. Note sur la photographie [1980]. Paris 2013. Derrida, Jacques. Marx’ Gespenster. Der Staat der Schuld, die Trauerarbeit und die neue Internationale. Aus d. Frz. v. Susanne Lüdemann. Frankfurt a.M. 1995. Derrida, Jacques. Spectres de Marx. L’État de la dette, le travail de deuil et la nouvelle Internationale. Paris 1993. Freud, Sigmund. »Jenseits des Lustprinzips« [1920]. In: Ders. Studienausgabe. Bd. 3: Psychologie des Unbewußten. Hg. v. Alexander Mitscherlich/Angela Richards/ James Strachey. Frankfurt a.M. 6 1989, 213–272. Friedrich, Gerhard. »Zwischen Psychiatrie und Volksfantasie. Trauma, Gespenster und Wiedergänger im ›neuen deutschen Familienroman‹«. In: Autobiographie und historische Krisenerfahrung. Hg. v. Heinz-Peter Preusser/Helmut Schmitz. Heidelberg 2010, 223–244. Grass, Günter. Im Krebsgang. Eine Novelle. Göttingen 2002. Klüger, Ruth. weiter leben – eine Jugend. Göttingen 1992. Kraft, Andreas. »Gespenstische Botschaften an die Nachgeborenen: ›Cultural Haunting‹ in der neueren deutschen Literatur«. In: Rendezvous mit dem Realen. Die Spur des Traumas in den Künsten. Hg. v. Aleida Assmann/Karolina Jeftic/Friederike Wappler. Bielefeld 2014, 141–165. Leonhardt, Nic. Durch Blicke im Bild. Stereoskopie im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Berlin 2016. Morrison, Toni. Beloved [1987]. London 2005. NDiaye, Marie. Selbstporträt in Grün. Aus d. Frz. v. Claudia Kalscheuer. Frankfurt a.M. 2012. NDiaye, Marie. Autoportrait en vert. Paris 2005. Pytlik, Prisca. Okkultismus und Moderne. Ein kulturhistorisches Phänomen und seine Bedeutung für die Literatur um 1900. Paderborn et al. 2005. Rilke, Rainer Maria. Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge [1910]. Kommentierte Ausgabe. Stuttgart 1997. Ryan, Judith. »›Hypothetisches Erzählen‹: Zur Funktion von Phantasie und Einbildung in Rilkes Malte Laurids Brigge«. In: Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft 15 (1971), 341–374. Stiegler, Bernd. Philologie des Auges. Die photographische Entdeckung der Welt im 19. Jahrhundert. München 2001. Torra-Mattenklott, Caroline. Poetik der Figur. Zwischen Geometrie und Rhetorik: Modelle der Textkomposition von Lessing bis Valéry. Paderborn 2016. Treichel, Hans-Ulrich. Der Verlorene. Frankfurt a.M. 1998. Wackwitz, Stephan. Ein unsichtbares Land. Familienroman. Frankfurt a.M. 2003.
»Die Erinnerung an jetzt.« Figuren der Vergegenwärtigung in Ilse Aichingers Kurzprosa Vivian Liska
1. Aggregate der Gegenwart Wenn Immanuel Kant in der ersten Fassung seiner Einleitung zur Kritik der Urteilskraft vom »Aggregat besonderer Erfahrungen als System« spricht, um auch für die Erfahrung systemhafte Gesetzmäßigkeiten bestimmen zu können, so verweist der Begriff auf eine vom Verstandesvermögen zusammengestellte Anhäufung aus der »unendliche[n] Mannigfaltigkeit und […] Heterogeneität der Formen der Natur« (Kant [1957] 1974, 16, Herv. i. O.). Ilse Aichingers Texte sind in jeder Hinsicht solche zusammengestellten Aggregate, in denen der Mangel an systematischem Zusammenhang zur Herausforderung an die Leser wird, in diesen – allerdings nur scheinbar zufälligen – Wortgefügen das Vergangene in einer Rekonstruktion der Erinnerungsspuren in die je eigene Gegenwart einzubringen. Die Schwierigkeit dieser Wanderungen in oft unwegsamem Gelände macht Aichingers Texte zu literarischen Stolpersteinen, eingelassen ins Pflaster von Straßen und Plätzen, von denen es in einem ihrer Texte heißt: »Die Orte, die wir sahen, sehen uns an.« (Aichinger [1954] 2001a, 11) Lapidarer als es dieser Chiasmus vorführt, kann sprachliche Vergegenwärtigung des Vergangenen kaum geschehen: steinartige Aggregatzustände der Zeit, Entgrenzung des Subjekt-Objekt Verhältnisses, Gegenlauf der Blickrichtung, Übertragung des Damals ins Heute, bei gleichzeitigem, sturem Verharren bei Ort und Zeit des Geschehenen, das sich, so Aichinger, als Erinnerung »nicht zu Ende begreif[en]« (Aichinger [1959] 1991f, 18) lässt, wohl aber eingedenkend zu erfahren ist. Ein Text aus den 1970er Jahren mit dem Titel Hilfsstelle, in der Textsammlung Kleist, Moos, Fasane, dessen Titelgeschichte mit den Worten: »Ich erinnere mich…« (Aichinger [1959] 1991f, 11) anfängt, setzt mit einem Satz ein, der exemplarisch vorführt, wie Sprache vergegenwärtigt: »Heute, das war Donnerstag. Die anderen Tage hießen gestern, vorgestern, vorvorgestern oder auch morgen, übermorgen, überübermorgen […]« (Aichinger [1987] 1991g, 28) Wenn die Temporaladverbien in der
74
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Erinnerung ihre entsprechende Zeitform verlieren – wenn heute nicht ›ist‹ und gestern nicht ›war‹, sondern wenn heute ›war‹ – versetzt uns die Gegenwart des Heute in die Vergangenheit, wird gestern und morgen aus diesem vergangenen Heute heraus wahrgenommen und wir befinden uns in der damaligen Zeit; gleichzeitig wird unser Heute mit der ›Last‹ von damals befrachtet, wie es im Text weiter heißt, »sie« – diese Tage – »teilten die alten Lasten unter sich, Vergangenheit und Zukunft, sie teilten unter sich Unsicherheit, Furcht vor Bomben und Staatspolizei, Gerüchte, Deportationsmöglichkeiten, schlechte Nachrichten« (Aichinger [1987] 1991g, 28). Sie verteilen sie unter sich und teilen sich uns mit, teilen sie mit uns. Beginnen wir in Wien, bei Aichingers Ursprüngen, die sie in den 1950er Jahren in Kurzschlüsse buchstäblich ›wiederbegeht‹.
2. Stadtmitte Etwas kommt in den Sinn. Jagt nicht und biegt nicht ein wie Wagen, die vom Stephansplatz in eine Nebengasse wollen, sondern biegt ein wie die Straße selbst, hat Knopfgeschäfte und Kaffeehäuser in sich, öffnet und verbirgt vieles, zeigt die Schaufenster und alles, was vorne liegt, und läßt die Magazine im Dunkel. Ich weiß von den Schokoladekuchen, von der Hochzeit des Joachim und der Anna, die sie vergessen haben, von der Judengasse, in die der Wind weht. So hilft uns der Himmel. Laßt doch die Sonne ruhig matter werden! Es gibt Wolle und Schuhe zu kaufen in den Seitengassen. Und eine Stiege, mit Gras bewachsen, führt hinunter. Die Orte, die wir sahen, sehen uns an. (Aichinger [1954] 2001a, 11) Mit diesem Text beginnt der kleine Band von Prosagedichten, die Aichinger unter dem Titel Kurzschlüsse und dem Untertitel Wien versammelt hat. Der letzte Satz, der wie ein Gedichtvers klingt, ist ausschlaggebend: Die Orte werden personifiziert – verlangen Rechenschaft. Sie sprechen geheimnisvoll und hermetisch, aber letztendlich auch entzifferbar von erfahrener Geschichte, von der nationalsozialistischen Vergangenheit, ihrem Vergessen und Verschweigen im Wien der Nachkriegszeit. Dies geschieht bei Aichinger in einem Wörtlichnehmen der Sprache: Es ist die Sprache, die Zusammenhänge schafft und in der Verschränkung von Denotation und Konnotation, konkreter Erfahrung und konzeptueller Abstraktion die Vergangenheit Wiens heraufbeschwört. Ein abstraktes »Etwas« kommt »in den Sinn«, taucht als Gedanke auf, erhält jedoch gleichzeitig Sinnhaftigkeit und Signifikanz. Das etwas kommt »nicht […] wie Wagen«, die ›einbiegen‹: nicht wie etwas, das vorüberfährt und vergeht, sondern etwas, das bleibt, das mit der Straße, dem Stephansplatz und seinen Nebengassen bleibt. Der Stephansplatz ist der Ort, an dem die Juden bekanntlich unter dem Ge-
Vivian Liska: »Die Erinnerung an jetzt.«
johle der Zuschauenden mit Zahnbürsten die Straße putzen mussten. An diesem Ort gibt es Knopfgeschäfte und Kaffeehäuser. Aus diesen Worten entfaltet Aichinger die Topografie von innen und außen, von Sichtbarem und Verborgenem, Verschwiegenem. Knöpfe, die Verhüllungen öffnen und schließen, wie sich an diesem Ort vieles »öffnet und verbirgt«, wie die Kaffeehäuser die Gemütlichkeit und Delikatessen – später im Text die Schokoladekuchen – vorgeben, so zeigt dieses Etwas »die Schaufenster und alles, was vorne liegt, und läßt die Magazine im Dunkel«. Magazine, das sind hier die wörtlich hinter den Schaufenstern, im hinteren Teil der Geschäfte liegenden Aufbewahrungsorte der Waren, sie verweisen aber auch auf Schusswaffen und Waffenarsenale: Die Gewalt liegt – und bleibt verborgen – hinter den schönen Fassaden Wiens. Von den Kaffeehäusern über die Sachertorte geht es in der impliziten Anspielung auf eine Hochzeitstorte zur »Hochzeit des Joachim und der Anna«: Anna, die Mutter Marias, die ebenfalls in unbefleckter Empfängnis nach 20-jähriger kinderloser Ehe mit Joachim geboren hat. Keineswegs unbefleckt ist allerdings der Ort, zu dem das »Etwas« vom Stephansplatz einbiegt: zum Hochzeitsbrunnen am Hohen Markt, der die Heirat Marias und Josephs feiert. Der Legende nach brachte Anna ihre Tochter Maria nach Jerusalem, und so führt Aichinger uns in die an den Hohen Markt anschließende Judengasse, die vom Hochzeitsbrunnen ausgeht. Die Judengasse, in die der Wind weht: Wieder holt sich Aichinger den Sinn aus der Sprache, dem Ausspruch »woher der Wind weht«, der ›begreifen, wo es lang geht, worum es eigentlich geht‹ bedeutet. Von dieser Redewendung führt der Text zu einer anderen, und zwar über den konkreten Bezug des Winds, der am Himmel ist – ein göttlicher Himmel, der hier ganz ironisch »geholfen« hat: Verschont wurde damals nur die Statue des Vermählungsbrunnens am Hohen Markt, die von den alliierten Bombenangriffen »vergessen« wurde, während der Rest des Platzes zerstört wurde, nachdem die Vernichtung von Leben in der Judengasse stattfand. Der Himmel führt zur Sonne, die hier matter werden, weniger glorreich scheinen sollte: Dieser helfende Himmel ›scheint nicht‹ in der Glorie: »Es gibt Wolle und Schuhe zu kaufen in den Seitengassen«. Es gibt heute Schutz gegen die Kälte in den Seitengassen der Stadtmitte, doch die Saitenstättengasse – eine Seitengasse der Judengasse – und ihre Synagoge waren damals ungeschützt. Geradeaus von der Judengasse führt »eine Stiege, mit Gras bewachsen, hinunter.« Diese Stiege führt hinunter über den Morzinplatz, hinunter ins Totenreich, sie führt von der Judengasse hinunter zum Josephskai: Über diese Stiegen gelangt man zum früheren Gestapo-Hauptquartier (das Hotel Metropol); in dessen Nähe lebte Aichinger, in der Marc-Aurel-Straße. Sie wohnte dort mit ihrer Mutter in einem Zimmer, das ihnen nach der Arisierung des Eigentums der von den Nazis aus Wien deportierten und ermordeten Großmutter zugewiesen wurde. Darüber, über diese Vergangenheit, »wächst« sprichwörtlich »Gras«: sie wurde vergessen, aber anders als die Statue des Vermählungsbrunnens wurden sie nicht verschont, sondern nach dem Krieg ver-
75
76
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
schwiegen. Diese vergessenen Orte, die Aichinger damals sah, »sehen uns an«. Wer ist hier »wir«, und wer ist »uns«? Diese Frage wird im darauffolgenden Text, Judengasse, weiter ausgeführt.
3. Judengasse Katzenköpfe. Was unsere Straßen schmückt, sind nicht mehr die Schädel der Opfertiere. Unser Stolz ist vergangen. Hinter unseren Gängen ticken die Uhren ins graue Licht. Junge Männer fragen lächelnd nach unseren Wünschen. Da rauscht kein rotes Meer. Nur unsere Wäsche trocknet noch im Ostwind. Es ist geschehen, weil wir die Nacht nicht abgewartet haben. Als die Sonne unterging, sind wir ihr nachgezogen. Und hier ist die Stelle, an der wir müde wurden, hier bauten wir Häuser. Hier ging die Sonne unter, hier krümmten wir uns, ohne uns zu beugen. Seither wächst Gras zwischen den Steinen. (Aichinger [1954] 2001b, 12) Katzenköpfe sind alte, unregelmäßige, abgerundete Pflastersteine, wie sie in alten Gassen noch zu finden sind. Von den Katzen und Köpfen, die hier wörtlich genommen werden, gelangen wir zu den »Schädel[n] der Opfertiere«: »Schädel der Opfertiere« sind oft verwendete Ornamente von barocken Häuserfassaden: Die Opfer der Judengasse sind unsichtbar geworden, wie auch diese Ornamente uns – Wien – nicht mehr zum Stolz, zur Glorie gereichen. Tatsächlich befindet sich auf der Seitenfassade der Wiener Gloriette in Schönbrunn ein Fries aus »Schädel[n] von Opfertieren«: Doch nun ist »unser Stolz vergangen«: Wir verbergen die wahren Opfer der Geschichte. »Hinter unseren Gängen ticken die Uhren ins graue Licht«: Hinter unseren Gängen ereignet sich buchstäblich die Vergangenheit. Die ›tickenden Uhren‹ könnten auf die Ankeruhr am Hohen Markt neben der Judengasse verweisen, mit ihren prominenten Gestalten Wiens, die jede Stunde einzeln und um 12 Uhr alle zusammen vorbeiziehen. Auch dieser Stolz ist vergangen. Die glorreichen Figuren erscheinen im grauen Licht, wie zuvor in der matten Sonne, um das Scheinen, den trügerischen Schein aufzudecken. In der Gegenwart stehen wie zuvor in den warengeschmückten Schaufenstern der »Stadtmitte« auch in der Judengasse die Verkäufer als Sinnbild einer vergesslichen, lächelnden Warenwelt. Da ist kein »rotes Meer«, das gleichzeitig ein geografischer Ort, ein Sinnbild für die Rettung der Israeliten und ein Meer des Blutes ist. Tatsächlich weht dort der Ostwind durch, weil das Ende der Judengasse unverbaut ist. Aber nicht nur Juden, auch andere Bewohner Wiens, die aus dem Osten oder eben vom roten Meer her, das die unterste Spitze der Sinai-Wüste umspült, nach Wien gekommen sind, wurden dort nach ihrem wandernden Umherziehen müde und bauten Häuser: Das Haus in der Judengasse an der Ecke zum
Vivian Liska: »Die Erinnerung an jetzt.«
Hohen Markt war einst das Palais Sina. Erbaut wurde es von Simon von Sina, dem Ahnherrn einer serbischen Dynastie. Darauf weist noch eine Inschrift am Eck der Judengasse hin. Kein rotes Meer ist dort noch zu sehen, auch weil das Blutmeer, das mit der Judengasse assoziiert ist, angesichts der lächelnden jungen Männer, die dort vor ihren Geschäften ihre Waren anpreisen, nicht mehr sichtbar ist. Nur »unsere Wäsche trocknet noch im Ostwind«: Der Wind, der im ersten Text erwähnt wurde, der Wind, der zeigt, wo es lang geht, führt hier von »unseren Wünschen« über die angebotenen Waren – meist Textil – und Unterwäschewaren zur »Wäsche«, die zum Trocknen hängt. Auch hier geschieht dies über ein Wörtlichnehmen der Sprache, jedoch nicht geradlinig: Aichinger spielt auf die Zeit nach dem Krieg an, auf den Versuch, sich das Blut von den Händen, die Schuld abzuwaschen – man sprach zur Zeit der ›Entnazifizierung‹ (in Anlehnung an die Waschmittelmarke) vom ›Persilschein‹, wobei es um Fragebögen zur Beteiligung an Naziverbrechen, insbesondere am Judenmord, ging; allerdings geschah dies nicht in Österreich, nicht in Wien: dort, in der Judengasse ist die Wäsche gerade frisch vom Blut gewaschen und zum Trocknen aufgehängt. »Es ist geschehen, weil wir die Nacht nicht abgewartet haben. Als die Sonne unterging, sind wir ihr nachgezogen.« Diese Anspielung auf die biblische Stelle in Jesaja 21,11: »Wächter, wie lange noch dauert die Nacht?«, ruft die Ungeduld in der Erwartung der Erlösung auf: Wir – und danach soll noch gefragt werden – wollten die Erlösung nicht abwarten, haben auf einen falschen, mörderischen Erlöser gesetzt, der es, in tragischer Ironie, zur gewaltsamen Endlösung gebracht hat. Aber »abgewartet« ist auch in einem anderen Sinn zu verstehen: Wir waren nicht vorbereitet auf diese Nacht, wir haben sie nicht »abgewartet«, nicht aufgehalten, nicht abgewendet, sondern sind »ihr nachgezogen«, haben uns ihr angeschlossen – auch Anschluss klingt hier mit. Wie in Stadtmitte stellt sich die Frage des Wir, des Uns. Wer ist hiermit gemeint? Wir Wiener, wir Juden? Wer etwa ist »wir« und »uns« in der Wende dieses Satzes: »die Stelle, an der wir müde wurden«? Offensichtlich bezieht sich dies auf die Hierhergezogenen aus dem Osten. Doch das Wir, dessen Wäsche noch zum Trocknen aufgehängt ist, sind die Schuldigen: Diese verwirrenden, unvereinbaren Identifizierungen tragen zum Verstörenden dieser Texte bei. Denn diese erfassen im Wien der Nachkriegszeit, in dem sich gleichzeitig Täter und Opfer, Mitläufer und Überlebende befinden, vielleicht alle diejenigen, die wegen der Unruhe des Ostwinds, der durch die Judengasse weht, nicht ganz zu Hause sind. »Hier ging die Sonne unter«: Hier ist der Westen, in den der Ostwind diese Einwanderer führte. »Hier krümmten wir uns, ohne uns zu beugen«, krümmten wir uns vor Schmerz, ohne uns zu unterwerfen: Widerstand klingt hier an, jener Widerstand, den Aichinger – etwa in ihrer Ehrbezeugung für die Geschwister Scholl – nach dem Krieg zur Grundlage ihrer Poetik machte. Das Motiv von Stadtmitte wieder aufnehmend endet der Text mit den Worten: »Seither wächst Gras zwischen den
77
78
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Steinen«: Die Steine dieser Kopfsteinpflaster, auf denen Blut floss, werden selbst zur Erinnerung, zum Gedenken an diese Vergangenheit: Das Gras ›wächst darüber‹, über die Geschehnisse, aber es wächst nur zwischen den Steinen. Aichingers Texte verändern den Aggregatzustand der Sprache, sie werden zu Steinen, die das Geschehene festhalten, ohne ein Auferstehen zu beschwören. Steine sind sie wie jene, die die Juden statt Blumen auf Gräber legen, Steine, die dieses Gras aufhalten, wenn sie von uns gelesen werden.
4. Entgrenzungen Entgrenzungen sind gut: Sie erweitern den Horizont, reißen Mauern nieder und führen Getrenntes zusammen. Aichinger zeichnet liminale Landschaften, in denen sie Grenzwächter und Zöllner, Pförtner und Ausgrenzer zur Verantwortung ruft. Eine entgrenzte Literatur könnte eine sein, die weit offen ist und allumarmend, die alle Linien und Konturen, alle Maßstäbe verliert, die einebnet und gleichschaltet. Literarische Entgrenzungen sind hier jedoch nicht nur der bedrohte, sondern auch der bedrohliche Horizont, gegen den Aichinger eine gegenläufige Geste einsetzt, jene die zur kleinsten Unterscheidung befähigt. »Ich möchte gern den Maßstab finden. Wonach richtet man sich?« (Aichinger [1976] 1991d, 83) heißt es mitten in Surrender einem kurzen, enigmatischen Text in fünf Absätzen, der, wie die anderen Texte aus Schlechte Wörter, nur auf Spurensuche zu erschließen ist, wobei ›erschließen‹ bei einem Text, der seinen Mangel an schlüssigen Kriterien eingesteht, vielleicht schon zuviel verheißt. Die Spuren führen gleichzeitig ins Öffentliche und Private, in Texte, Länder und Sprachen, fremde und eigene, ins Damals, Heute und Morgen. Und vor allem zu Unterscheidungen zwischen ihnen. »Ich zeichne ein Meßband, schwache und starke Teilstriche.« (Aichinger [1976] 1991d, 84) Dabei ist der Unterschied zwischen dem Maßstab zu bedenken, den das Ich gerne finden möchte, und dem Messband, das es zeichnet. Kein fester Stab zeigt hier die Norm an, sondern ein bewegliches Band, das die Dinge ausmisst und differenziert, und dies nicht, indem es sie auf den eigenen Nenner bringt, sondern indem es sich an sie anschmiegt. Und anders als der Stab, den nur die maßgebenden Autoritäten in Händen halten, steckt im Messband die Möglichkeit der Verbindung, gar der Verbindlichkeit, die sich zwischen jenen einstellen könnte, die im Bunde sind. Surrender endet mit der Frage: »Der Bund zwischen uns und uns, wollen wir ihm die Ehre antun? Lösen wir ihn?« (Aichinger [1976] 1991d, 84) Von welchem Bund ist die Rede? »Ich zeichne ein Messband, schwache und starke Teilstriche. Es ist auch rot dabei.« (Ebd.) Das Messband, das Aichinger in Surrender zeichnet, enthält Teilstriche, die inmitten scheinbarer Richtungslosigkeit Unterscheidungen einführen, etwa jene zwischen England, dem Ort an dem Zwillingsschwester Michie die Kriegsjahre
Vivian Liska: »Die Erinnerung an jetzt.«
in relativer Sicherheit verbrachte, und ihr selbst, der in Wien, in der Nähe des Gestapo-Hauptquartiers, Verbliebenen, zwischen Schutz und Ausgesetztsein, Rettung und Untergang. Die Erinnerung an eine Erfahrung der Gewalt liegt denn auch der Geschiedenheit zwischen den beiden Orten und ihren Sprachen zugrunde. Die von Rot durchsetzten Teilstriche auf Aichingers selbstgezeichnetem Messband fungieren gleichzeitig als maßgebliche Trennlinien, die Unterscheidungen ermöglichen, und als Maßeinheit der Ausrichtung von Aichingers Schreiben. Die Maßeinheit ist von der Möglichkeit bestimmt, Unterscheidungen zu machen, solche, bei denen es ums Ganze geht. Etwa um Blut. Im Abschnitt »Im Dienst einer fremden Macht« in Die größere Hoffnung ist zu lesen: In der Mitte der Gasse lag auf dem grauen Pflaster ein offenes Schulheft, ein Vokabelheft für Englisch. Ein Kind mußte es verloren haben, Sturm blätterte es auf. Als der erste Tropfen fiel, fiel er auf den roten Strich. Und der rote Strich in der Mitte des Blattes trat über die Ufer. Entsetzt floh der Sinn aus den Worten zu seinen beiden Seiten und rief nach einem Fährmann: Übersetz mich, übersetz mich! Doch der rote Strich schwoll und schwoll und es wurde klar, daß er die Farbe des Blutes hatte. Der Sinn war immer schon in Gefahr gewesen, nun aber drohte er zu ertrinken […]. Es regnete in Strömen, und noch immer irrte der Sinn rufend an den Ufern. Schon stieg die Flut bis zu seiner Mitte. Übersetzt mich, übersetzt mich! Aber das Heft war verloren. (Aichinger [1948] 1991j, 81f.) Verloren geht in Die größere Hoffnung die Möglichkeit, ans rettende englische Ufer übersetzen zu können. Anstelle der Hoffnung auf diese Rettung steht nunmehr der Aufruf, Englisch zu lernen, vom Deutschen ins Englische zu übersetzen. Das Übersetzen der Sprachen steht wiederum für die Hoffnung ein, dennoch den Sinn der Wörter zu bewahren, denn übersetzt werden kann nur dort, wo Sprachzeichen über sich hinaus, auf eine Bedeutung verweisen, die ihnen gemeinsam ist. Das Vokabelheft, in dem Übersetzung noch möglich, oder eher noch erhoffbar ist, ist schon im Roman bedroht, der rote Strich wird schon dort vom Regen weggeschwemmt. Die sintflutartige Katastrophe – der Englischlehrer wird im Roman auch mit Noah assoziiert – bedroht nicht nur den Bund zwischen den Schwestern oder den Kontinenten und Sprachen, sondern darüber hinaus den inneren Zusammenhang der Sprache überhaupt. Übrig bleiben im Vokabelheft auf beiden Seiten die leeren Worthülsen, die ohne den roten Strich, der sie trennt und dabei aufeinander bezieht, für den Sinnverlust einstehen. »Der Farbnachlaß, ohne den nichts groß wird« (Aichinger [1976] 1991d, 83): Dieser letzte Satz des ersten Abschnitts führt zum ersten Satz des zweiten Teils: »Ohne den die Felder aus den Fabeln geraten, der Abzug muß nicht berechnet werden.« (Ebd.) Im Vokabular der formalen Logik ist der Abzug eine Methode der Argumentation, in der eine allgemeine Regel gebraucht wird, um einzelne Elemente zu bestim-
79
80
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
men. Der Verlust der Singularität der spezifischen Erscheinungen ist dabei nicht berechenbar, da es für sie innerhalb der Methode keinen Maßstab gibt. Dieses Vorgehen, das sich in Aichingers Sprachauffassung aus der Ungenauigkeit der Wörter ergibt, »die nicht zutreffen« (Aichinger 1991e, 13), wird im Folgenden mit einer Poetik der Erinnerung an die Grauen des Krieges verknüpft: Nicht aus den Fugen, sondern aus den Fabeln geraten die Felder. Felder bezeichnen zunächst im übertragenen Sinn Einteilungen, die, wie Teilstriche, Unterscheidungen ermöglichen. Doch der »Farbnachlaß,« der eine trügerische Helle hervorbringt, weil er die singuläre, differenzierte Einfärbung der Dinge und Geschehnisse verleugnet, lässt auch weniger metaphorische »Felder aus den Fabeln« verschwinden. Geschwunden ist im Nachlassen der Farben hier auch nicht irgendeine Farbe, sondern jene, die später im Text explizit genannt wird: die Farbe Rot, jene Farbe, die es in der größeren Hoffnung erlaubt, die Weizen- von den Schlachtfeldern zu unterscheiden. Der nunmehr ganz konkrete Abzug erfolgt in Surrender denn auch aus den Schlachtfeldern, von denen die Soldaten nach der Ergebung abziehen. Die blutigen Felder verschwinden aber auch aus den wirklichkeitsbeschönigenden, harmonisierenden, tröstlichen und lügenhaften Fabelgeschichten der Literatur dieser Jahre. So wird Rot hier ein Haltzeichen, ein Stopplicht, das Verbindungen und Zusammenhänge unterbindet, wo sie, wie es im Eingangstext von Schlechte Wörter heißt, »vermeidbar sind« (Aichinger [1976] 1991e, 12), wo sie vermieden werden müssen, um den Schein einer harmonischen Kontinuität zu unterwandern, die Fehler offenzulegen, die von einer auf Kommunikation, Verständlichkeit und Sinnhaftigkeit ausgerichteten Sprache zugedeckt werden. In dieser Brüchigkeit bleibt die Erinnerung an geschichtliche und private Erfahrung von Tod und Gewalt ebenso bewahrt wie die daraus gefolgerte Einsicht in die Notwendigkeit, Unterscheidungen zu machen, auch ohne Gewähr und Verbindlichkeit. Im »Millimeterraum« (Aichinger [1976] 1991d, 83) des Kleinen und gleichzeitig jedem Maß sich Entziehenden gebraucht Aichinger Worte, die Teilstriche sind, die entgrenzen, indem sie Unterscheidungen zwischen scheinbar Gleichem einführen: zwischen Schweigen und Schweigen – einem ehrlosen Vertuschen und einem leisen geheimnisvollen Ton, der zu offenen Fragen neigt, Nuancen erfasst und Sprache erfahrbar macht; zwischen Ergebung und Ergebung – einer feigen, die sich anpasst, und einer, die im passiven, nur scheinbar aufgebenden Widerstand der Gewalt absagt und den Verlockungen der Macht widersteht; und zuletzt »zwischen uns und uns« (Aichinger [1976] 1991d, 84) – einem Kollektiv, das auf einer gemeinsamen nationalen Identität beruht, und einem, das sich aufgrund von Affinitäten des Schicksals, der Haltung und nicht zuletzt des Umgangs mit Sprache konstituiert. Doch das Hinterfragen eines Bunds »zwischen uns und uns« führt notwendigerweise auch quer durch das Ich, das am »uns« auf beiden Seiten des »und« teilhat und sich selbst nicht mehr als Einheit begreift.
Vivian Liska: »Die Erinnerung an jetzt.«
So lautet der letzte Satz von Surrender: »Der Bund zwischen uns und uns, wollen wir ihm die Ehre antun? Lösen wir ihn?« (Aichinger [1976] 1991d, 84) Aichingers Text endet mit Fragen. Um welchen Bund handelt es sich? Der autobiographische zwischen Zwillingsschwestern, die, auch wenn sie getrennt sind, ein ›Wir‹ bleiben? Ein geschichtliches, politisches Bündnis zwischen England und »Übersee« (Aichinger [1976] 1991d, 83), wobei die Zugehörigkeit, die Loyalität des Ich gespalten ist und beiden Seiten die Verbundenheit aufkündigt? Der Bund zwischen Gott und der Menschheit, ein Versprechen, das Gott in der Missachtung seines Bundeszeichens – dem Regenbogen, der verspricht, nicht mehr zu vernichten – verriet und dem seinerseits das Ich mit der Verweigerung der messianischen Erwartung eine Absage erteilt? Gott wird vielleicht Unehre angetan, wenn man ihm weiter huldigt: Er wäre, so Aichinger in einem späten Gespräch, »vielleicht enttäuscht, wenn nicht jemand sagte: es ist genug.« (Steinwendtner 1993, 8) Und was ist mit dem Bund zwischen Gott und »Britanniens Töchter[n]«, die ihm nichts »verübeln« (Aichinger [1976] 1991d, 83)? In Kleist, Moos, Fasane heißt es im Text Hilfsstelle: »Der Westen und der Osten – unnütz, die aufzuzählen, die uns allein mit unseren Verfolgern gelassen hatten.« (Aichinger [1987] 1991g, 29) England und Gott? Die westliche Welt und der vom Osten her erwartete Erlöser? Dass der Name ›Brit-annien‹ von ›Brit‹, dem biblischen, hebräischen Wort für ›Bund‹ herrühren könnte, wie oftmals angenommen wird, hat sich als falsche Vermutung erwiesen. Als schlechtes Wort, das nicht zutrifft und dennoch Bände spricht? Oder handelt es sich im fragwürdigen Bund allgemeiner um sinnstiftende Zusammenhänge überhaupt, die »nicht herzustellen sind, solange sie vermeidbar sind«? (Aichinger [1976] 1991e, 12) So ginge es zuletzt auch um den Bund mit dem Leser bzw. der Leserin, den die Unlösbarkeit des Rätsels dieser Sprache, dieses Texts und dieser offenen Fragen schon fast zum Aufgeben zwingt. »Der Bund zwischen uns und uns, wollen wir ihm die Ehre antun? Lösen wir ihn?« Eine Ehre erweist man einem, man tut sie ihm nicht an. Und einen Bund löst man auf, man löst ihn nicht. Was in dieser Verzerrung verschwiegen wird, hängt zusammen und deutet auf den politischen Gestus von Aichingers enigmatischem Schreiben, den Zusammenhang zwischen angetanen Ungerechtigkeiten und verrätseltem Schreiben, das den Bund zwischen Identischem auflöst, zwischen uns und uns.
5. Gegenläufige Erinnerung So kommen wir zum Schluss rückläufig in der eigenen Erinnerung zu Aichingers Auflösung eines Bunds in jenem Text, zu dem ich vor 23 Jahren auf der Tagung in Beer Sheva einen Vortrag unmittelbar nach dem Vortrag von Stephan Braese hielt, dem Text Der Engel (Aichinger [1965] 1991a), den Aichinger 1962 schrieb. Aichinger
81
82
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
war Mitglied der Gruppe 47, wurde jedoch, ebenso wie Paul Celan, Wolfgang Hildesheimer, Ingeborg Bachmann und einige andere,1 zu den internen Außenseitern der Gruppe gerechnet. Diese Autoren und Autorinnen hatten, wie Klaus Briegleb euphemistisch erklärt, eine andere Vergangenheit und schrieben aus einem anderen »Gedächtnisraum« heraus als die Mehrheit der Gruppe (vgl. Briegleb 1997, 29, 32)2 . Wie die anderen Mitglieder der Gruppe 47 verweigerte sich Aichinger einer ästhetisierenden und ornamentalen Schönschreiberei, wie sie von vielen älteren deutschen Schriftstellern und Schriftstellerinnen nach dem Krieg praktiziert wurde. Aber Aichinger ging weiter, indem sie sich zunehmend dem literarischen Programm der Gruppe verweigerte, das sich einer Poetik der realistischen Repräsentation und der narrativen Geschlossenheit verpflichtet hatte. Vor allem setzt sich Aichingers Werk von der in der Gruppe vorherrschenden Praxis des Nicht-Erinnerns ab. Auch wurde ihr die Art und Weise, wie die Gruppe funktionierte, zunehmend verdächtig, vor allem als diese ihre Funktion als literarische Werkstatt verlor und mehr und mehr institutionalisiert wurde.3 In den frühen 1960ern begann Aichinger sich von der Gruppe zu distanzieren (vgl. Arnold 1987 et al., 166). Dies geschah zu einer Zeit, in der trotz vermehrter politischer Aktionen, der organisierten Proteste gegen die Kriege in Algerien und Vietnam, eine von der deutschen Wiederaufrüstung gezeichnete, optimistische und geschichtsvergessene Atmosphäre auch den offiziellen Marktplatz des deutschen Literaturbetriebs bestimmte. In dieser Zeit entstand der kurze Prosatext Der Engel. In versteckten poetologischen Anspielungen gibt der Text die Hintergründe seiner Schreibweise preis und weist damit auf eine hermetische Poetik des Widerstands und Gedenkens hin. Der Engel ist ein zunächst völlig unverständlich erscheinender kurzer Prosatext, der 1965 in Aichingers Band Eliza, Eliza publiziert wurde. Die meisten Bezüge bleiben dunkel und auf den ersten Blick kann kein kohärentes Muster von Themen und Motiven festgestellt werden. Im einzigen Kommentar, den Aichinger selbst zu diesem Text abgab, erläutert sie, dass es sich um den Monolog eines Engels auf einem Friedhof handle. (vgl. Kleiber 1986, 114) Der Engel scheint von Gräbern umgeben zu sein und sich an die Toten zu wenden. Am Ende kündigt er sein Verschwinden an und bittet um einen letzten Atemzug, bevor seine Stimme verstummt und von mysteriösen »Pförtnerssöhne[n]« (Aichinger [1965] 1991a, 121, Herv. i. O.) übernommen wird. Zwischen dem ersten Wort, »stolpernd« (Aichinger [1965] 1991a, 113, Herv. i. O.) 1
2
3
Briegleb erwähnt in diesem Kontext auch Peter Weiss, der sich in Meine Ortschaft (1964) mit den Frankfurter Auschwitz-Prozessen beschäftigt und laut Briegleb »aus der Mitte der Gruppe heraus« getadelt wurde (Briegleb 1997, 32). »[Diese Autoren hatten] im Unterschied zum Gros der Gruppe ihre Arbeitsvoraussetzungen in einem Gedächtnisraum, in dem sie ein reflektiertes Selbstverhältnis zum Jüngstvergangenen literarisch erarbeiteten« (Briegleb 1997, 29). 1965 schrieb Rolf Schroers: »Das war die Veränderung, eine allerdings radikale Veränderung: Die Gruppe 47 wurde eine öffentliche Macht.« (Schroers 1967, 378)
Vivian Liska: »Die Erinnerung an jetzt.«
und diesem Ende gibt es eine parataktische Reihung von Sätzen, einen zusammenhanglosen Wortschwall, Ausrufe, Erinnerungen, Warnungen, unerkennbare Zitate. Die einzige Entwicklung einer möglichen Handlung besteht in der Ankündigung des Verschwindens des Engels. Der Text funktioniert daher als eine Art Testament des Engels. Das erste Wort nach »stolpernd« ist »Ring-« (Aichinger [1965] 1991a, 113). Stolpert der Engel über einen Ring, eine alte deutsche Bezeichnung für eine Vereinigung ähnlich denkender Menschen? Der Monolog des Engels beginnt mit folgenden Sätzen: »Ring- und Kupferschmiede! Diese Langweiler, die man immer wieder trifft. Die Luft sollte einem im Kreis ausgehen, Nägelrost, jedes Mal frisch, keine Zeit für Seufzer.« (Aichinger [1965] 1991a, 113) Später wird ein »Kreis der Freunde«, der versammelt war, erwähnt, es gibt »Preise«, »Jubilare«, ›Schirmherren‹ (versteckt in »Schirmhändler«), eine »Gesellschaft für Glasfluß«, »und am Ausgang einer mit einem scharfen Hund« (Aichinger [1965] 1991a, 114, 117, 118). Diese Passagen beziehen sich offenkundig auf eine Art halboffizielle Gesellschaft, allerdings eine, über die der Sprecher sagt: »Ich sehe da wenig Möglichkeiten für die Vereinigung.« (Aichinger 1991a, 117) Versteckt im Text ist der tatsächliche Schlüssel: »Rabenkinder, lasst euch auf meinen Schultern nieder, links sieben, rechts vier, ich vertrage da einiges« (ebd.). »Vertragen« bedeutet hier nicht nur ›ertragen‹, sondern buchstäblich ›ver-tragen‹, also etwas transportieren: etwas von einem Platz zu einem anderen tragen. Was hier tatsächlich den Platz getauscht hat, ist die Sequenz der Ziffern in der Zahl 47. Dieser Hinweis eröffnet nunmehr ein Netz von Verweisen auf die Gruppe 47, die den gesamten Text durchziehen und vom ersten Satz an auf das wiederholte Zusammentreffen von ›Schmieden‹ anspielt, die in einer ›Werkstatt‹ zusammenkommen. Offensichtlich handelt es sich hier um ›Wortschmiede‹, die sich in einer ›literarischen Werkstatt‹ versammeln, um dort das ›Handwerk‹ des Schreibens zu besprechen. Mitten in diese Umgebung erscheint die andere Erinnerung: [I]ch sah euch alle, was ihr für Schuhe trugt, und eure Hände, die sich nach der Decke sehnten, ja, ich sah euch. Ein Flakon schlug vom Dach und verschwendete euch gegen die Kerbhölzer, listig, triumphierend war es nicht so? Und ich? Pfiff euch aus, streute euch über die Tennen. Mischte mich in die Spielsärge, verteilte euch in die Logen, riß euch den Himmel von der Brust. Kann eine von euch sagen, ich wäre nicht bei euch gewesen? Hob ich nicht Wolken aus und finstere Hilfswerke und tat doch nichts von allem, schaute den Nummern zu und wie sie unter dem Windschatten unvermengt blieben? Berief mich auf nichts, obwohls mir freigestellt war, verzweifelt aber das eigene Lob klingt schwach, ich lobe mich auch nicht. Lob nicht, lob doch? Wer will mit mir das kurze Ende preisen, die alte Schienenmenge, wen reiß ich aus der Reihe? (Aichinger [1965] 1991a, 119f., Herv. i. O.) So verwirrend diese Sätze auch sind, die Bezüge sind unmissverständlich. Sie lassen an getragene Schuhe denken, an Zeichen an der Decke (etwa, wie sie in Alain Res-
83
84
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
nais Film Nuit et Brouillard gezeigt wurden?), die Flasche, die Schienen, die Reihen, die Nummern, gemischt mit einer Abwechslung von Selbstanklagen und Rechtfertigung. Die Stelle endet im Präsens: »[W]en reiß ich aus der Reihe«: Handelt es sich hier um eine Errettung aus den Todesreihen oder um eine Aufforderung, die Ränge zu verlassen? Eine andere erkennbare Referenz konkretisiert diesen Widerstand. Sie ist in einem Namen enthalten: »He, du da vorn, warst du der, der sich bückte und mit schwarzer Kreide über die Steine schmierte? Deine Sofie ist tot, ich fand sie zwischen den Schütteimern.« (Aichinger [1965] 1991a, 113) Von »Sofie« könnte ein Bezug zu ›Weisheit‹ hergestellt werden. Eine mögliche Interpretation wäre dann, dass die Weisheit jetzt in Trümmern liegt. Aber es gibt eine andere, wirkliche Sophie, die Aichingers Werk näher ist. In einigen kleinen und weniger bekannten Texten hat Aichinger schon vorher der Gruppe junger katholischer Widerstandskämpfer Tribut gezollt, die von den Studenten Sophie und Hans Scholl unter dem Namen Die Weiße Rose organisierte wurde. 1942 bezahlten die Geschwister Scholl ihre Gegnerschaft zum Nazi-Regime mit ihrem Leben. Eine ihrer Aktionen, genannt ›Schmieraktion‹, bestand darin, siebzig Mal »Nieder mit Hitler« auf die Wände zu schreiben, die zur Universität führten. Über deren Portal schrieben sie in großen Lettern das Wort »Freiheit«. Sie schrieben diese Protestworte in schwarzen Buchstaben auf Steinwände, oder, wie es in Aichingers Text heißt, »mit schwarzer Kreide über die Steine« (Aichinger [1965] 1991a, 113). Am Donnerstag, dem 18. Februar 1943, füllten sie eine Reisetasche mit Pamphleten, in denen zu einem Aufstand gegen das Regime aufgerufen wurde, und warfen sie in die Universitätshalle. Der Pedell der Universität, ein Pförtner mit dem Namen Schmidt, denunzierte sie bei der Gestapo. Sie wurden kurz darauf hingerichtet. Aichinger würdigte die Geschwister Scholl wiederholt in ihren früheren, essayistischen Texten und beschreibt deren Haltung als das höchste Ideal: Widerstand gegen die mörderische Macht des Faschismus. Im Zeichen dieses Widerstands klagt Aichingers Text die literarische Praxis der Nachkriegszeit an, die sich zu einer falschen Harmonisierung und Versöhnlichkeit verleiten ließ. In Über das Erzählen in dieser Zeit, einem früheren Text, in welchem Aichinger die Möglichkeiten der narrativen Darstellungsweise »in dieser Zeit« reflektiert, beschreibt sie traditionelle Erzählformen mit der Metapher eines ruhigen »Erzählfluss[es]« (Aichinger [1952] 1991b, 9), einer literarischen Form, die ihrer Meinung nach ungültig geworden war. Unter den bereits erwähnten Bezugnahmen auf die Gruppe 47 in Der Engel gibt es den Ausdruck: »Gesellschaft für Glasfluß« (Aichinger [1965] 1991a, 118), wobei Glas auf jene Durchsichtigkeit verweist, die den ›fließenden Realismus‹ der Gruppe anzeigen könnte. »Glasfluß« ist ein Glas mit hohem Glanz, das zur Nachahmung von Edelsteinen verwendet wird, der Begriff lässt also an Imitation und trügerischen Scheinwert denken. Im Wortlaut selbst vereint »Glasfluß« Transparenz und Kontinuität und verweist, wie die Metapher vom »Erzählfluss« in Aichingers Aufsatz Das Erzählen in dieser Zeit auf eine beschaulich dahinfließende
Vivian Liska: »Die Erinnerung an jetzt.«
Ausdrucksform, die Aichinger »in dieser Zeit« für ungültig erklärt. Zwar ist, heißt es dort, »der Vergleich mit dem Fluss […] noch immer richtig«, aber »wer heute Erzählungen mit Flüssen vergleicht, muß an reißendere Flüsse denken, mit steileren und steinigeren Ufern« (Aichinger [1952] 1991b, 9). Aichinger schreibt gegen die falsche Versöhnung eines ›heilenden‹ Erzählens an, das die deutsche Nachkriegsliteratur weitgehend bestimmte. Das »Sonntagsgerede« (Aichinger [1965] 1991a, 115) der »Gesellschaft für Glasfluß« kennt kein Stocken und keine Unterbrechung, der muntere Aufbau will Fortschritt und Kontinuität – »keine Zeit für Seufzer« (Aichinger [1965] 1991a, 113). Der geschlossenen Form, mit der man affirmative Werte setzen will, steht die Zusammenhanglosigkeit und Undurchsichtigkeit der Rede des Engels entgegen. Das Stocken des Atems, das der Engel am Anfang von »einem im Kreis« (ebd.) fordert, dient der Unterbrechung beruhigender Sinnstiftung. Gegen trostspendendes Erzählen steht dieses Stocken als Ausdruck der Angst, dass man, wie es in Das Erzählen in dieser Zeit heißt, »den Mund nicht mehr aufbringt« (Aichinger [1952] 1991b, 9). Die Stimme des Engels bringt nur noch Stolperndes, Stammelndes, Dunkles heraus. In dieser Form bewahrt sie die Worte auf, die »mit schwarzer Kreide auf die Mauer geschmiert« wurden: »Denn«, heißt es in der Erzählung Der Querbalken, »sie soll kein Lied werden, das nicht, ich will mir meine Stimme nicht mit Kreide weich machen lassen, oder war es Mehl?« (Aichinger [1963] 1991c, 125) Jedenfalls nicht weich und nicht weiß. Doch anders, eben hell, wollen es die »Höhlenkenner, Kammerzofen, Grasträger« (Aichinger [1965] 1991a, 118). Die Höhlenkenner, diese Experten der Dunkelheit – Hermeneuten, Kritiker und andere Erklärer –, suchen die Worte in ihren Verstecken auf und bringen sie ans Licht, die Kammerzofen wollen in den geheimen Kammern aufräumen, die Grasträger decken das Offene mit dem sprichwörtlichen Gras zu, das über die Gräber wächst. Doch der Engel widerspricht: »Es reicht nichts. Die Nachrichten sind vergeben.« (Aichinger [1965] 1991a, 118) Nachrichten in der Form von Berichten und Klarschriften, die erläutern und läutern, die klären und erklären, sind bereits vergeben, sind aber auch vergeblich und lassen vergessen. Aichinger kehrt das Spiel um: »Wir rennen den Efeu mit den Schlüsselbeinen ein, wer durchkommt, hat verloren. Der wird bestaunt, der läuft brennend die Wegzeilen hinauf.« (Aichinger [1965] 1991a, 117f.) Wer Klarheit und Eindeutigkeit sucht, erlebt den Triumph über das Unbekannte, Nichtbenannte, doch er bleibt ungerührt: »Den überrascht nichts mehr« (Aichinger [1965] 1991a, 118). Der Engel rät zu einem anderen Umgang mit seinen Worten: »[U]nd sollte jemand fragen, wer euch heimgesucht hat, wie es gemeint war: verweist ihn rasch mit Seufzern auf die Abstufungen, Mäander, Beerensucher leichthin und was uns nicht umstellt.« (Aichinger [1965] 1991a, 120, Herv. i. O.) Diesmal mit Zeit für Seufzer, für Nuancen und Umwege und für die Suche nach Beeren, nach kleiner, karger Nahrung. Anders als die Pförtnersöhne, die am Ende des Texts »euch über die Mauern nähren« (Aichinger [1965] 1991a, 121), soll hier nichts eingefangen, nichts festgehalten werden.
85
86
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Daher des Engels Bitte, die auch dem Leser bzw. der Leserin gilt: »Beherbergt, was ich sagte […] gebt ihm Brot und Wasser und laßt es ziehen.« (Ebd.) Bevor er geht, wendet sich der Engel um, spricht rückwärtsgewandt zu den Toten und ruft sie auf, ihm zu folgen: »Mit einer großen Handbewegung Kommt! Wir wollen sehen, was sich von dem Jammer noch retten lässt, von den geheilten Knochen.« (Aichinger [1965] 1991a, 118) Wie Walter Benjamins Engel der Geschichte schaut Aichingers Engel zurück und sieht einen Trümmerhaufen. Aber Aichingers Engel fragt, wie sich, angesichts der »geheilten Knochen«, in die kein Zeichen des Traumas mehr eingeschrieben ist, etwas vom »Jammer«, von der Untröstlichkeit bewahren lässt. »Ich kann«, so Aichinger in Kleist, Moos, Fasane, »getröstet nicht leben« (Aichinger [1987] 1991h, 65). Benjamins Engel möchte die Toten erwecken, doch der Wind des Fortschritts trägt ihn davon. Auch Aichingers Engel wird von jenen fortgetragen, die keine Zeit für Seufzer haben und im Namen des Neubeginns tröstend und getröstet der Zukunft entgegeneilen. Bevor er jedoch verschwindet, verkündet er seine Warnungen. Er warnt vor »falschen Vogelschwärmen […] gezielt und zugespitzt«, vor trügerischen Voraussagen und manipulierenden Versprechen, er warnt vor »Vorstadtpfeifer[n]« und »Perückenmacher[n]«, die »Tränen« trocknen und Trost spendend versprechen: »[D]er Himmel zeugt euch neu«. Sie nähren »über die Mauern«, sie monopolisieren mit einer scheinheilig-unschuldigen Engelsstimme die Wirklichkeit und schalten alles Fremde und jeden Widerspruch aus: »Hier ist nichts außer uns.« (alle Zitate: Aichinger [1965] 1991a, 121) »Hier ist nichts außer uns.« In den Worten der Pförtnersöhne treffen poetologische Reflexion und historischer Bezug aufeinander. Die Pförtnersöhne gehören zu jenen in Aichingers Texten immer wieder herausgeforderten Ordnungshütern der Worte, den Hausmeistern und Wächtern der Sprache, die Ungreifbares festnehmen und Aufständisches niederschlagen, die Grenzen ziehen und Einlass in Unerforschtes verwehren. Sie sind aber auch die Nachkommen des Pförtners Schmidt und, allgemeiner, all jener, die für eine totalitäre Ordnung ein- und aussperrten, die im Namen von Gesetzlichkeit und Autorität mörderisch Einstimmigkeit forderten und die Grenzen zwischen Eigenem und Anderem zogen. Ihre Söhne sprechen nun mit einer Engelsstimme, doch Aichingers Engel warnt, dass ihnen nicht zu trauen ist. Ihr Versprechen eines radikalen Neubeginns ist trügerisch und verleugnet die Spuren der Vergangenheit. Im Missbrauch durch die Söhne des Pförtners verschwindet zuletzt die Stimme des Engels. Zuvor hinterlässt sie eine Erinnerung an wahren Widerstand, einen Aufruf zum Misstrauen und eine Lücke, die offen bleibt. In diesem Sinne ist der Titel meines Beitrags zu verstehen. Er verdankt sich einer aphoristischen Bemerkung in Aichingers tagebuchartigen Einträgen aus dem Jahr 1958. Dort schreibt sie: »Die Erinnerung an jetzt ist in Gefahr, verloren zu gehen. Und was nützt jede andere Erinnerung, wenn diese eine fehlt?« (Aichinger [1987] 1991h, 55) »Die Erinnerung an jetzt«, das ist eine Bewusstseinsform, in der die Gegenwart aus der Perspektive des futurum imperfektum, eines ›wie es gewesen sein wird‹ erlebt
Vivian Liska: »Die Erinnerung an jetzt.«
wird. Es ist dann alles etwas fern und ungenau und sicher nicht zu Ende zu begreifen. Aber so unvollkommen es auch sein mag, es hat noch erinnerungsgesättigte Zukunft vor sich. Vielleicht ist das Lesen von Aichingers Texten ein Weg dorthin.
Literatur Aichinger, Ilse. »Stadtmitte« [1954]. In: Dies. Kurzschlüsse. Wien. Hg. u. mit einem Nachw. v. Simone Fässler. Wien 2001a, 11. Aichinger, Ilse. »Judengasse« [1954]. In: Dies. Kurzschlüsse. Wien. Hg. u. mit einem Nachw. v. Simone Fässler. Wien 2001b, 12. Aichinger, Ilse. »Der Engel« [1965]. In: Dies. Eliza, Eliza. Erzählungen 2 (1958–1968). Frankfurt a.M. 1991a, 113–121. Aichinger, Ilse. »Das Erzählen in dieser Zeit« [1952]. In: Dies. Der Gefesselte. Erzählungen 1 (1948–1952). Frankfurt a.M. 1991b, 9–11. Aichinger, Ilse. »Der Querbalken« [1963]. In: Dies. Eliza, Eliza. Erzählungen 2 (1958–1968). Frankfurt a.M. 1991c, 122–127. Aichinger, Ilse. »Surrender« [1976]. In: Dies. Schlechte Wörter. Frankfurt a.M. 1991d, 83–84. Aichinger, Ilse. »Schlechte Wörter« [1976]. In: Dies. Schlechte Wörter. Frankfurt a.M. 1991e, 11–14. Aichinger, Ilse. »Kleist, Moos, Fasane« [1959]. In: Dies. Kleist, Moos, Fasane. Frankfurt a.M. 1991f, 11–18. Aichinger, Ilse. »Hilfsstelle« [1987]. In: Dies. Kleist, Moos, Fasane. Frankfurt a.M. 1991g, 28–31. Aichinger, Ilse. »Aufzeichnungen 1950–1985« [1987]. In: Dies. Kleist, Moos, Fasane. Frankfurt a.M. 1991h, 41–89. Aichinger, Ilse. Die größere Hoffnung [1948]. Frankfurt a.M. 1991j. Arnold, Heinz Ludwig et al. Die Gruppe 47. Ein kritischer Grundriß. München 1980. Steinwendtner, Brita. »Ein paar Fragen in Briefen. Gespräch mit Ilse Aichinger«. In: Ilse Aichinger. Hg. v. Kurt Bartsch/Gerhard Melzer. Graz/Wien 1993, 7–13. Briegleb, Klaus: »Ingeborg Bachmann, Paul Celan. Ihr (Nicht-)Ort in der Gruppe 47 (1952–1964/65). Eine Skizze«. In: Ingeborg Bachmann und Paul Celan. Poetische Korrespondenzen. Vierzehn Beiträge. Hg. v. Bernhard Böschenstein/Sigrid Weigel. Frankfurt a.M. 1997, 29–84. Kant, Immanuel. »Erste Fassung der Einleitung in die Kritik der Urteilskraft« [1957]. In: Ders. Kritik der Urteilskraft. Frankfurt a.M. 1974, 7–68. Kleiber, Carine. Ilse Aichinger. Leben und Werk. 2. Aufl. Bern/Frankfurt a.M./New York 1986.
87
88
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Schroers, Rolf. »Gruppe 47 und die deutsche Nachkriegsliteratur«. In: Die Gruppe 47. Bericht, Kritik, Polemik. Ein Handbuch. Hg. v. Reinhard Lettau. Neuwied/Berlin 1967, 371–388.
Von den Enden des Ungeschriebenen Birgit R. Erdle
1. Ob Ilse Aichinger die Linientheorie Paul Klees kannte, ist nicht nachgewiesen, wenngleich ihre Schriften vereinzelte Spuren auslegen, die auf ihre Beachtung des künstlerischen und schriftstellerischen Werks Klees schließen lassen.1 Doch beschäftigen Linien ihre Literatur öfter, wie allein schon ihr Prosastück Die Linien meiner Schwester aus dem Jahr 1987 belegt, ein Text, der der Autorin und bildenden Künstlerin Helga Michie gewidmet ist, ihrer Zwillingsschwester. Das zeigen aber auch die zahlreichen Linienfiguren, die Linie des Blitzes und der Blüte, verblätterte Linien, die Bahn-, Bus- und Schattenlinien, die ihre Texte durchziehen. Für Paul Klee sind Punkte, die sich nicht bewegen und die nicht zur Linie werden, tote Punkte (vgl. Klee 1920, 29; vgl. dazu auch Zentrum Paul Klee/Osterwold 2005 und Bonnefoit 2009, 31–50). Ilse Aichinger interessiert dagegen am Punkt gegenüber der Linie etwas anderes: Sie setzt Punkte nahezu gleich mit Orten. In einer Tagebuch-Aufzeichnung von 1957 notiert sie: »Orte: Punkte, von denen man weggeht. Ausgeht? Weggeht oder ausgeht?« (Aichinger 1991a, 66). Ist der Ort also ein Ausgangspunkt? Eine Absprungmöglichkeit, wie es in einem der späteren Texte heißt? Ist im Verb ›weggehen‹, im Gegensatz zu ›bleiben‹, eine durch das Weg-sein-Wollen motivierte Bewegung angelegt, die sich Kontrapunkte schafft? Dass hier für die metapoetologische Reflexion ein Kristallisationspunkt liegt, der unterschwellig Aichingers Schreiben und ihr Nachdenken über Sprache, Form und Wirklichkeitstreue von
1
So in Die Küche in Großgmain (vgl. Aichinger [2002] 2021a, 239); einen weiteren Hinweis liefert die 1967 erschienene Ausgabe des Jahresring 67/68, Beiträge zur deutschen Literatur und Kunst der Gegenwart, in welcher sowohl Aichinger als auch Klee publizierten. Eine Postkarte mit einer Abbildung von Paul Klees Silbermondgeläute von 1922 sandte Aichinger an Helga Michie am 17. August 1984 (vgl. Wild 2021, 181). Die frühesten Spuren finden sich in der Korrespondenz mit Ingeborg Bachmann, im Brief Aichingers vom 26. September 1956, in dem sie an den »Nachtzug von München nach Wien« erinnert, »wo wir ein Buch mit Zeichnungen von Klee anschauten« (Bachmann/Aichinger/Eich 2021, 91); ebenfalls überliefert ist eine Postkarte mit Klees Reicher Hafen (1938), die Aichinger Bachmann am 20. Juni 1953 übersandte (vgl. Bachmann/Aichinger/Eich 2021, 182).
90
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
den 1950er Jahren bis in die frühen 2000er Jahre bestimmt, zeigt ihre Antwort auf die Frage, wie sie schreiben würde, würde sie heute damit beginnen. Dazu bemerkt Aichinger im November 1996: »Berichte schreiben, nichts Erfundenes. Genau sein. Kleine Dinge beobachten, Details. Punkte. Das Schreiben müsste punktueller sein.« (Aichinger [1996] 2011, 110–121, 117f.; vgl. Erdle 2021, 201–205) In Aichingers richtungsweisendem Anspruch eines punktuelleren Schreibens sammeln sich viele Züge, die ihre Poetologie auszeichnen: ihr Bemühen um Genauigkeit und Nüchternheit – »Toleranz scheint mir ein zu ungenaues Wort«, sagt Aichinger in ihrer Dankesrede zur Verleihung des Toleranzpreises im Wiener Rathaus 2002;2 ihre Zurückweisung von Wörtern, die »zu sehr nach einer Wolke« klingen, »die rasch zerblasen werden kann« (Aichinger [1996] 2001a, 24);3 ihre Haltung des Wartens und der Aufmerksamkeit, die sie mit Franz Kafkas Begriff der »Betrachtung« (Aichinger [1996] 2011, 110–121, 117) benennt; ihre Mahnung zur Vorsicht bei der Bildung von Zusammenhängen; der insistente Bezug ihrer Texte auf Gegenwart, dessen Verschränkung von Jetztzeit und Vergangenem eingeübte Denk(Gedenk)bahnen stört. Pointiert zeigt dies Stephan Braeses subtile Lektüre des unpublizierten Prosastücks Keine Erinnerung an Mauthausen [o. D.] (vgl. Braese 2021, 155–159). Der Forderung eines punktuelleren Schreibens trägt die mikroepische Form Rechnung, die Aichinger als ›einschmelzendes Schreiben‹ bezeichnet hat. In einer Aufzeichnung aus dem Jahr 1953 schreibt sie: »In der Erstarrung fällt Schreiben mit Atmen zusammen. Beide Möglichkeiten werden gleich schmal. D.h. das Schreiben schmilzt ein. Das Leben selbst wird zum Schreiben. Und ebenso schwierig. Jeder Atemzug muß für viele Stunden reichen.« (Aichinger 1991a, 41–87, 58) Von Alfred Polgars Bemerkung, die kleine Form könne »ganz gut ein Not-Effekt des kurzen Atems« (Polgar [1926] 1984, 372) sein, ist das hier benannte Zusammenfallen von Atmen und Schreiben weit entfernt. Es bleibt offen, ob der Schreibende erstarrt, der als Subjekt in dieser Aufzeichnung gar nicht in Erscheinung tritt, oder ob es das Schreiben ist, das erstarrt, sich zusammenzieht und eintrocknet zu kristallinen, störenden Flecken. Flecken ist der Titel eines Prosastücks von 1974 (Aichinger 1975, 20–22), gewidmet Rudolf Hirsch, dem späteren Cheflektor in Aichingers Verlag S. Fischer, der untergetaucht in den Niederlanden der nationalsozialistischen Verfolgung entkommen war (vgl. Berbig 2021, 140–143). So hält das Konzept des ›einschmelzenden Schreibens‹ einerseits Verbindung zur Kategorie der Zeitlichkeit: zum Augenblick, zur Markierung eines ›Hier‹, Moment oder Ort, der bei Aichinger aber profan bleibt. Das unterscheidet ihn zum
2 3
Die Geduld für das Kommende. Ilse Aichingers Rede zum Toleranzpreise (Aichinger 2002). »Es wird«, so der nachfolgende Satz, »immer um Genauigkeit gehen, die gerade im Bereich der Literatur leicht abhanden kommt« (Aichinger 2002). Siehe dazu Briegleb 2011, 220.
Birgit R. Erdle: Von den Enden des Ungeschriebenen
Beispiel von Kafkas Türhüter oder von dem Motiv des weißen Rechtecks auf der Fotografie in Dan Pagis’ Gedicht Fotografie am Ende der Brücke [Bridgehead Photograph] (Pagis 1996, 96–97). Auch das Erinnern ist bei Aichinger nicht dem Blättern im Fotoalbum nachgebildet, sondern als blitzhafte Belichtung gedacht. Zwar hält sich die Erinnerung in der Nähe der Chronologie auf, doch ist sie für Aichinger gegenläufig zur Chronologie und gerade »an diejenigen Augenblicke gebunden, in denen sie [die Erinnerung, Anm. B. E.] aus sich herausgerät« (Aichinger 2001b, 70) – ein Außer-sich-geraten oder ein Ausriss aus sich selbst, der aber nur als augenblickliches Ereignis denkbar ist, geladen von Jetztzeit. Ein einzelnes Zitat mag veranschaulichen, wie Aichingers Sätze das auf einem Zeitstrahl angeordnete Kontinuum erschüttern, das die Tempi der Vergangenheit und der Gegenwart, ›damals‹ und ›heute‹, bequem hintereinander rückt: »Unlängst«, so heißt es in dem 1966 entstandenen Prosastück Hilfsstelle, »ging ich an einem heißen Spätsommertag durch den zweiten Bezirk, vor langem und vor kurzem das Ghetto von Wien.« (Aichinger [1987] 1991b, 28). Die Leopoldstadt ist hier gemeint, eigentlich das ›Untere Werd‹. Dort befanden sich im 17. Jahrhundert das jüdische Ghetto und in den Jahren 1941 und 1942 die Internierungslager vor der Deportation nach Osten. Von dort, jenseits des Donaukanals, wurden Aichingers Großmutter Gisela Kremer und zwei der jüngeren Geschwister von Aichingers Mutter, Erna und Felix Kremer, nach Maly Trostinec bei Minsk verbracht. »Vor langem und vor kurzem« verortet das Ghetto und die mit ihm verbundene Geschichte der Juden, Aichingers Familiengeschichte, gemäß einem anderen Zeitmaß in der Topographie Wiens. Gerade die minimale Störung der gewohnten Zeitbegriffe, die in den Worten »vor langem und vor kurzem« liegt, ermöglicht ein blitzhaftes, flüchtiges Erkennen oder Erinnern. An vielen Texten Aichingers lässt sich zeigen, dass es gerade die Störungen und Unterbrechungen in der Fließrichtung des Prosatextes sind, in denen ein Wirkliches lesbar wird. Aichinger sagt 2001: »Ich will diesen Moment, diesen Riss in der Geschichte, den Augenblick der Gefahr, wo Vergangenheit in der Gegenwart aufspringt, sichtbar machen. Immer wieder.« (Reichensperger/Wittstock [2001] 2011, 158)
2. Das Konzept des ›einschmelzenden oder punktuelleren Schreibens‹ hält also einerseits Verbindung zur Kategorie der Zeitlichkeit, zu Augenblicken, die fast schon Orte sind. Andererseits hält es auch eine Verbindung zum Ungeschriebenen. Wie hängt das Schreiben mit dem Ungeschriebenen für Aichinger zusammen? »Jeder Satz, den man schreibt, muß durch ungeheuer viel ungeschriebene Sätze gedeckt sein, weil er sonst gar nicht dasteht« (zit.n. Esser 2003, 56f.), sagt Aichinger. Ihr
91
92
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Prosagedicht Ende des Ungeschriebenen trägt in der Manuskriptfassung die Datierung 12. März 1959. Die Sätze, die dastehen, lauten: Ende des Ungeschriebenen So wird niemand wissen von unseren Atemstößen als wir über die Brücke liefen, und was hinter uns liegt, erfahren sie nicht: Die schwachen Namenszüge, die geköpften Sonnen. Die Vorhallen der Spitäler sind still. (Aichinger [1959] 1991c, 26) Nur wenige Beobachtungen dazu. Schon die ersten drei Wörter, zugleich der Titel des Prosagedichts, konfrontieren uns als Lesende mit einer Lücke und einer Frage, eigentlich einem Bündel von Fragen, in denen sich der Leser sogleich verfängt. Wie kann Ungeschriebenes enden? An welchem Ende oder welchem äußersten Rand der Schrift/der Nichtschrift befindet sich das Gedicht bzw. befinden wir uns, die wir es lesen? Ist das Un- gleichbedeutend mit einem Nicht-? Kommt nach dem Ende des Ungeschriebenen nichts mehr, nicht einmal mehr Ungeschriebenes? Oder im Gegenteil: Könnte ein Ende des Ungeschriebenen ein Anfang des Geschriebenen sein? Hier stoßen wir auf ein Paradox: Am Anfang, nämlich in dem, was die Wörter der Titelzeile aussagen, hat das Ungeschriebene sein Ende (ohne bestimmten Artikel) erreicht, doch vor uns, den Lesenden, liegt das ›Ende des Ungeschriebenen‹ als geschriebener (und gedruckter) Text. Das Ungeschriebene assoziieren wir gewöhnlich mit sichtbar Leergelassenem, wie es der Weißraum im Druckbild, die Lücke zwischen Titelzeile und der folgenden Verszeile: »So wird niemand wissen« veranschaulicht. Mutmaßungen darüber, »was ›außerhalb der Sphäre des Geschriebenen verharrt […], warum es verschwiegen wird‹«, müssten »ins Leere laufen«, stellt Hannah Markus mit Referenz auf Vera Neuroth fest. (Markus 2015, 75) Das »Ende des Ungeschriebenen« rührt an eine Grenze, aber nicht an die Grenze eines Sagbaren oder Beschreibbaren, sondern an die eines Überlieferbaren – und in diesem Sinn greift es der Unterscheidung zwischen Lesbar- und Unlesbarkeit voraus. Auch die Schrift, so scheint es, vermag kaum mehr aufzubewahren und zu überliefern. Doch gibt es im Gedicht zu diesem Modus der Überlieferung der Nicht-Überlieferbarkeit eine gegenläufige Spur. Denn innerhalb der den ganzen Text bestimmenden Verneinung, an den Rändern der Negation, haben sich Reste erhalten: Es bildet sich eine Konstellation aus den Wörtern ›wissen‹, ›atmen‹, ›erfahren‹; es entsteht eine scharfe und nicht versöhnbare Konfrontation zwischen einem »wir« und ei-
Birgit R. Erdle: Von den Enden des Ungeschriebenen
nem »sie« – wir, die »wir über die Brücke liefen«, »sie«, die nicht erfahren, »was hinter uns liegt«; was hinter dem lyrischen Wir liegt, sind »geköpfte Sonnen« und Namenszüge, die immer schwächer werden, vielleicht ähnlich wie Atemzüge. Wie auch Markus betont hat, referieren die »geköpften Sonnen« auf eine Gewalttat, die an der Sonne begangen wurde (Markus 2015, 91). Die Sonnen-Metapher korrespondiert unter anderem mit einer Textpassage in Aichingers 1948 veröffentlichtem Werk Die größere Hoffnung: »Der Stern hatte die Farbe der Sonne. Entlarvt war sie, die angebetete Sonne, dieses strahlende Gestirn der Kinderzeit! Wenn man die Augen zusammenkniff, bekam sie schwarze Ränder, die sich gewandt einzogen und ausbuchteten, und in der Mitte stand ›Jude‹.« (Aichinger [1948] 1991d, 106) Das Motiv der schwarzen Ränder der Sonne zeichnet aber auch eine Spur in dem Gedicht Abhang von Helga Michie, der 1939 nach London geflüchteten Zwillingsschwester Ilse Aichingers. Dieses vermutlich zuerst in deutscher Sprache verfasste Gedicht, von dem wir nicht genau wissen, wann es entstanden ist, nähert sich der Beschreibung einer Falllinie an, der Linie des größten Gefälles auf einer geneigten Fläche: Abhang Die andern Grenzen waren es nicht an diesem ersten Tag, es war das Schweigen nachher. Es hing in der grellen Sonne ein schwarzes Tuch nicht mehr wegzudenken von den Beständen des Abgrunds, von den Wurzeln hinter Glas, von dem glucksenden Rinnsal, von der Reise meiner Großmutter nach Minsk schon im Fahrplan. (Michie 1978, 467) Der »erste[] Tag« in dem Gedicht könnte sich auf den Tag nach der Ankunft in Großbritannien beziehen, nach der geglückten Flucht aus dem nationalsozialistischen Wien, »das Schweigen nachher« auf die Schreibbedingungen im englischen Exil: Die postalische Rückverbindung zu den Angehörigen in Wien unterlag dem Gesetz der Zensur und der Verknappung der Wörter – »25 Wörter, einmal in drei Monaten«, »auf Korrespondenzkarten« (Michie/Reichensperger 2003, 209). Nachdem im Mai 1942 die Großmutter und zwei ihrer Kinder deportiert wurden, blieben ihre Namen auf den Karten fortan ausgelassen. Zur Bedeutung des Titelworts ›Abhang‹ erläutert Adelungs Grammatisch-kritisches Wörterbuch: »Die abhängige Seite einer Fläche, besonders eines Berges«,
93
94
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
»Ingleichen die Neigung, welche eine abhängige Fläche gegen den Horizont hat«; zum Zeitwort ›abhangen‹ findet sich die Kommentierung: »Von körperlichen Flächen, sich neigen; mit dem Horizonte einen spitzigen Winkel machen.« Und, der zweite Bedeutungsaspekt: »das Abhangen von einem andern«, der »Zustand, da ein Ding seinem Wesen oder auch nur seinen Umständen nach, in einem andern gegründet ist; noch häufiger die Abhängigkeit.« (Adelung 1811, 51–52) Konnotiert die erste Bedeutungsschicht des Wortes – die Neigung der abhängigen Fläche – eher das Gefälle in Richtung auf den Abgrund, könnte die zweite – das ›Abhangen von einem andern‹ – den Zustand der Trennung meinen, das offenbar unbegrenzte »Schweigen nachher«.4 Das »nachher« des Schweigens könnte sich jedoch bis in den »sprachpolitischen Block« (Braese 2001, 23) erstrecken, der sich in der Nachgeschichte des Nationalsozialismus nach 1945 ausprägt. Einen direkten Bezug zum Titelwort ›Abhang‹ stellt das Verb ›hing‹5 in der vierten Gedichtzeile her: »Es hing in der grellen Sonne/ein schwarzes Tuch«. Dieses Bild vom schwarzen Tuch, das in der grellen Sonne »hing«, erinnert an eine Textstelle in Das Buch Hiob und das Schicksal des jüdischen Volkes der Philosophin Margarete Susman, das im Jahr 1946 erschien und das Helga Michie möglicherweise gekannt hat. Darin ist von Hiobs Ahnung die Rede, in der »ein schweres schwarzes Tuch« über alles Geschaffene herabsinke (Susman [1946] 2018, 47). Die stillgestellte Bewegung, in der das schwarze Tuch in Michies Gedicht »in der grellen Sonne« »hing« (und »nicht mehr wegzudenken« ist), unterstreicht das Flächige und ruft eine Formsprache auf, die an den Kubismus erinnert und mit dem zeichnerischen Werk von Helga Michie korrespondiert. Die Lautspur, die im Bild des »glucksenden Rinnsal[s]« in Michies Gedicht aufgerufen wird, berührt eine frühe sprachkritische Reflexion Aichingers. »[…] ich kann nicht schreien und leuchten, ich kann mir nur eine alte kratzige Feder von Papa ausborgen u. zu schreiben beginnen, aber das kommt mir so vor wie der Bach der am Dorf vorbeifließt, wenn er gluckst unterm Eis u. nicht hervorkann! –« (Helga und Ilse Aichinger 2021, 231). Diese Aufzeichnung, die über das ›Schwächliche der Worte‹6 befindet, die über den Schreibakt, den Beginn des Schreibens nachdenkt, ist adressiert; sie findet sich in einem Brief Aichingers an ihre Schwester vom 12. Februar 1946.
4
5
6
In einem Entwurf zum Text Die Linien meiner Schwester, der im Nachlass Ilse Aichingers im Deutschen Literaturarchiv Marbach aufbewahrt wird, taucht das Wort ›Abhang‹ ebenfalls auf: »Auf den grasigen Abhängen steht in Hieroglyphen, was kommt und was war und wird eins. Es gibt nichts, was mich tiefer in Trauer und tiefer in Freude versetzt als die Linien meiner Schwester.« (Aichinger 2021c, 34) Das Verb ›hängen‹ stellt auch eine wortwörtliche intertextuelle Querverbindung zum Substantiv ›Verhängnis‹ her, dem einen der beiden Titelwörter in Aichingers Erzählung Film und Verhängnis (1995). »Ich find immer wieder, daß Worte schwächlich sind.« (Helga und Ilse Aichinger 2021, 231)
Birgit R. Erdle: Von den Enden des Ungeschriebenen
3. Die Enden des Ungeschriebenen nimmt ein vermutlich 1975 entstandener Prosatext auf, der den Titel Rahels Kleider trägt und in der Sammlung Schlechte Wörter enthalten ist. Der Text konstituiert sich über die Wörter Ahnung, wissen, Rest, übersetzen, Frage, die – neben einigen anderen – in immer wieder veränderten Konstellationen und beweglichen Verknüpfungen wiederholt werden. Man könnte den Text als Entwicklung der Geschichte einer Frage bezeichnen – oder als eine Geschichte des Fragens. »Wenn ich die Geschichte von den Lumpensammlern in Kensington niemandem mehr erzählte?« (Aichinger [1976] 1991e, 61) Auf diese erste Frage, mit der der Text beginnt, folgt mit dem nächsten Satz gleich die zweite Frage, durch die der Name Rahel eingeführt wird: »Und auch die nicht von Rahels Kleidern in den Wandschränken, die keine Wandschränke waren, sondern Durchgänge zur anderen Straßenseite, Durchstiege eigentlich, obwohl nach meinem Ermessen niemand mehr durchkam?« So wendet Rahels Kleider gleich im ersten Satz das Motiv des Erzählens so, dass der Anfang des Textes sich auf die Voraussetzung einer abwesenden Geschichte bezieht, einer Geschichte, die wir nicht kennen und die im Text nie erzählt wird. Die Geschichte existiert, zeichnet sich aber nur in Form einer Lücke oder einer Frage in den Text ein. Das Verschwinden nimmt in dem Prosastück Form an, indem die Figur – der Name (Rahel) – auf doppelte Weise verschwindet: Sie ist schon verschwunden, bevor der Text anfängt, nämlich 17 Jahre lang, wie wir durch eine weitere Frage erfahren, die dem Erzähler-Ich gestellt wird. Und die Figur, oder genauer: der Name, in den sie sich im Text zurückgezogen hat, verschwindet im Verlauf der Erzählung noch einmal anders, indem er – unmerklich und leise – dem Text abhandenkommt. Scharfe Abbiegungen und Abbrüche strukturieren das Prosastück, wie sich in dem schon zitierten zweiten Satz beobachten lässt. Wenn von den Wandschränken die Rede ist, »die keine Wandschränke waren, sondern Durchgänge zur anderen Straßenseite, Durchstiege eigentlich«, passiert etwas Unvorhergesehenes: Ein gewöhnliches, geschlossenes, der Aufbewahrung von Kleidern dienendes Möbelstück gibt sich plötzlich als Versteck zu erkennen, als Schlupfloch, das sich zu einer geheimen Fluchtmöglichkeit öffnet. Einer Möglichkeit der Flucht, die aber offenbar versperrt war: »Durchstiege eigentlich, obwohl nach meinem Ermessen niemand mehr durchkam« (Aichinger [1976] 1991e, 61). »Nicht nur wegen Rahels Kleidern«, setzt das Erzähler-Ich hinzu. Das Wort ›durchkommen‹ fächert sich an dieser Stelle vielschichtig auf, wird aber gerade nicht unbestimmt. Durch die Einschränkung (»nicht nur«) behält es seine referentielle Verknüpfung zu Rahels Kleidern. Unklar bleibt die Art des Verschwindens von Rahel – umso dringlicher und undurchdringlicher die materielle Hinterlassenschaft, der Rest, der auf den Eigennamen Rahel verweist. Rahels Kleider sind kein Symbol für etwas, bedürfen keiner
95
96
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Deutung, sie sind einfach insistent und unhintergehbar da. Als Abgelegtes, als Überbleibsel verweisen sie auf nichts als sich selbst und auf diejenige, die sie getragen und zurückgelassen hat. Zugleich könnte man sie als sichtbare Überreste oder Sedimente einer Geschichte beschreiben, die uns vorenthalten wird, deren Erzählbarkeit aber außer Frage steht. Ebenso wie die Erzählbarkeit der Geschichte von den Lumpensammlern in Kensington, welche das Aufsammeln der Reste, des Fortgeworfenen, Verlorenen oder Verachteten schon in ihrer Benennung als Erzählgegenstand einführt. Die Frageform des Textes setzt sich im vierten Satz so fort: »Wenn ich überhaupt nichts mehr erzählte und auch auf Fragen nur im äußersten Fall und nur dem Scheine nach einginge?« Die Fragen zu den zurückgelassenen Kleidern, die dem Erzähler-Ich gestellt werden, im Druck kursiv gesetzt, lauten zum Beispiel: »Wissen Sie vielleicht, weshalb Rahel ihre Kleider nicht mitnahm, als sie fortzog?« oder: »haben Sie eine Ahnung, weshalb sich Rahel ihr Zeug nicht nachschicken läßt? Nach siebzehn Jahren?« (Aichinger [1976] 1991e, 61, Herv. i. O.). Die Wörter ›wissen‹ und ›Ahnung‹ beziehen sich auf dieses Verschwinden und Nicht-Wiederkommen, das als »Rahels Geheimnis« (Aichinger [1976] 1991e, 62) benannt wird. ›Ahnung‹ ist hier nicht der Rand, der Ausläufer oder der Anfang von ›Wissen‹, sondern ist streng gegenläufig zu ihm. ›Ahnung‹ und ›wissen‹ schließen einander aus, wie sich zeigen wird. Die dem Erzähler-Ich gestellte Frage: »Oder haben Sie eine Ahnung, weshalb sich Rahel ihr Zeug nicht nachschicken läßt?« wird so beantwortet: Diese Frage könnte ich, wenn es mir schon nicht gelungen wäre, ihr zu entgehen, ohne zu zögern, verneinen. Denn ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß es. Und da man von den Dingen, die man einmal weiß, keine Ahnung mehr zu haben pflegt, ja, dem Wissen über gewisse Dinge im allgemeinen nur nachjagt, um die Ahnung, die man davon hat, zu verlieren, wäre ich im Recht. Einmal hatte ich, obwohl ich es schon wußte, eine Ahnung davon, weshalb sich Rahel ihr Zeug nicht nachschicken läßt. Sie war schrecklich. (Aichinger [1976] 1991e, 61f.) Die Asymmetrie zwischen Ahnung und Wissen könnte den Leser zu der Frage verleiten: Ist das Wissen schrecklicher als die schreckliche Ahnung? Oder weniger schrecklich? Oder jenseits eines ›mehr oder weniger schrecklich‹?7 Das Wissen des Erzähler-Ichs um das, was »Rahels Geheimnis« genannt wird, bleibt eine Leerstelle, die an ein Außerhalb des Textes – oder an so etwas wie ein inneres Außerhalb des Textes – gebunden ist und sich wie ein Keil in den Text schiebt. Wie der Text will das Erzähler-Ich »Rahels Geheimnis« wahren; die Antworten auf die ihm von anderen
7
Anders ins Verhältnis gerückt sind ›Ahnung‹ und ›Wissen‹ in Aichingers H.G. Adler gewidmetem Prosagedicht Versuch zu danken: »Die genaue Ahnung,/das genaue Wissen,/Schutz und Zuflucht./Die Helligkeit beim Eintritt/macht gewiß:/Hier ist einer durch die Schwärze gegangen/und bleibt« (Aichinger 1985, 1).
Birgit R. Erdle: Von den Enden des Ungeschriebenen
Sprechern gestellten Fragen müssen deshalb die Gefahr umgehen, das Gebot der Verschwiegenheit zu verletzen. Es ist eine Linie, die fluchtartig herausführt aus dieser Gefahr und ungeplant in anderen, unbekannten Gegenden mündet. »[B]enommen und schwach«, so heißt es im Text, landet das Erzähler-Ich, vor der Wissbegierde der Fragenden fliehend, in der Buslinie 147, die in südwestlicher Richtung unterwegs ist. Aber, so wird gesagt, »Rahels Geheimnis wäre gewahrt, der Schatten ihres Schicksals dem meinen um dieselbe Spur nähergerückt, um die es mir gelungen wäre, mein Wissen zu verleugnen.« (Aichinger [1976] 1991e, 62f.) Im Wort »gewahrt« trifft sich die Bedeutung von ›wahr‹, von ›bewahren‹ oder ›verwahren‹ mit jener von ›gewahr werden‹: das unterstreicht, dass Aufmerksamkeit der Sinn ist, der hier gefragt ist, jeden identifizierenden Zugriff verwehrend. Das Wort »Spur« in dieser Konstellation wirft mehrere Fragen auf: Man könnte es lesen als ›der um eine Spur, um eine Nuance verringerte Abstand‹, welcher zwischen dem Schatten des Schicksals von Rahel und demjenigen des ›Ich‹ des Textes besteht. Doch kann man es auch so lesen, dass das sprechende ›Ich‹ über eine Spur die Verbindung hält zu dem Schatten, den Rahels Schicksal wirft: Das Näherrücken des Schattens von Rahels Schicksal und die Verschwiegenheit über das eigene Wissen sind voneinander abhängig, aneinander gekoppelt, aber nicht durch ein Maß, sondern durch eine Spur. Das Wort »gewahrt« in dem zitierten Satz bringt jedoch auch sein Gegenteil ins Spiel, nämlich das unnütze Geschwätz. Geschwätzigkeit wird von Aichinger sehr klar bezeichnet: Das sprechende ›Ich‹ erwägt, eine der Fragen mit einem Kopfschütteln zu beantworten, verwirft dies aber, denn »das wäre schon geschwätziger, als Andeutung auslegbarer« (Aichinger [1976] 1991e, 61). Auslegbarkeit soll aber unbedingt vermieden werden, ebenso wie Geheimnistuerei. Dies lässt sich als poetologischer Kommentar lesen, der deutlich macht, dass es hier nicht einfach um einen antihermeneutischen Gestus des Textes geht: eher um eine Warnung an den Leser. Der Lesende soll davor gewarnt sein, so eine mögliche Lesart, Aichingers Sprache in diesem Prosastück als Andeutungssprache aufzufassen. Er soll sich bewusst sein, dass seine Lektüre sich in Ahnungen aufhält, die allerdings vage oder auch genau definiert sein können. So würde der Lesende einer Ahnung folgen, wenn er in Rahels Kleidern eine Andeutung auf eine Passage aus dem Text Aus der Geschichte der Trennungen erkennen will: In diesem Text, datiert auf den 8. November 2002 (Aichinger [2002] 2005a, 68–69), berichtet Aichinger über ihre 1939 nach England entkommene Tante, Klara Kremer, eine Fremdsprachenkorrespondentin. Im Krieg habe sie in London für ihre im Frühjahr 1942 aus Wien deportierte und ermordete Mutter, Gisela Kremer, Kleider gekauft; bis zu ihrem eigenen Tod habe sie diese Sammlung von Kleidern aufbewahrt.8 8
In dem wenig später entstandenen Text Eine Lobrede auf England lautet eine Passage: »Ich erinnere mich an die Vorgärten mit den Hortensien und Tulpen, oft noch spät im Jahr. Auch
97
98
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Der Text setzt solchen Zuschreibungen eine Zone der Verschwiegenheit entgegen, die der Leser nicht in Deutung oder Bedeutung auflösen kann und die seine Auslegungen, ebenso wie den literaturwissenschaftlichen Diskurs, auf die Probe stellt. Die Geschichte der Frage oder des Fragens, die den Text vorantreibt, gerät gegen Ende immer mehr in Zeitnot: »Jetzt rasch, rasch alle meine Fragen noch einmal. […] Zu spät. Es ist jetzt keine Zeit mehr […]. Jetzt nur die Fragen und ihre Reihenfolge.« (Aichinger [1976] 1991e, 66) Sie mündet in die Frage nach der letzten Frage: »Wie heißt die letzte Frage? Heißt sie wie wir« (Aichinger [1976] 1991e, 67), fragt das ›Ich‹ des Textes. Der Wortlaut der letzten Frage und der Eigenname lösen sich ineinander auf – wobei die Identität von Namen und Benanntem gerade da weiter bestritten wird, wo der Kontext jüdischer Überlieferung ins Spiel kommt: »Und dabei schwören könnten, daß Salomon nicht Salomon hieß, David nicht David«. Aber die letzte Frage, so wendet das sprechende ›Ich‹ gegen sich selbst ein, kann nicht »wie wir« heißen, »so ähnlich und so falsch.« »Wie heißt die letzte Frage?« (Aichinger [1976] 1991e, 67) Es ist der Moment, in dem der Text an sein Ende kommt und die letzte Frage zwar gefunden, aber verschwiegen wird.
4. Als Begriff schließt das Punktuelle den Gedanken der Form mit dem des Faktischen zusammen. Es betrifft die Wörter ebenso wie das ›Zwischen den Wörtern‹ und unterhält eine intensive Beziehung zum Schweigen und zum Nichtgeschriebenen. »[I]ch möchte keinen Trost. Ich möchte Fakt« (Aichinger [1993] 2011, 76), hält Aichinger einmal bündig fest. Schon Die größere Hoffnung (1948) nannte sie nachträglich einen »Bericht […] darüber, wie es wirklich war« (Aichinger [1986] 2011, 44): »An ein Buch habe ich gar nicht gedacht, ich wollte nur alles so genau wie möglich festhalten.« (Radisch 1996, 53-54) In seiner Besprechung des Buches im Mai 1960 in der in Tel Aviv erscheinenden deutschsprachigen Wochenschrift Hakidmah הקידמהrät Alfred Frankenstein »Menschen mit schwachen Nerven«, sie sollten »sich hüten, dies bitterernste Buch zur Hand zu nehmen« (Frankenstein 1960, 8) – eine Äußerung, die merklich abweicht von der Wahrnehmung des Romans im Nachkriegsdeutschland, welche eher das Allegorische und Symbolische des Textes betonte. Der Autor
an die vielen dunkel- und mittelgrauen Kleider, die die ältere Schwester unserer Mutter an einer Schnur in ihrem Pensionszimmer für unsere Großmutter untergebracht hatte. Die kam nie mehr, und ›Auntie‹ fragte auch nie mehr nach ihr. Ich denke, daß ich doch noch einmal in die Hauptstadt von Weißrußland fahren werde, wo sicher niemand ankam.« (Aichinger [2002] 2005b, 72)
Birgit R. Erdle: Von den Enden des Ungeschriebenen
der Buchbesprechung9 konzediert, der Name der jungen Autorin, Ilse Aichinger, sei »bei uns in Israel noch kaum bekannt«, deshalb wolle er sie der Leserschaft der Zeitung vorstellen. Er hebt hervor, zu welchem Zeitpunkt im israelischen Kalender dies geschieht, nämlich »gerade in einer Woche, die von zwei Gedenktagen eingeklammert wird, dem Gedenktag an die Opfer der Nazi-Vernichtung und dem Gedenktag der Toten des Befreiungskrieges« (Frankenstein 1960, 8). Damit stellt er Aichingers Buch genau in den Gedächtniskontext – oder in den Zwischenraum – von Shoah und der Gründung eines souveränen jüdischen Nationalstaats. Indem Frankenstein Erzählmotive wie die Hoffnung auf ein Visum und den Selbstmord der Großmutter, um der Deportation zu entkommen, hervorhebt, liest er das Buch als Legitimation des nation state, der den Status als Rechtssubjekt und Staatsbürger auch für Menschen »wie die kleine Ellen und ihre Spielgefährten« garantiert, bei denen, wie Helga Michie formulierte, »auch das Falsche nicht ganz war« (Michie/ Reichensperger 2003, 207). Im Kontext der komplexen Auseinandersetzung um den Realismus-Begriff in der deutschsprachigen Literatur nach 1945 wird Ilse Aichingers Schreiben in der jüngeren Forschung häufig ein ›Realismus der Wortwörtlichkeit‹ attestiert.10 Damit hängt zusammen, was man als Sprachursprungstheorie Aichingers bezeichnen könnte: Sprache entsteht bei ihr aus Auflehnung, sie bricht auf oder etwas bricht in ihr auf. Sie irritiert die bestehende Sprache und sucht nach einer Genauigkeit, die einer beruhigenden Historisierung und Normalisierung entgegenarbeitet. Sie setzt die Lesenden auf die Fährte einer Suche und fordert sie zugleich eindringlich auf, wie es in ihrem Essay Aufruf zum Misstrauen aus dem Jahr 1946 heißt, »[u]nserer eigenen Wahrhaftigkeit« (Aichinger [1946] 2021b, 22) zu misstrauen. Beim dritten deutsch-französischen Schriftstellertreffen zum Thema Le réalisme en littérature: l’écrivain devant le réel/Dichtung und Realismus. Der Schriftsteller vor der Realität, das vom 28. April bis 2. Mai April 1956 in Vézelay und Paris stattfand, entschied Ilse Aichinger, wie Paul Celan, ihre poetologischen Überlegungen zu dem Thema nicht in Form eines theoretischen Essays oder eines Erzähltextes zu präsentieren wie die meisten anderen Teilnehmer des Treffens, sondern in poetischer Sprache, im Prosagedicht Befehl des Baumeisters beim Bau der Prinz-Eugen-Straße. (Aichinger [1956] 1991f, 60)11 Dort wird das Aufbrechende, Aufstörende am Bild des Windstreifens sichtbar – »Gleich zu Beginn/ein breiter Streifen Wind« (Aichinger [1956] 1991f,
9
10 11
Alfred Frankenstein, promovierter Jurist, wurde 1906 in Berlin geboren; er emigrierte 1934 nach Mandats-Palästina und war dort u.a. im Rahmen des Ha’avara Transfer-Abkommens tätig. Darauf hat eindringlich zuerst Sigrid Weigel aufmerksam gemacht (vgl. Weigel 1987, 11–37). Siehe die Dokumentation der ins Deutsche übersetzten Beiträge von Roland Barthes, Luc Estang, Alain Robbe-Grillet neben jenen von Karl Korn, Günter Eich, Walter Höllerer und Hans Bender in Akzente. Zeitschrift für Dichtung 3.4 (1956), 303–338.
99
100
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
60), heißt es in den ersten Verszeilen. Von Anfang an bringen die anhaltenden, unberechenbaren Windstöße die Vorstellung befestigter Abmessungen und einer sicheren horizontalen Verlaufsrichtung der Straße ins Wanken. Der Wind erzeugt Staubwolken, die – »[w]enn diese Wolken/sich zu den helleren am Himmel schlagen,« – sich zu einem »Muster« formieren, in dem sich der »Plan« für den Bau abzeichnet (»kennt ihr das Muster,/findet ihr den Plan«) (Aichinger [1956] 1991f, 60).12 Eine Lesart des Textes zeigt, wie dieser die Reflexion über das Verhältnis von Poetologie und einer im Gegenwärtigen aufspringenden, historischen Realität zuspitzt.13 Die Anweisung des Baumeisters entwirft den Bauplan eines Ortes, der sich der Repräsentationsarchitektur der faktischen Prinz-Eugen-Straße im 4. Wiener Bezirk entgegensetzt, an der sich auch das von den Nationalsozialisten enteignete Rothschildpalais befand, Adolf Eichmanns Zentralstelle für jüdische Auswanderung. »Ein Gedicht gegen die Verplanung«, wird Aichinger zitiert und auf ihr Dialogstück Belvedere (1956) als »Beispiel für die zwingende Logik einer lückenlosen Verplanung« (Ratmann 2001, 96) verwiesen. So tragen nicht nur die mit dem Namen Prinz Eugen assoziierten stadtplanerischen Vorhaben ein historisch Reales in den Text, sondern auch die lückenlose Planung der Ausgrenzung, Beraubung und Vernichtung der Wiener Juden, die das Prosagedicht stillschweigend, der Ahnung oder dem (Nicht)Wissen-Wollen des Lesers anheimgegeben, adressiert.
Literatur Adelung, Johann Christoph. Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. 1. Tl.: A–E. Wien 1811. Aichinger, Ilse. »Die Küche in Großgmain« [2002]. In: Dies. Aufruf zum Mißtrauen. Verstreute Publikationen 1946–2005. Hg. v. Andreas Dittrich. Frankfurt a.M. 2021a, 237–240. Aichinger, Ilse. »Aufruf zum Mißtrauen« [1946]. In: Dies. Aufruf zum Mißtrauen. Verstreute Publikationen 1946–2005. Hg. v. Andreas Dittrich. Frankfurt a.M. 2021b, 21–22.
12
13
In dem Prosastück Einübung in Abschiede: Wien, vierter Juli 1939 (2003) korrespondiert eine Textstelle mit der Metapher des auffliegenden Staubs: »[…] ehe die Aufbrüche begannen, von denen sich keiner träumen ließ, der Staub, der immer wieder neu aufwirbelte und kurz zur Ruhe kam.« (Aichinger 2003, 203–206) Grundlegend zu Aichingers »topischem Schreiben« und der ihm entgegenschlagenden »Tabuisierung von Wissen«, erkennbar in der teils überaus beredten Abwehr schon im Kontext der Gruppe 47: Briegleb 2011 u.a. 201, 223; Briegleb 2003, 164–196, 308–309. Dazu auch: Liska 2011.
Birgit R. Erdle: Von den Enden des Ungeschriebenen
Aichinger, Ilse. »Die Geduld für das Kommende. Ilse Aichingers Rede zum Toleranzpreise«. Nur online in: Der Standard (12.11.2002). https://www.derstandard.at/s tory/1129672/die-geduld-fuer-das-kommende (11.10.2022). Aichinger, Ilse. [Entwurf zum Text »Die Linien meiner Schwester«, Typoskript]. »Konvolut: Texte in der Mappe ›Maulwürfe‹ [Verschiedenes]«, Nachlass, Handschriftensammlung [A: Aichinger, Ilse]. Deutsches Literaturarchiv Marbach. Abgedruckt in: Die Hochsee der Ilse Aichinger. Ein unglaubwürdiger Reiseführer zum 100. Geburtstag. Hg. v. Marie Luise Knott/Uljana Wolf. Heidelberg 2021c, 34. Aichinger, Ilse. Es muss gar nichts bleiben. Interviews 1952–2005. Hg. u. mit einem Nachw. v. Simone Fässler. Wien 2011. Aichinger, Ilse. »Aus der Geschichte der Trennungen« [2002]. In: Dies. Unglaubwürdige Reisen. Hg. v. Simone Fässler/Franz Hammerbacher. Frankfurt a.M. 2005a, 68–69. Aichinger, Ilse »Eine Lobrede auf England« [2002]. In: Dies. Unglaubwürdige Reisen. Hg. v. Simone Fässler/Franz Hammerbacher. Frankfurt a.M. 2005b, 71–73. Aichinger, Ilse. »Einübung in Abschiede: Wien, vierter Juli 1939« [2003]. In: Die Kindertransporte 1938/39. Rettung und Integration. Hg. v. Wolfgang Benz/Claudia Curio/Andrea Hammel. Frankfurt a.M. 2003, 203–206. Aichinger, Ilse. »Der Boden unter unseren Füßen«. [Rede zum Großen Österreichischen Staatspreis, Wien, 20.3.96]. In: Dies. Film und Verhängnis. Blitzlichter auf ein Leben. Frankfurt a.M. 2001a, 21–24. Aichinger, Ilse. »Vorbemerkung zum ›Journal des Verschwindens‹« [2001]. In: Dies. Film und Verhängnis. Blitzlichter auf ein Leben. Frankfurt a.M. 2001b, 65–71. Aichinger, Ilse. »Aufzeichnungen 1950–1985«. In: Dies. Werke. Taschenbuchausgabe in 8 Bden. Kleist, Moos, Fasane. Hg. v. Richard Reichensperger. Frankfurt a.M. 1991a, 41–87. Aichinger, Ilse. »Hilfsstelle« [1987]. In: Dies. Werke. Taschenbuchausgabe in 8 Bden. Kleist, Moos, Fasane. Hg. v. Richard Reichensperger. Frankfurt a.M. 1991b, 28–31. Aichinger, Ilse. »Ende des Ungeschriebenen« [1959]. In: Dies. Werke. Taschenbuchausgabe in 8 Bden. Verschenkter Rat. Gedichte. Hg. v. Richard Reichensperger. Frankfurt a.M. [1978] 1991c, 26. Aichinger, Ilse. Werke. Taschenbuchausgabe in 8 Bden. Die größere Hoffnung. Roman [1948]. Hg. v. Richard Reichensperger. Frankfurt a.M. 1991d. Aichinger, Ilse. »Rahels Kleider« [1976]. In: Dies. Werke. Taschenbuchausgabe in 8 Bden. Schlechte Wörter. Hg. v. Richard Reichensperger. Frankfurt a.M. 1991e, 61–68. Aichinger, Ilse. »Befehl des Baumeisters beim Bau der Prinz-Eugen-Straße« [1956]. In: Dies. Werke. Taschenbuchausgabe in 8 Bden. Verschenkter Rat. Gedichte. Hg. v. Richard Reichensperger. Frankfurt a.M. [1978] 1991f, 60. Aichinger, Ilse. »Versuch zu danken«. In: Europäische Ideen 60 [H.G. Adler zum 75. Geburtstag]. Hg. v. Andreas W. Mytze. Berlin 1985, 1.
101
102
Vergegenwärtigung, Gespenster, aufblitzende Erinnerung
Aichinger, Ilse. »Flecken« [1975]. In: Für Rudolf Hirsch. Zum siebzigsten Geburtstag am 22. Dezember 1975. Red. J. Hellmut Freund. Frankfurt a.M. 1975, 20–22. Aichinger, Helga und Ilse. »Ich schreib für Dich und jedes Wort aus Liebe«. Briefwechsel, Wien–London 1939–1947. Hg., kommentiert u. mit einem Nachw. v. Nikola Herweg. Wien 2021. Bachmann, Ingeborg/Aichinger, Ilse/Eich, Günter. »Halten wir einander fest und halten wir alles fest!« Der Briefwechsel. Hg. v. Irene Fußl/Roland Berbig. Berlin 2021. Berbig, Roland. »Hoffnungslosigkeiten aller Art«. In: Ilse Aichinger Wörterbuch. Hg. v. Birgit Erdle/Annegret Pelz. Göttingen 2021, 140–143. Bonnefoit, Régine. Die Linientheorien von Paul Klee. Petersberg 2009. Braese, Stephan. »Keine Erinnerung«. In: Ilse Aichinger Wörterbuch. Hg. v. Birgit Erdle/Annegret Pelz. Göttingen 2021, 155–159. Braese, Stephan. Die andere Erinnerung. Jüdische Autoren in der westdeutschen Nachkriegsliteratur. Berlin/Wien 2001. Briegleb, Klaus. »›Spiegelgeschichte‹ in der Nähe des Kinos – Zwei Personen am Aspangbahnhof in Wien. Ein historischer Entwurf zu Ilse Aichingers emblematischem Verfahren«. In: Absprung zur Weiterbesinnung. Geschichte und Medien bei Ilse Aichinger. Hg. v. Christine Ivanovic/Sugi Shindo. Tübingen 2011, 199–230. Briegleb, Klaus. Mißachtung und Tabu. Eine Streitschrift zur Frage: »Wie antisemitisch war die Gruppe 47?« Berlin/Wien 2003. Erdle, Birgit. »punktueller sein«. In: Ilse Aichinger Wörterbuch. Hg. v. Birgit Erdle/ Annegret Pelz. Göttingen 2021, 201–205. Esser, Manuel. »›Die Vögel beginnen zu singen, wenn es noch finster ist‹. Auszug aus einem Gespräch mit Ilse Aichinger«. In: Ilse Aichinger. Leben und Werk. Hg. v. Samuel Moser. Frankfurt a.M. 2003, 47–57. Frankenstein, Alfred. »[Neue Bücher] ›Die größere Hoffnung‹«. In: הקידמהHakidmah, Tel Aviv, 13.625 (6.5.1960), 8. Klee, Paul. Schöpferische Konfession. Hg. v. Kasimir Edschmid (Tribüne der Kunst und Zeit Bd.13). Berlin 1920, 28–40. Wiederabdruck in: Ders. Schriften. Rezensionen und Aufsätze. Hg. v. Christian Geelhaar. Köln 1976, 118–122. Liska, Vivian. »Sofies Engel. Ilse Aichinger und die ›Gruppe 47‹«. In: Dies. Fremde Gemeinschaft. Deutsch-jüdische Literatur der Moderne. Göttingen 2011, 231–244 (englischsprachige Fassung: »A Broken Ring: The ›Gruppe 47‹ and Ilse Aichinger’s Poetics of Resistance«. In: Dies. When Kafka says we. Uncommon Communities in German-Jewish Literature. Bloomington 2009, 141–150). Markus, Hannah. Ilse Aichingers Lyrik. Das gedruckte Werk und die Handschriften. Berlin/Boston 2015. Michie, Helga. »Abhang«. In: Literatur und Kritik. Österreichische Monatsschrift 128 [Deutschsprachige Literatur in England] (1978), 467. Michie, Helga/Reichensperger, Richard. »Ein Gespräch mit Ilse Aichingers Zwillingsschwester, geflohen aus Wien nach London mit dem Kindertransport am
Birgit R. Erdle: Von den Enden des Ungeschriebenen
4. Juli 1939«. In: Die Kindertransporte 1938/39. Rettung und Integration. Hg. v. Wolfgang Benz/Claudia Curio/Andrea Hammel. Frankfurt a.M. 2003, 206–209. Pagis, Dan. »Bridgehead Photograph«. In: The Selected Poetry Of Dan Pagis. Translated by Stephen Mitchell, with an introduction by Robert Alter. Berkeley/Los Angeles/ London 1996, 96–97. Polgar, Alfred. »Die kleine Form. (quasi ein Vorwort)«. In: Ders. Kleine Schriften 3. Hg. v. Marcel Reich-Ranicki in Zusammenarb. mit Ulrich Weinzierl. Berlin 1984, 369–373. Radisch, Iris. »Ilse Aichinger wird 75. Ein Zeit-Gespräch mit der österreichischen Schriftstellerin«. In: Die Zeit 45 (01.11.1996), 53-54, https://www.zeit.de/1996/45/ aich.txt.19961101.xml (10.10.2022) Ratmann, Annette. Spiegelungen, ein Tanz. Untersuchungen zur Prosa und Lyrik Ilse Aichingers. Würzburg 2001. Reichensperger, Richard/Wittstock, Uwe. »Ich bin im Film« [2001]. In: Ilse Aichinger. Es muss gar nichts bleiben. Interviews 1952–2005. Hg. u. mit einem Nachw. v. Simone Fässler. Wien 2011, 154–158. Susman, Margarete. Das Buch Hiob und das Schicksal des jüdischen Volkes [1946]. Frankfurt a.M. 2018. Weigel, Sigrid. »Schreibarbeit und Phantasie: Ilse Aichinger«. In: Frauenliteratur ohne Tradition? Neun Autorinnenportraits. Hg. v. Inge Stephan/Regula Venske/Sigrid Weigel. Frankfurt a.M. 1987, 11–37. Wild, Thomas. Ununterbrochen mit niemandem reden. Lektüren mit Ilse Aichinger. Frankfurt a.M. 2021. Zentrum Paul Klee/Tilman Osterwold (Hg.). Paul Klee, kein Tag ohne Linie [anlässlich der Ausstellung »Paul Klee, Kein Tag ohne Linie«. Zentrum Paul Klee, Bern, 20. Juni 2005 – 5. März 2006]. Ostfildern-Ruit 2005.
103
II. Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Telegraph der Vergangenheit, Mikroskop der Gegenwart und Fernrohr der Zukunft. Ludwig Börnes Figuren der Aktualität Daniel Weidner
Im Frühjahr 1818 kündigt der junge Ludwig Börne das Erscheinen einer neuen Zeitschrift an: In zwangloser Folge soll Die Waage. Eine Zeitschrift für Bürgerleben, Wissenschaft und Kunst erscheinen – sie wird es in den nächsten Jahren auf 13 Hefte bringen und die beachtliche Zahl von 600 Abonnenten erreichen. Selten ist emphatischer über das Medium Zeitschrift geschrieben worden als in der besagten Ankündigung – und selten reicher an Metaphern. Die neue Zeitschrift, so heißt es etwa, wolle nicht nur »als Sekundenzeiger an einer Uhr dienen, um den ungeordneten Puls des Staates zu verraten«, sie verstehe sich vielmehr »als das Triebwerk selbst, welches die Gänge der Zeit regelmäßig erhält und ihre Fortschritte abmißt« (Börne 1977, Bd. I, 667). Das Wissen der Zeit, die »Barren der Wahrheit von Reichen an Geist in großen Werken niedergelegt«, werde sie nutzbar und wirksam machen, indem es diese Barren ausmünzt: »Die Zeitschriften sind es, welche diese Münzen bilden; von der Ausbeute der Erkenntnis geprägt, unterhalten sie den Wechselverkehr zwischen Lehre und Ausübung. Nur sie führen die Wissenschaft ins Leben ein und das Leben zur Wissenschaft zurück.« (Börne 1977, Bd. I, 669) Gerade die Deutschen bedürften der Zeitschriften, denn für sie war bisher der »Baum der Erkenntnis eine ehrwürdige Eiche, die dem müden Menschen Schatten, aber der hungrigen Seele keine Speise gab« (ebd.). Um das Wissen wirksam zu machen und den »lebhaften Umtausch der Gedanken« (Börne 1977, Bd. I, 668) zu fördern, könne es gar nicht genug Zeitschriften geben, »ja oft wäre es zu wünschen, daß die Tageblätter in Stundenblätter auseinandergingen, damit nichts überhört werde und verloren gehe« (Börne 1977, Bd. I, 670f.). Zeitschriften sind dazu da, »die Aussagen der Zeit zu erlauschen, ihr Mienenspiel zu deuten und beides niederzuschreiben« (Börner 1977, Bd. I, 670), auch wenn diese Aussagen immer wechseln und das Mienenspiel konstant in Bewegung ist, ja sogar dann, wenn ihnen oft ganz ähnlich wie dem ausgemünzten Kleingeld Material von geringerem Werte beigemischt werde: Wenn auch manche Wahrheit nur mit Irrtum ausgebreitet und ein richtiges Urteil oft nur Eingang finden kann, wo es an Vorurteil sich knüpft, so wird doch endlich
108
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
das Untaugliche zu Boden sinken und das Gute allein sich emporhalten. Konnte doch die Vaterlandsliebe der Deutschen sich nur an einem ungebührlichen Hasse gegen ein fremdes Volk entzünden, und lodert nicht jetzt die schöne helle Flamme gereinigt fort, nach dem der schmutzige Schwamm, der sie erzeugte, schon längst verglommen ist? (Börne 1977, Bd. I, 669) Die letzte Analogie zeigt, wie schnell Börne hier von einem Vergleich zum anderen kommt – von der Münze zum Strom zur Flamme –, und wie prekär diese Vergleiche werden können: Prekär ist schon die Münzanalogie für die Wahrheit, prekär ist die Konzentration auf das Flüchtige, Vorübergehende, sich Wandelnde im Kontrast zu den festen Barren der Wahrheit, prekär ist die Vermischung von Wahrheit und Irrtum, prekär ist schließlich der Vergleich mit dem Nationalismus, weil sich doch, während Börne das schreibt, abzeichnet, dass Chauvinismus und Franzosenhass keineswegs nur Zündmittel für das deutsche Nationalgefühl sind, sondern es dauerhaft prägen. Der Diskurs der Zeitschrift ist also riskant, weil er auf nichts Stabilem und Sicherem beruht, sondern auf dem, was Börne dann auch als »Meinung« und »öffentliche Meinung« charakterisiert. ›Meinungen‹ sind das, was der hehren Wahrheit beigefügt werden muss, damit sie lebendig wird, und zwar ganz verschiedene Meinungen, von denen keine von vornherein auszuschließen ist – »es gibt nur eine verwerfliche Meinung, die verwerfende, welche keine andere als die ihr gleichen duldet« (Börne 1977, Bd. I, 677). Deshalb könne man eine Zeitschrift auch nicht dazu verpflichten, keine Irrtümer und Lügen zu verbreiten: Es werden jetzt so schön plattierte Lügen verfertigt, daß sie von echten Nachrichten gar nicht zu unterscheiden sind. Man sei doch nachsichtlicher hierin und bedenke, daß die großen Lügen, die allgemeinen Glauben suchen oder finden, für die Zeitgeschichte nicht minder wichtiger sind als wirklich geschehenen Dinge, weil sie am deutlichsten aussprechen, was die öffentliche Meinung wünscht, hofft oder fürchtet. (Börne 1977, Bd. I, 682) Die »öffentliche Meinung« ist hier also eine Sphäre sui generis, in der die Grenze von Lüge und Wahrheit nicht einfach zu ziehen ist und sich faktisch ebenso schnell verändert wie das »Mienenspiel« der Zeit. An die Stelle der einen Wahrheit, die nur außerhalb der Wirklichkeit zu haben wäre, tritt der Streit der Meinungen, der weder zu vermeiden noch zu fürchten sei: Ich hoff mit Männern zu reden, bei denen eine kindliche Geisterscheu nie Eingang fand und welche kein Rauschen der Blätter erschreckt. Das lange Stubenleben hat die Deutschen dem öffentlichen entwöhnt, und das beständige Tragen von Schafs- oder Wolfspelzen hat Niedere und Vornehme gegen den Eindruck jedes Lüftchens empfindlich gemacht. (Börne 1977, Bd. I, 679f.)
Daniel Weidner: Telegraph der Vergangenheit, Mikroskop der Gegenwart und Fernrohr der Zukunft
Diese männliche Aufgabe, den »Meinungskampf über Angelegenheiten des bürgerlichen Lebens zu beobachten und seinen abwechselnden Erfolg zu berichten« (Börne 1977, Bd. I, 676), zieht auch eine neue Autorenrolle nach sich: nicht mehr den Dichter, sondern den »Zeitschriftsteller«, der als »Fuhrmann der Wissenschaft und der Geschichte« das tote Wissen lebendig macht: »Er reicht uns das Gefäß, das unentbehrlich ist, um an der Quelle der Wahrheit für den Durst des Augenblicks zu schöpfen.« (Börne 1977, Bd. I, 668). Er macht das Wissen genießbar und nutzbar, indem er ihm etwas Ephemeres beimengt und eben mit der Zeit schreibt, im richtigen Moment, wie Börne in einem besonders markanten Bild zum Ausdruck bringt: Oft reißt die Geschichte ein Wort stammelnd auseinander, aber es sollen die Zeitschriftsteller nicht gleich einem Echo nur die letzten Silben der Ereignisse, sondern das ganze verständliche Wort wiederholen. Die Begebenheiten, diese Früchte der Zeit, haben ihren Endpunkt der Reife, wo sie gesammelt werden müssen; doch gelingt es nicht immer, sich jener flüchtigen Minute zu bemächtigen. Daher geschieht es, daß die Zeitschriftsteller bald den Baum der Geschichte zu frühe schütteln, und ihren hungrigen Gästen unreifes Obst vorsetzen, bald es zu spät tun, wann die Früchte schon faul und ungenießbar geworden sind. (Börne 1977, Bd. I, 682) Auf der bildlichen Ebene ist der Baum der Erkenntnis hier durch den Baum der Geschichte ersetzt: Was jener an Nahrhaftigkeit zu wünschen übrig ließ, ermöglicht dieser, aber eben nur unter den Bedingungen der Zeit, des richtigen Moments: Nicht ewige Wahrheit oder auch nur dauerhafte Kost gibt der Zeitschriftsteller seinen Leser:innen, sondern immer nur die Wahrheit im Moment, die ephemere und aktuelle Wahrheit, die nur für einen Moment, in einer flüchtigen Minute zu erkennen ist. Für den Zeitschriftsteller ist Zeit kein Hindernis, das zu überwinden ist oder dem man sich allenfalls anzupassen hat, sondern Bedingung dessen, was er sagen will – die Wahrheit hat für ihn, mit Walter Benjamin gesprochen, einen »Zeitkern« (Benjamin [1983] 1989, 578). Börnes Ankündigung der Waage ist die Ankündigung einer neuen Schreibweise, die Ankündigung eines Lebensprojektes und die Ankündigung einer Modernität, die sich im Wesentlichen von der Aktualität, vom präsentischen Moment des Schreibens her versteht. In nuce konvergieren in ihr verschiedene Momente dieser Modernität: eine mediale Modernität, die mit der Zeitschrift und der Presse die Welt öffentlicher Kommunikation radikal verändert, eine politische Modernität, welche die zentrale Bedeutung der »öffentlichen Meinung« für die demokratische Gesellschaft erkennt; sowie eine ästhetische Modernität, die sich für das Flüchtige, Vorübergehende interessiert. Auffällig ist dabei insbesondere, wie diese Modernität in einer geradezu überschießenden Metaphorik zum Ausdruck gebracht wird: von Uhren ist die Rede und von Früchten, von Münzen, Trinkgefäßen und Feuer, von Bäumen, vom Blätterrauschen und von Pelzen, und immer wieder von der Zeit in ganz ver-
109
110
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
schiedenen Metaphern. Gerade das Prekäre der Modernität, so lässt sich vermuten, wird durch diese Metaphorik in Szene gesetzt und dadurch überhaupt erst darstellbar gemacht. Vor dem Hintergrund organischer und mythischer Bildlichkeit wird das erkennbar, was sich als ephemer und flüchtig, als zu schnell und vielleicht auch zu groß der Anschaulichkeit entzieht. Und es ist die Fülle und Verbindung der Bilder, ihre Katachresen und ihr Übergang in kompliziertere Settings wie die kleine allegorische Szene von den rechtzeitig zu pflückenden Früchten, die an dieser Anschaulichkeit arbeiten. Die Schreibweise der Aktualität, die dabei entsteht, bringt nicht nur eine Reihe von prägnanten Figuren der Moderne hervor, sondern reflektiert auch zentrale Paradoxien der medialen, politischen und ästhetischen Moderne. Im Folgenden sollen zuerst zwei in der Forschung breit herausgearbeitete Bedingungen von Börnes Modernität vergegenwärtigt werden: seine jüdische Herkunft sowie die Verarbeitung einer Geschichte der Revolution. Anschließend soll an zwei widerläufigen, vielfältig aufeinander bezogenen Bildbereichen gezeigt werden, wie sich in Börnes wohl wichtigsten Texten – den Schilderungen bzw. Briefen aus Paris – die erwähnten Figuren der Aktualität entfalten: am Raum der Großstadt und an der Position des Propheten.
1. Stephan Braese hat vor einigen Jahren das ambivalente Verhältnis des jungen Ludwig Börne zum Volk untersucht: Einerseits berufe sich Börne als emphatischer Republikaner immer wieder auf das ›Volk‹ und beziehe seine schriftstellerische Legitimität daraus, in dessen Namen zu sprechen. Andererseits begleite ihn ein permanenter, wachsender Zweifel am Volk wie an sich selbst: ob jenes wirklich nach Herrschaft strebe oder nicht eher nach Feindschaft – wie im obigen Zitat über das Feuer des Nationalismus – und ob ihm selbst als Juden die Zugehörigkeit zu diesem Volk überhaupt zugesprochen werde. Diese Zweifel beruhen auf den Erfahrungen der nachnapoleonischen Zeit, in welcher einerseits die Restauration feudaler Zustände – inklusive der drückenden Judengesetze – auch in der liberalen Öffentlichkeit als »Befreiung« von französischer Fremdherrschaft gefeiert wird, oder darauf, dass andererseits die gewährte Pressefreiheit zu einer Fülle antijüdischer Hetze führt. Börnes wachsender »Vorbehalt gegenüber der Erkenntnisfähigkeit des ›Volkes‹« (Braese 2018, 130) verbindet das typische Misstrauen liberaler Eliten gegen das proletarische Moment der Revolution mit der Erfahrung der jüdischen Minderheit, die sich im prekären Zwischenbereich feudalen Schutzes und liberaler Partizipationsrechte befindet – Börne wird später für diese Position die treffende Metapher des Zweifrontenkrieges entwickeln: »Während die Deutschen nur mit ihren Regierungen um die Freiheit zu kämpfen haben, müssen die Juden mit Regierungen und mit dem Volk streiten und haben zwei Feinde zu bekämpfen.« (Börne 1977, Bd. V,
Daniel Weidner: Telegraph der Vergangenheit, Mikroskop der Gegenwart und Fernrohr der Zukunft
24) In dieser Formulierung können die Juden weder von den Regierungen noch vom Volk Unterstützung erwarten; liest man sie wörtlich, legt sie sogar nahe, dass es für die Juden vielleicht am gefährlichsten wäre, wenn das Volk die Regierung bildete. Der Zweifel am Volk betrifft aber nicht nur Börnes politische Einschätzung, sondern auch sein schriftstellerisches Projekt: als Jude für Juden und Deutsche zu kämpfen. Zunehmend kommt er, in Braeses Worten, in die Lage, »für die Interessen eines Volkes zu streiten, das […] ohne seine aggressive Nachtseite nicht zu haben war« (Braese 2018, 127). Wie Braese an anderer Stelle breit entfaltet hat, ist diese Ambivalenz für viele jüdische Autor:innen deutscher Sprache charakteristisch, die den Anspruch haben, auf Deutsch für Deutsche und Juden zu sprechen, sich des prekären Charakters dieses Projektes aber ausgesprochen oder unausgesprochen bewusst sind (vgl. Braese 2010). Allerdings dürfte es nur wenige Autor:innen geben, bei denen diese Ambivalenz und auch die Spannung zwischen den Polen – dem politischen und dem schriftstellerischen Projekt – so ausgeprägt sind, wie bei Börne. Denn Börne versagt sich dezidiert die Auswege, die viele andere deutsch-jüdische Autor:innen mit mehr oder weniger Erfolg aus dem Dilemma suchten. Das gilt auf der einen Seite für das Konzept der Nation: Trotz aller Skepsis bleibt für Börne das ›Volk‹ ein dezidiert politisches Projekt – das der Selbstregierung – und wird nicht der imaginären, vorpolitisch gedachten Gemeinschaft einer ›Nation‹ untergeordnet, wie es der europäische Nationalismus des 19. Jahrhunderts entwirft. Genau deshalb versteht sich sein Schreiben auf der anderen Seite auch nicht als Teil einer Nationalliteratur, die sich aus der vergangenen nationalen Geschichte herschreibt und Zugehörigkeit über ›Kultur‹ behauptet, sondern als Zeitschriftstellerei, deren Grund in Gegenwart und Zukunft liegt. Insbesondere macht dieses Schreiben keine Kompromisse mit der Kunst. Während für andere deutsche und jüdisch-deutsche Autor:innen die Berufung auf ›Volk‹ und ›Nation‹ fast immer mit einer Berufung auf ›Dichtung‹ einhergeht, die dann ihrerseits den politischen Anspruch mindert oder umlenkt, hält Börne an seinem politischen Projekt fest und bleibt daher auch schriftstellerisch ein politischer Autor sans phrase. Das mit diesem Projekt einhergehende veränderte Zeitverständnis ist in der Forschung ebenfalls schon breit erörtert worden. Bereits in den 1980er Jahren hat Inge Rippmann gezeigt, dass Börnes Selbstcharakterisierung als Zeitschriftsteller auf der Umwertung einer abfälligen Charakterisierung Goethes beruht, der eben den ›wahren‹ Dichter von dem bloß der Aktualität verschriebenen Publizisten unterscheidet (vgl. Rippmann 1988). Rippmann zeigt weiter, dass »Zeit« für Börne ein so zentraler wie »schillernder Begriff« ist, der durch das »Nebeneinander von aufklärerisch-rationaler, ja mechanistischer und romantisch-organologischer Metaphorik« bestimmt wird (Rippmann 1988, 141, 143, 145). Besonders die Auseinandersetzung mit der nachrevolutionären Geschichtsschreibung Frankreichs habe Börne die Erkenntnis vermittelt, dass Geschichte nicht ein dauerndes Bild der
111
112
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Vergangenheit entwerfen könne, sondern immer wieder umgeschrieben werden müsse, so Börne 1823 in einer Rezension: Es ist, als fiele es den Menschen wie Schuppen von den Augen und als erführen sie erst jetzt alte Geschichten, die schon vor tausend Jahren geschahen und schon viele tausend Male erzählt worden sind. Sie demokratisieren, liberalisieren sie und haben es schon dahin gebracht […] die Römer in ihren glänzendsten Zeiten nicht zu lieben. […] Sie revolutionieren die Vergangenheit auf eine solche Art, daß sie ganz diejenigen parodieren, welche die Zukunft contre-revolutionieren wollen. (Börne 1977, Bd. II, 473f.) Eine solche permanente Revolution der Vergangenheit verlangt auch nach einer anderen Schreibweise über die Gegenwart, da die Vergangenheit schließlich in der Gegenwart fruchtbar gemacht werden muss. Dass diese Perspektive ihrerseits auch als Reaktion auf die Durchsetzung eines neuen Geschichtsdenkens in Deutschland betrachtet werden kann, hat Ingrid Oesterle ebenfalls bereits in den 1980er Jahren untersucht. Nach ihr ruft die für die Sattelzeit charakteristische »Abstraktion von den vielen Geschichten zum Kollektivsingular Geschichte«, kompensatorisch »einen gesteigerten Unmittelbarkeits- und Empiriebedarf hervor, zu dem Anschauungs- und Lokalisierungswunsch gehören« (Oesterle 1985, 14). Denn die Verzeitlichung der Geschichte und die Professionalisierung der Geschichtsschreibung um 1800 bewirken unter anderem, dass die Geschichte der jüngsten Vergangenheit, die etwa in der Historiographie der Aufklärung noch fraglos Gegenstand der professionellen Geschichtsschreibung ist, jetzt von der Wissenschaft ausgeschlossen wird (D’Aprile 2013). Geschichte wird Nacherzählung vergangener Epochen, die erst nach deren Abschluss möglich wird; demgegenüber wird das jüngst Vergangene zum Gegenstand des Journalismus. Der »Funktionsübergang von Dichtung zu Publizistik« (Preisendanz 1968, 344), der überhaupt die Vormärzliteratur prägt, hat also auch eine zeitliche Komponente: Er führt dazu, dass Börne sein Schreiben mehr an der Zeit als an der Dauer und mehr an der Gegenwart als an der Vergangenheit orientiert. Dieses Schreiben der Gegenwart vollzieht sich damit auch in einem neuen ZeitRaum, der sich von demjenigen der Nationalliteratur wesentlich unterscheidet. Er schreibt nicht mehr auf, was das Volk immer schon sang und sprach, und mehrt insofern auch nicht deren dauerhaften Besitz, so wie die Gelehrsamkeit den Goldschatz des Wissens aufhäuft, sondern setzt auf permanente Zirkulation und Präsenz, in der auch das Vergangene immer wieder ausgemünzt und getauscht wird und das Volk etwas ist, was in diesem Austausch erst entsteht. Das zeitlich Flüchtige ist immer auch das epistemisch Schwache: eben die Meinungen, deren Zirkulation den Raum der »öffentlichen Meinung« organisiert, in dem sich der »Zeitschriftsteller« situiert, wie Börne schon 1817 in einem Brief formulierte:
Daniel Weidner: Telegraph der Vergangenheit, Mikroskop der Gegenwart und Fernrohr der Zukunft
Mir hat immer geschienen, daß die Ansichten und Meinungen über die Geschichten der Menschen die eigentliche Geschichte der Menschheit bildeten. Selten ist eine Begebenheit merkwürdiger als die Verschiedenheit der Art, wie sie betrachtet wird. Darum soll eine Zeitung nicht allein die denkwürdigen Ereignisse, sondern auch die unter einander abweichenden denkwürdigen Darstellungen der Ereignisse sammeln. (Börne 1977, Bd. V, 359) Börne situiert sein Schreiben also in der »öffentlichen Meinung«, die es in Deutschland so noch gar nicht gibt und tatsächlich erst durch Zeitschriftenprojekte wie das der Waage immer wieder hervorgebracht wird. Ähnlich wie die Öffentlichkeit überhaupt, changiert auch diese öffentliche Meinung zwischen einer Realität und einer Fiktion, sie bezieht sich auf den existierenden Austausch von und über Meinungen und fordert deren Universalisierung, sie entwirft sich als etwas Zukünftiges, das aber zugleich die Hervorbringung dieser Zukunft legitimiert (vgl. klassisch Habermas 1962 und Hohendahl 2000). Wie so häufig greift Börne auch hier zu einem Bild, das diese Paradoxien prägnant zusammenfasst, wenn er 1818 in einem Aufsatz über Pressefreiheit schreibt: Die öffentliche Meinung ist ein See, der, wenn man ihn dämmt und aufhält, so lange steigt, bis er schäumend über seine Schranken stürzt, das Land überschwemmt und alles mit sich fortreißt. Wo ihm aber ein ungehinderter Lauf gegeben ist, da zerteilt er sich in tausend Bäche mannigfaltiger Rede und Schrift, die, friedlich durch das Land strömend, es bewässern und befruchten. (Börne 1977, Bd. I, 824) Flüssig und fruchtbar, segenbringend und gefährlich, natürlich und künstlich, unendlich und ungreifbar – hier wird die öffentliche Meinung selbst zu einem dynamischen, nunmehr autorlosen Medium der Wahrheit. Sie spricht nicht mehr einfach aus, was das Volk denkt, sondern erzeugt sich im Sprechen, ist also wirklich ein Medium der Aktualität. Sie birgt einige Irritationen für den common sense wie für die philosophische Tradition: In ihr begründet die Meinung die Wahrheit, obwohl diese immer jener entgegengesetzt wurde. Die Öffentlichkeit erstellt sich gerade im Austausch privater Ansichten; der Grund demokratischer Legitimität beruht nicht auf den Dingen selbst, sondern auf den Standpunkten. Börnes Schreiben ist sich dieser Paradoxien bewusst und fasst sie in Bilder, welche, so noch einmal Braese, die »konstitutiven Aporien öffentlicher Meinung und ihrer Stellung im modernen demokratischen Gemeinwesen« zum Ausdruck bringen können (Braese 2018, 127). In diesen Aporien situiert sich auch Börnes weiteres Schreiben.
113
114
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
2. Das Schreiben der Gegenwart produziert nicht nur seine eigene Metaphorik, es konstituiert auch einen bestimmten Raum, in dem so etwas wie Gegenwart erfahrbar gemacht werden kann; einen Ort des Schreibens, an dem die Flüchtigkeit und Dynamik der Moderne erscheinen kann. Dieser Ort ist für Börne verdoppelt und verschoben: Geschrieben wird woanders, nicht in der Heimat, umgeben vom ›eigenen‹ Volk, sondern in der Fremde; aber auch aus der Fremde in die Heimat: Börne findet seine Schreibsituation, Rhythmus und Schreibweise zuerst in den 1822 bis 1824 erschienenen Schilderungen aus Paris und wiederholt und elaboriert das in den 1832–1834 erschienenen Briefen aus Paris. In diesen Texten verwirklicht sich nicht nur ein Schreiben zwischen Deutschland und Frankreich, sondern auch ein Schreiben im Medium der Zeitschrift, wie es in der Ankündigung der Waage entworfen worden war. Denn Briefe sind immer im Moment und auf den Moment hin geschrieben und gelesen und können über diese Inszenierung des Momenthaften hinaus auch mit der Differenz von Schreibzeit und Lesezeit spielen (vgl. Oesterle 1985, 18f.). Der Ort, aus dem sie stammen, Paris, wird dabei in eminentem Sinne zum Zeitort: zur Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, in der gerade das, was an der Gegenwart flüchtig, vergänglich und damit auch nicht darstellbar erscheint, seine eigene Form findet. Börnes Briefe stehen dabei nicht allein, sondern im Kontext verschiedener Genres: der Parisliteratur, die in der Darstellung der Stadt bestimmte Sozialtypen, insbesondere in der Form des Porträts, entwickelt, der Korrespondentenliteratur, in der deutsche Besucher mit der Darstellung ihrer Pariser Erlebnisse nicht nur das Informationsbedürfnis der deutschen Leser:innen stillen, sondern auch die relative Modernität der französischen und deutschen Gesellschaft und deren jeweiligen Umgang mit dieser Modernität darstellen, eine Tradition, die schon im 18. Jahrhundert mit Melchior Grimms Correspondance littéraire beginnt, dann in der Geschichtsschreibung der Revolution bei Joachim Heinrich Campe, Johann Wilhelm Archenholz und Georg Forster fortgesetzt wird und in den Berichten von Friedrich Raumer, Heinrich Heine und anderen Zeitgenossen Ludwig Börnes wiederkehrt (vgl. Booß 1977; Oesterle 1985, 38–40). All diese Texte funktionieren wesentlich als Beobachtung der Öffentlichkeit – sei es der gelebten öffentlichen Existenz, sei es der öffentlichen Debatte, sei es des Kunst- und Theaterbetriebs – und zielen darauf ab, im proteushaften Wandel der Moden und Meinungen, aber auch der Lebensverhältnisse, Typisches zu erkennen: Signaturen der Zeit, also Muster im Flüchtigen oder sogar Muster des Flüchtigen. Kaum einer der Korrespondenten hat dabei so emphatisch Paris als einen Zeitraum und Zeitort entworfen wie Ludwig Börne. Und wieder sind es gerade die Metaphern, die diesen Raum aktualisieren: so etwa gleich im zweiten Stück der Schilderungen aus Paris: »Paris ist der Telegraph der Vergangenheit, das Mikroskop der Gegenwart und das Fernrohr der Zukunft. Es ist ein Register der Weltgeschichte, und
Daniel Weidner: Telegraph der Vergangenheit, Mikroskop der Gegenwart und Fernrohr der Zukunft
man braucht bloß die alphabetische Ordnung zu kennen, um alles aufzufinden.« (Börne 1977, Bd. II, 16) Paris ist eine Zeitfigur, und zwar eine zusammengesetzte – Telegraph, Mikroskop, Fernrohr – wobei schon diese Aggregierung irritiert, weil die Bilder der Zeit wiederum Raumbilder sind, die abwechselnd für Fernes, Nahes und wieder Fernes stehen. Mit dem »Register« wird hier auch schon auf eine Schreibweise verwiesen: Paris bringt nicht nur das Ferne nah und macht das Nahe sichtbar, es macht die Geschichte auch lesbar, wenn man nur die Ordnung kennt. Und auch der »Telegraph« verbildlicht eine Schreibweise, weil er ja die Ferne nicht nur sichtbar macht, sondern sie auch schreibt – etwa wenn Börne von der »langarmigen Tyrannei« (Börne 1977, Bd. II, 59) des optischen Telegraphen spricht, der die Nachrichten aus Deutschland bringen könnte, auf die Börne so vehement wartet. Telegraph, Mikroskop, Fernrohr, Register: Paris erscheint im Bild und erscheint auch wieder nicht, da das Bild so zusammengesetzt ist, dass man eigentlich gar nicht sagen kann, was die Stadt ist. Paris sei, so heißt es im selben Stück, immer in Bewegung: »nicht einem Strome, einem Wasserfalle gleicht hier das Leben; es fließt nicht, es stürzt mit betäubendem Geräusch« (Börne 1977, Bd. II, 15). Dieses Bild ist ambivalent, spricht es doch nicht nur von Geschwindigkeit, sondern auch von Betäubung – vielleicht sogar von Gefahr – gegenüber der sich der Autor behaupten muss. Von Börne ist bekannt, dass er bei seinem ersten Aufenthalt zunächst gar nicht schreiben kann, und noch die Briefe aus Paris von 1831 beginnen unter anderem mit diesem Zweifel: »Schreiben, Schriftstellern, Gedanken bauen, wie wäre mir das möglich. Der Boden wankt unter meinen Füßen, es schwindelt um mich her.« (Börne 1977, Bd. III, 31) Das Schreiben der Aktualität hat keinen Boden und keinen stabilen Ort; insofern lässt sich die Briefform auch als Behelf eines instabilen, beweglichen Schreibens betrachten, das immer zwischen den Orten bleibt. Dabei ist nicht nur die Gegenwärtigkeit, sondern auch die Adressiertheit des Briefes zentral, mit anderen Worten die Distanz, die er überwindet. Denn der Strom des Lebens kann sichtbar gemacht werden, indem er in Bilder für Abwesende transformiert wird, und zwar zunächst schlicht durch Vergleiche. Gerade die Schilderungen aus Paris beginnen zunächst mit breit ausgeführten Vergleichen der Franzosen mit den Deutschen: Die Deutschen sind Protestanten, die Franzosen Katholiken, die französische Sprache ist wie Silber, die deutschen Worte wie Gold- oder Kupfermünzen – hier wieder die Münzanalogie – oder später: die Deutschen sind Essig, die anderen sind Öl: Genießbar sind sie nur zusammen. Sowohl die Überwältigung durch die Stadt als auch die eigene Fremdheit können bewältigt werden, indem sie in Beziehung gesetzt werden, und zwar weniger mit dem eigenen Maßstab als mit dem seiner Leser:innen: Der Zeitschriftsteller schreibt im jeweiligen Jetzt für einen Anderen, Abwesenden, im Wissen, dass sein Urteil immer unterwegs und bald schon überholt ist. Daher sind seine Vergleiche auch nie starr, sondern bleiben beweglich – spätestens dann, wenn Börne betont, dass ihm hier vieles vertrauter ist als zu Hause.
115
116
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
In diese Bewegung wird letztlich auch das schreibende Subjekt einbezogen, das sich in Bewegung setzen muss, gewissermaßen selbst zum Strom werden muss, um Paris gerecht zu werden. Börne fasst diese Vorform der flânerie bezeichnenderweise in eine Buchallegorie: »Ein aufgeschlagenes Buch ist Paris zu nennen, durch seine Straßen wandern heißt lesen. In diesem lehrreichen und ergötzlichen Werke, mit naturtreuen Abbildungen so reichlich ausgestattet, blättere ich täglich einige Stunden lang.« (Börner 1977, Bd. II, 34, Herv. i. O.) Das wandernde Subjekt ist nicht schlicht Beobachter, sondern Leser – umgekehrt wandert der Leser bzw. die Leserin seiner Briefe mit ihm durch die Stadt. Deshalb wird die Idee des lesbaren Paris auch stets von Bildern eines lesenden Paris begleitet, in denen Börne besonders das Zeitungswesen hervorhebt. Begeistert und detailliert beschreibt er die Organisation der Lesekabinette und die zahllosen Zeitschriften und Zeitungen, aus denen er – das wird selten verschwiegen – auch den größten Teil der Ereignisse hat, über die er in seinen Schilderungen und Briefen berichtet. Immer wieder ist auch davon die Rede, wie er aus den französischen Zeitungen etwas über die Ereignisse in Deutschland zu erfahren sucht. Das Zeitungslesen wird dabei selbst zu einer Signatur der Moderne, die Börne in einer Allegorie der Moderne entwickelt, die man Freuds Bild vom untergangenen Rom zur Seite stellen könnte: Wenn einst Paris auf gleiche Weise unterginge, wie Herkulanum [sic!] und Pompeji untergegangen, und man deckte den Palais Royal und die Menschen darin auf, und fände sie in derselben Stellung, worin sie der Tod überrascht – die Papierblätter in den Händen wären zerstäubt – würden die Altertumsforscher sich die Köpfe zerbrechen, was alle diese Menschen eigentlich gemacht hatten, als die Lava über sie kam. Kein Markt, kein Theater war da, das zeigt die Örtlichkeit. Kein sonstiges Schauspiel hatte die Aufmerksamkeit angezogen, denn die Köpfe sind nach verschiedenen Seiten gerichtet, und der Blick war zur Erde gesenkt. Was haben sie denn getan? wird man fragen, und keiner wird darauf antworten: sie haben Zeitungen gelesen. (Börne 1977, Bd. II, 48f.) Zeitungen sind gerade deshalb, weil ihr Papier gewissermaßen immer schon zerstäubt ist, weil es den Tag nicht überdauert, Ausdruck einer neuen Erfahrung von Modernität als Vermischung von Wandel und Ewigkeit, die nun selbst wieder ein eigenes Bild dessen generiert, was der Zeitschriftsteller tut: die einzelnen vorübergehenden Posen der Lektüre und der jeweiligen Meinungen festzuhalten. Die Lektüre der Stadt verlängert sich aber nicht nur in eine imaginierte Zukunft hinein, wichtiger ist die Vergangenheit. Was Paris auch für die anderen Korrespondenten so attraktiv macht, ist nicht nur die in Deutschland unbekannte Urbanität und Medienlandschaft, es ist auch die Geschichte, vor allem die Geschichte der Revolution, und zwar ganz besonders seit der Julirevolution von 1830, die sich ja selbst als Wiederholung der Revolution von 1789 inszenierte. Wenn irgendwo die Geschichte des jüngst Vergangenen zu betrachten und zu verstehen ist, dann hier,
Daniel Weidner: Telegraph der Vergangenheit, Mikroskop der Gegenwart und Fernrohr der Zukunft
wenn sich irgendwo eine Tradition der Revolution bildet, dann hier. Bewusst reist Börne 1831 nach Paris, um dort die Spuren dieser Revolution von 1830, aber auch der Revolution, die sich beständig wiederholt, zu finden, so dass ihm der Platz der Tuilerien zur »Landstraße der Zeit« und zum »Markt der Geschichte« wird, »wo die Wege der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sich kreuzen« (Börne 1977, Bd. III, 29). Nicht immer gelingt das: Am Anfang der Briefe aus Paris überwiegt eher die Enttäuschung: Von der Revolution, die gerade stattgefunden hat, ist fast nichts mehr zu sehen, von seinen deutschen Bekannten war niemand »auf dem Kampfplatze«: »nicht einer hat mitgefochten« (Börne 1977, Bd. III, 23). Selbst die Geister der Vergangenheit erweisen sich daher oft als prekär und flüchtig: »Für Ossians Aberglauben hätte ich in dieser Stunde meine ganze Philosophie gegeben. Wie hätte es mich getröstet, wie hätte ich mich versöhnt mit dem zürnenden Himmel, hätte ich glauben können um stille Mitternacht schreitet der Geist der gefallenen Helden über die Kettenbrücke« (Börne 1977, Bd. III, 35). Aber die Geister, die sich hier nicht ohne Weiteres zeigen, sind ansonsten durchaus präsent, etwa im Theater, in dem die Pariser immer wieder ihre Vergangenheit durchspielen und das auch für Börne wichtig ist, bezeichnet er es doch als ideale »Fremdenschule«: »Alte und neue Geschichte, Örtlichkeiten, Statistik, Sitten und Gebräuche von Paris werden da gut gelehrt« (Börne 1977, Bd. III, 257). Und so wie die Franzosen in der Geschichtsschreibung ihre Vergangenheit revolutionieren, so tun sie das auch auf der Bühne: Über die Besucher:innen eines Revolutionspanoramas schreibt Börne einmal, sie seien »zugleich Helden und Schauspieler« (Börne 1977, Bd. III, 152) und für sie sei das Theater »ein Zeiger ihrer Geschichte«: »er rückt von Erinnerung zu Erinnerung« vor (Börne 1977, Bd. III, 41) und gestaltet damit diejenige Zeit, die auch dem Zeitschriftsteller den Takt vorgibt (vgl. auch Gelber 2003). Der »Markt der Geschichte« verweist aber nicht nur auf die Agora, auf der sich die Gemeinschaft sammelt, er steht auch für den Markt der kapitalistischen Warenwelt. Die Schilderungen aus Paris schließen daher mit einer längeren Beschreibung der Pariser Industrieausstellung, die Börne explizit als den neuen Ort der Öffentlichkeit imaginiert, weil »in den Spielen der Völker sich immer der Ernst ihres Lebens verrate«: Die Griechen hätten die Olympischen Spiele gehabt, die Römer ihre Gladiatoren, das Mittelalter Ritterspiele, die Venezianer den Karneval – und die Gegenwart komme auf den »Wettkämpfen des Gewerbefleißes« (Börne 1977, Bd. II, 132) zu sich, zu denen das Volk in den Louvre strömt und somit wenigstens aus der alten monarchischen Stätte eine des Volkes macht. Börne betont dabei, dass eine »gründliche nationalökonomische Darstellung« seine Leser:innen nur langweilen würde und er daher von Dingen spreche, »weil sie glänzen, weil sie schön sind« (Börne 1977, Bd. II, 140f.): Es geht um Mode, Möbel, Genussmittel, um Gaslicht und allerhand weitere Produkte des Warenkapitalismus. Besonders interessiert sich Börne dabei für die Druckkunst, »die späteste unter den Künsten, erfunden, damit sie alle verteilten Bildungen der anderen versammle und für sich allein darstelle«, sie glei-
117
118
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
che darin der »Posaune des Weltgerichts, welche verborgene Frevel und Tugenden bekannt macht und die Schlechten wie die Guten vorladet, Rechenschaft zu geben oder ihren Lohn zu empfangen« (Börne 1977, Bd. II, 146). Aber auch hiervon geht es rasch weiter zu der anderen ungeheuren Fülle der Welt, zu der unendlichen Verschiedenheit der Produkte, die nun allerdings durch die Angleichung der Maßeinheiten immer leichter gegeneinander zu tauschen seien. Es sei, so entwickelt Börne am Schluss dieses Textes, ähnlich wie mit der Polizei, die jedem einzelnen einen Pass ausstelle, in dem seine Größe notiert werde: Gleich der pythagoräischen Schule bringt sie [die Polizei] alle Verhältnisse in Größen und Zahlen. Personen und Völker werden mit ihren Tugenden und Mängeln mit ihrem Werte und ihrem Preis addiert, nummeriert, subtrahiert, dividiert, einregistriert, protokolliert, inventiert – als wäre der Herr der Erde gestorben und die hinterlassene Menschheit sollte versteigert werden! (Börne 1977, Bd. II, 190) Paris als Hauptstadt des 19. Jahrhunderts ist hier Symbol und Medium einer zwiespältigen Moderne, in der das Politische – die Versammlung auf dem Markt und die Erzeugung der öffentlichen Meinung – immer mit der Registrierung und Vertextung verbunden ist, die der entstehende Warenkapitalismus hervorbringt. Die Menschheit kommt zu sich selbst und wird doch gleichzeitig schon auf die eigene Versteigerung vorbereitet.
3. So wie die Ankündigung der Waage zwischen verschiedenen metaphorischen Registern changierte, so vermischen auch Börnes Schilderungen bzw. Briefe aus Paris konstant verschiedene Bildfelder: politische, ästhetische, sensuelle – und auffällig oft auch religiöse, etwa wenn die Druckkunst zur Posaune des Jüngsten Gerichts wird und das Passwesen so etwas wie das Buch des Lebens fortschreibt. Die Präsenz dieser religiösen Bildlichkeit ist bekanntlich generell charakteristisch für die VormärzAutoren und ihre Kritik, die noch wesentlich Religionskritik ist und von dem zehrt, was sie kritisiert. Solange die Kritik sich noch nicht als wissenschaftlich oder dezidiert politisch versteht, solange hinter ihr nicht die marxistische Theorie oder eine Massenbewegung steht, ist sie mit denselben Problemen des Verhältnisses zur Gegenwart und zur Meinung konfrontiert, das auch schon den Zeitschriftsteller betraf: dass die Position des Schreibens zu allererst eingerichtet werden muss. Als Kritiker und als aktueller Schriftsteller verzichtet Börne dabei entschieden auf einen anderen Ausweg, den das 19. Jahrhundert Schriftsteller:innen anbietet: den des Werkes. Immer wieder betont Börne, er verfasse nur Schriften und keine Werke, immer wieder wendet er sich auch vom Paradigma der Werkproduktion – Goethe – ab: »Seit ich fühle, habe ich Goethe gehaßt, seit ich denke, weiß ich warum« (Börne 1977 Bd.
Daniel Weidner: Telegraph der Vergangenheit, Mikroskop der Gegenwart und Fernrohr der Zukunft
III, 71). Während etwa Heine sein Schreiben bewusst und konsequent in ein Ambivalenzverhältnis zu Goethe stellt und geradezu eine Komödie der Einflussangst inszeniert, positioniert sich Börne, nicht weniger bewusst, entschlossen außerhalb der deutschen Literaturgeschichte. Diese andere Haltung zur Zeit, zur Geschichte und zur Aktualität verkörpert sich in der Figur des Propheten, die eine der Rollen ist, in denen Börne sein Schreiben fasst. Auch diese Figur ist im Vormärz geradezu ubiquitär, man denke etwa an Bruno Bauers Glorifizierung der absoluten Kritik oder die Rekurse von Büchner, Heine oder Marx und Engels auf die Prophetie (vgl. Weidner 2008; Briegleb 1986, 127–129). Bei Börne taucht sie etwa an Neujahr 1831 auf: »Dieses Jahr ist mit Zähnen auf die Welt gekommen und will sich nicht wickeln lassen. Es wird mit Blut getauft werden. […] Ich spreche wie ein Prophet.« (Börne 1977, Bd. III, 106). Das hat nicht nur den trivialen Sinn der Vorhersage, sondern bezieht sich auch anspruchsvoll auf denjenigen, der in einem anderen Namen spricht, ja der eine Botschaft überbringt, die nicht leicht gehört werden wird. Es ist eine starke und gefährliche Rede, so führt Börne wenig später aus: Welche Rede wäre stark genug, diese wildgärende Zeit zu halten? Man müßte einen eisernen Reifen um jedes Wort legen und dazu gehört ein eisernes Herz. […] Was kann der Deutsche anders sein als Prophet? Wir sind keine Geschichtsschreiber, sondern Geschichtstreiber. Die Zeit läuft wie ein Reh vor uns her, wir, die Hunde, hintendrein. Sie wird noch lange laufen, ehe wir sie einholen, es wird noch lange dauern, bis wir Geschichtsschreiber werden. (Börne 1977, Bd. III, 156) Wie die Waage nicht nur Anzeiger, sondern Triebwerk der Gegenwart sein wollte, so geht es auch hier darum, die Geschichte nicht einfach aufzuschreiben, sondern sie gewissermaßen zur Strecke zu bringen: sie auf den Punkt der Krise hin zuzuspitzen. Zeitlich gesehen ist Prophetie ganz Aktualisierung, weil sie an ein Jetzt gebunden ist. Nicht die Vorhersage ist für sie entscheidend, sondern dass sie das Vorhergesagte aus der Geschichte ableitet, dass es die Geschichte auf jenen Punkt der zukünftigen Krise hin entwirft oder eben ›treibt‹, in dem sich Gegenwart und Geschichte treffen werden: auf den eigentlich revolutionären Moment hin. Prophetie ist daher immer auch eine Neuinterpretation der Geschichte – und zwar konkreter: der politisch-theologischen Geschichte. Denn die religiöse Rhetorik der Vormärz-Autoren rührt nicht zuletzt daher, dass diese die Revolution in einen größeren Zusammenhang stellen, den sie zwischen der religiösen Vergangenheit, der literarischen Gegenwart und der politischen Zukunft herstellen, indem sie wie schon Hegel die Revolution und die Reformation aufeinander beziehen. Paradigmatisch entwirft Heine diesen Zusammenhang 1834 in Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, wo Luthers spirituelle und Kants gedankliche Befreiung Deutschlands zugleich als Gegenstück zur Französischen Revolution und als Präfiguration der jetzt ausstehenden politischen Befreiung fungieren. Börne selbst ent-
119
120
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
wickelt niemals eine solche ausgeführte Geschichte, betrachtet aber schon vor Heine die Reformation deutlich kritischer, etwa in den Briefen aus Paris: Ach Luther! – wie unglücklich hat der uns gemacht! Er nahm uns das Herz und gab uns Logik; er nahm uns den Glauben und gab uns das Wissen; er lehrte uns rechnen und nahm uns den Mut, der nicht zählt. Er hat uns die Freiheit dreihundert Jahre ehe sie fällig war ausbezahlt und der spitzbübische Diskonto verzehrte fast das ganze Kapital. (Börne 1977, Bd. III, 175). Luther ist also nicht einfach Vorgänger, sondern ein verfrühter Vorläufer; spirituelle Freiheit bereitet die politische nicht vor, sondern wird geradezu ihr Ersatz, der das Streben nach politischer Freiheit schließlich unmöglich macht, weil es eben nur geglaubte Freiheit, in Börnes Metapher: Freiheit auf Kredit ist. In Börnes späterer Auseinandersetzung mit Menzel, die wohl auch schon auf Heines inzwischen publiziertes Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland antwortet, wird Börne noch deutlicher: Die Reformation war die Schwindsucht, an der die deutsche Freiheit starb und Luther war ihr Totengräber. Pfaffentrug hatte den alten guten Glauben mit Aberglauben verfälscht, so daß er gesunden Herzen nicht mehr munden konnte. Da kam Luther, der sich wie alle deutsche Gelehrte auf einen reinen Wein verstand, ließ das Faß auslaufen und bot dem Volke für den verdorbenen Wein des Glaubens das reine Wasser der Philosophie an. Was wurde dabei gewonnen? Der Westfälische Friede ist da mit seiner Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Reformation. Einige tausend Denker erwarben sich Gedankenfreiheit, und das ganze Land verlor seine Lebensfreiheit. An einem Wahn wurde das Volk ärmer, und an tausend Narrheiten, welche die deutschen Theologen und Philosophen ersonnen, wurde das Land reicher. (Börne 1977, Bd. III, 924f.) Luther hat den Glauben nicht befreit, sondern nur gereinigt, damit aber auch ernüchtert und entleert; ihm ist, so Börne, die vergeistigte Neigung der Deutschen zu verdanken. Indem Luther aus der Theologie eine Wissenschaft gemacht habe und den Deutschen Dienstbeflissenheit eingeimpft habe, habe er das Volk in den Schlaf gewiegt, den es immer noch schläft – und aus dem der prophetische Schriftsteller es »aufwecken« will wie die »Fliegen, die ihm um die Ohren summen und im Gesichte herumkitzeln« (Börne 1977, Bd. III, 933). Die Reformation hat die Deutschen zum Glaubensvolk gemacht, sie aber auch aus der Welt vertrieben – nicht unähnlich wie die Juden, wie Börne jetzt vergleicht: Sind sie [die Deutschen] nicht jetzt meine Glaubensgenossen und Leidensbrüder? Ist nicht Deutschland der Ghetto Europas? Tragen nicht alle Deutschen einen gelben Lappen am Hut? Könnte ich zumal gegen meine Vaterstadt noch den kleinsten Groll haben? Sind nicht die Frankfurter, meine ehemaligen Herren, den Juden
Daniel Weidner: Telegraph der Vergangenheit, Mikroskop der Gegenwart und Fernrohr der Zukunft
von früher gleich? Sind nicht die Österreicher und Preußen ihre Christen?« (Börne 1977, Bd. III, 889) Die Frankfurter als Juden – mit dieser Wendung pariert Börne nicht nur Menzels Unterstellung, er würde als Jude und als französisch schreibender Schriftsteller die Deutschen hassen. Er schreibt auch die politisch-theologische Geschichte fort und gibt ihr eine neue Wendung, indem er wieder auf das Verhältnis zwischen geistiger Freiheit und politischer Unterdrückung hinweist, sich nun aber selbst in dieses Bild miteinbezieht. Auch das ist im Übrigen ein sowohl politischer wie prophetischer Gestus: sich mit dem Volk solidarisch zu machen, zu dem man spricht, ihm aber zugleich das Selbstbewusstsein nehmen, auserwählt oder geistig überlegen zu sein. Politische Theologie und literarische Prophetie verbindet Börne auch noch auf andere Weise: als Übersetzer Félicité de Lamennais’ Paroles d’un croyant, eines zentralen Textes des sozialrevolutionären Christentums, den Börne 1834 ins Deutsche überträgt und dem er als Werbung einen Rettung betitelten Text vorausschickt. Dieser verkörpert nicht nur den prophetischen Gestus noch einmal in seiner ganzen Wucht, sondern setzt auch mit einer der wohl großartigsten Buch-Allegorien in Börnes Werk ein. Er erzählt, wie er einst unter einem Baum gesessen habe und ein Buch aufschnitt: So sitzt der Mensch auf der Erde mit dem Buche des Schicksals in den Händen, das am ersten Tag der Schöpfung schon geschrieben war. Und der Mensch trennt dessen zusammengefalteten [sic!] Blätter und liest darin, und jede Seite ist ihm ein Jahr, jeder Band ein Jahrhundert, und was er gelesen, ist seine Vergangenheit, was noch nicht, seine Zukunft. Und lesen nennt er leben, und das Buch glaubt er selbst geschrieben, die Geschichte darin selbst getan zu haben; und er ist stolz und dünkt sich groß und dünkt sich weise, weil er – lesen gelernt. Es wäre kindisch; aber ach! Das Blut ist mit Blut geschrieben, und das Schneidemesser ein Schwert, und der Mensch ist ein Teufel. (Börne 1977, Bd. II, 850) Dieses Buch, das Buch des eigenen Schicksals, das man Tag für Tag liest – das Buch des Zeitschriftstellers, ist man versucht zu sagen, tröstet nicht, es weckt die Frage, wie lang dieser Winter noch dauern wird und wann der Frühling kommt – ein Motiv, das aus dem Buch Jesaja (Jes 21,11f.) genommen ist. Rettung kommt aus einem anderen Buch, eben aus den Paroles d’un Croyant: Wahrlich dies Buch ist ein goldener Schlüssel, der tausend stillstehende Herzen in Bewegung setzt, tausend abgelaufenen Geistern wieder Leben geben wird. […] Und das kalte, bleiche, tote Wissen der Schriftgelehrten wird sich aus seinem Buchsarge erheben und, von der Liebe angehaucht, zu Fleisch und Blut werden, und lebend unter Lebendigen umherwandeln und nicht länger als ein Gespenst die Unwissenheit und den Aberglauben erschrecken. (Börne 1977, Bd. II, 852)
121
122
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Wie schon in der Ankündigung der Waage wird das Wissen lebendig, das Tote verwandelt sich in Leben – ein weiteres Motiv aus der prophetischen Tradition, insbesondere aus dem 37. Kapitel des Buches Hesekiel –, und die Gespenster verschwinden. Freilich geschieht das nicht unmittelbar und nicht sofort, denn das Buch wird zunächst nicht verstanden werden, die Herrschenden werden es unterdrücken, die Gebildeten werden es verachten, weil es Religion enthalte: Nach einiger Zeit wird man nicht mehr von dem Buche sprechen und es vergessen. Und jetzt beginnt seine Wirkung. Es wird in das Volk dringen, sich unter dem Volke verbreiten, von Hütte zu Hütte, von Hand zu Hand. Und sein Wort wird von Mund zu Mund, seine Lehren von Ohr zu Ohr, sein Licht von Aug zu Auge wandern. (Börne 1977, Bd. II, 853) Die Botschaft, die nicht gehört, sondern vergessen und sogar zerstört wird – auch das ist ein typisch prophetisches Motiv. Es findet sich etwa in der Berufung Jesajas: »Geh hin und sprich zu diesem Volk: Hören, ja, hören sollt ihr und nicht verstehen! Sehen, ja, sehen sollt ihr und nicht erkennen!« (Jes 6,9) oder in der Verbrennung der Prophetenrolle Jeremias’ (Jer 36). Insbesondere greift die Rede vom Buch, das zunächst vergessen, dann aber wiedergefunden wird, die Geschichte des Deuteronomiums auf, das an seinem Schluss explizit sein zukünftiges Vergessen vorwegnimmt (Deu 31) und in der biblischen Erzählung dann auch erst viel später vom König Josia wiederentdeckt wird (2 Könige 22). Und wenn Börne die unterirdische Wirkung und die schließliche Enthüllung von Lamennais’ Buch beschreibt, wird seine Beschreibung immer emphatischer und gleicht sich auch stilistisch ganz diesem Buch an, das selbst wiederum dezidiert biblisch die große Verbindung und die allgemeine Freiheit evoziert: Und Millionen werden erstaunen, daß sie erst jetzt bedenken, was sie schon längst gewußt. Und dann wird sich ein Herz an das andere, eine Hand an die andere ketten. Und die Kette wird immer länger und länger werden, bis das Volk seinen Riesenkreis geschlossen und ihr umringt seid. Dann rettet nichts mehr das Tier, das von Fleisch und Blut lebt, und die Welt ist frei. (Börne 1977, Bd. II, 854) So entwirft das Buch einen zukünftigen Moment, in dem das Buch gefunden und wiedererkannt wird und damit auch das Volk zu sich kommt, ja sich eigentlich erst bildet als eine unendliche Kette, die wohl auch für die Kette der Tradition steht und schließlich den Feind, das mythische ›große Tier‹ aus der Offenbarung des Johannes (Offb 13) zu Fall bringt – nicht ohne Ironie endet dieser Text Rettung mit dem, was nicht gerettet wird. Gerettet werden die Freiheit, das Volk und auch das Buch als solches, in dem der Autor am Anfang des Textes las, also auch die Lesbarkeit der Geschichte und die Veränderbarkeit der Welt. Und auch diese Rettung vollzieht sich in einem politisch-theologischen Rahmen, in den sowohl die eher jüdische Vorstellung einer Kette der Generationen als auch die eher christliche einer Liebesgemeinschaft
Daniel Weidner: Telegraph der Vergangenheit, Mikroskop der Gegenwart und Fernrohr der Zukunft
eingehen und in dem sie aktualisiert werden. In der Rettung wird das sichtbar und erkennbar, was lange unlesbar, verborgen und verachtet war: Sie schließt insofern eine Geschichte ab, als sie nicht nur deren Zusammenhang, sondern auch ihr Publikum, das Volk, wiederherstellt.
4. Börnes Projekt eines aktuellen Schreibens als Zeitschriftsteller erweist sich als komplexe Aufgabe. Zum Teil beruht sie auf einem Verzicht: auf der Abwendung vom ›Werk‹ und von der ›Nation‹, durch die Börne an seinem politischen Projekt festhalten kann – zwar bleibt das ›Volk‹ weiterhin Adressat und Grund seines Schreibens, aber ein Volk, das es so noch nicht gibt, das erst geweckt und aktualisiert, gewissermaßen visionär erzeugt werden muss. Zum anderen Teil korrespondiert diesem Verzicht ein imaginativer Aufwand eben jener Erweckung – wie groß er ist, macht der Text über Rettung deutlich, der nicht weniger als einen welt- und heilsgeschichtlichen Umweg nehmen muss, um das Buch des Lebens überhaupt wieder lesbar zu machen. Auch die öffentliche Meinung als Medium des Zeitschriftstellers ist alles andere als selbstverständlich, und auch das drückt sich in dem Umweg aus, den Börnes Schreiben nimmt: in den vielen Bildern, die es entwirft – vom See, von Münzgeld, vom Feuer, den Uhren usw. – und immer wieder überholt und variiert. Notwendig sind diese Bilder gerade, weil Börnes Schreiben um den prekären und gefährlichen Charakter dieser öffentlichen Meinung weiß, die keineswegs immun gegen Irrtum oder gegen Ausschluss ist, ja gerade ihn als Juden immer auszuschließen droht. Auf den problematischen Charakter der Öffentlichkeit antwortet Börne zum einen mit der Beweglichkeit seines Schreibens, dessen Figuren sich beständig wandeln, das sich selbst entortet bzw. an einen anderen Ort versetzt, sich dort als beweglich imaginiert und dem Wasserfall der Modernität hingibt, der eben ganz der ungreifbar schillernden, sich ständig ändernden öffentlichen Meinung entspricht. Zum anderen entwirft er in denselben Imaginationen komplementär einen Gegenraum, eine andere Welt, sei es eben im Stadtraum, sei es in der politisch-theologischen Erzählung, sei es im Rückgriff auf die biblische Tradition in der Figur der Prophetie. Gerade dieser Rückgriff macht noch einmal den prekären Charakter von Börnes Projekt aus, steht doch der Prophet in der biblischen Tradition für jenen Fall extremen Sprechens der Wahrheit, das um sein eigenes Nicht-Gehört-Werden weiß – und trotzdem spricht. Börnes Bilder sind meist witzig, vielfältig, oft extrem, mitunter verstörend: Paris als Telegraph zu beschreiben erscheint verspielt und leicht beliebig, die öffentliche Meinung als See, der Segen und Gefahr bringt, schon fast als gesucht. Tatsächlich ist für uns das Irritierende, auch Provokante dieser Bilder, wie auch der gesamten Schreibweise, nicht mehr leicht nachvollziehbar, insbesondere nicht der Ernst,
123
124
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
der dabei auch im Witz auf dem Spiel steht. Denn für uns Moderne scheint Öffentlichkeit selbstverständlich und Literatur selbstverständlich eine öffentliche Angelegenheit. Doch ist das wirklich so? Ist Öffentlichkeit nicht gerade so lange selbstverständlich, wie man nicht über sie nachdenkt? Und hat sich die akademische Literaturwissenschaft nicht von der Frage der Öffentlichkeit dezidiert abgewandt, insofern sie Literatur weiterhin vor allem als Nationalliteratur behandelt und der Gegenwartsliteratur allenfalls beiläufige Aufmerksamkeit schenkt? Heute, angesichts einer breiten Diskussion über die Krise der Öffentlichkeit, wird Börnes Schreibweise wieder aktuell und bedarf einer Neulektüre.
Literatur Benjamin, Walter. Gesammelte Schriften. Bd. 5: Das Passagen Werk [1983]. Hg. v. Rolf Tiedemann. Frankfurt a.M. 1989. Börne, Ludwig. Sämtliche Schriften in 5 Bden. Hg. v. Inge Rippmann/Peter Rippmann. Dreieich 1977. Booß, Rutger. Ansichten der Revolution. Paris-Berichte deutscher Schriftsteller nach der JuliRevolution 1830. Köln 1977. Braese, Stephan. »Ludwig Börne und das ›Volk‹. Die Anfänge seiner Publizistik zwischen politischer Kategorie und subjektgeschichtlicher Erfahrung«. In: HeineJahrbuch (2018), 126–151. Braese, Stephan. Eine europäische Sprache. Deutsche Sprachkultur von Juden 1760–1930. Göttingen 2010. Briegleb, Klaus. Opfer Heine? Berlin 1986, 127–129. D’Aprile, Iwan-Michelangelo. Die Erfindung der Zeitgeschichte. Geschichtsschreibung und Journalismus zwischen Aufklärung und Vormärz. Berlin 2013. Gelber, Mark H. »Ludwig Börnes Theaterkritik und der Antisemitismus: Seine Besprechungen K. B. A. Sessas und Shakespeares«. In: Ludwig Börne. Deutscher, Jude, Demokrat. Hg. v. Frank Stern/Maria Gierlinger. Berlin 2003, 159–171. Habermas, Jürgen. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Frankfurt a.M. 1962. Hohendahl, Peter Uwe (Hg.). Öffentlichkeit. Geschichte eines kritischen Begriffs. Stuttgart/Weimar 2000. Oesterle, Ingrid. »Der ›Führungswechsel der Zeithorizonte‹ in der deutschen Literatur«. In: Studien zur Ästhetik und Literaturgeschichte der Kunstperiode. Hg. v. Dirk Grathoff. Frankfurt a.M. 1985, 11–17. Preisendanz, Wolfgang. »Der Funktionsübergang von Dichtung und Publizistik bei Heine«. In: Die nicht mehr schönen Künste. Grenzphänomene des Ästhetischen. München 1968, 344–374.
Daniel Weidner: Telegraph der Vergangenheit, Mikroskop der Gegenwart und Fernrohr der Zukunft
Rippmann, Inge. »›Die Zeit läuft wie ein Reh vor uns her‹. Der Zeitschriftsteller als Geschichtsschreiber«. In: »Die Kunst – eine Tochter der Zeit«. Neue Studien zu Ludwig Börne. Hg. v. dems./Wolfgang Labuhn. Bielefeld 1988, 130–169. Weidner, Daniel. »Parodie und Prophetie. ›Literarische Säkularisierung‹ in Heines biblischer Schreibweise 1844«. In: Zeitschrift für Germanistik N. F. 18.3 (2008), 546–557.
125
Gegenwartsarbeit im Material. Kracauers materiale Soziologie und die Politik der kleinen Form Yashar Mohagheghi
1. Einleitung Siegfried Kracauer ist ein bedeutender Vertreter der Kultursoziologie. Soziologen wie Georg Simmel, dessen Bekanntschaft während des Studiums Kracauer nachhaltig prägte, erproben die Anwendung der Soziologie auf die vielfältigsten Bereiche der Kultur und die unscheinbarsten Dinge des alltäglichen Lebens. Dass damit ein Legitimationsdruck für die soziologische Methode verbunden ist, zeigt sich bei Autoren wie Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Ernst Bloch und anderen auch in der Erprobung neuer Schreibweisen. Die Erkundung des Kleinen geht bei ihnen auch mit neuen, essayistischen Formen einher, die durch ihren Ausschnittcharakter oder einen hybriden Sprachgestus zwischen analytischer und poetischer Diktion gekennzeichnet sind. Für Kracauer ist, schon von Berufs wegen, die kleine Form im journalistischen Kontext von Bedeutung. In seinen Miniaturen vermittelt er fragmentarische Einblicke in die heterogene Lebenswelt der Moderne. Da Ideologien und Herrschaftsstrukturen sich, so die Annahme, auf der Ebene alltäglicher Einrichtungen und habitualisierter Wahrnehmungsmuster bewegen und nur in ihnen sichtbar gemacht werden können, müsse politische Gegenwartsarbeit bzw. -kritik sich in der Analyse solcher ›Mikrodispositive‹ der Macht bewähren, wozu kleine Formen besonders geeignet seien. Doch im Unterschied zum ›rasenden Reporter‹ sind damit keine wirklichkeitsgetreuen Aufnahmen des gesellschaftlichen Lebens gefordert. Vielmehr verwahrt sich Kracauer gegen eine Wirklichkeitsvermittlung, die wie die Reportage bloße Reproduktion sei. Den partikulären Erscheinungen gesteht er epistemischen Wert zu, doch nur, weil sie allgemeine Strukturen widerspiegeln. So muss die einzelne physiognomische Beschreibung immer auch Gesellschafstheorie sein. Die kleinen Formen verkörpern dabei Kracauers materialsoziologischen Ansatz. Nur aus der Begegnung mit den konkreten Erscheinungen erwächst Einsicht in gesellschaftliche Funktionsweisen. Dieser methodische Grundsatz beruht auf
128
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
der Disposition der Wahrnehmungs- und Denkmuster im Kontext der modernen Massenmedien. Wie auch Benjamin sieht Kracauer die Ausbildung von Denkmustern durch die allmähliche, unterschwellige Wirkung unscheinbarer Codes und Wahrnehmungsgewohnheiten bestimmt – insbesondere im Rahmen der Massenmedien. Ideologische Strukturen verfestigen sich demnach nicht primär durch inhaltliche Vermittlung von Ideologemen, sondern über die konkreten Erscheinungen, die im alltäglichen Leben begegnen. In ihnen sind daher die soziologischen Strukturen aufzuweisen. Die Arbeit des politischen Schriftstellers besteht insofern nicht mehr im Kundtun von Meinungen. Vielmehr muss das Schreiben die materiellen Formen, die als Partikularitäten im alltäglichen Leben begegnen, sichtbar machen. Hier liegt die Begründung der physiognomischen Miniaturen, deren konkretistische Schreibweise auf der Schwelle zwischen physiognomischer Deskription und Propositionalität verbleibt. Die dermaßen in ihrem So-sein verschlossenen kleinen Prosastücke begegnen dem Leser gewissermaßen als ›Fakten‹ – so wie die heterogenen faits divers des gesellschaftlichen Lebens. In dieser widerständigen Kollision setzen sie Denkimpulse frei. Die komplexe Vielfalt des modernen Lebens macht in diesem Sinne diskursiv-systematisches Denken obsolet. Kritische Reflexion kann sich demnach nur im Partikulären vollziehen. Doch von dort wirft sie ein Licht auf die größeren gesellschaftlichen Zusammenhänge. Dergestalt begründen Autoren wie Benjamin und Kracauer die Verweisstruktur ihres mosaikartigen Schreibens: Zwischen den Analysen der lediglich partikulären Erscheinungen entsteht ein Netz, das rekurrente Muster sichtbar macht und breitere gesellschaftliche Strukturen zutage fördert. In diesem Sinne verhandeln die kleinen Formen Kracauers nicht nur politische Gehalte, sondern betreiben selbst Politik.
2. Das Allgemeine und das Konkrete in der frühen Kultursoziologie Die um 1900 entstehende Kultursoziologie unterzieht unterschiedlichste Phänomene der soziologischen Analyse und erschließt damit einen neuen Bereich für die Wissenschaft. Dies provoziert schon in ihrer Entstehungszeit Debatten über ihren epistemologischen Status. Diskutiert wird dabei insbesondere ihre Stellung zwischen Abstraktion und Konkretion und die Frage, wie dem Materiellen epistemischer Wert abgerungen werden kann. Diese Frage ist auch für Kracauer schon früh relevant. In seiner Schrift Soziologie als Wissenschaft von 1922 fragt er nach dem epistemologischen Status der Soziologie und des Konkreten. Seine Antwort ist hier noch vornehmlich phänomenologisch (Kracauer [1922] 2006, 41). Insgesamt verortet er die Soziologie – freilich noch sehr schematisch – in einem Spektrum zwischen zwei Polen. Auf der einen Seite steht die idiographische Deskription der individuellen Erscheinungsmannigfaltig-
Yashar Mohagheghi: Gegenwartsarbeit im Material
keit, die er der »materialen Soziologie« zuordnet, welche die »erkenntnismäßige Bewältigung der unmittelbar erfahrenen sozialen Wirklichkeit anstrebt« (Kracauer [1922] 2006, 77). Auf der anderen Seite steht die nomothetische Abstraktion durch Ableitung von Gesetzmäßigkeiten – »zur Bildung der Kategorie ›Form überhaupt‹« (Kracauer [1922] 2006, 67) –, die Kracauer als Prinzip der »allgemeinen bzw. formalen Soziologie« (Kracauer [1922] 2006, 66) bestimmt und die letztlich »eine Ontologie der Soziologie bedeuten würde« (ebd.). Da diese Pole für Kracauer schematisch auf einer negativ korrelierten Skala liegen, stellt die Soziologie für ihn im Ergebnis eine Aporie dar. Es gibt keinen Punkt auf dieser Skala, der a priori ein ›Optimum‹ darstellte. Vielmehr muss das jeweils ideale Mischungsverhältnis in der Analyse erprobt werden. Simmels Soziologie, die für Kracauer von besonderer Bedeutung war, befindet sich auf dieser Skala, im Unterschied etwa zu Max Webers, im mittleren Spektrum (in einer »mittleren Schicht«, Kracauer [1922] 2006, 66) zwischen materialer und formaler Soziologie. Seine gegenstandsorientierte Analyse schmiege sich einerseits, wie Kracauer in seinem Essay Georg Simmel von 1920 schreibt, »[m]it äußerster Geschmeidigkeit« der Eigenheit der Phänomene an, erschließe darin aber zugleich »eine tiefere symbolische Bedeutung« (Kracauer [1963] 2014, 214), womit das analytische Substrat gemeint ist. Simmel gehe von den konkreten Phänomenen aus und suche dabei, als Ersatz für die fehlende systematische Totalität, durch ein »Netz von Analogien« (Kracauer [1963] 2014, 234) die Einzelphänomene auf strukturelle Regelmäßigkeiten hin zu überschreiten. Sein Vorgehen sei »ein Wandern von Beziehung zu Beziehung«, »ohne Halt«, es »verliert sich im Endlosen« (Kracauer [1963] 2014, 241): Da es der einzige Sinn der zwischen den Erscheinungen angesponnenen Fäden ist, verborgene Zusammenhänge sichtbar zu machen, verlaufen sie ziemlich regellos und willkürlich, das Unsystematische wird bei ihnen geradezu System, es ist ganz gleichgültig, wohin man, sie auswerfend und anknüpfend, gelangt, wenn man nur überhaupt irgendwohin gelangt. (Ebd.) Diese Beschreibung von Simmels Methode aus der Feder des frühen Kracauer kann als Vorwegnahme von dessen eigenem unsystematischen Schreiben gelten, das in der Assemblierung von Partikularanalysen in kleinen Formen gesellschaftliche Strukturen sichtbar macht. Dabei ist die Bewertung Simmels in den früheren Schriften zwiespältig. Simmels Soziologie erscheint ihm doppelt kritikwürdig: Auf der einen Seite sieht er im formalsoziologischen Moment die Phänomene durch die »starren Begriffsgehäuse[]« (Kracauer [1963] 2014, 220) zu Momenten der Analogiebildung reduziert und entindividualisiert. Auf der anderen Seite bemängelt er schon zwei Jahre später in Soziologie als Wissenschaft in der allzu großen materialsoziologischen Annäherung an die Phänomene ein Fehlen »axiomatische[r]
129
130
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Fundierung«1 und fordert, »von der empirisch gegebenen Mannigfaltigkeit bzw. von den niedersten Arten soziologischer Wesenheiten alle individuellen Momente abzustreifen und aus der Fülle dieser Phänomene letzte kategoriale Gebilde herauszukristallisieren« (Kracauer [1922] 2006, 66). Schon wenige Jahre später hat sich in Kracauers Denken die Waage zwischen Formal- und Materialsoziologie zur Seite des Materiellen hin verschoben. In seiner Würdigung von Benjamins Schriften aus dem Jahr 1928 hebt er dessen »Aufmerksamkeit für das Unscheinbare, aber nur scheinbar Periphere« (Mülder-Bach 1985, 88), die Inka Mülder-Bach als verbindendes Element zwischen Kracauer, Benjamin und Bloch erkennt, hervor: Benjamins Gesellschaftsanalysen erbrächten den Nachweis, »daß das Große klein, das Kleine groß ist. Die Wünschelrute seiner Intuition schlägt im Bereich des Unscheinbaren, des allgemein Entwerteten, des von der Geschichte Übergangenen an und entdeckt gerade hier die höchsten Bedeutungen.« (Kracauer [1963] 2014, 252) So lobt Kracauer am Trauerspielbuch die Materialsättigung, die zugleich allgemeine Bedeutung erschließt: »Der Unterschied zwischen dem üblichen abstrakten Denken und dem Benjamins wäre also der: laugt jenes die konkrete Fülle der Gegenstände aus, so wühlt sich dieses ins Stoffdickicht ein, um die Dialektik der Wesenheiten zu entfalten.« (Kracauer [1963] 2014, 250f.) Kracauer erkennt hier unter anderem »die Bedeutungsgeschichte einer im Stofflichen inkarnierten Idee« (Kracauer [1963] 2014, 251). Benjamin gehe »von der Welt in ihrer Unmittelbarkeit aus«; erst von hier entfaltet sich »die reale Dialektik […] zwischen den Konkretionen und dem Abstrakten, zwischen dem Sinn der Gestalt und der Gestalt selbst« (Kracauer [1963] 2014, 254). Diese Dialektik zwischen Konkretem und Allgemeinen hat freilich Adorno in seiner postumen Würdigung Kracauer abgesprochen. Dessen durchaus richtiges »Bewußtsein von der Nichtidentität der Sache mit ihrem Begriff« habe Kracauer dazu gebracht, gänzlich der Vermittlung zwischen ihnen zu entraten und sich allein mit den materiellen Phänomenen zu begnügen, statt »den Gedanken aus dem ihm Widerspenstigen zu extrapolieren, das Allgemeine aus dem Extrem der Besonderung«: »Er beschied sich bei genauerer Fixierung des Besonderen zugunsten seines Gebrauchs als Exempel für allgemeine Sachverhalte. Das Bedürfnis nach strikter Vermittlung in der Sache selbst, nach dem Aufweis des Wesenhaften inmitten der innersten Zelle von Besonderung, war kaum das seine.« (Adorno [1964] 2003b, 394)
1
Da Simmel, so Kracauer über dessen Soziologie, »häufig dicht an die Erlebniswirklichkeit herandrängt, kaum je aber von ihr zu den obersten soziologischen Kategorien aufsteigt, fehlt seinen Studien die axiomatische Fundierung; es handelt sich in ihnen vielmehr vorwiegend um Erkenntnisse der schon subjektiv bestimmten deskriptiven Psychologie, die häufig einen ausgezeichneten Charakter dadurch annehmen, daß sie aus größter Nähe zu ihrem Gegenstand gewonnen werden.« (Kracauer [1922] 2006, 66)
Yashar Mohagheghi: Gegenwartsarbeit im Material
Den »Primat des Optischen« (Mülder-Bach 1985, 87), den Kracauer nach MülderBach Simmel zuschreibt, attestiert Adorno mithin Kracauer selbst. Kracauers frühes Diktum über Simmel – »Er zeichnet stets Gesehenes nach, sein ganzes Denken ist im Grunde nur ein Erfassen der Objekte durch das Hinblicken auf sie« (Kracauer [1963] 2014, 247) – kann demnach auch als eine methodologische Selbstbeschreibung Kracauers verstanden werden. In der Tat beruht Kracauers Kultursoziologie auf der Beobachtung von Oberflächenerscheinungen, die er als Chiffren tieferer gesellschaftlicher Strukturen analysiert, wie im Folgenden gezeigt werden soll.
3. Oberflächenanalyse: Die Bedeutung des Kleinen In seiner Kulturkritik ist Kracauer grundsätzlich von einer Arbeit am Konkreten geleitet. Er spricht von »Interpretationen im konkreten Material« (Kracauer [1933] 2011, 368).2 Politische Aufklärungsarbeit hat die gesellschaftlichen Strukturen in den materialen Erscheinungen selbst aufzuweisen. Denn die Form der kulturellen Phänomene und Institutionen selbst ist sinnhaft. Zu nennen sind etwa die Architektur der Arbeitsämter, die Form von Filmmontagen, die Organisation von Vergnügungsinstitutionen wie dem Kino und dem Zirkus usw. Als Chiffre lesbar sind beispielsweise die Rolltreppen, auf denen die Angestellten in die Vergnügungspaläste auffahren, »zu deren Funktionen vermutlich gehört, den leichten Aufstieg in die höheren Schichten zu versinnlichen« (Kracauer [1930] 2017, 98). Hier spiegelt also schon die äußere Architektur den für die Angestelltenschicht wesentlichen Mobilitäts- und Aufstiegsgedanken, den Kracauer in diversen Schriften – insbesondere in Die Angestellten – hervorhebt. Die methodische Bedeutung solcher Oberflächenerscheinungen beschreibt Kracauer in Das Ornament der Masse: Der Ort, den eine Epoche im Geschichtsprozeß einnimmt, ist aus der Analyse ihrer unscheinbaren Oberflächenäußerungen schlagender zu bestimmen als aus den Urteilen der Epoche über sich selbst. […] Jene gewähren ihrer Unbewußtheit we-
2
Über Leo Trotzkis materialistische Geschichtsauffassung schreibt Kracauer an dieser Stelle: »Statt sich von Begriffsfetischen her dem Stoff zu nähern, weist er die in der Empirie sich auswirkenden Gesetzmäßigkeiten auf; statt um irgendwelcher Maximen willen das Detail zu vernachlässigen, enthüllt er seine jeweilige Bedeutung; statt die Rolle der individuellen Faktoren von vornherein zu verkürzen, bemüht er sich stets darum, ihre Funktion voll zu erfassen. So entsteht ein Geschichtsbild, das weder eine weitmaschige Konstruktion ist, der die Tatsachen entgleiten, noch eine dokumentarische Betrachtung, die in der Fülle der Tatsachen versinkt. Vielmehr wird der Stoff hier erkenntnismäßig bewältigt und jede Erkenntnis dem Stoff entnommen.« (Kracauer [1933] 2011, 368)
131
132
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
gen einen unmittelbaren Zugang zu dem Grundgehalt des Bestehenden. (Kracauer [1963] 2014, 50) Der Rekurs auf die »Unbewußtheit« ist so zu verstehen, dass Ideologien nicht bloß durch Ideologeme wirksam sind, sondern – wie es das Rolltreppen-Beispiel eindrücklich veranschaulicht – in physischen Formen unbewusst wirken und sich so allmählich im Bewusstsein niederschlagen. In diesem Sinne stellt Inka Mülder-Bach über Kracauers Ideologiekritik fest, daß die synthetische Herstellung von Bewußtsein auf der Ebene physischer Modellierung beginnt, daß Ideologien sich längst nicht mehr nur konkret als kritisierbare Inhalte manifestieren, sondern zu Verhaltensmodellen geworden sind, deren weitgehend unbewußte Adaption erst die fugenlose Integration des Einzelnen ins Gesamtsystem garantiert. (Mülder-Bach 1985, 91f.) Dieser sozialpsychologische Mechanismus (der unbewussten Sedimentierung ideologischer Strukturen) liefert die methodische Rechtfertigung der Oberflächenanalyse, die er besonders wirkmächtig im Essay Das Ornament der Masse vorführt. Er beschreibt dort die Tanzgruppe der Tillergirls, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts hohe Popularität genossen. In der Synchronisierung der Bewegungsabläufe und Körper zum integralen Bewegungsbild sieht Kracauer die Mechanisierung betrieblicher Abläufe und die Atomisierung des Einzelnen zum Massenglied gespiegelt. (Kracauer [1963] 2014, 54) Die geometrische Figur, die nach Kracauer den Taylorismus und die Massengesellschaft verkörpert und die er auch in anderen Kontexten aufweist, bezeichnet er als Massenornament: »Die Struktur des Massenornaments spiegelt die der gegenwärtigen Situation wider.« (Kracauer [1963] 2014, 53) Nach Rudolf Helmstetter entspricht die Figur des Massenornaments der Abstraktion und Unanschaulichkeit der Moderne, deren Gesellschaftsstruktur und Funktionszusammenhänge sich der Sichtbarkeit und kontinuierlichen Erfahrbarkeit, der Evidenz und Repräsentation entziehen – während sie gleichzeitig durch Bildfülle und Präsenz der Spektakel gekennzeichnet ist. Mit der Figur des Massenornaments versuche Kracauer daher, gleichsam ›Algorithmen‹ der wiederkehrenden Bilder zu identifizieren, um ein approximatives Bild der Gesellschaft zu geben (Helmstetter 2004, 129). So wird das Massenornament für den Analytiker als Chiffre gesellschaftlicher Verhältnisse lesbar: Die »sinnentleerten Kettenbildungen synchroner Bewegungen menschlicher Körper schließen sich unter seinem beobachtenden Blick zur abstrakten Struktur Gesellschaft zusammen« (Todorow 2004, 121). Doch macht das Massenornament nicht nur die ideologischen Strukturen sichtbar, sondern es trägt durch seinen ästhetischen Eindruck selbst wieder zur Verfestigung dieser Strukturen bei, deren Reflex es ist, indem es durch seinen Formalismus gleichsam einen »magische[n] Zwang« (Kracauer [1963] 2014, 51) ausübt. Überhaupt prägen sich nach Kracauer wiederkehrende physisch-optische Eindrü-
Yashar Mohagheghi: Gegenwartsarbeit im Material
cke unbewusst ein. Insbesondere die Bilderflut der Medien trägt zur Ausbildung von Denk- und Wahrnehmungsmustern bei, die Ideologien festigen. Über den »Bildzauber« der illustrierten Zeitungen und Magazine heißt es, »daß die in ihnen immer wiederkehrenden Bildmotive wie magische Beschwörungsformeln gewisse Gehalte ein für allemal in den Abgrund bildloser Vergessenheit zu stürzen trachten« – mit der Folge, dass »[d]ie Flucht der Bilder […] die Flucht vor der Revolution und dem Tod« (Kracauer [1930] 2017, 99) nach sich ziehe. Die Suggestivkraft der Bilder, die in den Medien schnell zirkulieren, verdrängt also ›echte‹ Sinngehalte – sowohl gesellschaftlicher als auch ontologischer Natur. Jene »Gehalte« definiert Kracauer als solche, »die von der Konstruktion unseres gesellschaftlichen Daseins nicht umschlossen werden, sondern dieses Dasein selbst umklammern« (Kracauer [1930] 2017, 99). Der Bildersog verdeckt die Sicht auf die akuten gesellschaftlichen Zusammenhänge und perpetuiert durch Zerstreuung die immanente Betriebsamkeit des von der Wirtschaftsrationalisierung verstetigten3 Daseins, denn die betriebsame Zerstreuung, die der Arbeitnehmer in der Kulturindustrie findet, entspricht der Betriebsamkeit der modernen Wirtschaftsweise (vgl. Kracauer [1963] 2014, 313f.), nicht mehr nur im industriellen, sondern auch im Dienstleistungssektor. Insbesondere der Film unterhält einen derartigen suggestiven »Bildzauber«, wie Kracauer im Essay Film 1928 beschreibt. So beobachtet er im Film »typische, immer wiederkehrende Motive und Tendenzen« (Kracauer [1963] 2014, 295). Sie seien Produkt einer standardisierten Filmfertigung, in der eine »stabilisierte Technik« (ebd.), die »völlig mechanisiert« sei, »stabilisierte Bildformel[n]« (Kracauer [1963] 2014, 304) hervorbringe. Dabei käme es nach Kracauer doch eigentlich »auf die Verknüpfung der Gehalte im optischen Medium an, nicht auf die rein formale optische Verbindung unverknüpfter Stoffteile« (ebd., Herv. i. O.). Solche leeren formalen Verfahren, wie etwa der Schnitt von einer Einstellung zur anderen, können aber unterschwellig ideologische Denkmuster befördern. Dafür gibt Kracauer etwa folgendes Beispiel: Neuerdings hat sich eine bestimmte Methode des Übergangs eingebürgert, die bei jeder Gelegenheit wiederkehrt. Zwei sich folgende Auftritte, zwischen denen keine unmittelbare Beziehung besteht, sollen miteinander verschmolzen werden. In dem ersten möge ein eleganter Herr erscheinen, im zweiten eine zerlumpte
3
Zur Verstetigung des Daseins vgl. Kracauers Essay Die Reise und der Tanz, wo diese Freizeitaktivitäten, die vormals »Gehalte in der Zeit zum Ausdruck« bringen wollten, nur mehr der bloßen »Skandierung der Zeit« und dem »Rhythmus schlechthin« dienen, der die »Mechanisierung« (Kracauer [1963] 2014, 42) des modernen Lebens und die Entfremdung von Sinngehalten veranschauliche. Die Taylorisierung des Produktionsprozesses erfasse so auch den Menschen, der »selber zu einer mathematischen Gegebenheit in Raum und Zeit« werde und dessen Dasein »in eine Reihe organisatorisch geforderter Tätigkeiten« zerfalle und zu einem »nutzbaren Glied der intellektuellen Apparatur« werde. (Kracauer [1963] 2014, 45f.)
133
134
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Frau. Wie werden die Szenen verkoppelt? Der Blick wird von der Gesamtfigur des Herrn zu seinen Halbschuhen gelenkt, die sich unmerklich in grobe Stiefel verwandeln, denen die Frau entsteigt. (Kracauer [1963] 2014, 304) Solche standardisierten Montagen, die »sachlich nichts ausdrücken« (ebd.), sondern einer leeren »Konfektionstechnik« (Kracauer [1963] 2014, 301) folgen, sind indes nicht immer einfach kunstfremd, sondern transportieren häufig auch Ideologien.4 In dem genannten Beispiel, in dem die Montage Reichtum und Armut verblendet, suggeriert sie unterschwellig soziale Mobilität und Aufstieg.5 Durch die Repetition solcher Codes, formaler Schemata und Wahrnehmungsgewohnheiten prägen sich ideologische Strukturen ein. Das Kino ist dabei die vorzügliche Kunstform, die auf Zerstreuung gründet (Kracauer [1963] 2014, 312). In der Schockwirkung seiner Bilder bedient es die zerstreute Aufmerksamkeitsdisposition der Masse. Was für den Film gilt, behauptet Kracauer auch für die Kinos, die von ehemaligen Orten der Filmvorführung zu »Paläste[n] der Zerstreuung« (Kracauer [1963] 2014, 311) geworden seien. Ihr »Prunk der Oberfläche« gleiche einem »glänzende[n], revueartige[n] Gebilde«, dessen »optisches und akustisches Kaleidoskop« ein »Gesamtkunstwerk der Effekte« (ebd.) schaffe, in dem der Film nur eines unter den diversen Elementen der Orchestrierung sei. »Der Hang zur Zerstreuung fordert und findet als Antwort die Entfaltung der puren Äußerlichkeit.« (Kracauer [1963] 2014, 314) Diese Tendenz, »alle Darbietungen zu Revuen auszugestalten«, erkennt Kracauer als »Parallelerscheinung« zur »Häufung des Illustrationsmaterials in der Tagespresse und den periodischen Publikationen« (ebd.). Sowohl die Filmmontage als auch die orchestrierte Filmvorführung entsprechen der Fragmentierung des Großstadtpublikums und der Wahrnehmungsheterogenität, der es ausgesetzt ist. Im Kino begegnet es diesem »reinen Außen, trifft es sich selber an, die zerstückelte Folge der splendiden Sinneseindrücke bringt seine eigene Wirklichkeit an den Tag« (Kracauer [1963] 2014, 315). Hierin liegt für Kracauer aber dialektisch betrachtet auch eine Möglichkeit politischer Kritik enthalten. Denn gerade diese Disposition (der fragmentierten Wahrnehmungsweise, der Fassadenkultur, der Atomisierung) könnte der Film zum Vorschein bringen. »[I]hr Offenbar-
4
5
»Teils entfernen sie sich einfach von unserer Wirklichkeit in gleichgültige Weiten, teils richten sie im Interesse der stabilisierten Gesellschaft Ideologien auf« (Kracauer [1963] 2014, 300, Herv. i. O.), schreibt Kracauer über die standardisierten Durchschnittsproduktionen des Films. Für Kracauer stellt das Phantasma des sozialen Aufstiegs die von der Kultur- und Medienindustrie beförderte Ideologie dar, die in der Angestelltenschicht eine illusionäre Zugehörigkeit zur bürgerlichen Schicht nährt und damit eine Allianz mit der eigentlich näherstehenden Arbeiterschaft und die Politisierung überhaupt verhindert (vgl. etwa Kracauer [1930] 2017, 91).
Yashar Mohagheghi: Gegenwartsarbeit im Material
werden in der Zerstreuung hat moralische Bedeutung« (ebd., Herv. i. O.), und zwar wenn die Aufführungssituation als Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse erkannt würde. Doch stattdessen verdeckt das Kino diese seine ›Architektur der Zerstreuung‹ und kittet das Fragmentierte zur ästhetischen Einheit: Die Zerstreuung, die sinnvoll einzig als Improvisation ist, als Abbild des unbeherrschten Durcheinanders unserer Welt, wird von ihnen mit Draperien umhängt und zurückgezwungen in eine Einheit, die es gar nicht mehr gibt. Statt zum Zerfall sich zu bekennen, den darzustellen ihnen obläge, kleben sie die Stücke nachträglich zusammen und bieten sie als gewachsene Schöpfung an. (Kracauer [1963] 2014, 316) Der Film, der Kunstform sein will, darf sich nicht weiterhin als autonome Filmillusion zu verstehen geben, die sich von ihrer Aufführungssituation distinkt zeigt, sondern muss sich in der raumkörperlichen Erfahrung des Hier und Jetzt als Teil der heterogenen Effektvielfalt offenlegen, die die Lichtspielhäuser zum Erlebnis zu synthetisieren suchen (vgl. Kracauer [1963] 2014, 316). Erst so wird die filmische Erfahrung »radikal auf eine Zerstreuung abzielen, die den Zerfall entblößt, nicht ihn verhüllt« (Kracauer [1963] 2014, 317). Daher weist Kracauer die Rückkehr zu bildungsbürgerlichen Kunstformen wie dem Theater ab. Aufklärung kann sich nur über die konkreten materiellen Formen und Formate vollziehen, die der eigentümlichen Wahrnehmungsdisposition des Medienverbunds unterliegen – nur durch sie hindurch und nicht über sie hinweg. Allein in der Auseinandersetzung mit dem Material erschließt sich die Wirklichkeit in ihren – defizitären – Strukturen. Dass dies auch konkrete Folgen für Kracauers Schreibweise hat, soll im Folgenden erörtert werden.
4. Kleine Formen und ephemere Gegenwartsarbeit Benjamin hat seinem »Aphorismenbuch« (Benjamin 1997, 161),6 wie er die Einbahnstraße selbst nennt, ein programmatisches ›Denkbild‹ an den Anfang gestellt. Er gibt darin eine poetologische Begründung seines Textes, indem er die Rolle kleiner Formen von den modernen Aufmerksamkeitsökonomien im Kontext der Massenmedien und der Großstadt her begründet. So heißt es im ersten Aphorismus Tankstelle programmatisch:
6
An anderer Stelle spricht Benjamin vom »Aphorismenbüchlein« (Benjamin 1997, 85) und von »Aphorismen« (Benjamin 1997, 197). Detlev Schöttker weist aber zu Recht darauf hin, dass die Texte der Einbahnstraße einem breiteren Gattungsspektrum angehören. So finden sich dort auch Kurzprosaformen wie »Kurztraktat, Thesengruppe, Glosse, Prosaskizze und anderes mehr«. (Schöttker 1999, 190)
135
136
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Die Konstruktion des Lebens liegt im Augenblick weit mehr in der Gewalt von Fakten als von Überzeugungen. Und zwar von solchen Fakten, wie sie zur Grundlage von Überzeugungen fast nie noch und nirgend geworden sind. Unter diesen Umständen kann wahre literarische Aktivität nicht beanspruchen, in literarischem Rahmen sich abzuspielen – vielmehr ist das der übliche Ausdruck ihrer Unfruchtbarkeit. Die bedeutende literarische Wirksamkeit kann nur in strengem Wechsel von Tun und Schreiben zustande kommen; sie muß die unscheinbaren Formen, die ihrem Einfluß in tätigen Gemeinschaften besser entsprechen als die anspruchsvolle universale Geste des Buches in Flugblättern, Broschüren, Zeitschriftartikeln und Plakaten ausbilden. Nur diese prompte Sprache zeigt sich dem Augenblick wirkend gewachsen. Meinungen sind für den Riesenapparat des gesellschaftlichen Lebens, was Öl für Maschinen; man stellt sich nicht vor eine Turbine und übergießt sie mit Maschinenöl. Man spritzt ein wenig davon in verborgene Nieten und Fugen, die man kennen muß. (Benjamin [1928] 1991, 85) Literatur bzw. literarische Aktivität bezieht ihre Legitimation aus ihrer Wirksamkeit. Eine solche Wirksamkeit besitze sie, wenn sie materiell zirkuliert und physisch begegnet, und zwar in »unscheinbaren Formen«, die mit der »Gewalt der Fakten«, also der der konkreten Dinge in der Lebenswelt, wirken. Nur kleine Formen und fluide Formate seien in ihrer ›Promptheit‹ den schnellen und diffusen Perzeptionsprozessen adäquat. Das versinnbildlicht die Metapher des Tankens: Angesichts der Komplexität des Gesellschaftsapparats gehöre thetische Meinungsbildung (»Überzeugungen«) einem vergangenen Ideal an. Unter den gegebenen gesellschaftlichmedialen Bedingungen erfolge Meinungsbildung vielmehr allmählich und unterschwellig durch kleindosierte Einwirkung: Die unscheinbaren Gesten und Dinge, die die Alltags- und Lebenswelt bevölkern, schrieben sich viel tiefer in das Bewusstsein ein als Ideologeme. In der Einbahnstraße selbst sucht Benjamin die faits divers des großstädtischen Lebens und ihre ›physische‹ Begegnung durch eine topographische Ordnung, die die nicht-lineare Leserichtung zu durchbrechen sucht – wie nicht zuletzt der Titel ironisch zum Ausdruck bringt –, zumindest anzudeuten. So begegnet der frei stöbernde Leser bzw. die Leserin den Denkbildern in der virtuellen Topographie wie der Flaneur den Orten der Großstadt, die die Denkbilder durch ihre Titel aufnehmen (Normaluhr, Mexikanische Botschaft, Baustelle, Poliklinik usw.). Die Aufwertung der – als Analogon der städtischen Dinge verstandenen – faits divers gegenüber dem Leitartikel ist symptomatisch für Benjamins Bewusstsein von den veränderten Aufmerksamkeitsökonomien und der politischen Wirksamkeit von Schriftstellerei. Entscheidend sind dabei die mediengeschichtlichen Wandlungen: So geht das mediale Auftreten der Text-Bild-Kultur einher mit dem Geltungsverlust eines »cartesianischen Erkenntnis- und Begriffsideals und dem notwendigen Rückgang auf die komplexe lebensweltliche Sinnenwelt« (Todorow 2004, 110). Die Zeitung kann als Reflex der »mosaikhaften Arrangements der Massenmedien« gel-
Yashar Mohagheghi: Gegenwartsarbeit im Material
ten. Sie spiegelt die Bedingung »einer neuen technisch konstituierten, intermedial agierenden Medienwirklichkeit von Texten, Bildern und Geräuschen«, indem sie die medialen Interaktionen in ihre textinterne Struktur aufnimmt (Todorow 2004, 110). In diesem Sinne betont etwa Hermann von Wedderkop, Herausgeber der Zeitschrift Der Querschnitt, die Benjamins kulturpolitischen Vorstellungen weitgehend entsprach (Köhn 2004, 56): »Zeitung ist fait divers, nicht Leitartikel. Das Wesen der Zeitung besteht im Heterogenen.« (zit.n. Köhn 2004, 55) Die Zeitung bildet die Heterogenität der gesellschaftlichen faits divers nach. Das Bewusstsein wird stärker durch die gesellschaftliche Gemengelage bestimmt als durch die Propagierung von Meinungen. Damit wird auch das Autorsubjekt depotenziert. Vorbild ist nicht mehr der écrivain engagé des 19. Jahrhunderts, prototypisch verkörpert in Zola, dessen Anklage J’accuse den Inbegriff öffentlicher Meinungsäußerung eines sich interventionistisch verstehenden Intellektuellen darstellt. So erproben Autoren wie Benjamin Textformen als Zitatcollagen, in denen der Autor nur mehr die organisierende Instanz einer spannungsvollen Stimmenvielfalt ist. Auch in der Widmung der Einbahnstraße, die Benjamins marxistischer Bekannten Asja Lacis galt, welche ihn näher mit der russischen Avantgarde bekannt gemacht hatte (Schöttker 1999, 161) – »Diese Straße heißt/Asja-Lacis-Straße/nach der die sie/als Ingenieur/im Autor durchgebrochen hat« (Benjamin [1928] 1991, 83) – macht Benjamin den Ingenieur (im Autor) geltend, dessen Aufgabe darin bestehe, als Konstrukteur im Arrangement von (fremden und eigenen) Gedankenbruchstücken zu wirken. Statt den Leser bzw. die Leserin mit Meinungen überzeugen zu wollen, setzt ihn/sie die virtuelle städtische Topographie dem ›Zusammenstoß‹ mit Gedankenbruchstücken aus. Heinz Schlaffer hat für diese »kleine Prosaform zwischen Dichtung und Gesellschaftstheorie«, so der Untertitel seines einflussreichen Aufsatzes, von Benjamin die Bezeichnung ›Denkbild‹ übernommen. Als charakteristisch für das Denkbild, das er für Autoren im weiteren Umfeld der Frankfurter Schule (bis hin zu Brecht) untersucht, beschreibt er dessen »Zweiteilung in Erfahrung und Erkenntnis, Bericht und Reflexion, Fall und Theorem« bzw. von »Gedanke und Anschauung« (Schlaffer 1973, 142). Wenn Schlaffer eine »strukturelle[] Verwandtschaft« zum Emblem erkennt, so kennzeichnet das Denkbild im Unterschied zu diesem »nicht Entsprechung, sondern Opposition zwischen Gedanke und Konkretum« (Schaffer 1973, 143). In der dyadischen Struktur erkennt Schlaffer eine produktive Spannung, die reflexive Impulse freisetzt. Erkenntnismomente erwachsen im Denkbild demnach dem Spannungsverhältnis zwischen dem ›beredten Schweigen‹ der Anschauungskonkretion und der inscriptio des Titels, deren Zusammenhang von den Leser:innen erst herzustellen ist. In diesem Sinne sieht Adorno die Denkbilder in Benjamins Einbahnstraße »durch ihre Rätselgestalt schockieren und damit Denken in Bewegung bringen, weil es in seiner traditionellen begrifflichen Gestalt erstarrt, konventionell und
137
138
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
veraltet dünkt« (Adorno [1955] 2003a, 681). Für Kracauer belegt die ›aphoristische‹ Anlage von Benjamins Einbahnstraße den Versuch, der »diskontinuierliche[n] Struktur der Welt« in kleinen Miniaturen gerecht zu werden. (Kracauer [1963] 2014, 253) Über das Trauerspielbuch wiederum schreibt er: »Die im Barockbuch verwandte Methode der Dissoziierung unmittelbar erfahrener Einheiten muß, auf das Heute angewandt, einen wenn nicht revolutionären, so doch sprengenden Sinn erlangen.« (Ebd.) Er spricht auch davon, dass »die Sammlung reich an Detonationen« (ebd.) sei. Diese Sprengkraft verdanke sie den kleinen Formen, die in ihrer Konkretheit nur mittelbar auf Wahrheiten verweisen, statt offen Inhalte zu vermitteln: »Hinter dem Schutthaufen kommen weniger reine Wesenheiten als vielmehr kleine materielle Partikel zum Vorschein, die auf Wesenheiten weisen«. (Kracauer [1963] 2014, 253f.) Auch Kracauer spricht sich als Redakteur der Frankfurter Zeitung, im Unterschied etwa zu Friedrich Traugott Gubler, der von 1929 bis 1933 Leiter der Feuilletonund Literaturblattredaktion war, gegen Haltungsartikel aus und fordert, dass die Meinungsbildung implizit sein solle: Politische Kritik solle lediglich indirekt aus den materialen Analysen auf das Lesepublikum wirken (vgl. Stalder 2003, 105–111). Es soll sich die anschauliche Konkretion beschriebener Alltagsphänomene mit deren Theoretisierung verbinden, wie Almut Todorow über Das Ornament der Masse schreibt: Der Ornament-Text verschränkt in einer sprunghaften und zugleich im Wortsinne para-doxen Bewegung den Blick auf das konkrete, subjektive und situative Alltägliche mit dessen Theoretisierung als der modernen Gesellschaft. Er führt seine essayistische Poetik als grundlegende Option moderner Theoriebildung in den kulturellen Dispositiven der modernen Kommunikationssysteme vor. (Todorow 2004, 108f.) Nach Todorow markiert diese als Theorie auftretende Physiognomie des Alltäglichen einen Geltungsverlust des propositionalen Aussagenwertes von Texten, den Todorow auf mediengeschichtliche Wandlungen zurückführt: Das Ornament steht so gesehen für die selbstreflexiven arabesken Darstellungsund Argumentationsweisen, die sich im medienhistorischen Übergang von der unangefochtenen Geltung der Texte unter dem Primat von Schrift zur Infragestellung ihrer sprachlichen Intuitions- und Imaginationsleistungen in einer neuen technisch konstituierten, intermedial agierenden Medienwirklichkeit von Texten, Bildern und Geräuschen der komplexen, hochgradig vermittelten Wahrnehmungswelt der Wirklichkeit etablieren. (Todorow 2004, 109) Die veränderten Wahrnehmungsbedingungen und ihre gesellschaftlichen Wirkkräfte innerhalb des Medienverbunds lassen die konkreten Schreibweisen nicht unberührt. Seine Kulturkritik hat Kracauer selbst überwiegend in Einzelanalysen
Yashar Mohagheghi: Gegenwartsarbeit im Material
von verschiedensten Oberflächenerscheinungen des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens vorgenommen, die an die Stelle systematischer Betrachtungen treten. Ein Großteil von Kracauers Texten ist im Feuilleton der Frankfurter Zeitung erschienen, wo er ab 1922 freier Mitarbeiter und ab 1930 bis zur Emigration Chefredakteur war. So ist seine Kulturkritik nicht zu trennen von den kleinen Schreibweisen, »in denen das phänomenologische Verfahren der Oberflächenanalyse Gestalt annimmt« (Mülder-Bach 1985, 107). In einem Brief an Bloch sieht Kracauer seine kurze Prosa gekennzeichnet durch den »Ansatz beim Materiellen und Äußerlichen« (Brief von Kracauer an Bloch vom 27. Mai 1926, Bloch 1985, 274). Das »vorwaltende Interesse am Konkreten« bedinge die Scheu vor systematischen Abhandlungen zugunsten kleiner Formen, die Gesellschaftstheorie »auf die ephemere Erfahrung« gründen – so Schlaffer über die Prosa der Kritischen Theorie im Allgemeinen (Schlaffer 1973, 145). Die kleinen Formen sind wiederum auf ihre Assemblierung verwiesen. Sowohl Zeitgenossen (wie etwa Bloch)7 als auch die Forschung haben festgestellt, dass Kracauers verstreute Gesellschaftsaufnahmen erst in der »Zusammenschau« und »nicht am einzelnen Beispiel, obwohl sich allein dort die postulierte Konkretion bewähren kann« (Oschmann 2006, 205f.), ihren Aussagegehalt erweisen. Kracauer selbst spricht von »Mosaik«: Das Leben stecke »einzig und allein in dem Mosaik, das aus den einzelnen Beobachtungen auf Grund der Erkenntnis ihres Gehalts zusammengestiftet wird« (Kracauer [1930] 2017, 16). Mit dieser programmatischen Aussage in Die Angestellten wendet sich Kracauer gegen die Reportage, die, wie er sicherlich auch mit Blick auf so einflussreiche Reporter wie Egon Erwin Kisch sagt, »[s]eit mehreren Jahren […] in Deutschland […] Meistbegünstigung [genießt]« (Kracauer [1930] 2017, 15). Diese sei, wie er bemängelt, eine bloße »Reproduktion des Beobachteten« (ebd.). Es gelte aber: »Die Wirklichkeit ist eine Konstruktion.« (Kracauer [1930] 2017, 16) Sie werde in der – photographischen – Reproduktion des Seienden nicht erschöpfend erfasst, vielmehr lasse sich der wirkliche Gehalt der Phänomene aus ihnen nur chiffreartig herauslesen – wenn in der Zusammenschau frequente Strukturen bzw. »Algorithmen« (Helmstetter 2004, 129) sichtbar werden. Nach Helmstetter ist daher Kracauers Verfahren nicht physiognomisch, sondern konstruktivistisch: Es gehe weniger darum, in den literarischen Miniaturen die Dinge in ihrem partikulären So-sein einzufangen, sondern – das ist der nachfolgende und entscheidende Schritt – ihren Nexus aufzuzeigen (Helmstetter 2004, 136).8
7
8
Bloch bekundet die Absicht, Kracauers in Aufsätzen verfasstes Werk »im Zusammenhang seiner Zusammenhangslosigkeit einmal zu lesen«, und spricht von einem »einzigartige[n] Ornament der Zerstreuung« (Brief von Bloch an Kracauer vom 6. Juni 1926, Bloch 1985, 285). Insofern ist die ›Widerspiegelung‹ gesellschaftlicher Strukturen im Massenornament nicht als »Isomorphie«, sondern als »Funktionshomologie« zu begreifen. (Helmstetter 2004, 131)
139
140
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Das von Kracauer in Soziologie als Wissenschaft aufgeworfene Problem der Vermittlung zwischen idiographischer Konkretion und nomothetischer Verallgemeinerung kehrt in der Frage wieder, wie sich soziologische Strukturen in der Analyse partikulärer Erscheinungen abbilden (lassen). Die Antwort scheint für Kracauer zu sein: Die Assemblierung von Partikularanalysen (in kurzen Prosaformen) lässt rekurrente gesellschaftliche Muster sichtbar werden. Todorow spricht daher von einem »stereoskopische[n] Doppelblick« zwischen beschreibender Anschaulichkeit und einer produktiven, die Wahrnehmungsbedingungen des Sichtbaren überschreitenden Sehweise. Dabei werde die »Metaphorik des Vor Augen Stellens«, die Figur der Hypotypose, »selbst reflexiv in den Blick gerückt« (Todorow 2004, 123). Kracauer schaffe ein Bild gesellschaftlicher Realität, indem er in einem »weitläufige[n] Blickfeld« »heterogene[] Teilräume[] und Diskursfragmente[]« verbinde (Todorow 2004, 113). Beim Massenornament zeige sich das etwa dadurch, dass es schwanke zwischen »dem Ornament als bewegtem Bild vor Augen und dem Ornament als formaler Struktur und abstraktem Zeichen für etwas erst zu Bestimmendes, als leere Lineatur, deren Signifikat sich oszillierend entzieht« (Todorow 2004, 114f.). Kracauers Ornament-Essay entwerfe »einen heterogenen Zusammenhang von Fakten«, der deren Ratio, nämlich »das Dispositiv der treibenden und beharrenden Kräfte […] der Gegenwart«, veranschauliche, »die in den Medien zirkulierend die gesellschaftliche Praxis formieren« (Todorow 2004, 115). So ist die Form der Gesellschaftsbeschreibung Kracauers nach Todorow vergleichbar mit Foucaults Dispositivanalyse, da beide die Oberflächenstruktur der Gesellschaft als Netz ihrer diskursiven und nichtdiskursiven Elemente analysieren (Todorow 2004, 115f.). Während sich die Gattung des Feuilletons insbesondere von der Heterogenität des modernen Lebens her definiert, so bestimmt sich der Essay über den tentativen Charakter der Gegenwartsarbeit. Gerade dort, wo die Gattungsbezeichnung, wie Mülder-Bach feststellt, mehr als eine Verlegenheitsbezeichnung sei, etwa in Das Ornament der Masse, Die Wartenden und Die Photographie, verweise die Gattungsbezeichnung auf das Tastende einer Arbeit an der offenen Gegenwart, am »Aktuellen und Ephemeren«, was die politisierte »Essayistik gerade der zwanziger Jahre gegenüber der bildungsbeschwerten und historisierenden des 19. Jahrhunderts« kennzeichne (Mülder-Bach 1985, 107). Dem Verzicht auf Systemdenken zugunsten der Analyse unscheinbarer Phänomene in kleinen Formen kommt bei Kracauer und Benjamin in geschichtstheoretischer Hinsicht eine Absage an Großnarrative wie die Revolution – verstanden als bloßer Umsturz der politischen Institutionen – gleich. Über die neue »junge radikale Intelligenz«, wie Kracauer sie nennt, schreibt er, dass ihr revolutionärer Protest gegen den Kapitalismus sich nur auf die »extremen Fälle[]« beziehe, »ohne das normale Dasein in seiner unmerklichen Schrecklichkeit zu ermessen« (Kracauer [1930] 2017, 109):
Yashar Mohagheghi: Gegenwartsarbeit im Material
Nicht die Konstruktion dieses Daseins selber, sondern einzig und allein einige seiner weithin sichtbaren Ausstrahlungen treiben sie zur Gebärde der Rebellion. Sie greift also nicht eigentlich in den Kern des Gegebenen ein, sie hält sich an die Symptome; sie geißelt auffallende Entartungen und vergißt darüber die Folge der kleinen Ereignisse, aus denen sich unser normales gesellschaftliches Leben zusammensetzt und als deren Ergebnis erst jene Entartungen zu verstehen sind. Der Radikalismus dieser Radikalen hätte mehr Gewicht, durchdränge er wirklich die Struktur der Realität, statt von der Beletage herab seine Verfügungen zu treffen. Wie soll der Alltag sich wandeln, wenn auch die ihn unbeachtet lassen, die dazu berufen wären, ihn aufzurühren? (ebd.) Weiter schreibt Kracauer: »Man entledige sich doch des Wahns, daß es auch nur in der Hauptsache die großen Geschehnisse seien, die den Menschen bestimmen. Tiefer und dauernder beeinflussen ihn die winzigen Katastrophen, aus denen der Alltag besteht, und gewiß ist sein Schicksal vorwiegend an die Folge dieser Miniaturereignisse geknüpft.« (Kracauer [1930] 2017, 56) Es sind diese »Miniaturereignisse«, die die gesellschaftliche Wirklichkeit und das Bewusstsein im alltäglichen Leben bestimmen. Den scheinbar unscheinbaren Alltagsphänomenen stellt sich der Kulturkritiker daher in analytischen Miniaturen. Politische Aufklärungsarbeit ist Gegenwartsarbeit im Kleinen, und zwar in dreierlei Hinsicht: erstens am konkreten (häufig unscheinbaren) Material, zweitens in kleinen Formen als der adäquaten Schreibweise des Kultursoziologen und drittens in klein dimensionierter zeitlicher Perspektive – als kontinuierliche Arbeit an einer Gegenwart, die nur in kleinen Wahrnehmungstransformationen umgestaltet werden kann.
Literatur Adorno, Theodor W. »Benjamins ›Einbahnstraße‹« [1955]. In: Ders. Gesammelte Schriften. Bd. 11: Noten zur Literatur. Hg. v. Rolf Tiedemann. Frankfurt a.M. 2003a, 680–685. Adorno, Theodor W. »Der wunderliche Realist« [1964]. In: Ders. Gesammelte Schriften. Bd. 11: Noten zur Literatur. Hg. v. Rolf Tiedemann. Frankfurt a.M. 2003b, 388–408. Benjamin, Walter. Gesammelte Briefe. Bd. 3. Hg. v. Christoph Gödde/Henri Lonitz. Frankfurt a.M. 1997. Benjamin, Walter. »Einbahnstraße« [1928]. In: Ders. Gesammelte Schriften. Bd. IV,1: Kleine Prosa. Baudelaire-Übertragungen. Hg. v. Rolf Tiedemann/Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt a.M. 1991, 83–148. Bloch, Ernst. Briefe. 1903–1975. Bd. 1. Hg. v. Karola Bloch et al. Frankfurt a.M. 1985.
141
142
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Helmstetter, Rudolf. »Unanschaulichkeit mit Zuschauer. Siegfried Kracauer und die Lesbarkeit der modernen Welt«. In: Unbegrifflichkeit. Ein Paradigma der Moderne. Hg. v. Almut Todorow/Ulrike Landfester/Christian Sinn. Tübingen 2004, 125–144. Köhn, Eckhardt. »›Nichts gegen die Illustrierte!‹ Benjamin, der Berliner Konstruktivismus und das avantgardistische Objekt«. In: Schrift Bilder Denken. Walter Benjamin und die Künste. Hg. v. Detlev Schöttker. Frankfurt a.M. 2004, 48–69. Kracauer, Siegfried. Die Angestellten. Aus dem neusten Deutschland [1930]. Frankfurt a.M. 15 2017. Kracauer, Siegfried. Das Ornament der Masse [1963]. Frankfurt a.M. 12 2014. Kracauer, Siegfried. »›Oktoberrevolution‹. Revolutionärer Realismus« [1933]. In: Ders. Werke. Bd. 5.4: Essays, Feuilletons, Rezensionen. 1932–1965. Hg. v. Inka Mülder-Bach. Frankfurt a.M. 2011, 367–372. Kracauer, Siegfried. »Soziologie als Wissenschaft« [1922]. In: Ders. Werke. Bd. 1: Soziologie als Wissenschaft. Der Detektiv-Roman. Die Angestellten. Hg. v. Inka MülderBach. Frankfurt a.M. 2006, 9–101. Mülder-Bach, Inka. Siegfried Kracauer – Grenzgänger zwischen Theorie und Literatur. Seine frühen Schriften 1913 bis 1933. Stuttgart 1985. Oschmann, Dirk. »Kracauers Herausforderung der Phänomenologie. Vom Essay zur ›Arbeit im Material‹«. In: Essayismus um 1900. Hg. v. Wolfgang Braungart/ Kai Kauffmann. Heidelberg 2006, 193–211. Schlaffer, Heinz. »Denkbilder. Eine kleine Prosaform zwischen Dichtung und Gesellschaftstheorie«. In: Poesie und Politik. Zur Situation der Literatur in Deutschland. Hg. v. Wolfgang Kuttenkeuler. Stuttgart et al. 1973, 137–154. Schöttker, Detlev. Konstruktiver Fragmentarismus. Form und Rezeption der Schriften Walter Benjamins. Frankfurt a.M. 1999. Stalder, Helmut. Siegfried Kracauer. Das journalistische Werk in der »Frankfurter Zeitung« 1921–1933. Würzburg 2003. Todorow, Almut. »Unbegrifflichkeit und Essayismus: Siegfried Kracauers Das Ornament der Masse«. In: Unbegrifflichkeit. Ein Paradigma der Moderne. Hg. v. ders./ Ulrike Landfester/Christian Sinn. Tübingen 2004, 107–124.
Erinnerung an 1918. Rückblick und Deutung der Exilgegenwart in Anna Seghers’ Die Toten bleiben jung und Alfred Döblins November 1918 Christine Waldschmidt
1. Exil-Gegenwart und Deutungsanspruch Es ist ein bekanntes Faktum, dass für die Exilautor:innen in den späten 1930er Jahren mit der zunehmenden Dauer des Exils die Auseinandersetzung mit dem historischen Aufstieg des NS zur durchgesetzten sowie politisch, ökonomisch und kulturell stabilisierten Staatsräson Deutschlands unabweisbar wurde. Damit einher ging nicht nur eine verstärkte Reflexion der eigenen Exilsituation, sondern – insbesondere bei linken bzw. linksintellektuellen Autor:innen – eine geänderte Auffassung über die Möglichkeiten des Engagements und über diejenigen gesellschaftlichen Schichten, die sie zuvor als Träger eines möglichen Widerstands angesehen hatten. Ins Zentrum rückte nun mehr und mehr die analytische Frage nach der offensichtlich vorhandenen Massenbasis des NS-Regimes und seiner Durchsetzung, nach den Gründen der ideologischen Vereinnahmung und dem staatlich organisierten Antisemitismus, aber auch nach der alltäglichen Mitwirkung weiter bürgerlicher wie proletarischer Schichten an der Nazi-Herrschaft. Auch die späte Phase des Exils und die sich abzeichnende und schließlich eintretende militärische Niederlage Hitler-Deutschlands änderte an der Virulenz dieser Fragen nichts mehr – sie wurde höchstens in den Begegnungen der Remigrant:innen mit Deutschland noch einmal erneuert. Das Spezifische an den Zeitdiagnosen aus den 1940er Jahren und dem Nach-Exil ist allerdings, dass sich in ihnen dieser gesellschaftlich-analytische Klärungsbedarf mit einem Selbstverständnis und einem dichterischen Auftrag verbindet: Man sah sich in einen geschichtlichen Umbruch gestellt und zu Wortmeldungen zu einer Gegenwart verpflichtet, die einerseits den Exilautor:innen nahelegte, sich in ihrem antifaschistischen Engagement historisch ins Recht gesetzt zu sehen (vgl. Spies 2013, 100), für die andererseits aber völlig offen und noch nicht (praktisch) ausgemacht war, wohin diese Gegenwart sich gesell-
144
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
schaftspolitisch entwickeln würde – eine Lage, welche die Autor:innen als Aufforderung interpretierten, die eigenen Lehren aus der jüngsten Vergangenheit in die Debatten über die Gestaltung der Zukunft einzubringen und deren prognostizierte Entwicklungsmöglichkeiten an ihren eigenen Erwartungen zu messen. Vor dem Hintergrund einer solchen unabweisbaren Dringlichkeit und historischen Relevanz der Deutung eigener Gegenwart entstehen zahlreiche historische Romane des Exils, darunter auch einige, die sich mit der jüngsten Vergangenheit befassen und – mit Blick sowohl auf die ›Ursachen‹ der Durchsetzung des NS-Regimes als auch auf die mögliche Entwicklung nach dem Krieg und dem Ende des faschistischen Staates – das Jahr 1918 und die gescheiterte Revolution in den Fokus der Betrachtung rücken.1 So findet Alfred Döblins Roman-Trilogie November 1918, die der Autor 1937 in Frankreich begann und deren erster Teil 1939 publiziert wurde, im amerikanischen Exil nach 1940 seine Fortsetzung bzw. Fertigstellung: Die zwei Teile des zweiten Bandes (bzw. die Bände zwei und drei)2 beendet Döblin 1940/41 und ergänzt diese 1943 um den letzten und umfangreichsten Band (vgl. Links 1981, 306f.; Kiesel 1986, 275–277; Sander 2001, 201). Anna Seghers arbeitet ihren (seit 1939 geplanten) Roman Die Toten bleiben jung ab 1944 in Mexiko aus; fertiggestellt wird er nach Seghers’ Rückkehr nach Berlin (vgl. Hilzinger 2000, 184; Schrade 1993, 78; Franz 1987, 135f.). Beide Werke erscheinen erst in der Nachkriegszeit – Seghers’ Roman 1949, Döblins Trilogie 1948–503 . Mit ihrem Rückblick auf die Novemberrevolution 1918 und ihre Folgen schreiben sich beide Texte in ein Feld konkurrierender Erinnerungsnarrative zur jüngsten Vergangenheit ein. ›Erinnerung‹ erscheint damit in den Texten als – in ganz unterschiedlicher Weise – ambitioniert betriebene Erinnerungspolitik, als eine literarische und politische-ideologische Deutungsleistung zum Vergangenen.4 Das Generieren von aktueller Verbindlichkeit und gegenwärtiger Relevanz dieser Deutung wird dabei in beiden Werken in die narrativen Modi einer bilanzierend Rückblick haltenden Darstellung verlagert.
1 2
3
4
Vgl. dazu und zum diese Romane prägenden Bewusstsein, an einem historischen Wendepunkt zu stehen, die Hinweise bei Franz 1987, 136. 1943 entschloss sich Döblin, den zweiten Band in zwei Teile aufzuteilen, und sprach nun von einer ›Tetralogie‹, vgl. Kiesel 1986, 274f. (dort auch Hinweise zu den unterschiedlichen Bandzählungen) sowie Sander 2001, 202. Die Publikation 1948–50 umfasst nur drei Bände; der erste Band wurde wegen Einwänden der französischen Zensurbehörden, die »elsässische Dinge nicht zu berühren« (Döblin [1947] 1970, 379) wünschten, auf ein ›Vorspiel‹ reduziert (vgl. Links 1981, 307). Erinnerung ist hier also nicht als – der psychologischen Form nach – Identität prägendes und die Unmittelbarkeit bzw. Präsenz der Erfahrung von Bedrohung und Flucht, die sowohl Seghers als auch Döblin ihres politischen wie ihres jüdischen Hintergrundes wegen betraf, verlängerndes und deshalb Verbindlichkeit für die Gegenwart reklamierendes Moment verstanden, sondern fungiert ganz im Dienste der politischen Deutung.
Christine Waldschmidt: Erinnerung an 1918
Zwar ist die erzählerische Strategie, den Geltungsgrund des eigenen Urteils über die Gegenwart durch Rückblicke in die (jüngere) Vergangenheit abzusichern, kaum innovativ zu nennen: Über den Rückblick wird in der Regel das Zusammentreffen bzw. Übereinstimmen von eigenem Urteil und aktuellem Resultat der Weltläufte mit der Notwendigkeit bzw. Folgerichtigkeit seiner Entstehung bestätigt, oder kürzer gesagt: das eigene Urteil über die Welt als Gesetz ihrer Verläufe gezeigt. Beide Romane nutzen diese Strategie jedoch, um darin eine paradoxe Konstellation zu entfalten, über die ihnen das Beharren auf einer kritischen (sei es hinsichtlich gesellschaftlicher Alternativen konstruktiven, sei es diesbezüglich eher desillusionierten) Zeitdiagnose noch möglich ist: Die Romane von Seghers und Döblin halten zum einen den mit der Perspektive ex post, also mit dem Bestimmtsein der Ereignisse durch ihr Resultat, eingeführten, erst einmal ganz abstrakten Gedanken einer Notwendigkeit der Abläufe fest; der Inhalt ihres Urteils aber soll gerade ein Dementi dieser (schlechten) Notwendigkeit darstellen – eine prekäre Standortbestimmung, deren Ambivalenz bereits in der Anlage der rückblickenden Perspektive der Romane sichtbar ist: Als Erörterung der Frage, »wodurch alles so gekommen war« (Döblin 2015, 298) bzw. ›wie es zu all dem, und d.h. zur NS-Herrschaft, kommen konnte‹, will dieses erinnernde und bilanzierende Erzählen sowohl die Vorstellung einer Folgerichtigkeit des Verlaufs festhalten wie die der Differenz zu einer gewünschten Entwicklung als dem eigentlich Gültigen.
2. Einordnung der gescheiterten Revolution: negative Kontinuität als Grundlage für eine Emphase des Widerstands Für beide Romane ist der Rückblick auf 1918 die Erinnerung an eine Niederlage bzw. ein umfassendes Scheitern, und beide entwickeln ihre Erzählung davon ausgehend als breit angelegtes Panorama der gesellschaftlichen Kräfte in dieser Zeit. Seghers’ Die Toten bleiben jung ist dabei als ›Epochenroman‹ und eine »Bilanz deutscher Geschichte« (Maag 1984, 8)5 konzipiert: Die Perspektive des Erzählens 1944/45 ist die des Wissens um die Durchsetzung und um den militärischen Untergang des NS-Staates (vgl. Bock 1981, 367; Spies 2013, 99f.). Das Scheitern der Revolution von 1918 erhält im Roman den Stellenwert eines Ausgangspunktes, von dem aus die Entwicklungen hin zum Faschismus und in den Zweiten Weltkrieg in parallel verlaufenden, episodisch auftauchenden Erzählsträngen zu Figuren unterschiedlicher gesellschaftlicher Schichten (Adel, Militär, Industriekapital, Grundbesitzer,
5
Leicht variierte Formulierungen dieser Charakterisierung des Romans finden sich quasi standardmäßig, vgl. Bock 1981, 374, 390 (»Epochenbilanz«); Franz 1987, 136 (»bilanzierende[r] Epochenrückblick«); Spies 2013, 99 (»Roman einer Epoche«); Hilzinger 2000, 184 (»ein Panorama dieser Epoche deutscher Geschichte«).
145
146
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Bauern, Dienstpersonal und Arbeiter) nachgezeichnet werden, die nicht zuletzt hinsichtlich ihrer Beiträge zur Durchsetzung des NS-Staates befragt werden (vgl. Maag 1984, 8f.). Seghers’ Roman erzählt von 1918, indem er das Niederschlagen der Revolution durch Regierungstruppen und Freikorps an den Anfang des Epochenbildes stellt – geschildert wird es als in den Wirren der Zeit unbemerkt bleibende Hinrichtung eines Teilnehmers am bewaffneten Aufstand der Soldatenräte, der beim Kampf um den Marstall verhaftet und durch eine Gruppe Offiziere in einem Wald bei Berlin erschossen wird: »Macht Schluß!« Erwin verstand die Worte, obwohl sie der Hauptmann nur knurrte. Er begriff, daß sein Ende bevorstand. Als gestern die weißen Garden den Marstall gestürmt hatten, war ihm sein eigener Tod noch unfaßbar erschienen. […] […] Er machte eine Art Schulzeit durch im Schützengraben zwischen zwei Schlachten. Der Wind aus dem Osten trieb durch Deutschland, das, müde und hungrig, den vierten Kriegswinter erwartete, in einer verregneten Novembernacht das Laub aus dem roten Oktober an. Die Revolution war so jung wie er selbst. […] Sie hatten darunter nicht bloß den Umsturz verstanden, den Sowjetstaat, oder »Alle Macht den Räten!«. Sie hatten darunter das neue Leben verstanden, das mit dem vergangenen sowenig zu tun hatte wie das Jenseits mit dem Diesseits. Sie hatten die Aufteilung des Bodens genauso erwartet wie unerhörte Gefühle in ihrem Innern. Er hatte für sich genauso gehofft, daß er vielleicht jetzt doch noch Maschinenschlosser werden könnte […]. Dafür hatten sie sich wochenlang in den Straßen von Berlin geschlagen; zuletzt gegen die weißen Garden, die Noske zu Hilfe geholt hatte. Die Republik war ja im November wie das Kind im Märchen mit weißen Haaren greise zur Welt gekommen, gelähmt von den Lasten und Lastern der alten Zeit. Wenn jetzt sein eigener Tod wieder möglich wurde, hielt er ihn für eine beiläufige Episode in dem gemeinsamen Leben, das stürmisch weiterging mit ihm oder ohne ihn. Erst als die Garde den Marstall gestürmt, die nächsten Gassen besetzt und alle Gefangenen ausgezählt hatte, war ihm klargeworden, daß er eine nur ihm bestimmte Position in dem gemeinsamen, immerfort auffüllbaren Leben hatte, einen ihm zugemessenen Anteil am Leben und Sterben. […] […] Er rief oder glaubte zu rufen, denn seine Stimme war schwach: »Ihr könnt jetzt Schluß mit mir machen. Ihr kommt aber auch noch dran.« – Er fiel um, in den Kopf getroffen. (Seghers [1949] 1981, 7–10) Die Szene steht nicht nur am Anfang des Romans, sie ist in zweierlei Hinsicht als Beginn einer Entwicklung markiert. Erstens sind auf Seiten der Gegner der Revolution in dieser Szene fast alle Protagonisten der folgenden Episoden versammelt, deren Karrierewege und private Verhältnisse in der Weimarer Zeit im Roman auserzählt werden. Der Tote wiederum hinterlässt eine schwangere Freundin, deren Geschich-
Christine Waldschmidt: Erinnerung an 1918
te bzw. die ihres Sohnes einen weiteren Erzählstrang darstellt. Die Relation von Ausgangspunkt und Fortführung der Geschichten bietet dabei die geradezu überdeutliche Umsetzung jenes abstrakten Gedankens eines vom Ende her betrachtet mit Notwendigkeit erfolgenden Verlaufs, welchen die Perspektive, die ex post um den historisch desaströsen Ausgang weiß, generiert: Erzählerisch ausgestaltet ist sie als Überbetonung der Struktur von Voraussetzung und Einlösung. So gleichen die letzten Worte (oder Gedanken) des Opfers: »Ihr könnt jetzt Schluß mit mir machen. Ihr kommt aber auch noch dran« einer Vorausdeutung, die der Roman bestätigen wird. In den folgenden Jahren werden alle Beteiligten an Erwins Ermordung aus unterschiedlichen Gründen zu Parteigängern der Nazis und zu Beteiligten auch an den Gewalttaten des Zweiten Weltkrieges, in dem sie aber schließlich alle umkommen (abgesehen von Becker und Klemm, die beide schon zuvor bei Beckers Selbstmord sterben). Hauptmann von Wenzlow, der die tödlichen Schüsse auf Erwin abgegeben hatte, begeht am Ende in einer ausweglosen militärischen Lage Selbstmord, nachdem er ausgerechnet Hans, den Sohn Erwins, als Deserteur erschossen hat – und ihm dieser als Erscheinung des toten Revolutionärs von 1918 vorgekommen war. Nicht nur dieses geradezu aufdringliche Schließen des Kreises,6 das die mit der Revolution 1918 eröffnete historische Phase mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu einer abgeschlossenen erklärt, sondern auch die Geschichte von Erwins Sohn Hans, der, ohne seinen Vater zu kennen, dessen Ideale fortführt und – ausgerechnet durch Erwins einstigen Mitkämpfer und Freund Martin – zum Bewusstsein seiner Klasse und ihres historischen Auftrags gelangt, ist narrativ als Fortsetzung und Entsprechung zu den Hoffnungen seines Vaters, als deren Einlösung in Form einer Generationenfolge, gestaltet (auch in dieser Hinsicht bleiben die Toten jung). Zweitens enthält die Szene aus der Revolution von 1918 die Behauptung zweier negativer Kontinuitäten: Die Revolution ist nämlich der Anlass, die Wirkungsgrundlage der herrschenden und ihre überlegene Gewalt in der Niederschlagung der Revolution unter Beweis stellenden Schichten schon 1918 als bloße Fortsetzung darzustellen (vgl. die Hinweise auf »die Lasten […] der alten Zeit« oder die schon alt geborene Revolution) und für die folgenden Jahre nur mehr eine Kontinuität ihrer Teilhabe an der Gewalt – inklusive des Zusammenschlusses mit dem nächsten Gewaltregime – sowie das Fortbestehen eines kapitalistischen Systems zu entfalten, das den Krieg als »notwendiges Mittel [seines] Machtanspruchs« (Spies 2013, 103) perpetuiert. 1918 erscheint gleichsam als Beleg dafür, dass erneut all die Gründe wirksam werden, die diese Durchsetzung der Herrschenden begünstigt haben und weiterhin begünstigen. Dass die Niederlage der Revolution 1918 auch Anfang und
6
Mit der Ermordung von Hans ist der Kreis »geschlossen, die Ausgangslage von 1918 wiederhergestellt« und auch in der Fortsetzung des kommunistischen Kampfes über die Generationen hinweg reproduzieren sich nur die Gewalttaten, deren Opfer die Revolutionäre werden (Spies 2013, 101).
147
148
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Fortgang des sozialistischen Widerstands gegen diese Gewalt und seines wiederkehrenden Scheiterns sowie die Fortsetzung der im Widerstand geforderten Opfer bedeutet, ist die parallel dazu angelegte Kontinuität. Seghers’ Roman bleibt allerdings bei diesem durchaus bitteren Resümee des historischen Ablaufs nicht stehen. Die Plausibilisierung der vom Ende her gedachten Entwicklungen und ihrer erzählerischen Darstellung, d.h. der narrativen Folgerichtigkeit, ist nämlich darauf angewiesen, diese Notwendigkeit als eine in den historischen Verläufen und Übergängen enthaltene und wirksame nachzuweisen. Zu diesem Zweck betreibt der Text einen großen Aufwand im Entfalten der Übergänge, die von der Niederschlagung der Revolution und später der Ruhrblockade zur Festigung der Machtbasis ihrer Gegner bis hin zu Aufstieg und Durchsetzung des NS-Regimes führen. Er liefert darin allerdings nicht einfach nur Bebilderungen der narrativ implizierten Notwendigkeit, sondern Gründe für die Entwicklung. Hier liegt nicht nur die analytische Qualität des Romans; das narrative Schließen des Kreises ergibt auf diese Weise auch in inhaltlicher Hinsicht mehr als den bloßen Beweis seines Zustandekommens. Bereits am oben zitierten Anfang des Romans ist diese Richtung der Erzählung ablesbar: Der Roman bebildert hier die Niederlage der Revolution als Ende einer persönlichen Hoffnung wie auch der allgemeinen, ihr entsprechenden politischen Umwälzung, wobei er Wert darauf legt, dass beides ineinander aufgeht, aber auch immer wieder (in den ganz individuell ausfallenden Hoffnungen Erwins sowie in der Verdoppelung der politischen Ziele in ein ihnen zugeordnetes Gefühl) voneinander zu trennen ist. Das ist nicht nur ein Hinweis auf die Fassung des revolutionären Anliegens als Entsprechung zu einem Ideal des Menschlichen, das in ihm zum Zuge kommt, indem es der Entfaltung des Einzelnen Geltung verschafft und diese gerade nicht einfach unter das allgemeine Anliegen subsumiert, sondern auch auf die im gesamten Roman fortgesetzte Erzählweise, welche die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen als Ergebnis der Betätigung, des Kalküls und – vor allem – der Entscheidung des Einzelnen darstellt und darin immer Verhältnisse der einzelnen Figuren7 zu den Ereignissen, zur politischen und wirtschaftlichen Lage der Dinge einrichtet.8 Das ist ein Darstellungsmodus, der den abstrakten Gedanken 7
8
Dazu gehört auch die – in der Forschung wiederholt festgestellte – Erzählstrategie, alle »ZeitEreignisse wie die französische Besetzung des Rheinlandes, de[n] Kapp-Putsch, de[n] Tod Lenins, de[n] Spanienkrieg, die Pogromnacht, Konzentrationslager, ›Judentransporte‹« über die Reaktionen und Kommentare der Figuren vorkommen zu lassen (Hilzinger 2000, 185) bzw. historische Ereignisse stets dadurch zu thematisieren, dass die Romanfiguren mit ihnen konfrontiert werden und sie ihnen als persönliche Entscheidungssituationen entgegentreten (vgl. Bock 1981, 388f.). Ebenso wenig wie die formale, durch das Wissen um das Resultat der historischen Entwicklungen hergestellte Suggestion der Folgerichtigkeit sich auf deren weltanschaulichen Inhalt festlegt, ist deren Plausibilisierung darauf gerichtet, die Subjekte als dem Geschehen bloß unterworfen zu zeigen. Dass die Narration im Ganzen von einer »sozialgeschichtliche[n]
Christine Waldschmidt: Erinnerung an 1918
der Folgerichtigkeit, den der Roman konstruiert, in seiner Entfaltung in lauter konkrete soziale, ökonomische und psychologische Gründe auflöst. So wird erzählt, wie der Bauer Nadler sein hartes, schäbiges und wirtschaftlich prekäres Leben gerne für die Mitgliedschaft in Freikorps und ein Aktivwerden im Dienst der NSDAP aufgibt, da ihm dies zwar keinen wirtschaftlichen Aufstieg, wohl aber eine Überlegenheit als Ausübender der Gewalt einbringt; oder es werden die Überlegungen der Industriellen Klemm und Castricius dargestellt, die über eine Instrumentalisierung der Nazis und ihres Aufstiegs für eine ihnen günstige Lenkung der Arbeiterklasse diskutieren, womit sie zu Handlangern dieses Aufstiegs werden.9 Der adlige von Lieven, Mitglied der Freikorpstruppen im Baltikum, nach dem Krieg ohne Vermögen und sozial abgestiegen (vgl. Franz 1987, 144), legt hingegen eine als Überlegenheitsattitüde auftretende moralische Skrupellosigkeit an den Tag,10 die mit seinem Eintreten in die Waffen-SS nur ein praktisches Betätigungsfeld für seinen ›philosophischen‹ Zynismus findet. Für alle durchaus kleinschrittigen narrativen Entfaltungen der Gründe und materiellen wie psychologischen Konstellationen auf dem Weg zum NS-Staat gilt: In der Plausibilisierung der folgerichtigen Abläufe führt der Roman ein Moment der Unterscheidung zwischen ihnen und ihrem Zustandekommen ein und weist sie darin nicht als über die Welt verhängte, vielmehr als eine erst hergestellte Folgerichtigkeit aus.11
9
10
11
Determination« (Schrade 1993, 81) bzw. der »soziale[n] Determiniertheit allen Geschehens« (Bock 1981, 390) spreche oder den »Funktionsmechanismus zwischen Individuum und Klasse« (Bock 1981, 377) sichtbar mache, scheint mehr eine an den Text herangetragene Erwartung darzustellen und mit dem Ausweis einer Begründung von Haltungen und Entscheidungen aus konkreten gesellschaftlichen Gewalt- oder Abhängigkeitsverhältnissen oder sozial-psychologischen Faktoren nicht einfach deckungsgleich zu sein. Die Vertreter des Großkapitals setzen auf den Faschismus als Garant ihrer Macht – zum einen da sie die faschistische Ideologie der ›Volksgemeinschaft‹ als Mittel gebrauchen wollen, um die sozialistische Bewegung zu unterdrücken bzw. durch das nationalistische Programm die Arbeiter zu Mitwirkenden am Erhalt des wirtschaftlichen Systems zu machen, indem es ihnen als nationale Anstrengung vorgestellt wird, zum anderen weil mit dem Krieg der ökonomischen Macht neue Märkte und Rohstoffquellen erobert werden sollen (vgl. Maag 1984, 13, 15; Spies 2013, 102). Den Zusammenhang von NS-Regime und ökonomischen Interessen aufzuzeigen, ergibt in der narrativen Gestaltung etwas anderes als den abstrakten Verweis auf den Kapitalismus als Hauptursache des Faschismus, also auf die notwendige Kontinuität von Kapitalismus und Faschismus gemäß marxistischer Faschismustheorie (so aber Maag 1984, 11, 15). Gerade der Charakter Lievens wird dafür »in seinen psychischen Dispositionen und seinem […] Verhalten anderen Menschen gegenüber mit erheblichem Aufwand gestaltet« (Franz 1987, 143). Insbesondere in der westdeutschen Forschung ist Seghers’ Roman einige Zeit vorgeworfen worden, er gestalte seine Figuren nur als rein illustratives Material geschichtstheoretischer Thesen oder Konstrukte, sodass in ihnen keine Individualität vorkomme (vgl. z.B. Greiner 1983, 351f.; eine Übersicht über diese Rezeption bei Franz 1987, 141); die Kritik an diesem Urteil
149
150
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Die zweite Wendung liegt darin, dass der Vergleich von Ausgangs- und Endpunkt der Handlung eben nicht nur von einer Entsprechung zeugt, sondern auch von einer kleinen, aber entscheidenden Differenz (vgl. Spies 2013, 103): Der umfassende Untergang am Ende betrifft erneut die Kommunisten, aber nun trifft er auch die Inhaber der militärischen und gesellschaftlichen Gewalt. Das ist durchaus so gemeint, dass hierin der Untergang dieser Gesellschaft besiegelt wird, dass die Figuren durch ihre Mitwirkung am NS-Regime in letzter Instanz ihre eigenen Ziele untergraben, sie selbst ihren Untergang herbeiführen (vgl. Spies 2013, 102); hingegen ist der Untergang für die kommunistischen Kämpfer nur der Beweis für einen stets fortgesetzten und durch keine Niederlagen völlig auszuschaltenden Widerstand. Seghers’ Roman entwirft die Erzählung einer bis zur Gegenwart des militärischen Endes des NS-Regimes nachgezeichneten Entwicklung der Verhältnisse und der in sie eingebundenen Individuen, in der sich die Gewalt der Herrschenden ebenso bestätigt wie historisch um ihre Macht bringt und in der sich der Widerstand von 1918 als Kontinuität in allen und trotz aller Niederlagen erweist – es ist, wie Bernhard Spies das Paradox formuliert, auf sozialistischer Seite »zwar kein Sieg zu verzeichnen, aber so etwas wie Unbesiegbarkeit erwiesen« (Spies 2013, 103; vgl. auch Franz 1987, 139, 174), die als Potential auch und gerade für die Gegenwart in Anspruch genommen werden kann.12
3. Revolutionspanorama ohne Zusammenhang: Notwendigkeit und Relativierung des Politischen Döblins Roman November 1918 nimmt hingegen die Revolution nicht als Ausgangspunkt einer durch die Weimarer Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg nachgezeichneten Entwicklung, vielmehr entfaltet er die Vorgänge in den Monaten der Revolution selbst als großangelegtes Panorama. Die episodische Struktur der Darstellung, die er mit Seghers’ Roman teilt, wird hier sowohl quantitativ erweitert als auch in gar
12
hat dann zumeist die narrativen Qualitäten oder die psychologische Plausibilität der Figurengestaltung hervorgehoben (vgl. Schrade 1993, 79f., Hilzinger 2000, 185), es ist aber gerade die Ausgestaltung der narrativ eingerichteten Folgerichtigkeit als Begründungsverhältnisse, die gegen ein rein ›thesenhaftes‹ Erzählen arbeitet. Es handelt sich gerade nicht um eine Erzählung vom ›Sieg‹ der Arbeiterklasse oder um eine fiktionsimmanente Anerkennung, dass dieser Klasse ›die Zukunft gehört‹ (so aber Maag 1984, 9, 16f., 41). Das ist auch daran erkennbar, dass solche Interpretationen stets Niederlage und Untergang der anderen Seite schon als Gewinn für den kommunistischen Widerstand verbuchen müssen (vgl. etwa Schrade 1993, 82). Der Hinweis auf eine neue Generation des kommunistischen Widerstands, auf Emmis Kind (vgl. Maag 1984, 9, 17), widerspricht ebenfalls noch nicht per se der Möglichkeit einer erneuten Fortsetzung der negativen Kontinuität und weiterer Niederlagen.
Christine Waldschmidt: Erinnerung an 1918
nicht anders als durch die zeitliche Koinzidenz zusammenhängende und nicht in allen Fällen kontinuierlich weiterverfolgte Szenen und Figurenkonstellationen überführt.13 Gerade die ersten beiden Teile (I: Bürger und Soldaten 1918 und II,1: Verratenes Volk), deren Darstellung der Revolution hier behandelt werden soll, verfolgen – wie wiederholt bemerkt wurde (vgl. z.B. Kiesel 1986, 350) – einen quasi chronikalischen Ansatz, der die Szenen nach den Tagen der Revolution aufreiht. Die Perspektive ex post ist hier erst einmal abstrakt implementiert als das Wissen um das Scheitern der ›deutschen Revolution‹ (vgl. u.a. Althen 1993, 84), aber auch um den weiteren historischen Verlauf, das der historischen Phase ihre gegenwärtige Bedeutung erst zukommen lässt.14 Zudem formulieren die ab dem Band II,1 auftretenden (teils in ironischem Ton gehaltenen) Zusammenfassungen der Ereignisse am Anfang der Kapitel und die Kommentare einer mehr und mehr hervortretenden Erzählerstimme auch explizit eine deutende Perspektive zum Geschehen.15 Der Beginn des Romans, der sich dem Abzug der deutschen Soldaten aus dem Elsass nach der Kapitulation, Auf- und Abmärschen der Truppen, der Bildung von Soldatenräten wie den Reaktionen in der Bevölkerung und den Neuordnungen der Verhältnisse widmet, zeigt in seinen Szenen die schrittweise Auflösung der alten Ordnung. Zum einen lässt der Roman keine Zweifel daran, dass er diese Auflösung der alten, vom Militär gestützten und durchdrungenen Strukturen durchaus als zustimmungswürdiges Unterfangen betrachtet. Beispielhaft zeigt dies der in Bürger und Soldaten 1918 eingeschobene Bericht über die letzten Kriegsmonate: Dieser läuft durchweg hinaus auf den Gegensatz zwischen militärhistorischer
13
14
15
Zur Montagetechnik vgl. Kiesel 1986, 297–299, der diese in November 1918 allerdings als ›reduziert‹ beschreibt, gerade dem ersten Band aber noch eine »fast verwirrende[] Fülle kontrastiver ›Momentaufnahmen‹« attestiert (vgl. Kiesel 1986, 331). Dollinger 1994, 167f., begründet den Charakter von November 1918 als Zeitroman mit dem Verweis darauf, dass die Darstellung des Revolutionsgeschehens »von einem Erzähler, den der Nationalsozialismus bereits eingeholt hat«, präsentiert werde, das Wissen um die gegenwärtige Situation damit in die Vergangenheit hineingetragen sei und für diese Vergangenheit auch eine Relevanz hinsichtlich der Gegenwart behauptet werde; der Roman behandle die Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs und sei gleichzeitig ein Kommentar zu Entstehung und Durchsetzung des Nationalsozialismus. Vgl. etwa: »Überblicken wir an diesem Punkt die Ereignisse, die verflossen sind und uns unabwendbar überströmen, und bedenken wir, von einer erklärlichen plötzlichen Müdigkeit überfallen unter dem unaufhaltsamen Ansturm der Begebenheiten (und es sind erst zwanzig Tage der Revolution vorbei), was nun kommen wird, so ist uns schon einiges klar: mit der Revolution wird es auf diese Weise nicht vorwärtsgehen. Es wird mit ihr wahrscheinlich rückwärtsgehen« (Döblin [1948] 2008b, 279). Der Erzähler inszeniert sich hier überdeutlich als »urteilende[] Instanz« und sein Material als historisch verfügbares und bereits eingeordnetes (vgl. Dollinger 1994, 168, 169). Solche expliziten Urteile unterstreichen allerdings in der Tat nur, »was die zuvor erzählten Geschichten im Zusammenspiel von Erzählinhalt und Erzählstil ohnehin schon deutlich genug verraten« (Kiesel 1986, 287).
151
152
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Bestandsaufnahme bzw. Ausführungen zu den militärischen Strategien, in denen alles (Waffen wie Menschen) als quantitativ und nach noch vorhandener oder schon verbrauchter Tauglichkeit erfasstes Material sowie als Teil einer Maschinerie der Abläufe behandelt ist, und den Subjekten, über die in diesem Geschehen verfügt wird und zu dem es sich in aller Regel als bloße Brutalität verhält. Artikuliert ist darin deutlich genug der Gedanke, dass eine solcher Ordnung abgelöst werden, dass etwas anderes in dieser Welt gelten müsse. Die Szenen aus dem Elsass zeigen freilich auch, wie diese Auflösung der Ordnung im Gefolge der militärischen Niederlage aussieht: Sie manifestiert sich zwar als Unordnung, aber nicht als Chaos, sondern als eine Reihe von Widersprüchen: Für den frühen Nachmittag wurden alle Mann auf den riesigen Exerzierhof der Artilleriekaserne berufen, und von einem Fenster der ersten Etage schrien Soldaten heraus, neben denen einer eine kleine rote Fahne schwenkte. Das war der Soldatenrat. Einer schrie herunter: »Man plündert. Die Wachen werden scharfe Patronen bekommen. Wer ein und aus geht, wird kontrolliert.« Absolute Stille. Oben Gebrüll: »Wer erwischt wird, kommt vor Gericht.« Einzelne unten: »Wer ist das Gericht?« »Kameraden, es muß Ordnung gehalten werden. Diejenigen, die noch nicht wissen, was Revolution ist und die sie kompromittieren, sollen es erfahren. Wir haben Verräter zwischen uns. Wir haben Feinde der Revolution unter uns. Wer stiehlt, ist ein Feind der Revolution. Die Elsässer werden uns überfallen.« »Wir haben Gewehre.« »Sie auch. Gewehre und Maschinengewehre vom Flugplatz sind verschwunden. Wo sind sie?« Unwillen unten. Man schrie: »Abmarschieren!« Männer im ersten Stock: »Das ist leicht gesagt. Wir warten auf Waggons.« »Da könnt ihr lange warten. Wir wollen abziehen.« (Döblin [1939] 2008a, 61f.) Die sich nach der Kapitulation ergebende Auflösung des Heeres und seiner Hierarchien und die Versuche einer praktischen Beantwortung, wie eine neue politische Ordnung aussehen soll, ergeben hier ein vielstimmiges und im unvermittelten Gegeneinander der Stimmen uneinheitliches Bild, das gleich mehrere Widersprüche entfaltet: Die Revolutionäre gerieren sich als neue Ordnungsmacht, die die Form der bisherigen militärischen Disziplin nun auf die Revolution übertragen will, der aber die Gewaltmittel fehlen. Zudem zeigt die Szene einen Gegensatz zu denjenigen, die das politische Anliegen nicht teilen bzw. ihm nicht primäre Relevanz zuweisen und die sich deshalb seiner Mittel, einer Fortsetzung der militärischen Ordnung, verweigern. Die Gegensätze treten nicht in der Ausführung der unterschiedlichen Auffassungen hervor, sondern indem die Einwürfe einfach durchweg das gerade Beanspruchte wieder in Frage stellen – in seiner Durchsetzungsfähigkeit, aber auch in seinem politischen Inhalt, bis am Ende gänzlich bestritten ist, dass es ein solches politisches Anliegen gebe.
Christine Waldschmidt: Erinnerung an 1918
Andere Szenen aus dem elsässischen Städtchen und auch aus Straßburg legen weitere Konflikte offen: die zwischen einer bürgerlichen Bevölkerungsmehrheit, die den Wechsel der Machtverhältnisse als ihre wirtschaftliche Chance versteht, und Anstrengungen prekärer Existenzsicherung sowie einzelnen Rache- und Plünderungsaktionen,16 der (Nicht-)Organisation des deutschen Abzugs und Äußerungen eines französischen Patriotismus, zwischen revolutionären Gremien, der das Ende der Revolution erklärenden SPD-Regierung in Berlin und der Reorganisation der alten Kräfte. Auch mit dem Wechsel des Schauplatzes nach Berlin setzt sich diese Tendenz der Darstellung fort: Einzelne Episoden zeigen viele und mit gar nicht geringem Engagement am revolutionären Geschehen oder seiner Bewertung irgendwie Beteiligte, ebenso aber ihre ganz unterschiedlichen Zielsetzungen und Interessen an der Revolution (vgl. Althen 1993, 104f.). Gerade dort, wo die Revolution nach ihrer Massenbasis, also nach ihren potentiellen Trägern fragt, wird die Diagnose von der Disparatheit der von der Revolution erfassten Sphären und Interessen virulent. Dabei geht es dem Text nicht einfach darum, dass die jeweiligen Personen aus unterschiedlichen Gründen bei der Revolution mitmachen oder nicht, dass nicht nur ihre Motive und Erwartungen verschiedene sind, sondern darum, dass die Revolution darin gar nicht mehr als Zusammenhang oder Zusammenfassung dieser unterschiedlichen Anliegen vorkommt, in dem sie die partikulären Aspekte aufheben könnte. Die nebeneinanderstehenden Gegensätze werden – weder in der einzelnen Szene noch im Verhältnis der Szenen zueinander – aufgelöst, und diese Gleichzeitigkeit des Verschiedenen, genauer: des Widersprüchlichen, negiert immer wieder eine Zielrichtung der historischen Geschehnisse, was sie aber generiert, ist deren Dynamik. Ein Beispiel dafür – nun zu den Geschehnissen in Berlin – mag der Abschnitt »Beerdigung der Revolutionsopfer« darstellen: Auf der einen Seite stellt der Text die auftauchenden Menschenmassen heraus, die durch ihre schiere Quantität eine neue Bedeutung gewinnen: Maus verstand nichts. Er fühlte sich vor den Kopf geschlagen, denn der Aufmarsch war gewaltig, er nahm kein Ende, die Leute sahen gewiß friedlich aus, aber waren ungeheuer viel; und grade das war entsetzlich, daß diese einfachen friedlichen Leute, diese Schar kleiner Leute, Männlein und Weiblein, hier offen mitzogen, auf der Seite der Revolutionäre. […] Da gingen in Uniform zwei französische Kriegsgefangene und winkten nach beiden Seiten, die Masse applaudierte, […]. Trübe 16
Vgl. dazu auch Links 1981, 311, der dies als Kritik an der nur auf den eigenen Vorteil bedachten Bourgeoise deutet; mit anderer Akzentuierung Kiesel 1968, 345–350, der im elsässischen ›Vorspiel‹ schon die Entlarvung der revolutionären Bewegung vorgeführt sieht, die letztlich auf eine »Fortdauer der alten bürgerlichen Ordnung« (Kiesel 1968, 348), ihrer Eigentumsverhältnisse und einer Durchsetzung der antirevolutionären Kräfte unter der Parole von ›Ruhe und Ordnung‹ hinauslaufe.
153
154
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
trottete ein Haufen russischer Kriegsgefangener. Auch die wurden hier mit fortgerissen. (Döblin [1939] 2008a, 285) Es war dunkel, schon leerte sich der Friedhof, noch drängten neue Kranzdeputationen heran. Der Riesenzug, der vom Tempelhofer Feld herangewogt war, stieß bis zum Brandenburger Tor vor, wo er sich auflöste. Stundenlang scholl die Internationale über den Platz am Königstor. (Döblin [1939] 2008a, 290) Auch wenn in diesen von Hyperbeln geprägten Beschreibungen die Menge der Menschen als Konglomerat von einzelnen Gruppen mit ganz unterschiedlichen politischen Ambitionen oder zum Teil sogar als lediglich auf Sensation erpichte Zuschauer enthüllt wird, eignet der Darstellung der Massen und ihrer sich nur als Potential andeutenden, über soziale und nationale Trennungen hinwegreichenden Kraftentfaltung hier ein eigenes, ungebrochenes Pathos. Daneben stehen freilich Zurücknahmen dieser emphatischen Aufladung der Szenerie – sei es in der Überführung der pathetischen Szene in ein Benennen von Zweifeln der Beteiligten und in einen kritischen Kommentar durch den Erzähler (»Sie standen zu Tausenden Spalier auf den Trottoirs und rissen die Augen auf. […] Man hatte die heulenden fahnenschwenkenden Giganten des Kriegs erlebt; zweifelnd betrachtete man das neue Untier – die Revolution, die dem Krieg so ähnlich sah«, Döblin [1939] 2008a, 294), sei es in der Rahmung der Erzählung über die Beerdigung durch die Unterhaltung der sie ebenfalls begleitenden Schieber, Brose-Zenk und Motz, die sich ein Bild von der politischen Lage machen wollen, da sie um ihre Geschäfte fürchten. Die Schieber offenbaren in ihren Äußerungen ihre Abhängigkeit vom wie ihre Beteiligung am herrschenden bürgerlichen System; zugleich zeugen ihre selbstgefälligen Kommentare von der Unangefochtenheit dieses Systems, dessen revolutionären Gegnern sie die großen Worte gerne zugestehen, solange sie von deren Tatenlosigkeit überzeugt sind. Als die revolutionäre Bewegung Brose-Zenk und Motz dann tatsächlich erreicht, kommen sie nicht nur glimpflich davon, die revolutionäre Logik enthüllt sich zudem als bloßer Rachegedanke, der zwar die spontane gewaltsame Aktion trägt, nach dessen Befriedigung die Menge mit ihrem ›Sieg‹ aber gar nichts gewonnen hat und sich schwertut, weitere Beteiligte (hier den Kutscher) auf ihre Seite zu bringen. Motz und Brose-Zenk hingegen bleiben verschont, fahren mit der Straßenbahn nach Hause und lassen sich vom alten Dienstmädchen das Essen servieren (vgl. Döblin [1939] 2008a, 298f.). Unaufgelöst bleibt die Ambivalenz dieser Revolutionsbilder, die einerseits immer wieder das Potential der Revolution in spontanen Massenbewegungen erkennen wollen17 und die Revolution legitimiert sehen durch das Leiden an den
17
Ein weiteres, noch klarer auf die Spontanität der Massenaktion und die ganz eigene Legitimität ihres Handelns hinauslaufendes Beispiel ist das Kapitel »Sturm auf das Polizeipräsidium« (II,1); vgl. dazu Spies 2009, 17f.
Christine Waldschmidt: Erinnerung an 1918
bisherigen Verhältnissen und an den Machenschaften ihrer Repräsentanten, v.a. aber durch das Erfasstwerden von der revolutionären Bewegung selbst, in dem diejenigen, die gar keine Macht haben, von Objekten zu potentiellen Subjekten der neuen Ordnung und zu einer adäquaten Entsprechung zur historischen Situation werden. Andererseits aber betreiben die Bilder der Revolution zugleich eine Relativierung ihres Charakters als Ausdruck eines Willens, wobei sie allen Aktionen fehlende Richtung und Konsequenz,18 bloße Zufälligkeit oder das Disparate der darin waltenden Interessen attestieren – eine Ambivalenz, die im Grunde darauf hinausläuft, dass keiner der Beteiligten als Träger eines (neuen) politischen Willens in Frage kommt. Auch bei den erklärten politischen Funktionsträgern wiederholt sich dieses Bild – so in der Schilderung Karl Liebknechts, der als emphatisch-beseelter und dadurch auch die Massen begeisternder Redner gezeigt wird (vgl. z.B. Döblin [1948] 2008b, 207–213); zugleich aber wird der Wechsel dieser Überzeugungskraft zu einer ›bloß‹ abstrakten Revolutionstheorie einerseits und – hinsichtlich seiner Person – zu Phasen extremer Ermüdung und Zweifel andererseits herausgestellt. So entfaltet Liebknecht z.B. im Gespräch mit Radek im Kapitel »Im Hauptquartier von Spartakus« (II,1) den theoretischen Gegensatz einer Revolution, deren Ziel die Absetzung sozialer Gewaltverhältnisse ist, deren Durchsetzung aber auf den gewaltsamen Umsturz setzen muss, als Grundlage seines Zögerns bzw. seiner Bedenken hinsichtlich der Aktion, die er über der Frage nach ihrem geeigneten Zeitpunkt zu versäumen scheint.19 Andere Szenen wenden die Ambivalenz in eine scharfe Kritik: So bezichtigt Döblins Roman Friedrich Ebert expliziter als alle anderen des Verrats an der Revolution und der Arbeiterklasse. Ebert wird gezeigt als Figur, die die institutionelle Absicherung der Macht für die Arbeiterklasse ganz mit seiner Person verbindet, was dazu führt, dass sein Handeln nur noch den Erhalt dieser Macht für seine Person bezweckt.
18
19
Gerade die Masse bringt zwar einzelne spontane Aktionen hervor, in denen sich die ihr innewohnenden Möglichkeiten der Veränderung zeigen, die aber keine Richtung gewinnen und genauso schnell auch wieder vorüber sind. »›Darum bleib’ ich doch verantwortlich. – Ich will den Frieden. Ich wollte ihn immer. Den ganzen wirklichen Frieden. Dazu die Entwaffnung der Militärs, die Abrüstung draußen und drinnen, den Sozialismus, den Sturz des Kapitalismus.‹ ›Der ist nicht ohne Waffe zu haben.‹ ›Wenn ich aber zu früh zuschlage, bin ich ›Putschist‹, ›Blanquist‹ und störe alles.‹« Nach längerem Wortwechsel antwortet »Radek kalt: ›Die Revolution auf die lange Bank geschoben. Die Gegenrevolution. Man kann keine revolutionäre Situation konservieren. Das einzige, was sich konserviert, sind die revolutionären Phrasen‹« (Döblin [1948] 2008b, 476, 479). Ob der theoretische Widerspruch, der Liebknecht hier umtreibt und der gerade mit dem Versäumnis der Umsetzung assoziiert ist, auch die übergeordnete Problematik des Romans ist, wie es Köpke 2002, 249 sieht, erscheint eher fraglich.
155
156
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Es ist ein Volksbeauftragter, der bekannte Sozialdemokrat Ebert. Kaum steht er allein in dem großen, mit weißem Holz ausgelegten Raum, vor den Konsolen mit den Marmorbüsten von Staatsmännern und Feldherren, als er die Aktenmappen auf den Tisch wirft, eine fällt auf den Teppich, er plaziert sich wütend hinter einen Stuhl, einen gewöhnlichen, freilich goldlackierten […]. Es funktionierte noch immer nicht mit dem Hereintreten und dem Ausziehen des Mantels. Man gab ihm noch immer die Aktenmappen, statt daß der Diener sie hinter ihm her trug. […] Als wenn es sich noch immer um eine Sitzung des Parteivorstandes in der Lindenstraße handle. […] Und plötzlich stand er auf, […] und begann langsam, langsam […] auf dem Teppich hin und her zu schreiten. Er sagte sich: Immer Schritt für Schritt, […] und nicht die Miene verändern. Bei dem Gedanken: nicht die Miene verändern, blickte er sich im Raum um; natürlich kein Spiegel, um sich zu kontrollieren. (Döblin [1948] 2008b, 31, 32) Die Sicherung der Macht und damit ihre Äußerlichkeiten, ihre Repräsentation ersetzen in der Figur Ebert den politischen Inhalt,20 dem diese Macht dienen soll so vollständig, dass darin der (moralische) Vorwurf der Eitelkeit von dem der politischen Inhaltslosigkeit nicht mehr zu trennen ist. Döblin zeichnet auf diese Weise Ebert als Politiker ohne politischen Willen, dessen Streben nach Machterhalt ihn zu allen Kompromissen mit den bestehenden Mächten bereitfindet (letzteres belegen die ausführlichen Darstellungen seiner Telefonate mit der Obersten Heeresleitung in Kassel, vgl. u.a. Döblin [1948] 2008b, 42f.). Döblins Roman erzählt das Scheitern der Revolution als Menge einzelner Episoden, die alle abstrakt ihrem Verlauf zuzuordnen sind und die aus der Perspektive des Wissens um den Ausgang die Auskunft suggerieren, dass alle zu diesem Scheitern der Revolution beigetragen haben21 – diejenigen, die ohnehin wollten, dass sie scheitert, und die Revolutionäre, die sich um ihren Fortgang bemühten. Döblins Rückblick wirft – zumindest in den ersten Teilen – permanent die Frage nach der 20 21
Vgl. Schonfield 2009, 289f. (es tauche angesichts solcher Szenen die Frage auf: »Does Ebert assume power, or does the place of power assume him?«). Die sich aus der rückblickenden Perspektive ergebene abstrakte Mitteilung, dass alle Beteiligten zu diesem Scheitern beigetragen haben, legt sich auf den Inhalt einer Erklärung gerade nicht fest; in der Forschung ist diese ›Unentschiedenheit‹ oder ›Unbestimmtheit‹ immer wieder zugunsten einer oder mehrerer bestimmter Erklärungen aufgelöst worden, vgl. z.B. Althen 1993, 96, für die die Revolution im Roman »nicht nur an politischen Fehleinschätzungen scheitert, sondern auch an der Mehrzahl der Menschen, denen das Ende von Krieg und Hungersnot wichtiger ist als der neu zu organisierende Staat«; Dollinger 1994, 162, sieht die »Aufspaltung der sozialistischen Bewegung in eine führungslose Masse und eine ihre Macht verwaltende politische Führungselite« als vom Roman benannter Grund für das Misslingen der Revolution und den späteren Aufstieg des NS, während Kiesel 1986, 356f., dem Roman eine ganze Reihe von Gründen des Scheiterns entnimmt.
Christine Waldschmidt: Erinnerung an 1918
politischen Macht und ihrer Basis auf, andererseits aber ist das Ergebnis dieser Fragen, dass von einer Änderung der politischen Kräfte nichts zu erhoffen sei, ja dass Hoffnungen ohnehin nicht auf eine andere Staatsform oder überhaupt auf die Sphäre des Politischen zu setzen sind.22 Das hat weitreichende Konsequenzen: Wenn aus dem politischen Wechsel keine Veränderung mehr entstehen kann, dann soll sie stattdessen nur jenseits dieser Sphäre in einem irgendwie tiefer liegenden Grund zu denken sein. Die Protagonisten Friedrich Becker und Rosa Luxemburg sind dann die Vertreter dieser Verlagerung der grundlegenden Erneuerung ins Innere des Subjekts und in eine metaphysische Qualität aller Weltverhältnisse dieses Subjekts.23 Aber auch das Panorama der scheiternden Revolution, das die Gleichzeitigkeit des Verschiedenen an einem Ort und in einer historischen Phase nicht auflöst, sondern gerade als die Eigenart dieser Phase ausstellt,24 trägt zu diesem Übergang bei. So verweist die sich in den widersprüchlichen und disparaten Verhältnissen generierende allgemeine Dynamik der Ereignisse, ebenso wie die darin unterstellte Kraft einer gerade ganz inhaltslosen Verbindung alles Geschehens und aller Widersprüche25 darauf, dass es einen Zusammenhang von ganz anderer Qualität, eine Art metaphysischen Grund der Weltläufte gibt. Mehr als die Auskunft darüber, dass sich hier das christlich-mystische Weltbild des Autors schlicht demonstriere, lässt sich dem Scheitern der Revolution eine paradoxe Aussage über die Gesellschaft und ihre Subjekte ablesen: Politik und Gesellschaft kommen einerseits permanent als Zwänge und Notwendigkeiten vor, die die Subjekte erfassen, sie bestimmen und zu Anpassungen oder Anstrengungen des Überlebens oder des Widerstands veranlassen. Andererseits sind sie so dargestellt, also ob sie gerade
22
23
24
25
Insofern gilt das Paradox, das Bance/Hofmann 2009, 297, in der Zusammenschau festhalten, nämlich »dass der Roman die Herausforderung einer verzweifelten geschichtlichen Situation annimmt, […] dass der Geschichtsroman – und die Verheißung der Geschichte – angesichts eben dieser Herausforderung aufgegeben wird.« Mit der Figur Becker wird von Anfang an die Verstehens- und Sinnfrage zum historischen und politischen Geschehen als subjektiv und moralisch dringlich gestellt (vgl. Schonfield 2009, 277, 283; Sander 2001, 203) und zugleich als aus diesem Geschehen selbst nicht beantwortbar ausgewiesen. Wichert 1978, 108f., beschreibt nicht nur für November 1918, dass das Erzählen nach den Gesetzmäßigkeiten und Folgerichtigkeiten von Entwicklungen fragt und diese mit weiterhin Rätselhaftem beantwortet, darin aber die Vorstellung von einer hinter den Ereignissen liegenden Bedeutung oder ›Substanz‹ festhält. Dass insbesondere die räumlichen Verhältnisse vom Erzählen genutzt werden, um diese erst einmal abstrakte Zusammenschau aller Widersprüche herzustellen, ist wiederholt festgehalten und v.a. mit Analysen zu den Stadtbeschreibungen Berlins und Straßburgs belegt worden (vgl. Busch 1988; Köpke 1988; Schonfield 2009). Wiederholt ist die Stadt Berlin Ausdruck nebeneinander existierender Widersprüche, die in ihr nicht aufgelöst, sondern auf Dauer gestellt sind.
157
158
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
nicht schon das Notwendige wären, sondern nur Erscheinungen eines tiefer liegenden Schicksals (vor dem man sich dann nur noch bewähren kann, siehe die Figuren Becker und Rosa Luxemburg). Darin erscheint das, woran das Scheitern menschlicher und gesellschaftlicher Erneuerung abzulesen ist, und das, worin eine vage Hoffnung liegen soll, als – unaufhebbares und zugleich nicht mehr inhaltlich mit einander vermittelbares – Nebeneinander.
4. Selbstbehauptung des engagierten Gedankens Sowohl Die Toten bleiben jung als auch November 1918 produzieren eine Gegenwartsdeutung der späten Exilzeit, in der sie diese Gegenwart nicht in ihren aktuellen Erscheinungen in den Blick nehmen, sondern sie auf die in ihr anzunehmenden Entwicklungspotentiale befragen.26 Dabei fasst der dazu angestrengte Blick auf das Gewordensein, auf die historischen Gründe bzw. Voraussetzungen dieser Gegenwart jene Zeitdiagnose nicht als theoretisches Urteil zum vergangenen und gegenwärtigen Geschehen, vielmehr kommt es als in seinem historischen Verlauf enthaltene bzw. sich darin manifestierende Notwendigkeit vor. Nach der narrativen Seite betrachtet, produzieren die Rückblicke auf 1918 auf diese Weise einen Objektivitätsausweis und damit einen Geltungsgrund des jeweiligen Urteils. Der ›inhaltliche‹ Gewinn, der sich verbuchen lässt, betrifft das, wofür diese Geltung reklamiert wird: die Möglichkeit, gleichzeitig die Anerkennung eines umfassenden Verwiesenseins auf die realen und das heißt politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse, die das Subjekt bestimmen, und den Vorbehalt dagegen zu formulieren, dass diese Abhängigkeit über die Gültigkeit (bei Seghers auch über die künftige Geltung) alternativer Vorstellungen dieser Verhältnisse entscheidet. Das ergibt erst einmal nicht mehr und nicht weniger als eine kritische Distanz zur Gegenwart und zur Überwältigung durch sie, also eine Selbstbehauptung des engagierten Gedankens – offen für Übergänge auch in die (durchaus konstruktiv praktisch gemeinte) Emphase eines Aufbruchs (Seghers) oder eine existentielle bis metaphysische Wende der Desillusionierung (Döblin). Die Romane sprechen davon nicht zuletzt in ihrem Changieren 26
Der Gegenwartsbezug beider Texte ist oft mit einer Reflexion auch auf die breite Wirksamkeit der Darstellung in Verbindung gebracht worden, letztlich mit der Ausrichtung auf eine didaktische Wirkungsintention, auf die Überzeugungskraft eines gegen Faschismus bzw. Menschenverachtung und Gewalt gerichteten aufklärerischen oder warnenden Anliegens. Für Seghers ist insbesondere, aber nicht nur, von der DDR-Rezeption eine mit dem Ende des Krieges und der Frage nach einem ›Neuanfang‹ virulent werdende didaktische Funktion (etwa mit Blick auf die nötige ›Erziehung‹ einer noch faschistisch geprägten Jugend) in den Vordergrund gestellt worden (vgl. Bock 1981; Links 1981). Das mag sich mit dem (kultur-)politischen Engagement beider Autoren nach 1945 decken, die Romane erscheinen allerdings weit weniger von solchen Funktionsgedanken her konzipiert.
Christine Waldschmidt: Erinnerung an 1918
zwischen großangelegter urteilender (bei Döblin auch ironisch-satirischer) Wirklichkeitserfassung und einem eigenen Pathos dieser Erfassung.27
Literatur Althen, Christina. Machtkonstellationen einer deutschen Revolution. Alfred Döblins Geschichtsroman »November 1918«. Frankfurt a.M. et al. 1993. Bance, Alan/Klaus Hofmann. »Transcendence and the Historical Novel: A Discussion of November 1918«. In: Alfred Döblin. Paradigms of Modernism. Hg. v. dems./ Steffan Davies. Berlin/New York 2009, 296–321. Bock, Sigrid. »Erziehungsfunktion und Romanexperiment. Anna Seghers Die Toten bleiben jung«. In: Erfahrung Exil. Antifaschistische Romane 1933–1945. Hg. v. ders./ Manfred Hahn. 2. Aufl. Berlin/Weimar 1981, 364–398, 430–433. Busch, Arnold. »›Aber es ist Berlin‹. Das Bild Berlins in Döblins November 1918«. In: Internationale Alfred-Döblin-Kolloquien Marbach a. N. 1984, Berlin 1985. Bern et al. 1988, 239–246. Döblin, Alfred. Schriften zu Leben und Werk. Mit einem Nachw. v. Wilfried F. Schoeller. Frankfurt a.M. 2015. Döblin, Alfred. November 1918. Eine deutsche Revolution. Erzählwerk in 3 Tlen. I: Bürger und Soldaten 1918. Frankfurt a.M. [1939] 2008a. Döblin, Alfred. November 1918. Eine deutsche Revolution. Erzählwerk in 3 Tlen. II,1: Verratenes Volk. Frankfurt a.M. [1948] 2008b. Döblin, Alfred. »An den Karl Alber Verlag. Baden-Baden, den 28.11.1947«. In: Ders. Ausgewählte Werke in Einzelbänden. Briefe. Hg. v. Walter Muschg/Heinz Graber. Olten/Freiburg i.Br. 1970, 379–380. Dollinger, Roland. Totalität und Totalitarismus im Exilwerk Döblins. Würzburg 1994. Franz, Marie. Die Darstellung von Faschismus und Antifaschismus in den Romanen von Anna Seghers 1933–1949. Frankfurt a.M./Bern/New York 1987. Greiner, Bernhard. »Im Zeichen des Aufbruchs: die Literatur der fünfziger Jahre«. In: Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. 11: Die Literatur der DDR. Hg. v. Hans-Jürgen Schmitt. München/Wien 1983, 337–384. Hilzinger, Sonja. Anna Seghers. Stuttgart 2000. Kiesel, Helmuth. Literarische Trauerarbeit. Das Exil- und Spätwerk Alfred Döblins. Tübingen 1986.
27
Vgl. für Döblins November 1918 Sander 2001, 208; Bance/Hofmann 2009, 320; Kiesel 1968, u.a. 287 (zur Verbindung von satirischem und pathetischem Ton).
159
160
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Köpke, Wulf. »Die Überwindung der Revolutionen: November 1918«. In: Internationales Alfred-Döblin-Kolloquium Bergamo 1999. Hg. v. Torsten Hahn. Berlin et al. 2002, 243–259. Köpke, Wulf. »Abschied vom Mythos Berlin in November 1918«. In: Internationale Alfred-Döblin-Kolloquien Marbach a. N. 1984, Berlin 1985. Bern et al. 1988, 247–255. Links, Roland. »Mit Geschichte will man etwas. Alfred Döblin: November 1918«. In: Erfahrung Exil. Antifaschistische Romane 1933–1945. Hg. v. Sigrid Bock/Manfred Hahn. 2. Aufl. Berlin/Weimar 1981, 302–323, 424–426. Maag, Regula. Den Faschismus überwinden. Darstellung und Deutung des Faschismus in Anna Seghers’ Romanen. Diss. Zürich 1984. Sander, Gabriele. Alfred Döblin. Stuttgart 2001. Schonfield, Ernest. »November 1918: Topography of a Revolution.« In: Alfred Döblin. Paradigms of Modernism. Hg. v. dems./Steffan Davies. Berlin/New York 2009, 276–295. Schrade, Andreas: Anna Seghers. Stuttgart/Weimar 1993. Seghers, Anna. Die Toten bleiben jung [1949]. 2. Aufl. Darmstadt/Neuwied 1981. Spies, Bernhard. »Niederlage und Aufbruch. Die Toten bleiben jung von Anna Seghers«. In: Poetiken des Auf- und Umbruchs. Hg. v. Dagmar von Hoff/Monika Szczepaniak/Lena Wetenkamp. Frankfurt a.M. 2013, 99–109. Spies, Bernhard. »Die Macht der unbestimmten Zahl, oder: Erzählungen von der entsittlichenden Qualität der Quantität«. In: literatur für leser 32.2 (2009), 69–84. Wichert, Adalbert. Alfred Döblins historisches Denken. Zur Poetik des modernen Geschichtsromans. Stuttgart 1978.
Das billige Experiment. Zum historischen Funktionswandel von Hitler-Satiren und -Karikaturen Carsten Jakobi
Das Juli-Heft 2017 der Satire-Zeitschrift titanic machte, für alle erwartbar, mit einem Helmut-Kohl-Titel auf. Es bot eine grobe Karikatur des wenige Tage vor Erscheinen des Heftes verstorbenen Altkanzlers in Form einer gargantuesken Ansammlung von Organen, mit dem boulevardmäßigen Anreißer »Organspendenaffäre um Exkanzler: Wie tot ist Kohl wirklich?«1 Das Editorial des Chefredakteurs griff diese Titelthematik in folgender Form auf: »[…] Kohl war ein Traum für jeden Satiriker: dick, doof, provinziell, omnipräsent und unauslöschbar. Der zweitkomischste Kanzler der deutschen Geschichte war er, der heitere Hitler für kalte Kriegstage. Und somit Inspiration für das einzige Verdienst, das man ihm je anrechnen konnte: zahllose TITANIC-Scherze.« (Wolff 2017, 4) Das Editorial wurde flankiert durch nicht weniger als 16 historische titanic-Titel, die sich Kohl gewidmet hatten. Wer vor dem »zweitkomischste[n] Kanzler« der komischste war, wird im Klartext mitformuliert: Hitler. Der Verweis verlängert einerseits die satirische Schmähung gegen Kohl, der es nur auf einen zweiten Platz der Beliebtheit hinter einem singulären Kriegsverbrecher und Völkermörder gebracht habe, beschreibt aber andererseits selbstreflexiv die Aufmerksamkeit, die die titanic der historischen Figur Adolf Hitler gewidmet hat. Geradezu in Konkurrenz mit dem Spiegel, dessen Vorliebe für Hitler-Titelbilder notorisch ist, hat die titanic sich dessen Konterfeis bedient, um ihre Titelseite auszustatten – aber natürlich stets in einer satirischen Weise. Diese Beliebtheit ist kein singuläres Phänomen: Spätestens seit den 1990er Jahren bedienen sich satirische oder humoristische – allgemeiner: komische – Medien der Figur Hitlers: in Comedy-Shows, Filmen, Comics, Theaterstücken.2 Neu ist das nicht. Neben dem Mann aus Nazareth dürfte A.H. aus B. die meistkarikierte Figur
1 2
Im Original in Versalien. Zur Datierung des Beginns dieser Konjunktur vgl. Jung 2006.
162
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
der Weltgeschichte sein.3 Seit 1922 erschienen die ersten Satiren und Karikaturen auf Hitler im Münchner Satiremagazin Simplicissismus4 , dem lokalpolitisch versierten Medium für alle Fragen des bayrischen Rechtsextremismus. Seither gibt es eine Tradition satirischer und karikaturhafter Darstellungen Hitlers; dieser ästhetischen und ideologischen Tradition und der darin eingebundenen Traditionsbrüche soll im Folgenden exemplarisch nachgegangen werden. Die Frage nach der Möglichkeit von komischen Darstellungen des NS oder Hitlers stellt sich hier nicht, weil es diese Darstellungen nämlich gibt, weshalb sie auch theoretische Beachtung verdienen.5 Der kritische Einwand gegen diese gilt eher der moralischen Legitimität oder ihrer Berechtigung – damit ist er allerdings verallgemeinerbar: gegen jede ästhetische Vergegenwärtigung Hitlers oder gegen die Berechtigung jeglicher satirischen Befassung mit jedem beliebigen Gegenstand. Auch die Frage, welche objektive Wirkung Satiren in der Zeit des Aufstiegs oder der Herrschaft des Nationalsozialismus hatten oder hätten haben können, liegt außerhalb der folgenden Überlegungen: Nach diesem Maßstab hätte womöglich der einzige Georg Elser erfolgreicher als alle Satiren der Welt sein können.6 Umgekehrt: Ein praktisches politisches Scheitern der Satire oder anderer theoretischer oder ästhetischer Auseinandersetzungen kann schlechterdings kein ernsthafter Einwand sein: Sonst würde die Dialektik der Aufklärung tagtäglich durch das WWW widerlegt, weil sie in Hinblick auf die von ihr analysierten Phänomene zwar ›recht‹ hat, aber wirkungslos ist. Wenn im Folgenden von Hitler-Satiren und -Karikaturen die Rede ist, so gilt es zu reflektieren, dass diese eine Teilmenge der Satiren auf den NS-Faschismus sind.7 Dieser thematischen Engführung (der Produzent:innen solcher Satiren wie auch 3
4 5
6
7
Jost Hermand hingegen behauptet für die Zeit des NS auf empirisch schwacher Basis: »Über Hitler […] schwiegen sich die Satiriker der dreißiger und vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts meist aus.« (Hermand 2010, 68) Für die erste Satire vgl. Scher 1922, 498; für die erste Karikatur vgl. Heine 1923, 107. Vgl. dazu die Überlegungen zu einem benachbarten Genre in Jakobi 2005. – Die Rechtfertigung, Hitler als komische Figur darzustellen, gehört traditionell zum prooemium jeder theoretischen Befassung mit der komischen Darstellung Hitlers oder des NS-Faschismus (vgl. exemplarisch Hermand 2010, 68). Dabei gelangt kaum jemand zu dem Schluss, die prinzipielle Möglichkeit solcher Darstellungstechniken entschieden zu verneinen, sonst wären die entsprechenden Studien nach wenigen Sätzen bereits beendet. Eine Ausnahme stellt Adorno dar (vgl. Adorno [1967] 1994, bes. 604). Im Sinne von Woody Allens vielzitierter Szene in seinem Film Manhatten (1979): In einem Filmdialog heben einige Figuren die praktische Relevanz von Satiren für den Antisemitismus hervor. Doch die von Woody Allen verkörperte Hauptfigur setzt dagegen: »Knüppel und Baseballschläger sind eindeutig besser«, weil Gewalt bei den Nazis wesentlich besser ankomme als Satiren. (https://www.youtube.com/watch?v=jf9d3cwVWBY, 0:52). Zwei Hinweise für die theoretische Diskussion dieses Themenkomplexes mögen genügen: Naumann 1983; Braese 1996.
Carsten Jakobi: Das billige Experiment
der Analyse) lässt sich möglicherweise eine theoretische Auskunft über die Verfahrensweisen, d.h. ihre ästhetischen Mittel und die damit einhergehenden ideologischen Implikationen entnehmen.
1. Vor 1933 Bereits in der Weimarer Republik unterliegen die Formen und Funktionen der einschlägigen Texte und bildlichen Darstellungen Veränderungen, und zwar solchen, die in geringerem Umfang von innerästhetischen Gründen (etwa der Frage nach der Wiederkennbarkeit des Karikierten), in größerem Maße aber von außerästhetischen Faktoren abhängen. Genauer gesagt: Die Technik von Hitler-Satiren korrespondiert mit dem wechselnden politischen Erfolg des Nationalsozialismus, den dessen Parteichef repräsentiert. Bis etwa 1930 finden sich satirische Hitler-Darstellungen in Literatur und bildender Kunst, die aber zumeist unter dem Vorzeichen einer relativen Erfolglosigkeit stehen, genauer gesagt: einer tatsächlichen oder satirisch suggerierten Diskrepanz zwischen Hitlers herausposauntem Anspruch auf die Geltung seiner Führerperson bzw. seiner politischen Ziele einerseits und den geringen Realisierungsaussichten seiner Splitterpartei andererseits, die dem dumpfen Farbspektrum rechtsextremer Kleingruppen rechts der DNVP nur einen weiteren trostlos braunen Farbtupfer hinzuzufügen versuchte. Gerade dieser Widerspruch zwischen monströsen Absichten und kleinbürgerlicher Beschränktheit bietet satirisches Potential: vor dem HitlerPutsch und nach dessen kläglichem Scheitern. Die Machtlosigkeitsdiagnose zieht sich von Ernst Tollers früher satirischer Komödie Der entfesselte Wotan, entstanden in Tollers Festungshaft noch vor dem HitlerPutsch im November 1923, bis zu Lion Feuchtwangers satirischem München-Roman Erfolg (1930), in dem Hitler in der Figur des Rupert Kutzner als gescheiterter Putschist gezeichnet wird. Tollers Komödie verdient Interesse, da sie den Beginn der Tradition literarischer Hitler-Satiren markiert. Als Häftling des Freistaates Bayern und Repräsentant der gescheiterten Räterepublik München entwickelt Toller bereits früh eine Aufmerksamkeit für den Münchner Provinzagitator Hitler. Er basiert seine »Komödie« – so der Untertitel – auf einem elementaren Einfall, nämlich einen Hochstapler ins Zentrum zu stellen: Aus einem Friseur, Inbegriff des Bedienten, entwickelt sich der visionäre Verfechter eines ambitionierten, gleichwohl absurden und schlussendlich auch scheiternden Projekts: der Gründung eines »Büro[s] der Genossenschaft für brasilianische Auswanderer« (Toller [1923] 2015b, 245f.), ein Siedlungsprojekt für alle nach dem Ersten Weltkrieg enttäuschten Europäer:innen. Der Plan steht von vornherein auf weniger als tönernen Füßen; auch frühere überspannte Projekte des Friseurs Wotan sind kläglich gescheitert, wofür er jeweils die Juden verant-
163
164
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
wortlich macht (vgl. Toller [1923] 2015b, 244). Dennoch gelingt es Friseur Wotan, Anhänger:innen und Unterstützer:innen aus den gehobenen Kreisen zu gewinnen, die damit auf eine je spezifische ökonomische Besitzstandswahrung spekulieren – lediglich ein junger Arbeiter lässt sich instinktiv-klassenbewusst nicht blenden und bleibt resistent (vgl. Toller [1923] 2015b, 246). Wotan, eine in ihrem Personalstil geradezu Sternheimʼsche Figur,8 scheitert mit seiner absurden Idee, mit völkischer Agitation ein Auswanderungsprojekt zu befördern, an der simplen ökonomischen Logik der bürgerlichen Gesellschaft: Eben noch imaginiert er sich als Diktator der Welt (vgl. Toller [1923] 2015b, 272), als sein Schwindelunternehmen auffliegt. Er wird in Schutzhaft genommen, kündigt aber mit konsequenter Folgerichtigkeit an, im Zuchthaus seine Memoiren schreiben zu wollen: »Der Dolchstoß kurz vorm Ziel von Wilhelm Dietrich Wotan« (Toller [1923] 2015b, 275). Wie Toller diese Prophezeiung noch vor dem gescheiterten Hitler-Putsch vom November 1923, der sich daran anschließenden Haft und der darin erfolgten Abfassung von Mein Kampf formulieren konnte, mag verblüffen. Als in seiner Kommunikation höchst eingeschränkter, aber dennoch aufmerksamer politischer Häftling erkannte er immerhin schon in Hitlers Auftreten und Prätention dessen unerhörte Redseligkeit, seinen Selbstdarstellungsdrang und sein Selbstbewusstsein, eine vortreffliche Führerperson zu sein, in der Programmatik und Persönlichkeit unmittelbar zusammenfallen. Aus dieser Schnittmenge ergibt sich mit einer gewissen Folgerichtigkeit die Textsorte der zukunftsgerichteten politischen Memoiren. Ungeachtet (oder wegen?) solcher Antizipationsleistungen evoziert Tollers Komödie Rezeptionsschwierigkeiten: Wer ist in der Wotan-Figur überhaupt zur satirischen Darstellung gekommen? Vielfach wird behauptet, es sei Toller um eine Karikatur des abgedankten Kaisers Wilhelm II. gegangen.9 Die Frage einer einsinnigen Hitler-Referenz ist möglicherweise unbeantwortbar, aber auflösbar: Wenn Toller seine Figur Wotan mit verschiedenen Charakterzügen ausstattet,10 so soll sie of8 9
10
Bei der Rasur eines Kunden spricht Wotan, als sei er einer Komödie aus dem bürgerlichen Heldenleben entsprungen (vgl. Toller [1923] 2015b, 241). Zur Diskussion vgl. Hoffmann/Langemeyer/Unger 2015, 523–525. – Die Uraufführung durch Jürgen Fehling im Jahre 1926 legte sich in der Referenz fest, indem sie Wotan äußerlich als Hitler darstellte. Eine erste wissenschaftliche Untermauerung dieser These findet sich vergleichsweise spät, nämlich bei Willibrand 1945, 80f. Im unmittelbaren Entstehungskontext schrieb Toller an den Schauspieler Max Pallenberg (20. Juni 1923): »Daß wir aber aus diesem Taumel der Dumpfheit herausfinden, dazu soll der ›Wotan‹ mithelfen. Auf wen haue ich mit Keulen los? Auf jene Typen, die nach meiner tiefsten Überzeugung uns in den jammervollsten Dreck geführt haben und die das Volk, befreit es sich nicht von ihrem Einfluß, weiter und weiter hineinstoßen. Das Deutsche an Goethe, an Hölderlin, an Büchner (um nur ein paar aus der Schar der Großen zu nennen), was hat es gemeinsam mit dem Teutschen an Ruge etwa, an Theodor Fritsch, an Adolf Hitler?« (Toller [1935] 2015a, 383). Die Allusionen auf Wilhelm II. sind in der Tat unübersehbar (vgl. z.B. Toller [1923] 2015b, 261, 263, 268).
Carsten Jakobi: Das billige Experiment
fenbar eine Synthese aus politischen Diagnosen bilden, indem in der Figur Wotan die aus der Zeit fallenden Politiker Wilhelm II. und Hitler zusammengefasst sind. Der objektive Anachronismus des abgedankten Herrschers wird auf Hitlers Ambitionen übertragen. So ergeht die Mitteilung, dass Hitler schon jetzt – 1923 – so obsolet ist wie der abgedankte Kaiser, über den die Weltgeschichte bereits das praktische Urteil gefällt hat. Der Vergleich mit Wilhelm II. macht deutlich, was das Objekt der Satire ist: nämlich Hitler, während die Allusionen auf den deutschen Kaiser diesen als Medium der Satire konturieren. Die Engführung ist hier die spezifische Methode der satirischen Kritik, indem sie nicht in einem diskursiven Vergleich vorgetragen, sondern sinnlich anschaulich gemacht wird.11
Abb. 1: Thomas Theodor Heine: Ergebnislose Haussuchung bei Hitler (1930)
11
Schon der vollständige Name der Figur »Wilhelm Dietrich Wotan« formuliert diese Synthese aus dem Kaiser, seinem Untertan Diederich Heßling und Wagners germanischem Kriegsgott.
165
166
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Diese Technik, Hitler bzw. den Nationalsozialismus dadurch zu blamieren, dass deren maßloser Geltungsanspruch mit der faktischen Machtlosigkeit konfrontiert wird, findet sich im Laufe der Weimarer Republik immer wieder – bis zum Beginn der großen Wahlerfolge im Jahre 1930. Einen interessanten Übergang stellt in diesem Jahr eine Karikatur von Thomas Theodor Heine dar (Abb. 1), in der die Diskrepanz zwischen Hitlers angeblicher Dummheit und seinem wachsenden politischen Erfolg thematisiert und als offene Frage formuliert wird (Heine 1930, 23). Die politische Bilanz und politische Substanz solcher auf eine Personalsatire verengten Karikaturen sind ambivalent. Einerseits sind sie im genauen Sinne des Wortes unpolitisch, denn gegen Hitler und seine Bewegung wird hier kein einziger politischer Gedanke formuliert. Die Personalisierung geht einher mit einer individuellen Schmähung, die völlig willkürlich ist. Denn die Darstellung eines Hirnlosen ließe sich an jedem beliebigen anderen Politiker oder Prominenten ebenso durchführen. Andererseits liegt in dieser Personalisierung durchaus ein Urteil über den Nationalsozialismus vor, der sich schließlich als Führerbewegung verstanden hat. Insofern nimmt die individuelle Schmähkritik durchaus eine spezifische Wendung gegen die NS-Ideologie vor: Sie bestreitet den Geltungsanspruch des faschistischen Führers, der seine Politik ganz aus der Genialität seiner unübertrefflichen Persönlichkeit herleitet. Ein Hitler-Witz ist eben doch etwas anderes als ein Merkel-Witz: Er ist eine Attacke auf eine zentrale Legitimationsinstanz und Legitimationsmethode des nationalsozialistischen Herrschaftsanspruchs. Das satirisch durchgeführte Urteil, Hitler an seinem angemaßten Machtanspruch zu messen und ihn daran scheitern zu lassen, verliert ab 1930 offensichtlich an Plausibilität. Nunmehr tritt an die Stelle der Machtlosigkeit die Diagnose der Undurchführbarkeit der nationalsozialistischen Ambitionen unter den gegebenen politischen und ökonomischen Verhältnissen – also eine Modifikation des satirischen Urteils, der NS-Faschismus sei machtlos. In diesen Kontext gehören die bekannten Fotomontagen John Heartfields, in denen Hitler als passiver Auftragnehmer der ökonomischen Gewalt des Kapitals dargestellt wird, aber auch linksdemokratische Versuche, in ihm nicht mehr als den Restaurator monarchischer Verhältnisse zu sehen12 – in beiden Varianten wird der satirische Widerspruch inszeniert, dass die Machtmittel gegen den Machtzweck stehen. Der plötzliche Erfolg der Bewegung wird der Sache nach in seiner Grundlosigkeit herausgestellt, da diese doch noch
12
So etwa im sozialdemokratischen Zentralorgan Vorwärts (21.05.1931) oder in den linksliberalen Blättern Berliner Volks-Zeitung (08.05.1930) und Ulk (07.04.1932). Siehe Hanfstaengl 1933, 32f., 20f., 56f.; diese Sammlung von Hitler-Karikaturen, zusammengestellt von einem Hitler-Vertrauten, verdiente eine eigene genauere Betrachtung in Hinblick auf den sadistischen Hohn ihrer Kommentierung auf Kosten der antifaschistischen Publizistik vor 1933. Sie dient hier lediglich als Quellensammlung.
Carsten Jakobi: Das billige Experiment
kurz zuvor keinen Erfolg hatte. Dieser Widerspruch gilt schon als der entscheidende Beweis für die Grundlosigkeit und damit für den Einwand gegen den Erfolg. Die Satire dieser Zeit stellt ein geeignetes Mittel für dieses Beweisverfahren einer Selbstwiderlegung dar und erscheint den Zeitgenoss:innen damit als mögliches Kampfmittel, neben anderen Formen wie z.B. der diskursiven Aufklärung – oder dem Straßenkampf.
2. 1933-1945 Durch den Machtantritt der Nazis, die Entfaltung ihrer Macht und deren Benutzung zur Vernichtung jeden politischen Widerstands, zur Entfesselung eines Weltkrieges und schließlich zum industriellen Völkermord am europäischen Judentum ändern sich auch die Konstitutionsbedingungen antifaschistischer Satiren grundlegend: ihre Entstehungs- und Publikationsmöglichkeiten, ihre Legitimationszwänge, ihre politischen Funktionen. Dass die antifaschistische Satire dieser Zeit kein randständiges Phänomen darstellt, lässt sich am anhaltenden Interesse der Forschung erkennen. Wenn Braese für die Zeit ab 1933 der Satire den Status eines »teuren Experiments« attestiert, profiliert er eben diese Problematik: Was ändert sich nach der Aufkündigung des lizenzierten politischen Pluralismus für die – zumal antifaschistische – Satire? Wie geht sie mit ihrem staatlich institutionalisierten Verbot um? Wie stellt sie sich umgekehrt zu der expansiven Vergrößerung ihres Gegenstandsbereiches? Die sogenannte Kraus-Debatte, die Rezeption der von Karl Kraus publizierten Texte, in denen er – scheinbar – die Unzuständigkeit der Satire zur Befassung mit dem NS-Faschismus begründete, legt davon ein frühes beredtes Zeugnis ab.13 Gerade gegen den Öffentlichkeitsanspruch der Satire spaltet sich hier die zeitgenössische Rezeption in eine innere Selbstverständigung und eine auf ihr reales Objekt gerichtete Kritik. Nichts davon hat einen positiven Bezug zur beanspruchten Verallgemeinerung des satirischen Standpunktes – die als fraglos dargestellte und damit an dem satirischen Objekt selbst sichtbar werdende Hinfälligkeit dieses Objekts – aufzuweisen, lediglich negativ ist der Objektbezug noch zu diagnostizieren: die Satire verfehlte für Kraus immanent notwendig den Objektbezug.14
13 14
Vgl. zum Verlauf und den ideologisch-ästhetischen Implikationen Braese 1996, 15–26. Dieser Hinweis rekurriert auf Brummacks bekannte Bestimmung des Satirischen, das sich auch durch seinen konkreten Objektbezug auszeichne (vgl. Brummack 1977, 602). Dass Brummack diesem eigentlich banalen Merkmal Relevanz zuweist (jede Literatur hat einen Objektbezug), ist hier konkret satiretheoretisch zu verstehen: Erstens muss das Objekt der Satire bekannt und erkennbar sein; zweitens geht es dem Satiriker tatsächlich um dieses konkrete satirische Objekt und seine Bekämpfung, nicht um ein freies ästhetisches Spiel.
167
168
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Dennoch finden sich im Exil zahlreiche Satiren, die sich in ein Konkurrenzverhältnis zur herrschenden Macht und ihrem Repräsentanten begeben. In diesem Sinne verstehen sie sich als Kampfmittel gegen eine existente Macht. Ihre Methoden sind verschieden, indem sie verschiedene Merkmale des Satirischen privilegieren: Wenn Brecht in seinen Hitler-Chorälen die Versprechungen des »Anstreichers« als in sich unaufhebbar widersprüchlich darstellt – »Bittet den Anstreicher, daß er den Zinsfuß uns senke!/Und ihn zugleich/Auch noch erhöh in sei’m Reich/Ohne daß er sich verrenke!« (Brecht [1933] 1988, 217) –, stellt er den Maßstab immanenter Stimmigkeit ins Zentrum, an dem Hitlers Ideologie scheitere. Dagegen verschmilzt »Doktor Schrecklichkeit« (d. i. Robert Spence/Philip Spence) im Jahre 1941 aus britischer Perspektive Hitler mit dem Struwwelpeter (Abb. 2); das reale Objekt Hitler wird, ähnlich wie bei Toller, ästhetisch mit einem historisch disqualifizierten Prätext synthetisiert (Dr. Schrecklichkeit [1941] 2005).
Abb. 2: Doktor Schrecklichkeit [d. i.:Robert Spence/Philip Spence]: Struwwelhitler (1941), Titelbild
Hier dominiert der Gesichtspunkt des Lächerlichmachens, also der Aggressivität. Der prekäre Gesichtspunkt der Machtlosigkeit der Satire angesichts einer in-
Carsten Jakobi: Das billige Experiment
stallierten Gewalt wird in diesen Beispielen auf unterschiedliche Weise entfaltet. In allen Fällen aber hängt der Verallgemeinerungsanspruch nicht mehr allein am Objektivitätsausweis der Kritik: Während Brecht den Geltungsausweis seiner Kritik ganz in das immanente Gelingen seiner Satire – d.h. ihrer ästhetischen Form und ihres intellektuellen Witzes – verlagert, kann sich die Struwwelhitler-Travestie zumindest darauf verlassen, dass sie Teil eines militärisch organisierten und schlagkräftigen Widerstands der britischen Armee gegen den deutschen Faschismus ist. Diese Rückversicherung der antifaschistischen Satire bei einer realen Gewalt ist ein entscheidendes Merkmal der Hitler-Satiren in den Jahren des Zweiten Weltkriegs. Sie stiftet eine Einheit der imaginierten Macht des Satirikers mit einer (mit ihr verbündeten) realen Macht. Chaplins Film-Komödie über den Great Dictator nimmt in diesem Kontext eine Sonderrolle ein: Er benutzt die Satire als Agitationsmittel, die amerikanische Politik und Öffentlichkeit für eine Auseinandersetzung mit NS-Deutschland zu präparieren, also eine potente Gegenmacht überhaupt erst herzustellen: Bei aller inszenierten Lächerlichkeit ist der großtomanische Diktator Adenoid Hynkel jenseits einer solchen militärischen Perspektive nur im Rahmen einer lizenzierten und auf hyperbolische Weise unplausiblen ästhetischen Fiktion zu entmachten. Dem realen Hitler gegenüber sind die aufgebotenen Mittel – ausgerechnet ein jüdischer Friseur wird mit Hynkel verwechselt und hält vor einer begeisterten Masse von NS-Anhängern eine pazifistische Rede – weltfremd und substanzlos.
3. Nach 1945 Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, mit der Entmachtung des NS-Faschismus durch das Bündnis der zivilisierten Welt, ändert sich Grundlegendes auch für die Hitler-Satire. Zunächst einmal geht sie für lange Zeit nahezu verloren. Die Gründe sind evident: Mit Hitlers Existenz und Herrschaft ist auch das Objekt einer gegen sie gerichteten Satire entfallen. Die antinazistische Kritik überdauert indes ihren Gegenstand; sie benötigt aber nicht mehr die satirische Technik der Übertreibung: Die Verlaufsformen und Resultate der NS-Herrschaft sprechen ohne jeden subjektiven Zusatz gegen diese. Der prinzipielle und traditionsreiche Verdacht, man könne ›darüber‹ (vgl. Adorno [1967] 1994, 604) nicht lachen,15 tritt komplementär
15
Schon früh hieß es bei Kurt Tucholsky: »Satire hat eine Grenze nach oben: Buddha entzieht sich ihr. Satire hat auch eine Grenze nach unten. In Deutschland etwa die herrschenden faschistischen Mächte. Es lohnt nicht – so tief kann man nicht schießen« (Tucholsky [1932] 2011, 70; vgl. auch Adorno [1967] 1994, 604). Zur Dialektik der Causa Kraus und seiner öffentlichen Bekanntgabe, auf Hitler bzw. den NS-Faschismus nicht mit seinen Mitteln reagieren zu können – »Kein Wort, das traf« (Kraus 1933, 4) –, siehe Braese 1996.
169
170
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
zu diesem objektiven Funktionsverlust hinzu. Das bedeutet nicht, dass es keine komischen Auseinandersetzungen mit Hitler mehr gäbe, nur verändern sich die Formen ästhetischer Vergegenwärtigung ihres Objekts. Anders als in einer HeineKarikatur, einer Heartfield-Fotomontage oder einer Chaplin-Mimesis wird Hitler nicht mehr zum ästhetischen Objekt. Vielmehr erscheint seine Person oftmals in einem Modus verweigerter Unmittelbarkeit, also in einer darstellerischen Verschiebung. Dafür haben Literatur und Film in den 1950er und 1960er Jahren verschiedene Techniken entwickelt. In Erich Kästners satirisch-parabolischer Komödie Die Schule der Diktatoren (1956; erste Vorarbeiten 1949, UA 1957) besteht der Grundeinfall darin, nicht etwa Hitler als Person parabolisch zu transformieren – wie z.B. in Brechts Parabelstücken Die Rundköpfe und die Spitzköpfe und Der Aufstieg des Arturo Ui –, sondern in der dramatischen Fiktion dessen personale Existenz überhaupt zu bestreiten und damit durchzustreichen. Statt durch einen unersetzbaren großen Diktator legitimiert sich das faschistische Regime dadurch, dass dieser Diktator lediglich verkörpert wird und im Todesfall beliebig durch ein Double ersetzt werden kann. Seine äußere Hülle bleibt bestehen, als Person ist er schon seit geraumer Zeit entbehrlich. So gilt die Satire dem faschistischen Selbstbild einer auf der unübertrefflichen und vergleichslosen Genialität basierenden Macht des Führers und der Personalisierung in der historiographischen Faschismustheorie. In Kurt Hoffmanns Filmsatire Wir Wunderkinder (1958), eine der wenigen kritischen Auseinandersetzungen mit dem NS-Faschismus im westdeutschen Nachkriegsfilm, wird die Individualgeschichte eines deutschen Journalisten durch Wolfgang Neuss und Wolfgang Müller kabarettistisch eingerahmt und historisch in der Zeit zwischen Wilhelminismus und Wirtschaftswunder situiert. Der Aufstieg des NS-Faschismus wird gespiegelt in einer Satire auf seine untüchtigen Anhänger:innen – von Hitler sind nur die Stiefel im Bild, seine Geführten salutieren und geben darin ein Urteil darüber ab, was für eine Sorte Anhänger:innen dieser ›Führer‹ hat. Zum Zweiten gibt es eine eingelegte Kabarettnummer aus dem Münchner Fasching von 1931, also nach der Reichstagswahl von 1930. Es ist nicht Hitler selbst, sondern ein Kabarettist, der ins Bild gerückt wird, und die Komik ist nur indirekt vermittelt, also als historisches Zitat von Komik vorstellig gemacht. Dass diese Kabarettnummer in eine durch die Gewalt der Nazis provozierte Saalschlacht mündet, zeigt zweierlei: Der politische Inhalt der Auseinandersetzung wird zugunsten der bloßen äußeren Form der Wirtshausschlägerei entleert, was zweitens aber zugleich ein historisierendes Fazit über die Machtlosigkeit der Nazigegner und ihrer Satire wie auch über den Charakter des NS-Faschismus als Bewegung bedenkenloser Gewalt darstellt.
Carsten Jakobi: Das billige Experiment
Auch in Otto Basils alternativhistorischem Roman16 Wenn das der Führer wüßte (1966) tritt Hitler nur vermittelt auf: Nach dem Sieg NS-Deutschlands durch die frühzeitige Entwicklung von Nuklearbomben im Zweiten Weltkrieg liegt Hitler nun, Anfang der 1960er Jahre, im Sterben – genauer gesagt: er ist vergiftet worden. Der Roman entfaltet die Grundidee, wie sich die staatliche Macht nach dem Tod des unersetzlichen Führers modifiziere – so wird der Führerkult noch überboten durch die weitaus radikaleren Diadochen seiner Herrschaft. Einen unmittelbaren Auftritt hat Hitler auch hier nicht; er erscheint lediglich als der ideologische Reflex seiner Selbstdarstellung – Hitler wird in die christliche Trinität aufgenommen und ist im Himmel zuständig für »alle militärischen Obliegenheiten« (Basil [1966] 2013, 278). Er bleibt in der ästhetischen Darstellung körper- und gesichtslos. Eine metonymische Verschiebung erfährt die Hitler-Figur in Günter Grass’ zweitem Roman Hundejahre (1963). Hitlers Hund tritt hier an die Stelle seines Herrn, und die genealogische Kontinuität von Hitlers Hunden bildet die wesentliche Klammer eines Handlungsstranges einschließlich der Heidegger-Parodie, die das Motiv weiter von der unmittelbaren Hitler-Repräsentation ablöst und damit ironisch ins Zeitlose transzendiert. Alle angerissenen Beispiele belegen eine Technik der Indirektheit – nicht im satiretheoretischen Sinne Brummacks, sondern als mimetische Abwendung zu einem Ersatzobjekt, das mit dem historischen Hitler eine Ähnlichkeitsrelation aufweist (seine Doubles, sein Parodist, sein sterbender Körper, sein Hund).
4. Der neue Hitler Eben an dieser Verweigerung vor dem ästhetischen Objekt Hitler vollziehen sich in den 1980er Jahren bis zur Gegenwart entscheidende Veränderungen. Als ästhetisches Material gewinnt die Hitlerfigur erneutes prominentes Interesse, aber sie ist nicht mehr Objekt der Kritik. Vielmehr wird sie nun als Medium der Kritik an anderen Gegenstandsbereichen benutzt. Ein Beispiel, das Cover des Juliheftes 7 des Jahrgangs 2002 der titanic (Abb. 3), soll diese Behauptung illustrieren. Von der vergleichsweise geringfügigen ästhetischen Verzerrung abgesehen – der v.a. aus Schwarz-weiß-Fotos bekannte Hitler, in Gestik, Habitus und Physiognomie ansonsten eindeutig zu erkennen, bekommt ein leichtes Wangenrouge verpasst –, leitet sich der satirische Effekt aus dem eklatanten Widerspruch her, dass das denkbar Offensichtlichste, Hitlers Antisemitismus, als Pressesensation verkauft wird.
16
Zum Genre des alternativhistorischen oder kontrafaktischen Romans vgl. Widmann 2009.
171
172
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Abb. 3: titanic 7/2002, Titelbild
Aber inwiefern liegt hier eine Hitler-Satire vor? Von einer Entlarvung des einstigen Reichskanzlers kann keine Rede sein, dafür ist, abgesehen vom Anachronismus einer als aktuell herausgestellten Enthüllung, angesichts von Hitlers offen zur Schau gestellten antisemitischen Programmatik und Praxis der Mitteilungswert zu geringfügig. Offenbar geht es der titanic im Sommer 2002 um etwas anderes: nämlich ein anderes Objekt der satirischen Kritik. Genauer gesagt: Dass Hitler Antisemit – und zwar der historisch berüchtigtste Antisemit – war, ist bereits als Kenntnis unterstellt, um ein Urteil über dieses andere Objekt zu evozieren: Anlass des Bildes im Sommer 2002 war die Möllemann-Debatte, also die Frage, ob die antijüdischen und antiisraelischen Ausfälle Jürgen Möllemanns (damals stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP) antisemitisch seien oder nicht. Das Objekt der Satire ist hier aber auch nicht in erster Linie Möllemann, sondern, indem sie eine ungläubige Frage nach dem Selbstverständlichen formuliert, eine deutsche Medienlandschaft, in der das Selbstverständliche zum großen Rätsel aufgebauscht wird, sobald es um Antisemitismus und die Legitimität eines Antisemitismus-Vorwurfs geht. Hitler wird hier also in seiner inszenierten Anschaulichkeit nicht mehr – wie bis 1945, da er seine monströse Macht entfaltete – als der Gegenstand einer Kritik vergegenwärtigt, sondern als das Mittel, sich satirisch gegen andere Gegenstände zu wenden. Man
Carsten Jakobi: Das billige Experiment
könnte sagen: Er dient als hyperbolische Maßeinheit, in der für kritikabel erachtete Objekte gemessen werden. Dass dadurch der Objektbezug – das scheinbar einfachste der Satiremerkmale –Rezeptionsschwierigkeiten bereiten kann, ist kein Zufall: Er hat nämlich eine historische Dimension. Um ihn zu erkennen, muss man das Objekt kennen; sobald es nicht mehr präsent ist, wird die Satire un- oder missverständlich. Man muss die Möllemann-Debatte aus dem Jahre 2002 kennen, um zu verstehen, worum es dem titanic-Titelblatt geht.17 Das ist kein formeller, sondern ein gradueller Unterschied zu den früheren Hitler-Satiren, bei denen die Prominenz des Karikierten so monströs ist, dass es einer Kontextualisierung allenfalls in kleineren, spezifischen historischen Details bedarf. Es ist schwer zu sagen, wann diese gravierende Funktionsveränderung ihren Anfang genommen hat. Das titanic-Titelbild partizipiert, wie auch die Serie Der Führer privat (1995–1998),18 bereits an ihrer Durchsetzung. Möglicherweise stellte die stern-Affäre um die gefälschten Hitlertagebücher (1983) einen Dammbruch dar. Sie zog eine Vielzahl von Hitler-Karikaturen nach sich, die allesamt nicht auf Kosten Hitlers gingen, sondern des stern und seiner leichtgläubigen journalistischen Arbeit und sensationsheischenden Berichterstattung, die innerhalb kürzester Zeit wie ein Kartenhaus in sich zusammenfiel. Von dort bis zur satirischen Verfilmung der Affäre (Schtonk! von Helmut Dietl, 1992) vergingen zwar einige Jahre, es gibt aber keinen Sprung in der satirischen Logik. Noch bleibt in diesem Film die Darstellung der historischen Figur Hitler indirekt – es geht nicht um ein etwaig authentisches Tagebuch Hitlers, sondern dessen Fälschung; die Physiognomie des Fälschers nähert sich zwar zwischenzeitlich an die seines Fälschungsobjekts an, damit ist er aber nicht mit Hitler identisch. Jedoch finden sich seit dieser Zeit vermehrt satirische Darstellungen der Figur Hitlers – wie auf zahlreichen titanic-Titelblättern, in der ComedySendung Switch reloaded (2007–2012) oder in Daniel Levys Film Mein Führer – Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler (2007) mit Helge Schneider in der Titelrolle. Ein Ende dieser Konjunktur scheint nicht abzusehen. Worum es im Folgenden geht, ist keine auf Vollständigkeit abzielende Titelaufzählung, sondern eine abschließende exemplarische Analyse eines paradigmatischen literarischen Werks: Timur Vermesʼ Roman Er ist wieder da (2012).19 Sein Titel 17
18 19
Die Ausstellung »40 Jahre Titanic – Die endgültige Titel-Ausstellung im Frankfurter Caricatura Museum« (03.10.2019–02.02.2020), knapp 20 Jahre nach dem diskursiven Kontext der Titelkarikatur, stattete daher die Präsentation des Titelbildes mit einer ausführlichen Erläuterung aus. Gesammelt in: Greser [2000] 2011. Der Roman wurde 2015 von David Wnendt verfilmt. Die medienspezifische Transformierung aus der internen Fokalisierung des Romans in die externe Fokalisierung der Filmerzählung hat beträchtliche, auch inhaltliche Konsequenzen; dieser Vergleich wird hier aber nicht weiter verfolgt.
173
174
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
knüpft an Walter Moersʼ Hitler-Comic Adolf: Äch bin wieder da!! (1998) an, dessen Grundlage wiederum eine Karikaturen-Serie in der titanic darstellte. Der erzählerische Grundeinfall von Vermesʼ Roman ist allseits bekannt: Der historische Hitler erwacht im Sommer 2011, 66 Jahre nach seinem Selbstmord, zwar nach Benzin stinkend, aber sonst unbeschädigt und nicht gealtert, in der alten und neuen Hauptstadt Berlin wieder zum Leben. Plausibilitätsgerecht wird er von seiner Umgebung nicht als der authentische Hitler, sondern als Schauspieler bzw., dem durchgesetzten Genreformat von Hitler-Darstellungen entsprechend, als Comedian aufgefasst20 – während Hitler selbst von seiner Identität völlig überzeugt ist und alle Versuche, ihn als Comedian zu installieren und zu goutieren, als Zustimmung zu seinem neuen Welteroberungsplan missversteht. Letzteres Missverständnis beruht auf dem zentralen formalen Einfall, den Roman konsequent aus der Ich-Perspektive, also homodiegetisch und intern fokalisiert zu erzählen. So bei Hitlers erstem Fernsehaufritt als ›Hitler‹: Das Lob des Medienarbeiters Sawatzki für die künstlerische Professionalität erscheint Hitler als Anerkennung seiner politischen Haltung – die Leser:innen sehen sich unmittelbar mit dem Widerspruch zweier entgegengesetzter Irrtümer konfrontiert (vgl. Vermes 2012, 178). Wenn Hitler später auf dem Weg zu einer Wagner-Oper von Neonazis brutal zusammengeschlagen wird (vgl. Vermes 2012, 372), eskaliert dieses gegenseitige Missverstehen. Aus der Außenperspektive erscheint dies als satirischer Selbstwiderspruch: Die Neonazis attackieren, ohne es zu wissen, ihr größtes Idol, da dieses als scheinbarer Comedian ihr größtes Idol in den Dreck zieht. Auf diesem laufenden gegenseitigen Missverstehen beruht der erste satirische Grundeinfall des Romans. Sein zweiter hat eine ehrwürdige literarische Tradition: Der anachronistische Blick des personalen Mediums rückt die beschriebenen Verhältnisse der Gegenwart des zeitgenössischen Lesers in einen satirisch verfremdeten Fokus, insofern dem personalen Medium seine neue Umgebung unverständlich erscheint und es versucht, seine Wahrnehmungen an den Maßstäben der eigenen Erfahrungen zu messen. Das literarhistorisch womöglich berühmteste Beispiel dafür sind Montesquieus Lettres persanes (1721), in denen ein kulturell und politisch unwissender persischer Reisender von seiner Reise nach Paris berichtet: Der französische Blick auf das Vertraute der eigenen Gegenwart wird so satirisch korrigiert
20
Vermes kehrt damit die Konstellation aus Ernst Lubitschs legendärer Filmkomödie To Be or Not to Be (1942) in ihr Gegenteil um: Der Film beginnt noch vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs damit, dass eine polnische Theatergruppe ein antifaschistisches Zeitstück inszeniert, in dem auch Hitler auftritt. Dessen Darsteller Bronski (im Film verkörpert von Tom Dugan) unternimmt in einer Theaterpause in vollem Kostüm und voller Maske einen Gang durch Warschau, und er, der natürlich um seinen Schauspielerstatus weiß, wird dort von den Bewohner:innen entsetzt als der ›echte‹ Hitler angesehen.
Carsten Jakobi: Das billige Experiment
durch einen unvertrauten (›persischen‹) Blick auf das ihm Unvertraute. In expliziter Anbindung hat Herbert Rosendorfer diese Technik in seinem Roman Briefe in die chinesische Vergangenheit (1983) verwendet. An diesem Grundeinfall partizipiert auch Vermes zur Genüge, wenn er seinen Hitler mit den technischen und kulturellen Innovationen des 21. Jahrhunderts konfrontiert: Der Computer und v.a. das »Internetz« stehen zunächst jenseits von Hitlers Erfahrungswelt, und sein Nichtwissen, verstärkt durch seine charaktertypisch ausgeprägte vermeintliche Überlegenheit gegenüber dieser Welt, lässt ihn als Narren durch eine Welt der Zeitgenoss:innen laufen.21 Der Vergleich dieser Werke mag die unspezifische Komik von Vermesʼ Roman charakterisieren: ›Hitler‹ kürzt sich aus der satirischen Logik selbst heraus. Dass ein uralter, aus der Zeit gefallener Mann keine Ahnung vom Internet oder der kulturell etablierten Form einer Talkshow hat, stellt keinerlei Spezifik in Hinblick auf Hitler dar. So stellt sich hier die kulturhistorisch relevante Frage nach dem Objekt der Satire. Ein Paratext des Romans, der der Titelei vorangestellte Waschzettel (aus technischen Gründen kein Klappentext), formuliert halb richtig, halb falsch: »Weil der Leser sich zunehmend ertappt, wie er nicht mehr über Hitler lacht. Sondern mit ihm.« (Vermes 2012, 3) In der Tat provoziert die Schilderung oftmals ein Lachen aus der Perspektive des allerdings unspezifischen Mediums der Satire. Die Objekte der Satire weisen allerdings auf einen doppelten Maßstab zurück, einen des idealen Funktionierens und den seiner faschistischen Brauchbarkeit. Schließt man letzteren aus, bedeutet dies nicht, dass ein Lachen unmöglich sei oder im Anschluss an ›Hitler‹ bestünde. Anders gesagt: Über das gleiche Objekt zu lachen, bedeutet nicht, den jeweiligen Maßstab, von dem aus verlacht wird, zu teilen. Um dies an einigen Beispielen zu illustrieren: Das wohl prominenteste Objekt satirischer Kritik, das der Roman aufbietet, ist die Medienlandschaft des frühen 21. Jahrhunderts. Dies beginnt in elementarer Form, als Hitler einen weggeworfenen Media-Markt-Werbeflyer mit einer Zeitung verwechselt: »Die Informationen darin waren völlig unverständlich, Groll stieg in mir hoch, wie man in Zeiten der Papierknappheit mit so einem hirnlosen Dreck wertvolle Ressourcen des Volkseigentums unwiederbringlich verschleudern konnte.« (Vermes 2012, 18) Das Beispiel ist typisch für Hitlers Technik des Beurteilens: Stets versetzt die Figur das neu Beobachtete in ein Verhältnis zu seiner ›Gegenwart‹, und zwar erstens unter einem Nützlichkeitsaspekt für seine ›Gegenwart‹; zweitens in ein zeitliches und kausales Verhältnis zur
21
Im Unterschied zu Montesquieu und Rosendorfer ist das Medium der Begegnung mit ›hier‹ und ›heute‹ jedoch kein unbeschriebenes Blatt, sondern selbst hochprominente Vorgeschichte des Heute: Hitler steht, zumindest in politischer Hinsicht, im zeitlichen und kausalen Bezug zur Gegenwart und besichtigt das Resultat seiner Taten.
175
176
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Vergangenheit. Dass die Kausalität dabei durchgängig scheitert, macht die Komik dieses Anachronismus aus. Auch wenn man sich den faschistischen Maßstäben der Beurteilung nicht anschließt, kann die Kritik als berechtigt erscheinen: Ihr Gegenstand ist ein Ärgernis, das deshalb weggeworfen wurde. Ähnliches gilt für Hitlers Kritik des Radio-22 oder des Fernsehprogramms, in dem sich stereotyp Kochsendungen und private Elendstalkshows abwechseln (vgl. Vermes 2012, 72–74). Die Berechtigung dieser Kritik zeigt sich, wenn Hitler eine Gerichtsshow resümiert: »Der Anwalt hatte einen Bart wie Buffalo Bill, und sämtliche Darsteller sprachen und bewegten sich, als wäre die Stummfilmära erst am Vortage beendet worden.« (Vermes 2012, 76) Parallel zu solchen Einschätzungen vollzieht sich Hitlers Aufstieg zum Comedy-Star, der einen fragwürdigen Prominentenstatus erlangt wie auch andere Oktoberfestgäste, die er bei einem medial orchestrierten Wiesn-Besuch trifft (erkennbar sind Roberto Blanco, Ingrid van Bergen, Verona Pooth und Lothar Matthäus23 mit seiner »Tochter«; vgl. Vermes 2012, 348–354), welchen er selbst zutreffend ironisch kommentiert: »Wie mir mehrfach bestätigt wurde, war aus dem Oktoberfest inzwischen ein Volksfest geworden, das ohne allzu große Beteiligung der Bevölkerung auskam.« (Vermes 2012, 341) Indem der Roman auch ein Zusammentreffen Hitlers mit zeitgenössischen Politiker:innen veranstaltet, vollzieht er permanent einen Übergang ins Kabarettistische: Helmut Kohl ist in Hitlers Urteil der »klobigste und teigartigste« Kanzler (Vermes 2012, 141), Angela Merkel ist die »klobige Frau mit der zuversichtlichen Ausstrahlung einer Trauerweide« (Vermes 2012, 144). Von Helmut Schmidt, einer Ikone der BRD, heißt es: »[D]ieser Mann etwa hat absolute Narrenfreiheit und kann Blödsinn reden noch und noch. Man setzt ihn in einen Rollstuhl, wo er in ununterbrochener Reihenfolge Zigaretten abbrennt und in einem unerträglich langweiligen Duktus die dümmsten Allgemeinplätze verkündet.« (Vermes 2012, 282) Die – mäßig – komische Wirkung dieser kabarettistischen Einfälle basiert nicht darauf, dass Hitlers faschistische Maßstäbe der Beurteilung des politischen Personals mit denen der womöglich demokratische Politikerkritik gewohnten Rezipient:innen zusammenfielen: Eher treten Hitlers Maßstäbe ganz zurück, weil sie für den komischen Effekt gar nicht nötig sind. Wichtiger sind Hitlers Maßstäbe, wenn er sich mit der NPD – seiner angemaßten Nachfolgepartei – befasst. Ein Besuch in ihrer Parteizentrale vermittelt ihm den
22
23
»Direkt nach dem Einschalten ertönte ein infernalischer Lärm, häufig unterbrochen von unfassbarem, vollkommen unverständlichem Geschwätz. Am Inhalt änderte sich in der Fortdauer nichts, allein die Häufigkeit des Wechsels zwischen Getöse und Geschwätz nahm zu.« (Vermes 2012, 32). Ausgerechnet Matthäus, der nichts ›versteht‹, lobt Hitlers Auftritte jenseits aller Satire für ihren Klartext (vgl. Vermes 2012, 353).
Carsten Jakobi: Das billige Experiment
Eindruck maximaler Unfähigkeit. Von seinem Erstkontakt heißt es: »Das Jüngelchen jedenfalls, das ich gesehen hatte, wäre an der Schaufel genau sowenig zu gebrauchen gewesen wie im Felde« (Vermes 2012, 262) – und einen ebensolchen Eindruck vermittelt der herbeigeschlichene NPD-Bundesvorsitzende Holger Apfel (vgl. Vermes 2012, 268). Dass hier die geradezu zivile Tugend des Gammelns lächerlich gemacht wird, mag in Hitlers Weltbild stimmig sein – fatalerweise funktioniert hier aber die Satire nur dadurch, dass die NPD im Urteil ihres obersten Experten nicht faschistisch genug sei, also ein faschistischer Maßstab in Anschlag gebracht wird.24 Die Hitlersatire wird zum risikolosen konsensuellen Unterhaltungsprogramm ohne jede Gefahr eines Missverstehens – jedenfalls für Rezipient:innen jenseits des NPDSpektrums, die sich auch mit einer argumentlosen Kritik zufriedengeben. Etwas brisanter ist das kritische Verhältnis zur Grünen Partei. Im Vergleich mit den übrigen Parteien kommt sie in Hitlers Urteil besser davon, der »[e]inzige[] Lichtblick« (Vermes 2012, 145), der sich »[d]em Schutze der deutschen Umwelt« (Vermes 2012, 146) verschrieben habe. In einer direkten Talkshow-Konfrontation mit Renate Künast – damals Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion – macht Hitler ihr geradezu eine Koalitionsofferte (vgl. Vermes 2012, 333f.), lobt Joseph Fischers Einsatz für den Kosovo-Krieg (vgl. Vermes 2012, 337) und sieht sich mit Künast einig, den sinnlos gewordenen Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr abzubrechen (vgl. Vermes 2012, 338). Die Anerkennung dieser ›grünen‹ Perspektiven zielt auf die Irritation der Maßstäbe ihrer Anhänger ab: Die grünen und die hitlerischen Maßstäbe fallen nämlich auseinander, aber ohne dass Hitler diesen Dissens thematisierte oder Künast ihn zu artikulieren in der Lage wäre. Aus der Perspektive grünaffiner Rezipient:innen: Hitlers Lob für die Grünen ist wortwörtlich keine Kritik, soll aber, da vom Kriegsherrn Hitler artikuliert, eine sein – zumal sie einen ehemals zentralen programmatischen Baustein der grünen Politik, ihren Pazifismus, (be)trifft. Der Roman widmet sich damit einem breiten Objekt, allgemein: der deutschen Diskurslandschaft, und zwar nicht nur dort, wo sie Hitler als negatives Material einer gesellschaftlichen Debatte behandelt, sondern ganz unabhängig vom Umgang mit dem Nationalsozialismus. Nicht mehr steht, wie in der Filmsatire Schtonk!, der spezifisch liberal-verlegene Umgang mit Hitler im Zentrum, sondern die mediale 24
Ähnlich operiert, mit allen problematischen Implikationen, die Clip-Reihe NNN – Neueste Nationale Nachrichten des NDR-Magazins extra 3 (zum Thema NPD z.B.: https://www.youtube.c om/watch?v=ILuk4aflouA). Einer authentischen Hitlerrede wird ein jeweils auf einen aktuellen Anlass, meist auf das Spektrum des Rechtsextremismus bezogener, absichtsvoll plump von einem Stimmenimitator gesprochener Text unterlegt, in dem Hitler die Kritik an seinen unfähigen Nachfolgern artikuliert und darin deren Hilflosigkeit in Hinblick auf sein Erbe demonstriert. Es liegt hier fast eine Wiederkehr der sehr frühen Hitler-Satiren vor: Der Anspruch der politischen Bewegung wird gemessen an deren Hilflosigkeit. Allerdings richtet sich die Tendenz auch hier nicht gegen Hitler, sondern gegen ein Gegenwartsphänomen.
177
178
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Bereitschaft, alles zu verwerten – was selbst Gegenstand einer Satire sein kann (Greser [2000] 2011, unpaginiert [88], Abb. 4):
Abb. 4: Achim Greser: Der Führer privat
Offenbar störte sich der Karikaturist hier an der Sitte, noch die größten politischen Widerwärtigkeiten als Querdenkerei zu adeln.
Carsten Jakobi: Das billige Experiment
5. Fazit Der historische Wandel von ›Hitler-Satiren‹ signalisiert einen mehrfachen Sinn dieses Kompositums: Nach der welthistorischen Niederlage des NS-Faschismus (seither ist die Hitler-Satire kein wie auch immer prekäres und um seine Relevanz ringendes Medium der Kritik an ihrem Gegenstand) verschiebt sich der Gegenstandsbereich von Satiren, in denen die Figur Hitler direkt oder indirekt erscheint: Nicht mehr Hitler, sondern der Umgang mit dieser Figur wird zum Stoff der Satire – etwa in Hinblick auf dessen mediale Präsenz. Das Verhältnis der Gegenwart zu Hitler changiert zwischen frivoler Nonchalance und Faszination. Dies ist der Gestus von Vermesʼ Roman, sein Thema und seine Haltung. Das Wagnis des medial inszenierten Skandals um den Roman ist begrenzt: Er steht in dieser Ambivalenz viel zu nahe an seinem Gegenstand, als dass er als Provokation oder Risiko aufgefasst werden könnte. Er bleibt, im Gegensatz zu früheren Hitler-Satiren, die sich gegen den Bewerber, später Exekutor totaler Macht richteten, ein billiges Experiment – zum Ladenpreis von 19,33 €.
Literatur Adorno, Theodor W. »Ist die Kunst heiter?« [1967]. In: Ders. Noten zur Literatur. Frankfurt a.M. 6 1994, 599–606. Basil, Otto. Wenn das der Führer wüßte. Roman [1966]. Mit einem Nachw. v. Johann Holzner. Wien 3 2013. Brecht, Bertolt. »Hitler-Choräle 2« [1933]. In: Ders. Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. Hg. v. Werner Hecht et al. Bd. 11: Gedichte 1. Berlin, DDR/ Weimar/Frankfurt a.M. 1988, 217. Braese, Stephan. Das teure Experiment. Satire und NS-Faschismus. Opladen 1996. Brummack, Jürgen. »Satire«. In: Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Hg. v. Werner Kohlschmidt/Wolfgang Mohr. Bd. 3. Berlin, West/New York 2 1977, 601–614. Dogramaci, Burcu. »Der Stift als Seziermesser im englischen Exil. Politische Zeichnungen von Richard Ziegler und Walter Trier für Die Zeitung«. In: Exil im Krieg 1939–1945. Hg. v. Hiltrud Häntzschel et al. Göttingen 2016, 99–110. Dr. Schrecklichkeit. Struwwelhitler. A Nazi Story Book by Dr. Schrecklichkeit. Eine Parodie des Original-Struwwelpeter von Peter und Philip Spence [1941]. Aus d. Engl. übertragen v. Dieter H. Stündel. Berlin 2005. Greser, Achim. Der Führer privat [2000]. Mit einem Nachw. v. Wiglaf Droste. Berlin 3 2011. Hanfstaengl, Ernst. Hitler in der Karikatur der Welt. Tat gegen Tinte. Berlin 1933.
179
180
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Heine, Th[omas] Th[eodor]. »Ergebnislose Haussuchung bei Hitler«. In: Simplicissimus 35.2 (07.04.1930), 23. Heine, Th[omas] Th[eodor]. »Wie sieht Hitler aus?« In: Simplicissimus 28.9 (28.05.1923), 107. Hermand, Jost. »Brechts Hitler-Satiren«. In: Ders. Die Toten schweigen nicht. BrechtAufsätze. Frankfurt a.M. et al. 2010, 68–82. Hoffmann, Torsten/Langemeyer, Peter/Unger, Thorsten. »Nachwort«. In: Ernst Toller. Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe. Hg. v. Dieter Distl et al. Bd. 1: Stücke 1919–1923. Göttingen 2015, 521–536. Jakobi, Carsten. »Von den Freiheiten und Grenzen des komischen Dramas in finsteren Zeiten. Exilkomödien über den NS-Rassismus«. In: literatur für leser 28.2 (2005), 99–111. Jung, Thomas. »Die Unfähigkeit zu lachen. Die permanente Wiedergeburt des Führers aus dem Geist der Unterhaltung«. In: Zeitgeschichte-online. Zeitgeschichte im Film, März 2006. www.zeitgeschichte-online.de/film/die-unfaehigkeit-zulachen (Zugriff: 12.03.2022). Kraus, Karl: [o.T.]. In: Die Fackel 35.888 (1933), 4. Naumann, Uwe. Zwischen Tränen und Gelächter. Satirische Faschismuskritik 1933 bis 1945. Köln 1983. Neugebauer, Rosamunde. Zeichnen im Exil – Zeichen des Exils? Handzeichnung und Druckgraphik deutschsprachiger Emigranten ab 1933. Weimar 2003. NNN – Neueste Nationale Nachrichten. https://www.youtube.com/watch?v=ILuk4aflo uA. Scher, Peter [Ps. Trim]. »Rechter Hand, linker Hand, alles vertauscht«. In: Simplicissimus 27.35 (29.11.1922), 498. Schnorbach, Hermann. »Clement Moreaus Zeitungskarikaturen als Vorbild für Hitler-Figuren von Bertolt Brecht«. In: Hitler im Visier. Literarische Satiren und Karikaturen als Waffe gegen den Nationalsozialismus. Hg. v. Viktoria Hertling/Wulf Koepke/Jörg Thunecke. Wuppertal 2005, 175–192. Toller, Ernst. »Briefe aus dem Gefängnis« [1935]. In: Ders. Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe. Hg. v. Dieter Distl et al. Bd. 3: Autobiographisches und Justizkritik. Göttingen 2015a, 275–413. Toller, Ernst. »Der entfesselte Wotan. Eine Komödie« [1923]. In: Ders. Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe. Hg. v. Dieter Distl et al. Bd. 1: Stücke 1919–1923. Göttingen 2015b, 235–275. Tucholsky, Kurt [Ps. Theobald Tiger]. »Schnipsel« [1932]. In: Ders. Gesamtausgabe. Texte und Briefe. Hg. v. Antje Bonitz/Dirk Grathoff/Michael Hepp/Gerhard Kraiker. Bd. 15: Texte 1932/1933. Reinbek 2011, 69–71. [Erstmals in: Die Weltbühne (08.03.1932), 377f.]. Vermes, Timur. Er ist wieder da. Köln 2012.
Carsten Jakobi: Das billige Experiment
Widmann, Andreas Martin. Kontrafaktische Geschichtsdarstellung. Untersuchungen an Romanen von Günter Grass, Thomas Pynchon, Thomas Brussig, Michael Kleeberg, Philip Roth und Christoph Ransmayr. Heidelberg 2009. Willibrand, William A. Ernst Toller and his Ideology. Iowa City 1945. Wolff, Tim. »Liebe Fans!«. In: titanic 7 (2017), 4. https://www.titanic-magazin.de/fileadmin/_migrated/pics/Fuehrer_Privat42.jpg. (28.02.2023).
181
Der konzentrierte Blick. Zum Werk von Anna Katharina Hahn Jakob Hessing
Für Anna Katharina Hahn ist das Erzählen eine Notwendigkeit. Das sagt an sich noch wenig – so geht es vielen, die ihr Leben dem Schreiben widmen –, doch dieses scheinbar Offensichtliche verbirgt die Frage, warum das so ist. Zumeist nehmen wir Literatur als Konsument:innen wahr, wir wollen wissen, wie weit die Texte uns gefallen, was wir von ihnen haben. Welches Bedürfnis sie für den Schreibenden erfüllen, kommt dabei kaum in den Blick. Hahn selbst gibt uns eine Antwort darauf, und ich komme darauf zurück, aber erst später. Denn ich will nicht vorgreifen, will die Autorin und ihre Deutung des eigenen Schreibens nicht befragen, bevor wir uns in ihren Texten umgeschaut und die Welt kennengelernt haben, die in ihnen entsteht.
1. Stilübungen Hahn, 1970 als Tochter eines Arztes geboren, wuchs in Stuttgart auf. Hier lebt und schreibt sie auch heute, die Stadt ist zu einem Teil ihres Werkes geworden. Früh begann sie zu veröffentlichen, ihre ersten Texte erschienen in angesehenen Zeitschriften, als sie noch zur Schule ging. Dann, in den 1990ern, studierte sie in Hamburg Germanistik, Anglistik und Volkskunde, und fast schien es, als würde die Tochter aus gutem Hause die bildungsbürgerliche Bahn einschlagen: eine akademische Karriere. Sie hatte schon eine mittelalterliche Historienbibel ediert, das wäre kein schlechter Auftakt gewesen – aber es ist anders gekommen. Wir schauen zuerst auf Kavaliersdelikt, den zweiten Band der frühen Erzählungen, die den Anfang ihres Werkes bilden; Sommerloch erschien 2000 und 2002 im Taschenbuch, Kavaliersdelikt 2004. In der Titelgeschichte (Hahn 2004, 25–40) wertet eine wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für mittelalterliche Literatur den Wortschatz von Minneromanen aus. Das Zimmer teilt die junge Frau mit ihrer Vorgesetzten, die zugleich ihre Doktormutter ist und beim Lesen der Texte in erotische Ekstase gerät. Endlich bleibt die Hilfskraft allein und tritt nun selbst in die Welt ihres Textes ein. Als Zofe verkleidet, folgt sie dem Ritter in die Kemenate seiner Dame,
184
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
dort vertreibt er den alten Ehemann und vergewaltigt die Dame, dann knöpft er sich auch die Zofe vor und tut ihr Ähnliches an. Das stört die Zofe aber nicht, denn als sie die Augen aufschlägt – ob aus einem Schlaf oder einem Tagtraum, ist schwer zu sagen –, scheint sie recht angetan zu sein. Befriedigt schließt die Hilfskraft ihre Lektüre ab, beendet den Arbeitstag und verlässt das Büro. Sie hat sich die Nummer eines Kommilitonen notiert, mit dem sie bald Vergleichbares erleben möchte. Eine andere Geschichte des Bandes heißt Affenadam (Hahn 2004, 16–24). Sie spielt im Ostberlin nach dem Mauerfall, wo eine neue Boheme an die verschütteten Traditionen der Stadt anknüpft. Der Protagonist, Student der Medizin, sucht seine erotischen Abenteuer bei den Geisteswissenschaften, von denen er sich mehr verspricht als vom eigenen Fach. Die junge Dame, die er abschleppt, gaukelt ihm eine jüdische Herkunft vor und wandelt auf den Spuren Else Lasker-Schülers. Der Student hat keine Ahnung, wovon sie redet und kommt auch nicht zum Ziel bei ihr, doch heimlich nimmt er sich aus ihrem Zimmer ein schmales Buch mit. So lernt er einige Gedichte Gottfried Benns kennen, mit deren Hilfe er das nächste Treffen erfolgreicher gestaltet – und dass die Liebe zwischen den beiden dennoch nicht gedeihen will, gehört zu den Traurigkeiten des Lebens. In ihren frühen Erzählungen zeigt Hahn eine starke satirische Begabung, und es wird aus deren Lektüre schnell ersichtlich, warum auch die Autorin keinen Wert auf eine akademische Karriere legt. Der Kulturbetrieb erscheint darin suspekt, sie deckt seine Verlogenheit auf: die Verschleierungen des Wortschatzes, in den die Minnedichtung des christlichen Mittelalters die Wahrheiten unserer Geschlechtlichkeit hüllt; die ›Dichterliebe‹ zwischen Lasker-Schüler und Benn, mit der auch die Germanist:innen die historische Lüge von der ›deutsch-jüdischen Symbiose‹ verbreiten. Hahns Satire trifft aber nicht nur die Kultur, sondern das Leben selbst. Die letzte Geschichte des Bandes, Kommune Kalk (Hahn 2004, 77–88), ist eine Dystopie im Jahr 2050. Sechs alte Menschen – drei Frauen, drei Männer – entziehen sich der staatlichen Kontrolle und leben in einer WG, weil sie ihre Freiheit brauchen. Sie heißen wie ihre Gebrechen, Beta-Blocker-Boris und Parkinson-Paula, nur Zahn-Harry trägt noch die eigenen Zähne im Mund. Vor fünf Jahren haben sie ihre WG gegründet, und nun machen sie wieder einen Raubzug durch die Läden, um das gebührend feiern zu können. Auch mit den teuren Medikamenten müssen sie sich noch versorgen und werden bald jemandem auflauern, der mit vollen Taschen aus einer Apotheke kommt. Nicht nur Hahns Humor ist schwarz, sondern auch die Welt, die sie beschreibt. »76 war ich damals, als wir eingezogen sind«, sagt Beutel-Benni (Hahn 2004, 81). So heißt der Mann, der das erzählt, und hier liegt die Pointe. Wer im Jahr 2050 um die achtzig ist, kam zur gleichen Zeit zur Welt wie die Autorin selbst: Es ist ihre eigene Generation, der Anna Katharina Hahn einen dunklen Horizont aufspannt.
Jakob Hessing: Der konzentrierte Blick. Zum Werk von Anna Katharina Hahn
2. Am Ort der Tragödie Die alten Menschen in Kommune Kalk sind nicht die einzigen Außenseiter:innen in den Erzählungen. Diese wimmeln von schrägen Typen, die die Normen durchbrechen, kriminell und sexuell, und Hahn gelingt es, dies nicht als Schwäche ihrer Randfiguren sichtbar zu machen, sondern als Mangel einer Gesellschaft, die den Menschen keinen Halt mehr gibt. Das wurde beim ersten Erscheinen der Sammlung kaum bemerkt. Die Autorin, heißt es in einer Besprechung von Kavaliersdelikt, ist »weitgehend unbekannt geblieben. Sie begibt sich an die verschiedensten Orte und fördert dort groteske Abgründe zutage. Aber man weiß nicht, wo man sie einordnen soll.« (Weyh 2004) Der Rezensent gibt Hahn den Rat, ihr Talent nicht auf Phantasien zu richten, sondern auf eine Wirklichkeit, die der Leser mit ihr teilen kann. Genau das ist geschehen, als fünf Jahre später ihr erster Roman erscheint und zum Bestseller wird. Kürzere Tage1 (2009) spielt im Zentrum der Wohlstandsgesellschaft, Hahn verortet den Roman in den Straßen von Stuttgart und zeigt auch dem Ortsunkundigen, wo die Protagonist:innen sozioökonomisch anzusiedeln sind. Ihre Welt ist ›urban‹ geworden. Hat sie also den Rat erfahrener Kritiker beherzigt, kommt sie ihrem Publikum entgegen, um gelesen zu werden? Oder hat Hahns Leben sich geändert, hat sie nun selber eine Familie und schreibt mit anderer Erfahrung? All das mag seinen Anteil an der Entwicklung ihres Werkes haben, und künftige Biographen werden es erkunden. Entscheidend aber ist etwas anderes. In den Romanen, die sie bekannt gemacht haben, kehrt sich im Verhältnis zu den Erzählungen nun die Blickrichtung um. Hatte Hahn zuerst von den Rändern auf die Mitte geschaut, so ändert sie jetzt ihren Standpunkt, geht ins Zentrum der gesellschaftlichen Tragödie. Der Blick von außen wird zum Blick von innen, er zeigt das Herz dieser Gesellschaft2 und wird sparsamer, verzichtet auf satirische Überzeichnung. Statt der Bilderflut in ihren Erzählbänden sehen wir Großaufnahmen der Masken, unter denen die Protagonistinnen der Tragödie auftreten. In Kürzere Tage sind es Judith und Leonie, zwei junge Frauen, die in einem teuren Stadtviertel einander gegenüber wohnen. Leonie, erst kürzlich eingezogen, kennt ihre Nachbarin noch nicht, sieht sie durch ein Fenster nur beim Abendessen: Vater, Mutter und zwei kleine Söhne im Alter von Leonies Töchtern.
1 2
Auch die vier Romane sind bei Suhrkamp erschienen: Kürzere Tage (2009), Am schwarzen Berg (2012), Das Kleid meiner Mutter (2016), Aus und davon (2020). Auch eine Analyse ihres ersten Buches, Sommerloch, würde das spiegelbildliche Verhältnis zwischen den Erzählungen und den Romanen zeigen: Außen und Innen, Peripherie und Zentrum, Unterwelt und Oberwelt.
185
186
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Die großen Fenster im Haus gegenüber sind von gelbem Licht erfüllt […] von fremder Wärme, von der Verheißung einer Privatheit, die die eigenen vier Wände niemals bieten können. […] Wenn Leonie in das Fenster auf der anderen Straßenseite schaut, hat sie das Gefühl, ein Bilderbuch aufzuschlagen, in dem alles so ist, wie es sein soll. Sie gönnt sich den Anblick der heiligen Familie, wie sie die Nachbarn nennt, fast täglich. (Hahn 2009, 99–101) Da hat man schon hundert Seiten gelesen und weiß längst, dass es anders ist. Das kann gar nicht anders sein – heilige Familien gibt es nicht –, doch Hahn hat diesen ersten Schnittpunkt zweier Lebenswege sehr kunstvoll gewählt. Leonie blickt von außen, Judith von innen auf diese Szene eines Abendbrots, und beide glauben dasselbe zu sehen: Auch Judith stilisiert ihr Heim zu einem Hort der Heiligkeit, doch das scheinbar gemeinsame Wunschbild erwächst aus zwei sehr verschiedenen Welten. Judith ist eine gescheiterte Studentin der Kunstgeschichte. Oft wird sie von Ängsten gequält, dem »Wunsch, eine Mumie zu sein, reglos und starr, alle Glieder fest umwunden von harzgetränkten Binden, Finsternis vor den Augen« (Hahn 2009, 10f.). Das erzählt sie aber niemandem, auch ihrem Mann nicht, einem Professor für Maschinenbau, dem sie sich aufgedrängt hat, um sich zu retten. Das Idyll im erleuchteten Fenster ist ihr sorgfältig konstruiertes Tableau eines Scheinlebens. Leonie hat es leichter. Ihre Wünsche sind unschwer zu begreifen, und sie sind auch kaum geheim. Ihr Mann ist ein Aufsteiger in der Welt des Business, die neue Wohnung ist die nächste Stufe auf der sozialen Leiter, die er gerade erreicht hat, und auch sie denkt wie er. In einer Bank macht sie den Newsletter und preist dort die Vorzüge des Kapitalismus an, die sie durchaus zu genießen weiß. Ein bisschen neidisch ist sie nur, weil sie sich als berufstätige Frau nicht um ihre Töchter kümmern kann wie Judith um ihre Söhne. Auch einen kleinen Ehebruch, den sie noch nie begangen hat, würde sie gerne mal machen. Aber sie ist Katholikin und war lange Ministrantin; als es im Hotel mit dem fremden Mann fast so weit ist, tut sie es nicht. Das erfüllt sie tags darauf mit übelster Laune, und obwohl sie ihrem Mann nichts erzählt, kommt es zum Krach zwischen ihnen. Das braucht aber nicht weiter zu bekümmern – die beiden verstehen sich ja, sie werden sich wieder vertragen –, doch das erzählt uns Hahn nicht mehr. Denn an dieser Stelle endet der Roman in einer Katastrophe. Kürzere Tage spielt im Zentrum der Wohlstandsgesellschaft, aber Hahn vertuscht die Ränder nicht. Türkische Straßenjungen streunen durch das gepflegte Viertel, plötzlich wird der Laden überfallen, in dem Judith und Leonie ihre Einkäufe machen, Tumult bricht aus, das Geschäft steht in Flammen, Rettungswagen blockieren die Straße, Polizeistreifen sperren sie ab. Aber das ist nicht die Katastrophe. Der Brandschaden hält sich in Grenzen, die Versicherungen werden ihn decken, und
Jakob Hessing: Der konzentrierte Blick. Zum Werk von Anna Katharina Hahn
auch der Schreck, der den Bürger:innen in die Knochen gefahren ist, wird sich wieder legen. Die Katastrophe betrifft sie nicht, sie wissen nichts von ihr. Die Katastrophe trifft den kleinen Türkenjungen, der den Laden überfallen hat. Er heißt Marco und ist noch keine 13 Jahre alt, Hahn widmet ihm ein eigenes Kapitel. In einem Deutsch und einer Syntax, die uns fremd sind, hören wir von seinem leiblichen Vater, den er nicht kennt, und von dem zweiten Mann, der lange mit seiner Mutter gelebt hat. Der Mann war gut zu ihm, aber dann fuhr er in das ferne Land zurück, aus dem er stammt, Marco hat nur seine Adresse. Ein neuer Mann lebt jetzt mit seiner Mutter, der verprügelt ihn immer, und Marco beschließt, abzuhauen in das ferne Land. Das Geld dafür holt er sich im Laden der reichen Leute, und auf der letzten Seite des Romans steigt er in den Zug. Er geht auf eine Reise, die kein gutes Ende nehmen kann, aber das weiß nur der Leser. Das Kind ist noch zu jung dafür.
3. Elf Jahre später Sie war eine eifrige Studentin, heißt es über Judith, und bald wurde sie Hilfskraft bei ihrem Professor. Unsichtbare Fäden durchziehen das Werk von Anna Katharina Hahn und halten es zusammen. Eine Hilfskraft ist uns schon begegnet – in Kavaliersdelikt, der titelgebenden Erzählung aus der Sammlung von 2004, erträumt sie einen Minneroman –, doch jetzt ist sie älter und verheiratet, ihre Träume haben sich verkrampft. Über ihrem ersten Roman liegt eine Klaustrophobie, der niemand zu entkommen sucht, nur der kleine Marco. Elf Jahre später, in ihrem vierten Roman, nimmt Hahn das Thema der Flucht wieder auf, und schon in seinem Titel, Aus und davon (2020), schwingt ein Hauch von Freiheit mit. Aber er ist doppelbödig: Der Buchstabe, der die Redensart ändert, deutet auch ein Ende an. Eine Familie befindet sich im Stadium ihres Zerfalls. Cornelia, fünfundvierzig Jahre alt und Mutter zweier Kinder, wird von ihrem Mann verlassen. Sie braucht eine Auszeit, nimmt Urlaub in Amerika und bittet Großmutter Elisabeth, sich um die Kinder zu kümmern. Sie weiß noch nicht, dass auch ihr Vater, Elisabeths Mann, soeben das Haus verlassen hat. Die Mitte, von der Hahn auf ihre Tragödien blickt, bricht auseinander, und – es ist merkwürdig – gerade dies bringt Bewegung in den Roman, durchzieht ihn wie ein frischer Atem. Die Klaustrophobie in Kürzere Tage, so begreift man jetzt, erwächst aus einer Mitte, die sich nicht aufgeben kann und blind zusammenhält. Judith weiß, dass alles nur Fassade ist, doch sie gibt es nicht zu. Leonie ist einfacher und unreflektierter, aber im Grunde kaum anders. Auch die soziale Leiter, die sie mit ihrem Mann erklimmt, ist nur eine Illusion. In Aus und davon zerstört Hahn solche Lügen und gibt ihre Figuren frei. Drei Menschen werden auf sich selbst zurückgeworfen: Bruno, der kleine Junge, der noch
187
188
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
in die Grundschule geht; seine Mutter Cornelia, die in Amerika das Weite sucht und menschliche Nähe findet; Elisabeth, die spät, schon fast am Ende, alles neu bedenken muss. Seit sein Vater nicht mehr da ist, geht es Bruno schlecht. Ständig muss er etwas essen und wird immer dicker, die Mitschüler:innen verspotten ihn. Er schwänzt die Schule, auf einem Hinterhof vertilgt er die Wurst, die er sich heimlich eingesteckt hat, und eine Katze schaut ihm zu. Da teilt er die Wurst mit ihr und nimmt das Tier mit sich nach Hause. Auch Cornelia muss mit ihrer Einsamkeit leben. In einem Mietwagen fährt sie die lange Strecke von New York nach Pennsylvania, und nicht nur der Raum dehnt sich aus, auch die Zeit. Dort wohnen Verwandte, ein Zweig der Familie, der vor über hundert Jahren ausgewandert ist. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte die Mutter Elisabeths, Cornelias Großmutter, bei ihnen gearbeitet. Aber die Begegnung ist enttäuschend. Sie trifft eine Frau, deren Geschichten merkwürdig falsch klingen und den Mief uralter Ressentiments verbreiten, das braucht Cornelia jetzt nicht. Sie verabschiedet sich höflich und verbringt den Abend mit einem Mann, den sie zufällig kennenlernt. Er ist älter als sie und schon lange geschieden, er kocht ein schönes Abendessen für sie, und sie sprechen miteinander. Cornelia bemerkt seine verkrampfte Körperhaltung, und da sie Physiotherapeutin ist, macht sie ihm eine Massage und lockert die verspannte Muskulatur seines Rückens. Dann bleibt sie über Nacht bei ihm, und sie schlafen miteinander. Am Morgen bringt er ihr das Frühstück ans Bett, dann fährt er sie zum Flughafen und sie tritt die Heimreise an. Das ist kein Reiseabenteuer und keine erotische Pikanterie. Das ist ein seltener, perfekt erzählter Augenblick der Menschlichkeit in einer zerbrechlichen Welt. Die Geschichte der Urgroßmutter erzählt uns Elisabeth, und sie tut es auf eine besondere Weise. Aber vorher schauen wir noch auf die beiden anderen Romane, denn ihre neue Leichtigkeit hat Hahn sich schwer erkämpft.
4. Zwei Ehepaare und ein Kind Die in Hahns Werk gestaltete Ausweglosigkeit erreicht in Kürzere Tage noch nicht das volle Maß. Einmal deutet es Judiths Todeswunsch zwar an – »eine Mumie zu sein, reglos und starr, alle Glieder fest umwunden von harzgetränkten Binden, Finsternis vor den Augen« (Hahn 2009, 10f.) –, aber erst drei Jahre später, in Hahns zweitem Roman, erfüllt sich dieser Wunsch. Sein Titel, Am schwarzen Berg (2012), benennt eine fiktive Stuttgarter Straße, in der die Personen des Romans wohnen, und ist zugleich der Anfang eines Gedichtes von Eduard Mörike. Den Dichtern Stuttgarts erweist Hahn oft ihre Reverenz und gibt dem Werk damit eine weitere Tiefe, aber die Bilder wirken auch unmittelbar
Jakob Hessing: Der konzentrierte Blick. Zum Werk von Anna Katharina Hahn
und jenseits solcher Zusammenhänge. Aus und davon trägt einen Luftzug der Freiheit in die Erzählung, hier ist es umgekehrt: Wie eine Wand steht der schwarze Berg vor dem Leser bzw. der Leserin und erstickt den Atem. »Emil trat an das Balkongeländer, wo er langsam in die Hocke ging […]. Er atmete vorsichtig, voller Furcht, man könnte unten sein Schnaufen, sein Herzklopfen hören […], behielt das Nachbarhaus im Blick und blieb selbst unsichtbar.« (Hahn 2012, 12) So beginnt der Roman. Emil Bub, Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte, steht kurz vor seiner Pensionierung, seine Frau Veronika arbeitet in der Stadtbibliothek, das Ehepaar hat keine Kinder. Im Nachbarhaus wohnen der Arzt Hajo Rau und seine Frau Carla. Soeben ist Peter dort aufgetaucht, der seit Wochen verschollene Sohn, und Emil hält den Atem an, weil er zutiefst um ihn besorgt ist. Sie sind seit über dreißig Jahren Nachbarn, und Peter ist nicht nur bei seinen Eltern aufgewachsen, sondern auch bei Emil und Veronika. Mehr als der von der Praxis in Anspruch genommene Vater hat Emil den Werdegang Peters beeinflusst, und als er jetzt vom Balkon seine Heimkehr beobachtet, mischt sich ein Schuldgefühl in Emils Sorge. Das Ehepaar gehört dem Mittelstand an, aber sie fühlen sich in ihm nicht wohl. In der Stadtbibliothek lässt Veronika die Stuttgarter Obdachlosen ein, die ein wenig Wärme suchen, und eckt damit bei den Kolleg:innen an; Emil kennt den gesamten Mörike auswendig und hat Peter schon früh für die Abgründe seiner Dichtung begeistert. Auch der Lehrer hat seinen Anteil daran, dass Peter sich seit Jahren der Wohlstandsgesellschaft verweigert, seinen Brotberuf nicht ausüben will und lieber in der Natur lebt. Doch hat er eine Frau geheiratet, die anders denkt als er. Mia, wie Leonie, wünscht sich den sozialen Aufstieg, den Peter ihr nicht bietet, deshalb hat sie ihn verlassen und beide Söhne mitgenommen. Seither war Peter verschwunden, doch jetzt kommt er zurück, und manches erkennen wir wieder: Auch hier stehen sich eine brüchige Mitte und die Ränder gegenüber, auch hier löst eine Familie sich auf, doch das schafft keine Dynamik wie später in Aus und davon. An der Wand des schwarzen Berges kommt alle Bewegung zum Stillstand. Zur bitteren Ironie des Romans gehört es, dass Peter ein Logopäde ist, der nicht spricht. Anders als alle Gestalten, die sie sonst geschaffen hat, lässt Hahn ihn in der Depression verstummen und macht ihn so auch unsichtbar. Der schwarze Berg wirft einen Schatten, aus dem es kein Entrinnen gibt, und alles, was wir über Peter zu wissen glauben, bleibt eine Mutmaßung. Auf den letzten Seiten sitzt er im Abendrot auf der Wiese vor den Häusern. Plötzlich scheint er wieder da zu sein, Emil und der Vater nehmen ihm den wilden Bart ab, und alle sind glücklich. Aber der Leser/die Leserin weiß es besser, und als Peter sich waschen geht und nicht zurückkommt, endet der Roman:
189
190
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Im Haus der Raus brannte im gesamten unteren Stockwerk das Licht. […] Emil und Hajo liefen hintereinander die Stufen hoch. Auch der obere Flur war hell erleuchtet. Die Kinderzimmertür stand offen, dahinter war es dunkel bis auf den bläulichen Neonschein des Aquariums. Emil trat als erster ein. […] Das Fenster stand offen, und der Nachtwind bewegte die Vorhänge über dem Außensims. Auf dem Schreibtisch standen die beiden Pappgesichter, die Peters Söhne gebastelt hatten. Beide starrten mit ihren ungelenk umrandeten Augen auf die Sprossenwand neben dem gegenüberliegenden Regal. […] Peter hatte Carlas alten Gürtel um die oberste Sprosse geschlungen. Seine Füße hingen eine Handbreit über dem Boden. Emil konnte nur für den Bruchteil eines Augenblicks in sein Gesicht schauen. Er hob die Hände an die Ohren, als Hajo zu schreien begann […]. (Hahn 2012, 236f.) Ich habe eingangs erwähnt, dass Anna Katharina Hahn uns eine eigene Deutung ihres Schreibens gibt, und hier, am dunkelsten Punkt ihres Werkes, will ich sie heranziehen. Im Frühjahr 2018 wird sie Mainzer Stadtschreiberin, und in ihrer Antrittsrede spricht sie mit verblüffender Offenheit über sich selbst: »Meine ständige Begleiterin war die Angst. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der sie nicht im Hintergrund lauerte. Woher sie kam, weiß ich nicht. Nur, dass sie sich gierig auf mich stürzte und sich an mir festbiss.« (Hahn 2018) Ich maße mir als Leser nicht an, Hahn mit ihren Figuren in biographische Verbindung zu bringen, aber hier tut sie es selbst, und ich greife einen Punkt heraus. »Am stärksten fühlte ich den Wunsch nach Flucht. Ich wollte buchstäblich weg sein, ausradiert. Verpufft. Ausgelöscht.« Daher »habe ich mich weggedacht, in so viele andere Existenzen, mir so oft gewünscht, eine andere, ein anderer, etwas anderes zu sein.« Denn die Angst »hockte auf meinen Schultern, klammerte ihre knochigen Beine um meinen Hals und trieb mich unbarmherzig an – so wie der Buckelgeist, der in der Erzählung aus ›1001 Nacht‹ Sindbad den Seefahrer überfällt.« (Hahn 2018) Die Frau, die von Sindbad erzählt, heißt Scheherazade, und ihre Geschichten spinnt sie fort, um den König zu befriedigen. Sollte sie keine Geschichten mehr haben, ist sie des Todes. Für Anna Katharina Hahn, so haben wir anfangs gesagt, sei das Erzählen eine Notwendigkeit, und wir fragten, warum das so ist. Hier gibt sie uns eine Antwort.
5. Die Entfesselung der Phantasie Mit dem jungen Werther begrub Goethe einst auch dessen Ideen, die sich nicht leben ließen, und ebenso ist es hier: Mit Peter begräbt Hahn, was überwunden werden muss, wenn man leben will, und damit entwindet sie der Angst einen großen Teil ihrer Macht. »Ich bekämpfe die Angst nicht mehr«, sagt sie in der Mainzer Rede,
Jakob Hessing: Der konzentrierte Blick. Zum Werk von Anna Katharina Hahn
»sondern lebe mit ihr. Sie sitzt mir nicht mehr im Nacken, sondern beleidigt in einer Ecke, wenn ich sie ignoriere und mit anderen Dingen beschäftigt bin. Auf diese Weise kommen wir zurecht.« (Hahn 2018) Nachdem sie Peter sterben ließ, vergingen noch sechs Jahre, bevor sie offen darüber sprach. Peters Tod war ein großer Schritt auf dem Weg, den Hahn in ihrem Werk geht, aber die neue Freiheit wollte geübt sein. Ehe sie die Angst öffentlich in ihre Schranken weisen konnte, schrieb sie noch einen dritten Roman, und diesmal griff sie wieder in den Werkzeugkasten des Humors und der Satire, den sie seit ihren Erzählungen zugeklappt hatte. Das Kleid meiner Mutter (2016) unterscheidet sich in vieler Hinsicht von den anderen Romanen. Er spielt nicht in Stuttgart, sondern in Madrid, und aus der Mitte geht Hahn wieder zu den Rändern zurück. Anita, eine junge Spanierin, ist Lehrerin für kleine Kinder, hat ihren Beruf aber nie ausgeübt, denn sie gehört zur Generation der permanent Arbeitslosen und wohnt bei ihren Eltern. Der Roman spielt im Jahr 2012 zur Zeit der spanischen Wirtschaftskrise. Eine gesellschaftskritische Perspektive kennzeichnet nicht nur Hahns frühe Erzählungen, sondern auch ihre Romane. Als die Eltern plötzlich sterben, steht Anita vor dem Nichts. Sie beschließt, in die Rolle ihrer Mutter Blanca zu schlüpfen, und der Roman verwandelt sich in einen Maskenball. Nicht nur sein Humor, auch sein szenischer Reichtum, sein ständiges Changieren zwischen realen und erträumten Welten erinnern an Hahns frühe Erzählungen. Hier begnügen wir uns damit, einige Motive zu verfolgen, die verschiedene Teile ihres Werkes miteinander verbinden. Die Eltern haben sich hingelegt, es geht ihnen nicht gut, und Anita macht einen langen Spaziergang. Als sie zurückkommt, ist es still im Haus. »Im Flur hörte ich das Tappen meiner nackten Fußsohlen, als ich über den Läufer ging. Vor der geschlossenen Tür verharrte ich, legte das Ohr an das Holz, aber auf der anderen Seite war kein Ton zu hören.« (Hahn 2016, 43) Hahn stellt noch einmal die Szene nach, mit der Am schwarzen Berg endet: Dort gehen Emil und Hajo auf eine Tür zu, die den Tod verbirgt, hier ist es Anita. Jetzt tritt sie ein. »Ich ging geradewegs aufs Fenster zu. Ohne das Bett auch nur mit einem Seitenblick zu streifen, merkte ich, dass sich dort noch immer nichts regte.« Sie stößt die Fensterläden auf, und Licht fällt auf das Ehebett: »Meine Eltern lagen mit einander zugewandten Gesichtern […]. Sie lächelten, als träumten sie etwas besonders Schönes. Noch bevor ich sie berührt hatte, wusste ich, dass beide tot waren.« (Hahn 2016, 45) Am schwarzen Berg muss mit dem Schreckensbild des Selbstmörders enden, weil es danach kein Erzählen mehr gibt. Das Kleid meiner Mutter kehrt die Reihenfolge um: Der Tod der Eltern ist nur der Anfang des Romans, er ist auch die Geschichte einer Emanzipation. Anita kleidet die Toten an, setzt sie ans Fenster – dass die beiden täglich kleiner werden, gehört zu den witzigen Ideen aus Hahns Werkzeugkasten. In ihren Kleidern sind sie schließlich gar nicht mehr zu finden. Da holt Anita ihre al-
191
192
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
ten Puppen aus dem Schrank, zieht sie aus und steckt ihre geschrumpften Eltern in die Puppenkleider. Zumeist sitzen sie jetzt auf dem Vertiko im Flur, aber manchmal nimmt Anita sie herunter und lässt sie an ihren Entdeckungen teilnehmen. Dass die kleinen Eltern ihr dabei zuschauen, ist auch deshalb witzig, weil Anitas Entdeckungen Geheimnisse aus der Vergangenheit ihrer Eltern betreffen.
6. Übergangsobjekte Am Ende kehrt sie in die Wirklichkeit zurück und trägt ihre Eltern in den botanischen Garten, wo sie früher gerne spazieren gingen. Sie setzt sie neben sich auf eine Bank, und ein kleines Mädchen ist fasziniert von ihnen. »Gefallen dir meine Puppen? […] Sie heißen Blanca und Oscar. Kannst du dir das merken?« Sie nickte eifrig. »Sag mir mal ihre Namen!« »Blanca und Oscar«, wiederholte das Kind. – »Ich habe sie schon mein ganzes Leben lang. Aber jetzt bin ich erwachsen und brauche sie nicht mehr. Würdest du dich um sie kümmern?« – Das Kindergesicht verzog sich in ungläubigem Staunen. Ich nickte, griff nach den beiden und hielt sie dem Mädchen hin. »Ich schenke sie dir. Aber du musst mir versprechen, gut auf sie aufzupassen.« (Hahn 2016, 309) Wie Puppen gibt Anita ihre toten Eltern an das kleine Mädchen weiter und vollzieht ein altes Ritual. Denn Puppen gehören zu den Dingen, die man »Übergangsobjekte«3 nennt: Mit ihnen stellen Kinder die Verbindung zwischen ihren Wünschen und der Wirklichkeit her, und auch Erwachsene verwenden sie, um ihre Innen- und Außenwelt im Gleichgewicht zu halten. Ein Netz der Motive verbindet Hahns Werke miteinander. Aus Peters Tragödie wandert der Tod in Anitas Komödie hinüber, wird dort zum Spiel in ihren Händen; und bald darauf, in Aus und davon, kehrt eine Puppe aus Madrid nach Stuttgart zurück: Als Großmutter Elisabeth die Bettdecke des kleinen Bruno ausschüttelt, fällt sie heraus. »Das ist ja der Linsenmaier!« ruft sie überrascht, doch Bruno nennt ihn anders. »Das ist mein Trösterle. Den hab ich in Mamas Schrank gefunden.« (Hahn 2020, 78) Es ist ein schöner Name, den er der Puppe gegeben hat, und Brunos Sätze führen vor, wie Übergangsobjekte funktionieren: Sie trösten ein verstörtes Kind und kommen aus dem Schrank der Mutter – aus der Wärme des Nestes, nach der das Kind sich sehnt. Weil sie mit Linsen gefüllt ist, hieß die Puppe einst der Linsenmaier. Zuerst gehörte er Elisabeths Mutter, die als junges Mädchen bei Verwandten in Amerika 3
Der Begriff wurde von Donald Winnicott geprägt, einem englischen Kinderarzt und Psychoanalytiker.
Jakob Hessing: Der konzentrierte Blick. Zum Werk von Anna Katharina Hahn
gearbeitet hatte, dann kam er zu Elisabeth, Cornelia und Bruno. Jetzt, als Elisabeth ihn unerwartet wiedersieht, erregt es sie heimlich, und da sie nachts nicht schlafen kann, schreibt sie seine Geschichte auf. Vordergründig tut sie es für Bruno, dem sie das erzählen will, aber dafür scheint die Geschichte kaum geeignet. In einer kindlichen Sprache lässt Elisabeth den Linsenmaier vom Schiffsbrand berichten, dem ein Teil der amerikanischen Verwandten zum Opfer gefallen war, und von den Schreckensnächten, die Elisabeths Mutter als Pflegerin einer halb verbrannten Frau durchzustehen hatte. Aber in Wirklichkeit geht es um etwas anderes. Es ist die Geschichte ihres Elternhauses, die Elisabeth hier unter der Maske des Linsenmaier halb erzählt und halb verbirgt. In schlaflosen Nächten schreibt sie das nicht für Bruno auf, sondern für sich selbst und verschweigt dabei mehr, als sie aussprechen kann. Ihr Vater war ein fanatischer, vom Glauben an Jesus besessener Christ. Seine Frömmigkeit gab er als Liebe aus, aber sie war nur eine Form der Unterdrückung und hat Elisabeths Leben bestimmt. »Nicht zu oft mit dem Linsenkerl spielen, gell?« sagt er zu seiner fünfjährigen Tochter, als die Mutter ihr die alte Puppe schenkt. »Jedes Mal, wenn du auf etwas verzichtest, das dir gefällt, machst du dem Heiland eine Freude.« (Hahn 2020, 272) Das – ob sie es wollte oder nicht – hat sich in ihrer Seele festgesetzt. Die Lust des Fleisches ist ihr immer fremd geblieben, und jetzt hat ihr Mann sie verlassen. Was sie den Linsenmaier in schlaflosen Nächten erzählen lässt, ist die Vorgeschichte ihrer späten Einsamkeit. * Schon in Kürzere Tage, noch vor Peters Selbstmord, geht eine alte Frau auf eine Tür zu, hinter der ein Toter liegt. Sie wohnt im Parterre unter Judith, ist weit über achtzig und eine Ausnahme im Werk von Anna Katharina Hahn: Luise Posselt ist ein glücklicher Mensch. In der Hitlerzeit wächst sie zur jungen Frau heran, und im Sommer 1945 begegnet sie dem Lehrer Wenzel. Der ist aus den Sudeten nach Stuttgart gekommen, bald darauf heiraten sie und leben jetzt seit sechzig Jahren miteinander. Luise war im Krieg schon einmal Braut gewesen, ihr Verlobter war in Stalingrad gefallen. »Der Eugen war bei der Schutzstaffel […]. Ein Lustiger, machte immer Späßle: ›Der Katz miaut nicht mehr.‹« (Hahn 2009, 189) Was das bedeutete, wusste Luise sehr wohl. Der Eugen hatte ihr auch einen jüdischen Pelz gebracht, so war das damals halt. Aus dem Gestein eines Jahrhunderts meißelt Hahn eine deutsche Frau heraus, die weder besonders gut noch böse ist, weder besonders klug noch tief. Luise ist ein Mensch wie viele andere, doch ihren Wenzel liebt sie. Seine katholischen Leute aus den Sudeten haben ihm nie verziehen, dass er eine schwäbische Protestantin geheiratet hat, und Kinder haben sie nicht gekriegt. Das hat sie noch enger zusammengeschweißt, und an diesem frühen Morgen – während sie ihren schmerzenden
193
194
Zeitdiagnosen und Figuren der Aktualität
Körper zuerst zur Toilette und dann in die Küche schleppt – spult ihr Gedächtnis die Stationen eines langen Lebens ab. Allmählich wird es Zeit, den Wenzel zu wecken, durch den Flur geht sie zum Schlafzimmer zurück, berührt seine Hand, doch die ist schon kalt … Und plötzlich verwandelt Luise sich. Sie ist auf einem Bauernhof aufgewachsen, und wie man mit einer Leiche umgeht, das weiß sie. Jetzt macht sie alles selbst: Holt Wasser aus der Küche – »Es muß warm sein, mit einem Schuß Wein. Essig darf es auch sein, aber Wenzel soll keinen Essig bekommen« –, zieht ihm die besten Kleider an, legt ihn mit den Füßen zur Tür, stützt seine Fersen mit dem Gesangbuch: »Es ist sein ›Gotteslob‹, das evangelische würde er nicht wollen.« (Hahn 2009, 208, 230) Dies alles tut Luise mit den letzten Kräften. Sie führt dabei ein ständiges Gespräch mit ihm, und dieses Gespräch mit einem Toten gehört zum Schönsten, das Anna Katharina Hahn geschrieben hat. Vor der Ewigkeit, in die ihr Wenzel schon vorausgegangen ist, wird Luise Posselt zu einer unvergesslichen Gestalt.
Literatur Hahn, Anna Katharina. Aus und davon. Roman. Berlin 2020. Hahn, Anna Katharina. »Das Schreiben und die Angst«. In: FAZ (15.04.2018). https: //www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/antrittsrede-der-mainzer-s tadtschreiberin-anna-katharina-hahn-15540685.html?premium (13.12.2022). Hahn, Anna Katharina. Das Kleid meiner Mutter. Roman. Berlin 2016. Hahn, Anna Katharina. Am schwarzen Berg. Roman. Berlin 2012. Hahn, Anna Katharina. Kürzere Tage. Roman. Berlin 2009. Hahn, Anna Katharina. Kavaliersdelikt. Erzählungen. Frankfurt a.M. 2004. Weyh, Florian Felix. Topos und Vielfalt. [Besprechung von Anna K. Hahns Erzählungen Kavaliersdelikt]. Deutschlandfunk (25.11.2004). https://www.deutschlandfu nk.de/topos-und-vielfalt-100.html (13.12.2022).
III. Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
Beobachter der kranken deutschen Zeit. Das ›Dritte Reich‹ und seine Folgen in den Erinnerungen von Sebastian Haffner und Horst Krüger Nicolas Berg
1. Einleitung: Autobiographische Zeitdiagnostik In einem lesenswerten kurzen Text Wie verlaufen die Dinge und was wird Geschichte? hat der Prager Schriftsteller und Holocaustüberlebende H.G. Adler Anfang der 1960er Jahre darüber reflektiert, wie aus amorphem Geschehen, das im schwer zu fassenden Mahlstrom der Wochen, Monate und Jahre konturenlos dahinfließt, »verbuchbare Ereignisse« werden (Adler 1976, 259).1 Es ist dies eine der theoretischen Grundfragen zum Verhältnis von Geschichte (res gestae) und Geschichtsschreibung (historia rerum gestarum), und Adler zitiert in seinem Essay auch einige der klassisch gewordenen Formulierungen von Thukydides, Friedrich Schiller und Leopold von Ranke, die sich alle drei mit der methodologischen Reflexion des Problems beschäftigt haben, dass »stets nur eine beschränkte […] Auswahl«, also eine »Abstraktion« (ebd.), zur verfassten, geschriebenen Geschichte werden kann – und dass dies zudem noch unter dem Vorzeichen der vielfachen Perspektivität erfolgt, weil alle Quellen und alle Zeugen den eigenen Blick, die eigenen Ansichten und Wertungen mit ihrer Darstellung des Geschehens verknüpft haben. Schiller sprach 1788 von der Schwierigkeit, »die Wahrheit zu enträtseln« (ebd., 260), Ranke vom historiographischen Ideal, sein eigenes »Selbst« als Historiker »auslöschen« (ebd.) zu können, und Thukydides, der sich als Geschichtsschreiber gegen alle Elemente des »Fabelhaften« (ebd., 261) zu verwahren versuchte, indem er seinem Geschichtstext die Aufgabe zuwies, eine ungefärbt-faktische, gleichsam von Verfälschungen bereinigte Chronik der Vergangenheit zu bieten, auch Thukydides beklagte das Problem der Perspektivität des Ge1
Die literarische Prominenz der Wendung von den »verbuchbare[n]« Ereignissen, das Sentenzenhafte des Ausdrucks, geht auf Thomas Manns Exilroman Lotte in Weimar (1939) und den hier literarisch porträtierten Kellner im Hotel »Elephant«, Mager, zurück, der im Eingangskapitel leitmotivisch »buchenswert« zu Ereignissen sagt, die jenseits seiner Routine liegen.
198
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
dächtnisses der Parteien; denn nicht nur gingen intendierte Wertungen in die Geschichte ein, sondern immer auch ungewollte, Urteile also, die aus Fehlern, Lücken, Verwechselungen und anderen Fehlleistungen resultierten. Adler selbst verwendet im weiteren Verlauf seines Essays den inspirierenden Begriff der »konkreten Geschichtsschreibung« und meint damit die destillierte Form der Geschichte, also – wenn man so will – die Stoffseite des Texts und sein literarisches Genre (Adler 1976, 263). Ereignisse, so können wir mit Adler diese Denkfigur der »konkreten Geschichtsschreibung« verstehen, sind dann »verbuchbar«, wenn sie Text werden können, als Einheit beschreibbar und erzählbar sind. Es sei diese »Reduktion« (Adler 1976, 263)2 der unendlich reichen Geschehenswelt in eine konkrete Textgestalt, die Ereignisse in Geschichte verwandele. Das gerade interessiert uns als Historikerinnen und Historiker, deren berufliche Grundwährung ›das Ereignis‹ darstellt. Die Profession der Geschichtsschreibung besteht darin, die singuläre Einheit und ihre konsekutive Verknüpfung mit einem ›Davor‹ und ›Danach‹ zu erkennen und als Erklärung für den Geschichtsverlauf sich selbst und anderen plausibel zu machen. Es gehören zwei Voraussetzungen dazu, die erfüllt sein müssen, wenn beide Kriterien – das der Singularität, um erkennbar, und das der Verknüpfung, um erklärend zu sein –, gegeben sein sollen: 1.) Es muss im Ereignis selbst ein allgemeiner Bedeutungskern enthalten sein, der sich aus einer Schale zufälliger, belangloser Privatheit herauslösen lässt; 2.) Ereignisse sind im Sinne Adlers dann »verbuchbar«, wenn es jemanden gibt, der sie in Text-Erkenntnis übersetzt, was keine kommunikative Leistung allein ist, sondern vor allem eine besondere literarische Fähigkeit, eine Wissensform, die den Gang der Dinge mit Distanz, wie von außen, anzuschauen in der Lage ist. Und genau dies, das fast unverstellte Betrachten der Eigenzeit, der man als Person selbst angehört, das Überführen von Erfahrungen, die man selbst gemacht hat, in Erkenntnis, die einem nicht alleine gehört, dies sei im Folgenden am Beispiel zweier eminenter Autoren – Sebastian Haffner und Horst Krüger – vorgestellt. Beide sind Zeitzeugen, Autoren, die an sich selbst, am Beispiel ihrer eigenen Person, autobiographische ›Ereignisse‹ über die Zeit des ›Dritten Reichs‹ und seiner Folgewirkungen beobachten, Geschichtsfakten des eigenen Lebens also, die nicht nur persönlich sind, sondern deren Bedeutung gerade darin besteht, dass sie das Private verlassen und symptomatisch werden.3 Es sind erinnerte Ereignisse, die etwas über die Zeit von 1933–1945 und über die Erinnerung und
2
3
Adler bezieht seine Überlegungen nicht nur auf Augenzeugenberichte, sondern auch auf »amtliche Dokumente«, die er die »echten und doch oft täuschenden Kristalle der Geschichte« nennt. (Adler 1976, 263) Einführend zum Begriff des Zeitzeugen und zur Analyse der frühen deutschsprachigen Autobiographik über die Nazizeit: Sabrow 2012, 13–32; Steinbacher 2012, 145–156; Peitsch 1990; für die auf Zeugenschaft und autobiographischer Erinnerung basierenden jüdischen Gedächtnisdiskurse vgl.: Jockusch 2012; Michaelis 2013.
Nicolas Berg: Beobachter der kranken deutschen Zeit
den Umgang mit den NS-Jahren in der Bundesrepublik aussagen. Die Schlussfolgerungen aus diesen mikroskopischen Selbstbeobachtungen sind insgesamt in die allgemeine deutsche Erinnerungskultur eingegangen. Mitunter neigen wir dazu, zu vergessen, dass die Einsichten und Haltungen, die das kollektive Gedächtnis prägen oder in diesem aufgehoben sind, von vielen Einzelnen individuell vorgedacht wurden. Und Sebastian Haffner und Horst Krüger sind solche Einzelne; sie gehören zu den Zeitdiagnostikern, die aus ›Geschehen‹ Erkenntnis gemacht oder aus ›den Dingen‹ ›Geschichte‹ geformt haben; beide formulieren anhand eigener Lebensszenen Texte, die zeitgeschichtliche Relevanz enthalten und die schon allein deshalb von Interesse sind, weil sie in einer Zeit verfasst wurden, in der sie die »eingehegte Kritik« (von Hodenberg 2006, 101–228) am Verhalten der Deutschen in den Jahren der NS-Diktatur verlassen und zu ihrer Zeit alles andere als mehrheitsfähig waren. Im Folgenden werden Lektüren von zwei autobiographischen Texten auf diese Konstellation hin entfaltet: Erkennbar wird, wie die Autoren ihr eigenes Verhalten in der Nazizeit und im Rückblick auf diese betrachten, bewerten und kritisieren. Am jeweiligen Substrat beider autobiographischen Ich-Erzählungen zeigen sich erinnerungswürdige, beispielgebende oder sogar bekenntnishafte Einsichten, die nicht nur für diese Individuen gelten. Was also ist an diesen Ereignissen so besonders, sozusagen so ›ereignishaftig‹, dass sie nicht nur im individuellen Wertungsrahmen dieser beiden Autoren ihren Platz erhalten, sondern auch unserem prüfenden Blick Jahrzehnte später Stand halten? Die hier betrachteten Texte sind nicht aus dem Kanon jener »anderen Erinnerung«, mit der jüdische Autorinnen und Autoren in der westdeutschen Nachkriegsliteratur die Grundlagen zur Erkenntnis der Nazizeit gelegt haben, über die uns Stephan Braese so eingehend aufgeklärt hat (Braese 2001a); sie gehören zu den nichtjüdischen Deutschen, die über das ›Dritte Reich‹ nicht als Verfolgte oder als Vertriebene nachzudenken hatten. Beide Texte aber, sowohl der von Haffner als auch der von Krüger, bieten keine Verdrängungsprosa, so die These dieses Beitrags, sondern eine bemerkenswerte Auseinandersetzung mit dem Deutschland jener Jahre, mit ihrem Land in einer Zeit, die ihre eigene Jugend und junge Erwachsenenzeit war. Sebastian Haffner, Jahrgang 1907, stand um 1933 in seinen mittleren Zwanzigern und war 1945 Ende Dreißig; Horst Krüger, Jahrgang 1919, ist mehr als zehn Jahre jünger, erlebte also den Beginn der Herrschaft Hitlers als 14jähriger Jugendlicher in Berlin, den Sommer 1945 dann als junger Kriegsheimkehrer in Freiburg mit Mitte Zwanzig; er war also am Ende des ›Dritten Reichs‹ so alt, wie Haffner zu dessen Beginn (vgl. zum Jahrgang von Krüger auch Albers [2009] 2019). Keiner der beiden gehört zu den sogenannten »weißen Jahrgängen«4 , ihre Kohorten bildeten vielmehr die Kriegsteilnehmer-, die Mitläufer- oder Tätergeneration. Auch wenn die Unterschiede zwischen Haffner und 4
Der Terminus »weißer Jahrgang« bezeichnet junge Männer, für die keine Wehrpflicht gilt, die also zu jung waren, um als Soldat am Krieg teilzunehmen; im Hinblick auf den Zweiten
199
200
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
Krüger in Bezug auf Alter, Herkunftsmilieu, Erziehung und politische Sozialisation groß sind, so gibt es dennoch ein verbindendes Element denn beide schreiben über eine als »kranke deutsche Zeit« (Krüger [1966] 2019, 190) empfundene Pathologie der eigenen Heimat, von der sie schon vor Hitlers Machtübernahme angegriffen wurden und die sie auch lange danach nicht loslässt. Beide denken darüber nach, wie ihnen die Heimat mehr und mehr fremd und sogar feindlich wurde, wie ihr vormals ganz ungebrochenes Selbstverständnis als Deutsche in und durch diese Jahre erschüttert wurde, wie sie sich dem Angebot zum »Überlaufen« oder dem Sog zu einem »Doppelleben« (Haffner 2000, 97) in den Nazijahren oder der Verführung einer wohlfeilen Amnesie danach (so Krüger) zu entziehen hatten und wie sehr sie dies als Person verändert hat. Die Texte dieser beiden Autoren rücken in den Fokus des Interesses, gerade weil sie nicht in die in der Nachkriegszeit proliferierende Widerstandsliteratur einzuordnen sind; sie selbst tun dies nicht und wir folgen ihnen darin: Hier sprechen keine Helden, keine Vertreter des politischen Widerstands. Stattdessen zeigen beide Autoren auf, an welcher Stelle sie als Individuen Teil der Zeitereignisse und der deutschen Pathologie wurden. Sie versuchen zu verstehen, wie – mit Adler gesprochen – ihr Leben und die nun verhasste Geschichte zusammengehören. Das gerade macht diese beiden Texte so lesenswert: Sebastian Haffners Geschichte eines Deutschen5 (verfasst in England Anfang 1939, im Sommer 2000 postum veröffentlicht) und Horst Krügers Jugenderinnerungen Das zerbrochene Haus. Eine Jugend in Deutschland, die Mitte der 1960er Jahre in Frankfurt unter dem unmittelbaren Eindruck von Vormittagen auf der Besuchertribüne des Auschwitz-Prozesses entstanden. Beide sehen klar, entweder früher oder deutlicher als andere, was es mit dieser Zeit auf sich hatte. Somit beschreiben sie etwas aus der Innensicht, so dass es von außen erkennbar wird, beide ›transponieren‹ (Adler 1976, 263)6 – auch dies ein Ausdruck im Essay von H.G. Adler – das Private, nehmen dieses »etwas« (die Nazifizierung der deutschen Gesellschaft) als das Eigene in den Blick. Sie präsentieren auf diese Weise den Leserinnen und Lesern Elemente einer Phänomenologie politischer Ignoranz in Deutschland vor, während und nach
5
6
Weltkrieg waren dies die Jahrgänge ab 1930; zum Begriff auch: Rosenthal (1994); vgl. auch den Roman von Uwe Pörksen (Pörksen 1979). Die Wochenzeitschrift Der Spiegel titelte seinerzeit »Mirakel der Erinnerung« und betrachtete Haffners Darstellung als das »bedeutendste Buch des Jahres« (Mohr 2001); die Debatte um die Frage der Echtheit des Manuskripts wird im Folgenden nicht aufgegriffen; die Vermutungen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und anderer Zeitungen, das Buch Haffners sei nicht vor, sondern erst nach dem Zweiten Weltkrieg verfasst worden sei, konnten widerlegt werden. »Die Transposition besteht darin, daß abgelaufene Dinge – reales soziales Leben – aus dem vitalen Kontext herausgehoben und zu in sich abgeschlossenen literarischen Werken umgebildet werden.« (Ebd.)
Nicolas Berg: Beobachter der kranken deutschen Zeit
Hitler, deren Traditionen auch sie geprägt haben.7 Und in dieser sich selbst einbeziehenden Art und Weise werden beide Autoren zu Instanzen für den von Adler beschriebenen Prozess, aus dem Verlauf ›der Dinge‹ jene Erkenntnismomente der Geschichte festzuhalten, die »verbuchbar« sind, wenn wir aus Zeit das machen, was wir gemeinhin ›Geschichtsbewusstsein‹ nennen. Die Autoren sind keine unbekannten Namen, sondern sie wurden mit ihrer publizistischen Arbeit auch bei einem breiteren Publikum bekannt. Der Zeit seines Lebens als Journalist wirkende promovierte Jurist Haffner wurde 1907 als Raimund Pretzel in Berlin in die Familie eines Reformpädagogen und preußischen Kulturbeamten geboren. Er wurde aber nicht unter seinem Geburtsnamen, sondern unter seinem Pseudonym berühmt, das er in England für seine erste Publikation Germany. Jekyll and Hyde (1940) angenommen hatte, um seine in Deutschland gebliebenen Eltern zu schützen.8 Haffner ging 1938 mit seiner Frau ins englische Exil, von wo er 1954 als englischer Staatsbürger und Korrespondent des Observer nach Berlin zurückkehrte. Heute ist er uns als Autor markant-urteilender historisch-politischer Essays über Winston Churchill, über die Sozialdemokratie in der Revolution von 1918 und über das Erbe Preußens bekannt. Das berühmteste in der Reihe der hier aufzuführenden Bücher ist aber der Bestseller Anmerkungen zu Hitler von 1978 (Haffner 1978). Im Kontext der Frage nach der frühen Deutschlanddiagnostik betrachten wir aber nicht die Anmerkungen aus den 1970er Jahren und auch nicht den erwähnten Erstling Germany. Jekyll and Hyde von 19409 (auch wenn beide Bücher viel Stoff zum
7
8
9
Vor allem bei Haffner ziehen sich Beschreibungen einer fast schon anthropologisch zu nennenden deutschen politischen Unfähigkeit zur Freiheit – und damit zur Demokratie – durch den gesamten Text; so spricht er ausführlich davon, dass nach dem Ersten Weltkrieg »eine ganze Generation in Deutschland mit dem Geschenk eines freien Privatlebens nichts anzufangen wußte.« (Haffner 2000, 69) Bei den Deutschen sei »die Begabung […] zum persönlichen Leben und persönlichen Glück […] schwächer ausgebildet […] als die anderer Völker« (Haffner 2000, 70). Aus »Leere und Langeweile« (ebd.) resultiere, so Haffner, jene seltsame Obsession, sich als Erwachsene »hinter allzu fleißig, gründlich und pflichtbewußt betriebenen Geschäften und Organisationen« zu verstecken, dabei aber eine untergründige Sehnsucht nach »Erlösung«, nach »Massenrausch« zu kultivieren. (Haffner 2000, 71) Die Wahl von Vor- und Nachnamen bilden eine musikhistorische Hommage an Johann Sebastian Bach und an die sogenannte »Haffner«-Symphonie von Wolfgang Amadeus Mozart (Soukup [2001] 2003, 9); zum Gang ins Exil vgl. auch Haffner 2002. Diese Darstellung »der verschiedenen Volksstimmungen und Volksströmungen« folgt einer ganz ähnlichen Fragestellung, wie die Geschichte eines Deutschen, auch hier fragt Haffner, woher die breite Zustimmung für Hitler in den frühen Jahren der Diktatur herrührt. Haffner hat diese englischsprachige Publikation im Rückblick dann »ein zu optimistisches Buch« genannt und zu Protokoll gegeben, er habe beim Schreiben des Manuskripts Ende der 1930er Jahre »die Entwicklung im Dritten Reich« unter-, und umgekehrt »die Stärke der wirklichen Gegnerschaft« überschätzt (Haffner 2002, 20).
201
202
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
Thema böten), sondern das inhaltlich auf Jekyll and Hyde hinführende persönlichere Manuskript Geschichte eines Deutschen, der Erstling Haffners, entstanden in deutscher Sprache in den ersten Monaten seines englischen Exils, also noch vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs. Haffner brach die Arbeit an dieser Selbsterkundung im September 1939 ab, als ob das Weltgeschehen selbst nun den Neuanfang der Reflexion von ihm einforderte. So blieben die vierunddreißig Kapitel ein über Jahrzehnte in der eigenen Schreibtischschublade vergessenes, unvollendetes Konvolut, das erst nach Haffners Tod 1999 zur literarischen Sensation der Herbstsaison des Jahres 2000 wurde. Diesen Ruf hat das Buch zu Recht erlangt, allein schon aufgrund der wagemutig-hybriden Konstruktion, in der Zeit- und Selbstporträt miteinander verschränkt sind, aber auch wegen seiner enormen stilistischen Souveränität, die mitunter ganz vergessen lässt, dass es sich um ein Jugendwerk handelt. Vor uns liegt kein Versuch einer Historisierung der NS-Zeit oder gar der schlichten Exkulpierung der eigenen Rolle in den Zeitläuften; vielmehr lesen wir eine Gegenwarts- und Zeitdiagnostik, eine ›Zeitgeschichte‹ im Wortsinn dieser terminologischen Wendung, in der das erzählende Ich hart mit sich ins Gericht geht. Bei erneuter Lektüre nimmt man den Schreibanlass noch einmal genauer wahr, als seinerzeit, als das Buch erschien: Hier gibt ein unbekannter Autor seine persönliche Bilanz der veränderten deutschen Verhältnisse in einer Phase der Loslösung zu Protokoll, die von Haffner selbst »Zeitlupenflucht«10 genannt wurde und die die Abkehr von Deutschland mit einem Text begleitet oder sogar erst herstellt; wir haben es mit einem Abschiedstext zu tun, mit dem der Verfasser auf die sozialen und politischen Vergiftungen der Alltagskultur und der Politik in seiner Heimat nach dem Machtantritt Hitlers reagiert, mit einem Text also, mit dessen Hilfe er Deutschland den Rücken kehrt und mit dem er diesen Akt vor sich selbst rechtfertigt. Horst Krüger, zehn Jahre jünger als Haffner, wuchs – wie dieser – in Berlin auf. Anders aber als Haffner überstand er die NS-Zeit und den Weltkrieg nicht im Exil; seine Vita ist mit dem Deutschland der Hitlerjahre sehr viel enger verknüpft, als das für Haffner gilt. Mit zwanzig Jahren wird Krüger Soldat, kämpft im Weltkrieg an der Ostfront und in der Schlacht um Montecassino in Italien. Er war, wie die zeitgenössisch noch bis in die 1950er und 1960er Jahre häufig verwendete Vokabel jener Jahre lautete, mit der NS-Zeit ›verstrickt‹, gehörte ihrem Personal an, trug ihre Uniform und so ist sein Nachdenken über Kindheit und Jugend auch ein Lehrstück genau über dieses Thema: Über die Frage, wie eng diese Zugehörigkeit eigentlich war, welche Schuld sie mit sich gebracht hat und wie ein aufrichtiger Umgang mit diesen Jahren im Rückblick auf diese eigentlich möglich ist. Sein Text entspricht im Vergleich zu Haffner stärker den Genreerwartungen, die wir in Inhalt und Form 10
Den Ausdruck »Zeitlupenflucht« bezieht Haffner auf die Zeitspanne zwischen 1933 und 1938, seiner Ausreise aus Deutschland, der mehrere kürzere Englandaufenthalte vorausgehen (Soukup 2003, 39–61).
Nicolas Berg: Beobachter der kranken deutschen Zeit
an Autobiographien richten; in Form von Erinnerungen, für die er die titelgebende Metapher Das zerbrochene Haus wählt, schreibt er sie mit Mitte Vierzig, zwanzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, unter dem verstörenden Eindruck des Auschwitz-Prozesses (vgl. zum gesellschaftlichen Kontext u.a. Atze 2004a; Atze 2004b; Boyd 2004; Braese 2001b; Peitsch 2003; Peitsch 2010; Weisbrod 2008). Den Einzelheiten und der für ihn relevanten Bedeutung dieses Prozesses, der den Anstoß zur Autobiographie gibt, gilt im Buch das abschließende Kapitel »Gerichtstag«, das chronologisch betrachtet zuerst verfasst wurde und das bereits 1965 in seiner Erstfassung unter dem Titel Im Labyrinth der Schuld. Ein Tag im Frankfurter Auschwitz-Prozeß in Der Monat publiziert wurde (Krüger 1964).11 Sprechen wir von Genreerwartungen der Autobiographie, so sind damit vor allem die beiden gegenläufigen Impulse gemeint, zeitlich von ›später‹ nach ›früher‹ zu denken, aber schreibend ›von vorne‹ zu beginnen, also mit der Herkunft, den Eltern, dem Ort, an dem er aufwuchs, der eigenen Kindheit und der Jugend, den Jahren der Erziehung, der Schulzeit und des Bildungsgangs bis zum Verlassen des Elternhauses und der Selbständigkeit. Die Forschung hat sowohl Krügers Autobiographie als auch Haffners Geschichte eines Deutschen Aufmerksamkeit geschenkt. In beiden Texten bildet sich ein nachgerade klassisch zu nennendes Muster ab, das in Deutschland seit den späten 1950er Jahren in der bekannten Formeln von der ›Aufarbeitung der Vergangenheit‹ oder der ›Vergangenheitsbewältigung‹ sprichwörtlich wurde, Wendungen, die von den Zeitgenossen mit der Frage Adornos »Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit?« immer schon mit einem Fragezeichen versehen wurde, das anzeigte, dass das als nötig Empfundene, wenn man es denn aufrichtig meinte, im Grunde genommen alle bekannten Traditionen und Formen der Historiographie zu sprengen schien, außer vielleicht jene der Autobiographie, die hier auch als Bilanz, als ehrliche Rechenschaft, ja, als Beichte fungieren kann.
2. Sebastian Haffner und der Tabubruch im Lesesaal Haffner beschreibt in seinem Manuskript Geschichte eines Deutschen ein stärker und stärker werdendes Gefühl der Entfremdung, das ihn seine soziale Umwelt und vor allem die politischen Veränderungen klarer sehen lässt, als dies gemeinhin für die Nah-Zeit des Hier und Jetzt gilt; er blickt nicht von weither, aus einem zeitlichen ex post auf einen Prozess des schrittweise erfolgten Bruchs mit Deutschland zurück; vielmehr diagnostiziert Haffner sein Heraustreten aus der fraglosen Kongruenz mit seiner Heimat als blitzschlagartiges Ereignis, das ihn von einem Moment auf den anderen verändert und verwandelt hat, dass ihn gleichsam zu einem anderen Menschen werden ließ. Die Szene im Lesesaal der Bibliothek, die Haffner hier als einen 11
Im Buch heißt das Kapitel dann nur noch knapp »Gerichtstag« (Krüger [1966] 2019, 160–194).
203
204
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
entscheidenden Wendepunkt in seinem Verhältnis zu Deutschland ausmacht, ist faktisch wie eine Konversion geschildert, er selbst nennt es einen »Akt von biblischer Radikalität« (Haffner 2000, 208); wir folgen als Leserinnen und Leser von Haffners Erinnerungen einer politischen Konversion, dem Austritt aus einer Gemeinschaft, der man qua Geburt angehört und die man in einem Akt des Lossagens und des Seitenwechsels verlässt (oder doch zu verlassen beginnt); wir erleben den scharfen Schnitt mit, den er zieht und der nicht ohne Widerstände erfolgt, wie es eben für Konversionen zur Definition gehört, weil »der innere Abschied vom eigenen Land« (Haffner 2000, 206), so Haffner in der seinem Text, »immer schwer, mühsam und schmerzlich« ist. Dieser Abschied wurde zwar im oder sofort nach dem LesesaalErlebnis begonnen, aber eben nicht geradlinig, sondern »stockend und unter Rückfällen, manchmal glaubte ich«, so beschrieb er es, »ich würde nicht die Kraft haben, ihn wirklich zu vollziehen« (ebd.). Doch dann hält der Ich-Erzähler die sich bei ihm einstellende Gewissheit fest, dass er sich in diesen frühen Monaten der Hitler-Herrschaft, die er einen kollektiven Wahn, einen »Sturz in den Dreck« (ebd.) nennt, nur auf diese Weise retten kann. Haffners Selbstporträt, das auf der anderen Seite des Ärmelkanals entsteht, ist nicht ohne Ambivalenzen verfasst, doch es lässt das Glück des vollzogenen Abschieds erkennen, der ihm Treue zu sich selbst ermöglicht (Haffner 2000, 209): »Ich fühle mich nicht mehr auf festem Boden stehend, sondern im leeren Raum schwebend und schwimmend, eigentlich leicht, getragen und vogelfrei.« (Haffner 2000, 206) Und etwas später heißt es (in Fortführung dieser Linie der Erleichterung): »Jede Fremde, das fühlte man allmählich immer unausweichlicher, würde heimatlicher sein, als das ›Reich‹ Adolf Hitlers.« (Haffner 2000, 212) Haffner porträtiert sich hier als Geflüchteten, als Exilant und somit verwendet er auch die Metaphern der Emigration als im »luftleeren Raum« lebend; oder in die »fröstelnde Kühle« (Haffner 2000, 206) der Ungewissheit aufbrechend;12 auf der Ebene des Textes verweist diese Art der Selbstbeschreibung auf die Radikalität seines Erlebnisses, wie sie für die Entscheidung, ins Exil zu gehen, sozusagen zum Typus literarischer Gedächtnisbildung dazugehört. Diese Lossagung vom Eigenen steht im Zentrum seiner Aufzeichnungen. Das Erlebnis, das diesen Aufbruch erst möglich gemacht hat, ist die Erkenntnis, dass die neue Nazi-Realität sofort, schon in den ersten Wochen und Monaten, »die alte Trennung von Politik und Privatleben aufgehoben hatte« (Haffner 2000, 205) und dass sich die Wirklichkeit jener frühen Phase der Diktatur eben »nicht nur in der politischen Sphäre« ereignete, sondern ebenso »in jedem privaten Leben« (ebd.). Die Lesesaalszene ist Ausgangspunkt und Ausdruck dieser Einsicht, oder anders gesagt: Sie bietet die Möglichkeit, das Zustandekommen dieser Einsicht zu studieren. Sie beschreibt eine persönliche Niederlage, wird als ein Ereignis des Opportu12
Vom »fröstelnden Gefühl der Heimatlosigkeit« ist mehrfach die Rede (vgl. Haffner 2000, 178).
Nicolas Berg: Beobachter der kranken deutschen Zeit
nismus, des Mitläufertums, ja, der Selbstgleichschaltung präsentiert, als ein Verhalten also, das in diesen Monaten die Regel war und das Haffner pointiert als »simultane Massenentscheidungen« (Haffner 2000, 171) charakterisiert hat: Jeder Einzelne wird im Zuge der politischen Zeitveränderungen von den neuen Gesellschafts- und Politikregeln herausgefordert; und jeder Einzelne trifft jeden Tag Entscheidungen, die für das eigene Leben relevant sind. Wie also sah diese Entscheidung in seinem Falle aus, als er am 31. März, einem Freitag, im Lesesaal der Gerichtsbibliothek sitzt? Wofür oder wogegen hat sich Haffner hier entschieden? Er beschreibt, wie er an einem juristischen Gutachten arbeiten möchte und dafür in der Bibliothek des Kammergerichts an einem der Tische sitzt und liest. Alles wirkt wie »business as usual« (Haffner 2000, 143), sowohl auf den Straßen vor dem Gericht als auch drinnen, in der gewohnten Umgebung. Auch jüdische Anwälte verhandeln, wie gewohnt, ihre Fälle, so Haffner. Doch mitten in die gewohnte Atmosphäre der Routine, der »knisternden Stille vielfältiger, gesammelter geistiger Arbeit« (Haffner 2000, 144) des Lesesaals, schneiden lautes Türschlagen, Rufe und dem Ort ansonsten völlig fremde Geräusche von Getrampel durch die Ruhe der Bibliothek: »Einer sagte in die vorhaltende Stille hinein: ›SA‹.« (Haffner 2000, 145) Wie der Protokollant oder Rezensent eines vor ihm ablaufenden Theaterstücks13 hält Haffner das Skandalon des Augenblicks fest: »Darauf ein anderer, mit nicht besonders erhobener Stimme: ›Die schmeißen die Juden raus‹, und zwei oder drei Leute lachten dazu. Dieses Lachen war im Augenblick erschreckender als der Vorgang selbst: Es ließ blitzhaft daran denken, daß ja auch in diesem Raum, wie sonderbar, Nazis saßen.« (Haffner 2000, 145) Im Folgenden schildert Haffner, gleichsam in Zeitlupe, wie die Unruhe langsam »sichtbar« (Haffner 2000, 146) wird, wie Leser anfangen, miteinander zu reden und hin- und herzulaufen: Ein offenbar jüdischer Herr schlug schweigend seine Bücher zu, stellte sie sorgfältig in die Regale zurück, verstaute seine Akten und ging hinaus. Kurz darauf erschien jemand am Eingang, vielleicht eine Art Oberwachtmeister, und rief laut, aber mit besonnener Stimme, in den Raum: ›Die SA ist im Haus. Die jüdischen Herren tun besser, für heute das Haus zu verlassen.‹ Zugleich hörte man von draußen, wie zur Illustration, rufen ›Juden raus!‹ Eine Stimme antwortete: ›Sind schon raus‹, und wieder hörte ich die zwei oder drei Lacher von vorhin kurz und fröhlich aufglucksen. Ich sah sie jetzt. Es waren Referendare wie ich. (Haffner 2000, 146) 13
Tatsächlich ist der Ton der genauen Schilderung, des Nachvollzugs eines Geschehens auf der Bühne ein oft wiederkehrender Topos in Texten, die sich einem inneren Drama stellen; in Krügers Das zerbrochene Haus heißt es in diesem Sinne etwa, nachdem der Ich-Erzähler auf der Besuchertribüne des Verhandlungsraums Platz genommen hat: »Und wie es immer ist, wenn man plötzlich in ein laufendes Stück, ein Kino, ein Schauspiel eintritt, sitze ich zunächst etwas ratlos und benommen da und finde mich in der Handlung nicht zurecht.« (Krüger [1966] 2019, 167)
205
206
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
»Wie ich« heißt im Code dieser Zeitdiagnostik, dass hier nicht einfach nur ein Geschehen, das andere betrifft, referiert wird, sondern eine Entscheidung ansteht, die tatsächlich unmittelbar danach erfolgt. Der SA-Trupp tritt nämlich in den Lesesaal ein und ihr Anführer ruft »mit schallender, strammer Ausruferstimme« die Worte: »Nichtarier haben sofort das Lokal zu verlassen!« Und der Autor kommentiert so: »Es fiel mir auf, daß er den gewählten Ausdruck ›Nichtarier‹ und den höchst ungewählten Ausdruck ›Lokal‹ verwendete.« (Haffner 2000, 147) Haffner, der hier den Ablauf fast im Sekundentakt der Vorkommnisse festhält, schreibt weiter: Wieder antwortete einer, offenbar derselbe wie vorhin: ›Sind schon raus.‹ Unsere Wachtmeister standen in einer Haltung da, als wollten sie die Hand an die Mütze legen. Mir schlug das Herz. Was konnte man tun, wie wahrte man seine Haltung? Ignorieren, sich gar nicht stören lassen! Ich senkte mich auf mein Aktenstück. Ich las mechanisch irgendwelche Sätze: ›Unrichtig, aber auch unerheblich ist die Behauptung des Beklagten…‹ Keine Notiz nehmen! Indem kam eine braune Uniform auf mich zu und machte Front vor mir: ›Sind Sie arisch?‹ Ehe ich mich besinnen konnte, hatte ich geantwortet: ›Ja‹. Ein prüfender Blick auf meine Nase – und er retirierte. Mir aber schoß das Blut ins Gesicht. Ich empfand, einen Augenblick zu spät, die Blamage, die Niederlage. Ich hatte ›ja‹ gesagt! Nun ja, ich war ein ›Arier‹, in Gottes Namen. Ich hatte nicht gelogen. Ich hatte nur viel Schlimmeres geschehen lassen. Welche Demütigung, Unbefugten auf Befragen pünktlich zu erklären, ich sei arisch – worauf ich übrigens keinen Wert legte. Welche Schande, damit zu erkaufen, daß ich hier hinter meinem Aktenstück in Frieden gelassen würde! Überrumpelt auch jetzt noch! Versagt in der ersten Prüfung! Ich hätte mich ohrfeigen können. Und Haffner schließt das Lesesaal-Erlebnis mit der lakonisch und hyperbolisch zugleich formulierten fundamentalen Einsicht: »Als ich das Kammergericht verließ, stand es grau, kühl und gelassen da wie immer, vornehm abgerückt von der Straße hinter seinen Parkbäumen. Man sah ihm keineswegs an, daß es soeben als Institution zusammengebrochen war.« (Haffner 2000, 148) Auf diese Weise, indem er eine »intime Chronik« (Haffner 2000, 174) entfaltet, indem er beobachtet, wie er selbst von einer Sekunde auf die andere zu einer Nazi-ähnlichen Figur wird, indem er also beflissen genau die Worte spricht, die Nazis hören wollen und die weit über den Anlass des Moments hinausgehen, erkennt er, was insgesamt vor sich geht: das Zusammenbrechen einer Institution, »das trübe, ruhmlose Verenden und Versacken einer Welt« (Haffner 2000, 179). Aber durch die Art und Weise dieser Erkenntnis lernt Haffner auch, »die Heimat als Feindesland« zu empfinden (Haffner 2000, 208). Im Zusammenhang der Fragestellung dieses Beitrags ist hier das geschichtstheoretische Verhältnis von ›privat‹ und ›öffentlich‹, von Selbst- und Zeitbeobachtung deswegen so interessant, weil Haffner in dieser nur scheinbar zufällig-marginalen Geschichte das Umschlagmoment der allge-
Nicolas Berg: Beobachter der kranken deutschen Zeit
meinen Nazifizierung wiedererkennt: Denn er beschreibt sich gerade nicht als »ein besonders eingeweihter Augenzeuge« (Haffner 2000, 170), als jemanden, der der ›Geschichte‹ nahe ist, der als Held sozusagen in den Gang der Dinge eingreift; er beschreibt vielmehr bewusst eine »Privatgeschichte« (ebd.) und mit ihr die eigene Verfehlung: Ich habe in die Ereignisse nicht eingegriffen, ich war nicht einmal ein besonders eingeweihter Augenzeuge, und niemand kann die Bedeutung meiner Person skeptischer einschätzen, als ich selber. Und doch glaube ich […], daß ich mit der zufälligen und privaten Geschichte meiner zufälligen und privaten Person ein wichtiges, unerzähltes Stück deutscher und europäischer Geschichte erzähle – wichtiger und für alles Zukünftige bedeutsamer, als wenn ich erzähle, wer den Reichstag angesteckt hat und was zwischen Hitler und Röhm nun wirklich gesprochen worden ist. (ebd.) In Haffners individual-psychologischer Geschichtsreflexion findet sich der Satz H.G. Adlers zu den historischen Grundbausteinen fast wortwörtlich wieder: »Was ist Geschichte? Wo spielt sie sich ab?« (Haffner 2000, 170) Haffners Selbstbeobachtung im Lesesaal ist aus theoretisch-wissenssoziologischer Perspektive betrachtet deswegen so aufrichtig, weil er sich noch im Verfehlen, im Schuldigwerden, geschichtsphilosophisch ernst nimmt: [D]ie wirklich zählenden geschichtlichen Ereignisse und Entscheidungen unter uns [spielen sich im] Anonymen [ab], in der Brust einer jeden zufälligen und privaten Einzelperson […]. [G]egenüber diesen simultanen Massenentscheidungen, von denen ihre Träger oft selbst nichts wissen, [sind] die mächtigsten Diktatoren, Minister und Generale vollständig wehrlos […]. (Haffner 2000, 171) Seelische, private, persönliche Vorgänge oder moralische Entscheidungen, so Haffner, sind so geschichtsträchtig (Haffner 2000, 172) wie Haupt- und Staatsaktionen. Das Kammergericht als Institution bricht wirklich zusammen, wenn einer der hier arbeitenden Referendare auf die pöbelhafte Aufforderung, anzugeben, ob er »arisch« sei, mit »Ja« antwortet. Dieses Ereignis mag klein sein in seiner Alltäglichkeit, es ist aber von grundsätzlicher Dimension, die das Ganze angreift: Recht, Anstand, Freiheit und Menschlichkeit. Haffner, er kann das selbst diagnostizieren, hatte sich in seinen Reflexen und in seiner Beflissenheit, als private Existenz genauso verhalten wie viele Tausende. Die in ihrer »Simultanität und Massierung« von ihm als Geschichtsmacht erkannten und beschriebenen Einzelentscheidungen der Vielen haben »das Dritte Reich Hitlers erst möglich gemacht«, so spricht es die Selbstbeobachtung aus den späten 1930er Jahren aus; sie erst bilden »seinen unsichtbaren Hintergrund« (ebd.). Haffners Text ist so lesenswert, weil er durch die fast schon röntgenartige Selbstbeobachtung die Zeit selbst vor den Leserinnen und Lesern entfaltet, weil er den Ort der Zerstörung der Tradition und den Augenblick
207
208
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
der Selbstzerstörung der Deutschen benennen kann: Man komme den wirklich historischen Vorgängen nicht bei, so Haffners geschichtstheoretische Überzeugung, »ohne sie dorthin zu verfolgen, wo sie sich abspielen: im privaten Leben, Fühlen und Denken der einzelnen Deutschen.« (Haffner 2000, 173) Das »Gefühl von Irrenhaus« (Haffner 2000, 183), das Haffner in diesem Deutschland der frühen 1930er Jahre nicht mehr loslässt, beruht darauf: Dass Menschen auf einmal wie Nazis sprechen, denken und sogar fühlen. Der »gefräßige Staat« (Haffner 2000, 173), so die treffsichere Formulierung von Haffner, findet nicht allein in der vermeintlich fernen politischen Öffentlichkeit statt; er stößt gerade »in Privatzonen« (ebd.) vor, er ist »gefräßig[]«, weil er sich von dieser privaten Innenseite der Menschen im Wortsinne ernährt; diese füttern ihn mit ihren Empfindungen und Gefühlen und machen die Zeit zu dem, was sie wurde: »Die Welt, in der ich gelebt hatte, löste sich auf, verschwand, wurde unsichtbar, täglich und selbstverständlich, in aller Lautlosigkeit.« (Haffner 2000, 181) Aus der Rückschau erkennen wir Haffner als einen Protokollanten des »psychopathologischen Proze[sses], der sich seit 1933 in millionenhafter Wiederholung in Deutschland abspielt« (Haffner 2000, 185), weil er die Gemütsverfassung der Deutschen im Akt der Selbstgleichschaltung, des »Überlaufens« (Haffner 2000, 186) an sich selbst konstatiert und weil er diesen Vorgang zwar »Geisteskrankheit oder mindestens […] schwere Hysterie« (Haffner 2000, 185), »wie in einem Irrenhaus […] oder sagen wir, in einer psycho-pathologischen Versuchsanstalt« (Haffner 2000, 194) nennt, ihm aber gerade nicht die fatale Geschichtsträchtigkeit abspricht, die ihm vielmehr zukommt, auch wenn es sich vermeintlich ›nur‹ um Worte und Sprache handelt. Haffner ist einer der wenigen Selbstbeobachter dieses Prozesses, der diesen aufschreibt, weil er die Verführung zu dieser Selbstpathologisierung sogar an sich selbst zu erkennen in der Lage ist, als er sich als »arisch« bezeichnet, um ein Recht zu verteidigen, das jüdischen Kollegen willkürlich von einem Tag auf den anderen entzogen worden war. Der im Wortsinn so zu verstehende ›Sündenfall‹ jener Wochen und Monate, so Haffner, ist eine Art von ›Fallen‹; er wird bereits im gedanklichen Desertieren offenkundig, ohne Tat, denn ›getan‹ hatte Haffner eigentlich nichts, es handelte sich in seinem wie in so vielen anderen Fällen vielmehr um eine Unterlassung, seine missmutig-rhetorische Angleichung an das Denken und die Sprache der Nazis. Die spätere Empörung gegen die nach 1945 von den Alliierten vorgenommene Entnazifizierung der Deutschen ist in diesem NaziWerden mit schlechtem Gewissen schon angelegt, auch das erkennt Haffner schon vor dem Zweiten Weltkrieg: Die meisten Leute, so seine Voraussage in diesem Text, werden, »wenn der Tag kommt, ganz bestimmt es nicht werden gewesen sein wollen« (Haffner 2000, 187). Haffner schreibt (die persönliche Scham des Versagens im Lesesaal für diese Analyse sozusagen benutzend und zur Erkenntnis machend): »Ich wage zu prophezeien, daß dies die Grundhaltung Deutschlands nach dem verlorenen Nazikriege sein wird – das wilde bockige Heulen eines pathologischen
Nicolas Berg: Beobachter der kranken deutschen Zeit
Kindes, das den Verlust seiner Puppe begierig mit dem Weltuntergang gleichsetzt.« (Haffner 2000, 189) Genau diese Leute also, die heute »der Albdruck der Welt« (Haffner 2000, 187) geworden seien, so transponiert Haffner die Selbsterkundung ins Allgemeine, dabei aber plötzlich »Blut- und Bodenliteratur von entsetzlicher und beschämender Qualität« (Haffner 2000, 183) fabrizieren oder sich in eine sekundäre »Idyllenliteratur« (Haffner 2000, 193) ideell zu retten versuchen und »inmitten von Aufmärschen, Konzentrationslagern, Munitionsfabriken und Stürmerkästen« ein deutsches Selbstverständnis »von geradezu penetranter Innerlichkeit und Zeitlosigkeit« (Haffner 2000, 193) nach außen kehren, genau diese Leute werden morgen larmoyant darüber Beschwerde führen, dass man sie für Nazis hält. Dabei sind sie es, die den eigentlichen Geschichtsprozess tragen: »Ihre Geschichte«, so Haffner Ende der 1930er Jahre, »muß noch geschrieben werden.« (Haffner 2000, 187) Natürlich wirkt das frappierend für unseren Blick, der aus dem Jahr 2023 zurückgeht und das Folgende vor Augen hat: Während Haffner die Aufgabe einer angemessenen zukünftigen Geschichtsschreibung formuliert, die die Mikroelemente der Zustimmung, wie sie so viele schon im Augenblick der ersten Bewährungsprobe bekundet haben, ins Zentrum der Analyse zu rücken hätte, löst er sie mit seinem Text schon selbst ein. Und so lässt sich auch schlüssig begründen, wie der Titel seiner Introspektion zustande kam, warum Haffner seine Aufzeichnungen Geschichte eines Deutschen nannte; denn es sind weniger Erinnerungen eines Einzelnen (auch wenn sie von einem Individuum handeln); es sind keine autobiographischen Aufzeichnungen (obwohl sie konkrete Lebensgeschichte entfalten); es sind Vorstudien für eine Geschichtsschreibung der fehlgegangenen Deutschen insgesamt, die die Zeit als Ganzes zu entschlüsseln sucht und auf symptomatische Erkenntnis zielt. Und das Material dafür – das sucht und findet Haffner bei sich selbst. Als er später, in den 1960er Jahren, für die Wochenzeitschrift Stern die Uraufführung des Geschichtsdramas Der Stellvertreter von Rolf Hochhuth würdigte, wiederholte er diese Einsicht seiner 1939 in Geschichte eines Deutschen vorgenommenen introspektiven Geschichtsschreibung: »Die Schuld der Deutschen – das absichtliche Wegsehen, der stillgemütliche Zynismus, die verstockte Korrektheit im Angesicht des Urbösen – all das ist noch nie so schonungslos und so erschütternd dargestellt worden.« (zit.n. Braese 2001a, 273) Die in Paranthese aufgeführten Verhaltensmuster, vor allem die Wendung von der »verstockte(n) Korrektheit im Angesicht des Urbösen«, liest man nun, in Kenntnis der Lesesaalszene von 1933, anders als zuvor; denn in dieser markanten Formulierung ist keine lediglich abstrakte analytische oder bloß journalistische Beschreibung aufgehoben, sondern die Erfahrung einer Viertelsekunde, die zum Lebensthema wurde.
209
210
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
3. Horst Krüger und das sprachliche Labyrinth der Schuld Allgemeine Erkenntnis erstrebt auch die Schrift von Horst Krüger, dessen markantes Wort von der »kranken deutschen Zeit« (Krüger [1966] 2019, 190) den Bogen zu Haffners Beschreibungen der deutschen Selbstpathologisierung schlägt. Auch hier, bei Krüger, tritt diese Einsicht in das Zentrum des eigenen Textes: Das Deutschland, das in den 1930er und 1940er Jahren auf so fürchterliche Weise krank wurde, dieses Deutschland war man selbst. Es ist Krüger, der vom »Labyrinth der Schuld« spricht, als er in der Stadt, in der er nach einem Studium der Philosophie und der Literaturwissenschaften in Berlin und Freiburg (bei Nicolai Hartmann, Eduard Spranger und Martin Heidegger) und nach beruflichen Stationen als Journalist für Zeitungen und Rundfunk in Freiburg und Baden-Baden seit 1964 als freier Schriftsteller und Publizist arbeitet, Fritz Bauer kennenlernt und dessen Einladung folgt, die Prozesse gegen das NS-Wachpersonal im Frankfurter Römer und in den Gallus-Sälen zu besuchen, die als Auschwitz-Prozesse in das Gedächtnis der Republik eingegangen sind.14 Wie viele andere Beobachter der vor Gericht stehenden Täter blickt auch der Besucher Horst Krüger beim Anblick der Angeklagten in einen Spiegel, der ihm zunächst rätselhaft bleibt: Ich fahre zum Auschwitz-Prozeß, weil ich das sehen will. Ich meine, Sehen entzaubert jeden Spuk. Auschwitz ist wie ein Spuk. Das Wort ist zu einer seltsamen Metapher geworden: Metapher des Bösen in unserer Zeit. […] Ich fahre zum AuschwitzProzeß, um diesen Mythos in mir aufzuklären. Ich will nur dasitzen und zuhören, zusehen und beobachten. […] Es ist eine letzte Möglichkeit, der Vergangenheit in Fleisch und Blut, der Geschichte in ihren Akteuren zu begegnen, die Täter und ihre Opfer nicht als Standbilder des Schreckens oder Leidens, sondern als Menschen wie du und ich. Ich will dieses Drama der Zeitgenossen sehen, bevor es in den Abgrund der Geschichte versinkt. Ich will meiner Jugend unter Hitler noch einmal begegnen. (Krüger [1966] 2019, 162f.) Dann aber wird für Krüger der Blick auf die Täter zu einer Chimäre, denn natürlich sieht man ihnen ihre Taten auf den ersten Blick und von außen betrachtet nicht an, der Spiegel lügt gewissermaßen, der auf das Personal von Auschwitz geworfene Blick ›sieht‹ zunächst nichts, er bleibt blind und ist keine Hilfe für das Verste-
14
Die Eröffnung des Auschwitz-Prozesses Ende Dezember 1964 und die ersten Verhandlungstage fanden im Rathaus statt; ab Anfang April 1965 tagte der Prozess im Haus Gallus (Warnke 2014, 66); von einem »Labyrinth der Schuld« spricht Krüger sowohl in seinem Erinnerungsbuch als auch – hier sogar prominent im Titel – in der Erstveröffentlichung des Kapitels in Der Monat (Krüger [1966] 2019, 187; vgl. Krüger 1964). Zum Autor und seinen Publikationen insgesamt: Reich-Ranicki 1989 (hier auch mehrere Beiträge von Koeppen, Améry, Reich-Ranicki u.a. zu Das zerbrochene Haus).
Nicolas Berg: Beobachter der kranken deutschen Zeit
hen, weist keinen erkennbaren Weg für die Erkenntnis und bietet keine Antwort auf die Frage nach dem ›Warum?‹ Und dieser Hiatus zwischen Schein und Wirklichkeit, zwischen Innen und Außen, wiederholt sich in einer Pause der Verhandlungen des Auschwitz-Prozesses, in der Krüger das Gebäude der Verhandlung verlässt. Für eine kurze Mittagspause überquert er den Platz vor der Paulskirche und eilt dann, direkt von den Täter- und Zeugenvernehmungen kommend, hinüber zu Goethes Geburtshaus. Der Anblick dieses Symbols des anderen Deutschlands, der Erinnerungsort seiner kulturellen Würde, kontrastiert mit den Vorgängen, die wenige Minuten zuvor, vor Gericht verhandelt worden waren – und aus diesem Kontrast zwischen dem Tiefpunkt der Geschichte und dem Symbol der deutschsprachigen Literatur und Kultur entwickelt der Autor dann den folgenden Gedankengang: Ich habe mich in eine Nebenstraße gerettet. Ich schleiche, plötzlich von Melancholie gelähmt, an Mauern vorbei. Auch hier alles hohe, neue Bauten, aber dann wird es stiller, große, gepflegte Buchhandlungen tauchen auf, und plötzlich erinnert mich ein braunes, hohes Patrizierhaus mit Butzenscheibenfenstern, gestaffelten Etagen und schmiedeeisernen Türen daran, daß ich hier ja im Großen Hirschgraben bin: Geburtsort der deutschen Klassik, Goethehaus. Zwei Omnibusse, amerikanische Sightseeing-Cars, parken in der engen Straße, spucken Touristen aus, die sich hier das Deutschland der Denker und Dichter rasch zu Gemüte führen wollen. Sie werden auf diese Attrappe reinfallen, denke ich: Goethes Kamm und die Bratpfanne der Frau Rath, alles Plunder, alles Talmi. (Krüger [1966] 2019, 192) Schon direkt nach dem Krieg, in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre, im Hinblick auf das Jubiläum des 200. Geburtstags Goethes im Jahr 1949, lag die Frage nahe, wie nun diese zwei deutschen Traditionen zusammenzufügen waren, die Goethes und die Hitlers. Auf sehr viele Zeitgenossen wirkte das Jubiläum wie die Aufforderung zu einer Bilanz. Nun hatte man, anders als 1932, als man im Jahr vor der Selbstpreisgabe der Demokratie, den 100. Todestag Goethes feierlich beging, die Aufgabe, die zurückliegenden Hitlerjahre im Spiegel der eigenen Geistestradition neu zu betrachten und zu bewerten (zur Goetherezeption nach 1945: Berg 2003; Döring 2002; Klönne 1988; Krippendorf 2005; Nutz 1983; Schwab 1977; Wende-Hohenberger 1990). Der aus dem Exil nach Köln zurückgekehrte Germanist Richard Alewyn (Alewyn 1948/49) oder der nach Kriegsende nach Basel gezogene Philosoph Karl Jaspers (Jaspers 1951) warnten im Goethejahr 1949 vor einem »Goethe als Alibi« (dies die Formel, die Richard Alewyn prägte), womit sie heftige Debatten auslösten. So zeigt die heute nur noch erstaunlich zu nennende Heftigkeit der Antwort von Ernst Robert Curtius etwa, wie der beleidigte Reflex auf dieses Zusammendenken von Goethe und Hitler nicht selten besonders anmaßend und geradezu trotzig ausfiel und viele Deutsche der Neigung folgten, die positive Tradition Goethes hochzuhalten, wenn von der Vertreibung und Ermordung der Juden gesprochen wurde (vgl. Fuhrmann 2002). Der Romanist Leo Spitzer, der die Nazizeit im Exil in Istanbul überstanden hatte
211
212
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
und später in den Vereinigten Staaten lehrte, kommentierte die zornigen Ausfälle von Curtius gegen Jaspers zurückhaltende Kritik am kompensatorischen Umgang mit Goethe in der Nachkriegszeit treffend wie folgt: »Wehe wenn der unsterbliche Goethe angegriffen wird, das fordert den Zorn der Elite heraus, die sich aber distanziert, wenn Millionen Menschen gemordet werden.« (Spitzer 1949, 585) Der Blick der Deutschen auf sich selbst und derjenige, den andere auf sie hatten, fielen hier diametral auseinander. Schon Max Frisch notierte in seinem Tagebuch 1946–1949 in einer ganz ähnlichen Wortwahl wie Alewyn oder Jaspers sein Erstaunen, ja, seine Verachtung über diese deutsche Selbstamnestie, die auf einem Trotz ruhte, mit dem man vermeintlich ungerechte Vorwürfe zu widerlegen versuchte: »Wie oft, wenn wir einmal mehr von Deutschland sprechen, kommt einer mit Goethe, Stifter, Hölderlin und all den anderen, die Deutschland hervorgebracht hat, und zwar in diesem Sinne: Genie als Alibi –.« (Frisch [1950] 1988, 289) Auch der junge Frisch monierte, hierin Hannah Arendt vorwegnehmend, die kurze Zeit später ganz Ähnliches nach ihrer Reise durch Deutschland 1949/50 notierte, in der deutschen Haltung zu Krieg und Verbrechen eine penetrante Verwechslung von Ursache und Wirkung (vgl. Frisch [1950] 1988, 290). Beide, Arendt wie Frisch, kritisierten dabei aufschlussreicher Weise die »fieberhafte[] und mit verdächtigem Eifer geschürte[] Empörung« (Frisch [1950] 1988, 290) der Deutschen über die vermeintliche Einseitigkeit all jener Kritiker der Deutschen, die diese Schuldabwehr mit den Mitteln des Kulturpatriotismus nicht zu akzeptieren bereit waren. Denn diese Art, auf die eigene Hochkultur zu verweisen, als wäre sie ein unerschöpfliches Guthaben, auf das man zugreifen könne, wenn man von Dritten auf die angehäuften Schulden angesprochen wird, überzeugte keinen einzigen der vielen Deutschlandbesucher in der Zeit nach 1945. Frisch äußerte diese Einschätzung von 1948 mit großer Überzeugung und Empörung zugleich: »Besonders obszön empfinde ich es, wenn man es [das herrische Bewusstsein, mit dem man von den anderen verlangte, das ›Geschehene endlich geschehen sein lassen!‹] mit Goethischem umkleidet: mit dem schöpferischen Schlaf des Faust, mit dem heilenden Segen des Vergessens usw.« (Frisch [1950] 1988, 290) Erst diese durch das Goethejahr 1949 evozierten Zusammenhänge lassen die intellektuelle Radikalität Krügers erahnen, der in den 1960er Jahren genau daran nicht anknüpfen will: Schuldabwehr, drapiert – um mit Frisch zu sprechen – »mit Goethischem«. Krüger bezieht in der als Frankfurter Stadtspaziergang entfalteten Szene seiner zu Fuß zurückgelegten Wegstrecke von den Auschwitz-Verhandlungen zu einem Erinnerungsort der deutschen Klassik eine ganz und gar andere Position als zwanzig Jahre zuvor die Kritiker von Jaspers und Alewyn: »Das Goethehaus wurde im Krieg zerstört, brannte aus. Das Goethehaus gibt es nicht mehr. Es ist aus in Deutschland mit Goethe und Klassik. Es war ja wohl nur sinnvoll, daß im schlimmsten Jahr von Auschwitz auch dieses Haus in Asche sank« (Krüger [1966] 2019, 192). Das hier verwendete Wort »sinnvoll« ist nicht als Kausalargument gemeint, aber es wendet sich mit Verve gegen die unverfrorene Aufrechnung von Hochkultur gegen
Nicolas Berg: Beobachter der kranken deutschen Zeit
Massenverbrechen, wie sie noch bis in die 1960er Jahre hinein, in denen Krügers Reflexion entsteht, im deutschen Selbstentlastungsdiskurs üblich war. »Sinnvoll« ist hier ein Widerstands-Wort, nicht gegen die historischen Ereignisse im Dritten Reich (das wäre der nachgeholte Widerstand, den auch Krüger verachtete), aber gegen einen falschen Umgang mit den eigenen Traditionen. Und weil er genau weiß, dass die Goethe-Sprache des 18. und frühen 19. Jahrhunderts die Hitler-Sprache des 20. Jahrhunderts nicht verhindert hatte, ist der symbolische Akt, den Wiederaufbau des Geburtshauses Goethes gleichsam literarisch zu verfluchen, als »Attrappe« zu schmähen und stattdessen dafür zu plädieren, den Verlust auch augenfällig zu machen, indem man dieses Haus nicht mehr hätte aufbauen sollen, gedanklich in sich stimmig. Es bleibt natürlich ein gedankliches Experiment in einem Moment, als diese Entscheidung überhaupt nicht mehr ansteht, denn der Wiederaufbau war ja zwei Jahrzehnte zuvor für dringlich erachtet und auch vollbracht worden. Krügers Verwendung des Wortes »sinnvoll« akzentuiert den Gedanken, dass die Zerstörungen zusammengedacht werden müssen, jene im Römer und im Gallus-Saal der Frankfurter Auschwitz-Prozesse verhandelten Zerstörungen und der Verlust des Patrizierhauses, in dem am 28. August 1749 Johann Wolfgang Goethe um die Mittagsstunde zur Welt gekommen war. Krüger war natürlich nicht der Einzige, der die Auschwitz-Prozesse als den idealtypischen Ort begriff, an dem nicht nur die Sache der Angeklagten verhandelt wurde, sondern an dem alle Deutschen eine Lektion zu lernen hatten. Als junger Mann schrieb etwa auch der spätere Kunsthistoriker Martin Warnke als Pressebeobachter der Stuttgarter Zeitung vom »deutschen Streben, Verantwortung abzuschieben, Alibis für Versäumnisse zu suchen, Entschuldigungen an den Haaren herbeizuziehen, eigene Entscheidungen durch Verlagerung der Zuständigkeit nach oben zu meiden […].« (Warnke [1964] 2014, 28) Und wie Warnke kommt auch Horst Krüger hier auf ganz eigenem Wege zu einer Einsicht, die Theodor W. Adorno bereits 1949 in seinem Essay Die auferstandene Kultur in der folgenden Sentenz festgehalten hatte: Es hat sich noch nicht herumgesprochen, daß Kultur in traditionellem Sinn tot ist – daß sie in der Welt zu einer Ansammlung von katalogisiertem, an Verbraucher geliefertem, dem Verschleiß preisgegebenem Bildungsgut ward, dem man eben jenen Ernst verweigert, der ihr in Deutschland heute wie stets gezollt wird. Das Glück des sich selbst genießenden Geistes, dem gerade der Zurückkehrende nur allzu willig sich überläßt, läßt sich dem im Gewinkel altertümlicher Städtchen vergleichen. Es zehrt von dem, was noch übrig, was dem Gang des Fortschritts noch nicht geopfert ist. Der Umgang mit Kultur im Nachkriegsdeutschland hat etwas von dem gefährlichen und zweideutigen Trost der Geborgenheit im Provinziellen. Und wie im Angesicht der zerstörten Städte das Gerade-noch-übrig-sein, das Ausnahmehafte und Anachronistische dessen, was an alter Kulturlandschaft
213
214
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
erhalten blieb, ins grelle Licht tritt, so ist es vielleicht mit Kultur insgesamt bestellt. (Adorno [1949] 1986, 455, vgl. auch Meier 1988) Genau diesen »Trost der Geborgenheit im Provinziellen«, von dem Adorno im Goethejahr sprach, wollte Krüger in den 1960er Jahren nicht mehr beanspruchen. Auch bei ihm ist es die Sprache, die die Gesamttradition des Deutschen aufbewahrt, und dies in einem sehr konkreten Sinne. Über den Aspekt der Sprache stolpert Krüger, nachdem er in den Verhandlungssaal zurückgekehrt war und sich wieder der Vernehmung von weiteren Augenzeugen des Geschehens in Auschwitz zuwendet: er hört die Vokabel »Sanka«, kann sie aber zunächst nicht deuten: Der Zeuge hat eben das Wort ›Sanka‹ gebraucht. Ich stutze. Sanka – das kennst du doch? Ist das ein Ortsname im Osten, ein Medikament? Das hast du doch einmal gehört? Es ist so schwer, sich an alles zu erinnern nach zwanzig Jahren. Und während ich noch über dieses merkwürdige Wort nachgrüble, höre ich die Stimme sagen: ›Die meisten wurden direkt in Sankas mit Phenol abgespritzt.‹ Und da ist das Wort plötzlich da, aus den Schächten der Vergangenheit schnellt es empor: Erinnerung an meine Jugend, Erinnerung an die technische Sprache der Ordonnanzen und Bataillone, die verhaßte, schreckliche Sprache des Militärs, dem ich zugehörte: Sanka, das hieß Sanitätskraftwagen, und du damals in der zweiten Kompanie des 1. Fallschirmjäger-Regiments hast doch auch einen Sanka gefahren. Natürlich, das waren die kleinen, wendigen weißen Busse mit dem roten Kreuz auf dem Dach, auch Opel Blitz. Damit wurden die Verwundeten abgefahren, und sie schrien und stöhnten manchmal und wünschten ihren Fahrer in die Hölle. (Krüger [1966] 2019, 173) Erkenntnis – das ist der Lesesaalszene Haffners vergleichbar – erfolgt auch hier wie ein harter Schlag, den ein einzelnes Wort darstellt. Krüger spricht hier zweimal von sich; er betrachtet sich nicht nur in der Ich-Form, sondern er evoziert sich auch als ein zweites Alter Ego, das mit dem heutigen Ich dissoziiert erscheint, so dass er es mit »du« als sein fremd gewordenes Gegenüber ansprechen muss: »[D]u hast doch auch einen Sanka gefahren«. In diesem Zitat steht er sich faktisch gegenüber, spricht und wird angesprochen, erinnert sich und wird von der Evidenz der Fakten vor Gericht erinnert. Der Autor macht hier offenkundig die so besondere Gerichtsverhandlung literarisch auch zu seinem »Gerichtstag« und blickt nach dem Verlassen des Gerichtsgebäudes auf seine Notizen, die er während der Verhandlungen gemacht hatte: Ich schrieb da nur Worte mit, Worte des Zeugen Dr. Wolken, keine SS-Worte, sondern Worte des Opfers, Sprache des Lagers. Ich lese: ›Abstellen, einleiten, liquidieren, verladen, vergasen, krepieren, selektieren, Material aufarbeiten, anfallende Leichen verarbeiten, ins Gas gehen, Frauenlager B1, Zyklon B, auf die Rampe gehen, abführen, abstellen, überstellen, verlegen, Appell stehen, Sport
Nicolas Berg: Beobachter der kranken deutschen Zeit
machen, laufen, schießen, verladen, übergießen, Musikkapelle, Walzerklänge, Hundekommando, Hasenjagd, prügeln, im Totenbuch stehen, Muselmänner abstellen, Muselmänner waggonieren, Muselmänner erschlagen, ins Herz spritzen, ins Kreuz steigen, hüpfen…‹ Während ich diese Worte überfliege, begreife ich auf einmal den Traum von heute. Natürlich, das ist die Sprache der alten Uniform, das ist das Wort Sanka, an das du dich nicht erinnern konntest. Diese Sprache ist noch lebendig, sie gibt es noch, hier in Frankfurt wird sie wieder wach. Wir können uns noch so viel neue Uniformen, noch so viel goldene Kleider anlegen. (Krüger [1966] 2019, 192) Das Gerichtsereignis, dem Krüger als Beobachter folgt, setzt sich in der Selbstbefragung fort, die er literarisch vornimmt, indem er sich selbst verhört, als sei er selbst einer der Bogers oder Mulkas, die formell vor Gericht stehen. Dass Horst Krüger sich hier als Soldat und als Fahrer eines »Sanka« wiedererkennt ist gleichsam das Ergebnis seines Besuchs im Gerichtssaal: Er ist kein »Besucher«, er ist einer der Angeklagten. Bevor das Geschehen »in den Abgrund der Geschichte versinkt« (Krüger [1966] 2019, 163) und bevor aus dem Thema »Geschichte« wird und es »in die Hände der Historiker übergeh[t]« (ebd.), eignet sich Krüger die unabweisbare Einsicht an, dass er auch damals nicht zugeschaut, sondern gehandelt hat, dass er in der besagten Zeit als junger Soldat keine Goethe-, sondern Hitler-Sprache gesprochen hat; dass er – um seine Gegenüberstellung aufzugreifen – nicht für den Wiederaufbau von Goethes Geburtshaus sein kann, ohne einer historischen Rekonstruktion derjenigen Wirklichkeit zuzustimmen, die mit den Vokabeln »Sanka«, »selektieren«, »vergasen« und »Zyklon B« einhergeht.
4. Resümee: Ein seltener Ton in der frühen Vergangenheitsbewältigung In diesem Aufsatz wurden zwei Texte von – in Alter, Herkunft, politischer Überzeugung und Berufswahl – unterschiedlichen Autoren genauer betrachtet, Texte, die zudem auch nicht zur gleichen Zeit verfasst wurden, sondern im Jahre 1939 (so die Geschichte eines Deutschen von Haffner) und fünfundzwanzig Jahre später, in den Jahren des gesellschaftlichen Aufbruchs Mitte der 1960er Jahre (so Krügers Erinnerungsbuch Das zerbrochene Haus). Haffner fasst im hypertrophen, aber in sich schlüssigen Bild des virtuellen »Duells« (Haffner 2000, 9) zwischen dem nationalsozialistischen Staat und dem eigenen Ich eine existentielle und moralische Situation der Entscheidung in Worte, in der er sich selbst zwar als Unterlegenen beschreibt, aus dieser Diagnose aber die Konsequenz zieht: Er entschließt sich, dieses Deutschland zu verlassen, das ihn zu zwingen beginnt, das Nazitum in sein privatestes Leben einzulassen, und geht in die Emigration. Das »Duell«, so könnte man das von Haffner gleich am Beginn seines Textes eingeführte Bild aufnehmen, verliert er; dafür aber
215
216
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
gewinnt er die eigene Integrität als private Person. Bei Krüger ist es demgegenüber eine andere Situation, die sich nicht während des ›Dritten Reichs‹ vollzieht, sondern zweieinhalb Jahrzehnte danach. Bei ihm ist es auch eher ein von außen ›Erinnert-Werden‹, ein Wiedereintauchen in einen früheren Zustand, ein Innehalten mitten im Grauen, das durch den Prozess über das Lagerpersonal in Auschwitz in die deutsche und internationale Öffentlichkeit tritt. Das ›Eingeholt-Werden‹ durch die vor seinen Augen und Ohren erinnerte und erzählte Geschichte von Auschwitz wird zum Auslöser einer so persönlich-intimen wie intellektuellen Aktivität: Dem Wiedererkennen der Tatsache, dass man im Krieg selbst ein Sprecher jener Sprache der Unmenschlichkeit gewesen ist, die hier – im Frankfurt der 1960er Jahre – vor Gericht als ›Geschichte‹ ausgebreitet wird. So ist es die Wucht einzelner Worte und Slang-Vokabeln aus der Zeit als Lastwagenfahrer der Wehrmacht an der Ostfront, die ihn im Verhandlungssaal aus der Gegenwart des Jahres 1964 in die dunklen Jahre der NS-Zeit regelrecht zurückschleudert: Das Zuhören wirkt auf ihn, so heißt es einmal bei Krüger, »wie wenn die Planquadrate der Zeit durcheinandergeworfen wären: Welche Zeit gilt hier eigentlich? Die von damals?« (Krüger [1966] 2019, 171) Krüger bejaht diese Frage, denn das »damals« wird ihm hier noch einmal zur Erkenntnis, er selbst zum Ankläger der eigenen Person und was er in seinem Text daraus macht, ist nicht Schweigen und Scham; es entsteht ein echter Rechenschaftsbericht, ein Text, der sich durch Unbestechlichkeit und durch – hierin Haffner ähnlich – Aufrichtigkeit auszeichnet, weil er die eigene Schuld benennt. Es ist das Gegenteil einer Heldenerzählung, die hier präsentiert wird; keiner Schlussstrich-Sehnsucht wird hier Ausdruck verliehen, denn in Krügers Schlusssatz seiner Prozess-Erinnerung finden wir das Gegenstück zur notorischen Rede vom Schlussstrich, die Einsicht nämlich, dass die Folgen der Nazizeit noch lange nicht als abgeschlossen betrachtet werden können: »[d]ieser Hitler«, so endet sein Text von 1964, »bleibt – lebenslänglich« (Krüger [1966] 2019, 194). Insgesamt beobachten wir zwei Gesten des Rechenschaftsablegens über die je eigene Gegenwart. In den bereits zitierten Tagebüchern von Max Frisch finden wir die Notiz, wie nötig es nach 1945 war, »mit älteren Menschen zu sprechen«, weil die eigene Gegenwart »kein Maß« mehr für das Denken bereitstellte: »Das letzte Maß, das die meisten haben, ist bereits aus der Hitlerzeit«, so Frischs Beobachtungen auf seinen Nachkriegsreisen durch das zerstörte Deutschland (Frisch [1950] 1988, 194). Haffner und Krüger – und das ist beiden eigen – bieten Texte, die den Versuch unternehmen, jenes »Maß«, von dem Frisch spricht, wieder zu suchen, es neu zu lernen und zu bestimmen. Sie zeigen Variationen auf die bekannt gewordene Formulierung von Jaspers: »Wir selbst sind andere geworden seit 1933.« (Jaspers 1946) Im zeitverlangsamenden Protokoll von Haffners Versagen in der Bibliotheksszene liegt das Dokument eines jener so seltenen Lebensmomente vor uns, in dem ein Moment so genau und so erbarmungslos beobachtet wird, ein Augenblick, der in einer Unterlassung besteht, die man sofort bemerkt, nicht erst im Nachgang, spä-
Nicolas Berg: Beobachter der kranken deutschen Zeit
ter, wenn man objektiv klarer sieht und wirklich klüger geworden ist, sondern schon im Moment des eigenen Fehlens selbst. Haffners sofort erkanntes Fehlgehen in der Bibliothek wird zum Kairos, zu einem Zeitmoment der Umkehr, ein Stolpern, das ihn nicht fallen lässt, sondern rettet, weil er die kranke Zeit hier als Gewalt, die über ihn zu herrschen beginnt, beschreibbar machen kann. Er hält einen Moment fest, in dem er den Zeitgeist, dem er reflexhaft seine Referenz macht, erkennt und zu widersprechen lernt: Auch dies ein Wiedergewinn von Maß und Maßstab. In genau dem Moment, in dem sich die Zeit an Haffner vollzieht, bemerkt er dies und macht die eigene Passivität, in der wir uns gemeinhin der Zeit gegenüber befinden, zum Ausgangspunkt für eine Korrektur. So wird der Augenblick selbst im Erkennen und Beschreiben transzendiert, denn Haffner protokolliert letztlich eine Art Ausder-Zeit-Fallen bzw. ein Aus-der-Zeit-Springen, und dafür ist Aktivität nötig, die den Entschluss herbeiführt, ins englische Exil zu gehen. Der Vergleich der Texte von Haffner und Krüger begründet sich, so haben wir gesagt, durch das Element eines neuen Tons, in dem gedacht und geschrieben wird, um ein Maß aufrechtzuhalten, dessen Autorität schon in Stücke zerbrochen ist; er begründet sich durch eine zeitdiagnostische Aufrichtigkeit, die gerade diese beiden Dokumente enger zusammenrücken lässt, als sie in Wirklichkeit sind oder waren. ›Zeitdiagnostik‹ aber ist ein erläuterungsbedürftiger Begriff, dem abschließend noch kurz Aufmerksamkeit geschenkt sein soll (vgl. zum Konzept der Zeitdiagnostik Mülder 1985). Es fällt nämlich auf, dass beide Texte einen sprachkritischen Ansatz vertreten, mit dem ihre Autoren ›harte‹ politische Fakten und Zusammenhänge früher als die Mehrheit der Zeitgenossen zu erkennen in der Lage sind, weil sie die ›weiche‹ Veränderung der Sprache nicht als belangloses Detail verstehen, sondern als grundlegenden Eingriff in die eigene Welt und – ganz generell – in die Wirklichkeit. Haffners Lesesaalszene hat ihren Kern in der Sprengkraft einer Worterpressung der 1930er Jahre, in jenen beiden Vokabeln ›Nichtarier‹ und ›arisch‹, die in den Bibliotheksraum des Kammergerichts hineingetragen werden und mit denen der junge Referendar auch direkt angesprochen wird und dann Folge leistet, indem er beflissen zum Ausdruck bringt, »arisch« zu sein und so sein Recht auf das Verbleiben in der Bibliothek nazistisch begründet. Das ist die intellektuelle Pointe des Texts von Haffner; den Wahnsinn dieser Szene zwar zu spät, aber eben dennoch erkannt zu haben, diese Haltung des Erkennens geht als Argument, als Denkstruktur in seine Geschichte eines Deutschen ein: Der Irrsinn des politischen Geschehens ist an der neuen Sprache erkennbar. Nicht nur hier markiert der Autor seinen Blick für den semantischen Sündenfall dieser Zeit, sondern an mehreren Stellen des Manuskripts. Die entscheidende Trennlinie, so Haffner, die ihn und seine engsten Freunde von den anderen trennte, die nun zur Macht gekommen waren, wurde durch die verschiedenen Sprachen gezogen, die beide Gruppen sprachen:
217
218
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
Wir wußten, mit vielen unserer Altersgenossen konnten wir kein Wort reden, weil wir eine andere Sprache sprachen. Wir fühlten um uns herum das ›braune Deutsch‹ entstehen – ›Einsatz‹, ›Garant‹, ›fanatisch‹, ›Volksgenosse‹, ›Scholle‹, ›artfremd‹, ›Untermensch‹ – ein abscheuliches Idiom, das in jeder Vokabel eine ganze Welt von gewalttätiger Dummheit implizierte. (Haffner 2000, 81) Haffner protokolliert auch im weiteren Verlauf seiner Aufzeichnungen immer wieder Sprach- und Stilfragen, etwa »die Sprache der Gegner Rathenaus« (Haffner 2000, 51), den »Gebrauch der Gemeinheit« (Haffner 2000, 65) in den frühen Reden Hitlers, die »Übertriebenheit ihrer Drohungen und unverhohlenen Grausamkeit« (ebd.), die er als neuer Reichskanzler in Form von »wüsten Schmähungen gegen die Juden« (Haffner 2000, 107) zur Regel machte. In einschlägigen Zeitungen findet Haffner das publizistische Pendant der »Heilrufe« (ebd.) wieder; ab 1933 reißen die Ausfälle der neuen Regierung über die »Parasiten« und »Untermenschen« (ebd.) gar nicht mehr ab. Wiederholt deutet er in Geschichte eines Deutschen auf das Weltanschauungsvokabular der völkischen Bewegung, das dem politischen Stil der Zeit zum immer stabileren Fundament werden konnte. So kann Haffner die Vergiftung der öffentlich-politischen Sphäre bis zu einem sehr frühen Moment, bis in die Tage des Kapp-Putsches 1923, zurückverfolgen, in dessen Folge die paramilitärischen Jugendbünde (er nennt den »Bismarckbund« und den »Deutschnationalen Jugendverein«) einen neuen »Jargon« prägen, »der sie von allen anderen unterschied« (Haffner 2000, 46). Haffner erlebt und protokolliert schon hier, dass sich diese Sprache antisemitisch einfärbt, dass es der Antisemitismus ist, der darin zur sprachlich markierten Haltung gemacht wird, die Unterscheidungen als vermeintlich gegebene Differenzen einführt: »Auch fingen sie an«, so schreibt er über einige seiner Mitschüler, »sich unkameradschaftlich gegen die Juden unter uns zu benehmen« (ebd.). Der Autor kann aufgrund der stil- und sprachkritischen Diagnosen auch den Moment angeben, in dem das erst sehr viel später so angsteinflößende Zeichen von Hass und Gewalt in den Radius seiner Aufmerksamkeit tritt: Einen von ihnen sah ich damals, bald nach dem Kapp-Putsch, in einer langweiligen Stunde seltsame Figuren auf sein Heft kritzeln, immer wieder dasselbe: Ein paar Striche, die sich auf überraschende und befriedigende Weise zu einem symmetrischen, kästchenartigen Ornament formten. Ich war gleich in Versuchung, es nachzumachen. ›Was ist das?‹ fragt ich, flüsternd, denn es war in einer, wenn auch langweiligen, Schulstunde. ›Antisemitenabzeichen‹ flüsterte er im Telegrammstil zurück. ›Haben die Ehrhardt-Truppen am Stahlhelm getragen. Bedeutet Juden raus. Muss man kennen.‹ Und er kritzelte geläufig weiter. Das war meine erste Bekanntschaft mit dem Hakenkreuz. (Haffner 2000, 47) Auch Krügers Selbstaufklärung als »Sanka«-Fahrer an der Ostfront verdankt sich der sprachkritischen Wiedererkennung eines eigenen Idioms, mit dem man Anteil
Nicolas Berg: Beobachter der kranken deutschen Zeit
hatte an der Ungeheuerlichkeit der damaligen Verbrechen; der von ihm beschriebene Erinnerungsmoment erfolgt in der zu Protokoll gegebenen Einsicht, als Wehrmachtssoldat in jener Zeit selbst einer der Sprecher dieser Kürzelsprache, dieser Sprache der Besatzer, der Krieger und der todbringenden Mörder gewesen zu sein. In Zuspitzung der Methodologie der ›Zeitbeobachtung‹, die im vorliegenden Beitrag zu einer Leitlinie der Interpretation gemacht wurde, können wir die literarische Geschichtsbetrachtung des Essays, der Reportage, der autobiographischen Notate als Beobachtungen an der Sprache der Deutschen erkennen, der Tätersprache, des Sprachverlusts, der Überreste in der Sprache, die als Erinnerungsanstöße Erkenntnis bewirken wie in einer alltäglichen Psychoanalyse, die das Unbewusste zugleich umhüllt und enthält. Die beiden Persönlichkeiten, deren Umgang mit der NS-Zeit hier Thema waren, sind auf diese oder jene Weise ›Zeitbeobachter‹, und weil sie dabei im Eigenen das Allgemeine festzuhalten in der Lage sind, weil sie Ereignisse der Zeit betrachten, die zwar von einem Individuum erlebt wurden, zugleich aber über diesen je Einzelnen hinausweisen, liegt im Ergebnis bereits ein Appell an ein Publikum. Das Private des autobiographischen Rückblicks steht für etwas, das nicht nur für eine Person oder für deren direkt verstandene Familienangehörige erinnerungswürdig ist, sondern für die Öffentlichkeit insgesamt. Auch bei H.G. Adler wird die Frage nach dem »Sinn für den Ablauf der Dinge« (Adler 1976, 265) zu einer Reflexion über Sinn und Zweck der Zeitgeschichte, von der er auch sagt, »die beste Schule hierfür« sei »das historische Erarbeiten eines erst kürzlich abgelaufenen Geschehens, dessen Zeuge man wurde, ohne zu den Hauptbeteiligten zu gehören« (Adler 1976, 265). Genau diese Definition aber passt auf beide, auf Haffner und auf Krüger. Adler bedient sich einer aus dem Register der Kaufmannssprache entlehnten Wendung (»verbuchen«), um jene Alchemie aus Präzision und Prägnanz, aus Wissenschaft und Kunst vor seinen Leserinnen und Lesern zu entfalten, in deren Mischung die bloß verfließende Zeit in etwas anderes verwandelt wird, nämlich in gedeutete Geschichte – und somit in Geschichtsbewusstsein. Diese Verwandlung von Zeit in Geschichte hat ihr Recht vor allem in der Zeugenschaft, in der Autobiographie, denn es ist der eigene Lebensrückblick, bei dem sich jede und jeder den Fragen aussetzen muss: Was ist oder war relevant? Was bleibt rein privat und ist nicht für andere bestimmt? Was dagegen ist nicht nur für die Freunde, Familie und Kinder erzählenswert? Der autobiographische Moment der blitzhaften Einsicht in der Bibliothek, den Haffner schildert, und der Spaziergang in der Mittagspause des Auschwitz-Prozesses zum wiederaufgebauten Goethehaus, der bei Krüger zur Bereitschaft für die eigene Vergangenheitsbewältigung wird – beide Szenen deuten für zeitgenössische und zukünftige Leserinnen und Leser – also für uns – Momente des eigenen Lebens aus, aus denen allgemeine Geschichtserkenntnis möglich wird.
219
220
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
Literatur Adler, Hans Günther. »Wie verlaufen die Dinge und was wird Geschichte?« [1964]. In: Ders. Die Freiheit des Menschen. Aufsätze zur Soziologie und Geschichte. Tübingen 1976, 259–266. Adorno, Theodor W. »Die auferstandene Kultur« [1949]. In: Ders. Gesammelte Schriften. Bd. 20.2: Vermischte Schriften II. Aesthetica, Miscellanea. Hg. v. Rolf Tiedemann, unter Mitwirkung v. Gretel Adorno/Susan Buck-Morss/Klaus Schultz. Frankfurt a.M. 1986, 453–464. Albers, Bernhard (Hg.). Jahrgang 1919: Michael Guttenbrunner – Hans Bender – Horst Krüger [2009]. 3., überarb. Aufl. Aachen 2019. Alewyn, Richard. »Goethe als Alibi«. In: Hamburgische Akademische Rundschau 3 (1948/49), 685–687. Atze, Marcel. »Der Auschwitz-Prozeß in der Literatur, Philosophie und in der Publizistik«. In: Auschwitz-Prozeß 4 ks 2/63. Hg. v. Imtrud Wojak. Frankfurt a.M./Köln 2004a, 637–807. Atze, Marcel. »›Ich will nur dasitzen und zuhören, zusehen und beobachten.‹ Horst Krüger im Auschwitz-Prozess«. In: Rechenschaften. Juristischer und literarischer Diskurs in der Auseinandersetzung mit den NS-Massenverbrechen. Hg. v. Stephan Braese. Göttingen 2004b, 117–130. Berg, Nicolas. »›Gleichgewichtsverhältnisse der Seele‹ als Programm und ›Schicksal‹ als Erklärung: Zur Goethe-Rezeption Friedrich Meineckes«. In: Ders. Der Holocaust und die westdeutschen Historiker. Erforschung und Erinnerung. Göttingen 2003, 69–82. Boyd, Timothy. »Ein Erinnerungsgang durch ›Das zerbrochene Haus‹ von Horst Krüger«. In: Auschwitz-Prozeß 4 ks 2/63. Hg. v. Imtrud Wojak. Frankfurt a.M./ Köln 2004, 245–265. Braese, Stephan. Die andere Erinnerung. Jüdische Autoren in der westdeutschen Nachkriegsliteratur. Berlin 2001a. Braese, Stephan. »In einer deutschen Angelegenheit – Der Frankfurter AuschwitzProzess in der westdeutschen Nachkriegsliteratur«. In: »Gerichtstag halten über uns selbst…« Geschichte und Wirkung des ersten Auschwitz-Prozesses. Hg. vom Fritz Bauer Institut. Frankfurt a.M./New York 2001b, 217–244. Döring, Detlef. »Vergangenheitsbewältigung im Zeichen Goethes. Mitglieder der Leipziger Goethe-Gesellschaft im Umgang mit dem Dritten Reich (1945–1950)«. In: Figuren und Strukturen. Historische Essays für Hartmut Zwahr zum 65. Geburtstag. Hg. v. Manfred Hettling. München 2002, 757–778. Frei, Norbert. »Die Aufklärer und die Überlebenden«. In: Martin Warnke. Zum Auschwitz-Prozess 1964. Vorgestellt v. Pablo Schneider/Barbara Welzel. Zürich/Berlin 2014, 55–64. Frisch, Max. Tagebuch 1946–1949. 2. Aufl. Berlin 1988 [1950].
Nicolas Berg: Beobachter der kranken deutschen Zeit
Fuhrmann, Horst. »Karl Jaspersʼ Goethe-Rezeption und die Polemik von Ernst Robert Curtius«. In: Ders. Sechs Studien zur Goethe-Rezeption. Würzburg 2002, 83–123. Haffner, Sebastian. Als Engländer maskiert. Ein Gespräch mit Jutta Krug über das Exil. Mit einer Nachbemerkung v. Uwe Soukup, 2. Aufl., Stuttgart/München 2002. Haffner, Sebastian. Geschichte eines Deutschen. Die Erinnerungen 1914–1933. Stuttgart/ München 2000. Haffner, Sebastian. Germany: Jekyll & Hyde. 1939 – Deutschland von innen betrachtet [engl. 1940]. München 1996. Haffner, Sebastian. Anmerkungen zu Hitler. München 1978. Hodenberg, Christina von. »Die Ära der eingehegten Kritik 1945–1957«. In: Dies. Konsens und Krise. Eine Geschichte der westdeutschen Medienöffentlichkeit 1945–1973. Göttingen 2006, 101–228. Jaspers, Karl. »Unsere Zukunft und Goethe« [1947]. In: Ders. Rechenschaft und Ausblick. Reden und Aufsätze. München 1951, 26–49. Jaspers, Karl. Die Schuldfrage. Heidelberg 1946. Jockusch, Laura. »Jeder Überlebende ist ein Stück Geschichte«. Zur Entwicklung jüdischer Zeugenschaft vor und nach dem Holocaust. In: Die Geburt des Zeitzeugen nach 1945. Hg. v. Martin Sabrow/Norbert Frei. Göttingen 2012, 113–144. Klönne, Arno. »›Heimkehr zur Goethe?‹ Deutungen des Verhältnisses von Jugend, ›Bildungserbe‹ und Nationalsozialismus nach 1945«. In: Diskussion Deutsch 19.100 (1988), 144–156. Krippendorf, Ekkehart. »1945: Goethe als ›Heilung‹?« In: Goethe in Gesellschaft. Zur Geschichte einer literarischen Vereinigung vom Kaiserreich bis zum vereinigten Deutschland. Hg. v. Jochen Golz/Justus H. Ulbricht Köln/Weimar/Wien 2005, 151–155. Krüger, Horst. Das zerbrochene Haus. Eine Jugend in Deutschland [1966]. Frankfurt a.M. 2019. Krüger, Horst. »Im Labyrinth der Schuld. Ein Tag im Frankfurter Auschwitz-Prozeß«. In: Der Monat 16.188 (1964), 19–29. Meier, Bettina. Goethe in Trümmern. Zur Rezeption eines Klassikers in der Nachkriegszeit. Wiesbaden 1988. Michaelis, Andree. Erzählräume nach Auschwitz. Literarische und videographierte Zeugnisse von Überlebenden der Shoah. Berlin 2013. Mohr, Reinhard. »Mirakel der Erinnerung.« In: Der Spiegel 48 (27.11.2001), 306–310. Mülder, Inka. Siegfried Kracauer – Grenzgänger zwischen Philosophie und Literatur. Seine frühen Schriften 1913–1933. Stuttgart 1985. Nägele, Rainer. »Die Goethefeiern von 1932 und 1949«. In: Deutsche Feiern. Hg. v. Reinhold Grimm/Jost Hermand. Wiesbaden 1977, 97–122. Nutz, Maximilian. »Restauration und Zukunft des Humanen. Zur westdeutschen Goethe-Rezeption von 1945 bis 1949«. In: Klassik und Moderne. Die Weimarer Klassik als historisches Ereignis und Herausforderung im kulturgeschichtlichen Prozeß. Walter
221
222
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
Müller Seidel zum 65. Geburtstag. Hg. v. Karl Richter/Jörg Schönert. Stuttgart 1983, 457–481. Peitsch, Helmut. »Die Figur des nachgeholten Widerstands in der literarischen Publizistik der fünfziger und sechziger Jahre der BRD im Umkreis der Gruppe 47«. In: Bruders Hüter/Bruders Mörder. Intellektuelle und innergesellschaftliche Gewalt. Hg. v. Susanne Hartwig/Isabella von Treskow. Berlin/New York 2010, 65–92. Peitsch, Helmut. »Horst Krügers ›biographische Methode‹«. In: Die biographische Illusion im 20. Jahrhundert. (Auto-)Biographien unter Legitimierungszwang. Hg. v. Izabella Sellmer. Frankfurt a.M. 2003, 157–178. Peitsch, Helmut. »Deutschlands Gedächtnis an seine dunkelste Zeit«. Zur Funktion der Autobiographik in den Westzonen Deutschlands und den Westsektoren von Berlin, 1945 bis 1949. Berlin 1990. Pörksen, Uwe. Weißer Jahrgang. Düsseldorf 1979. Reich-Ranicki, Marcel (Hg.). Horst Krüger – ein Schriftsteller auf Reisen. Materialien und Selbstzeugnisse. Hamburg 1989. Rosenthal, Gabriele. »Zur Konstitution von Generationen in familienbiographischen Prozessen. Krieg, Nachkrieg und Genozid in Familiengeschichte und Biographie«. In: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 5 (1994), 489–516. Sabrow, Martin. »Der Zeitzeuge als Wanderer zwischen zwei Welten«. In: Die Geburt des Zeitzeugen nach 1945. Hg. v. dems./Norbert Frei. Göttingen 2012, 13–32. Schwab, Klaus. »Zum Goethe-Kult«. In: Zur literarischen Situation nach 1945. Hg. v. Gerhard Hay. Kronberg 1977, 240–251. Soukup, Uwe. Ich bin nun mal Deutscher – Sebastian Haffner. Eine Biographie [2001]. Frankfurt a.M. 2003. Spitzer, Leo. »Zum Goethekult«. In: Die Wandlung 4 (1949), 581–592. Steinbacher, Sybille. »Zeitzeugenschaft und die Etablierung der Zeitgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland«. In: Die Geburt des Zeitzeugen nach 1945. Hg. v. Martin Sabrow/Norbert Frei. Göttingen 2012, 13–32. Warnke, Martin. Zum Auschwitz-Prozess 1964. Vorgestellt v. Pablo Schneider/Barbara Welzel. Zürich/Berlin 2014. Weisbrod, Bernd. »Die ›Vergangenheitsbewältigung‹ der NS-Prozesse: Gerichtskultur und Öffentlichkeit«. In: Kontinuitäten und Zäsuren. Rechtswissenschaft und Justiz im ›Dritten Reich‹ und in der Nachkriegszeit. Hg. v. Eva Schumann. Göttingen 2008, 247–270. Wende-Hohenberger, Waltraud. »Thomas Mann im Goethejahr 1949«. In: Dies. Ein neuer Anfang? Schriftsteller-Reden zwischen 1945 und 1949. Stuttgart 1990, 242–277.
Mela Hartwigs postexilischer Roman Inferno (1948/2021) Primus-Heinz Kucher »…verwandelten sich die Worte, die aus jenem wie zum Schrei aufgerissenen Mund hervorquollen, in Blut, das über die lauschenden hinflutete…« (Hartwig 2017, 90)
1. Knapp vor der Mitte des bedauerlicherweise erst kürzlich, d.h. mit gut fünfzig Jahren Verspätung veröffentlichten Romans Inferno, lässt die 1967 im englischen Exil verstorbene, aus Wien gebürtige Mela Hartwig ihre Protagonistin Ursula, eine schwärmerische und zugleich wahrnehmungsscharfe junge angehende Malerin, nicht ihren ersten, wohl aber ihren entscheidenden Schock erleben: den Schock, Augenzeugin der November-Pogromnacht 1938 geworden zu sein und dabei die tief verstörende Erfahrung gemacht haben zu müssen, wie eine hochschwangere jüdische Frau, »halb nackt und nur noch in Fetzen gehüllt« (Hartwig 2017, 76) von ihrem Verfolger und Peiniger in den brennenden Tempel hineingestoßen, brutal ermordet wurde. Es handelt sich dabei vermutlich um den ersten Text einer ehemals österreichischen Autorin, der unmittelbar nach 1945 aus dem Exil heraus den Versuch einer doku-fiktionalen Rekonstruktion der veränderten Atmosphäre seit dem März 1938 im nationalsozialistisch okkupierten und sich zugleich dem nationalsozialistischen Großdeutschem Reich (selbst) angeschlossenen Österreich aus einer Doppelperspektive heraus unternommen hätte, nämlich aus der eines ideologisch gespaltenen Geschwisterpaars und einer innerlich zerrissenen Familie bis hin zum unrühmlichen Kriegsende 1945, das zudem von einem missglückten Anschlag als Akt verzweifelten Aufbäumens gegen die »von dem Atem des Todes verpestete Luft« (Hartwig 2017, 193) überschattet war. Hartwig ging bzw. geht es in diesem Text vor allem darum, anhand ihrer Protagonistin nachzuzeichnen, wie
224
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
das anfangs »ferne Grauen immer drohender anschwoll« (Hartwig 2017, 21), und dabei psychosoziale Gemengelagen freizulegen, welche einerseits Angehörige der Tätergruppe zu ihrem Handeln antrieb, andererseits verschiedene Einzelfiguren und Typen tendenziell widerstandsbereit eingestellter Opfer sowie Mitläufer:innen in ihren Haltungen konditionierte, aber auch zu brechen vermochte. Darüber hinaus war dieser Roman, dessen Entstehung, so die Angabe auf dem Typoskript, in die Jahre 1946–1948 zu datieren ist, für die Autorin mit der Hoffnung auf ein Wiederanknüpfen an die literarische Karriere in den späten 1920er und frühen 1930er Jahre verknüpft. Immerhin hatte diese in Alfred Döblin einen prominenten Fürsprecher gefunden, der als Preisrichter ihre ersten Novellen im Zuge eines Wettbewerbs der Literarischen Welt 1927 ausdrücklich empfahl und dazu beitrug, dass sie 1928 bei Paul Zsolnay veröffentlicht werden konnten (vgl. Polt-Heinzl 2007; Boxberger 2016, 238), wobei sie umgehend Aufmerksamkeit wie Irritation in der zeitgenössischen Kritik nach sich zogen. Anerkennen wollte die Kritik allerdings fast nur deren sprachliche Brillanz, fallweise auch die Kenntnis psychoanalytischer Problemlagen, nicht aber die Schärfe, mit der Hartwig ihre Konfliktszenarien entwickelte, um der Autorin eher einen Hysterisierungsgestus zum Vorwurf zu machen bzw. den, »überall einen Schritt zu weit gegangen« zu sein (f.l. 1928, 7), ebenso wie dies im Fall des nachfolgenden Romans Das Weib ist ein Nichts (1929) geschah, wenn etwa dem Text eine »Neigung zu überhitzter Sprache« vorgehalten wurde (Rhil 1929, 6), während ihre Texte vielmehr von »weiblicher Subjektwerdung und Selbstermächtigung« handeln (Danielczyk 2017, 18). Mit dieser Hoffnung auf ein Wiederanknüpfen – die Romanprojekte der frühen 1930er wurden von Zsolnay mit Verweis auf das inzwischen veränderte Weltbild »des deutschen Lesepublikums und besonders der deutschen Frau« abgelehnt (Rabinowich 2017, 43) – gingen auch Anstrengungen einher, Möglichkeiten einer Re-Migration, einer Rückkehr zu sondieren. Diese waren verbunden mit ersten Besuchen Österreichs, insbesondere von Graz, wo sie in den 1930er Jahren wohnhaft war, scheiterten allerdings rasch und nachhaltig aufgrund eines geradezu ostentativ zur Schau gestellten Antisemitismus überlebenden Exilant:innen gegenüber, wie auch angesichts einer heute unverständlich dünkelhaften Haltung von Verlagen und Literaturbetriebskennern wie z.B. (in Österreich) Oskar Maurus Fontana und Ernst Schönwiese. Zwar positionierten sich die Genannten in den ersten Nachkriegsjahren nicht nur demokratisch und (nach außen hin) antifaschistisch, sie schielten jedoch de facto ebenso auf ihr – trauerunfähiges – Lesepublikum und wiesen radikale Texte zur Schuldverstrickung mit Bedauern zurück. Gerade in dieser Hinsicht wäre Hartwigs Roman »bahnbrechend gewesen« (Löchel 2018), etwa mit Brechts Furcht und Elend des Dritten Reichs vergleichbar und zudem in der Zeichnung der ekstatischen Verzückung verführbarer Massen in einzelnen Szenen ein Vorgriff auf Canettis Masse und Macht (Hillgruber 2018). Obwohl er sich später (vergebens und mehrmals für sie einsetzte, sind offenbar die Kontakte zu Schönwiese zwischen Oktober 1947 und Ende April 1948 ebenso ergeb-
Primus-Heinz Kucher: Mela Hartwigs postexilischer Roman Inferno
nislos geblieben (vgl. Hartwig 1947) wie jene zu Fontana, der in den 1920er Jahren als einer der maßgeblichen österreichischen Literaturkritiker galt und als Mitarbeiter des Tage-Buch seit 1924 auch in die Berliner Literaturszene hineinwirkte (vgl. Kucher 2011, 41f.; Kucher 2016). Fast im Sinn eines letzten Versuchs hat Hartwig mit Fontana im Jahr 1951 Kontakt aufgenommen. In einem Brief, datiert mit 15.10.1951, dankt sie ihm ausdrücklich für seine vorangegangene Antwort, in der sie, obwohl jene abschlägig gewesen sei, »doch zwischen den Zeilen ganz leise ein Vielleicht mitzuschwingen« hörte, um nochmals nachzustoßen, ja bittend-förmlich nachzufragen, ob er, Fontana, nicht doch bereit wäre, »den Roman in Ihre Buchgemeinschaft aufzunehmen« (Hartwig 1951). Denn für sie stehe viel auf dem Spiel und er möge doch bedenken, »wie sehr ich mich darnach sehne, als Oesterreicherin in Oesterreich wieder eine kuenstlerische Heimat zu finden«, wobei sie abschließend darauf verwies, in einer der letzten Nummern der Zeitschrift silberboot (1946–1952), deren Herausgeber der zuvor erwähnte Schönwiese war, einen Essay über Virginia Woolf veröffentlicht zu haben, mit der sie im Londoner Exil befreundet war und deren Roman Between the acts sie übersetzt hatte (vgl. Danielczyk 2017, 19–22; Hartwig 1951; Schönwiese 1967, 407).
2. Der Roman selbst besteht aus drei ›Büchern‹, denen eine Exposition, »Straßen« übertitelt, vorangestellt ist. Als Zäsuren, welche diese Abschnitte voneinander teilen, werden klare zeitliche, historisch verbürgte Ereignisse angeführt: Buch eins erstreckt sich vom Anschluss Österreichs im März 1938 bis zum Novemberpogrom 1938, Buch zwei endet mit der Kriegserklärung, d.h. mit September 1939, während Buch drei die längste Streckung aufweist, nämlich bis zum Kriegsende im Mai 1945. Die auf den ersten Blick an äußeren Daten angelehnte Gliederung ist jedoch nicht diesen allein verpflichtet, d.h. versteht sich nicht primär als temporale Ordnungs- und Perspektivenkategorie. Sie wird vielmehr mit je auf die Wahrnehmung der sich abzeichnenden Veränderungen und der damit verknüpften Dynamik von Ereignissen im Sinn einer zunächst latenten, beobachtbaren, dann zunehmend eruptiven, enigmatischen und brutaler werdenden Gewalt parallelisiert, die sich dem Versuch der Protagonistin, dafür rationale Parameter zu finden, bis etwa ans Ende des ersten Buches weitgehend entzieht und zu existenziell grenzwertigen psychophysischen Krisen und Reaktionen führt. Dabei dient der prologartige Blick auf die Straßen, das ziellose Schlendern durch sie – so das Eingangsbild – dazu, einerseits der Rätsel und Vorgänge, die sich »hinter den Mauern abspielten« (Hartwig 2017, 5), sowie einer sich offenbar aufstauenden Melange aus Absperrung und Ausbruchswillen, einer beunruhigenden Brutstätte von Fäulnis und »grauenhafter Zufriedenheit« (Hartwig 2017, 6) gewahr und, so möglich, sich bewusst zu
225
226
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
werden. Andererseits versucht Hartwig, die »verwahrlosten Zinskasernen«, ihre rissigen Fassaden, die »keine Heimstätten sind, sondern nur Obdach, Asyle, in denen das Elend haust, Hunger und Haß, wie zum Sprung geduckt« (Hartwig 2017, 7), aber auch die »schimmernden Schaufenster« und Konsumtempel der breiter werdenden Geschäftsstraßen (Hartwig 2017, 10) der Stadt, die ungenannt bleibt, aber als Wien erkennbar wird, als grundlegende atmosphärische Gemengelage für die nachfolgende Konfliktentfaltung gleichsam filmisch zu skizzieren. Dabei erscheint die Richtung zunächst noch offen, offen zum einen für einen gleichsam in apokalyptische Bilder getauchten möglichen revolutionären Aufbruch der Zinshausmassen, deren »ausgemergelte Hände sich zur Faust ballen werden […] in das Morgen hinein« (Hartwig 2017, 8), zum anderen für einen »bestrickenden Zauber« (Hartwig 2017, 11) und einer Überflutung durch kaum entzifferbare Licht- und Schattenbilder (Hartwig 2017, 14f.). Letztere lassen Ursula sowohl in Träumereien abgleiten als auch in Momente tiefer Verunsicherung und Fremdheit. Jedenfalls skizziert dieser Prolog eine zunächst nicht näher sich ausweisende Perspektive in eine von dumpfem Brodeln hinter rissigen Fassaden und Mauern ebenso geprägte herandrängende Zeit wie eine von lichtdurchfluteter Gleichgültigkeit und Fratzenhaftigkeit entrückte Gegenwart: schwärende Wunde und magische Geschäftigkeit in einem und scharf voneinander geschieden, aufgerauscht »zu einer betäubenden Symphonie des täglichen Lebens« (Hartwig 2017, 16), so ihr Ausklang, der zugleich das dichte sprach-bildliche und analytisch-reflexive Potenzial der Autorin kenntlich macht und auf ein hochkomplexes Textensemble einstimmt.
3. Das erste Buch setzt mit einer Art Familienaufstellung vor dem Hintergrund der ersten Zäsur, d.h. dem Tag des Anschlusses Österreichs an Nazideutschland, ein. Ursula kommt von einem Gespräch an der Akademie, wo sie ihre Zeichnungen vorgelegt hat, um einen Freiplatz zu erhalten, nach Hause; ihr Bruder, bereits in neuer Uniform mit Parteiabzeichen, fällt ihr heftig ins Wort und konfrontiert sie mit dem sie irritierenden Vorwurf, er hoffe darauf, sich seiner Schwester nicht schämen zu müssen. Ihr hilfesuchender Blick bleibt unerwidert, denn ihre Eltern »saßen reglos und wie versteint und starrten völlig verstört auf ihre Teller nieder« (Hartwig 2017, 19). Hartwig zeichnet hier das Bild einer zerrissenen Familie, in der der ältere Bruder als überzeugter NS-Parteigänger den Rest der Familie brutal unter Druck setzt, insbesondere seinen Vater, dem er jede Autorität abspricht, eine typologisch bekannte, nun unter präzise ideologische Prämissen gesetzte Vatermord-Variante und zugleich eine Familienaufstellung, wie sie, insbesondere in Österreich rund um den Anschluss, als soziologisch-familiales Dispositiv eine nicht unbeträchtliche Verbreitung hatte. Während die Mutter zunehmend verstummt, vermag der Vater,
Primus-Heinz Kucher: Mela Hartwigs postexilischer Roman Inferno
der bald darauf von seinem Sohn tätlich angegriffen und mit Todesdrohungen gedemütigt wird – »Du dachtest, daß ich vergessen habe, daß es für deinesgleichen Konzentrationslager gibt?« (Hartwig 2017, 38) –, auch nur mehr in geschützten Augenblicken, d.h. in Absenz des Sohnes, eine Warnung auszusprechen und die Lage zu bewerten, wie sie sich ihm, der den »Staatstreich nicht billigte« (Hartwig 2017, 22), darstellte und welche sich fortan bleiern über das Zusammenleben legen wird. Der Mutter, die aufatmend bemerkt, der Sohn sei nun fortgegangen, antwortet er: ›Täusche dich nur nicht‹ entgegnete der Vater bitter. ›In Zukunft werden alle Wände Ohren haben und hinter jeder Tür wird einer horchen. Dein Sohn aber hat es nicht nötig, hinter Türen zu horchen. Er tritt unhörbar ins Zimmer, wenn du ihn am wenigsten erwartest. Er sitzt mit dir am Tisch. Er liest in deinem Gesicht. Du bist ihm auf Gnade und Ungnade ausgeliefert. (Hartwig 2017, 20f.) Hier wird nicht nur die Omnipräsenz des Denunzianten in Gestalt des eigenen Sohnes angesprochen und als neue Wirklichkeit eingeführt, mit der von einem Moment auf den anderen zu rechnen ist, sondern auch das Gefühl eines hilf- und ratlosen Ausgeliefert-Seins an eine Macht bzw. ein Regime, welches keine Hemmschwellen kennt und auf rücksichtslose Indoktrination und Gefolgschaft setzt. Ursula graut zwar davor »sich immer tiefer in das Ja verstricken zu müssen« (Hartwig 2017, 25), hinter das sie sich in ihrer Angst in »der Maske mädchenhafter Schüchternheit« (Hartwig 2017, 27) verschanzt; sie versucht diese Haltung maskierten Mitläufertums, das auch die Annahme des Parteibuchs inkludiert, damit zu rechtfertigen, dass offener Widerstand aussichtslos wäre, und meint, ihr künstlerisches Gewissen, ihren Anspruch auf den von ihr gewählten Weg auf diese Weise retten und zugleich die von ihr innerlich verabscheute Bewegung dabei besser beobachten zu können. Sie findet sich rascher als erwartet in dem kategorialen Zwiespalt, den bereits im September 1933 Ernst Fischer in seinem programmatischen Aufsatz Den Kompaß über Bord? (Fischer [1933] 1984) beschrieben und Hermynia Zur Mühlen in ihrem Roman Unsere Töchter, die Nazinen ansatzweise zu fassen versucht hatte, als sie ihre Protagonistin ins Tagebuch schreiben lässt, sie sehe sich angesichts der rohen Gewalt und der einsetzenden Vertreibungen »in einem Abgrund versinken, immer tiefer und tiefer, bis wir kein Stück blauen Himmels […] mehr sehen konnten« (Zur Mühlen [1936] 2000, 57). Ursulas Gratwanderung zwischen Kompromissbereitschaft, erwarteter Gefolgschaft und innerem Widerstand entfaltet sich zunächst nicht ohne Widersprüche. Hartwig zeichnet nämlich eine junge Frau, die, anfangs völlig auf sich gestellt, hin und hergerissen wird zwischen dem Abscheu vor den aufgepeitschten, gewaltbereiten Massen, die »mit speichelnden Lefzen und Schaum vor dem Mund sprungbereit nur darauf warteten, losgelassen zu werden« (Hartwig 2017, 28), und einer romantischen Solidarisierung mit dem Widerstand infolge einer Begegnung, aus der sich eine Liebesgeschichte entwickelt, die zugleich ihre nicht nur vom Bruder abgeforderte, sondern auch vom neuen Leiter der Kunstaka-
227
228
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
demie erwartete Gefolgschaftsbereitschaft, ja ein Aufgehen in dem neuen Regime, was es zumindest vorzutäuschen gilt, als exponierten Hochseilakt erscheinen lässt und Ursula wiederholt an die Grenzen der psychischen Belastbarkeit, aber auch der Glaubwürdigkeit heranführt. Dementsprechend wählt Hartwig eine sprachliche Signatur, die diesem permanenten Widerspruch – bereit zu sein für die nationalsozialistische Sache und Unterwanderung derselben in Form gezielter Nadelstiche für den (historisch bis Ende 1939 belegten) Widerstand – eine mitunter exaltierte, fiebrige Note verleiht und streckenweise an Erzählungen aus dem Ekstasen-Band (Hartwig [1928] 2004) anknüpft. Wie riskant diese Haltung war, ist ihr zunächst nicht bewusst, sondern muss ihr vom neuen Gefährten erklärt werden, als sich ein Mitstudent der Kunstklasse nach einer vorangegangenen Abführung eines Kollegen unmittelbar nach dem Aufrufen seines eigenen Namens am Gang erschießt, um nicht unter Einwirkung der zu erwartenden schweren Folter Namen preiszugeben, darunter auch den des bald als Geliebten firmierenden Gefährten Ursulas (Hartwig 2017, 48, 51). In der nachfolgenden, in klandestine Räume verlegten Anbahnung der Liebesbeziehung zum namenlos bleibenden Gefährten/Geliebten, zugleich eine zentrale Gestalt in einem Kreis junger Widerständler, erlebt Ursula am Beispiel von z.T. überraschenden Beobachtungen von Denunziationen oder von Fluchterfahrungen in gemischten Beziehungen, was es bedeuten kann, eine:n jüdische:n Partner:in zu haben, und muss sich überhaupt erst von eigenen, offenbar tiefer verwurzelten »Abneigungen gegen diese Menschen […], die sich Juden nennen« (Hartwig 2017, 61), befreien. Dieser Prozess wird maßgeblich durch die Schockerfahrung der in den brennenden Tempel gestoßenen schwangeren jüdischen Frau, der das erste Buch beschließt, vorangetrieben, aber noch keineswegs zum Abschluss gebracht. Die Ohnmacht, in die sie nach dieser grauenhaften Szene fällt, fängt zugleich an, eine kathartische Wirkung auszulösen; sie glaubt nach dem Aufwachen seit »dieser einen Nacht, die sie wie ein Abgrund von ihrem bisherigen Leben trennte, Jahre durchlebt zu haben und […] ein völlig veränderter Mensch zu sein« (Hartwig 2017, 83). Der Weg ist freilich noch lang und steinig und wird, wie sich zeigen sollte, von einigen Umwegen durchkreuzt. In der Akademie muss sie z.B. die Beobachtung machen, wie rasch Ansprachen der neuen Fanatiker, die im ersten Moment bei den zuhörenden Kolleg:innen noch Abscheu oder Empörung hervorzurufen scheinen, sich »in jubelnde Zustimmung zu verwandeln« vermögen (Hartwig 2017, 89). Daraus leitet sie die Einsicht ab, »daß Worten, die sich an eine Masse richten, eine unheimliche Gewalt innewohnt, weil das Wort […] zum Funken wird, der von einem auf alle andern überspringt« und tendenziell »den Willen jedes Einzelnen, der ihnen willfährigen Herzens lauscht, in den Massenwillen hineinschmelzen« (Hartwig 2017, 89). Ursula tritt nun in einen Reflexionsprozess über ihr eigenes Verhalten ein, hält »Gericht über sich selbst«, d.h. sie legt sich die Frage nach der eigenen Schuldverstrickung vor und findet auf diese, emotional bewegt von der Erfahrung des bren-
Primus-Heinz Kucher: Mela Hartwigs postexilischer Roman Inferno
nenden Tempels, eine bestätigende und sie gleichzeitig exponierende Antwort dem eigenen ›Du‹ gegenüber: Du hast dich nicht nur zur Mitschuldigen gemacht, an jedem Verbrechen, das andere begangen haben, denn ein Verbrechen, das wir geschehen lassen, begehen wir selbst, Du hast dich nicht nur mit dem Blut besudelt, das andere vergossen haben, denn Du hast nicht nur geschehen lassen, was geschah, Du hast es gutgeheißen. Um nach einer Tirade gegen sich selbst zu schließen: »Du aber bist in die Masse der Unmündigen hineingeschmolzen […]« und: »Du hast Dein Leben verwirkt, tausendfach hast Du es verwirkt.« (Hartwig 2017, 90f.) Gegen diese bedrückende Erkenntnis und gegen das Gefühl, überwacht zu werden, meint sie, ein heroisches Zeichen, auch im Sinn einer Distanz zur inneren Anfälligkeit, setzen zu müssen. Ohne entsprechende Vorabsprachen mit ihrem Gefährten deklariert sie sich am darauffolgenden Tag ihrem Bruder gegenüber, und zwar in der – vagen – Hoffnung, dass die Worte, die sie ausspricht, »anders wahr sein können« (Hartwig 2017, 95), d.h. eine Verstellung und Lüge als Wahrheit zu transportieren imstande wären: Ihre bisherige Einstellung, auch ihr Studium wolle sie aufzugeben, »um sich einer wichtigeren Aufgabe widmen zu können« (Hartwig 2017, 96), nämlich der ›neuen Idee‹ zu dienen und dabei gern eine Stelle in der Partei zu übernehmen – »als Deckmantel für ihre illegale Tätigkeit« (Hartwig 2017, 97), wie sich Ursula diesen kühnen und zugleich ein wenig naiv wirkenden Vorstoß austräumt. Dass diese Bitte ihren Bruder zunächst überrascht, aber auch erfreut, ist ebenso nachvollziehbar wie sein nicht weniger naives Bemühen, ihr nachzukommen. Ein Treffen mit dem zuständigen NS-Funktionär in einem Restaurant gerät allerdings zum Fiasko, nachdem sie – öffentlich hörbar – eine Beleidigung hinnehmen muss und – unhörbar – zugleich ihr Bruder ostentativ abgekanzelt wird, weshalb, von eisiger Stille begleitet und um eine nachdrückliche Wahrnehmung von Machtverhältnissen bereichert, beide daraufhin den Saal auch wieder verlassen (müssen). Nichtsdestotrotz wird sie zu einem Anstellungsgespräch bestellt, zugleich eine Ausnahmesituation, in der Ursulas Belastbarkeit auf eine Probe gestellt wird, die sie, erwartungsgemäß, nicht bestehen kann – eine Probe, die aus Drohungen ihren Vater betreffend besteht sowie aus einer sie demütigenden sexualisierten Machtgeste, deren Schockwirkung sie das Bewusstsein verlieren lässt: …näherte er sein Gesicht, das sich zu einer lüsternen, einer geilen Fratze verzerrt hatte, ihrem entsetzten Gesicht, bis sein Mund fast den ihren berührte, fast, und sein Atem sich mit ihrem vermischte, während sich seine gierigen Augen an ihren vor Angst und Entsetzen verzerrten Zügen weideten und er keuchend zu sprechen begann: ›Wie soll dein Vater sterben, mein Püppchen, wie? […]‹
229
230
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
Er sprach weiter, aber Ursula hörte seine Worte nicht mehr, sie dröhnten ihr nur noch in den Ohren, ein barmherziger Abgrund öffnete sich unter ihren Füßen und gütige Dunkelheiten schlugen über ihr zusammen. (Hartwig 2017, 108) Dieser Zusammenbruch, sichtbares Zeichen, den Herausforderungen (noch) nicht gewachsen zu sein, eröffnet ihr im Zuge der nachfolgenden Phase einen weiteren (Flucht)Raum, in dem Reflexionen über das Vorgefallene, aber auch die Hingabe an Kräfte, die in ihr gleichsam autonom, in Form von Stimmen und hereinflutenden Bildern, wirksam werden, zusammenfließen, um sie kritisch bilanzieren zu lassen, »daß sie sich Tag um Tag weiter von der Wirklichkeit entfernt hatte, der sie sich zu nähern beabsichtigt hatte« oder »daß sie sich in eine Schattenwelt der Verzückungen eingesponnen hatte« (Hartwig 2017, 114). Jedenfalls handelt es sich um Bilder, die sie meist noch nicht entziffern kann, die aber auf eine Entscheidung drängen. Ein Brief des Gefährten/Geliebten mit chiffrierten Botschaften »in einer Art Geheimschrift« (Hartwig 2017, 115) sowie ein nachfolgendes Treffen mit ihm leiten eine Wende ein, d.h. fangen an, ihre von Traumbildern überschatteten Augen für die Wirklichkeit zu öffnen. Ursula, die sich euphorisch-naiv, mit »überschwänglichen Worten« bereit fühlt, Opfer zu bringen, muss dabei allerdings zur Kenntnis nehmen, dass ihre Opfer- und Hingabebereitschaft nicht mit den Erfordernissen der Widerstandsarbeit konvergieren, ja sie gefährden können. Denn nicht um eine große Geste oder Tat gehe es, vielmehr, so ihr Geliebter, komme es auf »winzige Opfer« an, denn: »was wir brauchen, Ursula«, fuhr er beschwörend fort, »sind geduldige, nüchterne Hände, die Pässe und Ausweispapiere fälschen können, die unsere Druckerpressen in Bewegung setzen, Flugblätter verteilen und in dunklen Nächten Plakate anschlagen, barmherzige demütige Hände, die Liebesdienste niedrigster Art verrichten, für die Sterbenden und hilflosen Krüppel, die sich in unseren Schlupfwinkeln verkriechen, wenn die Gefängnisse, die Konzentrationslager sie ausspeien.« (Hartwig 2017, 120f.) Ein ABC der alltäglichen Widerstandsarbeit, wie es klarer kaum formuliert werden kann, wird Ursula vorgelegt und dabei auch eine klare Grenze gezogen, nämlich ihr die Bereitschaft abverlangt, sich damit zu begnügen, »zu tun, was not tut«. Denn: »Wir verlangen, daß Du Deinen Willen und Deinen Ehrgeiz ablegst und zum Werkzeug wirst, das wir brauchen« (Hartwig 2017, 121). Zur selben Zeit ist sie einer Observierung durch Parteigenossen ausgesetzt, die sie ebenfalls auf ihre Verwendbarkeit für den angestrebten Posten überprüfen und erstaunlicherweise für geeignet befinden, womit sie am Ende des zweiten Buches sich zwischen die zwei konträrsten Pole, den Widerstand und die NS-Partei, gestellt sieht: »Von diesem Tag an schien ihr Leben sich zu spalten, zerbrach in zwei Teile, von denen jeder ein ganzes, ein bis an den Rand erfülltes Leben war, das eine das andere verleugnete« (Hartwig 2017,
Primus-Heinz Kucher: Mela Hartwigs postexilischer Roman Inferno
125f.). Es versteht sich fast von selbst, dass Ursula diesem Druck auf die Dauer nicht standhalten kann, sich vor Übermüdung in Halluzinationen verstrickt und an ihrer Doppelrolle beinahe zerbricht – beinahe, denn im Zuge einer abendlichen Perlustrierung – sie war mit Flugblättern unterwegs angehalten worden – kommt ihr eine ebenfalls für beide Seiten tätige Frau helfend entgegen, sodass die belastenden Beweismittel im letzten Moment beiseitegeschafft werden können (Hartwig 2017, 129). Hartwig zeichnet an diesem Beispiel nicht nur die Mühen und Herausforderungen nach, welche eine opferbereite Haltung im Widerstand bei gleichzeitig vorgetäuschter Kollaborationsbereitschaft mit den Nazis abfordert, und dies so, als wäre sie selbst in einer vergleichbaren Situation und permanenten Entscheidungsabwägung über jeden auch noch so alltäglichen Schritt gestanden. Manche der Reflexionen mögen im Rückblick und im Wissen um die realen sowie um kaum mögliche Bewegungsräume zu ausladend, in eine mitunter exaltiert wirkende Bildsprache gepresst wirken. Wichtiger jedoch als die Frage, ob Ursulas Verhalten einer strengen Plausibilitätsprüfung standhalten kann, ob die Komplexität ihrer Überlegungen einer jungen, wenig lebenserfahrenen Frau angemessen sind, ist der Umstand, dass hier eine Autorin aus dem Exil heraus unmittelbar nach 1945 sowohl den intellektuell-habituellen Spielraum widerständigen Handelns auszuloten begann und diesen mit den Dynamiken und Unwägbarkeiten der alltäglichen Denunziations- und Kollaborationsbereitschaft sowie der Bereitschaft der Verführbarkeit breiter sozialer Schichten konfrontiert und verrechnet, ohne sich dabei auf einschlägige Studien über Funktionsmechanismen eines totalitären (Überwachungs)Systems stützen zu können. Zugleich nutzt sie die Unsicherheiten und Schwächen ihrer Protagonistin dazu, über das Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit nachzudenken, das angesichts der Brutalität des Systems die vertrauten Rollen- und Selbstzuschreibungen aus den Angeln hebt. Am Ende des zweiten Buches treffen diese auseinanderklaffenden Positionen nochmals scharf aufeinander: einerseits in Gestalt der vorsorglich geplanten Selbstverstümmelung des Geliebten, um nicht eingezogen zu werden und dem Widerstand nicht verloren zu gehen (Hartwig 2017, 139), und andererseits in jener des »fiebrig« erregten Bruders, der angesichts des Kriegsausbruches endlich seinen Traum vom Aufgehen in den Massen – »Wir marschieren und diesmal bin ich dabei…« (Hartwig 2017, 144) – sich vollenden sieht.
4. Das dritte Buch führt die aufgeheizte Stimmung – »betäubt vom Getöse, das sie umgab…« (Hartwig 2017, 147) und »Gehirne[] mit mystischer Trunkenheit erfüllt« (Hartwig 2017, 150) – nochmals eng, als sich, einem Crescendo gleich, die Ereignisse überschlagen. Indem fast gleichzeitig die Nachricht vom Tod des Bruders eintrifft und jene eines Sabotageaktes in genau der Munitionsfabrik, in der Ursulas
231
232
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
Geliebter arbeitet, was in der Folge zu dessen Deportation führt, verschwimmen, in Dämmerbilder getaucht, bei ihr neuerlich die Grenzen zwischen Realität und halluzinatorischen Zuständen, in denen sie durch Straßen irrend und stolpernd meint, ihn allgegenwärtig vor Augen zu haben, um schließlich an einer Hausmauer zusammenzubrechen. Im Krankenbett überblendet sich ihr realer Schmerz mit Anfällen, die sich u.a. darin ausdrücken, dass sie »verrenkten Gliedern einer Gefolterten« (Hartwig 2017, 165) ähneln, begleitet von nur für sie hörbaren Schmerzensschreien, die sie beständig daran erinnern, wie flüchtig und dennoch unauslöschlich die entscheidenden Begegnungen sein und welche Verpflichtungen sich aus ihnen ergeben können: etwa zu tun, »was not tut«, d.h. was den eigenen Möglichkeiten entspricht und der größeren Sache dient. In dieser Hinsicht unterscheiden sich die psychophysischen Krisen, die Kontrollverluste und Zusammenbrüche der Protagonistin, die »trägen Stunden tränenloser Trauer« (Hartwig 2017, 173), substanziell von den Hysterie-Szenen – auch im subversiven Sinn – in Hartwigs Vorkriegsproduktion: Sie bilden ein wesentliches Bindeglied zwischen dem emotional bestimmten Handeln und der sukzessiven politischen Bewusstwerdung dieser jungen Frau, die, mehrmals am Abgrund balancierend und der Gewalt mit offenen Augen ins Gesicht blickend, »als eine vom Schmerz Gezeichnete« ins (Weiter)Leben zurückfinden kann (Hartwig 2017, 175). In ihrem Fall trägt auch die Besinnung auf die Fertigkeiten als Malerin hierzu bei, die von anfangs düster-melancholischen Stimmungsskizzen im Zuge ihrer Wandlung zur überzeugten Widerständlerin zum Anfertigen von Aufsehen erregenden Plakaten führt, um nun visionär die zunehmende materielle Not mit der fortbestehenden Blindheit der Massen und der Notwendigkeit eines finalen Strafgerichts (Hartwig 2017, 179) verknüpfen zu können. Verschwinden diese Plakate aufgrund penibler Überwachung zwar alsbald, so tragen sie doch den Keim für die spätere Rückkehr zur Kunst in Gestalt eines Plans zum großen Gemälde in sich, mit dem sie »dem Grauen der letzten Jahre ein Denkmal setzen und das sie INFERNO nennen wollte« (Hartwig 2017, 189). Und sie geben ihr Halt, in imaginäre Gespräche mit dem Geliebten, die sich erkennbar mit der Stimme ihres Gewissens vermengen, einzutreten, poetologische Reflexionen anzustellen. Implizit wird dabei auch das Nachkriegstabu schlechthin, die Stunde-Null-Mentalität angesprochen und durch die tiefer gehende Nachfrage nach der Schuldverstrickung und der Unfähigkeit zu aufrichtiger Trauerarbeit, die sich am Ende als eine allumfassende abzeichnet, in Frage gestellt, wenn jene Stimme ihr zuflüstert, dies doch zu begreifen, »daß keiner schuldlos ist, nicht ein Einziger, auch Du nicht«, weil viele, sie eingeschlossen, letzten Endes »aus Feigheit geschehen ließen, was geschehen ist« (Hartwig 2017, 183). Ein Roman, der Ende der 1940er Jahre wahrscheinlich – denkt man bloß an die Reaktionen auf Robert Neumanns Die Kinder von Wien/The Children of Vienna (1948) – auf Ablehnung beim Lesepublikum gestoßen wäre, ein Roman zugleich, der die Schärfe des Blicks aus dem Exil heraus anzeigt, auch eine melancholische Verbitterung über dessen Vergeblichkeit, und somit das Potenzial einer Autorin wie Mela Hartwig do-
Primus-Heinz Kucher: Mela Hartwigs postexilischer Roman Inferno
kumentiert, das zudem Einsichten und Anregungen zu einer Re-Definierung des Verhältnisses von Exil und Nach/Post-Exil zu liefern imstande ist (vgl. Bannasch/ Sarkowsky 2020; Goldschmidt 2020).
Literatur Bannasch, Bettina/Sarkowsky, Katja. »Nachexil und Post-Exile: Eine Einleitung«. In: Exilforschung 38 (2020) = Nachexil/Post-Exile. Hg. v. dens., 1–11. Boxberger, Vivien. »Emanzipation der ›Neuen Tochter‹ in Mela Hartwigs Das Verbrechen (1927)«. In: Verdrängte Moderne – vergessene Avantgarde. Diskurskonstellationen zwischen Literatur, Theater, Kunst und Musik in Österreich 1918–1938. Hg. v. PrimusHeinz Kucher. Göttingen 2016, 237–250. Danielczyk, Julia. »Vorwort«. In: Julya Rabinowich. In Zerbrochenen Spiegeln. Wien 2017, 5–22. Fischer, Ernst. »Den Kompaß über Bord?« [1933]. In: Ders. Kultur Literatur Politik. Frühe Schriften. Hg. u. mit einem Nachw. v. Karl Markus Gauß unter Mitarb. v. Ludwig Hartinger. Frankfurt a.M. 1984, 61–67. f.[riedrich] l.[orenz]. »Konnersreuth in der Literatur. Das Novellenbuch einer österreichischen Dichterin«. In: Neues Wiener Journal (25.02.1928), 7–8. https://a nno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nwj&datum=19280225&query=%22Mela +Hartwig%22&ref=anno-search&seite=7 (25.08.2022). Goldschmidt, Georges-Arthur. Vom Nachexil. Göttingen 2020. Hartwig, Mela. Inferno. Mit einem Nachw. v. Vojin Saša Vukadinović. Graz/Wien 2017. Hartwig, Mela. Das Verbrechen. Novellen und Erzählungen. Mit einem Vorw. v. Margit Schreiner. Graz/Wien 2004 [unter dem Titel Ekstasen 1928]. Hartwig, Mela. [Brief an O. M. Fontana, 15.10.1951]. In: Nachlass Oskar Maurus Fontana. Wien Bibliothek, Sign. ZPH 1475, Box: 4. Hartwig, Mela. [Brief an Ernst Schönwiese, 29.10.1947]. In: Nachlass Mela Hartwig. Wien Bibliothek, Sign. ZPH 905, Sign. H.I.N. 231766. Hillgruber, Katrin. »Der Tempel brennt«. In: VOLLTEXT Nr. 3 (2018), 54–56. ht tps://volltext.net/texte/mela-hartwig-katrin-hillgruber-der-tempel-brennt/ (26.08.2022). Kucher, Primus-Heinz. »Oskar Maurus Fontana«. In: Ders. Transdisziplinäre Konstellationen in der österreichischen Literatur, Kunst und Kultur der Zwischenkriegszeit. Klagenfurt 2016. https://litkult1920er.aau.at/portraets/fontana-oskar-maurus/ (26.08.2022). Kucher, Primus-Heinz. »Zur Vielfalt und Spezifik Erster Briefe des österreichischen Exils. Kontaktaufnahmen von Exilanten (Angel, Bernfeld, Engel, Kramer, Polak, Zur Mühlen) zu literarischen Netzwerkern und Freunden (Basil, Dubrovic, Fon-
233
234
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
tana, Matejka)«. In: Erste Briefe/First Letters aus dem Exil 1945–1950. (Un)mögliche Gespräche. Fallbeispiele des literarischen und künstlerischen Exils. Hg. v. Primus-Heinz Kucher/Johannes F. Evelein/Helga Schreckenberger. München 2011, 32–62. Löchel, Rolf. »Literarische Individual- und Massenpsychologie. Über Mela Hartwigs bedeutenden antifaschistischen Roman Inferno«. In: Literaturkritik.de (2018). htt ps://literaturkritik.de/hartwig-inferno-literarische-individual-massenpsychol ogie-ueber-mela-hartwigs-bedeutenden-antifaschistischen-roman-inferno,2 4976.html (22.8.2022). Polt-Heinzl, Evelyne. »Mela Hartwigs Fallgeschichten. Korrekturen zum Thema Hysterie«. In: Literatur und Kultur im Österreich der Zwanziger Jahre. Vorschläge zu einem interdisziplinären Epochenprofil. Hg. v. Primus-Heinz Kucher. Bielefeld 2007, 211–226. Rabinowich, Julya. Mela Hartwig. In Zerbrochenen Spiegeln. Wien 2017. Rhil, Wilhelm. »Mela Hartwig. Das Weib ist ein Nichts«. In: Wiener Allgemeine Zeitung (07.09.1929) 5–6. https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=waz&d atum=19290709&seite=6&zoom=33&query=%22Weib%2Bist%2Bein%2BNichts %22&ref=anno-search (28.03.2023). Schönwiese, Ernst. »Mela Hartwig«. In: Literatur und Kritik 2 (1967), 406–409. Zur Mühlen, Hermynia. Unsere Töchter, die Nazinen. Hg. v. Jörg Thunecke. Wien 2000.
Die Moderne als Opfer. Andersch und Fühmann blicken auf Barlach Nike Thurn
Angesichts der Diskussion um den bislang weitgehend unhinterfragten Gründungsmythos, mit der Weltkunstausstellung documenta sei der Bundesrepublik 1955 ein ästhetisch-politischer Neuanfang gelungen, arbeitete die Kunsthistorikerin Julia Friedrich heraus, dass es kaum zufällig eine sehr selektive Moderne war, die dort gezeigt wurde: Es waren Werke, die es ermöglichten, sich einerseits als Gegenentwurf zu der Entartete Kunst-Ausstellung zu verstehen und von den geschehenen Verbrechen abzugrenzen, andererseits jedoch nicht zu sehr an ihnen zu rühren (vgl. Friedrich 2021). Die »geschichtspolitische Funktion und Wirkung« dessen fasste sie mit der Formel »Kunst als Kitt« zusammen (Friedrich 2021, 62). In diesem Zusammenhang fallen auch zwei literarische Texte dieser Zeit noch einmal neu ins Auge, in denen die Moderne in Form einer Skulptur von Ernst Barlach eine zentrale, ›kittende‹ Rolle spielt. Als Künstler verkörpert Barlach just jenen Typus, der Friedrich zufolge dem spiritus rector der documenta, Werner Haftmann, half, das Bild eines anderen Deutschland zu proklamieren. Barlach passte zu dieser Form der Kaschierung, einer allzu glatt inszenierten Überwindung der Vergangenheit, die dem Wunsch der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft nach Wiedereinbettung in die europäische Zivilisation entsprach, indem sie eine universalistisch gefasste Kontinuität abendländischen Fortschritts mithilfe moderner Kunst gewissermaßen vor Augen führte und so den Bruch zukittete, der angesichts der Folgen von deutscher Vernichtungspolitik und Krieg doch hätte klaffen müssen (Friedrich 2001, 61f.). Dass Haftmann indes Barlach und andere »bereits 20 Jahre zuvor der NS-Führung als Vertreter einer ›deutschen Sendung‹ vergebens angedient« hatte (Friedrich 2001, 61), war angesichts dessen schnell vergessen.1 1
In diese Reihe gehört auch Emil Nolde, dessen Opferinszenierung Aya Soika und Bernhard Fulda in der Ausstellung »Emil Nolde. Eine deutsche Legende« im Hamburger Bahnhof entkräfteten (vgl. Fulda/Ring/Soika 2019). Zuvor hatte auch er als verfolgter Künstler gegolten,
236
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
Im Folgenden geht es mir indes nicht um eine kunsthistorische Bewertung Barlachs und seines Werks oder die Frage, wie uneindeutig und widersprüchlich seine Rolle im Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit ist; stattdessen interessiert mich auch hier die »geschichtspolitische Funktion und Wirkung«, die Barlachs Arbeiten in zwei fast zeitgleich entstandenen literarischen Texten erfüllen und die mir vor diesem Hintergrund bemerkenswert erscheinen. Alfred Anderschs Sansibar oder der letzte Grund wurde 1957 veröffentlicht; Anfang der 1960er Jahre folgte Franz Fühmanns Ernst Barlach: Das schlimme Jahr (Fühmann 1963) – später als Barlach in Güstrow neu veröffentlicht. Beide stehen dem eigenen Selbstverständnis nach der NS-Doktrin klar entgegen, doch auch in ihnen finden sich Residuen dessen, was man zwar aufdecken wollte, wovon man sich selbst jedoch frei wähnte. Die Gemeinsamkeiten sind auffällig: Beide Texte spielen im Jahr 1937; in beiden geht es um Barlach-Werke, die sich in einer Kirche befinden und im nationalsozialistischen Deutschland bedroht sind; und in beiden Texten wird über den Barlach-Verweis der Holocaust thematisiert. Mit dem gemeinsamen Blick auf diese beiden Autoren folge ich Stephan Braese, dessen 2001 im Mittelweg 36 erschienener Aufsatz Unmittelbar zum Krieg. Alfred Andersch und Franz Fühmann einen weiteren Ausgangspunkt der Überlegungen bildet. Bei Anderschs Sansibar oder der letzte Grund ist es die Skulptur Der lesende Klosterschüler, die im Mittelpunkt steht. Die Ausgangslage ist schnell zusammengefasst: Der Pfarrer Helander, in dessen Kirche in Rerik sich das Werk befindet, möchte es mit Hilfe des Kommunisten Gregor und des Fischers Knudsen vor der Verfolgung der Nationalsozialisten in einem Boot nach Schweden retten; zeitgleich sucht die aus Hamburg geflohene Jüdin Judith nach einer Fluchtmöglichkeit von Rerik über das Meer. Was Braese für Anderschs Kirschen der Freiheit feststellte, gilt auch für diesen Text: Aller erkennbar gewollten Opposition zum Trotz, steckt er voller »Einschlüsse, die auf […] problematische Weise auf eine Unmittelbarkeit zu[m] […] NS-Faschismus [weisen]« (Braese 2001, 59). Wie Braese konkret für Sansibar herausgestellt hat, gleitet Andersch das »Sprach-, Bild- und Vorstellungsmaterial […], in dem es von den Zeichen wimmelt, vor denen man die Augen schließen möchte« (Braese 2001, 62), immer wieder aus den Händen. Dies wird – wie ich im Folgenden zu zeigen versuche – gerade in dem Verhältnis der Skulptur zu der verfolgten Judith deutlich. Bei Fühmanns Barlach in Güstrow ist es die Skulptur Der Schwebende, deren Entfernung aus dem dortigen Dom durch die Nationalsozialisten als Ausgangspunkt dient. Auch hier sind die äußeren Grundzüge schnell nacherzählt: Der hier
der im Verborgenen malen und seine Arbeiten verstecken musste. Als 2020 eine neue Biographie Barlachs erschien, titelte Der Tagesspiegel entsprechend: »Kunst im Dritten Reich: Ist Ernst Barlach ein zweiter Fall Nolde?« (vgl. Schröder 2020). Der Text verneinte dies; eine ähnlich genaue Revision wie jene Noldes steht indes noch aus.
Nike Thurn: Die Moderne als Opfer. Andersch und Fühmann blicken auf Barlach
selbst als Figur auftauchende Barlach erfährt die Ablehnung seines Werks im Nationalsozialismus, will sich aufgrund der zunehmenden Verfolgung seiner Arbeit zunächst umbringen, sieht dann jedoch ein, dass er vielmehr stoisch weiterarbeiten muss (vgl. Fühmann 1966, 74). Marcel Reich-Ranicki hatte die ersten lyrischen Versuche Fühmanns – der zunächst überzeugter Nationalsozialist und SA-Mitglied war, dann nach Antifa-Schulen in der Kriegsgefangenschaft überzeugter Sozialist wurde – 1963 noch als reine ideologische Umetikettierung bezeichnet (vgl. ReichRanicki 1963b, 426). Als Fühmann 1973 an diese Kritik zurückdachte, gestand er zu: »er hatte recht; er hatte auf die richtige Stelle gezeigt; nicht auf eine schmerzende Stelle, die findet man selbst, nein, auf jene, die man heil glaubt« (Fühmann 1973, 190). Braese zufolge schloss sich an diese Anfänge jedoch eine gelungene »selbstkritisch[e] Reflexion der eigenen Geschichte« (Braese 2001, 61) an. Seiner Analyse folgend, ordne ich diese Erzählung als Kippmoment zwischen den werkhistorischen Phasen ein: Als alter ego des Autors dient die titelgebende Hauptfigur der von Braese benannten »subjektgeschichtlich[en] Selbstvergewisserung« (Braese 2001, 62) über Bande; unterhalb dieser Ebene befinden sich meines Erachtens jedoch neben umetikettierten auch unreflektierte Residuen. Ich greife pro Text zwei Beispiele heraus, an denen sich die genannten Punkte besonders deutlich zeigen, und diskutiere sie – auch hier Braeses Vorbild folgend – abwechselnd.
1. Es gibt keine Nazis in Sansibar An Anderschs Sansibar ist die Opposition zwischen den »guten Deutschen« und den Nationalsozialisten, die schematisch und abwehrend nur als die »Anderen« bezeichnet werden, früh (vgl. Baumgart 1966, 31) und seither auch viel (vgl. u.v.a. Klüger [1997] 2006, 16; Ächtler 2016, 18; Joch 2016, 218) kritisiert worden.2 Weniger beachtet scheint mir zu sein, dass zu den »guten Deutschen« hier erkennbar auch die Skulptur gehört und es in diesem Punkt eine wenngleich mutmaßlich unfreiwillige, so doch deutliche Opposition zu der Figur Judith gibt. Gleich bei der ersten Begegnung identifiziert Gregor sich mit der Skulptur und bezieht sie explizit in sein ›Wir‹ ein: »Das sind ja wir, dachte Gregor. […] Genau so sind wir in der Lenin-Akademie gesessen, und genau so haben wir gelesen, gelesen, gelesen. […] So versunken wie er. Er
2
Vgl. auch Hans-Joachim Hahn, der präzise zusammenfasste, dass so »die historische Ausnahme – dass Juden von nichtjüdischen Deutschen während des Nationalsozialismus gut behandelt wurden – zur selbstverständlichen Norm« werde (Hahn 2011, 367), und Marcel Reich-Ranicki, der hierzu festhielt: »[Andersch] bemüht sich, mit der Wirklichkeit jener Zeit […] nicht in Widerspruch zu geraten« (Reich-Ranicki 1963a, 107).
237
238
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
ist wir.« (Andersch [1957] 2004, 53, Herv. N. T.) In scharfem Kontrast dazu steht seine erste Begegnung mit Judith, bei der seine Gedanken lauten: »Eine Jüdin, dachte Gregor, das ist ja eine Jüdin.« (Andersch [1957] 2004, 72) Wird die Skulptur als ›einer von uns‹ eingeführt, wird Judith unmittelbar und explizit aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen: »Gregor konnte sehen, daß sie nicht zu den Leuten gehörte; […] sie war eine Fremde […] mit einem in Rerik ungewohnten Gesicht« (ebd.). Während er Knudsen geradezu befiehlt, mit seinem Schiff das Kunstwerk in Sicherheit zu bringen, glaubt er nicht, dies auch für Judith tun zu können: Knudsen, so glaubt Gregor, werde mit seinem Schiff wohl »kein Abenteuer für ein junges schwarzhaariges Mädchen [riskieren], das einen hellen Trenchcoat anhatte, für eine Fremde mit einem schönen, zarten, fremdartigen Rassegesicht, für eine Ausgestoßene mit wehenden Haarsträhnen über einem hellen, elegant geschnittenen Trenchcoat« (Andersch [1957] 2004, 76).3 Im direkten Vergleich erscheint ihm die Skulptur deutlich vernünftiger als der Mensch: »ruhig und aufmerksam würde er [gemeint ist der »Klosterschüler«, N. T.] sein Buch zuklappen und aufstehen, wenn man zu ihm sagen würde: komm mit, du mußt eine Seereise machen« (Andersch [1957] 2004, 68), vermutet Gregor über das Stück Holz; als er hingegen Judith genau dies sagt, stellt sie sich als außerordentlich ungelenk, geradezu als ›Klotz am Bein‹ heraus: Sie agiert gerade nicht ruhig, sondern geht »sehr schnell […], so daß er […] zu ihr sagen mußte: Langsam, immer mit der Ruhe! Er dachte: hoffentlich versaut sie mit ihrer Nervosität nicht alles!« (Andersch [1957] 2004, 122) Sein Ärger darüber hängt deutlich damit zusammen, dass dies die andere Rettung gefährdet: Er »wunderte […] sich selbst über die Geduld, die er […] aufbrachte. Was bewog ihn, hier […] kostbare Zeit zu verschwenden, […] mitten in einer Aktion, an der das Leben mehrerer Menschen hing und das Schicksal des lesenden jungen Mannes in der Kirche.« (Andersch [1957] 2004, 124) Als Judith ein Foto ihrer Mutter retten möchte, wehrt Gregor dies ab. Er ergänzt gedanklich zwar, dass »der Lesende auch nur ein Bild [sei], und vielleicht war das Bild der Mutter dieses Mädchens genau so viel wert wie das Bild eines jungen Burschen, der las« (Andersch [1957] 2004, 124f.), doch die gesamte Textkonstruktion steht dieser kurzzeitigen Überlegung entgegen. Im Grunde wird hier nur den Leserinnen und Lesern selbst die Zurückweisung dieses Vergleichs übertragen: Die Skulptur ist mehr. Er exkludiert Judith zudem deutlich, wenn er ihr Verhalten nicht als individuelle Verfehlung, sondern als kollektive Eigenheit wertet: Explizit ist es »[i]hr verwöhntes Gesicht […], ihre abwesende und fremdartige Hilflosigkeit« (Andersch [1957] 2004, 122), die ihn abstoßen. Wenn er ihre Situation mit den Worten kommentiert: »Und nun haben Sie also das erlebt, was man in Ihren Kreisen einen
3
Wie Nicolas Berg und Liliane Weissberg auf der Tagung »›Aggregate der Gegenwart.‹ Entgrenzte Literaturen und gegenläufige Erinnerungen« (RWTH Aachen, 5.–7.10.2021), auf der dieser Band basiert, hervorhoben, exkludiert diese doppelte Nennung des Trenchcoats als ›fremdem‹ und ›abgehobenem‹ Kleidungsstück die Figur abermals.
Nike Thurn: Die Moderne als Opfer. Andersch und Fühmann blicken auf Barlach
Schicksalsschlag nennt, was?« (Andersch [1957] 2004, 129), überrascht der verächtliche Ton angesichts der tatsächlich dramatischen Lage, in der Judith sich befindet: Gerade hat ihre Mutter sich umgebracht und sie ist mit nichts als einem Koffer allein auf der Flucht vor den Nationalsozialisten. Irritierend ist jedoch auch die Unterstellung, dass ausgerechnet die verfolgte Jüdin dies als »Schicksalsschlag« abtun und nicht als Folge von Faschismus und Terror erkennen sollte. Ihre merkwürdige Zeichnung kann jedoch nicht allein auf Gregor – als zwar identifikatorisch aufgebauter, aber nicht uneingeschränkt vertrauenswürdiger Figur – zurückgeführt werden; seine Urteile werden vom Text selbst gestützt. Durch sein Fluchtangebot gerade erst aus der Ausweglosigkeit gerettet, denkt Judith als erstes wehmütig »an das Kleid, die Wäsche, und die zwei Paar Schuhe […], die sich in ihrem Koffer befanden. Die hübschen Toilettensachen« (Andersch [1957] 2004, 123). Gregors immer wieder geäußerter Vorwurf, sie sei verwöhnt (Andersch [1957] 2004, 122, 128), wird durch diese innere Rede gerade nicht entkräftet, sondern bestätigt. Wenn Irene Heidelberger-Leonard festhält, dass nicht nur Nationalsozialisten in diesem Text abwesend sind, sondern auch Antisemiten (vgl. Heidelberger-Leonard 1994, 56), trifft dies nur insofern zu, als keine Figuren im Text explizit als solche gezeichnet und vorgeführt werden. Das jedoch bedeutet für die ganze Reihe antisemitischer Stereotype, die sich hier finden, dass der Text an ihnen teilhat und sie gerade nicht ausstellt.
2. Die eigenen Konzentrationslager Auch am Anfang des Fühmann’schen Textes wird die Verfolgung von Menschen und Kunstwerken auf bemerkenswerte Weise enggeführt. Barlach erwacht aus Albträumen, in denen er »von einer Schar eberköpfiger Männer, die kleine, einen schwarzen Haken erst weiß und dann rot umrandende Schildchen am linken Arm trugen«, mit dem Tod bedroht wird – allerdings mit dem »Hinrichtungswerkzeug der spanischen Inquisition. […] Goyas Garrotte war ein Bild, das ihm seit vier Jahren furchtbar vertraut war«. Als das Telefon »schrillt[]« (Fühmann 1966, 8), ist er sich sicher: »Kein Zweifel: das Todesurteil sollte zugestellt werden« (ebd.). Die Reaktion der Lebensgefährtin, die den Anruf entgegennimmt, bestätigt diese Vermutung: »blaß, […] zu Tod erschrocken, die […] Lippen, die zusammengepreßt waren, das Schrein zu verhindern […]. ›Wann?‹ fragte er tonlos und hörte wie von weit her das Schluchzen ihrer Antwort: ›Heut nacht zwischen zwölf und eins!‹« (Fühmann 1966, 11f.). Erinnerungen werden eingefügt, wie Barlach u.a. als »Kulturschänder!«, »Undeutscher!« und »Jude!« beschimpft wurde. Doch während einige dieser Begriffe zu der erzählten Zeit tatsächlich ein Todesurteil bedeuten konnten oder definitiv bedeuteten, stellt sich heraus, dass mit »Todesurteil« hier doch etwas anderes gemeint ist: »Barlach hatte erfahren, daß zwischen Mitternacht und Glock eins sein Engel
239
240
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
aus dem Güstrower Dom von unbekannten Tätern entfernt worden war« (Fühmann 1966, 13). Er zieht sich zurück, »abwechselnd die Worte ›Kulturschänder‹ und ›Undeutscher‹, diese vernichtenden Bannflüche, die der Staat der Kerkermeister und Kirchenräuber wider ihn geschleudert, aus seinem Mund stoßend« (Fühmann 1966, 16). Den vernichtendsten der zuvor genannten »Bannflüche« aber, deren Trägern gegenüber der Staat deutlich mehr als »Kerkermeister und Kirchenräuber« war, lässt er aus. Die Szene spielt sich an einem bemerkenswert benannten Ort ab: Barlach befindet sich in einem »Bollwerk, das den ersten Stock seiner Wohnung im Haus […] zu einer selbst einem Massenangriff trotzenden Festung oder, wie Barlach oft murrte, zu seinem eigenen Konzentrationslager verwandeln konnte« (Fühmann 1966, 10). Diese Bezeichnung als Schutzraum vor Angriffen ist in sich schon irreführend. Barlach hat sich dieses »Privat-KZ«, wie es an anderer Stelle heißt (Fühmann 1966, 61), zudem selbst bauen lassen, bezeichnenderweise »im Jahr 1933, [als] Drohrufe, anonyme Briefe und Schmähplakate einen baldigen Sturm auf die als ›Judenburg‹ und ›Bolschewistennest‹ verketzerten […] Häuser, das Atelier und das Wohnhäuschen, angekündigt hatten« (Fühmann 1966, 10f.).4 Dass der literarische Barlach um die Existenz der tatsächlichen Konzentrationslager weiß, wird deutlich, wenn er später im Text an »die Rotten der braunen Ratten« und »ihre Lager [denkt], in denen sie Menschen prügelten und peitschten und kreuzigten, nur weil sie sich dem grölenden Heil der Unmenschlichkeit entgegensprachen oder auch nur entgegenschwiegen« (Fühmann 1966, 41). Diese Eingangsszene prägt daher eine merkwürdige Mischung von Abstraktion und Konkretion, die eine Schieflage entstehen lässt. Das Geschehen wird zeitlich genau datiert – es ist der 24. August 1937 –, doch die Hakenkreuzbinden werden umständlich verklausuliert; zwar bedrohen ihre Träger Barlach historisch korrekt »seit vier Jahren« (Fühmann 1966, 8), doch entstammt ihr (gar kunsthistorisch präzisiertes) Mordwerkzeug aus längst vergangenen Zeiten. Während die Garrotte von dort an leitmotivisch die ganze Erzählung durchzieht, kommt das eigentliche Mordwerkzeug Konzentrationslager nur als selbst gebauter Rückzugsort vor, der wiederum aufgrund der Verleumdung des Hauses als »Judenburg« nötig geworden ist. Die Abholung des Engels wird als »Todesurteil« bezeichnet und mit der Verfolgung als »Jude« korreliert – dass es eine Bedrohung von Juden gibt, ist textintern also bekannt; bedroht wird jedoch ein als Jude nur Bezeichneter, »getötet« lediglich ein von diesem geschaffenes Kunstwerk. In den aufgerufenen Lagern indes werden Menschen ausgerechnet »gekreuzigt«; doch
4
Wenn er erläutert, dass der daraufhin gebaute »festungsähnliche[] Schutz« durch einen Mechanismus funktioniert, der »nur vom Schlafzimmer aus zu betätigen« (Fühmann 1966, 11) war, erscheint das »Konzentrationslager«-Bild immer abstruser.
Nike Thurn: Die Moderne als Opfer. Andersch und Fühmann blicken auf Barlach
wenn betont wird, dass sie nicht aufgrund ihres Seins, sondern ihrer widerständigen Handlungen verfolgt werden, rückt erkennbar eine andere Opfergruppe in den Fokus.5 Juden kommen in diesem Text nur als Gerücht oder Beschimpfung6 vor.
3. Subjektivierte Objekte Ruth Klüger hat in ihrer Lektüre von Sansibar kritisiert, dass der Mensch Judith »keineswegs gefährdeter« (Klüger [1997] 2006, 13) ist als die Holzskulptur: »Beide sind hilflos ausgeliefert und moralisch nicht autonom in einem Werk, dessen eigentliches Anliegen das Problem der ethischen Autonomie ist und das dieses Anliegen mit Hilfe einer Rettungsaktion für die beiden ›Objekte‹, Jüdin und Schnitzwerk, artikuliert.« (Klüger [1997] 2006, 14) Das Irritierende ist jedoch nicht nur diese Objektifizierung der Jüdin, sondern die gleichzeitige, gegenläufige Subjektifizierung der Skulptur: Die Beziehung beider ist diesbezüglich intrikat. Durch zahlreiche Vergleichsmomente werden beide von Beginn an enggeführt. So geht es im Text zwei Mal konkret um die Sorge, von den »Anderen« aufgesucht zu werden: bei Judith und ihrer gelähmten Mutter, die buchstäblich unbeweglich und dadurch hilflos ausgeliefert ist, Judith zur Flucht drängt und sich umbringt (vgl. Andersch [1957] 2004, 24–27); und bei der Skulptur, über die Gregor festhält: »Er sieht aus wie einer, der jederzeit das Buch zuklappen kann und aufstehen, um etwas ganz anderes zu tun.« (Andersch [1957] 2004, 53) Im Verlauf des Textes wird die Plastik immer humanoider, und zugleich – wie im Gespräch zwischen dem Pfarrer Helander und dem »jungen Herrn Doktor«7 – immer religiöser aufgeladen: »Wir wollen ihn schützen, Herr Pfarrer. – Sie wollen ihn einsperren, Herr Doktor. – Er steht nun einmal auf der Liste […] – […] Vielleicht ist es besser, der Klosterschüler stirbt […]. Glauben Sie an das Ewige Leben, Herr Doktor? Auch an das ewige Leben einer Figur, die gestorben ist, weil sie nicht ausgeliefert wurde?« (Andersch [1957] 2004, 38f.) Die Subjektifizierung wird schon durch die Pronomina deutlich: Gregor nimmt die Skulptur zunehmend als Person wahr8 und spricht bald nicht mehr von »ihr« oder
5
6 7 8
Die einzige andere Erwähnung der realen Konzentrationslager geschieht im Zusammenhang mit einem »Rotfrontler«. Wie bei Andersch sind es nicht Jüdinnen und Juden, die bedroht sind, sondern Kommunisten (vgl. Fühmann 1966, 61). Vgl. u.a. »Da sitzt doch dieser Drecksjude drin!« (Fühmann 1966, 22) »Keiner von den Andren, sondern ein Geschickter, Wendiger, ein Karrierist, der sich durschlängelte.« (Andersch [1957] 2004, 37) »Sie standen die ganze Zeit, während sie miteinander sprachen, neben der Figur. Eigentlich sind wir zu viert, dachte Gregor.« (Andersch [1957] 2004, 66) Vgl. auch Helanders Sicht: »Aber plötzlich sah er Gregors Hand. Sie lag auf der Schulter des ›Lesenden Klosterschülers‹; in einer leichten und brüderlichen Bewegung hatte sie sich auf das Holz gelegt.« (Andersch [1957] 2004, 70)
241
242
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
»der Figur«, sondern nur noch von »ihm« und dem »lesenden Klosterschüler«, wodurch in seinen Gedanken aus dem Titel des Kunstwerks immer mehr eine Personenbeschreibung wird: wir drei wollen weg – ich, der Klosterschüler, das Mädchen. Aber es ist ein Unterschied […] zwischen mir und den beiden anderen. Ich will weg, aber sie müssen weg. Ich bin zwar bedroht, mit dem Konzentrationslager, mit dem Tod, aber ich kann trotzdem frei entscheiden, ob ich bleibe oder gehe. Ich kann wählen […]. Sie aber können nicht wählen: sie sind Ausgestoßene.9 (Andersch [1957] 2004, 74) Ruth Klüger hat aufgezeigt, wie Judith in Handlungsfähigkeit und Willensfreiheit hier einem Stück Holz gleichgesetzt wird. Wann hat man ein Kunstwerk zuletzt frei wählen sehen? Tatsächlich wird ihm bei näherem Hinsehen jedoch sogar mehr agency zugestanden, wenn es später in fast wortgleicher Wiederholung der oben zitierten Passage – aber nun nicht mehr mit einem vergleichenden »wie« (»Er sieht aus wie einer, der«), sondern mit dem »um« eines gezielt Handelnden – heißt: »Der saß und las schweigend, aber nur, um eines Tages aufzustehen und fortzugehen.« (Andersch [1957] 2004, 108) Gregor stellt Judith das Kunstwerk entsprechend wie eine Person vor: »Stellen Sie sich gut mit ihm, dann nimmt er Sie vielleicht mit. […] Er? sagte Judith zweifelnd. Ja. Er ist ein junger Mann, der liest.« (Andersch [1957] 2004, 131) Als Gregor die Skulptur für die Flucht abschraubt, kommt es zudem zu einem denkwürdigen Bild: »als er sich erhob und aufblickte, sah er das Mädchen auf dem Boden knien, die aufgefangene Figur in den Armen, als trüge sie eine Puppe oder ein Kind« (Andersch [1957] 2004, 139). Wir sehen die ›schöne Jüdin‹ als Mischung aus Madonna mit Kind und Pietà, mit dem vom Kreuz bzw. vom Sockel abgenommenen Retter im Schoß.10 Mit Blick auf die Relation von Subjekt und Objekt ist zudem zentral, dass es schließlich die ›reiche Jüdin‹ ist, die den so beharrlich subjektifizierten hölzernen Klosterschüler wieder zum Objekt macht: Nachdem sie das Gesicht befühlt hatte, stieß sie einen Ruf des Erstaunens aus und nannte den Namen des Bildhauers, der die Statue gemacht hatte. […] Natürlich, dachte er, in ihren Kreisen kennt man solche Namen. In ihren Kreisen haben solche Namen wahrscheinlich einen bestimmten Preis – und deshalb kennt man sie. Und in der Tat hörte er sie sagen: Das ist eine sehr wertvolle Plastik. (Andersch [1957] 2004, 132) Die Kunst, die sie retten kann – oder, um in der Sprache des Textes zu bleiben: den Retter, der sie mitnehmen kann –, erkennt die ›reiche Jüdin‹ nur als geldwertes Ob9 10
Hier fehlen nun sogar die Anführungsstriche bei »Klosterschüler«. Barlachs Entwurf einer Pietà für Stralsund von 1932 wurde indes aufgrund nationalsozialistischer Proteste nie realisiert.
Nike Thurn: Die Moderne als Opfer. Andersch und Fühmann blicken auf Barlach
jekt. Die Dopplung des »in ihren Kreisen« hebt hervor, dass dies nicht auf einen individuellen Charakterzug, sondern ihre Herkunft zurückgeführt wird. Jüdin und Kunstwerk sind über das Ressentiment verbunden.11
4. Urdeutsche Undeutsche Zwar subjektifiziert auch Fühmanns Text – mit den genannten problematischen Implikationen –, wenn von einem »Todesurteil« und später den »fünf Mörder[n]« (Fühmann 1966, 24) der Skulptur die Rede ist; doch ist deren Rolle dabei deutlich komplexer. Historisch durchaus plausibel geht Barlach hier davon aus, dass sie nach der Abhängung nun in gewisser Weise in den Krieg eingezogen und dort selbst zum Mordwerkzeug wird: »der Engel war fort, der Engel war Schrott und fuhr morgen vielleicht schon als Ring um Granaten über die Welt, die Völker in neuen Schlachten zerfetzend« (Fühmann 1966, 25). Wenn Barlach erfährt, dass es ›ganz gewöhnliche Deutsche‹ waren, die für die Abhängung des Engels verantwortlich sind, werden die Nationalsozialisten anders als bei Andersch gerade nicht als ›Andere‹, sondern die vermeintlich ›guten Bürger‹ als die todbringenden gezeigt. Fühmann gibt ihnen ein Gesicht, das bewusst kein Besonderes ist, und entanonymisiert sie, ohne ihre Masse damit zu mindern (vgl. Fühmann 1966, 30f.). Die Skulptur markiert die Differenz zwischen Barlach, der ebenso patriotisch wie pathetisch in den Ersten Weltkrieg
11
Unterstrichen wird dies durch das textinterne Kunstsystem: Die Barlach-Skulptur wird dem »Degas im Salon« von Judiths Mutter gegenübergestellt; auch dies ein verfolgtes Kunstwerk, das gerettet werden muss (vgl. Andersch [1957] 2004, 123). Nicht nur wird Judith hierdurch abermals als außergewöhnlich reich charakterisiert (auch die Adresse am Leinpfad, das Alstersegeln, die Urlaube in Kampen und Sils Maria tragen überaus klischiert dazu bei); sie wird zudem zur Vertreterin einer antagonistischen Kunst: Hier der gute nordische Expressionismus, dort der französische Impressionismus. Dies entspricht der Positionierung Barlachs, der lange überlegte, als er das Präsidentenamt der Ausstellungsgemeinschaft ›Ring deutscher Künstler‹ angetragen bekam und mit dessen Motto »Gegen französisches Ästhetentum – für bodenständige deutsche Kunst« durchaus viel anfangen konnte (vgl. Schröder 2020). Gregor als Identifikationsfigur des Textes zieht aus dieser Szene die Konsequenzen und belehrt sie entsprechend: »So wertvoll, bemerkte er spöttisch, dass Sie die Chance haben, von diesem Burschen aus Holz mitgenommen zu werden. Als Draufgabe sozusagen. Er ist uns nämlich wichtiger als Sie.« (Andersch [1957] 2004, 132) Davon angewidert, wie der Pfarrer und Judith sich unterhalten, und sich ausgeschlossen fühlend, heißt es später ähnlich: »Aber dann fiel sein Blick auf den lesenden Mönch, […] und er wußte wieder, warum er hier war, auch der Genosse Klosterschüler gehörte nicht zu ihnen, er gehörte zu Gregor, er gehörte zu denen, die in den Texten lasen, aufstanden und fortgingen, er gehörte in den Club derer, die sich verschworen hatten, niemandem mehr zu gehören.« (Andersch [1957] 2004, 137) Hier werden denkwürdige Gruppenbildungen vollzogen.
243
244
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
gezogen war,12 dort jedoch die Gräuel des Krieges erkannte und seither pazifistische Mahnmale schafft, und jenen, denen diese Werke ein Ärgernis sind, weil sie sich nicht zu Heldenverehrung und Kriegspathos eignen.13 Als Beispiel wird neben dem Güstrower Engel das Magdeburger »Ehrenmal« Barlachs angeführt. Er sinniert daher fassungslos über »diese haßschnaubende Ablehnung seiner Werke, die um die fünf Millionen im Mörser des Krieges zerstampften Menschen trauerten« und daran erinnerten, daß Irr- und Gierwahn eines Klüngels Politiker, Generäle und Finanzleute fünf Millionen Menschen ins ewige Schweigen geworfen hatten, daß fünf Millionen Herzen, ein Blutkatarakt, nun nicht mehr schlugen, daß fünf Millionen Paar Hände […] nun nicht mehr am Werk waren, daß fünf Millionen Seelen nicht mehr sannen; er hatte in einem unerbittlichen geistigen Ringen den Weg der Wandlung vom wütigen Berserkerdenken der ersten Kriegsjahre bis hin zur Verfluchung des Völkermords und der Einsicht in Deutschlands Verschulden ja selbst durchlitten […]. (Fühmann 1966, 25f.) Über den Begriff der »Wandlung«, der Fühmanns Werk leitmotivisch und selbsterklärtermaßen biographisch durchzieht, wird Barlach hier unmissverständlich als alter ego-Figur erkennbar. Über den Begriff des Völkermords und die geradezu exzessive Wiederholung der Zahl fünf Millionen – die mit Blick auf die Todeszahlen des Ersten Weltkriegs keinen Sinn ergibt – wird (wenngleich die Zahl auch hier markant abweicht) erkennbar etwas anderes aufgerufen. Der zum Zeitpunkt der erzählten Zeit noch nicht ausgebrochene Zweite Weltkrieg hatte Fühmanns Wandlung vom überzeugten Nationalsozialisten zum antifaschistischen Sozialisten ausgelöst. Die Nationalsozialisten des Textes werden entsprechend gleich mehrfach als die »Unwandelbaren« benannt. (Fühmann 1966, 27)
12
13
»[I]ch werde Soldat, ich kann nicht mehr länger ruhig am Zeichentisch sitzen und Papier mit Linien bekritzeln, […] ich will mit ihnen gehen, mit ihnen ausharren und mit ihnen stürmen und frieren, will mich einbetten in die Gemeinschaft des Volkes, mich einmanteln in seine Not und einpelzen in seine Leiden, um dann auch aufzuleuchten im Glanz seines tiefen Glücks!« (Fühmann 1966, 19f.) »›Unsere Toten verlangen nach heldischen Denkmälern, drum fort mit diesem widerlichen Schund!‹ hörte Barlach die Stimme des kampffrohen Pastors von der Kanzel des Magdeburger Doms erschallen. ›Unserer Toten Ehrenschild wird von diesem fischmäuligen Engel in den Kot gezerrt! Hörte er den Führer des Güstrower ›Stahlhelms‹ […] blaffen: das also war es: ihre Toten, ihre Lebenden und unter ihres Reiches Grund nun noch ihre Toten, welch widerwärtige Heuchelei! […] ›Nicht um der Toten Ehre und Nachruhm geht es […] – das Schattenreich der Geopferten wollt ihr annektieren wie eine besiegte Provinz, um eure Niederlage im Namen der teuren Toten umzufälschen in euren Sieg; was ihr auf dem Schlachtfeld nicht erringen konntet, den Sieg, ihn soll euch der Künstler nun durch die Hintertür schleppen.« (Fühmann 1966, 31f.; Herv. i. O.)
Nike Thurn: Die Moderne als Opfer. Andersch und Fühmann blicken auf Barlach
Während der literarische Barlach seine eigene Wandlung hier jedoch selbst lobend hervorhebt, durchzieht den Text zugleich die Klage über eine andere. Barlach wird vorgestellt als »ein Arbeitsbesessener, dessen Werk nach dem Krieg wieder Zeugnis abgelegt hatte von bester deutscher Art und Kunst, ja das mitunter als zu deutsch, und das sollte heißen: abseits der modischen Normen des internationalen Kunstmarkts gelegen, leise getadelt worden war« (Fühmann 1966, 12). Auf der gleichen Seite wird kontrastiert, dass der kürzlich in seiner Kunst noch zu Deutsche plötzlich »Undeutscher! Undeutscher, Undeutscher!« genannt wird. (Herv. i. O.) Kunst und ›Deutschtum‹ werden hier eng verknüpft. Nicht seine Kunst hat sich jedoch verändert, sondern lediglich deren Wahrnehmung sich gewandelt. Damit aber wird abermals eine merkwürdige Gegenüberstellung aufgemacht: Hier der »international[e] Kunstmarkt« der Weimarer Republik, der gegen das ›Deutsche‹ ist und Barlach deshalb nicht anerkennt; dort die Nazis, die sich zwar auf das ›Deutschtum‹ berufen, ihn aber auch nicht anerkennen.14 Von allem, was ihm widerfährt, ist es dieser zweite Ausschluss, der ihm keine Ruhe lässt: »Barlach hatte nie ganz verstehen können, warum bestimmte, nach eigener Aussage sich dem deutschen Volk und dessen Kriegserlebnis besonders verpflichtet fühlende Kreise […] seine Kriegermale als dem deutschen Fühlen unerträglich […] in Verruf gebracht hatten, um sie schließlich zu verfolgen und auszumerzen« (Fühmann 1966, 25; Herv. i. O.). Wie als Verteidigung wird immer und immer wieder angeführt, dass er der doch eigentlich besonders deutsche Künstler15 sei: als einzige Antwort auf Beschwerden und Proteste wie auch auf Fragen, was denn an seinem Werk, das in seiner Verbundenheit mit deutschem Land und deutschem Volk im Kunstschaffen der Gegenwart wohl einzig dastehe, nun eigentlich 14
15
Vgl. hierzu auch: »Abgesehen von einer Schar verständiger armer Schlucker und einzelnen begüterten Kennern, waren’s doch nur Berliner Börsianer und andere großmächtige Sedemunds gewesen, die sich einen Barlach gekauft hatten, um ihren Salon damit zu schmücken, ihren Salon mit ihrem, dem damals noch modern gewesenen Barlach: […] Der Barlach der Bankiers und Börsenjobber zu werden, vor diesem Geschick hatte ihm immer geschaudert.« (Fühmann 1966, 42, Herv. i. O.) Zu dieser Inszenierung gehört seine Darstellung als besonders verwurzelt »in jenem Strich Deutschlands […], in dem er geboren und aufgewachsen war und wo einzig er atmen und arbeiten konnte […] und wohin er nach verzweifelt-vergeblichen Versuchen, in der hetzenden Hast der heillosen Hölle Berlin ansässig zu werden, zurückgeflohen war, heimkehrend in die geliebte Landschaft des Grauregensturms und Möwenflugs« (Fühmann 1966, 14). Zu dieser Gegenüberstellung von Landschaftsidylle und Großstadtverdammung kommt unverkennbar auch ein DDR-sozialistisch geprägter Blick hinzu, wenn zusätzlich betont wird, dass »eine Reise durch Rußland mit seinen in Leidenschaften und Gefühlen ohnemaßen echten und wahrhaftigen Menschen ihm zum rettenden, ihn auf den rechten Weg seines bildnerischen Müssens stoßenden Erlebnis geworden war«. Hier habe er »die Gewißheit gewonnen, sie, diese unverfälschten, einem größeren Werk als der Selbstsucht verpflichteten Menschen dereinst auch in Deutschlands Alltag und Volk aufspüren zu können« (Fühmann 1966, 13f.).
245
246
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
auszusetzen sei, hatte er nur das […] Ableiern der unsinnigen Bannsprüche Kulturschänder Undeutscher russischjüdischer Bolschewik samt dem höhnischen Rat zu hören bekommen, er, Barlach, könne ja in die Emigration gehen (Fühmann 1966, 18; Herv. i. O.)16 , – was für ihn gerade deshalb außer Frage steht, denn: »außerhalb Deutschlands würde er niemals leben, geschweige denn arbeiten können«, heißt es; »er und sein Haus konnten nur auf deutsch, nur unter den Deutschen, auch wenn man an ihnen litt, bestehen« (Fühmann 1966, 15). Die Erzählung, in der kaum ein Begriff prägnanter wiederholt wird als die immer wieder angeführte Beschimpfung Barlachs als »Undeutscher«, bemüht sich im Grunde die ganze Zeit um eine Widerlegung dieses Vorwurfs. Wenn jedoch aufgrund dieses Vorwurfs des »Undeutsche[n]« seine Werke »verfolgt und ausgemerzt« werden, wäre es für die Balance des Textes bedeutsam gewesen herauszustellen, dass vor allem Menschen aufgrund dieses Vorwurfs »verfolgt und ausgemerzt« wurden.
5. Schluss Dass Andersch und Fühmann sich mit ihren Texten in deutlicher Opposition zur NS-Doktrin sahen, ist unzweifelhaft; doch transportieren ihre Texte dennoch die von Stephan Braese so treffend benannten »Einschlüsse«. Beide positionieren sich unfreiwillig ungelenk zur – wie Braese es formulierte – »paradigmatischen ›Leerstelle‹ im Diskurs der nachkriegsdeutschen Literaturen […] – der Vernichtung der europäischen Juden« (Braese 2001, 51). Während bei Andersch durch krude Konstellierungen die Judenverfolgung und -ermordung nivelliert und die einzige jüdische Figur diffamiert wird, rettet sich bei Fühmann der als »Jude« nur beschimpfte Künstler in ein selbstgebautes »Privat-KZ«. Die Skulptur in Sansibar wird von den Figuren als autonom, handlungsfähig und selbstbestimmt charakterisiert, dient bei
16
Und weiter: »alle herkömmlichen Mittel geistigen Kampfes dagegen hatten sich als nutzlos erwiesen; Erwiderungen wurden nicht angehört, auf Diskussionsversuche wurde nicht eingegangen, ja sogar sachliche Berichtigungen waren mit Repressalien beantwortet worden: ein Freund hatte den Stammbaum des Hauses Barlach, der dies Geschlecht als seit über vierhundert Jahren im niederdeutschen Handwerk und Pastorentum verwurzelt nachwies, […] publiziert, doch die Lüge von Barlachs jüdischer Abstammung, die Barlach nie als Beleidigung (sein Freund Paul Cassierer, dessen Verlag er noch immer die Treue hielt, war ja Jude gewesen), sondern eben als unwahre, der Öffentlichkeit einen billigen Vorwand […] liefernde Behauptung empfunden hatte, war lauthals weiter durchs Land gelästert« (Fühmann 1966, 18). Barlachs hier imaginierte Rechtfertigungen – ›einige meiner besten Freunde sind Juden‹ –, sind plumper, als sie es in der Realität waren.
Nike Thurn: Die Moderne als Opfer. Andersch und Fühmann blicken auf Barlach
genauerem Hinsehen jedoch im Gegenteil außerordentlich passiv dazu, die Identifikationsfigur Gregor in einem guten Licht dastehen zu lassen: Der gute Deutsche rettet die ›schöne Jüdin‹ und die moderne Kunst. Die Skultptur in Barlach in Güstrow wiederum, über die ein »Todesurteil« verhängt und von deren »Mördern« gesprochen wird, ist gefährdeter als jeder Mensch. Mit Blick auf Julia Friedrichs einleitend zitierte Einordnungen ließe sich sagen: Die Wahl Barlachs als Vertreter einer gut verträglichen Moderne ist hier vielsagend; ein jüdischer, deutlich existenzieller verfolgter und schließlich ermordeter Künstler wie Otto Freundlich oder Felix Nussbaum hätte gänzlich andere Fragen aufgeworfen und zu sehr auf das verwiesen, was so nur im Hintergrund aufscheint. Während die Jüdin bei Andersch aus dem deutschen ›Wir‹, zu dem auch das Kunstwerk gehört, erkennbar ausgeschlossen wird, wehrt Barlach sich bei Fühmann nach Kräften gegen den Vorwurf, wahlweise Jude oder »Undeutscher« zu sein und ebensolche Kunst zu produzieren – und wird deutlich als Vertreter des eigentlichen, des guten Deutschlands gezeigt, das dennoch bzw. gerade betont deutsch ist. Die eigene Wandlung steckt an bemerkenswerter Stelle fest, wenn das Hauptanliegen diese ›Ehrenrettung‹ zu sein scheint.
Literatur Ächtler, Norman. »Einleitung«. In: Alfred Andersch. Engagierte Autorschaft im Literatursystem der Bundesrepublik. Hg. v. dems. Stuttgart 2016, 1–42. Andersch, Alfred. »Sansibar oder der letzte Grund« [1957]. In: Ders. Gesammelte Werke in 10 Bden. Kommentierte Ausgabe. Bd. 1.: Sansibar oder der letzte Grund. Roman. Die Rote. Roman. Hg. v. Dieter Lamping. Zürich 2004, 7–183. Baumgart Reinhard. »Unmenschlichkeit beschreiben«. In: Ders. Literatur für Zeitgenossen. Essays. Frankfurt a.M. 1966, 12–36. Braese, Stephan. »Unmittelbar zum Krieg. Alfred Andersch und Franz Fühmann«. In: Mittelweg 36.4 (2001), 49–70. Friedrich. Julia. »Kunst als Kitt. Spuren des Nationalsozialismus in der ersten documenta«. In: documenta. Politik und Kunst. Hg. v. Raphael Gross et al. München/ London/New York 2021, 60–65. Fühmann, Franz. Zweiundzwanzig Tage oder Die Hälfte des Lebens. Rostock 1973. Fühmann, Franz. »Barlach in Güstrow«. In: Ders. König Ödipus. Gesammelte Erzählungen. Berlin/Weimar 1966, 5–74. Fühmann, Franz. »Das schlimme Jahr«. In: Ernst Barlach. Das schlimme Jahr. Grafik, Zeichnungen, Plastik, Dokumente. Mit einem Text v. Franz Fühmann. Rostock 1963, o. S. Fulda, Bernhard/Christian Ring/Aya Soika (Hg.). Emil Nolde. Eine deutsche Legende. Der Künstler im Nationalsozialismus. Essay- und Bildband. München 2019.
247
248
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
Hahn, Hans-Joachim. »Andersch, Klüger, Sebald: Moral und Literaturgeschichte nach dem Holocaust – Moral im Diskurs«. In: Alfred Andersch ›revisited‹. Werkbiographische Studien im Zeichen der Sebald-Debatte. Hg. v. Jörg Döring/Markus Joch. Berlin/Boston 2011, 357–379. Heidelberger-Leonard, Irene. »Erschriebener Widerstand? Fragen an Alfred Anderschs Leben und Werk«. In: Alfred Andersch. Perspektiven zu Leben und Werk. Hg. v. Ders./Volker Wehdeking. Opladen 1994, 51–61. Joch, Markus. »Vom Existenzialismus light zur verdeckten Selbstkritik. Biografie, Diskurs und Ästhetik bei Alfred Andersch«. In: Alfred Andersch. Engagierte Autorschaft im Literatursystem der Bundesrepublik. Hg. v. Norman Ächtler. Stuttgart 2016, 212–230. Klüger, Ruth. »Gibt es ein ›Judenproblem‹ in der deutschen Nachkriegsliteratur?« In: Dies. Katastrophen. Über deutsche Literatur [1997]. Göttingen 2 2006, 9–39. Reich-Ranicki, Marcel. »Alfred Andersch, ein geschlagener Revolutionär«. In: Ders. Deutsche Literatur in West und Ost. München 1963a, 101–119. Reich-Ranicki, Marcel. »Kamerad Fühmann«. In: Ders. Deutsche Literatur in West und Ost. München 1963b, 422–433. Schröder, Christian. Kunst im Dritten Reich: Ist Ernst Barlach ein zweiter Fall Nolde? In: Der Tagesspiegel (01.01.2020). https://www.tagesspiegel.de/kultur/ku nst-im-dritten-reich-ist-ernst-barlach-ein-zweiter-fall-nolde/25380244.html (12.08.2022).
Das Buch, die Kritik und der Markt. Takis Würgers Roman Stella und seine Auswirkungen Alfred Bodenheimer
1. Kaum je im vergangenen Jahrzehnt ist eine literarische Neuerscheinung mit so geballter Empörung, ja teilweise beinahe Abscheu von der Kritik fast aller deutschsprachiger Leitmedien konfrontiert worden wie Takis Würgers 2019 erschienener Roman Stella. Aus der Perspektive des fiktiven Ich-Erzählers namens Friedrich, der aus reichem Haus im Kanton Genf stammt, wird darin dessen Liebesbeziehung zu Stella Goldschlag 1942 in Berlin geschildert. Stella Goldschlag hinwiederum war eine reale Persönlichkeit, eine berühmt-berüchtigte jüdische Berlinerin, die, zunächst um ihre Eltern vor der Deportation zu retten (was nicht gelang), bis fast zum Ende des Kriegs für die Gestapo auf Jagd nach untergetauchten Jüdinnen und Juden ging. Dem Roman wird von der Kritik unter anderem vorgeworfen, eine historisch verstörende Konstellation, die tatsächlich Potential für literarische Bearbeitung habe, in eine kitschige, an der Oberfläche der betont naiven Perzeption des unsterblich verliebten, über die Dauer eines Jahres im Hotel Adlon logierenden Simpels zu verwandeln, mit nichtssagenden Dialogen, Allgemeinplätzen über Schuld und Unschuld und einer in Kitsch sich verlierenden Herz-Schmerz-Geschichte, unterbrochen von ein paar brutalen Folterszenen, schockierenden Aussagen eines frivoldekadenten SS-Obersturmbannführers und kursiv gedruckten Auszügen aus Gerichtsprotokollen jenes Verfahrens, das 1946 zu einem Schuldspruch eines sowjetischen Militärtribunals gegen Goldschlag und einer langen Haftstrafe führte.1 1
Der Umstand, dass diese Dokumente eingebaut wurden, hat zu einer juristischen Intervention der Erbin der publizistischen Persönlichkeitsrechte Stella Goldschlags geführt, die sich gegen eine ihrer Meinung nach aus dem Zusammenhang gerissene Publikation dieser Auszüge zu wehren versuchte. Wie aus einem Interview mit dem Anwalt der Erbin, Karl Alich, im Deutschlandfunk hervorgeht, sind die Protokolle der Gerichtsverhandlung in West-Berlin 1957, in der Goldschlag ebenfalls schuldig gesprochen, aber aufgrund ihrer langen vorhergehenden Haftstrafe nicht neuerlich zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, 1994 amtlich vernichtet worden (vgl. Debatte über den Roman 2019). Die von Alich in dem Gespräch nahegelegte Schwärzung der Auszüge aus den Gerichtsdokumenten ist nicht erfolgt, ebensowenig scheint
250
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
Besonders drastisch fällt etwa die Kritik in der Rezension von Manfred Papst in der NZZ am Sonntag aus, der in seinem Resümee meint: »Die Greuel der Nazizeit: Hier werden sie zur Operette. Ein schlechteres, dümmeres und verwerflicheres Buch ist im renommierten Hanser-Verlag noch nie erschienen.« Dass Verlagschef Jo Lendle sich auf dieses Werk überhaupt eingelassen habe, weckt in Papst einen bösen Verdacht: »Wir wagen die Behauptung: Er hat einfach den Erfolg gesucht – Stichwort: Holocaust zieht immer – und deshalb seinen Verstand ausgeschaltet.« (Papst 2019) Ein böser Verdacht in der Tat, aber da das Werk zeitgleich in neun Übersetzungen erschien, ist er vielleicht nicht ganz unbegründet. Die taz wiederum warf Würger vor, er habe »Lektüreporn« produziert, und verglich sein Werk mit den kurz zuvor breit diskutierten Affären um die erfundenen Reportagen von Claas Relotius und dem erwiesenermaßen erfundenen Zitat Walter Hallsteins, das Robert Menasse in der Europadiskussion angeführt hatte (vgl. dazu: Erfundene Zitate 2019). »Auch ›Stella‹ von Takis Würger«, heißt es da, »erzählt eben eine solche Geschichte, die zu perfekt ist, um wahr zu sein – auch zu perfekt, um literarisch wahr zu sein. Anstatt sich ihr auszusetzen und auch das eigene Interesse an ihr zu hinterfragen, richtet er sie so zu, dass er sie bequem und hurtig aufschreiben kann« (Knipphals 2019). Der Roman hat aber auch Verteidiger gefunden, und damit ist nicht primär das sicher verkaufsfördernde, aber flapsige Lob von Daniel Kehlmann auf dem Umschlag gemeint, sondern eher das Nachwort, das Sascha Feuchert, einer der anerkannten Forscher für Holocaust-Literatur im deutschsprachigen Raum, der Taschenbuchausgabe beigegeben hat. Feuchert verteidigt die Freiheiten, die ein literarisches Werk gegenüber der Geschichtsschreibung habe, das mit der »Mischung aus Fakten und Fiktionen«, anders als ein wissenschaftliches Werk, Empathie schaffen könne (Feuchert 2020, 230). Dabei verweist er auf das, was dieser »historische Roman« (Feuchert 2020, 229) am Bild der literarischen Figur wie auch der realen Person Stella Goldschlag illustriere: Die »brutal erzwungene Mitwirkung vieler Opfer am Holocaust«, die sich auch in der Form der sogenannten Judenräte oder der Kapos in den Konzentrationslagern gezeigt habe – und die daraus sich ergebende, kaum lösbare Frage nach deren Schuld (Feuchert 2020, 231f.). Dass der von Feuchert gewählte Begriff des historischen Romans hier kaum greift, weil man den prägenden Theorien und Ausführungen dieses Genres, etwa bei Georg Lukács oder Alfred Döblin, zufolge von einem historischen Roman eine bestimmte Weite des Blicks in den beobachteten Zeitraum erwartet, die gerade der quasi aus der Perspektive des soeben gelandeten Aliens erzählende dauererstaunte Friedrich in Berlin nicht besitzt, sei nur am Rande erwähnt.
der Rechtsstreit fortgesetzt worden zu sein – ein Szenario, das Alich zufolge zur Vermeidung weiterer Publizität der Sache auch nicht erwünscht war.
Alfred Bodenheimer: Das Buch, die Kritik und der Markt
Die entscheidende Frage, die Feuchert allerdings nicht in den Blick nimmt, ist m.E. folgende: Inwiefern bestimmt die Art und Weise, mit der das erzeugt wird, was er Empathie nennt, darüber, ob die Frage nach der Schuld adäquat gestellt werden kann? Oder anders gefragt: Wieviel Abweichung und Verkürzung gegenüber der Realität ist in einem solchen Bereich, der die empfindlichste Stelle deutschen wie jüdischen Geschichtsdenkens berührt, noch legitim, wenn man das erreichen will, worum es Würger angeblich geht, nämlich den Holocaust in der Gesellschaft wieder bewusster zu machen?2 Denn wenn ein bestimmter Roman tatsächlich der Trigger für eine bestimmte Leserschaft ist, sich mit der Thematik zu befassen, dann ist natürlich auch das im Roman Beschriebene zunächst einmal das, was man mit der Thematik assoziiert. Wichtig ist angesichts dessen: Abgesehen von der Exposition, die die Jugend Friedrichs in der Schweiz beschreibt, umfasst der in Berlin angesiedelte Teil das ganze Jahr 1942, von Friedrichs Ankunft dort bis zu seiner Abreise, und um das zu verdeutlichen, tragen die Kapitel die Namen des jeweiligen Monats. Diese Kapitel werden jeweils mit einigen Ereignissen eingeführt, die sich in diesem Monat zugetragen haben, was größere oder kleinere Pressemeldungen sein können oder auch die Erwähnung der Geburt einer später berühmtgewordenen Persönlichkeit wie Paul McCartney, Cassius Clay oder Alice Schwarzer. Dazu steht bei den meisten Kapiteln jeweils eines von Goebbels’ »10 Geboten für jeden Nationalsozialisten«, was befremdlich erscheint vor dem Hintergrund, dass diese lange vor der Machtergreifung, im Jahr 1929, erschienen sind und in keinem nachvollziehbaren Zusammenhang mit den Ereignissen des jeweiligen Monats im Jahr 1942 oder der Handlung des jeweiligen Kapitels stehen. Jedes Kapitel enthält auch einen kurzen Absatz mit einem Zitat aus der Berliner Gerichtsverhandlung gegen Goldschlag von 1946, in der sie von Zeuginnen und Zeugen des Verrats bestimmter Personen bezichtigt wird. Soweit so realitätsbezogen. Das Problem – und es scheint keinem der Rezensentinnen und Rezensenten in den Medien aufgefallen oder wichtig gewesen zu sein: Stella Goldschlag wurde von der Gestapo erst ab Spätsommer 1943 als Greiferin eingesetzt. Das Jahr 1942 hindurch schuftete sie, wie auch ihre Eltern, als Zwangsarbeiterin zehn Stunden am Tag bei Siemens. Sie war seit Oktober 1941 frisch mit dem gleichaltrigen Manfred Kübler verheiratet, der 1943 deportiert und in Auschwitz ermordet wurde. Um das zu wissen, muss man gar nicht, wie es Würger getan hat, die Prozessakten studieren, es reicht schon, dass man das Buch liest, das der Journalist Peter Wyden in den 1990er Jahren auf der Basis breiter Recherchen und auch von Gesprächen mit damals noch lebenden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, nicht zuletzt
2
»Ihn habe die Perspektive interessiert, sagt Würger. Vor allem aber gehe es ihm darum, den Holocaust im Gedächtnis zu halten. Erst vor kurzem habe er gelesen, dass vier von zehn Deutschen über 14 Jahren nicht wüssten, dass Auschwitz-Birkenau ein Vernichtungslager war.« (Mamer 2019)
251
252
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
Stella Goldschlag selbst, über sie geschrieben hat. Wyden, der ursprünglich Weidenreich hieß, kannte Stella Goldschlag aus der Schulzeit in der jüdischen GoldschmidtSchule in Berlin, wo er das bildschöne, begabte und auch manipulative Mädchen angehimmelt hatte. Anders als Stellas Familie gelang derjenigen von Wyden 1937 die Emigration in die USA, und als Wyden nach dem Krieg als US-Armeeangehöriger im Presseamt nach Berlin kam, erfuhr er zu seinem Entsetzen von dem Prozess gegen die ehemalige Greiferin. Jahrzehnte später hatte er die Spur wieder aufgenommen und jenes Buch geschrieben, das auch auf Deutsch übersetzt wurde. Bei Würger jedoch, der Wydens Buch in seiner Bibliographie zum Roman aufführt und in vielen auch nebensächlichen Details verwendet hat, entsteht der ganze Kontakt zwischen Stella (die sich im Roman lange den Decknamen Kristin gibt) und Friedrich überhaupt nur deshalb, weil Friedrich sich in Berlin in einer Zeichenakademie einschreibt, wo Stella als Aktmodell sitzt; zudem arbeitet sie noch als Privatlehrerin für Latein und hat Auftritte als Jazzsängerin im Melodie Club, wo verbotene ›verjudete‹ Musik gespielt wird. Dass Goldschlag den Melodie Club, der später Hot Club hieß, besucht hatte, ist bekannt, auch als Aktmodell in der besagten Zeichenschule hatte sie gearbeitet, aber nicht 1942, sondern früher. Also gibt das Jahr 1942 einerseits nicht mehr das laszive Setting her, das es Friedrich erst möglich macht, sie zu treffen und in der Nobelherberge Adlon mit ihr intim zu werden, andererseits ist es 1942 noch nicht so weit, dass ihre Eltern schon verhaftet waren und nach Auschwitz gebracht werden sollten, was ihren Verrat erst auslöste. Aber 1942 erschien dem Autor eben gut insofern, als damals das Leben in Berlin noch soweit möglich war, dass man mit Mühe und Not einen Schweizer dorthin reisen lassen konnte, zugleich aber doch schon die Vernichtungslager im Osten standen und Menschen deportiert wurden. Nun ja, mag man sagen: Dichterische Freiheit eben. Würgers Stella ist eben nur eine Kunstfigur, an die echte Stella Goldschlag »angelehnt«, wie er gegenüber der Zeitung Neue Presse erklärt hat. (Cvjetkovic 2019) Doch so einfach ist es nicht. Denn Würgers bindungslose Stella, die sich (wie gemäß Wyden auch die echte Stella) soweit als möglich ohne obligaten Judenstern durch die Stadt bewegt und auf ihr ›arisches‹ Aussehen vertraut, hat durch ihren sehr viel weniger streng strukturierten Lebenswandel viel mehr Möglichkeiten, ihren Lebenshunger zu stillen und damit bis zum Exzess zu gehen. So begleitet sie Friedrich und ihren Bekannten Tristan von Appen, der Jazz-Fan, aber zugleich SS-Offizier ist, in einem gemeinsam mit Friedrich aus Jux gestohlenen Haute Couture-Kleid zu einem Fest von Nazi-Eliten am Wannsee (vgl. Würger 2020, 104–112) und amüsiert sich dort prächtig, unter anderem im Gespräch und Tanz mit dem bekannten Nazi-Autor Ernst Hiemer (1900–1974), dem Autor des berüchtigten antisemitischen Machwerks Der Giftpilz. Auf dem Fest scheint von Appen misstrauisch zu werden, und da wir später erfahren, dass er Stella nach ihrem Nachnamen gefragt hat (vgl. Würger, 2020, 121) und unmittelbar nach dem Fest die Verhaftung von Stella und ihren Eltern erfolgt,
Alfred Bodenheimer: Das Buch, die Kritik und der Markt
liegt der Verdacht nahe, sie habe sich durch ihren übermäßigen Hedonismus selbst ins Unglück geritten, zumal sie selbst, als sie mehrere Tage danach von Folterungen gezeichnet wieder zu Friedrich kommt, dauernd wiederholt: »Ich war nicht vorsichtig genug« – worauf sie ihm erst offenbart, dass sie jüdisch ist (Würger 2020, 123). All das hat mit der echten Stella Goldschlag, deren Namen, deren Bild und deren Prozessakte dieser Roman verwendet, überhaupt nichts zu tun, ja, es vermittelt den Eindruck, mit ein bisschen Vorsicht und weniger von der NS-Durchhaltedroge Pervitin, die die Roman-Stella dauernd in Form von Pralinen in sich stopft, wäre es so schlimm vielleicht nie gekommen, und Stella hätte ein relativ bequemes Leben einer Untergetauchten zwischen Hotel Adlon und irgendwelchen sonstigen Unterschlupfen, die der Erzähler und somit auch der Leser nicht kennt, führen können. Die echte Stella Goldschlag hingegen wurde im Sommer 1943, nachdem sie, um der Deportation zu entgehen, mit ihren Eltern einige Monate im Untergrund gelebt hatte, selbst von einer Greiferin ausgeliefert, wie bei Peter Wyden nachzulesen ist (Wyden 2021,132). Demgegenüber wird implizit die Schuld von Würgers Stella noch größer, denn sie scheint die Zwangslage, in der sie sich befindet, durch ihren Leichtsinn und ihre Tollkühnheit selbst herbeigeführt zu haben – was bei der realen Stella Goldschlag, so schwer ihre Taten wiegen, nicht der Fall war. Solche Fragen in einem sensiblen moralischen und historischen Bereich sind mit der dem Roman vorangestellten Vorbemerkung: »Teile dieser Geschichte sind wahr« (Würger 2020, 5) nicht einfach weggeräumt – umso weniger, da der Autor angeblich den Anspruch erhebt, dem Fall Goldschlag adäquat und im besten Falle sogar noch in aufklärend-pädagogischer Weise zu entsprechen. Entkernt man, wie es Würgers Roman tut, Stella Goldschlags Existenz praktisch vollständig ihrer realen Gegebenheiten, rechnet man etwa auch die Dynamik heraus, dass sich die echte Stella im Dienste der Gestapo in einem komplexen Gefüge zwischen ihrem Chef Walter Dobberke und ihrem zweiten Ehemann, dem skrupellosen Greifer Rolf Isaaksohn, bewegte, wird die eigentliche Frage, um derentwillen die literarische Beschäftigung mit dieser Person einen Wert hätte, ausgeblendet. Wyden stellt in seinem Buch diese Frage, und Sascha Feuchert bemüht sich in seinem Nachwort, sie zur Angelegenheit des Romans zu machen. Es ist jene Frage, die seit Hannah Arendts Buch zum Eichmann-Prozess immer wiederkehrt, nach den unterschiedlichen Graden innerjüdischer Kooperation mit den Nationalsozialisten, von den Judenräten über die Ghettopolizei, die Greifer und die Kapos in den Lagern bis hin zu den Sonderkommandos, die für das Verbrennen der Toten zuständig waren. Eine Frage, die umso bedrängender wird in der Zeit, wo die GenozidForschung den Holocaust einzuebnen droht – denn keine andere völkermordende Macht richtete so perfid ein System ein wie jenes der Nationalsozialisten, das Wyden als die von Eichmann und seinen Schergen installierte »Politik der jüdischen Selbstvernichtung« bezeichnet hat (Wyden 2021, 106). Bei Würger hingegen kommt
253
254
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
Friedrich angesichts des Wissens um Stellas Greifer-Tätigkeit (von der uns vorenthalten wird, wie sie sie ihm konkret schildert), zum tiefsinnigen Schluss: »Ich weiß nicht, ob es falsch ist, einen Menschen zu verraten, um einen anderen zu retten. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, einen Menschen zu verraten, um einen anderen zu retten.« (Würger 2020, 209) Das klingt eher nach zeitgeistiger Dilemma-Dramatik im Stile Ferdinand von Schirachs als nach einer Formulierung, vor deren Hintergrund sich das Ausmaß von Auschwitz auch nur ansatzweise ermessen lässt.
2. Dass der literarische Umgang mit historischen Ereignissen insgesamt nicht beliebig ist, sondern einer akribisch gezogenen Linienführung zwischen Fiktion und Realität bedarf, scheint der Roman selbst dadurch zu unterstreichen, dass ihm ein Epilog folgt, in dem einige zentrale Figuren eingeordnet werden. Doch in der HardcoverAusgabe wird genau dieses auktoriale Mittel (das sich nicht mehr auf einen ›unzuverlässigen Erzähler‹ zurückziehen kann) zu einer besonderen Form der Irreführung. Zum einen nämlich befinden sich dort einige Informationen zu historischen Personen, etwa zu Stella Goldschlag selbst, ihrem Auftraggeber Walter Dobberke oder ihrem Berliner Bekannten Cioma Schönhaus (dessen Identität Wyden seinerzeit auf Schönhaus’ Wunsch hin noch geheim hielt). Dann findet sich in diesem historischen Informationsteil auch folgende Bemerkung: »Noah K. wurde deportiert und überlebte, weil er sich freiwillig für die Boxstaffel in Auschwitz meldete. Er lebt heute in Israel am Ende einer Palmenallee. Seine Geschichte geht weiter.« (Würger 2019, 212) Gemeint ist mit Noah K. der Holocaustüberlebende und spätere israelische Sportfunktionär Noah Klieger, der wenige Wochen vor Erscheinen von Stella im Dezember 2018 gestorben war und dem Würger in der Folge ein eigenes Buch mit dem Titel Noah (Würger 2021) gewidmet hat. Als Noah stellt sich in Stella ein jüdischer einstiger Boxmeister vor, der in einer surreal scheinenden Szene in eine Kneipe voller SS-Männer tritt, dort stellvertretend für den furchtsamen Friedrich einen Kerl niederschlägt, der sich mit Stella vergnügt und der trotz des Versuchs von Kameraden des Geschlagenen, ihn zu stellen, unbeschadet den Raum wieder verlässt. Der angedeutete Epilog-Verweis auf Klieger hat in der Realität keinerlei Basis, weil dieser während des Krieges nie in Berlin und schon gar kein ehemaliger Boxmeister war, sondern als Jugendlicher aus Belgien nach Auschwitz deportiert wurde, wo er, obwohl im Boxen gänzlich unerfahren, als Mitglied des von einem Kommandanten zusammengestellten Boxteams überleben konnte. Dass aber diese fiktive Figur im Epilog mit einer realen gleichgesetzt wird, verleiht der irrealen Szene scheinbare Authentizität. In der Taschenbuchausgabe ist der Verweis auf »Noah K.« im Epilog verschwunden, der Boxer in der entsprechenden Szene nennt sich Isaak (Würger 2020, 157).
Alfred Bodenheimer: Das Buch, die Kritik und der Markt
An einem anderen Beispiel im Epilog zeigt sich noch deutlicher, dass der Autor hin- und hergerissen ist zwischen dem Spieltrieb des Romanciers, der in gewisser Weise literarische Freiheit auch als Lizenz zur historischen Irreführung versteht, einerseits und einer Verantwortung vor der Geschichte der Judenvernichtung, zu der er sich nach Erscheinen des Romans bekannt hat, andererseits: an der Figur Tristan von Appens. Der Bonvivant und Jazzfan, der nebenher auch noch SS-Obersturmbannführer ist, erklärt Friedrich bei ihrem letzten Treffen im Oktober 1942, er arbeite an einem Plan, die Juden des Deutschen Reiches nach Madagaskar zu verbringen. In der Erstausgabe wird von Appen im Epilog ebenfalls erwähnt. Kurz nach Weihnachten 1942, heißt es dort, sei von Appen von der Gestapo festgenommen worden, während er zwischen Süßrahmbutter und Roquefort schwebte und Benny Goodman hörte, und weiter: Die Staatsanwaltschaft erhob im Eilverfahren Anklage wegen Sabotage, Schleichhandels und Vaterlandsverrat gegen von Appen, weil er gegen die Kriegswirtschaftsverordnung, das Lebensmittelgesetz und gegen die Volksschädlingsverordnung verstoßen hatte. Der Richter sprach in seinem Urteil von einem Präzedenzfall, da von Appen Obersturmbannführer der SS war, und verurteilte ihn zum Tode durch den Strang. Er wurde in Berlin-Schöneberg gehängt. Die Arbeit am sogenannten Madagaskarplan wurde eingestellt. (Würger 2019, 211) In der Taschenbuchausgabe ist auch dies geändert worden. Hier heißt es zu von Appen lapidar: »Tristan von Appen ist eine fiktionale Figur. Der Madagaskar-Plan wurde 1939 eingestellt.« (Würger 2020, 223) Man schreckt zurück. Hat Takis Würger sich tatsächlich, gemäß seinem Verständnis von schriftstellerischer Lizenz, den Spaß erlaubt, bei der Figurenerklärung im Epilog die Leserinnen und Leser der Erstausgabe kichernd auf eine falsche Spur zu leiten und ihnen den erfundenen von Appen als scheinbar reale Figur zu verkaufen? Einfach um die Verwirrung komplett zu machen? Geht es ihm am Ende darum und gar nicht um einen der verstörendsten Stoffe aus der Geschichte des Holocaust? Ist am Ende einfach alles ein großer Spaß, ein romaneskes Ratespiel auf der Folie von Verrat und Massenmord? Und dann reibt man sich, der Änderung in der Taschenbuchausgabe gewärtig, erneut die Augen. Es werden wohl Rückfragen aus der Leserschaft gewesen sein, die Autor und Verlag zu einer Offenlegung der Fiktionalität von Appens bewegten – aber ist nun die Bemerkung zum Madagaskarplan eine neuerliche Finte, oder beruht sie auf der Unfähigkeit des Autors, immerhin eines Spiegel-Journalisten, einfach zu ermittelnde historische Daten richtig wiederzugeben? Der Madagaskarplan, den es ja tatsächlich gab, der seine Vorläufer in vorangehenden Plänen u.a. der polnischen Regierung besaß und der seitens des Dritten Reiches weit mehr als nur die Juden Deutschlands in den Blick nahm, wurde von der deutschen Regierung mitnichten 1939 eingestellt, sondern erlangte überhaupt erst 1940, nach dem Sieg gegen die Kolonialmacht Madagaskars, Frankreich, relevante
255
256
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
Bedeutung in der deutschen Führung. Er wurde 1942 eingestellt, und zwar schon in der ersten Jahreshälfte nach der Wannseekonferenz, vollständig aber nach der Landung der Briten in Madagaskar im Mai. Dazu gibt es ausreichend Fachliteratur3 und, wenn man es einfacher möchte, auch einen gut recherchierten Wikipedia-Eintrag (Madagaskarplan [2022]). Ist es einfach egal, wann und wie historische Prozesse im Umfeld des Holocaust abliefen, wenn man einen Holocaust-Roman schreibt, muss einfach nur der Plot hübsch genug sein, und ist der Madagaskarplan einfach ein Gag, der auch noch rein sollte? Ist dies das, was den von Würger beklagten 40 Prozent der über 14jährigen Deutschen hinterbracht werden muss, die nicht wissen, was Auschwitz-Birkenau war (vgl. Mamer 2019)? Stolz verweist der Autor darauf, von drei Historikern beraten worden zu sein, Literatur und Akten gewälzt zu haben, und ja, tatsächlich habe man im Bombenkeller des Adlon während der Angriffe Wein und Schokolade serviert, wie er es im Roman schildere (vgl. Bartels/Würger 2019). Ist das die historische Wahrheit, die er übermitteln will, weil sie so hübsch klingt, während alles andere gerade so zurechtgestutzt wird, wie es passt? Relotius reloaded im Dunstkreis der Judenvernichtung?
3. Die Frage, ob es ein einigermaßen kohärentes Literaturverständnis bei einem Autor gibt, der einen brisanten historischen Stoff so nachlässig behandelt und zu einer bittersüßen Romanze mit moralischem Wermutstropfen hinunterschraubt, stellt sich dann doch – und sie lässt sich m.E. beantworten. Interessanterweise gehörte just die Jüdische Allgemeine zu jenen Medien, die Würgers Roman etwas abgewinnen konnten. In dem Interview, das Philipp Peyman Engel dort mit ihm führte, um dem Autor Raum zur Widerlegung der gegen ihn gerichteten Vorwürfe zu geben, findet sich eine Bemerkung Würgers, die unauffällig daherkommt, aber genau betrachtet den Schlüssel zum Verständnis dieses Romans bildet. Was Würger denjenigen antworte, die behaupteten, er instrumentalisiere in dem Roman die Shoa, lautet die Frage – und die Erwiderung des Autors: »Hat Bernhard Schlink die Schoa instrumentalisiert, als er den Vorleser schrieb?« (Peyman Engel 2019) Zwar erwähnt Würger noch andere Autorinnen und Autoren und Werke, aber eigentlich ist es klar: Die Struktur von Stella entspricht der Struktur des Vorlesers – und in gewisser Weise tut es auch die Schlussfolgerung, die die Erzählstimme des Romans zieht. Im Vorleser wie in Stella erleben wir die Begegnung eines unbedarften Jungen oder jungen Mannes (der in beiden Fällen auch der Ich-Erzähler ist) mit einer weit erfahreneren Frau, über die er fast nichts weiß, die ihn aber vollständig in ihren 3
Genannt seien hier mit Jansen 1997 und Brechtken 1997, 226–283, nur die beiden Standardwerke zum Thema.
Alfred Bodenheimer: Das Buch, die Kritik und der Markt
erotischen Bann schlägt und weitgehend dominiert. Die Faszination, die beschrieben wird, gleicht sich bis ins Detail. Der fünfzehnjährige Michael Berg, der Hanna Schmitz im Vorleser erstmals bei ihr zu Hause beim Anziehen zusieht, ist so fasziniert, dass er die Augen nicht von ihr lassen kann (Schlink 1997, 15), Friedrich ist nicht imstande, den Akt Stella zu malen, als er sie erstmals sieht, und schaut sie einfach nur an (Würger 2020, 41). Hannas Überlegenheit kommt von ihrem Altersabstand zu Michael, der 21 Jahre beträgt, sie ist seine Geliebte, aber zugleich seine sexuelle Erzieherin, und ihr Verhältnis wird zunehmend hierarchisch. »Wenn sie drohte, habe ich bedingungslos kapituliert« (Schlink 1997, 50). Über Stella sagt Friedrich: »Sie war eine starke Frau, ich war schwach.« (Würger 2020, 144) Auch das Nichtwissen um den Namen der Frau spielt in beiden Romanen eine Rolle: Erst nach mehreren Tagen fragt Michael Hanna, die er bis dahin nur als Frau Schmitz kennt, nach ihrem Vornamen und weckt damit ihr Misstrauen, auch wenn sie ihm ihren Namen danach lachend nennt (Schlink 1997, 35), Friedrich wiederum kennt Stella lange Zeit nur unter dem Decknamen Kristin, und nach vielen Monaten, als ihn von Appen nach Kristins Nachnamen fragt, stellt er fest, dass er ihn nicht weiß (Würger 2020, 106). Beide Erzähler wissen auch nicht, was die Geliebte macht, wenn sie nicht mit ihnen zusammen ist. »Ich habe nie erfahren, was Hanna machte, wenn sie weder arbeitete noch wir zusammen waren. Fragte ich danach, wies sie meine Frage zurück. Wir hatten keine gemeinsame Lebenswelt, sondern sie gab mir in ihrem Leben den Platz, den sie mir geben wollte. Damit hatte ich mich zu begnügen.« (Schlink 1997, 75) Auch Stella entzieht sich dauernd, sie bleibt nie über Nacht bei Friedrich und erlaubt ihm keinen Einblick in ihr Privatleben. Zu einem bestimmten Zeitpunkt verschwinden sowohl Hanna (um nicht befördert und als Analphabetin enttarnt zu werden) wie auch Stella (weil sie verhaftet wird) ohne Abschied, und beide Male sind es die jungen Männer, die sich irrtümlicherweise Selbstvorwürfe machen. Weil Michael sie im Schwimmbad ignorierte, als er Hanna dort gesehen hat, weil er sich vor seinen Freunden schämte, empfindet er nach ihrem Weggang Schuld (Schlink 1997, 80), und auch Friedrich meint, er habe am Vorabend am Wannsee etwas falsch gemacht, als er die Geliebte auf ihre antisemitischen Äußerungen im Gespräch mit dem Autor Hiemer angesprochen hatte (Würger 2020, 116). Beide leiden seelisch und körperlich an der Abwesenheit der Geliebten. In beiden Fällen auch ist das spätere Wiedersehen mit unangenehmen Erkenntnissen des Erzählers über die geliebte Frau verbunden. Im Vorleser dauert es Jahre, bis Michael als Jura-Student Hanna als Angeklagte im Gerichtssaal sieht und von ihrer Rolle als KZ-Aufseherin erfährt. Nach und nach erschließt sich ihm, dass ihr Analphabetismus ihr ganzes Leben geprägt hat – immer wieder ist sie vor Entwicklungen weggelaufen, die von ihr verlangt hätten, eine Aufgabe zu übernehmen, die zwingend das Lesen erfordert hätte. Zuletzt führt die Scham, den Analphabetismus zuzugeben, soweit, dass sie, bloß um einem gerichtlich verlangten Schriftver-
257
258
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
gleich zu entgehen, erklärt, als SS-Angehörige einen sie inkriminierenden Bericht geschrieben zu haben, was sie in der Folge in die Rolle der Hauptschuldigen beim Verbrennen Hunderter von jüdischen Frauen drängt. Bei Stella dauert es nur acht Tage bis zum Wiedersehen mit Friedrich, aber sie ist in dieser Zeit, durch Folter und faktische Erklärung ihrer Eltern zu Geiseln, gefügig gemacht worden und bereit, für die Gestapo nach dem Papierfälscher Cioma Schönhaus und, da sie diesen nicht fassen kann, nach vielen anderen im Untergrund lebenden Juden und Jüdinnen zu fahnden. So wie Michael Berg erfährt, dass seine Geliebte eine SS-Wärterin war, erfährt Friedrich, dass Kristin eigentlich Stella heisst, Jüdin ist und nun einen Auftrag der Gestapo auszuführen hat. Ähnlich sind auch die Reaktionen beider Erzähler auf die Erkenntnis der Schuldverstrickung der geliebten Frau. Beide generieren eine Art Schuldausgleich, der zur Entlastung der Frau und zur Selbstbezichtigung führt. Bei Schlink klingt das so: Nein, habe ich mir gesagt, Hanna hatte sich nicht für das Verbrechen entschieden. Sie hatte sich gegen die Beförderung bei Siemens entschieden und war in die Tätigkeit als Aufseherin hineingeraten. Und nein, sie hatte die Zarten und Schwachen nicht mit dem Transport nach Auschwitz geschickt, weil sie ihr vorgelesen hatten, sondern hatte sie fürs Vorlesen ausgewählt, weil sie ihnen den letzten Monat erträglich machen wollte, ehe sie ohnehin nach Auschwitz mußten. (Schlink 1997, 128) Während also Hanna entlastet wird, belastet Michael Berg sich selbst. Ich war sicher gewesen, sie vertrieben, weil verraten und verleugnet zu haben, und tatsächlich hatte sie sich einfach einer Bloßstellung bei der Straßenbahn entzogen. Allerdings änderte der Umstand, daß ich sie nicht vertrieben hatte, nichts daran, daß ich sie verraten hatte. Also blieb ich schuldig. Und wenn ich nicht schuldig war, weil der Verrat einer Verbrecherin nicht schuldig machen kann, war ich schuldig, weil ich eine Verbrecherin geliebt hatte. (Schlink 1997, 129) Bei Würger verteilt sich diese Ambivalenz, weit weniger artikuliert, über mehrere, kürzere Passagen gegen das Ende des Buchs. Wir zahlten Schwarzmarktpreise und aßen Austern und Bienenstich, wir tranken Kognak, zeichneten mit Kohle, hörten Swing und selten tanzten wir. Manchmal schafften wir es, Stellas Eltern zu vergessen. Wir machten uns schuldig, jeder auf seine Art. (Würger 2020, 186) Ich wollte mich verkriechen, weil ich wusste, dass ich dem Schicksal nicht gewachsen war, aber es mischte sich ein anderes Gefühl dazu. Ich spürte eine Verbundenheit mit Stella. Sie tat etwas, für das andere Menschen sie hassten, und ich stand bei ihr. Ich verstand sie nicht, aber ich stand. (Würger 2020, 209)
Alfred Bodenheimer: Das Buch, die Kritik und der Markt
»Es ist alles meine Schuld«, sagte sie leise. Ich spürte ihren Atem an meinem Hals. »Schuld gibt es gar nicht«, sagte ich. (Würger 2020, 215). Als Friedrich schließlich, zu Weihnachten 1942, Berlin überstürzt in Richtung Schweiz wieder verlässt, heißt es: Ich dachte an eine Lügnerin. Ich wusste nicht, wie viele Menschen sie verraten hatte, hundert, zweihundert. Ich dachte an meine Frau. Ich dachte an dich. […] Der Zug rollte an. Ich entknotete meine Fliege und steckte sie in die Innentasche meines Smokings, meine Fingerspitzen berührten einen Zettel. Vater hatte Unrecht. Es gibt Schuld. Ich schaute aus dem Fenster auf die Lichter Berlins und wusste, dass mir für immer etwas fehlen würde, aber ich war auch dankbar. Du wirst meine schönste Erinnerung bleiben. Danke, dass du mir gezeigt hast, was Liebe ist. (Würger 2020, 221) Es geht hier nicht primär darum, Würger zu unterstellen, er habe mit der Vermischung von Schuld, Liebe und Holocaust versucht, schlicht ein Erfolgsrezept von Schlink nachzustellen – wenn auch eine Analogie zu den Konstellationen des Vorlesers offenkundig ist. Entscheidend ist vielmehr, dass sich der Diskurs der Schuldfrage, den Schlink aus der Perspektive der ersten Nachkriegsgeneration in Deutschland angeht, gut zwanzig Jahre später auf eine andere Ebene verschoben hat. Wenn bei Schlink, wie etwa Ruth Franklin in ihrer Analyse des Vorlesers gezeigt hat, auf der Folie der Liebesbeziehung die dialektische Beziehung von persönlicher Nähe und objektiver Schulderkenntnis gegenüber der Generation der Eltern abgearbeitet wird (vgl. Franklin 2011, 199–214), so ist bei Würger die romantische Erzählung Grundlage einer literarischen Docufiction geworden, die zum Teil gerade dort, wo sie auf historische Zuverlässigkeit referiert, mit Finten und Fehlern arbeitet und die den moralisch unfassbaren Vorgang der Verfolgung und Vernichtung der Juden zum moralischen Grübelstoff eines nachdenklich im bequemen Nachtzug entschwindenden Liebhabers eindampft. Womöglich ist die Lektüre des Romans aber genau deshalb instruktiv – und beängstigend. Wenn nämlich die Gegenwart der Auseinandersetzung mit dem Holocaust etwas auszeichnet, dann ist es oft nicht so sehr eine komplette Ignoranz des Geschehenen als vielmehr die Disparatheit, die Ungenauigkeit des Zugangs und die Beliebigkeit der Perspektiven, die sich in Massen- und sozialen Medien auf diesem unsicheren Grund formen. Gerade dies aber, so scheint es, ist für die Übermittlung des größten Menschheitsverbrechens die allerschlechteste Voraussetzung. Es führt in die Irre, erlaubt Verallgemeinerungen und schiefe Vergleiche, verwischt Strukturen, Entwicklungen und Hemmnisse, die zwingend zur Geschichte der Shoa und ihrem Verständnis gehören. Anders als bei Schlink, wo gerade die moralische Herausforderung, Schuld zu definieren, als existentielle Aufgabe einer ganzen Generation hervorbricht, begnügt sich eine Generation später Würger sinnbildlich mit der
259
260
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
Formel: ›Gut, dass wir darüber geredet haben.‹ Damit, so sein Anspruch, wolle er dem Vergessen entgegenarbeiten. Doch das, was nicht vergessen werden soll, wird hier durch etwas ersetzt, was die Erinnerung manipuliert. Nicola Gess hat jüngst in ihrem breit rezipierten Buch Halbwahrheiten dargelegt, dass gerade darin die allergrösste Gefahr für die Verständigung unserer Gesellschaft über ihre Wirklichkeit liegt (vgl. Gess 2021).
Literatur Bartels, Gerrit/Würger, Takis. »Takis Würger und Stella. ›Der Vorwurf der Leichtfertigkeit trifft mich‹«. In: Tagesspiegel (20.01.2019). https://www.tagesspiegel.d e/kultur/takis-wuerger-und-stella-der-vorwurf-der-leichtfertigkeit-trifft-mic h/23886660.html (10.03.2023). Brechtken, Magnus. »Madagaskar für die Juden«. Antisemitische Idee und politische Praxis 1885–1945. München 1997. Debatte über den Roman »Stella« von Takis Würger. Anwalt kritisiert »Banalisierung«. Karl Alich im Gespräch mit Frank Meyer. Deutschlandfunk Kultur (31.1.2019). https://w ww.deutschlandfunkkultur.de/debatte-ueber-roman-stella-von-takis-wuerge r-anwalt.1270.de.html?dram:article_id=439811 (20.08.2021) Cvjetkovic, Mirjana. »Takis Würger gibt Stella ein Gesicht«. In: Neue Presse (08.01.2019). https://www.neuepresse.de/lokales/hannover/zweiter-roman-ta kis-wuerger-gibt-stella-ein-gesicht-QOLHCMFBWQMLQY5EQYLI5T2MTM.h tml (20.03.2023). »Erfundene Zitate. Darum geht es in dem Fall Robert Menasse«. In: Der Spiegel (04.01.2019). https://www.spiegel.de/kultur/literatur/robert-menasse-schriftst eller-hat-zitate-erfunden-der-ueberblick-a-1246396.html Feuchert, Sascha. »Nachwort«. In: Takis Würger. Stella. Roman. München 2020, 229–238. Franklin, Ruth. A Thousand Darknesses. Lies and Truth in Holocaust Fiction. Oxford et al. 2011. Gess, Nicola. Halbwahrheiten. Zur Manipulation von Wirklichkeit. Berlin 2021. Jansen, Hans. Der Madagaskar-Plan. Die beabsichtigte Deportation der europäischen Juden nach Madagaskar. Aus d. Niederl. v. Markus Jung/Ulrike Vogl/Elisabeth Weissenböck. München 1997. Knipphals, Dirk. »Relotius, Menasse und der Roman Stella. Wunsch nach Lektüreporn«. In: taz (20.01.2019). https://taz.de/Relotius-Menasse-und-der-Roman-S tella/!5564017/ Madagaskarplan. https://de.wikipedia.org/wiki/Madagaskarplan (26.07.2022).
Alfred Bodenheimer: Das Buch, die Kritik und der Markt
Mamer, Blance. »Die Nähe von Schönheit und Terror«. In: Süddeutsche Zeitung (01.03.2019). https://www.sueddeutsche.de/muenchen/starnberg/lesungdie-naehe-von-schoenheit-und-terror-1.4351304 (19.08.2021). Papst, Manfred. »Ausgerechnet ein Edelverlag veröffentlicht diesen Nazikitsch, ein Machwerk der übelsten Sorte«. In: NZZ am Sonntag (27.01.2019). https://magazi n.nzz.ch/kultur/stella-takis-wuerger-machwerk-der-uebelsten-sorte-ld.14545 69?reduced=true (10.03.2023). Peyman Engel, Philipp. »Eine wichtige Debatte«. In: Jüdische Allgemeine (16.01.2019). https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/eine-wichtige-debatte/(19.06.2023). Schlink, Bernhard. Der Vorleser. Zürich 1997. Würger, Takis. Stella. Roman. München 2019. Würger, Takis. Stella. Roman. München 2020. [Taschenbuchausgabe] Würger, Takis. Noah. Von einem, der überlebte. München 2021. Wyden, Peter. Stella Goldschlag. Eine wahre Geschichte. Aus d. Amerik. v. Ilse Strasman. Göttingen 2021.
261
Terror & Entertainment. Christopher Roths Baader und die Schwierigkeiten der Erinnerung Jörn Ahrens
Diesen Text, der sich für die Tücken kultureller Erinnerung interessiert, beginne ich mit drei persönlichen Erinnerungen. Eins: Im Jahr 2002 erlebe ich die Aufführung von Christopher Roths Baader in dessen erster Vorführung im Wettbewerb der Berlinale. Vollbesetztes Wettbewerbskino am Potsdamer Platz, das Publikum bleibt während des Screenings ganz brav, im Anschluss jedoch tumultuöse Szenen. In meiner Erinnerung kippt auf der Galerie eine Frau beinahe übers Geländer, so weit lehnt sie sich vor, ruft immer wieder an Roth gewandt: »Warum zeigst du nicht die Wahrheit?!« Ich selbst sitze im Parkett und schaue fasziniert rauf, verstehe diese Fehleinschätzung überhaupt nicht, bin begeistert vom Film und kann die skandalträchtige Aufregung darüber, die über die Pressekonferenz und in der Berlinale Berichterstattung folgt, beim besten Willen nicht verstehen. Zwei: 1986, ich besuche die zwölfte Klasse eines ländlichen Gymnasiums, organisieren wir als ›Terrorismus-AG‹ einen Kinobesuch, um Reinhard Hauffs Stammheim zu sehen. Vor dem Kino demonstrieren autonome Gruppen gegen den Film, es hat auch schon Buttersäureanschläge auf Kinos gegeben, die den Film zeigen. In Braunschweig passieren wir eher eine Art Mahnwache, nehmen Flugblätter entgegen, die sich in meiner Erinnerung vor allem dagegen wenden, dass Hauff sowohl den Tod Ulrike Meinhofs 1974 als auch die Tode von Stammheim 1977 als Selbstmorde interpretiert und nicht als Staatsmorde. Der Film, dem ansonsten größtmögliche Authentizität in der Rekonstruktion der Ereignisse, vor allem des Stammheimer Verfahrens gegen die erste Generation der RAF bescheinigt wurde, polarisiert seinerzeit enorm, weil er nicht nur die Erinnerung an die RAF insgesamt, die damals noch absolute Aktualität war, ganz neu und nachdrücklich ventiliert, sondern auch, weil hier jemand, der als linksintellektuell gilt, der These vom Mord an den Kadern nicht mehr folgt und die Selbstmordversion allgemein kulturfähig macht. Insofern bedeutet Stammheim wohl eine Art Diskurszäsur. Während es heute nahezu absurd erscheint, die Selbstmordversion noch in Frage zu stellen, konnte sie vor 35 Jahren noch nachdrücklich provozieren. Jedenfalls saßen wir ziemlich beeindruckt im Ki-
264
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
no. Als linken Schüler:innen war uns die Inszenierung der Klaustrophobie des Prozesses, die Illustration der Isolationshaft, immer Ulrike Meinhofs kanonische Zeilen im Kopf, die Dokumentation der Unzulänglichkeit des vorsitzenden Richters, viel wichtiger als die Frage nach Mord oder Selbstmord. Drei: 2005 gebe ich am Kulturwissenschaftlichen Seminar der Humboldt-Universität zu Berlin ein Seminar über Filme zur RAF und zeige u.a. Stammheim (Baader ist seinerzeit als DVD noch nicht erhältlich). Die sehr klugen, sehr kritischen und höchst kulturaffinen Studierenden empfinden den Film, den ich selbst als prägend erlebt habe, als ungeheuer öde, artifiziell, theaterhaft. Nach dem Seminar sitzen wir lange in einer Kneipe und diskutieren. Der Reigen privater Erinnerungen an kulturelle Spurenreste im Umgang mit dem Linksterrorismus in Deutschland zeigt, was Sozial- und Kulturwissenschaftler:innen ohnehin wissen, weil es zu den Selbstverständlichkeiten kultureller Semiotik und Performanz gehört: dass sich Modi kultureller Erinnerung permanent verschieben. Sie tun dies, weil sie als Erinnerungsspuren Resultate kultureller Praktiken sind, von sich beständig anpassenden Rahmensetzungen eines sich je nach Diskurslage neu ausrichtenden, historischen Narrativs. Dies vorausgesetzt, stellt sich die Frage, weshalb manche Kulturartefakte kontrovers oder ablehnend aufgenommen werden, während andere entweder keine besondere Aufmerksamkeit erfahren oder aber ausgesprochen positive Resonanz auslösen. Prekär ist in dieser Perspektive immer das Verhältnis von Kultur und Geschichte, weil Geschichte notwendig über Formen kultureller Repräsentation vermittelt wird, bei denen zwar fraglich ist, inwieweit sie sich zu den historischen Begebenheiten kongruent verhalten, die aber das Bild von Geschichte zumindest nicht unwesentlich mitprägen. Jeder Film trifft daher immer auch eine Aussage über das historische Geschehen, das er zeigt, ordnet Begebenheiten ein, interpretiert Situationen und Figuren. Die Frage, ob es einen Film geben kann, der nicht interpretativ vorginge, der lediglich historisches Geschehen abbildete und den Rezipient:innen zur Verfügung stellte, stellt sich daher im Grunde nicht. Einen solchen Film kann es nicht geben. Roths Baader ist ein moderner Historienfilm mit akkurater Ausstattung. 2002 produziert, erhält Baader gemischte Kritiken. Unter den wohlwollenden Verrissen findet sich Stefan Reineckes Kritik aus der taz vom 18. Oktober 2002: »Angesichts der stotternden Unschlüssigkeit dieser Inszenierung läuft eigentlich jede kritische Anstrengung ins Leere. Auch zum Radical Chic fehlt Baader, hilflos zwischen Gangsterfilmzitat, Fernsehspiel, Action und Studententheater schwankend, Sinn für Timing, Inszenierung, Überhöhung« (Reinecke 2002). Und Reinecke schließt seinen Text mit der Sentenz: »Nach Baader möchte man gerne einen Film sehen, der etwas präzise erzählt. […] Einen Film, der sich für Erfahrungen interessiert, nicht für Klischees« (ebd.). Ganz anders hingegen äußert sich Rainer Gansera in der Süddeutschen Zeitung vom 17. Mai 2010, der eine gerade Linie von Roth zu Godard zieht und feststellt:
Jörn Ahrens: Terror & Entertainment
In den ersten Minuten des Films fragt man sich immerfort: War es damals wirklich so, da stimmt doch was nicht. […] Es ist wichtig, diese Frage schnell abzustellen und sich dem Film zu überlassen, als sei er ganz und gar erfunden, um dann zu entdecken, dass gerade die ausdrücklich fiktiven Passagen in erstaunlichem Maß der Wahrheitsfindung dienen. So erkennt man die Filme, die in den Köpfen der Figuren ablaufen und zur Selbststilisierung werden, so kann der 1964 geborene Christopher Roth sich die Historie aneignen. (Gansera 2010) In einem Punkt haben diese Kritiken etwas gemeinsam und stehen somit stellvertretend für die Auseinandersetzung um Roths Baader. In beiden Fällen geht es um die Verhandlung der Bedeutung von Wahrheit, mindestens von Wahrhaftigkeit. Kann ein Film für sich beanspruchen, die (historische) Wahrheit abzubilden und, noch vielmehr, sollte er diesen Anspruch überhaupt für sich formulieren? Schließlich, was heißt filmische Wahrheit überhaupt, welches ästhetische, aber auch kulturprogrammatische Konzept könnte für eine Form von Wahrheit einstehen? Interessanterweise kommt nur wenig später als Baader, 2004, ein weiterer deutscher Film in die Kinos, der rasch mit seinem Anspruch auf Abbildung einer grundsätzlich unzugänglichen historischen Wahrheit konfrontiert und ebenfalls höchst kontrovers diskutiert wird. Der Film heißt Der Untergang und beschreibt die letzten Tage Adolf Hitlers im Führerbunker zu Berlin. Auf Spiegel.de vom 15. September 2004 spricht Andreas Borcholte vom »Deckmantel der Quasi-Authentizität« und resümiert: »Am Ende des Bunkerspiels bleibt nur die Faszination der akkuraten HitlerDarstellung, weil sie den Reiz des Verbotenen besitzt. Erkenntnisse über die agierenden Menschen, ihre Beweggründe und Motivationen bietet der Film nicht an.« (Borcholte 2004) Geht es in beiden Fällen um Probleme eines filmischen Umgangs mit der Wahrheit oder vielmehr des Zugangs zu dieser, so steht doch einmal im Vordergrund das Misslingen ihrer Rekonstruktion, auch der von de facto historisch nicht zugänglichen Sequenzen, so bei Der Untergang, während im andern Fall, also bei Baader, die Fallstricke einer Korrektur der Wahrheit das Thema sind. Mindestens einen Fehler begeht Roths Baader nämlich gerade nicht: Er beansprucht für sich nicht, die bessere historische Erkenntnis zu liefern, als dies eine Geschichtswissenschaft jemals könnte, für die auch die Figur Baader ganz sicher maximal unzugänglich bleibt. So verwechselt dieser Film in keinem Moment Wahrheit mit Authentizität. Genau dies beansprucht aber Eichingers und Hirschbiegels Der Untergang, deren von Bruno Ganz verkörperter Hitler in der kulturellen Imago an die Stelle des historischen Hitler treten soll. Roths Konzept von Wahrheit funktioniert ganz anders und fällt nur im Idealfall auch mit Authentizität zusammen. In Wirklichkeit aber trennt er die Wahrheit, der Geschichte ebenso wie die der Figuren (dieser vor allem), radikal von der Authentizität der historischen Darstellung ab. Es ist auch nicht so, dass Baader frei von Geschichte wäre. Im Gegenteil hält sich Roth über weite Strecken durchaus akribisch
265
266
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
ans historische Script, dessen verbriefte Stationen er gerade im ersten Drittel des Films ziemlich brav abfilmt. Das geht schnell und wird nicht weiter eingeführt. Vom Publikum wird erwartet, dass es auch Austs Baader Meinhof Komplex gelesen hat (Aust 1986), um mit der Szenenfolge Schritt halten zu können. Tatsächlich muss das Publikum in Baader eine Unmenge an Vorwissen mitbringen, das hier für ein akkurates Filmverständnis notwendig ist, gerade auch wenn es darum geht zu verstehen, wo der Film Wahrheit und Authentizität endgültig trennt. Der ignorante Blick, wie ihn etwa Thomas Vorwerk auf satt.org mit unverhohlenem Stolz dem Film angedeihen lässt, hilft da nicht weiter, denn es ist nicht damit getan, Roths Baader schlicht als Genrefilm zu verstehen (vgl. Vorwerk 2002). Das ist er, wie jeder Film, zwar auch, geht aber bei weitem darin nicht auf, sondern stellt konsequent weitreichende Fragen zu den Möglichkeiten einer filmischen Inszenierung von Wahrheit. Hier muss man nicht nur jeweils sehr genau wissen, was gerade wo abläuft, sondern auch, welcher Charakter welche Figur darstellt oder welche Figurenverdichtung von einzelnen Protagonist:innen verkörpert wird. Im Grunde muss dieses Publikum auch über ein hinreichendes historisches Bildwissen verfügen, muss zeitgeschichtliche Fotos kennen, die Roth gern nachstellt, als sei sein Film ein nicht enden wollendes Tableau vivant. Im Gegensatz zu seinem Image im Diskurs, das von Roths Baader annimmt, er nehme sich allzu viele Freiheiten im Sinne einer spekulativen Filmerzählung erfordert dieser Film also von den Rezipient:innen zunächst ein gerüttelt Maß an zeithistorisch esoterischem Spezialwissen, das mit Sicherheit nur ein Bruchteil des Publikums mitbringt. Die spekulative Ebene der Wahrheitszeichnung, die den Film stilistisch insbesondere auszeichnet, besteht darin, dass er an entscheidenden Punkten seine ganz eigene Wahrheit der Dinge findet oder vielmehr erfindet, Baader schreibt das Geschehen um, interpretiert es neu. Auch wenn Hirschbiegel das in seinem Untergang natürlich ganz ebenso macht, und auch gar nicht anders machen kann, so trennt beide Produktionen doch der Umstand, dass Der Untergang, ganz altbackener Historienfilm, genau dieses Vorgehen unter dem Deckmantel der Authentizität kaschiert, während Baader an eben diesem Vorgehen faktisch keinen Zweifel lässt. Hier wird Geschichte zum Randthema. Während im Vordergrund ganz die Figur des Baader steht und sein Name alles andere vollkommen dominiert. Tatsächlich fällt der Terminus Rote Armee Fraktion im ganzen Film kein einziges Mal, was bemerkenswert ist in einem Film, der nach landläufigem Verständnis von genau deren Gründung und kurzer Geschichte bis 1972 handeln sollte. Viel wichtiger als das historische Moment, als die Politik, ist diese eine Figur und ihr vermeintliches Charisma, für das der historische Baader bekanntlich schon zu Lebzeiten legendär war. Mit seinem Baader streift Roth hingegen alle Heldenverehrung ab. Dieser Baader ist völlig unpolitisch, bleibt ein Kleinkrimineller im Milieu der Revolution und lebt vor allem davon, dass er reine Virilität verkörpert. Im Unterschied zum historischen Baader verkörpert der Film-Baader dies aber konsequent. Vielmehr ist er strikt gegen sein Image be-
Jörn Ahrens: Terror & Entertainment
setzt und wirkt nicht besonders attraktiv – Roths Baader ist klein, dicklich, pausbäckig. Sein Charisma, seine Virilität, seine mangelnde Attraktivität kompensiert er lediglich durch seine aggressive, misogyne Sprache sowie, ganz wie sein filmisches Vorbild Clyde Barrows, durch die Waffe, die vorn im Hosenbund steckt. Roths Baader ist eine oberflächenhafte James Dean-Figur, die buchstäblich nicht weiß, was sie tut. Das ist der einzige Hintergrund, den der Film sorgsam vorbereitet. Dieser Baader ist ein wilder Lebemann, und genau so wird er historisch allseits geschildert, nicht nur bei Stefan Aust, von dem freilich die Geschichte mit den roten Samthosen im Fatah-Camp stammt. Von Politik hingegen weiß dieser Baader nichts. Baader sitzt in Stadelheim wegen Fahrens ohne Führerschein in einem gestohlenen Wagen im Englischen Garten zu München. Dort besucht ihn seine Frau mit dem gemeinsamen Kind, dem Baader zärtlich den Rauch seiner Zigarette ins Gesicht bläst, und sie erzählt von Berlin, Kommune 1, Verhaftungen, dem Pudding Attentat auf den amerikanischen Vizepräsidenten Humphrey. Baader kennt nichts davon, aber schon in der nächsten Szene zeigt ihn Roths Film, was sich die Rezipient:innen auch erst einmal zusammenreimen müssen, in einer Bar in Berlin. Dort fällt er insbesondere dadurch auf, dass er markige Sprüche klopft, die militant und gewaltbereit klingen, sich aber letztlich im »Auf die Fresse!« erschöpfen. Die Studierenden werden deshalb auch gleich misstrauisch gegenüber diesem dahergelaufenen Aktionisten, sind aber zu konziliant, um ihn offensiv anzugehen. Immerhin beeindruckt Baader als Macho Ende der 1960er Jahre noch die Frauen, insbesondere Gudrun Ensslin, die ihn sieht, fasziniert erregt ist und gleich flirtet. Das wäre also Baader und seine Wirkung als Testosteron-Revolutionär, der weder von Politik noch von Theorie oder Programmatik auch nur annähernd etwas versteht. Im Film verdichtet sich genau so schließlich auch die Rekrutierung von Ulrike Meinhof in die Gruppe. Im Prozess erblickt Baader die Meinhof, wie sie im Publikum sitzt, aufmerksam zuhört, Notizen macht. Viel mehr noch als der Prozess selbst, als das Forum mit Richter:innen und Sympathisant:innen ist offenkundig sie es, die ihm erstmals das Gefühl gibt, bedeutend zu sein, ein Performer, dessen Auftreten dokumentiert wird. Angeklagt wegen der Frankfurter Kaufhausbrandstiftung, hat Baader selbst gar keine Ahnung, für was er eigentlich einsteht, ihm fehlt der Zugang zu jedweder Meta-Ebene seiner Tat. Diese erschließt sich ihm erst über die im Film für einen Moment groß ins Bild geholte Kolumne Ulrike Meinhofs zur Warenhausbrandstiftung: Gegen Brandstiftung im allgemeinen spricht, daß dabei Menschen gefährdet sein könnten, die nicht gefährdet werden sollen. Gegen Warenhausbrandstiftung im besonderen spricht, daß dieser Angriff auf die kapitalistische Konsumwelt […] eben diese Konsumwelt nicht aus den Angeln hebt, sie nicht einmal verletzt, das, was sie treibt, selbst treibt, denen, die daran verdienen, Verdienste ermöglicht. […] Das progressive Moment einer Warenhausbrandstiftung liegt nicht in der
267
268
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
Vernichtung der Waren, es liegt in der Kriminalität der Tat, im Gesetzesbruch (Meinhof [1968] 1988, 153f.). Ungefähr diese Passage rezitiert auch der Film, und sie erschließt Baader den Sinn seines Tuns; so wird ihm klar, dass die schlichte kriminelle Tat ein avantgardistisches Air erhalten kann. Meinhof liefert ihm den anspruchsvollen Überbau zu seiner wenig intellektuellen bis latent anti-intellektuellen Haltung. Während in jener Bar die linken Theoretiker-Aktivist:innen durchaus zivilisiert das Rechte diskutieren wollen, benötigt Baader keine Theorie und zeigt mit zwei Sätzen aus der Grundschule der Semantik den Irrweg der theoriebesessenen Politikzirkel der Zeit auf. Seine Intervention ist denkbar kurz: »Nix ausdiskutieren! Auf die Fresse!« Und obwohl augenscheinlich ein Neuling in der Szene, schafft es der theoretische Neandertaler, sich zum Alpha unter den belesenen und gesitteten Homo Sapiens zu machen. Dazu nutzt Baader eine Leerstelle der Theorie, nämlich deren Angst vor dem Realwerden als gesellschaftliche Praxis. Baader hingegen kann nichts anderes als praktisch werden, und zwar auf der Ebene kriminellen Handelns, das, an sich unspektakulär, nun aufgewertet wird als revolutionäre Tat, gar als Propaganda der Tat. Zum Anführer wird Baader, weil er der Einzige ist, bei dem die Triebkontrolle, dank mangelnder Literarisierung, so niedrigschwellig geblieben ist, dass er den anderen den Weg in den Untergrund bahnen kann; er ist der Einzige, der eine handfeste Antwort auf die klassische Frage des Revolutionärs hat: »Was tun?« (Lenin [1902] 1970, 37–179). Im Bonusmaterial zur DVD spricht Roth davon, dass Baader sich faszinierend vom Kleinkriminellen zum Revolutionstheoretiker entwickelt habe, die anderen Mitglieder der Gruppe aber umgekehrt von Intellektuellen zu Verbrecher:innen regrediert seien (vgl. Roth 2003). Wir können dahingestellt sein lassen, ob das so stimmt. Eher scheint Roths Baader zu wissen, dass er dieser Theoretiker der Revolution nie sein wird, und Lenin hat er natürlich auch nicht gelesen. Außerdem weiß er, dass ein Theoretiker der Revolution auch zu ganz anderen Schlüssen gelangen kann als dem »auf die Fresse«. So etwa Rudi Dutschke 1977: »Als Sozialist bekämpfe ich die Vertreter der herrschenden Klasse politisch und den außerparlamentarischen und parlamentarischen Möglichkeiten gemäß – und nicht mit der sich von der Bevölkerung abwendenden Methode des individuellen Terrors« (Dutschke [1977] 1980, 104). Gegen diese intellektuelle Kraft hilft Baader seine bloße Gewalt nicht weiter. Ulrike Meinhof hingegen ebnet ihm diesen Weg. Deshalb umgarnt er sie, besucht sie in ihrer großbürgerlichen Wohnung mit den wohlerzogenen Kindern und verkumpelt sich mit ihr über den gemeinsamen Drogenkonsum. Erstaunlich ist, wie erfolgreich im Film Baaders simple Anwerbestrategie ist, einfach etwas Verbotenes zu tun, und wie überzeugend sie über den Film hinaus erscheint. Weniger als Chefideologin wird Meinhof hier als Ghostwriterin rekrutiert. Dass sie sich in der Illegalität ungeschickt anstellt, streift der Film nur anekdotisch. Wichtiger ist, dass
Jörn Ahrens: Terror & Entertainment
Baader sie allein über seinen Blick im Gerichtssaal sofort eingefangen hat, so wie er es auch damals in der Bar mit Gudrun Ensslin gemacht hat. Im Anschluss an diesen Blick gelingt dann sehr schnell die Kontaktanbahnung, auch wenn die Frauen ihn eigentlich rasch durchschauen. Ensslin etwa, die gleich diagnostiziert: »Ein bisschen verklemmt bist du aber schon.« Durch den gesamten Film legt Roth daher Fährten des unzuverlässigen, nur scheinbar authentischen Erzählens. Die Originalität des Films besteht gerade darin, dass er nicht wirklich Anleihen beim Dokumentarischen macht, dass er aber auch keineswegs pure Fiktion ist, sondern dass genau die Grenze zwischen Fiktion und Authentizität zusehends niedergerissen wird, dass diese Unterscheidung für den Film schlicht nicht einmal bedeutend ist, weil dieser Film zeigt, dass die Wahrheit der Figur gerade im Zwischenraum von Fiktion und Authentizität liegt. Die minutiöse, sich auf Expertenwissen verlassende, anfängliche Inszenierung historischer Szenenfolgen wird zunehmend gebrochen und konterkariert durch eine Agenda des Films, die dessen eigene Wahrheit akzentuiert und narrativ durchsetzt. Das ist im Grunde nicht einmal die Explikation der Fiktionalisierung der Legende Baaders. Vielmehr ist die These des Films, Roth selbst hat dies mehrfach hervorgehoben, dass gerade die Fiktionalisierung die eigentliche Wahrheit der Person Andreas Baader ausmacht, dieser also am Ende auf eine Art literarische oder filmisch fiktive Figur heruntergebrochen wird. Selbst gespickt mit Filmzitaten, macht der Film somit deutlich, dass die Person Baader nur eine popkulturelle Zitatassemblage ist und de facto über keinen realen Persönlichkeitskern verfügt. Baader ist weit mehr eine Figur als ein Subjekt. Damit, und dieser Punkt berührt schließlich auch Praktiken, mithin Strategien des gesellschaftlichen und kulturellen Erinnerns, stellt sich die Frage nach einer Geschichtsschreibung der Gegenwart mit den Mitteln einer kultursemiotischen Historiographie des Gesellschaftlichen ganz neu, also Dramaturgisierung, Narrativierung, Ikonisierung, Ästhetisierung. Im Grunde plädiert Roths Film hier für eine Hybridisierung der Geschichte, welche die Genese des als wirklich Anerkannten nicht widerstandslos den dokumentierten Fakten überlässt, sondern Handlungsverläufe anbietet, die der dramaturgischen Narration der Geschichte (im doppelten, überwiegend sogar im prosaischen Sinne) eher entsprechen. Schließlich arbeitet die Historiographie des Tatsächlichen nicht selten gegen ihre Protagonist:innen. Gegen diese Hegemonie einer zum Fakt geronnenen Geschichte verschmilzt der Ansatz, den Roth in Baader ausprobiert, Fakt und Fiktion zu einer Hybrid-Konstellation, die das Verständnis von kultureller Wirklichkeit neu fokussiert. Im Vordergrund steht hier nicht mehr die Absicht, zu einer Wahrhaftigkeit des Faktischen im Sinne der möglichst überzeugenden Nachzeichnung authentisch historischer Ereignisse vorzudringen, sondern stattdessen die narrative, semiotische Wahrheit des Gegenstands, des kulturellen Artefakts oder Charakters herauszuarbeiten. Baader folgt einem völlig anderen Verständnis von Wahrheit, als es üblicherweise an historische Ereignisse, deren Vergegenwärtigung, Abbildung und Rekonstruktion
269
270
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
herangetragen wird. Im Unterschied zur noch immer und gerade im öffentlichen, kulturell-politischen Diskurs einer gängigen Historiographie der Nachzeichnung, im Unterschied also zu einem in die Gegenwart getragenen Kultur-Historismus, bietet Baader eine neue Variante der »Metahistory« an, um Hayden Whites gut eingeführte Begriffsschöpfung aufzugreifen (White [1973] 2008). Diese verfolgt einen gegenüber dem Historismus der Gegenwart alternativen, durchaus normativen Ansatz, indem sie zu zeigen versucht, wie Geschichte hätte verlaufen sollen, nicht wie sie tatsächlich verlaufen ist. Das konjunktivische Potential im Geschichtsverlauf arbeitet dieser Ansatz heraus und stellt es vor, im Film zumal, der Dramaturgie und Visualisierung zu einer eindringlichen Ästhetik amalgamiert. Präziser ausgedrückt, interessiert sich diese Form einer ästhetischen Reflexion der Geschichte für die Frage, welche Figurenführung für die historischen Charaktere angemessen gewesen wäre. In diesem Sinne beansprucht Baader für sich nichts weniger, von Roth in diversen Interviews formuliert, insbesondere im Bonusmaterial zur DVD (2003), als eine Korrektur der Geschichte. Das falsche Moment im nicht mehr rückholbaren geschichtlichen Ereignis wird hier kassiert und, erstens, die Wahrheit der Figur im Sinne ihrer eigenen Inszenierung gezeigt, während, zweitens, die normative Wahrheit des dieser Inszenierung angemessenen Verlaufs der Geschichte vorgestellt wird, nicht der Verlauf selbst. Damit diffundiert eindeutig die Differenz zwischen Fakt und Fiktion, beziehungsweise löst sie sich vollständig auf. Auch wenn White in seiner Metahistory kaum eine konsequente Fiktionalisierung der Geschichtsschreibung vorschwebt, so folgt Roth in seiner Inszenierung des historischen Stoffes einer Geschichte des Linksterrorismus in Deutschland doch sehr konsequent jenen Fährten, die White auslegt. Dieser dekonstruiert zielstrebig die Integrität einer faktenbasierten Geschichtsschreibung, wenn er zum einen vom »unvermeidlich poetischen Charakter der Geschichtsschreibung« (White [1973] 2008, 11) spricht, deren sprachliche Performanz notwendig auf Mittel der Intentionalität, Interpretation und Dramaturgisierung zurückgreife, und zum anderen hervorhebt, es stecke »in jeder historischen Darstellung der Wirklichkeit eine irreduzibel ideologische Komponente« (White [1973] 2008, 38). Letzteres umso mehr, als White deutlich macht, dass es keine Vergangenheit geben kann, die unabhängig wäre von der Gegenwart, von der aus sie perspektiviert und damit auch erinnert wird. »Die Behauptung, eine vergangene von einer gegenwärtigen Wirklichkeit des gesellschaftlichen Bewußtseins und seiner Praxis unterschieden zu haben, impliziert eine bestimmte Vorstellung davon, welche Form das Wissen von der Gegenwart haben muß, insofern dies eine Fortsetzung der Vergangenheit ist« (ebd.). Diese Einsicht in den Konstruktionsund Assemblagecharakter vergegenwärtigter Vergangenheit radikalisiert Roth im Grunde nur, indem er nicht nur die Form verbriefter, dokumentierter Ereignisse seiner eigenen Interpretation unterzieht, sondern indem er diese Ereignisse zumindest zum Teil schlichtweg umschreibt. Heute dürfte diese Herangehensweise,
Jörn Ahrens: Terror & Entertainment
2002 höchst kontrovers diskutiert, nicht einmal mehr strittig sein, hat Roth damit doch im Grunde nur das sieben Jahre später von Quentin Tarantino in Inglorious Basterds (2009) furios angewendete Verfahren einer Neucodierung von Geschichte vorweggenommen. Ein solcher Zugriff auf Geschichte wird auch gestützt durch Ausführungen Reinhart Kosellecks, der verschiedene »Zeiten der Geschichte« (Koselleck 2000, 101) unterscheidet, die nicht etwa als Epochenfolge organisiert sind, sondern generationell und somit perspektivisch. Koselleck zufolge sind diese Zeitschichten »von vornherein zwischenmenschlich konstituiert, es handelt sich immer um Gleichzeitigkeiten des Ungleichzeitigen, um Differenzbestimmungen, die ihre eigene Endlichkeit enthalten, die nicht auf eine ›Existenz‹ zurückführbar ist« (ebd.). Eine solche »Existenz« entspräche dem, was ich hier, etwas vereinfachend, den kulturellen Historismus nenne, also eine essentiell gültige Erfahrung von Geschichte und Geschichtlichkeit, die sich nicht etwa aus der jeweiligen Gegenwartsperspektive konstituiert, sondern die im Gegenteil diese Gegenwart als Determinante erst selbst hervorbringt. Dass daher die Gegenwart rein chronologisch immer auf den Schultern der Vergangenheit aufsitzt, dass wir immer und notwendig als Individuen in eine Gegenwart eintreten, deren Narration tief in eine vorexistente Vergangenheit zurückreicht, prägt bis heute ein Geschichtsbild, das die Vergangenheit als distinkt und als ausgestattet mit einer eigenen Dignität begreift. White und Koselleck hingegen haben maßgeblich dazu beigetragen, diese Perspektive zu korrigieren und zu erschließen, wie sehr sich Vergangenheit als in der Gegenwart wirksame Determinante nur über die Diskursparameter dieser Gegenwart erschließen und erstellen lässt. Ausgerechnet am Beispiel der Studentenproteste Ende der 1960er Jahre führt Koselleck aus, die zwangsläufige Abfolge von Generationen in ihrer sich fortzeugenden, faktischen und zeitlichen Überlappung führe zu immer neuen Ausschließungen, zu diachronen Innen- und Außenbestimmungen, zum Früher oder Später der jeweils generationsspezifischen Erfahrungseinheiten. Ohne diese Ausschließungen ist keine Geschichte denkbar« (Koselleck 2000, 107). Das heißt, Geschichte wird in einem fortlaufenden generativen Prozess immer neu konstituiert, mithin neu geschrieben, indem sie aus den Auseinandersetzungen der Gegenwart, ihren je spezifischen Möglichkeiten der Erfahrung, hervorgeht. Sofern es daher um die Wahrheit geschichtlicher Erfahrung geht, bedarf deren Erfassung grundsätzlich »der Rückbindung an die Modi sinnlich-imaginärer Wahrnehmung, an das Wittern und Spüren, Vernehmen und Bemerken, Nachempfinden und Gewahrwerden« (Gamm 1992, 65). Wahrheit, präzisiert Gerhard Gamm, ist eindeutig »nicht allein Aussagenwahrheit; sie erschöpft sich nicht in propositionalem oder diskursivem Wissen« (ebd.). Vor diesem Hintergrund einer Theoretisierung der Geschichtsschreibung ist man versucht, den Skandal, den Baader 2002 noch immer auslösen konnte, für völlig unbegründet zu halten. Insbesondere was dem Film zuallererst vorgehalten wurde, dass er sich einreiht in eine Ästhetisierung der RAF,
271
272
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
dass er die naiv wirkende Fixierung der Protagonist:innen auf Güter des Konsums ausstellt, insbesondere aber der ästhetisierten Warenwelt, gegen welche die Gruppe vermeintlich ankämpfte, erweist sich nunmehr als lapidares Verfahren einer generativ geprägten historischen Wahrnehmung, die ihre Wahrnehmung eben nicht in erster Linie aus den Archiven bezieht, sondern aus kultureller Erfahrung, welcher sie dann die aus den Archiven bezogenen Informationen anpasst. Dass Geschichte und ihre Darstellung, egal in welcher Form, immer mit gebührender Vorsicht, mithin mit Skepsis zu begegnen ist, ist im Grunde eine Banalität, die Roths Baader recht eindrucksvoll vorführt. Sein Baader ist eine konsequent ausbuchstabierte Imago; aber er ist eben kein schlicht herbeifabulierter Charakter, sondern in weiten Teilen des Films geschult, geschliffen und abgearbeitet am historischen Material. In wenigen, dafür umso stärker hervorstechenden Szenen weitet Roth diese Imago als filmische Poetologie kultureller Erfahrung zu einer Umschrift der Geschichte aus. Das wäre einerseits das nächtliche Rendezvous zwischen Baader und dem BKA-Chef Kurt Krone aka Horst Herold, andererseits das Finale in einer Frankfurter Hochhaussiedlung mitsamt fallenartig gebauter Garage, bei dem Baader nicht etwa angeschossen und in Unterhose abgeführt, sondern vom Kugelhagel der Polizei durchsiebt wird. Aber was ist das für eine Umschrift? Sind beide Szenen doch so überdeutlich sowohl in konventionalisierten Genre-Traditionen abgefilmt als auch mit filmhistorischen Zitatverweisen versehen, dass die Fiktionalität der Szenen schon fast aufdringlich wirkt, so übercodiert sind sie beide. Die Analogie zwischen dem in Krones Auto friedlich miteinander palavernden Terroristen und dem Fahnder gemahnt nur allzu deutlich an die Szene in Michael Manns Heat (1995), in der sich Cop und Gangster im Diner zum Plausch treffen – was in der Rezeption so häufig angemerkt wurde, dass gelegentlich sogar von einem Remake gesprochen wurde. In der Finalszene wiederum dreht sich der Kriminalfilm, der bis dahin seine Inspiration aus Film Noir, Nouvelle Vague und deutschem Fernsehkrimi bezieht, in den Western und ruft Reminiszenzen an Arthur Penns Bonnie and Clyde (1967), Sam Peckinpahs The Wild Bunch (1969) und George Roy Hills Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) auf. So ostentativ hat man einen Film wohl selten aufzeigen sehen, dass es sich um pure Fiktion handelt. Eine Ästhetik der Gegenüberstellung von zwei Terroristen in einer ausweglos versiegelten Garage als Falle, die sich einer Heerschar von Polizisten gegenübersehen, die aus heutiger Perspektive geradezu komisch daherkommen, im Anzug und mit Bauarbeiterhelm, die Waffe in der Hand. Eine Ästhetik, die sich konsequent am Fernsehrealismus von Krimiserien wie Derrick oder Der Alte orientiert und dann plötzlich, aber in der für den Film üblichen, nicht besonders hastigen Geschwindigkeit gebrochen wird, wenn Baader gleich zwei Pistolen aus dem Hosenbund hervorzieht und geradewegs von Kugeln durchsiebt wird, während in der Garage die Holger Meins-Figur bereits vorab mit den Fingern in die Luft schießt, als spiele er schon einmal den Film nach, den er gleich zu sehen bekommt. Der Imago
Jörn Ahrens: Terror & Entertainment
des coolen Baader, der es sich zur Ehrensache macht, nicht gefasst zu werden, zumindest nicht lebend, gibt Roth damit seine Würde zurück und seine Konsequenz. Es ist, wie Roth selbst mehrfach hervorgehoben und letztlich im Einklang mit Koselleck formuliert hat, der Blick einer Generation, die über diese kulturelle Imago sozialisiert wurde, deren Kindheit von der düsteren Faszination der Fahndungsplakate auf den Postämtern Westdeutschlands geprägt wurde. Baader hatte ein Versprechen gegeben, welches das Aufbegehren, den Primat der Aktion über die Theorie, gepaart mit Ästhetik und Coolness, zusammenschloss mit einem Heroismus der Selbstüberwindung. Was hier keine Bindung mehr an einen Primat der Selbsterhaltung haben sollte – ikonisch geworden in der Geste Baaders, seinen Fingerabdruck auf Bekennerschreiben absichtlich zu hinterlassen, wo sich nachfolgende Generationen der RAF die Fingerkuppen sorgsam verätzten. Gegen die Fetischisierung einer poesielosen Historie, die eine notwendig perspektivierte und ästhetisierte Wahrheit mit der historischen Akkuratesse modellbaugleicher Authentizität verwechselt, setzt Roths Film vollkommen auf die narrativen und ästhetischen Kompetenzen des Mediums, auf die Erschließung des historischen Raums durch den Eigensinn des filmischen Bildes, das, wie die Geschichte auch, niemals außerhalb des Imaginären operieren kann. In seinen semiotisch angeleiteten Überlegungen zum Film formuliert Peter Wollen, die Sprache des Films würde verkümmern, würde sich der Film seiner inhärenten Realität entledigen, die zugleich seine mythische Bestimmung sei (vgl. Wollen 1982, 206). Das Filmemachen, meint er, könne durchaus ein Projekt der Erzeugung von Sinn und Bedeutung sein und verweise deutlich auf Horizonte jenes seiner selbst, zugleich aber situiert im Rahmen einer gegebenen ideologischen Arena (vgl. ebd.). Das konstruiert eine einigermaßen aporetische Situation des Mediums Film im Kontext von Kultur, zwischen Ideologie einerseits und Transzendierung vorgefertigter Sinnbestände andererseits: »The imaginary must be de-realized; the material must be semioticized« (ebd.). An diese Regieanweisung hält sich Roth ausgesprochen strikt, indem er den Mythos Baader gerade nicht dekonstruiert, sondern dessen Realismus transzendiert hin zu einer Ebene, die Baader mit sich selbst und sein Versprechen mit seinem Publikum aussöhnen kann. Die Wahrheit des Films liegt darin, die Figur Baader am Ende ernster zu nehmen, als diese sich selbst genommen hat. Historisch wissen wir längst, dass Baaders Coolness bloß Pose war und der Dringlichkeit und Dramatik der historischen Situation letztlich nicht standhalten konnte. Wäre er Bandleader geworden oder Filmstar, wie viele der Kritiker von Roths Baader vorgeschlagen haben, hätte diese Pose zweifellos besser funktioniert, weil sie sich niemals hätte existentiell beweisen müssen. Roth macht Baader nun posthum ein Kindergeschenk, die Korrektur der Pose in eine mögliche Form des historischen Endes. Baader darf so sein, wie die Vorbilder in den von ihm gern gesehenen Filmen.
273
274
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
Das ist schon deshalb legitim, weil es vollkommen im Einklang mit der Einstellung des Pop als Kultur steht, den Baader im Grunde mitzugründen half und in den sich auch Roths Baader integriert: Pop als »eine Haltung gegenüber dem eigenen kinematischen Verfahren als populärer Zeichensprache, die in gewissen Filmen angelegt ist« (Bronfen 2009, 115). Gerade der Realismus des Pop, führt Elisabeth Bronfen aus, folge einem »Verständnis von Realismus als einer Erfahrung aus zweiter Hand« (Bronfen 2009, 132), indem hier individueller ästhetischer Anspruch unauflösbar und höchst gewollt verzahnt werde mit einer »Sprache der Massenkultur« (Bronfen 2009, 133). Damit akzentuiert ein Medium wie der Film innerhalb existierender kultureller Ausdrucksformen und speziell in deren vehementer und unverhohlener Anwendung letztlich eine allgemeine Einsicht in das Wesen von Geschichte. Es scheint lediglich, dass dieses Wesen der Geschichte erst das Medium Film gebraucht hat, um an den Tag treten zu können, und die Reaktionen auf Filme wie Roths Baader verdeutlichen, dass es Gesellschaft, Diskursordnungen und normativ geronnenen Konventionen ausgesprochen schwerfällt, die damit verbundenen Einsichten zu akzeptieren. Denn, wie Lorenz Engell hervorhebt: »Geschichte ist keinesfalls das, was geschieht, auch nicht das, was geschehen ist und was eben dadurch, dass es geschehen ist, unabänderlich vergangen und vorüber ist, woran keinerlei Geschichtsforschung etwas ändern kann. Geschichte ist nicht mit dem Geschehen selbst identisch, sondern sie ist eine Verarbeitungsform des Geschehens« (Engell 2010, 33). Insofern ist Geschichte selbst und sogar zwingend »ein Artefakt« (ebd.) und als solche der Logik des Filmischen und Seriellen ausgesprochen nahe, da sie immer wieder neu und im Neuen immer wieder abweichend erzählt wird. Das Imaginäre des Films trifft daher die Realität der Gesellschaft und ihrer Geschichte sehr genau, während das Reale der Geschichte stets unzulänglich bleiben muss (vgl. Engell 2000, 209). Mit dieser Realität konfrontiert Roths Baader sein Publikum gleich zu Beginn: Das in der Nacht am Hafen parkende Auto mit Baader darin, niemand weiß, weshalb er dort sitzt. Vielleicht ist er bloß sauer über die, historisch korrekte, vom BKA gestreute Falschmeldung »Andreas Baader will sich stellen«, die ihn zu einem Fehler verleiten soll. Dann nähert sich der Polizist von hinten, prüft Wagen und Fahrer, wird von diesem schließlich ins Bein geschossen und schießt selbst dem flüchtenden Wagen noch hinterher. Möglich, dass es diese Szene wirklich gegeben hat. Jedenfalls entspricht sie dem Selbstbild Baaders als Kino- und Terrorheld, der ausgesprochen verärgert war über die Unterstellung, er wolle sich stellen, und sie entspricht auch vollkommen der Imago, die Baader selbst, aber eben nicht nur er selbst, von sich installiert hat. So hätte es durchwegs sein sollen, einmal ein deutscher Mythos von Format, die Anti-Nibelungen, die in einer Szene von Roths Film in ihrer Nibelungentreue ziemlich verloren und frierend herumsitzen. Für die Wirklichkeit, und zumal fürs Kino, hat das trotzdem nicht getaugt. Schließlich distanzieren sich, wie auch der Film einmal zeigt, auch die Sympathisanten schnell und mit gut vorgeschobenen Gründen,
Jörn Ahrens: Terror & Entertainment
weshalb abschließend noch einmal Dutschke bemüht werden soll, der Baader (oder Baader?) avant la lettre charakterisiert, ohne es zu ahnen: »Der individuelle Terror ist der Terror, der in die individuelle despotische Herrschaft führt, aber nicht in den Sozialismus. Das war nicht unser Ziel und wird es nie sein. Wir wissen nur zu gut, was die Despotie des Kapitals ist, wir wollen sie nicht ersetzen durch Terrordespotie« (Dutschke [1977] 1980, 105).
Literatur Aust, Stefan. Der Baader Meinhof Komplex. Hamburg 1986. Borcholte, Andreas. »Der Untergang«: Die unerzählbare Geschichte (2004). https://www. spiegel.de/kultur/kino/der-untergang-die-unerzaehlbare-geschichte-a-31803 1.html (23.05.2022). Bronfen, Elisabeth. Crossmappings. Essays zur visuellen Kultur. Zürich 2009. Dutschke, Rudi. »›Kein Mensch ist austauschbar‹. Über Gewalt und Gegengewalt« [1977]. In: Ders. Mein langer Marsch. Reden, Schriften und Tagebücher aus zwanzig Jahren. Hg. v. Gretchen Dutschke-Klotz/Helmut Gollwitzer/Jürgen Miermeister. Reinbek b. Hamburg 1980, 97–106. Engell, Lorenz. Playtime. Münchener Film-Vorlesungen. Konstanz 2010. Engell, Lorenz. Ausfahrt nach Babylon. Essais und Vorträge zur Kritik der Medienkultur. Weimar 2000. Gamm, Gerhard. Die Macht der Metapher. Im Labyrinth der modernen Welt. Stuttgart 1992. Gansera, Rainer. Bewusst, wie ein Projektil. Wie Christopher Roth den Mythos von »Baader« zerbröselt (2010). https://www.sueddeutsche.de/kultur/im-kino-baader-bewuss t-wie-ein-projektil-1.426004 (23.05.2022). Koselleck, Reinhart. Zeitschichten. Studien zur Historik. Frankfurt a.M. 2000. Lenin, Vladimir Il’ič. »Was tun? Brennende Fragen unserer Bewegung« [1902]. In: Ders. Studienausgabe. Bd. 1. Hg. v. Iring Fetscher. Frankfurt a.M. 1970, 37–179. Meinhof, Ulrike. »Warenhausbrandstiftung« [1968]. In: Dies. Die Würde des Menschen ist antastbar. Aufsätze und Polemiken. Mit einem Nachw. v. Klaus Wagenbach. Berlin 1988, 153–156. Reinecke, Stefan. Das RAF-Gespenst (2002). https://taz.de/!1090495/ (23.05.2022). White, Hayden. Metahistory. Die historische Einbildungskraft im 19. Jahrhundert in Europa. Frankfurt a.M. 2008 [engl. 1973]. Vorwerk, Thomas. Berlinale-Wettbewerb: Baader (2002). https://www.satt.org/film/0 2_02_baader_1.html (23.05.2022). Wollen, Peter. Readings and Writings: Semiotic Counter-Strategies. London 1982.
275
276
Geschichte und Ambivalenzen kultureller Erinnerung nach 1945
Filme Baader (2002): Regie Christopher Roth, D/UK (DVD: 2003, Universum Film) Der Untergang (2004): Regie Oliver Hirschbiegel, D/AU/IT Inglorious Basterds (2009): Regie Quentin Tarantino, D/USA Heat (1995): Regie Michael Mann, USA Bonnie and Clyde (1967): Regie Arthur Penn, USA The Wild Bunch (1969): Regie Sam Peckinpah, USA Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969): Regie George Roy Hill, USA/MEX
IV. Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Wie Rechte Lange lesen. Horst Langes Kriegserzählung Die Leuchtkugeln (1944) im Lektürekanon von Götz Kubitschek Jörg Döring
1. Die neue Rechte und der Krieg Kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 herrschte unter den Lesern der Sezession, der wichtigsten publizistischen Stimme der neuen Rechten, noch Uneinigkeit. Mit welcher Seite sollte man sympathisieren: mit Vladimir Putin auf seinem Feldzug gegen westliche Dekadenz und einen jüdischen Präsidenten in ›Kleinrussland‹? Oder mit den befreundeten ukrainischen Faschisten, die im Kampf gegen die russischen Invasoren ihr Leben gaben? Am 16. März hatte der rechte Jungeuropa Verlag1 den Tod seines Autors Mykola Krawtschenko bekanntgegeben, der tags zuvor (ausgerechnet) in Butscha gefallen war. Daraufhin schrieb Chefredakteur Götz Kubitschek im Editorial der Sezession: Mykola, Jahrgang 1983, hatte für die deutsche Übersetzung der ukrainischen Programmschrift Natiokratie ein Vorwort verfaßt und die Bedeutung dieses Buches für das Selbstverständnis seiner Nation erläutert. Er fiel durch Artilleriebeschuß […] Der Krieg in der Ukraine rückt auf diese Weise näher, weil jemand, der noch vor wenigen Monaten oder Wochen als Wissenschaftler und Publizist gearbeitet und Pläne für Projekte gehabt hatte, seinen Schreibtisch verließ, um etwas kaum 1
Der Jungeuropa Verlag wird von Philip Stein geleitet, der sich selbst als rechtsradikal bezeichnet und dem politischen Verein ›Ein Prozent für unser Land‹ vorsteht, der vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall für verfassungsfeindliche Bestrebungen eingestuft wird. Der Jungeuropa Verlag stand im Zentrum der öffentlichen Auseinandersetzungen um die Anwesenheit rechter Verlage auf der Frankfurter Buchmesse 2021. Die Autorin Jasmina Kuhnke hatten ihren Auftritt auf der Buchmesse abgesagt, weil sie sich u.a. durch die Anwesenheit Steins bedroht fühlte. Dieser hatte zuvor auf Twitter die Abschiebung der in Hagen geborenen Autorin in den Senegal gefordert. Vgl. https ://www.spiegel.de/kultur/literatur/frankfurter-buchmesse-2021-absage-von-jasmina-kuhn ke-wegen-rechter-verlage-a-90d50374-1358-48cf-9673-332f3e17fd9b.
280
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Vorstellbares zu tun: zu kämpfen und einen frühen Tod in Kauf zu nehmen. (Kubitschek 2022a) Diese Parteinahme gefiel nicht allen Lesern der Sezession. Im Kommentarteil des Editorials schrieb »Volksdeutscher«: Mich rührt das Schicksal des Kiewer Regimes nicht, sie können mit noch so viel falschem Pathos den Äther füllen. Dieser Lumpenstaat hat versagt […] ›Ihre‹ Führer, die ihnen falsche Versprechungen machten und den Anschluß an ›Europa‹ einredeten, sowie zu ihrer Täuschung den großen Nationalisten vorspielten, gehören zu einer anderen Ethnie, deren emotionalen Bindungen nicht in der ukrainischen Volksseele, sondern eher in Tel Aviv zu suchen sind. (Ebd.) Etwas nachdenklicher zeigte sich »Adler und Drache«: »Am Putinismus ist nichts begehrenswert, das sollte wohl klar sein. Nichts. Keiner von euch will darunter leben, und ich auch nicht. Dennoch ist er die aktuelle Verteidigungslinie gegen das Regenbogenimperium. Man muss sich mit dem arrangieren, was ist, nicht auf das warten, was man sich wünscht« (ebd.). Einen ideologischen Ausweg weist der Leser »Der_Juergen«: »Dass ich die russische Intervention für absolut notwendig halte – Putin hatte im Interesse seines Volkes keine andere Wahl mehr, als einzugreifen –, hindert mich nicht daran, den ukrainischen Nationalisten, die für ihre Ideen ihr Leben zu geben bereit sind, meine Achtung zu zollen« (ebd.). Kubitschek sah sich durch diese Debatte zu einem Nachtrag genötigt: Das Kommentariat kommentierte und fragte nach. Könnte es nicht sein, daß sich Fragen erübrigen, wenn Leute mit ihrem Leben bezahlen? Ich schlage mich, indem ich das schildere, nicht auf eine Seite […] Es wird mobilgemacht, es wird gekämpft, mancher fällt. Das kann man beschreiben und mit unserer Lage vergleichen, und man macht es wohl, um zu zeigen, daß man auch dieses Mal nicht in der moralischen Bundesliga mitspielen will, um eine weitere Gut-Böse-Partie auszutragen. (Ebd.) Wichtiger als die Parteinahme für eine Seite, das muss der Leitartikler seinen meinungsfreudigen Lesern offenbar nachträglich einschärfen, ist die Anerkennung des Krieges als factum brutum und der Vergleich mit der eigenen Lage. Das Editorial in seiner Netzversion ist überschrieben mit »Widerstand und Tod, Vormärz und Biedermeier«. In der Printversion vom April 2022 heißt es dann nur noch »Vormärz und Biedermeier« (Kubitschek 2022b, 1). Mit »Biedermeier« ist der »falsche Frieden« der deutschen Gegenwart bezeichnet, mit »Vormärz« die »Ansammlung von revolutionären Impulsen in einer Zeit abträglicher Stabilität«: Kampf, Ausharren, Flucht, Tod – elementare Daseinsbilder […], die in unserer deutschen Welt nicht mehr vorkommen. Wir verlassen unsere Schreibtische, wenn überhaupt, um gegen eine Fehlentwicklung zu demonstrieren […] Wir
Jörg Döring: Wie Rechte Lange lesen
haben aber, wenn wir aus freien Stücken auf die Straße gehen, kaum etwas zu befürchten, jedenfalls keinen Beschuß und kein Gefecht auf Leben und Tod […] Dagegen ist nichts einzuwenden, so ist es hierzulande. Das ist der Vormärz, das ist die Lage hilfloser Bürger nach der Restauration […] es ist die Zeit des bespöttelten kleinen Glücks, des Rückzugs ins Private […] Stichelei und Sammlung, Rückzug, kein Verschleiß, Vormärz und Biedermeier – das ist unsere beschämende Lage. Da muß keine klare Entscheidung fallen, man kann auch lavieren. In sich selbst gegen einen falschen Frieden den Ernstfall auszurufen ist eben etwas anderes, als zu wissen: Diese Stadt, dieses Haus, dieses Fensterloch muß heute und morgen von mir gehalten werden, denn es ist jetzt kein anderer da. (Kubitschek 2022b, 1) Die Empathie mit den realen Kriegern in der Ukraine soll auch bei den hiesigen Biedermännern die Bereitschaft wecken, eine revolutionäre Lage nach dem ›Vormärz‹ zu imaginieren: Ein Ende der restaurativen Verhältnisse, den »Ernstfall«, in dem es auf die Entschlossenheit und den Opfermut jedes einzelnen Kämpfers ankommt. Das Editorial verdeutlicht, dass der Krieg im Diskurs der neuen Rechten nicht in erster Linie als realpolitisches Geschehen, sondern mit Blick auf die eigenen politischen Ziele als Pathosformel und Sinnressource verhandelt wird: Der Krieg fasziniert, weil er mit einem Mal mehr als nur denkmöglich erscheint und sein Erlebnis nicht allein nachgelesen ist. Er ist real geworden und psychopolitisch in greifbare Nähe gerückt, soll für die hiesigen Vormärzler als Weckruf aus privater Verzagtheit dienen und zum Widerstand gegen die beschämenden Verhältnisse stimulieren. Es hat vor nicht allzu langer Zeit eine literaturwissenschaftliche Kontroverse darum gegeben, ob man (den studierten Germanisten) Kubitschek unterdessen eher als traurig-heiteren »Fantasten« zu deuten habe, der gar nicht (mehr) von der »realistischen Möglichkeit einer völkisch-antiliberalen Utopie« überzeugt sei (Busch 2021). Oder ob es sich bei seiner seit 2018 vermehrt geäußerten »kultur- und politikpessimistischen Rückzugsmelancholie« (Hoffmann/Kempke 2022) eher um eine rhetorische Strategie der »Selbstverharmlosung« (Kubitschek 2017) handle. Weder der Hype um die neue Rechte im Gefolge von Sieferles Bestseller Finis Germania und der aufgeregten Berichterstattung rund um die Präsenz rechter Verlage auf den Frankfurter Buchmessen 2017 und 2018 hatten zum gewünschten politischen Erdrutsch geführt. Seither versuche Kubitschek die Vorwürfe seiner politischen Gegner durch »die Zurschaustellung der eigenen Harmlosigkeit« zu entkräften (Hoffmann/Kempke 2022). Das Kubitschek-Editorial zum Beginn des UkraineKriegs spielt nun auf beides zugleich an: die scheinbar resignative Beschwörung einer »Zeit der Einsicht in Machtverhältnisse, der Ernüchterung und des Zurechtkommens«, des »Rückzug(s)« ebenso wie das politisch-romantische Pathos des Ernstfalls, die Gewissheit realer Gefechte »um Leben und Tod« (Kubitschek 2022b, 1). Mit Blick auf die metapolitische Strategie der neuen Rechten für eine autoritäre Revolte (vgl. Weiß 2017) könnte sich hier ein Momentum abzeichnen: eine Phase, in
281
282
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
der die erstrebte »Kulturrevolution von rechts« (vgl. de Benoist 2017) kommunikativ auch wieder offensiver vertreten werden wird. Man kann sich ja fragen, wer die revolutionären Subjekte für diese autoritäre Revolte sein sollen. Kubitschek jedenfalls denkt dabei auch die Soldaten der Bundeswehr – die aktiven, aber auch künftige, die sich für die Ausbildung an der Waffe rekrutieren lassen (vgl. u.a. Hoffmann/Kempke 2022). Kubitschek – Reserveoffizier der Bundeswehr, der 1997/98 als Freiwilliger am Auslandseinsatz der Bundeswehr in Bosnien teilgenommen hatte (bis er wegen rechter Agitation nach Hause geschickt wurde) – adressiert dabei insbesondere jene rechtsgerichteten Soldaten, denen seit Ursula von der Leyens Stuben- und Spindkontrollen 2017 im Gefolge der Terrorvorwürfe gegen den Offenbacher Oberleutnant Franco A. öffentliches Misstrauen entgegenschlägt (»Die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem«). Ob es nur als Ausdruck politischer Romantik zu verstehen ist, dass Kubitschek von diesen Soldaten sagt: »Wir werden sie aufsuchen müssen, übermorgen. Wir werden sie wecken müssen« (Kubitschek 2020b, 172f.)? Es bleibt abzuwarten, ob die Bilder und Erzählungen, die der gegenwärtige Krieg in der Ukraine produziert, von der neuen Rechten künftig ebenso politisch-ästhetisch instrumentalisiert werden wie bisher die Literatur der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts. Diese strategische Lektüre von Kriegsliteratur als Teil neurechter Literaturpolitik zur Einübung von konkreter Wehrbereitschaft und eines soldatischen Habitus wird Gegenstand der folgenden Ausführungen sein – am Beispiel von Götz Kubitscheks Lektüren von Horst Langes Kriegserzählung Die Leuchtkugeln von 1944.
2. Zur Literaturpolitik der neuen Rechten Es ist mittlerweile unstrittig, dass es eine neurechte Literaturpolitik in der Bundesrepublik gibt (vgl. Steinmayr 2020; Gladic/Thomalla 2021; Hoffmann 2021; Steinmayr 2021; Busch 2021; Hoffmann/Kempke 2022). Offen bleibt, ob man sich damit beschäftigen sollte. Wer immer sich auf dieses Feld begibt, sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, sich an der akademischen Aufwertung der neuen Rechten zu beteiligen. Welcher aufmerksamkeitsökonomischen Strategie der neuen Rechten geht man auf den Leim, wenn man Götz Kubitscheks Einlassungen zur deutschen Literatur in einem literaturwissenschaftlichen Kontext erörtert? Droht hier nicht u.a. die Falle, in die die Soziologen Armin Nassehi und Claus Leggewie getappt sind, als sie – nicht zuletzt zum Ausweis ihrer überlegenen liberalen Gesinnung – sich in einen Briefwechsel mit Kubitschek verstricken ließen, der dann zunächst als Anhang von Nassehis Buch Die letzte Stunde der Wahrheit. Warum rechts und links gar keine Alternativen mehr sind von 2015 abgedruckt wurde und als Beitrag zu einer liberalen Kultur des ›Mit Rechten reden‹ verstanden wurde, im Ergebnis aber eher zu einer Charismatisierung von Kubitschek als diskurswürdigem Repräsentanten der neuen Rech-
Jörg Döring: Wie Rechte Lange lesen
ten geführt hat? Danach pilgerte dann die internationale Qualitätspresse von New York Times bis Neue Zürcher Zeitung auf das Rittergut Schnellroda, um diesen »Prophet of Germany’s New Right« (Angelos 2017) zu porträtieren und diesem Gelegenheit zur Etablierung einer Bildpolitik zu geben, die bis heute das öffentliche Gesicht von Kubitschek prägt: die Selbstinszenierung wahlweise als virilen Bildungsbürger, als selbstversorgerischen Ziegen- und Gänsehirt in Strickjacke oder als gefährlichen Denker (ein »Barbarian«-Aufkleber schmückt dann sichtbar sein Laptop-Gehäuse für die Spiegel-Homestory aus Schnellroda), der – bis hin zur Selbstironie – alle Register populärer Selbstinszenierung zieht. In dem berühmtesten aus dieser Serie von Selbstporträts für die internationale Qualitätspresse (für die NZZ 2018) posieren Kubitschek und seine Ehefrau Ellen Kositza frontal mit grimmigem Blick am Abendbrottisch (Abb. 1). Die Streichwurst ist mittig zwischen den Porträtierten und dem Betrachter platziert. Vor der weiß gekleideten blonden schmalen Frau steht ein riesiger Bierhumpen. Kubitschek ist schwarz gekleidet und sitzt auf einem deutlich größeren Stuhl als seine Frau. Als Rahmungselement dienen dieser sorgfältig arrangierten Tischszene akkurat-symmetrisch ausgerichtete Bierflaschen, zwei neben der Frau, eine neben dem Mann. Im linken Bildhintergrund, hinter Kubitschek, zeigt sich der Bücherstapel eines Beistelltisches, auf dem – gewiss nicht zufällig als einziges Schriftelement der ganzen Szenerie, gut lesbar für den Betrachter – ein Mastermind-Spiel ausgelegt ist: so witzig inszeniert sich der Chefbarbar der neuen deutschen Rechten.
Abb. 1: Mastermind der Neuen Rechten
Welches Risiko liberale Wissenschaftler:innen eingehen, die aus lauterer Gesinnung die Nähe zu Kubitschek und den Diskurs mit der neuen Rechten nicht verweigern, das zeigt die Nachgeschichte des Gesprächs mit Nassehi: Kubitschek veröf-
283
284
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
fentlichte sowohl diesen Briefwechsel als auch den mit dem Soziologen Claus Leggewie ohne die Zustimmung seiner Gesprächspartner im eignen Antaios-Verlag – ebenfalls ansässig im Schnellrodaer Rittergut – unter dem Titel: Nassehi, ich und Leggewie (Kubitschek 2021). Im Gespräch mit Nassehi hatte Kubitschek gar keinen Zweifel daran gelassen, worum es ihm ging: sich als »salonfähigen Rechtsintellektuellen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken« (Weiß 2016). Die Liberalen hatten dazu beigetragen, ihn als ernstzunehmenden Gesprächspartner zu adeln, und damit – aus Sicht der Rechten – wieder einmal die Schwäche des Liberalismus unter Beweis gestellt. Die feuilletonistische Popularisierungsgeschichte der neuen Rechten hat nicht nur mit Kubitschek zu tun, sondern auch mit der öffentlichen Aufmerksamkeit für ein anderes, in ideologischer Hinsicht mehr als bizarres Power-Couple: die Ehe zwischen Helmuth Lethen und Caroline Sommerfeld. Lethen ist heute einer der meistgelesenen deutschen Literaturwissenschaftler, früher war er ein Maoist, APO-Aktivist und so links, dass er in der Bundesrepublik lange nicht berufen werden konnte. Caroline Sommerfeld indes, eine promovierte Philosophin und ehemalige Studentin von Lethen, mit dem sie drei Kinder hat, ist heute eine der bekanntesten Stimmen der intellektuellen Rechten. Wie eine solche Ehe gelebt wird, darüber haben die beiden nicht nur der New York Times Auskunft gegeben (vgl. Bennhold 2018), sondern Sommerfeld auch in dem bis heute vielleicht populärsten Buch der neuen Rechten (gemeinsam mit Martin Lichtmesz): Mit Linken leben (Lichtmesz/Sommerfeld 2017) – dessen Titel sich wiederum in ironischer Überbietung auf den Band Mit Rechten reden. Ein Leitfaden von Per Leo, Maximilian Steinbeis und Daniel Pascal Zorn bezieht (Leo/Steinbeis/Zorn 2017). Man sieht an diesen Beispielen, dass man auch für die akademische Beachtung der neuen Rechten einen Preis bezahlt – solche Aufmerksamkeitsgewinne entsprechen ziemlich genau ihrer metapolitischen Strategie auf dem Weg zur Erringung kultureller Hegemonie.2 Wenn ich mich hier – wie auch die oben genannte literaturwissenschaftliche Forschung – über diese Vorbehalte hinwegsetze und der neuen Rechten weitere Aufmerksamkeitsgewinne zuteilwerden lasse, dann hat das vor allem mit der großen Bedeutung von Literatur für deren metapolitische Strategie zu tun. Man kann mit Torsten Hoffmann sagen, dass es im gegenwärtigen politischen Spektrum keine Strömung, keinen öffentlichen Akteur gibt, der die Literatur so ernst nimmt wie die neue Rechte (vgl. Hoffmann 2021, 226). Auf Seiten der Linken – von extrem bis gemäßigt – findet sich diese Literaturemphase schon lange nicht
2
Als Wegmarken dieser ›Normalisierung‹ und Verschiebung des öffentlichen Diskurses nach rechts seither können u.a. gelten: der Bestseller von Thilo Sarrazin: Deutschland schafft sich ab (2010); die Gründung der Partei ›Alternative für Deutschland‹ (AfD) (2013), auch die Diskussion um Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit an den bundesdeutschen Hochschulen und ihre vermeintliche Gefährdung durch cancel culture und linke Identitätspolitik (seit 2017).
Jörg Döring: Wie Rechte Lange lesen
mehr – trotz der Heinrich-Böll-Stiftung und den Endmoränen des Leselands DDR. Sie findet sich nicht mehr beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Hier werden die einst bedeutsamen Literaturformate beschnitten oder ganz abgebaut. Auch nicht mehr im gymnasialen Deutschunterricht, wo man der grassierenden Leseunlust der Schülerinnen und Schüler mit einer handlungs- und produktionsorientieren Didaktik zu entsprechen versucht. Auch an den Universitäten, blickt man auf die Einschreibezahlen, nimmt die Bedeutung des Fachstudiums Literatur spürbar ab. Wem also wird mit der scheinbar aus der Zeit gefallenen Literaturemphase der neuen Rechten ein Angebot gemacht? Im Prinzip allen, denen die Literatur am Herzen liegt und die nach wie vor von ihrer Bedeutsamkeit überzeugt sind: von der Bedeutsamkeit für das einzelne lesende Individuum, von der Bedeutsamkeit der Literatur als Reflexionsmedium der Gesellschaft als Ganzer, so wie es die Linken um 1968 gedacht haben. Von der Bedeutsamkeit des Literaturlesens und Vorlesens auch für das Empathielernen von Kindern und Jugendlichen, von der Bedeutsamkeit von Literatur für Bildungsprozesse insgesamt. Hier erschließt sich für die neue Rechte durch geschickt vermittelte Literaturemphase ein breiter, politisch interessanter Sympathisantenkreis: von den wertkonservativen Bildungsbürgern aus Philologenverband und Universität, über Eltern, Erzieher:innen, Primarschullehrer:innen, also fast alle, die für kindliche Bildungsprozesse verantwortlich sind und das Lesen von Büchern dem Lesen auf digitalen Endgeräten vorziehen. Bis hin – Stichwort: Leseland DDR – zu den älteren Leser:innen in Ostdeutschland, die noch geschult sind in der Lektüre zwischen den Zeilen, die in der Lektüre belletristischer Literatur so etwas wie ein Widerstandsgefühl gegen die herrschende Ordnung zu kultivieren gelernt haben: den Habitus des dissidenten Lesers. Für all diese Zielgruppen hat die sehr vielfältige Literaturpolitik der neuen Rechten inzwischen ein deutlich vernehmbares Angebot entwickelt. Man kann – in Anlehnung an die Arbeiten von Hoffmann und teils über sie hinaus – von im Wesentlichen drei Strategien kurrenter neurechter Literaturpolitik sprechen: a) Die Simulation einer literarischen Leseöffentlichkeit unter neurechten Vorzeichen Insbesondere an die Bildungsbürger und die ostdeutsch sozialisierten Leser:innen richtet sich das literaturkritische YouTube-Format »Aufgeblättert Zugeschlagen« – neuerdings nur noch genannt »Das literarische Trio«, eine Anspielung auf das »Literarische Quartett« im ZDF, die Mutter aller öffentlich-rechtlichen TV-Literaturformate – bei welchem Ellen Kositza, mittlerweile die bekannteste Literaturkritikerin der neuen Rechten, und die Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen jeweils mit einem Gast über ausgewählte Buchtitel diskutieren. Nun soll der Doppelsinn von »Zugeschlagen« offensichtlich auch einen handfest-virilen Subtext zu erkennen geben – gegebenenfalls mitten ins Gesicht des mainstream-Feuilletons: Diese Literaturkritik will offenbar keinesfalls kraftlos und verweiblicht erscheinen. Frü-
285
286
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
her hieß das Format auch: Mit Rechten lesen. Diese Markierung ist aus dem Formattitel mittlerweile verschwunden – vermutlich aus Gründen der Zielgruppenmaximierung. Die bisher bekannteste Folge war die elfte aus dem Jahr 2020, bei der mit Martin Sellner einer der intellektuellen Vordenker der Identitären Bewegung in Österreich zu Gast war, dessen YouTube-Account eine Woche zuvor wegen Terrorismusverherrlichung gesperrt worden war und der unter falschem Namen und dem Deckmantel einer Literatursendung in die YouTube-Produktion von Kositza und Dagen eingeschmuggelt wurde: ein medialer Coup der rechtsextremen Szene, der in den Kommentaren zum Video auch entsprechend gefeiert wurde (vgl. dazu Hoffmann 2021, 224–226). Die Rollenverteilung der beiden Hosts in diesem literaturkritischen Format ist eindeutig: Kositza adressiert den literaturaffinen Teil der extremen Rechten, während Susanne Dagen, die prominente Buchhändlerin, Verlegerin und Lokalpolitikerin aus Dresden, die Brücke ins bürgerliche Leselager schlagen soll. Zur Strategie einer Simulation literarischer Öffentlichkeit gehört auch die Umwidmung traditionell linkscodierter Begriffe. So nennt Dagen die Schriftenreihe ihrer Buchhandlung Buchhaus Loschwitz, in der seit 2020 Schriften von Uwe Tellkamp (Tellkamp 2020), Monika Maron (Maron 2020), Konrad Adam oder Frank Böckelmann erscheinen, »Buchreihe EXIL«. Programmatisch wird die Reihe beschrieben »als Kunst der Zuflucht ebenso wie als Zuflucht der Kunst, die sich einem Klima zunehmender politischer Anfeindung ausgesetzt sieht« (Edition Buchhaus Loschwitz 2022). Das Opferkapital historischer Exilschicksale soll hier der vermeintlich inneren Emigration dissidenter BRD-Autoren wie Tellkamp und Maron zuteilwerden. Hoffmann nennt dies treffend: rechte Dissidenz, die »sich selbst in die Tradition der Opfer- und Widerstandskollektive der beiden deutschen Diktaturen einzureihen« versuche (Hoffmann 2021, 222). Gezielt präsentierte Dagen die ersten drei Titel dieser Buchreihe am Jahrestag der Dresdner Bücherverbrennungen von 1933. b) Neurechte Lesepädagogik Die neue Rechte wendet sich überdies an literaturbeflissene Eltern und Pädagog:innen, indem sie die erzieherische Aufgabe des Vorlesens unterstreicht und dabei praktisch-nützliche Vorschläge in Form eines kommentierten Lektürekanons für Kinder bis zur Pubertät vorlegt (Kositza/Sommerfeld 2020). In der Verlagsbeschreibung dieses Buches, das mit dem – wahlweise als Tätigkeitsbeschreibung oder als Imperativ zu verstehenden – Titel Vorlesen überschrieben ist, heißt es: »Vorlesen ist eine der wichtigsten Aufgaben, die Eltern erfüllen müssen: Es gibt Berge voller schlechter, schäbiger, zersetzender Bücher, unmögliches Zeug, schädliche Lektüre. Kositza und Sommerfeld kennen sich vorzüglich aus und empfehlen in ihrem gemeinsamen Buch Vorlesen rund 180 Bücher, Klassiker, Verborgenes, Entdeckungen.«3 Bezeichnend, dass hier eine Debatte um geeigneten Vorlesestoff, um die 3
Vgl. https://antaios.de/cat/index/sCategory/150 (15.12.2022).
Jörg Döring: Wie Rechte Lange lesen
vermeintliche Vorherrschaft eines diversitätsbejahenden links-liberalen Lektürekanons mit der Warnung vor »schädliche[r]« Lektüre verbunden wird: und dabei das Signalwort »zersetzend[]« nicht gescheut wird – ausgerechnet jenes SchmähAttribut, mit dem die deutschen Antisemiten von Ernst Moritz Arndt bis Adolf Hitler den jüdischen Einfluss auf den ›organischen Volkskörper‹ zu verunglimpfen suchten. Hier – auf der Antaios-Verlagsseite – ist die rechte Literaturpädagogik für literaturbeflissene Eltern (die inhaltlich kaum mehr als einen fast einwandsimmunen Kanon von Vorleseklassikern von Lindgren bis Walter Moers anzubieten hat) lexikalisch mit einem klar markierten Regelbruch verbunden: der Verwendung eines NS-Fahnenwortes (vgl. Schmitz-Berning 2007). Das YouTube-Werbevideo zum Buch ist dann wieder moderater und ersichtlich an bürgerliche Vorleseeltern gerichtet. Es beginnt mit Sonnenlicht in Fensterscheiben, Gitarrengeklimper, einem blonden Kind halbnah, das im Bett liest, dann kommt eine blonde Mutter, Ellen Kositza, die diesem blonden Kind vorliest, und nach dem Umschnitt in die Kamera spricht: Einig sind sich ja alle, dass zu wenig gelesen wird und dass Vorlesen doch etwas sehr Wichtiges ist. Wir haben uns gefragt: Warum eigentlich? Braucht es einen Lesekanon, einen verbindlichen? Eine Kinderbibliothek? Wozu? Wenn doch heute die Kompetenz eigentlich alles ist […] Lesen fördert einfach die Entfaltung der Persönlichkeit, weil es einen ganzen Fächer von Lebensmöglichkeiten eröffnet. Es macht kreativ, es erweitert den Wortschatz und regt nicht zuletzt den Widerspruchsgeist an.4 Ein kleiner Seitenhieb gegen die Kompetenzorientierung im Nach-Pisa-Deutschunterricht, die gewiss auch vielen bürgerlichen Eltern schulpflichtiger Kinder ein Graus ist. Die Pointe dieses gefälligen Leselobs für die große Zielgruppe aber ist der »Widerspruchsgeist«: (Vor-)Lesen ist Erziehung zum Non-Konformismus. Nur dass sich das so gestärkte Kinder-Ich dann gegen den mainstream der Diversitätsbejahung zur Wehr setzen kann. Auch in der rechten Lesepädagogik zeigt sich die Strategie, links-codierte Konzepte, hier das Erziehungsziel der nonkonformistischen Persönlichkeit, anzueignen und umzuwidmen. c) Die Aneignung/Relektüre des klassischen Literaturkanons sowie die sozialmedial unterstützte Popularisierung eines Gegenkanons Die Selbstdarstellung als »kulturalistische Rechte« (Gladic/Thomalla 2021, 7) wird vor allem durch die elitistische Privilegierung des vermeintlich ›alten Mediums‹ Literatur unterstrichen. Film- und Kunstkritik, Texte zu Theater, Serien oder Computerspiel finden sich in den Büchern, Zeitschriftenartikeln, Podcasts und Videos
4
Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=NMp2aEUNb7E, 0.16 – 1.18 (11.12.2022).
287
288
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
der neuen Rechten anteilig viel seltener als die Beschäftigung mit Literatur, darauf hat Hoffmann hingewiesen: »Das Spektrum reicht dabei von Brecht bis Benn, von der Kinderliteratur bis zur ästhetizistischen Lyrik, vom ›Aufruf zur Lektüre‹ bis zum Lernbefehl (›Auswendiglernen!‹)« (Hoffmann 2021, 226). Der hohe Stellenwert der Literaturformate zeigt sich auch auf der Übersichtsseite des YouTube-»kanal schnellroda«: Sie finden sich gleichrangig angeordnet direkt unter den am meisten rezipierten Formaten mit Politprominenz (Aufzeichnungen von Alice Weidel, Alexander Gauland, Björn Höcke oder des hypermaskulinen Neo-Tribalisten Jack Donovan). Gleich darunter schon die Buchempfehlungen von Ellen Kositza und der Hinweis auf »Aufgeblättert Zugeschlagen«. Die Zugriffs-counter zeigen, dass in absoluten Zahlen die Literaturformate zwar deutlich weniger aufgerufen werden. Aber in der Selbstpräsentation des relevanten Content sind sie just one click away.5 Wie überhaupt der Erfolg der neurechten Literaturpolitik nicht zuletzt auf großzügige Content-Bereitstellung und Search Engine Optimization im Internet zurückzuführen ist. Leicht auffindbar im Netz sind dann auch tendenziöse Re-Lektüren klassischer Literatur aus dem Schulkanon, die im Kontext von Hausaufgaben oder Unterrichtsvorbereitung von Schülern oder Lehrpersonen im Internet gesucht werden. Dort stößt man z.B. auf Kubitscheks Text über Trakls Grodek aus der Sezession, der mit einem prägnanten Vers des Gedichtes »Alle Straßen münden in schwarze Verwesung« überschrieben ist und mit dem folgenden Absatz beginnt: Der Krieg setzt für manchen, der ihn ausficht, der Banalität und Langeweile der Friedensexistenz ein Ende: Es geht plötzlich um etwas, man schweift aus, spürt das Blut auf andere Weise kreisen und kommt zu jenen kleinen Portionen an Macht und Ansehen, die im Zivilen keine Bedeutung haben und zu denen es im bürgerlichen Leben nicht reichte. Derlei Daseinssteigerung zu ahnen und auf sie zu hoffen: das war 1914 neben nationaler Begeisterung, Pflichtbewußtsein und Gruppenzwang ein Aspekt für etliche Freiwilligenmeldungen. Für den Dichter Georg Trakl war diese existentielle Komponente sogar der einzige Grund – oder eher Abgrund: fort an die Front, um sich selbst zu entkommen oder sich seiner selbst sogar zu entledigen. Das Freiwillige ist: das Erlösende einer Entscheidung. (Kubitschek 2014, 2) Es liegt auf der Hand, dass es hier dem Autor mehr als um Trakl um die Faszination für den Krieg und das Kriegerische zu tun ist. Denunziert wird die fade »Friedensexistenz«, der gegenüber das Kriegserlebnis als »Daseinssteigerung« gelangweilter Bürgerssöhne beworben wird. Anekdotisch sei berichtet, wie ich zum ersten Mal auf diese rechte Trakl-Lektüre aufmerksam wurde – bei einem Unterrichtsbesuch im Praxissemester. Ein Student hatte ihn für seinen Unterrichtsversuch in Klasse
5
Vgl. https://www.youtube.com/c/kanalschnellroda (11.12.2022).
Jörg Döring: Wie Rechte Lange lesen
11 kommentarlos auf dem Handout für die Schülerinnen und Schüler als Trakl-Sekundärliteratur aufgeführt. Einfach, weil der Text ihm beim Googeln so schnell in die Hände gefallen sei, gab er auf Rückfrage an. Just a few clicks away. Der Autor Kubitschek war ihm unbekannt, die Tendenz des Textes unauffällig geblieben (wie im Übrigen auch dem betreuenden Fachlehrer). Vielleicht hatte er ihn in Ermangelung weiterer bibliografischer Funde einfach aus Verlegenheit mit auf die Literaturliste genommen. Da stand nun der Link – und man kann sich ein paar Schüler vorstellen, die diesen Kubitschek-Text über die »Daseinssteigerung« durch das Kriegserlebnis dann tatsächlich für ihre Abiturvorbereitung benutzen. So oder ähnlich haben sich die Strategen der neuen Rechten die Diskursverschiebung nach rechts auch in den schulischen Lern- und Lesegemeinschaften gewiss vorgestellt.6 Am ehesten erwartbar als Strategie einer rechten Literaturpolitik ist das Bemühen, sowohl in Form traditioneller Literaturrezensionen oder Essays in der Sezession oder aber sozial medial vermittelt durch Videoblogs im »kanal schnellroda« einen Gegenkanon zum vermeintlich herrschenden literaturgeschichtlichen mainstream zu popularisieren. Dabei geht es – wenig erstaunlich – insbesondere um eine Revision der Literatur während des Nationalsozialismus – vorrangig nicht der dezidiert nationalsozialistischen Literatur, sondern solcher Autoren, die zur Zeit des NS in Deutschland erscheinen konnten: Gottfried Benn, Ernst und Friedrich Georg Jünger, Hans Fallada, Jochen Klepper, Horst Lange, Ernst Wiechert, Ernst v. Salomon. In diesem Segment neurechter Literaturpolitik geht es vor allem darum, junge Leser von der Qualität und der Vielstimmigkeit der Literatur während des NS zu überzeugen. Am Beispiel der neurechten Verhandlung der Kriegserzählung Die Leuchtkugeln von Horst Lange aus dem Jahr 1944 soll im Folgenden analysiert werden, wie diese Strategie neurechter Literaturpolitik im Medienverbund funktioniert. Kubitschek bedenkt Horst Lange und seine Erzählung schon 2004 in Form eines Essays in der Sezession (Kubitschek 2004) ebenso wohl wie 2021 in einem fast zweistündigen Literaturgespräch mit Erik Lehnert im Videoblog Livestream. Mit Blick auf den Gegenstand dieser Erzählung – soldatisches Handeln während des Zweiten Weltkriegs – wird zu beobachten sein, mit welchen erzählerischen wie darstellerischen Mitteln auf unterschiedlichen Ausspielwegen junge – vor allem männliche – Leser für die Lektüre aus Sicht der neuen Rechten gelungener Kriegsprosa gewonnen werden sollen.
6
Diese rechte Aneignung gilt nicht nur dem literaturgeschichtlichen Kanon, sondern erstreckt sich inzwischen auch auf die Klassiker der popliterarischen Gegenwartsliteratur. Im Falle des Antaios-Bandes Tristesse Droite. Die Abende von Schnellroda (Kositza/Kubitschek 2015), das scheinaffirmativ das um 2000 viel diskutierte Gesprächsbuch Tristesse Royale. Das popkulturelle Quintett von Joachim Bessing, Christian Kracht, Eckhart Nickel, Alexander von Schönburg und Benjamin v. Stuckrad-Barre (Bessing et al. 1999; vgl. Döring 2019) travestiert, kann man gar von einer paratextuellen Enteignung sprechen. Vgl. dazu auch Lorenz/Riniker 2021.
289
290
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
3. Rechte Pflichtlektüren. Warum Horst Lange (am Beispiel Die Leuchtkugeln, 1944)? Die Erzählung ist noch während des Krieges in Deutschland erschienen, sie gehört damit der so genannten operativen Literatur an (vgl. Benjamin 2012; Hübner/Schütz 1976): Literatur, von der sich das Propagandaministerium an der ›Heimatfront‹ bestimmte kriegsdienliche Wirkungen erhoffte – z.B. die Durchhaltebereitschaft der Bevölkerung im Bombenkrieg zu erhöhen und Empathie für den Heldenmut der Soldaten an der Front zu wecken. Man kann sich leicht vorstellen, dass angesichts des Kriegsverlaufs 1944 aus Sicht des Propagandaministeriums ein besonderer Bedarf für operative Literatur dieses Typs bestand. Der Autor Horst Lange, Jahrgang 1904, hatte während des ›Dritten Reichs‹ schon zwei Romane veröffentlicht: Schwarze Weide von 1937 (Lange 1937) und Die Ulanenpatrouille von 1940 (Lange 1940), beide im Hamburger Goverts Verlag erschienen, der innerhalb des NS-Literaturbetriebs gewissermaßen das Qualitätssegment repräsentierte (vgl. Wallrath-Jansen 2007). Der Autor sollte zunächst als Angehöriger einer Propagandakompanie am Feldzug gegen die Sowjetunion teilnehmen, wurde aber wegen eines disziplinarischen Vorfalls in eine Pioniereinheit an die Front strafversetzt, erlebte den scheiternden Vormarsch der Wehrmacht auf Moskau im Herbst 1941 und wurde im Dezember 1941 schwer verwundet. Im Lazarett entstand dann die Erzählung Die Leuchtkugeln, die genau davon erzählt, wie der Vormarsch auf Moskau mit dem Einbruch des russischen Winters in einen überstürzten Rückzug umschlägt. Ein Ich-Erzähler schildert, wie seiner Pionierkompanie ein geheimnisvoller Neuer zugewiesen wird, der Hermes heißt – wie der griechische Götterbote –, im bürgerlichen Leben Organist ist und sich, aus zunächst ungeklärten Gründen, freiwillig vom Stab an die Front gemeldet hat. Er bleibt vorerst ein Außenseiter in der derben Frontkameradschaft der Kompanie, erwirbt sich aber bald den Respekt und den Neid der Soldaten, weil er Russisch beherrscht und damit in privilegierten Kontakt zur Zivilbevölkerung treten kann. Sein Kriegserleben ist durch diese Kompetenz intensiver, das spüren die Kameraden. Der Ich-Erzähler ist zunächst befremdet, später immer mehr fasziniert von diesem Außenseiter, beginnt sich mit ihm anzufreunden. Auf einem gemeinsamen Meldegang im Feindgebiet, der den größten Teil der Erzählzeit dieser Prosa einnimmt, vertraut Hermes dem Ich-Erzähler seine Vorgeschichte an – die back-story, die motiviert, warum er das Fronterlebnis freiwillig sucht. Er ist als Musiker mit großen künstlerischen Ambitionen gestartet, dann aber durch die bürgerliche Ehe, durch die familiären Ansprüche seiner Frau in eine tiefe Schaffenskrise geraten, die ihn an seiner Produktivität zweifeln lässt. So ähnlich wie in Thomas Manns Novelle Tonio Kröger sind es die »Wonnen der Gewöhnlichkeit«, die Hermes’ Künstlerexistenz bedrohen, und daher sucht er den Krieg als Option, als Ausflucht aus einer existentiellen Sinnkrise. Das titelgebende Motiv der Leuchtkugeln wird mit einer prägenden Kindheitserfahrung in Zusammenhang gebracht. Während des Ersten
Jörg Döring: Wie Rechte Lange lesen
Weltkriegs wird das Kind Hermes Zeuge eines nächtlichen Manövers im winterlichen Heimatdorf. Fasziniert betrachtet das Kind, wie die Leuchtkugeln das imaginierte Schlachtfeld erleuchten, und erträumt sich die existentielle Gemeinschaft der Kriegskameradschaft. Im Moment seiner wirklichen Lebenskrise viele Jahre später wird der reale Krieg dann zur sinngebenden Option. Und die Leuchtkugeln bleiben auch in der Erzählgegenwart die Zentralmetapher dieser Prosa: Nach dem geschilderten Meldegang kehren Hermes und der Ich-Erzähler zu ihrer Kompanie zurück, die aber des Nachts vom Feind umzingelt wird und sich in einer aussichtslosen Lage befindet. Woraufhin Hermes zur existentiellen Tat schreitet: Er wählt den Opfertod, indem er Leuchtkugeln abschießt, damit die Aufmerksamkeit der gegnerischen Truppen allein auf sich zieht und seinen Kameraden dadurch zur Flucht aus dem Kessel und zum Überleben verhilft. Der unheroische Bildungsbürger hat sich zum Helden transformiert, der den Opfertod für seine Kameraden stirbt und seinem als unproduktiv empfundenen bürgerlichen Leben einen Sinn verleiht. Bislang ist nichts darüber gesagt, was an dieser Prosa gegebenenfalls gelungen ist – sie ist von der Germanistik, die sich mit der Literatur während des NS beschäftigt, des Öfteren als eine der wenigen bedeutenden deutschsprachigen Erzählungen aus dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet worden (vgl. Schäfer 2 1984; Denkler 1999; Peitsch 1984; Denkler 2006). Dieses Urteil kann hier nicht diskutiert werden. Es sollte nur deutlich geworden sein, was am Plot dieser Erzählung für die neue Rechte so attraktiv gewesen sein könnte, dass Die Leuchtkugeln zur dringlichen Leseempfehlung werden, zum sozialmedial popularisierten Bestandteil eines rechten Gegenkanons: ein literarischer Text aus der Tradition der deutschen Wehrmacht, der – selbst noch retrospektiv im Bewusstsein um die historische Kriegsniederlage – von der Faszination der Kriegsgemeinschaft und der individuellen Läuterung durch den Krieg handelt – ein Plot, der erkennbar eine attraktive Sinnressource bereitstellt. Mit welchen Mitteln nun bewirbt die neue Rechte diesen Text im Medienverbund? Zunächst dadurch, in dem sie ihn verfügbar macht: Die Erzählung wird im hauseignen Antaios-Verlag neu aufgelegt und vertrieben (Lange 2014). Dann aber auch mit den traditionellen Mitteln des Feuilletons – durch ein Autorenporträt Langes von Kubitschek in der hauseigenen Zeitschrift Sezession (vgl. Kubitschek 2004), innerhalb dessen eine Lektüre von Langes Gesamtwerk mitsamt der Leuchtkugeln offeriert wird, die für die Aneignungstendenz der neuen Rechten in mehrfacher Hinsicht symptomatisch ist. Kubitschek schreibt: In seiner Haltlosigkeit und Verwirrtheit war Horst Lange ein besonders stark ausgeformter Vertreter der sogenannten »Jungen Generation«, die den Ersten Weltkrieg als extreme Erschütterung erfahren hatte, wobei ihr – im Unterschied zur Frontgeneration – aufgrund des Alters ein tatkräftiges Gegenhalten nicht möglich gewesen war. Der Zusammenbruch der alten Ordnung konnte bloß erduldet werden. (Kubitschek 2004, 5f.)
291
292
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Gewählt wird hier das Format des Autorenporträts offenbar auch deshalb, damit das Werk auf den Autor als Person und seine Generationserfahrung zurückgeführt werden kann. Der Autor war zu jung, um noch im Ersten Weltkrieg mitkämpfen zu können. Deshalb konnte der »Zusammenbruch der alten Ordnung […] bloß erduldet werden«, fühlt Kubitschek sich ein. Lange selbst fehlte die Erfahrung des »tatkräftigen Gegenhaltens«, die er – wie der Held seiner Erzählung – erst im Zweiten Weltkrieg würde nachholen können. Schon hier wird aus den Leuchtkugeln eine im Wesentlichen autobiografisch motivierte Erzählung. Was dann folgt, sind für den Diskurs der neuen Rechten sehr kennzeichnende geschichtspolitische und literaturgeschichtliche Akzentuierungen: Lange und viele Vertreter seiner Generation (nahmen) den abermaligen Machtwechsel innerhalb der Weimarer Republik Anfang 1933 nicht als revolutionäre Zäsur (wahr). Die künstlerischen Projekte liefen kontinuierlich über ein Datum hinweg, das sich erst nach und nach als entscheidende Wegmarke darstellte. Von hier führt eine direkte Entwicklungslinie in klassizistische, eine formale Strenge und Ordnung betonende Formen, wie sie in ganz Europa und vor allem auch in Deutschland gegen die Auflösungskunst der Avantgarde Ende der zwanziger Jahre entwickelt wurde. Das »Statische« als positiv empfundene Ruhe und Haltbarkeit ist über Gottfried Benns Gedichte zu einem Bestimmungsmerkmal dieses Ansatzes geworden. Mit der Schwarzen Weide erschien 1937 ein Roman, der begeisterte Besprechungen erfuhr und Lange aus der Sicht vieler Rezensenten zu einem »Dichter europäischen Ranges« (Sebastian Haffner) machte. Die Schwarze Weide wird damit zum Focus, durch den die Kulturpolitik des Dritten Reiches sich als differenziertes Gebilde zeigt. Die Auffassung, daß nur in der Emigration deutsche Kunst überdauern konnte, während im Reich selbst eine Eiszeit jede Entwicklung zum Erliegen brachte, stimmt nicht. (Kubitschek 2004, 6) Der Absatz zeigt, wie auch in einem literarischen Porträt jederzeit die geschichtspolitischen Revisionen der neuen Rechten eingelassen sein können: der 30. Januar 1933 sei keine »Zäsur«, sondern nur ein »abermalige[r] Machtwechsel innerhalb der Weimarer Republik« gewesen. Und das Gesamtwerk Horst Langes wird nicht nur als Beleg für die vermeintlich differenzierte Kulturpolitik während des NS gelesen, die solche Leistungen ermöglichte – sondern auch als Protest gegen die vermeintliche »Auflösungskunst der Avantgarde«, als Traditionslinie einer deutschen klassizistischen Antimoderne – das ist die literaturgeschichtliche Stoßrichtung dieses Porträts: Es sei die Literatur während des Dritten Reiches, die sich der kulturellen Hegemonie der Moderne entgegenstellt habe. Was Lange wiederum besonders attraktiv macht, ist, dass man ihn zum Kronzeugen einer Verachtung der modernen Literatur aufbauen kann:
Jörg Döring: Wie Rechte Lange lesen
Moderne muß nicht zwingend Auflösungskunst sein, das ist eine Erkenntnis Langes: »Mit äußerstem, immer noch wachsendem Widerstreben den Band Kafka zu Ende gelesen. Eine Erzählung wie ›In der Strafkolonie‹ ist das exkrementäre Produkt einer kranken Phantasie. Sadismus, der zur Metaphysik wird« (Tagebücher, 16. II. 45). (Kubitschek 2004, 7) Genüsslich zitiert Kubitschek diese Pathologisierung Kafkas, immer noch eines der Säulenheiligen des kultusministeriell beglaubigten Schullesekanons. An dieser Denunziation der literarischen Moderne zeigt sich deutlich, dass Kubitschek die germanistische Forschung zur modernen Klassik und zur Inneren literarischen Emigration während des NS (vor allem die berühmte Studie von Hans Dieter Schäfer, 1984) nur zur Selbstlegitimation usurpiert. Dem Zitat aus dem Tagebuch Langes folgt bei Kubitschek nun noch der Hinweis, dass Lange nach 1945 in der Bundesrepublik keinen Anschluss an die Gruppe 47, damit an den mainstream der literarischen Nachkriegsmoderne, gesucht habe – ein Dissident gegenüber der kulturellen Hegemonie der Linken zeitlebens und daher interessant als role model für die Sympathisanten der neuen Rechten. Unmittelbar zu der Erzählung Die Leuchtkugeln führt Kubitschek aus: 1944 erschienen die Leuchtkugeln, drei Erzählungen aus dem Rußlandfeldzug, den Lange bis zu seiner Verwundung am 9. Dezember 1941 als Pionier mitgemacht hatte. Lange hat die drei Erzählungen 1943 im Lazarett niedergeschrieben, Carl Zuckmayer bezeichnete die Titelgeschichte als die »beste deutsche Prosadichtung aus dem letzten Krieg«. […]. Der einzelne Soldat kämpft gegen die Gleichgültigkeit und Unabsehbarkeit der russischen Landschaft, jedoch protokolliert er nicht in aufgefächerten Sätzen seinen Untergang, sondern wirft sich auf das, was hält: Auftrag, Kameradschaft, gute Geschichten während langer Nachtwachen, ein paar Schuß Munition gegen die Partisanen in einem Wäldchen irgendwo vor Moskau. Zwar hat die Hauptfigur, der Soldat Hermes, eine Vorgeschichte, etwas Ungelöstes aus seinem zivilen Leben vor dem Krieg, aber das dominiert nicht jeden Schritt. Mehr: Es wird in der kameradschaftlichen Frontatmosphäre auf untergeordnete Stelle verwiesen. Das Jetzt, das bestanden werden soll, überlagert alles. Lange hat in Tagebucheinträgen und Briefen diese Atmosphäre als gesund und heilsam bezeichnet. Die literarische Qualität der Leuchtkugeln ist herausragend, ihr Ton auch 1944 tragbar. (Kubitschek 2004, 6f.) Im Zentrum steht die gesunde und auch für die männliche Seele heilsame Atmosphäre der Front. Der soldatische »Auftrag« und die Kameradschaft, die männliche Gemeinschaft während »langer Nachtwachen« und lebensbedrohlicher Meldegänge überlagern die individualistische Schwermut aus dem zivilen Alltag. Auffällig nur, dass der Clou des Plots bei Lange – das Selbstopfer des Helden Hermes – bei Kubitschek gar nicht erwähnt wird. Man kann sich schon fragen, warum das so ist. Viel-
293
294
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
leicht verfolgt die neue Rechte auch hier ein lesepädagogisches Kalkül. Kubitschek wirbt für die Lektüre und vertraut dann auf die umso stärkere Suggestivkraft einer Erzählung vom Opfertod für die militärische Gemeinschaft als persönliche Sinngebung. Wenn es einem damit ernst ist – so wie der neuen Rechten – dann soll die nachahmenswerte Ideologie des Helden bei Lange allein von der Kraft der literarischen Erzählung beglaubigt werden, nicht durch ihre Nacherzählung in der Sezession. Wie nun bespricht Kubitschek Horst Lange im Livestream-Literaturgespräch? Denn so bedeutsam erscheint der neuen Rechten Horst Lange für ihren Gegenkanon, dass sein Gesamtwerk 2021 noch einmal fast zwei Stunden lang mündlich im Videoblog erörtert wird. Lange gehört zu jenen Autoren, über die Kubitschek seit 2020 gemeinsam mit seinem sidekick Erik Lehnert, einem promovierten Historiker und derzeitigen Geschäftsführer des Schnellrodaer Instituts für Staatspolitik, eine Serie erstaunlich ausführlicher und grundständiger Literaturgespräche geführt hat, die per Livestream ins Internet übertragen wurden und von der community live im chat kommentiert werden konnten. Archiviert sind sie im »kanal schnellroda« unter Hinzufügung dieses live chats, so dass man auch in der Re-Live-Ansicht die Diskussion der community nachvollziehen kann.
Abb. 2: Horst Lange im »kanal schnellroda«
Jörg Döring: Wie Rechte Lange lesen
Auffällig ist zunächst der digitale Paratext: die grafische Gestaltung der Startfläche des Literaturgesprächs auf YouTube (Abb. 2). Wie für alle Folgen dieser Serie wird auch hier ein fotografisches Porträt des zu besprechenden Autors mit einem Grafik-Filter nachgezeichnet und vor einen kolorierten, textil anmutenden Hintergrund gestellt, was dem Porträt etwas Manieriertes, dezidiert Altmodisches verleiht. Wichtiger ist aber hier, welches Foto ausgewählt wurde. Lange wird nicht mit einem seiner bekannteren Porträts abgebildet, die ihn als jungen, nachdenklichen, gutaussehenden Mann, wahlweise mit oder ohne Dichterpfeife, zeigen, sondern mit einer deutlich später entstandenen Frontalansicht eines älteren, etwas aufgeschwemmten Mannes, die vor allem von der riesigen Augenklappe dominiert wird: das Zeichen von Langes Kriegsversehrung scheint kommunikativ bedeutsamer als seine Wiedererkennbarkeit als Autor.
Abb. 3: Lange lesen mit Lehnert (li.) und Kubitschek
Das Literaturgespräch selbst ist mit mehreren Kameras aufgezeichnet, wird aber von einer liebevoll ausgeleuchteten Halbtotalen in nächtlicher Kaminzimmeratmosphäre dominiert, die zwei Männer zeigt – Lehnert links und Kubitschek rechts im Bild – die nebeneinander sitzen und sprechend vor allem die Kamera, mithin das Publikum ihres Livechats und alle späteren Internetuser, frontal adressieren. Zwischen den beiden und der Kamera ist ein großer Tisch, auf dem in sorgfältig arrangierter Unordnung Bücher ausgelegt sind. Atmosphärisch auffällig sind aber vor allem die Flaschen mit alkoholischen Getränken, die diese Gesprächsszene rahmen: Bier, Weinbrand, die passenden Gläser. Also weder der lauwarme Weißwein, der bei der typischen Buchmessen- oder Literaturhausveranstaltung des linksliberalen mainstream ausgeschenkt wird, noch das asketische Nüchtern-
295
296
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
heitsdispositiv der so genannten ›Wasserglaslesung‹ (vgl. Döring 2018) sollen hier die mise en scène bestimmen: Die neue Rechte bevorzugt ersichtlich männlichere Stimulantien für ihr Literaturgespräch (Abb. 3 und 4).
Abb. 4: Keine Wasserglaslesung
Mit folgendem Dialog eröffnen Lehnert und Kubitschek nun dieses Gespräch über Horst Lange: Lehnert: Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer mittlerweile achten Folge unserer Reihe, ähm, Mit Dichtern leben. Mit Dichtern denken. Dichter besprechen – das, äh, könnense sich aussuchen […] Und wir haben uns für die letzte Folge dieser Staffel entschieden für Horst Lange, Horst Langes Werk, äh, wieder etwas populär zu machen, dafür zu werben, weil er unserer Meinung nach einer der wichtigsten Autoren der 30er Jahre ist. Und damit sind wa im Grunde schon beim ersten Punkt des heutigen Abends, nämlich der vielleicht für Aussenstehende etwas merkwürdigen Häufung der Vertreter der so genannten Inneren Emigration, Götz, wenn ick da an Dich überjeben kann, vielleicht schon mal…? Kubitschek: Ja, also Horst Lange, Schlesier, der zweite nach Jochen Klepper, Niederschlesier, äh, in Liegnitz geboren 1904, und dann, äh, im Grunde im Exil in Bayern 1971 verstorben, also vor 50 Jahren, und, äh, des Stichwort is Innere Emigration, es is auch, will ich gleich mal, ah, an der Stelle nochmal sagen, sehr schön, was wir auch an Leserzuschriften aufgrund unserer Livegespräche, Livereihe bekommen, eines der Themen, das immer wieder angesprochen wird: Innere Emigration. Man sollte diesen Begriff also nochmal klären und nochmal deutlich machen, ähm, was
Jörg Döring: Wie Rechte Lange lesen
wir darunter verstehen oder was man gemeinhin darunter versteht und vielleicht warum das auch für uns so’n wichtiger Begriff ist… Lehnert: Mhm, im Grunde fängts ja damit an, warum isser für uns so wichtig. Vielleicht oder vielleicht fangen wa mit der Klärung an. Also Innere Emigration sagt ja im Grunde so etwas, dass man aus ner Sache aussteigt, weggeht, ohne wegzugehen. Und man verstummt nicht. Das, hatten wa uns drauf jeeinigt… Kubitschek: Genau… Lehnert: Es gibt die Emigration, die ist bekannt, das sind so Thomas Mann, Heinrich Mann, die gehen ins Exil, das sind die Migranten. Die versuchen von außen, machen se ihre Literatur und arbeiten ja größtenteils gegen die, äh, gegen Deutschland. Kubitschek: Also der Exitus… Lehnert: Exodus meinst Du… (Lehnert grinst) Kubitschek: Exodus, Tschuldigung, Exitus, mein Gott, also der Exodus… Lehnert: Jetzt konzentrier Dich mal nen bisschen… Kubitschek: Is gut, also der Exodus, der fand wirklich unmittelbar im Frühjahr bis innen Sommer 33 statt, Thomas Mann, Heinrich Mann sind nur zwei sehr prominente Beispiele… (Kubitschek/Lehnert 2021, 0.00 – 2.50) Gleich nach der Zielgruppenansprache (»liebe Freunde«) wird das existentielle Literaturinteresse der neuen Rechten bekräftigt (»Mit Dichtern leben«), das sich offenbar auch auf das ideologische Projekt bezieht (»Mit Dichtern denken«). Von einfach nur ›Dichter lesen‹ ist hier bemerkenswerterweise nicht die Rede. Popularisiert werden soll Horst Lange, weil er »einer der wichtigsten Autoren der 30er Jahre ist« – man unterstellt der Zielgruppe offenbar kein allgemein literaturgeschichtliches Interesse, sondern valorisiert wird ›dissidente‹ Literatur aus der Zeit des NS. Das »Mit Dichtern denken« bezieht sich hier vor allem auf den literaturgeschichtlichen Begriff der »Inneren Emigration«, der beiden Sprechern wichtig ist, weil man ihn für die Beschreibung der eigenen Lage zu instrumentalisieren versucht. Bei der 20. Winterakademie des Instituts für Staatspolitik am 12.1.2020 hatte Kubitschek bereits einen Vortrag zum Thema: »Zwischen den Zeilen. Gibt es bereits wieder eine ›Innere Emigration‹?« (Kubitschek 2020a) gehalten.7 Die Beschäfti7
Anlass war seinerzeit die öffentliche Debatte um Monika Marons Beitrag in der Neuen Zürcher Zeitung »Unser galliges Gelächter. Es liegt mir fern, die Bundesrepublik mit der DDR zu
297
298
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
gung mit den »Dichtern« der Inneren Emigration der »30er Jahre« flankiert diese Einübung einer Selbstbeschreibung des Nichtverstummens im inneren Ausland. Die Aneignung und Umwidmung des links codierten Exilvokabulars setzt sich hier fort: Lange sei 1971 in Bayern »im Exil« verstorben, gewaltsam vertrieben aus seiner Heimat Niederschlesien. Eine solche Reterritorialisierung der Literatur – fast schon im Stile von Nadlers Literaturgeschichte der Stämme und Landschaften (Nadler 1941) – zieht sich durch die meisten der bisher produzierten Literaturgespräche der neuen Rechten. Sie erstreckt sich auch auf die Sprecher selbst: beide kultivieren ihre mundartliche Färbung. Lehnert berlinert, Kubitschek belehrt im getragenen Oberschwäbisch. Das äußere Exil, das seien – in der unverhohlen kruden Diktion Lehnerts – »die Migranten«, die versuchen, »gegen Deutschland« zu »arbeiten«. Und als ob das Ressentiment dieser Begriffsaneignung noch nicht ausreichte, setzt Kubitschek noch eine klassische Freud’sche Fehlleistung obendrauf: Sprechen will er vom »Exodus«, also von der massenhaften Auswanderung biblischen Ausmaßes der linken Schriftsteller im Frühjahr 1933, aber was ihm sein Unbewusstes auf die Zunge zaubert, ist »Exitus« – nach Freud mithin der nicht mitteilbare Wunsch des Sprechers, all diese Migranten möchten nicht nur vertrieben, sondern besser längst tot sein. Da grinst Lehnert und witzelt: »Jetzt konzentrier Dich mal nen bisschen…« Dem inneren Kontext des Transkriptes wie vor allem des Videos kann man m.E. eindeutig entnehmen, dass es sich hier tatsächlich um einen ungeplanten Versprecher handelt, also ausdrücklich nicht um eine inszenierte sprachliche Entgleisung. (Kubitschek selbst scheint sie peinlich: »Exodus, Tschuldigung, Exitus, mein Gott, also der Exodus…«) Dennoch wird die Fehlleistung nach dem Livestream nicht etwa rausgeschnitten für die edierte Fassung des Videos im »kanal schnellroda«, sondern zeugt seither von der non-konformistischen Kühnheit selbst noch des Unbewussten der neuen Rechten. Auch das ein Signal an die Zielgruppe. Als das Literaturgespräch nach über einer Stunde endlich auch auf Langes Leuchtkugeln eingeht, bestätigt sich eine Lektüretendenz, die wir schon aus dem Autorenporträt Langes aus der Sezession kennen. Kubitschek führt aus: Es ist im Grunde schon deswegen extrem genial, find ich, diese Erzählung, weil sie diese Unübersichtlichkeit kleiner, fast auf sich selbst gestellter Einheiten in diesem unendlichen russischen Raum schildert – im Winter – und der Hermes, diese Hauptfigur, ist son bisschen der Lange selbst, der da in so ne rohe Kameradschaft reinkommt und derjenige ist, von dem man nicht so genau weiß, warum ist er jetzt eigentlich hier und wo kommt er eigentlich her, was hat er eigentlich mal gemacht, man weiß nur, er hat irgendwas drauf, was die anderen nicht drauf
vergleichen« vom 7.11.2019, in dem sie behauptet hatte, auch in einem Rechtsstaat wie der Bundesrepublik bestünden »Möglichkeiten«, »Menschen wegen unerwünschter Meinungen die Existenz zu erschweren oder sogar zu zerstören.« Vgl. dazu auch Hoffmann (2021).
Jörg Döring: Wie Rechte Lange lesen
haben. So. Zuckmayer hat später gesagt, dass es wohl die beste Erzählung ist, die im Zweiten Weltkrieg veröffentlicht wurde und geschrieben wurde, und ich muss sagen, dass ich sie natürlich mehrere Male gelesen hab, wir haben sie ja auch, das kann ich ja jetzt vielleicht hinstellen, veröffentlicht, 2014 ist des erschienen. (Kubitschek/Lehnert 2021, 1.15.40 – 1.16.35) Hier findet sich wieder die Werbung für den eignen Medienverbund: wer die Leuchtkugeln auch lesen will, kann gleich bei Antaios bestellen. Die Reterritorialisierungstendenz dieser rechten Lektüre, die wir im Beharren auf den landsmannschaftlichen Eigenheiten von Stoff und Sprechern schon festgestellt hatten, setzt sich hier fort im literaturkritischen Urteil: Kubitschek findet die Erzählung offenbar vor allem aus geoliterarischen Gründen »genial«, weil es ihr gelinge, die auf sich gestellten, kleinen Wehrmachtseinheiten im »unendlichen russischen Raum« zu schildern: der (schließlich unbesiegbare) Feind – wird hier kolportiert – war auch das Terroir. Und die Koppelung von Werk, Figur und Autor, die im Sezession-Porträt schon zu beobachten war, wird im mündlichen Duktus noch weitergetrieben (»der Hermes, diese Hauptfigur, ist son bisschen der Lange selbst«), verbunden mit einem Identifikationsangebot auch für die Gebildeten in der kämpfenden Truppe. Hermes sei jemand, der der etwas »rohe[n] Kameradschaft« etwas geben kann, was »die anderen nicht drauf haben«. Das hört sich fast an wie Zuspruch für die gemobbten bücherlesenden Einzelgänger unter den Rekruten des Kommando Spezialkräfte. Wie Hermes, der mit seinen Sprachkenntnissen und seiner musischen Begabung in den Leuchtkugeln zum heimlichen Anführer der Wehrmachtseinheit aufsteigt, könnten auch die Lesenden unter den Soldaten der Bundeswehr eines Tages – nach Biedermeier und Vormärz – den revolutionären Unterschied ausmachen. Auch diese Zielgruppenansprache passt zum elitistischen Konzept der neuen Rechten.8 Aber auch hier wie im Sezession-Porträt: bezeichnenderweise kein Wort vom Opfertod der Hauptfigur, dem libidinösen Kern der Erzählung. Kein spoiler für die jungen rechten Männer, die zum Antaios-Band greifen und von der Suggestivität des heldischen Habitus überzeugt werden könnten. Gegen Ende des Livestream-Literaturgesprächs über Horst Lange kommt auch noch eine dritte Person ins Bild: Ellen Kositza, die Ehefrau Kubitscheks. Ihre Rolle ist, den Live-chat zu moderieren und Fragen des Publikums an die beiden Diskutanten zu überbringen (Abb. 5):
8
Die Zeitschrift Sezession beschreibt sich selbst: »Sezession arbeitet nicht in die Breite, sondern in die Spitze. Das bedeutet: Ziel unserer Zeitschrift ist es nicht, möglichst viele Leser zu erreichen. Wichtig sind uns die richtigen Leser […].« Vgl. https://sezession.de/konzept (20.12.2022).
299
300
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Abb. 5: Livechat zum Literaturgespräch
Ellen Kositza: Vielleicht eine übergreifende Frage noch […] es wird gefragt: Warum sollte man Horst Lange lesen? Sie ham es kurz beantwortet, ihr beide habt’s kurz beantwortet, aber die Leute wollen, glaub ich, irgendwie den politischen Kick haben, den das alles bringen könnte. Kubitschek: Also, ich will des gerade sagen: den brauchen wir hier gar nicht, also Horst Lange ist einfach nen großartiger Schriftsteller, ja, jetzt könn wa ja aufzählen: wer die Schwarze Weide liest, wer Die Ulanenpatrouille liest, wer Die Leuchtkugeln, den Sohn der Hauptmannswitwe und also Auf den Hügeln vor Moskau liest, und wer eventuell noch Verlöschende Feuer liest und die Tagebücher, der wird bei keinem dieser Werke enttäuscht werden, des ist, ähm, des ist einfach ein ganz großartiger Schriftsteller […] Und wir brauchen überhaupt keinen politischen Impuls. Dass das mit dazukommt, hier mal zu sehen: Wie schreibt einer, der im Dritten Reich schreibt, wie schreibt einer, der Soldat war, und wie schreibt einer, der im Grunde versucht, die Bindung an des Landschaftserlebnis der Kindheit und der Jugend fruchtbar zu machen, der hat nen Nebengewinn. Aber es ist einfach das, was Literatur sein soll: eine großartige Beschäftigung Horst Lange zu lesen. Lehnert: Ich denk ooch, dass die Frage ›Warum‹ immer son bißchen auf ne Nutzanwendung zielt. Kositza: Genau. Lehnert: Das ist eijentlich nicht der Hintergrund, es sollte eigentlich in den Sendungen ooch klarjeworden sein, dass Literatur, gute Literatur letztlich unabhängig davon existiert, welchen Nutzen man daraus zieht, also wer an guter Literatur keine Freude hat, der wird auch mit Horst Lange nix anfangen können, det is numma so, da…
Jörg Döring: Wie Rechte Lange lesen
Kubitschek: Also, wer so liest, ist Stellensucher, der forscht nach Stellen, die er vernutzen kann und sagen ka… (Abbruch der edierten Aufzeichnung) (Kubitschek/Lehnert 2021, 1.48.10 – 1.49.40) Wer sich die Mühe macht und den live-chat nachliest, der das Gespräch begleitet, wird feststellen, dass die Frage nach dem »politischen Kick«, den die Lektüre von Horst Lange »bringen könnte«, gar nicht gestellt wird. Es handelt sich vielmehr um eine scheinpartizipative Inanspruchnahme des Publikums zum Zweck einer weiteren vorbereiteten lesepädagogischen Lektion: Kubitschek und Lehnert dürfen auf diesem Weg den Vorwurf einer rein instrumentellen Horst-Lange-Lektüre für den politischen Kampf wortreich zurückweisen – verbunden sogar mit einer Schein-Beschimpfung der eigenen ungeduldig-illiteraten Klientel, die vorschnell auf die politische Nutzanwendung pocht. Gelernt haben Kubitschek und Lehnert hier wieder bei den 68er-Linken: So oder ähnlich mag sich der Verleger KD Wolff verteidigt haben, als er den Revolutionären der proletarischen Wende in seinem Verlag Roter Stern nun nicht mehr die Schriften von Eldridge Cleaver (Zur Klassenanalyse der Black Panther Partei, 1970), Kim Il Sung (Reden und Aufsätze, 1971) oder Jan Carl Raspe (Zur Sozialisation proletarischer Kinder, 1972) anbot, sondern eine historisch-kritische Hölderlin-Faksimile-Ausgabe. Bei Kubitschek und Lehnert wird die angeblich vernutzende, interessierte, politisch bornierte Lange-Lektüre (an der man die Nazis erkennt) zurückgewiesen, nicht aber natürlich ohne schlussendlich eine Strichaufzählung des (politischen) »Nebengewinns« zu geben: Man lese Lange für beispielhaftes Schreiben/im ›Dritten Reich‹/als Soldat/im fruchtbaren Banne des Landschaftserlebnisses aus Kindheit und Jugend. So gelingt dem Sprecher Kubitschek beinah mühelos beides zugleich: sich zu immunisieren gegen den Vorwurf, ein reiner Stellensucher zu sein, und im gleichen Atemzug den Nutzen der Literatur Langes für die neue Rechte in perfekter didaktischer Reduktion vorzuführen. An genau diesem Prägnanzpunkt bricht die edierte Aufzeichnung ab – der Schnitt ist spürbar roh und schneidet den Restsatz von Kubitschek einfach ab. Das natürliche Gespräch, das hier aufgezeichnet wurde, geht ersichtlich noch weiter (und man soll es auch hören, dass es noch weiterging). Offenbar war der Regie wichtig, dass die Selbstdarstellung der neuen Rechten als Leser genau an dieser Stelle abbricht.
4. Schluss: Die neue Rechte und die Bundeswehrbibliotheken Hier sollte deutlich gemacht werden, mit welchen Strategien, in welchen medialen Formaten und mit welchen sprachlichen Registern die neue Rechte die Lektüre von insbesondere deutschsprachiger Kriegsliteratur aus der Wehrmachtstradition zu popularisieren versucht. Mit Blick auf Langes Leuchtkugeln mögen sich Kubitschek et al. einen jungen männlichen Leser imaginieren, der sich von Langes Prot-
301
302
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
agonisten Hermes das Gefühl des Besonderen und Überlegenen, den soldatischen Habitus und nicht zuletzt die Bereitschaft zum Selbstopfer für die Kameraden abschaut. Wehrbereitschaft, Nonkonformismus, die »Daseinssteigerung« jenseits einer als banal empfundenen Zivilexistenz: Solche Gefühle sollen eingeübt und beglaubigt werden durch die Lektüre ausgewählter Kriegsliteratur und könnten sich als anschlussfähig erweisen für das ideologisch-politische Projekt. Deshalb bewirbt die neue Rechte diese Lektüre und begleitet sie lesepädagogisch. Dass Kubitschek in den Soldaten der Bundeswehr eine Rekrutierungsreserve für die Ziele der neuen Rechten erkennt, dass er sie zu gegebener Zeit zu »wecken« beansprucht, davon war schon die Rede. In einem weiteren Literaturgespräch aus der YouTube-Serie zur Popularisierung eines Gegenkanons, dem live vor Publikum in Schnellroda aufgezeichneten Gespräch zu Edwin Erich Dwinger aus dem Jahr 2022, wiederum gibt Kubitschek darüber Auskunft, inwieweit die Bundeswehr zu seiner eigenen literarisch-politischen Bildung beigetragen hat – ein für Rechte offenbar faszinierend exterritorialer Ort jenseits des vermeintlich liberalen Kontrollund Zensurzwangs: Lehnert: Jetzt frag ich Dich: Wann haste das erste Mal in Deinem Leben von Dwinger gehört? Das ist ja jetz nich so, dass man des mitter Muttermilch aufsaugt. Kubitschek: Das erste Mal in meinem Leben hab ich von Dwinger beim Militär gehört. Das war 1990 in der Fernspähkompanie 200 Weingarten, und wir hatten ne gut sortierte Bibliothek. Und der Betreuer dieser Bibliothek war Oberleutnant Saul, und der wohnte in der Kompanie. Also wir alle wohnten in der Kompanie, und er wohnte dort auch. Die Feldwebel wohnten dort auch. Das war damals schon ne Besonderheit, aber des hat bei uns in der Einheit noch gut geklappt. Und der hat uns jungen Offiziersanwärtern Literatur zu lesen gegeben. Ich hab damals Dwinger kennengelernt, aber auch Bergengruen… Lehnert: Lass uns mal bei Dwinger bleiben. (Gelächter im Publikum) Kubitschek: Also gut. Also ich hab damals Dwinger kennengelernt. Und was ich las, ist, ähm, natürlich eines dieser Kernbücher, das in jede gut sortierte rechte Bibliothek gehört: Die Armee hinter Stacheldraht und dann den Tod in Polen […] Des warn die beiden Bücher, die ich von Dwinger las, ich glaub, da warn noch mehr vorhanden, aber ich hab dann andere Autoren bevorzugt… Lehnert: Das ist aber ne erstaunlich gut sortierte Bibliothek gewesen, wenn man bedenkt, dass ja dieses Buch über den Tod in Polen ein Auftragswerk des Propagandaministeriums war. Dass sich das noch inner Bundeswehrbibliothek befand damals (lachend), erstaunlich.
Jörg Döring: Wie Rechte Lange lesen
Kubitschek: Ich glaub, so Kompanien damals waren so wie unaufgeräumte Speicher, also, da lag halt alles rum, wenn man an die richtige Stelle griff. (Kubitschek/Lehnert 2022, 1.09 – 3.30) Die Bundeswehr wird hier als Schule auch der rechten literarischen Bildung geadelt. Mit einem Oberleutnant, der in erzieherisch beauftragter Kasernengemeinschaft mit den Soldaten lebt und den jungen Offiziersanwärtern auch die richtige klandestine Literatur zu lesen befiehlt – solche, die in den öffentlichen Bibliotheken draußen vor dem Kasernentor längst aus Gründen der political correctness makuliert worden ist. Es sei erwähnt, dass (hier der mit Klarnamen benannte) Ausbilder Oberleutnant Saul seinem lesewilligen Untergebenen Kubitschek das Werk eines Autors zur Gesinnungsschulung anempfahl, der 1941, mit SS-Sondervollmachten ausgestattet, an die Ostfront geschickt worden war, um für Himmler das künftige Nationalepos über die germanische Neubesiedelung der unterworfenen Ostgebiete zu schreiben (vgl. Sarkowicz/Mentzer 2011, 212). Kubitschek macht junge Soldaten und solche, die es werden wollen, neugierig auf die ›gefährlichen‹ Buchbestände in den unzensierten Kasernenbibliotheken. Zugleich schürt er lustvoll die Ängste der liberalen Gesellschaft vor einer rechten Unterwanderung der Bundeswehr. Auch das ist ein kurrentes Register neurechter Literaturpolitik.
Literatur Angelos, James. The Prophet of Germany’s New Right. https://www.nytimes.com/2017/ 10/10/magazine/the-prophet-of-germanys-new-right.html (23.11.2022). Benoist, Alain de. Kulturrevolution von rechts. (Rev. Neuausg.). Dresden 2017. Benjamin, Walter. »Der Autor als Produzent«. In: Ders. Der Autor als Produzent. Aufsätze zur Literatur. Hg. v. Sven Kramer. Stuttgart 2012, 228–249. Bennhold, Katrin. »A Very German Love Story: When Old Left and Far Right Share a Bedroom«. In: New York Times (01.05.2018), 39. Bessing, Joachim/Christian Kracht/Eckhart Nickel/Alexander v. Schönburg/ Benjamin v. Stuckrad-Barre. Tristesse Royale. Das popkulturelle Quintett. Berlin 1999. Busch, Nicolai. Neurechte Pop-Lektüren. Eine Replik. https://pop-zeitschrift.de/2021/1 1/29/neurechte-pop-lektueren-eine-replikautorvon-nicolai-busch-autordatum 29-11-2021/ (14.12.2022). Denkler, Horst. Werkruinen, Lebenstrümmer. Literarische Spuren der »verlorenen Generation« des Dritten Reiches. Tübingen 2006. Denkler, Horst. »Was war und was bleibt? Versuch einer Bestandsaufnahme der erzählenden Literatur aus dem ›Dritten Reich‹«. In: Zeitschrift für Germanistik 9.2 (1999), 279–293.
303
304
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Döring, Jörg. »Tristesse Royale. Das popkulturelle Quintett mit Joachim Bessing, Christian Kracht, Eckhart Nickel, Alexander v. Schönburg und Benjamin v. Stuckrad-Barre (1999)«. In: Handbuch Literatur & Pop. Hg. v. Moritz Baßler/ Eckhard Schumacher. Berlin/Boston 2019, 552–567. Döring, Jörg. »Marcel Beyer liest. Gedicht und performativer Epitext«. In: Marcel Beyer. Perspektiven auf Autor und Werk. Hg. v. Christian Klein. Stuttgart 2018, 73–93. Edition Buchhaus Loschwitz. https://www.kulturhaus-loschwitz.de/impressum.ht ml (16.12.2022). Gladic, Mladen/Erika Thomalla. »Literatur als Klartext. Wie Rechte lesen«. In: Merkur 862.75 (2021), 5–15. Hoffmann, Torsten. »Ästhetischer Dünger. Strategien neurechter Literaturpolitik«. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 95.2 (2021), 219–254. Hoffmann, Torsten/Kevin Kempke. Ernstfall und Schwächeanfall. Zu den Ambivalenzen neurechter Literaturpolitik und ihrer Rezeption. https://pop-zeitschrift.de/2022/03/ 08/ernstfallundschwaechefall/ (12.12.2022). Hübner, Raoul/Erhard Schütz (Hg.). Literatur als Praxis? Aktualität und Tradition operativen Schreibens. Opladen 1976. Kositza, Ellen/Götz Kubitschek. Tristesse Droite. Die Abende von Schnellroda. Schnellroda 2015. Kositza, Ellen/Caroline Sommerfeld. Vorlesen. Schnellroda 2019. Kubitschek, Götz. Widerstand und Tod, Vormärz und Biedermeier. https://sezession.de/ 65587/widerstand-und-tod-vormaerz-und-biedermeier (18.03.2022a). Kubitschek, Götz. »Vormärz und Biedermeier«. In: Sezession 107 (2022b), 1. Kubitschek, Götz. Nassehi, ich und Leggewie. Zwei Briefwechsel. Schnellroda 2021. Kubitschek, Götz. »Zwischen den Zeilen«. In: Sezession 94 (2020a), 8–11. Kubitschek, Götz. »Übermorgen, oder: die Abrißkante«. In: Ders. Hin und wieder zurück. 2017–2021. Schnellroda 2020b, 169–178. Kubitschek, Götz. »Selbstverharmlosung«. In: Sezession 76 (2017), 26–28. Kubitschek, Götz. »Alle Straßen münden in schwarze Verwesung«. In: Sezession 58 (2014), 2f. Kubitschek, Götz. »Autorenportrait Horst Lange«. In: Sezession 7 (2004), 2–7. Kubitschek, Götz/Erik Lehnert. Edwin Erich Dwinger. Erik Lehnert und Götz Kubitschek im Literaturgespräch. https://www.youtube.com/watch?v=vl-uFiKoth4 (13.01.2023) Kubitschek, Götz/Erik Lehnert. Horst Lange. Erik Lehnert und Götz Kubitschek im Livestream (2021). https://www.youtube.com/watch?v=zj7RPB94qek&list=PLAWiZ CGHaksbpus4UI4cu-q9YxtBIelCu&index=5 (03.12.2022) Lange, Horst. Die Leuchtkugeln. Erzählung. Schnellroda 2014.
Jörg Döring: Wie Rechte Lange lesen
Lange, Horst. »Die Leuchtkugeln« [1944]. In: Ders. Die Leuchtkugeln. Vier Erzählungen. Köln-Lövenich 1982, 7–152. Lange, Horst. Ulanenpatrouille. Roman. Hamburg 1940. Lange, Horst. Schwarze Weide. Roman. Hamburg 1937. Leo, Per/Maximilian Steinbeis/Daniel-Pascal Zorn. Mit Rechten reden. Ein Leitfaden. Stuttgart 2017. Lichtmesz, Martin/Caroline Sommerfeld. Mit Linken leben. Schnellroda 2017. Lorenz, Matthias/Christine Riniker. »Christian Kracht und die (Neuen) Rechten. Zum rechten Verständnis einer abklingenden Provokation«. In: Skandalisieren, stereotypisieren, normalisieren. Diskurspraktiken der Neuen Rechten aus sprach- und literaturwissenschaftlicher Perspektive. Hg. v. Steffen Pappert et al. Hamburg 2021, 237–264. Maron, Monika. Krumme Gestalten vom Wind gebissen. Essays aus drei Jahrzehnten. Dresden 2020. Nadler, Josef. Literaturgeschichte der Stämme und Landschaften. Bd. 4: Reich (1914 – 1940). Berlin 1941. Nassehi, Armin. Die letzte Stunde der Wahrheit. Warum rechts und links keine Alternativen mehr sind und Gesellschaft ganz anders beschrieben werden muss. Hamburg 2015. Peitsch, Helmut. »Am Rande des Krieges. Nichtnazistische Schriftsteller im Einsatz von Propagandakompanien gegen die Sowjetunion«. In: Kürbiskern 3 (1984), 126–149. Sarkowicz, Hans/Alf Mentzer. Schriftsteller im Nationalsozialismus. Ein Lexikon. Berlin 2011. Schäfer, Hans Dieter. Das gespaltene Bewußtsein. Über deutsche Kultur und Lebenswirklichkeit 1933–1945. Frankfurt a.M. et al. 2 1984. Schmitz-Berning, Cornelia. »Zersetzung, zersetzen, zersetzend«. In: Dies. Vokabular des Nationalsozialismus. Berlin/New York 2 2007, 698–705. Steinmayr, Markus. »Philister, Autodidakten, Parrhesiasten. Bildungsfiguren im Diskurs der Neuen Rechten.« In: Merkur 862.75 (2021), 77–87. Steinmayr, Markus. »Poetik, Provokation, Lektüre. Björn Höcke und Rolf-Dieter Sieferle im Kontext«. In: Kulturwissenschaftliche Zeitschrift 2 (2020), 37–53. Tellkamp, Uwe. Das Atelier. Dresden 2020. Wallrath-Janssen, Anne-Margret. Der Verlag H. Goverts im Dritten Reich. München 2007. Weiß, Volker. »Die große Inszenierung. Der Literaturwissenschaftler Helmut Lethen und seine Ehefrau Caroline Sommerfeld behaupten, ihre Familie sei Opfer von ›Sippenhaft‹ durch politisch korrekte Kreise. Aber ist das so? Eine Recherche«. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (03.02.2019), 35. Weiß, Volker. Die autoritäre Revolte. Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes. Stuttgart 2017.
305
306
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Weiß, Volker. »Ab wann ist konservativ zu rechts? Pegida, völkisches Denken und seine Wurzeln: Der renommierte Soziologe Armin Nassehi schreibt Briefe an Götz Kubitschek, eine Schlüsselfigur der ›Neuen Rechten‹«. In: Die Zeit (19.02.2016), 20.
»Dasein heißt keine Rolle spielen.« Liebe, Geschichte und keine Erlösung bei Botho Strauß Hans Kruschwitz
1. Episoden ohne Zusammenhang Das große Thema von Botho Strauß’ 2019 erschienenem Erzählband zu oft umsonst gelächelt ist die Liebe. Aber das klingt harmloser, als es ist. Ein alter »Romancier« (Strauß 2019, 9) erzählt einem »jungen Kollegen« (ebd.), den er zum »Abendtisch« (ebd.) geladen hat, im Anschluss an die Bemerkung, dass ihm außer der »Episode« nichts von der Welt bleibe, ausführlich von den »Liebesarten« (Strauß 2019, 20) der Menschen: Was bleibt mir von der Welt als nur die Episode? Von Mann und Frau, von Gott und Mensch? Die Episode. Es folgt nun eine auf die andere, narratio continua. Ein Wort gibt das andere … Der Personen Schreien, Weinen, Befehlebrüllen, ihr Beten und Schmeicheln, ohne jeden Zusammenhang, nur Stöße, Reize, Sprünge, Wirbel: immerzu auf den Spuren ausgestorbener Liebesarten. (Strauß 2019, 20, Herv. i. O.) Was auf diese Einleitung folgt, ist nicht nur eine Revue des Zusammenlebens von Liebenden, es ist ein Panorama, das erweisen soll, dass Weltgeschichte, wenn man die berühmte Formel aus Schillers Antrittsvorlesung Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? (1789) hier verwenden möchte, lediglich als »Aggregat von Bruchstücken« (Schiller [1789] 2004, 763) gedacht und geschrieben werden kann. Präsentiert wird eine lange Reihe von Prosastücken, die entweder gar nicht oder über das Thema der Liebe nur sehr lose zusammenhängen und deren Folge zudem von etlichen Metareflexionen des alten Romanciers durchbrochen wird. Es ist ganz deutlich, dass das Buch damit schon formal gegen die Idee von Zusammenhang und Fortschritt opponieren möchte, ähnlich wie das mit Paare, Passanten (1981) oder Der junge Mann (1984) schon frühere Bücher von Strauß getan haben. In Letzterem hatte sich Strauß’ Erzähler sogar ganz offen gegen diese Idee erklärt, indem er gleichsam aus einer Fremdperspektive über sich und sein erzählerisches Verfahren räsonierte:
308
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Vielleicht wird er zunächst gut daran tun, sich in Form und Blick zunutze zu machen, worin ihn die Epoche erzogen hat, zum Beispiel in der Übung, die Dinge im Maß ihrer erhöhten Flüchtigkeit zu erwischen und erst recht scharfumrandet wahrzunehmen. Statt in gerader Fortsetzung zu erzählen, umschlossene Entwicklung anzustreben, wird er dem Diversen seine Zonen schaffen, statt Geschichte wird er den geschichteten Augenblick erfassen, die gleichzeitige Begebenheit. (Strauß 1984, 10) Wie Christoph Parry bemerkt hat, verwies Strauß damit abermals auf Foucault als spritus rector seiner Ablehnung des linearen Erzählens (vgl. Parry 1995, 97, 106). Bereits in seinem Versuch, ästhetische und politische Ereignisse zusammenzudenken von 1970 hatte Strauß sich für eine an Foucaults Archäologie des Wissens (1969) orientierte Optik ausgesprochen, die nicht etwa darauf zielt, die syn- und diachrone »Unterschiedlichkeit der Rede- und Denkweisen zu vermindern«, sie gar auf »eine einheitliche Gesamtheit« zu bringen (Strauß 1987, 51), sondern im Gegenteil darauf, sie in ihrer Vielfalt zu erhalten. Mit dem Konzept vom »geschichteten Augenblick«, das Strauß seinen Erzähler im Jungen Mann gegen die lineare Geschichte in Stellung bringen ließ, kam er darauf zurück (vgl. Willer 2000, 79). Vollends deutlich wurde seine erneute Bezugnahme auf Foucault in jenem Kapitel des Jungen Manns, in dem er den Erzähler als ethnologischen Beobachter auftreten ließ. Zu beobachten hat dieser die »Syks«, ein kulturell angeblich unschöpferisches, nur die bekannten Traditionsbestände immer wieder neu zusammensetzendes Kleinvolk, das keinen Wert darauf legt, zu irgendeinem Ganzen zu kommen. Der wohl intelligenteste Deuter ihrer sogenannten »Ideen-Geschichten« (Strauß 1984, 123) erkennt und würdigt diese Scheu vor dem ›großen Ganzen‹ und erteilt seinen Kollegen den Rat, ihre Geschichten gleichsam vom Standpunkt eines Foucaultschen Archäologen aus zu lesen: »Es wird sehr schwer sein«, so begann er, »das Ganze dieses ungewöhnlichen [in einer der Ideen-Geschichten der Syks geschilderten; hk] Vorfalls zu verstehen. Wir sind durchaus in der Lage, fast sämtliche Motive und Einzelteile des Geschehens zu entschlüsseln und abzuklären. […] Was uns aber fehlt, ist die Fähigkeit zu erkennen, welcher Ordnung des Seins das Geschehen denn letztlich im Ganzen angehört. Wir befinden uns sozusagen in der Lage eines Archäologen, der an seiner Ausgrabungsstätte alle Bruchstücke und Scherben eines Gefäßes gefunden hat, tatsächlich alle. Und siehe da, sie passen auch haargenau aufeinander, sie fügen sich nahtlos zu einem formschönen Ganzen. Nur stammen sie offenkundig aus den verschiedensten Epochen und Zeitschichten, und das Gefäß, das sich daraus so mustergültig und harmonisch rekonstruieren ließ, das kann es zu keinem einzigen Zeitpunkt der Menschengeschichte je gegeben haben.« (Strauß 1984, 130f., Herv. i. O.)
Hans Kruschwitz: »Dasein heißt keine Rolle spielen.«
Worauf es Strauß immer ankommt, was er stets vermeiden möchte, das ist die vorschnelle Einebnung des Mannigfaltigen durch die Herstellung falscher Zusammenhänge oder durch das Fällen ahistorischer Urteile im Glauben an die eigene, größere Aufgeklärtheit. Wo solche »Totalherrschaft der Gegenwart« statthat (Strauß [1993] 2020a, 230), warnt er, muss die Aufklärung ihren Kopf verlieren. Nur leider bleibt Strauß bei dieser dialektischen, selbst noch aufklärerischen Position nicht stehen, wie sie etwa von Jürgen Habermas formuliert wurde: »Daß die Aufklärung sich über sich selbst, auch über das von ihr angerichtete Unheil aufklärt, gehört […] zu ihrer eigenen Natur.« (Habermas 1988, 64) Stattdessen überschreitet Strauß »die Grenzen zur offenkundigen Gegenaufklärung« (Gottwald 2008, 323). Zahllos sind die Stellen, an denen seine Figuren und Stimmen das aufklärerische Denken pauschal in Frage stellen. Was sie ihm entgegenhalten, ist das Plädoyer für eine Erneuerung des Numinosen, geschichtlich: des Sinns fürs blinde »Verhängnis« (Strauß [1993] 2020a, 232), das der Autor im Anschwellenden Bocksgesang (1993) auch für den Umgang mit dem Holocaust in Anspruch genommen hat: »Die Verbrechen der Nazis«, so heißt es dort, »stehen zuletzt außerhalb der Ordnung des Politischen. […] Eine über das Menschenmaß hinausgehende Schuld wird nicht durch moralische Scham oder staatsbürgerliche Gedenkstunden über ein paar Generationen ›abgearbeitet‹. Sie wird den Nachlebenden vielmehr zum Verhängnis in der sakralen Dimension des Wortes, indem sie ihr geschichtliches und gesellschaftliches Leben auf Dauer entstellt.« (Strauß [1993] 2020a, 241) Es ist bekannt, dass Strauß mit diesem Text scharfe Kritik herausgefordert hat. Sie soll hier nicht im Einzelnen nachvollzogen werden, nur zwei Dinge seien mit Blick auf die unterschiedlichen Fassungen, in denen der Text zirkuliert, bemerkt. In der eben zitierten, meist ›Langfassung‹ genannten Version des Anschwellenden Bocksgesangs muss schon die Perspektivierung von Strauß erstaunen. Als »Verhängnis« erscheinen die »Verbrechen der Nazis« darin nämlich weniger aus der Sicht der Opfer denn aus Sicht der Nachlebenden, deren »geschichtliches und gesellschaftliches Leben auf Dauer entstellt« wird, und zwar, so darf man das im Kontext anderer Texte von Strauß verstehen (vgl. Parry 1995, 108f.), durch die mutmaßliche AuschwitzZentrierung des öffentlichen Diskurses. Diese bemerkenswerte Verlagerung des Gewichts von den Opfern auf die »Nachlebenden« wird in der sogenannten ›Kurzfassung‹, die im Spiegel publiziert wurde, vermieden. Hier ist pauschaler vom »Verhängnis« der »Verbrechen der Nazis« die Rede (Strauß 1993, 204), und es scheint allgemeiner in den Zusammenhang jenes unvermeidbaren Unheils gerückt, das die antike Tragödie nach Strauß »ertragen zu lernen« aufgab (Strauß 1993, 205) – was freilich problematisch genug ist. Denn Thomas Anz hat richtig eingewandt, dass eine solche Inanspruchnahme des Tragischen zur Beschreibung des Holocaust einem Geschichtsverständnis Vorschub leistet, in dem nun vollends keine Verantwortung mehr gilt. Sie führt zurück zur »Vorstellung eines von übermenschlichen Mächten gelenkten Geschichtsprozesses, in dem man allenfalls schuldlos schuldig« wird (Anz
309
310
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
1996, 385). Der einzig richtige Umgang mit der schrecklichen Geschichte könnte darin bestehen, sich nicht-verstehend von ihr erschüttern zu lassen. Der Auftrag aber, aus ihr zu lernen, sie für gegenwärtige und zukünftige Zwecke in Anspruch zu nehmen, wäre aus ihr nicht ableitbar. In den Fragmenten der Undeutlichkeit (1989) hat eine von Strauß’ Stimmen denn auch genau diesen Umgang mit Geschichte empfohlen: Wir stürzen unsere Zeit über alle anderen nieder. Kolonialherren der Vergangenheit! Die siegreiche Gegenwart unterwirft sich, was allemal anders gewesen ist, zerstört die Wildnis, die Regenwälder der Geschichte. Warum haben wir nicht gelernt, dies alles unverständiger zu betrachten, die Fremde zu ehren, statt sie zu erobern und mit unbefugten Begriffen zu beherrschen. Wann endlich dient die Methode dem helleren Nicht-Verstehen? (Strauß 1989, 57f., Herv. i. O.) Wie also auch schon in früheren Texten, so wird in zu oft umsonst gelächelt keine ›Geschichte‹ erzählt, sondern ein Panorama von Episoden entfaltet, mit dem kein Zusammenhang erlogen, sondern das Außerordentliche akzentuiert werden soll, das in der Liebesbegegnung besonders scharf hervortritt. Stefan Willer hat diesbezüglich geradezu von einer Strauß’schen »Liebestheorie« sprechen wollen, da Strauß die Begegnung von Liebenden immer wieder mit Attributen wie »Fremdheit, Zufall, Plötzlichkeit« verknüpft (Willer 2000, 105). Die Liebesbegegnung, so ließe sich Strauß’ Theorie wohl mit Hilfe eines Zitats aus seinem Essay Der Aufstand gegen die sekundäre Welt (1991) auf eine knappe Formel bringen, zerschneidet das »scheinbar undurchdringliche Geflecht von Programmen und Prognosen, Gewöhnungen und Folgerichtigkeiten« und belehrt mithin darüber, »daß es der Geschichte sehr wohl beliebt, Sprünge zu machen, ebenso wie der Natur« (Strauß [1991] 2020b, 15). Aber ist die Funktion der Liebe damit erschöpft? Schon eine der ersten Episoden, die der alte Romancier zum Besten gibt, verneint diese Frage. Ein Mann und eine Frau treten darin auf. Von ihm sagt der Romancier, dass er der »größte Unordnungsstifter von allen« sei (Strauß 2019, 16), und sie, so ergänzt er, stehe ihm in dieser Begabung »in nichts nach« (ebd.). Die Wohnung der Freunde, in der sie übernachten, verwandeln sie aufgrund ihres Talents innerhalb kürzester Zeit in ein Schlachtfeld. Anschließend bricht ein Streit zwischen ihnen aus, wer an dem Chaos schuld sei. »Du verbreitest Chaos, nicht ich«, sagt er oder sie (ebd.), und das salomonische Urteil, auf das sie zur beiderseitigen Entlastung schnell zusteuern, lautet: »Nichts, wo Menschen am Werk sind, befindet sich am rechten Fleck. In der gesamten Weltgeschichte gibt’s weltweit ein ständiges Suchen, Verlegen, Vergessen, Verwechseln und Liegenlassen.« (Ebd.) Kann die beiden Liebenden das beruhigen? Es hat nicht den Anschein, denn vor der nun notwendigen Konsequenz, das ewige »Grau in Grau« (Strauß 2019, 17) der also unrettbar chaotischen Welt zu akzeptieren, scheuen sie zurück, und zwar wohl deshalb, weil es ihrem Zusammenleben den Reiz nähme. Es wird nun wichtig, dass der Liebesbegegnung bei Strauß nicht nur wie bei Charles Baudelaire, im berühm-
Hans Kruschwitz: »Dasein heißt keine Rolle spielen.«
ten Gedicht A une passante (1855), das Moment des ewigen Sich-Verpassens, sondern auch der trotzige Wunsch nach Dauer eingeschrieben ist (vgl. Willer 2000, 106). Darum begnügen sich die beiden Liebenden nicht mit ihrer Einsicht ins ewige »Grau in Grau« der Welt, sondern sie fallen zurück in ihre Rolle als Liebende. Sie beschwören die Liebesbegegnung als das Wiederholbare, das sie vor dem Deprimierenden ihrer Einsicht schützen kann. Sie soll ihrem Leben auch weiterhin Intensität und Tiefe verleihen: Und was jetzt? Alles Grau in Grau. Ja. Alles Grau in Grau in Grau in Grau in Grau … Halt, haltloser Gedanke! riefen nun beide mit einer Stimme. Nicht weiterschweifen! Am Ende plagt uns Ernüchterung, und nichts zum Verlieben können wir je wieder aneinander entdecken. (Strauß 2019, 17)
2. Hauptsache Pathos Wie sehr die Liebe in Strauß’ Band zu oft umsonst gelächelt damit zur unerschöpflichen Quelle des Pathetischen bzw. Mythischen wird, wenn man im Mythos mit Strauß denn die Sammlung jener »Urbilder« vom »härteren Schicksal« erkennen möchte, das das »heilig Unvorhersehbare« dem Menschen auferlegt (Strauß 2020c, 303), und wie sehr die Beschwörung des Mythos von Strauß gegen den Humanismus ins Feld geführt wird, das soll im Folgenden anhand von fünf Texten seiner Liebesarten-Revue gezeigt werden. Der erste ausgewählte Text setzt abrupt mit der Darstellung eines Mordes ein. Ein enttäuschter Liebhaber, so scheint es, nimmt Rache am Objekt seiner Begierde: »Er stach sie nieder auf offener Straße. Dort, wo es am zivilsten zugeht: Jeder streift, ohne anzuecken, am anderen vorbei, verfolgt seinen Weg, kommt niemandem in die Quere.« (Strauß 2019, 97) Der Text ist kurz, die Leserinnen und Leser erfahren nichts über den Hintergrund der Tat. Dafür aber um so mehr darüber, wie der Romancier die Tat von einem höheren Standpunkt als pathetische Durchbrechung des Alltags bewertet, nämlich sehr positiv. Sie ist ihm ein willkommener Einbruch des Außerordentlichen: Auf offener Straße sollte kein Hindernis den Strom der Passanten aufhalten. […] Die Mitte des Bürgersteiges ist reserviert für den Strom. Der Strom wird unterbrochen, staut sich, eine Runde von Stehenbleibenden umgibt das Opfer am Boden, ein Zwischenfall hat sich ereignet, ein Gewaltakt schlug einen Krater in den Alltag. […] Der Alltag, Alltag alle Tage. Welch eine Gewalt, welch kritische Masse! Etwas, worüber man den Verstand verlieren könnte. Man wird es nie begreifen. Alltag läßt ir-
311
312
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
gendwann nichts Unalltägliches mehr zu. Er ist das Vernichtendste und das Heilsamste, das dem Zeitfresser Mensch geboten wird. (Strauß 2019, 97) Zugegeben, hier scheint auch noch ein Gegenzug zur positiven Bewertung des Mordes zu existieren. Der öde Alltag ist nicht nur das »Vernichtendste«, sondern auch das »Heilsamste«, das dem »Zeitfresser Mensch geboten wird«. So sehr er ihn langweilt, so sehr trägt er ihn auch. Doch schon im zweiten Prosastück verliert sich dieser Gegenzug und der Alltag wird ohne jeden Abstrich negativ bewertet. Man liest darin die Klagerede einer Frau, die von ihrem Mann wegen einer Jüngeren verlassen wurde. Dann folgt der Kommentar des Erzählers, in dem die Beschränkung dieser Frau auf eine ›bloße‹ Klagerede kritisiert wird. Die für die Mitteilung notwendige Einhegung ihres Pathos scheint ihm nicht angemessen: Aufruhr, Schmerz und Schrei einer Frau, die einer jüngeren weichen muß in der Ehe mit einem Ungerechten. Es gibt Augenblicke, in denen die Milderungen und Abschwächungen, die liberalen Sicherungen unserer Moral plötzlich aussetzen, Augenblicke, in denen alles dafür spricht, daß das Töten einer Liebe jetzt wie vorzeiten durch Vergeltung bestraft gehört. […] Wie es aber der Alltag will, verkleinert die anfangs Vergeltungssüchtige für sich die Erschütterung auf ein gerade noch zur Mitteilung geeignetes Format. Bei jeder Gelegenheit äußert sie sich zur Sache ihrer Demütigung, teilt sich mit, ja hält die Verkleinerung des Formats sogar für eine Therapie. (Strauß 2019, 83) Im dritten kurzen Text wird die Klage über den Alltag unmissverständlich mit der Abwehr dessen verbunden, was man politische Korrektheit nennt. Alltag ist für Strauß ja, wie er im Anschwellenden Bocksgesang deutlich zur Kenntnis gegeben hat, nicht zuletzt diskursiv erlahmter, in »kritischer Bequemlichkeit« erstarrter Alltag (Strauß [1993] 2020a, 234). Die Liebende, der man im dritten Text begegnet, ist eine junge Kunststudentin. Sie ist mit einem älteren Maler namens »Vescor« (lat. »ich speise, tafle, genieße«) liiert (Strauß 2019, 35), dem Sohn eines holländischen Widerstandskämpfers und Antifaschisten, der allerdings wenig liebenswürdig erscheint. Der Erzähler nennt ihn einen »eitle[n], kalte[n] Mann« (Strauß 2019, 36), der von seiner Frau »in der schwierigsten Zeit des Widerstands und seiner aufopferungsvollen Tätigkeit« (ebd.) betrogen wurde. Vescor hat wohl aufgrund dieser Kälte nie eine Verbindung zu seinem Vater aufbauen können. Er hielt es stattdessen mit der Mutter, »die er liebte und deren Untreue er immer hochhielt« (ebd.). Die Kunststudentin muss nun erleben, wie die Bilder Vescors von ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen an der »Staatlichen Kunstschule« aufs Schärfste verurteilt werden. »Reaktionärer Kitsch! schallt es im Chor aus dem Saal«, als »eine Referentin es wagt« (Strauß 2019, 35), ihn in den Rang eines großen Malers zu erheben. »Eine Schande für die fortschrittliche Kunst der ganzen Welt« sei er (ebd.).
Hans Kruschwitz: »Dasein heißt keine Rolle spielen.«
»Denn sein Credo laute: Ich bin dabei, alles Neue mit feurigem Alten zu zertrümmern. Wer so etwas sage, […] sei auf ästhetischem Gebiet ein Salafist!« (ebd.). Worin das »feurige Alte«, das für Vescor so wichtig ist, genau besteht, bleibt, wie so vieles in Strauß’ Texten, eher unklar (vgl. Spits 2009, 240–243). Man erfährt nur, dass Vescor wegen seiner »erzählerischen Phantastik« bewundert wird (Strauß 2019, 36). Ihm ist »unter dem Einfluß der Erinnerungen an die Mutter der Entwurf einer gestaltenreichen, frei erfundenen Mythologie«, »einer dunklen, gewalttätigen Alptraumgesellschaft« gelungen (ebd.). Doch auch wenn man nichts Genaueres über diese Alptraumgesellschaft erfährt, offensichtlich ist, dass seine Bilder in scharfem Gegensatz zur »Zucht und Kühle« (ebd.) seines Vaters stehen und dass die Ablehnung, die Vescor ihretwegen erfährt, auf einen letztlich auch seine Freundin erfassenden ›öffentlichen Diskurs‹ zurückzuführen ist, in dem das Dunkle und Gewalttätige als Erscheinungsformen des Außerordentlichen – wie beim Mord des Liebhabers im ersten Text – keinen Platz hat. Die folgsame Masse hält es blind mit dem ›politisch korrekten‹ Vater. Bis zur Parodie gesteigert findet sich das so gezeichnete Bild einer ›Meinungsdiktatur‹ der Gutmenschen, in der alles und jedes über den Leisten der politischen Korrektheit geschlagen wird, unabhängig davon, ob das bei ästhetischen Erscheinungen nun angemessen ist oder nicht, im vierten der ausgewählten Texte. Es ist einer der ganz wenigen, in denen von Liebe auch im weitesten Sinn eigentlich nicht die Rede ist, dafür aber um so mehr von der gefühlten Verpflichtung, es immer allen rechtmachen zu müssen und bloß niemals etwas Anstößiges sagen zu dürfen. Im ersten Teil dieses Textes heißt es mit plumpem Bezug auf die politische Farbenlehre in Deutschland: Gisbert, ein Mann, der sich in Gegenwart jedes Menschen, der eine feste Behauptung aufstellt, geradezu windet vor Zustimmung, der’s voller Bestätigungsdrang gar nicht erwarten kann, in ein erlösendes Nicken und Bejahen zu verfallen, sich von ganzem Herzen sinken läßt in die Zustimmung. Bestätigen als Daseinsform. Dagegen schlingernd, vorbehaltlich, verschämt und unterwürfig, was er selbst als Urteil oder Meinung beisteuert, der offenen Behauptung eher ausweichend. Der kleine Gisbert, Begründer der Gisbertologie, der Lehre vom Zustimmen. Am Beispiel des Gisbert, der zart und mitfühlend ist und sich auch an Hitzetagen stets eine rot-grün karierte Decke über die Beine legt, lernt man, wie man bekräftigend wirkt auf seinen Nächsten. Seit jeher vermeidet er, eine abweichende Meinung zu vertreten. Der moralische Anspruch des Abweichens und Andersseins überfordert ihn. (Strauß 2019, 115) Vollends verworfen wird das angeblich zum Alltag verflachte, von der Forderung nach politischer Korrektheit reglementierte Leben im fünften hier präsentierten Text, der der ›Liebesart‹ des berühmten Feldherrn, Politikers und Liebhabers von Kleopatra, Markus Antonius, nachspürt, die im Freitod endete. Antonius’ Art zu
313
314
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
lieben wird von Strauß’ Romancier zum Muster eines gleichsam noch von keiner »politischen Krankheit« (Strauß [1993] 2020a, 226) beschädigten, also noch rein pathetischen Lebens erhoben, dessen Elemente sich – wie angeblich auch die der Weltgeschichte – nicht durch Zusammenhang auszeichnen, sondern nur durch »Stöße, Reize, Sprünge, Wirbel« (Strauß 2019, 20): Des Antonius wirre Ausschläge – verletzt durch Liebe. Jede Handlung wird abrupt und nicht mehr einsehbar. Verrat und Rückkehr, Eifersucht und Unterwerfung. Die gewaltsamen Kehren eines sich zu Tode Hetzenden. Die hohe Reizbarkeit des Trunksüchtigen, unkontrolliertes Herumreißen des Ruders. Es sind extreme Ausschläge, alle auf der gleichen Skala der Leidenschaft oder der Exaltation. Noch das Liebesende ausrufen heißt neues Feuer fangen. Der Kreis des Taumels liegt um »Ägypten« – was mag es bedeuten, eine Frau zu nennen nach ihrem Machtbereich! (Strauß 2019, 45) Die Vorbildhaftigkeit des angeblichen Irrlichterns von Antonius wird von Strauß’ Romancier weiter mit Shakespeare, von dessen Drama er offenbar ausgeht, und Shakespeare selbst mit dem »Eklat des Humanums« in Verbindung gebracht (Strauß 2019, 47), was eine komplizierte Formel für die Außerkraftsetzung der »liberalen Sicherungen unserer Moral« (Strauß 2019, 83) zu sein scheint, für die er schon früher seine Sympathie erklärt hat: Das ist sie, den Braven schwer vermittelbar, Shakespeares Größe: den Konflikt stets bis zum Eklat des Humanums zu führen, so daß nichts mehr von einem Menschen übrig bleibt als die heiße Welle seines Bluts; und am Ende bloß die Erhöhung, von der der Sturz geschieht, um an der eigenen Leidenschaft zu zerbrechen. Dies Feuer hat sich für uns Moderne weit von seinem Herd entfernt. Übrig sind der Mann, die Frau: selbst bei wildem Reden doch zwei Zivilisierte, Friedliebende, deren Waffen abseits ruhen im Depot. Da in der Liebe jetzt den anderen zu verlassen der einzig tödliche Angriff ist. (Strauß 2019, 47) Nimmt man diese Darstellung von Antonius und seiner Leidenschaft als gültige Beschreibung auch für das »feurige Alte[]« (Strauß 2019, 35) jener Albtraumwelten, mit dem der zuvor behandelte Maler Vescor »alles Neue« zertrümmern will (ebd.), und verbindet man sie zudem mit dem Lob jenes Mordes, den der enttäuschte Liebhaber im ersten Text begeht – dann muss sich die Frage aufdrängen, inwieweit hier einem A-Humanismus gehuldigt wird. Hat Strauß’ Romancier in fortgesetzter Abkehr von der Idee des Zusammenhangs einen Weg beschritten, an dessen Ende er dem Menschen nicht mehr anders als gleichgültig gegenüberstehen kann? Ist der von Strauß mit dem Romancier in Szene gesetzte »Fulgurist«, der »keinen Tropfen Kontinuität mehr zu sich nimmt« (Strauß 2020c, 304), also dahin gekommen, das Gegenteil von dem zu erreichen, was im Anschwellenden Bocksgesang noch eines von Strauß’ Hauptanliegen zu sein schien, nämlich die Erneuerung der Erschütte-
Hans Kruschwitz: »Dasein heißt keine Rolle spielen.«
rungsfähigkeit? Denn von welchem Geschehen, welchem ›tragischen Zusammenhang‹ kann sich der, der ohnehin an keine Zusammenhänge mehr glaubt, schon erschüttern lassen? Welches Unglück sollte er betrauern? Er dürfte sich doch nur noch an den wechselnden Mustern ergötzen, die die durch »Stöße, Reize, Sprünge, Wirbel« (Strauß 2019, 20) miteinander verwobenen Dinge bilden und die gelegentlich eben einen Mord einschließen.
3. Asozialer Wildwuchs Zunächst muss man konzedieren, dass Strauß’ Denken selbst bei einer solchen Wendung keineswegs ›ungeschichtlich‹ würde. Noch immer könnte Strauß einem solchen Vorwurf mit dem Hinweis entgegentreten, dass ›ungeschichtlich‹ doch eher seine Antipoden, die Fortschrittsoptimisten dächten, wenn sie alles unter die »Totalherrschaft der Gegenwart« (Strauß [1993] 2020a, 230) stellten. Ihnen gegenüber, so könnte er wiederholen, sei sein mythisches Denken, das von nichts als der Erinnerung an Vergangenes und dem Bewusstsein lebe, das auch das »Niedagewesene« letztlich »aus einer Zelle der ewigen Wiederkehr« geboren werde (Strauß 2020c, 304), doch höchst geschichtlich. Das ist wahr, aber das Problem liegt gar nicht im Geschichtlichen, sondern im Sozialen. Das zeigt ein weiterer Text des Bandes, in dem Strauß’ Romancier ein anschauliches Beispiel dafür gibt, was es denn bedeuten soll, das Vergangene ohne den vom Autor inkriminierten Kolonialherrengestus zu sichten. Der Text, von dem hier die Rede ist, ist einer der ersten des Bandes und spricht von einem ganz besonderen Treppenhaus sowie der doppelten Perspektive, die es eröffnet, wenn man durch das Fenster darin hinausschaut: Narzissen im Regen und ein Fenster im Treppenhaus, von dem man die Straße gesondert in zwei Versionen sah. Einmal so, wie sie gewöhnlich war, nüchtern gegenwärtig. Und einmal in einer virtuellen »historischen« Perspektive. Kolonnen von behelmten Motorradpolizisten waren in beiden, also gegenläufigen Richtungen unterwegs. Sie eskortierten eine nicht abreißende Folge von Aufmärschen, jeweils in Fahrtrichtung, so daß sie den gesamten Straßenverkehr verdrängten, zwar nur den virtuellen, aber man fand sich auch in seinem »realen« Auto im fiktiven Gedränge. In der Mitte der Fahrbahn wechselten Revolutions-Szenen, gab es eine Hinrichtung, umgeben von dichter Volksmenge, schnell geschehen, dann im raschen Wechsel Volksredner, Brände, Lagerkämpfe, Erschießungen, Führerovationen, Attentate – immer begleitet von den rollenden Kolonnen behelmter (heutiger) Polizisten. Das Fenster zum Aufruhr. (Strauß 2019, 13) Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass das Fenster, von dem hier gesprochen wird, das Vergangene nicht tilgt, sondern vergegenwärtigt. Wer in diesem Treppen-
315
316
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
haus steht und durch dieses Fenster schaut, dem rückt das Vergangene buchstäblich auf den Leib. Allerdings, und darauf kommt es an, keineswegs so, dass man sich zum Vergangenen auch verhalten müsste. Das unterstreicht auch der unmittelbar vorangehende Text, der zu jenen Einschüben gehört, mit denen der alte Romancier seine Revue der Liebesarten unterbricht, um sich mit einer Bemerkung an seinen jungen Kollegen zu wenden. In diesem Fall dient die Bemerkung des alten Romanciers dazu, eine politische Positionierung angesichts der gleich vorgeführten Gegenwärtigkeit des Vergangenen geradezu zu verhindern – oder genauer: sie für irrelevant zu erklären. Denn der Romancier sagt: Wir hier, junger Mann, sind noch einmal ein anderes Ufer. Drüben auf besiedelter Seite stehen die protzigen Villen der Hablichen, liegen verfallen die Quartiere der Habenichtse. Sie halten sich für die getrenntesten aller Welten. Doch zwischen beiden und uns, die mit den Worten handeln, verläuft eine nochmals tiefere Trennung. Not und Erschrecken angesichts der Zeugschwäche der Worte. Daß sie nichts mehr hervorrufen, keine Farbe, keine Stimmung, keine Verständigung; daß sie keinen Lichthof, keine Resonanz mehr haben. (Strauß 2019, 12, Herv. i. O.) Man muss sich den Zusammenhang beider Texte völlig klarmachen: Während der Fenster-Text die Gegenwärtigkeit des Vergangenen unterstreicht, die lange Folge der Aufstände und politischen Zusammenstöße in Erinnerung ruft, die auch den Heutigen noch bedrängen, wischt der vorangesetzte beiseite, was vielen dieser Aufstände und Zusammenstöße zugrunde lag, nämlich den sozialen Konflikt. Die Intensität der historischen Erfahrung ist dem alten Romancier wichtiger als ihr politischer Gehalt. Ihn interessiert zwar der »Wechsel« der »Volksredner, Brände, Lagerkämpfe, Erschießungen, Führerovationen, Attentate«. Nicht geheuer sind ihm aber die »Kolonnen behelmter (heutiger) Polizisten« (Strauß 2019, 13), die schon irgendetwas Militant-Agitatorisches in den Blick auf das Vergangene miteinmischen, so als könne es noch darum gehen, aus dem vergangenen Geschehen irgendeinen Auftrag oder irgendein Ziel für die Zukunft abzuleiten, als wäre es also möglich, über das ewige Hin und Her der Geschichte irgendwie hinauszugehen. Ganz in diesem Sinne lässt Strauß im zweiten Teil des heterogenen FensterTexts auch noch zwei weitere Figuren auftreten, nämlich »Fortuna« (Strauß 2019, 13), die sich selbst missverstehende Repräsentantin des (deutschen) Wirtschaftswachstums, die glaubt, alles allein aus sich heraus leisten zu können, und ihren nackten »Wasserträger« (Strauß 2019, 14), der mehr über die wechselhafte Natur seiner Herrin zu wissen scheint als diese selbst. Denn er wird als Mann vorgestellt, »der einen Waagebalken mit zwei Schalen auf den Schultern trägt« (ebd.) und der alles, was »im Leben an Grauen und Herrlichkeit« vorkommt, zum Ausgleich bringt, unabhängig davon, was seine Herrin tut:
Hans Kruschwitz: »Dasein heißt keine Rolle spielen.«
Alles, was gegeneinander abgewogen wird, das verkörpert dieser Mann und geht zuverlässig neben ihr. Was im Leben an Grauen und Herrlichkeit sich die Waage hält: das trägt für sie dieser Mann. Der Ausgleich ist er. Ohne ihn keine Balance im Wechsel von Tagen und Jahren. (Strauß 2019, 14) Auch wenn Botho Strauß’ Orientierung am Mythos also nicht ›ungeschichtlich‹ genannt zu werden verdient, so ist sie doch auf eine Weise historisch, die dem Menschen keinen Einfluss auf den Gang der Geschichte gestattet. »Dasein«, so urteilt Strauß’ alter Romancier dementsprechend, seinen A-Humanismus schonungslos offenbarend, »heißt keine Rolle spielen« (Strauß 2019, 107). Nichts ist dieser Sicht entgegengesetzter als Walter Benjamins Glaube daran, dass »uns wie jedem Geschlecht, das vor uns war, eine schwache messianische Kraft mitgegeben« sei, »an welche« – und darauf kommt es an – »die Vergangenheit Anspruch« hat (Benjamin [1942] 1980, 694). Nach Benjamins Auffassung dürfen vergangene Geschlechter Erlösung von uns fordern. Es ist an uns, den Gegenwärtigen, ihnen rückwirkend Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Darum wundert es nicht, dass Strauß seinen Romancier hier, wie schon in früheren Texten (vgl. Thomas 2004, 190–237), in engem Anschluss an seine Gewährsleute der sogenannten ›Konservativen Revolution‹ Hand an die Wurzel des auch von Benjamin in Anspruch genommenen theologischen Erlösungsdenkens legen lässt, das später zum Fortschrittsdenken säkularisiert wurde. Die Polemik von Strauß’ Romancier gilt exakt dem Punkt der biblischen Schöpfungsgeschichte, an dem die Existenz des Menschen aus dem großen Kreislauf des Seins herausgelöst und zwischen Vertreibung und Erlösung gespannt, das heißt auf ein wie auch immer ›imaginäres‹ Ziel hin orientiert wird: Dasein heißt keine Rolle spielen, fährt nun der alte Dichter im Ton der Zelotin fort, allerdings leise und deutlich ins Bittere gewendet. Nackt, bedürftig, verirrt und einsam unter gleißender Sonne durch den Staub schleichen, Davonschleichen, des Menschen Los von Anbeginn. Ewig fortgesetzt wird einzig die Vertreibung. Seit dem »schöpfungsdynamischen« Rauswurf des Paars hört das menschliche Sichdavonstehlen nicht auf und nennt sich »Gang der Geschichte«. (Strauß 2019, 107, Herv. i. O.) Was an die Stelle des nach Strauß’ Romancier also nur in der Einbildung der Menschen existierenden ›Gangs der Geschichte‹ als Fortschrittsgeschichte tritt, ist der Wildwuchs der Worte, die, weit entfernt davon, ein bloßes Medium der Vernunft zu sein, ein phantastisches Eigenleben führen. Das wäre im Sinne einer sich selbst über ihre sprachlichen Grundlagen aufklärenden Vernunft noch durchaus dialektisch gedacht, wenn die Entgegensetzung von Sprache und Vernunft bei Strauß nicht absolut und, ja, eine Feier des Irrationalismus würde. Was der alte Romancier zu Beginn seiner Liebesarten-Revue noch meinte beklagen zu müssen, die angebliche »Zeugschwäche der Worte« (Strauß 2019, 12), das wird nun, nachdem die Frage nach der wahren Natur des Geschichtsprozesses und
317
318
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
dem Wert des menschlichen Daseins geklärt ist, nämlich zurückgenommen: Die Zeugkraft der Worte erneuert sich und findet in einem Text, der das letzte Drittel des Bandes einleitet, ihre Repräsentation in einer – wie könnte es bei so vielen Stereotypen anders sein – natürlich weiblichen Liebenden, die von der männlichen Vernunft nicht durchdrungen werden kann: Mit ihrer Scheu vor eindeutigen Worten, vor jedem »Klartext« zurückzuckend, aber flink und unverfolgbar in verschlungenen Ornamenten sprechend, bleibt sie ihrem Liebsten, bleibt sie männlicher Vernunft an sich oft unzugänglich und wird nur selten so verstanden wie erwünscht. Niemals wird sie etwas sagen können, ohne sich in Abschweifungen zu verlieren. Was sie selber glaubt offen dargelegt zu haben, bleibt für ihre Umgebung eine dichte Verästelung von einander widerstrebenden und sich überlagernden Botschaften, gleichsam ein Glossenwerk, überfüllte Ränder eines letztlich unerschließbaren Haupt- und Grundtextes. Doch schön ist es, wie jedes ihrer Geistesgewächse, jede ihrer sich rankenden Umschreibungen die natürliche Wildnis verdichtet, der zwei Menschen ihre erhöhte Wachsamkeit wie auch ihr blindes Vertrauen zueinander verdanken. (Strauß 2019, 167) Mann und Frau werden damit, wie es in einem ähnlichen, nicht weit entfernten Text heißt, in den »Garten der Beunruhigung« entlassen, in dem sich »ihre Worte wildwuchernd verzweigen« (Strauß 2019, 144f.), das heißt in dem sie erleben können, »wie sie auf einmal ohne Zusammenhang, ungehemmt, von allem zugleich sprechen, von Lüsten, Armut, Schmerzen und Religion« (ebd.). Zentral ist nun nicht mehr das, was ihre Worte meinen oder ausdrücken wollen, sondern dass ihre Worte »in ein freies Entgleiten übergeh[en],« in »ein Abschwirren und Drunter-und-Drüber, in ein dämonisches Allerlei, das schließlich der Wind der Beliebigkeit vollends zerstreut« (Strauß 2019, 145). Daran sind zwei abschließende Bemerkungen zu knüpfen. Erstens sollte die Qualifikation des so beschriebenen Wildwuchses der Worte als ›dämonisches Allerlei‹ mit Vorsicht genossen werden. Im Kontext des hier Entwickelten zeugt sie von einer beunruhigenden Gewaltfaszination. Vom Mord des enttäuschten Liebhabers am Objekt seiner Begierde auf offener Straße über die »dunkle[], gewalttätige[] Alptraumgesellschaft« (Strauß 2019, 36) eines Malers, der solche Gesellschaft der »Zucht und Kühle« seines Vaters, eines »tapfere[n] Widerstandskämpfer[s] und Antifaschist[en]« vorzieht (ebd.), bis hin zum »Eklat des Humanums« in den Dramen Shakespeares (Strauß 2019, 47), die vom Menschen nichts übrig lassen »als die heiße Welle seines Bluts« (ebd.): Immer führt das Dämonische weit über das Ästhetische hinaus, bleibt also nicht Metapher fürs wilde Gestöber der Worte, sondern sprengt bewusst die »liberalen Sicherungen unserer Moral« (Strauß 2019, 83) und bereitet damit jenes Urteil vor, nach dem das Dasein des/eines Menschen eigentlich keine Rolle spielt. Ausgehend von der Klage über die »Zeugschwäche der Worte« (Strauß
Hans Kruschwitz: »Dasein heißt keine Rolle spielen.«
2019, 12) betreibt Strauß so eine Form der ästhetischen Mobilmachung, und zwar auf entlarvende Weise – denn wie will die Faszination fürs »dämonische Allerlei« zu Strauß’ einstiger Behauptung passen, dass »rechts« zu sein bedeute, »die Übermacht« geschichtlicher Erinnerung zu erleben (Strauß [1993] 2020a, 230), und der sich so verstehende Rechte »vom Neonazi« ungefähr »so weit entfernt« sei »wie der Fußballfreund vom Hooligan« (Strauß [1993] 2020a, 231)? Wer sich wie Strauß so sehr einer Überwältigungsästhetik verschreibt (vgl. Hoffmann 2006, 245–268) und wer den Menschen so rückhaltlos zum Spielball wildwuchernder Worte erklärt, den Mord, zu dem ihr Wuchern führt, so ausdrücklich als willkommene Erscheinung des Außergewöhnlichen begrüßt wie sein alter Romancier, der scheint viel näher beim Hooligan zu stehen, als er selbst ahnen möchte.1 Zweitens macht die Strauß’sche Verknüpfung von ästhetischem Wildwuchs und Gewaltfaszination sichtbar, wie nötig eine Darstellung wäre, die zeigt, wie leicht ein aufs Schlagwort des »ewigen Sinnentzugs« (Koschorke 2018, 109) (infolge des ›Gleitens der Signifikanten‹, des ›historischen Wechsels von Wissenssystemen‹ etc.) verflachte Rezeption des Poststrukturalismus anschlussfähig für neurechtes Denken gemacht werden kann. Strauß’ Aneignung von Foucaults archäologischer Methode im Versuch, ästhetische und politische Ereignisse zusammenzudenken dürfte als guter Ausgangspunkt dafür dienen. Strauß’ richtige Warnung davor, mit dem Vergangenen nach Art von Kolonialherren umzugehen (vgl. Strauß 1989, 57f.), schreibt sich von dieser Aneignung ebenso her wie seine spätere Empörung darüber, dass wir »nicht mehr verstehen«, warum »ein Volk sein Sittengesetz gegen andere behaupten will und dafür bereit ist, Blutopfer zu bringen« (Strauß [1993] 2020a, 228). Hier wie dort ist ein durchaus kritischer Geist am Werk, der seine »Energie« allerdings vor allem »gegen den westlichen Liberalismus selbst« richtet (Koschorke 2018, 112) und moralische Begriffe in schlechtem Anschluss an Nietzsche generell zu »unbefugten Begriffen« erklärt (Strauß 1989, 58).
Literatur Anz, Thomas. »Sinn für Verhängnis und Opfer? Zum Tragödien-Verständnis in Botho Strauß’ Anschwellender Bocksgesang«. In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 40 (1996), 379–387. Benjamin, Walter. »Über den Begriff der Geschichte« [1942]. In: Ders. Gesammelte Schriften. Bd. I,2. Hg. v. Rolf Tiedemann/Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt a.M. 1980, 691–704. 1
Zur Spannung, die dadurch entsteht, dass Strauß den »Rechten« einerseits klar vom »Neonazi« unterscheiden will, andererseits jedoch unzweifelhaft »Familienmitglieder« in ihnen erkennt, vgl. Hahn 2022, 78–80.
319
320
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Gottwald, Herwig. »Aufklärung, Aufklärungskritik und Gegenaufklärung bei Botho Strauß«. In: Nachklänge der Aufklärung im 19. und 20. Jahrhundert. Hg. v. Klaus Müller-Salget/Sigurd Paul Scheichl. Innsbruck 2008, 315–328. Habermas, Jürgen. »Die neue Intimität zwischen Politik und Kultur«. In: Die Zukunft der Aufklärung. Hg. v. Jörn Rüsen/Eberhard Lämmert/Peter Glotz. Frankfurt a.M. 1988, 59–68. Hahn, Hans-Joachim. »Ästhetisierung rechter Gewalt: Kulturpolitische Interventionen im Nachwendejahrzehnt«. In: Rechte Gewalt erzählen. Doing Memory in Literatur, Theater und Film. Hg. v. Matthias N. Lorenz/Tanja Thomas/Fabian Virchow. Stuttgart 2022, 75–88. Hoffmann, Thomas. Konfigurationen des Erhabenen. Berlin 2006. Koschorke, Albrecht. »Linksruck der Fakten«. In: ZMK Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung 9.2 (2018), 107–118. Parry, Christoph. »Zwischen Erinnerung und Verdrängung. Poetik und Geschichte bei Botho Strauß«. In: Geschichte als Erfahrung und literarische Form. Hg. v. Liisa Saariluoma/Gerhard Schmitt. Oulu 1995, 91–113. Schiller, Friedrich. »Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?« [1789]. In: Ders. Sämtliche Werke. Bd. 4: Historische Schriften. Hg. v. Peter-André Alt. München 2004, 749–767. Spits, Jerker. »Waldgänger und Außenseiter-Heros. Ernst Jünger und Botho Strauß als Dichter der Gegenaufklärung«. In: Ein Gedenkband zum 10. Todestag von Professor Konrad Gajek. Hg. v. Edward Białek. Dresden 2009, 231–252. Strauß, Botho. »Anschwellender Bocksgesang« [1993]. In: Ders. Die Expedition zu den Wächtern und Sprengmeistern. Kritische Prosa. Hamburg 2020a, 225–244. Strauß, Botho. »Der Aufstand gegen die sekundäre Welt. Bemerkungen zu einer Ästhetik der Anwesenheit« [1991]. In: Ders. Die Expedition zu den Wächtern und Sprengmeistern. Kritische Prosa. Hamburg 2020b, 15–30. Strauß, Botho. »Sprengsel«. In: Ders. Die Expedition zu den Wächtern und Sprengmeistern. Kritische Prosa. Hamburg 2020c, 281–314. Strauß, Botho. zu oft umsonst gelächelt. München 2019. Strauß, Botho. »Anschwellender Bocksgesang«. In: Der Spiegel 6 (1993), 202–207. Strauß, Botho. Fragmente der Undeutlichkeit. München 1989. Strauß, Botho. »Versuch, ästhetische und politische Ereignisse zusammenzudenken«. In: Ders. Versuch, ästhetische und politische Ereignisse zusammenzudenken. Texte über Theater, 1967–1986. Frankfurt a.M. 1987, 50–76. Strauß, Botho. Der junge Mann. München/Wien 1984. Thomas, Nadja. »Der Aufstand gegen die sekundäre Welt« – Botho Strauß und die »Konservative Revolution«. Würzburg 2004. Willer, Stefan. Botho Strauß zur Einführung. Hamburg 2000.
Die Gegenwart des literarischen Antisemitismus. Zum religiösen Gefühlswissen seit der Romantik – mit einem Close-Reading von Peter Handkes Text Die Lehre der Saint-Victoire (1980) Jan Süselbeck
1. Einführende Überlegungen zur Persistenz antisemitischen Gefühlswissens Während das Wirkungspotenzial des literarischen Antisemitismus im Lauf der Zeit starken Wandlungen unterworfen sein kann, frappiert die Langlebigkeit des emotionalen Gedächtnisses, das solche Narrative bewusst oder unbewusst aufzurufen vermögen. Wir sprechen hier nicht etwa von bloßen hartnäckigen Vorurteilen, sondern, wenn man der Antisemitismus-Definition der Linguistin Monika SchwarzFriesel folgt, von etwas sehr viel Größerem, Umfassenderem, Gefährlicherem: Es handele sich um ein auf »judeophoben Stereotypen basierendes Glaubens- und Weltdeutungssystem, das im kollektiven Bewusstsein der abendländischen Denkund Gefühlsstrukturen verankert und im kommunikativen Gedächtnis durch seit Jahrhunderten reproduzierte Sprachgebrauchsmuster gespeichert ist« (SchwarzFriesel 2015, 38). Im literarischen Antisemitismus, wie man ihn als spezifisches ästhetisches Phänomen im Medium der Literatur verstehen gelernt hat (vgl. u.a. Gubser 1998), geht es jedoch nicht nur um »Sprachgebrauchsmuster«, sondern auch um komplexe Erzähltechniken. Ein Stereotyp steht in einem literarischen Text zur Aufrufung eines bestimmten Gefühlswissens zum Beispiel nie allein, sondern ist in der Regel mit historisch vielfach erprobten emotionalen Skripten oder narrativen Mustern verknüpft, die in der Rezeption sehr oft mit weit verbreiteten Legenden oder auch religiösen Überlieferungen verbunden werden können. Dies vermag die emotionalen Effekte eines Textes wiederum bedeutend zu erhöhen und zu intensivieren. Wichtig ist hier die Einsicht des Historikers Uffa Jensen, dass es beim Verständnis des Phänomens des Antisemitismus auch ganz allgemein um mehr als bloße Stereotype geht. Jensen erinnert daran, dass menschliche Emotionen Resultat eines er-
322
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
lernten Gefühlswissens sind, welches auf einer Verknüpfung seit der frühen Kindheit erworbener kognitiver und emotionaler Bewertungsmechanismen beruht. Diese Bewertungen richten sich gerne anhand toxischer Affekte wie Groll, Häme, Ekel und Ressentiments auf konstruierte Fremdgruppen, die Jensen als die »moralisch Anderen« in die Debatte über negative Gefühle einführt. Was alle diese Gruppen eine, existiere allerdings nur »aus der Perspektive der ressentimentgeladenen Menschen«, wie es Jensen formuliert. Die Anderen verstießen nur aus der Sicht der Hassenden gegen »die moralische Ordnung der Gesellschaft«, indem sie »amoralisch handeln oder eine andere moralische Ordnung propagieren« (Jensen 2021, 177): In der Forschung nur von Vorurteilen oder Stereotypen zu reden, so Jensen, verfehle »ganz grundsätzlich den wirklichkeitsverzerrenden Charakter dieser spezifischen Mischungen eines Gefühls-Wissens« (Jensen 2021, 178). Das Gefühlswissen des Antisemitismus wird seit Jahrhunderten über Medien wie das der Literatur vermittelt und multipliziert. Die Romantik z.B. entdeckt im frühen 19. Jahrhundert alle möglichen phantastischen, mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Legenden über ›die Juden‹ wieder. Sie werden zu dieser Zeit vemehrt erneut adaptiert und in modifizierter Fortschreibung in das Repertoire des aktuellen Diskursen angepassten modernen Antisemitismus mitaufgenommen. Dazu zählen etwa Teufels- und Golem-Mythen, Ritualmordlegenden (vgl. Süselbeck 2018, 237–262), der Vorwurf der Brunnenvergiftung (siehe Gubser 1998, 59), die biblische Geschichte des Verrats durch Judas (vgl. Gubser 1998, 146) und der Ahasver-Mythos bzw. die frühneuzeitliche Legende vom ›Ewigen Juden‹. Wie jüngst in verschiedenen Aufsätzen gezeigt wurde (Hahn/Süselbeck 2020; Süselbeck 2021a; Süselbeck 2021b), kehrt vor allem letzteres Affektszenario bei Autoren wie Achim von Arnim und E.T.A. Hoffmann in verschiedenen Abstufungen wieder, die teils weniger im Sinne eines expliziten literarischen Antisemitismus funktionieren, als dass sie erzählerische Grauzonen impliziter Konstruktionen von Fremdheit entfalten, die das Publikum aufgrund von deren Vernetzung mit altbekannten antisemitischen Mythen zumindest potenziell emotionalisieren können. Dämonische Figuren wie Hoffmanns Sandmann etwa gemahnen dabei in ihrer literarischen Profilierung auch ohne jede explizite Identifikation als ›Juden‹ an zeitgenössische Phantasmen ›des Jüdischen‹ – und sie korrespondieren zugleich intertextuell mit offener antisemitischen Texten der Zeit, seien es solche aus dem Werk des gleichen Autors oder anderer Schriftsteller, sowohl synchron als auch diachron. Die weiterhin im kommunikativen Gedächtnis lebendigen Schauergeschichten, die in der Romantik zum Einsatz kommen, werden auch im modernen Judenhass und im aktuellen Post-Holocaust-Antisemitismus weiterverwendet. Bei der Einordnung dieser verstörenden aktuellen Reflexe althergebrachter Ressentiments in der Gegenwartsliteratur ist ein Verständnis der gewandelten Tradierungsformen des Antisemitismus nach 1945 wichtig. Der Judenhass funktioniert hier vor allem über
Jan Süselbeck: Die Gegenwart des literarischen Antisemitismus
Andeutungen und das Aufrufen von Codes, die gleichwohl Echos aus der Tradition des religiösen Antijudaismus aufweisen können. Wie stark gewisse emotionale Bewertungsmuster religiöser Natur in der europäischen Kultur auch im Zeitalter der Aufklärung weiter präsent blieben, demonstriert der Historiker Jacob Katz in seinem Standardwerk Vom Vorurteil bis zur Vernichtung. Der Antisemitismus 1700–1933 anhand des Religionskritikers Voltaire. Mitte des 18. Jahrhunderts konnte dieser trotz seiner Kritik an der christlichen Kirche nicht davon ablassen, im Zuge seiner Demontage irrationaler Glaubensinhalte das Judentum anhand von Stereotypen zu attackieren, die über Jahrhunderte genau durch die von ihm gescholtene christliche Kirche etabliert worden waren: »Wie ein frommer Christ hielt Voltaire daran fest, dass die Juden eine Gruppe von Schuften und Betrügern waren, und er blieb der kollektiven Feindseligkeit treu, die er in seiner frühen christlichen Erziehung ererbt hatte und von der sich zu befreien er nie einen Anlaß sah.« Diese Treue Voltaires zu den Resten der christlichen Tradition möge widersprüchlich erscheinen, räumt Katz ein, doch das Aufgeben eines dogmatischen Inhalts bedeute noch lange nicht, dass man »sich auch von den damit verbundenen emotionalen Ansichten befreit« (Katz 1989, 51). Weiter resümiert Katz: »Emotional besetzte Bilder von Juden und Judentum im Bewußtsein von Menschen haben Generationen lang bestanden, auch wenn ihre geistigen Gründe längst verloren waren« (Katz 1989, 245). Damit ist Katz einer der wenigen Antisemitismusforscher, die den Aspekt der Affekte nach 1945 nach einem jahrzehntelangen Verstummen der diesbezüglichen Diskussion in Antisemitismustheorien vor dem Zweiten Weltkrieg (vgl. Hahn 2021) wenigstens wieder einmal benannt haben. Er sah das Phänomen ganz richtig in einer »kollektiven Kulturtradition«, wenn er es auch nicht näher untersuchte (Katz 1989, 245). Noch bis vor Kurzem hörte kaum jemand auf Katz’ Forderung, man müsse sich »der Analyse sowohl der kognitiven und emotionalen Inhalte der antisemitischen Ideologien als auch der gesellschaftlichen Situation zuwenden, in der sie ihre konkrete Gestalt annehmen« (Katz 1989, 249). Der Literatur kommt in diesem Feld sozial konstruierter Emotionsregeln und -regimes die Rolle eines kreativen Spielfeldes und Erprobungsmediums zu, das mit vielsagenden Ambiguitäten arbeiten kann, die in der Rezeption leicht in destruktiven Hass umkippen können, aber nicht müssen. Im vorliegenden Beitrag soll nun gefragt werden, inwiefern implizite pseudo-christliche oder proto-religiöse Affektszenarien des literarischen Antisemitismus in der Gegenwart auftauchen. Bei der Recherche stieß der Verfasser neben den üblichen Verdächtigen Günter Grass, Martin Walser, oder, bereits sehr viel umstrittener, Christian Kracht, auf Peter Handke, der in diesem Kontext bisher noch kaum behandelt worden ist. Um einen Anfang zu machen, soll es im Folgenden exemplarisch um einen Handke-Text von 1980 gehen, der mit diesem Erscheinungsjahr wohl eher noch der Nachkriegs- denn der Gegenwartsliteratur zuzuordnen ist, aber dennoch typische Emotionalisierungsstrategien aufweist, die sich auch in neueren Texten bei ihm und den anderen genann-
323
324
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
ten Autoren wiederfinden. Der vorliegende Beitrag soll damit als erste Modellstudie und Anregung für weitere Untersuchungen nicht nur zu Handke dienen.
2. Codierte antisemitische Feindbilder bei Peter Handke So sehr sich Peter Handke seit den späten 1970er Jahren bemühte, seine Erzähler oder dramatischen Figuren als weltabgewandte Wandersmänner und Einzelgänger in meditierender Betrachtung einfacher Naturschönheiten und Alltagsgegenstände zu inszenieren, als Sprachrohre eines entfernt an Adalbert Stifter erinnernden Detailrealismus, so brechen aus der friedlich erscheinenden Beschaulichkeit seiner Idyllen dennoch Affekte hervor, die über diese betont unpolitische Ästhetik hinausweisen. Die Ausgangsposition gleicht dabei einer Misanthropie, wie man sie in der Nachkriegsliteratur sehr viel prominenter und polemischer bei Thomas Bernhard oder Arno Schmidt findet. »Was die Einsamkeit, die soziale Isolierung des Autors betrifft«, erklärt etwa der Literaturwissenschaftler Jürgen Jacobs, »so sieht Handke in ihr eine notwendige Voraussetzung seiner literarischen Produktivität. Daß sein Werk aufgrund dieser Voraussetzung außerhalb der Geschichte und fern der Gesellschaft bleibt, nimmt er in Kauf, ja er empfindet es eigentlich nicht als Mangel.« (Jacobs 1993. 10) Jacobs hat bereits moniert, dass sich Handke dabei den Gestus eines poeta vates, eines regelrechten Gurus anmaße (Jacobs 1993, 18–21). Zugleich attackiert Handke jedoch den Journalismus oder die Literaturkritik auffällig heftig dort, wo er meint, durch sie in seinem vergeistigten Exil empfindlich gestört zu werden: Hie die Ergriffenheit angesichts einer »heiligen Welt« und des »zeitlosen Gesetz[es] hinter den Erscheinungen« (Handke 1991, 43), dort der »elementare Ekel« vor den »Kleinkreise[n]« des Literaturbetriebs (Handke 1987, 37; vgl. Jacobs 1993, 10, 15). In seiner Erzählung Nachmittag eines Schriftstellers (1987) beschreibt sich Handkes Erzähler etwa als »der Gefangene der Redakteure«, deren »Meinungsgefechte[n]« er zunächst noch mit durchaus ambivalenten Gefühlen folgt, da für ihn das »Blättern in den Zeitungen eine Sucht« (Handke 1987, 33) sei, die »daneben nicht einmal auch eine Lust war« (Handke 1987, 34). Am Ende fasst er für sich den Entschluss: »Nie mehr würde er mittun bei diesem Kreislauf aus Einordnungen und Urteilen, die doch fast nur aus dem Ausspielen des einen gegen den anderen bestanden.« (Handke 1987, 36f.) Die Welt des Feuilletons beschreibt er als den »despotischsten der Kleinstaaten, entweder dumpf und kumpelhaft zusammengeschart oder spinnefeind auseinandergewürfelt«, in dem »selbst die Ungebärdigsten« binnen Kurzem »zu Diplomaten entartet« seien, weil sie sich »von betriebsblinden Bütteln« beherrschen ließen, die, »Machtwillen anstelle der Unterscheidungskraft, umso willkürlicher mit ihrer Beute umsprangen, als sie nach außen das Bild liebedienerischer
Jan Süselbeck: Die Gegenwart des literarischen Antisemitismus
Biederleute abgaben« (Handke 1987, 35). Die Literaturkritik erscheint diesem Erzähler dabei als »Falschspiel«, in dem »Winkelpolitik getrieben wurde« (Handke 1987, 34). Nicht nur das Adjektiv »entartet« lässt in dieser Darstellung der Literaturkritik aufhorchen. Berüchtigt ist in diesem Kontext die auf den Kritiker Marcel Reich-Ranicki gemünzte Passage in dem Buch Die Lehre der Saint-Victoire (1980), die keineswegs aus heiterem Himmel erschien. Bereits seit Handkes Lesung bei der Gruppe 47 in Princeton 1968 hatte der Autor Reich-Ranicki immer wieder polemisch angegriffen (vgl. Struck 2021). Dass es in der Lehre der Saint-Victoire überhaupt auf verschlüsselte Weise um den jüdischen Kritiker gehen soll, was auf den ersten Blick keinesfalls unmittelbar evident ist, gab Handke 1989 in einem Interview mit André Müller selbst zu. Müller hakte damals nach, als Handke in einer einigermaßen wirr anmutenden Passage des Interviews zusammenhanglos meinte: »Man möchte die Leute vernichten. Was in der Literatur herumkrabbelt, das möchte man alles vernichten.« (Müller/Handke 1989) Die Formulierung deutet bereits eine im Antisemitismus typische Perhorreszierung des Judentums als Insekt an, taucht hier aber ohne klar benannte Zielrichtung auf. Handke bejaht in dem Interview jedoch, dass er gerade an eine Passage in seiner Lehre der Saint-Victoire gedacht habe, um auf Anfrage seines Gesprächspartners zuzugeben, was in diesem Text nirgends steht – dass er dort seinerzeit Reich-Ranicki gemeint habe. Allerdings fügt Handke sofort hinzu: »Diesen Namen werden Sie aus meinem Mund niemals hören. Sie können ihn mir ruhig zehnmal sagen. Das geht zum einen Ohr hinein, zum anderen wieder hinaus. Es gab eine Zeit, in der ich von konvulsivischem Widerwillen befallen wurde, sobald dieser Mann nur in Erscheinung trat. Er hat über Jahre versucht, mich zu vernichten. Er hatte die Illusion, das zu können.« (Müller/Handke 1989) Die erstaunlich heftige somatische Reaktion, die Handke hier beschreibt, deutet auf den Affekt des Ekels hin. Sie erinnert verblüffend an einen Befund in SchwarzFriesels und Jehuda Reinharz’ Studie zur Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert, die zahlreiche solcher Beispiele von Ekelsäußerungen gegenüber Juden analysiert: Typische Verfasser produzieren demnach Texte mit einem so hohen Emotionspotenzial, als ob »ihnen selbst unermessliches Leid zugefügt worden sei« (SchwarzFriesel/Reinharz 2021, 269). Zur Stelle in der Lehre der Saint-Victoire und Handkes codierter Attacke auf ReichRanicki, auf die im Text nur sehr wenige Details hinweisen und die man ohne genaueres Vorwissen leicht überliest, äußert Handke weiter: Ja, mich hat, was der schreibt, vor zehn Jahren, das gebe ich zu, sehr beschäftigt, weil er dachte, nun hätte er mich endgültig zur Strecke gebracht. Da habe ich mir gesagt, na, jetzt werden wir mal schauen. Ich glaube, daß ihm der Geifer noch immer von den Fangzähnen tropft. Ein besonderes Phänomen ist auch, wie oft diese Groteskgestalt parodiert wird. Ich kenne viele, die finden ihn amüsant. Die haben
325
326
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
gar keinen Stolz. Die sagen, wenn der einmal stirbt, wird man das sehr bedauern. Dem kann ich nun nicht beipflichten. (Müller/Handke 1989) Auch in einem 2007 mit der österreichischen Zeitschrift profil geführten Interview kommt das Thema noch einmal zur Sprache. Handke bestätigt hier zudem abermals, dass er das einstige Ableben Reich-Ranickis keineswegs bedauern werde, um zugleich jedweden Antisemitismus empört von sich zu weisen (Handke 2007). Im Rahmen meines Monographieprojektes zur Affektivität des literarischen Antisemitismus seit 1781 wurde ich selbst erst aus gegebenem öffentlichen Anlass auf diesen überdurchschnittlich deutlichen Fall aufmerksam, in dem ein Autor sogar selbst über Jahre wiederholt stolz auf seine Polemik verweist, auch wenn diese bereits mit Judenhass in Zusammenhang gebracht wurde: Die kroatisch-deutsche Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Alida Bremer griff Handkes Text in einem kritischen Essay zur monatelangen, erhitzten Debatte anlässlich der Verleihung des Literaturnobelpreises an Handke im Jahr 2019 auf – nicht ohne auf den grotesken Umstand hinzuweisen, dass in der Begründung des Nobel-Komitees ausgerechnet die Lehre der Saint-Victoire als Werk genannt wurde, in dem sich der prämierte Autor in vorbildlicher Weise mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinandergesetzt habe (Bremer 2019). Zugleich machte Bremer darauf aufmerksam, dass der glühende Handke-Hagiograph Lothar Struck die Botschaft der betreffenden Passage in der Lehre der Saint-Victoire heruntergespielt habe, um die darin versteckte Reich-Ranicki-Attacke rundheraus zu leugnen. Kurz: Auch wenn die fragliche Intention eines Autors für den Beleg des antisemitischen Wirkungspotenzials eines solchen Textes sekundär sein mag, ist Handkes Bekenntnis in dem Zeit-Interview von 1989 deshalb wichtig, weil es die Leugnungsstrategien höriger Handke-Forscher unmittelbar ad absurdum führt (vgl. Bremer 2019, unter Verweis auf Struck 2013). Ob Peter Handke selbst Antisemit ist, kann und soll hier im Folgenden jedoch nicht weiter Gegenstand der Spekulation sein. Vielmehr geht es um die Analyse der Semantik und der Affektszenarien in der Lehre der Saint-Victoire: Wie zu zeigen sein wird, klingt eine zentrale Formulierung aus diesem Text in einer weiteren Interview-Aussage Handkes im Gespräch mit profil explizit wieder an. Zunächst behauptet der Autor einmal mehr, der ungenannte Gemeinte (aka Reich-Ranicki) habe ihn zerstören wollen. Diese Projektion eigenen Hasses auf den halluzinierten Todfeind entpuppt sich sodann als zentraler Umkehr-Affekt in Handkes jahrzehntealtem Saint-Victoire-Text und der dort zum Einsatz kommenden proto-religiösen Dämonisierungstechnik: »Früher, als ich so dreißig, vierzig war, da habe ich schon manchmal bösartig losgelegt. Da wollte ich jemanden zwar nicht vernichten, aber weghaben von mir. Aber dann hat der andere, zu Recht, mich vernichten wollen.« (Handke 2007, Herv. J. S.) Nicht nur dieser seltsamen Unterscheidung von einem ›Vernichten‹ und ›Weghaben wollen‹ soll nun anhand der Lehre der Saint-Victoire in einem kurzen Close Reading auf den Grund gegangen werden.
Jan Süselbeck: Die Gegenwart des literarischen Antisemitismus
3. Die Begegnung mit dem absoluten Bösen in der Lehre der Saint-Victoire Der Erzähler in der Lehre der Saint-Victoire wandert um und auf den gleichnamigen Berg in der Provence, um dort allerlei empfindsame Betrachtungen vorzunehmen. Angesichts eines zähnefletschenden Wachhundes hinter dem Zaun einer Kaserne der Fremdenlegion wird er auf seinem Weg jedoch zu einem geradezu kosmisch anmutenden Hass aufgestachelt. Der Text evoziert hier zunächst Ekel- und GewaltAssoziationen durch eine Kindheitserinnerung an einen verwesenden Hundeleichnam bzw. eine schwarze Dogge und einen Dobermann, die einen weißen Pudel »entzweirissen« (Handke 1980, 53–54). Sodann wird das Auftauchen des bedrohlichen Hundes hinter Stacheldraht beschrieben, angekündigt durch »ein metallisches Klirren, wie von einem Laufenden mit gezogener Waffe«. Die Rede ist von »Grollen« und »Gebrüll«, den »bösesten aller Laute, Todes- und Kriegsschrei zugleich, ohne Ansatz das Herz anspringend«. Das »Gebißweiß, und dahinter bläuliches Fleischpurpur« symbolisieren hier ein evolutionär-ursprüngliches Panik-Gefühl, das den Protagonisten befällt (Handke 1980, 55). Kopf und Gesicht des Hundes sind »tiefschwarz«: »Sieh dir das Böse an«, ermahnt sich der Erzähler nun und fährt mit Beschreibungen fort, die, wenn man denn Handkes Interviewäußerungen im Kopf hat, tatsächlich entfernt als typische Karikatur Reich-Ranickis gelesen werden können. Ein sehr bekanntes dieser satirischen Porträts stellte den Kritiker schließlich als eine Art ridikülisierten Höllenhund dar, wenn auch dieses berühmte Spiegel-Cover mit dem Titel Der Verreißer, das mit einer Google-Bildersuche im Netz leicht zu finden ist, erst am 04.10.1993 erschienen sein mag. Wurde es womöglich sogar durch Handkes Szene von 1980 inspiriert, falls sich deren Bedeutung im Literaturbetrieb seit den 1980er Jahren herumgesprochen haben sollte? Im Interview mit der Zeit behauptete das Handke jedenfalls auf die Frage: Meinen Sie Reich-Ranicki? Handke: Ja, das hat mir unglaubliches Vergnügen bereitet. Glauben Sie, daß er es weiß? Handke: Sicher, das wissen alle. So sehen also Ihre geheimen Triumphe aus. (Müller/Handke 1989) In der Lehre der Saint-Victoire klingt dieser ›Triumph‹ so: »Der Schädel des Hundes war breit und erschien trotz der hängenden Lefzen verkürzt; die Dreiecksohren verkürzt wie kleine Dolche. Ich suchte die Augen und traf auf ein Glimmen. In einer Brüllpause, während er um Atem rang, geschah nur das lautlose Tropfen von Geifer.« (Handke 1980, 56) Der Hund wird als nächstes sogar zur Kriegsmetapher, da die umliegende Landschaft mit seinem Gebell in der Wahrnehmung des Protagonisten »in einem einzi-
327
328
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
gen Strudel von Bombentrichtern und Granatlöchern« verschwindet (Handke 1980, 56). Das Wesen der Dogge verbindet sich im Text mit dem Territorium der Fremdenlegion. Das Tier warte nur darauf, unbewaffnete Passanten, die Anzeichen von Angst und Schwäche zeigen, in seinem »Blutdurst« anzugreifen. Einerseits bringt der von Handke beschriebene Hund also Tod und Verderben, andererseits ist er selbst verloren, da ihn »gleichsam etwas Verdammtes umtrieb« (Handke 1980, 57). Der mehrfach erwähnte Stacheldraht, durch den der Erzähler den »Feind« betrachtet, verbindet sich semantisch mit der wohl verräterischsten Assoziation von Handkes Hasstirade, wonach der Hund »in seiner von dem Getto vielleicht noch verstärkten Mordlust jedes Rassenmerkmal verlor und nur noch im Volk der Henker das Prachtexemplar war« (Handke 1980, 58). Vor diesem Hintergrund wirken auch die folgenden Formulierungen besonders perfide. Der Erzähler wirft dem Tier eine Metro-Karte hin, die es nach den Worten Handkes wie ein Marder, also ein »Allesfresser«, verschlingt, um sogleich ein weiteres Ekel-Szenario heraufzubeschwören: Im Phantasiebild fielen sofort die Würmer, die in seinem Inneren von ihm lebten, in einem finsteren Nachgetümmel über den Fahrschein her – und schon schied die Dogge auch tatsächlich ein verdrehtes, wie ihre Dolchohren spitzes Türmchen aus; worauf ich erst bemerkte, daß sie rundum auf dem Beton mit vergleichbaren, vertrockneten und ausgebleichten Gebilden, die auch in Häufchen gesammelt erschienen (insgesamt eine großspurige Krakelschrift), sich sozusagen einen öffentlichen Machtbereich abgesteckt hatte. (Handke 1980, 59) Der Kritiker erscheint hier also, und dies in den bisherigen Handke-Zitaten aus der Saint-Victoire nicht zum ersten Mal, als geifernder Hund, den bekanntlich schon Goethe in seinem sprichwörtlich gewordenen Gedicht Der Rezensent getötet sehen wollte: »Schlagt ihn tot, den Hund! Es ist ein Rezensent« (Goethe 1982, 62).1 Hinzu kommt ein weiterer Klassiker des literarischen bzw. dramatischen Antisemitismus seit Gustav Freytags Lustspiel Die Journalisten (1854), wo ein opportunistischer jüdischer Skribent namens Schmock auftaucht, der seiner Zunft kaum zur Ehre gereicht: Dieser Hund kann bei Handke auch nicht schön und deutlich schreiben, er kann sich, mit anderen Worten, nicht in klarem Deutsch ausdrücken, mehr noch: Er steckt seinen »Machtbereich« mit Kot ab, er schreibt gewissermaßen nichts als ›Scheiße‹.
1
Goethes 1773 oder 1774 entstandenes Gedicht ist zuerst ohne Titel im Wandsbecker Boten vom 9.3.1774, wenig später unter dem Titel Der unverschämte Gast im Jahrgang 1775 des Göttinger Musenalmanachs und 1815 (etwas verändert) in der Rubrik »Parabolisch« unter dem Titel Recensent in Goethe’s Gedichte (2 Bde. Stuttgart und Tübingen in der J. G. Cotta’schen Buchhandlung) erschienen.
Jan Süselbeck: Die Gegenwart des literarischen Antisemitismus
Ein wechselseitiges Drohstarren von Protagonist und Tier, Auge in Auge, führt hier zur Erkenntnis, »auf ewig Todfeinde« zu sein. Kein Zweifel: Der Hund trachtet dem Erzähler »nach dem Leben«, so wie der Protagonist selbst ihn »mit einem Machtwort« tot und »weg haben« möchte (Handke 1980, 60). Das ist sie wieder, die oben zitierte Formulierung, die Handke noch 2007 erneut im Interview verwendet, als er auf seine literarische Reich-Ranicki-Polemik zurückkommt: »Da wollte ich jemanden zwar nicht vernichten, aber weghaben von mir« (Handke 2007). »Sprachlos vor Hass« verlässt der Erzähler darauf das Terrain (Handke 1980, 60). Falls es bis jetzt noch nicht deutlich geworden ist, wird in dieser superlativischen Rhetorik die religiös konnotierte Totalität des Bösen nun greifbarer: Der Hund wird zu einer Satansfigur, als sein Hecheln im Text nach Flügeln klingt, »mit denen er gleich über den Zaun setzen würde« (Handke 1980, 60). Die Begegnung lässt dem erbosten Wanderer die gesamte Attraktivität der Saint-Victoire, des nahen Berges, bedeutungslos werden. Das mit allen nur erdenklichen Negativzeichen belegte dämonische Fremde der Dogge macht dem Erzähler also das in Handkes Poetik Wesentlichste unmöglich, es vernichtet seine romantische Naturwahrnehmung. Die Begegnung mit dem Hunde-Satan nimmt dem Protagonisten die Fähigkeit, die heilige Landschaft unbeschwert zu durchwandern, sie dabei literarisch zu erfassen, zu ›lesen‹ und zu beschreiben: »Vergessen die Dankbarkeit über den bisherigen Weg; die Schönheit des Berges wurde nichtig; nur noch das Böse war wirklich. Stumm, wie ich war, fiel mir auch das Gehen sehr schwer. Der Feind zuckte in mir weiter und stank dann schon. In der Natur nichts Erkennbares, vor allem nichts Benennbares mehr« (Handke 1980, 61). Auch wenn die longue durée des Phänomens in der Forschung umstritten sein mag, fallen an der Passage eine ganze Reihe von Affektszenarien und Implikaturen auf, wie sie im literarischen Antisemitismus seit Jahrhunderten auftauchen. Zunächst einmal ist von Belang, dass die gesamte Szene ohne weitere explizite Markierungen in die Wanderbeschreibung des Textes montiert ist und nur mittels Kenntnis einer Reihe von Kontexten als Karikatur und als Polemik gegen den einflussreichen Kritiker und Feuilleton-Leiter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Marcel ReichRanicki, decodierbar ist – etwa durch die Physiognomie des geifernden Hundes, seine Ohren, seinen angeblichen Speichelfluss, seine vernichtende Machtgier, seine identitäts- und buchstäblich rassenlose Herkunft aus dem »Getto« und ReichRanickis vermeintlich ekelerregenden Stil, der mit den Körperausscheidungen der Dogge verglichen wird. Die Andeutung, der Hund sei von einer Verdammnis umgetrieben (Handke 1980, 57), erinnert nicht zuletzt an das antisemitische Stereotyp des ›Ewigen Juden‹. Dass Reich-Ranicki das Warschauer Getto überlebte, macht Handkes Allegorie endgültig zu einem Musterbeispiel des literarischen Antisemitismus, einer typischen Täter-Opfer-Umkehr, die etwa auch die von Thomas Anz erstellte Website zu Marcel Reich-Ranicki und seinen »Freunden und Feinden« benennt, als sie die
329
330
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Saint-Victoire zitiert: »Ein Opfer der deutschen Nationalsozialisten, so der maßlose Vergleich« bei Handke, sei »als Kritiker selbst zum Täter geworden.« (Anz 2021) Man sollte die affektive Botschaft der Szene jedoch noch genauer beschreiben. Der Erzähler kann hier im Grunde froh sein, dass der beschriebene »Leithund« (Handke 1980, 56) hinter Stacheldraht tatsächlich nur bellt und nicht die in seinen Assoziationen zu den Atemgeräuschen des Tieres aufgerufenen satanischen Schwingen hat, um das Hindernis zu überwinden und dem Protagonisten das Leben zu nehmen. Noch einmal der komplette Wortlaut des betreffenden Satzes: »Der nächste Laut des Hundes war kein Gebell, sondern ein inständiges Hecheln, das immer heftiger wurde und schließlich wie das Geräusch von ihm gerade anwachsenden Flügeln war, mit denen er gleich über den Zaun setzen würde« (Handke 1980, 60). So gelesen, belebt Handkes Szene geradezu ein nationalsozialistisches Propagandaszenario wieder: Der Feind als ungreifbare, teuflische ›Gegenrasse‹, die man im ›Dritten Reich‹ mit einem universalen Hass verfolgte, gefährdete aus dieser Propaganda-Sicht das Innerste der europäischen Kultur, er verbreitete Tod und Verderben, er stank, weil man ihn im Getto und im Konzentrationslager tatsächlich zu dem gemacht hatte, was man in ihm als ›Krankheitsherd‹ sehen wollte, und er musste deshalb einfach ›weg‹. Auch bei Handke richtet sich die Drohung des Leithundes und seiner Meute letztlich nicht nur gegen den Erzähler, sondern gegen den gesamten Gebirgszug der Saint-Victoire, der Handkes Text seinen Titel gibt. Sein Erzähler bemerkt, dass das Geheul des Hundes nicht nur ihm allein galt, sondern »dem Weiß der Bergkette dahinter, oder allem jenseits des Tierbereichs« (Handke 1980, 60). Kein Zweifel: Dieser Feind ist ein totaler, tierischer, teuflischer. Und er möchte alles zerstören, das nicht zur eigenen ›Gegenrasse‹ gehört. Die Dichotomie von Gut und Böse, die Handke hier entwirft, fußt auf einer auffallenden Häufung antisemitischer Stereotype eines kollektiven Gefühlswissens, das aus den Untiefen des christlichen Antijudaismus stammt. Es zielt auf emotionale Reaktionen wie Angst, Häme, Ekel und Hass. Handkes Wut-Szene wirkt dabei in sich widersprüchlich, weil die exterritoriale Beobachterposition seines Erzählers, diese gesamte Poetik und Ästhetik literarischer Snapshots und flaneurhafter Beobachtungen am Wegesrand, eine Erfindung des deutschsprachigjüdischen Schreibens von Heinrich Heine bis zu Siegfried Kracauer war. Eignet sich Handke hier zwecks literarischer Distinktion ausgerechnet eine innovative Form deutschsprachig-jüdischen Schreibens der Moderne an, um seine ›Einflussangst‹ (Harold Bloom) mittels althergebrachter Ekel- und Hassformeln aus der mittelalterlich-christlichen »Judensau«-Dämonisierung des Judentums, die schließlich ebenfalls schon mit derbstem Fäkalhumor operierte, zu exorzieren? Handkes narzisstische Selbstüberhöhungen gegenüber der literarischen Welt und dem Feuilleton, wie man sie aus seinem Zeit-Interview mit André Müller kennt, sind jedenfalls mehr als deutlich: »Ja, denn je länger Sie in diesem Kunstbetrieb und
Jan Süselbeck: Die Gegenwart des literarischen Antisemitismus
Literaturbetrieb leben, desto gründlicher vergessen Sie alles, was Sie sich einmal zum Ziel gesetzt haben. Es gibt ja nichts anderes als die Schönheit, nichts, was wirklicher wäre«, verkündet er hier, um sich zu der bemerkenswerten Behauptung zu versteigen: »Ich kenne niemand Lebenden, der so reine Literatur macht wie ich. Alle anderen verbreiten bloß Meinungen. […] Das einzige, was mir im Leben wirklich gelungen ist, worauf ich stolz bin, ist, ein Weltbild vermieden zu haben.« (Müller/ Handke 1989) Schon Jürgen Jacobs dekonstruierte solche Aussagen anlässlich der Reich-Ranicki-Passage aus der Lehre der Saint-Victoire, die in dem hier nachgezeichneten Kontext fasst schon wortwörtlich als ›Lehre vom Sieg-Heil‹ zu übersetzen wäre, mit den sarkastischen Worten: »Ob dies noch ›reine‹, absichtslose, meinungsfreie Literatur ist, wird man bezweifeln müssen. Fraglich scheint auch, ob eine so maßlose Attacke, die offensichtlich vom Haß diktiert ist, sich mit jenem ›sanften Gesetz‹ in Einklang bringen läßt, das doch im Zentrum der Lehre der Sainte-Victoire steht.« (Jacobs 1993) Damit war die Geschichte jedoch noch lange nicht zuende. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung wurde Handke 2012, also ein Jahr vor dem Tod des F.A.Z.Kritikers 2013, einmal mehr mit bohrenden Fragen über sein schwieriges Verhältnis zu Reich-Ranicki konfrontiert. In einer Zurückweisung der Idee, sich mit seinem Rezensenten jemals zu versöhnen, bekennt der Autor abermals seinen Stolz über seine Attacke von 1980, die er erneut mit einer brüsken Zurückweisung jedweden Antisemitismusverdachts verbindet, während er Reich-Ranicki zynisch nachruft: »Ich glaube, das ist unsterblich, wie ich es in der Lehre der Sainte-Victoire geschrieben habe: Ein paar getrocknete Haufen liegen herum von dem Hund. Das wurde mir übel genommen als Antisemitismus, aber da konnte ich auch nur staunen drüber. Er lebe in Frieden. Ich sage das ganz ernsthaft.« (Handke 2012) Zugleich verweist Handke in diesem Gespräch im Whataboutism-Gestus auf Martin Walsers Verhältnis zu Marcel Reich-Ranicki »15 Jahre meines Lebens hat mich das wirklich beschäftigt. Auch Martin Walser war ja fast krank, besessen. Da bin ich noch ein harmloser Fall.« (Handke 2021) Ein vergleichender Blick in Walsers einschlägigen Skandaltext lässt diese Einschätzung jedoch zweifelhaft erscheinen. Fallen doch an Handkes Hunde-Metaphorik zumindest partielle Ähnlichkeiten zu Walsers Reich-Ranicki-Karikaturen in dessen Roman Tod eines Kritikers (2002) auf. So wird hier der jüdische Kritikerpapst André Ehrl-König ebenfalls als von Grund auf und willentlich schlechter Charakter eingeführt: »Er wollte böse sein. Er glaubte dafür Gründe zu haben. Er wollte groß sein im Bösesein. Seine Tragödie: er [sic!] blieb ewig hängen im Giftigsein. Giftzwerg sei ein Wort, daß man in seiner Gegenwart niemals gebrauchen durfte.« (Walser 2002, 108) Auch das Geifern, das Handke mehrfach mit Reich-Ranicki assoziiert, taucht bei Walser wieder auf, jedenfalls in dem obszönen Herrenwitz, dass Ehrl-Königs Geliebte Cosima von Syrgenstein über ihr Zusammensein mit dem Kritiker einen Roman mit dem Titel »Einspeicheln« zu schreiben beabsichtigt (Walser 2002, 179).
331
332
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
4. Schluss: Zur Wiederaufrufung antisemitischer Emotionalisierungsstrategien in wechselnden Kontexten Die Affekte und Projektionen, die den hier analysierten Text Handkes prägen, sind zweifellos extrem. Die Lehre der Saint-Victoire ist damit im Werks dieses Autors aber sicher kein Einzelfall. Der jüdische Nachkriegsautor Wolfgang Hildesheimer dachte darüber am 5. Januar 1984 in einem langen Brief an Christiaan L. Hart Nibbrig und dessen Studentin (und spätere Ehefrau) Melanie Kuster nach, die sich Hildesheimer gegenüber als Verehrerin des ›späten Handke‹ zu erkennen gegeben hatte. Die bemerkenswerte Hellsichtigkeit von Hildesheimers damaligen Gedanken sei hier in ihrer Drastik abschließend paraphrasiert, weil sie das, was in der Lehre der SaintVictoire geschieht und sich emotional auf die lesenden ›Jünger‹ übertragen soll, auf frappierende Weise treffen. Handke halte sich für »auserwählt«, urteilt Hildesheimer. »Denn um elitär zu sein, bedarf es nur der eigenen Überzeugung, es zu sein.« In Wirklichkeit sei Handke ein »Menschenverächter« und ein »Hasser« – ein »Mann inhumaner Anwandlungen und des selbstüberwältigenden Affektes«. Seine Helden, »ohne Zweifel zu einem hohen Grade Objekte der Selbstidentifikation«, neigten »stark zu Grausamkeit, zu plötzlicher Gewalttätigkeit, manche morden auch, ohne sich über die verbrecherische Seite ihres Handelns Rechenschaft abzulegen«. Ihre Handlungen erscheinen Hildesheimer wie »seltsam zwanghafte Rituale, die auf die Täter reinigend, wenn nicht gar kathartisch wirken, und ihr Inneres sozusagen purgieren« (Hildesheimer [1984] 1999, 296). Ihm sei Handke »zutiefst unheimlich« und er sei froh, dass er »nicht mehr jung genug« sei, »um Resultate der ideologischen Auswirkung seiner und anderer literarischer Verhaltensmodelle zu erleben« (Hildesheimer [1984] 1999, 297). Kurz: Ich kann mir nicht helfen, ich sehe in diesem Kult des Irrationalen faschistoide Züge. Ich bin alt genug, um mich zu erinnern, wie gerade Schöngeister mit dem Hang zum Esoterischen den Eliteeinheiten der Nazis beitraten, von denen sie sich eine Bereicherung ihrer Gefühlsfreiheit und eine geistige Erneuerung ihrer potentiellen Gefolgschaft versprachen. (Hildesheimer [1984] 1999, 296f.)2 Handkes hier interpretierter Text, den Hildesheimer in seinem Brief nicht nennt, ruft letzlich ein Gefühlswissen auf, das sogar noch sehr viel älter als der Faschismus oder der Nationalsozialismus ist und seit der Romantik im literarischen Antisemitismus immer wieder virulent wurde. Zugleich liegen uns in diesem Fall genug Selbstzeugnisse dieses Autors vor, um annehmen zu können, dass ihm sein literarisiertes Ressentiment über drei Jahrzehnte lang eine enorme persönliche Befriedigung verschaffte: »Grollende suchen fast nach einem Anlass«, notiert Uffa
2
Für den Hinweis auf diese Fundstelle danke ich Stephan Braese.
Jan Süselbeck: Die Gegenwart des literarischen Antisemitismus
Jensen, um ein solches ausbrechendes, manifestes, vollgültiges Gefühl zu empfinden: »Für die fühlende Person liegt darin ein Versprechen auf ein kathartisches Moment.« (Jensen 2021, 177) Wer aber sind die Leserinnen und Leser, die diese Art Text genießen und solche ästhetisierten Gefühlslagen in ihrem eigenen Empfinden genießend spiegeln? Wird ihnen bewusst, dass sie so an literarisch codierten antisemitischen Affekten teilhaben? So naheliegend die intuitive und emotionale Erfassung judenfeindicher Codes bei der Rezeption solcher literarischer Szenarien wie bei Handke oder Walser im Publikum auch sein mag, so wenig dringt sie seltsamerweise ins öffentliche Bewusstsein vor. Davon zeugt die brüske mehrheitliche Abwehr kritischer Interpretationen, wie sie in den Debatten um Günter Grass’ Gedicht Was gesagt werden muss, zu Walsers Tod eines Kritikers oder auch in dem monatelangen öffentlichen Streit um die Verleihung des Literaturnobelpreises an Peter Handke im Jahr 2019 zu beobachten war. Es steht jedenfalls zu vermuten, dass sich bei Handke noch viel mehr frei flottierende Instrumentalisierungen ursprünglich antisemitischer Codes zu Emotionalisierungszwecken finden lassen, als sie bisher überhaupt benannt und diskutiert worden sind: Alida Bremers Andeutungen von 2019 folgend (Bremer 2019), ließe sich eine eingehende Analyse der Semantik und der Affektszenarien in Handkes Theaterstück zum Kosovo-Krieg, Die Fahrt im Einbaum oder Das Stück zum Film vom Krieg (1999), vornehmen – mit frappierenden und zugleich schockierenden Resultaten. Tatsache ist, dass die Forschung zum literarischen Antisemitismus in den letzten Jahren insofern weitergekommen ist, als sie begonnen hat, ihren Gegenstand mit größerer interdisziplinärer Variabilität zu betrachten und dabei mehr denn je auch emotionale Zwischentöne, scheinbar gegenläufige Gefühle wie Trauer (Geier 2017) oder sogar Versuche des Aufweisens oder der Kritik von Antisemitismus mit einzubeziehen, die in ihrer Plakativität selbst wieder Stereotype und ein Gefühlswissen zu reaktivieren drohen, dem sie angeblich ursprünglich entgegentreten wollten (Shavit 2021; Geier 2021). Eine solche Differenzierung erscheint bei Handke allerdings gar nicht nötig. In dem bei ihm auftauchenden Hass und Ekel geht es, wie gezeigt, um eine auffällig starke affektive Intensität. Es sind Darstellungen von einer potentiell immensen affektiven Wucht. Man könnte es vielleicht so formulieren: Selbst demonstrative poetische Feinsinnigkeit, wie sie Handke auch noch in seinen jüngeren Interviews zum Thema immer wieder ins Feld führte, um sich selbst von der Diagnose des literarischen Antisemitismus in seinen Texten freizusprechen, schützt nicht vor dem Rückfall in pseudo-religiöse Barbarei.
333
334
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Literatur Anz, Thomas. Marcel Reich-Ranicki: Freunde und Feinde. https://m-reich-ranicki.de/in dex.php?content=https://m-reich-ranicki.de/content_themen_freundeFeinde. html (28.06.2021). Bremer, Alida: »Die Spur des Irrläufers«. In: perlentaucher.de (25.10.2019). https://w ww.perlentaucher.de/essay/peter-handke-und-seine-relativierung-von-srebr enica-in-einer-extremistischen-postille.html (28.06.2021). Geier, Andrea. Fragwürdige Provokationen. Die scheiternde Aufklärung über Antisemitismus und das Gedächtnis der Literatur. https://literaturkritik.de/fragwuerdige-pro vokationen-scheiternde-aufklaerung-ueber-antisemitismus-gedaechtnis-liter atur,27783.html (10.05.2021). Geier, Andrea: »Emotionalisierungsverfahren und kollektive Identitäten in Wilhelm Hauffs Erzählung Jud Süß«. In: Transformationen literarischer Kommunikation. Kritik, Emotionalisierung und Medien vom 18. Jahrhundert bis heute. Hg. v. Jörg Schuster/ André Schwarz/Jan Süselbeck. Berlin 2017, 111–132. Goethe, Johann Wolfgang von: Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bden. Bd. 1: Gedichte und Epen I. Textkritisch durchges.u. komm. v. Erich Trunz. 12. Aufl. München 1982. Gubser, Martin. Literarischer Antisemitismus. Untersuchungen zu Gustav Freytag und anderen bürgerlichen Schriftstellern des 19. Jahrhunderts. Göttingen 1998. Hahn, Hans-Joachim. »Die geteilten Gefühle des Antisemitismus. Prolegomena zu einer Reflexionsgeschichte antijüdischer Emotionen«. In: Emotionen und Antisemitismus. Geschichte – Literatur – Theorie. Hg. v. Stefanie Schüler-Springorum/Jan Süselbeck. Göttingen 2021, 87–106. Hahn, Hans-Joachim/Süselbeck, Jan. »Ekel und Abscheu. Zur Affektpoetik des literarischen Antisemitismus in E.T.A. Hoffmanns Erzählung Der Sandmann«. In: E.T.A. Hoffmann Jahrbuch 28 (2020), 46–67. Handke, Peter. »›Ich wäre liebend gern ein Böser‹. Peter Handke kann schon ziemlich schroff werden. Aber nur, wenn er sich in die Enge getrieben fühlt. Sonst ist er ›schändlich versöhnlich‹, sagt er. Ein Gespräch über Widersprüche«. In: Süddeutsche Zeitung Magazin (22.10.2012). https://sz-magazin.sueddeutsche.de/liter atur/peter-handke-nobelpreis-79280 (30.06.2021). Handke, Peter. »Ich bin ein Idiot im griechischen Sinne. Der Schriftsteller Peter Handke im Interview«. In: profil (01.09.2007). https://www.profil.at/home/ich -idiot-sinne-182406 (28.06.2021). Handke, Peter. Versuch über den geglückten Tag. Frankfurt a.M. 1991. Handke, Peter. Nachmittag eines Schriftstellers. Erzählung. Salzburg 1987. Handke, Peter. Die Lehre der Saint-Victoire. Frankfurt a.M. 1980.
Jan Süselbeck: Die Gegenwart des literarischen Antisemitismus
Hildesheimer, Wolfgang. »An Melanie Kuster und Christiaan L. Hart Nibbrig. [Poschiavo,] 5.1.84«. In: Ders. Briefe. Hg v. Silvia Hildesheimer/Dietmar Pleyer. Frankfurt a.M. 1999, 293–298. Jacobs, Jürgen. »Autor und Autorschaft in Peter Handkes Nachmittag eines Schriftstellers«. In: Partir, revenir. En route avec Peter Handke. Hg. v. Laurent Cassagnau/ Jacques Le Rider/Erika Tunner. Paris 1993. https://books.openedition.org/psn/ 4949 (10.05.2022) Jensen, Uffa. »Häme als Ressentimentverbindung. Wie und warum man im 19. Jahrhundert Juden verlachte«. In: Emotionen und Antisemitismus. Geschichte – Literatur – Theorie. Hg. v. Stefanie Schüler-Springorum/Jan Süselbeck. Göttingen 2021, 167–189. Katz, Jacob. Vom Vorurteil bis zur Vernichtung. Der Antisemitismus 1700–1933. Aus d. Engl. v. Ulrike Berger. München 1989. Müller, André/Handke, Peter. »Wer einmal versagt im Schreiben, hat für immer versagt. André Müller spricht mit Peter Handke«. In: Die Zeit (03.03.1989). https ://www.zeit.de/1989/10/wer-einmal-versagt-im-schreiben-hat-fuer-immer-ve rsagt/komplettansicht (28.06.2021). Schwarz-Friesel, Monika. »Antisemitische Hass-Metaphorik. Die emotionale Dimension aktueller Judenfeindschaft«. In: Interventionen – Zeitschrift für Verantwortungspädagogik H. 6 (2015), 38–44. Schwarz-Friesel, Monika/Reinharz, Jehuda: Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert. Berlin/Boston 2012. Shavit, Zohar. Good Intentions. On the Role of Philo- and Anti-Semitic Stereotypes in the Construction of the German Historical Narrative for Children. https://literaturkritik.d e/shavit-role-of-philo-and-anti-semitic-stereotypes,27753.html (10.05.2022). Struck, Lothar. Der Begleitschreiber. Einige Anmerkungen zum Kritiker und Leser Peter Handke (2016). https://www.uibk.ac.at/literaturkritik/zeitschrift/der-begleitsc hreiber.html (28.06.2021). Struck, Lothar. »Der mit seinem Jugoslawien«. Peter Handke im Spannungsfeld zwischen Literatur, Medien und Politik. Leipzig/Weißenfels 2013. Süselbeck, Jan. »Schöne Augen. Emotionalisierungsstrategien in E.T.A. Hoffmanns Erzählung Der Sandmann«. In: Emotionen und Antisemitismus. Geschichte – Literatur – Theorie. Hg. v. Stefanie Schüler-Springorum/Jan Süselbeck. Göttingen 2021a, 42–83. Süselbeck, Jan. Mehr als nur ein Stereotyp. Zum religiösen Gefühlswissen in der deutschsprachigen Literatur seit dem 18. Jahrhundert (2021b). https://literaturkritik.de/me hr-als-nur-ein-stereotyp-religioesen-gefuehlswissen-deutschsprachigen-liter atur-seit-18-jahrhundert,27730.html (15.09.2021). Süselbeck, Jan. »›Kindermörder Israel‹. Die Affektpoetik des literarischen Antisemitismus und der Judenhass der Gegenwart«. In: Der Neue Weltengarten. Jahrbuch für Literatur und Interkulturalität (2017/18), 237–262.
335
336
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Walser, Martin. Tod eines Kritikers. Roman. Frankfurt a.M. 2002.
»… als was waren Sie dort?« Rostock-Lichtenhagen als Schauplatz jüdischer Selbstermächtigung Matthias N. Lorenz
Im August 1992 wurde das sogenannte Sonnenblumenhaus in der Mecklenburger Allee im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen über einen Zeitraum von vier Tagen und Nächten angegriffen. Ziel der Attacken waren die in dem Wohnblock untergebrachte Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber des Landes MecklenburgVorpommern sowie, nach deren Evakuierung, das im selben Block benachbarte Wohnheim für vietnamesische Vertragsarbeiter*innen. Vorausgegangen war eine Kapitulation der Behörden vor der Zahl von v.a. aus Südosteuropa Geflüchteten, unter ihnen viele Roma, die nicht mehr ordnungsgemäß untergebracht und versorgt wurden und entsprechend mitten im Wohngebiet vor dem Haus kampieren und auf Aufnahme warten mussten. Die rechte Szene mobilisierte angesichts dieses Missstandes erfolgreich, und zeitweise fanden die nicht nur jugendlichen Angreifer*innen bis zu 3.000 Unterstützer*innen unter den Anwohner*innen, die ihren Parolen und Würfen mit Steinen und Brandsätzen applaudierten. Während eine völlig überforderte Polizei sich zurückzog und die Feuerwehr von dem rassistischen Mob am Löschen gehindert wurde, wurde das Sonnenblumenhaus in Brand gesetzt und die über 100 noch im Haus befindlichen Menschen, überwiegend Vietnames*innen, blieben sich selbst überlassen. Sie konnten sich schließlich über das Dach retten. Die Ereignisse vom 22. bis 25. August 1992 sind als größtes rassistisches Pogrom seit dem Ende der NS-Zeit in die Geschichte der Bundesrepublik eingegangen. Aufgrund der Erfahrungen von 1992 wurde im Folgejahr von der CDU-Regierung mit den Stimmen der SPD das Grundrecht auf Asyl geändert. ›Rostock-Lichtenhagen‹ ist zu einer Chiffre für rechte Nachwendegewalt, aber auch für einen Extremismus der Mitte geworden. Zahlreiche Reportagen und politische Studien sind dazu erschienen, die Chiffre ist in unzähligen Punk- und HipHop-Songs zu finden, es gibt mittlerweile ein Mahnmal in Rostock, literarische Texte und Filme über das
338
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Pogrom. Dieser Beitrag1 will in Erinnerung rufen, dass 1992 auch eine Solidarisierung jüdischer Interessenvertretungen mit den Betroffenen des Pogroms stattgefunden hat, und er zeichnet nach, wie diese Solidaritätsbekundung von der deutschen Mehrheitsgesellschaft aufgenommen wurde – oder genauer: wie sie zurückgewiesen wurde. Das Erscheinen jüdischer Vertreter*innen an einem prominenten Tatort rechter Gewalt markiert einen Schulterschluss jüdischer und migrantischer Opfer von rechter Gewalt in Vergangenheit und Gegenwart, der von jüdischer Seite aus heute u.a. von dem Aktivisten und Dichter Max Czollek als »postmigrantischer Antifaschismus« (Czollek 2020, 158) vertreten wird und in den jüdischen Interventionen des Jahres 1992 einen weitgehend vergessenen Vorläufer hat.
1. Besuch in Rostock (1): Die Söhne und Töchter der deportierten Juden Frankreichs Gut zwei Monate nach den Anschlägen auf das Sonnenblumenhaus, am 19. Oktober 1992, reisten rund 60 Vertreter*innen jüdischer Organisationen in Frankreich in zwei Bussen nach Rostock (vgl. AP 1992). Beteiligt waren, neben den zumeist schon älteren Fils et filles de déportés juifs de France (im Folgenden FFDJF) auch die Union des étudiants juifs de France und die rechtsgerichtete zionistische Organisation Betar mit ihrer Jugendabteilung Tagar (vgl. Klarsfeld 2015, 489; AFP/AP 1992). Angeführt wurde die Delegation aus Frankreich von den als ›Nazijägern‹ bekannten Beate und Serge Klarsfeld und deren Sohn Arno, damals Generalsekretär der Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme. Adressat ihrer Demonstration war die Bundesregierung, die rund drei Wochen zuvor, am 24. September 1992, ein Rückübernahmeabkommen mit Rumänien geschlossen hatte. Es ermöglichte, rumänische Staatsangehörige, die illegal eingereist waren oder deren Antrag auf Asyl abgelehnt worden war, ab dem 1. November desselben Jahres direkt abzuschieben. Von diesem Abkommen, das als erstes seiner Art2 die spätere Einschränkung des Grundrechts auf Asyl mit vorbereitete, waren auch die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs aus Rumänien eingereisten Roma betroffen, die im August in Rostock attackiert worden waren. Dort hatte, noch während die Pogrome liefen und als erste Reaktion darauf,
1
2
Der vorliegende Beitrag basiert auf Essays aus dem gemeinsam mit Tanja Thomas und Fabian Virchow verfassten Buch Doing Memory. Perspektiven des Erinnerns an Rostock-Lichtenhagen ’92 (erscheint bei Metropol), die hier zusammengeführt werden. Die BRD schloss bilaterale Rückübernahmeabkommen 1992 mit Rumänien, 1993 (in Vorbereitung seit 1991) mit Polen, 1994 mit Kroatien, Bulgarien, der Tschechischen Republik, 1996 mit Jugoslawien und Bosnien-Herzegowina; zeitgleich wurden in der ganzen EU Dutzende solcher Abkommen geschlossen (vgl. Parusel 2010, 121).
Matthias N. Lorenz: »… als was waren Sie dort?«
Bundesinnenminister Rudolf Seiters (CDU) auf einer Pressekonferenz am 24. August 1992 dafür geworben, das Asylrecht einzuschränken, um ›Asylmissbrauch‹ zu verhindern.3 Auf die Ankündigung staatlichen Handelns nicht gegen die Täter*innen, sondern gegen die Opfer reagierten die FFDJF mit einer Pressemitteilung, in der sie ihre Solidarität mit den bedrohten Roma erklärten. Serge Klarsfeld verglich der Presse gegenüber die Ausschreitungen im August 1992, aufgrund derer hunderte Roma evakuiert worden waren, mit den nationalsozialistischen Razzien gegen jüdisch-rumänische Geflüchtete in Frankreich vor 50 Jahren: »That is why Rostock was chosen for this action« (AP 1992). Bei derartigen Bekundungen ging es offenkundig nicht um eine akkurate historische Analogie – war die Gewalt 1942 doch staatlich organisiert gewesen, während sich in Lichtenhagen 1992 ein Mob Straßenschlachten mit den staatlichen Organen lieferte –, sondern um ein möglichst drastisches moralisches Argument, um die Abschiebung Angehöriger einer Opfergruppe nationalsozialistischer Verfolgung zu verhindern und vor einem Wiederaufleben rechter Gewalt zu warnen. Entsprechend formulierten die FFDJF ihre Forderung, auf die Anwendung des Abkommens mit Rumänien zu verzichten: Wir verlangen von Deutschland, dass es dem Schicksal dieser Roma, die die Nachkommen der Opfer nationalsozialistischer Verfolgung sind, Rechnung trägt. Wir verlangen von den Deutschen, […] den fremdenfeindlichen Ausschreitungen, die ihr Land in Misskredit bringen, ein Ende zu setzen. (Pressemitteilung der FFDJF, zit.n. Klarsfeld 2015, 489) Eine solche Anerkennung als Nachfahren von Opfern der NS-Vernichtungspolitik, deren Anliegen und Rechte Mehrheitsgesellschaft und Staat aus einer historischen Verantwortung heraus besonders zu achten hätten, hatte sich auch die von den Klarsfelds gegründete Gruppe in ihrer französischen Heimat erst erkämpfen müssen. Die sich auch als ›Militants de la Mémoire‹ bezeichnenden FFDJF konnten, wie Anne Klein nachgezeichnet hat, zwischen 1970 und 1980 die Deutungsmuster jüdischer Überlebender gegen das zuvor übermächtige Narrativ der Résistance durchsetzen und so einen Bruch in der französischen Erinnerungskultur bewirken, die sie zuvor weitgehend ausgeschlossen hatte (vgl. Klein 2009, 133–135). Diese Position im Diskurs verdankte die Gruppe ausgerechnet einer nichtjüdischen Deutschen, der Tochter eines Wehrmachtssoldaten: Beate Auguste Künzel, 1939 geboren und verheiratet mit Serge Klarsfeld, einem 1935 in Bukarest geborenen Anwalt und Historiker. Dessen jüdische Familie war 1940 nach Frankreich geflohen, von wo aus sein Vater nach Auschwitz deportiert und ermordet wurde. Beate Klarsfeld hatte internationale Bekanntheit erlangt, als sie am 7. November 1968 auf einem CDU-Parteitag den Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, NSDAP-Mitglied seit 1933 3
Vgl. hierzu inkl. O-Ton von Seiters’ Pressekonferenz: Schmidt 2007.
339
340
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
und in Goebbels’ NS-Rundfunk tätig, als ›Nazi‹ beschimpfte und ohrfeigte. Noch am selben Tag war Beate Klarsfeld in einem Schnellverfahren zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Unter großer öffentlicher Anteilnahme und internationalem Druck wurde diese Strafe nachträglich auf vier Monate reduziert und zur Bewährung ausgesetzt. Damit war ein Muster gesetzt, dessen sich die Klarsfelds fortan immer wieder bedienen sollten: Mit Interventionen, die auch gezielte Gesetzesverstöße bis hin zum Entführungsversuch beinhalteten (vgl. Klein 2009, 139f.), provozierten sie den medialen Resonanzraum für ihre Anklage der Täter. Mehrfach wurde Beate Klarsfeld in Deutschland bei ihren Aktionen zur Verfolgung von NS-Tätern festgenommen, zweimal auch vor Gericht gestellt und verurteilt. Öffentlichkeitswirksam ließ sie sich z.B. 1974 symbolträchtig im KZ Dachau festnehmen, was umgehend heftigen internationalen Protest u.a. aus Israel und Frankreich zur Folge hatte und schließlich dazu führte, dass das Urteil nicht vollstreckt wurde (vgl. Klein 2009, 140f.). »Hierbei stand nicht nur die Bestrafung der Täter im Vordergrund, sondern auch die Forderung, die Würde der Opfer wieder herzustellen«, so Neele Kerkmann (Kerkmann 2015, 196) über Beate Klarsfeld. So sollte sich auch, wie Klein zu den ›Militants de la Mémoire‹ ausführt, »durch die selbstbewussten, vielfach militanten Aktionen zwangsläufig das stereotype Juden-Bild der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft verändern« (vgl. Klein 2009, 145). Mit der Militarisierung des Protests ging eine Kriminalisierung der Beteiligten einher – die Medien titulierten die Klarsfelds als ›Nazi-Jäger‹, ihre Gruppe als ›Klarsfeld-Bande‹ (vgl. Klein 2009, 139) –, durch die die mit dem Stigma der Passivität behafteten Opfer als selbstbestimmte und wirkmächtige Akteure sichtbar wurden. In Rostock nun wurden die Klarsfelds von Vertreter*innen der Roma empfangen, die seit einigen Jahren ebenfalls versuchten, dem (west-)deutschen Staat durch Konfrontation die Durchsetzung von Minderheitenrechten abzuringen und in der Gesellschaft Gehör für ihre Anliegen zu finden. Während der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma sich v.a. als Vertretung der seit Generationen ansässigen deutschen Sinti verstand und keine Einwände gegen das Abkommen zur Rückführung nach Rumänien hatte (vgl. »Benzin ins Feuer« 1992; Fings 2016, 103), engagierte sich insbesondere die von Rudko Kawczynski mitgegründete Hamburger Rom und Cinti Union für das Bleiberecht staatenloser und in ihren südosteuropäischen Herkunftsländern verfolgter Roma, die in Deutschland Asyl suchten. Kawczynski hatte die Besetzung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme 1989 und einen Hungerstreik organisiert, um ein Bleiberecht für geflüchtete Roma zu erzwingen. Bereits seit den 1980er Jahren legitimierten Roma-Aktivist*innen ihre Proteste immer wieder auch mit dem Verweis auf ihre Verfolgung im Nationalsozialismus, besetzten Täter-Orte wie KZ-Lager oder das Tübinger Universitätsarchiv, wo die Akten der ›Rassenhygienischen Forschungsstelle‹ lagerten, und erinnerten an die besondere historische Verpflichtung Deutschlands den Opfern des Porajmos, der Ermordung hundert-
Matthias N. Lorenz: »… als was waren Sie dort?«
tausender Sinti und Roma, gegenüber (vgl. Baeck/Herold; Fings 2016, 104–106). Erst 1982 hatte die Bundesregierung Sinti und Roma überhaupt als Opfergruppe des NS-Völkermords anerkannt, jedoch nur in wenigen Fällen Entschädigungen gezahlt (vgl. Fings 2016, 106f.). Die jüdischen ›Militants de la Mémoire‹ wie auch jene von Kawczynski vertretene Fraktion von Roma-Aktivist*innen zeichnete ihre Strategie aus, Resonanz durch Aufstörung zu provozieren, die auch die Aktion am 19. Oktober 1992 vor dem Rostocker Rathaus prägte. Die Demonstration, bei der eine Straße blockiert, die Israelfahne geschwenkt und eine Hakenkreuzfahne verbrannt wurde (vgl. AP 1992), war nicht angemeldet und die Anbringung der Gedenktafel nicht mit der Stadt abgestimmt (dpa/OZ/ADN 1992, 1). Kern der Aktion war die Anbringung einer Tafel an der Rathausfassade mit der folgenden Aufschrift: In dieser Stadt gingen Menschen im August 1992 erneut mit rassistischen Gewalttaten und Brandstiftungen gegen unschuldige Familien, Kinder, Frauen und Männer vor. Wir erinnern an die Millionen Kinder, Frauen und Männer, die, weil als Juden, Sinti und Roma (»Zigeuner«) geboren, dem nationalsozialistischen Völkermord zum Opfer fielen. In einer einzigen Nacht unvergesslichen Grauens wurden am 2. August 1944 die 3000 noch lebenden Menschen im »Zigeunerlager« von Auschwitz-Birkenau durch Gas ermordet. Diese Erfahrungen und historischen Verpflichtungen für das deutsche Volk müssen wachgehalten werden, um zu verhindern, dass sich Gewalt und Menschenverachtung jemals wiederholen.4 Der Text der Tafel adressiert die Stadt Rostock direkt als Ort rassistischer Gewalt (»In dieser Stadt …«), die in Beziehung gesetzt wird zur rassistischen Vernichtungspolitik gegen die beiden im Nationalsozialismus »rassisch verfolgten« Bevölkerungsgruppen: Jüdinnen und Juden und Sinti und Roma. Während die Pressemitteilung der FFDJF und die Beteiligung von Roma-Aktivist*innen wie Rudko Kawczynski auf die drohende Abschiebung rumänischer Roma abheben, fehlt dieser tagesaktuelle
4
Der Wortlaut wird hier zitiert nach einem Pressefoto von der ersten Anbringung der Tafel 1992 (vgl. Brumberg 1992). Auf der Replik der Tafel, die 2012 aufgehängt wurde, findet sich ein in Teilen abgeänderter Text, der auch in den Memoiren der Klarsfelds wiedergegeben wird (vgl. Klarsfeld 2015, 490).
341
342
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Aspekt auf der Tafel. Sie erinnert ausschließlich an die (neo)nazistische Gewalt gegen Roma 1944 und 1992, aus der die Mahnung gegen Geschichtsvergessenheit begründet wird. Die Polizei, zunächst mit lediglich 30 Kräften vor Ort, ließ die Aktivist*innen gewähren (vgl. Malzahn 1992a, 4). Gänzlich unvorbereitet konnte sie nicht sein, hatte doch bereits zwei Tage zuvor die taz eine französische Agenturmeldung über die geplante Protestaktion gebracht (Juden für Roma; vgl. AFP 1992b). Nach der Anbringung der Tafel drangen mehrere Aktivist*innen aus der französischen Delegation, unter ihnen der 1965 geborene Arno Klarsfeld,5 in Räume der CDU-Fraktion im ersten Stock des Rathauses ein und hängten Transparente aus den Fenstern. Die Banner der Demonstrierenden stellten explizit einen Bezug zwischen Porajmos und Abschiebepolitik her (»Damals vergast, heute abgeschoben«); englischsprachige Parolen (»Germany, don’t forget history«) legen die Vermutung nahe, dass ein internationales Presseecho von Beginn an Teil der Proteststrategie war (vgl. AFP/AP 1992a). Als die Polizei diese vier Aktivisten verhaftete, eskalierte die Situation: »Dabei«, so die Ostseezeitung am nächsten Tag über den Polizeieinsatz, »teilte sie – nicht zimperlich – den sich heftig Wehrenden Stockhiebe aus« (Feuerstein 1992b). Der Polizei zufolge wurden bei der anschließenden Befreiung der Festgenommenen durch den »Ordnungsdienst« der französischen Demonstrant*innen acht Polizisten verletzt (vgl. dpa/OZ/ADN 1992, 1). Tatsächlich zeigt eine kurze Filmaufnahme der Auseinandersetzung, die CBS News damals sendete, ein durchaus brutales Vorgehen auch einiger Demonstranten, die Polizisten mit Fahnenstöcken und Reizgas attackieren (vgl. Fenton 1992). Die Jüdinnen und Juden verschanzten sich anschließend in ihren Reisebussen, während die Polizei Verstärkung anforderte. Serge Klarsfeld berichtet in seinen Memoiren: »[In Rostock] erlebte ich, wie Dutzende Polizeiwagen unseren Bus umstellten und eine Hundertschaft Polizisten, gerüstet wie Gladiatoren, uns in Gewahrsam nahmen, als wären wir rechtsextreme Kriminelle, denen sie indes bei ihren Angriffen auf Asylantenheime aus dem Weg gingen.« (Klarsfeld 2015, 489f.) Anschließend wurden die Busse zu einer Sporthalle eskortiert, wo 46 französische Jüdinnen und Juden vorläufig festgenommen wurden, erst nach einer Intervention des Französischen Konsuls in Hamburg habe sich die Lage etwas entspannt, so Serge Klarsfeld: »Beate, Arno und ich wurden der Rädelsführerschaft beschuldigt, und drei der jungen Leute wurden wegen ›schwerer Körperverletzung, Widerstands gegen die Staatsgewalt und Gefangenenbefreiung‹ angeklagt und mehrere Tage in Haft behalten« (Klarsfeld 2015, 490f.).
5
Paradoxerweise spielte Arno Klarsfeld später eine entgegengesetzte Rolle als Beauftragter des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy (UMP) in Einwanderungsfragen. Klarsfeld rechtfertigte mit der Autorität eines Angehörigen der FFDJF ausgerechnet Abschiebemaßnahmen von Roma nach Rumänien und tätigte dabei durchaus antiziganistische Äußerungen (vgl. Le Monde/AFP 2013).
Matthias N. Lorenz: »… als was waren Sie dort?«
Diese Eskalation, die die in Frankreich führende linksliberale Tageszeitung Le Monde (die wie der französische Fernsehsender TF1 auch vor Ort gewesen war; vgl. Zaidmann 1992, 6) »Ungeschicklichkeiten« (zit.n. Kaps 1992, 4) sowohl auf Seiten der Aktivist*innen als auch der deutschen Behörden zuschrieb, generierte Aufmerksamkeit auch außerhalb von Rostock. In Berlin demonstrierte eine Initiative zur Freilassung der in Rostock inhaftierten Franzosen (vgl. Kaps 1992, 4) und der Sprecher der Roma Union Berlin, Alfred Erdölli, begrüßte, »daß sich französische Juden für die Belange der Roma einsetzen« (Malzahn 1992a, 4). Am 25. Oktober hängten die Antirassistischen Gruppen Frankfurt und die Antifaschistische Aktion eine nahezu gleichlautende Tafel am Frankfurter Römer auf (vgl. FR 1992; Förderverein Roma Frankfurt a.M.). Am 27. Oktober besetzten Mitglieder der Roma-Initiative Köln das Dach des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, hier verband sich der Protest gegen die Inhaftierung der französischen Juden und Jüdinnen in Rostock mit einer lokalen Initiative gegen die Publikation eines Institutsmitarbeiters, die den »Zigeuner[n] Rumäniens« den Anspruch auf Asyl »zu hundert Prozent« absprach (Wolf Oschließ zit.n. exp 1992). Bereits in der Nacht zum 21. Oktober 1992 hatte ein Komitee zur Solidarität mit den jüdischen Häftlingen in Deutschland das Goethe-Institut in Paris angegriffen, »Fensterscheiben eingeworfen und Wände mit antinationalsozialistischen Parolen beschmiert« und die weitere »Zermürbung und Demütigung« deutscher Institutionen angekündigt (AP/dpa 1992; vgl. Kaps 1992, 4). Damit war der Konflikt auf der Bühne internationaler Beziehungen angekommen: Das französische Außenministerium bedauerte die Aggression französischer Staatsbürger*innen gegen Polizist*innen in Rostock (vgl. [AFP] 1992a). Als die FFDJF und ihre Mitstreiter*innen am Folgetag ein Sit-In mit 200 Demonstrant*innen vor der Deutschen Botschaft organisierten, um Freiheit für die drei in Rostock Verhafteten zu fordern, riegelten über einhundert Bereitschaftspolizist*innen die Avenue Roosevelt ab. Lediglich eine sechsköpfige Delegation wurde zur Botschaft vorgelassen, dort aber nicht empfangen. Auch hier hatte Serge Klarsfeld wieder die Annullierung des deutsch-rumänischen Abschiebeabkommens gefordert. Eine Einlassung des neuen Koordinators für die deutsch-französischen Kulturbeziehungen, Ex-Verteidigungsminister Gerhard Stoltenberg (CDU), der an jenem Tag seinen Antrittsbesuch machte, spiegelt die Haltung, mit der die Bundesregierung der rechten Gewalt und den Protesten gegen Abschiebungen entgegentrat: Die von einigen wenigen herbeigeführte Konfrontation könne den deutsch-französischen Beziehungen nicht schaden, denn auch die Französ*innen sollten verstehen, dass das deutsche Asylrecht immer noch das großzügigste aller EG-Staaten sei. Zwar müsse man konsequent gegen rechten Terror vorgehen, er habe jedoch, so die Berichterstatterin der taz, »Verständnis für die Schwierigkeiten der Polizei in Ostdeutschland« (Kaps 1992, 4). Mit der Eskalation der Aktion in Rostock wurde die öffentliche Aufmerksamkeit v.a. auf die beteiligten Jüdinnen und Juden gelenkt. Dass eine zwanzigköpfige
343
344
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
(vgl. o. A. V. 1992b) Roma-Delegation die ›Militants de la Mémoire‹ empfangen und mit ihnen gemeinsam die Tafel angebracht hatte, wurde bestenfalls am Rande gewürdigt. National überwog offenbar der Schock über das aggressive und wehrhafte Verhalten von Jüdinnen und Juden, das man in Deutschland nicht gewohnt war und als Gefährdung für eine »mühsame, leise Aussöhnung« (Jungkunz 1992) ansah. Dass die Opfergruppe dem Täterkollektiv (selbst)bewusst unversöhnlich begegnen könnte, passte nicht ins landläufige Bild. Und international lag das Interesse darauf, dass in Deutschland wieder Juden verhaftet und möglicherweise Opfer von Polizeigewalt geworden waren – weshalb Senat und Bürgerschaft sich genötigt sahen, als Zeichen der Deeskalation bald darauf den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland nach Rostock einzuladen. Den Aktivist*innen war eine Verschiebung im Diskurs gelungen: zunächst durch Signifikantenkopplung (Deportation nach Auschwitz – Abschiebung von Roma) einen Konflikt um das Asylrecht zu einem Konflikt zwischen NS-Opfern und Täterkollektiv zu machen, und diesen Konflikt anschließend durch die Provokation eines Eklats (staatliche Gewalt gegen Juden ausgerechnet wieder in Deutschland) international zu skalieren. Damit ließ sich die gerade erst wiedervereinigte Bundesrepublik an einem empfindlichen Punkt treffen, stand der gesamte Einigungsprozess doch unter kritischer Beobachtung des Auslands, insbesondere der ehemaligen Alliierten. Nicht nur die britische Premierministerin Margaret Thatcher hatte große Vorbehalte gegen ein wiedererstarkendes Deutschland. Jede Kontinuität zwischen NS-Reich und neuem Deutschland galt es daher zu verwischen, das breite Medienecho des Lichtenhäger Pogroms im August 1992 in der ganzen Welt, v.a. aber auch in den USA, war ein Desaster für die auf Außenwirkung bedachte Exportnation und wurde von der Kohl-Regierung auch entsprechend beantwortet: durch Leugnung und Beschwichtigung.6 Entsprechend war die Pressemitteilung der FFDJF zum deutsch-rumänischen Abkommen durchaus strategisch. Nach den »fremdenfeindlichen Ausschreitungen, die ihr Land in Misskredit bringen« (Pressemitteilung der FFDJF zit.n. Klarsfeld 2015, 489), konnte Beate Klarsfeld mit Blick auf die Auseinandersetzung bei der Anbringung der Gedenktafel der Associated Press diktieren: »›Especially Rostock‹ should find it necessary to back such an action, she said. ›The Image of Rostock has been blackened in the entire world.‹« (AP 1992) Nicht ganz zu Unrecht hatte die Stadtgesellschaft das Gefühl, gezielt provoziert worden zu sein, um »erneut in den Medien vorgeführt« zu werden: »die Ohrfeige
6
So behauptete Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) allen Ernstes, die Ausschreitungen seien von der Stasi inszeniert worden (vgl. Lausberg 2012, 63), während Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Bernd Seite (CDU) die Täter im linken Spektrum der Autonomen, Hausbesetzer und Atomkraftgegner vermutete und sein Innenminister Lothar Kupfer (CDU) abwiegelte, zu keiner Zeit seien Menschen gefährdet worden, es habe schließlich auch keine Verletzten gegeben (vgl. Schmidt 2002, 158–143).
Matthias N. Lorenz: »… als was waren Sie dort?«
für die Stadt war einkalkuliert« (F[euerstein] 1992a), so die Kommentatorin der Ostseezeitung. Rostock war der Ort, wo das wiedervereinigte Deutschland in der internationalen Wahrnehmung sein hässlichstes Gesicht gezeigt hatte. Wer dessen Ausländerpolitik treffen wollte, konnte sich sicher sein, dass die Weltöffentlichkeit nach Rostock blicken würde, wenn es dort erneut zu ›fremdenfeindlichen‹ Auseinandersetzungen kommen würde. Dem Kalkül einer internationalen Beschämung der deutschen Politik folgend, konnte die Demonstration in Rostock nicht angemeldet und in Zusammenarbeit mit den lokalen Institutionen durchgeführt werden, wie es sich der grüne Rostocker Bürgerschaftspräsident Christoph Kleemann gewünscht hätte, ein ehemaliger Pastor, Friedensaktivist und DDR-Bürgerrechtler, der erst aus den Medien von der Demonstration erfahren haben will (vgl. AP 1992). Dies mag erklären, warum die französische Gruppe ihre Aktion durchführte, obwohl es im Vorfeld bereits eine erste Kommunikation zwischen den Klarsfelds und der Stadt gegeben hatte. So berichtete die Presse damals, dass der Rostocker Senat generell der Anbringung einer Gedenktafel zugestimmt hätte: »OB Klaus Kilimann wollte die Schirmherrschaft übernehmen, die Delegation empfangen, ein Gebäude für die Tafel finden.« (Feuerstein 1992b) Geplant war ursprünglich wohl eine Zeremonie Ende Oktober (vgl. Lambeck 1992, 1) – am 1. November sollte nun allerdings bereits das deutsch-rumänische Rückführungsabkommen in Kraft treten. V. a. aber wünschte die Stadt noch gravierende Änderungen am Text: Den ersten Satz wollte der Präsident der Bürgerschaft, Christoph Kleemann (Bündnis 90), streichen und durch die Worte »Wehret den Anfängen« ersetzen lassen. Satz Nummer drei sollte völlig gestrichen werden. »Es gab in Rostock keine rassistischen Gewalttaten«, empörte sich der Referent des Präsidenten, Holger Jahns, gestern und machte sich Sorgen um eine saubere Geschichtsschreibung: »Man kann doch Lichtenhagen und Auschwitz nicht gleichsetzen.« (Malzahn 1992b, 4) Die Tafel, die die Stadt vorschlug, hätte somit aber v.a. jeden Bezug auf die Ausschreitungen vom vergangenen August vermissen lassen, stattdessen lediglich sehr allgemein der im NS ermordeten Juden, Sinti und Roma gedacht, um nur daraus eine heutige Verpflichtung abzuleiten. Angesichts der offiziellen Leugnung rassistischer Gewalt durch Referent Jahns verwundert es nicht, dass die FFDJF der Bitte von Oberbürgermeister Kilimann (SPD) »um eine ›entschärfte‹ Version« (Malzahn 1992a, 4) nicht nachkamen, sondern die Verhandlungen abbrachen und stattdessen Tatsachen schufen. Mit ihrem für bundesrepublikanische Verhältnisse rüden Vorgehen setzten sie genau das um, was eine erfolgreiche Störung ausmacht, wie der Historiker Volker Weiß ausführt:
345
346
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Die Provokation gehört fest ins Aktionsrepertoire aller Kräfte, die zunächst um Aufmerksamkeit buhlen müssen, weil ihre Position sonst nicht wahrgenommen werden würde. Sie ist die perfekte Waffe des politischen Partisanen, da sie ihre Wirkung auch aus einer defensiven und unterlegenen Position entfaltet. Das Missverhältnis in der Kräfteverteilung ist sogar eine gute Voraussetzung. Eine gelungene Provokation verwandelt die eigene Schwäche in Stärke und die Überlegenheit des Gegners in Schwäche. In dieser Rechnung ist die Möglichkeit einer medialen Auswertung einkalkuliert, nur sie kann aus der Niederlage einen Sieg machen. Denn wird aus der überlegenen Position auf eine Provokation mit übertriebener Härte reagiert, kann dies dem Provokateur neben der Aufmerksamkeit auch die Sympathien des Publikums einbringen. (Weiß 2017, 128) Auch wenn die übertriebene Härte wohl nicht einseitig bei der Rostocker Polizei verortet werden kann und die ›Militants de la Mémoire‹ und ihre Mitstreiter- und Sympathisant*innen lokal aggressiv auftraten, war der Claim von Polizeigewalt gegen Juden und ihrer Verhaftung in Deutschland zu stark, als dass er medial nicht verfangen hätte. Während lokale Medien und Parteien bis ins Lager von Bündnis 90/Die Grünen hinein die Aktion der Klarsfelds aufgrund der Eskalation einhellig verurteilten (»Gewalt bringt keine Sympathie«; F[euerstein] 1992a; vgl. Malzahn 1992a, 4), registrierten nationale wie internationale Medien die Vorgänge aufmerksam (»Rostock ist drauf und dran, weltweit in Verruf zu geraten«; Jungkunz 1992). Wie die Störungsforschung unter Bezugnahme auf Niklas Luhmanns Systemtheorie herausgearbeitet hat, gehört zu jeder Störung auch eine Antwort des von ihr herausgeforderten Systems. Carsten Gansel hat drei Stufen der Störung vorgeschlagen: Aufstörung, Verstörung und Zerstörung (vgl. Gansel 2013, 35). Während ein stabiles System eine Aufstörung, die der Gewinnung von Aufmerksamkeit dient, problemlos integrieren kann, stellt eine Verstörung eine schwerwiegende Irritation des Systems dar, die repariert werden muss; die nicht-integrierbare Zerstörung hätte schließlich eine Umwälzung zur Folge. Die Anbringung einer Gedenktafel mag im Sinne einer Medienstrategie als Aufstörung intendiert gewesen sein, durch die gewaltsame Eskalation avancierte sie zu einer gravierenden Verstörung im Diskurs um Kontinuitäten rechter Gewalt. In Reaktion darauf lassen sich verschiedene Versuche der Entstörung identifizieren.
2. Besuch in Rostock (2): Der Zentralrat der Juden in Deutschland Zeitnah wurde die Tafel abgehängt, die durch die Insinuation einer Fortsetzung der Deportation von Roma aus Deutschland die bundesrepublikanische Basiserzählung (vgl. Herz 1997; Thomas/Virchow 2019) der bewältigten Vergangenheit infragestellte. Die mitunter kolportierte Aussage, diese erste Tafel sei heute nicht mehr auf-
Matthias N. Lorenz: »… als was waren Sie dort?«
findbar (vgl. VVN-BdA 2012), trifft allerdings nicht zu. Unmittelbar nach der Aktion verschwand die Tafel zwar zunächst im Keller der Bürgerschaft (vgl. Malzahn 1992b, 4), obwohl das Rostocker Jugend-Alternativ-Zentrum JAZ angeboten hatte, sie zu übernehmen und an ihrem Gebäude anzubringen (vgl. Malzahn 1992a, 4). Seit 1997 ist sie jedoch im Depot des Kulturhistorischen Museums der Stadt eingelagert; sie wurde bislang noch nie ausgestellt.7 Im Bemühen, den Imageschaden zu begrenzen, luden der Senat und die Bürgerschaft den neuen Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, den erst vor drei Wochen ins Amt gewählten Ignatz Bubis, nach Rostock ein. Oberbürgermeister Klaus Kilimann (SPD) bot zudem an, den Wiederaufbau einer jüdischen Gemeinde in Rostock zu unterstützen (vgl. CCM 1992, 3). Serge Klarsfeld erinnert sich: »Die jüdischen Organisationen reagierten insgesamt nicht wohlwollend auf unsere Initiative und wollten die Verbindung zwischen den Roma von 1992 und den Juden von 1942 nicht sehen.« (Klarsfeld 2015, 491) Damit kann im deutschen Kontext nur der Zentralrat gemeint sein, und es dürfte auch dieser Vorgeschichte geschuldet sein, dass kurz vor dem Jahrestag der antisemitischen Novemberpogrome von 1938 eine Zentralratsdelegation Rostock besuchte. Bubis nennt wenige Jahre später in seiner Autobiografie durchaus widerstreitende Motive für den Besuch: Er habe sich einerseits an der medialen Präsenz der Täter*innen und Claqueure gestört, während die Opfer kaum Gehör fanden. Zugleich sollte seine Anwesenheit aber auch Rostocker Bürger*innen vom Ruch der »Buhstadt der Nation« (Bubis [1996] 1998, 214) befreien und ihnen Mut machen, Zivilcourage zu zeigen. Und er wollte ein Signal an jüdische Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen UdSSR senden, die in der DDR aufgelöste Jüdische Gemeinde der Stadt neu zu gründen. Die Reise nach Rostock war damit auch ein Versuch der Deeskalation, der Entstörung des Eklats mit den französischen Aktivist*innen: Bubis stellte sich zur Verfügung, um auszusprechen, dass man »nicht verallgemeinern und nunmehr Rostock pauschal schuldig sprechen« dürfe – er erinnert sich, es habe Kilimann und den Rostocker Politiker*innen »ganz gut getan, daß ausgerechnet so ein ›Mahner und Warner‹ wie ich« das sagte (Bubis [1996] 1998, 214). Die Delegation des Zentralrats der Juden wurde bei der Tatortbegehung in Lichtenhagen von einem Pressetross begleitet. Bubis trug am Revers ein Ansteckmikrophon und wurde vor laufender Kamera nach seinen Gefühlen befragt. Obwohl er also offensichtlich mit seinem Einverständnis gefilmt wurde und auch als medial erfahren gelten durfte, rang Bubis vor der immer noch von Brandspuren gezeichneten Fassade des Sonnenblumenhauses sichtlich um Fassung. Auffällig vermied er
7
Auskunft des Leiters des Kulturhistorischen Museums Rostock Dr. Steffen Stuth vom 03.03.2022. Die Tafel ist mit der Nummer R 557 inventarisiert und hat die Maße 61,5cm (Höhe) x 85cm (Breite).
347
348
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
es, in der ersten Person zu antworten: »Man kann nicht drüber reden.« Als der Reporter insistierte und »die sozialen Umstände hier« als mögliche Erklärung für die rassistischen Ausschreitungen anbot, wiedersprach der Zentralratspräsident: »Die Menschen hier, die können doch nichts für die sozialen Umstände« (zit.n. Bubis – das letzte Gespräch 2017) – dann versagte ihm die Stimme, er weinte. Mit einem Begriff des Soziologen Michal Bodemann ließe sich sagen, dass hier das deutsch-jüdische »Gedächtnistheater« (vgl. Bodemann 1996, 80–128) einen gewichtigen Moment lang stockt. Der Zentralrat war von der Rostocker Politik erkennbar v.a. deshalb eingeladen worden, um die Stadt von dem doppelten Stigma zu befreien, erst das mehrtägige rassistische Pogrom im August nicht aufgehalten und anschließend ausgerechnet eine Gruppe jüdischer Nachfahren von Holocaustopfern inhaftiert zu haben (vgl. Klarsfeld 2015, 489f.). Beide Ereignisse hatten unvorteilhafte Bilder einer Stadt produziert, in der ›Fremde‹ attackiert und auch von der Polizei nicht geschützt werden. Ignatz Bubis war offenkundig dazu bereit, mit seinem Besuch an der Korrektur dieser Eindrücke mitzuwirken. Mit Gedächtnistheater meint Bodemann eben diese Rolle, die Juden und Jüdinnen im Nachkriegsdeutschland immer wieder im öffentlichen Gedenken an die NS-Verbrechen zugewiesen wurde: dem Kollektiv der Täter*innen die Absolution zu erteilen, indem sie an einer Gedenkkultur teilnahmen, die v.a. einer Stabilisierung der deutschen Nachkriegsidentität als geläuterter diente. Er zeichnet nach, wie deutsche Regierungen von Konrad Adenauer bis Helmut Kohl die jüdische Gemeinschaft in der Bundesrepublik als außenpolitisches Aushängeschild einer stabilen Demokratie und sogar als Propagandist*innen für die deutsche Exportwirtschaft bemühten (vgl. Bodemann 1996, 156–176; Bodemann 1986, 59–62). Den jüdischen Repräsentant*innen wirft Bodemann vor, sie leisteten »ideologische Arbeit« (Bodemann 1986, 52) im Dienste der Mehrheitsgesellschaft, er erkennt jedoch auch die paradoxe Situation von Juden und Jüdinnen im Nachkriegsdeutschland: Diese müssten sich einerseits innerhalb der deutschen Gesellschaft behaupten, andererseits aber auch – insbesondere gegenüber Israel und internationalen jüdischen Organisationen – ihre Existenz im Land der Täter*innen permanent rechtfertigen. Dies zwinge sie förmlich, nach außen um Vertrauen für Deutschland zu werben und sich innenpolitisch zu integrieren. Das Mahnen vor Neonazismus etwa dürfe keinesfalls auf Kosten der von der deutschen Politik immer wieder eingeforderten Versöhnung gehen (vgl. Bodemann 1996, 33f.). Auch Bubis wirkte mit seiner im Vergleich zu seinem Amtsvorgänger Galinski als konziliant empfundenen Art (vgl. Benz 2011) daran mit, etwa die Erinnerungspolitik Kohls zu legitimieren, die unter dem Paradigma einer undifferenzierten Versöhnung der Deutschen mit ihren
Matthias N. Lorenz: »… als was waren Sie dort?«
Opfern wie mit ihrer eigenen Vergangenheit stand (vgl. Bubis [1996] 1998, 263f., 279f.).8 Diese Bereitschaft, im deutschen Gedächtnistheater mitzuspielen, sofern sich dadurch die Situation jüdischer Menschen in Deutschland positiv beeinflussen ließ, trat in den Hintergrund und setzte schließlich temporär aus, als Bubis im November 1992 den Rostocker Tatort besichtigte. Die Betroffenheit des Zentralratspräsidenten erzählt ohne Worte eine gegenteilige Version der Geschehnisse, die die Vertreter*innen der Stadt gerne beglaubigt gesehen hätten: Seine stumme, emotionale Reaktion auf den Ort der Gewalt zeugt davon, dass ein rassistisches Massenpogrom in Deutschland immer an die Pogrome der Vergangenheit erinnern wird. Der irritierende Moment bleibt im Gedächtnis: Ein semidokumentarisches Biopic des Hessischen Rundfunks über Ignatz Bubis eröffnet 2017 sogar mit den Fernsehbildern aus Rostock-Lichtenhagen (vgl. Bubis – das letzte Gespräch 2017). Er selbst schreibt in seiner Autobiografie: »Rostock war etwas unerhört Neues. Ich mußte sofort an das Pogrom von Kielce denken, als ich davon erfuhr. Auch hier richtete sich der Haß gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen nur deshalb, weil sie Fremde, weil sie anders waren.« (Bubis [1996] 1998, 213) Damit offenbart Bubis als Privatperson eine ganz andere Motivlage als die eingangs geschilderten Absichten des Funktionärs: Im polnischen Kielce wurden am 4. Juli 1946 40 jüdische Überlebende des Holocaust von einem antisemitischen Mob umgebracht und weitere 80 verletzt. Auch in Kielce war das Ziel der Attacke ein einzelnes Haus, in dem die Juden und Jüdinnen Zuflucht gefunden hatten, auch hier waren die Angriffe seitens ihrer Mitbürger unter den Augen der örtlichen Polizei erfolgt, die über Stunden nicht eingegriffen hatte. So liegt die Deutung nahe, dass die Besichtigung des Schauplatzes, an dem neun Wochen zuvor das größte Pogrom Nachkriegsdeutschlands stattgefunden hatte, an traumatische Erinnerungen des Holocaustüberlebenden rührt, der angesichts der Brandfassade die erwartete Agenda einer Beschwichtigung nicht durchsetzen kann, dem es stattdessen die Sprache verschlägt und der die Fassung verliert. Ein halbes Jahr vor seinem Tod erinnert er sich: »Ich stand vor dem Haus mit den verrußten Fenstern und habe mir vorgestellt, es waren Menschen drin und es wurden Molotowcocktails dort reingeschmissen. Das hat bei mir schlimmste Erinnerungen wach8
Bubis wollte mit dem Zentralrat auf keinen Fall in Konfrontation zum Bundeskanzler gehen, so setzte er 1988 durch, dass Kohl gegen den erklärten Willen der Frankfurter jüdischen Gemeinde auf der zentralen jüdischen Gedenkfeier zum 50. Jahrestag der Novemberpogrome sprechen konnte, indem er mit Rücktritt – damals noch aus dem Verwaltungsrat – drohte: »Eine Ausladung Kohls wäre meines Erachtens derart zu unserem eigenen Schaden gewesen, daß ich eine solche Entscheidung keinesfalls vertreten wollte.« (Bubis [1996] 1998, 190) Auch bei der Großdemonstration am 8. November 1992 in Berlin unter dem Motto »Die Würde des Menschen ist unantastbar« verteidigte Bubis die anwesende CDU-Elite, während Demonstrierende deren Teilnahme angesichts der von der CDU forcierten Asylrechtsänderung als Heuchelei ablehnten (vgl. Kempe 2012).
349
350
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
gerufen.« (Bubis et al. 1999, 452) Bubis hat später sein Engagement gegen den Asylrechtskompromiss damit begründet, dass ihn der Umgang mit verfolgten Menschen im wiedervereinigten Deutschland an den Antisemitismus der 1920er Jahre erinnere: »Und das ist eine sehr unangenehme Assoziation.« (Bubis 1996, 58) Er fühle sich als Überlebender von Verfolgung und Gewalt grundsätzlich »allen Menschen, die Ähnliches mitgemacht haben, tief verbunden.« (Bubis [1996] 1998, 40) Bubis’ medial präsente, nonverbale, körperliche Reaktion auf den Anschlagsort in Lichtenhagen irritierte die eingeübten Abläufe zwischen Mehrheitsgesellschaft und jüdischer Minderheit in der Bundesrepublik. Die emotionale Solidarisierung des Zentralratspräsidenten mit den in Rostock Angegriffenen stellte etablierte Vorstellungen einer versöhnlichen Haltung von Jüdinnen und Juden sowie das Bild einer sich in Deutschland sicher fühlenden jüdischen Gemeinschaft vehement in Frage und wurde entsprechend auch als Provokation wahrgenommen. So fragte der Vorsitzende des Innenausschusses der Rostocker Bürgerschaft, der CDU-Politiker Karlheinz Schmidt, bei der anschließenden Pressekonferenz zum Besuch der jüdischen Delegation: »Sie bezeichnen sich als deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. Ist das richtig?«, um nachzusetzen: »Aber Ihre Heimat ist doch Israel. Was halten Sie denn von den Gewalttaten zwischen Israelis und Palästinensern?« (zit.n. Bubis [1996] 1998, 240) Bubis’ Replik erfasste die Invektive, die einer Ausbürgerung gleichkam: »Sie wollen mit anderen Worten wissen, was ich hier eigentlich zu suchen habe?« (zit.n. CCM 1992, 3) Der Eklat schaffte es nicht nur in die »Tagesschau« (vgl. Bubis – das letzte Gespräch 2017), sondern wurde auch international registriert.9 Auf öffentlichen Druck hin distanzierte sich die CDU und Schmidt trat noch am gleichen Abend von seinen Ämtern zurück (vgl. CCM 1992, 3; Starcevic 1992). Der Versuch der städtischen Image-Politik, die rassistischen Ausschreitungen vom August keinesfalls als Pogrom anzuerkennen und somit jede Verbindung zu den antisemitischen Pogromen der NS-Vergangenheit zu negieren, v.a. aber den unangemessenen Polizeieinsatz gegen die Gruppe der ›Söhne und Töchter der deportierten Juden Frankreichs‹ vergessen zu machen und mit einem positiven Signal – der Neugründung einer Rostocker jüdischen Gemeinde, die schließlich 1994 erfolgte – zu überschreiben, war durch den antisemitischen Ausfall Schmidts zunichte gemacht. Der in Breslau geborene Bubis, der nie eine andere Staatsbürgerschaft als die deutsche besaß, hatte sich öffentlich stets als »deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens« verortet, musste jedoch im Laufe der 1990er Jahre erkennen, dass viele Deutsche in ihm gleichwohl einen Fremden sahen (vgl. Bubis 1996, 13). Insofern fand auf der Pressekonferenz eine doppelte Desillusionierung
9
Den Wortlaut des verbalen Schlagabtauschs dokumentierten sowohl die amerikanische Associated Press, die größte Nachrichtenagentur der Welt (vgl. Starcevic 1992) als auch das American Jewish Year Book (vgl. Ostow 1994, 312).
Matthias N. Lorenz: »… als was waren Sie dort?«
von Gastgebern und Gast statt, die jeweils nicht die Anerkennung – als normale Stadt, als normaler Deutscher – erhielten, die sie sich erhofft hatten.
3. Nachwirkungen (I): Die Entstörung der Tafel Langfristig erwies sich der Versuch einer Entstörung durch Beschweigen, der sich von der plumpen Leugnung rassistischer Angriffe bis zur Abhängung der originalen Gedenktafel zieht, als nicht erfolgreich. Im Laufe der folgenden Jahre verfestigte sich der Ortsname Rostock-Lichtenhagen als Chiffre für ein Fanal von rassistischer Gewalt und Polizeiversagen, wovon nicht zuletzt zahlreiche popkulturelle Bezugnahmen bis in die Gegenwart zeugen. Die kurzzeitige Anbringung der Gedenktafel der Roma und Juden und ihre Entfernung durch die Stadt hatten nur zu deutlich gemacht, dass ein lokales Gedenkzeichen für eine Auseinandersetzung mit dem Pogrom fehlte und von Seiten der Behörden offensichtlich auch nicht gewollt war. Anlässlich von Jahrestagen wurden jedoch immer wieder zivilgesellschaftliche Forderungen nach einem angemessenen städtischen Erinnern an das Pogrom laut. Nach jahrelangem Ignorieren durch die Stadt wurde ein erster größerer Anlauf hierzu 2012 – sicher auch unter dem Eindruck der Selbstenttarnung der rechtsextremen NSU-Terrorist*innen im Vorjahr, die auch in Rostock gemordet hatten (Mehmet Turgut war hier 2004 erschossen worden) – zum 20. Jahrestag der Ausschreitungen unternommen. Bundespräsident Joachim Gauck reiste zu den Feierlichkeiten nach Rostock, wo eine Gedenkeiche am Tatort Sonnenblumenhaus gepflanzt wurde. Ein Bündnis antifaschistischer und antirassistischer Initiativen mobilisierte zugleich zu einer Großdemonstration am 25. August unter dem Motto »20 Jahre nach dem Pogrom – Das Problem heißt Rassismus«. Die Plakate zeigten die Tafel, die im Oktober 1992 aufgehängt und entfernt worden war. Dabei handelte es sich allerdings weder textuell noch von ihrem Erscheinungsbild her um eine genaue Replik. Denn insgesamt gibt es drei Tafeln, die in ihrer Beschaffenheit auch den Weg des Protestes nachzeichnen: Die ursprüngliche Gedenktafel war vom Satz her mit gleichmäßiger schwarzer Kursivschrift vergleichsweise anspruchslos. Die Platte war aus weißem Kunststoff, die Anbringung erfolgte mit Klebstoff. Das Material war marmoriert und imitierte so die Optik eines Gedenksteins. Die aus Solidarität mit den jüdischen Inhaftierten noch im Oktober 1992 am Frankfurter Römer befestigte Tafel war im Wortlaut dem veränderten Ort angepasst worden. Ihr Text in deutlich klarerer, recte und fett gesetzter Groteskschrift begann wie folgt:
351
352
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
In Rostock und anderen deutschen Städten gingen Menschen im August 1992 mit rassistischen Gewalttaten und Brandstiftungen gegen unschuldige Familien, Kinder, Frauen und Männer vor. […]10 Bei der Frankfurter Tafel waren die Worte »In Rostock«, »Auschwitz-Birkenau« und »Gewalt und Menschenverachtung« im Sinne der Signifikantenkopplung im deutschen Umgang mit den Roma von 1944 und 1992 jeweils freigestellt und in größerer Type gesetzt. Auch in Frankfurt wurde die Anbringung der Tafel von der Stadt geduldet und diese nach dem Ende der Aktion dann wieder entfernt (vgl. ads 1992). Bei der Demonstration des Jahres 2012 brachte das Bündnis »20 Jahre nach dem Pogrom – Das Problem heißt Rassismus« im Beisein von 1.500 Menschen schließlich am Vormittag des 25. August erneut eine Gedenktafel am Rostocker Rathaus an. Diese dritte Tafel wurde nun mit dem Einverständnis der Stadt am Eingang eines Seitenflügels platziert. Die taz berichtete: Cornelia Kerth, Bundesvorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, erklärt, dass der parteilose Rostocker Oberbürgermeister Roland Methling zugesagt habe, die Gedenktafel nicht sofort zu entfernen. »In der Bürgerschaft soll eine Entscheidung gefunden werden«, sagt Kerth. […] In einem Grußwort schildert [Beate] Klarsfeld die Geschehnisse [von 1992]: »Natürlich waren wir darauf vorbereitet, dass die Polizei eingreifen würde, aber nicht so brutal, wie sie es taten«, wird vorgelesen. […] Doch heute hatte die Stadt für die Gedenktafel Löcher vorgebohrt. (Speit 2012) Die Federführung der VVN-BdA-Vorsitzenden Kerth bei der erneuten Anbringung einer Gedenktafel am Rathaus zeigt, wie erfolgreich die 1992 gesetzte Verknüpfung von rechter Gewalt und Abschiebepolitik mit der nationalsozialistischen Verfolgung war. Den ›Preis‹ hierfür zahlten in gewisser Weise die Roma, die in der Berichterstattung über das Reenactment zum 20. Jahrestag der Aktion schlicht nicht mehr vorkamen. So wurde die 1992 in der deutschen Mehrheitsgesellschaft noch nicht selbstverständliche Anerkennung von Sinti und Roma als zentrale Opfergruppe der NS-Vernichtungspolitik auch 2012 unhinterfragt reproduziert. Die dritte Tafel trägt den Text der Frankfurter Tafel, adressiert den Ort des Geschehens also nicht mehr exklusiv, wie noch die erste Tafel (»In dieser Stadt«), sondern reiht das Pogrom in eine Reihe anderer rassistischer Gewalttaten ein (»und 10
Die Tafel wird heute vom Förderverein Roma e.V. Frankfurt a.M. verwahrt, den Beteiligte der Aktion am Römer ein Jahr später gründeten. Ich danke dem Filmemacher Adrian Oeser für ein Foto der Frankfurter Tafel.
Matthias N. Lorenz: »… als was waren Sie dort?«
anderen deutschen Städten«). Damit wird – ob beabsichtigt oder nicht – subtil angedeutet, es nicht mit einem lokalen, sondern einem historischen Phänomen zu tun zu haben. Unterstrichen wird dieser Eindruck durch die Einfassung des Textes mit Anführungszeichen, die den Appell der Tafel als ein Zitat historischer Kämpfe lesen lassen. Möglicherweise haben auch diese kleinen Verschiebungen es der Rostocker Bürgerschaft leichter gemacht, die Tafel nunmehr und (trotz Kontroversen, vgl. VVN-BdA 2012) auch dauerhaft zu akzeptieren. Ästhetisch wurde die dritte Tafel gegenüber ihren Vorläufern deutlich als Mahntafel aufgewertet. Wirkte die extrem schlichte erste Tafel noch wie ein vergrößerter Ausdruck eines Textverarbeitungsprogramms auf einem eher billigen Imitat und die zweite Tafel in Frankfurt mit ihren Hervorhebungen ein wenig wie ein agitatorisches Plakat, so ist die dritte Tafel eher wie eine Mahnmals- oder Grabinschrift ausgeführt, in weißer Schrift auf schwarzem Glas. Neu hinzugekommen ist die Überschrift »Deutschland im Herbst«, die nicht weiter erläutert wird (und auch nicht recht zu den beiden Daten im August 1944 und im August 1992 passen will), aber sowohl Assoziationen zu einer kanonischen filmischen Auseinandersetzung mit dem RAFTerror als auch zu einem Gedicht der afrodeutschen Aktivistin und Lyrikerin May Ayim zulässt, das 1992 in Reaktion auf den rechten Terror entstand (vgl. Ayim 2020, 72–74). Und neu ist auch die kleine Zusatzplakette – auch sie ein Paratext mit eher musealisierender Wirkung –, die darauf hinweist (bzw. behauptet), es mit einem Replikat der Originaltafel zu tun zu haben, die 1992 von den FFDJF aufgehängt und von der Stadt wieder entfernt worden sei. Auch hier fällt auf, dass die RomaDelegation, die damals beteiligt war, nunmehr zugunsten einer ausschließlichen Würdigung der französischen Jüdinnen und Juden verschwiegen wird. So zeigen die Solidaritätsaktionen rund um die Tafeln auch jeweils blinde Flecken, die veranschaulichen, dass die Parteinahme durch Empathie stets Ausschlüsse Dritter produziert, was Fritz Breithaupt als Die dunkle Seite der Empathie (Breithaupt 2017) bezeichnet hat. Dies galt auch schon für die Aktion von 1992, die in bemerkenswerter Weise die in Rostock nach der Evakuierung der Roma mit dem Feuertod bedrohten vietnamesischen Vertragsarbeiter*innen überging, denen nach dem Zusammenbruch der DDR überdies ebenfalls die Abschiebung aus Deutschland drohte. Das Los der Vietnames*innen ließ sich offenbar nicht in die von den Klarsfelds gewählte Rhetorik integrieren, die die maximale moralische Autorität von Auschwitz für ihren Protest gegen die Abschiebungen der Roma bemühten. Das Narrativ dieser Signifikantenkopplung erweist sich als so mächtig oder attraktiv, dass die Vietnames*innen auch in den 2015 erschienenen Memoiren der Klarsfelds noch immer mit keiner Silbe erwähnt werden. In der Nacht auf den 5. Dezember 2012 wurde die dritte Mahntafel geschändet, indem die Täter sie durch eine Tafel mit der Aufschrift »Für immer Deutschland« (das »s« in Runenschrift) ersetzten. Doch schon am 17. Dezember weihte der VVNBdA den Gedenkort am Rathaus mit einer Replik der dritten Tafel erneut ein
353
354
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
(vgl. VVN-BdA 2012). Seither ist es ruhig geworden um sie. Mit ihrer deutlich als Mahnzeichen aufgewerteten Erscheinung entspricht sie den Konventionen einer Denkmalsplakette. Als solche stört sie weit weniger an einem offiziellen Gebäude als jene spontan angeklebte Tafel von 1992. Diese wurde noch durch Entfernung zu entstören versucht, im veränderten Bewusstsein des 20. Jahrestages 2012 fand die Entstörung der vermeintlichen Replik durch eine örtliche Verlegung, die subtile Universalisierung der Anklage, ihre Historisierung und eine ästhetische Aufwertung statt, die paradoxerweise eine geringere Sichtbarkeit zur Folge hat. Zwar sind Erinnerungszeichen wie Mahntafeln »Anleitung für die Lebenden« (Kirschbaum 2020, 9). Wie James E. Young in Formen des Erinnerns, seinem kanonischen Werk zu Gedenkstätten des Holocaust, ausführt, können Monumente die Betrachtenden jedoch auch entlasten, indem sie ihnen die Erinnerungsarbeit abnehmen: »Denn sobald wir der Erinnerung eine monumentale Form zugewiesen haben, haben wir uns bis zu einem gewissen Grad auch unserer Erinnerungspflicht entledigt. […] Wir vergessen in dem Maße, in dem wir Monumenten unsere Erinnerungsarbeit übertragen.« (Young 1997, 32f.) Young verweist zudem auf eine weitere Gefahr monumentalisierten Erinnerns: »Indem Monumente gemeinsame Orte der Erinnerung schaffen, schaffen sie gleichzeitig die Illusion einer gemeinsamen Erinnerung.« (Young 1997, 33) Ein offiziell geprägtes Erinnerungszeichen wie die dritte Tafel von 2012 nivelliert damit die scharfe Einrede der Opferverbände, die sich 1992 mit der ersten Tafel ganz bewusst aus einer partikularen und unversöhnlichen Position zum Widerstand gegen dominanzgesellschaftliche Narrative entschlossen hatten. Die Akzeptanz einer abgemilderten Tafel für ein historisiertes Ereignis an einem weniger exponierten Ort fungiert als Reparatur der Störung und wirkt sich so letztlich systemstabilisierend aus – sowohl für eine gedenkpolitisch ›geläuterte‹ Stadtverwaltung wie auch die dergestalt nobilitierte FFDJF. Die Ehrung Beate Klarsfelds mit dem Bundesverdienstkreuz 2015 gehorcht derselben Logik. Diese Form der Entstörung entspricht der systemtheoretischen Erkenntnis, dass eine Störung zum Anstoß gesellschaftlicher Selbstreflexion und Selbsterneuerung wird, die sich durch Anpassung – in diesem Fall der Integration einer ›gezähmten‹ Mahntafel in das Rathausumfeld – wieder stabilisiert (vgl. Gansel/Ächtler 2013, 10). Die v.a. obrigkeitlich gesteuerten Entstörungsversuche des Gedenkjahres 2012 – Bundespräsidentenrede, Gedenkeiche, Tafel am Rathaus – waren indes nicht von Dauer. Ihr Scheitern war der Anlass für eine erneute Auseinandersetzung der Stadt mit ihrer jüngeren Geschichte, die sich erst einer mehrstimmigen zivilgesellschaftlichen Partizipation öffnen musste, um glaubhaft zu werden, und die in einen Mahnmalswettbewerb zum 25. Jahrestag des Pogroms mündete (vgl. Heinrich 2018).
Matthias N. Lorenz: »… als was waren Sie dort?«
4. Nachwirkungen (2): Die Zurückweisung des Zeugen Im letzten Lebensjahr von Ignatz Bubis, 1998/99, gewann der verunglückte RostockBesuch der jüdischen Delegation von 1992 noch einmal Aufmerksamkeit in einer bundesweiten Auseinandersetzung um die Rolle der Juden in der Bundesrepublik – im »erste[n] Antisemitismusstreit der […] Berliner Republik«, wie der Politikwissenschaftler Lars Rensmann (2000, 116) die Walser-Bubis-Debatte genannt hat. Der Schriftsteller Martin Walser hatte in seiner Dankesrede für die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels am 11. Oktober 1998 in der Frankfurter Paulskirche eine »Instrumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken« (Walser 1999, 12) beklagt. Gemeint war der öffentliche Umgang mit den NS-Verbrechen, Walser spielte u.a. auf das geplante Holocaust-Mahnmal in Berlin als »fußballfeldgroßen Alptraum« und »Monumentalisierung der Schande« an. Walser bekannte, angesichts der »unaufhörlichen Präsentation unserer Schande, fange ich an wegzuschauen« (Walser 1999, 12). Die Erinnerung an Auschwitz sei im öffentlichen Diskurs zur »Drohroutine« verkommen, »jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule« (Walser 1999, 13). Ignatz Bubis und seine Frau Ida – gut sichtbar in der ersten Reihe – verweigerten dem von 1.200 Hörer*innen aus Kultur und Politik mit Standing Ovations bedachten Redner die Reverenz, indem sie demonstrativ sitzenblieben. Kurz darauf kündigte Bubis seine jährliche Ansprache zum Jahrestag der Pogrome vom 9. November als Erwiderung auf Walser an und nannte dessen Rede eine »geistige Brandstiftung« (dpa/FAZ [1998] 1999). Mit dieser Wendung hatte er zuvor bereits Politiker rechtsradikaler Parteien wie NPD und DVU belegt und ihnen damit eine unmittelbare Mitverantwortung für die Taten gegen jüdische Einrichtungen wie etwa den Brandanschlag auf die Lübecker Synagoge 1994, aber auch die Anschläge auf Migrant*innen wie u.a. in Rostock, Mölln und Solingen zugewiesen (vgl. Bubis [1996] 1998, 226f.). Zahlreiche prominente Stimmen nahmen daraufhin Walser gegen diesen Vorwurf in Schutz, unter ihnen Klaus von Dohnanyi, Rudolf Augstein, Michael Wolffsohn und Siegfried Unseld. Die enorme Intensität der sich aus Walsers Rede und Bubis’ Gegenrede ergebenden öffentlichen Konfrontation, der über Monate bis ins Frühjahr 1999 v.a. in den Printmedien geführten Walser-Bubis-Debatte (vgl. Lorenz 2004), wird erst verständlich, wenn man auch diese als nachhaltige Irritation des Gedächtnistheaters versteht. Walsers Rede von einem nationalen »Wir« als Kollektiv der im Erinnerungsprozess »Beschuldigten« (Walser 1999, 11) schloss Jüdinnen und Juden per se vom Deutschsein aus, die ja keine Schuld abzuarbeiten hatten, sich nun aber unversehens in der Rolle von ›Beschuldigern‹ wiederfanden. Insofern stellte sie Bubis’ Selbstbild als deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens grundlegend infrage und war eine Absage an ein gemeinsames und dialogisches Erinnern. Bubis seinerseits war nicht bereit, beim Gedenkakt zur Pogromnacht, an der traditionell
355
356
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
auch der Bundespräsident teilnimmt, diesen Affront unkommentiert hinzunehmen und das von Walser diffamierte ›Ritual‹ einfach abzuspulen, das für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland eine doppelte Funktion der Anerkennung hat: als Anerkennung des damals erlittenen Unrechts und Leides ebenso wie als Anerkennung der heutigen Juden und Jüdinnen als Mitglieder der deutschen Gesellschaft. Wie Bodemann ausgeführt hat, versichern wiederum diese durch ihre Teilnahme an dem Gedenkakt der Mehrheitsgesellschaft und der Weltöffentlichkeit, dass das heutige Deutschland kein antisemitischer Staat mehr ist. Nach hunderten von Meinungsartikeln für und wider Walsers »Moralkeule« und Bubis’ »Brandstifter« trafen die beiden Kontrahenten im Erinnerungsstreit am 14. Dezember 1998 zu einem klärenden Gespräch zusammen. Ließ sich die Friedenspreisrede noch als Medienschelte lesen, so konkretisierte Walser hier die Redeaussage zu einer Absage an die jüdische Einrede in deutsche Erinnerungsangelegenheiten. Der Vorwurf der Instrumentalisierung der deutschen Schuld traf nun nicht mehr namenlose »smarte Intellektuelle[]« (Walser 1999, 12) und das Fernsehen, sondern die Opfergruppe selbst. Und dazu wiederholte Walser in variierter Form ausgerechnet die Frage des Rostocker Abgeordneten Karlheinz Schmidt. Walser: Schauen Sie, wenn in der Bundesrepublik Brutalitäten gegen Ausländer vorkommen, gegen Asylanten, dann sind unsere Medien sofort bereit, das zurückzubinden an diese deutsche Vergangenheit. […] Bubis: Dagegen habe ich mich immer öffentlich gewandt. Walser: Ich glaube, ich habe Sie im Fernsehen gesehen in Lichtenhagen bei Rostock. Jetzt frage ich Sie, als was waren Sie dort? Bubis: Das will ich Ihnen sagen. Walser: Denn ich sah Ihr empörtes, ergriffenes Gesicht im Fernsehen, begleitet vom Schein der brennenden Häuser, das war sehr heroisch. (Bubis et al. 1999, 451) Die Verschiebung der Diffamierung ist subtil, aber deutlich: Schmidt hatte Bubis das Recht, sich über das Pogrom zu äußern, durch die Nichtanerkennung seiner deutschen Staatsbürgerschaft absprechen wollen. In einer eingeübten Form des nachkriegstypischen Schuldabwehr-Antisemitismus, der ›Israelkritik‹ (vgl. Holz 2005), unterstellte er, die Opfergruppe trete heute in ihrem eigenen Staat selbst als Täter auf – nichts anderes insinuiert die scheinheilige Frage nach Bubis’ Meinung zu den »Gewalttaten zwischen Israelis und Palästinensern« (zit.n. Bubis [1996] 1998, 240). Walser hingegen spricht gezielt die NS-Vergangenheit an und verwahrt sich gegen eine Gleichsetzung von 1938 und 1992. Dies begründet er jedoch nicht sachlich – worin Bubis ihm zugestimmt haben würde, der in diesem Gespräch auf
Matthias N. Lorenz: »… als was waren Sie dort?«
dem Unterschied beharrt: »das war in Lichtenhagen der Mob. Und das, woran ich mich erinnert habe, war der Staat« (Bubis et al. 1999, 452) –, sondern mit einer Invektive gegen Bubis persönlich, dem unterstellt wird, sich »heroisch« im »Schein der brennenden Häuser« (Bubis et al. 1999, 451) medial produziert zu haben. Die in Rostock gezeigte Emotion des jüdischen Überlebenden wird von Walser als berechnendes Kalkül des jüdischen Funktionärs dargestellt. Die der Friedenspreisrede inhärente Frage nach dem cui bono der »Instrumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken« (Walser 1999, 12) lässt einer Analyse des Antisemitismusforschers Klaus Holz zufolge »nur die Juden als Profiteure« (Holz 2007, 57) einer den Deutschen angeblich aufgezwungenen Gedenkkultur zu. Diese Antwort wird jedoch in der Rede offengehalten, sie wird – im Kontext zeitgenössischer Diskussionen um das Holocaustmahnmal und eine Zwangsarbeiter*innen-Entschädigung – lediglich nahegelegt. In der Aussprache mit Bubis wird die implizite Antwort nun manifest. Der Vorwurf zielt darauf ab, dass der Zentralratspräsident ein gegenwärtiges Ereignis dazu missbraucht habe, um seine eigenen Interessen zu verfolgen – was erkennbar nicht stimmt: Bubis hatte den Tatort Monate nach dem Brand besucht und keineswegs empörte Mahnungen ausgesprochen, sondern öffentlich geweint. Im Fokus der Abwehr steht nun nicht mehr der Jude als vermeintlich ›Fremder‹, der sich raushalten möge, sondern der Vertreter der zentralen Opfergruppe der NS-Vernichtungspolitik. Als solchem aber wird ihm nahegelegt, zu schweigen: »verstehen Sie, wenn Sie auftauchen, dann ist das sofort zurückgebunden an 1933« (Bubis et al. 1999, 452). Walser führt ein Zitat des Judaisten Jacob Taubes an, der festgestellt hatte, dass er als Jude im Nationalsozialismus keine Wahl gehabt habe, für oder gegen Hitler zu sein und daher auch heute »im Urteil eingeschränkt« (Bubis et al. 1999, 452) sei. Hiermit wird nun der Opferseite geboten, sich zu enthalten – und zwar sowohl in Bezug auf die rassistischen Anschläge der Gegenwart wie auch (durch das Taubes-Zitat und die Unterstellung, im Gedenken »gegenwärtige Zwecke« zu verfolgen) in Bezug auf die NS-Vergangenheit. Damit aber wäre das Silencing, das Stummschalten der Juden in der Tätergesellschaft absolut und die von dem Historiker Dan Diner beschriebene »negative Symbiose« (Diner 1988) von Juden und Deutschen, die in der Erinnerung an den Holocaust unlösbar aufeinander bezogen sind, einseitig aufgekündigt. Das im Grunde völkisch legitimierte und auf erinnerungspolitische Dominanz angelegte Konzept von Nation, wie Walser es vertritt, negiert die Idee eines nicht-konsensuellen Erinnerns innerhalb einer pluralen Gesellschaft, wie es heute u.a. als multiperspektivisches, dialogisches oder »agonistisches Erinnern« (vgl. Bull/Hansen 2016) diskutiert wird.
357
358
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
5. Fazit In der jüdischen Solidarisierung mit den Opfern des rassistischen Pogroms in Lichtenhagen spitzt sich das deutsch-jüdische Verhältnis konflikthaft zu: Die Montage einer Gedenktafel durch die Gruppe der Nachfahren der französischen Opfer des Holocaust wird vereitelt, dem Zentralratspräsidenten wird in der zur Deeskalation einberufenen Pressekonferenz das Deutschsein abgesprochen und Walser baut wenige Jahre später im Gespräch mit Bubis dessen Auftritt vor dem Sonnenblumenhaus (kontrafaktisch) als konkretes Beispiel für jene »Instrumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken« (Walser 1999, 12) auf, von deren Profiteuren er in der Friedenspreisrede nur geraunt hatte. Mit dem Eklat um die Gedenkaktion der Klarsfelds und mit den Versuchen Schmidts und später Walsers, den höchsten Vertreter der jüdischen Opfergruppe in Deutschland zum Schweigen zu bringen, sind die innerdeutschen Beziehungen zwischen jüdischer Minorität und Mehrheitsgesellschaft auf einem Tiefpunkt angelangt: Es sind unverblümte Angriffe von nichtjüdischer Seite auf die Artikulation einer abweichenden jüdischen Erfahrung. Mit einer Formulierung der Literaturwissenschaftlerin Ruth Klüger lässt sich feststellen, dass in jenem Augenblick, in dem Juden nicht mehr bereit sind, auf der Bühne des öffentlichen Gedenkens der »Legende vom vergebenden Juden« (Klüger 1998, 180) zu entsprechen, das Gedächtnistheater eskaliert. Die Forderung an die jüdische Opfergruppe nach Versöhnlichkeit entpuppt sich hier als Machtgeste der Mehrheitsgesellschaft, die Abweichungen von der Inszenierung entsprechend sanktioniert. Vergeblich waren die jüdischen Interventionen an einem der prominentesten Tatorte rechter Nachkriegsgewalt indes nicht, markieren sie doch einen Schulterschluss mit migrantischen Opfern rechter Gewalt, der bestimmend blieb für die Arbeit des Zentralrats der Juden in Deutschland. Mit Bubis zog im Zentralrat ein neues Selbstverständnis ein, das mit seinem Besuch in Rostock erstmals sichtbar wurde: »Dass die Beschäftigung mit allen Problemen der Gesellschaft zum Interesse aller Beteiligten, also auch der jüdischen Minderheit, gehöre, war ihm selbstverständlich,« wie der Historiker Wolfgang Benz (2011, 196) resümiert. Entsprechend nahm der neue Zentralratspräsident nach seinem Besuch in Rostock-Lichtenhagen auch an der Gedenkfeier für die Ende 1992 bei einem neonazistischen Brandanschlag in Mölln ermordeten Mitglieder der türkischen Familie Arslan teil und besuchte ein Jahr später den Tatort des Solinger Anschlags, wo fünf weitere türkeistämmige Menschen starben. In Reaktion auf die ausländerfeindlichen Ausschreitungen der Nachwendejahre stellte Bubis seine Erinnerung als Überlebender des Holocaust in eine Relation zum Rassismus der Gegenwart und erkannte damit das Aufeinanderbezogensein derartiger Gewalterfahrungen an: »Wir leben nicht nur für uns, sondern in dieser Gesellschaft, und es kann uns nicht egal sein, was sich in ihr abspielt.« (zit.n. Benz 2011, 197)
Matthias N. Lorenz: »… als was waren Sie dort?«
Literatur o. A. d. Verf. »Benzin ins Feuer«. In: Der Spiegel (08.11.1992). o. A. d. Verf. »Französische Studenten prügelten auf Polizisten ein«. In: [Erscheinungsort unbekannt, Archiv der FFDJF (wahrscheinlich BILD Ausgabe Mecklenburg-Vorpommern)] 20.10.1992. ads. »Gedenktafel wieder von Rathauswand genommen«. In: FAZ (26.10.1992). [AFP]. »Rostocker Aktion französischer Juden sollte Deutsche mobilisieren«. In: Frankfurter Rundschau (22.10.1992a). AFP. »Rostock: Juden für Roma«. In: taz (17.10.1992b). AFP/AP. »Juden demonstrieren in Rostock«. In: Frankfurter Rundschau (20.10.1992). AP. »French Jews, led by Klarsfelds, protest in Germany«. [Erscheinungsort unbekannt, Archiv der FFDJF] 20.10.1992. AP/dpa. »Deutsches Kulturzentrum in Paris verwüstet«. In: FAZ (22.10.1992). Ayim, May. »deutschland im herbst«. In: Dies. weitergehen. Gedichte. Berlin 2 2020, 72–74. Baeck, Jean-Philipp/Kathrin Herold. »Ein langer Weg«. In: taz (Hamburg/Bremen) (18.07.2015), 44. Benz, Wolfgang. »Charisma und Resignation: Ignatz Bubis«. In: Ders. Deutsche Juden im 20. Jahrhundert. München 2011, 195–207. Bodemann, Michal Y. Gedächtnistheater. Die Jüdische Gemeinde und ihre deutsche Erfindung. Hamburg 1996. Bodemann, Michal Y. »Staat und Ethnizität. Der Aufbau der jüdischen Gemeinden im Kalten Krieg«. In: Jüdisches Leben in Deutschland seit 1945. Hg. v. Brumlik et al. Frankfurt a.M. 1986, 49–69. Breithaupt, Fritz. Die dunklen Seiten der Empathie. Berlin 2017. Brumberg, Hans-Hubertus. »Umstrittene Tafel ist bereits verschwunden«. In: Norddeutsche Neueste Nachrichten. Rostocker Anzeiger (20.10.1992), 9. Bubis, Ignatz. »Damit bin ich längst noch nicht fertig«. Die Autobiographie [1996]. Mit Peter Sichrovsky. Berlin 1998. Bubis, Ignatz. Juden in Deutschland. Hg. v. Wilhelm von Sternburg. Berlin 1996. Bubis, Ignatz et al. »Wir brauchen eine neue Sprache für die Erinnerung. Ein Gespräch« [14.12.1998]. In: Die Walser-Bubis-Debatte. Eine Dokumentation. Hg. v. Frank Schirrmacher. Frankfurt a.M. 1999, 438–465. Bubis – das letzte Gespräch. [Dokumentation mit Spielszenen] Hessischer Rundfunk 2017. Bull, Anna Cento/Hans Lauge Hansen. »On Agonistic Memory«. In: Memory Studies 9.4 (2016), 390–404. CCM. »Rostock tut Buße«. In: taz (04.11.1992), 3. Czollek, Max. Gegenwartsbewältigung. München 2020.
359
360
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Diner, Dan. »Negative Symbiose – Deutsche und Juden nach Auschwitz«. In: Jüdisches Leben in Deutschland nach 1945. Hg. v. Micha Brumlik et al. Frankfurt a.M. 1988, 243–257. dpa. »Geistige Brandstiftung. Bubis wendet sich gegen Walser« [13.10.1998]. In: Die Walser-Bubis-Debatte. Eine Dokumentation. Hg. v. Frank Schirrmacher. Frankfurt a.M. 1999, 34–35. dpa/OZ/ADN. »46 Festnahmen in Rostock nach jüdischer Protestaktion«. In: OstseeZeitung (20.10.1992), 1. exp. »Protest gegen Abschiebevertrag«. In: Kölner Express (28.10.1992). Fenton, Tom. [Beitrag für] CBS News, 1992 (genaues Sendungsdatum unbekannt; Mitschnitt im Archiv der FFDJF, freundlicherweise zur Verfügung gestellt v. Adrian Oeser). F[euerstein], I[ngrid]. »Gewalt bringt keine Sympathie«. In: Ostseezeitung (20.10.1992a), 13. Feuerstein, Ingrid. »Gutes Anliegen mit Stöcken kaputtgeschlagen«. In: Ostseezeitung (20.10.1992b), 13. Fings, Karola. Sinti und Roma. Geschichte einer Minderheit. München 2016. Förderverein Roma Frankfurt a.M. Gedenktafeln in Frankfurt a.M. www.foerdervereinroma.de/romaffm/mahntaf/mahntaf.htm (24.02.2022). FR. »Rostocker Mahntafel hängt jetzt am Römer«. In: Frankfurter Rundschau (26.10.1992). Gansel, Carsten/Norman Ächtler. »Das ›Prinzip Störung‹ in den Geistes- und Sozialwissenschaften – Einleitung«. In: Das ›Prinzip Störung‹ in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Hg. v. dens. Berlin/Boston 2013a, 7–13. Gansel, Carsten. »Zu Aspekten einer Bestimmung der Kategorie ›Störung‹ – Möglichkeiten der Anwendung für Analysen des Handlungs- und Symbolsystems Literatur«. In: Das ›Prinzip Störung‹ in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Hg. v. dems./Norman Ächtler. Berlin/Boston 2013b, 31–56. Heinrich, Gudrun. »Rostock Lichtenhagen 1992–2017: Aufarbeitung und Erinnerung als Prozess der lokalen politischen Kultur. Ein Essay«. In: Politische Führung im Spiegel regionaler politischer Kultur. Hg. v. Martin Koschkar/Clara Ruvituso. Wiesbaden 2018, 293–310. Herz, Thomas. »Die ›Basiserzählung‹ und die NS-Vergangenheit. Zur Veränderung der politischen Kultur in Deutschland«. In: Umkämpfte Vergangenheit. Diskurse über den Nationalsozialismus seit 1945. Hg. v. dems./Michael Schwab-Trapp. Opladen 1997, 249–265. Holz, Klaus. »Die Paradoxie der Normalisierung. Drei Gegensatzpaare des Antisemitismus vor und nach Auschwitz«. In: Literarischer Antisemitismus nach Auschwitz. Hg. v. Klaus-Michael Bogdal/Klaus Holz/Matthias N. Lorenz. Stuttgart/ Weimar 2007, 37–57.
Matthias N. Lorenz: »… als was waren Sie dort?«
Holz, Klaus. »Antizionistischer Antisemitismus«. In: Die Gegenwart des Antisemitismus. Islamistische, demokratische und antizionistische Judenfeindschaft. Hg. v. dems. Hamburg 2005, 79–99. Jungkunz, Alexander. »Ach, Rostock … Wieder wirft ein Polizeieinsatz Fragen auf«. In: Nürnberger Nachrichten (21.10.1992). Kaps, Bettina. »Protest vor der deutschen Botschaft«. In: taz (24.10.1992), 4. Kempe, Frank. Rassistische Gewalt bringt Leute zur Demo. Deutschlandfunk (08.11.2012). https://www.deutschlandfunk.de/rassistische-gewalt-bringt-leu te-zur-demo-100.html (15.03.2022). Kerkmann, Neele. »Beate Klarsfeld«. In: Lexikon der ›Vergangenheitsbewältigung‹ in Deutschland. Debatten- und Diskursgeschichte des Nationalsozialismus nach 1945. Hg. v. Torben Fischer/Matthias N. Lorenz. Bielefeld 3 2015, 196–197. Kirschbaum, Jan Niko. Mahnmale als Zeitzeichen. Der Nationalsozialismus in der Erinnerungskultur Nordrhein-Westfalens. Bielefeld 2020. Klarsfeld, Serge. »An der Seite der Roma in Rostock«. In: Erinnerungen. Hg. v. Beate Klarsfeld/Serge Klarsfeld. München 2015, 488–491. Klein, Anne. »›Militans de la Mémoire‹. Repräsentationen jüdischen Engagements in den 1970er Jahren«. In: Opfer als Akteure. Interventionen ehemaliger NS-Verfolgter in der Nachkriegszeit. Hg. v. Katharina Stengel/Werner Konitza. Frankfurt a.M./ New York 2009, 126–147. Klüger, Ruth. »Zeugensprache: Koeppen und Andersch«. In: Deutsche Nachkriegsliteratur und der Holocaust. Hg. v. Stephan Braese et al. Frankfurt a.M. 1998, 173–181. Lambeck, Silke. »Aktion französischer Juden gegen Abschiebung von Roma«. In: Berliner Zeitung (20.10.1992), 1. Lange, Katharina. »Gedenkstätte Neue Wache«. In: Lexikon der ›Vergangenheitsbewältigung‹ in Deutschland. Debatten- und Diskursgeschichte des Nationalsozialismus nach 1945. Hg. v. Torben Fischer/Matthias N. Lorenz. Bielefeld 2007, 271–272. Lausberg, Michael. Die extreme Rechte in Ostdeutschland 1990–1998. Marburg 2012. Le Monde/AFP. »Arno Klarsfeld remplacé par Rémy Schwartz à la tête de l’OFII«. In: Le Monde (15.01.2013). https://www.lemonde.fr/politique/article/2013/01/15/ar no-klarsfeld-evince-de-l-office-francais-de-l-immigration_1817093_823448.ht ml (01.03.2022). Lorenz, Matthias N. »›Familienkonflikt‹ oder ›Antisemitismusstreit‹. Zur WalserBubis-Debatte«. In: Seelenarbeit an Deutschland. Martin Walser in Perspective. Hg. v. Stuart Parkes/Fritz Wefelmeyer. Amsterdam/New York 2004, 363–388. Malzahn, C[laus] C[hristian]. »Drei Franzosen bleiben in Haft«. In: taz (21.10.1992a), 4. Malzahn, C[laus] C[hristian]. »Serge Klarsfeld gibt sich militant«. In: taz (22.10.1992b), 4. Ostow, Robin. »Federal Republic of Germany«. In: The American Jewish Year Book 94 (1994), 306–327.
361
362
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Parusel, Bernd. Abschottungs- und Anwerbungsstrategien. EU-Institutionen und Arbeitsmigration. Wiesbaden 2010. Rensmann, Lars. »Enthauptung der Medusa. Zur diskurshistorischen Rekonstruktion der Walser-Debatte im Licht politischer Psychologie«. In: Umkämpftes Vergessen. Walser Debatte, Holocaust-Mahnmal und neue deutsche Geschichtspolitik. Hg. v. Micha Brumlik/Hajo Funke/Lars Rensmann. Berlin 2000, 28–126. Röger, Maren. »Gnade der späten Geburt«. In: Lexikon der ›Vergangenheitsbewältigung‹ in Deutschland. Debatten- und Diskursgeschichte des Nationalsozialismus nach 1945. Hg. v. Torben Fischer/Matthias N. Lorenz. Bielefeld 2007, 226–227. Schmidt, Jochen. Politische Brandstiftung. Warum 1992 in Rostock das Ausländerwohnheim in Flammen aufging. Berlin 2002. Schmidt, Thilo. Der Sündenfall. Deutschlandfunk (24.08.2007). https://www.deutsc hlandfunkkultur.de/der-suendenfall-100.html (23.02.2022). Speit, Andreas. »›Fällt alle deutschen Eichen‹. In Rostock erinnern mehrere tausende Demonstranten an den Pogrom in Lichtenhagen. Sie bringen eine Gedenktafel am Rathaus an – nicht zum ersten Mal«. In: taz (25.08.2012). Starcevic, Nesha. Jewish Leaders Angry After Affront by City Official. AP [Associated Press] News (02.11.1992) https://apnews.com/article/15f230f5a90b3a2a22374fe18 49fcf89 (05.09.2022). Thomas, Tanja/Fabian Virchow. »Praxen der Erinnerung als Kämpfe um Anerkennung. Zu Bedingungen einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit rechter Gewalt«. In: Leerstelle Rassismus? Analysen und Handlungsmöglichkeiten nach dem NSU. Hg. v. Tina Dürr/Reiner Becker. Frankfurt a.M. 2019, 156–168. VVN-BdA. Presseerklärung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, 06.12.2012. Walser, Martin. »Erfahrungen beim Verfassen einer Sonntagsrede« [1998]. In: Die Walser-Bubis-Debatte. Eine Dokumentation. Hg. v. Frank Schirrmacher. Frankfurt a.M. 1999, 7–17. Weiß, Volker. Die autoritäre Revolte. Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes. Stuttgart 2017. Young, James E. Formen der Erinnerung. Gedenkstätten des Holocaust. Wien 1997. Zaidman, Annette. »Témoigne de la Manifestation de Solidarité avec les Tsiganes«. In: Bulletin de liaison des Fils et Filles des Déportés Juifs de France 39 (1992), 4–6.
»What a brainfuck.« Zum Verhältnis von Geschichte und Erinnerung in der Gegenwart Hans-Joachim Hahn
1. Objektive Erinnerungsdifferenz und multidirektionale Gedächtnisse Im Frühjahr 2021 kam die deutsche Übersetzung von Michael Rothbergs vieldiskutierter Studie Multidirectional Memory. Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization heraus, die auf Englisch bereits 2009 erschienen war. Damit liegt eine literatur- und kulturwissenschaftlich orientierte Untersuchung zu kulturellen Reflexionen des Holocaust auf Deutsch vor, die sich in verschiedener Hinsicht mit Stephan Braeses Die andere Erinnerung. Jüdische Autoren in der westdeutschen Nachkriegsliteratur (Braese [2001] 2002) vergleichen lässt, auch wenn sich beide Studien auf unterschiedliche literarische und kulturelle Räume beziehen: Gegenstand von Rothbergs Untersuchung sind neben Kapiteln zu Hannah Arendt und W. E. Du Bois eine Reihe von Texten, Bildern und Filmen, in denen sich die Auseinandersetzung mit Frankreichs Rolle während der deutschen Okkupation im Zweiten Weltkrieg und bei der Deportation von Jüdinnen und Juden mit der Reflexion des gewaltsamen Prozesses der Dekolonisierung verschränkt. Ein zentrales historisches Ereignis, dem sich die Studie in der Analyse kultureller Texte nähert, ist das Massaker vom 17. Oktober 1961 mitten in Paris, bei dem algerische Demonstrant:innen von Polizeikräften unter Leitung des Polizeipräfekten Maurice Papon, der als Beamter des Vichy-Regimes Verantwortung für Deportationen in die Vernichtungslager trug, getötet und in die Seine geworfen wurden. Im vierten Teil seiner Studie reflektiert Rothberg über dieses Massaker und befragt verschiedene seiner kulturellen Darstellungen als Orte des Holocaustgedenkens. In Abgrenzung zu Daniel Levys und Natan Sznaiders Erinnerung im globalen Zeitalter: Der Holocaust (2001) veranschaulicht er daran u.a., »dass die transnationale Zirkulation des Holocaust als Aspekt der Multidirektionalität von Erinnerung« zu verstehen sei (Rothberg [2009] 2021a, 306). Betont wird so der aktive Anteil anderer Geschichten und Erinnerungen bei der Globalisierung und Universalisierung des Holocaustgedenkens.
364
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Die Gemeinsamkeit der Studien von Braese und Rothberg liegt in ihrer jeweiligen Rekonstruktionsarbeit, die unser Wissen über Prozesse des kulturellen Umgangs mit dem Holocaust insbesondere in literarischen Texten erweitert. Zugleich unterscheiden sich beide Projekte jedoch grundlegend mit Blick auf die analysierten Erinnerungsdynamiken, was weniger mit der zeitlichen Differenz von einem Jahrzehnt als mit der jeweiligen Perspektive zusammenhängt. Braese sieht den Ort, von dem ausgehend jüdische Autor:innen deutscher Sprache in der westdeutschen Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur schrieben, bestimmt durch eine, ihnen allen gemeinsame »Positur: im Gegenüber zum Gros der deutschsprachigen Autoren und ihrer Arbeit, in das die objektive Erinnerungsdifferenz sie unweigerlich stellte« (Braese [2001] 2002, 29). Charakterisierend für diesen »eigentümlichen Ort jüdischer Autoren in der westdeutschen Nachkriegsliteratur« sei nicht die je spezifische Stellung »im Traditionskontinuum der – vielsprachigen – jüdischen Literatur«, sondern ein »›sozialgeschichtlicher‹ Sachverhalt: ihre Nicht-Teilhabe an der kollektiven Erfahrung der Mehrheit der Deutschen zwischen 1933 und 1945 sowie deren subjektgeschichtliche Aufzeichnung – der anderen Erinnerung« (Braese [2001] 2002, 30). Während in Frankreich der Holocaust mit den noch andauernden Auseinandersetzungen um Rassismus und Fremdenfeindlichkeit verknüpft sei, spiegelte der Umgang mit Erinnerungen an den Holocaust in Deutschland oftmals »politische, ideologische und Generationenkonflikte wider« (Novick 2001, 350), schrieb Peter Novick ebenfalls vor etwa zwei Jahrzehnten und hielt so eine erinnerungskulturelle Differenz fest, die hier mit Blick auf die unterschiedlichen Perspektiven beider Studien angeführt werden kann. Bald nach Erscheinen der übersetzten Studie von Rothberg veröffentlichten verschiedene überregionale Publikationsorgane Besprechungen, von denen einige den Vorwurf teilten, Rothbergs Studie stelle die Singularität des Holocaust infrage. In einer Besprechung in der taz wird sogar unterstellt, Rothbergs Wendung gegen Opferkonkurrenz sei bloß ein »Trick«, der darauf beruhe, dass er das »Missverständnis« verbreite, »die Behauptung der Beispiellosigkeit der Shoah sei borniert eurozentrisch und verdränge andere Erinnerungen und Traumata« (Martini 2021). Wie andere stellt Tania Martini in ihrer Kritik an Rothbergs Studie eine Verbindung her zum sogenannten ›Historikerstreit‹ aus dem Jahr 1986, der während der letzten dreieinhalb Dezennien regelmäßig als Stichwort angeführt wird, wenn Fragen der deutschen Erinnerungspolitik diskutiert werden; Rothberg selbst bemüht den Vergleich im Sommer 2021 in seiner Analyse der letzten erinnerungspolitischen Debatten in Deutschland, allerdings in anderer Perspektive (Rothberg 2021b). Für Martini steht fest, dass im Historikerstreit der 1980er Jahre »die Singularität der Shoah von Habermas, Wehler, Brumlik und anderen gegen die konservativen Relativierer Nolte, Hillgruber etc., verteidigt« wurde, die nun neuerdings wieder zur Diskussion stünde (Martini 2021).
Hans-Joachim Hahn: »What a brainfuck.«
Der Streit um die Singularität der Shoa bestimmte den erinnerungspolitischen Debattenhorizont im Sommer 2021 und entzündete sich vor allem an einem Pamphlet, das dessen Autor u.a. mit Blick auf die missgünstige Rezeption von Rothbergs übersetzter Studie und offensichtlich in polemischer Absicht lanciert hatte. Die Rede ist von A. Dirk Moses’ Der Katechismus der Deutschen, einem Artikel, der auf dem Zürcher Online-Forum Geschichte der Gegenwart veröffentlicht eine monatelange Kontroverse auslöste (Moses 2021). Durchaus in Kenntnis aktuellerer erinnerungskultureller Auseinandersetzungen (vgl. exemplarisch Neiman/Wildt 2022), wie etwa um das antisemitische Banner von Taring Padi auf der documenta 15 im Sommer 2022, unternimmt die folgende Darstellung jedoch in erster Linie eine Rekonstruktion der Situation im Sommer 2021 – samt ihren Vorgeschichten und zwei literarischen Reflexionen. Einer der interessantesten Beiträge zur damaligen Kontroverse stammt von Omri Boehm, der inzwischen eine kleine Studie mit dem Plädoyer für einen, an Kant anknüpfenden »radikalen Universalismus« vorgelegt hat (Boehm 2022), worin Gedanken seines Debattenbeitrags aus dem Vorjahr wieder anklingen. In seinem Artikel argumentierte Boehm 2021 ebenfalls im Rekurs auf den ›Historikerstreit‹, es sei Jürgen Habermas bei seinem Einspruch gegen den konservativen Ideologiehistoriker Ernst Nolte darum gegangen, den Universalismus gegen Noltes Versuch einer Neulegitimierung deutschen »Nationalbewusstseins« zu verteidigen. Gegen dessen instrumentalisierende Holocaust-Relativierung sei die Verpflichtung auf universalistische Grundsätze sicherzustellen. Implizit erscheint hier der Holocaust als Menschheitsverbrechen, weshalb aus der Erinnerung seiner Besonderheiten, seiner ›Singularität‹, eine Verantwortung für die Menschenwürde weltweit erwachse. Genau an diesem Punkt sah Boehm jedoch im Sommer 2021 – Monate vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine – ein gegenwärtiges Dilemma deutscher Erinnerungspolitik, einen Konflikt zwischen Partikularismus und Universalismus, aufbrechen. Denn, wie lasse sich, so fragt der Philosoph, Deutschlands besonderes Verhältnis zum Staat Israel damit vereinbaren, »dass dieses Bekenntnis in unseren Tagen eine wachsende Herausforderung für Deutschlands Verpflichtung auf die Menschenrechte und das Völkerrecht bedeutet« (Boehm 2021)? Boehm versteht, wie erläutert, Habermas’ Intervention im Historikerstreit von 1986 als Verpflichtung auf den Universalismus, der gerade aus der Verantwortung für Auschwitz erwachse. Anstelle der von Nolte vorgebrachten Begründung »nationaler Identität« aus dem Umgang mit der Vergangenheit vertrat Habermas das Konzept des »Verfassungspatriotismus« bzw., in seiner Bilanz der Kontroverse (Nachspiel), das »ein[es] nationale[n] Selbstbewußtsein[s], das seine Kräfte einzig schöpft aus der kritischen, durch Auschwitz belehrten Aneignung unserer an unzweideutigen Vorbildern glücklicherweise nicht so armen Traditionen« (Habermas 1987, 158). Vor diesem Hintergrund kritisiert Boehm, dass das gegenwärtige Deutschland sich jüngst gegen die Autorität des Internationalen Strafgerichtshofs in Den
365
366
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Haag gewendet habe, als dessen Chefanklägerin Voruntersuchungen zu angeblichen Kriegsverbrechen der Hamas und Israels einleitete. Paradox erscheint, dass Deutschland gerade aufgrund seiner Vergangenheit der Autorität des IStGH hoch verpflichtet sei, sich jetzt aber aus demselben Grund gegen dessen Autorität stelle. Sein Resümee: So sehe es aus, »wenn die Autorität des Universalismus an der Türschwelle der Singularität endet« (Boehm 2021). Mit der deutschen Vergangenheit werden bis heute vor allem moralische Entscheidungen in der Gegenwart begründet. Was heißt es aber für das deutsche Staatsverständnis, wenn es primär aus der Differenz zu »Auschwitz« bestimmt wird? Welches Verhältnis besteht dabei zwischen kollektiven Erinnerungen, auf die sich die etablierte Gedächtnisforschung seit den 1990er Jahren bezieht, und Geschichte, wie sie in der Historiografie (re)konstruiert wird? Wie verhalten sich schließlich die aktuellen publizistischen Debatten um die Vergangenheit zu deren literarischer Reflexion? Pointiert gefragt: Hat Thomas Assheuer Recht, wenn er schreibt, »[d]ie Medialisierung des Grauens im publizistischen Tageskampf« sei »die perfideste Form des Vergessens« (Assheuer 2021)?
2. Geschichte und Erinnerung: Zum Umgang mit der Vergangenheit Für ein genaueres Verständnis der erinnerungspolitischen Debatten im Sommer 2021 soll hier zunächst auf die Diskussion um die Begriffe »Geschichte« und »Erinnerung« kursorisch eingegangen werden. Denn bereits der ›Historikerstreit‹ 1986/87 kreiste um das Verhältnis von Geschichtsschreibung als einer Wissenschaft sine ira et studio und dem öffentlichen Gebrauch von Geschichte, bei dem es immer um Moral und expliziten Gegenwartsbezug geht. In seinem Beitrag zu einer Festschrift für Edzard Reuter im Jahr 1988 stellte Eberhard Jäckel (1929–2017) allgemeine Reflexionen Über den Umgang mit der Vergangenheit an, wie der Aufsatz überschrieben ist (Jäckel [1988] 1989b, 118–130). Zwei Jahre zuvor hatte sich der Historiker mit zwei Beiträgen am Historikerstreit beteiligt. In einem davon vertrat er die Auffassung, dass der nationalsozialistische Mord an den Juden und Jüdinnen Europas deshalb einzigartig sei, weil noch nie zuvor ein Staat mit der Autorität seines verantwortlichen Führers beschlossen und angekündigt hatte, eine bestimmte Menschengruppe einschließlich der Alten, der Frauen, der Kinder und der Säuglinge möglichst restlos zu töten, und diesen Beschluß mit allen nur möglichen staatlichen Machtmitteln in die Tat umzusetzen (Jäckel [1986] 1989a, 72f.). Jäckel gehört innerhalb der Debatte nicht nur klar zu den Verfechtern der Singularität, sondern auch zu den Teilnehmern der Kontroverse, deren Texte beim Wiederlesen durch einen ruhigen Ton und den abwägenden, argumentierenden Gestus
Hans-Joachim Hahn: »What a brainfuck.«
überzeugen. Ein bemerkenswerter Ausdruck davon ist seine Relativierung der Bedeutung dieser Singularität, wenn er nahelegt, dass sie am Ende gar so wichtig überhaupt nicht sei. Denn was, so fragt Jäckel, würde sich eigentlich ändern, falls der nationalsozialistische Genozid nicht einzigartig gewesen wäre? Das Problem hinsichtlich des nationalsozialistischen Mords sei allenfalls, dass die bundesdeutsche Gesellschaft – zeitlich geht es um die letzten Jahre der 1980er – wenig davon wisse (Jäckel [1986] 1989a, 73). In dem Essay Über den Umgang mit der Vergangenheit aus dem Jahr 1988 entfaltet der Historiker allgemeine Überlegungen zur Beschäftigung mit Vergangenem, die er als alltägliche Kulturpraxis beschreibt. Menschliches Leben sei »wesentlich Umgang mit der Vergangenheit« (Jäckel [1988] 1989b, 118). Was der Mensch aus ihr mache, heiße Geschichte. Denn nur umgangssprachlich bedeute Geschichte das, was geschehen sei; vielmehr stelle sie »die künstliche Anordnung von Wissen über Vergangenheit« dar (Jäckel [1988] 1989b, 118). Die zweite umgangssprachliche Bedeutung, dass Geschichte auch Erzählung heiße, streicht Jäckel daher besonders heraus: Geschichte sei »die Vergegenwärtigung von Vergangenheit« (Jäckel [1988] 1989b, 119). Jäckels Aufsatz steckt voller Merksätze. Geschichte gebe es nicht in der Einzahl, sondern nur als Geschichten (Jäckel [1988] 1989b, 120). Dem öffentlichen Umgang mit Vergangenheit weist er dabei einen hohen Stellenwert zu, wofern der »sich in Kommunikation, in Rede und Gegenrede, in Für und Wider, im Austausch von Argumenten, die überprüfbar sind und Zustimmung finden können« vollziehe (Jäckel [1988] 1989b, 121). Die Geschichtswissenschaft gilt ihm als »kontrollierter und kontrollierbarer Umgang mit Vergangenheit« (Jäckel [1988] 1989b, 122), wobei der Anspruch einer Kontrolle der eigenen Bilder von Vergangenheit nicht auf Historiker:innen beschränkt bleibe. Die Methoden der Historiographie wiederum seien die anderer Wissenschaften und die historischen Beschreibungen blieben »Konstrukt[e] des menschlichen Geistes« (Jäckel [1988] 1989b, 123), zumal Historiker:innen erklären wollten und daher Ursachen ausmachten, die es indes in der Geschichte gar nicht gebe. So stelle die Gerechtigkeit für die Vergangenheit die größte Herausforderung im Umgang mit Geschichte dar (Jäckel [1988] 1989b, 123). »Wer etwas ermitteln, verstehen und richtig beschreiben« wolle, der müsse unparteilich sein und wie ein Untersuchungsrichter, der für Jäckel viel mit dem Historiker gemein hat, »im Interesse der Untersuchung« (Jäckel [1988] 1989b, 123) handeln. Dass »kritische Geschichtswissenschaft« überhaupt nur unter rechtsstaatlichen Bedingungen möglich sei und zudem vom »merkwürdige[n] Interesse der Staaten an Geschichte« behindert werde, weil den »Machthabenden« niemals gleichgültig sei, welches Bild sich die Bürger:innen von der Geschichte machten, lässt sie als hohes Gut erscheinen. Angesichts der Inanspruchnahme historischer Narrative zur Rechtfertigung von Kriegen und imperialistischen Machtansprüchen, erscheint Rechtstaatlichkeit als Voraussetzung unabhängiger und kritischer Geschichtsschreibung unhintergehbar. Jäckel vertritt jedoch die Auffassung, dass
367
368
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
auch »in freiheitlichen und demokratischen Staaten« der Staat die Herrschaft über die Vergangenheit beanspruche (Jäckel [1988] 1989b, 129). Nur kurze Zeit nach dem ›Historikerstreit‹ also äußert er sich darüber, dass der Streit zwischen Historiker:innen zwar in der Regel darüber geführt werde, welches Bild der Vergangenheit der Wirklichkeit am nächsten käme, dass dabei aber oftmals weniger »wissenschaftliche Kriterien, sondern politische Interessen und Meinungen den Ausschlag« (Jäckel [1988] 1989b, 130) gäben. Die von Jan und Aleida Assmann vertretene, auf Maurice Halbwachs soziologische Studien zum »kollektiven Gedächtnis« aus den 1920er Jahren aufbauende Gedächtnistheorie teilt mit den hier rekonstruierten Überlegungen Jäckels die Zurückweisung einer polaren Gegenüberstellung von Geschichte und Gedächtnis (vgl. Assmann 1999, 30). Ebenso wie den Historiker interessiert die Kulturwissenschaftlerin in ihrer mit Ute Frevert verfassten Monografie Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessenheit aus dem Jahr 1999 vor allem der Umgang mit »den Vergangenheiten« in Deutschland nach 1945. Die in der Studie wie auch andernorts vorgestellten drei Formen von Gedächtnis gehen von der Annahme aus, »daß sich Erinnerungsprozesse im Spannungsfeld zwischen subjektiver Erfahrung, wissenschaftlich objektivierter Geschichte und kultureller Kommemoration« bewegten (Assmann 1999, 34). Während das kommunikative Gedächtnis, als das Jan und Aleida Assmann die individuellen, aber im kommunikativen Austausch geprägten Erinnerungen bezeichnen, in ein »implizites Generationsgedächtnis« eingebunden sei (Assmann 1999, 38), beschreibe das kollektive Gedächtnis eine andere Ebene: In der Verbindung mit einem Kollektiv, das Assmann auch als »Solidargemeinschaft« (Assmann 1999, 42) bezeichnet, stelle es eine »Steigerungsform des Generationsgedächtnisses« dar und sei zugleich »immer ein politisch instrumentalisiertes Gedächtnis« (Assmann 1999, 41, 42). Assmanns Modell für kollektives Gedächtnis ist das nationale Gedächtnis. Hier sieht sie Vereinheitlichung am Werk, während sich das kulturelle Gedächtnis schließlich auf das »kulturelle Archiv« stütze, das heißt auf Pluralität, »auf eine Vielfalt medialer Präsentationen und künstlerischer Gestaltungen, die immer wieder neu gedeutet und angeeignet werden müssen« (Assmann 1999, 51). Ohne an dieser Stelle eigens auf die Kritik am Assmann’schen Modell kollektiver Gedächtnisprozesse eingehen zu können, sei nur hervorgehoben, dass der von Jäckel erwähnte Streit über die Frage, welches Bild von der Vergangenheit der ›Wirklichkeit‹ am nächsten komme, innerhalb dieser schematisierten Gedächtnisformen und Ebenen der Erinnerung kaum thematisiert wird. An dieser Stelle soll noch eine weitere Position zur Frage des Umgangs mit der Vergangenheit des deutschen Genozids an den europäischen Juden angeführt werden. Im gleichen Jahr wie die Studie von Assmann/Frevert erschien auch Peter Novicks Untersuchung The Holocaust in American Life, dessen deutsche Ausgabe 2001 vorlag. Auch Novick greift auf Halbwachs zurück, bezeichnet das kollektive Gedächtnis allerdings als »ahistorisch oder gar antihistorisch« (Novick [1999] 2002, 14). Von
Hans-Joachim Hahn: »What a brainfuck.«
den Vereinfachungen des kollektiven Gedächtnisses unterscheidet er das »historische Bewußtsein«, das sich auf die »Geschichtlichkeit« der Ereignisse beziehe; etwas historisch zu verstehen, bedeute daher, »sich seiner Komplexität bewußt sein, über eine hinreichende Distanz zu verfügen, es aus mehreren Perspektiven zu sehen, die Mehrdeutigkeit (auch die moralische Mehrdeutigkeit) der Motive und Verhaltensweisen der Protagonisten zu akzeptieren« (Novick [1999] 2002, 14). Novicks Perspektive auf den Umgang mit dem Holocaust in den USA ist geprägt von seiner grundsätzlichen Skepsis gegenüber der Vorstellung, »Lehren aus dem Holocaust« (Novick [1999] 2002, 27) ziehen zu können. Dafür nennt er vor allem zwei Gründe. Gerade wegen des »extremen Charakters« des Holocaust führe eine »Konfrontation« etwa mit dem Verhalten der SS im Zweiten Weltkrieg kaum dazu, dass sich Besucher:innen der amerikanischen Holocaust-Museen als potentielle Täter sähen (Novick [1999] 2002, 27f.). Sein zweiter Grund scheint noch gewichtiger: Wenn der Holocaust zum Maßstab von Unterdrückung und Grausamkeit erklärt werde, würden »Verbrechen eines geringeren Ausmaßes trivialisiert«, was er am Beispiel der Debatte illustriert, ob im jugoslawischen Bürgerkrieg in Bosnien »ein echter Genozid« stattgefunden habe oder ob die Ereignisse »bloß grausam« gewesen seien (Novick [1999] 2002, 28). Die drei hier kursorisch angeführten Reflexionen zum Umgang mit Geschichte, die sich nicht nur hinsichtlich der Bewertung von kollektiven Gedächtnissen unterscheiden, sondern auch bezüglich der Frage, ob – und, falls überhaupt, welche – Lehren aus dem Holocaust gezogen werden können, verdeutlichen das gewaltige Konfliktpotential, das im Umgang mit Vergangenheiten steckt. Einerseits scheinen identitätspolitische Vereindeutigungen, zu denen kollektive Gedächtnisse neigen, kein »historisches Bewusstsein« im emphatischen Sinn von Novick zu ermöglichen. Andererseits scheint Novick gerade die Singularität des Holocaust ein Hindernis dafür, ihn als Maßstab für die Bewertung gegenwärtiger Grausamkeiten heranzuziehen, weil dadurch andere Verbrechen trivial erscheinen.
3. Falscher Gruß, falsche Trauer: Zwei Bücher Im Sommer 2021 erschienen zwei Bücher, die ungeachtet ihrer schon in formaler Hinsicht und mit Blick auf ihre Schreibweisen offensichtlich beträchtlichen Unterschiede, zum Vergleich einladen, denn beide reflektieren die Singularitätsdebatte und rekurrieren dabei auf den mehr als dreieinhalb Jahrzehnte zurückliegenden ›Historikerstreit‹. Beide Bücher haben zudem ein beträchtliches Presseecho erfahren, wobei die Stimmen beim einen, soweit ich sehe, durchweg positiv ausfielen, während beim anderen die kritischen überwiegen. Mit seinem Buch Tränen ohne Trauer treffe Per Leo »seltsamerweise den Zentralnerv der deutschen Bewusstseinslage im Sommer 2021«, befand Alexander Cammann in der ZEIT, ohne allerdings
369
370
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
zu verraten, warum das eigentlich so seltsam sei (Cammann 2021). Hingegen fragte sich der frühere ZEIT-Autor Thomas Assheuer in der taz, warum den Kritiker:innen »das Sittengemälde unserer Gegenwart« in Maxim Billers Der falsche Gruß so gefalle, sie sich aber scheuten, »den Provokationsgehalt des angeblichen Schlüsselromans offen auszusprechen?« (Assheuer 2021). Die Provokation besteht nach Ansicht des Kritikers in der Enthemmung, die der Protagonist von Billers Text im deutschen Kulturbetrieb auslöse, als ihm wider Erwarten mit seinem Doku-Roman über den jüdischen Sowjetfunktionär Naftali Frenkel (1883–1960) ein Bestseller gelinge. Billers Ich-Erzählung seziert die Ängste und antijüdischen Ressentiments des jungen deutschen Autors Erck Dessauer aus Leipzig, aus dessen Projektionen sich der Text zusammensetzt. Auch darin ist Assheuer zuzustimmen, dass alle im Text auftauchenden Personen »Komparsen im Kopfkino« des Erck Dessauer sind (Assheuer 2021), eines, wie zu ergänzen wäre, zudem unzuverlässigen Erzählers. Die in zwölf Abschnitte unterteilte Novelle setzt zu Beginn mit einer ungenauen Erinnerung des Ich-Erzählers ein, die zugleich das zentrale Ereignis benennt, um das der Text kreist und worauf der euphemistische Titel anspielt: »Es war eine Mischung aus Hitlergruß und dem verrutschten Armwedeln eines Betrunkenen, aber vielleicht war es auch einfach nur mein ungeschickter Versuch, den französischen Quenelle nachzumachen, das weiß ich nicht mehr genau.« (Biller 2021a, 9) Auf der letzten Seite des Buchs wird Dessauer die Szene, bei der er sich im Restaurant Trois Minutes in der Berliner Torstraße gegen den jüdischen Erfolgsautor Hans Ulrich Barsilay wendet, ganz anders erinnern; hier greift er nur noch nach dem Wasserglas des von ihm perhorreszierten imaginierten Widersachers, um es »gierig wie ein Verdurstender« (Biller 2021a, 121) zu leeren. Von Anfang an ist dieser vielleicht nur eingebildete Skandal Auslöser der aggressiven und antisemitischen Opferfantasien des Ich-Erzählers, der sich verfolgt glaubt, nur weil er »aus Versehen gegen eines der ungeschriebenen Gesetze der großen Umerziehung verstoßen« habe (Biller 2021a, 10). Geschickt stattet Biller seinen Protagonisten mit einer Reihe solcher ideologischen Phrasen der Neuen Rechten aus. Konstant unterscheidet er zwischen »uns« und »ihnen«, imaginiert sich sogar als »Nazi-Émigré« (Biller 2021a, 10), der wegen seines Verstoßes »für immer Deutschland« verlassen müsse. Vor dieser Folie, mit der Selbstwahrnehmungen neurechter Gegenwartsautor:innen, die sich in Texten als exiliert im eigenen Land stilisieren, aufgerufen sind,1 platziert Biller seine zentrale Pointe, die in den Reaktionen auf die Publikation von Dessauers Enthüllungsbuch Eine sibirische Karriere über den darin zum Organisator des Gulagsystems aufgebauten Frenkel liegt. Denn anders als für Ernst Nolte, der in seinem den Historikerstreit auslösenden FAZ-Artikel Gulag und Auschwitz gegeneinander aufrechnete – das ist der Vorwurf, den ihm Habermas machte – und durch die Debatte sein
1
Zu denken wäre etwa an die Buchreihe Exil der edition buchhaus loschwitz.
Hans-Joachim Hahn: »What a brainfuck.«
akademisches Renommee verlor, beginnt für Dessauer mit dem »endgültigen Beweis dafür, dass die schrille Weltbürgerkriegsthese des leider schon wieder halb vergessenen Ernst Nolte stimmte« (Biller 2021a, 87), den er angeblich mit seinem Buch liefert, seine Karriere als erfolgreicher Autor. Zugleich bleibt er weiterhin, trotz seines »Sieges über Barsilay« in Angst vor dessen möglicher »Rache« befangen, weil er ja »mitten in einem bekannten Berliner Prominenten-Restaurant wie ein abgedrehter Nazi-Exhibitionist öffentlich gegen die Gesetze des großen Holocaustkults verstoßen hatte« (Biller 2021a, 98). Gerade weil die Selbstwahrnehmung dieses weinerlichen Antisemiten so offenbar an den im Buch geschilderten Realitäten vorbeigeht – der Kulturbetrieb feiert ihn –, wirkt Billers Darstellung vielfach komisch. Als Porträt neurechter Befindlichkeit lässt sich der überaus anspielungsreiche Monolog als eine kluge Analyse deutscher Entlastungsfantasien lesen. Im Kontext des Debattensommers 2021 wird die Sache jedoch komplizierter. Ich komme dabei noch einmal auf Assheuers Besprechung zurück. Der Kritiker argumentiert, dass Biller die Literatur gegenüber der öffentlichen Meinung aufwerte, die hier, merkwürdig genug, fast wie in der Diktion der Neuen Rechten als »Kulturkampfbetrieb mit seinen Feuilletons« bezeichnet wird: Nur außerhalb diskursiver Machtspiele habe »der singuläre metaphysische Horror von Auschwitz noch einen Ort«, weshalb Biller »auch keine Geschichte aus der Gegenwart, sondern über die Gegenwart« verfasst habe. Bemerkenswert ist auch die Behauptung, Billers Roman begleite seinen Helden durch dessen Gedankenunterwelt und zeige, »was die Agenten im Kulturbetrieb unterschlagen, verdrängen oder durch Vergleich verleugnen« (Assheuer 2021). Assheuers Rhetorik bedient sich durchgängig einer hyperbolischen Darstellung, die das Grauen von Auschwitz nicht nur als singulär bezeichnet, sondern sogar mit Metaphysik verbindet; die Rede ist vom »undarstellbaren Schrecken« (Assheuer 2021), wobei Literatur der öffentlichen Debatte radikal gegenübergestellt wird. Mit der raunenden Zuschreibung an die »Agenten im Literaturbetrieb«, ausgerechnet »durch Vergleich« (!) zu verleugnen, erscheint Assheuers Analyse der Novelle doppelbödig: nicht nur als kluge Besprechung von Billers Roman, sondern zudem als parteiische Stimme in einer Debatte, die sich gar nicht auf Angriffe der neurechten Szene auf die Erinnerungskultur bezieht. Es lässt sich zeigen, dass der Kritiker bis in die Formulierung hinein einer Polemik Billers gegen die angeblich »neuen Relativierer« des Holocaust folgt, gemeint sind der Genozidforscher A. Dirk Moses, der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer und Michael Rothberg, worin Biller ebenfalls vom »metaphysischen Horror« spricht. Eingereiht finden sich die drei Genannten hier in einer Reihe mit Ernst Nolte und Joachim Fest, die versucht hätten, »das Gespenst Holocaust aus ihren schweren deutschen Träumen zu vertreiben« (Biller 2021b). Nach einer Beschimpfung ad personam folgt die rhetorische Frage, ob Moses & Co. »wirklich nur Gerechtigkeit für die millionenfachen Opfer des Kolonialirrsinns« wollten oder ob »sie einfach nur die neueste Generation linker Antisemiten« seien, »die mit Karl Marx den Boden
371
372
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
dieser Erde betreten haben« (Biller 2021b). Was im literarischen Text als interessante Konstruktion neurechter Gesinnung und deutscher Entlastungsfantasien glückt, erscheint in der Feuilleton-Intervention vor allem als wütende Beschimpfung, die die Diskursgegner nicht argumentativ zu widerlegen, sondern nur zu diffamieren sucht. An dieser Stelle will ich kontrastiv auf Per Leos Tränen ohne Trauer eingehen, das im Untertitel programmatisch »Nach der Erinnerungskultur« (Leo 2021) heißt. Sein Gegenstand ist die Reflexion eines Unbehagens an der etablierten deutschen Erinnerungskultur, die er – wie er es in einem Interview zum Buch ausführte – vor allem von Opferidentifikation und Täterdämonisierung geprägt sieht (Cordsen 2021). Wie Biller misstraut er den Errungenschaften dieser Erinnerungskultur und interessiert sich zugleich für das gegenwärtige Sprechen über den Nationalsozialismus und den Holocaust, dem er in Form eines Essays nachgeht. Im Unterschied allerdings zum Autor von Der falsche Gruß sieht Leo in der gegenwärtigen Kontroverse um die Singularität des Holocaust nicht einfach eine Neuauflage des ›Historikerstreits‹ von 1986, in dem gewissermaßen wiederum ein Versuch von Relativierern des deutschen Genozids an den europäischen Jüdinnen und Juden abgewendet werden müsse, wie es in Billers Intervention zu lesen ist. Vielmehr widmet Leo das erste seiner vier je etwa 50–80 Seiten umfassenden Kapitel unter dem erneut (wie bereits bei seiner Dissertation) auf Nietzsche verweisenden Titel »Der Wille zum Maß« dem Versuch, einen »Maßstab« zu finden, um »unser Verhältnis« (Leo 2021, 12) zur Vergangenheit beurteilen zu können. Es ist kein Zufall, dass Leo hier Nietzsche im Titel bemüht, denn die zweite seiner Unzeitgemäßen Betrachtungen: Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben bildet die Klammer seines Buches. Den Hinweis auf Nietzsches Text könnte Leo dabei von Jäckel übernommen haben, der in seinem Aufsatz Über den Umgang mit Vergangenheit kurz an Nietzsches »berühmte« Betrachtung erinnerte und den Gedanken aufgriff, nur soweit die Historie dem Leben diene, »wollen wir ihr dienen« (Jäckel [1988] 1989b, 125). Weil Nietzsche seine vom Historismus geprägte Zeit von einem »Übermaß an historischer Bildung« geprägt sah, die die Ereignisse der Vergangenheit in »ein Erkenntnisphänomen« hätte auflösen wollen, richtete sich seine Kritik gegen eine Form der Geschichtsschreibung, in der der lebendige Zusammenhang zwischen den Zeiten zerschnitten sei (Leo 2021, 13). Nietzsches Bezug auf die Kategorie des »Lebens« sei dabei zu Unrecht als eine Vorläuferkategorie des NS verdächtigt worden, obwohl es sich bei ihm »gut goetheanisch« um eine Kategorie des Wachstums gehandelt habe (ebd.). Leo übernimmt auch Nietzsches Form der Darstellung, die Letzterer als »Naturbeschreibung meiner Empfindung« (Nietzsche [1874] 1954, 210) charakterisierte (Leo 2021, 14). Zugleich lässt er keinen Zweifel daran, dass heute beim besten Willen nicht mehr »[v]on einem Übermaß an historischer Bildung« gesprochen werden könne, die Vergangenheit in Deutschland
Hans-Joachim Hahn: »What a brainfuck.«
gleichwohl jedoch »oft auf eine so hemmungslose Weise präsent« sei, dass sie, nach Ansicht des Autors, allmählich die »Entfaltung« des Landes hemme (Leo 2021, 13f.). Zu Leos Autorinszenierung und Selbstpositionierung gehört auch die selbstironische Rede von seinen drei Berufen, von denen er einzig den des Schatullenhändlers als seriös gelten lässt (»dem einzig seriösen unter meinen Berufen«; Leo 2021, 244), während er den des Historikers konjunktivisch in die Vergangenheit rückt (»[w]äre ich noch Historiker«; Leo 2021, 159), um den dritten schließlich, den des Schriftstellers, nur distanziert zu beanspruchen: »Aber ich habe mit der Schriftstellerei ja nicht umsonst einen Beruf ergriffen, der zumindest in Deutschland die Lizenz zur nationalen Kathederrede enthält.« (Leo 2021, 159) Vor dem Hintergrund der hier knapp über den Rekurs auf Nietzsche umrissenen Vorstellung, Deutschland und dem Leben seiner Bevölkerung sei nicht jede Form der Beschäftigung mit dessen Vergangenheit nützlich, empfindet Leo die »Erinnerungskultur« als öffentlichen Gebrauch von Geschichte mit einem »Unbehagen« und unterzieht sie daher einer kritischen Analyse, bei der es u.a. um eine gewisse Rehabilitierung der Geschichtswissenschaft geht; zumindest um eine Anerkennung ihrer Verdienste bei der historischen Analyse der nationalsozialistischen Verbrechen seit Mitte der 1980er Jahre. Ohne hier genauer auf Leos identitätsreflexiven Ansatz eingehen zu können, will ich kurz auf den zweiten Teil des einleitenden Kapitels, den furiosen, fast vierzigseitigen Abschnitt »1986 und wir« (Leo 2021, 19–57) verweisen. Zu Leos Annahmen gehört, dass die Frage bis heute ungeklärt sei, wie sich das von Habermas nicht nur 1986 vertretene »verfassungspatriotische« Zugehörigkeitsgefühl zur langen Geschichte der deutschen Nation verhalte (Leo 2021, 23). Habermas’ Forderung einer selbstkritischen Haltung zur deutschen Nationalgeschichte sei nach Ansicht von Leo nicht zu trennen gewesen »von der kategorischen Aussage, dass der Holocaust ein singuläres Verbrechen sei« (Leo 2021, 24). Daraus folgert Leo, »die Bindung der deutschen Identität an den Singularitätssatz« hätte zur Folge gehabt, »dass die absolute Bedeutung des Holocaust im gleichen Maße zu einem Politikum wurde, wie dessen komplexe Realität aus der politischen Öffentlichkeit verschwand« (Leo 2021, 24). Der Singularitätssatz könne in zweierlei Weise, als These oder als Dogma auftauchen. Thesen seien das Geschäft der Wissenschaft, zu deren Postulaten jedoch die Vorläufigkeit allen Wissens gehöre (vgl. Leo 2021, 39). Unter Rückgriff auf Mathias Brodkorbs Anthologie zum Historikerstreit (Brodkorb 2011) gelangt Leo zur Auffassung, dass die Frage nach der Singularität des Holocaust zuletzt zu einer Alternative führe, die sich nur mit den Mitteln der Philosophie, wenn nicht gar der Theologie, entscheiden lasse (Leo 2021, 44). Der Satz von der Singularität des Holocaust sei ein Satz wie jeder andere auch, was er bedeute, ob er gelte und wie er wirke, hänge von der Form ab, in der er auftrete, und dem Gebrauch, den man von ihm mache (Leo 2021, 52). Am Ende des einleitenden Kapitels zieht Leo das folgende Fazit:
373
374
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Die Ermordung der europäischen Juden war ein Verbrechen der Maßlosigkeit. Ein Denken, das es erfassen will, […], darf darum nicht selbst maßlos sein. Vielleicht sollten wir in diesem Sinne den Satz von der Singularität des Holocaust nicht in jeder Form, aber immer dann, wenn er ein Bekenntnis fordert, als zu extrem erachten. (Leo 2021, 57) Seine Argumentation stellt einen Versuch dar, die Verwerfungen in den gegenwärtigen vergangenheitspolitischen Debatten in Deutschland zu verstehen. Zu diesen Verwerfungen gehört eine weitreichende Polemik gegen postkoloniale Theorie sowie, wie Leo beobachtet, ein immer wieder gegenüber »israelkritische[n] Juden« erhobener Antisemitismusverdacht (Leo 2021, 183). Im dritten Teil seines dritten Kapitels, den er »Kurzschluss Naher Osten« nennt, charakterisiert er u.a. »die antideutsche Identifikation mit Israel« als »schlechte Antwort ohne Frage« (Leo 2021, 183), dabei ein David Grossman zugeschriebenes, unausgewiesenes Zitat abwandelnd, der Israel einmal als Antwort auf eine sehr gute Frage bezeichnet haben soll. Zugleich problematisiert Leo jedoch auch die postkoloniale Perspektive auf den Nahostkonflikt: Darin verwandle sich Israel vom zionistischen Staat einer Heimstatt für alle Jüdinnen und Juden in einen Staat des »Westens«, der seine Identität durch die Abgrenzung vom »kolonisierten Anderen« (Leo 2021, 173) herstelle. Obwohl Leo dieser Perspektive selbst wenig abzugewinnen scheint, hält er deren Verteufelung als »antisemitisch« gleichwohl für falsch: Da Juden sich mit dieser Theorie im einen Kontext als Opfer, im anderen als Täter rassistischer Gewalt begreifen lassen, und so eine begriffliche Identifizierung Israels mit dem Nationalsozialismus denkbar wird, sieht sich wiederum die postkoloniale Perspektive mit dem Vorwurf konfrontiert, antisemitisch zu sein. What a brainfuck. Wie schmutzig und ergebnislos diese Fragen in Deutschland diskutiert werden, ließ sich jüngst an der Debatte um den kamerunischen Politologen Achille Mbembe beobachten. (Leo 2021, 173) Die Anspielung bezieht sich auf die im Frühjahr 2020 von dem nordrhein-westfälischen FDP-Politiker Lorenz Deutsch mit einem offenen Brief entfachte Debatte um den in Südafrika lehrenden, international erfolgreichen und auch in Deutschland ausgezeichneten Intellektuellen Achille Mbembe. Die Kontroverse markiert fraglos eine Zäsur im erinnerungskulturellen Diskurs in Deutschland (vgl. Böckmann et al. 2022), bei der die ambivalenten Folgen des BDS-Beschlusses des Deutschen Bundestags vom 17. Mai 2019 zutage traten. Deutsch hatte Mbembe, der die Eröffnungsrede auf der später abgesagten – offiziell: wegen der Pandemie – Ruhr-Triennale halten sollte, sowohl eine antisemitische »Israelkritik« als auch Relativierung des Holocaust vorgeworfen. Die, ungeachtet einiger problematischer und sicher diskutierbarer Aussagen Mbembes, haltlosen Vorwürfe, die auf aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten beruhten (vgl. dazu diverse Beiträge in Böckmann et al. 2022),
Hans-Joachim Hahn: »What a brainfuck.«
fanden gleichwohl rasch Eingang in zentrale Leitmedien, verstärkt u.a. durch Felix Klein, der als Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus die Vorwürfe von Deutsch bekräftigte, offenbar ohne wirkliche Textkenntnis (vgl. Brumlik 2021, 44; Carp 2022, 30). Stefanie Carp, die geschasste Leiterin der Ruhr-Triennale, schreibt Klein zudem eine aktive Rolle bei der Verknüpfung der Vorwürfe mit einer angeblichen BDS-Nähe Mbembes zu (vgl. Carp 2022, 30). Erst vor diesem Hintergrund lässt sich Leos subjektiver und drastischer Kommentar nachvollziehen.
4. Nach der Erinnerungskultur Nachdem sich schließlich auch Jürgen Habermas zur Debatte um den vermeintlichen ›Historikerstreit 2.0‹ im Philosophie Magazin geäußert hatte (Habermas [2021] 2022), behauptete ein Kommentator in der NZZ noch einmal, die »zentrale Frage« des ersten ›Historikerstreits‹ sei gewesen, ob »man den Holocaust mit anderen historischen Tatsachen vergleichen« könne, um sichtlich überfordert anzufügen: »Und darf man es tun?« (Ribi 2021) Dass es darum nicht gegangen war, sondern um eine Relativierung (Aufrechnung) des Holocaust, während die Texte von Rothberg und anderen um dessen Universalisierung und Kontextualisierung kreisten, zeigt einer der instruktivsten Beiträge der ganzen Debatte, Gavriel Rosenfelds Blind Spots in the German ›Catechism‹-Debate (Rosenfeld 2021). In seiner historischen Analyse erinnert Rosenfeld auch daran, dass zahlreiche andere Kontroversen wie die Goldhagen-Debatte oder jene um Jörg Friedrichs Buch Der Brand im Jahr 2002 bereits als Neuauflagen des ›Historikerstreits‹ bezeichnet wurden. Rosenfeld hält es allerdings für zutreffender, die Katechismus-Debatte vor dem Hintergrund der internationalen Singularitätsdebatte zu diskutieren, die vor etwa drei Jahrzehnten entstanden sei und inzwischen mehrere Phasen durchlaufen habe. Die deutsche Katechismus-Debatte könne als eine weitere verstanden werden. Angesichts von Moses’ Angriff auf die Singularitätsthese sei es wichtig, daran zu erinnern, dass sie in den 1970er und 1980er Jahren zunächst von Forscher:innen in einer Art »defensive response« aufgegriffen wurde, um auf das etablierte, langjährige Herunterspielen der »Holocaust’s Jewish specificity« zu antworten (ebd.). Während dann die Debatte in den 1990er Jahren keine Einigung darüber erbrachte, ob ein Holocaustbewusstsein auch für die Anerkennung anderer Massenverbrechen hilfreich sei (einschlägig dazu Rosenbaum 1996), wurde ein solcher Konsens in den Nuller Jahren jedoch erzielt. Unter dem Einfluss der jugoslawischen Bürgerkriege und des »memory booms« seien Forscher:innen wie John Torpey, Alan Steinweis, Samantha Power, Michael Rothberg, Daniel Levy und Natan Sznaider zu zwei grundsätzlichen Einsichten gelangt: Einerseits hätten sie das Konzept der Singularität als begrifflich und politisch unzureichend abgelehnt, zugleich aber auch die Behauptung zurückgewiesen, dass ein Ho-
375
376
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
locaustbewusstsein die Aufmerksamkeit von anderen Genoziden abziehe. Verallgemeinert ließe sich für die zweite Phase festhalten, dass »a general scholarly consensus had been established endorsing the virtues of Holocaust consciousness« (ebd.). Moses wird von Rosenfeld als Teilnehmer dieser Debatten seit etwa der Jahrtausendwende identifiziert, der sich um 2010 herum von einem Vermittler und »peacemaker« zu einem Polemiker und Kritiker der Singularitätsthese gewandelt habe (ebd.). Dieser Kontext einer bereits Jahrzehnte andauernden, internationalen Kontroverse wurde in der deutschen Debatte weitgehend vernachlässigt. Dabei steht die Dialektik von Partikularismus und Universalismus der Holocausterinnerung, wie sie Omri Boehm als Problem der heutigen Außenpolitik Deutschlands dargestellt hat, auch im Zentrum der vergangenheitspolitischen Debatten und widerstreitenden Texte, die hier diskutiert wurden. Schon im Mai 2021 veröffentlichte Susan Neiman einen Beitrag für die ZEIT, den sie mit den folgenden Zeilen beschloss: »Verfangen in der Scham, Nachfahren der Nazis zu sein, fällt es manchen Deutschen leichter, universalistische Juden als Antisemiten zu beschimpfen, als sich klarzumachen, wie viele jüdische Positionen es gibt.« Sie fügt hinzu, dass Scham und Trauer über die Nazi-Eltern und -Großeltern der erste Schritt zur Aufarbeitung der Vergangenheit seien, um dann pointiert mit dem Appell zu enden: »Lasst es nicht den letzten sein.« (Neiman 2021) Per Leo resümiert, die »normative Kraft« sei erschöpft, die die deutsche Gesellschaft »lange aus der Abgrenzung vom Nationalsozialismus« hatte ziehen können (Leo 2021, 239). Was Leo für die Zeit »[n]ach der Erinnerungskultur« anbietet, ist ein kritischer Blick auf falsche Selbstgewissheiten, ein selbstgerechtes »deutsche[s] Gewissen«, das durch »Identifikation mit den Opfern des Holocaust« erlaube, »Herkunft und Fortdauer des eigenen Antisemitismus zu verdrängen« und auf jene Einwanderergruppen abzuwälzen, »denen die Mordserie des NSU« galt (Leo 2021, 239). Mit Novick, Jäckel und vielen anderen lässt sich ergänzen, dass all dies als Plädoyer für mehr historisches Bewusstsein verstanden werden kann, ein Geschichtsbewusstsein, das selbstreflexiv, transnational und universalistisch, gewissermaßen unbestechlich gegenüber den identitätspolitischen Ansprüchen von kollektiver Erinnerung, auf analytischer Distanz besteht.
Literatur Assheuer, Thomas. »Verlangen nach Entlastung. Debatte um Maxim Billers neuen Roman«. In: taz (11.09.2021). https://taz.de/Debatte-um-Maxim-Billers-neuenRoman/!5797037/ (25.10.2022). Assmann, Aleida. »Teil I«. In: Dies./Frevert, Ute. Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessenheit. Vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten nach 1945. Stuttgart 1999, 17–147.
Hans-Joachim Hahn: »What a brainfuck.«
Biller, Maxim. Der falsche Gruß. Köln 2021a. Biller, Maxim. »Holocaust-Verharmlosung. Die neuen Relativierer«. In: Die ZEIT (04.09.2021b). https://www.zeit.de/2021/36/holocaust-verharmlosung-leugnu ng-gleichsetzung-kolonialgeschichte-erklaerung (25.10.2022). Böckmann, Matthias et al. (Hg.). Jenseits von Mbembe. Geschichte, Erinnerung, Solidarität. Berlin 2022. Boehm, Omri. Radikaler Universalismus. Jenseits von Identität. Aus d. Engl. v. Michael Adrian. Berlin 2022. Boehm, Omri. »Die universalen Menschenrechte und die Fallen der Realpolitik. Dass der Internationale Strafgerichtshof Israel kritisiert, missfällt deutschen Außenpolitikern. Für diese Linie der Bundesregierung sollten die Erinnerungen an den Holocaust nicht herhalten«. In: Die ZEIT (12.08.2021), 46. Braese, Stephan. Die andere Erinnerung. Jüdische Autoren in der westdeutschen Nachkriegsliteratur. Berlin/Wien 2 2002 [2001]. Brodkorb, Mathias (Hg.). Singuläres Auschwitz? Ernst Nolte, Jürgen Habermas und 25 Jahre »Historikerstreit«. Banzkow 2011. Brumlik, Micha. Postkolonialer Antisemitismus? Achille Mbembe, die palästinensische BDS-Bewegung und andere Aufreger. Hamburg 2021. Cammann, Alexander. »Unter Erinnerungsweltmeistern. [Per Leos] Tränen ohne Trauer«. In: Die ZEIT (07.08.2021). https://www.zeit.de/2021/32/trauer-ohne-t raenen-per-leo-buch-erinnerungskultur-nationalsozialismus (25.10.2022). Carp, Stefanie. »Rassismus und deutscher Opportunismus. Wie Achille Mbembe für eine deutsche Provinzintrige missbraucht wurde«. In: Jenseits von Mbembe. Geschichte, Erinnerung, Solidarität. Hg. v. Böckmann et al. Berlin 2022, 25–44 Cordsen, Knud. »Zwischen Pathos und Nüchternheit.« Gespräch mit Per Leo. Bayrischer Rundfunk (06.08.2021). https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiow elt/per-leo-traenen-ohne-trauer-erinnerungskultur-100~_node-4c0beb4c-26 e7-4ccc-91cc-9a2177cdc5d7_-3b958557ab20343a312d037c84405afef8c772e3.html (29.03.2023) Habermas, Jürgen. »Statt eines Vorworts« [2021]. In: Ein Verbrechen ohne Namen. Anmerkungen zum Streit über den Holocaust. Hg. v. Saul Friedländer et al. München 2022, 7–13. [Urspr. unter dem Titel »Der neue Historikerstreit« im Philosophie Magazin (09.09.2021) veröffentlicht]. Habermas, Jürgen. »Nachspiel«. In: Ders. Eine Art Schadensabwicklung. Kleine Politische Schriften VI. Frankfurt a.M. 1987, 149–158. Jäckel, Eberhard. »Faktisches Prius und kausaler Nexus« [1986]. In: Ders. Umgang mit Vergangenheit. Beiträge zur Geschichte. Stuttgart 1989a, 69–76. Jäckel, Eberhard. »Über den Umgang mit Vergangenheit« [1988]. In: Ders. Umgang mit Vergangenheit. Beiträge zur Geschichte. Stuttgart 1989b, 118–130. Leo, Per. Tränen ohne Trauer. Nach der Erinnerungskultur. Stuttgart 2021.
377
378
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
Martini, Tania. »Debatte um die Gedenkkultur. Diffuse Erinnerung«. In: taz (05.03.2021). https://taz.de/Debatte-um-die-Gedenkkultur/!5751296/ (24.10. 2022). Moses, A. Dirk. »Katechismus der Deutschen«. In: Geschichte der Gegenwart (23.05.2021). https://geschichtedergegenwart.ch/der-katechismus-der-deutsc hen/ (25.10.2021). Neiman, Susan. »Ignoranz aus Scham«. In: Die ZEIT (27.05.2021), 55. Neiman, Susan/Wildt, Michael (Hg.). Historiker streiten. Gewalt und Holocaust – die Debatte. Berlin 2022. Nietzsche, Friedrich. »Unzeitgemäße Betrachtungen. Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben«. In: Ders. Werke in zwei Bden. Bd. 1. Hg. v. Karl Schlechta. München 1954, 209–285. Novick, Peter. Nach dem Holocaust. Der Umgang mit dem Massenmord. Aus d. Amerik. v. Irmela Arnsperger/Boike Rehbein. Stuttgart/München 2001. Ribi, Thomas. »Was nun also? Der Holocaust ist singulär. Aber so ganz eben doch nicht? Jürgen Habermas greift ein im Streit um die deutsche Erinnerungskultur«. In: NZZ (16.09.2021). https://www.nzz.ch/feuilleton/holocaust-geden ken-juergen-habermas-aeussert-eine-heikle-these-ld.1645598?fr=operanews (17.09.2021). Rosenbaum, Alan S. (Hg.). Is the Holocaust Unique? Perspectives on Comparative Genocide. With a Foreword by Israel W. Charny. Boulder, Col. 1996. Rosenfeld, Gavriel. »Blind Spots in the German ›Catechism‹-Debate«. In: The Journal of Holocaust Research (05.08.2021). https://journalofholocaustresearch.wordpres s.com/2021/08/05/blind-spots-in-the-german-catechism-debate-gavriel-rose nfeld/?fbclid=IwAR0PLXxx8Jx5GibxE1FXEEUlwga4jpwFFCxXwy4dMDR8SlT1 E3Lx3ecppYA#_edn10 (20.04.2023). Rothberg, Michael. Multidirektionale Erinnerung. Holocaustgedenken im Zeitalter der Dekolonisierung. Aus d. Engl. v. Max Henninger. Berlin 2021a [2009]. Rothberg, Michael. »Der neue Historikerstreit bedarf einer anderen Richtung«. In: Die ZEIT (24.07.2021b). https://www.zeit.de/kultur/2021-07/umgang-mit-dem -holocaust-historikerstreit-kontroverse-voelkermord (25.10.2022).
Autorinnen und Autoren
Jörn Ahrens, Dr. phil., Kulturwissenschaftler/Kultursoziologe, Professor für Kultursoziologie mit Schwerpunkt Transformation von Kulturen, Justus-Liebig-Universität Gießen & Extraordinary Professor of Social Anthropology, North-West University, Südafrika. Arbeitsschwerpunkte: Natur & Kultur (Klimawandelfolgen im südlichen Afrika); populäre Medien und Kulturen (Film, Comic); Gesellschaft, Angst, Gewalt; Kultur- und Sozialtheorie. Nicolas Berg, Dr. phil., Historiker und Kulturwissenschaftler, Leiter des Forschungsressorts »Wissen« am Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow, Universität Leipzig; Arbeitsschwerpunkte: Deutsche und deutsch-jüdische Geschichte und Geschichtsschreibung, Wissenschafts- und Wissensgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert; Exilforschung; Sprachkritik, Begriffsund Metapherngeschichte; Geschichte des Antisemitismus und des völkischen Nationalismus. Alfred Bodenheimer, Prof. Dr., Professor für Religionsgeschichte und Literatur des Judentums an der Universität Basel und Leiter des dortigen Zentrums für Jüdische Studien. Arbeitsschwerpunkte: Jüdische Religionsgeschichte mit Schwerpunkt Moderne, jüdische Narrative und Traditionsübermittlung, deutschsprachig-jüdische Literatur. Jörg Döring, Univ.-Prof. Dr. phil., Prof. für Neuere deutsche Philologie, Medienund Kulturwissenschaft an der Universität Siegen. Stellvertretender Sprecher des Sonderforschungsbereichs 1472 »Transformationen des Populären«. Arbeitsschwerpunkte: Literatur und ›Drittes Reich‹, Nachkriegsliteratur, Gegenwartsliteratur, Wissenschaft im westdeutschen Taschenbuch, Lesungsforschung. Birgit R. Erdle, Dr. phil., Privatdozentin am Institut für Philosophie-, Literatur-, Wissenschafts- und Technikgeschichte der TU Berlin. Arbeitsschwerpunkte: deutschsprachig-jüdische Literatur- und Ideengeschichte in der Moderne, Nach-
380
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
geschichte des Nationalsozialismus und der Shoah, Dynamiken zwischen Erinnerung, Materialität und Wissen, Epistemologie der Zeit in Literatur und Theorie, Bezüge zwischen poetischer und wissenschaftlicher Sprache im Exil. Hans-Joachim Hahn, Priv.-Doz., Dr. phil., Literaturwissenscha tler/Kulturhistoriker, Fellow am Zentrum für Jüdische Studien der Universität Basel sowie Privatdozent am Institut für Germanistische und Allgemeine Literaturwissenschaft der RWTH Aachen. Arbeitsschwerpunkte: Deutschsprachig-jüdische Literatur seit Aufklärung und Haskala, »Weltliteratur«, mediale Darstellungen des Holocaust, Comicforschung sowie Geschichte und Formen des Antisemitismus. Jakob Hessing, Germanist und Autor, Prof. em. für Deutsche Literatur an der Hebräischen Universität Jerusalem. Arbeitsschwerpunkte: Deutsch-jüdische Literatur vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, Jiddischer Humor. Carsten Jakobi, Dr. phil., Akademischer Direktor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Mitherausgeber der kritischen und kommentierten Anna Seghers Werkausgabe. Arbeitsschwerpunkte: Deutschsprachige Literatur des 18. bis 20. Jahrhunderts, insbesondere Exilliteratur 1933–1945, Komik und Komiktheorie. Hans Kruschwitz, Priv.-Doz., Dr. phil., Literaturwissenschaftler, Privatdozent am Institut für Germanistische und Allgemeine Literaturwissenschaft der RWTH Aachen. Arbeitsschwerpunkte: Europäisch-jüdische Literatur- und Kulturgeschichte; Sprach- und Bildreflexionen; das Politische (in) der Literatur; psychoanalytische Literaturwissenschaft; Gegenwartsliteratur. Primus-Heinz Kucher, Univ.-Prof. i. R., Literatur- und Kulturwissenschaftler, lehrte bis 2022 am Institut für Germanistik der Universität Klagenfurt. Gastprofessuren u.a. in Chicago, Udine, Ljubljana und Burlington sowie Leiter mehrerer FWF-Projekte. Arbeitsschwerpunkte: deutsche und österreichische Literatur im zentraleuropäischen Kontext mit Akzenten auf Exil und Immigration, Moderne und Avantgarde, Literarische Mehrsprachigkeit sowie Deutschsprachig-jüdische Literatur. Vivian Liska, Professorin für deutsche Literatur und Direktorin des Instituts für jüdische Studien an der Universität Antwerpen, Belgien sowie Distinguished Visiting Professor an der Hebrew University, Jerusalem. Arbeitsschwerpunkte: Deutsche Literatur der Moderne, Literatur und Philosophie, Literaturtheorie und vergleichende Literaturwissenschaft, Deutschsprachig-jüdische Denker und Autoren des 20. und 21. Jahrhunderts.
»Aggregate der Gegenwart«: Autorinnen und Autoren
Matthias N. Lorenz, Prof. Dr., Lehrstuhl für Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik an der Leibniz Universität Hannover, Extraordinary Professor an der Stellenbosch University (Südafrika). Arbeitsschwerpunkte: Literatur und Politik (u.a. Erinnerungskulturen, Antisemitismus- und Zensurforschung), Literarisches Leben, Gegenwartsliteratur, Popliteratur, Postmigrantische Literatur, Postkolonialismus und Intertextualität. Yashar Mohagheghi, Dr. phil., Literaturwissenschaftler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Germanistische und Allgemeine Literaturwissenschaft an der RWTH Aachen. Arbeitsschwerpunkte: Hölderlin, Kulturgeschichte des Festes, materielle Kulturen, europäischer Ästhetizismus, kleine Formen, Kultursoziologie des frühen 20. Jahrhunderts, Prosaroman des 15. und 16. Jahrhunderts. Jan Süselbeck, Associate Professor für deutschsprachige Kulturstudien an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens in Trondheim (NTNU). Arbeitsschwerpunkte: Emotionswissenschaft, Schreiben nach der Shoah und literarischer Antisemitismus. Nike Thurn, Dr. phil., Kultur-/Literaturwissenschaftlerin, Stabstelle Wissenschaftliches Programm im Präsidium des Deutschen Historischen Museums in Berlin. Arbeitsschwerpunkte: Literarischer Antisemitismus, Ausstellen von Antisemitismus, Passing und Performativität, Dokumentartheater und Reenactment. Caroline Torra-Mattenklott, Prof. Dr. phil., Literaturwissenschaftlerin, Professorin für Germanistische und Allgemeine Literaturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Wissensformen an der RWTH Aachen und Mitherausgeberin der Zeitschrift figurationen. gender – literatur – kultur. Arbeitsschwerpunkte: deutsche und französische Literatur, Poetik und Ästhetik des 18. bis 20. Jahrhunderts, Literatur und Wissen, Literatur und andere Künste, aktuell: Abstraktion und Konkretion als poetische und epistemische Verfahren; Reiseliteratur. Christine Waldschmidt, Dr. phil., wissenschaftliche Mitarbeiterin am D-A-CHHandbuchprojekt »Deutschsprachig-jüdische Literatur von der Aufklärung bis zur Gegenwart – Neue Forschungszugänge in Paradigmen« am Institut für Germanistische und Allgemeine Literaturwissenschaft der RWTH Aachen. Arbeitsschwerpunkte: Lyrik des 20. Jahrhunderts, Sprachkritik der Moderne, Literatur der Aufklärung, Erzählen in theoretischen Kontexten, Kulturgeschichte im 18. Jahrhundert sowie deutschsprachig-jüdische Literatur im 18. und 20. Jahrhundert. Daniel Weidner, Prof. Dr., Komparatist und Germanist, Professor für Komparatistik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Arbeitsschwerpunkte: Li-
381
382
Antisemitismus, Neue Rechte, Erinnerungspolitik und Solidarität
teratur und Religion, Geschichte und Theorie von Literaturwissenschaft und Philologie, Deutsch-jüdische Literatur. Liliane Weissberg, Christopher H. Browne Distinguished Professor in Arts and Science, University of Pennsylvania. Arbeitsschwerpunkte: Deutsche, französische und amerikanische Literatur und Kulturgeschichte des späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert, deutsch-jüdische Studien, Arbeit für und über Museen und Archive.
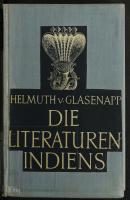


![Der entgrenzte Kosmos und der begrenzte Mensch: Beiträge zum Verhältnis von Kosmologie und Anthropologie [1 ed.]
9783788731960, 9783788729813, 9783788729806](https://dokumen.pub/img/200x200/der-entgrenzte-kosmos-und-der-begrenzte-mensch-beitrge-zum-verhltnis-von-kosmologie-und-anthropologie-1nbsped-9783788731960-9783788729813-9783788729806.jpg)

![Entgrenzte Stadt: Räumliche Fragmentierung und zeitliche Flexibilisierung in der Spätmoderne [1. Aufl.]
9783839411186](https://dokumen.pub/img/200x200/entgrenzte-stadt-rumliche-fragmentierung-und-zeitliche-flexibilisierung-in-der-sptmoderne-1-aufl-9783839411186.jpg)



