Wozu preußische Geschichte im 21. Jahrhundert? [1 ed.] 9783428538744, 9783428138746
Die preußische Geschichte braucht neue Programme und Ideen. Die Geschichtswissenschaft hat bisher den preußischen Staat,
136 94 295KB
German Pages 86 Year 2012
Polecaj historie
Citation preview
Wozu preußische Geschichte im 21. Jahrhundert?
Von Wolfgang Neugebauer
Duncker & Humblot · Berlin
WOLFGANG NEUGEBAUER Wozu preußische Geschichte im 21. Jahrhundert?
Lectiones Inaugurales Band 2
Wozu preußische Geschichte im 21. Jahrhundert?
Von Wolfgang Neugebauer
Duncker & Humblot · Berlin
Gedruckt mit Unterstützung der Alfred Freiherr von Oppenheim Stiftung zur Förderung der Wissenschaften
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten © 2012 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme: Klaus-Dieter Voigt, Berlin Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin Printed in Germany ISSN 2194-3257 ISBN 978-3-428-13874-6 (Print) ISBN 978-3-428-53874-4 (E-Book) ISBN 978-3-428-83874-5 (Print & E-Book) Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 ∞
○
Internet: http://www.duncker-humblot.de
Vorwort Am 7. Dezember 2011 wurde im Senatssaal der Humboldt-Universität zu Berlin, im Gebäude Unter den Linden Nr. 6, die Antrittsvorlesung der Alfred Freiherr von Oppenheim-Professur für die Geschichte Preußens gehalten. Der Vortragstext, der zu diesem Anlaß gekürzt werden mußte, kann an dieser Stelle vollständig publiziert werden – mit Belegen, die zeigen mögen, wie empirische Quellenforschung und programmatisches Bemühen aufeinander bezogen werden können. Diese grundsätzlichen Überlegungen sind Resultat langjähriger Beschäftigung mit unterschiedlichen Problemen, Epochen und Regionen der preußischen Geschichte. Es handelt sich gleichsam um den Versuch einer Abstraktion aus empirischer Forschung zum Zwecke praktischer Impulse für künftige Arbeit und – so ist zu hoffen – für folgende Historikergenerationen. Um den Bezug zu meinen bisherigen Studien deutlicher als durch gelegentliche Anmerkungen zum Text aufzuzeigen, ist mein Schriftenverzeichnis beigegeben worden. Dieses und der Vorlesungstext bilden eine Einheit. Wenn nunmehr die reale Aussicht besteht, daß Kolleginnen und Kollegen diesen programmatischen Impuls diskutieren, gewiß revidieren und vielleicht auch in mancher Hinsicht falsifizieren werden, wenn also preußische Geschichte zu einem modernen und wie-
der lebendigen Arbeitsgebiet historischer Forschung werden kann, so ist dies alles andere als selbstverständlich. Die Alfred Freiherr von Oppenheim-Stiftung hat die Grundlagen dafür gelegt, daß lange schon gehegte Überlegungen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Humboldt-Universität zu Berlin zum Erfolg geführt werden konnten; von den Beteiligten seien nur Christoph Markschies, Günter Stock und Michael Borgolte namentlich genannt. Die Einrichtung dieser Stiftungsund Akademieprofessur ermöglicht es auf wunderbare Weise, Archiv-Forschung und Universitäts-Lehre wieder zu verknüpfen. Die Alfred Freiherr von Oppenheim-Stiftung hat auch die Publikation meiner Antrittsvorlesung im Verlag Duncker & Humblot auf den Weg gebracht. Ihr und dem Verleger, Herrn Dr. Florian R. Simon, sei dafür herzlich gedankt. Berlin, im Frühjahr 2012 Wolfgang Neugebauer
Inhalt Wozu preußische Geschichte im 21. Jahrhundert? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Wissenschaftliche Veröffentlichungen von Wolfgang Neugebauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Zum Autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
Wozu preußische Geschichte im 21. Jahrhundert? Es mag auf den ersten Blick riskant erscheinen, just in dem Moment die Frage beantworten zu wollen, wozu preußische Geschichte im 21. Jahrhundert nützlich oder gar nötig ist, in dem das Wetterleuchten eines neuen Preußenjahres nicht mehr übersehen werden kann. Die Feuilletons haben in ersten Sammelrezensionen die frühen Produkte im Vorfeld des „Friedrich-Jahres“ abgearbeitet, die erste Vorwelle bunter kleiner Bücher zum großen König perlustriert, und Weiteres wird folgen, Sammelbände, auch Neuauflagen von Biographien der letzten Jahre, in denen der Forschungsstand des ehrwürdigen 19. Jahrhunderts von den Marketingstrategen unserer Tage zum gut geplanten und wohlorganisierten Medienerfolg geführt worden ist1. Kolloquien und ganze Tagungs1 Statt einzelner, in Kürze in jeder Hinsicht überholter Buchtitel sei verwiesen auf die hübsche, aber immer noch zu wohlwollende Sammelbesprechung von Andreas Kilb, Er schrieb sich sein Stellenprofil selbst. Erotische Diagnosen, Negativportraits, Quellensammlungen, transatlantische Vergleiche und Geschichten einer zerstörten Kindheit: Im Januar wird Friedrich der Große dreihundert Jahre alt, und die Verlage haben dazu bereits einiges aufgeboten, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 234 vom 8. Oktober 2011, L 33; zu den Aktivitäten von Belzig bis Neuruppin ders., Die Reußen waren die besseren Preußen. Noch ist nicht alles zu Friedrich dem Großen gesagt. Um
9
sequenzen werden veranstaltet und medial aufbereitet; oft genug beeindruckt einen nur die Kühnheit, mit der längst gesicherte Lehrbuchmeinungen als Neuentdekkung ausgegeben werden. Wenn es hoch kommt, so steht zu erwarten, werden hier und da in Sammelbänden einzelne Wissenslücken geschlossen werden, so zur Auslandssicht auf Friedrich II. – das freilich auch schon ein Standardthema historischer Arbeit seit rund einhundert Jahren2. Unterdessen berichten Fernsehseine Familien-, Städte- und Finanzpolitik bis hin zur Schussgeschwindigkeit geht es bei zwei Veranstaltungen in Potsdam, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 249 vom 26. Oktober 2011, N 4; und mit z. T. identischer Bildausstattung Klaus Wiegrefe, Der kleine König. Vor 300 Jahren wurde der populärste Herrscher der Deutschen geboren: Friedrich der Große. Das Leben des Hohenzollern ist reich an Mythen, Legenden und Widersprüchen. Doch wer war er wirklich: Dämon oder Wohltäter, Despot oder Aufklärer?, in: Der Spiegel Nr. 45 vom 7. November 2011, 72–83, mit erstaunlichen Exempeln für einen unkritischen Literaturgebrauch (76). 2 Z. B. schon Emmy Allard, Friedrich der Große in der Literatur Frankreichs. Mit einem Ausblick auf Italien und Spanien (Beiträge zur Geschichte der romanischen Sprachen und Literaturen, 7), Halle a. S. 1913, zu zeitgenössischen und postumen (S. 89) Reflexionen; Standardstudie: Stephan Skalweit, Frankreich und Friedrich der Große. Der Aufstieg Preußens in der öffentlichen Meinung des „ancien régime“ (Bonner Historische Forschungen, 1), Bonn 1952, bes. 40–65; Michel Kerautret, Zum Bild Friedrichs II. in Frankreich am Vorabend der Revolution, in: Fridericianische Miniaturen 2 (1991), 203–222, bes. zu den 1780er Jahren (204–210); Klassiker: Manfred Schlenke, England und das friderizianische Preußen 1740– 1763. Ein Beitrag zum Verhältnis von Politik und öffentlicher Meinung im England des 18. Jahrhunderts (Orbis Academicus), Freiburg/München 1963, bes. 93 ff.; Hans Portzek, Friedrich der Große und Hannover in ihrem gegenseitigen Urteil (Veröffentlichungen der Historischen 10
anstalten zur besten Sendezeit über die Restaurierung eines wurmstichigen Sofas Friedrichs aus Potsdamer Sammlungen, unwahrscheinlich schon deshalb, weil nach 1786 die persönliche Ausstattung Friedrichs aus Sanssouci in recht pietätloser Weise verschenkt worden ist3. Allerdings: Das Friedrich-Jahr beginnt ja erst; lassen wir uns also überraschen. Der eventheischende Verschleiß der preußischen Geschichte etwa in periodisch wiederkehrenden Jubiläumsjahren läßt da noch manches erwarten, aber es ist nicht ausgeschlossen, daß in kurzer Zeit die Lasten die Kosten überwiegen. Halbseidenes und Aufgewärmtes auf preußischem Arbeitsfelde ist Gift für die wissenschaftliche und außerwissenschaftliche Akzeptanz Preußens als Forschungsthema, vom Geld- und Kraftverbrauch ganz zu schweigen. Aber: Auf welcher Quellengrundlage beruhen eigentlich diese neuen Produktionen? Vor noch nicht allzu langer Zeit wurden Forschungsbefunde veröffentlicht, die jeden sorglosen und rein kompilatorischen Umgang mit den Quelleneditionen zum Friedrich-Thema und mit dem Kommission für Niedersachsen, 25), Hildesheim 1958, 9 ff., u. ö., freilich mit Schwerpunkt auf die diplomatische Welt. Kenntnislücken wären für den katholisch-reichischen Raum zu schließen, d. h. analoge Forschungen zu Österreich und zu Bayern wären erwünscht; zu Polen vgl. jetzt Agnieszka Pufelska, Der vergessene Kulturtransfer. Polen und Preußen in der Zeit der Aufklärung, in: Aufklärung und Kulturtransfer in Mittel- und Osteuropa, hrsg. v. ders./Iwan-Michelangelo D’Aprile (Aufklärung und Moderne, 19), o. O. (2009), 35–51, hier 37 ff., mit älterer Lit. 3 Dazu z. B. Gustav Berthold Volz, Das Sans, Souci Friedrichs des Großen, mit einem Anhang: Das Sanssouci von heute, Berlin/Leipzig 1926, 97; P. G. Hübner, Schloß Sanssouci, Berlin 1926, 24. 11
darauf beruhenden Schrifttum zu Epoche und Person dieses Monarchen schlechterdings verbieten. Denn auch die großen akademischen Werk- und Korrespondenzausgaben, die seit den 1840er Jahren und dann seit der Öffnung der Archive für wissenschaftliche Zwecke in Dutzenden von Bänden vorgelegt wurden und bis heute eine scheinbar sichere Basis für die Beschäftigung mit diesem Thema bieten, sind alles andere als das. Sie galten höheren Orts zum Zeitpunkt ihrer Entstehung als ein ausgesprochenes Politikum und wurden deshalb nicht nur unter streng wissenschaftlichen Kriterien zusammengestellt. Gleich anfangs, als seit den 1840er Jahren die Œuvres Friedrichs des Großen durch den Geschichtslehrer am medizinisch-chirurgischen Institut, Johann David Erdmann Preuß4 herausgegeben wurden, hat Friedrich Wilhelm IV. eigenhändig verfügt, daß gerade diejenigen „Documente, so kitzlicher Art“ seien, nicht ohne weiteres gedruckt werden dürften, sondern einer gründlichen Prüfung hinsichtlich ihrer „theilweise(n) oder ganze(n) Publicirung oder Nichtpublicirung“ unterzogen werden müßten5. Was davon alles betroffen 4 Zur Person mit weiterer Lit. Wolfgang Neugebauer, Preußen in der Historiographie. Epochen und Forschungsprobleme der preußischen Geschichte, in: Handbuch der preußischen Geschichte, Bd. 1, hrsg. v. dems., Berlin/New York (2009), 3–109, hier 20 f. 5 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (zit. GStA PK), I. HA, Rep 76 Vc, Sekt 1, Tit. XI, Teil VB, Nr. 2, Bd. 2, Marginal am Immediatbericht Wittgensteins, Maltzahns und Stolbergs vom 4. Dezember 1841, dort der Vermerk des Königs, ferner in Abschrift; vgl. Wolfgang Neugebauer, Friedrich der Große in der Sicht von Untertanen und Geschichtsschreibern, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 56 (2010), 135–156,
12
war, ist nicht mehr zu ermitteln, was alles unterdrückt wurde, ist unklar. Die Preußische Akademie der Wissenschaften protestierte denn auch mannhaft gegen solche – so wörtlich: – „Censur“. Und als kurz nach der Publikation in den 1840er und 1850er Jahren nachgeschaut wurde, wie zuverlässig der Druck denn ausgefallen sei, ergab die Recherche ein desaströses Resultat6, so daß doch davon abgeraten werden muß, diese Edition weiterhin – und wie ja bisher durchweg – als tragfähige Arbeitsbasis für alles, was Friedrich als Aufklärer und Literat betrifft, zu akzeptieren. Auch die große akademische Ausgabe der politischen Korrespondenz Friedrichs7 ist (zumindest anfangs) unter Beobachtung des Auswärtigen Amtes und nicht allein unter dem Gesichtspunkt umfassender Vollständigkeit, sondern eben mit politischer Rücksichtnahme erarbeitet worden, so daß alle Stücke, die „wegen Bedenklichkeit des Inhalts“ ausgeschieden wurden, im späten 19. Jahrhundert der Forschung gar nicht mehr vorgelegt werden durfhier 153 ff., „Censur“: 154; diese Befunde wurden vom Vf. vortragsweise in Potsdam am 24. Januar 2010 mitgeteilt. 6 Im Antiquariatshandel tauchten im Jahre 2006 mehrere Bände der „Œuvres de Frédéric le Grand“ auf, die zeitgenössisch nachkorrigiert worden sind. Sie weisen den Textbestand der ausgelieferten Buchhandelsausgabe auf und auf eingebundenen Blättern z. T. sehr umfangreiche Korrekturen und bisweilen mehrseitige Ergänzungen, die im Druck fehlen. Im Einband der (nicht ganz richtige) spätere Vermerk: „Manuskriptexemplar“. Einige dieser Bände im Besitz des Vf. 7 Politische Correspondenz Friedrich’s des Großen, (bisher:) 47 Bde., Berlin (usw.) 1879–2003; vgl. W. Neugebauer, Friedrich der Große (Anm. 5), 154 f. 13
ten8. Kurz: Alles, was wir zur Zeit zu Friedrich hören, lesen und sehen können und was so ganz auf die alten Quellendrucke und die vorhandene Literatur aufbaut, ignoriert in bedenklicher Weise den Umstand, daß die Quellenbasis ein fröhlich-eventbezogenes Kompilieren und Variieren doch gar nicht zuläßt. Geradezu Unsinn ist die bisweilen geäußerte Meinung, alles Wichtige sei ja wohl gedruckt. Nach alldem könnte gefragt werden: Lohnt sich dafür preußische Geschichte im 21. Jahrhundert? Und die erste Antwort ist klar: Neue Archivforschung, nicht Zusammenfassung ist geboten, und vor allem: Sie ist möglich. Denn: Die Masse an Originalquellen ist erhalten9. Um der Gefahr preußenhistorischer 8 GStA PK, I. HA, Rep 178, Tit. XIV, Nr. 7, Vol. 1, vor allem die eigenhändige Verfügung des Archivdirektors Heinrich von Sybel vom 22. Oktober 1880; das Stück ediert bei Wolfgang Neugebauer, Gustav Schmoller, Otto Hintze und die Arbeit an den Acta Borussica, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 48 (1997), 152– 202, hier 154 Anm. 9a; dieser Befund ist von um so größerer Relevanz, als ja in den Anfangsjahren dieses Unternehmens der „PC“ in rascher Folge schon rund zwei Dutzend Bände (ohne Herausgeberangabe, bearbeitet von Reinhold Koser und Albert Naudé) vorgelegt wurden; vgl. die Übersicht bei Klaus Müller (Bearb.), Absolutismus und Zeitalter der Französischen Revolution (1715–1815) (Quellenkunde zur deutschen Geschichte der Neuzeit von 1500 bis zur Gegenwart, 3), Darmstadt 1982, 100 f.; vgl. die wichtigen Mitteilungen bei Helga Fiechtner, Die Öffnung des Preußischen Geheimen Staatsarchivs für die wissenschaftliche Forschung im 19. Jahrhundert, Abschlußarbeit für die Staatsprüfung zum Diplomarchivar am Institut für Archivwissenschaft in Potsdam, (Potsdam) 1958 (masch.), 51. 9 Vgl. jetzt Jürgen Kloosterhuis (Hg.), Tektonik des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz, bearb.
14
Redundanz zu entgehen, ist ein Weg der: Forschung statt Collage. Und preußische Geschichte ist natürlich auch mehr als historische Friedrichkunde. Preußen war – mit Leopold von Rankes „Großen Mächten“ zu sprechen – einer der fünf europäischen Hauptfaktoren historischer Entwicklung, und noch im 20. Jahrhundert hatte Preußen fast so viele Einwohner wie Frankreich. Allgemeine Geschichte ohne Preußen ist nicht möglich. Die Quellenlage erlaubt zumal seit der Wiedervereinigung der in Deutschland befindlichen Archive einen neuen wissenschaftlichen Zugriff auf diesen historischen Gegenstand. Und dies ist um so nötiger, als die Phase aktiver Forschungen zur preußischen Geschichte im Vergleich mit anderen europäischen Historiographien nur sehr kurz gewesen ist. Die großen Historiker des Preußenthemas im 19. Jahrhundert, Leopold von Ranke und Johann Gustav Droysen, haben sich auch als amtliche Historiographen10 preuvon Rita Klauschenz, Sven Kriese, Mathis Leibetseder (Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, Arbeitsberichte, 12), Berlin 2011, 29 f. 10 Vgl. mit weiterer Lit. Wolfgang Neugebauer, Die preußischen Staatshistoriographen des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Das Thema „Preußen“ in Wissenschaft und Wissenschaftspolitik des 19. und 20. Jahrhunderts, hrsg. v. dems. (Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge, Beiheft 8), Berlin 2006, 17–60, hier 42–48; und mit weiterer Lit. ders., Preußen in der Historiographie (Anm. 3), 22–26. Zur Stellung Preußens in Rankes Konzeption Leopold von Ranke, Die großen Mächte, zuerst 1833, wieder in: ders., Abhandlungen und Versuche. Erste Sammlung, 2. Aufl., Leipzig 1877, 1–40, hier 20–29; Größenordnungen: Hans-Joachim Winkler, Die Weimarer Demokratie. Eine politische Ana15
ßischen Themen zugewandt, als die Archive für wissenschaftliche Zwecke noch nicht allgemein und auch für sie nicht frei zugänglich waren. Die editorische Erschließung der Überlieferung setzte in den 1860er Jahren zunächst für die brandenburg-preußische Politik des 17. Jahrhunderts ein, und zunächst war solche Grundlagenforschung nur unter sehr spezifischen Bedingungen überhaupt möglich, hier: unter den Bedingungen einer Koalition von liberaler Historiographie und Hof in den Jahren der Neuen Ära um 1860. Der Kronprinz und spätere Kaiser Friedrich III. hat denn auch lange Zeit das Protektorat über dieses Projekt wahrgenommen11. – Erst seit den 1870er Jahren wurden die preußischen Staatsarchive für die Forschung freier benutzbar12, und nun setzte jene rund vier Jahrlyse der Verfassung und der Wirklichkeit (Zur Politik und Zeitgeschichte, Heft 12/13), Berlin 1963, 36 f. 11 Vgl. dazu Wolfgang Neugebauer, „Großforschung“ und Teleologie. Johann Gustav Droysen und die editorischen Projekte seit den 1860er Jahren, in: Johann Gustav Droysen. Philosophie und Politik – Historie und Philologie, hrsg. v. Stefan Rebenich/Hans-Ulrich Wiemer, Frankfurt/New York 2012, 261–292; siehe auch Wolfgang Neugebauer, Wissenschaftsautonomie und universitäre Geschichtswissenschaft im Preußen des 19. Jahrhunderts, in: Die Berliner Universität im Kontext der deutschen Universitätslandschaft nach 1800, um 1860 und um 1910, hrsg. von Rüdiger vom Bruch, unter Mitarbeit von Elisabeth Müller-Luckner (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien, 76), München 2010, 129–148, hier 145 f. 12 Vgl. zu den Details R. Haym, Das Leben Max Dunckers, Berlin 1891, 423 f.; Heinrich von Treitschke, Max Duncker, in: ders., Historische und politische Aufsätze, 4. Bd., Leipzig 1897, 401–423, hier 416; Wilfried Nippel, Johann Gustav Droysen. Ein Leben zwischen Wissenschaft und Politik (München 2008), 280; Jürgen Kloosterhuis, Edition – Integration – Legitimation. Politische Im16
zehnte währende Phase intensiver preußischer Forschungen ein, in der – sieht man genauer hin – bis zum heutigen Tage die eigentlichen Grundlagen jeder wissenschaftlichen Befassung mit diesem Themenfeld gelegt worden sind. Pars pro toto ist nur das Akademieprojekt der Acta Borussica zu erwähnen, durch das die preußischen Staatsstrukturen, die Staatswirtschaft und wichtige Bereiche der Staatsfinanzen Preußens vor allem im 18. Jahrhundert in Quelleneditionen und monographischen Studien bearbeitet worden sind13. Der Anstoß dazu ging nicht von einem Geplikationen der archivischen Entwicklung in Preußen, 1803 bis 1924, in: Das Thema „Preußen“, hrsg. v. W. Neugebauer (Anm. 10), 83–113, hier 95 f., 104; weitere Öffnung des Archivs unter der Leitung Sybels: z. B. Johanna Weiser, Geschichte der preußischen Archivverwaltung und ihrer Leiter. Von den Anfängen unter Staatskanzler Hardenberg bis zur Auflösung im Jahre 1945 (Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, Beiheft 7), Köln/Weimar/Wien 2000, 65 f., und H. Fiechtner, Die Öffnung (Anm. 8), 46. 13 Mit Quellen und weiterer Lit. Wolfgang Neugebauer, Zum schwierigen Verhältnis von Geschichts-, Staats- und Wirtschaftswissenschaften am Beispiel der Acta Borussica, in: Die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften zu Berlin im Kaiserreich, hrsg. v. Jürgen Kocka (Interdisziplinäre Arbeitsgruppen. Forschungsberichte, hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, 7), Berlin (1999), 235–275; Wolfgang Neugebauer, Die „Schmoller-Connection“. Acta Borussica, wissenschaftlicher Großbetrieb im Kaiserreich und das Beziehungsgeflecht Gustav Schmollers, in: Archivarbeit für Preußen. Symposion der Preußischen Historischen Kommission und des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz aus Anlaß der 400. Wiederkehr seiner archivischen Tradition, hrsg. v. Jürgen Kloosterhuis (Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, Arbeitsberichte, 2), Berlin 2000, 261–301. 17
schichtswissenschaftler, sondern von einem historisch arbeitenden Staats- (und Sozial-)Wissenschaftler aus, von Gustav Schmoller, der – was oft beschrieben worden ist – mit der These vom sozialen Beruf der Hohenzollern die Forderung einer aktiven Sozialpolitik in der Gegenwart verband. Schmoller, der dann Talente wie den jungen Historiker Otto Hintze14 entdeckte, hat also frühe Staats-Struktur- und Wirtschaftsgeschichte in den Mittelpunkt seines Werkes gestellt, Bereiche, die schon im späten 19. Jahrhundert längst die ältere Politik- und Kriegsgeschichte Preußens verdrängt hatten15. Die Kooperation von Universitätsfunktion und Akademieprojekt erwies sich in den Jahrzehnten um 1900 für die preußischen Quellenforschungen als konstitutiv, und dem Machtmenschen Schmoller, von sozialer Herkunft ein ehrbarer Schwabe, gelang es, um die Acta Borussica herum ein gut getarntes Imperium von Publikationsreihen, Kommissionen und auch von Finanzkonstruktionen zu errichten, dem seine ihn mißtrauisch beobachtenden traditionelleren Historikerkollegen nichts auch nur entfernt Vergleichbares entgegenzusetzen vermoch-
14 Mit der älteren Lit. Wolfgang Neugebauer, Otto Hintze (1861–1940), in: Das Kaiserreich. Portrait einer Epoche in Biographien, hrsg. v. Michael Fröhlich, Darmstadt (2001), 286–298. 15 Vgl. zur Entwicklung strukturgeschichtlicher Ansätze der preußischen Forschungen vor und bis Schmoller: Wolfgang Neugebauer, Die Anfänge strukturgeschichtlicher Erforschung der preußischen Historie, in: Agrarische Verfassung und politische Struktur. Studien zur Gesellschaftsgeschichte Preußens 1700–1918, hrsg. v. dems./ Ralf Pröve (Innovationen, 7), (Berlin 1998), 383–429.
18
ten16. Ein Monopol auf preußischem Arbeitsfelde, wie er es wohl gerne gesehen hätte, ließ freilich das preußische Kultusministerium denn doch nicht zu. Ein Friedrich Althoff protegierte durchaus auch Schulen, die preußenkritischer waren als das, was in der Hauptstadt üblich war, nicht in Berlin, wohl aber in Breslau und in Göttingen, wohin solche preußischen Professoren retirierten, die Bücher über Friedrich den Großen als Kriegstreiber publizierten17 und damals publizieren konnten! Diese Phase preußenhistoriographischer Produktivität, gekennzeichnet durch einen gern übersehenen Pluralismus in der Spannbreite des seinerzeitigen Verfassungskonsenses, endete mit dem Ersten Weltkrieg. Danach war kaum mehr als ein wissenschaftlicher Notbetrieb möglich, und dies in den Jahren nach 1918/19 nur dadurch, daß ein Max Planck Otto Hintze in dem verzweifelten Bemühen kräftig unterstützte, die Traditionen der preußischen Forschungen, gerichtet – ich zitiere Hintze 1922 – gegen „Illusionen und Parteilegenden“18, nicht völlig zusammen16 Mit weiteren Angaben W. Neugebauer, SchmollerConnection (Anm. 13), 281–300. 17 Vgl. W. Neugebauer, Preußen in der Historiographie (Anm. 4), 53–60 (u. a. Max Lehmann). 18 Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Hist. Abt. II–VII, 214, mit den Stücken Plancks und Hintzes von 1922; ausgewertet bei Wolfgang Neugebauer, Das Ende der alten Acta Borussica, in: Wissenschaftsfördernde Institutionen im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Beiträge der gemeinsamen Tagung des Lehrstuhls für Wissenschaftsgeschichte an der HumboldtUniversität zu Berlin und des Archivs zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, 18.–20. Februar 1999, hrsg. v.
19
brechen zu lassen. In den Zeiten der Hyperinflation gelang das nur, weil mit dem Bankhaus Mendelssohn & Co., Adresse Jägerstraße 49/51, ein Mäzen hinzutrat mit Mitteln, die in Dollar-Schatzanweisungen abgesichert waren19. Gut zehn Jahre danach brach die Zeit der zweiten historiographischen Katastrophe für preußische Studien an, denn den Nationalsozialisten genügte für die propagandistische Verwertung des Preußenthemas durchaus der Kenntnisstand des früheren 19. Jahrhunderts20; für Forschungen, gar für Archivforschungen zur preußischen Geschichte gab es damals wenig Bedarf. So kamen die preußischen Akademieeditionen in den späten 1930er Jahren zum Erliegen, jene Großprojekte also, die in den Jahrzehnten zuvor das Rückgrat dieses Forschungsfeldes dargestellt hatten mit einer Fülle darauf bezogener Monographien und Spe-
Rüdiger vom Bruch/Eckart Henning (Dahlemer Archivgespräche 5/1999), Berlin 1999, 40–56, hier 47 f.; vgl. ergänzend den Anm. 19 zitierten Beitrag. 19 Wiederum nach den Akten des Akademiearchivs der BBAW Wolfgang Neugebauer, Zur preußischen Geschichtswissenschaft zwischen den Weltkriegen am Beispiel der Acta Borussica, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 50 (1999), 169–196, hier 176. 20 Konrad Barthel, Friedrich der Große in Hitlers Geschichtsbild (Frankfurter Historische Vorträge, Heft 5), Wiesbaden 1977, 7 f.; vgl. Helmut Heiber, Walter Frank und sein Reichsinstitut für Geschichte des neuen Deutschlands (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, 13), Stuttgart 1966, 518; zur Quellenfeindlichkeit der nationalsozialistischen Geschichtspolitik vgl. grundsätzlich Hagen Schulze, Walter Frank, in: Deutsche Historiker, 7, hrsg. v. Hans-Ulrich Wehler, Göttingen 1980, 69–81, hier 71 („Schluß mit den Aktenpublikationen“). 20
zialstudien. Gewiß: Immer hatte es auch die bedeutende Einzelleistung gegeben; noch wurde dem Wissenschaftsindividuum nicht die Arbeitsluft durch Kollektivierung abgedrückt. Die Stein-Biographie eines Gerhard Ritter (1931) oder die Friedrich-Studie Arnold Berneys (1934) seien hier exemplarisch genannt21. Auch Carl Hinrichs gehört seit 1933 zu diesem Typus, wiewohl er seine grundlegenden Forschungen zur politischen Kommunikation in der Frühen Neuzeit am preußischen Beispiel in – wie sich heute zeigt – erschreckend engem Bündnis mit nationalsozialistischen Geschichtskonjunkturen erarbeitet hat22. Und doch: Dies waren wissenschaftliche Einzelfahrer. Ein Spezifikum Preußens ist das Abbrechen der staatlichen und damit der historiographischen Kontinuität, wo immer man die Zäsur setzen mag – 1932, 1934 oder 1947. Nicht primär archivalische Kriegsverluste, wohl aber die für dieses Thema besonders gravierenden Folgen des Zweiten Weltkriegs markieren jene Zäsur, von der dieses Forschungsfeld sich erst seit einiger Zeit zu regenerieren beginnt. Die Zerreißung der Archivlandschaften zwischen Ost und West, zwischen
21 Mit der speziellen Lit. und dem Nachweis der Titel: W. Neugebauer, Preußen in der Historiographie (Anm. 4), 66 f., 75. 22 Vgl. Wolfgang Neugebauer, Wissenschaft und politische Konjunktur bei Carl Hinrichs. Die früheren Jahre, in: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge 21 (2011), 141–190, bes. 178– 183.
21
Deutschland, Polen und der früheren Sowjetunion23 sowie die politischen (und finanziellen!) Restriktionen, die jedes längerfristigere Unternehmen bedroh23 Das Bundesinstitut für ostdeutsche Kultur und Geschichte hat Archivberichte früherer preußischer Archive nun in deutscher Sprache publiziert, z. B. Ros´cisław Z˙erelik/Andrzej Deren´ (Bearb.), Staatsarchiv Breslau – Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945 . . . Aus dem Polnischen übersetzt von Stefan Hartmann (Generaldirektion der Staatlichen Archive Polens. Schriften des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte, 9), München 1996, mit Verweis auf andere Archive (z. B. 319); in derselben Reihe: Radosław Gazin´ski/Paweł Gut/Maciej Szukała (Bearb.), Staatsarchiv Stettin – Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945 . . . Aus dem Polnischen übersetzt von Peter Oliver Loew (Generaldirektion der Staatlichen Archive Polens. Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 24), München 2004, zur Organisation nach 1945: 30 f.; dazu ferner Heiko Wartenberg (Bearb.), Archivführer zur Geschichte Pommerns bis 1945 (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 33), München 2008, zu den Beständen des Landesarchivs Greifswald, der Staatsarchive in Stettin, Köslin, Posen und Landsberg a. d. Warthe, ferner diverser kommunaler Archive, u. a. m.; und die Übertragung des (in dem Wydawnictwo Naubowe PWN, Warszawa/Łódz´ 1992 erschienenen) Bandes von Czesław Biernat (Bearb.), Staatsarchiv Danzig – Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945. Aus dem Polnischen übersetzt von Stephan Niedermeier (Generaldirektion der Staatlichen Archive Polens. Schriften des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte, 16), München 2000, zu den Resten der Güterarchive: 515–521; Ostpreußen: Krystyna Cybulska/Maria Tarnowska, Zaso´b Wojewo´dzkiego Archiwum Pan´stwowego w Olsztynie, Informator, Olsztyn 1982, zu Adelsgütern vgl. 53 ff.; nicht alle der in Allenstein befindlichen Bestände sind in diesem Buch nachgewiesen; ergänzend nützlich: Joachim Tauber/ Tobias Weger (Hrsg.), Archivführer zur Geschichte des Memelgebietes und die deutsch-litauischen Beziehun-
22
ten und belasteten, haben Forschungen auf preußischen Themenfeldern – wenn sie nicht gerade das Rheinland und Westfalen betrafen – enge Grenzen gesetzt. Hinzu kam im Westen eine gewisse Quellengen, bearb. von Christian Gahlbeck und Vacys Vaivada (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 27), München 2006, bes. 122–132, dieses Verzeichnis schließt Bestände in Wilna mit ein (19); neben der von Jürgen Kloosterhuis (Anm. 9) vorgelegten Tektonik des GStA PK ist zu vergleichen zu den jetzt in Berlin zu benutzenden ostpreußischen Beständen: Kurt Forstreuter, Das Preußische Staatsarchiv in Königsberg. Ein geschichtlicher Rückblick mit einer Übersicht über seine Bestände (Veröffentlichungen der Niedersächsischen Archivverwaltung, Heft 3), Göttingen 1955, 97–106; dazu K. Cybulska/M. Tarnowska, Zaso´b (s. o.), 21; vgl. die vorzügliche Abhandlung von Klaus Garber, Der alte deutsche Sprachraum des Ostens. Stand und Aufgaben der literatur-, buch- und bibliotheksgeschichtlichen Forschung am Beispiel des Kleinschrifttums, zuerst 1997, wieder in ders., Das alte Buch im alten Europa. Auf Spurensuche in den Schatzhäusern des alten Kontinents, München 2006, 679–748, hier 722, Anm. 85; Rainer Täubrich, Archive in Ostpreußen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg unter Einschluß des Memellandes und des Soldaugebietes (Bonn 1990), bes. 47 ff.; Lutz F. W. Wenau, Ostpreußische Archivalien in der litauischen Akademie-Bibliothek in Vilnius (Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen e.V. Quellen, Materialien und Sammlungen zur altpreußischen Familienforschung, 10), Hamburg 2004, zu Beständen in russischen Archiven: VII; aus dem reichen Aufkommen polnischer Archivhilfsmittel sei exemplarisch noch genannt: (M. Pestkowska/ H. Stebelska [Bearb.]) Katalog inwentarzy archiwalnych (Naczelna Dyreckja Archiwów Pan´stwowych), Warszawa 1971, Allenstein: 422–430; schließlich die von der HansBöckler-Stiftung vorgelegte Broschüre von Götz Aly/Susanne Heim, Das Zentrale Staatsarchiv in Moskau („Sonderarchiv“). Rekonstruktion und Bestandsverzeichnis verschollen geglaubten Schriftguts aus der NS-Zeit (Düsseldorf 1992), 20, 26, 44 f., u. ö. 23
phobie, im Osten die Reduktion auf bestimmte Themenbereiche oder besser: die Konzentration der Forschungsaktivitäten auf wissenschaftspolitisch vorgegebene Schwerpunktthemen24. Mit der Wiedervereinigung der Archive im Jahrzehnt nach 1989 stellt sich das Arbeitsfeld jetzt ganz anders dar als zuvor. Dies bietet die Basis für einen Neubeginn im 21. Jahrhundert. Den Quellenverlusten (etwa denen des früheren Heeresarchivs in Potsdam) stehen Aktenzugänge gegenüber, z. B. die für die europäische Dimension dieses Themas besonders wichtigen Bestände des früheren Staatsarchivs Königsberg, das wir heute hier in Berlin nutzen können und das uns davor bewahrt, preußische zur großbrandenburgischen Geschichte zu verengen. Dazu kommen große Bestände, die vor dem Zweiten Weltkrieg noch nicht der Forschung in Archiven zugänglich waren25. Die Einzelheiten können hier nicht betrachtet werden. 24 Zusammenfassend W. Neugebauer, Preußen in der Historiographie (Anm. 4), 99–106; Forschungsplanung: Bärbel Holtz, Das Thema Preußen in Wissenschaft und Wissenschaftspolitik der DDR, in: Das Thema „Preußen“, hrsg. v. W. Neugebauer (Anm. 10), 329–354, hier 344 f., Agrargeschichte: 350. 25 Vgl. soeben: Werner Heegewaldt/Harriet Harnisch (Bearb.), Übersicht über die Bestände des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, Teil I/1: (Adlige) Herrschafts-, Guts- und Familienarchive (Rep 37) (Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, 60), Berlin (2010), zu Kriegs- und Nachkriegsverlusten: in der Einleitung von Werner Heegewaldt XXXVII–XLIV; zu den Nachlässen im GStA PK (manche davon unter den Gefahren des Luftkrieges der frühen 1940er Jahre ins Archiv gegeben) exemplarisch J. Kloosterhuis, Tektonik des GStA PK (Anm. 9), 193–293.
24
Wichtig ist das geradezu strategische Faktum, daß die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften gleich bei ihrer Neukonstituierung in den frühen 1990er Jahren – ganz in der Linie ihrer Traditionen der Preußischen Akademie der Wissenschaften – das Arbeitsgebiet der preußischen Quellenforschungen und -editionen zu einem integralen Bestandteil ihrer geistes- und sozialwissenschaftlichen Aktivitäten gemacht hat. Was bisher schmerzlich fehlte, das war – wenn ich es so sagen darf – die Wiederherstellung der vor hundert Jahren produktiven Verbindung von Akademieforschung und Universitätsarbeit zum beiderseitigen Nutzen. Das heißt nun freilich nicht, daß es um die bloße Fortsetzung früherer Forschungsansätze geht, und das auch dann nicht, wenn die Erträge der Schmoller- und Hintzeschen Epoche anerkannt und gerade nicht in modischer Weise devaluiert werden. Schon die Wendung hin zu Themen der politischen Kulturgeschichte der Vormoderne – ich erwähnte schon Carl Hinrichs um 1940 – war zwar als (partieller) Bruch mit der älteren Staats-Strukturgeschichte gedacht worden26. Das Gemeinsame der älteren Forschung blieb aber die Fixierung auf den Staat, auch auf dynastische Zäsuren, schon weniger auf Dynastie in einem umfassenderen überpersonalen Sinne. Diese älteren Forschungserträge bleiben gewiß wichtig, aber ihre spezifische Perspektivierung der preußischen Geschichte birgt doch Probleme. Ein Beispiel: Die Acta Borussica, so modern sie um 1900 26
W. Neugebauer, Carl Hinrichs (Anm. 22), bes. 172–
178. 25
auch waren27, waren eben eine staatswissenschaftliche Edition, es war ganz wesentlich Staats-Strukturgeschichte, die im Mittelpunkt der Arbeit stand. Vielleicht ist aber das so erarbeitete Bild von Preußen schon dadurch überhaupt zu „staatlich“ geworden und auch zu monolithisch. Wir müssen konzeptionell zu neuen Ufern aufbrechen. Lassen Sie mich das exemplarisch illustrieren: Im Siebenjährigen Krieg, als es für Friedrich II. um alles ging, zeigte sich die erstaunliche Fragilität dieses scheinbar so fest gefügten „absolutistischen“ Staates. Nicht nur, daß die Staatsverwaltung um 1760 an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gekommen war und auffällige Zeichen der Desintegration erkennen ließ. Ganz im Westen, wo französische Truppen die zu Preußen gehörenden Gebiete am Niederrhein und in Westfalen okkupierten und, mehr noch, ganz im Osten zeigten sich die „Grenzen der Identifikation“28 des Untertanen mit dem Staat. Im östlichen „Preußen“, also demjenigen Land, an dem ja die Kronqualität des Gesamtstaates hing, wurde gleich bei Kriegsausbruch die scheinbar ganz verschwundene landstän27 Was übrigens schon damals zu Schüssen aus der Hinterbühne seitens konservativerer Schulhäupter führte, vgl. das Beispiel bei W. Neugebauer, Geschichts-, Staatsund Wirtschaftswissenschaften (Anm. 13), 271. 28 So für die westfälischen Gebiete Horst Carl, Okkupation und Regionalismus. Die preußischen Westprovinzen im Siebenjährigen Krieg (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Abt. Universalgeschichte, 150), Mainz 1993, Zitat: 368, wo darauf hingewiesen wird, daß die Konfessionszugehörigkeit entscheidender für die Loyalitätsbindungen war als die Staatszugehörigkeit.
26
dische Partizipationskultur wieder aktiv29, und als dann seit 1758 eine übrigens recht milde russische Besatzung30 dort das Heft übernahm, arbeiteten die ostpreußischen Landeseliten, Landadel und Städtedeputierte, mit den neuen Herrn erstaunlich gut zusammen. Dabei spielte nicht nur eine Rolle, daß die russische Okkupationsmacht das Gegenteil von verbrannter Erde intendierte. Im 18. Jahrhundert schien ein mildes Besatzungsregiment die beste Voraussetzung für einen späteren Anschluß. In Ostpreußen, wo 1758 ständische Wahlen unter dem Adel sowie den nichtadligen Landbesitzern stattgefunden hatten31, eine autonome Landespolitik also auf eine traditional breite Basis gestellt worden war, wurden nun Organe für eine Praxis geschaffen, die eine selbständige Außen-
29 Wolfgang Neugebauer, Zwischen Preußen und Rußland. Rußland, Ostpreußen und die Stände im Siebenjährigen Krieg, in: Zeitenwende? Preußen um 1800, hrsg. v. Eckhart Hellmuth/Immo Meenken/Michael Trauth (Festgabe für Günter Birtsch zum 70. Geburtstag), Stuttgart/ Bad Cannstatt 1999, 43–76, hier 50; diese Studie auf der Basis von Akten des Staatsarchivs Königsberg und solcher Bestände, die gerade im Ausland aufgetaucht waren und für das GStA PK erworben werden konnten, auch zum folgenden. 30 Vgl. z. B. Kurt Stavenhagen, Kant und Königsberg, Göttingen (1949), 15 f.; X(aver) von Hasenkamp, Ostpreußen unter dem Doppelaar. Historische Skizze der russischen Invasion in den Tagen des siebenjährigen Krieges. Fortsetzung, in: Der neuen Preußischen Provinzialblätter dritte Folge, 3 (1865), 478–508, z. B. 481 f., 497. 31 Vgl. W. Neugebauer, Zwischen Preußen und Rußland (Anm. 29), 52 f.; mögliche baltische Vorbilder: 75; vgl. die hellsichtigen Vermutungen bei Theodor Schieder, Friedrich der Große. Ein Königtum der Widersprüche, (Frankfurt a. M./Berlin/Wien 1983), 214 f.
27
politik dieses Landes in europäischen Kontexten ermöglichte. Alles weist darauf hin, daß ganz im Osten Preußens nicht die Bindung an den Berlin-Potsdamer „Absolutismus“, sondern die Erfahrung einer landesstaatlichen Autonomie unter lockerer russischer Oberhoheit die Loyalitäten strukturierte, eine Erfahrung, die ja die benachbarten livländischen Landesstaaten damals seit einem halben Jahrhundert schon gemacht hatten. Dort lebte der Landadel mit seiner alten ständischen Organisation und den vom Zaren bestätigten überlieferten älteren Landesprivilegien recht friktionslos – denn der Zar war weit. In der politischen Praxis des Siebenjährigen Krieges wurden die Netzwerke ostmitteleuropäischer Adelskulturen nun hoch relevant. Angehörige von Adelsfamilien aus dem russisch-baltischen Herrschaftsbereich wurden in der russischen Besatzungsadministration Ostpreußens an zentralen Stellen plaziert, und die ostpreußischen Stände entsandten in Preußen und jenseits der Staatsgrenzen gut vernetzte Adlige nach Rußland, damit sie dort die Interessen ihres Landes vertreten. Ein russischer Korff amtierte als Generalgouverneur in Königsberg, ein ostpreußischer Korff ging für die Stände als Landesdeputierter nach St. Petersburg ab32. So hielten sich im 18. Jahrhundert „Exzesse“ der Besatzer in Grenzen. Ebenso wirkten Netzwerke nach Kriegsende, auf daß den beteiligten Personen und Familien nach Restauration des absolutistischen Regimes aus der Richtung von Berlin und Potsdam nichts passierte. Friedrich II. ahnte wohl etwas, aber schwer32 Mit weiteren Nachweisen W. Neugebauer, Zwischen Preußen und Rußland (Anm. 29), 52 und 66.
28
lich wird er das alles gewußt haben. Dabei war im Kriege durchaus nicht entschieden, welche historischen Folgen die autonom agierenden Elitenetzwerke letztendlich haben würden. Immerhin ging es um den möglichen Verlust des Königslandes der brandenburgischen Hohenzollern mit unabsehbaren Folgen. Daß Familien innerhalb und außerhalb Preußens agierten, in Polen, in Kurland und auch am Königsberger Schloßteich saßen33, war lange Zeit Normalität. Die Freiherrn von Puttkamer, um ein Exempel zu geben, gut und alteingesessen in Pommern und dann auch in Schlesien, entsannen sich 1764, als die letzte polnische Königswahl anstand, „plötzlich der früheren (nur noch theilweise damals bestehenden) Beziehungen ihrer Familie zur Republik Pohlen“. Es wurde diskutiert, ob die weitverzweigte Familie einen gemeinsamen Wahldeputierten bestimmen und finanzieren sollte, bis dann einige von ihnen auf eigene Kosten nach Warschau gingen, dort auch, wie überliefert ist, unter „großem Aufwand . . . repräsentirte(n)“. Dieser Fall steht nicht einzig da34. Er zeigt, daß auch in ei33 Georg Conrad, Beiträge zur Biographie des Kaiserlich Russischen Geheimen Rats Heinrich Christian Reichsgrafen von Keyserling und seiner zweiten Gemahlin Charlotte Caroline Amalie geb. Reichs-Erb-Truchseß Gräfin zu Waldburg, verwitwete Gräfin von Keyserling, in: Altpreußische Monatsschrift 48 (1911), 77–114, 185–220, hier 93 f., 98, 101, 191, 196, u. ö. 34 L(udwig) Clericus (Red.), Geschichte des Geschlechts der Herren, Freiherrn und Grafen von Puttkamer. Herausgegeben von der Familien-Genossenschaft. Auf Grund der Sammlungen und Vorarbeiten der Freiherrn Constantin und Emil von Puttkamer, Berlin 1878/ 1880, 291 f.
29
ner solchen, zumal in militärischen Diensten dem preußischen Staat durchaus verbundenen Familie noch immer verschiedene Loyalitäten miteinander konkurrierten. Das war jahrhundertelang ein selbstverständlicher Teil der politischen Kultur in Preußen. Die mentale Landkarte war noch lange nicht von Staatsgrenzen allein bestimmt; immer wieder werden größere und ältere europäische Raumbezüge in der politischen Kultur Brandenburg-Preußens relevant. Im 17. Jahrhundert hat sogar der Große Kurfürst, wenn er in sein östlichstes Herzogtum reiste, nach Ausweis seiner Schneiderrechnungen gewöhnlich „einen polnischen Anzug“ getragen35. Selbst am Hofe blieben noch lange Spuren überstaatlicher Raumbeziehungen symbolisch lebendig. Es ist bekannt, daß in den Städten der preußischen Ostseeküste, von wo aus enge Beziehungen nicht nur nach West- und Nordeuropa unterhalten wurden, solche Kaufleute eine große Rolle spielten, die aus englischen und schottischen Familien stammten. Sinnlos sind da Fragen nach Staatszugehörigkeit und dominanten Loyalitäten. Die Quellen, noch die aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, berichten, dort und 35 (Adolf Friedrich) Riedel, Die Chatulleinrichtung des Großen Kurfürsten, in: Märkische Forschungen 2 (1841), 297–337, hier 301; derartige Signale ostmitteleuropäischer „mental maps“ finden sich auch noch sehr viel später am preußischen Hof: während der Anwesenheit des Königspaares in Königsberg 1798 wurde im Königsberger Schloß „durch Mädchen im National-Costüm der Polinnen“ serviert, mitgeteilt bei Sophie Marie Gräfin von Voß, Neunundsechzig Jahre am Preußischen Hofe. Aus den Erinnerungen der Oberhofmeisterin, 2. Aufl., Leipzig 1876, 226 f.
30
im preußischen Osten überhaupt seien die Menschen durchweg „englisch gesinnt“, und der kulturelle Transfer wurde sichtbar auch in den Kleidungsgewohnheiten36. Weniger schon ist bekannt, daß auch unter den Kaufleuten und Handwerkern der Hauptstadt Berlin noch im 18. Jahrhundert nicht der „Staat“ die mentale Landkarte bestimmte, sondern das Land, also etwa die Mittelmark37. Die intellektuell-mentale Landkarte der Preußen war auch zur Mitte des 19. Jahrhunderts nicht allein die eines Staates, sondern geprägt von älteren Regionen.
36 Karl-Heinz Ruffmann, Engländer und Schotten in den Seestädten Ost- und Westpreußens, in: Zeitschrift für Ostforschung 7 (1958), 17–39, bes. 27–38; englische Gesinnung: Aus den Papieren des Ministers und Burggrafen von Marienburg Theodor von Schön, Bd. 1, Halle a. S. 1875, 71 (1812); vgl. die Schilderung zur Stadt Memel bei Ludwig von Baczko, Reise durch einen Theil Preussens, 1. Bändchen, Hamburg und Altona 1800, 141: „. . . Memel dürfte wohl der theuerste Ort in Preußen seyn. Der Luxus ist beträchtlich, und die vielen Erzeugnisse fremder Länder, welche die Schiffer hier einbringen, dienen zu seiner Vermehrung. Ich glaube, daß es Leute in Memel gibt, die, von dem Hemde aus holländischer Leinwand angerechnet, hin zu den Stiefeln aus englischem Leder, kein preussisches Erzeugniß an ihrem Leibe haben und in Meubeln, Speisen und Getränken herrscht der nämliche Luxus.“ Ähnlich (nicht nur für Memel) C. F. W. Dieterici, Statistische Uebersicht der wichtigsten Gegenstände des Verkehrs und Verbrauchs im preußischen Staate . . ., Berlin/ Posen/Bromberg 1838, 9. 37 Vgl. mit Quellenbelegen Wolfgang Neugebauer, Zur Geschichte der preußischen Untertanen – besonders im 18. Jahrhundert, in: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge 13 (2003), 141– 161, hier 146 f., für die Zeit des Siebenjährigen Krieges auch zum folgenden.
31
Auch aus der Sicht preußischer Untertanen, zumal solcher, die nicht oder gerade eben an der Schriftkultur ihrer Zeit teilnehmen konnten, wurden Staat und Staatlichkeit erst sehr langsam, in einem Prozeß, in dem Kriegserfahrungen eine wesentliche politischpsychologische Rolle spielten, zu einem dominanten Bezugsrahmen, auch zum bestimmenden Faktor der „mental maps“ der „Untertanen“. Die Außensicht des Staates war freilich eine ganz andere, geprägt von Stärke, markanter Martialität und Geschlossenheit38. Um 1800 begann der Staat die Loyalitäten neu zu ordnen. Jetzt wurde es zum Problem, zum Problem der Höfe und der Ministerialinstanzen in Europa, wenn bis dahin preußische Grenzen in den Landschaften und in den Köpfen nur schwach markiert waren, ge38 Diese Sicht wird im Perspektivenwechsel einer Person deutlich, wenn der Deserteur Ulrich Bräker, solange er bei den preußischen Fahnen kämpft, von den Regimentern des Königs als Brandenburgern und Pommern, von „Preußen und Brandenburgern“ – also von Herkunftsregionen im landschaftlichen Sinne spricht; beim und nach dem Seitenwechsel sind es dann alles Preußen, das Preußische wird zur Fremd-Sicht, Ulrich Bräker, Lebensgeschichte und natürliche Abenteuer des armen Mannes im Tockenburg (benutzt in der Ausgabe:) Berlin bzw. Stuttgart 1985, erste Phase: 97, 113 (Soldaten als „Preußen und Brandenburger“), dann (2. Phase): 110, 116, 117 f.; vgl. dazu prinzipieller Jürgen Kloosterhuis, Donner, Blitz und Bräker. Der Soldatendienst des „armen Mannes im Tockenburg“ aus der Sicht des preußischen Militärsystems, in: Schreibsucht. Autobiographische Schriften des Pietisten Ulrich Bräker (1735–1798), hrsg. v. Alfred Messerli/Adolf Muschg, Göttingen 2004, 129–187, hier 140, 165–181; vgl. zur Feind-Sicht z. B. Colmar Grünhagen, Zwei Demagogen im Dienste Friedrichs des Großen. Nach handschriftlichen Quellen, Breslau 1861, 34 f.
32
sichert allenfalls durch zwei Dutzend Grenz-„Jäger“ im Westen der Mark Brandenburg und drei Dutzend von der Elbe ab an der mecklenburgischen Grenze39. 39 Listen der Feldjäger im Grenzdienst aus dem Jahre 1801 betreffend Altmark und Prignitz in der den Getreidehandel betreffenden Akte des Generaldirektoriums: GStA PK, II. HA, Gen.Dir., (Abt. 14), Kurmark, Materien, Tit. CCXXII, Nr. 16; vgl. auch Otto Hintze/(August) Skalweit, Die Wirtschaftspolitik Friedrichs des Großen. Vortrag in der militärischen Gesellschaft zu Berlin am 25. Oktober 1911 . . ., in: Beiheft zum Militär-Wochenblatt 1911 2. Heft, Berlin (1911), 381–398, hier 393: „Erst nach Einführung der Akziseregie (1766) ist es zur Bewachung der Grenzen durch sogenannte Zollbrigaden gekommen“. – Das Thema „Grenze“ im Sinne von Konstruktion, Wahrnehmung und Praktik gehört zu den Schwerpunkten der politischen Kulturgeschichte, die für die preußischen Regionen nur ganz unzureichend aufgegriffen worden sind; aus der produktiven Schule von Jan Peters die (freilich an einem eher untypischen Fall argumentierende) Studie von Christoph Motsch, Grenzgesellschaft und frühmoderner Staat. Die Starostei Draheim zwischen Hinterpommern, der Neumark und Großpolen (1575–1805) (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 164), Göttingen 2001, zum preußischen Fall mit guten Beobachtungen und weiterführender Literatur 3 ff.; aus der reichen allgemeinen Literatur vgl. etwa Hans Medick, Grenzziehungen und die Herstellung des politisch-sozialen Raumes. Zur Begriffsgeschichte und politischen Sozialgeschichte der Grenzen in der Frühen Neuzeit, in: Grenzland. Beiträge zur Geschichte der deutsch-deutschen Grenze. Herausgegeben vom Arbeitskreis Geschichte des Landes Niedersachsen, hg. von Bernd Weisbrod (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen, 38), Hannover 1993, 195–207, bes. 199 ff., 204 ff.; Étienne François/Jörg Seifarth/Bernhard Struck, Grenzen und Grenzräume. Erfahrungen und Konstruktionen, in: Die Grenze als Raum, Erfahrung und Konstruktion. Deutschland, Frankreich und Polen vom 17. bis zum 20. Jahrhundert, hg. von dens., Frankfurt/ New York 2007, 7–29, bes. 14 ff.; oder der Band: Gren-
33
Jetzt wurden Grenzen moderner, sie wurden gewissermaßen „schärfer“. Die Verflechtungen Preußens in die europäische Umgebung wurden in neuer Weise zum Problem. Die brandenburg-preußischen Monarchen hatten ja seit dem 17. Jahrhundert versucht, ihre Territorien aus den größeren europäischen Regionen, in denen sie lagen, gleichsam herauszuschneiden: ihre Gebiete im Westen, zumal am Niederrhein mit ihren traditionell engen Bindungen zu den Niederlanden, die mittelelbischen früheren Bistumslande Magdeburg und Halberstadt oder auch das westfälische Minden mit ihren alten und starken Verzahnungen im Heiligen Römischen Reich, schließlich die östlichen Regionen mit den Verbindungen nach Polen oder in die livländisch-baltischen Landschaften40. Aber erst um 1800 wurde es zum Problem, daß Adelsfamilien in Preußen und in Polen oder in Livland präsent waren, dort über Besitzungen verfügten – „gemischte Untertanen“ waren, unter verschiedenen, wie es heißt, „Souveränitäten“. So wurde 1797 in St. Petersburg zwischen Preußen und Rußland ver-
zen in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Aktuelle Forschungsprobleme, hg. von Hans Lemberg (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung, 10), Marburg 2000, darin: Einleitung, 1–6, bes. 3, und in dem Band die Beiträge von Peter Haslinger und Gert von Pistohlkors. 40 Vgl. näheres bei Wolfgang Neugebauer, Staatliche Einheit und politischer Regionalismus. Das Problem der Integration in der brandenburg-preußischen Geschichte bis zum Jahre 1740, in: Staatliche Vereinigung: Fördernde und hemmende Elemente in der deutschen Geschichte. Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in Hofgeismar vom 13.3.–15.3.1995, hrsg. v. Wilhelm Brauneder (Beihefte zu „Der Staat“, 12), Berlin (1998), 69 ff. 34
abredet, daß diese Familien gezwungen werden sollten, eine „Souveränität“ zu wählen und den Besitz jenseits der Grenzen zu verkaufen. Da freilich Rußland in der Praxis nichts unternahm, entschied man in Berlin 1801, gleichfalls an den Dingen nicht zu rühren41. Erst der Nationalismus des 19. Jahrhunderts sprengte die älteren Verflechtungen auf, in denen Preußen bis dahin gelebt hatte: Liberalen Beamten schien es schon in den 1820er Jahren ganz unerträglich, daß Adelsfamilien sich nicht für eine Nationalität entscheiden wollten, Familienverbindungen nach Polen pflegten, ja zwei Familiennamen, einen deutschen und einen slawischen führten42. Nach 1830 41 Korrespondenz zwischen Kabinetts- (d. h. Außen-) Ministerium und Generaldirektorium im Jahre 1801, GStA PK, II. HA, (Abt. 7), Ostpreußen, II. Materien Nr. 5813; dort auch ein Publikandum, datiert Berlin 17. Januar 1799, wegen der „vermischte(n) Unterthanen“ mit „Besitzungen in den verschiedenen Souveränitäten“ mit Folgen für die „Heyraths-Contracte“, Erbschaften u. a. m. Als 1801 festgestellt wurde, daß russischerseits im Falle der Keyserlingschen Besitzungen in Kurland nichts unternommen wurde, wurde in Preußen analog verfahren; zu den familiären Netzwerken, die den ostpreußischen Adel mit dem baltischen, etwa dem kurländischen verbanden, im Kontext insbesondere der „Kulturbeziehungen“ vgl. August Seraphim, Ostpreußisch-baltische Kulturbeziehungen im Zeitalter der Aufklärung, in: Aus vier Jahrhunderten. Gesammelte Aufsätze zur baltischen Geschichte, hrsg. v. dems./Ernst Seraphim, Reval 1913, 259–298, hier 261. 42 Jahresbericht des Oberpräsidenten Theodor von Schön, 20. Juni 1829, GStA PK, XX. HA, Rep 2, Oberpräsidium II, Nr. 1969; zitiert bei W. Neugebauer, Zwischen Preußen und Rußland (Anm. 29), 45 f.; zu den deutsch-polnischen Adelsfamilien(-Namen) vgl. die interessanten Ausführungen von George Adalbert von Mülverstedt, Geschichtliche Nachrichten von dem altpreußi-
35
begann der gesellschaftliche Verkehr zwischen deutschem und polnischem Adel im Osten abzunehmen, wurden von polnischen Familien nur noch Polen zu Bällen eingeladen43. Am Hof Wilhelms I., hier gerade gegenüber im Palais Unter den Linden, war freilich noch in den 1880er Jahren polnisch-katholischer (Magnaten-)Adel wohlgelitten. Aber dieser Hof des alten Wilhelm galt ja sowieso im Berlin dieser Epoche als hoffnungslos unmodern, und die Czapskis oder Radziwiłłs gerieten ihrerseits unter Verdacht seitens des polnischen Nationalismus44. Zur selben Zeit wurde es zum Staatsproblem, wenn die Landbevölkeschen Adelsgeschlecht von Ostau . . ., Magdeburg 1886, 58 ff. 43 Vgl. Peter Böhning, Die national-polnische Bewegung in Westpreußen 1815–1871 (Marburger Ostforschungen, 33), Marburg/Lahn 1973, 57. 44 Siehe Bogdan Graf von Hutten-Czapski, Sechzig Jahre Politik und Gesellschaft, 1. Bd., Berlin 1936, 38, vgl. auch 35, 46 f. (Radziwiłł), 48 (polnischer Adel zieht sich später aus dem preußischen Offizierskorps zurück); Hugo Freiherr von Reischach, Unter drei Kaisern, Berlin (1925), 75; und (anonym): Am Hofe des Kaisers, 2. Tausend, Berlin 1886, 26 f., 83–100 („Die Radziwiłł“); zu den traditionellen Beziehungen des preußischen Hofes zu Rußland vgl. jetzt den programmatischen Aufsatz von Frank-Lothar Kroll, Staatsräson oder Fürsteninteresse? Möglichkeiten und Grenzen dynastischer Netzwerkbildung zwischen Preußen und Rußland im 19. Jahrhundert, in: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge 20 (2010), 1–41, hier 3, 19 f. (Hoffeste), Entfremdung um 1848: 33, unter Alexander II. Wiederannäherung: 27 ff., 38: „hocharistokratische(s) Netzwerk“; das Folgende: z. B. Helmut Walser Smith, An Preußens Rändern oder: Die Welt, die dem Nationalismus verloren ging, in: Das Kaiserreich transnational. Deutschland in der Welt 1871–1914, hrsg. v. Sebastian Conrad/Jürgen Osterhammel, 2. Aufl. (Göttingen 2006), 149–169, hier 36
rung in Preußisch-Litauen und in Masuren, wiewohl seit Jahrhunderten amtliche Protestanten, immer wieder katholische Affinitäten zeigte und religiöse Praktiken die Grenzen transzendierten. Der Nationalismus aller Seiten machte preußisch-alteuropäischer Tradition ein Ende. Und Preußen sollte letztlich eben daran sterben. Solche Verflechtungsstrukturen und politische Kulturen hat die ältere, allzu staatszentrierte Forschung gerne ausgeblendet. Der Staat wurde damit stärker und moderner als er tatsächlich war, wo doch Staatsbildung vom preußischen Typ lange Zeit nur eine selektive war, konzentriert und reduziert auf machtrelevante Elemente von politischer Kultur, die des Militärsystems zumal45. Aber gerade eine solche Achsendrehung der Perspektiven macht Preußen anschlußfähig für moderne wissenschaftliche Fragestellungen. Wenn Preußen nie national-deutsch war, so lag dies nicht an den legendenhaft überhöhten Sondergruppen wie Hugenotten, Holländern usw. allein, die übrigens in der neuesten Forschung sehr viel nüchtern-realistischer betrachtet werden, in Distanz zu beliebten Legenden und Histörchen46. – Jenseits der selbstreferentiellen Preußen158 ff.; das Phänomen tritt schon in Quellen um 1800 entgegen. 45 Vgl. grundsätzlich Wolfgang Neugebauer, Zur Staatsbildung Brandenburg-Preußens. Thesen zu einem historischen Typus, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 49 (1998), 183–194. 46 Die süßliche Hugenotten-Legende der preußischen Geschichte wird – um ein Beispiel zu geben – seit einiger Zeit durch eine realistische Betrachtungsweise ersetzt, 37
geschichten vom type ancien hat dieser Ansatz viel beizutragen zu einem Forschungskomplex, der gerade das übernationale Phänomen Preußen im Lichte transnationaler Fragestellungen und transstaatlicher Verflechtungen zum Thema macht. Die seit einigen Jahren international geführte Debatte um „Transnationalität“47 hat ja längst die Epoche klassischer Nasiehe z. B. Silke Kamp, Die verspätete Kolonie. Hugenotten in Potsdam 1685–1809 (Quellen und Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, 42), Berlin 2011 (eine Berliner Dissertation von 2009, Gutachter: Étienne François und Wolfgang Neugebauer); vgl. jetzt ferner Ursula Fuhrich-Grubert, Minoritäten in Preußen: Die Hugenotten als Beispiel, in: Handbuch, hrsg. von W. Neugebauer (Anm. 4), 1125–1223; zum Kultur-Transfer der den Deutschen verwandten Niederländer im slawischen Raum die mit zeittypischen Tönen durchsetzte Monographie von (Otto Glaser), Die Niederländer in der brandenburg-preußischen Kulturarbeit, Berlin 1939, (5), 9, 21 („Freiheit des niederländischen Volkstums“), 36, 45 u. ö. Freilich entgeht auch die jüngere Minoritätenforschung am preußischen Fall nicht der Versuchung aktualitätspolitischer Dienstleistung und – bisweilen – der Instrumentalisierung. 47 Sehr gut: Andreas Rödder, Klios neue Kleider. Theoriedebatten um eine Kulturgeschichte der Politik in der Moderne, in: Historische Zeitschrift 283 (2006), 657–688, hier 660 mit etwas zu enger Definition („Unter transnationalen Beziehungen werden grenzüberschreitende Interaktionen verstanden, bei denen mindestens ein Interaktionspartner kein staatlicher Akteur ist“); dort zu begrifflichen Unschärfen des Ansatzes; Frank Hadler/Matthias Middell, Auf dem Weg zu einer transnationalen Geschichte Ostmitteleuropas, in: Comparativ 20 (2010), I/II, 18–29, hier 23; vgl. damit Dominic Sachsenmaier, Europäische Geschichte und Fragen des historischen Raumes, in: Die Vielfalt Europas. Identitäten und Räume. Beiträge einer internationalen Konferenz Leipzig, 6. bis 9. Juni 2007, hrsg. v. Winfried Eberhard/Christian Lübke, Leipzig 2009, 38
tionalstaatlichkeit im engeren zeitlichen und geographischen Sinne verlassen, sie hat auch die frühneu559–571, hier 563; Netzwerkanalysen: Jürgen Osterhammel, Transnationale Gesellschaftsgeschichte. Erweiterung oder Alternative?, in: Geschichte und Gesellschaft 27 (2001), 464–479, hier 474, 471: „Was bedeutet ,transnational‘? Der Begriff ist in der Geschichtswissenschaft noch kaum eingeführt.“ – Das hat sich seitdem tendenziell geändert; Sebastian Conrad/Jürgen Osterhammel, Einleitung, in: Das Kaiserreich transnational, hrsg. v. dens. (Anm. 44), 7–27, hier 14 f.; Susanne-Sophia Spiliotis, Das Konzept der Transterritorialität oder Wo findet Gesellschaft statt, in: Geschichte und Gesellschaft 27 (2001), 480–488, 485; und jüngst Melanie Hühn/Dörte Lerp/Knut Petzold/Miriam Stock (Hg.), Transkulturalität, Transnationalität, Transstaatlichkeit, Translokalität. Theoretische und empirische Begriffsbestimmungen (Region – Nation – Europa, 62), Münster 2010, darin die Einleitung von dens., In neuen Dimensionen denken? Einführende Überlegungen zu Transkulturalität, Transnationalität, Transstaatlichkeit und Translokalität, 11–46, hier 14, 16, auch innerhalb von Staaten: 22, ein Beitrag, der freilich die Gefahr des Umschlags einer produktiven Diskussion in begrifflich-theoretische Abundanzen aufzeigt; schwungvolle und zu Recht warnende Einwände: Hans-Ulrich Wehler, Transnationale Geschichte – der neue Königsweg historischer Forschung?, in: Transnationale Geschichte. Themen, Tendenzen und Theorien, hrsg. v. Gunilla Budde/Sebastian Conrad/Oliver Janz, 2. Aufl. (Göttingen 2010), 161– 174, hier 163, 167 und 171; zuletzt zur Herkunft des Konzepts: Rüdiger Graf/Kim Christian Priemel, Zeitgeschichte in der Welt der Sozialwissenschaften. Legitimität und Originalität einer Disziplin, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 59 (2011), 479–508, hier 491–494; und soeben als Kondensat in der Reihe „Grundkurs Neue Geschichte“: Margrit Pernau, Transnationale Geschichte, Göttingen (2011), bes. 36–67, freilich mit Beispielen überwiegend aus jüngeren Epochen. – Es sei an dieser Stelle nur erwähnt, daß das Thema weltgeschichtlicher „Verflechtungen“ schon im Lamprecht-Streit um 1900 und dann in der (Rezeption der) Soziologie in den 1920er 39
zeitliche Epoche erreicht und modifiziert entsprechend das kategoriale Instrumentarium48. Ein Jürgen Osterhammel hat seine Perspektive ja nie auf das europäische 19. Jahrhundert beschränkt49, und die Einsicht ist längst formuliert worden, „daß auch die Geschichtsschreibung multinationaler politischer Einheiten wie etwa der österreichisch-ungarischen Dop-
Jahren eine wichtige Rolle spielte, vgl. Max Scheler, Probleme einer Soziologie des Wissens, in: Versuche zu einer Soziologie des Wissens, hg. im Auftrage des Forschungsinstituts für Sozialwissenschaften in Köln von dems. (Schriften des Forschungsinstituts für Sozialwissenschaften in Köln, 2), München/Leipzig 1924, 5–146, hier 24 f., und dazu Otto Hintze, Max Schelers Ansichten über Geist und Gesellschaft, zuerst 1926, wieder in: ders., Soziologie und Geschichte. Gesammelte Abhandlungen zur Soziologie, Politik und Theorie der Geschichte, 2., erw. Aufl., hg. von Gerhard Oestreich, Göttingen (1964), 155–192, hier 170, und in diesem Bande ders., Über individualistische und kollektivistische Geschichtsauffassung, zuerst 1897, wieder a. a. O., 315–322, hier 321 f. 48 Unter Betonung der Prozeßhaftigkeit einer transnationalen (Gesellschafts-)Geschichte: Martin Krieger, „Transnationalität“ in vornationaler Zeit? Ein Plädoyer für eine erweiterte Gesellschaftsgeschichte der Frühen Neuzeit, in: Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), 125–136, hier 125 f. 49 Vgl. Jürgen Osterhammel, Imperien, in: Transnationale Geschichte, hrsg. v. G. Budde/S. Conrad/O. Janz (Anm. 47), 56–67, hier 56, 64; vgl. ders., Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, München (2009), 84–99, zur Frühneuzeit: 99 ff.; mit einem weit gefaßten Begriff von Globalisierung: Jürgen Osterhammel/Niels P. Petersson, Geschichte der Globalisierung. Dimensionen, Prozesse, Epochen, (München 2003), 36 ff. (Ralf Dahrendorf faßte den Begriff sehr viel enger). 40
pelmonarchie . . . ohne Berücksichtigung transnationaler Prozesse kaum denkbar“ ist50. Das gilt auch für die lange preußische Geschichte, und die soeben vorgestellten Exempel deuten in eben diese Richtung, zumal auf die spezifisch ostmitteleuropäische Verflechtungslage51, auf die unter beziehungsgeschichtlichem Aspekt Klaus Zernack in seinem Werk immer wieder aufmerksam gemacht hat52. 50 Sebastian Conrad, Doppelte Marginalisierung. Plädoyer für eine transnationale Perspektive auf die deutsche Geschichte, in: Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), 145–169, hier 147 f. 51 F. Hadler/M. Middell, Weg (Anm. 47), 25 f., 29 („strukturelle Vernetzungen und kulturelle Transfers“); Matthias Middell, Auf dem Weg zu einer transnationalen Geschichte Europas, in: Die Vielfalt, hrsg. v. W. Eberhard/G. Lübke (Anm. 47), 533–544, hier 543 („transnationale Geschichte . . . anschlußfähig etwa an Konzepte einer Ostmitteleuropaforschung“); Albert Wirz, Für eine transnationale Gesellschaftsgeschichte, in: Geschichte und Gesellschaft 22 (2001), 489–498, 490 f. mit einem Plädoyer dafür, gerade für „Ost- und Südosteuropa“ „die bislang einseitige Ausrichtung der Forschung am Nationalstaat“ zu überwinden. 52 Klassisch: Klaus Zernack, Preußen als Problem der osteuropäischen Geschichte, zuerst 1965, wieder in: ders., Preußen – Deutschland – Polen. Aufsätze zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen, hrsg. v. Wolfram Fischer/Michael G. Müller (Historische Forschungen, 44), Berlin (1991), 87–104, wo 90 die Aufgabe formuliert wird, „die osteuropäisch-slawenbaltenländischen Verzahnungen in ihrer Bedeutung für den Gesamtprozeß der preußischen Geschichte zu würdigen“; Rolle der Stände: 92 f., Brandenburg und Ostmitteleuropa: 95; vgl. ders., Osteuropa. Eine Einführung in seine Geschichte, München (1977), 33 ff.; umfassend ders., Polen in der Geschichte Preußens, in: Handbuch der Preußischen Geschichte, 2, hrsg. v. Otto Büsch, Berlin/New York 1992,
41
Und in der Tat spricht alles dafür, unter den vielfachen europahistorischen Verflechtungen der preußischen Historie Ostmitteleuropa besonders zu akzentuieren; die Hälfte des heutigen Polen hat vor 1918 zu Preußen gehört53, und vor 1806 hat für kurze Zeit sogar Warschau in einer preußischen Annexionsprovinz 377–448, bes. 413 f., und ergänzend aus dieser Schule Martin Schulze Wessel, Die Epochen der russisch-preußischen Beziehungen, in: Handbuch der Preußischen Geschichte, 3, hrsg. v. Wolfgang Neugebauer, Berlin/New York 2001, 713–787, in diplomatiegeschichtlich-mächtehistorischer Akzentuierung; programmatisch: Klaus Zernack, Das Jahrtausend deutsch-polnischer Beziehungsgeschichte als geschichtswissenschaftliches Problemfeld und Forschungsaufgabe, in: Grundfragen der geschichtlichen Beziehungen zwischen Deutschen, Polaben und Polen. Referate und Diskussionsbeiträge aus zwei wissenschaftlichen Tagungen, hrsg. v. dems./Wolfgang H. Fritze (Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, 18), Berlin 1976, 3–46, „Beziehungsgeschichte als ein Wirkungsfaktor sui generis“: 5, weiter 15 ff., 7: Hoetzsch und Halecki; Bezug auf Zernack: F. Hadler/M. Middell, Weg (Anm. 47), 18; zur „Raumkategorie“ Ostmitteleuropa vgl. Jürgen Kocka, Das östliche Mitteleuropa als Herausforderung für eine vergleichende Geschichte Europas, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 49 (2000), 159–174, hier 165, dabei „Altpreußen“: 166, und 172 f.: „Vergleichsweise breite Partizipation in den frühneuzeitlichen Adelsgesellschaften, eine besondere Form des Ständewesens und der damit verbundenen Freiheiten“. 53 So Richard Breyer, Preußen in der heutigen polnischen Historiographie, in: Zur Problematik ,Preußen und das Reich‘, hrsg. v. Oswald Hauser (Neue Forschungen zur Brandenburg-Preußischen Geschichte, 4), Köln/Wien 1984, 331–355, hier 334; zum Folgenden vgl. Leszek Belzyt, Sprachliche Minderheiten im preußischen Staat 1815–1914. Die preußische Sprachenstatistik in Bearbeitung und Kommentar (Quellen zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas, 3), Marburg 1998, bes. 18–21; und schon die kenntnisreichen Mitteilungen bei Kurt 42
gelegen. Preußen war nie nur ein deutsches „Land“, vielleicht ein halb deutsches, und eigentlich auch noch mehr. „Acht Sprachen“, so schon Friedrich Samuel Bock in seiner „Einleitung in den Staat von Preußen“ (1749), wurden „in den gesamten königlich preußischen Landen . . . geredet . . ., deutsch, holländisch, französisch, pohlnisch, lithauisch, wendisch, curisch und cassubisch“. Die preußischen Forschungen des 21. Jahrhunderts haben von der transnationalen „Kontakt- und Verflechtungsgeschichte“ Ostmitteleuropas54 und ihrer spezifisch polynationalen Gemengelage vielfach zu profitieren, ein Beispiel für übernationale historische Phänomene, die tief in unsere Historie hineinreichen. Forstreuter, Die Anfänge der Sprachstatistik in Preußen und ihre Ergebnisse zur Litauerfrage, zuerst 1953, wieder in ders., Wirkungen des Preußenlandes. Vierzig Beiträge (Studien zur Geschichte Preußens, 33), (Köln/Berlin 1981), 312–333, bes. 318–333; und die von mir aufgefundene Tabelle aus dem Jahre 1825/26 zum Regierungsbezirk Gumbinnen („Volkssprache“), mitgeteilt bei Wolfgang Scharfe/Wolfgang Neugebauer, Administrativ-statistischer Atlas vom preußischen Staate. Vorgeschichte, Entstehung und Umfeld des preußischen Nationalatlas von 1827/28, in: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge 1 (1991), 241–284, hier 274 f.; folgendes Zitat: Friedrich Samuel Bock, Einleitung in den Staat von Preußen, die er in besondern academischen Lehrstunden zum Grunde ausführlicher Erzählungen leget, Berlin 1749, 147. 54 Wichtig dazu Manfred Hildermeier, Osteuropa als Gegenstand vergleichender Geschichte, in: Transnationale Geschichte, hrsg. v. G. Budde/S. Conrad/O. Janz (Anm. 47), 117–136, hier 130 f., 122: zum Begriff Ostmitteleuropa („östlich der Elb-Saale-Linie“); Helmut Walser Smith, An Preußens Rändern (Anm. 44), 149–169, hier 159 f. (Preußisch-Litauen und Masuren). 43
Die lange Zeit (aus naheliegenden Gründen) perhorreszierte Kategorie des Raumes55 wird dann aber gerade für ein historisches Phänomen wie Preußen um so unverzichtbarer sein, als die Regionalität dieses eben nur scheinbar monolithisch-einheitsstaatlichen Gebildes in der jüngsten Forschung immer mehr als Ausgangspunkt genommen wird56. Christopher Clark hat ja gerade darauf hingewiesen, daß die Rolle der 55 In unserem Kontext: J. Osterhammel, Transnationale Gesellschaftsgeschichte (Anm. 47), 473, 475, 477; unter Bezugnahme auf die Frühe Neuzeit: S. Conrad, Marginalisierung (Anm. 50), 149, mit Kritik am Modernisierungsansatz in der Tradition Max Webers; Regionen und Transnationalität: D. Sachsenmaier, Europäische Geschichte (Anm. 47), 569 ff.; vgl. in methodischer Hinsicht Thomas Zitelmann, Translokalität, Bewegung und Einrichtung in Süd-Süd-Beziehungen, in: Jahresbericht der Geisteswissenschaftlichen Zentren Berlin 2003, (Berlin 2004), 36– 45, hier 38 zur „räumlichen Wende in den Sozial- und Kulturwissenschaften“; und prinzipiell wiederum Jürgen Osterhammel, Die Wiederkehr des Raumes: Geopolitik, Geohistorie und historische Geographie, in: Neue Politische Literatur 43 (1998), 374–397, bes. 374 f. („Raumtabu“), „Globalanalysen und Regionalstudien“: 386 ff.; vgl. ders., Die Verwandlung der Welt (Anm. 49), 168–175 („Raumordnungen: Macht und Raum“). 56 Dies eine der Grundlagen bei Wolfgang Neugebauer, Die Geschichte Preußens. Von den Anfängen bis 1947, 5. (7.) Aufl., München 2011, etwa 11 ff.; zur Frühen Neuzeit vgl. ders., Staatliche Einheit und politischer Regionalismus (Anm. 40), ein Vortrag vor der Vereinigung für Verfassungsgeschichte, der bei Exponenten einer etatistischtraditionelleren Sicht auf heftige Reaktionen stieß; mit der These einer um 1800 wieder zunehmenden Regionalität; Wolfgang Neugebauer, Der Adel in Preußen im 18. Jahrhundert, in: Der europäische Adel im Ancien Régime. Von der Krise der ständischen Monarchien bis zur Revolution (ca. 1600–1789), hrsg. v. Ronald G. Asch, Köln/Weimar/Wien 2001, 49–76.
44
Region und – damit zusammenhängend – die „Fragilität und Wandelbarkeit der Machtverhältnisse“ in der neueren Geschichtsschreibung zu Preußen zu einem zentralen Aspekt avanciert sind57. Und die historische Entwicklung ist alles andere als linear in Richtung stärkerer staatlicher Integration verlaufen; nach der Reformzeit und im Vormärz deutet alles auf eine wieder zunehmende Heterogenität58 hin, in politischer, im Zeitalter der großen Industrie ökonomischer und auch konfessioneller Beziehung. Diese „Hinwendung zum Lokalen, Regionalen“ ist Teil einer transnationalisierten Geschichtsforschung mit ihrem starken „Interesse an Identitäten, vor allem multiplen, sich überlappenden Identitäten“ (David Blackbourn)59. Was aber bedeutete das für die Preußen, die nie nur Untertanen waren? Mit der vorgeschlagenen Achsendrehung wird die historische Widerständigkeit und die Dynamik, die aus der spezifisch polyethnischen und europäisch-verflochtenen Regionalität Preußens resultierte, nicht allein auf isoliert-endogene Impulse der Entwicklung bezogen. Der billige Vorwurf eines neuen „Borussismus“ ginge hier gänzlich in die Irre. Wird nach „grenzüberschreitenden Beziehungen“60 (auch) im 57 Christopher Clark, Preußenbilder im Wandel, in: Historische Zeitschrift 293 (2011), 307–321, hier 320. 58 Worauf auch Monika Wienfort, Geschichte Preußens, (München 2008), 68 mit Recht hingewiesen hat. 59 David Blackbourn, Das Kaiserreich transnational. Eine Skizze, in: Das Kaiserreich transnational, hrsg. v. S. Conrad/J. Osterhammel (Anm. 44), 302–324, Zitate: 302 f. 60 S. Conrad/J. Osterhammel (Hg.), Einleitung (Anm. 47), 14.
45
preußischen Falle gefragt, ist nicht mehr primär von außenpolitischen Kontakten die Rede. Wenn in unseren Zusammenhängen unlängst dazu aufgefordert worden ist, „überregionale Beziehungen“ etwa im Fernhandel, in Waren- und Zahlungsströmen aufzusuchen und überhaupt die in letzter Zeit wohl etwas marginalisierte Wirtschaftsgeschichte zu reaktivieren, um „Raumbezüge menschlichen Handelns“61 zum Thema zu machen, so ist dies mit modernen Forschungsansätzen aus der preußischen Geschichte sehr gut zu verbinden, dies freilich in einem über die Wirtschaftsgeschichte weit hinausgehenden Verständnis. Gefragt wird auch nicht allein nach dem damit verzahnten kulturellen Transfer. Es geht ganz wesentlich um (nicht nur europäische! und nicht nur ökonomische) Markt-Verflechtungen Brandenburg-Preußens und seiner Regionen in einem umfassenden Verständ61 M. Middell, Auf dem Weg (Anm. 51), 542, dazu 539; dazu jetzt F. Hadler/M. Middell, Weg (Anm. 47), 25; S.-S. Spiliotis, Konzept (Anm. 47), 486; D. Sachsenmaier, Europäische Geschichte (Anm. 47), 567 ff.; vgl. D. Blackbourn, Kaiserreich (Anm. 59), 308, mit dem Ruf, „die zentrale Stellung der Wirtschaftsgeschichte wiederherzustellen“. Der Vf. hat anschlußfähige programmatische Vorschläge schon vor 20 Jahren formuliert: Wolfgang Neugebauer, Brandenburg-Preußische Geschichte nach der deutschen Einheit. Voraussetzungen und Aufgaben, zuerst 1992, zuletzt in: Die Historische Kommission in Berlin. Forschungen und Publikationen zur Geschichte von Berlin-Brandenburg und Brandenburg-Preußen, hrsg. v. Wolfgang Ribbe, Potsdam (2000), 19–53; vgl. ergänzend Manfred Kittel, Preußens Osten in der Zeitgeschichte. Mehr als nur eine landeshistorische Forschungslücke, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 50 (2002), 435–463, bes. 440–446 („Forschungsschwerpunkte und Forschungslükken“), ferner 455 ff., mit einigen sehr treffenden auch forschungspolitischen Beobachtungen (z. B. 454).
46
nis, wirkungsgeschichtlich orientiert auf Machtverhältnisse wie auf kulturelle Prozesse. Ein solcher Ansatz ist epochenübergreifend gültig. Bekanntlich hatte schon der „entstehende Weltmarkt“62 des 16. und 17. Jahrhunderts Auswirkungen auf das Verhältnis von Fürst und (zumal adligen) Eliten einerseits, auf die Stellung der untertänigen Bevölkerung andererseits. Konjunkturbedingte Prosperität spielte ganz unmittelbar in die territorialen Kräfteverhältnisse und mithin auch in das Verhältnis zum Monarchen hinein63. Und 62 So schon Richard van Dülmen, Formierung der europäischen Gesellschaft in der Frühen Neuzeit. Ein Versuch, in: Geschichte und Gesellschaft 7 (1981), 5–41, hier 9, 37 Anm. 83; Volker Press hat diese Zusammenhänge gesehen und in größerem Kontext formuliert: Formen des Ständewesens in den deutschen Territorialstaaten des 16. und 17. Jahrhunderts, in: Ständetum und Staatsbildung in Brandenburg-Preußen. Ergebnisse einer internationalen Fachtagung, hrsg. v. Peter Baumgart/Jürgen Schmädeke (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, 55), Berlin/New York 1983, 280–318, hier 300 f.; ders., Vom „Ständestaat“ zum Absolutismus. 50 Thesen zur Entwicklung des Ständewesens in Deutschland, in: ebd., 319– 326, hier 319, 323; beide auch zum Folgenden. 63 Francis L(udwig) Carsten, Die Entstehung Preußens, (dt. Ausgabe:) Köln/Berlin 1968, 98, 105, 122, 134–145; ders., Die Entstehung des Junkertums, in: Preußen. Epochen und Probleme seiner Geschichte, hrsg. v. Richard Dietrich, Berlin 1964, 57–76, 171–173, hier 69–73 mit Ausblick in die Entwicklung der Kräfteverhältnisse bis in das späte 17. Jahrhundert; vgl. Hans Rosenberg, Die Ausprägung der Junkerherrschaft in Brandenburg-Preußen, 1410–1618, in: ders., Machteliten und Wirtschaftskonjunkturen. Studien zur neueren deutschen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, 31), Göttingen 1978, 24–82, 298–308, bes. 58–68, 74 ff., mit guten überepochalen Beobachtungen; vgl. Klaus Zernack, Der Ostseehandel der Frühen Neuzeit
47
in der Tat: Diese Perspektive zeigt schon in der Frühen Neuzeit geradezu globale Faktoren auf, die nach Preußen hineinwirkten. Die Agrarkonjunktur im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts war jedenfalls auch dadurch beeinflußt, daß die exportierenden Regionen des Staates zunehmend in den „Welthandel hineingezogen“ wurden; der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, der ältere Handelsbeziehungen störte und beeinflußte, wirkte stimulierend nach Preußen hinein64. Um 1800 war aus (ost-)preußischer Perspektive „Nordamerika“ schlechterdings der „gefährliche Mit(be)werber im Getreidehandel“65. „Durch den nordund seine sozialen und politischen Wirkungen, in: Schichtung und Entwicklung der Gesellschaft in Polen und Deutschland im 16. und 17. Jahrhundert. Parallelen, Verknüpfungen, Vergleiche, hrsg. v. dems./Marian Biskup (Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beihefte, 74), Wiesbaden 1983, 1–20, hier 8 f. 64 Informativ: Franz Kegler, Untersuchungen über den ostpreußischen Handel in der Zeit der polnischen Teilungen, Phil. Diss. Königsberg i. Pr. (Masch.) (1922), 71, besonders England vermehrte seinen Getreideimport aus den preußischen Ostseeprovinzen; Maximum 1783: 76; zur Entwicklung in längerfristiger Perspektive: August Meitzen, Der Boden und die landwirtschaftlichen Verhältnisse des Preußischen Staates nach dem Gebietsumfange von 1866, 3. Bd., Berlin 1871, 270; vgl. noch Gustav von Gülich, Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaues der bedeutendsten handeltreibenden Staaten unserer Zeit, 1. Bd., Jena 1830, 122 und Bd. 2, 300. 65 Denkschrift des Etatsministers von Schrötter, 15. November 1800, mitgeteilt von: August Skalweit, Die Getreidehandelspolitik und Kriegsmagazinverwaltung Preußens 1756–1806, Darstellung mit Aktenbeilagen und Preisstatistik (Acta Borussica: Denkmäler der Preußischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert, [Abt.:] Die einzelnen Gebiete der Verwaltung, Getreidehandelspolitik, 4. Bd.), Ber48
amerikanischen Befreiungskrieg, die französische Revolution und die daran sich knüpfenden Kämpfe hatte sich die Nachfrage nach Getreide . . . so sehr gesteigert, daß“ um 1800 „die Getreidepreise eine bis dahin nicht geahnte Höhe erreichten.“66 Die wirtschaftsgeschichtlichen Einzelheiten sollen uns hier nicht interessieren67, wohl aber die wirkungsgeschichtlichen, weil sie die Verflechtungsfolgen, die Globalisierungsimplikationen für die preußische Geschichte exemplarisch belegen. Marion Gräfin Dönhoff hat in ihrer 1936 erschienenen Dissertation die unmittelbare Wirkung der, wie sie schrieb, europäischen „Koalitionskriege“ (um 1800) auf einzelne Gutsherrschaften präzis nachgewiesen. „Denn die Ausläufer dieser politischen Ereignisse erreichten auch den abgelegensten Wirtschaftsbetrieb, und die lin 1931, 583 (Nr. 148); vgl. auch die Akte im GStA PK II. HA, Gen. Dir., (Abt. 7), Ostpreußen, II. Materien 3585: „Acta betr. die Ursachen, welche es hindern, daß Preußen nicht auch wie Nord Amerika, Weitzen Mehl statt rohen Weitzens exportiret“, von 1803/4, zur Konkurrenz mit Nordamerika. 66 D. Dillenburger, Beiträge zur Geschichte des Handels von Königsberg, in: Zeitschrift des Königlich Preußischen Statistischen Bureaus 9 (1869), 55–66, 273–304, Zitat: 56; Wirkungen der Französischen Revolution: Hans Chr. Johansen, Shipping and Trade between the Baltic Area and Western Europe 1785–95 (Odense University Studies in History and Social Sciences, 82), Odense 1983, 75 f. 67 Dazu und zu den struktur- und mentalitätsgeschichtlichen Resultaten Wolfgang Neugebauer, Marktbeziehung und Desintegration. Vergleichende Studien zum Regionalismus in Brandenburg und Preußen vom 16. bis zum frühen 19. Jahrhundert, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 45 (1999), 157–207, zum ganzen Komplex. 49
Erschütterungen des Marktes pflanzen sich auf dem Wege des Preises bis zu ihm fort.“68 Die Gewinnspannen, auch für Bauern, die ansteigenden Bodenpreise – das alles hatte tiefgreifende Wirkungen im Politischen, Sozialen und weit darüber hinaus. In ostpreußischen Dörfern war um 1810 die Lage des „Seehandels“ ein wichtiges Thema, das sogar in der Kirchenchronik Niederschlag fand. In den letzten Jahren konnte auf der Basis neuer Aktenforschungen und entgegen der Lehrbuchmeinung gezeigt werden, daß diese also letztlich globalen Zusammenhänge mit ihren Konjunkturen und mit ihren Krisenfolgen im frühen 19. Jahrhundert eine bemerkenswerte Mobilisierung der politischen Kulturen in den Regionen Preußens bewirkt haben. Jedenfalls war für den Adel gerade in den östlichen preußischen Regionen, in der Neumark Brandenburg, in Schlesien und in Ostpreußen um 1810/15 der Weg zum konstitutionellen Staat 68 Marion Gräfin Dönhoff, Entstehung und Bewirtschaftung eines ostdeutschen Großbetriebs. Die Friedrichsteiner Güter von der Ordenszeit bis zur Bauernbefreiung, Königsberg i. Pr. (1936), 102, vgl. noch 72; Wirkungen aus Nordamerika: auch Hans Plehn, Die Geschichte der Agrarverfassung von Ost- und Westpreußen, in: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 17 (1904), 383–466, 18 (1905), 61–122, hier 18, 120; Bodenpreise: Robert Stein, Die Umwandlung der Agrarverfassung Ostpreußens durch die Reform des 19. Jahrhunderts, Bd. 1 (Schriften des Königlichen Instituts für ostdeutsche Wirtschaft an der Universität Königsberg, 5. Heft), Jena 1918, 520; folgendes Beispiel (Dorfchronik): Auszug aus der Kirchen-Chronik von Gallingen betreffend die Zeit von 1805–1815, in: Emil Hollack (Bearb.), Nachrichten über die Grafen zu Eulenburg als Fortsetzung und Ergänzung des Urkundenbuchs, 1. Heft. 2. verm. Aufl. Als Manuskript gedruckt, Königsberg i. Pr. 1911, 69.
50
durchaus attraktiv und mehrheitsfähig69. Die marktaktiven Eliten rechneten ihre Zukunftschancen in einer modernisierten Welt aus, und noch schien die Fortschrittsrendite verlockend. Erst später wuchsen in den mittleren Staatsgebieten konservative Reserven gegen den Wandel. Die bisher allzu etatistische Forschung hat dies nicht sehen wollen und vielleicht auch nicht bemerken können: Politischer Wandel mußte für sie wenn 69 Vgl. Wolfgang Neugebauer, Verfassungswandel und Verfassungsdiskussion in Preußen um 1800, in: Alois Schmid (Hg.), Die bayerische Konstitution von 1808. Entstehung – Zielsetzung – Europäisches Umfeld (Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, Beiheft 35), München 2008, 147–177; vgl. schon Wolfgang Neugebauer, Das Problem von Reform und Modernisierung auf dem ostpreußischen Landtag des Jahres 1798, in: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 19 (1997), Nr. 3/4, 177–192; ders., Finanzprobleme und landständische Politik nach dem preußischen Zusammenbruch von 1806/07, in: Krise, Reformen – und Finanzen. Preußen vor und nach der Katastrophe von 1806, hrsg. v. dems./Jürgen Kloosterhuis (Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge, Beiheft 9), Berlin (2008), 121– 146, bes. 140 ff. nach neuerschlossenen schlesischen Akten; schließlich mit ostmitteleuropäischer Ausweitung Wolfgang Neugebauer, Verfassungspolitik des preußischen Adels um 1800, in: Deutsches Adelsblatt, 30 (2011), mit wiss. Apparat: Sonderdruckausgabe o. O. 2011; diese Befunde sind anschlußfähig an osteuropahistorische Erkenntnisse, z. B. M. Hildermeier, Osteuropa (Anm. 54), 174: „Und in der politisch-geistigen Kultur hat die Überlegung ein positives Echo gefunden, daß zivilgesellschaftlich-liberale Ideale und Wünsche nicht nur in Rußland, sondern gerade auch in anderen osteuropäischen Gesellschaften vom ansonsten eher konservativ-ständisch orientierten Adel artikuliert wurden. Er übernahm damit eine Rolle, die in ,westeuropäischen‘ Gesellschaften mit bürgerlicher Sozialisation und Bürgerlichkeit verbunden war.“
51
nicht von Monarchen so von der Modernisierungsbürokratie herkommen. Diese Perspektive ist zu eng. In der preußischen Geschichte gibt es starke nicht-staatliche Wandlungspotentiale, wie denn auch die Agrarhistorikerin Lieselott Enders überzeugend nachgewiesen hat, daß in der Mark Brandenburg der alles andere als stumpfe und geduckte Untertan mit einem erstaunlichen und nie verlorenen Gespür für Markt-Rationalität im 17. und im 18. Jahrhundert seine Freiräume, seine ökonomischen Spielräume nutzte, um sich lange vor Stein und Hardenberg auf den Weg der Selbstbefreiung zu machen70. Nicht bei allem hat immer nur der Staat Preußen in die Zukunft Preußens geführt. Auch da gibt es keine Linearität. Im 19. Jahrhundert hat „die Dynamik des Bodenmarktes“ lange Zeit der Kontrollsucht der Verwaltung enge Grenzen gesetzt71. Vielleicht taugt der Aspekt der marktförmigen Verhältnisse in einem weiten Sinne dazu, gerade am preußischen Beispiel historische Dynamik jenseits des Staates für das Geschichtsbild starkzumachen. Vernetzung und – nicht nur im ökonomischen Verständnis – Markt an Stelle des zu starren Staatspri70 Es sei gestattet, statt vielfachen Einzelbelegen aus dem Werk von Lieselott Enders auf meine Analyse ihrer Thesen zu verweisen: Wolfgang Neugebauer, Lieselott Enders’ Beiträge zu Grundproblemen der Frühneuzeitforschung, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 57 (2011), 285–293, bes. 291 ff.; ders., Das alte Preußen. Aspekte der neuesten Forschung, in: Historisches Jahrbuch 122 (2002), 462–482, bes. 478 ff., in thematisch weiteren Bezügen, die hier nicht zu wiederholen sind. 71 So die quellenintensive und grundlegende Studie von Patrick Wagner, Bauern, Junker und Beamte. Lokale Herrschaft und Partizipation im Ostelbien des 19. Jahrhunderts (Moderne Zeit, 9), Göttingen (2005), 49.
52
mats können zu neuen Forschungsperspektiven führen. Wenn wir an der Akademie der Wissenschaften derzeit in einem Editions- und Forschungsprojekt „Preußen als Kulturstaat“ in den Mittelpunkt der Arbeit stellen, so werfen wir die Frage auf, wie es zu erklären ist, daß ausgerechnet der Militär- und Machtstaat Preußen im 19. und im frühen 20. Jahrhundert auch auf kulturpolitischem Gebiet so starke Potentiale entwickelte. Die Quantitäten der Bürokratie haben zunächst, in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, schwerlich ausgereicht, etwa auf dem Befehlswege Impulse von oben nach unten, von Berlin bis zum Niederrhein und östlich der Memel einfach durchzustellen. Die gesellschaftliche Nachfrage nach kultureller Daseinsvorsorge war vielmehr ein entscheidendes Movens, wie etwa am Beispiel von Kunstmarkt und kulturellem Vereinswesen gezeigt werden kann. Die Staatsverwaltung erreichte besondere Effekte dann, wenn sie auf vorhandenes gesellschaftliches Interesse stieß. Die nationale, dann internationale und schließlich um 1900 globale Konkurrenz kam als zweiter gleichsam nichtstaatlicher Faktor hinzu, Staatsbildung auf kulturellem Felde voranzutreiben. Wurden im 19. Jahrhundert kulturelle Staatsleistungen und politische Loyalitäten auf neue Weise „ausgehandelt“? Das Preußen, das wir jetzt eben nicht nur an der Akademie, sondern auch am Arbeitsbereich der Professur für die Geschichte Preußens untersuchen, wird so nicht demokratischer – aber es wird „gesellschaftlicher“ 72. 72 Programmatisch: Wolfgang Neugebauer, Preußen als Kulturstaat, in: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge 17 (2007), 161–179,
53
Ein letztes Beispiel dafür, daß im Lichte dieses Ansatzes preußische Staatlichkeit in einer neuen Perspektive erscheinen kann, freilich auch essentialistiKonkurrenzen: 161 ff.; ders., Staatlicher Wandel. Kulturelle Staatsaufgaben als Forschungsproblem, in: Acta Borussica, Neue Folge, 2. Reihe: Preußen als Kulturstaat, hrsg. v. d. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter Leitung von Wolfgang Neugebauer, Bd. 1,1, Berlin 2009, XI–XXXI; Wolfgang Neugebauer, Verwaltung und Gesellschaft in der Geschichte des preußischen Kulturstaats, in: Krise, Reformen – und Kultur. Preußen vor und nach der Katastrophe von 1806, hrsg. v. Bärbel Holtz (Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge, Beiheft 11), Berlin 2010, 299–318, und die anderen Beiträge dieses Bandes; vergleichend: Wolfgang Neugebauer/Bärbel Holtz (Hrsg.), Kulturstaat und Bürgergesellschaft. Preußen, Deutschland und Europa im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Im Auftrag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin (2010); Wolfgang Neugebauer, Preußen – seine Kultur und die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, in: Kennen Sie Preußen – wirklich? Das Zentrum „Preußen – Berlin“ stellt sich vor. Im Auftrag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften hrsg. v. dems./Bärbel Holtz, Berlin (2009), 3–30; gegen gezielte Mißverständnisse: ders., Ausgerechnet Preußen ein Kulturstaat? Zum Programm eines Projektes, in: Die Akademie am Gendarmenmarkt 2009/10, (Berlin 2009), 36–42; zum über die ökonomische Dimension hinausgehenden sozialwissenschaftlichen Marktbegriff (wie er hier zugrundegelegt wird) sei nur verwiesen auf den Artikel von Gerhard Scherhorn, Markt, in: Wörterbuch der Soziologie, hg. von Günter Endruweit/Gisela Trommsdorff, Bd. 2 (Taschenbuchausgabe:) Stuttgart 1989, 416 f. (Lit.); wichtige theoretische Grundlagen (bis hin zu Grundlagen der „Emotionsforschung“) in dem Band: Marktpsychologie, 1. Halbband: Marktpsychologie als Sozialwissenschaft, hg. von Martin Irle (Handbuch der Psychologie, 12), Göttingen (1983), hier etwa der Beitrag von Günter Wiswede, Marktsoziologie, 151–224, bes. 175 ff. 54
sche Eindeutigkeit verliert, zugunsten eines dynamischen Modells, das Markt- und Verflechtungsfolgen stark macht auch für die je epochenspezifische Lebenswirklichkeit politischer Strukturen: Das preußische Dreiklassenwahlrecht, so wie es 1849 oktroyiert worden war73, hat durchaus nicht zu allen Zeiten in dieselbe politische Richtung gewirkt. Nach der Konjunktur der 1850er und frühen 1860er Jahre bevorzugte dieses ja plutokratische System die ökonomischen Profiteure dieser Entwicklung, und diese waren nach 1860 ganz überwiegend Unterstützer eines kämpferischen Liberalismus, der bekanntlich dem gerade berufenen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck schwer zu schaffen machte, Resultat jener „dem wirtschaftlichen Aufschwung entsprechende(n) Verschiebung der Wählerklassifizierung zu Gunsten bürgerlicher Schichten“, von der Günther Grünthal gesprochen hat. Diese Schichten „usurpierte(n)“ gleichsam das nun im antigouvernementalen Sinne wirkende Dreiklassenwahlrecht74, das also unter der Wirkung ökonomischer 73 Aus der Literatur: Günther Grünthal, Parlamentarismus in Preußen 1848/49–1857/58. Preußischer Konstitutionalismus – Parlament und Regierung in der Reaktionsära (Handbuch der Geschichte des deutschen Parlamentarismus), Düsseldorf (1982), 66–82; Hans Dietzel, Die preußischen Wahlrechtsreformbestrebungen von der Oktroyierung des Dreiklassenwahlrechts bis zum Beginn des Weltkrieges, Emsdetten (Westf.) 1934, 6. Vgl. Anm. 74. 74 Vgl. die interessanten Beobachtungen bei Günther Grünthal, Das preußische Dreiklassenwahlrecht. Ein Beitrag zur Genesis und Funktion des Wahlrechtsoktrois vom Mai 1849, in: Historische Zeitschrift 226 (1978), 17–66, hier 62 f.; dazu Thomas Kühne, Dreiklassenwahlrecht und Wahlkultur in Preußen 1867–1914. Landtagswahlen zwischen korporativer Tradition und politischem Massen-
55
Konjunkturen seinen Charakter temporär wandeln konnte und durchaus nicht in allen Epochen der jüngeren preußischen Geschichte das gleiche geblieben ist. – Die wirtschaftliche Konjunktur stärkte freilich zur gleichen Zeit auch die Regierung: Die Steuerflüsse, unabhängig von der kodifizierten Verfassungsordnung und vom geltenden Etatsrecht, bestimmten ganz wesentlich das politische Kräftegefüge in der Reichsgründungszeit75. Wirtschaftslagen in europäisch-globalen Bezügen sind ein Indiz für die transnationalen Bedingungen preußischer Geschichte. Die Verflechtungslagen Preußens und seiner Regionen sind ein überepochales Problem, das die Formarkt (Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, 99), Düsseldorf 1994, 51 ff.: „Der liberale Wahlterror in der Reichsgründungszeit“; zum Zusammenhang von Wirtschaftsaufschwung und liberalen Wahlresultaten nach 1858 siehe ferner Wolfgang Zorn, Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Zusammenhänge der deutschen Reichsgründungszeit (1850–1879), zuerst 1963, wieder in: Moderne deutsche Sozialgeschichte, hg. von Hans-Ulrich Wehler (Neue Wissenschaftliche Bibliothek, 10. Geschichte), 4. Aufl. Köln 1973, 254–270, hier 260, auch zur konservativen Trendwende der späteren 1860er Jahre. 75 Vgl. Näheres bei G. Grünthal, Parlamentarismus (Anm. 73), 467; ders., Grundlagen konstitutionellen Regiments in Preußen 1848–1867. Zum Verhältnis von Regierung, Bürokratie und Parlament zwischen Revolution und Reichsgründung, in: Regierung, Bürokratie und Parlament in Preußen und Deutschland von 1848 bis zur Gegenwart, hg. von Gerhard A. Ritter (Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, 73), Düsseldorf (1983), 41–55, hier 47, 49; und schon die Beobachtungen von Ludwig Dehio, Die Taktik der Opposition während des Konflikts, in: Historische Zeitschrift 140 (1929), 279–347, hier 332 und 334. 56
schung mehr als bisher beschäftigen muß. Staatlichkeit in diesem Sinne ist dann nicht allein ein Produkt endogener Prozesse, sondern ganz wesentlich bedingt von Transferentwicklungen, die über politische Bedingungen von Staatsbildung weit hinausreichen. Die künftige Forschung wird deshalb wohl auch entindividualisiert werden müssen, womit auch eine Entmythologisierung einhergehen darf: An die Stelle tritt also ein Preußen, das bei aller Machtentfaltung mit neu erkannten Freiräumen und Dynamiken interessanter wird, vielleicht auch „normaler“76. Von spezifisch preußischen Qualitäten, gar von „Preußentum“ zu reden, fällt da sehr schwer. Gerade ist der Streit darüber neu entflammt, worin eigentlich der spezifisch preußische Weg wenigstens im 19. und frühen 20. Jahrhundert bestehe, und nicht einmal das Kriterium der konstitutionellen Sonderstellung des preußischen Militärs hält einer komparatistischen Überprüfung im europäischen Vergleich noch stand77. 76 Vgl. für die frühneuzeitlichen Jahrhunderte Heinz Duchhardt, Barock und Aufklärung. 4., neu bearbeitete und erweiterte Auflage des Bandes „Das Zeitalter des Absolutismus“ (Oldenbourg Grundriß der Geschichte, 11), München 2007, 186. 77 Vgl. Hans-Christof Kraus, Monarchischer Konstitutionalismus. Zu einer neuen Deutung der deutschen und europäischen Verfassungsentwicklung im 19. Jahrhundert, in: Der Staat 43 (2004), 595–620, hier 615, in Diskussion von Martin Kirsch, Monarch und Parlament im 19. Jahrhundert. Der monarchische Konstitutionalismus als europäischer Verfassungstyp – Frankreich im Vergleich (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 150), Göttingen 1999, 399 f.; vgl. damit aber C. Clark, Preußenbilder (Anm. 57), 318, und mit Clark wiederum Hartwin Spenkuch, Vergleichsweise besonders? Politisches
57
Mit anderen Worten: Wir müssen auch mit einer Entessentialisierung Preußens rechnen – wenn wir uns darauf einlassen wollen, Preußische Geschichte als Wissenschaftsobjekt im Orbit aller Disziplinen so zu verankern, daß sie wichtig bleibt auch im 21. Jahrhundert. Preußische Geschichte, wenn sie im 21. Jahrhundert modernisiert werden kann und soll, wird also in ganz neuem Sinne eine verflochtene Geschichte sein, verflochten nicht nur mit der europäischen Geschichte, sondern in globalen Bezügen. Dieses Preußen wird tendenziell entetatisiert werden. Staatsintegration und Untertanenautonomie müssen in der Geschichte Preußens beachtet werden. Die ältere „staatswissenschaftliche“ Forschung behält ihren Wert als ein, nicht aber mehr als das Fundament dieses Arbeitsgebietes. Die wunderbare, d. h. wie durch ein Wunder über die Katastrophen der Nationalismen und der Kriege gekommene Archivüberlieferung muß das Gedruckte stets erweitern und kontrollieren im Sinne modernerer Fragestellungen. Universität, Akademie und Archiv gehören – wie vor 100 Jahren schon – dabei strategisch zusammen.
System und Strukturen Preußens als Kern des „deutschen Sonderwegs“, in: Geschichte und Gesellschaft 29 (2003), 262–293, hier 269, 283 f. 58
Wissenschaftliche Veröffentlichungen von Wolfgang Neugebauer Monographien Absolutistischer Staat und Schulwirklichkeit in Brandenburg-Preußen (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 62), Berlin/New York 1985 (715 S.). Politischer Wandel im Osten. Ost- und Westpreußen von den alten Ständen zum Konstitutionalismus (= Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa, in Verbindung mit dem Vorstand des Verbandes der Osteuropa-Historiker hg. von Erwin Oberländer, Bd. 36), Stuttgart 1992 (552 S.). Standschaft als Verfassungsproblem. Die historischen Grundlagen ständischer Partizipation in ostmitteleuropäischen Regionen, Goldbach 1995 (131 S.). Die Hohenzollern, Bd. 1: Der Aufstieg. Landesstaat und monarchische Autokratie, Stuttgart 1996 (240 S.). Residenz – Verwaltung – Repräsentation. Das Berliner Schloß und seine historischen Funktionen vom 15. bis 20. Jahrhundert (= Kleine Schriftenreihe der Historischen Kommission zu Berlin, Heft 1), Potsdam 1999 (71 S.). Zentralprovinz im Absolutismus. Brandenburg im 17. und 18. Jahrhundert (= Bibliothek der Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Bd. 5. Brandenburgische Geschichte in Einzeldarstellungen, Bd. 4), Berlin 2001 (222 S.). 59
Die Hohenzollern, Bd. 2: Dynastie im säkularen Wandel. Von 1740 bis in das 20. Jahrhundert, Stuttgart 2003 (233 S.). Geschichte Preußens, Darmstadt (bzw. Hildesheim/Zürich/New York) 2004 (159 S.); Neuauflagen im Verlag Piper unter dem Titel: Die Geschichte Preußens. Von den Anfängen bis 1947, 1. Aufl. München 2006, 5. Aufl. München 2011 (160 S.).
Editionen Schule und Absolutismus in Preußen. Akten zum preußischen Elementarschulwesen bis 1806 (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 83, Quellenwerke, Bd. 8), Berlin/New York 1992 (814 S.), (darin: Einführung, S. 1–112). Otto Hintze, Allgemeine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Neueren Staaten. Fragmente, Bd. 1 (= Palomar Athenaeum, Bd. 17), Neapel 1998 (zus. mit Giuseppe Di Costanzo und Michael Erbe). Acta Borussica. Neue Folge. 1. Reihe: Die Protokolle des Preußischen Staatsministeriums 1817–1934/38, hg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter Leitung von Jürgen Kocka und Wolfgang Neugebauer, Bd. 10, Hildesheim/Zürich/New York 1999 (495 S.) – mit verschiedenen Bearbeitern. – Bd. 7, Hildesheim/Zürich/New York 1999 (533 S.). – Bd. 3, Hildesheim/Zürich/New York 2000 (555 S.). – Bd. 5, Hildesheim/Zürich/New York 2001 (451 S.). – Bd. 1, Hildesheim/Zürich/New York 2001 (443 S.). – Bd. 9, Hildesheim/Zürich/New York 2001 (488 S.). – Bd. 11 (in 2 Teilen), Hildesheim/Zürich/New York 2002 (780 S.). 60
– Bd. 8 (in 2 Teilen), Hildesheim/Zürich/New York 2003, (757 S.). – Bd. 4 (in 2 Teilen), Hildesheim/Zürich/New York 2003, (738 S.). – Bd. 6 (in 2 Teilen), Hildesheim/Zürich/New York 2004 (806 S.). – Bd. 12 (in 2 Teilen), Hildesheim/Zürich/New York 2004 (796 S.). – Bd. 2, Hildesheim/Zürich/New York 2004 (496 S.). Acta Borussica. Neue Folge. 2. Reihe: Preußen als Kulturstaat, hg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter Leitung von Wolfgang Neugebauer, Abteilung I: Das preußische Kultusministerium als Staatsbehörde und gesellschaftliche Agentur (1817–1934), Bd. 1,1, Berlin 2009 (382 S.) versch. Autoren bzw. Bearbeiter. – Bd. 1,2, Dokumente, Berlin 2009 (419 S.). – Bd. 2,1, Darstellung, Berlin 2010 (784 S.). – Bd. 2,2, Dokumente, Berlin 2010 (820 S.). – Bd. 3,1, Fallstudien, Berlin 2012 (424 S.). – Bd. 3,2, Dokumente, Berlin 2012 (454 S.).
Herausgebertätigkeit Moderne Preußische Geschichte 1648–1947. Eine Anthologie, 3 Bde. (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 52), Berlin/New York 1981 (zusammen mit Otto Büsch). Sammlung der auf den Oeffentlichen Unterricht in den Königl. Preußischen Staaten sich beziehenden Gesetze und Verordnungen von Johann Daniel Ferdinand Neigebaur, Nachdruck mit einer Einleitung hg. (= Sammlung der Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Bekannt61
machungen zum Elementar- bzw. Volksschulwesen im 19./20. Jahrhundert, Bd. 6), Köln/Wien 1988. Dona Brandenburgica. Festschrift für Werner Vogel zum 60. Geburtstag (= Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte, 41. Bd.), Berlin 1990 (zusammen mit Eckart Henning). Potsdam – Brandenburg – Preußen. Beiträge der Landesgeschichtlichen Vereinigung zur Tausendjahrfeier der Stadt Potsdam (= Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte, Bd. 44), Berlin 1993. Die Protokolle des Preußischen Staatsministeriums 1817– 1934/38. Microfiche-Volltext-Verfilmung und wissenschaftliche Erschließungsbände. Probetext . . . (Acta Borussica, Neue Folge, 1. Reihe), Hildesheim/Zürich/ New York 1996 (zusammen mit Jürgen Kocka und Reinhold Zilch). Agrarische Verfassung und politische Struktur. Studien zur Gesellschaftsgeschichte Preußens 1700–1918 (= Innovationen, Bd. 7), Berlin 1998 (zusammen mit Ralf Pröve). Handbuch der Preußischen Geschichte, Bd. 3, Berlin/New York 2001 (812 Seiten – Alleinherausgeber). Das Thema „Preußen“ in Wissenschaft und Wissenschaftspolitik des 19. und 20. Jahrhunderts (= Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge, Beiheft 8), Berlin 2006 (373 S.). Krise, Reformen – und Finanzen. Preußen vor und nach der Katastrophe von 1806 (= Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge, Beihefte, Bd. 9), Berlin 2008 (346 S., hg. zusammen mit Jürgen Kloosterhuis). Kennen Sie Preußen wirklich? Das Zentrum „Preußen – Berlin“ stellt sich vor. Im Auftrag der Berlin-Branden62
burgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 2009, 195 S. (zusammen mit Bärbel Holtz). Handbuch der Preußischen Geschichte, Bd. 1: Das 17. und 18. Jahrhundert und Große Themen der Geschichte Preußens, Berlin/New York 2009, 1271 S. (unter redaktioneller Mitarbeit von Frank Kleinehagenbrock). Kulturstaat und Bürgergesellschaft. Preußen, Deutschland und Europa im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Im Auftrag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 2010, 265 S. (zusammen mit Bärbel Holtz).
Handbuchbeiträge Das Bildungswesen in Preußen seit der Mitte des 17. Jahrhunderts, in: Handbuch der Preußischen Geschichte, Bd. 2, hg. von Otto Büsch, Berlin/New York 1992, S. 605–798. Brandenburg im absolutistischen Staat. Das 17. und 18. Jahrhundert, in: Ingo Materna/Wolfgang Ribbe (Hg.), Brandenburgische Geschichte, Berlin 1995, S. 290– 395. Niedere Schulen und Realschulen, in: Notker Hammerstein/Ulrich Herrmann (Hg.), Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, Bd. 2: 18. Jahrhundert. Vom späten 17. Jahrhundert bis zur Neuordnung Deutschlands um 1800, München 2005, S. 213–261. Preußen in der Historiographie. Epochen und Forschungsprobleme der Preußischen Geschichte, in: Handbuch der Preußischen Geschichte, Bd. 1, hg. von Wolfgang Neugebauer, Berlin/New York 2009, S. 3–109. Brandenburg-Preußen in der Frühen Neuzeit. Politik und Staatsbildung im 17. und 18. Jahrhundert, in: A. a. O., S. 113–407. 63
Aufsätze Zur neueren Deutung der preußischen Verwaltung im 17. und 18. Jahrhundert in vergleichender Sicht, zuerst in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands, Bd. 26 (1977), S. 86–128, erw. in: Otto Büsch/ Wolfgang Neugebauer (Hg.), Moderne Preußische Geschichte 1648–1947. Eine Anthologie, Bd. 2 (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 52/2), Berlin/New York 1981, S. 541–597. Schule und Stadtentwicklung. Zweieinhalb Jahrhunderte Schulwirklichkeit in der Residenz und Großstadt Charlottenburg, in: Wolfgang Ribbe (Hg.), Von der Residenz zur City. 275 Jahre Charlottenburg (1./2. Aufl.), Berlin 1980, S. 103–143. Preußenforschung in eineinhalb Jahrhunderten, in: Forschungen zur preußischen Geschichte aus dem Verlag Walter de Gruyter, Berlin 1981, S. 1–4. Schule und Industrialisierung im Norden Berlins, in: Karl Schwarz (Hg.), Berlin. Von der Residenzstadt zur Industriemetropole, Bd. 1: Aufsätze, Berlin 1981, S. 553–562. Bemerkungen zum preußischen Schuledikt von 1717, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 31 (1982), S. 155–176. Die Stände in Magdeburg, Halberstadt und Minden im 17. und 18. Jahrhundert, in: Peter Baumgart (Hg.), Ständetum und Staatsbildung in Brandenburg-Preußen. Ergebnisse einer internationalen Fachtagung (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 55), Berlin/New York 1983, S. 170–207. Demagogenverfolgungen im preußischen Vormärz. Bericht über einen Aktenfund, in: Aufklärung – Vormärz – Revolution. Mitteilungen der internationalen Forschungsgruppe „Demokratische Bewegungen in Mit64
teleuropa 1770–1850“ an der Universität Innsbruck, Bd. 3 (1983), S. 57–63. Truppenchef und Schule im Alten Preußen. Das preußische Garnison- und Regimentsschulwesen vor 1806, besonders in der Mark Brandenburg, in: Eckart Henning/Werner Vogel (Hg.), Festschrift der Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg zu ihrem hundertjährigen Bestehen 1884–1984, Berlin 1984, S. 227–263. Johann Peter Süßmilch. Geistliches Amt und Wissenschaft im friderizianischen Berlin, in: Berlin in Geschichte und Gegenwart. Jahrbuch des Landesarchivs Berlin 1985, S. 33–68. Verwaltungsstaat und Bildungswesen, in: Wilhelm Treue (Hg.), Preußens großer König. Leben und Werk Friedrichs des Großen. Eine Ploetz-Biographie, Würzburg 1986, S. 70–80. „Von Friedrich soll ich reden – ich nenne Ihn nicht den Großen“. Peter Villaumes Gedächtnisschrift auf Friedrich II., in: Berlin in Geschichte und Gegenwart. Jahrbuch des Landesarchivs Berlin 1986, S. 7–37. Einleitung, in: Johann Daniel Ferdinand Neigebaur, Sammlung der auf den Oeffentlichen Unterricht in den Königl. Preußischen Staaten sich beziehenden Gesetze und Verordnungen, Nachdruck hg. von Wolfgang Neugebauer (= Sammlung der Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Bekanntmachungen zum Elementar- bzw. Volksschulwesen im 19./20. Jahrhundert, Bd. 6), Köln/Wien 1988, S. V–XXVII. Die Demagogenverfolgungen in Preußen. Beiträge zu ihrer Geschichte, in: Wilhelm Treue (Hg.), Geschichte als Aufgabe. Festschrift für Otto Büsch zu seinem 60. Geburtstag, Berlin 1988, S. 201–245. Bildung, Erziehung und Schule im Alten Preußen. Ein Beitrag zum Thema: „Nichtabsolutistisches im Abso65
lutismus“, in: Karl-Ernst Jeismann (Hg.), Bildung, Staat, Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Mobilisierung und Disziplinierung. Im Auftrage der Freiherr-vomStein-Gesellschaft (= Nassauer Gespräche der Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft, Bd. 2), Wiesbaden/Stuttgart 1989, S. 25–43. Staatswirksamkeit in Österreich und Preußen im 18. Jahrhundert. Problemskizze am Beispiel des niederen Bildungswesens, in: A.a.O., S. 103–115. Die Entstehung des Atlaswerkes zwischen Hof und Verwaltung, in: Wolfgang Scharfe (Hg.), AdministrativStatistischer Atlas vom Preussischen Staate . . . Neudruck mit einer Einführung und Erläuterungstexten zu den 22 Atlaskarten (= Publikationen der Historischen Kommission zu Berlin . . . Erläuterungsband zum Administrativ-Statistischen Atlas vom preussischen Staate), Berlin 1990, S. 19–21, S. 27 f. Unterrichts- und Bildungsanstalten, in: A. a. O., S. 165– 174. Landständischer Verband, in: A. a. O., S. 183–193. Bildungsreformen vor Wilhelm von Humboldt. Am Beispiel der Mark Brandenburg, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 41 (1990), S. 226–249. Johann Peter Süßmilch, in: Gerd Heinrich (Hg.), Berlinische Lebensbilder. Theologen (= Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 60. Berlinische Lebensbilder, hg. von Wolfgang Ribbe, Bd. 5), Berlin 1990, S. 183–200. Altstädtische Ordnung – Städteordnung – Landesopposition. Elbings Entwicklung in die Moderne im 18. und 19. Jahrhundert, in: Bernhart Jähnig/Hans-Jürgen Schuch (Hg.), Elbing 1237–1987. Beiträge zum Elbing-Kolloquium im November 1987 in Berlin (= Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreußens, Nr. 25), Münster/Westf. 1991, S. 243–279. 66
Administrativ-Statistischer Atlas vom Preußischen Staate. Vorgeschichte, Entstehung und Umfeld des Preußischen Nationalatlas von 1827/28, in: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte. Neue Folge, Bd. 1 (1991), S. 241–284 (zusammen mit Wolfgang Scharfe). Der Königsberger Landtag von 1840. Zu Verlauf und Hintergründen, in: Preußenland. Mitteilungen der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung und aus den Archiven der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Jg. 30 (1992), Nr. 1, S. 1–12. Brandenburg-Preußische Geschichte nach der deutschen Einheit. Voraussetzungen und Aufgaben, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 43 (1992), S. 154–181; stark erw. und überarb. in: Werner Buchholz (Hg.), Landesgeschichte in Deutschland. Bestandsaufnahme – Analyse – Perspektiven, Paderborn/ München/Wien/Zürich (1998), S. 179–212; erneut umgearb. und erw. in: Wolfgang Ribbe (Hg.), Die Historische Kommission zu Berlin. Forschungen und Publikationen zur Geschichte von Berlin-Brandenburg und Brandenburg-Preußen (= Kleine Schriftenreihe der Historischen Kommission zu Berlin, Heft 3), Potsdam 2000, S. 19–53. Die Protokolle des ost- und westpreußischen Huldigungslandtages von 1840, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 41 (1993), S. 235–262. Potsdam–Berlin. Zur Behördentopographie des preußischen Absolutismus, in: Bernhard R. Kroener (Hg.), Potsdam. Staat, Armee, Residenz in der preußischdeutschen Militärgeschichte, Frankfurt a. M./Berlin 1993, S. 273–296. Otto Hintze und seine Konzeption der „Allgemeinen Verfassungsgeschichte der neueren Staaten“, in: Zeitschrift für historische Forschung, Bd. 20 (1993), Heft 1, S. 65–96; erw. in: Otto Hintze, Allgemeine Verfas67
sungs- und Verwaltungsgeschichte der neueren Staaten. Fragmente, Bd. 1, hg. von Giuseppe Di Costanzo/ Michael Erbe/Wolfgang Neugebauer (= Palomar Athenaeum, Bd. 17), Neapel 1998, S. 35–83. Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Deutsche Geschichte im Zeitalter der Weltkriege, in: Historisches Jahrbuch, 113. Jg. (1993), S. 60–97. Das preußische Kabinett in Potsdam. Eine verfassungsgeschichtliche Studie zur fürstlichen Zentralsphäre in der Zeit des Absolutismus, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 44 (1993), S. 69–115. Monarchisches Kabinett und Geheimer Rat. Vergleichende Betrachtungen zur frühneuzeitlichen Verfassungsgeschichte in Österreich, Kursachsen und Preußen, in: Der Staat 33 (1994), Heft 4, S. 511–535. Ständische Quellen zum preußischen Vormärz, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 43 (1995), S. 45–58. Hans Rothfels als politischer Historiker der Zwischenkriegszeit, in: Peter Drewek/Klaus-Peter Horn/Christa Kerstin/Heinz Elmar Tenorth (Hg.), Ambivalenzen der Pädagogik – Zur Bildungsgeschichte der Aufklärung und des 20. Jahrhunderts. Harald Scholtz zum 65. Geburtstag, Weinheim 1995, S. 169–183. Die Schulreform des Junkers Marwitz. Reformbestrebungen im brandenburg-preußischen Landadel vor 1806, in: Peter Albrecht/Ernst Hinrichs (Hg.), Das niedere Schulwesen im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert (= Wolfenbütteler Studien zur Aufklärung, Bd. 20), Tübingen 1995, S. 259–288. Zu Stand und Aufgaben moderner europäischer Bildungsgeschichte, in: Zeitschrift für historische Forschung 22 (1995), Heft 2, S. 225–236. 68
Hans Rothfels (1891–1976) in seiner Zeit, in: Dietrich Rauschning/Donata v. Nerée (Hg.), Die Albertus-Universität zu Königsberg und ihre Professoren. Aus Anlaß der Gründung der Albertus-Universität vor 450 Jahren (= Jahrbuch der Albertus-Universität zu Königsberg/Pr. 1994, Bd. XXIX), Berlin (1995), S. 245– 256. Die Gründungskonstellation des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Deutsche Geschichte und dessen Arbeit bis 1945. Zum Problem historischer „Großforschung“ in Deutschland, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 44 (1996), S. 151–179; wieder in: Bernhard vom Brocke/Hubert Laitko (Hg.), Die KaiserWilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft und ihre Institute. Studien zu ihrer Geschichte: Das Harnack-Prinzip, Berlin/New York 1996, S. 445–468. Die Kurmark und ihre Verwaltung vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Hauptlinien und Grundprobleme, in: Fünf Jahre Bundesland Brandenburg. Ein neues altes Land. Kolloquium der Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg e.V. und des Landtages Brandenburg am 28.10.1995 (= Schriften des Landtages Brandenburg, Heft 2/1996) (Potsdam 1996), S. 29–51. Hans Rothfels’ Weg zur vergleichenden Geschichte Ostmitteleuropas, besonders im Übergang von früher Neuzeit zur Moderne, in: Berliner Jahrbuch für osteuropäische Geschichte, 1996, Bd. 1: Osteuropäische Geschichte in vergleichender Sicht (Berlin 1996), S. 333– 378. Die preußischen Provinzialstände nach 1823/24 und Theodor von Schön, in: Bernd Sösemann (Hg.), Theodor von Schön. Untersuchungen zu Biographie und Historiographie (= Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, Bd. 42), Köln/Weimar/Wien 1996, S. 125–140. 69
Raumtypologie und Ständeverfassung. Betrachtungen zur vergleichenden Verfassungsgeschichte am ostmitteleuropäischen Beispiel, in: Joachim Bahlcke/Hans-Jürgen Bömelburg/Norbert Kersken (Hg.), Ständefreiheit und Staatsgestaltung in Ostmitteleuropa. Übernationale Gemeinsamkeiten in der politischen Kultur vom 16.– 18. Jahrhundert (= Forschungen zu Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa), Leipzig 1996, S. 283–310. Ständische Renaissance und politische Reform im preußischen Osten. Zum Verfassungswandel in Ost- und Westpreußen 1772–1815, in: Marian Biskup (Red.), Ziemie Pólnocne Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w dobie rozbiorowej 1772–1815. Materialy z konferencji miedzynarodowej odbytej w dniach 11–14 maja 1995 r. w Toruniu, (= Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk – Towarzystwo Naukowe w Toruniu), Warszawa/Torun 1996, S. 23–37. Die Leibeigenschaft in der Mark Brandenburg. Eine Enquete in der Kurmark des Jahres 1718, in: Friedrich Beck/Klaus Neitmann (Hg.), Brandenburgische Landesgeschichte und Archivwissenschaft. Festschrift für Lieselott Enders zum 70. Geburtstag (= Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, Bd. 34), Weimar 1997, S. 225–241. Frankreich in der Mark um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Betrachtungen zu den Marktbeziehungen von Land und Residenz, in: Ursula Fuhrich-Grubert/Angelus H. Johansen (Hg.), Schlaglichter Preußen-Westeuropa. Festschrift für Ilja Mieck zum 65. Geburtstag (= Berliner Historische Studien, Bd. 25), Berlin 1997, S. 319–334. Das Problem von Reform und Modernisierung auf dem ostpreußischen Landtag des Jahres 1798, in: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, 19. Jg. (1997), S. 177–192. 70
Gustav Schmoller, Otto Hintze und die Arbeit der Acta Borussica, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 48 (1997), S. 152–202. Staatsverwaltung, Manufaktur und Garnison. Die polyfunktionale Residenzlandschaft von Berlin–Potsdam– Wusterhausen zur Zeit Friedrich Wilhelms I., in: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte. Neue Folge, Bd. 7 (1997), S. 233–257. Staatliche Einheit und politischer Regionalismus. Das Problem der Integration in der brandenburg-preußischen Geschichte bis zum Jahre 1740, in: Wilhelm Brauneder (Hg.), Staatliche Vereinigung: Fördernde und hemmende Elemente in der deutschen Geschichte. Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in Hofgeismar 13.3.–15.3.1995 (= Der Staat, Beiheft 12), Berlin (1998), S. 49–87. Landstände im Heiligen Römischen Reich an der Schwelle der Moderne. Zum Problem der Kontinuität und Diskontinuität um 1800, in: Heinz Duchhardt/Andreas Kunz (Hg.), Reich oder Nation? Mitteleuropa 1780–1815 (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Abteilung Universalgeschichte, Beiheft 46), Mainz 1998, S. 51–86. Die Anfänge strukturgeschichtlicher Erforschung der preußischen Historie, in: Wolfgang Neugebauer/Ralf Pröve (Hg.), Agrarische Verfassung und politische Struktur. Studien zur Gesellschaftsgeschichte Preußens 1700– 1918 (= Innovationen, Bd. 7), Berlin 1998, S. 382– 429. Die wissenschaftlichen Anfänge Otto Hintzes, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, 115. Bd. (1998), S. 540–551. Zur Staatsbildung Brandenburg-Preußens. Thesen zu einem historischen Typus, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 49 (1998), S. 183–194. 71
Martin Hass. Beiträge zur Biographie eines preußischen Historikers und Wegbereiters der Aktenkunde als Historischer Hilfswissenschaft, in: Herold-Jahrbuch 3 (1998), S. 53–71. Die Berliner Spree-Insel im preußischen Residenzengefüge. Das 18. Jahrhundert, in: Helmut Engel u. a. (Hg.), Geschichtswerkstatt Spree-Insel. Historische Topographie – Stadtarchäologie – Stadtentwicklung (= Publikationen der Historischen Kommission zu Berlin), Potsdam (1998/1999), S. 99–114. Altständische Tradition und absolutistische Herrschaft. Zur politischen Kultur Westpreußens nach 1772, in: Pommerellen – Preußen – Pomorze Gdanskie. Formen kollektiver Identität in einer deutsch-polnischen Region (= Nordost-Archiv IV/1997, Heft 2), Lüneburg (1999), S. 629–647. Zwischen Preußen und Rußland. Rußland, Ostpreußen und die Stände im Siebenjährigen Krieg, in: Eckhart Hellmuth/Immo Meenken/Michael Trauth (Hg.), Zeitenwende? Preußen um 1800. Festgabe für Günter Birtsch, Stuttgart 1999 (2000), S. 43–76. Marktbeziehung und Desintegration. Vergleichende Studien zum Regionalismus in Brandenburg-Preußen vom 16. bis zum frühen 19. Jahrhundert, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 45 (1999), S. 157–207. Max Toeppen und die Berliner Geschichtswissenschaft in seiner Zeit, in: Wlodzimierz Ste¸pin´ski/Zygmunt Szultka (Red.); Pomorze – Brandenburgia – Prusy. Panstwo i społeczenstwo, Stettin/Szczecin 1999, S. 241–260. Zum schwierigen Verhältnis von Geschichts-, Staats- und Wirtschaftswissenschaften am Beispiel der Acta Borussica, in: Jürgen Kocka (Hg.), Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften zu Berlin im 72
Kaiserreich. Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Berliner Akademiegeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, Berlin 1999, S. 235–275. Das historische Verhältnis der Mark zu Brandenburg-Preußen. Eine Skizze, in: Lieselott Enders/Klaus Neitmann (Hg.), Brandenburgische Landesgeschichte heute (= Brandenburgische Historische Studien, Bd. 4), Potsdam 1999, S. 177–196. Zur preußischen Geschichtswissenschaft zwischen den Weltkriegen am Beispiel der Acta Borussica, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 50 (1999), S. 169–196. Zur Quellenlage der Hintze-Forschung, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 45 (1999), S. 323–338. Brandenburger in Preußen – ein großes Thema für eine breite Öffentlichkeit. Bericht über ein Ausstellungskonzept für den Kutschpferdestall in Potsdam, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 50 (1999), S. 216–232 (zusammen mit Peter Baumgart/Karl Heinrich Kaufhold/Bernd Sösemann). Wissenschaftskonkurrenz und politische Mission. Beziehungsgeschichtliche Konstellationen der Königsberger Geisteswissenschaften in der Zeit der Weimarer Republik, in: Bernhart Jähnig/Georg Michels (Hg.): Das Preußenland als Forschungsaufgabe. Eine europäische Region in ihren geschichtlichen Bezügen. Festschrift für Udo Arnold zum 60. Geburtstag gewidmet von den Mitgliedern der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung (= Einzelschriften der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung, Bd. 20), Lüneburg 2000, S. 741–759. Das Ende der alten Acta Borussica, in: Rüdiger vom Bruch/Eckart Henning (Hg.), Wissenschaftsfördernde 73
Institutionen im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Beiträge der gemeinsamen Tagung des Lehrstuhls für Wissenschaftsgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und des Archivs zur Geschichte der MaxPlanck-Gesellschaft, 18.–20. Februar 1999 (= Dahlemer Archivgespräche, Bd. 5), Berlin 1999 (2000), S. 40–56. Die neumärkischen Stände im Lichte ihrer Tätigkeit, in: Neumärkische Stände (Rep. 23 B), bearbeitet von Margot Beck und eingeleitet von Wolfgang Neugebauer (= Quellen, Findbücher und Inventare des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, Bd. 9), Frankfurt/M. u. a. 2000, S. XVII–LXXVI. Friedrich III./I. (1657/88–1713), in: Frank-Lothar Kroll (Hg.), Preußens Herrscher. Von den ersten Hohenzollern bis Wilhelm II., München 2000, S. 113–133, S. 324–327 (Taschenbuchauflage, München 2006). Kurbrandenburg im 16. und frühen 17. Jahrhundert – Politik, Herrschaft und Residenzen, in: Boje Schmuhl/ Konrad Breitenborn (Hg.), Jagdschloß Letzlingen (= Schriftenreihe der Stiftung Schlösser, Burgen und Gärten des Landes Sachsen-Anhalt, Bd. 2), Halle a. d. S. (2000), S. 89–114; erw. Vorabdruck unter dem Titel: Residenzenpraxis und Politik in Kurbrandenburg im 16. Jahrhundert, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 51 (2000), S. 124–138. Die „Schmoller-Connection“. Acta Borussica. Wissenschaftlicher Großbetrieb im Kaiserreich und das Beziehungsgeflecht Gustav Schmollers, in: Jürgen Kloosterhuis (Hg.), Archivarbeit für Preußen. Symposion der Preußischen Historischen Kommission und des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz aus Anlaß der 400. Wiederkehr der Begründung seiner archivischen Tradition (= Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, Arbeitsberichte, Bd. 2), Berlin 2000, S. 261–301. 74
Der dritte Band des Handbuchs der Preußischen Geschichte, in: Wolfgang Neugebauer (Hg.), Handbuch der Preußischen Geschichte, Bd. 3, Berlin/New York 2001, S. 1–11. Preußens erster König, in: Damals. Das aktuelle Magazin für Geschichte und Kultur 33 (2001), Heft 1, S. 10–17. Einfach erfunden: Der Ahnherr Graf Thassilo, in: A.a.O., S. 43 f. Hof und politisches System in Brandenburg-Preußen: Das 18. Jahrhundert, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 46 (2001), S. 139–169. Otto Hintze, in: Michael Fröhlich (Hg.), Das Kaiserreich. Portrait einer Epoche in Biographien, Darmstadt 2001, S. 286–298. Vom höfischen Absolutismus zum fallweisen Prunk. Kontinuitäten und Quantitäten in der Geschichte des preußischen Hofes im 18. Jahrhundert, in: Klaus Malettke/ Chantal Grell (Hg.), Hofgesellschaft und Höflinge an europäischen Fürstenhöfen in der Frühen Neuzeit (15.–18. Jh.) – „Société de cour et courtisans dans l’Europe de l’époque moderne (XVe–XVIIIe siècle)“, Internationales Kolloquium, veranstaltet vom Seminar für Neuere Geschichte des Fachbereichs Geschichte und Kulturwissenschaften der Philipps-Universität Marburg in Zusammenarbeit mit der Universität Versailles Saint-Quentin (ESR 17–18) vom 28. bis zum 30. September 2000 in Marburg, unter Mitwirkung von Petra Holz (= Forschungen zur Geschichte der Neuzeit. Marburger Beiträge, Bd. 1), Münster/Hamburg/Berlin/London 2001, S. 113–124. Herrschaft, Regierung, Verwaltung in Brandenburg-Preußen um 1700, in: Preußen 1701. Eine europäische Geschichte. Essays, hg. vom Deutschen Historischen Museum und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, o. O. 2001, S. 90–100. 75
Hintze, Otto (1861–1940), in: International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, hg. von Neil J. Smelser/Paul B. Baltes, Bd. 10, Amsterdam usw. 2001, S. 6708–6711. Der Adel in Preußen im 18. Jahrhundert, in: Ronald G. Asch (Hg.), Der europäische Adel im Ancien Régime. Von der Krise der ständischen Monarchien bis zur Revolution (ca. 1600–1789), Köln/Weimar/Wien 2001, S. 49–76. Bildung und Staatsbildung in der Frühen Neuzeit, in: Berliner Wissenschaftliche Gesellschaft. Jahrbuch 2000 (Berlin 2001), S. 57–69. Preußens Weg zum Kulturstaat, in: Politische Studien 52 (2001), Heft 377, S. 25–32. La „vecchia Prussia“. Aspetti delle ricerche recenti, in: Storica 7 (2001), S. 191–207. Das historische Argument um 1701. Politik und Geschichtspolitik, in: Johannes Kunisch (Hg.): Dreihundert Jahre preußische Königskrönung. Eine Tagungsdokumentation (= Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge, Beiheft 6), Berlin 2002, S. 27–48. Das alte Preußen – Aspekte der neuesten Forschung, in: Historisches Jahrbuch 122 (2002), S. 463–482. Staatsverfassung und Heeresverfassung in Preußen während des 18. Jahrhunderts, in: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge 13 (2003), S. 83–102; Neudruck in: Peter Baumgart/ Bernhard R. Kroener/Heinz Stübig (Hg.), Die preußische Armee, Zwischen Ancien Régime und Reichsgründung, Paderborn/München/Wien/Zürich (2008), S. 27–44. 76
Preußen, in: Religion in Geschichte und Gegenwart, 4. Aufl., hg. von Hans Dieter Betz u. a., Bd. 6, Tübingen 2003, Sp. 1634–1638. Friedrich III./I. – Herrschaftspraxis und europäische Politik, in: Königliche Visionen. Potsdam – eine Stadt in der Mitte Europas. Katalog, (Potsdam 2003), S. 70–74. Puttkamer/Robert Victor von P., in: Neue Deutsche Biographie, 21. Bd., Berlin 2003, S. 19–21. Staat – Krieg – Korporation. Zur Genese politischer Strukturen im 17. und 18. Jahrhundert, in: Historisches Jahrbuch 123 (2003), S. 197–237. Staatsverfassung und Bildungsverfassung, in: Hans-Jürgen Becker (Hg.), Interdependenzen zwischen Verfassung und Kultur. Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in Hofgeismar vom 22.3.–24.3.1999 (= Der Staat, Beiheft 15), Berlin 2003, S. 91–125. Zur Geschichte des preußischen Untertanen – besonders im 18. Jahrhundert, in: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge 13 (2003), S. 141–161. Hohenzollern, Brandenburg. Linie. Ab ca. 1500, in: Werner Paravicini (Hg.), Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch, Teilband 1, bearb. von Jan Hirschbiegel und Jörg Wettlaufer (= Residenzenforschung, Bd. 15/1), Ostfildern 2003, S. 121–127. Kultureller Lokalismus und schulische Praxis. Katholisches und protestantisches Elementarschulwesen, besonders im 17. und 18. Jahrhundert in Mitteleuropa, in: Peter Claus Hartmann (Hg.), Religion und Kultur im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts, unter Mitarbeit von Annette Reese (= Mainzer Studien zur Neueren Geschichte, Bd. 12), Frankfurt a. M. 2004, S. 385–408. 77
Kulturstaat als Kulturinterventionsstaat und als historischer Prozeß. Am Beispiel des Bildungswesens bis in das frühe 20. Jahrhundert, in: Jahrbuch für Historische Bildungsforschung 10 (2004), Bad Heilbrunn/Obb. 2005, S. 101–131. Hans Rothfels und Ostmitteleuropa, in: Johannes Hürter/ Hans Woller (Hg.), Hans Rothfels und die deutsche Zeitgeschichte (= Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Bd. 90), München 2005, S. 39–61. Kabinett und Öffentlichkeit um 1800. Der Fall Potsdam– Berlin, in: Iwan M. D’Aprile/Martin Disselkamp/Claudia Sedlarz (Hg.), Tableau de Berlin. Beiträge zur „Berliner Klassik“ (1786–1815) (= Berliner Klassik. Eine Großstadtkultur um 1800, Bd. 10), Hannover/ Laatzen 2005, S. 19–33. Schloß und Staatsverwaltung im Hochbarock/Absolutismus, in: Wolfgang Ribbe (Hg.), Schloß und Schloßbezirk in der Mitte Berlins. Das Zentrum der Stadt als politischer und gesellschaftlicher Ort (= Publikationen der Historischen Kommission zu Berlin), Berlin 2005, S. 75–88. Rothfels, Hans, Historiker, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 22, Berlin 2005, S. 123–125. Bildungsgeschichte, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 56 (2005), S. 584–593, S. 644–656, S. 719– 731. Ernst Moritz Arndts Alterswerk, in: Ernst Moritz Arndt, Meine Wanderungen und Wandlungen mit dem Reichsfreiherrn Heinrich Karl Friedrich vom Stein. Mit einer Einleitung von Wolfgang Neugebauer, Hildesheim 2005, S. I–XXX. Aufgeklärter Absolutismus, Reformabsolutismus und struktureller Wandel im Deutschland des 18. Jahrhunderts, in: Werner Greiling/Andreas Klinger/Christoph Köhler (Hg.), Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg. 78
Ein Herrscher im Zeitalter der Aufklärung (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen, Kleine Reihe, Bd. 15), Köln/Weimar/Wien 2005, S. 23–39. Teutscher Krieg und große Politik – Das Ende der Selbständigkeit Magdeburgs 1631–1680, in: Matthias Puhle/Peter Petsch (Hg.), Magdeburg. Die Geschichte der Stadt 805–2005. Herausgegeben im Auftrag der Landeshauptstadt Magdeburg, Dössel 2005, S. 425–450. Konfessionelle Klientelpolitik im 17. Jahrhundert. Das Beispiel der Reichsgrafen von Sayn-Wittgenstein, in: Zeitenblicke (http://www.dipp.zeitenblicke.de/2005/3/ Neugebauer), zugleich in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 51 (2005), S. 91–108. Staatskrise und Ständefunktion. Die Landstände der mittleren Provinzen Preußens in der Zeit nach 1806, besonders in der Neumark Brandenburg, in: Roland Gehrke (Hg.), Aufbrüche in die Moderne. Frühparlamentarismus zwischen altständischer Ordnung und monarchischem Konstitutionalismus 1750–1850. Schlesien – Deutschland – Mitteleuropa (= Neue Forschungen zur schlesischen Geschichte, Bd. 12), Köln/Weimar/Wien 2005, S. 241–266. Zur Einführung: Fragen zur preußischen Historiographieentwicklung, in: Ders. (Hg.), Das Thema „Preußen“ in Wissenschaft und Wissenschaftspolitik des 19. und 20. Jahrhunderts (= Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge, Beiheft 8), Berlin 2006, S. 9–15. Die preußischen Staatshistoriographen des 19. und 20. Jahrhunderts, in: A. a. O., S. 17–60. Amtsträgerformation und Universität im Deutschland der Frühen Neuzeit. Einige grundsätzliche Annotationen, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 9 (2006), S. 165–176. 79
Preußen, in: Werner Heun u. a. (Hg.), Evangelisches Staatslexikon. Neuausgabe, Stuttgart 2006, Sp. 1831–1838. Klientel und Protektion. Reichsgrafen und Untertanen aus Sayn und Wittgenstein in ihrem Verhältnis zu Brandenburg-Preußen (17. bis frühes 18. Jahrhundert), in: Siegener Beiträge. Jahrbuch für regionale Geschichte 11 (2006), S. 35–54. Forschung und Synthese. Das Handbuch der bayerischen Geschichte im wissenschaftsgeschichtlichen Kontext, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 70/I (2007), S. 11–32. Elementarer Bildungswandel im Kurfürstentum Mainz des 18. Jahrhunderts, in: Helmut Flachenecker/Dietmar Grypa (Hg.), Schule, Universität und Bildung. Festschrift für Harald Dickerhof zum 65. Geburtstag (= Eichstätter Studien, Neue Folge, Bd. 59), Regensburg 2007, S. 67–82. Preußen als Kulturstaat, in: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge 17 (2007), S. 161–179, gekürzt in: Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz, Bd. 44 (2008), S. 109–120. Anton Friedrich Büsching 1724–1793, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 58 (2007), S. 84– 101. Zur Einführung. Probleme der älteren Finanzgeschichte am Beispiel Preußens, in: Jürgen Kloosterhuis/Wolfgang Neugebauer (Hg.), Krise, Reformen – und Finanzen. Preußen vor und nach der Katastrophe von 1806 (= Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge, Beiheft, Bd. 9), Berlin 2008, S. 9–16. Finanzprobleme und landständische Politik nach dem preußischen Zusammenbruch von 1806/07, in: A. a. O., S. 121–146. 80
Funktion und Deutung des „Kaiserpalais“. Zur Residenzenstruktur Preußens in der Zeit Wilhelms I., in: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge 18 (2008), S. 67–95. Verfassungswandel und Verfassungsdiskussion in Preußen um 1800, in: Alois Schmid (Hg.), Die Bayerische Konstitution von 1808, Entstehung – Zielsetzung – Europäisches Umfeld (= Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, Beiheft 35), München 2008, S. 147–177. Ausgerechnet Preußen ein Kulturstaat? Zum Programm eines Projektes, in: Günter Stock (Hg.), Die Akademie am Gendarmenmarkt 2009/2010, (Berlin 2009), S. 36–42. Ein Zentrum im Salon. Zur Einführung, in: Bärbel Holtz/ Wolfgang Neugebauer (Hg.), Kennen Sie Preußen wirklich? Das Zentrum „Preußen – Berlin“ stellt sich vor. Im Auftrag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 2009, S. V–VIII. Preußen – seine Kultur und die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, in: A. a. O., S. 3–30. Staatshistoriographen und Staatshistoriographie in Brandenburg und Preußen seit der Mitte des 17. Jahrhunderts, in: Markus Völkel/Arno Strohmeyer (Hg.), Historiographie an europäischen Höfen (16.–18. Jahrhundert). Studien zum Hof als Produktionsort von Geschichtschreibung und historischer Repräsentation (= Zeitschrift für historische Forschung, Beiheft 43), Berlin (2009), S. 139–154. Politik und Residenzbildung in Kurbrandenburg, 1415– 1619, in: Cranach und die Kunst der Renaissance unter den Hohenzollern. Kirche, Hof und Stadtkultur, Berlin/München 2009, S. 143–150. (Katalogbeitrag) Spezialforschung und Weltgeschichte. Berliner Akademiehistoriker im 19. und 20. Jahrhundert, in: Gegenworte. Hefte für den Disput über Wissen 22 (2009), S. 28–31. 81
Der erste Band des Handbuchs der Preußischen Geschichte, in: Wolfgang Neugebauer (Hg.), Handbuch der Preußischen Geschichte, Bd. 1. Das 17. und 18. Jahrhundert und Große Themen der Preußischen Geschichte, Berlin/New York 2009, S. XIII–XXII. Staatlicher Wandel. Kulturelle Staatsaufgaben als Forschungsproblem, in: Acta Borussica. Neue Folge, 2. Reihe, Preußen als Kulturstaat, hg. von der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter Leitung von Wolfgang Neugebauer, Bd. 1, 1. Teil: Darstellung, Berlin (2009), S. XI–XXXI. Wissenschaftsautonomie und universitäre Geschichtswissenschaft im Preußen des 19. Jahrhunderts, in: Rüdiger vom Bruch (Hg.), Die Berliner Universität im Kontext der deutschen Universitätslandschaft nach 1800, um 1860 und um 1910 (= Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien Bd. 76), München 2010, S. 129–148. Kulturstaat und Bürgergesellschaft. Problemstellung und Ergebnisse, in: Wolfgang Neugebauer/Bärbel Holtz (Hg.), Kulturstaat und Bürgergesellschaft. Preußen, Deutschland und Europa im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Im Auftrag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 2010, S. 3–12. (zusammen mit Bärbel Holtz) Kultur und Staat in Preußen um 1800, in: A. a. O., S. 15– 36. Friedrich der Große in der Sicht von Untertanen und Geschichtsschreibern, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 56 (2010), S. 135–156. Preußische Traditionen der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte, in: Michael Hochedlinger/Thomas Winkelbauer (Hg.), Herrschaftsverdichtung, Staatsbildung, Bürokratisierung. Verfassungs-, Verwaltungs- und Behördengeschichte der Frühen Neuzeit (= Veröffent82
lichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Bd. 57), Wien/München 2010, S. 87–104. Verwaltung und Gesellschaft in der Geschichte des preußischen Kulturstaats, in: Bärbel Holtz (Hg.), Krise, Reformen – und Kultur. Preußen vor und nach der Katastrophe von 1806 (= Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge, Beihefte, Bd. 11), Berlin 2010 S. 289–318. Verfassungspolitik des preußischen Adels um 1800, in: Deutsches Adelsblatt 50 (2011), Nr. 7, S. 16–19, Nr. 8, S. 14–18; Sonderdruck (mit Nachweisen): Kirchbrak 2011 (14 Seiten). Daniel Ernst Jablonskis Spielräume in Brandenburg-Preußen, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 57 (2011), S. 37–55. Lieselott Enders’ Beiträge zu Grundproblemen der Frühneuzeitforschung, in: A. a. O., S. 285–293. Zum dritten Band der Reihe, in: Acta Borussica. Neue Folge, 2. Reihe, Preußen als Kulturstaat, Abt. I, Band 3,1, Berlin (2012), S. XXX–XXXIV. Großforschung und Teleologie. Johann Gustav Droysen und die editorischen Projekte seit den 1860er Jahren, in: Stefan Rebenich/Hans-Ulrich Wiemer (Hg.), Johann Gustav Droysen. Philosophie und Politik – Historie und Philologie (= Campus Historische Studien, Bd. 61), Frankfurt/New York 2012, S. 261–292. Untertan, in: Simone Neuhäuser (Red.), Friedrich – Fritz – Fridericus. Ein Handbuch zum König, hg. von Kulturland Brandenburg e.V. Potsdam (Leipzig 2012), S. 184– 187. Wissenschaft und politische Konjunktur bei Carl Hinrichs. Die früheren Jahre, in: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge 21 (2011), S. 141–190 (erschienen März 2012). 83
Reihen (Mitherausgeberschaft) Bildungs- und kulturgeschichtliche Beiträge für Berlin und Brandenburg, Berlin 1999 bis 2006. Quellen und Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Bd. 24 ff., Berlin 2004 ff. (zusammen mit Johannes Kunisch, seit 2006 mit Frank-Lothar Kroll). Historische Studien der Universität Würzburg, Bd. 1 ff., 2003–2010. Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge, Beihefte Bd. 7 ff., 2005 ff. (zusammen mit Johannes Kunisch, seit 2006 mit FrankLothar Kroll).
Zeitschriften (Mitherausgeberschaft) Jahrbuch für historische Bildungsforschung, Bd. 5–17, 1999–2011/12 (Verlag: Klinkhardt). Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. Zeitschrift für preußische und vergleichende Landesgeschichte, Bd. 45 ff., 1999/2000 ff. Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte, Bd. 41 (1990) bis 52 (2001). Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge, Bd. 12 ff. (2002 ff.) (zusammen mit Johannes Kunisch, seit 2006 zusammen mit FrankLothar Kroll).
Bibliographie Auswahlbibliographie zur preußischen Geschichte, in: Otto Büsch/Wolfgang Neugebauer (Hg.), Moderne Preußische Geschichte 1648–1947. Eine Anthologie, Bd. 3 (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 52/3), Berlin/New York 1981, S. 1677–1764. Außerdem ca. 135 kleinere Artikel und Rezensionen. 84
Zum Autor Wolfgang Neugebauer, geb. 1953 in Berlin, bekleidete 2000–2010 den Lehrstuhl für Neuere Geschichte an der Universität Würzburg; im Oktober 2010 wurde er auf die Alfred Freiherr von Oppenheim-Professur für die Geschichte Preußens an der Humboldt-Universität zu Berlin berufen. Er ist Ordentliches Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und leitet dort das Zentrum „Preußen – Berlin“. Ferner ist er Mitherausgeber der Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte.

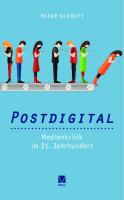







![Paradigma der Medizin im 21. Jahrhundert [1 ed.]
9783540390145](https://dokumen.pub/img/200x200/paradigma-der-medizin-im-21-jahrhundert-1nbsped-9783540390145.jpg)
![Wozu preußische Geschichte im 21. Jahrhundert? [1 ed.]
9783428538744, 9783428138746](https://dokumen.pub/img/200x200/wozu-preuische-geschichte-im-21-jahrhundert-1nbsped-9783428538744-9783428138746.jpg)