Tradition und Innovation: Die Funktion der Metapher in der theologischen Theoriesprache [Reprint 2015 ed.] 3110155753, 9783110155754, 9783110808162
182 82 7MB
German Pages [252] Year 1997
Polecaj historie
Table of contents :
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
A. METAPHOROLOGIE
Kapitel 1: Die lebendige Metapher
1. Die Semiotik der Metapher
2. Die Semantik der Metapher
3. Die Referenz der Metapher
4. Metapher und philosophischer Diskurs
5. Das Wirken der Ähnlichkeit
6. Fazit: Leistung und Grenzen einer Theorie der lebendigen Metapher
Kapitel 2: Die konzeptuelle Metapher
1. Argumentationstheoretische Grundlegung
2. Metapherntheoretische Anwendung
3. Metaphern und Topoi
4. Metaphern und Mentalitäten
5. Fazit: Leistung und Grenzen einer Theorie der konzeptuellen Metapher
Kapitel 3: Die absolute Metapher
I. Die absolute Metapher
1. Zur Rehabilitierung der Metapher
2. Die Funktion der absoluten Metapher
3. Hintergrundmetaphorik
4. Sprengmetaphorik und Metaphorisierung der Dogmatik
II. Metapher und Lebenswelt
1. Die Metapher als Refundierung
2. Die Metapher als Störung
3. Rhetorische Anthropologie der Metapher
4. Fazit: Leistung und Grenzen einer Theorie der absoluten Metapher
B. METAPHOROLOGISCHE THEOLOGIE
Kapitel 4: Metapher und biblische Bildsprache
1. Das Gleichnis als lebendige Metapher
2. Das Gleichnis als religiöse Spannungsmetapher
3. Das Gleichnis als theologische Analogiemetapher
4. Das Gleichnis als konzeptuelle Metapher
5. Mythos und Metapher
Kapitel 5: Die Metapher als Sprachform der Dogmatik
1. Das Problem der Sagbarkeit Gottes
2. Die These von der Unsagbarkeit Gottes
3. Die traditionelle Analogielehre
4. Die Metapher als analog-anthropomorphe Rede von Gott
5. Das Evangelium als Maßstab metaphorischer Rede von Gott
6. Fazit: Leistung und Grenzen der theologischen Analogiemetapher
Kapitel 6: Die Inkamationsmetapher als Grundübertragung des Christentums
1. Die metaphorische Interpretation der Inkarnation
2. Die inkarnatorische Interpretation der Metapher
3. Fazit: Die metaphorische Ursprungsbildung des Dogmas
C. TRADITION UND INNOVATION
Kapitel 7: Die absoluten Metaphern der Theologiegeschichte
1. Theologische Paradigmen
2. Theologische Verlegenheit und religiöse Glaubenskrise
3. Fazit: Leistung und Grenzen einer metaphorischen Theologiegeschichte
Kapitel 8: Theologische Traditionsmetaphorik
1. Traditionsmetaphorik als Ursprungsüberlieferung
2. Traditionsmetaphorik als Erinnerungskultur
Kapitel 9: Theologische Innovationsmetaphorik
1. Innovationsmetaphorik als Creatio
2. Innovationsmetaphorik als Renovatio
Schlußwort
Literaturverzeichnis
Namensverzeichnis
Citation preview
Markus Buntfuß Tradition und Innovation
W G DE
Theologische Bibliothek Töpelmann Herausgegeben von O. Bayer · W. Härle · H.-P. Müller
Band 84
Walter de Gruyter · Berlin · New York 1997
Markus Buntfuß
Tradition und Innovation Die Funktion der Metapher in der theologischen Theoriesprache
Walter de Gruyter · Berlin · New York 1997
® Gedruckt auf säurefreiem Papier, das die US-ANSI-Norm über Haltbarkeit erfüllt.
Die Deutsche Bibliothek -
ClP-Einheitsaufnahme
Buntfuß, Markus: Tradition und Innovation : die Funktion der Metapher in der theologischen Theoriesprache / von Markus Buntfuß. - Berlin ; New York : de Gruyter, 1997. (Theologische Bibliothek Töpelmann ; Bd. 84) Zugl.: München, Univ., Diss., 1996 ISBN 3-11-015575-3
© Copyright 1997 by Walter de Gruyter & Co., D-10785 Berlin Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Printed in Germany Druck: Werner Hildebrand, Berlin Buchbinderische Verarbeitung: Lüderitz & Bauer-GmbH, Berlin
Für Gretel und Uli
Unsere Sprache wächst durch Metaphern. Und zwar kann man sagen, daß jede Metapher zuerst bewußt gebraucht wird und in den Organismus der Sprache, als Zuwachs, erst dann eingetreten ist, wenn man sie nicht mehr als Metapher fühlt. Fritz Mauthner
Wenn man ein altes Wort gebraucht, so geht es oft in dem Kanal nach dem Verstand, den das ABC-Buch gegraben hat; eine Metapher macht sich einen neuen, und schlägt oft grad durch. Georg Christoph Lichtenberg
Vorwort Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 1996 von der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München als Dissertation angenommen. Mein Dank gilt allen voran Herrn Prof. Dr. Dr. Hermann Timm. Durch ihn und im Kreis seiner Doktorandinnen und Doktoranden wurde mir vielfältige Förderung zuteil. Im Rahmen meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter räumte er mir nicht nur die Zeit zum Schreiben ein, sondern wendete auch selbst viel Engagement und Zeit für die Betreuung des Projektes auf. Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Trutz Rendtorff danke ich für die Übernahme des Korreferates. Den Herausgebern der 'Theologischen Bibliothek Töpelmann' und dem Verlag Walter de Gruyter versichere ich meine Freude, einen so renommierten Platz für meine Arbeit gefunden zu haben. Für die Gewährung eines zweijährigen Stipendiums danke ich der Bayerischen Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses. Hilfe und Anregung wurde mir durch zahlreiche Freundinnen und Freunde zuteil. Mit förderndem Interesse begleitete Prof. Dr. Dr. Klaas Huizing die Verfertigung der Gedanken beim Schreiben. Frau Dr. Friederike Nüssel gab aufschlußreiche Hinweise. Mit den Kollegen Dr. Christian Senkel und Dr. Thomas Vogl verband sich eine freundschaftliche Arbeitsgemeinschaft. Schließlich hätte die Arbeit nicht ohne die Unterstützung und das Verständnis meiner Frau Daniela Jelinek entstehen können. Das Verdienst meiner Eltern sei mit der Widmung zum Ausdruck gebracht. Sie haben in jeder Hinsicht den Grund für einen erfolgreichen Abschluß gelegt. Ihnen danke ich von ganzem Herzen. Kirchheim bei München im Juni 1997
Markus Buntfuß
Inhaltsverzeichnis Vorwort Inhaltsverzeichnis Einleitung
VII IX 1
A. METAPHOROLOGIE Kapitel 1: Die lebendige Metapher (P. Ricoeur) 1. Die Semiotik der Metapher 2. Die Semantik der Metapher 2.1 Metapher und Semantik der Aussage 2.2 Metapher und Semantik der Rede 2.3 Metapher und semantische Rhetorik 3. Die Referenz der Metapher 4. Metapher und philosophischer Diskurs 4.1 Metapher und Philosophie bei M. Heidegger und J. Derrida 4.2 Zur ontologischen Explikation des Referenzpostulats 5. Das Wirken der Ähnlichkeit 6. Fazit: Leistung und Grenzen einer Theorie der lebendigen Metapher
13 16 22 23 25 25 32 40 40 45 47 50
Kapitel 2: Die konzeptuelle Metapher (M. Pielenz) 1. Argumentationstheoretische Grundlegung 2. Metapherntheoretische Anwendung 2.1 Die konzeptuelle Metapherntheorie von Lakoff/Johnson 2.2 Alltagskreative und theoriekreative Metaphern 2.3 Die Mikrostruktur konzeptueller Metaphern 2.4 Bereichsmetaphern 2.5 Lebendige und tote Metaphern 3. Metaphern und Topoi 4. Metaphern und Mentalitäten 4.1 Mentalitätsgeschichte 4.2 Mentalität und Metapher 5. Fazit: Leistung und Grenzen einer Theorie der konzeptuellen Metapher
53 58 61 62 64 66 68 69 71 73 73 81 84
X
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 3: Die absolute Metapher (H. Blumenberg)
87
I. Die absolute Metapher 90 1. Zur Rehabilitierung der Metapher 90 2. Die Funktion der absoluten Metapher 95 2.1 Die lebensweltliche Verlegenheit pragmatischer Orientierungsfragen.... 95 2.2 Die logische Verlegenheit theoretischer Totalitätsfragen 97 3. Hintergrundmetaphorik 99 4. Sprengmetaphorik und Metaphorisierung der Dogmatik 101 II. Metapher und Lebenswelt 1. Die Metapher als Refundierung 2. Die Metapher als Störung 3. Rhetorische Anthropologie der Metapher 4. Fazit: Leistung und Grenzen einer Theorie der absoluten Metapher ....
105 106 108 109 113
B. METAPHOROLOGISCHE THEOLOGIE Kapitel 4: Metapher und biblische Bildsprache
117
1. 2. 3. 4. 5.
Das Gleichnis als lebendige Metapher Das Gleichnis als religiöse Spannungsmetapher Das Gleichnis als theologische Analogiemetapher Das Gleichnis als konzeptuelle Metapher Mythos und Metapher
119 120 121 129 133
Kapitel 5: Die Metapher als Sprachform der Dogmatik
139
1. Das Problem der Sagbarkeit Gottes 2. Die These von der Unsagbarkeit Gottes 2.1 Die Verneinung und der Rückgang auf die Wirkungen Gottes 2.2 Die Selbstausschaltung der Sprache im Verschweigen Gottes 2.3 'Sprengmetapher' und 'Duplex Theoria' 3. Die traditionelle Analogielehre 4. Die Metapher als analog-anthropomorphe Rede von Gott 5. Das Evangelium als Maßstab metaphorischer Rede von Gott 6. Fazit: Leistung und Grenzen der theologischen Analogiemetapher
140 143 144 146 147 150 153 161 166
Kapitel 6: Die Inkarnationsmetapher als Grundübertragung des Christentums
171
1. Die metaphorische Interpretation der Inkarnation 2. Die inkarnatorische Interpretation der Metapher 3. Fazit: Die metaphorische Ursprungsbildung des Dogmas
172 182 185
Inhaltsverzeichnis
XI
C. TRADITION UND INNOVATION Kapitel 7: Die absoluten Metaphern der Theologiegeschichte
189
1. Theologische Paradigmen 2. Theologische Verlegenheit und religiöse Glaubenskrise 3. Fazit: Leistung und Grenzen einer metaphorischen Theologiegeschichte
193 198 204
Kapitel 8: Theologische Traditionsmetaphorik
207
1. Traditionsmetaphorik als Ursprungsüberlieferung 2. Traditionsmetaphorik als Erinnerungskultur
210 212
Kapitel 9: Theologische Innovationsmetaphorik
217
1. Innovationsmetaphorik als Creatio 2. Innovationsmetaphorik als Renovatio
217 220
Schlußwort
225
Literaturverzeichnis
229
Namensverzeichnis
239
Einleitung
Theologie wird mit Worten gemacht. Trotz seiner Überzeugungskraft erweckt dieser Satz den Verdacht der simplifizierenden Verkürzung. Doch hinter der sprachlichen Verfaßtheit der Theologie verbergen sich Konsequenzen, die zu verkennen Gefahr läuft, wer diese einfache aber keineswegs triviale These zurückweist. So läßt sich eine strikte Unterscheidung zwischen sprachlicher Form und theologischem Gehalt schwerlich aufrechterhalten, wenn jenes sprachgenetische und sprachlogische Axiom zutrifft. Die besondere Form der theologischen Sprachbildung hätte vielmehr unbestreitbare Folgen für die theologische Theoriebildung. Eine Theologie, die dieser Wechselwirkung nicht unbewußt ausgesetzt sein will, hat deshalb die Art und Weise ihres Zustandekommens auch in der Darstellung ihrer Themen mitzubedenken und inhaltlich fruchtbar zu machen. Die Einsicht in die grundlegende Sprachlichkeit der Theologie formierte sich mit der Entstehung des hermeneutischen Bewußtseins in der Theologiegeschichte des 20. Jahrhunderts. War die frühe 'Dialektische Theologie' noch mit erheblichen Vorbehalten gegenüber hermeneutischen Grundsatzüberlegungen behaftet, so stellte sich bald das Bedürfnis nach sprachtheologischer Selbstreflexion ein. Es entsprang der Problemstellung einer strikten 'WortGottes-Theologie', die sich am Paradigma der Predigt einerseits und der unmöglichen Möglichkeit menschlicher Rede von Gott andererseits herauskristallisierte. Demnach galt die Sprache als weltliche Sprache und konnte Gott in seinem qualitativ unendlichen Unterschied nicht zureichend aussagen. Eine Folge dieser Aporie war die fundamentaltheologische Besinnung auf das Wesen und die Funktion der Sprache für die theologische Arbeit. Hermeneutik kam zum Einsatz, um theologische Paradoxien einer Lösung zuzuführen. Von daher erklärt es sich, daß eine theologische Rezeption des 'linguistic turn' vor allem in der Strömung der 'Dialektischen Theologie' und ihrer Seitenarme erfolgte. Dabei blieb jedoch die Perspektive leitend, auf hermeneutischem Wege zu lösen, was theologisch nur in widersprüchlicher Weise zum Ausdruck gebracht werden konnte. Ein solches Vorgehen beruht aber noch immer auf einer, wenn auch unbewußten, Trennung von sprachlicher Form und theologischem Gehalt. Zudem erhalten Hermeneutik und Sprachwissenschaft die undankbare Aufgabe, theologische Krisenbewältigungsstrategien bereitstellen zu müssen. Hermeneutik wird so nur als dogmatisches Problem, mithin als
2
Einleitung
untergeordnete Hilfswissenschaft anerkannt. Eine theologische Alternative zu jener Aporetik konnte dabei gar nicht in den Blick kommen. Nimmt man hingegen die theoretischen Innovationen der Hermeneutik nicht nur als Problemlösungsstrategien für bestehende theologische Theorieaporien ernst, sondern folgt ihren Intentionen erst einmal um ihrer selbst willen, dann ergeben sich auch neue theologische Sprach- und Theoriemöglichkeiten, die die Probleme, zu deren Lösung Hermeneutik eingesetzt wurde, erst gar nicht aufkommen lassen. Aus diesem Grund kann sich auch die in der theologischen Hermeneutik entwickelte Rede vom Sprachereignis (E. Fuchs) und Sprachgeschehen (G. Ebeling) nicht auf ein bereits fixiertes dogmatisches Problem beziehen, sondern muß als derjenige Modus verstanden werden, in dem sich Theologie überhaupt erst vollzieht. Theologie als hermeneutische Wissenschaft hat es nicht nur mit einem Sprachgeschehen zu tun, sondern konstituiert sich als ein solches. Dieser Umstand nötigt zur hermeneutischen Selbstreflexion und nicht nur zur Besinnung auf ein externes Sprachereignis qua Wort Gottes, Schrift oder Offenbarung. Damit wird ein vorschneller Subjektwechsel problematisiert, der immer schon von der anderen Seite her zu sprechen beansprucht und das eigene Wort als Wort des Anderen ausgibt, bzw. als solches zu vernehmen vorgibt. Die prompte Auskunft, immer schon bei der Sache zu sein, weil man von ihr ausgehen müsse, übersieht, daß man sich dabei durchaus noch innerhalb der eigenen Sprachgebundenheit und einer bestimmten Traditionsverbundenheit bewegt und keineswegs schon an Ort und Stelle ist. Aus diesem Grund plädiert eine radikalisierte Versprachlichung der theologischen Arbeit dafür, daß die Theologie ihre Sache nicht einfach vorfindet oder in Gestalt bestimmter Formeln hat, sondern, daß sie diese allererst über den Umweg der eigenen Sprachlichkeit zu ihrer Sache macht. Theologie wird mit Worten gemacht. Daß diese Worte und die mit ihrer Hilfe gebildeten theologischen Aussagen oftmals eine metaphorische Interpretation nahelegen, darauf hat sowohl die einschlägige Religionskritik als auch die Theologie in Gestalt ihrer hermeneutischen Selbstreflexion hingewiesen. Der bloße Sachverhalt kann somit als bekannt gelten. Die Intention dieser Arbeit zielt deshalb über die Erhärtung des Befundes hinaus auf die These, daß metaphorischer Sprachgebrauch keineswegs eine Aporie für die theologische Terminologie darstellt, sondern im Gegenteil neue und vielversprechende Wege zu erschließen in der Lage ist. Theologische Metaphorik avanciert demzufolge von einem Defizienzmodus uneigentlicher Rede zu einem genuinen sprachlichen Steigerungsmodus der Theologie. Voraussetzung dafür ist die Überwindung einer bloßen metaphorologischen Kritik in Richtung auf eine metaphorische Gestaltung der Theologie. Denn die Kritik bleibt an die Negation verhaftet, wenn sie nur den blinden Fleck der anderen beleuchtet. Darüber hat eine theologische Sprachlehre hinauszugehen. Sie
Einleitung
3
darf nicht stehenbleiben bei dem theologiekritischen Befund, sondern muß zur konstruktiven Integration des Erkannten fortschreiten. Sprachliche Verfaßtheit im allgemeinen und metaphorischer Sprachgebrauch im besonderen müssen aus der Sache der Theologie begründet werden. Es versteht sich von selbst, daß diese Sache der Theologie dabei nicht wieder sprachlos gedacht werden darf. Es wird demnach zu zeigen sein, inwiefern Metaphorik selbst ein Ereignis von Wahrheit sein kann. Der Gestus der Entlarvung muß in die Arbeit der Gestaltung einmünden, sonst bleiben die gewonnenen Einsichten fruchtlos. Der Weg hat von der metaphorologischen Destruktion begrifflich verfaßter Wahrheitsansprüche zur metaphorischen Konstruktion spezifisch theologischer Sinnangebote fortzuschreiten. Metaphorologie soll von daher im folgenden nicht heißen: die unerkannte Metaphorik der anderen, sondern: das theologisch qualifizierte Reden und Denken in Metaphern als Ausdruck einer genuinen Form eigentlicher theologischer Sprache. Dabei hat sich eine heuristische Ortsbestimmung der Metapher in der Theologie mit durchaus Geläufigem auseinanderzusetzen. Denn die bildhaft veranschaulichende Leistung der Metapher ist nicht nur seit der antiken Rhetorik wohl bekannt, sondern wurde auch in den theologischen Disziplinen von jeher geschätzt. Dagegen ist die unersetzbare und kognitive Leistung der Metapher erst in diesem Jahrhundert ins sprachwissenschaftliche Bewußtsein getreten und wurde in der Theologie bisher nur sporadisch diskutiert. Im Hinblick auf diese kognitiven Leistungen lassen sich unter Inkaufnahme gewisser Verallgemeinerungen zwei Typen von Metapherntheorien unterscheiden: 1. 'Schwache' Metapherntheorien, die der Metapher nur eine uneigentliche Bedeutung zumessen, sowie 2. 'Starke' Metapherntheorien, die die Metapher als genuine Sprachform eigentlicher Rede auffassen und ihre Unersetzbarkeit behaupten. Historisch kann man sie die traditionellen und die modernen Metapherntheorien nennen. Mit dieser Alternative verbinden sich ebenfalls unter Inkaufnahme gewisser Verkürzungen zwei unterschiedliche Umgangsweisen mit der Metapher: 1. Metaphernrepugnante Umgangsweisen, welche die theorierelevante Verwendung von Metaphern leugnen. Für sie wirkt sich der Nachweis faktischen Metapherngebrauchs ruinös aus (metaphorologisch-metaphorischer Selbstwiderspruch). 2. Metaphernaffine Umgangsweisen, die der Metapher eine unentbehrliche Funktion zuerkennen. Sie befinden sich im Einklang mit ihrer eigenen Metaphorizität (selbstreferentielle Entsprechung zwischen Metaphorologie und Metaphorik). Auf den ersten Blick scheinen beide Alternativen ( l . / l . und 2.12.) als gleichwertige Optionen für sich bestehen zu können, ohne voneinander etwas halten zu müssen. Zwei unterschiedliche Denkstile, repräsentiert durch zwei unterschiedliche Denkkollektive prallen aufeinander bzw. ignorieren sich. Ein doppelter Sachverhalt jedoch, der zunehmend ins Bewußtsein tritt, nötigt den jeweils ersten Typus (schwache Metapherntheorie mit metaphernrepugnanter
4
Einleitung
Verhaltensweise) zu einem erheblichen Aufwand an Apologetik: zum einen die wachsende Kritik an einem alltagssprachlich entfremdeten Begriffs- und Eindeutigkeitsideal und zum anderen die Einsicht in die diachron metaphorische Herkunft sowie den synchron metaphorischen Verwendungsstatus zahlreicher begrifflicher Redeweisen. Dieser Befund, wie gesagt, ist unwiderlegbar. Mit ihm gilt es sich auseinanderzusetzen. Entweder affirmierend oder negierend, wobei der metaphorologischen Negation inzwischen der schwierigere Part zugefallen ist. Denn das cartesianische Projekt einer fortschreitenden Ausmerzung unklaren, bildhaften und 'bloß übertragenen' Sprachgebrauchs wird nicht nur durch die wissenschaftliche Schreibpraxis, sondern auch durch ein gestiegenes sprachtheoretisches Problembewußtsein seiner Realitätsferne überführt. Es scheint demnach angeraten, sich auf Seiten der Metaphernverehrer zu befinden. Dafür will diese Arbeit Gründe liefern. Gründe für eine starke Metapherntheorie, das heißt für die kognitive Funktion der Metapher, sowie Gründe dafür, auch in der wissenschaftlichen Theologie ein metaphernaffines Verhalten an den Tag legen zu müssen, soll die Gefahr des metaphorologisch-metaphorischen Selbstwiderspruchs gemindert und dem Kriterium metaphorologisch-metaphorischer Selbstreferentialität Genüge getan werden. Daß die dabei avisierte theologische Metaphorologie einzumünden hat in das umfassendere Konzept einer metaphorologischen Theologie, stellt die systematisch-theologische Hauptthese dieser Arbeit dar. Eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen dieses Unternehmens bildet die Wahl der zugrundeliegenden Metapherntheorie. Wie für die gesamte Intellektualgeschichte des 20. Jahrhunderts stellt der sogenannte 'linguistic turn', also die Einsicht in die fundamentale sprachliche Verfaßtheit des Geistigen und Intelligiblen, auch für die Metapherntheorie eine entscheidende Zäsur dar. Vor diesem Umbruch läßt sich die Theorie der Metapher durch eine Vorstellung leiten, der Piaton im Timaios folgendermaßen Ausdruck verleiht: „Zwei Dinge aber lassen sich für sich allein nicht haltbar zusammenfügen; es gehört notwendig dazu ein drittes, ein vermittelndes Band nämlich, welches die Vereinigung beider erst zustande bringen kann. " 1 Diese Theorie des vermittelnden Bandes führte in der mit Aristoteles anhebenden Metapherntheorie zur Suche nach einem Vergleichspunkt (tertium comparationis), der die beiden Hälften der metaphorischen Aussage miteinander zu vermitteln in der Lage sei. Piaton zufolge ist aber „das schönste aller Bänder" die Analogie. Aus dieser zweiten Vorentscheidung seines Lehrers erklärt es sich, daß auch Aristoteles der Metapher κατ άναλογίαν eine besondere Stellung zuwies. Seither spielt die als Analogie verstandene Metapher auch in der theologischen Gotteslehre, insbesondere der Scholastik, Piaton: Timaios 31, Sämtliche Dialoge, hg. von Otto Apelt, Bd VI, Hamburg 1988, S. 49.
Einleitung
5
eine zentrale Rolle. Zuletzt haben K. Barth und E. Jüngel der Analogiemetapher noch einmal zu theologischen Ehren verholfen, und zwar als der einzig adäquaten Weise, sachgemäß von Gott reden zu können. In der neueren Metaphorologie hat diese Auffassung als „substitution..." oder „comparison view of metaphor" 2 erhebliche Kritik erfahren. Denn „solange die Metapher als kontingenter sprachlicher Ausdruck einer Analogie oder eines Vergleichs gedacht wird, kann ihre Eigenständigkeit nicht in den Blick kommen." 3 Die Unersetzbarkeit der Metapher bildet dagegen die thematische Mitte der Metapherntheorien nach jener sprachtheoretischen Wende. Sie gehen von einer zweistelligen statt von einer dreistelligen Übertragungsrelation aus. Demnach stoßen in der Metapher zwei Kontexte oder Konzepte aufeinander, ohne schon von vornherein durch ein drittes Moment umspannt oder auf einer höheren Ebene miteinander vermittelt zu sein. Das in der Ontologie wurzelnde Paradigma der Vermittlung durch Ähnlichkeit wird durch das Paradigma der semantischen Wechselwirkung („interaction view of metaphor"4) abgelöst. Dieser Wechsel bedeutet, „daß die Forderung nach der Unersetzbarkeit der Metapher das sprachliche Zentrum einer modernen, 'nachanalogischen' [...] Ontologie ist." 5 Mit der Akzentverlagerung von der ontologisch-analogischen zur semantischen Metapherntheorie hängt ein zweites Charakteristikum moderner Metapherntheorien zusammen. Es formiert sich an dem jeweiligen Verhältnis von Sachlichkeit und Sprachlichkeit. Zwar ist man sich auch seitens der theologischen Hermeneutik vollständig im klaren darüber, daß 'Unterwegs zur Sache' (M. Heidegger) sich nur befindet, wer 'Unterwegs zur Sprache' (E. Jüngel) ist. Dabei ist es jedoch von entscheidender Bedeutung, welchem von beiden Momenten die stärkere Attraktionskraft zugeschrieben wird. Diesbezüglich verfolgte die bisherige theologische Hermeneutik eher die Tendenz zur Ontologisierung der Sprache, während die moderne Metapherntheorie mit Nachdruck die Semantisierung der Sache betreibt. Eine dem 'linguistic turn' folgende Metapherntheorie impliziert die Radikalisierung der Einsicht in die prinzipielle Sprachlichkeit des Wirklichen im Unterschied zu einer aus der Destruktion der Ontologie resultierenden Bemühung um den Nachweis der Wirklichkeit der Sprache. Während die ältere theologische Hermeneutik im wesentlichen an der W\xk\\c\)ke\t&erhellenden Funktion der Metapher interessiert war, kümmert sich die neuere Metaphorologie verstärkt um ihre wirklichkeit¿erstellende Funktion. War die theologische Hermeneutik bisher in Anlehnung an die heideggersche Etymologie von άλήθεια als UnverborgenMax Black: Models and Metaphors. Studies in Language and Philosophy, Ithaka/New York 1962, 3. Aufl. 1966, S. 31 u. 35. Christian Strub: Kalkulierte Absurditäten. Versuch einer historisch reflektierten sprachanalytischen Metaphorologie, Freiburg/München 1991, S. 30. Black, Models and Metaphors, S. 38. Strub, Kalkulierte Absurditäten, S. 28.
6
Einleitung
heit vom 'Sprachereignis' ausgegangen und deshalb an der Weltentdeckung orientiert, so untersucht die Hermeneutik der Metapher die sprachlichen 'Weisen der Welterzeugung' (N. Goodman). Letztere geht von der Konstruktivität der Metapher aus, die keiner ontologischen Rückversicherung mehr bedarf, weil die Einsicht in die Materialität der Sprache an die Stelle der Substanzontologie getreten ist. 6 Schließlich ist im Hinblick auf die wissenschaftlichen Untersuchung der Metapher ein weiterer Unterschied zu bemerken. Er betrifft die 'Theoretisierung der Metapher' einerseits und die 'Metaphorisierung der Theorie' andererseits. Im ersten Fall wird die Metapher zum Gegenstand einer möglichst schlüssigen Theoriebildung gemacht. Diesbezüglich liegt mittlerweile eine Unzahl von Entwürfen vor, die teilweise so heterogen sind, daß sie untereinander schlechthin inkompatibel erscheinen. Im Wettlauf um die schlüssigste Metapherntheorie konkurrieren vornehmlich Sprachanalyse, Strukturalismus und Hermeneutik. Diese Phase der 'Theoretisierung der Metapher' hebt mit Beginn dieses Jahrhunderts an und findet ihren Höhepunkt in den 60er und 70er Jahren. Im zweiten Fall wird versucht, mit flexiblen Grundannahmen zum Wirken der Metapher diese nicht als theoretischen Zweck, sondern als heuristisches Mittel zur Interpretation von literarischen oder wissenschaftlichen Texten einzusetzen. Derartige Bestrebungen können eine hohe Aktualität beanspruchen und schließen an die sich in der Mitte dieses Jahrhunderts verselbständigenden Theoriedebatten an. Der vorliegende Versuch möchte als Beitrag zu den an zweiter Stelle genannten Bemühungen verstanden werden. Die Theorie der Metapher soll dazu dienen, die Interpretation theologischer Aussagen und Texte anzuleiten. Ein solcher Umgang mit der Metapherntheorie findet sein Kriterium in ihrer Erklärungskraft für die jeweiligen Theoriemetaphern. Nicht die Schlüssigkeit einer Definition, sondern die heuristische Potenz für die Interpretation dient als Maßstab einer Theorie der Metapher. Deshalb verdienen die theorieinternen Purismen einiger Metapherntheoretiker nur bedingt Berücksichtigung. Ihrem Selbstverständnis nach entwickeln Theorien zwar durchaus die Tendenz zur Verabsolutierung. Der verstehende Nachvollzug jedoch hat dazu ein kritisches Gegengewicht zu schaffen. Sonst erliegt man leicht der Versuchung, sich die metaphorische Beobachtungsbasis Von einem ontologischen Charakter der Metapher zu sprechen macht deshalb nur dann noch Sinn, wenn man Ontologie im Sinn von „sprachlicher Rahmen", oder „begriffliches Schema" versteht. Damit ist gemeint, „daß es unter heutigen Bedingungen keinen Sinn mehr macht, Fragen der Struktur der Welt gesondert von Fragen der sprachlich formulierten Erkenntnisleistungen der in dieser Welt lebenden Subjekte zu behandeln. " (Christian Strub: Abbilden und Schaffen von Ähnlichkeiten. Systematische und historische Thesen zum Zusammenhang von Metaphorik und Ontologie, in: Lutz Danneberg u. a. (Hg.): Metapher und Innovation. Die Rolle der Metapher im Wandel von Sprache und Wissenschaft, Bern u. a. 1995, S. 111, Anm. 15).
Einleitung
7
von vornherein zu verengen. Ein Grund für diese Gefahr liegt in dem auffallenden Sachverhalt, daß die Theorie über die Metapher einerseits und die metaphorische Interpretation andererseits selten gemeinsam in Angriff genommen werden und sich demnach nicht wirklich befruchten. Dem Reichtum faktisch vorkommender Metaphorik steht zumeist eine starre Metapherntheorie gegenüber, welche sich - um die Schlüsse aus ihren Prämissen nicht zu gefährden - immer wieder zu der Behauptung gezwungen sieht, es könne metaphorologisch nicht sein, was metaphorisch der Fall ist. Dieses Dilemma versucht die vorliegende Arbeit für ihr Arbeitsgebiet zu vermeiden, indem eine Pluralität von heuristischen Aspekten eröffnet wird, in der sich unterschiedliche Phänomene theologischer Metaphorik erfassen lassen. Es soll deshalb keine weitere Metapherntheorie entworfen werden, sondern in Übernahme bestehender Theoriemodelle das Thema der unersetzbaren Metapher zur Interpretation religiöser und theologischer Aussagen herangezogen werden. Dazu wird ein Set von Untersuchungshypothesen zum Einsatz kommen, das sich durch seine hermeneutische Anwendbarkeit und Fruchtbarkeit im Vollzug der Interpretation legitimieren soll. Das Ergebnis der Interpretation von Theoriemetaphern in einer konkreten wissenschaftlichen Disziplin entscheidet der hier vertretenen Auffassung zufolge über die Tragweite einer Theorie über die Metapher. Die Perspektive des ersten Hauptteils (A. Metaphorologie) wird sich in dreifacher Weise auffächern: die lebendige (Kapitel 1), die konzeptuelle (Kapitel 2) und die absolute Metapher (Kapitel 3). Diese drei metaphorologischen Diskurse beruhen auf den Paradigmen von Poetik, Topik und Historik. Die gemeinsame Fragerichtung folgt kritisch aus einem Ungenügen an der isolierten Wortmetapher und einem rein rhetorisch verstandenen 'Reden in Metaphern'. Konstruktiv wird dagegen der kognitive Aspekt metaphorischen Sprachgebrauchs, mithin das 'Denken in Metaphern' hervorgehoben. Die Metapher wird also nicht nur grammatikalisch und rhetorisch, sondern auch texttheoretisch und sprachphilosophisch analysiert. Damit wird die Untersuchungsebene des Wortes und der einzelnen Metapher in Richtung auf den Satz und den Text hin überschritten, die beide an dem umfassenderen Phänomen der Metaphorizität orientiert sind. Außerdem finden alle drei genannten Metapherntheorien ihr Genügen nicht schon in einem textimmanenten Sinn, sondern behaupten darüber hinaus eine Wirklichkeitserschließende Bedeutung. Die Funktion der Metapher kann deshalb nicht bloß in einer didaktischen Vermittlung bestehen (ornamental-rhetorisch), sondern weitet sich zu einer erkenntnisstiftenden Heuristik aus (kognitiv-epistemologisch). Dabei gehen alle drei Ansätze von einer 'Interaktionstheorie' der Metapher aus, die M. Black als erster von zwei klassischen Theoriemodellen unterschieden hat: 'Substitutionstheorie' und 'Vergleichstheorie'. Der Substitutionstheorie zufolge gilt die Metapher als Ersatz eines verbum proprium,
8
Einleitung
das man ebenso hätte verwenden können. Insofern ist die Metapher auf ein passendes Wort zurückfährbar, welches aus stilistischen Gründen vermieden wurde. Die These der Vergleichstheorie geht in eine ähnliche Richtung. Sie behauptet, daß die metaphorische Aussage durch einen äquivalenten wörtlichen Vergleich ersetzbar ist. In diesem Fall entspricht der uneigentlichen Metapher keine eigentliche Wortbedeutung, sondern eine eigentliche Aussageform. Die Metapher wird als impliziter Vergleich aufgefaßt, dessen Relationshälften via Analogie oder Ähnlichkeit zusammenhängen. Dem bekannten Beispiel aus der antiken Rhetorik, 'Achill ist ein Löwe', entspräche also entweder die eigentliche Wortbedeutung 'Achill ist tapfer' (oder wild, etc.) oder die eigentliche Aussageform 'Achill ist wie ein Löwe' (aufgrund seiner Tapferkeit oder Wildheit, etc.). Sowohl analoge wie substitutive Metaphern können durch eigentliche und wörtliche Umformungen ersetzt werden und stellen keine eigenständige und unreduzierbare sprachliche Aussage dar. Im Gegensatz dazu insistiert die Interaktionstheorie darauf, daß die metaphorische Aussage kein Ersatz für einen formalen Vergleich oder eine wörtliche Aussage ist, sondern ihre eigenen charakteristischen Möglichkeiten und Leistungen aufzuweisen hat. Natürlich ist nicht zu bestreiten, daß es auch Substitutionsund Vergleichsmetaphern gibt. Sie sind jedoch ersetzbar. Dies geschieht zwar auf Kosten von Charme, Stil und Lebendigkeit, aber ohne Verlust an kognitivem Gehalt. Interaktionsmetaphern sind dagegen unentbehrlich. Sie lassen keine verlustfreie Paraphrase zu, weil sie nicht dieselbe Einsicht vermitteln wie die Metapher. Der gemeinsame Bezug auf eine so verstandene Interaktionstheorie gestaltet sich jedoch in unterschiedlicher Art und Weise. Die lebendige Metapher beruht auf der Grund- und Wurzelmetapher 'Metapher als Neubeschreibung'. Schöpferische Metaphern zeichnen sich durch einen geringen Grad an Usualität aus. Sie dienen einer theoriekreativen 'Logik der Entdeckung' und eröffnen neue Interpretationshorizonte, die unkonventionelle Beschreibungsmöglichkeiten nach sich ziehen. Sie helfen, nicht mehr nachvollziehbare Erklärungsmodelle zu sprengen und ungewohnte Verstehensperspektiven anzubahnen. Die lebendige Metapher ist überall dort am Werk, wo sich die Theologiegeschichte sprunghaft verändert. Als solche hatte die theologischlebendige Metapher ihre Stunde etwa in der allgemeinen Krisensituation zu Beginn dieses Jahrhunderts und durchwirkt darüber hinaus die gesamte Kultur dieser Jahrzehnte. Die konzeptuelle Metapher dagegen beruht auf der Grundmetapher 'Metapher als Argumentation'. Sie deckt den Bereich konventioneller, schlafender und abgenutzter Metaphern mit hoher Usualität ab. Hinsichtlich ihres Grades an Auffälligkeit steht sie deutlich hinter der lebendigen Metapher zurück. Zur Anwendung gelangt die konzeptuelle Metapher im Bereich der Theoriesicherung und Argumentationsstützung. Ihre Stärke ist im Unterschied zur ordnungskritischen Funktion der lebendigen Metapher die Stabilisierung
Einleitung
9
von kollektiven Überzeugungen. Insofern eignet ihr auch eine eminent mentalitätshaltige und mentalitätsprägende Kraft. Arbeitet die lebendige Metapher mit den Mitteln der Verflüssigung festgefahrener Deutemuster, so verfolgt die konzeptuelle Metapher die Strategie der Konsolidierung überlieferter Geltungsansprüche. Es wird sich zeigen, daß die von ihrem Gegenstand her konservative Theologie von der konzeptuellen Metapher ebensoviel Gebrauch macht, wie von der theoriekreativen Funktion innovativer Metaphern. Die Paradigmatik absoluter Metaphern schließlich unternimmt die historische Ortsbestimmung sowohl lebendiger als auch konzeptueller Metaphern in Theorie und Lebenswelt. Sie bestimmt keine neuen Wesenseigenschaften der Metapher, sondern erbringt eine Präzisierung hinsichtlich der geschichtlichen Funktion, die bestimmte Metaphern in der Geistesgeschichte eingenommen haben. Geltung und Genese innovativer Aufbrüche sowie konzeptueller Kanonbildung erfahren somit im Zusammenhang einer umfassenden Geschichte der Metapher eine diachrone Vermittlung. Als Ergebnis des ersten Hauptteils ergibt sich somit eine metaphorologische Grundspannung zwischen Traditionsmetaphern und Innovationsmetaphern. Dieser Antagonismus ist zwar einer historisch rückblickenden Vermittlung fähig, läßt sich aber für die jeweils aktuelle Interpretation weder zugunsten eines Modells entscheiden noch vorschnell harmonisieren. Die Mannigfaltigkeit der Metaphorik stellt das Nachdenken der Metaphorologie in ein fruchtbares Spannungsverhältnis, dessen sich diese nicht ohne Verlust entledigen darf. Dieses Fazit des ersten Teils dient als leitende Fragestellung für den zweiten Hauptteil (B. Metaphorologische Theologie). Lebt das Neue vom Alten oder lebt das Alte vom Neuen? Welche Rolle spielen Metaphern in theologischen Traditions- und Innovationsprozessen? Inwiefern lassen sich Wandel und Veränderung in der Theologie mit metaphorischen Paradigmenwechseln in Zusammenhang bringen? Über die Analyse der Funktion metaphorischer Rede in biblischer Bildsprache und theologischer Theoriesprache soll die spezifische Leistung theologischer Traditions- und Innovationsmetaphern in den Blick kommen. Der Gedankengang entzündet sich zunächst an dem faktischen Befund metaphorischen Sprachgebrauchs in der religionsproduktiven Gründungssprache des Christentums, insbesondere den neutestamentlichen Gleichnissen (Kapitel 4). Gleichzeitig mit der neueren Sprachwissenschaft hat auch die Gleichnisforschung des 20. Jahrhunderts die Metapher als genuine Sprachform eigentlicher Rede in den Blick gerückt. Doch mit der Metaphorizität der Gleichnisse wird notwendigerweise auch die Frage nach der metaphorischen Verfaßtheit ihrer reflektierenden Explikation zum Thema. Wenn die Metapher als unersetzbarer und elementarer Bestandteil des christlichen Glaubens diesen selbst und seinen Gegenstand in nicht beliebig transformierbarer Weise
10
Einleitung
zum Ausdruck bringt - und eine solche 'starke' Metapherntheorie wird in der Gleichnisforschung heute fast durchgängig vertreten - dann muß die gängige Vorstellung einer bruchlosen Überführbarkeit des damit Gemeinten in wörtlich-begriffliche Explikation als problematisch erscheinen. Soll nicht wieder eine Substitutionstheorie höherer Ordnung greifen, dann kann die in einem bestimmten Fundierungsverhältnis zur neutestamentlichen Glaubenssprache stehende theologische Theoriesprache nicht als prinzipiell unmetaphorisch gelten. Aus diesem Problemüberhang ergibt sich die Dringlichkeit, zu einer theologischen Metaphorologie fortzuschreiten. Hinzu kommt noch ein interner Grund, der auch die reflexive Erfassung der Glaubensgehalte zur Anerkennung ihrer eigenen Metaphorizität nötigt. Er beruht in der für die Theologie konstitutiven Diskrepanz zwischen Präsenz und Präsentation, zwischen Gegenwart und Vergegenwärtigung ihres Gegenstands. Das Thema der Gotteserkenntnis beinhaltet deshalb seit der Patristik das Erschließen per analogiam, das übertragene Sprechen über einen Gegenstand, welcher der unmittelbaren Darstellung als unzugänglich gilt. Daß die Metapher im Unterschied zur Analogie dabei keine herausragende Rolle gespielt hat, resultiert aus ihrer wirkungsgeschichtlichen Restriktion auf die Rhetorik im schulphilosophischen Sinn. Dagegen wird sich die traditionelle Schwerpunktverteilung zwischen Analogie und Metapher unter den Bedingungen von nachanalogischer Ontologie und moderner Semantik umkehren und der Metapher eine vollgültige Rehabilitierung bescheren (Kapitel 5). Die Insuffizienz der Vergleichs- und Substitutionstheorie nötigt schließlich auch auf der Ebene der theologischen Theoriesprache zu weitergehenden Folgerungen. Soll die Metapher nicht als sekundäre Einkleidung eines wörtlich aussagbaren Sachverhalts gelten, sondern eine ursprüngliche Aussageform theologischer Gotteserkenntnis darstellen, so genügt es nicht, eine methodisch begrenzte theologische Metaphorologie zu entwickeln, sondern dann muß zur Konzeption einer umfassenden metaphorologischen Theologie fortgeschritten werden. Von daher verbietet sich der erneute Versuch, ein außersprachliches bzw. außermetaphorisches Kriterium zum Maßstab der metaphorischen Rede von Gott zu machen. Es geht also nicht darum, das Vorkommen einzelner Metaphern in der Theologie zu untersuchen. Vielmehr soll ansatzweise auch eine Erweiterung theologischer Rationalität angebahnt werden. Inwiefern kann diese als metaphorisch in einem übergreifenden Sinne verstanden werden? Damit wird die theologische Verankerung der Metapher im Kern der Theologie erforderlich. Diese Aufgabe übernimmt die Metapher der Inkarnation (Kapitel 6). Aufgrund ihrer metaphorologisch selbstreferentiellen Struktur vermag die Inkarnationsmetapher, die Metapher nicht nur als theologische Verlegenheitslösung gelten zu lassen, sondern sie als genuine Sprachform theologischer Rede zu begründen. Die Inkarnationsmetapher kann als die theologische Grundübertragung begriffen werden, weil sie inhaltlich ihrem formalen Zu-
Einleitung
11
standekommen entspricht. Entgegen einem weitverbreiteten Mißverständnis ist die Inkarnation kein 'Bild' für etwas anderes (etwa 'die Bedeutung Jesu für uns'), sondern irreduzibler und unersetzbarer Ausdruck für das damit Gemeinte. Ihre Bedeutung deckt sich mit ihrem Verfahren, das im Bedeutungstransfer zwischen dem Konzept 'Mensch' und dem Konzept 'Gott' besteht. Damit ist jedoch der Prozeß der metaphorisch-theologischen Theoriebildung weder stillgestellt noch abgeschlossen. Die Inkarnationsmetapher ist keine Abschluß-, sondern eine Eröffnungsfigur. Insofern sie den Gedanken nicht fixieren will, sondern eine Aufforderung zur unabschließbaren Arbeit der Interpretation ist, macht sie den Weg für die wechselvolle Geschichte einer metaphorologischen Theologie frei. Dieses offene Fazit der metaphorologischen Untersuchung der Dogmatik veranlaßt mich in einem letzten Schritt zu einer methodischen Verortung der Metapher im geschichtlichen Prozeß theologischer Theoriebildung zwischen Tradition und Innovation. Der abschließende Teil (C. Tradition und Innovation) nimmt den Faden des ersten Teils auf und verbindet ihn mit dem Ergebnis des zweiten Teils zu einer metatheoretischen Reflexion auf den Zusammenhang zwischen Theologie und Metapher, wie er sich durch die drei Paradigmen Historik, Topik und Poetik strukturieren läßt. Diese Rekapitulation des ersten metaphorologischen Hauptteils in umgekehrter Reihenfolge soll zunächst die Theologiegeschichte als einen Prozeß wechselnder Leit- und Hintergrundmetaphern zu verstehen geben (Kapitel 7). Doch für die Beurteilung des aktuellen Stellenwertes der Metapher in der theologischen Theoriesprache reicht die historische Aufklärung allein nicht aus. Den Abschluß bildet deshalb eine Erörterung der Bedeutung von Traditionsmetaphern (Kapitel 8) und Innovationsmetaphern (Kapitel 9) für die gegenwärtige theologische Theoriebildung.
A. Metaphorologie Kapitel 1 Die lebendige Metapher Als der prominenteste Fall metaphorischer Rede gilt in der neueren Metapherntheorie die lebendige (P. Ricoeur), emphatische (M. Black) oder kühne Metapher (H. Weinrich). In Auseinandersetzung mit zahlreichen Autoren der neueren - vor allem auch angloamerikanischen - Metaphorologie wurde die Theorie der lebendigen Metapher durch Paul Ricoeur' entwickelt. Im Unterschied zu Autoren wie J. Derrida oder H. Blumenberg nähert sich Ricoeur der Metapher nicht über ein sprachkritisches oder begriffsarchäologisches Paradigma, sondern entwirft eine an der aktuellen Funktionsweise der Sprache orientierte Theorie der Metapher. Die Grundfunktion der lebendigen Metapher beruht in der innovativen Neubeschreibung der Wirklichkeit. Insofern sich das Erkennen einer Neubeschreibung jedoch nicht in einem semantisch-syntaktischen Vakuum, sondern nur vor dem Hintergrund möglicher und bekannter Beschreibungsstrukturen vollzieht, bildet der „Zusammenhang zwischen dem Schöpferischen und der Regel" 2 den methodischen Rahmen für eine hermeneutische Theorie der lebendigen Metapher. Der geregelte Strukturzusammenhang der Metapher wird durch die Sprache und ihre Formen abgesteckt. Von daher liefert nur eine Analyse der Metapher im Hinblick auf ihre sprachliche Funktionsweise diejenige Folie, vor welcher sich ihre schöpferische Innovationskraft angemessen erfassen und würdigen läßt. Die Dynamik der spannungsreichen Beziehung zwischen Neubeschreibung und sprachlicher Regel wird dabei in der semantisch interpretierten produktiven Einbildungskraft, also in der schöpferischen Freiheit des Menschen im Umgang mit der Sprache verortet. Ricoeur vertritt weder eine rein ingeniöse Theorie der metaphorischen Spontaneität, noch eine rhetorische Stilistik der metaphorischen Figuren und Bei der Darstellung Ricoeurs folge ich dem Gedankengang seines gleichnamigen Werkes: La métaphore vive, Paris 1975; dt. Die lebendige Metapher, München 1986; eine Zusammenfassung seines Ansatzes hat Ricoeur auch in den beiden ersten Teilen des Aufsatzes: Stellung und Funktion der Metapher in der biblischen Sprache (in: Paul Ricoeur/Eberhard Jüngel: Metapher. Zur Hermeneutik religiöser Sprache, Sonderheft Evangelische Theologie, München 1974) vorgelegt. Ricoeur, lebendige Metapher, S. I.
14
Die lebendige Metapher
Tropen. Für den metaphorischen Prozeß ist vielmehr entscheidend, daß „das Schaffen zu dem der Mensch befähigt ist, ein geregeltes, kein Schaffen ex nihilo, keine absolute Spontaneität ist. " 3 Weder soll das emphatisch überhöhte metaphorische Ereignis, noch die schlichte Machbarkeit der Metapher im Sinne stilistischer Verwendungskompetenz verabsolutiert werden. Indem die Metapher als sprachliches Phänomen und damit als Bestandteil eines bestimmten Ordnungsgefüges verstanden wird, entspricht dem Metaphorischen ein Forschungsbereich mit eigenen Regeln, Normen und Prinzipien, an denen weder die distanzierte Analyse noch die kongeniale Hermeneutik vorübergehen können. Insofern schließlich die Metapher dem kreativen Imaginations- und Sprachvermögen des Menschen entspringt, scheiden ebenfalls die Theorien eines metaphorischen Subjektwechsels aus, die der Metapher quasi-ontologische Ursprungsqualitäten zuschreiben wollen. Im Gegensatz zu solchen metaphorologischen Alteritätskonzepten werden die menschlichen Möglichkeiten des Ausdrucks und des Verstehens als schöpferisches Sprachverhalten qualifiziert. Im Anschluß an G. Frege" geht Ricoeur von der Unterscheidung zwischen Sinn und Bedeutung aus und erweitert deren Geltungsbereich über die Beschreibungssprache der Logik hinaus auf die Sprache in ihrem ganzen Umfang3, also auch auf den dichterischen und theoretischen Diskurs. Der Vorgang der Sprachschöpfung unter dem Aspekt des Sinns, meint eine sprachimmanente Sinnproduktion, unter dem Aspekt der Bedeutung dagegen eine Erweiterung des Entdeckungs- und Verwandlungsvermögens von Wirklichkeit. Diese beiden Momente, der immanent-sinnhafte und der transzendierend-referentielle, werden mit den Begriffen der 'semantischen Innovation' und der 'heuristischen Funktion' benannt. Beide Wirkungsweisen der Sprache entspringen der Doppelnatur des Zeichens, welches zu einem Zeichensystem gehört und auf andere Zeichen verweist, sowie auf unsere Erfahrung rekurriert und den Zeichencode auf die Realität hin transzendiert. Diese Unterscheidung darf freilich nicht zu einer Trennung der Aspekte führen. Die Frage nach dem semantischen Sinn treibt vielmehr über sich hinaus zu der Frage nach der Bedeutung, auch wenn gilt, daß nicht jedes sinnhafte Zeichen bzw. jeder sinnhafte Ausdruck tatsächlich auf etwas anderes referiert, d. h. eine Bedeutung hat. Die Untersuchung der lebendigen Metapher wird sich an diesen beiden Leistungen der Sprache orientieren. Der eigentliche Nachweis liegt jedoch in 3 4
5
Ebd. Gottlob Frege: Über Sinn und Bedeutung, Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100, 1892. Ricoeur beruft sich hinsichtlich dieser allgemeinen Voraussetzungen und Annahmen über das Wesen der Sprache auch auf Humboldt und Cassirer, die „die Funktion der Sprache als Artikulation unserer Welterfahrung, als ihrer Formgebung aufgefaßt" hätten (Ricoeur, Stellung und Funktion, S. 49).
Die lebendige Metapher
15
der heuristischen Funktion der Metapher auf der Ebene der Bedeutung, welche als Funktion der Neubeschreibung der Wirklichkeit durch die Metapher bestimmt wird. Die Intention dieses Ansatzes läuft somit auf ein „Plädoyer für die metaphorische Referenz" 6 hinaus, weil damit auch „die Entscheidung über die letzte Bedeutung der Sprache fallt" 7 . Die Frage 'Hat unser Sprechen Inhalt?'8, also die Frage, ob die Sprache von etwas anderem als von sich selbst handelt, muß mit einem eindeutigen 'Ja' beantwortet werden. Der W e g zur heuristischen Funktion der Metapher bzw. zur metaphorischen Referenz wird jedoch nicht direkt eingeschlagen, sondern führt über die metaphorische Sinnschöpfung auf der semantisch-sprachimmanenten Ebene. Die Stufen dieses Weges bilden das Wort (Semiotik), der Satz (Semantik) und schließlich die Rede oder der Text (Hermeneutik). Ricoeur strebt darin über eine rhetorisch-ornamentale Metapherntheorie des Nomens hinaus und versteht die Metapher auf der umfassenderen Satz- und Textebene9, d. h. vor dem Hintergrund eines Kontextes, als ungewöhnliche Prädikation. Aber auch die poetologisch-semantische Sinntheorie auf der Ebene der Textstruktur wird noch einmal überboten durch die These von der 'metaphorischen Wahrheit' oder Referenz. Erst die Berücksichtigung der 'Welt des Textes' führt über die textimmanente semantische Innovation hinaus und erfaßt die Metapher als Mittel einer „Heuristik des Denkens"10, welche „eine andere Dimension der Wirklichkeit aufdeckt und damit eine neue Deutung der Welt und unserer selbst freisetzt." 11 Ihre endgültige Pointe erhält die Theorie der lebendigen Metapher also noch nicht im Rahmen einer Semantik der Metapher, sondern erst in dem Versuch, die wirklichkeitserstellende Funktion des Metaphorischen zu erweisen.
6 7 8
9
10 11
Ricoeur, lebendige Metapher, S. III Ebd. S. IV. Vgl. dazu Georg Steiner: Von realer Gegenwart, München 1990, und sein Plädoyer für die Realpräsenz der Sprache, d. h. für ihre Referentialität. Den Vorrang des Satzes vor dem einzelnen Wort als Untersuchungsbereich für die Metapher hat vor Ricoeur bereits Franz Vonessen gesehen (Die ontologische Struktur der Metapher, ZPhF 13, 1959, S. 397-418). Dem rationalistischen Vorwurf, die Metapher sei nicht wahrheitsfähig, weil sie keine Aussage, sondern nur ein Ausdruck sei, entgegnet er dort mit der Behauptung, „daß die Metapher faktisch fast immer und der Entstehung nach stets und sogar mit Notwendigkeit eine Aussage ist. [...] Metaphorisch ist dann aber der ganze Satz und nicht nur das Wort, das an ihm selbst weder direkt noch metaphorisch sein kann, sondern seinen immer unveränderten Sinn in verschiedene Schilderungen hineingibt, indem es seine direkte oder metaphorische Bedeutung, seine Funktion im Satz erst vom Ganzen des Urteils her erhält." (ebd. S. 401f.) Ricoeur, lebendige Metapher, S. 28. Ebd. S. VII.
16
Die lebendige Metapher
1. Die Semiotik der Metapher Das Phänomen der Metapher ist denkgeschichtlich zuerst im Zusammenhang von Rhetorik und Poetik überliefert. Mit dem wechselvollen Schicksal dieser beiden Disziplinen ist auch die Erörterung der Metapher ab ovo verbunden. Der Versuch zu einer philosophischen Metapherntheorie hat sich von daher demjenigen Autor zuzuwenden, der als erster Rhetorik und Poetik in einem übergreifenden Rahmen philosophisch durchdacht hat. Die Untersuchung beginnt deshalb mit einer Interpretation der aristotelischen Definition der Metapher. Bei Aristoteles kommt die Metapher zum ersten Mal in dem theoretischen Spannungsgeflecht von Philosophie, Rhetorik und Poetik zu stehen, welches die Metapherntheorie hinsichtlich des damit eröffneten strukturellen Problemgehalts bis heute bestimmt. Dessen Eckpunkte werden erstens markiert durch eine 'Logik des an sich Wahren', zweitens durch eine 'Logik des jeweils Wahrscheinlichen' und der argumentativen Überzeugung sowie drittens durch eine 'Logik des lebendigen Ausdrucks' und der effektiven Darstellung. Im Bezugsfeld dieser Trias gründet die spezifische Leistungsweise der Metapher, wobei sich freilich der Schwerpunkt ihrer Funktion im Verlauf der Geschichte einmal mehr auf die Rhetorik, einmal mehr auf die Poetik und ein andermal mehr auf die Logik verlagert hat. Für eine aktuelle Metapherntheorie gilt damit auf jeden Fall die unhintergehbare Ausgangsbedingung, daß sich Wesen und Wirken der Metapher nur aus dem komplexen Beziehungsgefüge dieser drei Diskurse erheben lassen. Von daher wird für die gesamte Untersuchung sowohl hinsichtlich ihrer methodischen Durchführung als auch hinsichtlich ihres sachlichen Ergebnisses der Gedanke der Spannung und der Wechselwirkung konstitutiv. Bei Aristoteles taucht das Moment der Spannung zwar schon auf, aber es kann noch als ausgeglichen beurteilt werden. Sein Name steht in der Geschichte der divergierenden und gegenläufigen Entwicklungen jener Diskursformen für eine, wenn auch nur anfangliche und labile Gleichgewichtslage. Noch kurz vor Aristoteles stellen Poetik und Rhetorik keine eigenständigen und ausdifferenzierten Disziplinen der Philosophie dar und schon bald nach ihm setzt ein gegenläufiger Prozeß der Ausdifferenzierung ein. In dessen Verlauf emanzipieren sich zum einen Rhetorik und Poetik von der Philosophie und verlieren dabei tendenziell ihren Zusammenhang mit der 'Logik des an sich Wahren', zum anderen erhebt die Philosophie einen Alleingeltungsanspruch, wodurch sie ihrer Verbindung mit der 'Logik der Überzeugung' und deren Darstellung verlustig zu gehen droht. Ricoeurs Besinnung auf den aristotelischen Ursprung einer gleichsam harmonischen Komplexgestalt jener unterschiedlichen Rationalitätsformen hat zum Ziel, in modifizierter Weise noch einmal eine Theorie der Metapher zu skizzieren, an welcher Philosophie, Rhetorik und Poetik unter Wahrung ihrer Verschiedenheit in
Die Semiotik der Metapher
17
gleicher Weise Anteil und Wirkung haben sollen.12 Der bereits genannte Gedanke einer Wechselwirkungs- und Spannungstheorie der Metapher impliziert demnach sowohl den Unterschied als auch die Überschneidung zwischen jenen Diskursen. Die Metapher gehört Aristoteles zufolge in die Rhetorik und in die Poetik. Sie spielt also in zwei unterschiedlichen Verwendungsweisen der Sprache eine Rolle. Insofern partizipiert die Metapher an zwei verschiedenen 'Welten der Rede'. Die Rhetorik, ursprünglich verstanden als Argumentationstheorie13, orientiert sich an dem jeweils Wahrscheinlichen und dient der Überzeugung. Sie kann demnach als die Kunst bezeichnet werden, Beweise zu finden und zu erfinden. Die Poetik als Theorie der Tragödie hingegen dient der Läuterung der Leidenschaften. Ihre Kunst liegt in der treffenden und ergreifenden Darstellung. „Die Metapher steht nun aber mit einem Fuß in beiden Bereichen." 14 Ihre Struktur ist zwar eine einzige, nämlich die Verschiebung des Wortsinnes aufgrund einer Übertragung, ihre Funktion aber ist eine doppelte. „Die eine Struktur der Metapher muß daher nacheinander vor dem Hintergrund der mimetischen Künste und derjenigen des überzeugenden Beweises gesehen werden." 15 Auf dieser Doppelfunktion der Metapher beruht schließlich auch die metaphorische 'Neubeschreibung der Wirklichkeit'. Deskription und Argumentation spielen dabei zu gleichen Teilen eine entscheidende Rolle und ermöglichen nur im Zusammenspiel eine innovative Heuristik des Weltverstehens. Unerachtet ihrer doppelten Funktion hat die Metapher jedoch eine einheitliche Struktur. In der Poetik schreibt Aristoteles: „Metapher ist die Übertragung eines fremden Nomens, entweder von der Gattung auf die Art oder von der Art auf die Gattung oder von einer Art auf eine andere oder gemäß der Analogie"". Diese Definition der Metapher in der Poetik übernimmt Aristoteles auch in der Rhetorik. Die Struktur der Metapher wird in beiden Werken als Transformation des Wortsinnes verstanden. Der funktionale
13
14 15 16
Insofern wirkungsgeschichtlich allein die Rhetorik das Erbe der Metapher angetreten hat, gilt es für eine Theorie der lebendigen Metapher ihren Anteil eher zu schmälern, um die Bedeutung von Philosophie und Poetik für die Metaphorologie verstärkt zur Geltung bringen zu können. Das erklärt, warum sich Ricoeur immer wieder gegen eine ausschließlich - rhetorische Metapherntheorie zur Wehr setzt. Es gehört zum verhängnisvollen Schicksal der Rhetorik, daß gerade dieser Bestandteil ihrer Theorie und damit der Zusammenhang über die Dialektik mit der Philosophie im Verlauf der Entwicklung verloren ging, und die Rhetorik somit zur „Manie der Figurenklassifizierung" (Ricoeur, lebendige Metapher, S. 14) verkam. Neuere Ansätze zur Rhetorik bemühen sich von daher wieder verstärkt um den Zusammenhang mit einer allgemeinen philosophischen Argumentationstheorie. Diesen Aspekt wird die topischrhetorische Theorie der 'konzeptuelle Metapher' (Kap 2) aufgreifen. Ricoeur, lebendige Metapher, S. 19. Ebd. Aristoteles, Poetik, 1457b 6-9.
18
Die lebendige Metapher
Unterschied zwischen poetischer und rhetorischer Metapher läßt sich deshalb nur aus dem Kontext erschließen. Dieser wird sowohl in der Rhetorik als auch in der Poetik durch die Lexis gebildet. Lexis bezeichnet die gesamte Ebene des Ausdrucks und der Sprachform. Die Lexis bringt die Rede zur Erscheinung. Indem Ricoeur die jeweilige Eigenart der rhetorischen und der poetischen Sprachform charakterisiert, gewinnt er an der Interpretation des aristotelischen Metaphernbegriffs seine Kriterien für eine aktuelle Theorie der Metapher. Dabei zeigt sich, daß bereits im Ursprung Verstehen und Verkennen eng beieinanderliegen. Eine angemessene Perspektive auf die Wiege der philosophischen Metapherntheorie entscheidet bereits darüber, ob die Metapher mit einem beschränkten Konzept von Rhetorik'7 untergehen muß, oder als lebendiger Ausdrucksakt im Rahmen eines poetisch-hermeneutischen Sprachverständnisses weiterbestehen kann. Zunächst sollen deshalb die möglichen 'Holzwege' für eine produktive Metapherntheorie erkannt und für das weitere Vorgehen als unzulänglich ausgeschieden werden. Die Lexis als Kontext der Metapher bezeichnet bei Aristoteles zwar die gesamte Ebene des Ausdrucks und der Sprachform, sie wird jedoch im wesentlichen auf ihre elementaren Bestandteile und damit auf die Zentralstellung des einzelnen Nomens reduziert. „Nomen ist ein zusammengesetzter bedeutungshafter Laut, ohne Zeitelement und ohne daß ein Teil von ihm an sich bedeutungshaft wäre." 18 Vor diesem Verständnis der Lexis als kleinster semantischer Grundeinheit wird die Metapher schließlich als Bedeutungsübertragung eines Nomens bestimmt. Damit droht jedoch das vorzeitige Ende einer produktiven Metapherntheorie. Indem die Metapher nämlich mit der Lexis verknüpft und diese wiederum mit dem Nomen identifiziert wird, erfährt die Metapher eine Verkürzung ihres Geltungsbereichs auf der isolierten Wortebene, ohne auch in dem übergreifenderen Zusammenhang des Satzes und der Rede beachtet zu werden. Das bedeutet, daß das Phänomen der Metapher seine Realisierung nur als eine unter vielen Wortfiguren (Tropen) finden kann. Diese Reduktion stellte für die theoretische Wirkungsgeschichte den Anlaß zu einer immer subtileren Klassifizierungsmethode der Metapher als eines Tropus unter anderen dar. Eine derartige „Botanik der Redefiguren"" etablierte sich jedoch auf Kosten der Einsicht in den einheitlichen und umfassenden Funktionszusammenhang der Metapher. Die Hauptintention einer erneuerten Metapherntheorie muß deshalb darin bestehen, die frühzeitige Verengung auf eine Nomen-Theorie der Metapher zu verhindern. Der Weg der Untersuchung führt deshalb von der Semiotik (Wortebene) über die
18
"
Vgl. Gérard Genette: La rhétorique restreinte, (dt. Die restringierte Rhetorik, in: Haverkamp, Theorie der Metapher, S. 229-252). Aristoteles, Poetik 1457a 10-11. Ricoeur, lebendige Metapher, S. 15.
Die Semiotik der Metapher
19
Semantik (Satzebene) zu einer umfassenden philosophischen Hermeneutik der Metapher (Rede- bzw. Textebene). Die Übertragung der Metapher wird als έπιφορά des Nomens verstanden. Diese Transformation geschieht mittels eines zweiten Nomens, das Aristoteles 'fremd' nennt20, und das durch eine Ähnlichkeitsbeziehung mit dem zu übertragenden Nomen zusammenhängt. Damit wird die Metapher als Abweichung vom gewöhnlichen Wortgebrauch definiert. Hier droht bereits die zweite Sackgasse. Denn von der Vorstellung eines gewöhnlichen Sprachgebrauchs zu dem Gedanken einer unfigürlichen und eigentlichen Wortbedeutung ist es nur ein kleiner Schritt. Für die Metapher folgt daraus jedoch die Gleichsetzung mit einem deviant-uneigentlichen Wortgebrauch. Demnach würde die Metapher in der Ersetzung des eigentlichen durch einen uneigentlich-übertragenen Wortsinn bestehen. Daraus ergibt sich aber zwanglos die metaphernkritische Forderung nach Rückübersetzung, bzw. nach Vermeidung metaphorischen Sprachgebrauchs. Ein aus der 'Nomentheorie' und der 'Theorie der eigentlichen Bedeutung' sich ergebendes drittes Moment der Verkennung ist die Vorstellung von der Metapher als einem Ergebnis von Substitution. Dabei konvergiert der semantische Informationswert der Metapher gegen Null, ihre Funktion wird zur bloßen Dekoration degradiert. Die Metapher stellt kein Mittel zur Neubeschreibung dar, sondern dient lediglich der freien Variation über einen schon vorher feststehenden Sachverhalt. Was man später in der Geschichte der philosophischen Interpretation in kritischer Absicht als 'bloße Rhetorik der Metapher' anführen wird, speist sich immer aus einer unterschiedlichen Melange dieser drei folgenschweren Irrtümer: a) der Nomentheorie, b) der Theorie der eigentlichen und wörtlichen Bedeutung und c) der Substitutionstheorie. Wie aber sehen die Alternativen aus, die nach einer Interpretation 'gegen den Strich' ebenfalls im aristotelischen Opus angelegt sind? Eine Interpretation der aristotelischen Definition der Metapher fördert nämlich auch Aussagen zu Tage, die geeignet sind, jene dreifache theoretische Beschränkung im Ansatz zu überwinden. Zum einen wird die Funktion der Metapher bei Aristoteles selbst mit einer Bewegungsmetapher beschrieben. Der Prozeß der BedeutungsVeränderung wird als έπιφορά bezeichnet. Damit verlagert sich das theoretische Interesse von der Klasse der Figuren zum Prozeß der Figur als solcher. Die Bedeutungsveränderung als Bewegung der Übertragung ist hinsichtlich ihrer formalen Struktur dazu in der Lage, auch den Gegenstandsbereich des Nomens zu überschreiten. In der Bezeichnung der Metapher als μεταφορά bzw. έπιφορά wird somit exemplarisch deutlich, was sich für die gesamte Metaphernforschung bestätigen läßt, daß es unmöglich ist, von der Metapher 20
μεταφορά δέ έστιν ονόματος άλλοτρίου έπιφορά, Aristoteles, Poetik 1457b 6.
20
Die lebendige Metapher
unmetaphorisch zu sprechen. Die Definition der Metapher ist selbstreflexiv. Zumindest für die Metapher selbst scheint damit die These ihrer Ersetzbarkeit durch einen eigentlichen Ausdruck widerlegbar. Die Selbstrekurrenz der Metapher verhindert angesichts ihrer Funktion als Übertragung, von der einfachen Unterscheidung zwischen wörtlicher und übertragener Bedeutung auszugehen. Denn einen „metaphernfreien Ort, von dem aus man die Metapher und alle sonstigen Redefiguren wie ein dem Blick vorliegendes Spiel betrachten könnte, gibt es nicht. "2I Indem zum anderen das zur Übertragung herangezogene Nomen als 'fremd' bezeichnet wird, tritt nicht nur der negative Aspekt einer Abweichung, sondern zugleich auch der positive Vorgang einer Entlehnung in den Blick. Das Fremde ist nicht das ganz Andere, sondern läßt einen konkreten Ursprungsbereich erkennen. Der affirmative Aspekt der Entlehnung aber fordert ebensowenig einen Übergang zu der Annahme einer 'eigentlichen Bedeutung', wie zu der Unterstellung einer 'bloßen Substitution'. Vielmehr hat sich an den Aspekt der Entlehnung als einer positiven Beziehung zwischen zwei Kontexten eine Theorie der Wechselwirkung anzuschließen, die geeigneter ist, die Funktion der Metapher zu erfassen. Im Anschluß an die einheitliche Funktionsbestimmung der Metapher als έπιφορά gibt Aristoteles eine kurze Typologie der Metapher: „...entweder von der Gattung auf die Art oder von der Art auf die Gattung oder von einer Art auf eine andere oder gemäß der Analogie"22. Damit wird der Relationsbereich der Übertragung, also der Ursprungsort der Entlehnung und der Zielort der Applikation auf der Ebene der Kategorialität lokalisiert. Das Wesen der Übertragung muß demnach als Verletzung einer kategorialen Ordnung verstanden werden. Aus diesem Grund kann die Metapher auch als 'categorymistake' (G. Ryle23) beschrieben werden, jedoch nicht in dem Sinne eines unbeabsichtigten Fehlers, sondern einer 'gezielten Kategorienüberschreitung'. Wenn Metaphern in diesem Sinne als „kalkulierte Absurditäten"24 bestimmt werden, ergeben sich Möglichkeiten, sie nicht nur als dekorative Variation, sondern als produktive Neubeschreibung der Wirklichkeit zu interpretieren. Das Durcheinandergehen der Klassifizierung markiert nicht nur die logischen Kosten des metaphorischen Prozesses, sondern auch den semantischen und kategorialen Gewinn. Mit dem instruktiven Gedanken einer bewußten Kategorienüberschreitung verbinden sich deshalb drei Interpretationshypothesen, welche für eine Theorie der lebendigen Metapher zugleich als Arbeitshypothesen zu verstehen sind.
Ricoeur, lebendige Metapher, S. 23. Aristoteles, Poetik 1457b 7-9. Gilbert Ryle: The Concept of Mind, London 1949; dt. Stuttgart 1969. Christian Strub: Kalkulierte Absurditäten. Versuch einer historisch reflektierten sprachanalytischen Metaphorologie, Freiburg/München 1991.
Die Semiotik der Metapher
21
Der metaphorische Prozeß ist erstens ein relationales Phänomen, d. h. es sind immer zwei Ideen notwendig, um eine Metapher zu schaffen. Gezielte Verwechslung und kalkulierter Irrtum machen aus der Metapher ein diskursives Phänomen, das Destabilisierung in einem komplexen Beziehungsgeflecht bewirkt, weil es für jede bestehende Klassifikation eine Bedrohung darstellt. Entscheidend ist dabei jedoch weniger der negative Aspekt einer logisch-kategorialen Abweichung oder Ablenkung, sondern vielmehr der positive Aspekt einer neuen Sinn- und Bedeutungsproduktion. Zweitens könnte der Umstand, daß die Metapher Sinn und Bedeutung produziert, für das davon betroffene kategoriale Ordnungsgefüge bedeuten, „daß die Metapher eine Ordnung nur auflöst, um eine andere zu erfinden" 25 , daß also „die Kategorienverwechslung nur die Kehrseite einer Logik der Entdeckung ist".26 Die Metapher hätte demnach nicht nur eine ordnungskritische, sondern ebenso eine ordnungskreative Funktion. „Die Kategorienverwechslung wäre damit das dekonstruktive Zwischenspiel zwischen Beschreibung und Neubeschreibung." 27 Dieses Verständnis einer heuristischen Funktion der Metapher würde die diametrale Gegenthese zu einer ornamentalen Schmucktheorie bedeuten, wie sie sich aus der Substitutionstheorie ergibt.28 Die dritte und weitreichendste Schlußfolgerung, die sich an die bisherigen Überlegungen anschließt, beruht darin, die Metapher nicht nur als ordnungskritisches und ordnungskreatives Verfahren zu verstehen und dabei immer noch eine unmetaphorische, 'eigentliche' Sprachordnung vorauszusetzen, sondern - nach einem Gedanken H.-G. Gadamers 2 ' - die 'ursprüngliche Metaphorik' bei jeder Entstehung von sprachlicher Ordnung zu bedenken, mithin die 'ordnungskonstitutive Funktion' der Metapher zu vertreten. Diese starke Lesart der Metapher als Mittel einer eigenständigen Kombinatorik und Heuristik stellt den Angel- und Zielpunkt der Ricoeurschen Metaphernhermeneutik dar.
26 27 28
29
Ricoeur, lebendige Metapher, S. 28. Ebd. Ebd. Die Interaktionstheorie der Metapher verknüpft die logische Form und die kognitive Funktion der Metapher dergestalt, daß der logische Widerspruch durch die Metapher überbrückt wird, indem sie neue Konnotationen freisetzt. „'Logische Absurdität' charakterisiert den kontextuellen Effekt der Metapher ex negativo, indem sie den kreativen Konflikt, den die Metapher provoziert, logisch reduziert" (Anselm Haverkamp (Hg.): Theorie der Metapher, Darmstadt 1983, S. 11). Kurz: „Die kognitive Funktion des metaphorischen Konflikts erklärt den Erfolg der Metapher." (ebd.). Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, 2. Aufl., Tübingen 1965, S. 71.
22
Die lebendige Metapher
2. Die Semantik der Metapher In einem zweiten Untersuchungsgang, der direkt aus der griechischen Antike in die Neuzeit springt und in der modernen Sprachwissenschaft angesiedelt ist, erfolgt der Nachweis, daß eine rhetorisch-semiotische Metapherntheorie der Denomination auf der Ebene des Wortes ungenügend bleibt und von sich aus zu einer semantisch-diskursiven Metapherntheorie der Prädikation auf der Ebene des Satzes hinaustreibt. Das Bindeglied zwischen Wort- und Satzebene bildet die Strukturdefinition des metaphorischen Prozesses als Sinnverschiebung oder Bedeutungsveränderung sowie deren Kontextabhängigkeit. Die „Untersuchung der Sinnbeanspruchung" 30 , welche die Übertragung eines Nomens hervorbringt, sprengt den engen Bezugsrahmen des Wortes und zwingt dazu, „die Aussage als die Kontextform zu betrachten, in der allein die Sinnübertragung stattfindet." 31 Statt von der 'Metapher' wird deshalb im folgenden auch von der 'metaphorischen Aussage' die Rede sein. Zunächst fallt jedoch auf, daß die gesamte neuere strukturale Linguistik von F. de Saussaure bis zu R. Jakobson in ihrem Verständnis der Metapher nicht über die Auffassung der klassischen Rhetorik hinausgeht, derzufolge die Metapher ein Tropus bzw. eine Figur ist, welche nur ein Wort umfaßt. Der Grund dafür liegt in einer Beschränkung des methodischen Ausgangspunktes auf einen semiotischen Monismus, demzufolge sich alle Strukturebenen der Sprache unter dem einheitlichen und homogenen Aspekt ihrer Zeichenhaftigkeit zusammenfassen lassen. Diesem semiotischen Monismus entspricht ein Primat des Wortes in der Metapherntheorie, der die Metapher im Rahmen der klassischen Substitutionstheorie nur als Lehnwort für ein fehlendes passendes Wort begreift. Indem die Metapher auf diesen Aspekt der Abweichung von einer eigentlichen Wortbedeutung reduziert wird, kann sie nicht als genuine Aussageform einer ungewöhnlichen Prädizierung auf der Ebene des Satzes oder der ganzen Rede begriffen werden. Dies wird vielmehr erst dann möglich, wenn man den Saussureschen Monismus des Zeichens durch einen Dualismus des Semiotischen und des Semantischen ersetzt, wie er etwa durch den Sprachwissenschaftler E. Benveniste32 etabliert wurde. Benveniste unterscheidet die Sprache hinsichtlich der Redeeinheiten oder Sätze und der Spracheinheiten oder Zeichen. Im Bereich der Metapherntheorie kommt damit statt der alten Substitutionstheorie eine Theorie der Wechselwirkung zur Geltung, welche nicht die Ersetzung eines Wortes durch ein anderes fordert, sondern die gegenseitige Anregung
30 31 32
Ricoeur, lebendige Metapher, S. 118. Ebd. Emile Benveniste: Problèmes de linguistique générale, Paris 1966 (dt. München 1974).
Die Semantik der Metapher
23
und wechselseitige Durchdringung zweier Begriffe bzw. zweier Begriffskontexte zur Geltung bringt. 2.1 Metapher und Semantik der Aussage Um zu zeigen, inwiefern eine am Wort orientierte Semiotik der Metapher an dem Punkt der Sinnveränderung oder Bedeutungsverschiebung über sich hinaus auf die Ebene des Satzes verweist, lehnt sich Ricoeur an die strukturale Wortsemantik St. Ullmanns33 an. Dieser geht in der Nachfolge Saussures von dem Wort als elementarem Träger des Sinnes aus. Das Wort darf zwar nicht vom Satz getrennt werden, noch weniger geht es jedoch in seinem Kontext auf. Vielmehr hat jedes Wort einen hard core an bleibender Bedeutung, weil es möglich ist, den Sinn eines isolierten Wortes zu verstehen und beispielsweise in Wörterbüchern zu erfassen. Doch bereits bei dieser Beziehung des einzelnen Wortes bzw. Namens zu seinem Sinn, erzwingt das Phänomen der lexikalischen Mehrdeutigkeit die Annahme einer polysemischen Name-Sinn-Beziehung, denn „auf einen Namen kommt mehr als ein Sinn"34. Diese Polysemie der Name-Sinn-Beziehung führt Ullmann auf die allgemeine vagueness der Sprache zurück. Demnach hat die lexikalische Struktur der Sprache nur einen geringen systematischen und eindeutigen Charakter, weshalb immer eine nähere Unterscheidung durch den Kontext erforderlich wird. Außerdem hat die lexikalische Mehrdeutigkeit ihren Grund neben der allgemeinen Vagheit der Sprache in der spezifischen Kumulationsfahigkeit der Worte. Jede semantische Neuschöpfung setzt diese kumulative Potenz voraus. Die Möglichkeit von Sinnveränderung gründet letztlich in dieser Eigenschaft der Sinnkumulierung. Die fehlende Eindeutigkeit der Name-Sinn-Beziehung und die Fähigkeit der Worte, mehr als einen Sinn in sich zu vereinigen, bekunden die Unzulänglichkeit der isolierten Wortanalyse und verlagern die Kriterien zur Sinnbestimmung auf die Ebene des Kontextes. Hinzu kommen zwei weitere Eigenschaften der Sprache auf der Ebene ihrer elementaren Bestandteile, die eine semantische Betrachtungsweise erfordern. Jedes mehrschichtige Bedeutungsfeld grenzt nämlich an ein darüber hinausgehendes Assoziationsfeld von Worten, die mit der jeweiligen Bedeutung durch Beziehungen der sachlichen Angrenzung oder der strukturellen Ähnlichkeit auf der Ebene des Namens oder des Sinnes verbunden sind. Jede Sinnveränderung und damit auch jede semantische Neuschöpfung zehrt in der Hauptsache von diesem angrenzenden Assoziationsfeld. Schließlich gilt es, neben dem reinen Bezeichnungswert der Worte die zahlreichen emotive overtones, die emotionalen Ausdruckswerte zu berückStephen Ullmann: The Principles of Semantics, Glasgow/Oxford 1951; Ders: Semantics. An Introduction to the Science of Meaning (1962), Oxford 1967. Ricoeur, lebendige Metapher, S. 67.
24
Die lebendige Metapher
sichtigen, die bei jeder Verwendung zusätzlich mitschwingen und die NameSinn-Beziehung um einen weiteren Aspekt anreichern. Dieses vielfaltige Netz von Bedeutungs- und Referenzstrukturen bezeichnet Ulimann als „die unendliche Komplexität der semantischen Beziehungen".35 Was folgt daraus für die Metapher? Polysemie, Assoziationsfelder und emotionale Ausdruckswerte lassen den metaphorischen Prozeß als Sinnveränderung hervortreten, der prinzipiell über den Bezugsrahmen des einzelnen Wortes hinausweist. Vielmehr ermöglicht erst die Beachtung des Kontextes, 'die unendliche Komplexität der semantischen Beziehungen' und deren Sinnverschiebungen in den Blick zu bekommen. Die Metapher kann von daher nur als worttranszendierendes Phänomen voll erfaßt werden.36 Sie läßt sich nicht auf eine lexikalische Veränderung zurückführen, sondern stellt eine kontextuelle Bedeutungsveränderung dar.37 Bereits im Rahmen einer am Wort und seiner festen Bedeutung orientierten Semantik ergibt sich die Notwendigkeit einer Überwindung des Zeichenmonismus. Das Wort bleibt ohne den Kontext unvollständig, auch wenn es nicht restlos in ihm aufgeht. Polysemie und Kontextwerte bezeichnen den internen Verweisungscharakter des Wortes auf den Satz und die Rede. Damit wird die Metapher als Aussagephänomen zum Untersuchungsgegenstand. Das heißt nicht, daß die Metapher als Wortphänomen erledigt wäre. Das Wort bleibt als Träger des metaphorischen Sinneffektes, genauer als dessen focus bestehen. Der focus wird jedoch unzureichend bestimmt, ohne den ihn umgebenden Rahmen.38 Damit ist Ricoeur bei einer wechselseitigen Durchdringung zweier Betrachtungsweisen angelangt: So wie das Wort der Kontextualisierung durch die Aussage, bedarf diese der Fokussierung durch das Wort. Dabei zeigt sich, daß die Metapher ein Schwellenphänomen κατ' έ ξ ο χ ή ν zwischen Wort und Satz darstellt. Daraus resultiert letztlich auch die Schwierigkeit, das Phänomen des Metaphorischen unter linguistischen Bedingungen zu identifizieren. Der Weg über die Analyse metaphorischen Sprachgebrauchs in alltagssprachlichen Verwendungszusammenhängen scheint deshalb weiterzuführen.
Ullmaiin, Semantics, S. 63; zit. bei Ricoeur, lebendige Metapher, S. 67. F. Prammer (Die philosophische Hermeneutik Paul Ricoeurs in ihrer Bedeutung für eine theologische Sprachtheorie, Innsbruck/Wien 1988) weist darauf hin, daß Ricoeur nicht den beliebten Fehlschluß zieht, aus dem Phänomen der Polysemie folge die allgemeine Metaphorizität der Sprache überhaupt (ebd., S. 95). Vgl. Paul Ricoeur: Die Metapher und das Hauptproblem der Hermeneutik, in: Haverkamp, Theorie der Metapher, S. 356-375, ebd., S. 361. Zu Fokus und Rahmen s. u. S. 28.
Die Semantik der Metapher
25
2.2 Metapher und Semantik der Rede Im Unterschied zur französischen Tradition der struktural-linguistischen Sprachanalyse setzt ein breiter Strom der angelsächsischen semantischen Sprachphilosophie direkt am Phänomen der Rede, bzw. des natürlichen Sprachgebrauchs (ordinary language) an. Im Interesse an einer disziplinenund schulübergreifenden Forschung jedoch beurteilt Ricoeur den unvermittelten Ansatz bei der Rede als ein Überspringen der notwendigen semiotischlinguistischen Untersuchungsebene, auch wenn - wie gerade Ricoeur selbst betont - nicht bei dieser stehengeblieben werden darf. Aus diesem Grund geht Ricoeur einen indirekten Weg, der sich den anvisierten Fragestellungen und Ergebnissen der Semantik erst durch das Nadelöhr der Semiotik nähert. Das gleiche gilt für den dritten Schritt von der Semantik zur philosophischen Hermeneutik. Auch hier würde sich ein direkter Einsatz bei übergreifenden texthermeneutischen Intentionen den klärenden Diskussionsmöglichkeiten mit ihren konkurrierenden Diskursnachbarn berauben und die differenzierten Einsichten der linguistischen und semantischen Einzelwissenschaften einer zwar bestechenden, aber abstrakten und harmonisierenden Problemlösung opfern.3® Im nächsten Schritt sollen jedenfalls die Ergebnisse der sprachphilosophischen Semantik mit den Einsichten aus der linguistischen Semiotik vermittelt werden. Ausgehend von E. Benvenistes Unterscheidung zwischen Semiotik und Semantik tritt das Phänomen der Rede in ihrer Grundeinheit als Satz in Erscheinung. Der Satz aber „bildet eine Gesamtheit, die sich nicht auf die Summe seiner Teile reduziert. "40
2.3 Metapher und semantische Rhetorik Die Initialzündung für die Aufnahme des Metaphernbegriffs in die angelsächsische sprachanalytische Semantik lieferte I. A. Richards41. Mit dem Titel 'The Philosophy of Rhetoric' (1936) greift er zunächst auf die philosophische Rhetorik-Kritik seit Bacon zurück, um sie ihrerseits der Metakritik zu unterziehen. Ein modifiziertes Verständnis von Rhetorik soll ihrer Verachtung entgegentreten und im Gegenzug die Philosophie der Naivität hinsichtlich ihrer eigenen Rhetorizität überführen. Zu diesem Zweck vollzieht Richards 39
40 41
Dennoch wird Ricoeur gerade dieser Vorwurf von Haverkamp (Theorie der Metapher, S. 6) und Georg Schöffel (Denken in Metaphern. Zur Logik sprachlicher Bilder, Opladen 1987, S. 3f.) gemacht, weil er besagte Diskurse nicht alternativ nebeneinander stehen läßt, sondern in einen zwar systematischen, aber ahistorischen Problemverlauf stellt. Ricoeur, lebendige Metapher, S. 121. In der folgenden Darstellung orientiere ich mich an der deutschen Übersetzung aus 'The Philosophy of Rhetoric' bei Haverkamp, Theorie der Metapher, S. 31-52, sowie seiner Einleitung, ebd., S. 7ff.
26
Die lebendige Metapher
eine kommunikationstheoretische Wende in der Rhetorik und gewinnt seinen Maßstab nicht mehr am erfolgreichen persuasiven Akt, sondern an der Unterscheidung zwischen gelungener bzw. mißlungener Kommunikation. Rhetorik stellt demnach kein doktrinäres Argumentationsmanagement unter dem Erfolgsprinzip der Überzeugung dar, sondern formiert sich zu einer kritischen Theorie der Kommunikation mit dem Ziel der Behebung kommunikativer Schwächen und Verluste/ 2 Aufgabe der Rhetorik „should be a study of misunderstanding and its remedies".43 Als Mittel zum Zweck des Auffindens und Vermeidens von Mißverständnissen dient eine Untersuchung der Funktionsweise der Wörter in der Rede. Wesen und Wirken der Rhetorik sollen mit Hilfe der Semantik rehabilitiert werden. Richards leitet seinen Ansatz zu einer semantischen Philosophie der Rhetorik durch einen gezielten Angriff gegen die Hauptunterscheidung der klassischen Rhetorik zwischen eigentlichem und bildlichem Sinn ein. Den 'Aberglauben an die eigentliche Bedeutung' ersetzt er durch eine kontextuelle Sinntheorie. Das dabei zugrundeliegende 'Theorem der Kontextgebundenheit der Bedeutung' („context theorem of meaning"44) bildet den Ausgangspunkt für eine Semantik, die von „der wechselseitigen Beseelung der Wörter im lebendigen Aussageakt"45, der 'interanimation of words' ausgeht. Im Rahmen dieses dynamischen Beziehungsgeschehens kann es keine feste und bleibende Bedeutung der Wörter ohne Rücksicht auf ihre Verwendung im Kontext geben, das bedeutet: „...what a word means is the missing parts of the contexts from which it draws its delegated efficacy".46 Vielmehr zeichnen sich die durch den lebendigen Aussageakt allererst in ihrer Bedeutung konstituierten Wörter durch Überdeterminiertheit aus.47 Worte können niemals nur für sich verstanden werden, sondern existieren immer schon als abgekürzte Kontexte, bzw. als Kontextverweisungen. Sinnkonstanz gibt es nur als Konstanz der Kontexte. Diese Semantik des lebendigen Aussageaktes bildet wiederum den Ansatzpunkt für eine positive Beurteilung der Metapher. Denn gerade die Metapher erlaubt es, neue Beziehungen zwischen den Dingen zu sehen, d. h. die kontextuellen Verweisungsstrukturen der Wörter neu miteinander zu verbinden und somit neue Wortverbindungen und neue Kontexte zu schaffen. Insofern darin ein Hauptmerkmal der Sprache und des Denkens besteht, rük-
43 44 45 44 47
Vgl. Haverkamp, Theorie der Metapher, S. 7. Richards, Philosophy of Rhetoric, S. 3. Ebd., S. 40. Ricoeur, lebendige Metapher, S. 137. Richards, Philosophy of Rhetoric, S. 35. Das Phänomen der Vieldeutigkeit wird dabei nicht als Mangel, sondern als ein konstitutives Kennzeichen der Sprache angesehen. Wissenschaft und Poesie unterscheiden sich darin nur graduell, das heißt sie stellen die Endpunkte einer Skala dar, deren Mitte der alltägliche Sprachgebrauch bildet (vgl. Schöffel, Denken in Metaphern, S. 129).
Die Semantik der Metapher
27
ken bei Richards Denken, Sprache und Metapher eng zusammen.48 „Denken ist metaphorisch und verfährt vergleichend; daraus leiten sich die Metaphern der Sprache her." 4 ' Das Verstehen der Metapher fungiert als Paradigma für das Verstehen der Sprache überhaupt. Im Anschluß an P. Shelley versteht Richards die Sprache als „vitally metaphorical".50 Anstatt als Abweichung von den gewöhnlichen Operationen der Sprache zu gelten, wird die Metapher als eine ihrer konstitutiven Funktionen angesprochen. Diese Konstitutionsfunktion beruht auf dem 'Theorem der Kontextgebundenheit der Bedeutung'. Weil die Worte nicht durch eine vorausgesetzte Bedeutung definiert sind, sondern erst im Vollzug des Aussageaktes aus ihrer Überdeterminiertheit in einen konkreten Bedeutungskontext überführt werden, kann man sagen, daß das Prinzip der Metapher auf der Konstitution der Worte beruht, indem sie zwei Gedanken verschiedener Dinge zusammenhält. Insofern kann die Metapher auch als „the omnipresent principle of language"51 verstanden werden. Sie vollzieht sich in den Tiefen der Wechselwirkung zwischen den Worten, und das heißt, „daß die Metapher in einer einfachen Bedeutung zwei verschiedene fehlende Teile der verschiedenen Kontexte dieser Bedeutung zusammenhält. Es handelt sich also nicht mehr um eine bloße Verschiebung der Worte, sondern um einen Austausch zwischen Gedanken, um eine Transaktion zwischen Kontexten".32 In Anlehnung an einen Ausspruch von S. Johnson versteht Richards die Metapher als Verbindung zweier Vorstellungen, als Interaktion zweier kopräsenter Gedanken. Die Metapher „is a borrowing between an intercourse of thoughts, a transaction between contexts."53 Den kontextuellen Bedeutungstransfer bestimmt Richards dabei als Erfassen eines zugrundeliegenden Kontextes, den er tenor nennt, durch einen zweiten Kontext, der als vehicle bezeichnet wird. Deren doppelteinheitliches Endprodukt („double unit"54) ist die Metapher, denn was diese hervorbringt, ist das gleichzeitige Vorhandensein von tenor und vehicle einschließlich ihrer Wechselwirkung. Daraus resultiert die Verabschiedung des Ähnlichkeitsaxioms und damit jeder Form der Vergleichs- oder Substitutionstheorie55.
48
Daran schließen v. a. auch G. Lakoff und M. Johnson (Metaphors We live by, Chicago/London 1980) an (vgl. Kap. 2). 49 Richards, bei Haverkamp, Theorie der Metapher, S. 35. 50 Ricoeur, lebendige Metapher, S. 138. 51 Richards, bei Haverkamp, Theorie der Metapher, S. 7. 52 Ricoeur, lebendige Metapher, S. 139. 53 - Richards, Philosophy of Rhetoric, S. 94. 54 Ebd., S. 96. ss Letztere nimmt an, daß Bildspender und Bildempfänger unterschieden werden können, und somit eine eindeutige Übertragungsrichtung gegeben sei. Demgegenüber geht die Interaktions-, oder Wechselwirkungstheorie davon aus, daß die Übertragungsrichtung
28
Die lebendige Metapher
„Wir dürfen nicht in Übereinstimmung mit dem 18. Jahrhundert annehmen, daß die Interaktionen von Tenor und Vehikel an ihre Ähnlichkeit [resemblance] gebunden sein müssen. Es gibt auch Wirkung durch Disparität."58 Richards vertritt nicht nur eine Theorie der metaphorischen Wechselwirkung, sondern auch eine Theorie der metaphorischen Spannung (tension). Das Verständnis der Metapher als Interaktion zwischen tenor und vehicle hat M. Black in seinem klassischen Text 'Metaphor'57 aufgenommen und weitergeführt. Black stellt die Frage nach der 'logischen Grammatik' der Metapher. Dabei bestimmt er die Mikrostruktur der metaphorischen Aussage jedoch etwas anders als Richards. Den Ausgangspunkt bildet auch bei ihm die vollständige Aussage, also die Satzebene, wobei sich jedoch die metaphorologische Aufmerksamkeit auf ein besonderes Wort bzw. einen besonderen Ausdruck richtet. Nicht die interaktive Überschneidung gleichwertiger Kontexte, sondern das Schweben des metaphorischen Sinnes zwischen einem bestimmten Wort bzw. Ausdruck und dem ihn umgebenden Rahmen charakterisiert Blacks Grundmodell. Die metaphorische Aussage ist kein irgendwie geartetes Beieinandersein zweier verschiedener 'Gedanken' oder 'Vorstellungen', sondern das Beieinandersein von sowohl metaphorisch als auch unmetaphorisch gebrauchten Wendungen in einer Aussage. Die metaphorisch gebrauchten Worte nennt Black focus, den unmetaphorischen Rahmen frame. Der metaphorisch gebrauchte focus gewinnt im unmetaphorischen frame eine neue Bedeutung, die weder der Bedeutung seiner wörtlichen Verwendung, noch der Bedeutung eines wörtlichen Substituts entspricht. Vielmehr bewirkt der neue Kontext beim focus eine Erweiterung des Bedeutungsumfangs. Damit wird das Phänomen der Fokussierung deutlicher herausgestellt als in der Terminologie von Richards, der von zwei gleichwertigen Größen eines im ganzen metaphorisch qualifizierten Ausdrucks ausgeht. Um das metaphorische Gefälle stärker hervorzuheben spricht Black auch von einem rahmenden 'Hauptgegenstand' und dem 'untergeordneten Gegenstand' des focus. Black macht sich dabei jedoch keines Rückfalls in die Nomen-Theorie schuldig. Vielmehr ergibt sich der metaphorische Gebrauch des focus, und somit die metaphorische Aussage, erst aus dem Verhältnis zwischen focus und frame. Kontextualisierung und Fokussierung spielen eine gleichbedeutende Rolle und lassen sich nicht aufeinander zurückführen. Dem Verhältnis zwischen focus und frame entspricht wie bei den anderen Semantikern der
innerhalb einer Metapher mehrfach wechseln kann (vgl. dazu auch Schöffel, Denken in Metaphern, S. 135). Richards, bei Haverkamp, Theorie der Metapher, S. 50. Zuerst in: Proceedings of the Aristotelian Society 55 (1954), S. 273-294; wieder abgedruckt in: 'Models and Metaphors', Ithaka 1962, S. 25^7.
Die Semantik der Metapher
29
Metapher eine Theorie der Wechselwirkung. Genauer: Black konzipiert eine Interaktionstheorie der Metapher, wie sie für viele Metapherntheoretiker bestimmend wird. Er begreift die metaphorische Interaktion als einen Vorgang, in dem der focus den Rahmen nicht um seine gängige lexikalische Bedeutung ergänzt, sondern mittels eines Systems assoziierter Gemeinplätze („system of associated comonplaces"58) überformt und neu beschreibt. Durch einen Filter- oder Schirmeffekt3' schaltet der focus bestimmte Bedeutungen aus, akzentuiert andere und vermittelt eine neue Einsicht auf den Rahmen. Darin besteht der Beitrag der Metapher zu einer Logik des schöpferischen Denkens. An die Stelle des Informationsdefizits im Gefolge von Substitutions· und Vergleichstheorie tritt der Erkenntnisgehalt der Metapher infolge einer Theorie der Wechselwirkung. In einem 7-Punkte-Programm faßt Black seine Überlegungen zur Interaktionstheorie zusammen: 1. Eine Metapher besteht aus zwei Teilen, die nicht gleichwertig sind, sondern als Hauptgegenstand (frame) und untergeordneter Gegenstand (focus) die metaphorische Aussage bilden. Diese irreduzible Doppelheit der Metapher scheidet eine Substitutionstheorie aus. 2. Die beiden Teile stellen keine einzelnen 'Dinge', sondern vielmehr 'Systeme von Dingen', also Kontexte dar, wodurch eine Nomen-Theorie ausgeschlossen wird. Damit geht Black nach seiner eigenen Einschätzung über Richards hinaus, der von einem Beieinander zweier 'Gedanken' oder 'Vorstellungen' ausgegangen war.60 3. Beim metaphorischen Prozeß wird auf den Rahmen (frame, Hauptgegenstand) ein 'System von assoziierten Implikationen' übertragen, welche kennzeichnend für den untergeordneten Gegenstand (focus) sind. 4. Diese Implikationen sind Gemeinplätze und Topoi über den focus oder auch ad-hoc-Assoziationen. 5. Die Metapher als Resultat der Interaktion zwischen focus und frame modifiziert den Hauptgegenstand durch den untergeordneten Gegenstand. 6. Aber auch das System des focus erfährt dadurch Bedeutungsverschiebungen, welche Black die 'untergeordneten Metaphern' im Unterschied zu den eigentlich 'emphatischen Metaphern' über den frame (Hauptgegenstand) nennt. 7. Dabei gibt es keine formalen Kriterien für das Funktionieren einer Metapher oder das Scheitern einer anderen, wie etwa eine zugrundeliegende bzw. nicht vorhandene Ähnlichkeit. Mit dieser These wird noch einmal eine Vergleichstheorie der Metapher verworfen. Im Zusammenhang einer Theorie der lebendigen Metapher bleibt jedoch in bezug auf Blacks Konzeption die Frage bestehen, wie es durch die Metapher zu einer wirklichen semantischen Innovation kommen kann, was die Interaktionstheorie doch verspricht. Leistet dies der Filtervorgang durch ein
59 60
Black, bei Haverkamp, Theorie der Metapher, S. 71. Vgl. Michael Pielenz: Argumentation und Metapher, Tübingen 1993, S. lOOff. Vgl. aber oben S. 34, wo Richards thougts als contexts versteht, also nicht als vereinzelte Vorstellungen, sondern ebenfalls als Gedankenkomplexe.
30
Die lebendige Metapher
'System assoziierter Gemeinplätze'? „Ist dieses System nicht etwas Totes oder zumindest etwas bereits Etabliertes?"41 Das Ersetzen der lexikalischen Bedeutung des focus aus dem Fundus eines Assoziationsrahmens erweitert zwar den Bedeutungsspielraum des frame und der ganzen metaphorischen Aussage. Aber ein begrenztes und endliches Spektrum von Variationsmöglichkeiten, wie es die Begriffe 'System' und 'Gemeinplatz' nahelegen, wird dabei nicht überschritten.62 Eine Logik des schöpferischen Denkens erfordert mehr. Die wirklich innovative Metapher kann keinem System von assoziierbaren Implikationen entspringen. Das hieße nämlich, die Metapher nur der Topik zuzuordnen und sie damit letztlich wieder dem Herrschaftsbereich der rhetorischen Substitution zu unterwerfen. Statt die Quelle der metaphorischen Übertragung in einem vorhandenen System von Konnotationen zu verorten, läßt sich Ricoeur deshalb durch die These leiten, „daß die metaphorische Attribution wesentlich in dem Aufbau des Netzes von Wechselwirkungen besteht, das einen bestimmten Kontext zu einem aktuellen und einzigartigen macht. Die Metapher ist dann ein semantisches Ereignis, das am Schnittpunkt mehrerer semantischer Felder eintritt"*3. Nicht die Variation im Rahmen eines bestehenden Pools von Kontexten, sondern die Produktion eines neuen Kontextes unter Heranziehung unterschiedlicher Wortfelder macht die metaphorische Innovation aus. Diese zentrale Definition der Metapher wird im Auge zu behalten sein. Die Frage nach der semantischen Innovation und dem semantischen Ereignis der schöpferischen Metapher führt zu einer Hermeneutik der Metapher, die auch noch über den semiotisch-semantischen Fragehorizont hinausgeht. Exkurs: Bevor die Untersuchung in dieser Richtung fortschreitet, verdient noch ein weiterer semantischer Zugang zur Metapher Erwähnung. Im Zusammenhang seines Versuchs einer umfassenden Grammatik der Bildrede unterzieht P. Michel64 auch die metaphorische Rede einer differenzierten Analyse. Im Unterschied zu Ricoeur bestimmt er die Metapher auf der linguistischen Ebene jedoch ausschließlich als Wortphänomen: „Eine Metapher ist grob gesagt ein in einem Satz schief verwendetes Wort (...) Das 'Kaliber' der Metapher ist also das Wort-im-Satz."63 Dennoch erweitert Michel den semantischen Untersuchungsrahmen, inso61
ω
63 u
65
Ricoeur, Die Metapher und das Hauptproblem der Hermeneutik, bei Haverkamp, Theorie der Metapher, S. 365. Vgl. das Statement von Pielenz: „Prinzipiell ist daher jede ad hoc-Metapher [=lebendige Metapher, M.B.], wie originell auch immer sie sein mag, vorhersagbar." (Argumentation und Metapher, S. 84). Ricoeur, lebendige Metapher, S. 165. Paul Michel: Alieniloquium. Elemente einer Grammatik der Bildrede (Zürcher germanistische Studien; Bd. 3), Bern 1987. Ebd., S. 157.
Die Semantik der Metapher
fem er sich vor allem für die Rezeptionsbedingungen interessiert, die zum Verständnis einer Metapher nötig sind. „Unsere Betrachtung ist hörerseitig ausgerichtet; wir begnügen uns damit zu sehen, wie der Hörer die Sprecherintention rekonstruiert und kümmern uns nicht darum, ob er dabei die wirkliche Intention des Sprechers trifft."" Nach Michel kommen bei der Exegese einer Metapher simultan vier Stratageme zum Einsatz: 1. Ein Diagnoseverfahren, das feststellt, „ob überhaupt und an welcher Stelle im Text ein Element 'uneigentlich' gebraucht wird."" Den Anlaß dazu liefert ein Gefühl der Regelverletzung, wobei der common sense als Kriterium dient. Dieser setzt sich zum einen aus den sprachlichen Regeln und zum anderen aus einem bestimmten Weltwissen zusammen. Je nachdem, ob die Metapher mehr die innersprachlichen Regeln oder aber ein bestimmtes Weltbild verletzt, unterscheidet Michel zwischen Kontextmetaphern (Folge: Störung) und Denotatmetaphern (Folge: kein propositionaler Gehalt). 2. Eine Suchregel, die den Impuls zur Neuinterpretation gibt und bereits von Karl Bühler so formuliert wurde: „Wir machen beim normalen Sprechverkehr die durchaus begründete Voraussetzung, dass der Sprecher sinnvolle sprachliche Kompositionen bildet, und variieren bei schwer vereinbaren Redestücken probierend aus, wie sie am Ende doch noch ein Gefüge zulassen."68 Dieses experimentierende Verhalten basiert auf einem Vertrauensvorschuß, der dem Text trotz Störungen und Unstimmigkeiten Sinnhaftigkeit unterstellt. Wäre diese Bereitschaft nicht gegeben, würde metaphorische Rede sofort als bloßer Nonsense abgetan. 3. Eine Konjektur, mit der der Interpret den metaphorischen Ausdruck - ähnlich wie der Textkritiker eine verderbte Stelle bearbeitet. Dabei wird in einem ersten Teilschritt der Bedeutungsumfang des Rahmens abgesteckt (extensionale Bestimmung). In einem zweiten Teilschritt werden mögliche Aussagen über den focus probeweise auf den Rahmen projiziert (intensionale Bestimmung). „Nun hat der Interpret das, was der Text mit der Metapher meint, zwischen extensionaler und intensionaler Bestimmung in der Zange."69 Das Ergebnis der extensionalen Bestimmung entscheidet weiterhin über die Funktion der Metapher. Ist der Denotatbereich des Rahmens eng und besteht demzuEbd., S. 139. Ebd., S. 160. Zit. bei Michel ebd., S. 166. Ebd., S. 171.
32
Die lebendige Metapher
folge eine hohe Determinationserwartung auf Seiten des Hörers, so hat die Metapher eher eine ersetzbare ornato-Funktion. Ist er dagegen weit und die Determinationserwartung dementsprechend niedrig, so kommt der Metapher eine unersetzbare necessitasFunktion zu. Im zweiten Fall dient die Metapher der Auskundschaftung intensionaler Züge an dem extensional erst schwach bestimmten Rahmen. Die intensionalen Züge des focus werden zur Heuristik benutzt. 4. Schließlich ein Test auf den informativen und kommunikativen Mehrwert der Metapher. Er dient als Vergewisserung, ob die metaphorische Interpretation berechtigt und sinnvoll war. Zwei Ergebnisse sind möglich: a) die Metapher ergibt keinen Mehrwert, dann ist sie ersetzbar (ornatus-Funktion); b) die Metapher läßt das Explanandum in einem neuen Aspekt sehen, also ist sie nicht ersetzbar (necessitas-Funktion). An dieser Stelle ist jedoch der Einwand zu wiederholen, der bereits oben (S. 30f.) mit Ricoeur gegen Black ins Feld geführt wurde: Die Semantik der Metapher erkennt nicht die wirklich innovative und ordnungsstiftende Funktion der Metapher. Diese sprengt vielmehr den Rahmen vorgegebener Bezeichnungs- und Kombinationsregeln und schafft etwas Neues, das nicht nur einen bereits vorhandenen Ausdruck umschreibt oder eine vorhandene, als solche bereits vorher bewußte, semantische Lücke schließt. Diese Grenze aller semantischen Metapherntheorien überschreitet erst eine am umfassenden Phänomen der Metaphorizität orientierte Hermeneutik der Metapher.
3. Die Referenz der Metapher Mit der Frage nach dem Wirklichkeitsgehalt der Metapher schreitet die Untersuchung von der Ebene der 'sprachimmanenten Sinnproduktion' fort zur 'sprachtranszendierenden Referenz' der Metapher hinsichtlich ihres innovativen Entdeckungs- und Verwandlungsvermögens von Wirklichkeit. Mit der Unterscheidung von Sinn und Referenz schließt Ricoeur an G. Frege an, wobei er die Geltung dieser Unterscheidung nicht nur in den Grenzen der Logik, sondern prinzipiell für jede Rede behauptet, insofern sie nicht nur Zeichencharakter (Sinn) hat, sondern auch Verweisungsträger (Bedeutung) ist. Die Frage nach der Referenz erhebt sich dabei immer erst auf der Grundlage der Frage nach dem Sinn. Das betrifft nicht nur das Wort, sondern auch den Satz. „Wort und Satz sind also die beiden Pole derselben semantischen Einheit; nur zusammen haben sie Sinn (wieder im semantischen Ver-
Die Referenz der Metapher
33
stand) und Bedeutung (Referenz)."70 Mit der Ausweitung der Fragestellung von der Sinn- auf die Referenzfunktion wird auch eine Erweiterung der methodischen Untersuchungsperspektive notwendig. Darum wird die Semantik durch die Hermeneutik abgelöst bzw. ergänzt. „Das Postulat der Referenz fordert nun aber eine getrennte Bearbeitung, wenn es die besonderen Redeeinheiten betrifft, die man 'Texte' nennt, also Kompositionen von größerer Ausdehnung als dem Satz. Die Frage unterliegt dann eher der Zuständigkeit der Hermeneutik als der Semantik, für die der Satz zugleich die erste und die letzte Einheit ist".71 Die Hermeneutik lehrt, den Text als Werk zu verstehen, und leitet im Zuge ihrer Interpretationsarbeit von der formalen Struktur des Werkes über zu der dem Werk entspringenden Welt. Die „Hermeneutik ist nichts anderes als die Theorie, die den Übergang von der Struktur des Werkes zur Welt des Werkes regelt."72 Einen Text interpretieren heißt demnach, seine Welt entfalten, auf die er sich nicht zuletzt aufgrund seiner metaphorischen Form bezieht. Nicht die Intention des Autors, sondern die eigene Welt des Werkes bildet nach Ricoeur den Gegenstand der Hermeneutik.73 Um den eigentümlichen Charakter der metaphorischen Referenz klären zu können, macht sich Ricoeur zunächst das kritische „Plädoyer gegen die Referenz" zu eigen, wie es nicht nur von einer verkürzten Rhetorik, sondern auch von den Anhängern linguistischer und literaturkritischer Metapherntheorien (etwa R. Jakobson74 und N. Frye73) vertreten wird. Denn eine Analyse der poetischen Funktion der Sprache und der Metapher legt eine Auffassung des metaphorischen Sinnes nahe, die seine Referenz aufzuheben scheint. In dieser Richtung liegt die generelle Tendenz einer Literaturkritik (New Criticism), die um der reinen poetischen Funktion willen auf die Vernichtung der Referenz dringt. Die poetische Funktion der Sprache beruht demnach nicht in der Darstellung von etwas anderem, sondern in der Präsentation ihrer selbst. Poetische Sprache betont ihren Aussagegehalt 'for its own sake' (Jakobson). Darin macht sich gewissermaßen eine zentripetale Bewegung der Sprache auf sich selbst gegenüber einer zentrifugalen Bewegung in Richtung auf Referenz geltend. Zu dieser poetologischen Referenzkritik gesellt sich außerdem noch ein erkenntnistheoretisches Argument gegen die Referenz der Metapher qua poetischer Rede. Dieses beruht in der Unterschei70
Ebd., S. 212.
71
Ebd., S. 2 1 3 .
72
Ebd., S. 214. Damit nimmt er eine kritische Haltung gegenüber der romantisch-psychologischen Tradition von Schleiermacher bis zu Dilthey ein; vgl. dazu auch die Einleitung von P. Gisel, in: Ricoeur, Paul/JUngel, Eberhard: Metapher. Zur Hermeneutik religiöser Sprache, Sonderheft Evangelische Theologie, München 1974, S. 18. Roman Jakobson: Linguistics and Poetics, in: Style and Language, ed. Thomas Sebeok, Bloomington, Ind. 1978, S. 84-97. Northrop Frye: Anatomy of Criticism, Princeton 1957.
73
74
75
34
Die lebendige Metapher
dung zwischen deskriptiv-kognitiver und effektiv-emotionaler Sprache, wobei letztere nur als subjektive Innenseite des Affekts ohne äußere Realitätsentsprechung angesehen wird. Hier verankert Ricoeur seine Metakritik an der literaturkritischen Referenzkritik. Sieht man nämlich genauer zu, so zeigt sich, daß der Gegenstandsbezug der poetisch interpretierten Metapher gerade nicht wegfallt, sondern vielmehr mehrdeutig wird. Um diesen Vorgang genauer zu erfassen, führt Ricoeur den zentralen Begriff der 'verdoppelten Referenz' ein, mit dem er seine Auffassung von der metaphorischen Wahrheit näher zu bestimmen sucht. Die These „geht davon aus, daß die Suspension der Referenz im Sinne der Normen der deskriptiven Rede die negative Bedingung dafür ist, daß ein fundamentalerer Modus der Referenz hervortritt, der von der Interpretation expliziert werden muß"76. Der Prozeß, in welchem sich die Verdoppelung der Referenz ereignet, gestaltet sich wie folgt: Der Sinn einer metaphorischen Aussage ergibt sich zunächst aus dem Scheitern der wörtlichen bzw. gewöhnlichen Deutung. Indem sich der gebräuchliche Sinn selbst aufhebt, bricht auch die damit verbundene primäre Referenz zusammen. Die Krise des gewöhnlichen Sinnes und der primären Referenz stellt aber nur die negative Seite des metaphorischen Prozesses dar. Der Selbstaufhebung des Sinnes aufgrund 'semantischer Impertinenz' entspringt eine Innovation des Sinnes auf der Ebene der gesamten Aussage. Mit einer neuen semantischen Pertinenz tritt auch die Möglichkeit einer neuen Referenzperspektive in den Blick. Um diese heuristische Funktion und Leistungsweise der Metapher zu plausibilisieren, greift Ricoeur auf den Gedanken Blacks von der Verwandtschaft zwischen wissenschaftlichem Modell und Metapher zurück. Dessen These lautet, daß das Modell in der Wissenschaftssprache dieselbe Funktion erfüllt, wie die Metapher in der dichterischen Sprache. Die Analogie zwischen beiden soll bei Black dazu dienen, eine vorausgesetzte Metapherntheorie für eine noch zu entfaltende Modelltheorie fruchtbar zu machen. Ricoeur bedient sich der Idee einer strukturellen Verwandtschaft zwischen Modell und Metapher hingegen, um die Rückwirkungen einer derartigen Modelltheorie auf die Metapherntheorie auszuwerten. Das Modell dient in der wissenschaftlichen Sprache als „heuristisches Instrument, das vermittels der Fiktion eine inadäquate Interpretation sprengen und einer neuen, adäquateren den Weg bahnen soll."77 Das Modell fungiert als Mittel zur Neubeschreibung des Explanandums oder Originals. Deshalb ist es nicht Bestandteil einer 'Logik der Beweisführung' im Dienste bereits bestehender Interpretationen, sondern vielmehr einer 'Logik der Entdeckung' neuer Interpretationsmöglichkeiten. Auch der Metapher wächst somit ihre wesentliche Funktion im Entdeckungszusammenhang theoriekreativer Prozesse zu. Der Umstand, daß das Modell 76 77
Ricoeur, lebendige Metapher, S. 224f. Ebd., S. 228.
Die Referenz der Metapher
35
nichts beweist, bedeutet dabei nicht, daß sein Verfahren als irrational bezeichnet werden müßte. Vielmehr beinhaltet es einen eigenen kognitiven Prozeß mit spezifischer Rationalität. Die Eigenlogik des Modells gründet sich auf die „erkenntnistheoretische Dimension der wissenschaftlichen Imagination"78. Das Modell ist Ausdruck der schöpferischen Einbildungskraft. Black unterscheidet drei Arten von Modellen mit wachsender heuristischer Qualität. Vor allem das dritte Modell zeichnet sich hinsichtlich seiner Funktionsweise durch eine große Nähe zur Metapher aus. 1. Maßstabsgetreue Modelle, die in asymmetrischer Beziehung auf ein entsprechendes Original verweisen (ein Schiffsmodell). 2. Analoge Modelle, die einen Wechsel des Mediums vollziehen und auf der strukturanalogen Darstellung des Originals beruhen (ein Schaltplan). 3. Theoretische Modelle, die zwar wie die analogen Modelle auf einer Strukturgleichheit mit dem Original beruhen, aber zu diesem Zweck eine neue Sprache einführen, in der das Original beschrieben wird. Entscheidend ist dabei nicht die geistige Transformation und Übersetzung an sich, sondern die Reichhaltigkeit an Implikationen und die Ergiebigkeit an Hypothesen, die durch eine neue Beschreibungssprache eröffnet werden. Dabei bleibt der Realitätsstatus des Modells unerheblich. „Es geht nicht darum zu wissen, ob und wie das Modell existiert, sondern welches die Interpretationsregeln des theoretischen Modells [...] sind."7® Gerade die Entpflichtung auf seine ontische Faktizität verschafft dem neuen sprachlichen Spielraum des theoretischen Modells seine ontologische Geltung. Nicht die Verpflichtung auf eine harte Realität, sondern die potentielle Ausschöpfbarkeit der sprachlichen Implikationen machen die spezifische Leistungsweise des theoretischen Modells aus. „Der Kern der Methode besteht darin, auf eine bestimmte Art und Weise zu sprechen." 80 Die produktive Einbildungskraft kann als Kompetenz dieser Explikation, also als Beherrschung auch der fernliegenden Implikationen des Modells bezeichnet werden. „In dieser Hinsicht bedeutet der Rückgriff auf die wissenschaftliche Imagination kein Nachgeben der Vernunft, keine Zerstreuung durch Bilder, sondern das wesentlich sprachliche Vermögen, an einem 'beschriebenen Modell' neue Relationen auszuprobieren. "81 Modelle dienen mithin als Anleitung zur theoriehaltigen Kombinatorik und eröffnen neue Sichtweisen, denen neue Begründungen folgen. Die Logik der Imagination geht dabei der Logik der Beweisführung voraus. Sie bedeutet jedoch kein intuitiv-genialisches Entwerfen, sondern untersteht einem eigenen Kalkül. „Diese Imagination gehört zur Vernunft aufgrund der Korrelations78 19 80
81
Ebd. Ebd., S. 230. Mary B. Hesse: Models and Analogies in Science, University of Notre Dame Press 1966, S. 229; zit. bei Ricoeur, lebendige Metapher, S. 230. Ebd.
36
Die lebendige Metapher
regeln, denen die Übersetzung der Aussagen über den Sekundärbereich in Aussagen, die auf den Originalbereich anwendbar sind, untersteht."82 Darin besteht gewissermaßen der Spielraum des imaginativen Verhaltens. Der Isomorphismus der Relationen begründet die Logik der Imagination und der Entdeckung. „Die wissenschaftliche Imagination besteht darin, auf dem Umweg über diese 'beschriebene' Sache neue Zusammenhänge zu sehen."83 Leugnet man die heuristische Funktion des Modells, oder reduziert man es auf eine Verstandeskrücke für den vorstellungshaft gebundenen Geist, so beschränkt man letztlich die Logik der Entdeckung auf das Verfahren der Deduktion. Wenn aber modellhafte Innovationsprozesse als unverzichtbar für die wissenschaftliche Theoriebildung angesehen werden können, dann gilt es, die überkommene Auffassung von der Notwendigkeit einer streng-deduktiven Ableitbarkeit neuer theoretischer Hypothesen und Theorieentwürfe zu überdenken. „Man muß das deduktive Modell der wissenschaftlichen Erklärung verändern und ergänzen und die theoretische Erklärung als die metaphorische Neubeschreibung des Bereichs des Explanandums auffassen."84 Damit ist der Punkt markiert, an dem Metapher und Modell Hand in Hand gehen. Das Modell arbeitet nicht nur wie die Metapher, sondern mit der Metapher. Die Kritik am Deduzierbarkeitsideal läßt die Erklärungskraft des Modells als Neubeschreibung erkennen, die der Funktionsweise der Metapher entspringt. „Der Rückgriff auf die metaphorische Neubeschreibung ist eine Konsequenz der Unmöglichkeit, eine strenge Deduktionsrelation zwischen dem Explanans und dem Explanandum zu erzielen."85 Statt eine deduktive Ableitung des Originals zu sein, ist das theoretische Modell a) eine metaphorische Neubeschreibung, die vorher so nicht impliziert war und b) ein durch das Dazwischentreten von Korrespondenz- und Übertragungsregeln vermitteltes Explanans: „auf das Modell zurückgreifen heißt, die Korrespondenzregeln im Sinne der Erweiterung der Beobachtungssprache durch Metapherngebrauch zu interpretieren. Das Modell entspricht somit der Wechselwirkung der Metapher und nicht dem der Substitutionstheorie verwandten Verfahren der Deduktion. Um eine wirkliche Neubeschreibung hervorzubringen, muß das Modell mit dem metaphorischen Mittel der Bedeutungsverschiebung arbeiten und nicht nur eine schon vorhandene Menge an Deduktionsmöglichkeiten durchspielen. Mit dem Postulat der Neubeschreibung ist aber die Modelltheorie ebenfalls bei dem Problem der metaphorischen Referenz angelangt. Durch den deskriptiven Charakter des theoretisch-innovativen Modells verändert sich nämlich auch das Explanandum. Auch für den Bereich wissenschaftlicher Theoriebil-
82 83 84 85 86
Ebd. Ebd., S. 230f. Hesse, bei Ricoeur, lebendige Metapher, S. 231. Ebd. Ebd., S. 231 f.
Die Referenz der Metapher
37
dung müßte demnach eine 'Invarianz der Bedeutung' angenommen werden, die sich bereits auf der Ebene der alltäglichen Beschreibungssprache als Unmöglichkeit einer 'eigentlichen' und feststehenden Bedeutung erwiesen hat. Aus diesem Grund drängt sich auch für das Modell der Wissenschaftssprache eine Theorie der Wechselwirkung auf. Soviel zu den Folgen einer Ausweitung der Metapherntheorie auf die Modelltheorie. Ricoeur interessieren jedoch die nunmehr möglichen Rückschlüsse auf die vorausgesetzte Metapherntheorie. Es zeigt sich nämlich, daß nicht nur die Modelltheorie von der Metapherntheorie profititiert, sondern daß auch die Metapherntheorie nicht unverändert aus dem Theorievergleich mit dem Modell hervorgeht. Zunächst ist festzustellen, daß die versuchsweise Ausweitung auf die Modelltheorie die wesentlichen Eigenschaften der dabei zugrundegelegten Metapherntheorie bestätigt hat: 1) 2) 3) 4)
Die Unerschöpflichkeit und Unübersetzbarkeit durch Paraphrasen, was sowohl eine Substitutions- wie eine Vergleichstheorie ausschließt.87 Die wechselseitige Durchdringung von Prädikat und Hauptsubjekt, die eine Theorie der Wechselwirkung stützt. Den kognitiven Wert der Aussage, was für den rationalen Aspekt der metaphorischen Erklärung spricht. Die Produktion einer neuen Information, wodurch die These von der metaphorischen Neubeschreibung der Wirklichkeit an Plausibilität gewinnt.
Damit können zwei Reduktionstheorien als unzureichend ausgeschieden werden: Erstens ein Verständnis des Modells als psychologisch-pädagogisches Hilfsmittel sowie zweitens ein Verständnis der Metapher als schmückendes Ornament und stilistischer Zierrat. Darüber hinaus wirft die Modelltheorie aber auch ein neues Licht auf die Metapherntheorie: Auf der Ebene des Untersuchungsgegenstandes entspricht dem Modell nicht die einzelne Metapher oder die metaphorische Aussage, sondern die von Ricoeur sogenannte „ausgeführte Metapher" 88 , das heißt ein beziehungsreiches Metaphernnetz. Die systematische Entfaltbarkeit des Modells führt auf Seiten der Metapher zu einer „Untersuchung der Netzbildung der metaphorischen Welt" 8 '. Dem Isomorphismus, der die Korrespon-
88 89
Die Analogie von Metapher und Modell sowie ihre Unübersetzbarkeit hat A. Haverkamp auch auf das Verhältnis zwischen Metapher und Paradigma ausgeweitet, in: PARADIGMA METAPHER, METAPHER PARADIGMA - Zur Metakinetik hermeneutischer Horizonte (in: Epochenschwelle und Epochenbewußtsein, Poetik und Hermeneutik XII, hg. v. R.Herzog und R.Koselleck, München 1987) behandelt Haverkamp „das Problem der Inkommensurabilität der Paradigmen" (S. 560) bei H. Blumenberg, J. Derrida, Th. Kuhn, M. Foucault und M. Black. Ricoeur, lebendige Metapher, S. 233. Ebd.
38
Die lebendige Metapher
denzbedingungen beim Gebrauch von Modellen regelt, entspricht eine Art von Metapher mit einerseits radikalem, andererseits systematischem Charakter. Sogenannte „root metaphors" (S. Pepper90) gestalten Metaphern zu Netzen. Dieser Metapherntyp hat „eine weniger lokale, weniger punktuelle Existenz als die Metapher: er entspricht einem 'Bereich' von Erfahrungen oder Tatsachen"." Die referentielle Verweisungsfunktion der Metapher beruht auf einem solchen Metaphernnetz und nicht auf einer isolierten metaphorischen Aussage. Ist jedoch mit der metaphorischen Referenz im semantischen Sinne auch schon positiv über die Möglichkeit einer 'metaphorischen Wahrheit' im philosophischen Sinne entschieden? Ricoeur ist der Auffassung, diese Frage stellen zu müssen, um dem Anspruch zu begegnen, der mit der realistischen Intention der metaphorischen Neubeschreibung erhoben wird. Wenn sich die Metapher nicht auf eine literarische Verzierung reduzieren oder als erkenntnistheoretische Verschleierung denunzieren läßt, dann wird die Frage nach der Wirklichkeitsbeziehung und dem Realitätsgehalt der Metapher unabweisbar. Der methodische Leitfaden der bisherigen Untersuchung, die Idee einer grundlegenden Spannung (Wort-Satz, focus-frame, Semiotik-Semantik, wörtliche Interpretation-metaphorische Interpretation), gibt auch den Rahmen für die Erörterung der metaphorischen Wahrheit ab. Ricoeur untersucht zu diesem Zweck die Spannung, die in der Existenzfunktion (im Unterschied zur Relationsfunktion) der Kopula einer metaphorischen Aussage impliziert ist. Das Wort 'sein' soll dazu selbst metaphorisch interpretiert werden. Hierzu ist es nötig, in dem 'ist' der Kopula auch ein 'ist nicht' aufzuweisen. Die Spannung der metaphorischen Existenzkopula und damit auch die Spannung der metaphorischen Wahrheit bestünde dann in dem zugleich von 'ist' und 'ist nicht'. Dabei muß diese Unterscheidung nicht grammatikalisch eindeutig bezeichnet sein. Dies ist sogar unwahrscheinlich, weil die Metapher sonst keine eigene Funktion hätte und somit keine Spannung, sondern ein klar erkennbarer Unterschied vorläge. Ein solcher aber erlaubte es, von Fall zu Fall zwischen wahrer und falscher Bedeutung zu unterscheiden. Der Nachweis der Spannung in der metaphorischen Existenzkopula zwischen 'ist' und 'ist nicht' wird wie bei dem Nachweis der metaphorischen Referenz auf indirektem Wege angegangen, nämlich indem folgende zwei Gegenthesen widerlegt werden sollen: 1) Die Leugnug des kritischen 'ist nicht', die in ontologische Naivität verfallt und 2) Die Leugnung des 'ist', die nur ein fiktives 'als ob' zuläßt. Das Scheitern dieser beiden Weisen des Verkennens wird als Abstoßeffekt für das Erkennen einer Spannungstheorie der metaphorischen Wahrheit zwischen 'ist' und 'ist nicht' benutzt. Die Fehlform der ontologischen Naivi90 91
Stephen C. Pepper: World Hypotheses, University of California Press 1942. Ricoeur, lebendige Metapher, S. 234.
Die Referenz der Metapher
39
tät, welche das kritische 'ist nicht' um einer ungeschiedenen Totalität und Präsenz willen leugnet, ist vergleichbar mit einem Vitalismus, der sämtliche Funktionen der Sprache und ihre Beziehung zur Welt in organische Lebensbegriffe faßt. Diese vitalistische Auffassung von Sprache und Welt als spannungsvolle Lebendigkeit wird gegen die trennenden Operationen des abstrahierenden Verstandes in Anschlag gebracht. Doch die auf Ungeschiedenheit, Einheit und Präsenz abzielende Lebenssemantik triumphiert schließlich in einer Metaphysik, die die kritisch-konstruktiven Spannungsbeziehungen in der Sprache sowie zwischen Sprache und Welt vorschnell einebnet. Die diametral entgegengesetzte Fehlform des rationalistischen Metaphernverdachts - etwa bei Turbayne92 - reduziert die Spannung dagegen auf ein fiktiv verstandenes 'als ob'. Vom Standpunkt eines erkenntnistheoretischen Positivismus aus wird versucht, zwischen rechtem Gebrauch und Mißbrauch der Metapher zu unterscheiden. Die Konzentration auf den Sachverhalt der bewußten Verwendung bzw. Vermeidung läßt dabei schon die Nähe zur rhetorischen Metapherntheorie erkennen. Anknüpfend an das Phänomen der Abweichung, die als logische Verwechslung verstanden wird, hebt diese Metaphernkritik lediglich den negativen Aspekt des Ordnungsverlustes hervor, ohne auch nur die positive Möglichkeit eines semantischen und kategorialen Gewinns zu erwägen. Absicht der Metapher kann es demnach nur sein, einen Zusammenhang vorzutäuschen, der vor dem gedanklichen Hintergrund von Substitution, Deduzierbarkeit, klarer und distinkter Begrifflichkeit sowie der Annahme von eigentlichen und feststehenden Wortbedeutungen keinen Bestand haben kann. Dabei wird der bereits erwähnte fehlende grammatikalische Unterschied dazu benutzt, das 'ist' als metaphorische Verschleierungstaktik zu perhorreszieren, um im Gegenzug dazu nur eine Interpretation im Sinne des 'ist nicht' qua 'als ob' zuzulassen. Dieser Beurteilung der Metapher fehlt also gerade die spannungsvolle Differenz zwischen metaphorischer und wörtlicher Bedeutung. Im Gegensatz dazu vertritt Ricoeur eine Vermittlungsposition zwischen ontologischer Naivität und entmythologisierter Metapher, die das Moment der Spannung aus der immanenten Semantik der Aussage herausführt und zwischen metaphorischer und wörtlicher Wahrheit ansiedelt. Dabei kommt es zu dem unüberwindlichen Paradox, „daß es keine andere Möglichkeit gibt, dem Begriff der metaphorischen Wahrheit gerecht zu werden, als die kritische Spitze des (wörtlichen) 'ist nicht' in die ontologische Vehemenz des (metaphorischen) 'ist' einzuschließen."®3 Die Wahrheit der Metapher besteht darin, daß beides zugleich ausgesagt werden muß. Andernfalls drohen sprachmagische Skylla oder positivistische Charybdis.
Colin M. Turbayne: The Myth of Metaphor, Yale University Press 1962. Ricoeur, lebendige Metapher, S. 251.
40
Die lebendige Metapher
4. Metapher und philosophischer Diskurs Mit diesen Überlegungen zur metaphorischen Wahrheit stellt sich schließlich die Frage nach dem grundsätzlichen Verhältnis zwischen Metapher und philosophischem Diskurs. Bereits die Wortwahl gibt zu erkennen, daß es dabei nicht um die Philosophie, aber auch nicht nur um irgendeine Philosophie, sondern um Philosophie als Diskurs unter anderen geht. Die Philosophie steht für ein ' Sprachspielvon dem die Metapher zunächst einmal unterschieden wird. Es geht also nicht um philosophische Metaphern oder um eine Philosophie der Metapher, sondern um das Verhältnis zwischen metaphorischem und philosophischem Diskurs. Damit ist der Grenzbereich gemeint, in dem sich beide Diskurse berühren, evt. überlappen und deshalb auch füreinander relevant, das heißt förderlich oder bedrohlich werden. Dieses Grenzgebiet kann zunächst mit den Stichworten 'Hermeneutik' und 'Referenzproblematik' markiert werden. Indem die bisherige Untersuchung der Metapher von der Semiotik über die Semantik zur Hermeneutik und von der Sinn- zur Referenz geführt hat, knüpft Ricoeur im Bereich der Philosophie dort an, wo diese Momente im Verbund eine Rolle spielen. Das heißt, wo eine hermeneutische Philosophie der Beziehung der Sprache zum Sein nachgeht (M. Heidegger). Sodann aber gilt es ebenfalls zu fragen, wie es um die Einheit dieser verschiedenen Diskursformen bestellt ist. Ricoeur plädiert „für einen relativen Pluralismus der Formen und der Diskursebenen1"4, also für eine Spannungstheorie auf höchster Ebene. Leitendes Interesse ist dabei eine gewisse Autonomie des spekulativ-philosophischen Diskurses - im Unterschied zu Konzepten, die entweder die Metapher als möglichen Gegenstand der Philosophie zwanglos unter deren begrifflichen Erkenntnisanspruch unterordnen, oder die die Philosophie nur noch im Zusammenhang einer universalen Metaphorologie verhandeln. Im Unterschied zu derartigen Verschmelzungstheorien - entweder zugunsten der Metapher oder zugunsten der Philosophie - hält Ricoeur daran fest, daß sich die Modalitäten der Wechselwirkung und der wechselseitigen Anregung zwischen den Diskursen erst vor dem Hintergrund der Anerkennung ihrer Disparatheit und Diskontinuität erfassen und würdigen lassen. 4.1 Metapher und Philosophie bei Martin Heidegger und Jacques Derrida Für die Interpretation philosophischer Texte seit Nietzsche kann eine gewisse Bevorzugung des Verfahrens genealogischer Infragestellung festgestellt werden, die den betreffenden Autor eher nach seinen verborgenen Voraussetzungen und Interessen als nach seinen erklärten Absichten befragt. Dieses Programm gipfelt in Derridas Dekonstruktion. Vor diesem Hintergrund wurde 94
Ebd., S. 253.
Metapher und philosophischer Diskurs
41
auch die Metapher weniger als heuristisches Instrument zur innovativen Neubeschreibung erkannt, sondern vielmehr zum Gegenstand einer bestimmten Verdächtigungs- und Entlarvungshermeneutik gemacht. Seine Spitze erhält dieses Verfahren aus der philosophischen Ablehnung der Metapher seitens der analysierten Autoren, die in einem Widerspruch zu der fundamentalen Rolle der Metapher steht, welche die Metapher in jenen Konzepten spielt. Ein prominentes Beispiel dafür ist Heideggers Diktum: „Das Metaphorische gibt es nur in der Metaphysik"*5. Heidegger unterstellt damit, daß die Funktionsweise der Metapher in einer Übertragung vom Eigentlichen zum Bildlichen besteht und daß diese Übertragung der gleichen Logik entspringt wie die metaphysische Überschreitung des Sinnlich-Sichtbaren ins UnsinnlichUnsichtbare. Demnach hängen die abendländische Tradition der Rhetorik und der Metaphysik ursprünglich miteinander zusammen und bestimmen seither sowohl unsere maßgebliche Vorstellung vom Wesen der Sprache als auch vom Wesen des Denkens. Bekanntlich will vor allem der späte Heidegger hinter diese Auffassung von Sprache und Denken als vermittelt-vermittelnder Überschreitung zurückgehen, um eine unmittelbarere Entsprechungsstruktur zwischen Sein, Sprache und Denken aufzuweisen. Deshalb kann er die Metapher denunzieren, derselben Denkweise zuzugehören wie die Metaphysik. Dabei macht sich Heidegger jedoch einer zweifachen Reduktion schuldig. Ricoeur weist darauf hin, daß Heidegger erstens einem eingeschränkten Metaphernbegriff verhaftet bleibt, welcher a) den Bereich der Philosophie gar nicht verläßt und die Metapher nur am Beispiel verblaßter philosophischer Metaphern erörtert, und b) das Phänomen des Metaphorischen auf die isolierte Wortmetapher beschränkt und damit ihre Funktionsweise auf eine einzige Art der Übertragung reduziert. Zweitens zwingt Heidegger die Philosophie in ein Prokrustesbett, wenn er sie in toto auf eine bestimmte Erscheinungsform, nämlich die platonisch-neuplatonische Metaphysik reduziert. In einem dritten Schritt erfolgt dann die zwanglose Identifikation einer doppelt zugerichteten Theoriegestalt: Philosophie=Metaphysik und Metaphysik= Metapher. Sieht man jedoch einmal von dieser expliziten, wenn auch unzulänglichen, Metaphernkritik Heideggers ab und unterzieht seine Texte einer aufmerksamen Lektüre, so findet die negative Bewertung ihr positives Korrelat in einer zwar explizit nicht thematisierten, aber implizit um so ausgiebiger gebrauchten Metaphorik. Wenn etwa im Zusammenhang des 'Satzes vom Grund' die Notwendigkeit eines meditierenden statt eines vorstellenden Denkens gefordert wird, in dessen Folge „das Denken hörend blickt und blickend hört"96, um die Tiefenresonanz jenes Satzes zu erfassen, so verläßt Heidegger sowohl die Umgangssprache als auch den Rahmen einer ausgewiesenen philosophischen Terminologie und stellt das Denken in den semantischen Umkreis
96
Martin Heidegger: Der Satz vom Grund, Pfullingen 1957, S. 89. Ebd., S. 89.
42
Die lebendige Metapher
des sinnlichen Vernehmens. Insofern kehrt sich die Verdachtshermeneutik gerade gegen ihren Verwender und läßt trotz erklärten Metaphernverbots die verborgene, aber produktive Verwendungsweise von Metaphern hervortreten. Doch während Heidegger mit der Metapher noch ein bestimmtes philosophisches Problem in Verbindung bringt, nämlich die Übertragung des Sinnlichen aufs Unsinnliche, identifiziert Derrida die Metapher ganz mit dem philosophischen Diskurs. Dachte Heidegger noch daran, jenseits von Metaphysik und Metapher die eigentliche Aufgabe der Philosophie in Angriff nehmen zu können, so verfahrt Derrida entschieden radikaler und unternimmt den Versuch, die grenzenlose Metaphorizität des philosophischen Diskurses als Zusammenhang zwischen abgenutzter Metapher und verdeckter Metaphysik nachzuweisen. War Heideggers Metaphernkritik begrenzt, so läuft Derridas Dekonstruktion auf eine unbegrenzte Entlarvung der allgegenwärtigen Metapher in der philosophischen Begriffssprache hinaus. Derrida konzentriert seinen dekonstruktiven Blick dabei auf zwei Schwerpunkte: a) die allgemeine Entropie der Sprache und die spezielle Abnutzung der Metapher; b) die universale Wirkungsweise der abgenutzten Metapher, die sich im philosophischen Diskurs als uneingestandene Metaphysik auswirkt und in einem proportionalen Entsprechungsverhältnis zur aufsteigenden Bewegung der Begriffsbildung steht. Derrida nähert sich der Metapher nicht über die Metaphorik des Lebens, sondern des Todes. Der Auffassung von einer rekreativen und revitalisierenden Funktionsweise der Sprache stellt er die Behauptung ihrer allgemeinen Entropie gegenüber. Das Metaphorische gibt es demnach nicht nur innerhalb der Metaphysik, vielmehr gründet diese letztlich in nichts anderem als in einem Herbarium abgenutzter Metaphern97, die nicht mehr als solche erkennbar sind. Das heißt die abgenutzte Metapher bleibt in der Regel verborgen. „In ihr wirkt das Metaphorische uns unbewußt, hinter unserem Rücken"98. Das Zusammenspiel von Metapher und Metaphysik ereignet sich meist auf dem Feld unbewußter Voraussetzungen und Interessen und bildet dort ein nur schwer aufhellbares Konglomerat „von uneingestandener Metaphysik und abgenutzter Metapher"99. Um diesem verborgenen Zusammenhang auf die Spur zu kommen, ist die heideggersche Verdachtshermeneutik um die Genealogie Nietzsches, die Psychoanalyse Freuds und die marxistische Ideologiekritik zu erweitern. Erst mit diesen Waffen ist die Kritik imstande, den Zusammenhang zwischen verdeckter Metaphysik und abgenutzter Metapher zu entlarven. Auf sie gründet Derrida seine eigentliche Pointe der proportionalen Entsprechung zwi-
98 99
Derrida greift hier auf einen Gedanken Jean Pauls zurück, demzufolge Jede Sprache in Rücksicht geistiger Beziehungen ein Wörterbuch erblasseter Metaphern" ist (Vorschule der Ästhetik § 50, Sämtl. Werke Bd. 11, S. 170). Ricoeur, lebendige Metapher, S. 260. Ebd.
Metapher und philosophischer Diskurs
43
sehen der absinkenden Bewegung der Metapher und der damit zugleich aufsteigenden Bewegung der Begriffsbildung. Denn die Bildung des Begriffs qua 'Aufhebung' „ist kein beliebiges Sprachphänomen, sondern die philosophische Geste im besonderen Sinne"100. Die Abnutzung der Metapher muß als die Kehrseite der 'relève' des Begriffes verstanden werden. Derrida behauptet einen direkten Zusammenhang zwischen metaphorischer Abnutzung und begrifflicher Idealisierung. Deren Spitze besteht darin, daß der metaphorische Diskurs von der Metaphorizität des philosophischen Diskurses selbst eingeholt und gefangengenommen wird. „Die Theorie der Metapher verweist zirkulär auf die Metapher der Theorie."101 Darin gründet, was man „das Paradox der Selbstimplikation der Metapher"102 nennen kann. Es gibt keinen begrifflich gesicherten Standpunkt, von dem aus die Metapher Gegenstand einer unmetaphorischen Definition werden könnte, d. h. „es gibt keinen Diskurs über die Metapher, der nicht mit einem Begriffsnetz arbeitet, das selbst metaphorisch hervorgebracht wurde. Es gibt keinen metaphernlosen Ort, von dem aus Ordnung und Umgrenzung des metaphorischen Bereiches zu überblicken wären. Die Metapher wird metaphorisch formuliert."103 Dem entspricht die gegenläufige Denkstrategie der 'Dekonstruktion', welche die Revitalisierung der Metapher zur Entlarvung des Begriffes nutzen will. „Die Metaphysik hat in ihr selbst die mythische (fabuleuse) Szene ausgelöscht, die sie hervorbrachte und die doch wirksam, regsam, mit weißer Tinte geschrieben, als unsichtbare, im Palimpsest verdeckte Zeichnung erhalten bleibt"104. Indem die 'weiße Mythologie' wieder zum Vorschein gebracht wird, soll der metaphysische Begriffszauber zergehen. Hinter dieser gegenläufigen Identifizierung von Metapher und Begriff verbirgt sich jedoch Ricoeur zufolge eine „Metaphysik der Analogie"105, welche sich selbst nicht mehr kritisch zu Gesicht bekommt. Indem jede Analogie letztlich auf die metaphysische Übertragung vom Sinnlichen aufs Unsinnliche zurückgeführt wird, kann jede Metapher umstandslos dem Metaphysikverdacht und jedes Philosophem dem Metaphernverdacht ausgesetzt werden. Daran wird deutlich, worin Derrida letztlich auch mit Heidegger übereinstimmt: „die angebliche Komplizität zwischen dem Metaphernpaar des Eigentlichen und des Bildlichen und dem metaphysischen Paar des Sichtbaren und des Unsichtbaren."106 Beide Gedanken dieser Reduktionstaktik stellen sich 100 101
103 104 105 106
Ebd., S. 264. Ebd., S. 263. Ebd. Ebd. Zit. ebd. Ebd., S. 265. Ebd., S. 272. In einer Replik hat sich Derrida zu dieser ihm von Ricoeur unterstellten Komplizität mit Heidegger geäußert (Le retrait de la métaphore, in: Poésie 6, 1979; dt.: Der Entzug der Metapher, in: Romantik, Literatur und Philosophie, hg. v. Volker
44
Die lebendige Metapher
jedoch bei näherer Betrachtung als theoretische Pappkameraden heraus: a) Die Übertragung vom Eigentlichen zum Bildlichen stellt nur eine unter vielen Übertragungsarten der Metapher dar und kann nur vor dem Hintergrund einer ihrerseits reduktionistischen Substitutionstheorie als Primär- und Wesensübertragung der Metapher behauptet werden; b) die sogenannte platonisch-neuplatonische 'Metaphysik', verstanden als Übertragung vom Sichtbaren aufs Unsichtbare, ist zwar eine bedeutende philosophische Tradition, aber nicht die einzige und insofern nicht mit dem philosophischen Diskurs gleichzusetzen.'07 Ricoeurs Kritik und Alternative setzt deshalb an folgenden drei Punkten an: 1. dem Wirken der Ähnlichkeit, 2. der Bedeutung der abgenutzten Metapher und ihr Zusammenhang mit dem philosophischen Begriff, 3. der im metaphorischen Diskurs implizierten Ontologie. Ad 1. Ricoeurs eigener Analyse zufolge setzt der metaphorische Sinn den Kontrast zum wörtlichen Sinn voraus. Dies trifft nur für die lebendige Metapher, also im Falle einer bestimmten Metapher, nur für einen begrenzten Zeitraum zu, solange nämlich bis sich der semantische Kontrast abschleift und die neue metaphorische Bedeutung selbstverständlich wird. 'Tote' Metaphern sind demnach keine Metaphern mehr, sondern gehen als Erweiterung der gewöhnlichen Bedeutung und damit der Polysemie in den Wortschatz ein. Sowohl eine spezifische Fruchtbarkeit als auch eine unausdrückliche Wirksamkeit der abgenutzten Metapher lehnt Ricoeur von daher ab. Ad 2. Der Zusammenhang von Begriff und Metapher erscheint deshalb auch weniger unter genealogischer Hinsicht interessant, als unter der erneuten Revitalisierung der Metapher, die den Begriff in einen neuen semantischen Kontext stellt. Dabei behauptet Ricoeur jedoch gegen Derrida: Eine „tote Metapher beleben heißt keineswegs den Begriff entlarven."108 Sowenig sich der semantisch-abstrakte Gehalt des Begriffs auf eine abgenutzte Metapher reduzieren läßt - dieser gegenüber stellt er vielmehr ein Neues dar -, sowenig springt aus dem entlarvten Begriff eine wiedererweckte Metapher hervor. Metapher und Aufhebung stellen nicht zwei Seiten desselben Verfahrens dar, sondern bezeichnen zwei unterschiedliche Operationen. Weder kann der Begriff als Restprodukt der Aufhebung einer Metapher verstanden werden, Bohn, Frankfurt am Main 1987). Derrida weist darauf hin, bereits selbst in einer Anmerkung zu Heidegger dessen Reduktion der Metapher als Übertragung vom Sinnlichen auf das Nichtsinnliche kritisiert zu haben (vgl. Derrida, Mythologie blanche, S. 347 Anm. 31). Darüber hinaus sei die gesamte 'Mythologie blanche' damit befaBt, die herkömmliche philosophische Auslegung der Metapher als Übertragung vom Sinnlichen auf das Intelligible zu hinterfragen (Derrida, Rückzug, S. 326). Auch gegen diesen Vorwurf verwahrt sich Derrida in seiner Entgegenung auf Ricoeur (Derrida, Rückzug, S. 328f.); ebenso beansprucht er, die kritische Vorarbeit an dem von Ricoeur extensiv abgelehnten Primat der Denomination sowie der Nomentheorie der Metapher geleistet zu haben (ebd., S. 330). Ricoeur, lebendige Metapher, S. 269.
Metapher und philosophischer Diskurs
45
noch setzt der entlarvte Begriff aus sich heraus eine wiedererweckte Metapher frei. Die Revitalisierung abgenutzter oder toter Metaphern erfordert vielmehr komplexere Verfahren als es die Enthüllungshermeneutik der Dekonstruktion glauben macht. Dazu gehören etwa die Erweckung der etymologischen Motivationen bis hin zur 'falschen' Etymologie.109 Nur so führt die Neubelebung zu einer Neubeschreibung. Damit aber entspricht die wiedererweckte Metapher der sinnschöpferischen Funktionsweise der lebendigen Metapher. Das Interesse am metaphorischen Prozeß leitet sich demnach allein aus der lebendigen Metapher ab und führt im Falle ihrer Abnutzung wieder auf sie zurück. Dies betrifft schließlich auch die Annahmen zum Verhältnis zwischen metaphorischem und philosophischem Diskurs. Eine restlose Identifizierung ermöglicht keine dynamischen Anregungsprozesse. Die spannungsreichen Wechselbeziehungen zwischen Metapher und Begriff lassen sich nur vor dem Hintergrund einer gewissen Eigenständigkeit und Autonomie der Diskurse erfassen. Ad 3. Damit stellt sich die Frage nach einer der Metaphorologie entsprechenden, diese in irgendeiner Weise aufnehmenden Ontologie. Welche Philosophie paßt zur Metapher, bzw. ist bereits in dieser impliziert oder vorausgesetzt? Wie gestaltet sich die Möglichkeit einer Antwort des spekulativen Diskurses auf die semantische Innovation des metaphorischen Diskurses? Antwort: durch eine ontologische Explikation der verdoppelten Referenz und der Neubeschreibung. 4.2 Zur ontologischen Explikation des Referenzpostulats Die Philosophie der lebendigen Metapher führt Ricoeur zufolge auf eine Ontologie der Mehrdeutigkeit', welche die Dinge als Handlungen, also das Sein 'in actu' sieht und welche im metaphorischen Ereignis die 'Entstehung der wachsenden Dinge' (Aristoteles) begreift. Diese skizzenhaften Andeutungen Ricoeurs lassen sich am ehesten mit der Unterscheidung zwischen einer 'offenen' und einer 'geschlossenen' Ontologie erläutern." 0 Die starke Kreativitätsthese einer Theorie der lebendigen Metapher hat eine Ontologie der offenen Welt zur Folge. „In einer geschlossenen Welt kann nichts kategorial Neues hinzukommen, sehr wohl aber in einer offenen. Die geschlossene Welt ist also eine begrenzte Entdeckungswelt, die offene eine
Vgl. etwa Hegels Wahrnehmung als 'Für-wahr-nehmen' und Heideggers 'aletheia' als Unverborgenheit. Ich folge hier Christian Strub: Abbilden und Schaffen von Ähnlichkeiten. Systematische und historische Thesen zum Zusammenhang von Metaphorik und Ontologie, in: Danneberg, Lutz u.a. (Hg.): Metapher und Innovation. Die Rolle der Metapher im Wandel von Sprache und Wissenschaft, Bern u.a. 1995, S. 105-125.
46
Die lebendige Metapher
entgrenzende Erfindungswelt: Die Entdeckungswelt wird innerhalb ihrer Grenzen stabilisiert, die Grenzen der Erfindungsweit sind verschiebbar."111 Dies führt zur ricoeurschen These einer Wechselwirtschaft zwischen dichterisch-metaphorischem und spekulativ-philosophischem Diskurs zurück. Die dichterische Metapher beschränkt sich nicht auf den Bereich des BildlichVorstellungshaften oder gar des Irrationalen, sondern führt von sich aus zu der Nötigung, eine Spannungstheorie der Wahrheit zu denken, die sich in einer Theorie der verdoppelten Referenz niederschlägt. Indem sie diese spannungshafte Doppelheit in dem Paradox der metaphorischen Kopula des gleichzeitigen 'ist' und 'ist nicht' zusammenhält, drückt die Metapher eine Erfahrung der Nähe zwischen bisher unverbundenen Vorstellungen aus. Das spekulative Denken zehrt von dieser Dynamik der metaphorischen Aussage, die sich ursprünglich einer Erfahrung von Zusammengehörigkeit verdankt, dann aber im Vollzug der Verdoppelung der Referenz und der Neubeschreibung der Wirklichkeit bereits jene Distanzierung vorbildet, welche schließlich in Gestalt des spekulativen Diskurses auf ihre höchste Reflexionsstufe gehoben wird, um dort Analogie und Ähnlichkeit einer Identifizierung und Verselbigung zuzuführen. Der spekulative Diskurs bedient sich deshalb, wo er sich selbst richtig versteht, der lebendigen Metapher und setzt damit eine 'Ontologie der Mehrdeutigkeit' voraus, die keine statischen Wahrheiten und eigentlichen Bedeutungen kennt, aber auch „jenen unüberschreitbaren Abstand zwischen dem Selben, das zu denken aufgegeben ist, und der metaphorischen Ähnlichkeit"112 bezeugt. Eine Hermeneutik der lebendigen Metapher hat dieser Dialektik zwischen Nähe und Distanz, zwischen Identität und Differenz die Waage zu halten und sich nicht widerstandslos dem Gefälle von der Metapher zum Begriff zu ergeben. Von daher ergeben sich für die Struktur des Zusammenhangs zwischen Begriff und Metapher folgende Bedingungen. Soll die Theorie der Spannung und Wechselwirkung zutreffen, so erfordert dies sowohl eine Theorie des Unterschieds als auch eine Theorie der Überschneidungen. Nur im Rahmen dieser Dialektik lassen sich die wechselseitigen Beziehungen erfassen. Für den spekulativen Diskurs heißt das, daß er seine Möglichkeit in der semantischen Dynamik der Metapher hat, daß er aber seine Notwendigkeit in sich selbst trägt. Seine Notwendigkeit resultiert nicht aus seiner Möglichkeit, sondern umgekehrt. Der Forderung des Metaphorischen kommt der Begriff nur auf einer anderen Sprachebene nach. Für die Metapher heißt das, daß sie zwar von sich aus zum Begriff drängt und diesen motiviert, aber nicht auch schon aus sich heraus erschafft. Der metaphorische Bedeutungsgewinn ist per se noch kein Begriffsgewinn. Aus dem semantischen Schock geht eine Begriffsforderung, aber kein begriffliches Wissen hervor. Die metaphorische 111 112
Strub, Abbilden und Schaffen von Ähnlichkeiten, S. 118. Ricoeur, lebendige Metapher, S. 298.
Das Wirken der Ähnlichkeit
47
Assimilierung ist keine begriffliche Sinnidentität, das Ähnliche kein Selbes. Der metaphorische Bedeutungsgewinn kann aber nicht zum Begriff erhoben werden, solange die verdoppelte Referenz zwischen dem Differenten und dem Identischen, zwischen wörtlicher und metaphorischer Bedeutung gefangen bleibt. Der Begriff verlangt von sich aus nach Klarheit und Eindeutigkeit. Die Eigendynamik treibt demnach von der Differenz über die Ähnlichkeit zur Selbigkeit, hin zur Fixierung, zur abgeschlossenen Gestalt, zur festen Bedeutung. „Jede Interpretation will den von der metaphorischen Aussage vorgezeichneten Entwurf in einen Horizont des begrifflich verfügbaren und beherrschbaren Verstehens eintragen.""3 Diesem Gefalle jedoch hat sich eine Interpretation entgegenzustemmen, die nicht alles in der fixierten Eindeutigkeit des Begriffes kulminieren lassen, sondern vielmehr der gegenseitig befruchtenden Wechselwirkung zwischen Begriff und Metapher entsprechen will. Ricoeur fordert deshalb einen hermeneutischen Stil, der zwischen den rivalisierenden Forderungen der Klarheit des Begriffs einerseits und der Dynamik der Bedeutung andererseits die Waage zu halten versucht und nicht dem Drängen einer von beiden Bezugsgrößen nachgibt. Die Folge wäre ein Sprechen, ein Verstehen, eine Interpretation zwischen zwei Versuchungen: der des Irrational-Unsagbaren einerseits und des gewöhnlichen Sprechens andererseits, zwischen dem Triumph des Unartikulierten und des bloßen Zeichens.
5. Das Wirken der Ähnlichkeit Im Anschluß an den weitausholenden Gedankengang Ricoeurs sei abschließend noch ein Problem angeschnitten, das als neuralgischer Punkt beinahe alle neueren Ansätze zur Metapherntheorie beschäftigt und vor allem auch in der Theologie von höchster Relevanz ist: die Frage nach dem Wirken der Ähnlichkeit bzw. Analogie im metaphorischen Prozeß, oder genauer die Frage, ob dieses Wirken als Abbilden oder als Schaffen von Ähnlichkeiten, respektive von Analogien aufgefaßt werden muß. Im Zusammenhang der bisherigen Überlegungen scheint jedenfalls der entscheidende Unterschied einer Spannungstheorie gegenüber der Substitutionstheorie darin zu bestehen, daß· jene für die Bildung von Metaphern keine vorausgesetzte Entsprechung zwischen den jeweiligen Aussagehälften unterstellt, sondern den metaphorischen Prozeß als Aufeinanderprall zweier zunächst unvereinbarer Kontexte interpretiert, welcher eine 'semantische Impertinenz' zur Folge hat. Doch bereits hier gilt es zu beachten, daß die semantische Krise nur das Durchgangsstadium zu einer neuen semantischen Gestalt, mithin zu einer neuen Pertinenz darstellt. Die Metapher besteht nicht nur aus dem Konflikt einer alten Bedeutung, son113
Ebd., S. 284.
48
Die lebendige Metapher
dem findet ihre Bestimmung erst in einer neuen Bedeutung. Dann stellt sich aber sogleich die Frage, wie sich die neue Pertinenz konstituieren soll, wenn nicht auf der Grundlage einer bisher unbekannten, nun aber sichtbar gewordenen Ähnlichkeit. Zumindest ein analogiestiftendes Moment muß also auch für die Spannungsmetapher vorausgesetzt werden. Darüber hinaus haben zahlreiche Autoren114 darauf hingewiesen, daß auch schon für die Bildung einer Metapher ein 'fundamentum in re' erforderlich ist, soll es ein Kriterium für das Gelingen von Metaphern geben und die Metaphernproduktion nicht einfach ein kontingentes Experimentieren mit möglichst unpassenden und widersprüchlichen Wortfeldern sein. Ein wie immer geartetes Analogieverhältnis sei auch schon für die gezielte Konfrontation bestimmter Kontexte zu behaupten, da sich sonst weder die Motivation zur Bildung einer Metapher noch die Selektion bestimmter Kontexte oder Wortfelder zur Metaphorisierung nachvollziehen lasse. Vor diesem Problemhintergrund erkennt auch Ricoeur die Notwendigkeit, das Ähnlichkeitstheorem aus seiner bisherigen Bindung an die Substitutionstheorie zu lösen und auf dem Boden der Spannungstheorie in veränderter Weise zu reformulieren. Wieder einmal beginnt Ricoeur seine Argumentation mit einem kritischen Gang, indem er zunächst die Gleichsetzung von Ähnlichkeit und Substitution zu widerlegen sucht. Sowohl in der klassischen Rhetorik als auch in der strukturalen Linguistik scheint diese Identifikation unstrittig zu sein. Indem Aristoteles die Metapher auch als abgekürzten Vergleich bezeichnen kann, bestimmt er letztlich die Ähnlichkeit als Grundlage der Substituierbarkeit. Diese Tendenz findet ihre Fortsetzung in der Semiotik R. Jakobsons, welcher Metapher und Metonymie als die beiden Grundtropen und darüber hinaus als die allgemeinsten Sprachprozesse überhaupt verstehen will, wobei die Metapher auf dem Phänomen der Ähnlichkeit, die Metonymie dagegen auf der Angrenzung beruht. Damit bleibt die Metapher jedoch lediglich Bestandteil eines semiotischen Prozesses und kann nicht auch als Vorgang einer Attribution erkannt werden. Ricoeur urteilt deswegen: „was hier gänzlich übersprungen wird, ist der prädikative Charakter der Metapher."" 5 Dieser wird erst vor dem Hintergrund der Unterscheidung zwischen Semiotik und Semantik erkennbar, der sich ein 'Monismus des Zeichens' beharrlich verschließt. Die Folge ist, daß Jakobsons Metapherntheorie Substitution und Ähnlichkeit zusammenzieht: „Die Ähnlichkeit verknüpft einen metaphorischen Ausdruck mit dem Ausdruck, für welchen er gesetzt wird."" 6 Trotz einer weiten Metapherntheorie verfügt Jakobson somit nur über einen engen, nämlich substitutiven, Metaphernbegriff. Von daher erklärt sich die starke Ablehnung, die das Ähnlich-
Vgl. Strub, Abbilden und Schaffen von Ähnlichkeiten, S. 109; sowie dort der Verweis auf H. Khatchadourian, Anni. 12. Ricoeur, lebendige Metapher, S. 177. Jakobson, zit. nach Ricoeur, lebendige Metapher, S. 177.
Das Wirken der Ähnlichkeit
49
keitstheorem durch die Verfechter einer Spannungstheorie erfährt. Beschreibt Black die Relation zwischen metaphorischem Hauptsubjekt und Nebensubjekt als Schirm- oder Filtereffekt, so verzichtet M. Beardsley vollständig auf Analogieverhältnisse und betont dagegen die logische Absurdität der Metapher. Ricoeur versucht sich mit seiner Rehabilitierung der Ähnlichkeit unter den Voraussetzungen der Spannungstheorie zwischen beiden Positionen zu behaupten. Bei dem Übergang von der semantischen Impertinenz zu einer neuen Pertinenz spielt die Ähnlichkeit eine unverzichtbare Rolle. Was nämlich die neue Pertinenz ausmacht, ist die semantische Nähe, die trotz des Abstandes zwischen den Begriffen entsteht. Dies kann im Unterschied zur Substitution eines Zeichens als die prädikative Wirkung der Ähnlichkeit bezeichnet werden. Von daher ergibt sich, daß „Spannung, Widerspruch und Kontroversheit nur die Kehrseite der Art von Annäherung sind, durch die die Metapher Sinn ergibt."117 Dabei muß jedoch zwischen Abbilden und Schaffen von Ähnlichkeit unterschieden werden. Ph. Wheelwright führte dazu die Differenz von epiphor und diaphor ein. Die Ähnlichkeit entspringt gleichursprünglich einem intuitiven Sehen118 und einer diskursiven Konstruktion. „Die Diaphora der Epiphora ist eben dieses Paradox, das dem 'Blick' zugrundeliegt, der jenseits der Scheidung die Verbundenheit erkennt." 1 " Darin aber entspricht das Wirken der Ähnlichkeit dem Verhältnis zwischen Identität und Differenz, das in die Spannungsmetapher eingegangen ist. Die Metapher auf das Wirken der Ähnlichkeit zurückzuführen, bedeutet deshalb nicht zwangsläufig, eine vorgängige Identität zu behaupten, sondern sichert gerade die Verschiedenheit des ungewohnt miteinander Verbundenen. Das Ähnlichkeitstheorem besagt aber über die These vom kalkulierten Kategorienfehler hinaus auch, daß dabei nicht stehengeblieben werden kann, daß sich also die Metapher nicht schon in ihrer ordnungskritischen, sondern erst in ihrer ordnungskreativen Funktion erfüllt. „Mit anderen Worten, die Gewalt der Metapher bestünde darin, eine frühere Kategorisierung zu brechen, um auf den Trümmern der älteren logischen Grenzen neue zu errichten."120 Der aristotelischen Verankerung des Ähnlichkeitsbegriffs in der Metapherntheorie ('gut zu übertragen heißt, das Ähnliche sehen') gilt es von daher den Satz M. Blacks an die Seite zu stellen, daß es in vielen Fällen aufschlußreicher wäre zu sagen, „die Metapher schafft die Ähnlichkeit, statt zu sagen, sie formuliert eine bereits vorher existierende Ähnlichkeit."121 Zwischen Abbilden und Schaffen von Ähnlichkeit vollzieht sich jener 'Zusammenhang zwischen dem Schöpferi-
117 118 119 120 121
Ricoeur, lebendige Metapher, S. 183. Aristoteles, Poetik, 149a 5-8: „Denn gut zu übertragen bedeutet das Ahnliche sehen." Ricoeur, lebendige Metapher, S. 185. Ebd., S. 188. Black, bei Haverkamp, Theorie der Metapher, S. 68.
50
Die lebendige Metapher
sehen und der Regel', den die Einleitung in dieses Kapitel als einen Aspekt des methodischen Rahmens von Ricoeur genannt hatte.122 Der Ort dieser Dynamik liegt in der produktiven Einbildungskraft. Kant unterscheidet sie von der reproduktiven Einbildungskraft um sie mit dem 'Schema' zu identifizieren, welches eine Methode zur Konstruktion von Vorstellungsinhalten und Aussagen ist. „Die Einbildungskraft ist diese Kompetenz, diese Fähigkeit, neue logische Räume durch prädikative Angleichung zu schaffen und sie trotz - und dank - des anfänglichen Unterschieds zwischen den Termini zu schaffen, die sich der Angleichung widersetzen."123 Insofern entspricht ihre Funktion jener 'Ontologie der Mehrdeutigkeit' in einer offenen Entdeckungswelt, die als Bedingung der Möglichkeit für eine innovative Metaphorologie zu gelten hat.
6. Fazit Leistung und Grenzen einer Theorie der lebendigen Metapher Als Schlüssel zur Theorie der lebendigen Metapher dient der Begriff der 'semantischen Innovation'. Mit diesem Suchbegriff gelingt es, die heuristische Funktion der Metapher für die Neubeschreibung der Wirklichkeit zu erfassen und im Gegenzug die reduktionistischen Tendenzen der rhetorischen Metapherntheorien (Nomen-, Substitutions- und Vergleichstheorie) als unzulänglich auszuscheiden bzw. auf eine bestimmte Menge von Fällen zu beschränken. Ein weiterer Beitrag ist die Ausweitung der Untersuchungsperspektive von der Wort- über die Satz- zur Textmetaphorik. Damit verbindet sich die Einsicht, daß ein Text oder ein Satz im Kontext auch bei Fehlen einzelner Metaphern metaphorisch konstituiert sein kann, indem er an einer modellanalogen Leitmetaphorik orientiert ist, die als solche nicht in Gestalt von konkreten Wortmetaphern realisiert zu sein braucht, sondern die Denkbewegung untergründig steuert. Insofern die Frage nach der Referenz von der Metaphorik des Werkes zur Metaphorik der Welt des Werkes überleitet, wird das Bewußtsein für das hermeneutische Phänomen metaphorischer 'Weisen der Welterzeugung' geschärft. Schließlich ist das Konzept der lebendigen Metapher in der Lage, die logische Störung als gezielte Kategorienüberschreitung zu würdigen und darin die ordnungskonstitutive Funktion der Metapher zu erkennen. Im Rahmen einer Logik der Entdeckung in einer offenen Erfindungsweit dienen unkonventionelle Metaphern mit hoher Auffälligkeit dazu,
122 123
S. o. S. 13. Paul Ricoeur: Erzählung, Metapher und Interpretationstheorie, in: ZThK 84, 1987, S. 232-253; ebd., S. 241.
Leistung und Grenzen einer Theorie der lebendigen Metapher
51
in produktiver Weise über kategorial fixierte Beschreibungsmöglichkeiten hinauszugelangen und neue Interpretationen anzubahnen. In der Verpflichtung der Metapher auf semantische Innovationsleistungen liegt jedoch auch die Grenze eines Konzeptes der lebendigen Metapher. Denn der damit verbundene quasi-poetische Novitätsanspruch verstellt den Blick auf Metaphern mit geringerer Auffälligkeit und hoher Usualität. Was sich einerseits als konstruktive Wahrnehmung der metaphorischen Störung qua Kategorienüberschreitung bewährt, läuft andererseits Gefahr, nur noch die verstörende Fremdheit und Anderheit der Metapher, aber nicht mehr ihren alltagssprachlichen Gebrauchswert wahrzunehmen. Wenn alles Gewicht auf den 'semantischen Schock' der Metapher gelegt wird, bleibt der Status quo der Sprache mit ihrem Schatz an sedimentierten Metaphern außer Betracht. Dies führt zu der erzwungenen Behauptung, daß eingebürgerte Metaphern nicht mehr als solche gelten dürften bzw. als 'tote Metaphern' metaphorologisch uninteressant seien. Hier ist ein blinder Fleck der poetischen Metapherntheorien zu konstatieren. Aber bereits bei Ricoeur lassen sich Ansätze zur metaphorologischen Modifikation und Korrektur ausfindig machen, freilich ohne daß er diese selbst gesehen oder genutzt hätte. In dem Sinn wie die Theorie der lebendigen Metapher die internen Beschränkungen der aristotelischen Metapherntheorie durch eine kritische Interpretation schon im Ansatz überwindet, gilt es auch in Ricoeurs Ansatz diejenigen Implikationen zu entdecken, die eine rein poetologisch-innovative Metaphorologie um eine topisch-konventionelle Metaphorologie anzureichern erlauben. Diese verbergen sich zum einen in Ricoeurs Rezeption und Integration des kognitiven Modellbegriffs angloamerikanischer Provenienz und zum anderen in seiner Ausweitung des metaphorischen Gegenstandsbereichs auf das Phänomen der Text-, Werk- und Weltmetaphorik. Indem Ricoeur zur Klärung der metaphorischen Funktion den Modellbegriff heranzieht, hat er seinen Ansatz unter der Hand bereits im Blick auf eine konzeptuell-konventionelle Metapherntheorie hin geöffnet. Modelle fungieren in den Wissenschaften nämlich nicht nur theoriekreativ, sondern auch theoriesichernd und -bewahrend. Insofern die Metapher hinsichtlich ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit mit der Funktion des Modells verglichen wird, muß prinzipiell auch die theorieorientierende Funktion konventionell-konzeptueller Metaphern mit in Betracht gezogen werden. Dazu kommt ein zweites: Insofern dem Modell nicht die isolierte Metapher, sondern vielmehr ein Metaphernnetz entspricht, hatte Ricoeur die Metapher auch als Textphänomen bestimmt. Damit ist jedoch die metaphorische Innovationsfunktion in Reinkultur ebenfalls überschritten. Metaphorische Texte sowie Kontextverbindungen sind niemals ausnahmslos innovativ, sondern stellen immer ein 'corpus permixtum' aus traditionellen und innovativen Momenten dar. Diese Überlegung wird durch Einbeziehung des Problems der 'toten Metapher' noch
52
Die lebendige Metapher
gestützt. Denn das Kriterium des Eingehens in den lexikalisierten Wortschatz für das Absterben einer Metapher kann nur bei Wortmetaphern zur Anwendung gelangen. Kontextmetaphern, Modelle und Konzepte dagegen sind prinzipiell nicht lexikalisierbar, sondern stellen komplexe semantische Strukturen dar. Ebensowenig kann die Metaphorizität eines Textes, das heißt seine implizite Leitmetaphorik als solche in den lexikalisierten Code eingehen, sondern bleibt auf die jeweilige Interpretation angewiesen. Metaphorizität auf der Textebene ebenso wie Situationsmetaphorik sind deshalb weder ersetzbar noch erschöpfend paraphrasierbar. Textmetaphorik läßt sich nicht auf isolierte Wortmetaphern zurückführen, genauso wie sich lebendige, emphatische oder kühne Metaphern nicht durch wörtliche Rede substituieren lassen. Insofern die tote Metapher lediglich ein Problem der Wortmetapher, nicht jedoch der kontextuellen Metapher und der leitenden Textmetaphorik darstellt, können konventionelle Metaphern nicht einfach als metaphorologisch irrelevant gelten. Daß von daher in der produktiven Wahrnehmung traditioneller Metaphern metaphorologischer Nachholbedarf besteht, sollen die folgenden Darlegungen zur konzeptuellen Metapher zeigen.
Kapitel 2 Die konzeptuelle Metapher Nicht nur der rationalistische Diskurs über die Metapher ist vorurteilsbeladen. Auch innerhalb der neueren Metaphorologie haben sich bereits bestimmte Klischees festgesetzt. Dazu gehört auch die immer wieder vorgebrachte Behauptung, daß es unter den methodischen Rahmenbedingungen von Topik und Rhetorik keine zureichende Metapherntheorie geben könne, weil die Grundaxiome dieser Disziplinen zwangsläufig dazu führen müßten, den metaphorischen Sprachgebrauch als uneigentliche Rede abzuwerten. Im Gegensatz dazu sei allein die Poetik in der Lage, diejenigen Prämissen bereitzustellen, die eine unreduzierte Theorie starker Metaphern ermögliche. Die Folge dieser methodischen Alternative ist jedoch eine Vereinseitigung in der Wahrnehmung metaphorischer Sprachphänomene. Denn die Bandbreite metaphorischer Rede wird ausschließlich auf die lebendige Metapher, die ihr Paradigma vor allem in der modernen Lyrik hat, eingeschränkt. Die folgenden Darlegungen zur konzeptuellen Metapher scheinen demgegenüber geeignet, die Vorurteile gegenüber konventionellen Metaphern zu revidieren und dem rhetorisch-topischen Paradigma wieder einen Platz in der Metaphorologie einzuräumen. In der Konsequenz dieser erweiterten Fragerichtung wird dann neben der innovativen auch die traditionsstiftende Funktion der Metapher in den Blick treten. Die konzeptuelle Metapher beruht im Unterschied zur lebendigen Metapher auf der „Faszination konventioneller Metaphern"1 und unterscheidet sich von dieser darin, daß mit ihrer Hilfe bereits existierende und vertraute metaphorische Verbindungen abgerufen werden. Die konzeptuelle Metapher regelt mithin die Kommunikation zwischen ausdifferenzierten und fixierten Kontexten, Konzepten und Diskursen. Dieser Austausch zielt weniger auf die erkenntnisstiftende, als auf die begründungssichernde Funktion metaphorischer Rede. Damit steht im Unterschied zur innovativen Funktion der lebendigen Metapher die stabilisierende Orientierungskraft im Vordergrund. Um diesen kognitiv-argumentativen Aspekt zu plausibilisieren, soll die Theorie der konzeptuellen Metapher vorgestellt werden, die M. Pielenz im Anschluß an die viel diskutierte Arbeit von Lakoff/Johnson2 skizziert hat. Während es Pielenz jedoch in der Hauptsache um die alltagsorientierende Begründungs-
2
Michael Pielenz: Argumentation und Metapher, Tübingen 1993, S. 115. George Lakoff/Mark Johnson: Metaphors We live by, Chicago/London 1980.
54
Die konzeptuelle Metapher
funktion von Metaphern in der kollektiven Lebenswelt von Kommunikationsgemeinschaften und Kulturen geht3, wird für die Heuristik der vorliegenden Arbeit vor allem die geltungssichernde Funktion theoriestützender Metaphern zu beachten sein. Pielenz baut seine Arbeit auf einem methodischen Vierschritt auf. In Auseinandersetzung mit der Argumentationstheorie (St. Toulmin4), der Metapherntheorie (M. Black und G. Lakoff/M. Johnson), sowie der Topik (L. Bornscheuer5) und der Mentalitätsgeschichte (die französische Schule der Annales6) sucht er, die These von der argumentativen Funktion konzeptueller Metaphern in quasi-topischen Begründungsverfahren zu erhärten. Er will zeigen, „wie wir alltäglich und notwendig auf Geheiß konzeptueller Metaphern argumentieren. " 7 Im Anschluß an Lakoff/Johnson wird dazu die Allgegenwart sowie die zentrale und unverzichtbare Bedeutung konzeptueller Metaphern analysiert. „Sowohl in der allgemeinen Redepraxis als auch in der wissenschaftlichen Theoriebildung spielen sie ihre unverzichtbare Rolle, bieten epistemische Leitvorstellungen, liefern Interpretationshilfen und bergen Handlungsziele. Kurzum: sie generieren Theorien für Wissenschaft und Alltag."8 Mit St. Toulmin und G. Öhlschläger' erfährt das Programm konzeptueller Metaphern eine argumentationstheoretische Zuspitzung. Aus 'Metaphors we live by' werden 'Metaphors we argue by'. In diesem Zusammenhang wird die Funktionsäquivalenz zwischen einer argumentationstheoretischen Schlußregel bzw. Schlußpräsupposition und der konzeptuellen Metapher aufgewiesen.
4
5
6
7
„Letztlich beschäftigt sich meine Arbeit damit, die Orte aufzufinden, an denen sich Rationalität ins Alltagsverständnis eingenistet hat. [...] Vor allem interessiert mich die soziale Verwendung der Metapher, im Vordergrund steht ihr Gebrauch als sozial konstituiertes Modell alltäglicher Lebenserfahrung." (Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 9). Stephen Toulmin: The uses of arguments, Cambridge 1958; dt. Der Gebrauch von Argumenten, Kronberg 1975. Lothar Bornscheuer: Topik. Zur Struktur der gesellschaftlichen Einbildungskraft, Frankfurt am Main 1976; Ders.: Art.: Topik, in: Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte Bd 4, S. 454-475. Die Gründimg der 'Annales d'histoire économique et sodale' erfolgte 1929 durch den Neuzeit-Historiker Lucien Febvre und den Mediävisten Marc Bloch; vgl. dazu Matthias Middell/Steffen Sammler (Hg.): Alles Gewordene hat Geschichte. Die Schule der ANNALES in ihren Texten 1929-1992, Leipzig 1994; und Ulrich Raulff (Hg.): Mentalitäten-Geschichte. Zur historischen Rekonstruktion geistiger Prozesse, Berlin 1987. Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 11.
8
Ebd
9
Günther Öhlschläger: Linguistische Überlegungen zu einer Theorie der Argumentation, Tübingen 1979.
·
Die koiizeptuelle Metapher
55
In Anlehnung an L. Bornscheuer soll schließlich in einem dritten Schritt die argumentative Funktion konzeptueller Metaphern topisch verortet und konkretisiert werden. Metaphern kommen in strukturanaloger Weise wie Topoi in Rechtfertigungszusammenhängen zum Einsatz. „Jede konzeptuelle Metapher läßt sich als eine stille Matrix impliziter Schlußpräsuppositionen quasi-topisch deuten, die in Rechtfertigungszusammenhängen Argumente zur Befestigung kritisierter Geltungsansprüche anbietet." 10 Metaphern wie Topoi rekurrieren auf den stillen Überzeugungsfundus einer jeweiligen Kommunikationsgemeinschaft und stellen für deren Mitglieder einen Vorrat an plausiblen Argumenten bereit. Wenn Bornscheuer die Topik als 'Struktur der gesellschaftlichen Einbildungskraft' verstanden wissen will, so kann Pielenz die Metapher als topische 'Tiefenstruktur der kulturellen Einbildungskraft' bezeichnen. Metaphern als Mittel der argumentativ-sozialen Praxis nehmen somit eine kulturprägende Funktion ein. Doch um die argumentative Funktion der konzeptuellen Metapher zu verdeutlichen, bedarf es zunächst der 'Entrhetorisierung' der Metapher im Sinne eines Mittels zur bloßen Überredung oder Verzierung bzw. zu sprachlichem l'art pour l'art, woraufhin erst in einem zweiten Schritt ihre argumentativkognitive Affirmierung erfolgen kann. Die Metapher muß von Unterstellungen befreit werden, die in ihr nur eine 'Sprachverführung' und 'Lügenerscheinung im Sprachleben' (F. Kainz) aufgrund eines erkenntnisverhindernden 'Verhüllungsbedürfnisses' (H. Werner) erkennen oder ihre theoretische Valenz nur in der Funktion als 'Erkenntnisbremse' (N. Luhmann) sehen.11 „Das gelingt, indem man Metaphern als kulturell entfaltete und unentbehrliche kognitive Kategorien individueller wie kollektiver Lebenserfahrung interpretiert." 12 Um die Metapher in diesem Sinne als 'kulturelles Modell' verstehen zu können, ist in einem vierten Schritt die Erweiterung eines Ansatzes der sozialen Kommunikation um eine kulturtheoretische bzw. kulturgeschichtliche Perspektive erforderlich. Sie wird durch das Programm der 'Mentalitätsgeschichte' als einer Geschichte des inneren Menschen und seiner Lebenswelt eröffnet. Sein methodisch synthetisches Anliegen zusammenfassend stellt Pielenz die These auf, „daß wir unablässig und zumeist unbemerkt konzeptuelle Metaphern als Argumentationsbasis individuell wie kollektiv voraussetzen, in denen eine von allen Kommunikationsteilhabern getragene Logik des Plausiblen die alltägliche Handlungs- und Rechtfertigungspraxis durchdringt. In dieser Gestalt repräsentieren konzeptuelle Metaphern genuine kulturelle
10 11
12
Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 12. Zitate und Nachweise bei Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 60f. und ebd. in Anm. 12-17. Ebd., S. 12.
56
Die konzeptuelle Metapher
Modelle, in denen der kulturgeschichtliche Erfahrungshorizont herrschender Mentalitäten sedimentiert ist."13 Indem Metaphernforschung, Argumentationstheorie und Topik derart in einen Zusammenhang gestellt werden, greift Pielenz der Intention nach auf, was nach Aristoteles verloren gegangen war, nämlich die Verbindung der Rhetorik mit einer allgemeinen Argumentationstheorie und - über Dialektik und Topik - ihr Zusammenhang mit der Philosophie. Damit reaktiviert Pielenz das ursprünglich aristotelische Theoriegefüge einer philosophisch vermittelten Rhetorik als einer Logik der Überzeugung am Leitfaden des jeweils Wahrscheinlichen. Das dabei diagnostizierte neue Interesse an der Metapher und den damit verbundenen aufstrebenden Erkenntnisanspruch der Rhetorik kann man deshalb auch als Ausdruck einer allgemeinen 'Rhetorisierung der Wissenschaften' und einer daraufhin erfolgten kognitiven, d. h. wissenschaftlichen Durchdringung der Rhetorik selbst verstehen14. Vor dem Hintergrund dieser 'Trendwende' 15 in der Einstellung zur Rhetorik hat die „Verleumdung der Rhetorik" 16 durch ihre rationalistischen Gegner inzwischen selbst einen topischen Charakter angenommen. Ungeachtet dieser positiven Bezüge auf das ursprüngliche Programm einer unreduzierten Rhetorik vollzieht Pielenz jedoch seinem Selbstverständnis zufolge „die endgültige Abkehr von aristotelisch inspirierten Metapherntheorien, in denen die stilistisch-rhetorische Wirkungsmächtigkeit der Metapher zwar gelobt, doch ihre Sprachverführung und Erkenntnisverhinderung gegeißelt wurde." 17 Hier scheint jedoch ein (Selbst-)Mißverständnis vorzuliegen. Denn zahlreiche neuere Arbeiten zur aristotelischen Metapherntheorie haben deutlich gemacht, daß sich eine derartige Deutung nicht auf Aristoteles, sondern erst auf seine Epigonen und ihre 'Rhétorique restreinte' (G. Genette18) und die Wirkungsgeschichte einer zunehmend schrumpfenden Disziplin beziehen kann. In Pielenz' eigenem Anliegen lebt dagegen die ursprünglich aristotelische Komplexgestalt zwischen Rhetorik, Topik, Dialektik und Philosophie durchaus wieder auf. Dafür spricht auch, daß Pielenz die Hauptfunktion der Metapher im Bereich lebensweltlich-sozia13 14
15 16 17 18
Ebd., S. 14. Das philosophische Vorurteil gegen die Rhetorik hat demnach seit der sprachphilosophischen Wende (linguistic turn) dieses Jahrhunderts einen sukzessiven Abbau erfahren. Peter L. Oesterreich (Philosophen als politische Lehrer, Darmstadt 1994) verweist z. B. auf Ch. Perelmans Nachweis des „spezifisch argumentativen Charakters der Rhetorik", die sogenannte 'Topik-Renaisance' der fünfziger Jahre, sowie E. Grassis Bemühungen um den „Philosophie-Charakter des rhetorischen Sprachhumanismus" (ebd., S. 16). Oesterreich, Philosophen als politische Lehrer, S. 17. Ebd. Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 11. Gérard Genette: La rhétorique restreinte, dt.: Die restringierte Rhetorik, in: Haverkamp, Theorie der Metapher, S. 229-252.
Die konzeptuelle Metapher
57
1er Rationalität verortet und die Metaphorik in die Nähe einer „aristotelisch orientierten Topik"1® rückt. Die öffentliche Beredsamkeit sowie die argumentative Redepraxis geben den Rahmen für eine auch im weitesten Sinne aristotelisch-rhetorische Metapherntheorie ab. Mit der konzeptuellen Metapher wechselt die Szene also vom hermeneutisch-intimen tête-à-tête zwischen Text und Leser auf das öffentliche Feld von Argumentation, gesellschaftlicher Kommunikation und ihren Formen alltäglicher Redepraxis. Während die Hermeneutik der Metapher ihre individuelle Hervorbringung und Darstellung betont hatte, bemüht sich die Topik der Metapher um soziale Kommunikation und Überzeugungspraxis. Hatte die Semantik die Metapher als Wechselwirkung von Kontexten beschrieben, so lehrt die Argumentationstheorie, die Metapher als Interaktion von Konzepten zu verstehen. Wurde die heuristische Funktion der quasi-poetischen Metapher als Neubeschreibung der Wirklichkeit verstanden, so besteht die heuristische Funktion der quasi-topischen Metapher in der Herstellung eines bestimmten Einverständnisses über die Wirklichkeit. Konnte Ricoeur gerade auf den positiven Effekt der metaphorischen Störung abheben, so bestreitet Pielenz für die konzeptuelle Metapher ihre angeblich deviante Eigenschaft. Die topos-analoge Metapher stellt keine Störung oder semantische Unregelmäßigkeit dar, sondern verweist auf den kollektiven Überzeugungsfundus einer kulturell geprägten Mentalität. Die Pathologie der Metapher wird durch die Behauptung ihrer Selbstverständlichkeit ersetzt. An die Stelle einer innovativen 'Logik der Entdeckung' tritt die argumentative 'Logik der Begründung', die jedoch nicht am wissenschaftlichen Beweisverfahren orientiert ist, sondern an der „Logik des Einleuchtenden"20 eines jeweiligen sensus communis. Im Hinblick auf das Vorhaben der vorliegenden Arbeit soll jedoch die Gegenüberstellung zwischen lebendig-innovativer und konzeptuell-konventioneller Metapher nicht exklusiv verstanden werden. Vielmehr erfährt die heuristische Funktion der lebendigen Metapher eine Ergänzung durch die quasi-topische Gebrauchsfunktion der konzeptuellen Metapher. Insofern nicht das Wesen, sondern das Wirken der Metapher im Mittelpunkt des Interesses steht, geht es nicht um metapherntheoretische Purismen, sondern um die möglichst umfassende Wahrnehmung und Interpretation der unterschiedlichen Verwendungs- und Funktionsweisen kognitiver Metaphorik in theoretischen Traditions- und Innovationsprozessen.
" 20
Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 173. Ebd., S. 13.
58
Die konzeptuelle Metapher
1. Argumentationstheoretische Grundlegung Um die Plausibilität der These von der impliziten Argumentationshaltigkeit der konzeptuellen Metapher zu erweisen, ist zunächst die Argumentationstheorie aus ihren formallogischen Verengungen herauszulösen. In einer um die „weicheren Formen des Schließens"21 erweiterten Argumentationstheorie kann auch der Metapher ein argumentativer Stellenwert eingeräumt werden. Zu diesem Zweck lehnt sich Pielenz an das argumentationstheoretische Modell von St. Toulmin an und modifiziert es mit Hilfe eines Gedankens des Linguisten G. Öhlschläger. Toulmins Argumentationsmodell läßt sich nicht ohne die philosophischen Implikationen verstehen, die seinem Ansatz zugrunde liegen. Diese erhalten ihren theoretischen Stellenwert vor dem Hintergrund einer allgemeinen Tendenzwende in der analytischen Philosophie von der formalen zur informellen Logik. Im Gegensatz zu einer bloß formalen Gültigkeit berücksichtigt diese mehr den inhaltlichen Aspekt bei der Bewertung von Argumenten. An die Stelle eines geometrischen Argumentationsmodells setzt Toulmin deshalb ein dem juridischen Verfahren analoges Modell. Dieser Schritt ist wiederum durch die Neuorientierung der analytischen Philosophie an der sogenannten 'ordinary language' motiviert. Markante Eckpunkte dieser Wende stellen L. Wittgensteins 'Sprachspiele', J. L. Austins Frage 'How to do things with words' und J. R. Searles 'Sprechakte' dar. Toulmin gründet seinen Ansatz auf eine in den Wissenschaften und dem öffentlichen Diskurs gebräuchliche Argumentationspraxis, die sich von den Schranken einer unpragmatischen und rein formalen Logik befreien will. Denn der Typus der formal-analytischen Argumentation findet sich weder in der alltäglichen Argumentationspraxis noch in den außermathematischen Wissenschaften, geschweige denn in den Geisteswissenschaften. Dort kommen vielmehr von Toulmin als 'substantiell' bezeichnete Argumente zum Einsatz, d. h. Argumente, deren Schlüsse nicht schon in den Prämissen enthalten sein müssen. Derartige Argumente, die auf induktivem Wege gewonnen werden, können jedoch unter formal-logischen Bedingungen keine Gültigkeit beanspruchen. Ihre Schlußfolgerung beruht lediglich auf einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Gültigkeit und Rationalität hängen aber nicht nur von der Form einer Argumentation ab, wie dies im klassischen Syllogismus der Fall ist, sondern dependieren ebenso von inhaltlichen Kriterien. Damit ist zugleich eine Kritik an der Auffassung einer 'kontextinvariablen Gültigkeit' impliziert. Während die Argumente in der formalen Logik deduktiv und analytisch gewonnen
Lutz Danneberg u. a. (Hg.): Metapher und Innovation, S. 15. Als Beispiel nennt Danneberg dort das Verfahren des 'analogical reasoning' (Lit. ebd. Anm. 27).
Argumentationstheoretische Grundlegung
59
werden22, müssen sich die Argumente einer informellen Sachlogik immer auch 'kontextsensitiv' verhalten. Das entsprechende Argumentationsmodell muß deshalb prozedural bestimmt werden, d. h. die Prämissen dürfen nicht als statisch fixierte Ausgangsgrößen angesehen werden, von denen man jederzeit zu dem gleichen Schluß gelangen muß. Vielmehr entspricht jedem Schritt eines prozedural-argumentativen Verfahrens eine kontextabhängige Verwendungs- und Funktionsweise. Um dies zu verdeutlichen, wählt Toulmin das juridische Paradigma aus. In der juridischen Argumentationspraxis erhalten nämlich alle Äußerungen durch ihren jeweiligen Ort im Verfahren ihre spezifische Bedeutung. Die Bedingung der Möglichkeit für eine Argumentation besteht in dem Aufstellen einer Behauptung (Conclusion) und in der Bestreitung ihres Geltungsanspruches. „Wird also der Geltungsanspruch einer Aussage problematisiert, bedarf er der Abstützung: q, weil p." 23 Für diese Abstützung sind Daten erforderlich, welche die bezweifelte Behauptung zu begründen in der Lage sind. Diese können nun ihrerseits zum Gegenstand der Bestreitung werden, dann geht die Argumentation in eine Schleife. Werden die zur Begründung der Conclusion angeführten Daten jedoch akzeptiert, kann trotzdem eine weitere Absicherung verlangt werden, in der nun keine neuen Daten erwartet werden, sondern in der die Relation der Daten zur Conclusion in Frage steht. Antworten auf diese Nachfrage sind Toulmin zufolge kategorial anderer Natur als die Daten der Begründung: nämlich Regeln, Prinzipien und Schlußregeln. Sie sollen die Verbindung von Begründung und Behauptung absichern. Toulmin nennt derartige Aussagen 'warrant'. Dieser kann auch mit Einschränkungen wie z. B. 'es sei denn...' verbunden werden. Wird jedoch auch die Geltung des warrant bezweifelt, muß zuletzt eine 'Stützung' (backing) erfolgen, die sich im Unterschied zum hypothetischen warrant durch einen „kategorisch abgesicherten Faktenstatus ü24 auszeichnet. Der zentrale Gedanke des Toulminschen Argumentationsmodells beruht darin, daß ein zur Stützung (backing) einer bestrittenen Schlußregel (warrant) eingesetztes Argument demselben Sachbereich entstammen muß, wie die ursprüngliche Behauptung. Während die dazwischenliegende Begründung (die 'Daten') sowie die zur Begründung herangezogenen Schlußregeln und Prinzipien auch aus anderen Kontexten stammen oder rein formaler Natur sein können, muß die Stützung einer bestrittenen Begründung der Begründung (also die Begrün-
23 24
Auf Toulmins argumentationstheoretische Kritik am Absolutheitsanspruch des deduktiven Verfahrens bezieht sich auch M. B. Hesses Einwand im metapherntheoretischen Kontext: „Man muß das deduktive Modell der wissenschaftlichen Erklärung verändern und ergänzen und die theoretische Erklärung als die metaphorische Neubeschreibung des Bereichs des Explanandum auffassen." (zit. bei Ricoeur, lebendige Metapher, S. 231). Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 22. Ebd., S. 25.
60
Die konzeptuelle Metapher
dung dritter Ordnung) in inhaltlicher Kontinuität zu der anfangs aufgestellten Behauptung stehen. Die Stützung sichert in diesem Modell somit den thematischen Wirklichkeits- und Sachbezug einer Argumentation. Daraus folgt, daß die Gültigkeit eines Argumentes 'feldabhängig', d. h. abhängig von dem in der Behauptung jeweils eröffneten Argumentations- und Wissensbereich ist. Pielenz hebt hervor, daß Toulmins Intention in nichts anderem besteht, als in diesem Nachweis der Feldabhängigkeit von Gültigkeit. Er kritisiert jedoch an Toulmin, daß dieser die Unterscheidung zwischen der Begründung zweiter Ordnung (Schlußregel, warrant) und dritter Ordnung (Stützung, backing) nicht genau bestimmen kann und in der begrifflichen Bestimmung dieser Ebenen schwankt. Pielenz zieht deshalb die Unterscheidung zwischen Schlußregel und Stützung ein und ersetzt sie durch den Begriff der Schlußpräsupposition, der durch G. Öhlschläger eingeführt wurde. Öhlschläger versteht ein Argument zunächst von seinem Behauptungscharakter aus. Mit Tugendhat" faßt er Behauptungshandlungen als Garantiehandlungen auf. Etwas behaupten heißt demzufolge immer, etwas anderes vorauszusetzen, zu präsupponieren. Eine Behauptung muß also zugleich garantieren, ihre eigenen Voraussetzungen erfüllen zu können. Präsuppositionen stellen die notwendige Bedingung für die Gültigkeit einer Behauptung dar. Das Argument entspricht einer Behauptung, die zur Stützung einer bestrittenen Behauptung aufgestellt wird. Die von der Gültigkeit einer argumentierenden Behauptung abhängigen Präsuppositionen nennt Öhlschläger Schlußpräsuppositionen. „Deren Funktion besteht darin, den Schluß vom Argument auf die Conclusion zu rechtfertigen".26 Öhlschläger schreibt dazu: „Wer argumentiert, behauptet etwas, - das sog. Argument -, um etwas, das in Frage steht - die sog. Konklusion - zu stützen, und präsupponiert, daß die Konklusion aus dem Argument folgt, d. h. schließt vom Argument auf die Konklusion aufgrund der Schlußpräsupposition.u27 Für den Zusammenhang zwischen Metapher, Argument und Topos ist die strukturelle Verwandtschaft zwischen dem Argument im Sinne Toulmins und dem Topos der klassisch-antiken Rhetorik aufschlußreich. Toulmin bildet nämlich im wesentlichen das antik-römische Schema des 'Epicheirem' nach. Ein Vergleich beider Modelle zeigt, „daß der Topos als propositio im Epicheirem wie auch als warrant im Toulminschen Schema in der Rolle der Schlußregel funktional denselben Platz einnimmt.u28 Deshalb kann die neuere
26 27
28
Ernst Tugendhat: Vorlesungen zur Einführung in die analytische Sprachphilosophie, Frankfurt am Main 1976. Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 51. Öhlschläger, Linguistische Überlegungen, S. 99; zit. bei Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 51 f. Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 38. Aus dieser Funktionsäquivalenz zwischen Topos und Schlußregel darf jedoch nicht der Umkehrschluß gezogen werden, jede Schlußregel sei ein Topos, (vgl. ebd. S. 55).
Metapherntheoretische Anwendung
61
Forschung den Toposbegriff auch als Suchformel oder Schlußregel interpretieren. 2 ' Diese Schlußregelhaftigkeit des Topos zieht Pielenz heran, um seinen Vergleich mit der argumentativen Funktion konzeptueller Metaphern zu untermauern. Dabei legt er seinen Überlegungen einen kognitiven Metaphernbegriff zugrunde, wie er nach I. A. Richards und M. Black vor allem von G. Lakoff und M. Johnson in ihrem Buch 'Metaphors we live by' konzipiert worden ist. Mit ihnen möchte Pielenz seine These vom impliziten Schlußregelcharakter der konzeptuellen Metapher stützen.
2. Metapherntheoretische Anwendung Durch die unüberschaubare Fülle der Metapherntheorien schlägt sich Pielenz eine Bresche, indem er das Kriterium ihrer Beurteilung von der Frage abhängig macht, „ob das Verstehen und Erzeugen von Metaphern als ein kognitiver Prozeß aufgefaßt wird." 30 Kognitive Metapherntheorien unterscheiden sich von nicht-kognitiven Metapherntheorien dadurch, daß sie die Metapher als ein Ergebnis „mentaler Konstruktion"31 auffassen. Insofern nennt Pielenz kognitive Metapherntheorien auch 'konstruktivistische Metapherntheorien'. Kognition wird demnach von einer aktiven Konstruktion abhängig macht. Produktive Erkenntnis versteht sich nur als produzierte Erkenntnis. Deshalb kommt die Metapher insbesondere als rhetorische, d. h. als bewußt eingesetzte Argumentationsfigur in den Blick. Dabei droht freilich die Gefahr, daß der kognitive Aspekt der Sprache in ihrer Eigendynamik ungebührlich in den Hintergrund gedrängt wird. Im folgenden wird es von daher auch darauf ankommen, den kognitiven Aspekt der Metapher nicht nur in der Verwendungskompetenz von Sprechern, sondern ebenso in der semantischen Sogwirkung der Sprache zu verorten, welche die Verwender metaphorischen Sprachgebrauchs mehr unbewußt in ihren Bann zieht, als daß sie diese in jedem Fall bewußt gestalten. Im Unterschied zu den konstruktivistischen leugnen die nicht-konstruktivistischen Metapherntheorien den Zusammenhang zwischen Kognition und Metapher. Sie sehen in der Metapher nur einen von der Norm abweichenden Sprachgebrauch, der zur Überredung oder Verzierung eingesetzt wird. Mit Ricoeurs Worten können solche Auffassungen nur die logischen Kosten, nicht aber den semantischen und kognitiven Gewinn der Metapher wahrnehmen. 29
30 31
Pielenz beruft sich auf Wilhelm A. De Pater (Les Topiques d'Aristote et la dialectique platonicienne, Fribourg 1965). Nach Bornscheuer kann ein Topos „sowohl die Funktion eines Vordersatzes bzw. einer Prämisse als auch die einer interimistischen Argumentationsstütze haben." (Art.: Topik, S. 455.) Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 59. Ebd.
62
Die konzeptuelle Metapher
Als Ziehvater dieser deviànten Verführungs- und Schmucktheorie der Metapher führt Pielenz Aristoteles an, unerachtet dessen argumentationstheoretischer Einbettung der Metapher über Rhetorik und Dialektik in die Philosophie. Als die zwei Hauptvertreter nicht-kognitiver Metapherntheorien gelten seit Black die Substitutions- und die Vergleichstheorie der Metapher. Ihnen stehen auf kognitiv-konstruktivistischer Seite die Theorie der Wechselwirkung (Richards, Black) und die konzeptuelle Metapherntheorie (Lakoff/ Johnson) gegenüber. Gegen die „main defects of substitution and comparison views"32 hatte M. Black deshalb seine kognitive Interaktionstheorie entworfen, welche der Metapher eine wesentliche, nicht-paraphrasierbare und wirklichkeitsstrukturierende Rolle zuerkannte. An ihn schließen Lakoff/ Johnson mit ihrer konzeptuellen Metapherntheorie an. Vor dem Hintergrund dieses Theoriezusammenhangs kann Pielenz die Begriffe konstruktiv und kognitiv synonym verwenden, da sie alle dieselbe heuristisch-epistemische Funktion der Metapher hervorheben. 2.1 Die konzeptuelle Metapherntheorie von Lakoff/Johnson Die erklärte Hauptintention von Lakoff/Johnson besteht darin, die Metapher aus überkommenen Beschränkungen zu lösen und für eine allgemeine Bedeutungstheorie fruchtbar zu machen. Die Hindernisse, die dieser Absicht im Wege stehen, erkennen sie: 1) 2) 3)
in der Reduktion auf isolierte Wortmetaphern, die als Abweichungen vom wörtlichen Sprachgebrauch dazu dienen, eine Bedeutungsverschiebung zu bewirken, welche auf einer Ähnlichkeitsrelation basiert.
Darin erkennt man unschwer die Nomen-, die Substitutions- und die Vergleichstheorie. Die metaphorologische Negativfolie, die Lakoff/Johnson ihren eigenen Überlegungen unterlegen, entspricht genau derjenigen, gegen die auch Ricoeur und Black zu Felde ziehen. Während Ricoeur jedoch die heuristische Funktion der lebendigen Metapher in der sprachlichen Neubeschreibung der Wirklichkeit erkennt, heben Lakoff/Johnson auf die fundamentalanthropologische und alltagskonstitutive Funktion konzeptueller Metaphern beim Sprechen, Denken und Handeln ab. „We have found [...] that metaphor is pervasive in everyday live, not just in language but in thougt and action. Our ordinary conceptual system, in terms of wich we both think and act, is fundamentally metaphorical in nature. "M Das sprachlichkonzeptuelle System des Menschen ist metaphorisch strukturiert und Black, Models and Metaphors, S. 38. Lakoff/Johiison, Metaphors We live by, S. 3; zit. bei Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 66.
Metapherntheoretische Anwendung
63
bestimmt Wahrnehmungen und Handlungen gleichermaßen. Um die These von der metaphorischen Konzeptualität des Menschen zu stützen, wählen Lakoff/Johnson den Weg über die Sprache bzw. die Sprachlichkeit des Menschen. Konzeptualität, Kognition und Sprachlichkeit werden aufeinander zurückgeführt, um aus der metaphorischen Eigenart der Sprache die Metaphorizität der kognitiven Konzeptualität zu folgern. Demnach besteht das Wesen der Metapher und damit auch ein fundamentaler Aspekt von Denken und Sprechen darin, einen Sachverhalt in der Begrifflichkeit eines anderen zu verstehen und wahrzunehmen. Damit reüssiert die Metapher zu einem unvermeidbaren und unverzichtbaren Raster der kognitiven Fähigkeit des Menschen. Die Funktionsweise der konzeptuellen Metapher wird mit Hilfe der Unterscheidung zwischen Fokus und Rahmen erläutert. Über den Fokus verweisen unterschiedliche Metaphern auf ein gemeinsames Konzept. Die im Fokus jeweils unterschiedlich realisierten lexikalischen und semantischen Einheiten können somit als Instantiierungen derselben konzeptuellen Metapher erfaßt werden. Die konzeptuelle Metapher stellt demnach eine „kontextfreie Abstraktionsform"34 dar, welche nur über ein konkretes Metaphernvorkommnis (token) verwirklicht werden kann. Demnach entscheidet der Kontext darüber, in welchem systematischen Sinn jeweils von der Metapher gesprochen wird. In der Terminologie von Pielenz also entweder im Sinn eines konzeptuellen type oder eines konkreten token. Die Realisierung eines types durch ein token kann dabei entweder in Gestalt einer lexikalisierten oder einer spontan-okkasionellen Metapher erfolgen. Das Unterscheidungskriterium bemißt sich an der Usualität. Sprachliche Konvention läßt ursprüngliche 'ad hoc-Metaphern' zu 'festen Metaphern' gerinnen, die sich in den Sprachgebrauch einnisten und dann unbewußt, gewissermaßen hinter dem Rücken ihrer Verwender, zum Einsatz kommen und Wirkung erlangen. Diese verborgene Wirkmächtigkeit usualisierter Konzeptmetaphern, die das Denken und Handeln immer schon bestimmen und untergründig steuern, bildet das zentrale Interesse von Lakoff/Johnson. Um ihr auf die Spur zu kommen, sind die konkret verwendeten Metaphern auf ihren jeweiligen konzeptuellen Grundtyp zurückzuführen, weil dieser das ganze Netz der realisierten tokenMetaphern trägt. Dabei ist entscheidend, daß der type im Unterschied zum token oftmals nicht geläufig ist. Je weniger dies der Fall ist, d. h. je stärker die Intensität an konzeptueller Metaphorizität ist, desto undurchsichtiger gestalten sich auch die Produktion, Verwendung und Wirkung von Metaphern. Daß Formulierungen wie 'Du raubst mir meine Zeit', oder der Topos 'Zeit ist Geld' auf die dahinterstehenden Konzeptmetapher 'Zeit als kostbare Ware' bzw. 'Zeit als knappe Ressource' verweisen, ist relativ klar zu Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 71.
64
Die konzeptuelle Metapher
erschließen. Daß sich dagegen kritische Äußerungen wie 'Dein Argument wackelt', oder 'Deine Theorie bricht zusammen' der Konzeptmetapher 'Argumentation als Gebäude' verdanken, ist schon viel weniger deutlich und wird in faktischen Rechtfertigungszusammenhängen erfahrungsgemäß auch nicht thematisiert. 2.2 Alltagskreative und theoriekreative Metaphern Von der im Anschluß an Lakoff/Johnson bisher zugrundegelegten alltagskreativen Metapher unterscheidet Pielenz im weiteren die theoriekreativen Metaphern. Während alltagskreative Metaphern Orientierung innerhalb der Lebenswelt stiften, fungieren theoriekreative Metaphern als Movens bei der Entstehung wissenschaftlicher Interpretationswelten und Erklärungsmodelle35, „wobei der metaphorische Charakter einer Theoriegenese nicht ohne weiteres bloßliegt.a36 Die metaphorisch-konzeptuelle Initialzündung für eine bestimmte theoretische Figur kann also auch verborgen bleiben, dies ist sogar die Regel. Pielenz versteht unter theoriekreativer Metaphorik also nicht den semantischen Innovationsschock lebendiger Metaphern, sondern mit E. Fink37 die operativ verschattete Verwendung einer bestimmten metaphorischen Topik in einem ungewöhnlichen theoretischen Kontext. Nach Fink operieren Autoren philosophischer Texte „mit intellektuellen Schemata, die sie gar nicht zu einer gegenständlichen Fixierung bringen. Sie denken durch bestimmte Denkvorstellungen hindurch auf die für sie wesentlichen thematischen Grundbegriffe hin."38 Operative Konzeptmetaphern stellen das Begriffsmedium und das Begriffsfeld zur Verfügung, durch das das Denken zu seinen thematischen Begriffen kommt. Die Denkbahnen der operativen Begriffe stehen zwar nicht im Lichtkegel der jeweiligen intentionalen Denkrichtung, sondern bilden gleichsam den „Schatten einer Philosophie"39, aber sie eröffnen allererst den begrifflichen Fundus an intellektuellen Schemata, der die Bedingung der Möglichkeit für die thematische Begriffsbildung
36 37
38 39
Pielenz will die Unterscheidung zwischen alltags- und theoriekreativen Metaphern jedoch nur funktional-pragmatisch und nicht im Sinne einer Wesens- und Begriffsdefinition verstanden wissen, denn „die damit unterstellte Hypostasierung von 'Alltagswelt' und 'Theorie' läßt sich nicht ohne weiteres aufrechterhalten" (ebd., S. 76, Anm. 71). Ebd., S. 76. Eugen Fink: Operative Begriffe in Husserls Phänomenologie, in: ZPhF 11, 1957, S. 321ff. ; wiederabgedruckt in ders.: Nähe und Distanz. Phänomenologische Vorträge und Aufsätze, Freiburg/München 1976, S. 180ff; vgl. auch E. W. Orth: Operative Begriffe in Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen, in: H. J. Braun / H. Holzey / E. W. Orth (Hg.): Über Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen, Frankfurt/Main 1988, S. 45ff. Fink, Operative Begriffe, S. 324f. Ebd., S. 325.
Metapherntheoretische Anwendung
65
ist. „Das Denken selbst gründet im Unbedenklichen. Es hat seinen produktiven Schwung im unbedenklichen Gebrauch von verschatteten Begriffen. u4° Die Metaphorizität operativer Begriffe ergibt sich dabei aus dem Umstand, daß sie selten aus dem thematisch traktierten Fachbereich stammen, sondern aus benachbarten Diskursen entlehnt sind. Theoriekreative Konzeptmetaphern erklären sich vor dem Hintergrund, „daß vielfach die Auslegung einer Daseinsdimension die Kategorien anderer Dimensionen gebraucht oder verbraucht" 41 . Begriffe aus derartigen Leih-Diskursen42 fungieren im thematischen Begriffsaufbau als Kontext-Metaphern. „Die operative Verschattung besagt aber nicht, daß das Verschattete gleichsam abseitig wäre, außerhalb des Interesses, - es ist vielmehr das Interesse selbst"43. Das operative Metaphernfeld fungiert gleichsam als Filter oder Bildschirm: „Es ist das Nichtgesehene, weil es das Medium des Sehens ist."44 Konzeptuelle Metaphern in einem philosophischen Text stellen keine uneigentliche Redeweise dar, die nur zur Dekoration dient oder gar zur Verschleierung sachlicher Probleme benützt wird, vielmehr bilden sie denjenigen Rahmen von Assoziationen, Denkvoraussetzungen und Grundannahmen, vor deren Hintergrund die thematischen Begriffe erst verständlich und nachvollziehbar werden. Metaphern fungieren sowohl im Prozeß des philosophischen Denkens selbst als auch in seinem rezeptiven Nachvollzug als 'orientierendes Geländer', 'geistiges Spielfeld' und 'begrenzendes Terrain' und stecken den verschatteten Rahmen ab, vor dem sich die im hellen Licht des Vordergrundes stehenden thematischen Begriffe allererst abheben. Derartige wissenschaftskreative Metaphern wurden über die Philosophie hinaus bereits für zahlreichen Disziplinen erkannt und nachgewiesen. Sie strukturieren den Forschungsprozeß in entscheidender Weise, indem sie anhand ungewohnter metaphorischer Grundkonzepte eine Vielzahl neuer Suchrichtungen, Hypothesen und Schlußfolgerungen eröffnen. Pielenz verweist auf die einschlägigen Beiträge vor allem aus den 'exakten' Naturwissenschaften und den 'empirischen' Humanwissenschaften. 45 Die Fülle alltagswie theoriekreativer Metaphern belegt gleichermaßen, „in welchem Ausmaße konzeptuelle Metaphern unser Leben durchdringen und unsere intuitive wie auch wissenschaftliche Weltsicht organisieren, indem sie Interpretationsangebote anbieten und unerläßliche Orientierungshilfe leisten. u4i 40 41 42
43 44 45 44
Ebd. Ebd., S. 326. Jacques Derrida, weiße Mythologie, S. 215 unterscheidet zwischen ursprünglichen Diskursen und Leihdiskursen (discours preteurs) bzw. geborgten Diskursen (discours d'emprunt). Fink, Operative Begriffe, S. 327. Ebd. Nachweise bei Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 78-80, und Anm. 81. Ebd., S. 81.
66
Die konzeptuelle Metapher
2.3 Die Mikrostruktur konzeptueller Metaphern Wie aber funktionieren konzeptuelle Metaphern? Pielenz wendet sich dazu dem Vorgang der metaphorischen Übertragung zu und zeigt, in welcher Weise der Urprungsbereich einer metaphorischen Aussage auf den Zielbereich seine Anwendung findet. Er verdeutlicht dies mit W. Liebert47 aus lexikalischer Sicht. Die konkrete token-Metapher einer sprachlichen Äußerung kann als Projektion begriffen werden, in deren Verlauf eine Lexemmenge des Ursprungsbereiches mit einer anderen Lexemmenge des Zielbereichs identifiziert wird. Das Resultat nennt Pielenz im Anschluß an Liebert 'Lexemmetapher'. Die Lexemmetapher als token verweist jedoch ihrerseits auf eine 'Konzeptmetapher' als deren type. Diese muß von daher entsprechend analysiert werden. Auf der Ebene der Konzeptmetapher findet eine Lexemmenge des Ursprungsbereichs zunächst ihre Applikation auf eine 'Strukturfolie' desselben Bereichs. Diese Strukturfolie bezeichnet den Zusammenhang der möglichen Vorkommensweisen der betreffenden Lexemmenge. Die LexemStrukturfolie-Beziehung des Ursprungsbereichs wird nun auf ein anderes Lexem-Strukturfolie-Paar des Zielbereichs projiziert. Konzeptmetaphern beruhen demnach auf einer Relation zwischen jeweils einem Konzeptpaar, das wiederum aus einer bestimmten Lexemmenge und einer zugeordneten Strukturfolie besteht. Dabei ist jedoch festzustellen, daß der lexematischstrukturelle Zusammenhang des Zielbereichs erst durch die identifizierende Projektion der Metapher geschaffen wird und nicht schon vorher besteht. Die Leistung der Metapher besteht gerade darin, ein derartiges Konzeptpaar auf der Zielseite allererst zu erzeugen. „Alle konzeptuellen Metaphern sind das Resultat einer solchen konzeptuellen Projektion. [...] Nur auf der Grundlage solcherart durch Projektion generierten konzeptuellen Metaphern sind die festen, i. e. die lexikalisierten Metaphern zu verstehen.1,48 Doch nicht nur feste Metaphern lassen sich Pielenz zufolge mit diesem kognitiven Abbildungsverfahren aufschlüsseln, sondern auch die lebendigen 'ad hoc-Metaphern'. In diesem Fall wird ein Element aus der Lexemmenge einer ungewöhnlichen Strukturfolie des Ursprungsbereiches herausgegriffen und auf den Zielbereich übertragen. Dabei liegt eine ungewöhnliche Realisierung auf der token-Ebene vor, wobei die Konzeptmetapher bereits als bestehend vorausgesetzt wird. „Prinzipiell ist daher jede ad hoc-Metapher, wie originell auch immer sie sein mag, vorhersagbar. "4® Vor diesem Hintergrund
48 49
Wolfgang-Andreas Liebert: Zu einem Wörterbuch der festen Metaphern der deutschen Alltagssprache im Spannungsfeld zwischen kognitiver Linguistik und onomasiologischer lexikographischer Datenbank, in: B. Schaeder/B. Rieger (Hg.): Lexikon und Lexikographie, Hildesheim 1990. Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 84. Ebd.
Metaphemtheoretische Anwendung
67
kann es für Pielenz keine wirklich neuen Metaphern geben.50 Vielmehr schließt er mit Lakoff/Johnson an Blacks 'System assoziierter Gemeinplätze' an, das für die metaphorische Übertragung nur einen topisch feststehenden Fundus von Konzepten zuläßt. Hier zeigt sich, daß eine strikt konzeptuelle Metapherntheorie Gefahr läuft, eine fixierte Bestimmung von Sprache und Welt vorauszusetzen, die kein dynamisches Verständnis von Wirklichkeit und Wahrheit mehr zuläßt, wie dies etwa Ricoeur in der Konsequenz seiner These von der metaphorischen Neubeschreibung als erforderlich erschienen war. Zur Art und Weise des Funktionierens konzeptueller Metaphern kommt noch ein weiterer Gesichtspunkt hinzu. Die Frage betrifft das Verhältnis von semantischer Überschußproduktion und semantischer Selektion. Die Beantwortung dieser Frage, wie nämlich „durch die Reduktion von Sinnmöglichkeiten Sinnmöglichkeiten eröffnet werden können, heißt metaphorische Rede begriffen zu haben." 51 Die Metapher beruht wie jede Prädikation auf der Beschränkung von Sinn- und Bedeutungsmöglichkeiten zugunsten einer bestimmten Interpretation. Black hatte von daher das Funktionieren der Metapher mit einem Filter verglichen. Der focus filtert die Bedeutungsmöglichkeiten des frame bzw. läßt diesen durch einen bestimmten Filter oder 'Schirm' erkennen. Deshalb spricht Black im Zusammenhang des focus von einem 'system of associated commonplaces'. Demnach gründet der kreative Zug der Metapher darin, ein Zielkonzept (frame) durch ein Herkunftskonzept von Alltagsassoziationen und Gemeinplätzen (focus) zu überformen und in einem - wenn auch nicht radikal neuen, so doch - ungewöhnlichen Licht erscheinen zu lassen. Entscheidend ist dabei, daß neue Einsichten nur durch die Kombination von Bekanntem erreicht werden können. Hier schließt sich der erste Kreis von Metaphorologie und Argumentationstheorie. Denn die Art und Weise der konzeptuell-metaphorischen Wechselwirkung kann im Rückgriff auf die Funktion der argumentationstheoretischen Schlußregel beschrieben werden. Der Inhalt der Schlußregel wird durch die interaktiven Konzepte bestimmt. Sie regelt, auf welche Weise welche Gemeinplätze des Herkunftsbereiches auf welche Gemeinplätze des Zielbereiches projiziert werden. Der Schlußregelcharakter der Metapher erlaubt es, angeben zu können, inwiefern nicht nur zusätzliche semantische Sinnmöglichkeiten geschaffen werden, sondern auch, auf welche neuen Sinnmöglichkeiten die Metapher den Austausch zwischen zwei Konzepten beschränkt. Während die metaphorische Wechselwirkung zwischen - mindestens - zwei unterschiedlichen Konzepten für die schöpferische Sinnproduktion verant-
Ein anderer Fall läge vor, wenn eine neue Konzeptmetapher generiert würde, indem eine oder mehrere neue und zusammengehörige Lexemmetaphern mit gleichem Ursprungs- und Zielbereich auftauchen. Ingolf U. Dalferth, Religiöse Rede von Gott, München 1981, S. 222.
68
Die konzeptuelle Metapher
wortlich zeichnet, steht der metaphorische Schlußregelcharakter für die Reduktion der damit eröffneten Sinnmöglichkeiten. Pielenz interpretiert diese Selektionsfunktion der Schlußregel darüber hinaus im Sinne einer topisch-argumentativen Legitimierungsfunktion. Indem eine Metapher zum Einsatz gelangt, werden auch die darin implizierten Schlußregeln vom focus auf den frame anerkannt. Der Verweis auf derartige Schlußregeln kann bei allgemeiner Akzeptanz der jeweiligen Metapher von daher selbst wieder in rechtfertigender Absicht verwendet werden. Insofern das Akzeptieren einer Metapher sogleich das Erheben eines Geltungsanspruches beinhaltet, kann die Metapher vermöge ihres implikativen Charakters als Argumentationstopos fungieren. „Insofern wirkt eine konzeptuelle Metapher sowohl begründend als auch beglaubigend."52 Die damit etablierte Zirkelstruktur illustriert aufs neue die Selbstrekurrenz der Metapher: „So gesehen agiert die konzeptuelle Metapher selbstbestätigend: Sie begründet einen Wirklichkeitsentwurf, um ihn sogleich mit Rekurs auf ihren Geltungsanspruch fortwährend zu sichern. Hieraus gewinnt die Metapher ihre mögliche affirmative und systemerhaltende Kraft."53 Der 'metaphorische Zirkel' stiftet die theoriesichernde und lebensweltlich-orientierende Stabilisierungsfunktion der konzeptuellen Metapher. 2.4 Bereichsmetaphern Bereits die Theorie der lebendigen Metapher hatte zu der Einsicht geführt, daß die Analogie zur Modelltheorie den Forschungsgegenstand der Metapherntheorie über die einzelne metaphorische Aussage hinaus auf einen Metaphernverbund hin erweitert. Insofern sich auch die konzeptuelle Metapher an die Interaktionstheorie anschließt, gilt auch hier, daß die Konzeptmetapher noch nicht die größte Einheit des konzeptuellen Metaphernkosmos darstellt. Mehrere Metaphern können ein Konzept aus unterschiedlichen Perspektiven mit unterschiedlichen Pointen aktualisieren. Dies führt zu dem Phänomen der 'Subkategorisierung', bei dem der gesamte Sprachgebrauch eines Herkunftkonzeptes auf ein Zielkonzept projiziert wird. Als Beispiel führt Pielenz die Konzeptmetapher 'Zeit ist Geld' an. Insofern in unserer Kultur Geld als 'knappe Ressource' und deshalb als 'kostbare Ware' gilt, kann Zeit ebenso als knappe Ressource und als wertvolle Ware metaphorisiert werden. Der gesamte Sprachgebrauch des Geldsystems findet somit Anwendung auf das Zeitsystem. Auf diese Weise können Metaphern in Netzbeziehungen zusammenhängen bzw. sich gegenseitig stützen, interpretieren und implizieren. So lassen sich thematische Häufungen metaphorischer Konzepte als einheitlicher Vorgang beschreiben. Darüber hinaus macht der Vorgang
53
Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 108. Ebd., S. 108.
Metapherntheoretische Anwendung
69
der Subkategorisierung deutlich, daß Metaphern nicht nur eine ordnungskritische, sondern auch eine ordnungskonstitutive Funktion haben. Die Betonung der systematischen Kohärenz der metaphorischen Subkategorisierung durch Lakoff/Johnson wird von Pielenz jedoch auf einen lockeren Verbund im Rahmen eines gemeinsamen Themas zurückgestuft. Denn die Ordnung der Metapher ist nicht mit der Ordnung des Begriffs identisch. Die Metapherntheorie fallt einem Selbstmißverständnis zum Opfer, wenn sie versucht, an einem ihr äußerlichen und fremden Ideal Maßstab zu nehmen. Die kognitive Rehabilitierung der Metapher kann gerade nicht darin bestehen, daß sie 'genauso funktioniert' wie die auf Klarheit und Eindeutigkeit abzielende Begriffssprache. Das gemeinsame Thema eines Metaphernnetzes bezeichnet auf der konzeptuellen Ebene des Metaphernverbundes, was der frame auf der Ebene der konkreten Lexemmetapher beinhaltet. Um die Netzbildung von Metaphern zu bezeichnen, kann man auch mit Liebert von 'Bereichsmetaphern' sprechen. Eine Bereichsmetapher liegt demnach vor, wenn sie sich in mehrere Konzepte unterteilen und von dort aus lexemmetaphorisch realisieren läßt. Bereichsmetapher und Subkategorisierung bringen also den gleichen Sachverhalt jeweils unter übergeordnetem und untergeordnetem Gesichtspunkt zum Ausdruck. 2.5 Lebendige und tote Metaphern Die Unterscheidung und Bewertung lebendiger und toter Metaphern spielte bereits zwischen Ricoeur und Derrida eine entscheidende Rolle. Auch Pielenz ist sich der metaphorologischen Bedeutung dieser Differenz sowie einer zwangsläufigen Präferenz der lebendigen Metapher vor der konzeptuell-topische Metapher bewußt. Dennoch will er beide Typen nicht alternativ verstanden wissen. Vielmehr versteht Pielenz die Bezeichnungen 'lebendige', 'schlafende' oder 'tote' Metapher als „Endpunkte eines Kontinuums der Metaphorizität" 54 , das seinen Maßstab zum einen in der sprachlichen Usualität und zum anderen in der metaphorischen Auffälligkeit hat. „Je metaphorischer ein Ausdruck, desto geringer ist seine Usualität. Lebendige Metaphern also, die sich durch ein hohes Maß an Metaphorizität auszeichnen, sind durch ein Minimum an Usualität gekennzeichnet. Schlafende Metaphern hingegen besitzen ein Maximum an Usualität."55 In diesem Zusammenhang stellt sich erneut das Problem der metaphorischen Wiederbelebung, das in der Debatte zwischen Ricoeur und Derrida eine wichtige Rolle gespielt hatte. Mit Ricoeur sieht Pielenz die Möglichkeit zur Reanimierung fester oder konventioneller Metaphern in einem Akt unerhörter Prädizierung. Indem eine feste und habitualisierte token-Metapher auf ihren ursprünglichen type zurückgeführt
55
Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 111. Ebd.
70
Die konzeptuelle Metapher
wird, eröffnet sich auch die Möglichkeit zu einer lebendigen und unkonventionellen Realisierung des metaphorischen Konzepts. Entscheidend ist dabei jedoch, daß Pielenz die Gradunterschiede 'lebendig', 'konventionell', etc. nur auf der Ebene des token, also der konkret verwirklichten Einzelmetapher für sinnvoll erachtet. Lebendige Metaphern gibt es nur als Realisierungen bereits bestehender types, die sich zwar wandeln können, aber immer schon auf bestimmte Vorbilder zurückgreifen oder historische Vorläufer haben. Zum Beispiel die lebendige Metapher: 'Seine Theorie wies Tausende kleiner Zimmer a u f , die eine innovative Realisierung der Konzeptmetapher 'Theorie bzw. Argumentation als Gebäude' darstellt, wie sie auch in dem token 'Dein Argument wackelt' oder 'der Aufbau deiner Theorie hat kein Fundament' bzw. 'ist brüchig/bricht auseinander' zum Ausdruck kommt. Die metapherngeschichtliche Perspektive wird bei Pielenz eingesetzt, um so etwas wie einen archetypischen Kanon von Metaphernkonzepten zu etablieren. Doch die historische Metaphorologie - darauf wird das dritte Kapitel eingehen - kennt neben der Kontinuität konzeptueller Grundmetaphern ebenso die Diskontinuität metaphorischer Umbrüche und innovativer Aufbrüche. Im Rahmen einer rein konzeptuellen Metaphorologie können lebendige Metaphern nur in Gestalt neuer Variationen und Kombinationen auftauchen, nicht jedoch als wirklich innovative Neubeschreibungen auf der konzeptuellen Ebene von Bereichs- oder Wurzelmetaphern. Hier wirkt sich der topische Untersuchungsrahmen aus. Er findet seine Grenze in der metaphorischen Parallelverschiebung, d. h. in der „generatio von Metaphern im Rahmen eines vorgegebenen Bildfeldes" und schreitet nicht zur schöpferischen Möglichkeit der „creado eines neuen Bildfeldes" weiter.5® Darin unterscheiden sich die am Paradigma von Topik und Rhetorik orientierten Metapherntheorien von denjenigen Ansätzen, die sich an das Paradigma der Poetik oder einer historischen Paradigmatik anlehnen.
Harald Weinrich: Sprache in Texten, Stuttgart 1976, S. 288, zit. bei Dalferth, Religiöse Rede, S. 226.
Metaphern und Topoi
71
3. Metaphern und Topoi Metaphern fungieren als topisches Rechtfertigungsreservoir in lebensweltlichen und wissenschaftlichen Argumentationszusammenhängen. So die These der methodischen Synopse von Pielenz. Welchen Anhaltspunkt hat nun aber die Metapher in der Topik? Worin genau besteht die 'quasi-topische Gebrauchsfunktion' konzeptueller Metaphern? Um diese Frage beantworten zu können, gilt es den Toposbegriff zu untersuchen, der die behauptete Verwandtschaft zwischen Metaphorik und Topik stützt. Nach Aristoteles ist das Ziel der Topik „ein Verfahren (methodos) zu finden, mit dessen Hilfe wir gegenüber jeder Problemstellung {problema) auf der Grundlage der geltenden Meinungen (endoxa) zu einem schlüssigen Urteil kommen können (syllogizesthai) und, wenn wir selbst einer Argumentation standhalten sollen, in keine Widersprüche geraten."57 Hauptmittel dieses Verfahrens sind allgemeine Argumentationsgesichtspunkte, sogenannte 'topoi'. Unter einem Topos wird also weniger eine sprachlich fixierte Formulierung verstanden, als vielmehr ein argumentativ gehandhabtes Denkmuster. Vor diesem Hintergrund eines eher formalen Toposbegriffs kann die Topik auch als „eine Art von Argumentationsphantasie" bestimmt werden, „die aus dem Fundus der gesellschaftlich allgemein anerkannten bzw. konsensus-fähigen Meinungen (...) 'allgemeine Argumentationsgesichtspunkte' (...) sammelt und jederzeit zur Verfügung hat."58 Im Unterschied zu einem materialen Topikverständnis kann eine formale Topik auch als Heuristik möglicher Argumente bestimmt werden. Als Strukturmomente einer in diesem Sinne aristotelisch-heuristischen Topik hat L. Bornscheuer Habitualität, Potentialität, Intentionalität und Symbolizität bestimmt. Mit dem Begriff der Habitualität wird auf die aristotelische 'endoxa' abgehoben. Dabei beziehen sich jene 'herrschenden Meinungen' nicht nur auf ein Repertoire von geläufigen Antworten oder einzelne Denkschemata, sondern darüber hinaus auf ein komplexes Netzwerk zusammenhängender Grundmuster. „Zu den endoxa ist mit dem Sententiösen, Sprichwörtlichen und Zitathaften der Bereich aller gesellschaftsgeschichtlichen Erfahrungen und Erinnerungen wie auch aller handlungsorientierenden, zukunftsweisenden Bedeutungsgehalte zu rechnen [...]. Im weiteren Sinne gehören daher zu den 'Meinungsnormen' neben den sittlich-sozialen Wertmaßstäben nicht nur alle weltbildprägenden Überzeugungen und Wissensinhalte, sondern auch alle kognitiven, logischen und bewußtseinspsychologischen Muster und Formprinzipien."5® Der Topos als elementarer Bestandteil des habitual isierten Horizontwissens liegt allem Argumentieren voraus und gewährleistet dadurch 57 58 59
Topik I, 1, 100a 17-22. Bornscheuer, Art.: Topik, S. 455. Bornscheuer, Topik, S. 95f.
72
Die konzeptuelle Metapher
seine Geläufigkeit, d. h. seine rasche und flexible Verfügbarkeit in lebensweltlichen und wissenschaftlichen Rechtfertigungszusammenhängen. Dabei darf der topische Fundus jedoch nicht als begrenztes Reservoir starrer Bedeutungen aufgefaßt, sondern muß hinsichtlich seiner offenen Potentialität und Fülle60 betrachtet werden. „Während die Habitualität die Topik als eine im Denkkollektiv wirksame generationsmächtige Grammatik verfaßt, differenziert das Moment der 'Potentialität' deren kreative Leistungsbereitschaft, sich jedem beliebigen Argumentationsanlaß mit der Perspektive auf Urteilsfindung öffnen zu können. "61 Topoi dürfen also nicht als vorgefertigte Klischees, sondern müssen als flexible Verfahrenstechniken der argumentativen Einbildungskraft verstanden werden. Nur dann ist gewährleistet, was Aristoteles als die Aufgabe der topoi erkannte: gegenüber jeder Problemstellung zu einem schlüssigen Urteil kommen zu können. „Jeder Topos ist 'an sich' unbestimmt-allgemein, eröffnet jedoch in einem bestimmten Problemzusammenhang für die verschiedenartigsten Interessen konkrete Argumentationsperspektiven.u62 Daraus ergibt sich als drittes Strukturmerkmal eines allgemeinen Toposbegriffs die Intentionalität. Um etwas Bestimmtes zu bedeuten, muß der unbestimmt-allgemeine bzw. polyvalente Topos mit einer intentionalen Wirkungsabsicht verbunden werden. Diese ergibt sich aus der Verwendungssituation innerhalb einer situativ konkretisierten Interpretation. Die Intentionalität des Topos läßt somit auch den Aspekt des Performativen hervortreten. Damit ein Topos Geltungs- und Durchschlagskraft erhält, bedarf er der bewußt-absichtsvollen Selektion und Präsentation in einem konkreten Argumentationszusammenhang. „Ohne aktuellen Gebrauch in der Erörterung lebensbedeutsamer Problemfälle sinkt ein Topos entweder zum Klischee ab, d. h. in die reflexionslose Habitualität, oder er verflüchtigt sich zum bloßen Einfall, d. h. in eine unverbindliche Potentialität."63 Jenseits von trivialem Gemeinplatz und geistreichem Bonmot beruht die Funktion des Topos also in seiner intentionalen Lebensbedeutsamkeit und damit in einer jeweils gelingenden Synthese von Situation und Überlieferung. „Nach seiner höchsten Leistungsfähigkeit konzentrieren sich im Topos Kräfte der Tradition und der Innovation; sie gelangen ins Gleichgewicht nach Maßgabe der jeweils argumentatorisch erreichbaren situativen Verbindlichkeit."6* Das vierte und letzte Charakteristikum stellt die unableitbare Symbolizität des Topos dar. Diese beruht in der Fokussierung des jeweils kollektiv Gültigen in eine nicht weiter reduzierbare sprachliche Form bzw. Formel. Vor
61 62 63 64
Cicero sprach in diesem Zusammenhang von der 'copia rerum et verborurrí·, vgl. Bornscheuer, Topik, S. 61-90. Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 127. Bornscheuer, Topik, S. 99. Ebd., S. 102. Ebd., S. 102f.
Metaphern und Mentalitäten
73
dem Hintergrund eines komplexen Argumentationsgefüges eignet dem Topos ein sprachlich kondensierter Elementarcharakter, der seine Abgrenzbarkeit, Erkennbarkeit, Merkbarkeit und Wiederholbarkeit gewährleistet. Zusammenfassend kann der Topos als ein Horizontwissen bezeichnet werden, das zugleich Ursprung und Ergebnis des sprachlich vermittelten und gesteuerten sensus communis ist. Dem metaphorischen Zirkel entspricht somit der topische Zirkel. Er beruht darin, „zugleich das grundlegende Interpretandum wie auch das zentrale Interpretament der gesellschaftlich jeweils relevanten Verständigungsstruktur zu sein."65 Doch die Funktion des Topos erschöpft sich nicht in seiner systemerhaltenden Kraft. Das topische Instrumentarium fungiert zwar als erlerntes und prägendes, aber ebenso als flexibles und veränderbares Bildungsmedium. Der Topos dient gleichermaßen als Mittel für argumentative und innovative Verständigungsprozesse. „Er ist das tragende Bauelement jedes sprachlich-sozialen Kommunikationsgefiiges, Umschlagplatz zwischen Kollektiv und Individuum, Bewußtsein und Unbewußtem, Konvention und Spontaneität, Tradition und Innovation, Erinnerung und Imagination."66 Deshalb auch kann der Topos als hochgradig mentalitätshaltig beschrieben werden. Die Überlegungen des nächsten Abschnitts gehen der Frage nach, inwiefern die quasi-topische Gebrauchsfunktion der Metapher in ihrer historischen Dimension mit dem neueren Mentalitätsbegriff erfaßt werden kann.
4. Metaphern und Mentalitäten Vor dem methodischen Hintergrund von historischer Semantik, Begriffsgeschichte und Bedeutungsforschung verweisen Metaphern und Mentati itäten auf strukturverwandte und funktionsäquivalente Phänomene. Metaphorologie und Mentalitätsgeschichte, können deshalb in ein produktives Ergänzungsverhältnis zueinander gebracht werden. Um für den Zusammenhang der vorliegenden Studien den möglichen Ertrag einer Geschichte des Mentalen für die Untersuchung der Metaphern zu verdeutlichen, wird die 'nouvel histoire' im Folgenden Überblickshaft skizziert. 4.1 Mentalitätsgeschichte Der seinem Selbstverständnis nach die Grenzen herkömmlicher Geschichtsschreibung überwindende Ansatz einer 'histoire des mentalités' entspringt einer Richtung der neueren französischen Geschichtswissenschaft ('nouvel histoire'), der sogenannten 'Ecole des Annales'. Ihr geistiges Zentrum bildet 65 66
Ebd., S. 104. Ebd., S. 105.
74
Die konzeptuelle Metapher
die Zeitschrift 'Annales. Economies, Sociétés, Civilisations', die 1929 durch den Neuzeit-Historiker Lucien Febvre und den Mediävisten Marc Bloch gegründet wurde.67 Ihr ursprünglich sozial- und wirtschaftsgeschichtlich geprägtes Programm, das auf eine umfassende 'histoire de l'homme' abzielt, erfuhr seit den 60er Jahren besonders durch den Mittelalter-Historiker George Duby eine forcierte Erweiterung um den Aspekt der Mentalitäten, der freilich schon in den Studien von Bloch und Febvre angelegt war. Insofern ist die Mentalitätsgeschichte68 eine französische Erfindung. Das große französische Nachschlagewerk 'Encyclopaedia universalis' behauptet sogar noch in der neuesten Auflage von 1989: „cette histoire ne se pratique guère hors de France. " M Doch im Zuge der - sehr zögerlichen - Rezeption ist man auch im deutschsprachigen Raum auf eine Mentalitätsgeschichtsschreibung avant la lettre aufmerksam geworden. Die denkgeschichtliche Väterzeugung verweist etwa auf Johan Huizingas 'Herbst im Mittelalter'70 oder auf „die Autorschaft des berühmtesten Beispiels deutscher Mentalitätsgeschichtsschreibung - Max Webers Untersuchung über die protestantische Ethik und den Geist des Kapitalismus"71. U. Raulff sieht sogar die Möglichkeit einer Rückführung bis auf Dilthey, Herder und Vico. Einen umfassenden 'Erörterungszusammenhang', das heißt ein über den einzelnen Autor hinausgehendes Problembewußtsein verortet er jedenfalls „in einem Feld, das sich mit den Namen Burckhardt, Lamprecht, Dilthey, Warburg abstecken läßt."72 Aber wie berechtigt und sinnvoll derartige Vorläuferkonstruktionen auch sein mögen, das Verdienst der „'Entdeckung' der Mentalitäten"73 als einer neuen Dimension der Geschichte kommt den Historikern jenseits des Rheins zu, wohingegen die 67
68
69
70
71
72 73
Damals noch unter dem Namen 'Annales d'histoire économique et sociale'·, seit 1939 hieß die Zeitschrift 'Annales d'histoire sociale', ab 1942 'Mélanges d'histoire sociale' und nach dem zweiten Weltkrieg 'Annales. Economies, Sociétés, Civilisations'. Zur Geschichte der Annales vgl. u. a. Matthias Middell: Die unendliche Geschichte, in: ders./Steffen Sammler (Hg.): Alles Gewordene hat Geschichte. Die Schule der ANNALES in ihren Texten 1929-1992, Leipzig 1994. Inzwischen hat sich für die französische 'histoire des mentalités' die Übersetzung 'Mentalitätsgeschichte' statt der genaueren 'Mentalitäten-Geschichte' eingebürgert. Robert Mandrou: Art.: L'Histoire des mentalités, in: Encyclopaedia universalis 11,2. Auflage, Paris 1989, S. 479b; zit. bei Peter Dinzelbacher, Europäische Mentalitätsgeschichte, S. XV. So übereinstimmend Hagen Schulze, Mentalitätsgeschichte, S. 250; Jacques le Goff, Eine mehrdeutige Geschichte, S. 28; Peter Burke, Stärken und Schwächen der Mentalitätsgeschichte, S. 128; Peter Dinzelbacher, Europäische Mentalitätsgeschichte, S. XV. Volker Sellin, Mentalität und Mentalitätsgeschichte, in: HZ 241, 1985, S. 597; auf Weber verweist auch Goff: Eine mehrdeutige Geschichte, in: Ulrich Raulff, Mentalitäten-Geschichte, S. 19. Ebd., S. 9. Middell, Alles Gewordene hat Geschichte, S. 17.
Metaphern und Mentalitäten
75
unterschiedlichen germanisierenden Genealogien im Zusammenhang einer Erleichterung der massiven Rezeptionsschwierigkeiten zu verstehen sind. Diese zeichneten sich nämlich lange durch „heftige Reaktionen, unbewußte Reflexe und Abschottungsmechanismen"74 aus. Noch 1985 konnte Volker Sellin in seinem grundlegenden Aufsatz über 'Mentalität und Mentalitätsgeschichte' feststellen, „daß sich bisher in Deutschland nur ganz wenige Autoren mit der Frage beschäftigt haben, was unter Mentalität und Mentalitätsgeschichte eigentlich zu verstehen sei."75 Zehn Jahre später hat sich die Situation zwar auf dem Buchmarkt geändert. Titel, die um die Begriffe 'Mentalität' und 'Mentalitätsgeschichte' kreisen, erscheinen ungleich häufiger als noch vor einem Jahrzehnt. Dennoch steckt die akademisch-geschichtswissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem mentalitätsgeschichtlichen Programm der 'Annales', ganz zu schweigen von eigenständigen mentalitätsgeschichtlichen Studien, noch immer in den Kinderschuhen.76 Was aber ist 'Mentalität' ? Ein Grund für die Vorbehalte der theoriegeleiteten deutschen Historik gegenüber der Mentalitätsgeschichte liegt zweifelsohne in den Schwierigkeiten, das Phänomen der Mentalität begrifflich zu fixieren, denn „Mentalität [...] als historische Kategorie läßt sich besser beschreiben als definieren." 77 Dieser Umstand hängt vor allem mit einer gewissen Theorieabstinenz der Annales-Historiker und einem weitgehenden „Verzicht auf programmatische Erklärungen"78 zumindest seit den Vertretern der dritten Generation der Annales zusammen. „Sie gestalteten die Annales [...] nicht vorrangig zu einem Blatt programmatischer Debatten, sondern zu einem Experimentierfeld der neuen Geschichtsauffassung."79 Der Nachteil einer nur wenig trennscharfen Begrifflichkeit erweist sich jedoch auch als Vorteil. Denn die flexible Grundaxiomatik erlaubt den Mentalitätshistorikern einen anpassungsfähigen Umgang mit den oftmals sehr heterogenen Quellen. Aus diesem Grund führen die von außen unternommenen Definitionsversuche hinsichtlich der Kategorie des Mentalen mitunter zu recht unterschiedlichen Ergebnissen. Hier seien nur einige Beispiele herausgegriffen:
75
76
77 78 79
Peter Schöttler, Zur Geschichte der Amiales-Rezeption in Deutschland (West), in: Middell, Alles Gewordene hat Geschichte, S. 51. Sellin, Mentalität und Mentalitätsgeschichte, S. 558. Die Gründe für dieses fehlende Interesse hat Hartmut Kaelble (Sozialgeschichte in Frankreich und der Bundesrepublik: Annales gegen historische Sozialwissenschafien? in: Geschichte und Gesellschaft 13, 1987, S. 77-93) analysiert; kritisch äußert sich dazu Schöttler, Zur Geschichte der Annales-Rezeption, S. 49 ff. Noch 1993 urteilt Dinzelbacher im Rekurs auf Sellins Beschreibung, daß sich „die Situation bis heute kaum geändert" habe (Dinzelbacher, Europäische Mentalitätsgeschichte, S. XVII). Ebd., S. XXI. Middell, Alles Gewordene hat Geschichte, S. 25. Ebd., S. 9.
76
Die konzeptuelle Metapher
a)
„Man meint eine Haltung oder einen Zustand des Geistes von relativer Konstanz, eine Disposition zur Wiederholung gewohnter Denkweisen, nicht etwa originelle Einfalle, kein spontanes Denken, kein Theoretisieren, das in Reproduktion oder Fortspinnen eine reflektierende oder gar zu wählender Entscheidung zwingende Anstrengung fordert. " " b) Mentalitäten sind Kategorien „die bei der Konstruktion von Raum und Zeit, bei der Produktion des Imaginären, bei der kollektiven Wahrnehmung der menschlichen Aktivitäten am Werk sind [...]. Die Ideen, die über die Zirkulation der sie bezeichnenden Wörter erfaßt, in ihrer sozialen Verwurzelung eingeordnet, in ihrem affektiven und emotionalen Gehalt ebenso wie in ihrem intellektuellen Inhalt gedacht werden"81. c) „Die Ebene der Mentalitätengeschichte ist die des Alltäglichen und des Automatischen, dessen, was den individuellen Subjekten der Geschichte entgeht, weil es den unpersönlichen Inhalt ihres Denkens ausmacht"82. d) „Mentalitätsgeschichte konzentriert sich auf die bewußten und besonders die unbewußten Leitlinien, nach denen Menschen in epochentypischer Weise Vorstellungen entwickeln, nach denen sie empfinden, nach denen sie handeln. Sie fragt nach dem sozialen Wissen bestimmter historischer Kollektive und untersucht den Wandel von Kognitionsweisen und Vorstellungswelten, die jeweils historisches Sein auf intersubjektiver Ebene prägen. "83 e) „Historische Mentalität ist das Ensemble der Weisen und Inhalte des Denkens und Empfindens, das für ein bestimmtes Kollektiv in einer bestimmten Zeit prägend ist. Mentalität manifestiert sich in Handlungen. f) „Mentalität, wie sie im einzelnen auch definiert werden mag, steht für die nicht eindimensional aus einem Ideenkonstrukt, sei es Ideologie oder Theologie, ableitbaren Meinungskomplexe, die sinndeutend und handlungsleitend fungieren.ü85 Aus der Fülle von Motiven und Kriterien zur Bestimmung des Mentalen werden im folgenden nur diejenigen ausgewählt, welche für die Mehrzahl der Autoren einen gewissen Konsens markieren. Der Träger des Mentalen ist - etwa im Unterschied zum zoon politikon der politischen Ereignisgeschichte - der historische homo humanus. Insofern 80
81
82 83 84 85
Günter Teilenbach, Mentalität: Geschichte, Wirtschaft, Gesellschaft, Festschrift für C. Bauer, Berlin 1974, S. 15. Roger Chartier, Intellektuelle Geschichte und Geschichte der Mentalitäten, in: Raulff, Mentalitäten-Geschichte. S. 79. Goff, Eine mehrdeutige Geschichte, S. 21. Dinzelbacher, Europäische Mentalitätsgeschichte, S. IX. Ebd., S. XXI. Heinz Hürten, Alltagsgeschichte und Mentalitätsgeschichte als Methoden der Kirchlichen Zeitgeschichte, in: Kirchliche Zeitgeschichte 5, 1992, S. 29.
Metaphern und Mentalitäten
77
hat es die Mentalitätsgeschichte weniger mit überindividuellen Größen wie Kulturen, Institutionen oder Ideen zu tun, als mit 'wirklichen Menschen'. Sie versteht sich im weitesten Sinne als 'Historische Anthropologie'. Dabei steht jedoch nicht das Handeln eines als fertig und unwandelbar unterstellten Menschen im Vordergrund, sondern vielmehr der „Prozeß der Menschwerdung selbst, oder richtiger: die Prozesse, durch die Menschen zu dem wurden, was sie jeweils waren."84 Eine solcherart genetische Anthropologie historischer Mentalitäten kann deshalb auch aus der Entgegensetzung zum Phänomen der Idee und des Ideologischen87 im weitesten Sinne begriffen werden. „Der übliche Ideologiebegriff ist noologischen Charakters [...] Die Mentalität dagegen ist geistig seelische Disposition [...] Mentalität ist geistig-seelische Haltung, Ideologie aber geistiger Gehalt [...] Mentalität ist 'früher', ist erster Ordnung - Ideologie ist 'später' oder zweiter Ordnung [...] Mentalität ist Lebensrichtung - Ideologie ist Überzeugungsinhalt [...] Mentalität ist, im Bilde gesprochen, eine Atmosphäre - Ideologie ist Stratosphäre. Mentalität ist eine Haut Ideologie ist ein Gewand."88 Mentalitätsgeschichte will also gleichsam 'näher heran' an den historischen Menschen, als es eine überindividuelle Ideen-, Kultur- oder Geistesgeschichte vermag. Mentalität stellt im Unterschied zur Ideologie „ein vortheoretisches Wissen"89 des homo humanus dar, das seine jeweilige Lebenswelt strukturiert und geprägt hat. Der Begriff der 'Lebenswelt' als vortheoretische Sphäre menschlicher Daseinsbewältigung gewinnt von daher entscheidende Bedeutung für die methodische Erfassung des Gegenstandsbereichs der Mentalitätsgeschichte. Deshalb muß „bei der Lebenswelt ansetzen, wer Verhalten aus Mentalitäten erklären möchte."90 Denn: „Was die Dinge in dieser Sphäre gelten, wie sie erscheinen, wozu sie dienen: das ist das Material, aus dem Mentalitäten gemacht sind."91 Aus der anthropologisch-lebensweltlichen Verortung des Mentalen ergibt sich eine zweite Übereinstimmung, derzufolge Mentalität kein isoliert-individuelles, sondern ein kollektives Phänomen darstellt. Mentalitätsgeschichte erforscht die kollektiven Vorstellungen, Erwartungen und Verhaltensweisen einer jeweiligen Epoche. Dieses 'kollektive Mentale' hat seine terminologischen Ursprünge in den 'représentations collectives' Emil Dürkheims. Auch die Sozialpsychologie stellt entscheidende methodische Hilfsmittel zur Men-
87
88
89 90 91
Raulff, Mentalitäten-Geschichte, S. 8. Dem Begriff des Ideologischen kommt in diesem Zusammenhang eine rein kategoriale Funktion zu. Ideologie will deshalb im folgenden rein deskriptiv im Unterschied zu Mentalität und nicht normativ - etwa als intolerante Weltanschauung - verstanden werden. Theodor Geiger: Die soziale Schichtung des deutschen Volkes, Stuttgart 1932, S. 77f.; zit. bei Raul ff, Mentalitäten-Geschichte, S. 10. Sellin, Mentalität und Mentalitätsgeschichte, S. 579. Ebd., S. 574. Ebd., S. 573.
78
Die konzeptuelle Metapher
talitätsgeschichtsschreibung bereit. Mentalität wird also nicht mehr als Bezeichnung für den geistig-seelischen Charakter eines Individuums verwendet, sondern fungiert als Kategorie des 'objektiven Geistes', d. h. als Begriff für das soziale Wissen, die sozialen Strategien und Techniken einer Gemeinschaft. Das muß nicht bedeuten, daß der Gegenstand einer sozialgeschichtlich-kulturwissenschaftlich betriebenen Mentalitätsgeschichte nur die anonyme Masse der geschichtlichen Menschheit sein muß. Vielmehr können durchaus auch herausragende Persönlichkeiten mentalitätsgeschichtlich erforscht werden. Entscheidend ist weniger der Gegenstand als die Perspektive und die Fragerichtung. An Luther würde etwa nicht sein einzigartiges Persönlichkeitsprofil interessieren, das ihn im kulturellen Gedächtnis zu dem Reformator werden ließ, sondern vor allem diejenigen Einstellungen, Erwartungen und Verhaltensweisen, die ihn zu einem Kind seiner Zeit machten.®2 „Die Mentalität eines historischen Individuums liegt ungeachtet seiner möglichen Größe gerade in dem, was es mit anderen Menschen seiner Zeit gemeinsam hat. "*3 Darin drückt sich die Einsicht einer Schwachstelle herkömmlicher Ideen- und Geistesgeschichte aus, die die Entwicklung des Gedankens und der Wissenschaften ausschließlich als 'Gipfelgespräch' führender Köpfe auffaßte und nicht berücksichtigte, daß einen entscheidenden Anteil an der Geschichte des Geistes auch die 'kollektiven Denkstile' beanspruchen.®4 Mentalitäten als anthropologische Kollektivphänomene historischer Lebenswelten zeichnen sich drittens eher durch Latenz und Unbewußtheit als durch Bewußtheit aus. Sie stellen „unausgesprochene und unbewußte Annahmen"95 dar und entsprechen dem, was man auch als 'implikative Modelle' bezeichnet hat.®6 Mentalitäten sind Schemata, „die, selbst wenn sie auf individuelle Weise geäußert werden, in Wirklichkeit die nicht gewußten und verinnerlichten Verbindungen sind, durch die eine Gruppe oder Gesellschaft ein Vorstellungs- und Wertesystem miteinander teilt, ohne daß dieses explizit formuliert zu sein braucht."®7 Mentalitäten liegen deshalb auch für den Historiker nicht unmittelbar vor Augen, sondern entziehen sich der intentio recta des historischen Blicks. Aus diesem Grund versuchen die Mentalitätshistoriker, das faktische Handeln und Verhalten der Menschen auf „die
93 94
®5 96
97
Zur mentalitätsgeschichtlichen Erforschung Luthers vgl. den 'Klassiker' von Lucien Febvre: Martin Luther, un destin, Paris 1928 (dt. Luther, Frankfurt/Main u.a. 1976); neu übersetzt u. herausgegeben von Peter Schüttler, Frankfurt/New York 1996. Goff, Eine mehrdeutige Geschichte, S. 19. Vgl. dazu Ludwik Fleck: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, Basel 1935, Neuauflage Frankfurt am Main 1980. Burke, Stärken und Schwächen der Mentalitätsgeschichte, S. 127. Hans Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie, in: Archiv für Begriffsgeschichte, Bd 6, 1960, S. 16. Chartier, Intellektuelle Geschichte und Geschichte der Mentalitäten, S. 78.
Metaphern und Mentalitäten
79
dahinterstehenden mentalen Konzepte"98 hin transparent zu machen, die eine Gemeinschaft eher hintergründig und operativ-verschattet steuern. „Jedes Handeln sagt etwas über die dahinterstehende Mentalität aus1"®. In der metaphorologischen Terminologie können Mentalitäten als latente Dispositionen, d. h. als types bezeichnet werden, die erst sichtbar werden, „wenn sich 'Mentalität' im Denken, Fühlen, Handeln materialisiert."100 Mentalität kann ebenso wie die Metapher nur von ihrem token, d. h. „von der positiven Realisierung der Disposition her"101 erfaßt und beschrieben werden. Dieser Sachverhalt deutet die Verbindung zur Metapher als einem herausragenden Kristallisationspunkt des Mentalen an. Insofern sich vorbewußte Mentalitäten im Denken, Fühlen und Handeln kollektiver menschlicher Gemeinschaften realisieren, wird ein viertes Charakteristikum des Mentalen sichtbar: seine kognitive, effektive und normative Komplexqualität. Mentalität meint sowohl Einstellungen als auch Gefühle und Verhalten sowie ihre gegenseitigen Rückwirkungen. „Aus Einstellungen resultieren Verhaltensweisen. Verhaltensweisen lassen auf Einstellungen zurückschließen."1"2 Mentalitäten steuern das 'kollektive Imaginäre' ebenso wie die Sittlichkeit und das soziale Wissen einer Gesellschaft. „Mentalitäten sind demnach nicht nur Vorstellungen, Einstellungen und evtl. Regeln, sie sind nicht zuletzt auch gefühlsmäßig getönte Orientierungen; [...] Mentalitäten umschreiben kognitive, ethische und affektive Dispositionen."103 Dagegen hat V. Sellin die dabei vorausgesetzte Unterstellung eines Kausalzusammenhanges zwischen Einstellungen und Verhaltensweisen kritisiert: „Es ist nicht ratsam, von dem einen auf das andere zu schließen."1" Es sei vielmehr eine alltägliche Erfahrung, daß Überzeugung und Handeln nicht übereinstimmen. Sellin will Mentalität nicht als Ursache, sondern nur als Interpretament für faktisches Handeln verstanden wissen. „Mentalitäten sind nicht Ursachen des Verhaltens, sie bezeichnen lediglich Tendenzen und Dispositionen, bestimmte Situationen, die ein Verhalten auslösen, in charakteristischer Weise zu deuten."105 Mit der Behauptung einliniger Kausalzusammenhänge wird man also vorsichtig sein müssen. Doch die methodische Schwierigkeit und die begrenzte Berechtigung, unmittelbare Rückschlüsse vom Verhalten auf dahinterstehende Mentalitäten zu ziehen, ändert nichts an der komplexen Phänomenalität des Mentalen. Gegebenenfalls läßt sich gerade ein angeblicher
99 100 101 m
103 104 105
Dinzelbacher, Europäische Mentalitätsgeschichte, S. XXVIII. Ebd., S. XXV. Raulff, Mentalitäten-Geschichte, S. 11. Ebd., S. 11. Rolf Sprandel: Erfahrungen mit der Mentalitätengeschichte, in: Raulff, MentalitätenGeschichte. S. 110. Raulff, Mentalitäten-Geschichte, S. 10. Sellin, Mentalität und Mentalitätsgeschichte, S. 569. Ebd., S. 588.
80
Die konzeptuelle Metapher
Widerspruch zwischen Überzeugung und Verhalten selbst als Kennzeichen einer bestimmten Mentalität beschreiben. Die sicher zu Recht angemahnte Vorsicht mit vorschnellen Folgerungen darf deshalb nicht zu einem Verbot führen, Mentalität als vielschichtiges Phänomen zu beschreiben, sondern muß als Aufforderung verstanden werden, die methodische Wahrnehmungskompetenz und Sensibilität im Beschreiben von Mentalitäten ständig zu verfeinern. Ein fünftes Merkmal des Mentalen liegt in seiner zeitlichen Trägheit und Beständigkeit. Seit Fernand Braudels kanonischem Essay aus dem Jahr 1958 wird die Mentalitätsgeschichte als Geschichte der 'longe durée' beschrieben.106 Entsprechend dem Phänomen der Hintergrundmetaphorik, die ein System von Einstellungen, Überzeugungen und Bewertungen über lange Zeiträume hinweg im Verborgenen prägen kann, behaupten sich auch Mentalitäten oft über eine lange Dauer hinweg. Dies hat zur Folge, daß die überkommenen Epocheneinteilungen der Geschichtswissenschaft keine verbindlichen und bindenden Zäsuren mehr für die Geschichte des Mentalen darstellen. Diese können vielmehr auch lange Perioden überdauern und gewohnte Grenzen überlappen. „Die Mentalität ist das, was sich am langsamsten ändert. Die Mentalitätengeschichte ist die Geschichte der Langsamkeit in der Geschichte."107 Doch die Geschichte des Mentalen besteht nicht nur aus statischen Motiven, sondern ist auch eine „histoire du mouvement".108 Vor allem Michel Vovelle109 hat den Blick auf „mentalitätshistorische Umbrüche"110 gelenkt. Demnach gibt es auch „Veränderungen im Mentalitätsbereich, Strukturbrüche, die innerhalb weniger Jahre nachweisbar sind."111 Die Unabhängigkeit von traditionellen Zeiteinteilungen bleibt davon jedoch unberührt. Auch die veränderlichen Paradigmen des Mentalen entziehen sich überkommenen Einteilungsmustern. Ein gewisses Problem stellt dabei die Bestimmung der Dauer einer Mentalität dar. Wie lange darf sie als meinungsbildend und handlungsleitend unterstellt werden? Als Kriterium kann nach Jacques Le Goff die Topik wertvolle Dienste leisten: „Hier muß die Studie der topoi weiterhelfen. Wann tritt ein Gemeinplatz auf, wann verschwindet er, wann fristet er, und das ist schwer zu bestimmen, nur noch eine kümmerliche Restexistenz?"112 Dieses Vorgehen einer „Art 'topischer' Bestimmung des Mentalen"113 läßt die Funktion von Mentalitäten besonders deutlich hervortre-
107 108 109
110 111 112 113
Fernand Braudel: Histoire et sciences sociales. La longue durée, in: Annales 13, 1958. Goff, Eine mehrdeutige Geschichte, S. 23. Schulze, Mentalitätsgeschichte, S. 257. Michel Vovelle: „Un temps plus long": Résistances et longue durée dans les mentalités collectives, in: ders.: Idéologies et mentalités, Paris 1982. Dinzelbacher, Europäische Mentalitätsgeschichte, S. XXVII. Schulze, Mentalitätsgeschichte, S. 257. Goff, Eine mehrdeutige Geschichte, S. 29. Raulff, Mentalitäten-Geschichte, S. 11.
Metaphern und Mentalitäten
81
ten und leitet nicht nur zu einem weiteren Spezifikum des Mentalen, sondern auch zu einer weiteren Analogie zur Metapher über: Vergleichbar mit der argumentativen und quasi-topischen Funktion konzeptueller Metaphern resultiert auch das Wirken des Mentalen aus seiner grundlegenden Orientierungsleistung. Mentalitäten sichern das jeweilige Weltbild, die 'kodierten Blicke'114 einer Gemeinschaft. „Die Mentalität fungiert in konkreten Situationen als Hilfe bei der Entscheidung, wie man sich verhalten soll, sie ist die Summe der Orientierungsangebote, die in einem Kollektiv jeweils aktuell sind."115 Der quasi-topische Charakter von Mentalitäten dient analog der konzeptuellen Metaphorik zur lebensweltlichen und alltäglichen Systemstabilisierung. Mit der Nähe zur Topik als einem Bestimmungskriterium der Lebensdauer ist schließlich sechstem auch die Sprachlichkeit der Mentalität berührt. Das Mentale stellt nicht nur einen bestimmten Fundus an Überzeugungsinhalten dar, sondern steht auch für eine spezielle Form von kollektiven Einstellungen. Die mentalitätsgeschichtliche Notwendigkeit, daß das Mentale nur als realisiertes token erfaßt werden kann, wirft auch die Frage nach seinen sprachlichen Realisationsformen auf. Bereits Sellin verweist in diesem Zusammenhang auf „die enge Beziehung zwischen Mentalität und Sprache"116 und auf die naheliegende Folgerung, „Mentalitätsgeschichte als Bedeutungsgeschichte" zu betreiben. Auch Burke fordert die Mentalitätshistoriker auf, sich „etwas näher mit der Sprache zu befassen, insbesondere mit ihren Metaphern und Symbolen."117 Neben der historischen Semantik erlangen somit auch Begriffsgeschichte und Metaphorologie heuristische Relevanz für die Mentalitätsgeschichte. „Methodisch erscheint namentlich derjenige Bereich der Begriffsgeschichte, in dem nicht gelehrte Definitionen, sondern die alltäglichen Bedeutungen herausgestellt werden, geradezu als ein wesentlicher Bestandteil der mentalitätsgeschichtlichen Bemühungen."118 Die Nähe einer so verstandenen „Archäologie der Sprache"119 zur Metaphorologie drängt sich geradezu auf. Im Folgenden soll deshalb näherhin auf das Verhältnis zwischen Mentalitäten und Metaphern eingegangen werden. 4.2 Mentalität und Metapher Inwiefern lassen sich Mentalitätsgeschichte und Metaphorologie in einen sinnvollen und fruchtbaren methodischen Zusammenhang bringen? Die Ant-
115 116 117 118 119
Zum Begriff der kodierten Blicke vgl. Michel Foucault: Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris 1966. Dinzelbacher, Europäische Mentalitätsgeschichte, S. XXVI. Sellin, Mentalität und Mentalitätsgeschichte, S. 576. Burke, Stärken und Schwächen der Mentalitätsgeschichte, S. 139. Sellin, Mentalität und Mentalitätsgeschichte, S. 579. Schulze, Mentalitätsgeschichte, S. 255.
82
Die konzeptuelle Metapher
wort auf diese Frage wurde bereits von beiden Seiten angebahnt. P. Burke120 fordert eine Erweiterung des mentalitätsgeschichtlichen Ansatzes um die Metaphorologie, während M. Pielenz im Anschluß an Burke die konzeptuelle Metapherntheorie um den Aspekt der Mentalitäten bereichert hat. Im Zuge seiner kritisch-konstruktiven Sichtung des Programms der Mentalitätsgeschichte kommt Burke zu dem Schluß: „Die Mentalitätengeschichte sollte sich stärker mit Interessen, mit Kategorien und mit Metaphern beschäftigen als bislang."121 Burke hält die metaphorologisch modifizierte Reformulierung des mentalitätsgeschichtlichen Ansatzes vor dem Hintergrund konzeptioneller Schwächen und berechtigter Einwände für unabdingbar. Zu jenen Schwächen zählt beispielsweise ein bisweilen evolutionistisches Geschichtsbild seitens der Mentalitätshistoriker, das ihnen lediglich erlaube, vergangene Mentalitäten sowie ihren Wandel mit den grobschlächtigen Klassifizierungen von 'primitiv-zivilisiert', 'prälogisch-logisch', oder 'traditionell-modern' zu erfassen. Demgegenüber käme es darauf an, nicht nur den Gehalt von Mentalitäten, sondern auch ihre Form zu beachten. Mentalitätsgeschichte habe auch ein methodisches Interesse „für die Struktur von Meinungen, für Kategorien, für Metaphern und Symbole, dafür wie die Leute denken und nicht nur dafür was sie denken"122 auszubilden. Das bedeutet aber, die Sprachlichkeit des Mentalen in angemessener Weise zu berücksichtigen. Insbesondere die Rede von 'kollektiven Meinungsschemata' und 'stillschweigenden Überzeugungssystemen', die das Denken insgesamt strukturieren, gewinnt an heuristischer Differenziertheit, „wenn wir uns etwas näher mit der Sprache befassen, insbesondere mit ihren Metaphern und Symbolen."123 Denn sie sind in der Lage, das Mentale dichotomiefrei und kontextvariant zu beschreiben. Wie Metaphern haben auch Mentalitäten das Kriterium ihrer lebensweltlichen Orientierungsfunktion und Überzeugungskraft an sich selbst und lassen sich nicht in ein - letztlich ethnozentrisches - Evolutionsschema (analog der Figur: vom Mythos zum Logos) pressen. Die Logik des Mentalen kann von daher auch nicht als zeitlos gelten, sondern muß paradigmatisch verstanden werden. Entsprechend dem Vorgehen Blumenbergs wären demnach weniger eine fortlaufende Mentalitätsgeschichte als vielmehr typologische 'Paradigmen zu einer Mentalitätsgeschichte' zu konzipieren, die keiner eindeutigen Teleologisierung mehr unterworfen werden könnten. Im Anschluß an die neue Hinwendung zur Metapher durch Literaturwissenschaftler, Ethnologen und Philosophen lohnt es sich deshalb auch für Mentalitätenhistoriker, deren Beispiel zu folgen.
121 122 123
Burke, Stärken und Schwächen der Mentalitätengeschichte, S. 127-145. Ebd., S. 137. Ebd., S. 127. Ebd., S. 139.
Metaphern und Mentalitäten
83
Dieser Aufforderung hat in umgekehrter Rezeptionsrichtung M. Pielenz Folge geleistet, indem er den Mentalitätsbegriff seinerseits für die Metapherntheorie fruchtbar zu machen sucht. Im Schlußabschnitt seiner argumentativen Metapherntheorie skizziert Pielenz einen methodischen Bogen vom topisch-konzeptuellen Metaphernbegúff über die Theorie kultureller Modelle zur Mentalitätsgeschichte. Im Anschluß an die kognitive Anthropologie wird Kultur als Kognition im weitesten Sinne begriffen. Kultur stellt demnach ein mentales Phänomen dar, in dem das Wissen einer Gemeinschaft gesammelt und organisiert ist. Kultur bezeichnet also den konstruierten Aspekt von Bedeutungssystemen zur Bewältigung der Lebenswelt. Kulturelle Modelle dienen dazu, die Vielfalt des kulturellen Wissens zu verarbeiten und zu strukturieren. Sie lassen „Kultur als interaktiv konstruiertes Bedeutungssystem"124 erkennen. Aber auch wenn das kulturelle Modell als 'mental' und 'kognitiv' beschrieben wird, bedeutet dies keine intellektualistische Überformung des Kulturbegriffs. Der kognitive Charakter des kulturellen Modells kommt keiner explanativ-wissenschaftlichen Theoriebildung gleich, sondern fungiert als 'folk theory' oder 'naive Theorie' auf lebensweltlich orientierender Ebene. Kulturelle Modelle „schaffen die Möglichkeit, die kognitive Forderung nach erfahrungsnahen Begriffen zu erfüllen und die alltägliche Lebenswelt bestimmter sozialer Gruppen oder Kulturen aus deren Perspektive zu entschlüsseln."125 Daran wird die Analogie zwischen kulturellem Modell, Mentalität und konzeptueller Metapher sichtbar. Modelle und Mentalitäten verhalten sich zur Idee, wie die Metapher zum Begriff. Gegenüber Idee und Begriff kommen kulturelle Modelle, Mentalitäten und konzeptuelle Metaphern auf Seiten der Lebenswelt zu stehen und fungieren dort als flexible theoretische Grundannahmen mit begrenzter Reichweite. Ihre Geltung ist logisch und zeitlich begrenzt und unterliegt paradigmatischen Brüchen. Das topisch-argumentationstheoretische Pendant zum kulturanthropologischen Modell ist demnach die konzeptuelle Metapher. „Indem konzeptuelle Metaphern einen Fundus an Leitvorstellungen und Meinungsnormen formulieren [...] entpuppen sie sich als genuine kulturelle Modelle."124 Dabei treten konzeptuelle Metaphern entweder selbst als kulturelle Modelle in Erscheinung oder dienen als Bestandteile derselben. Hier schließt Pielenz explizit den Schritt zur Mentalitätsgeschichte an: „Beschreiben aber Mentalitäten die Einstellungen und Denkmuster gewöhnlicher Menschen zum Alltagsleben, sind konzeptuelle Metaphern und ebenso Topoi ihre elementaren Gerinnungsformen. "127 Mentalitäten artikulieren sich oftmals in Gestalt von Metaphern, weshalb es - wie schon Burke zu recht betont - für die Beschreibung von
125 126 127
Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 163. Ebd., S. 164. Ebd., S. 167. Ebd., S. 170.
84
Die konzeptuelle Metapher
Mentalitäten zweckdienlich ist, „sich an die wiederkehrenden Metaphern zu halten, insbesondere wenn sie das Denken insgesamt zu strukturieren scheinen."128 In der Terminologie der konzeptuellen Metapherntheorie gesprochen können Metaphern Mentalitäten konstituieren (types) während Mentalitäten sich sprachlich in Gestalt von Metaphern realisieren (token). „In der Mentalität fließen Denkweise und Alltagskultur, endoxa und kollektive Vorstellungen in Gestalt kultureller Modelle zusammen und bilden einen Strom dichter Meinungssysteme mit hoher Erklärungskraft. [...] Erst vor dem Hintergrund der umfassenden Mentalität wird das Profil des Topos und vor allem der konzeptuellen Metapher vollends sichtbar."12®
5. Fazit Leistung und Grenzen einer Theorie der konzeptuellen Metapher Der heuristische Dreh- und Angelpunkt der konzeptuellen Metapherntheorie ist die argumentativ-topische Legitimierungs- und Orientierungsfunktion konventioneller Metaphern im Zusammenhang mit lebensweltlichen und theoretischen Meinungsbildungsprozessen. Im Hinblick auf die kognitive Valenz ergänzt eine konzeptuelle Metapherntheorie das Funktionsspektrum der Metapher, insofern nicht nur die theoriekreative Neubeschreibung, sondern auch die theoriestützende Legitimierung in den Blick tritt. Die damit einhergehenden Merkmale der Usualität und Habitualität rücken die konzeptuelle Metapher in eine eindeutige Nähe zum 'system of associated commonplaces' von M. Black. Damit greift die Theorie der konzeptuellen Metapher auch auf den Modellcharakter der Metapher zurück und führt ihn einen Schritt weiter, indem Modelle nicht nur als heuristische Innovationsmittel, sondern auch als implizite Leitstrukturen für lebensweltliche und theoretische Einstellungen, Überzeugungen und Grundhaltungen interpretiert werden. Die Metapher in diesem Sinne als Modell zu verstehen, bedeutet demnach, sie als elementaren Baustein eines interaktiv konstruierten Bedeutungssystems zu bestimmen. An diesem Punkt ergeben sich konstruktive Bezüge zu den Begriffen des Topos und der Mentalität. Indem bestimmte Metaphern als sprachlich kondensierter Niederschlag des kollektiven Überzeugungshaushaltes einer Gemeinschaft (Mentalität) gelten, können sie in Rechtfertigungszusammenhängen eine quasi-topische Gebrauchsfunktion einnehmen. Auf die mentale Prägekraft konzeptueller Metaphern wird zurückgegriffen, wenn Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt oder brüchig werden. Dieser Rekurs auf Sinn und Bedeutung 128
129
Burke, Stärken und Schwächen der Mentalitätsgeschichte, S. 139, zit. bei Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 170. Pielenz, Argumentation und Metapher, S. 171.
Leistung und Grenzen einer Theorie der konzeptuellen Metapher
85
metaphorischer Konzepte in geltungslegitimierender Absicht läßt die Metapher ebenso als Bestandteil einer 'Logik der Begründung' hervortreten und verhindert die Beschränkung auf eine rein schöpferische Funktion im Rahmen einer 'Logik der Entdeckung'. Indem die konzeptuelle Theorie der Metapher Argumentation statt Innovation zum Paradigma erklärt, schärft sie die metaphorologische Wahrnehmungskompetenz für das spezifische Leistungsprofil von konventionellen Metaphern mit geringer Auffälligkeit und hoher Usualität. Denn die eher latente Wirkmächtigkeit dieses Metapherntyps muß einem poetologisch ausgerichteten Beobachtungsraster verborgen bleiben. Eine weitere Bereicherung resultiert aus der Differenzierung zwischen metaphorischer Verwirklichung (token) und dem dabei zugrundeliegenden metaphorischen Konzept (type). Sie erlaubt es, den emphatischen Novitätsanspruch poetischer Metapherntheorien im Einzelfall etwas genauer zu beschreiben, insofern sich 'lebendige' Metaphern oft als sprachliche Variationen über eine bereits bestehende Konzeptmetapher entpuppen. Nicht zuletzt eröffnet sich dadurch auch die Möglichkeit, die umstrittene Frage nach der Wiederbelebung abgenutzter, schlafender oder toter Metaphern zu beantworten, indem Revitalisierung zumindest fallweise als Variation auf der metaphorischen Realisierungsebene verstanden werden kann. Dennoch wird jede Modifikation in differenzierender Absicht genau dann zum theoretischen Hemmschuh, wenn sie sich ihrerseits absolut setzt. In diesem Fall also, wenn das topische Kriterium von allgemeiner Akzeptanz und kollektiver Usualität zum alleingültigen Maßstab für Metaphorizität erklärt wird. Eine Topik der abgenutzten Metapher, welche die Möglichkeit echter Neubeschreibung ungebührlich beschränkt und herabsetzt, indem sie generell die Möglichkeit der Produktion neuer Konzepte und Bildfelder (types) leugnet, erweist sich letztlich nur auf dem anderen Auge blind als eine rein poetische Theorie der lebendigen Metapher. Entgegen einer topischen Verengung der Untersuchungsperspektive darf deshalb Innovation nicht einfach auf Variation reduziert werden. Vielmehr müssen sich beide Konzepte, die kognitive Poetik der Metapher und die kognitive Topik der Metapher ergänzen, um der Vielfalt metaphorischer Phänomene gerecht werden zu können. In historischer Perspektive erscheint die metaphorologische Paradigmatik als möglicher Weg zu einer vermittelnden Verhältnisbestimmung beider Theorieansätze.
Kapitel 3 Die absolute Metapher Die Metapher von der 'absoluten Metapher' hält nur bedingt, was sie auf den ersten Blick zu versprechen scheint, zumal wenn sie hier nach der 'lebendigen' und der 'konzeptuellen' Metapher an dritter Position verhandelt wird. Gewarnt sei deshalb ausdrücklich vor allen Erwartungen, die sich von einem idealistischen Konzept des Absoluten herleiten. Die absolute Metapher fungiert mitnichten als Metapher des Absoluten. Das soll freilich nicht heißen, daß es keine absoluten Metaphern für das Absolute gäbe, oder daß das Absolute nicht selbst eine Metapher sei. Hier soll nur dem Mißverständnis vorgebeugt werden, Wesen und Funktion der absoluten Metapher gründeten in der Metapher des Absoluten. Vielmehr beansprucht die absolute Metapher keine universale Geltung, sondern lediglich eine irreduzible Eigenbedeutung. Ebenso generiert sie keine teleologischen Geschichtsprozesse, sondern unterliegt den kontingenten Bedingungen des Historischen. Trotzdem bildet die absolute Metapher eine Synthesis der beiden bisher verhandelten Konzepte. Absolute Metaphern können als lebendige oder konzeptuelle Metaphern mit einer bestimmten Funktion in Begriffsgeschichte und Lebenswelt verstanden werden. Insofern bezeichnet die absolute Metapher keinen dritten inhaltlich bestimmten Metapherntyp, sondern entspringt einer funktionalen Analyse des geschichtlichen wie des lebensweltlichen Vorkommens von lebendigen und konzeptuellen Metaphern. Dieses Verständnis absoluter Metaphern geht auf H. Blumenberg zurück. Sein metaphorologisches Programm wird im folgenden darzustellen sein. Blumenbergs Denken ist insbesondere durch die Doppelfunktion von historischer und systematischer Methode geprägt. Geltungsfragen werden historisiert und erfahren ihre konkrete geschichtliche Situierung, während Fragen der Genese 'logifiziert' und in ihrer eigenen Rationalität gewürdigt werden. Geltung kann ein Gedanke oder Theorem nur für eine bestimmte Zeit beanspruchen, und die Geschichte kann nur vor dem Hintergrund konkreter Geltungsansprüche verstanden werden. Synchrones Denken verlangt nach dem diachronen Bewußtsein und umgekehrt. Das Phänomen, welches am deutlichsten den Zusammenhang von Geltung und Geschichte demon-
88
Die absolute Metapher
striert, ist die 'Epochenschwelle" als Geburtsstunde eines neuen Denkens. Hier tritt die Verschränkung von synchroner Evidenz und diachroner Kontingenz am klarsten hervor. Diejenige Epoche, die sich die damit angeschnittene Frage selbst gestellt hat, ist die 'Neuzeit'. Insofern sie sich selbstreferentiell zu derjenigen Problematik verhält, welche die Bedingung ihrer eigenen geschichtlichen Existenz ist, stellt ihre Legitimität ein herausragendes Untersuchungsfeld für Blumenberg dar.2 Die spezifische Verschränkung von Geltung und Geschichte, wie sie sich am Phänomen der Epochenschwelle zeigen läßt, expliziert Blumenberg methodisch im Rahmen von Begriffsgeschichte und Metaphorologie. Beobachtungsfeld einer im Anschluß an Husserl konzipierten 'genetischen Phänomenologie der Geschichte' sind die Zeiten von Metaphern und Topoi einschließlich ihrer Wandlung. Phänomenologie, so verstanden, dient der Erhellung von sprachlichen Genesen. Dabei resultiert die hohe Bedeutung von Metaphern aus ihrer komplexen Einstellungshaltigkeit, die den vorbegrifflichmentalen Überzeugungshaushalt einer jeweiligen Epoche in sich birgt. „Ihr Gehalt bestimmt als Anhalt von Orientierungen ein Verhalten, sie geben einer Welt Struktur, repräsentieren das nie erfahrbare, nie übersehbare Ganze der Realität. Dem historisch verstehenden Blick indizieren sie also die fundamentalen, tragenden Gewißheiten, Vermutungen, Wertungen, aus denen sich die Haltungen, Erwartungen, Tätigkeiten und Untätigkeiten, Sehnsüchte und Enttäuschungen, Interessen und Gleichgültigkeiten einer Epoche regulierten." 3 Erst vor dem operativ-verschatteten Hintergrund derartiger Mentalitätsmetaphern erhalten theoretische Begriffe ihre thematisch scharf umrissene Bedeutung. Blumenberg entwirft seine genetische Phänomenologie zum Behuf einer Kritik der theoretischen Alltäglichkeit und betreibt die Kontingenzverschärfung gegen eine sich jeweils absolut setzende Gestalt von Rationalität, die sich nicht ihrer Gewordenheit und Bedingtheit bewußt wird. Dies muß zur Problematisierung unhaltbarer Geltungs- und Gewißheitsansprüche führen, wie sie vor allem durch die beiden klassischen Normbegriffe schlechthin erhoben werden: Natur und Wahrheit. In zahlreichen Analysen zeigt Blumenberg, daß wenig Vorstellungen so sehr dem Wandel unterliegen, wie das jeweilige Verständnis von Natur und Natürlichkeit einschließlich ihrer Bewertung. Natur konvergiert nicht nur mit dem Hergestellten, sondern auch mit Technik, Kultur und den Wissenschaften.4 Auf der anderen Seite ist
2 3
4
Vgl.: Hans Blumenberg: Epochenschwelle und Rezeption, in: Philosophische Rundschau, Bd. 6, 1958; außerdem: Reinhart Herzog/Reinhart Koselleck (Hg.): Epochenschwelle und Epochenbewußtsein, Poetik und Hermeneutik Bd XII, München 1987. Hans Blumenberg: Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt/Main 1966. Hans Blumenberg: Paradigmen zu einer Metaphorologie, in: Archiv für Begriffsgeschichte, Bd 6, 1960, S. 20. Vgl. Hans Blumenberg: Lebenswelt und Technisierung, in: Wirklichkeiten in denen wir leben, S. 47f.
Die absolute Metapher
89
Wahrheit ein in metaphorischen Annäherungen umkreister Begriff, der nicht nur in den Zuständigkeitsbereich von Metaphysik, Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, sondern ebenso in die Anthropologie, Metaphorologie und die Rhetorik gehört. Unter diesen Bedingungen kann der Philosophie nur noch Verbindlichkeit zukommen, wenn sie das - nach rationalistischem Verständnis - andere ihrer selbst in sich aufnimmt. Insofern dieses andere aber immer schon sprachlich vermittelt ist, hat sich die Philosophie der kontrollierten Mehrdeutigkeit der Sprache in konstruktiver Weise zu bedienen, statt der Illusion nachzuhängen, diese konstitutive Mehrdeutigkeit, die sich vor allem in Gestalt von Metaphern Ausdruck verschafft, ausmerzen zu können. Blumenbergs Metaphorologie speist sich entsprechend der beschriebenen Doppelstruktur aus zwei thematischen und methodischen Teilaspekten, die sich relativ symmetrisch auf die früheren historisch-paradigmatischen Untersuchungen und die späteren programmatischen Schriften verteilen lassen. In den 'Paradigmen zu einer Metaphorologie1 und den 'Beobachtungen an Metaphern'5 entfaltet Blumenberg das Konzept einer diachron-historischen Metaphorologie als sprachkritische Aufklärungsarbeit an begriffs- und theoriegeschichtlichen Prozessen. In diesem Zusammenhang entwickelt er jedoch keine zusammenhängende Metapherntheorie, sondern durchschießt seine historischen Untersuchungen mit programmatischen Aussagen zur Metaphorologie. Für die Interessen der vorliegenden Arbeit müssen vor allem diese systematischen Äußerungen im Vordergrund stehen, ohne immer in ihrem umfassenden historiographischen Kontext beachtet werden zu können. Eine Interpretation muß deshalb die verstreuten Sentenzen zusammentragen und beim Wort nehmen sowie den jeweiligen thematischen Zusammenhang herstellen. Im 'Ausblick auf eine Theorie der Unbegrifflichkeif6 und der 'Anthropologischein] Annäherung an die Aktualität der Rhetorik'1 skizziert Blumenberg dagegen das Programm einer synchron-systematischen Metaphorologie als Untersuchung zur aktuellen Funktions- und Verwendungsweise von Metaphern. Im Rahmen der historischen Metaphorologie arbeitet Blumenberg also die spezifische Leistung sowie die umfassende theoriegeschichtliche Bedeutung von absoluten Leitmetaphern heraus. Diese Einschätzung der elementaren Leistungsweise der Metapher hält sich auch in den späteren Aufsätzen durch. Dagegen beurteilt er die Möglichkeiten einer aktuellen und bewußten Verwendung von Metaphern unterschiedlich. In den frühen Arbeiten schätzt er die Möglichkeiten einer 'zweiten metaphorischen Naivität', d. h. einer
6
7
Hans Blumenberg: Beobachtungen an Metaphern, in: Archiv für Begriffsgeschichte, Bd 15, 1971. Hans Blumenberg: Ausblick auf eine Theorie der Unbegrifflichkeit, in: ders.: Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher, Frankfurt am Main 1979. Hans Blumenberg: Anthropologische Annäherung an die Aktualität der Rhetorik, in: ders.: Wirklichkeiten, in denen wir leben, Stuttgart 1981.
90
Die absolute Metapher
aktiven Verwendung von Metaphern eher negativ ein, wohingegen er später besonders im Zusammenhang der fundamentalanthropologischen Bedeutung der Rhetorik - zu wesentlich positiveren Ergebnissen gelangt. Dies hängt, wie sich zeigen wird, mit einem Wechsel der Beobachterperspektive zusammen. Denn an die Stelle der zunächst denkarchäologischen Aufklärungsarbeit tritt die späte Hinwendung zu den allgemeinen menschlichen Daseinsverhältnissen im Rahmen einer Theorie der Lebenswelt.
I. DIE ABSOLUTE METAPHER 1. Zur Rehabilitierung der Metapher Blumenberg umreißt die Problemexposition einer historischen Metaphorologie mit den beiden gegensätzlichen Positionen von R. Descartes und G. Vico. Zwischen diesen beiden Polen, also zwischen dem Begriffsideal eines 'Discours de la Méthode' und dem Plädoyer für eine geschichtlich-produktive Einbildungskraft in der 'Scienza Nuova' entscheidet sich nach Blumenberg das Schicksal einer zukünftigen Metaphorologie. Folgt man dem methodischen Programm des Descartes, dann hat die Philosophie einer inneren „Teleologie der Logisierung"8 zu folgen, in deren Verlauf eine vollständige begriffliche Erfassung des Gegebenen das Ziel aller Denkbemühungen darstellt. Demzufolge bestünde ein imaginierter Endzustand der Philosophie, wie ihn Descartes durchaus für erreichbar hielt, in dem Ideal voller Vergegenständlichung der Wirklichkeit und einer entsprechenden begrifflichen Vollendung der Terminologie als deren sprachlichem Fundus an klaren und eindeutigen Definitionen über alles Gegebene. „In diesem Endzustand wäre die philosophische Sprache rein 'begrifflich' im strengen Sinne: alles kann definiert werden, also muß auch alles definiert werden." 9 In diesem Ansinnen erblickt Blumenberg „die morphische Statik des Aristotelismus mit seiner Unterstellung der Möglichkeit eines definitiven Kompendiums der Weltdinge"10. Allgemein übertragene und spezifisch metaphorische Ausdrücke hätten im Prozeß einer derart universalen Verbegrifflichung nur eine funktionale Übergangsbedeutung und wären aufgrund ihrer Vorläufigkeit logisch überholbar. Mit der Erreichung jenes Zustandes wären sowohl eine geschichtliche Untersuchung der Begriffsentwicklung als auch eine historische Metaphorologie überflüssig geworden und an ihr vorzeitiges Ende gelangt. Geschichtliches Bewußtsein und bildhaft-anschauliche Sprache würden in der vollständig sowie clare et distincte erfaßten Welt terminieren. 8 9 10
Blumenberg, Paradigmen, S. 9. Ebd., S. 7. Ebd., S. 62.
Zur Rehabilitierung der Metapher
91
Gegen die Aufwertung einer ausschließlich begrifflich definierenden Rationalität auf Kosten anderer Formen des Rationalen und gegen die gleichzeitige Abwertung der Geschichte zum bloßen Durchlaufstadium der Logisierung hat Giambattista Vico sein aufklärungskritisches Programm einer 'Logik der Phantasie' gestellt. Demzufolge bleibt die volle Klarheit und Wahrheit des Gegebenen, das verum ipsum factum, qua Schöpferwerk der göttlichen Einsicht und Allwissenheit vorbehalten, während der Mensch nur das von ihm selbst Hervorgebrachte erkennen kann: „die Welt seiner Bilder und Gebilde, seiner Konjekturen und Projektionen, seiner 'Phantasie' in dem neuen produktiven Sinne, den die Antike nicht gekannt hatte."11 Dies alles begegnet dem Menschen im Rahmen und in Gestalt seiner Geschichte. Dabei liegt die Pointe des Vico-Axioms - 'Der Mensch macht die Geschichte"2 weder in der metaphysisch-theologischen Selbstbeschränkung des menschlichen Geistes zugunsten des göttlichen Schöpferwissens noch in der geschichtsphilosophischen Autonomiethese einer bewußten Planbarkeit und Machbarkeit der Geschichte, sondern in der Idee einer geistig-schöpferischen Produktivität der menschlichen Einbildungskraft. Die 'Phantasie' als sinnlich-anschauliches Bildbewußtsein und die 'Geschichte' als der Spielraum ihrer Realisierung reüssieren zu philosophischen Grundaxiomen und konterkarieren das cartesische Programm einer nur begrifflich verfaßten und zeitlos vorgestellten Vernunftwahrheit. In das Repertoire einer solchen 'Logik der Phantasie' gehört deshalb auch die übertragene Redeweise der Metapher bzw. ein angemessenes Bewußtsein von Wesen und Funktion der Metapher, das diese nicht zum Ornament einer bereits anderwärts festgestellten oder noch festzustellenden Wahrheit entwertet. Der Autor der Scienza Nuova unterscheidet zwischen dem Syllogismus und der Metapher, „welche die beiden Grundformen geistiger Synthesis repräsentieren. Dem Syllogismus entspricht das für den rationalistischen Erfahrungsbegriff konstitutive Prinzip der Reihe, während die Metapher das Prinzip der über die Reihenbildung hinausgehenden Beziehungen zwischen gegebenen Vorstellungen darstellt."13 Insofern Vico offensichtlich von dieser interaktiven Funktion der Metapher zwischen verschiedenen Gedanken und Vorstellungen ausgeht, kann er als der erste Theoretiker der metaphorischen Wechselwirkung gelten. Denn in dem Vermögen zur metaphorischen Verbindung verschiedenartiger Vorstellungen erkennt Vico „jene in der Metapher repräsentierte Form der induktiven Zusammenschau, die gegen den deduktiven Charakter der analytischen Methode ausgespielt wird"14. Dabei 11 n
13 14
Ebd., S. 8. Ferdinand Fellmann: Das Vico-Axiom: Der Mensch macht Geschichte, burg/München 1976. Ebd., S. 172. Ebd., S. 176.
Frei-
92
Die absolute Metapher
beschränkt sich die Leistungsweise der Metapher nicht nur auf das kombinatorische Vermögen mit vorhandenen Vorstellungen. Vielmehr intendiert eine 'Logik der Phantasie' darüber hinaus die Wirklichkeitserzeugende Produktivität des menschlichen Geistes. Deshalb gehört die Metapher in den Sachzusammenhang einer „poetischen Logik"15. Die an der Synthesis der Metapher gemessene Leistung der Phantasie hebt auf die wirkliche Erzeugung als notwendige Voraussetzung sowohl des praktischen als auch des theoretischen Weltverhaltens ab. „Die Metapher bildet für Vico die gemeinsame Grundfigur der Produktivität des menschlichen Geistes sowohl in praktischer als auch in theoretischer Hinsicht."16 Vico kann somit nicht nur als erster Zeuge der Interaktionstheorie bezeichnet werden, sondern er erkannte offenbar auch schon die heuristische Funktion der theoriekreativen und alltagskreativen Metapher. Insofern die Erzeugung der Metapher dem Wesen der geistigen Erzeugung generell entspricht, bildet die Metapher eine Grundfunktion der 'poetischen Logik der Phantasie'. Im Hinblick auf das Verhältnis zwischen begrifflichem und metaphorischem Denken muß man sich also seit Descartes und Vico entscheiden. Blumenberg spitzt die Verhältnisbestimmung zwischen metaphorischem und philosophisch-spekulativem Diskurs auf den Gegensatz zwischen Metaphorologie und Cartesianismus zu. Dem ungeschichtlichen 'Purismus der Vernunft' (Hamann) einer klaren und distinkten Begrifflichkeit setzt er mit Vico das Programm einer kritischen Sprach- und Begriffsgeschichte entgegen. Den Unterschied zwischen begrifflichem und metaphorischem Verfahren nach Aufwertung der Geschichte und Entdeckung der produktiven Einbildungskraft in ihrer Bedeutung für die Geistesgeschichte verdeutlicht Blumenberg beispielsweise am Wandel der Wahrheitsvorstellung, der am metaphorischen Paradigma von der 'nackten Wahrheit' ablesbar wird. „Die Entdeckung der Geschichte inmitten der Aufklärung und gegen ihren Sinnstrom ist die Entdeckung der Illusion der 'nackten Wahrheit' oder der Nacktheit als Illusion, die Aufhebung der Metapher und ihre Erneuerung in der Richtung, daß die 'Verkleidungen' der Wahrheit nun nicht mehr rhetorischem Schmuckbedürfnis und dichterischer Phantasie entstammen, ja überhaupt nicht akzidentiellabstreifbare 'Zutaten' darstellen, sondern den Manifestationsmodus der Wahrheit konstitutiv ausmachen."17 Nimmt man die Anregungen einer geschichtlich argumentierenden und sprachlich bewußten Vernunftkritik ernst, so muß die philosophiegeschichtlich etablierte und tiefsitzende „Gleichsetzung übertragener und uneigentlicher Redeweise fragwürdig" wer-
16 17
Giambattista Vico: Die Neue Wissenschaft von der gemeinschaftlichen Natur der Nationen. Auswahl, Übersetzung und Einleitung von Ferdinand Fellmann, Frankfurt/Main 1981, S. 69. Ebd., S. 176. Blumenberg, Paradigmen, S. 55.
Zur Rehabilitierung der Metapher
93
den18. Zumindest hat bereits Vico die Metapher für ebenso 'eigentlich' erklärt wie die in der Regel als 'eigentlich' geltenden Aussageformen der Sprache. Die Einsicht in die spezifische Funktion und Leistungskraft der Metapher erfordert demzufolge, „das Verhältnis von Phantasie und Logos neu zu durchdenken"19 und die Metapher nicht nur nach ihrer technischen Vermittlung von Wahrheitsaussagen, sondern nach ihrem „Mehr an Aussageleistung"20 zu beurteilen. Blumenberg nennt das Beispiel 'Der Wald steht schwarz und schweiget'21. Eine Zurückführung auf das primäre Assoziationsfeld von 'Wald' liefert keine anschaulichen Deutungsmöglichkeiten für diese Metapher. Ihr Aussagewert gründet in einer irreduziblen Eigenbedeutung. „Die absoluten Metaphern, die für die Welt gefunden worden sind, lösen sich so wenig in Eigenschaften und Bestimmbarkeiten auf wie dieser letztinstanzliche Wald in Bäume.1,22 Das Untersuchungsfeld einer Analyse der Überschußproduktion von Bedeutung durch metaphorischen Sprachgebrauch verortet Blumenberg nun aber im Unterschied zu den bisherigen Autoren in der Geschichte der Metaphern, „denn der historische Wandel einer Metapher bringt die Metakinetik geschichtlicher Sinnhorizonte und Sichtweisen selbst zum Vorschein, innerhalb deren Begriffe ihre Modifikationen erfahren."23 Blumenberg formuliert damit in hermeneutischer Terminologie die Verhältnisbestimmung E. Finks zwischen operativen und thematischen Begriffen, wobei die operative Begriffsschicht zudem als eminent mentalitätshaltig erkennbar wird. Das erste metaphorologische Forschungsgebiet bilden somit topisch-konzeptuelle Metaphern mit operativ verschatteter Hintergrundfunktion. Blumenberg unterscheidet dabei das im engeren Sinne metaphorologische Verfahren des historischen Längsschnitts, das die Dynamik des metaphorischen Prozesses widerspiegelt, indem es durch eine Reihe von metaphorischen Belegen eine Interpretationskurve zieht, von einem Querschnittsverfahren, das heißt einer Deutung aus dem jeweiligen gedanklichen Zusammenhang, die nicht mehr rein metaphorologisch ist, sondern Begriff und Metapher als Einheit der Ausdruckssphäre eines Denkers oder einer Zeit versteht. Die Aufgabe einer solchen gegenläufig analysierten Begriffsgeschichte in Gestalt der 'metaphorologischen Paradigmatik' besteht darin, „Felder abzugrenzen, innerhalb deren man absolute Metaphern vermuten kann, und Kriterien für deren Feststellung zu erproben."24 Um die avisierte 'Metakinetik geschichtlicher Sinnhorizonte und Sichtweisen', wie sie sich in der Hinter18 19 20 21 22 23 24
Ebd., S. 10. Ebd. Ebd., S. 9. Blumenberg, Unbegrifflichkeit, S. 80. Ebd. Blumenberg, Paradigmen, S. 11. Ebd.
94
Die absolute Metapher
grundfunktion konzeptueller Metaphern vollzieht, in den Blick zu bekommen, hat eine historische Metaphorologie den jeweiligen Ort der Metapher und das heißt, „die logische 'Verlegenheit' zu ermitteln, für die die Metapher einspringt, und solche Aporie präsentiert sich gerade dort am deutlichsten, wo sie theoretisch gar nicht 'zugelassen' ist."25 Die Notwendigkeit des metaphorischen Umwegs steigt also im Verhältnis zu seiner theoretischen Unzulässigkeit an. Daraus resultiert die „'Verborgenheit' der Metapher"26 im Prozeß der philosophischen Begriffsbildung, wobei gilt, daß die tiefgreifendste Funktion jeweils mit ihrer dichtesten Verschleierung einhergeht. Dieser Umstand eines diametral entgegengesetzten Verhältnisses zwischen Funktion und Bewußtheit legt die Annahme nahe, daß es sich bei Metaphern nicht nur um „Restbestände [...] auf dem Wege 'vom Mythos zum Logos'", sondern um „Grundbestände der philosophischen Sprache"27 handelt, das heißt um solche „'Übertragungen', die sich nicht ins Eigentliche, in die Logizität zurückholen lassen."28 Blumenberg nennt solche irreduziblen Übertragungen 'absolute Metaphern', wobei ihre Absolutheit darin besteht, „daß sie sich gegenüber dem terminologischen Anspruch als resistent erweisen, nicht in Begrifflichkeit aufgelöst werden können, nicht aber, daß nicht eine Metapher durch eine andere ersetzt bzw. vertreten oder durch eine genauere korrigiert werden kann. "29 Absolute Metaphern wiederholen also gerade nicht den Fehler einer Philosophie zeitloser Vernunftwahrheiten, sondern fügen sich ein in die lebendige und kontingente Dynamik der Metapherngeschichte. Auch absolute Metaphern haben ihre Geschichte, nehmen für einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Position ein und können durch andere Metaphern von gleicher Bedeutungskraft abgelöst werden. Im Prozeß der historischen Begriffsbildung unterlaufen absolute Metaphern die cartesische Teleologie der Logisierung und etablieren in dem Maße der Einsicht in ihre Funktion eine alternative Sicht auf den geschichtlichen Verlauf der Konstitution einer philosophischen Terminologie. Das herkömmliche Bedingungsverhältnis zwischen begrifflich fixierter und vorbegrifflicher Redeweise kehrt sich damit um. Nicht erst die streng begriffliche Fassung qua 'Aufhebung' rechtfertigt den vorphilosophischen Sprachgebrauch und gesteht ihm in seinen durch den Begriff gezogenen Grenzen einen legitimen Verwendungsbereich zu, vielmehr macht erst umgekehrt die Kenntnis jener präterminologischen Sprachsphäre die semantische Verengung und Fixierung in Gestalt klarer und eindeutiger Begriffe verständlich. Die Metaphorologie ist deshalb kein Untergebiet einer allgemeinen 25 26 27 28 29
Ebd., S. 9. Ebd. Ebd. Ebd. Ebd., S. 11.
Die Funktion der absoluten Metapher
95
Untersuchung philosophischer Begriffe unter der Voraussetzung der cartesianischen Teleologisierung, sondern deckt einen Zusammenhang auf, den traditionelle Untersuchungen gar nicht in den Blick bekommen: die „genetische Struktur der Begriffsbildung"30, und somit die Frage, wie überhaupt aus 'weiten' Wortbedeutungen 'enge' Begriffsverwendungen werden können. Damit leistet die Metaphorologie eine Aufklärungsarbeit an der philosophischen Terminologie, „in der zwar die Forderung der Eindeutigkeit nicht erfüllt wird, die aber die Eindeutigkeit des Resultats als Verarmung an imaginativem Hintergrund und an lebensweltlichen Leitfäden erkennen läßt"31. Im Gegenzug zum abstraktiv-begrifflichen Verfahren versucht die Metaphorologie deshalb „an die Substruktur des Denkens heranzukommen, an den Untergrund, die Nährlösung der systematischen Kristallisationen"32. Struktur und Textur werden in umgekehrter Weise interpretiert als dies in einer sich begrifflich-rational verstehenden Denkgesinnung der Fall ist. Während dort die Textur nur als Oberfläche und die logische Struktur als eigentliche Tiefenschicht eines Gedankens oder Systems aufgefaßt werden, begreift Blumenberg die metaphorische Textur als die eigentliche Substruktur des Denkens, die durch die logische Struktur immer schon vorausgesetzt wird.
2. Die Funktion der absoluten Metapher 2.1 Die lebensweltliche Verlegenheit pragmatischer OrìenAerungsfragen Blumenberg bemüht sich nicht um eine Bestimmung des Wesens der Metapher. Den zahlreichen Metapherndefinitionen fügt er keine weitere hinzu. Um die Bedeutung der von ihm so genannten 'absoluten Metapher' genauer in den Blick zu bekommen, unternimmt er eine Beschreibung ihrer Funktion. Nicht 'Was ist die Metapher?', sondern 'Was macht die Metapher?' ist die zentrale Frage neuerer Untersuchungen zur Eigenart metaphorischen Sprachgebrauchs. Die Frage nach der Funktion der Metapher stellt sich aber in Form der Frage nach denjenigen Fragen, auf die in Metaphern Antworten gesucht werden. Da sie sich offenbar von solchen Fragen unterscheiden, die durch klare und eindeutige Begriffe beantwortbar sind, müssen jene Fragen von diesen hinsichtlich ihrer Geltung und ihres Gegenstandsbereichs differieren. Fragen, auf die Metaphern antworten, sind „Fragen präsystematischen Charakters, deren Intentionsfülle die Metapher gleichsam 'provoziert' hat"33. Ihr Überschuß an Fragwürdigkeit macht sie ungeeignet für eine definitiv30 31 32 33
Blumenberg, Beobachtungen, S. 163. Ebd. Ebd., S . l l . Ebd., S. 13.
96
Die absolute Metapher
begriffliche Beantwortung. In bezug auf ihr Differenzierungspotential erscheinen sie zwar zwangsläufig als naiv, aber für die elementare Orientierung des Menschen, das heißt für sein Welt- und Selbstverständnis sind sie von grundlegender Bedeutung und unabweisbarer Dringlichkeit. „Absolute Metaphern 'beantworten' jene vermeintlich naiven, prinzipiell unbeantwortbaren Fragen, deren Relevanz ganz einfach darin liegt, daß sie nicht eliminierbar sind"34. Ihr implikativer Charakter läßt darauf schließen, daß solche Fragen einschließlich der Versuche ihrer Beantwortung in keinem umfassenderen begrifflich-philosophischen Kontext fehlen, auch dann nicht, wenn sie nicht explizit gestellt werden. Der Griff zur Metapher bzw. der Sprung in die Metapher motiviert sich durch Fragen, „die zwar in den Systemen nicht formuliert enthalten, wohl aber impliziert durchstimmend, färbend, strukturierend gegenwärtig und wirksam" sind35. „Dieses implikative Fragen hat sich immer wieder in Metaphern 'ausgelebt' und aus Metaphern Stile von Weltverhalten induziert. "36 Der Struktur dieser Fragen entspricht es, daß ihre metaphorische Beantwortung kein Wissen, sondern ein Verhalten vermittelt.37 Metaphern steuern Mentalitäten und leiten zur Identifikation mit ihnen an. Von daher bestimmt Blumenberg die Relevanz der absoluten Metapher, ihre historische Wahrheit als Wahrheit in einem pragmatischen Sinn. Metaphorologie verlangt nach einer Methode der „pragmatischen Interpretation"38 als „einer entschlossenen Kritik der Sprache in ihrer 'Leitfunktion' für unser Denken."39 Dabei bleibt es nicht aus, daß die Form der metaphorischen Antwort auf jene lebensweltlichen Orientierungsfragen oft zu „jenem Zuviel-Versprochenen" tendiert, „das sich den Einlösungsforderungen entzieht. "40 Indem die Metapher gleichsam über das Ziel hinausschießt, spiegelt sie jedoch lediglich die prinzipielle Offenheit und Unabschließbarkeit jener Fragen wieder, die wir „als im Daseinsgrund gestellte vorfinden"41. Dieser Tatbestand gründet in dem Mißverhältnis zwischen der menschlichen Kompetenz zu befriedigenden Antworten und dem unabschließbaren Vermögen, immer weitergehende Fragen zu stellen. Die Metapher greift letztere nur auf bzw. läßt sich durch sie provozieren und versucht, sie einer ihrer Problemhaltigkeit adäquaten Lösung 34 35 36 37
38 39
40 41
Ebd., S. 19. Ebd., S. 13. Ebd., S. 21. G. Schöffel erkennt den gleichen Sachverhalt, wenn er schreibt: „Wir sollten aber beachten, daß Metaphern, obwohl sie auf komplexe Weise mit dem Wissen verflochten sind, nicht Wissen vermitteln, sondern Einstellungen beeinflußen und hervorrufen..." (Denken in Metaphern. Zur Logik sprachlicher Bilder, Opladen 1987, S. 173). Blumenberg, Paradigmen, S. 23. Ebd., S. 20. Blumenberg, Beobachtungen, S. 169. Blumenberg, Paradigmen, S. 19.
Die Funktion der absoluten Metapher
97
zuzuführen. Blumenberg gesteht durchaus zu, „daß Metaphorik den Vorgriff oder Übergriff des Zuviel-Versprechens rhetorisch überdehnt; aber die Struktur von Vorgriff und Übergriff schafft sie nicht, sondern in sie tritt sie ein"42. Das unabschließbare Orientierungsbedürfnis des Menschen kann nicht als ein abgeleitetes und sekundäres Verhalten abgetan werden, sondern stellt ein Fundamentalanthropologicum dar, das direkt aus der spezifischen Stellung des weltoffenen Menschen im Kosmos folgt.43 Das Verlangen, 'prinzipiell unbeantwortbare Fragen' zu stellen, resultiert nicht bloß aus einer luxurierenden Neugierde, die sich abstellen oder vermeiden ließe. Vielmehr entspringt die „Intentionalität vorgreifender und übergreifender Erweiterungen"44 der Lebenswelt bzw. dem Dasein des Menschen selbst. In dem Versuch der metaphorischen Beantwortung artikuliert sich dieser unbestimmte Erwartungshorizont. Die Metapher weckt nicht ein Sinnbedürfnis, das vorher so gar nicht bestand, sondern die Weltoffenheit des Menschen provoziert die Metapher. 2.2 Die logische Verlegenheit theoretischer Totalitätsfragen Der intentionale Ausgriff und Vorgriff, der dem lebensweltlichen Dasein selbst entspringt, bleibt jedoch nicht bei jenen pragmatischen Orientierungsfragen stehen, sondern bemächtigt sich auch der darüber hinausgehenden theoretischen Neugierde des Menschen und führt zu den sich dabei einstellenden logischen Verlegenheiten angesichts der großen theoretischen Totalitätsfragen. „Am deutlichsten wird das dort, wo das Urteil mit seinem Identitätsanspruch überhaupt nicht ans Ziel kommen kann, [...] weil sein Gegenstand das Verfahren überfordert"45. Das ist der Ort der theoriekreativen Metapher. Sie springt in die logisch-aporetische Situation ein und führt das Problem einer Lösungsmöglichkeit zu, indem sie die kontextuelle Ebene wechselt. Die „Situation theoretischer Verschlossenheit und Uneinsichtigkeit ist die Provokation der 'Übertragung'." 46 Dies setzt freilich voraus, daß „sowohl die gläubige wie die skeptische Resignation des theoretischen Anspruchs überwunden ist"47. Der Mut zur Metaphorisierung bedarf eines kognitiven Befreiungsschlags vom zwanghaften Begründungsanspruch 42 43
44 45 46 47
Blumenberg, Beobachtungen, S. 169f. Blumenberg greift hier auf die charakteristischen Motive der Geistanthropologie von Max Scheler zurück, wie sie dieser in seiner Gründungsschrift der Philosophischen Anthropologie des 20. Jhs. 'Die Stellung des Menschen im Kosmos' (1928) formuliert hat. Blumenberg, Beobachtungen, S. 170. Blumenberg, Anthropologische Annäherung, S. 116. Blumenberg, Paradigmen, S. 75. Ebd.
98
Die absolute Metapher
und zwar sowohl hinsichtlich der Erwartung ihm genügen, als auch hinsichtlich der Enttäuschung, ihn nicht erfüllen zu können. Nur dann kann die produktive Einbildungskraft der Phantasie einspringen und auf metaphorischem Umweg erreichen, was der 'Direttissima' des definierenden Zugriffs verschlossen bleiben muß. Der Sachverhalt logischer Verlegenheiten im Angesicht theoretischer Totalitätsfragen und ihrer theoriekreativen Beantwortung durch die Metapher zeigt sich im Rahmen einer historischen Metaphorologie hinsichtlich eines doppelten Befundes. Zum einen hinsichtlich des Umstandes, „daß bestimmte Begriffe schon immer in dem Verdacht standen, sie erfüllten nicht die Erfordernisse, die an einen Begriff gestellt werden müssen, und könnten diese womöglich auch gar nicht erfüllen"48. Dazu gehören Begriffe wie 'Zeit', 'Leben', oder 'Welt'. Zum anderen hinsichtlich des Schwenks vom begrifflichen zum vorstellungshaften Gebrauch eines Wortes. „Es ist bezeichnend für die Funktion der Metapher, daß vom terminologischen Gebrauch eines Ausdrucks in dem Augenblick auf seinen imaginativen Horizont geschwenkt wird, in dem eine Disziplin in Richtung auf ihre Grundlagen den Bereich ihrer fixierten und methodisch definierten Gegenständlichkeit überschreitet."49 Dies ist zum Beispiel bei Begriffen wie 'Bewußtsein' und 'Geschichte' der Fall. Blumenberg erinnert daran, daß wir zwar immer schon mit Geschichten vertraut sind, daß wir aber gar nicht wirklich wissen, was es bedeutet, den kollektiven Singular der 'Geschichte' zu gebrauchen. Die von Blumenberg festgestellten „hypostasierenden Leistungen"50 eines solchen Singulars kann man auch als 'Singularmetaphorik' bezeichnen. Die Funktion der Metapher besteht dabei in der Übertragung der grammatikalischen Singularstruktur auf Sachverhalte, von denen für gewöhnlich nur in der Form des Plurals die Rede ist. „Der Singular von Geschichte ist selbst eine absolute Metapher, eines der großen Worte aus der Welt der Substantive, die uns die großen Probleme und die ihnen entsprechenden Metaphysiken schaffen. " J1
48 49 50 M
Blumenberg, Beobachtungen, S. 165f. Ebd., S. 194f. Ebd., S. 168. Ebd.
Hintergnindmetaphorik
99
3. Hintergrundmetaphorik Auch in bezug auf theoretische Totalitätsfragen, die sich in Begriffen wie 'Sein', 'Welt', 'Geschichte', 'Bewußtsein' oder 'Leben' widerspiegeln, gilt das erwähnte 'Verborgenheitstheorem'. Demnach legen die „großen Konzepte des Ganzen und seiner Phrasierungen"52 ihre metaphorische Orientierung nicht offen, sondern verstecken sie proportional zu ihrer Abhängigkeit. Die Not zur Metaphorisierung macht sich folglich in zahlreichen Fällen als „Verbot von Metaphorik" oder „Metaphernverdikt"53 geltend. Auch Blumenberg kommt zur Illustration dieser Behauptung auf das Beispiel der heideggerschen Fundamentalontologie zu sprechen: „Für sie galt striktes Metaphernverbot". Mit diesem Verdikt verwickelt sich Heidegger jedoch in einen metaphernrepugnanten54 Selbstwiderspruch, denn „die Sprache der 'Seinsgeschichte' belegt, daß es nicht einzuhalten war." 55 Auch bei Heidegger widerspricht ein fehlendes Bewußtsein von der Funktion der Metapher ihrem faktischen Gebrauch". Von dieser Paradoxie sind besonders die hohen Leitbegriffe der Abstraktion und Spekulation betroffen. „Die in der rigorosen Selbstverschärfung der theoretischen Sprache verächtlich gewordene Ungenauigkeit der Metapher entspricht auf andere Weise der oft so eindrucksvollen höchsten Abstraktionsstufe von Begriffen wie 'Sein', 'Geschichte', 'Welt', die uns zu imponieren nicht nachgelassen haben. Die Metapher jedoch konserviert den Reichtum ihrer Herkunft, den die Abstraktion verleugnen muß."57 Die Angewiesenheit auf den metaphorischen Umweg und die theoretische Verlegenheit, die zum Umweg nötigt, steigt mit der Abstraktionsstufe eines Begriffs. Nicht dort, wo die Begriffe nicht hinreichen, gleichsam in die 'dunklen Ecken' der sinnlich-bildhaften Anschauung und des unbestimmten Gefühls, sondern dort, wo sie ihrem eigenen Selbstverständnis nach am leistungsfähigsten sind und ihrer Eigenbewegung zufolge den Gipfel ihrer Entfaltungsmöglichkeiten erreicht haben, steigt der Nötigungsdruck zum metaphorischen Sprachgebrauch, wenn überhaupt noch etwas gesagt und nicht nur gebannt auf den Begriff gestarrt werden soll. „Je mehr wir uns von der kurzen Distanz der erfüllbaren Intentionalität entfernen Blumenberg, Beobachtungen, S. 169. Blumenberg, Unbegrifflichkeit, S. 92. Zur Unterscheidung zwischen rhetorikaffin und rhetorikrepugnant s. u. Asm. 116. Blumenberg, Unbegrifflichkeit, S. 92. Diesen performativen Selbstwiderspruch bei Heidegger hat auch P. L. Oesterreich analysiert und kommt hinsichtlich von 'Sein und Zeit' zu dem Urteil: „Die philosophische Pathosrhetorik der Eigentlichkeit und Ursprünglichkeit wird im Text nicht thematisiert und offengelegt. [...] 'Sein und Zeit' stellt insgesamt einen rhetorikrepugnanten Text dar, in dem sich die rhetorische Irreflexibilität mit der Einsichtslosigkeit in eine Konzeption öffentlicher Vernunft verbindet." (Philosophen als politische Lehrer, S. 30f.). Blumenberg, Unbegrifflichkeit, S. 80.
100
Die absolute Metapher
und auf Totalhorizonte beziehen, die für unsere Erfahrung nicht mehr zu durchschreiten und abzugrenzen sind, um so impressiver wird die Verwendung von Metaphern."58 Die Dialektik zwischen metaphorischer Funktion, metaphorischer Verborgenheit und Metaphernverbot bedingt eine Weise metaphorischer Verwendung, die unbewußt bleibt und ihre Wirkung nur versteckt ausüben kann. Dabei steigt der interpretative Aufwand mit dem Grad der Verleugnung und Verschleierung metaphorischen Sprachgebrauchs proportional an, „denn das Verdikt der Metapher erschwert die Wahrnehmung ihrer faktischen Hintergrundfunktion"59. Dieses Phänomen konzeptueller und operativ verschatteter Metaphern, die einen Text hintergründig auf entscheidende Weise prägen und für die Rezeption unterschwellig vorstrukturieren, faßt Blumenberg unter der Bezeichnung Hintergrundmetaphorik. „Metaphorik kann auch dort im Spiele sein, wo ausschließlich terminologische Aussagen auftreten, die aber ohne Hinblick auf eine Leitvorstellung, an der sie induziert und 'abgelesen' sind, in ihrer umschließenden Sinneinheit gar nicht verstanden werden können."60 In diesem Fall muß der metaphorische type gar nicht als realisierter token vorliegen, um seine theorie- und argumentationssichernde Funktion ausüben zu können. Vielmehr kann der Vorgang der produktiven geistigen Übertragung auch der terminologischen Fixierung einer Aussage vorausgehen und bleibt dann hinter der begrifflich geschlossenen Textgestalt latent verborgen. Eine kritische Interpretation solcher logisch geronnenen Aussagen, die nicht bei der erklärten Absicht eines Autors stehenbleiben, sondern seine Gründe auf Beweggründe zurückführen will, kann jedoch nur gelingen, wenn jene ursprünglichen Transferleistungen der produktiven Einbildungskraft erschlossen werden können. „Haben wir einen Kunstbau spekulativer Aussagen vor uns, so wird die Interpretation uns erst dann 'aufgehen', wenn es uns gelungen ist, nachvollziehend in den Vorstellungshorizont des Autors einzutreten, seine 'Übertragung' ausfindig zu machen."61 Blumenberg unterscheidet dabei den Grad und die Qualität der jeweiligen Hintergrundmetaphorik bei originären Denkern und ihren Epigonen dahingehend, daß jene ihr System „in der lebendigen Orientierung" halten, „während der Schulbetrieb die Begriffe zu einer eigensinnigen Atomistik 'entwurzelt'." 62 Im Verlauf orthodoxer Schematisierungen und Systematisierungen geht demnach der ursprünglich metaphorische Vorstellungshintergrund in seiner Funktion als dynamischer Motivierungsrückhalt der jeweiligen Theoriebildung zumeist verloren und hinterläßt ein abgekoppeltes System hypostasierter Dingbegriffe.
58 59 60 61 62
Ebd. Blumenberg, Anthropologische Annäherung, S. 132. Blumenberg, Paradigmen, S. 69. Ebd. Ebd.
Sprengmetaphorik und Metaphorisierung der Dogmatik
101
Insofern die terminologisch-thematische Textoberfläche von einem metaphorisch-operativen Hintergrund her gewonnen und noch immer an ihm orientiert ist, ohne daß dieser in dem gleichen Maße als solcher explizit gemacht wird, spricht Blumenberg auch von einem 'implikativen Modell'63. Der damit bezeichnete Sachverhalt entspricht genau dem Phänomen der Hintergrundmetaphorik. „Das bedeutet, daß Metaphern in ihrer besprochenen Funktion gar nicht in der sprachlichen Ausdruckssphäre in Erscheinung zu treten brauchen; aber ein Zusammenhang von Aussagen schließt sich plötzlich zu einer Sinneinheit zusammen, wenn man hypothetisch die metaphorische Leitvorstellung erschließen kann, an der diese Aussagen 'abgelesen' sein können. "64 Trifft es zu, daß sich metaphorische Übertragungsregeln von begrifflich-logischen Kohärenzkriterien wesentlich unterscheiden, so gibt die Erschließung einer bestimmten implikativen Hintergrund- und Leitmetaphorik der Interpretation Mittel an die Hand, mit denen Gedanken, Sätze und Bilder, die in logischer Hinsicht unverbunden nebeneinander stehen bleiben müssen, dennoch einem sinnvollen Zusammenhang zugeordnet werden können.
4. Sprengmetaphorik und Metaphorisierung der Dogmatik Für eine theologische Metaphorologie ist Blumenbergs Ansatz besonders aufschlußreich, weil er bereits auf verschiedene Anwendungsbeispiele von Metaphern in der theologisch-dogmatischen Tradition aufmerksam gemacht hat, freilich ohne dabei auch ihre theologische Leistung und Berechtigung untersucht zu haben. a) Ein erster Anknüpfungspunkt für den Einsatz von Metaphern in der theologischen Theoriesprache besteht in dem, was bereits als 'metaphorischer Vor- und Übergriff sowohl angesichts pragmatischer Orientierungsfragen als auch theoretischer Totalitätsfragen genannt wurde. Wird dieser Übergriff vor allem im Zusammenhang philosophisch-theologischer Spekulation sprachlich 'überdehnt', so spricht Blumenberg von „Sprengmetaphorik".65 In diesem Kontext tauchen nach einer Formulierung von E. R. Curtius „jene bezeichnenden Metaphern [auf], welche die Anschauung vergewaltigen."66 Doch was Blumenberg 'Sprengmetaphorik' nennt, geht noch über das hinaus, was Curtius im Auge hatte. Ihren historischen Ursprung erblickt Blumenberg in der negativen Theologie neuplatonischer Prägung und dem Umstand, daß dieses Programm gleichsam eine neue Sprache notwendig gemacht hat. Denn die in der mystischen Tradition der via negationis zuerst auftretende Sprengmeta63 64 65 66
Ebd., S. 16. EM., S. 17. Blumenberg, Paradigmen, S. 131. Ebd., S. 132, Anm. 199.
102
Die absolute Metapher
pher hat ihren Grund in der „elementaren Verlegenheit jeder Theologie, über Gott unentwegt sprechen zu sollen, ohne über ihn etwas zu sagen sich zutrauen zu dürfen." 47 Die Leistung der Sprengmetapher beruht nun aber gerade darin, das auszudrücken, was prinzipiell nicht begrifflich faßbar, geschweige denn theoriefahig ist, also „die Unsagbarkeit selbst sprachlich darzustellen"68. Aus der Not dieser Aporie machte Nikolaus von Kues die Tugend der coincidentia oppositorum. Mit einem doppelten Transzensus will der Kusaner zu einem Erfassen des Absoluten kommen. Da unser Erkennen an die sinnlich wahrnehmbare Realität gebunden ist, muß diese notwendig überschritten werden. Dazu sollen mathematische Symbole zur Anwendung gelangen. „Der Überschritt selbst vollzieht sich in zwei Stufen, zunächst von der endlichen mathematischen Figur zur unendlichen mathematischen Figur, und dann von der unendlichen mathematischen Figur zum absoluten Maximum." 69 Um diesen Überschritt zu vollziehen und zu verdeutlichen, konzipiert Nikolaus von Kues im 13. Kapitel seiner Schrift Dg docta ignorantia die Sprengmetapher eines Kreises, dessen Radius unendlich wird, wobei sein Kreisbogen eine unendlich geringe Krümmung erhält, so daß er schließlich im Unendlichen mit einer Geraden zusammenfällt.70 Bei dieser Metapher eines 'geraden Kreises' wird die „Intentionalität der Anschauung überdehnt, um ihre Vergeblichkeit in ihr selbst auszusprechen, im Vorgriff zugleich die Zurücknahme des Übergriffs zu vollziehen."71 Denn ein Kreis mit gerader Bogenlinie kann kein Gegenstand der Anschauung werden. Der Dialektik dieses Verfahrens zufolge vollzieht die Sprengmetapher eine Transzendierungsleistung unter gleichzeitigem Vergeblichkeitsbewußtsein. In diesem Sinne kann Blumenberg auch sagen, die Sprengmetapher sei zugleich „Metapher für das Nachgebildete und Metapher für das Nichterreichen-Können. "72 Nikolaus von Kues verstand die docta ignorantia „als jene Unwissenheit, die sich selbst als Indiz der Übergröße ihres unabdingbaren Gegenstan-
68 69
71 72
Blumenberg, Unbegrifflichkeit, S. 84. Ebd. Hermann Schnarr: Modi essendi. Interpretationen zu den Schriften De docta ignorantia, De coniecturis und De venatione sapientiae von Nikolaus von Kues (Buchreihe der Cusanus-Gesellschaft Bd. V), Münster 1973, S 3f. „si igitur curva linea in sua curvitate recipit minus, quanto circumferentia fuerit maioris circuii, igitur circumferentia max imi circuii, quae maior esse non potest, est minime curva; quare maxime recta. Coincidit igitur cum máximo minimum, ita ut ad oculum videatur necessari um esse, quod maxima linea sit recta maxime et minime curva. " (De docta ignorantia', Buch I, Kap XIII, in: Nikolaus von Kues: Philosophisch-theologische Schriften Bd 1, hg. von Leo Gabriel, Wien 1964, Nachdruck 1982, S. 234). Vgl. z. B. auch Karl Barths paradoxe Metaphorik im 'Römerbrief, bes. die Kreis-TangentenMetapher für das Verhältnis von Zeit und Ewigkeit bzw. alter Welt und neuer Welt (Der Römerbrief, 2. Aufl. Zürich 1922, S. 6). Blumenberg, Unbegrifflichkeit, S. 84. Blumenberg, Paradigmen, S. 131.
Sprengmetaphorik und Metaphorisiening der Dogmatik
103
des 'weiß' und die sich von scholastischer Wissenschaft, als Unterschätzung dieses Gegenstandes, absetzt." 73 Das kognitive Resultat dieser belehrt-unwissenden Sprengmetapher kann deshalb auch nicht als ein neues theoretisch-affirmatives Wissen beschrieben werden, sondern führt zu einer veränderten theoretischen Haltung. Die Tradition der 'negativen Theologie' sowie ihr adäquates Darstellungsmittel, die Sprengmetapher, „stellt nicht einen Wissensstatus dar, sondern sie ist ein Weg, eine Praxis, eine Methode zu einem Modus des Sichverhaltens. "74 Damit wird gleichzeitig die Einsicht zum Ausdruck gebracht, daß Metaphorik und - in einem weiteren Sinne - „Unbegrifflichkeit nicht kongruiert mit Anschaulichkeit." 75 Die absolute Metapher und vor allem die spekulative Sprengmetapher bedient kein bildhaft gebundenes Bewußtsein, das der didaktischen Veranschaulichung bedarf, sondern verweist auf ein reflektiertes Bewußtsein des sprachlichen Sichverhaltens, einen Modus der Sprachumgangskultur, der die theoretische Problematisierung und begriffliche Fixierung allererst ermöglicht. Damit etabliert sich ein Strukturphänomen, das bereits im Zusammenhang der konzeptuellen Metapher als 'metaphorischer Zirkel' bezeichnet wurde. 76 Im Fall der kusanischen Metaphorik heißt das: „Die von der Metapher induzierte Haltung aktualisiert sich im Gebrauch der Metapher, deren Implikation docta ignorantia ist. " 77 Der für die einstellungshaltige (konzeptuell-mentale) Metapher charakteristische Zirkel vergewissert sich seiner gewissermaßen selbst und leitet wiederum zu dem Verhalten an, dem er entspringt. Gelingende Metaphorisierung wirkt sich folglich nicht nur auf das Resultat, sondern auch auf den Weg seiner künftigen Erreichbarkeit aus. „Die Metapher, die aus dem ursprünglich theoretischen Anspruch hervorgegangen ist, wirkt auf diese Ausgangshaltung modifizierend zurück." 78 In diesem Sinne einer theoretischen Einstellung intendiert die theologische Sprengmetapher „die Transzendenz als Grenze theoretischen Vollzugs [...] 'erlebbar' zu machen." 79 „Hier wird deutlich, daß auch die 'Wahrheit' der Sprengmetaphorik, wie wir es für die absolute Metapher herauszuarbeiten versuchten, wesentlich pragmatisch ist: sie induziert eine Haltung, ein Verhalten, die mit großer Allgemeinheit als 'mystisch' bezeichnet werden"
73 74 75 16
77 78 79
Ebd., S. 135. Ebd., S. 132. Blumenberg, Unbegrifflichkeit, S. 85. Vgl. Pielenz, Argumentation und Metapher: „So gesehen agiert die konzeptuelle Metapher selbstbestätigend: Sie begründet einen Wirklichkeitsentwurf, um ihn sogleich mit Rekurs auf ihren Geltungsanspruch fortwährend zu sichern. Hieraus gewinnt die Metapher ihre mögliche affirmative und systemerhaltende Kraft." (ebd., S. 108). Blumenberg, Paradigmen, S. 135. Ebd., S. 76. Ebd., S. 133.
104
Die absolute Metapher
kann.80 In genealogischer Ergänzung zur negativen Theologie zeichnet auch die Mystik für das Entstehen der theologischen Sprengmetapher verantwortlich, denn ihr Verfahren „zieht die Anschauung in einen Prozeß hinein, in dem sie zunächst zu folgen vermag [...], um aber an einem bestimmten Punkt [...] aufgeben - und das wird verstanden als 'sich aufgeben' - zu müssen."81 Wie beim Kusaner, ist der Unendlichkeitsbegriff eines der am häufigsten gebrauchten Sprengmittel dieser Metaphorik - v. a. in der Tradition der spekulativen Mystik. b) Die Analyse metaphorischen Sprachgebrauchs in der theologischen Dogmatik muß jedoch auch beachten, was Blumenberg in den 'Paradigmen' als „Metaphernrealismus"82 bezeichnet. Damit öffnet sich „das diffizile Feld der Übergänge von der Metapher zum Begriff. [...] Die Metapher nimmt hier das Wort beim Wort, nicht als Namen für eine definierte Regel von Sachverhalten."83 Das Stichwort 'Metaphernrealismus' besagt, daß die Metapher nicht mehr als solche rezipiert wird, sondern eine begriffliche Festschreibung erfährt, die es ihr nicht mehr erlaubt, ihr Eigenes in einer ihr angemessenen Weise darzustellen. Indem die Metapher als Begriff genommen wird, führt sie zu verfehlten Ansprüchen und Erwartungen und bewirkt schließlich die Remetaphorisierung der fälschlicherweise wörtlich verstandenen metaphorischen Rede. Deshalb fordert Blumenberg, „auch den umgekehrten Weg vom Begriff zur Metapher"84 zu beachten, soll nicht der Eindruck eines schlichten Evolutionsschemas analog der Formel 'Vom Mythos zum Logos' erweckt werden. Blumenberg erweitert also das einlinige Gefalle von der Metapher zum Begriff um den umgekehrten Fall einer Remetaphorisierung des Begriffs. Demnach wird eine begriffliche Erkenntnis nicht als solche, sondern als Metapher aufgefaßt. Dies muß jedoch nicht absichtlich geschehen. Es ist hingegen der Fall belegbar, daß ein intendierter Übergang von der Metapher zum Begriff fehlschlägt und die versuchte Etablierung des Begrifflichen nicht durchdringt, sondern in ihre metaphorische Qualität zurückschlägt.85 Im 'Ausblick auf eine Theorie der Unbegrifflichkeit' geht Blumenberg näher auf diese 'Verfallsformen' terminologisierter Metaphern und remetaphorisierter Begriffe ein, „die nach beim Wort genommener Rede als Verlegenheit vor dem realistischen Anspruch auftreten."86 So hat nach Blumenbergs Auffassung die theologische Christologie mit ihrem Insistieren auf dem „Realismus
80 81 82 83 84
85
86
Ebd., S. 135. Ebd., S. 132f. Blumenberg, Paradigmen, S. 109, 114, 136 u. ö. Ebd., S. 88. Ebd., S. 106. Blumenbergs Beispiel ist die kopermkamsche Metaphonsierung der Kosmologie (Blumenberg, Paradigmen, S. 106ff.). Blumenberg, Unbegrifflichkeit, S. 87.
Metapher und Lebenswelt
105
der Inkarnation"87 gegen alle Formen des Doketismus die ursprüngliche Metaphorik der Bekenntnisformeln in einer Weise ernst und beim Wort genommen, die sich nicht ohne Remetaphorisierung aufrechterhalten ließ. Als Indiz dafür dient ihm die Praxis der mittelalterlichen Schriftauslegung, denn „schon die exegetischen Künste der Vervielfältigung des Schriftsinnes haben diesen Realismus aufgeweicht, und die Metapher ist die Sprachform des Ausweichens vor seinen strikten Anforderungen."88 Die Metapher kuriert gleichsam selbst das MißVerständnis, das aus ihrer Fehlinterpretation folgt. Ebenso erinnert Blumenberg an die zunehmende „Metaphorisierung der theologischen Dogmatik" als Krisensymptom des ausgehenden Mittelalters und zieht eine Parallele zu der „Wiederholung der Metaphorisierung in unserem Jahrhundert nach der Phase der Überforderung durch die dialektische Theologie."89 Das theologische Ansinnen Rudolf Bultmanns wird von daher metaphorologisch interpretierbar. „Die Entmythisierung ist zu einem guten Anteil nichts anderes als Remetaphorisierung: das punktuelle Kerygma strahlt auf einen Hof von Sprachformen aus, die nun nicht mehr beim Wort genommen zu werden brauchen."90 Trifft diese Behauptung Blumenbergs zu, wird zumindest erklärlich, warum der Zusammenhang zwischen Metapher und biblischer Sprachform in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, sozusagen post Bultmann locutum,91 ein derart reges Interesse finden konnte. Im Zuge der Entmythologisierung vollzieht sich - so die These Blumenbergs - die Remetaphorisierung der metaphysischen Dogmatik (bzw. der dogmatischen Metaphysik). Mit einer dekonstruktiven Figur beschließt Blumenberg in den 'Paradigmen' das Thema der Dialektik zwischen Metaphysik bzw. Dogmatik und Metaphorik: „Die absolute Metapher so sahen wir, springt in eine Leere ein, entwirft sich auf der tabula rasa des theoretisch Unerfüllbaren; [...] Metaphysik erwies sich uns oft als beim Wort genommene Metaphorik; der Schwund der Metaphysik ruft die Metaphorik wieder an ihren Platz."92
II. Metapher und Lebenswelt „Im Dienst der Begriffsgeschichte hat die Metaphorologie die Verlegenheiten rubriziert und beschrieben, die im Vorfeld der Begriffsbildung, im Umfeld des harten Kerns klarer und deutlicher Bestimmtheit, auch in endgültiger 87 88
Ebd., S. 86f. Ebd., S. 87. cu Ebd.
8» '0 T-UJ 91
92
Ebd. Vgl. H. Symanowski u. a. (Hg.): Post Bultmann locutum. Eine Diskussion zwischen H. Gollwitzer und H. Braun, Hamburg 1966. Blumenberg, Paradigmen, S. 142.
106
Die absolute Metapher
Abseitigkeit zu diesem, auftreten."93 Indem die historisch-paradigmatische Metaphorologie die Rolle der Metapher bei d.er Konsolidierung der philosophischen Terminologie herausgearbeitet hat, bereitete sie den Versuch vor, den Raum für eine irreduzible Eigenbedeutung der Metapher abzustecken. Das Ergebnis läßt sich zunächst nur ex negativo beschreiben. „Der Raum der Metapher ist der Raum der unmöglichen, der fehlgeschlagenen oder der noch nicht konsolidierten Begriffsbildung."94 Im Rahmen einer rein anticartesianisch ausgerichteten Metapherngeschichte, das heißt einer ausschließlich diachronen Untersuchungsrichtung, können also Funktion und Bedeutung der Metapher noch nicht vollständig erfaßt werden. Erst eine darüber hinausgehende synchrone Besinnung auf die Beziehung zwischen theoretischem Weltmodell und metaphorisch konstituierter Lebenswelt läßt den vollen Bedeutungs- und Verwendungsstatus der Metapher hervortreten. Der prä- und paraterminologischen Struktur der Metapher, die sich aus dem begriffsgeschichtlichen Vergleich ergeben hat, entspricht eine Verankerung der Metapher in der vortheoretischen Lebenswelt. Erst unter Berücksichtigung der lebensweltlichen Rückbindung wird die genuine Eigenart metaphorischen Sprachgebrauchs deutlich und die Gegenläufigkeit zur begrifflichen Abstraktions- und Definitionsweise in ihre volle Dialektik getrieben.
1. Die Metapher als Refundierung Vor dem Hintergrund des „Dualismus von Weltmodell und Lebenswelt"95 eignet der Metapher „nicht die Hoheit der konstruktiven Begriffsbildung."96 Denn der Primat einer thetisch-konstruktiven Begrifflichkeit verstellt den Blick auf das spezifische Leistungsprofil des nach terminologischen Kriterien Ephemeren: Metaphern, Gleichnisse, vergangene Wendungen, etc. Auf ihren abstrakten Ertrag hin befragt, müssen diese Sprachformen notgedrungen schweigen. Deshalb impliziert eine lebensweltlich orientierte Metaphorologie die Kritik an der systematischen Endgestalt theoretischer Begriffe und ihres angeblich feststellbaren Resultats. Positiv gewendet heißt das, Metaphorologie erschließt „die Rückführbarkeit des konstruktiven Instrumentariums auf die lebensweltliche Konstitution, der es zwar nicht entstammt, auf die es aber vielfaltig zurückbezogen ist."97 Damit verweist die Metapher auf dasjenige Feld vorgreifender Orientierungen, dem die Norm der Begrifflichkeit allererst entspringt. Metaphorologie leistet eine Refundierung des deskriptiven
94 95 96 97
Blumenberg, Unbegrifflichkeit, S. 86. Blumenberg, Beobachtungen, S. 171. Ebd., S. 164. Ebd., S. 163. Ebd., S. 164.
Die Metapher als Refundierung
107
und interpretativen Instrumentariums, „in der zwar die Forderung der Eindeutigkeit nicht erfüllt wird, die aber die Eindeutigkeit des Resultats als Verarmung an imaginativem Hintergrund und an lebensweltlichen Leitfaden erkennen läßt."98 Aller lebensweltlichen Verortung zum Trotz ist damit aber auch eine gewisse Ortlosigkeit des Metaphorischen verbunden. Denn in einer „durch disziplinierte Erfahrung bestimmten Welt" hat das sich der Eindeutigkeitsforderung Entziehende keinen Platz. „Es sei denn, es qualifiziere sich in der entgegengesetzten Tendenz als 'ästhetisch'", 99 womit es unter arbeitsteiligen Bedingungen die „Lizenz für Vieldeutigkeit"100 erworben hat. Gegenüber diesem Konzept der Ausdifferenzierung, welches nur darauf hinausläuft, daß das Geschäft - und sei es das akademische - unbehelligt weitergehen kann, fordert Blumenberg auch innerhalb des wissenschaftlichen Betriebs eine Besinnung auf das der Theorie Andere, das Vortheoretische, ihr Fremdes als Unbegrifflich-Vorbegriffliches, das als solches jedoch konstitutiv für die Entstehung jeder theoretischen Neugierde ist. Im Vollzug ihres reduktiven Verfahrens läßt die Metaphorologie deshalb auch die der Lebenswelt eigene 'Widerstandsstruktur' gegen ihre begriffliche Verarbeitung und abstraktive Aufhebung erkennen. Das heißt, sie rührt an jene Schichten heran, „in denen sich die philosophische oder vorphilosophische Sprache ihrer Auflösung in Begrifflichkeit widersetzt und in denen die Metapher jene absolute Funktion annehmen kann, an der manifest wird, daß sie nicht beliebig in 'eigentliche Rede' übersetzt oder durch diese umbesetzt werden kann."101 Insofern fungiert die Metapher als Anwalt des Überschießenden, des nicht integrierbaren Restes einer systematischen Vereinnahmung, denn „die metaphorische Extrapolation hält doch wenigstens fest, was als Prozeß der Vergegenständlichung den Leistungen einer Disziplin zugrunde liegt und was dabei außerhalb ihres Horizontes von Objektivierung gelassen wurde."102 Metaphorologie als Metakritik dient der Rehabilitierung des durch den Begriff Ignorierten und Diskreditierten. Was in den 'Beobachtungen an Metaphern' (1971) bereits anklingt, wird von Blumenberg in dem 'Ausblick auf eine Theorie der Unbegrifflichkeit' (1979) explizit auf den Weg gebracht. Dies betrifft zum einen die Erweiterung des Programms der Metaphorologie. Nicht mehr ihre negative Abgrenzungsfunktion zur Seite der philosophischen Begrifflichkeit steht im Vordergrund, sondern auch die positive Näherbestimmung der Metapher im Hinblick auf ihre Rückbezogenheit auf die Lebenswelt. „Das Rätsel der Meta98 99
100 101 102
Ebd., S. 163. Ebd., S. 83. Zu dieser bei Blumenberg häufigeren Figur der Kunst als Erbe und Statthalter des vom Begriff Verdrängten, also auch des Metaphorischen vgl. Blumenberg, Paradigmen, S. 20, Anm 18. Blumenberg, Unbegrifflichkeit, S. 83. Blumenberg, Beobachtungen, S. 164. Ebd., S. 195.
108
Die absolute Metapher
pher kann nicht allein aus der Verlegenheit um den Begriff verstanden werden." 103 Damit verliert aber auch der Typus der absoluten Metapher seine metaphorologische Zentralstellung. Metaphorik soll darüber hinaus auch „als eine βμίΐιεηΐΐβσΐιβ Leistungsart der Erfassung von Zusammenhängen, die nicht auf den engen Kern der 'absoluten Metapher' einzugrenzen ist" 104 verstanden werden. In einem weiteren Schritt fordert Blumenberg außerdem den methodischen Überstieg der rein metaphorologischen Perspektive in Richtung auf eine allgemeine Theorie der Unbegrifflichkeit, in der „Metaphorik nur als ein schmaler Spezialfall von Unbegrifflichkeit zu nehmen ist." 105 „Im Aspekt der Lebenswelt-Thematik ist die Metapher, noch dazu in ihrer rhetorisch präzis definierten Kurzform, etwas Spätes und Abgeleitetes. Deshalb wird eine Metaphorologie, will sie sich nicht auf die Leistung der Metapher für die Begriffsbildung beschränken, sondern sie zum Leitfaden der Hinblicknahme auf die Lebenswelt nehmen, nicht ohne die Einfügung in den weiteren Horizont einer Theorie der Unbegrifflichkeit auskommen."106 Blumenberg kommentiert seine eigene theoretische Entwicklung, wenn er bemerkt, „die Blickrichtung habe sich umgekehrt: sie ist nicht mehr vor allem auf die Konstitution von Begrifflichkeit bezogen, sondern auch auf die rückwärtigen Verbindungen zur Lebenswelt als dem ständigen - obwohl nicht ständig präsent zu haltenden - Motivierungsrückhalt aller Theorie." 107 Solange die Metapher nur auf ihren Unterschied zum Begriff hin befragt wird, kann sie ihr Eigenes noch nicht adäquat zum Ausdruck bringen. Erst die Hinwendung zur Lebenswelt läßt das Proprium des metaphorischen Sprachgebrauchs vollständig hervortreten. Darüber hinaus bleibt der Perspektivenwechsel auch für den Begriff nicht ohne Folgen, denn der Theorieschwenk zur Lebenswelt erhellt nicht nur die eigentümliche Verwobenheit der Metapher mit dieser, sondern läßt auch etwas von der Genese theoretischer Probleme erahnen, insofern die Lebenswelt als 'Motivierungsrückhalt aller Theorie' ausfindig gemacht wird. In diesem Sinne können Metaphern auch als „Leitfossilien einer archaischen Schicht des Prozesses der theoretischen Neugierde"108 bezeichnet werden.
2. Die Metapher als Störung Was historisch-paradigmatisch als 'Mehr an Aussageleistung', als metaphorische Alternative zum Begriff und als unerledigter Rest der Theorie beschrie-
103 104 105 106 107 108
Blumenberg, Unbegrifflichkeit, S. 77. Ebd., S. 77. Ebd., S. 77. Ebd., S. 83. Ebd., S. 77. Ebd., S. 77.
Die Metapher als Störung
109
ben wurde, erscheint nunmehr unter synchron-metaphorologischen Bedingungen als semantisch-pragmatische Anderheit der Metapher. Damit trägt Blumenberg dem Umstand des Spannungscharakters der metaphorischen Aussage Rechnung. Es muß folglich geklärt werden, wie die Metapher lebensweltlich überhaupt ertragen wird, denn in einem jeweils aktuellen Verständigungsprozeß stellt sie zunächst eine 'Störung' dar, insofern sie ein heterogenes Element einführt, das in einen anderen als den aktuellen Zusammenhang verweist. Die Metapher ist mit Husserl zunächst „Widerstimmigkeit"109. Die Antwort darauf, wie Metaphern ertragen werden, liegt in einer immer schon vorgängig erfolgten bzw. immer wieder möglichen Transformation des in der Metapher Übertragenen an die Erfahrung. „Lebensweltlich muß es immer schon Rückübertragungsverhältnisse der Anschauung gegeben haben, damit die Forcierung des Bewußtseins durch die Metapher ertragen werden konnte."110 So kann die Metapher vom Buch der Natur, bzw. der Lesbarkeit der Welt nur als metaphorische Erwartung über die Art der Erfahrung verstanden werden, wie sie aus der lebensweltlichen Einstellung gegenüber Natur und Welt vor aller Theorie resultiert. „Das Buch der Natur ist eben nicht nur ein Belegsammlungsobjekt der Toposforschung. Es ist auch Orientierung für das Zurückfragen vom faktischen Status des theoretischen Weltverhaltens zu den ihm zugrundeliegenden lebensweltlichen Sinngebungen."111 Die in der Metapher nachklingende lebensweltliche Bedeutungskomponente erweist den „sekundären Richtungssinn des theoretischen Verhaltens."112 Indem die Metapher den Bedeutungsreichtum ihrer lebensweltlich-lebenssprachlichen Herkunft konserviert, ist sie dem Begriff überlegen, der im Zuge seiner abstrahierenden Teleologie jenen Herkunftsboden verlassen muß.
3. Rhetorische Anthropologie der Metapher Die durch die Anschauung 'lebensweltlicher Sinngebungen' gemilderte Widerstimmigkeit der Metapher verlangt in der Konsequenz des metaphorologischen Weges 'vom Begriff zur Lebenswelt' jedoch noch nach einer genaueren methodischen Ortsbestimmmung. Den dazu erforderlichen Reflexionsrahmen stellen Anthropologie und Rhetorik bereit. Die fundamentalrhetorische Funktion der Metapher beruht - so die These - in ihrer fundamen109 110 111
Ebd., S. 78. Ebd., S. 79. Ebd., S. 81. Die Bemerkung über die Toposforschung richtet sich kritisch gegen die von W. Perpeet posthum herausgegebenen Materialien Erich Rothackers über das Buch der Natur (Erich Rothacker: Das 'Buch der Natur'. Materialien und Grundsätzliches zur Metapherngeschichte, aus dem NachlaB herausgegeben und bearbeitet von Wilhelm Perpeet, Bonn 1979.) Blumenberg, Unbegnfflichkeit, S. 81.
110
Die absolute Metapher
talanthropologischen Bedeutung.113 Bereits 1971 - zeitgleich mit den 'Beobachtungen' - hat Blumenberg den Zusammenhang zwischen Metapher, Rhetorik und Anthropologie thematisiert. In der 'Anthropologischein] Annäherung an die Aktualität der Rhetorik'114 kommt die Metapher in jeweils unterschiedlicher Weise auf den beiden Seiten einer anthropologisch-rhetorischen Grunddifferenz zu stehen. Demnach läßt sich die philosophische Anthropologie auf die Alternative zwischen 'Fähigkeitswesen' und 'Mängelwesen' bringen. Entsprechend kann man eine Rhetorik des Wahrheitsbesitzes und eine Rhetorik der Ermangelung von Wahrheit unterscheiden. Beide Distinktionen lassen sich miteinander verschränken. Im Zusammenhang einer 'rhetorikrepugnanten' Anthropologie des 'reichen' Menschen entspricht die Funktion der Metapher lediglich der uneigentlichen Rede, da der Mensch als animal rationale - zumindest potentiell - im Besitze der Wahrheit gedacht wird und keiner rhetorischen Vermittlungsleistung zu deren Darstellung bedarf. „Entspräche die Welt des Menschen dem Optimismus der Metaphysik von Leibniz, [...] so gäbe es keine Rhetorik, denn es bestände weder das Bedürfnis noch die Möglichkeit, durch sie zu wirken."115 Demgegenüber zeichnet sich eine 'rhetorikaffine'"6 Anthropologie des 'armen' Menschen durch die kognitive Hochschätzung der Metapher aus, weil dem Mängelwesen der direkte Zugang zu sich, wie zur Welt verwehrt ist. „Der Mensch als das reiche Wesen verfügt über seinen Besitz an Wahrheit mit den Wirkungsmitteln des rhetorischen ornatus. Der Mensch als das arme Wesen bedarf der Rhetorik als der Kunst des Scheins, die ihn mit seinem Mangel an Wahrheit fertig werden läßt."117 Blumenberg entscheidet den Streit zwischen beiden Konzepten jedoch nicht, sondern versucht, eine dialektische Vermittlungsposition einzunehmen. Der Mensch ist zwar das Wesen, „dem Wesentliches mangelt",118 aber er ist darin nicht nur passiv konstituiert, sondern kann sich zu diesem Sachverhalt
114
115 116
117 118
Zum Programm einer fiindamentalrhetorischen Anthropologie vgl. auch Peter L. Oesterreich, Fundamentalrhetorik (Anm. 117). Hans Blumenberg: Anthropologische Annäherung an die Aktualität der Rhetorik, in: Wirklichkeiten, in denen wir leben, Stuttgart 1981. Blumenberg, Anthropologische Annäherung, S. 124. Die Unterscheidung rhetorikrepugnant - rhetorikaffin übernehme ich von Peter L. Oesterreich, der sie zuerst in seinem Buch: Fundamentalrhetorik. Untersuchungen zu Person und Rede in der Öffentlichkeit (Hamburg 1990) eingeführt und dann in: Philosophen als politische Lehrer (Darmstadt 1994, S. 22) wieder aufgegriffen hat. Oesterreich beschreibt damit den häufig anzutreffenden Sachverhalt von antirhetorischem Inhalt (rhetorikrepugnant) und rhetorischer Form (rhetorikaffin) eines Gedankens oder Textes, welcher durch eine rhetorische Metakritik als „Widerspruch im Vollzug" (ebd.) aufgewiesen werden mu£, um diesen seiner eigenen Rhetorizität ansichtig werden zu lassen. Blumenberg, Anthropologische Annäherung, S. 105. Ebd., S. 124.
Rhetorische Anthropologie der Metapher
111
in konstruktiver Weise verhalten, indem er sowohl auf den Grad seiner Bedürfnishaltung als auch seiner Erfüllungshoffnung reflektiert. In dieser Möglichkeit erkennt Blumenberg eine gewisse „Rationalisierung des Mangels [...]. Sie besteht darin, die Erwägung dessen, was wir als Erfüllung der Intentionalität des Bewußtseins leisten sollen, zu ergänzen durch die eher anthropologische Abwägung, was wir uns an Erfüllung leisten können."119 Der Mensch ist das einzige Wesen, das sich selbst eine 'Diätetik der Sinnerwartung' (O. Marquard)120 verordnen kann. Diese Fähigkeit verweist auf eine Anthropologie des armen und des reichen Menschen zugleich, insofern der Mensch seine Mangelhaftigkeit in konstruktiver Weise kompensieren kann. Max Scheler beschrieb diesen Sachverhalt, indem er formulierte, der Mensch sei „der 'Neinsagenkönner', der 'Asket des Lebens', der ewige Protestant gegen alle bloße Wirklichkeit."121 Blumenberg betont jedoch ebenso stark eine Mängelanthropologie Gehlen'scher Prägung, der er eine Fundamentalrhetorik an die Seite stellt. Die damit einhergehende Behauptung einer fundamentalanthropologischen Bedeutung der Metapher hängt unmittelbar mit den bereits gewonnenen denkarchäologischen Erkenntnissen zusammen. Denn diese hatten ein ontologisierendes Verständnis der großen philosophischen Normbegriffe wie 'Natur' oder 'Wahrheit' als unhaltbar erwiesen. Was jeweils als Natur oder als Wahrheit zu gelten hat, hängt von einem sensus communis ab, der qua Benennung zu einem kollektiven Einverständnis führt. Eine Philosophie der absoluten Ziele und ihr semantisches Sachverhältnis zur Sprache erfährt eine entscheidende Korrektur durch eine Theorie der Mittel einschließlich ihrer pragmatischen Sprachauffassung, wie sie durch die Rhetorik vertreten wird. Im Unterschied zu Metaphysik und rationalistischem Erkenntnisideal versteht Rhetorik die Sprache nicht bloß als reibungsfreies Medium für den davon unabhängigen gedanklichen Gehalt, sondern als eigenständigen Ersatz für die Instinktarmut des nichtfestgestellten Menschen. „Denn die Rhetorik geht aus von dem, worin der Mensch einzig ist, und zwar nicht deshalb, weil Sprache
1 IQ
120
121
Blumenberg, Unbegnfflichkeit, S. 89. Die 'Redimensionierung' der Erwartungshaltung könnte auch für eine Theologie von therapeutischem Wert sein, die zwischen ihrem Anspruch einerseits und der Einsicht in ihr Unvermögen andererseits hin- und hertreibend zu immer abstrakteren Ausdrucksmitteln greift und sich dadurch semantisch aufzureiben droht. Die Aporie eines rationalistischen Begriffsideals betrifft die theologische wie die philosophische Terminologie. Von daher wächst der Nötigungsdruck einer aktuellen Selbstverständigung über den Status dogmatischer Begriffe. Metaphorologie kann dazu einen wesentlichen Beitrag leisten, wenn es gelingt, das vor dem Hintergrund eines obsolet gewordenen Begriffsideals gängige Vorurteil der Metapher als uneigentlicher Rede zu überwinden. Max Scheler: Die Stellung des Menschen im Kosmos (1928), 12. Auflage, Bonn 1991, S. 55.
112
Die absolute Metapher
sein spezifisches Merkmal wäre, sondern weil Sprache in der Rhetorik als Funktion einer spezifischen Verlegenheit des Menschen zutage tritt."122 Eine rhetorikaffine Anthropologie begreift die Sprachlichkeit des Menschen deshalb nicht als transzendenten Überschuß, sondern als Ausdruck eines immanenten Mangels. Demnach fungiert die Sprache als Mittel zur Selbstverständigung des 'indirekten Wesens' Mensch, dem kein unmittelbares Selbstverhältnis gegeben ist. „Der menschliche Wirklichkeitsbezug ist indirekt, umständlich, verzögert, selektiv und vor allem 'metaphorisch'."123 Auf dem Weg zu sich selbst ist der Mensch auf Umwege angewiesen. Hier lokalisiert Blumenberg die Funktion der rhetorischen Metapher in fundamentalanthropologischer Weise. „Der metaphorische Umweg, von dem thematischen Gegenstand weg auf einen anderen zu blicken, der vorgreifend als aufschlußreich vermutet wird, nimmt das Gegebene als das Fremde, das Andere als das vertrauter und handlicher Verfügbare."124 In diesem Sinne versteht Blumenberg die Wesensdefintion des Menschen durch Ernst Cassirer.125 Der Mensch als animal symbolicum erschließt sich die Welt über Stellvertretungsund Repräsentationsakte. Nicht das identifizierende Urteil, das etwas als etwas zu erfassen sucht, sondern die Metapher, die etwas durch etwas anderes begreifen lehrt, entspricht dem symbolisch-metaphorisch konstituierten Menschen. Dies erweist sich vor allem dort, wo der Identitätsanspruch des Urteils notorisch zu kurz greift, weil der Gegenstand das Verfahren überfordert, also bei den Großfragen und Großbegriffen wie Welt, Leben, Geschichte, Bewußtsein und Zeit, etc. Wo Wittgensteins bekanntes Diktum worüber man nicht sprechen kann, solle man schweigen - die Grenze für die Zuständigkeit einer propositionalen Aussagenlogik zieht, kann der Mensch gerade nicht stehen bleiben. Das ist die Situation, in der die Phantasie dem Logos zur Seite springt. Das imaginativ-projektive Verfahren der Metapher kommt zum Einsatz, wo die Logik aufgrund von Unabschließbarkeit und Unentscheidbarkeit der zwar naiv anmutenden, damit aber um so dringlicheren Fragen eine Antwort verweigern muß. Denn auch, wenn alle möglichen Fragen nach dem, was der Fall ist, beantwortet werden könnten, wären die Lebensprobleme noch gar nicht berührt. Die anthropologische Bedeutung der Metapher besteht also in der Rolle, welche diese für das Mängelwesen Mensch spielt, der sich nur über anderes der Welt und seiner selbst versichern kann. „Der Mensch begreift sich nur über das, was er nicht ist, hin-
122 123 124 125
Blumenberg, Anthropologische Annäherung, S. 108. Ebd., S. 115. Ebd., S. 116. Vgl. Ernst Cassirer: Essay on Man, New Haven 1944; dt. Was ist der Mensch? Versuch einer Philosophie der menschlichen Kultur, Stuttgart 1960.
Leistung und Grenzen einer Theorie der absoluten Metapher
113
weg. Nicht erst seine Situation, sondern schon seine Konstitution ist potentiell metaphorisch."126 Die anthropologischen Annäherungen an die Thematik der Metapher eröffnen rückblickend eine Möglichkeit, die Spannungsmomente, welche Blumenbergs Metaphorologie durchziehen, in konstruktiver Weise miteinander ins Verhältnis zu setzen. Denn der Grund für jene unterschiedlichen Interpretationstendenzen muß in seiner dialektisch verfaßten Anthropologie verankert werden. Demnach löst Blumenberg den Gegensatz zwischen einer Anthropologie des reichen und einer Anthropologie des armen Menschen nicht auf. Tendiert er auch zunächst zur ersten (Scheler) und im programmatischen Spätwerk zur zweiten Form (Gehlen), so behalten doch beide Aussagen ihre Gültigkeit. Von daher entspricht einer Anthropologie des weltoffenen Geistwesens ein metaphorologischer Fragehorizont, der auf die theoretische Neugierde des Menschen abhebt und die Funktion der Metapher bei den umfassenden Totaldeutungen der Welt untersucht. Im Hinblick auf historisch 'durchschaute' Paradigmen der Metapher kann eine derartige Interpretationsperspektive dann nur noch die verlorene metaphorische Unschuld konstatieren. Aber insofern der Mensch zugleich als instinktarmes Mängelwesen beschrieben werden muß, kommen zwangsläufig jene Rückbindungsverhältnisse in den Blick, die das theoretische Verhalten des Menschen allererst ermöglichen. Somit eröffnet die Einsicht in das lebensweltliche Orientierungsbedürfnis des Menschen eine positive Würdigung der fundamentalanthropologischen Bedeutung des rhetorisch-metaphorischen Umwegs. Damit kann aber auch die Bedeutung der metaphorischen Produktions- und Verwendungskompetenz in neuer Weise zur Geltung gebracht werden.
4. Fazit Leistung und Grenzen einer Theorie der absoluten Metapher Indem es den jeweiligen Ort der Metapher in Geschichte und Lebenswelt thematisiert, geht das Konzept der absoluten Metapher über die Theorien der lebendigen und der konzeptuellen Metapher noch ein Stück hinaus. Denn außer einzelnen Aspekten zu Wesen und Wirken der Metapher ('semantische Innovation' oder 'topische Argumentation') tritt bei Blumenberg die grundlegende Frage nach der Geltung und Genese von Metaphern in den Blick. Am historischen Schnittpunkt von Epochenschwellen wird die geschichtliche 126
Blumenberg, Anthropologische Annäherung, 134f. Von einer idealistisch-bewuBtseinstheoretisch verstandenen 'Selbstexplikation im Medium des anderen' unterscheidet sich der metaphorische Umweg darin, daB er in der Übertragung seine Erfüllung findet und keinen dritten Schritt der Aufhebung erfordert.
114
Die absolute Metapher
Dimension der Metapher sowie die metaphorische Dimension der Geschichte deutlich. Ersteres meint die Geschichte des metaphorischen Prozesses selbst, also den Aufstieg und Niedergang bestimmter Leit- und Hintergrundmetaphern, die das jeweilige Selbst- und Weltverständnis einer Epoche strukturieren. Letzteres läßt eine begriffskritische Gegengeschichte zur philosophischen Ideen- und Problemgeschichte hervortreten, in welcher die latent verborgene und nicht teleologisierbare 'Metakinetik geschichtlicher Sinnhorizonte und Sichtweisen' aufgedeckt wird. Darüber hinaus erschließt die Frage nach den lebensweltlichen Rückübertragungsverhältnissen die grundlegende Funktion von Metaphern sowohl für pragmatische Orientierungsfragen als auch für theoretische Totalitätsfragen. Die rhetorisch-anthropologische Verankerung schließlich läßt Metaphern als das Feld vorgreifender Orientierungen, lebensweltlicher Leitfäden und Mentalitäten erkennen. Blumenbergs Metaphorologie besticht deshalb nicht zuletzt durch ihre flexible Heuristik im methodischen Umgang mit der Vielfalt geschichtlichen Vorkommens von Metaphorik. Im Hinblick auf die bisher verhandelten Metapherntheorien der lebendigen und der konzeptuellen Metapher folgt daraus, daß Blumenberg beide Theorieansätze - in àtrkgeschichtlicher Perspektive - miteinander vermittelt: Zum einen die innovative Sprengkraft lebendiger Spannungsmetaphern, die epochale Umbrüche im Denken, Fühlen und Handeln kollektiver geschichtlicher Gemeinschaften bewirken. Zum anderen die strukturierende Konzeptualität verborgener Hintergrundmetaphern, welche ihr Werk als quasi-topische Leitmetaphern in Theorie und Lebenswelt verrichten. Für eine theologische Metaphorologie ist Blumenbergs Ansatz darüber hinaus von besonderer Relevanz, als er seinerseits durch die Thematisierung theologischer Theoriebeispiele und Problemhorizonte (Metaphorisierung der Dogmatik) - freilich ohne selbst damit theologische Intentionen zu verfolgen oder gar anzubahnen - die Theologie zur Auseinandersetzung mit der Metaphorologie nötigt. Die historisch-paradigmatische Betrachtungsweise stößt jedoch dort an ihre Grenze, wo die Aktualität der Metapher, das heißt die aktive und bewußte Umgangsweise mit Metaphern entweder ganz geleugnet wird, weil sie einem Prozeß der Aufklärung zum Opfer gefallen sei, oder nur noch programmatisch gestreift wird. Dies hat seinen Grund in einer unzureichenden semantisch-sprachlichen Reflexion auf Wesen und Wirken der Metapher. Blumenberg verläßt die Betrachtungsebene einer denkarchäologischen Sprachkritik à la Nietzsche nicht, um den linguiste turn in der Metaphorologie zu vollziehen. Die Metapher bleibt Ausdrucksmittel des Geistes, ohne auf ihre semantisch-pragmatische Eigenheit hin untersucht zu werden. Blumenberg bleibt dem Konzept einer kritischen Rezeptionsmetaphorologie verhaftet, ohne zur Produktionsmetaphorologie vorzustoßen. Hier fordern Poetik, Rhetorik und Topik erneut ihr Recht. Nur mit ihrer Hilfe kann es gelingen, über die metaphorologische Theorieinterpretation zu den Bedingungen
Leistung und Grenzen einer Theorie der absoluten Metapher
115
und Möglichkeiten einer metaphorologischen Theoriebildung hinauszugelangen. Insofern scheint - so das Fazit dieses ersten Teils - nur ein komplexes Theorieset den vielfaltigen Herausforderungen bei der theoretischen Erfassung des Metaphorischen zu genügen.
Β. METAPHOROLOGISCHE THEOLOGIE Kapitel 4 Metapher und biblische Bildsprache Der erste Hauptteil führte in die metaphorologische Grundspannung zwischen Innovationsmetaphern und Traditionsmetaphern. Die Fragestellung, die sich daraus für die Theologie ergibt, soll Gegenstand des zweiten Hauptteils sein. Welche Rolle spielen Metaphern in theologischen Traditions- und Innovationsprozessen? Inwiefern lassen sich Wandel und Veränderung in der Theologie mit metaphorischen Paradigmawechseln in Zusammenhang bringen? Die Analyse metaphorischer Rede in biblischer Bildsprache und theologischer Theoriesprache soll die spezifische Leistung theologischer Traditions- und Innovationsmetaphern erkennen lassen. Auszugehen ist deshalb zunächst von dem faktischen Befund metaphorischen Sprachgebrauchs in der biblischen Gründungssprache des Christentums, insbesondere den neutestamentlichen Gleichnissen. Gleichzeitig mit der neueren Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie hat auch die Biblische Hermeneutik des 20. Jahrhunderts die Metapher als genuine Sprachform eigentlicher Rede in den Blick gerückt. Nachdem der Beitrag der ersten Gruppe exemplarisch dargestellt wurde, soll nunmehr als Einleitung in die theologische Fragestellung auch die für die theologische Forschung maßgebliche neuere Gleichnistheorie und Hermeneutik vorgestellt werden, bevor im 5. Kapitel das Verhältnis von Metaphorologie und Dogmatik zur Darstellung kommt. Die Bedeutung der Metapher für die exegetisch-hermeneutische Arbeit der Bibelinterpretation nachzuweisen, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Sind es doch gerade die exegetischen Disziplinen gewesen, die das Thema der starken Metapher in die Theologie eingeführt haben. Vor allem die moderne Gleichnisforschung seit A. Jülicher1 hat sich der Metapher als Sprachform biblischer Bildsprache angenommen und eine rhetorisch-semantische Reflexion auf die Sprachgestalt der biblischen Schriften sowie eine adäquate Interpretationssprache angebahnt. Der Streit geht seitdem um die Bewertung, nicht mehr um den Beftmd als solchen. Metapher, Gleichnis und biblische Sprachform gelten hinsichtlich ihrer Zusammengehörigkeit als unbestritten, seit sich die bibelwissenschaftliche Metapherntheorie im VerDie Gleichnisreden Jesu, 2 Bde (1888/1899), 2. Aufl., Tübingen 1910.
118
Metapher und biblische Bildsprache
bund mit den Anrainerdisziplinen der linguistischen, semiotischen, semantischen, rhetorischen, und literaturwissenschaftlichen Metapherntheorien der Interpretation biblischer Metaphorik zuwendet. Ein weiteres Paradigma biblisch-hermeneutischer Metaphorologie stellt die von R. Bultmann entfachte Entmythologisierungsdebatte dar. Hier hat die neuerliche Unterscheidung zwischen Mythos und Metapher bzw. die Interpretation des Mythos durch die Metapher entscheidende Diskussionsbeiträge geliefert, die eine falsche Alternative zugunsten oder zu Lasten des Mythos überwunden haben. Im folgenden soll jedoch weder die lange Geschichte der modernen Gleichnisexegese noch die komplexe existential-hermeneutische Beziehung von Mythos und Metapher im ganzen nachgezeichnet werden.2 Vielmehr kommen zwei Ausschnitte der aktuelleren Debatte zur Darstellung, in der vor allem die heuristische sowie die kognitiv-innovative Funktion der Metapher diskutiert wird. Sachlich steht dabei die Frage im Vordergrund, ob und wie die metaphorisch interpretierten Gleichnisse ein neues Selbst-, Weltund Gottesverständnis anbahnen (Innovationsfunktion), bzw. ob und wie sie ein bestimmtes Selbst-, Welt- und Gotteskonzept über lange Zeitstrecken hinweg stützen und bewahren (Traditionsfunktion). Gleichnis und Mythos verweisen somit vor dem Hintergrund ihrer Strukturaffinität zur Metapher auf die umfassendere Fragestellung nach der Adäquatheit der Metapher für eine Semantik religiöser Rede. An diesem Punkt beginnt die Metaphorologie für die Theologie im ganzen relevant zu werden. Indem Sprachtheorie und biblische Hermeneutik die Rehabilitierung der Metapher betreiben und die Metapher die Eigenart der biblischen Rede von Gott produktiv aufzuschließen in der Lage ist, vermag eine Theorie der Metapher auch Aufklärung über den spezifischen Status religiöser und theologischer Rede überhaupt zu geben. Damit ergibt sich der Übergang zu einer Ortsbestimmung der Metapher in der theologischen Begriffssprache selbst. Die Entdeckung der heuristischen Funktion für die biblische Bildsprache nötigt zu der weitergehenden Problemanzeige, ob und inwiefern die Metapher nicht als eliminierbarer Restbestand, sondern als unverzichtbarer Grundbestand der systematisch-dogmatischen Theoriesprache begriffen werden muß (Kap 5 und 6).
Vgl. dazu die beiden Bände von Wolfgang Harnisch (Hg.): Die Gleichnisse Jesu. Positionen der Auslegung von Adolf Jülicher bis zur Formgeschichte (WdF 366), Darmstadt 1982; Ders. (Hg.): Die neutestamentliche Gleichnisforschung im Horizont von Hermeneutik und Literaturwissenschaft (WdF 575), Darmstadt 1982; sowie die Arbeit von Mogens Stiller Kjärgaard: Metaphor and Parable, Leiden 1986.
Das Gleichnis als lebendige Metapher
119
1. Das Gleichnis als lebendige Metapher Inspiriert wurde die exegetisch-hermeneutische Rezeption der neueren Metapherntheorie vor allem durch das Konzept der lebendigen Metapher von Paul Ricoeur. Das beruht auf seinem emphatisch-poetologischen Metaphernbegriff, der das Resultat des metaphorischen Prozesses in den Gleichnisreden Jesu als innovativen Sprach- und Seinsgewinn zu verstehen gibt, sowie darauf, daß Ricoeur selbst die Applikation seiner Metapherntheorie auf die biblische Hermeneutik unternommen hat. 3 Dabei soll das Gleichnis als biblische Sprachform zur innovativen Neubeschreibung der religiösen Wirklichkeit verstanden werden. Indem die wörtliche Deutung an der semantischen Impertinenz der Gleichnisse scheitert, erzwingen diese einen semantischen 'Dreh' (Twist), der die neue Pertinenz hervortreten läßt und die religiöse Neubeschreibung ermöglicht. Dabei muß jedoch ein wesentlicher Unterschied zwischen Metapher und Gleichnis auffallen. Das Gleichnis kann nämlich nicht einfach als metaphorische Aussage auf der semantischen Ebene des Satzes interpretiert werden, sondern stellt eine komplexe erzählerische Komposition dar. Dies hat Folgen für den Spannungscharakter des Gleichnisses. Die 'tension' besteht nicht wie bei der metaphorischen Aussage zwischen wörtlicher und metaphorischer Verwendung von zwei Satzteilen (tenor und vehicle), sondern betrifft vielmehr das Gleichnis im ganzen als Spannung zwischen Erzählung und alltäglich erlebter Wirklichkeit. Die Spannung wird demnach auf der Wirklichkeitsebene selbst zwischen Beschreibung und Neubeschreibung eingeführt. Die 'Extravaganz' als Grad der Metaphorizität der Erzählung resultiert aus dem Vorkommen des Außergewöhnlichen innerhalb des Gewöhnlichen. Im Gleichnis durchwirkt ein metaphorischer Prozeß die narrative Form. Dadurch wird die Geschlossenheit der Erzählform durch die Offenheit des metaphorischen Prozesses aufgebrochen und eröffnet eine neue Sicht auf die Wirklichkeit. Dies kann jedoch im Rahmen einer literarisch-poetischen Hermeneutik nur als Neubeschreibung einer menschlichen Erfahrung verstanden werden. Das Symbol des 'Himmelreiches' dient lediglich dazu, die gleichnisimmanente Spannung zu verdeutlichen. „Insofern müssen wir sagen, daß der letzte Bezugspunkt der Gleichnisse [...] nicht das Reich Gottes ist, sondern das Ganze der menschlichen Wirklichkeit. " 4
Paul Ricoeur: Stellung und Funktion der Metapher in der biblischen Sprache, in: Paul Ricoeur/Eberhard Jiingel, Metapher, S. 45-70.; sowie Ders.: Biblische Hermeneutik, in: Harnisch, Die neutestamentliche Gleichnisforschung im Horizont von Hermeneutik und Literaturwissenschaft, S. 248-339. Ricoeur, Biblische Hermeneutik, S. 338.
120
Metapher und biblische Bildsprache
2. Das Gleichnis als religiöse Spannungsmetapher Dieser poetologisch-innovativen Gleichnisinterpretation hat sich W. Harnisch 5 auf Seiten der theologischen Gleichnisexegese angeschlossen, auch wenn er darum bemüht ist, die Besonderheit der religiösen Form poetischer Rede gegenüber der Dichtung deutlicher als Ricoeur zum Ausdruck zu bringen. Zunächst wird das Gleichnis als „die metaphorische Wirkungsweise einer Erzählung" 6 bestimmt. Dabei steht vor allem die Theorie der Spannung im Vordergrund der Überlegungen, die als das Herzstück einer innovativen Metapherntheorie zu verstehen ist. Im Anschluß an Ricoeur verortet auch Harnisch die Spannung der Gleichnisse nicht zwischen zwei unterscheidbaren Aussagehälften. Gegen Ricoeur erkennt sie Harnisch aber auch nicht zwischen Erzählung und alltäglich erlebter Wirklichkeit, sondern findet sie innerhalb der Erzählung selbst. Die metaphorische Spannung durchzieht die Gleichniserzählung im ganzen. Der metaphorische Spannungscharakter kommt einem schwer lokalisierbaren Verfremdungseffekt gleich. „Das Vertraute wird vom Nicht-Vertrauten hintergangen. " 7 Zwar entstammt das Inventar der Gleichnisse, worauf in der exegetischen Literatur oftmals hingewiesen wurde, der vertrauten Lebenswelt. Es läßt sich aber ebensowenig übersehen, „daß sich das Gesicht der Wirklichkeit im Verlauf der Szenenfolge wandelt." 8 Die alltägliche Lebenswirklichkeit dient nicht der leicht faßlichen Veranschaulichung einer Glaubensbotschaft, sondern erfährt im Zuge der Erzählung eine zunehmende Infragestellung. „Die vertraute Lebenswelt ist durch Ereignisse des Ungewohnten und Unerhörten verfremdet. " 9 Im Unterschied zur Allegorie und zur modernen literarischen Parabel hält sich jedoch die erzählerische Extravaganz der Gleichnisse im Rahmen. Der metaphorische Verfremdungseffekt wird nicht zur gänzlichen Entwirklichung der Szene gesteigert. Durch den bestimmten Spannungsgrad soll ein neuer Referenzbezug eröffnet und nicht verabschiedet werden. Die Intensität der Metaphorizität in Jesu Gleichnisreden bemißt sich nicht an ihrer maximalen Steigerungsform zur 'kühnen Metapher', die ihren Höhepunkt in der modernen Lyrik erreicht, sondern hält sich die Waage zwischen Usualität und Extravaganz. Dieses Korrektiv zu einem emphatisch-poetologischen Konzept der lebendig-kühnen Metapher im Dienst der religiösen Form poetischer Rede wird jedoch von Harnisch nicht noch einmal metaphorologisch reflektiert. Dies würde nämlich bedeuten, nicht nur quantitative Einschränkungen hin-
^ η 8 9
Wolfgang Harnisch: Die Gleichniserzählungen Jesu. Eine hermeneutische Einführung, Göttingen 1985. Ricoeur, Biblische Hermeneutik, S. 298, zit. bei Harnisch, Die Gleichniserzählungen Jesu, S. 141. Harnisch, Die Gleichniserzählungen Jesu, S. 144. Ebd., S. 147. Ebd., S. 149.
Das Gleichnis als religiöse Spannungsmetapher
121
sichtlich des Grades an Metaphorizität vorzunehmen, sondern auch explizit eine Theorie der topisch-konzeptuellen Metapher bei der Gleichnisinterpretation mit heranzuziehen. Insofern dieser Theoriestrang jedoch zu Unrecht mit dem methodischen Ansatz Jülichers identifiziert wird, verschließt sich Harnisch den Einsichten der neueren Rhetorik- und Topikdebatte in der Metaphorologie und Gleichnisexegese. Entscheidend für die metaphorische Wirkung der Gleichniserzählung ist jedenfalls, daß sie sich weder in die restlose Stimmigkeit des Bildwortes überführen 10 noch zur totalen Hermetik eines autonomen Kunstwerks stilisieren läßt. 11 Zwischen den Extremformen eines rein rhetorischen und eines exklusiv poetologischen Metaphernverständnisses zielt die hermeneutische Interpretation Harnischs darauf ab, den auf der Grundlage der gescheiterten wörtlichen Deutung entstandenen Auslegungsspielraum zu ermessen, der durch den metaphorischen Twist zur neuen Pertinenz eröffnet wurde. „Der Rezipient ist demnach angefordert, seine Einbildungskraft produktiv einzusetzen und die narrative Vakanz durch einen hermeneutischen Entwurf auszufüllen." 12 Zum Auslegungsspielraum einer religiösen Möglichkeit wird die neue Pertinenz der metaphorischen Gleichniserzählung aber dadurch, daß sie mit der Gottesherrschaft in Verbindung gebracht wird. Auf Seiten des Rezipienten entspricht dieser Interpretationsrichtung „die Einbildungskraft des Glaubens" 13 , welche die Gleichniserzählung schließlich zu einem kerygmatischen Ereignis werden läßt.14
3. Das Gleichnis als theologische Analogiemetapher Dem etwas mühsam wirkenden Nachweis der kerygmatischen Funktion von Jesu Gleichnisreden stellt H. Weder eine Gleichnisauslegung entgegen, welche diese von vornherein als 'theologische Metaphern' verstanden wissen will. In seiner für die deutsche Diskussion15 grundlegenden Dissertation16
"
11 13
^
So Jülicher: „das Gleichnis geht auf wie eine mathematische Gleichung" (Die Gleichnisreden Jesu Bd I, S. 336). So etwa Dan O. Via: Die Gleichnisse Jesu. Ihre literarische und existentiale Dimension, BEvTh 57, 1970, S. 34 u. 75ff. Harnisch, Die Gleichmserzählungen Jesu, S. 156. Ebd., S. 167. Unter systematisch-theologischer Perspektive hat Klaas Huizing (Homo legens. Vom Ursprung der Theologie im Lesen, Berlin/New York 1996) diese poetische Ausdrucksdimension der Gleichnisse untersucht, die zum Nachspielen der biblischen Schauspiellehre in Geschichten anregen soll. Im anglo-amerikanischen Raum waren bereits die Arbeiten von A. Wilder, R. Funk, D. O. Via und J. D. Crossan vorangegangen; vgl. dazu Harnisch, Die neutestamentliche Gleichnisforschung im Horizont von Hermeneutik und Literaturwissenschaft.
122
Metapher und biblische Bildsprache
versteht Weder die Metapher zunächst mit Ricoeur als ein Phänomen der Prädikation auf der Satzebene. Die metaphorische Aussage hat die Struktur: S(atz) - K(opula) - (P)rädikat. Vor dem Hintergrund dieser sprachlichen Grundform sollen die Gleichnisse Jesu als „Gottesreichgleichnisse"17 verstanden werden. Demnach wird nicht das Gleichnis als solches metaphorisch interpretiert, sondern S mit dem Gottesreich und Ρ mit der Gleichniserzählung identifiziert. Die primäre semantische Spannung der Metapher beruht also zwischen der Basileia und der Erzählung, von der sich die sekundäre semantische Spannung zwischen alltäglich erfahrener Wirklichkeit und szenisch verstandener Erzählung allererst ableitet. Die metaphorisch interpretierte Kopula vereinbart ein 'ist wie' und ein 'ist nicht' miteinander und sagt somit, „als was die Basileia ist". 18 In kritischer Absicht gegen die philosophisch-hermeneutische Gleichnisauslegung macht Weder jedoch vor allem auch auf die Unterschiede zwischen Gleichnis und Metapher aufmerksam. Während die Metapher als Satzphänomen zu bestimmen sei, beruhe das Gleichnis auf einer umfassenden Kompositionseinheit. Dabei wird nicht erwähnt, daß bereits Ricoeur die Untersuchung der Metapher von der Wortebene über die Satzebene auf die Textebene gehoben hat. Von daher trifft es keineswegs zu, daß die Metapher nur „als Spannung zwischen Wörtern"19 zu beschreiben ist. Die Hermeneutik der Metapher hatte vielmehr gezeigt, daß Metaphorizität auch auf der Textebene als Spannung zwischen umfassenderen Kontexten fungiert. Eine zweite Differenz sieht Weder in der Lebensdauer von Metapher und Gleichnis. Während der lebendigen 'Spannungsmetapher' nur eine „Augenblicksexistenz" 20 beschieden sei, welche sie bald zur 'toten Metaphern' ersterben lasse, würden sich die Gleichniserzählungen durch eine ungleich größere Langlebigkeit auszeichnen. Hier kann sich Weder mit Fug und Recht auf Ricoeur berufen, auch wenn dieser bereits Überlegungen zur Revitalisierung abgestorbener Metaphern angestellt hat. Grundsätzlich ist aber an diesem Punkt auch die Grenze eines Konzeptes der lebendigen Metapher berührt. Wie bereits bemerkt, erweist es sich für die Gleichnisforschung als nachteilig, ein emphatisch-poetologisches Modell der lebendigen Metapher zum alleinigen Interpretationsparadigma zu erklären (was sich freilich aus der Abkehr von der jahrzehntelangen Vormachtsstellung der Rhetorik sowie einer nur sehr zögerlich fortschreitenden Ausbildung einer modifizierten topischrhetorischen Metapherntheorie erklärt). Eine Erweiterung der Untersuchungsperspektive um das Konzept der topischen Metapher würde auch hier 16 17 18 19 20
Hans Weder: Die Gleichnisse Jesu als Metaphern (1978), 4. Aufl., Göttingen 1990. Ebd., S. 60. Ebd., S. 62. Ebd. Ricoeur, Biblische Hermeneutik, S. 302.
Das Gleichnis als theologische Analogiemetapher
123
die hermeneutische Wahrnehmungskompetenz entscheidend bereichern. Drittens schließlich unterscheide sich, so Weder, das Gleichnis von der Metapher hinsichtlich des damit verbundenen Spannungscharakters. Während sich die Metapher durch die semantische Spannung verschiedener Sinnhorizonte auszeichne, trete im Gleichnis eine gleichsam ontologische Spannung zwischen zwei prinzipiell unterschiedenen Sinnhorizonten auf: zwischen Gott und Welt. „Während die Metaphern Weltliches dem Weltlichen prädizieren, prädizieren die Gleichnisse Jesu Weltliches Gott." 21 Dies führt Weder zu der metaphorologischen Grundunterscheidung zwischen 'gewöhnlichen' und 'theologischen' Metaphern. Ohne die grundsätzliche Berechtigung dieser Unterscheidung anzweifeln zu wollen, sei jedoch angefragt, ob Weder diesen pauschalen Unterschied in die Gesamtheit der Gleichnisse nicht eher hineinträgt, als ihn in detaillierter Einzelanalyse herauszulesen. Harnisch zumindest weist darauf hin, daß diese prinzipielle Differenzierung auf einer durchgängigen Interpretation aller Gleichnisse als 'Gottesreichgleichnisse' beruht und daß sich darin ein systematisch-theologisches Anliegen zu Wort meldet, das sich nicht immer und an allen neutestamentlichen Gleichnistexten belegen läßt. Deshalb sieht Harnisch den Unterschied im Spannungscharakter darin, daß das Gleichnis nicht wörtliche und metaphorische Elemente zusammenjocht, sondern als Ganzes sowohl wörtlich als auch metaphorisch zu verstehen sei. Galt es zuerst, die Unterschiede zwischen Gleichnis und Metapher ins Bewußtsein zu heben, so wendet sich Weder nunmehr seinem eigentlichen Ziel zu: dem Nachweis einer fruchtbaren Strukturanalogie zwischen Gleichnis und Metapher. Mit Hilfe der Metaphorologie überwindet er zunächst das 'Uneigentlichkeitstheorem' und damit den überholten Gegensatz zwischen sogenannter Bild- und Sachhälfte. Wenn das metaphorisch verstandene Gleichnis als Sprachgewinn zu interpretieren ist, dann kommt ihm vielmehr eine irreduzible Eigenbedeutung zu, die sich nicht in die terminologisch fixierende Begriffssprache übersetzen läßt. Eine Substitutionstheorie der Gleichnisse (etwa durch dogmatische Lehrsätze) wird damit ausgeschlossen. Ebenso eine Vergleichstheorie, die immer das tertium comparationis zwischen Bildund Sachhälfte gesucht hat. „Es gibt kein Drittes, das zwischen der Basileia und dem Gleichnis vermittelt. " 2 2 Daraus folgt für die Gleichnisauslegung wie für die Interpretation der biblischen Schriften im ganzen, 23 daß die Interpretation keine wie immer geartete Ersetzung sein kann, sondern sich um eine explikative Umschreibung zu bemühen hat, die prinzipiell als unabschließbar bestimmt werden muß. 1 22
yi
Weder, Die Gleichnisse Jesu als Metaphern, S. 62. Ebd., S. 65. So schon Joh. Scotus Eriugena: „sanctae scripturae interpretatio infinita", zit. bei Beierwaltes, Duplex Theoria, S. 63, Nachweis Anm. 77. Zur Bedeutung von Eriugena für die theologische Metaphorologie vgl. u. S. 171.
124
Metapher und biblische Bildsprache
Im Hinblick auf die konkrete Einzelauslegung der Gleichnisse fordert Weder einen methodischen Zweischritt. Zunächst sei nur das Prädikat auszulegen, „indem die Erzählung in sich interpretiert wird und dabei besonders beachtet wird, wie sich erzählte Welt und vorfindliche Welt zueinander verhalten." 24 Erst danach kommt das Subjekt - also die Gottesherrschaft - und sein Verhältnis zum Prädikat in den Blick. Der Deutung der sekundären Spannung innerhalb der Gleichniserzählung folgt die Interpretation der primären Spannung zwischen Basileia und Erzählung. „Dies geschieht dadurch, daß die zunächst für sich analysierte Welt des Gleichnisses in den Kontext der Gottesherrschaft gestellt und sowohl von ihr her als auch auf sie hin ausgelegt wird." 25 Damit soll ausgeschlossen werden, daß die Gleichnisse als eine ontologische Möglichkeit des Menschen und seiner Welt - etwa im Sinne D. O. Vias als 'Existenzverständnis' - aufgefaßt werden. Damit nämlich würde „Gott in den Horizont menschlicher Existenz gerückt" 26 , und das muß Weders theologischer Grundüberzeugung zufolge unbedingt vermieden werden. Die Gleichnisse seien keine 'Neubeschreibung der Existenz', sondern der Gottesherrschaft. Darauf weise das metaphorische Gefalle und der semantische Richtungssinn der Metapher hin. Demnach werde in dem Beispiel 'Achill ist ein Löwe' „nicht Achill in den Kontext des Löwen gestellt [...], sondern umgekehrt der Löwe in den Kontext Achills. In diesem Kontext erscheint der Löwe in neuer Sicht." Hier haben die apologetischen Intentionen jedoch den Blick für die semantische Feinanalyse verstellt. Es verhält sich nämlich gerade anders herum: Achill wird in den Kontext des Löwen gestellt und das heißt, nicht der Löwe, sondern Achill erscheint in neuer Sicht. Daß im Zuge einer Wechselwirkungstheorie der Metapher auch das Prädikat (vehicle, focus, Bildspender) eine Modifikation erfahrt, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß der primäre Richtungssinn das Subjekt (tenor, frame, Bildempfanger) der metaphorischen Aussage neu zu verstehen gibt. Denn für Propositionen prädikativer Struktur gilt, wie I. U. Dalferth unter Verweis auf dasselbe Beispiel richtig bemerkt, „daß ihr logisches Subjekt als Bildempfänger, das, was von ihm prädiziert wird (der Prädikator), als Bildspender fungiert (cf. 'Achill ist ein Löwe')." 27 In der Terminologie M. Blacks fungiert der Löwe (das Löwensystem) als Filter, der die Ansicht von Achill (das Achillsystem) in neuer Weise organisiert. Von daher verkehrt Weder seinerseits, was er der existentialen Interpretation als Verkehrung des Verhältnisses zwischen Gott und Mensch vorwirft, wenn er schreibt: „Daß die Welt zum metaphorischen Prädikat Gottes wird, hat zweifellos Folgen für
2
![Die soziale Funktion der Wissenschaft [Reprint 2022 ed.]
9783112645864](https://dokumen.pub/img/200x200/die-soziale-funktion-der-wissenschaft-reprint-2022nbsped-9783112645864.jpg)
![Die Aufgabe der theologischen Facultäten und die allgemeine Religionsgeschichte [3. Aufl. Reprint 2019]
9783111673172, 9783111288437](https://dokumen.pub/img/200x200/die-aufgabe-der-theologischen-facultten-und-die-allgemeine-religionsgeschichte-3-aufl-reprint-2019-9783111673172-9783111288437.jpg)
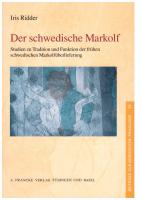
![Die astrologische Lehre der Doryphorie: Eine soziomorphe Metapher in der antiken Planetenastrologie [Reprint ed.]
3598778260, 9783598778261](https://dokumen.pub/img/200x200/die-astrologische-lehre-der-doryphorie-eine-soziomorphe-metapher-in-der-antiken-planetenastrologie-reprintnbsped-3598778260-9783598778261-t-6199514.jpg)
![Kant: Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie [Reprint 2015 ed.]
9783110204773, 9783110178623](https://dokumen.pub/img/200x200/kant-die-fremde-vernunft-und-die-sprache-der-philosophie-reprint-2015nbsped-9783110204773-9783110178623.jpg)
![Die astrologische Lehre der Doryphorie: Eine soziomorphe Metapher in der antiken Planetenastrologie [Reprint ed.]
3598778260, 9783598778261](https://dokumen.pub/img/200x200/die-astrologische-lehre-der-doryphorie-eine-soziomorphe-metapher-in-der-antiken-planetenastrologie-reprintnbsped-3598778260-9783598778261.jpg)

![Unmöglichkeit und Pflichtverletzung: Die Funktion der Unmöglichkeitstatbestände im BGB und der Reformversuch der Schuldrechtskommission [1 ed.]
9783428505821, 9783428105823](https://dokumen.pub/img/200x200/unmglichkeit-und-pflichtverletzung-die-funktion-der-unmglichkeitstatbestnde-im-bgb-und-der-reformversuch-der-schuldrechtskommission-1nbsped-9783428505821-9783428105823.jpg)
![Der häretische Imperativ: Überlegungen zur theologischen Dialektik der Kulturwissenschaft in Deutschland [Reprint 2019 ed.]
3484651318, 9783484651319](https://dokumen.pub/img/200x200/der-hretische-imperativ-berlegungen-zur-theologischen-dialektik-der-kulturwissenschaft-in-deutschland-reprint-2019-ed-3484651318-9783484651319.jpg)

![Tradition und Innovation: Die Funktion der Metapher in der theologischen Theoriesprache [Reprint 2015 ed.]
3110155753, 9783110155754, 9783110808162](https://dokumen.pub/img/200x200/tradition-und-innovation-die-funktion-der-metapher-in-der-theologischen-theoriesprache-reprint-2015-ed-3110155753-9783110155754-9783110808162.jpg)