Religionswissenschaft und Theologie: Disziplinen diskursiv denken 9783111091747, 9783111079042
Religious studies and theology are two closely interwoven disciplines, both in their historical development and through
204 91 6MB
German Pages 360 Year 2023
Polecaj historie
Table of contents :
Inhalt
Vorwort
1 Prolegomena
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
3 Was den Unterschied ausmacht: Die Fragestellung als Strukturmerkmal disziplinärer Diskurse
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
5 Wie fragt Theologie?
6 Die Zusammenschau: Eine Verhältnissetzung von Religionswissenschaft und Theologie auf Grundlage ihrer diskursspezifischen Fragestellungen
7 Literatur- und Quellenverzeichnis
8 Optionale Lesehilfe zu den angewandten Begriffen
Index
Citation preview
Christiane Nagel Religionswissenschaft und Theologie
Theologische Bibliothek Töpelmann
Herausgegeben von Bruce McCormack, Friederike Nüssel und Judith Wolfe
Band 204
Christiane Nagel
Religionswissenschaft und Theologie
Disziplinen diskursiv denken
ISBN 978-3-11-107904-2 e-ISBN (PDF) 978-3-11-109174-7 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-109285-0 ISSN 0563-4288 Library of Congress Control Number: 2023939396 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. © 2023 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck www.degruyter.com
Inhalt Vorwort
IX
1
Prolegomena
2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2
Die Geschichte einer schwierigen Beziehung 10 Akademische Religionswissenschaft ab dem 19. Jahrhundert 10 Die Anfänge 10 Die Institutionalisierung 16 20 Joachim Wach und die wissenschaftstheoretische Grundlegung Manifestation der Fronten im 20. Jahrhundert 22 Die epistemische Wende der Theologie zur Religion – moderne 25 Entwicklungen Immanuel Kant und die Kritik spekulativer Metaphysik 26 Friedrich Schleiermacher und die Eigenständigkeit des religiösen 28 Gefühls Georg Wilhelm Friedrich Hegel und der absolute Geist 31 Albrecht Ritschl und die historisch-wissenschaftliche Grundlegung der 35 Theologie Ernst Troeltsch und die Religionsgeschichtliche Schule 38 Dialektische Theologie und der Offenbarungsbezug der Theologie 41 46 Paul Tillich und die Theologie der Kultur Resümee: Der fachgeschichtliche Hintergrund aktueller Beziehungsprobleme 48 Einlicke in systematisch-theologischer Absicht: Religionswissenschaft und Theologie im heutigen deutschsprachigen Hochschulraum 49 Religionswissenschaft im deutschsprachigen Hochschulraum 50 Evangelische Theologie im deutschsprachigen Hochschulraum 52 Profile der innerhalb der evangelischen Theologie verorteten religionswissenschaftlichen Lehrstühle 54 Religionswissenschaft und Theologie im Vereinigten Königreich – ein Eindruck in systematisch-theologischer Perspektive 58
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5
3 3.1
1
Was den Unterschied ausmacht: Die Fragestellung als Strukturmerkmal disziplinärer Diskurse 68 Probleme klassischer Differenzkriterien 68
VI
3.2
3.3
Inhalt
Impuls: Die Fragestellung als Differenzkriterium – Assoziationen aus binnendisziplinärer Sicht zur fachgeschichtlichen Relativierung der 79 eigenen These Definitorische Setzung: Das Differenzkriterium der Fragestellung 87
95 4 Wie fragt Religionswissenschaft? 4.1 Historische und Systematische Religionswissenschaft 96 100 4.1.1 Systematische Religionswissenschaft – als Metatheorie 4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“ 105 4.2.1 Historisch-philologisch 109 118 4.2.1.1 Zwischenbilanz 4.2.2 Empirisch-sozialtheoretisch 119 4.2.2.1 Zwischenbilanz 127 129 4.2.3 Philosophisch-phänomenologisch 4.2.3.1 Zwischenbilanz 137 4.2.4 Psychologisch-kognitionswissenschaftlich 138 144 4.2.4.1 Zwischenbilanz 4.3 Religionswissenschaft disziplinär 147 4.3.1 Das innerdisziplinäre System der Religionswissenschaft 147 4.3.2 Methodologische und epistemische Konsequenzen 151 156 4.4 Religionswissenschaft interdisziplinär 4.4.1 Verortung im universitären Fächerkanon: Religionswissenschaft als Kulturwissenschaft 156 161 4.4.2 Der Theologiebegriff der Religionswissenschaft 4.5 Zusammenfassung: Die Fragestellung der Religionswissenschaft 165 5 Wie fragt Theologie? 167 5.1 Die enzyklopädische Frage 167 5.1.1 Theologie als Sechsfächerkanon 172 5.1.2 Fundamentaltheologie – als Metatheorie 204 5.2 Theologische „Zugriffe“ 216 5.2.1 Historisch-begrifflich 219 5.2.1.1 Zwischenbilanz 236 5.2.2 Empirisch-sozialtheoretisch 238 248 5.2.2.1 Zwischenbilanz 5.2.3 Hermeneutisch-religionsphilosophisch 249 5.2.3.1 Zwischenbilanz 261 5.2.4 Religionspsychologisch-anthropologisch 262 5.2.4.1 Zwischenbilanz 273
Inhalt
5.3 5.3.1 5.3.2 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 6
6.1
Theologie disziplinär 275 276 Das innerdisziplinäre System der Theologie Methodologische und epistemische Konsequenzen 283 Theologie interdisziplinär 295 Verortung im universitären Fächerkanon: Theologie als 295 Kulturwissenschaft Der Religionswissenschaftsbegriff der Theologie 299 306 Zusammenfassung: Die Fragestellung der Theologie Die Zusammenschau: Eine Verhältnissetzung von Religionswissenschaft und Theologie auf Grundlage ihrer diskursspezifischen Fragestellungen 309 Epilegomena: Offen gebliebene und weiterführende Fragen – 314 ausgewählte Impulse
7 7.1 7.2
Literatur- und Quellenverzeichnis 319 319 Alphabetisches Verzeichnis der zitierten Printmedien Alphabetisches Verzeichnis der zitierten Internetquellen 336
8
Optionale Lesehilfe zu den angewandten Begriffen
Index
349
347
VII
Vorwort Die vorliegende Arbeit wurde im Januar 2022¹ an der Theologischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel als Promotionsschrift verteidigt und mit der Gesamtnote summa cum laude bewertet. Im Mai 2023 wurde sie darüber hinaus mit dem Fakultätspreis der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel prämiert. Für die Veröffentlichung wurden geringfügige Überarbeitungen vorgenommen; v. a. die wertvollen Hinweise aus den Gutachten fanden Eingang in das Endmanuskript. Für die finanzielle Förderung der ersten drei Jahre der Promotionsphase sei der HannsSeidel-Stiftung e. V. gedankt. Hinter jeder erfolgreich abgeschlossenen Dissertation stehen vielzählige Menschen, die den Prozess zu unterschiedlichsten Zeiten beeinflusst und gefördert haben. Der allerherzlichste Dank gilt meinen theologischen Doktorvätern Prof. Dr. André Munzinger und Prof. Dr. Matthias Petzoldt: Durch ihre kontinuierliche, nicht nur fachliche, sondern insgesamt umfassende akademische Betreuung und Förderung sind beide für mich zu wichtigen Mentoren über die Promotionszeit hinaus geworden. Ohne den Beistand, den beide mir auf ihre je eigene Art immer wieder leisten, wäre ich niemals Theologin geworden bzw. geblieben. Ebenfalls danke ich dem Leipziger Religionswissenschaftler Prof. Dr. Christoph Kleine, der in der Anfangsphase des Projektes und am Ende durch das Drittgutachten zur Promotion wichtigen Input für mich als Nicht-Religionswissenschaftlerin gegeben hat. Weiterhin Dank gilt Prof. Dr. Christoph Berner, Prof. Dr. Uta PohlPatalong, Prof. Dr. Ulrich Volp und Prof. Dr. Christiane Zimmermann, die aus ihrer jeweiligen theologisch-disziplinären Perspektive wichtige Impulse für das theologisch-enzyklopädische Kapitel gegeben haben. Dem Kieler Kollegium sei ebenfalls gedankt für die bereichernde Zusammenarbeit. Wärmstens hervorzuheben sind hier Dr. Saskia Eisenhardt, Stefanie-Christine Hertel-Holst, Roberto Jürgensen und v. a. auch Bettina Kühl. Ebenso danke ich dem Leipziger Doktorand*innenkolloquium rund um Matthias Petzoldt für den kontinuierlichen Austausch und wichtigen Input über die Jahre hinweg. Für das Korrekturlesen und insgesamt immer wieder Mitdenken 1 Theologische Dissertationen gehen bekanntlich einen langen Weg von ihrer Einreichung an einer theologischen Fakultät bis hin zu ihrer Veröffentlichung. Diese Arbeit wurde Anfang des Jahres 2021 eingereicht. Ein Großteil ihrer argumentativen Datengrundlage entstand dementsprechend vor diesem Datum. Dazu zählen insbesondere die v. a. (aber nicht nur) in den Kapiteln 2.4. und 2.5. angeführten Weblinks. Da es sich dort um Lehrstuhlprofile, Studiengangsbeschreibungen und ähnliches handelt, die Grundlage der Argumentationsfolge sind und gleichsam naturgemäß immer einer gewissen Dynamik unterliegen, sind diese Links auch mit dem Datum ihres damaligen Abrufs versehen. Die Quellenangaben beziehen sich also bewusst auf diesen Stand. https://doi.org/10.1515/9783111091747-001
X
Vorwort
danke ich allerherzlichst Carsten Baumgart, Anja Christof und besonders – auch für seine unendliche Geduld und Unterstützung v. a. in der Endphase der Dissertation – Christian Laudan. Insgesamt bedanke ich mich bei all meinen Freund*innen für die stets offenen Ohren, wohldosierte Ablenkung und positive Bestärkung – gerade dann, wenn ich sie besonders nötig hatte. Gedankt sei außerdem meinen Eltern, die mir den Zugang zu Bildung im Allgemeinen und das Theologiestudium im Besonderen so einfach wie möglich gemacht haben: Meine Situation als Akademikerin ist eine vielfach privilegierte. Ich weiß mich dem – wissenschaftstheoretisch und -ethisch – verpflichtet. Christiane Nagel, Wiesbaden im Frühjahr 2023
1 Prolegomena Gesellschaft ist grundlegend angewiesen auf verlässlich funktionierende Wissenschaft. Wissenschaftliches Wissen ordnet Diskurse und gibt Orientierung,¹ indem es intersubjektiv begründet, was als wahr bzw. richtig und was als falsch² gelten kann. Dadurch eröffnet Wissenschaft nicht nur Erkenntniswelten, sondern gerade auch Handlungsspielräume und befähigt Gesellschaft zur mündigen Aktion und Reaktion auf alle Veränderungsprozesse, die eine in sich genuin dynamische Welt schon immer mit sich bringt. Diese Dynamik der Welt, in der Wissenschaft sich vollzieht, bedingt gleichzeitig die paradigmatische Abhängigkeit der Wissenschaft von den soziokulturellen Kontexten ihres Vollzugs. Wissenschaftliches Wissen ist erkenntnistheoretisch immer vorwissenschaftlich im epistemischen Kontext seines Generiertwerdens begründet³ – und zielt in seiner Erkenntnisabsicht wiederum genau auf diesen ab. Aufgrund ebendieser wechselseitigen epistemischen Abhängigkeit ist Gesellschaft grundlegend angewiesen auf Wissenschaft als dem Ort, an dem dieses Wechselverhältnis nicht nur hergestellt, sondern auch reflektiert, eingeordnet und dadurch überhaupt gestaltbar gemacht wird. Ohne dieses Orientierungs- und Gestaltungswissen driften gesellschaftliche Diskurse auseinander, werden untereinander unübersetzbar, also inkommunikabel und verfehlen sich somit letztlich. Gerade um dieser Kommunikabilität willen sind Reflexionen auf genau diesen Zusammenhang zwischen Welt – verstanden als denkerischer Überbegriff der Denk- und Handlungszusammenhänge von Menschen in historisch-soziokulturellen Kontexten – und Wissenschaft unverzichtbar. Zu diesen Reflexionen gehört ein grundlegendes Verständnis für die Struktur und den Gehalt dieser Denk- und Handlungszusammenhänge im Allgemeinen und im Besonderen. Weltanschauungen und Religionen sind (zumindest in absehbarer Zukunft)⁴ zentrale Akteurinnen in diesen Zusammenhängen. Kein wissenschaftli-
1 Vgl. Habermas, Jürgen, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt a. M. 51979, 153. 2 Vgl. z. B. Luhmann, Niklas, Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1990, 272 – 274. 3 Vgl. Haraway, Donna, Situated Knowledges. The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, in: Feminist Studies 14/3 (1988), 575 – 599, 580 f. Vgl. auch Herms, Eilert, Das Selbstverständnis der Wissenschaften heute und die Theologie (1993), in: Ders., Kirche für die Welt. Lage und Aufgabe der evangelischen Kirchen im vereinigten Deutschland, Tübingen 1995, 349 – 387, 359. 4 Zu einer aktuellen Einschätzung der vielschichtigen, globalen religiösen Wandlungsprozesse „einer widersprüchlichen Moderne“ in säkularisierungstheoretischer Hinsicht vgl. Pollack, Detlef, Tendenzen des religiösen Wandels, in: Könemann, Judith/Seewald, Michael (Hg.), Wandel als Thema religiöser Selbstdeutung. Perspektiven aus Judentum, Christentum und Islam (QD 310), Freiburg i. Br. 2021, 13 – 36, Zitat 36. https://doi.org/10.1515/9783111091747-002
2
1 Prolegomena
ches System ist vollständig ohne die Disziplinen, die auf die Bedeutung und Bedingtheit von Religionen in den Denk- und Handlungszusammenhängen der Welt reflektieren. Weil aber Weltanschauungen und Religionen zentrale Elemente bzw. Faktoren des wechselseitigen Welt-Wissenschafts-Zusammenhangs sind, können sie nicht als klar abgrenzbarer Aufgabenbereich oder gar Identity Marker für (eine oder einige wenige) Disziplinen fungieren, sondern sind vielmehr optionaler Gegenstandsbereich aller Geistes- und Kulturwissenschaften, also aller Disziplinen, die sich die Reflexion auf den Zusammenhang von Welt und Wissenschaft explizit zur Aufgabe gemacht haben. Diese Problematik einer daraus resultierend erschwerten Identifizierung der einzelnen Disziplinen betrifft in besonderer Weise die „religionsbezogenen Wissenschaften“⁵ der verschiedenen Theologien und der Religionswissenschaft – und das bereits seit dem Werden Letzterer. Gerade Religionswissenschaft und evangelische Theologie sind bis heute auf wissenschaftstheoretischer (und -praktischer) Ebene nicht eindeutig unterschieden. Außerhalb des akademischen Raums ist ein begründetes Verständnis für die Differenz, geschweige denn die Identität dieser beiden Fächer höchstwahrscheinlich nur begrenzt anzufinden. Bei allem Potential fliehender Fächergrenzen zu durchaus wünschenswerter gesteigerter Interdisziplinarität sorgen solche Unklarheiten nur allzu oft für äußerst angespannte Verhältnisse, die sich nicht nur in wahrscheinlich wissenschaftstypischen Kämpfen um Deutungshoheiten und gesellschaftliche Relevanz äußern, sondern im harten Realfall auch in hochschulpolitischen Fragen der institutionellen und finanziellen Verfasstheit.⁶ Gerade aber auch in Bezug auf Ersteres ist klare 5 Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Theologien und religionsbezogenen Wissenschaften an deutschen Hochschulen, Köln 2010, 4. Zur Problematik dieser Bezeichnung vgl. z. B. Scheliha, Arnulf von, Religiöse Pluralität an der Universität. Chancen und Probleme staatlicher Steuerung und fachlicher Selbstbestimmung – am Beispiel der Etablierung des Faches Islamische Studien/Theologie an deutschen Universitäten, in: Ders., Religionspolitik. Beiträge zur politischen Ethik und zur politischen Dimension des religiösen Pluralismus, Tübingen 2018, 227– 239, 237. In der vorliegenden Arbeit werden – bei allem Bewusstsein für die grundsätzliche Problematik des Religionsbegriffs – aufgrund der Fokussierung auf den deutschsprachigen Hochschulraum und der Orientierung an den Empfehlungen des Wissenschaftsrates (WSR) Religionswissenschaft und evangelische Theologie unter dem Sammelbegriff der religionsbezogenen Wissenschaften subsumiert. Zu Letzterem gehören alle forschungsprozesslich material und formal auf Religion(en) (verstanden v. a. als zu deessentialisierende, heuristische Begriffskategorie) bezogenen akademischen Disziplinen. Vgl. zu Religion als Wissenskategorie Auga, Ulrike, Geschlecht und Religion als kritische intersektionale Kategorien. Deessentialisieren und Disidentifizieren als Aufgabe, in: Krannich, Laura-Christin/Reichel, Hanna/Evers, Dirk (Hg.), Menschenbilder und Gottesbilder. Geschlecht in theologischer Reflexion, Leipzig 2019, 43 – 72, 62 f. 6 Gegen Ende des Jahres 2020 brach unter dem Thread „Literatur zu ‚deskriptivem, wertneutralem Schreibenʻ“ (wieder einmal) eine geradezu klassische Debatte zur Frage nach der weltanschaulich-
1 Prolegomena
3
Disziplinarität ein nicht zu unterschätzender Wert: Das Bewusstsein für die eigene Position, Funktion und Absicht befähigt – im Angesicht eines sich immer weiter ausdifferenzierenden Wissenschaftssystems – überhaupt erst zu genau dem Diskurs um (bessere) Deutungsangebote, den Wissenschaft braucht, um zu verlässlichen Aussagen über wahr bzw. richtig und falsch kommen zu können. Die Maßgabe der Reflexion auf erkenntnistheoretische Bedingtheiten gilt also nicht nur sozusagen in der wissenschaftstheoretischen Außenperspektive für den Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Welt, sondern gerade auch im nach innen gerichteten Blick auf die inter-/disziplinäre Gestalt von Wissenschaft selbst.⁷ Somit stellt sich gerade auch für Religionswissenschaft und evangelische Theologie die andauernde Herausforderung, sich der eigenen Gestalt und des schwierigen Verhältnisses zueinander bewusst zu werden, um darauf aufbauend überhaupt erst produktiv zusammenarbeiten zu können. Analog zur Wechselseitigkeit von Welt und Wissenschaft kann ein solches fachliches Selbstbewusstsein nur inklusive der Reflexion auf die Vor-/Bedingungen seiner Genese und Gestalt
konfessionellen Un-/Gebundenheit als Differenzkriterium zwischen Theologie und Religionswissenschaft auf Yggdrasil aus, der Mailingliste der European Association for the Study of Religions.Vgl. die Website der Philipps-Universität Marburg. Yggdrasil, https://www.lists.uni-marburg.de/lists/ sympa/info/yggdrasill – 04.02.21. Als Beispiel für die Aktualität und forschungs- bzw. berufspraktische Tragweite des andauernd problematischen Verhältnisses zwischen evangelischer Theologie und Religionswissenschaft sei aus dieser Diskussion hier in dankenswerter Absprache mit ihrer*ihrem Verfasser*in eine Wortmeldung zitiert, in der eine*r religionswissenschaftliche*r Nachwuchswissenschaftler*in – in Reaktion auf eine Stellenausschreibung (offen für Absolvent*innen der Religionswissenschaft und/oder Theologie) der Evangelischen Zentrale für Weltanschauungsfragen – darauf reflektiert, warum „ich zwar kompetent wäre, aber mich nicht bewerben werde. […] Ich als Diplom-Religionswissenschaftler_in ohne Religionszugehörigkeit empfinde es als großes Problem, dass die beiden Großkirchen Zugangs- und Perspektivenvoraussetzungen vorgeben. […] Es ist eine wichtige Errungenschaft dass sich Religionswissenschaft von der Theologie unabhängig gemacht hat. […] Die Theologie ist in der Tat ein Machtfaktor mit viel Kapital, Personal und Ressourcen. […] Vielleicht würden[!] man diese Diskussion weniger als cismännliches professorales Dominanzgespräch führen, wenn das Kapital gleichermaßen verteilt wäre und wir weniger in Konkurrenz sondern in Koorperation[!] denken würden. […] Als Religionswissenschaftler_in darf ich religiös, nicht religiös, ambivalent etc. sein, aber ich stelle meinen Gegenstand nicht aus einer evangelischen, katholischen, esoterischen, muslimischen, jüdischen etc. Perspektive da[!], sondern aus einer säkular-religionswissenschaftlichen Perspektive. […] Als Politiklehrer_in gebe ich auch keinen Partei-Unterricht, sondern vermittel Wissen über die Politiklandschaft und unterschiedlichen Parteien und nicht-parteilichen politischen Bewegungen. […] Das gleiche sollte für Religion gelten.“ Eva Tolksdorf @[YGG] Antwort: AW: Literatur zu „deskriptivem, wertneutralem Schreiben“, 20.11.20 – 11h51. Hervorhebungen C. N. 7 „[D]er auffallende Zug des postmodernen wissenschaftlichen Wissens besteht in der – jedoch expliziten – Immanenz des Diskurses über die Regeln, die seine Gültigkeit ausmacht.“ Lyotard, JeanFrançois, Das postmoderne Wissen. Ein Bericht (Edition Passagen 7), Graz/Wien 1986, 159.
4
1 Prolegomena
entstehen – und dementsprechend auch nur in Auseinandersetzung mit den disziplinären Gegenübern, die den eigenen Fachdiskurs bedingen.⁸ Vor diesem – hier nur grob anzureißenden – Hintergrund der Wechselseitigkeit dieser erkenntnistheoretischen Reflexionsprozesse will diese Arbeit ein (unabgeschlossen-vorläufiges) Angebot machen, evangelische Theologie und Religionswissenschaft zueinander in ein wissenschaftstheoretisches Verhältnis zu setzen, das die Verbindungen der Disziplinen zueinander nicht nur aufzeigt, sondern auch wertschätzt – und dabei trotzdem klare, sozusagen Identität stiftende Abgrenzungsmöglichkeiten auf der wissenschaftstheoretischen Ebene aufzeigt. Weil Wissenschaft – und damit auch diese Arbeit – sich wie oben angedeutet eben immer nur in bestimmten Kontexten vollziehen kann, ist auch dieses Vorhaben soziokulturell deutlich begrenzt. Genau diese Partikularität ⁹ macht es dann aber eben intersubjektiv überprüfbar und somit dem großen gesamtwissenschaftlichen Diskurs zugänglich. Um also diese zentralen Einschränkungen zu verdeutlichen, wird deswegen an dieser Stelle zunächst der Gegenstand der Arbeit umrissen und dann die spezifische Positionalität der Herangehensweise dargelegt. So ist zunächst festzuhalten, dass es in dieser Arbeit eindeutig um eine Verhältnisbestimmung von Religionswissenschaft und evangelischer Theologie¹⁰ geht. Nicht beachtet werden also die vielfältigen Entwicklungen im Bereich religionsbezogener Wissenschaften allgemein, vor allem der verschiedenen christlich-konfessionellen oder aber islamischen oder jüdischen Theologien.¹¹ Ebenfalls kommt hier ein eng verstandener Religionswis-
8 Denn „unsere wissenschaftliche Subjektivität [kann sich] ohne die anderen nicht entwickeln“. Zima, Peter V., Was ist Theorie? Theoriebegriff und Dialogische Theorie in den Kultur- und Sozialwissenschaften, Tübingen 22017, 209. 9 „Keinen Überblick zu haben, ist der Normalfall des Lebens und folglich auch der wissenschaftlichen Existenz. Den Überblick mit dem eigenen Blick zu verwechseln nutzt weder dem Alltagsleben noch der wissenschaftlichen Realitätserschließung.“ Alkier, Stefan, Das Neue Testament im Kreis der theologischen Fächer. Neutestamentliche Wissenschaft als Beitrag der Erschließung eines evangelischen Wirklichkeitsverständnisses, in: Buntfuß, Markus/Fritz, Martin (Hg.), Fremde unter einem Dach? Die theologischen Fächerkulturen in enzyklopädischer Perspektive (TBT 163), Berlin 2014, 43 – 67, 43. 10 Aus diesem Grund wird im Fortlauf der Arbeit an vielen Stellen „Theologie“ synonym für „evangelische Theologie“ verwendet. Damit sollen keinerlei inhaltliche oder institutionelle Ansprüche in irgendeine Richtung zum Ausdruck kommen – es handelt sich vielmehr schlichtweg um eine stilistische Straffung. 11 Wenngleich eine solche Horizonterweiterung für den größeren Diskurskontext dieser Arbeit sehr zielführend wäre. Beispielhaft dafür mögen die – mittlerweile wohl verebbten – Diskussionen rund um die Pläne einer Fakultät der Theologien an der Humboldt-Universität zu Berlin gelten. Die Auseinandersetzung um die Möglichkeit einer solchen inter- bzw. multikonfessionellen Einrichtung, die v. a. durch die Frage der Institutionalisierung Islamischer Theologie an der HU ausgelöst wurde,
1 Prolegomena
5
senschaftsbegriff zum Einsatz: Es geht um Religionswissenschaft als eigenständige akademische Disziplin, nicht als (dann häufig im Plural formulierte) Programmatik (ähnlich zu der der Kulturwissenschaften). Deutlich ist dabei also, dass sowohl Religionswissenschaft als aber eben auch Theologie als Wissenschaften verstanden werden: Reflexionen auf plurale Theologieverständnisse (z. B. als Lai*innentheologie, als innerreligiöser Vollzug o. ä.) sind nicht Zielfokus der Betrachtung. Es geht um die Formen von Theologie, die sich als Akteurinnen im wissenschaftlichen Feld verstehen und dementsprechend auch ein inhärentes Interesse an einer Kompatibilität des eigenen Vollzugs mit den Ansprüchen und Standards des Systems Wissenschaft haben. Des Weiteren ist deutlich hervorzuheben, dass diese Arbeit sich in all ihren Analysen und Konstruktionen auf den heutigen bundesdeutschen Hochschulraum begrenzt.¹² Das Bewusstsein für historische Bedingtheiten und Kontingenzen ist explizit, jedoch nicht Gegenstand der Arbeit. Blicke über den bundesdeutschen Tellerrand werden vereinzelt getätigt – immer jedoch in der Absicht, das Wissen um die eigene Fokussierung zu schärfen.¹³ Außerdem ist klar zu benennen,
wurde 2017 unter medialer Aufmerksamkeit diskutiert und spiegelt die durchaus schwierige Situation wider, in der sich konfessionsgebundene Disziplinen hochschulpolitisch – und dann auch in Reflexion darauf wissenschaftstheoretisch – befinden. Zentral war dabei die Wortmeldung Ingolf U. Dalferths in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 04.05. 2017, in der er mit der Gründung einer solchen multikonfessionellen Fakultät die drohende „Abschaffung“ theologischer Fakultäten insgesamt prophezeite.Vgl. Dalferth, Ingolf U., Auf dem Weg zur Abschaffung, in: FAZ 103 (04.05. 2017), 7. Deutlicher Hintergrund seiner Wortmeldung sind seine eigenen Erfahrungen im US-amerikanischen Raum. Zu einer Auseinandersetzung mit den durchaus polemischen Vorwürfen Dalferths an die zuständige Kommission der Berliner Theologischen Fakultät an der HU vgl. Slenczka, Notger, Der Vorschlag einer Zusammenführung konfessionsgebundener Forschungs- und Lehrinstitute zu einer gemeinsamen Fakultät und die Anfrage von Professor Dr. Ingolf Dalferth in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung v. 4.5. 2017, v. a. 7– 10, PDF-Datei (22.05. 2017), https://www.theologie.hu-berlin.de/de/ professuren/stellen/st/Fakultaet%20der%20Theologien/fakultaet-der-theologien_slenczka.pdf – 04.02.21. Das konzeptuelle Desiderat bzw. vielmehr die Angewiesenheit einer solchen multikonfessionellen Einrichtung auf eigenständige Religionswissenschaft betont Hafner, Johann, Der blinde Fleck. Religions-Fakultät statt Theologien-Fakultät, in: HerKorr 5/71 (2017), 15 – 16, 15. 12 Mit dieser Einschränkung wird auch den pluralen spezifischen hochschulpolitischen Situationen religionsbezogener Wissenschaften in der BRD Rechnung getragen, wenngleich diese große Problematik selbst aus Gründen der Themenstellung und des Umfangs nicht Gegenstand dieser wissenschaftstheoretischen Arbeit sein kann, aufgrund ihrer Bedeutsamkeit für die konkrete Verfasstheit und den Vollzug religionsbezogener Wissenschaften aber idealiter sein sollte.Vgl. dazu z. B. Scheliha, Arnulf von, Religionsfreiheit und staatliche Lenkung. Chancen und Grenzen gegenwärtiger Religionspolitik in Deutschland, in: Ders., Religionspolitik. Beiträge zur politischen Ethik und zur politischen Dimension des religiösen Pluralismus, Tübingen 2018, 256 – 267, 260. 13 Wobei sich genau mit dieser expliziten Positionalität auch ein gewisser heuristischer Wert über den deutschsprachigen Hochschulraum hinaus ergibt, da gerade die im Kontext dieser Arbeit zu analysierende Problemlage einer schwierigen Verhältnisbestimmung für Wissenschaftler*innen
6
1 Prolegomena
dass sich diese Arbeit als ein explizit evangelisch-fundamentaltheologisches Vorhaben vollzieht:¹⁴ Zwar wird der Versuch unternommen, sich dem fachlichen Selbstverständnis von Religionswissenschaft in allen Arbeitsschritten anzunähern; dennoch kommt die Arbeit nicht aus der erkenntnistheoretischen Situation heraus, dass es sich eben um eine theologische Arbeit handelt, also um eine Analyse im Kontext evangelisch-theologischer Fach- und Denktraditionen. Noch näher lässt sich diese spezifische Positionalität verdeutlichen durch die Selbsteinordnung in das große Erbe der (weit verstandenen) liberalen Theologie: als dem Versuch, Theologie im Kontext der sie umgebenden erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Paradigmen zu durchdenken und sprachfähig zu halten. Solches gründet in der eigenen, westlich-europäisch, ostdeutsch, protestantisch geprägten Biografie der Autorin.¹⁵ Zur Anwendung kommt dabei – wie oben auch schon angedeutet – ein praktisches, konstruktivistisches Verständnis von Wissenschaft; als der sprachlich grundgelegten Tätigkeit agierender Subjekte, durch die Wissen aktiv hergestellt wird.¹⁶ Zentral ist dabei, dass solches Wissen intersubjektiv transparent generiert
aus dem deutschsprachigen Raum auch außerhalb diesem existent ist. Dennoch ist sich die Arbeit ihrer grundsätzlichen Partikularität und epistemischen Provinzialität bewusst – und steht damit in einem gewissen sowohl poststrukturalistischen als auch postkolonialen Erbe. 14 Was allein durch die offenkundige Gemengelage der jeweiligen Analysen und Konstruktionen deutlich wird (vgl. allein den Umfang von Kapitel 4 zu Kapitel 5): Zwar wird der Versuch unternommen, dem religionswissenschaftlichen Fachverständnis so nah wie möglich zu kommen. Doch vollzieht sich diese Arbeit eben als der Versuch einer Verhältnissetzung von Theologie zur Religionswissenschaft innerhalb des theologischen Diskurses bzw. aus diesem heraus, womit sie aus einer gewissen genuinen Übergriffigkeit nicht herauskommt. Diese Übergriffigkeit stellt ein Grundproblem der gesamten Arbeit dar, insofern als dass nicht nur die Debattenlage zwischen evangelischer Theologie und Religionswissenschaft hochgradig schwierig ist, sondern auch innerhalb der beiden Disziplinen selbst. Das Risiko, sich in derartige Kontroversen fundamentaltheologisch hineinzubegeben, ist ein von Anfang an bewusster denkerischer Hintergrund dieser Arbeit, die sich dementsprechend auch nicht als neutrale Deskription, sondern als proaktiver Versuch versteht, diesen Debattenraum für sich selbst zu vermessen und einen eigenständigen Beitrag in den inner- und interdisziplinären Diskursen anzubieten. 15 So gründet das fundamentaltheologische Interesse an der wissenschaftlichen Kommunikabilität evangelischer Theologie darin, im sowohl von Konfessionslosigkeit als auch eher konservativ orientierter lutherischer Landeskirchlichkeit geprägten Sachsen nicht nur aufgewachsen zu sein, sondern gerade da auch erste theologische Schritte in Auseinandersetzung mit einer sich deutlich als Gegenspielerin darstellenden Religionswissenschaft unternommen zu haben. Zentral für den auf Diskursivität ausgerichteten Ansatz dieser Arbeit war (und ist) dabei die eigene Perspektive auf vor allem gender- und queertheoretische Problematiken in Wissenschaft und Gesellschaft allgemein, durch die ein grundlegendes Interesse an der erkenntnistheoretischen Funktion und Macht von Sprache und Ontologie geweckt wurde. 16 Vgl. z. B. Mittelstraß, Jürgen, Die Möglichkeit von Wissenschaft (Stw 62), Frankfurt a. M. 1974, 158 ff.
1 Prolegomena
7
und diskursiv begründet und dadurch verlässlich bzw. legitimiert ist: „Das wissenschaftliche Wissen ist eine Art des Diskurses.“¹⁷ Der im Hintergrund der gesamten Arbeit angewandte (idealtypische)¹⁸ Diskursbegriff ist dabei dementsprechend zwar formal dominant, in seiner inhaltlichen Füllung allerdings schwach bzw. weit, nämlich verstanden als ein historischsoziokulturell bedingter gesellschaftlicher argumentativer Prozess,¹⁹ der nicht nur Inhalte in ihrer Deskriptivität darlegt, sondern dadurch auch präskriptiv Wahres/ Richtiges und Falsches normiert-normierend kontinuierlich-vorläufig ²⁰ verhandelt. ²¹ In diesem niedrigschwelligen Diskursbegriff ist auch das hier vorzustellende Konzept der Fragestellung als wissenschaftstheoretischem Differenzkriterium begründet: Es soll keinesfalls um eine sozusagen substantielle, material gefüllte Formulierung einer allen jeweiligen theologischen bzw. religionswissenschaftlichen Forschungsprojekten übergeordneten Master-Frage gehen. Vielmehr agiert das Konzept des Differenzkriteriums der Fragestellung idealiter auf diskursstruktureller Ebene. Vor dem Hintergrund des oben angerissenen Verständnisses von wissenschaftlichen Disziplinen als Diskursen, also als historisch-soziokulturell bedingten Tätigkeitssystemen, fungiert die Fragestellung als das Differenzkriterium, das diese Diskurse in ihrer wechselseitigen positionellen Abhängigkeit und in Gegenstandsbereich und Methode sich überschneidenden forschungspraktischen Verbundenheit diskursiv-identitätsstiftend strukturiert; ²² also die gedachten for-
17 Lyotard, Das postmoderne Wissen, 20. Hervorhebung C. N. 18 Vgl. Peukert, Helmut, Wissenschaftstheorie – Handlungstheorie – fundamentale Theologie. Analysen zu Ansatz und Status theologischer Theoriebildung (Stw 231), Frankfurt 32009, 286. 19 Vgl. Habermas, Jürgen, Theorie des kommunikativen Handelns. Band I. Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung, Frankfurt a. M. 21982, 39. 20 „Der Konsens ist ein Horizont, er wird niemals erworben.“ Lyotard, Das postmoderne Wissen, 177. 21 Grob in der Tradition von Michel Foucault und bzw. via Judith Butler. Vgl. dazu nur kurz Villa, Paula-Irene, (De)Konstruktion und Diskurs-Genealogie. Zur Position und Rezeption von Judith Butler, in: Becker, Ruth/Kortendiek, Beate (Hg.), Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung (Geschlecht und Gesellschaft), Wiesbaden 2010, 146 – 157, 149 f. Vgl. auch Petzoldt, Matthias, Sprache schafft Wirklichkeit. Zur Rezeption der Sprechakttheorie in der Fundamentaltheologie, Darmstadt 2020, 85 f. Vgl. exemplarisch auch Butler, Judith, Das Unbehagen der Geschlechter (Gender Studies 1722), Frankfurt a. M. 192018, 16 ff. 22 In ebendieser Hintergrundfolie des Verständnisses von Disziplinen als Diskursstrukturen mag dann vielleicht auch eine (im Kontext dieser Arbeit nicht leistbare, aber als Erfahrungswert immer implizit mitlaufende) denkerische Antwort auf die Frage liegen, warum diese Diskurse (von Religionswissenschaft und Theologie inter-, aber auch innerdisziplinär) an einer gegenseitigen Anerkennung im forschungspraktischen Vollzug nur allzu oft scheitern: In der unreflektierten Fokussierung der Vollzüge auf die je eigene Fragestellung und die darin mitgegebenen eigenen Sprachlogiken und -regeln ist die Entstehung von sozusagen toten Winkeln und daraus entste-
8
1 Prolegomena
malen Normpunkte im inner- und interdisziplinären Diskursnetz markiert, zwischen denen sich konkrete Forschungsprojekte je nach ihrer Verortung in den jeweiligen inner- und interdisziplinären Diskursen bewegen. Die Fragestellung ist im Kontext dieser Arbeit also keine materiale Schubladenkategorie, in die sich Disziplinen fein säuberlich einsortieren lassen, sondern eben ein formaler Diskursstrukturbegriff – und als solcher auf einer sozusagen metatheoretischen Ebene angesiedelt. Um dieses hier kurz angedeutete wissenschaftstheoretische Konzept darzulegen, verfolgt diese Arbeit in gewisser Weise einen leseleitenden Ansatz, mit der Absicht, den hier dahinter- bzw. vorliegenden unabgeschlossenen Denkprozess transparent, nachvollziehbar und überprüfbar aufzuzeigen. Im ersten Großkapitel soll zunächst ein Gefühl für die vielschichtigen Schwierigkeiten in der Beziehung zwischen Religionswissenschaft und evangelischer Theologie vermittelt werden, indem basal einführend auf die fachgeschichtlichen Verbindungslinien und institutionellen Verzahnungen eingegangen wird. Dabei wird der Versuch unternommen, die jeweilige Besonderheit der Fachlogik von Religionswissenschaft und Theologie in ihren Grundzügen der jeweils anderen Disziplin einsichtig zu machen. Daran schließt sich die grundlegende Explikation bzw. Setzung der Fragestellung als wissenschaftstheoretischem Differenzkriterium an, wobei auch hier wieder versucht wird, dabei der jeweiligen disziplinären Binnenlogik gerecht zu werden und die Anwendung des Differenzkriteriums der Fragestellung nicht als je fachfremdes Novum, sondern eben als extrahiert-konstruiertes²³ Strukturmerkmal aufzuzeigen. In den darauf folgenden zentralen Hauptkapiteln 4 und 5 werden die disziplinären Diskurse²⁴ vor dem Hintergrund eines kulturwissenschaftlich fokussierten
henden Inkommunikabilitäten vielleicht diskursprozesslogisch mitgegeben. Umso wichtiger erscheint der Übersetzungsbedarf sowohl zwischen den Disziplinen als auch innerhalb ihrer Substrukturen selbst. Denn „[i]m theoretischen Diskurs kommt es primär darauf an, das eigene Unrecht, die eigenen blinden Flecken zu erkennen und dialogisch zu beseitigen.“ Zima, Was ist Theorie?, 63. 23 So wird an entsprechenden Stellen immer wieder darauf hingewiesen werden, dass der Gedanke einer Fragestellung als Erkenntnisvollzüge unterscheidendes Merkmal zumindest in Ansätzen in verschiedenen Konzepten gefunden werden kann. Die in dieser Arbeit vorgeschlagene Setzung des Differenzkriteriums der Fragestellung steht somit einerseits in einer gewissen – maßgeblich hermeneutischen – Tradition, bezieht diese aber eben auf diskurstheoretische Gedankengänge neu, um sie so auf die formale Ebene der Diskursstruktur zu heben. 24 Aufgrund dieser Vorgehensweise ergibt sich eine gewisse, nicht ignorierbare diskursive Hegemonialität dieser Arbeit: Indem sozusagen der jeweilige Mainstream des Fachdiskurses untersucht wird, reiteriert bzw. aktualisiert diese Arbeit bestimmte dominante fachliche und soziokulturelle Diskursstrukturen in Bezug auf u. a. Herkunft, Perspektive, Alter und Gender. Vgl. dazu auch z. B.
1 Prolegomena
9
Wissenschaftsverständnisses dann auf genau dieses Strukturmerkmal – aktiv konstruierend – untersucht, so dass am Ende jeweils ein Formulierungsvorschlag für die den jeweiligen Fachdiskurs strukturierende Fragestellung steht. Im letzten Kapitel erfolgt dann eine nur noch kurze systematisierende Zusammenschau, die erneut die diskursstrukturellen Verbindungslinien und Differenzen anhand dieser Fragestellungen evoziert, um dadurch das Potential zu klarer Disziplinarität und damit gesteigerter Interdisziplinarität im Kontext eines sich immer weiter pluralisierenden und spezialisierenden Wissenschaftssystems aufzuzeigen. Der hier getätigte Vorschlag versteht sich insgesamt in seiner expliziten Positionalität als eben genau dies: Als eine historisch-soziokulturell bedingte, dementsprechend unabgeschlossene und vorläufige Möglichkeit, das Verhältnis zweier material und forschungspraktisch eng verwobener (Kultur‐) Wissenschaften in ihrer jeweiligen disziplinären Eigenständigkeit und historisch-soziokulturellen Bedingtheit²⁵ zu denken. Idealziel eines solchen Vorschlags wäre, wenn er im jeweiligen Fachdiskurs selbst betrachtet, intersubjektiv überprüft und – in positiver Annahme als nutzbar oder in negativer Ablehnung als diskursfremd – in den Diskurs selbst integriert wird. Bei aller Partikularität aufgrund von inhärenter Positionalität will diese Arbeit dadurch also dennoch ihren (fundamentaltheologischen) Teil zum großen Ganzen liefern und weiß sich diesem Großkontext auch abhängig und verpflichtet – denn höchstwahrscheinlich ist solch Vereinzeltes nur im Horizont eines Allgemeinen überhaupt denkbar.
Auga, Ulrike, Aus- oder Anschlüsse? Theologie – Geschlechtertheorie – Religionswissenschaft, in: Lanwerd, Susanne/Moser, Márcia E. (Hg.), Frau – Gender – Queer, Gendertheoretische Ansätze in der Religionswissenschaft, Würzburg 2010, 229 – 250, 234 f. 25 Denn auch die Nicht-/Existenz von Disziplinen ist positionell. Vgl. Krüger, Lorenz, Einheit der Welt – Vielheit der Wissenschaft, in: Kocka, Jürgen (Hg.), Interdisziplinarität. Praxis – Herausforderung – Ideologie, Frankfurt a. M. 1987, 106 – 125, 116 f.
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung Das Problem des wissenschaftstheoretischen Verhältnisses von Religionswissenschaft und Theologie ist so alt wie erstere selbst – und liegt höchstwahrscheinlich in den fachgeschichtlichen Entwicklungen begründet. Die Entstehung der Religionswissenschaft ging Hand in Hand mit einer von Anfang an schwierigen Beziehung zur Theologie. Dementsprechend ist – um ein Gefühl für die innere Fachlogik der jeweiligen Disziplin auch nur in Grundzügen zu vermitteln – eine kurze, basale Auseinandersetzung mit dem Wechselverhältnis der beiden Fachgeschichten zueinander unumgänglich. So soll nun im Folgenden einführend zuerst die Entstehung akademisch-institutioneller Religionswissenschaft (mit Fokus auf den bundesdeutschen Hochschulraum) in ihren Grundzügen dargelegt werden. Im Anschluss werden die Entwicklungslinien akademischer evangelischer Theologie in ihrem Bezug zum disziplinären Verhältnis zur Religionswissenschaft, maßgeblich als epistemische (und methodologische) Wende der Theologie hin zum Gegenstandsbereich der (christlichen) Religion, im entsprechenden zeitgeschichtlichen Kontext dargelegt. Diese ersten beiden Abschnitte abschließend folgt ein Einblick über die aktuelle institutionelle Situation von evangelischer Theologie und Religionswissenschaft im deutschsprachigen Hochschulraum. Um das Bewusstsein für die spezifische soziokulturelle Positionalität dieser Herangehensweise zu schärfen, wird in einem dritten Schritt exemplarisch die universitäre Situation von Religionswissenschaft und Theologie in Großbritannien kurz beleuchtet werden. Es geht also in diesem gesamten zweiten Kapitel grundsätzlich nicht um eine lückenlose Darstellung einer Wissenschaftshistorie, sondern – dem Thema dieser Arbeit gemäß – um das Aufzeigen einer schwierigen Beziehungsgeschichte.
2.1 Akademische Religionswissenschaft ab dem 19. Jahrhundert 2.1.1 Die Anfänge Einsteigend ist hier zunächst ganz grundsätzlich zu betonen, dass das Fach der Religionswissenschaft seine Ursprünge und Impulse durch Forschungen über Religion(en) natürlich nicht nur in der Theologie hat, sondern auch und maßgeblich in der Philologie, Ethnologie und Anthropologie, Soziologie u. v. a. Seine Wurzeln werden nicht selten (vereinfacht) im kritischen Reflektieren über Religion(en)
https://doi.org/10.1515/9783111091747-003
2.1 Akademische Religionswissenschaft ab dem 19. Jahrhundert
11
überhaupt gesehen¹ – so auch im hier fokussierten (deutschsprachigen) westeuropäischen Kontext. Je stärker spätestens ab dem 15./16. Jahrhundert der Kontakt zu anderen, nichteuropäischen Kulturräumen wurde, desto größer wurde auch das wissenschaftliche Interesse an deren Riten und Kulten.² Dieser kritisch-reflexive Ansatz verschärfte sich naturgemäß mit dem Zeitalter der Aufklärung zunehmend: Aufgrund des starken Interesses an nicht-christlichen Religionen verbunden mit dem aufklärerischen Diktum der Leitung der Vernunft bezeichnet sich Religionswissenschaft durchaus bis heute als „Kind der Aufklärungszeit“³. War da allerdings – in der innerdisziplinären Retrospektive – die Frage nach dem Wesen der Religion als einem Phänomen sui generis (dann oft verstanden als vernunftmäßige, über-kulturelle religio naturalis) vordergründig gewesen,⁴ so hat sich im Rahmen der geistesgeschichtlichen Weiterentwicklung der Aufklärung und des erstarkenden Positivismus langfristig der Fokus verschoben auf das Spezifische der Geschichte und die Konstitution der einzelnen positiven Religion.⁵ Das 19. Jahrhundert (bis hinein in die Anfänge des 20. Jahrhunderts) zeigte sich nunmehr als die konstituierende Phase akademischer Religionswissenschaft.⁶ So fallen in diesen Zeitraum nicht nur die ersten Lehrbücher für Religionsgeschichte;⁷ sondern auch erste Schritte in Richtung einer enzyklopädisch-disziplinären Grundlegung des Fachs wurden unternommen: Im religionswissenschaftlichen Fachdiskurs wird sich in diesem Zusammenhang besonders auf den Philologen und
1 Vgl. Wießner, Gernot, Religionswissenschaft, in: Strecker, Georg (Hg.), Kirchenrecht – Religionswissenschaft (GKT 10,1), Stuttgart 1994, 65 – 178, 65. Vgl. auch Figl, Johann, Einleitung. Religionswissenschaft – historische Aspekte, heutiges Fachverständnis und Religionsbegriff, in: Ders. (Hg.), Handbuch Religionswissenschaft. Religionen und ihre zentralen Themen, Innsbruck 2003, 18 – 80, 20. 2 Vgl. Mensching, Geschichte der Religionswissenschaft, Bonn 1948, 39 f. 3 Rudolph, Kurt, Geschichte und Probleme der Religionswissenschaft (SHR 53), Leiden/New York/ Köln 1992, 3. 4 Vgl. Klimkeit, Hans-Joachim, Art. Religionswissenschaft, in: TRE 29 (1998), 61 – 67, 64. 5 Vgl. Mensching, Geschichte, 49 f.Vgl. auch Kohl, Karl-Heinz, Geschichte der Religionswissenschaft, in: Cancik, Hubert/Gladigow, Burkhard/Laubscher, Matthias (Hg.), Systematischer Teil. Alphabetischer Teil: Aberglaube – Antisemitismus (HRWG 1), Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1988, 217– 262, 240. 6 Vgl. Kohl, Geschichte, 241. 7 Vgl. u. a. Chantepie de la Saussaye, Pierre Daniel, Lehrbuch der Religionsgeschichte. Erster Band (Sammlung theologischer Lehrbücher), Freiburg i. Br. 1887. Vgl. auch Meiners, Christoph, Allgemeine kritische Geschichte der Religionen, Hannover 1806/1807. Meiners wird z. B. von von Kurt Rudolph als einer der „Pioniere der deutschen Religionsgeschichte“ bezeichnet. Rudolph, Kurt, Die Religionsgeschichte an der Leipziger Universität und die Entwicklung der Religionswissenschaft. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte und zum Problem der Religionswissenschaft (SSAW.PH 1/107), Berlin 1962, 41.
12
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
Indologen Friedrich Max Müller bezogen, der v. a. auch durch seine umfassende Quellsammlung Sacred books of the East Grundlagen für das Studium von religionswissenschaftlich interessanten Texten schuf ⁸ und im Vorwort seiner Beiträge zur vergleichenden Religionswissenschaft grundsätzliche Reflexionen zu einer religionswissenschaftlichen Disziplin darlegte. Von der vergleichenden Sprachwissenschaft (in Anlehnung v. a. an Franz Bopp)⁹ herkommend, machte sich Müller für einen philologisch fundierten komparativen Ansatz in der Religionsforschung stark und gilt deswegen bis heute als Begründer vergleichender Religionswissenschaft.¹⁰ So griff z. B. auch Edmund Hardy, katholischer Theologe, Religionshistoriker und v. a. auch Indologe,¹¹ diesen Ansatz in seinem religionswissenschaftstheoretisch klassischen Beitrag Was ist Religionswissenschaft auf.¹² Hardy machte sich hier für Religionswissenschaft als eine eigenständige und empirisch fundierte Wissenschaft stark, die in einen historisch und einen vergleichend arbeitenden Zweig zu unterteilen sei.¹³ Gerade bei Müller, aber auch bei Hardy scheint der Bezug der Religionswissenschaft zu den sich ebenfalls in diesem Zeitraum immer mehr etablierenden anderen Kulturwissenschaften, wie eben auch der Philologie und Ethnologie,
8 Vgl. Klimkeit, Art. Religionswissenschaft, 65. 9 Vgl. Wießner, Religionswissenschaft, 115. 10 Vgl. Müller, Friedrich Max, Beiträge zur vergleichenden Religionswissenschaft. Nach der 2. englischen Ausgabe mit Autorisation des Verfassers ins Deutsche ü bertragen, in: Ders., Essays. Bd. 1, Leipzig 1869, XVII. Dabei scheint allerdings gleichsam deutlich, dass Müller die komparative Methode aus einem vielleicht nicht mehr dem heutigem Mainstream des religionswissenschaftlichen Fachverständnissen entsprechenden Interesses stark macht. Exemplarisch mag dafür folgendes Zitat stehen: „So weit wir die Geschichte zurückverfolgen können, finden wir die Urbestandteile und Wurzeln aller Religion gegeben; und die Geschichte der Religion […] zeigt uns überall nur neue Verbindungen und Mischungen derselben ursprünglichen Elemente.“ Ebd., VIII. Die von Müller anvisierte Suche nach den allen Religionen gemeinsamen Ursprungselementen, im Sinne eines Wesens der Religion gilt in weiten Teilen unter aktuelleren wissenschaftstheoretischen Gesichtspunkten nicht mehr als Absicht der Religionswissenschaft, wie schon Rudolph in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts konstatierte. Vgl. Rudolph, Die Religionsgeschichte, 13. So diagnostizierte dieser bei Müller auch nicht-religionswissenschaftliche, „theologische[…] Ideen“. Ebd., 14. (Zum Theologiebegriff der Religionswissenschaft vgl. Kapitel 4.4.2.) 11 Vgl. Haekel, Josef, Art. Hardy, Edmund, in: LthK3 4 (2006), 1189. 12 Vgl Hardy, Edmund, Was ist Religionswissenschaft? Ein Beitrag zur Methodik der historischen Religionsforschung (1898), in: Lanczkowski, Günter (Hg.), Selbstverständnis und Wesen der Religionswissenschaft (WdF 263), Darmstadt 1974, 1 – 29, 2. 13 Vgl. ebd., 3.7 f.14.17. Obwohl Hardy von der katholischen Theologie herkam, wurde er – aufgrund seiner streng historisch-empirischen methodologischen Grundlegung – selbst von Rudolph, der die theologischen Einflüsse auf deutschsprachige Religionsforschung als besonders gravierend bewertete, als Teil einer „gesunde[n] Entwicklung der deutschen Religionswissenschaft“ angesehen. Rudolph, Die Religionsgeschichte, 52.
2.1 Akademische Religionswissenschaft ab dem 19. Jahrhundert
13
deutlich.¹⁴ Darin begründet sich die bis heute starke philologische Orientierung der Religionswissenschaft auf Quelltexte etc. Dementsprechend war auch das erste fachliche „Organ“ für Religionswissenschaft, „das 1898 von Th. Achelis begründete ‚Archiv für Religionswissenschaft‘ von Philologen [u. a. Hardy] geleitet“.¹⁵ Unter Aufnahme der Forschungsergebnisse Müllers formierte sich auch die „erste Schule einer Religionswissenschaft“¹⁶, die sogenannte „naturmythologische Schule“, die den religionswissenschaftlichen Diskurs in Deutschland zunächst bestimmte.¹⁷ Parallel zu dieser philologisch-historischen Herangehensweise als einem grundlegenden Strang wurde auch eine philosophisch-psychologisierende Interpretation religiöser Phänomene stark. Exemplarisch können dafür William Jamesʼ Ausführungen zu seinen Vorstellungen einer „Science of Religions“¹⁸ stehen. Religiöse Erfahrungen und Inhalte galten im Zusammenhang eines zeitgenössischen verkürzenden Szientismus und Materialismus als rein subjektiv und damit einer wissenschaftlichen, also nach damaligem Verständnis objektiven Untersuchung nicht zugänglich. Dieser Annahme suchte James zu widersprechen, indem er religiöse Erfahrungen als real zeichnete; nämlich insofern, als dass ihr Erleben reelle Konsequenzen im Handeln des religiösen Individuums habe.¹⁹ Dadurch konnte er Religion, verstanden als ein Bewusstseinszustand,²⁰ zum Untersuchungsgegenstand einer Religionswissenschaft machen, deren Aufgabe er darin sah, zwischen Wissenschaft und Religiosität zu vermitteln.²¹ Dafür wäre metaphysisch-deduktiv ar-
14 Womit an dieser Stelle bereits einem sozusagen monokausal antitheologischen Ursprung von Religionswissenschaft widersprochen wird. Vgl. dazu Berner, Ulrich, Braucht Religionswissenschaft konfessionelle Theologie?, in: Alkier, Stefan/Heimbrock, Hans-Günter (Hg.), Evangelische Theologie an staatlichen Universitäten. Konzepte und Konstellationen evangelischer Theologie und Religionsforschung, Göttingen 2011, 243 – 261, 246. 15 Rudolph, Die Religionsgeschichte, 49 f. 16 Wießner, Religionswissenschaft, 115. 17 Vgl. Rudolph, Die Religionsgeschichte, 46 f. Die grundlegende These der naturmythologischen Schule war die Annahme, dass Gottheiten etc. die aus Urängsten der Menschen entstandenen Personifizierungen von Naturmächten waren. Vgl. Wießner, Religionswissenschaft, 115. Andere, darauf zum Teil reagierende religionswissenschaftliche Theorien, die – ihrem wissenschaftsgeschichtlichen Kontext entsprechend – nach dem Ursprung bzw. der Ursache von Religion forschten, waren z. B. der Animismus (in Anlehnung an Sir Edward Burnett Tylor) oder der Urmonotheismus (nach Andrew Lang), aber auch der Manismus, Totemismus, Präanimismus, oder Magismus. Vgl. Rudolph, Die Religionsgeschichte, 17. 18 James, William, The Varieties of religious Experience. Edited with an Introduction and Notes by Matthew Bradley, Oxford 2012, 347. 19 Vgl. ebd., 390 f. 20 Vgl. Herms, Eilert, Radical Empiricism. Studien zur Psychologie, Metaphysik und Religionstheorie William Jamesʼ, Gütersloh 1977, 248. 21 Vgl. James, The Varieties, 387.
14
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
beitende Philosophie in kritisch-induktive Science of Religions umzuwandeln, deren Aufgabe James dann nicht allein im Sammeln empirischer Fakten über Religion(en) sah, sondern im Kritisieren religiöser Inhalte vor dem Hintergrund ihrer Geschichte und unter Beachtung aktuell-zeitgenössischer wissenschaftlicher Erklärungsmodelle.²² Dabei sollte die Science of Religions religiöse Ansichten mit wissenschaftlichen Weltbildern in Kongruenz bringen, ohne dabei auf der einen Seite religiöse Inhalte auf szientistische Perspektiven zu reduzieren und ohne auf der anderen Seite selbst Religion zu substituieren. Denn als Wissenschaft seien ihr Grenzen gesetzt: Sie höre da auf, wo der „over-belief“, also die inhaltlich-supranaturale Deutung religiöser Erfahrungen durch das Individuum, anfängt.²³ Gleichzeitig schrieb James dieser Religionswissenschaft die Aufgabe zu, nach den allen Religionen gemeinsamen Aspekten zu suchen, so dass ihr auch im interreligiösen Dialog eine vermittelnde Rolle zukäme.²⁴ Weitere wichtige Impulse zur Entwicklung der Religionswissenschaft kamen dann in der Geschichte ihrer Entstehung v. a. aus der Soziologie: Die durch den Positivismus Auguste Comtes angeregte soziologische Schule aus Frankreich gab den Anstoß, Religion unter primär soziokulturellen Gesichtspunkten zu betrachten, was neben der philologisch-historischen und der philosophisch-psychologisierenden Herangehensweise den dritten Strang religionswissenschaftlicher Forschung bildete. Fortgeführt wurde diese empirische Herangehensweise der Religionsforschung durch die sich als spezielle Forschungslinie abzweigende Religionssoziologie, wie sie bekanntlich maßgeblich durch Émile Durkheim und Max Weber begründet wurde.²⁵ In seinem Werk Die elementaren Formen des religiösen Lebens untersuchte Durkheim die Kulte „archaischer“ Religionen mit dem Impetus, die grundlegende gesellschaftliche Struktur und Bedeutung von Religion(en) zu erfassen. Dabei kennzeichnete er Religion als eine „eminent soziale Angelegenheit“,²⁶ deren Erforschung nach streng wissenschaftlichen Methoden zu erfolgen habe.²⁷ Durkheim zeigte so grundlegend, dass zum Zweck wissenschaftlicher Forschung eine objektive,
22 Vgl. ebd., 346 f. 23 Vgl. ebd., 370 f. 24 Vgl. ebd., 347. 25 Vgl. Wießner, Religionswissenschaft, 124.Vgl. Pickel, Gert, Religionssoziologie. Eine Einführung in zentrale Themenbereiche, Wiesbaden 2011, 87. 26 Durkheim, Émile, Die elementaren Formen des religiösen Lebens. Aus dem Französischen von Ludwig Schmidts, Frankfurt a. M. 2007, 25. 27 Vgl. Waardenburg, Jacques, Classical Approaches to the Study of Religion. Aims, Methods and Theories of Research. Bd. 1. Introduction and Anthology, New York/Berlin 1999, 44.
2.1 Akademische Religionswissenschaft ab dem 19. Jahrhundert
15
also wertfreie Betrachtung des Forschungsgegenstands unumgänglich sei²⁸ – ein bis heute in der Religionswissenschaft zwar viel diskutierter, aber eben immer noch zentraler Grundsatz.²⁹ Somit bestehe kein innerer Widerspruch in der wissenschaftlichen Erforschung des (vermeintlich) irrationalen Phänomens von Religion(en); vielmehr sei Religion eine (soziale) Realität und somit per se Forschungsgegenstand.³⁰ Weber stellte wie Durkheim die Frage nach der sozialen Bedeutung von Religion und schuf damit (nicht nur) religionswissenschaftlich schulbildende Theorien für die Forschung über Religion(en). So untersuchte er die empirischen Zusammenhänge zwischen Religionszugehörigkeit bzw. Konfessionalität und sozialem Status und den daraus resultierenden gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen,³¹ v. a. und grundlegend in seiner Schrift Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Dabei trug er grundlegend zur Klärung der Frage nach dem Verhältnis von Wissenschaft und Religion und somit der Forschung über Religion bei, indem er (religiös motivierten) ethischen Werturteilen eine eigene Bedeutsamkeit zuordnete und sie somit als Gegenstand der wissenschaftlichen Reflexion zugänglich zeigte.³² Was diese – überblicksartig und exemplarisch knappen – Betrachtungen implizieren, ist, dass die Anfänge der Religionswissenschaft nicht in einer einzelnen Disziplin lagen, sondern eher im Interesse an Religion und Religionen konkreter forschenden Personen, die aus verschiedensten Fächern, wie zu großen Teilen der Philologie, Ethnologie aber auch Soziologie, kamen. Dass zwar auch von Seiten der Theologie das Anliegen groß war, Erkenntnisse über „fremde“ Religionen zu erlangen, ist gut nachvollziehbar – sei es, dass zwecks apologetischer Reflexionen über das Verhältnis der eigenen zu anderen Religionen Informationen über ver-
28 Vgl. Durkheim, Die elementaren, 13 ff. 29 Durkheims Herangehensweise wirkte im weiteren Fortlauf schulbildend. Seine Interpretation von Religion als gesellschaftlicher Funktion (der Integration) wurde weiterentwickelt – u. a. von Marcel Mauss, der eine vollkommene Interdependenz von Individuum und Gesellschaft konstatierte und dementsprechend jede evolutionistische Interpretation von Religion ablehnte. Vgl. Waardenburg, Classical Approaches, 45. Dadurch „fügte sich Mauss im Grunde schon in die vorherrschende, wertungsfreie Problemsicht des 20. Jahrhunderts ein, in der die Frage nach dem Ursprung der Religion keine entscheidende Rolle mehr spielt[e].“ Wießner, Religionswissenschaft, 125. 30 Vgl. Durkheim, Die elementaren, 629. 31 Vgl. Pickel, Religionssoziologie, 91. 32 Vgl. Küenzlen, Gottfried, Max Weber. Wissenschaft und Religion. Ein Rekonstruktionsversuch in gegenwartsdiagnostischer Absicht, in: Bienfait, Agathe (Hg.), Religionen verstehen. Zur Aktualität von Max Webers Religionssoziologie, Wiesbaden 2011, 150 – 176, 152 f.159. Vgl. Weber, Max, Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, in: Ders., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen 71988, 146 – 214, 149 ff.
16
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
schiedenste Religionen von Interesse waren oder sei es, dass ein missionarisches Anliegen bestand.³³ Dennoch ist an dieser Stelle grundsätzlich zu betonen, dass heutige akademische Religionswissenschaft ihren Ursprung nicht allein im theologischen Kontext hat, sondern vielmehr in mindestens drei überdisziplinären Strängen, hier systematisiert als in einer historisch-philologischen, einer philosophisch-psychologisierenden und einer empirisch-soziologischen Herangehensweise.
2.1.2 Die Institutionalisierung Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts begann die akademische Institutionalisierung der Religionswissenschaft (zunächst häufig noch unter dem Namen „Religionsgeschichte“).³⁴ Dabei ist augenfällig, dass – trotz der disziplinär pluralen Ursprünge des Faches – dies zunächst oft im Kontext von Theologie geschah. So entstand 1873 der erste Lehrstuhl für „Allgemeine Religionsgeschichte“ an der theologischen Fakultät der Universität zu Genf.³⁵ 1877/78 wurden zwei konfessionell unabhängige Lehrstühle an den staatlichen Universitäten in Leiden und Amsterdam eingerichtet, allerdings mit zwei Theologen (Cornelis Pieter Tiele und Pierre Daniel Chantepie de la Saussaye)³⁶ besetzt.³⁷ 1879 wurde mit dem protestantischen
33 Gerade im 19. Jahrhundert beginnt sich auch die Missionswissenschaft als akademisches Fach zu etablieren. Schleiermacher ordnete sie in seiner Kurzen Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen in die praktische Theologie ein (§ 298). Vgl. auch Ustorf, Werner, Art. Missionswissenschaft, in: TRE 23 (1994), 88 – 98, 91. Vgl. dazu noch Kapitel 5.1.1. 34 Näheres zur Bedeutung des Historischen für Religionswissenschaft in Kapitel 4. 35 Vgl. Figl, Einleitung, 22. Allerdings wurde diese Professur – nachdem sie zwischenzeitlich aufgehoben war – 1895 an die Faculté des Lettres verlegt. Vgl. Clemen, Carl, Allgemeine Religionsgeschichte im Schul- und Universitätsunterricht, in: PrJ 1/152 (1913), 217– 227, 221. 36 Tiele und Chantepie de la Saussaye können zusammen mit Müller als „Gründungsväter“ der Religionswissenschaft angesehen werden. Vgl. Figl, Einleitung, 23. Tiele gab im Rahmen der GiffordVorlesungen eine enzyklopädisch-disziplinäre Einführung in die Religionswissenschaft. Vgl. Tiele, Cornelis Petrus, Einleitung in die Religionswissenschaft. Bd. 1. I. Teil: Morphologie, Gotha 1899, 1 – 25. Chantepie de la Saussaye war Autor eines der ersten Lehrbücher für Religionsgeschichte, welches in seiner ersten Auflage von 1887 als erstes Beispiel gelten kann für eine bereits bestehende praktische Anwendung der von Joachim Wach in seiner noch näher zu besprechenden Habilitationsschrift geforderten Zweiteilung von Religionswissenschaft in einen historischen und einen systematischen Zweig.Vgl. Haas, Hans, Joachim Wach. Prolegomena zur Grundlegung der Religionswissenschaft, in: Hase, Thomas/Espig, Christian (Hg.), 100 Jahre Leipziger Religionswissenschaft. Ausgewählte Texte, Leipzig 2012, 57– 63, 62. (Siehe dazu auch Kapitel 2.1.3.) In der Tat ist das Inhaltsverzeichnis Chantepie de la Saussayes Lehrbuch der Religionsgeschichte von 1887 unterteilt in einen einerseits allgemeinen, phänomenologischen und ethnografischen Teil und einen andererseits historischen Teil. Vgl.
2.1 Akademische Religionswissenschaft ab dem 19. Jahrhundert
17
Theologen Albert Réville am Collège de France eine Professur für Histoire des religions eingerichtet.³⁸ Réville wurde 1886 Direktor an der École pratique des Hautes Études, an der im gleichen Jahr ein Forschungsinstitut für Religionswissenschaft, die Ve Section des sciences religieuses, eingerichtet wurde, die – aufgrund ihrer dominant historisch-philologischen Ausrichtung – bald zu „einer der bedeutendsten Forschungsstätten“³⁹ wurde. In Brüssel wurde der erste Lehrstuhl für Religionsgeschichte 1884 ins Leben gerufen. Die erste Professur für Religionsgeschichte in den USA wurde 1890 an der Cornell University in der Sage School of Philosophy eingerichtet.⁴⁰ In Deutschland hingegen ging die Institutionalisierung einer eigenständigen Religionswissenschaft langsamer von statten – wohl auch aufgrund eines starken Interesses von Theologie an religionswissenschaftlicher Forschung.⁴¹ Dabei wurden nichtsdestotrotz schon vor einer Institutionalisierung Lehrveranstaltungen zu religionswissenschaftlichen Themen gegeben: An der Universität Leipzig z. B. wurde bereits im Wintersemester 1841/42 durch den Ägyptologen Gustav Seyffarth und 1865/66 durch den Philosophen Karl Rudolf Seydel über allgemeine Religionsgeschichte gelesen.⁴² Der Göttinger Neutestamentler Wilhelm Bousset referierte bereits ab 1897/98 über Religionsgeschichte.⁴³ Ab 1905 hielt Alfred Jeremias verschiedene Vorlesungen über religionsgeschichtliche Themen. Ebenso las Martin Rade 1906 eine Einführung in Religionsgeschichte. Otto Pfleiderer arbeitete seit 1875 in Berlin religionsgeschichtlich. Sein Lehrstuhl (auf den er Schleiermacher gefolgt war) wurde 1910 in die erste Professur in Deutschland für „Allgemeine Religionsgeschichte und Religionsphilosophie“⁴⁴ umgewandelt und mit Edvard Lehmann besetzt.⁴⁵
Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte1, VIIff. Bereits in der zweiten Auflage von 1897 fehlt dieser erstere (von Hans Haas als „systematisch“ bezeichnete) Teil bzw. ist dieser zusammengeschrumpft auf zwei einleitende Paragraphen über Religionswissenschaft und Religion im Allgemeinen. Vgl. Chantepie de la Saussaye, Pierre Daniel, Lehrbuch der Religionsgeschichte. Erster Band. Zweite völlig neu gearbeitete Auflage (Sammlung theologischer Lehrbücher), Freiburg i. Br./Leipzig 21897, V. 37 Vgl. Kohl, Geschichte, 241. 38 Vgl. Mensching, Geschichte, 67. 39 Kohl, Geschichte, 241. 40 Vgl. Clemen, Allgemeine, 221. 41 Vgl. Kohl, Geschichte, 241. 42 Vgl. Rudolph, Geschichte, 324. 43 Vgl. dazu und zum Folgenden ders., Die Religionsgeschichte,61 ff. Zur sogenannten Religionsgeschichtlichen Schule, zu der auch Bousset zu zählen ist, siehe 2.2.3. 44 Laut RGG1 wurde der erste Lehrstuhl für Religionsgeschichte in Deutschland bereits 1904 an einen Theologen erteilt – wo und an wen bleibt ungenannt. Vgl. Rade, Martin, Art. Religionsge-
18
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
Gerade am Beispiel dieses Lehrstuhls lässt sich das schwierige Verhältnis zwischen Theologie und Religionswissenschaft an einem geradezu klassischen Musterbeispiel darlegen: Denn bis heute gilt Adolf (von) Harnacks Berliner Rede von 1901, in der er sich deutlich gegen die Umwandlung der theologischen in eine Fakultät für allgemeine Religionsgeschichte aussprach, als paradigmatisch für das vielschichtige Verhältnis zwischen Religionswissenschaft und Theologie. Seine Beweggründe waren dabei u. a. wissenschaftstheoretisch-philosophischen Charakters: So genüge es nicht, Religionen nur unter dem Aspekt ihrer historischen Entstehung zu untersuchen. Nicht nur die Geschichte, sondern auch Inhalte, Praktiken, Sprache und v. a. die soziokulturelle Kontextualisierung insgesamt müsse bei jedem Forschungsvorhaben über Religionen zwingend berücksichtigt werden, will man ein vollständiges Bild erlangen: „Wie soll man nun der Theologischen Facultät zumuthen, alle diese Studien, d. h. nicht weniger als die gesammte Sprachwissenschaft und Geschichte, in ihre Mitte aufzunehmen? Weist man ihr aber nur die von Sprache und Geschichte losgelöste Religionsgeschichte zu, so verurtheilt man sie zu einem heillosen Dilettantismus.“⁴⁶ Da Theologie den erstgenannten umfassenden Anforderungen in Bezug auf das Christentum aber bereits gerecht würde, sah Harnack überhaupt keine Notwendigkeit zur Transformation des Forschungsgebiets seiner Fakultät in allgemeine Religionsgeschichte, denn – so sein mittlerweile paradigmatisch gewordener Spruch: „Wer diese Religion [das Christentum] nicht kennt, kennt keine, und wer sie sammt ihrer Geschichte kennt, kennt alle.“⁴⁷ Harnack wertete somit in der Konsequenz – wohl durchaus aus Interesse an der Wahrung qualitativ hochwertiger akademisch-theologischer Forschung – eigenständiges religionswissenschaftliches Arbeiten grundlegend ab und beeinflusste das schichte und Religionsgeschichtliche Schule, in: RGG1 4 (1913), 2183 – 2200, 2185. Vgl. ebenso Rudolph, Die Religionsgeschichte, 62. 45 Vgl. ders., Geschichte, 12. 46 Harnack, Adolf von, Die Aufgabe der theologischen Facultäten und die allgemeine Religionsgeschichte. Rede zur Gedächtnisfeier des Stifters der Berliner Universität König Friedrich Wilhelm III, Berlin 1901, 9. Ob Harnack hierbei ein zutreffendes Bild von religionswissenschaftlicher Forschung hatte, ist natürlich fraglich. 47 Ebd., 10, Hervorhebung C. N. Harnack zitierte hier indirekt Müller und wertete dessen Votum um, der im Rahmen seiner am Londoner Royal Institut gehaltenen Vorlesungen die Notwendigkeit der historischen und vergleichenden Erforschung (möglichst) aller Religionen durch ein wiederum indirektes Goethe-Zitat wie folgt markant begründete: „Wer eine [Religion] kennt, kennt keine.“ Müller, Friedrich Max, Erste Vorlesung. Gehalten am XIX. Februar MDCCCLXX an der Royal Institution in London, in: Ders., Einleitung in die vergleichende Religionswissenschaft. 4 Vorlesungen im Jahre MDCCCLXX an der Royal Institution in London gehalten. Nebst zwei Essays „Über falsche Analogien“ und „Über Philosophie der Mythologie“, Straßburg 1874, 1 – 93, 13. Vgl. Goethe, Johann Wolfgang, Maximen und Reflexionen (Bibliothek des 18. Jahrhunderts), Leipzig 1988, 37: „Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.“
2.1 Akademische Religionswissenschaft ab dem 19. Jahrhundert
19
Verhältnis zwischen Theologie und Religionswissenschaft damit nachhaltig negativ. Gleichzeitig könnte man ihm aber auch den indirekten „Verdienst [zurechnen], daß er die allgemeine Religionsgeschichte grundsätzlich in die philosophische Fakultät verwiesen hat.“⁴⁸ Die Konsequenz von Harnacks Abwehrhaltung gegen Religionsgeschichte sollte deren „Abwanderung“ zunächst an philosophische, später an kultur- oder sozialwissenschaftliche Fakultäten sein:⁴⁹ So entstand eben nicht nur (aus Pfleiderers Lehrstuhl) eine Professur für Religionsgeschichte, sondern diese ging des Weiteren 1914 an die philosophische Fakultät über.⁵⁰ Im Laufe der nächsten Jahre entstanden weitere religionswissenschaftliche Lehrstühle. z. B. wurde 1912 an der theologischen Fakultät der Universität Leipzig ein Lehrstuhl für Religionsgeschichte eingerichtet und mit Nathan Söderblom besetzt,⁵¹ der bereits seit 1901 Professor für Religionsgeschichte in Uppsala war.⁵² 1920 kam Friedrich Heiler an den Lehrstuhl für Religionsgeschichte und -philosophie in Marburg, wo bereits seit 1917 Rudolf Otto religionswissenschaftlich wirkte.⁵³ Heiler und Otto, aber auch Söderblom, waren Vertreter der klassischen Religionsphänomenologie,⁵⁴ die einerseits über Klassifizierungen und Analysen nach dem Wesenhaften religiöser Phänomene suchte und andererseits religiöse Erscheinungen, Objekte etc. anhand ihrer Wesenszüge kategorisieren wollte.⁵⁵ Auf Gustav Mensching, selbst ein etwas späterer Vertreter dieser Richtung, geht wohl die markante Bezeichnung als „Religionswissenschaft des Verstehens“⁵⁶ zurück: In Anlehnung an die phänomenologische Reduktion Edmund Husserls und die wis-
48 Rudolph, Die Religionsgeschichte, 61 f. 49 Vgl. Hock, Klaus, Einführung in die Religionswissenschaft (Einführung Theologie), Darmstadt 2002, 162. 50 Vgl. Rudolph, Die Religionsgeschichte, 63. 51 Vgl. Kohl, Geschichte, 251. 52 Vgl. Fitschen, Klaus, Nathan Söderblom. Religionswissenschaftler, Kirchenmann, Friedensnobelpreisträger, in: Journal Universität Leipzig 3 (2012), 21. 53 Vgl. Kohl, Geschichte, 251. 54 Weitere Vertreter: J. Wach, G. van der Leeuw, J. W. Hauer, M. Eliade, K. Goldammer, … Vgl. Figl. Einleitung, 24. Religionsphänomenologie schien einem idealistisch-romantischen Zeitgeist zu entsprechen und war wohl deswegen gerade in der Weimarer Zeit en vogue. Vgl. Flasche, Rainer, Religionsmodelle und Erkenntnisprinzipien der Religionswissenschaft in der Weimarer Zeit, in: Cancik, Hubert/Bausinger, Hermann (Hg.), Religions- und Geistesgeschichte der Weimarer Republik. 6. Tübinger Religionswissenschaftliche Ringvorlesung, Düsseldorf 1982, 261 – 276, 261 ff. Gerade Ottos religionsphänomenologische Monografie Das Heilige, in dem Otto eben jenes Heilige, Numinose als das Wesen aller Religion darlegte, war lange Zeit ein Bestseller. So erschienen allein zwischen 1917 und 1929 22 Auflagen. Vgl. ebd., 267. 55 Vgl. dazu und zum Folgenden Figl, Einleitung, 24 f. 56 Mensching, Geschichte, 83. Vgl. auch Figl, Einleitung, 24.
20
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
senschaftstheoretische Bestimmung der Geisteswissenschaften als Wissenschaften des Verstehens durch Wilhelm Dilthey versuchte die klassische Religionsphänomenologie durch „intuitives Nacherleben, kongenialisches Nachvollziehen, Schauen der wahren Intention, Mitfühlen, Einfühlen [und] Nachbilden“⁵⁷ das Wesen der Religion zu ergründen. Denn nur über das individuelle Erleben durch die sie untersuchende Person sei Religion als ein dem Menschen genuines Medium der Wirklichkeitserfahrung zu erforschen.⁵⁸ Dadurch wurde „das subjektive Element im religionswissenschaftlichen Erkenntnisvorgang zum Maßstab allen Vorgehens“⁵⁹, was innerhalb der religionswissenschaftlichen Fachdiskurse in der Retrospektive teilweise als Öffnung hin zu einem gewissen Irrationalismus interpretiert wurde und wird.⁶⁰ Ungeachtet dieser Einschätzung war diese Form klassischer Religionsphänomenologie lange Zeit prägend für deutsche Religionswissenschaft⁶¹ bzw. für den wissenschaftstheoretischen Diskurs und damit auch für das Verhältnis zur Theologie.⁶²
2.1.3 Joachim Wach und die wissenschaftstheoretische Grundlegung Von zentraler wissenschaftstheoretischer Bedeutung für die Etablierung einer eigenständigen Religionswissenschaft gelten die Ausführungen Wachs. In seiner
57 Flasche, Religionsmodelle, 269. 58 Zur Methodologie der Religionsphänomenologie vgl. z. B. Leeuw, Gerardus van der, Phänomenologie der Religion (NTG), Tübingen 1933, 646 ff. 59 Flasche, Religionsmodelle, 271. 60 Solches entspricht zu großen Teilen nicht mehr heutigem religionswissenschaftlichen Selbstverständnis. So legt z. B. die Leipziger Religionswissenschaft deutlichen Wert darauf, ihr eigenes Arbeiten nicht im Erbe der Religionsphänomenologie zu sehen, obwohl es ja Söderblom – der dennoch aufgrund seines enormen wissenschaftlichen Verdienstes v. a. im Bereich der Religionsgeschichte als „umfassender Gelehrter“ anerkannt wird – war, der die erste religionsgeschichtliche Professur in Leipzig innehatte. Vielmehr wird als positives Merkmal hervorgehoben, dass es in der Geschichte der institutionalisierten Leipziger Religionswissenschaft nur zwei Religionsphänomenologen (nämlich Söderblom und Wach) gab.Vgl. Hase, Thomas/Espig, Christian, Zu diesem Band, in: Dies. (Hg.), 100 Jahre Leipziger Religionswissenschaft. Ausgewählte Texte, Leipzig 2012, 7 f., 7. 61 Zu neueren religionsphänomenologischen Zugriffen in der Religionswissenschaft vgl. Kap. 4.2.3. 62 Rudolph kennzeichnete die religionsphänomenologische Richtung als eigentlich (krypto‐) theologisch und sah hierin einen Grund dafür, dass Religionswissenschaft in Deutschland sich lange nicht von der Theologie emanzipierte: „Wenn die Religionswissenschaft in Deutschland heute noch vielfach mit theologischen und dogmatischen Begriffen und Methoden operiert, so ist das nicht zuletzt dem Einfluß dieser theologisch-religionswissenschaftlichen Schule zuzuschreiben“. Rudolph, Die Religionsgeschichte, 18.
2.1 Akademische Religionswissenschaft ab dem 19. Jahrhundert
21
Habilitationsschrift Religionswissenschaft. Prolegomena zu ihrer wissenschaftstheoretischen Grundlegung von 1924 unterteilte er die Disziplin in einen historischen und einen systematischen Zweig, nämlich in „Religionsgeschichte“ und „Systematische (bzw. allgemeine und/oder vergleichende) Religionswissenschaft“ als ihre beiden Hauptfächer, denen alle anderen Unter- bzw. Teildisziplinen zuzuordnen seien.⁶³ Damit prägte Wach die akademische Religionswissenschaft maßgeblich, so dass im Folgenden kurz auf seine Person als Wissenschaftler und die Grundzüge seiner Habilitationsschrift eingegangen werden soll. Wach, 1898 in Chemnitz als Nachfahre Felix Mendelssohn-Bartholdys geboren, begann 1918 sein Studium zunächst an der philosophischen Fakultät der Universität Leipzig, studierte aber auch in München (u. a. bei Heiler), in Freiburg (bei Husserl) und in Berlin, wo er mit der Theologie Harnacks und Ernst Troeltschs in Kontakt kam.⁶⁴ 1922 wurde er in Leipzig zum Dr. phil. promoviert; zwei Jahre später habilitierte er sich mit oben genannter Arbeit, wodurch es in „Leipzig erstmalig einen Dozenten für Religionswissenschaft in der Philosophische[n] Fakultät“⁶⁵ gab. Des Weiteren erhielt Wach 1927 ebenfalls in Leipzig den deutschlandweit ersten Lehrauftrag für Religionssoziologie; 1929 wurde er schließlich zum Professor für Religionswissenschaft ernannt. Die nächsten Jahre lehrte und forschte Wach (hauptsächlich in Leipzig) – bis er 1935 „aus rassenpolitischen Gründen […] als Nichtarier“⁶⁶ sein Amt aufzugeben gezwungen war. Es folgte die Emigration in die USA, wo er religionswissenschaftliche Professuren zunächst an der Brown University in Providence, Rhode Island⁶⁷ und später an der Divinity School der University of Chicago innehatte.⁶⁸ Wach starb 1955 während eines Familienaufenthalts in Locarno. In seiner Habilitationsschrift ging Wach grundlegend auf das Problem bzw. die Notwendigkeit einer eigenständigen akademischen Religionswissenschaft ein. So konstatierte er zunächst die Unabgeschlossenheit ihres Emanzipationsprozesses „von anderen, sie bevormundenden Geisteswissenschaften“⁶⁹ wie eben der Theologie, Geschichte, Philologie etc. Zwar nutzten jene Fächer religionswissenschaftliche Forschung für ihre eigenen Anliegen, doch seien deren Vorgehensweisen,
63 Vgl. Flasche, Rainer, Die Religionswissenschaft Joachim Wachs, Berlin 1978, 179. 64 Vgl. dazu und zum Folgenden Rudolph, Die Religionsgeschichte, 138 ff. Flasche, Die Religionswissenschaft, 18 ff. Zu Troeltsch vgl. 2.2.3. 65 Rudolph, Geschichte, 332. 66 Flasche, Die Religionswissenschaft, 20. 67 Vgl. Rudolph, Die Religionsgeschichte, 140 f. 68 Vgl. Flasche, Die Religionswissenschaft, 24. 69 Wach, Joachim, Religionswissenschaft. Prolegomena zu ihrer wissenschaftstheoretischen Grundlegung (ThST 13), Waltrop 2001, 1 f.
22
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
Aufgaben und Interessen nicht mit denen der Religionswissenschaft identisch.⁷⁰ „Den Gegenstand der Religionswissenschaft bildet die Mannigfaltigkeit der empirischen Religionen. Sie gilt es zu erforschen, zu verstehen und darzustellen. Und zwar wesentlich nach zwei Seiten hin: nach ihrer Entwicklung und nach ihrem Sein, ‚längsschnittmäßig‘ und ‚querschnittmäßig‘. Also eine historische und eine systematische Untersuchung der Religionen ist die Aufgabe der Religionswissenschaft.“⁷¹ Innerhalb des religionsgeschichtlichen Zweiges solle also die Genese empirisch vorfindlicher Religionen diachron untersucht und (systematisch) dargestellt werden. Die Systematische Religionswissenschaft hingegen sei der synchron arbeitende, verstehende ⁷² Teil religionswissenschaftlichen Arbeitens, in dem versucht werde, das Typische, Wesenhafte eines bestimmten religiösen Phänomens zu eruieren.⁷³ Dabei kennzeichne sich Religionswissenschaft durch ihre streng empirische, nicht-normative Grundlegung, die sie vor allem auch von der Theologie unterscheide.⁷⁴ Mit diesen Ausführungen aus seinem Frühwerk hatte Wach Religionswissenschaft als eine eigenständige Disziplin wissenschaftstheoretisch dargelegt;⁷⁵ die von ihm vorgestellte Zweigliedrigkeit des Faches in einen systematischen resp. vergleichenden/allgemeinen und einen historischen Zweig spiegelt sich teilweise bis heute in der akademischen Religionswissenschaft wider.⁷⁶
2.1.4 Manifestation der Fronten im 20. Jahrhundert Wach wirkte im weiteren Verlauf seiner akademischen Tätigkeit schulbildend. Innerhalb des religionswissenschaftlichen Fachdiskurses wird dabei aber wohl v. a. auf sein Frühwerk Bezug genommen, da seine wissenschaftliche Arbeit später einen gewissen Wandel durchlebt habe, der biografisch an seiner Emigration nach Amerika, namentlich seiner Chicagoer Zeit, festgemacht wird. Im Zuge seiner
70 Vgl. ebd., 14 f. 71 Ebd., 21 f. Hervorhebung C. N. 72 Hier sind die bereits weiter oben genannten Einflüsse der Diltheyschen Bestimmung von Geisteswissenschaften als verstehende Wissenschaften deutlich. Vgl. auch Flasche, Die Religionswissenschaft, 186. 73 Vgl. Wach, Religionswissenschaft, 165 f. Vgl. auch Flasche, Die Religionswissenschaft, 186. 74 Vgl. Wach, Religionswissenschaft, 32.62. 75 Vgl. Figl, Einleitung, 24. 76 Vgl. z. B. die beiden Professuren der Leipziger Religionswissenschaft auf der Website des Instituts für Religionswissenschaft der Universität Leipzig. Team, https://www.gkr.uni-leipzig.de/religi onswissenschaftliches-institut/institut/team/ – 14.01. 2021. Zur wissenschaftstheoretischen Bedeutung dieser beiden Zweige im Kontext dieser Arbeit vgl. Kap. 4.1.
2.1 Akademische Religionswissenschaft ab dem 19. Jahrhundert
23
Lehrtätigkeit in den USA sei für Wach immer stärker die eigene Religiosität in den Fokus seines religionswissenschaftlichen Arbeitens gerückt. Ziel seines Forschens sei mehr und mehr „ein besseres Verstehen der Religion und dadurch Vertiefung der eigenen religiösen Erfahrung“⁷⁷ gewesen. Dieser als hermeneutisch-phänomenologisch verstandene Ansatz wurde prägend für die Chicagoer Religionswissenschaft.⁷⁸ Zusammen mit Mircea Eliade, der 1957 Wachs Nachfolge für History of Religions an der Divinity School antrat,⁷⁹ gilt Wach als Begründer „der sog. Chicago-Schule, einer der bis heute einflußreichsten Richtungen innerhalb der amerikanischen Religionswissenschaft.“⁸⁰ Vor allem Eliade war dadurch auch für die Entwicklung akademischer Religionswissenschaft in Deutschland von zentraler Bedeutung – insbesondere weil seine populären literarisch-religionsphänomenologischen Arbeiten⁸¹ immer wieder Anlass für innerdisziplinäre Auseinandersetzungen um die Methodologie der Religionswissenschaft waren.⁸² Exemplarisch dafür soll hier nur kurz die methodologische Auseinandersetzung und Gegenpositionierung⁸³ des bekannten Religionswissenschaftlers Rudolphs⁸⁴ zum Ansatz Eliades referiert werden. Rudolph, selbst Verfechter einer streng empirisch ausgerichteten, wertfrei arbeitenden Religionswissenschaft,⁸⁵ beschrieb Eliades religionshistorisches Anliegen als die Suche nach dem „übergeschichtlichen Sinn“ religiöser Phänomene, also nach ihrer existentiellen Bedeutung,
77 Flasche, Die Religionswissenschaft, 245. Wach habe also nicht nur nach dem Wesen von Religion gefragt, sondern sich in diesem Zusammenhang – im Grunde konträr zu den Ausführungen in seiner Habilitationsschrift – auch für die Integration der Religionswissenschaft in den Fächerkanon der Theologie stark gemacht. Vgl. ebd., 24. 78 Vgl. Sharpe, Eric J., Comparative Religion. A History, New York 1975, 240 ff. 79 Vgl. Berner, Ulrich, Mircea Eliade (1907– 1986), in: Michaels, Axel (Hg.), Klassiker der Religionswissenschaft. Von Friedrich Schleiermacher bis Mircea Eliade, München 22004, 343 – 353, 344. 80 Kohl, Geschichte, 257. 81 Zu nennen ist dabei wohl vor allem Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des Religiösen, aber auch Die Religionen und das Heilige. Elemente der Religionsgeschichte. Die große Breitenwirkung Eliades lässt sich v. a. auch mit seinem literarischen Schaffen begründen. Ein gutes Beispiel dafür dürfte der von Francis Ford Coppola nach der gleichnamigen Novelle Eliades 2007 gedrehte Spielfilm Jugend ohne Jugend sein. Vgl. die Website der International Movie Data Base. Jugend ohne Jugend, http://www.imdb.com/title/tt0481797/ – 14.01. 2021. 82 Vgl. Berner, Mircea Eliade, 350. 83 Was ihn allerdings nicht daran hindert, Eliade als „faszinierenden Autor“ zu würdigen. Vgl. Rudolph, Geschichte, 382. 84 Zur Person Rudolphs vgl. z. B. die Website des Instituts für Religionswissenschaft der Universität Leipzig. Ehemalige Professoren, https://www.gko.uni-leipzig.de/de/religionswissenschaft/institut/ge schichte-des-instituts/ehemalige-professoren.html – 14.01. 2021. 85 Vgl. Rudolph, Geschichte, 3.13 ff.
24
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
nach dem dahinter liegenden Gehalt, der sich zeigt. ⁸⁶ Damit sei Eliades Interesse eindeutig „das Programm einer empirisch arbeitenden Wissenschaft sprengen[d]“⁸⁷ und somit nicht mehr den Ansprüchen einer rein historisch und philologisch fundierten Religionswissenschaft gerecht werdend. Dadurch, dass Eliade sich so mit der „religiösen Perspektive“⁸⁸ identifiziere, sei ein die Religionsforschung einengender subjektivistischer Reduktionismus und Ahistorismus die Konsequenz.⁸⁹
Diese absolut konträre Positionierung Rudolphs zu Eliade und der sich daran anschließenden religionswissenschaftlichen Richtung war das gesamte 20. Jahrhundert hindurch bestimmend für methodologisch-enzyklopädische Auseinandersetzungen innerhalb der Religionswissenschaft im deutschsprachigen Raum⁹⁰ – Fragen der Nicht-/Normativität und des Empiriebezugs akademischer Religionswissenschaft sind bis in die neueste Zeit ein Dauerbrenner innerfachlicher Diskurse um das eigene disziplinäre Selbstverständnis.⁹¹ Als Zwischenergebnis dieser ersten Ausführungen des Kapitel 2.1. kann resümiert werden, dass die Problematik des Verhältnisses zwischen Religionswissenschaft und Theologie aus dem Blickwinkel Ersterer disziplinär nicht mit ihren materialen Entstehungszusammenhängen zu begründen ist. Vielmehr kann Religionswissenschaft in ihrer fachgeschichtlichen Genese als Tochter verschiedenster Disziplinen gelten. Systematisieren lässt sich dieser plurale Entstehungshintergrund in (schon angesprochene) mindestens drei Ursprungsstränge einer philologisch-historischen, einer philosophisch-psychologisierenden und einer empirischsoziologischen Herangehensweise. Kompliziert war (und ist) das Verhältnis zur großen Schwester Theologie eher aufgrund der formalen Entstehungszusammenhänge durch die maßgebliche Institutionalisierung von Religionswissenschaft in-
86 Vgl. dazu und zum Folgenden ebd., 382 ff.387. 87 Ebd., 408. 88 Ebd., 409. 89 Vgl. ebd., 24.409. 90 So diagnostizierte es in den neunziger Jahren auch Rudolph, wenn er Religionswissenschaft als „zwischen einem religiös theologischen oder philosophischen und einem philologisch-historischen Pol hin- und herschwank[end]“ beschrieb. Ebd., 4. 91 So lautete der Titel der 31. Jahrestagung der Deutschen Vereinigung für Religionswissenschaft (DVRW) 2013 „Empirie und Theorie. Religionswissenschaft zwischen Gegenstandsorientierung und systematischer Reflexion“. Vgl. die Website der Deutschen Vereinigung für Religionswissenschaft. Vergangene Tagungen, https://www.dvrw.uni-hannover.de/de/tagungen/vergangene-tagungen/ – 14.01. 2021. Näheres dazu in wissenschaftstheoretischem Blickwinkel in Kap. 4.3.2. Aber auch auf der eingangs schon zitierten Mailingliste Yggdrasil brechen immer wieder Diskussionen um das Selbstverständnis der Religionswissenschaft als rein empirisch-deskriptiv und wertneutral auf.
2.2 Die epistemische Wende der Theologie zur Religion – moderne Entwicklungen
25
nerhalb theologischer Einrichtungen.⁹² Solches lässt sich – neben gewissen entstehungsgeschichtlichen Zufälligkeiten und Kontingenzen – vermutlich mit einem besonderen Interesse von Theologie an Forschung über Religion(en) begründen.
2.2 Die epistemische Wende der Theologie zur Religion – moderne Entwicklungen Im Folgenden sollen eben jene theologischen Entwicklungen kurz dargelegt werden, die Auswirkungen auf die Beziehung zwischen evangelischer Theologie und Religionswissenschaft hatten. Dabei besteht der Anspruch also offenkundig nicht in einer vollständigen Darstellung der neueren Theologiegeschichte in Bezug auf ihre verschiedensten Religionsbegriffe bzw. gar einer vollständigen Darlegung der vorgestellten Ansätze, sondern im illustrierenden Aufzeigen zentraler zeitgeschichtlicher innertheologischer Tendenzen oder Umschwünge, die das Verhältnis zwischen den beiden Fächern und dementsprechend ihre Positionierung zueinander maßgeblich beeinflussten. Für die Logik dieser Arbeit zentral wird also wie oben schon angedeutet im Hintergrund die Frage sein, wie sich der Umgang der Theologie mit dem empirischen Phänomen der im Kontext der Moderne – als eine „neue[…] Grundlegung der Theologie im Religionsbegriff“⁹³ – gestaltete, ob dementsprechende Konsequenzen für die wissenschaftstheoretische Selbstbestimmung des Faches sich mit den bisher vermuteten Kompetenzen der Religionswissenschaft überschnitten und daraus tatsächliche Ansprüche der Theologie auf Letztere entstanden.
92 Vgl. Mohn, Jürgen, Religionswissenschaft als nicht-theologische Disziplin in ihrem Bezug zur theologischen Enzyklopädie. Verortungen und Entwicklungen von der Emanzipation zur Partizipation, in: Albrecht, Christian/Gemeinhardt, Peter (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und außen, Tübingen 2021, 181 – 191, 187 f. 93 Danz, Christian, Systematische Theologie (UTB 4613), Tübingen 2016, 61. Hervorhebung C. N. Im Folgenden soll es also nicht um eine Auseinandersetzung mit den verschiedensten Thematisierungen von „Religion“ im Kontext (evangelischer) Theologie gehen – solches müsste z. B. gerade auch den voraufklärerischen Gebrauch von religio reflektieren. Mit der Betrachtung einer epistemischen Wende der Theologie hin zur Religion sei also keinesfalls impliziert, dass Religion vor dieser neuzeitlichen Wende kein theologisches Thema gewesen sei. Gemeint ist vielmehr, dass akademische Theologie im Vollzug dieser epistemisch-methodologischen Wende auf ihre sich verändernden erkenntnistheoretischen Bedingungen der Moderne reagiert, indem der Religionsbegriff zum epistemischen Anker- bzw. Ausgangspunkt theologisch-wissenschaftlicher Reflexionen wird.
26
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
2.2.1 Immanuel Kant und die Kritik spekulativer Metaphysik Die epistemische (und methodologische) Wende der Theologie zur Religion hat als einen ihrer maßgeblichsten Ursprungsimpulse bekanntermaßen die philosophische Revolution Immanuel Kants, der – mindestens in der ideengeschichtlichen Rezeption – mit seiner erkenntnistheoretischen Grundlegung in der Kritik der reinen Vernunft ⁹⁴ das Feld der Wissenschaften insgesamt und damit auch und vor allem akademische Theologie nachhaltig umwälzte. Hinter diese Neufokussierung der Fragestellung nach menschlich zugänglichem, gesicherten Erkennntis- und Wissensvermögen konnte (und kann) gerade auch Theologie nicht mehr zurück. Als theo-logia, die gleichsam Mitspielerin im wissenschaftlichen Feld sein und bleiben wollte, war Theologie gezwungen, sich über ihre doch eben spezifischen Gegenstandsbereiche, deren substantiellen, begrifflichen oder hermeneutischen Gehalt und deren Erkennbarkeit grundsätzlich neu zu verständigen. Denn mit dem Versuch, Empirismus und Rationalismus kontrolliert zu verbinden, konstatierte Kant bekanntermaßen, dass es keine menschliche Erkenntnis vor der zeitlich und räumlich gebundenen Erfahrung von Sinneseindrücken gebe.⁹⁵ Dabei beschrieb er mit dem Ausdruck der Sinnlichkeit oder Anschauung die Fähigkeit der sensuellen Wahrnehmung von Erkenntnisobjekten, die durch den Verstand unter Leitung der Vernunft zu einer Welt geordnet werden: „Vermittelst der Sinnlichkeit also werden uns Gegenstände gegeben, und sie allein liefert uns Anschauungen; durch den Verstand aber werden sie gedacht, und von ihm entspringen Begriffe. Alles Denken aber muß sich […] auf Sinnlichkeit beziehen, weil uns auf andere Weise kein Gegenstand gegeben werden kann.“⁹⁶ Solche Verstandestätigkeit unterschied er bekanntlich in analytische und synthetische Urteile: Erstere seien „durch Analyse des als Subjekt auftretenden Begriffs“⁹⁷ eruierbar, böten dafür aber in Bezug auf die Erkenntnis des Gegenstands kaum einen Mehrgewinn.⁹⁸ Letztere seien zwar aus der Erfahrung heraus zu fällen,
94 Vgl. Beck, Lewis White, Kants „Kritik der praktischen Vernunft“. Ein Kommentar (UTB 1833), München 31995, 29. In Grundzügen können die Anfänge der Kritik Kants bereits 1770 in De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis angesetzt werden, also über zehn Jahre vor Erscheinen der ersten Auflage der KrV, da er bereits dort zwischen „der sinnlich-phänomenalen und der geistig-numeralen Welt“ unterschied und wissenschaftliche Erkenntnis auf den Bereich Ersterer beschränkte. Rohls, Jan, Protestantische Theologie der Neuzeit. Band 1. Die Voraussetzungen und das 19. Jahrhundert, Tübingen 1997, 226. 95 Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft (1787), in: AA 3 (1911), 1 – 552, B1 f. Die Seitenangabe zur KrV erfolgt nach Originalpaginierung. 96 Ebd., B33. Hervorhebung C. N. 97 Beck, Kants, 30. 98 Z. B. „Alles Blaue ist farbig.“ Vgl. ebd., 30 f.
2.2 Die epistemische Wende der Theologie zur Religion – moderne Entwicklungen
27
da das im Urteil dem Gegenstand zugesprochene Prädikat logisch nicht allein aus seinem Begriff ableitbar sei.⁹⁹ Allerdings setze wiederum ein jedes solches auf empirischer Beobachtung ruhendes Urteil bereits definitorische Verstandestätigkeit voraus.¹⁰⁰ Daraus ergibt sich für Kant in der KrV die paradigmatisch-berühmte grundsätzliche erkenntnistheoretische Frage: „Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?“¹⁰¹ Die Antwort liege in den apriorischen Formen des Verstandes, den Kategorien und den dazugehörigen Regeln der Verstandestätigkeit: Unter Beachtung gewisser Grundsätze, im Sinne von „apriorischen Regeln des Gebrauchs der […] Kategorien“,¹⁰² ordne der Verstand unter Anwendung der Kategorien die Sinneseindrücke der empirischen Welt.¹⁰³ Daraus folge erkenntnislogisch, dass synthetische Urteile a priori möglich sind, „weil es apriorische Formen der Anschauung und des Verstandes gibt, über die sie etwas aussagen.“¹⁰⁴ Da also jede Erkenntnis solche apriorische Verstandestätigkeit voraussetze, kann nie das Ding an sich, sondern immer nur seine dem Menschen vorfindliche Erscheinung, sein durch den Verstand erarbeiteter sozusagen phänomenaler Charakter erkannt werden:¹⁰⁵ Das Ding an sich ist empirischer Erkenntnis nicht zugänglich. Damit hatte Kant jeglicher rationalistischen Metaphysik zunächst den Boden genommen: Denn Gegenstand wissenschaftlich-gesicherter Erkenntnis können eben nur Gegenstände der empirisch erfahrbaren Welt sein.¹⁰⁶ Dadurch ergaben sich direkte Konsequenzen für theologisches Arbeiten: Natürliche Theologie, die also versuchte, die Existenz Gottes mit reinen Vernunftgründen zu beweisen, erwies sich in der erkenntnistheoretischen Grundlegung Kants als wissenschaftlich nicht durchführbar. Vielmehr verlagerte Kant bekannter Weise die Frage nach der Denknotwendigkeit Gottes in den Bereich der Ethik,¹⁰⁷ wie er sie in der Grundlegung der Metaphysik der Sitten, der Kritik der praktischen Vernunft und der Metaphysik der Sitten darlegte. Klassische Gottesbeweise konnten für Kant nicht greifen, denn sie bedeuteten – durch den Versuch, mit menschlicher, erfahrungsbezogener Erkenntnis meta-physische, also der Erfahrung nicht zu-
99 Vgl. Kant, KrV, B11 – 14. 100 So setzt bspw. das Urteil „Die Tasse ist aus Porzellan.“ verschiedene Grundlegungen voraus, nämlich z. B. die Definition sowohl von „Tasse“ als auch von „Porzellan“, als auch die Zuordnung von Gegenstand (als „Substanz“) zu Material (als seine „Akzidenz“). Vgl. Beck, Kants, 30 f. 101 Kant, KrV, B20. 102 Rohls, Protestantische, 229. 103 Vgl. ebd., 228. Kant unterschied hierbei zwischen Kategorien der Quantität, der Qualität, der Relation und der Modalität. Vgl. Kant, KrV, B106 f. 104 Rohls, Protestantische, 229. 105 Vgl. ebd., 229. 106 Vgl. Beck, Kants, 30.32 f. 107 Vgl. dazu und zum Folgenden Rohls, Protestantische, 232 ff.
28
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
gängliche Gegenstände zu begründen – immer ein Überstrapazieren menschlicher Vernunft. Einzig im Bereich der Moral könne die Denknotwendigkeit einer Existenz Gottes vernünftig dargelegt werden: Die Gültigkeit des individuelle Entscheidungsfreiheit voraussetzenden Sittengesetzes könne nur gegeben sein, wenn es einen Zusammenhang zwischen Tugend und individueller Glückseligkeit gebe. Fällt die Möglichkeit der Erlangung dieses höchsten Guts, Sittlichkeit und Glückseligkeit, weg, so sei auch die Erfüllung des Sittengesetzes gegenstandslos. Sittlichkeit und Glückseligkeit befänden sich aber im Diesseits in Antinomie zueinander. Somit ergaben sich für Kant als Postulate der praktischen Vernunft – neben der Unsterblichkeit der Seele – als Garant für den Zusammenhang von Sittlichkeit und Glückseligkeit Gott. ¹⁰⁸ Die maßgeblichsten Wirkungen Kants auf die Theologie lagen also in der Widerlegung der Möglichkeit jeglicher rationalistisch-metaphysischen, natürlichen Theologie und in der Zuspitzung (vernünftiger) Religion auf den Bereich der Ethik. Gerade Ersteres sollte starke Folgen auch für die spätere Entstehung der Religionswissenschaft haben, denn spätestens nun – konkret mit den im Folgenden angerissenen Ausführungen Friedrich Daniel Ernst Schleiermachers –¹⁰⁹ begann der Wandel des Gegenstandsbereichs der Theologie von „Gott“ hin zum empirischen Phänomen der Religion.
2.2.2 Friedrich Schleiermacher und die Eigenständigkeit des religiösen Gefühls Schleiermachers Zuschreibung als „Kirchenvater des 19. Jahrhunderts“¹¹⁰ wird – neben seinen noch nicht abschließend erforschten grundsätzlichen inter- und transdisziplinär kulturwissenschaftlichen Weiten- und Breitenwirkungen – in der Perspektive dieser Arbeit an dieser Stelle zunächst vor allem aufgrund seiner Schule machenden Bestimmung von Religion als einem eigenständigen Aspekt menschlichen Seins – und somit als eigentlichen Gegenstandsbereich von Theologie – argumentativ genutzt, da in dieser religionstheoretischen Grundlegung die Wei-
108 Vgl. Kant, Immanuel, Kritik der praktischen Vernunft (1788), in: AA 5 (1913), 1 – 163, 124. (Im Folgenden abgekürzt KpV.) 109 Vgl. Mohn, Jürgen, Die Impulse der„Religionstheologie“ Schleiermachers für die Ausbildung der Religionswissenschaft(en), in: Gräb, Wilhelm/Slenczka, Notger (Hg.), Universität – Theologie – Kirche. Deutungsangebote zum Verhältnis von Kultur und Religion im Gespräch mit Schleiermacher (ASyTh 4), Leipzig 2011, 87– 127, 91. 110 Thielicke, Helmut, Glauben und Denken in der Neuzeit. Die großen Systeme der Theologie und Religionsphilosphie, Tübingen 21988, 249.
2.2 Die epistemische Wende der Theologie zur Religion – moderne Entwicklungen
29
chen für das Verhältnis von Theologie zur Religionswissenschaft nachhaltig gestellt wurden. In der berühmten Schrift Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern beschrieb Schleiermacher Religion bekanntlich als jenes autonome Phänomen menschlicher Lebenswirklichkeit, welches weder als rationalistische Metaphysik noch als Moral erklärt werden könne:¹¹¹ „Ihr Wesen ist weder Denken noch Handeln, sondern Anschauung und Gefühl.“¹¹² In Aufnahme der Kritik Kants an rationalistischer Metaphysik zeichnete er so Religion als eigentlichen Gegenstand der Theologie, und versuchte gleichzeitig, Kant dahingehend theologisch zu überwinden, indem er Religion nicht in den Bereich der Ethik auslagerte, sondern ihre Eigenständigkeit eben als menschliche Gemütsverfassung postulierte, als „Sinn und Geschmack fürs Unendliche“¹¹³ bzw. als ein „Anschauen des Universums“.¹¹⁴ Eine Auflösung in vernünftig-natürliche Religion werde ihrem Wesen genauso wenig gerecht wie ihre Reduktion auf ethische Postulate und Regeln. Dieses Phänomen eigentlicher Religion manifestiere sich immer in konkret vorfindlichen, also „positiven“ Religionen,¹¹⁵ so dass alle Beschäftigung mit ihr sich nur an ihren empirisch vorfindlichen Variationen vollziehen könne.¹¹⁶ Denn die Wahrnehmung bzw. das Erfahren von etwas Ewigem und Unendlichem (und somit also menschlich nie voll Erkennbarem) wie der Religion könne für den Menschen nur anhand konkretvorfindlicher Formen derselben geschehen.¹¹⁷ Dadurch sei also die Vielfältigkeit der
111 Vgl. Hägglund, Bengt, Geschichte der Theologie. Ein Abriss (KT 79), München 21993, 276. Vgl. auch Mildenberger, Friedrich, Geschichte der deutschen evangelischen Theologie im 19. und 20. Jahrhundert (ThW 10), Stuttgart 1981, 71 f. 112 Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern (1799), in: KGA I,2 (1984), 185 – 326, 211. 113 Ebd., 212. 114 Ebd., 213. 115 Vgl. ebd., 296. Darin liegt auch die Neubestimmung bzw. Präzisierung des Schleiermacherischen Religionsbegriff gegenüber dem, was ideengeschichtlich auch schon vor-aufklärerisch als Gegenstand von Theologie zu gelten vermochte: So z. B. „Religion“ in der altprotestantischen Orthodoxie, dann verstanden als aus der vernünftigen Gotteserkenntnis gespeiste, durch Offenbarung aufgezeigte christlich-wahre religio. Vgl. Wagner, Falk, Was ist Religion? Studien zu ihrem Begriff und Thema in Geschichte und Gegenwart, Gütersloh 21991, 32 f. Die Justierung Schleiermachers liegt also in dem Fokus – weg von natürlich-theologischer Metaphysik – auf Religion als eigenständigem, anthropologischem Phänomen, das sich notwendiger Weise nur in positiven Religionen manifestiert und nur als empirischer ein wissenschaftlicher Gegenstand sein kann. 116 Vgl. Herms, Eilert, Theologie an der Universität. Die Gegenwartsrelevanz von Schleiermachers Programm, in: Gräb, Wilhelm/Slenczka, Notger (Hg.), Universität – Theologie – Kirche. Deutungsangebote zum Verhältnis von Kultur und Religion im Gespräch mit Schleiermacher (ASyTh 4), Leipzig 2011, 24 – 50, 42. 117 Vgl. Schleiermacher, Über die Religion, 213 ff.295.
30
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
positiven Religionen kein (sich der Theologie stellendes) Problem, sondern gerade zum Wesen der Religion gehörend, denn „sie muß also ein Princip sich zu individualisiren in sich haben, weil sie sonst gar nicht dasein und wahrgenommen werden könnte“.¹¹⁸ Im Schleiermacherischen Denken hatte dies naturgemäß Konsequenzen für das Verständnis von Theologie: In der bis heute fundamentaltheologisch-enzyklopädisch wirkmächtigen¹¹⁹ Kurzen Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen charakterisierte Schleiermacher sie als eine durch ihren funktionalen Bezug auf die Kirchenleitung positive Wissenschaft, die sich mit der konkret-vorfindlichen Religion des Christentums beschäftige.¹²⁰ Ihre Einheit und ihren Charakter erhielte sie dadurch, dass eben all ihr Forschen auf die (weit zu verstehende)¹²¹ Leitung der christlichen Glaubensgemeinschaft bezogen sei: „Die christliche Theologie ist […] der Inbegriff derjenigen wissenschaftlichen Kenntnisse und Kunstregeln, ohne deren Besitz und Gebrauch […] ein christliches Kirchenregiment nicht möglich ist. […] Dieselben Kenntnisse, wenn sie ohne Beziehung auf das Kirchenregiment erworben und besessen werden, hören auf, theologische zu sein“.¹²² Theologie ergehe sich also nicht in irgendwelchen Spekulationen, sondern beschäftige sich so mit ganz konkreten Gegenständen, sei es in den exegetischen Fächern, in der Kirchengeschichte oder sei es in der Systematischen Theologie, die sich mit der „geschichtliche[n] Kenntniß von dem gegenwärtigen Zustande des Christenthums“¹²³ auseinandersetze. Dadurch kennzeichnete Schleiermacher Theologie als den „profanen“ Wissenschaften gleichwertig,¹²⁴ indem er aber auch gleichzeitig zu jenen klare Grenzen zog. Die einen dürfen nicht in den Zuständigkeitsbereich der anderen eingreifen (und umgekehrt), sollten beide fruchtbringend forschen dürfen; denn das käme einer Kompetenzüberschreitung gleich, die letzt-
118 Ebd., 296. 119 Vgl. dazu auch Kapitel 5.1. 120 Vgl. Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst, Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitenden Vorlesungen (1830), in: KGA I,6 (1998), 317– 446, 325. (Im Folgenden abgekürzt KD.) Vgl. auch Mildenberger, Geschichte, 76. 121 Kirchenleitung ist hier also nicht zwingend als normative Bindung von Theologie an die Institution Kirche zu lesen, sondern erstreckt sich als normativer Rahmen des Schleiermacherischen Theologiekonzeptes vielmehr auf die positive Religion des Christentums insgesamt und somit Kirche im weitesten Sinne. Vgl. Barth, Ulrich, Wissenschaftstheorie der Theologie. Ein Durchgang durch Schleiermachers Enzyklopädie, in: Ders., Kritischer Religionsdiskurs, Tübingen 2014, 263 – 278, 268. 122 Schleiermacher, KD, 328. 123 Ebd., 393. 124 „[Man] beginnt […] erst seit Schleiermacher die Theologie als eine Wissenschaft zu betrachten, die den profanen Wissenszweigen völlig gleichwertig ist.“ Hägglund, Geschichte, 281.
2.2 Die epistemische Wende der Theologie zur Religion – moderne Entwicklungen
31
lich beide Seiten gefährde: „Soll der Knoten der Geschichte so auseinander gehn? das Christenthum mit der Barbarei, und die Wissenschaft mit dem Unglauben?“¹²⁵ Die Konsequenzen der Ausführungen Schleiermachers für Religionswissenschaft liegen zu großen Teilen in der Fokussierung auf das Individuum in seinen konkret vorfindlichen soziokulturellen Kontexten und seine Erfahrungen.¹²⁶ Dadurch, dass er Religion als das vom Menschen empfundene Abhängigkeitsgefühl kennzeichnete, rückte er das Augenmerk religionsbezogener Forschung auf das Erlebnis des Individuums: Im Anschauen des Universums werde der Mensch selbst beeinflusst vom „Angeschaueten“.¹²⁷ Vor allem im Bereich der Religionsphänomenologie kann deswegen ein „deutlicher und expliziter Rückbezug auf Schleiermacher“¹²⁸ gesehen werden. Denn gerade da gehe es im religionswissenschaftlichen Arbeiten zu großen Teilen um das sich zeigende religiöse Phänomen, das der Mensch vollständig nur über das eigene Erleben erfahren und erkennen könne. Doch nicht nur in diesem speziellen Fall, sondern grundlegend für Religionswissenschaft insgesamt hatten die Darlegungen Schleiermachers Einfluss auf die Entstehung akademischer Religionswissenschaft: „Denn Schleiermacher hat die Möglichkeit, ‚Religion‘ als autonomen ‚Gegenstand‘ zu thematisieren, der späteren Religionswissenschaft begründend vorgegeben.“¹²⁹ Dadurch ergaben sich aber auch grundlegende Probleme in der Zuordnung der jeweiligen Kompetenzbereiche von Theologie und Religionswissenschaft, denn nun wurde immer mehr Religion zum Thema und Gegenstand auch der Theologie.
2.2.3 Georg Wilhelm Friedrich Hegel und der absolute Geist Aufgrund seiner für die Geistes- (und Kultur‐) Wissenschaften insgesamt wissenschafts- und auch religionstheoretischen Wirkmächtigkeit¹³⁰ ist in der Logik dieses Kapitels auch kurz auf die fundamentaltheologischen Konsequenzen der Philosophie Georg Wilhelm Friedrich Hegels¹³¹ einzugehen. Denn deren bleibende Wir125 Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst, Über die Glaubenslehre. Zwei Sendschreiben an Lücke (1829), in: KGA I,10 (1990), 307– 394, 347. 126 Vgl. Mohn, Die Impulse, 88. 127 Schleiermacher, Über die Religion, 213. 128 Mohn, Die Impulse, 92. Otto selbst hat z. B. Schleiermachers Reden über die Religion herausgegeben und kommentiert. 129 Ebd., 89. 130 Vgl. dazu z. B. Simon, Josef, Art. Hegel/Hegelianismus, in: TRE 14 (1986), 530 – 560, 530. 131 Zu einer kurzen biografischen Einordnung vgl. ebd., 530 f. Ausführlicher und werksgeschichtlich fokussierter vgl. Schäfer, Rainer, Hegel. Einführung und Texte (Studium Philosophie 3439), München 2011, 13 – 37.
32
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
kung auf das Verhältnis zwischen Religionswissenschaft und Theologie lag v. a. darin, dass die Hegelsche Religionsphilosophie weitreichenden Einfluss auf den epistemisch-methodologischen theologischen Umgang mit Religion(en) hatte – ohne auch hier nur ansatzweise eine fachgeschichtliche Darlegung dieser Einflüsse¹³² geben zu wollen.¹³³ Ähnlich wie Schleiermacher (wenngleich später dann auch in Abwendung von ebendiesem)¹³⁴ ging es Hegel grundsätzlich um ein Weiter- bzw. Überdenken der Impulse der Kantischen Vernunftkritik.¹³⁵ Die Metaphysikkritik Kants betonte, wie unter 2.2.1. bereits angeführt, die epistemisch-redliche Nichterkennbarkeit des Dings an sich – wodurch logisch-prinzipiell eine Trennung von Erfahrungs- und gedachter bzw. denkerischer Welt die Konsequenz war.¹³⁶ Dieses Auseinanderfallen von Denken und Leben versuchte Hegel – aufbauend auf den Kantischen Verstandesbegriffen (bzw. diese aus- und weiterbauend)¹³⁷ – so zu spezifizieren, indem genau diese denkerische Trennung zwischen Subjekt und Objekt als Gedanke selbst ¹³⁸ zu Ende gedacht wurde.¹³⁹ Im System¹⁴⁰ der Hegelschen Geistphilosophie wurden der (subjektive) Erkenntnisvollzug, sein (objektiver) Gegenstand und das Ergebnis dieses Vollzugs im Begriff des (absoluten) Geistes zu einem sich durchdringenden Prozess (als einer „Leistung des Bewußtseins und der
132 Zur innerfachlichen Wirkung Hegels auf die Theologie vgl. exemplarisch Henrici, Peter, Hegel für Theologen. Gesammelte Aufsätze (Schriftenreihe der Theologischen Hochschule Chur 8), Fribourg 2009, 43 f. 133 Wohl wissend, dass damit dem Selbstverständnis des Systemdenkers Hegel höchstwahrscheinlich nicht Rechnung getragen werden kann. Denn „[d]ie angemessene Darstellung der Hegelschen Philosophie ist nur die systematische Entwicklung, in der das Wahre eigentlich ‚das Ganze‘ ist, d. h. der Begriff mit seiner Entwicklung und damit Begründung.“ Römpp, Georg, Hegel leicht gemacht. Eine Einführung in seine Philosophie (UTB 3114), Köln 2008, 283. Hervorhebung C. N. 134 Zu einer differenzierten Darlegung des Verhältnisses zwischen Schleiermacher und Hegel vgl. den Aufsatz von Müller, Ernst, Zur Modernität des Hegelschen Religionsbegriffs, in: Arndt, Andreas/ Müller, Ernst (Hg.), Hegels „Phänomenologie des Geistes“ heute (DZPh.S 8), München 2009, 175 – 193, v. a. 176 – 188. 135 Vgl. Simon, Art. Hegel, 531. 136 Vgl. Arndt, Andreas, Schleiermacher in der nachkantischen Philosophie, in: Ohst, Martin (Hg.), Schleiermacher Handbuch (Handbücher Theologie), Tübingen 2017, 32 – 48, 33. 137 Vgl. Schäfer, Hegel, 76 f. 138 „Dass sich das Denken auf etwas außerhalb des Denkens bezieht, wenn es zu einer Erkenntnis führen soll, ist ein Gedanke. Man könnte darin die Philosophie des sog. ‚objektiven Idealismus‘ in nuce zusammengefasst sehen.“ Römpp, Hegel, 283. 139 Vgl. ebd., 22. 140 Zur historisch-soziokulturellen Bedingtheit dieses System-Entwurfs vgl. Schupp, Franz, Geschichte der Philosophie im Überblick. Band 3. Neuzeit, Hamburg 2005, 408 f.
2.2 Die epistemische Wende der Theologie zur Religion – moderne Entwicklungen
33
Reflexion“¹⁴¹) zusammengeführt.¹⁴² Wenn in solcher Form Erkenntnis (als Tätigkeit) und Erkanntes zusammengedacht wurden, war in der Systemlogik Hegels letztlich eine metatheoretische Erkenntniskritik nicht mehr sinnvoll möglich. Vielmehr war es dann die erkenntnistheoretische Aufgabe der Philosophie, genau diesen epistemisch-holistischen Prozess aufzuzeigen, also den Weg nachzuzeichnen, auf dem Wissen prozessual erscheint. „Diß Werden der Wissenschaft überhaupt, oder des Wissens“¹⁴³, kennzeichnete Hegel in der Vorrede seiner Phänomenologie des Geistes als seine erkenntnistheoretische Absicht. Hegel legte hier im Begriff ¹⁴⁴ des Geistes in seinen Entwicklungsstufen „die Geschichte des sich selbst in seiner Wahrheit erfahrenden, seinen jeweiligen Selbstbegriff, in dem es sich allem anderen als Prinzip der Einheit gegenübersetzt, relativierend überwindenden Bewußtseins“¹⁴⁵ dar. Erkenntnistheoretisch handelte es sich dabei sozusagen um den Weg von der unmittelbaren sinnlichen Gewissheit im subjektiven Geist als reflektiertes Selbstbewusstsein, über den objektiven Geist, in dem sich diese sinnliche Gewissheit selbst objektiviert, also als in konkret vorfindlichen (gesellschaftlichsittlichen) Formen daseiend reflektiert, bis hin zum absoluten Wissen, in dem Begriff und Gegenstand nicht mehr auseinanderfallen, also zum absoluten Geist, der sich seiner selbst als solcher bewusst wird:¹⁴⁶ „Als absolut bezeichnet Hegel das Wissen darum, dass sich das Bewusstsein nicht im Gegensatz zu einer gegenständlichen ‚Welt‘ befindet, sondern diese ebenso begrifflich strukturiert ist wie das Wissen selbst und deshalb auch in ihrer inneren Verfasstheit erkennbar ist, so dass der Gegensatz von Idealismus und Realismus keine Bedeutung hat.“¹⁴⁷ Wahrheit bzw. wahres Wissen war bei Hegel also nicht vom Prozess des Wahrheit generierenden Erkenntnisvollzug losgelöstes Ergebnis von Philosophie bzw. Wissenschaft, sondern „[d]ie wahre Gestalt, in welcher die Wahrheit existirt, kann allein das
141 Simon, Art. Hegel, 532. 142 Vgl. Schäfer, Hegel, 76 f. 143 Hegel, Georg Friedrich Wilhelm, Phänomenologie des Geistes, in: GW 9 (1980), XXXII. (Im Folgenden abgekürzt PhG.) 144 „Wahre Gedanken und wissenschaftliche Einsicht ist nur in der Arbeit des Begriffes zu gewinnen. Er allein kann die Allgemeinheit des Wissens hervorbringen, welche weder die gemeine Unbestimmtheit und Dürftigkeit des gemeinen Menschenverstands, sondern gebildete und vollständige Erkenntiß, – noch die ungemeine Allgemeinheit der durch Trägheit und Eigendünkel von Genie sich verderbenden Anlage der Vernunft, sondern die zu ihrer einheimischen Form gediehene Wahrheit, welche fähig ist, das Eigenthum aller selbstbewußten Vernunft zu seyn.“ Ebd., LXXXVIII. 145 Simon, Art. Hegel, 532. 146 Vgl. Arndt, Schleiermacher, 46. Vgl. Blasche, Siegfried, Art. Geist, absoluter, in: EphW 1 (1980), 722. 147 Arndt, Schleiermacher, 46.
34
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
wissenschaftliche System derselben seyn.“¹⁴⁸ Durch diesen Subjekt und Objekt integrativ vermittelnden Ansatz ersetzte Hegel erkenntnistheoretisch das Kantische Prinzip der Subjektivität mit dem der Intersubjektivität.¹⁴⁹ Religionstheoretisch bzw. -philosophisch siedelte Hegel die (aus dezidiert evangelisch-christlichem Blickwinkel betrachtete)¹⁵⁰ Religion – zusammen mit Kunst und Philosophie – als einem Entwicklungsschritt des Phänomens des Selbstbewusstseins auf der Stufe des absoluten Geistes an.¹⁵¹ In der Religion komme der absolute Geist als „Bewußtsein des absoluten Wesens überhaupt“¹⁵² zu sich selbst: „Der sich selbst wissende Geist ist in der Religion unmittelbar sein eignes reines Selbstbewußtsein.“¹⁵³ Als Religion verharre der Geist – sozusagen als Vorstufe der Philosophie¹⁵⁴ – dabei noch in der Vorstellung, in der er selbst und sein Gegenstand noch unterschieden werden. Erst „in der christlichen als der absoluten Religion, genauer im wahren […] Begriff der christlichen Religion als solche Vor148 Hegel, PhG, VI. Vgl. auch Römpp, Hegel, 32. 149 Vgl. Simon, Art. Hegel, 532. 150 Vgl. Schupp, Geschichte, 380 f. 151 Auch hier zeigt sich Hegels Weiterdenken bzw. geradezu eine Radikalisierung der Metaphysikkritik Kants. Die Postulate der praktischen Vernunft werden als kategoriale Begriffe, die im Erkenntnisprozess selbst mit enthalten sind, gezeichnet. Vgl. Arndt, Schleiermacher, 47. Gleichzeitig versuchte Hegel so die reine Vernunftreligion Kants zu überwinden, indem er die gelebte Religion als den Ort ansetzte, an dem in der Vorstellung zwischen der sinnlichen Erfahrungswelt und ihrem geistigen Gehalt einschließlich ihrer Moral vermittelt werde. Vgl. Blasche, Siegfried, Art. Hegel, in: EphW 2 (1984), 48 – 54, 49. Vgl auch Henrici, Hegel, 27. So „umgeht Hegel die romantische Figur einer ursprünglichen, in Mythos und Religion gegründeten Identität und Unmittelbarkeit, die sich so als hochgradig vermittelte Konstruktion erweist.“ Müller, Zur Modernität, 188. Darin wendete sich Hegel in der PhG (im Gegensatz zu seinen ersten religionsphilosophischen Reflexionen) auch vom einen ähnlich vermittelnden Ansatz verfolgenden Schleiermacher ab, dessen Fokussierung auf die Unmittelbarkeit des religiösen Selbstbewusstseins für Hegel „bloßer Ausdruck eines unaufgelösten Empirismus [war], eine Form der Subjektivität und Partikularität, die die Entzweiung auf höherer Stufe wiederholt.“ Ebd., 185. 152 Hegel, PhG, 625. Hegel identifiziert also im Begriff des absoluten Geistes, der als Selbstbewusstsein nur als Subjekt (und Objekt) gedacht werden kann, (den christlich zu verstehenden) Gott. „Die Philosophie ist also nichts anderes als die Selbstauslegung Gottes, wie sie uns in der Form der christlichen Religion gegeben ist, nun aber in die Form des Begriffs gebracht wird. Damit wird diese Philosophie auch an einen ganz bestimmten Ort in der Geschichte gestellt, sie ist somit selbst ein Resultat der Geschichte und ist gleichzeitig als System das Begreifen dieser Geschichte.“ Schupp, Geschichte, 386. „Hegels ‚Phänomenologie‘ ist sozusagen seine Fundamentaltheologie.“ Henrici, Hegel, 30. 153 Hegel, PhG, 627. 154 „Der Geist der offenbaren Religion hat sein Bewußtseyn als solches noch nicht überwunden, oder, was dasselbe ist, sein wirkliches Selbstbewußtseyn ist nicht der Gegenstand seines Bewußtseyns; er selbst überhaupt und die in ihm sich unterscheidenden Momente fallen in das Vorstellen und in die Form der Gegenständlichkeit.“ Ebd., 742. Vgl. dazu z. B. Römpp, Hegel, 116 – 122.
2.2 Die epistemische Wende der Theologie zur Religion – moderne Entwicklungen
35
stellung [hebe sie sich letztlich] in der Philosophie auf.“¹⁵⁵ Somit haben erkenntnisprozesslogisch also Religion und Philosophie den gleichen Inhalt, unterscheiden sich aber dadurch, dass eben in der Religion der absolute Geist vorgestellt, in der Philosophie dann endlich gedacht wird.¹⁵⁶ Durch diese materiale Identifizierung gestaltete sich Hegels Philosophie letztlich als „spekulative Auslegung der Religion, und zwar nicht der Religion im Allgemeinen, sondern der christlichen Religion.“¹⁵⁷ Aufgrund der erkenntnistheoretischen Leistung auf erkenntnisprozesslogischer Ebene einerseits und der sozusagen materialen bzw. substantiellen Füllung dieser Erkenntnistheorie andererseits beeinflusste das Hegelsche System nicht nur das Feld der Geisteswissenschaften insgesamt,¹⁵⁸ sondern maßgeblich das der Theologie und – dann in ihrem Verhältnis dazu – auch das der Religionswissenschaft: Denn gerade durch die integrative Verhältnissetzung von christlicher Religion und Philosophie, von empirisch vorfindlicher Religiosität und gedachter Welt ergaben (und ergeben) sich im Feld der religionsbezogenen Wissenschaften mehr oder weniger explizite bzw. implizite Geltungsansprüche darüber, was „wahre“, vollendete Religion sei und wie bzw. ob sie sowohl erkenntnistheoretisch redlich als auch ihrer selbst gerecht werdend erforscht und dargelegt werden könnte.
2.2.4 Albrecht Ritschl und die historisch-wissenschaftliche Grundlegung der Theologie Albrecht Benjamin Ritschl, „nach Schleiermacher […] der einflußreichste Theologe des 19. Jahrhunderts“,¹⁵⁹ griff die Stoßrichtungen Kants und Schleiermachers¹⁶⁰ auf, 155 Simon, Art. Hegel, 539. Zu den Stufen der Religion (natürliche – künstlicher – offenbare) vgl. Hegel, PhG, 635 f. 156 „[R]eligiöses Wissen und philosophisches (= absolutes) Wissen [sind] hinsichtlich ihres Inhalts identisch. Während aber im religiösen Wissen der Inhalt (das Absolute, die Wahrheit) erst in der ihm letztlich adäquaten Form des Vorstellens gewußt wird, wird er im philosophischen (= absoluten) Wissen in der ihm adäquaten Form, der Form der Wahrheit oder der wahren Form, der ‚Form des Wissens seiner selbst‘, im ‚selbstbewußten Denken‘ gewußt.“ Aschenberg, Reinhold, Der Wahrheitsbegriff in Hegels „Phänomenologie des Geistes“, in: Ders./Schneider, Friedhelm/Hartmann, Klaus/Brinkmann, Klaus (Hg.), Die Ontologische Option. Studien zu Hegels Propädeutik, Schellings Hegel-Kritik und Hegels Phänomenologie des Geistes, Berlin/New York 1976, 211 – 312, 294. 157 Schupp, Geschichte, 395. „[D]ie hegelsche Dialektik ist in ihrem Ursprung wie in ihrem Ziel eine Interpretation des Glaubens, so wie Hegel sich diesen eben vorstellte. Es geht dabei keineswegs um ein vorgegebenes abstraktes Schema, sondern um die Lösung eines konkreten, historischen, aus der christlichen Theologie stammenden Problems: […] Wie ist das Verhältnis von Einzelnem und Allgemeinem zu begreifen oder zu glauben?“ Ebd., 383. 158 Vgl. Simon, Art. Hegel, 530. 159 Thielicke, Glauben, 423.
36
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
indem er versuchte, die Religion des Christentums mit den neuen Denkparadigmen der Moderne zu harmonisieren und die Denkfähigkeit bzw. Vernünftigkeit des christlichen Glaubens aufzuweisen.¹⁶¹ Grundlegend war dabei die von ihm gesetzte enge Verbindung zwischen Rechtfertigung und Ethik. Deutlich wird dies im zentralen Begriff des Reichs Gottes, dem Ziel christlicher Erlösung und der „geistige[n] und sittliche[n] Aufgabe der in der christlichen Gemeinde versammelten Menschheit“.¹⁶² Durch moralisches Handeln, initialisiert durch das Doppelgebot der Liebe (Mt 22,37 ff ), könnten laut Ritschl die Menschen an der Entstehung des Reiches Gottes als einer diesseitigen sittlichen Gemeinschaft der Menschen mit Gott, die gleichzeitig sowohl Ziel als auch Inhalt christlicher Erlösung sei, mitwirken.¹⁶³ Ritschl verband so zwar wie Kant Religion mit Moral, stärkte aber gleichzeitig wie Schleiermacher ihren Gemeinschaftscharakter¹⁶⁴ und ihre Eigenständigkeit gegenüber der Ethik,¹⁶⁵ indem er nicht jene, sondern eben das Reich Gottes als Zweck und den göttlichen Willen zur Gemeinschaft als Wesen der Religion kennzeichnete.¹⁶⁶ Diese Autonomie der Religion begründete Ritschl, unter Rezeption der Wertphilosophie Rudolf Hermann Lotzes,¹⁶⁷ mit der Eigenständigkeit religiöser Werturteile: ¹⁶⁸ Aufgabe der Religion sei nicht die metaphysisch-spekulative Erklärung dogmatischer Inhalte (wie es z. B. in den klassischen Gottesbeweisen geschehe), die
160 Vgl. Hägglund, Geschichte, 295. 161 Vgl. Mildenberger, Geschichte, 128. 162 Ritschl, Albrecht, Unterricht in der christlichen Religion. Studienausgabe nach der 1. Auflage von 1875 nebst den Abweichungen der 2. und 3. Auflage. Eingeleitet und herausgegeben von Christine Axt-Piscalar (UTB 2311), Tübingen 2002, 17. 163 Vgl. ebd., 13 ff. Dies darf nicht missverstanden werden im Sinne von Werksgerechtigkeit: Vielmehr ging bei Ritschl die Versöhnung des Menschen im Sinne der inneren Umwandlung aufgrund eines Erlösungsbewusstseins der Mitarbeit am Reich Gottes voraus: Erstere setze die Werke für Letztere erst frei. Vgl. z. B. ebd., 60 f. Vgl. Hägglund, Geschichte, 295 f. Thielicke, Glauben, 439. 164 In dem Sinne, dass Ritschl, wie Schleiermacher, Rechtfertigung „nicht primär im individualistischen Sinne“ verstand. Lessing, Eckhard, Geschichte der deutschsprachigen evangelischen Theologie von Albrecht Ritschl bis zur Gegenwart. Band 1. 1870 – 1918, Göttingen 2000, 41. 165 Es darf allerdings nicht verschwiegen werden, dass Ritschl dennoch durch seine Ausführungen als „Wegbereiter des Moralismus in der protestantischen Theologie“ zu gelten vermochte. Thielicke, Glauben, 423. 166 Vgl. Schäfer, Rolf, Ritschl. Grundlinien eines fast verschollenen dogmatischen Systems (BHTh 41), Tübingen 1968, 129 ff.163 f. 167 So differenzierte auch Lotze zwischen wissenschaftlichen und religiösen Erfahrungen. Vgl. Bohner, Hermann, Die Grundlage der Lotzeschen Religionsphilosophie, Erlangen 1914, 24 f. Vgl. zur Person Lotzes Kettern, Bernd, Art. Lotze, Rudolf Hermann, in: BBKL 5 (1993), 270 – 277, 270 ff. 168 Vgl. Ritschl, Albrecht, Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung. Band 3. Die positive Entwickelung der Lehre, Berlin/Boston 2020, § 29, 198 ff. (Im Folgenden abgekürzt RV III.)
2.2 Die epistemische Wende der Theologie zur Religion – moderne Entwicklungen
37
unwillkürlich mit naturwissenschaftlichen Weltbildern kollidiere. Sondern in der Religion werde die Stellung des Menschen zur Welt und zu Gott derart gedeutet, dass Letzterer ihn aus den kontingenten Einschränkungen ersterer heraushebe:¹⁶⁹ „Die Erkenntnis Gottes ist nur dann als religiöse Erkenntnis nachweisbar, wenn Gott in der Beziehung gedacht wird, daß er dem Gläubigen die Stellung in der Welt verbürgt, welche die Hemmungen durch dieselbe überwiegt. Außerhalb dieses Werthurteils durch den Glauben findet keine Erkenntnis Gottes statt […]. Vielmehr erkennt man das Wesen Gottes oder Christi nur innerhalb ihres Werthes für uns.“¹⁷⁰ Theologie habe nunmehr die Aufgabe, diese Gottesgemeinschaft des historischpositiven Christentums darzulegen.¹⁷¹ Dementsprechend machte Ritschl sich, beeinflusst auch durch den vom Hegelschen System herkommenden Ferdinand Christian Baur, für eine geschichtlich-wissenschaftliche Theologie unabhängig von metaphysischen Spekulationen stark.¹⁷² Ausgangspunkt war für Ritschl dabei die Figur des historischen Jesus,¹⁷³ da sich in seiner Person der Gemeinschaftswille Gottes geschichtlich kundgetan habe.¹⁷⁴ Dadurch band Ritschl vor allem auch „die systematische Theologie an die Geschichte.“¹⁷⁵ Gerade darin sollte Ritschl noch zu Lebzeiten schulbildend wirken:¹⁷⁶ „Dogmatik und Exegese fordern einander, wenn anders die erstere nicht eine geschichtliche Wirklichkeit postulieren und die letztere sich nicht in Religionsgeschichte auflösen will. Dieser programmatischen Verbindung von ernsthafter geschichtlicher Forschung und Dogmatik verdankt Ritschl seinen Einfluß auf die junge Generation.“¹⁷⁷ Die große theologiegeschichtliche Bedeutung seiner Person liege dementsprechend dann auch vor allem in den Ritschlianern, die bis Ende des 19. Jahrhunderts mit die bedeutendste theologische Schule darstellten;¹⁷⁸ so z. B. bekannter Weise Wilhelm Herrmann, der nach Er-
169 Vgl. Mildenberger, Geschichte, 128. 170 Ritschl, RV III § 29, 198. 171 Vgl. Hägglung, Geschichte, 295. 172 Vgl. Lessing, Geschichte, Bd. 1, 36. 173 Vgl. Schäfer, Ritschl, 174 f. 174 Vgl. Mildenberger, Geschichte, 129 f. 175 Schäfer, Ritschl, 177. 176 Vgl. Lessing, Geschichte, Bd. 1, 78 ff. So waren die Ausführungen Ritschls von einer großen Breitenwirkung gekennzeichnet. Gerade auf die im Folgenden noch zu behandelnde Religionsgeschichtliche Schule hatte die historische Fundierung der Theologie durch Ritschl großen Einfluss. Vgl. Schäfer, Ritschl, 178. 177 Schäfer, Ritschl, 178. Berühmte Ritschlianer waren: W. Herrmann, A. v. Harnack, M. Rade, J. Weiß, auch E. Troeltsch u. v. a.Vgl. Ders, Art. Ritschl, Albrecht/Ritschlsche Schule (1822 – 1889), in: TRE 29 (1998), 220 – 238, 232. 178 Vgl. Lessing, Geschichte, Bd. 1, 81. Als bedeutendster Ritschlianer dürfte Harnack gelten.
38
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
scheinen von Ritschls Rechtfertigung und Versöhnung (1870 – 1874) den Kontakt zu ihm suchte.¹⁷⁹ In Fortführung von Ritschls Ansatz grenzte Herrmann Theologie sowohl gegen Metaphysik als auch gegen die durch das moderne Weltbild aufkommenden Deutungsansprüche der Naturwissenschaften ab.¹⁸⁰ Grundlegend ist also zu konstatieren, dass die anhaltende Bedeutung Ritschls in seinem Versuch der Aussöhnung des traditionellen Christentums mit den Erklärungs- und Denkmustern der Moderne und der daraus resultierenden historischwissenschaftlichen Grundlegung der Theologie zu sehen ist, deren Gegenstände die Geschichte und Inhalte des positiv-vorfindlichen Christentums sind.
2.2.5 Ernst Troeltsch und die Religionsgeschichtliche Schule Eine für die Beziehung zur Religionswissenschaft dauerhaft bedeutende, wenn nicht aus heutiger (Außen‐) Sicht sogar explizit problematische Etappe der Wissenschaftsgeschichte der Theologie war die Ende des 18. Jahrhunderts in Göttingen entstandene sogenannte Religionsgeschichtliche Schule (RS).¹⁸¹ Zunächst in Anlehnung, dann aber vielmehr in kritischer Auseinandersetzung mit Ritschl¹⁸² und dem Kulturprotestantismus bildete sich die „kleine Göttinger Fakultät“¹⁸³ um namhafte Theologen wie Bousset, Johannes Weiß, William Wrede u. v. a., deren Einfluss bald auch über Göttingen hinaus wuchs. Der, „wissenschaftsgeschichtlich geurteilt, an die Werke Ferdinand Christian Baurs anknüpf[ende]“¹⁸⁴Grundgedanke dieser „Arbeitsrichtung“¹⁸⁵ war die historisch-kritische Untersuchung der Religionsgeschichte des Christentums und damit dessen Einordnung in die Zusammenhänge einer allgemeinen Religionsgeschich-
179 Vgl. Schäfer, Art. Ritschl, 232 ff. 180 Vgl. dazu z. B. Mildenberger, Geschichte, 133 ff. 181 Vgl. Lessing, Geschichte, Bd. 1, 278. 182 Vgl. Lüdemann, Gerd, Das Wissenschaftsverständnis der Religionsgeschichtlichen Schule im Rahmen des Kulturprotestantismus, in: Müller, Hans Martin (Hg.), Kulturprotestantismus. Beiträge zu einer Gestalt des modernen Christentums, Gütersloh 1992, 78 – 107, 79 ff. Vor allem Ritschls strikt diesseitig-ethische Interpretation des „Reiches Gottes“ verursachte bei den Vertretenden der Religionsgeschichtlichen Schule zunehmend Widerspruch. Vielmehr betonten sie den eschatologischen Charakter des durch Jesus von Nazareth verkündigten Reiches Gottes. Vgl. Weiss, Johannes, Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes, Göttingen 21900, 71 ff. Nicht die Aussöhnung biblischer Inhalte mit Denkmustern der Moderne, sondern deren historisch-kritische Ausarbeitung standen im Vordergrund. 183 Troeltsch, Ernst, Die „kleine Göttinger Fakultät“ von 1890, in: ChW 18/34 (1920), 281 – 283, 281. 184 Lüdemann, Das Wissenschaftsverständnis, 106. 185 Lessing, Geschichte, Bd. 1, 273.
2.2 Die epistemische Wende der Theologie zur Religion – moderne Entwicklungen
39
te.¹⁸⁶ „Ihre Hauptüberzeugung war, daß Religion nichts Feststehendes, sondern etwas sich Entwickelndes, der menschlichen Geschichte Unterworfenes sei.“¹⁸⁷ Eine religionsgeschichtliche Betrachtung des Christentums beinhaltete also einerseits die historische Auseinandersetzung mit dem Christentum selbst, als auch dessen Vergleich mit und dementsprechend die Erforschung von anderen Religionen – initiiert durch die seit dem 18. Jahrhundert stetig ansteigende Verfügbarkeit religionsbezogenen Quellenmaterials.¹⁸⁸ Dadurch wurde zwar die christliche Religion einerseits vergleichbar gemacht, andererseits aber auch der Blick für ihre Eigenarten geschärft.¹⁸⁹ Haupterkenntnis der RS war, dass vielzählige Vorstellungen des (Ur‐) Christentums aus den Einflüssen durch seine Umweltreligionen, v. a. dem Judentum resultierten.¹⁹⁰ Die größte Wirkung der RS lag allerdings nicht in ihren systematischen Gedanken, sondern in der methodologischen Fokussierung auf rein historisch-komparative Forschung.¹⁹¹ Die große Ausnahme bildete dabei Troeltsch als der Systematiker der RS, der sich intensiv mit zeitgenössischer Wissenschaftstheorie und deren Konsequenzen für Theologie auseinandersetzte.¹⁹² In seiner Schrift Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte von 1902 versuchte Troeltsch, die aus der historisch-komparativen Methode resultierende Relativität des Christentums mit einem Absolutheits- und Wahrheitsanspruch zu korrelieren: So konstatierte Troeltsch eine aus der allgemeinen Religionsgeschichte ersichtliche vorläufige Absolutheit der christlichen Religion; nämlich insofern, als dass sie „die stärkste und gesammeltste Offenbarung der personalistischen Religiosität“¹⁹³ sei. Die allen „großen“ Religionen innewohnenden vier Grundgedanken Gott, Welt, Seele und das „höhere, überweltliche Leben“¹⁹⁴ seien im Christentum „zu voller Selbständigkeit und Kraft
186 Vgl. Hägglund, Geschichte, 310 f. 187 Lüdemann, Gerd/Özen, Alf, Art. Religionsgeschichtliche Schule, in: TRE 28 (1997), 618 – 624, 618. Dabei wurde der Gedanke einer Entwicklungsgeschichte aller Religionen teilweise so weit geführt, dass auch die Darwinsche Evolutionstheorie auf die Religionsgeschichte angewandt wurde – im Sinne einer Entwicklung von „primitiven“ Religionen bis hin zum als höchste Stufe gewerteten Christentum. Vgl. ebd., 620. 188 Vgl. Lüdemann, Das Wissenschaftsverständnis, 84. 189 Vgl. Hägglund, Geschichte, 311. 190 Lüdemann/Özen, Art. Religionsgeschichtliche Schule, 619 f. 191 Vgl. Hägglund, Geschichte, 313.Vgl. ebenso Lüdemann/Özen, Art. Religionsgeschichtliche Schule, 622. 192 Vgl. Lessing, Geschichte, Bd. 1, 286. 193 Troeltsch, Ernst, Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte (1902/1912). Mit den Thesen von 1901 und den handschriftlichen Zusätzen, in: KGA 5 (1998), 81 – 244, 195. 194 Ebd., 196.
40
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
gelangt“.¹⁹⁵ Dabei sei die christliche Religion allerdings nicht der letzte, sondern nur der vorläufige Höhepunkt der Religionsgeschichte,¹⁹⁶ denn als „geschichtliche Tatsache“¹⁹⁷ sei sie wesenhaft nur in individuell-historischer, empirisch-vorfindlicher Form anschaubar.¹⁹⁸ Die Wertung des Christentums als endgültigen Höhepunkt aller religionsgeschichtlichen Entwicklung vermöge nur der Glaube, nicht die theologisch-wissenschaftliche Betrachtung.¹⁹⁹ Gerade die RS stellte die Religionswissenschaft vor Probleme bei der Distanzierung von der Theologie. Die historisch-komparative Herangehensweise der RS wurde vor allem retrospektiv als Vereinnahmung ²⁰⁰ religionswissenschaftlicher Arbeitsweisen durch die Theologie empfunden. So urteilte bereits Rudolph in Bezug auf das Verhältnis der beiden Fächer zueinander negativ über diese wissenschaftsgeschichtliche Etappe: In der RS werde „die christliche Theologie zu einer Disziplin der allgemeinen Religionswissenschaft gemacht, doch nicht so, daß man dem christlichen Glauben den Abschied gibt, vielmehr versucht man ihn mittels der religionsgeschichtlichen Methode als allen anderen Religionen überlegen aufzuweisen.“²⁰¹ Diese Verquickung religionswissenschaftlicher Vorgehensweise und
195 Ebd. 196 Vgl. Thielicke, Glauben, 634. 197 Troeltsch, Die Absolutheit, 197. 198 Vgl. ders., Was heißt „Wesen des Christentums“?, in: ChW 19/17 (1903), 443 – 446, 445. Troeltsch setzte sich hier u. a. mit dem Ritschl-Schüler Harnack auseinander, der in seiner Schrift Das Wesen des Christentums darzulegen ansetzte, dass die bleibend bedeutenden Inhalte des Christentums allein durch die Rekonstruktion der ursprünglichen Botschaft des historischen Jesus zu eruieren sind. Vgl. z. B. Harnack, Adolf von, Das Wesen des Christentums. Neuauflage zum fünfzigsten Jahrestag des ersten Erscheinens. Mit einem Geleitwort von Rudolf Bultmann, Stuttgart 1950, 91 ff. Troeltsch entgegnete hier dazu, dass jedes Urteil über die Frage nach dem Wesen einer Religion nie über eine rein historische Methode funktionieren könne, sondern immer mit bestimmten Wertvorstellungen verbunden sei. Vgl. Troeltsch, Was heißt, 448. 199 Vgl. ders., Die Absolutheit, 198. 200 Eine teilweise bis heute artikulierte Sorge religionswissenschaftlicher Fachvertreter*innen. So geriet die Verfasserin dieser Arbeit im Frühjahr 2023 in eine halb private Email-Debatte um die potentielle Mitgliedschaft und v. a. aktive Mitwirkung von „reinen“ Theolog*innen in der Deutschen Vereinigung für Religionswissenschaft (DVRW), die hier nur anekdotisch erwähnt sein soll. Ein*e anerkannte*r Professor*in der Religionswissenschaft äußerte in diesem Zusammenhang die wohl gängige Befürchtung einer Übernahme der DVRW durch Theolog*innen. Begründet wurde dies im späteren Verlauf der Kommunikation damit, dass Theologie sich aufgrund der aktuell schwierigen hochschulpolitischen Lage vermehrt religionswissenschaftlichen Herangehensweisen widmen würde, um ihre universitäre Daseinsberechtigung weiterhin zu rechtfertigen. 201 Rudolph, Die Religionsgeschichte, 53.
2.2 Die epistemische Wende der Theologie zur Religion – moderne Entwicklungen
41
theologischen Interesses könne auf Dauer nur zu unaushaltbaren Spannungen führen, was Rudolph gerade auch bei Troeltsch festzustellen glaubte.²⁰² So hatte diese von Rudolph als ungesund²⁰³ gewertete Entwicklung in der Wissenschaftsgeschichte auch nachhaltigen Einfluss auf die Religionswissenschaft; namentlich im bereits genannten Religionsphänomenologen Otto, einem der populärsten Religionswissenschaftler, der gleichzeitig als Vertreter der RS gewertet werden kann. Durch ihn habe die „idealistisch-romantische Religionsauffassung“ der RS Einzug in die Religionswissenschaft gehalten, und mit ihr „Irrationalismus und Mystizismus, der den wissenschaftlichen Charakter der Religionswissenschaft untergräbt“.²⁰⁴ Will man den teils hoch polemischen Ausführungen Rudolphs nicht zustimmen, so lässt sich dennoch konstatieren, dass die Impulse der RS die Schwierigkeiten einer Abgrenzung von Theologie verschärften. Einmal in Bezug auf den Gegenstandsbereich, denn der „Religionsbegriff wird [allerspätestens mit der RS, C. N.] nun der maßgebliche Grundbegriff [der Theologie].“²⁰⁵ Und andererseits in Bezug auf die Methodologie, denn die Hauptwirkung der RS auf akademische Theologie lag in ihrer streng historisch-komparativen Methodik²⁰⁶ – einem (zumindest selbst-affirmativen) Charakteristikum religionswissenschaftlichen Forschens.²⁰⁷
2.2.6 Dialektische Theologie und der Offenbarungsbezug der Theologie In Bezug auf die Dialektische Theologie muss zwar vorausschickend konstatiert werden, dass es sich natürlich auch und gerade hier um eine in sich äußerst heterogene Denkrichtung²⁰⁸ handelte, so dass eine Eingliederung in die Analyse dieses Unterkapitels nur grob elementarisierend vollzogen werden kann. Dennoch muss
202 Vgl. ebd. Troeltsch selbst sah wissenschaftliche Theologie und Religionswissenschaft in einer unauflösbaren wechselseitigen Verbindung, die er sowohl fachgeschichtlich als auch konzeptionellwissenschaftstheoretisch aufmachte. Vgl. z. B. Troeltsch, Ernst, Theologie und Religionswissenschaft des 19. Jahrhunderts (1902), in: KGA 1 (2009), 895 – 924, 898.919. Er schrieb hier explizit von „religionswissenschaftlicher Theologie“. Ebd., 919. 203 Vgl. Rudolph, Die Religionsgeschichte, 52. 204 Ebd., 56. 205 Lessing, Geschichte, Bd. 1, 304. 206 Vgl. Lüdemann, Das Wissenschaftsverständnis, 106 f. Und in der Gründung des theologischen Handwörterbuchs Religion in Geschichte und Gegenwart. Vgl. Lessing, Geschichte, Bd. 1, 278. 207 Vgl. dazu ausführlich Kapitel 4.3.2. 208 Vgl. Härle, Wilfried, Art. Dialektische Theologie, in: TRE 8 (1981), 683 – 696, 683. Lessing, Eckhard, Geschichte der deutschsprachigen evangelischen Theologie von Albrecht Ritschl bis zur Gegenwart. Band 2. 1918 – 1945, Göttingen 2004, 25.
42
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
sie an dieser Stelle unter einem bestimmten Gesichtspunkt kurz bzw. verkürzend betrachtet werden, nämlich unter ihrer das Verhältnis von Theologie und Religionswissenschaft nachhaltig beeinflussenden Wesensbestimmungen von Religion und Theologie.²⁰⁹ Dabei soll der Fokus zunächst naheliegender Weise²¹⁰ auf Karl Barth und seiner Verhältnisbestimmung von Offenbarung, Glaube und Religion liegen. In der Kirchlichen Dogmatik legte Barth die freie Selbstoffenbarung Gottes, sein Wort, als Bezugs- und Begründungsrahmen der Theologie dar:²¹¹ Die Funktion akademischer Theologie sei die Selbstreflexion der Kirche und die Überprüfung der in ihr geschehenden, durch Offenbarung verursachten Verkündigung des Wortes Gottes.²¹² „So ist Theologie als biblische Theologie die Frage nach der Begründung, als praktische Theologie die Frage nach dem Ziel, als dogmatische Theologie die Frage nach dem Inhalt der der Kirche eigentümlichen Rede. […] Indem sich die Kirche die Wahrheitsfrage in diesem dreifachen Sinn nicht willkürlich, sondern sachgemäß stellt, bekommt diese ihre Selbstprüfung den Charakter eines wissenschaftlichen Unternehmens“.²¹³ Also sei Theologie für Barth schon allein deswegen de facto Wissenschaft, weil sie eine spezifische, in ihrem „Erkenntnisweg“²¹⁴ bestimmte und in ihrer Vorgehensweise nachvollziehbare Art menschlicher Wahrheitssuche sei.²¹⁵ De jure hänge die Aufgabe der Theologie aber nicht an ihrer Kategorisierung als Wissenschaft; v. a. rechtfertige diese Einordnung in den Wissenschaftskanon keine – einem zeitgenössischen Weltbild entspringenden – wissenschaftstheoretischen Anforderungen an die Theologie, da ihre Legitimation und ihr Auftrag allein aus der Verantwortung gegenüber der Offenbarung Gottes resultierten.²¹⁶ Dadurch war für Barth also nicht Religion, sondern die Selbstof209 Zeit- und ideengeschichtliche Kontextualisierungen sollen also auch an dieser Stelle keine besondere Achtung erfahren, da – wie gehabt – das Augenmerk auf den das Verhältnis von Religionswissenschaft und Theologie beeinflussenden substantiellen Aspekten liegen soll. Grundsätzlich ist aber natürlich anzumerken, dass auch Dialektische Theologie nicht losgelöst von ihrem zeitgenössischen Kontext verstanden werden kann. So ist gerade auch bei Barth daran zu erinnern, dass seine Theologie hochgradig historisch bedingt ist. Seine Betonung einer Unverfügbarkeit und dementsprechend methodisch empirischen Entzogenheit eines (christlichen) Glaubensgrundes ist als vor allem auch als Abgrenzung zu natürlicher Theologie, Evolutionismus, Empirismus und Historismus zu verstehen. 210 Vgl. nämlich auch Kapitel 4.4.2. 211 Vgl. Barth, Karl, Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur kirchlichen Dogmatik. §§ 1 – 12, in: KD I,1 (1975), § 7.1, 262 ff. (Im Folgenden abgekürzt KD I,1.) 212 Ebd., § 1, 1. § 3.1, 41. 213 Ebd., § 1, 3. 214 Ebd., § 1, 5. 215 Vgl. ebd. 216 Vgl. ebd., § 1, 6.9. Wie z. B. empiristisch-positivistische, naturalistische oder historistische wissenschaftstheoretischen Anforderungen.
2.2 Die epistemische Wende der Theologie zur Religion – moderne Entwicklungen
43
fenbarung des Wortes Gottes der – unverfügbare, nur in dialektischen²¹⁷ Aussagen annäherbare – Gegenstand der Theologie. Religion, als (Sozial‐) Form, sei vielmehr „Unglaube“,²¹⁸ da sie immer den menschlichen Versuch der Erkenntnis Gottes darstelle.²¹⁹ Der Mensch sehe sich selbst hierbei als Akteur. Wahrer Glaube hingegen sei das Resultat des souveränen Gnadenhandeln Gottes – bei dem der Mensch nur Reakteur sein könne. Theologie könne dementsprechend also niemals in Religionswissenschaft aufgehen, da ihr Gegenstand nicht die vorfindliche(n) Religion(en) sei,²²⁰ sondern eben die Offenbarung Gottes. Eine rein historisch-empirische Untersuchung der christlichen Religion sah bekanntermaßen auch Rudolf Bultmann als theologisch verfehlt an. Einerseits (u. a.) von der RS herkommend und deren Interesse an einer religionsgeschichtlichen Erforschung des (Ur‐) Christentums folgend,²²¹ andererseits die Impulse Barths aufnehmend,²²² entwickelte Bultmann sein Schule machendes Programm der Entmythologisierung zur Erforschung urchristlicher Texte. „Bultmann [stand] in der großen Tradition jener Exegeten, die in bedingungsloser Kritik das Neue Testament zunächst als historische Quelle untersucht haben.“²²³ Seine hermeneutisch grundlegende exegetische Einsicht bestand darin, dass die urchristlichen Texte geprägt
217 Vgl. Hägglund, Geschichte, 316. 218 Barth, Karl, Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur kirchlichen Dogmatik. §§ 13 – 24, in: KD I,2 (1960), § 17.2, 324. (Im Folgenden abgekürzt KD I,2.) 219 Vgl. ebd., 324 ff. „Religion ist Unglaube; Religion ist […] die Angelegenheit des gottlosen Menschen. […] Dieser Satz kann […] nichts zu tun haben mit einem negativen Werturteil. Er enthält kein religionswissenschaftliches und auch kein religionsphilosophisches Urteil […]. Er soll nicht nur irgendwelche andere mit ihrer Religion, sondern er soll auch und vor allem uns selbst als Angehörige der christlichen Religion treffen. Er formuliert das Urteil der göttlichen Offenbarung über alle Religion.“ Ebd., 327. 220 Vgl. Hägglund, Geschichte, 313. Vgl. auch Barth, Karl, Der Römerbrief (1922). Zweite Fassung, Zürich 172005, XI. Barth sprach sich hier gegen eine einseitig historisch-kritische Betrachtungsweise biblischer Texte aus: „Die historisch-kritische Methode der Bibelforschung hat ihr Recht: sie weist auf eine Vorbereitung des Verständnisses, die nirgends überflüssig ist. Aber wenn ich wählen müßte zwischen ihr und der alten Inspirationslehre, ich würde entschlossen zu der letzteren greifen: sie hat das größere, tiefere, wichtigere Recht, weil sie auf die Arbeit des Verstehens selbst hinweist, ohne die alle Zurüstung wertlos ist.“ Ebd. 221 Vgl. Lessing, Geschichte, Bd. 2, 26. 222 Vgl. ebd., 28. Vgl. auch ders., Geschichte der deutschsprachigen evangelischen Theologie von Albrecht Ritschl bis zur Gegenwart. Band 3. 1945 – 1965, Göttingen 2009, 26. Vgl. z. B. auch Bultmann, Rudolf, Theologische Enzyklopädie, Tübingen 1984, 63: „[V]on Gott kann nur die Rede sein aufgrund seiner Offenbarung.“ Zu Bultmanns Theologieverständnis vgl. v. a. ebd., 159 f. 223 Peukert, Wissenschaftstheorie, 25.
44
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
seien von einem mythisch-kultischen Weltbild,²²⁴ welches nicht mit den von Wissenschaft geprägten Ansichten der Moderne vereinbar sei.²²⁵ Um also die christliche Botschaft dem neuzeitlichen Menschen zu vermitteln, müssten ihre Gehalte erst aus den sie umschreibenden Mythen und kultischen Zusammenhängen extrahiert und in den Duktus einer modernen Sprache übersetzt werden. Denn „[e]hrlich bekannt werden können solche Sätze [wie bspw. die im Glaubensbekenntnis] nur, wenn es möglich ist, ihre Wahrheit von der mythologischen Vorstellung, in die sie gefaßt ist, zu entkleiden“.²²⁶ Diese Form der Hermeneutik werde dabei der Intention der Mythen selbst gerecht, denn in ihnen solle gar kein „objektives Weltbild“²²⁷ dargelegt werden, sondern „wie sich der Mensch selbst in seiner Welt versteht“.²²⁸ Hier ging das Entmythologisierungsprogramm Bultmanns über das Programm einer klassischen historisch-kritischen Exegese deutlich hinaus: „der Mythos will nicht kosmologisch, sondern […] existential interpretiert werden.“²²⁹ Durch eine entmythologisierende, die urchristliche Botschaft in aktuelle Sprachformen übersetzende wissenschaftliche Hermeneutik solle der moderne Mensch existentiell angesprochen werden.²³⁰ Mit diesem Programm versuchte Bultmann, die Anforderungen der wissenschaftlichen Redlichkeit durch eine historisch-kritische Untersuchung des Neuen Testaments mit den Anstößen Barths, dem Offenbarungsbezug der Theologie, zu harmonisieren.²³¹ Als weiteres zentrales Beispiel für die innerhalb der Dialektischen Theologie pluralen Ansätze der Verhältnisbestimmung von Mensch, Glaube und Welt und dementsprechend auch von Theologie, Welt und Wissenschaft wird abschließend nun noch illustrierend Friedrich Gogarten herangezogen.²³² Mit dem Ansatz einer Säkularisierungstheorie in seinem Spätwerk legte er einen immanenten Zusammenhang zwischen modernen Prozessen der Säkularisierung,²³³ also der Verwelt-
224 Vgl. Bultmann, Rudolf, Neues Testament und Mythologie. Das Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung. Nachdruck der 1941 erschienen Fassung (BEvT 96), München 31988, 12. 225 Vgl. ebd., 14. 226 Ebd., 15. 227 Ebd., 22. 228 Ebd. 229 Ebd. 230 Vgl. Lessing, Geschichte, Bd. 3, 32. Mildenberger, Geschichte, 207. 231 Vgl. ebd., 208. 232 Die Relevanz seiner Person bzw. Position mag durch die Erinnerung daran veranschaulicht werden, dass nach einem seiner Aufsätze von 1921 das „Organ“ der Dialektischen Theologie, die Zeitschrift Zwischen den Zeiten, benannt worden war. Vgl. Lessing, Geschichte, Bd. 2, 24. 233 Vgl. Gogarten, Friedrich, Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit. Die Säkularisierung als theologisches Problem, Stuttgart 21958, 7.
2.2 Die epistemische Wende der Theologie zur Religion – moderne Entwicklungen
45
lichung der modernen Welt, und dem christlichen Glauben dar.²³⁴ Unter Aufgriff der lutherischen Unterscheidung von Gesetz und Evangelium konstatierte Gogarten, dass der Mensch durch das Offenbarungsgeschehen Gottes in Jesus Christus von aller Werkgerechtigkeit befreit sei, so dass er im Umgang mit der Welt allein seiner Vernunft folgen könne: „Ist die Unterscheidung zwischen der göttlichen Wirklichkeit des Heils und den Werken des Gesetzes […] das eigentliche und höchste Geschäft des Glaubens, weil er nur so das Heil, wie es von Gott verwirklicht ist, zu bewahren vermag, dann hat die Säkularisierung ihren Ansatz im Glauben selbst. Denn indem der Glaube in dieser Unterscheidung die Werke in ihrer irdisch-weltlichen Bedeutung hütet, läßt er sie eine der Vernunft des Menschen überantwortete Angelegenheit der Welt, des Säkulums sein.“²³⁵ Dementsprechend sei die moderne, säkularisierte Existenz des Menschen nichts dem Christentum entgegengesetztes, sondern ihm geradezu immanent.²³⁶ Die Chance liege hierbei darin, dass der Mensch durch seinen Glauben von irdischem Kult befreit sei.²³⁷ Es bestehe nun aber gleichsam die Gefahr, dass die Erkenntniskraft menschlicher Vernunft überschätzt werde, nämlich dann, wenn der Mensch glaubt, vollkommene Welterkenntnis erlangen zu können. Gogarten bezeichnete dies als „Säkularismus“.²³⁸ Vor solcher Hybris könne den Menschen nur der durch göttliche Offenbarung hervorgerufene Glaube und die daraus resultierende mündige „Sohnschaft“,²³⁹ der verantwortungsvolle Umgang des Menschen mit der Welt, bewahren.²⁴⁰ Es gehe also bei Gogartens Säkularisierungstheorie zusammengefasst um die – wechselseitig bedingte – Existenz des Menschen „coram deo, coram seipso und coram mundo.“²⁴¹ Die Dialektische Theologie kann für die Problematik dieser Arbeit als geradezu symptomatisch wichtige Strömung der Theologiegeschichte gelten²⁴² – nicht nur wegen ihrer theologiefachgeschichtlich lange anhaltenden Dominanz, sondern gerade explizit in Bezug auf das Verhältnis der Theologie zur Religionswissenschaft: Denn der (vermeintliche) Offenbarungsbezug der Theologie wird gerade von Seiten der Religionswissenschaft als Unterscheidungskriterium zum eigenen Fach und als
234 Vgl. Mildenberger, Geschichte, 137. 235 Vgl. Gogarten, Verhängnis, 102. 236 Vgl. Mildenberger, Geschichte, 137. 237 Vgl. Hägglund, Geschichte, 327. Was in Konsequenz bedeutete, dass irdischer Kult, also Religion, nicht der angemessene Gegenstand der Theologie sei. 238 Gogarten, Verhängnis, 143. 239 Vgl. ebd., 33 ff. 240 Vgl. Mildenberger, Geschichte, 139. 241 Lessing, Geschichte, Bd. 3, 43. In dieser existentialen Fragestellung zeigt sich die enge Beziehung zwischen Gogarten und Bultmann. Vgl. ebd. 242 Vgl. Härle, Art. Dialektische Theologie, 686: „[D]ie dialektische Theologie [ist] die bisher wirkungsgeschichtlich relevanteste theologische Bewegung des 20. Jh.“
46
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
Ausweis der intersubjektiv unüberprüfbaren Normativität und damit in letzter Konsequenz der Unwissenschaftlichkeit der Theologie herangezogen.²⁴³
2.2.7 Paul Tillich und die Theologie der Kultur Die innere Vielfalt der Theologie Paul Tillichs darzulegen, kann ebenfalls nicht Sinn und Aufgabe dieser Arbeit sein. Vielmehr sollen einige für das Verhältnis von Religionswissenschaft und Theologie bedeutsame Aspekte seines Religions- und Theologieverständnisses aufgezeigt werden, da in Tillich die innere Pluralität des Religionsbezugs der Theologie und damit möglicher Verhältnisbestimmungen der Theologie zur Religionswissenschaft geradezu repräsentiert sind. Religion bestimmte Tillich bekanntlich als die „Erfahrung des Unbedingten“,²⁴⁴ also als Erfahrung dessen, „was uns unbedingt angeht.“²⁴⁵ Da das Unbedingte der Grund allen Seins sei,²⁴⁶ könne Religion nicht auf einen bestimmten kulturellen Bereich, also auch und gerade nicht die vorfindlichen Religionen, beschränkt sein. Religion sei keine Funktion des menschlichen Geistes neben anderen,²⁴⁷ sondern manifestiere sich als die „Tiefendimension“²⁴⁸ des menschlichen Geistes in allen kulturellen Bereichen. Religion sei somit eine anthropologische Grundkonstante. Deswegen unterschied Tillich „zwischen Religion als Leben in der Dimension der Tiefe und den konkreten Religionen, in deren Symbolen und Einrichtungen das religiöse Anliegen des Menschen Gestalt gewonnen hat.“²⁴⁹ Religion und Kultur seien also realiter nicht zu unterscheiden: ²⁵⁰ „Religion ist die Substanz der Kultur und Kultur die Form der Religion.“²⁵¹ Folglich könne auch Theologie nicht auf einen bestimmten Gegenstandsbereich wie den der empirisch-vorfindlichen Religion (des Christentums) beschränkt sein, sondern müsse sich „auf das richten, was uns [Menschen] unbedingt angeht“.²⁵²
243 Vgl. dazu v. a. Kapitel 4.4.2. dieser Arbeit. 244 Tillich, Paul, Über die Idee einer Theologie der Kultur, in: GW 9 (1967), 13 – 31, 18. 245 Ders., Religion als eine Funktion des menschlichen Geistes?, in: GW 5 (1987), 37– 42, 41. 246 Tillich meinte mit dem Unbedingten bzw. mit dem, was einen unbedingt angeht, explizit (den christlich geprägten) Gott bzw. das Göttliche und begründete dies mit dem 1. Gebot des biblischen Dekalogs. Vgl. Ders., Systematische Theologie I, Stuttgart 1955, 19. (Im Folgenden abgekürzt ST I.) 247 Vgl. auch z. B. ders., Über die Idee, 16 f. 248 Ders., Religion als, 40. 249 Ebd., 44. 250 Vgl. ders., Über die Idee, 27. 251 Ders., Religion und Kultur, in: GW 9 (1967), 82 – 93, 84. 252 Ders., ST I, 20. Vgl. auch ders., Dogmatik. Marburger Vorlesung von 1925, Düsseldorf 1986, 25.
2.2 Die epistemische Wende der Theologie zur Religion – moderne Entwicklungen
47
Gegenstand der Theologie seien somit alle Ausdrucksformen des menschlichen Geistes.²⁵³ Mit anderen Worten: Theologie sei „nicht Rede von Gott als von einem Gegenstand neben anderen […], sondern […] Rede von der Manifestation des Göttlichen in allem Seienden und durch alles Seiende hindurch.“²⁵⁴ Tillich subsumierte diese wissenschaftstheoretischen Bestimmungen unter seinem Programm der „Kulturtheologie“²⁵⁵ – einer Theologie, welche „die konkreten religiösen Erlebnisse, die in allen großen Kulturerscheinungen eingebettet liegen“,²⁵⁶ extrahiert und darstellt. Dementsprechend positionierte Tillich Theologie wissenschaftssystematisch nicht als eine (Geistes‐) Wissenschaft neben anderen in dem Sinne, dass sie andere Gegenstände untersuchte;²⁵⁷ sondern er kennzeichnete sie als „theonome Systematik“.²⁵⁸ In Konsequenz daraus unterschied Tillich auch nicht zwischen Theologie und Religionswissenschaft anhand vermeintlich unterschiedlicher Gegenstände, Methoden oder Perspektiven.²⁵⁹ Vielmehr bezeichnete er Theologie als „normative
253 „Bilder, Gedichte und Musik können Gegenstand der Theologie werden, nicht unter dem Gesichtspunkt ihrer ästhetischen Form, sondern im Hinblick auf ihre Fähigkeit, durch ihre ästhetische Form gewisse Aspekte dessen auszudrücken, was uns unbedingt angeht. Physikalische, historische oder psychologische Einsichten können Gegenstand der Theologie werden, nicht wegen ihres Charakters als Formen der Erkenntnis, sondern wegen ihrer Fähigkeit, etwas von letzter Bedeutung zu enthüllen. Soziale Ideen und Handlungen, Gesetzesvorschläge und Verfahren, politische Programme und Entscheidungen können Gegenstand der Theologie werden, aber nicht hinsichtlich ihrer sozialen, gesetzlichen oder politischen Form, sondern im Hinblick auf ihre Fähigkeit, etwas uns unbedingt Angehendes durch ihre soziale, gesetzliche und politische Form zu verwirklichen. Persönlichkeitsprobleme und -entwicklungen, Erziehungsziele und -methoden, körperliche und geistige Heilungen können Gegenstand der Theologie werden, aber nicht unter dem Gesichtspunkt ihrer autonomen Form, sondern unter dem Gesichtspunkt ihrer Fähigkeit, durch ihre autonome Form etwas von letztem und unbedingtem Gewicht zu vermitteln. […] Das, was uns unbedingt angeht, ist das, was über unser Sein oder Nichtsein entscheidet. Nur solche Sätze sind theologisch, die sich mit einem Gegenstand beschäftigen, sofern er über unser Sein oder Nichtsein entscheidet.“ Ders., ST I, 21. 254 Ders., Zur Theologie der bildenden Kunst und der Architektur, in: GW 9 (1967), 345 – 355, 346. 255 Ders., Über die Idee, 20. 256 Ebd., 19. 257 Zum heutigen Verständnis von Theologie als Kulturwissenschaft vgl. Kapitel 5.4.1. dieser Arbeit. 258 Ders., Das System der Wissenschaften nach Gegenständen und Methoden, in: GW 1 (1959), 111 – 293, 276. Zur Unterscheidung von Theonomie und Autonomie: „Theonomie ist Wendung zum Unbedingten um des Unbedingten willen. Während die autonome Geisteshaltung sich auf das Unbedingte richtet und auf das Unbedingte nur, um das Bedingte zu fundieren, gebraucht die Theonomie die bedingten Formen, um in ihnen das Unbedingte zu erfassen.“ Ebd., 271. 259 Gerade zum Stichwort „Perspektive“ merkte Tillich an, dass es nie „standpunktfreie“ Geistesbzw. Kulturwissenschaften geben könne, „weil in den geistigen Dingen der Geist nie in objektiver
48
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
Religionswissenschaft“.²⁶⁰ Eine wissenschaftstheoretisch-qualitative Unterscheidung der Theologie von den anderen Geisteswissenschaften sah Tillich als nicht gegeben an. So sei auch die Existenz eigener theologischer Fakultäten nicht wissenschaftstheoretisch, sondern eher praktisch mit der Existenz konkreter Kirchen zu begründen.²⁶¹
2.3 Resümee: Der fachgeschichtliche Hintergrund aktueller Beziehungsprobleme Wie die bisherigen Darlegungen deutlich zeigten, war das Verhältnis von Religionswissenschaft und Theologie von Anfang an schwierig. Zwar ist zunächst evident, dass Religionswissenschaft in ihren Ursprüngen keine genuin theologische Disziplin ist, sondern aus den verschiedenen Kontexten der Philologie, Anthropologie, Ethnologie, Soziologie (und auch Theologie) entstand und sich also eher durch eine innere Interdisziplinarität auszuzeichnen scheint.²⁶² Doch bereits im Zuge ihrer Institutionalisierung zeigten sich die engen Verbindungen zur Theologie – sei es, dass erste religionsgeschichtliche Lehrstühle mit Theologen besetzt wurden; sei es, dass jene zunächst an theologischen Fakultäten verortet wurden. Es wird vor dem Hintergrund dieser historischen Entwicklungen deutlich, dass eine Abgrenzung der Religionswissenschaft von Theologie aufgrund unterschiedlicher institutioneller Verortung also nicht zielführend ist, zumal bis heute Religionswissenschaft sowohl an theologischen Fakultäten als auch außerhalb derselben anzutreffen ist.²⁶³ Des Weiteren erschwerten die wissenschaftstheoretischen Entwicklungen innerhalb der Theologie jedwede Abgrenzung von Religionswissenschaft: Seit Schleiermacher, später Ritschl, noch deutlicher spätestens seit Troeltsch und der RS teilt Theologie sich ihren wissenschaftstheoretischen Gegenstandsbereich partiell mit der Religionswissenschaft, nämlich den Bereich der vorfindlichen Religion.²⁶⁴
Ferne den Dingen gegenübersteht, sondern sie in sich selbst in erlebnishafter Nähe hat“. Ders., Theologie als Wissenschaft, in: Vossische Zeitung 512 (30.10.1921), 2 – 3, 2. 260 Vgl. z. B. ders., Das System, 228. 261 Vgl. ders., Theologie als, 3. 262 Man denke bspw. nur an einen ihrer „Gründungsväter“, den Philologen Müller. Genauso sei erinnert an die Einflüsse aus der Soziologie, namentlich durch Durkheim. 263 Näheres dazu unter Punkt 2.4. 264 Zwar bildete die Dialektische Theologie hier eine starke Ausnahme, doch ist darauf hinzuweisen, dass auch dort der Arbeitsgegenstand der Theologie im Empirisch-Vorfindlichen lag, nämlich in den Zeugnissen göttlicher Offenbarung. „Gott“ selbst sei hingegen der unverfügbare, und damit nicht mit anderen Gegenständen gleichzusetzende Zielpunkt der Theologie. Vgl. z. B. Bultmann, Theologische, 63. Es soll angemerkt werden, dass der wissenschaftstheoretische Offenba-
2.4 Einlicke in systematisch-theologischer Absicht
49
Vor allem die RS machte deutlich, dass gerade Theologie sich eben nicht nur mit dem Christentum, sondern grundlegend historisch-komparativ auch mit anderen Religionen beschäftigt.²⁶⁵ Deutlich wird in dieser wissenschaftsgeschichtlich begründeten Wende der Theologie zur Religion, dass der wechselseitige Bezug zwischen Religionswissenschaft und Theologie im Kontext gesamtwissenschaftlicher Entwicklungstendenzen stand und steht, weswegen wissenschaftstheoretische und -praktische Verzahnungen zwischen diesen beiden religionsbezogenen Disziplinen die wissenschaftstgeschichtslogische Konsequenz zu sein scheinen. Denn ebenso zeigten die innertheologischen Entwicklungen, dass auch nach methodologischen Gesichtspunkten keine eindeutigen Abgrenzungen zwischen den Fächern gezogen werden könne. (Als bestes klassisches Beispiel mag dafür die historisch-kritische Exegese als Methode beider Disziplinen gelten.) Vielmehr stellt sich die Frage, ob eine klare Trennung der Fächer sinnvoll ist, oder ob eine Verhältnisbestimmung beider zueinander nicht eher integrativ vollzogen werden sollte, wie es z. B. Tillich mit seiner Konzeption von Theologie als „normativer Religionswissenschaft“ unternahm. Grundlegend hat es den Anschein, als ob die Probleme einer Verhältnisbestimmung von Religionswissenschaft und Theologie aus der Vorgehensweise der bisherigen Untersuchung resultierten: Weder Gegenstand, noch Methode, noch institutionell-perspektivische Verortung können die Fächer eindeutig voneinander unterscheiden.²⁶⁶
2.4 Einlicke in systematisch-theologischer Absicht: Religionswissenschaft und Theologie im heutigen deutschsprachigen Hochschulraum In den folgenden Abschnitten soll eine Art Eindruck über die (zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Arbeit) aktuelle²⁶⁷ institutionelle Situation von Religionswissen-
rungsbezug Theologie sicherlich auch vor ideologischen Vereinnahmungen moderner Denkmuster schützen sollte – sei es vor Empirismus, Szientismus oder eben auch vor kruden Formen natürlicher Theologie zu Zeiten des deutschen Nationalsozialismus. 265 Dadurch kann die RS als Paradebeispiel für die Abgrenzungsproblematik der Religionswissenschaft von der Theologie gelten. Vor allem am Exempel Ottos, der sowohl zur RS als auch zur Religionsphänomenologie (als einer Form der Religionswissenschaft) gezählt werden kann, wird die Schwierigkeit der disziplinären Differenzierung deutlich. 266 Näheres dazu in Kapitel 3.1. dieser Arbeit. 267 Die folgenden Angaben beziehen sich auf eigene Onlinerecherchen auf Basis der Selbstauskünfte der untersuchten staatlichen und kirchlichen Hochschulen und Universitäten aus dem Jahr
50
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
schaft und (evangelischer) Theologie in der deutschsprachigen Wissenschaftslandschaft gegeben werden, um – in einer schwachen Begründungsfunktion²⁶⁸ – zu eruieren, ob sich aus den verschiedentlichen Institutionalisierungsformen von Religionswissenschaft (außerhalb oder innerhalb von bzw. gemeinsam mit Theologie) und deren fachlicher Selbstauskunft Rückschlüsse auf unterschiedliche Fachverständnisse ableiten lassen könnten. Zentral sind im Folgenden also – vor dem Hintergrund eines Blicks auf die verschiedenen Verortungsmöglichkeiten – die jeweiligen veröffentlichten Selbstverständnisse als Disziplin.
2.4.1 Religionswissenschaft im deutschsprachigen Hochschulraum Bei einem Blick auf die aktuelle Hochschullandschaft²⁶⁹ zeigt sich schnell, dass die historisch gewachsenen Abgrenzungsprozesse der Religionswissenschaft von akademischer Theologie durchaus (noch) nicht als abgeschlossen gelten können. Knapp zwei Drittel aller religionswissenschaftlichen Einrichtungen (also Lehrstühle, Seminare, Abteilungen o. ä.) sind im Kontext theologischer Fakultäten, Fachbereiche, Seminare o. ä. verortet.²⁷⁰ Deutlich ist auch, dass es vor allem die evangelische Theologie ist, mit der viele institutionelle Verknüpfungen bestehen: Von den im Kontext theologischer Institutionen existierenden religionswissenschaftlichen
2020. Die Quellenangabe der einzelnen Weblinks erfolgt dementsprechend auch unter Angabe des damaligen Abrufdatums und bezieht sich auf diesen Stand. Dabei wurden auf Grundlage der Angaben des WSR in seinen „Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Theologien und religionsbezogenen Wissenschaften an deutschen Hochschulen“ von 2010 in Abgleich mit den Angaben der DVRW bzw. der WGTh die Lehrstühle bzw. Professuren für Religionswissenschaft und evangelische Theologie in ihrer akademischen Institutionalisierung und jeweiligen Selbstauskunft zum Fachverständnis betrachtet, um gegenseitige Verzahnungen sowohl auf institutioneller als auch in Teilen auf personeller Ebene zu illustrieren. Alle Angaben sind ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit oder Gewähr zu verstehen. 268 So soll damit nicht die dieser Arbeit zugrunde liegende Hauptthese einer Unterscheidbarkeit der beiden Disziplinen anhand ihrer jeweiligen wissenschaftstheoretischen Fragestellung begründet, sondern vielmehr die Existenz und spezifische soziokulturelle Positionalität der disziplinären Unterscheidungsproblematik an sich veranschaulicht werden. 269 Quelle: eigene Onlinerecherchen auf Basis der Selbstauskünfte von 32 untersuchten staatlichen und kirchlichen Hochschulen und Universitäten. 270 Dies deckt sich mit den Angaben des WSR von 2010: „Nach wie vor ist rund die Hälfte aller religionswissenschaftlichen Professuren an den Theologischen Fakultäten institutionalisiert, in der Mehrzahl an einer Evangelisch-Theologischen Fakultät“. WSR, Empfehlungen, 89. Daraus könnte – trotz aller Entwicklungen im Bereich der religionsbezogenen Wissenschaften innerhalb der letzten zehn Jahre – geschlossen werden, dass sich die Grundsituation der Religionswissenschaft seit 2010 nicht signifikant geändert hat.
2.4 Einlicke in systematisch-theologischer Absicht
51
Einrichtungen sind ebenfalls knapp zwei Drittel im evangelisch-theologischen Kontext angesiedelt.²⁷¹ Dabei bestätigt sich grundsätzlich der auch vor einem Jahrzehnt dominierende Eindruck, dass insgesamt der „Platz der Religionswissenschaft im Fächerspektrum bis heute unklar geblieben [ist].“²⁷² Nicht nur, dass auch außerhalb der Theologie Religionswissenschaft an den verschiedenen Hochschulen immer wieder unterschiedlichen Institutionen zugeordnet ist – mal der Philosophie, mal der Philologie, mal den Kultur- und Sozialwissenschaften.²⁷³ Sondern relativ häufig existieren mehrere Einrichtungen für Religionswissenschaft an einer Hochschule an verschiedenen Institutionen. So gibt es z. B. an der Universität Tübingen einmal ein „Seminar für Religionswissenschaft und Judaistik“ an der Evangelisch-Theologischen Fakultät²⁷⁴ – aber auch eine „Abteilung Religionswissenschaft und einen Lehrstuhl für „Indologie und Vergleichende Religionswissenschaft“ an der Philosophischen Fakultät. Ähnliche Konstellationen finden sich an den Universitäten in Erfurt, Frankfurt am Main, Göttingen, Heidelberg, Mainz, Marburg, München, Münster oder auch Würzburg. Dabei sind also oft Konstellationen anzutreffen, bei denen Religionswissenschaft zusätzlich zu einer theologischen eben auch noch mit einer nicht-theologischen Disziplin verortet ist. Ebenfalls häufig tritt allerdings der Fall auf, dass Religionswissenschaft sowohl an einer evangelisch-theologischen als auch einer katholisch-theologischen Institution existiert. Insgesamt sind diese Doppelkonstellationen allerdings durchaus fundiert durch ein an sich interdisziplinäres Fachverständnis²⁷⁵ – ein Aspekt, der an immer mehr bundesdeutschen Hochschul271 Über die Selbsteinschätzung dieser Lehrstühle als „religionswissenschaftlich“ oder/und „theologisch“ wird unter 2.4.1.1. zu sprechen sein. 272 Ebd., 87. 273 Solches spiegelt gut ihre interdisziplinären Ursprünge wider, die anhaltenden sowohl wissenschaftstheoretischen als auch -praktischen Einfluss auf das Fach haben. „Auf der professoralen Ebene rekrutiert die Religionswissenschaft im deutschsprachigen Raum vielfach nach wie vor ihren wissenschaftlichen Nachwuchs aus anderen Disziplinen.“ Ebd., 92. Gleichzeitig kann diese interdisziplinäre Ausrichtung auch im Kontext der kulturwissenschaftlichen Wende der Religionswissenschaft verstanden werden. Vgl. dazu Kapitel 4.4.1. dieser Arbeit. Der WSR konstatierte ähnliches in seinen „Empfehlungen …“ und warnte vor dem Hintergrund einer verstärkten Ausrichtung auf kultur- bzw. sozialwissenschaftliche Forschungen, dass dadurch die Vernachlässigung des Studiums der Quellsprachen und damit einhergehend eine „Provinzialisierung“ des Fachs drohen könne. Vgl. ebd., 91 f. 274 Vgl. die Website der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Seminar für Religionswissenschaft und Judaistik, https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/evangelisch-theologischefakultaet/lehrstuehle-und-institute/religionswissenschaft-und-judaistik/ – 14.12.20. 275 „Wegen der enormen Breite des Faches sind die ReligionswissenschaftlerInnen hier in Frankfurt in die Fachbereiche 06 (Evangelische Theologie), FB 07 (Katholische Theologie) […] und FB
52
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
standorten zentral wird; so z. B. explizit in Göttingen, aber auch an vielen anderen Universitäten. Als geradezu musterhaft dafür ist z. B. Bochum zu nennen mit dem interdisziplinären Forschungszentrum CERES.²⁷⁶ Dennoch ist deutlich, dass Religionswissenschaft mit keinem anderen Fach so viele Verzahnungen nicht nur auf institutioneller, sondern gerade auch auf personeller Ebene aufzuweisen hat wie mit der Theologie. Dies spiegelt sich zu großen Teilen auch in den Lebensläufen der Lehrstuhlinhabenden wider: Deutlich mehr als die Hälfte aller religionswissenschaftlichen Professor*innen hat im Zuge ihrer akademischen Laufbahn (unter anderem) christliche Theologie studiert und/oder sich in Theologie an der ein oder anderen Stelle der beruflichen Vita wissenschaftlich qualifiziert – davon knapp zwei Drittel in evangelischer Theologie. Im deutschsprachigen Ausland²⁷⁷ ergibt sich ein ähnliches (wenn auch aufgrund unterschiedlicher administrativer Gegebenheiten vielleicht nicht unbedingt gleichsetzbares) Bild: Die Hälfte aller religionswissenschaftlichen Einrichtungen ist zusammen mit reformiert-theologischer oder katholisch-theologischer Theologie verortet, wobei sich hier die konfessionelle Aufteilung ungefähr die Waage hält – was auch auf personeller Ebene gilt: Ein Drittel aller Professor*innen für Religionswissenschaft hatten im Laufe ihrer akademischen Ausbildung mit Theologie zu tun, davon jeweils die Hälfte mit evangelischer oder eben katholischer Theologie.
2.4.2 Evangelische Theologie im deutschsprachigen Hochschulraum Evangelische Theologie kann in der BRD an insgesamt 29 Standorten studiert werden.²⁷⁸ Davon sind drei als Kirchliche Hochschulen verfasst; der Rest existiert in
09 (Islamische Studien) eingebunden, außerdem bestehen Kooperationen u. a. zur jüdischen Religionsphilosophie, Judaistik, Ethnologie, Geschichte und zur Soziologie.“ Website der Religionswissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt a. M., https://www.uni-frankfurt.de/42495474/Profil – 14.12.20. 276 Vgl. die Website CERES an der Ruhr-Universität Bochum, http://www.ceres.ruhr-uni-bochum.de/ – 14.12.20. Gegründet wurde CERES am 09.12.09, also noch vor den Empfehlungen des WSR. 277 Quelle: eigene Onlinerecherchen auf Basis der Selbstauskünfte der 9 untersuchten Hochschulen und Universitäten. 278 Quelle: eigene Onlinerecherchen auf Basis der Selbstauskünfte der 29 untersuchten staatlichen und kirchlichen Hochschulen und Universitäten. Hierbei wurde ein sozusagen umfassendes Verständnis des Theologiestudierens angewandt: Nicht nur Hochschulstandorte mit sogenannter Volltheologie (also der Abschlussmöglichkeit Kirchliches Examen bzw. Diplom) werden aufgeführt, sondern auch solche, die Theologie allein im Kontext des Lehramtsstudiums anbieten. Katholische Theologie findet im Folgenden keine Berücksichtigung. Diese Fokussierung resultiert vor allem aus der Beschränkung dieser Arbeit auf eine Verhältnisbestimmung von Religionswissenschaft und
2.4 Einlicke in systematisch-theologischer Absicht
53
Form von theologischen Fakultäten oder Fachbereichen an deutschen Universitäten oder Hochschulen. An der Hälfte dieser Standorte gibt es religionswissenschaftliche Einrichtungen mit im Schnitt einer halben Professur – im Verhältnis zu insgesamt durchschnittlich 10 Professuren pro Standort. Das heißt, dass insgesamt gerade einmal reichlich 5 % aller evangelisch-theologischen Professuren für Religionswissenschaft angedacht zu sein scheinen.²⁷⁹ Diese sind ihrer Bezeichnung nach in drei Übergruppen teilbar, nämlich erstens in solche mit dem zusatzlosen Titel „Religionswissenschaft“ und/oder„Religionsgeschichte“, in zweitens solche mit einer Form der Namenskombination „Religions- und Missionswissenschaft“ und in drittens jene in der Zusammenstellung „Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie“. Die letzte Gruppe macht mit 50 % die größte aus, gefolgt von der ersten mit knapp einem Drittel; abgeschlossen von der Gruppe mit der Fachkombination „Religions- und Missionswissenschaft“ mit insgesamt zwei Einrichtungen.²⁸⁰ Vergleicht man nun in einem letzten – äußerst grob gehaltenen – Schritt evangelische Theologie nach Anzahl der Lehrstühle mit Religionswissenschaft, so lässt sich Folgendes konstatieren: Evangelische Theologie ist nicht nur allein von der Anzahl der Lehrstühle her (mit 265 Professuren) gegenüber der Religionswissenschaft (mit 54 Professuren) quantitativ weitaus besser aufgestellt. Auch die Studierendenzahlen zeigen deutlich, dass Theologie das mengenmäßig ²⁸¹ größere Fach ist:²⁸² Im Wintersemester 2019/2020 studierten insgesamt 10509 Personen evangelische Theologie als erstes Studienfach an einer deutschen Universität bzw. Hoch-
evangelischer Theologie, korreliert aber auch mit der im Vorherigen exemplifizierten Erkenntnis, dass der Großteil der innerhalb der Theologie verorteten religionswissenschaftlichen Einrichtungen im Zusammenhang evangelischer Theologie institutionalisiert ist. 279 Im deutschsprachigen Ausland fallen auf insgesamt 41 evangelisch-theologische Professuren an insgesamt 4 Standorten 3 Professuren für Religionswissenschaft bzw. empirische Religionsforschung. Auch hier ist evangelische Theologie also im Schnitt mit ca. 10 Professuren pro Standort aufgestellt, davon im Schnitt 0,75 für Religionswissenschaft. Das heißt dann also, reichlich 7 % aller Lehrstühle insgesamt sind für Religionswissenschaft (angedacht). Quelle: eigene Onlinerecherchen im November 2020 unter Orientierung an der Auflistung der WGTh. Vgl. die Website der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie. Fakultäten, http://wgth.de/index.php/fakultaeten – 26.11.20. Alle Angaben auch hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Gewähr. 280 Zu der dahinterliegenden Entwicklung im Bereich der Interkulturellen Theologie vgl. Kapitel 5.1.1. dieser Arbeit. 281 Davon lässt sich natürlich keinesfalls auf Forschungsintensität, Bedeutsamkeit o. ä. zurückschließen. 282 Allerdings ist anzumerken, dass die Studierendenzahlen mit Theologie als Hauptfach seit der letzten Jahrzehnte sinken. Vgl. WSR, Empfehlungen, 28 f. Zumal hier (aus Gründen des Recherchezeitraums) nicht beachtet die Einbrüche der Studierendenzahlen im Kontext der Corona-Pandemie sind.
54
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
schule, davon 903 im ersten Hochschul- und 1911 im ersten Fachsemester.²⁸³ Religionswissenschaft wurde im Wintersemester 2019/2020 von insgesamt 1940 Studierenden als erstes Studienfach belegt; davon waren 173 im ersten Hochschul- und 445 im ersten Fachsemester.²⁸⁴ Dies spiegelt keineswegs eine größere gesellschaftliche oder wissenschaftliche Bedeutsamkeit der Theologie wider, sondern verdeutlicht vielmehr, dass Religionswissenschaft im Vergleich zur Theologie eine junge und dementsprechend nicht gleichermaßen etablierte Disziplin ist. Theologie gehört zum traditionellen Fächerkanon der klassischen Universität; ihre Existenz ist verfassungsrechtlich abgesichert. So wurden z. B. auch während der Nachkriegszeit an vielen neugegründeten Universitäten geradezu selbstverständlich theologische Fakultäten eingerichtet.²⁸⁵ Die erste neu gegründete Universität ohne Theologie entstand erst 1914 in Frankfurt am Main.²⁸⁶ Es ist wichtig, diesen Machtvorteil der Theologie gegenüber der Religionswissenschaft im Verlauf der folgenden wissenschaftstheoretischen Analysen im Hinterkopf zu behalten.
2.4.3 Profile der innerhalb der evangelischen Theologie verorteten religionswissenschaftlichen Lehrstühle Um zu überprüfen, inwiefern sich das Selbstverständnis der innerhalb der Theologie verorteten religionswissenschaftlichen Lehrstühle mit dem Fachverständnis der außer-theologischen Einrichtungen für Religionswissenschaft deckt oder schneidet, werden im Folgenden die Profile dieser Lehrstühle mit dem Verständnis der DVRW von Religionswissenschaft verglichen.²⁸⁷ Dabei liegt der Fokus auf solchen Professuren, die innerhalb evangelischer Theologie institutionalisiert sind. Zum Fachverständnis der DVRW soll folgendes Zitat maßgeblich²⁸⁸ sein:
283 Vgl. Statistisches Bundesamt, Bildung und Kultur. Studierende an Hochschulen. Wintersemester 2019/2020 (Fachserie 11 Reihe 4.1/17.09. 2020), 114. Interessant ist, nebenbei bemerkt, dass das Statistische Bundesamt in seinen Publikationen Religionswissenschaft nicht in eine Fächergruppe zusammen mit Theologie einordnet, sondern sie dem Bereich der Philosophie zuweist.Vgl. ebd., 432. 284 Vgl. ebd., 115. 285 Vgl. WSR, Empfehlungen, 16 f. 286 Vgl. ebd., 17. 287 Hintergrund ist, dass alle außerhalb der Religionswissenschaft verorteten Lehrstühle auf der Internetpräsenz der DVRW aufgelistet werden, während einige innerhalb der Theologie institutionalisierte Lehrstühle nicht repräsentiert sind. Es wird im Folgenden davon ausgegangen, dass Erstere sich zum Fachverband der DVRW und dementsprechend zu seinem Fachverständnis zugehörig fühlen. 288 Denn „[w]issenschaftliche Fachgesellschaften haben wichtige Funktionen in der gemeinsamen Willensbildung ihrer Mitglieder, nicht zuletzt in Fragen fachbezogener Standards und Normen
2.4 Einlicke in systematisch-theologischer Absicht
55
„Nach Verständnis der DVRW ist Religionswissenschaft eine bekenntnisunabhängige Gesellschafts- und Kulturwissenschaft. Sie beschäftigt sich kulturvergleichend mit menschlichen Handlungen,Vorstellungen und Institutionen in Geschichte und Gegenwart, die gemeinhin und aus Gründen, nach denen die Religionswissenschaft selbst forscht, als ‚religiösʻ betrachtet werden.“²⁸⁹
Definitorisch zentral sind also die Aspekte der Bekenntnisunabhängigkeit, der Einordnung in den wissenschaftsparadigmatischen Bereich der Kultur- und Sozialwissenschaften, der sowohl syn- als auch diachronen Ausrichtung und des komparativen Forschungsansatzes. Schaut man sich nun vergleichender Weise die Selbstpräsentation²⁹⁰ der innerhalb der Theologie verorteten Lehrstühle für Religionswissenschaft an, so sind folgende zentrale Ergebnisse zu verzeichnen. Bei den Lehrstühlen mit der einfachen, also ohne disziplinäre Zusätze versehenen Bezeichnung „Religionswissenschaft“ können in Bezug auf das reine Fachverständnis, wie es auf den jeweiligen Internetseiten der Professuren selbst bekundet wird, keine inhaltlichen Widersprüche zum Verständnis von Religionswissenschaft der DVRW gefunden werden. Vielmehr lässt sich eine deutliche Beziehung zwischen den Fachverständnissen feststellen. So wird auf den Internetseiten der im Fachbereich für Evangelische Theologie verorteten Professur für Religionswissenschaft an der Universität Frankfurt am Main oben angegebenes Zitat der DVRW direkt wiedergegeben: „Religionswissenschaft ist eine bekenntnisunabhängige Gesellschafts- und Kulturwissenschaft. Sie beschäftigt sich analysierend und vergleichend mit menschlichen Handlungen, Vorstellungen und Institutionen in Geschichte und Gegenwart, die gemeinhin und aus Gründen, nach denen die Religionswissenschaft selbst forscht, als ‚religiösʻ betrachtet werden.“²⁹¹ Des Weiteren wird an der Universität Göttingen das in der Theologischen Fakultät institutionalisierte Fachgebiet Religionswissenschaft als historisch arbeitende „kulturvergleichende Betrachtung geschichtlicher und lebendiger Religionen aus einer bekenntnisunabhängigen Perspektive „²⁹² charakterisiert. Die Verortung innerhalb der Theologie wird als historisch bedingte in-
professioneller Arbeit“. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Empfehlungen der Kommission „Selbstkontrolle in der Wissenschaft“. Ergänzte Auflage, Weinheim 2013, 28. 289 Website der Deutschen Vereinigung für Religionswissenschaft. Das Fach ‚Religionswissenschaftʻ, https://www.dvrw.uni-hannover.de/de/religionswissenschaft/ – 14.12.20. 290 Es wird auch hierbei immer auf die Selbstdarstellung auf den Internetseiten der Lehrstühle Bezug genommen. 291 Website der Religionswissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt a. M. 292 Website der Religionswissenschaft an der Georg-August-Universität Göttingen, https://www.unigoettingen.de/de/17564.html – 14.12.20.
56
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
stitutionelle Tatsache angesprochen.²⁹³ Auf der Internetpräsenz des Instituts für Religionswissenschaft am Institut für Religionswissenschaft der Philosophischen Fakultät der Universität Hannover wird dem noch deutlicher Ausdruck gegeben: „Die persönliche Glaubensüberzeugung spielt […] keine Rolle.“²⁹⁴ Eine etwas andere Pointierung zeigt sich am Lehrstuhl für Religionswissenschaft an der Theologischen Fakultät der Universität Jena. Die Besonderheit dieses Lehrstuhls liege in einer Kombination der „Außen- und Innenperspektive“, so dass Religionswissenschaft hier sowohl „als empirische Kulturwissenschaft mit rational wertfreier Perspektive“ als auch „als hermeneutische Disziplin“ zu verstehen sei.²⁹⁵ Bei den Lehrstühlen mit der Bezeichnung „Religions- und Missionswissenschaft“ ²⁹⁶ in Hamburg und Mainz zeigt sich insgesamt kein grundsätzlich anderes Bild bezüglich des reinen Fachverständnisses. Religionswissenschaft wird beschrieben als eine Disziplin, die „dezidiert im Horizont kulturwissenschaftlicher Methoden und Theoriebildung“²⁹⁷ und in expliziter „Aussenperspektive[!] auf die Vielfalt der Religionen“²⁹⁸ arbeitet. Auch bei diesen Lehrstühlen ist also die perspektivische Wertneutralität, verbunden mit einem historisch-komparativen Forschungsansatz, von großer Bedeutung für das Fachverständnis der reinen Religionswissenschaft.²⁹⁹ Allerdings wird auf die spezifische Ausrichtung religionswissenschaftlicher Lehrstühle in Fächerkombination mit Missionswissenschaft an Theologischen Fakultäten reflektiert. So bestehe die Besonderheit einer Verortung innerhalb der Theologie darin, dass ein expliziter Fokus auf den interreligiösen Dialog gelegt werde – und zwar aus der Perspektive einer bestimmten Religion, nämlich dem Christentum. Besonders deutlich wird dieser Aspekt auf den Internetseiten des Lehrstuhls für Religions- und Missionsswissenschaft im Evangelisch-Theologischen Fachbereich der Universität Mainz: Hier wird dezi-
293 Vgl. Website der Religionswissenschaft an der Georg-August-Universität Göttingen. Das Fach Religionswissenschaft, https://www.uni-goettingen.de/de/fach/443160.html – 14.12.20. 294 Website des Instituts für Religionswissenschaft an der Leibniz-Universität Hannover. Studium, http://www.ithrw.uni-hannover.de/studium2.html – 14.12.20. 295 Website der Religionswissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, https://www.theo logie.uni-jena.de/religionswissenschaft – 14.12.20. 296 Solche finden sich an den Universitäten München, Erlangen-Nürnberg, Hamburg (hier noch in Kombination mit „Ökumene-/wissenschaft“), Mainz und der Humboldt-Universität zu Berlin. 297 Website des Instituts für Missions-, Ökumene- und Religionswissenschaft an der Universität Hamburg, https://www.theologie.uni-hamburg.de/einrichtungen/institute/moer.html – 25.11.20. 298 Website der Religions- und Missionswissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, https://www.ev.theologie.uni-mainz.de/religions-und-missionswissenschaft/ – 25.11.20. 299 Auf das Fachverständnis der Missionswissenschaft wird an dieser Stelle nicht Bezug genommen. Näheres dazu in Kapitel 5.1.1.
2.4 Einlicke in systematisch-theologischer Absicht
57
diert der Religionswissenschaft die Außen- und der Missionswissenschaft die Innenperspektive zugesprochen.³⁰⁰ Diese Ausrichtung findet sich noch deutlicher an Lehrstühlen der Gruppe „Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie“. Hier wird ausdrücklich von einem Forschungsinteresse an „Interaktionen und Transformationsprozessen zwischen Christentum und nicht-christlichen Religionen und Weltanschauungen“³⁰¹ gesprochen. Religionswissenschaft in Kombination mit Interkultureller Theologie beschäftigt sich hier also nicht nur„kulturvergleichend mit menschlichen Handlungen, Vorstellungen und Institutionen in Geschichte und Gegenwart,“³⁰² sondern sie fragt (auch) nach der „sinnvermittelnden und herausfordernden Funktion in den Botschaften/Lehren/Praktiken der Religionen.“³⁰³ Die von keiner religiösen Perspektive ausgehende Bekenntnisunabhängigkeit, wie sie im oben aufgeführten Zitat der DVRW hervorgehoben ist, wird hier also explizit verlassen. Es lässt sich also insgesamt feststellen, dass das „reine“ Fachverständnis im Sinne von Methodologie und Gegenstand der Religionswissenschaft von innerhalb der evangelischen Theologie verorteten Lehrstühlen zunächst nicht grundsätzlich vom Verständnis der DVRW abweicht. Allerdings ist durchaus zu registrieren, dass zu großen Teilen als Besonderheit solcher Professuren der Blickwinkel des interreligiösen Dialogs und somit eine nicht mehr gänzlich aufrecht erhaltene konfessionelle Unabhängigkeit bzw. Neutralität angeführt wird. Inwiefern dann die Profile solcher Lehrstühle tatsächlich noch dem Fachverständnis der DVRW entsprechen können, bleibt zu diskutieren und soll an dieser Stelle (aufgrund der Außenperspektive der Arbeit auf eben jenes forschungspraktische Fachverständnis der DVRW) nicht entschieden werden.
300 Vgl. ebd. 301 Website des Seminars für Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie an der MartinLuther-Universität Halle, http://www.theologie.uni-halle.de/rw/#anchor179362 – 14.12.20. 302 Website der Deutschen Vereinigung für Religionswissenschaft. Das Fach ‚Religionswissenschaftʻ. 303 Website des Seminars für Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Profil, https://www.uni-muenster.de/EvTheol/rwit/profil. html – 14.12.20.
58
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
2.5 Religionswissenschaft und Theologie im Vereinigten Königreich – ein Eindruck in systematisch-theologischer Perspektive Die bisherigen Untersuchungen (des zweiten Kapitels im Besonderen und der gesamten Arbeit an sich) sind fokussiert auf den deutschsprachigen Hochschulraum – und sollen es um einer sauber abgegrenzten Analyse willen auch bleiben. Dennoch impliziert eine solche, in der Einleitung dieser Arbeit auch angekündigte Beschränkung, so berechtigt sie forschungsprozesslogisch ist, konsequenterweise offene Fragen bzw. mögliche Hypothesen. Gerade vor dem Hintergrund der in den vorherigen Teilen des zweiten Kapitels dargelegten formalen Verschränkungen zwischen Religionswissenschaft und evangelischer Theologie auf institutioneller und personeller Ebene und einer daraus ablesbaren vermehrt interdisziplinären Ausrichtung ließe sich z. B. der Gedanke aufstellen, dass eine nach klaren disziplinären Grenzen funktionierende Organisation des Hochschulraums den eigentlichen Anforderungen moderner Geistes- bzw. Kulturwissenschaften³⁰⁴ nicht (mehr) entsprechen könnte. Um also im Fortlauf der Arbeit diese besondere Positionalität des deutschsprachigen Hochschulraums bewusst und explizit vor Augen zu haben, soll im Folgenden zum Vergleich kurz analog dazu auf die akademische Konstellation in Großbritannien eingegangen werden. Denn gerade das britische Hochschulsystem insgesamt hat in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten grundsätzliche Umstrukturierungen erfahren, die auch maßgeblichen Einfluss auf die institutionelle Verfasstheit der religionsbezogenen Wissenschaften haben. Im hier Folgenden kann und soll dabei nun wieder keine umfassende Darstellung dieser Umstrukturierungen im Allgemeinen oder des religionswissenschaftlichen und theologischen Arbeitens im Vereinigten Königreich im Besonderen erfolgen; sondern vielmehr liegt der Fokus auf den – zur Situation in der BRD sehr unterschiedlichen – institutionellen Beziehungen der beiden Fächer zueinander. Die institutionellen Verzahnungen zwischen Theologie und Religionswissenschaft sind im Vereinigten Königreich noch um ein Vielfaches schwieriger darzustellen als dies in Deutschland der Fall ist. Grundsätzlich ist zunächst anzumerken, dass die Übergänge zwischen Theology und History/Study of Religion(s) oder auch Religious Studies gerade auch auf institutioneller Ebene deutlich fließender sind als dies im deutschsprachigen Hochschulraum der Fall ist. So tragen bspw. auch in Großbritannien bereits seit einiger Zeit viele akademische Institutionen in der ei-
304 Zur Frage nach dem Selbstverständnis von Religionswissenschaft und evangelischer Theologie im kulturwissenschaftlichen Paradigma vgl. Kapitel 4.4.1 bzw. 5.4.1.
2.5 Religionswissenschaft und Theologie im Vereinigten Königreich
59
nen oder anderen Form den Titel „Theology and Religious Studies“³⁰⁵ – zumal es sich hierbei oft um ursprünglich rein theologische Institutionen handelt, deren Arbeitsspektrum in neuerer Zeit um religionswissenschaftliche Forschungsinteressen erweitert wurde.³⁰⁶ Die Anfänge akademischer Religionswissenschaft sind in Großbritannien – ähnlich zu Deutschland – nur grob bestimmbar: „It would be difficult to say exactly when the study of religions, as opposed to theology, began in the English-speaking world. […] In Britain one of the first scholars to study world religions was Friedrich Max Müller […].³⁰⁷ […] The first post in comparative religion in Britain was that of Joseph Estlin Carpenter in 1876, at Manchester College“.³⁰⁸ Zu Beginn ihrer Entstehung als institutionalisiertes Fach war Religionswissenschaft zunächst maßgeblich durch private Stiftungen an den Universitäten vertreten; zu nennen sind hier v. a. sowohl die Gifford- als auch die Hibbert-Lectures.³⁰⁹ „It was not until 1967 that the first department of religious studies was founded at Lancaster“.³¹⁰ Trotz dieser späten Konsolidierung als akademische Disziplin ist Religionswissenschaft in Großbritannien mittlerweile zu einem renommierten Fach in der britischen Hochschullandschaft geworden.³¹¹ „[M]ost of the forty or so universities of Great Britain have some department of theology or religious studies.“³¹² Aufgrund der allerdings schon angesprochenen Umstrukturierungen und damit einhergehend sowohl begrifflich als auch institutionell eher fluiden Grenzen zwischen Theologie und Religionswissenschaft scheinen die beiden Fächer entsprechend schwer wissenschaftstheoretisch unterscheidbar, zumal das jeweilige Fachverständnis sowohl für Theology als auch für Religious Studies o. ä. in sich 305 Vgl. Antes, Peter, A Survey of New Approaches to the Study of Religion in Europe, in: Ders. (Hg.), New approaches to the study of religion. Band 1. Regional, critical and historical approaches (RaR 42), Berlin 2004, 43 – 61, 53. Hervorhebung C. N. 306 Vgl. Corrywright, Dominic/Morgan, Peggy, Get set for religious studies, Edinburgh 2006, 45. 307 Gerade durch Persönlichkeiten wie Müller, aber auch E. B. Tylor und J. G. Frazer kann Großbritannien als eines der frühen Zentren (vergleichender) Religionswissenschaft gelten.Vgl. Rudolph, Die Religionsgeschichte, 16 f. 308 Ward, Keith, The Study of Religions, in: Nicholson, Ernest W. (Hg.), A Century of Theological and Religious Rtudies in Britain (British Academy Centenary Monographs), Oxford 2003, 271 – 294, 271. Bei dem hier angesprochenen „Posten“ für Vergleichende Religionswissenschaft am Manchester College handelte es sich ursprünglich wohl erst einmal nur um einen Lehrauftrag, der dann später (1904) in einen Lehrstuhl umgewandelt wurde. Vgl. Clemen, Allgemeine Religionsgeschichte, 221. 309 Namenspatrone sind hier Lord Adam Gifford und Robert Hibbert. Vgl. Rudolph, Die Religionsgeschichte, 18 f. 310 Ward, The Study of, 271. 311 Vgl. ebd. 312 Parrinder, Geoffrey, Religious Studies in Great Britain, in: Religion sup1/5 (1975), 1 – 11, 2. Zu beachten ist, dass dieses Zitat bereits aus den 1970er Jahren stammt.
60
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
höchst plural ist.³¹³ Erschwerend kommt hinzu, dass Theologie im Vereinigten Königreich nicht einfach durch die institutionelle Bindung an eine (christliche) Kirche zu identifizieren ist: „One of the main differences that have been made historically between theology and religious studies, particularly as emphasised by those whose field is religious studies, is that no particular religious beliefs are necessary to study religions. Notice […] that this is also now said of the study of theology. What is required is a rigorous intellectual interest in the issues and the material.“³¹⁴ Um also das Verhältnis von Religionswissenschaft und Theologie in Großbritannien im Vergleich zur deutschsprachigen Situation näher zu betrachten, soll im Folgenden ein kurzer Eindruck der vielfältigen fachlichen Selbstverständnisse von Religionswissenschaft und christlicher Theologie im Vereinigten Königreich erfolgen. Da allerdings, wie schon angemerkt, bei den 38 britischen Hochschulstandorten, an denen Angebote für Religionswissenschaft und/oder Theologie gefunden wurden, zu großen Teilen keine eindeutige institutionelle Differenzierung bzw. Zuordnung von religionswissenschaftlichen gegenüber theologischen Einrichtungen möglich ist, soll, um die in Großbritannien vorherrschenden Fachverständnisse zu eruieren, bei den folgenden Analysen das Angebot der verschiedenen Studiengänge und deren Profile im Fokus stehen.³¹⁵ Die hier zu betrachtenden 102 auffindbaren Studiengänge³¹⁶ lassen sich grob in fünf Kategorisierungen unterteilen: Die größte Gruppe stellen dabei Studiengänge mit der Bezeichnung Theology, Theological Studies o. ä. ³¹⁷ dar. Darauf folgen Studiengänge, die als Religion, Religious Studies o. ä. in Kombination mit Theology o. ä. tituliert werden Als dritte Gruppe schließen sich Studiengänge an, in denen Reli313 Vgl. Corrywright/Morgan, Get set for, 45 f.47 f. 314 Ebd., 50. 315 Es wurde sich also auch hier wieder an der Selbstauskunft der jeweiligen Hochschule/Universität orientiert, nur dass im Folgenden eben das Fachverständnis aus der jeweiligen Studiengangsbeschreibung extrahiert wurde. Denn „more important than titles [of departments] alone are the syllabuses in the different departments and the range of methods and religions on which they focus.“ Ebd., 46. Hervorhebung C. N. 316 Quelle: eigene Onlinerecherchen im Jahr 2020 auf Basis der Selbstauskünfte der 38 untersuchten Universitäten – ohne Gewähr oder Anspruch auf Vollständigkeit. Die Quellenangabe der einzelnen Weblinks erfolgt dementsprechend auch unter Angabe des damaligen Abrufdatums und bezieht sich auf diesen Stand. Es wurde sich orientiert an den Mitgliedern der Vereinigung Theology and Religious Studies UK. Vgl. dazu Website von Theology and Religious Studies UK. Mitglieder, https://trs.ac.uk/about-trs-uk/who-we-are/ – 29.03.21. Besonderer Dank aber an Patricia Kelly für die Auflistung der Mitglieder per Mail (wg. Wartungsarbeiten an der eigentlichen Website Ende des Jahres 2020) – 02.12.20. 317 In diese Gruppe wurden auch vor allem praxistheologische Studiengänge eingeordnet, wie Chaplaincy, Ministry, Divinity, aber auch Biblical Studies o. ä.
2.5 Religionswissenschaft und Theologie im Vereinigten Königreich
61
gion, Religious Studies o. ä. in Verbindung mit Philosophy und/oder Ethics studiert werden kann. Die viertgrößte Gruppe stellt das Fach Religion, Religious Studies oder Study of Religions ohne weitere Fachkombination dar. Darauf folgt als kleinste aufmachbare Kategorie die Fächerkombination aus Religion o. ä. mit Sociology, Politics o. ä. Bei der ersten Gruppe, im Folgenden vereinfachend Theology ³¹⁸ genannt, scheint es sich zumindest rein vom Fächerkanon um das zu handeln, was auch im deutschsprachigen Raum enzyklopädisch als Theologie angesehen wird: „Biblical studies, the history and interpretation of doctrine [and] philosophical theology“ ³¹⁹ erinnern an den an deutschen Hochschulen üblichen historisch, exegetisch und praktisch- bzw. systematisch-theologisch ausdifferenzierten theologischen FächerKanon. Ähnlich zur Situation in der BRD, wo Religionswissenschaft teilweise als sechstes Fach innerhalb des theologischen Kanons angeboten wird, haben auch hier einige theologische Studiengänge Religion, Religious Studies o. ä. mit im Angebot.³²⁰ Trotz dieser Integration religionswissenschaftlich-komparativer Inhalte scheint in diesen Konstellationen dabei das fachliche Selbstverständnis als christliches Theologiestudium, z. B. als existentielles „thinking about God and Christian faith“³²¹ deutlich: Bspw. mit Fragen, „how people of faith have instilled life with religious meaning“³²²; oder dem Ziel „to understand how Christian beliefs and values are relevant to the world.“³²³ Allerdings ist ein augenfälliger – und sicherlich vor allem in der unterschiedlichen staats- und kirchenrechtlichen Verfasstheit der theologischen Fakultäten in der BRD und den Schools oder Departments o. ä. für Divinity, Theology, Religion etc. im Vereinigten Königreich begründeter – Unterschied zu Deutschland, dass keinerlei Religionszugehörigkeit Voraussetzung für diese Studiengänge ist. Vielmehr werden gerade auch theologisch fokussierte Studiengänge als
318 Interessant ist, dass gerade auch im Bereich akademischer Theologie in Bezug auf die fachliche Selbstbezeichnung eine stärker anmutende Binnendifferenzierung vorzuherrschen scheint: So wird häufig zwischen Theology – im Sinne von klassisch-akademischer Theologie – und Divinity, Chaplaincy und/oder Ministry als explizit auf die theologische Praxis- bzw. Amtsausbildung bezogene Studiengänge unterschieden. Vgl. exemplarisch par excellence das Studienangebot auf der Website der School of Divinity der University of St. Andrews. Prospective Students, https://www.st-andrews. ac.uk/divinity/prospective/ – 15.12.20. 319 Website des Studiengangs Theology an der Canterbury Christ Church University, https://www. canterbury.ac.uk/study-here/courses/theology – 15.12.20. 320 Vgl. Website der School of Divinity der University of Edinburgh. Theology, https://www.ed.ac.uk/ divinity/undergraduate/degree-programmes/ma-theology – 04.12.20. 321 Website des Studiengangs Theology an der Canterbury Christ Church University. 322 Ebd. 323 Ebd.
62
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
„broad-minded and open to people of all religious persuasions“³²⁴ dargestellt. Somit scheint also die klare Zeichnung des theologischen Profils zumindest nicht an eine formal innerreligiöse Perspektive gebunden zu sein. Allerdings lässt sich aufgrund der jeweiligen Curricula daraus kein grundsätzlicher Unterschied im theologischen Fachverständnis zwischen Deutschland und Vereinigtem Königreich konstruieren, da der materiale Fokus auf christliche Glaubensinhalte dennoch zentral ist. Die konfessionelle Un-/Gebundenheit von Theologie scheint also keinen maßgeblichen Einfluss auf das theologische Selbstverständnis im Sinne eines disziplinären Identity Markers zu haben. Die zweitgrößte Gruppe von Studiengängen, also Religion, Religious Studies oder Study of Religions in Verbindung mit Theology o. ä., zeichnet sich schon allein aufgrund eben ihrer kombinierten Gestalt durch eine in ihren verschiedenen Bezeichnungen schon implizierte starke Interdisziplinarität aus.³²⁵ Dabei kann in Analogie zu deutschsprachigen Fachverständnissen grundsätzlich von einer Kombination (oben beschriebener) theologischer und (im Sinne v. a. historisch-soziokulturell kontextualisiert komparativer) religionswissenschaftlicher Herangehensweisen ausgegangen werden³²⁶ – als eine „opportunity to study Christian Theology whilst at the same time exploring other major religious traditions of the world“.³²⁷ Was also in der vorherigen Gruppe in Bezug auf religionsvergleichende Fragestellungen eher (optionaler) Teilaspekt zu sein scheint, zeigt sich hier durch den (kombinierten) Fokus auf Religion etc. als fachlicher Grundgedanke des Studiengangs: „With no binding ties to religious institutions, we approach our subject from a distinctively comparative, contextual and interdisciplinary angle.“³²⁸ Somit findet sich zwar auch hier sehr häufig eine Betonung der Unabhängigkeit des akademischen Vollzugs von jeglicher Religionszugehörigkeit und eine damit einhergehende grundlegende Offenheit „for those who are fascinated by the world of theology and religion – whether they be for committed believers, questioning agnostics and ar-
324 Website des Studiengangs Christian Theology an der University of Wales Trinity Saint David, https://www.uwtsd.ac.uk/mth-christian-theology/ – 04.12.20. Hervorhebung C. N. 325 Vgl. Website des Studiengangs Theology and Religious Studies an der University of Leeds, https://courses.leeds.ac.uk/620/theology%E2%80%90and%E2%80%90religious%E2%80%90studies% E2%80%90ba – 04.12.20. 326 Vgl. Website des Studiengangs Theology and Religion an der University of Aberdeen, https:// www.abdn.ac.uk/study/undergraduate/degree-programmes/535/V605/theology-and-religious-studies/ – 03.12.20. 327 Website des Studiengangs Theology and Religious Studies an der Liverpool Hope University, https://www.hope.ac.uk/undergraduate/undergraduatecourses/theologyreligiousstudies/ – 04.12.20. 328 Website des Studiengangs Religions and Theology and der University of Manchester, https:// www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/01297/ma-religions-and-theology/course-details/ #course-profile – 04.12.20. Hervorhebung C. N.
2.5 Religionswissenschaft und Theologie im Vereinigten Königreich
63
dent atheists“.³²⁹ Allerdings lässt sich daraus ebenfalls in keinerlei Richtung ein wie auch immer zu fassender Identity Marker ableiten, da auch solche Fachbeschreibungen aufzufinden sind, die (ähnlich vielleicht zur in 2.4. aufgezeigten und in 5.1.1. näher zu betrachtenden theologischen Fachkombination von Religionswissenschaft mit Interkultureller Theologie) eine religiöse Innen- und Außenperspektive miteinander kombinieren, als „both from within, seeking to test our own beliefs for clarity and coherence, and from without, as critical observers“.³³⁰ Zentral scheint auch in diesen Studienbeschreibungen vielmehr ein gewisses holistisches Grundverständnis zu sein, nämlich insofern, als dass häufig das Ziel – das umfassende „understanding of religion“³³¹ – als „indispensable knowledge for anyone functioning within a contemporary, multicultural society“³³² dargestellt wird. In der dritten Gruppe der Fächerkombinationen aus Religion o. ä. und Philosophy und/oder Ethics liegt der Fokus maßgeblich auf den „fundamental life questions“³³³ bzw. den „fundamental questions in philosophy of religion and ethics“,³³⁴ „covering truth, morality, God, love and death by engaging in depth with global religions and philosophies“³³⁵ in soziokultureller Kontextualisierung in Geschichte und Gegenwart.³³⁶ Durch die Kombination Religion etc. scheint sich dabei also auch hier wieder eine deutlich komparative Vorgehensweise³³⁷ in Bezug auf (die ethischmoralischen Systeme verschiedener) Religionen und Philosophien und deren wechselseitiges Verhältnis zu eben ihren jeweiligen historisch-soziokulturellen
329 Website des Studiengangs Theology and Religious Studies an der Bishop Grosseteste University, https://www.bishopg.ac.uk/courses/matheology – 03.12.20. 330 Website des Department of Theology and Religion der Durham University. Theology and Religion, https://www.dur.ac.uk/theology.religion/undergrad/programmes/theolrel/ – 04.12.20. 331 Website des Studiengangs Theology and Religion an der University of Birmingham, https://www. birmingham.ac.uk/undergraduate/courses/thr/theology.aspx#CourseDetailsTab – 03.12.20. 332 Ebd. 333 Website der School of Philosophy, Religion and History of Science an der University of Leeds. Philosophy, Ethics and Religion, https://ahc.leeds.ac.uk/courses/g184/philosophy,-ethics-and-religionba – 04.12.20. 334 Website der School of Philosophy, Religion and History of Science an der University of Leeds. Philosophy of Religion and Ethics, https://ahc.leeds.ac.uk/courses/d958/philosophy-of-religion-andethics-ma – 04.12.20. Hervorhebung C. N. 335 Website des Studiengangs Philosophy, Religion and Ethics an der University of Roehampton London, https://www.roehampton.ac.uk/undergraduate-courses/philosophy-religion-and-ethics/ – 04.12.20. 336 Vgl. Website des Studiengangs Religion, Philosophy and Ethics an der York St. John University, https://www.yorksj.ac.uk/courses/undergraduate/religion-philosophy/religion-philosophy-ethics-bahons/ – 04.12.20. 337 Vgl. z. B. die Website des Studiengangs Philosophy and Religion an der University of Wales Trinity Saint David, https://www.uwtsd.ac.uk/ma-philosophy-religion/ – 04.12.20.
64
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
Kontexten zu ergeben,³³⁸ indem eben „religions, philosophies and ethics from a global perspective“³³⁹ in ihren jeweiligen Verschränkungen betrachtet werden. Durch die eher religionsphilosophische Akzentuierung auf „issues and questions of the human condition“³⁴⁰ an sich wird dabei auch die Differenz zur vorherigen, theologisch kombinierten Gruppe deutlich.³⁴¹ Die viertgrößte Gruppe der Religious Studies bzw. Study of Religions oder auch Religion zeichnet sich grundsätzlich zwar durch eine hohe innere Pluralität bzw. interdisziplinäre Ausrichtung aus: So können von komparativ-historischen über religionssoziologischen aber auch linguistischen, literaturwissenschaftlichen oder philosophischen und anthropologischen Herangehensweisen aus Zugänge zum religiösen Feld gefunden werden,³⁴² wobei auch dezidiert Ansätze unter religionsphilosophisch-existentiellen Fragestellungen vertreten sind³⁴³ – allerdings (so zumindest der Eindruck) immer unter reflektierter Einbeziehung der historischsoziokulturellen wechselseitigen Bedingtheit der auf diese Fragen antwortenden religiösen Systeme.³⁴⁴ Grob die Hälfte der Studiengänge dieser Gruppe läuft dabei unter dem Titel Religious Studies; ca. ein Drittel trägt die Fachbezeichnung Religion; die kleinste Gruppe sind – soweit es die Recherchen dieser Arbeit ergeben haben – Studiengänge unter dem Namen Study of Religions. Dabei scheint die spezifische 338 Vgl. z. B. die Website des Studiengangs Philosophy, Ethics and Religion an der University of Chester, https://www1.chester.ac.uk/study/undergraduate/philosophy-ethics-and-religion – 03.12.20. Vgl. auch die Website des Studiengangs Religion, Philosophy and Ethics an der University of Gloucestershire, https://www.glos.ac.uk/courses/undergraduate/rpe/pages/religion-philosophy-andethics-ba-hons.aspx??query=undergraduate/rpe/pages/religion%E2%80%90philosophy%E2%80% 90and%E2%80%90ethics%E2%80%90ba%E2%80%90hons.aspx – 04.12.20. 339 Website des Studiengangs Religions, Philosophies and Ethics der Bath Spa University, https:// www.bathspa.ac.uk/courses/ug-religions-philosophies-and-ethics/ – 03.12.20. Hervorhebung C. N. 340 Website des Studiengangs Philosophy, Religion and Ethics and der University of Birmingham, https://www.birmingham.ac.uk/undergraduate/courses/thr/philosophy-religion-ethics.aspx – 03.12.20. Hervorhebung C. N. 341 Wenngleich für eine wirkliche Evidenz natürlich auf den Unterschied zwischen Theologie und Religionsphilosophie reflektiert werden müsste. Solches kann vorliegende Arbeit im Rahmen ihrer Forschungsfrage nicht leisten. 342 Vgl. z. B. die Website der School of Divinity der University of Edinburgh. Religious Studies, https://www.ed.ac.uk/divinity/undergraduate/degree-programmes/religious-studies – 04.12.20. Vgl. auch die Website des Studiengangs Religion am Kingʼs College London, https://www.kcl.ac.uk/study/ postgraduate/taught-courses/religion-ma – 04.12.20. 343 Vgl. z. B. die Website des Studiengangs Religious Studies an der Liverpool Hope University, https://www.hope.ac.uk/undergraduate/undergraduatecourses/religiousstudies/religiousstudiesand philosophyethics/ – 04.12.20. 344 Vgl. z. B. die Website des Studiengangs History and Religious Studies an der University of Gloucestershire, https://www.glos.ac.uk/courses/undergraduate/hir/pages/history-and-religious-stu dies-ba-hons.aspx – 04.12.20.
2.5 Religionswissenschaft und Theologie im Vereinigten Königreich
65
Fachbezeichnung keinen grundsätzlichen Einfluss auf bspw. eine etwaige existentiell-philosophische Herangehensweise zu haben: So scheinen sich Religious Studies genauso wenig durch dezidiert existentiell-philosophische Fragestellungen zu kennzeichnen wie Study of Religions. Vielmehr scheint grundsätzlich die starke Betonung einer kontextualisierenden und religionsvergleichenden Herangehensweise³⁴⁵ zu dominieren. Ebenso scheint – unabhängig von der jeweiligen konkreten Fachbezeichnung – allgemein eine gewisse Außenperspektive auf Religion(en) vorausgesetzt zu sein.³⁴⁶ Gerade die hauptsächlich deskriptive, historisch-soziokulturell kontextualisierende, religionsvergleichende Ausrichtung dieser Fächergruppe lässt das hieraus extrahierbare Fachverständnis – analog zu den Betrachtungen der vorherigen Fächergruppen – von Religion, Religious Studies oder eben auch Study of Religions in großer Nähe zum in Deutschland vorfindlichen Fachverständnis von Religionswissenschaft erscheinen.³⁴⁷ Die quantitativ kleinste Gruppe, in der Religion soziologisch und/oder politikwissenschaftlich kombiniert wird, lässt sich durchaus in Analogie zum deutschsprachigen Verständnis von Religionssoziologie³⁴⁸ umschreiben. Denn diesen Fächern (bzw. vielmehr Fächerkombinationen) ist grundsätzlich gemein, dass (zeitgenössische) Religionen – als „significant dimensions of public and private li-
345 Vgl. z. B. die Website des Studiengangs Religious Studies an der Lancaster University, https:// www.lancaster.ac.uk/study/postgraduate/postgraduate-courses/religious-studies-ma/ – 04.12.20. 346 Vgl. die Website der School of Divinity der University of Edinburgh. Religious Studies. 347 Eine Beobachtung, die nicht sonderlich überraschend ist, gehören doch sowohl die DVRW als auch ihr britisches Pendant, die British Association for the Study of Religions (BASR) zum großen Verband der International Association for the History of Religion (IAHR). Vgl. die Website der International Association for the History of Religion. Members and Affiliates, http://www.iahrweb.org/ members.php#uk – 15.12.20. Das Fachverständnis der BASR ähnelt somit in den entscheidenden Punkten dem der DVRW, wobei die interdisziplinäre Ausrichtung hier noch stärker betont zu werden scheint – was natürlich auch maßgeblich mit der unterschiedlichen hochschulorganisatorischen Situation begründet werden kann: „The object of BASR is to promote the academic study of religion/s, understood as the historical, social, theoretical, critical and comparative study of religion/s through the interdisciplinary collaboration of all scholars whose research is defined in this way.“ Website der British Association for the Study of Religions. About BASR, https://basr.ac.uk/aboutbasr/ – 15.12.20. An dieser Stelle lässt sich die (hier nicht weiter auszuführende) These aufstellen, dass Fachverständnis und organisatorische Konstitution sich vielleicht nicht gegenseitig begründen müssen, aber sich dennoch höchstwahrscheinlich auf Dauer wechselseitig beeinflussen können. Dadurch wird die konstante Relevanz von Hochschulpolitik und v. a. deren Angewiesenheit auf den kontinuierlichen Austausch mit Wissenschaft bzw. Wissenschaftstheorie in Bezug auf die Bedeutung und Zukunft von Universität(en) deutlich. 348 Als das Fach, das sich mit „Fragen nach der Vitalität, politischen Relevanz, Konfliktträchtigkeit oder individueller Bedeutung von Religion oder Religionen“ beschäftigt. Pickel, Religionssoziologie, 11.
66
2 Die Geschichte einer schwierigen Beziehung
fe“³⁴⁹ – unter dem Aspekt ihrer aktuellen gesellschaftlichen Relevanz und ihren Wechselbeziehungen zu Kultur und Gesellschaft betrachtet werden.³⁵⁰ Religiöse Glaubenssysteme und Weltanschauungen werden einerseits auf ihren politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Impetus hin untersucht. Andererseits sind daraus entstehende soziokulturelle und politische Konfliktpotenziale Gegenstand der Betrachtungen.³⁵¹ „[D]esigned to appeal to policy-makers, analysts, journalists and researchers in either international, national or regional institutions and organisations engaged in policy formation, inter-religious dialogue and community development, social work, development, conflict resolution, peace building or diversity management“³⁵² in lokal bis global religionsvergleichender Perspektive und unter historisch-soziokultureller Kontextualisierung zeigt sich auch hier der Impetus des Fokus Religion in Bezug auf Fragestellungen rund um Gesellschaft und Politik in ebendieser vornehmlich deskriptiven und komparativen Ausrichtung – mit dem Ziel des „understanding the current religious climate and the interrelation of secular and religious communities“.³⁵³ Insgesamt zeigen die Recherchen zu Studiengängen der Religionswissenschaft und Theologie im Vereinigten Königreich, dass in Großbritannien ein durchaus integrales Fächerverständnis vorliegt, bei dem der Fokus nicht so sehr auf disziplinären Grenzziehungen, sondern vielmehr auf Interdisziplinarität und Kooperativität liegt: Religionswissenschaft und Theologie werden an vielfachen Stellen miteinander verzahnt, kombiniert und ihre Ergebnisse gegenseitig fruchtbar gemacht. Erschwert diese Situation zwar im ersten Blick eine wissenschaftstheoretische Verhältnisbestimmung der Fächer zueinander, macht sie aber gleichzeitig deutlich, dass solche Verhältnisbestimmungen nicht aufgrund institutioneller und/ oder konfessioneller Zuweisungen möglich sind. Vielmehr zeigen die Selbstbeschreibungen der an den verschiedenen Institutionen angebotenen Studiengänge, dass durchaus ein Verständnis für die Unterschiede zwischen Theology (der oben beschriebenen größten Fächergruppe) und Religious Studies/Study of Religion(s)
349 Website des Studiengangs Politics, Religion and Philosophy an der University of Birmingham, https://www.birmingham.ac.uk/undergraduate/courses/thr/politics-religion-philosophy.aspx – 03.12.20. 350 Website des Studiengangs Religion, Culture and Society an der University of Central Lancashire, https://www.uclan.ac.uk/courses/ma_religion_culture_society.php – 04.12.20. 351 Vgl. z. B. die Website des Studiengangs Religion, Ethics and Society an der University of Chichester, https://www.chi.ac.uk/philosophy-theology-and-religion/philosophy-theology-and-religioncourses/ba-hons-religion-ethics-and-society – 03.12.20. 352 Website des Department of Religions & Philosophies an der SOAS University of London. Religion in Global Politics, https://www.soas.ac.uk/religions-and-philosophies/programmes/ma-religion-in-glo bal-politics/ – 04.12.20. 353 Website des Studiengangs Religion in Society an der York St. John University, https://www.york sj.ac.uk/courses/postgraduate/theology-religion-studies/religion-in-society-ma/ – 04.12.20.
2.5 Religionswissenschaft und Theologie im Vereinigten Königreich
67
(der viertgrößten Gruppe) vorliegt, welches sich aber eben nicht in Differenzierungen anhand unterschiedlicher konfessioneller Perspektiven oder Bindungen ausdrückt, sondern in den spezifischen Fokussierungen und Fragestellungen, mit denen im Studium den jeweiligen Gegenständen mit unterschiedlichsten methodischen Herangehensweisen begegnet werden soll. Dementsprechend wichtig erscheint dadurch eine wissenschaftstheoretische Verhältnisbestimmung, die einerseits Raum für ein integrales Fächerverständnis angesichts eines gemeinsamen geistesund kulturwissenschaftlichen Methodenkanons, überschneidender Gegenstandsbereiche und nicht eindeutig zuordenbarer Perspektiven lässt und andererseits der je spezifischen Fachidentität von sowohl Religionswissenschaft bzw. Religious Studies/Study of Religions und Theologie bzw. Theology gerecht wird.
3 Was den Unterschied ausmacht: Die Fragestellung als Strukturmerkmal disziplinärer Diskurse 3.1 Probleme klassischer Differenzkriterien Im Folgenden soll es darum gehen, den Ansatz einer Differenzierung von Fächern anhand ihrer unterschiedlichen Fragestellungen zunächst basal argumentativ zu begründen. Dabei sei die zugrundeliegende Annahme vorausgeschickt, dass die Nutzung von Fragestellungen als Differenzkriterien – unabhängig von einem diskursiven Disziplinenverständnis – kein neues wissenschaftstheoretisches Konzept darstellt, sondern mindestens implizit (so die These) in der Geschichte von Religionswissenschaft und Theologie Tradition hat¹ und auch aktuell mehr oder weniger explizite Anwendung findet; zumal sie als Alternative zu bisherigen klassischen, aber wissenschaftstheoretisch inkonsequenten Verhältnisbestimmungen gesehen werden kann, welche im hier Folgenden kurz problematisiert werden. Klassische wissenschaftstheoretische Unterscheidungen zwischen Theologie und Religionswissenschaft lassen sich im Großen und Ganzen anhand von drei angewandten, hier noch näher einzugrenzenden Differenzkriterien kategorisieren, nämlich dem Gegenstand, der Methode oder der Perspektive des jeweiligen Faches.² Dass solche Versuche von Verhältnisbestimmungen in Anbetracht der wissenschaftlichen Praxis nur unsauber vollzogen werden können, haben mindestens implizit bereits die Analysen der ersten beiden Kapitel dieser Arbeit vorbereitend gezeigt, in denen sowohl die methodische als auch materiale und gerade auch institutionelle Bezogenheit von Religionswissenschaft und Theologie zueinander auf syn- und diachroner Ebene dargestellt wurde. Die mangelnde wissenschaftstheo-
1 Näheres dazu unter Punkt 3.2. 2 Nicht nur im konkreten Fall von Theologie und Religionswissenschaft, sondern auch auf allgemein wissenschaftstheoretischer Ebene werden solche drei klassischen Kriterien herangezogen. So wird auch in der Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie eine wissenschaftliche Disziplin als die „Bezeichnung für einen Teilbereich innerhalb der Wissenschaften, der durch Gegenstand, Methode oder Erkenntnisinteresse von anderen Teilbereichen abgrenzbar ist“ definiert. Gräfrath, Bernd, Art. Disziplin, wissenschaftliche, in: EPhW 2 (1984), 237– 238, 237. Augenfällig ist hier, dass nicht der Begriff der Perspektive (der vielleicht eher in kulturwissenschaftstheoretischen Diskussionen Anwendung findet wie dem der religionsbezogenen Wissenschaften), sondern vielmehr das Erkenntnisinteresse als drittes klassisches Kriterium genannt wird. Der Begriff des (Erkenntnis‐) Interesses wird im Folgenden unter 3.3. noch in das vorliegende Konzept integriert werden. https://doi.org/10.1515/9783111091747-004
3.1 Probleme klassischer Differenzkriterien
69
retische Funktionalität dieser klassischen Differenzkriterien soll im Folgenden nun noch einmal systematisch skizziert werden. So überschneiden sich die Gegenstandsbereiche ³ von Religionswissenschaft und Theologie maßgeblich – und zwar unabhängig davon, worauf man diese festlegt:⁴ Beide Fächer⁵ beschäftigen sich – spätestens unter dem Fokus der in Kapitel 2.2. beschriebenen Wende der Theologie – potenziell mit dem Gegenstand des anthropologisch-soziokulturellen Phänomens der Religionen in Geschichte und Gegenwart, sei es mit nichtchristlichen oder christlichen. Auch das in diesem Zusammenhang vor allem von theologischer Seite oft angeführte Thema Glaube⁶ kann Gegenstand beider Disziplinen sein: Denn sowohl Religionswissenschaft als auch Theologie können die spezifischen Formen, Gehalte und Implikationen des (christlichen) Glaubens als Ausdruck menschlicher Religiosität auf verschiedensten Ebenen und unter Anwendung verschiedenster Methodiken erforschen. Genauso ist es natürlich Beiden möglich, sich mit den christlichen Glaubensgegenständen, also Gott, Erlösung o. ä. zu beschäftigen. Auf geradezu banale Weise erscheint dabei deutlich, dass, nur weil Religionswissenschaft sich mit Christentum, christlichem Glauben oder christlichen Gottesvorstellungen befasst, sie nicht automatisch zu
3 Als Gegenstandsbereich gilt hier mithin nicht einfach ein konkretes, empirisches Objekt, sondern vielmehr „Systeme solcher Eigenschaften und Zusammenhänge [von empirischen, also material oder formal vorfindlichen Objekten, C. N.]“. Guntau, Martin/Laitko, Hubert, Entstehung und Wesen wissenschaftlicher Disziplinen. Der Ursprung der modernen Wissenschaften, in: Dies. (Hg.), Der Ursprung der modernen Wissenschaften. Studien zur Entstehung wissenschaftlicher Disziplinen, Berlin 1987, 17– 89, 23. Dass diese eingefügte Definition von „empirisch“ nicht der Intention der Autoren dieses Zitates entsprechen mag, ist an dieser Stelle bewusst. Der marxistisch-leninistische Hintergrund der Autoren ist bei diesem Zitat mitzudenken, der einem gewissen Empirismus die Lanze brechen könnte. Dennoch greift dieses Zitat, verbunden mit einem differenzierteren EmpirieVerständnis, gut den Unterschied zwischen einem konkreten Untersuchungsobjekt und einem disziplinären, systemisch bzw. strukturell zu denkenden Gegenstandsbereich auf. 4 Wichtig ist hier zu betonen, dass es sich bei dieser Grundthese nicht um eine Auflösung des Gegenstandsbegriffs handelt. Natürlich widmet sich bspw. Religionswissenschaft als religionsbezogene Wissenschaft einem sehr spezifischen Gegenstandsbereich, der auch zu einem gewissen Grad hin charakterisierend für ihren Forschungsvollzug ist. Dennoch teilt sie sich diesen Bereich maßgeblich mit anderen (v. a., aber nicht nur religionsbezogenen) Wissenschaften – und so scheint es in Bezug auf die Gegenstandsbereiche vieler Disziplinen der Fall zu sein. Vgl. Rüpke, Jörg, Historische Religionswissenschaft. Eine Einführung (Religionswissenschaft heute 5), Stuttgart 2007, 26 f. 5 Neben vielen anderen potentiell religionsbezogenen Disziplinen. Vgl. Franke, Edith, Fachliche Spezialisierung, methodische Integration, Mut zur Theorie und die Marginalität der Kognitionswissenschaften, in: Dies./Maske,Verena (Hg.), Religionswissenschaft zwischen Sozialwissenschaften, Geschichtswissenschaft und Kognitionsforschung. Ein Autoren-Workshop mit Hubert Seiwert (Marburg Online Books 2), Marburg 2014, 33 – 42, 36. 6 Zu einer differenzierteren Reflexion auf die fundamentaltheologische Bedeutung des Glaubensbegriffs siehe Kapitel 5.3.2.
70
3 Was den Unterschied ausmacht
Theologie wird. Und genauso deutlich scheint zu sein, dass Theologie nicht zwangsläufig ihren Fachdiskurs verlässt, sobald sie sich mit den Vorstellungswelten nichtchristlicher Religionen beschäftigt.⁷ Eine Unterscheidung der Fächer anhand des Differenzkriteriums des Gegenstandes scheint auf wissenschaftstheoretischer Ebene nicht zu gelingen, will man die jeweiligen disziplinären Diskursstrukturen in ihren nach innen und nach außen gerichteten Vernetzungen in ihrem jeweiligen Vollzug einordnen;⁸ zumal auf Grundlage der bisherigen Analysen und als Vorausschau auf die innerdisziplinären Konstruktionen in Kapitel 4 und 5 dieser Arbeit insgesamt zu konstatieren ist, dass beide Fächer als Geistes- bzw. Kulturwissenschaften nicht einen überhistorisch konstanten, klar umreißbaren Gegenstand haben, sondern – wie oben schon angerissen – vielmehr auf einen in sich pluralen, inhaltlich dynamischen, soziokulturell bedingten Gegenstandsbereich im Sinne eines diskursiven Systems bzw. einer Struktur ebenso dynamisch und soziokulturell bedingt bezogen sind. Die Disziplinen unterscheidende Funktion von Gegenstandsbereichen läge dann, wenn überhaupt, höchstwahrscheinlich nicht in ihrem materialen bzw. substantiellen Gehalt, sondern darin, wie sich innerhalb der jeweiligen Disziplin in der Struktur ihres Forschungsdiskurses auf sie bezogen wird⁹ – also wie sie erforscht werden. Summa summarum scheinen „Gegenstände allein […] in
7 Solches beträfe alle Subdisziplinen der Theologie. Besonders anschaulich erscheint es z. B. in Bezug auf Alttestamentliche Wissenschaft, die dann im Großteil ihrer Subdiskurse wahrscheinlich eher der Altorientalistik zuzuordnen wäre als der Theologie. Dass Alttestamentliche Wissenschaft dessen ungeachtet natürlich auch in anderen Fachdiskursen agiert, ist dabei angesichts des heutigen v. a. kulturwissenschaftlichen Paradigmas forschungsprozesslogisch nicht überraschend oder gar illegitim. Die Selbsteinordnung als theologische Disziplin hängt nicht davon ab, ob der eigene Fachdiskurs nicht auch andere Disziplinen als Bezugsgrößen und Gesprächspartnerinnen wahrnimmt – sondern vielmehr davon, in welchen diskursiven Großkontext hinein diese Selbsteinordnung vollzogen wird. Näheres dazu in Kapitel 5.3.1. 8 Zumal viele Disziplinen sich in immer währenden Streitfragen um die Definition ihrer Gegenstandsbereiche befinden: „In manchen Fällen mag es sogar strittig sein, ob eine Wissenschaft überhaupt einen spezifischen Gegenstand oder Gegenstandsbereich hat. Die Psychologie ist zweifellos ein mit gutem Recht und Erfolg installierte Disziplin unabhängig von der Entscheidung der Streitfrage, ob es die Psyche als Entität gibt.“ Krüger, Lorenz, Einheit der Welt – Vielheit der Wissenschaft, in: Kocka, Jürgen (Hg.), Interdisziplinarität. Praxis – Herausforderung – Ideologie, Frankfurt a. M. 1987, 106 – 125, 111. Ähnliches gilt für den Geschichts-, Kunst-, Gender-, Lebens-, Kultur(usw.) Begriff im Kontext der jeweilig darauf bezogenen Wissenschaften. Einem ähnlichen Problem stellen sich also auch alle religionsbezogenen Wissenschaften bei der Frage nach der jeweiligen Definition von Religion. Das Ergebnis sind meist arbeitstechnische Hypothesen mit fachspezifischen Fokussierungen, wie z. B. substantiellen oder funktionalen Definitionen von Religionen als gesellschaftlichen Phänomenen bzw. Faktoren in der Religionssoziologie. 9 Vgl. dazu z. B. Bergunder, Michael, Was ist Religion? Kulturwissenschaftliche Überlegungen zum Gegenstand der Religionswissenschaft, in: ZfR 19 (2011), 3 – 55.
3.1 Probleme klassischer Differenzkriterien
71
keinem Fall eine Disziplin [zu definieren]; es muß zumindest noch so etwas wie die Auswahl von jeweils interessierenden Aspekten, Fragen oder Problemen hinzutreten.“¹⁰ Ähnliche bzw. noch deutlichere Unschärfen ergeben sich auch bei der Anwendung des Differenzkriteriums der Methode. Grundsätzlich ist hier zunächst wieder daran zu erinnern, dass sowohl Religionswissenschaft als auch Theologie aus dem gemeinsamen Fundus des geistes- und kulturwissenschaftlichen Methodenkanons schöpfen¹¹ – die religionswissenschaftliche oder die theologische Methode gibt es schlichtweg nicht.¹² Vielmehr wenden Religionswissenschaft und Theologie zu großen Teilen gleiche Methoden auf gleiche Gegenstände an – sei es die historisch-kritische Exegese von Texten oder quantitative oder qualitative sozialwissenschaftlich-empirische Erhebungen in Bezug auf religiöse Phänomene sozialer Gegenwartskultur. Erscheint also schon rein forschungstechnisch das Festmachen einer Disziplin an ihren Methoden unsachgemäß,¹³ ist dann dennoch zu fragen, warum bzw. inwiefern nichtsdestotrotz methodologischen Entscheidungen ¹⁴ Disziplinen charakterisierendes Potenzial zugeschrieben wurde – und teilweise noch wird. Für die Debatte um eine Verhältnisbestimmung von Religionswissenschaft und Theologie war (und ist teilweise noch) dabei klassisch, Religionswis10 Krüger, Einheit, 111. 11 Vgl. z. B. WSR, Empfehlungen, 52. Zumal hier anzumerken ist, dass auch dieser Kanon sich natürlich im Wandel befindet bzw. nicht nur kultur- und geisteswissenschaftliche, sondern auch immer verstärkter sozial- und naturwissenschaftliche Methoden hinzugezogen werden, um religionswissenschaftliche Forschung zu betreiben – z. B. unter religionssoziologischen oder auch religionspsychologischen Fokus. Jüngstes Beispiel dafür dürfte v. a. die sogenannte Cognitive Science of Religion sein. Vgl. dazu Näheres in Kapitel 4.2.4. 12 „[Es] wird hoffentlich schon einleuchten, daß man zwar mit dem Hinweis auf die Methoden im günstigen Falle gewisse Schwerpunkte des formalen Vorgehens in verschiedenen Disziplinen hervorheben kann, nicht jedoch Disziplinen voneinander abgrenzen. […] Allgemein gesprochen fehlt es im Bereich der Rede von Methoden völlig an einer übersichtlichen Ordnung […]. […] Wie hoffnungslos man in dieser Sache daran ist, läßt sich schon mit dem Hinweis illustrieren, daß man in der Physik oder der Geologie ebenso wie in der Geschichtswissenschaft hypothetisch-deduktiv vorgehen und daß man in allen drei Wissenschaften die C14-Methode einsetzen kann.“ Krüger, Einheit, 112. 13 Schließlich bestimmt doch wohl eher das Zusammenspiel von Erkenntnisinteresse, Gegenstandsbereich, Untersuchungsobjekt etc. die Methodologie, also die Frage nach der Wahl der adäquaten Methodik. 14 Hilfreich könnte (vorweg greifend) im Folgenden eine Differenzierung sein zwischen Methode und Methodologie: Wie eine Disziplin auf den geistes- und kulturwissenschaftlichen Methodenkanon zugreift, also welche Methoden sie wann, wie und wozu anwendet, ist natürlich disziplinenspezifisch methodologisch bestimmt. Methodologische Entscheidungen scheinen dabei wiederum dadurch bestimmt zu sein, warum und wozu welche Methode woraufhin angewandt wird – also unter welcher Fragestellung.
72
3 Was den Unterschied ausmacht
senschaft auf der einen Seite die empirisch (also an vorfindlichen Daten orientierte) fundierte Deskription und Theologie auf der anderen Seite eine ihr immanente heuristische und hermeneutische Normativität (z. B. im Sinne der Grundannahme der Existenz Gottes) als methodologische Grundeinschränkung zuzuschreiben.¹⁵ Kern dieser These ist also, dass Theologie als Wissenschaft nicht durchführbar sei ohne die vorausgehende Annahme solcher grundlegender Glaubenswahrheiten seitens der forschenden Person.¹⁶ Diese Behauptung impliziert erstens in sich ein stark zu diskutierendes Verständnis von christlichem Glauben, nämlich als einem bei allen Christ*innen identischen weltanschaulichen „Für-wahr-halten“ von wie auch immer aufzufassenden „Tatsachen“. Glaubensinhalte wären dann sozusagen „Fakten“, also im Grunde ontologisch vom Subjekt unabhängige Entitäten – sonst könnte man sie nicht zur substantiellen Bedingung von Theologie erklären.¹⁷ Zweitens wird dann auch ein bestimmtes Konzept von Wissenschaft vorausgesetzt: Und zwar stünde dahinter dann die ebenfalls im Grunde ontologische Annahme, dass es bei wissenschaftlichen Erkenntnisprozessen darum ginge, eine real als Einheit in sich existente Welt zu erkennen. Wissen wäre dann nicht Produkt,¹⁸ sondern der – von der forschenden Person unabhängige – in sich existente und konstante Gegenstand von Wissenschaft. Und Wissenschaft selbst wäre dann natürlich in Konsequenz auch ein potentiell subjektinvariantes Geschehen. Es sei an dieser Stelle konstatiert, dass ein solches Verständnis von Wissenschaft in der
15 Vgl. z. B. Rudolph, Geschichte, 29. Solches führt von religionswissenschaftlicher Seite in den härtesten Fällen dann dazu, Theologie jegliche Wissenschaftlichkeit abzusprechen und Religionswissenschaft als im Grunde einzige legitime religionsbezogene Wissenschaft darzustellen. 16 Mit dem Differenzkriterium der Methode wird hier also letztlich auf eine argumentative Verschränkung bestimmter Verständnisse von Methodiken und Theorien abgehoben.Vgl. dazu Schmidt, Jochen, Standort, Perspektive, Haltung. Überlegungen zum Proprium der Kirchengeschichte als einer Disziplin theologischer Wissenschaft, in: Kampmann, Claudia/Volp, Ulrich/Wallraff, Martin (Hg.), Kirchengeschichte. Historisches Spezialgebiet und/oder theologische Disziplin (Theologie – Kultur – Hermeneutik 28), Leipzig 2020, 393 – 408, 394 f. 17 „Bei diesem Verständnis gerät Glaubenserkenntnis unter vornehmlicher Fixierung auf ihren besonderen ‚Gegenstandʻ in einen Sonderbezirk gegenüber Erfahrung und wissenschaftlicher Erkenntnis aller Art. Glaube wird zunächst einmal in seinem Vollzug unabhängig von Vernunft, Welt, Wirklichkeitsverstehen und Erfahrung gesehen. Dem steht entgegen, daß christlicher Glaube von seinem Grundvorgang her ein personaler Akt ist, der mitten in den Vollzügen des Lebens der Welt erfolgt, im Horizont von Sprache, Erfahrung und Vernunft, unter den Bedingungen von Natur und Gesellschaft usw. usf.“ Petzoldt, Matthias, Sola scriptura – brauchbares Prinzip zur Rechenschaft über den Glauben?, in: Ders., Christsein angefragt. Fundamentaltheologische Beiträge, Leipzig 1998, 11 – 24, 19. 18 So in der konstruktiven Wissenschaftstheorie. Vgl. z. B. Kambartel, Friedrich, Art. Wissenschaft, in: EPhW 4 (1996), 719 – 721, 719.
3.1 Probleme klassischer Differenzkriterien
73
Praxis des Forschens zwar durchaus in uso sein mag,¹⁹ wissenschaftstheoretisch bzw. methodologisch aber kaum stringent durchreflektierbar ist.²⁰ Nichtsdestotrotz scheint aber dann ein dermaßen geradezu naturalistisches Verständnis von wissenschaftlicher Methode im religionswissenschaftlich-theologischen Kontext zu bestehen, wenn als Differenzkriterium zwischen Theologie und Religionswissenschaft die konstatierte Normativität Ersterer gegenüber der vermeintlichen Deskriptivität Letzterer behauptet wird:²¹ Zuspitzung finden solche Typisierungen in der inner-religionswissenschaftlichen Forderung nach „methodologischem Atheismus/Agnostizismus“ als einem unhintergehbarem Idealkriterium: Religionswissenschaftlich arbeitende Personen müssten (so weit wie irgend möglich) jegliche metaphysische Fragestellungen ausklammern. Dass die Absolutsetzung einer solchen Forderung dem Diktum eines methodologischen Atheismus,²² und somit also der normativen Setzung einer bestimmten weltanschaulichen, meta-physischen Sichtweise auf den Gegenstandsbereich der Religionen gleichkommt, wurde auf Seiten beider Fächer schon mehrfach diskutiert.²³ Mittlerweile gilt es – im Groß-
19 Vgl. z. B. den jüngst diskutierten Aufsatz Seiwert, Hubert, Theory of Religion and Historical Research. A Critical Realist Perspective on the Study of Religion as an Empirical Discipline, in: ZfR 28/ 2 (2020), 207– 236, besonders z. B. 218 – 225. Zur Kritik v. a. seines ontologisch-methodologischen Ansatzes vgl. die Diskussion im 2021er Herbst-Heft der Zeitschrift für Religionswissenschaft, besonders z. B. Gardiner, Mark Q./Engler, Steven, Allies in the Fullness of Theory, in: ZfR 29/2 (2021), 259 – 267, v. a. 263. Vgl. aber auch Becker, Carmen, Returning to the Empirical after the Discursive Turn?, in: ZfR 29/2 (2021), 275 – 280, v. a. 278. 20 „Sinnesdaten, die auf uns einströmen, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf jene Ausschnitte vorfindlicher Wirklichkeit richten, die als Quellen historischer Erkenntnis erschlossen werden sollen, ordnen sich nicht von selbst nach einem Muster, das aus eigenem Antrieb die Konturen historischer Ereignisse oder Prozesse hervortreten ließe. Mehr noch, bereits die Festlegung der Grenzen des näher in Augenschein zu nehmenden Ausschnitts der Wirklichkeit setzt zumindest rudimentäre theoretische Vorannahmen voraus. Es bedarf einer theoretischen Rahmung der Wahrnehmung der Quellen, d. h. es bedarf bestimmter Fragen an das in Augenschein zu nehmende Quellenmaterial und es bedarf einer hypothetischen Vorstellung davon, wie diese Fragen beantwortet werden könnten, wenn die Quellen denn zum Sprechen gebracht werden sollen.“ Schmidt, Standort, 397. 21 Vgl. Auga, Aus- oder Anschlüsse, 234. 22 Zur Frage nach der Forderung des methodologischen Atheismus oder Agnostizismus der Wissenschaft in Bezug auf die Wissenschaftlichkeit der Theologie siehe Kapitel 5.3.2. 23 So plädierte in diesem Zusammenhang z. B. Perry Schmidt-Leukel für einen „engeren“ methodologischen Agnostizismus: „Da sich die Frage nach der Existenz transzendenter Wirklichkeit wissenschaftlich nicht entscheiden lässt, hat sich die Religionswissenschaft in ihrer Durchführung apodiktischer Urteile über diese Frage zu enthalten.“ Schmidt-Leukel, Perry, Der methodologische Agnostizismus und das Verhältnis der Religionswissenschaft zur wissenschaftlichen Theologie, in: BThZ 1/29 (2012), 48 – 72, 57. Schmidt-Leukel soll hier nur als eine Beispielposition bzw. einen besonders aktiven Player einer Debatte gelten, die er selbst durchaus immer wieder neu initiiert (so
74
3 Was den Unterschied ausmacht
kontext der geistesgeschichtlichen Entwicklungen seit der Neuzeit – in beiden Fächern seit langem als Common Sense, dass keine Wissenschaft epistemisch voraussetzungslos ist,²⁴ sondern alle Forschung immer betrieben wird von umweltlich, soziokulturell und fachtraditionell bedingten und geprägten Subjekten,²⁵ und dass es also vor allem darum gehen muss, diese eigenen erkenntnisleitenden Bedingtheiten und Prägungen offenzulegen und mitzureflektieren.²⁶ Im (kulturwissenschaftlich-paradigmatischen) Kontext wissenschaftlichen Arbeitens ist dementsprechend das Bewusstsein gang und gäbe, dass jede Disziplin über ihre je eigenen, soziokulturell-historisch bedingten und somit dynamischen epistemisch- und methodologisch-normativen Setzungen verfügt.²⁷ Dass diese aber
z. B. via der bereits in der Einleitung zitierten religionswissenschaftlichen Mailingliste Yggdrasil). Das mag durchaus mit Schmidt-Leukels eigener (u. a. katholisch-theologisch bzw. anglikanisch geprägten) fachlichen Biografie zusammenhängen. Nichtsdestotrotz trifft er mit seinen Ausführungen zur Frage nach einem methodologischen Atheismus einen wunden Punkt dieser wissenschaftstheoretischen Problemlage. Vgl. Kapitel 5.3.2. 24 Dabei impliziert solches keinesfalls einen uneingeschränkten Relativismus in der Forschung. Die Möglichkeit, das Kriterium nach objektiver, bzw. intersubjektiver Gültigkeit von Wissenschaft dennoch aufrecht zu erhalten, ergibt sich aus einem differenzierteren Verständnis von eben „Objektivität“. So wird z. B. klassischerweise in Auseinandersetzung mit Karl Popper betont, dass sein wissenschaftstheoretisches Konzept „Objektivität an wechselseitige Kontrolle und Kritik bindet. […] Die Objektivität der Wissenschaft beruht also gerade nicht auf der Objektivität der einzelnen Wissenschaftler. Es ist vielmehr der Wettstreit kontrastierender Ansätze, aus dem der Erkenntniszuwachs stammt. In diesem pluralistischen Verständnis werden Bindungen und Interessen nicht vermieden, sondern durch entgegengesetzte Bindungen und Interessen ausbalanciert.“ Carrier, Martin, Wissenschaftstheorie zur Einführung (Zur Einführung 353), Hamburg 32011, 43. 25 „[E]s gilt für jeden Standpunkt, auch für einen explizit nichtreligiösen, dass es ein erkenntnisleitendes Interesse gibt, das die Auswahl der Gegenstände, die Fragestellungen und eventuell auch die Ergebnisse bestimmt.“ Berner, Ulrich, Theologie und Religionswissenschaft. Ansätze zur Einordnung und Abgrenzung, in: Albrecht, Christian/Gemeinhardt (Hg.), Peter, Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und von außen, Tübingen 2021, 225 – 244, 237 f. 26 Vgl. Freiberger, Oliver, Ist Wertung Theologie? Beobachtungen zur Unterscheidung von Religionswissenschaft und Theologie, in: Löhr, Gebhard (Hg.), Die Identität der Religionswissenschaft. Beiträge zum Verständnis einer unbekannten Disziplin (GTF 2), Frankfurt a. M. 2000, 97– 121, 115.Vgl. ebenfalls Herms, Das Selbstverständnis, 359 – 378. Vgl. weiterhin Kollmar-Paulenz, Karénina, Zur Relevanz der Gottesfrage für eine transkulturell orientierte Religionswissenschaft, in: Körtner, Ulrich H. J. (Hg.), Gott und Götter. Die Gottesfrage in Theologie und Religionswissenschaft, NeukirchenVluyn 2005, 23 – 49, 23. 27 Schon bspw. Max Weber, der innerhalb der Religionswissenschaft gerne von Verfechter*innen absoluter methodologischer Wertneutralität rezipiert wird, wies auf die Voraussetzungshaftigkeit aller Empirie hin. Vgl. Weber, Die „Objektivität“, 149.157.212 f. Zum Hintergrundverständnis dieser Arbeit vom Wechselverhältnis von Epistemik und Methodologie vgl. Nagel, Christiane, Theologie als erkenntnistheoretischer Sonderfall? Die Voraussetzungshaftigkeit von Wissenschaft und der zirkuläre Zusammenhang von Epistemik und Methodik, in: Kirschner, Martin/Ruhstorfer, Karlheinz
3.1 Probleme klassischer Differenzkriterien
75
wiederum nicht in den Status eines Differenzkriteriums auf der wissenschaftstheoretischen Metaebene gehoben werden können, ist mit eben jener Dynamik und der darin implizierten starken Abhängigkeit von den individuellen und soziokulturellen Voraussetzungen der forschenden Personen zu begründen und gerade auch forschungsethisch schwer argumentativ durchzuhalten.²⁸ Also kann auch nicht die jeweilige Tradition von Normen o. ä. einer Disziplin das sie als eigenständig setzende Spezifikum sein, da erstens sonst einem zu starken soziokulturellen Relativismus Raum gegeben wird, der die Grenzen zwischen den Fächern eher verschwimmen lässt, als sie zu definieren. Und zweitens ist auch hier – angesichts der forschungpraktischen Verzahnungen von Religionswissenschaft und Theologie auf methodologischer Ebene – wieder zu resümieren, dass materiale bzw. substantielle Füllungen normativer methodologischer Anforderungen – ähnlich zur Auseinandersetzung mit dem Differenzkriterium des Gegenstandsbereichs – schwer geeignet zu sein scheinen, Disziplinen als Diskursstrukturen zu differenzieren. Die disziplinäre Identität entscheidende Implikation der jeweiligen Methode scheint vielmehr summa summarum wiederum in der auf der diskursstrukturellen Ebene angesiedelten methodologischen Frage zu liegen, warum (woraufhin und wie) – also unter welcher Fragestellung – bestimmte Methoden im Forschungsprozess zur Anwendung kommen. Die Argumentationen, die dem Postulat des Differenzkriteriums der Methode zugrunde liegen, decken sich in großen Teilen bzw. leiten zumindest fließend über zu dem dritten und argumentativ auf den ersten Blick am schwierigsten zu widerlegenden klassischen Differenzkriterium, der Perspektive der forschenden Person auf ihren Erkenntnisgegenstand. Auch hierbei ist die These grundlegend, dass die Nicht-/Religiosität der forschenden Person Disziplinen grundlegend unterscheidenden Charakter hat: Religionswissenschaft arbeite in der weltanschau-
(Hg.), Die gegenwärtige Krise Europas. Theologische Antwortversuche (QD 291), Freiburg/Basel/Wien 2018, 210 – 223, 212 f. 28 Denn in der Offenlegung der forschungsprozesslichen Relevanz der verschiedentlichen soziokulturellen Voraussetzungen des Forschungsprozesses geht es nicht darum, diese in den Status normativer, vorwissenschaftlicher Bedingungen zu erheben. Trotz aller Voraussetzungshaftigkeit kennzeichnet sich Wissenschaft weithin durch einen bestimmten freiheitlich-egalitären Berufsethos, wie es sich in Bezug auf die forschende Person hier klassisch im Mertonschen Ideal des Universalismus von Wissenschaft widerspiegelt. Vgl. Merton, Robert K., A Note on Science and Democracy, in: Journal of Legal and Political Sociology 1 (1942), 115 – 126, 118. Im Kontext dieser Arbeit geht es in der ethischen Stoßrichtung dann nicht um die Ausschaltung des epistemisch-methodischen Einflusses des forschenden Subjekts, sondern um deren bewusste Reflexion und um die transparente und faire Anwendung gleicher Kriterien im Zuge der Bewertung der Forschungsergebnisse (und somit der retrospektiven Normierung des Forschungsprozesses) – die ist nur möglich, wenn alle den Forschungsprozess beeinflussenden Faktoren offengelegt sind.
76
3 Was den Unterschied ausmacht
lich-religiös „neutralen“ Außen-, Theologie hingegen in der religiös-konfessionellen Innenperspektive.²⁹ Dem ist soziologisch auf institutioneller bundesdeutscher Hochschulebene zunächst einmal nicht zu widersprechen: Theologische Fakultäten gehören zu den gemeinsamen Angelegenheiten von Staat und Kirche. Religionswissenschaft hingegen kann – wie unter Punkt 2.4. illustriert wurde – sowohl innerals auch außerhalb solcher Fakultäten institutionalisiert sein und unterliegt somit nicht zwingend solchen (diskussionswürdigen)³⁰ Bindungen. Doch zeigte z. B. der unter Punkt 2.5. getätigte Blick nach Großbritannien, dass die deutsche Situation nicht die einzig mögliche ist: Auch ohne konfessionelle Gebundenheit kann Theologie (auch in verschiedentlicher konfessioneller sozusagen Perspektivität) existieren. Zumal grundsätzlich hervorzuheben ist, dass die Faktizität kirchlich-institutioneller Un-/Gebundenheit nicht genügt, um die daraus (vermeintlich) resultierende Perspektivität zum Differenzkriterium auf der wissenschaftstheoretischen Metaebene zu ernennen. Solches hätte in diesem Fall ja dann absurderweise zur prinzipientheoretischen Folge, dass alle konfessionell nicht gebundene Theologie (wie z. B. eben in Großbritannien) eigentlich Religionswissenschaft wäre – und im Umkehrschluss alle einer christlichen Konfession angehörenden religionswissenschaftlich das Christentum Erforschenden eigentlich zur Theologie gezählt werden könnten.³¹ Hierbei handelt es sich vielmehr um eine argumentative (bis
29 Vgl. Franke, Fachliche Spezialisierung, 35. 30 Dazu einige assoziative Überlegungen: Die Frage, ob Theolog*innen Angehörige einer christlichen Kirche sein müssen, kann nicht ohne weiteres zweifelsfrei bejaht werden. Zunächst ist auf die verfassungsrechtlich gesicherte weltanschauliche Freiheit von Wissenschaft hinzuweisen (GG Art. 5 Abs. 3). Theologie, die sich selbst im akademischen Raum verortet, sollte also auch allen potenziellen Forschenden zugänglich sein – nicht nur aus einem juristischen, sondern gerade auch aus einem wissenschaftsethischen Blickwinkel: „The acceptance or rejection of claims entering the lists of science [oder Geistes- und Kulturwissenschaften, C. N.] is not to depend on the personal or social attributes of their protagonists, his race, nationality, religion, class and personal qualities are as such irrelevant.“ Merton, A Note, 118. Hervorhebung C. N. Auch wenn man dagegen das religiöse Recht auf Selbstbestimmung in den eigenen Angelegenheiten (zu denen theologische Fakultäten gehören) stark macht, so ist auch aus (evangelisch‐) theologischer Binnensicht die Notwendigkeit einer konfessionellen Bindung anzweifelbar: Sagt die administrative Nicht-/Zugehörigkeit zur „irdischen“ Institution einer der christlichen Kirchen so viel über die innere religiöse Bindung der individuellen Person aus? Zumal sich dann nicht nur aus ökumenisch-theologischer, sondern auch schon aus rein organisatorischer Sicht die Frage aufdrängt, warum dann akademische Theologie nicht für jede einzelne christliche Konfession (und überhaupt noch weitere Religionen) mindestens potenziell existiert oder eben nicht existieren kann. 31 Zumal auch innerhalb der Religionswissenschaft (zugegebenermaßen strittig) diskutiert wurde (und auch teilweise noch wird), inwiefern Religionswissenschaft betreibende Personen die Innenperspektive religiöser Erfahrung mindestens kennen sollten, um ihr Forschungsobjekt umfassend verstehen zu können. (Solche Anforderungen bzw. Diskussionen setzen allerdings wieder implizit
3.1 Probleme klassischer Differenzkriterien
77
polemische) Vermischung bestimmter soziokultureller Positionalitätsfaktoren mit bestimmten inhaltlichen, vermeintlich substantiell-epistemischen Gehalten des Forschungsprozesses bzw. Anforderungen an den Forschungsprozess. Das wird gerade dann deutlich, wenn sich mit dem Argument der Perspektive wieder der Versuch verbindet, darauf abzuheben, dass zum wissenschaftlichen Betreiben von christlicher Theologie de jure die innere religiöse Zustimmung zum Christentum, also (theologisch gesprochen) der Glaube der forschenden Person notwendig sei. Dann lässt sich auch hier wieder grundsätzlich kritisch fragen, was die (gerade aus inner-theologischer Sicht) inhaltliche Begründung dafür sein solle – und wie solches gegebenenfalls zu überprüfen sei.³² Dabei ist im Zusammenhang der Frage nach einem disziplinären Differenzkriterium zusammenfassend wieder darauf hinzuweisen, dass auch eine so verstandene geradezu substantiell gefüllte Perspektive aufgrund ihrer in sich genuin mit gegebenen Pluralität kein strukturelles Differenzkriterium darstellen kann.³³ Vielmehr gilt in Bezug auf die Frage nach der Perspektive insgesamt das Gleiche zu betonen wie in puncto auf das Differenzkriterium der Methode: Die Forderung nach selbstkritischer Reflexion auf die Voraussetzungshaftigkeit aller Erkenntnis durch das forschende Subjekt – und damit eben auch u. a. auf die eigene Nicht-/Religiosität – ist sowohl im Fach der Religionswissenschaft als auch in der Theologie bewusst und kann somit nicht als wissenschaftstheoretisches Differenzkriterium zwischen diesen beiden religionsbezo-
die ontologische Existenz einer erkennbaren, als Einheit existenten Welt voraus, deren Erkenntnis zum Ziel wissenschaftlicher Arbeit erklärt wird.) Die Frage wäre für die hier getätigte Diskussion in Bezug auf das Kennen der Innenperspektive dann, wo der ausschlaggebende Unterschied liegen soll, zwischen einer forschenden Person, die diese Innenperspektive aus der eigenen, und eine solche, die sie aus einer fremden Erfahrungswelt kennt. In beiden Fällen handelte es sich dabei um lebensweltliche, also vor- bzw. transwissenschaftliche, soziokulturell hochgradig dynamische und relative Gehalte bzw. Vorbedingungen des Forschungsprozesses. Und als solche wären sie in ihrer forschungsprozesslichen Implikation und Anwendung dann natürlich wiederum kritisch transparent und intersubjektiv überprüfbar zu machen, so dass also in beiden Fällen auch wieder von der konkreten Lebenswelt wissenschaftlich zu abstrahieren wäre. 32 Vgl. dazu auch wieder Kapitel 5.3.2. 33 Zumal deutlich zu betonen ist, dass es sich hierbei wieder um ein drastisches Missverständnis von christlichen Glauben oder Glaubensaussagen als primär einem weltanschaulichen „Für-wahrhalten“ gewisser Aussagesätze handeln würde, die auf der gleichen Ebene wie wissenschaftliche Hypothesen agieren wollen. Dass es Konzepte gibt, die theologische Aussagen als Hypothesen darlegen, wird davon nicht primär tangiert (wenngleich eine intensivere Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Verständnis vom Verhältnis zwischen Theologie und Glaube wiederum essentiell wäre). Vgl. dazu klassisch-exemplarisch Pannenberg, Wolfhart, Wissenschaftstheorie und Theologie, Frankfurt a. M. 1973, (z. B.) 335 f.
78
3 Was den Unterschied ausmacht
genen Wissenschaften herhalten.³⁴ Ergo scheint der Disziplinen differenzierende Impact der weltanschaulich-positionellen Perspektivität eher darin zu liegen, wie sie im strukturellen Zusammenspiel von Methode und Gegenstandsbereich im Forschungsprozess an welchen Stellen Einfluss hat und als solcher Einfluss wiederum kritisch reflektiert wird. Es lässt sich in Bezug auf die hier genannten drei klassischen Differenzkriterien insgesamt betonen, dass zwischen der potentiellen Faktizität gewisser disziplinentypischer Gegenstandsbereiche, methodisch-normativer Haltungen und eben auch institutionell oder individuell gegebener Perspektiven auf der einen und der formallogischen Stringenz eines wissenschaftstheoretischen Differenzkriteriums auf der anderen Seite unterschieden werden muss: Nur weil bspw. Theologie in der BRD sich möglicherweise zu großen Teilen mit bestimmten historisch gewachsenen Gegenstandsbereichen (z. B. christlichem Glauben) in Anwendung bestimmter Methodiken und Theorien (z. B. Hermeneutik) unter einer bestimmten institutionellen oder auch individuell-religiösen Perspektive (z. B. evangelisch) beschäftigt, heißt das nicht, dass jene Charakteristika zu Kriterien einer wissenschaftstheoretischen Selbst- und daraus resultierenden Verhältnisbestimmung zu anderen Fächern gehoben werden können. Das bedeutet dann nicht, dass Gegenstand, Methode und Perspektive ohne wissenschaftstheoretische Bedeutung innerhalb der jeweiligen disziplinären Fachdiskurse wären. Die Fächer unterscheidende Funktion dieser drei Aspekte scheint aber dann eben nicht in ihren jeweiligen substantiellen und/ oder materialen Gehalten zu liegen, sondern in ihren jeweiligen diskursstrukturellen Implikationen, die sich metatheoretisch dann – so Ausgangsthese und Ziel dieser Arbeit – in einem diese Diskursstruktur beschreibenden Differenzkriterium auf genau dieser diskurslogischen Metaebene ausdrücken lassen. Eine zielführende, weil (vorläufig‐) persistente Unterscheidung zweier Disziplinen, die zunächst eine klare Identifikation der beiden Fächer an sich impliziert, gelingt vermutlich also dann, wenn das angewandte Differenzkriterium zwar unabhängig von spezifischen sowohl fachtraditionellen als auch personell-individuellen soziokulturellen Gegebenheiten auf die Disziplin als Diskursstruktur angewandt werden kann – und dabei aber eben trotzdem die einzelnen hochgradig pluralen und dynamischen disziplinären Faktoren (wie also die Gegenstandsbereiche, Methode, Perspektive im Sinne der soziokulturellen Positionalität) in das Differenzierungskonzept integriert werden können. Das funktioniert höchstwahrscheinlich am besten, wenn von substantiell bzw. material gefüllten Kriterien (aufgrund ihrer hohen soziokulturellen Dynamizität und Relativität) abgesehen
34 Näheres dazu wieder in den Kapiteln zu den jeweiligen epistemisch-methodologischen Konsequenzen in Kapiteln 4.3.2. und 5.3.2.
3.2 Impuls: Die Fragestellung als Differenzkriterium
79
wird – und vielmehr eben auf der strukturellen Ebene gefragt wird, was die Disziplinen im Prozess identifizieren kann. Es bleibt im Folgenden dieser Arbeit also bei dem Gedanken, dass sich Disziplinen, so dynamisch und weltanschaulich abhängig und miteinander verwoben ihre Konstitutionen sind, auf der daraus gewachsenen ³⁵ wissenschaftstheoretischen Ebene unterscheiden (sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht zu ihrer relativ permanenten Ausdifferenzierung gekommen). Im Folgenden besteht nun die weitere Vorgehensweise – auf Grundlage einer im nächsten Schritt vollzogenen definitorischen Setzung des Differenzkriteriums der Fragestellung als einem solchen disziplinären Strukturmerkmal – in der wissenschaftstheoretischen Verhältnissetzung im Konstruieren einer fachspezifischen Fragestellung von jeweils Religionswissenschaft (Kapitel 4) und (evangelischer) Theologie (Kapitel 5), welche in ihrer jeweiligen ersten (als Vorschlag anzusehenden) Ausformulierung für die beiden Disziplinen idealtypisch zu verstehen ist, deren eigentliche wissenschaftstheoretische Tragweite aber vielmehr in ihrer Funktion als formalem Strukturmerkmal bestehen soll (welches dann je nach eigener fachlichen Position also natürlich unterschiedlich material gefüllt, sprich ausformuliert werden könnte und im Verlauf dieser Arbeit auch einmal exemplarisch gefüllt wird).
3.2 Impuls: Die Fragestellung als Differenzkriterium – Assoziationen aus binnendisziplinärer Sicht zur fachgeschichtlichen Relativierung der eigenen These Wie soeben hergeleitet geht diese Arbeit grundlegend davon aus, dass die Unterscheidung zweier Disziplinen, namentlich von Religionswissenschaft und evangelischer Theologie, anhand ihrer unterschiedlichen Fragestellungen (verstanden als formal-strukturellem Merkmal des jeweiligen Fachdiskurses) im wissenschaftlichen Vollzug nichts Artfremdes ist, sondern sogar – so die These des hier folgenden Unterkapitels – retrospektiv (und insofern auf gewisse Art und Weise aktiv konstruierend) in verschiedenen identitätsstiftenden wissenschaftstheoretischen Konzeptionen von Beginn ihrer jeweiligen disziplinären Ausdifferenzierung an her-
35 Damit wird auch deutlich, dass gerade der Ansatz dieser Arbeit, abseits von materialen Füllungen ein Differenzkriterium anzuwenden, das Disziplinen als Diskursstrukturen unterscheidet, im Kontext genau dieser – inhaltlich und formal bestimmten – Fachgeschichte der eigenen Ausgangsdisziplin steht.
80
3 Was den Unterschied ausmacht
ausgearbeitet werden kann.³⁶ Diese Grundthese soll im Folgenden aus der jeweiligen Sicht der Fächer an wenigen, eher willkürlich ausgewählten Beispielen kurz argumentativ illustriert werden, um so diese eigene These gleichsam fachgeschichtlich zu relativieren. Es geht dabei also im Folgenden erst einmal um die Möglichkeit einer zunächst basal-heuristischen Anwendung eines Differenzkriteriums der Fragestellung auf bestimmte innerdisziplinäre, identitätsstiftende Fachkonzeptionen – und weder um eine umfassende Darstellung des jeweiligen wissenschaftstheoretischen Selbstverständnisses noch um eine konzeptuelle Ausarbeitung einer fachlichen Fragestellung an sich. Die eigentliche wissenschaftstheoretische Untersuchungs- und Konzeptionsarbeit in den jeweiligen Disziplinen wird anschließend in den Kapiteln 4 und 5 vollzogen. Religionswissenschaft hat, wie in Kapitel 2.1. bereits dargelegt wurde, ihre wissenschaftshistorischen Ursprünge in verschiedenen disziplinären Fachbereichen, sei es Philologie, Soziologie, Philosophie oder eben auch Theologie, was sich in bestimmte Hauptursprungszweige, nämlich (im Kontext dieser Arbeit) v. a. einen historisch-philologischen, einen empirisch-soziologischen und einen historischphilologischen systematisieren lässt. Dennoch scheint es ein Element religionswissenschaftlichen Arbeitens zu geben, das in der retrospektiven Selbstzuschreibung zur Ausdifferenzierung einer eigenständigen Disziplin maßgeblich war, nämlich das des kritisch-reflexiv komparativen Ansatzes ihres Arbeitens, der auch eine bestimmte Art zu fragen evozierte. Erinnert sei an dieser Stelle z. B. an Müllers Beiträge zur vergleichenden Religionswissenschaft oder die paradigmatische enzyklopädische Einteilung von Religionswissenschaft in einen historischen und einen systematisierenden Zweig bei Hardy und daran anknüpfend bei Wach. Die forschungspraktische Daseinsberechtigung der Religionswissenschaft wurde (mindestens implizit) legitimiert durch den sie charakterisierenden und von anderen grundlegend differenzierenden Aspekt ihrer empirisch fundierten, komparativen Fragestellung. Dabei ist interessant, dass z. B. Wach selbst das Moment der Fragestellung explizit als ein disziplinäres Differenzkriterium aufmachte – im Zusammenhang der Abgrenzung von Religionswissenschaft und Religionsphilosophie: „[A]uch die Religionsphilosophie untersucht das Verhältnis von Religion und Recht,
36 Denn es „ist im Auge zu behalten, daß terminologische Vorschläge auch zur Rekonstruktionszwecken, d. h. der Rekonstruktion herrschenden Sprachgebrauchs, geeignet sein müssen. Sonst greifen Vorschläge nicht in einer Diskussion, die bereits durch eine bestimmte (und sei es auch kritikbedürftige) Begrifflichkeit inhaltlich strukturiert ist.“ Mittelstraß, Jürgen, Über Interessen, in: Ders. (Hg.), Methodologische Probleme einer normativ-kritischen Gesellschaftstheorie, Frankfurt a. M. 1975, 126 – 159, 133. D. h. also, dass auch die sprachliche Anschlussfähigkeit einer definitorischen (Neu‐) Setzung der Fragestellung als wissenschaftstheoretischem Differenzkriterium an bisherige wissenschaftstheoretische Selbstbestimmungen zumindest exemplarisch aufzuzeigen ist.
3.2 Impuls: Die Fragestellung als Differenzkriterium
81
Religion und Kunst, Religion und Wirtschaft, aber ihre Fragestellung ist von der religionswissenschaftlichen verschieden.“³⁷ Retrospektiv lässt sich demnach dann auch konstatieren, dass es eben jenes spezifische Fragen war, das – auf lange Sicht hin – Religionswissenschaft von anderen, im zeitgenössischen Umfeld ebenfalls gerade entstehenden Disziplinen unterschied. So fragt(e) z. B. Religionssoziologie ³⁸ im Unterschied zum Fach der Religionswissenschaft genuin nach der sozialen Bedeutung von Religion(en).³⁹ Bis heute gilt die komparative Stoßrichtung religionswissenschaftlichen Arbeitens als die Disziplinarität begründende Ingredienz.⁴⁰ Dass sich potentiell⁴¹ aus diesem Spezifikum immanent eine disziplinäre Selbstbestimmung über das Differenzkriterium der Fragestellung zumindest ergeben kann, soll an folgendem Zitat⁴² kurz exemplarisch veranschaulicht werden. „Die Identität unseres Fachs ergibt sich meines Erachtens also vornehmlich daraus, dass sich die Religionswissenschaft bekenntnisunabhängig, systematisch, vergleichend, kritisch, methoden- und theoriegeleitet sowie methoden- und theoriebildend mit Phänomenen beschäftigt, die aus angebbaren – aber natürlich auch angreifbaren – Gründen als religiös qualifiziert
37 Wach, Religionswissenschaft, 102 f. Hervorhebung C. N. 38 Die Auseinandersetzung um das Verhältnis zur Religionssoziologie ist in der aktuellen Religionswissenschaft durch ihren immer stärker werdenden Fokus auf sozialwissenschaftliche Forschungsprojekte rund um das Phänomen Religion(en) ein zwar dringendes, in dieser Arbeit angesichts ihrer Forschungsfrage und ihres Umfangs im Grunde nicht diskutierbares Problem. Vgl. zur Problematik einer zunehmenden sozialwissenschaftlichen Fokussierung der Religionswissenschaft auch WSR, Empfehlungen, 91 f. 39 Auch hier ist wieder anzumerken, dass natürlich auch Religionswissenschaft religionssoziologisch orientierte Forschungen durchführen kann. Entscheidend ist aber auch hier wieder der Gesamtdiskurs, in den sich solche Forschungen einordnen. Vgl. dazu z. B. Kapitel 4.2.2. 40 Vgl. z. B. Rüpke, Historische Religionswissenschaft, 27. Oder vgl. auch WSR, Empfehlungen, 88. Vgl. besonders Freiberger, Oliver, Der Vergleich als Methode und konstitutiver Ansatz der Religionswissenschaft, in: Kurth, Stefan/Lehmann, Karsten (Hg.), Religionen erforschen. Kulturwissenschaftliche Methoden in der Religionswissenschaft, Wiesbaden 2011, 199 – 218, v. a. 215 f. Vgl. auch (mindestens implizit) Führding, Steffen, Diskursgemeinschaft Religionswissenschaft, in: Franke, Edith/Maske, Verena (Hg.), Religionswissenschaft zwischen Sozialwissenschaften, Geschichtswissenschaft und Kognitionsforschung. Ein Autoren-Workshop mit Hubert Seiwert (Marburg Online Books 2), Marburg 2014, 55 – 68, 62. 41 Eine tatsächliche Herleitung der Fragestellung der Religionswissenschaft erfolgt in Kapitel 4. 42 Situativer Hintergrund dieses Zitates des Leipziger Religionswissenschaftlers Christoph Kleine ist das hundertjährige Bestehen der Religionswissenschaft an der Universität Leipzig. Zu seiner Person vgl. die Website des Instituts für Religionswissenschaft der Universität Leipzig. Christoph Kleine, https://www.uni-leipzig.de/personenprofil/mitarbeiter/prof-dr-christoph-kleine/ – 19.01.21. Kleine wird an dieser Stelle als exemplarisch herangezogen, da aus seiner Forschungstätigkeit im Allgemeinen und aus dem zitierten Aufsatz im Besonderen das Zusammenspiel aus systematischreligionswissenschaftlichem und religionsgeschichtlichen Herangehensweisen innerhalb der Religionswissenschaft besonders deutlich ablesen lässt.
82
3 Was den Unterschied ausmacht
werden können. Im Gegensatz zur Theologie tut sie dies nicht auf der Grundlage religiöser Vorannahmen; und im Gegensatz zu anderen Disziplinen tut sie dies, um religiöse Phänomene, Entwicklungen, Denkmuster, Symbol- und Deutungssysteme, Organisationsformen usw. verstehen und erklären zu können, und nicht primär um etwas anderes mit Hilfe der Religion(en) zu erklären.“⁴³
Anhand des vorliegenden Zitats lässt sich deutlich zeigen, dass der Aspekt des reflexiv-komparativen, systematisierenden Arbeitens – neben den klassischen Kriterien der Perspektive, der Methode und dem Gegenstand, die hier jedoch m. E. eher als Deskriptionen des Forschungsvollzugs, denn als wissenschaftstheoretische Differenzkriterien zu verstehen sind⁴⁴ – in Verbindung mit einer spezifischen Stoßrichtung, nämlich dem Erklären und Verstehen religiöser Phänomene an sich, das Charakteristikum der Disziplin Religionswissenschaft ausmacht. Extrahiert man aus diesem eher impliziten wissenschaftstheoretischen Entwurf nun eine Fragestellung der Religionswissenschaft als ihr Differenzkriterium zu anderen Disziplinen, dann läge also das Spezifikum der Religionswissenschaft darin, dass Religionswissenschaft nicht religionssoziologisch nach bspw. der Bedeutung religiöser Phänomene für die Gesellschaft fragt, sondern kritisch-empirisch und komparativsystematisierend nach dem Gehalt, den Entstehungsformen und -prozessen der religiösen Phänomene an sich im Vergleich.
43 Kleine, Christoph, Wozu außereuropäische Religionsgeschichte? Überlegungen zu ihrem Nutzen für die religionswissenschaftliche Theorie- und Identitätsbildung, in: Hase, Thomas/Espig, Christian (Hg.), 100 Jahre Leipziger Religionswissenschaft. Ausgewählte Texte, Leipzig 2012, 223 – 265, 226. Hervorhebung C. N. 44 Diese Interpretation lässt sich auch aus dem Kontext des Zitates begründen, z. B. in Hinblick auf den Gegenstand: Im Zusammenhang der inner-disziplinären Notwendigkeit einer Arbeitsdefinition von Religion(en) wird deutlich gemacht, dass die Art und Weise, wie Religionswissenschaft ihren Forschungsgegenstand definiert, sie von anderen Disziplinen, mit denen sie sich den Forschungsgegenstand teilt, unterscheidet – und eben nicht der Gegenstand selbst. Vgl. ebd., 226 ff. Problematisch bleibt an dieser Stelle allerdings die Verhältnissetzung zur Theologie, die strikt nach dem klassischen Differenzkriterium der Perspektive vollzogen wird. Argumentativ wird der Theologie ihrer Bekenntnisgebundenheit wegen hier eine Sonderstellung zugeteilt – neben den anderen religionsbezogenen Wissenschaften, zu denen sich Religionswissenschaft ins Verhältnis setzen muss. Dass aber die potentielle Konfessionalität von Theologie nicht als wissenschaftstheoretisches Differenzkriterium fungieren kann, wurde im Kontext dieser Arbeit unter Punkt 3.1. schon erläutert. Wenn man dies berücksichtigt, wäre das Verhältnis zur Theologie diesem Konzept nach also ebenso darin zu bestimmen, dass Theologie mit dem Erforschen religiöser Phänomene etwas anderes will bzw. eben anders fragt als Religionswissenschaft.
3.2 Impuls: Die Fragestellung als Differenzkriterium
83
Ähnlich lässt sich nun auch aus binnen-theologischem Blickwinkel vorgehen, deren Spezifikum dann ebenfalls daraufhin herausgearbeitet ⁴⁵ werden kann, dass (dynamische, weil historisch-soziokulturell wechselnde) Gegenstandsbereiche in Anwendung spezifischer Methoden unter bestimmten Perspektiven auf ein gewisses Forschungsinteresse hin befragt werden. Solches lässt sich als Grundimpetus schon aus ältesten wissenschaftstheoretischen Konzeptionen konstruktiv extrahieren, was im Folgenden einsteigend exemplarisch an Thomas von Aquin dargelegt werden soll. Daran anschließend folgt eine dazu analoge (Re‐) Konstruktion in wenigen Sätzen der Positionen ausgewählter in Kapitel 2.2. vorgestellter Fachvertretender unter dem Fokus, wie eine jeweils spezifische Art zu fragen auch in ihren wissenschaftstheoretischen Selbst-Konzeptionen als formal-strukturelles Spezifikum theologischer Reflexionsprozesse gesehen werden kann. So definierte Thomas das Besondere der Theologie bekanntermaßen nicht einfach nur über ihren Bezug auf den bestimmten Gegenstand (Theo‐), von dem sie redet (‐logia), sondern – gerade angesichts der Unverfügbarkeit des alle Wirklichkeit bestimmenden Gehalts des Gegenstandsbereichs – über die Art und Weise, wie dieser Gegenstand im theologischen Vollzug zum theologischen Forschungsobjekt wird:⁴⁶ So ergebe sich die Einheit und gleichsam die Identität einer Disziplin zwar material durch ihren Gegenstandsbezug, doch sei der Gegenstandsbereich der Theologie, nämlich Gott in seinem Verhältnis zu seiner Schöpfung, sowohl in sich äußerst plural als auch der menschlichen Erkenntnis nicht zugänglich.⁴⁷ Die wissenschaftstheoretische Einheit der Theologie liege dann also darin, dass Gott formal Gegenstand der Erkenntnis ist, also in seiner durch ihn geoffenbarten Beziehung zu seiner Schöpfung.⁴⁸ Das die Identität der Theologie stiftende Moment sei also ihre spezifische Betrachtungsweise ihrer Gegenstände, nämlich daraufhin, inwiefern sie Inhalt göttlicher Offenbarung sind.⁴⁹ Im Rahmen eines substanz-ontologischen Denkhorizonts, der die potentielle Erkennbarkeit der Welt als seiender Einheit an sich voraussetzt,⁵⁰ formulierte Thomas diese Spezifität der Theologie als eine bestimmte ratio, einen bestimmten Grund der Erkennbarkeit, der sie von anderen Disziplinen unter-
45 „Dabei geht es nicht um den Nachweis, dass dieser Theologe oder diese Theologin in der Geschichte bereits ähnliches gedacht oder gleiche Begriffe verwendet hat“, sondern um aktive retrospektive Konstruktion.“ Wittekind, Folkart, Theologie religiöser Rede. Ein systematischer Grundriss, Tübingen 2018, 9. 46 Vgl. Thomas von Aquin, Gottes Dasein und Wesen, in: DThA 1 (1934), q 1,1. 47 Vgl. ebd., q 1,3. 48 Vgl. ebd., q 1,7. 49 Vgl. ebd., q 1,3.Vgl. Axt-Piscalar, Christine, Was ist Theologie? Klassische Entwürfe von Paulus bis zur Gegenwart (UTB 3579), Tübingen 2013, 67 f. 50 Vgl. Thomas, Gottes Dasein, q 1,2.
84
3 Was den Unterschied ausmacht
scheidet.⁵¹ Vor dem Hintergrund aktueller, pluraler Rationalitäten, also prozessualen, funktionalen etc. Denkhorizonten ließe sich nun dieses Konzept des Thomas auch in Form einer spezifischen Fragestellung wie bspw. der folgenden aktiv-konstruierend transformieren: (Christliche) Theologie fragte dann nach dem geoffenbarten, also von Menschen als vorfindlich gesetzt empfundenen Beziehungsverhältnis zwischen ihnen und der als Gegenüber erlebten, alle Wirklichkeit bestimmenden Größe Gott – also nach Glauben als einem spezifischen Faktor menschlichen In-der-Welt-Seins. Auch bei Martin Luther könnte (aktiv-konstruierend) ein durch eine bestimmte Fragestellung (neu)⁵² strukturierter Diskurs⁵³ als das Eigentliche, das Identität Stiftende der Theologie herausgearbeitet werden. Theologie „disputat de homine peccatore.“ ⁵⁴ Eigentlicher Gegenstand der Theologie sei demnach keine isoliert religionsphilosophisch-scholastische Rede von Gott, seinen Eigenschaften und Denknotwendigkeiten, sondern der „homo peccati reus ac perditus et Deus iusitificans ac salvator hominis peccatoris.“⁵⁵ Dabei handele es sich eben nicht um eine „Näherbestimmung[…] [des theologischen Gegenstandsbereichs] von ‚Gottʻ und ‚Menschʻ […], sondern [um] die jeweilige Wesensbestimmung“,⁵⁶ die das eigentliche Kernthema von Theologie markiert. Diese „Verschränkung der Sichtweise“⁵⁷ im Wechselverhältnis von Gott und Mensch kann dann im hier vorliegenden argumentativen Kontext als eine den theologischen Diskurs strukturierende Frage nach eben dieser spezifischen Relation herausgestellt werden, nämlich als Frage nach dem Verhältnis des sowohl sündigen als auch gerechtfertigten Menschen zu Gott, von dem er sich im Glauben als in dieses simul-iustus-et-peccator-Verhältnis gesetzt erlebt.⁵⁸ Ähnlich ließe sich in der Logik dieser Arbeit, wie in Kapitel 2.2.2. schon angerissen und deswegen an dieser Stelle nur thetisch anzuführen, auch bei Schleier-
51 Vgl. ebd., q 1,1. 52 „Die Bedeutung Luthers für das Verständnis christlicher Theologie besteht darin, dass […] die primäre Bezugsbasis der Theologie auf die durch den Glauben gegebene Gemeinschaft mit Gott als die Realisierung individuellen Heils umgestellt wird. Damit wird im Gesamtgefüge von Theologie und Kirche eine bis dahin nicht denkbare Akzentsetzung vorgenommen, die die theologischen Anschauungen, Lehren und Argumente neu perspektiviert, ohne freilich den Zusammenhang insgesamt zu zerstören.“ Korsch, Dietrich, Theologische Prinzipienfragen, in: Beutel, Albrecht (Hg.), Luther-Handbuch, Tübingen 32017, 398 – 408, 399. 53 Zum zeitgenössischen wissenschaftstheoretischen Hintergrund Luthers vgl. einführend Leppin, Volker, Universitätswissenschaft, in: Beutel, Albrecht (Hg.), Luther-Handbuch, Tübingen 32017, 84 – 90. 54 Luther, Martin, Enarratio Psalmi LI, in: WA 40/2, (313 – 314.)315 – 470, 327. 55 Ebd., 328. 56 Korsch, Theologische Prinzipienfragen, 402. 57 Ebd. 58 Vgl. Axt-Piscalar, Was ist, 48 f.
3.2 Impuls: Die Fragestellung als Differenzkriterium
85
macher das Charakteristikum der Theologie anhand einer spezifischen Fragestellung aktiv konstruieren; nämlich insofern, als dass ihre Konstitution bzw. ihre Einheit als eigenständige akademische Disziplin, die sich nicht in ihre sie umgebenden Nachbardisziplinen auflösen lässt,⁵⁹ sich auch da nicht über eine gewisse Methode oder einen nur ihr zuzusprechenden Gegenstandsbereich ergibt, sondern darin, dass sie ihre Gegenstände in einer spezifischen formalen Ausrichtung auf ihren positiv-praktischen Bezug zur Kirchenleitung,⁶⁰ also aus und auf die soziale Konstitution einer „bestimmten Gottesbeziehung“⁶¹, sozusagen die weit zu verstehende Glaubenspraxis als Weltdeutung und -gestaltung des Christentums hin befragt.⁶² Oder auch die Konzeption von Theologie des schon in Kapitel 2.2.6. angesprochenen und deswegen hier ebenfalls nur kurz erinnerten Barths könnte so gelesen werden, dass sich die Differenzierung der Disziplinen anhand ihrer spezifischen Fragestellungen verdeutlicht: So fragte Theologie dann in ihrem gesamten Tun nach dem am Menschen ergangenen und Glaubensbeziehung stiftenden Wort Gottes bzw. der ihm gemäßen Rede „nach Maßgabe des der Kirche eigenen Prinzips.“⁶³ Im theologischen Konzept des in Kapitel 2.2.7. bereits zur Sprache gekommenen Tillichs kann die spezielle Frage der Theologie darin konstruiert werden, dass sie im Zusammenhang der existenziellen Sinnfrage des Menschen nach der Manifestation des Göttlichen in allem Seienden als transzendente Antwort darauf fragt.⁶⁴ Auf die gleiche Art ließe sich – analog zu den Reflexionen auf das oben angeführte Kleine-Zitat – nun auch in neueren wissenschaftstheoretischen Selbstbestimmungen von Theologie vorgehen, was hier exemplarisch an den Ausführungen des früheren⁶⁵ Dalferths nur kurz angedeutet werden soll. In seiner Bestimmung
59 Vgl. Schleiermacher, KD, 328. 60 „Der Ausdrukk Kirchenleitung ist hier im weitesten Sinne zu nehmen, ohne daß an irgend eine bestimmte Form zu denken wäre.“ Ebd., 327. Die funktionale Ausrichtung auf die Kirchenleitung markiert also im theologischen Fachdiskurs diejenigen „wissenschaftlichen Kenntnisse und Kunstregeln [als zum formalen Kompendium der Theologie], ohne deren Besiz und Gebrauch eine zusammenstimmende Leitung der christlichen Kirche, d. h. ein christliches Kirchenregiment nicht möglich ist.“ Ebd., 328. 61 Ebd., 325. 62 Zur fundamentaltheologischen (genauer enzyklopädischen) Bedeutung Schleiermachers im Kontext dieser Arbeit vgl. Kapitel 5.1. 63 Vgl. Barth, KD I,1, § 1. 64 Vgl. Tillich, Zur Theologie, 346. 65 Dalferth fungiert hierbei wirklich lediglich als – teilweise auch innerhalb religionswissenschaftlicher Debatten zum Theologie-Begriff rezipiertes – Beispiel. Gerade von neueren Ausführungen Dalferths zu Wissenschaftlichkeit distanziert sich diese Arbeit explizit. Vgl. für ein Beispiel solcher distanzierungswürdigen Ausführungen Dalferth, Ingolf U., Ideologische Selbstzerstörung.
86
3 Was den Unterschied ausmacht
von Theologie als „praktische[r] Disziplin der Lebensorientierung durch kritische Entfaltung des christlichen Glaubens und seines Wirklichkeitsverständnisses“⁶⁶ geht er im hier zitierten Aufsatz ausdrücklich auf ihre Differenz zur Religionswissenschaft aufgrund ihres unterschiedlichen Fragens ein.⁶⁷ In diesem Konzept⁶⁸ wird die Eigenart der Theologie explizit nicht über ihren spezifischen Gegenstand, Methode oder eine wie auch immer zu bestimmende Glaubensnähe bestimmt,⁶⁹ sondern über ihr fragendes, zielgerichtetes Erkenntnisinteresse nach einer praktischen Lebensorientierung im Kontext der kritischen Reflexion auf christlichen Glauben. Diesen immer nur kurz thetisch angeführten Selbstbestimmungen theologischer Wissenschaft kann bei aller (materialen) Verschiedenheit als auf der strukturell-formalen Meta-Ebene dennoch untereinander als Gemeinsamkeit heraus konstruiert werden, dass sie sich von anderen Disziplinen nicht aufgrund der oben genannten klassischen Differenzkriteria charakteristisch wissenschaftstheoretisch unterscheiden,⁷⁰ sondern dass das Identitätsstiftende der Theologie formal in einer (material verschiedentlich gefüllten) Art und Weise liegt, aus welchem Grund und woraufhin Theologie ihre Gegenstände in Anwendung bestimmter Methoden und in gewissen Perspektiven befragt. ⁷¹
Kritische Anmerkungen zur allgemeinen Entwicklung an den Universitäten in den USA, in: Zeitzeichen (04.01. 2021), https://zeitzeichen.net/node/8764 – 07.03.23. 66 Ders., Theologie im Kontext der Religionswissenschaft. Selbstverständnis, Methoden und Aufgaben der Theologie und ihr Verhältnis zur Religionswissenschaft, in: ThLZ 1/126 (2001), 3 – 20, 18. 67 Vgl. ebd., 6. „Religionswissenschaft und Theologie reden in je ihrem Horizont und in je ihren Perspektiven über die im Licht je ihrer Fragen thematisierten Phänomene, […]. […] Nicht was sie thematisieren, sondern wie und in welchem Sinn sie es tun, unterscheidet Theologie und Religionswissenschaft.“ Ebd., 12. 68 Zur weiteren Konzeption seines hermeneutisch fokussierten Theologiebegriffs vgl. v. a. Ders., Evangelische Theologie als Interpretationspraxis. Eine systematische Orientierung (ThLZ.F 11/12), Leipzig 2004. Dalferth konzipierte Theologie hier (im Versuch einer gewissen Synthese von Schleiermachers Ansatz beim religiösen Subjekt mit dem Grundgedanken der Dialektischen Theologie der wissenschaftstheoretischen Verpflichtung auf das Wort Gottes) als die auf die „christliche Glaubenspraxis als Ausgangs- und Zielpunkt“ (ebd., 176) ausgerichtete Interpretationspraxis, die danach fragt, in welchen Phänomenen die „Selbstkommunikation“ (ebd., 110) Gottes als Kern christlicher Glaubenswirklichkeit erfahren und gedeutet wird. An (spätestens) dieser Stelle wird die spezifische substantielle Füllung des Dalferthschen Theologiebegriffs, dem diese Arbeit als strukturlogische wissenschaftstheoretische Reflexion explizit nicht folgt, deutlich. 69 Vgl. ders., Theologie im Kontext, 8 ff. 70 Nichtsdestotrotz finden diese klassischen Differenzkriterien – wie bereits erwähnt – natürlich dennoch Anwendung in den genannten Entwürfen; dann aber eben nicht als wissenschaftstheoretische Differenzkriterien der einzelnen disziplinären Diskurse per se, sondern vielmehr als inhaltliche und formale, dynamische Faktoren des jeweiligen Diskurses. 71 Näheres zur Fragestellung der Theologie dann in Kapitel 5, v. a. 5.5.
3.3 Definitorische Setzung: Das Differenzkriterium der Fragestellung
87
3.3 Definitorische Setzung: Das Differenzkriterium der Fragestellung Nachdem im Bisherigen also die innere wissenschaftstheoretische Logik und Adäquatheit der disziplinären Unterscheidung anhand des Differenzkriteriums der Fragestellung dargelegt wurde, soll im Folgenden die Herleitung einer Definition dessselben erfolgen. Grundsätzlich wird im Folgenden davon ausgegangen, dass das, was eine Disziplin von einer anderen unterscheidet, mit dem, was ihre eigene Disziplinarität begründet, zumindest teilweise zusammenfällt.Vorauszuschicken ist dabei an dieser Stelle die Grundannahme, dass die Entstehung einer Disziplin, also die Binnendifferenzierung des Feldes der Wissenschaft,⁷² nicht primär wissenschaftstheoretisch notwendig, sondern vielmehr sowohl ideengeschichtlich als auch soziokulturell kontingent bedingt ist.⁷³ Denn maßgeblicher Impuls für den Entwicklungsprozess eines wissenschaftlichen Faches ist das zielgerichtete Erkenntnisinteresse an einem spezifischen Problem einer forschenden Person bzw. Gruppe von Personen, welches durch die individuellen Voraussetzungen eben dieser Personen (wie bspw. ihre dynamischen kulturellen Wahrnehmungsraster, ihre multidimensionale sprachlich-ethnische Sozialisation u. v. a.) bedingt ist⁷⁴ – und welches dementsprechend aber auch als „eine allgemeine Zwecksetzung […] die Konstitution und Ausdifferenzierung des (wissenschaftlich) erkannten Gegenstandes leitet.“⁷⁵ Denn es gibt keine Wissenschaft ohne das sie betreibende Subjekt: Akademische Disziplinen sind „gegenstandsorientierte Tätigkeitssysteme“⁷⁶ und kulturelle Praxis. Somit sind schon die sozusagen apriorischen Entstehungsvoraussetzungen einer Disziplin höchst kontingent, historisch wandelbar und in sich fluid und plural; zumal eben diese Voraussetzungen nicht nur dem Entstehungsprozess, sondern natürlich auch jedem einzelnen Forschungsprojekt immer vorausgehen. Dadurch prägen diese Voraussetzungshaftigkeiten nicht nur den konkreten Forschungsprozess, sondern sind gleichzeitig selbst geprägt durch vorausgehende Forschungsprozesse als Teil des soziokulturell-epistemischen Rahmens, in dem sie sich überhaupt erst (gigantum
72 Vgl. Stichweh, Rudolf, Differenzierung der Wissenschaft, in: ZfS 1/8 (1979), 82 – 101, 82. 73 Vgl. z. B. schon Kant, Immanuel, Der Streit der Facultäten (1798), in: AA 7 (1917), 1 – 116, 18 f. Vgl. aber auch Krüger, Einheit der Welt, 116. 74 Interesse an etwas zu nehmen könnte mithin sogar als eine gewisse anthropologische Grundkonstitution gesetzt werden, wenn man eben jenes inter-esse der Person zwischen dem Objekt und dem eigenen Subjekt „als Möglichkeit von wie Notwendigkeit von Welt- und Selbstvermittlung“ definiert. Vgl. Eßer, Albert, Art. Interesse, in: HphG 2 (1973), 738 – 747, 745 f. 75 Gethmann, Carl F., Art. Erkenntnisinteresse, in: EPhW 2 (1984), 376 – 377, 376. 76 Guntau/Laitko, Entstehung, 26.
88
3 Was den Unterschied ausmacht
humeris insidentes) konstituieren: Die voraussetzungsvoll bestimmte, fluid-dynamische Identität der forschenden Person, die sich also aus der vorwissenschaftlichen soziokulturellen Prägung und der wissenschaftlichen Position innerhalb einer spezifischen Fach- und Wissenschaftstradition ebenso konstant-dynamisch und fluid zusammensetzt, bestimmt mithin maßgeblich den Prozess des Forschens – und wird, als Teil ihrer Fach- und Wissenschaftstradition, wiederum durch den Forschungsprozess selbst bestimmt.⁷⁷ Solches soll im Folgenden unter dem Stichwort der Positionalität von Wissenschaft subsumiert werden: Als die „Bestimmtheit des Forschungsprozesses durch die forschende Person bei gleichzeitiger Bestimmtheit der forschenden Person durch den Forschungsprozess.“ ⁷⁸ Gerade am Begriff des Interesses zeigt sich sowohl einerseits die ideengeschichtliche Wandelbarkeit des konnotierten Gehalts als auch andererseits seine unübersehbare wissenschaftstheoretische Bedeutsamkeit als vorwissenschaftlicher Impuls von Erkenntnis – und dementsprechend als wirkmächtiger Faktor des Forschungsprozesses: Denn lag sein Ursprung im Alltagspraktisch-Lebensweltlichen⁷⁹ (wie das so wohl bei einer Vielzahl von Fachbegriffen der Fall sein dürfte), so fand er dann im Laufe seiner Existenzgeschichte Eingang in wissenschaftsphilosophische Debatten,⁸⁰ ohne dabei natürlich seine alltagssprachlich-handlungsorientierte Bedeutung zu verlieren: Interesse an etwas ist eben immer konkret situations- und dementsprechend handlungsbezogen.⁸¹ Gerade daraus resultiert dann auch eine gewisse Schwierigkeit bei der expliziten Integration des Begriffs in wissenschaftstheoretische Konzeptionen, da er aufgrund seines lebensweltlichen Ursprungs mit einer gewissen Dynamizität und wertenden Subjektivität konnotiert ist,⁸² die nicht zum traditionellen Postulat einer werturteils- und interessenfreien
77 Vgl. Oorschot, Jürgen van, Das Alte Testament im Kreis der theologischen Fächer. Theologische Wahrnehmung altorientalischer und jüdischer Religion innerhalb des christlichen Kanons, in: Buntfuß, Markus/Fritz, Martin (Hg.), Fremde unter einem Dach? Die theologischen Fächerkulturen in enzyklopädischer Perspektive (TBT 163), Berlin 2014, 23 – 41, 37. 78 Nagel, Theologie, 214. 79 Als wirtschaftliche Gegenstandskategorie, wie eben als (Kapital‐) Zins.Vgl. Schütte, Hans-Walter, Erkenntnis und Interesse in der Theologie, in: NZSTh 13/3 (1971), 335 – 350, 335 f. 80 So wurde maßgeblich durch den deutschen Idealismus der Begriff des Interesses als Reflexionskategorie in den Zusammenhang erkenntnistheoretischer Diskussionen gestellt. Vgl. Schütte, Erkenntnis, 337 f. „Alles Interesse meiner Vernunft (das spekulative sowohl, als das praktische) vereinigt sich in folgenden drei Fragen: 1. Was kann ich wissen? 2. Was soll ich tun? 3. Was darf ich hoffen?“ Kant, KrV, B 832. 81 Vgl. Mittelstraß, Über Interessen, 133 f. 82 Vgl. Schütte, Erkenntnis, 336 f.
3.3 Definitorische Setzung: Das Differenzkriterium der Fragestellung
89
Wissenschaft zu passen scheint.⁸³ Dabei ist jedoch erneut kritisch daran zu erinnern, dass alle Erkenntnis durch die Tätigkeit des forschenden Subjekts immer in einen komplexen und dynamischen individuell-epistemischen Rahmen eingebunden ist und somit also alle Wissenschaft eben auch maßgeblich durch das Interesse der forschenden Person vorwissenschaftlich erkenntnisgeleitet ist⁸⁴ und es dementsprechend keine interessenfreie Wissenschaft geben kann.⁸⁵ Es kann also im Erkenntnisprozess nicht darum gehen, diese geradezu apriorische Prägung durch solche individuellen soziokulturell bedingten Faktoren auszuschalten oder gar zu ignorieren.⁸⁶ Ergebnis wäre in der Endkonsequenz dann ein höchst dogmatischer Szientismus: „Gerade die reine Theorie, die alles aus sich selber haben will, fällt dem verdrängten Äußeren anheim und wird ideologisch.“⁸⁷ Vielmehr kann nicht oft genug betont werden, dass die Interessengeleitetheit aller Wissenschaft aufzudecken und im Forschungsprozess selbst mitzureflektieren ist, denn erst dann besteht die Möglichkeit zu einem bewussten, „gesunden“, weil reflektierten wissenschaftsethischen Objektivismus in der Wissenschaft; nämlich dann, wenn es um die aktive Offenlegung und Ausschaltung partikularer, den Forschungsprozess verfälschender Einzelinteressen geht.⁸⁸ Damit ist also summa summarum die wissenschaftliche Positionalität vor und während des Forschungsprozesses zwingend immer mitzureflektieren und offenzulegen, um dadurch Transparenz zu schaffen: Die Wissenschaftlichkeit einer Aussage hängt dann nicht
83 Vgl. v. a. Habermas, Jürgen, Erkenntnis und Interesse. Frankfurter Antrittsvorlesung vom 28. Juni 1965, in: Merkur 213/19 (1965), 1139 – 1153, 1140 – 1142. Die vieldiskutierten Ausführungen Jürgen Habermasʼ verdeutlichen, dass dieses Postulat einer positivistischen und interessenfreien Wissenschaft einen inneren Widerspruch in mehrfachem Sinne darstellt: So resultiere der Positivismus heutiger Wissenschaft zwar durchaus aus dem klassischen Theorieverständnis der philosophischen Antike, in der θεωρία als die reine, interessenfreie Anschauung des κόσμος galt und die dementsprechend eine gewisse ontologische Dichotomie zwischen dem Sein und der Zeit voraussetzte. Diese Ontologie rezipiere das moderne Wissenschaftsbild, ignoriere aber dabei den sich im Ethos ausdrückenden lebensweltlichen Impetus des klassischen Verständnis von θεωρία: „Theorie prägt dem Leben ihre Form auf.“ Ebd., 1140. Außerdem verkenne solcher heutiger Szientismus seine eigene höchst normative Ontologie, die in ihrem positivistischen Vorverständnis dem Sein von vornherein ein Sollen entgegensetzt. 84 Vgl. ebd., 1145 – 1148. 85 Habermas systematisiert dieses in der Lebenswelt der „Menschengattung“ sowohl begründete als auch diese formende Interesse der Wissenschaft bekannter Weise in drei Kategorien: das technische Interesse der empirisch-analytischen (Einzel‐) Wissenschaften, das praktische Interesse der historisch-hermeneutischen und das emanzipatorische Interesse der kritischen Wissenschaften (also maßgeblich der Philosophie). Vgl. ebd., 1145 – 1150. 86 Vgl. ähnlich dazu auch schon die Diskussion im Vorherigen in Kapitel 3.1. 87 Ebd., 1151. 88 Vgl. ebd., 1148. Dazu sollten also dann auch religiös-institutionelle Einzelinteressen zählen.
90
3 Was den Unterschied ausmacht
vom (epistemisch schwer durchführbaren) Ausschalten der Positionalität ab; wenngleich natürlich die kritische Selbstreflexion auf die eigenen vorwissenschaftlichen Erkenntnisbedingungen den konsekutiven methodischen Schritt der Distanzierung – sowohl zum Gegenstandsbereich, als auch zur eigenen Position – in sich trägt. Zentral für den wissenschaftlichen Forschungsprozess ist vielmehr, dass die Genese und Argumentation einer Aussage diskursiv-intersubjektiv⁸⁹ nachvollziehbar und ihr Ergebnis ebenfalls so sprachlich verobjektiviert wird, dass die Scientific Community ihre Entstehung, Bedingungen und Implikationen nachvollziehen und veri- bzw. falsifizieren kann.⁹⁰ Im Entstehungsprozess akademischer Disziplinen sind also gerade die fundamentalen, erkenntnisleitenden Interessen maßgeblich konstitutiv:⁹¹ Denn das zunächst kontingent durch ein Problem affizierte Interesse verbindet sich mit einer dezidierten Forschungsabsicht und verdichtet sich als wissenschaftliche Disziplin in einer konkret problemorientierten Fragestellung.⁹² „Forschung ist […] nicht möglich ohne Probleme; man muß – zumindest im Umriß – vorzeichnen, was man will, man muss Fragen haben. Und die Sorte von Fragen, die man auf einen Gegenstand richtet, sind möglicherweise das, was bei der Identifikation von Disziplinen und Subdisziplinen weiterhelfen könnte.“⁹³ Auch und gerade der Begriff der Fragestellung hat seinen Ursprung im Lebensweltlich-Alltäglichen – und so gleichsam Eingang gefunden in grundlegende
89 Intersubjektiv meint dann eben wie bereits erwähnt nicht subjektinvariant, sondern im Diskurs zwischen Subjekten. 90 Vgl. z. B. auch Seiwert, Hubert, Systematische Religionswissenschaft. Theoriebildung und Empiriebezug, in: ZMR 1/61 (1977), 1 – 18, 7.10 f. 91 Und dennoch können sie nicht zum wissenschaftstheoretischen Differenzkriterium erhoben werden: „Entscheidend […] ist der Einwand, daß Interessen und Disziplinen(‐gruppen) sich fast beliebig kombinieren lassen. […] [Z. B. auch] [d]ie Naturwissenschaften sind erst spät und allmählich ins Stadium technischer Nutzbarkeit eingerückt; auch heute ist keineswegs unumstritten, daß sie etwa nur deshalb betrieben werden oder betrieben werden sollten. […] Darauf kommt es […] an, nämlich zu betonen, daß hier nicht feste disziplinen-definierende Normierungen, sondern wandelbare historische Präferenzen in Rede stehen.“ Krüger, Einheit der Welt, 114. 92 Ähnlich beschrieb Bultmann das auf der forschungstechnischen Mikroebene, nämlich im Zusammenhang seiner methodischen Ausführungen zur Hermeneutik: „Die Fragestellung erwächst aus einem Interesse, das im Leben des Fragenden begründet ist, und es ist die Voraussetzung aller verstehenden Interpretation, daß dieses Interesse auch in irgendeiner Weise in den zu interpretierenden Texten lebendig ist und die Kommunikation zwischen Text und Ausleger stiftet. […] Das Interesse an der Sache motiviert die Interpretation und gibt ihr die Fragestellung, ihr Woraufhin.“ Bultmann, Rudolf, Das Problem der Hermeneutik, in: Ders., Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze. Band 2, Tübingen 1965, 211 – 235, 217.219. 93 Krüger, Einheit der Welt, 114.
3.3 Definitorische Setzung: Das Differenzkriterium der Fragestellung
91
philosophische Debatten: In sprechakttheoretischer⁹⁴ Definition ist eine Sprachhandlung nur dann eine Frage, wenn der fragenden Person die Antwort nicht schon vorher bekannt ist.⁹⁵ Das heißt gleichsam, dass auch in wissenschaftstheoretischer Hinsicht die Voraussetzung einer Frage bzw. einer ausdefinierten Fragestellung das Nichtwissen der Fragenden ist. Das wiederum impliziert jedoch sehr konkretes Vorwissen:⁹⁶ „Um fragen zu können, muß man wissen wollen, d. h. aber: wissen, daß man nicht weiß.“⁹⁷ (Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass, wer wissen will, fragen können muss.)⁹⁸ Auch hier zeigt sich also die Voraussetzungshaftigkeit des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses,⁹⁹ denn solches Fragen ist genuin immer problemorientiert selektiv und abstrahierend. ¹⁰⁰ Diese problemorientierte Fragestellung bedingt mithin forschungsleitend einerseits den Gegenstandsbereich, an dem jenes Problem in konkreten Forschungsvorhaben untersucht wird. Deutlich ausgedrückt konstruiert Wissenschaft sich ihre Gegenstände im Erkenntnisprozess selbst. Andererseits bedingt diese Konstruktion von Gegenstandsbereichen auch die an ihnen und der Problemstellung ausgerichteten anzuwendenden Methoden. ¹⁰¹
94 An dieser Stelle exemplarisch angeführt, aber insofern für diese Arbeit paradigmatisch, als dass der Hintergrund des hier vorliegenden Diskursverständnisses – wie eingangs dargelegt – sprechakttheoretisch konnotiert ist. 95 Vgl. Searle, John R., Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay, Frankfurt a. M. 122013, 102. 96 Vgl. Coreth, Emerich, Art. Frage, in: HphG 1 (1973), 485 – 493, 490. 97 Gadamer, Hans-Georg, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Hermeneutik I, in: GW 1 (1986), 369. 98 „Wissen ist dialektisch von Grund aus.“ Ebd., 371. Denn eine Frage ist – auch wenn sie von einer Gruppe forschender Personen an einen Gegenstandsbereich gestellt wird – ein „Redehandlungstyp, mit dem der Autor einen Adressaten dazu zu bringen versucht, ihm eine durch den propositionalen Gehalt der Redehandlung spezifizierte Information zur Verfügung zu stellen.“ Gethmann, Carl F., Art. Frage, in: EPhW 2 (1984), 544 – 545, 544. 99 „Im Wesen der Frage liegt, daß sie einen Sinn hat. Sinn aber ist Richtungssinn. Der Sinn der Frage ist mithin die Richtung, in der die Antwort allein erfolgen kann, wenn sie sinnvolle, sinngemäße Antwort sein will. Mit der Frage wird das Befragte in eine bestimmte Hinsicht gerückt.“ Gadamer, Wahrheit und Methode, 368. 100 Denn es ist „die Eigenart der Wissenschaft, bestimmt begrenzte Frage-Intentionen auszusondern und mit entsprechenden Methoden zu verfolgen. Jede Einzelwissenschaft ist insofern ‚abstrakt‘, als sie von anderen Frage-Bezügen und -Zusammenhängen absieht.“ Coreth, Art. Frage, 486 f. M. a. W. im Begriff der Frage sind epistemisch-logische Begrenzungen mitgegeben: „Zu einer Antwort, die man nicht aussprechen kann, kann man auch die Frage nicht aussprechen. […] Wenn sich eine Frage überhaupt stellen lässt, so kann sie auch beantwortet werden.“ Wittgenstein, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus, in: Werkausgabe 1 (2016), 7– 85, 84. 101 Mit anderen Worten: „Wenn ihr Wesen [der Disziplin] durch ihren ‚Gegenstand‘ (Material- und Formalobjekt) definiert wird, so ist dies schon die Definition einer bestimmten Frage-Stellung; die Methode der Wissenschaft besteht in der Weise, wie sie an ihren Gegenstand Fragen stellt und darauf Antworten zu erhalten sucht.“ Coreth, Art. Frage, 486 f.
92
3 Was den Unterschied ausmacht
Dementsprechend ist auch alle Methode an sich schon von vornherein höchst voraussetzungsvoll. Nicht nur aufgrund ihrer Arbeitshypothesen und Setzungen, sondern schon allein aufgrund der epistemischen Bedingungen des sie auswählenden Forschungssubjekts. Als die ein akademisches Fach definierende Fragestellung gilt also mithin die den disziplinären Diskurs identitätsstiftend strukturierende, weil forschungsleitende Konkretisierung einer durch das Erkenntnisinteresse hervorgerufenen Forschungsabsicht an einem bzw. mehreren Forschungsgegenständen auf ein spezifisches Problem hin. D. h. in der wissenschaftstheoretischen Fragestellung eines Faches (als ein Disziplinen unterscheidendes Differenzkriterium auf der forschungstechnischen Metaebene) wird das grundlegend-disziplinäre Interesse auf eine problemorientiert gezielte Frage hin zugespitzt, welche im Einzelnen zu in diesem Rahmen durchzuführenden diskursiv-intersubjektiv überprüfbaren Forschungsvorhaben ausformuliert werden kann, wodurch diese als zum spezifischen fachlichen Diskurs¹⁰² gehörend gekennzeichnet sind. Die Ergebnisse dieser Forschungsvorhaben und somit einer Disziplin sind Theorien,¹⁰³ deren Explikation auf Grundlage wissenschaftlicher, also kohärenter, stabiler und intersubjektiv überprüfbarer¹⁰⁴ Beobachtungen basiert. Ihre Akzeptanz in der entsprechenden Scientific Community hängt dabei nicht nur von jenen Beobachtungen, sondern maßgeblich auch von parallel mitschwingenden, nichtempirischen Anforderungen ab, wie z. B. der normativen Maßgabe der Einfachheit, Einheitlichkeit bzw. Kohärenz und Wahrscheinlichkeit. Auch die Größe ihrer Anwendungsbereiche, die ohne zusätzlich stützende „Ad-hoc-Hypothesen“ aufrecht erhalten werden kann, ist entscheidend.¹⁰⁵ Gerade hier zeigt sich wieder die Voraussetzungshaftigkeit wissenschaftlichen Arbeitens. Implizit ergibt sich daraus die retrospektive wissenschaftstheoretische Überprüfbarkeit des disziplinären Differenzkriteriums der Fragestellung an den Ergebnissen ihrer Forschungsvorhaben, also den Theorien.¹⁰⁶ (Erzielte eine Disziplin unter Anwendung ihrer spezifischen Fragestellung in allen bzw. mehrheitlich allen Fällen die gleichen Ergebnisse wie eine
102 Das Differenzkriterium der Fragestellung ist also als ein Diskursbegriff zu denken – und nicht als klar abgrenzbare kategoriale Schublade. Dabei ist wieder zu erinnern, dass es sich hierbei um ein absolut niedrigschwelliges Verständnis von Diskursen handelt, nämlich im Sinne von intersubjektiven, argumentativen Kommunikationsstrukturen. 103 Vgl. Tetens, Holm, Wissenschaftstheorie. Eine Einführung (Beckʼsche Reihe 2808), München 2013, 55. 104 Vgl. Carrier, Wissenschaftstheorie, 58. 105 Vgl. ebd., 100. 106 So zumindest die These dieser Arbeit. Eine Durchführung dieser These findet sich v. a. in den Kapiteln 4.2. und 5.2.
3.3 Definitorische Setzung: Das Differenzkriterium der Fragestellung
93
ihrer Nachbardisziplinen, wäre die Trennung dieser beiden Fächer höchstwahrscheinlich kritisch zu hinterfragen.)¹⁰⁷ Mit anderen Worten: „Die Theorie T1 lässt sich erfolgreich auf die Theorie T2 reduzieren, wenn alles, was die Theorie T1 über die Wirklichkeit aussagt, genauso gut innerhalb der Theorie T2 gesagt werden kann.“¹⁰⁸ Damit ist nicht gesagt, dass verschiedene Disziplinen in einzelnen Forschungsvorhaben nicht zu den gleichen Ergebnissen kommen können. Sondern umgekehrt zeigt sich die Verschiedenheit von Fächern, wenn sie unter Anwendung ihrer fachspezifischen, den einzelnen Forschungsprojekten übergeordneten Fragestellung auf diese Ergebnisse jener Projekte zu verschiedenen Antworten gelangen.¹⁰⁹ Die Eigenständigkeit einer Disziplin ist also dann wissenschaftstheoretisch gerechtfertigt, wenn unter ihrer Fragestellung langfristig ein eigenes diskursives Theoriensystem ausgebildet wird¹¹⁰ und sie als so entstandenes Tätigkeitssystem eine gewisse (vorläufige) Permanenz vorweisen kann.¹¹¹ Wichtig ist auch hier zu betonen, dass das so generierte Theoriensystem in sich höchst dynamisch ist und nicht als ein statisch abzugrenzender Bereich vorgestellt werden kann. Die einzelnen Theoriebausteine können je nach Gegenstandsbereich, Methodik und aktuellen soziokulturellen Bedingungen des Forschungsprozesses variieren – die Einheit des Theoriensystems ergibt sich bei dieser dynamischen Pluralität seiner Einzelteile 107 Denn schließlich stehen Ergebnisse immer im Kontext bestimmter Fachdiskurse. D. h., dass natürlich (im konkreten Fall dieser Arbeit) Religionswissenschaft und Theologie zu gleichen Forschungsergebnissen kommen können – bei überschneidenden Gegenstandsbereichen und demselben geistes- und kulturwissenschaftlichen Methodenkanon kann das kaum überraschen. Dennoch – so die hier zugrundeliegende These – verorten sich einzelne Forschungsprojekte mehr oder weniger explizit innerhalb bestimmter Fachdiskurse. Eine solche Selbstverortung wird höchstwahrscheinlich implizit oder explizit Einfluss haben auf die Ergebnisse des Forschungsprojekts. In der „Summe“ des jeweiligen Fachdiskurses dürfte so sozusagen ein Referenznetzwerk entstehen, durch das sich die Forschungsprojekte in ihren Ergebnissen selbst positionieren. 108 Tetens, Wissenschaftstheorie, 37. 109 Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass man die „Aussagen einer Einzelwissenschaft […] daher in ihrem Sinn, ihrer Tragweite und ihren Grenzen nur richtig verstehen [kann], wenn man sie als Antwort auf eine bestimmt begrenzte Frage-Intention versteht, ohne ihre Bedeutung darüber hinaus zu verallgemeinern. Die meisten Mißverständnisse und Konflikte, z. B. zwischen Theologie und Naturwissenschaften, gehen darauf zurück, daß die grundsätzliche Verschiedenheit der Fragestellungen nicht beachtet wird.“ Coreth, Art. Frage, 487. 110 Dabei fungieren wiederum nicht die Theoriensysteme selbst als wissenschaftstheoretische Differenzkriterien. Gegen bspw. Krüger, Einheit, 116 f. Sondern sie sind als Ergebnis einer durch ihre spezifische Fragestellung von anderen Fächern unterschiedenen Disziplin das sozusagen empirische Faktum, an dem wiederum die Existenz einer dem Forschungsprozess zugrunde liegenden fachspezifischen Fragestellung überprüft werden kann. Mit anderen Worten: Wenn in einer Disziplin immer dieselben Antworten wie in einer Nachbardisziplin gefunden werden, ist irgendwann zu überprüfen, ob tatsächlich noch nach etwas anderem gesucht wird. 111 Vgl. Guntau/Laitko, Entstehung, 27.
94
3 Was den Unterschied ausmacht
vielmehr aus seiner diskursiven Kohärenz insgesamt. Zumal dieses Theoriensystem nicht einfach nur Ergebnis, sondern gleichzeitig wiederum Umwelt aller Forschungsprozesse im System selbst ist: Disziplinäre Forschung vollzieht sich immer im Kontext solcher disziplinären Theoriensysteme, die sie gleichzeitig zu ihrem Ergebnis hat. Dementsprechend agieren Theorien nicht einfach nur als Forschungsergebnisse, sondern wandeln sich zu – teilweise nur impliziten – Voraussetzungen wissenschaftlichen Arbeitens insgesamt und beeinflussen somit – als Faktor der soziokulturellen Bedingtheit des forschenden Subjekts – wiederum das sich in einer Forschungsabsicht verdichtende Erkenntnisinteresse und die daraus abgeleitete konkrete Fragestellung. Aufgrund dieser inhärenten Dynamik wird dann auch abschließend noch einmal deutlich, dass das Differenzkriterium der Fragestellung nicht im Sinne einer Kategorie mit harten Außengrenzen verstanden werden kann, sondern ein den wissenschaftlichen Diskurs strukturierender Begriff ist. Vielmehr zeigen die idealtypisch formulierten Fragestellungen verschiedener Disziplinen in ihrer Eigenschaft als Diskursmerkmale sozusagen die Pole bzw. Normpunkte von Spektren an, auf denen sich Forschung bewegt: D. h. im Einzelfall ist ein konkretes Forschungsprojekt o. ä. auf wissenschaftstheoretisch-definitorischer Ebene nicht zwingend eindeutig einer Disziplin zuordenbar. Aber es bewegt sich – durch Selbst-/ Eingliederung in einen spezifischen Diskurs – aller Wahrscheinlichkeit mehr oder weniger im Kontext einer bestimmten Disziplin, nämlich eben jenes spezifischen Diskurses, der sich auf eine – wie gesagt idealtypisierte – Fragestellung zuspitzt.
4 Wie fragt Religionswissenschaft? Die bisherigen Darlegungen haben zum Einen im zweiten Kapitel dieser Arbeit deutlich gezeigt, dass eine wissenschaftstheoretische Verhältnisbestimmung von Theologie und Religionswissenschaft durch verschiedene Problematiken vorbelastet ist, als da u. a. wären die historisch gewachsenen institutionellen Verzahnungen, der sich überschneidende Methodenkanon und Gegenstandsbereich oder die innere Pluralität des fachlichen Selbstverständnisses der beiden Disziplinen. Gerade Letzteres birgt einige grundlegende Schwierigkeiten in sich, da in der Logik dieser Arbeit angesichts der multidimensionalen Vernetzungen disziplinärer Diskurse mit- und untereinander nur metatheoretisch klare Disziplinarität überhaupt erst die Grundlage für zielführende Interdisziplinarität sein kann. Dementsprechend erfolgt nunmehr der Versuch einer proaktiven Darstellung der fachlichen Identität von sowohl Religionswissenschaft als auch Theologie – vor eben jenem Hintergrund der Pluralität. Außerdem wurde im Bisherigen dargelegt, dass das wissenschaftstheoretische Spezifikum einer Disziplin laut den Ausführungen des dritten Kapitels dieser Arbeit in ihrer Fragestellung liegt. Ergo wird die nun anschließende Ausarbeitung der Identität der beiden Fächer nicht im Sinne einer Deskription ihrer pluralen Selbstverständnisse im Sinne einer Summe aller Religionswissenschaft bzw. Theologie erfolgen, sondern eher als wissenschaftstheoretisch konzentrierte Konstruktion unter der Fokussierung auf die spezifische Fragestellung der jeweiligen Disziplin. Somit wird also im nun folgenden Schritt untersucht, wonach bzw. besser wie Religionswissenschaft als eigenständige, identifizierbare Disziplin auf der Metaebene ihrer Diskursstruktur spezifisch fragt.¹ Vorausgeschickt bzw. erinnert sei dabei gleichsam daran, dass eine solche Konstruktion religionswissenschaftlicher Fachidentität im Kontext dieser Arbeit natürlich nicht aus der religionswissenschaftlichen Innenperspektive erfolgen kann.² Vielmehr stellt dieses vierte Großkapitel den – aus dieser grundlegenden Übergriffigkeit nicht herauskommenden – Versuch einer Fundamentaltheologin dar, über Disziplinen als Diskursstrukturen in ihren inneren und äußeren Wechselverhältnissen nachzudenken und daraus konstruktiv die Möglichkeit einer Verhältnisbestimmung zwischen Theologie und einer ihrer religionsbezogenen Schwesterdisziplinen aufzuzeigen. Dementsprechend vollzieht sich das vierte Kapitel – wie auch Großteile der Arbeit insgesamt – aus und in einem spezifischen fundamentaltheologischen Diskurs (mit den für diesen Diskurs typischen Sprach-/
1 Daran anschließend wird im Kapitel 5 analog dazu die spezifische Fragestellung evangelischer Theologie herausgearbeitet. 2 Vgl. dazu die positionellen Eingrenzungen in der Einleitung dieser Arbeit. https://doi.org/10.1515/9783111091747-005
96
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
Regeln etc.) über einen anderen Fachdiskurs und nur als eine solche Außenperspektive auch in diesen hinein fokussiert. Daraus ergeben sich dann auch gewisse sprachliche, inhaltliche und formale Herangehensweisen und Aspekte, die eben aufgrund ihrer Genese in bzw. aus einem fundamentaltheologischen Diskurskontext heraus mit hoher Wahrscheinlichkeit unorthodox für den religionswissenschaftlichen Fachdiskurs erscheinen werden. Eine Übersetzungsarbeit in religionswissenschaftliche Diskursstrukturen hinein wäre Aufgabe eines im religionswissenschaftlichen Diskurs selbst verorteten Forschungsprojekts.
4.1 Historische und Systematische Religionswissenschaft Seit den Bestimmungen Wachs gilt, wie im zweiten Kapitel dieser Arbeit bereits erwähnt, eine prinzipielle Unterteilung von Religionswissenschaft in zwei forschungslogische, wechselseitig aufeinander bezogene Hauptmomente als ihre klassische metatheoretische Struktur: „Den Gegenstand der Religionswissenschaft bildet die Mannigfaltigkeit der empirischen Religionen. Sie gilt es zu erforschen, zu verstehen und darzustellen. Und zwar wesentlich nach zwei Seiten hin: nach ihrer Entwicklung und nach ihrem Sein, ‚längsschnittmäßig‘ und ‚querschnittmäßig‘. Also eine historische und eine systematische Untersuchung der Religionen ist die Aufgabe der Religionswissenschaft.“³
Solches hat sich maßgeblich in ihrer Fachgeschichte⁴ und auch in ihrer disziplinären Konstitution⁵ niedergeschlagen. Dabei ist jedoch anzumerken, dass diese beiden Momente – vor allem im Kontext neuerer wissenschaftsgeschichtlicher und innerdisziplinärer Entwicklungen – nicht so verstanden werden wollen, als handele es sich hier um zwei zwar miteinander verschränkte, aber dennoch trennbar parallel arbeitende „Sparten“⁶ oder Stoßrichtungen von Religionswissenschaft (im Sinne von Subdisziplinen o. ä.).⁷ Vielmehr zeigt, wie im Folgenden dargelegt werden 3 Wach, Religionswissenschaft, 21 f. 4 Vgl. z. B. als religionswissenschaftstheoretischen Klassiker Greschat, Hans-Jürgen, Was ist Religionswissenschaft? (UTB 390), Stuttgart 1988, 35. 5 Auch neuere Entwürfe bzw. Systematisierungen setzen diese Zweiteilung als gegeben: „Heute ist vielfach die Unterteilung der Religionswissenschaft in zwei Grundbereiche anzutreffen, nämlich in Historische Religionswissenschaft und in Systematische Religionswissenschaft. Darüber besteht weithin Übereinstimmung.“ Figl, Einleitung, 37. 6 Greschat, Was ist, 35. 7 Zu einer tiefgründigen kritischen Analyse des durchaus engführenden Wachschen Geschichtsbegriffs vor dem Hintergrund der Historismusdebatte vgl. Rüpke, Historische Religionswissenschaft, 17– 25.
4.1 Historische und Systematische Religionswissenschaft
97
soll, die innerfachliche Pluralität von Religionswissenschaft, dass historische und systematische Religionswissenschaft in einem differenzierteren epistemisch-methodologischen Verhältnis zueinander stehen. Solches hat dann logischerweise auch Konsequenzen für die Darstellung der etwaigen innerdisziplinären Teilgebiete von Religionswissenschaft – und die sie miteinander verbindende Fragestellung. Historische Religionswissenschaft oder auch Religionsgeschichte also galt in klassischen Selbstbestimmungen seit Wach als eine der beiden „Säulen“⁸ akademischer Religionswissenschaft. Aufgrund der Tatsache, dass erste religionswissenschaftliche Lehrstühle zunächst eben unter der Bezeichnung „Religionsgeschichte“ liefen,⁹ wurde (und wird) sie gleichzeitig als Ursprungszweig des heutigen Fachs der Religionswissenschaft an sich gesehen.¹⁰ So lautete z. B. der Titel der DVRW bis zum Jahre 2005 „Deutsche Vereinigung für Religionsgeschichte“.¹¹ Historisch-empirisches Forschen – im weitesten Sinne verstanden ¹² – stellt sicherlich bis heute ein genuines Grundmoment¹³ von Religionswissenschaft dar: Die Aufgabe der Religionsgeschichte laut Wach sei „das Werden der Religionen, ihre Entwicklung zu erforschen und darzustellen.“¹⁴ „Werden“ ist nunmehr – vor allem im Kontext neuester kulturwissenschaftlicher Entwicklungen innerhalb der Religionswissenschaft, wie z. B. ihrer immer stärkeren Öffnung zu den Sozialwissenschaften¹⁵ – umfassend zu verstehen, nämlich sowohl in Bezug auf die Historie, als auch die historisch bedingte aktuelle zeitgenössische Konstitution von Religionen: Konkret meint solches also im heutigen Wissenschaftsvollzug unter Anwendung verschiedenster geschichts- und kulturwissenschaftlicher Methoden die deskriptiv-empirische Darstellung sowohl dieser historischen Genese als eben auch der aktuellen Verfasstheit von Religionen als empirisch vorfindlichen Größen menschlicher Kultur.¹⁶
8 Hock, Einführung, 22. 9 Siehe oben unter Kapitel 2.1.2. 10 Vgl. Maier, Bernhard, Art. Religionsgeschichte (Disziplin), in: TRE 28 (1997), 576 – 585, 577 f. 11 Vgl. Rüpke, Historische Religionswissenschaft, 15. 12 Von einer Reflexion auf die verschiedenen Möglichkeiten der Definition von Geschichte, Geschichtstheorie, Geschichtswissenschaft, Historie o. ä. wird im Laufe dieser Arbeit aus Gründen der inhaltlichen Fokussierung abgesehen. Zur Einführung sei verwiesen auf Tschiggerl, Martin/Walach, Thomas/Zahlmann, Stefan, Geschichte, in: Dies., Geschichtstheorie, Wiesbaden 2019, 11 – 34. 13 So gerade auch in explizit kulturwissenschaftlich fokussierten Konzeptionen des Fachs. Vgl. Bergunder, Was ist, 19 f. 14 Wach, Religionswissenschaft, 72. 15 Eine Entwicklung, die der WSR z. B. als gefährlich einstuft, da sie dadurch zu einer immer stärkeren Fokussierung auf Religion(en) in Europa bzw. der BRD neige, was zu einer Provinzialisierung des Faches führen könne. Vgl. WSR, Empfehlungen, 91 f. 16 Vgl. z. B. Figl, Einleitung, 38.
98
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
Dieses Bezugsgebiet solcher umfassend verstandenen historisch-empirischen Religionswissenschaft selbst ließe sich dann, so man wollte, in Anlehnung an klassische Konzeptionen in drei materiale¹⁷ Teilbereiche gliedern – immer unter der Maßgabe der grundsätzlichen thematischen Verschränktheit dieser drei Bereiche untereinander und des eben beschriebenen umfassenden Verständnisses vom „Werden“ der Religionen: Allgemeine (oder auch universale), besondere und spezielle Religionsgeschichte. ¹⁸ Erstere befasste sich mit der „Gesamtheit aller Religionen in ihrer historischen Dimension“¹⁹ – im Prinzip eine (religionstheoretisch entsprechend hermeneutisch geleitete) „Gesamtdarstellung“²⁰ vom Beginn menschlicher Kultur bis heute. Zweitere untersuchte die geschichtlich-empirische Genese einer bestimmten Religion. Und als eine Art Ausspezifizierung aus den ersten Beiden untersuchte spezielle Religionsgeschichte „die Geschichte einzelner Elemente entweder innerhalb einer bestimmten Religion oder im Zusammenhang einer mehrere Religionen übergreifenden religiösen Tradition.“²¹ Dabei ist so verstandene historische Religionswissenschaft insgesamt sich trotz ihrer ausdrücklich empirisch-deskriptiven Ausrichtung ihres immanent hermeneutischen Impetus und ihrer heuristischen Voraussetzungshaftigkeit – gerade auf epistemisch-methodologischer Ebene²² – bewusst:²³ So ist die Wahrnehmung historisch-empirischer Fakten (wie alles Forschen) natürlich immer bedingt durch individuelle Voraussetzungen der forschenden Person, die sich in einem spezifischen soziokulturellen Umfeld befindet.²⁴
17 Dass dabei unterschiedlichste Ansätze von Geschichtsschreibung (als Mentalitäts- oder Sozialgeschichte, Ideen- oder Kulturgeschichte etc. pp.) zur Anwendung kommen können, sei an dieser Stelle stillschweigend mitgedacht. 18 Besondere und spezielle Religionsgeschichte werden teilweise auch als zusammengehörend betrachtet, so dass dementsprechend nur zwei Teilgebiete historischer Religionswissenschaft konstatiert werden. Vgl. z. B. Hutter, Manfred, Art. Religionsgeschichte, in: RGG4 7 (2004), 318 – 321, 320 f. 19 Hock, Einführung, 22. 20 Figl, Einleitung, 39. 21 Hock, Einführung, 22. 22 Vgl. z. B. zu dem Versuch einer globalen Religionsgeschichte gerade angesichts der den Fachdiskurs prägenden Eurozentristikproblematik des Religionsbegriffs Bergunder, Michael, Umkämpfte Historisierung. Die Zwillingsgeburt von „Religion“ und „Esoterik“ in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und das Programm einer globalen Religionsgeschichte, in: Hock, Klaus (Hg.), Wissen um Religion. Erkenntnis – Interesse. Epistemologie und Episteme in Religionswissenschaft und Interkultureller Theologie (VWGTh 64), Leipzig 2020, 47– 131, v. a. 60 – 77. 23 Vgl. z. B. Stolz, Fritz, Grundzüge der Religionswissenschaft (KVR 1527), Göttingen 1988, 193 f. 24 So sei „darauf hinzuweisen, daß der Religionshistoriker grundsätzlich unter denselben Bedingungen arbeitet wie jeder andere Historiker auch. Er ist damit durchweg abhängig von den Quellen, die ihm zur Verfügung stehen, und von den Fragen, die er an diese Quellen zu stellen versteht. Die Religionsgeschichte beschreibt daher ebensowenig wie die Kirchen-, Wirtschafts- oder Sozialge-
4.1 Historische und Systematische Religionswissenschaft
99
Dadurch ist ihr Arbeiten nicht nur empirisch, sondern – wie alle Empirie – selektiv, systematisierend und dementsprechend auch immer interpretativ.²⁵ Gerade deswegen erfülle auch religionshistorisches Arbeiten immer eine gewisse „ideologiekritische“²⁶ Funktion für Religionswissenschaft als Fach insgesamt, da sie im Vollzug ständig überprüfen muss, ob die angewandten heuristischen Kategorien und Begrifflichkeiten dem Forschungsobjekt oder eher vielmehr dem Erwartungshorizont der forschenden Person entsprechen.²⁷ Dies hat logische Konsequenzen für eine differenzierte Zuordnung historischreligionswissenschaftlicher zu systematisch-religionswissenschaftlichen Momenten der Forschung zur Folge. Denn da Religionsgeschichte solcherart eine Grundfunktion religionswissenschaftlicher Arbeitsweise ist und schon in ihrem Vollzug systematisierend-komparative Aspekte zwingend beinhaltet, wird also im weiteren Verlauf dieser Arbeit davon ausgegangen, dass diese historisch-empirische Ausrichtung zwar als ein grundlegendes Proprium der Religionswissenschaft angesehen werden kann.²⁸ Systematisch-religionswissenschaftliches Forschen ist dann allerdings ein dem historisch-empirischen Arbeiten immer schon immanenter Aspekt: Alle historisch-empirische Forschung muss zwingend ihre erforschten Phänomene analysieren, kategorisieren und komparativ-hermeneutisch systematisieren – und also Begriffe und Theorien sowohl auf das historisch-empirische Material anwenden als auch aus eben diesem heraus bilden. Diese immanente Hermeneutik gilt nicht nur in Bezug auf die Frage nach dem materialen Erkennt-
schichte, wie es eigentlich gewesen, sondern schafft vielmehr in der lebendigen Auseinandersetzung des Historikers mit den Quellen ein durchaus wandelbares Bild der Religion(en) einer bestimmten Zeit und Kultur. Das mit der geschichtlichen Bedingtheit des Forschers vorgegebene Moment der Subjektivität liegt im Wesen jeder historischen, also auch der religionsgeschichtlichen Arbeit und kann daher reflektiert, aber keineswegs ausgeschaltet werden.“ Maier, Art. Religionsgeschichte, 583. Vgl. zum Wahrheitsanspruch von Geschichtswissenschaft Sellin, Volker, Einführung in die Geschichtswissenschaft, Göttingen 2014, 209 – 220. 25 Vgl. Hardy, Was ist, 3 f. 26 Hutter, Art. Religionsgeschichte, 320. 27 „Studying religion is not like looking through a window. It is necessary to see with glasses, to use models and maps to see religion not as a metaphysical truth to be perceived, but as a cultural phenomenon, itself a construction, a living reality. […] Historians of religion are not supposed to reveal a ‚truth‘, but to reflect on an always ongoing discourse about their truths – and on our own discourse.“ Borup, Jørn, Zen and the Art of Inverting Orientalism. Buddhism, Religious Studies and Interrelated Networks, in: Antes, Peter, New approaches to the study of religion. Band 1. Regional, critical and historical approaches (RaR 42), Berlin 2004, 451 – 487, 482. 28 Religionsgeschichte ist in diesem Sinne also keine Subdisziplin von Religionswissenschaft, sondern „‚Religionswissenschaft‘ und ‚historische Religionswissenschaft‘ sind […] Synonyme.“ Rüpke, Historische Religionswissenschaft, 32. Eine Einordnung dieses speziellen Verständnisses erfolgt in Kapitel 4.2.1.
100
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
nisgehalt historisch-empirischer Forschung, sondern ist letztlich geradezu erkenntnistheoretisch bedingt: „[D]ie Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten“.²⁹ Zusammengefasst sind historische und systematische Religionsforschung also nicht zwei arbeitstechnisch abzugrenzende Teilbereiche oder -gebiete³⁰ von Religionswissenschaft, sondern vielmehr die zwei das Fach insgesamt konstituierenden, verschiedene Methoden implizierenden Grundpfeiler von akademischer Religionswissenschaft als eigenständiger Disziplin.³¹ Beide Momente von Religionsforschung – der empirisch-historische und der systematisierende – bedürfen also zur Konstitution von Religionswissenschaft als Fach genuin einander.³²
4.1.1 Systematische Religionswissenschaft – als Metatheorie Im oben beschriebenen bzw. interpretierten Sinne sind die Ausführungen Wachs bis heute noch maßgeblich: Religionswissenschaft entsteht erst im Zusammenspiel ihrer – so weit wie möglich zu verstehenden – historisch-empirischen und her-
29 Kant, KrV, B XVI. 30 Dementsprechend umfassen auch akademische Institutionen, an denen bspw. nur ein Lehrstuhl unter der Titulierung „Religionsgeschichte“ o. ä. existiert, also das ganze Spektrum religionswissenschaftlichen Arbeitens. Vgl. dazu auch Hock, Einführung, 22. Auf der anderen Seite ist es durchaus denkbar, dass Institute, an denen sowohl historische als auch systematische Religionswissenschaft explizit-nominell in Form von Lehrstühlen vertreten sind, damit das Profil eigenständiger Religionswissenschaft als Disziplin betonen wollen – eben durch einen besonderen Fokus auf die Notwendigkeit genuin religionswissenschaftlicher Begriffs- und Theoriebildung.Vgl. z. B. die Website des Instituts für Religionswissenschaft der Universität Leipzig. Team, https://www.gkr.uni-leipzig.de/religionswissenschaftliches-institut/institut/team/ – 14.01. 2021. 31 In dieser forschungslogischen Binnenstrukturierung von Religionswissenschaft findet also der (eher nicht im Mainstream der aktuellen Religionswissenschaft zu verortende) Ansatz einer praktischen Religionswissenschaft, wie er maßgeblich von Udo Tworuschka initiiert wurde, keine Betrachtung, da davon ausgegangen wird, dass es sich dabei nicht um ein wissenschaftstheoretisches Grundmoment von Religionswissenschaft als Disziplin handelt, sondern eher um eine Spielart am Rande religionsphänomenologisch ausgerichteter Religionswissenschaft, die als „engagierte Religionswissenschaft“ ein spezifisches, beinahe existentielles Interesse an „ihrem Gegenstand, also [der] lebendige[n] Religion“ hat. Gantke, Wolfgang, Gelebte Religion. Probleme und Perspektiven der „Praktischen Religionswissenschaft“, in: Burkard, Franz-Peter (Hg.), Praktische Religionswissenschaft. Theoretische und methodische Ansätze und Beispiele. Festschrift zum 65. Geburtstag von Udo Tworuschka (Studien und Dokumentationen zur praktischen Religionswissenschaft 1), Münster 2014, 35 – 44, 37. 32 Vgl. dazu auch Seiwert, Systematische Religionswissenschaft, 3 f.
4.1 Historische und Systematische Religionswissenschaft
101
meneutisch-systematisierenden Momente.³³ Erforscht historische Religionswissenschaft Religionen bzw. als religiöse kategorisierte Phänomene als empirische Größen in ihrer geschichtlichen Genese, so liegt in Anlehnung an seine klassische Zweiteilung der Fokus des systematisch-religionswissenschaftlichen Moments wie bereits erwähnt darin, den Ertrag der historischen Forschung zu systematisieren, zu kategorisieren, zu vergleichen und so „religion(en)übergreifende Themen, Gegenstände, ‚Phänomene‘“³⁴ zu erfassen. Damit ist es einerseits ein der historischen Religionsforschung immanenter hermeneutischer Aspekt. Andererseits impliziert eine solche Aufgabenbeschreibung systematischen Arbeitens nach Ansicht dieser Arbeit ebenfalls ein im Folgenden zu erörterndes Verständnis von Systematischer Religionswissenschaft als Metatheorie – also als „einer Theorie darüber, wie Theorie konstituiert und legitimiert wird.“³⁵ 33 „Die Religionswissenschaft will die Religionen erforschen, verstehen und deuten. So wird sie vor allem ihr Werden, ihr Entstehen und Vergehen: ihre Geschichte aufklären. […] [Aber auch] Querschnitte werden gelegt werden müssen. Von entscheidenden zentralen Punkten aus wird die systematische Erforschung, Deutung und Darstellung vorzunehmen sein. Sie führt über die religionsgeschichtliche Arbeit hinaus und ergänzt sie, weist aber im Grunde auf diese als ihren Ursprung […] zurück. So ist auch die Systematik wieder nichts Letztes, sondern wird in gewisser Weise von der Geschichte umgriffen. […] um im Strom des Werdens das Lotblei des Erkennens senken zu können, müssen wir Ankerpunkte wählen und bezeichnen, aber die Bewegung des Lebens geht weiter, und wir müssen ihr folgen.“ Wach, Religionswissenschaft, 192. Vor diesem Hintergrund ist auch Jörg Rüpkes Kritik an einer Eigenständigkeit systematischer Religionsforschung innerhalb des Faches der Religionswissenschaft zu hinterfragen. Rüpke hängt seine Ausführungen, nach denen alle Religionswissenschaft Historische Religionswissenschaft ist, maßgeblich an Wachs vermeintlich zu eng gefasstem Verständnis „historischer“ Forschung auf, die dann natürlich erkenntnistheoretisch angewiesen ist auf Systematische Religionswissenschaft. Vgl. Rüpke, Historische Religionswissenschaft, 22 f. Dass Rüpke damit Wachs Verständnis nicht unbedingt gerecht wird, zeigt sich nicht nur in obigem Zitat, sondern z. B. auch darin, dass Wach religionspsychologische Forschung als ebenfalls historisch, weil auf empirisch-vorfindliches Material angewiesen kennzeichnet. Vgl. Wach, Religionswissenschaft, 109. 34 Figl, Einleitung, 42. 35 Schülein, Johann August/Reitze, Simon, Wissenschaftstheorie für Einsteiger (UTB 2351), Wien 4 2016, 25. Damit (und grundsätzlich mit ihrer metatheoretisch-kulturwissenschaftlich fokussierten Herangehensweise) verortet sich diese Arbeit mehr oder weniger explizit in einer aktuell bzw. konstant zentralen innerreligionswissenschaftlichen Debatte nach dem Verhältnis zwischen Religionsgeschichte (als dem Kerngeschäft von Religionswissenschaft) und neueren kulturwissenschaftlichen (zumeist diskurstheoretisch, poststrukturalistisch und/oder postkolonialtheoretisch fokussierten) Metatheoretisierungen von Religionswissenschaft. Vgl. dazu Laack, Isabel, Wozu Postkolionalismus, Diskurstheorie und Religionsästhetik? Überlegungen zu ihrem Nutzen für die religionsgeschichtliche Forschung (am Beispiel der Azteken), in: ZfR 29/2 (2021), 186 – 215, 187– 196. Vgl. als Hintergrund die Diagnose Hubert Seiwerts einer (vermeintlichen) „negligence of the history of religions in theoretical discussions on the aims, methods, and competences of the study of religion“ (Seiwert, Theory of Religion, 209) – und die bereits in Kapitel 3.1. in den Fußnoten ange-
102
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
Dem Erkenntnisinteresse nach wohl entstanden aus dem Anliegen der Religionsphänomenologie³⁶ wird dem systematisch-religionswissenschaftlichen Moment der Forschung prinzipiell „das ‚Allgemeine‘, das Regel- oder Gesetzmäßige eines Objektbereichs“³⁷ als Gegenstandsbereich zugeschrieben – im Gegensatz zur klassisch verstandenen Religionsgeschichte, deren Ziel eben vielmehr die Herausarbeitung des individuellen religiös-kulturellen Phänomens in seinem geschichtlichen Werden sei.³⁸ Damit agiert aber eben auch Systematische Religionswissenschaft idealiter – durch ihre Bezogenheit auf das historisch-religionswissenschaftliche Material – explizit empirisch-deskriptiv, historisch kontextualisiert und induktiv.³⁹ Sie fragt also nicht nach zeitübergreifenden, kontextunabhängigen Wesenseigenschaften von Religionen oder gar dem anthropologischen Phänomen Religion an sich. Sondern es ist geradezu unumgänglich, dass sie – vor dem Hintergrund der historisch-soziokulturellen Abhängigkeit und dementsprechend Wandelbarkeit ihres Materials – auf die konsequente, kontextualisierte Ausdifferenzierung und Neureflexion religionssystematischer Begriffe, Kategorien und Theorien drängt. Das vergleichende Systematisieren des in der Religionsgeschichte gesammelten empirischen Materials als ein zentraler Aspekt von Religionsforschung überhaupt kann so wie gesagt als konstitutiv für Religionswissenschaft als dezidiert kompa-
sprochene kritische Auseinandersetzung mit Seiwerts Diagnose und Ansatz im 2021er Herbstheft der Zeitschrift für Religionswissenschaft. 36 So wird in einigen Ausführungen das Konzept einer systematischen Religionswissenschaft geradezu als Überwindung von Religionsphänomenologie beschrieben – bei gleichzeitiger Bewahrung ihres Anliegens einer Frage nach dem Allgemeinen, dem Über-Individuellen und somit dem Verstehen von Religion.Vgl. z. B. Baaren, Theodorus P. van, Science of Religion as a Systematic Discipline. Some Introductory Remarks, in: Ders./Drijvers, Hendrik Jan Willem (Hg.), Religion, culture and methodology. Papers of the Groningen Working-Group for the Study of Fundamental Problems and Methods of Science of Religion (RaR 8), Den Haag/Paris 1973, 35 – 56, 45. Dadurch wurden die Begriffe „Religionsphänomenologie“ und „systematische Religionswissenschaft“ teilweise synonym gebraucht: „[E]inige sagen lieber ‚Religionsphänomenologie‘, andere ‚Systematische Religionswissenschaft‘.“ Greschat, Was ist, 35. Vgl. aber auch Baaren, Theodorus P. van, Systematische Religionswissenschaft, in: NedThT 24 (Dezember 1969/70), 81 – 88, 81. 37 Seiwert, Systematische Religionswissenschaft, 2. Seiwert plädierte hier für eine dynamische Sichtweise systematisch-religionswissenschaftlichen Arbeitens: So sind die aus dem empirischhistorischen Material herauszuarbeitenden „Gesetzmäßigkeiten“ religiöser Phänomene nie überzeitlichen Charakters, sondern immer in Relation zu ihrem soziokulturellen Kontext zu stellen. Vgl. ebd., 13 f. 38 Vgl. ebd., 13 f. Oder mit den Worten Wachs: „Was interessiert den Historiker? Die Entwicklung, das Werden. […] Der Systematiker dagegen will Querschnitte legen, ihn interessiert nicht das Werden, sondern das Gewordene.“ Wach, Religionswissenschaft, 177. 39 Vgl. Baaren, Science of Religion, 47.
4.1 Historische und Systematische Religionswissenschaft
103
rativ-historisch ausgerichteter Disziplin überhaupt angesehen werden: „Solange die Religionsforschung allein unter individualisierendem Aspekt erfolgt, ist es nicht möglich, mehr zu leisten, als eine Aneinanderreihung von Aussagen über individuelle historische Sachverhalte. Schon eine Ordnung dieser Aussagen nach welchen Kriterien auch immer […] würde bedeuten, daß systematische Aspekte mit ins Spiel kommen.“⁴⁰ Dadurch leistet Religionsforschung unter systematischen Aspekten einen integrativen Dienst für die Identität von Religionswissenschaft an sich, da so einerseits durch die systematisierende Zusammenschau des sonst nur partikularen historisch-empirischen Materials die Aufsplittung von Religionswissenschaft in Einzeldisziplinen der Religionsforschung verhindert wird. Denn andernfalls bliebe „die Frage, […] wozu man eigentlich ein solches Wissen sammelt“,⁴¹ vermutlich unterbestimmt. Und andererseits ermöglichen die durch Systematische Religionswissenschaft erarbeiteten Begriffe und Kategorien überhaupt erst die Integration der Forschungsergebnisse anderer religionsbezogener Disziplinen in den Pool religionswissenschaftlicher Daten.⁴² Der Moment der Systematischen Religionswissenschaft agiert also klassischerweise in drei Stoßrichtungen – der Klassifizierung des empirischen Materials von Religionen, der Bildung religionswissenschaftlicher Begriffe und der religionswissenschaftlichen Theoriebildung über Religion(en).⁴³ Solches vollzieht sich einmal wie unter 4.1. beschrieben dann eben als grundlegender Moment in konkreten Forschungsprojekten. Auf der anderen Seite gestaltet sich Systematische Religionswissenschaft dann auch als dem konkreten Forschungsprozess sowohl voraus- als auch mit- und nachgehende Metatheorie der Religionswissenschaft insgesamt: Ohne vorausgehende Begriffe keine Klassifizierung von empirischen Datenmaterialien – und ohne Datenmaterial keine Bildung 40 Seiwert, Systematische Religionswissenschaft, 4. 41 Antes, Peter, Systematische Religionswissenschaft. Eine Neuorientierung, in: ZMR 2/3 70 (1986), 214 – 221, 214. „[D]amit ist die integrative Funktion der systematischen Religionswissenschaft als ein dringliches Desiderat der Stunde genannt. Die Erwartung an die Religionswissenschaft ist von daher groß. Immer mehr Einzelwissenschaften werden in Zukunft nach solch integrierenden Entwürfen Ausschau halten und viel Orientierung für die eigene Arbeit von integrativ angelegten Wissenschaften erwarten.“ Ebd., 214 f. 42 Vgl. ebd., 216. 43 Vgl. Seiwert, Systematische Religionswissenschaft, 16. Schon bei Wach können verschiedene Ebenen systematischer Religionswissenschaft vorgefunden werden, allerdings zweiteilig konzipiert als materiale und formale Religionssystematik. Erstere systematisiere dann das empirische Material einer „bestimmten Religion zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Bereich“; Letztere erarbeite über den Vergleich verschiedener Phänomene etc. in verschiedenen Religionen „eine oberste abstrakteste Klasse von religionswissenschaftlichen Begriffen“. Wach, Religionswissenschaft, 177 f. „Wohlgemerkt: es handelt sich nicht um philosophische Wesensbestimmung auf apriorischem oder deduktivem Wege, […] sondern um eine Art der Abstraktion, die wir aus allen systematischen Geisteswissenschaften kennen.“ Ebd., 178.
104
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
begrifflicher Kategorien.⁴⁴ Daraus ergibt sich implizit ihre Aufgabe als fundamentale Theorie von Religionswissenschaft überhaupt: Die kritische Reflexion auf verwendete Begriffe und Theorien hat zwingend die Auseinandersetzung mit dem Prozess der Generierung dieser Begriffe und Theorien zur Folge. In dieser zweiten Form wäre Systematische Religionswissenschaft durchaus als eigenständiges Teilgebiet denkbar:⁴⁵ Eben sowohl als kritische Revision der verwendeten Begriffe, Methoden und Theorien in ihrer religionswissenschaftlich-historischen und -systematischen Genese und Bedeutung; als auch als Metatheorie über den Prozess der das Fach konstituierenden Begriffs- und Theoriebildung, also ihre Wissenschaftsund ihre Erkenntnistheorie,⁴⁶ vielleicht sogar im Sinne einer fundamentalen Religionswissenschaft. ⁴⁷ Dabei ist allerdings wieder wichtig abschließend zu betonen, dass so verstandene Systematische Religionswissenschaft – gerade auch vor dem Hintergrund ihrer Genese – natürlich nicht den Dienst einer allgemeinen Erkenntnistheorie in Bezug auf einen (vermeintlich) allgemeinen Gegenstand der „Religion(en)“ leisten
44 „Die Arbeit der systematischen Religionswissenschaft kann auf jeder der drei Ebenen (Begriffsbildung, Klassifikation, Theoriebildung) als Hilfsdienst für die religionshistorische Forschung angesehen werden. […] Umgekehrt leistet die historische Religionsforschung gewissermaßen Hilfsdienst für die systematische Religionswissenschaft, insofern als die Ergebnisse historischer Forschung die notwendigen empirischen Daten liefern, deren die systematische Religionsforschung bedarf, will sie nicht zur Religionsspekulation ausarten.“ Seiwert, Systematische Religionswissenschaft, 16. 45 Als ein Ansatz in diesem Kontext könnte z. B. durchaus das Konzept einer diskursiven Religionswissenschaft gelten, wie sie beispielsweise Kocku von Stuckrad (Näheres zu seiner Person in Kapitel 4.2.2.) vorschlägt. Vgl. z. B. Stuckrad, Kocku von, The scientification of religion. An historical study of discursive change, 1800 – 2000, Berlin 2014, 13 f. 46 Es scheint in einzelnen Teilen der Religionswissenschaft gewisse Ressentiments gegen Erkenntnistheorie zu geben. Vgl. z. B. Schüler, Sebastian, Religion, Kognition, Evolution. Eine religionswissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Cognitive Science of Religion (Religionswissenschaft heute 9), Stuttgart 2011, 46 f. Hier ließe sich, wie auch weiter unten ausgeführt wird, ein gewisses Missverständnis von Erkenntnistheorie vermuten – bzw. gewisse intransparente ontologische Grundvorstellungen von Erkenntnisgegenständen. 47 Es ist an dieser Stelle bewusst, dass mit dieser Begrifflichkeit durchaus vorsichtig umzugehen ist. „Fundamentale Religionswissenschaft“ hat zumindest in den Ohren der Verfasserin natürlich Anklänge an „Fundamentaltheologie“, den Bereich der Theologie, der sich eben selbstreflexiv mit den wissenschaftstheoretischen Herausforderungen der Genese und aktuellen Konstitution von akademischer Theologie befasst. Vgl. dazu Kapitel 5.1.2. Mit dem Gedanken einer „fundamentalen Religionswissenschaft“ soll keineswegs aus der Sprache der Theologie heraus der Religionswissenschaft ihre subdisziplinäre Ausdifferenzierung vordekliniert werden. Vielmehr wird nur – eben in der Sprache der Fundamentaltheologin – mit dem Begriff das versucht zu beschreiben, was Systematische Religionswissenschaft als Metatheorie für das Fach der Religionswissenschaft insgesamt leisten kann und sollte.
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
105
soll und kann.⁴⁸ Solches wäre ein überzogener Anspruch, der weder dem Fach der Religionswissenschaft selbst noch anderen religionsbezogenen Wissenschaften gerecht wird. Vielmehr ist es Aufgabe eines jeden Faches – und so eben auch der Religionswissenschaft – selbst, die fachtypischen, sowohl vor- als auch innerwissenschaftlich bedingten epistemischen Voraussetzungen und Vollzüge ihrer innerfachlichen Forschungsprozesse um der intersubjektiven und dann auch interdisziplinären Überprüfbarkeit willen offenzulegen und kritisch zu reflektieren.⁴⁹
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“ Lässt sich Religionswissenschaft einerseits, wie unter Punkt 4.1. dargelegt, in zwei wechselseitig aufeinander bezogene metatheoretische Strukturmomente – ein systematisches und ein historisches – einteilen, so soll im Folgenden ein Vorschlag erfolgen, sie andererseits auf methodologisch-praxeologischer Ebene – ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Voraussetzung einer mitschwingenden inneren Hierarchie oder gar Symmetrie – in vier korrigier- und ergänzbare, exemplarische, bis heute in der fundamentaltheologischen Außenwahrnehmung den Diskurs mehr oder weniger (proaktiv positiv oder auch als Abgrenzungsfolie negativ) markierende Zugriffe zu strukturieren. Der Vorteil einer solchen Konstruktion von methodologisch-praxeologischen Zugriffen liegt dabei darin, dass quer zu klassischen innerreligionswissenschaftlichen Einteilungen in Teilgebiete, Subdisziplinen etc. auch hier nach den diskursiven Strukturmomenten gefragt wird, die im Kontext eines gesamtkulturwissenschaftlichen Paradigmas die Spezifität und Identität des multidimensionalen religionswissenschaftlichen Fachdiskurses markieren können. Der argumentative Mehrwert liegt also darin, dass damit eine Alternative zu herkömmlichen innerdisziplinären Selbstzuschreibungen geboten wird, die
48 „Wenn darunter in philosophisch kritischem Sinne Kategorien der Auffassung verstanden werden sollen, so ist […] diese Bestimmung falsch. Die Herausarbeitung und Untersuchung der erkenntnistheoretischen Begriffe gehört […] in die Philosophie (Religionsphilosophie), wo auch darüber entschieden werden muß, inwieweit es etwa eine spezifische Erkenntnistheorie der Religion, bzw. einzelner Religionen gibt, die sich von der allgemeinen unterscheidet. […] Die Untersuchung bestimmter, immer wiederkehrender Grundrichtungen des menschlichen – hier: religiösen – Denkens und Empfindens würde dahin [in die systematische Religionswissenschaft] gehören, ebenso wie die Analyse gewisser Formtypen im – religiösen – Ausdruck. […] Es handelt sich für uns um die Gewinnung einer materialen und einer formalen Religionssystematik.“ Wach, Religionswissenschaft, 176 f. 49 Zu einer ähnlichen Darlegung metatheoretischer Reflexionen als zentralem Proprium von Religionswissenschaft als eigenständiger Disziplin vgl. auch ähnlich, aber anders Führding, Diskursgemeinschaft, 66.
106
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
häufig in diskursiv schon stark segmentierten Narrativen und Polemiken verhaftet bleiben – wohingegen der kulturwissenschaftlich-metatheoretisch fokussierte Gedanke von Zugriffen eher auf inner- und interdisziplinäre wissenschaftstheoretische Brückenmomente abhebt. Die hier generierten Zugriffe stellen also in keinster Weise eine normative und/ oder vollständige Zuschreibung der innerreligionswissenschaftlichen Diskursstruktur dar, sondern sind ein proaktiv-konstruierender, fast schon spielerischer Vorschlag, den Diskurs der Religionswissenschaft bei all seiner inneren Multidimensionalität metatheoretisch zu strukturieren. Diese Zugriffe stehen dabei eben weder in einer hierarchischen Reihenfolge zueinander noch gleichberechtigt oder symmetrisch nebeneinander. Vielmehr wurde versucht, die im Gesamtkontext kulturwissenschaftlicher Entwicklungen zu verstehenden, den religionswissenschaftlichen Binnendiskurs auf die eine oder andere Art und Weise bestimmenden Zugriffe darzustellen, die die schillernde Weite des religionswissenschaftlichen Spektrums anzeigen. Solches stellt natürlich nur einen Vorschlag aus dem Blickwinkel einer (evangelischen) Fundamentaltheologin dar. So entspricht gerade auch die Titulierung der einzelnen Zugriffe nicht dem, wie Religionswissenschaft selbst sich klassischerweise subdisziplinär strukturieren würde, sondern erfolgt mit einem fundamentaltheologisch geprägten wissenschaftstheoretischen Vokabular. ⁵⁰ Die konkret vorgeschlagenen Zugriffe werden nun im Folgenden kurz vor allem aus den Darlegungen zur Fachgeschichte von Religionswissenschaft heraus argumentativ konstruiert. Entgegen einer zu Beginn ihrer Entstehung vorherrschenden Fokussierung auf „normative Hochtexte“ von solcher Art dem Christentum ähnlichen Religionen⁵¹ greift heutige Religionswissenschaft auf einen vielfältigen Fundus an Quellen zu,⁵² als da wären nicht nur Schriftzeugnisse, sondern eben auch archäologische Funde wie Plastiken, bildhafte Darstellungen, „organische Funde“⁵³ oder auch statistische und „medial-ästhetische Quellen“⁵⁴ (wie Video- oder Audioaufnahmen, Social Media etc. pp.). Um diesen Fundus unter religionswissenschaftlicher Fragestellung bear-
50 Wünschenswert wäre auch hier wieder eine Korrektur oder Ergänzung sowohl der religionswissenschaftlich-unorthodoxen Titulierung als auch der Konstruktion und Setzung insgesamt gerade aus einer innerreligionswissenschaftlichen Fachlogik selbst heraus. 51 „Die Geschichte einer Religion läßt sich dann am ehesten schreiben, wenn die Tradition dieser Religion selber unter der Kontrolle von Spezialisten liegt“. Gladigow, Burkhard, Mögliche Gegenstände und notwendige Quellen einer Religionsgeschichte, in: Beck, Heinrich (Hg.), Germanische Religionsgeschichte. Quellen und Quellenprobleme (RGA.E 5), Berlin/New York 1992, 3 – 26, 25 f. 52 Vgl. Hutter, Art. Religionsgeschichte, 319 f. 53 Ebd. 54 Ebd.
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
107
beiten zu können, nutzt Religionswissenschaft den umfangreichen geistes-, sozialund kulturwissenschaftlichen Methodenkanon ihrer verschiedensten Hilfsdisziplinen,⁵⁵ als da wären natürlich die zur Lektüre von Quelltexten nötigen Sprachwissenschaften, aber auch die Archäologie, Ethnologie, Geografie, Soziologie u. v. a.⁵⁶ Dementsprechend gehören zu einer umfassenden religionswissenschaftlichen Arbeitsweise auch „politische, soziologische, juristische, architektonische, ökonomische, ikonographische und rituelle [u. v. a., C. N.] Perspektiven;⁵⁷ eine religionshistorische Analyse [z. B.] von Opfer, Kultbild und Tempel kann für keine der Religionen, die diese Institutionen besitzen, auf die angesprochene Kombination von Perspektiven verzichten.“⁵⁸ Daraus ergeben sich nun – so der Vorschlag dieser Arbeit – vier mögliche, ein Spektrum jeweils in sich und von Religionswissenschaft insgesamt aufmachende (und eben durchaus ergänzungsbedürftige) methodologisch-praxeologische Zugriffe auf ihren Gegenstandsbereich der Religion(en), die den religionswissenschaftlichen Diskurs auf die eine oder andere Art – positiv, negativ, fachgeschichtlich, … – bestimmen: einen historisch-philologischen, einen empirisch-sozialtheroetischen, einen philosophisch-phänomenologischen und einen psychologisch-kognitionswissenschaftlichen Zugriff.⁵⁹ Mit diesen vorgeschlagenen exemplarischen Vier wird nun zwar hier einerseits, wie oben bereits angesprochen, eine aktive Setzung in fundamentaltheologisch-wissenschaftstheoretischer Außenperspektive vollzogen. Andererseits lässt sich diese Setzung – zumindest in Bezug auf die drei Erstgenannten – bereits aus der historischen Genese des Faches, wie sie im zweiten Kapitel dieser Arbeit dargelegt wurde, zumindest herleiten, in dem von drei grundsätzlichen Entstehungssträngen – einem philologisch-historischen, einem empirisch-soziologischen und einem philosophisch-psychologischen – akademischer Religionswissenschaft die Rede war. In Bezug auf den letztgenannten Entstehungsstrang wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass er sich im Laufe neuerer gesamtwissenschaftlicher Entwick-
55 „Hilfsdisziplin“ ist hier also nicht so zu verstehen, dass die verschiedenen Fächer der Religionswissenschaft unterzugliedern wären, sondern dass Religionswissenschaft auf die Ergebnisse dieser eigenständigen Disziplinen produktiv zugreift. 56 Vgl. Hock, Einführung, 28.30. 57 Der Perspektivenbegriff ist hier nicht wie in Kapitel 3 gebraucht, sondern orientiert sich an der Sprache des Verfassers des nachfolgenden Zitats. 58 Gladigow, Mögliche Gegenstände, 25. 59 Die jeweiligen Titulierungen der Zugriffe sind dabei so weit bzw. integrativ wie möglich zu verstehen. So steht z. B. hinter dem empirisch-sozialtheoretischen Zugriff ein weiter Empiriebegriff, nämlich verstanden als einer grundsätzlichen epistemisch-methodologischen Orientierung an sozusagen erfahrbaren Daten- bzw. Materialgrundlagen. Darunter ließen sich dann, so man will, klassisch qualitative oder quantitavie religionssoziologisch-empirische Arbeiten subsumieren. Diese wären dann aber eben „nur“ eine Variante dieses Zugriffs.
108
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
lungen, die natürlich auch Einfluss auf Religionswissenschaft haben, noch einmal aufsplitten lässt: Mit den neuen Deutungsansprüchen in den Neuro- und Kognitionswissenschaften ist seit einigen Jahrzehnten das Gebiet der Cognitive Science of Religion im kontinuierlichen Entstehen und Umformieren, was (nicht nur) für Religionswissenschaft veränderte methodologisch-epistemische Anforderungen an ihr Selbstverständnis als Disziplin mitbringt und deswegen durchaus gesonderter Beachtung bedarf.⁶⁰ Im Folgenden soll nun so vorgegangen werden, dass die einzelnen Zugriffe auf ihr konkretes Forschungsinteresse am Gegenstand Religion(en) und den daraus erfolgenden Implikationen für eine religionswissenschaftliche Fragestellung untersucht werden. Um dabei erstens die Spezifität der Zugriffe darstellen zu können und dabei aber gleichzeitig nicht zu sehr in bestimmte Einzeldiskurse religionswissenschaftlicher Forschung abzutauchen und zweitens trotzdem daraus noch ein Gesamtverständnis von Religionswissenschaft herausarbeiten zu können, wird dies sehr basal anhand der Analyse von Einführungsliteratur ⁶¹ in das Fach der Religionswissenschaft geschehen, indem jene auf ihr religionswissenschaftliches Tun, also ihre Forschungsabsichten und -vorhaben, ihren konkreten Gegenstandsbereich, die daraus resultierende Methode und das sich darin andeutende Theoriensystem befragt wird. Damit einher geht – bei dem Versuch der (Re‐) Konstruktion bestimmter Aspekte der oben genannten vier Zugriffe – allerdings natürlich eine gewisse Einschränkung der Datengrundlage.⁶² Außerdem werden die Einführungswerke hier eben unter innerhalb dieser Arbeit generierten Zugriffen betrachtet – was (teilweise) gegenläufig zu ihren jeweiligen innerreligionswissenschaftlichen (Selbst‐) Bezeichnungen sein dürfte. Aufgrund also von gewissen methodischen Einschränkungen ergibt sich an einigen Stellen eine für einen innerreligionswissenschaftlichen Blickwinkel sicherlich zunächst verwirrende Sonderlichkeit der konkreten
60 Vgl. hierzu besonders Schüler, Religion, 21.33. Näheres unter 4.2.4. 61 Dem voraus geht die Grundannahme, dass nirgends so explizit und v. a. selektierend fokussiert das Fachverständnis einer Disziplin in ihrer Methodologie und Praxeologie dargestellt wird, wie dies in Einführungsliteratur geschieht. „Das hat diese Art von Texten z. B. mit Stadtführungen gemeinsam: Würde man jeden einzelnen Hinterhof besuchen, würde es sich nicht mehr um eine Stadtführung handeln.“ Baumann, Peter, Erkenntnistheorie (Lehrbuch Philosophie), Stuttgart/Weimar 3 2015, 6. Die ausgewählte Literatur wird also dann nicht primär aufgrund ihrer fachlichen Güte ausgesucht, sondern unter der Maßgabe der expliziten Transparenz des jeweiligen Religionswissenschaftsverständnisses. 62 Bestimmte, den Diskurs dominierende Einführungsliteratur, wie z. B. die hier bereits zitierte Einführung in die Religionswissenschaft von Klaus Hock, fällt aufgrund der Tatsache heraus, als dass es sich hierbei durchaus auch um ein Standardwerk innerhalb der evangelischen Theologie handelt und damit die Spezifität von Religionswissenschaft gegenüber Theologie nur schwer argumentativ herleitbar wäre.
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
109
Literaturwahl bei den einzelnen Zugriffen – die nur im dezidierten, lesenden Nachvollziehen der hier vollzogenen Herangehensweise aufgelöst werden kann und die für den dahinterstehenden Ansatz auch nicht grundsätzlich problematisch ist. Vielmehr sei die These vorausgeschickt, dass sich diese Vorgehensweise natürlich auch auf andere, hier nicht beachtete, aber vielleicht ja doch noch geeignetere Einführungsliteratur anwenden ließe. Konkret begibt sich diese Arbeit im nun Folgenden also an ausgewählten Beispielen auf die Suche nach darin vorkommenden Aspekten der oben genannten vier Zugriffe. Auf keinste Weise ist damit der Versuch verbunden, die untersuchten Werke unter den jeweiligen anvisierten Zugriff zu subsumieren. Sondern es wird der Versuch unternommen, bestimmte exemplarische, ergänz- und korrigierbare Arten des Religionswissenschaft Treibens aus dafür als (explizit oder implizit) geeignet erachteten Einführungswerken in Ansätzen heraus zu konstruieren.⁶³
4.2.1 Historisch-philologisch Für das Herausarbeiten bestimmter Aspekte des historisch-philologischen Zugriffs der Religionswissenschaft bietet sich die (im Verlauf dieser Arbeit bereits zitierte) Monografie Historische Religionswissenschaft. Eine Einführung des renommierten Philologen und Religionswissenschaftlers Rüpke an, derzeitig Professor für Vergleichende Religionswissenschaft an der Philosophischen Fakultät der Universität Erfurt.⁶⁴ Direkt zu Beginn ist offen zu legen, dass es sich hierbei um kein unumstrittenes Werk handelt.⁶⁵ Explizit geschrieben als eine „‚Einführungʻ [für] Studie63 Wichtig ist dabei bereits an dieser Stelle zu betonen, dass aus den jeweiligen Beispielen von Einführungsliteratur ebenfalls immer nur bestimmte Aspekte des jeweiligen Zugriffs herausgearbeitet werden, da gerade auch die Zugriffe selbst in sich multidimensionale Spektren darstellen, wie Religionswissenschaft vollzogen werden kann. So kann z. B. der historisch-philologische Zugriff verschiedenste Ansätze umfassen, die sich auf die eine oder andere Art mehr oder weniger explizit (mindestens im Forschungshabitus) durch eine grundlegende Orientierung an historisch-kritischer Quellenarbeit auszeichnen. 64 Vgl. die Website von Prof. Dr. Jörg Rüpke an der Universität Erfurt, https://www.uni-erfurt.de/in dex.php?id=933 – 20.01.21. 65 „Dieser Titel lässt den über aktuelle Diskurse innerhalb der Religionswissenschaft informierten Leser aufhorchen, denn der Stellenwert der Religionsgeschichte innerhalb der Religionswissenschaft wird seit einigen Jahren kontrovers diskutiert.“ Wustmann, Claudia, Rüpke, Jörg. Historische Religionswissenschaft, in: H/Soz/Kult (24.10. 2008), https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/ reb-11264 – 20.01.21. Seine – bereits in Kapitel 4.1. angesprochene und im folgenden Fließtext noch einmal kurz anzureißende – Auseinandersetzung mit Wach und der Frage nach der Systematischen Religionswissenschaft wurde mehrfach diskutiert. Vgl. Stausberg, Michael, Jörg Rüpke. Historische Religionswissenschaft, in: ZRGG 2/61 (2009), 183 – 185, 185.Vgl. auch die Rezension von Rudolph, Kurt,
110
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
rende der Religionswissenschaft oder benachbarter Disziplinen, die nach Zugängen zu den Gegenständen und Fragen des Faches ‚Religionswissenschaftʻ suchen“⁶⁶, birgt das Buch schon in Titel und Vorgehensweise einige zu diskutierende Voraussetzungshaftigkeiten und Besonderheiten, die im Folgenden nun unter der Frage nach dem spezifisch religionswissenschaftlichen Forschungsimpetus untersucht werden sollen. Zur Kontextualisierung seiner Person ist in aller Kürze nur Folgendes anzumerken: Rüpke (Jahrgang 1962),⁶⁷ „der seit 1999 den seinerzeit neu geschaffenen Lehrstuhl für Vergleichende Religionswissenschaft an der Universität Erfurt innehat“⁶⁸, studierte Religionswissenschaft, Klassische Philologie (Latein) und Theologie, wobei der Fokus während seiner herausragenden Karriere dezidiert auf den beiden Ersteren lag und liegt.⁶⁹ So gilt Rüpke heute weltweit als einer der führenden Fachexperten im Bereich römisch-antiker Religion. Diese Expertise und bestimmte Faktoren seiner positionellen Bestimmtheit spiegeln sich auch in seinem hier zu analysierenden Einführungswerk wider: So dienen vor allem eben Christentum (bzw. die „abrahamitischen“ Religionen) und römisch-antike Religiosität primär als empirische Grundlage für die einzelnen methodologischen Ausführungen. Rüpke beginnt sein Einführungswerk direkt mit einer grundlegenden wissenschaftstheoretischen Bestimmung eigentlichen religionswissenschaftlichen Forschens, indem er direkt auf das zu problematisierende Selbstverständnis von Religionswissenschaft abhebt und seinen eigenen Impetus dazu schon im Vorwort offenlegt: „Die im Titel vorgenommene Einschränkung ‚Historische Religionswissenschaft‘ möchte keine Engführung des Faches anzeigen, sondern offenlegen, dass sich das Buch gerade angesichts der Aktualität von Religion zur Religionsgeschichte als zentralen Gegenstand von Religionswissenschaft bekennt und für ein Verständnis des Faches als historisch ausgerichtete Disziplin wirbt.“⁷⁰ Klar positioniert sich Rüpke hier: Eigentliche Religionswissenschaft ist immer historische Religionswissenschaft.⁷¹ Im darauf folgenden einführenden Kapitel erläutert er den Hintergrund und die Problematik seiner Position. So setzt er mit der grundlegenden Diagnose ein, dass „Geschichte“, bzw. der Fokus auf historisches Arbeiten innerhalb des Fachs der Religionswissenschaft in neuerer Zeit immer mehr in den Hinter-
Historische Religionswissenschaft. Eine Einführung, in: ThLZ 4/134 (2009), 418 – 420, 418 f. Vgl. ebenfalls die schon zitierte Rezension von Wustmann, Rüpke. 66 Rüpke, Historische Religionswissenschaft, 11. 67 Vgl. Wikipedia. Art. Jörg Rüpke, https://de.wikipedia.org/wiki/Jörg_Rüpke – 20.01.21. 68 Stausberg, Jörg Rüpke, 183. 69 Vgl. die Website von Prof. Dr. Jörg Rüpke an der Universität Erfurt. 70 Rüpke, Historische Religionswissenschaft, 12. 71 Ähnlich vgl. Stolz, Grundzüge, 194.
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
111
grund trete.⁷² Diese Entwicklung kulminierte zunächst (wenngleich sie da nicht stoppte) 2005 in der (bereits in 4.1. angesprochenen) Umbenennung der „Deutschen Vereinigung für Religionsgeschichte“ in „Deutsche Vereinigung für Religionswissenschaft“, was laut Rüpke keine rein pragmatische bzw. praxisorientierte, sondern vielmehr auch eine programmatische Entscheidung war.⁷³ So habe sich ein Verständnis von Religionswissenschaft entwickelt, das von einer deutlichen Zweiteilung des Faches ausgehe, nämlich in Historische und Systematische Religionswissenschaft,⁷⁴ die Rüpke zutreffenderweise auf die schon diskutierten Ausführungen Wachs zurückführt. Wachs Begriff von Geschichte sieht Rüpke als vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund des Historismus und der daraus resultierenden Historismuskritik zwar als einen verständlichen, aber dennoch zu engen Begriff historisch-wissenschaftlichen Arbeitens an – mit einer starken erkenntnistheoretischen Position, nämlich der Forschungsabsicht, eine überhistorische Religionssystematik durch eben die systematisierende Untersuchung des historischen Materials zu gewinnen und somit Religion als Phänomen sui generis näher zu kommen – unter Voraussetzung eben eines für sich existenten „systematischen Zusammenhanges ‚Religionʻ“.⁷⁵ Dieser – erkenntnistheoretisch geleitete – Begriff von Systematik greife laut Rüpke nicht mehr für heutige Grundlegungen des Fachs der Religionswissenschaft, da sich der Religionsbegriff innerhalb des Fachs selbst ausdifferenziert und pluralisiert hat und so seine historische Gewachsenheit und Interessengeleitetheit als methodisch-heuristischer Begriff evident geworden sei.⁷⁶ „Religion“ fungiere im Forschungsprozess nicht mehr als überhistorisches, an sich existentes Phänomen. So liege es denn auch in eben diesem historisch-gewordenen Verständnis des Religionsbegriffs begründet, über den sich Religionswissenschaft (wohl nicht exklusivistisch, aber identifikatorisch)⁷⁷ als Disziplin charakterisiert, dass das Fach in sich genuin in grundlegend historischer Perspektive arbeite bzw. arbeiten müsse. Diese Konstitution von Religionswissenschaft über ihren Gegenstand bedeute in Bezug auf eben diesen Forschungsgegenstand der Religion(en) konkret, dass –
72 Vgl. Stausberg, Jörg Rüpke, 183. 73 Vgl. Rüpke, Historische Religionswissenschaft, 15 f. 74 Vgl. Kapitel 4.1. 75 Rüpke, Historische Religionswissenschaft, 23. 76 Vgl. ebd., 26. 77 Vgl. ebd., 27. Rüpke hebt an dieser Stelle zwar darauf ab, dass „Religion“ als Gegenstandsbereich das Fach Religionswissenschaft definieren würde, macht aber direkt deutlich, dass sie sich diesen Gegenstandsbereich mit anderen Disziplinen teilt. Dementsprechend fungiert in der Logik dieser Arbeit dieses – laut Rüpke identifikatorische Spezifikum – nicht als wissenschaftstheoretisches Differenzkriterium zu anderen Disziplinen.
112
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
ohne Anwendung einer überhistorischen definitorischen Religionssystematik – als religiös eingestufte Phänomene in ihrer historisch-positiven Genese und Verfasstheit untersucht werden. Dass diese Phänomene überhaupt als religiös eingestuft werden, vollziehe sich dabei zunächst über einen heuristischen Begriff von Religion, der als Begriffsinhalt (nicht als wissenschaftliche Definition) vorwissenschaftlich phänomenologisch der Alltagssprache entnommen wird:⁷⁸ „Die Konstitution dieses Gegenstandes [Religion] erfolgt dabei immer von einem vorwissenschaftlichen, einem alltagssprachlichen Begriff her. Dieser benennt somit ein selbst standortbedingtes, ein sich auch wandelndes Interesse historischer Gesellschaften an diesem Gegenstand. In einer wissenschaftlichen Reflexion wird dieser vorwissenschaftliche Begriff natürlich problematisch, […] wird auch das Vorverständnis von ‚Religion‘ in Frage gestellt.“⁷⁹ D. h. auch historisch ausgerichtete Religionswissenschaft, wie Rüpke sie konzeptuell entwickelt, wendet – allein durch ihre Konstitution durch ein bestimmtes Interesse am Gegenstand Religion – einen über den Einzelphänomenen „schwebenden Religionsbegriff“ an; doch sei dieser eben nicht vergleichbar mit einer überhistorischen Religionssystematik, die in den Einzeldingen (den konkreten Religionen) Verwirklichungsformen des Wesens von Religion aufzeigen will. Vielmehr fungiere er eben als Suchinstrument, wodurch der Datenbereich von Religionswissenschaft erst einmal basal erschlossen werden könne. Die eigentliche Entwicklung eines wissenschaftlichen Religionsbegriffs im Sinne eines Theoriensystems oder Modells vollziehe sich dann im historischen Vergleich der Strukturen, Inhalte und Verknüpfungen konkreter Phänomene des religiösen Felds – und gestalte sich somit nicht als Begriff über den Phänomenen, sondern als eben für diese konkreten Phänomene aussagekräftiges und gleichsam an ihnen zu messendes Modell: „Wenn nicht eine vorausliegende Religionssystematik die Heuristik bestimmt, sondern an konkreten anderen Fällen gewonnene Befunde der Erforschung eines als ‚religiösʻ in den Blick genommenen Sachverhaltes dienen sollen, bezeichnet man das als ‚Vergleichʻ, der durch die Befunde im Falle B wiederum auf die Interpretation des Falles A zurückwirken kann – wie auch ein abstraktes Modell in der Anwendung auf konkrete Fälle Modifikationen erfahren kann.“⁸⁰ Durch diese Abstraktionsleistung vom konkreten Datenbefund auf ein Theoriensystem berechtige sich dann auch die Bezeichnung des Fachs als Religionswissenschaft ⁸¹ –
78 Vgl. zur wissenschaftstheoretischen Problematik dieses alltagssprachlichen Religionsbegriffs als Heuristikum der Religionswissenschaft maßgeblich Bergunder, Was ist, v. a. 7– 13. 79 Ebd. 80 Ebd. 81 Es kann konstatiert werden, dass Rüpke hier im Grunde der gleichen Argumentationskette folgt wie solche Ansätze, die das Systematische der Religionswissenschaft als das die Disziplin als Wis-
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
113
und nicht Religionsgeschichte; wenngleich dieses Fach in seiner Grundkonstitution eben immer historisch sei, da es sowohl sein Datenmaterial (die konkret-positiven Religionen) als auch seine systematisierenden Begrifflichkeiten und Theorien („Religion“ als strukturell-funktionaler Begriffsinhalt) immer nur „aus der Geschichte, auch aus der jüngsten, gewinnt. […] Eine Trennung von Religionswissenschaft und Religionsgeschichte lässt sich so weder forschungspragmatisch noch erkenntnistheoretisch rechtfertigen.“⁸² Nach dieser Grundlegung seines Fachverständnisses von Religionswissenschaft exerziert Rüpke in den folgenden drei Hauptkapiteln diesen „religionswissenschaftlichen Zugriff […] [an] unterschiedliche[n] Befunde[n]“⁸³ durch und geht dadurch im Vollzug – dem Grundgedanken von Einführungsliteratur folgend – auf grundlegende thematische Begriffe und Ankerpunkte religionswissenschaftlicher Forschung ein. Im ersten Hauptkapitel wendet Rüpke seine Herangehensweise unter der Schlagzeile „Religiöse Texte“⁸⁴ an. Religionen, deren Gegenstände wie eben bspw. Gott/Götter (hier orientiert sich Rüpke ausgehend von einem alltagssprachlichen Religionsverständnis an einem substantiellen Religionsbegriff ) empirisch nicht vorfindlich sind,⁸⁵ seien grundlegend auf Kommunikation über eben jene Gegenstände angewiesen. Diese Kommunikation vollziehe sich über verschiedenste (visuelle, sprachliche, …) Medien, von denen einige „[h]istorisch gesehen […] von besonderer Bedeutung gewesen“⁸⁶ sind. Religionsgeschichte sei dann also zunächst maßgeblich Mediengeschichte. Rüpke diagnostiziert in diesem Zusammenhang, dass sich historische Religionswissenschaft traditionell durchaus als zu einseitig „textfokussiert“ gestaltet habe, weist aber im gleichen Atemzug darauf hin, dass diese Fokussierung nicht nur einer gewissen Ignoranz gegenüber der medialen Vielfalt des Kommunikationssystems Religion geschuldet sei, sondern
senschaft überhaupt Konstituierende setzen (wie unter 4.1. schon reflektiert wurde) – nur eben von der anderen Seite her. Vgl. Seiwert, Systematische Religionswissenschaft, 2. 82 Rüpke, Historische Religionswissenschaft, 28. Hervorhebung C. N. 83 Ebd., 32. 84 Vgl. ebd., 33. 85 Eine Grundthese, die laut Rüpke nötig sei, um „religionswissenschaftliche Untersuchungen von Religionen von dem religiösen Problem freizuhalten, über die Existenz des Göttlichen zu entscheiden.“ Ebd., 35. Es muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass mit der zwar durchaus berechtigten, aber eben doch starken These, dass Gott/Götter/das Göttliche empirisch nicht vorfindlich sind, eine starke Begriffsdefinition und normative Grundsetzung religionswissenschaftlicher Forschung einhergeht. Selbst bzw. gerade der Rückzug auf empirische Nicht-Vorfindlichkeit vermeidet keine methodologisch-weltanschauliche Positionierung gegenüber dem „religiösen Problem“ (im Sinne eines methodologischen Atheismus/Agnostizismus), sondern impliziert diese direkt. Vgl. dazu auch Kapitel 5.3.2. 86 Ebd., 36.
114
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
dafür auch einige schwerwiegende forschungspragmatische Gründe angeführt werden können, wie eben die (als Entstehungsimpuls für religionswissenschaftliches Forschen überhaupt anzusehende) gute Verfügbarkeit und untersuchungstechnisch sehr gute Handhabbarkeit von Textmaterial („wie die gegenwärtige Beliebtheit von Interviews bezeugt“⁸⁷). Außerdem sei es gerade dem Einfluss der kulturwissenschaftlich orientierten Philologie zu verdanken, dass bereits zum Entstehungsbeginn der Religionswissenschaft die im Text untersuchten religiösen Phänomene immer auf ihren kontextuell-strukturellen Zusammenhang hin befragt wurden. Dementsprechend fokussiert Rüpke in seinen weiteren Ausführungen – anschließend an sein kommunikationstheoretisches Grundkonzept von Religion – auf eine „mediengeschichtlich sensibilisierte Präzisierung der Begriffe“⁸⁸ in Hinblick eben auf Art und Struktur der Medien religiöser Kommunikation. Dabei geht er zunächst auf das forschungsgeschichtlich wohl mit einflussreichste Begriffspaar der „Heiligen Schriften“ ein und untersucht grundlegend den Zusammenhang seiner forschungstechnischen Entstehung, die damit verbundenen materialen und formalen Implikationen und vor allem auch die konzeptuell damit verbundenen forschungsleitenden hermeneutisch-strukturellen Engführungen seiner Anwendung im Forschungsprozess.⁸⁹ Daran logisch anschließend setzt er sich mit den sozial-strukturellen Implikationen und vor allem kommunikationstheoretischen Potentialen von Schriftlichkeit selbst und den daraus folgenden forschungstechnischen Konsequenzen auseinander.⁹⁰ In einem dritten Schritt weitet Rüpke nun seinen Zugriff von den Medien auf die Inhalte religiöser Kommunikation aus. Stimmig zu seinen bisherigen Ausführungen, die die Medien der Repräsentation, also der Kommunikation über die empirisch nicht vorfindlichen Gegenstände von Religion (hier Gott/Götter) untersuchten, nimmt Rüpke nunmehr die Gottesvorstellungen selbst in Blick – stringent zu seinem kommunikationstheoretischen Ansatz mit speziellem Fokus auf die „sozialen Muster, die die rituelle Konstruktion von Göttern prägen.“⁹¹ Dabei stützt er sich – auch hier der Logik seiner religions-
87 Ebd., 44. 88 Ebd. 89 Vgl. ebd., 44 – 48. 90 Vgl. ebd., 48 – 52. 91 Ebd., 53. Dass Gottesvorstellungen maßgeblich sozial konstruiert werden, legt Rüpke als einen Grundaspekt eben solcher Gottesvorstellungen dar. Gottesbilder korrelierten immer mit Selbstbildern, was sich maßgeblich vor allem in philosophischer Religionskritik von Anfang an äußerte. Religionswissenschaft habe diese Grundkomponente in der Geschichte ihrer Forschung mitbedacht und ausdifferenziert. Rüpke verweist hier z. B. auf Burkhard Gladigow, seinen „Tübinger Lehrer“ (Stausberg, Jörg Rüpke, 184), laut dessen Ansatz griechisch-mythische Gottesvorstellungen Reflexionen auf soziale Macht seien. In diesem Zusammenhang weist Rüpke auch sehr deutlich auf die Gefahr des hermeneutischen Zirkels hin, der gerade in diesem Zusammenhang auch ein historisch-
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
115
wissenschaftlichen Herangehensweise folgend – auf konkretes „historisches Material“⁹² und spitzt damit zugleich den primären Aussagebereich seiner Ergebnisse auf eben jenen historischen Zusammenhang zu. Im zweiten Hauptkapitel, das unter der Überschrift „Religiöses Handeln“⁹³ verfasst ist, wendet Rüpke seine Vorgehensweise auf „den großen Bereich des Rituals“⁹⁴ an – auch hier wieder nicht als ein Phänomen, in dem sich das „Wesen“ von Religion an sich zeigt, sondern als kommunikationstheoretisch ausgerichtete Untersuchung von konkreter „Religion in bestimmten historischen Gesellschaften“.⁹⁵ Rüpke spiegelt hier in den ersten beiden Unterkapiteln zwei Ansätze, durch die er ein kontextualisiertes, methodisch-historisches Modell von Religion als Kommunikationssystem entwickelt, das für bestimmte, (kontextuell und/oder strukturell) vergleichbare Religionen als „Beschreibungsmodell“⁹⁶ dienen soll: Ausgehend von der kritischen Revision einmal der Einordbarkeit historischer Befunde und einmal der religionswissenschaftlich angewandten Begriffe selbst. Bei der ersten Vorgehensweise konzentriert er sich dabei auf die Problematik der Beschreibung antiker Religionen und erarbeitet hier unter Anwendung seines kommunikationstheoretischen Ansatzes in Verbindung mit grundlegenden Aspekten der Luhmannschen Systemtheorie ein Modell von Religion als einem gesellschaftlichen System in Kommunikation mit anderen Systemen⁹⁷ – als ein „Kommunikationsmodell […], das gewissen Spezifika antiker Religion gerecht wird und in hinreichendem Umfang Ansätze zur Erschließung und Typisierung bietet, ohne allzu komplex zu werden.“⁹⁸ Bei der zweiten Vorgehensweise untersucht Rüpke in kritischer Begriffsrevision den Zusammenhang zwischen dem Kommunikationssystem Religion und „Krieg“, den er als sozialen, zu kommunizierenden, also konstruierten Zustand⁹⁹ bzw. als eine prozesshaft charakterisierte, weil letzte „Form der Konfliktlösung“¹⁰⁰ bestimmt, um so (beispielhaft) ein Struktur-Modell zu entwickeln, das „auf konkrete historische Befunde angewandt“¹⁰¹ wird, indem er auf die verschiedenen kommu-
kontextualisierendes und methodisch konkret eingebettetes und dadurch epistemisch sauber begrenztes religionswissenschaftliches Arbeiten erfordere. Vgl. Rüpke, Historische Religionswissenschaft, 54 f. 92 Ebd., 71. Konkret: Das „Rom der späten Republik.“ Ebd. 93 Ebd. 94 Ebd., 73. 95 Ebd. 96 Ebd. 97 Vgl. v. a. ebd., 82 – 87. 98 Ebd., 82. 99 Vgl. ebd., 91. 100 Ebd., 89. 101 Ebd., 73.
116
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
nikationstheoretischen Strukturzusammenhänge eingeht, die zwischen dem System Religion und „Krieg“ bestehen können.¹⁰² Um dem im Bisherigen möglicherweise entstandenen Eindruck eines einseitig kommunikationstheoretischen Deutungsanspruchs auf religiöse Phänomene entgegenzuwirken, schiebt Rüpke an dieser Stelle – also im Kontext seiner ritualtheoretischen Ausführungen – noch einmal ein metatheoretisches Kapitel ein, in dem er zwar am konkreten Beispiel, jedoch gleichsam grundlegend auf die Problematik der Pluralität von sowohl religiösen als dann eben auch religionswissenschaftlichen Deutungsmustern eingeht. Wieder am Beispiel antiker Religiosität führt er deutlich aus, dass die Pluralität religiöser Deutungen (von Ritualen) eine religionswissenschaftliche Analyse nicht nur erschwere, sondern diese Deutungsmuster sich aufgrund eben ihrer religiösen, und damit nicht auf Richtigkeit überprüfbaren Funktion summa summarum nicht als Kriterium für eine religionswissenschaftliche Analyse insgesamt eignen.¹⁰³ Stattdessen stellt er die den Ritualen zugrundeliegenden expliziten und impliziten „syntaktischen Regeln“¹⁰⁴ als möglichen analytischen Ankerpunkt heraus, da sich über diese Regeln, deren Ausarbeitung nur über die entsprechende historische soziokulturelle Kontextualisierung erfolgen könne, schon aufgrund eben dieses zwingenden methodischen Zugriffs mehr über den Bedeutungshorizont von Ritualen aussagen ließe, als über einen semantischen Zugriff der Deutung (den er insgesamt eher im Religionsverständnis der europäischen Moderne geschuldet sieht¹⁰⁵). Dementsprechend spricht Rüpke auch hier wieder eine Warnung vor „universalen Generalisierungen überhaupt […] [und ein] Plädoyer für Modelle und Verallgemeinerungen mittlerer Reichweite, für den kontrollierten Vergleich“¹⁰⁶ aus. Daran logisch anschließend folgt eine ebenso warnende Kritik vor der unreflektierten Übernahme forschungstraditioneller Theorien und Begriffe, deren Tradierung eben unter Umständen auf die unreflektierte Anwendung von (religiösen, polemischen, …) Deutungsmustern als Analysestrategien zurückgeführt werden könne.¹⁰⁷ In diesen grundlegenden Warnungen und Aufforderungen zu historisch-soziokulturell kontextualiserten Analysestrategien lag dann auch aller Wahrscheinlichkeit nach die Funktion dieses metatheoretischen Einschubs.
102 103 104 105 106 107
Vgl. ebd., 92 – 96. Vgl. ebd., 99. Ebd. Vgl. ebd., 104. Ebd., 106. Vgl. ebd., 107.116 ff.
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
117
Im seinem dritten Hauptkapitel wendet Rüpke seinen spezifischen religionswissenschaftlichen Zugriff auf „Religiöse Organisationen“¹⁰⁸ an: „[M]it Hilfe eines soziologisch orientierten Gruppenbegriffs“¹⁰⁹ versucht er, die „Grundstrukturen in der Ausbildung religiöser Organisationen zu erfassen“¹¹⁰ und so den religionswissenschaftlichen terminus technicus der „organisierten Religion“ zu schärfen. Auch hier wird Religion als soziales Konzept maßgeblich über seinen kommunikationstheoretischen Zugriff analysiert, wobei Rüpke dabei sehr deutlich die (weiter oben erwähnte) mittlere Reichweite und dementsprechend notwendige historisch-soziokulturelle Kontextualisierung auch dieses Vorgehens herausstellt: „Auch eine soziologisch inspirierte Gruppenanalyse erschließt nur einen Teil religiöser Wirklichkeit.“¹¹¹ Daran schließen sich wieder kritische Revisionen fachtradierter religionswissenschaftlicher (häufig zumindest dem Anschein nach unterreflektiert transkulturell angewandter) Begrifflichkeiten¹¹² an – der inhaltlichen Logik des dritten Hauptkapitels folgend bezogen auf „religiöse Spezialisten“ –,¹¹³ um auch hier seiner Herangehensweise folgend ausgehend vom Befund ein Modell (mittlerer Reichweite) für innerreligiöse Spezialisierungen zu entwickeln. Der inhaltlich-thematischen Vollständigkeit halber folgt darauf noch die Anwendung seiner Vorgehensweise auf „zeitliche Strukturen religiöser Aktivitäten“¹¹⁴ – auch hier wieder als eine Analyse sozialer Strukturen von bspw. Kalendern etc. Rüpke geht hier dezidiert religionssoziologisch vor, indem er u. a. aktuelle Entwicklungen zeitlicher Strukturen im Christentum in der BRD untersucht – und widerspricht damit in seiner Logik keinesfalls seinem spezifisch historisch orientierten Ansatz, denn „[h]istorische Religionswissenschaft muss nicht nur nach hinten schauen.“¹¹⁵ An diese drei thematischen Hauptkapitel schließt sich ein viertes an, das in seiner argumentativen Absicht aus der Logik der vorherigen drei herauszufallen scheint: Unter dem Punkt „Religions-Wissenschaft“¹¹⁶ geht Rüpke auf die grundle-
108 Ebd., 119. 109 Ebd., 121. 110 Ebd. 111 Ebd., 127. 112 Rüpke setzt hier zunächst mit einer Kritik von maßgeblich von (Schleiermacher und) Wach herkommender Typologie religiöser Spezialisierungen an, deren Problematik laut Rüpke darin liegt, dass sie nicht an strukturellen (also syntaktisch-verknüpfenden?) Merkmalen religiöser Spezialist*innen festgemacht ist, sondern an der (semantisch-deutenden?) Kategorisierung anhand vermeintlicher „Intensivierung des religiösen Grunderlebnisses“ der religiösen Person. Ebd., 130. 113 Ebd., 128. 114 Ebd., 138. 115 Ebd., 149. Gerade an dieser Stelle zeigt sich eindrücklich Rüpkes Auffassung von „historisch“. 116 Ebd., 151.
118
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
gend problematische Geschichte der Konstellation (bis hin zur „Frontstellung“¹¹⁷) von Wissenschaft und Religion ein. Anders als bei seinen bisherigen Ausführungen geht er dabei an dieser Stelle diachron (beginnend im Grunde bei der Religionskritik antiker Philosophen bis hin zur Jetztzeit) vor und analysiert das (strukturell) wechselseitige Verhältnis von Religion(en), Wissenschaft und Religionskritik. Interessant ist an dieser Stelle, dass er dabei in einer knappen (also nicht weiter ausgeführten) Verhältnisbestimmung von Religionswissenschaft und Theologie endet, deren parallele Existenz im heutigen Wissenschaftsraum deutlicher Indikator dafür sein könne, wie kompliziert das Verhältnis von Wissenschaft und Religion(en) sei:¹¹⁸ So werde Theologie der „Innenperspektive“ zugeordnet, während Religionswissenschaft „scheinbar historisch-neutral Religion […] untersucht.“¹¹⁹ Damit unterstützt Rüpke also eine Zuordnung von Theologie in den Bereich des Systems der Religion;¹²⁰ allerdings macht er in diesem Zusammenhang ebenso deutlich, dass auch Religionswissenschaft keine neutrale Außenperspektive auf Religion(en) einnimmt, sondern diese gleichsam als Akteurin im religiösen Feld mit produziert: „Religionswissenschaft ist Teil moderner Religionsgeschichte.“¹²¹ Damit positioniert er sich hier deutlich gegen eine antonyme Zuordnung von Religion und Wissenschaft und resümiert – noch einmal in einem letzten Rückgriff auf Luhmann – beide als „sinnproduzierende Systeme, die mal konkurrierende, mal sich ergänzende Ansprüche erheben.“¹²² In seinen letzten zwei Sätzen macht Rüpke dadurch auch den metatheoretischen Anspruch bzw. das Interesse von Wissenschaft insgesamt deutlich: Es sei „eine gesellschaftliche Aufgabe, den Einzelnen zu befähigen, […] mit plural-konkurrierenden Sinnsystemen umgehen zu können. Wissenschaften wie Religionen treten im Plural auf. Niemand hält das besser präsent als eine historisch orientierte Religionswissenschaft.“¹²³ 4.2.1.1 Zwischenbilanz Nach dieser kurzen Analyse von Rüpkes Einführungswerk bietet es sich nun an, mit dem Fokus des im dritten Kapitel dieser Arbeit erarbeiteten Differenzkriteriums der Fragestellung eine Zwischenbilanz durchzuführen und Rüpkes Historische Religionswissenschaft durch das Herausarbeiten bestimmter Aspekte des historisch-
117 118 119 120 121 122 123
Ebd., 153. Vgl. ebd., 160 f. Ebd., 160. Vgl. zu einer Gegenargumentation Kapitel 3.1. Ebd., 161. Ebd. Ebd., 162.
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
119
philologischen religionswissenschaftlichen Zugriffes auf eine für eben diesen methodologisch-praxeologischen Zugriff passende Fragestellung hin zu systematisieren. Zunächst ist Rüpkes grundlegend-positionelles Forschungsinteresse an v. a. christlichen und antik-römischen Religionen in seiner gesamten Monografie deutlich, bieten diese doch immer wieder das Datenmaterial, anhand dessen er sein Konzept von explizit historisch arbeitender Religionswissenschaft durchexerziert.¹²⁴ Dieses maßgebliche Forschungsinteresse spitzt sich im Zuge seiner Darlegungen zu und wird v. a. durch seine methodischen Herangehensweise an „Religion“ deutlich. So fungiert „Religion“ bei Rüpke nicht als überhistorisches Phänomen, das sich in konkret-historischen Religionen manifestiert, sondern zunächst vielmehr als methodisch-heuristischer Begriffsinhalt. Ausgehend von einem ersten (dann zwingend alltagssprachlich und fachtraditionell geprägten) Begriff von Religion werden historische Religionen in ihrer (hier v. a. soziologisch-kommunikationstheoretischen) Struktur untersucht, um daraus ein Theoriensystem zu entwickeln, mit dem dann andere – historisch-kontextuell vergleichbare – religiöse Phänomene verglichen werden. Zentral ist also die bedingte Reichweite der so entwickelten Religionssystematik:¹²⁵ Es geht um den kontrolliert-kontextualisierten historischen Vergleich. In dieser Theorien bildenden Abstraktionsleistung liegt dann für Rüpke auch der wissenschaftliche Anspruch von Religionswissenschaft begründet. Die Fragestellung einer historisch-philologisch agierenden Religionswissenschaft könnte also auf Grundlage dieser Ausführungen so formuliert werden: Religionswissenschaft im historisch-philologischen Zugriff untersucht historisch kontextualisiert die Befunde konkreter historisch vorfindlicher Religionen daraufhin, ob sich an ihnen Merkmale/Strukturen/Typologien etc. generieren lassen, anhand derer die Befunde anderer historisch ähnlich kontextualisierbarer vorfindlicher Religionen verglichen werden können.
4.2.2 Empirisch-sozialtheoretisch Als nächstes wird die 2003 erschienene Einführung in die Religionswissenschaft ¹²⁶ von Hans Kippenberg und von Stuckrad daraufhin untersucht, inwiefern in ihr Aspekte eines empirisch-sozialtheoretischen religionswissenschaftlichen Zugriffes
124 Was an dieser Stelle nicht als ethnozentrische oder anderweitige Engführung verstanden werden sollte, sondern stringent scheint mit seiner Forschungslogik. 125 Die für Rüpke in einem deutlichen Widerspruch zu dem steht, was bspw. Wach unter Systematischer Religionswissenschaft verstand. 126 Kippenberg, Hans G./Stuckrad, Kocku von, Einführung in die Religionswissenschaft. Gegenstände und Begriffe (C. H. Beck Studium), München 2003.
120
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
herausgearbeitet werden können. Kippenberg, mittlerweile emeritiert, gilt als einer der berühmtesten Religionswissenschaftler der neuesten Zeit, was nicht nur, aber doch maßgeblich seinen soziologisch-kulturwissenschaftlich ausgerichteten Analysen zum potentiell inhärenten Zusammenhang von Religionen und Gewalt geschuldet sein mag.¹²⁷ Kippenberg studierte Theologie, semitische Sprachen und vergleichende Religionswissenschaft¹²⁸ und promovierte zunächst innerhalb der Theologie,¹²⁹ bevor er sich dann im Laufe seiner internationalen Karriere zunehmend auf Forschung im Bereich historischer und vergleichender Religionswissenschaft fokussierte.¹³⁰ Maßgeblich war und ist bei seiner Arbeit dabei ein religionssoziologischer Zugriff, der sich sowohl in seiner akademischen Laufbahn als auch zum Teil in seinen fachlichen Publikationen widerspiegelt.¹³¹ Von Stuckrad gilt als einer der Schüler*innen Kippenbergs, wenngleich er sich in seinen Forschungspräferenzen und seinem Fachverständnis im Verlauf seiner Wissenschaftskarriere deutlich in andere Richtungen entwickelt hat.¹³² Von Stuckrad ist Professor für Religionswissenschaft an der Fakultät für Theology and Religious Studies der Universität Groningen.¹³³ Seine weit gefächerten Forschungsinteressen erstrecken sich von historischen bis hin zu vor allem erkenntnistheoretischen
127 Vgl. dazu die Monografie Kippenberg, Hans G., Gewalt als Gottesdienst. Religionskriege im Zeitalter der Globalisierung, München 2008.Vgl. z. B. auch Speckmann, Thomas, Fundamentalisten – Verteufeln bringt nichts, in: Welt (27.01. 2008), https://www.welt.de/kultur/article1593488/Fundamen talisten-Verteufeln-bringt-nichts.html – 21.02.21. 128 Vgl. die Website von Prof. Dr. Hans G. Kippenberg, http://hans-kippenberg.com/ – 21.01.21. 129 Vgl. die Monografie Kippenberg, Hans G., Garizim und Synagoge. Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zur samaritanischen Religion der aramäischen Periode (RVV 30), Berlin/New York 1971. 130 Vgl. die Website von Prof. Dr. Hans G. Kippenberg. 131 Bspw. die Beschäftigung mit Weber zieht sich durch Kippenbergs gesamte Karriere. Als Beispiel sei seine Herausgeberschaft des Teilbandes I/22 – 2 der MWG genannt. Vgl. die Website der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Max Weber-Gesamtausgabe, https://mwg.badw.de/beteiligte. html – 21.01.21. Auch im hier behandelten Einführungswerk zur Religionswissenschaft wird immer wieder auf Weber rekurriert. Dazu jedoch in den folgenden Ausführungen mehr. Grundsätzlich zeigt sich der religionssoziologische Zugriff Kippenbergs in der Auflistung seiner Forschungsgebiete auf seiner Homepage. Vgl. die Website von Prof. Dr. Hans G. Kippenberg. 132 Heute dürfte von Stuckrad wohl weniger als markanter Vertreter einer empirisch-sozialtheoretischen Religionswissenschaft gelten, sondern vielmehr im Kontext der – in diesem Werk durchaus ja auch schon teilweise mitschwingenden – Programmatik einer diskursiven Religionswissenschaft bekannt sein. 133 Vgl. die Website von Prof. Dr. Kocku von Stuckrad an der University of Groningen, http://www. rug.nl/staff/c.k.m.von.stuckrad/ – 21.01.21.
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
121
Fragestellungen, wobei u. a. ein Fokus auf kulturwissenschaftliche Analysen markant ist.¹³⁴ Dementsprechend ist an dieser Stelle nun kurz auf den spezifischen soziologisch fokussierten Kulturbegriff zu referieren, den das hier untersuchte Einführungswerk zu vertreten scheint,¹³⁵ um damit gleichsam deutlich zu machen, inwiefern hier Aspekte eines empirisch-sozialtheoretischen Zugriffs neuerer Religionswissenschaft herausgearbeitet werden können. Grundlegend deutlich ist zunächst, dass Kippenberg und von Stuckrad ihren Kulturbegriff logischerweise maßgeblich im Zusammenhang ihrer Gegenstandsbestimmung von Religionswissenschaft explizieren, indem sie Religion(en) als Teilsystem von Kultur kennzeichnen.¹³⁶ Dabei ist augenfällig, dass Religion(en) als „Akte der Erzeugung von Gewissheit und Sinn“¹³⁷ gleichsam als etwas Soziales, Gemeinschaftliches, mithin Öffentliches in den Fokus gerückt werden, als „ein Instrument der gemeinschaftlichen Selbstverortung.“¹³⁸ Hinter letzterem, der gemeinschaftlichen Selbstverortung, scheint sich demnach auch schon der Kulturbegriff zu verbergen.¹³⁹ Die dementsprechende Fokussierung auf Religion als „Teil einer öffentlichen [im Sinne einer sozial kommunizierten] Kultur“¹⁴⁰ spiegelt gleichzeitig eine methodologische Grundlegung von Religionswissenschaft wider: Entgegen der (in Deutschland vermeintlich dominanten) Position, Religion(en) müssten aus der „Innenperspektive“¹⁴¹ heraus betrachtet werden, betonen die Autoren im Rahmen ihrer Einleitung,
134 Vgl. ebd. So wird er auf der Website der Universität auch als einer der in verschiedenen Disziplinen arbeitenden Forschenden im Bereich „Cultural Studies“ aufgeführt. Vgl. die Website der University of Groningen. Staff Members with Discipline Cultural Studies, http://www.rug.nl/about-us/ how-to-find-us/find-an-expert?discipline=Cultural+Studies – 21.01.21. 135 Dabei wird – durchaus (problem‐) bewusst – Eisegese betrieben, da der Kulturbegriff der Autoren selbst nicht Thema des Einführungswerks ist. Es wird also der Versuch unternommen, anhand der Ausführungen Kippenbergs und von Stuckrads einen metatheoretischen Begriff von Kultur zu extrahieren. 136 Schon in diesen systemtheoretischen bis strukturfunktionalistischen Anklängen zeigt sich eine spezifisch sozialtheoretische Fokussierung von Religionswissenschaft, die eben durchaus nicht untypisch für einen spezifischen Zugriff von Religionswissenschaft ist. Vgl. dazu ähnlich z. B. Gladigow, Burkhard, Religion in der Kultur – Kultur in der Religion, in: Jaeger, Friedrich/Liebsch, Burkhard (Hg.), Grundlagen und Schlüsselbegriffe (Handbuch der Kulturwissenschaften 1), Stuttgart 2011, 21 – 33, 21. 137 Kippenberg/Stuckrad, Einführung, 14. 138 Ebd., 7. 139 In diesem Kontext ist man auch an Webers Ausführungen zum Kulturbegriff erinnert: „‚Kulturʻ ist ein vom Standpunkt des Menschen aus mit Sinn und Bedeutung bedachter endlicher Ausschnitt aus der sinnlosen Unendlichkeit des Weltgeschehens.“ Weber, Die „Objektivität“, 180. 140 Kippenberg/Stuckrad, Einführung, 7. 141 Ebd., 11.
122
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
dass „Glaubensanschauungen und Handlungen nicht isoliert von der öffentlichen Kommunikation über sie Gegenstand der Religionswissenschaft werden können.“¹⁴² Religionswissenschaft sei dann Beschreibung des Diskurses um und über Religionen als kulturellen Phänomenen. ¹⁴³ Zentral scheint also für die wissenschaftstheoretische Verortung von Religionswissenschaft zu sein, dass sie Religion(en) im Zusammenhang „öffentlicher“ Gesellschaft untersuche. Die Autoren knüpfen hierbei explizit an Clifford Geertz und dessen Weber-Rezeption (v. a. dessen handlungstheoretischen Modells) an, indem Religionen als „kulturelle Symbolsysteme“¹⁴⁴ als Forschungsgegenstand gezeichnet werden: Es gehe also um Religionen als soziale bzw. soziokulturelle Systeme, in denen Menschen weltanschaulich bedingt durch Kommunikation und Handeln gemeinschaftlich-öffentlich Wirklichkeit – und damit auch sich selbst – ordnen und sinnhaft deuten. Damit ist dann auch die heuristische Stoßrichtung des Werkes umrissen: Da die Innenperspektive von Religion(en) nicht Orientierung für Religionswissenschaft sei und es „für Religion keine Evidenz an sich gibt“,¹⁴⁵ könne der Untersuchungsgegenstand von Religionswissenschaft nicht in einer normierenden Auseinandersetzung mit den (Glaubens‐) Inhalten von Religionen zu finden sein. Sondern Religionswissenschaft habe dann als empirische Datenbasis die Handlungen (im weitesten Sinne) der Gläubigen zum Gegenstand und untersuche diskurs-metatheoretisch, in welchem Verhältnis Weltanschauungen (also hier subsumiert auch Religionen) und jene Handlungen zueinander stehen. Es geht den Autoren dabei explizit nicht darum, herkömmliche Rivalitäten zwischen reduktionistisch religionsphänomenologischen und religionssoziologischen „Paradigmen“¹⁴⁶ zu bespielen, deren Differenz v. a. eben in der Religionstheorie (substantielle Definitionen von „Religion [als Phänomen sui generis] als eine Transzendenzerfahrung“ versus religionssoziologisch-funktionale Religions-definitionen¹⁴⁷), der darin impliziten Ontologie und daraus resultierenden Methode läge.¹⁴⁸ Sondern vielmehr soll mit einem Fokus auf soziokulturelle Analysen (im oben beschriebenen Sinne) „das Postulat einer Vielfalt der Perspektiven“¹⁴⁹ beworben werden, ohne sich dabei einer erkenntnistheoretischen Beliebigkeit hinzugeben: Nämlich unter dem Leitgedanken, dass Religionen bzw. Weltanschauungen als soziokulturelle (Kommunikations‐)
142 143 144 145 146 147 148 149
Ebd. Vgl. ebd., 14. Ebd., 33. Ebd., 34. Ebd., 30. Ebd., 92. Vgl. ebd. Ebd.
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
123
Systeme Handlungen freisetzen, so soziale Wirklichkeit formen und gleichzeitig von diesen Handlungen und der so evozierten Wirklichkeit geformt werden. Dementsprechend vollziehe sich Religionswissenschaft – als Kulturwissenschaft – selbst in (Reflexion) soziokultureller Positionalität. Der hier vorgestellte Ansatz von Religionswissenschaft kennzeichnet sich zusammengefasst also stark dadurch, dass kulturelle Phänomene vor allem in ihrer (kommuniziert) öffentlich-gesellschaftlichen Dimension untersucht werden. Damit bewegt sich das Einführungswerk in einem spezifischen kulturwissenschaftlichen Zugriff auf Religion, nämlich in einer starken Fokussierung auf soziologische Herangehensweisen, die allerdings sowohl zur Fachtradition der Kulturwissenschaften passen als auch repräsentativ für innerreligionswissenschaftliche Fachdiskurse sind.¹⁵⁰ Beides scheint mit Blick auf die Wissenschaftsgeschichte herleitbar zu sein: So entstand das Verständnis für Kulturwissenschaften maßgeblich im Kontext der Soziologie bzw. wurde bekanntermaßen lange nicht zwischen Kultur- und Sozialwissenschaft differenziert¹⁵¹ – Weber selbst z. B. nannte als „Objekt“ der Sozialwissenschaft(en) „menschliche Kulturinstitutionen und Kulturvorgänge“.¹⁵² Und innerhalb der Religionswissenschaft gilt der Cultural Turn der 1960/70er Jahren als retrospektives Indiz für eine Ablösung von bis dato dominanten religionsphänomenologischen und/oder theologischen Zugriffen auf Religion(en)¹⁵³ – was sich wohl bündig an die oben beschriebene Argumentation von Kippenberg und von Stuckrad anschließen lässt, die ihren empirisch-sozialtheoretischen Zugriff unabhängig der religiösen Innenperspektive der Gläubigen ¹⁵⁴ als Gegenentwurf zu einer in Deutschland vermeintlich dominanten religionsphänomenologischen Strömung darstellen. Aus dem Aufbau bzw. der Vorgehensweise des Einführungswerks lassen sich entsprechend der eben angerissenen Herangehensweise Aspekte eines empirischsozialtheoretischen Zugriffs innerhalb von Religionswissenschaft herausarbeiten.
150 So werden in einschlägigen Methodikwerken der Religionswissenschaft sozialwissenschaftliche Methoden unter kulturwissenschaftlichen Herangehensweisen subsumiert. Vgl. z. B. Lehmann, Karsten/Kurth, Stefan, Kulturwissenschaftliche Methoden in der Religionswissenschaft, in: Dies., Religionen erforschen. Kulturwissenschaftliche Methoden in der Religionswissenschaft, Wiesbaden 2011, 7– 19, 7. 151 Vgl. Friese, Heidrun, Cultural Studies. Forschungsfelder und Begriffe, in: Jaeger, Friedrich/ Straub, Jürgen (Hg.), Paradigmen und Disziplinen (Handbuch der Kulturwissenschaften 2), Stuttgart/ Weimar 2011, 467– 485, 467 f. 152 Weber, Die Objektivität, 148. Vgl. dazu auch ebd., 170. 153 Vgl. Lehmann/Kurth, Kulturwissenschaftliche Methoden, 11 f. 154 Hierin scheint ein Hinweis auf den dahinterstehenden Theologiebegriff der beiden Autoren zu liegen. Theologie scheint sich dann eben durch das Differenzkriterium der Innenperspektive zu kennzeichnen.
124
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
Nach der Einleitung (Kapitel I), in der die Disziplin Religionswissenschaft zunächst grundlegend im – oben angedeuteten – kulturwissenschaftlichen Kanon verankert wird, und einer u. a. kulturgeschichtlich fokussierten Beschreibung der Disziplinengeschichte (Kapitel II), die in einem Abriss von Impulsen der Aufklärung bis hin zu symboltheoretischen Religionskonzeptionen (Geertz) die schon in der Fachgeschichte ersichtliche immanent interdisziplinäre Ausrichtung des Fachs verdeutlichen soll, folgt im III. Kapitel die Darlegung der eben beschriebenen „theoretischen Perspektiven“¹⁵⁵, in dem – wie oben aufgezeigt – der Religionsbegriff als Gegenstandsbereich des Faches durchleuchtet wird: Unter Reflexion der verschiedenen sowohl soziokulturellen als auch wissenschaftstheoretischen positionellen Abhängigkeiten bzw. Problematiken¹⁵⁶, in denen sich religionswissenschaftliche Begriffsbildung vollzog und vollzieht, wird so gleichsam anhand konkreter Beispiele aus der Religionsgeschichte der empirisch-sozialtheoretische Zugriff auf Religion(en) vollzogen. Dabei liegt in der sozialtheoretischen Untermauerung bspw. ein expliziter Fokus auf der Kombination von handlungstheoretischen Modellen (in Anschluss an Weber) und (v. a.) funktionalen Religionsdefinitionen (in Anschluss an z. B. Durkheim, aber auch wieder Weber),¹⁵⁷ methodologisch passend zum soziologisch-kommunikationstheoretischen Religionsbegriff verbunden mit diskurstheoretischen Analysestrategien im Feld der Religion(en).¹⁵⁸ Solches wird an unterschiedlichen religionswissenschaftlichen Themenbereichen deutlich gemacht, so z. B. in Auseinandersetzung mit dem das Fach prägenden Spannungsfeld verschiedener Rationalitäten (wissenschaftlicher versus religiöser Aussagesysteme),¹⁵⁹ aber auch bspw. in der Analyse gendertheoretischer Fragestellungen: Als roter Erklärungsfaden zieht sich immer wieder die Frage nach den kulturell-sozialen (und daraus resultierenden kommunikationstheoretischen) Strukturen durch,¹⁶⁰ um so quasi monokausalen bzw. positionell-zentristischen inhaltlichen Erklärungsengen zu entgehen: „Mit der Anerkennung einer Vielzahl von Perspektiven und der Beschreibung ihres jeweiligen kulturellen Ortes geht keineswegs eine Beliebigkeit der
155 Kippenberg/Stuckrad, Einführung, 37. 156 So wird z. B. sowohl auf die Intentionalität von Religionsdefinitionen insgesamt hingewiesen, als auch – z. B. anhand des Kolonialismus – auf die Probleme, die aus der Kultur- und Disziplinengeschichte erwachsen. Als Reaktion auf diese Problematiken wird methodologisch eine kommunikations- und diskurstheoretische Herangehensweise starkgemacht, um so einen differenzierteren Zugang zum Gegenstandsbereich von Religionswissenschaft zu ermöglichen. Vgl. ebd., 38.59 ff.68 ff. 157 Vgl. ebd., 48 – 52. 158 Vgl. ebd., 68 f. 159 Vgl. ebd., 70 f. 160 Vgl. z. B. ebd., 83.
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
125
Standpunkte einher, wohl aber eine gewisse Bescheidenheit der Religionswissenschaft, da sie ihre Beschreibungen und Erklärungen nur als vorläufig betrachtet.“¹⁶¹ Im nächsten großen Kapitel IV lassen sich weitere empirisch-sozialtheoretische methodologisch-praxeologische Aspekte konstruieren: hier mit besonderem Fokus auf die Rolle von Religion(en) in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit; verbunden mit der Aussage, dass – entgegen aktueller Säkularisierungstheorien (bzw. entgegen bestimmter Interpretationsmuster derselben) – „auch noch der vergesellschaftete Mensch der Moderne in die Religionsgeschichte verstrickt ist“.¹⁶² Anhand von Themenbereichen rund um Zivilreligion, das Verhältnis von Religion(en) und Recht, die religiöse Legitimation und Konstruktion von Räumen (im weitesten Sinne) und das Verhältnis pluraler Religionen zueinander werden die unterschiedlichen „öffentlichen Arenen“¹⁶³, in denen Religionen spielen, durchleuchtet: „Religion¹⁶⁴ [geht] nicht nur in politische Diskurse ein, sondern kann das gesamte öffentliche Zeichensystem mitprägen, von der Architektur bis zu modernen Massenmedien.“¹⁶⁵ Unter Rekurs auf religionssoziologische Klassiker wie Luhmann, Bellah u. a. besteht auch hier wieder die Argumentationslinie darin, Inhalt und (gesellschaftliche) Relevanz religiöser Kommunikation an den soziokulturell bedingten Strukturen, in denen sie sich vollzieht, (in einem wohl mehrdimensional-wechselseitigen Verhältnis zueinander) festzumachen. Die Aufgabe von Religionswissenschaft sei es dann logischerweise, diese diskursiven Prozesse zu analysieren und dementsprechend in ihrer soziokulturellen Bedeutung, Tragweite etc. zu untersuchen (anstatt auf vermeintlich normierende Urteile über die etwaige formale und/oder materiale Angemessenheit religiöser Kommunikation abzuheben):¹⁶⁶ „Da religiöse Überzeu161 Ebd., 92 f. 162 Ebd., 135. Das Buch ist 2003 erschienen und steht also wahrscheinlich im Kontext des Diskurses um eine mögliche „Wiederkehr“ der Religionen, der sich – u. a. in Reaktion auf 9/11 – entgegen bis dato vermeintlich unwiderlegbarer Säkularisierungstheorien entwickelte. Vgl. ebd., 126. Dementsprechend wird dieser Problematik auch ein eigenes Unterkapitel gewidmet: Unter der Schlagzeile „Pluralismus: Europäische Religionsgeschichte“ wird umfassend die konstante Bedeutung verschiedener religiöser Traditionen in der westlich-europäischen Geistesgeschichte referiert, um sich mit der These vom „Pluralismus als Normalfall in Europa“ gegen vermeintlich überstrapazierte Säkularisierungstheorien zu positionieren. Ebd., 126.131. 163 Ebd., 94. 164 An dieser Stelle scheint die Wortwahl markant: Von „Religion“ im Singular so zu schreiben, als ob es ein allgemeines Phänomen wäre, dass in unterschiedlichen „öffentlichen Arenen“ agiert, wirkt inkonsistent zu einem soziokulturell differenzierten Zugriff auf Religionen, wie ihn die Autoren hier sonst vertreten. 165 Ebd., 95. 166 Vgl. ebd., 124. Hier am Beispiel des „mapping“: Ein Urteil über die Angemessenheit der Titulierung eines Gebiets als „heilig“ könne sich Religionswissenschaft nur in sozial-struktureller Hinsicht erlauben – ob Orte „tatsächlich“ heilig sind, falle nicht in den Urteilsbereich einer so ver-
126
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
gungen erst dann wissenschaftlich erkennbar werden, wenn sie geäußert und in Handlungen kommuniziert werden, geht es der Religionswissenschaft nicht um den inneren ‚Glaubenʻ, sondern um die öffentliche Organisation von Glaubensaussagen und die kulturelle Manifestation religiöser Traditionen.“¹⁶⁷ Im letzten materialen¹⁶⁸ Kapitel V wird unter dem Stichwort „Gemeinschaftshandeln“¹⁶⁹ noch einmal differenzierter auf die verschiedenen Sozialformen, in denen sich Religionen manifestieren können, referiert. Ausgehend von individualisierungstheoretischen Religionskonzeptionen¹⁷⁰ wird auf die gestiegene Autonomie des Individuums zur religiösen Identitätsbildung eingegangen, um gleichsam auf die sowohl individuellen als auch soziokulturellen Gegebenheiten und Diskurse hinzuweisen, in denen solche Identitätsbildung von statten geht.¹⁷¹ Dementsprechend sind es gerade die diversen kollektiven Sozialformen der Moderne, die hier in den Blick geraten: Entgegen einseitiger Privatisierungstheorien über Religion(en)/ Religiosität verdeutlichen die Autoren hier, dass soziale Strukturen sich auf unterschiedlichste (dynamische) Weisen ausbilden können. Die Rede von religiöser Gemeinschaft sei demnach nicht abhängig von klassischen institutionellen Formen (wie eben z. B. Kirchen), sondern sei weiter differenziert auf verschiedene gruppendynamische Prozesse zu beziehen. Soziale Gemeinschaften entstehen über Kommunikation (auch hier wieder soziologisch verstanden im weitesten Sinne).¹⁷² Als Beispiele für die Bildung solcher Gruppenidentitäten dienen den Autoren hier Konzepte von „Magie“¹⁷³ und Apokalyptik¹⁷⁴; aber auch – und dies scheint dem oben
standenen Wissenschaft. Dass solches bis dato dennoch nicht genügend Aufmerksamkeit innerhalb der Religionswissenschaft bekommen habe, läge an einer vermeintlichen „Vorherrschaft einer theologisch oder phänomenologisch [Hervorhebung C. N., man beachte die im Grunde synonyme Verwendung dieser Bezeichnungen] ausgerichteten Religionswissenschaft, die Heiligkeit mit Epiphanien des Göttlichen in Zusammenhang bringt“. Ebd., 115. 167 Ebd., 135. Metatheoretisch religionswissenschaftlich interessant ist hier die Wortwahl „Glaube“, die eventuell auf den theologischen Fachhintergrund Kippenbergs hinweisen könnte. 168 In den anschließenden Kapiteln VI bis IX werden – der Logik eines Einführungswerks gerecht werdend – sinnvolle „technische“ Informationen gegeben, wie bspw. eine Auflistung der wichtigsten Nachschlagewerke. Vgl. das Inhaltsverzeichnis ebd., 6. 169 Ebd., 136. 170 Vgl. ebd., 136 f. 171 Vgl. ebd., 139 – 146. Hier v. a. am Beispiel von Konversionen. 172 Vgl. ebd., 156. 173 Vgl. ebd., z. B. 155 f. Gerade am Beispiel von „Magie“ wird wieder auf die Bedeutung des Bezugs zur „Öffentlichkeit“ als kriteriologischem Merkmal abgehoben. Vgl. ebd., 159. 174 Vgl. ebd., 164 – 172. Interessant ist hier vielleicht, dass apokalyptische Erzählmuster in politischen Diskursen aufgedeckt werden (Stichwort „kupierte Apokalypse“), um so auf die Interdependenzen zwischen den verschiedenen soziokulturellen Systemen (Religion – Politik – … ) aufmerksam zu machen. Ebd., 172.
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
127
angesprochenen Forschungsfokus Kippenbergs geschuldet zu sein – (ritualisierte) religionsimmanente Gewaltpotentiale und ihr wechselseitiges Verhältnis zu soziokulturellen und politischen (Konflikt‐) Situationen liegen hier im Fokus der Betrachtung.¹⁷⁵ Analytisch lassen sich auch hier wieder Aspekte eines empirisch-sozialtheoretisch fokussierten Zugriffs herausarbeiten: Die Einordnung von Handlungen, Narrativen, Strukturen etc. als „religiös“ o. ä. erfolgt immer über ihre Einbettung in den soziokulturellen Diskurs, in dem sie sich vollziehen und erlaubt so einen differenzierten Blick auf religiöse Gemeinschaftsbildung insgesamt. 4.2.2.1 Zwischenbilanz Auch an dieser Stelle gilt es wieder, das vorgestellte Einführungswerk mit dem im dritten Kapitel dieser Arbeit dargelegten wissenschaftstheoretischen Fokus der Fragestellung als Differenzkriterium kurz zu analysieren. Dabei ist zunächst grundsätzlich zu registrieren, dass die Autoren selbst das Spezifikum der Religionswissenschaft auf den ersten Blick an ihrem Gegenstandsbereich festmachen, nämlich unter der Grundthese, „dass es die Gegenstände sind, die eine wissenschaftliche Disziplin formen, und nicht vorgefasste Theorien und Begriffe […]. Neue Theorien sind vielmehr das Ergebnis von veränderten gesellschaftlichen Fragestellungen und Gegenständen.“¹⁷⁶ Allerdings konstatieren sie in diesem Zuge, dass diese Grundlegung nicht im Sinne eines Differenzkriteriums verstanden werden könne. Vielmehr, so betonen die Autoren, „verschwinden die Grenzen zwischen den wissenschaftlichen Fächern, die sich mit diesen Diskursen [über Religion] befassen.“¹⁷⁷ Charakteristikum der Religionswissenschaft sei kein (methodisch‐) eigenständiger Zugriff auf den Gegenstandsbereich Religion neben anderen Fächern, sondern sie agiere methodisch-interdisziplinär „quer“¹⁷⁸ zum etablierten Disziplinenspektrum. Die Aufgabe von Religionswissenschaftler*innen liege dann maßgeblich in der Moderation dieses inter- und transdisziplinären Diskurses um und über Religionen. Dass dabei die Formung des wissenschaftlichen Diskurses durch den Gegenstandsbereich kein unilaterales Geschehen ist, sondern „Theorien […]
175 Vgl. ebd., 172 – 183. Religiös motivierte Gewalt wird hier als ein Instrumentarium religiöser zeitlicher und räumlicher (im weitesten Sinne) Selbstverortung dargelegt. Was eine Gewalthandlung als „religiös“ kennzeichnet, wird auch hier wieder über den Bezug zur „Öffentlichkeit“ definiert: „Erst die soziale Kontextualisierung einer Handlung generiert ihre spezifische Bedeutung.“ Ebd., 181. 176 Ebd., 8. 177 Ebd. Auch an dieser Stelle wird der spezifisch kulturwissenschaftstheoretische Hintergrund der Monografie deutlich. 178 Ebd.
128
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
aufgrund ihrer Reflexionstätigkeit das Objekt ihrer Untersuchung auch mitgeprägt [haben]“¹⁷⁹, ist den Autoren – v. a. in Reflexion der Fachgeschichte der Religionswissenschaft – natürlich dennoch bewusst. Allerdings ist dann auch gerade an dieser Stelle (unter Einsicht des wechselseitigen Verhältnisses von Gegenstandsbereich und Theorien)¹⁸⁰ nachzufragen, ob tatsächlich von einer gegenstandsfokussierten Bestimmung des Faches ausgegangen werden kann, die sich in der Moderation des Diskurses erschöpft – der ja als solcher eigentlich nicht durch übergeordnete Moderation agiert, sondern sich durch wechselseitige intersubjektive Überprüfung kennzeichnet. Zumal die These, es gebe nicht-theoriengeleitete Moderation, sowohl erkenntnis- als auch wissenschaftstheoretisch schwer argumentierbar ist. Schließlich zeigt die im Vorherigen vollzogene Analyse des Einführungswerks deutlich, dass die Autoren ihre spezifische kulturwissenschaftlich fundierte Herangehensweise aktiv vollziehen und sich ja gerade aufgrund dieser Praxis Aspekte eines empirisch-sozialtheoretischen Zugriffs auf Religion(en) herausgearbeitet werden können. Und gerade darin offenbart sich dann, so wieder die These dieser Arbeit, auch wiederum ein Spezifikum religionswissenschaftlichen Arbeitens. Deutlich ist, dass das grundlegende Forschungsinteresse der beiden Autoren an einer Beschreibung des Phänomens Religion als kultureller, also öffentlich-gesellschaftlich kommunizierter Größe abseits einseitig (normierend) fachlicher Perspektiven besteht. Mit solchen Aspekten eines spezifischen empirisch-sozialtheoretischen Zugriffs konkretisiert sich das Forschungsinteresse (soziologisch sowohl auf Mikro- als auch auf Makroebene) auf den wechselseitigen Zusammenhang zwischen religiösen Weltanschauungen und den entsprechenden sozialen Handlungen. Letztere stellen die empirische Datenbasis da, aufgrund derer so verstandene Religionswissenschaft ihr datengeleitetes Theoriensystem entwickle. Dementsprechend orientiert sich Religionswissenschaft an den historischen und soziokulturellen Kontexten dieser Daten und versucht so, religiöse Aussagen durch ebendiese Kontextualisierung religiöser Kommunikation zu erklären. So könnte nun die Fragestellung der Religionswissenschaft in der konstruierenden Analyse des Werkes von Kippenberg und von Stuckrad wie folgt formuliert werden: Religionswissenschaft unter empirisch-sozialtheoretischem Zugriff fragt interdisziplinär-diskursiv nach den soziokulturellen Diskursstrukturen von und über Religion(en) als kulturellem Phänomen, indem sie Handlungen religiöser Individuen in ihren sozialen und kulturellen Implikationen auf Makro- und Mikroebene analysiert.
179 Ebd., 68. 180 Vgl. u. a. ebd., 38.110.
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
129
4.2.3 Philosophisch-phänomenologisch Als eher klassisches Werk zum wohl fachintern umstrittensten, heute vielleicht eher nicht mehr zentral-integrativen, aber dennoch (in Abgrenzungen – z. B. zur Theologie, aber auch innerdisziplinär) diskursbestimmenden¹⁸¹ Bereich religionswissenschaftlicher Forschung, der Religionsphänomenologie, soll im folgenden das (unter den hier vorgestellten auch älteste)¹⁸² Werk von Günter Lanczkowski Einführung in die Religionsphänomenologie ¹⁸³ von 1978 auf seine Fragestellung und seine Aspekte eines philosophisch-phänomenologischen Zugriffs hin untersucht werden. Damit zählt die Primärquelle dieses Kapitels zwar definitiv nicht mehr zu den aktuellsten, kann aber dafür in seinen Forschungsabsichten bzw. -praktiken als geradezu repräsentativ für einen bis heute existenten¹⁸⁴ (wenngleich auch sicherlich nicht dominanten) Zugriff religionswissenschaftlicher Forschung gelten. Lanczkowskis (geboren 1917 in Kassel,¹⁸⁵ gestorben 1993 in Heidelberg,¹⁸⁶ Studium in Marburg, Professor u. a. in Heidelberg) religionswissenschaftliches Wirken
181 Vgl. Führding, Diskursgemeinschaft, 58. Vgl. auch Zhdanov, Vadim, Zwischen Religionsphänomenologie und Kulturhermeneutik. Eine methodische Reflexion, in: Franke, Edith/Maske, Verena (Hg.), Religionswissenschaft zwischen Sozialwissenschaften, Geschichtswissenschaft und Kognitionsforschung. Ein Autoren-Workshop mit Hubert Seiwert (Marburg Online Books 2), Marburg 2014, 99 – 118, 107. 182 Darin könnte ein Anzeichen dafür liegen, dass Religionsphänomenologie und alles, was mit ihr assoziiert wird, nicht (mehr) dem Mainstream der Religionswissenschaft entsprechen zu scheint. Das bedeutet allerdings nicht, dass es keine aktuelle Religionsphänomenologie gäbe. Allerdings wird (in der eigenen Erfahrung der Verfasserin) bspw. in Gesprächen auf Tagungen der DVRW oder IAHR deutlich, dass religionsphänomenologisch arbeitende Forscher*innen zumindest im deutschsprachigen Raum geradezu als ein Kuriosum aus vergangenen Zeiten angesehen werden. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen prägt aber Religionsphänomenologie bzw. ihr epistemisch-methodologisches Erbe dennoch – vielleicht als negative Abgrenzungsfolie – auch den deutschsprachigen innerreligionswissenschaftlichen Diskurs. Zumal noch gesondert zu untersuchen wäre, welche aktuellen, vielleicht auch gerade postmodernen religionswissenschaftlichen Strömungen vielleicht implizit oder explizit, bewusst oder unbewusst, in religionsphänomenologischem Erbe stehen. Zumindest kann, so die Ansicht dieser Arbeit, das Spektrum der Religionswissenschaft nicht nachgezeichnet werden, ohne auf diesen Zugriff innerhalb des Faches einzugehen – vor allem auch im Hinblick auf das Verständnis von der Schwierigkeit des Verhältnisses zwischen Religionswissenschaft und (evangelischer) Theologie. Vgl. dazu auch Kapitel 2.1.2, aber auch 2.2.1. 183 Lanczkowski, Günter, Einführung in die Religionsphänomenologie, Darmstadt 31992. 184 Vgl. einführend dazu Figl, Einleitung, 37 f. Vgl. auch Zhdanov, Zwischen Religionsphänomenologie…, 107 ff. 185 Vgl. Wißmann, Hans, Ein Kapitel Heidelberger Religionswissenschaft. Günter Lanczkowski (1917– 1993), in: Branković, Carina/Heidbrink, Simone/Lagemann, Charlotte (Hg.), Religion in ExPosition. Eine religionswissenschaftliche Ausstellung. Begleitband zur Ausstellung (Kataloge/Universitätsmuseum Heidelberg 11), Heidelberg 22016, 31 – 33, 31.
130
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
war von Anfang an geprägt durch das grundlegende Interesse, sowohl den Einzelreligionen in ihrer eigenständigen Spezifität gerecht zu werden, als auch einen Allgemeinbegriff des „Phänomens“ Religion zu erarbeiten. (Gerade in Bezug auf Letzteres dürfte seine Schülerschaft bei Heiler¹⁸⁷ einflussreich gewesen sein.) Sein Forschungsgebiet erstreckte sich dabei von der „wahrhaft enzyklopädischen Behandlung der ‚großenʻ Religionen“¹⁸⁸ und in der v. a. philologisch zentrierten Beschäftigung mit den Kulturen der Azteken, Maya und Inka¹⁸⁹ bis hin zu wissenschaftstheoretischen Orientierungen im Bereich der Religionswissenschaft.¹⁹⁰ Das grundlegende Forschungsinteresse, in der Pluralität der Religionen zu einem Allgemeinbegriff zu kommen, zeigt sich denn auch maßgeblich in seinem Einführungswerk zur Religionsphänomenologie, die er zwar hier als Zweig von Religionswissenschaft darstellte,¹⁹¹ deren genuinen Beitrag zum Fach der Religionswissenschaft er allerdings gleichermaßen verdeutlichte. Und zwar sei Religionsphänomenologie, deren Aufgabe laut Lanczkowski darin liege, die religionswissenschaftliche „Stoffülle[!] zu vergleichen und aufzugliedern“,¹⁹² um so (in Anschluss an die Ausführungen Wachs) begriffliche Kategorien religiöser Phänomene herauszuarbeiten,¹⁹³ ein wichtiges Instrument der „Religionsforschung“,¹⁹⁴
186 Vgl. ebd. Vgl. dazu auch die Website der Deutschen Nationalbibliothek. Günter Lanczkowski, https://d-nb.info/gnd/116669748 – 22.01.21. 187 Vgl. Wißmann, Ein Kapitel, 31. 188 Ebd., 32. 189 Vgl. ebd. Vgl. auch seine Publikationsliste auf der Website der Deutschen Nationalbibliothek. Günther Lanczkowski. Publikationsliste, https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showFirstResultSi te¤tResultId=auRef%3D116669748%26any¤tPosition=30 – 22.01.21. 190 Vgl. seine drei Publikationen Einführung in die Religionsgeschichte, Einführung in die Religionsphänomenologie und Einführung in die Religionswissenschaft. 191 Vgl. Lanczkowski, Einführung, 14. 192 Ebd., 17. Eine Forschungsabsicht, die laut Lanczkowski schon in den ersten Impulsen religionsphänomenologischer Arbeit deutlich wurde: So habe Chantepie de la Saussayes deutliches Interesse der „systematische[n] Erfassung der Fülle aller einzelnen Erscheinungsformen“ gegolten, wenn er der „Religionsphänomenologie als eigenständige[r] Teildisziplin der Religionsforschung“ ihren Start gab. Ebd., 23. 193 Vgl. ebd., 14. Damit scheint deutlich, dass Lanczkowski den Aufgabenbereich der Religionsphänomenologie hier (in Teilen) mit dem der oben beschriebenen Systematischen Religionswissenschaft gleichsetzt. 194 Ein Begriff, der eine gewisse wissenschaftstheoretische Anschlussfähigkeit Lanczkowskis z. B. an Kippenberg und von Stuckrad vermuten lässt: Mit „Religionsforschung“ meint der Autor „Religionswissenschaft“, als deren Teildisziplin er Religionsphänomenologie kennzeichnet – neben Religionsgeschichte, Religionspsychologie, Religionssoziologie und Religionsethnologie. Vgl. ebd., 14.17. Mit einer solchen Aufzählung pluraler Subdisziplinen scheint sich Religionswissenschaft also auch hier wieder durch eine genuine Interdisziplinarität zu kennzeichnen. Das Spezifikum der Religi-
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
131
indem sie die Beschäftigung mit dem Phänomen Religion(en) vor erkenntnistheoretischen Reduktionismen bewahre.¹⁹⁵ Denn dadurch, dass Religionsphänomenologie sich zur Maßgabe setze, „Religion als Religion ernst zu nehmen“,¹⁹⁶ stelle sie einen Gegenimpuls zu monokausal evolutionistisch, religionssoziologisch o. ä. argumentierenden Erklärungsmustern dar, wodurch sie geradezu zu einem Bollwerk für gesteigerte Wertneutralität gegenüber dem Phänomen Religion werde. Denn bei genannten erkenntnistheoretisch stark vorgeprägten Ansätzen bestünde immer die Gefahr, dass „[d]em Erfordernis einer neutralen Darstellung […] oft die Absicht entgegen[steht], eine bestimmte These zu verifizieren.“¹⁹⁷ Im Gegensatz dazu konzentriere sich Religionsphänomenologie auf die „religiösen Intentionen“,¹⁹⁸ um so der eigenständigen, durch ihren genuin religiösen Sinn¹⁹⁹ erst entstehenden religiösen Innenperspektive gerecht zu werden und sich dem Verstehen ²⁰⁰ des Phänomens sui generis Religion ²⁰¹ anzunähern: „[E]rst die Erkenntnis des religiösen Sinnes unterscheidet […] einen Opferpriester von einem
onswissenschaft sei dann allerdings eben, wie oben gezeigt werden soll, durch das Erkenntnisinteresse der Religionsphänomenologie gegeben. 195 So ähnlich z. B. auch Waardenburg, Jacques, Religionen und Religion. Systematische Einführung in die Religionswissenschaft (SG 2228), Berlin 1986, 27 f. 196 Lanczkowski, Einführung, 31. Hier mag sich Lanczkowskis Schülerschaft bei Heiler zeigen, auf dessen grundlegenden Beitrag zur Religionsphänomenologie Lanczkowski in der disziplinengeschichtlichen Hinführung seines Einführungswerks rekurrierte, indem er dessen Erkenntnisinteresse, „zum innersten Wesen, zum Mysterium des Religiösen vorzudringen“ als herausragenden Impuls religionsphänomenologischer Forschung kennzeichnete. Ebd., 27. 197 Ebd., 23. So diagnostizierte Lanczkowski im Falle des Evolutionismus, den er als schwieriges Erbe der religionswissenschaftlichen Impulse der Aufklärung zeichnet, einen methodologisch-erkenntnistheoretischen Zirkelschluss: So werde empirisches Datenmaterial (vorfindlicher religiöser Phänomene) mit einer „Unbekannten“ verglichen, deren definitorische Füllung gleichsam das eigentliche Ziel des Vergleichs ist, nämlich mit der Vorstellung einer Urreligion o. ä. Vgl. ebd., 19.21. 198 Ebd., 14. 199 Vgl. z. B. ebd., 32. 200 So habe gerade van der Leeuw, mit dem Religionsphänomenologie ihren fachgeschichtlichen Durchbruch hatte, betont, dass es ihr nicht um die Darstellung empirischer Daten noch um deren subjektive Bewertung, sondern eben um die Bedeutung, den dahinter stehenden religiösen Sinn des Einzelphänomens gehe. Vgl. z. B. ebd., 25. 201 Nicht ganz eindeutig ist hierbei allerdings die ontologische Implikation des Ansatzes. Denn es gehe der Religionsphänomenologie um das „Verstehen nicht nur einzelner religiöser Erscheinungen, sondern auch ihrer Gesamtheit und damit letztlich der Religion als einem Begriff, dem wir sehr verschiedene historische Erscheinungen subsumieren.“ Ebd., 13. Es ist hier nicht klar, ob unter der Religion hier nun eine real-ontologische Größe an sich oder eben ein Phänomen auf strukturellbegrifflicher Ebene o. ä. verstanden ist. Die weiteren Ausführungen des Werkes (im Zusammenhang v. a. des „Heiligen“) werden allerdings hier im Fortlauf zeigen, dass sich eine Tendenz zu Ersterem vermuten lässt.
132
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
Metzger.“²⁰² Solches geschehe methodisch-formal über den religionsphänomenologischen Vergleich, der auch gleichsam als das technische Proprium dieses religionswissenschaftlichen Zugriffs gezeichnet wird. Unter der Maßgabe der größtmöglichen Neutralität²⁰³ gegenüber einem Gegenstand, dem gegenüber aufgrund seiner Beschaffenheit eigentlich keine Neutralität möglich ist,²⁰⁴ bediene sich Religionsphänomenologie einer – ihren Erkenntnisinteressen angepassten – phänomenologischen Methode:²⁰⁵ Um „Phänomene, die in formaler und institutioneller Hinsicht vergleichbar sind,²⁰⁶ einander zuzuordnen, ohne ihre speziellen Ausprägungen in den einzelnen Religionen zu übersehen“,²⁰⁷ müsse sich die*der religionsphänomenologische Forschende in die bewusste Epoché, also in die Enthaltung aller vorgefassten Urteile,²⁰⁸ begeben. Damit das nicht-hintergehbare Interesse bzw. (ontologisch noch zugespitzter) die Methexis,²⁰⁹ also die innere Teilnahme der Beobachtenden am Beobachteten, mit der religiösen Phänomenen unumgehbar begegnet wird, keinen unwissenschaftlichen Subjektivismus zur Folge hat, müsse dieser eben die Epoché im Sinne einer phänomenologischen Reduktion vorausgehen. Dadurch sei Religionsphänomenologie zwar immer noch bewusst und explizit nicht standpunktlos, sondern sozusagen die Positionalität des forschenden Subjekts²¹⁰ aktiv in den Forschungsprozess integrierend, versuche aber durch eben jene Urteilsenthaltung dem Phänomen Religion eidetisch, also im Sinne einer Wesensschau²¹¹ näher zu kommen: Durch „Vergleich und Unterscheidung [der Einzelphänomene gelangt
202 Ebd., 14. 203 „[E]ine Entmythologisierung gehört nicht zu den legitimen Aufgaben der Religionsphänomenologie.“ Ebd., 15. 204 Vgl. ebd., 33. 205 Ziel sei dabei immer noch grundsätzlich, – in Anlehnung bzw. Tradierung Husserls phänomenologischer Methode – zu den eigentlichen Dingen, den Phänomenen in ihrem Wesen vorzudringen. Vgl. Thiel, Christian, Art. Phänomenologie, in: EPhW 3 (1995), 115 – 119, 116 f. 206 Es sei also zentral, dass die verglichenen religiösen Einzelphänomene tatsächlich auch vergleichbar sind, was gewisse soziokulturelle Kontextualisierungen logisch zwingend zur Folge habe. Bzw. gehe es der Religionsphänomenologie eben nicht darum, „vordergründig zu systematisieren, vielmehr [frage] sie nach dem historisch bedingten Sinngehalt“. Lanczkowski, Einführung, 36. Hervorhebung C. N. So z. B. auch explizit bei Stolz, Fritz, Einführung, in: Ders./Michaels, Axel/PezzoliOlgiati, Daria, Noch eine Chance für die Religionsphänomenologie? (StRH 6/7.2000/01), Bern 2001, 9 – 18, 12. 207 Lanczkowski, Einführung, 15. 208 Vgl. ebd., 15.30. 209 Vgl. ebd., 33 f. 210 Wie es ja auch typisch für Phänomenologie als einer Methode ist, da sie ja nach den sich dem Bewusstsein zeigenden Erscheinungen fragt. 211 Ebd., 13.
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
133
die*der Religionsphänomenolog*in] zur Wesenserfassung“.²¹² Um dabei einer eigentlich vermeintlich logisch folgenden zu eng-subjektivistischen Perspektivität vorzubeugen, sei eine „Breite der religionsgeschichtlichen Basis“²¹³ (im Sinne einer Fülle empirischen Datenmaterials) zentral.²¹⁴ Methodisch-inhaltlich bestimmt werde dieser religionsphänomenologische Vergleich dabei wiederum dadurch, dass die Einzelphänomene – um ihren religiösen Intentionen gerecht zu werden – auf ihren Bezug zum Sakralen hin befragt werden. (Hier zeigt sich auch die stark spezifische methodologische Voraussetzungshaftigkeit, für die Religionsphänomenologie seit jeher in der Kritik ihres fachtraditionellen Umfelds steht.)²¹⁵ Denn durch diese „sakralen Bezüge“²¹⁶ konstituiert sich überhaupt erst die religiöse Bedeutung, also das „Wesen des religiösen Phänomens“.²¹⁷ Ausgehend von einer exemplarischen Betrachtung, was „heilige Stätte[n]“²¹⁸ als ebensolche markiere, deutete Lanczkowski (in seiner Herleitung v. a. über Schleiermacher und Otto) das Attribut „sakral/heilig“ dahingehend, dass es Phänomene kennzeichne, in denen eine wie auch immer gestaltete Verschränkung von Transzendenz und Immanenz, von „Jenseits“ und „Diesseits“ anzutreffen sei.²¹⁹ Auch unter etymologischen Gesichtspunkten ließe sich diese These stärken, da jene Orte, die als „heilig“ betitelt werden, sich eben dadurch auszeichnen, dass 212 Ebd., 1. 213 Ebd., 33. 214 Hierin zeigt sich auch die beinahe wechselseitige Zuordnung Lanczkowskis von Religionsphänomenologie und Religionsgeschichte: Erstere brauche Letztere aus materialen Gründen; Letztere werde erst in Kombination mit dem Erkenntnisinteresse Ersterer zu vollständiger, weil dem religiösen Phänomen gerecht werdender Religionswissenschaft. Allerdings wird dadurch natürlich Religionsgeschichte gleichsam als methodologisch-erkenntnistheoretische Vorstufe von Religionsphänomenologie gekennzeichnet. Vgl. ebd., 14.22.34. 215 In Teilen kommt diese Kritik aus religionsphänomenologischen Reihen selbst, die sich grundsätzlich durch starke innere Pluralität kennzeichnen. So haben in den letzten Jahrzehnten große wissenschaftstheoretische Entwicklungen bzw. Ausdifferenzierungen im religionsphänomenologischen Bereich stattgefunden, die bis hin zu dem Postulat variieren, den eigentlich phänomenologischen Ansatz zu Gunsten einer reinen Typologie der Religionen o. ä. aufzugeben.Vgl. dazu kurz zusammengefasst Zinser, Hartmut, Religionsphänomenologie, in: Cancik, Hubert/Gladigow, Burkhard/Laubscher, Matthias (Hg.), Systematischer Teil. Alphabetischer Teil: Aberglaube – Antisemitismus (HRWG 1), Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1988, 306 – 309, 307 f. Vgl. aber auch Stolz, Einführung, 11 f. Es kann vermutet werden, dass dann Religionsphänomenologie in (einen Teil der oben vorgestellten) Systematische(n) Religionswissenschaft überführt wird, welche in ihren Kategorisierungsabsichten – wie Lanczkowskis Rückführungen auf Wach zeigen – ja auch zu den grundlegenden Entstehungsimpulsen von Religionsphänomenologie zählt. 216 Lanczkowski, Einführung, 14. 217 Ebd., 37. 218 Ebd. 219 Vgl. ebd.
134
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
sie abgesondert bzw. besonders, gleichsam „dem Alltäglichen enthoben“²²⁰ sind. So entstünden religiöse Phänomene eben durch Manifestationen (im Sinne bspw. göttlicher Offenbarungen) oder menschliche Realisationen (z. B. durch kultische Verehrung etc.) des Heiligen,²²¹ also dieser „Anteilhabe am Irdischen und zugleich am Göttlichen“.²²² Zentral scheint also zu sein, dass es eine – zumindest phänomenologisch erfassbare – transzendente Wirklichkeit gebe, die sich in den religiösen Einzelphänomenen dem menschlichen Bewusstsein zeige ²²³ – bzw. dass es zur erkenntnistheoretischen Neutralität religionsphänomenologischer Forschung zu gehören scheint, die potentielle (wie auch immer gefüllte) Existenz einer solchen Realität denkerisch in den Forschungsprozess inkorporieren zu können. Diese Herangehensweise des religionsphänomenologischen Vergleichs religiöser Einzelphänomene unter der Frage nach ihrem Bezug zum Heiligen zieht sich dementsprechend durch das gesamte Einführungswerk Lanczkowskis, der – ähnlich wie die beiden hier bisher vorgestellten Publikationen – nach diesen grundlegenden methodologischen Ausführungen zentrale Themen und Begriffe religionswissenschaftlicher Forschung analysierte. So folgt auf die wissenschaftstheoretischen, disziplinengeschichtlichen und methodologischen Ausführungen nach eben jener Herleitung des Sakralen als der methodisch-inhaltlichen Bestimmung des religionsphänomenologischen Vergleichs die exemplarische Durchführung dieses Ansatzes einer durch Vergleich generierten Typologisierung religiöser Phänomene auf Themenbereiche rund um Gottesvorstellungen, das Konzept des Mythos, religiöse Raum- und Zeitkonzeptionen, „Typen religiöser Autorität“, die Frage nach „heilige[r] Sprache und heilige[r] Schrift“, religiösen Kult und religiöses Geschichtsverständnis, woran sich abschließend eine kurze Reflexion der Frage nach einer „Typologie der Religionen“ angliedert.²²⁴
220 Ebd., 40. 221 Vgl. ebd., 38. 222 Ebd., 40. 223 Eine explizite real-ontologische Füllung nahm Lanczkowski – wahrscheinlich sehr bewusst – nicht vor. Vielmehr betonte er im Zusammenhang einer Reflexion über den Gottesbegriff der Religionsphänomenologie, dass die Objekte der phänomenologischen Wesensschau immer nur als wahrgenommene bzw. erfahrene verstanden werden können. Religionsphänomenologische Aussagen über Gott gälten dementsprechend in Anlehnung an Otto immer nur für den Deus relevatus, nicht für „den Deus absonditus oder Deus ipse“. Ebd., 42. Allerdings lassen die Herleitungen Lanczkowskis eben dennoch vermuten, dass eine grundsätzliche Bereitschaft zur Grundannahme transzendenter (real‐) ontologischer Wirklichkeiten zum erkenntnistheoretischen Neutralitätsbegriff der Religionsphänomenologie zu gehören scheint. 224 Ebd., Vf.
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
135
Auffällig ist auch hier, dass allen Analysen dabei wieder gewisse nicht explizit transparent gemachte ontologisch-methodische Normierungen zugrunde zu liegen scheinen. So ist als grundlegende Frage an das Einführungswerk heranzutragen, nach welchen Kriterien ²²⁵ das empirische Datenmaterial der religiösen Einzelphänomene ausgewählt wurde, das dann unter den Fragestellungen des jeweiligen Themenbereichs religionsphänomenologischen Vergleichen unterzogen wird.²²⁶ Schwierig wird das dann vor allem noch dadurch, dass – zumindest auf sprachlicher Ebene – eine gewisse ontologische Grundansicht durchscheint, die der eingangs starkgemachten Forderung nach (Wert‐) Neutralität nicht gerecht zu werden vermag: So scheint Lanczkowskis Vokabular erstens vordergründig doch stark von seiner (u. a.) theologischen²²⁷ Ausbildung geprägt.²²⁸ Und zweitens ließe sich die Vermutung anstellen, dass hier eine gewisse erkenntnistheoretisch normierende Richtung des Erkenntnisprozesses von oben nach unten vorzuliegen scheint, also von einer transzendenten Größe als Initiatorin resp. Ursache religiöser Phänomene ausgegangen wird. Besonders deutlich wird das – in Kontrastierung v. a. zu den beiden vorher dargestellten Einführungswerken, deren Argumentationen stark über die menschliche Sozialität liefen, in der sich religiöse Phänomene ausgestalten – am 225 Ein Problem, dass innerhalb der Religionsphänomenologie selbst stark reflektiert wird. Vgl. z. B. Michaels, Axel, Nachwort. Die Religionsphänomenologie ist tot – Es lebe die Religionsphänomenologie, in: Ders./Pezzoli-Olgiati, Daria/Stolz, Fritz (Hg.), Noch eine Chance für die Religionsphänomenologie? (StRH 6/7.2000/01), Bern 2001, 489 – 492, 489. 226 So vollzog Lanczkowski einen – zumindest nicht deutlich kontextualisierten – Vergleich von aztekischen über germanische und antik-griechische Gottheiten bis hin zu Gottesvorstellungen des Christentums, um daran das religiöse Phänomen von Himmelskörper symbolisierenden Gottesbildern auszuleuchten. Vgl. Lanczkowski, Einführung, 49 f. Ein noch undurchsichtigeres bzw. schwer nach-vollziehbares Vergleichsbeispiel wird unter der Frage nach heiligen Ordnungskonzeptionen offenkundig, wenn Lanczkowski einen raschen Sprung von Schillers „segensreicher Himmelstochter“ aus dem Lied von der Glocke zur ägyptischen Maat machte. Vgl. ebd., 66. Auch bei eher strukturell angesetzten Analysen, wie z. B. im Zusammenhang der Frage nach Typen religiöser Autoritäten, werden überschnelle Schritte vollzogen, die bei so wenig Explikation einem Einführungswerk vielleicht nicht gerecht werden; wenn Lanczkowski z. B. unter der Kategorie der „Reformatoren“ (einer eindeutig christentumszentristischen Vokabel) nicht nur Luther, Zwingli und Calvin, sondern eben auch Konfuzius subsumiert. Vgl. ebd., 95. 227 Vgl. Wißmann, Ein Kapitel, 31. 228 So schrieb er eben, um nur einige Beispiele zu nennen, (in wohlgemerkt pluralen kulturellen Kontexten sich bewegend) von „Verborgenen Heilsbringern“ (und nannte hier als Beispiele Barbarossa oder auch Alexander den Großen), von „Gnadengabe“, die Voraussetzung einer Kennzeichnung von Personen als „religiöser Autoritäten“ zu sein scheint oder einfach nur vermehrt von „Offenbarung“ – gern auch im Zusammenhang von Religionen, bei denen die Angemessenheit des Offenbarungsbegriffs in einem solchen Einführungswerk doch vielleicht explizit reflektiert werden könnte. Vgl. u. a. Lanczkowski, Einführung, 73.84.101 f.
136
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
Beispiel des Idealtyps des Priesters, dessen gesellschaftliche Sonderstellung eindeutig damit begründet wird, dass ihm „kraft göttlicher Vollmacht“²²⁹ Sonderwissen zuteil würde, wodurch er herausgehobene gesellschaftlich-kultische Aufgaben übernehme – und nicht umgekehrt.²³⁰ Es kann sein, dass dies dem grundlegenden Interesse Lanczkowskis geschuldet ist, der religiösen Innenperspektive gerecht zu werden: Anstatt religiöse Einzelphänomene auf biologische, evolutionstheoretische, soziologische,²³¹ psychologische o. a. Erklärungsmuster zu reduzieren,²³² ging es ihm maßgeblich um eine Darstellung des eigenständigen Phänomens Religion.²³³ Bestätigt wird diese Annahme im letzten Kapitel,²³⁴ in dem Lanczkowski „eine Typologie der Religionen, d. h. die Erfassung ihrer jeweils typischen Züge […], die dann weiterhin das Prinzip einer Einteilung und Gruppierung aller Religionen bilden sollen […] [als] die abschließende Aufgabe einer Religionsphänomenologie“²³⁵ herausstellte und in diesem Zusammenhang konstatierte, dass diese Aufgabe vor allem dahingehend wesentlich sei, weil durch sie in der heutigen, von religiösem Pluralismus gekennzeichneten Welt „geistige Orientierung“²³⁶ gegeben werden könne.²³⁷ Damit positionierte er sich deutlich gegen klassische, den religionswissenschaftlichen Diskurs dominierende Positionen, die den Aufgabenbereich von
229 Ebd., 96. 230 Vgl. ebd., 96 f. 231 Interessant ist dabei auch, dass er an einer Stelle sich zwar typischer religionssoziologischer Begrifflichkeiten bedient, diese aber ontologisch anders füllt: So definiert er – im Zusammenhang der Frage nach religiösen Raum- und Zeitkonzeptionen – mit Makrokosmos den „Zusammenhang der großen, äußeren Welt“ und mit Mikrokosmos die „Lebenswelt des Menschen“. Ebd., 70. Religionssoziologisch verbreiteter dürfte eher eine Zuordnung sein, die unter Makrokosmos den gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang und unter Mikrokosmos die gesellschaftlichen Subsysteme versteht. 232 Womit er ein typisches Grundanliegen der Religionsphänomenologie vertrat. Vgl. z. B. dem ähnlich Stolz, Einführung, 13. 233 So konzentrierte er sich z. B. in Auseinandersetzung mit der Kategorie des Mythos auf existenzielle Deutungsstrategien. Vgl. Lanczkowski, Einführung, 57.61. 234 Explizit z. B. in Auseinandersetzung mit den Begriffen der „Primitiv-“ oder auch „Kulturreligion“, die er v. a. deswegen als unpassend kennzeichnete, weil sie nicht dem Selbstverständnis der jeweiligen Religionen entsprechen. Vgl. ebd., 125. 235 Ebd., 122. 236 Ebd. 237 Dem folgt dann logischerweise eine positive Zuordnung von Religionsphänomenologie und Theologie. Vgl. ebd. Interessant ist, dass Lanczkowskis Ausführungen im weiteren Verlauf, in denen er die Bedeutung der Religionsphänomenologie auch in interreligiösen Dialogen reflektierte, doch eine stark christentumsorientierte Perspektivik zu bespielen schien. Vgl. ebd., 124.
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
137
Religionswissenschaft als viel stärker„weltanschaulich-neutral“ deskriptiv im Sinne informativer Orientierung beschreiben.²³⁸ 4.2.3.1 Zwischenbilanz Auch an dieser Stelle lohnt es sich nun wieder, zwischenresümierend die Aspekte eines philosophisch-phänomenologischen Zugriffes im Ansatz Lanczkowskis mit dem Fokus der Fragestellung als wissenschaftstheoretischem Differenzkriterium zu untersuchen. So wurde vor allem sein grundlegendes Erkenntnisinteresse deutlich, das auf eine Darstellung religiöser Einzel-/Phänomene abseits reduktionistischer Erklärungsmuster abzielt. Vielmehr ging es Lanczkowski zentral um ein Verstehen²³⁹ von Religion als Religion – was gleichermaßen einen stark-direkten Einfluss seiner eigenen erkenntnistheoretischen Positionalität auf den Forschungsprozess zeigt. Unter der inhaltlichen Normierung, von einer – ontologisch wie auch immer zu füllenden – Größe des Heiligen ausgehend, lag seine Forschungsabsicht im religionsphänomenologischen Vergleich einzelner religiöser Phänomene anhand ihrer jeweiligen sakralen Bezüge, um daraus sowohl Typologien religiöser Phänomene als auch des Phänomens Religion an sich zu ziehen. Es ging ihm also nicht nur um eine ausführliche Darstellung und Kategorisierung der Einzelreligionen, sondern um das Deuten und Verstehen des genuin religiösen Sinns in den Einzelphänomen, also um das Deuten und Verstehen der Religion selbst. Erst ein dermaßen holistischer Ansatz gebe dann Religionswissenschaft überhaupt erst ihre eigene Identität – neben religionssoziologischen, biologischen, ethnologischen u. ä. Zugriffen auf das Phänomen Religion(en). Dementsprechend sind Religionsgeschichte und Religionsphänomenologie auch einander positiv zuzuordnen – ähnlich (wenngleich nicht damit gleichzusetzen) wie bereits Wach das in seinen Ausführungen vornahm und wie es im Rahmen dieser Arbeit unter der Frage nach dem Verhältnis von historischer und systematischer Religionswissenschaft schon reflektiert wurde. Die Probleme von Lanczkowskis Ansatz wurden oben schon angerissen, so dass hier nun systematisiert ein Formulierungsvorschlag für eine Fragestellung von Religionswissenschaft im religionsphänomenologischen Zugriff versucht werden kann.
238 Vgl. z. B. Zinser, Hartmut, Grundfragen der Religionswissenschaft, Paderborn/München/Wien/ Zürich 2010, 32 – 34. 239 Worin gleichsam das bleibende Erbe der Religionsphänomenologie liegt: „Auch wenn die alte Religionsphänomenologie heute kaum noch methodisch anwendbar ist, bleibt ihre Forderung ‚Religionen zu verstehenʻ nach wie vor eine Aufgabe der Religionswissenschaft.“ Zhdanov, Zwischen Religionsphänomenologie, 99.
138
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
Philosophisch-phänomenologisch orientierte Religionswissenschaft fragt in Anwendung religionsphänomenologischer Vergleiche, die auf eine – idealiter historisch und soziokulturell kontextualisierte – Typologisierung sowohl religiöser Einzelphänome als auch des Phänomens Religion sui generis abzielen, nach dem genuin religiösen Sinn der Einzelerscheinungen und versucht so, Religion als eigenständige Größe des menschlichen Geisteslebens zu verstehen und zu deuten, wodurch sie eine explizite Orientierungsfunktion im Bereich der Religion(en) übernimmt.
4.2.4 Psychologisch-kognitionswissenschaftlich Der letzte und, wie unter 4.2. schon angedeutet, jüngste und vielleicht eher einen exemplarischen Spezialfall darstellende Zugriff religionswissenschaftlichen Arbeitens soll anhand der psychologisch-kognitionswissenschaftlichen Impulse der Cognitive Science of Religion (CSR) untersucht werden, einer besonderen Strömung²⁴⁰ innerhalb des Spektrums der Religionsforschung, die versucht, die Entstehung und Tradierung religiöser Vorstellungen und Praktiken auf Grundlage evolutionstheoretisch-kognitionswissenschaftlicher Theorien und Methoden zu erklären.²⁴¹ Exemplarisch ist dieser Zugriff metatheoretisch insofern, als dass hieran aufgezeigt wird, dass Religionswissenschaft – wie alle Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften – sich ihre Themen nicht einfach nur fachtypisch sucht, sondern eben in ihren Forschungsinteressen bedingt ist von aktuellen, sich stetig verändernden Lebenswirklichkeiten und Weltdeutungen, die den wissenschaftlichen Diskurs insgesamt prägen. Neuere Forschungsfragen stehen in einer gewissen thematischen Abhängigkeit von dominanten gesellschaftlichen, politischen und technischen Entwicklungen und Diskursen. Kognitionswissenschaftliche Fokussierungen gehören zu einer der vielzähligen aktuell prägenden Problemstellungen, wie bspw. jüngste Diskurse rund um Künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen und Implikationen deutlich machen dürften.²⁴² Religionswissenschaft – wie alle Wissenschaft – reagiert auf diese Debattenlage. Als eine solche exemplarische (in der
240 Oder auch einer „programmatische[n] Wissenschaftscommunity“ – und nicht so sehr eines eigenen methodischen Ansatzes. Schüler, Religion, 111. Explizite Anleihen kommen v. a. aus der Neurolinguistik. Das Programmatische der CSR wird aber vielleicht vor allem durch die Verwendung „analoge[r] Metaphern zu digitalen Prozessen bei Computern“ exemplarisch evident. Ebd., 37. Vgl. ebd., 86 f. 241 Vgl. ebd., 26 f. 242 Vgl. z. B. grundlegend Holzer, Boris, Maschinelle Mission, in: FAZ (09.03. 2023), https://www.faz. net/aktuell/wissen/geist-soziales/chatgpt-chatbots-koennen-menschen-politisch-ueberzeugen18720335.html – 09.03.23. Vgl. als v. a. ethische Problematisierung z. B. Perrigo, Billy, OpenAI used Kenyan Workers on less than $2 per Hour to make ChatGPT less toxic, in: TIME (18.01.23), https://time. com/6247678/openai-chatgpt-kenya-workers/ – 09.03.23.
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
139
Auswahl argumentativ auch schon oben unter 4.2. hergeleitete) Reaktion soll also der hier vorgestellte Zugriff fungieren. Da es sich bei diesem religionswissenschaftlichen Typus um eine wissenschaftsgeschichtlich recht junge, im deutschsprachigen Hochschulraum auch eher untypische²⁴³ und wenn, dann eher vereinzelt auftretende Erscheinung handelt,²⁴⁴ dessen Beliebtheit sich (bisher) vor allem auf den englischsprachigen Raum konzentriert(e),²⁴⁵ unterscheidet sich dieses Unterkapitel von seinen drei Vorgängern vor allem dadurch, dass hier als Primärquelle genretechnisch kein klassisches Einführungswerk im engeren Sinne dient, sondern vielmehr eine Art Überblicksanalyse. Dieser Unterschied wiegt allerdings für die Absichten dieses Unterkapitels insofern nicht zu schwer, als dass die hier gewählte Literatur in ihrem grundlegenden Impetus dennoch bzw. besonders pointiert-positioniert einführen will: Die aus seiner Dissertation hervorgegangene Monografie Sebastian Schülers mit dem Titel Religion, Kognition, Evolution. Eine religionswissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Cognitive Science of Religion von 2012 kann „insbesondere aufgrund des hohen Informationswertes“²⁴⁶ als eine der grundlegenden Überblicksdarstellungen im religionswissenschaftlich-deutsch(sprachig)en Blickwinkel angesehen werden.²⁴⁷ Schüler, Professor für Allgemeine und Vergleichende Religionswissenschaft an der Universität Leipzig,²⁴⁸ konzentriert sich in seiner vergleichsweise jungen, aber etablierten Wissenschaftskarriere bisher auf sozial-, evolutions- (psychologische) und kognitionswissenschaftliche Aspekte von Religion(en). Zentral ist dabei immer wieder die Auseinandersetzung mit vor allem dem „Evangelikale[n] und Charismatische[n] Christentum (USA und Europa)“.²⁴⁹ 243 Vgl. Franke, Fachliche Spezialisierung, 39 – 41. Vgl. aber ebenfalls Maske, Verena, Kontinuität, Kohärenz und Anerkennung. Überlegungen zur Identität der Religionswissenschaft, im selben Band, 119 – 133, 125. 244 Zum Cognitive Turn in den Geisteswissenschaften vgl. hierfür Schüler, Religion, 33. 245 Vgl. zu bisherigen religionswissenschaftlichen Auseinandersetzungen und zur grundsätzlichen Literaturlage zur CSR ebd., 28.34 f. 246 Klein, Andreas, Schüler, Sebastian. Religion, Kognition, Evolution. Eine religionswissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Cognitive Science of Religion, in: ThLZ 4/140 (2015), 344 – 346, 346. 247 „Diese von der DVRW mit dem Dissertationspreis prämierte Monographie ist ein Muss für jeden, der einen kritischen, aber differenzierten Zugang zu diesem neuen Forschungsfeld in der Religionswissenschaft sucht.“ Schröder, Anna-Konstanze, Sebastian Schüler. Religion, Kognition, Evolution. Eine religionswissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Cognitive Science of Religion, in: ZfR 1/21 (2013), 131 – 134, 131. 248 Vgl. hierzu die Website des Instituts für Religionswissenschaft der Universität Leipzig. Sebastian Schüler, https://www.gkr.uni-leipzig.de/personenprofil/mitarbeiter/prof-dr-sebastian-schueler/ – 22.01.21. 249 Ebd.
140
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
So bildet auch den Auftakt seiner Dissertation ein kurzer Prolog, in dem Schüler auf Basis seiner Feldforschungen „idealtypisch“²⁵⁰ das Phänomen der Glossolalie in einem freikirchlichen Sonntagsgottesdienst beschreibt. Dieses Beispiel kann für Schüler als argumentativer Angelpunkt fungieren, da er gerade hierbei die Bedeutung von sozialer, körperlicher Interaktion als zentral für die Entstehung religiöser Phänomene der rituellen Synchronisation wie dem der Glossolalie²⁵¹ als evident zu zeichnen vermag. Denn Hauptkritikpunkt seiner Auseinandersetzung mit der CSR ist vor allem in Bezug auf ihren Religionsbegriff ein (vielleicht eher vermeintlicher)²⁵² Reduktionismus auf naturalistischen Individualismus,²⁵³ der von einer – von Schüler als „holistisch“²⁵⁴ bezeichneten alternativen – integrativen Analyse des wechselseitigen Zusammenhangs verkörperter individueller und sozialer Kognitionen schlichtweg absehe.²⁵⁵ Daraus erschließt sich auch die strukturelle Logik²⁵⁶ seiner Monografie: Sowohl bei seinem ersten Arbeitsschritt (im I. und II. Großabschnitt), in dem er grundlegende erkenntnistheoretische Vorbedingungen und methodologische -Ismen der CSR einer kritischen Revision unterzieht, als auch in der zweiten Phase (im III. Großabschnitt), in der er alternative kognitionswissenschaftliche Zugriffe und damit seinen eigenen holistischen Ansatz vorstellt, fungiert (nicht nur die Religionstheorie, sondern vor allem auch) die Ritualtheorie
250 Schüler, Religion, 14. 251 Vgl. ebd., 41. 252 Vgl. Klein, Schüler, 344 f. 253 Im Sinne eines „gehirnbiologischen Materialismus“. Schröder, Sebastian Schüler, 131. Vgl. Schüler, Religion, 50 ff. Schüler sieht hierin ein spätes Erbe des cartesianischen Geist-Materie-Dualismus: Kognitionswissenschaftlich werde der Geist „auf Gehirnfunktionen reduziert“ und diese „unabhängig vom Körper“ zum isolierten Gegenstand der Kognitionswissenschaften erhoben. Dadurch sei der einzige körperliche Bezugspunkt das Gehirn – ohne tiefere Reflexion seines Verhältnisses zur Umwelt und Sozialität. Vgl. ebd., 103. 254 Z. B. ebd., 46. 255 Dass diese Analysen Schülers vielleicht nicht vollends den Stand kognitionswissenschaftlicher Forschung treffen, wird an dieser Stelle nicht weiter betrachtet. Vgl. dazu z. B. Schröder, Sebastian Schüler, 133 f. Zumal durchaus die Überlegung gerechtfertigt ist, ob etwaige polarisierend-pointierte bis vielleicht polemisch-verkürzte Darstellungen nicht vor allem dem strategischen Anspruch geschuldet sind, durch solche Kontrastierungen die eigene Position noch stärker herauszuarbeiten. Vgl. Klein, Schüler, 346.Vgl. v. a. auch z. B. selbst Schüler, Religion, 109. Dahingegen soll der Fokus der hiesigen Auseinandersetzung mit seiner Monografie, wie bisher auch in den vorherigen drei Unterkapiteln gehabt, die Frage nach seinem kognitionswissenschaftlich-affizierten Verständnis religionswissenschaftlichen Arbeitens sein. Von einer Untersuchung der Treffsicherheit seiner Ergebnisse auf kognitionswissenschaftlicher oder geistphilosophischer Ebene wird also im Folgenden abgesehen. 256 Zu einem kurzen Referat seiner Vorgehensweise vgl. z. B. Pacyna, Tony, Religion, Kognition, Evolution by Sebastian Schüler, in: Journal for the Cognitive Science of Religion 2/1 (2014), 241 – 243.
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
141
als Fixpunkt der Argumentation. Denn gerade am Beispiel der Ritualtheorie als einer der „Hauptsäulen“²⁵⁷ der CSR kann Schüler in seinem zweiten Arbeitsschritt die Bedeutsamkeit des wechselseitigen Verhältnisses von Kognition und Sozialität für die Entstehung religiöser Vorstellungen und v. a. synchronisierten religiösen Verhaltens,²⁵⁸ in dem sich solche Vorstellungen re-/produzieren, herausarbeiten und also im weiteren Sinn die Soziogenese als genuinen Bestandteil menschlicher Kultur²⁵⁹ verdeutlichen. Dieses Vorgehen lässt sich hier im Folgenden kurz darstellen, indem Aspekte eines psychologisch-kognitionswissenschaftlichen Zugriffs aus Schülers²⁶⁰ Werk herausgearbeitet werden. Schüler übernimmt die Fragestellung der CSR: Wie entstehen auf kognitiver Ebene religiöse Vorstellungen und Verhaltensweisen?²⁶¹ Zur Argumentation seines spezifischen Ansatzes einer „Dynamik ritueller Synchronisation“²⁶² positioniert Schüler sich hier geist-theoretisch²⁶³ – gegen den von ihm so konstatierten Mainstream der Theorie-Theorie²⁶⁴ innerhalb der CSR – im Rahmen der Simulationstheorie: Laut derer verfügen Menschen über bestimmte kognitive Funktionen, mit denen sie spezifische Situationen oder Vorstellungen simulieren, nachvollziehen und prognostizieren können.²⁶⁵ Schüler erweitert diese Theorie mit dem Ansatz der embodied cognition: ²⁶⁶ 257 Schüler, Religion, 150. 258 Vgl. z. B. ebd., 191. 259 Vgl. ebd., 189. 260 Schülers Vorgehen selbst ist in Bezug auf CSR metatheoretisch anzusehen. Als Professor für Allgemeine und Vergleichende Religionswissenschaft vollzieht Schüler hier genau das, was in Kapitel 4.1.1. als Metatheorie der Religionswissenschaft beschrieben wurde – und das eben aufgrund des Gegenstandsbereichs in einem psychologisch-kognitionswissenschaftlich fokussierten Zugriff. 261 Vgl. ebd., 27. 262 Ebd., 98. 263 Mit theory of mind ist in diesem Kontext die kognitionswissenschaftliche bzw. geistphilosophische Fragestellung gemeint, wie – also mit welchen kognitiven Mustern und Funktionen – Menschen in der Lage sind, andere Menschen und deren Vorstellungen zu verstehen. Vgl. ebd., 94. 264 Theorie-Theorie gehe von einer Art intuitivem Vorwissen aus, das verschiedenen Domänen bzw. Modulen des Denkens zugeschrieben wird und mit Hilfe dessen Menschen ihre Umwelt und Mitmenschen verstehen können, indem sie dieses tacit knowledge auf bestimmte Situationen und Erfahrungen anwenden. Vgl. ebd., 96 ff. Religiöse Vorstellungen kennzeichnen sich dann dadurch, dass sie die dahinterstehende intuitive Ontologie, also die basalen Erfahrungskategorien, die in diesem Wissen mitgesetzt sind, verletzen. Vgl. ebd., 119 f.126. (Z. B. wenn eine Person als omnipräsent erfahren wird oder einem Berg personale Eigenschaften zugeschrieben werden etc. pp.) Dadurch kennzeichnet sich der Religionsbegriff der Mainstream-CSR als eng substantiell. Vgl. ebd. 157. Der soziokulturelle Entstehungskontext solcher Vorstellungen finde hier, so Schüler, keine Beachtung. 265 Vgl. ebd., 98 f. 266 Vgl. ebd., 104 f.
142
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
Da Kognitionen simulationstheoretisch als logischerweise situativ-kontextualisiert betrachtet werden,²⁶⁷ ist es für Schüler nur folgerichtig, hier den Einfluss des Körpers²⁶⁸ und dementsprechend auch der Umwelt und Interaktionen des Individuums²⁶⁹ auf kognitive Prozesse²⁷⁰ in die Betrachtung mit einzubeziehen. Religionstheoretisch kommt Schüler dementsprechend zu der Position, dass es nicht nur biologisch-individuelle (wie die der kognitiven Strukturen des Gehirns), sondern auch soziologisch-kulturelle Faktoren sind,²⁷¹ die religiöse Vorstellungen im Geist entstehen lassen. Das verdeutlicht auch, dass religiöse Vorstellungen nicht im isolierten Gehirn des Individuums entstehen, sondern eine geschichtliche, in Sozialität eingebundene Entwicklung vollziehen. Geist, Gehirn, Körper, Inter-/Sozialität und Kultur stehen also in mehrdimensionalen Wechselverhältnissen zueinander. Somit beeinflussen religiöse Praxis und religiöse Vorstellungen durch ihre genuine Einbindung in soziokulturelle Kontexte sich gegenseitig.²⁷² Kulturelles Wissen, also gerade auch religiöse Vorstellungen, manifestieren und tradieren sich in Ritualen. ²⁷³ Gerade hier kann Schüler die adaptive Funktion von Religionen verdeutlichen. In erweiterter Durkheim-Rezeption²⁷⁴ betont er die Gruppenkohäsion stärkende sozialkognitive Funktion des Ritus: Durch rituelle „Verkörperungsprozesse“²⁷⁵ entstehe erhöhte „Verbindlichkeit […], die die Ritualteilnehmer miteinander verbindet“.²⁷⁶ Somit entstehen durch soziale Interaktionen
267 Vgl. ebd., 102. 268 „Körperlichkeit ist eine untrennbare Disposition für kognitive Prozesse.“ Ebd., 208. Natürlich gerade auch sozial-kognitive Interaktionen vollziehen sich nicht über isolierte Gehirne, sondern körperlich – durch Kommunikation im weitesten Sinn. Bei der Entstehung religiöser Vorstellungen ist also für Schüler zwar Sozialität entscheidend [Vgl. ebd., 213.], doch kommt dem Körper eben durch die Integration des Ansatzes der embodied cognition eine herausgehobene, nämlich religiöse Vorstellungen generierende Funktion zu. Vgl. ebd., 236. 269 Schüler integriert dafür maßgeblich das kognitionswissenschaftliche Konzept der Spiegelneuronen in seinen Ansatz. Vgl. ebd., 203 ff. 270 So brauche „das Gehirn [eine] Grundlage, womit es theoretisieren oder simulieren könne.“ Ebd., 104 f. Schüler referiert hier auf den Philosophen Shaun Gallagher, der die Körperlichkeit verstehender Interaktion noch vor einer vollständigen Ausbildung einer theory of mind betone. 271 Vgl. dazu schon ebd., 48. Vgl. v. a. aber auch ebd., 213.231.233. 272 Schüler geht hier über eine (moderne) Durkheim-Rezeption, zentral über den Begriff der Efferveszenz. Vgl z. B. ebd., 70.77. 273 Vgl. ebd., 191. 274 Der als Funktion des Ritus die Stärkung des „moralischen Zusammenhalts“ bezeichne.Vgl. ebd., 239. 275 Ebd. 276 Ebd.
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
143
soziale Emotionen. ²⁷⁷ Gerade im Ritus werden solche Kollektivemotionen generiert, koordiniert und synchronisiert und eben so der Gruppenzusammenhalt gestärkt.²⁷⁸ Am Ende seines Werkes exemplifiziert Schüler das am Prolog-Beispiel der Glossolalie: Durch gemeinsames Singen, Tanzen etc. komme es zu einer spezifischen Gruppendynamik, die eine kognitiv-körperliche Synchronisation der einzelnen Ritualteilnehmenden (manifestiert in Zungenrede) verursache, so dass die Gruppendynamik selbst zur von den einzelnen Individuen verkörperten und diese dadurch steuernden „treibenden Kraft der Gruppe“²⁷⁹ werde: Die „von der Gruppe erzeugte Dynamik [wirke] wie ein eigener Akteur im Körper des Glossolalikers“.²⁸⁰ Gerade an diesem Beispiel verdeutlicht Schüler den wechselseitigen Zusammenhang zwischen Kognition, Körper und Sozialität. Synchronisationsprozesse zwischen Individuen seien also logischerweise gleichsam kognitive und soziale Phänomene.²⁸¹ Schüler vertritt hierbei die These, dass religiöse Rituale wohl den höchsten Grad kollektiver Synchronisationen darstellen.²⁸² Wie alle kognitiven Prozesse seien auch diese dann kulturell-situativ und somit dynamisch. Derart gestärkter Gruppenzusammenhalt stellt dann sowohl auf Individual- als auch auf Sozialebene einen evolutionären Vorteil dar, nämlich die Fähigkeit der (wechselseitigen) Anpassung an eine sich permanent verändernde Um-/Welt.²⁸³ „Menschen müssen sich synchronisieren, um als soziale Gemeinschaft zu überleben.“²⁸⁴ Synchronisationsprozesse stellen also „eine biosoziale Eigenschaft des Menschen dar, die seine Anpassungsfähigkeit und damit sein Überleben sichert.“²⁸⁵ In ebendiesem Sinne haben dann gerade Religionen als „kulturelle Kooperationssysteme“²⁸⁶ evolutionär-kognitiv eine dynamisch-adaptive Funktion für
277 Zwar liege Schülers Fokus primär auf den Zusammenhängen zwischen Körper und Kognitionen, doch betont er selbst berechtigter Weise den wechselseitigen Zusammenhang zwischen Kognitionen und Emotionen, weswegen er Letztere dann folgerichtig in seine Analysen miteinbezieht. Vgl. ebd., 245. 278 Vgl. ebd., 249. Rituale sind also gleichsam Ergebnis als auch Mechanismus solcher Gruppenkohäsion. Vgl. ebd., 257. 279 Ebd., 266. 280 Ebd. 281 Vgl. ebd., 252.263. 282 Vgl. ebd., 254. 283 Vgl. ebd., 221.260. 284 Ebd., 259. 285 Ebd., 263. 286 Ebd., 189.
144
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
Individuum und Kollektiv,²⁸⁷ nämlich indem sie durch sozial-kognitive Synchronisationen „kohäsiv auf Gruppen und integrativ auf Individuen wirken.“²⁸⁸ 4.2.4.1 Zwischenbilanz Auch Schülers (implizites) Verständnis von Religionswissenschaft als eigenständiger Disziplin soll nun in einer kurzen Zwischenbilanz herausgearbeitet werden. Evident ist bei seiner Monografie von Anfang an sein zentrales Interesse an einer von ihm so bezeichneten holistischen Herangehensweise. Affiziert durch ein innerhalb der Religionswissenschaft bereits länger diagnostiziertes²⁸⁹ Problem des Mangels eigener, genuin religionswissenschaftlicher Theorien ist es sein grundlegendes Anliegen, neue Forschungsimpulse – eben auch aus dem Bereich der CSR – vor dem Hintergrund klassisch-religionswissenschaftlicher Ansätze zu reflektieren und gegebenenfalls zu integrieren. ²⁹⁰ Durch reflektierte Adaption nicht-religionswissenschaftlicher Ansätze und rückwirkende Einbringung dezidiert religionswissenschaftlicher Zugriffe in wiederum außer-disziplinäre Forschungskontexte käme es so zur Schärfung einer eigenständig-religionswissenschaftlichen Perspektive auf den Gegenstandsbereich der Religion(en).²⁹¹ Holistisch gestalte sich sein Zugriff, wie oben bereits dargestellt, dadurch, dass Individualismen, kulturübergreifende Universalismen und Naturalismen²⁹² der CSR nun vor dem Hintergrund klassisch religionswissenschaftlicher Ansätze (in Schülers Fall maßgeblich via Durkheim) einer kritischen Revision unterzogen werden: Anstatt Kultur (und eben auch Religion) aus Natur analytisch abzuleiten,²⁹³
287 Vgl. ebd., 258 f. Wenn Schüler sie gleichsam als regelrechte „Synchronisationsmaschinen“ bezeichnet, dann hebt er damit auf genau diesen Punkt seiner These ab, dass hier besonders effizient und intensiv kollektive Emotionen generiert und gepflegt werden. Ebd., 256. 288 Ebd., 259. Schülers Religionsbegriff gestaltet sich dementsprechend als explizit funktionaler Begriff von Religion und hat dabei dann eben mehr als deutliche Anklänge an Durkheim und dessen Rezeption: Substantielle Gehalte, wie z. B. der Begriff der Sakralisierung, finden ebenfalls v. a. unter der Prämisse Anwendung, dass die Zuschreibungen sakral/profan auch auf rituellen und somit sozialen Prozessen beruhen. Vgl. ebd., 258 f. Damit kritisiert Schüler den – von ihm so diagnostizierten – substantiellen Religionsbegriff der CSR. Vgl. auch ebd., 156 f. 289 Schüler nennt hier selbst die als exemplarisch geltenden Ausführungen aus den 90er Jahren seines Leipziger Kollegen Seiwert, der zusammen mit Carlos Marroquín einen der „post-phänomenologischen Kritik“ geschuldeten „Theoriemangel“ der Religionswissenschaft konstatiere. Vgl. ebd., 21. 290 Vgl. ebd. 291 Vgl. ebd., 22. 292 Vgl. z. B. noch einmal ebd., 89 f.116. 293 Vgl. ebd., 50.
4.2 Religionswissenschaftliche „Zugriffe“
145
wie es in der methodologischen Engführung²⁹⁴ der CSR geschehe, fokussiert sich Schüler konsequent auf eine gegenseitige Befruchtung kognitions- und sozialwissenschaftlicher Perspektiven:²⁹⁵ Kulturelle und biologische Evolution werden so in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander gesehen.²⁹⁶ Damit versuche er jenen genannten -Ismen, die durch die CSR Eingang in die Religionswissenschaft gefunden hätten,²⁹⁷ eine alternative Herangehensweise entgegenzusetzen. Zentral sei dabei, bei aller Schärfung der religionswissenschaftlichen Identität, eine erhöhte Bereitschaft zu effektiver wechselseitiger Interdisziplinarität zwischen Kognitionswissenschaften auf der einen und Kultur- und Sozialwissenschaften auf der anderen Seite,²⁹⁸ womit er ultimativ seinen eigenen methodischholistischen Zugriff auf die Frage nach der Entstehung religiöser Vorstellungen und Praktiken begründen kann: „Die Kluft zwischen Soziologie einerseits und naturalistischer Psychologie andererseits scheint gerade mit den Ansätzen verkörperter und sozialer Kognitionen zu verschwinden.“²⁹⁹ Und genau in dieser Wechselseitigkeit liege dann auch das Kernanliegen eines solchen methodologischen Holismus, der sich nicht durch eine Auflösung der Einzelteile in einen alles in sich vereinheitlichenden Ansatz kennzeichne, sondern dessen Charakteristikum und Stärke
294 Vgl. ebd., 46 f. Interessant ist hier, dass Schüler diese Problemstellung als wissenschaftstheoretisch, also v. a. methodologisch kennzeichnet. Erkenntnistheoretische Fragen zum Gegenstandsbereich, also was über Religion(en) „tatsächlich gewusst werden kann“, gehörten nicht zum Fragenkatalog der Religionswissenschaft. Ebd., 47. Zwar gibt Schülers Monografie hier keine expliziten Ausführungen, doch lässt sich hier vielleicht ein seinem eigenen holistischen Konzept widerstrebender Wissens- bzw. Erkenntnisbegriff vermuten: Die These, dass über die tatsächliche Erkenntnis des Gegenstandsbereichs Religion(en) (religions‐) wissenschaftlich nichts gesagt werden könne, suggeriert, dass es den Gegenstandsbereich unabhängig von jenen Erkenntnisprozessen gäbe, quasi als Entität an sich. Auch wenn das sicher nicht in Schülers Sinn ist, hat solches dann rein logisch Anklänge an ein substanzontologisches und/oder metaphysisches oder gern auch naturalistisches Verständnis von Religion(en) als Phänomen sui generis. 295 Vgl. z. B. noch einmal ebd., 63. 296 Vgl. ebd., 39. 297 „Die triviale Feststellung, dass der Mensch genauso Naturwesen wie Kulturwesen ist, scheint auf einen neuen Prüfstand gekommen zu sein.“ Ebd., 19. Schüler macht hier im Fortlauf seiner Monografie eine Entwicklungsgeschichte des Problems auf: Schon Ende der 80er Jahre könne eine Biologisierung der Religionsforschung konstatiert werden. Vgl. ebd., 31. Das Neue am Naturalismus der CSR, also „spätestens seit der sogenannten kognitiven Wende“, läge dann nicht darin, Religion mit naturwissenschaftlichen (psychologischen und oder biologischen) Theoriensystemen zu erklären, sondern das Phänomen Religion/Religiosität selbst „als Teil der menschlichen Evolution zu biologisieren.“ Ebd., 47. 298 Vgl. ebd., 72. Solches erscheint leicht nachvollziehbar, da Interdisziplinarität rein logisch Disziplinarität vorauszusetzen scheint. 299 Ebd., 211.
146
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
eben darin liege, „dass auch scheinbar disparate [Theorie‐] Ebenen miteinander verbunden sein können und gewisse gegenseitige Abhängigkeiten bestehen.“³⁰⁰ Auffällig ist und bleibt bei all dieser Wechselseitigkeit dennoch der Fokus Schülers auf die Sozialität von Religion(en) und dementsprechend auf das Primat sozio-kulturell kontextualisierender Religionsforschung. Seine – mindestens implizite – Verortung der Religionswissenschaft im universitären Fächerkanon scheint also einen deutlichen Fokus auf Sozial- und Kulturwissenschaften zu haben. Gerade am Beispiel des Religionsbegriffs selbst expliziert er dann auch sein primäres Verständnis genuin religionswissenschaftlichen Arbeitens, wie es sich auch in seiner kontinuierlichen (u. a.) Durkheim-Rezeption zeigt: So sei es hier maßgeblicher Verdienst der Religionswissenschaft, dass sie „einiges geleistet und versucht [hat], den Religionsbegriff immer wieder zu dekonstruieren“³⁰¹ und dabei auf seine „sozialen Aspekte“³⁰² zu untersuchen und so naturalistischen und/oder psychologisierenden Reduktionismen entgegenzuwirken.³⁰³
300 Ebd., 61. Interessant ist, dass Schüler – aus in der religionswissenschaftlichen Außenperspektive der theologischen Verfasserin dieser Arbeit nicht so recht ersichtlichen Gründen – hier versucht, sich gegen vermeintliche metaphysische bzw. gar „theologische“ ontologische HolismusKonzepte zu positionieren, denen es angeblich um Konzepte wie „ganzheitlichen Glauben“ im Dialog mit Naturwissenschaft gehe. Vgl. ebd., 62. Für die Notwendigkeit oder Treffsicherheit dieser Abgrenzung nennt Schüler keine Quellen. Das ließe Raum für die zugegeben steile Vermutung, dass auch in der jüngeren Religionswissenschaft die Verhältnisbestimmung zur Theologie wenn überhaupt, dann nur als unabgeschlossen-polemisch charakterisiert werden kann. Außerdem zeigt sich hier womöglich auch ein eher unterreflektiertes Ontologie- und/oder Metaphysik-Verständnis. Die Vermeidung ontologisch-metaphysischer Aussagen impliziert schließlich trotz allem immer noch einen ontologisch-metaphysischen Grundbegriff. Die mal mehr, mal weniger unterschwelligen Fronten um und innerhalb der Religionswissenschaft, die im Kern unterschiedliche erkenntnistheoretische Grundannahmen haben, zeigen sich bei Schüler auch an anderer Stelle. So lobt er bspw. die Möglichkeiten einer kognitionswissenschaftlichen Erforschung des Verhältnisses zwischen Religiosität und Emotionen als in diesem Fall willkommene naturalistische Alternativen, „die nicht Gefahr laufen müssen, subjektivierende, empathische oder rein phänomenologische Beschreibungen zu sein.“ Ebd., 245. Hier lässt sich ein Seitenhieb sowohl gegen vermeintlich theologische als auch religionsphänomenologische Zugriffe auf Religion(en) vermuten. 301 Ebd., 157 f. 302 Ebd., 158. 303 Interessant ist an dieser Stelle, dass laut Schüler die Entstehung kognitionswissenschaftlichnaturwissenschaftlicher Zugriffe auf Religion(en) selbst der Versuch war, bestimmten sozialwissenschaftlichen Reduktionismen zu widerstreben. Vgl. ebd., 38. Es bleibt an dieser Stelle die Frage offen, inwiefern Schüler selbst diesem Reduktionismus-Vorwurf entgegentreten könnte. Zwar bemüht er sich um eine wie oben beschriebene holistische Herangehensweise. Doch könnte durch das Primat des Sozialen immer noch eine gewisse methodologische Ur-Monokausalität diagnostiziert werden.
4.3 Religionswissenschaft disziplinär
147
Vor dem Hintergrund dieser kurzen Zwischenbilanz lässt sich nun ein – wie immer vorläufiger – Entwurf der Fragestellung einer Religionswissenschaft unter psychologisch-kognitionswissenschaftlichem Zugriff, wie man sie in Ansätzen aus den Darlegungen Schülers ableiten kann, versuchen: Psychologisch-kognitionswissenschaftlich fokussierte Religionswissenschaft fragt nach der Entstehung, den Zusammenhängen und Funktionsweisen religiöser Kognitionen auf Individual- und Sozialebene, indem sie unter dem methodologischen Primat sozialwissenschaftlich fokussierter Kulturwissenschaft kognitionswissenschaftliche Modelle und Theorien zur Erforschung der Genese und Evolution religiöser Vorstellungen auf Mikro- und Makroebene anwendet, um so zu einem umfassenden Religionsbegriff jenseits reduktionistisch-naturalistischer oder -soziologischer Erklärungsmuster zu gelangen.
4.3 Religionswissenschaft disziplinär Nachdem im Bisherigen Religionswissenschaft auf ihre innerdisziplinären Strukturen im Einzelnen hin untersucht wurde, geht es im nun Folgenden darum, ebendiese spezifischen Momente und aus ausgewählten Werken konstruierten Zugriffe zu einem offenenen Gesamtkonzept von Religionswissenschaft als – bei aller intrinsischen Pluralität – eigenständig-spezifischer Disziplin zu systematisieren. Wieder soll dabei also unter dem Vorzeichen des im dritten Kapitel erarbeiteten Differenzkriteriums der Fragestellung – nicht in Analyse, sondern in zusammentragender Setzung – eruiert werden, was die verschiedenen beleuchteten Diskurse zu Religionswissenschaft macht. Dabei wird zunächst versucht, ein integrales Konzept aus einerseits den unter 4.1. besprochenen historischen und systematischen Momenten und andererseits den vier vorgeschlagenen Zugriffen von 4.2. zu erstellen, indem – dem Gedankengang der Fragestellung folgend – nach den zentralen gemeinsamen Erkenntnisinteressen und Forschungsabsichten gesucht wird. Daran schließen sich logisch Betrachtungen der daraus folgenden methodologischen und epistemischen Konsequenzen für das Fach der Religionswissenschaft an.
4.3.1 Das innerdisziplinäre System der Religionswissenschaft Zunächst gilt es also, die zwei historischen und systematischen Momente der Religionswissenschaft und die hier vier konstruierten, exemplarischen Zugriffe in ein konzeptuelles Verhältnis zueinander zu setzen. Dabei kann als Erstes konstatiert werden, dass allen vier Zugriffen religionswissenschaftlicher Forschung beide Grundabsichten sowohl der historischen als auch der systematischen Momente von
148
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
Religionswissenschaft, wie sie unter 4.1. erarbeitet wurden, inhärent sind: Egal ob historisch-philologisch, empirisch-sozialtheoretisch, philosophisch-phänomenologisch oder psychologisch-kognitionswissenschaftlich fokussiert – allen vier Typen ist gemein, dass sie Religionen sowohl in ihrer historischen Genese und aktuellen Verfasstheit untersuchen, als auch aus dem – in unterschiedlicher methodischer Ausführung gewonnenen – Datenmaterial Begriffe, Strukturen, Kategorien und Theorien über Religion(en) als signifikanten Größen in sozialer, kultureller oder evolutionspsychologischer Hinsicht herausarbeiten wollen. Dementsprechend finden sich die beiden schon in den wissenschaftstheoretischen Grundlegungen Wachs gesetzten Grundpfeiler der Religionswissenschaft in allen 4 Zugriffen gleichermaßen – aber eben in unterschiedlicher Ausführung – wieder. So lässt sich – das unter 4.2. vorgestellte Feld von hinten aufrollend – zunächst bei den aus dem Werk Schülers herausgearbeiteten Aspekten eines psychologisch-kognitionswissenschaftlichen Zugriffs als historisch-religionswissenschaftliches Moment resümieren, dass die Entstehung und Manifestation konkret-vorfindlicher religiöser Vorstellungen und Handlungen auf sozial-kognitiver Ebene untersucht werden. Systematisch-religionswissenschaftlich ist dieser Zugriff dadurch, dass es dabei zur Ausarbeitung der körperlichen kognitiven und sozialen, sich wechselseitig bedingenden Strukturen und Mechanismen kommt, die zu einer ebensolchen Entstehung und Manifestation religiöser Phänomene führen. Der aus der Monografie Lanczkowskis konstruierte Zugriff gestaltet sich ebenfalls insofern als historisch-religionswissenschaftlich, als dass sich auch hier Religionen in ihrer historischen Genese und aktuellen Verfasstheit als Ausgangspunkt seiner Betrachtungen zeigen. In der grundlegenden Absicht, sowohl eben den Einzelreligionen als historisch-vorfindlichen Größen als auch dem Allgemeinbegriff der „Religion an sich“ gerecht zu werden, zeigt sich das (allerdings durch eine, wie schon unter 4.2.3. ausgeführte, sehr spezifische implizite Ontologie geprägte) systematisch-religionswissenschaftliche Moment seines Arbeitens. Der anhand Kippenbergs und von Stuckrads Ansatz erarbeitete Zugriff trägt ebenfalls beide Momente der Religionswissenschaft in sich. Mit einem Fokus auf religiöse Handlungen als ihrem empirischen Datenmaterial ist diese Arbeit insofern historisch-religionswissenschaftlich, als dass auch hierbei vorfindlich-konkrete Religionen als kulturelle Symbolsysteme in ihrem Entstehen und Sein im Blick sind. Der systematisch-religionswissenschaftliche Moment zeigt sich dann in genau dieser spezifisch sozialtheoretisch-kulturwissenschaftlichen Forcierung, indem konstatiert wird, dass Religionswissenschaft – quer zu den einzelnen religionsbezogenen Disziplinen bzw. diese moderierend – den Diskurs um und über Religionen beschreibt und die zugrundeliegenden Strukturen dieses Diskurses offenlegt.
4.3 Religionswissenschaft disziplinär
149
Auch und gerade³⁰⁴ im aus dem Einführungswerk Rüpkes konstruierten Zugriff lassen sich schlussendlich ebenfalls beide Grundaspekte von Religionswissenschaft aufzeigen. So wird zwar betont, dass alle religionswissenschaftliche Forschung in ihrem Grundimpetus historisch-religionswissenschaftlich sei; außerdem wird sich explizit gegen eine der Heuristik vorgeschaltete Religionssystematik³⁰⁵ ausgesprochen. Doch zeigt dieser Ansatz selbstverständlich auch ein in sich systematischreligionswissenschaftliches Moment: Denn der vorgestellte kontrollierte Vergleich als grundlegend historische Methode hat ja gerade zum Ziel, auf Basis konkretempirischer Datenbefunde vergleichbare Kategorien und Begrifflichkeiten herauszuarbeiten, die dann wieder auf damit eben (historisch-soziokulturell kontextualisiert) vergleichbare weitere Daten angewendet werden können. Auch hier geht es also – bei aller explizit historischen Titulierung – um das Generieren von Begriffen, Strukturen und Theorien um und über Religion(en). Es zeigt sich summa summarum offenkundig bei allen vier erarbeiteten Zugriffen,³⁰⁶ dass sowohl historisch- als auch systematisch-religionswissenschaftliche Momente ihnen genuin inhärent³⁰⁷ sind – nämlich als ebenjene zwei Grundpfeiler von Religionswissenschaft, als die sie unter 4.1. auch vorgestellt wurden. Auf ebendiesem zweifachen Fundament ruhen die vier Zugriffe, die sich, wie eben und in 4.2. exemplarisch dargelegt, in ihren jeweiligen methdologisch-praxeologischen Fokussierungen zwar unterscheiden, aber durch diese gemeinschaftliche zweifache Grundierung auch in ihren zentralen Erkenntnisinteressen bzw. Forschungsabsichten überschneiden. Denn darin, so lässt sich nun wissenschaftstheoretisch systematisierend erschließen, liegt dann auch unter dem Vorzeichen der Fragestellung als wissenschaftstheoretischem Differenzkriterium das, was die hier vorgeschlagenen konstruierten Vier zu einem disziplinären Diskurs verbindet: Die grundlegend gemeinsame Forschungsabsicht, Religion(en) in ihrer Genese und Konstitution nicht nur im konkret-empirischen Einzelnen zu beschreiben, sondern auf einer Meta-Ebene implizit oder explizit – durch Systematisieren, Kategorisieren, Theoretisieren etc. – vergleichbar zu machen, ohne dabei bestimmten epistemischen
304 Rüpke selbst referiert äußerst explizit auf die seinen Ausführungen nach epistemisch problematische Zweiteilung der Religionswissenschaft durch Wach, wie unter 4.1. und 4.2.1. bereits dargelegt wurde. 305 Eben im Wachschen Sinne. 306 Was im Grunde als beinahe Zirkelschluss auch zu erwarten war. Schließlich wurden sowohl die zwei Momente als auch die 4 Zugriffe der Religionswissenschaft aus ihrer Fachgeschichte abgeleitet. 307 Vgl. dazu noch einmal Seiwert, Systematische Religionswissenschaft, 3 f.
150
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
und/oder methodologischen Reduktionismen zu verfallen.³⁰⁸ Solcherart verstanden kann also in der Logik der bisherigen Kapitel konstatiert werden, dass Religionswissenschaft als in sich durch starke, fachgeschichtlich gewachsene Pluralität gekennzeichnete Disziplin dadurch von anderen wissenschaftlich-religionsbezogenen Diskursen abhebt, als dass sie eben historisch-systematisierend (in unterschiedlicher forschungstechnischer Ausführung, inner- und interreliös) vergleicht – und das nicht nur als Methode, sondern eben auch als metatheoretisch denkerisches Ziel der Forschung: „Von größerer Bedeutung ist hier, dass das gesamte metasprachliche Vokabular der Religionswissenschaft – ob im Einzelfall problematisch oder nicht – das Produkt vergleichender Studien ist. Vergleiche auf der Makro- und (in geringerem Umfang) der Mikroebene liefern Termini, Modelle und Theorien für die Religionswissenschaft. Auch Studien, die nicht im engeren Sinne vergleichen, beziehen sich doch in der einen oder anderen Weise immer auf das vorhandene Vokabular und unterziehen es einer ständigen kritischen Prüfung und Modifizierung. Der Vergleich kann somit nicht nur als eine bedeutende Untersuchungsmethode in der Religionswissenschaft gelten, sondern als integraler Bestandteil des religionswissenschaftlichen Erkenntnisinteresses.“³⁰⁹ Damit unterscheidet sich die hier vorgenommene innerdisziplinäre Strukturierung von der Wachs – und folgt ihr gleichzeitig. Denn zwar werden Religionsgeschichte und Systematische Religionswissenschaft nicht als zwei epistemisch geradezu bipolare Grundstoßrichtungen gekennzeichnet, von der die eine das Werden, die andere das Sein der Religionen zum Gegenstand hätte. Aber dennoch ist es als zentrales und Disziplinen-generierendes Erkenntnisinteresse eben sowohl das Systematisierende, weil kontrolliert Vergleichende und Vergleichbar-Machende von Religion(en), als auch eben das Historisch-Religionswissenschaftliche, weil geschichtlich-empirisch Kontextualisierende von Religion(en),³¹⁰ was jene vier vorgestellten, fachgeschichtlich gewachsenen Zugriffe zu einem religionswissenschaftlichen Diskurs zu verbinden scheint.
308 Tatsächlich scheint gerade diese Abwehrhaltung gegen jeweilige als Fronten gesetzte Reduktionismen ein wichtiger Identity Marker von Religionswissenschaft zu sein. Wehrt sich Rüpke gegen eine vor- bzw. überhistorische Religionssystematik und positionieren sich von Stuckrad und Kippenberg gegen vermeintlich innerreligiöse Perspektiven einnehmende Religionsphänomenologie, so stellt sich Lanczkowski gegen alle Ansätze, die Religion(en) nicht „als Religion“ selbst, also als eigenständiges Phänomen wahrnehmen. Und Schülers antireduktionistische Tendenzen werden in seinem gesamten, „holistischen“ Ansatz auf Religion(en) deutlich, bei dem versucht wird, naturalistisch-individualistischen, kognitivistisch monokausal argumentierenden Herangehensweisen eine Alternative gegenüber zu stellen. 309 Freiberger, Der Vergleich, 216. Hervorhebung C. N. 310 Hier also auch mit und gegen Rüpke.
4.3 Religionswissenschaft disziplinär
151
4.3.2 Methodologische und epistemische Konsequenzen Das im Vorherigen ausgearbeitete, den religionswissenschaftlichen Diskurs verbindende Spezifikum des Vergleichs als metatheoretische Forschungsabsicht hat gewisse denkerische Konsequenzen in methodologischer und epistemischer Hinsicht. So ist methodologisch zunächst auf das Verhältnis der in dieser Arbeit konstruierten vier Zugriffe religionswissenschaftlicher Forschung aus 4.2. und eben der für das Fach so identitätsstiftenden Komparativität einzugehen. Denn bisher scheint allgemein, entgegen der Position dieser Arbeit (bzw. diese Position nur zur Hälfte einschließend), der religionswissenschaftliche Vergleich v. a. als methodologisches Spezifikum³¹¹ zu gelten – und nicht als epistemisches Kriterium im Kontext der Forschungsabsicht, was zu einem großen Teil aus der Fachgeschichte der Religionswissenschaft hergeleitet werden kann. Denn da, wie in Kapitel 2 schon zur Genüge dargelegt, Religionswissenschaft maßgeblich im Kontext der Etablierung verschiedener Geistes- und Kulturwissenschaften³¹² entstand, ist es auch logisch (wenngleich nichtsdestotrotz explizit zu machen),³¹³ dass Religionswissenschaft methodologisch von diesem Entstehungskontext bedingt ist:³¹⁴ In zentralen me-
311 So ja z. B. auch bei Rüpke – siehe Kapitel 4.2.1. 312 Vgl. zum Verständnis von Religionswissenschaft im Kontext der Kulturwissenschaften Kapitel 4.4.1. 313 Denn schließlich darf nicht aus dem Blick geraten, dass Methode in vielen Verhältnissetzungen immer noch als klassisches Differenzkriterium der Religionswissenschaft gegenüber anderen Disziplinen, namentlich der Theologie gesetzt wird. 314 Wobei anzumerken ist, dass solches von Fachvertretenden wie bspw. dem bereits rezipierten Rudolph auch nicht aus der Fachgeschichte, sondern auf wissenschaftstheoretischer Ebene aus dem Gegenstandsbereich heraus begründet wird: „Da das Objekt der Religionswissenschaft Teil der Geschichte, der Kultur, der Literatur, Sprache, einer Ethnie und Gesellschaft ist, hat sie auch Teil an den Methoden der Kulturwissenschaften, vor allem im Bereich der Komparatistik.“ Rudolph, Kurt, Vergleich, religionswissenschaftlich, in: Cancik, Hubert/Gladigow, Burkhard/Laubscher, Matthias (Hg.), Säkularisierung – Zwischenwesen. Register (HRWG 5), Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 2001, 314 – 323, 319. Dem schließt sich die hier vorliegende Arbeit nicht an (ohne sich explizit dagegen auszusprechen), da – wie in Kapitel 3 schon ausgeführt – Gegenstandsbereiche hier als zu positionell und dynamisch gesehen werden, als dass sie zu wissenschaftstheoretischen Argumentationen der MetaEbene herangezogen werden. Dass Rudolph hier stärker auf der Ebene der Gegenstandsbereiche argumentiert als auf der der Fachgeschichte, kann vielleicht darin begründet sein, dass es eben diese Geschichte der Komparatistik innerhalb der Religionswissenschaft ist, die er in sehr kritisches Licht stellt: So verweist Rudolph darauf, dass im Zuge der Entstehung religionswissenschaftlicher Komparatistik das unreflektierte vor-wissenschaftliche, stark ethnozentrische Interesse verschiedener schulbildenden Forschenden darin gelegen habe, durch Vergleichen das Wesen der Religion und das Christentum als die (bisher) vollkommenste Verwirklichung dieses Wesens herauszustellen; was Rudolph in der bis
152
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
thodologischen Reflexionen (hier aus dem Klassiker des Handbuchs religionswissenschaftlicher Grundbegriffe) wird dann auch „religionswissenschaftliche Komparatistik“³¹⁵ als die Anwendung der „kulturwissenschaftliche[n] Methode der Vergleichung auf den Bereich der Religionen und ihrer Sachverhalte in Geschichte und Gegenwart“³¹⁶ beschrieben. Dementsprechend vollziehe sich religionswissenschaftliche Komparatistik auf zwei „Ebenen“³¹⁷ – der zeitlichen, also unter chronologischer Fokussierung vergleichenden, und der räumlichen, also unter topografischen Gesichtspunkten religiöse „Sachverhalte“³¹⁸ ins Verhältnis setzenden Ebene. Dabei habe sie eben die Ziele, die das Vergleichen als kulturwissenschaftliche Methode allgemein hat, nämlich das Generieren „genereller Aussagen […], Typenbildungen […], Klassifizierungen […], Theorienbildungen“³¹⁹ etc. pp. Hier ist nun sofort zweierlei augenscheinlich, nämlich erstens, dass das Vergleichen als Methode über seine Ziele, mithin also seine Absichten charakterisiert wird; und zweitens, dass ebendiese Ziele genau jene sind, die, wie bereits unter 4.1. ausgeführt wurde, das systematische Moment der Religionswissenschaft kennzeichnen. Es zeigt sich nun also deutlich, was oben schon konstatiert wurde: Dass der religionswissenschaftliche Vergleich bzw. das vergleichbar Machen nicht einfach nur ein (durchaus ja grundlegender) Aspekt der Methodologie der Religionswissenschaft ist, sondern die das Fach – durch das Wechselspiel von historischer und systematischer Religionswissenschaft – als eigenständige Disziplin konstituierende Absicht. ³²⁰ Dementsprechend können die vier vorgeschlagenen Zugriffe der Religionswissenschaft aus 4.2. nun auch wieder derart zur komparativen Methode ins Verhältnis gesetzt werden, als dass sie darin – bei aller von jedem von ihnen betonten interdisziplinären Ausrichtung der Religionswissenschaft – ihre gemeinsamen ultimativen Ziele auf der methodologisch-epistemischen Meta-Ebene haben, wie es im vorherigen Unterkapitel ja auch schon ausgeführt wurde. Methodologisch kann also resümiert werden, dass alle vier Zugriffe sich ihren verschiedenen Stoßrichtungen entsprechenden Methodiken bedienen – seien es soziokulturelle Kommunikations-
dahin starken Dominanz christlicher Theologie im Feld der Religionsforschung begründet sieht.Vgl. Rudolph, Vergleich, 315 f. 315 Ebd., 314. 316 Ebd. 317 Ebd., 319. Vgl. hier auch zum Folgenden. 318 Ebd. Anstelle des für Rudolph sicherlich belasteten, weil an Religionsphänomenologie erinnernden Begriffs der religiösen „Phänomene“. 319 Ebd., 318. Hier eine umfassende Auflistung der Chancen und Risiken. 320 Worin sich in allgemein wissenschaftstheoretischer Perspektive sehr deutlich wieder der zirkuläre Zusammenhang von Epistemik und Methodik zeigt – denn Absichten, Erkenntnisinteressen etc. sind, wie in Kapitel 3 auch schon ausgeführt wurde, zentrale Punkte der Erkenntnistheorie. Vgl. zu diesem Zirkel auch Nagel, Theologie, 213 f.
4.3 Religionswissenschaft disziplinär
153
und Strukturanalysen, die holistisch intendierte Anwendung kognitionswissenschaftlicher Konzepte wie der embodied cognition oder phänomenologische Eidetik. In all diesen verschiedenen Methodiken liegt ein sowohl empirisch- als auch hermeneutisch-deskriptiver Impetus: Religionswissenschaft, in diesen vorgestellten vier Zugriffen, versucht offensichtlich, religiöse Phänomene durch Anwendung verschiedener, dem jeweiligen Typus entsprechender Methoden zu beschreiben und zu verstehen ³²¹ – mit eben dem metatheoretischen Großziel, sie vergleichbar zu machen. Dadurch gestaltet sich Religionswissenschaft in allen vier Zugriffen (trotz und gerade angesichts ihrer hermeneutisch- und empirisch-deskriptiven Ausrichtung) wie jede Wissenschaft als positionell. ³²² Gerade unter dem Aspekt des Vergleichs – sowohl als methodologische als auch als epistemische Größe – wird dies deutlich, denn „Sprache, Interessen und Wertvorstellungen beeinflussen auf vielfältige Weise die vergleichende Arbeit“.³²³ Die Wissenschaftlichkeit der Religionswissenschaft ist hier – wie eben auch bei Wissenschaft im allgemeinen – durch die Herstellung potentieller intersubjektiver Überprüfbarkeit gegeben. Gerade in Absicht und Vollzug des Vergleichs wird dies nicht nur deutlich, sondern vor allem möglich, denn nur durch „Relativierung“³²⁴ des „Standpunkt[s] des Komparatisten“,³²⁵ also „in einer Art dialektischer Reflexion im Verfahren [des Vergleichs] selbst“³²⁶ wird der vergleichende Forschungsprozess konkret soziokulturell (und fachtraditionell) kontextualisiert und somit intersubjektiv überprüfbar. Positionalität ist dementsprechend Bedingung und Gegenstand des Vergleichs selbst, was potentiell die „Einschränkung und Minimalisierung ethnozentrischer Standpunkte“³²⁷ zur Folge hat. Das ist für Religionswissenschaft insofern besonders wichtig, als dass die Ge-
321 Mit Beschreiben und Verstehen sind hier keine konkreten Methoden gemeint, wie das in früheren Konzeptionen (Systematischer) Religionswissenschaft noch war. Vgl. Seiwert, Systematische Religionswissenschaft, 7. Sondern vielmehr können sie als zwei epistemische mittlere Zielaspekte gesehen werden, deren Verbindung wiederum in der Absicht des Vergleichs liegt. Empirie und Hermeneutik sind an dieser Stelle also wieder in ebenfalls solchem weitesten Sinne zu verstehen: Mit empirisch ist mithin gemeint, dass alle religionswissenschaftlichen Forschungsprozesse datenbasierte Aussagen zum Ziel haben. Hermeneutik ist ihnen dahingehend inhärent, als dass in ihrem Vollzug diese Daten interpretiert werden. Vgl. z. B. zu diesem weiter gefassten HermeneutikBegriff Veraart, Albert/Wimmer, Reiner, Art. Hermeneutik, in: EPhW 2 (1984), 85 – 90, 85. 322 Im Sinne des in dieser Arbeit im 3. Kapitel vorgestellten Begriffs von Positionalität – hier auf Ebene des forschenden Subjekts. Vgl. dazu auch Freiberger, Der Vergleich, 207. 323 Rudolph, Vergleich, 321. 324 Ebd. 325 Ebd. 326 Ebd. 327 Ebd.
154
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
fahr von bzw. Sorge vor Ethnozentrismen³²⁸ ein fachgeschichtliches Erbe ist, das allerdings verschiedentlich eingeordnet werden kann, was hier nur kurz skizziert werden soll: Ihrem Selbstverständnis nach versucht Religionswissenschaft wie bereits erwähnt in allen vier Zugriffen reduktionistischen Betrachtungen von Religion(en) entgegenzuwirken. Ziel ist hier größtmögliche Objektivität ³²⁹ – welche logischerweise bei nicht-reflektierten Ethnozentrismen gefährdet ist: Und zwar einerseits allgemein, weil dann intersubjektive Überprüfbarkeit nicht mehr gegeben ist; und andererseits konkret-inhaltlich, weil dann nicht-kommunizierte, positionellepistemische, (vor‐) wissenschaftliche Grundannahmen den Forschungsprozess aktiv, aber eben unreflektiert mit bestimmen. Genau an dieser Stelle wird dann vielleicht auch das bereits mehrfach angesprochene methodologisch-epistemische Grundproblem evident, das innerhalb der Religionswissenschaft mit Religionsphänomenologie besteht: Religionsphänomenologische Zugriffe haben prinzipiell genauso wie die drei anderen die Absicht, den Einzelphänomenen, also den konkret empirisch-vorfindlichen religiösen Erscheinungen gerecht zu werden und dafür bzw. darauf aufbauend Strukturen, Typologien, Theoretisierungen etc. herauszuarbeiten. Innerreligionswissenschaftlich problematisch ist v. a. im konkreten Beispiel aus 4.2.3. allerdings die substantielle, auf keine Weise empirisch hergeleitete Füllung des Religionsbegriffs mit dem Bezug zum Heiligen als eigenständiger Größe. Solches verrät in der religionswissenschaftlichen Diskurslogik steil-ontologische³³⁰ Vorannahmen (der Existenz einer Sphäre des Heiligen überhaupt), anhand derer schon allein die Kategorisierung nicht-/religiös geschieht, so dass weitere systematischreligionswissenschaftliche Analysen nicht überprüfbar sind.³³¹ 328 Vgl. z. B. zu einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem Ethnozentrismusproblem des Religionsbegriffs der Religionswissenschaft Bergunder, Umkämpfte Historisierung, 55. Vgl. dazu auch Laack, Isabel, Wozu, 190 ff. 329 „Objektiv“ ist hier allerdings nicht im alltagssprachlichen positivistisch-realistischen Sinne zu verstehen, sondern eher im Sinne einer dem Objekt, also „dem Gegenstand, wenn er in eine bestimmte Fragestellung gerückt ist, angemessene“ Erkenntnis. Bultmann, Das Problem, 229. 330 Im geradezu klassisch-metaphysischen Sinne. 331 In verschiedenen religionswissenschaftlichen Fachkonzeptionen wird diese spezifische Positionalität mit der vermuteten christlichen Religiosität des forschenden Subjekts selbst begründet. In solchen Argumentationskontexten kann das dazu führen, dass der Forschungsprozess des Subjekts insgesamt dann als in einer religiösen Innenperspektive stehend gesehen und dann – der Logik des Differenzkriteriums der Perspektive folgend – nicht als Religionswissenschaft, sondern als (Krypto‐) Theologie gekennzeichnet wird. Vgl. dazu z. B. die fachgeschichtlich hergeleiteten, wissenschaftstheoretischen Beschreibungen eines „theologischen Zugriffs“, als deren Vertretende dann Gründungsfiguren der Religionsphänomenologie, wie Otto oder Heiler, genannt werden, bei Gladigow, Burkhard, Gegenstände und wissenschaftlicher Kontext von Religionswissenschaft, in: Ders./Cancik, Hubert/Laubscher, Matthias (Hg.), Systematischer Teil. Alphabetischer Teil: Aberglaube – Antisemitismus (HRWG 1), Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1988, 26 – 40, 26.29 – 31.
4.3 Religionswissenschaft disziplinär
155
Dem entgegen wird innerhalb der Religionswissenschaft immer wieder die Notwendigkeit des methodologischen Atheismus/Agnostizismus laut,³³² der sich ontologischer Aussagen enthalte.³³³ Es ist nun an dieser Stelle wieder nur am Rande, allerdings erneut grundsätzlich kritisch anzumerken, dass solche Forderungen nicht aufgehen können: Es gibt – ganz basal – kein epistemisches Nicht-Verhalten zu ontologischen Fragestellungen.³³⁴ Jedes Aussagesystem funktioniert schon allein sprachlich nur über implizite oder explizite Ontologie. Jedes der vier auf Aspekte religionswissenschaftlicher Zugriffe untersuchte Werk aus Kapitel 4.2. trägt solche impliziten Ontologien als forschungstechnische Vorbedingungen mit sich.³³⁵ Ein v. a. wissenschaftstheoretisch kommunikatives Grundproblem der Religionswissenschaft insgesamt, dass sich am allerdings durchaus problematischen Beispiel der Religionsphänomenologie besonders deutlich zeigt³³⁶ und gleichzeitig aber die Verhältnisbestimmungen zu anderen religionsbezogenen Wissenschaften (vor allem allerdings der Theologie)³³⁷ insgesamt erschwert, könnte dann darin liegen, dass jene impliziten Ontologien an keiner Stelle bewusst geschweige denn transparent gemacht werden³³⁸ und somit der grundsätzlichen Maßgabe der intersubjektiven Überprüfbarkeit nur bedingt entsprochen wird.
332 Vgl. dazu bereits Kapitel 3 und vor allem die Ausführungen in 5.3.2. Es wäre zu überprüfen, ob das Schlagwort des methodologischen Agnostizismus, einer allein begrifflich hochgradig voraussetzungsvollen Wortkombination, auch in anderen interdisziplinären Diskursen bemüht wird – oder nur in (teilweise hochgradig polemischer) Abgrenzung von Theologien, denen man implizit dadurch den Status einer Wissenschaft abzusprechen versucht. 333 So z. B. in die Richtung gehend Rüpke. 334 Vgl. Kippenberg/Stuckrad, Einführung, 92. 335 Gutes Beispiel innerhalb dieser Arbeit ist dafür z. B. der von Schüler vorgestellte Ansatz und seine Betrachtung der Glossolalie, deren Entstehung kognitionswissenschaftlich und sozialtheoretisch erklärt wird. Solche Analysen sind kein Nicht-Verhalten zur Ontologie, sondern eine bewusste (und durch die Forschungsfrage ja durchaus begründete) Entscheidung für – klassisch gesprochen – methodologischen Atheismus, womit sehr konkrete metaphysisch-ontologische Grundannahmen einhergehen, die den Forschungsprozess genuin mitbestimmen. 336 Religionsphänomenologie, die nicht unter ähnlichen substanzontologisch überfüllten Religionsbegriffen fungiert und die Methode des phänomenologischen Vergleichs z. B. auf subjekt- bzw. rezeptionsästhetischer Ebene o. ä. anwendet, stellt dann also im Grunde kein epistemisches Problem für Religionswissenschaft dar und müsste prinzipiell in den religionswissenschaftlichen Diskurs integrierbar sein. Vgl. als solche die Neustil-Phänomenologie bei z. B. Waardenburg, Religionsphänomenologie, 741. 337 Näheres dazu unter 4.4.2. 338 Zumindest war das bei keinem der vier vorgestellten Zugriffe der Fall.
156
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
4.4 Religionswissenschaft interdisziplinär Im Anschluss an diese kurze innerdisziplinäre Systematisierung von Religionswissenschaft soll nun ein ebenfalls knapper, durch das Vorzeichen der Fragestellung als wissenschaftstheoretischem Differenzkriterium gestraffter Blick auf die Positionierung von Religionswissenschaft als eigenständiger Disziplin im universitären Fächerkanon vorgenommen werden.
4.4.1 Verortung im universitären Fächerkanon: Religionswissenschaft als Kulturwissenschaft Im Mainstream der religionswissenschaftlichen Selbstverortungen der letzten Jahrzehnte wurde die eigene Disziplin gesamt-enzyklopädisch wiederholt als kulturwissenschaftlich eingeordnet.³³⁹ Dies hat sehr wahrscheinlich mit langfristigen Entwicklungstendenzen auf der wissenschaftlichen Großebene zu tun. So wird der Cultural Turn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – wie schon unter 4.2.2. angesprochen – geradezu als ein Wendepunkt innerhalb der Religionsforschung gesehen, der ursächlich gewesen sei für das Ende der Vorherrschaft religionsphänomenologisch bis theologisch dominierter Ansätze; also solcher Konzeptionen, die die (vermeintlich) religiöse Innenperspektive zum Bestandteil des Forschungsprozesses erhoben und die „Religion“ als ein für sich existentes, sich in Einzelreligionen nur unterschiedlich manifestierendes Phänomen sui generis voraussetzten. Und natürlich ging mit dem Cultural Turn auch eine ontologisch-epistemische Verschiebung innerhalb der (Geistes‐) Wissenschaften einher:³⁴⁰ Anstatt Fächer oder Forschungsprogramme nach substantiellen Gegenständen zu differenzieren, werden „formale logische Kriterien“³⁴¹ bzw. strukturelle Interpretativa zum spezifizierenden Kriterium: „‚Kultur‘ ist kein Gegenstand neben anderen Gegenständen. ‚Kulturwissenschaft‘ ist keine spezifische geistes- oder sozialwissenschaftliche Disziplin. […] [N]icht eine Partialperspektive, sondern eine Totalperspektive ‚Kultur‘
339 So z. B. durchgehend im Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe – vgl. Kohl, Geschichte, 261. Oder vgl. systematisch Gladigow, Gegenstände, 32 – 38. Vgl. aber auch Hock, Einführung, 9. Vgl. eine kritischere Auseinandersetzung bei Figl, Einleitung, 28 f. Vgl. auch Frenschkowski, Marco, Der Teil und das Ganze. Wovon handelt Religionswissenschaft?, in: Court, Jürgen/Klöcker, Michael (Hg.), Wege und Welten der Religionen. Forschungen und Vermittlungen. Festschrift für Udo Tworuschka, Frankfurt a. M. 2009, 113 – 124, 123. 340 Vgl. parallel dazu Kapitel 5.4.1. 341 Därmann, Iris/Jamme, Christoph, Art. Kulturwissenschaft(en), in: EnzPh 2 (2010), 1353 – 1359, 1355.
4.4 Religionswissenschaft interdisziplinär
157
wird im kulturwissenschaftlichen Forschungsprogramm eröffnet. Jeder Gegenstand der Geistes- und Sozialwissenschaften kann und soll nun als kulturelles Phänomen rekonstruiert werden“.³⁴² Dahinter steht ein im Laufe der Entstehung und Pluralisierung kulturwissenschaftlicher Konzeptionen zwar ausdifferenzierterer Kulturbegriff im Sinne eines heuristischen Schlüssels, doch lässt sich der prinzipielle Denkansatz durchaus auf einen zentralen Aspekt³⁴³ beinahe alltagssprachlicher Verständnisse von Kultur zurückführen: Kultur als „das, was die Menschen aus sich und ihrer Welt machen und was sie dabei denken und sprechen.“³⁴⁴ Kultur ist demnach alle menschliche Praxis und – in gewissem Sinne – Theorie. Ergo kennzeichnen sich kulturwissenschaftliche Zugriffe nicht durch spezifischen Disziplinen im Einzelnen³⁴⁵ angehörige Methodiken oder Ansätze aus, sondern sie gestalten sich vielmehr als quer zu diesen stehende „Forschungsprogramm[e]“,³⁴⁶ die nach den spezifischen (je nach forschungstechnischem Fokus im Einzelnen unterschiedlich methodologisierten und kategorisierten) zugrundeliegenden Strukturen menschlichen Handelns und Denkens fragen. Kulturwissenschaft – auch und gerade in diesem disziplinenübergreifenden Verständnis – ist dann, wie alles wissenschaftliche Treiben, positionell. Vor allem die soziokulturell bedingte Dynamizität des Heuristikums des Kulturbegriffs hat logisch die soziokulturelle Abhängigkeit resp. „Kontingenz“³⁴⁷ kulturwissenschaftlicher Forschung insgesamt – also sowohl auf erkenntnistheoretischer als auch auf gegenständlicher Ebene – zur Folge. Mit dieser ontologisch-epistemischen Verschiebung von Geisteswissenschaf³⁴⁸ ten hin zu einem heuristisch leitenden kulturwissenschaftlichen Forschungsprogramm konnte und kann der Großteil der Religionswissenschaft aus naheliegenden, bereits wiederholt angesprochenen Gründen mitgehen bzw. hat diese Verschiebungen selbst mit erlebt und gestaltet. Eine kulturwissenschaftliche Fül-
342 Reckwitz, Andreas, Die Kontingenzperspektive der ‚Kulturʻ. Kulturbegriffe, Kulturtheorien und das kulturwissenschaftliche Forschungsprogramm, in: Jaeger, Friedrich/Liebsch, Burkhard (Hg.), Grundlagen und Schlüsselbegriffe (Handbuch der Kulturwissenschaften 1), Stuttgart/Weimar 2011, 1 – 20, 1. Hervorhebung C. N. 343 Zu etwas differenzierteren Überlegungen zu verschiedenen Verständnissen von Kultur vgl. z. B. Schwemmer, Oswald, Art. Kultur, in: EPhW 2 (1984), 508 – 511, 508. 344 Maurer, Reinhart, Art. Kultur, in: HphG 2 (1973), 823 – 832, 823. Hervorhebung C. N. 345 Zumindest wird dieses Verständnis von Kulturwissenschaft in dieser Arbeit zugrunde gelegt. Dass es alternativ dazu auch Konzeptionen gibt, die Kulturwissenschaft als eigenständiges Fach definieren, sei nicht verschwiegen und stellt auch keinen inhärenten Widerspruch dar – kann hier aufgrund eines anderen wissenschaftstheoretischen Fokusses jedoch nicht mit reflektiert werden. Vgl. dazu kurz Reckwitz, Die Kontingenzperspektive, 1. 346 Ebd., 2. 347 Ebd., 8. 348 Im klassisch Diltheyschen Sinne verstanden.
158
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
lung des Religionsbegriffs mit all ihren methodologischen Implikationen bietet Chancen zur Verhinderung ebenjener Ethnozentrismen und Reduktionismen, von denen sich Religionswissenschaft – bedingt durch ihr fachgeschichtliches bzw. fachgeschichtlich tradiertes Trauma der früheren religionsphänomenologischtheologischen Dominanz – bis heute absetzen will:³⁴⁹ Anstatt nach einem wie auch immer zu definierenden Wesen von Religion zu suchen, konzentriere sich Religionswissenschaft kulturwissenschaftlich betrieben auf die „Aufarbeitung der Elemente des Zeichensystems“³⁵⁰ Religion im konkret vorfindlichen, soziokulturell kontextualisierten Einzelfall. Im Extremfall führte dieser Ansatz zu Positionen innerhalb der Religionswissenschaft, die den Religionsbegriff durch konsequentualistische Anwendung spezifischer kulturwissenschaftlicher Kriteriologien vollends im Kulturbegriff auflösten.³⁵¹ Im Hauptstrang kulturwissenschaftlich selbstverorteter Religionswissenschaft dürften jedoch solche Ansätze vertreten sein, die Religion(en) als ein kulturelles Phänomen bzw. als eine Praxis der menschlichen Kultur neben anderen (wie Politik o. ä.) verstehen und dementsprechend den Gegenstandsbereich der Religionswissenschaft genau daraufhin zugespitzt sehen.³⁵² Die unter 4.2. vorgestellten vier Zugriffe innerhalb von Religionswissenschaft lassen sich nun im Folgenden grob in diese innerfachliche Gesamtentwicklung einordnen – auch wenn damit natürlich keinerlei Anspruch auf Konzeptualität oder vollständiger Auflösung in ebensolche kulturwissenschaftliche Programmatik verbunden ist. Beginnend mit dem Anhand des Einführungswerkes von Rüpke konstruierten historisch-philologischen Zugriff lässt sich sofort herausarbeiten, dass ein solcher Ansatz sich in den Duktus der Kulturwissenschaft integrieren lässt. Die Betonung einer soziokulturellen Bedingtheit des Religionsbegriffs selbst und der daraus resultierenden Notwendigkeit historisch-soziokulturell kontextualisierter Analysestrukturen zeigt das Bewusstsein für die – oben angesprochene – Kontingenz religionswissenschaftlicher Praxis. Anstelle einer forschungstechnisch vorausgehenden substantiell gefüllten Religionssystematik fungiert hier, wie unter 4.2.1. zur Genüge ausgeführt, „Religion“ als heuristischer Begriffsinhalt, mithilfe dessen dann im kontrollierten Vergleich die sozialen und kommunikationstheoretischen Strukturen herausgearbeitet werden, die dem Sinnsystem Religion zugrunde liegen.
349 Vgl. z. B. zum Ansatz einer Religionshermeneutik als Kulturhermeneutik Zhdanov, Zwischen Religionsphänomenologie, 109 – 114. 350 Gladigow, Gegenstände, 33. 351 Prominent dafür ist die sogenannte „Römische Schule“ nach Dario Sabbatucci. Vgl. ebd., 19.32 f. 352 Vgl. Figl, Einleitung, 28 f.36 f.
4.4 Religionswissenschaft interdisziplinär
159
Bei dem aus dem Werk von Kippenberg und von Stuckrad erarbeiteten empirisch-sozialtheoretischen Zugriff erscheint eine ebensolche Analyse beinahe hinfällig, ordnen die Autoren ihren Ansatz insgesamt ja explizit in kulturwissenschaftlich fokussierte Herangehensweisen ein. Doch lässt sich der Vollständigkeit halber auch hier noch einmal systematisieren, dass Religion als ein Sinn konstituierendes Teilsystem menschlicher Kultur Gegenstand der Forschung ist. Zum Paradebeispiel für diesen kulturwissenschaftlichen Fokus innerhalb der Religionswissenschaft wird dieses Konzept vor allem auch durch die Betonung der inhärenten Interdisziplinarität von Religionswissenschaft, die letztlich quer zu den klassischen Fachgrenzen die kommunikationstheoretischen Strukturen in wissenschaftlichpluralen Perspektiven erforschen soll. Religionswissenschaft wird hier also geradezu in kulturwissenschaftliche Denkprogrammatik aufgelöst, behält ihre Spezifität allerdings eben durch die Fokussierung auf ihren Gegenstandsbereich Religion(en). Schwierig erscheint eine solche Einordnung nach dem oben Genannten auf den ersten Blick bei dem aus Lanczkowskis Monografie konstruierten philosophischphänomenologischen Zugriff. Doch lässt sich selbst bei diesem vermeintlich offensichtlichen Gegenspieler zur Kulturwissenschaft als epistemisch-ontologischer Verschiebung schon Teilaspekte dessen herauskristallisieren, was Religionswissenschaft im Rahmen eines kulturwissenschaftlichen Programms charakterisiert – ohne diesen Ansatz damit krampfhaft harmonisieren zu wollen. Aber so betont auch Lanczkowski einerseits die der Religionsforschung inhärente Multidisziplinarität und dementsprechend andererseits die Notwendigkeit der Kontextualisierung des religiösen Datenmaterials. Religionsphänomenologie sei letztlich empirische Religionswissenschaft,³⁵³ da sie nicht normativ konstruieren, sondern – jeglichen Reduktionismen wehrend – dem religiösen Phänomen selbst gerecht werden will. Natürlich steht Lanczkowski mit seinem Konzept insofern quer zu kulturwissenschaftlichen Konzeptionen, als dass er mindestens implizit einen substantiell gefüllten Religionsbegriff als einem Phänomen sui generis bedient. Mit den oben genannten Teilaspekten lässt sich allerdings zumindest anmerken, dass selbst sein Ansatz – der älteste³⁵⁴ unter den vieren – schon kulturwissenschaftliche Einflüsse spüren lässt. Allerdings lässt sich das eben, wie mit aller Deutlichkeit zu betonen ist, aufgrund seiner geradezu substanzontologischen Anwendung der Kategorie des „Heiligen“ als Marker des Religiösen nicht ohne Schwierigkeiten in oben dargestellte Konzeptionen einordnen. Der aus Schülers holistischem Ansatz erarbeitete psychologisch-kognitionswissenschaftliche Zugriff auf Religionswissenschaft hingegen lässt sich logischer-
353 Vgl. Lanczkowski, Einführung, 14. 354 Von 1978 – also wohl noch beinahe mitten im Cultural Turn selbst.
160
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
weise weniger schwierig in kulturwissenschaftlichen Parametern denken. Als der jüngste der vier vorgestellten Ansätze könnte konstatiert werden, dass diese Herangehensweise bereits im nächst-generationalen Erbe des Cultural Turn steht. Als solche Beerbung ließen sich durchaus einzelne Aspekte gesondert herausstellen – wie z. B. eine Fronthaltung gegenüber naturalistischen Individualismen. Doch kann hier – auf all das überspannender Ebene – auf die wiederholte und starke Betonung des wechselseitigen Verhältnisses von Kultur und Sozialität mit Natur und Biologizität der menschlichen Existenz hingewiesen werden. Gerade unter Beachtung eines – bei allem Holismus – methodologisch-epistemischen Primats kontextualisierender sozialwissenschaftlicher Forschungsansätze lässt sich, wie bereits ausgeführt, eine Selbstverortung im Rahmen von Kulturwissenschaft vermuten – die für Schüler als aktuellstes Werkbeispiel eben vielleicht sogar geradezu selbstverständlich sein dürfte. Alle vier Zugriffe tragen also auf verschiedenen Ebenen kulturwissenschaftliche Aspekte in sich – wenn auch nicht (immer) als ex- oder implizites forschungstechnisches Programm. Dennoch lässt sich hier vor allem vor dem Hintergrund der oben getätigten fachgeschichtlichen Reflexionen in Kombination mit den Analysen der vier Zugriffe Religionswissenschaft gut im Rahmen von Kulturwissenschaft verorten. Ihr Verhältnis zu anderen Fachdisziplinen ist dann logisch von genau dieser Selbstverortung bestimmt, was sich in ihren verschiedenen Institutionalisierungsformen im Rahmen von Universitäten dann auch widerspiegelt:³⁵⁵ Religion als Gegenstandsbereich und heuristische Begriffskategorie wird dann also betrachtet als ein Phänomen kultureller Praxis und Theorie neben anderen, dem sich verschiedene derart kulturwissenschaftlich fokussierte Disziplinen, mit ihren je spezifischen Fragen an die dem System Religion zugrundeliegenden „symbolischen Ordnungen, kulturellen Codes und Sinnhorizonte[n]“,³⁵⁶ widmen können – und Religionswissenschaft ist dann logischerweise eine von ihnen.³⁵⁷
355 Vgl. Kapitel 2.4.1. und 2.5. 356 Reckwitz, Die Kontingenzperspektive, 2. 357 Damit geht allerdings keinesfalls eine Spezifizierung von Religionswissenschaft über ihren Gegenstandsbereich einher. Das wäre geradezu unlogisch, da die kulturwissenschaftliche Programmatik sich ja gerade durch ihren disziplinenübergreifenden Ansatz kennzeichnet. Die Differenzierungsprobleme, die in Kapitel 2 und 3 verdeutlicht wurden, werden durch eine kulturwissenschaftliche Programmatik nicht weniger – sondern bleiben, vor dem Hintergrund des Gedankens, dass natürlich gerade auch Theologie als Geisteswissenschaft den Cultural Turn mitvollzogen hat, bestehen. Näheres zu Letzterem unter Kapitel 5.4.1.
4.4 Religionswissenschaft interdisziplinär
161
4.4.2 Der Theologiebegriff der Religionswissenschaft Nach dieser Verortung von Religionswissenschaft im Rahmen kulturwissenschaftlicher Forschungsprogrammatik soll nun – dem Fokus dieser Arbeit entsprechend – noch ein gesonderter kurzer Blick auf religionswissenschaftliche Theologieverständnisse, auf Grundlage der Haupttendenzen fachinterner Verhältnissetzungen bzw. Abgrenzungsstrategien zur Theologie, geworfen werden. Vorausgeschickt wird dabei direkt die Grundannahme, dass hinter solchen Strategien verschiedene Impetus liegen – seien sie hochschulpolitisch, wissenschaftstheoretisch oder in besonderen Fällen auch einfach durch persönliche oder fachlich tradierte Erfahrungswerte oder gar Ressentiments geprägt. Im Folgenden soll der Fokus nun auf den durch Abgrenzungsstrategien indizierten, epistemisch-wissenschaftstheoretisch intendierten Begriffen von Theologie liegen. Dafür lässt sich zunächst der Übersicht halber noch einmal die Kategorisierung von Verhältnisbestimmungen anhand der klassischen angewandten Differenzkriterien aus Kapitel 3.1. als Hintergrundfolie bemühen. Am seltensten sind dabei wahrscheinlich Konzeptionen vertreten (und werden im Folgenden darum auch nicht weiter analysiert), die in Anwendung des Differenzkriteriums des Gegenstands vollzogen werden. Dies ist zum Einen relativ logisch aus den in Kapitel 2.2. dargelegten fachgeschichtlichen Entwicklungslinien ableitbar, da – gerade aus religionswissenschaftlicher Sicht – ja gerade das Problem zwischen Theologie und Religionswissenschaft vor allem dadurch entstand bzw. genuin mitgesetzt war, dass Theologie die geistesgeschichtlichen Entwicklungen der Entstehungszeit der Religionswissenschaft mitgetragen und -geführt hat, indem sie sich dem Gegenstandsbereich der Religion(en) zuwandte und durch ebendiese epistemisch-methodologische Zuwendung eine der Ursprungsdisziplinen von Religionswissenschaft überhaupt war.³⁵⁸ Zum Anderen ist eine wissenschaftstheoretische Gegenstandsbezogenheit innerhalb der Religionswissenschaft selbst kontrovers, da gerade der Religionsbegriff ein höchst umstrittener ist. Dass heutige Abgrenzungsstrategien nicht mehr nach dem Differenzkriterium Gegenstand vollzogen werden, zeigt dabei auch, dass das eigene wissenschaftstheoretische Verständnis im Kontext von Kulturwissenschaften entwickelt wird und substantielle Gegenstände nicht mehr als Disziplinen charakterisierend betrachtet werden.
358 Theologiekonzeptionen, die – in welcher Füllung auch immer – „Gott“ o. ä. als ihren Gegenstandsbereich im Sinne eines zu untersuchenden materialen Objekts setzen, dürften als Abgrenzungsfolie sowieso schwer zu finden sein. „Gott“ als Differenzkriterium würde aus innertheologischer Perspektive eher als methodologisch-epistemisches Spezifikum konzipiert werden – so z. B. in der dialektischen Theologie – und dementsprechend eher als Differenzkriterium der Perspektive oder der Methode einordbar sein.
162
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
Ergiebiger zeigen sich Betrachtungen solcher Ansätze, die das Differenzkriterium der Methode anwenden. Hierbei wird, wie bereits ausgeführt wurde, das Proprium der Religionswissenschaft gegenüber Theologie auf methodologischer Ebene in der Empirizität und Deskriptivität gesehen: „Science of Religion differs from theology […] because it is limited to an empirical study of religions as they are,³⁵⁹ and because it does not acknowledge the authority of any religion to influence or determine the results of this research.“³⁶⁰ In diesem Konzept sind theologische Aussagen gleichgesetzt mit „Glaubensaussagen“³⁶¹ und gehören als solche aufgrund ihrer inhärenten normativen Vorbestimmung³⁶² in extremsten Sichtweisen nicht in den Kontext von Wissenschaft insgesamt.³⁶³ In weniger extremer Interpretation wird versucht, mit der Differenzierung in nicht-/empirisch, keine grundsätzliche Wertung insgesamt mitzugeben.³⁶⁴ Da aber gleichzeitig das Kriterium der Empirizität immer wieder zum Marker wissenschaftlicher Forschung erhoben wird, fallen logischerweise alle als nicht-empirisch titulierten Disziplinen, und dann eben auch Theologie, aus dem Forschungsdiskurs heraus. Denn zentral für Wissenschaft sei immer die Anforderung der höchstmöglichen Objektivität bzw. des, wie oben schon angesprochen, methodologischen Atheismus/Agnostizismus.³⁶⁵ Theologie könne dies nicht leisten, weil sie eben methodologisch-epistemischen Grundannahmen (der Existenz Gottes, der Auferstehung Christi, …)³⁶⁶ verpflichtet wäre, die alle Orientierung an empirischer Vorfindlichkeit unmöglich machten.
359 Hier ein deutliches Beispiel, wie sich dahinter bestimmte ontologische, nicht weiter kommunizierte Grundannahmen verstecken. Die These, man könne Religionen erforschen as they are, lässt ein beinahe vorkantianisches Verständnis von wissenschaftlicher Erkenntnis vermuten. 360 Baaren, Science of Religion, 42. Ein Beispiel aus den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts – in seiner Stoßrichtung allerdings durchaus bis heute noch exemplarisch. 361 Ders., Systematische Religionswissenschaft, 83. Zwar an anderer Stelle, aber aus dem gleichen Diskurskontext. 362 Also „Glaubensaussagen“ hier in einem sehr spezifischen ontologisch-epistemischen Verständnis: „Das verbreitete Argument, daß auch dem nichttheologischen Religionswissenschaftler unkontrollierbare Vorentscheidungen oder gar Vorurteile eigen sind, ist keineswegs mit einem theologischen Vorverständnis zu konfrontieren, da letzteres eine der Wissenschaft letzthin unzugängliche und eben nicht nachprüfbare Glaubensentscheidung beinhaltet. Dieses Argument wird übrigens fast ausnahmslos von Theologen vorgebracht, um ihre Nichtvoraussetzungslosigkeit zu rechtfertigen oder zu verschleiern.“ Rudolph, Geschichte und Probleme, 29. Hervorhebung C. N. 363 Solche innertheologischen Subdisziplinen, die empirisch-deskriptiv vorgehen, seien dann eigentlich der Religionswissenschaft zuzuordnen. Vgl. Baaren, Science of Religion, 44. 364 Vgl. Seiwert, Systematische Religionswissenschaft, 10. 365 Vgl. Kapitel 3.1., Kapitel 4.3.2. und 5.3.2. 366 Hier zeigt sich wieder ein sehr schwieriges Verständnis von (christlich‐) religiösen Glaubensaussagen – im Sinne substanzontologischer Aussagen. Näheres dazu in Kapitel 5.3.2.
4.4 Religionswissenschaft interdisziplinär
163
Dies leitet nahtlos über zum aktuell³⁶⁷ am häufigsten angewandten Differenzkriterium bzw. ist von diesem beinahe ununterscheidbar, dem der Perspektive. Theologie wird hier als innerreligiöse (und dementsprechend dann voreingenommene) Selbstreflexion auf Glaubensaussagen³⁶⁸ in das System von Religion eingeordnet³⁶⁹ – und ist somit nicht dem der Wissenschaft zugehörig, sondern Gegenstand von (Religions‐) Wissenschaft.³⁷⁰ In diese Analysen lassen sich die unter 4.2. konstruierten vier Zugriffe nun ebenfalls kurz einordnen; wenngleich natürlich darauf hinzuweisen ist, dass alle vier auf die jeweiligen Zugriffsaspekte hin untersuchten Werke keine expliziten Konzeptionen von Theologie als akademischer Disziplin liefern, sondern wenn dann nur über die eigene Identitätsbeschreibung ein Verständnis von Theologie mitgeben. Beginnend mit dem aus Rüpkes Monografie erarbeiteten Zugriff ist hier daran zu erinnern, dass Rüpke Theologie explizit der religiösen „Innenperspektive“ zuordnet.³⁷¹ Religionswissenschaft hingegen habe den, zwar ebenfalls nicht neutralen, weil positionellen Blick auf Religion und verhalte sich durch die Praxis des Forschens ebenfalls als Akteurin im religiösen Feld. Doch lässt Rüpke in dieser Differenzierung dennoch durchscheinen, dass letztlich Theologie Bestandteil von Religion selbst sei – und nicht außerhalb dieser agiere. (Religions‐) Wissenschaft und Religion (also auch Theologie) stehen dann als konkurrierende Sinnsysteme zueinander im Verhältnis. Sehr ähnlich lässt sich der ebenfalls eher implizite Theologiebegriff bei Kippenberg und von Stuckrad herausarbeiten: Auch hier wird an einer Stelle auf Theologie als Innenperspektive von Religion abgehoben.³⁷² Gleichzeitig wird an anderer Stelle die Religion(en) mit konstituierende Aktivität religionswissenschaftlicher Forschung im religiösen Feld betont.³⁷³ Am undeutlichsten gestaltet sich die Einordnung Lanczkowskis, der Theologie und Religionswissenschaft grundsätzlich in ein als Disziplinen gegenseitig sehr
367 Was höchstwahrscheinlich auch wieder mit gesamtwissenschaftlichen Entwicklungslinien zu tun haben dürfte – Gegenstände und rein-empirische Methoden als Differenzkriterien lassen auf beinahe positivistische Wissenschaftsbilder schließen, die eine kulturwissenschaftlich konzipierte Religionswissenschaft kaum mitträgt. 368 Vgl. Gladigow, Gegenstände, 36. 369 Vgl. Mohn, Religionswissenschaft, 189. 370 Vgl. Stolz, Grundzüge, 35.38. 371 Vgl. Rüpke, Historische Religionswissenschaft, 160 f. 372 Vgl. Kippenberg/Stuckrad, Einführung, 14 f. 373 Vgl. ebd., 46.
164
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
positiv befruchtendes Verhältnis einordnet.³⁷⁴ Allerdings zeigt sich in diesem Kontext, dass auch er Theologie als innerreligiöse Reflexion voraussetzt.³⁷⁵ Schlussendlich lässt sich auch Schüler in solche Differenzierungsmuster einordnen: In Auseinandersetzung mit religions-kognitionswissenschaftlichen Experimenten zu anthropomorphen Göttervorstellungen in Benutzung „theologisch korrekter“ und „theologisch inkorrekter Vorstellungen“³⁷⁶ kritisiert Schüler, dass hier der „kulturspezifische Begriff“ der Theologie als „wissenschaftliche Kategorie […] mit universellen Ansprüchen“³⁷⁷ geradezu konzeptuell missbraucht wird. Theologie ist in Schülers Ansatz ebenfalls im System Religion verortet³⁷⁸ – und nicht im System Wissenschaft. So seien – spätestens seit des Cultural Turn – religiöse Wahrheitsfragen alleinige Aufgabe der Theologie. Religionswissenschaft habe sich als Wissenschaft demgegenüber solcher innerreligiösen Themen zu enthalten.³⁷⁹ Bei allen vier aus den jeweiligen Werken erarbeiteten Zugriffen ist also augenfällig, dass Theologie als innerreligiöse Reflexion auf – wie auch immer gefüllte, aber immerhin unter der Wahrheitsfrage reflektierte – Glaubensaussagen gekennzeichnet wird. Dieses scheint sich mit dem oben nur angerissenen Mainstream des Theologiebegriffs innerhalb der Religionswissenschaft zu decken. Denn, egal ob die Differenz in der normativ vorbelasteten Methodologie der Theologie oder ihrer innerreligiösen Perspektivität gesehen wird: Zentral ist, dass Theologie einer Religion nicht nur strukturell oder im Sinne ihrer spezifischen Gegenstandsbezogenheit (auf christliche Religion/Religiosität) zuzuordnen sei, sondern dass sie durch diese Zugehörigkeit sich in ihrem Erkenntnisprozess grundlegend von Religionswissenschaft unterscheide – eben durch die Vorschaltung von Glaubenswahrheiten oder religiösen Grundannahmen, die dem Forschungsprozess vorausgehen und diesen grundlegend mitbestimmten. Es sei an dieser Stelle, um dem 5. Kapitel dieser Arbeit nicht zu viel vorwegzunehmen, nur angedeutet, dass solches wahrscheinlich − wenn überhaupt − nur auf sehr spezifische Theologiekonzepte zutrifft. Es könnte z. B. vermutet werden, dass bestimmte dialektisch-theologische Konzeptionen im
374 Vgl. Lanczkowski, Einführung, 122. 375 Beispielhaft ist dafür seine kurze Ausführung zur Notwendigkeit einer Religionstheologie, die er mehr oder weniger indirekt als kirchliche, also explizit innerreligiöse Aufgabe kennzeichnet, wenn er in diesem Kontext auf Konzeptionen des 2. Vaticanums hinweist. Vgl. ebd. 376 Vgl. Schüler, Religion, 132. 377 Ebd., 133. 378 Beispielhaft kann dafür diese Wortgruppenzusammenstellung sein: „abstrakte Göttervorstellungen (Theologie)“. Ebd., 142. 379 Vgl. ebd., 45.
4.5 Zusammenfassung: Die Fragestellung der Religionswissenschaft
165
Hintergrund stehen, wenn davon ausgegangen wird, dass christliche Wahrheitsverkündigung ein Auftrag der Theologie sei.³⁸⁰
4.5 Zusammenfassung: Die Fragestellung der Religionswissenschaft In einer nun letzten kurzen Systematisierung soll im Folgenden das 4. Kapitel dieser Arbeit abgeschlossen werden, indem die hier insgesamt vollzogenen Analysen und Setzungen zu einer Fragestellung der Religionswissenschaft als diskursiv-wissenschaftstheoretischem Differenzkriterium zusammengeführt werden. Die zwar ebenfalls systematisierend, aber voneinander denklogisch getrennt betrachteten einzelnen Momente, Zugriffe, disziplinären Selbstbestimmungen, methodologischepistemischen Konsequenzen und interdisziplinären Selbstverortungen werden also nunmehr im Versuch einer konstruierten Gesamtschau zu einem kriteriologischen Spezifikum von Religionswissenschaft als eigenständiger Disziplin im Sinne eines spezifischen fachlichen Diskurses mit eigener Fachtradition, grundlegendgemeinsamer Forschungsabsicht und spezifischen Forschungsvorhaben verbunden. Damit kann zunächst konstatiert werden, dass sowohl in disziplinärer als auch in interdisziplinärer Sicht Religionswissenschaft sich maßgeblich als eine kulturwissenschaftliche Disziplin versteht: Das zeigt sich zum einen methodologischepistemisch durch die klare Fokussierung auf den Vergleich sowohl als Methode als auch als gemeinsame Forschungsabsicht. Zum anderen äußert sich das durch das Selbstbewusstsein der Dynamizität und Positionalität der eigenen Disziplin³⁸¹ und dementsprechend vor allem des eigenen Gegenstandsbereichs. Dadurch ist der Religionswissenschaft auch das Bewusstsein für die eigene Rolle im Forschungsprozess geschärft: Kulturwissenschaftlich orientierte Religionswissenschaft untersucht in wechselseitig-interdisziplinärer Orientierung Religion(en) systemtheoretisch gedacht in der Außenperspektive der Wissenschaft – und ist dadurch gleichzeitig in wechselseitig-beeinflussendem Verhältnis zu diesem Gegenstandsbereich stehende Akteurin im religiösen Feld selbst. Ausdruck findet dieses kulturwissenschaftliche Selbstverständnis vor allem in der innerfachlichen Struktur des religionswissenschaftlichen Diskurses: Im genuinen Wechselspiel von syste380 Natürlich wird in klassischen Konzeptionen auch innerfachlich Theologie als innerreligiöse Reflexion eingeordnet. Allerdings, so zumindest eine grundsätzliche Vermutung an dieser Stelle, sind damit andere Kategorien und Spezifizierungen intendiert, als dies bei solchen religionswissenschaftlichen Sichtweisen der Fall ist. Dazu allerdings mehr in Kapitel 5., besonders Kapitel 5.3.2. 381 Vgl. z. B. Führding, Diskursgemeinschaft, 56 ff.
166
4 Wie fragt Religionswissenschaft?
matischer und historischer Religionswissenschaft konstituiert sich diese die einzelnen Zugriffe verbindende gemeinsame, metatheoretische Forschungsabsicht des methodisch kontrollierten Vergleichbarmachens von empirisch vorfindlichen Religionen. Vor dem Hintergrund dieses Grundgedankens und dem Problembewusstsein der Schwierigkeit und dennoch Anforderung, Religion(en) trotz aller kulturwissenschaftlichen Positionalität und Kontingenz antireduktionistisch und so objektiv (also sach-gemäß) wie möglich erforschen zu wollen, gestaltet sich solche Religionswissenschaft in konkreten Forschungsvorhaben, die in der Konzeption dieser Arbeit exemplarisch (ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Angabe irgendeiner Hierarchie oder sozusagen Gleichwertigkeit untereinander) historischphilologisch, empirisch-sozialtheoretisch, philosophisch-phänomenologisch oder psychologisch-kognitionswissenschaftlich fokussiert bzw. bedingt sein können und dabei eben dennoch alle durch die grundlegende Absicht des Vergleichs verbunden sind. Somit kann als Vorschlag für eine gesetzte Fragestellung der Religionswissenschaft folgende Formulierung grundlegend zur Debatte gestellt werden: Religionswissenschaft als eigenständige Disziplin im Kontext von Kulturwissenschaft fragt metatheoretisch als interdisziplinär orientierter Diskurs nach der Vergleichbarkeit empirischvorfindlicher Religionen, indem sie vor dem Hintergrund des Problems potentieller Reduktionismen und unter dem Bewusstsein der fachlichen und individuellen soziokulturellen Positionalität und Kontingenz methodisch-epistemisch kontrolliert Religionen (in sich und untereinander) vergleicht, um so Kategorien, Typisierungen und Strukturen in u. a. historischphilologischer, empirisch-sozialtheoretischer, philosophisch-phänomenologischer und psychologisch-kognitionswissenschaftlicher Fokussierung systematisch zu erarbeiten.
5 Wie fragt Theologie? Im Folgenden soll nun, der Logik dieser Arbeit gemäß, die Disziplinarität akademischer evangelischer Theologie anhand ihrer sie diskurslogisch als Fach konstituierenden Fragestellung ausgearbeitet werden. In der Vorgehensweise wird dabei um der Vergleichbarkeit willen versucht, sich an der formalen Großstruktur des vierten Kapitels zur Fragestellung der Religionswissenschaft zu orientieren. Dennoch ist zu betonen, dass die fachliche Positionalität der Arbeit und die Eigenarten der beiden Fächer sowohl in ihrer jetzigen Struktur als auch in ihrer spezifischen Fachtradition die Vorgehensweise maßgeblich bedingen. Dementsprechend wird als Erstes eine Orientierung in der fundamentaltheologischen Grundfrage der Enzyklopädie der Theologie versucht, um die Disziplinarität der Theologie unter dem Vorzeichen ihrer innerdisziplinären Pluralität der klassischen Kernfächer in den Blick zu nehmen.¹
5.1 Die enzyklopädische Frage Auch das Selbstverständnis evangelischer Theologie kann nur unter Berücksichtigung ihrer innerdisziplinären Struktur überhaupt in den Blick genommen werden. Denn die „Gesamtheit der Theologie ist nur im Zusammenspiel der Fächer zu erfassen. Jedes theologische Fach bietet einen perspektivierten Zugriff auf das Ganze der Theologie.“² Diese Frage nach der formalen ³ Enzyklopädie, ⁴ also sowohl nach
1 Das ändert nichts daran, dass auch dieses Großkapitel in fundamentaltheologischer Absicht vollzogen wird.Vielmehr geht es darum, in eben diesem fundamentaltheologischen Zugriff dennoch die innerdisziplinäre Pluralität von Theologie im Blick zu haben. 2 Leppin,Volker, Die Kirchengeschichte im Kreis der theologischen Fächer. Historische Offenlegung der vielfältigen Möglichkeiten christlicher Religion, in: Buntfuß, Markus/Fritz, Martin (Hg.), Fremde unter einem Dach? Die theologischen Fächer in enzyklopädischer Perspektive (TBT 163), Berlin 2014, 69 – 93, 80. 3 Im Gegensatz zur Realenzyklopädie als einer Sammlung von Wissensbeständen, wie z. B. klassisch die Theologische Realenzyklopädie. Vgl. Albrecht, Christian/Gemeinhardt, Peter, Einleitung, in: Dies. (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und von außen, Tübingen, 2021, 1 – 9, 2. 4 Zum Begriff der Enzyklopädie hier vgl. kurz Beutel, Albrecht, Theologische Enzyklopädie. Bemerkungen zur Genese, Bedeutung und Aktualität einer notwendigen Disziplin, in: Albrecht, Christian/Gemeinhardt, Peter (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und von außen, Tübingen 2021, 13 – 34, 14 f. Zu den Anfängen theologischer Enzyklopädie vgl. ebd., 15 – 19. Vgl. zu Literaturhinweisen zur Geschichte der Enzyklopädie Alkier, Das Neue Testament, 43 (Fußnote 2). https://doi.org/10.1515/9783111091747-006
168
5 Wie fragt Theologie?
der Gliederung als auch nach der Ganzheit der Theologie stellt (als eine der Grundfragen der Fundamentaltheologie) gleichzeitig die Frage nach dem dar, was Theologie als Wissenschaft ist. ⁵ Common Sense ist, dass die innere Ausdifferenzierung akademischer Theologie in ihre Subdisziplinen (so wie wohl alle kulturellhistorischen Ausdifferenzierungsprozesse) nicht aufgrund innerer, gar wissenschaftstheoretischer Notwendigkeiten geschah. Vielmehr zeichneten und zeichnen sich diese in dem Sinne kontingenten Prozesse zu großen Teilen als Abgrenzungsprozesse aus, bei denen es nicht selten um die deutliche Selbst- und/oder Fremdpositionierung als eigenständig und/oder andersartig gegenüber dem wie auch immer verstandenen Vorherigen oder nur Andersartigen ging.⁶ Damit geht denkerisch einher, dass diese Prozesse immer in konkreten Kontexten von statten gingen und somit natürlich direkt ausgelöst bzw. geprägt waren von den sie umgebenden erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Bedingungen ihrer Zeit.⁷ Somit stehen auch klassische enzyklopädische Entwürfe als Reaktionen⁸ auf diese Prozesse in diesen Kontexten. So reagierte Schleiermachers Kurze Darstellung, um in den Anfang des hier anvisierten enzyklopädischen Denkens kurz mit diesem schon erwähnten Klassiker einzuführen, als sein Begleitwerk für den eigenen Vorlesungsbetrieb nicht nur auf die Schwierigkeit des Arbeitens mit schon bestehenden theologisch-enzyklopädi-
5 Womit gleichzeitig natürlich in jeder enzyklopädischen Konzeptionierung eine gewisse Hegemonialität inhärent ist. Vgl. ebd., 43 f.66 f. „Die enzyklopädische Bildung ist gleichermaßen ein pädagogisches wie ein politisches Kreise-Ziehen.“ Ebd., 44. 6 Vgl. Roth, Michael, Die Ausdifferenzierung der theologischen Wissenschaft als Problemstellung der evangelischen Theologie, in: Petzoldt, Matthias (Hg.), Evangelische Fundamentaltheologie in der Diskussion, Leipzig 2004, 73 – 94, 80 f. Vgl. ebenso Ders., Was kann der Systematiker vom Kirchengeschichtler erwarten, wenn er überhaupt etwas erwarten darf?, in: Kampmann, Claudia/Volp, Ulrich/Wallraff, Martin (Hg.), Kirchengeschichte. Historisches Spezialgebiet und/oder theologische Disziplin (Theologie – Kultur – Hermeneutik 28), Leipzig 2020, 409 – 424, 410. 7 Zur Geschichte theologischer Enzyklopädie insgesamt vgl. ausführlich Hummel, Gert, Art. Enzyklopädie. theologische, in: TRE 9 (1982), 716 – 742, 726 – 738. Dazu geraffter vgl. Becker, Eve-Marie/ Hiller, Doris, Theologische Enzyklopädie. Eine Einführung, in: Dies. (Hg.), Handbuch Evangelische Theologie. Ein enzyklopädischer Zugang (UTB 8326), Tübingen 2006, 2 – 26, 2 – 16. Beispielhaft vgl. auch Pannenberg, Wissenschaftstheorie, 19 – 23. Vgl. knapp auch Alkier, Das Neue Testament, 44.46 f. 8 Theologische Enzyklopädie kann also als ein gewisses „Krisenphänomen“ der Theologie gesehen werden. Kubik, Andreas/Murrmann-Kahl, Michael, Einleitung. Viele Fächer – keine Einheit?, in: Dies. (Hg.), Die Unübersichtlichkeit des theologischen Studiums heute. Eine Debatte im Horizont von Schleiermachers theologischer Enzyklopädie (BRTh 21), Frankfurt a. M. 2013, 9 – 25, 9. Wodurch sie sich in ihrer dementsprechend apologetischen Ausrichtung als klassisch fundamentaltheologisch kennzeichnet. Näheres dazu in Kapitel 5.1.2.
5.1 Die enzyklopädische Frage
169
schen Einführungswerken.⁹ Sondern sie stand auch im Zusammenhang des neuzeitlichen, sich immer weiter ausdifferenzierenden Wissenschaftsbetriebes, dessen Auswirkungen Theologie insofern besonders deutlich zu spüren vermag, als dass sie „[m]ethodisch und thematisch aufgefächert, […] die Beziehung zu außertheologischen Disziplinen“¹⁰ und somit die Tendenz zum innerdisziplinären Auseinanderdriften selbst in sich zu tragen scheint. Dementsprechend fungierte die Kurze Darstellung dann eben nicht nur als Einführungswerk für Studierende im Sinne eines Kompendiums der theologischen Subdisziplinen. Vielmehr entwarf Schleiermacher hier bekanntermaßen eine Wissenschaftstheorie der Theologie auf der fundamentaltheologischen Metaebene mit dem argumentativen Zielfokus,¹¹ die Einheit der Theologie in ihrer subdisziplinären Ausdifferenziertheit, also die Theologizität ihrer Subdisziplinen ¹² aufgrund ihrer kritisch¹³ positiv-praktischen Funktionalität¹⁴ darzulegen. Mit dieser präskriptiven Analyse nimmt „Schleiermachers kleine Enzyklopädie […] den Rang des unbestrittenen Klassikers an, den[!] dem sich alle Positionen [positiv und negativ, C. N.] orientieren.“¹⁵
9 Vgl. Schmid, Dirk, Einleitung des Bandherausgebers, in: KGA I,6 (1998), IX–XC, XXXVIIIf. Zu weiteren ersten theologischen Enzyklopädien vgl. Beutel, Theologische Enzyklopädie, 19 – 27. 10 Becker/Hiller, Theologische Enzyklopädie, 8. 11 Zu diesen drei Zielen der Kurzen Darstellung vgl. Barth, Wissenschaftstheorie der Theologie, 264 f. 12 Vgl. Roth, Die Ausdifferenzierung, 75. 13 Vgl. Ohst, Martin, Das Neue Testament in konsequent-historischer Sicht. Bemerkungen zu Jens Schröters Beitrag, in: Albrecht, Christian/Gemeinhardt, Peter (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und außen, Tübingen 2021, 82 – 96, 92 f. 14 Vgl. dazu schon Kap. 2.2.1. 15 Korsch, Dietrich, Zweihundert Jahre nach Schleiermachers „Kurzer Darstellung des theologischen Studiums“. Wie unterscheidet sich die Theologie von anderen wissenschaftlichen Disziplinen?, in: Kubik, Andreas/Murrmann-Kahl (Hg.), Die Unübersichtlichkeit des theologischen Studiums heute. Eine Debatte im Horizont von Schleiermachers theologischer Enzyklopädie (BRTh 21), Frankfurt a. M. 2013, 203 – 215, 203.Vgl. auch Albrecht/Gemeinhardt, Einleitung, 3.Vgl. ebenso Moxter, Michael, Enzyklopädie aus der Perspektive Systematischer Theologie, in: Albrecht, Christian/Gemeinhardt, Peter (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und außen, Tübingen 2021, 121 – 142, 121.. Grundsätzlich muss an dieser Stelle allerdings angemerkt werden, dass das Interesse an expliziten enzyklopädischen Entwürfen innerhalb der Theologie – aus wohl verschiedensten materialen und formalen Gründen – eher gering zu sein scheint. Wenn, dann finden sich Ansätze zur Enzyklopädie der Theologie eher implizit in wissenschaftstheoretischen Entwürfen entweder zur Theologie insgesamt oder zu einer ihrer Subdisziplinen. Vgl. Hummel, Art. Enzyklopädie, 738 – 741. Allerdings „ist nur begrenzt die Bereitschaft vorhanden zu zeigen, inwiefern die eigene Disziplin an der Einheit der Theologie partizipiert, d. h. Auskunft zu geben über die Theologizität der je eigenen Disziplin.“ Roth, Die Ausdifferenzierung, 78. Deswegen wird bei dieser kurzen Einführung in die fundamentaltheologische Denkart der enzyklopädischen Frage an dieser Stelle der Sprung von Schleiermacher zu Ebeling auch relativ nonchalant vollzogen – als zwei der
170
5 Wie fragt Theologie?
Dafür kann als zentrales Beispiel Gerhard Ebelings offenkundig in der Tradition Schleiermachers stehende, ebenfalls kontextuell aus seiner Vorlesungstätigkeit heraus entstandene¹⁶ Einführung in das Studium der Theologie gelten, die gekennzeichnet ist von dem Versuch, theologische Enzyklopädie „im Rahmen einer evangelischen Fundamentaltheologie“¹⁷ zu betreiben. Allerdings präzisierte Ebeling sein Vorhaben insofern, als dass seine „enzyklopädische Orientierung“¹⁸ weder den Aufgabenbereich einer konzeptuellen Fundamentaltheologie¹⁹ abdecken, noch mit einer ebenso systemisch gedachten Formalenzyklopädie²⁰ der Theologie insgesamt gleichgesetzt werden könne. Vielmehr versuchte auch Ebeling – ebenfalls affiziert durch den eigenen Lehrbetrieb und das davon wechselseitig beeinflusste Forschungsinteresse –²¹ eine „Orientierungshilfe“²² zu leisten, in der sowohl der „Tatbestand der verschiedenen Disziplinen“²³ als auch seine Relativierung „auf das Ganze der Theologie“²⁴ Gegenstand und Zielfokus der Analyse sind. Insofern fragte auch seine Darstellung danach, was die Subdisziplinen der Theologie zu theologischen Disziplinen macht.²⁵ Die Virulenz dieser Frage ist augenfällig – und hat sich im Laufe der theologischen Fachgeschichte nicht abgeschwächt, sondern im erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Erbe der Neuzeit stehend vielmehr unweigerlich immer mehr verschärft. Zumal das Interesse an enzyklopädischen Selbstverortungen der einzelnen Subdisziplinen im theologischen Gesamtdiskurs eher hintergründig zu sein scheint. Denn die „Diskurse in den eingeweihten Kreisen der jeweiligen Fächerkulturen funktionieren. Man kennt die Spielregeln. Das Anliegen aber, gemeinsam
prominentesten, wenngleich deswegen auch bzw. gerade nicht unumstrittenen konzeptuellen Ur-/ Väter neuerer fundamentaltheologischer Enzyklopädie. 16 Vgl. Beutel, Theologische Enzyklopädie, 27. 17 Becker/Hiller, Theologische Enzyklopädie, 14. 18 So der Untertitel der Monografie. 19 Welches mit der „umfassenden Besinnung auf das Wesen von Theologie, ihre Sache und Methode, ihre Sprache und Wahrheit“ bestimmt sei. Ebeling, Gerhard, Studium der Theologie. Eine enzyklopädische Orientierung (UTB 3582), Tübingen 22012, 9. Näheres zur Fundamentaltheologie in Kapitel 5.1.2. 20 „[D]eren unerreichtes Vorbild Schleiermachers ‚Kurze Darstellung des theologischen Studiumsʻ ist“ und die sich durch „eine explizite wissenschaftsmethodologische Grundlegung und die streng systematische Form“ kennzeichne. Ebd., 9. 21 Vgl. ebd., VII. 22 Ebd., 9. 23 Ebd., 10. 24 Ebd. 25 Vgl. ebd., 12. Ebeling bezeichnet diesen Aspekt der Theologizität der Subdisziplinen mit der Formel eines „theologischen Verstehensvorgang[s]“, der sie als „hermeneutischer Prozeß“ zum Ganzen der Theologie zusammenhält. Ebd., 11.
5.1 Die enzyklopädische Frage
171
evangelische Theologie zu betreiben, ‚zusammen zu denken‘, um damit Kirche, Schule und Gesellschaft zu fördern, spielt – wenn überhaupt – auch bei Kirchengeschichtlerinnen, Ethikern und Religionspädagoginnen eine recht untergeordnete Rolle.“²⁶ Deutlich ist vielmehr, „dass sich die unterschiedlichen theologischen Disziplinen so stark voneinander gelöst haben, dass gar kein Zusammenhang in ihrem faktischen Arbeitsvollzug zu bestehen scheint.“²⁷ Vor dem Hintergrund dieses Problemhorizonts soll im folgenden Unterkapitel dementsprechend auch keine eigene material- oder formalenzyklopädische Konzeptionierung stattfinden. Für keine der theologischen Subdisziplinen soll eine Präskription ihres jeweiligen fachlichen Selbstverständnis aus Perspektive der Systematischen bzw. Fundamentaltheologie erfolgen,²⁸ sondern – in explizit fundamentaltheologischer Absicht – die theologischen Teildisziplinen metatheoretisch auf ihre (Selbst‐) Verortung als eben theologische Disziplinen, also auf die im- oder explizite (Selbstbeschreibung ihrer) Theologizität hin untersucht werden.²⁹ Dadurch ergibt sich dann, vor dem im dritten Kapitel dieser Arbeit dargelegten wissenschaftstheoretischen Hintergrund, dass die im Folgenden versuchte Konstruktion der Theologizität der theologischen Subdisziplinen nicht über die Präskription eines materialen oder auch funktionalen Propriums der jeweiligen Subdisziplin für die gesamte Theologie erfolgen kann. Vielmehr wird, auf Basis der Fragestellung als den spezifisch theologischen Fachdiskurs strukturierendem Differenzkriterium, ver-
26 Alkier, Das Neue Testament, 45. 27 Roth, Die Ausdifferenzierung, 78. Umso krasser zeichnet Roth an dieser Stelle angesichts der Deutlichkeit des Problems die mangelnde Bereitschaft zur Problemlösung innerhalb der einzelnen Subdisziplinen – ein Problem, das sich bis heute gehalten zu haben scheint.Vgl. Beutel, Theologische Enzyklopädie, 30. Vor allem „[f ]ür Studierende bedeutet die Ausdifferenzierung der theologischen Fächer von Kolleg zu Kolleg, von Buch zu Buch ein Wechselbad, das die Lebensgeister stärken kann, mitunter aber auch latente Gesundheitsschwächen zum Ausdruck bringt.“ Sauter, Gerhard, Zugänge zur Dogmatik. Elemente theologischer Urteilsbildung (UTB 2064), Göttingen 1998, 319. 28 Keinesfalls angedacht ist also eine Darlegung oder Einführung in die innere Fachlogik, Methodologie oder den Gegenstandsbereich der jeweiligen Subdisziplinen. Solches wird erstens der inneren Pluralität einer jeden Subdisziplin nicht annähernd gerecht und kann zweitens weder im Rahmen dieser Arbeit noch mit der Kompetenz der Verfasserin angegangen werden. Vielmehr ist eben gerade auch das gesamte Kapitel 5.1. ein explizit fundamentaltheologisches – sowohl in der Absicht, als auch im Vollzug. 29 Damit verfolgt der hier angebotene Ansatz eine anders fokussierte Stoßrichtung als der Ebelings. Während Ebeling fragt, „[i]nwiefern repräsentiert die Disziplin einen notwendigen Aspekt der Theologie“ (Ebeling, Studium, 12), und somit eine innere Notwendigkeit sozusagen als verbindendes Normalprinzip voraussetzt, geht der im folgenden ausgeführte Ansatz eher diskurs- bzw. praxistheoretisch heran: Theologische Disziplinen qualifizieren sich selbst als solche, indem und weil sie sich am theologischen Diskurs als ihrer qualitativen Zielfokussierung beteiligen.
172
5 Wie fragt Theologie?
sucht, die damit implizierte innere strukturelle Logik des theologischen Diskurses (und damit letztlich seine Disziplinarität) aufzuzeigen.
5.1.1 Theologie als Sechsfächerkanon Dass im nun Folgenden die enzyklopädische Frage nach der Theologizität der Subdisziplinen an den Sechsfächerkanon ³⁰ der Theologie gestellt werden soll, muss vorab kurz erläutert werden. Grundsätzlich ist noch mal zu betonen, dass die innerdisziplinäre Ausdifferenzierung akademischer Theologie nicht als Ergebnis einer inhaltlich-logischen oder gar funktionalen Notwendigkeit verstanden werden kann, sondern vielmehr verursacht war durch verschiedenste Emanzipationsprozesse, die im Kontext sich verändernder wissenschaftlicher Paradigmen zu sehen sind. Zentral war dabei zunächst v. a. das im Laufe der Aufklärung aufgekommene Bewusstsein für die historische Relativität von evangelischer Theologie – sowohl in ihrer eigenen methodologisch-epistemischen Genese und Konstitution als auch in ihrem wohl Identität stiftendsten Forschungsgegenstand, dem biblischen Kanon: Mit dem neu erwachten Erkenntnisinteresse, sowohl die Texte der Bibel selbst als auch ihre Kanonizität in ihrer historischen Entstehung, Entwicklung und soziokulturellen Bedingtheit zu erforschen, entstanden neue theologische Fragestellungen, die zu einer eigenständigen Forschungsarbeit mit der Bibel und letztlich zu einer Ausdifferenzierung der historisch-kritischen Disziplinen führten:³¹ „Der Aufstieg der historisch-kritischen Bibelforschung bedeutet[e] damit auch die Emanzipation der exegetischen Disziplinen. Durch sie hält das neuzeitliche Denken Einzug in die protestantische Theologie.“³²
30 Es wird sich im Folgenden (in Zahl und Titulierung der Subdisziplinen) an den Fachgruppen der WGTh orientiert. Vgl. die Website der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie. Fachgruppen, http://wgth.de/index.php/fachgruppen – 25.01.21. 31 „Im Prozeß der europäischen Aufklärung bildete sich ein historisches Bewußtsein aus, das einen kritischen Blick auf die Zuverlässigkeit und Echtheit der [biblischen] Texte warf.“ Lauster, Jörg, Prinzip und Methode. Die Transformation des protestantischen Schriftprinzips durch die historische Kritik von Schleiermacher bis zur Gegenwart (HUTh 46), Tübingen 2004, 1. Was also als Versuch begann, die historische Autorität biblischer Texte zu erweisen, entwickelte sich im Laufe der Fachgeschichte dann bald zu ihrer Kritik. 32 Ebd., 2. Allerdings muss an dieser Stelle sofort präzisiert werden, dass die Entwicklung hin zu eigenständigen historisch-exegetischen Disziplinen nicht so verstanden werden kann, als ob das Bewusstsein für historisch-kritisches Denken nicht auch Einfluss auf Systematische Theologie gehabt hätte. Vielmehr handelte es sich hier um einen gesamttheologischen Umbruch, der nicht mit klaren Subdisziplinengrenzen gekennzeichnet werden kann. So konnten natürlich exegetisch-historische Forschungen durch z. B. dogmatisch-theologische Erkenntnisinteressen geleitet sein – und
5.1 Die enzyklopädische Frage
173
Ohne damit auch nur ansatzweise die fachgeschichtliche Genese von Theologie hier beschreiben zu wollen, soll damit an dieser Stelle lediglich angedeutet sein, dass die (Weiter‐)Entwicklung fachlicher Strukturen im engen Zusammenhang mit den epistemischen Bedingen ihrer Umwelt bzw. ihres historischen Kontextes steht. Dementsprechend ist natürlich der hier vorgestellte Sechsfächerkanon kein letztgültiges Sollen, sondern vielmehr ein vorläufiges So-Sein. Nichtsdestotrotz lassen sich im nun Folgenden diese sechs Fächer metatheoretisch auf ihre diskursstrukturellen Verbindungen³³ hin untersuchen, um darüber Hinweise auf die Diskurslogik von Theologie als Disziplin selbst zu erlangen, die dann im Fortgang der Arbeit auf die Möglichkeit einer Fragestellung als ihr sie strukturierendes Differenzkriterium analysiert werden kann. Vorausgeschickt sei dabei an dieser Stelle, dass es sich auch im hier Folgenden – ähnlich zu den Ausführungen in Kapitel 4.1. – um eine Untersuchung in einer gewissen (subdisziplinären) Außenperspektive handelt, die nicht aus einer genuinen Übergriffigkeit herauskommt, da aus einem evangelischfundamentaltheologischen Diskurs heraus die Fachdiskurse der theologischen Teildisziplinen auf ihre Theologizität hin befragt werden. Beginnend³⁴ mit dem Versuch einer enzyklopädischen Betrachtung der Alttestamentlichen Wissenschaft wird sofort das Grundproblem deutlich: Der Theologiebegriff ist nicht nur zwischen den Subdisziplinen, sondern auch innerhalb jeder einzelnen erwartungsgemäß (positionell bedingt) plural bis widersprüchlich.³⁵
systematisch-theologische Forschung im Zeichen historischer Kritik vollzogen werden. Vgl. Ebeling, Studium, 8. 33 Es soll im Folgenden also, wie bereits erwähnt, explizit nicht um eine Darstellung des jeweiligen subdisziplinären Selbstverständnisses auf konkret forschungsprozesslicher Ebene gehen, sondern metatheoretisch-fundamentaltheologisch nach den die einzelnen Subdisziplinen verbindenden Strukturmomenten auf der Ebene des theologischen Gesamtdiskurses gefragt werden. Dementsprechend können die einzelnen Subdisziplinen nicht in ihrem eigenen, sondern eben nur in einem fundamentaltheologischen Fachverständnis porträtiert werden. 34 Bei der Analyse der Theologizität der einzelnen Subdisziplinen wird in der Reihenfolge in keinem Fall einer (durchaus möglichen) inneren materialen Logik gefolgt, sondern sich schlichtweg an einer gemeinhin gebräuchlichen Reihung dieser Disziplinen orientiert. 35 Eine differenzierte Betrachtung der jeweiligen inner- und interdisziplinären Theologiebegriffe wäre an dieser Stelle sinnvoll, kann aber vor dem Hintergrund der eigentlichen Frage dieser Arbeit nicht vollzogen werden. Zu einer fachgeschichtlichen Hinführung zur Pluralisierung des Theologiebegriffs innerhalb der Alttestamentlichen Wissenschaft vgl. Schmid, Konrad, Gibt es Theologie im Alten Testament? Zum Theologiebegriff in der alttestamentlichen Wissenschaft (ThSt N.F. 7), Zürich 2013, v. a. 46 – 51. Bezeichnend mag an dieser Stelle allerdings exemplarisch für das hier angesprochene Problem der Titel der eben angeführten Publikation in Kombination mit ihrem Untertitel sein: Gibt es Theologie im Alten Testament? Zum Theologiebegriff der alttestamentlichen Wissenschaft. Hier erscheint der Theologiebegriff einer wissenschaftlichen Disziplin implizit gleichgesetzt mit dem Vorkommen von „Theologie“ in einer Sammlung religiöser Quelltexte. Deutlich macht
174
5 Wie fragt Theologie?
Dadurch erschwert sich das Herausarbeiten einer wissenschaftstheoretischen Theologizität des jeweiligen Fachs begriffslogischerweise – zumal solche innertheologischen Selbstverortungen selten explizit vollzogen werden. Aufgrund der Fachgeschichte der Alttestamentlichen Wissenschaft, die sich – wie alle modernen Fachgeschichten – durch immer stärkere Ausdifferenzierung und (in diesem Falle) vor allem immer stärkere Historisierung³⁶ und Abgrenzung von bestimmten Formen „dogmatischer“ Theologie kennzeichnete, ranken sich innerdisziplinäre wissenschaftstheoretische Überlegungen klassischerweise um die Frage danach, wie die Einzelergebnisse alttestamentlicher Forschung einander zugeordnet werden können und was sie demnach als Teile eines Ganzen, nämlich einer theologischen Subdisziplin konstituiert, die nicht in andere historisch fokussierte philosophischkulturwissenschaftliche Disziplinen auflösbar ist: Worin liegt gleichsam das Theologische der Alttestamentlichen Wissenschaft als theologischer Subdisziplin? Diese in sich komplexe und bedeutungsschwere Debatte kann und soll im Folgenden – nicht als Einführung in das Fach an sich, sondern eben als fundamentaltheologischenzyklopädische Anfrage – nur grob verkürzend, exemplarisch und elementarisierend betrachtet werden, nämlich in der plakativen Gegenüberstellung zweier mittlerweile klassischen Positionen, die eine Schlüsselfrage Alttestamentlicher Wissenschaft markieren: Religionsgeschichte Israels versus Theologie des Alten Testaments. ³⁷
Schmid direkt in seiner Einleitung, dass sich innerhalb der Alttestamentlichen Wissenschaft die Frage nicht um einen gesamttheologisch-enzyklopädischen Theologiebegriff dreht, sondern vielmehr um die Frage nach der Möglichkeit einer Subsubdisziplin der „Theologie des Alten Testaments“.Vgl. ebd., 9. Es kann an dieser Stelle nur noch einmal betont werden, dass mit der Frage nach der Theologizität schon ein bestimmter, nämlich wissenschaftstheoretischer Theologiebegriff zwingend implizit ist. Weitere Theologiebegriffe (z. B. im Sinne des konkreten religiösen Vollzugs, Lai*innentheologie, …) sind damit immer noch nicht Gegenstand der Reflexion. 36 Wenngleich neuere Ansätze gerade auch eine Umkehrung dieser Historisierungen anvisieren. So z. B. in verschiedenen narratologisch fokussierten Zugriffen. Vgl. dazu einführend Schmidt, Uta, Narratologie und Altes Testament, in: ThLZ 5/143 (2018), 423 – 438, v. a. 428 – 433. 37 Wohl wissend, dass eine solche Gegenüberstellung dieser beiden alttestamentlichen Positionen eine in sich artifizielle ist: Es handelte sich hier um eine Grundsatzfrage, „die gegen Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein sachliches Recht gehabt hat […], mit Blick auf die gegenwärtige Forschungslage aber wohl falsch gestellt ist und dem Sachanliegen beider [Teil‐] Disziplinen unbeschadet bestehender Interdependenzen nicht mehr gerecht wird.“ Gertz, Jan Christian, Grundfragen einer Theologie des Alten Testaments, in: Ders. (Hg.), Grundinformation Altes Testament. Eine Einführung in Literatur, Religion und Geschichte des Alten Testaments (UTB 2745), Göttingen/Stuttgart 2010, 509 – 526, 521. Dennoch muss hier grundlegend konstatiert werden, dass diese Debatte keinesfalls als beendet oder überholt gelten kann, da beide Pole sozusagen als argumentative Normpunkte des alttestamentlich-wissenschaftlichen Diskurses bspw. gerade auch in
5.1 Die enzyklopädische Frage
175
Problemhorizont dieser bis heute andauernden Debatte ist die stetig wachsende Zahl v. a. religionshistorischer und literaturgeschichtlicher Forschungsergebnisse, die die multidimensional-wechselseitigen soziokulturell-historischen Relationen der Texte (und/bzw. Textschichten) des Alten Testaments in sich, untereinander und mit den sie umgebenden historisch-soziokulturell dynamischen Umwelten immer weiter auffächern. In diesem Kontext wird nicht nur die Frage nach der Möglichkeit einer Zusammenschau der einzelnen Forschungsergebnisse immer virulenter, sondern auch der Forschungsgegenstandsbereich selbst – und dementsprechend auch wieder die auf ihn reflektierenden Forschungsergebnisse – fächert sich infinit aus. Denn die alttestamentlichen Texte können, wenn sie in historisch-kritischem Bewusstsein erforscht sein sollen, nicht ohne „Einbeziehung der Geschichtswelt“,³⁸ wie es z. B. in Gerhard von Rads paradigmatischer Theologie des Alten Testaments hieß, betrachtet werden. Dementsprechend kann Alttestamentliche Wissenschaft nicht ohne (forschungsprozesslich immer wieder integrativ auf Gegenstandsbereich und Methode rückkoppelnde) Erforschung der verschiedensten vor- und umliegenden textlichen, archäologischen etc. Quellen dieser Texte bearbeitet werden. Als methodologisch-epistemische Reaktion darauf differenzierte sich die Disziplin der Alttestamentlichen Wissenschaft selbst immer weiter aus, was den inner- und interdisziplinären theologischen Zusammenhang erschwert.³⁹ Im Umgang mit dieser Problematik haben sich in der Alttestamentlichen Wissenschaft eben genannte zwei Pole eines Spektrums möglicher Herangehensweisen ⁴⁰ herauskristallisiert: So steht – arg idealtypisch verkürzt – auf der einen Seite des Spektrums das Ausarbeiten einer theologischen Mitte (im Sinne vielleicht eines hermeneutischen Schlüssels) der Texte des Alten Testaments als theologischneueren Diskussionen immer wieder bemüht werden, um die innere Pluralität oder Spannung Alttestamentlicher Wissenschaft zu beschreiben. 38 Rad, Gerhard von, Theologie des Alten Testaments. Band 1. Die Theologie der geschichtlichen Überlieferung Israels (EETh 1), München 81982, 134. 39 Vgl. Berner, Christoph, Gottes Wort und Schreibers Griffel. Die Redaktionsgeschichte alttestamentlicher Texte als Herausforderung für Exegese und Theologie, in: ZThK 2/118 (2021), 141 – 159, 141 f. 40 Als ein Beispiel für einen eher zwischen diesen Polen verortbaren Ansatz sei an dieser Stelle kurz verwiesen auf den eben zitierten Aufsatz von Christoph Berner, dessen redaktionsgeschichtlicher Zugriff die Möglichkeit und Notwendigkeit aufzeigt, die literarischen Abhängigkeiten und Entwicklungsprozesse alttestamentlicher Text(schicht)e(n) als genuinen Teil eines in diesen Text(schicht)en sich dazu wechselwirksam vollziehenden theologischen Diskurses zu zeichnen. Vgl. ebd., 153 ff. Denn diese Redaktionsgeschichte der alttestamentlichen Texte sei selbst ein „Prozess der Aneignung eines mit Verbindlichkeit formulierten und als verbindlich erachteten Deutungsangebots“. Ebd, 157. Hervorhebung C. N. In dieser grundlegenden Absicht, „den vorliegenden Text aus seinem Entstehungsprozess heraus zu begreifen“ (ebd., Hervorhebung C. N.) zeigt sich das Agieren dieses Ansatzes zwischen den (Extrem‐) Polen von Theologie des Alten Testaments versus Religionsgeschichte Israels.
176
5 Wie fragt Theologie?
disziplinärem Proprium – und auf der anderen Seite die konsequent historischkritische Darstellung einer mit (u. a.) den alttestamentlichen Schriften generierbaren Religionsgeschichte.⁴¹ Betont Erstes einen hermeneutisch-theologisch geradezu normativ erscheinenden Auftrag,⁴² fokussiert Letztes unter Verzicht „auf jeden normativen Wahrheitsanspruch“⁴³ die Darstellung des Facettenreichtums spezifischer konkreter Religionen bzw. Religiosität, wie sie in den alttestamentlichen Schriften und ihren Umwelttexten geschichtlich belegt sind. Droht (in dieser betont plakativen Darstellung) Ersteres also augenscheinlich mit einer gewissen ahistorisch anmutenden Normativität, die potentiell den Texten weder historisch noch soziokulturell⁴⁴ gerecht werden könnte, scheint sich Letzteres durch immer
41 Repräsentiert sind beide Ansätze klassisch in von Rads Theologie des Alten Testaments von 1957/ 67 und in Rainer Albertz Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit von 1992. Letzterem wird wohl (vor allem von Vertreter*innen pro einer Theologie des AT) diese geradezu antithetische Positionierung dieser beiden Zugriffe zugeschrieben. Vgl. Schmid, Konrad, Theologie des Alten Testaments (NTG), Tübingen 2019, 84. 42 Der sich aus den Texten (bzw. z. B. ihrer kanonisierten Konstitution oder aber ihrer Genese und Geschichte) selbst ergeben würde.Vgl. so z. B. Janowski, Bernd, Old Testament Theology. Preliminary Conclusions and Future Prospects, in: Sæbø, Magne/Machinist, Peter (Hg.), The twentieth century. From Modernism to Post-Modernism (HBOT III/2), Göttingen 2015, 642 – 673, 667. Für Bernd Janowski besteht der hermeneutisch-theologische Schlüssel der alttestamentlichen Texte im Verhältnis von „YHWH and Israel“. Ebd., 671. Aufgabe der Alttestamentlichen Wissenschaft bzw. ihrer Kerndisziplin der Theologie des Alten Testaments bestünde dann darin, dieses Kommen JHWHs zu Israel nicht nur in seiner Genese, sondern auch in seiner „validity“ zu explizieren. Ebd., 664.667. So verstandene Theologie kennzeichnet sich also durch eine gewisse valide Normativität aus, wenn eben nicht „nur“ die historische Entstehung der Religion Israels (wie auch immer dieser Begriff zu füllen sein dürfte), sondern auch die Gültigkeit dieses speziellen „discourse about God“ (ebd., 667) zum Thema wird. Für Janowski geht es dabei darum, die „‚uniquenessʻ, or, better said, the ‚self-conceptʻ […] of Israelite religion“ zum Ausdruck zu bringen – ohne dabei den historischen Kontext zwangsläufig zu vernachlässigen. Ebd., 654. 43 Saur, Markus, Alttestamentliche Wissenschaft, in: Becker, Eve-Marie/Hiller, Doris (Hg.), Handbuch Evangelische Theologie. Ein enzyklopädischer Zugang (UTB 8326), Tübingen 2006, 27– 86, 56. 44 Schließlich handelt es sich – in Blick sowohl auf ihre Genese als auch auf ihre Rezeption als Kanon – (auch) um heilige Schriften des Judentums. Der Frage nach dem vielfältig reflektierten und konstant zu reflektierenden Umgang mit dieser – gerade für deutschsprachige Theologie – offensichtlich heiklen Situation kann hier nicht nachgegangen werden. Verwiesen sei als Beispiel für die anhaltende theologische Tragweite dieses Problemhorizonts an dieser Stelle nur auf die schwerwiegende Debatte von 2015 um den explizit provokanten Vorstoß Notger Slenczkas. Vgl. Slenczka, Notger, Das Alte Testament und die Kirche, in: Gräb-Schmidt, Elisabeth/Preul, Reiner (Hg.), Das Alte Testament in der Theologie (MthSt 119), Leipzig 2013, 83 – 119, 83. Mit seinem Votum in Rezeption Harnacks und Schleiermachers, das Alte Testament zwar als Teil der (Vor‐) Geschichte, nicht aber als kanonische, normative Schrift des Christentums zu werten und dementsprechend seinen kirchlichen Gebrauch (z. B. als Predigttextgrundlage) kritisch zu überdenken (vgl. ebd., 118 f.), brach er eine über die Grenzen des rein theologischen Fachdiskurses hinaus reichende Debatte über die Frage
5.1 Die enzyklopädische Frage
177
weiter sich schlimmstenfalls vereinzelndes Sammeln und Analysieren auszudifferenzieren.⁴⁵ Deutlich bleibt ein grundlegendes hermeneutisches Problem historisch-kritischer Wissenschaft: „Geschichte […] ist ein Sinnkonzept“,⁴⁶ also „ein plausibler und verlässlich beglaubigter reflektierter Bedeutungszusammenhang der Erfahrungs- und Lebenswelt.“⁴⁷ Dementsprechend läuft historische Forschung nur über bestimmte heuristische Deutungskategorien,⁴⁸ Typisierungen und Begriffe, welche in beiden stilisierten Positionen selbstverständlich in der Systematisierung des historischen Datenmaterials zur Anwendung kommen. Unterschied dürfte vor allem, wie eben angedeutet, die jeweilige Wichtung bzw. Normativität der Herleitung und Anwendung dieser Kategorien sein.⁴⁹ Mit dieser methodologischepistemischen Grundsatzfrage als die die Pluralität des innerdisziplinären Diskurses illustrierende Hintergrundfolie zeigt sich dann also zwar kein der Disziplin gegenwärtiger, die inneren Differenzen harmonisierender Theologie- bzw. Theologizitätsbegriff als allgemein anerkannt vorfindlich. Doch erscheinen in den verschiedenen Positionen gewisse Gemeinsamkeiten, von denen dann auf implizit verbindende epistemische Interessen auf einer Meta-Ebene geschlossen werden kann. So ist vor allem der grundlegende Bezug auf Quellen – wie er typischer „Ausgangspunkt“ in „allen […] historisch und philologisch arbeitenden Disziplinach der Stellung des Alten Testaments im Kontext christlicher Theologie los. Vgl. dazu z. B. Klatt, Thomas, Nicht ohne das Alte Testament? Die Thesen des Berliner Theologen Notger Slenczka, in: Deutschlandfunk (16.12. 2015), https://www.deutschlandfunk.de/die-thesen-des-berliner-theologennotger-slenczka-nicht.886.de.html?dram:article_id=339892 – 16.02. 2021. Aufgrund der Brisanz seiner Thesen, in denen ein spezifisches Verständnis von Schrift, Kanonizität und Theologischer Wissenschaft mehr oder weniger explizit zum Ausdruck kommt, hatte Slenczka damals den Ruf auf eine Professur für Systematische Theologie an der Universität Leipzig nicht erhalten.Vgl. dazu Pilz, Dirk, Der Bibelstreit, in: Frankfurter Rundschau (11.08. 2017), https://www.fr.de/kultur/bibelstreit-11026185. html – 16.02.21. 45 Vgl. für eine solche Gegenüberstellung Schaper, Joachim, Problems and Prospects of a ‚History of the Religion of Israelʻ, in: in: Sæbø, Magne/Machinist, Peter (Hg.), The twentieth century. From Modernism to Post-Modernism (HBOT III/2), Göttingen 2015, 622 – 641, 639 ff. 46 Rüsen, Jörn, Historik. Theorie der Geschichtswissenschaft, Köln 2013, 99. 47 Ebd. 48 „Forschung zur Geschichte verbindet empirisch-rezeptive Rekonstruktion mit konstruierendgegenwartsbezogener Arbeit.“ Oorschot, Das Alte Testament, 35 f. 49 Verschiedene Positionen auf dem Spektrum zwischen diesen beiden Extrempolen argumentieren über solche hermeneutische Kategorien. So spricht sich Joachim Schaper für eine sowohl die konstatierte normative Verengung einer Theologie des Alten Testaments und das vereinzelnde Sammeln einer Religionsgeschichte Israels überwindende Alternative aus, die er in der „History of Israel“ als „‚queenʻ of Old Testament sub-disciplines“ sieht. Schaper, Problems and Prospects, 639. Israel fungiert hier dann als deutender Begriff, unter dessen Anwendung Alttestamentliche Wissenschaft ihre Forschung synthetisiert, indem sie israelische Geschichte in Bezug auf Politik, Wirtschaft und Alltagskultur hin rekonstruiert.
178
5 Wie fragt Theologie?
nen“⁵⁰ ist – evident: Es geht um das (wie auch immer inhaltlich konnotierte) Erforschen der Texte des Alten Testaments; nicht in rein literarischer Absicht, sondern mit dem Impetus, die Welt dieser Texte in ihrer Genese und Geschichte, also ihrem syn- und diachronen soziokulturellen Kontext zu verstehen ⁵¹ (im weitesten Sinne). Dieses Interesse an den Schriften des Alten Testaments und seiner Umwelt allein ist natürlich noch nicht das theologische Identität stiftende Proprium der Alttestamentlichen Wissenschaft.⁵² Doch ist es gesamttheologisch-fachgeschichtlich ja aber durchaus kein Zufall, dass diese Texte als eines der Zentren wissenschaftlich-theologischer Forschung gelten, sondern ergibt sich aus dem (lebens‐) weltlichen ⁵³ Kontext des Fachs: In diesem Falle (der christlichen Theologie) aus der religiösen Rezeption des Alten Testaments⁵⁴ im (Juden- und) Christentum in seinen Kontexten in Geschichte (und Gegenwart).⁵⁵ Somit scheint dann der Meta-Kontext der Theologizität dieses Forschungsinteresses in eben jenem sozusagen (lebens‐) weltlichen Bezug von Theologie zu liegen: Der diskurslogisch metatheoretische „Interpretationsrahmen“ historisch-kritischer
50 Berlejung, Angelika, Quellen und Methoden, in: Gertz, Jan Christian (Hg.), Grundinformation Altes Testament. Eine Einführung in Literatur, Religion und Geschichte des Alten Testaments (UTB 2745), Göttingen/Stuttgart 2010, 15. 51 Vgl. Saur, Alttestamentliche Wissenschaft, 27. 52 Zumal, wie in Kapitel 3 dargelegt wurde, Untersuchungsgegenstände wissenschaftstheoretisch wohl kaum die Eigenständigkeit von (Sub‐) Disziplinen begründen. Gerade die Texte des Alten Testaments und seiner Umwelt können Gegenstand verschiedenster Fächer sein – seien es altorientalistische, kunsthistorische, gendertheoretische oder anderweitig geistes- und kulturwissenschaftliche. 53 „Lebenswelt [lässt sich] als der jeweils nicht-überschreitbare, nur intuitiv mitlaufende Erfahrungshorizont und als nicht-hintergehbarer, nur ungegenständlich präsenter Erlebnishintergrund einer personalen, geschichtlich situierten, leiblich verkörperten und kommunikativ vergesellschafteten Allttagsexistenz beschreiben. Wir sind uns dieses Existenzmodus unter verschiedenen Aspekten bewusst. Wir erfahren uns performativ als erlebende, in organische Lebensvollzüge eingelassene, als vergesellschaftete, in ihre sozialen Beziehungen und Praktiken verstrickte, und als handelnde, in die Welt eingreifende Subjekte.“ Habermas, Jürgen, Von den Weltbildern zur Lebenswelt, in: Gethmann, Carl Friedrich (Hg.), Lebenswelt und Wissenschaft. XXI. Deutscher Kongreß für Philosophie. 15. – 19. September 2008 an der Universität Duisburg-Essen. Kolloquienbeiträge (Deutsches Jahrbuch Philosophie 2), Hamburg 2011, 63 – 88, 64. Hervorhebung C. N. In diesem Vortrag vollzog Habermas seine sozialtheoretisch-kommunikationstheoretisch fokussierte Erweiterung eines (hier auf Husserl rekurrierenden) Lebensweltbegriffs als Kernmoment von Gesellschaft und Bedingung von (Philosophie und) Wissenschaft. 54 Damit soll keinesfalls einem unreflektierten Verständnis des Prinzips sola scriptura zugesprochen werden. Vielmehr steht dahinter das Grundverständnis, dass „[d]ie Geltung des biblischen Kanons [und somit auch des Alten Testaments] ein Phänomen der Rezeptionsgeschichte der Bibel“ ist. Schmid, Theologie des Alten Testaments, 5. 55 Vgl. dazu auch Oorschot, Das Alte Testament, 38.40.
5.1 Die enzyklopädische Frage
179
Erforschung der Texte des Alten Testaments und seiner Umwelt wäre dann „die kirchliche Situation [im weitesten Sinne, C. N.] der Gegenwart“.⁵⁶ Solche „hermeneutischen, d. h. auf die Möglichkeiten der Auslegung und Übertragung bezogenen Reflexionen“⁵⁷ dieser Texte in ihrer Genese und Geschichte sind dann nicht der materiale Arbeitsauftrag Alttestamentlicher Wissenschaft (und somit auch nicht ihr vermeintlich methodologisch-epistemisches Proprium). Aber sie ist dadurch eingebunden in einen gesamttheologischen Diskurs ⁵⁸ – und ist eben dadurch dann eine theologische Disziplin.⁵⁹ Auf ähnliche Weise lässt sich (wieder nicht als Einführung in die Subdisziplin an sich, sondern als eine fundamentaltheologisch-enzyklopädische Anfrage) die Theologizität der Neutestamentlichen Wissenschaft konstruieren – wenngleich natürlich fachspezifisch differierende, eigenständige Fokussierungen und Fragekomplexe für das Selbstverständnis der Subdisziplin zentral sind. Dennoch gilt auch für die Wissenschaft zum Neuen Testament, dass sie – als post-/moderne historischphilologische Wissenschaft – geprägt ist von kontinuierlichen Abgrenzungs-,⁶⁰ Ausdifferenzierungs- und Spezialisierungsprozessen, wie sie nicht nur typisch, sondern genuin sind für moderne Wissenschaft und damit auch für wissenschaftlich betriebene Theologie: „Die wissenschaftliche Einheit der Theologie basiert auf der Spezialisierung ihrer Teildisziplinen.“⁶¹ Dementsprechend ranken sich (auch
56 Saur, Alttestamentliche Wissenschaft, 58. 57 Ebd. 58 Vgl. Anselm, Reiner, Das Verbindende der Praxis. Der Bezug auf die Vollzüge des Christentums macht die Theologizität einer Disziplin aus. Ein Kommentar zum Impuls von Konrad Schmid, in: Albrecht, Christian/Gemeinhardt, Peter (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und außen, Tübingen 2021, 59 – 62, 60. 59 Vgl. z. B. Saur, Alttestamentliche Wissenschaft, 58. Vgl. auch Schmid, Konrad, Die Wissenschaft vom Alten Testament im Rahmen der Theologie, in: Albrecht, Christian/Gemeinhardt, Peter (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und von außen, Tübingen 2021, 37– 46, 39. 60 Neutestamentliche Wissenschaft als solche gibt es fachgeschichtslogischerweise erst seit es ein Verständnis vom Neuen Testament als eigenständiger historischer Größe gibt. Dementsprechend entstand Neutestamentliche Wissenschaft in modernen Abgrenzungsprozessen von bis dato sozusagen dogmatisch-theologisch fokussierten Forschungsinteressen an den Texten des Neuen Testaments. Vgl. Becker, Eve-Marie, Neutestamentliche Wissenschaft, in: Dies./Hiller, Doris (Hg.), Handbuch Evangelische Theologie. Ein enzyklopädischer Zugang (UTB 8326), Tübingen 2006, 87– 156, 90. Deutlicher wird das – ähnlich wie bei Alttestamentlicher Wissenschaft (bzw. Wissenschaft überhaupt) – durch den Großkontext der Abgrenzung von voraufklärerischen Wissenschaftsverständnissen überhaupt. Vgl. ebd., 96. Die Abgrenzung erfolgte gegenüber der Dominanz durch eine spezifische, nämlich ebenfalls voraufklärerische Art theologischer Dogmatik. Somit entsprechen diese Abgrenzungsprozesse gleichsam den innertheologischen Ausdifferenzierungsprozessen. 61 Ebd., 136.
180
5 Wie fragt Theologie?
bei Neutestamentlicher Wissenschaft in den meisten Fällen eher implizite) enzyklopädische Selbstverortungen ebenfalls wieder um die Frage, was sie zu einer konkreten theologischen Subdisziplin macht. Auch hier wird der Theologiebegriff mit sehr differierenden Konnotationen – verschiedentlich in-/transparent – zum Einsatz gebracht: So existiert begriffslogisch eben unter anderem einerseits wieder die fachliche Selbstverortung im akademisch-theologischen Fächerkanon und dementsprechend die Implikation eines wissenschaftstheoretisch-disziplinären Verständnisses von Theologie als einer Facheinheit. Und andererseits ist der Gedanke einer aus bzw. mit den Quelltexten in ihren verschiedenen Schichten zu generierenden Theologie des Neuen Testaments ⁶² eine der Schlüsselfragen Neutestamentlicher Wissenschaft. In dieser Pluralität begriffslogischer Ansätze äußert sich dann auch immer wieder der Versuch, den theologisch-disziplinären Kern der Neutestamentlichen Wissenschaft zu setzen. Ob dieser eben material in einer Theologie des Neuen Testaments, methodologisch in einer Religionsgeschichte des Urchristentums o. ä.⁶³ liegt, wird dabei naturgemäß dauerhaft verschiedentlich diskutiert. Wobei die verschiedenen Positionen logisch auch verschiedene Verständnisse des Theologiebegriffs⁶⁴ und der sowohl wissenschaftlichen als auch frömmigkeitsgeschichtlichen Art und Funktion der Umwelt-/Texte des Neuen Tes-
62 Exemplarisch steht dafür die Theologie des Neuen Testaments von Ferdinand Hahn von 2003. Hahn zeichnete hier die Aufgabe einer Theologie des Neuen Testaments als in der Genese und Geschichte der Jesustradition selbst angelegt: „Die [neutestamentlich-theologische, C. N.] Rückfrage erfolgt ja aufgrund der vollzogenen Integration der Jesusüberlieferung in das nachösterliche Kerygma, und auf dem Weg über die Rückfrage wird der Integrationsprozeß selbst durchsichtig und nachvollziehbar.“ Hahn, Ferdinand, Theologie des Neuen Testaments. Band 1. Die Vielfalt des Neuen Testaments (UTB 3500), Stuttgart 22011, 22. Da Theologie in Hahns Konzeption „Nachdenken über den als gültig anerkannten Wahrheitsanspruch der christlichen Botschaft“ (ebd., 1) der Jesustradition sei, wie sie eben maßgeblich in den Texten des Neuen Testaments bezeugt werde, habe also eine Theologie des Neuen Testaments die in der Tradition selbst begründete Aufgabe, solches in Fokussierung auf eben dieses „Glaubenszeugnis des Urchristentums, das als solches Grundlage aller Theologie und Verkündigung ist“, zu vollziehen. Ebd. Hervorhebung C. N. Zu einem kurzen einführenden, ansatzlogisch geordneten Überblick über weitere zentrale neuere Konzeptionen einer Theologie des Neuen Testaments vgl. Bormann, Lukas, Theologie des Neuen Testaments. Grundlinien und wichtigste Ergebnisse der internationalen Forschung (Basiswissen Theologie und Religionswissenschaft 4838), Göttingen 2017, 25 – 28. 63 Vgl. zu einer knapp-exemplarischen Auflistung ebd., 28 f. 64 Lukas Bormann macht in seiner 2017 erschienenen, hier bereits zitierten Theologie des Neuen Testaments ein Spektrum auf zwischen einem offenen, eher anthropologisch fundierten Theologieverständnis und einem eher geschlossenen, substantiell dogmatisch-topologisch orientierten Theologiebegriff. Vgl. ebd., 30 f.
5.1 Die enzyklopädische Frage
181
taments und des neutestamentlichen Kanonbegriffs insgesamt⁶⁵ mit sich tragen. Ähnlich wie bei der Alttestamentlichen Wissenschaft scheint (in den Augen der Fundamentaltheologin) auch hier die Frage dahinterzustehen nach der kritischreflexiven wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzung mit einem (wie auch immer zu füllenden) Schriftprinzip als zentralem Identity Marker evangelischer Theologie im Verhältnis zum Selbstverständnis von Theologie als nach bestimmten epistemischen Übereinkünften agierender Wissenschaft. Denn auch Neutestamentliche Wissenschaft ist als solche natürlich eine spezifisch quellenbezogene Disziplin: Es geht um die Erforschung und Auslegung der verschiedensten Quellen, v. a. der Umwelt-/Texte und Textschichten sowohl des neutestamentlichen Kanons als auch seiner Kontexte nicht-kanonisierter Schriften in ihrer Genese, Geschichte und eben quellentechnischen Kontextualität.⁶⁶ Mit divergierenden Schriftverständnissen variieren dementsprechend – sowohl in fachgeschichtlicher als auch in aktueller Perspektivität – die Fachverständnisse. Diese spezifische methodologischepistemische Quellbezogenheit Neutestamentlicher Wissenschaft ist natürlich auch wiederum keine Zufälligkeit, sondern ergibt sich aus der (so weit wie möglich zu verstehenden) Rezeptionsgeschichte des Neuen Testaments⁶⁷ und der Frömmigkeitsgeschichte des Urchristentums. Das hat zwar aufgrund dieser Positionalität metatheoretisch wissenschaftslogischerweise dann auch eine immanente infinite Pluralität Neutestamentlicher Wissenschaft zur Folge. Gleichzeitig scheint sich darin aber auch wiederum die Theologizität des Faches zu zeigen. Denn was den Selbstverständnissen dieser Subdisziplin als theologische – in all ihren Verschiedenheiten – gemein zu sein scheint, ist der denkerische vor-/wissenschaftliche Großkontext christlicher Religion bzw. christlichen Glaubens in Geschichte (bzw. Geschichtlichkeit) und Gegenwart. ⁶⁸ Aus diesem lebensweltlichen Kontext heraus bedingt sich metatheoretisch gedacht das theologische Forschungsinteresse an den Texten des Neuen Testaments überhaupt. Auch hier ist damit nicht gemeint, dass die explizite – gar hermeneutisch fokussierte – Reflexion
65 Was wiederum mit der Fokussierung auf unterschiedliche hermeneutische Schlüssel einhergeht. Als exemplarische Reflexion dazu bei Hahn: „Während das Insistieren auf einem ‚Kanon im Kanon‘ eine prinzipielle sachkritische Funktion und die Tendenz zu einer eindeutigen Festlegung hat, wird bei der Frage nach der ‚Mitte der Schrift‘ nach Gemeinsamkeiten und Beziehungen trotz erkennbarer Unterschiede gefragt, was allerdings nicht völlig ausschließt, daß auch hier einzelne Texte der aufgezeigten Mitte nicht entsprechen und an den Rand gerückt bzw. ausgegliedert werden.“ Hahn, Theologie, 24 f. 66 „Die Exegese ist der Ausgangs- und Zielpunkt neutestamentlicher Wissenschaft.“ Becker, Neutestamentliche Wissenschaft, 115. 67 Vor allem, da die Kanonisierung biblischer Schriften nie uniform, überkontextuell oder voraussetzungsfrei, sondern immer konkret intendiert war. Vgl. Ohst, Das Neue Testament, 90 f. 68 Vgl. zum Gegenwartsbezug z. B. Alkier, Das Neue Testament, 57 f.63 f.
182
5 Wie fragt Theologie?
dieses Kontextes Arbeitsauftrag Neutestamentlicher Wissenschaft sei. Sondern vielmehr wird auch an dieser Stelle darauf abgehoben, dass Neutestamentliche Wissenschaft aus diesem Kontext heraus in einen Kontext hinein entstanden ist: Indem sie im Diskurs des theologischen Fächerkanons, also unter einer gemeinsamen Fragestellung steht,⁶⁹ ist sie eine theologische Disziplin.⁷⁰ Daraus ergeben sich dann gleichsam wiederum die subdisziplinär spezifischen theologischen Arbeitsaufträge, denn „die Gemeinsamkeit der Fragestellung erfordert eine Delegation von Einzelaufgaben.“⁷¹ Und diese theologischen Einzelaufgaben legitimieren sich wiederum durch den gesamttheologischen Diskurs, in dem sie generiert und ausgeführt werden.⁷² Im Falle der Neutestamentlichen Wissenschaft bestehen diese, wie bereits erwähnt, dann in der historisch-kritischen und – durch die daraus entstandene diskursive Kommunikabilität⁷³ – theologischen Auslegung der verschiedenen Quellen, Umwelt-/Texte und Textschichten des Neuen Testaments und seiner Kontexte als (wiederum Kontexten von) zentralen Zeugnissen urchristlichen Glaubens und seiner Reflexion im Kontext seiner Entstehungsphase. Diese diskursiv-wissenschaftstheoretische Einordnung lässt sich auch am Fach der Kirchengeschichte ⁷⁴ konstruieren:⁷⁵ Exemplarisch – also auch hier wieder nicht
69 Vgl. z. B. ebd., 60 f. 70 Vgl. Becker, Neutestamentliche Wissenschaft, 88. Für Neutestamentliche Wissenschaft bedeutet das dann auch, dass sie, je nachdem ob sie im innertheologischen oder im außertheologischen interdisziplinären Diskurs steht, unterschiedliche Fokusse in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit anlegt. Vgl. ebd., 131 ff. 71 Ebd., 135. 72 Vgl. ebd. 73 Genau hierin besteht die Angewiesenheit der anderen theologischen Subdisziplinen auf die Neutestamentliche Wissenschaft: Durch historisch-kritische Exegese im Horizont des gesamttheologischen Diskurses werden die Texte des Neuen Testaments in ihrer spezifischen soziokulturellen Kontextualität und Positionalität dem „inter-subjektiven Verstehen“ der Scientific Community zugeführt. Ebd., 109. 74 Auch an dieser Stelle erfolgt also keine Darlegung der innerdisziplinären Fachlogik. Solches wäre, angesichts der inneren Pluralität der Disziplin, die sich in unterschiedlichen kirchengeschichtlich-innerdisziplinären Teil-Logiken (z. B. Patristik versus Reformationsgeschichte) äußert, auch im Rahmen dieser Arbeit weder schaffbar noch angemessen. Es geht auch im hier Folgenden wieder um die fundamentaltheologische Reflexion auf die Theologizität der Kirchengeschichte auf der Ebene der gesamttheologischen Diskursstruktur. 75 Nicht im Fokus sind hier also die in der innerkirchengeschichtlichen Debattenlage immer wieder zentralen Selbstverhältnissetzungen zur allgemeinen Geschichtswissenschaft – gerade angesichts des im Grunde identischen Methodenkanons der Geistes- und Kulturwissenschaften zwischen Kirchen- und sozusagen Profangeschichte. Allerdings lässt sich hier direkt die These aufstellen, dass der kirchengeschichtliche Theologiebegriff wechselseitig beeinflusst sein dürfte vom Verständnis dessen, was allgemein als geschichtswissenschaftlich bzw. als Geschichte verstanden wird. Vgl. zu theologisch-kirchengeschichtlichen Reflexionen auf den Geschichtsbegriff exempla-
5.1 Die enzyklopädische Frage
183
verstanden als Einführung in das Fach selbst, sondern als Anfrage in fundamentaltheologisch-enzyklopädischer Forcierung – im nun Folgenden sich aufhängend an der anhaltenden Auseinandersetzung um die evangelisch theologisch-disziplinäre Bestimmung des Fachs durch Ebeling als „Geschichte der Auslegung der Heiligen Schrift“.⁷⁶ Ausgehend von der Reflexion auf den in der Fachtitulierung mitgegebenen Begriff der Kirche (und in denkerischer Zusammenschau mit CA VII als einem der Identity Marker reformatorischen Christentums) stellte Ebeling Kirchengeschichte als die theologische Disziplin dar, die historisch-kritisch untersuche, wann, wo und wie historische Ereignisse in „nicht nur ausgesprochene[r], sondern auch […] unausgesprochene[r], nicht nur […] bewußte[r], sondern auch […] unbewußte[r], nicht nur […] positive[r], sondern auch […] negative[r] Beziehung zur Heiligen Schrift“⁷⁷ stehen. Auslegung meine hier also nicht (nur) theologische Textarbeit oder kirchliche Verkündigung, sondern auch „Handeln und Leiden“⁷⁸ im weitesten Sinne, das wiederum in verschiedentlich möglicher Beziehung zu den Texten des Neuen und des Alten Testaments stehe.⁷⁹ Diese Bestimmung der Theologizität der Kirchengeschichte wird zwar durchaus bis heute innerdisziplinär rezipiert,⁸⁰ stand aber gleichzeitig von Anfang an in stärkster kirchengeschichtlicher Kritik,⁸¹ da Ebelings Vorstoß eingeschätzt wurde als forschungsprozesslogisch unsachgemäße normative Vorgabe an ihrem Selbstverständnis nach in aufkläreri-
risch Gemeinhardt, Peter, Geschichte des Christentums als theologische Disziplin. Eine intra- und interdisziplinäre Verortung, in: Ders./Albrecht, Christian (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und außen, Tübingen 2021, 97– 113, 100 ff. 76 Ebeling, Gerhard, Kirchengeschichte als Geschichte der Auslegung der Heiligen Schrift, in: Ders., Wort Gottes und Tradition (KiKonf 7), Göttingen 1964, 9 – 27, 9. Seine 1947 gehaltene und dann verschriftlichte Habilitationsvorlesung gilt als einer der „Referenztexte[…] für kirchengeschichtliche Selbstverständnisse im deutschen Sprachraum. Kaum ein Autor und kaum eine Autorin verzichtet darauf, sich in Zustimmung oder Ablehnung auf Ebelings möglicherweise wirkungsmächtigsten Text zu beziehen.“ Keßler, Martin, „Kirchengeschichte als Geschichte der Auslegung der Heiligen Schrift“. Gerhard Ebelings handschriftliche Vorbereitung seiner Habilitations-Probevorlesung (1946), in: Kampmann, Claudia/Volp, Ulrich/Wallraff, Martin (Hg.), Kirchengeschichte. Historisches Spezialgebiet und/oder theologische Disziplin (Theologie – Kultur – Hermeneutik 28), Leipzig 2020, 283 – 320, 283. 77 Ebeling, Kirchengeschichte, 24. 78 Ebd. 79 Weshalb so verstandene Kirche in Reflexion der reformatorisch-theologischen Tradition dann spätestens seit dem Pfingsten der Apostelgeschichte als dynamisch-kontinuierlicher Gegenstandsbereich der Kirchengeschichte gelte. Vgl. ebd., 22 f. 80 Vgl. z. B. Markschies, Christoph, Arbeitsbuch Kirchengeschichte (UTB 1857), Tübingen 2011, 150 ff. 81 Zumal Ebeling selbst wohl dieses Programm „nie weiter verfolgte“. Ohst, Das Neue Testament, 85.
184
5 Wie fragt Theologie?
scher Tradition stehende Kirchengeschichte als einem „Kind der Neuzeit“⁸² – also als v. a. empirisch-deskriptiver ⁸³ historischer Disziplin.⁸⁴ Die Ebelingsche Konstruktion verkürze dadurch kirchengeschichtliche Forschung, dass sie – multidimensional – eingrenzt: Maßgeblich auf eben einen bestimmten reformatorischen Kirchenbegriff und das damit korrespondierende Schriftprinzip.⁸⁵ Unabhängig davon, ob damit der (an dieser Stelle nicht weiter zu bewertende) fundamentaltheologische ⁸⁶ Kern von Ebelings Ansatz getroffen wurde, wird anhand dieser 82 Ritter, Adolf Martin, Kirchengeschichte – was ist das? Ein Gespräch mit Wolfram Kinzig und Hartmut Leppin, in: Kampmann, Claudia/Volp, Ulrich/Wallraff, Martin (Hg.), Kirchengeschichte. Historisches Spezialgebiet und/oder theologische Disziplin (Theologie – Kultur – Hermeneutik 28), Leipzig 2020, 373 – 392, 389. 83 Vgl. Leppin, Die Kirchengeschichte, 75 f. 84 Vgl. dazu z. B. Leppin, Volker, Kirchengeschichte und europäische Religionsgeschichte, in: Ders./ Fitschen, Klaus/Kinzig, Wolfram/Kohnle, Armin (Hg.), Kirchengeschichte und Religionswissenschaft. Methoden und Fallstudien (AKThG 51), Leipzig 2018, 17– 34, 24 f. Vgl. ebenso ders., Kirchengeschichte zwischen historiographischem und theologischem Anspruch. Zur Bedeutung der Semiotik für das Selbstverständnis einer theologischen Disziplin, in: Ders./Nowak, Kurt/Kinzig, Wolfram/Wartenberg, Günther (Hg.), Historiographie und Theologie. Kirchen- und Theologiegeschichte im Spannungsfeld von geschichtswissenschaftlicher Methode und theologischem Anspruch (AKThG 15), Leipzig 2004, 223 – 234, 224 f. Solche Vorstöße werden hier gezeichnet als „die dogmatische Falle der normativen Überformung empirischen Arbeitens“. Ebd., 225. In der Kontrastierung von Kirchengeschichte und Dogmatik könnte man sich an dieser Stelle schon allein sprachlich erinnert fühlen an Dichotomisierungen zwischen Religionswissenschaft als empirisch-deskriptiv und dementsprechend eigentlich wissenschaftlich – und Theologie als normativ voraussetzungsvoll-unwissenschaftlich. Und vielleicht scheinen solche Zuschreibungen Hintergrund von Ebelings Votum gewesen zu sein, „daß von den Theologen gewöhnlich noch am ehesten der Kirchenhistoriker allgemeine wissenschaftliche Reputation genießt und daß zuweilen solche, die mit der Theologie nicht zurechtkommen, hier ein neutrales Refugium suchen.“ Ebeling, Studium, 69. 85 Ebeling selbst versuchte in Reaktion darauf später in seinem hier schon vielfach zitierten Ansatz theologischer Enzyklopädie noch einmal zu verdeutlichen, dass der von ihm angesetzte Begriff der Auslegung nicht als auf das reformatorische Schriftprinzip normierende materiale Beschränkung zu verstehen sei, sondern es sich dabei vielmehr um eine hermeneutische Bestimmung handele, die letztlich zwar auch den Text der Schrift, aber eben auch umso stärker den wechselseitigen Bezug zu seinem lebensweltlich-geschichtlich-dynamischen Kontext fokussiert. Vgl. ebd., 80. 86 Es könnte konstatiert werden, dass Ebeling – zumindest retrospektiv betrachtet – wohl von Anfang an (offenbarungstheologisch orientierte) fundamentaltheologische Forschungsschwerpunkte verfolgte; so eben auch in jener Habilitationsvorlesung 1946. Vgl. zum fachlich-entstehungsgeschichtlichen Hintergrund der Antrittsvorlesung Keßler, „Kirchengeschichte …“, 290 – 294. Es wäre also zu überlegen, ob der (anfangs) Kirchengeschichtler hier nicht vielmehr bereits als Fundamentaltheologe metatheoretisch auf die Enzyklopädie der Theologie reflektierte – und nicht auf forschungspraxeologischer Ebene ein materiales, normatives Heuristikum aller Kirchengeschichte aufstellte. Ersteres wäre wahrscheinlich weniger problematisch, da „nach alter Lehre die Prinzipien einer Disziplin nicht Arbeitsergebnis dieser Disziplin selbst, sondern deren Vorgabe“ sind. Pesch, Otto Hermann, Gerechtfertigt aus Glauben. Luthers Frage an die Kirche (QD 97), Freiburg i. Br. 1982, 114. Es gäbe dann vielleicht im An-
5.1 Die enzyklopädische Frage
185
(Negativ‐) Folie deutlich, dass gerade Kirchengeschichte in ihrem Selbstverständnis als historische Disziplin geprägt ist von ihren berechtigten fachgeschichtlichen Emanzipationsprozessen,⁸⁷ so dass sie sich als Disziplin in den Spektren zwischen dem gesamttheologischen Diskurs und der allgemeinen Geschichtswissenschaft zu bewegen scheint.⁸⁸ Gerade angesichts dieser nicht nur operativen, sondern auch epistemisch-methodologischen Dynamik lässt sich die bleibende „Notwendigkeit des Zusammenhalts von Kirchengeschichte mit dem Ganzen der Theologie ebenso wie des engen Kontakts mit der allgemeinen Geschichte“⁸⁹ verstehen. Deswegen kann ihre Theologizität auch nicht in einer von anderen historischen Disziplinen verschiedenen normativen, gar methodologisch-leitenden Beschränkung liegen:⁹⁰ Kirchengeschichte greift auf keinen anderen Methodenkanon zu als den der Geistes- und Kulturwissenschaften⁹¹ und unterscheidet sich grundepistemisch in dieser Hinsicht nicht von der allgemeinen Geschichtswissenschaft.⁹² Und auch der rein schluss an Ebelings Ansatz vielmehr „auch zu der Frage Anlaß […], ob die wissenschaftstheoretische Selbstverständigung über Wesen und Aufgabe der Kirchengeschichte nicht ohnehin viel eher in der theologischen Enzyklopädie ihren sachgemäßen Ort haben würde als in einer Propädeutik der eigenen Disziplin.“ Beutel, Albrecht, Kirchengeschichte als Geschichte der Auslegung der Heiligen Schrift. Ein tragfähiges Modell?, in: Nowak, Kurt/Kinzig, Wolfram/Leppin, Volker/Wartenberg, Günther (Hg.), Historiographie und Theologie. Kirchen- und Theologiegeschichte im Spannungsfeld von geschichtswissenschaftlicher Methode und theologischem Anspruch (AKThG 15), Leipzig 2004, 103 – 118, 114. 87 Namentlich zumindest in der Rezeption von der „Marginalisierung“ der Kirchengeschichte als theologische Hilfswissenschaft durch Karl Barth. Leppin, Kirchengeschichte und, 24. Vgl. Barth, KD I,1, § 1, 3. Vgl. z. B. Schmidt, Standort, 393. Dieser Zuschreibung Barths scheint ebenfalls eine anhaltende und „vergleichbare Relevanz“ in innerkirchengeschichtlichen Debatten um das Selbstverständnis zuzukommen wie der der Konzeption Ebelings, da sie „nach wie vor […] leidenschaftliche[n] Widerspruch [zu] provozieren“ scheint. Keßler, „Kirchengeschichte …“, 284. „Beide Autoren teilen das Schicksal, dass ihr jeweiliges Kirchengeschichtsverständnis häufig in schlagwortartiger Verkürzung begegnet.“ Ebd. 88 Vgl. Leppin, Die Kirchengeschichte, 72 f. 89 Ritter, Kirchengeschichte, 384. 90 Vgl. Schmidt, Standort, 402. 91 Vgl. Leppin, Die Kirchengeschichte, 83. 92 Vgl. Schmidt, Standort, 394. Vgl. problematisierend dazu z. B. Fitschen, Klaus, Aktuelle Methodendebatten in der protestantischen Geschichtsschreibung, in: Nowak, Kurt/Kinzig, Wolfram/Leppin, Volker/Wartenberg, Günther (Hg.), Historiographie und Theologie. Kirchen- und Theologiegeschichte im Spannungsfeld von geschichtswissenschaftlicher Methode und theologischem Anspruch (AKThG 15), Leipzig 2004, 39 – 52, 52 f. Gerade wegen ihres Zugriffs auf den geistes- und kulturwissenschaftlichen Methodenkanon ergeben sich hier auf forschungspraxeologischer Ebene auch wieder methodologische Schnittstellen zur Religionswissenschaft. Vgl. dazu z. B. den Aufsatz von Volp, Ulrich, Die Christianisierung des Todes. Zum Nutzen religionswissenschaftlicher Modelle für die Erforschung der Christentumsgeschichte, in: Fitschen, Klaus/Kinzig, Wolfram/Kohnle, Armin/Leppin, Volker (Hg.), Kirchengeschichte und Religionswissenschaft. Methoden und Fallstudien (AKThG 51), Leipzig 2018, 117– 134, besonders 134.
186
5 Wie fragt Theologie?
nominelle Gegenstands- bzw. besser Bezugsbereich der (im weitesten Sinne) christlichen Kirche(n) fungiert weder als exakte Gegenstandsbereichsbeschreibung noch als ihre Theologizität begründendes Spezifikum ⁹³ – weswegen die vorliegende Arbeit auch explizit nicht dem Ebelingschen Votum und v. a. nicht dessen materialer Füllung folgt. Was sie von allgemeiner (Kirchen‐) Geschichte unterscheidet, scheint wieder vielmehr ein bestimmter, vor-/wissenschaftlicher theologischer Diskurskontext⁹⁴ unter einer eigenen Fragestellung zu sein,⁹⁵ aus dem sich dann ihre spezifisch kirchengeschichtliche subdisziplinäre Diskurslogik ergibt.⁹⁶ Dabei liegt die die Theologizität der Kirchengeschichte explizierende Kraft ihrer Titulierung⁹⁷ eben höchstwahrscheinlich nicht in einer wie auch immer zu ver-
93 Vgl. Schmidt, Standort, 394. Natürlich könne zwischen allgemeiner und theologischer Kirchengeschichte unterschieden werden. Vgl. dazu Schäufele, Wolf-Friedrich, Theologische Kirchengeschichtsschreibung als Konstruktionsaufgabe. Ein Plädoyer, in: ThLZ 7/8/139 (2014), 831 – 850, 832 f. Zumal Kirchengeschichte als theologische Teildisziplin die in Kapitel 2.2. angerissene Wende zur Religion in ihrer eigenen subdisziplinären Binnenstruktur natürlich mitvollzogen hat.Vgl. dazu z. B. Leppin, Kirchengeschichte und, 19 – 25. Grundsätzlich wurde außerdem in Kapitel 3 schon diskutiert, dass Gegenstandsbereiche keine wissenschaftstheoretisch logisch stringenten Differenzkriterien sind. Denn auch im Falle der Kirchengeschichte entstünden dann wissenschaftstheoretische Abgrenzungsprobleme zu ihren Nachbardisziplinen – nicht nur zur Geschichtswissenschaft, sondern natürlich gerade auch zur (allgemeinen und speziell christlichen) Religionsgeschichte. Die gleiche Problematik täte sich auch beim Differenzkriterium der Methode auf. Vgl. ebd., 26 – 30. 94 Vgl. z. B. Ritter, Kirchengeschichte, 390 ff. Vgl. auch Roth, Was kann, 418 f. 95 Vgl. so ähnlich z. B. Beutel, Albrecht, Vom Nachteil und Nutzen der Kirchengeschichte. Begriff und Funktion einer theologischen Kerndisziplin, in: ZthK 94 (1997), 84 – 110, 89 – 92. Vgl. auch, aber anders Leppin, Kirchengeschichte und, 32 f. 96 Aus diesem Diskurskontext heraus bedingt sich dann vielmehr sowohl der materiale Gegenstandsbereich ihrer verschiedenen Teilgebiete als auch die Art und Weise, wie Kirchengeschichte (dann eben durchaus in Differenz zu anderen historischen Wissenschaften) in ihren verschiedenen Teilgebieten auf den großen geistes- und kulturwissenschaftlichen Methodenkanon zugreift. 97 Nicht zu übersehen ist allerdings, dass natürlich gerade auch im Kontext der Kirchengeschichte die fachlichen Selbstbezeichnungen differieren können, die wiederum Rückschlüsse auf das dahinterstehende enzyklopädische Theologieverständnis zulassen könnten – die allerdings wiederum keinesfalls eindeutig sein müssen. So trägt z. B. eine kirchengeschichtliche Professur in Heidelberg den Titel Historische Theologie.Vgl. die Website von Prof. Dr. Winrich Löhr an der Universität Heidelberg, https:// www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/theologie/personen/loehr.html – 25.01.21. Zu dieser Begriffskonstruktion und den dahinter stehenden Implikationen vgl. Kinzig, Wolfram, Wie theologisch ist die „Historische Theologie“? Bemerkungen zur Geschichte eines Begriffs und seiner heutigen Bedeutung, in: Ders./Fitschen, Klaus/Kohnle, Armin/Leppin, Volker (Hg.), Kirchengeschichte und Religionswissenschaft. Methoden und Fallstudien (AKThG 51), Leipzig 2018, 49 – 91, 86 – 91. Wolfram Kinzig widersprach hier der u. a. in TRE und RGG rezipierten These, dass hinter dem Begriff eine auch an Ebeling orientierte Absicht der „Re-Theologisierung“ der Kirchengeschichte stünde. Stöve, Eckehart, Art. Kirchengeschichtsschreibung, in: TRE 18 (1989), 535 – 560, 554. Vielmehr handele es sich hier um das Eintragen eines historischen Grundverständnisses in den Gesamtdiskurs der Theologie. Vgl. Kinzig, Wie
5.1 Die enzyklopädische Frage
187
stehenden forschungsprozesslich-materialen Füllung im Sinne eines Objekts (oder Subjekts) des wie auch immer gefüllten Begriffs der „Kirche“⁹⁸ – das ergibt sich aufgrund der allein schon innerkirchengeschichtlich begrifflichen Pluralität und historisch-empirischen Dynamizität von Kirche(n) nicht.⁹⁹ Kirchengeschichtlich zu forschen scheint vielmehr eine Formalbestimmung zu sein, unter der diese Vielfalt und Dynamik von „Kirche(n)“ bzw. besser Christentum ¹⁰⁰ explizit in den Forschungsprozess integriert wird.¹⁰¹ Die kirchengeschichtlich-wissenschaftstheoretischen Ausgestaltungen dieses metatheoretischen Formalprinzips fallen dann naturgemäß unterschiedlich aus: „Kirchengeschichte als die Inanspruchnahme des Christlichen“¹⁰², als „Transformationsgeschichte des Christentums“¹⁰³ oder als „historische Semiotik“¹⁰⁴ „christlicher Zeichensysteme“¹⁰⁵ – um nur ein paar (willkürliche, aber nicht unwesentliche) Beispiele zu nennen, an denen die potentielle Pluralität der materiellen Ausgestaltung von „kirchengeschichtlich“ als diskursstrukturellem Formalprinzip deutlich wird. Was diese unterschiedlichen Ausgestaltungen aber verbindet, ist die Tatsache, dass sie auf die Genese dessen reflektieren, was – historisch betrachtet – für Christentum im weitesten Sinne relevant war und ist bzw. sein kann; und zwar auf Basis des gesamttheologischen Diskurses, in dem die Frage nach der Entstehung und Entwicklung des Christentums in verschiedenen Kontexten gestellt wird: Durch diesen Diskurskontext erhält kirchengeschichtliche Arbeit ihre theologische Fokussierung¹⁰⁶ als Teil der Reflexion christlichen Glaubens in Geschichte und Ge-
theologisch, 51.88f. Solches wird auch für die Geschichte des Heidelberger Lehrstuhls konstatiert. Vgl. Ritter, Kirchengeschichte, 382 f. 98 Zumal, wie im folgenden noch ausgeführt wird, diese Füllungen durch die fachgeschichtlichen und allgemeinwissenschaftlichen Entwicklungen der Moderne erstens weder eindeutig, noch zweitens jemals als abgeschlossen betrachtet werden können. 99 Vgl. Nowak, Kurt, Wie theologisch ist die Kirchengeschichte? Über die Verbindung und die Differenz von Kirchengeschichtsschreibung und Theologie, in: ThLZ 1/122 (1997), 3 – 12, 9 f. 100 Vgl. Gemeinhardt, Geschichte, 98. 101 Vgl. Beutel, Vom Nachteil und Nutzen, 87. 102 Ebd. 103 Schäufele, Theologische Kirchengeschichtsschreibung, 842. 104 Leppin, Kirchengeschichte zwischen, 230. 105 Ebd., 234. 106 Vgl. Gemeinhardt, Geschichte, 107. Vgl. auch Leppin, Die Kirchengeschichte, 77. Die „Generierung der für Kirchengeschichte [heuristisch, C. N.] leitenden Fragen [geschieht, C. N.] aus dem theologischen Diskurs […]: Die theologischen Interessen des Faches Kirchengeschichte ergeben sich nicht allein aus dem zufälligen individuellen Bildungshorizont des Kirchengeschichte treibenden Theologen oder gar seiner individuellen Glaubensüberzeugung, sondern aus dessen fachlicher Verankerung.“ Ebd., 79.
188
5 Wie fragt Theologie?
genwart. ¹⁰⁷ Auch das resultiert wieder – ähnlich wie das bei Alttestamentlicher und Neutestamentlicher Wissenschaft der Fall zu sein scheint – aus dem lebensweltlichen Kontext der Theologie als Wissenschaft insgesamt, nämlich eben (im weitesten Sinne) Christentum. Wie alle Wissenschaft ist auch Theologie in ihrer Genese, Entwicklung und Persistenz als Disziplin abhängig von dem Lebenskontext, aus dem sie entsteht.¹⁰⁸ Dazu gehört im konkreten Fall der Kirchengeschichte eben maßgeblich die Konstitution des (hier evangelischen) Christentums in (wie auch immer begrifflich konkret zu füllenden) Kirche(n)¹⁰⁹ – und das im Laufe der wissenschaftsgeschichtlichen Entwicklungen der Neuzeit evident gewordene Verständnis für die historische Abhängigkeit, Kontingenz und Dynamik eben dieser Tatsachen. Dementsprechend ist „kirchengeschichtlich“ als formalprinzipielle Bestimmung nunmehr nicht als normierende, forschungsprozesslogisch materiale Präskription zu verstehen, sondern Ausdruck der Reflexion darauf, dass christlicher Glaube in seinen – sozialen und individuellen – Institutionen ein geschichtliches Phänomen ist. Die Funktion der Kirchengeschichte für den theologischen Gesamtdiskurs liegt dann (zusätzlich zu den materialen Ergebnissen ihrer historischen Arbeit) maßgeblich im kritischen Aufzeigen eben dieser geschichtlichen Abhängigkeit, Pluralität und Partikularität des Christentums in seinen verschiedentlichen Institutionalisierungs-, Frömmigkeits- und letztlich Lebensformen¹¹⁰ – und dementsprechend also des lebensweltlichen Kontextes bzw. insgesamt der Positionalität wissenschaftlicher Theologie selbst.¹¹¹ Auch Systematische Theologie lässt sich in diesen Diskurskontext als theologische Subdisziplin einordnen, ohne hier wieder auch nur annähernd eine Einführung in dieses Fach geben zu wollen. Allerdings schwebt auch bzw. gerade hier
107 „Kirchengeschichte ist nicht dadurch eine theologische Disziplin, dass theologische Theorien und Überzeugungen konkurrierenden Sichtweisen übergeordnet sind, sondern dadurch, dass die Kirchengeschichtlerin immer wieder neu auf theologische Perspektiven zurückkommt. Auf theologische Voraussetzungen zurückzukommen und diese zur Geltung zu bringen zu suchen, könnte etwa darin bestehen, dass die Antworten auf Fragen und Herausforderungen, mit denen eine vergangene Kommunikationsgemeinschaft gerungen hat, für eine gegenwärtige Kommunikationsgemeinschaft und ihr Ringen mit je ihren Fragen und Herausforderungen in christlich-religiöser Hinsicht erhellend werden.“ Schmidt, Standort, 407. 108 Vgl. dazu maßgeblich den in dieser Arbeit schon zitierten Herms, Das Selbstverständnis, 359 – 379. „[D]em heutigen Verständnis von Wissenschaft [liegt] die Einsicht zugrunde, daß Wissenschaft nur aus dem konstitutiven Zusammenhang von Gewißheit und Handeln heraus begriffen werden kann und in seinem Kontext verstanden werden muß. Ebd., 359. 109 Vgl. anders aber ähnlich Leppin, Kirchengeschichte und, 31 ff. 110 Vgl. ähnlich (wenngleich anders material gefüllt) Roth, Was kann, 421. Vgl. auch Gemeinhardt, Geschichte, 102 f. 111 Vgl. Leppin, Die Kirchengeschichte, 93.
5.1 Die enzyklopädische Frage
189
die Vermutung im Raum, dass innerhalb der Systematik die Frage nach der eigenen Theologizität im Grunde selten bis kaum explizit gestellt wird.¹¹² Solches ist – genauso wie bei den bisherigen Subdisziplinen – nicht (zwingend) mit wissenschaftstheoretischer Selbstvergessenheit gleichzusetzen, sondern zeigt hier vielmehr, dass nicht so sehr die Frage danach zentral zu sein scheint, warum man überhaupt im theologischen Fächerkanon steht, als was man innerhalb dieses Kanons vor dem Hintergrund der auf der Folie des neuzeitlich-modernen Wissenschaftsverständnisses agierenden exegetischen und historischen Disziplinen überhaupt spezifisch Systematisches beisteuert. Präzisiert: Kaum scheint fraglich, dass man genuin zum theologischen Fächerkanon gehört und für diesen zentrale Auf-
112 Auch wenn – zumindest vielleicht im Gegenüber zu den bisherigen exegetischen und historischen Subdisziplinen – die Frage nach der Theologizität der Systematischen Theologie auf den ersten Blick als beinahe begrifflich redundant erscheinen könnte, da Systematische Theologie teilweise – zumindest implizit – nahezu gleichgesetzt wird mit dem, was „theologisch“ sei. So zeichnet zum Beispiel der hier bereits vielfach zitierte Michael Roth (unter der enzyklopädischen Frage) Theologie als „Selbstexplikation des christlichen Glaubens zum Zwecke des Erweises seines Wahrheitsanspruches“. Roth, Die Ausdifferenzierung, 85. Dieses „besondere Erkenntnisinteresse [sei zwar] in allen theologischen Disziplinen wirksam“ (ebd.) – falle aber eben auch mit der „Funktion und Aufgabe der Systematischen Theologie“ (ebd., 86) zusammen. Als solches Erkenntnisinteresse aller theologischen Subdisziplinen könne diese Formulierung also nur dann verstanden werden, wenn sie weder eine systematischtheologische Vereinnahmung noch Abwertung der anderen theologischen Disziplinen impliziert, da sonst – gerade aus dem Blickwinkel der historisch-exegetischen Disziplinen – „im schlimmsten Fall“ der Rückfall in „das Stadium der vorkritischen Theologie“ (ebd., 87) befürchtet werden könnte. Sondern sie müsse als Horizont verstanden werden, vor dem die einzelnen Disziplinen ihrer jeweiligen subdisziplinären Fragestellung nachgehen. Vgl. ebd., 89. Diese Argumentation wurde von Roth auch kürzlich noch einmal vollzogen. Vgl. dazu Ders., Was kann, 414 – 417. Auch wenn Roth mit diesen Formulierungen auf ein Worst Case Scenario der innertheologischen Missverständnisse abhebt, von dem er sich selbst abgrenzt, scheint in diesen Ausführungen dennoch ein im Gesamtkontext von Theologie irgendwo und irgendwie mitschwingendes Verständnis impliziert, nach dem sozusagen vorkritische Theologie begriffslogisch gleichsetzbar sei mit Systematischer Theologie. Es wäre – wenn solches existieren sollte – die Rückfrage zu stellen, ob eine solche Zuschreibung wirklich zutreffend sei, denn natürlich hat gerade auch Systematische Theologie die wissenschaftstheoretischen Wendungen seit der Aufklärung mit durchlaufen – und existiert letztlich in ihrer heutigen Form erst auch seitdem als solche. „[E]s war im Wesentlichen die sich philosophisch reflektierende Vernunft der Aufklärung, welche zum einen eine gegenüber dem Glauben eigenständige historisch-kritische Behandlung der Überlieferung des Christentums forderte und zum anderen zunächst auch selbst die von einer solchen ‚theologica biblicaʻ nun neu zu unterscheidende dogmatische Theologie zu bestimmen beanspruchte.“ Kleffmann, Tom, Systematische Theologie zwischen Philosophie und historischer Wissenschaft, in: NZSTh 2/46 (2004), 207– 225, 207. Eine – auch nur argumentative – Gleichsetzung von Theologie vor der Aufklärung mit Systematischer Theologie erschiene dann wie ein anachronistischer Fehlschluss. Gerade vor dieser (gedachten) Folie muss die Frage nach der Theologizität der Systematischen Theologie genauso rigoros immer wieder vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftstheoretischer und erkenntnistheoretischer Anforderungen gestellt werden.
190
5 Wie fragt Theologie?
gaben erfüllt¹¹³ – die innerfachliche Problematik besteht vielmehr darin, wie man diesen Aufgabenbereich modern-wissenschaftstheoretisch redlich umreißt und transparent und dadurch überzeugend notwendig macht. Schon allein durch die Titulierung als Systematische Theologie¹¹⁴ unterscheidet sie sich von den bisherigen Genannten maßgeblich, insofern dass ein bestimmtes systematisches Anliegen die theologisch-diskursstrukturelle Funktion der Disziplin auszumachen scheint. Je nachdem, wie dieses systematische Anliegen gefüllt wird, variiert der Referenzrahmen des subdisziplinären Gegenstandsbereichs: Vom Wort Gottes bzw. seiner Offenbarung¹¹⁵ oder der „Rechenschaft über den Wahrheitsgehalt des christlichen Glaubens angesichts interner und externer Herausforderungen“¹¹⁶ über christliche Religiosität bzw. Religion an sich¹¹⁷ bis hin zur alle Wirklichkeit umspannenden Reflexion auf das „gegenwärtige christliche Leben in der Geschichte“¹¹⁸ lassen sich alle möglichen innerdisziplinären (Selbst‐) Zuschreibungen finden. Damit korreliert dann auch wieder eine innere Pluralität der Methodik. Bzw. ist auch hier zu präzisieren, dass es keine eigentlich systematisch-theologische leitende Methode gibt, sondern sie sich vielmehr am geistes- und kulturwissenschaftlichen Methodenkanon – je nach Forschungsfrage und Forschungsobjekt – kreativ bedient.¹¹⁹ Doch nicht nur der praktische Forschungsvollzug, sondern gerade auch die wissenschaftstheoretische Selbstbesinnung wird durch dieses inhärente Möglichkeitsspektrum (zwar durchaus expliziert, aber eben auch) beinahe infinit pluralisiert: So variieren innersystematische Aufteilungskonzeptionen von
113 Wenn, dann können sich v. a. bestimmte Probleme in Bezug auf eine Verhältnissetzung zur Philosophie ergeben, die je nach Wissenschafts- und Theologieverständnis entsprechend unterschiedlich gelöst werden können – z. B. über die unterschiedlichen Gegenstandsbereiche und Perspektiven „von Theologie als positiver Wissenschaft und Philosophie als freier Vernunft- oder Fundamentalwissenschaft“. Ebd., 211. 114 Gleichzeitig steht auch hier eine gewisse begriffliche Schwierigkeit dahinter, die auf ein in sich plurales Fach- (und Theologie‐) Verständnis der Systematischen Theologie selbst schließen lässt. Denn „einmal [wird die Bezeichnung der Systematischen Theologie angewandt] als Sammelbezeichnung für eine theologische Disziplin und zum anderen als Titel von Büchern. Im letzteren Fall meint der Begriff so viel wie Darstellung der christlichen Lehre und entspricht Bezeichnungen wie Dogmatik oder Glaubenslehre.“ Danz, Systematische Theologie, 3. 115 Vgl. Pannenberg, Wissenschaftstheorie, 350 f. 116 Härle, Wilfried, Dogmatik (De Gruyter Studium), Berlin/Boston 52018, 35. Hervorhebung C. N. 117 Vgl. Danz, Systematische Theologie, 3. 118 Herms, Eilert, Systematische Theologie. Band 1. Das Wesen des Christentums. In Wahrheit und aus Gnade leben, Tübingen 2017, XIX. 119 Weswegen Systematische Theologie wahrscheinlich tatsächlich mehr ein Handwerk, eine τέχνη ist, als ein System von Glaubensinhalten o. ä. Vgl. Schwöbel, Christoph, Doing Systematic Theology. Das Handwerk der Systematischen Theologie, in: Ders., Gott in Beziehung. Studien zur Dogmatik, Tübingen 2002, 1 – 24, 1 – 3.
5.1 Die enzyklopädische Frage
191
einer Zweiteilung (in klassisch Dogmatik und Ethik) bis hin zu einer Vierteilung (in bspw. Fundamentaltheologie, Religionsphilosophie, Dogmatik und Ethik) usw. usf.¹²⁰ Gemein ist diesen unterschiedlichen Bestimmungen, so zumindest die hier zugrundeliegende These, ein grundsätzliches Erkenntnisinteresse an der Bestimmung dessen, was identitätskonstituierend für christliche Religion und Religiosität ist, wie also christlicher Glaube im wechselseitig-dynamischen Verhältnis von Denken und Handeln ¹²¹ in verschiedenen Kontexten steht. Dass Systematische Theologie also im weitesten Sinne über christlichen Glauben, Glaubensinhalte und deren denkerische und handlungsbezogene Weltbedeutung nachdenkt, scheint unstrittig. Schwierig ist also vielmehr, wie bereits angemerkt, auf der wissenschaftstheoretischen MetaEbene und in Zusammenschau mit den bisherigen exegetisch-historischen theologischen Subdisziplinen, welche Funktion Systematische Theologie dann im enzyklopädischen Diskurskontext hat. Sprich: In welchem Verhältnis steht sie sowohl zu den anderen theologischen Subdisziplinen als auch zum modernen Wissenschaftsbild selbst? Hintergrundproblematik dieser Frage ist, dass innerhalb der Systematischen Theologie Selbstbestimmungen des eigenen theologischen Aufgabenbereichs häufig unter Konstatierung einer bestimmten religiösen Innenperspektivität umrissen werden; bspw. als „die Selbstexplikation des christlichen Glaubens hinsichtlich der Wahrheitsansprüche und Handlungsnormen […], die in ihm behauptet, vorausgesetzt oder impliziert sind.“¹²² Das hat insofern natürlich Tradition, als dass fides quaerens intellectum ¹²³ sicherlich als das selbstaffirmative Leitmotiv Systematischer Theologie schlechthin gelten kann; doch stellt sich dann wieder die Grundsatzfrage, welche Funktion fides im Erkenntnisprozess hat: Sind Glaubensinhalte Voraussetzung oder Horizont und Gegenstand systematisch-theologischer Vollzüge?¹²⁴ Diese Debatte kann hier in concreto nicht nachvollzogen werden. Wichtig ist für den zugrundeliegenden enzyklopädischen Kontext hervorzuheben, dass wissenschaftstheoretisch gedacht al-
120 Vgl. z. B. Härle, Dogmatik, 35 – 38. Vgl. dagegen Danz, Systematische Theologie, 9 – 21. 121 Die sich als Motive durch alle Subdisziplinen der Systematischen Theologie ziehen. 122 Schwöbel, Doing Systematic Theology, 3. Hervorhebung C. N. 123 Anselm von Canterbury, Proslogion. Fides quaerens intellectum (1078), in: S. Anselmi Cantuariensis archiepiscopi opera omnia. Band 1. Hrsg. v. Franciscus Salesius Schmitt, Seckau 1938, 89 – 139, 94. 124 Hier geht es nicht um die klassische Dichotomisierung zwischen liberaler und Offenbarungstheologie – das wäre erstens plakativ und in Bezug auf heutige Forschungskontexte auch nicht mehr in dieser Dichotomie durchzuhalten und käme zweitens einer an dieser Stelle zu einseitigen Fokussierung auf die Frage nach der Reichweite menschlicher Vernunft im Erkenntnisprozess gleich. Die Frage, der hier nachgegangen werden soll, ist vielmehr sowohl für liberal- als auch für offenbarungstheologische Vollzüge virulent: Sind Glaubensinhalte epistemische Voraussetzung oder Gegenstand der Forschungsprozesse der Systematischen Theologie? Sprich (im Sprachgebrauch des Kontextes dieser Arbeit): Wird Systematik in religiöser Innen- oder Außenperspektive vollzogen?
192
5 Wie fragt Theologie?
lein schon mit der Reflexion auf christlichen Glauben (oder Religion/Religiosität/…) im wechselseitigen Kontext von Denken und Handeln diverse Abstraktionsleistungen, Verkürzungen und Synthetisierungen vollzogen werden, die den Reflexionsprozess allein rein formal aus dem konkret-religiösen Vollzug heraus und in den wissenschaftlich-theologischen Diskurs transferieren. Systematische Theologie agiert so verstanden genauso empirisch-deskriptiv wie die bisherigen genannten Subdisziplinen, nämlich indem sie eben auf Glauben, Glaubensinhalte und dazu in Bezug stehende Handlungsmöglichkeiten reflektiert und dadurch letztlich Glaubensvollzüge rekonstruiert. ¹²⁵ So verstanden könnte Glauben (als Weltdeutung und -gestaltung) dann im weitesten Sinne als Gegenstandsbereich Systematischer Theologie verstanden werden. Gleichzeitig bedingt er den systematisch-theologischen Forschungsprozess allerdings natürlich, nämlich insofern positionell, als dass christlicher Glaube/christliche Religiosität der lebensweltliche Kontext ist, aus dem heraus überhaupt erst das Erkenntnisinteresse von Systematischer Theologie und Theologie insgesamt entsteht: Welt konstituiert auch und gerade hier Wissenschaft. Und genau dadurch steht dann auch Systematische Theologie wiederum im gesamttheologischen Großdiskurs, indem sie lebensweltlich aus Glauben wissenschaftlich auf Glauben reflektiert. Ihre Funktion im Unterschied zu und Abhängigkeit von den anderen theologischen Subdisziplinen für den gesamttheologischen Diskurs besteht dann in der Reflexion auf die Genese, Gestalt und Funktion von christlichem Glauben als Weltdeutung und -gestaltung im wechselseitigen Zusammenhang von Denken und Handeln christlicher Individuen und Gemeinschaften in spezifischen soziokulturellen Kontexten. Ebenso lässt sich – wieder in keiner Weise als Einführung in die innere Fachlogik zu verstehen – auf die Theologizität der Praktischen Theologie reflektieren. Ähnlich wie bei den bisherigen Disziplinen ist auch in diesem Falle die innere Pluralität des fachlichen Selbstverständnisses und die damit wechselseitig korrelierende Bedeutungsvielfalt des Theologiebegriffs überhaupt augenfällig.¹²⁶ Letzteres allerdings erscheint besonders im Fall der Praktischen Theologie sowohl hochgradig virulent als auch dem fachlichen Forschungsprozess starke innere Dynamik verleihend: Praktisch-theologische Forschungsprojekte sind nicht nur epistemisch-enzyklopädisch, sondern methodologisch explizit abhängig davon, welcher
125 Vgl. Danz, Systematische Theologie, 5. Vgl. auch Schwöbel, Doing Systematic Theology, 3 – 5. 126 Vgl. z. B. zu den verschiedenen Dimensionen der Frage nach der Theologizität der Religionspädagogik Schweitzer, Friedrich, Das Theologische der Religionspädagogik. Grundfragen und Herausforderungen, in: Schlag, Thomas/Suhner, Jasmine/Burrichter, Rita/Grümme, Bernhard/Mendl, Hans/Pirner, Manfred L./Rothgangel, Martin (Hg.), Theologie als Herausforderung religiöser Bildung. Bildungstheoretische Orientierungen zur Theologizität der Religionspädagogik (Religionspädagogik innovativ 17), Stuttgart 2017, 9 – 20, 10 – 14.
5.1 Die enzyklopädische Frage
193
wie gefüllte Theologiebegriff gerade woraufhin wie transparent angewandt, befragt und erforscht wird.¹²⁷ Je nachdem ob man im Kontext bzw. in Bezug auf akademische oder professionelle oder Lai*innentheologie¹²⁸ usw. usf. praktisch-theologisch forscht, impliziert das verschiedene korrelierende (möglicherweise durchaus operative) Verständnisse von sowohl Theologie an sich – als dann auch von Praktischer Theologie als Anwendungswissenschaft, Orientierungswissenschaft, Handlungswissenschaft, Wahrnehmungswissenschaft o. ä. Damit wird hier keinesfalls auf kausal-konsekutive Parallelitäten zwischen Theologiebegriffen und dann also daraus resultierenden Verständnissen von Praktischer Theologie (oder vice versa) abgehoben.¹²⁹ Zum Ausdruck soll vielmehr kommen, dass die verschiedenen
127 Vgl. Roser, Traugott/Zitt, Renate, Praktische Theologie, Religions- und Gemeindepädagogik, in: Becker, Eve-Marie/Hiller, Doris (Hg.), Handbuch Evangelische Theologie. Ein enzyklopädischer Zugang (UTB 8326), Tübingen 2006, 301 – 362, 326 ff. Die inner-praktisch-theologischen metatheoretischen Reflexionen auf und um die vielfältigen Theologiebegriffe ihrer subdisziplinären Diskurslogik sind – aufgrund der angesprochenen Dynamizität – selbst hochgradig dynamisch. 128 Zu den jeweiligen Begriffen müsste viel gesagt werden, da gerade hier der praktisch-theologische Diskurs intensiv ist. Es kann aber an dieser Stelle keine ausführliche Reflexion erfolgen. Einführend zum Grundgedanken des (wechselseitig-dynamischen) Verhältnisses von sozusagen akademischer und Lai*innentheologie vgl. Astley, Jeff, The Analysis, Investigation and Application of Ordinary Theology, in: Ders./Francis, Leslie J. (Hg.), Exploring ordinary theology. Everyday Christian believing and the church (Explorations in practical, pastoral, and empirical theology), Farnham/ Burlington 2013, 1. 129 Keinesfalls soll hier eine irgendwie deutliche Zuordenbarkeit von Theologiebegriff und praktischtheologischem Selbstverständnis impliziert werden. Auch da sind die verschiedenen strukturellen Verbindungsmöglichkeiten in sich multidimensional plural. Zu dieser Typisierung vgl. Roser/Zitt, Praktische Theologie, 326.Vgl. auch Schröder, Bernd, In welcher Absicht nimmt die Praktische Theologie auf Praxis Bezug? Überlegungen zur Aufgabenstellung einer theologischen Disziplin, in: ZthK 1/98 (2001), 101– 130, 103 – 123. Bernd Schröder selbst beabsichtigt hier eine Synthese aus den genannten Verständnissen von Praktischer Theologie als „die der religiösen, christlichen und kirchlichen Lebenswirklichkeit zugewandte Weise, die Grundfragen der Theologie selbständig, nämlich in Wahrnehmung reflektierender, orientierender und handlungsoptimierender Absicht auf kirchliches Handeln hin zu entfalten.“ Ebd., 127. Zentral sei dabei als ihre „spezifische Denkrichtung“ das epistemischmethodische Primat der Praxisfokussierung, indem sie „von Phänomenen der Praxis her Theorie“ bildend sei. Ebd. Das Proprium theologischer Grundfragen wird hier, abgeleitet von Wilfried Härle, im „Wirklichkeitsverständnis des christlichen Glaubens“ gesetzt. Ebd.; zitiert aus Härle, Dogmatik, 193. Dementsprechend liegt hier ein Beispiel für die gegenseitige Bedingtheit des Theologizitätsbegriffs und des theologischen Selbstverständnisses des eigenen Fachs vor. Zu betonen ist, dass der hier bereits im Kontext der Systematischen Theologie zitierte Härlesche Theologiebegriff ein höchst spezifischer ist, da Härle Theologie als „aus der Innenperspektive“ im Unterschied zu Religionswissenschaft kontrastiert. Ebd., 10. Theologie sei laut Härle eine „Funktion des christlichen Glaubens“ – insofern, als dass es erstens christliche Theologie nur solange geben kann, solange es christlichen Glauben gebe, und dass zweitens die Aufgabe der Theologie sei, christlichen Glauben „auf seinen Wahrheitsgehalt hin“ zu überprüfen. Grundsätzlich muss an dieser Stelle dagegen noch mal betont werden, dass vorliegende
194
5 Wie fragt Theologie?
(multidimensionalen) Theologiebegriffe innerhalb der Praktischen Theologie und das eigene theologisch-subdisziplinäre Fachverständnis selbst – aufgrund des wechselseitigen Zusammenhangs von Epistemik und Methodik und eben der Multidimensionalität des Theologiebegriffs – in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander stehen. So ist es gerade im Kontext der Praktischen Theologie nicht nur eine fundamentaltheologische, sondern auch eine forschungsprozesslich pragmatische Frage, ob Theologie epistemisch-methodologisch als mit einer religiösen Innen- oder Außenperspektive vereinbar gesehen wird wird.¹³⁰ Besonders (wenngleich nicht nur) im Bereich der Religionspädagogik¹³¹ werden dadurch nicht nur forschungs-/
Arbeit gerade in ihrem enzyklopädischen Ansatz sich explizit nicht auf der Ebene einer funktionalen Theologiebestimmung bewegt. Das bedeutet nicht, dass (Sub‐) Disziplinen nicht bestimmte Funktionen für den jeweiligen Fachdiskurs und dann auch für das wissenschaftliche System und somit für die Gesellschaft insgesamt erfüllen. Eine Bestimmung von Systemen über ihre Funktionen ist natürlich ein klassischer gangbarer Weg. In der Logik der vorliegenden Arbeit jedoch ist die Funktion eines Faches nicht das, was ihr Proprium generiert, sondern eher Ergebnis einer fachspezifischen Art zu fragen.Vgl. Kapitel 3. 130 Gerade im Kontext der Lai*innentheologie gehört diese Fragestellung zur epistemisch-methodologischen Grundlagenreflexion. Vgl. dazu z. B. Eisenhardt, Saskia, „Also vielleicht hat er ja die Fähigkeiten von Gott bekommen“. Theologisieren mit religionsfernen Jugendlichen im evangelischen Religionsunterricht, in: PrTH 1/55 (2020), 17– 21, 18f. Doch nicht nur im (durchaus gesondert zu betrachtenden) hier zitierten Bereich der Religionspädagogik, sondern im gesamten Spektrum der Praktischen Theologie ist der Theologiebegriff praxeologisch und fundamentaltheologisch entscheidend, was besonders an der Frage nach der Innen- und Außenperspektive deutlich wird – indem z. B. potentiell darauf reflektiert wird, was in der gemeindlichen Praxis geschieht oder geschehen kann: Von wem, für wen und mit wem (also von, mit und für Pfarrer*innen, Diakon*innen, religiösen oder eben auch nicht-religiösen Gemeindegliedern etc.). Die Positionierung in der Frage, ob (z. B. Lai*innen‐) Theologie auch von der Außenperspektive her betrieben werden kann, hat gerade auch hier Auswirkungen auf das jeweilige Verständnis von katechetischer, homiletischer etc. Praxis(reflexion) – und dadurch auch von Praktischer Theologie selbst. 131 Damit wird an dieser Stelle deutlich, dass vorliegende enzyklopädische Reflexion in Anlehnung an die Fachgruppenbezeichnung der WGTh Religionspädagogik als Teil der Praktischen Theologie betrachtet.Vgl. Website der WGTh. Fachgruppen. Praktische Theologie, http://wgth.de/index.php/fachgrup pen/praktische-theologie – 03.03.21 Dass eine Subsumierung von Religionspädagogik in Praktische Theologie weder wissenschaftshistorisch noch -institutionell stringent sein muss, sei im Folgenden schweigend mitgedacht.Vgl. dazu nur kurz Schlag, Thomas/Schröder, Bernd, Einführung, in: Dies. (Hg.), Praktische Theologie und Religionspädagogik. Systematische, empirische und thematische Verhältnisbestimmungen (VWGTh 60), Leipzig 2020, 9 – 30, 11. Vgl. ebenfalls Grethlein, Christian, Praktische Theologie, Berlin/Boston 22016, 67 f. Es wäre sicherlich darüber nachzudenken, ob nicht mindestens eine Doppelbezeichnung Religionspädagogik und Praktische Theologie den wissenschaftstheoretischen Verbindungslinien und gleichzeitigen Differenzierungen angesichts dieser „disziplinäre[n] Geschwisterlichkeit“ (Schlag/Schröder, Einführung, 12) gerechter werden würde – oder eben eine Konstitution von Religionspädagogik als eigenständiger theologischer Subdisziplin.
5.1 Die enzyklopädische Frage
195
pragmatische, sondern auch programmatische Anfragen an das eigene Selbstverständnis als theologische Disziplin – v. a. auch im Unterschied zu religionswissenschaftlich fokussierter religionsbezogener Pädagogik – deutlich:¹³² Denn gerade „[a]uch in der öffentlichen Wahrnehmung scheint ein religionsvergleichender Zugang im Rahmen schulischer Bildung deutlich attraktiver zu sein als die dezidiert theologische Prägung religiöser Bildungsprozesse. Zwar zeigt sich ein deutliches Interesse am Zusammenhang von Religion und gelebter Kultur. Allerdings wird die theologische Thematisierung existenzieller Fragestellungen im Klassenzimmer nicht selten mit dem Verdacht belegt, dass hier gleichsam durch die Hintertür nur wieder die alten, konfessionellen Missionierungsabsichten revitalisiert werden könnten.“¹³³ Zentral scheint bei aller inneren Dynamizität und Pluralität des Theologiebegriffs dabei also dennoch der – verschiedentlich gefüllte bzw. gerichtete – explizite Bezug auf gelebte religiöse Praxis ¹³⁴ zu sein.¹³⁵ Mit Schleiermachers Grundbestimmung bekommt die praxistheoretische Zuspitzung¹³⁶ der Theologie und damit einhergehend das Auseinanderdifferieren von Praxis im Sinne gelebter
132 Vgl. dazu Englert, Rudolf, Das Theologische der Religionspädagogik. Grundfragen und Herausforderungen, in: Schlag, Thomas/Suhner, Jasmine/Burrichter, Rita/Grümme, Bernhard/Mendl, Hans/Pirner, Manfred L./Rothgangel, Martin (Hg.), Theologie als Herausforderung religiöser Bildung. Bildungstheoretische Orientierungen zur Theologizität der Religionspädagogik (Religionspädagogik innovativ 17), Stuttgart 2017, 21 – 32, 29 – 31. 133 Schlag, Thomas/Suhner, Jasmine, Was erschließt die Perspektive der Theologizität? Erkenntnisse und Herausforderungen, in: Dies./Burrichter, Rita/Grümme, Bernhard/Mendl, Hans/Pirner, Manfred L./Rothgangel, Martin (Hg.), Theologie als Herausforderung religiöser Bildung. Bildungstheoretische Orientierungen zur Theologizität der Religionspädagogik (Religionspädagogik innovativ 17), Stuttgart 2017, 179 – 190, 180. Hervorhebung C. N. 134 Dabei ist der Praxisbegriff selbst innerhalb der Praktischen Theologie sowohl in seinen wissenschaftstheoretischen Implikationen als auch in seinen materialen Füllungen (als bspw. religiös, christlich oder kirchlich) hoch diskutiert – und steht als solcher wiederum im Wechselverhältnis zu den damit korrelierenden (heuristischen) Begriffen von Theologie, Kirche, Christentum und Religion, was wiederum (wechselseitigen) Einfluss auf das Selbstverständnis als Praktische Theologie haben wird. Bedeutsam ist das Praxisverständnis der Praktischen Theologie vor allem insofern, als dass gerade angesichts moderner Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse im religiösen Feld der Gegenstandsbereich Praktischer Theologie, also die Kennzeichnung menschlicher Praxis als z. B. (christlich‐) religiös verschiedene hermeneutische Entscheidungen fordert bzw. Implikationen mit sich trägt und so praktisch-theologische Forschungsprozesse bedingt. 135 Was damit konkret gemeint ist, differiert logischerweise. Deutlich ist zumindest, dass Praktische Theologie hier wohl auch bestimmte innertheologische Bewegungen im Kontext verschiedener Wissenschaftsparadigmen mitvollzogen hat: Maßgeblich vom Fokus auf kirchliche Praxis hin zum Paradigma der Religion (bzw. Religiosität). 136 Im Sinne der Bestimmung der Theologie als ausgerichtet auf die angemessene Struktur und Ausübung des Kirchenregiments. Vgl. Schleiermacher, KD, 7.
196
5 Wie fragt Theologie?
Religiosität und deren wissenschaftlicher Reflexion in akademischer Theologie¹³⁷ neue fundamentaltheologische Bedeutung. Dieser Impuls zur Ausbildung einer eigenständigen praktisch-theologischen Subdisziplin ist in dieser pragmatischen Stoßrichtung bis heute zwar maßgeblich. Dennoch ist zu betonen, dass die innerfachlichen Selbstbestimmungen im Laufe der fachgeschichtlichen Entwicklungen in Bezug auf Methode und Theorie zu großen Teilen über das Schleiermacherische Verständnis von „Kunstregeln“¹³⁸ als Zielergebnisse Praktischer Theologie hinausgehen (bzw. dieses weiterdenken).¹³⁹ Praktische Theologie als „Theorie der christlichen Religionspraxis“¹⁴⁰, als „Deutekunst“¹⁴¹ o. ä. ist vielmehr Erforschung von gelebter Praxis in theoretischer Hinsicht – in ihrer Genese und Kontextualität.¹⁴² Dementsprechend gestaltet sich Praktische Theologie seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts¹⁴³ als methodologisch maßgeblich empirisch bestimmte Disziplin, der es um die „Wahrnehmung der gelebten Religion als einem soziokultu-
137 Vgl. Wagner-Rau, Ulrike, Praktische Theologie als Theorie der christlichen Religionspraxis, in: Dies./Fechtner, Kristian/Hermelink, Jan/Kumlehn, Martina/Jähnichen, Traugott/Ritter, Adolf Martin/ Rüterswörden, Udo/Schwab, Ulrich/Stuckenbruck, Loren T. (Hg.), Praktische Theologie. Ein Lehrbuch, Stuttgart 2017, 19 – 28, 19 f. 138 Schleiermacher, KD, 113. Dem vorausgeschickt: „Für die richtige Fassung der Aufgaben ist durch die Theorie [praktisch-theologisch, C. N.] nichts weiter zu leisten, wenn philosophische und historische Theologie klar und im richtigen Maaß angeeignet sind.“ Ebd., 110. 139 Vgl. zu einer explizit Schleiermacherisch grundgelegten Konzeption von Praktischer Theologie Albrecht, Christian, Die Praktische Theologie im Kreis der theologischen Fächer. Theorie der religiösen Praxis des Christentums, in: Buntfuß, Markus/Fritz, Martin (Hg.), Fremde unter einem Dach? Die theologischen Fächerkulturen in enzyklopädischer Perspektive (TBT 163), Berlin 2014, 149 – 165, v. a. 152 – 155. 140 Wagner-Rau, Praktische Theologie, 19. 141 Roser/Zitt, Praktische Theologie, 335. 142 Dementsprechend ist zwar der Gegenwartsbezug von Praktischer Theologie evident und wahrscheinlich das Fach im innertheologischen Vergleich epistemisch-methodologisch am stärksten und schnellsten prägend – aber eben auch nicht gleichzusetzen mit ihrem theologischen Proprium, da natürlich genauso historische Perspektiven praktisch-theologisch relevant sind – ebenso wie systematische oder exegetische. Zu betonen ist hier also keine vermeintliche epistemisch-methodologische Chronologie der Fächer untereinander, sondern der jeweils verschiedentlich fokussierte Bezug auf christliche Religiosität, hier also konkret gelebte (wie auch immer konkret bestimmte) christlich-religiöse Praxis im weitesten Sinne. 143 Zur empirischen Wende der Praktischen Theologie vgl. einführend Grethlein, Praktische Theologie, 51 f.57 f.69 f. „[D]iese [u. a. ja auch in der Systematischen Theologie vollzogene] Wende [markiert] ein zunehmendes Bewusstsein für die enorme Vielfalt der sozialen Verhältnisse und der individuellen Lebensorientierung, die sich durch die herkömmlichen Systeme und Großbegriffe nicht mehr erfassen lässt.“ Hermelink, Jan/Schulz, Claudia, Von der „empirischen Wende“ zu empirisch induzierten Bindungskonflikten. Praktisch-theologische Rückblicke und Ausblicke, in: PrTH 1/54 (2019), 39 – 42, 39. Hervorhebung C. N.
5.1 Die enzyklopädische Frage
197
rellen Phänomen“¹⁴⁴ geht – und deren Fokus dadurch maßgeblich auf der Perspektive des religiösen (bzw. vielleicht religiös im weitesten Sinne praktizierenden) Subjekts liegt.¹⁴⁵ Durch ihren expliziten Praxisbezug ist Praktische Theologie auf der einen Seite wahrscheinlich mit am deutlichsten durch innerfachliche Uneindeutigkeiten geprägt,¹⁴⁶ und steht auf der anderen Seite – in der Logik dieser Arbeit – klar im theologischen Diskurs. Als Theorie der Praxis ¹⁴⁷ ist hier das epistemischmethodologische Wechselverhältnis zwischen theologischer Wissenschaft und ihrem lebensweltlichen Kontext, nämlich der konkret christlich-religiösen, also Glaubenspraxis ¹⁴⁸ als Weltdeutung und -gestaltung (und die damit einhergehende gesteigerte Vernetzung über den rein theologisch-wissenschaftlichen Diskurs hinaus) hochgradig augenfällig.¹⁴⁹ Denn wissenschaftlich-disziplinäre Diskurse sind, wie im dritten Kapitel dieser Arbeit angedacht, keine in sich abgeschlossenen Systeme; und ihre Identifizierung funktioniert nicht – wie bereits mehrfach angemerkt
144 Gräb, Wilhelm, Wissenschaftsgeschichte der Praktischen Theologie, in: Schlag, Thomas/Schröder, Bernd (Hg.), Praktische Theologie und Religionspädagogik. Systematische, empirische und thematische Verhältnisbestimmungen (VWGTh 60), Leipzig 2020, 33 – 55, 45. Hervorhebung C. N. 145 Zur Subjektorientierung in Religionspädagogik und Praktischer Theologie vgl. kurz Pohl-Patalong, Uta, Diskurse verstärken. Religionspädagogische Perspektiven und Facetten praktisch-theologischer Forschung, in: Schlag, Thomas/Schröder, Bernd (Hg.), Praktische Theologie und Religionspädagogik. Systematische, empirische und thematische Verhältnisbestimmungen (VWGTh 60), Leipzig 2020, 285 – 305, 289 – 291. 146 Mit der – im Laufe der zeitgenössischen Entwicklungen immer stärkeren – Dynamizität und Pluralität gelebter religiöser Praxis geht wissenschaftslogisch die Dynamizität und Pluralität von Gegenstandsbereich, Forschungsinteresse und Methodologie einher. 147 Der methodologisch-funktionale Zusammenhang von Theorie und Praxis (und dementsprechend die Frage danach, was wovon wie bedingt ist) wird dabei unterschiedlich gewichtet, wie die oben genannten verschiedenen Verständnisse von Praktischer Theologie schon implizierten. Zentral scheint im innerfachlichen Selbstverständnis jedoch eben zu sein, dass „es einer Theorie der Praxis zunächst nicht um die Veränderung der Praxis, sondern um ihre theoretische Bestimmung“ geht. Roser/Zitt, Praktische Theologie, 325. Hervorhebung C. N. Über diese theoretische Bestimmung hinausgehend bzw. mit dieser korrelierend kann dann aber damit – je nach Forschungsinteresse und konkretem Projekt – natürlich das Ziel verbunden sein, Praxis zu transformieren. Der Gedankengang der theoretischen Bestimmung der Praxis scheint vielmehr darauf abzuheben, dass es die konkret lebensweltlichen Vollzüge sind, die die theoretischen Vollzüge epistemisch leiten, welche dann wiederum im wechselseitigen Verhältnis zur Praxis stehen. Fachgeschichtlich lässt sich das mit den auf die Praktische Theologie stark einwirkenden sog. zwei empirischen Wenden (sicherlich auch bedingt durch die Entwicklung einer eigenständigen Religionspädagogik) begründen, durch die sich Praktische Theologie von den bis dato maßgeblichen Bestimmungen als rein technische Anwendungswissenschaft emanzipieren und interdisziplinär öffnen konnte. Vgl. ebd., 307 f.311. 148 Weswegen gerade auch Praktische Theologie wohl nur in expliziter Positionalität vollzogen werden kann. Vgl. ähnlich Schleiermacher, KD, 116. 149 Vgl. dazu ähnlich, aber anders Albrecht, Die Praktische Theologie im Kreis, 160.
198
5 Wie fragt Theologie?
wurde – kategorial über klar umreißbare Gegenstandsbereiche, sondern strukturell über ihre inneren Kommunikationsparameter: im Sinne dieser Arbeit also darüber, wie und wonach gefragt wird. Praktische Theologie scheint für diese Konstitution von akademischer Theologie als wissenschaftlicher Diskurs ein Beispiel par excellence zu sein, da hier der wissenschaftstheoretische Zusammenhang zwischen den multidimensionalen Verständnissen von Theologie als religiöser Reflexionspraxis (in ihren verschiedentlichen Professionalitäts- und Lai*innenbezügen und Innenund Außenperspektiven) und von Theologie als fachwissenschaftlicher Reflexion auf diese Praxis besonders deutlich vor Augen tritt. Als jüngstes im Kanon der Theologie lässt sich nun noch (wieder nicht zu verstehen als Einführung in der Subdisziplin selbst) auf die diskurslogische Theologizität des Fachs bzw. der Fachkombination der Interkulturellen Theologie/Missionswissenschaft ¹⁵⁰ reflektieren.¹⁵¹ Ihre Ursprungsdisziplin¹⁵² der Missionswissenschaft war „entstanden aus der Praxis der christlichen Mission des 19. Jh. und bedeutet[e] zunächst den Versuch, eine Praxis der notwendigen theologischen Kritik anzusetzen.“¹⁵³ Durch diese – im Missionsauftrag des Christentums biblischhermeneutisch legitimierte¹⁵⁴ – Praxis war Missionswissenschaft einerseits von Anfang an zwar ausgelegt auf den durchaus auch auf Komparativität ausgelegten Kontakt zu nichtchristlichen Religionen; und stand gleichzeitig dadurch in besonders starker Abhängigkeit von ihren politisch- und soziokulturell-historischen Bedingungen der christlichen Lebenswelt – und damit eben auch in Erbschaft zu kolonialen Selbstverständnissen und Überlegenheitsattitüden.¹⁵⁵ Mit dem Wandel der
150 So z. B. die Titulierung im bis heute für das Selbstverständnis des Faches immer noch maßgeblichen Positionspapier der Fachgruppe Religions- und Missionswissenschaft der Gesellschaft für Wissenschaftliche Theologie und des Verwaltungsrates der Deutschen Gesellschaft für Missionswissenschaft von 2005, http://wgth.de/index.php/fachgruppen/religionswissenschaft-und-interkultu relle-theologie – 26.02.21. Vgl. kurz zum Positionspapier Nehring, Alexander, Die Interkulturelle Theologie im Kreis der theologischen Fächer. Differenzsensible Wahrnehmung der weltweiten Christentümer, in: Buntfuß, Markus/Fritz, Martin (Hg.), Fremde unter einem Dach? Die theologischen Fächerkulturen in enzyklopädischer Perspektive (TBT 163), Berlin 2014, 127– 147, 131 f. 151 Auf – im Kontext der Theologie durchaus aufzufindende – Kombinationen inklusive Religionswissenschaft wird an dieser Stelle nicht abgehoben. Vgl. zum fachlichen Selbstverständnis von innerhalb der Theologie verorteter Religionswissenschaft Kapitel 2.4.3. 152 Vgl. Küster, Volker, Einführung in die interkulturelle Theologie. Mit dreizehn Übersichten (UTB 3465), Göttingen 2011, 24. 153 Ustorf, Art. Missionswissenschaft, 88. Als wichtiger Vordenker ist Schleiermacher zu nennen, der Mission in den Bereich der Praktischen Theologie einordnete. Gründungsvater der Missionswissenschaft als eigenständiger Disziplin ist Gustav Warneck. Vgl. Küster, Einführung, 28 f. 154 Vgl. ebd., 30 – 35. 155 Vgl. dazu z. B. ebd., 109 f. Vgl. auch Nehring, Die Interkulturelle Theologie, 131.
5.1 Die enzyklopädische Frage
199
Weltgeschichte und der davon beeinflussten „Lage der Weltchristenheit“¹⁵⁶ veränderte sich dann allerdings auch dementsprechend das Selbst- und Fachverständnis. Missionswissenschaft reagierte darauf konzeptionell reflektierend in ihrer fachgeschichtlichen Weiterentwicklung u. a. durch die Institutionalisierung in Lehrstühlen in Fächerkombination mit Religionswissenschaft und/oder Ökumenik, so dass andere Religionen sowohl immer deutlicher deskriptiv¹⁵⁷ betrachtet als auch idealiter als gleichberechtigte Gesprächspartnerinnen wahrgenommen wurden. Trotz oder gerade wegen dieser fachlichen Weiterentwicklungen hat sich mittlerweile im Fortgang der Fachgeschichte unter der Bezeichnung Interkulturelle Theologie ¹⁵⁸ nicht unbedingt eine Neutitulierung, sondern vielmehr eine „Interpretation des älteren Begriffs“¹⁵⁹ der Missionswissenschaft etabliert: „Die Missionswissenschaft hat sich seit ihrem Entstehen den Prozessen der Kulturbegegnung und ihren Implikationen gewidmet. Aus ihr geht darum mit gewisser Natürlichkeit eine interkulturelle Theologie hervor.“¹⁶⁰ Das Kontinuum dieser Beerbung der Missionswissenschaft durch Interkulturelle Theologie liege also vor allem in der Wahrnehmung der (anderen) Religionen als einer notwendigen Aufgabe für den gesamten Diskurs der Theologie¹⁶¹ – indem sie nämlich als Gegenüber und Kontext eines dadurch sowohl implizit als auch explizit auf seine eigene Identität reflektierenden Christentums in unterschiedlichen Gestalten und Kontexten in den Fokus gerückt werden. Durch diese Fokussierung zeigt sich deutlich die Differenz zu einer klassisch religionswissenschaftlichen Betrachtung von Religion(en), wie sie im vierten Kapitel dieser Arbeit vorgestellt wurde: Religion(en) sind in der Fächer-
156 Küster, Einführung, 29. 157 Innerhalb der theologischen Fächer Missions- oder auch Ökumenewissenschaft oder Interkulturelle Theologie wird der religionswissenschaftliche Zugriff zu großen Teilen gleichgesetzt mit einer deskriptiven Betrachtung von Religionen. Vgl. z. B. Feldtkeller, Andreas, Religions- und Missionswissenschaft. Was den Unterschied ausmacht für das Gesamtprojekt Theologie, in: Dalferth, Ingolf U. (Hg.), Eine Wissenschaft oder viele? Die Einheit evangelischer Theologie in der Sicht ihrer Disziplinen (ThLZ.F 17), Leipzig 2006, 121 – 139, 129 f. 158 „Die Einführung des Neologismus Interkulturelle Theologie ist eng verbunden mit den Namen der Gründungsherausgeber der Reihe Studien zur interkulturellen Geschichte des Christentums, Walter Hollenweger, Hans Jochen Margull und Richard Friedli.“ Küster, Einführung, 110. Vgl. hier auch zur historischen Genese der Disziplin. 159 Wrogemann, Henning, Interkulturelle Theologie. Zu Definition und Gegenstandsbereich des sechsten Faches der Theologischen Fakultät, in: BThZ 2/32 (2015), 219 – 239, 223.Vgl. dazu auch Küster, Einführung, 115. 160 Sinner, Rudolf von, Interkulturelle Theologie. Hermeneutische und theologische Überlegungen, in: BThZ 2/32 (2015), 240 – 263, 240 f. 161 „Die Theologie muss die andern Religionen kennen, um sich der eigenen Art des Christentums klarer bewusst zu werden.“ Söderblom, Nathan, Natürliche Theologie und allgemeine Religionsgeschichte, in: BRW 1/I (1913/14), 1 – 110, 73 f.
200
5 Wie fragt Theologie?
kombination Interkulturelle Theologie/Missionswissenschaft nicht unter der Fragestellung Gegenstand, inwiefern Vergleiche zwischen soziokulturell und historisch vergleichbaren religiösen Phänomenen gezogen werden können. Sondern der Ursprung dieser Disziplinenkombination lag (bedingt durch das missionarische Interesse) in der Wahrnehmung der anderen Religion(en) als Gesprächspartnerin(nen) im interreligiösen Kontakt ¹⁶² – als Wahrnehmung sozusagen des „Fremden“ im Vergleich zum Christentum. Ebendieser zunächst rein missionarische Impuls hat sich im Laufe der fachgeschichtlichen Veränderungen zu einer eigenständig theologisch-wissenschaftlichen Fragestellung entwickelt, der es um eine Beschreibung und Einordnung der Interaktionsprozesse eines in pluralen Kontexten sich unterschiedlich ausgestalteten Weltchristentums mit verschiedensten religiös-kulturellen Phänomenen in unterschiedlichen Ausgestaltungen in pluralen Kontexten geht.¹⁶³ So verstandene multipositionelle Interkulturelle Theologie kennzeichnet sich also dadurch, dass die Deskription religiös-kultureller Phänomene aus dem
162 Was als Grundgedanke aller Theologien der Religionen konstatiert werden kann. So z. B. auch explizit im Falle der Komparativen Theologie, wie sie maßgeblich im deutschsprachigen Raum (als Alternative zu den klassischen theologisch-religionstheoretischen Modellen des Exklusivismus, Inklusivismus und Pluralismus) von Klaus von Stosch als eigenständige Programmatik des interreligiösen Dialogs etabliert wurde und wird. Vgl. dazu Stosch, Klaus von, Komparative Theologie als Wegweiser in der Welt der Religionen (Beiträge zur komparativen Theologie 6), Paderborn/München/Wien/Zürich 2017, v. a.148 – 155. Dementsprechend beerben solche Ansätze zwar auf der einen Seite bestimmte Ursprünge der Religionswissenschaft, namentlich den Grundgedanken der Komparativität. Vgl. die Ausführungen zu den Anfängen der Religionswissenschaft in Kapitel 2.1., v. a. 2.1.1. Vgl. dazu auch die Rezension zu von Stoschs Werk von Bernhardt, Reinhold, Komparative Theologie, in: ThR 2/78 (2013), 187– 200, 187. Nichtsdestotrotz ordnen sich auch solche Ansätze explizit in den theologischen Fachdiskurs – und nicht in den (vergleichend) religionswissenschaftlichen – ein. Vgl. Stosch, Komparative Theologie, 230. Auch hier wird – trotz bzw. gerade angesichts des Grundgedankens der unvoreingenommenen Wahrnehmung der anderen Religionen – die Selbstverortung letztlich über den spezifischen Lebensweltbezug von Theologie zu christlicher Glaubenspraxis genommen. 163 Vgl. Wrogemann, Interkulturelle Theologie, 226. „Interkulturelle Theologie reflektiert die durch den universalen Geltungsanspruch ihrer Heilsbotschaft motivierten missionarisch-grenzüberschreitenden Interaktionen christlichen Glaubenszeugnisses, die im Zusammenspiel mit den jeweiligen kulturellen, religiösen, gesellschaftlichen und anderen Kontexten und Akteuren zur Ausbildung einer Vielzahl lokaler Christentumsvarianten führen, die sich durch das Bewusstsein ihr[!] Zusammengehörigkeit vor die Aufgabe gestellt sehen, normative Gehalte christlicher Lehre und Praxis in der Spannung zwischen Universalität und Partikularität immer wieder neu auszuhandeln.“ Ders., Lehrbuch Interkulturelle Theologie, Missionswissenschaft. Band 3. Theologie interreligiöser Beziehungen. Religionstheologische Denkwege, kulturwissenschaftliche Anfragen und ein methodischer Neuansatz, Gütersloh 32015, 420.
5.1 Die enzyklopädische Frage
201
Interesse der normativen Einordnung in die multidimensionale Netzstruktur interreligiöser und interkultureller Begegnungen (im weitesten Sinne) erfolgt.¹⁶⁴ Indem dadurch also in der Endkonsequenz das (Selbst‐) Verständnis des Christentums als globaler, in sich pluraler„Religionsformation“¹⁶⁵ sowohl Ausgangsals auch Zielpunkt der Vorgehensweise ist, bewegt sich Interkulturelle Theologie so im epistemischen und methodologischen Rahmen zwischen Universalität und Partikularität¹⁶⁶ – zwischen der Universalität des Christentums in seinem Selbstverständnis als Weltreligion und seinen multidimensional-pluralen Ausgestaltungsformen in genauso multidimensional-pluralen soziokulturellen Kontexten mit entsprechend ebenfalls wiederum multidimensional-pluralen religiös-kulturellen Gegenübern.¹⁶⁷ Dadurch gestaltet sie sich in ihrer Konzeption gleichsam (ähnlich vielleicht zur Praktischen Theologie) als konstante Kritik am Theologiebegriff selbst. Denn indem die Frage danach gestellt wird, wie, wann, wo und mit wem interkulturell-theologisch Begegnung beschrieben und gestaltet werden kann, kommt in den Blick, was letztlich unter der Vokabel theologisch zu verstehen sei.¹⁶⁸ Darin impliziert sei – vor dem Hintergrund des oben genannten sowohl deskriptiven als auch normativen Forschungsinteresses – ein entsprechend sowohl deskriptiver als auch normativer Theologiebegriff. So könne Theologie hier „einerseits definiert werden als diejenige Wissenschaft, die sich mittels deskriptiv-analytischer Methodik […] auf ihren Gegenstand bezieht. […] Theologie ist darüber hinaus jedoch in einem reflektierten Sinne auch eine normative Wissenschaft, da der Theologe/die Theologin in einem methodisch zweiten Schritt die Ansprüche der christlichen
164 Vgl. Sinner, Interkulturelle Theologie, 242 ff. 165 Wrogemann, Lehrbuch Interkulturelle Theologie …. Bd. 3, 431. 166 Vgl. Gruber, Judith, Intercultural Theology. Exploring World Christianity after the Cultural Turn (RCR 25), Göttingen 2017, 11. 167 Dieses wechselseitige Verhältnis von Religion und Kultur gehört zu den Grundeinsichten interkultureller Theologie: „In unterschiedlichen Kulturen erhalten Religionen unterschiedliche Ausprägungen. Dabei kann eine Kultur multi-religiös sein, oder eine Religionsgemeinschaft multi-kulturell.“ Küster, Einführung, 19. Dementsprechend „sind auch die interkonfessionellen und interreligiösen Interaktionsprozesse als interkulturelle Phänomene zu verstehen. Interkulturelle Theologie entfaltet sich dann in drei Dimensionen: interkonfessionell, interkulturell und interreligiös.“ Ebd., 132. 168 „Es geht für die Interkulturelle Theologie um die grundlegende Frage, was eigentlich mit ‚Theologie‘ genau gemeint ist, und das heißt wiederum: Es geht um die Frage, worin – in welchen Medien – sich Theologie manifestiert. Damit steht als Forschungsgegenstand Interkultureller Theologie der Theologiebegriff selbst zur Diskussion. Was in diesem Lehrbuch gezeigt werden soll, ist, dass Theologie sich nicht nur in rationalen Lehrsätzen verdichtet […]. […] Theologie drückt sich vielmehr auch aus in Sprichwörtern des alltäglichen Lebens, in bestimmten Riten“. Wrogemann, Henning, Lehrbuch Interkulturelle Theologie, Missionswissenschaft. Band 1. Interkulturelle Theologie und Hermeneutik. Grundfragen, aktuelle Beispiele, theoretische Perspektiven, Gütersloh 2012, 33. Vgl. ebenfalls Ders., Interkulturelle Theologie, 224 ff.
202
5 Wie fragt Theologie?
Tradition für sich gelten lässt und im Blick auf gegenwärtige Herausforderungen von Christsein in der Welt […] zu verstehen und auszulegen sucht.“¹⁶⁹ In diesem reflexiven Wechselspiel aus Deskription und normierender Einordnung – sowohl in methodisch-religionstheoretischer als auch in metatheoretischer Hinsicht – liege dann auch ihre Aufgabe und Funktion nicht nur in ihrer wissenschaftstheoretischen Eigenlogik,¹⁷⁰ sondern gerade auch im Diskurs der theologischen Fächer. Durch dieses Bewusstsein für Interkulturalität und religiöse Pluralität trägt sie nicht nur zur Ausbildung grundlegender interreligiöser Kompetenzen im Bereich des Theologietreibens bei, sondern bringt erkenntnis- und wissenschaftstheoretisch diese interreligiöse Perspektivität der multidimensionalen wechselseitigen Abhängigkeit von Religionen, Kulturen, ihren Kontexten ¹⁷¹ und kontextuell-dynamischen Interaktionen ¹⁷² und den wissenschaftlichen, ebenso positionellen Reflexionen darauf ¹⁷³ in den theologischen Diskurs ein.¹⁷⁴ Ihre Theologizität steht – analog zu den anderen theologischen Subdisziplinen – dann diskurslogisch im materialen und formalen Bezug auf die Multipositionalität christlicher Religiosität in ihren verschiedensten Kontexten – und vollzieht sich also wieder über das epistemisch-methodologische Wechselverhältnis zwischen theologischer Wissenschaft und ihrem
169 Ders., Lehrbuch Interkulturelle Theologie …. Bd. 3, 414 f. 170 „Aufgabe der Interkulturellen Theologie/Missionswissenschaft ist es, die Interaktion zwischen Christentum und nicht-christlichen Religionen und Weltanschauungen sowie die dadurch ausgelösten Transformationsprozesse des Christentums in unterschiedlichen kulturellen Kontexten theologisch zu reflektieren. Im Rahmen der deutschsprachigen evangelischen Theologie entfaltet sie sich in drei Hauptarbeitsfeldern: 1. Theologie- und Christentumsgeschichte Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und Ozeaniens; 2. Interkulturelle Theologie im engeren Sinn (z. B. kontextuelle Theologien, Nord-Süd-Wechselwirkungen und Konflikte in der Weltchristenheit, Migration, Entwicklungsproblematik); 3. Theologie und Hermeneutik interreligiöser Beziehungen (z. B. interreligiöser Dialog, Missionstheologie, Theologie der Religionen).“ Positionspapier der Fachgruppe Religions- und Missionswissenschaft, 3 f. 171 Dadurch ist Interkulturelle Theologie offensichtlich maßgeblich angewiesen auf die Ergebnisse und Methoden von Religionswissenschaft. Doch geht – wie vor dem Hintergrund der Fragestellung dieser Arbeit kurz zu betonen ist – keine Vereinnahmung von Religionswissenschaft als formal oder material theologischer Disziplin einher: „Die Hinwendung zur Religionswissenschaft bedeutet nicht, dass Religionswissenschaft für die Theologie vereinnahmt werden soll. […]. […] Religionswissenschaft wird als eine Kulturwissenschaft verstanden, auf deren Expertise die Interkulturelle Theologie/Missionswissenschaft in vielen Arbeitsfeldern angewiesen ist. Sie ist in dieser Hinsicht an einer starken Religionswissenschaft als eigenständiger kulturwissenschaftlicher Disziplin interessiert.“ Ebd., 3. 172 Vgl. Küster, Einführung, 132. 173 Vgl. Wrogemann, Lehrbuch Interkulturelle Theologie …. Bd. 1, 13. 174 „Diese Interkulturelle Theologie leugnet ihre Verortung in der europäischen akademischen Theologie nicht. Im Sinne einer reflexiven Moderne, die sich selbst kritisch hinterfragt und sich der Ambiguität und Fluidität heutigen Theologietreibens bewusst ist, will sie das Aufklärungsparadigma noch stets radikal zu Ende denken.“ Küster, Einführung, 13.
5.1 Die enzyklopädische Frage
203
lebensweltlichen Kontext,¹⁷⁵ nämlich der konkret christlich-religiösen, in diesem Falle interreligiösen Glaubenspraxis. ¹⁷⁶ Dass Theologie sich dergleichen diskurstheoretisch denken lässt, wurde im Ansatz allgemein-wissenschaftstheoretisch schon im dritten Kapitel dieser Arbeit vorbereitet, in dem die fachspezifische Fragestellung als disziplinäre Diskurse strukturierendes und so identifizierendes Differenzkriterium eingeführt wurde. Vor dem Hintergrund der hier kurz dargestellten enzyklopädisch fokussierten Überlegungen lässt sich dies insofern material konkretisieren, als dass das Spezifikum des wissenschaftlich-theologischen, sechsfächrig gegliederten Diskurses auf Grundlage der bisherigen Überlegungen wohl in einem spezifischen epistemischreflexiven Bezug zu christlichem Glauben ¹⁷⁷ in seinen denkerisch-lebensweltlichen Kontextualitäten, Bedingungen und Implikationen als dem Theologie bedingenden Lebensweltkontext ¹⁷⁸ zu sehen ist.¹⁷⁹ Glaube ist also nicht das wissenschaftstheoretische Differenzkriterium im Sinne eines Gegenstandsbereichs, sondern ist der Kontext, aus dem heraus und auf den hin Theologie disziplinär überhaupt erst gewachsen ist. Dadurch gestaltet sich Theologie logisch als Diskurs: Glaube selbst ist – in dieser großdimensionalen Bestimmung des wechselseitigen Verhältnisses von Denken und Handeln – eben ein Wechselspiel aus Weltanschauung und Weltge-
175 „Epistemologisch wird das eigene theologische Verständnis herausgefordert, insofern die eigene Identität gerade in der Begegnung mit dem Fremden in Frage gestellt oder gar überhaupt erst bewusst wird. Daraus erwachsen auch Anfragen an die eigene und die fremde Rationalität, den Charakter wissenschaftlicher Theologie in ihrem Verhältnis zur Akademie ebenso wie zur Gesellschaft und zur Kirche, die Bedeutung von individueller und kollektiver Erfahrung, die Analyse der jeweiligen Lebenswelt in ihrem Verhältnis zur Glaubenserklärung usw.“ Sinner, Interkulturelle Theologie, 262. 176 Positionspapier der Fachgruppe Religions- und Missionswissenschaft, 2. 177 Alternative den Diskurs strukturierende Begriffe wären denkbar – klassisch dafür wären theologiegeschichtlich „Religion“, „Christentum“, „Wort Gottes“ u. v. a. Es handelt sich an dieser Stelle letztlich um die bewusste Entscheidung einer (Re‐) Konstruktion und damit um ein spezifisches Theologieverständnis, wenn ein – spezieller und durchaus eingeengter – Glaubensbegriff als Referenzpunkt des theologisch-interdisziplinären Diskurses gesetzt wird. Vgl. zur wissenschaftstheoretischen Bedeutung des Glaubensbegriffs Kapitel 5.1.2. und 5.3.2. 178 „Der Existenzgrund von Theologie ist die geschichtliche Realität der Christenheit und des christlichen Lebens in ihr. […] Wo keine Christenheit und kein christliches Leben, da auch keine christliche Theologie. […] Das schließt ein, daß christliche Theologie auch nur im Leben der Christenheit und im christlichen Leben in ihr existiert. Sie ist eine der Hervorbringungen der Realität der Christenheit und des christlichen Lebens.“ Herms, Systematische Theologie, 16. 179 Vgl. auch Auga, Aus- oder Anschlüsse, 233 f.
204
5 Wie fragt Theologie?
staltung, also (so man will) kommunikatives Handeln. ¹⁸⁰ In Kombination damit, dass Wissenschaft allgemein abhängig ist vom Zusammenhang von Weltanschauung und Weltgestaltung (in seiner damit implizierten, soziokulturell bedingten multidimensionalen inneren Pluralität) und dadurch als spezifisches „Unterscheidungssystem“¹⁸¹, also als „Bestandteil einer gemeinsamen, kommunikativ verfaßten Praxis“¹⁸² mit „expliziten Regelungen“¹⁸³ grundsätzlich sprachlich konstituiert ist, scheint der durch wissenschaftliche Kommunikationsvereinbarungen geregelte, spezifisch lebensweltlich (durch christlichen Glauben) bedingte Diskurscharakter akademischer Theologie deutlich: „Sie hat ihren Ort in der wissenschaftlichen Kommunikationsgemeinschaft; sie ist dabei an die Prinzipien und Prozeduren öffentlicher wissenschaftlicher Kommunikation gebunden und an ihnen ausgerichtet. Sie ist demzufolge auf argumentative Auseinandersetzung und diskursive Verständigung hin orientiert.“¹⁸⁴ Ebendiese spezifisch-theologische Diskursstruktur ist dann auch genau das, was die Theologizität ihrer Subdisziplinen (also ihrer kommunikativen Teilstrukturen) und damit die strukturelle Logik ihrer enzyklopädischen Gestalt auszumachen scheint.¹⁸⁵
5.1.2 Fundamentaltheologie – als Metatheorie Im Folgenden soll nun gesondert der Frage nach der Theologizität evangelischer Fundamentaltheologie als eigenständiger Disziplin, also ihrer Position im innertheologisch-disziplinären Diskurs nachgegangen werden. Dem muss grundlegend die Tatsache vorausgeschickt werden, dass bis heute Fundamentaltheologie im deutschsprachigen Hochschulraum nicht zu den Kernfächern evangelischer Theologie gehört, während sie sich innerhalb der römisch-katholischen Theologie längst
180 Vgl. Höhn, Hans-Joachim, Glaube im Diskurs. Notizen zur diskursiven Verantwortung christlicher Glaubensvermittlung, in: ThPh 60 (1985), 213 – 238, 226. Vgl. auch Peukert, Wissenschaftstheorie, 346. 181 Mittelstraß, Die Möglichkeit, 160. 182 Ebd. 183 Ebd. 184 Arens, Edmund, Gottesverständigung. Eine kommunikative Religionstheologie, Freiburg i. Br. 2007, 263. 185 „Keine [theologische Sub‐]Disziplin kann beanspruchen, ohne Selbstbeschädigung die Aufgabe der anderen übernehmen zu können, keine kann den Theologiebegriff exklusiv für sich beanspruchen.“ Moxter, Enzyklopädie, 142.
5.1 Die enzyklopädische Frage
205
als Grundlagenfach etabliert hat¹⁸⁶ – wenngleich in fachlicher Weiterentwicklung¹⁸⁷ mit unterschiedlichsten Profilierungen bzw. Selbstverständnissen.¹⁸⁸ Gerade die Tatsache, dass Fundamentaltheologie besonders stark im Kontext römisch-katholischer Theologie betrieben wurde und wird, scheint (neben vielen anderen) einer der Gründe dafür zu sein, dass auf Seiten evangelischer Theologie bis heute stärkste Skepsis besteht: Entstanden aus apologetischen Grundimpulsen ¹⁸⁹ in Fokussierung auf anti-„aufklärerische“ bzw. -rationalistische Erkenntnisinteressen verbunden gleichzeitig mit der grundsätzlichen Möglichkeit natürlicher Theologie im Sinne vernunftmäßiger Gotteserkenntnis, wie sie vor allem im I.Vatikanum in Dei Filius manifestiert wurde,¹⁹⁰ scheint Fundamentaltheologie – verstanden als die Disziplin, die sich mit der Vernunftmäßigkeit von Glaube und Offenbarung ¹⁹¹ beschäftigt – in evangelisch-theologischer Wahrnehmung geradezu der Identity Marker römisch-katholischer Theologie zu sein bzw. ihre Nicht-Existenz der der evangelischen Theologie.¹⁹² Es dürfte der 1970 erschienene Aufsatz Ebelings Erwägungen zu einer evangelischen Fundamentaltheologie gewesen sein, in dem er ebendiese konfessionellen Differenzen als grundlegend-fundamentaltheologische Fragestellung auch und gerade innerhalb evangelischer Theologie zur Diskussion stellte¹⁹³ und damit zu einer
186 Erste Lehrstühle mit der Bezeichnung Fundamentaltheologie entstanden an römisch-katholischen Fakultäten bereits Mitte des 19. Jahrhunderts.Vgl. Stock, Konrad, Die Theorie der christlichen Gewißheit. Eine enzyklopädische Orientierung, Tübingen 2005, 269. 187 Vgl. dazu anreißend Schmidt-Leukel, Perry, Grundkurs Fundamentaltheologie. Eine Einführung in die Grundfragen des christlichen Glaubens, München 22014, 15 f. 188 Vgl. dazu überblicksmäßig Wagner, Harald, Art. Fundamentaltheologie, in: TRE 11 (1993), 738 – 752, 743 – 747. 189 Vgl. Schmidt-Leukel, Grundkurs Fundamentaltheologie, 12 f. 190 Vgl. v. a. Denzinger, Heinrich, Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen. Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Herausgegeben von Peter Hünermann, Freiburg i. Br. 452017, DH 3004.3019. 191 „‚Ist der christliche Glaube vernünftig?ʻ – So lautet die Grundfrage der sogenannten ‚Fundamentaltheologieʻ.“ Schmidt-Leukel, Grundkurs Fundamentaltheologie, 7. „Diese Aufgabe kann entweder im Sinn einer rationalen Begründung oder einer rationalen Verantwortung des Glaubens verstanden werden.“ Ebd., 11. 192 So werden bis heute alternative Bezeichnungen (näheres dazu im folgenden Fließtext) für fundamentaltheologische Arbeitsweisen eingesetzt, um „offensichtlich […] die konfessionelle Differenz anzuzeigen.“ Petzoldt, Matthias, Konfessionelle Differenzen? Ansätze zu einer evangelischen Fundamentaltheologie, in: Meyer zu Schlochtern, Josef/Siebenrock, Roman (Hg.), Wozu Fundamentaltheologie? Zur Grundlegung der Theologie im Anspruch von Glaube und Vernunft (PaThSt 52), Paderborn 2010, 203 – 233, 207. 193 Vgl. Ebeling, Gerhard, Erwägungen zu einer evangelischen Fundamentaltheologie, in: ZthK 67 (1970), 479 – 524, 481.
206
5 Wie fragt Theologie?
eigenständigen evangelisch¹⁹⁴-fundamentaltheologischen Profilierung konstitutiv beigetragen hat.¹⁹⁵ Denn zu betonen ist, dass fundamentaltheologische Fragestellungen – v. a. im Kontext der neuzeitlichen Entwicklungen im Bereich der Wissenschaft – gerade auch in der evangelischen Theologie keinesfalls ignoriert wurden bzw. werden.¹⁹⁶ Allerdings wurde der Vorstoß Ebelings sofort als für evangelische Theologie höchst kritisch eingeschätzt. Maßgeblich Gerhard Sauter kennzeichnete die Entstehung eigenständiger evangelischer Fundamentaltheologie als „Krisenerscheinung“,¹⁹⁷ vor allem weil damit die klassisch dogmatisch-theologische Frage nach der Grundlegung von Theologie problematischer Weise aus der Dogmatik ausgelagert werde – und damit außerdem der Anspruch vertreten werde, Theologie bzw. Glauben außer-theologisch, nämlich allgemein-rational zu begrün-
194 Zu einer explizit konfessionellen Grundlegung von evangelischer Fundamentaltheologie vgl. formelhaft zusammengefasst Petzoldt, Matthias, Zur Frage nach der Konfessionalität der Fundamentaltheologie, in: Ders., Christsein angefragt. Fundamentaltheologische Beiträge, Leipzig 1998, 56 – 78, 78. 195 So dass im Fortgang der Fachgeschichte eigenständige Entwürfe zu evangelischer Fundamentaltheologie geliefert wurden – wenngleich auch immer wieder unter anderer Bezeichnung. Maßgebliches explizites Lehrbuch für Fundamentaltheologie ist bis heute die Monografie Fundamentaltheologie. Theologische Grundlagen- und Methodenprobleme von Wilfried Joest, auf die weiter unten noch einmal gesondert eingegangen wird. 196 Vgl. ders., Konfessionelle Differenzen, 203. Matthias Petzoldt nennt im Folgenden Dalferth als einen exemplarischen Theologen, der „[z]u allen Aufgabenfeldern der Fundamentaltheologie […] wichtige Bücher und Aufsätze verfasst [hat]. Für seine Arbeit und für eine sachgerechte Entfaltung theologischer Wissenschaft lehnt er aber eine fundamentaltheologische Konzeptionalisierung ausdrücklich ab.“ Ebd., 214. Petzoldt sieht darin auch bei Dalferth u. a. einen gewissen konfessionellen Vorbehalt gegenüber Fundamentaltheologie als eigenständiger Disziplin – aufgrund seiner argumentativen Fixierung auf „traditionelle katholische Fundamentaltheologie“. Ebd., 214.217. Dies trifft insofern zu, als dass Dalferth eine Fundamentaltheologie, die vernünftige „Gründe für die Glaubwürdigkeit des Glaubens“ liefern wolle, für überflüssig und theologisch verfehlt sieht. Dalferth, Ingolf U., Fundamentaltheologie oder Religionsphilosophie?, in: Petzoldt, Matthias (Hg.), Evangelische Fundamentaltheologie in der Diskussion, Leipzig 2004, 171 – 193, 189. Dass sei darin begründet, dass alle Vernunft „immer nur Vernunft des Unglaubens oder des Glaubens“ sei und somit eine rationale Darlegung von Glauben entweder redundant oder nicht zielführend sei. Ebd. „Die eigentliche Schwierigkeit ist nicht, den Glauben zu verstehen oder verständlich zu machen, sondern ihn zu leben und sich durch ihn verändern zu lassen.“ Ebd. Fundamentaltheologie könne also nicht die Voraussetzungen und Bedingungen von Theologie a priori der Glaubenserfahrung klären, sondern erst, wenn diese Erfahrung eben schon geschehen ist, als „Darlegung des Zufalls der Gnade“ agieren. Ebd., 193. „Diese Darlegung aber ist das Geschäft der ganzen Theologie.“ Ebd. Am Beispiel Dalferths zeigt sich also tatsächlich ein sehr konservativ katholisch-theologisch geprägter Fundamentaltheologie- und ein spezifischer Theologiebegriff insgesamt. Dadurch wird an seiner Position auch exemplarisch die in sich logische wechselseitige Abhängigkeit der beiden Begriffe evident. 197 Sauter, Zugänge, 311.
5.1 Die enzyklopädische Frage
207
den. ¹⁹⁸ Diese Einschätzung Sauters kann bis heute als einen großen Teil des evangelisch-theologischen Diskurses über Fundamentaltheologie bestimmend angesehen werden: Glaube, und dementsprechend dann der Gegenstandsbereich von Theologie, könne – evangelisch-theologisch – nicht rational begründet ¹⁹⁹ werden. Dennoch hat sich innerhalb der evangelischen Theologie mittlerweile ein eigenes Spektrum fundamentaltheologischer Arbeitsweisen ausgebildet – bzw. erlebt Fundamentaltheologie thematisch seit ein paar Jahrzehnten einen gewissen Aufschwung, der nicht (nur) auf Ebelings Vorstoß, sondern v. a. auch auf weitere fundamentaltheologisch orientierte Arbeiten²⁰⁰ zurückzuführen ist; und in dem sich
198 Sauter vertritt hier ein sehr eng geführtes Bild von Fundamentaltheologie. Joest, der in der obigen Fußnote schon als Klassiker evangelischer Fundamentaltheologie eingeführt wurde, stellt für ihn eine Ausnahme dar. Fundamentaltheologie selbst sei immer auf das Ziel einer „Begründung […] [ausgerichtet], die dem Reden in Glauben und auf Hoffnung hin vorangeht und ihm zugrunde liegen soll“. Ebd., 312. 199 Es muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass auch römisch-katholische Theologie – bei aller Offenheit für natürliche Gotteserkenntnis – ebenfalls nicht zwingend von einer vernunftmäßigen Begründung des Glaubens ausgeht.Vgl. dazu Petzoldt, Zur Frage, 63. Dei Filius selbst scheint deutlich darauf abzuheben, dass auch natürliche Gotteserkenntnis nicht ohne das Vorzeichen der Offenbarung gedacht werden könne. Vgl. Denzinger, Kompendium, DH 3005. Zumal auch evangelische Theologie sich in der hier angesprochenen Grundsatzfrage nach dem Verhältnis von Vernunft und Offenbarung sich ebenso durch eine gewisse „Bandbreite von Positionen“ zeigt. Disse, Jörg, Die Frage nach dem Proprium der Fundamentaltheologie im evangelisch-katholischen Dialog. Stellungnahme zu Matthias Petzoldt, in: Meyer zu Schlochtern, Josef/Siebenrock, Roman (Hg.), Wozu Fundamentaltheologie? Zur Grundlegung der Theologie im Anspruch von Glaube und Vernunft (PaThSt 52), Paderborn 2010, 235 – 253, 247. Es ließe sich die Vermutung aufstellen, dass in einigen Diskussionen Fachtradition, konkreter Forschungsvollzug und – zumindest in Teilen – gegenseitige konfessionell zugespitzte Polemik sich in solchen Konstruktionen von Gegenpositionen zu vermengen scheinen. 200 So ist Fundamentaltheologie expliziter Forschungsschwerpunkt verschiedenster evangelischer Theolog*innen. Exemplarisch kann hier der bereits angeführte Roth genannt werden, der z. B. mit seiner Habilitationsschrift Gott im Widerspruch apologetisch fokussiert grundlegend fundamentaltheologisch arbeitet und die Bedeutsamkeit dieser Arbeit für Theologie insgesamt betont: „Apologetik – verstanden als wissenschaftlich-reflektierte Form der ‚Rechenschaft vom Glaubenʻ vor einem externen Forum – ist […] eine notwendige Aufgabe der Theologie“. Roth, Michael, Gott im Widerspruch? Möglichkeiten und Grenzen der theologischen Apologetik (TBT 117), Berlin 2002, 1. Auch in zahlreichen weiteren Veröffentlichungen agiert Roth in klassischen fundamentaltheologischen Themengebieten, wie z. B. zentral der Enzyklopädie. Vgl. z. B. den in dieser Arbeit schon viel zitierten Aufsatz: Ders., Die Ausdifferenzierung, 73 – 94. Als maßgebliches Beispiel für eine eher wissenschaftstheoretische Spielrichtung fundamentaltheolgischen Arbeitens mag der in dieser Arbeit bereits vielzitierte Eilert Herms gelten. Exemplarisch zu nennen sei hier – neben seiner 2017 erschienen Systematischen Theologie – die Monografie Herms, Eilert, Theologie. Eine Erfahrungswissenschaft (TEH N.F. 199), München 1978. Oder der in dieser Arbeit schon viel zitierte Aufsatz: Ders., Das Selbstverständnis der Wissenschaften. Genannt werden müssten an dieser Stelle viele
208
5 Wie fragt Theologie?
„eine anhaltende Orientierungssuche unter wachsendem Problembewusstsein für Fundamentaltheologie im protestantischen Raum“²⁰¹ zeigt. Zumindest das Attribut „fundamentaltheologisch“ scheint auch im evangelisch-theologischen Diskurskontext auf immer mehr Akzeptanz zu stoßen:²⁰² Zentrales (bisher allerdings noch vereinzelt auftretendes) Beispiel dafür ist die sozusagen Umbenennung der klassischen Prolegomena evangelischer Dogmatik, in denen grundlagentheoretische Fragen zu den Bedingungen und Vollzügen theologisch-wissenschaftlicher Erkenntnisprozesse bearbeitet werden, in „Fundamentaltheologie“.²⁰³ Häufiger allerdings werden solche Grundlagenfragen der Theologie – v. a. eben im Sinne ihrer Wissenschafts- und Erkenntnistheorie – mit der Zuschreibung „fundamentaltheologisch“ versehen.²⁰⁴ In beiden Beispielen kommt es also nicht zur Konzeption einer eigenständigen evangelischen Fundamentaltheologie.²⁰⁵ Denn gerade auch die andere fundamentaltheologisch arbeitende Theolog*innen. Eine auch nur annähernd auf Vollständigkeit abhebende Auflistung würde allerdings einerseits den Rahmen dieses Kapitels sprengen – und gestaltet sich andererseits insofern als schwierig, als dass Fundamentaltheologie weder ein geschützter noch ein immer explizit verwendeter Begriff ist. 201 Petzoldt, Konfessionelle Differenzen, 205. 202 Vgl. dazu und zum Folgenden ebd., 205 ff. Aber auch schon ders., Notwendigkeit und Gefahren einer verselbständigten Fundamentaltheologie, in: Ders. (Hg.), Evangelische Fundamentaltheologie in der Diskussion, Leipzig 2004, 21 – 40, 29 f. 203 So im Grunde z. B. in der vierten Auflage der Grundinformation Dogmatik von Rochus Leonhardt. Vgl. Leonhardt, Rochus, Grundinformation Dogmatik. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Studium der Theologie (UTB 2214), Göttingen 42009, 132. 204 „Am auffälligsten hat sich jene Entwicklung in der vierten Auflage der RGG niedergeschlagen. Fiel das Wort in den vorausgehenden Auflagen überhaupt nicht, sind nun zu über hundert Stichworten Artikel verfasst worden, die das Thema auch ‚fundamentaltheologischʻ abhandeln. Bei den vielen Autoren, die hierbei zum Zuge gekommen sind, lässt sich begreiflicherweise kein bestimmtes Konzept von Fundamentaltheologie in den Lexikon-Artikeln ausmachen.“ Petzoldt, Konfessionelle Differenzen, 205. So wird z. B. der Begriff Erlebnis – neben religionswissenschaftlicher und religionsphilosophischer (und ethischer) Fokussierung – in einem extra Unterkapitel „III. Fundamentaltheologisch“ umrissen, allerdings in auffällig religionstheoretischer Perspektive: nämlich unter der Frage nach religiösen Erlebnissen als Kategorien theologischer Wissenschaft. Vgl. Sparn, Walter, Art. Erlebnis, in: RGG4 2 (1999), 1425 – 1429, 1427. 205 Exemplarisch für diesen Umgang mit Fundamentaltheologie kann auch Konrad Stock gelten, der schon 2005 in seiner hier bereits zitierten Monografie Die Theorie der christlichen Gewißheit deutlich machte, dass fundamentaltheologische Fragestellungen zwar tatsächlich Grundfragen der Theologie thematisieren, aber gerade als solche eben nicht in einer eigenständigen, subdisziplinären Konzeption vollzogen werden können, sondern vielmehr als eine Art „fundamentaltheologische[s] Verfahren“, bzw. als „fundamentaltheologische[s] Interesse […] in allen theologischen Disziplinen“ zu pflegen sei. Stock, Die Theorie, 273 f. [Hervorhebung C. N.] In der Einleitung in die Systematische Theologie von 2011 scheint er diesen Gedankengang für die Disziplin der Systematischen Theologie unter dem Stichwort einer „Prinzipienlehre“ zu vollziehen, in der es darum gehen soll, über die „wissenschaftliche Form“ der Systematischen Theologie „Rechenschaft“ abzulegen.
5.1 Die enzyklopädische Frage
209
Umbenennung der Prolegomena scheint an dieser Stelle deutlich zu zeigen, dass es sich dann nicht um ein den gesamten theologisch-interdisziplinären Erkenntnisprozess reflektierenden Ansatz handeln kann – sonst wäre da kritisch die Rückfrage zu stellen, warum so etwas allein aus dem Blickwinkel der Dogmatik geschehe. Diesem prinzipiellen Aufschwung des Fundamentaltheologiebegriffs steht für eine Ausbildung einer eigenständigen fundamentaltheologischen Disziplin allerdings gegenüber, dass ebensolche für Theologie in ihrer Inner- und Interdisziplinarität wissenschaftstheoretisch aktuell sehr zentrale Fragestellungen zu großen Teilen unter explizit nicht-fundamentaltheologischer Titulierung²⁰⁶ vollzogen werden: Zwar zeigt sich hierin auf der einen Seite ein großes Interesse für die Thematik an sich, doch scheinen sich hier sowohl divergierende Theologiebegriffe als auch jene schon angedeutete Vorbehalte weiterhin zu äußern, die es von Seiten evangelischer Theologie gegenüber einer eigenständigen Fundamentaltheologie in evangelisch-theologischer Konzeptionierung zu geben scheint.²⁰⁷ Häufiger sind
Ders., Einleitung in die systematische Theologie (De Gruyter Studium), Berlin 2011, 3. Diesen Gedankengang scheint er dann im 2017 erschienenen ersten Band seiner Systematischen Theologie in gesteigerter Explizitheit weiterzugehen: Im Weiterdenken von Schleiermachers Konzeption der philosophischen Theologie will Stock hier seine „Prinzipienlehre im Sinne einer Fundamentaltheologie“ entwickeln, deren Aufgabe darin bestehe, „die wissenschaftliche Form zu finden und zu begründen, die das systematisch-theologische Denken in der Dogmatik wie in der Theologischen Ethik prägen und befruchten wird.“ Ders., Systematische Theologie. Teil 1. Erfahrung und Offenbarung, Göttingen 2017, 131.128. Dabei scheint es sich also ausdrücklich auch wieder nicht um eine eigenständige subdisziplinäre Konzeption des Fundamentaltheologiebegriffs in evangelisch-theologischer Perspektive zu handeln, sondern eher um ein Verständnis von Fundamentaltheologie, das in allen theologischen Subdisziplinen gegeben sei. Weiteres zu Stocks Theologiebegriff in 5.2.3. 206 Schon oben genanntes Beispiel wäre Dalferth. Vgl. für eine Übersicht über diese Spielart fundamentaltheologischen Denkens Petzoldt, Konfessionelle Differenzen, 213 f. 207 Als anonymisiertes, anekdotisches Beispiel für solche konfessionellen Vorbehalte mag ein zwangloses Gespräch der Verfasserin mit einem Exegeten auf einer kleineren theologischen Tagung 2018 gelten, bei dem der Exeget die Widersinnigkeit zwischen einer dem Schriftprinzip (als Formalprinzip) verpflichteten Theologie in reformatorischen Erbe und dem Anspruch einer unter dem Primat der Vernunft agierenden Fundamentaltheologie betonte. Vielmehr müsse das Studium der Bibel unverfälscht, also ohne philosophisches Vorstudium, erfolgen. Dieses – hier ohne Begründungsfunktion angebrachte – Gespräch könnte zumindest als exemplarisch dafür gedeutet werden, dass „das Schriftprinzip die evangelische Theologie lange davon abgehalten [zu haben scheint], die fundamentaltheologischen Überlegungen der Prolegomena zu einer eigenständigen Disziplin auszubauen. Diese Bedenken waren zumeist, daß Offenbarung und Schrift […] in ihrer exklusiven Begründungsfunktion auf dem Spiel stehen, wenn die Fundamentaltheologie zum Beweis für die Autorität und Glaubwürdigkeit der Offenbarung nach Gründen und Kriterien außerhalb ihrer selbst sucht.“ Petzoldt, Sola scriptura, 13. Hier könnte also sowohl ein sehr spezifisches Verständnis vom konfessionellen Proprium evangelischer Theologie als auch von der Aufgabe und Funktion von Fundamentaltheologie zumindest als fachtraditionelles Erbe dahinter zu stehen.
210
5 Wie fragt Theologie?
Bezeichnungen wie Prinzipienlehre, Apologetik oder auch Religionsphilosophie²⁰⁸ zu finden, unter deren Namen dann theologische Grundlagenfragen erörtert werden. Dementsprechend scheinen Konzeptualisierungen nomineller evangelischer Fundamentaltheologie zumindest nicht im Mainstream des theologischen Fachdiskurses mitzuspielen. Das zur dennoch anfänglich „frühe[n] Profilierung“²⁰⁹ des Faches maßgeblich beitragende (bis heute wohl einzige evangelisch-theologische) Lehrbuch zur Fundamentaltheologie stammt von Joest und erschien erstmals 1974, mit dem – auch schon ein spezifisches konzeptionelles Verständnis deutlich machenden – Untertitel Theologische Grundlagen- und Methodenprobleme. Bereits auf der ersten Seite seiner Einleitung machte Joest deutlich, dass ihm an einer disziplinär eigenständigen Fundamentaltheologie gelegen sei, denn „die Besinnung auf Grundlagen und Methoden […] [habe] der Theologie im Ganzen zu gelten“²¹⁰. Deutlich ist in dem gesamten Werk der Anspruch, „Theologie als Wissenschaft im Kreis der andern Wissenschaften“²¹¹ zu durchdenken. Als „Reflexionsbemühung […], die sich auf christlichen Glauben bezieht“,²¹² sei es ihre Aufgabe, auf Grundlage bzw. Voraussetzung dieses Glaubens – sowohl in seiner weltanschaulich-reflexiven, als auch in seiner praktischen Gestalt²¹³ – seine „Vertretbarkeit […] [und] Bedeutung für das menschliche Leben“²¹⁴ kritisch darzulegen. Unter dem Stichwort der „Grundlagenproblematik“²¹⁵ wird dann fundamentaltheologisch der epistemischen Frage nachgegangen, wie diese Voraussetzung von Theologie zu verstehen ist, also wie (und nicht ob oder dass) und in welchen Kontexten und unter welchen christlichreligiösen Spezifika christlicher Glaube als Grundlage von Theologie entsteht, wo und wie sich letztlich „Offenbarung Gottes“ im christlichen Glauben vollziehe. Unter
208 Wie immer stehen auch hinter diesen Entscheidungen für oder gegen bestimmte Bezeichnungen auch spezifische Theologieverständnisse in Bezug auf ihre epistemisch-methodischen Grundlagen und Aufgaben. Vgl. z. B. die Gliederung bei Christian Danz in seinem Einführungswerk Systematische Theologie von 2016 in Ethik, Dogmatik und Religionsphilosophie: „Indem die Philosophie der Religion den Nachweis erbringt, dass Religion gleichsam zur conditio humana (Bedingung des Menschen) gehört, begründet sie deren Notwendigkeit und damit den Gegenstand der Theologie.“ Danz, Systematische Theologie, 11. Hervorhebung C. N. Vgl. dazu auch Moxter, Enzyklopädie, 127 f. 209 Petzoldt, Konfessionelle Differenzen, 204. 210 Joest, Wilfried, Fundamentaltheologie. Theologische Grundlagen- und Methodenprobleme (ThW 11), Stuttgart 31988, 10. 211 Ebd., 14. 212 Ebd., 23. 213 Vgl. ebd. 214 Ebd., 24. 215 Ebd., 27.
5.1 Die enzyklopädische Frage
211
der Frage der „Methodenproblematik“²¹⁶ wird dann eben methodologisch reflektiert, wie Theologie auf Grundlage dieser Voraussetzung in Bezug auf ihre Funktion für Kirche und Gesellschaft, auf die Art und Gestalt ihrer Quellen und ihre konkreten (v. a. hermeneutischen) Methodiken verfährt. Fundamentaltheologie als eigenständige Disziplin gestaltet sich bei Joest also v. a. als Frage nach der Epistemik und Methodik von christlicher Theologie als Reflexion christlichen Glaubens. Als weniger klassisches Beispiel für eigenständige Konzeptionen von Fundamentaltheologie kann Peter Dabrock gelten, der in seinem Dissertationsprojekt von 1999 ein Konzept entwickelte von evangelischer „integrativ-intrinsezistische[r]²¹⁷ Fundamentaltheologie als theologischer Schwellen- und Verantwortungswissenschaft“²¹⁸: In Rezeption von Bernhard Waldenfels²¹⁹ konkretisiert Darbrock sein Verständnis von Fundamentaltheologie als responsive Rationalität des Glaubens, den er als (geglaubte) Hoffnung näher bestimmt. Die Aufgabe einer solchen apologetisch fokussierten Fundamentaltheologie bestünde dann in einer „Identitätsund Relevanzrechenschaft des christlichen Glaubens“²²⁰ in einer sich immer weiter ausdifferenzierenden Gesellschaft, in der ebenjene Identität und Relevanz weder innerhalb noch außerhalb der christlichen Glaubensgemeinschaft selbst noch einsichtig sei. Responsiv sei diese rationale Rechenschaft insofern, als dass der christliche Glaubensbegriff Ausdruck eines Angesprochenseins durch das Wort Gottes sei, indem sich gleichsam soteriologisch die Erfahrung eines als befreiend erlebten Zuspruchs Gottes an den Menschen ausdrückt.²²¹ Der „Impuls der responsiven Rationalität für die Fundamentaltheologie besteht deshalb darin, diese aufzufordern, in der eigenen Tradition (des Gesagten theologischer Lehre) und nicht vor, über oder hinter ihr ihre ursprünglichen asymmetrischen Ansprüche [der Gott-Mensch- und der Kirche-Welt-Differenz, C. N.] zu entdecken und wachzuhal-
216 Ebd., 135. 217 Der nicht unbedingt eindeutige Begriff des Intrinsezismus kommt hier aus dem Bereich der römisch-katholischen Fundamentaltheologie. Vgl. Seckler, Max, Fundamentaltheologie. Aufgaben und Aufbau, Begriff und Namen, in: HFTh2 4 (2000), 331 – 402, 398 – 400. Dabrock definiert intrinsezistisch als die „Vektorbezeichnung für die theologische Argumentation, die von der Inhaltlichkeit des Geglaubten ausgeht und auf dessen glaubens- oder kirchenexterne Plausibilisierung zielt“. Dabrock, Peter, Antwortender Glaube und Vernunft. Zum Ansatz evangelischer Fundamentaltheologie (FSy 5), Stuttgart 2000, 19. 218 Ebd., 301. 219 Dabrock greift hier auf Waldenfels und dessen Phänomenologie des Fremden zurück, um die „Konflikte […], die sich aus der Thematisierung der Gott-Mensch- und der Kirche-Welt-Differenz ergeben“ in Bezug auf die „Rationalität und Kommunikabilität der geglaubten Hoffnung im Sinne von 1 Petr 3,15“ zu beleuchten. Ebd., 179. 220 Ebd., 14. 221 Vgl. ebd., 302 ff.
212
5 Wie fragt Theologie?
ten.“²²² Als intrinsezistisch begründete Fundamentaltheologie positioniert sich Dabrocks Ansatz dadurch als sowohl explizit positionell, und somit auch als evangelisch-theologisch, als auch als inter- bis transdisziplinär und -konfessionell.²²³ Anhand der genannten Beispiele und des angerissenen Problemhorizonts wird deutlich, dass Fundamentaltheologie bis heute im evangelisch-theologischen Kontext nicht als eigenständige Disziplin etabliert ist und dementsprechend auch eher vereinzelte²²⁴ wissenschaftstheoretische Konzeptionen²²⁵ eines solchen Fachs vorliegen. Wenn der Begriff der Fundamentaltheologie angewandt wird, dann zu großen Teilen als grundsätzliches Forschungsinteresse oder in bestimmten Fachbeiträgen als (wie oben beschriebenes) Attribut für meist apologetisch bzw. wissenschafstheoretisch fokussierte Grundlagenfragen der Theologie bzw. der theologischen Subdisziplinen. Vor dem Hintergrund dieser (nur angedeuteten) Problemanzeige soll im Folgenden in Anschluss an das vorherige Unterkapitel zur Theologizität der theologischen Subdisziplinen und aufbauend auf dem wissenschaftstheoretischen Konzept dieser
222 Ebd., 306. 223 Im weiteren Verlauf seiner Karriere hat Dabrock sich mittlerweile bekanntermaßen viel stärker im ethisch-theologischen Bereich fokussiert, macht aber dabei seine Konzeption von Fundamentaltheologie weiterhin fruchtbar, indem er bspw. auch theologische Ethik als Ethik „responsivkommunikativer, sprich: verantwortlicher Freiheit bestimmt“. Ders., Konkrete Ethik in fundamentaltheologischer Perspektive, in: Held, Marcus/Roth, Michael (Hg.), Was ist theologische Ethik? Grundbestimmungen und Grundvorstellungen, Berlin/Boston 2018, 19 – 40, 21. 224 Vgl. z. B. Ohly, Lukas, Theologie als Wissenschaft, Eine Fundamentaltheologie aus phänomenologischer Leitperspektive (Theologisch-Philosophische Beiträge zu Gegenwartsfragen), Frankfurt a. M. 2017. 225 Als maßgeblicher Entwurf einer explizit eigenständigen Disziplin evangelischer Fundamentaltheologie, an dessen Konzeption sich diese Arbeit insgesamt (vielleicht nicht auf substantieller, aber auf struktureller Ebene) teilweise orientiert, ist der hier bereits vielfach zitierte Petzoldt anzuführen. In Anlehnung u. a. an Ebeling und Joest hat Petzoldt ein Konzept evangelischer Fundamentaltheologie entwickelt, das ausgehend vom christologisch-sprechakttheoretisch konkretisierten Glaubensbegriff das Fach als Disziplin im evangelisch-theologischen Fächerkanon aufstellt. „Fundamentaltheologie wird verstanden als systematisch-theologische Reflexion zur Rechenschaft über den christlichen Glauben angesichts der Herausforderungen äußerer Infragestellung und innerer Suche nach Vergewisserung; sie vollzieht sich als Besinnung auf den Grundvorgang, in dem und durch den Jesus Christus Grund des Glaubens wird, und zielt auf die Explikation des solchermaßen gegründeten Glaubens im Horizont gegenwärtiger Daseinserfahrung und Wissenschaftsverantwortung.“ Petzoldt, Konfessionelle Differenzen, 212. Der apologetische Grundimpuls – „angesichts der Herausforderungen des Glaubens von außen wie zugleich seiner inneren Suche nach Vergewisserung“ – ist evident. Ders., Sola scriptura, 11. Durch die Ausdifferenzierung zu einer systematisch-theologischen Reflexion auf den genannten Grundvorgang erstrecken sich ihre Aufgabenbereiche dann über „theologische Prinzipienlehre, Hermeneutik, Apologetik, […] Enzyklopädie und Wissenschaftstheorie der Theologie.“ Ders., Zur Frage, 59.
5.1 Die enzyklopädische Frage
213
Arbeit (Kapitel 3) der eigene erste Ansatz zu einem möglichen Konzept von evangelischer Fundamentaltheologie als eigenständiger Disziplin, also als eigenständiger Teilnehmerin am theologischen Fächerdiskurs als denkerischer Hintergrund (nicht nur, aber vor allem der noch folgenden Kapitel) dieser Arbeit angerissen werden. In Anlehnung (wenngleich nicht in Parallelisierung) an die Ausführungen in Kapitel 4.1.1. zur Frage nach der Möglichkeit und Notwendigkeit einer Systematischen Religionswissenschaft als Metatheorie der Religionswissenschaft kann zunächst einsteigend festgehalten werden, dass Fundamentaltheologie hier und um Folgenden als Metatheorie evangelischer Theologie ²²⁶ verstanden wird. Unter der Frage nach den Bedingungen und der Möglichkeit von Theologie als Wissenschaft²²⁷ wird also auch hierbei der apologetische Grundimpuls des Rechenschaftgebens aufgenommen – allerdings wissenschaftstheoretisch zugespitzt. Nicht Rechenschaft christlichen Glaubens (im Sinne einer spezifischen Form religiöser Weltanschauung und -gestaltung) gegenüber dem Forum einer als autonom verstandenen Vernunft o. ä. ist die Aufgabe der fundamentaltheologischen Fragestellung, sondern Rechenschaft der akademischen Disziplin der Theologie – nach außen gerichtet in den gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Kontext ihres Arbeitens hinein und nach innen gerichtet als Reflexion auf ihr epistemisches und wissenschaftstheoretisches Selbstverständnis – als Wissenschaft. Dadurch werden klassischerweise der Fundamentaltheologie zugeordnete Aufgabengebiete (Apologetik, Prinzipienlehre, Hermeneutik, Religionstheorie, …) nicht relativiert oder untergeordnet, aber durch eine bestimmte, nämlich eben wissenschaftstheoretische Fragestellung fokussiert,²²⁸ also durch die Frage nach dem Fundament der Theologie als Wissenschaft.²²⁹ Dadurch ergeben sich zwei Grundstoßrichtungen der Fundamentaltheologie, nämlich evangelisch-theologische Er226 In der Titulierung findet sich hier eine formale Anlehnung an Petzoldt vor. Vgl. Konfessionelle Differenzen, 210. Die inhaltliche Ausgestaltung des Fundamentaltheologiebegriffs differiert allerdings, wie im Folgenden dargelegt werden soll. 227 Vgl. z. B. Ohly, Theologie, 13. 228 Vgl. ähnlich, aber anders ebd., 16. 229 Auch hier ist wieder zu betonen, dass es nicht die Gegenstandsbereiche oder Aufgabenfelder sind, die die theologischen Subdisziplinen voneinander wissenschaftstheoretisch unterscheiden, sondern vielmehr die die jeweilige Subdisziplin dominierende Fragestellung den eigenständigen Fachdiskurs bestimmt. Besonders deutlich kann das am Verhältnis von Fundamentaltheologie und Dogmatik werden, da erstere sich zu großen Teilen ja aus letzterer (bzw. ihren Prolegomena) heraus entwickelt hat, weswegen eine gewisse inhaltlich-strukturelle Nähe zwischen der dogmatischen und der fundamentaltheologischen Fragestellung und eine explizite Überschneidung der Gegenstandsbereiche vermutet werden kann: Gerade die klassischen dogmatischen Topoi können Thema der Fundamentaltheologie sein – allerdings wird diese sie nicht (primär) auf das darin vermittelte Mensch- und Weltverständnis des christlichen Glaubens befragen, sondern vielmehr auf ihre epistemisch-wissenschaftstheoretischen Implikationen hin und die daraus erwachsenden Konsequenzen für den und Wechselwirkungen mit dem theologischen Forschungsprozess.
214
5 Wie fragt Theologie?
kenntnistheorie und Wissenschaftstheorie (sowohl partikular als auch in ihrem Wechselverhältnis zueinander). Unter diesen zwei Stoßrichtungen reflektiert Fundamentaltheologie dann auf die Gegenstandsbereiche (Glaube, Religion, Wort Gottes – je nach fachlich-theologischer Positionalität), die Epistemik (im Sinne der erkenntnisleitenden Vor-/Bedingungen und Normierungen bzw. Normativität – wie eben bspw. die spezifische Positionalität, der soziokulturelle Kontext, das forschende Subjekt, der „Glaube“ etc. pp.), die Enzyklopädie der theologischen Disziplinen zueinander und die Konsequenzen für die Methodologie der Theologie. Deutlich wird dabei also, dass der Fokus sowohl auf der Praxis des Forschungsprozesses als auch auf den anthropologischen Grundbedingungen theologischer Erkenntnis selbst liegt. Die Theologizität der Fundamentaltheologie besteht dann einerseits in eben dieser Metareflexivität, indem gerade auf den im vorherigen Kapitel genannten Zusammenhang zwischen Theologie und ihrem lebensweltlichen Kontext in Geschichte und Gegenwart reflektiert wird; und andererseits ergibt sich das grundlegende Erkenntnisinteresse der Fundamentaltheologie aus eben diesem Lebenskontext von christlichem Glauben verstanden als Weltanschauung und -gestaltung in Geschichte und Gegenwart selbst. So verstandener Glaube, so ist an dieser Stelle noch einmal dringend zu betonen, wird dann fundamentaltheologisch nicht gefasst als normierender Gegenstandsbereich oder als epistemische Normierung, sondern als Diskursstrukturbegriff, nämlich als das lebensweltliche Phänomen, aus dem heraus der christlich-theologische Diskurs überhaupt erst entsteht. Deutlich wird das im Kontext der wissenschaftstheoretischen Grundkonzeption dieser Arbeit, wie sie im dritten Kapitel eingeführt wurde: Aus dem Kontext christlichen Glaubens heraus entstand und entsteht das grundlegende Interesse, theologisch zu reflektieren und verdichtet sich im Laufe sowohl der Fachgeschichte als auch des jeweiligen Forschungsprozesses selbst zu theologischen Forschungsabsichten, die in einer theologischen Fragestellung konkretisiert werden. Wissenschaftstheoretisch-logischerweise wirkt das (wechselseitig) dann natürlich auf den Gegenstandsbereich von Theologie ein,²³⁰ was sich auch anhand der gröberen Fachgeschichte nachvollziehen ließe:²³¹ Aus dem grundlegenden Erkenntnisinteresse, Theo-Logie zu betreiben, also Gottesvorstellungen zu reflektieren und in ihren lebensweltlichen Implikationen (weiter) zu entwickeln, verschob bzw. differenzierte sich diese Forschungsabsicht im Laufe der Neuzeit im Kontext des sich wandelnden Wissenschaftsverständnisses mit der großlandschaftlich-epistemischen Wende zum Subjekt und der damit ein230 Zur epistemisch-methodologischen Implikation des Positionalitätsfaktors Glaube vgl. Kapitel 5.3.2. 231 Ein solcher Gedankengang kann im Grunde als Hintergrundfolie von Kapitel 2.2. angesehen werden.
5.1 Die enzyklopädische Frage
215
hergehenden theologischen Wende zur konkreten Religion hin zu der Grundeinsicht, dass von „Gott“ nur in den Erfahrungen²³² der religiösen Subjekte, die sich christlich-religiös als Glaube äußern, intersubjektiv überprüfbar gesprochen werden kann.²³³ Das darin zum Ausdruck kommende intersubjektiv-relative und damit in sich plurale Verständnis von Theologie findet seine fachgeschichtlich-enzyklopädische Entsprechung in der innerfachlichen Ausdifferenzierung, wie sie im vorherigen Kapitel fundamentaltheologisch angerissen wurde. Ebendiese Entwicklung zu reflektieren und aufzuzeigen, ist – exemplarisch – Fundamentaltheologie. Als so verstandene Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie der Theologie steht Fundamentaltheologie – trotz ihrer Funktion als Metatheorie – forschungspraktisch im theologischen Fächerdiskurs gleichberechtigt-abhängig neben den klassischen Fächern der Theologie.²³⁴ Denn um die Grundbedingungen von Theologie als Wissenschaft reflektieren zu können, ist sie auf ebenjenen Diskurs angewiesen, aus dem heraus sie ihre – je nach Kontext neu zu formulierenden – konkreten Aufgaben bekommt. Dementsprechend wäre es m. E. mehr als zuträglich, dass so verstandene Fundamentaltheologie als eigenständige Disziplin im theologischen Fächerkanon agiert²³⁵ – um so gleichsam die pluralen Forschungsperspektiven der Subdisziplinen sowohl als ihre Datenbasis als auch als ihre Normierung bzw. ihren Anspruch an sich wahrzunehmen. Darauf aufbauend kann sie dann im theologischen Diskurs dynamisch-plural zwischen den Fächern agieren – was innertheologisch in Bezug auf die Enzyklopädie der Theologie überhaupt fundamentaltheologisch immer wieder zu betonen ist: Die einzelnen Subdisziplinen sind nicht im Sinne klar abgrenzbarer Bereiche zu verstehen, sondern markieren vielmehr diskursive Normpunkte im Sinne einer Subdisziplinen strukturierenden Fragestellung, von denen ausgehend das forschende Subjekt sich dann je nach konkretem Forschungsprojekt im Spektrum des theologischen Diskurses situativ-thematisch bewegt. Nur in dieser pluralen Diskursivität kann Fundamentaltheologie ihrer Aufgabe zur Rechenschaft über die Wissenschaftlichkeit akademischer Theologie, also des theologischen Diskurses insgesamt –
232 Vgl. zum Erfahrungsbegriff in Bezug auf Glauben Herms, Eilert, Art. Erfahrung IV, in: TRE 10 (1982), 128 – 136, 131 f. 233 „Christliche Theologie ist abhängig von christlichen Erfahrungen.“ Ohly, Theologie, 15. 234 Vgl. so ähnlich auch ebd., 14 f. 235 Wenngleich natürlich bewusst ist, dass ein solcher Vorschlag einer eigenständigen Fundamentaltheologie in der aktuellen evangelisch-theologischen Wissenschaftslandschaft im deutschsprachigen Hochschulraum kaum praktikabel, geschweige denn erwünscht erscheint. Die Aufgabe der fundamentaltheologischen Grundlagenreflexion wird größtenteils (wenn überhaupt, dann) eben in den systematisch-theologischen Teildiskurs eingeordnet. Vgl. z. B. Meyer-Blanck, Michael, Systematische und Praktische Annäherungen an die theologische Hermeneutik, in: Albrecht, Christian/Gemeinhardt, Peter (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und außen, Tübingen 2021, 151 – 155, 152.
216
5 Wie fragt Theologie?
nach außen gerichtet auf Gesellschaft und Wissenschaft und nach innen auf ihr wissenschaftliches Selbstverständnis – gerecht werden. Ähnlich also wie im Falle der Systematischen Religionswissenschaft als Metatheorie vollführt Fundamentaltheologie nicht den Dienst einer allgemeinen Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, sondern sie (re‐) konstruiert die fachtypischen, sowohl vor- als auch innerwissenschaftlich bedingten epistemischen Voraussetzungen und Vollzüge ihrer innerfachlichen Forschungsprozesse um der intersubjektiven und dann auch interdisziplinären Überprüfbarkeit willen.
Abbildung 1: Diskursstruktur der Theologie (eigene Grafik)
5.2 Theologische „Zugriffe“ Analog zum Kapitel 4.2., in dem Religionswissenschaft – fachgeschichtlich hergeleitet – auf vier exemplarische methodologisch-praxeologische Zugriffe hin analysiert wurde, soll im nun Folgenden Theologie – quer zu ihrer subdisziplinären Aufteilung – auf ebensolche vier mögliche, exemplarische (ergänzungs- und kritikbedürftige) Arten des Theologietreibens hin befragt werden. Gesetzt ist hier die These, dass Theologie formal relativ ähnliche praxeologisch-methodologische Ausdifferenzierungsprozesse durchlaufen hat (bzw. durchläuft) wie Religionswissen-
5.2 Theologische „Zugriffe“
217
schaft – ohne damit auch nur annähernd materiale Gleichsetzungen oder disziplinäre Parallelisierungen implizieren zu wollen. Vielmehr wird mit dieser vorsichtig analogisierenden Vorgehensweise der Versuch unternommen, formale Brückenbaumomente zwischen den beiden Disziplinen aufzumachen. Der Hintergedanke dabei ist, dass erstens sich die fachgeschichtlichen Entwicklungen beider Fächer, wie in Kapitel 2 bereits angemerkt wurde, in wissenschaftstheoretischer und -praktischer Hinsicht nicht unabhängig voneinander, sondern vielmehr wechselseitig beeinflusst vollzogen haben. Und zweitens zeigt sich hierin, dass diese beiden Fachgeschichten im Kontext der gesamtwissenschaftlichen Entwicklungsgeschichte zu sehen sind, die sich in der (groben) großen Linie von den erkenntnistheoretischen Umwälzungen der Aufklärung über den Historismus hin zum kultur- und sozialwissenschaftlichen Paradigma der neuesten Zeit charakterisiert. Dem versucht diese Arbeit also insofern Rechnung zu tragen, als dass sie einerseits formal-methodisch auf Optionen für solche Brückenbaumomente reflektiert und dabei andererseits in der materialen (also v. a. begrifflichen) Herleitung und Füllung der disziplinären Substrukturen die jeweiligen fachgeschichtlichen und sozusagen diskurs-grammatikalischen Eigenarten nicht ignoriert.²³⁶ Für Theologie zeigte sich das im bisherigen Verlauf dieser Arbeit implizit in der epistemisch-methodologischen Wende hin zum Gegenstandsbereich der Religion (Kapitel 2.2.) und dem Prozess ihrer innertheologischen Aufsplittung in sechs (bzw. laut Kapitel 5.1.2. potentiell sieben) Subdisziplinen: Durch die Verschiebung im Gegenstandsbereich ergaben sich methodologisch-epistemische Konsequenzen, die in der innertheologischen Fachstruktur ihren (zwar nicht zwingend notwendigen, aber heute durchaus faktischen) methodologisch-praxeologischen Niederschlag fanden bzw. finden. So kennzeichnet sich Theologie als moderne Geistesbzw. Kulturwissenschaft²³⁷ durch eine inhärente Interdisziplinarität, die sich mit ihrer subdisziplinären Aufteilung in im weitesten Sinne historisch-exegetische und systematisch-praktische Fächer ausdrückt: In einem sich immer weiter ausdifferenzierenden Spektrum von u. a. historisch-begrifflichen, hermeneutisch-religionsphilosophischen, empirisch-sozialtheoretischen und religionspsychologisch-anthropologischen Zugriffen ²³⁸ erstrecken sich (neben vielen anderen denkbaren Konstruktionen) die – sowohl in sich als auch zueinander – multidimensionalen
236 Solches schlägt sich dann auf der sozusagen Makro-Ebene dieser Arbeit maßgeblich in der jeweilig konkreten Vorgehensweise in Kapitel 4 und 5 und auf der Mikro-Ebene z. B. in den Bezeichnungen der jeweiligen subdisziplinären Strukturen (v. a. der Zugriffe) wider. 237 Vgl. dazu Kapitel 5.4.1. 238 Auch hier sind wieder – analog zu den Ausführungen in Kapitel 4.2. – die Titulierungen der Zugriffe so weit wie möglich zu verstehen.
218
5 Wie fragt Theologie?
Möglichkeiten, Theologie zu betreiben.²³⁹ Da es sich bei Disziplinenabgrenzungen, wie in 5.1. zur Genüge betont wurde, nicht unbedingt um wissenschaftstheoretische Notwendigkeiten, sondern eher um fachgeschichtliche Emanzipationen handelt, wird im Folgenden nun versucht, diese vier exemplarischen Zugriffe quer zu den innertheologischen Disziplinengrenzen zu analysieren. Das entspricht dem oben gesetzten Verständnis von Theologie als Diskursstruktur, in der die einzelnen Subdisziplinen keine klar abgrenzbaren Kategorien oder Bereiche sind, sondern eben jene in 5.1.2. genannte diskursive Normpunkte des innerdisziplinären theologischen Diskursspektrums. Wenn forschende Subjekte sich in diesem Diskursspektrum von Theologie situativ-kreativ bewegen können, dann ist es wissenschaftstheoretisch strukturell logisch, dass die vier exemplarischen, hier zu untersuchenden Arten, Theologie zu betreiben, nicht mit den subdisziplinären Normpunkten zusammenfallen, sondern eher in der konkreten Forschungsaktivität des Subjekts – also auf den möglichen Spektren in und zwischen den Disziplinen – vollzogen werden. Dementsprechend werden im Folgenden vor allem solche theologischen Ansätze auf eine theologische Fragestellung als wissenschaftstheoretisches Differenzkriterium im Sinne des dritten Kapitels dieser Arbeit untersucht, die nicht aufgrund ihrer disziplinären Zuordnung, sondern aufgrund ihrer Art, Theologie zu betreiben, exemplarisch auf ausgewählte Aspekte von einem der vier genannten Zugriffe hin analysiert werden können. Daraus ergibt sich auch, dass im Gegensatz zum entsprechenden Kapitel zur Religionswissenschaft (4.2.) nicht (subdisziplinäre) Einführungsliteratur hier als Primärquellengenre fungieren kann – dann wäre man wieder in der Logik der jeweiligen Subdisziplin. Sondern anstelle dessen wird versucht, sich im Folgenden auf gesamttheologisch maßgebliche Werke zu konzentrieren, aus denen jeweils einer der vier Zugriffe in einzelnen Aspekten konstruiert werden kann.²⁴⁰ Diese Ansätze
239 Bei diesen vier vorgestellten Zugriffen handelt es sich wieder – analog zu Kapitel – 4.2. um einen Vorschlag ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Gewähr und ohne Implikation von Hierarchien oder Symmetrien dieser Zugriffe zueinander, der sich seiner eigenen Positionalität und Kontingenz bewusst ist, sich aber aus der Vorgehensweise der Arbeit heraus ableiten lässt. Alternative Herleitungen kämen logischerweise auf alternative Vorschläge. Eine Kritik oder Erweiterung der hier vorgestellten Zugriffe wäre also nicht nur denkmöglich, sondern fundamentaltheologisch stringent und wünschenswert. 240 Denn disziplinäre Diskurse sind u. a. durch die Namen geprägt, die wiederholt zitiert werden. Dementsprechend stellen die im Folgenden genutzten Beispiele zwar eine relativ situative und willkürlich anmutende Auswahl dar – es könnten im Grunde beliebig andere Namen hinzugezogen werden. Geachtet wurde aber bei der Auswahl auf eine gewisse Repräsentation der (empfundenen) aktuellen Mainstreamdiskurslandschaft der Theologie. Das damit natürlich auch gewisse (Macht‐) Strukturen des theologischen Fachdiskurses aktualisiert werden, kann dabei nicht ignoriert werden, stellt aber in dieser – am diskursiven Mainstream orientierten – Arbeit keinen Fokus dar. Eine
5.2 Theologische „Zugriffe“
219
werden auf ihr Verständnis von Theologie als eigenständiger Wissenschaft dahingehend untersucht, als dass die in ihnen implizit oder explizit zum Ausdruck gebrachten theologischen Forschungsinteressen, der sich daraus ergebende Gegenstandsbereich und die Methodologie auf die daraus erfolgenden Implikationen für eine theologische Fragestellung hin analysiert werden.
5.2.1 Historisch-begrifflich Als erstes Werk wird hier im Folgenden Christian Albrechts Habilitationsschrift mit dem Titel Historische Kulturwissenschaft neuzeitlicher Christentumspraxis. Klassische Protestantismustheorien in ihrer Bedeutung für das Selbstverständnis der Praktischen Theologie aus dem Jahr 2000 auf Aspekte eines methodologisch im historisch-begrifflichen Spektrum agierenden theologischen Zugriffs hin analysiert. Albrecht, geboren 1961 in Ahrensburg,²⁴¹ ist seit 2008 Professor für Praktische Theologie²⁴² an der evangelisch-theologischen Fakultät der Ludwig-MaximiliansUniversität München. Unter seinen sich über ein großes Spektrum²⁴³ der Praktischen Theologie erstreckenden Forschungsschwerpunkten²⁴⁴ sticht für die folgenden Untersuchungen vor allem das grundlegende Interesse an prinzipien- bzw. wissenschaftstheoretischen Fragestellungen zur Praktischen Theologie hervor. Verbunden mit einem Fokus auf zentrale Entwicklungen der neueren Theologiegeschichte (mit besonderem Interesse an Schleiermacher und Troeltsch) bzw. auf deren theologisch-disziplinäre Gegenwartswirksamkeit zeigt sich bereits an dieser Stelle, dass Albrechts Ansatz sich hervorragend für die Konstruktion eines historisch-begrifflichen Zugriffs innerhalb der Theologie eignet – ohne dabei natürlich Albrechts Werk in irgendeiner Art und Weise unter diesen Zugriff subsumieren zu
wissenschaftstheoretische Analyse der theologischen Fachstruktur im Blickwinkel der Fragestellung als Differenzkriterium und in einer expliziten (z. B. gendertheoretisch, interkulturell, befreiungstheologisch, politisch-theologisch etc. pp. orientierten) Durchbrechung bestimmter Machtstrukturen wäre weiterführend mehr als wünschenswert und notwendig. 241 Vgl. die Website von Prof. Dr. Christian Albrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Vita, https://www.pt1.evtheol.uni-muenchen.de/personen/albrecht/vita/index.html – 28.01.21. 242 Vgl. die Website des Lehrstuhls für Praktische Theologie mit den Schwerpunkten Homiletik und Theorie medialer Kommunikation an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Porträt, https:// www.pt1.evtheol.uni-muenchen.de/ueber_uns/portrait/index.html – 28.01.21. 243 Mit Ausnahme der Religionspädagogik. Vgl. ebd. 244 Vgl. die Website von Prof. Dr. Christian Albrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Forschungsschwerpunkte, https://www.pt1.evtheol.uni-muenchen.de/personen/albrecht/ schwerpunkte/index.html – 28.01.21.
220
5 Wie fragt Theologie?
wollen. In seiner eben genannten Monografie unternimmt Albrecht – „deutlich in der Tradition des opus magnum ‚Neuzeitliche Konstitutionsbedingungen der Praktischen Theologieʻ von Volker Drehsen“²⁴⁵ – den Versuch, durch eine theologiegeschichtliche Analyse die spezifische Genese und systematische Konstitution seines Faches der Praktischen Theologie darzulegen. In Anwendung des heuristischen Programmbegriffs des Protestantismus wird so eine eigenständige wissenschaftstheoretische Programmatik Praktischer Theologie historisch hergeleitet und konstruiert.²⁴⁶ Ausgangspunkt dieser Unternehmung sei die im Kontext der allgemeinen Säkularisierungs- und inneren Pluralisierungsgeschichte des Christentums stehende „Beobachtung […] eines Strukturwandels der Praktischen Theologie im Laufe ihrer Geschichte“²⁴⁷ – weg von einer vornehmlich an klassisch institutionalisierter Kirchlichkeit orientierten reinen Anwendungswissenschaft hin zu einer „Theorie der Praxis des Christentums in der modernen Gesellschaftskultur“.²⁴⁸ Durch diesen heuristischen Bezug auf das positive Christentum zeige sich die theologisch-enzyklopädische Position bzw. Bedeutsamkeit der Praktischen Theologie, da diese „Praxisdimension […] der Theologie insgesamt aufgegeben ist, [nämlich als] Frage nach der faktisch gelebten Religion“²⁴⁹ – wodurch gleichsam die wissenschaftstheoretische „subtile[…] [aber zentrale] Unterscheidung von Religion und Theologie“²⁵⁰ expliziert sei. Dadurch fokussiert sich gleichsam Albrechts Vorhaben, indem die Wissenschaftsgeschichte der Praktischen Theologie eben auf jene wissenschaftstheoretischen Bedingungen und Implikationen hin untersucht wird, die Grundlage für eine immer stärkere Öffnung der Praktischen Theologie hin zur „sozialkulturellen Lebenswelt christlicher Religion“²⁵¹ seien. Dass diese Wende hin zur konkreten Religion wissenschaftsgeschichtslogisch nicht nur von Praktischer Theologie vollzogen wurde, sondern als gesamttheologische Entwicklung zu betrachten ist,²⁵² begründet, warum Albrechts Monografie im hier Folgenden zur exemplarischen Konstruktion eines spezifischen Zugriffs auf
245 Grethlein, Christian, Historische Kulturwissenschaft neuzeitlicher Christentumspraxis. Klassische Protestantismustheorien in ihrer Bedeutung für das Selbstverständnis der Praktischen Theologie, in: ThLZ 126 (2001), 319 – 321, 319. 246 Vgl. Albrecht, Christian, Historische Kulturwissenschaft neuzeitlicher Christentumspraxis. Klassische Protestantismustheorien in ihrer Bedeutung für das Selbstverständnis der Praktischen Theologie (BHTh 114), Tübingen 2000, 1. 247 Ebd. 248 Ebd. 249 Ebd. 250 Ebd., 3. 251 Ebd., 4. 252 Vgl. Kapitel 2.2. dieser Arbeit.
5.2 Theologische „Zugriffe“
221
Theologie insgesamt herangezogen wird. Praktische Theologie fungiere im innertheologischen Diskurs dann als diejenige Disziplin, die konkret die Formen und Funktionen dieser Religiosität in ihrer Geschichte und Gegenwart zum Gegenstand hat und daraus dann ihre Theorie der christlich-religiösen Praxis entwickelt.²⁵³ Damit wird auch deutlich, dass wissenschaftstheoretische Aussagen über die Subdisziplin der Praktischen Theologie (schon allein diskurslogisch) im wechselseitigen Verhältnis zum Verständnis von Theologie als Disziplin insgesamt stehen. „Denn die Praktische Theologie verdankt ihre Existenz ja nicht sich selbst, sondern Forderungen, die der Theologie als ganzer gelten und darum auch Begründungen, die aus der Theologie als ganzer müssen abgeleitet werden können.“²⁵⁴ Durch die Konzentration also auf die Frage nach den „Legitimationsstrategien“ und „Begründungsmuster[n]“,²⁵⁵ die hinter der gesamttheologischen Wende zur gelebten Religion stehen, eignen sich die Ausführungen Albrechts für eine fundamentaltheologische Analyse auf einen spezifisch theologischen Zugriff hin.²⁵⁶ Albrecht konzentriert seine Vorgehensweise dabei – wie oben schon angedeutet – auf ein spezifisches, theologiefachgeschichtlich zentrales Begründungsmuster, auf den Protestantismusbegriff, der im Laufe des 19. Jahrhunderts „in der prinzipientheoretischen Grundlagenreflexion der evangelischen Theologie eine vo[m] [ursprünglichen] konfessionspolemischen Ort sich lösende, selbständige Bedeutung als programmatischer Selbstauslegungsbegriff eines bestimmten, kulturpraxisorientierten Typs des evangelischen Christentums gewonnen hat.“²⁵⁷ Durch diese Konzentration engt sich somit der material-historische Bezugsrahmen seiner Arbeit ein: Maßgebliche protestantismustheoretische Entwürfe des 19. und frühen 20. Jahrhunderts werden daraufhin untersucht, ob ihnen eben solche Legitimationsstrategien zugrunde liegen, die für eine „der religiösen Kulturpraxis des Christentums zugewandte Praktische Theologie“²⁵⁸ argumentieren und als solche auch innerhalb der praktisch-theologischen Selbstreflexion genutzt wurden. Dementsprechend beschränkt sich Albrecht aus pragmatischen und formalen Gründen auf innerreformatorisch-theologische „profilierte Repräsentanten“²⁵⁹ protestantismustheoretischer Selbstreflexion und deren jeweilige wissenschaftlich praktischtheologische Rezeption zwischen ca. 1810 und 1930 aus dem deutschsprachigen
253 254 255 256 257 258 259
Vgl. ebd., 1 f. Ebd., 2. Ebd., 4. Vgl. dazu auch ebd., 14 f. Ebd., 5. Ebd., 4. Ebd., 11.
222
5 Wie fragt Theologie?
Kulturraum:²⁶⁰ Programmatisch beginnend mit Hegel und dann über Philipp Konrad Marheineke, zieht Albrecht somit seine ideengeschichtliche Analyse über F. C. Baur und Immanel Nitzsch, Richard Rothe und Ernst Christian Achelis sowie Heinrich Bassermann bis hin zu Troeltsch und dessen Einfluss auf Otto Baumgarten.²⁶¹ Dass der Protestantismusbegriff für eine solche Untersuchung auf Begründungsmuster hin Beispiel par excellence sei, liege an seiner im vom gesellschaftlichen Wandel geprägten historischen Kontext zu sehenden programmatischen Zuspitzung hin zum Selbstauslegungsbegriff eines Christentums, „das sich selbst fragwürdig, aber nicht obsolet geworden ist.“²⁶² Er sei im Grunde der kulturhermeneutische Antwortversuch²⁶³ auf die Frage nach durch die Geschichte hindurch bleibender Identität eines Christentums, das sich im Laufe der Moderne immer mehr sowohl institutionell als auch theologischselbstreflexiv von den bekannten und sichtbaren, klassisch christlich-religiösen Formen löst, von innen heraus pluralisiert und säkularisiert. Durch dieses lebensweltliche Erkenntnisinteresse an durch die Geschichte hindurch bleibender Identität der Legitimationsstrategie des Protestantismusbegriffs zeigt sich eine diesem Programmbegriff inhärente historisch-begriffliche Perspektive in Bezug auf seine Funktion sowohl als kulturchristlicher Selbstauslegungsbegriff als auch als praktisch-theologisch wissenschaftstheoretische Deutekategorie:²⁶⁴ So lässt sich diese historische Perspektive eben auch in gewisser Hinsicht als einen auf die genannten „Hauptaspekte der Ideengeschichte“²⁶⁵ (mit seinen oben erwähnten pragmatischen und formalen Beschränkungen) fokussierten historischbegrifflichen Zugriff auf (Praktische) Theologie konstruieren. Maßgeblich für das Vorhaben Albrechts einer – eine „gewisse Deutungsaksese [pflegenden]“²⁶⁶ – historischen Rekonstruktion sei dann auch das „vorbehaltlos[e] [Bekenntnis] zu den
260 Vgl. ebd., 8 f. 261 Vgl. ebd., 11. 262 Ebd., 5. 263 „[D]en Protestantismusbegriff [gibt] es offensichtlich nur als Gegenstand einer Deutung […]. Der Begriff bezeichnet kein ohne weiteres empirisch quantifizierbares Gebilde. Der Protestantismusbegriff ist auch nicht ausschließlich als lineare Folge seines historischen Ursprungsdatums, der Reformation greifbar. Vielmehr gibt es den Protestantismus nur in der Gestalt einer Theorie zu seiner Interpretation.“ Ebd., 8. 264 „Denn auch für die Grundlegungsprobleme der Praktischen Theologie gilt schließlich, daß ihre Probleme als echte Probleme sich nicht dadurch erweisen, daß sie eine Lösung hatten, sondern erst dadurch, daß sie eine Geschichte haben.“ Ebd., 16. 265 Ebd., 11. 266 Ebd., 13.
5.2 Theologische „Zugriffe“
223
Grundsätzen historischer Methode in der Theologie“,²⁶⁷ wozu für die Albrechtsche Arbeit vor allem und grundsätzlich der „Dienst [an] ihre[n] Quelltexten“²⁶⁸ zählt. Albrecht beginnt seine Ausführungen mit einer grundlegenden Darlegung des Forschungsstands der Geschichte der Protestantismusdeutung,²⁶⁹ durch die er jenen Grundsätzen historischen Arbeitens folgend sein eigenes Vorhaben – und vor allem die von ihm ausgewählten profilierten Repräsentanten²⁷⁰ – noch einmal kontextualisiert und eingrenzt. Ausgehend von der innerhalb der begriffsgeschichtlichen Forschung als Konsens anzusehenden Grundthese, dass die spätere „Deutefunktion“²⁷¹ des Protestantismusbegriffs bereits in seinen historischen Ursprüngen angelegt sei, zieht Albrecht hier einen Überblick in zehn Etappen über die programmatische Entwicklung des Begriffs von der Protestatio zu Speyer 1529 bis in die Zeit des Nachkriegsdeutschlands. Deutlich macht er dabei, dass die Entwicklung von einer„ursprüngliche[n] Schmähbezeichnung“ zur„Selbstbezeichnung“²⁷² bis hin im 18. Jahrhundert zum Begriff für eine „religiös-konfessionelle[n] Bewegung […], wenn man so will: zu einem ‚soziologischenʻ Begriff […], der abzielt auf die religiösen Motive, die politische, nationale oder auch regionale Identität der Bewegung, auf ihr laienhaftes und schließlich auf ihr bekenntnisbildendes Element“²⁷³ als ein lang gesponnener Bogen sich immer weiter ausdifferenzierender evangelischchristlicher Selbstreflexion zu sehen sei. Für den Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert können dabei zwei in spannungsvoller Wechselseitigkeit zueinander stehende, bis in die neueste Zeit in (praktisch‐) theologisch metatheoretischen Selbstverortungen wirksame Linien dieser Selbstreflexion hervorgehoben werden – einmal eine „instrospektiv[e]“,²⁷⁴ also eine religionssoziologisch nach innen gerichtete Reflexion auf die „kirchlich-konfessionellen Lehr- und Lebensgestaltungen des Protestantismus“;²⁷⁵ und einmal eine vielmehr auf die überkonfessionellen gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Formen und Funktionen des Protestantismus ausgerichtete Reflexion. Diesen langen Bogen dieser im Protestantismusbegriff selbst angelegten zwei Leitlinien weiter aufschlüsselnd geht Albrecht auf die maßgeblichen ideenge-
267 268 269 270 271 272 273 274 275
Ebd., 14. Ebd., 13. Hervorhebung C. N. Vgl. ebd., 18 – 37. Vgl. ebd., 21 f. Ebd., 22. Ebd., 23. Ebd. Ebd., 24. Ebd.
224
5 Wie fragt Theologie?
schichtlichen Etappenschritte der Entwicklung der Protestantismusprogrammatik ein, die für das oben angerissene Ziel seiner Arbeit zentral sind.²⁷⁶ Daran schließt sich in der Albrechtschen Monografie die materiale Arbeit an den „profilierten Repräsentanten“ an. Den Einstieg mit der – im bisherigen Forschungskontext erst langsam in den Blick genommenen – Ausarbeitung der Hegelschen Protestantismusprogrammatik begründet er damit, dass Hegel „die Begründung für eine Kulturpraxis des Protestantismus […] in einer Weise [formuliert], die für die Theoriegeschichte protestantischer Selbstauslegung des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts prägend geworden ist, auch wenn dabei nicht immer explizit Bezug genommen worden ist auf Hegel, und wenn seine diesbezüglichen Wirkungen weitgehend subkutan verlaufen zu sein scheinen.“²⁷⁷ Dabei beabsichtigt Albrecht – schon allein aus formal-pragmatischen, aber auch aus dem Hegelschen System immanenten materialen Gründen – keine Einzeichnung des Protestantismusbegriffs im Kontext des gesamten philosophischen Systems Hegels, sondern beschränkt sich auf eine Darstellung der „Grundzüge dieser Protestantismustheorie“,²⁷⁸ um so – der Logik seiner Monografie folgend – die oben genannte Prägekraft des Hegelschen Protestantismusbegriffs für die neueste Zeit protestantischer Selbstauslegung zu verdeutlichen. 276 Genannt und damit als Kontext der eigenen Untersuchungen aufgezeigt werden n. v. a. die Frage nach dem Geist des Protestantismus und seiner kulturtheoretischen Begriffsrezeption im Deutschen Idealismus (vgl. ebd., 27); die maßgeblich durch Baur eingeführte Funktion des Protestantismusbegriffs als theologischer Leitbegriff (vgl. ebd., 27 f.), die sich in seinen späteren „partielle[n] […] Inanspruchnahme[n]“ in Bezug auf bestimmte „Sachthemen“ (ebd., 28), wie z. B. als Freiheitsprinzip bei Strauß u. ä., äußerte und auch in geschichtstheoretischen Überlegungen zum Ausdruck komme. Deutlich wird dabei, dass gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Begriff wieder mehr und mehr zum Leitbegriff konfessionell nach innen gerichteter Selbstreflexion der Spezifität protestantischer Lehre werde (vgl. ebd., 28 f.), was vor allem in der bei Ritschl rekonstruierten und reflektierten Debatte um die Unterscheidung des Protestantismusbegriffs als Formal- und Materialprinzip „gebündelt“ werde (ebd., 30). Diese innerprotestantische Selbstbesinnung auf die „eigene Theoriegeschichte“ (ebd.) sei dann wiederum kennzeichnend für die Protestantismusprogrammatiken zum Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert im Kontext neu- und kulturprotestantischer fachund ideengeschichtlicher Selbstverortungen. Für die „bisher erst schwach erforschte Phase des Nachkriegsprotestantismus“ (ebd., 35) Mitte des 20. Jahrhunderts sei dann wieder ein Absehen von „integralen Protestantismustheorien“ zentral und eine erneute Konzentration auf die Anwendung des Protestantismusbegriffs „in primär thematische[n] Zusammenhängen“ (ebd.), wie eben z. B. in Bezug auf seine Kirchlichkeit. Dass solche ekklesiologischen Überlegungen zum Protestantismusbegriff gleichsam nicht nur seiner Anwendung auf partielle Themen, sondern auch seinem inhärenten integralen Gehalt gerecht werden, zeigen laut Albrecht exemplarisch die Reflexionen zur Ambivalenz des Protestantismusbegriffs zwischen Kirchlichkeit und individualisierter Frömmigkeit Hans-Joachim Birkners (vgl. ebd., 37). 277 Ebd., 38 f. 278 Ebd., 40.
5.2 Theologische „Zugriffe“
225
Als zentrale Konstitutionselemente dieses Protestantismusbegriffs arbeitet Albrecht zwei in wechselseitiger bzw. systemlogischer Abhängigkeit zueinander stehende Aspekte heraus: Einerseits streicht er den Aspekt der Innerlichkeit in Hegels Religions- bzw. Frömmigkeitsbegriff hervor; nämlich insofern, als dass „das Innere des individuellen Menschen [der] Konstitutionsort der protestantischen Frömmigkeit [ist;] […] oder, in geistphilosophischer Terminologie ausgedrückt, der Ort der Selbstmanifestation des Geistes im Geiste.“²⁷⁹ Und andererseits steht dazu in Beziehung das reflexive Moment der „gedankliche[n] Verobjektivierung des Innerlichen“:²⁸⁰ In der dem protestantisch-freiheitlichen Prinzip eingegebenen Reflexionsbewegung verobjektiviere sich der Geist und finde so gleichsam zu sich selbst.²⁸¹ Diese innere Dynamizität zeige sich dann im Hegelschen Prinzip des Protestantismus als ihre „Grundfigur“,²⁸² als – sich sowohl auf individueller Mikro- wie auf universalgeschichtlich-politischer Makroebene ²⁸³ – vollziehende Bewegung der „Verinnerlichung des Religiösen als entäußernde Hineinbildung des Religiösen in die Welt“.²⁸⁴ Aus diesem dynamischen Prinzip ergeben sich laut Albrecht drei ableitbare „Grundmerkmale eines auf Kulturpraxis drängenden Protestantismus“,²⁸⁵ die in der nachfolgenden Theoriegeschichte immer wieder ex- oder implizit rezipiert bzw. kreativ tradiert werden (und in den nächsten Schritten seiner Monografie dann auch als sozusagen ideengeschichtliches Traditionsgut herausgearbeitet werden). Erstens dränge der Protestantismus durch den rational-verobjektivierenden Prozess der Hineinbildung in die Welt auf eine rational-autonomisierende „Versachlichung“²⁸⁶ ebendieser, indem sowohl der Mensch in seiner Religiosität als auch die Gesellschaft in ihrer Rationalität und Funktionalität sich emanzipieren. Zweitens gestalte sich diese Hineinbildung des Religiösen in die Welt argumentativlogisch dann gleichzeitig auch als „Restitution der Religion“²⁸⁷ als gesellschaftlicher Größe, da dieser Hineinbildungsprozess in seiner Dialektik zwischen Innerlichkeit und Entäußerung sich nur konkret innerweltlich vollziehen könne.
279 Ebd., 42. 280 Ebd., 44. 281 Vgl. ebd., 45. 282 Ebd., 46. 283 Albrecht exemplifiziert dies am „Anwendungsfall der Protestantismustheorie Hegels: [der] Hineinbildung des Protestantismus in den Staat“. Ebd., 51; vgl. dazu näher ebd., 51 – 58. Anhand dieses Beispiels erarbeitet Albrecht jene im Fortlauf des Fließtextes genannten „Hauptkennzeichen“ (ebd., 58) eines sich in die Welt entäußernden Protestantismus. 284 Ebd., 49. 285 Ebd., 58. 286 Ebd., 59. 287 Ebd.
226
5 Wie fragt Theologie?
Drittens betont deswegen Albrecht auch – im metatheoretischen Blick auf den Hegelschen Protestantismusbegriff – eine gewisse gegenwartsanalystische „diagnostische Dimension“²⁸⁸ dieses Begriffs, da mit Hegel gedacht jede Reflexion auf Protestantismus als sich in die Welt entäußernde Verinnerlichung nur in Verbindung mit der sozusagen „kulturdiagnostische[n]“ ²⁸⁹ Analyse ebendieser Welt vollzogen werden könne. Diese von Albrecht nur angerissenen Grundaspekte des Hegelschen Protestantismusbegriffs arbeitet er im Fortlauf seines Werkes als die Theoriegeschichte protestantisch praktisch-theologischer Selbstreflexion prägend weiter heraus. Er steigt hier mit „Hegels Leser Philipp Konrad Marheineke“²⁹⁰ ein, an dem sich die langfristige Tiefenwirkung der Hegelschen Protestantismusdeutung für die Praktische Theologie in ihren inhaltlich-materialen und wissenschaftstheoretisch-funktionalen Effekten „in beispielhafter Konzentriertheit anschaulich“²⁹¹ verdeutlichen lasse. Dabei analysiert er Marheinekes Hegelrezeption im Kontext von dessen sozusagen vorhegelianischen Protestantismusbegriff,²⁹² der über „prinzipielle Charakterisierungen“²⁹³ seines Wesens als Konfessionsbegriff zunächst in der Grundansicht münde, dass Protestantismus sich eben nicht durch eine reine Anti-Position zum Katholizismus charakterisieren ließe. Sondern vielmehr kennzeichne er sich dadurch, dass er nicht auf Formen reformatorisch-christlicher bzw. -kirchlicher Institutionalität beschränkt, sondern auch außerhalb dieser Formen – sowohl eben institutionell als aber auch im Sinne einer „anthropologische[n] Fundamentalkonstante“²⁹⁴ – zu finden sei. Im späteren, dann durch die Hegelrezeption geprägten Verlauf seines Schaffens rekurrierte Marheineke „im Zusammenhang praktischtheologischer Erwägungen“²⁹⁵ wieder auf seine protestantismustheoretischen Grundsatzüberlegungen, da „[o]ffensichtlich […] gerade der Zusammenhang der Praktischen Theologie […] Erörterungen über das Wesen des Protestantismus naheleg[e].“²⁹⁶ Hier entwickelte er eine praktisch-theologische Kirchentheorie über den Gedanken der Hineinbildung der Kirche in den Staat als das Grundideal des Protestantismus.²⁹⁷ Für die Forschungsfrage Albrechts ist Marheinekes Vorge-
288 289 290 291 292 293 294 295 296 297
Ebd., 61. Vgl. ebd. Ebd. Ebd., 63. Vgl. ebd. Ebd., 64. Ebd. Ebd., 66. Hervorhebung C. N. Ebd. Vgl. ebd., 69 ff.
5.2 Theologische „Zugriffe“
227
hensweise dann insofern bedeutsam, als dass in ihm der Anfangspunkt einer „Tradition der praktisch-theologischen Anknüpfung an klassische Protestantismusdeutungen“²⁹⁸ zu sehen sei, die gleichsam auf den Kontext des gesamten theologischen Diskurs angewiesen ist. Deutlich werde so am Beispiel Marheinekes die (für das hier vorliegende Kapitel zentrale) Eingangsthese Albrechts, dass praktisch-theologische Theoriebildung (hier in Bezug auf die Frage nach der angemessenen institutionellen Verfasstheit des Protestantismus) eben nicht allein inner-subdisziplinär vollzogen werden könne, „sondern daß innerhalb der Praktischen Theologie auf prinzipientheologische und historisch-theologische Theoriestücke zurückgegriffen werden muß.“²⁹⁹ Diesen Gedanken³⁰⁰ spinnt Albrecht – sowohl in theoretischer Reflexion als auch gleichsam in praktischer Durchführung – weiter mit der umfassenden Analyse F. C. Baurs als nächsten, in der Ideengeschichte der Protestantismusdeutungen wohl mit profiliertesten Repräsentanten, dem er – aufgrund seines engen Konnex zwischen Protestantismus- und Geschichtstheorie – eine „Scharnierfunktion […] in der Geschichte der protestantischen Selbstreflexion“³⁰¹ zuspricht. Diese Verbindung begründe sich bei Baur grundsätzlich zunächst in dem Grundgedanken des Sinnzusammenhangs von Geschichte als einem gedeuteten Zusammenhang, als „Entfaltung eines überindividuellen Bewußtseins“.³⁰² Der historisch-kritischen Methode gehe es dann nicht um die Frage danach, wie es „gewesen sei, sondern wie es zu verstehen ist.“³⁰³ Sie kennzeichne sich dann also – in aktiv-kritischer Reflexion des Sinnprinzips von Geschichte – durch eine gewisse „Empirie-Skepsis, Selbstkritik des Historikers und […] vermittelnde Konstruktivität.“³⁰⁴ In diesen Grundgedanken der Sinnhaftigkeit von Geschichte gliederte Baur nun den Protestantismusbegriff so ein, dass Protestantismus in seinem Wesen und seiner Funktion nicht auf einen Begriff
298 Ebd., 72. 299 Ebd. 300 Zur Frage nach der Hegelrezeption bei Baur betont Albrecht, dass die Reichweite des Hegelschen Einflusses bei Baur innerhalb der Forschung an sich schon stark umstritten sei. Problematisch sei bei dieser Fragestellung dann aber vor allem, dass sie selbst als Frage den Forschungsprozess in eine starke Perspektivität bzw. gar Befangenheit stelle.Vgl. ebd., 76. Ein passendes Beispiel für die im Kontext dieser Arbeit im dritten Kapitel dargelegte Betonung der Positionalität von – gerade auch historisch orientierter – Wissenschaft. 301 Ebd., 74. 302 Vgl. ebd., 77. 303 Ebd., 83. Diesen epistemisch-hermeneutischen Grundgedanken holte Baur methodisch in der Frage nach der Vermittlung zwischen den historischen Ereignissen und dem sie rekonstruierend deutenden Individuum mit der Methode der Spekulation ein. Vgl. ebd., 86. 304 Ebd., 83. Hervorhebung C. N.
228
5 Wie fragt Theologie?
oder eine Leitidee reduzierbar sei, sondern als das diesem eher zugrundeliegende „Strukturprinzip“³⁰⁵ anzusehen sei. Baurs dahinterstehender hermeneutischer Ansatz sei zunächst das Verständnis von der Reformation als einem epochalen Wendepunkt der Geschichte, in dem „selbst schon das Wesensprinzip der neuen Epoche mitgesetzt“³⁰⁶ sei. Dieses Prinzip finde strukturell seinen Ausdruck in der „Unterscheidung zwischen sichtbarer und unsichtbarer Kirche“³⁰⁷ – und in dann verallgemeinerter Zuspitzung im Strukturgedanken der Differenz zwischen Idee und Erscheinung,³⁰⁸ der dann wiederum ableitbare „Subunterscheidungen“³⁰⁹ aufmache. Der davon abstrahierbare „sachliche Gehalt“³¹⁰ dieses sich darin ausdrückenden Strukturprinzips des Protestantismus liege dann nicht darin, dass die aufgemachten Unterscheidungen ausgeglichen, gelöst oder manifestiert werden,³¹¹ sondern dass es um genau diesen Prozess des Differenzierens und somit des Aneinanderbildens der Gegensatzpaare gehe. Protestantismus als Strukturprinzip sei dann „der auf Dauer gestellte Impuls der Differenzvermittlung.“ ³¹² Die darin immanente Dynamizität des Protestantismusbegriffs begründe so auch den wechselseitigen Zusammenhang zwischen Geschichtsund Protestantismustheorie bei Baur, indem Protestantismus – als historisches Ereignis – einerseits eben Gegenstand dieser Geschichtstheorie sei und andererseits als vermittelnder Strukturbegriff in Korrelation zu Geschichte als Sinnzusammenhang selbst stehe.³¹³ Dementsprechend bestehe auch eine wechselseitige Bewegung von Theologie zu Geschichtstheorie – und umgekehrt.³¹⁴ Protestantische
305 Ebd., 97. 306 Ebd., 98. 307 Ebd., 101. 308 Vgl. ebd, 102 f. 309 Ebd., 104. Z. B., wie Albrecht dann im Folgenden (ebd., 107– 118) ausführt, die Differenz zwischen Subjektivität und Objektivität, zwischen Protestantismus und Katholizismus, oder Innerlichkeit und Äußerlichkeit. Deutlich ist, dass das dahinter stehende Prinzip des Protestantismus hier also nicht grundsätzlich material gefüllt ist, sondern eben als Strukturprinzip fungiert, als „unterscheidungsfähige[s] Differenzbewußtsein“. Ebd. 310 Ebd., 118. 311 Vgl. ebd., 119 f. 312 Ebd., 118. 313 Vgl. ebd., 121 f. 314 Vgl. ebd., 122 ff. Ausdruck finde das vor allem „in der [vollständigen] Einstellung der theologischen Disziplinen auf die historische Methode“ (ebd., 122). Aus dieser Fokussierung von Theologie auf Geschichte und die darin mitgegebene Perspektive des Wandels und der historisch-kulturellen Abhängigkeit leiten sich dann wiederum auch die – im Prinzip des Protestantismus mitgegebenen – theologischen Aufgaben der Kulturkritik und Gegenwartsdiagnostik ab (vgl. ebd., 130 f ). Auf der anderen Seite vollziehe sich die theologische Aufladung der Geschichtstheorie in der – im Begriff von Geschichte als sinnhaftem Zusammenhang mitgegebenen – Deutung von Geschichte als
5.2 Theologische „Zugriffe“
229
Theologie gestalte sich dann – verstanden als „historisch-wissenschaftliche Selbstaufklärung des Protestantismus“³¹⁵ – als auf Gegenwartsdiagnostik bezogene Geschichtstheorie. Den (zumindest impliziten)³¹⁶ Einfluss dieses selbstaufklärerischen, entdogmatisiert-kulturdiagnostisch³¹⁷ fokussierten protestantischen Theologieverständnisses auf Praktische Theologie zeigt Albrecht im nächsten Schritt am Beispiel Nitzschs³¹⁸ auf, bei dem Protestantismus als eben bereits etablierter Selbstauslegungsbegriff zum Einsatz komme.³¹⁹ So definierte Nitzsch die Aufgabe der Theologie insgesamt als – in Bezug auf das Selbstverständnis der christlichen Kirche in Geschichte und Gegenwart – rekonstruktiv. ³²⁰ Praktische Theologie komme in diesem Diskurs dann ihrer spezifischen Subfragestellung nach, indem sie sich „als Reflexionswissenschaft der Bedingungen und Möglichkeiten kirchlichen Handelns überhaupt“³²¹ vollziehe. Der Einfluss der Baurschen Protestantismusdeutung zeige sich hier dann vor allem in der darin gesetzten „Entdogmatisierung der praktischtheologischen Wahrnehmung kirchlich-religiöser Lebenswirklichkeit“³²² und der – in dieser Bezugnahme auf die faktisch gelebte Religiosität – mitgegebenen geschichtlichen Verfasstheit und wechselseitigen Bedingtheit der Disziplin selbst. Praktische Theologie gestalte sich so durch ihre spezifische Subfragestellung als eigenständige theologische Disziplin mit einer eigenständig „protestantismustheoretisch-ekklesiologisch fundierte[n]“³²³ Perspektive im Gesamtdiskurs der Theologie.
„Selbstrealisierungsgeschehen der Vernunft im historischen Prozeß bzw. als Selbstoffenbarung Gottes“. Ebd., 123. 315 Ebd., 132. 316 So „läßt sich eine unmittelbare und explizite Rezeption der Protestantismusdeutung Ferdinand Christian Baurs in der Praktischen Theologie nicht nachweisen.“ Ebd., 133. Nichtsdestoweniger„wird Baurs Protestantismusdeutung auf dem Feld der Praktischen Theologie in der gleichen Weise wirksam wie in der Theologie insgesamt: Auch in der Praktischen Theologie zeigt sich der […] Umstand […] einer thematischen Auffächerung des Protestantismusbegriffs im Gefolge Baurs. Auch in der Selbstverständigung der Praktischen Theologie zeigt sich, daß der Protestantismusbegriff seit Baur zur gängigen Münze theologischer Selbstauslegung geworden ist […], daß freilich doch auch diese Wirkungen Baurs häufig nur in sehr vermittelter Weise erkennbar sind, weil explizite Bezugnahmen kaum artikuliert werden.“ Ebd., 134. 317 Vgl. ebd., 132. 318 Dem Albrecht „– literarisch gesehen – eine mehrfach vermittelte Wahlverwandtschaft“ mit Baurs Protestantismusdeutung nachweist. Ebd., 137. 319 Vgl. ebd., 144. 320 Vgl. ebd., 138. 321 Ebd., 139. 322 Ebd., 145. 323 Ebd.
230
5 Wie fragt Theologie?
Um den weitreichenden Einfluss der Programmatik des Protestantismusbegriffs weiterhin auszuführen, analysiert Albrecht als nächstes ausführlich die Aneignung des Protestantismusbegriffs als „historische[…] Deutekategorie“³²⁴ bei Rothe. Albrecht verdeutlicht hier, dass Rothes „umstrittene Auffassung […] einer geschichtsnotwendigen Auflösung der Kirche in den sittlichen Kulturstaat“³²⁵ eher zu verstehen sei als vollständige Umformung des Christentums bzw. eben sozusagen soteriologische Verchristlichung der Gesellschaft; und dass diese Auffassung als solche nur verständlich sei vor dem Hintergrund eines vertieften, geschichtstheoretisch gefüllten Protestantismusbegriffs, nämlich als ein „Paradigma für das Bewegungsgesetz der Christentumsgeschichte“.³²⁶ Verbunden mit einem auf immer weiter fortschreitende Entwicklung ausgerichteten Geschichtsbegriff zeige sich die „historische Kontinuität“³²⁷ des protestantischen Geschichtsparadigmas in seinem strukturellen Grundgedanken der Umformung und Neubildung, der „auf Dauer gestellte[n] Idee des Bruches“,³²⁸ deren „institutionalisierte Gestalt“³²⁹ der Protestantismus als geschichtstheoretischer Strukturbegriff dadurch gleichsam repräsentiere. Der enge Zusammenhang zwischen Geschichts- und Christentumstheorie sei so gerade auch bei Rothe evident: Geschichte werde verstanden als sich kontinuierlich in Stufen fortschreitend entwickelnde Heilsgeschichte, die sich durch die „zunehmende[…] Selbstentschränkung des Christentums von seiner kirchlichen Gestalt, […] [also] der zunehmenden Ausdehnung des Christlichen auf weltliche Bereiche der Gesellschaftskultur“³³⁰ kennzeichne. Dadurch verlagere sich auch bei Rothe die Wesensbestimmung des Prinzips des Protestantismus in den Bereich des religiös Sittlichen bzw. Versittlichten: weg von einer Fokussierung der klassischkirchlichen Sphäre hin zur sozusagen weltlich-staatlichen, gewissermaßen soziokulturellen Sphäre.³³¹ Und gleichzeitig werde die Bedeutung des Protestantismus
324 Ebd., 148. Diese Deutekategorie konkretisiere sich bei Rothe im Kontext seines geschichtstheoretischen Ansatzes einer spekulativen Methode, verstanden als „Entschlüsselung“ (ebd., 170) bzw. soteriologisch aufgeladene Rekonstruktion des Geschichtsverlaufs – eben als Heilsgeschichte. Vgl. ebd., 172 f. „Die wesentliche Voraussetzung der Protestantismusdeutung […] Rothe[s] bleibt deren religiöse Motiviertheit.“ Ebd., 161. 325 Ebd., 147. 326 Ebd., 149. Hervorhebung C. N. 327 Ebd. 328 Ebd. Auch Rothe rekurriere dafür konstruierend-deutend auf das Ereignis der Reformation als einem zentralen Wendepunkt der Geschichte, indem genau dieser Gedanke der „permanente[n] Überwindung und […] permanente[n] Umbildung“ (ebd.) als Idee zum Ausdruck käme. Vgl. dazu ebd., 177. 329 Ebd., 164. 330 Ebd., 175. 331 Vgl. ebd., 162.
5.2 Theologische „Zugriffe“
231
für die Ausbildung der Moderne insgesamt betont: Durch die verschiedenen historischen Umbildungsprozesse, für deren Strukturprinzip das geschichtstheoretische Paradigma des Protestantismus stehe, implementieren sich „das die Neuzeit konstituierende Bewußtsein des Individuums und das Prinzip der Subjektivität in [der] moderne[n] Kultur“.³³² Für Theologie bedeute das alles im Gegenzug dann auch wieder die konsequente Zuwendung zur Kulturtheorie, wie (implizit) in Rothes Forderungen nach einer „protestantischen Kulturgeschichtsschreibung“³³³ und einer „protestantischen Gegenwartsanalytik“³³⁴ deutlich werde. Zur praktisch-theologischen Rezeption dieser methodisch spekulativ angesetzten Theologie Rothes führt Albrecht im Folgenden Achelis und Bassermann an. Achelisʼ differenziert-kritische Rezeption Rothes „für die Konstitution der Praktischen Theologie“³³⁵ zeige sich schon in einer grundlegenden Anforderung an die Theologie – die der reflektiert-kritischen Untersuchung der kirchlichen Praxisgeschichte: ³³⁶ Indem Achelis prinzipiell die Protestantismustheorie Rothes annehme, korrigiere er sie in ihren ontologisch-spekulativen Implikationen zurück auf die Notwendigkeit einer grundlegend „empirischen Unterfütterung [dieser] christentumstheoretischen Kulturtheorie“,³³⁷ um so ihre potentielle Überführung in konkrete Praxistheorie zu realisieren.³³⁸ Bassermanns „präzise [praktisch-theologisch prinzipientheoretisch ausgerichtete] Anknüpfung an Rothes Protestantismustheorie“³³⁹ konzentriere sich explizit um den Kirchenbegriff, dessen Reflexion (in konfessioneller Differenzierung) in der prinzipientheoretischen Weiterführung Bassermanns die zentrale, inhärente Aufgabe Praktischer Theologie sei – und dadurch gleichsam die wissenschaftstheoretische Reflexion ihrer eigenen Konstitution beinhalte.³⁴⁰ Die geschichtstheoretisch bedingte grundlegende Dynamizität des protestantischen Kirchenbegriffs habe dann auch zur Konsequenz, dass Praktische Theologie schon konstitutiv keine reine Anwendungswissenschaft sein könne, sondern vielmehr auf die praxistheoretischen (Vor‐) Bedingungen der Anwendungen in sowohl systematischer als auch historischer Perspektive wissenschaftlichkontrolliert reflektiert.³⁴¹ In dieser streng wissenschaftlichen Ausrichtung sei dann
332 333 334 335 336 337 338 339 340 341
Ebd., 189. Ebd., 193. Ebd., 195. Ebd., 206. Vgl. ebd., 203 ff. Ebd., 209. Vgl. ebd., 210. Ebd., 213. Vgl. ebd., 216 ff. Vgl. ebd., 219.
232
5 Wie fragt Theologie?
auch der „praxisbegründende[…] Praxisbezug“³⁴² der Praktischen Theologie begründet. Theologisch-enzyklopädisch betrachtet kennzeichne sich Praktische Theologie dann bei Bassermann wie auch bei Achelis sozusagen nicht einfach durch die Anwendbarkeit ihrer Ergebnisse auf die kirchliche Lebens- und Handlungswirklichkeit – das sei vielmehr Aufgabe und Fokus protestantischer Theologie insgesamt.³⁴³ Sondern ihre Eigenständigkeit als theologische Subdisziplin komme ihr vielmehr zu durch ihre eigene historisch und systematisch orientierte Metareflexion auf die Dynamizität von Kirche und deren praxistheoretische Implikationen.³⁴⁴ Als letzten Repräsentanten dieser ideengeschichtlichen Entwicklungslinien theologisch wirkmächtiger Protestantismustheorien führt Albrecht Troeltsch an, der sich aufgrund seines „methodisch vermittelnden Charakters […] hervorragend zur Reflexion des eigenen, gegenwärtigen Selbstverständnisses“³⁴⁵ eigne – trotz oder gerade wegen der spezifischen soziokulturellen und fachgeschichtlichen Positionalität Troeltschs. Denn in seiner historisch-methodischen Grundlegung, die nicht nur auf die Inhalte von Theologie, sondern damit auch auf ihre eigenen „Herkunfts-, Entstehungs- und Entfaltungsbedingungen“³⁴⁶ bezogen sei, werde gleichsam „ein methodischer Standard versachlichter Selbstreflexion etabliert“³⁴⁷ – worin Albrecht auch den Grund für die heutige maßgebliche Troeltsch-Rezeption sieht.³⁴⁸ Dadurch sei also die Auseinandersetzung mit der Troeltschen Protestantismustheorie in der Werkslogik Albrechts insofern besonders spannend, als dass sie nicht nur auf ihre sozusagen materialen Implikationen und Wirkungen auf das Selbstverständnis der Praktischen Theologie hin befragt wird, sondern dass in „Troeltschs funktionalem Zugriff auf die Protestantismustheorie“³⁴⁹ selbst ein heu-
342 Ebd., 221. 343 Vgl. ebd., 220. 344 Vgl. ebd., 225. 345 Ebd., 227. „Die Rezeption Troeltschs fungiert faktisch als methodische Selbstauslegung von Motiven, Bedingungen und Zielen der gegenwärtigen Theologie – die Interpretation Troeltschs erlaubt nicht nur, sondern sie ist selbst schon die methodische Selbstartikulation. […] [G]eeignet ist [das Werk Troeltschs dafür] deswegen, weil Troeltsch selbst schon die Bestimmung des eigenen Selbstverständnisses im Medium der historischen Reflexion vornahm und in diesem Zusammenhang die methodischen Grundzüge einer solchen historisch verschlüsselten Selbstreflexion ausarbeitete.“ Ebd. Hervorhebungen Albrecht. 346 Ebd. 347 Ebd. 348 „Die versachlichende Selbstverständigung der Theologie sucht sich im Modus der Rezeption eines von ihr reetablierten Klassikers versachlichter theologischer Selbstverständigung zu artikulieren und zu sublimieren.“ Ebd., 228. 349 Ebd., 229. Hervorhebung Albrecht.
5.2 Theologische „Zugriffe“
233
ristisches Mittel zur kulturtheoretischen Reflexion der eigenen Gegenwart mitgegeben sei. Troeltschs „Frage nach der Bedeutung des Protestantismus in [der] modernen Welt“³⁵⁰ sei grundlegend einzuordnen als Spezifizierung seiner „Frage nach dem Absolutheitsanspruch des Christentums unter den Bedingungen historischer Relativität“³⁵¹ und gehöre somit wissenschaftssystematisch zur Troeltschen Geschichtsphilosophie der Religion. ³⁵² Methodisch liege dann also der „Kern […] in der historischen Abstraktion“,³⁵³ mithilfe derer kulturtheoretisch-gegenwartsdiagnostisch orientierte Allgemeinbegriffe konstruiert werden können. Diese historischmethodische Fundierung zeige sich dann auch in Troeltschs Protestantismusdeutung, die als – religionstheoretisch an den sozialen Wirksamkeiten des Christentums interessierte – „Frage nach den Kulturbeziehungen des Protestantismus“³⁵⁴ fokussiert sei. Durch seine Differenzierung in verschiedene Epochen des Protestantismus gelinge es Troeltsch dabei, die vielschichtigen Wechselwirkungen zwischen Protestantismus und Kultur – und dann auch die kulturtheoretischen Wirkungslinien der protestantischen Epochen zueinander – aufzuzeigen.³⁵⁵ Troeltschs dadurch Gegenwart „konstruierende Protestantismusdeutung“,³⁵⁶ verstanden als historisch-methodisch fundierter, kulturtheoretisch-gegenwartsanalytischer Ansatz an sich in Anwendung, sei dementsprechend die „Einlösung“³⁵⁷ dessen, was bei Hegel, Baur und Rothe zuvor gefordert wurde. Daraus ergeben sich dann auch „epistemologische Konsequenzen“³⁵⁸ für Theologie insgesamt; maßgeblich die Konsequenz der „historisierende[n] Individualisierung und Relativierung der eigenen Reflexionshaltung, die auf eine methodische Selbstkontrolle angewiesen ist.“³⁵⁹ Ziel und Aufgabe der Theologie sei dann eben keine normativ-normierende Deutung des Geschichtsverlaufs, sondern das zur Diskussion Stellen des Maßstabs solcher Deutung.³⁶⁰ Dadurch zeige sich der Individualisierungsbegriff in seinen kon-
350 Ebd., 236. 351 Ebd. 352 Vgl. ebd., 244. 353 Ebd., 248. 354 Ebd., 254. 355 Vgl. ebd., 260.274 ff. So kann Albrecht in der Troeltschen Protestantismusdeutung eine Linie von der„in der Reformation keimartig angelegte[n] Reziprozität zwischen dem Protestantismus und der Kultur seiner Gegenwart“ (ebd., 274) bis hin zum Neuprotestantismus ziehen: „Der neue Protestantismus ist auf vermittelte Art das Ergebnis seiner eigenen (vom alten Protestantismus ausgegangen) Wirkungen auf die Kultur.“ Ebd., 276. 356 Ebd., 278. 357 Ebd. 358 Ebd., 280. 359 Ebd. 360 Vgl. ebd., 280 f.
234
5 Wie fragt Theologie?
struktiven, heuristischen Implikationen im Troeltschen System (sowohl protestantismustheoretisch als auch insgesamt) als sein Zentralgedanke, nämlich eben dem der „Rationalisierung und Kontextualisierung von Subjektivität.“³⁶¹ Als abschließenden materialen Schritt zeigt Albrecht die Reichweite der programmatischen Wirksamkeit der Troeltschen Protestantismustheorie in der praktisch-theologischen Selbstreflexion Baumgartens auf.³⁶² Den oben genannten Zentralgedanken des Individualisierungsbegriffs entwickle Baumgarten in seiner implizit als „materiale Entfaltung“³⁶³ der Programmatik Troeltschs gestalteten Rezeption weiter zur Grundkontur seines Protestantismusbegriffs: als die auf Mündigkeit ausgerichtete Bestimmung des protestantischen, sozial-kulturell aktiven (und so Welt verändernden) Menschen, in dem genau dieses in die Gesellschaft eingehende und in ihr wirksame protestantische Individualitätsprinzip als Wesensprinzip ausgedrückt werde.³⁶⁴ Material exemplarisch und gleichzeitig prinzipientheoretisch deutlich werde dies an Baumgartens Konzeption einer Seelsorgelehre, in der seine Konstitution Praktischer Theologie zum Ausdruck komme.³⁶⁵ Ausgang der Reflexion sei dabei keine normierend-normative Kirchentheorie, sondern die „Faktizität pfarrämtlichen Wirkens“.³⁶⁶ Protestantische Seelsorge sei – vor dem Hintergrund des oben angerissenen Protestantismusbegriffs – nur möglich „im Horizont ihrer gesellschaftlichen Verflechtung“³⁶⁷ im Kontext der modernen Kultur. Die Anforderung an die seelsorgerlich tätige Person bestehe dann auch nicht nur in einer angemessenen (klassisch verstandenen) theologisch-fachlichen Versiertheit, sondern eben auch in der Kompetenz, die Wechselwirksamkeit von Alltagskultur und individueller Religiosität wahrzunehmen.³⁶⁸ Dadurch müsse Seelsorgelehre ausdifferenziert werden zu einer „weiter ausgreifenden Theorie der Bedingungen und Formen religiösen Lebens in der modernen Gesellschaftskultur
361 Ebd., 282. 362 Vgl. ebd., 283 f. 363 Ebd., 287. Baumgartens Protestantismusdeutung bilde insofern „eine für ihre Zeit typische praktisch-theologische Protestantismustheorie, daß sie die Einsichten und Kautelen eines prinzipiellen Begriffes vom Wesen des neuzeitlichen Protestantismus nun unbefangen auch für die Entfaltung von Leitideen in klassischen kirchlichen und klassischerweise praktisch-theologisch zu begleitenden Handlungsfeldern fruchtbar zu machen sucht.“ Ebd. 364 Vgl. ebd., 288 ff. Albrecht referiert hier Baumgartens Ausführungen zum genau diese Individualität und Mündigkeit fokussierenden protestantischen Bildungsprinzip. Stoß- und Zielrichtung dieses Bildungsprinzips sei letztlich die (im Gedanken des Reiches Gottes religiös ausgedrückte) gesellschaftsverändernde Kulturwirksamkeit des Protestantismus. Vgl. ebd., 294. 365 Vgl. ebd., 295. 366 Ebd., 296. 367 Ebd., 301. 368 Vgl. ebd., 306 f.
5.2 Theologische „Zugriffe“
235
und in der modernen Lebenswelt“.³⁶⁹ Durch diese sowohl kulturtheoretische als auch (in der Reflexion auf die Genese der Bedingungen und Formen mitgegebene) historische Perspektivität kann Albrecht so Baumgarten als Beispiel für die Selbstkonstitution Praktischer Theologie setzen, die sich letztlich „als historische Kulturtheorie neuzeitlicher Christentumspraxis“³⁷⁰ vollzieht. Abschließend summiert Albrecht die Ergebnisse seiner exemplarischen materialen Untersuchungen zu einem kulturpraxisorientierten Begriff von (Praktischer) Theologie. In den ausgewählten Beispielen habe sich gezeigt, dass sich der Protestantismusbegriff in seiner Programmatik für eine solche wissenschaftstheoretische Rezeption innerhalb der Praktischen Theologie hervorragend eigne:³⁷¹ Das (in der Vorgehensweise Albrechts) seit Hegel rezipierte Charakteristikum des Protestantismus als Programmbegriff, sich in Selbstentäußerung in die Welt hinein zu bilden, sei die epistemische Grundlage für eine explizit gegenwartsanalytisch-kulturdiagnostische Praktische Theologie.³⁷² Dadurch sei ihr dann gleichzeitig eine grundlegend historische Perspektive inhärent: in der Reflexion auf die Geschichtlichkeit sowohl der gegenwärtigen Kultur und Gesellschaft als auch der praktisch-theologischen Problemstellungen an sich.³⁷³ „Mit der protestantismustheoretischen Begründung gewinne die Praktische Theologie eine Dimension, die sie als Reflexionstheorie der Kulturpraxis des Christentums bestimmt.“³⁷⁴ Praktische Theologie in solcher Protestantizität, als dementsprechend zweckgebundene, positive Wissenschaft, sei somit einerseits – soziokulturell-historisch wissenschaftstheoretisch – außerhalb ihrer selbst begründet.³⁷⁵ Und gleichzeitig komme ihr als Reflexionstheorie so eine grundlegende gesellschaftlich-aufklärerische Funktion zu – „durch Analyse- und Deskriptionsleistung geschichtlicher und gegenwärtiger […] christlicher Praxis.“³⁷⁶ Deswegen könne Praktische Theologie dann auch nicht auf rein kirchlich-konfessionelle Formen religiöser Praxis bezogen sein, sondern habe
369 Ebd., 312. 370 Ebd. Hervorhebung C. N. 371 Vgl. ebd., 313. 372 Vgl. ebd., 314. 373 Vgl. ebd., 315. 374 Ebd., 317. Hervorhebung C. N. 375 Vgl. ebd., 316. 376 Ebd., 318. Womit gleichzeitig auf der einen Seite ein gewisses Anforderungsprofil an praktische Theolog*innen mitgeliefert ist, nämlich der angemessenen Wahrnehmung und Einschätzung der Genese und Bedingungen kultureller Praxis. Vgl. ebd. Auf der anderen Seite wird dabei ebenso evident, dass Praktische Theologie dann auch aktive Teilnehmerin an der Kulturgeschichtsschreibung sei – im Wechselverhältnis zwischen protestantischer Selbstaufklärung und Aufklärung der Kultur insgesamt. Vgl. ebd., 320.
236
5 Wie fragt Theologie?
letztlich (christliche) Religion an sich ³⁷⁷ kulturtheoretisch im Blick;³⁷⁸ worin auch gleichzeitig ihre Theologizität begründet liege – und so Albrechts enzyklopädischer Theologiebegriff zum Ausdruck kommt:³⁷⁹ „Als Repräsentantin der Fragestellung nach der faktisch gelebten Religion [als ihrem innertheologischen Differenzkriterium, C. N.]³⁸⁰ hat die protestantismustheoretisch begründete Praktische Theologie es mit Grundfragen und Grundbegriffen zu tun, die für die theologische Arbeit in allen Disziplinen leitende Bedeutung haben. In dieser Hinsicht ist die Praktische Theologie […] ein Element und Aspekt aller theologischen Fächer. […] Denn die Theologie ist als ganze praktisch, so wie sie auch als ganze historisch verfährt und systematisch.“³⁸¹ Die Ausdifferenzierung in verschiedene theologische Subdisziplinen kennzeichnet Albrecht abschließend noch einmal als funktionale Arbeitsteilung, die gleichzeitig „das Prinzip des Zusammenhangs der theologischen Disziplinen untereinander“³⁸² darstelle. Theologie insgesamt sei eine positive und zweckbestimmte Wissenschaft, die sich dann – aufgrund der praktischen, historischen und systematischen Dimensionen – durch inhärente Dynamizität und Interdisziplinarität kennzeichnet.³⁸³ Praktische Theologie trage durch ihre spezifische Frage nach der Faktizität der gelebten Religion und der damit einhergehenden selbstaufklärerischen Wechselwirkung auf Theologie selbst gleichsam einen kulturwissenschaftlichen Blick in den theologischen Diskurs hinein.³⁸⁴ 5.2.1.1 Zwischenbilanz An dieser Stelle soll – analog zu den jeweiligen Ausführungen im Kapitel 4 zur Religionswissenschaft – eine Zwischenbilanz unter dem Fokus des wissenschaftstheoretischen 3. Kapitels dieser Arbeit vollzogen werden, indem der Ansatz Albrechts nun auf seine Fragestellung als Differenzkriterium der Theologie insgesamt hin systematisiert wird. Deutlich wurde in der Analyse der Albrechtschen Monografie grundlegend ihre – das Erkenntnisinteresse offen prägende – fachgeschichtliche Positionalität: Al-
377 „Indem der Protestantismus an diesen Begriff der gelebten Religion anknüpft, folgt er also einer Vorstellung der Religion, in der diese nicht nur als individuelle Funktion, sondern zugleich auch als eine kulturelle und gesellschaftliche Funktion in den Blick gerät.“ Ebd., 319. 378 Vgl. ebd., 318. 379 Vgl. ebd., 319 f. 380 Vgl. ebd.,321. 381 Ebd., 324. Hervorhebungen C. N. 382 Ebd. 383 Vgl. ebd., 325 f. 384 Vgl. ebd., 319.
5.2 Theologische „Zugriffe“
237
brechts Forschungsinteressen, die im großen Feld zwischen neuerer Theologiegeschichte und (praktisch‐) theologischer Prinzipientheorie spielen, haben nicht nur die materiale Auswahl, sondern die Forschungsfrage an sich deutlich geformt. In der historischen Rekonstruktion durch akribische Quellenarbeit– unter der Maßgabe der kritischen Reflexion der eigenen mitlaufenden Hermeneutik – schafft Albrecht es auf beeindruckende Art und Weise, das gegenseitige Wechselverhältnis zwischen historischer Empirie und prinzipientheologischer Theorie für seine Forschungsfrage fruchtbar zu machen. Durch den heuristischen Programmbegriff des Protestantismus, dessen traditionsgeschichtliche Genese und Wirkung Albrecht an den profilierten Repräsentanten exemplarisch ausarbeitet, können anhand seiner Verfahrensweise Aspekte eines historisch-begrifflich fokussierten Zugriffs auf Theologie herausgearbeitet werden. In Anwendung des heuristischen Deutebegriffs des Protestantismus extrahiert Albrecht zwei grundlegende Dimensionen von Theologie: ihre nach innen gerichtete Anlage zur prinzipientheoretischen Selbstreflexion und die dazu im Wechselverhältnis stehende grundlegende gegenwartsanalytisch-kulturdiagnostische Stoßrichtung. Durch diese beiden grundlegenden Dimensionen kommt der allgemeintheologische Bezugsrahmen der positiven Religion in Geschichte und Gegenwart deutlich hervor. Albrechts Theologiebegriff kennzeichnet sich so durch eine äußerst differenzierte enzyklopädische Zuordnung, die die Spezifität der einzelnen Subdisziplinen nicht an ihrer Fokussierung (historisch/systematisch/praktisch) festmacht, sondern Theologie im Grunde als einen multidimensionalen Diskurs zwischen diesen Momenten aufzeigt, in dem die einzelnen Subdisziplinen Ankerpunkte von durch spezifische Fragestellungen signifizierten Spektren darstellen. Alle wissenschaftstheoretischen Aussagen, die Albrecht über Praktische Theologie tätigt, lassen sich dann also in der metatheoretischen Reflexion resümierend auf evangelische Theologie insgesamt beziehen, als da maßgeblich wären die Protestantizität, der damit einhergehende Kontext der faktisch gelebten Religion und der darin mitgegebene kulturwissenschaftliche Fokus. Zusammenfassend lässt sich daraus folgende Fragestellung von Theologie konstruieren: Evangelische Theologie unter historisch-begrifflich fokussiertem Zugriff fragt nach der Genese, den Bedingungen und der Konstitution der faktisch gelebten Religion protestantischen Christentums in Geschichte und Gegenwart im praktischen und theoretischen Wechselverhältnis zu ihrem soziokulturellen Kontext.
238
5 Wie fragt Theologie?
5.2.2 Empirisch-sozialtheoretisch Zur Konstruktion von Aspekten eines empirisch-sozialtheoretischen Zugriffs wird im Folgenden Gerd Theißens bekannte Monografie Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie des Urchristentums von 2000, zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit in der 4. Auflage erhältlich, herangezogen. Theißen, Jahrgang 1943, war Professor für Neues Testament in Kopenhagen und in Heidelberg. Seine Forschungsinteressen konzentrieren sich vor allem auf die Sozialgeschichte und Religionstheorie des Urchristentums, die Theologie des Neuen Testaments und die Frage nach dem historischen Jesus.³⁸⁵ Sein internationales Renommee kommt unter anderem auch durch seine Lecture-Tätigkeiten und seine zahlreichen Ehrendoktorwürden zum Ausdruck.³⁸⁶ Die hier zu analysierende Monografie, die auf Grundlage seiner zuerst englischsprachig veröffentlichten Speakerʼs Lectures an der Universität Oxford entstanden ist,³⁸⁷ kann mittlerweile als ein Standardwerk theologischer Wissenschaft gelten – und war gleichzeitig in ihrer Herangehensweise für ein neutestamentlichwissenschaftliches Unterfangen von Anfang an nicht unumstritten.³⁸⁸ Besonderes Augenmerk im Kontext der hier zu vollziehenden Untersuchung wird auf den auch semiotischen und religionspsychologischen, hier aber vor allem fokussiert als empirisch-sozialtheoretisch ³⁸⁹ (re‐) konstruierten Ansatz gelegt, mithilfe dessen er seine Theorie des Urchristentums entwickelt. Vorgeschoben sei an dieser Stelle eine kurze Reflexion auf die – für diese Arbeit argumentativ zentrale – wissenschaftstheoretisch-disziplinäre Selbstpositionierung Theißens im Rahmen seiner methodologischen Grundlegung im ersten Teil seines 385 Vgl. die Website von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Gerd Theißen den der Universität Heidelberg, https:// www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/theologie/personen/theissen.html – 29.01.21. 386 Vgl. die Website von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Gerd Theißen den der Universität Heidelberg. Biographische Daten, https://www.uni-heidelberg.de/md/theo/personen/biographische_daten_2019_ a.pdf – 29.01.21. 387 Vgl. Theißen, Gerd, Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie des Urchristentums, Güterslsoh 42008, 14. 388 Vgl. Luz, Ulrich, Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie des Urchristentums, in: ThLZ 4/ 126 (2001), 409 – 413; gegen Reiser, Marius, Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie des Urchristentums, in: TThZ 111 (2002), 77– 78. Augenfällig ist, dass in beiden Rezensionen zur Sprache kommt, dass Theißen im Grunde Wredes Programm vermeintlich geradezu beerbe (vgl. dazu selbst Theißen, Die Religion, 17 f.) – und damit exemplarisch sei für die Debatte rund um die Frage nach einer programmatischen Ergänzung bis Ablösung einer klassischen Theologie des Neuen Testaments durch eine Religionsgeschichte des Urchristentums. Es wird im folgenden Fließtext kurz dargelegt, dass Theißen selbst seinen Zugriff explizit nicht als theologisch, sondern als religionswissenschaftlich bezeichnet. Vgl. ebd., 13. 389 Vgl. Luz, Die Religion, 410.
5.2 Theologische „Zugriffe“
239
Buchs: Direkt zu Beginn seiner Monografie ordnet er sein eigenes Vorhaben als nicht theologisch, sondern religionswissenschaftlich ein – wodurch nicht nur sein sehr spezifischer Religionswissenschafts-, sondern natürlich auch gleichsam sein Theologiebegriff hervortritt. Ziel seines Werkes sei nämlich, „was die Menschen im Urchristentum in ihrem Innersten bewegt“³⁹⁰ in einer Außenperspektive ³⁹¹ auf die Religion des Urchristentums für alle Leser*innen – also „unabhängig von ihrer religiösen oder nicht-religiösen Einstellung“³⁹² – verständlich darzulegen. Eine solche, die eigene Positionalität seiner forschenden Person als explizit christlicher Theologe zwar reflektierende und transparent machende, aber eben davon abstrahierende Vorgehensweise kennzeichnet Theißen nicht nur als grundsätzlich wissenschaftlich, sondern – in diesem Kontext beinahe synonym – eben als „religionswissenschaftlich“.³⁹³ Theologie hingegen sei „an lebendige religiöse Erfahrung gebunden“³⁹⁴ und verschließe sich – so ließe sich Theißens Positionierung zumindest interpretieren – somit wohl auf gewisse Weise dem interweltanschaulichen Dialog, wenn sie nicht um religionswissenschaftliche Herangehensweisen erweitert werde. Zwar könne man „[b]ekanntlich […] von ‚Theologieʻ in einem deskriptiven und einem konfessorischen Sinne reden.“³⁹⁵ Doch sei eine nach dieser Dichotomie eingeteilte konfessorische Theologie des Neuen Testaments zu positionell; eine deskriptiv verfahrende Theologie des Neuen Testaments, verstanden als „Analyse aller Aussagen im NT […], die von Gott sprechen oder von Welt und Mensch in ihrer Beziehung zu Gott, ohne dass für solche Aussagen ein normativer Anspruch erhoben wird“,³⁹⁶ sei hingegen nicht ausreichend, um „den urchristlichen Glauben in seiner das ganze Leben bestimmenden Dynamik“³⁹⁷ zu erfassen und für Nicht-Christ*innen wissenschaftlich einsichtig zu machen. Dieses aber habe sich Theißen zum Ziel gesetzt, indem er unter Anwendung „allgemeine[r] religionswissenschaftliche[r] Kategorien“³⁹⁸ eine erste „Skizze einer allgemeinen Religionstheorie“³⁹⁹ des Urchristentums entwickele. Für seinen Religionswissenschaftsbegriff bedeutet das
390 Theißen, Die Religion, 13. 391 So nach der im dritten Kapitel dieser Arbeit vorgelegten Logik der drei klassischen Arten wissenschaftstheoretisch-disziplinärer Differenzkriterien. 392 Ebd. 393 Ebd. 394 Ebd., 410. Hervorhebungen C. N. 395 Ebd., 17. 396 Ebd. Hervorhebung C. N. 397 Ebd. 398 Ebd. 399 Ebd., 36.
240
5 Wie fragt Theologie?
dann, dass er sich eben vor allem durch eine (vermeintliche) Außenperspektive auf die urchristliche Religion ⁴⁰⁰ kennzeichne.⁴⁰¹ Da die vorliegende Arbeit, wie im dritten Kapitel ausführlich dargelegt wurde, die wissenschaftstheoretische Stringenz des Differenzkriteriums der Perspektive anzweifelt, wird von dieser Selbstpositionierung in der folgenden Analyse nunmehr abgesehen und das Werk Theißens vielmehr eben dafür herangezogen, einen hier zwar religionsgeschichtlich verortbaren, aber methodisch vor allem empirisch-sozialtheoretischen Zugriff innerhalb der Theologie zu konstruieren – womit Theißen „in konsequenter Fortführung der Frage nach dem Sitz im Leben“⁴⁰² ja schließlich auch theologische Schule gemacht hat.⁴⁰³
400 Wobei fraglich ist, ob diese tatsächlich gewahrt bleibt, wenn Theißen seine eigene Haltung gegenüber dem „semiotischen Dom“ des Urchristentums, wie er diese Religion bezeichnet, verehrend zum Ausdruck bringt bzw. was dann mit Außenperspektive epistemisch effektiv noch gemeint sein kann: „Der säkularisierte Besucher [dieses] Doms kann und darf ihn im Bewusstsein besichtigen, dass hier eine in Stein gegossene Gestalt menschlicher Selbsttranszendierung vorliegt […]. Aber ein solcher säkularisierter Besucher wäre in seiner menschlichen Sensibilität verkümmert, wenn er den Dom nicht auch als ein gewaltiges Zeugnis menschlichen Lebens achten könnte, das eine Sehnsucht nach mehr als Dahinleben enthält. Andere Besucher werden den Dom aufsuchen, um ihre Gedanken durch die steingewordene Dynamik des Gebäudes auf seine letzte Wirklichkeit lenken zu lassen. […] Was spricht nun dagegen, dass beide Besucher […] in ein vernünftiges Gespräch über den Dom eintreten? Die hier vorgelegten Skizzen zu einer Theorie der urchristlichen Religion wollen ein solches Gespräch ermöglichen […]. Für manche ist das ein Stück Denkmalpflege […]. Ich sollte hinzufügen, dass für mich die Beschäftigung mit der urchristlichen Religion mehr als solche Denkmalpflege ist.“ Ebd., 44. Hervorhebungen C. N. 401 An dieser Stelle wird die schwache Stringenz des Differenzkriteriums der Perspektive – gerade im Kontext historisch-kritischer Forschung – wieder einmal evident: Rein denklogisch wäre an dieser Stelle nämlich zurückzufragen, inwiefern eine heute forschende Person eine epistemische Innenperspektive zu einer Religion von vor ca. 2000 Jahren einnehmen kann – ohne dabei allein schon zentrale Grundsätze historisch-kritischer Forschung zu verletzen. Das bedeutet natürlich nicht, dass die forschende Person sich als religiöses Individuum nicht in der geschichtlichen Tradition ihrer Religion verstehen kann. Doch davon auszugehen, dass man deswegen eine Innenperspektive auf diese Religion vor mehreren Jahrtausenden habe, ist wissenschaftlich-erkenntnistheoretisch nur schwer vorstellbar. In der Monografie Theißens scheint sich diese Problematik zumindest in Teilen vielleicht epistemisch niederzuschlagen – trotz aller positionellen Transparenz und Abstraktion. Solches zeigt sich m. E. in Theißens Tendenz zum Aufzeigen großer bzw. weiträumiger religionsgeschichtlicher Entwicklungslinien – oder auch einfach in nebensätzlichen Formulierungen: So zeige sich laut Theißen z. B. „dieselbe numinose Erfahrung“ (ebd., 114, Hervorhebung C. N.) mit Status bzw. Statusverzicht zwischen Gottheit und Mensch in Orient und Okzident. 402 Gemünden, Petra von/Horrell, David G./Küchler, Max, Vorwort, in: Dies. (Hg.), Jesus – Gestalt und Gestaltungen. Rezeptionen des Galiläers in Wissenschaft, Kirche und Gesellschaft. Festschrift für Gerd Theißen zum 70. Geburtstag (NTOA/StUNT 100), Göttingen 2013, 5 – 9, 5.
5.2 Theologische „Zugriffe“
241
Theißens Ansatz kennzeichnet sich grundsätzlich zunächst durch die bereits angesprochene Verknüpfung „semiotische[r], sozialgeschichtliche[r] und psychologische[r] Fragestellungen“,⁴⁰⁴ die in seiner methodologischen Grundlegung durch die Setzung seines Religionsbegriffs schon deutlich hervortreten. Er zeichnet (im Bewusstsein der Partikularität und Vorläufigkeit aller religionstheoretischen Definitionsversuche) Religion hier – unter Rückgriff auf Geertz – als ein kulturelles Zeichensystem, das substantiell durch seinen Bezug auf eine „letzte Wirklichkeit“⁴⁰⁵ funktional „Lebensgewinn“⁴⁰⁶ verheiße, den eine (nach seiner Setzung) religionswissenschaftlich fokussierte Analyse vor allem in Hinblick auf psychisch-individuelle und soziale Aspekte untersuche.⁴⁰⁷ Daraus ergeben sich zentrale hermeneutische Ankerpunkte seiner Theorie der urchristlichen Religion: Denn als ein „semiotisches Phänomen“⁴⁰⁸ diene sie der lebenswirksamen⁴⁰⁹ „Interpretation der Welt“⁴¹⁰ in Mythos, Ritus und Ethos als ihren Ausdrucksformen.⁴¹¹ Zum Verständnis von Religion gehöre also dann, die Systemizität dieses Phänomens zu untersuchen und gleichsam auf ihre semiotische „Grammatik“⁴¹² hin zu befragen. Und als „kul-
403 Damit entspricht die Rezeption Theißens in diesem Kapitel auch dem im Vorherigen vorgestellten Grundgedanken, dass Theologie ein Diskurs ist – und dass eine Zuschreibung als theologisch dann eben nicht primär aufgrund einer einmal getätigten statischen Selbstpositionierung, sondern aufgrund der Teilhabe am Diskurs stattfindet. 404 Luz, Die Religion, 409. 405 Theißen, Die Religion, 19. Theißen betont an dieser Stelle, dass mit dem Bezug auf letzte Wirklichkeiten keine normative Setzung dieser Wirklichkeiten als gegeben einhergehen solle, sondern dass dieser substantielle Gehalt vielmehr dem Selbstverständnis der Religionen entspreche. Vgl. ebd., 20. 406 Ebd., 19. 407 Vgl. ebd., 29 f. So bestehe der „psychische Lebensgewinn“ (ebd., 29) einer Religion in ihren vor allem sinnstiftenden kognitiven, emotionalen und pragmatischen Wirkungen auf das religiöse Individuum. Der „soziale Lebensgewinn“ (ebd.) bestehe vor allem in einer einerseits das Individuum sozialisierenden und andererseits die soziale Gruppe nach innen stabilisierenden, und nach außen konfliktregulierenden Funktion. Vgl. ebd., 31 f. 408 Ebd., 20. 409 Mythos, Ritus und Ethos seien insofern lebenswirksam, als dass sie durch die Setzung bzw. Aktualisierung bestimmter „Rollen, Symbole und Normen“ (ebd., 33) „Denken, Fühlen und Handeln bestimmen und Menschen zu sozialer Kooperation und Konflikt befähigen“ (ebd.) können. 410 Ebd., 20. 411 Diese drei Formen stehen schon allein aufgrund ihrer semiotischen Funktion in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander: Religion habe in Mythos, Ethos und Ritus somit „eine narrative Zeichensprache bestehend aus Mythos und Geschichte, eine präskriptive Zeichensprache bestehend aus Imperativen und wertenden Sätzen und eine rituelle Zeichensprache bestehend vor allem aus den urchristlichen Sakramenten Taufe und Abendmahl.“ Ebd., 171. 412 Ebd., 25.
242
5 Wie fragt Theologie?
turelles Phänomen“⁴¹³ könne sie nur verstanden werden als soziales Handeln von Menschen in historischen soziokulturellen Kontexten. Hintergrund einer solchen Definition von Religion als kulturellem Zeichensystem sei damit grundlegend die „Überzeugung, dass eine geschichtlich vorgegebene Zeichensprache die Bedingung der Möglichkeit religiöser Erfahrungen und Lebensfunktionen ist.“⁴¹⁴ Für eine Theorie des Urchristentums bedeute dies, dass die Beschreibung des urchristlichen „Propriums“⁴¹⁵ als ein solches Zeichensystem also kontextualisiert vollzogen werden muss, am besten durch Kontrastierung zur „jüdischen Mutterreligion“.⁴¹⁶ Das Besondere des urchristlichen Mythos liege nun laut Theißen in einer wechselseitigen Intensivierung von Mythos und Historizität, indem die Figur Jesus Christus neues heilsgeschichtliches Zentrum wird.⁴¹⁷ Der urchristliche Ethos kennzeichne sich vor allem durch eine gleichzeitige Radikalisierung und Relativierung bestehender ethischer Normen.⁴¹⁸ Und das Spezifische des urchristlichen Ritus liege darin, dass zwar neue Riten geschaffen werden, darin aber schon im soziokulturellhistorischen Kontext angelegte Tendenzen weitergeführt werden.⁴¹⁹ Anhand dieser methodischen Grundlegung arbeitet Theißen in den folgenden Teilen seine Theorie des Urchristentums aus, indem er zunächst die drei Grundmotive von Mythos, Ethos und Ritus im Urchristentum detailliert analysiert. Um hier Aspekte eines sozialtheoretischen Zugriffs zu extrahieren, kann dabei an dieser Stelle wiederholend betont werden, dass in Bezug auf den urchristlichen Mythos ⁴²⁰ der historisch-soziokulturelle Kontext für ein fundiertes Verständnis als entscheidend gezeichnet wird: In der Figur des historischen Jesus zeige sich im Motiv der Gottesherrschaft eine „Revitalisierung der Zeichensprache der jüdischen Religion“⁴²¹ und ihres Grundaxioms des Monotheismus. Sozialtheoretisch relevant ist das außerdem insofern, als dass in dieser motivischen Transformation die „gegenwärtig Lebenden an der hereinbrechenden Gottesherrschaft“⁴²² beteiligt seien. Dieses präsentische Verständnis sei laut Theißen kombiniert mit einer deutlichen Verschiebung seiner politischen Implikation, als dass nämlich das sogenannte Hei-
413 Ebd., 27. 414 Ebd., 33. 415 Ebd., 37. 416 Ebd. 417 Vgl. ebd., 39 f. 418 Vgl. ebd., 40 f. 419 Vgl. ebd., 41 f. 420 „Mythen sind Erklärungen aus einer für die Welt entscheidenden Zeit mit übernatürlichen Handlungsträgern, die einen instabilen [psychologisch-individuellen und/oder sozialen, C. N.] Zustand in einen stabilen überführen.“ Ebd., 49. 421 Ebd. Hervorhebung C. N. 422 Ebd, 51.
5.2 Theologische „Zugriffe“
243
dentum in diesen Gottesherrschaftsbegriff inkludiert wird.⁴²³ Die Ablösung vom jüdischen Zeichensystem als eigenständige religiöse Bewegung sei erst in der Reaktion auf Ostern geschehen, indem sich das Zeichensystem von seiner ursprünglichen Theozentrik hin zu einer Jesuzentrik transformierte.⁴²⁴ Ausgang nehmend von den religiösen Erfahrungen der urchristlichen Gemeinschaft begründet Theißen diese Transformation des Zeichensystems mit der Notwendigkeit der religiösen psychischen und sozialen Dissonanzbewältigung, die im Tode Jesu in Kontrast zur Naherwartung empfunden wurde und die sich in der nachösterlichen Vergöttlichung Jesu vollzogen habe. Die Möglichkeit dazu sei wiederum im (historisch-soziokulturellen Kontext des) Zeichensystems selbst angelegt, das überhaupt erst offen für so einen Transformationsprozess sein müsse,⁴²⁵ wodurch die Bedeutsamkeit des (makro‐) sozialen Kontextes deutlich wird: Denn nicht die religiösen Erfahrungen bedingen das Zeichensystem, sondern „[d]as Zeichensystem geht den persönlichen Erfahrungen voraus.“⁴²⁶ Diese sozialtheoretische Dimension der religiösen Semiotik wird bei Theißen auch exemplarisch in der Analyse der Auseinandersetzung des urchristlichen Zeichensystems mit dem Kaiserkult deutlich, im Zuge derer ebenfalls göttliche Prädikate auf die Figur Jesus Christus übertragen wurden.⁴²⁷ Denn trotz bzw. gerade aufgrund aller sozialstrukturellen Parallelen, die sich daraus ergeben,⁴²⁸ habe sich im Zuge dieses sozialpolitisch wirksamen religiösen „Überbietungssynkretismus“⁴²⁹ der„soziale Sitz im Leben“⁴³⁰ verschoben – weg von der politischen Oberschicht hin zu den sozialen Underdogs. Gerade anhand seiner Untersuchungen des urchristlichen Ethos werden Aspekte eines sozialtheoretisch fokussierten Zugriffs evident, was zunächst ganz basal ableitbar ist aus der Wechselseitigkeit, in der er Mythos und Ethos zueinander zeichnet.⁴³¹ Somit steht auch das Ethos in einem unmittelbaren historisch-soziokulturellen Kontext. In den zwei Grundwerten des Urchristentums, die Theißen ausmacht, der Liebe und des Demuts bzw. des Statusverzichts, vollziehe sich die
423 Vgl. ebd., 53. 424 Vgl. ebd., 71 ff. 425 Vgl. ebd., 73. 426 Ebd., 80. 427 Vgl. ebd., 85 ff. 428 Als da wären „Formen überregionaler Solidarität, eine Verheißung von Veränderung des Lebens, schichtübergreifenden Zusammenhalt, eine gewisse Privilegierung gegenüber allen anderen“. Ebd., 90. 429 Ebd., 84. 430 Ebd., 90. 431 „Die narrative Zeichensprache des Mythos findet ihre Entsprechung in der pragmatischen Zeichensprache des Ethos.“ Ebd., 120. Vgl. dazu auch ebd., 101.166 f.
244
5 Wie fragt Theologie?
oben bereits angesprochene gleichzeitige Radikalisierung und Relativierung bestehender Normen.⁴³² Denn diese ethischen Grundwerte des urchristlichen Zeichensystems, die weitere Werte und Normen prägen, setzen bestimmte sozusagen inner- und außersystemisch wirksame soziale Dynamiken bzw. Grenzüberschreitungen frei.⁴³³ In ihrem Grundmotiv, dass der „Wert der Menschen unabhängig von Status und Gruppenzugehörigkeit“⁴³⁴ sei, werde deutlich, dass der „Sitz im Leben eines solchen Ethos“⁴³⁵ heterogene Gruppen waren, die eine „eigene Größe neben Oikos und Polis“⁴³⁶ darstellten und somit also die ethische Priorität der urchristlichen Gemeinde gegenüber den klassischen sozialen Institutionen Familie und Staat hervorhoben,⁴³⁷ wodurch grundlegend soziale Status relativiert bzw. transformiert wurden. Das urchristliche Ethos radikalisierte also auf der einen Seite spezifische ethische Forderungen der (Nächsten‐) Liebe und Demut gegenüber Anderen, und relativierte diese gleichsam in ihrer ethisch-moralischen Implikation durch eine Radikalisierung des Gedankens der Gnade, wodurch sich die Integrationskraft der urchristlichen Gemeinschaft verstärkt habe.⁴³⁸ Die Wechselwirksamkeit von Ethos und Sozialgefüge habe somit eine grundlegende inhärente Dynamizität – denn mit dem radikalisiertem Ethos transformiere sich die Gemeinschaft und vice versa. Solches komme in zentralen Demokratisierungstendenzen zum Ausdruck, wie bspw. der Ausweitung von Weisheit und Heiligkeit auf Lai*innen, wodurch klassische Hierarchisierungen, Machtsicherungsstrategien und Nationalisierungen überschritten bzw. aufgehoben wurden.⁴³⁹ Auch an Theißens Analyse des urchristlichen Ritus,⁴⁴⁰ also der Sakramente Abendmahl und Taufe, verdeutlicht sich noch einmal sein sozialtheoretischer Zugriff auf Religion. So bestehe ihre soziale Funktion grundlegend darin, Aggressionen insofern abzuwehren, als dass – angesichts der Unsicherheiten der Welt – im Ritus in geordneter Form das empfundene Chaos abgewehrt werde, indem es durch das strenge Regelwerk des Ritus zeitlich und räumlich begrenzt zugelassen werde.⁴⁴¹ Durch diesen kontrollierten Tabubruch diene der Ritus der „Strukturierung der Zeit
432 Vgl. ebd., 102 ff. So z. B. klassisch in der Ausweitung der Nächsten- auf die Feindesliebe.Vgl. ebd., 105 f. 433 Vgl. ebd., 123 f. 434 Ebd., 164. 435 Ebd. 436 Ebd. 437 Vgl. ebd., 165. 438 Vgl. ebd., 166. 439 Vgl. ebd., 152 f.160 ff. 440 Theißen betont dabei die Bedeutung religiöser Riten für das Verständnis des Urchristentums. „In den Riten verdichtet sich das Zeichensystem einer Religion.“ Ebd., 171. 441 Vgl. ebd., 172 f.
5.2 Theologische „Zugriffe“
245
und [der] Koordinierung von Menschen.“⁴⁴² Dass Taufe und Abendmahl zu Sakramenten wurden und sie als Riten des Urchristentums auf solche Art der Überwindung von Chaos und moralischen und sozialen Tabus dienen, sei Ergebnis einer Entwicklung;⁴⁴³ und geschah erst durch den sekundären Bezug prophetischer Symbolhandlungen, die Johannes dem Täufer und Jesus zugeschrieben wurden, auf den Kreuzestod Jesu,⁴⁴⁴ der „in seiner Deutung als Opfertod zur Beendigung der [traditionell-rituellen] Opferpraxis beitrug.“⁴⁴⁵ Die Taufe überwinde soziale Tabus dadurch, dass in der mit ihr verbundenen Todes- und Begräbnissymbolik, die im zeitgenössischen Judentum eher mit Unreinheit und somit sozialer Distanzierung assoziiert ist, eben genau jene Unreinheit zugelassen, durchlebt und überwunden werde und so traditionelle soziale Grenzen irrelevant werden. Durch die Taufe werde die Zugangsberechtigung zu einer neuen Gemeinschaft, die sich dann im Abendmahl vollzieht, erteilt.⁴⁴⁶ Auch und gerade der Tabubruch im Abendmahl, der Verzehr von Jesu Fleisch und Blut, habe – neben der offensichtlichen Mahlsgemeinschaft – eine deutlich soziale Funktion: „Die in der Imagination zugelassene Barbarei im Ritus ist ein Beitrag dazu, im Alltag die Barbarei zu überwinden“.⁴⁴⁷ Beide Sakramente haben also eine gesellschaftlich integrative bzw. konsolidierende Wirkung für das Zeichensystem der urchristlichen Religion, da sie „uneingestanden das verborgene antisoziale Wesen des Menschen aus[sprechen]. Aber sie tun es, um dies antisoziale Wesen des Menschen in Motivation zu prosozialem Verhalten zu verwandeln.“⁴⁴⁸ Im Anschluss an die Grundlegung der drei Ausdrucksformen Mythos, Ethos und Ritus unternimmt Theißen im vierten Teil seines Buches den Versuch, in der historischen Analyse dieser drei Ausdrucksformen eine kurze Skizze der geschichtlichen Entwicklung⁴⁴⁹ des Urchristentums aus dem Judentum heraus hin zu einem eigenständigen Zeichensystem zu liefern. Theißen zeichnet hier zwei Etappen nach: So ordnet er die erste Generation des Urchristentums noch als ein Schisma innerhalb des Judentums ein, das durch die Transformation und Relativierung der mythischen, ethischen und rituellen Zeichensprache des Judentums entstand;⁴⁵⁰ erst
442 Ebd., 173. 443 Vgl. ebd., 195. 444 Vgl. ebd., 178 f. 445 Ebd., 178. Das sei nur möglich gewesen, weil in den neuen urchristlichen Riten traditionelle Opferriten funktional äquivalent ersetzt wurden. Vgl. ebd., 217 ff. 446 Vgl. ebd., 188 f. 447 Ebd., 187. 448 Ebd., 190. Hervorhebung C. N. 449 Vgl. ebd., 222. 450 Vgl. ebd., 227– 233.
246
5 Wie fragt Theologie?
mit der zweiten Generation und der Evangelienschreibung habe sich die völlige Ablösung von der Mutterreligion vollzogen. In den Synoptikern, die „von vornherein mit kanonischem Anspruch [als „autoritative Grundlage einer religiösen Gemeinschaft“⁴⁵¹] geschrieben„⁴⁵² wurden, habe sich diese Abgrenzung religionstheoretisch in Analogie zu den drei Ausdrucksformen gestaltet: Im Markusevangelium durch die Einsetzung von Taufe und Abendmahl als rituelle Abgrenzung vom Judentum,⁴⁵³ im Matthäusevangelium durch die ethische Transformation in der Bergpredigt⁴⁵⁴ und im Lukasevangelium durch die „narrativ-historische Abgrenzung zum Judentum“⁴⁵⁵ vor allem in der Weihnachtsgeschichte. „Höhepunkt“⁴⁵⁶ dieser Entwicklung hin zur Autonomie des urchristlichen Zeichensystems komme laut Theißen in der christozentrisch gestalteten theologischen Selbstreflexion im Johannesevangelium zum Ausdruck: „Im JohEv erscheint die neue religiöse Zeichensprache [die in den Synoptikern entwickelt wurde, C. N.] als ein sich selbst [christozentrisch] organisierendes Zeichensystem.“⁴⁵⁷ Dadurch vollziehe sich hier auf Ebene von Mythos, Ritus und Ethos eine Konsolidierung des Urchristentums durch die Abgrenzung nach außen und die Integration nach innen.⁴⁵⁸ Im abschließenden fünften Teil seiner Monografie reflektiert Theißen auf die religionsgeschichtlichen Krisen dieser Autonomie des urchristlichen Zeichensystems und analysiert daran die Bedingungen und Möglichkeiten seiner historischen Persistenz. Als Krise setzt er „den Zustand einer Gesellschaft oder einer Gemeinschaft, die unter Zeitdruck [mit] schwierige[n] Probleme[n] der Anpassung an eine neue Situation, der Koordination zwischen ihren verschiedenen Gruppen und ggf. der Strukturveränderung und Systemerhaltung“ konfrontiert ist.⁴⁵⁹ In Bezug auf die Geschichte der urchristlichen Religion macht er – in (heuristisch-normativer?) Analogie zu den drei Ausdrucksformen von Religion – drei Krisen aus, in denen sich die Autonomie und Beständigkeit des religiösen Systems immer wieder beweisen musste. In der von ihm so genannten judaistischen Krise musste das junge Urchristentum seine auf Dauer gestellte Unabhängigkeit vom Judentum aufzeigen, was
451 452 453 454 455 456 457 458 459
Ebd., 233. Ebd. Vgl. ebd., 240 f. Vgl. ebd., 244 f. Ebd., 247. Ebd., 280. Ebd., 257. Vgl. ebd., 273 ff. Ebd, 284.
5.2 Theologische „Zugriffe“
247
vor allem im Ritus geschah.⁴⁶⁰ Mit der gnostischen Krise wurde die Frage nach der Einzigartigkeit gegenüber anderen religiösen und philosophischen Strömungen gestellt.⁴⁶¹ Das Urchristentums zeigte sich hier durch seine einzigartige Verbindung von Geschichte und Mythos als anknüpfungsfähiger an bestehende Zeichensysteme und dadurch dann im Effekt persistenter.⁴⁶² Die Bewältigung des immer wieder auftretenden Phänomens der prophetischen Krisen, in denen die bleibende Relevanz bzw. Differenz des Urchristentums gegenüber seiner Umwelt unter Beweis gestellt werden musste,⁴⁶³ sei maßgeblich in der Ausdrucksform des radikalisierten Ethos vollzogen worden.⁴⁶⁴ Diese Fähigkeit des Urchristentums, auf Gefährdungen seiner Autonomie und Persistenz als religiöses Zeichensystem dynamisch zu reagieren, sieht Theißen vor allem in der Kanonbildung, die eine Reaktion auf den Streit um Marcion darstellte.⁴⁶⁵ Mit der Bildung des Kanons habe das Urchristentum es geschafft, der eigenen inneren soziokulturellen Pluralität nach innen und der sozialen Einheit nach außen einen zeichensprachlichen Rahmen zu geben, denn ein solcher „Kanon besteht [in religionstheoretischer Definition] aus den normativen Texten, die geeignet sind, das Zeichensystem einer Religion immer wieder neu zu rekonstruieren und durch Auslegung für eine Gemeinschaft bewohnbar zu machen.“⁴⁶⁶ Dadurch, dass der entstehende Kanon in der Auswahl seiner Bestandteile ein breites Spektrum urchristlicher Religiosität abbilde,⁴⁶⁷ hatte er laut Theißen das Potential, den zugehörigen urchristlichen Gruppierungen einen vor allem rituellen Rahmen zu geben,⁴⁶⁸ dessen innerer Zusammenhalt durch die Grammatik (rund um die Grundaxiome des Monotheismus und des Erlöserglaubens) der zugrundeliegenden religiösen Zeichensprache gewährleistet sei.⁴⁶⁹ 460 Vgl. ebd. Die Bewältigung dieser Krise macht Theißen vor allem an der Figur des Paulus fest, da gerade hier die Auseinandersetzung mit dem Zeichensystem der jüdischen Mutterreligion evident werde. „Zur judaistischen Krise gehört die paulinische Theologie.“ Ebd., 286. 461 Vgl. ebd., 285. 462 Interessant ist hier also mit Augenmerk auf Aspekte eines sozialtheoretischen Zugriffs, dass Theißen den Untergang der Gnosis, trotz ihrer auf Universalität abstellenden Zeichensprache und der wohl eigentlich günstigen politischen Situation, damit begründet, dass sie anders als das Urchristentum nicht genügend an bestehende Zeichensysteme anknüpfen konnte. Auch hier wird wieder die immense religionstheoretische Bedeutung des historisch-soziokulturellen Kontextes deutlich. Vgl. ebd., 323 ff. 463 Vgl. ebd., 285. 464 Vgl. ebd., 326 ff. 465 Der Elemente aller drei Krisen in sich vereint habe und dadurch „wohl die größte Herausforderung für die entstehende Kirche“ darstellte. Ebd., 337. 466 Ebd., 341 f. 467 Vgl. ebd., 356 – 368. 468 „[I]nsofern der die Bücher umfasst, die im Gottesdienst gelesen werden.“ Ebd., 367. 469 Vgl. ebd., 368 f.
248
5 Wie fragt Theologie?
In den Schlussbetrachtungen seines Buches reflektiert Theißen noch einmal auf die innere Plausibilität des urchristlichen Zeichensystems, die er nicht am Inhalt der religiösen Aussagen des Urchristentums, sondern an der Plausibilität eben dieses Zeichensystems, also an der Grammatik der Zeichensprache festmacht.⁴⁷⁰ Diese Grammatik bestätige sich dann, wenn mit ihrer Hilfe das religiöse Subjekt sein Verhältnis zur Welt, zu sich selbst und zu anderen Menschen weltordnend und sinnstiftend strukturieren kann.⁴⁷¹ Das religiöse Zeichensystem des Urchristentums habe aufgrund seiner spezifischen Axiomatik eine dem auf Transzendenz angelegten Wesen des Menschen entsprechende⁴⁷² „dynamische Weltsicht“⁴⁷³ ermöglicht und so seine sozial konstituierende und konsolidierende Kraft freigesetzt.⁴⁷⁴ 5.2.2.1 Zwischenbilanz Auch in Bezug auf einen empirisch-sozialtheoretischen Zugriff erfolgt an dieser Stelle eine Systematisierung der dafür anhand von Theißens Monografie konstruierten Aspekte auf eine wissenschaftstheoretische Fragestellung als Differenzkriterium der Theologie⁴⁷⁵ insgesamt hin. Das Ziel der Arbeit des Neutestamentlers Theißens ist in den oben getätigten Ausführungen deutlich hervorgetreten: Es gehe ihm um eine allgemein zugängliche religionstheoretische Darstellung des Urchristentums, die seiner inneren Dynamik und Pluralität gerecht wird.⁴⁷⁶ Als methodische Basis dienen klassische sozial- und 470 Vgl. ebd., 392. 471 Vgl. ebd., 393. 472 Vgl. ebd., 400 f. 473 Ebd., 395. 474 Vgl. ebd., 405 ff. 475 Das geschieht im expliziten Bewusstsein, dass dies nicht unbedingt dem Theologiebegriff Theißens entsprechen kann, da er, wie oben aufgeführt wurde, den Unterschied zwischen Religionswissenschaft und Theologie am Differenzkriterium der Perspektive festmacht. Allerdings zeichnet Theißen selbst die Außenperspektive auf Religion als zwingend für angemessenes theologisches Arbeiten. Vgl. ebd., 17 f. Theißens Monografie wird hier also dennoch als ein (polarisierendes) Standardwerk der Theologie analysiert, aus dem sich exemplarisch und paradigmatisch ein empirisch-sozialtheoretischer Zugriff auf Theologie herausarbeiten lässt. Es sei noch einmal daran erinnert, dass die hier vorliegende Arbeit mit voller Absicht gegen die klassischen Differenzkriterien (laut drittem Kapitel dieser Arbeit) agiert – und sich somit rein formallogisch nicht mit Theißens Ansatz überschneiden kann, der ein solches klassisches Differenzkriterium anwendet. Als Theologe, der ein maßgeblich im theologischen Diskurs rezipiertes Standardwerk geschrieben hat, steht Theißen mit seinem Zugriff dann in der Logik dieser Arbeit dennoch bzw. gerade für einen innerhalb von Theologie vollzogenen Zugriff. (Und gleichzeitig für ein Beispiel dafür, dass auf die drei klassischen Differenzkriterien sowohl innerhalb der Religionswissenschaft als auch innerhalb der Theologie rekurriert wird.) 476 Vgl. ebd., 18.
5.2 Theologische „Zugriffe“
249
kulturwissenschaftliche Analyseinstrumentarien (wie bspw. der Kulturbegriff des maßgeblich v. a. von Talcott Parsons und Weber herkommenden Geertz). Mit der Reflexion auf die Geschichte, Strukturen, Bedingungen und Möglichkeiten der urchristlichen Religion als eigenständigem kulturellem Zeichensystem geht die gleichzeitige Reflexion auf den historisch-soziokulturellen Kontext dieses Systems zwingend einher, denn „[d]ie Dynamik des urchristlichen Glaubens ist in der Dynamik des Lebens verwurzelt.“⁴⁷⁷ Die Lebenswirksamkeit von Religion in ihren mythischen, ethischen und rituellen Ausdrucksformen bestehe darin, dass sie religiöse Subjekte in spezifischen Kontexten dazu befähigt, ihre Welt sinnstiftend zu ordnen, so Orientierung zu konstruieren und handlungsfähig zu sein, wodurch sie Integration und Konsolidierung in sozialen Gruppen ermöglicht. So verstandene Religion wird also immer als soziales Handeln betrachtet. Fokussiert man nun einen solchen sozialtheoretischen Zugriff auf Religionstheorie⁴⁷⁸ hin zu einem Theologiebegriff, lässt sich daraus folgende Fragestellung der Theologie konstruieren: Theologie in einem empirisch-sozialtheoretischen Zugriff fragt unter Anwendung sozial- und kulturwissenschaftlicher Analyseinstrumentarien nach den Möglichkeiten, Bedingungen und Strukturen auf Mikro- und Makroebene der christlichen Religionspraxis als einem kulturellen System in spezifischen historisch-soziokulturellen Kontexten.
5.2.3 Hermeneutisch-religionsphilosophisch Zur Konstruktion eines hermeneutisch-religionsphilosophisch ausgerichteten Zugriffs innerhalb evangelischer Theologie soll im Folgenden Christoph Markschiesʼ Monografie Gottes Körper. Jüdische, christliche und pagane Gottesvorstellungen der Antike von 2016 der Analyse unter dem Differenzkriterium der Fragestellung unterzogen werden. Dass dieses Werk von Markschies (geboren 1962 in Berlin),⁴⁷⁹ der aufgrund seiner starken medialen Präsenz⁴⁸⁰ wahrscheinlich kaum der Kontex-
477 Ebd., 17. 478 Die in der hier vorgestellten Arbeit u. a. Thema der Systematischen und/oder Fundamentaltheologie ist. 479 Vgl. die Website von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Christoph Markschies an der Humboldt-Universität zu Berlin, https://www.antikes-christentum.de/markschies-kurzinfo – 29.01.21. 480 So ist Markschies u. a. als Kolumnist tätig und gilt als gefragter theologischer Fachexperte im Bereich von Print und Fernsehen. Vgl. z. B. die Website des Magazins Chrismon. Christoph Markschies, https://chrismon.evangelisch.de/personen/professor-dr-christoph-markschies-13215 – 29.01.21. Vgl. auch z. B. das YouTube-Video Prof. Dr. Christoph Markschies – „Gottes Körper“ – Campus Talks auf dem ARD Youtube Channel, https://www.youtube.com/watch?v=qN9wK5U75u8 – 29.01.21. Oder auch als Experte in der Dokumentation Die Strafsache Jesu – Der Faktencheck mit Petra Gerster
250
5 Wie fragt Theologie?
tualisierung bedarf, sich dafür hervorragend eignet, zeigt auch in Bezug auf seine Person bereits ein Blick auf seine Forschungsinteressen,⁴⁸¹ vor allem in Hinblick auf den „besondere[n] Schwerpunkt auf der Geistes- und Ideengeschichte“.⁴⁸² Mit Blick auf seine umfangreiche Publikationstätigkeit⁴⁸³ ist auch schnell evident, dass er zu den aktivsten und bekanntesten Kirchengeschichtler*innen der Gegenwart gehört. Aktuell ist er Inhaber der Professur für Antikes Christentum an der HumboldtUniversität zu Berlin, deren Präsident er von 2006 bis 2010 war.⁴⁸⁴ Seine Forschungsvita⁴⁸⁵ weist in ihren Stationen und verschiedenen Würdigungen auf sein internationales Renommee – innerhalb und außerhalb der akademischen Theologie – hin. In seiner, mittlerweile auch ins Englische übertragenen, hier zu untersuchenden „magistralen Studie“⁴⁸⁶ unternimmt Markschies den historiografischen Versuch, antike pagane, jüdische und christliche Vorstellungen von einer Körperlichkeit Gottes – unter Verwendung des Begriffs des Anthropomorphismus ⁴⁸⁷ – in der
(2014), vgl. die Website der International Movie Data Base. Strafsache Jesu. Full Cast & Crew, https:// www.imdb.com/title/tt4045914/fullcredits/?ref_=tt_ov_st_sm – 29.01.21. 481 Vgl. die Website von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Christoph Markschies an der Humboldt-Universität zu Berlin. Forschungsschwerpunkte, https://www.antikes-christentum.de/de/team/mitarbeitende/ markschies-kurzinfo/forschung – 29.01.21. 482 Website des Instituts Kirche und Judentum Berlin. Team, https://www.ikj-berlin.de/ikj/mitarbei tende.html – 29.01.21. Hervorhebung C. N. 483 Vgl. die Website von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Christoph Markschies an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bibliografie, https://www.antikes-christentum.de/de/team/mitarbeitende/markschies-kurz info/bibliographie – 29.01.21. 484 Vgl. die Nachricht auf der Website des Informationsdienstes Wissenschaft. Zappe, Heike, Christoph Markschies neuer Präsident der Humboldtuniversität, https://idw-online.de/en/ news134346 – 29.01.21. 485 Vgl. die Website von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Christoph Markschies an der Humboldt-Universität zu Berlin. Biographie, https://www.antikes-christentum.de/de/team/mitarbeitende/markschies-kurz info/biographie – 29.01.21. Besonders interessant ist – neben vielen sicherlich nennenswerten Stationen seiner Karriere – vielleicht die Tatsache, dass ihm als ersten Protestanten überhaupt katholische Ehrendoktorwürden „durch die päpstliche Lateran-Universität in Rom und das Forschungsinstitut Augustinianum“ verliehen wurden.Vgl. die Nachricht auf der Website der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Ehrendoktorwürde für Christoph Markschies und Franz-Kafka-Preis an Claudio Magris, http://www.adwmainz.de/nachrichten/artikel/ehrendoktorwu erde-fuer-christoph-markschies-und-franz-kafka-preis-an-claudio-magris.html – 29.01.21. 486 Walter, Uwe, Markschies, Christoph. Gottes Körper, in: FAZ (19.08. 2016), 10, ebd. 487 Markschies diagnostiziert Anthropomorphismus im Folgenden als einen – v. a.. im deutschen Idealismus etablierten – polemischen Begriff mit der Bedeutung „eine[r] unangemessenen ‚Vermenschlichung Gottesʻ, die eine wie auch immer zu beschreibende Unterscheidung zwischen Gott und Mensch schwierig oder gar unmöglich macht“. Markschies, Christoph, Gottes Körper. Jüdische, christliche und pagane Gottesvorstellungen in der Antike, München 2016, 44.
5.2 Theologische „Zugriffe“
251
„sorgfältigen Nachzeichnung von Entwicklungen, in deren Verlauf einst breiter vertretene Vorstellungen [von solcher Körperlichkeit, C. N.] marginalisiert wurden und in Minderheitenpositionen abwanderten“,⁴⁸⁸ darzulegen. Impuls für dieses Vorhaben sei eine langjährige Entwicklung v. a. im Rahmen seiner Vorlesungstätigkeit gewesen.⁴⁸⁹ Die Ausgangsthese seiner Arbeit sei also der Gedanke, dass die neuzeitliche Vormachtstellung der „leiblosen Personalität Gottes […] nicht für die Antike – und zwar für die antiken Religionen in ihrer Gesamtheit“⁴⁹⁰ – galt. Die Verdrängung anthropomorpher Gottesvorstellungen im Laufe der Geistesgeschichte, die theologiegeschichtlich laut Markschies maßgeblich v. a. mit der Marginalisierung der Körperlichkeit Christi in der Zweinaturenlehre der Alten Kirche beginne und sich im Laufe der Zeit über die – sowohl christliche als auch jüdische – Theologie des Mittelalters bis hin zur Neuzeit manifestiere,⁴⁹¹ sei denn auch Grund dafür, dass eine reflektiert anthropomorphe Gottesrede ein bisher uneingelöstes theologisches „Desiderat“⁴⁹² sei. Im ersten Kapitel seiner Monografie legt Markschies dar, wie er diesem Manko begegnen will: Unter Beachtung der Geschichte und Implikationen des sich aktuell entwickelnden geschichts- und kulturwissenschaftlichen Zugriffs der Körpergeschichte ⁴⁹³ zeichnet er hier Anforderungen an einen Körperbegriff, die sich im Spektrum von Multidisziplinarität, Prozessualität und anti-dualisitischer Ambiguität bewegen.⁴⁹⁴ Dementsprechend methodisch und historisch kontextualisiert soll nach dem Gehalt und Einfluss bzw. der hierarchischen Stellung anthropomorpher Gottesvorstellungen im antiken Juden- und Christentum gefragt werden, um so in der reflektierten Analyse zu einer treffenderen Rede über die Körperlichkeit Gottes im Laufe ihrer Geschichte zu kommen. Als ersten Schritt auf dem Weg zu diesem angerissenen Ziel untersucht Markschies im zweiten Großkapitel seines Werks den Befund und die Rezeption bzw. „Transformation“⁴⁹⁵ anthropomorpher Gotteskonzeptionen im Tanach und der Septuaginta im Rahmen der Theologie und ihrer philosophischen Diskurskontexte im 2./3. Jh. n. Chr. Er unternimmt hier den Beweis, dass bereits innerhalb der
488 Ebd., 14. Hervorhebung C. N. 489 Vgl. ebd., 14 f. 490 Ebd., 13. 491 Vgl. zu dieser Entwicklungslinie ebd., 19 – 30. 492 Vgl. ebd., 38. „Die Idee eines Körpers Gottes scheint für neuzeitliche westliche Philosophen wie Theologen so absurd zu sein, dass sie oft nicht einmal das Bedürfnis empfinden, diesen Gedanken explizit zu formulieren.“ Ebd., 30. 493 Vgl. ebd., 34 – 37. 494 Vgl. ebd., 38 ff. 495 Ebd., 33.
252
5 Wie fragt Theologie?
biblischen Texte Reflexionen⁴⁹⁶ bzw. „theologische Diskussion[en]⁴⁹⁷ über die Frage nach der Un-/Körperlichkeit vollzogen wurden – und dass deren Auslegung wiederum in engem Zusammenhang mit den zeitgenössischen philosophischen Entwicklungen stand. So habe letztlich „die Marginalisierung der Vorstellung von einem göttlichen Körper seit der Antike […] auch die [Marginalisierung der] entsprechenden biblischen Passagen […] [bzw. deren Wegrationalisierung als] rein metaphorische Passagen“⁴⁹⁸ zur Folge gehabt. Dem setzt Markschies die Pluralität der biblischen Konzeptionen zur Körperlichkeit Gottes entgegen, die u. a. von „unterschiedlichen Ein- und Verkörperungen des Gottes an unterschiedlichen Stellen“⁴⁹⁹ sprechen – auch wenn sich gewisse Tendenzen innerhalb der Beschreibungen eines göttlichen Körpers im Alten Testament ausmachen ließen.⁵⁰⁰ Die Rede vom Körper Gottes schien somit – zumindest zu Beginn der theologischen Reflexionen – nicht außergewöhnlich zu sein. Die Entstehung „intellektuelle[r] Probleme mit anthropomorphen Gotteskörpern“⁵⁰¹ setzte vielmehr dort ein, wo versucht wurde, diese biblische Rede mit bestimmten hellenistisch-philosophischen, v. a. platonischen Gottesvorstellungen zu harmonisieren. Dadurch stehe die jüdische und frühchristliche Exegese dann auch mitten im zeitgenössischen philosophischen Diskurs⁵⁰² – denn keineswegs sei der philosophische Aufstieg körperloser Gottesvorstellungen von Anfang an exponentiell gewesen. Vielmehr zeichnete sich auch die zeitgenössische Philosophie – genauso wie die biblisch-
496 Vgl. z. B. ebd., 43 f. 497 Ebd., 49. 498 Ebd., 41. Hervorhebung C. N. „[S]pätestens in der europäischen Neuzeit [ist eine metaphorische] Interpretation der entsprechenden ‚anthropomorphenʻ [biblischen] Passagen zum Normalfall geworden“. Ebd., 45. Markschies stellt sich gegen eine solche prinzipielle Auslegung der entsprechenden Bibelstellen, da eine Metapher immer den Ausgleich bzw. die Übertragung eines gewissen fremden Gehalts auf einen Aspekt impliziere und eine solche kategoriale Fremdheit oder „programmatische Unähnlichkeit“ (ebd., 46) eben nicht automatisch als Grundintention der Texte konstatiert werden könne und referiert hier auf jüngere Diskussionen der neuesten Exegese. Vgl. ebd., 45. 499 Ebd., 53. 500 „Man kann also festhalten, dass der göttliche Körper, auf den viele Passagen der Hebräischen Bibel anspielen, in der Vorstellung der Glaubenden offenbar aus einer leichten Materialität bestand, nicht aus Fleisch, Blut und Knochen. Weiter ist selbstverständlich, dass er keine Defizienzen […] aufweist, aber mit voller Emotionalität agiert. […] Ganz offensichtlich steht eher ein männlicher Körper im Hintergrund der Beschreibungen, auch wenn […] der Eindruck einer expliziten Geschlechtlichkeit streng vermieden wird. Außerdem fehlen Hinweise auf diejenigen Körperteile, mit denen Individualitäten beschrieben werden können“. Ebd., 48. 501 Ebd., 53. 502 Vgl. zu seiner philosophischen Einordnung der Debatten der Un-/Körperlichkeit Gottes von Platonismus versus Epikurismus versus Stoa versus aristotelische Schule ebd., 57– 85.
5.2 Theologische „Zugriffe“
253
theologischen Reflexionen – dadurch aus, dass es zeitweise „zwei Konzepte […] gleichzeitig“⁵⁰³ gab, in deren Spektrum um verschiedene Vorstellungen von der Nicht-/Materialität Gottes gerungen wurde: die Körperlichkeit Gottes versus seine Körperlosigkeit. „Bevor […] eine [dieser] beiden Denktraditionen an den Rand gedrängt und marginalisiert wurde, entfaltete sich auch in der christlichen Religion eine umfangreiche Debatte über Recht und Grenze dieser Vorstellung.“⁵⁰⁴ Diesen von ihm so gezeichneten heftigen Streit⁵⁰⁵ legt Markschies zunächst v. a. anhand der Position Origenesʼ bzw. der von ihm insinuierten anthropomorphen Gegenpositionen⁵⁰⁶ dar – und kann daran verdeutlichen, dass anthropomorphe Gottesvorstellungen keineswegs symptomal für unterreflektierte philosophisch-theologische Positionen waren, „sondern mithilfe philosophischer Konzepte eine besondere Leiblichkeit des göttlichen Körpers angenommen wurde.“⁵⁰⁷ Deutlich werde dabei also, dass die jeweiligen Vorstellungen von der Un-/Körperlichkeit Gottes in wechselseitigem Zusammenhang zur dahinter- (oder davor‐) stehenden Ontologie und v. a. Anthropologie stünden⁵⁰⁸ – und auch hier dementsprechend von einer gewissen Pluralität zwischen diesen zwei Polen auszugehen sei. Hier kann Markschies – dann als Abschluss dieses ersten Schrittes – resümieren, dass „[w]eder das Judentum noch das Christentum […] in Blick auf die Vorstellung von einem göttlichen Körper so monolithisch [waren], wie es sich ein Origenes der Antike wünschte […] und ein Leibniz in der Barockzeit kanonisierte.“⁵⁰⁹ Im nächsten, dritten Kapitel seiner Monografie unternimmt Markschies den Versuch, v. a. anhand bildlicher und mythologischer Götterdarstellungen in Statuen und Geschichten Konzepte „des Körpers Gottes in der paganen griechisch-römischen Kultur“⁵¹⁰ und deren Einfluss auf die „religiöse Alltagspraxis“⁵¹¹ darzustellen. Deutlich arbeitet er hier die Bedeutung von Statuen und Kultbildern – und der darin repräsentierten, selbstverständlich körperlichen Darstellung von Gottheiten⁵¹² – für das religiös-kollektive Gedächtnis und somit für den Vollzug und die Vorstellungswelt von antiker Religiosität insgesamt heraus. Dabei betont er, dass in
503 504 505 506 507 508 509 510 511 512
Ebd., 85. Ebd. Vgl. ebd., 86. Vgl. ebd., 87. Ebd., 106. Vgl. ebd., 110 f. Ebd., 111. Ebd., 33. Ebd. Vgl. ebd., 118 ff.
254
5 Wie fragt Theologie?
der religiösen Vorstellungswelt in diesen Darstellungen von Verkörperung (oder auch Einkörperung) zwar durchaus zwischen der irdischen Materialität der Statuen und der Beseelung durch die entsprechende Gottheit differenziert werden konnte;⁵¹³ damit sei aber noch nichts über die eigentliche Un-/Körperlichkeit der Gottheit ausgesagt.⁵¹⁴ Deutlich werde die religiöse Bedeutsamkeit von Materialität dabei aber vor allem dadurch, dass solche Verkörperungen in Kultbildern als handlungstragend, als „Garant für die Anwesenheit von Kraft“⁵¹⁵ galten – und das eben auch in verschiedenen sozial-intellektuellen Schichten.⁵¹⁶ Dementsprechend kann Markschies einer wohl durchaus gängigen historiografisch-retrospektiven Interpretation von Kultbildern und Statuen als körperliche Darstellung des eigentlich Körperlosen ⁵¹⁷ in der antiken Alltagsreligiosität nur widersprechen: „Energische Voten für die Differenz zwischen einem körperlichen Abbild und einem körperlosen Urbild, wie sie sich bei Seneca oder Plutarch finden, dürfen nicht zur einer generellen Aussage über pagane Frömmigkeit in der Antike verallgemeinert werden.“⁵¹⁸ Vielmehr sei hier auf den Unterschied zwischen Philosophie und Theologie als „gelehrte[r] Reflexion über gelebte Religion“⁵¹⁹ und konkreter Alltagsreligiosität hinzuweisen. Letztere zeichnete sich gerade dadurch aus, dass die „Grenzen zwischen Gott und Mensch […] vielmehr fließend“⁵²⁰ gewesen seien – wie gerade auch verschiedene literarische Darstellungen göttlicher Epiphanien in bspw. „ganz bestimmte[r] menschliche[r] Gestalt“⁵²¹ verdeutlichen. Deutlich macht Markschies am Ende dieses Kapitels den Einfluss solcher paganen Religiosität auf die Ikonografie des antiken Judentums und Christentums, die sich als „Teil einer multireligiösen Umwelt“⁵²² solchen „Konventionen, Götter in körperlicher Gestalt darzustellen, […] trotz des […] normierten Bilderverbotes“⁵²³ nicht gänzlich haben entziehen können: „Auch die antike christliche Kunst bildet Gott, den Vater [zwar] sehr selten ab. Aber
513 Vgl. ebd., 116 f. 514 Vgl. ebd., 121 ff. 515 Ebd., 124. „Wenn dagegen in einem Tempel die Statue fehlte, galt der Tempel als verlassen.“ Ebd., 125. 516 Vgl. ebd., 125 f.128 f. 517 Markschies referiert hier auf einen Vortrag von Ulrich von Wilamotwitz-Moellendorff von 1913. Vgl. ebd., 120. 518 Ebd., 129. 519 Ebd. 520 Ebd., 114. 521 Ebd., 132. 522 Ebd., 143. 523 Ebd., 137.
5.2 Theologische „Zugriffe“
255
ganz selbstverständlich stellte man […] körperliche Details wie die Hand Gottes dar.“⁵²⁴ Im nächsten Schritt, dem vierten Kapitel, untersucht Markschies die Bedeutung der Vorstellung von einer „Körperlichkeit der Seele in spätantiken Diskussionen“⁵²⁵ für nicht-/anthropomorphe Gottesvorstellungen – und betont auch hier (wie im Vorherigen) wieder, dass eine „nach dem klassischen Dual einer schlichten [von anthropomorphen Vorstellungen geprägten, C. N.] Alltagsfrömmigkeit der Massen und einer [dem konträr gegenüberstehenden] reflektierten Intellektuellen-Religiosität modellierte Sichtweise die antike Wirklichkeit nur in sehr begrenztem Maße trifft“.⁵²⁶ Demgegenüber zeichnet Markschies hier wieder den wechselseitigen Einfluss zwischen gelebter Alltagsreligiosität und darauf reflektierender, sich entsprechend wandelnder Philosophie und (als deren Rezeption) Theologie nach⁵²⁷ – wodurch philosophisch-theologische Diskussionen um die Seelenlehre⁵²⁸ sich durch eine gewisse Dynamizität kennzeichneten.Vor allem am Beispiel Augustinusʼ kann er aufzeigen, dass in der philosophie- bzw. theologiegeschichtlichen Entwicklung zwar die platonisch geprägte Vorstellung der Körperlosigkeit der Seele – und damit Gottes⁵²⁹ – immer mehr Popularität gewann; dass dabei aber trotzdem von einer gewissen Substantialität sui generis von Seele und Gott ausgegangen werden konnte.⁵³⁰ Dennoch wurden insgesamt die in sich wohl viel pluraleren Debatten innerhalb der spätantiken Philosophie im Spektrum v. a. zwischen (Neu‐) Platonismus und Stoa nicht direkt rezipiert. Vielmehr folgten „die einflussreichsten christlichen Schriften über die Seele […] weiter dem klassischen [platonischen] Paradigma, dass Seele und Gott gleichermaßen körperlos zu denken seien.“⁵³¹ Somit sei „die Frage nach der Körperlichkeit Gottes innerhalb der christlichen Theologie am Ende des 5 Jahrhunderts im Westen definitiv beantwortet […], nämlich negativ.“⁵³²
524 Ebd., 142. 525 Ebd., 33. 526 Ebd., 145. 527 Vgl. ebd., 146. 528 Vgl. hier seine Darstellung der Debatte (Neu‐) Platonismus versus Stoa ebd., 146 – 157. 529 „Die unterschiedlichen Stellungnahmen des Augustinus machen auf ihre Weise deutlich, wie eng die Vorstellung von einer Körperlichkeit der Seele mit einer Körperlichkeit Gottes miteinander zusammenhing.“ Ebd., 172. 530 Vgl. ebd., 171 f. Markschies zeichnet hier eine Entwicklung Augustinusʼ nach, der zunächst – wohl unter stoischem Einfluss – noch von einer gewissen Körperlichkeit von Gott und Seele ausging und sich erst in Mailand davon vollständig abwendete. 531 Ebd., 177. 532 Ebd.
256
5 Wie fragt Theologie?
Das fünfte Kapitel des Werkes stellt den Versuch dar, „heute weitgehend vernachlässigte Traditionslinien [in biblischen Schriften und in antiken philosophischen und theologischen Konzeptionen] unterschiedlicher jüdischer und christlicher Vorstellungen von Gottes Körperlichkeit zu rekonstruieren.“⁵³³ Hier widmet sich Markschies vor allem „einem interessanten Textkorpus der spätantiken und frühmittelalterlichen jüdischen Mystik, genannt ‚Shiʼur Qomaʻ ()שׁיעור קומה, Schriften über die ‚Maße der Gestalt (des göttlichen Körpers)ʻ“.⁵³⁴ In diesen Schriften, die in der Beschreibung der Körperlichkeit Gottes wohl den Tendenzen bestimmter biblischer Passagen ⁵³⁵ entsprechen,⁵³⁶ werde Gottes Körper bzw. Gestalt zwar als menschenähnlich, aber eben doch kategorial vom Menschen verschieden beschrieben,⁵³⁷ was z. B. durch die Angabe geradezu phantastischer Körpermaße zum Ausdruck komme.⁵³⁸ Gleichzeitig werde die Schönheit der göttlichen Form⁵³⁹ betont – etwa mit besonders harmonischen Proportionen (ohne konkrete Maßangaben). Parallelen zu diesen besonderen Beschreibungen der Shiʼur Qoma fänden sich wohl vor allem „am Rande der sich formierenden christlichen Mehrheitskirche in der hohen römischen Kaiserzeit.“⁵⁴⁰ Zusammen mit der angeschlossenen Analyse möglicher Analogien zur christlichen Gnosis (die sich zwar durch starke Parallelen, aber eben auch durch starke Unterschiede kennzeichne)⁵⁴¹ kommt Markschies also auch in Auseinandersetzung mit diesen Traditionslinien sowohl in den gnostischen als aber eben auch bereits in den nachbiblischen jüdischen Texten zu der These, dass „[v]iele, aber eben nicht alle […] streng gegen die Vorstellung einer Körperlichkeit Gottes [argumentieren].“⁵⁴²
533 Ebd., 247. 534 Ebd., 33. 535 Vgl. ebd., 182 – 200. Markschies analysiert hier vor allem die Thronwagen-Vision zu Beginn des Ezechielbuchs, die mit ihren anthropomorphe Gottesbilder evozierenden Bildern „eine zentrale Rolle für die theologische Spekulation über die Körperlichkeit Gottes“ (ebd., 183) spielte. Allerdings betont Markschies, dass (v. a. in der Auseinandersetzung um diese Passage) eine „deutlich größere Zahl von Texten […] die Unvorstellbarkeit Gottes“ (ebd., 186) akzentuierte und vielmehr jegliche Spekulationen über Gottes Körper unterband, indem sie „seine Form hinter seinem Lichtglanz oder einem Feuer […] unzugänglich werden“ (ebd.) ließ. Dies sei aber nicht aus der Antiposition zu einem unangemessenen Anthropomorphismus entstanden, sondern vielmehr „zum Schutz von Gottes Privatssphäre“. Ebd., 200. 536 Vgl. ebd., 205. 537 Vgl. ebd. 538 Vgl. ebd., 219. 539 Vgl. ebd., 204.219. Schönheit sei auch gerade im (Neu‐) Platonismus eine (später in Abstufungen existente) Eigenschaft des höchsten Prinzips. 540 Ebd., 227. 541 Vgl. ebd., 236 ff. 542 Ebd., 241. Hervorhebung C. N.
5.2 Theologische „Zugriffe“
257
Dass sich vor allem „in der christlichen Literatur keine wirklichen Parallelen zu den Shiʼur Qoma-Passagen finden“,⁵⁴³ deute seines Erachtens nach am wahrscheinlichsten auf eine deutliche Konkurrenzsituation mit der „spätantiken und byzantinischen Christologie [hin].“⁵⁴⁴ Das sechste Kapitel konzentriert sich als vorletzter materialer Schritt der Monografie auf „körperliche Vorstellungen in der spätantiken christlichen Theologie […], besonders [auf ] Konzepte der sogenannten [monastisch formierten, C. N.] Anthropomorphiten“,⁵⁴⁵ um damit letztlich der Frage nachzugehen, „wie die Vorstellung von einem göttlichen Körper und einer göttlichen Leiblichkeit vor allem in [jenen] monastischen Kreisen des ägyptischen Mönchtums überlebte, während sie in der bischöflich geprägten Mehrheitstheologie der Spätantike energisch an den Rand gedrängt wurde.“⁵⁴⁶ Auch hier unternimmt Markschies wieder den Versuch zu beweisen, dass anthropomorphe Vorstellungen keinesfalls in naiv dualistischer Zuordnung nur einer begrenzten ungebildeten Gruppe zuzuschreiben seien,⁵⁴⁷ sondern dass sowohl körperliche als auch unkörperliche Gottesvorstellungen sich sowohl in spezifischen Frömmigkeitsformen als auch theologischen Reflexionen verschiedener Positionierungen⁵⁴⁸ wiederfinden ließen;⁵⁴⁹ und dass es sich auch beim Streit um die Anthropomorphiten, dem „Höhepunkt – und […] chronologischen Schlusspunkt – der vielfältigen Kontroversen im antiken Christentum über die Frage, ob Gott mit einem wie auch immer gearteten Körper vorzustellen sei“,⁵⁵⁰ weiterhin wohl nicht um den Erfolg theologisch stringenterer Positionen, sondern vielmehr um einen häresiologisch motivierten Prozess der aktiven Marginalisierung von Randgruppenpositionen handelte.⁵⁵¹ Hintergrundfolie dieser Debatte⁵⁵² sei letztlich die Frage um „Recht und Grenze der [radikalisierten,⁵⁵³ C. N.] Theologie des
543 Ebd., 245. 544 Ebd. 545 Ebd., 33. 546 Ebd., 247. 547 Vgl. ebd., 282 f. 548 Vgl. ebd., 310. 549 Markschies zeichnet hier als maßgeblich exemplarisch für diese verschiedentlich möglichen Positionierungen und als Teil der Vorgeschichte des Streits um die Anthropomorphiten die un-/ körperlichen Gotteskonzeptionen von Melito von Sardes und Irenaeus von Lyon nach.Vgl. ebd., 249 – 267. 550 Ebd., 310. 551 Vgl. ebd. 552 Dessen „Vor- und Nebengeschichte“ (ebd., 284) Markschies anhand der die Dominanz der Vorstellung von der Unkörperlichkeit Gottes belegenden bischöflich-theologischen Positionen von Lactanz, Eusebius von Emesa und Augustinus skizziert. Vgl. ebd., 284 – 309. 553 Vgl. dazu Markschiesʼ Ausführungen zu Evagrius Ponticus ebd., 327– 333.
258
5 Wie fragt Theologie?
Origenes“⁵⁵⁴ gewesen, gegenüber dessen vermeintlich körperfeindlicher Theologie (bzw. deren dergestalter Rezeption)⁵⁵⁵ und seiner (polemischen) Einordnung als „geistige[n] ‚Vater des Ariusʻ“⁵⁵⁶ immer mehr Argwohn entstanden sei. Demgegenüber vertraten die Anthopomorphiten – orientiert am schöpfungstheologischen Gedanken der Gottebenbildlichkeit des Menschen in Körper und Seele – eine Art materieller Gottesvorstellung;⁵⁵⁷ zu verstehen als eine „monastische Transformation der klassischen christlichen Ansichten über den Körper Gottes für die Zwecke von asketischen Gemeinschaften“.⁵⁵⁸ Mit der schlussendlichen Verdrängung dieser Positionierungen an den theologischen Rand ging im Nachgang des Konflikts⁵⁵⁹ letztlich das Verschwinden solcher materialistisch orientierten Vorstellungen von der Körperlichkeit Gottes einher. Markschies schließt seine Betrachtungen hier mit einer erneuten kurzen Reflexion auf das wechselseitige Verhältnis von Gotteslehre und theologischer Anthropologie ab. So spräche „einiges dafür, dass Mönche, die kritisch gegenüber jeder körperlichen Vorstellung von Gott sind, eher dazu neigen, ihren Körper zu zerstören, weil der Körper den Unterschied zwischen dem Mönch und seinem Gott ausmacht. […] Ein Mönch, der dachte, dass Gott einen speziellen himmlischen Körper hat, versuchte vermutlich, seinen eigenen irdischen Körper in diese spezifische Art eines göttlichen himmlischen Körpers zu verwandeln.“⁵⁶⁰ Im siebten Kapitel seines Werkes unternimmt Markschies den Versuch, „explizite Verbindungen oder aber versteckte Linien“⁵⁶¹ zwischen nach-/biblischen Vorstellungen zur Körperlichkeit Gottes und den christologischen Debatten um die zwei Naturen Jesu Christi aufzudecken. Zur Frage nach der Beschaffenheit der Leiblichkeit des Gottmenschen weist er hier zwei grobe Linien auf, zwischen denen sich die verschiedenen Positionierungen bewegen: Entweder die doketistische Abwertung des Körpers Jesu Christi als Scheinleib oder seine Aufwertung als vollkommen menschlich.⁵⁶² Theologisch bzw. v. a. letztlich soteriologisch zentral sei dabei vor allem, dass hiermit immer die Frage nach der Beschaffenheit des Auf-
554 Ebd., 310. 555 Mit Konsequenzen bis hin zu (teilweise unterstellten) Sebstverstümmelungen. Vgl. ebd., 337 f. 556 Ebd., 326. 557 Vgl. ebd., 356. 558 Ebd., 357. Hervorhebung C. N. Womit sie für Markschies „in der Tradition der christlichen Lehrbildungen des zweiten und dritten Jahrhunderts“ stehen. Ebd. 559 Vgl. ebd., 361 ff. 560 Ebd., 364 f. 561 Ebd., 34. 562 Vgl. ebd., 378 f. Letzteres exemplifiziert er vor allem anhand von Tertullian. Ersteres ließe sich nur aus Polemiken rekonstruieren.
5.2 Theologische „Zugriffe“
259
erstehungsleibes Jesu Christi verbunden gewesen sei.⁵⁶³ Denn gerade hierin werde die anthropologische und lebensweltliche Bedeutsamkeit⁵⁶⁴ von Körpervorstellungen in Bezug auf (Gott und) den Gottmenschen deutlich – und damit auch der Einfluss „auf das alltägliche Leben der Christenmenschen“.⁵⁶⁵ Markschies sieht in diesen Debatten um die Körperlichkeit Christi – und damit um die Frage nach „einem menschlichen Körper Gottes“ ⁵⁶⁶ – letztlich die Evidenz für die Bedeutsamkeit einer differenzierteren Reflexion über anthropomorphe Gottesvorstellungen. Denn vielleicht fände sich hier „die radikalste Form, in der die ursprüngliche jüdische Idee, dass der Mensch nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen wurde, weitergedacht wurde: Der göttliche Körper ist eben der menschliche Körper – und umgekehrt.“⁵⁶⁷ Zum Abschluss seiner Monografie systematisiert Markschies sein „als historische Untersuchung angelegt[es]“⁵⁶⁸ Vorhaben unter der Fragestellung nach der bleibenden theologischen Bedeutsamkeit der Reflexion über Gottes Körper. Er betont hier noch einmal zusammenfassend, dass es sich bei anthropomorphen Gottesvorstellungen nicht um ein „heute erledigte[s] Detail des Gottesbildes unaufgeklärter Vorfahren“⁵⁶⁹ handelt, sondern dass solche Konzeptionen „die jüdischchristliche Bibel nahezu auf jeder Seite [prägen] und […] daher dem Judentum und dem Christentum bis heute gemeinsames Erbe“⁵⁷⁰ seien. Theologische Reflexion sei also darauf angewiesen, über dieses Erbe gerade auch im Zusammenhang sich ändernder Rationalitätskonzepte immer wieder nachzudenken, denn „[d]er in den biblischen Schriften bezeugte Gott kann nicht ohne substantiellen Verlust auf ein körperloses, schlechthin transzendentes Wesen reduziert werden“.⁵⁷¹ Zumal die Behauptung, anthropomorphe Gottesvorstellungen seien als überholt oder mit neuzeitlichen Rationalitätsstandards unvereinbar anzusehen, „ein mehr oder weniger gut begründetes philosophisches Urteil [darstellten] und keine religionswissenschaftliche⁵⁷² Beschreibung vorhandener Religiosität.“⁵⁷³ Den laut Markschies
563 Vgl. ebd., 394 f. Selbst Origenes ging von einem festen, berührbaren (Ideal‐) Körper des Heilands aus. Vgl. ebd., 398 f. 564 Vgl. ebd., 415 ff. 565 Ebd., 414. 566 Ebd., 418. 567 Ebd. 568 Ebd., 428. 569 Ebd., 418. 570 Ebd. 571 Ebd., 419. 572 Markschies grenzt seine Verwendung des Attributs „religionswissenschaftlich“ hier nicht ein. Der Kontext lässt darauf schließen, dass es sich hier eben um eine materiale Deskription von Religion/Religiosität handele.
260
5 Wie fragt Theologie?
immer wieder konstruierten unvereinbaren Widerspruch zwischen anthropomorphen Gottesvorstellungen und moderner Rationalität bzw. modernen Rationalitäten versucht er zumindest etwas aufzulösen, indem er auf das notwendige reflexive Wechselspiel zwischen der durchaus exegetisch-hermeneutischen Notwendigkeit eines entmythologisierenden Umgangs mit den biblischen Schriften und der dennoch dahinterstehenden Wahrheit des Mythos hinweist. Ziel sei dabei letztlich, in der Frage nach dem Körper Gottes schlichten Dualismen, ontologischen Hierarchisierungen und allen damit verbunden Konsequenzen (bis hin zu einer imoder expliziten Leibfeindlichkeit) entgegenzuwirken.⁵⁷⁴ Durch die Reflexion auf die unumgehbare Wechselhaftigkeit zwischen Entmythologisierungsnotwendigkeit und Wahrheitsanspruch werde sowohl die kategoriale Differenz zwischen Gott und Mensch gewahrt – als auch auf die (gerade in der Trinitätslehre zum Ausdruck kommende) ontologische Verbindung zwischen Schöpfer und Schöpfung hingewiesen. In Konsequenz werde damit auch allen Reduktionismen im Bereich der Anthropologie theologischer Widerstand entgegengebracht.⁵⁷⁵ Gerade dieser Zusammenhang zwischen Gotteslehre und Anthropologie stelle resümierend den theologischen Impuls von Markschiesʼ Monografie dar, die trotz (oder gerade wegen) des historischen Selbstanspruchs mit der„Anregung [schließt], ob es nicht auch im Interesse des menschlichen Körpers sinnvoll sein könnte, sich mit größerer Aufmerksamkeit mit dem Thema [des Körpers Gottes] zu befassen […]. Ein reflektierter Anthropomorphismus des Gottesbildes verhindert, dass die religiöse Rede von Gott die Menschlichkeit Gottes außer Acht lässt.“⁵⁷⁶
573 Ebd., 422. Als Beispiel für einen persistenten Anthropomorphismus in der christlichen Frömmigkeit referiert Markschies hier auf Gottesvorstellungen der Mormonen. Vgl. ebd., 422 ff. 574 Vgl. ebd., 426. 575 Vgl. ebd., 427 ff. Interessant ist, dass in diesem Zusammenhang gerade auch bei Markschies eine durch einen gewissen Materialismus geprägte Ontologie zumindest implizit zum Ausdruck zu kommen scheint. „Wenn Gott begriffen werden darf als der Grund aller Möglichkeiten […], dann ist die Rede von seinem Körper ein Hinweis darauf, dass es weder den Grund der Möglichkeiten noch Möglichkeiten als rein geistige Strukturen ohne materielles Substrat gibt.“ Ebd., 426 f. Hervorhebung C. N. Ähnliches ließe sich auch zu Beginn seiner Monografie diagnostizieren, wenn er in Darlegung der Entwicklungslinien im Bereich der Körpergeschichte bestimmten dekonstruktivistischen Positionen entgegenhält, dass „Konstruktion nicht auf einer tabula rasa stattfindet, sondern auf der Grundlage spezifischer natürlicher Dispositionen.“ Ebd., 37. Markschies geht ontologisch explizit von einer „nur in den Konstruktionen zugängliche[n] biologische[n] Basis aller Konstruktion“ aus. Ebd. Hervorhebung C. N. 576 Ebd., 428.
5.2 Theologische „Zugriffe“
261
5.2.3.1 Zwischenbilanz Auch an dieser Stelle soll nun im Folgenden eine kurze Systematisierung der Monografie Markschiesʼ unter dem Analyseinstrument der Fragestellung als wissenschaftlichem Differenzkriterium erfolgen, um so einen hermeneutisch-religionsphilosophisch fokussierten Zugriff auf Theologie herauszuarbeiten. Deutlich wird in Betrachtung von Markschiesʼ Studie sofort, dass sie ein bestimmtes Ziel verfolgt. In Anwendung des religionsphilosophischen Begriffs des Anthropomorphismus, der sozusagen als heuristische Deutekategorie auf antike Gottesvorstellungen in verschiedenen Quellen angewandt wird, soll so die Geschichte einer Marginalisierung unpopulärer theologischer Positionen nachgezeichnet werden. Markschies stellt sich von Anfang an explizit gegen solches dualistisch verfahrendes Wegdrängen spezifischer Konzeptionen und plädiert vielmehr für eine differenzierte Sicht auf die potentielle theologische Pluralität in diesem spezifischen Bereich der Gotteslehre. In detaillierter historisch-kritischer, kontextualisierender Quellarbeit mit verschiedensten Texten der Antike kann er so eine multidimensionale religionsphilosophische und theologische Debattenlage nachzeichnen. Deutlich wird dabei (trotz der vielleicht berechtigten Rückfrage nach der bei solcher expliziten Forderung nach einem reflektierten Anthropomorphismus mitschwingenden Möglichkeit einer potentiell epistemisch-methodologisch zu starken Absicht des Gesamtvorhabens) das Wechselverhältnis zwischen theologischen Reflexionen und den sie umgebenden philosophischen Diskursen; genauso wie der wechselseitige Zusammenhang zwischen gelebter Religiosität in multidimensionalen Umwelten – und Theologie als der Reflexion darauf. Markschiesʼ theologischer Impetus wird dabei deutlich: Auf Grundlage des laut ihm evidenten biblischen Zeugnisses und seiner verschiedentlichen theologischen und religionsphilosophischen Rezeptionsgeschichte spricht er sich für einen differenzierten Umgang mit der Frage nach der Körperlichkeit Gottes aus, die (unter Wahrung aller kategorialen Differenz zwischen Gott und Mensch) Ausdruck der aus der konkreten Religiosität der Menschen freigesetzten Reflexion auf den Zusammenhang zwischen Gottesbild und Menschenbild sei. Gerade in den Figuren der Christologie und Trinitätslehre komme die Frage nach der Menschlichkeit Gottes – und somit seines Verhältnisses zum Menschen – zum Ausdruck. Vor dem Hintergrund dieses kurzen Resümees kann nun also als Fragestellung von Theologie in einem hermeneutisch-religionsphilosophischen Zugriff folgende Formulierung konstruiert werden: Theologie unter einem hermeneutisch-religionsphilosophischen Zugriff fragt in Geschichte und Gegenwart nach der Entstehung, der Tradierung und den Inhalten christlicher Glaubensaussagen auf Basis der in den biblischen Texten belegten Vorstellungen, um so zu einer biblisch verantworteten und der konkreten religiösen Erfahrungswelt von Christ*innen angemessenen Rede über christliche Glaubensvorstellungen in Geschichte und Gegenwart zu gelangen.
262
5 Wie fragt Theologie?
5.2.4 Religionspsychologisch-anthropologisch Zur Konstruktion des letzten innertheologischen, religionspsychologisch-anthropologisch⁵⁷⁷ fokussierten Zugriffs wird nun im Folgenden Stocks hier bereits zitierte enzyklopädische Orientierung Die Theorie der christlichen Gewißheit von 2005 auf eine aus ihr ableitbare Fragestellung akademischer evangelischer Theologie hin untersucht. Stock, Jahrgang 1941 (geboren in München)⁵⁷⁸, ist emeritierter Professor für Systematische Theologie. Sein akademischer Werdegang von Studium und Promotion bis Emeritierung weist Stationen in München, Tübingen, Heidelberg u. v. a. auf. Zuletzt hatte er eine Professur für Systematische Theologie an der Universität Bonn (Außenstelle Köln) inne.⁵⁷⁹ Bekannt ist Stock nicht nur für seine auf Grundlagenthemen bezogenen Forschungen und Publikationen im Bereich der Systematischen Theologie, sondern auch maßgeblich für seine Tätigkeit als Mitherausgeber der Theologischen Realenzyklopädie.⁵⁸⁰ Aus seiner Publikationsliste⁵⁸¹ lässt sich eine gewisse Zuspitzung auf eine anthropologisch fundierte Art des Theologietreibens ableiten, in der die Subjektivität der glaubenden Person als Drehund Angelpunkt des dogmatischen Reflektierens fungiert.
577 Gerade in der Titulierung dieses Zugriffs zeigt sich exemplarisch – im Gegenüber zum psychologisch-kognitionswissenschaftlichen Zugriff der Religionswissenschaft in Kapitel 4.2.4. – der Versuch dieser Arbeit, zwar formale Brückenbaumomente zwischen Religionswissenschaft und Theologie auf der Ebene ihrer subdisziplinären Diskursstrukturen aufzuzeigen – und dabei dennoch der jeweiligen eigenen Fachlogik, Tradition und Sprache Rechnung zu tragen. Hintergrund für die unterschiedlichen Bezeichnungen dieser beiden Zugriffe sind entsprechend auch (Vermutungen über) unterschiedliche Fachtraditionen, die im jeweiligen Diskurs von relativer Bedeutung sind: Auf der einen Seite eine vielleicht eher sozusagen material(istisch)e Psychologie – und auf Seiten der Theologie der (v. a. im Schleiermacherischen Erbe stehende) Gedanke einer kategorialen Psychologie als Grundlage von Theologie. Deutlich soll hier also werden, dass es nicht um Parallelisierungen zwischen den disziplinären Zugriffen geht, aber dennoch gewisse denkerische strukturelle Anknüpfungspunkte aufgezeigt werden können. 578 Vgl. die Website der Deutschen Nationalbibliothek. Konrad Stock, https://d-nb.info/gnd/ 123254108 – 29.01.21. 579 Vgl. Stock, Die Theorie, Impressum. 580 Vgl. die PDF TRE_TRE_Herausgeber.pdf auf der Website von de Gruyter. Theologische Realenzyklopädie. Produktinformation, https://www.degruyter.com/publication/dbid/tre/downloadAsset/ TRE_TRE_Herausgeber.pdf – 29.01.21. Mit dem TRE-Artikel Theologie, Christliche III. Enzyklopädisch habe Stock einen „literarischen Zwischenstand“ seiner enzyklopädischen Reflexionen, die im hier analysierten Werk ausführlicher dargelegt werden, geliefert. Stock, Die Theorie, VII. Vgl. Ders., Art. Theologie, Christliche III. Enzyklopädisch, in: TRE 33 (2002), 323 – 343. 581 Vgl. die Website der Deutschen Nationalbibliothek. Konrad Stock. Publikationsliste, https://por tal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&reset=true&cqlMode=true&query=auRef% 3D123254108&selectedCategory=any – 29.01.21.
5.2 Theologische „Zugriffe“
263
Die hier zu analysierende, für das Vorhaben dieses Kapitels deutlich geeignete sachlogische „enzyklopädische Konzeption“⁵⁸² evangelischer Theologie Stocks ist entstanden auf der Grundlage seiner Vorlesungstätigkeit und damit kontextuell verbunden mit der Absicht, Theologiestudierende wieder in „Lust und Liebe“⁵⁸³ für „diese große, schöne und ernste Wissenschaft“⁵⁸⁴ entbrennen zu lassen. Diesen Praxisbezug verdeutlicht Stock von der ersten Seite des Vorworts an: Er zeichnet hier Theologie – explizit in der Beerbung Schleiermachers⁵⁸⁵ – als eine positiv auf die Tätigkeit des „theologischen Berufs“⁵⁸⁶ ausgerichtete Disziplin.⁵⁸⁷ Direkt vorweg nimmt er eine erste nähere Bestimmung seines Theologiebegriffs vor, indem er ihren Gegenstand mit der Formel „Wesen des Christentums“⁵⁸⁸ umreißt, welches sich in der Gemeinschafts- und Weltverantwortung bildenden „Gewißheit von der Wahrheit des Evangeliums“⁵⁸⁹ ausdrücke. Bereits auf diesen ersten Seiten zeigt sich der Grundansatz seiner Herangehensweise: Ausgehend von der Perspektive des religiösen Subjekts habe Theologie zum Ziel, im „Selbstverständnis des Glaubens“⁵⁹⁰ dessen Wirklichkeitsverständnis „unter ständigem Rekurs auf das Phänomen […] menschlichen In-der-Welt-Seins“⁵⁹¹ kritisch-reflexiv darzustellen, zu verstehen und zu erklären. Darauf gegründete evangelische Theologie in formalenzyklopädischer Perspektive, so verdeutlicht Stock in seiner sich anschließenden knappen Grundlegung des Enzyklopädiebegriffs, sei als eine Schleiermacherisch-positive, bei der religiösen Erfahrung ansetzende und auf Gesellschaft bezogene Wissenschaft auszuformulieren als die „Theorie der christlichen Gewißheit“.⁵⁹² Um diese Theorie in den folgenden Kapiteln seiner Monografie darzulegen, steigt Stock ein mit einer Näherbestimmung von Theologie als Wissenschaft. In einer kurzen Analyse der wissenschaftsgeschichtlichen Grundentwicklungslinien
582 Nüssel, Friederike, Die Theorie der christlichen Gewißheit. Eine enzyklopädische Orientierung, in: ThLZ 4/133 (2008), 1253 – 1256, 1253. 583 Stock, Die Theorie, VII. 584 Ebd. 585 Vgl. dazu u. a. ebd., 3 ff. 586 Ebd., VII. 587 Das hier anvisierte „Praxisbild“ sei dabei weit zu verstehen. Im Fokus sei die Übernahme „ethischer Verantwortung“, die letztlich das Ziel aller Theologie sei – weswegen Stock auch im Rahmen seiner enzyklopädischen Orientierung für die Entwicklung des Paradigmas einer öffentlichen Theologie plädiert. Ebd., IX. 588 Ebd., VII. 589 Ebd. 590 Ebd., VIII. 591 Ebd., IX. Hervorhebung C. N. 592 Ebd., 5. Hervorhebung C. N.
264
5 Wie fragt Theologie?
(via Kant, Schleiermacher und Husserl) kommt Stock hier zu einer historisch-soziokulturell positionell kontextualisierten, lebensweltlich bzw. lebenspraktisch fundierten Bestimmung von Wissenschaft bzw. wissenschaftlichen Wissen als Praxis tätiger Individuen. ⁵⁹³ Durch diesen am wissenschaftlichen Individuum handlungs- und bewusstseinstheoretisch verankerten dynamischen Bezug zwischen Welt und Wissenschaft sei „das Wissen selbst ein Sachverhalt von ethischer Natur und […] die Theorie des Wissens zugleich ein Gegenstand der ethischen Verantwortung.“⁵⁹⁴ Denn aufgrund der „Perspektivität der menschlichen Vernunft […] haben wir in allen Einzelwissenschaften mit einem unabgeschlossenen und unabschließbaren Erkenntnisprozeß zu rechnen.“⁵⁹⁵ Dementsprechend positioniere sich Theologie als Wissenschaft auch nicht konträr, sondern eher grundlegend zur heutigen Idee von Wissenschaft selbst: Denn indem sie als Theorie der christlichen Gewissheit auf und aus Glauben als einer lebens-/geschichtlich bedingten anthropologischen Grundbestimmung⁵⁹⁶ „das Gegeben-Sein und damit das Begrenzt-Sein der menschlichen Vernunft radikal ernst nimmt“,⁵⁹⁷ reflektiere sie auf genau diese Bedingtheit der „Erschließungssituation“⁵⁹⁸ des Erkenntnisprozesses – die in theologischer Perspektive offenbarungs- und schöpfungstheologisch bestimmt sei als grundständig abhängig vom Schöpfergott als dem Ursprung allen Seins. Theologie als positive „Grund-Wissenschaft“⁵⁹⁹ reflektiere also auf den Gesamtzusammenhang menschlicher Erfahrung in Perspektive des Glaubens, also in der Perspektive des in bestimmte Freiheit gesetzten geschaffenen Individuums. Durch diesen verantwortlichen, lebenspraktischen Bezug ergebe sich ihr von Stock hier schon angerissenes, später aber näher ausgeführtes Schleiermacherisch-positives Ziel dann in der Ausbildung einer „kommunikativen Kompetenz“⁶⁰⁰ – in Bezug auf genau diesen Welt- und Selbstzusammenhang christlicher Erfahrungswirklichkeit. „Die argumentative Bewegung von allgemeinen Begriffsbestimmungen hin zur Besonderheit theologischer Theoriesprache wiederholt sich im dritten Kapitel über den Gegenstand der Theologie.“⁶⁰¹ Mit der Frage nach dem Gegenstand geht für Stock die Frage seines Gegebenseins einher.⁶⁰² Als Theo-Logie (in Schleiermacheri-
593 594 595 596 597 598 599 600 601 602
Vgl. ebd., 8 ff.14. Ebd., 14. Ebd., 15. Vgl. ebd., 11. Ebd., 16. Ebd., 20. Ebd., 31. Ebd., 30. Nüssel, Die Theorie, 1253. Vgl. Stock, Die Theorie, 33.
5.2 Theologische „Zugriffe“
265
schem anthropologischen bzw. bewusstseinstheoretischen neuzeitlichen Erbe) konstituiere sich ihr Gegenstand „Gott“ bzw. „Gottes Wirklichkeit […] in Erschließungssituationen“⁶⁰³ religiöser Individuen – durch Offenbarung. Für eine christlichtheologische wissenschaftstheoretische Grundlagenreflexion in enzyklopädischer Fokussierung bedeute dies, dass auf die Spezifität dieser Erschließungssituationen als Spezialfall von (Schleiermacherischer) Frömmigkeit⁶⁰⁴ zu reflektieren sei: als Frage nach der „konkrete[n] religiöse[n] Identität des Christentums“,⁶⁰⁵ also als Frage nach seinem Wesen. ⁶⁰⁶ Stock beginnt hier also mit einer grundlegenden religionstheoretischen Herleitung dieses Wesens, indem er zunächst Religion allgemein als ein spezifisches „Phänomen menschlichen In-der-Welt-Seins“⁶⁰⁷ zeichnet. Als solches habe sie eine bestimmte Funktion für die Lebensführung von Individuen und damit das ethische Gefüge von Gesellschaft insgesamt.⁶⁰⁸ In Rezeption des Schleiermacherischen Gefühls der schlechthinnigen Abhängigkeit des religiösen Individuums von einer Ursprungsmacht kann Stock hier Religion als das Phänomen kennzeichnen, worin dem religiösen Selbstbewusstsein genau dieses „Verhältnis zwischen dem ‚Universumʻ und der individuellen Person“⁶⁰⁹ selbst erschlossen wird. Dementsprechend komme mit dem Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit fundamentaltanthropologisch das Bewusstsein dafür zum Ausdruck, aufgrund dieser kontingenten Abhängigkeit vom Ursprung in relative Freiheit zur Welt gesetzt zu sein.⁶¹⁰ Christentum als (auf diese gottesebenbildlich-verantwortliche Freiheit abhebender) Spezialfall dieser Frömmigkeit gestalte sich damit als dynamisches Wechselverhältnis zwischen Selbst- und Weltverhältnis, zwischen Für-sich- und Für-AndereSein der Person⁶¹¹ – wodurch gleichsam die grundlegende integrative bzw. inklusive Funktion von Religion für die Gesellschaft und der „ethische Grundsinn aller Religion“⁶¹² zum Ausdruck komme.⁶¹³ An diese allgemeinbegrifflich-religionstheoretische Bestimmung schließt Stock die Reflexion auf das Spezifische des Wesens des christlichen Glaubens als das ChristSein in der Welt an – als Frage nach der christlichen Identität. Als hier zu entfal603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613
Ebd., 34. Vgl. ebd., 41 f. Ebd., 37. Vgl. ebd., 38. Ebd., 42. Vgl. ebd., 43.59 ff. Ebd., 45. Vgl. ebd., 46 f. Vgl. ebd., 50 – 64. Ebd., 64. Vgl. ebd., 61.
266
5 Wie fragt Theologie?
tende „Kurzformel des christlichen Glaubens“⁶¹⁴ definiert er die durch Offenbarung gestiftete „Gewißheit der Wahrheit des Evangeliums“.⁶¹⁵ Offenbarung leitet er dabei alltagssprachlich ab als die grundanthropologische Erfahrung von „Erschließungssituationen“,⁶¹⁶ in denen also dem Individuum etwas offenbar wird. Christlicher Offenbarungsglaube kennzeichne sich dadurch, dass im Offenbarungsgeschehen die Liebe Gottes sich zeige als „Versöhnungsund Vollendungsgeschehen“,⁶¹⁷ durch das christliches Leben anthropologisch grundbestimmt werde als in Freiheit gesetzter Vollzug des Schöpferwillen Gottes. Die in dieser Daseinsgewissheit mit gesetzte Erkenntnis der eigenen menschlichen Vorläufigkeit und Fehlbarkeit zeigt die ethischen Implikationen der Glaubensgewissheit und deren genuine Verknüpfung mit dem eigenen Gewissen auf:⁶¹⁸ Im Gewissen als „Eigenart des personalen Selbstbewußtseins“⁶¹⁹ komme genau diese „Möglichkeitsbedingung des Gottes- und des Weltverhältnisses“⁶²⁰ des Individuums – und damit seine soteriologische schöpfungsmäßige Bestimmung – zum Bewusstsein. Christlicher Glaube an die „Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit Gottes des Schöpfers“⁶²¹ und seines dem gemäßen Versöhnungswillens definiere sich also als die durch die „Gewißheit eines unbedingten und stets kontrafaktischen GebliebtSeins“⁶²² inhaltlich bestimmte „Gottesgewißheit, die sich dem Selbst oder der Selbstgewißheit der Person als wahr erschlossen hat.“⁶²³ Abschließend zur Frage nach dem Gegenstand der Theologie reflektiert Stock auf die soziale Form dieser Glaubensgewissheit, die Kirche. Glaube, der ein bestimmtes Sein in der Welt impliziert, habe in der Kirche als der „Wahrheitsgemeinschaft des Glaubens“⁶²⁴ seine soziale Entsprechung des Schöpferwillen Gottes – und sei damit „selbst ein Gegenstand der christlichen Wahrheitsgewißheit“.⁶²⁵ (Nicht nur, aber auch) dadurch komme einer grundlegenden ekklesiologischen Bestimmung eine „Schlüsselrolle“⁶²⁶ in Stocks enzyklopädischer Orientierung zu, da die eingangs als Ziel anvisierte „theologische Kompetenz […] sich im Rahmen des
614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626
Ebd., 69. Ebd., 68. Ebd., 70. Ebd., 83. Vgl. ebd., 84 f. Ebd., 85. Ebd. Ebd., 90. Ebd., 91. Ebd., 90. Hervorhebung C. N. Ebd., 101. Ebd. Ebd., 103.
5.2 Theologische „Zugriffe“
267
Kommunikationssystems der Kirche realisiert.“⁶²⁷ Deren Aufgabe bestehe darin, Verantwortung in allen „öffentlichen Kommunikationssituationen“⁶²⁸ zu übernehmen und so gleichsam für alle Mitglieder der Wahrheitsgemeinschaft die Bedingungen für eine selbstverantwortliche, mündige Teilhabe an der Kirche für die Welt zu schaffen. Denn da christliche Existenz immer Existenz in der Welt ist, gehe damit die schöpfungstheologisch-anthropologisch begründete Verantwortlichkeit zur aktiven Gestaltung der Gesellschaft einher. Theologie, die auf solche öffentliche Kommunikationskompetenz abziele, sei also immer auch „öffentliche Theologie“⁶²⁹. Im Anschluss an diese Grundlagenreflexion legt Stock seine enzyklopädische Konzeption vor. Beginnend mit der exegetischen Theologie, also den Wissenschaften des Alten und Neuen Testaments, legt er hier (auch wieder in Anlehnung an Schleiermacher)⁶³⁰ die fundamentaltheologische Bedeutsamkeit der exegetischen Kompetenz für das Gesamte der Theologie als positiver, praxisorientierter Wissenschaft dar:⁶³¹ Denn da die „kirchlich verfaßte Wahrheitsgemeinschaft“⁶³² sich im Laufe ihrer Geschichte immer soziokulturell angemessen selbst reflektiere und erneuere, sei sie angewiesen auf für die jeweilige Gegenwart orientierendes geschichtliches Wissen von der Genese und Konstitution der eigenen Wahrheitsgewissheit, wie sie sich eben vor allem in der „Bibel als Indiz und als Mitteilung der Lebensform einer christlichen Glaubensgemeinschaft“⁶³³ tradiere. In der Frage nach dem „adäquaten Begriff der Autorität der Heiligen Schrift für das je gegenwärtige Geschehen des Glaubens“⁶³⁴ liege die Unverzichtbarkeit der historischkritischen Methode der Exegese und Hermeneutik als zentraler „theologischer Kompetenz“⁶³⁵ insgesamt. Die spezifische Aufgabe der exegetischen Theologie in diesem enzyklopädischen Zusammenhang liege dabei in der Vermittlung der angemessenen „Kenntnis des Urchristentums“⁶³⁶ auf Grundlage der biblischen Quelltexte. Damit einher gehe also eine fundierende Reflexion auf die Frage nach der Hermeneutik des Kanons als in sich pluraler Textsammlung. Die Schwierigkeit liege also darin, dass die „erinnernde und vergegenwärtigende […] Funktion des Kanons als der maßgeblichen Darstellung der urchristlichen Wahrheitsgewiß-
627 628 629 630 631 632 633 634 635 636
Ebd. Ebd., 114. Ebd., 122. Vgl. ebd., 128 f. Vgl. ebd., 129. 170 f. Vgl. ebd., 126. Vgl. ebd., 127. Vgl. ebd., 136. Vgl. ebd., 137. Vgl. ebd., 128.
268
5 Wie fragt Theologie?
heit“⁶³⁷ nur in Form „differenter Darstellungen des Offenbarungsgeschehens gegeben ist.“⁶³⁸ Die zentrale Aufgabe der historisch-kritischen Exegese und Hermeneutik liege deswegen in der Reflexion auf ebendiesen Wahrheitsanspruch in den Aussageintentionen der biblischen Autor*innen.⁶³⁹ Stock stellt in diesem Zusammenhang seinen eigenen (auf fundamentaltheologischer Ebene agierenden) Ansatz von Exegese und Hermeneutik als „Besinnung auf die [Grenzen und] Bedingungen des Verstehens“⁶⁴⁰ vor. Dabei geht er grundsätzlich von Schleiermachers Kennzeichnung von biblischer Hermeneutik als fundamentaltanthropologisch im Selbstbewusstsein der schlechthinnigen Abhängigkeit begründeten Kunst der Interpretation bzw. „Interpretationsrahmen“⁶⁴¹ der Bibel als einem „besonderen geschichtlichen Fall der religiösen Kommunikation“⁶⁴² aus. Besonderes Augenmerk legt er hierbei aber auf die Weiterführung von Bultmanns Ansatz der existentialen Interpretation als Reflexion auf das Vorverständnis als der notwendigen Möglichkeitsbedingung des Verstehens, in der durch „die Identität des Interpreten“⁶⁴³ der hermeneutische Verstehenszusammenhang fundamentaltheologisch und -anthropologisch bestimmt werde:⁶⁴⁴ Da Exegese und Hermeneutik nicht nur Glaubenslehre, sondern gleichsam eben die „Lebensform des Glaubens in der Phase des Urchristentums“⁶⁴⁵ zum Gegenstand haben, sei die „kategoriale Bestimmung der allgemeinen, wesentlichen und dauernden Momente des Menschseins“⁶⁴⁶ notwendig, um den Verstehenszusammenhang zwischen Verfassenden und Rezipierenden herzustellen. Dementsprechend sei das Auslegen und Verstehen der Bibel nie voraussetzungslos, sondern vollziehe sich immer im religiösen Einverständnis mit dem in ihr mitgesetzten schöpfungstheologisch fundierten Wirklichkeits- und Wahrheitsverständnis.⁶⁴⁷ In diesen „kategorialen Bestimmungen des menschlichen Daseins“⁶⁴⁸ liege dann auch die Verbindung der exegetischen Theologie zu den anderen theologischen Disziplinen.
637 Vgl. ebd., 132. 638 Vgl. ebd., 133. Dementsprechend liege für Stock die Einheit des Kanons auch in dem „Geschehen [begründet], das das Glaubenszeugnis der Bibel in seiner synchronen und diachronen Vielfalt ermöglicht und provoziert hat“ (ebd., 169) – in „Gottes je besonderem Offenbar-Werden.“ Ebd., 170. 639 Vgl. ebd., 134 f. 640 Vgl. ebd., 154. 641 Vgl. ebd., 157. 642 Vgl. ebd. 643 Ebd., 162. Hervorhebung C. N. 644 Vgl. ebd., 158 ff. 645 Ebd., 163. Hervorhebung C. N. 646 Ebd., 164. Hervorhebung C. N. 647 Vgl. ebd., 165. 648 Ebd., 172.
5.2 Theologische „Zugriffe“
269
Historische Theologie, hier also Kirchengeschichte, reflektiere auf die „Möglichkeit und die Notwendigkeit einer Geschichtserkenntnis und Geschichtsschreibung aus der Sicht des Glaubens“,⁶⁴⁹ also aus der Perspektive der christlichen Wahrheitsgewissheit und deren Wirklichkeitsverständnisses. Stock steigt hier ein mit einer theologischen Historik, also einer epistemischen Reflexion auf den Geschichtsbegriff aus Perspektive des Glaubens,⁶⁵⁰ um darauf aufbauend „historiographische Grundsätze der Kirchengeschichte“⁶⁵¹ und deren Bedeutung für Theologie insgesamt zu entwickeln. Geschichte sei als das „Zeitbewußtsein“⁶⁵² freier Menschen auf Wirklichkeit und Möglichkeit zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft selbst schon eine fundamentalanthropologische Deutekategorie, die sich im Wechselspiel zwischen Historizität, Weltanschauung und Weltgestaltung individuell und sozial konstituiere.⁶⁵³ Christlicher Glaube, als eine spezifische Form der religiösen Weltanschauung, vollziehe sich immer in solchen historisch-soziokulturellen Kontexten und sei demnach ein wesentliches Merkmal allen Geschichtsverstehens.⁶⁵⁴ Die Funktion einer theologischen Historik zwischen diesen Ankerpunkten liege für das Gesamte der Theologie – als Reflexion auf das angemessene Verstehen der Bedingtheit menschlicher Handlungsmacht –⁶⁵⁵ in der Besinnung auf die historische Wirkung der christlich-religiösen Weltanschauung und -gestaltung. ⁶⁵⁶ Die Spezifität der Kirchengeschichte bestehe dabei in ihrem heuristischen Gegenstandsbezug auf die Kirche als religiösem Kommunikations- und Traditionsprozess in wechselseitigem Verhältnis zu ihrer jeweiligen historisch-soziokulturell spezifischen Umwelt – und dem damit verbundenen kirchenleitenden Interesse.⁶⁵⁷ „[D]ie Mitglieder dieser Glaubensgemeinschaft hinsichtlich ihres Geschichtsbewusstseins zu beraten“⁶⁵⁸ und so zu mündigen Kirchen- und Weltmitgliedern werden zu lassen, sei die positiv-theologisch zentrale historische Kompetenz. Durch diese Steigerung des Bewusstseins der Geschichtlichkeit des eigenen christlichen Wahrheits- und Wirklichkeitsverständnisses befähige Kirchengeschichte gleichsam „zur Diagnose der Gegenwart, die zugleich prognostischen Sinn
649 650 651 652 653 654 655 656 657 658
Ebd., 182. Vgl. ebd., 183 – 191. Ebd., 182. Ebd., 183. Vgl. ebd., 183 – 191. Vgl. ebd., 189 f. Vgl. ebd., 190. Vgl. ebd., 181. Vgl. ebd., 193 ff. Ebd., 173.
270
5 Wie fragt Theologie?
hat.“⁶⁵⁹ Kirchengeschichte sei somit die Struktur- und Interaktionsgeschichte der christlichen Wahrheitsgemeinschaft in ihren historisch-soziokulturellen Kontexten. Auch die Funktion der Systematischen Theologie liege – für den Gesamtzusammenhang positiver Theologie – in der Steigerung der „religiösen Mündigkeit der Einzelnen und der Bildung ihrer eigenen Überzeugung“.⁶⁶⁰ Als das „organisierende Zentrum der Theologie“⁶⁶¹ habe sie die freiheitlich-positionell wissenschaftlichdiskursive⁶⁶² Aufgabe, den Wahrheitsanspruch christlichen Glaubens in seinen Inhalten und seiner „Lebensdienlichkeit“⁶⁶³ evident zu machen und so die „Sprachund Urteilsfähigkeit“⁶⁶⁴ in Bezug auf öffentliche Kommunikationssituationen der Kirche zu schärfen.⁶⁶⁵ Durch das hier wieder anklingende, im Glauben genuin mitgegebene Wechselverhältnis zwischen Weltanschauung und Weltgestaltung bestehe auch ein de facto nicht trennbarer Zusammenhang zwischen Dogmatik und Ethik. Dogmatik, als die Frage nach der „gegenwärtigen Wahrheit oder Angemessenheit“⁶⁶⁶ dieser öffentlichen religiösen Kommunikation bemühe sich also um das Welt orientierende „Verstehen der Wirklichkeit“⁶⁶⁷ aus Perspektive des Glaubens. Die materialen Topoi der Dogmatik ranken sich dementsprechend – ausgehend vom theologischen Gegenstandsbezug des geoffenbarten, lebenswirksamen Wahrheitsbewusstseins – um vier basale „Gedankenkreise“:⁶⁶⁸ der Gotteserkenntnis bzw. -lehre, der Ontologie und Anthropologie, der Soteriologie und Christologie und der Eschatologie.⁶⁶⁹ Da mit diesem Verstehen der Wirklichkeit unter dem Vorzeichen eines universalen christlichen Wahrheitsbewusstseins auch immer der Anspruch der Kommunikabilität seiner lebensdienlichen Tragfähigkeit und Anknüpfbarkeit einhergehe, sei Dogmatik grundlegend bezogen auf situative religiöse Praxis.⁶⁷⁰ Dadurch fungiere Dogmatik als „Rahmentheorie der Ethik“.⁶⁷¹ Die Kompetenz der theologischen Ethik liege dann darin, „zum Leben des Glaubens in konkreter, substantieller Sittlichkeit“⁶⁷² anzuleiten – denn mit dem
659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672
Ebd., 207. Ebd., 211 f. Ebd., 212. Vgl. ebd., 220. Ebd., 211. Ebd., 212. Vgl. ebd., 219 f. Ebd., 226 f. Ebd., 227. Ebd., 237. Vgl. ebd., 238 – 244. Vgl. ebd., 233. Ebd., 237. Ebd., 245.
5.2 Theologische „Zugriffe“
271
Lebenssinn des Glaubens gehe immer auch der Anspruch an eine bestimmte Lebensführung einher: Das christliche Ethos kennzeichne sich durch die offenbarte Grundmaxime, im Einklang mit dem Schöpferwillen Gottes zu sein.⁶⁷³ Als reine bzw. kategoriale Ethik nimmt sie dann auch ihren Ausgang in einer fundamentalanthropologischen Bestimmung menschlichen Daseins und Handelns durch schöpfungsmäßig-relatives Freiheitsbewusstsein. ⁶⁷⁴ Diese geoffenbarte Bestimmung zu weltgestaltender Freiheit komme im synoptischen Doppelgebot der Liebe als ihrer „Grund-Norm“⁶⁷⁵ zum Ausdruck. Aus dieser leite sich – gleichsam als methodischer Aufbau einer theologischen Ethik – die Frage nach den normierend-normativen Gütern, den gemeinschaftlichen Pflichten und den der schöpfunsgmäßigen Bestimmung menschlicher Existenz entsprechenden Tugenden ab.⁶⁷⁶ Indem Stock so die relativ-freiheitliche Verantwortlichkeit des sittlichen Person-Seins in den Versöhnungs- und Vollendungswillen Gottes des Schöpfers zur Gemeinschaft mit allen Menschen einzeichnet, kann er auf Grundlage dieser ethischen Methodik die Frage nach der Ordnung der Gesellschaft als den Rahmen der einzelnen Bereichsethiken in sein System eingliedern.⁶⁷⁷ Die Leitlinie in allen Bereichen, das christliche Ethos, sei dann immer wieder das „Leitbild der christlichen Lebensführung“⁶⁷⁸ auf Grundlage des christlichen Lebenssinns in seinem Wirklichkeitsverständnis und Wahrheitsbewusstsein. (In der Logik dieser Arbeit) besonders an Stocks Ausführungen zur Systematischen Theologie sind seine in diesem Kontext zwischen- und nachgeschalteten Ausführungen zur Notwendigkeit einer der Dogmatik und Ethik vorangehenden eigenständigen Prinzipienlehre – und einer darüber stehenden Fundamentaltheologie als einem kunstfertigen Moment der gesamten Theologie. Die Aufgabe der Prinzipienlehre bestehe in der Frage nach den epistemischen Bedingungen von Dogmatik und Ethik „aus der Besinnung auf den Geschehenszusammenhang […], dem sich die Wahrheitsgewißheit des Glaubens verdankt.“⁶⁷⁹ Sie reflektiere also grundlegend auf die Erkenntnisbedingungen und -vollzüge des Systematische Theologie betreibenden Subjekts und auf das diesem vorausgehende Offenbarungsgeschehen seiner Glaubensgewissheit. Als solche gehe sie den eigentlichen dogmatischen und ethischen Reflexionsvollzügen voraus. Fundamentaltheologie hingegen frage nach der „Verantwortung des Glaubens im Hinblick auf das Fun-
673 674 675 676 677 678 679
Vgl. ebd., 247. Vgl. ebd., 250 f. Ebd., 252. Vgl. ebd., 253 – 263. Vgl. ebd., 263 – 267. Ebd., 267. Ebd., 228.
272
5 Wie fragt Theologie?
damentale“,⁶⁸⁰ das für Stock im „Evident-Werden [der Glaubens‐] Wahrheit im Selbst der Person“⁶⁸¹ liege. Es gehe ihr also um die (apologetisch nach innen und nach außen angefragte)⁶⁸² Wahrhaftigkeit christlicher Glaubensreflexion. Als solche sei sie – analog zu seinen oben angeführten Ausführungen zum Gegenstand der Theologie – eine „Hermeneutik der Faktizität des Daseins“,⁶⁸³ die sich durch alle theologischen Disziplinen ziehe. Fundamentaltheologie sei also keine eigenständige systematisch-theologische Disziplin, sondern vielmehr eine theologische „Kunstlehre des Argumentierens“.⁶⁸⁴ Stock schließt seine enzyklopädische Konzeption mit der Praktischen Theologie ab. Habe Theologie als positive Wissenschaft insgesamt die praktische Aufgabe, Glauben im lebensweltlichen Alltag zu erhalten und zu fördern,⁶⁸⁵ bestehe der spezifische Auftrag der Praktischen Theologie als (Schleiermacherische) Technik ⁶⁸⁶ darin, „allgemeine Regeln der Kommunikation“⁶⁸⁷ auf Basis der Erkenntnisse der historischen und systematischen Disziplinen zu entwickeln. Denn zur Leitung einer Wahrheitsgemeinschaft im Sinne eines spezifischen Traditions- und Kommunikationsprozesses sei sie um der „sachgemäßen Bestimmung der menschlichen Praxissituation“⁶⁸⁸ willen grundlegend angewiesen auf ein geschärftes Geschichtsbewusstsein und innere Wahrheitsgewissheit des Leitungsamtes, um den „Austausch des [je] frommen Selbstbewußtseins“⁶⁸⁹ der Kirchenmitglieder in innerer und äußerer Pluralität in institutionellen Formen zu leiten. Und da die Förderung des Glaubens auch über die Grenzen der Kirchlichkeit hinausgehe,⁶⁹⁰ müsse Praktische Theologie in ihrer kommunikativen Kompetenz bei der Entwicklung, Anwendung und Einübung ihrer Regeln der Kommunikation auf eine dementsprechende anthropologische und soziokulturell-situative Angemessenheit achten. Diese Regeln der Kommunikation zielen – vor dem Hintergrund der „Bildungsbedürftigkeit des
680 Ebd., 269. 681 Ebd., 272. 682 Vgl. ebd., 268 f. 683 Ebd., 274. 684 Ebd., 271. 685 Vgl. ebd., 276.280. 686 Vgl. ebd., 279. 687 Ebd., 219. 688 Ebd., 275. 689 Ebd., 283. 690 „So gibt die [Schleiermacherische] Metapher der [Praktischen Theologie als] Krone [der Theologie] anschaulich zu verstehen, daß die Praktische Theologie das Einwirken auf das gegenwärtige Leben der Mitglieder der Glaubensgemeinschaft in ihrer Gesellschaft und für ihre Gesellschaft zum Gegenstand hat und daß sie eben deshalb auf eine schwer zu erfassende Weise verästelt und verzweigt ist.“ Ebd., 289.
5.2 Theologische „Zugriffe“
273
Menschen“⁶⁹¹ in schöpfungsmäßig-relativer Freiheit – auf Basis „personale[r] Identität“⁶⁹² letztlich auf die Überlegung ab, wie die „Wahrheitsgewißheit des Glaubens […] innerhalb einer individuellen Bildungsgeschichte menschlich möglich wird.“⁶⁹³ Abgerundet wird die enzyklopädische Orientierung Stocks mit einer grundlegenden Reflexion über das Ziel von Theologie als Wissenschaft insgesamt, das im Bilden der theologischen Identität ihrer Subjekte liege. Mit dieser Formel bezeichnet Stock hier die „innere Bedingung eines Menschen […], der sich zum Studium der Theologie und zur Ausübung eines theologischen Berufes hingezogen fühlt.“⁶⁹⁴ Es gehe ihm hier also grundlegend um die innere Haltung von Theologietreibenden,⁶⁹⁵ um das theologische Ethos.⁶⁹⁶ Als positive Wissenschaft in der Perspektive des Glaubens und mit dem Ziel der Ausbildung von kommunikativer Kompetenz sei eine reflektierte und eigenständige Frömmigkeitspraxis aller Theolog*innen ⁶⁹⁷ auf Basis ebendieser Wahrheitsgewissheit des Glaubens notwendig für eine kontinuierliche Selbstvergewisserung des darin enthaltenen christlichen Wahrheits- und Wirklichkeitsverständnisses. In dieser theologischen Haltung verankere sich die „kommunikative Kompetenz kirchlichen Handelns“.⁶⁹⁸ Theologische Identität entstehe somit im Wechselspiel zwischen intersubjektiver Rationalität und individueller Spiritualität, denn: „[d]ieses Studium ist das eigene Leben.“⁶⁹⁹ 5.2.4.1 Zwischenbilanz Stocks enzyklopädische Orientierung über die Wissenschaft der Theologie eignet sich nicht nur material durch ihren wissenschaftstheoretischen Inhalt, sondern vor allem auch formal aufgrund der Spezifität des hier vollzogenen theologischen Ansatzes für eine nun resümierend-konstruierende Analyse unter dem Aspekt der herausgearbeiteten Fragestellung der Theologie in religionspsychologisch-anthropologischer Fokussierung. Ausgehend von der vor allem durch die Rezeption
691 692 693 694 695 696 697 698 699
Ebd., 299. Ebd. Ebd. Ebd., 309. Vgl. ebd., 311. Vgl. ebd., 309. Vgl. ebd., 314. Ebd., 319. Ebd., 7.
274
5 Wie fragt Theologie?
Schleiermachers⁷⁰⁰ bestimmten spezifisch religionspsychologischen Fundierung menschlicher Erkenntnisprozesse im Bewusstsein des erkennenden Subjekts entwickelt Stock in seiner Monografie einen Theologiebegriff, der in seinem positiven Praxisbezug und seiner enzyklopädischen Ausgestaltung immer wieder auf genau diese bewusstseinstheoretisch basierte Subjektivität rekurriert. Indem er also Wissenschaft und Erkenntnis grundlegend fundamentalanthropologisch bestimmt, kann er diese wissenschaftstheoretische Grundlegung auf sein Verständnis von Theologie als Wissenschaft zuspitzen. Dabei wird dann aber nicht Theologie als ein erkenntnistheoretischer Sonder- oder Spezialfall von Wissenschaft entwickelt, sondern vielmehr Theologie zur Grundlagenwissenschaft der Reflexion auf ebendiesen historisch-soziokulturell positionellen Welt- und Selbstbezug aller wissenschaftlichen Erkenntnisprozesse erklärt: Denn alle Wissenschaft beruhe – als Praxis tätiger Individuen – auf den Bedingungen, die das Selbst- und Weltbewusstsein dieser Individuen bestimmen. Somit sei Theologie die Wissenschaft, die in der Perspektive des Glaubens als einem spezifischen Wirklichkeitsverständnis auf genau diese Zusammenhänge reflektiere. Dementsprechend stehe sie – wie alle Wissenschaft – im wechselseitigen Verhältnis zum sozialen Handeln und zur Gesellschaft als Tätigkeit Welt-gestaltender Individuen. Wissenschaft und Theologie seien dementsprechend nicht getrennt zu denken von Ethik und/bzw. Ethos. Denn gerade christlicher Glaube impliziere nicht nur einen bestimmten Lebenssinn, sondern eben auch eine spezielle Lebensform – beides spiegele sich im Verständnis und Vollzug von Theologie wieder. Als Gegenstand der Theologie entwickelt Stock entsprechend dieser subjektivbewusstseinstheoretischen Positionalität einen Wesensbegriff des Christentums, der sich über die religiöse Innenperspektive der Wahrheitsgewissheit christlichen Glaubens definiert. Diese Wahrheitsgewissheit sei dadurch als christlich-religiös bestimmt, als dass sie sich dem religiösen Subjekt als gegebene Selbstoffenbarung des Schöpfergottes als soteriologische Bestimmung des Mensch-Seins in der Welt erschließt. Theologie als Wissenschaft bewegt sich dann als Reflexion in und auf dieses Wahrheits- und Wirklichkeitsverständnis, indem sie das Phänomen der christlichen Gewissheit in Geschichte und Gegenwart im Fächerkanon ihrer historisch-kritischen, systematischen und praktischen Subdisziplinen auf das christliche Selbstverständnis, seine Geschichtlichkeit und seine damit einhergehende Bedeutung für Gesellschaft in Geschichte und Gegenwart aus der Perspektive dieser Gewissheit heraus zu verstehen sucht. In dieses Verständnis von Glaube und
700 Als Begründer einer spezifischen Form von Religionspsychologie als Grundlagenwissenschaft. Vgl. Huxel, Kirsten, Psychologie, in: Ohst, Martin (Hg.), Schleiermacher Handbuch (Handbücher Theologie), Tübingen 2017, 285 – 290, 285 ff.
5.3 Theologie disziplinär
275
Theologie als einem spezifischen In-der-Welt-Sein religiös bestimmter Subjekte zeichnet Stock die Positivität von Theologie als bezogen auf theologische Berufe ein – mit dem Ziel der Ausbildung der kommunikativen Kompetenz für ebendieses Inder-Welt-Sein. Damit kennzeichnet sich diese Ausbildung dann in ihrer religionspsychologisch-anthropologischen Stoßrichtung nicht als ein Wissens- und Technikerwerb, sondern als das kontinuierliche und nie abgeschlossene Ein-Leben einer theologischen Identität. Stocks hier noch einmal zusammengefassten Ausführungen können somit exemplarisch auf zentrale Aspekte eines spezifisch religionspsychologisch-anthropologischen Zugriffs auf Theologie – hier beispielhaft auf die Wissenschaftstheorie und Enzyklopädie der Theologie – hin resümiert werden. Unter der hier vollzogenen Konstruktion lässt sich dann auf wissenschaftstheoretischer Meta-Ebene in der Logik des dritten Kapitels dieser Arbeit folgende Formulierung als Fragestellung von Theologie in religionspsychologisch-anthropologischem Zugriff aufstellen: Theologie in religionspsychologisch-anthropologischer Fokussierung fragt nach dem Selbstbewusstsein christlicher Individuen in Geschichte und Gegenwart als Glauben, indem sie auf die Möglichkeitsbedingungen und Handlungsimplikationen dieses Bewusstseins in konstruktiver Analyse ihrer historischen und soziokulturellen Positionalität reflektiert und so christliches Wirklichkeits- und Wahrheitsverständnis in Geschichte und Gegenwart darlegt.
5.3 Theologie disziplinär Analog zur disziplinären Konzeption von Religionswissenschaft in Kapitel 4.3. sollen im Folgenden nun die Analysen der zwei wissenschaftstheoretisch-metatheoretischen Ebenen des theologischen Diskurses, also die Enzyklopädie und die Zugriffe aus 5.1. und 5.2., zu einem konzeptuellen Begriff von Theologie als Disziplin konstruierend zusammengeführt werden. Es wird also der Versuch unternommen, die disziplinäre Binnenlogik des theologischen Diskurses in seinen Subdisziplinen zusammen mit den maßgeblichen praxeologischen Zugriffen in ein System von Theologie als Disziplin zu bringen, indem – auch hier wieder dem Gedankengang der Fragestellung aus Kapitel 3 folgend – nach den zentralen gemeinsamen Erkenntnisinteressen, Strukturen und Forschungsabsichten dieser zwei unterschiedlichen Diskursebenen des theologischen Forschungsbegriffs gesucht wird. Daran schließen sich logisch Betrachtungen der daraus folgenden methodologischen und epistemischen Konsequenzen für Theologie an.
276
5 Wie fragt Theologie?
5.3.1 Das innerdisziplinäre System der Theologie So ist zunächst vor dem Hintergrund der in 5.1. angerissenen formal-enzyklopädischen Frage herauszustreichen, dass die einzelnen Subdisziplinen der Theologie sich zwar im Laufe der Fachgeschichte immer weiter voneinander emanzipiert und systemisch sowohl inter- als auch innerdisziplinär ausdifferenziert haben − und dennoch aber durch die Verortung innerhalb der Diskursstruktur der Theologie in wechselseitiger ideell struktureller Verbundenheit und Abhängigkeit zueinander stehen. Als verbindendes Element der Fächer zueinander kann auf wissenschaftstheoretischer Meta-Ebene – wie oben schon angedeutet wurde – der theologisch spezifische Zusammenhang zwischen (Lebens‐) Welt und wissenschaftlichem Vollzug angesehen werden, der sich im Falle der Theologie (wie bereits angerissen und unter 5.3.2. noch näher auszuführen) mit dem Aspekt der christlichen Glaubenspraxis umreißen lässt. Diese Glaubenspraxis selbst steht, als weltdeutender und -gestaltender Vollzug religiöser Individuen und Gemeinschaften, in historischer und soziokultureller Relativität – und ist für die Disziplin der Theologie sowohl lebensweltlicher Kontext als auch wissenschaftlich-praxeologischer Zielfokus. Durch ihren Charakter als Wissenschaft allgemein, v. a. aber durch jenen die Identität des Diskurses markierenden Welt-Wissenschafts-Zusammenhang – Glaubenspraxis in historisch-soziokultureller Relativität – zeichnen sich die sechs (bzw. potentiell sieben) Fächer des theologischen Kanons sowohl in ihrem Gegenstandsbezug als auch in ihrer Methodologie und dann auch in ihren verschiedensten positionell-fachlichen und -fachgeschichtlichen Strömungen und Akzentuierungen selbst durch hohe historische und soziokulturelle Relativität und Dynamik aus. Dadurch, dass Theologie genau auf diesen Zusammenhang reflektiert, ergibt sich auf subdisziplinärer und praxeologischer Ebene eine gewisse innerdisziplinär-logische Struktur, die sowohl die einzelnen Subdisziplinen zueinander in Bezug setzt, als auch die innerhalb dieser subdisziplinären Spektren agierenden gemeinsamen Herangehensweisen verdeutlicht. So scheint summa summarum, vor dem Hintergrund der oben getätigten Analysen, der innerdisziplinäre Vollzug sowohl in den sechs (bzw. eben sieben) Fächern als auch quer dazu in den Zugriffen durch eine sich also aus der Spezifität des Welt-Wissenschafts-Bezugs (der Glaubenspraxis in seiner historischen und soziokulturellen Relativität) ergebenden metatheoretischen Trias aus – begrifflich so weit wie möglich zu verstehenden – historischen, systematischen und praktischen Momenten ⁷⁰¹ zu gestalten; und zwar sowohl als immer wieder Impuls gebendes
701 Mit diesen drei Begriffen wird auf keinerlei Weise auf die methodologischen Selbstzuschrei-
5.3 Theologie disziplinär
277
Erkenntnisinteresse, als auch als den Erkenntnisprozess dann entsprechend leitendes Strukturmerkmal. Gemeint sei damit im hier Folgenden, dass sich auf beiden Ebenen, also quer durch alle Subdisziplinen und durch alle vier Zugriffe diese drei Momente ziehen: Erstens das Moment der historischen Reflexivität, die als solche nicht nur historische Quellen etc. als materiale Basis hat, sondern für die eine historische Kontextualisierung bzw. das Bewusstsein für historische Relativität sowohl auf quellentechnisch-materialer als auch auf forschungsprozesslich-formaler und -praktischer Ebene genuin zum theologisch-wissenschaftlichen Vollzug dazugehört.⁷⁰² Genauso zeichnen sich alle Disziplinen und Zugriffe zweitens durch ein das historisch relative Datenmaterial ordnendes systematisches Moment aus, indem nämlich in Anwendung bestimmter (je nach subdisziplinärer und/oder praxeologischer Fragestellung verschiedentlich material gefüllter) Heuristika das historischreflexiv generierte Datenmaterial gleichsam geordnet wird – und das forschungsprozesslogisch gedacht auch wiederum sowohl als Forschungsimpuls und -absicht, als auch als den Prozess gestaltende Struktur. Und drittens findet sich – maßgeblich durch den wechselseitigen (Lebens‐) Weltbezug des theologischen Forschungsprozesses selbst – in allen Subdisziplinen und Zugriffen ein praktisches Moment: Indem nämlich christliche Glaubenspraxis in Geschichte und Gegenwart sowohl Impuls als auch metatheoretisch verstandener Zielfokus des historisch-systematischen Arbeitens ist.⁷⁰³ Wichtig ist an dieser Stelle anzumerken, dass diese drei Momente von Theologie aus binnendisziplinärer und praxeologischer Ebene nicht in einer Chronologie oder Hierarchie zu verstehen sind, sondern sich – aufgrund des zirkulären Zusammenhangs zwischen Forschung(‐sprozess) und Welt(‐bezug) – in wechselseitiger Durchdringung und Abhängigkeit zueinander stehen; und das wieder forschungsprozesslogisch sowohl auf materialer als auch auf struktureller Ebene. Damit ist Theologie selbst als Diskurs in sich historisch, systematisch und praktisch, was sich im Einzelnen – bei aller jeweiligen Fokussierung auf eine subdisziplinäre
bungen abgehoben, die innerhalb der jeweiligen exegetisch- bzw. historisch-kritischen, systematischen und praktischen Subdisziplinen als eben methodologische Fokussierungen genannt werden. Mit dem historischen Moment der theologischen Gesamtdiskursstruktur ist also nicht dasselbe gemeint wie das, was z. B. innerhalb der Kirchengeschichte als „historisch“ auf methodologischer Ebene verhandelt wird. 702 Vgl. Alkier, Das Neue Testament, 47. Vgl. auch Gemeinhardt, Geschichte, 100. 703 Vgl. auch Albrecht, Christian, Die Praktische Theologie im Gesamtzusammenhang der Theologie, in: Ders./Gemeinhardt, Peter (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und außen, Tübingen 2021, 157– 173, 168.
278
5 Wie fragt Theologie?
Fragestellung innerhalb des theologischen Diskurses – auch an jeder einzelnen Teildisziplin des Sechsfächerkanons⁷⁰⁴ aufzeigen lässt.⁷⁰⁵ Im Kontext der Alttestamentlichen Wissenschaft liegt die Trias des historischen, systematischen und praktischen Moments in der historisch-kritischen Forschung an den Text(schicht)en und Quellen des Alten Testaments und seiner Umwelt, eingebunden in den „Interpretationsrahmen“⁷⁰⁶ christlicher Glaubenspraxis in Geschichte und Gegenwart: Das historische Moment alttestamentlicher Forschung liegt augenscheinlich in ihrem materialen und formalen Bezug auf verschiedenste Quellen und deren historisch-kritischen Einordnung – inklusive der damit wechselwirksam einhergehenden epistemischen und methodologischen Implikationen. Systematisch ist dieses Fach insofern, als dass jene Quellen – wie das bei historischkritischer Arbeit epistemisch der Fall ist – unter Anwendung formaler und/oder materialer Heuristika (wie z. B. bestimmter religions-, form- oder gattungsgeschichtlicher Kategorien, unter Reflexion auf den Begriff des Kanons, unter der Frage nach „Israel“ etc. pp.) in Bezüge gestellt und somit in verschiedene formale und/oder materiale Kontexte eingestellt werden. Praktisch ist diese Subdisziplin aufgrund des oben angesprochenen Interpretationsrahmens insofern, als dass ebenjene (Umwelt‐) Texte etc. theologisch-diskurslogisch gedacht deswegen erforscht werden (also sowohl im Sinne des Forschungsimpulses als auch des Zielfokus), weil sie zum großen Kontext der Traditions- und Rezeptionslinie christlicher Religionspraxis gehören. Ähnlich lässt sich das Verhältnis der drei Momente theologischen Arbeitens auch in Bezug auf die Neutestamentliche Wissenschaft konzeptualisieren: Als eine in ihrem Selbstverständnis explizit historisch-kritische Teilnehmerin am theologischen Diskurs forscht sie durch den grundlegenden Bezug auf (Text‐) Quellen der Religion des Urchristentums und seiner Umwelt in formal- und material-historischer Reflexivität ebendieser Quellen und Kontexte. Dabei kommen systematisch formale und/oder materiale Heuristika (wie z. B. Leitbegriffe wie Religionsgeschichte, Urchristentum, Neues Testament, Kanon, Theologie des Neuen Testaments etc. pp.) zur Anwendung. Und praktisch fragt sie aus und in den durch die Quellen (als dessen Zeugnis) freigelegten Großkontext christlicher Glaubenspraxis heraus und hinein. Auch Kirchengeschichte, als wie in 5.1.1. angerissene methodisch historischkritische, inhaltlich formalprinzipielle Erforschung des wie auch immer im einzelnen material festgelegten Bezugssbereichs christlicher Glaubenspraxis in ihrer 704 Im Folgenden wird von Fundamentaltheologie als eigenständiger theologischer Subdisziplin abgesehen und sich am Standard-Sechsfächerkanon der Theologie orientiert. 705 Materiale und argumentative Basis der folgenden Argumentationen sind also immer die Analysen aus 5.1. 706 Saur, Alttestamentliche Wissenschaft, 58. So schon zitiert in Kapitel 5.1.1.
5.3 Theologie disziplinär
279
Geschichte, zeigt im Prozess die drei Momente theologischen Arbeitens auf. Historisch ist auch sie – ähnlich wie die exegetischen Disziplinen in relativ augenfälliger Weise – insofern, als dass das Erkenntnisinteresse in Bezug auf geschichtliche Ereignisse und (in forschungslogisch wechselseitiger Abhängigkeit) anhand entsprechender geschichtlicher Quellen sowohl formal als auch material bestimmend ist für den Vollzug des Forschens. Das systematische Moment dieses Forschens liegt dann ebenfalls wieder in dem methodologisch-epistemischen Ausgangsinteresse und Zielfokus des Ordnens dieses historischen Prozesses und seiner Materialien und Ergebnisse anhand bestimmter formaler und materialer Heuristika (die sich, wie oben aufgezeigt, im Falle der Kirchengeschichte maßgeblich um die Füllung ihres Bezugssbereichs ranken). Praktisch ist auch diese Disziplin wiederum durch den theologisch-diskurslogischen reflexiven Bezug (sowohl im Sinne eines vor-/ wissenschaftlichen Kontextes als auch im Sinne der eigenen Zielstellung der Forschung) auf die historisch relative, partikulare und in sich plurale Genese und Konstitution des Christentums bzw. christlicher Glaubenspraxis in ihren verschiedenen Institutionalisierungs- und Lebensformen als einer historisch vorfindlichen Religion bzw. Religiosität in Geschichte und (als Diskurskontext eben auch) Gegenwart. Gerade auch in Bezug auf Systematische Theologie lässt sich die Trias der drei Momente ebenfalls aufschlüsseln, wenngleich es sich an dieser Stelle nun der Nachvollziehbarkeit halber anbietet, die Reihenfolge der Betrachtung zu ändern. So ist das systematische Moment allein schon nominell (und auch vor dem Hintergrund der Ausführungen in 5.1.1.) relativ evident: Als formale Reflexion auf die identitätsstiftenden Glaubensvollzüge christlicher Religiosität in Denken und Handeln sind es genau die dann jeweils angewandten formalen und materialen Heuristika („Glaube“, „christliche Gewissheit“, „Religion“ usw. usf.), unter denen solche Glaubenspraxis als Weltdeutung und -gestaltung in Geschichte und Gegenwart systemisch untersucht wird. Daraus erschließt sich geradezu in einem Atemzug die historische Reflexivität der Systematischen Theologie: Denn weil Glaubenspraxis im weitesten Sinne sich innerweltlich vollzieht und gleichsam auf Welt bezogen ist, also in soziokulturellen und historischen Kontextualitäten steht, ist diese Praxis historisch relativ und dynamisch. Systematische Theologie, die auf die Genese, Gestalt und Funktion von christlichem Glauben im wechselseitigen Zusammenhang von Denken und Handeln christlicher Individuen in spezifischen soziokulturellen Kontexten reflektiert, kann sich also forschungsprozesslogisch nur unter der sowohl formalen als auch materialen Bezogenheit auf historische Quellen solcher historisch-soziokulturell relativen Glaubenspraxis vollziehen – mit allen dazu wechselwirksam stehenden epistemischen und methodologischen Konsequenzen. Ebenso erschließt sich daraus das praktische Moment ihres theologischen Subdiskurses: Im Bezug auf Glauben als lebensweltlichem Diskurskontext und formal-
280
5 Wie fragt Theologie?
wissenschaftlichem Gegenstandsbereich ihrer Reflexionen ist Systematische Theologie grundlegend ausgerichtet auf das Phänomen christlicher Religiosität von Individuen in Kontexten und spezifischen Institutionalisierungen – sowohl als ihrem lebensweltlichem Kontext, als auch als ihrem metatheoretischen Zielfokus. Ähnlich lassen sich die drei Momente innerhalb der Praktischen Theologie (einfacher durch eine Veränderung der Betrachtungsreihenfolge) veranschaulichen. So ist das praktische Moment im Sinne einer Fokussierung auf christliche Glaubenspraxis in Geschichte und Gegenwart sowohl als Impuls als auch als metatheoretischer Zielfokus durch den expliziten formalen und materialen Bezug der Subdisziplin auf religiöse Praxis als ihrem Gegenstandsbereich und Zielfokus besonders deutlich. Gleichzeitig ist – ebenfalls ähnlich wie zum Vorherigen – evident, dass durch diese Bezogenheit das Moment der sowohl formalen als auch materialen historischen Reflexivität gleichsam mitgegeben ist. Denn auch hier ist die historischsoziokulturelle Relativität und Dynamik solcher Glaubenspraxis sowohl Gegenstand als auch Kontext der Forschungstätigkeit, was sich ebenfalls wieder sowohl epistemisch als auch methodisch im Bezug auf solche Glaubenspraxis erforschbar machende historische Quellen zeigt. Dass sich eine solche Erforschung religiöser Praxis gleichsam in Anwendung bestimmter formaler und materialer Heuristika (wie z. B. „Praxis“, „Kirche“, „evangelisch“, „Kirchenleitung“, „Theorie der Praxis“, „empirisch“, „Kultur“, „Theologie“, …) als systematisches Moment vollzieht, schließt sich daran denklogisch an. Diese Analyse der drei Momente innerhalb der Subdisziplinen des theologischen Sechsfächerdiskurses lässt sich abschließend auch anhand der Interkulturellen Theologie/Missionswissenschaft vollziehen. Hier liegt ebenfalls das praktische Moment ihres Arbeitens relativ offenkundig vor Augen: Durch die subdisziplinäre Fragestellung nach religiöser historisch-soziokulturell relativer und dynamischer, multi-dimensional pluraler Glaubenspraxis in historisch-soziokulturell relativen und dynamischen interkulturellen und -religiösen Interaktionen ist ihre formale und materiale Bezogenheit auf ebenjene religiöse Praxis als sowohl lebensweltlicher Kontext als auch selbstreflexiver Zielfokus ihres Forschens evident. Dass dabei gleichsam bestimmte Heuristika („Religion“, „Kultur“, „Dialog“, „Mission“, „deskriptiv/normativ“, …) systematisch zur Anwendung kommen, erschließt sich aus dem Interesse der Einordnung solcher Interaktionen in die multidimensionale Netzstruktur interreligiöser und -kultureller Begegnungen. Dadurch, dass sie ihrem Selbstverständnis nach dabei gleichsam grundlegend empirisch-deskriptiv zu arbeiten hat, um diesen historisch-soziokulturellen Dynamiken und Relativitäten überhaupt gerecht werden zu können, und eben durch ihren formalen und materialen Bezug auf christliche Glaubenspraxis, vollzieht sie sich in sowohl formaler als auch materialer historischer Reflexivität.
5.3 Theologie disziplinär
281
Diese Trias aus sowohl formalen als auch materialen praktischen, systematischen und historischen Momenten lässt sich nun gleichsam auf praxeologischer Ebene anhand der vier in Kapitel 5.2 herausgearbeiteten Zugriffe aufzeigen. Beginnend mit dem Beispiel der historisch-begrifflichen Art des Theologietreibens, wie es in Aspekten exemplarisch anhand der Monografie Albrechts konstruiert wurde, kann auch hier der innere Zusammenhang der drei Momente nachvollzogen werden: In der historisch verantworteten, akribischen Arbeit an Quellen (sowohl als methodologischer als auch als epistemischer Leitlinie) und unter Anwendung des heuristischen Programmbegriffs des Protestantismus, der nicht nur der Systematisierung des Datenmaterials, sondern auch als wesentlicher Faktor der eigenen prinzipientheologisch-theoretischen Reflexion dient, und der sich aus dem Wechselverhältnis zu dieser historischen Herangehensweise und heuristischen Reflexivität ergebende Bezug auf die Praxis protestantischer, faktisch gelebter Religion als sowohl Gegenstand als auch Zielfokus werden diese theologischen Kernmomente⁷⁰⁷ metatheoretisch explizit. In dieser prinzipientheoretischen Selbstreflexion in Verbindung mit der historisch kontextualisierten gegenwartsanalytisch-kulturdiagnostischen Stoßrichtung zeigt sich Theologie als historischer, systematischer und praktischer Diskurs in kulturwissenschaftlicher Fokussierung. Ähnlich kann der empirisch-sozialtheoretische Zugriff, wie er anhand von Theißens Veröffentlichung konstruiert wurde, auf diese Trias hin resümiert werden. In der methodologisch sozial- und kulturwissenschaftlich fokussierten Frage nach christlicher Religionspraxis als einem kulturellen System in historisch-soziokultureller Kontextualität sind die drei Momente des Theologietreibens geradezu intrinsisch gegeben. Die formale und materiale historische Reflexivität zeigt sich im forschungsprozesslichen Bezug auf die Kontextualität in Geschichte, Strukturen und Bedingungen (ur‐) christlicher Religionspraxis sowohl epistemisch als auch methodologisch. Indem dabei diese Religionspraxis als ein kulturelles, sinnstiftend orientierendes Zeichensystem betrachtet wird, kommen gleichsam semiotische und sozialtheoretische Heuristika nicht nur zum Einsatz, sondern bedingen auch wiederum den Forschungsprozess selbst. Und durch genau diesen Bezug auf dieses Zeichensystem als einem sozialen Handeln, also in seinen mikro- und makrosozialen Strukturen, Implikationen, Konsequenzen und Kontextualitäten zeigt sich das der Theologie inhärente praktische Moment als Forschungsimpuls und -ziel. Der hermeneutisch-religionsphilosophische Ansatz, wie er anhand von Markschies Buch herausgestellt wurde, trägt ebenfalls diese Trias in sich. Mit dem expliziten Impetus, gegen einseitige Hierarchisierungen bzw. Marginalisierungen in
707 „Denn die Theologie ist als ganze praktisch, so wie sie auch als ganze historisch verfährt und systematisch.“ Albrecht, Historische Kulturwissenschaft, 324. So schon zitiert in 5.2.1.
282
5 Wie fragt Theologie?
Bezug auf anthropomorphe Gottesvorstellungen durch historisch-kritische Quellenbelege zu argumentieren, zeigt sich die forschungsprozessliche Wechselseitigkeit der drei theologischen Momente. In Anwendung des Begriffs des Anthropomorphismus als sowohl metatheoretisch formale und in Bezug auf die Auswahl und Analyse der Quellen materiale heuristische Deutekategorie und unter Reflexion auf die soziokulturell-historische Kontextualität sowohl der Forschungsgegenstände als auch des Forschungsprozesses selbst vollzieht sich solche hermeneutisch-religionsphilosophisch verfahrende Theologie im deutlichen Bezug auf die lebensweltliche Religionspraxis – wieder als Forschungsimpuls und -ziel. Am Beispiel Markschiesʼ wurde dies anhand seiner theo-logischen Grundabsicht deutlich, auf Basis biblischer Gottesvorstellungen zu einem differenzierteren Umgang mit der Frage nach der Körperlichkeit Gottes zu kommen: Denn durch das wechselseitige Verhältnis von Gotteslehre und Anthropologie, wie es sich eben auch in den heiligen Schriften des Christentums finden lasse, stehe diese Frage im direkten Zusammenhang mit der christlichen Religionspraxis – in Geschichte und in Gegenwart. Letztlich zeigen sich die drei theologischen Momente auch im religionspsychologisch-anthropologischen Zugriff, wie er anhand der Monografie Stocks exemplarisch dargestellt wurde. Theologie als wissenschaftliche Reflexion auf Glauben als einem spezifischen Aspekt „menschlichen In-der-Welt-Seins“,⁷⁰⁸ also als „Theorie der christlichen Gewißheit“⁷⁰⁹ gestaltet sich hier insofern in methodologisch-epistemischer historischer Reflexivität, indem auf ebendieses christliche Wahrheitsbewusstsein und Wirklichkeitsverständnis in seiner soziokulturell-historischen Relativität geschaut werde und somit ein historisches Moment allen theologischen Subdisziplinen zu Eigen ist (wie oben ja auch bereits ausgeführt wurde). Durch diese subjektivitätstheoretisch und ontologisch normierte Heuristik vollzieht sich solche historische Reflexivität gleichsam unter dem Vorzeichen des systematischen Moments, nämlich insofern eben, als dass die innerreligiöse Wahrheitsgewissheit des Glaubens in aller lebensweltlichen und forschungsprozesslichen Positionalität zum formal und material heuristisch-normierenden Wesensbegriff des Christentums wird. Und genau in diesem Bezug auf christliches Wirklichkeits- und Wahrheitsverständnis in Geschichte und Gegenwart wird das praktische Moment theologischer Forschung deutlich – wieder sowohl als lebensweltlicher Forschungsimpuls als auch als Ziel von Theologie selbst. Es scheint sich also, diese kurzen Überlegungen abschließend, noch einmal deutlich zu zeigen, dass die (lebens‐) weltliche Kontextualität des in soziokultureller und historischer Relativität stehenden christlichen Glaubens als Weltdeutung und
708 Stock, Die Theorie, IX. So schon zitiert in 5.2.4. 709 Ebd., 5. So schon zitiert in 5.2.4.
5.3 Theologie disziplinär
283
Gestaltung die Diskursstruktur evangelischer akademischer Theologie material und formal, epistemisch und methodologisch grundlegend bedingt. Denn durch diesen wechselseitigen Welt-Wissenschafts-Zusammenhang vollzieht sich Theologie als Reflexion auf (so weit wie möglich zu verstehenden) christlichen Glauben, der eben nicht nur ihr Gegenstandsbereich, sondern auch ihr historisch-soziokultureller Lebensweltimpuls ist, sowohl in binnendisziplinärer als auch in praxeologischer Perspektive mit – jeweils im konkreten Vollzug unterschiedlich dominanten, aber immer aufgrund der wechselseitigen Abhängigkeit voneinander mindestens latent bzw. implizit mitlaufenden – Momenten der historischen Reflexivität, der Systematik und der Praxis bzw. des Praxisbezugs. Damit geht also eine weitreichende Interpretation des Glaubensbegriffs als Diskursstrukturmerkmal und Lebensweltimpuls einher. Um das noch deutlicher vor Augen zu führen, soll im nun folgenden Kapitel kurz auf die epistemischen und methodologischen Konsequenzen dieser Interpretation eingegangen werden.
5.3.2 Methodologische und epistemische Konsequenzen Dass christlicher Glaube eine wie auch immer näher zu fassende starke wissenschaftstheoretische Bedeutung für den Vollzug theologischer Erkenntnisprozesse zu haben scheint, war – spätestens seit der Aufklärung⁷¹⁰ – immer schon Angriffspunkt für Argumentationen gegen die Wissenschaftlichkeit der Theologie. ⁷¹¹ Nicht nur dass Glaube als vorwissenschaftlicher soziokultureller Faktor der Positionalität der theologischen Forschungssubjekte in vermeintlich augenfällig hoher Quantität vorzukommen scheint,⁷¹² sondern gerade auch seine sowohl außer- als auch in-
710 Siehe zu den Grundzügen der historischen Entwicklung der Gegenstandsbereiche der Theologie Kapitel 2.2. und dann zu den wissenschaftstheoretischen Implikationen dieser Entwicklung Kapitel 3.2. dieser Arbeit. Vgl. zur Historie des Vorwurfes der unwissenschaftlichen Voraussetzungshaftigkeit von Theologie Pannenberg, Wissenschaftstheorie, 259 ff. 711 „Die Theologie hat in der europäischen Geistesgeschichte das eigentümliche Schicksal erlebt, von der Königin der Wissenschaften […] herabzusteigen bis zum Zustand der Anfechtung ihres wissenschaftlichen Charakters überhaupt. […] [T]rotz aller Zugeständnisse, die seitens der Theologie gemacht sind, beherrscht auch jetzt noch weite Kreise bei dem Wort ‚Theologie‘ und bei dem Begriff ‚Theologische Fakultät‘ das Gefühl, es mit einer nicht ganz reinlichen Wissenschaft zu tun zu haben, sondern mit einem Gemisch von Wissenschaft und unbegründbarem, subjektivem Glauben.“ Tillich, Theologie, 2. Vgl. dazu auch Herms, Das Selbstverständnis, 382 – 384. 712 Wenngleich diese Behauptung erstens einer empirischen Überprüfung bedürfe und aber zweitens gleichsam dogmatisch-theologisch gedacht (wissenschaftstheoretisch-paradoxer Weise) nicht überprüfbar zu sein scheint.
284
5 Wie fragt Theologie?
nertheologische Bemühung als wissenschaftstheoretisches Differenzkriterium⁷¹³ von Theologie als eigenständigem akademischem Fach haben diese Angriffsposition noch unterstützt.⁷¹⁴ Im Kontext eines zwar neuzeitlich-modernen post-positivistischen, aber immer noch von naturalistischen und empiristischen Reminiszenzen geprägten Wissenschaftsverständnisses⁷¹⁵ scheint es einen grundlegenden Widerspruch zwischen Glauben als epistemisch einflussreichem Positionalitätsfaktor und intersubjektivüberprüfbaren wissenschaftlichen Erkenntnisprozessen zu geben. Dahinter scheint die nicht neue Grundannahme zu stehen, dass Glaube – als mindestens rational unverfügbares, wenn nicht gar gegen alle Rationalität stehendes religiöses Geschehen – und wissenschaftlich-redliche Vernunft sich auf so unterschiedlichen Ebenen vollziehen, dass eine den Maßgaben der intersubjektiven Überprüfbarkeit angemessene Verhältnissetzung dieser beiden Aspekte menschlicher Welt- und Wirklichkeitsverständnisse nicht durchführbar sei. Um nun also genauer die wissenschaftstheoretischen Implikationen und Funktionen des Faktors Glauben für die Diskursstruktur wissenschaftlicher (bzw. wissenschaftlich ambitionierter) Theologie eruieren zu können, muss im Folgenden grundlegend auf die Frage nach dem formalen und materialen Gehalt des Postulats der Intersubjektivität von Wissenschaft und dem dieses dann eben fördernden oder behindernden vorwissenschaftlichen Faktor Glauben eingegangen werden, bevor dann überzeugend auf die Funktion von Glauben im theologisch-wissenschaftlichen Diskurs reflektiert werden kann.⁷¹⁶
713 Vor allem zur Religionsphilosophie, aber eben – wie bereits in Kapitel 3.2. schon angemerkt wurde – auch maßgeblich zur Religionswissenschaft. Vgl. zu ersterem z. B. Tillich, ST I, 15 – 18. 714 Zumal an dieser Stelle natürlich offengelegt werden muss, dass es einen nicht unbeachtlichen Teil innertheologischer Positionen gab und gibt, für die diese These der Unwissenschaftlichkeit der Theologie entweder kein Problem oder aber auch einfach kein Thema darstellt. Paradigmatisch dafür dürfte immer noch Barth sein: „Es würde aber an dem, was sie zu tun hat, nicht das Geringste ändern, wenn sie als irgendetwas anderes denn gerade als ‚Wissenschaft‘ zu gelten hätte. Keinesfalls folgt aus der Tatsache, daß sie als solche gilt und auch wohl zu gelten beansprucht, die Verpflichtung, sich mit Rücksicht auf das, was sonst ‚Wissenschaft‘ heißt, in ihrer eigenen Aufgabe stören und beeinträchtigen zu lassen.“ Barth, KD I,1, §§ 1 – 7, 6. Wie aber in der Einleitung im ersten Kapitel dieser Arbeit schon dargelegt wurde, beschränken sich die hier getätigten Analysen, Systematisierungen und Konstruktionen auf Theologie, die Mitspielerin im wissenschaftlichen Diskurs sein will und sich also auch an die Spielregeln dieses Diskurses zu halten hat. Vgl. dazu klassischerweise Foucault, Michel, Die Ordnung des Diskurses. Mit einem Essay von Ralf Konersmann, Frankfurt a. M. 12 2012, 22, aber auch ebd., 34 f. 130 f. 715 Vgl. dazu einführend z. B. Tetens, Wissenschaftstheorie, 66.70 f.117 716 Vgl. Nagel, Theologie, 217– 223. Glaube wird im hier Folgenden in explizit fundamentaltheologischer Fokussierung untersucht, also in Hinblick auf seine erkenntnis- und wissenschaftstheore-
5.3 Theologie disziplinär
285
Intersubjektive Überprüfbarkeit als Idealkriterium von Wissenschaft lässt sich grob zwischen zwei Polen eines Bedeutungsspektrums interpretieren. Auf der einen Seite steht das Verständnis von Intersubjektivität wissenschaftlicher Erkenntnisse bzw. deren Gewinnung im Sinne der Subjektinvarianz. Damit ist grundlegend gemeint, dass Erkenntnisprozesse und ihre Ergebnisse dann wissenschaftlich sind, wenn sie in ihrer Durchführung sowohl formal (also z. B. in Bezug auf angewandte Wissenschaftssprache oder Theoriemodelle) als auch material (z. B. in Bezug auf die benutzten Daten, Instrumente, Quellen etc.) so wiederholbar sind, dass – unabhängig vom forschenden Subjekt – immer die gleichen Ergebnisse generierbar sein müss(t)en.⁷¹⁷ Dahinter lässt sich leicht die ontologische Grundannahme von wissenschaftlichen Ergebnissen als subjektunabhängigen Entitäten vermuten. Wahr bzw. gesichertes Wissen wäre dann also wissenschaftlich gesehen nur das, was unabhängig von Situation und Forschungssubjekt gelte. Intersubjektivität als Idealkriterium bedeutet hier also eine größtmögliche Ausschaltung des Wechselverhältnisses von der Positionalität des Forschungssubjekts und des Forschungsprozesses, indem die unterschiedlichen positionellen Bedingtheiten zwar nicht unbedingt unterbunden, in ihrer epistemischen Wirkmacht aber mindestens „ausbalanciert“⁷¹⁸ werden. Auf der anderen Seite des Bedeutungsspektrums steht ein Verständnis von intersubjektiver Überprüfbarkeit, bei dem der epistemische Einfluss dieser grundlegenden Positionalität von Forschung und Person nicht so weit wie möglich ausgeschaltet, sondern als eben epistemischer Faktor integrativ reflektiert werden soll. Intersubjektivität entsteht dann wiederum durch die Offenlegung der den Forschungsprozess beeinflussenden epistemischen und methodologischen vorwissenschaftlichen und forschungsprozesslichen Faktoren, also auch den soziokulturellen Vor-/Bedingungen des forschenden Subjekts – sowohl in ihrem Gehalt als auch in ihrem forschungspraktischen Einfluss. Durch diese Anerkennung der epistemischen Wirkmacht der Positionalität – also der Bedingtheit des Forschungsprozesses durch das forschende Subjekt bei gleichzeitiger Bedingtheit des forschenden Subjekts durch den Forschungsprozess – nicht als im schlimmsten Falle Ergebnisse verbiegende Fehlerquelle, sondern als genuiner Bestandteil aller menschlichen Erkenntnisprozesse (und dann eben auch desjenigen der Wissenschaft), entsteht Intersubjektivität dann eben nicht durch Ausbalancieren, sondern durch Anerkennung der epistemischen Konsequenzen der unhintergehbaren Subtischen Implikationen. Von einer explizit dogmatischen und/oder ethisch-theologischen Füllung wird an dieser Stelle abgesehen. 717 Vgl. Schwemmer, Oswald, Art. Intersubjektivität, in: EPhW 2 (1984), 282 – 284, 282 f. Vgl. gerade auch Popper, Karl, Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf, Hamburg 41998, 50 – 57. 718 Carrier, Wissenschaftstheorie, 43.
286
5 Wie fragt Theologie?
jektbezogenheit von Erkenntnis.⁷¹⁹ Darin liegt dann (idealiter) kein (ontologischer oder forschungspraktischer⁷²⁰) Relativismus, der Forschungsergebnisse bzw. deren Richtigkeit den jeweiligen Positionalitätsfaktoren unterwirft, sondern eigentliche erkenntnis- und forschungsprozessliche Redlichkeit. Und gerade darin zeigt sich diese positionelle Intersubjektivität dann – sowohl als Anerkennung als auch vorwissenschaftliche Vereinbarung der unhintergehbaren Perspektivität bzw. Aspektivität von Wissenschaft – als ein objektives epistemisches Kriterium für wissenschaftliche Erkenntnisprozesse,⁷²¹ weswegen sogar, wenn man denn so wollte, von einem gewissen internen Realismus von Wissenschaft ⁷²² gesprochen werden könnte: Die Realität bzw. Wahrheit von Erkenntnissen kann nur innerhalb bestimmter epistemischer vor-/wissenschaftlicher Rahmenbedingungen – sowohl des forschenden Individuums als auch der Scientific Community als auch des Forschungsprozesses als Tätigkeit selbst – verhandelt werden. Diese Logik auf subjektiver, intersubjektiver und prozessualer Ebene gilt grundsätzlich für alle menschlichen Erkenntnisprozesse,⁷²³ ergo auch und gerade für Wissenschaft. Je nachdem wo man sich nun im Bedeutungsspektrum des Ideals der Intersubjektivität bzw. intersubjektiven Überprüfbarkeit befindet, wird das gewisse epistemisch-logische Konsequenzen für die Bewertung des soziokulturellen Positi-
719 „Es gibt Grundprinzipien der Erkenntnistheorie, die einem im Bewußtsein gegenwärtig bleiben müssen. Das Objekt kann nur begriffen werden durch einen ersten Schritt des Subjekts, es kann nur erkannt werden durch das Erfassen und Begreifen des Subjekts.“ Clavier, Henri, Wiederaufbruch eines Methodenproblems in der Religionsgeschichte (1968), in: Lanczkowski, Günter (Hg.), Selbstverständnis und Wesen der Religionswissenschaft (WdF 263), Darmstadt 1974, 272 – 302, 279. 720 Gerade auf praxeologischer Ebene sei an dieser Stelle daran erinnert, dass auch bzw. gerade bei Anerkennung der Positionalität aller Forschung ja dennoch ein – zwar soziokulturell bedingtes, aber eben auch immer wieder kontextuell auszuhandelndes – wissenschaftliches Ethos existiert, das ermöglicht, zwischen grundanthropologischen epistemischen Faktoren und dem Einfluss prozessfremder Einflüsse zu differenzieren. So z. B. im Falle der Hermeneutik: „Die Forderung, daß der Interpret seine Subjektivität zum Schweigen bringen, seine Individualität auslöschen müsse, um zu einer objektiven Erkenntnis zu gelangen, ist also die denkbar widersinnigste. Sie hat Recht und Sinn nur, sofern damit gemeint ist, daß der Interpret seine persönlichen Wünsche hinsichtlich des Ergebnisses der Interpretation zum Schweigen bringen muß […]. […] Sonst aber verkennt jene Forderung das Wesen echten Verstehens schlechterdings. Denn diese setzt gerade die äußerste Lebendigkeit des verstehenden Subjekts, die möglichst reiche Entfaltung seiner Individualität voraus.“ Bultmann, Das Problem, 230. Hervorhebung C. N. 721 Vgl. Tetens, Wissenschaftstheorie, 85 f. 722 Vgl. Stegmüller, Wolfgang, Evolutionäre Erkenntnistheorie, Realismus und Wissenschaftstheorie, Spaemann, Robert/Koslowski, Peter/Löw, Reinhard (Hg.), Evolutionstheorie und menschliches Selbstverständnis. Zur philosophischen Kritik eines Paradigmas moderner Wissenschaft (Civitas Resultate 6), Weinheim 1984, 5 – 34, 20 f. 723 Vgl. dazu auch (anders, aber ähnlich) Peukert, Wissenschaftstheorie, 268.
5.3 Theologie disziplinär
287
onalitätsfaktors Glauben haben. Im Falle einer Interpretation von Intersubjektivität im Sinne von Subjektinvarianz gehörte Glaube zu den potentiell Forschungsergebnisse verfälschenden Einflüssen, deren epistemische Wirkmacht entweder auszuschalten oder aber mindestens auszubalancieren wäre. Solche Anforderungen an Wissenschaft werden, wie auch in Kapitel 3.1. dieser Arbeit bereits angedeutet, meistens unter dem Schlagwort des methodologischen Atheismus oder Agnostizismus ⁷²⁴ verhandelt, nach dem v. a. gewisse ontologische Gehalte religiöser Überzeugungen aus dem Forschungsprozess auszuschließen seien.⁷²⁵ Dahinter scheint dann vor allem eine Fokussierung auf ein Verständnis von Glauben als Für-wahr-Halten bestimmter intersubjektiv unüberprüfbarer (im Zweifelsfall supranaturaler) Tatsachen zu stehen. „Bei diesem Verständnis gerät Glaubenserkenntnis unter vornehmlicher Fixierung auf ihren besonderen ‚Gegenstandʻ in einen Sonderbezirk gegenüber Erfahrung und wissenschaftlicher Erkenntnis aller Art. Glaube wird zunächst einmal in seinem Vollzug unabhängig von Vernunft, Welt, Wirklichkeitsverstehen und Erfahrung gesehen.“⁷²⁶ Inwiefern ein solches sozusagen material-epistemisches Glaubensverständnis die wesentlichen Aspekte eines christlich-religiösen Selbstverständnisses trifft, sei an dieser Stelle wieder grundsätzlich angezweifelt und wird im Folgenden auch noch kurz genauer ausgeführt werden. Doch selbst wenn die Forderung nach methodologischem Atheismus/Agnostizismus in Verbindung mit differenzierteren Glaubensdefinitionen (wie z. B. als Beziehungsgeschehen, Gewissheitsempfinden o. ä.) erhoben wird, zeigt sich eine grundsätzliche ontologische Aporie: Die Forderung nach dem Ausschalten bzw. Ausbalancieren gewisser religiös-weltanschaulicher Grundgehalte ist nicht vereinbar mit dem gleichsam postulierten Anspruch der intersubjektiven Überprüfbarkeit im Sinne einer wie auch immer gearteten weltanschaulichen Neutralität. ⁷²⁷ Denn
724 Vgl. Tetens, Wissenschaftstheorie, 117. 725 Solches findet sich auch in innertheologischen (Selbst‐) Reflexionen: „Die alttestamentliche Wissenschaft ist für sich genommen keine theologische Wissenschaft. Sie ist den üblichen wissenschaftlichen Standards verpflichtet und pflegt deshalb auch in ihren exegetischen Vollzügen einen methodischen Atheismus.“ Schmid, Die Wissenschaft, 39. (Konrad Schmid macht in diesem Aufsatz die Theologizität der alttestamentlichen Wissenschaft an ihrer diskursiven Verortung und Teilhabe am theologischen Gesamtdiskurs und einer darin mitgegebenen sozusagen hermeneutischen Fragestellung nach der Bedeutung ihres empirisch-historischen Gegenstandes fest. Vgl. ebd.) 726 Petzoldt, Sola scriptura, 19. 727 Zumal die Forderung nach methodologischem Atheismus/Agnostizismus in u. a. interkultureller bzw. rassismuskritischer und postkolonialer Perspektive hochgradig problematisch ist. Den Gedanken der weltanschaulichen Neutralität scheinen sich nur hochgradig privilegierte, sozusagen nicht-markierte Personen leisten zu können. „[T]he stark separation of nonconfessional from confessional studies of religion imposes its own worldview on scholars while claiming to be neutral.
288
5 Wie fragt Theologie?
auch und gerade methodologisch-atheistische oder agnostische Positionen implizieren mindestens ein spezifisches vorwissenschaftliches ontologisch-metaphysisches Grundverständnis⁷²⁸ von (wissenschaftlich erkennbarer) Welt und Wirklichkeit.⁷²⁹ Mit anderen Worten: Es gibt erkenntnistheoretisch kein Nicht-Verhalten zur Ontologie – und damit auch keine (nicht mal gedacht idealiter) erreichbare APositionalität. Eine normative Unterscheidung zwischen religiösen und nicht-religiösen Positionalitätsfaktoren im Sinne einer epistemischen Abwertung ersterer funktioniert dann nur, wenn (in diesem Falle) christlich-religiöser Glaube als von allen anderen Positionalitätsfaktoren grundsätzlich verschieden und intersubjektiv inkommunikabel anzusehen ist. Auch das entspräche dann aber wieder einer vorwissenschaftlichen ontologisch-anthropologischen Grundannahme und wäre dann auch wieder kein Nicht-Verhalten zu im Grunde metaphysischen Fragen. Im Falle des Ansatzes der intersubjektiven Überprüfbarkeit im Sinne einer proaktiven Anerkennung der genuinen Positionalität aller wissenschaftlichen Erkenntnisprozesse bestünde die Chance, den epistemischen Positionalitätsfaktor Glauben als solchen wahrzunehmen – und gerade dadurch einer gesteigerten transweltanschaulichen intersubjektiven Überprüfbarkeit zuzuführen. Dadurch bestünde also wissenschaftslogisch auch nicht mehr die metatheoretische Forderung nach einem methodologischen Atheismus/Agnostizismus der Wissenschaft, da Weltanschauungen und religiöse Faktoren als gleichermaßen in ihren Wirkungen auf den Forschungsprozess transparent zu machend angesehen werden. Auch eine atheistische Grundhaltung wäre dann den gleichen Anforderungen der proaktiven Anerkennung des epistemischen Einflusses unterworfen wie eine christlich-religiöse Haltung zu Welt und Wirklichkeit. Damit sich diese Anforderung der Transparenz nicht zu einem unendlichen Regress permanenter Aktualisierung der eigenen Positionalität karikiert, wird es von Bedeutung sein, nur diejenigen Aspekte bestimmter Positionalitätsfaktoren der intersubjektiven Überprüfung zuzuführen, die tatsächlich bzw. höchstwahrschein-
[…] [Some scholars] suggest that what is sometimes called methodological atheism forces all scholars who pursue work outside of theology and ethics to separate their academic work from the rest of their lives. Given that more white people than people of color are atheists, some have also pointed out that methodological atheism may privilege the perspectives of white scholars and marginalize scholars of color and those from the Global South/Global East.“ Wilcox, Melissa, M., Queer Religiosities. An Introduction to Queer and Transgender Studies in Religion, Lanham/Boulder/New York/ London 2021, 13. 728 „Die Ontologie ist kein spekulativer oder phantastischer Versuch, eine Welt hinter der Welt aufzubauen; sie ist eine Analyse jener Gestalten des Seins, denen wir in jedem Zusammentreffen mit der Wirklichkeit begegnen. Das war auch der ursprüngliche Sinn von Metaphysik“. Tillich, ST I, 29. 729 Z. B. im Falle naturalistischer Grundannahmen: „Der Naturalismus ist die zur Metaphysik erhobene Wissenschaft.“ Tetens, Wissenschaftstheorie, 91.
5.3 Theologie disziplinär
289
lich Einfluss auf den Forschungsprozess haben. Damit einher geht dann grundsätzlich die hohe wissenschaftsethische Anforderung an die forschende Person, sich der Struktur, dem Gehalt und den Implikationen der eigenen Positionalitätsfaktoren immer wieder bewusst zu werden. Im Falle von evangelischer Theologie gehörte dazu also wahrscheinlich dann eine konsequente Auseinandersetzung damit, was das epistemisch Wesentliche des Glaubens und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Positionalität wissenschaftlicher ⁷³⁰ Erkenntnisprozesse sind. Die vorliegende Arbeit vertritt offenkundig ein Verständnis von intersubjektiver Überprüfbarkeit, das eher an dem Ende des Spektrums hin zu einem Ansatz der epistemisch-proaktiven Integration der Positionalitätsfaktoren in den Forschungsprozess liegt. Dementsprechend soll im hier Folgenden der Faktor Glaube genau daraufhin und in seinen wissenschaftstheoretischen Implikationen für den theologisch-wissenschaftlichen Fächerdiskurs als Forschungsprozess untersucht werden. Dadurch wird nun also im Grunde genau das exemplarisch vollzogen, was eben als Transparenzanforderung vorgestellt wurde. Es ist also mit dem hier⁷³¹ zugrundeliegenden Verständnis des epistemisch Wesentlichen des christlichen Glaubens einzusteigen, bevor im Anschluss dann eben die Konsequenzen für die Positionalität wissenschaftlicher Theologie ausgeführt werden können. Dabei ist nun zunächst zu konstatieren, dass in dieser Arbeit von einem relationalen Glaubensverständnis ausgegangen wird; von christlichem Glauben als einem inter-/subjektiven, die Welt- und Wirklichkeitswahrnehmung und -gestaltung der betroffenen Personen auf Mikro- und Makroebene⁷³² maßgeblich bestimmenden Beziehungsgeschehen: „Christlicher Glaube ist in seinem Grund ein Geschehen, das sich zwischen zwei Personen abspielt. Er ist somit – vom glaubenden 730 D. h. dann also auch, dass die verschiedenen vor-/wissenschaftlichen Anforderungen und Vereinbarungen zu den Kriterien wissenschaftlicher Erkenntnisse (z. B. im Sinne der Merton’schen Ideale wissenschaftlicher Praxis o. ä.) diesen Prozess der Selbstaktualisierung der eigenen Positionalität strukturieren: Die Implikationen bspw. christlichen Glaubens werden in Bezug auf ihren positionellen Einfluss auf wissenschaftliche (nicht auf politische, juristische, religiöse, …) Erkenntnisse eruiert. 731 Die vielfältigen Möglichkeiten der Definition von dem, was christlichen Glauben wesentlich ausmacht, können an dieser Stelle gar nicht umfassend dargestellt werden – und sind vor dem Hintergrund des hier angewandten positionellen Wissenschaftsverständnis auch gar nicht gefragt. Dennoch ist zu betonen, dass der Verfasserin die Spezifität ihres Glaubensbegriffs auf wissenschaftstheoretischer Ebene vollends bewusst ist. Gleichzeitig steht dieser Glaubensbegriff natürlich in gewissen theologischen Traditionslinien. Exemplarisch für die Pluralität von Glaubenstheorien sei verwiesen auf die Habilitationsschrift von Heiko Schulz, in der er eine am englischsprachigen Raum orientierte Typisierung von Glaubenstheorien in drei Grundtypen (Eliminativismus, Reduktionismus und Nonreduktionismus) aufmacht. Vgl. Schulz, Heiko, Theorie des Glaubens (RPT 2), Tübingen 2001, 139 f. 732 Vgl. Peukert, Wissenschaftstheorie, 346.
290
5 Wie fragt Theologie?
Menschen her betrachtet – das befreiende Geschehen des vertrauensvollen SichEinlassens auf die bedingungslose Zuwendung Jesu Christi, in der Gott offenbar wird. […] Christlicher Glaube muß deshalb von seinem Grund her in der Kategorie des personalen Vertrauens verstanden werden.“⁷³³ Ähnlich zu fundamentalen zwischenmenschlichen Beziehungen prägt solcher Glaube das Weltbild des Individuums und der Gemeinschaft von Individuen in Denken und Handeln, so dass es – im Laufe der religionsgeschichtlichen Entwicklung – zur Ausbildung einer „Erfahrungs- und Interpretationstradition“⁷³⁴ kommt, die wiederum sowohl die Welt- und Wirklichkeitsverständnisse der glaubenden Individuen prägt, als auch durch diese bestimmt ist. Glaube als geoffenbarte, also sich dem religiösen Subjekt existentiell erschließende ⁷³⁵ Form der Existenz,⁷³⁶ als „Leben aus Gewißheit“⁷³⁷ über „Ursprung, Wesen und endgültige Bestimmung des Menschen“⁷³⁸ stellt also eine historisch-soziokulturell⁷³⁹ bestimmte Art, die Welt zu sehen und zu gestalten dar⁷⁴⁰ und kommt somit auch zu – in jeweiligen spezifischen soziokulturellen Kontexten eingebetteten ⁷⁴¹ – Aussagen über Welt und Wirklichkeit:
733 Petzoldt, Matthias, Glaube und Wissen. Marginalien zu einer marxistischen Diskussion, in: Ders., Christsein angefragt. Fundamentaltheologische Beiträge, Leipzig 1998, 121 – 144, 139. Hervorhebung C. N. Damit ist im Kontext dieser Arbeit noch nichts über die sozusagen ontologische Füllung des Personenbegriffs gesagt. Entscheidend ist an dieser Stelle, dass Glaube – inklusive der beteiligten Akteur*innen – nicht unter substanzontologischer Füllung, sondern in Reflexion auf seine epistemische, hier sprechakttheoretisch fundierte Bedeutung für das glaubende Subjekt betrachtet wird. 734 Dalferth, Ingolf U., Religiöse Rede von Gott (BevT 87), München 1981, 472. 735 Vgl. Herms, Eilert, Wahrheit – Offenbarung – Vernunft, in: Ders., Phänomene des Glaubens. Beiträge zur Fundamentaltheologie, Tübingen 2006, 96 – 115, 108 f. „Offenbarung ist, gerade weil der Begriff selbst schon religiösen Deutungen zugehört, nicht etwas, was diesen Deutungen zugrunde liegt bzw. ihnen vorausgeht, sondern was ihnen selbst schon zugehört: als Deutungskategorie. Dasjenige Dasein, das sein Leben religiös deutet, greift auf den Terminus ‚Offenbarung‘ zurück.“ Wendel, Saskia, Christliche Selbstdeutungen im Spiegel religiöser Pluralität, in: Könemann, Judith/Seewald, Michael (Hg.), Wandel als Thema religiöser Selbstdeutung. Perspektiven aus Judentum, Christentum und Islam (QD 310), Freiburg i. Br. 2021, 272 – 285, 283. Hervorhebung C. N. 736 „Religiöse Selbst- und Weltdeutungen beziehen sich somit auf den konkreten Existenz- und Handlungsvollzug des Daseins, aus dem sie entspringen, und sie sind selbst schon ein konkreter Existenzvollzug, eine Lebenspraxis bzw. Lebensform.“ Ebd., 277. Hervorhebung C. N. 737 Herms, Das Selbstverständnis, 380. 738 Ebd., 381. 739 Vgl. Wendel, Christliche Selbstdeutungen, 276. 740 Vgl. ähnlich auch Dalferth, Religiöse Rede, 471 f. 741 „Bereits die Konstitution des Glaubens ist kontextuell bedingt, weil die je eigene Lebensgeschichte derjenige Kontext ist, in dem die Zusage des Glaubens Bedeutung gewinnt und verstanden wird. Insofern die Theologie Teil an der Wahrnehmung des Glaubens hat, ist ihr die Kontextualität
5.3 Theologie disziplinär
291
„Glaube setzt nicht nur die emotional-intuitive Seite des Bewußtseins frei, sondern auch den Willen, auch das theoretische Denken. […] Glaube führt zu Aussagen, die […] nicht nur die Reflexionen zwischen Person und Person wiedergeben, sondern die auch Reflexionen über das Verhältnis von Mensch zu Mitwelt, zur Welt der Dinge formulieren. […] Glaube in diesem umfassenden Sinne öffnet also das Bewußtsein auch zur theoretischen Erkenntnis der Welt: Glaube öffnet zum Wissen.“⁷⁴² Dadurch besteht ein epistemischer Zusammenhang zwischen Glauben und Wahrheit als Strukturbegriffen ⁷⁴³ – auch und gerade wenn Glauben fundamentaltheologisch wesentlich als Beziehungsgeschehen verstanden wird.⁷⁴⁴ Glaubenswahrheiten sind dann aber eben genau wegen dieser fundamentaltheologischen Wesensbestimmung verschieden von Wahrheitsprädikationen anderer Erkenntnisprozesse – und somit also auch von dem der Wissenschaft.⁷⁴⁵ Schließlich vollziehen sich wie bereits mehrfach erwähnt alle menschlichen Erkenntnisprozesse innerhalb bestimmter, teilweise vorvereinbarter epistemischer Referenzrahmen. So gelten für den Wahrheitsgehalt der Ergebnisse wissenschaftlicher Erkenntnisprozesse⁷⁴⁶ andere Kriterien⁷⁴⁷ (wie z. B. das der Reproduzierbarkeit oder eben transweltanschaulichen intersubjektiven Überprüfbarkeit) als für Glaubenser-
eingeschrieben. Es gibt nichts, was unabhängig von der Plausibilität für das Subjekt Geltung beanspruchen kann.“ Roth, Was kann, 420. 742 Petzoldt, Glaube und Wissen, 134. Vgl. auch ebd., 139. 743 „Indem christlicher Glaube das, was ihn unbedingt angeht, und zugleich diese seine Grundbetroffenheit (unter anderem) mit dem Wort Wahrheit ausdrückt, zeigt er selbst an, dass er sich in dem gemeinsamen kulturellen Rahmen von Umgangssprache und Wissenschaftsstandards zu verstehen sucht.“ Ders., Sprache, 237. 744 Vgl. ebd., 154.160. 745 „Für die Theologie gibt es nur eine Zukunft, wenn sie zwischen Glauben und Wissen, Wirklichkeitspräsenz und gegenständlicher Wirklichkeit nicht nur unterscheidet, sondern beides strikt und kompromisslos voneinander trennt und alles vermeidet, was die Wirklichkeit Gottes in die gegenständliche Perspektive ziehen könnte.“ Fischer, Johannes, Über das Verhältnis von Glauben und Wissen. Eine Auseinandersetzung mit Jürgen Habermasʼ Genealogie des nachmetaphysischen Denkens, in: ThLZ 3/117 (2020), 316 – 346, 344. 746 „Wissenschaft ist ohne die Unterscheidung von wahr und falsch undenkbar. Die Idee der Wissenschaft wurde erst in dem Augenblick geboren, als Menschen es einer Lebensaufgabe nachdrücklich für wert befanden, systematisch herausfinden zu wollen, ob etwas tatsächlich der Fall ist oder ob sie es nur fälschlicherweise glauben. Wissenschaft steht und fällt mit ihrem Wahrheitsanspruch.“ Tetens, Wissenschaftstheorie, 18. 747 Denn grundsätzlich ist zu konstatieren, dass vor dem Hintergrund wahrheitstheoretischer Grundannahmen Wahrheit kein ahistorisch substantiell gefüllter Materialbegriff ist, sondern eher als (konsens-, kohärenz- und korrespondenztheoretisch) diskursstrukturierender Formalbegriff agiert.
292
5 Wie fragt Theologie?
kenntnisse, deren formale und materiale Wahrheitskriterien (vor dem Hintergrund des hier angewandten Glaubensverständnisses) vielmehr davon bestimmt sind, inwiefern ihre Aussagen innerhalb des Referenzrahmens von Glauben als Beziehungsgeschehen ⁷⁴⁸ konsistent und kohärent sind.⁷⁴⁹ Dementsprechend agieren Glaubensaussagen zwar epistemisch fundamental auf einer anderen Ebene als wissenschaftliche Aussagen, bedingen aber eben wie gesagt aufgrund der Welt- und Wirklichkeitswahrnehmung und -gestaltung prägenden Effekte von Glauben höchstwahrscheinlich auch die Erkenntnisprozesse anderer Referenzrahmen – damit also auch die von Wissenschaft und also auch vor allem die von akademischer Theologie. Denn als Wissenschaft⁷⁵⁰ vollzieht Theologie ihre Aussagen zwar unter dem Vorzeichen ihrer spezifischen Positionalität und dann eben auch des Faktors Glauben, aber eben innerhalb des Referenzrahmens Wissenschaft.⁷⁵¹ Gerade auch Theologische Aussagen agieren grundsätzlich auf einer anderen Ebene als Glaubensaussagen. Christlicher Glaube fungiert dabei im theologischen Fächerdiskurs sowohl als (wahrscheinlicher) Positionalitätsfaktor (unter vielen) als auch als Gegenstandsbereich ⁷⁵² von Theologie,⁷⁵³ so dass im Voll-
748 „Denn: entscheidende Voraussetzung für die Einsicht in den christlichen Glauben ist der Glaube selber, genauer: der Glaube als personaler Akt, als Geschehen der Begegnung mit Jesus als dem Christus, das Widerfahrnis seiner Zuwendung und das Sich-Verlassen auf ihn.“ Petzoldt, Glaube und Wissen, 143. 749 Eine mögliche Strukturierung und Füllung bietet hier Petzoldt: „Grundlegendes Kriterium ist, ob die fundamentale Erfahrungsgewißheit (vom personalen Grund des Glaubens betroffen zu sein) sich in der je unterschiedlichen Explikationsrichtung des Glaubens in der gegenwärtigen Wirklichkeitserfahrung (in den Lebens- und Welterfahrungen, in den Erkenntnissen der Wissenschaften usw.) als entscheidend helfend bewährt, d. h.: durchhält (= Ebene von Wahrheit als Begegnung). […] In zweiter Linie, insofern die Reflexionsebenen des Glaubens in theologischen Sätzen Ausdruck finden, kommen die weiteren Kriterien zur Geltung. So müssen sich theologische Aussagen daraufhin überprüfen lassen können: inwieweit sie mit dem im biblischen Zeugnis vergegenwärtigten Grund des Glaubens übereinstimmen (Korrespondenz); inwieweit sie sich mit anderen theologischen Aussagen des Glaubens widerspruchsfrei zusammenfügen lassen (Kohärenz); inwieweit sie für andere theologische Aussagen nachvollziehbar, verbindend und darüber auch verbindlich sein können (Konsens).“ Ders., Wahrheit als Begegnung. Dialogisches Wahrheitsverständnis im Licht der Analyse performativer Sprache, in: Ders., Christsein angefragt. Fundamentaltheologische Beiträge, Leipzig 1998, 25 – 40, 39 f. 750 Vgl. Thomas, Gottes Dasein, q 1,2. 751 „Theologische Integrität bedeutet: nicht mehr versprechen, als man halten kann; […] keine Denkfehler und Diskursvermengungen in Kauf nehmen, auch nicht in bester Absicht.“ Sauter, Zugänge, 309. 752 Vgl. als Beispiel zu einer (alternativen) epistemischen Einordnung von Glauben als Gegenstandsbereich Dalferth, Evangelische Theologie, 53 – 56. Es sei hier kurz noch einmal daran erinnert, dass sowohl Gegenstandsbereich als auch Perspektive (im Sinne von Positionalität) dann aber nicht die Differenzkriterien zu anderen Disziplinen, vor
5.3 Theologie disziplinär
293
zug des theologischen Forschungsdiskurses schon allein prozesslogisch durch die erkenntnistheoretische und materielle Reflexion auf Glauben von diesem selbst abstrahiert und so distanziert wird.⁷⁵⁴ Dadurch befindet sich Theologie epistemischwissenschaftstheoretisch in der religiösen Außenperspektive:⁷⁵⁵ „[O]hne diese Fä-
allem nicht zur Religionswissenschaft darstellen. Gerade auch Religionswissenschaft kann (so wie Theologie) unter Anwendung ihrer Fragestellung christlichen Glauben in seiner Struktur, seiner Genese, seinen Gehalten und Implikationen in Anwendung verschiedenster sozial- und kulturwissenschaftlicher Methoden untersuchen – und dabei eben im Forschungsprozess auf die Nicht-/ Wirksamkeit ihrer Positionalitätsfaktoren (wie eben auch der eigenen Nicht-/Religiosität) reflektieren. Vgl. dazu Kapitel 3.1. dieser Arbeit. Die disziplinäre Eigenständigkeit von Theologie resultiert also im Umkehrschluss auch nicht aus ihrer spezifischen Perspektivität bzw. Positionalität oder aus ihrem Gegenstandsbereich – der Positionalitätsfaktor Glaube fungiert nicht als epistemische Bedingung oder methodologische Normierung. Die Differenz von Theologie zu anderen Fachdiskursen entsteht vielmehr dadurch, dass im Zusammenspiel von Positionalität – Epistemik – Methodologie eine spezifisch theologische Fragestellung zur Anwendung kommt.Vgl. dazu Kapitel 5.5. dieser Arbeit. Dass Positionalitätsfaktoren nicht als Differenzkriterien fungieren können, liegt wiederum daran, dass – grob formuliert – Welt zwar Wissenschaft bedingt, diese aber eben nicht metatheoretisch in Disziplinen vordifferenziert. Denn eine solche wissenschaftstheoretische Differenzierung ist als Metatheorie immer eine nachträgliche Interpretation und Reflexion auf vorwissenschaftliche Bedingungen. 753 „Indem Glaube über sich selbst nach-denkt, (auf seinen Reflexionsebenen) sich zu verstehen sucht, wird er – mit Notwendigkeit – sich selbst zum Gegenstand [….]. […] Insofern christlicher Glaube auf diesen seinen Ebenen geordnet nach-denkt (wissenschaftliche Reflexion in diskursiver Sprache), kommt er zu theologischen Aussagen.“ Petzoldt, Wahrheit als Begegnung, 39. 754 Das bedeutet – vor dem Hintergrund der zum Eingang dieses Unterkapitels angedeuteten Polemik – dann eben, dass Glauben zwar ein (schon allein quantitativ) sehr wahrscheinlicher Positionalitätsfaktor von Theologie ist, aber eben keine vorauszusetzende Anforderung an das forschende Individuum sein kann. Glaube ist nur in der wissenschaftstheoretischen Retrospektive Voraussetzung, also als vorwissenschaftlicher Faktor – und keine epistemische Grundbedingung im Forschungsprozess. Vgl. ähnlich Moxter, Michael, Wozu braucht Theologie Religionswissenschaft? in: Alkier, Stefan/Heimbrock, Hans-Günter (Hg.), Evangelische Theologie an staatlichen Universitäten. Konzepte und Konstellationen evangelischer Theologie und Religionsforschung, Göttingen 2011, 262 – 291, 269. 755 Vgl. anders, aber ähnlich Wagner, Was ist, 443. Vgl. außerdem Moxter, Wozu, 278 f. Vgl. auch Wittekind, Theologie religiöser Rede, 5. So ähnlich auch schon bei Schleiermacher, der mit dem Versuch, „seine methodologische Grundposition als Theologie zu präzisieren, [sich] […] eindeutig zu einem Standpunkt im Christentum [bekennt], auf das jeweils angemessen einzuwirken ist. Er verlässt diesen Standpunkt jedoch dann, wenn er zu wissenschaftlichen Aussagen über das Wesen, sprich das wesentlich Charakteristische am Christentum als einer konkreten Religion im Reigen anderer Religionen gelangen will. Dann nimmt er einen Standpunkt über demselben ein […]. Als Bedingung der Möglichkeit sachgerechter Urteile müssen glaubensbedingte Vorurteile aus der theologischen Betrachtung vorübergehend sistiert werden […]. Man kann das durchaus als eine methodisch gebotene A-Christlichkeit bezeichnen, was Schleiermacher hier als Kunst der Theologie einfordert […].“ Mädler, Inken, Wesen oder Wahrheit? F. Schleiermachers Verhältnisbestimmung
294
5 Wie fragt Theologie?
higkeit, zum eigenen religiösen Bewusstsein reflektierend in Distanz treten zu können, lässt sich Theologie als Wissenschaft nicht leisten. Theologie ist der gebildete Umgang mit Religion“.⁷⁵⁶ Eine solche erkenntnistheoretisch-perspektivische Standortbestimmung ist dabei vor dem wissenschaftstheoretischen Hintergrund eines proaktiv trans-weltanschaulichen Intersubjektivitätsverständnisses nicht mit der Forderung nach methodologischem Atheismus/Agnostizismus gleichzusetzen, da die epistemische Wirkmacht weltanschaulicher Positonalitätsfaktoren ja gerade nicht so weit wie möglich ausgeschaltet, sondern zum Zweck der gesteigerten intersubjektiven Transparenz epistemisch integriert und damit also prozesslogisch davon abstrahiert werden muss. Theologie, die sozusagen aus Glauben (als Kontext und Faktor ihrer Positionalität) auf Glauben (als ihrem Gegenstandsbereich)⁷⁵⁷ reflektiert, kann wissenschaftstheoretisch dabei geradezu sowohl als spezifisch als auch als exemplarisch gesehen werden: Als einer der wissenschaftlichen Diskurse, die auf genau diesen Zusammenhang von Welt und Wissenschaft so reflektieren, dass sie versuchen, diese Vorwissenschaftlichkeit in ihrer Genese, ihrer Konstitution und ihren Implikationen zu verstehen.⁷⁵⁸ Nur unter diesen Vorbestimmungen könnte Theologie – im Kontext der hier zugrundeliegenden erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Vorverständnisse – redlicher Weise als metatheoretisch „reflektierende Selbstauslegung [christlichen] Glaubens“⁷⁵⁹ verstanden werden. Ihre Aufgabe besteht in Bezug auf den Positionalitätsfaktor und Gegenstandsbereich Glauben dann in der wissenschaftlichen Auslegung, also in der orientierenden Beschreibung ⁷⁶⁰ seiner Genese und Konstitution in Geschichte und Gegenwart eben als Positionalitätsfaktor und Gegenstandsbereich von Theologie, sozusagen als Beschreibung des theologisch wesentlichen Merkmals christlicher Identität in Pluralität, Partikularität und Universalität.⁷⁶¹
von Religionswissenschaft und Theologie, in: Alkier, Stefan/Heimbrock, Hans-Günter (Hg.), Evangelische Theologie an staatlichen Universitäten. Konzepte und Konstellationen evangelischer Theologie und Religionsforschung, Göttingen 2011, 292 – 299, 297. 756 Murrmann-Kahl, Michael, Zwischen Religionskritik und Fundamentalismus, in: Ders./Kubik, Andreas (Hg.), Die Unübersichtlichkeit des theologischen Studiums heute. Eine Debatte im Horizont von Schleiermachers theologischer Enzyklopädie (BRTh 21), Frankfurt a. M. 2013, 163 – 185, 183. 757 Vgl. dazu auch im Einzelnen die Ausführungen in Kapitel 5.1. und 5.2. und 5.3.1. 758 Vgl. ähnlich Herms, Das Selbstverständnis, 385 – 387. 759 Ebd., 382. Hervorhebung C. N. 760 Vgl. ders., Systematische Theologie, 20.58. Vgl. zur Grundsätzlichkeit der Orientierungsleistung von Wissenschaft allgemein ebd., 17. Vgl. als eine andere materiale Füllung der deskriptiven Aufgabe der Theologie Dalferth, Religiöse Rede, 477. 761 Vgl. zu einer Zuordnung der Pluralität und Partikularität in Bezug auf Glauben Herms, Systematische Theologie, 5 f.10 f.33.
5.4 Theologie interdisziplinär
295
5.4 Theologie interdisziplinär Analog zu den Ausführungen in Kapitel 4.4. zur Religionswissenschaft folgt nun im Anschluss an die Konzeptualisierung von Theologie als eigenständiger Disziplin der Blick auf ihre Verortung im universitären Fächerkanon, indem ihre innerdisziplinäre Logik unter dem das Vorhaben eingrenzenden Vorzeichen des Differenzkriteriums der Fragestellung aus Kapitel 3 auf ihre interdisziplinären Konsequenzen hin untersucht wird.
5.4.1 Verortung im universitären Fächerkanon: Theologie als Kulturwissenschaft Durch ihren spezifischen Welt-Wissenschaftsbezug (als Identity Marker ihrer innerdisziplinären Diskursstruktur), der maßgeblich im Positionalitätsfaktor und Gegenstandsbereich christlichen Glaubens begründet liegt, sind gewisse – sowohl formale als auch materiale – wissenschaftstheoretische Implikationen in Bezug auf das Selbstverständnis⁷⁶² so verstandener Theologie als Kulturwissenschaft ⁷⁶³ mitgegeben. „Es sind diese Strukturelemente des Glaubens […], die den Glauben zur Kultur in Beziehung setzen“.⁷⁶⁴ Denn Glaube, als spezifisch christliche, historischsoziokulturell relative Weltdeutung und -gestaltung, ist Teil⁷⁶⁵ von Kultur, also von
762 Zum theologiegeschichtlichen Kontext dieses Selbstverständnisses vgl. Nüssel, Friederike, Theologie als Kulturwissenschaft?, in: ThLZ 11/130 (2005), 1153 – 1168, 1154 – 1157. Hervorzuheben ist hier, dass die Selbstkonzeption von Theologie als Kulturwissenschaft maßgeblich in Auseinandersetzung mit der Krise der Geisteswissenschaften vollzogen wurde. Dadurch verortet sich Theologie in einer zwar spezifischen, aber zentralen Variante kulturwissenschaftlicher Programmatik. In dieser wissenschaftsgeschichtlichen Großwetterlage ist klassisch die in Kapitel 2 dieser Arbeit angerissenen Wende der Theologie hin zur Religion einzuordnen. Grundsätzlich kann ebenfalls wiederum verdeutlicht werden, dass Theologie als Wissenschaft sich nur im Kontext eben solcher Großwetterlagen vollziehen kann. Der hier in seinen Auswirkungen reflektierte Cultural Turn gehört zu einem (der maßgeblichen) Ereignisse unter vielen. 763 Vgl. zur kulturwissenschaftlichen Programmatik (deswegen auch bereits zitiert in Kapitel 4.4.) Reckwitz, Die Kontingenzperspektive, 2. 764 Schwöbel, Christoph, Glaube und Kultur. Gedanken zur Idee einer Theologie der Kultur, in: NZSTh 38 (1996), 137– 154, 144. 765 „Der Gegenstand der Theologie fällt in den beschriebenen weiten, aber dennoch wohl definierten Bereich von Kultur. Wie alle anderen […] Kulturwissenschaften behandelt auch die Theologie keineswegs das Ganze von Kultur, sondern nur einen Ausschnitt kultureller Phänomene, freilich einen vielleicht überdurchschnittlich komplexen, nämlich eine Gesamtkultur, welche im Kontext aller anderen existiert: die christliche.“ Herms, Eilert, Theologie als Kulturwissenschaft, in: Ders., Phänomene des Glaubens. Beiträge zur Fundamentaltheologie, Tübingen 2006, 432 – 454, 441.
296
5 Wie fragt Theologie?
Welterfahrung und -deutung⁷⁶⁶ – und also Teil des „Inbegriff[s] aller möglichen Spielarten menschlicher Lebensbewältigung und Lebensverständnisse, die jeweils gegenwärtig sind unter den dauernden Bedingungen von Geschichte“.⁷⁶⁷ Dementsprechend besteht aufgrund ebendieser soziokulturellen Relativität eine epistemisch formale und materiale wechselwirksame Abhängigkeit zwischen Glauben und Kultur. Analog ist auch Theologie, als das – im Sinne des vorherigen Kapitels dieser Arbeit zu verstehende – „Bemühen, christlichen Glauben auszulegen und zu verstehen“,⁷⁶⁸ nicht nur die (kultur‐) wissenschaftliche Reflexion auf den Gegenstandsbereich Glauben. Sondern als Kulturwissenschaft selbst⁷⁶⁹ ist sie – als durch ihren Positionalitätsfaktor Glauben in ihrer Struktur bedingter Diskurs – Teil von (nicht nur, aber eben maßgeblich auch christlicher) Kultur.⁷⁷⁰ Denn keine Kulturwissenschaft steht – in der wissenschaftstheoretischen Logik der kulturwissenschaftlichen Programmatik selbst – außerhalb von Kultur:⁷⁷¹ „Theologie entwickelt sich immer kontextuell, das heißt innerhalb eines kulturellen Kontextes.“⁷⁷² Dadurch, dass diese Situierung nicht nur vorwissenschaftliche Bedingung, sondern gleichzeitig wiederum wissenschaftstheoretisch formaler und materialer Inhalt und Zielfokus kulturwissenschaftlicher Forschung ist, hat der Aspekt der Positionalität im kulturwissenschaftlichen Programm sowohl formal wissenschaftsprozesslogisch als auch material in Bezug auf die Konstitution der jeweiligen Gegenstandsbereiche zentrale Bedeutung.⁷⁷³ Denn „[d]as Wissen um die Relativität, das
766 Vgl. Moxter, Michael, Kultur als Lebenswelt. Studien zum Problem einer Kulturtheologie (HUTh 38), Tübingen 2000, 279. 767 Herms, Theologie als Kulturwissenschaft, 439. Hervorhebung C. N. 768 Nüssel, Theologie, 1153. 769 Vgl. Herms, Theologie als Kulturwissenschaft, 447. 770 Vgl. ebd., 442. 771 Vgl. ebd., 439. 772 Nehring, Die Interkulturelle Theologie, 139. 773 „Eine standpunktfreie Kulturwissenschaft ist eine Unmöglichkeit, weil in den geistigen Dingen der Geist nie in objektiver Ferne den Dingen gegenübersteht, sondern sie in sich selbst in erlebnishafter Nähe hat, und darum Kulturwissenschaft immer zugleich Kulturschöpfung ist.“ Tillich, Theologie, 2. Diese Positionalität bedingt – analog zur Theologie – die einzelnen Kulturwissenschaften formal und material in Bezug auf ihren Gegenstandsbereich, ihre Methodologie und ihre Fragestellungen. Dass bei all dieser historisch-soziokulturell bedingten Relativität und ergo Pluralität dennoch von einer kulturwissenschaftlichen Programmatik gesprochen werden kann, ist im Kulturbegriff selbst bedingt. So geht mit dem Grundgedanken der Positionalität zwar eine im Begriff selbst angelegte Pluralität des jeweiligen Verständnisses vom Gegenstandsbereich „Kultur“ einher. Aber indem er die inner- und interdisziplinären Diskurse der jeweiligen Kulturwissenschaften strukturiert, fungiert der Kulturbegriff gleichsam als Kulturwissenschaft(en) konstituierender Identity Marker dieser
5.4 Theologie interdisziplinär
297
Bezogensein auf eine bestimmte Kultur und deren institutionellen Arrangements ist selbst Kennzeichen einer kulturwissenschaftlichen Wahrnehmung“.⁷⁷⁴ Dadurch gehört auch Theologie als Wissenschaft selbst wiederum in den holistischen Gegenstandsbereich der kulturwissenschaftlichen Programmatik⁷⁷⁵ – und kann gleichzeitig die anderen Kulturwissenschaften operativ in ihren Gegenstandsbereich und ergo auch ihre Epistemik und Methodologie integrieren. Dementsprechend hat Theologie keinen eigenständigen Methodenkanon und keine in ihren Prinzipien grundverschiedene Erkenntnistheorie, sondern sie nutzt operativ-konkret unter Anwendung ihrer je spezifischen (Sub‐) Fragestellung und in Bezug auf ihre Gegenstandsbereiche den sich aus dem Zusammenspiel der verschiedensten Disziplinen generierbaren Methodenkanon der Kulturwissenschaften. Dass Theologie als Kulturwissenschaft im hier angerissenen Sinne konzipierbar ist, soll anhand ihres innerdisziplinären Systems, wie es in den ersten drei Unterpunkten des fünften Großkapitels entwickelt wurde, an dieser Stelle noch einmal kurz resümierend verdeutlicht werden. So wurde bereits an der Frage nach der Theologizität der einzelnen Subdisziplinen des Fächerkanons der Theologie der wissenschaftstheoretische Effekt ihrer spezifischen historisch-soziokulturellen Positionalität⁷⁷⁶ deutlich:⁷⁷⁷ Indem in allen Subdisziplinen (unter ihrer je eigenen innersubdisziplinären Forschungslogik, also unter Anwendung der jeweiligen subdisziplinären Fragestellung und Methodologie in Bezug auf die jeweiligen Bezugs- und Gegenstandsbereiche) sowohl in ihren materialen Inhalten als auch in ihren formalen (Selbst‐) Bestimmungen positionell aus und wissenschaftstheoretisch auf Glauben Theologie vollzogen wird, entsteht genau dieser spezifische Welt-Wissenschaftsbezug der theologischen Diskursstruktur, durch den sie sich selbst sowohl als Teil von Kultur als auch als Reflexion darauf und dadurch als Mitspielerin im kulturwissenschaftlichen Programm zeichnet. Ebenso lässt sich dieser Grundaspekt in den in Kapitel 5.2 vorgestellten theologischen Zugriffen nachweisen. So wird im historisch-begrifflichen Zugriff, wie er in Aspekten anhand von Albrechts Monografie herausgearbeitet wurde, ausdrücklich ein historisch-kulturwissenschaftlicher Theologiebegriff in Anspruch genommen, indem in Anwendung des Heuristikums der Protestantizität die faktisch ge-
inner- und interdisziplinären Diskursstrukturen (analog wie das im hier vorgestellten Konzept von Theologie im Begriff „Glauben“ angelegt ist). Vgl. dazu ähnlich Herms, Theologie als Kulturwissenschaft, 447. 774 Tanner, Klaus, Theologie im Kontext der Kulturwissenschaften, in: BThZ 1/19 (2002), 83 – 98, 88 f. 775 „Theologie [wird] selbst beschreibbar als als eine partikulare, sozial und kulturell bedingte Praxis der Auslegung des Christentums und seiner Kulturbedeutung.“ Ebd., 96. 776 Vgl. Herms, Theologie als Kulturwissenschaft, 446. 777 Vgl. Kapitel 5.1.1. und 5.1.2.
298
5 Wie fragt Theologie?
lebte Religion evangelischen Christentums kulturhermeneutisch auf die Frage nach ihrer weltdeutenden und -gestaltenden Identität hin untersucht wird. So ist einerseits der Gegenstandsbereich dieses theologischen Zugriffs eindeutig Teil jenes oben beschriebenen Kulturbegriffs. Und gleichzeitig ergeben sich – wie bei allen in 5.2 vorgestellten Zugriffen – so auch hier daraus explizit programmatisch-kulturwissenschaftliche Konsequenzen: Nämlich konkret insofern, als dass in dieser Identitätsbestimmung sowohl theologisch-prinzipientheoretische als auch gegenwartsanalytische Reflexionen auf ebendiese Zusammenhänge zwischen Welt, Wissenschaft, Kultur, Glaube und Theologie mitgegeben sind. Darauf aufbauend lässt sich nun ähnlich eindeutig der empirisch-sozialtheoretische Zugriff – am Beispiel von Theißens Buch konstruiert – auf eine kulturwissenschaftliche Programmatik hin konsolidieren: Durch den Einsatz sozial- und kulturwissenschaftlicher Analyseinstrumente (wie z. B. ganz zentral des Geertzschen Kulturbegriffs) wird der Gegenstandsbereich der (ur‐) christlichen Religion bzw. Religiosität als kulturelles Subsystem in spezifischen historisch-soziokulturellen Kontexten untersucht. Ebenfalls in Anwendung einer bestimmten begrifflichen Heuristik, allerdings unter eher hermeneutisch-religionsphilosophischer Fokussierung, zeigt sich der anhand von Markschiesʼ Monografie erarbeitete Zugriff auf Theologie: Unter dem Leitmotiv der Frage nach anthropomorphen Gottesvorstellungen wird in akribischer historischkritischer Quellenarbeit die konkrete religiöse Erfahrungswelt christlicher Religion in ihren spezifischen historisch-soziokulturellen Kontexten untersucht, um so in prinzipientheoretischer Konsequenz zu einer die verschiedenen historisch-soziokulturellen Positionalitäten christlicher Religiosität integrierenden und in diesem Sinne angemesseneren Rede von Gott zu gelangen. Diese kurze Systematisierung der Zugriffe abschließend lässt sich dann auch der religionspsychologisch-anthropologische Ansatz, wie er mithilfe von Stocks Buch konstruiert wurde, als eine Spielart der Kulturwissenschaft der Theologie darstellen. Denn indem christliches Bewusstsein als ein bestimmter Lebenssinn und eine bestimmte Lebensform, also als eine spezifische Form menschlichen In-derWelt-Seins untersucht wird, kommt die Frage nach dem wechselseitigen Zusammenhang solchen Seins und seiner historisch-soziokulturellen Umwelt in den Blick. Theologie als eine in solcher Form fokussierte Kulturwissenschaft untersucht dann die Möglichkeitsbedingungen und (Handlungs‐) Implikationen dieser Weltdeutung und -gestaltung – und kommt damit eben nicht nur zu Aussagen über diese Spielart „menschlicher Lebensbewältigung und Lebensverständnisse“⁷⁷⁸ als ihrem Gegenstandsbereich, sondern trägt gleichsam zur gesamtkulturwissenschaftlichen Programmatik bei, indem sie diese Spielart in all ihren Kontextualitäten wissen-
778 Ebd., 439. So bereits oben zitiert.
5.4 Theologie interdisziplinär
299
schaftstheoretisch-material und -formal reflektiert und diese Ergebnisse in den interdisziplinären Diskurs einbringt. Der sich durch diese vier Zugriffe durchziehende spezifische Welt-Wissenschaftszusammenhang der Theologie, der sich in ihrem Bezogensein auf das kulturelle Phänomen christlichen Glaubens als sowohl ihrem Gegenstandsbereich als auch maßgeblichen Positionalitätsfaktor ausdrückt, lässt sich schlussendlich auch anhand des unter 5.3. angerissenen innerdisziplinären Systems der Theologie (als der Zusammenschau ihrer Enzyklopädie und ebenjener Zugriffe) als ihr kulturwissenschaftlicher Identity Marker herausstreichen. Denn weil das kulturelle Subphänomen christlicher Glaubenspraxis in ihrer historisch-soziokulturellen Relativität sowohl den epistemischen Kontext als auch die wissenschaftstheoretische Stoßrichtung des theologischen Fächerdiskurses darstellt, vollzieht sich Theologie als Reflexion aus Glauben auf Glauben in Abhängigkeit zu genau dieser historischsoziokulturellen Relativität christlicher Glaubenspraxis: Die historischen, systematischen und praktischen Momente ihres Forschungsvollzugs (als ihre Impuls gebenden Erkenntnisinteressen und den Forschungsprozess leitenden Strukturmerkmale) prägen das innerdisziplinäre System insgesamt – also sowohl auf Ebene der Zugriffe, als auch auf Ebene der Enzyklopädie. Dementsprechend gestaltet sich der gesamte Diskurs von Theologie in solcher historischer, systematischer und praktischer Relativität. Und genau in diesen Mehrfachrelativitäten zu ihren historisch-soziokulturellen und wissenschaftstheoretischen Kontexten ist die kulturwissenschaftliche Programmatik von Theologie evident. Damit ist der spezifische Welt-Wissenschaftsbezug von Theologie, wie er sich maßgeblich im kulturellen Phänomen christlichen Glaubens ausdrückt, nicht nur innerdisziplinär Spezifikum ihrer Theologizität, sondern auch interdisziplinär ihr Identity Marker im kulturwissenschaftlichen Fächerkanon.
5.4.2 Der Religionswissenschaftsbegriff der Theologie Analog zu Kapitel 4.4.2. erfolgt an dieser Stelle ein kurzer Blick auf Strategien innertheologischer⁷⁷⁹ Verhältnissetzungen zur Religionswissenschaft. Ziel soll dabei nicht nur sein, bestimmte Spezifika des theologischen Religionswissenschaftsbegriffs zu beleuchten, sondern darüber vor allem das fachliche Selbstverständnis evangelischer Theologie als religionsbezogener Kulturwissenschaft im Verbund mit 779 Die hier rezipierten Fachvertretenden werden also als vor allem im theologischen Diskurs agierende Forschende verstanden, auch wenn einige unter ihnen durchaus in beiden Disziplinen bzw. in den Bereichen der Spektren zwischen Theologie und Religionswissenschaft forschen, was vor allem in der theologischen Fachgeschichte begründet ist (vgl. Kapitel 2.2.).
300
5 Wie fragt Theologie?
ihrer Schwesterdisziplin zu präzisieren. Die (nicht noch einmal im Einzelnen zu diskutierende) Hintergrundfolie ist auch hier wieder das Schema der klassischen Differenzkriterien, wie es in Kapitel 3 dieser Arbeit aufgestellt wurde. Vorausgeschickt sei dabei grundsätzlich, dass im Folgenden keine umfassende Analyse weder der Entwicklungsgeschichte, noch der Gesamtheit solcher theologischer Religionswissenschaftsverständnisse geliefert werden kann – und auch gar nicht Sinn und Zweck dieses Unterkapitels sein soll. Vielmehr geht es eben darum, die durch den innertheologischen Fachdiskurs bedingte Spezifität des angewandten bzw. tradierten Begriffs von Religionswissenschaft aufzuzeigen – und dadurch auch auf seine Stringenz und Implikationen für das Differenzkriterium einer theologischen Fragestellung hin zu untersuchen. So kann zunächst festgehalten werden, dass – bei aller innerfachlichen Pluralität der Diskussionslage⁷⁸⁰ – der Religionswissenschaftsbegriff innertheologisch mittlerweile vor allem daraufhin erörtert wird, inwiefern bzw. wie stark Theologie als Disziplin auf Religionswissenschaft angewiesen ist bzw. von ihr profitiert.⁷⁸¹ Hierbei scheint im Hintergrund zu stehen, dass innerhalb des theologischen Diskurses vielfach die gemeinsame Fachgeschichte⁷⁸² mit Religionswissenschaft Anlass zu wissenschaftstheoretischen Selbstreflexionen und Verhältnissetzungen zu geben scheint.⁷⁸³ Dabei wird maßgeblich auf die für (das Studium der) Theologie uner-
780 Vgl. zu einer sehr klassischen Kategorisierung innertheologischer Strategien der Verhältnissetzung von Religionswissenschaft und Theologie Sundermeier, Theo, Was ist Religion? Religionswissenschaft im theologischen Kontext. Ein Studienbuch (Theologische Bücherei Studienbücher 96), Gütersloh 1999, 223 ff. 781 Vgl. so z. B. klassisch Ebeling, Studium, 50 f. 782 Vgl. z. B. Körtner, Ulrich H. J., Zur Einführung. Die Gottesfrage in Theologie und Religionswissenschaft, in: Ders. (Hg.), Gott und Götter. Die Gottesfrage in Theologie und Religionswissenschaft, Neukirchen-Vluyn 2005, 1 – 22, 3. 783 Dabei werden nicht nur die historisch bedingten Gemeinsamkeiten betont; sondern in relativer Häufigkeit wird dabei ein (vermeintlich) christentums- und theologiekritischer Impetus der neu entstehenden Schwesterdisziplin konstatiert. Vgl. Herms, Eilert, Theologie und Religionswissenschaft, in: Ders., Phänomene des Glaubens. Beiträge zur Fundamentaltheologie, Tübingen 2006, 455 – 475, 451.466. Dass vor dem Hintergrund der pluralen Entstehungsdisziplinen eine solche einseitige Fokussierung der Religionswissenschaft kaum durchführbar ist, haben die Ausführungen in Kapitel 2 und 4 bereits aufgezeigt. Allerdings kann – vor dem Hintergrund des im vorherigen Unterkapitel 5.4.1. ausgeführten kulturwissenschaftlichen Paradigmas – durchaus festgehalten werden, dass mit der Konstitution der Religionswissenschaft als eigenständiger Disziplin eben auch zumindest eine (historische) Relativierung von Theologie einherging. „Das Christentum selbst und mit ihm auch die Theologie [wurden und] werden nun zum Objekt religionswissenschaftlicher Betrachtung. Durch die Religionswissenschaft wird die Theologie nicht einfach um eine weitere Disziplin vermehrt oder durch eine außertheologische Nachbardisziplin ergänzt, vielmehr überhaupt in Frage gestellt.“ Ebeling, Studium, 41.
5.4 Theologie interdisziplinär
301
lässliche Notwendigkeit religionsvergleichender Forschung – immer in Bezug auf die eigene theologische Fragestellung – abgehoben: „Nur im Wechselspiel authentischer Repräsentation divergierender Religionsgestalten und intensiver Arbeit an der eigenen Tradition kann Urteilsfähigkeit im Blick auf die Frage, was an der eigenen Religion auch zukünftig tradiert zu werden verdient, entstehen und verstärkt werden.“⁷⁸⁴ Im Gegensatz zu früheren vor allem religionsphänomenologisch dominierten Religionswissenschaftsbegriffen⁷⁸⁵ scheint also mittlerweile auch innerhalb der Theologie ein Verständnis von Religionswissenschaft als deskriptivkomparativer Kulturwissenschaft vorzuherrschen, was sich dann auch in den jeweiligen Verhältnissetzungen widerzuspiegeln vermag. In einer Vielzahl dieser Verhältnisbestimmungen werden dabei auf den ersten Blick mehr oder weniger explizit Differenzkriterien im (weitesten) Sinne der Perspektive oder der Methode bemüht:⁷⁸⁶ Entweder nämlich insofern, als dass z. B. die proaktive Selbstreflexion der Religion des Christentums mit dem Fokus der Ausbildung ihrer Amtsträger*innen und Lehrkräfte ⁷⁸⁷ als die disziplinäre Identität stiftende Aufgabe der Theologie genannt wird;⁷⁸⁸ denn „Religionswissenschaftler
784 Moxter, Wozu, 287. Im Hintergrund steht hier das Schleiermacherische Verständnis von Theologie als positiver Wissenschaft. 785 Vgl. maßgeblich Wagner, Was ist, 310 f.323.442. 786 Vgl. dazu basal Hock, Einführung, 168 f. Differenzierungen aufgrund unterschiedlicher Gegenstandsbereiche lassen sich in wissenschaftstheoretischer Stringenz kaum auffinden – und wären vor dem Hintergrund der Wende der Theologie zur Religion (vgl. Kapitel 2.2. dieser Arbeit) argumentativ auch nur schwer durchführbar. Selbst in den Konzeptionen, in denen die Spezifität der Theologie auf den ersten Blick in einem alternativen Gegenstandsbereich konstatiert zu werden scheint, wird auf den zweiten Blick vielmehr auf das Differenzkriterium der Perspektive abgehoben. So z. B. bei Ulrich Körtner, der Theologie zwar als Rede von Gott kennzeichnet. Ihre Spezifität liege aber nicht darin, dass sie von einem unverfügbaren Gegenstandsbereich spricht (Gott), sondern dass sie dies in normativer Fokussierung auf eine bestimmte (innerreligiöse) Funktion hin tut – nämlich in der existentiellen Frage nach der Sinnhaftigkeit solcher Gottesrede im Kontext konkreter vorfindlicher Religiosität. Vgl. Körtner, Zur Einführung, 7 f. 787 „Dennoch lässt sich nach heutigem Stand zumindest so viel sagen, dass die Trennung von Wissenschaft und religiösen Institutionen in der Religionswissenschaft konsequenter durchgeführt ist als in den Theologien. In Bezug auf die von der Säkularisierung gezogene Trennlinie zwischen den weiterhin religiös bestimmten und den nicht religiös bestimmten Bereichen der Gesellschaft gehört die Religionswissenschaft klar auf die Seite der Säkularität, während die Theologien durch die Ausbildung von künftigen Akteuren der Religionsgemeinschaften eine enge Verbindung zum religiösen Bereich der Gesellschaft behalten haben.“ Feldtkeller, Andreas, Umstrittene Religionswissenschaft. Für eine Neuvermessung ihrer Beziehung zur Säkularisierungstheorie (ThLZ.F 31), Leipzig 2014, 26. 788 Vgl. z. B. Schmitz, Bertram, Zur Verhältnisbestimmung von Theologie und Religionswissenschaft. Reflexionen über ein schwieriges Verhältnis und Zukunftsperspektiven, in: BThZ 1/19 (2002), 138 – 157, 138. „Wenn jemand innerhalb seines eigenen Glaubens in bewusst kritisch reflektierender
302
5 Wie fragt Theologie?
wollen (in der Regel) nicht an der Selbststeuerung der evangelischen Kirche teilnehmen.“⁷⁸⁹ Oder aber (bzw. und) indem auf die Deskriptivität religionswissenschaftlich-komparativen Arbeitens im Unterschied zur positionellen Normativität der Theologie⁷⁹⁰ (aufgrund ihres sozusagen innerreligiösen Erkenntnisinteresses als positive Wissenschaft) verwiesen wird.⁷⁹¹ Solches scheint dann unbeeinflusst davon zu sein, ob Religionswissenschaft aufgrund ihrer Notwendigkeit für ein umfassendes Theologietreiben innerhalb⁷⁹² oder zur Stärkung ihrer sozusagen Horizonte erweiternden Funktion⁷⁹³ außerhalb des theologischen Fächerkanons verortet wird.⁷⁹⁴ Gemein haben beide (spektralen) Verortungen, dass der Mehrwert für den innertheologischen Diskurs in der Eigenständigkeit des religionswissenschaftlichen Zugriffs gesehen wird. Auf einen zweiten Blick lassen sich allerdings bei diesen Zuordnungen gerade innerhalb der Theologie stärker zwischen den verschiedenen erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Ebenen solcher Verhältnissetzungen differenzierende
Weise konstruktiv gestaltet, dann betreibt er oder sie Theologie. […] Wenn aber jemand diese (theologische) Gestaltung von außen beschreibt […], von einem einzelnen oder einer gesamten Religionsgemeinschaft, dann handelt es sich um ein religionswissenschaftliches Vorgehen. Das, was er darstellt, wird zum Objekt, zum Gegenstand der Forschung. […] Der Religionswissenschaftler beschreibt, interpretiert und erschließt Theologie(n), doch er treibt selbst keine Theologie.“ Ebd., 155. 789 Moxter, Wozu, 289. Vgl. ähnlich, aber anders Feldtkeller, Andreas, Das Menschenbild von Religionswissenschaft und Theologien als Raum ihrer Abgrenzung und Kooperation, in: BThZ 1/29 (2012), 97– 118, 98. 790 Vgl. z. B. Körtner, Zur Einführung, 8 f. 791 Solches findet sich z. B. maßgeblich in fachlichen Selbstreflexionen im Kontext der Interkulturellen Theologie wieder. Vgl. z. B. Wrogemann, Interkulturelle Theologie, 236 f. Vgl. dazu auch Kapitel 5.1.1. Vgl. aber auch z. B. Berner, Theologie, ff. Oder vgl. Gemeinhardt, Geschichte, 111. 792 „Meines Erachtens sollte die Religionswissenschaft immer dort ihren Platz haben, wo sie dringend benötigt wird. Und das ist ohne Zweifel innerhalb der Theologie der Fall, um dem Studenten neben seiner eigentlichen Fachausbildung eine Spezialausbildung auf dem Gebiete der Religionen zu erteilen, damit er lernt, das Christentum in seinen Übereinstimmungen mit anderen Religionen sowie in seinem spezifischen Sondergeist richtig einordnen und dadurch besser verstehen zu können.“ Lohmann, Theodor, 30 Jahre Religionswissenschaft in unserem Land, in: Tworuschka, Udo (Hg.), Religion, Religionen, Religionswissenschaft. Festschrift zum 70. Geburtstag (Interreligiöse Horizonte 2), Köln 1998, 201 – 210, 202. 793 „Sie übt den Blickwechsel und das Verstehen des Fremden ein. Den anderen in seiner Religion so zu verstehen, wie er sich selbst versteht und sieht, ist eine der Kernaufgaben der Religionswissenschaft im theologischen Kontext.“ Sundermeier, Was ist, 248. 794 Vgl. z. B. das Positionspapier der Fachgruppe Religions- und Missionswissenschaft, 3. Denn selbst da, wo „religionswissenschaftliche Lehrstühle an Theologischen Fakultäten angesiedelt sind, tragen sie zur interdisziplinären Vernetzung der Theologie bei.“ Ebd. Hervorhebung C. N. Vgl. ähnlich, aber anders auch Ebeling, Studium, 41.
5.4 Theologie interdisziplinär
303
Strategien feststellen. So wird vor allem die epistemische Voraussetzungshaftigkeit beider Fächer⁷⁹⁵ immer deutlicher in den Vordergrund gerückt⁷⁹⁶ – worin sich gerade auch sowohl innertheologische als auch gesamtwissenschaftlich-fachgeschichtliche Entwicklungen widerzuspiegeln scheinen.⁷⁹⁷ Umso stärker wird dabei die methodologische Verbundenheit⁷⁹⁸ dieser beiden Kulturwissenschaften⁷⁹⁹ betont, so dass letztlich konstatiert werden kann, „dass es
795 Vgl. z. B. Schwöbel, Christoph, Theologie und Religionswissenschaft. Vorläufige Bemerkungen zur Gestaltung eines schwierigen Verhältnisses, in: Härle, Wilfried/Preul, Reiner (Hg.), Religion. Begriff, Phänomen, Methode (MThSt 74), Marburg 2003, 63 – 80, 71.73. 796 Vgl. Feldtkeller, Das Menschenbild, 101. 797 „Die Vorliebe für eine nicht-wertende Haltung gegenüber Menschen anderer Religionen ist weniger eine Frage der Zugehörigkeit zu den Disziplinen Religionswissenschaft oder Theologie, sondern sie ist mehr eine Generationenfrage: während frühere Generationen von Religionswissenschaftlern genauso beherzt gewertet haben wie die entsprechenden Theologiegenerationen, ist in der jüngeren Generation der Theologinnen und Theologen die nicht-wertende Begegnung mit Menschen anderer Religionen ebenso selbstverständlich geworden wie in der Religionswissenschaft.“ Ebd., 112. 798 Vgl. auch ebd., 102. Teilweise scheint hinter solchen Betonungen der fachgeschichtlichen Verbundenheit die Absicht zu bestehen, geradezu ein historisches Abhängigkeitsverhältnis zwischen Religionswissenschaft und Theologie aufzuzeigen: „Für einen Teil der protestantischen Theologien in Europa lässt sich sogar sagen, dass die Säkularisierung ihrer Methoden der Erforschung von Religion begonnen hat, bevor sich von Religionswissenschaft als einer eigenständigen Wissenschaft sprechen lässt, und dass die genau hier im Raum der Theologie errungene Befreiung der Religionsforschung von religiösen Vorgaben eine wichtige Voraussetzung dafür war, dass darauf aufbauend Religionswissenschaft entstehen konnte.“ Ders., Umstrittene Religionswissenschaft, 25. Interessant ist bei diesem Beispiel vor allem die Kennzeichnung historisch-kritischer Methoden (wie sie ja durchaus im Kontext wissenschaftsparadigmatischer Entwicklungsprozesse zum Kennzeichen geistes- bzw. dann kulturwissenschaftlicher Forschung wurden) als säkular. 799 Wobei auch hier zu betonen ist, dass das Verständnis der Implikationen von Kulturwissenschaftlichkeit in Bezug auf das Verhältnis zur Religionswissenschaft gerade auch innerhalb der Theologie hochgradig plural sind. Als ein eher die Differenz betonendes Extrembeispiel sei hier noch einmal Körtners Zuordnung angeführt: „Der Begriff einer normativen Religionswissenschaft aber ist – zumindest in der Perspektive einer sich konsequent als empirische Kulturwissenschaft oder Kulturanthropologie begreifenden Religionswissenschaft – eine contradictio in adjecto. Entweder verfährt eine sich mit Religion bzw. mit dem Christentum befassende Wissenschaft rein deskriptiv – dann handelt es sich um Religionswissenschaft, aber nicht um Theologie; oder aber sie formuliert – wenn nicht durchgängig, so doch zumindest auch – normative Urteile über religiöse Sachverhalte – dann handelt es sich um Theologie, aber eben nicht um Religionswissenschaft. […] Daß die Theologie ihre Orientierungskrise dadurch überwindet, daß sie sich ihrerseits als Kulturwissenschaft definiert, darf bezweifelt werden. Dies gelänge allenfalls um den Preis, daß sie jeden normativen Geltungsanspruch aufgäbe.“ Körtner, Zur Einführung, 6. Da in der vorliegenden Arbeit allerdings, wie es im bisherigen Argumentationsverlauf auch als maßgebliches innertheologisches Selbstverständnis hergeleitet wurde, Theologie als Kulturwissenschaft betrachtet wird, fallen Zuordnungen wie die Körtners eher an den Rand der wissenschaftstheoretischen Selbstreflexion. Als
304
5 Wie fragt Theologie?
sich bei dem Kontrast von Binnen- und Außenperspektive um einen Gegensatz innerhalb der Religionstheorie handelt, also um alternative Methoden und Schulen der Religionswissenschaft. Wie auch immer man sich zu deren Konkurrenz verhalten mag, eine durchschlagende Bedeutung für die Differenzierung zwischen Theologie und Religionswissenschaft sollte man nicht erwarten, weil sie auf beiden Seiten gleichermaßen vorkommen kann.“⁸⁰⁰ Eine derartige Betonung der epistemischen Wirksamkeit der weltanschaulichen Positionalität kann dann wiederum in Konzeptionen bestimmter Traditionslinien zu einer explizit integralen Zuordnung der beiden Fächer zueinander führen und soll hier um Folgenden kurz an der Konzeption Hermsʼ verdeutlicht werden. Unter Hinweis auf die grundständige Voraussetzungshaftigkeit aller (Kultur‐) Wissenschaft⁸⁰¹ wird hier auf die weltanschauliche Perspektivität gerade auch von Religionswissenschaft abgehoben,⁸⁰² denn „Theologie und alle sonst noch möglichen Religionswissenschaften gehören zum gleichen kulturwissenschaftlichen Paradigma.“⁸⁰³ Theologie gestalte sich dabei dann als eine spezifische Variante solcher weltanschaulich-positioneller Religionswissenschaft:⁸⁰⁴ „Theologie ist Religionswissenschaft, und zwar in exemplarischer Gestalt Religionswissenschaft als Kulturwissenschaft.“⁸⁰⁵ Im Kontext eines Kulturbegriffs als dem Zusammenhang menschlichen Weltdeutens und -gestaltens⁸⁰⁶ wird der Lebensbereich Religion als ein Teilaspekt dieses Handlungszusammenhangs verstanden.⁸⁰⁷ Religionsbezogene Wissenschaften können sich dann in unterschiedlichen Fokussierungen auf diesen Lebensbereich vollziehen, sind aber dementsprechend nicht aufgrund ihres Gegenstands (der Religion[en]) oder ihrer Perspektive (durch weltanschauliche Positionalitätsfaktoren) voneinander wissenschaftstheoretisch differenzierbar und solche haben sie ihre Bedeutung und Legitimität im Spektrum wissenschaftstheoretischer Theologiekonzeptionen, gelten aber eben nicht als Mainstream im vorliegenden Konzept. 800 Moxter, Wozu, 266. Vgl. anders, aber ähnlich Herms, Theologie als Kulturwissenschaft, 451. Vgl. auch Richter, Cornelia, Wahrheit und Relevanz in Religionswissenschaft und Theologie, in: Albrecht, Christian/Gemeinhardt, Peter (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und außen, Tübingen 2021, 200 – 203, 200 f. 801 Vgl. noch mal grundlegend Herms, Das Selbstverständnis, 359. 802 Vgl. dazu maßgeblich ders., Theologie und Religionswissenschaft, 468 f. 803 Ebd., 470. 804 So natürlich schon bei Tillich in seinem Konzept einer Theologie der Kultur: „Theologie ist […] konkret-normative Religionswissenschaft.“ Tillich, Über die Idee, 14. Vgl. auch ders., ST I, 19. Vgl. hierzu Moxter, Wozu, 275. Vgl. auch Kapitel 2.2.5. 805 Herms, Theologie und Religionswissenschaft, 459. Eine Zuordnung, die natürlich für „die Religionswissenschaft überraschend und herausfordernd wäre […], wenn sie denn wahrgenommen worden wäre“. Berner, Theologie und Religionswissenschaft, 229. 806 Vgl. zur Erinnerung die Ausführungen im vorherigen Kapitel 5.4.1. 807 Vgl. Herms, Theologie und Religionswissenschaft, 456 – 459.
5.4 Theologie interdisziplinär
305
haben alle Anteil am kulturwissenschaftlichen Methodenkanon. Somit sind alle religionsbezogenen Wissenschaften als Kulturwissenschaften in ihrem wissenschaftlichen Vollzug sowohl gegenständlich als auch perspektivisch wechselseitig bezogen auf den Gesamtzusammenhang Kultur und dadurch „ein wesentlicher […] Teil genau desjenigen Aspekts von Kultur, den sie erforschen.“⁸⁰⁸ Theologie könne nun dabei insofern nicht als Gegenüber, sondern vielmehr als Spezialfall von Religionswissenschaft verstanden werden, da hier die weltanschauliche Positionalität im Forschungsprozess explizit reflektiert und angewandt werde. Theologie vollziehe sich in diesem Verständnis also durchaus in einer religiösen Innenperspektive auf das Christentum⁸⁰⁹ – und stehe dadurch aber dann eben keinesfalls im Widerspruch zu einem kulturwissenschaftlichen Verständnis von Religionswissenschaft,⁸¹⁰ denn zwar „[n]icht alle Religionswissenschaft ist Theologie. Aber alle Religionswissenschaft ist positional und praxisbezogen.“⁸¹¹ Als Mitspielerin im kulturwissenschaftlichen Paradigma komme gerade auch der Religionswissenschaft eine grundlegende Orientierungsfunktion für den Handlungszusammenhang der Kultur zu.⁸¹² Dadurch fungiert insgesamt auch in dieser Zuordnung von Theologie und Religionswissenschaft die Innen- bzw. Außenperspektive nicht als wissenschaftstheoretisches Differenzkriterium,⁸¹³ sondern markiert epistemisch-positionale Spezifika religionsbezogener Kulturwissenschaften insgesamt – und dann natürlich auch von Religionswissenschaft und Theologie. Die Integralität von Religionswissenschaft und Theologie entsteht bei Herms also sowohl über den konstatierten gemeinsamen Gegenstandsbereich von Religion als einem Aspekt von Kultur als auch über die beiden gemeinen epistemisch-methodologischen (Konstitutions‐) Bedingungen von (Kultur‐) Wissenschaft. Damit stehen (abgesehen von der materialen Füllung des Herms’schen Religionsbegriffs)⁸¹⁴ dann sowohl seine als auch die vorherigen Ausführungen dieses Unterkapitels auf metatheoretischer Ebene in keinem grundlegenden Widerspruch zum wissenschaftstheoretischen Ansatz der vorliegenden Arbeit, in der ebenfalls von der grundlegenden Voraussetzungshaftigkeit sowohl von Religionswissenschaft
808 Ebd., 465. 809 Vgl. ebd., 463. 810 Vgl. ebd., 464. 811 Ebd., 466. 812 Vgl. ebd., 471 ff. 813 Vgl. ders., Theologie als Kulturwissenschaft, 451. 814 Zur mehr als berechtigten Kritik der materialen Füllung des Herms’schen Religionsbegriffs im Kontext seiner Verhältnisbestimmung von Religionswissenschaft und Theologie vgl. Nehring, Die Interkulturelle Theologie, 138 f.
306
5 Wie fragt Theologie?
als auch Theologie, deren sich teilweise überschneidender Gegenstandsbereich und ihrem gemeinsamen kulturwissenschaftlichen Methodenkanon ausgegangen wird. Das Zentrale des innertheologischen Religionswissenschaftsbegriff scheint – das Bisherige hier kurz zusammenfassend – in der Logik des theologischen Fachdiskurses darin zu liegen, dass Theologie nach Religionswissenschaft vor allem in Hinblick auf die Nicht-/Zugehörigkeit zu ihrem eigenen Fächerkanon fragt. Der Mehrwert der religionskomparativen Fragestellung der Religionswissenschaft für das Theologietreiben steht dabei explizit im Vordergrund: Durch die Relativierung des eigenen Fachdiskurses – sowohl auf epistemisch-methodologisch formaler als auch auf gegenständlich materialer Ebene – kann Theologie ihrem kulturwissenschaftlichen Fachinteresse an der soziokulturellen Kontextualisierung christlichen Glaubens als ihrem Positionalitätsfaktor und Zielfokus nachgehen. Das aufgrund dieses grundlegenden Angewiesenseins teilweise noch Ansätze existieren, die deswegen auf eine Verortung von Religionswissenschaft innerhalb des theologischen Fächerkanons insistieren, ist dann zwar (bedingt) verständlich, lässt sich wissenschaftstheoretisch allerdings gerade vor dem Hintergrund dieser grundlegenden Funktion von Religionswissenschaft für Theologie im kulturwissenschaftlichen Paradigma argumentativ schwer durchhalten.⁸¹⁵ Theologie hat ein wissenschaftstheoretisch grundsätzliches Interesse an einer eigenständigen Religionswissenschaft.
5.5 Zusammenfassung: Die Fragestellung der Theologie Auch in Bezug auf die bisherigen Analysen des inner- und interdisziplinären Systems des theologischen Fachdiskurses soll nun eine kurze abschließende Zusammenschau des fünften Kapitels erfolgen, indem die Reflexionen und Setzungen zur formalen Struktur und Theologizität der einzelnen Subdisziplinen und Zugriffe und die damit zusammenhängenden epistemologisch-methodologischen Konsequenzen und interdisziplinären Verortungen zu einer Fragestellung evangelischer Theologie als diskursiv-wissenschaftstheoretischem Differenzkriterium zusammengeführt werden. In der systematisierenden Zusammenschau der in den vorherigen Unterkapiteln untersuchten wissenschaftstheoretischen Ebenen theologischer Selbstverständnisse soll so ein Vorschlag gegeben werden zu einem metatheoretisch
815 „So sehr es zu begrüßen ist, dass eine theologisch orientierte Religionswissenschaft darum bemüht ist, Religionen zu verstehen, den Anderen als anderen wahrzunehmen, die Verhältnisse zwischen den Religionen zu klären, Probleme im Dialog zu bewältigen, den Glauben gemeinsam zu durchdenken, wofür heute die Komparative Theologie steht, und Spiritualität zu ergründen, so sehr muss doch auch darauf reflektiert werden, dass die Religionswissenschaft bzw. (im Plural) die Religionswissenschaften anders arbeiten als die Theologie.“ Ebd., 137.
5.5 Zusammenfassung: Die Fragestellung der Theologie
307
kriteriologischen Spezifikum von Theologie als eigenständigem Fachdiskurs mit einer sich in verschiedensten Forschungsvorhaben manifestierenden spezifischen grundlegenden Forschungsabsicht. So ist gerade auch in Bezug auf Theologie grundlegend zu resümieren, dass sie sich – im Verständnis dieser Arbeit – maßgeblich als Kulturwissenschaft im Kontext anderer Kulturwissenschaften versteht. Kennzeichen einer solchen theologisch-fokussierten kulturwissenschaftlichen Programmatik ist die Einsicht in die grundlegende wechselwirksame Positionalität von Wissenschaft (mit allen epistemischmethodologischen Konsequenzen und Implikationen), die sich vor allem in zweierlei Stoßrichtungen äußert: So richtet sich der Fokus von Theologie als Mitspielerin im kultur-/wissenschaftlichen Gesamtdiskurs nach innen auf die Reflexion ihrer eigenen erkenntnis- und wissenschaftstheoretisch fokussierten Prinzipientheorie; gleichsam wirkt sie nach außen aufgrund dieser exemplarisch-prinzipientheoretischen Grundlagenreflexion auf Möglichkeiten und Bedingungen wissenschaftlicher Erkenntnisprozesse kultur- und gegenwartsdiagnostisch in den Gesamtzusammenhang von Kultur-/Wissenschaft hinein. Damit verdeutlicht Theologie exemplarisch die grundlegende Perspektivität bzw. Aspektivität aller Wissenschaft. Ihr interdisziplinär-kulturwissenschaftlicher Identity Marker als Fachdiskurs liegt dabei in ihrer Theologizität: Im Wechselspiel von christlichem Glauben als ihrem vorwissenschaftlichen Impuls gebenden Positionalitätsfaktor und wissenschaftlichem Gegenstandsbereich liegt der spezifische Welt-Wissenschaftsbezug von Theologie begründet. Dadurch kennzeichnet sich Theologie auf all ihren wissenschaftstheoretischen Ebenen – also sowohl in ihrer subdisziplinären Diskursstruktur als auch in ihren hier exemplarisch vorgestellten methodologisch-praxeologischen vier Zugriffen und den damit verbundenen epistemischmethodologischen Konsequenzen – durch eine starke historisch-soziokulturelle Relativität und Dynamik, die sich in den historischen, systematischen und praktischen formalen und materialen Momenten ihres Arbeitens äußert. Als (Kultur‐) Wissenschaft ist sie dabei auf der einen Seite Akteurin im kulturellen bzw. religiösen Feld; andererseits befindet sie sich dabei in der Reflexion aus Glauben (als einem ihrer Positionalitätsfaktoren) auf Glauben (als ihrem historisch-soziokulturell immer wieder neu zu kontextualisierenden Gegenstandsbereich) in der wissenschaftlichen Außenperspektive auf konkrete christliche Religion bzw. Religiosität. Theologie ist in diesem Verständnis dann also explizit keine Glaubenswissenschaft – und Glaube (bzw. zu glauben) keine epistemische Grundanforderung an das theologisch forschende Subjekt. Sondern in der epistemisch-methodologischen Reflexion auf Glauben als einem Aspekt ihrer vorwissenschaftlichen Bedingtheit führt sich Theologie der intersubjektiven Überprüfung im wissenschaftlichen Gesamtdiskurs zu, indem sie die Spezifität ihres Welt-Wissenschaftsbezugs transparent macht. So verstandene Theologie ist grundlegend wechselseitig angewiesen auf
308
5 Wie fragt Theologie?
ihre verschiedensten interdisziplinären Mitspielerinnen – vor allem (wie im vorherigen Unterkapitel ausgeführt wurde) auf eine eigenständige Religionswissenschaft als ihrem (kultur‐) wissenschaftlichen Gegenüber. Dieses kurze Resümee lässt sich nun also abschließend zu folgendem Formulierungsvorschlag für die Setzung einer theologischen Fragestellung als ihrem wissenschaftstheoretischen Differenzkriterium zusammenfassen: Theologie als eigenständige Disziplin im interdisziplinären Kontext von Kulturwissenschaften fragt historisch, systematisch und praktisch, in impliziter und expliziter Reflexion ihres spezifischen epistemisch-methodologischen Zusammenhangs von Welt und Wissenschaft („aus“ Glauben) und in Anwendung verschiedenster kulturwissenschaftlicher Methoden nach der Genese, Tradierung und dem Gehalt christlichen Glaubens als spezifischer Weltdeutung und -gestaltung in Geschichte und Gegenwart, um so in unter anderem historisch-begrifflich, empirisch-sozialtheoretisch, hermeneutisch-religionsphilosophisch und religionspsychologischanthropologisch fokussierten Zugriffen wissenschaftliche Orientierung zu geben für die Konstitution, Identität und Bedeutung solcher konkreter christlicher Glaubenspraxis in historischsoziokulturellen Kontexten.
6 Die Zusammenschau: Eine Verhältnissetzung von Religionswissenschaft und Theologie auf Grundlage ihrer diskursspezifischen Fragestellungen An dieser Stelle erfolgt nun – als finaler Schritt und Abschluss dieser Arbeit – eine systematisierende wissenschaftstheoretische Verhältnissetzung von Religionswissenschaft und evangelischer Theologie, indem sowohl die diskursstrukturellen Verbindungslinien als auch ihre den je eigenen Fachdiskurs charakterisierenden Spezifika und Differenzen zueinander anhand ihrer je facheigenen Fragestellungen aufgezeigt werden. So ist zunächst zu resümieren, dass als Grundgedanke dieser Arbeit ein programmatisch-kulturwissenschaftlich orientiertes Verständnis von Wissenschaft herausgearbeitet wurde, das wissenschaftliche Disziplinen als zwar eigenständige, aber multidimensional miteinander verwobene Diskurse darstellt. Konkrete Forschungsprojekte bewegen sich operativ – je nach Forschungsabsicht, Untersuchungsobjekt und Methodologie – in den Spektren zwischen den Disziplinen, die durch ihre jeweilige Fragestellung als dem Identität stiftenden Normpunkt der Disziplin auf der strukturellen Ebene des inter-/disziplinären Diskurses als eigenständige Disziplin identifizierbar sind. Dementsprechend ist es gerade im kulturwissenschaftlichen Bereich durchaus wahrscheinlich, dass ein einzelnes Forschungsprojekt ohne ausdrückliche Betrachtung seiner disziplinären Kontexte nicht eindeutig einer bestimmten kulturwissenschaftlichen Disziplin zugeordnet werden kann. Dadurch aber, dass sich das Forschungsprojekt im Vollzug implizit oder explizit in bestimmten inter-/disziplinären Diskursen verortet, gibt es sozusagen seine (dynamischen, weil – durch Gegenstand, Forschungsfrage und Methode – situativen) Koordinaten innerhalb des großen (kultur‐) wissenschaftlichen Gesamtdiskurses an. Als Kriterium dieser Selbstverortung fungieren dann eben genau die Normpunkte selbst, also die Fragestellungen, durch die die Spektren zwischen den Disziplinen, in denen Forschungsprojekte sich bewegen können, überhaupt erst aufgemacht werden. Ein solches operativ-dynamisches Verständnis von interdisziplinären Verhältnissen mag an einigen Stellen im konkreten Vollzug für eine stringente Abgrenzung situativ, relativ und damit instabil anmuten, bietet aber auf der wissenschaftstheoretischen Meta-Ebene den – gerade im Kontext der Debatte um Religionswissenschaft versus Theologie – beachtlichen Vorteil, dass die vielzähligen, in dieser Arbeit nur anreißbaren materialen und formalen wechselseitigen Verbindungen und Schnittpunkte zwischen den Fächern in die disziplinäre Abgrenzung integriert https://doi.org/10.1515/9783111091747-007
310
6 Die Zusammenschau
werden können. Ein solches Verständnis von Disziplinen als multidimensional miteinander vernetzten Diskursen ermöglicht also sowohl klare Disziplinarität als auch gesteigerte Interdisziplinarität – und wird so den Anforderungen eines sich immer weiter ausdifferenzierenden und spezialisierenden Wissenschaftssystems gerecht. Dieses Grundgerüst von (Kultur‐) Wissenschaft lässt sich anhand des spezifischen Verhältnisses von Religionswissenschaft und evangelischer Theologie nun also wie folgt exemplifizieren. Als religionsbezogene Kulturwissenschaften teilen sie sich in unterschiedlicher Fokussierung den Gegenstandsbereich von Religion(en), bedienen sich operativ des großen geistes- und kulturwissenschaftlichen Methodenkanons und reflektieren dabei beide explizit, aber je fachspezifisch auf ihre pluralen Perspektiven auf den Forschungsgegenstand. Letzteres bedingt sich durch das spezifische Wechselverhältnis von Welt und Wissenschaft, in dem beide als Kulturwissenschaften stehen: D. h. die jeweiligen Forschungsprozesse sind in ihrem Gegenstandsbezug, ihrer Methodologie und eben auch ihrer Perspektivik positionell bedingt durch die Welt, in der sie sich vollziehen und in die sie gleichsam als orientierendes Wissen generierende Disziplinen hineinwirken. Beide Fächer reflektieren auf diesen Positionalitätszusammenhang aller Kulturwissenschaft(en) mit dem Ziel, die jeweiligen Forschungsprozesse transparent und intersubjektiv überprüfbar zu gestalten. Die sich aus der jeweiligen übergeordneten Fragestellung ergebenden fachlichen Spezifika dieser Reflexionen liegen dann darin, dass Religionswissenschaft auf der einen Seite solches unter der Frage nach der Vergleichbarkeit bzw. dem Vergleichbarmachen von Religion(en) bzw. religiösen Phänomenen reflektiert: Um Kategorien, Typisierungen und Systematisierungen von Religion(en) zu erstellen, muss der epistemische Entstehenszusammenhang dieser Kategorien, Typisierungen und Systematisierungen im Vollzug des Forschens selbst transparent gemacht werden, damit diese aufgestellten Vergleichskriterien wiederum der intersubjektiven Überprüfbarkeit zugeführt werden und so überhaupt erst als den jeweiligen Untersuchungsobjekten un-/angemessen beurteilt werden können. Also vollzieht sich Religionswissenschaft durch diese Abstraktionsleistung sozusagen systemtheoretisch gedacht in der Außenperspektive der Wissenschaft auf Religionen – und ist aber gleichzeitig aufgrund des wechselseitig-beeinflussenden Verhältnisses von Wissenschaft und Welt Akteurin im Bereich von Kultur und damit auch im religiösen Feld selbst. Theologie auf der anderen Seite reflektiert auf ihren spezifischen Welt-Wissenschaftsbezug unter der Fragestellung nach der Genese und Konstitution christlichen Glaubens als einem zentralen Aspekt von Kultur: Ohne Reflexion auf den wechselseitigen Zusammenhang zwischen Glauben als Positionalitätsfaktor und Glauben als Zielfokus ihres Forschungsprozesses kann Theologie nicht auf die spezifischen Implikationen von Glauben als Weltgestaltung und -deutung, also als einem umfassenden kulturellen
6 Die Zusammenschau
311
Phänomen, zu sprechen kommen, wenn sie dem Untersuchungsgegenstand gegenüber sachgemäß – also nicht an der konkreten historisch-soziokulturellen Situation von Glauben vorbei sprechend – sein will. Dadurch aktiviert Theologie im Forschungsprozess erkennntistheoretisch-proaktiv ihre spezifische Positionalität als Kulturwissenschaft und führt diese durch die explizite Reflexion derselben der intersubjektiven Überprüfbarkeit zu. Durch diese Reflexionsleistung abstrahiert also auch Theologie von ihrer konkreten Positionalität, besonders vom Positionalitätsfaktor Glauben, und vollzieht sich systemtheoretisch gesprochen dann ebenso in der wissenschaftlichen Außenperspektive auf christlichen Glauben. Als religionsbezogene Kulturwissenschaften, die sich beide am geistes- und kulturwissenschaftlichen Methodenkanon bedienen, stehen sowohl Religionswissenschaft als auch Theologie in dem Bewusstsein der historisch-soziokulturellen Bedingtheit dieses Methodenkanons und ihres großen Gegenstandsbereichs Religion(en). Solches äußert sich in beiden Wissenschaften durch die all ihren innerdisziplinären Strukturen gemeinsamen historischen und systematischen Momente ihres jeweiligen Forschungsvollzuges. Spezifisch für Religionswissenschaft als Frage nach der Vergleichbarkeit empirisch vorfindlicher Religionen ist dabei, dass sie in allen ihren Spielarten Religionen in ihrer historischen Genese und aktuellen Verfasstheit untersucht, gleichzeitig eben Systematisierungen und Kategorisierungen von Religionen auf Grundlage dieses Datenmaterials erarbeitet und diese dann wiederum heuristisch auf die empirische Analyse der Geschichte und Konstitution empirisch vorfindlicher Religionen unter der übergeordneten, metatheoretischen Fragestellung ihrer Vergleichbarkeit anwendet. Für Theologie als Frage nach der Entstehung, Tradierung und Gestalt christlichen Glaubens in Geschichte und Gegenwart gehören diese historischen und systematischen Momente insofern zu ihrem Fachdiskurs genuin dazu, als dass Theologie sich auf der einen Seite in allen ihren innerdisziplinären Strukturebenen in sowohl quellen-technisch materialer als auch forschungsprozesslich-formaler historischer Reflexivität vollzieht. Auf der anderen Seite zeichnet sich gerade auch Theologie in allen ihren Disziplinen und Zugriffen durch ein das historisch relative Datenmaterial ordnendes systematisches Moment aus, indem nämlich in Anwendung bestimmter subdisziplinärer und/oder praxeologisch verschiedentlich material gefüllter Heuristika das historisch-reflexiv generierte Datenmaterial zur Entstehung, Tradierung und dem Gehalt von Glauben gleichsam geordnet wird. Als besonderes Spezifikum ihres Forschungsprozesses, das in ihrem epistemisch-proaktiv genutzten Positionalitätsbezug begründet ist, hat Theologie darüber hinaus noch ein genuines praktisches Moment, indem Glauben nicht nur eben Positionalitätsfaktor, sondern gerade auch metatheoretisch verstandener Zielfokus des historisch-systematischen Arbeitens ist. Dadurch, dass sowohl Religionswissenschaft als auch Theologie nicht nur den wissenschaftsprogrammatischen Cultural Turn mitvollzogen haben, sondern be-
312
6 Die Zusammenschau
reits vorher in ihrer jeweiligen Fachgeschichte maßgeblich durch die erkenntnistheoretischen Impulse der Aufklärung bzw. der Neuzeit geprägt sind, ergeben sich – bei aller fachlichen Spezifität – auch gewisse Brückenbaumomente in Bezug auf ihre historisch (dann eben fachlich spezifisch) gewachsene metatheoretisch-disziplinäre Binnenstruktur, die wiederum im wissenschaftstheoretischen Zusammenhang steht zu oben genannten Implikationen des jeweiligen Welt-Wissenschaftsbezugs in Blick auf Gegenstandsbereich, Methode und Perspektive. Sowohl Religionswissenschaft als auch Theologie lassen sich – ohne Anspruch auf Abgeschlossenheit oder Vollständigkeit – in vier exemplarische Zugriffe einteilen. So vollzieht sich Religionswissenschaft im in dieser Arbeit vorgestellten, erweiterbaren System exemplarisch unter historisch-philologischer, empirisch-sozialtheoretischer, philosophisch-phänomenologischer und psychologisch-kognitionswissenschaftlicher Fokussierung. Theologie agiert ebenfalls exemplarisch in historisch-begrifflicher, empirisch-sozialtheoretischer, hermeneutisch-religionsphilosophischer und religionspsychologisch-anthropologischer Fokussierung. Beide kennzeichnen sich hier also – bei aller fachlichen Spezifität – durch Zugriffe, die sich formal und material charakterisieren durch eine Bezogenheit auf historisches Datenmaterial (v. a. von Texten, aber eben auch anderen Artefakten), durch eine sich daraus ergebende Angewiesenheit auf die intensive Auseinandersetzung mit den entsprechenden Quellsprachen, durch eine formal und material an den sozialwissenschaftlichen Dimensionen und Implikationen ihrer Fragestellung orientierte Zugangsweise, durch eine fachspezifische Reflexion in (v. a. philosophischer) Fokussierung auf Begriffe und religiöse Inhalte und durch eine forschungsprozessliche Orientierung an den anthropologischen, psychologischen und/bzw. kognitiven Bedingungen und Konstitutionen des religiösen Subjekts. Dabei vollziehen sich diese hier vorgestellten, exemplarischen vier Zugriffe wiederum unter der jeweiligen übergeordneten Fragestellung des Fachdiskurses (woraus sich – maßgeblich in Kombination mit der jeweiligen Fachtradition – dann auch in der Logik dieser Arbeit nicht nur die differierenden Bezeichnungen, sondern eben auch methodologisch-praxeologischen Konkretisierungen dieser Zugriffe ergeben). Religionswissenschaft fragt dann also metatheoretisch historisch und systematisch in den hier vorgeschlagenen vier Zugriffen jeweils nach der Vergleichbarkeit historisch-kontextualisiert generierter Befunde konkreter historisch vorfindlicher Religionen, nach soziokulturellen Diskursstrukturen von Religionen in konkreten Kontexten, nach der Möglichkeit und Gestalt von Typologisierungen religiöser (Einzel‐) Phänomene und nach potentiell zu vergleichenden Zusammenhängen und Funktionsweisen religiöser Kognitionen auf Individual- und Sozialebene. Theologie hingegen fragt in den dargelegten vier Zugriffen historisch, systematisch und praktisch je nach der Entstehung und Konstitution faktisch gelebter christlicher Religiosität in Geschichte und Gegenwart, nach den Bedingungen und Strukturen christlicher Glaubenspraxis als einem kulturellen
6 Die Zusammenschau
313
System auf gesellschaftlicher Mikro- und Makroebene, nach der Entstehung, der Tradierung und den Inhalten christlicher Glaubensaussagen als Weltanschauungsaussagen und nach dem Selbstbewusstsein christlicher Subjekte als eben christlich-religiöser Subjekte (individuell und in Gemeinschaft), also nach ihrem christlichen Wahrheits- und Wirklichkeitsverständnis. In diesem im Zusammenhang dieser Arbeit nur grob anreißbaren Großkontext kulturwissenschaftlicher Forschungsprogrammatik generieren also sowohl Religionswissenschaft als auch Theologie unter je fachspezifischer Reflexion auf die epistemisch-methodologischen Implikationen ihrer jeweiligen Positionalität, durch die Nutzung des kulturwissenschaftlichen Methodenkanons und in hier je vier exemplarischen, durch historische, systematische (und praktische) Momente geprägten Zugriffen auf den großen Gegenstandsbereich der Religion(en) verlässliches Wissen über Religion(en): Indem sie als Wissenschaften im Kontext von Welt und Wissenschaft(en) in inter-/disziplinärer Ausrichtung unter ihrer jeweiligen Fragestellung Diskurse von und über Religionen ordnen, Orientierung geben und Informationen, Daten, Quellen und Phänomene strukturieren, kategorisieren und interpretieren. Dadurch eröffnen Religionswissenschaft und Theologie zusammen mit anderen religionsbezogenen Wissenschaften nicht nur Erkenntniswelten, sondern vielzählige gesellschaftliche Handlungsspielräume in Bezug auf Religion(en) als zentralem Faktor menschlicher Kultur in verschiedenen historisch-soziokulturellen Kontexten: indem sie Religion(en) in ihren Kontexten vergleichbar, verstehbar und kommunikabel deuten, mit dem großen Grundziel aller (Kultur‐) Wissenschaft, ihren gesellschaftlichen, wissenschaftlich spezifischen Beitrag dazu zu leisten, menschliche (Lebens‐) Welt nicht nur zu verstehen, sondern auch zu gestalten. Dafür sind Religionswissenschaft und Theologie eben nicht nur aufeinander, sondern – aufgrund des in sich vielfältigen und immer weiter ausdifferenzierenden und pluralisierenden Welt-Wissenschaftsbezugs – auf potentiell alle (religionsbezogenen Kultur‐) Wissenschaften angewiesen. Denn die Spezifität des eigenen Fachdiskurses lässt sich nur unter expliziter Reflexion auf seine Enstehungs- und Vollzugszusammenhänge herstellen. Dazu gehört dann im kulturwissenschaftlichen Paradigma nicht nur Kultur mit allen ihren Aspekten (also allen Bereichen, Phänomenen und darauf bezogenen Wissenschaften) als Gegenstandsbereich, sondern auch als Kontext, in dem man sich als Disziplin selbst vollzieht. Eine solche klare Disziplinarität im Angesicht der Interdisziplinarität ist Grundvoraussetzung für ein fruchtbares Miteinander als Wissenschaften mit gesellschaftlicher Verantwortung. Gerade auch Religionswissenschaft und Theologie brauchen – um ihrer selbst willen – einander als je eigenständige Disziplinen.
314
6 Die Zusammenschau
6.1 Epilegomena: Offen gebliebene und weiterführende Fragen – ausgewählte Impulse Eine Verhältnissetzung zweier Disziplinen unter dem Vorzeichen eines durch bestimmte Strukturmomente geprägten Verständnisses von (Kultur‐) Wissenschaften als positionell bedingten, also genuin dynamischen Diskursen unter je spezifischen Fragestellungen kann – vor dem Hintergrund ebendieses Verständnisses – nur unter bestimmten fachlich-positionell bedingten Einschränkungen und Isolierungen vollzogen werden, so dass unweigerlich das gesamte Vorhaben an sich hochgradig vorläufig und partikular ist. Dadurch ergeben sich eine Vielzahl toter Winkel, ignorierter Problemstellungen und offengebliebener Fragen, von denen nun an dieser Stelle als Nachgang der Arbeit nur einige wenige, ausgewählte Aspekte angesprochen werden sollen. Die grundsätzlichste unbeantwortete Frage, die im Hintergrund – als Forschungsimpuls und -zielfokus – dieser Arbeit konstant mitlief, scheint die Frage danach zu sein, warum die Kommunikation über das jeweilige Selbstverständnis und somit die Wahrnehmung der je Anderen zwischen den Fachdiskursen (von Religionswissenschaft und evangelischer Theologie) in der alltäglichen Forschungspraxis nur allzu oft schiefzugehen scheint: Wie in der Einleitung bereits angedeutet und im Fortgang der Arbeit mehrmals angemerkt, scheint – bei aller kulturwissenschaftlichen Nähe der Disziplinen zueinander – das Verständnis für die Eigenständigkeit und den wissenschaftlichen Eigenwert der je anderen Disziplinen nur bedingt vorhanden zu sein. Es können im Zusammenhang dieser Arbeit nun vorerst nur Vermutungen angestellt werden, welche diskurslogischen Gründe für diese Missverständnisse in der Kommunikation untersuchend heranzuziehen wären.¹ So liegt der analytische Fokus dieser fundamentaltheologischen Arbeit – bei allem Bewusstsein für die Positionalität und Dynamizität von Wissenschaft – auf idealen Diskursen in ihrer sprachlichen Konstitution. (Wissenschaftliche) Diskurse im alltagsrealen Vollzug sind nun aber höchstwahrscheinlich eben aufgrund ihrer Positionalität multidimensional geprägt – und stehen somit unter Einfluss nicht nur wissenschaftsrationaler, sondern auch mehr oder weniger bewusst verschiedenster wissenschaftsirrationaler Faktoren. Diskurse sind als praktischer Vollzug immer auch Performance; Sprache ist immer auch Rhetorik. Dementsprechend wäre die Frage nach den nonverbalen und/bzw. unaussprechlichen Faktoren der Diskurse
1 Diese Frage ließe sich dann nicht nur an das Verhältnis von Religionswissenschaft und Theologie stellen, sondern – gerade auch aus theologisch-enzyklopädischem Interesse heraus – an den theologischen Fächerkanon selbst.
6.1 Epilegomena: Offen gebliebene und weiterführende Fragen – ausgewählte Impulse
315
vielleicht dahingehend zielführend, um auf unhintergehbare Inkommunikabilitäten ² zwischen den Disziplinen reflektieren und diese so transparent, kommunikabel und intersubjektiv überprüfbar machen zu können – und so „das Inkommensurable [besser, C. N.] zu ertragen.“³ Denn wahrscheinlich ist epistemisch ja gerade auch innerhalb des Systems Wissenschaft von bestimmten positionell bedingten Unübersetzbarkeiten auszugehen – und von der Vorstellung allgemein anerkannter bzw. allgemeingültiger, metaphysischer, transnationaler, -historischer und/oder -kultureller Regeln des wissenschaftlichen (Gesamt‐) Diskurses abzusehen.⁴ Umso wichtiger erscheint dann eine andauernde Auseinandersetzung mit den Bedingungen der Diskurse: Die Frage nach den verschiedensten Machtstrukturen,⁵ die allein schon durch das Agieren im Diskurs (als ein Sprechen in und über ihn) immer wieder neu aktualisiert werden, könnte Potential dafür bieten, auf die gerade auch wissenschaftstheoretischen Wirksamkeiten dieser (Macht‐) Strukturen reflektieren zu können.⁶ Denn (vermeintlich) äußere Bedingungen wie z. B. hochschul- bzw.
2 Ein – in dieser Arbeit mehrfach schon angesprochenes – Dilemma, in dem gerade vorliegende Arbeit explizit und bewusst steht: Rein forschungsprozesslogisch kommt sie sowohl in Auseinandersetzung mit Religionswissenschaft als auch mit den theologischen Subdisziplinen – gerade auch in Bezug auf die sozusagen diskursive Grammatik – aus einer fundamentaltheologischen Sprache und einer gewissen formal-materiellen Übergriffigkeit nicht heraus. Z. B. das zur Anwendung kommende Vokabular, aber auch das methodologische Vorgehen an sich dürfte höchstwahrscheinlich sowohl dem innerreligionswissenschaftlichen Diskurs in Teilen fremdartig oder unorthodox erscheinen als auch an den jeweiligen theologischen subdisziplinären Teildiskursen an einigen Stellen am jeweiligen eigenen Selbstverständnis vorbeigehend wirken. Dabei ist die Ursache dieses Dilemmas im Grunde gleichsetzbar mit ihrer Lösung: Nur durch bewusstes Reflektieren und Transparentmachen der jeweiligen soziokulturellen und fachlichen Positionalität können Forschungsprojekte in all ihrer Partikularität überhaupt erst für eine Übersetzung in andere Diskurse geöffnet werden. Wünschenswerter Idealfall für die hier vorliegende Arbeit wäre also, wenn aus den jeweiligen Diskursen heraus in ihrem jeweiligen Sprachspiel – sozusagen als Übersetzung – auf den hier getätigten Vorschlag einer Verhältnissetzung von Disziplinen anhand ihrer unterschiedlichen Fragestellungen in der eigenen Diskurslogik eingegangen werden könnte. 3 Lyotard, Das postmoderne Wissen, 16. 4 „Es gibt in der Wissenschaft keine allgemeine Metasprache, in die alle anderen übertragen und in der sie bewertet werden können.“ Ebd., 185 f. 5 „Wer entscheidet, was Wissen ist, und wer weiß, was es zu entscheiden gilt?“ Ebd., 35.Vgl. auch (in Auseinandersetzung mit Habermasʼ Konsenstheorie) ebd., 16. 6 Wodurch genau diese Machtstrukturen immer wieder nicht nur aufgedeckt, sondern gleichsam (idealiter) relativiert werden könnten. Eine solche (im Grunde) Konterkarierung von Machtstrukturen durch ihre Aufdeckung ist angesichts des hier immer wieder genannten Ideals der Intersubjektivität und Transparenz von Wissenschaft zentral: Denn um Transparenz vor allem in Bezug auf die Positionalität von Wissenschaft als (vor‐) wissenschaftliche Bedingung als Maxime des wissenschaftlichen Diskurses zu setzen, müssen kontinuierlich diskursive Strukturen geschaffen
316
6 Die Zusammenschau
wissenschaftspolitische Konstellationen prägen eben nicht nur die äußere Struktur, sondern gerade dadurch auch den Prozess von Wissenschaft und somit den Inhalt selbst. Dies leitet über zu einer weiteren Grundsatzfrage des Verhältnisses von Religionswissenschaft und evangelischer Theologie v. a. im bundesdeutschen Hochschulraum, die im Rahmen dieser Arbeit nicht betrachtet werden konnte: Die immer wieder neu zu thematisierenden Fragen nach der wissenschaftsethischen Bewertung wissenschaftspolitischer Strukturfaktoren, in denen sich – je nach Blickwinkel – auch gewisse Machtstrukturen auszudrücken scheinen. Die Frage, „ob der Staat nicht seine Verpflichtung zur Neutralität im Bereich der Wissenschaft verletzt, wenn er der ‚säkularen‘ Religionswissenschaft gerade im Vergleich zur Theologie als kirchlich gebundener Wissenschaft so wenig Raum zur Entfaltung gewährt“,⁷ ist nicht neu, vieldiskutiert – und gerade deswegen eben immer wieder neu zu thematisieren. Denn natürlich birgt die verfassungsrechtliche Konstitution theologischer Fakultäten als res mixtae von Staat und Kirche verschiedene hochschulpolitische Vorteile für evangelische Theologie im bundesdeutschen Hochschulraum.⁸ Solches entlastet aber keineswegs von einer inner- und interdisziplinären Diskussion über die weitreichenden wissenschaftstheoretischen und -praktischen Implikationen und Konsequenzen dieser spezifischen Situation. Gerade im größeren Zusammenhang der religionsbezogenen Wissenschaften wäre vor dem Hintergrund des hier vorgestellten Konzepts von Theologie als wissenschaftlicher Außenperspektive auf (eine konkrete) Religion die Frage zu stellen, mit welchem Recht, wozu und woraufhin der Aspekt ihrer Konfessionsbindung wissenschaftsethisch und -praktisch angeführt werden kann und sollte, da sich daraus mindestens implizit Anforderungen an religionsbezogene Wissenschaften im Allgemeinen und an Theologien anderer Religionsgemeinschaften im Besonderen ergeben zu scheinen – woraus sich wieder bestimmte (Macht‐) Konstellationen im Diskurs der religionsbezogenen Wissenschaften ergeben.⁹ Diese Frage ist insofern für das Verhältnis von Religionswissenschaft und evangelischer Theologie virulent, als dass es sich hier um einen (eingangs in den Prolegomena schon in einer Fußnote
werden, die diese Transparenz – gerade in Bezug auf die soziokulturellen Faktoren dieser Positionalität – fördern und schützen. 7 Solte, Ernst-Lüder, Theologie an der Universität. Staats- und kirchenrechtliche Probleme der theologischen Fakultäten, München 1971, 205. 8 Vgl. exemplarisch noch einmal Dalferth, Auf dem Weg, 7. 9 Vgl. dazu exemplarisch Scheliha, Arnulf von, Religionspolitische Konstellationen und wissenschaftsethische Folgerungen im Zusammenhang mit der Etablierung von Zentren für Islamische Theologie, in: Ders., Religionspolitik. Beiträge zur politischen Ethik und zur politischen Dimension des religiösen Pluralismus, Tübingen 2018, 240 – 255, 242 – 250.
6.1 Epilegomena: Offen gebliebene und weiterführende Fragen – ausgewählte Impulse
317
exemplarisch angeführten) Kernvorwurf der Religionswissenschaft gegenüber der Theologie handelt: Die konfessionelle Bindung – nicht als vorwissenschaftlicher Positionalitätsfaktor, sondern als formal-juristische Bedingung an das forschende Subjekt – einer religionsbezogenen Wissenschaft erscheint vor dem Hintergrund der Wissenschaftsfreiheit im Kontext eines auf Interdisziplinarität ausgerichteten kulturwissenschaftlichen Paradigmas nur schwer von theologischen in andere religionsbezogene Diskurse übersetzbar.¹⁰ Abschließend ließen sich vor der eben angesprochenen Hintergrundfolie eines kulturwissenschaftlichen Paradigmas einige, wenige, nur vorsichtig formulierte Thesen andeuten, deren wissenschaftstheoretische Überprüfung im hier vorgestellten Ansatz noch aussteht: Der Vorteil eines Verständnisses von Religionswissenschaft und evangelischer Theologie als Kulturwissenschaften, also als Akteurinnen in einem gemeinsamen Großdiskurs, scheint in der gesteigerten Möglichkeit zu Interdisziplinarität bei gestärkter Disziplinarität zu liegen. Wenn dem so ist, dann folgert sich daraus die grundlegende Anforderung, die Disziplinarität der je anderen Disziplin als solche auch wahrzunehmen. Für Religionswissenschaft implizierte das eine stärkere Bereitschaft zu wissenschaftstheoretischen Diskussionen auf Augenhöhe über die eigene Fachgrenze hinaus. Für Theologie bedeutete dies konkret, von jeglichen Vereinnahmungsstrategien gegenüber Religionswissenschaft abzusehen – so begründet sie im konkreten Forschungsvollzug auch erscheinen mögen. Theologie hat als religionsbezogene Kulturwissenschaft ein genuines Interesse an einer eigenständigen Religionswissenschaft. Versuche, Religionswissenschaft weiterhin als theologisches Fach im theologischen Fachdiskurs selbst zu verorten, sind dementsprechend grundsätzlich und kontinuierlich kritisch zu überdenken. Vielmehr erscheint hier sowohl eine Spezialisierung auf theologisch-religionskomparative Zugänge innerhalb der Theologie (als Interkulturelle Theologie) als auch eine höhere Bereitschaft zu interdisziplinären Strukturen wünschenswert: Der Mehrwert von Religionswissenschaft für das theologische Studium, wie er u. a. auch in den Anforderungen in § 7 Abs. 8 der Rahmenordnung für die Erste Theologische Prüfung/die Prüfung zum Magister Theologiae in Evangelischer Theologie Ausdruck findet,¹¹ ist nicht abzustreiten. Gerade vor diesem Hintergrund wäre aber eben zu überlegen, ob dieser Mehrwert nicht in einer vom theologischen Fächerkanon eigenständigen Religi-
10 Und auch im innertheologischen Diskurs wäre hier immer wieder die Frage zu stellen, wie sehr das eigene Fachverständnis als Wissenschaft auf diese Konfessionsbindung rekurrieren kann und sollte. 11 Vgl. Rahmenordnung für die Erste Theologische Prüfung/die Prüfung zum Magister Theologiae in Evangelischer Theologie vom 3. Dezember 2010, https://kirchenrecht-ekd.de/document/19641?#s8. 100010 – 12.02.21.
318
6 Die Zusammenschau
onswissenschaft liegen würde: Es wäre die Frage zu stellen, ob Prüfungsordnungen im Kontext eines kulturwissenschaftlichen Selbstverständnisses nicht stärker daraufhin zu konzipieren wären, dass Möglichkeiten bzw. sogar Anforderungen geschaffen werden, für das theologische Studium zentrale Teilprüfungen außerhalb der theologischen Fakultät abzulegen.¹² Solches scheint einem kulturwissenschaftlichen Selbstverständnis von evangelischer Theologie als der Frage nach christlichem Glauben als spezifischer Weltdeutung und -gestaltung und als gleichberechtigter Mitspielerin im Feld der religionsbezogenen Wissenschaften nicht nur formal, sondern auch inhaltlich näher zu stehen als der nach innen gerichtete Rückzug auf den theologischen Binnendiskurs.
12 Und das nicht nur im Bereich der Religionswissenschaft, sondern gerade auch im Bereich der Philosophie, der Soziologie, aber auch der Jurisprudenz etc. pp.
7 Literatur- und Quellenverzeichnis Die Abkürzungen gehen nach Schwertner, Siegfried M., IATG³. Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete. Zeitschriften, Serien, Lexika, Quellenwerke mit bibliographischen Angaben, Berlin/Boston ³2014. Ergänzende Abkürzungen werden entnommen aus Redaktion der RGG4 (Hg.), Abkürzungen Theologie und Religionswissenschaft nach RGG4 (UTB 2868), Tübingen 2007.¹ Die Kurztitel der Fußnoten folgen – in bis auf wenigen, kenntlich gemachten Ausnahmen – der Logik [Verfasser*in], [Anfang des Titels].
7.1 Alphabetisches Verzeichnis der zitierten Printmedien Albrecht, Christian, Die Praktische Theologie im Gesamtzusammenhang der Theologie, in: Ders./ Gemeinhardt, Peter (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und außen, Tübingen 2021, 157 – 173. Albrecht, Christian, Die Praktische Theologie im Kreis der theologischen Fächer. Theorie der religiösen Praxis des Christentums, in: Buntfuß, Markus/Fritz, Martin (Hg.), Fremde unter einem Dach? Die theologischen Fächerkulturen in enzyklopädischer Perspektive (TBT 163), Berlin 2014, 149 – 165. Albrecht, Christian, Historische Kulturwissenschaft neuzeitlicher Christentumspraxis. Klassische Protestantismustheorien in ihrer Bedeutung für das Selbstverständnis der Praktischen Theologie (BHTh 114), Tübingen 2000. Albrecht, Christian/Gemeinhardt, Peter, Einleitung, in: Dies. (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und von außen, Tübingen, 2021, 1 – 9. Alkier, Stefan, Das Neue Testament im Kreis der theologischen Fächer. Neutestamentliche Wissenschaft als Beitrag der Erschließung eines evangelischen Wirklichkeitsverständnisses, in: Buntfuß, Markus/Fritz, Martin (Hg.), Fremde unter einem Dach? Die theologischen Fächerkulturen in enzyklopädischer Perspektive (TBT 163), Berlin 2014, 43 – 67. Anselm, Reiner, Das Verbindende der Praxis. Der Bezug auf die Vollzüge des Christentums macht die Theologizität einer Disziplin aus. Ein Kommentar zum Impuls von Konrad Schmid, in: Albrecht, Christian/Gemeinhardt, Peter (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und außen, Tübingen 2021, 59 – 62. Anselm von Canterbury, Proslogion. Fides quaerens intellectum (1078), in: S. Anselmi Cantuariensis archiepiscopi opera omnia. Band 1. Hrsg. v. Franciscus Salesius Schmitt, Seckau 1938, 89 – 139. Antes, Peter, A Survey of New Approaches to the Study of Religion in Europe, in: Ders. (Hg.), New approaches to the study of religion. Band 1. Regional, critical and historical approaches (RaR 42), Berlin 2004, 43 – 61. Antes, Peter, Systematische Religionswissenschaft. Eine Neuorientierung, in: ZMR 2/3 70 (1986), 214 – 221. Arens, Edmund, Gottesverständigung. Eine kommunikative Religionstheologie, Freiburg i. Br. 2007.
1 Mit folgenden gemeinhin üblichen Ausnahmen: AA steht für Akademie-Ausgabe, GW für Gesammelte Werke und KGA für Kritische Gesamtausgabe. https://doi.org/10.1515/9783111091747-008
320
7 Literatur- und Quellenverzeichnis
Arndt, Andreas, Schleiermacher in der nachkantischen Philosophie, in: Ohst, Martin (Hg.), Schleiermacher Handbuch (Handbücher Theologie), Tübingen 2017, 32 – 48. Aschenberg, Reinhold, Der Wahrheitsbegriff in Hegels „Phänomenologie des Geistes“, in: Schneider, Friedhelm/Hartmann, Klaus/Brinkmann, Klaus/Aschenberg, Reinhold (Hg.), Die ontologische Option. Studien zu Hegels Propädeutik, Schellings Hegel-Kritik und Hegels Phänomenologie des Geistes, Berlin/New York 1976, 211 – 312. Astley, Jeff, The Analysis, Investigation and Application of Ordinary Theology, in: Ders./Francis, Leslie J. (Hg.), Exploring ordinary theology. Everyday Christian believing and the church (Explorations in practical, pastoral, and empirical theology), Farnham/Burlington 2013. Auga, Ulrike, Aus- oder Anschlüsse? Theologie – Geschlechtertheorie – Religionswissenschaft, in: Lanwerd, Susanne/Moser, Márcia E. (Hg.), Frau – Gender – Queer, Gendertheoretische Ansätze in der Religionswissenschaft, Würzburg 2010, 229 – 250. Auga, Ulrike, Geschlecht und Religion als kritische intersektionale Kategorien. Deessentialisieren und Disidentifizieren als Aufgabe, in: Krannich, Laura-Christin/Reichel, Hanna/Evers, Dirk (Hg.), Menschenbilder und Gottesbilder. Geschlecht in theologischer Reflexion, Leipzig 2019, 43 – 72. Axt-Piscalar, Christine, Was ist Theologie? Klassische Entwürfe von Paulus bis zur Gegenwart (UTB 3579), Tübingen 2013. Baaren, Theodorus P. van, Science of Religion as a Systematic Discipline. Some Introductory Remarks, in: Ders./Drijvers, Hendrik Jan Willem (Hg.), Religion, culture and methodology. Papers of the Groningen Working-Group for the Study of Fundamental Problems and Methods of Science of Religion (RaR 8), Den Haag/Paris 1973, 35 – 56. Baaren, Theodorus P. van, Systematische Religionswissenschaft, in: NedThT 24 (Dezember 1969/70), 81 – 88. Barth, Karl, Der Römerbrief (1922). Zweite Fassung, Zürich 172005. Barth, Karl, Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur kirchlichen Dogmatik. §§ 1 – 12, in: KD I,1 (1975). Barth, Karl, Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur kirchlichen Dogmatik. §§ 13 – 24, in: KD I,2 (1960). Barth, Ulrich, Wissenschaftstheorie der Theologie. Ein Durchgang durch Schleiermachers Enzyklopädie, in: Ders., Kritischer Religionsdiskurs, Tübingen 2014, 263 – 278. Baumann, Peter, Erkenntnistheorie (Lehrbuch Philosophie), Stuttgart/Weimar 32015. Beck, Lewis White, Kants „Kritik der praktischen Vernunft“. Ein Kommentar (UTB 1833), München 3 1995. Becker, Eve-Marie, Neutestamentliche Wissenschaft, in: Dies./Hiller, Doris (Hg.), Handbuch Evangelische Theologie. Ein enzyklopädischer Zugang (UTB 8326), Tübingen 2006, 87 – 156. Becker, Carmen, Returning to the Empirical after the Discursive Turn?, in: ZfR 29/2 (2021), 275 – 280. Becker, Eve-Marie/Hiller, Doris, Theologische Enzyklopädie. Eine Einführung, in: Dies. (Hg.), Handbuch Evangelische Theologie. Ein enzyklopädischer Zugang (UTB 8326), Tübingen 2006, 2 – 26. Bergunder, Michael, Was ist Religion? Kulturwissenschaftliche Überlegungen zum Gegenstand der Religionswissenschaft, in: ZfR 19 (2011), 3 – 55. Bergunder, Michael, Umkämpfte Historisierung. Die Zwillingsgeburt von „Religion“ und „Esoterik“ in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und das Programm einer globalen Religionsgeschichte, in: Hock, Klaus (Hg.), Wissen um Religion. Erkenntnis – Interesse. Epistemologie und Episteme in Religionswissenschaft und Interkultureller Theologie (VWGTh 64), Leipzig 2020, 47 – 131.
7.1 Alphabetisches Verzeichnis der zitierten Printmedien
321
Berlejung, Angelika, Quellen und Methoden, in: Gertz, Jan Christian (Hg.), Grundinformation Altes Testament. Eine Einführung in Literatur, Religion und Geschichte des Alten Testaments (UTB 2745), Göttingen/Stuttgart 2010, 19 – 54. Berner, Christoph, Gottes Wort und Schreibers Griffel. Die Redaktionsgeschichte alttestamentlicher Texte als Herausforderung für Exegese und Theologie, in: ZThK 2/118 (2021), 141 – 159. Berner, Ulrich, Braucht Religionswissenschaft konfessionelle Theologie?, in: Alkier, Stefan/Heimbrock, Hans-Günter (Hg.), Evangelische Theologie an staatlichen Universitäten. Konzepte und Konstellationen evangelischer Theologie und Religionsforschung, Göttingen 2011, 243 – 261. Berner, Ulrich, Mircea Eliade (1907 – 1986), in: Michaels, Axel (Hg.), Klassiker der Religionswissenschaft. Von Friedrich Schleiermacher bis Mircea Eliade, München 22004, 343 – 353. Berner, Ulrich, Theologie und Religionswissenschaft. Ansätze zur Einordnung und Abgrenzung, in: Albrecht, Christian/Gemeinhardt (Hg.), Peter, Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und von außen, Tübingen 2021, 225 – 244. Bernhardt, Reinhold, Komparative Theologie, in: ThR 2/78 (2013), 187 – 200. Beutel, Albrecht, Kirchengeschichte als Geschichte der Auslegung der Heiligen Schrift. Ein tragfähiges Modell?, in: Nowak, Kurt/Kinzig, Wolfram/Leppin, Volker/Wartenberg, Günther (Hg.), Historiographie und Theologie. Kirchen- und Theologiegeschichte im Spannungsfeld von geschichtswissenschaftlicher Methode und theologischem Anspruch (AKThG 15), Leipzig 2004, 103 – 118. Beutel, Albrecht, Theologische Enzyklopädie. Bemerkungen zur Genese, Bedeutung und Aktualität einer notwendigen Disziplin, in: Albrecht, Christian/Gemeinhardt, Peter (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und von außen, Tübingen 2021, 13 – 34. Beutel, Albrecht, Vom Nachteil und Nutzen der Kirchengeschichte. Begriff und Funktion einer theologischen Kerndisziplin, in: ZthK 94 (1997), 84 – 110. Blasche, Siegfried, Art. Geist, absoluter, in: EphW 1 (1980), 722. Blasche, Siegfried, Art. Hegel, in: EphW 2 (1984), 48 – 54. Bohner, Hermann, Die Grundlage der Lotzeschen Religionsphilosophie, Erlangen 1914. Bormann, Lukas, Theologie des Neuen Testaments. Grundlinien und wichtigste Ergebnisse der internationalen Forschung (Basiswissen Theologie und Religionswissenschaft 4838), Göttingen 2017. Borup, Jørn, Zen and the Art of Inverting Orientalism. Buddhism, Religious Studies and Interrelated Networks, in: Antes, Peter, New approaches to the study of religion. Band 1. Regional, critical and historical approaches (RaR 42), Berlin 2004, 451 – 487. Bultmann, Rudolf, Das Problem der Hermeneutik, in: Ders., Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze. Band 2, Tübingen 1965, 211 – 235. Bultmann, Rudolf, Neues Testament und Mythologie. Das Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung. Nachdruck der 1941 erschienen Fassung (BEvT 96), München 3 1988. Bultmann, Rudolf, Theologische Enzyklopädie, Tübingen 1984. Butler, Judith, Das Unbehagen der Geschlechter (Gender Studies 1722), Frankfurt a. M. 192018. Carrier, Martin, Wissenschaftstheorie zur Einführung (Zur Einführung 353), Hamburg 32011. Chantepie de la Saussaye, Pierre Daniel, Lehrbuch der Religionsgeschichte. Erster Band (Sammlung theologischer Lehrbücher), Freiburg i. Br. 1887. Chantepie de la Saussaye, Pierre Daniel, Lehrbuch der Religionsgeschichte. Erster Band. Zweite völlig neu gearbeitete Auflage (Sammlung theologischer Lehrbücher), Freiburg i. Br./Leipzig 21897.
322
7 Literatur- und Quellenverzeichnis
Clavier, Henri, Wiederaufbruch eines Methodenproblems in der Religionsgeschichte (1968), in: Lanczkowski, Günter (Hg.), Selbstverständnis und Wesen der Religionswissenschaft (WdF 263), Darmstadt 1974, 272 – 302. Clemen, Carl, Allgemeine Religionsgeschichte im Schul- und Universitätsunterricht, in: PrJ 1/152 (1913), 217 – 227. Coreth, Emerich, Art. Frage, in: HphG 1 (1973), 485 – 493. Corrywright, Dominic/Morgan, Peggy, Get set for religious studies, Edinburgh 2006. Därmann, Iris/Jamme, Christoph, Art. Kulturwissenschaft(en), in: EnzPh 2 (2010), 1353 – 1359. Dabrock, Peter, Antwortender Glaube und Vernunft. Zum Ansatz evangelischer Fundamentaltheologie (FSy 5), Stuttgart 2000. Dabrock, Peter, Konkrete Ethik in fundamentaltheologischer Perspektive, in: Held, Marcus/Roth, Michael (Hg.), Was ist theologische Ethik? Grundbestimmungen und Grundvorstellungen, Berlin/ Boston 2018, 19 – 40. Dalferth, Ingolf U., Auf dem Weg zur Abschaffung, in: FAZ 103 (04. 05. 2017), 7. Dalferth, Ingolf U., Evangelische Theologie als Interpretationspraxis. Eine systematische Orientierung (ThLZ.F 11/12), Leipzig 2004. Dalferth, Ingolf U., Fundamentaltheologie oder Religionsphilosophie?, in: Petzoldt, Matthias (Hg.), Evangelische Fundamentaltheologie in der Diskussion, Leipzig 2004, 171 – 193. Dalferth, Ingolf U., Religiöse Rede von Gott (BevT 87), München 1981. Dalferth, Ingolf U., Theologie im Kontext der Religionswissenschaft. Selbstverständnis, Methoden und Aufgaben der Theologie und ihr Verhältnis zur Religionswissenschaft, in: ThLZ 1/126 (2001), 3 – 20. Danz, Christian, Systematische Theologie (UTB 4613), Tübingen 2016. Denzinger, Heinrich, Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen. Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Herausgegeben von Peter Hünermann, Freiburg i. Br. 452017. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Empfehlungen der Kommission „Selbstkontrolle in der Wissenschaft“. Ergänzte Auflage, Weinheim 2013. Disse, Jörg, Die Frage nach dem Proprium der Fundamentaltheologie im evangelisch-katholischen Dialog. Stellungnahme zu Matthias Petzoldt, in: Meyer zu Schlochtern, Josef/Siebenrock, Roman (Hg.), Wozu Fundamentaltheologie? Zur Grundlegung der Theologie im Anspruch von Glaube und Vernunft (PaThSt 52), Paderborn 2010, 235 – 253. Durkheim, Émile, Die elementaren Formen des religiösen Lebens. Aus dem Französischen von Ludwig Schmidts, Frankfurt a. M. 2007. Ebeling, Gerhard, Erwägungen zu einer evangelischen Fundamentaltheologie, in: ZthK 67 (1970), 479 – 524. Ebeling, Gerhard, Kirchengeschichte als Geschichte der Auslegung der Heiligen Schrift, in: Ders., Wort Gottes und Tradition (KiKonf 7), Göttingen 1964, 9 – 27. Ebeling, Gerhard, Studium der Theologie. Eine enzyklopädische Orientierung (UTB 3582), Tübingen 2 2012. Eisenhardt, Saskia, „Also vielleicht hat er ja die Fähigkeiten von Gott bekommen“. Theologisieren mit religionsfernen Jugendlichen im evangelischen Religionsunterricht, in: PrTH 1/55 (2020), 17 – 21. Englert, Rudolf, Das Theologische der Religionspädagogik. Grundfragen und Herausforderungen, in: Schlag, Thomas/Suhner, Jasmine/Burrichter, Rita/Grümme, Bernhard/Mendl, Hans/Pirner, Manfred L./Rothgangel, Martin (Hg.), Theologie als Herausforderung religiöser Bildung.
7.1 Alphabetisches Verzeichnis der zitierten Printmedien
323
Bildungstheoretische Orientierungen zur Theologizität der Religionspädagogik (Religionspädagogik innovativ 17), Stuttgart 2017, 21 – 32. Eßer, Albert, Art. Interesse, in: HphG 2 (1973), 738 – 747. Feldtkeller, Andreas, Das Menschenbild von Religionswissenschaft und Theologien als Raum ihrer Abgrenzung und Kooperation, in: BThZ 1/29 (2012), 97 – 118. Feldtkeller, Andreas, Religions- und Missionswissenschaft. Was den Unterschied ausmacht für das Gesamtprojekt Theologie, in: Dalferth, Ingolf U. (Hg.), Eine Wissenschaft oder viele? Die Einheit evangelischer Theologie in der Sicht ihrer Disziplinen (ThLZ.F 17), Leipzig 2006, 121 – 139. Feldtkeller, Andreas, Umstrittene Religionswissenschaft. Für eine Neuvermessung ihrer Beziehung zur Säkularisierungstheorie (ThLZ.F 31), Leipzig 2014. Figl, Johann, Einleitung. Religionswissenschaft – historische Aspekte, heutiges Fachverständnis und Religionsbegriff, in: Ders. (Hg.), Handbuch Religionswissenschaft. Religionen und ihre zentralen Themen, Innsbruck 2003, 18 – 80. Fischer, Johannes, Über das Verhältnis von Glauben und Wissen. Eine Auseinandersetzung mit Jürgen Habermasʼ Genealogie des nachmetaphysischen Denkens, in: ThLZ 3/117 (2020), 316 – 346. Fitschen, Klaus, Aktuelle Methodendebatten in der protestantischen Geschichtsschreibung, in: Nowak, Kurt/Kinzig, Wolfram/Leppin, Volker/Wartenberg, Günther (Hg.), Historiographie und Theologie. Kirchen- und Theologiegeschichte im Spannungsfeld von geschichtswissenschaftlicher Methode und theologischem Anspruch (AKThG 15), Leipzig 2004, 39 – 52. Fitschen, Klaus, Nathan Söderblom. Religionswissenschaftler, Kirchenmann, Friedensnobelpreisträger, in: Journal Universität Leipzig 3 (2012), 21. Flasche, Rainer, Die Religionswissenschaft Joachim Wachs, Berlin 1978. Flasche, Rainer, Religionsmodelle und Erkenntnisprinzipien der Religionswissenschaft in der Weimarer Zeit, in: Cancik, Hubert/Bausinger, Hermann (Hg.), Religions- und Geistesgeschichte der Weimarer Republik. 6. Tübinger Religionswissenschaftliche Ringvorlesung, Düsseldorf 1982, 261 – 276. Foucault, Michel, Die Ordnung des Diskurses. Mit einem Essay von Ralf Konersmann, Frankfurt a. M. 12 2012. Franke, Edith, Fachliche Spezialisierung, methodische Integration, Mut zur Theorie und die Marginalität der Kognitionswissenschaften, in: Dies./Maske, Verena (Hg.), Religionswissenschaft zwischen Sozialwissenschaften, Geschichtswissenschaft und Kognitionsforschung. Ein AutorenWorkshop mit Hubert Seiwert (Marburg Online Books 2), Marburg 2014, 33 – 42. Freiberger, Oliver, Ist Wertung Theologie? Beobachtungen zur Unterscheidung von Religionswissenschaft und Theologie, in: Löhr, Gebhard (Hg.), Die Identität der Religionswissenschaft. Beiträge zum Verständnis einer unbekannten Disziplin (GTF 2), Frankfurt a. M. 2000, 97 – 121. Freiberger, Oliver, Der Vergleich als Methode und konstitutiver Ansatz der Religionswissenschaft, in: Kurth, Stefan/Lehmann, Karsten (Hg.), Religionen erforschen. Kulturwissenschaftliche Methoden in der Religionswissenschaft, Wiesbaden 2011, 199 – 218. Frenschkowski, Marco, Der Teil und das Ganze. Wovon handelt Religionswissenschaft?, in: Court, Jürgen/Klöcker, Michael (Hg.), Wege und Welten der Religionen. Forschungen und Vermittlungen. Festschrift für Udo Tworuschka, Frankfurt a. M. 2009, 113 – 124. Friese, Heidrun, Cultural studies. Forschungsfelder und Begriffe, in: Jaeger, Friedrich/Straub, Jürgen (Hg.), Paradigmen und Disziplinen (Handbuch der Kulturwissenschaften 2), Stuttgart/Weimar 2011, 467 – 485.
324
7 Literatur- und Quellenverzeichnis
Führding, Steffen, Diskursgemeinschaft Religionswissenschaft, in: Franke, Edith/Maske, Verena (Hg.), Religionswissenschaft zwischen Sozialwissenschaften, Geschichtswissenschaft und Kognitionsforschung. Ein Autoren-Workshop mit Hubert Seiwert (Marburg Online Books 2), Marburg 2014, 55 – 68. Gadamer, Hans-Georg, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Hermeneutik I, in: GW 1 (1986). Gantke, Wolfgang, Gelebte Religion. Probleme und Perspektiven der „Praktischen Religionswissenschaft“, in: Burkard, Franz-Peter (Hg.), Praktische Religionswissenschaft. Theoretische und methodische Ansätze und Beispiele. Festschrift zum 65. Geburtstag von Udo Tworuschka (Studien und Dokumentationen zur praktischen Religionswissenschaft 1), Münster 2014, 35 – 44. Gardiner, Mark Q./Engler, Steven, Allies in the Fullness of Theory, in: ZfR 29/2 (2021), 259 – 267. Gemeinhardt, Peter, Geschichte des Christentums als theologische Disziplin. Eine intra- und interdisziplinäre Verortung, in: Ders./Albrecht, Christian (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und außen, Tübingen 2021, 97 – 113. Gemünden, Petra von/Horrell, David G./Küchler, Max, Vorwort, in: Dies. (Hg.), Jesus – Gestalt und Gestaltungen. Rezeptionen des Galiläers in Wissenschaft, Kirche und Gesellschaft. Festschrift für Gerd Theißen zum 70. Geburtstag (NTOA/StUNT 100), Göttingen 2013, 5 – 9. Gertz, Jan Christian, Grundfragen einer Theologie des Alten Testaments, in: Ders. (Hg.), Grundinformation Altes Testament. Eine Einführung in Literatur, Religion und Geschichte des Alten Testaments (UTB 2745), Göttingen/Stuttgart 2010, 509 – 526. Gethmann, Carl F., Art. Erkenntnisinteresse, in: EPhW 2 (1984), 376 – 377. Gethmann, Carl F., Art. Frage, in: EPhW 2 (1984), 544 – 545. Gladigow, Burkhard, Gegenstände und wissenschaftlicher Kontext von Religionswissenschaft, in: Ders./Cancik, Hubert/Laubscher, Matthias (Hg.), Systematischer Teil. Alphabetischer Teil: Aberglaube – Antisemitismus (HRWG 1), Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1988, 26 – 40. Gladigow, Burkhard, Mögliche Gegenstände und notwendige Quellen einer Religionsgeschichte, in: Beck, Heinrich (Hg.), Germanische Religionsgeschichte. Quellen und Quellenprobleme (RGA.E 5), Berlin/New York 1992, 3 – 26. Gladigow, Burkhard, Religion in der Kultur – Kultur in der Religion, in: Jaeger, Friedrich/Liebsch, Burkhard (Hg.), Grundlagen und Schlüsselbegriffe (Handbuch der Kulturwissenschaften 1), Stuttgart 2011, 21 – 33. Goethe, Johann Wolfgang, Maximen und Reflexionen (Bibliothek des 18. Jahrhunderts), Leipzig 1988. Gogarten, Friedrich, Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit. Die Säkularisierung als theologisches Problem, Stuttgart 21958. Gräb, Wilhelm, Wissenschaftsgeschichte der Praktischen Theologie, in: Schlag, Thomas/Schröder, Bernd (Hg.), Praktische Theologie und Religionspädagogik. Systematische, empirische und thematische Verhältnisbestimmungen (VWGTh 60), Leipzig 2020, 33 – 55. Gräfrath, Bernd, Art. Disziplin, wissenschaftliche, in: EPhW 2(1984), 237 – 238. Greschat, Hans-Jürgen, Was ist Religionswissenschaft? (UTB 390), Stuttgart 1988. Grethlein, Christian, Historische Kulturwissenschaft neuzeitlicher Christentumspraxis. Klassische Protestantismustheorien in ihrer Bedeutung für das Selbstverständnis der Praktischen Theologie, in: ThLZ 126 (2001), 319 – 321. Grethlein, Christian, Praktische Theologie, Berlin/Boston 22016. Gruber, Judith, Intercultural Theology. Exploring World Christianity after the Cultural Turn (RCR 25), Göttingen 2017.
7.1 Alphabetisches Verzeichnis der zitierten Printmedien
325
Guntau, Martin/Laitko, Hubert, Entstehung und Wesen wissenschaftlicher Disziplinen. Der Ursprung der modernen Wissenschaften, in: Dies. (Hg.), Der Ursprung der modernen Wissenschaften. Studien zur Entstehung wissenschaftlicher Disziplinen, Berlin 1987, 17 – 89. Haas, Hans, Joachim Wach. Prolegomena zur Grundlegung der Religionswissenschaft, in: Hase, Thomas/Espig, Christian (Hg.), 100 Jahre Leipziger Religionswissenschaft. Ausgewählte Texte, Leipzig 2012, 57 – 63. Habermas, Jürgen, Erkenntnis und Interesse. Frankfurter Antrittsvorlesung vom 28. Juni 1965, in: Merkur 213/19 (1965), 1139 – 1153. Habermas, Jürgen, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt a. M. 51979. Habermas, Jürgen, Theorie des kommunikativen Handelns. Band I. Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung, Frankfurt a. M. 21982. Habermas, Jürgen, Von den Weltbildern zur Lebenswelt, in: Gethmann, Carl Friedrich (Hg.), Lebenswelt und Wissenschaft. XXI. Deutscher Kongreß für Philosophie. 15. – 19. September 2008 an der Universität Duisburg-Essen. Kolloquienbeiträge (Deutsches Jahrbuch Philosophie 2), Hamburg 2011, 63 – 88. Hägglund, Bengt, Geschichte der Theologie. Ein Abriss (KT 79), München ²1993. Haekel, Josef, Art. Hardy, Edmund, in: LthK3 4 (2006), 1189. Härle, Wilfried, Art. Dialektische Theologie, in: TRE 8 (1981), 683 – 696. Härle, Wilfried, Dogmatik (De Gruyter Studium), Berlin/Boston 52018. Hafner, Johann, Der blinde Fleck. Religions-Fakultät statt Theologien-Fakultät, in: HerKorr 5/71 (2017), 15 – 16. Hahn, Ferdinand, Theologie des Neuen Testaments. Band 1. Die Vielfalt des Neuen Testaments (UTB 3500), Stuttgart 22011. Haraway, Donna, Situated Knowledges. The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, in: Feminist Studies 14/3 (1988), 575 – 599. Hardy, Edmund, Was ist Religionswissenschaft? Ein Beitrag zur Methodik der historischen Religionsforschung (1898), in: Lanczkowski, Günter (Hg.), Selbstverständnis und Wesen der Religionswissenschaft (WdF 263), Darmstadt 1974, 1 – 29. Harnack, Adolf von, Die Aufgabe der theologischen Facultäten und die allgemeine Religionsgeschichte. Rede zur Gedächtnisfeier des Stifters der Berliner Universität König Friedrich Wilhelm III, Berlin 1901. Harnack, Adolf von, Das Wesen des Christentums. Neuauflage zum fünfzigsten Jahrestag des ersten Erscheinens. Mit einem Geleitwort von Rudolf Bultmann, Stuttgart 1950. Hase, Thomas/Espig, Christian, Zu diesem Band, in: Dies. (Hg.), 100 Jahre Leipziger Religionswissenschaft. Ausgewählte Texte, Leipzig 2012, 7 f. Hegel, Georg Friedrich Wilhelm, Phänomenologie des Geistes, in: GW 9 (1980). Henrici, Peter, Hegel für Theologen. Gesammelte Aufsätze (Schriftenreihe der Theologischen Hochschule Chur 8), Fribourg 2009. Hermelink, Jan/Schulz, Claudia, Von der „empirischen Wende“ zu empirisch induzierten Bindungskonflikten. Praktisch-theologische Rückblicke und Ausblicke, in: PrTH 1/54 (2019), 39 – 42. Herms, Eilert, Art. Erfahrung IV, in: TRE 10 (1982), 128 – 136. Herms, Eilert, Das Selbstverständnis der Wissenschaften heute und die Theologie (1993), in: Ders., Kirche für die Welt. Lage und Aufgabe der evangelischen Kirchen im vereinigten Deutschland, Tübingen 1995, 349 – 387.
326
7 Literatur- und Quellenverzeichnis
Herms, Eilert, Radical Empiricism. Studien zur Psychologie, Metaphysik und Religionstheorie William Jamesʼ, Gütersloh 1977. Herms, Eilert, Systematische Theologie. Band 1. Das Wesen des Christentums. In Wahrheit und aus Gnade leben, Tübingen 2017. Herms, Eilert, Theologie als Kulturwissenschaft, in: Ders., Phänomene des Glaubens. Beiträge zur Fundamentaltheologie, Tübingen 2006, 432 – 454. Herms, Eilert, Theologie an der Universität. Die Gegenwartsrelevanz von Schleiermachers Programm, in: Gräb, Wilhelm/Slenczka, Notger (Hg.), Universität – Theologie – Kirche. Deutungsangebote zum Verhältnis von Kultur und Religion im Gespräch mit Schleiermacher (ASyTh 4), Leipzig 2011, 24 – 50. Herms, Eilert, Theologie. Eine Erfahrungswissenschaft (TEH N.F. 199), München 1978. Herms, Eilert, Theologie und Religionswissenschaft, in: Ders., Phänomene des Glaubens. Beiträge zur Fundamentaltheologie, Tübingen 2006, 455 – 475. Herms, Eilert, Wahrheit – Offenbarung – Vernunft, in: Ders., Phänomene des Glaubens. Beiträge zur Fundamentaltheologie, Tübingen 2006, 96 – 115. Höhn, Hans-Joachim, Glaube im Diskurs. Notizen zur diskursiven Verantwortung christlicher Glaubensvermittlung, in: ThPh 60 (1985), 213 – 238. Hock, Klaus, Einführung in die Religionswissenschaft (Einführung Theologie), Darmstadt 2002. Hummel, Gert, Art. Enzyklopädie, theologische, in: TRE 9 (1982), 716 – 742. Hutter, Manfred, Art. Religionsgeschichte, in: RGG4 7 (2004), 318 – 321. Huxel, Kirsten, Psychologie, in: Ohst, Martin (Hg.), Schleiermacher Handbuch (Handbücher Theologie), Tübingen 2017, 285 – 290. James, William, The varieties of religious experience. Edited with an Introduction and Notes by Matthew Bradley, Oxford 2012. Janowski, Bernd, Old Testament Theology. Preliminary Conclusions and Future Prospects, in: Sæbø, Magne/Machinist, Peter (Hg.), The twentieth century. From Modernism to Post-Modernism (HBOT III/2), Göttingen 2015, 642 – 673. Joest, Wilfried, Fundamentaltheologie. Theologische Grundlagen- und Methodenprobleme (ThW 11), Stuttgart 31988. Kambartel, Friedrich, Art. Wissenschaft, in: EPhW 4 (1996), 719 – 721. Kant, Immanuel, Der Streit der Facultäten (1798), in: AA 7 (1917), 1 – 116. Kant, Immanuel, Kritik der praktischen Vernunft (1788), in: AA 5 (1913), 1 – 163. Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft (1787), in: AA 3 (1911), 1 – 552. Kettern, Bernd, Art. Lotze, Rudolf Hermann, in: BBKL 5 (1993), 270 – 277. Keßler, Martin, „Kirchengeschichte als Geschichte der Auslegung der Heiligen Schrift“. Gerhard Ebelings handschriftliche Vorbereitung seiner Habilitations-Probevorlesung (1946), in: Kampmann, Claudia/Volp, Ulrich/Wallraff, Martin (Hg.), Kirchengeschichte. Historisches Spezialgebiet und/oder theologische Disziplin (Theologie – Kultur – Hermeneutik 28), Leipzig 2020, 283 – 320. Kinzig, Wolfram, Wie theologisch ist die „Historische Theologie“? Bemerkungen zur Geschichte eines Begriffs und seiner heutigen Bedeutung, in: Ders./Fitschen, Klaus/Kohnle, Armin/Leppin, Volker (Hg.), Kirchengeschichte und Religionswissenschaft. Methoden und Fallstudien (AKThG 51), Leipzig 2018, 49 – 91. Kippenberg, Hans G., Garizim und Synagoge. Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zur samaritanischen Religion der aramäischen Periode (RVV 30), Berlin/New York 1971.
7.1 Alphabetisches Verzeichnis der zitierten Printmedien
327
Kippenberg, Hans G., Gewalt als Gottesdienst. Religionskriege im Zeitalter der Globalisierung, München 2008. Kippenberg, Hans G./Stuckrad, Kocku von, Einführung in die Religionswissenschaft. Gegenstände und Begriffe (C. H. Beck Studium), München 2003. Kleffmann, Tom, Systematische Theologie zwischen Philosophie und historischer Wissenschaft, in: NZSTh 2/46 (2004), 207 – 225. Klein, Andreas, Schüler, Sebastian. Religion, Kognition, Evolution. Eine religionswissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Cognitive Science of Religion, in: ThLZ 4/140 (2015), 344 – 346. Kleine, Christoph, Wozu außereuropäische Religionsgeschichte? Überlegungen zu ihrem Nutzen für die religionswissenschaftliche Theorie- und Identitätsbildung, in: Hase, Thomas/Espig, Christian (Hg.), 100 Jahre Leipziger Religionswissenschaft. Ausgewählte Texte, Leipzig 2012, 223 – 265. Klimkeit,Hans-Joachim, Art. Religionswissenschaft, in: TRE 29 (1998), 61 – 67. Körtner, Ulrich H. J., Zur Einführung. Die Gottesfrage in Theologie und Religionswissenschaft, in: Ders. (Hg.), Gott und Götter. Die Gottesfrage in Theologie und Religionswissenschaft, Neukirchen-Vluyn 2005, 1 – 22. Kohl, Karl-Heinz, Geschichte der Religionswissenschaft, in: Cancik, Hubert/Gladigow, Burkhard/ Laubscher, Matthias (Hg.), Systematischer Teil. Alphabetischer Teil: Aberglaube – Antisemitismus (HRWG 1), Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1988, 217 – 262. Kollmar-Paulenz, Karénina, Zur Relevanz der Gottesfrage für eine transkulturell orientierte Religionswissenschaft, in: Körtner, Ulrich H. J. (Hg.), Gott und Götter. Die Gottesfrage in Theologie und Religionswissenschaft, Neukirchen-Vluyn 2005, 23 – 49. Korsch, Dietrich, Theologische Prinzipienfragen, in: Beutel, Albrecht (Hg.), Luther-Handbuch, Tübingen 3 2017, 398 – 408. Korsch, Dietrich, Zweihundert Jahre nach Schleiermachers „Kurzer Darstellung des theologischen Studiums“. Wie unterscheidet sich die Theologie von anderen wissenschaftlichen Disziplinen?, in: Kubik, Andreas/Murrmann-Kahl, Michael (Hg.), Die Unübersichtlichkeit des theologischen Studiums heute. Eine Debatte im Horizont von Schleiermachers theologischer Enzyklopädie (BRTh 21), Frankfurt a. M. 2013, 203 – 215. Kubik, Andreas/Murrmann-Kahl, Michael, Einleitung. Viele Fächer – keine Einheit?, in: Dies. (Hg.), Die Unübersichtlichkeit des theologischen Studiums heute. Eine Debatte im Horizont von Schleiermachers theologischer Enzyklopädie (BRTh 21), Frankfurt a. M. 2013, 9 – 25. Küenzlen, Gottfried, Max Weber. Wissenschaft und Religion. Ein Rekonstruktionsversuch in gegenwartsdiagnostischer Absicht, in: Bienfait, Agathe (Hg.), Religionen verstehen. Zur Aktualität von Max Webers Religionssoziologie, Wiesbaden 2011, 150 – 176. Küster, Volker, Einführung in die interkulturelle Theologie. Mit dreizehn Übersichten (UTB 3465), Göttingen 2011. Krüger, Lorenz, Einheit der Welt – Vielheit der Wissenschaft, in: Kocka, Jürgen (Hg.), Interdisziplinarität. Praxis – Herauforderung – Ideologie, Frankfurt a. M. 1987,106 – 125. Laack, Isabel, Wozu Postkolionalismus, Diskurstheorie und Religionsästhetik? Überlegungen zu ihrem Nutzen für die religionsgeschichtliche Forschung (am Beispiel der Azteken), in: ZfR 29/2 (2021), 186 – 215. Lanczkowski, Günter, Einführung in die Religionsphänomenologie, Darmstadt 31992. Lauster, Jörg, Prinzip und Methode. Die Transformation des protestantischen Schriftprinzips durch die historische Kritik von Schleiermacher bis zur Gegenwart (HUTh 46), Tübingen 2004. Leeuw, Gerardus van der, Phänomenologie der Religion (NTG), Tübingen 1933.
328
7 Literatur- und Quellenverzeichnis
Lehmann, Karsten/Kurth, Stefan, Kulturwissenschaftliche Methoden in der Religionswissenschaft, in: Dies., Religionen erforschen. Kulturwissenschaftliche Methoden in der Religionswissenschaft, Wiesbaden 2011, 7 – 19. Leonhardt, Rochus, Grundinformation Dogmatik. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Studium der Theologie (UTB 2214), Göttingen 42009. Leppin, Volker, Die Kirchengeschichte im Kreis der theologischen Fächer. Historische Offenlegung der vielfältigen Möglichkeiten christlicher Religion, in: Buntfuß, Markus/Fritz, Martin (Hg.), Fremde unter einem Dach? Die theologischen Fächer in enzyklopädischer Perspektive (TBT 163), Berlin 2014, 69 – 93. Leppin, Volker, Kirchengeschichte und europäische Religionsgeschichte, in: Ders./Fitschen, Klaus/ Kinzig, Wolfram/Kohnle, Armin (Hg.), Kirchengeschichte und Religionswissenschaft. Methoden und Fallstudien (AKThG 51), Leipzig 2018, 17 – 34. Leppin, Volker, Kirchengeschichte zwischen historiographischem und theologischem Anspruch. Zur Bedeutung der Semiotik für das Selbstverständnis einer theologischen Disziplin, in: Ders./Nowak, Kurt/Kinzig, Wolfram/Wartenberg, Günther (Hg.), Historiographie und Theologie. Kirchen- und Theologiegeschichte im Spannungsfeld von geschichtswissenschaftlicher Methode und theologischem Anspruch (AKThG 15), Leipzig 2004, 223 – 234. Leppin, Volker, Universitätswissenschaft, in: Beutel, Albrecht (Hg.), Luther-Handbuch, Tübingen 32017, 84 – 90. Lessing, Eckhard, Geschichte der deutschsprachigen evangelischen Theologie von Albrecht Ritschl bis zur Gegenwart. Band 1. 1870 – 1918, Göttingen 2000. Lessing, Eckhard, Geschichte der deutschsprachigen evangelischen Theologie von Albrecht Ritschl bis zur Gegenwart. Band 2. 1918 – 1945, Göttingen 2004. Lessing, Eckhard, Geschichte der deutschsprachigen evangelischen Theologie von Albrecht Ritschl bis zur Gegenwart. Band 3. 1945 – 1965, Göttingen 2009. Lohmann, Theodor, 30 Jahre Religionswissenschaft in unserem Land, in: Tworuschka, Udo (Hg.), Religion, Religionen, Religionswissenschaft. Festschrift zum 70. Geburtstag (Interreligiöse Horizonte 2), Köln 1998, 201 – 210. Lüdemann, Gerd, Das Wissenschaftsverständnis der Religionsgeschichtlichen Schule im Rahmen des Kulturprotestantismus, in: Müller, Hans Martin (Hg.), Kulturprotestantismus. Beiträge zu einer Gestalt des modernen Christentums, Gütersloh 1992, 78 – 107. Lüdemann, Gerd/Özen, Alf, Art. Religionsgeschichtliche Schule, in: TRE 28 (1997), 618 – 624. Luhmann, Niklas, Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1990. Luther, Martin, Enarratio Psalmi LI, in: WA 40/2, (313 – 314.)315 – 470. Luz, Ulrich, Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie des Urchristentums, in: ThLZ 4/126 (2001), 409 – 413. Lyotard, Jean-François, Das postmoderne Wissen. Ein Bericht (Edition Passagen 7), Graz/Wien 1986. Mädler, Inken, Wesen oder Wahrheit? F. Schleiermachers Verhältnisbestimmung von Religionswissenschaft und Theologie, in: Alkier, Stefan/Heimbrock, Hans-Günter (Hg.), Evangelische Theologie an staatlichen Universitäten. Konzepte und Konstellationen evangelischer Theologie und Religionsforschung, Göttingen 2011, 292 – 299. Maier, Bernhard, Art. Religionsgeschichte (Disziplin), in: TRE 28 (1997), 576 – 585. Markschies, Christoph, Arbeitsbuch Kirchengeschichte (UTB 1857), Tübingen 2011. Markschies, Christoph, Gottes Körper. Jüdische, christliche und pagane Gottesvorstellungen in der Antike, München 2016.
7.1 Alphabetisches Verzeichnis der zitierten Printmedien
329
Maske, Verena, Kontinuität, Kohärenz und Anerkennung. Überlegungen zur Identität der Religionswissenschaft, in: Dies./Franke, Edith (Hg.), Religionswissenschaft zwischen Sozialwissenschaften, Geschichtswissenschaft und Kognitionsforschung. Ein Autoren-Workshop mit Hubert Seiwert (Marburg Online Books 2), Marburg 2014, 119 – 133. Maurer, Reinhart, Art. Kultur, in: HphG 2 (1973), 823 – 832. Meiners, Christoph, Allgemeine kritische Geschichte der Religionen, Hannover 1806/1807. Mensching, Gustav, Geschichte der Religionswissenschaft, Bonn 1948. Merton, Robert K., A Note on Science and Democracy, in: Journal of Legal and Political Sociology 1 (1942), 115 – 126. Meyer-Blanck, Michael, Systematische und Praktische Annäherungen an die theologische Hermeneutik, in: Albrecht, Christian/Gemeinhardt, Peter (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und außen, Tübingen 2021, 151 – 155. Michaels, Axel, Nachwort. Die Religionsphänomenologie ist tot – Es lebe die Religionsphänomenologie, in: Ders./Pezzoli-Olgiati, Daria/Stolz, Fritz (Hg.), Noch eine Chance für die Religionsphänomenologie? (StRH 6/7.2000/01), Bern 2001, 489 – 492. Mildenberger, Friedrich, Geschichte der deutschen evangelischen Theologie im 19. und 20. Jahrhundert (ThW 10), Stuttgart 1981. Mittelstraß, Jürgen, Die Möglichkeit von Wissenschaft (Stw 62), Frankfurt a. M. 1974. Mittelstraß, Jürgen, Über Interessen, in: Ders. (Hg.), Methodologische Probleme einer normativkritischen Gesellschaftstheorie, Frankfurt a. M. 1975, 126 – 159. Mohn, Jürgen, Die Impulse der „Religionstheologie“ Schleiermachers für die Ausbildung der Religionswissenschaft(en), in: Gräb, Wilhelm/Slenczka, Notger (Hg.), Universität – Theologie – Kirche. Deutungsangebote zum Verhältnis von Kultur und Religion im Gespräch mit Schleiermacher (ASyTh 4), Leipzig 2011, 87 – 127. Moxter, Michael, Enzyklopädie aus der Perspektive Systematischer Theologie, in: Albrecht, Christian/ Gemeinhardt, Peter (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und außen, Tübingen 2021, 121 – 142. Moxter, Michael, Kultur als Lebenswelt. Studien zum Problem einer Kulturtheologie (HUTh 38), Tübingen 2000. Moxter, Michael, Wozu braucht Theologie Religionswissenschaft? in: Alkier, Stefan/Heimbrock, HansGünter (Hg.), Evangelische Theologie an staatlichen Universitäten. Konzepte und Konstellationen evangelischer Theologie und Religionsforschung, Göttingen 2011, 262 – 291. Müller, Ernst, Zur Modernität des Hegelschen Religionsbegriffs, in: Arndt, Andreas/Müller, Ernst (Hg.), Hegels „Phänomenologie des Geistes“ heute (DZPh.S 8), München 2009, 175 – 193. Müller, Friedrich Max, Beiträge zur vergleichenden Religionswissenschaft. Nach der 2. englischen Ausgabe mit Autorisation des Verfassers ins Deutsche ü bertragen, in: Ders., Essays. Bd. 1, Leipzig 1869. Müller, Friedrich Max, Erste Vorlesung. Gehalten am XIX. Februar MDCCCLXX an der Royal Institution in London, in: Ders., Einleitung in die vergleichende Religionswissenschaft. 4 Vorlesungen im Jahre MDCCCLXX an der Royal Institution in London gehalten. Nebst zwei Essays „Über falsche Analogien“ und „Über Philosophie der Mythologie“, Straßburg 1874, 1 – 93. Murrmann-Kahl, Michael, Zwischen Religionskritik und Fundamentalismus, in: Ders./Kubik, Andreas (Hg.), Die Unübersichtlichkeit des theologischen Studiums heute. Eine Debatte im Horizont von Schleiermachers theologischer Enzyklopädie (BRTh 21), Frankfurt a. M. 2013, 163 – 185. Nagel, Christiane, Theologie als erkenntnistheoretischer Sonderfall? Die Voraussetzungshaftigkeit von Wissenschaft und der zirkuläre Zusammenhang von Epistemik und Methodik, in: Kirschner,
330
7 Literatur- und Quellenverzeichnis
Martin/Ruhstorfer, Karlheinz (Hg.), Die gegenwärtige Krise Europas. Theologische Antwortversuche (QD 291), Freiburg/Basel/Wien 2018, 210 – 223. Nehring, Alexander, Die Interkulturelle Theologie im Kreis der theologischen Fächer. Differenzsensible Wahrnehmung der weltweiten Christentümer, in: Buntfuß, Markus/Fritz, Martin (Hg.), Fremde unter einem Dach? Die theologischen Fächerkulturen in enzyklopädischer Perspektive (TBT 163), Berlin 2014, 127 – 147. Nowak, Kurt, Wie theologisch ist die Kirchengeschichte? Über die Verbindung und die Differenz von Kirchengeschichtsschreibung und Theologie, in: ThLZ 1/122 (1997), 3 – 12. Nüssel, Friederike, Die Theorie der christlichen Gewißheit. Eine enzyklopädische Orientierung, in: ThLZ 4/133 (2008), 1253 – 1256. Nüssel, Friederike, Theologie als Kulturwissenschaft?, in: ThLZ 11/130 (2005), 1153 – 1168. Ohly, Lukas, Theologie als Wissenschaft, Eine Fundamentaltheologie aus phänomenologischer Leitperspektive (Theologisch-Philosophische Beiträge zu Gegenwartsfragen), Frankfurt a. M. 2017. Ohst, Martin, Das Neue Testament in konsequent-historischer Sicht. Bemerkungen zu Jens Schröters Beitrag, in: Albrecht, Christian/Gemeinhardt, Peter (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und außen, Tübingen 2021, 82 – 96. Oorschot, Jürgen van, Das Alte Testament im Kreis der theologischen Fächer. Theologische Wahrnehmung altorientalischer und jüdischer Religion innerhalb des christlichen Kanons, in: Buntfuß, Markus/Fritz, Martin (Hg.), Fremde unter einem Dach? Die theologischen Fächerkulturen in enzyklopädischer Perspektive (TBT 163), Berlin 2014, 23 – 41. Pacyna, Tony, Religion, Kognition, Evolution by Sebastian Schüler, in: Journal for the Cognitive Science of Religion 2/1 (2014), 241 – 243. Pannenberg, Wolfhart, Wissenschaftstheorie und Theologie, Frankfurt a. M. 1973. Parrinder, Geoffrey, Religious studies in Great Britain, in: Religion sup1/5 (1975), 1 – 11. Pesch, Otto Hermann, Gerechtfertigt aus Glauben. Luthers Frage an die Kirche (QD 97), Freiburg i. Br. 1982. Petzoldt, Matthias, Glaube und Wissen. Marginalien zu einer marxistischen Diskussion, in: Ders., Christsein angefragt. Fundamentaltheologische Beiträge, Leipzig 1998, 121 – 144. Petzoldt, Matthias, Konfessionelle Differenzen? Ansätze zu einer evangelischen Fundamentaltheologie, in: Meyer zu Schlochtern, Josef/Siebenrock, Roman (Hg.), Wozu Fundamentaltheologie? Zur Grundlegung der Theologie im Anspruch von Glaube und Vernunft (PaThSt 52), Paderborn 2010, 203 – 233. Petzoldt, Matthias, Notwendigkeit und Gefahren einer verselbständigten Fundamentaltheologie, in: Ders. (Hg.), Evangelische Fundamentaltheologie in der Diskussion, Leipzig 2004, 21 – 40. Petzoldt, Matthias, Sola scriptura – brauchbares Prinzip zur Rechenschaft über den Glauben?, in: Ders., Christsein angefragt. Fundamentaltheologische Beiträge, Leipzig 1998, 11 – 24. Petzoldt, Matthias, Sprache schafft Wirklichkeit. Zur Rezeption der Sprechakttheorie in der Fundamentaltheologie, Darmstadt 2020. Petzoldt, Matthias, Wahrheit als Begegnung. Dialogisches Wahrheitsverständnis im Licht der Analyse performativer Sprache, in: Ders., Christsein angefragt. Fundamentaltheologische Beiträge, Leipzig 1998, 25 – 40. Petzoldt, Matthias, Zur Frage nach der Konfessionalität der Fundamentaltheologie, in: Ders., Christsein angefragt. Fundamentaltheologische Beiträge, Leipzig 1998, 56 – 78. Peukert, Helmut, Wissenschaftstheorie – Handlungstheorie – fundamentale Theologie. Analysen zu Ansatz und Status theologischer Theoriebildung (Stw 231), Frankfurt 32009.
7.1 Alphabetisches Verzeichnis der zitierten Printmedien
331
Pickel, Gert, Religionssoziologie. Eine Einführung in zentrale Themenbereiche, Wiesbaden 2011. Pohl-Patalong, Uta, Diskurse verstärken. Religionspädagogische Perspektiven und Facetten praktischtheologischer Forschung, in: Schlag, Thomas/Schröder, Bernd (Hg.), Praktische Theologie und Religionspädagogik. Systematische, empirische und thematische Verhältnisbestimmungen (VWGTh 60), Leipzig 2020, 285 – 305. Pollack, Detlef, Tendenzen des religiösen Wandels, in: Könemann, Judith/Seewald, Michael (Hg.), Wandel als Thema religiöser Selbstdeutung. Perspektiven aus Judentum, Christentum und Islam (QD 310), Freiburg i. Br. 2021, 13 – 36. Popper, Karl, Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf, Hamburg 41998. Rad, Gerhard von, Theologie des Alten Testaments. Band 1. Die Theologie der geschichtlichen Überlieferung Israels (EETh 1), München 81982. Rade, Martin, Art. Religionsgeschichte und Religionsgeschichtliche Schule, in: RGG1 4 (1913), 2183 – 2200, 2185. Reckwitz, Andreas, Die Kontingenzperspektive der ‚Kulturʻ. Kulturbegriffe, Kulturtheorien und das kulturwissenschaftliche Forschungsprogramm, in: Jaeger, Friedrich/Liebsch, Burkhard (Hg.), Grundlagen und Schlüsselbegriffe (Handbuch der Kulturwissenschaften 1), Stuttgart/Weimar 2011, 1 – 20. Reiser, Marius, Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie des Urchristentums, in: TThZ 111 (2002), 77 – 78. Richter, Cornelia, Wahrheit und Relevanz in Religionswissenschaft und Theologie, in: Albrecht, Christian/Gemeinhardt, Peter (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und außen, Tübingen 2021, 200 – 203. Ritschl, Albrecht, Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung. Band 3. Die positive Entwickelung der Lehre, Berlin/Boston 2020. Ritschl, Albrecht, Unterricht in der christlichen Religion. Studienausgabe nach der 1. Auflage von 1875 nebst den Abweichungen der 2. und 3. Auflage. Eingeleitet und herausgegeben von Christine Axt-Piscalar (UTB 2311), Tübingen 2002. Ritter, Adolf Martin, Kirchengeschichte – was ist das? Ein Gespräch mit Wolfram Kinzig und Hartmut Leppin, in: Kampmann, Claudia/Volp, Ulrich/Wallraff, Martin (Hg.), Kirchengeschichte. Historisches Spezialgebiet und/oder theologische Disziplin (Theologie – Kultur – Hermeneutik 28), Leipzig 2020, 373 – 392. Römpp, Georg, Hegel leicht gemacht. Eine Einführung in seine Philosophie (UTB 3114), Köln 2008. Rohls, Jan, Protestantische Theologie der Neuzeit. Band 1. Die Voraussetzungen und das 19. Jahrhundert, Tübingen 1997. Roser, Traugott/Zitt, Renate, Praktische Theologie, Religions- und Gemeindepädagogik, in: Becker, EveMarie/Hiller, Doris (Hg.), Handbuch Evangelische Theologie. Ein enzyklopädischer Zugang (UTB 8326), Tübingen 2006, 301 – 362. Roth, Michael, Die Ausdifferenzierung der theologischen Wissenschaft als Problemstellung der evangelischen Theologie, in: Petzoldt, Matthias (Hg.), Evangelische Fundamentaltheologie in der Diskussion, Leipzig 2004, 73 – 94. Roth, Michael, Gott im Widerspruch? Möglichkeiten und Grenzen der theologischen Apologetik (TBT 117), Berlin 2002. Roth, Michael, Was kann der Systematiker vom Kirchengeschichtler erwarten, wenn er überhaupt etwas erwarten darf?, in: Kampmann, Claudia/Volp, Ulrich/Wallraff, Martin (Hg.), Kirchengeschichte. Historisches Spezialgebiet und/oder theologische Disziplin (Theologie – Kultur – Hermeneutik 28), Leipzig 2020, 409 – 424.
332
7 Literatur- und Quellenverzeichnis
Rudolph, Kurt, Die Religionsgeschichte an der Leipziger Universität und die Entwicklung der Religionswissenschaft. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte und zum Problem der Religionswissenschaft (SSAW.PH 1/107), Berlin 1962. Rudolph, Kurt, Geschichte und Probleme der Religionswissenschaft (SHR 53), Leiden/New York/Köln 1992. Rudolph, Kurt, Historische Religionswissenschaft. Eine Einführung, in: ThLZ 4/134 (2009), 418 – 420. Rudolph, Kurt, Vergleich, religionswissenschaftlich, in: Cancik, Hubert/Gladigow, Burkhard/Laubscher, Matthias (Hg.), Säkularisierung – Zwischenwesen. Register (HRWG 5), Stuttgart/Berlin/Köln/ Mainz 2001, 314 – 323. Rüpke, Jörg, Historische Religionswissenschaft. Eine Einführung (Religionswissenschaft heute 5), Stuttgart 2007. Rüsen, Jörn, Historik. Theorie der Geschichtswissenschaft, Köln 2013. Saur, Markus, Alttestamentliche Wissenschaft, in: Becker, Eve-Marie/Hiller, Doris (Hg.), Handbuch Evangelische Theologie. Ein enzyklopädischer Zugang (UTB 8326), Tübingen 2006, 27 – 86. Sauter, Gerhard, Zugänge zur Dogmatik. Elemente theologischer Urteilsbildung (UTB 2064), Göttingen 1998. Schäfer, Rainer, Hegel. Einführung und Texte (Studium Philosophie 3439), München 2011. Schäfer, Rolf, Art. Ritschl, Albrecht/Ritschlsche Schule (1822 – 1889), in: TRE 29 (1998), 220 – 238. Schäfer, Rolf, Ritschl. Grundlinien eines fast verschollenen dogmatischen Systems (BHTh 41), Tübingen 1968. Schäufele, Wolf-Friedrich, Theologische Kirchengeschichtsschreibung als Konstruktionsaufgabe. Ein Plädoyer, in: ThLZ 7 – 8/139 (2014), 831 – 850. Schaper, Joachim, Problems and Prospects of a ‚History of the Religion of Israelʻ, in: in: Sæbø, Magne/ Machinist, Peter (Hg.), The twentieth century. From Modernism to Post-Modernism (HBOT III/2), Göttingen 2015, 622 – 641. Scheliha, Arnulf von, Religionsfreiheit und staatliche Lenkung. Chancen und Grenzen gegenwärtiger Religionspolitik in Deutschland, in: Ders., Religionspolitik. Beiträge zur politischen Ethik und zur politischen Dimension des religiösen Pluralismus, Tübingen 2018, 256 – 267. Scheliha, Arnulf von, Religionspolitische Konstellationen und wissenschaftsethische Folgerungen im Zusammenhang mit der Etablierung von Zentren für Islamische Theologie, in: Ders., Religionspolitik. Beiträge zur politischen Ethik und zur politischen Dimension des religiösen Pluralismus, Tübingen 2018, 240 – 255. Scheliha, Arnulf von, Religiöse Pluralität an der Universität. Chancen und Probleme staatlicher Steuerung und fachlicher Selbstbestimmung – am Beispiel der Etablierung des Faches Islamische Studien/Theologie an deutschen Universitäten, in: Ders., Religionspolitik. Beiträge zur politischen Ethik und zur politischen Dimension des religiösen Pluralismus, Tübingen 2018, 227 – 239. Schlag, Thomas/Schröder, Bernd, Einführung, in: Dies. (Hg.), Praktische Theologie und Religionspädagogik. Systematische, empirische und thematische Verhältnisbestimmungen (VWGTh 60), Leipzig 2020, 9 – 30. Schlag, Thomas/Suhner, Jasmine, Was erschließt die Perspektive der Theologizität? Erkenntnisse und Herausforderungen, in: Dies./Burrichter, Rita/Grümme, Bernhard/Mendl, Hans/Pirner, Manfred L./Rothgangel, Martin (Hg.), Theologie als Herausforderung religiöser Bildung. Bildungstheoretische Orientierungen zur Theologizität der Religionspädagogik (Religionspädagogik innovativ 17), Stuttgart 2017, 179 – 190.
7.1 Alphabetisches Verzeichnis der zitierten Printmedien
333
Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst, Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitenden Vorlesungen (1830), in: KGA I,6 (1998), 317 – 446. Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst, Über die Glaubenslehre. Zwei Sendschreiben an Lücke (1829), in: KGA I,10 (1990), 307 – 394. Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern (1799), in: KGA I,2 (1984), 185 – 326. Schmid, Dirk, Einleitung des Bandherausgebers, in: KGA I,6 (1998), IX–XC. Schmid, Konrad, Die Wissenschaft vom Alten Testament im Rahmen der Theologie, in: Albrecht, Christian/Gemeinhardt, Peter (Hg.), Themen und Probleme Theologischer Enzyklopädie. Perspektiven von innen und von außen, Tübingen 2021, 37 – 46. Schmid, Konrad, Gibt es Theologie im Alten Testament? Zum Theologiebegriff in der alttestamentlichen Wissenschaft (ThSt N.F. 7), Zürich 2013. Schmid, Konrad, Theologie des Alten Testaments (NTG), Tübingen 2019. Schmidt, Jochen, Standort, Perspektive, Haltung. Überlegungen zum Proprium der Kirchengeschichte als einer Disziplin theologischer Wissenschaft, in: Kampmann, Claudia/Volp, Ulrich/Wallraff, Martin (Hg.), Kirchengeschichte. Historisches Spezialgebiet und/oder theologische Disziplin (Theologie – Kultur – Hermeneutik 28), Leipzig 2020, 393 – 408. Schmidt-Leukel, Perry, Der methodologische Agnostizismus und das Verhältnis der Religionswissenschaft zur wissenschaftlichen Theologie, in: BThZ 1/29 (2012), 48 – 72. Schmidt-Leukel, Perry, Grundkurs Fundamentaltheologie. Eine Einführung in die Grundfragen des christlichen Glaubens, München 22014. Schmidt, Uta, Narratologie und Altes Testament, in: ThLZ 5/143 (2018), 423 – 438. Schmitz, Bertram, Zur Verhältnisbestimmung von Theologie und Religionswissenschaft. Reflexionen über ein schwieriges Verhältnis und Zukunftsperspektiven, in: BThZ 1/19 (2002), 138 – 157. Schröder, Anna-Konstanze, Sebastian Schüler. Religion, Kognition, Evolution. Eine religionswissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Cognitive Science of Religion, in: ZfR 1/21 (2013), 131 – 134. Schröder, Bernd, In welcher Absicht nimmt die Praktische Theologie auf Praxis Bezug? Überlegungen zur Aufgabenstellung einer theologischen Disziplin, in: ZthK 1/98 (2001), 101 – 130. Schülein, Johann August/Reitze, Simon, Wissenschaftstheorie für Einsteiger (UTB 2351), Wien 42016. Schüler, Sebastian, Religion, Kognition, Evolution. Eine religionswissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Cognitive Science of Religion (Religionswissenschaft heute 9), Stuttgart 2011. Schütte, Hans-Walter, Erkenntnis und Interesse in der Theologie, in: NZSTh 13/3 (1971), 335 – 350. Schulz, Heiko, Theorie des Glaubens (RPT 2), Tübingen 2001. Schupp, Franz, Geschichte der Philosophie im Überblick. Band 3. Neuzeit, Hamburg 2005. Schweitzer, Friedrich, Das Theologische der Religionspädagogik. Grundfragen und Herausforderungen, in: Schlag, Thomas/Suhner, Jasmine/Burrichter, Rita/Grümme, Bernhard/ Mendl, Hans/Pirner, Manfred L./Rothgangel, Martin (Hg.), Theologie als Herausforderung religiöser Bildung. Bildungstheoretische Orientierungen zur Theologizität der Religionspädagogik (Religionspädagogik innovativ 17), Stuttgart 2017, 9 – 20. Schwemmer, Oswald, Art. Intersubjektivität, in: EPhW 2 (1984), 282 – 284. Schwemmer, Oswald, Art. Kultur, in: EPhW 2 (1984), 508 – 511. Schwöbel, Christoph, Doing Systematic Theology. Das Handwerk der Systematischen Theologie, in: Ders., Gott in Beziehung. Studien zur Dogmatik, Tübingen 2002, 1 – 24. Schwöbel, Christoph, Glaube und Kultur. Gedanken zur Idee einer Theologie der Kultur, in: NZSTh 38 (1996), 137 – 154.
334
7 Literatur- und Quellenverzeichnis
Schwöbel, Christoph, Theologie und Religionswissenschaft. Vorläufige Bemerkungen zur Gestaltung eines schwierigen Verhältnisses, in: Härle, Wilfried/Preul, Reiner (Hg.), Religion. Begriff, Phänomen, Methode (MThSt 74), Marburg 2003, 63 – 80. Searle, John R., Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay, Frankfurt a. M. 122013. Seckler, Max, Fundamentaltheologie. Aufgaben und Aufbau, Begriff und Namen, in: HFTh2 4 (2000), 331 – 402. Seiwert, Hubert, Systematische Religionswissenschaft. Theoriebildung und Empiriebezug, in: ZMR 1/61 (1977), 1 – 18. Seiwert, Hubert, Theory of Religion and Historical Research. A Critical Realist Perspective on the Study of Religion as an Empirical Discipline, in: ZfR 28/2 (2020), 207 – 236. Sellin, Volker, Einführung in die Geschichtswissenschaft, Göttingen 2014. Sharpe, Eric J., Comparative religion. A history, New York 1975. Simon, Josef, Art. Hegel/Hegelianismus, in: TRE 14 (1986), 530 – 560. Sinner, Rudolf von, Interkulturelle Theologie. Hermeneutische und theologische Überlegungen, in: BThZ 2/32 (2015), 240 – 263. Slenczka, Notger, Das Alte Testament und die Kirche, in: Gräb-Schmidt, Elisabeth/Preul, Reiner (Hg.), Das Alte Testament in der Theologie (MthSt 119), Leipzig 2013, 83 – 119. Söderblom, Nathan, Natürliche Theologie und allgemeine Religionsgeschichte, in: BRW 1/I (1913/14), 1 – 110. Solte, Ernst-Lüder, Theologie an der Universität. Staats- und kirchenrechtliche Probleme der theologischen Fakultäten, München 1971. Sparn, Walter, Art. Erlebnis, in: RGG4 2 (1999), 1425 – 1429. Statistisches Bundesamt, Bildung und Kultur. Studierende an Hochschulen. Wintersemester 2019/2020 (Fachserie 11 Reihe 4.1/17. 09. 2020). Stausberg, Michael, Jörg Rüpke. Historische Religionswissenschaft, in: ZRGG 2/61 (2009), 183 – 185. Stegmüller, Wolfgang, Evolutionäre Erkenntnistheorie, Realismus und Wissenschaftstheorie, Spaemann, Robert/Koslowski, Peter/Löw, Reinhard (Hg.), Evolutionstheorie und menschliches Selbstverständnis. Zur philosophischen Kritik eines Paradigmas moderner Wissenschaft (Civitas Resultate 6), Weinheim 1984, 5 – 34. Stichweh, Rudolf, Differenzierung der Wissenschaft, in: ZfS 1/8 (1979), 82 – 101. Stock, Konrad, Art. Theologie, Christliche III. Enzyklopädisch, in: TRE 33 (2002), 323 – 343. Stock, Konrad, Die Theorie der christlichen Gewißheit. Eine enzyklopädische Orientierung, Tübingen 2005. Stock, Konrad, Einleitung in die systematische Theologie (De Gruyter Studium), Berlin 2011. Stock, Konrad, Systematische Theologie. Teil 1. Erfahrung und Offenbarung, Göttingen 2017. Stöve, Eckehart, Art. Kirchengeschichtsschreibung, in: TRE 18 (1989), 535 – 560. Stolz, Fritz, Einführung, in: Ders./Michaels, Axel/Pezzoli-Olgiati, Daria (Hg.), Noch eine Chance für die Religionsphänomenologie? (StRH 6/7.2000/01), Bern 2001, 9 – 18. Stolz, Fritz, Grundzüge der Religionswissenschaft (KVR 1527), Göttingen 1988. Stosch, Klaus von, Komparative Theologie als Wegweiser in der Welt der Religionen (Beiträge zur komparativen Theologie 6), Paderborn/München/Wien/Zürich 2017. Stuckrad, Kocku von, The scientification of religion. An historical study of discursive change, 1800 – 2000, Berlin 2014. Sundermeier, Theo, Was ist Religion? Religionswissenschaft im theologischen Kontext. Ein Studienbuch (Theologische Bücherei Studienbücher 96), Gütersloh 1999. Tanner, Klaus, Theologie im Kontext der Kulturwissenschaften, in: BThZ 1/19 (2002), 83 – 98.
7.1 Alphabetisches Verzeichnis der zitierten Printmedien
335
Tetens, Holm, Wissenschaftstheorie. Eine Einführung (Beckʼsche Reihe 2808), München 2013. Theißen, Gerd, Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie des Urchristentums, Güterslsoh 42008. Thiel, Christian, Art. Phänomenologie, in: EPhW 3 (1995), 115 – 119. Thielicke, Helmut, Glauben und Denken in der Neuzeit. Die großen Systeme der Theologie und Religionsphilosphie, Tübingen 21988. Thomas von Aquin, Gottes Dasein und Wesen, in: DThA 1 (1934). Tiele, Cornelis Petrus, Einleitung in die Religionswissenschaft. Bd. 1. I. Teil: Morphologie, Gotha 1899. Tillich, Paul, Das System der Wissenschaften nach Gegenständen und Methoden, in: GW 1 (1959), 111 – 293. Tillich, Paul, Dogmatik. Marburger Vorlesung von 1925, Düsseldorf 1986. Tillich, Paul, Religion als eine Funktion des menschlichen Geistes?, in: GW 5 (1987), 37 – 42. Tillich, Paul, Religion und Kultur, in: GW 9 (1967), 82 – 93. Tillich, Paul, Systematische Theologie I, Stuttgart 1955. Tillich, Paul, Theologie als Wissenschaft, in: Vossische Zeitung 512 (30. 10. 1921), 2 – 3. Tillich, Paul, Über die Idee einer Theologie der Kultur, in: GW 9 (1967), 13 – 31. Tillich, Paul, Zur Theologie der bildenden Kunst und der Architektur, in: GW 9 (1967), 345 – 355. Troeltsch, Ernst, Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte (1902/1912). Mit den Thesen von 1901 und den handschriftlichen Zusätzen, in: KGA 5 (1998), 81 – 244. Troeltsch, Ernst, Die „kleine Göttinger Fakultät“ von 1890, in: ChW 18/34 (1920), 281 – 283. Troeltsch, Ernst, Theologie und Religionswissenschaft des 19. Jahrhunderts (1902), in: KGA 1 (2009), 895 – 924. Troeltsch, Ernst, Was heißt „Wesen des Christentums“?, in: ChW 19/17 (1903), 443 – 446. Tschiggerl, Martin/Walach, Thomas/Zahlmann, Stefan, Geschichte, in: Dies., Geschichtstheorie, Wiesbaden 2019, 11 – 34. Ustorf, Werner, Art. Missionswissenschaft, in: TRE 23 (1994), 88 – 98. Veraart, Albert/Wimmer, Reiner, Art. Hermeneutik, in: EPhW 2 (1984), 85 – 90. Villa, Paula-Irene, (De)Konstruktion und Diskurs-Genealogie. Zur Position und Rezeption von Judith Butler, in: Becker, Ruth/Kortendiek, Beate (Hg.), Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung (Geschlecht und Gesellschaft), Wiesbaden 2010, 146 – 157. Volp, Ulrich, Die Christianisierung des Todes. Zum Nutzen religionswissenschaftlicher Modelle für die Erforschung der Christentumsgeschichte, in: Fitschen, Klaus/Kinzig, Wolfram/Kohnle, Armin/ Leppin, Volker (Hg.), Kirchengeschichte und Religionswissenschaft. Methoden und Fallstudien (AKThG 51), Leipzig 2018, 117 – 134. Waardenburg, Jacques, Classical Approaches to the Study of Religion. Aims, Methods and Theories of Research. Bd. 1. Introduction and Anthology, New York/Berlin 1999. Waardenburg, Jacques, Religionen und Religion. Systematische Einführung in die Religionswissenschaft (SG 2228), Berlin 1986. Wach, Joachim, Religionswissenschaft. Prolegomena zu ihrer wissenschaftstheoretischen Grundlegung (ThST 13), Waltrop 2001. Wagner, Falk, Was ist Religion? Studien zu ihrem Begriff und Thema in Geschichte und Gegenwart, Gütersloh 21991. Wagner, Harald, Art. Fundamentaltheologie, in: TRE 11 (1993), 738 – 752. Wagner-Rau, Ulrike, Praktische Theologie als Theorie der christlichen Religionspraxis, in: Dies./ Fechtner, Kristian/Hermelink, Jan/Kumlehn, Martina/Jähnichen, Traugott/Ritter, Adolf Martin/ Rüterswörden, Udo/Schwab, Ulrich/Stuckenbruck, Loren T. (Hg.), Praktische Theologie. Ein Lehrbuch, Stuttgart 2017, 19 – 28.
336
7 Literatur- und Quellenverzeichnis
Walter, Uwe, Markschies, Christoph. Gottes Körper, in: FAZ (19. 08. 2016), 10. Ward, Keith, The study of religions, in: Nicholson, Ernest W. (Hg.), A century of theological and religious studies in Britain (British Academy centenary monographs), Oxford 2003, 271 – 294. Weber, Max, Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, in: Ders., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen 71988, 146 – 214. Weiss, Johannes, Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes, Göttingen 21900. Wendel, Saskia, Christliche Selbstdeutungen im Spiegel religiöser Pluralität, in: Könemann, Judith/ Seewald, Michael (Hg.), Wandel als Thema religiöser Selbstdeutung. Perspektiven aus Judentum, Christentum und Islam (QD 310), Freiburg i. Br. 2021, 272 – 285. Wießner, Gernot, Religionswissenschaft, in: Strecker, Georg (Hg.), Kirchenrecht – Religionswissenschaft (GKT 10,1), Stuttgart 1994, 65 – 178. Wilcox, Melissa, M., Queer Religiosities. An Introduction to Queer and Transgender Studies in Religion, Lanham/Boulder/New York/London 2021. Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Theologien und religionsbezogenen Wissenschaften an deutschen Hochschulen, Köln 2010. Wißmann, Hans, Ein Kapitel Heidelberger Religionswissenschaft. Günter Lanczkowski (1917 – 1993), in: Branković, Carina/Heidbrink, Simone/Lagemann, Charlotte (Hg.), Religion in Ex-Position. Eine religionswissenschaftliche Ausstellung. Begleitband zur Ausstellung (Kataloge/ Universitätsmuseum Heidelberg 11), Heidelberg 22016, 31 – 33. Wittgenstein, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus, in: Werkausgabe 1 (2016), 7 – 85. Wittekind, Folkart, Theologie religiöser Rede. Ein systematischer Grundriss, Tübingen 2018. Wrogemann, Henning, Interkulturelle Theologie. Zu Definition und Gegenstandsbereich des sechsten Faches der Theologischen Fakultät, in: BThZ 2/32 (2015), 219 – 239. Wrogemann, Henning, Lehrbuch Interkulturelle Theologie, Missionswissenschaft. Band 1. Interkulturelle Theologie und Hermeneutik. Grundfragen, aktuelle Beispiele, theoretische Perspektiven, Gütersloh 2012. Wrogemann, Henning, Lehrbuch Interkulturelle Theologie, Missionswissenschaft. Band 3. Theologie interreligiöser Beziehungen. Religionstheologische Denkwege, kulturwissenschaftliche Anfragen und ein methodischer Neuansatz, Gütersloh 32015. Zhdanov, Vadim, Zwischen Religionsphänomenologie und Kulturhermeneutik. Eine methodische Reflexion, in: Franke, Edith/Maske, Verena (Hg.), Religionswissenschaft zwischen Sozialwissenschaften, Geschichtswissenschaft und Kognitionsforschung. Ein Autoren-Workshop mit Hubert Seiwert (Marburg Online Books 2), Marburg 2014, 99 – 118. Zima, Peter V., Was ist Theorie? Theoriebegriff und Dialogische Theorie in den Kultur- und Sozialwissenschaften, Tübingen 22017. Zinser, Hartmut, Grundfragen der Religionswissenschaft, Paderborn/München/Wien/Zürich 2010. Zinser, Hartmut, Religionsphänomenologie, in: Cancik, Hubert/Gladigow, Burkhard/Laubscher, Matthias (Hg.), Systematischer Teil. Alphabetischer Teil: Aberglaube – Antisemitismus (HRWG 1), Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1988, 306 – 309.
7.2 Alphabetisches Verzeichnis der zitierten Internetquellen Die Alphabetisierung erfolgt nach der gewählten Titulierung in den Fußnoten. Aufgeführt werden alle zitierten Internetquellen. Die Kurztitel der Fußnoten folgen
7.2 Alphabetisches Verzeichnis der zitierten Internetquellen
337
entweder der Logik [Verfasser*in], [Anfang des Titels] – oder Website (der/des/von) [Anfang der Titulierung]. Dalferth, Ingolf U., Ideologische Selbstzerstörung. Kritische Anmerkungen zur allgemeinen Entwicklung an den Universitäten in den USA, in: Zeitzeichen (04. 01. 2021), https://zeitzeichen. net/node/8764 – 07.03.23. Holzer, Boris, Maschinelle Mission, in: FAZ (09. 03. 2023), https://www.faz.net/aktuell/wissen/geistsoziales/chatgpt-chatbots-koennen-menschen-politisch-ueberzeugen-18720335.html – 09.03.23. Klatt, Thomas, Nicht ohne das Alte Testament? Die Thesen des Berliner Theologen Notger Slenczka, in: Deutschlandfunk (16. 12. 2015), https://www.deutschlandfunk.de/die-thesen-des-berlinertheologen-notger-slenczka-nicht.886.de.html?dram:article_id=339892 – 16. 02. 2021. Perrigo, Billy, OpenAI used Kenyan Workers on less than $2 per Hour to make ChatGPT less toxic, in: TIME (18.01.23), https://time.com/6247678/openai-chatgpt-kenya-workers/ – 09.03.23. Pilz, Dirk, Der Bibelstreit, in: Frankfurter Rundschau (11. 08. 2017), https://www.fr.de/kultur/bibelstreit11026185.html – 16.02.21. Positionspapier der Fachgruppe Religions- und Missionswissenschaft der Gesellschaft für Wissenschaftliche Theologie und des Verwaltungsrates der Deutschen Gesellschaft für Missionswissenschaft von 2005, http://wgth.de/index.php/fachgruppen/religionswissenschaftund-interkulturelle-theologie – 26.02.21. Rahmenordnung für die Erste Theologische Prüfung/die Prüfung zum Magister Theologiae in Evangelischer Theologie vom 3. Dezember 2010, https://kirchenrecht-ekd.de/document/19641? #s8.100010 – 12.02.21. Slenczka, Notger, Der Vorschlag einer Zusammenführung konfessionsgebundener Forschungs- und Lehrinstitute zu einer gemeinsamen Fakultät und die Anfrage von Professor Dr. Ingolf Dalferth in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung v. 4.5. 2017, PDF-Datei (22. 05. 2017), https://www.theologie. hu-berlin.de/de/professuren/stellen/st/Fakultaet%20der%20Theologien/fakultaet-der-theologien_ slenczka.pdf – 04.02.21. Speckmann, Thomas, Fundamentalisten – Verteufeln bringt nichts, in: Welt (27. 01. 2008), https://www. welt.de/kultur/article1593488/Fundamentalisten-Verteufeln-bringt-nichts.html – 21.02.21. Website CERES an der Ruhr-Universität Bochum, http://www.ceres.ruhr-uni-bochum.de/ – 14.12.20. Website CERES an der Ruhr-Universität Bochum. Religionswissenschaft, https://studium.ceres.rub.de/ de/studieninteressierte/religionswissenschaft-bochum/schwerpunkte/ – 14.12.20. Website der Abteilung für Religionswissenschaft an der Universität Bonn. Studienprofil, https://www. ioa.uni-bonn.de/de/inst/religionswissenschaft/studium – 25.11.20. Website der Abteilung Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie an der Universität Heidelberg, http://rmserv.wt.uni-heidelberg.de/webrm/studium/informationen – 25.11.20. Website der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Ehrendoktorwürde für Christoph Markschies und Franz-Kafka-Preis an Claudio Magris, http://www.adwmainz.de/nachrichten/ artikel/ehrendoktorwuerde-fuer-christoph-markschies-und-franz-kafka-preis-an-claudio-magris. html – 29.01.21. Website der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Max Weber-Gesamtausgabe, https://mwg. badw.de/beteiligte.html – 21.01.21. Website der British Association for the Study of Religions. About BASR, https://basr.ac.uk/about-basr/ – 15.12.20. Website der Deutschen Nationalbibliothek. Günther Lanczkowski, https://d-nb.info/gnd/116669748 – 22.01.21.
338
7 Literatur- und Quellenverzeichnis
Website der Deutschen Nationalbibliothek. Günther Lanczkowski. Publikationsliste, https://portal.dnb. de/opac.htm?method=showFirstResultSite¤tResultId=auRef%3D116669748% 26any¤tPosition=30 – 22.01.21. Website der Deutschen Nationalibibliothek. Konrad Stock, https://d-nb.info/gnd/123254108 – 29.01.21. Website der Deutschen Nationalbibliothek. Konrad Stock. Publikationsliste, https://portal.dnb.de/opac. htm?method=simpleSearch&reset=true&cqlMode= true&query=auRef% 3D123254108&selectedCategory=any – 29.01.21. Website der Deutschen Vereinigung für Religionswissenschaft. Das Fach ‚Religionswissenschaftʻ, https://www.dvrw.uni-hannover.de/de/religionswissenschaft/ – 14.12.20. Website der Deutschen Vereinigung für Religionswissenschaft. Institute, Seminare, Lehrstühle, https:// www.dvrw.uni-hannover.de/de/religionswissenschaft/institute-seminar-lehrstuehle/ – 14.12.20. Website der Deutschen Vereinigung für Religionswissenschaft. Vergangene Tagungen, https://www. dvrw.uni-hannover.de/de/tagungen/vergangene-tagungen/ – 14. 01. 2021. Website der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Seminar für Religionswissenschaft und Judaistik, https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/evangelischtheologische-fakultaet/lehrstuehle-und-institute/religionswissenschaft-und-judaistik/ – 14.12.20. Website der Faculty of Divinity. Theology for Ministry an der University of Cambridge, https://www. divinity.cam.ac.uk/study-here/ministry – 03.12.20. Website der Faculty of Divinity. Theology, Religion and Philosophy of Religion an der University of Cambridge, https://www.divinity.cam.ac.uk/study-here/undergraduate – 03.12.20. Website der International Movie Data Base. Jugend ohne Jugend, http://www.imdb.com/title/ tt0481797/ – 14. 01. 2021. Website der International Movie Data Base. Strafsache Jesu. Full Cast & Crew, https://www.imdb.com/ title/tt4045914/fullcredits/?ref_=tt_ov_st_sm – 29.01.21. Website der International Association for the History of Religion. Members and Affiliates, http://www. iahrweb.org/members.php#uk – 15.12.20. Website der Philipps-Universität Marburg. Yggdrasil, https://www.lists.uni-marburg.de/lists/sympa/info/ yggdrasill – 04.02.21. Website der Professur für Religionswissenschaft an der Universität des Saarlandes, https://www.unisaarland.de/fachrichtung/kath-theologie/lehrstuhl/religionswissenschaft.html – 25.11.20. Website der Religions- und Missionswissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, https://www.ev.theologie.uni-mainz.de/religions-und-missionswissenschaft/ – 25.11.20. Website der Religionswissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, https://www.theologie.unijena.de/religionswissenschaft – 14.12.20. Website der Religionswissenschaft an der Universität Bayreuth, https://www.religion.uni-bayreuth.de/ de/index.html – 24.11.20. Website der Religionswissenschaft an der Georg-August-Universität Göttingen, https://www.unigoettingen.de/de/17564.html – 14.12.20. Website der Religionswissenschaft an der Georg-August-Universität Göttingen. Das Fach Religionswissenschaft, https://www.uni-goettingen.de/de/fach/443160.html – 14.12.20. Website der Religionswissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt a. M., https://www.unifrankfurt.de/42495474/Profil – 14.12.20. Website der Religionswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin, https://www.theologie.huberlin.de/de/professuren/professuren/rmoe/religions wissenschaft – 25.11.20. Website der Religionswissenschaft an der Universität Bielefeld, https://www.uni-bielefeld.de/ fakultaeten/theologie/lehre/religionswissenschaft/– 25.11.20.
7.2 Alphabetisches Verzeichnis der zitierten Internetquellen
339
Website der Religionswissenschaft an der Universität Potsdam, https://www.uni-potsdam.de/de/js-rw/ religionswissenschaft/religionswissenschaft-in-potsdam – 25.11.20. Website der School of Divinity der University of Edinburgh. Divinity and Classics, https://www.ed.ac.uk/ divinity/undergraduate/degree-programmes/divinity-classics – 04.12.20. Website der School of Divinity der University of Edinburgh. Religious Studies, https://www.ed.ac.uk/ divinity/undergraduate/degree-programmes/religious-studies – 04.12.20. Website der School of Divinity der University of Edinburgh. Theology https://www.ed.ac.uk/divinity/ undergraduate/degree-programmes/ma-theology – 04.12.20. Website der School of Divinity der University of Edinburgh. Undergraduate Study, https://www.ed.ac. uk/divinity/undergraduate – 04.12.20. Website der School of Divinity der University of St. Andrews. Prospective Students, https://www.standrews.ac.uk/divinity/prospective/ – 15.12.20. Website der School of Divinity, History and Philosophy der University of Aberdeen. Divinity, https:// www.abdn.ac.uk/sdhp/divinity-religious-studies/ – 03.12.20. Website der School of History, Philosophy and Social Sciences an der Bangor University, https://www. bangor.ac.uk/history-philosophy-and-social-sciences/about_the_school/index.php.en – 03.12.20. Website der School of Philosophy, Religion and History of Science an der University of Leeds. Philosophy, Ethics and Religion BA, https://ahc.leeds.ac.uk/courses/g184/philosophy,-ethics-andreligion-ba – 04.12.20. Website der School of Philosophy, Religion and History of Science an der University of Leeds. Philosophy of Religion and Ethics, https://ahc.leeds.ac.uk/courses/d958/philosophy-of-religionand-ethics-ma – 04.12.20. Website der School of Philosophy, Religion and History of Science an der University of Leeds. Religion, Politics and Society BA, https://ahc.leeds.ac.uk/courses/g560/religion,-politics-and-society-ba – 04.12.20. Website der School of Philosophy, Religion and History of Science an der University of Leeds. Religion, Politics and Society MA, https://ahc.leeds.ac.uk/courses/I553/religion-politics-society-MA – 04.12.20. Website der Schweizerischen Gesellschaft für Religionswissenschaft, http://www.religionswissenschaft. ch/religionswissenschaft_in_der_schweiz.html – 27.11.20. Website der Unité dʼHistoire et dʼAnthropologie des Religions an der Universität Genf, https://www. unige.ch/lettres/antic/unites/hr/accueil/ – 27.11.20. Website der University of Groningen. Staff Members with Discipline Cultural Studies, http://www.rug. nl/about-us/how-to-find-us/find-an-expert?discipline=Cultural+Studies – 21.01.21. Website der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie. Fachgruppen, http://wgth.de/index.php/ fachgruppen – 25.01.21. Website der WGTh. Fachgruppen. Praktische Theologie, http://wgth.de/index.php/fachgruppen/ praktische-theologie – 03.03.21. Website der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie. Fakultäten, http://wgth.de/index.php/ fakultaeten – 26.11.20. Website des Department of Religions & Philosophies an der SOAS University of London. Religion in Global Politics, https://www.soas.ac.uk/religions-and-philosophies/programmes/ma-religion-inglobal-politics/ – 04.12.20. Website des Department of Theology and Religion der Durham University. About the Department, https://www.dur.ac.uk/theology.religion/about/ – 04.12.20.
340
7 Literatur- und Quellenverzeichnis
Website des Department of Theology and Religion der Durham University. Religion, Society and Culture, https://www.dur.ac.uk/theology.religion/undergrad/programmes/ba.rsc/ – 04.12.20. Website des Department of Theology and Religion der Durham University. Theology and Religion, https://www.dur.ac.uk/theology.religion/undergrad/programmes/theolrel/ – 04.12.20. Website des Evangelisch-Theologischen Fakultätentages. Mitglieder, http://evtheol.fakultaetentag.de/ index.php?p=mitglieder – 26.11.20. Website des Fachbereichs Religionswissenschaft an der Universität Basel, https://religionswissenschaft. unibas.ch/de/fachbereich/#c753 – 26.11.20. Website des Fachbereichs Religionswissenschaft an der Universität Freiburg. Profil, https://www3.unifr. ch/sr/de/fachbereich/profil.html – 27.11.20. Website des Fachgebiets Religionsgeschichte an der Philipps-Universität Marburg, https://www.unimarburg.de/de/fb05/fachgebiete/fachgebiete/religionsgeschichte – 27.11.20. Website des Fachgebiets Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie an der Universität Rostock, https://www.theologie.uni-rostock.de/fachgebiete/religionswissenschaft-undinterkulturelle-theologie/ – 25.11.20. Website des Fachs Religionswissenschaft an der Philipps-Universität Marburg, https://www.unimarburg.de/de/fb03/ivk/fachgebiete/religionswissenschaft – 25.11.20. Website des Fachs Religionswissenschaft an der Philipps-Universität Marburg. Profil, https://www.unimarburg.de/de/fb03/ivk/fachgebiete/religionswissenschaft/fach/profil – 25.11.20. Website des Informationsdienstes Wissenschaft. Zappe, Heike, Christoph Markschies neuer Präsident der Humboldtuniversität https://idw-online.de/en/news134346 – 29.01.21. Website des interfakultären Studiengangs Religionswissenschaft an der Ludwig-MaximiliansUniversität München, https://www.religionswissenschaft.uni-muenchen.de/index.html – 25.11.20. Website des Instituts für Empirische Religionsforschung an der Universität Bern, https://www.ier.unibe. ch/index_ger.html – 27.11.20. Website des Instituts für Interkulturelle Theologie und Interreligiöse Studien an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel, https://www.iitis.de/ziele-aufgaben/ – 16.01.21. Website des Instituts für Missions-, Ökumene- und Religionswissenschaft an der Universität Hamburg, https://www.theologie.uni-hamburg.de/einrichtungen/institute/moer.html – 25.11.20. Website des Instituts für Religionswissenschaft an der Freien Universität Berlin, https://www.geschkult. fu-berlin.de/e/relwiss/index.html – 24.11.20. Website des Instituts für Religionswissenschaft an der Universität Bern, https://www.relwi.unibe.ch/ index_ger.html – 27.11.20. Website des Instituts für Religionswissenschaft an der Universität Heidelberg, http://www.zegk.uniheidelberg.de/religionswissenschaft/ – 25.11.20. Website des Instituts für Religionswissenschaft an der Leibniz-Universität Hannover. Studium, http:// www.ithrw.uni-hannover.de/studium2.html – 14.12.20. Website des Instituts für Religionswissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, https://www.uni-muenster.de/FB2/religionswissenschaft/ – 25.11.20. Website des Instituts für Religionswissenschaft der Universität Leipzig, https://www.gkr.uni-leipzig.de/ religionswissenschaftliches-institut/institut/ – 14. 01. 2021. Website des Instituts für Religionswissenschaft der Universität Leipzig. Christoph Kleine, https://www. uni-leipzig.de/personenprofil/mitarbeiter/prof-dr-christoph-kleine/ – 19.01.21. Website des Instituts für Religionswissenschaft der Universität Leipzig. Sebastian Schüler, https://www. gkr.uni-leipzig.de/personenprofil/mitarbeiter/prof-dr-sebastian-schueler/ – 22.01.21.
7.2 Alphabetisches Verzeichnis der zitierten Internetquellen
341
Website des Instituts für Religionswissenschaft der Universität Leipzig. Team, https://www.gkr.unileipzig.de/religionswissenschaftliches-institut/institut/team/ – 14. 01. 2021. Website des Instituts für Religionswissenschaft der Universität Leipzig. Ehemalige Professoren, https:// www.gko.uni-leipzig.de/de/religionswissenschaft/institut/geschichte-des-instituts/ehemaligeprofessoren.html – 14. 01. 2021. Website des Instituts für Religionswissenschaft und Religionspädagogik an der Universität Bremen. Profil, https://www.uni-bremen.de/religionswissenschaft/profil – 24.11.20. Website des Instituts für Systematische Theologie und Religionswissenschaft an der Universität Wien. Religionswissenschaft, https://etfst.univie.ac.at/ueber-uns/geschichte-und-aufgaben/ religionswissenschaft/allgemeine-informationen/ – 27.11.20. Website des Instituts Kirche und Judentum Berlin. Team, https://www.ikj-berlin.de/ikj/mitarbeitende. html – 29.01.21. Website des Lehrstuhls für Fundmentaltheologie und Religionswissenschaft an der Universität Erfurt. Profil, https://www.uni-erfurt.de/katholisch-theologische-fakultaet/professuren-lektorate/systematisch/ fundamentaltheologie-und-religionswissenschaft/forschung-und-publikationen – 24.11.20. Website des Lehrstuhls für Interkulturelle Theologie, Missions- und Religionswissenschaft an der Augustana, https://augustana.de/forschung-lehre/interkulturelle-theologie/lehrstuhlinhaberinprof-dr-heike-walz.html#c3301 – 27.11.20. Website des Lehrstuhls für Praktische Theologie mit den Schwerpunkten Homiletik und Theorie medialer Kommunikation an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Porträt, https://www. pt1.evtheol.uni-muenchen.de/ueber_uns/portrait/index.html – 28.01.21. Website des Lehrstuhls für Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie an der FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg, https://www.theologie.fau.de/institut-st-landing/ lehrstuhl-fuer-religionswissenschaft-und-interkulturelle-theologie/profil-des-lehrstuhls/ – 25.11.20. Website des Lehrstuhls für Religionswissenschaft und Religionsgeschichte an der Ludwig-MaximiliansUniversität München, https://www.rw.evtheol.uni-muenchen.de/index.html – 25.11.20. Website des Lektorats Religionswissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, https:// www.theol.uni-kiel.de/de/institute-lektorate-einrichtungen/weitere-einrichtungen/ religionswissenschaft – 25.11.20. Website des Religionswissenschaftlichen Seminars an der Universität Luzern, https://www.unilu.ch/ fakultaeten/ksf/institute/religionswissenschaftliches-seminar/profil/ – 27.11.20. Website des Magazins Chrismon. Christoph Markschies, https://chrismon.evangelisch.de/personen/ professor-dr-christoph-markschies-13215 – 29.01.21. Website des Religionswissenschaftlichen Seminars an der Universität Zürich, https://www. religionswissenschaft.uzh.ch/de/studium/einblicke.html – 27.11.20. Website des Seminars für Religionswissenschaft an der Universität Erfurt, https://www.uni-erfurt.de/ philosophische-fakultaet/seminare-professuren/religionswissenschaft/startseite – 24.11.20. Website des Seminars für Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie an der Martin-LutherUniversität Halle, http://www.theologie.uni-halle.de/rw/#anchor179362 – 14.12.20. Website des Seminars für Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Profil, https://www.uni-muenster.de/EvTheol/rwit/profil.html – 14.12.20. Website des Studiengangs Ancient Religions an der University of Wales Trinity Saint David, https:// www.uwtsd.ac.uk/ma-ancient-religions/ – 04.12.20.
342
7 Literatur- und Quellenverzeichnis
Website des Studiengangs Applied Theology an der University of Oxford, https://www.ox.ac.uk/ admissions/graduate/courses/mth-applied-theology – 04.12.20. Website des Studiengangs Biblical Interpretation an der University of Wales Trinity Saint David, https:// www.uwtsd.ac.uk/ma-biblical-interpretation/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Biblical Studies an der University of St. Andrews, https://www.st-andrews. ac.uk/subjects/divinity/biblical-studies-ma/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Biblical Studies and Theology an der University of Nottingham, https:// www.nottingham.ac.uk/ugstudy/course/Biblical-Studies-and-Theology-BA – 04.12.20. Website des Studiengangs Christian Spirituality an der St. Maryʼs University Twickenham London, https://www.stmarys.ac.uk/postgraduate-courses-london/christian-spirituality – 04.12.20. Website des Studiengangs Christian Theology an der University of Wales Trinity Saint David, https:// www.uwtsd.ac.uk/mth-christian-theology/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Comparative Religion and Social Anthropology an der University of Manchester, https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/12806/bacomparative-religion-and-social-anthropology/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Contemporary Christian Theology an der Newman University Birmingham, https://www.newman.ac.uk/course/contemporary-christian-theology/september-2021/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Death, Religion and Culture an der University of Winchester, https://www. winchester.ac.uk/study/postgraduate/courses/ma-death-religion-and-culture/ – 04.12.20. Website des Studiengangs History and Religious Studies an der University of Gloucestershire, https:// www.glos.ac.uk/courses/undergraduate/hir/pages/history-and-religious-studies-ba-hons.aspx – 04.12.20. Website des Studiengangs Interfaith Studies an der University of Wales Trinity Saint David, https:// www.uwtsd.ac.uk/ma-interfaith-studies/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Philosophical Theology an der University of Oxford, https://www.ox.ac.uk/ admissions/graduate/courses/mphil-philosophical-theology – 04.12.20. Website des Studiengangs Philosophie und Religion an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, https://www.hw.uni-wuerzburg.de/philosophie-und-religion/studium/ – 25.11.20. Website des Studiengangs Philosophy and Religion an der University of Manchester, https://www. manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/13042/ba-philosophy-and-religion/coursedetails/#course-profile – 04.12.20. Website des Studiengangs Philosophy and Religion an der University of Wales Trinity Saint David, https://www.uwtsd.ac.uk/ma-philosophy-religion/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Philosophy and Theology an der University of Oxford, https://www.ox.ac. uk/admissions/undergraduate/courses-listing/philosophy-and-theology – 04.12.20. Website des Studiengangs Philosophy, Ethics and Religion an der Leeds Trinity University, https://www. leedstrinity.ac.uk/courses/undergraduate/philosophy-ethics-and-religion/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Philosophy, Ethics and Religion an der Liverpool Hope University, https:// www.hope.ac.uk/undergraduate/undergraduatecourses/philosophyethicsreligion/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Philosophy, Ethics and Religion an der University of Chester, https://www1. chester.ac.uk/study/undergraduate/philosophy-ethics-and-religion – 03.12.20. Website des Studiengangs Philosophy, Religion and Ethics and der University of Birmingham, https:// www.birmingham.ac.uk/undergraduate/courses/thr/philosophy-religion-ethics.aspx – 03.12.20. Website des Studiengangs Philosophy, Religion and Ethics an der University of Roehampton London, https://www.roehampton.ac.uk/undergraduate-courses/philosophy-religion-and-ethics/ – 04.12.20.
7.2 Alphabetisches Verzeichnis der zitierten Internetquellen
343
Website des Studiengangs Philosophy, Religion and Ethics an der University of Sheffield, https://www. sheffield.ac.uk/undergraduate/courses/2021/philosophy-religion-and-ethics-ba – 04.12.20. Website des Studiengangs Philosophy, Religion and Ethics an der University of Winchester, https:// www.winchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/ba-hons-philosophy-religion-and-ethics/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Philosophy, Religion and Ethics an der University of Wolverhampton, https://www.wlv.ac.uk/courses/ba-hons-philosophy-religion-and-ethics/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Politics, Religion and Philosophy an der University of Birmingham, https:// www.birmingham.ac.uk/undergraduate/courses/thr/politics-religion-philosophy.aspx – 03.12.20. Website des Studiengangs Politics, Religion and Values an der Lancaster University, https://www. lancaster.ac.uk/study/undergraduate/courses/politics-religion-and-values-ba-hons-lv28/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Religion an der University of Bristol, http://www.bristol.ac.uk/study/ postgraduate/2021/arts/ma-religion/ – 03.12.20. Website des Studiengangs Religion and Oriental Studies an der University of Oxford, https://www.ox. ac.uk/admissions/undergraduate/courses-listing/religion-and-oriental-studies – 04.12.20. Website des Studiengangs Religion an der University of Stirling, https://www.stir.ac.uk/courses/ug/ religion/#course-tabs__overview – 04.12.20. Website des Studiengangs Religion and Theology an der Cardiff University, https://www.cardiff.ac.uk/ study/undergraduate/courses/2021/religious-studies-and-theology-ba – 03.12.20. Website des Studiengangs Religion and Theology an der University of Bristol, http://www.bristol.ac.uk/ study/undergraduate/2021/religion-theology/ – 03.12.20. Website des Studiengangs Religion and Theology an der York St. John University, https://www.yorksj. ac.uk/courses/undergraduate/religion-philosophy/religion-and-theology-ba-hons/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Religion am Kingʼs College London, https://www.kcl.ac.uk/study/ postgraduate/taught-courses/religion-ma – 04.12.20. Website des Studiengangs Religion, Culture and Ethics an der University of Nottingham, https://www. nottingham.ac.uk/ugstudy/course/Religion,-Culture-and-Ethics-BA – 04.12.20. Website des Studiengangs Religion, Culture and Society an der University of Central Lancashire, https://www.uclan.ac.uk/courses/ma_religion_culture_society.php – 04.12.20. Website des Studiengangs Religion, Ethics and Society an der University of Chichester, https://www.chi. ac.uk/philosophy-theology-and-religion/philosophy-theology-and-religion-courses/ba-honsreligion-ethics-and-society – 03.12.20. Website des Studiengangs Religion in Society an der York St. John University, https://www.yorksj.ac.uk/ courses/postgraduate/theology-religion-studies/religion-in-society-ma/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Religion, Philosophy and Ethics an der Canterbury Christ Church University, https://www.canterbury.ac.uk/study-here/courses/religion-philosophy-and-ethics – 03.12.20. Website des Studiengangs Religion, Philosophy and Ethics an der University of Gloucestershire, https://www.glos.ac.uk/courses/undergraduate/rpe/pages/religion-philosophy-and-ethics-bahons.aspx??query=undergraduate/rpe/pages/religion%E2%80%90philosophy%E2%80%90and% E2%80%90ethics%E2%80%90ba%E2%80%90hons.aspx – 04.12.20. Website des Studiengangs Religion, Philosophy and Ethics an der York St. John University, https:// www.yorksj.ac.uk/courses/undergraduate/religion-philosophy/religion-philosophy-ethics-ba-hons/ – 04.12.20.
344
7 Literatur- und Quellenverzeichnis
Website des Studiengangs Religions and Theology and der University of Manchester, https://www. manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/01297/ma-religions-and-theology/course-details/ #course-profile – 04.12.20. Website des Studiengangs Religions, Philosophies and Ethics der Bath Spa University, https://www. bathspa.ac.uk/courses/ug-religions-philosophies-and-ethics/ – 03.12.20. Website des Studiengangs Religions, Theology and Ethics an der University of Manchester, https:// www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/17846/ba-religions-theology-andethics/course-details/#course-profile – 04.12.20. Website des Studiengangs Religion, Theology and Culture an der University of Roehampton London, https://www.roehampton.ac.uk/undergraduate-courses/religion-theology-and-culture/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Religious Experience an der University of Wales Trinity Saint David, https:// www.uwtsd.ac.uk/mres-religious-experience/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Religious Studies an der Lancaster University, https://www.lancaster.ac.uk/ study/postgraduate/postgraduate-courses/religious-studies-ma/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Religious Studies an der Liverpool Hope University, https://www.hope.ac. uk/undergraduate/undergraduatecourses/religiousstudies/religiousstudiesandphilosophyethics/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Religious Studies an der University of Chester, https://www1.chester.ac.uk/ study/undergraduate/religious-studies – 03.12.20. Website des Studiengangs Religious Studies an der University of Kent, https://www.kent.ac.uk/courses/ undergraduate/54/religious-studies – 04.12.20. Website des Studiengangs Religious Studies an der University of Wales Trinity Saint David, https:// www.uwtsd.ac.uk/ba-religious-studies/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Religious Studies and Philosohy an der Cardiff University, https://www. cardiff.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/philosophy-and-religious-studies-ba – 03.12.20. Website des Studiengangs Study of Religions an der University of Wales Trinity Saint David, https:// www.uwtsd.ac.uk/ma-study-of-religions/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Study of Religions an der University of Oxford, https://www.ox.ac.uk/ admissions/graduate/courses/mst-study-religions – 04.12.20. Website des Studiengangs Systematic and Philosophical Theology an der University of Nottingham, https://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/course/taught/systematic-and-philosophical-theologydistance-learning-ma – 04.12.20. Website des Studiengangs Theological Studies an der University of St. Andrews, https://www.standrews.ac.uk/subjects/divinity/theological-studies-ma/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Theological Studies an der University of the Highlands and Islands, https:// www.uhi.ac.uk/en/courses/ba-hons-theological-studies/#tabanchor – 04.12.20. Website des Studiengangs Theological Studies in Philosophy and Ethics an der University of Manchester, https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/08507/batheological-studies-in-philosophy-and-ethics/course-details/#course-profile – 04.12.20. Website des Studiengangs Theology an der Canterbury Christ Church University, https://www. canterbury.ac.uk/study-here/courses/theology – 15.12.20. Website des Studiengangs Theology an der Cardiff University, https://www.cardiff.ac.uk/study/ postgraduate/taught/courses/course/theology-mth – 03.12.20. Website des Studiengangs Theology an der Liverpool Hope University, https://www.hope.ac.uk/ undergraduate/undergraduatecourses/theology/ – 04.12.20.
7.2 Alphabetisches Verzeichnis der zitierten Internetquellen
345
Website des Studiengangs Theology an der St. Maryʼs University Twickenham London, https://www. stmarys.ac.uk/postgraduate-courses-london/theology – 04.12.20. Website des Studiengangs Theology an der University of Chester, https://www1.chester.ac.uk/study/ undergraduate/theology – 03.12.20. Website des Studiengangs Theology an der University of Chichester, https://www.chi.ac.uk/philosophytheology-and-religion/philosophy-theology-and-religion-courses/ba-hons-theology – 03.12.20. Website des Studiengangs Theology an der University of St. Andrews, https://www.st-andrews.ac.uk/ subjects/divinity/theology-mtheol/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Theology an der University of Winchester, https://www.winchester.ac.uk/ study/undergraduate/courses/ba-hons-theology/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Theology and Philosophy an der Newman University Birmingham, https:// www.newman.ac.uk/course/theology-and-philosophy-ba-hons/september-2021/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Theology and Religion an der University of Aberdeen, https://www.abdn.ac. uk/study/undergraduate/degree-programmes/535/V605/theology-and-religious-studies/ – 03.12.20. Website des Studiengangs Theology and Religion an der University of Birmingham, https://www. birmingham.ac.uk/undergraduate/courses/thr/theology.aspx#CourseDetailsTab – 03.12.20. Website des Studiengangs Theology and Religion an der University of Exeter, http://www.exeter.ac.uk/ undergraduate/courses/theology/theology/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Theology and Religion an der University of Oxford, https://www.ox.ac.uk/ admissions/undergraduate/courses-listing/theology-and-religion – 04.12.20. Website des Studiengangs Theology and Religious Studies an der University of Chester, https://www1. chester.ac.uk/study/undergraduate/theology-and-religious-studies – 03.12.20. Website des Studiengangs Theology and Religious Studies an der Liverpool Hope University, https:// www.hope.ac.uk/undergraduate/undergraduatecourses/theologyreligiousstudies/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Theology and Religious Studies an der Bishop Grosseteste University, https://www.bishopg.ac.uk/courses/matheology – 03.12.20. Website des Studiengangs Theology and Religious Studies an der University of Leeds, https://courses. leeds.ac.uk/620/theology%E2%80%90and%E2%80%90religious%E2%80%90studies%E2%80% 90ba – 04.12.20. Website des Studiengangs Theology & Religious Studies an der University of Glasgow, https://www. gla.ac.uk/undergraduate/degrees/theologyreligiousstudies/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Theology and Religious Studies an der University of Nottingham, https:// www.nottingham.ac.uk/ugstudy/course/Theology-and-Religious-Studies-BA – 04.12.20. Website des Studiengangs Theology and Religious Studies an der University of Roehampton London, https://www.roehampton.ac.uk/postgraduate-courses/theology-and-religious-studies/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Theology, Ecology and Ethics an der University of Roehampton London, https://www.roehampton.ac.uk/postgraduate-courses/theology-ecology-and-ethics/ – 04.12.20. Website des Studiengangs Theology, Philosophy and Ethics and der Bishop Grosseteste University, https://www.bishopg.ac.uk/course-subjects/theology – 03.12.20. Website des Studiengangs Theology, Religion and Ethics an der St. Maryʼs University Twickenham London, https://www.stmarys.ac.uk/undergraduate/theology-religion-and-ethics – 04.12.20. Website des Studiengangs Theology, Religion and Ethics an der University of Winchester, https://www. winchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/ba-hons-theology-religion-and-ethics/ – 04.12.20.
346
7 Literatur- und Quellenverzeichnis
Website des Studiengangs Theology, Religion and Philosophy an der University of Winchester, https:// www.winchester.ac.uk/study/postgraduate/courses/ma-theology-religion-and-philosophy/ – 04.12.20. Website Religionswissenschaft von Dr. Angelika Rohrbacher. Universitäten, https://www. religionswissenschaft.at/universities/ – 27.11.20. Website von de Gruyter. Theologische Realenzyklopädie. Produktinformation, https://www.degruyter. com/publication/dbid/tre/downloadAsset/TRE_TRE_Herausgeber.pdf – 29.01.21. Website von Prof. Dr. Christian Albrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Forschungsschwerpunkte, https://www.pt1.evtheol.uni-muenchen.de/personen/albrecht/ schwerpunkte/index.html – 28.01.21. Website von Prof. Dr. Christian Albrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Vita, https:// www.pt1.evtheol.uni-muenchen.de/personen/albrecht/vita/index.html – 28.01.21. Website von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Christoph Markschies an der Humboldt-Universität zu Berlin, https://www.antikes-christentum.de/markschies-kurzinfo – 29.01.21. Website von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Christoph Markschies an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bibliografie, https://www.antikes-christentum.de/de/team/mitarbeitende/markschies-kurzinfo/ bibliographie – 29.01.21. Website von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Christoph Markschies an der Humboldt-Universität zu Berlin. Biographie, https://www.antikes-christentum.de/de/team/mitarbeitende/markschies-kurzinfo/ biographie – 29.01.21. Website von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Christoph Markschies an der Humboldt-Universität zu Berlin. Forschungsschwerpunkte, https://www.antikes-christentum.de/de/team/mitarbeitende/ markschies-kurzinfo/forschung – 29.01.21. Website von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Gerd Theißen den der Universität Heidelberg, https://www.uniheidelberg.de/fakultaeten/theologie/personen/theissen.html – 29.01.21. Website von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Gerd Theißen den der Universität Heidelberg. Biographische Daten, https://www.uni-heidelberg.de/md/theo/personen/biographische_daten_2019_a.pdf – 29.01.21. Website von Prof. Dr. Hans G. Kippenberg, http://hans-kippenberg.com/ – 21.01.21. Website von Prof. Dr. Jörg Rüpke an der Universität Erfurt, https://www.uni-erfurt.de/index.php?id=933 – 20.01.21. Website von Prof. Dr. Kocku von Stuckrad an der University of Groningen, http://www.rug.nl/staff/c.k. m.von.stuckrad/ – 21.01.21. Website von Prof. Dr. Volkhard Krech am CERES an der Ruhr-Universität Bochum, https://ceres.rub.de/ de/personen/volkhard-krech/ – 24.11.20 Website von Prof. Dr. Winrich Löhr an der Universität Heidelberg, https://www.uni-heidelberg.de/ fakultaeten/theologie/personen/loehr.html – 25.01.21. Website von Theology and Religious Studies UK. Mitglieder, https://trs.ac.uk/about-trs-uk/who-we-are/ – 29.03.21. Wikipedia. Art. Jörg Rüpke, https://de.wikipedia.org/wiki/Jörg_Rüpke – 20.01.21. Wustmann, Claudia, Rüpke, Jörg. Historische Religionswissenschaft, in: H/Soz/Kult (24. 10. 2008), https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-11264 – 20.01.21. YouTube-Video Prof. Dr. Christoph Markschies – „Gottes Körper“ – Campus Talks auf dem ARD Youtube Channel, https://www.youtube.com/watch?v=qN9wK5U75u8 – 29.01.21.
8 Optionale Lesehilfe zu den angewandten Begriffen Systematische Theologie hat als eine ihrer Hauptmethoden das operative Ausdefinieren von Begriffen zu einem System von Aussagen. Dadurch entwickelt jedes einzelne systematisch-theologische Forschungsprojekt sozusagen immer eine eigene kleine Sprachwelt, deren Vokabular sich dann maßgeblich aus dem systemischen Zusammenhang erschließt. Weil solche Vokabeln aber dann nicht unbedingt dem jeweiligen (intuitiven) Sprachgebrauch entsprechen müssen, ein entsprechendes Erschließen aus verschiedenen Gründen auch schiefgehen kann und außerdem diese Arbeit dennoch auch nur in Ausschnitten lesbar sein möchte, wird an dieser Stelle eine zentrale Auswahl der in dieser Arbeit angewandten und/oder gesetzten Begriffe gegeben – sozusagen als optionale Lesehilfe. Atheismus/Agnostizismus, methodische Anforderung der Ausschaltung weltanschaulicher → Positimethodologischer onalitätsfaktoren im Forschungsprozess; v. a. innerhalb des religionswissenschaftlichen Fachdiskurses Außenperspektive ↔ Innenperspektive, in Debatten um die Verhältnisbestimmung von Religionswissenschaft und Theologie häufig angeführt als spezifische (z. B. systemtheoretisch gedachte) Position der Religionswissenschaft zu ihrem → Gegenstandsbereich der → Religion(en) (die in diesem Beispiel als Teil des Systems → Wissenschaft „von außen“ das System Religion erforscht) Differenzkriterium gedachter formaler Normpunkt im inner- und interdisziplinären → Diskurs, zwischen denen sich konkrete Forschungsprojekte je nach ihrer Verortung in den jeweiligen inner- und interdisziplinären Diskursen bewegen Diskurs historisch-soziokulturell bedingter gesellschaftlicher argumentativer Prozess, der sowohl Inhalte in ihrer Deskriptivität darlegt, als auch dadurch präskriptiv Wahres/Richtiges und Falsches normiert-normierend verhandelt Disziplin wissenschaftliche Diskursstruktur eines historisch-soziokulturell bedingten Tätigkeitssystems Dynamizität Eigenschaft, genuin dynamisch zu sein; v. a. von → Diskursen in all ihren Strukturen und Faktoren Empirisch (epistemisch‐) methodologischer Begriff zur Beschreibung der Abhängigkeit des Forschungsprozesses von Daten Epistemisch erkenntnistheoretisch Erkenntnisinteresse vorwissenschaftlich bedingte Zwecksetzung von Forschungsprozessen, die die Formulierung einer Forschungsfrage leitet Fragestellung wissenschaftstheoretisches → Differenzkriterium zur normierenden Strukturierung inner- und interdisziplinärer → Diskurse Gegenstand formales oder materiales Untersuchungsobjekt eines konkreten Forschungsvorhabens Gegenstandsbereich diskursives System bzw. Struktur von (Untersuchungs‐) → Gegenständen einer → Disziplin https://doi.org/10.1515/9783111091747-009
348
8 Optionale Lesehilfe zu den angewandten Begriffen
Glaube, christlicher
Identität Innenperspektive
Interesse Kultur Kulturwissenschaften Metatheorie Methode Methodologie Moment
Perspektive Positionalität
Positionalitätsfaktor Religion(en) religionsbezogene Wissenschaften Religionswissenschaft Theologie, ev. (Lebens‐) Welt Wissenschaft Zugriff
wissenschaftstheoretischer → Positionalitätsfaktor; hier fundamentaltheologisch relational bestimmt als spezifische Lebensform der als in ein Beziehungsgeschehen gesetzt empfundenen Weltdeutung und -gestaltung von → Disziplinen, im Sinne ihrer Identifizierung bzw. Unterscheidbarkeit im inner- und interdisziplinären → Diskurs ↔ Außenperspektive, in Debatten um die Verhältnisbestimmung von Religionswissenschaft und Theologie häufig angeführt als spezifische (z. B. systemtheoretisch gedachte) Position der Theologie zu ihrem → Gegenstandsbereich der → Religion(en) (die in diesem Beispiel das System Religion in christlicher → Perspektive „von innen“ erforscht) an etwas, sowohl vorwissenschaftlicher als auch den Forschungsprozess aktiv gestaltender Impuls erkenntnistätiger (Gruppen von) Subjekte(n) heuristischer Schlüsselbegriff einer Wissenschaftsprogrammatik aller menschlichen Praxis wissenschaftstheoretischer Programmbegriff, hier Diskurssystem von material und/oder formal auf → Kultur bezogenen → Disziplinen die Theorie der Theorie disziplinäres Differenzkriterium oder wissenschaftliches Handwerkszeug innerdisziplinäre Reflexion auf die Wahl geeigneter Methoden wissenschaftstheoretischer Strukturbegriff zur Einteilung von → Disziplinen auf der → metatheoretischen Ebene (Momente der Religionswissenschaft: historisch und systematisch; Momente der Theologie: historisch, systematisch und praktisch) epistemischer Ausdruck für die soziokulturellen und fachlichen Faktoren der → Positionalität der forschenden Person Bestimmtheit des Forschungsprozesses durch die forschende Person bei gleichzeitiger Bestimmtheit der forschenden Person durch den Forschungsprozess die spezifische → Positionalität historisch-soziokulturell bedingt material und formal bestimmend, z. B. → Glaube wissenschaftstheoretisch gesehen eine heuristische Begriffskategorie eurozentristischer Prägung, Teilaspekt von → Kultur → Disziplinen, die material und/oder formal auf → Religion(en) bezogen sind eine → religionsbezogene Wissenschaft eine → religionsbezogene Wissenschaft Überbegriff der Denk- und Handlungszusammenhänge von Menschen in historisch-soziokulturellen Kontexten Diskurssystem und Tätigkeit agierender Subjekte, durch die Wissen aktiv hergestellt wird wissenschaftstheoretischer Strukturbegriff in Bezug auf die methodologisch-praxeologische Unterteilung von → Disziplinen quer zu klassischen subdisziplinären Binnenstrukturlogiken (wie Teildisziplinen)
Index Atheismus/Agnostizismus, methodologischer 73, 155, 162, 287, 294 Außenperspektive 76, 96, 165, 173, 191, 194, 198, 293, 305, 307, 310 f., 316 Differenzkriterium 7, 68, 78, 87, 147, 161, 173, 203, 284, 308 Diskurs 3, 7, 78, 92, 106, 147, 165, 173, 182, 187, 192, 197, 199, 202 – 204, 214 f., 218, 275, 277, 283, 294, 296, 299, 307, 309 f., 313 – 315 Disziplin 7, 79, 90, 92, 147, 156, 165 – 167, 171, 173, 179, 182, 204, 213, 215, 218, 275, 295, 308 f., 310, 313 f. Dynamizität 78, 88, 157, 165, 187, 195, 225, 228, 231 f., 236, 244, 255, 314 empirisch 12, 25 f., 72, 97, 99, 107, 153, 162, 166, 184, 192, 196, 308, 311 epistemisch 1, 26, 74, 92, 151, 155, 165 f., 173, 213 f., 283, 285, 288 f., 303, 305, 307 f., 310, 313 Erkenntnisinteresse 68, 86 f., 92, 94, 149, 275 f. Fragestellung 7 f., 79, 87, 90, 92, 119, 128, 137, 147, 165 f., 173, 182, 213, 215, 237, 249, 261, 275, 306, 308 – 310, 314 Gegenstand 4, 49, 69, 71, 78, 161, 304, 310 Gegenstandsbereich 2, 28, 31, 48, 69 f., 78, 91, 108, 158, 161, 166, 192, 203, 214, 217, 283, 292, 294 f., 299, 307 f., 310 f., 313 Glaube, christlicher 69, 72, 77, 187, 191 f., 197, 203, 213 – 215, 261, 275 f., 282 f., 287, 289, 292, 294 f., 297, 299, 306 – 308, 310 Identität 2, 75, 88, 92, 301 Innenperspektive 76, 95, 156, 191, 194, 198, 305 Interesse 11, 15, 88 – 90, 92, 177, 306, 317 Kultur 46, 87, 156 – 158, 295 ff., 305, 310, 313 Kulturwissenschaften 2, 55, 70, 74, 156 f., 165 f., 295 – 297, 299, 305 – 311, 314, 317
https://doi.org/10.1515/9783111091747-010
(Lebens-)Welt 1 – 3, 44, 157, 178, 181, 192, 197 f., 202 f., 214, 276 f., 282 f., 294 f., 297, 299, 307 f., 310, 312 f. Metatheorie 100, 166, 171, 173, 181, 204, 213, 215, 294, 311 Methode 49, 71, 78, 91, 150, 162, 301, 305, 310 f., 313 Methodologie 23, 26, 41, 49, 71, 75, 151 f., 165, 214, 283, 308, 313 Moment 96, 100, 147, 165, 276 – 281, 299, 307, 311, 313 Perspektive 49, 75, 77 f., 163, 301, 304, 310 Positionalität 4, 58, 87 ff., 153, 165 f., 188, 192, 197, 214, 275, 283, 285, 288 f., 292, 294, 296 f., 304 f., 307, 310 f., 313 f. Positionalitätsfaktor 77, 284, 286, 288, 292, 294 – 296, 299, 304, 306 f., 310 f., 317 Religion(en) 1 f., 10, 14, 25, 28, 31 f., 42 f., 46, 48, 69, 101, 119, 128, 138, 147, 149, 154, 158, 161, 165 f., 191 f., 198 – 200, 215, 217, 237, 249, 307, 310 f., 313 religionsbezogene Wissenschaften 2, 4, 304 f., 310 f., 313, 316 Religionswissenschaft 2, 4, 10, 16, 20, 24 f., 48 – 50, 55, 58, 68 f., 71, 75, 80, 95 f., 100, 119, 128, 138, 147, 150, 154, 156, 165 f., 299, 306, 308 – 313, 316 f. Theologie, ev. 2, 4, 25, 28, 31, 35, 42, 45, 47 f., 50, 52, 58, 68 f., 71, 76, 83, 161, 164, 167, 172 f., 179, 188, 198 f., 201, 203 f., 213, 215 f., 237, 249, 261, 275 – 277, 283, 292 – 295, 297, 299, 306 – 313, 316 f. Wissenschaft 1 – 6, 72, 74, 87 – 89, 91, 153, 162, 168, 188, 191 f., 204, 213, 216, 276, 283, 285 – 287, 291 f., 294 f., 297, 299, 307 f., 309 f., 312 – 316
350
Index
Zugriff 105 – 107, 109, 119, 128 f., 137 f., 147 – 154, 158, 160, 163 – 166, 217 – 219, 237 f., 249,
261 f., 275 – 277, 281, 299, 306 – 308, 311 – 313




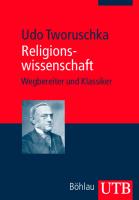


![Zentrierte Theologie: Karl Barths Beitrag zur Verständigung der theologischen Disziplinen [1 ed.]
9783666557996, 9783525557990](https://dokumen.pub/img/200x200/zentrierte-theologie-karl-barths-beitrag-zur-verstndigung-der-theologischen-disziplinen-1nbsped-9783666557996-9783525557990.jpg)

![Religionswissenschaft und Psychoanalyse [Reprint 2019 ed.]
9783111388038, 9783111026732](https://dokumen.pub/img/200x200/religionswissenschaft-und-psychoanalyse-reprint-2019nbsped-9783111388038-9783111026732.jpg)
