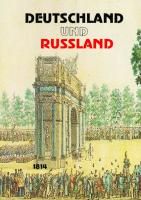Plenum – Orte der Macht: Sonderausgabe Biennale Venedig 2014 9783038215516, 9783038216919
Architektur als Medium des Politischen A current contribution to the debate on the crisis of representation
151 23 55MB
German Pages 168 Year 2014
Polecaj historie
Table of contents :
Inhalt
Vorwort
Provvisorio / Zur Einleitung
Je nachdem, in welcher Anwaltschaft ich mich sehe
Im Schatten der Pyramide. Ein »Offenes Parlament« für Tirana
Müde Monumente. Anmerkungen zu einem Ausstellungskonzept
Monument / Moment. Fotoessay
Repräsentation der Repräsentation?
Postdemokratische Räume
Orte der Versammlung
Gegner, Personen, Wesen. Gedanken zum Parlament als agonistischer Raum
Nation und Stil. Zur Formfindung parlamentarischer Repräsentation im 19. Jahrhundert
Prunk und Prestige, Funktionalität und Eleganz. Das Wiener Parlamentsgebäude und sein Plenarsaal
Dank
Anhang
Citation preview
UmBau 27 Plenum. Orte der Macht Sonderausgabe Biennale Venedig 2014
Österreichische Gesellschaft für Architektur (Hrsg.)
UmBau 27 Plenum. Orte der Macht Sonderausgabe Biennale Venedig 2014
Birkhäuser Basel
Sponsoren Wir danken den Institutionen und Unternehmen
Public Partner
institut für architektur und entwerfen technische universität wien • architektur-entwerfen.tuwien.ac.at
Hauptsponsoren autodesk • www.autodesk.com bai – bauträger austria immobilien • www.bai.at big – bundesimmobiliengesellschaft • www.big.at vasko + partner • www.vasko-partner.at waagner-bíro • www.waagner-biro.com wolf theiss rechtsanwälte • www.wolftheiss.com
bauunternehmung granit • www.granit-bau.at wienerberger • www.wienerberger.com general laser • www.general-laser.at kalbeck media • www.kalbeck.com kallco bauträger • www.kallco.at
asSEmbLy nicera nippon ceramic • www.nicera.co.jp ösw – österreichisches siedlungswerk • www.oesw.at
Sondersponsoren
buero bauer • www.buerobauer.com bundeskammer der architekten und ingenieurkonsulenten bundessektion architekten • www.arching.at fritz egger – holzwerkstoffe • www.egger.com
Sponsoren
Medienpartner dérive – verein für stadtforschung • www.derive.at insiderei • www.insiderei.com
9 Vorwort Christian Kühn 10 Provvisorio Zur Einleitung Gespräch mit Gabu Heindl, Christian Kühn und Wolf D. Prix 18 Je nachdem, in welcher Anwaltschaft ich mich sehe Christian Kühn 25 Im Schatten der Pyramide Ein »Offenes Parlament« für Tirana Christian Kühn | Harald Trapp 34 Müde Monumente Anmerkungen zu einem Ausstellungskonzept Andreas Balon 44 Monument | Moment Fotoessay Alfred J. Noll 74 Repräsentation der Repräsentation? Jens Kastner 90 Postdemokratische Räume Harald Trapp 100 Orte der Versammlung Peter Androsch 116 Gegner, Personen, Wesen Gedanken zum Parlament als agonistischer Raum Ita Heinze-Greenberg 124 Nation und Stil Zur Formfindung parlamentarischer Repräsentation im 19. Jahrhundert
Nott Caviezel 142 Prunk und Prestige, Funktionalität und Eleganz Das Wiener Parlamentsgebäude und sein Plenarsaal 160 Dank 162 Anhang Biografien, Bildnachweis, Backlist
barRicAdes
ögfa
Vorwort Die Österreichische Gesellschaft für Architektur freut sich, als Publikation zum österreichischen Beitrag der Architekturbiennale 2014 in Venedig eine Sonderausgabe des UmBau, der interdisziplinären Zeitschrift zur Architekturtheorie, zu präsentieren. Für den Inhalt dieser UmBau-Sondernummer verantwortlich ist der diesjährige Kommissär des Österreichischen Pavillons, Christian Kühn, der selbst seit Langem mit dem UmBau verbunden ist, zunächst als Vorstandsmitglied der ögfa und anschließend – gemeinsam mit Kari Jormakka – als verantwortlicher Redakteur für die Ausgaben 18 bis 25. Der UmBau setzt sich seit 1979 mit der Theorie der Praxis auseinander und macht Hintergründe und Zusammenhänge sichtbar. Als eine der wenigen kontinuierlich erscheinenden Publikationsreihen zur Architekturtheorie im deutschsprachigen Raum gestaltet er seit Jahrzehnten den Diskurs mit. Für die ögfa sind Fragen nach Teilhabe und SelbstRepräsentation ein zentrales Anliegen. Im Schwerpunktthema »Solidarität. Wie entstehen demokratische Räume?« (2012|13) ging es nicht um die Repräsentationsbauten, sondern um die Alltags-Orte kleiner demokratischer Momente. Der lau fende Schwerpunkt »Das Geschäft mit der Stadt« hinterfragt die gegenwärtige Stadtplanung in Wien und anderen euro päischen Städten: Wessen Anwaltschaft übernimmt sie, wo es um Besitzverhältnisse, ökonomische Rhetorik und Verteilungsgerechtigkeit geht? Nicht zuletzt freuen wir uns über die Gelegenheit, mit dieser Sondernummer den UmBau einer erweiterten LeserInnenschaft näher zu bringen. Den Vertrieb hat mit der vor liegenden Ausgabe der Birkhäuser Verlag übernommen, um gemeinsam mit uns den UmBau als Beitrag zum kritischen Diskurs zu Architektur und Stadtplanung weiterzuentwickeln.
CaNdIdAte
Gabu Heindl Vorsitzende Österreichische Gesellschaft für Architektur 9
Christian Kühn Provvisorio Zur Einleitung Als ich im März 2013 zum Kommissär für die kommende Architekturbiennale in Venedig bestellt wurde, ergab sich bald die Gelegenheit zu einem Gespräch mit meinem Vorgänger, Arno Ritter, dem Leiter des Tiroler Architekturforums aut. Neben vielen praktischen Informationen wies er mich auf ein Foto hin, das er bei einem seiner ersten Besuche als Kommissär in Venedig vor dem Biennale-Gelände aufgenommen hatte. Es zeigt die Rückansicht einer tief gebeugten alten Frau, die sich auf einen Stock stützt und in ausladende schwarze Kleider gehüllt ist. Das Bild hätte ihn bei der folgenden Arbeit in Venedig begleitet, als eine Art Vorahnung auf die Überlage rungen und Übergänge von menschlichen und technischarchitektonischen Körpern, denen sich das mit Wolfgang Tschappeller für den Österreichischen Pavillon entwickelte Projekt widmete. Das Bild, das mich bei meiner Arbeit in Venedig begleitet hat, entstand ebenfalls auf der Promenade, die am Meer entlang zum Ausstellungsgelände der Biennale führt. Es zeigt ein banales Detail des Bodenbelags im Segmentbogenverband, das an dieser Stelle mit einer Betonfüllung notdürftig repariert wurde. In den weichen Beton eingeritzt steht das Adjektiv provvisorio. Man kann sich das Entstehen dieser Füllung und ihrer Beschriftung unterschiedlich erklären. Vielleicht stammt die Schrift vom beauftragten Handwerker, der – nachdem er die Füllung gegossen hatte – noch einmal zurückblickte und diesen Kommentar aus Gründen der Berufsehre für nötig hielt. Vielleicht ist sie aber auch der ironische Kommentar eines Passanten, im Bewusstsein, dass dieses Provisorium noch jahrelang zu sehen sein wird.
10
cENsOr
Das Bild, das dieses Foto zeigt, lässt sich als Metapher für einen gesellschaftlichen Zustand lesen: für das Zerreißen eines sozialen Gewebes; den unbeholfenen Versuch, es zusammenzuhalten; die verbreitete Ansicht, dass diese Maßnahme provisorischen Charakter haben sollte; und die ebenso verbreitete dunkle Ahnung, dass dieses brutale Provisorium nicht nur dauerhaft sein könnte, sondern zur Norm werden könnte. Tatsächlich wird Politik heute nicht als der kunstvolle Aufbau von Strukturen wahrgenommen, wie man sie in der Pflasterung auf dem Bild ausmachen kann: eine nichthierarchische Ordnung aus individuellen Elementen, arran giert zu einem feinen Netzwerk aus Beziehungen, das ohne Anfangs- und Endpunkt auszukommen scheint. Stattdessen wirkt Politik aktuell oft als technokratische Reparatur von Fehlstellen im sozialen Gewebe, die nur für den Augenblick das Zerreißen verhindert. Mut zu neuen Verknüpfungen, zum Umstülpen oder Neu-Denken scheint weitgehend zu fehlen.
11
Wer in dieser Situation nach Orten und Räumen sucht, die als Laboratorien einer solchen Erneuerung dienen können, wird sie heute vor allem im öffentlichen urbanen Raum finden. Kein politischer Frühling der letzten Jahre, dessen Akteure nicht auf die Straße gehen, um einen Ort für sich in Besitz zu nehmen. Schon eine kleine Versammlung von ein paar Tau send übertrifft die Zahl der demokratisch gewählten politischen Repräsentanten selbst der größten Staatsgebilde. Ab einer gewissen Menge macht sich der Eindruck breit, dass das Volk endlich sich selbst repräsentiert, indem es eins zu eins das strukturierte Gewebe der Gesellschaft darstellt. Die Besetzung des Stadtzentrums von Kairo um den Tahrir-Platz hat Bilder hinterlassen, die diesen Eindruck nahelegen. Beim »Marsch der Millionen« am 1. Februar 2011 traten hier bis zu zwei Millionen Menschen für einen Wandel ein. Im Laufe der Besetzung entstand eine eigene urbane Struktur mit Kindergärten und Krankenhäusern, dem Protestcamp im Zentrum und einer eigenen Müllentsorgung. Zum Freitags gebet verwandelten sich weite Teile des Platzes in eine ge richtete Ordnung, die in der brodelnden Menge einen Teppich aus betenden Körpern entstehen ließ und zugleich auf die zu erwartenden Spannungen zwischen säkularen und reli giösen Kräften aufmerksam machte.
Tahrir Platz Kairo Februar 2011
12
Der Unterschied zwischen einer klassischen Demonstration und diesen neuen Massenphänomenen liegt in der Art der Organisation. Taucht man aus der Vogelperspektive ins Geschehen ein, wird sofort klar, dass Massen dieser Dimension ohne die neuen digitalen Kommunikationsmittel wie Facebook und Twitter niemals über Monate strukturiert gehalten werden könnten. Das Bedrohliche für die Machthaber in Ägypten war nicht das Protestcamp im Zentrum des TahrirPlatzes per se, sondern der sich unaufhörlich erneuernde Ring aus hunderttausenden Körpern, der sich um dieses Camp gelegt hatte, nachdem es von den Schlägertrupps der Regie rung attackiert worden war. So attraktiv es ist, die Auseinandersetzung mit Orten der Macht von diesen neuen Phänomenen her zu beginnen, so hat die Entwicklung der letzten Jahre gezeigt, dass die Idee, diese politischen Aktionen im öffentlichen Raum seien Ausdruck eines allgemeinen Volkswillens, eine – wenn auch alles andere als wirkungslose – Illusion bleiben muss. Dass hier endlich wieder authentische Begeisterung für politisches Handeln aufkommt, macht die Kraft dieser Bewegungen aus.
ciVilian proTest
In die Krise geraten sie, sobald Macht geteilt und verteilt werden muss, sobald es um die Frage der Delegation und Repräsentation geht und um den Ausgleich von Interessen, kurz: Sobald der Freiraum, in dem noch alles möglich scheint, in Richtung Institutionalisierung verlassen wird. Die Macht verlagert sich nach innen und folgt dort den alten Mustern. In unserem Beitrag zur aktuellen Architekturbiennale gehen wir der Frage nach, wie Architektur zur Legitimation politischer Institutionen beiträgt. Wir gehen dabei nicht von den dynamischen neuen Formierungen im öffentlichen Raum aus, sondern vom anderen Ende, von den Monumentalbauten, mit denen die Nationen der Welt ihrem Souverän, dem Volk, von dem alle Macht im Staat ausgehen soll, ein Denkmal setzen und ihn gleichzeitig in eine Form zwingen. Indem wir alle Parlamentsgebäude der Welt zu einem Plenum versammeln, können wir zeigen, wie diese Gebäude im Chor die letzte der großen Erzählungen von sich geben: Die Entwicklung vom Gottesgnadentum zum Verfassungsstaat, von der Auto13
kratie zur modernen Demokratie. Sie beginnt in den Revo lutionen des 18. Jahrhunderts, setzt sich fort in den bürgerlich geprägten Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts und überlebt im 20. Jahrhundert die Katastrophe der totalitären Regime und zweier Weltkriege. In der Zusammenschau zeigt sich, wie homogen die Hüllen fast aller Parlamente der Welt diese ihrem Gehalt nach eurozentrische Geschichte nacherzählen. Das vorherrschende Idiom ist die Sprache des Neoklassizismus, gefolgt von der Klassischen Moderne und wenigen Ver suchen, autochthone Ausdrucksformen zu finden. Die Vorherrschaft des Klassizismus bis in die Gegenwart ist umso verwunderlicher, als nur knapp über 30 der von uns untersuchten 196 nationalen Parlamente in Häusern tagen, die vor dem Jahr 1914 entstanden. Weitere 20 stammen aus den Jahren 1915 bis 1949, die restlichen 143 aus der Zeit danach. Die Moderne hat in diesem symbolbeladenen Sektor der Architektur offenbar weniger Strahlkraft entwickeln können als der Universalstil des 18. Jahrhunderts, der Klassizismus. Wenn bei der aktuellen Architekturbiennale von Rem Koolhaas die Frage gestellt wird, wie die Architektur der Jahre 1914 bis 2014 die Moderne absorbiert hat, lautet unser Befund angesichts der Weltproduktion an politischem Monumentalbau: Dort, wo es darum ging, durch Architektur eine dauerhafte politische Ordnung darzustellen, hatte kaum ein staatlicher Bau herr den Mut zur Moderne. Unter den Weltparlamenten sticht jenes in Brasília von Oscar Niemeyer heraus. Louis Kahns Parlament für Bangladesch in Dhaka ist der seltene Beleg für eine gelungene moderne Interpretation im weitesten Sinn lokaler – in diesem Fall der Mogul-Architektur zuzurechnender – Vorbilder. Das eigentlich Erstaunliche am monumental-klassizisti schen Chor der Weltparlamente ist, dass nur eine Minderheit dieser Institutionen annähernd das lebt, was aus westlicher Perspektive als Demokratie bezeichnet werden kann. Nun wird die repräsentative Demokratie ja per se besser als Utopie verstanden, der man sich annähert, ohne sie im Ideal erreichen zu können. Aber dass das Parlament Nordkoreas wie ein Abziehbild seines finnischen Gegenstücks erscheint, über rascht doch. Wie viel Hierarchie, wie viel autoritäre Struktur steckt im Parlamentsgebäude einer fast makellosen Demo kratie, dass es von einem der autoritärsten Staaten der Welt 14
als Vorbild für das eigene Haus des Volkes genommen werden kann? Wie könnten, über 200 Jahre nach der Unabhängig keitserklärung der usa und der Französischen Revolution, die Räume einer fortgeschrittenen Demokratie aussehen, die nicht mehr im Monumentalen Halt suchen muss? Unsere Nachforschungen zu diesen Fragen stehen erst am Anfang. In der Ausstellung – wie sie weiter hinten von Harald Trapp und mir beschrieben wird – haben wir versucht, den Problemaufriss räumlich umzusetzen: Das Plenum der Parlamente, die aus ihrer statischen Position in eine prekäre Lage gekippt sind und zum Ornament einer globalen Ordnung zu werden drohen, die durch alles andere als demokratische Kräfte geprägt ist; die Andeutung eines offenen Arrangements aus Stimmen und Pflanzen im Hof; und der Versuch einer Aufl ösung von Monumentalität in einen Strom von Bildern in den Seitenräumen des Pavillons. Für die vorliegende Ausgabe des UmBau haben wir Autoren aus unterschiedlichen Disziplinen gebeten, sich mit der Rolle von Architektur in repräsentativen Demokratien zu befassen. Für den Juristen Alfred J. Noll liegt der Witz des Parlaments in seiner Qualität als sozialer und symbolischer Institution. Wir alle wüssten, dass im Parlament kein Konsens hergestellt und der kollektive Dissens nicht adäquat zum Ausdruck gebracht werde – aber als kollektive Fiktion habe es dennoch seine Berechtigung. Dass diese Fiktion sich nach wie vor aus Überblendungen von parlamentarischer Volksrepräsentanz und monarchischer Epiphanie speise, sei jedoch problematisch. Eine Gesellschaft, die ihre Normativität aus sich selbst schöpft, dürfe sich nicht mit Repräsent ationsvorstellung abfinden, die ihren Ursprung im »mythischen Denken« hätten. Der Soziologe und Kunsthistoriker Jens Kastner lotet in seinem Beitrag über »Postdemokratische Räume« Möglichkeiten für neue Formen der Versammlung aus. Mit Bezug auf Bruno Latour und den spatial turn weist er auf die Ambiva lenz des Begriffs »Postdemokratie« hin, der sowohl den Abbau von Demokratie (im Zuge der Neoliberalisierung) als auch die Ausweitung der Demokratie (im Hinblick auf das Drängen
cLassiCism
15
der Dinge und die Ausweitung kritischer Reflexionsräume) beschreiben müsste. Kunst hätte hier insofern eine besondere Funktion, als sie nicht nur den Bruch mit vorherigen Mal- und Gestaltungsweisen, sondern auch das Aufbrechen gewohnter Seh- und Sichtweisen und das Durchbrechen von Klassenschranken in Produktion und Rezeption von Kunst impliziere. Harald Trapp beschreibt in seinem Beitrag unter Bezugnahme auf Niklas Luhmann und Peter Sloterdijk, wie sich die repräsentative Demokratie seit dem 18. Jahrhundert schritt weise geeignete Raumformen erarbeitet hat. Das Besondere an dieser Entwicklung sei, dass nicht nur das Volk souverän wird, sondern zugleich das vernunftbegabte Individuum, dessen wachsende Autonomie als treibende Kraft der gesellschaftlichen Rationalisierung wirkt. Wenn heute die Reprä sentierten auf den Kanälen der neuen sozialen Medien selbst präsent werden, sei dies eine Herausforderung an die Demo kratie, neue Organisations- und Raumformen zu erfinden. Es folgt Peter Androschs Analyse des Parlaments aus der Perspektive des zoon akoustikon. Die zentralen Tätigkeiten des Parlamentarismus seien Sprechen und Hören. Androsch zeigt auf, dass es dabei um mehr geht als eine technische Qualität, sondern um Reflexion im weitesten Sinn, die erst Orientierung und damit Positionierung ermöglicht. Parlamente dürften keine antagonistischen Räume werden, in denen Mundtot-machen des Gegners versucht wird, sondern agonistische Räume, in denen das Gegenüber als Person – also im wörtlichen Sinn als Durch-Klingendes – anerkannt wird. Den Abschluss der Essays bilden die beiden Beiträge aus dem Bereich der Kunstgeschichte von Ita Heinze-Greenberg und Nott Caviezel. Heinze-Greenberg befasst sich mit der Koevolution von Nationalstaat und Parlamentsarchitektur im 19. Jahrhundert. Die Perzeption einer gemeinsamen Geschichte – inklusive erfundener Traditionen – stellte sich als stärkstes Bindemittel für den Zusammenhalt oftmals heterogener ethnischer Gruppen unter dem Dach der Nation dar. Die Verlagerung vom Klassizismus zur Nationalromantik, die sich im Lauf des 19. Jahrhunderts beobachten lässt, ist in diesem Kontext naheliegend. Wo die nationale Klammer beim besten Willen nicht zu konstruieren war, blieb der Klassizismus der Stil der Wahl. Das gilt unter anderem für das Parlament der österreichisch-ungarischen Monarchie, mit dessen 16
Wiederaufbau in den 1950er-Jahren sich Nott Caviezels Bei trag befasst. Sein leidenschaftliches Plädoyer für die Erhaltung des damals entstandenen neuen Plenarsaals legt die Latte für eine radikale Neugestaltung – der ich selbst den Vorzug geben würde – so hoch, wie es der Aufgabe gebührt. Im aktuellen Teil wird ein Projekt besprochen, in dem sich viele Aspekte der Essays wiederfinden: das albanische Parla ment in Tirana von Coop Himmelb(l)au. Unter der Regierung von Sali Berisha initiiert, war das Projekt von Beginn an um stritten: für die einen ein Zeichen für den demokratischen Neubeginn, für die anderen ein verschwenderisches Projekt, eine Camouflage für ein politisches System, das noch einen weiten Weg bis zu einer vollwertigen Demokratie vor sich habe. Als besonders umstritten erwies sich der geplante Standort, auf dem sich derzeit das pyramidenförmige ehemalige Enver-Hoxha-Museum befindet. Wäre der Abriss dieses vormaligen Zentrums des Hoxha-Kults mit der Auslöschung von Geschichte gleichzusetzen? Oder wäre er die Gelegenheit, sich von der Vergangenheit zu lösen und ein neues Kapitel der Geschichte aufzuschlagen?
CoMe ToGethEr
Ob das verletzliche Glashaus, das Coop Himmelb(l)au für Tirana konzipiert haben, das richtige Zeichen für eine junge Demokratie auf der Suche nach sich selbst ist, muss fürs Erste eine offene Frage bleiben, die nur vom politischen Diskurs im Land beantwortet werden kann.
17
Gespräch mit Gabu Heindl, Christian Kühn und Wolf D. Prix Je nachdem, in welcher Anwaltschaft ich mich sehe Christian Kühn: Die 14. Architekturbiennale stellt die Frage nach den Fundamentals, womit – wenn man Rem Koolhaas’ Ankündigung folgt, eine Ausstellung über Architektur und nicht über Architekten machen zu wollen – die fundament alen materiellen Bestandteile der Architektur zu verstehen sind: das echte Fundament, die Wand, der Balkon oder die Treppe. Macht und Geld als unsichtbare Fundamente der Architektur kommen in diesem Konzept nicht vor, zumindest nicht ex plizit. Für mich sind das aber zentrale Fragen. Wie nahe an Macht und Geld muss Architektur sein, und wie weit kann sie ihre Autonomie bewahren? Gabu Heindl: Ich persönlich behaupte gar nicht, dass die Architektur eine autonome Disziplin sein soll. Ich bin für Heteronomie und glaube auch nicht, dass man sich zur »Macht« positionieren kann wie zu einem Gegenstand. Wenn ich Macht so definiere wie Hannah Arendt, kann Macht nur von vielen ausgehen; ein Einzelner hingegen kann nur Gewalt ausüben. Ich verstehe Architektur als involvierte Disziplin und deswegen ist es wichtig, dass man als Architekt oder Architektin eine politische Haltung einnimmt. Man setzt selbst eine Position in den Raum, die kann man entweder auf der Widerstandsseite verorten, oder – wie in einem Gentrifizierungsfall, wo man mitgentrifiziert – etwa aufseiten von Investoreninteressen. Wolf Prix: Es war Hans Hollein, der 1969 in der Ausstellung Architektur die Architektur als ein Zeichen der Macht gesehen hat. Ich glaube das auch, denn die Gebäude, die wir sehen, sind nur die Spitze eines Eisbergs. Über die unsicht bare Architektur – also Politik und Macht, Geld, Ökonomie, die Baugesetze etc. – wird nicht gesprochen. Aber sie ist der gefährlichere Teil. Ich wollte, Hanna Arendt hätte Recht, aber momentan hat Architektur sehr viel mit Macht zu tun. Allerdings sind die Auftraggeber nicht mehr einzelne 18
Personen, sondern meistens Komitees oder Jurys, die direkt oder indirekt sehr viel mit Entscheidungen, also Macht zu tun haben. Architektur ist schwer von Gewicht, kostet Zeit und Geld, und wo Geld ist, ist Politik. ck: Hans Hollein hat ja bei Clemens Holzmeister studiert, der seinen Schülern vor allem vermittelt hat, wie man mit Macht umgeht. Sonst haben die Holzmeisterschüler Wilhelm Holzbauer, Hans Hollein und Gustav Peichl ja wenig Gemeinsamkeiten. Holzmeister war ein Virtuose im Umgang mit Macht, von der Arbeit für die Vaterländische Front über die Projekte für Atatürk bis zu seiner dominanten Rolle nach dem Zweiten Weltkrieg. wp: Alle Architekten, die sich in den 60ern mit Strategie beschäftigt haben, also auch Hans Hollein, haben sich darauf konzentriert, Macht auszuüben, indem sie Information mono polisiert haben. Die Monopolisierung dieser Information von einer Einzelperson hat sich allerdings durch die sozialen Medien total aufgelöst, durch Facebook und Informations kanäle, die nicht mehr von einem Einzelnen zu steuern sind. gh: Man könnte in diesem Zusammenhang über die Entstehung einer kritischen Masse nachdenken. Gerade über Architektur, über Planung, über Planungsinitiativen kann diese kritische Masse generiert werden, die dann selbst auch machtvoll ist. Es ist wichtig, Machtverhältnisse zu verstehen und aktiv mitzuarbeiten: Je nachdem, in welcher Anwaltschaft ich mich sehe. ck: Wie sieht das aus beim Bauen für autoritäre Systeme, beispielsweise für China? Die Position von Coop Himmelb(l)au in dieser Frage hat sich in dieser Hinsicht ja deutlich verändert. wp: Etwa im Jahr 2000 wollte ich nichts mehr für China entwerfen, weil wir uns immer hintergangen fühlten. Aber inzwischen können wir dort bauen, was wir auch wirklich bauen wollen. Das ist eine entscheidende Frage: Baut man, wenn man das bauen kann, was man wirklich bauen will? Oder lehnt man ab, weil man glaubt, den Auftraggeber moralisch verurteilen zu müssen? Rem Kohlhaas’ cctv-Zentrale ist eine Architektur, die nicht dem chinesischen »Geschmack« und den Richtlinien der Architektur dort entspricht – das
ConSpiRacY
19
1 vid. http://www.the guardian.com/world/ 2014/feb/25/zahahadid-qatar-worldcup-migrant-workerdeaths (03.05.2014).
gilt ebenso für das Vogelnest von Herzog de Meuron und Ai Wei Wei. Die Wohnbauten von Steven Holl sind sogar gegen die Klischees einer chinesischen Wohnung gerichtet. Man sollte nur nicht glauben, dass sich die demokratische Idee eines Gebäudes dann auf die Gesellschaft übertragen lässt. So wie Rem Kohlhaas meint, dass seine cctv-Zentrale die Demokratisierung des Landes beschleunigen wird – das glaube ich nicht. Aber die Option einer demokratischen Organisation ist nach wie vor in dem Gebäude vorhanden und das finde ich so wie bei unserem Kultur-Kongress-Gebäude in Dalian in Ordnung. gh: Mit einem Gebäude unmittelbar auf die Medienfreiheit eines Landes zu wirken, ist eine maßlose Über schätzung der Architektur. Ich ziehe jetzt absichtlich Zaha Hadid als Beispiel heran und ihr letztes Guardian-Interview zu den Hunderten Toten auf ihrer Baustelle in Katar – sie hat sich in dem Interview dazu geäußert, dass sie nichts dafür kann.1 Es stimmt, dass sie persönlich nichts dafür kann, aber es stimmt nicht, dass es nicht in ihrer Macht liegt, etwas dagegen zu tun: Gerade als Architektin müsste ich, wenn ich so ein Projekt annehme, entrüstet sein und öffentlich im Interview meine absolute Verabscheuung dieser Tatsachen bekunden, aber nicht voller Zynismus sagen, dass es im Verantwortungsbereich einer Regierung liege, mit der sie nichts zu tun hat. Es ist katastrophal, weil es kein Bewusstsein für die prekäre Situation gibt, in die sich eine Architektin begibt, wenn sie in solchen Regimen baut. Grundsätzlich wäre nicht für diese Regime zu bauen die bessere Lösung, und ich glaube auch nicht, dass es darum geht, dass man bauen kann, was man selbst will. Für mich wäre das kein Parameter in der Frage nach dem Bauen für autoritäre Regime. wp: Es sollte nicht so klingen wie die Fabel vom Fuchs, dem die Trauben zu sauer sind. Wenn man als Architekt in die Verlegenheit kommt, bei einem großen Auftrag entwerfen zu können, was man will, sieht die Sache vielleicht etwas anders aus. gh: Ich glaube, dass man sich bei jeder Bauaufgabe überlegen muss, in welcher Position man zu den politischen Verhältnissen steht. Ich persönlich hätte beispielsweise bei einem Wettbewerb für ein Schubhaftzentrum einfach nicht mitgemacht. 20
ck: Ich habe Wolf Prix’ Aussage so verstanden, dass man Bedingungen stellt, die nicht unbedingt soziale Bedingungen sein müssen. Es können auch ästhetische Bedingungen sein, in deren Rahmen man sich frei bewegen kann. Man kann mittels der Architektur Angebote machen, die von den Nutzern realisiert, also verwirklicht werden müssen. Michel Foucault hat dazu gesagt, dass Architektur keine Freiheit schaffen kann, sondern Freiheitsangebote macht, die auf eine Freiheitspraxis der Nutzer treffen muss. Es kann auch Fälle geben, bei denen es nicht sofort gelingt, sondern erst in zehn oder zwanzig Jahren. Das Projekt für das albanische Parlament in Tirana könnte dafür ein Beispiel werden. Wenn man sich die Blogs durchliest, die das Coop Himmelb(l)au Projekt thematisieren, gibt es zwei Parteien. Einerseits jene, die sagen, dass diese Demokratie noch so wenig weit entwickelt ist, dass ein solches Glashaus eine reine Camouflage dieser Situation wäre. Man gibt etwas vor, das mit der Realität nichts zu tun hat. Und die Position der Befürworter ist, dass dieses Gebäude bewusst eine Utopie darstellt, etwas, das man in Zukunft erreichen möchte. Demokratie ist ja immer Utopie. wp: Es hat zwei Wettbewerbe für das Parlament in Tirana gegeben, und da für mich ein Parlament zu entwerfen eine der vornehmsten Aufgaben der Architektur darstellt, haben wir uns an beiden Wettbewerben beteiligt. Dass das größere Projekt voraussichtlich nicht realisiert wird, hat zu tiefst politische Gründe. Wobei ich die Argumentation, dass man das ehemalige Mauso leum für Enver Hoxha, auf dessen Areal unser Projekt hätte entstehen sollen, nicht wegreißen darf, sondern als Mahnmal oder gar als Jugendzentrum erhalten sollte, nicht nachvollziehen kann. Aber da spielen viele unbewusste Ängste mit. Wenn ich wirklich demokratisch denke, reiße ich diese Pyramide weg. gh: Der Umgang mit solchen Monumenten wirft immer besondere Fragen, wie bei dem Projekt, das ich mit Hito Steyerl an den ns-Brückenkopfgebäuden in Linz realisiert habe. Auch hier wurde diskutiert: Warum reißt man die Gebäude nicht gleich ab? Warum lässt man unsere konstruierte Fassa denzerstörung nicht als permanentes Zeichen stehen? Das
coNsTitUtion
21
Ringen um diese Fragen ist ja beinahe das Interessanteste daran. Die Architektur nicht geschichtsblind zu machen, das wäre mir sehr wichtig. wp: Nicht die Architektur ist geschichtsblind, sondern die Architekten. Denn oft ist es letztendlich interessanter, die verdeckten Prozesse sichtbar zu machen, als es das gebaute bzw. nicht gebaute Resultat wäre. Ich bin natürlich in unserem Fall für das Abreißen der Pyramide, nicht weil ich dort unbedingt etwas bauen will, sondern weil ich das Argument der »Geschichtsträchtigkeit« nur bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann. In dreißig Jahren wird Enver Hoxha in Albanien hoffentlich nur noch eine blasse Erinnerung sein. Warum soll man seinem Gedenken den besten Platz der Stadt überlassen? Für die Aufarbeitung der Geschichte lassen sich andere Orte finden. ck: Von den 196 Parlamentsgebäuden, die wir in Venedig zeigen, atmet ein Großteil den Geist des Klassizismus, obwohl sich viele davon an Orten befinden, an denen der Klassizismus kulturell alles andere als beheimatet ist. Ich habe das anfangs eher als Skurrilität gesehen, wenn man sich etwa die frappante Ähnlichkeit zwischen Parlamenten von Nord korea und Finnland ansieht. Aber dann habe ich mich doch gefragt: Wie viel Autoritäres steckt in dieser Architektur, die bis heute zum Einsatz kommt, wenn es darum geht, etwas Dauerhaftes, Staatstragendes, Wichtiges zu realisieren? Unser Österreichisches Parlament ist ja keine Ausnahme. gh: Auch neuere Architektur, die nicht klassizistisch ist, kann für Autorität stehen, der Dekonstruktivismus genauso wie postmoderne Formen. ck: Auf der ästhetischen Ebene war der Klassizismus genauso wie die Moderne eine internationale Sprache. Mit beiden war die Hoffnung verbunden, eine für alle verständliche Welt zu errichten. Deswegen werden sie auch so gerne von der politischen Elite verwendet. Postmoderne und Dekonstruktivismus haben diese Hoffnung bewusst aufge geben, entweder durch Ironie oder durch das Beanspruchen einer idiosynkratischen Sprache, die gar nicht mehr universell verstanden werden möchte. Das halte ich doch für einen fundamentalen Unterschied. gh: Das Ergebnis ist aber Signature Architecture im Dienst des globalisierten Kapitalismus. Der Neoliberalismus baut 22
ja genau darauf auf, dass er modular und flexibel ist, dass er individuell ist. Insofern geht die Entwicklung der Architektur einher mit der Konstitution der Nationen, mit der Veränderung dieses Konzepts und auch mit den Veränderungen des Kapitals, das schneller und mobiler geworden ist. ck: Sind die neuen sozialen Bewegungen ein Indiz, dass Architektur und Macht heute ein neues Verhältnis eingehen könnten? gh: Ja, ich glaube schon. Architektur kann Teil der Bewegungen oder aber auch ihr Anstoß sein, so wie es bei den Protesten in Istanbul 2013 gegen die Rekonstruktion der Topçu-Kaserne als Einkaufszentrum anstatt des Gezi-Parks der Fall war. Architektur eignet sich ebenso wie Stadtplanung gut als Anlass für Proteste, weil sie ganz konkret und für alle fassbar ist. wp: Die Architektur war in diesem Fall höchstens der vorgeschobene Anlass, aber sicher nicht der Hauptgrund, warum diese Unzufriedenheit, die sich ja über die sozialen Medien rasend schnell verbreitet hat, artikuliert wurde. Die Ursache für die generelle Unzufriedenheit waren nicht die Baupläne im Park, sondern die Unzufriedenheit mit der Politik. Das Bauvorhaben war nur der Zündfunken für die Proteste. ck: Die Art, in der sich die neuen sozialen Bewegungen im öffentlichen Raum artikulieren, ist nicht zuletzt ein ästhe tisches Phänomen. Das waren ja zumindest anfangs keine Barrikaden, sondern leichte Zeltarchitekturen, Temporäres, Strukturen, die man leicht bewegen kann. Könnte diese Ästhetik ansteckend wirken, vielleicht gerade dort, wo es um Staatstragendes geht? wp: Wichtig für mich ist immer die Gleichzeitigkeit der Systeme. Dass alles leicht und temporär aus Papier oder Karton gebaut werden soll, ist ein Traum. Dass alles betoniert werden soll, ist auch ein Traum, möglicherweise ein reaktionärer. Ich denke, dass die Gleichzeitigkeit und die Vernetzung der Systeme in der Architektur, wie in den sozialen Medien, noch wichtiger werden wird. Wie das geht, hat uns ja Cedric Price für seine Zeit vorgemacht. ck: Und in einem Interview, das wir hier im UmBau 20 abgedruckt haben, wurde vor der Nostalgie für die 1960er-Jahre
coNtrOL
23
gewarnt. Die Begriffe, die ich gerade verwendet habe, passen aber durchaus zu den Dingen, die Coop Himmelb(l)au in den 1960er-Jahren gemacht hat. wp: Ästhetisch haben wir uns ja auch durchgesetzt, aber den politischen Traum hat meine Generation verloren. ck: Ist heute zumindest euer Büro demokratisch organisiert? wp: Das ist schwierig. Die Verantwortung in meinem Büro trage letztendlich ich. Daher lautet mein Motto eher: »Jeder darf tun, was ich will«. Aber die letzte Entscheidung behalte ich mir vor. Das heißt aber nicht, dass Teamarbeit in meinem Atelier nicht gefordert ist. gh: Ich halte nichts davon, sich vorzumachen, dass man im Büro keine Hierarchien hat. Mir ist wichtig, dass jeder zur rechten und vereinbarten Zeit anständig bezahlt wird, dass es keine Ausbeutung gibt, und dass man mit Respekt miteinander umgeht. Teamarbeit hat per se noch nichts mit Demokratie zu tun; das ist auch eine postfordistische Standardform, die eine gewisse Produktivität bewirkt.
24
Christian Kühn Im Schatten der Pyramide Ein »Offenes Parlament« für Tirana Die Errichtung eines neuen Parlaments fällt oft in Perioden der Konsolidierung nach einer größeren historischen Zäsur. Das gilt auch für das Projekt eines neuen Parlamentsgebäudes für Albanien. Als 2007 der erste Wettbewerb dafür stattfand, hatte sich das Land gerade nach einer Transformationsphase stabilisiert, die dramatischer abgelaufen war als in den anderen Ländern des Ostblocks, zu dem Albanien streng genommen nur von 1948 bis 1968 gehörte. Nach 1945 zuerst an Jugoslawien, dann an der Sowjetunion orientiert, verließ das Land 1968 den Warschauer Pakt, ging ein enges Bündnis mit China ein, das bis 1978 dauerte, und verfolgte schließlich nach 1978 eine völlige Isolationspolitik, die erst nach dem Tod des Diktators Enver Hoxha 1985 gelockert wurde. An der Praxis des stalinistischen Terrorregimes änderte das freilich nichts: Noch Ende der 1980er-Jahre konnte in Albanien gehängt werden, wer ein falsches Gedicht veröffentlicht hatte. Die Entwicklung zur Demokratie war in Albanien von zahlreichen Krisen begleitet. Die Wirtschaft war de facto zusammengebrochen, Regeln für das private Bankwesen fehlten und ausländische Investitionen waren durch die grassierende Korruption behindert. Freie Medien waren nicht existent, weshalb die Kommunistische Partei bei den ersten demokratischen Wahlen 1991 noch einen Sieg erringen konnte. Erst die katastrophale Wirtschaftslage und die Massenflucht aus dem Land führten 1992 zu freien Wahlen, in denen die Kommunisten unterlagen. Im Jahr 1997 fiel das Land nach dem Platzen mehrerer Pyramidenspiele, in denen viele Menschen ihr Geld angelegt hatten, in eine Anarchie, zu deren Begleitumständen Schießereien im Parlament und politisch motivierte Morde zählten. Erst die Verhängung des Ausnahmezustands und eine Militärintervention von uno-Truppen konnten die Lage beruhigen. Zusätzlicher Druck entstand
deMoLitiOn
25
durch die Kosovo-Krise und die dadurch ausgelöste Flüchtlingswelle 1999, in deren Verlauf 300.000 Kosovo-Albaner im Land untergebracht werden mussten. Im selben Jahr konnte auf Initiative des deutschen Außenministers Joschka Fischer der Stabilitätspakt für Osteuropa ins Leben gerufen werden, an dem sich unter anderem die eu, die usa und Russland beteiligten. Die in diesem Pakt enthaltene Wirtschaftshilfe brachte der Region eine wirtschaftliche Erholung, von der auch Albanien profitierte, zuerst unter einer Mitte-links Koalition unter Führung der Sozialistischen Partei. Der Machtwechsel nach den Wahlen 2005 verlief ruhig und ohne die üblichen Vorwürfe der Wahlfälschungen und brachte eine Regierung der Demokratischen Partei unter Sali Berisha an die Macht. Die Errichtung eines neuen Parlamentsgebäudes sollte die erreichte demokratische Stabilisierung deutlich sichtbar machen. Ein Wettbewerb, bei dem es um Umbau und Erweiterung eines Verwaltungsbaus im Stil des Sozialistischen Realismus ging, fand 2007 statt. Der erste Preis ging an den Schweizer Mario Campi, der zweite an Coop Himmelb(l)au. Das Areal liegt direkt an der Hauptachse Tiranas, 500 Meter entfernt vom Skanderbeg-Platz, dem Zentrum der Stadt. Dort befindet sich auch das erste Parlamentsgebäude Albaniens aus den späten 1920er-Jahren, in dem heute das Kinderpuppentheater untergebracht ist. Im Bauarchiv der Stadt finden sich Pläne für ein Regierungsviertel an dieser Stelle, die der österreichische Architekt Walter Köhler (1899 – 1974) im Jahr 1927 ausgearbeitet hat. Auftraggeber war Ahmet Zogu, der 1925 Albanien zur Republik nach amerikanischem Vorbild erklärte und sich zum Präsidenten wählen ließ. De facto regierte Zogu aber diktatorisch über weit reichende Klientelbeziehungen, und krönte sich 1928 zum König. Das Land geriet unter seiner Herrschaft in zunehmende Abhängigkeit vom faschistischen Italien. Auf diese Phase geht ein Projekt für ein Parlamentsgebäude am Boulevard Mussolini aus dem Jahr 1931 zurück . Ausgeführt wurde ein neues, formal nicht unähnliches Parlamentsgebäude erst 1955 unter sowjet ischem Einfluss. Dort tagt – unter der aktuellen Adresse George-Bush-Straße – bis heute das Albanische Parlament. Adaptiert wurde nur der Plenarsaal, dessen Sitzreihen – eine Form, die in totalitären Systemen oft gewählt wird – 26
Walter Köhler Entwurf für das Regierungsviertel von Tirana 1927
Perspektive Parlament
Albanisches Parlament Tirana Florestano di Fausto Entwurf 1931
dicTatOr S. Luarasi und D. Vasilef Ausführungsprojekt 1955
durch eine in Kreisbögen organisierte Bestuhlung ersetzt wurden, die den klassischen Theatertypus zumindest andeutet. Nach dem neuerlichen Wahlsieg von Sali Berishas Demokratischer Partei 2009 entschied sich die Regierung dazu, statt der Erweiterung eines Bestandsbaus ein komplett neues Parla mentsgebäude zu errichten und lobte dafür einen Wettbewerb aus, den Coop Himmelb(l)au 2011 für sich entscheiden konnten. Vom Projekt aus dem Jahr 2007 übernommen ist die Idee des Plenarsaals: kreisförmige Sitzanordnung und ein hoher, leicht geneigter Konus als Abschluss und Geste nach oben. Dieser verglaste Konus ist von einem im Grundriss annähernd quadratischen Bürotrakt umgeben. An der nordwestlichen Ecke ist dieser Trakt aufgebrochen, um eine visuelle Verbindung zu einem zweiten, etwas niedrigeren Konus herzustellen, der die Eingangshalle markiert und durch seine Lage 27
am Hauptboulevard von Weitem sichtbar ist. Das Motiv ist jedenfalls einprägsam: Jože Pleˇcniks Entwurf für das slowe nische Parlament hat es sogar ohne Realisierung auf die 10 -Cent-Münze des Landes geschafft.
Kathedrale der Freiheit Jože Pleˇcnik Entwurf 1947
Für Coop Himmelb(l)au dürften eher Tatlins geneigter Turm für die 3. Internationale und die Lichtbrunnen Le Corbusiers als Referenzen gedient haben. Dem Projektnamen Open Parliament wird der Entwurf gerecht, indem er die Besucher über eine Freitreppe auf ein Terrassenniveau führt, von dem aus der Plenarsaal direkt einsichtig ist. Da der Verwaltungsbau auf nur vier Kernen aufgelagert ist und über dieser Terrasse zu schweben scheint, ist der Blick in den verglasten Konus aus allen Richtungen möglich. Die gefaltete Außenhaut des Verwaltungstrakts dient als vorgehängter Sonnenschutz, für den mehrere Varianten, von Stahlgewebe über eine Seilkon struktion bis zur Membrankonstruktion, untersucht wurden. Projekt Open Parliament 2011
Lage Projekt New Parliamentary Complex 2007
Projekt New Parliamentary Complex 2007
28
discRIMinAtIon
29
Grundriss Ebene 7
Grundriss Ebene 1
30 0
4
8
12
16
20
Level 1 | 1:500 Level 8 | 1:500
Schnitt
»Landscape Plaza«
Plenarsaal
0
4
8
12
16
20
Section A-A | 1:500
Büroräume »Urban Plaza«
Parkdeck Haupteingang Öffentliche Einganghalle
Modell Open Parliament 2011
31
dIVideD
In der Entwicklung von Coop Himmelb(l)au markiert das Projekt eine Phase, in der die Erfahrungen der bisher realisierten Großprojekte – von der bmw-Welt, dem Musée des Confluences bis zur Europäischen Zentralbank und zum Konferenzzentrum in Dalian – im Entwurf wirksam werden. Das Büro hat für sich einen formalen und technischen Apparat entwickelt, der es ihm erlaubt, dosiert und kalkuliert zu arbeiten, und bei Bedarf nach wie vor ins Irrationale zu kippen, das sich dann ohne weitere Erklärung im erzielten Effekt beweisen muss. Wie viel Irrationalität das Gehäuse eines Parlamentbetriebs verträgt, ist eine Frage für sich: Muss die Vernunft jede Gesetzgebung beherrschen, oder gibt es eine Politik der starken Emotionen, ohne die in Wahrheit kein demokratisches System funktioniert? Das Motiv der Doppeltrichters, das Coop Himmelb(l)au schon oft projektiert haben, widmen sie hier jedenfalls einem vernünftigen Zweck: Als große Sanduhr instrumentalisiert, soll es im Foyer die Zeit anzeigen, die der Regierung innerhalb der Legislaturperiode zur Umsetzung ihrer Vorhaben zur Verfügung steht. Für die Regierung von Sali Berisha ist diese Sanduhr zu schnell abgelaufen, um das Projekt noch realisieren zu können. Hauptgrund für die Verzögerung waren Proteste gegen den dafür notwendigen Abbruch eines bestehenden Gebäudes, des Museums und Mausoleums für den Diktator Enver Hoxha, das nach seinem Tod 1985 auf Initiative seiner Tochter, einer Architektin, errichtet wurde . Die Pyramide sei, so die Kritiker, Teil der Geschichte Albaniens und müsse daher als Mahnmal an die Vergangenheit erhalten bleiben. Auch die Sozialistische Partei sprach sich massiv gegen den Abbruch aus. Die politischen Hintergründe der Befürworter und Gegner dürften über die Frage des Denkmalschutzes hinausgehen: Trotz bekannt klingender ideologischer Bezeichnungen sind die Parteien Albaniens tendenziell Milieuparteien mit kulturhistorisch und geographisch bedingten Abgrenzungen. Viele der führenden Akteure hatten unter der Diktatur Enver Hoxhas offizielle Rollen – so etwa Sali Berisha als Leibarzt des Diktators – und auch jüngere Politiker sind zumindest in der Nomenklatura sozialisiert. Ein neues Parlament als Symbol für einen radikalen Neubeginn und die Beseitigung der Reste der Diktatur dürfte unter diesen Umständen für viele das Vorstellbare überschreiten. Coop Himmelb(l)au haben mit einer Überarbeitung 32
Modell Open Parliament 2011
Museum Enver Hoxha am Boulevard Die Helden der Nation
dOmiNanT
ihres Entwurfs reagiert, bei dem der Teil der Pyramide, der sich nicht auf dem Areal des Neubaus befindet, als funktionsloses Denkmal erhalten bleiben kann. Seit den Wahlen vom Juni 2013, bei denen die Sozialistische Partei unter dem ehemaligen Bürgermeister von Tirana, Edi Rama, die Mehrheit erlangte, ist das Projekt bis auf weiteres ad acta gelegt. Der Schatten der Pyramide Enver Hoxhas ist offenbar lang: Vielleicht braucht es nach 50 Jahren Diktatur und Anarchie gleich viel Zeit zum Verarbeiten und Vergessen. Der utopische Sprung nach vorne, wie ihn Coop Himmelb(l)au in ihrem Projekt vorgeschlagen haben, gehört freilich auch zum Wesen der Demokratie.
33
Christian Kühn | Harald Trapp Müde Monumente Anmerkungen zu einem Ausstellungskonzept Parlamente haben in der modernen Welt eine doppelte Funktion. Einerseits sind sie funktionale Orte der politischen Auseinandersetzung, Werkstätten der Gesetzgebung und Arenen für die Begegnung zwischen Regierung und Opposition. Andererseits sind sie symbolische Orte, an denen Macht und Würde des jeweiligen politischen Systems zum Ausdruck kommen sollen. Parlamentsbauten erzählen von der Geschichte und von den Utopien der Versammlungen, die sie beherbergen und sind damit Monumentalbauten im eigentlichen – vom lateinischen »monere«, also »erinnern« abgeleiteten – Sinn des Begriffs: Erinnerungsorte und Ermahnungsorte zugleich.
Collage zum Konzept Christian Kühn Juli 2013
34
Österreichischer Pavillon Venedig Zustand 1950
Wenn im österreichischen Pavillon bei der Architektur biennale 2014 das Parlament zum Thema gemacht wird, findet diese Ausstellung von Monumentalbauten selbst in einem Monument statt, dem denkmalgeschützten Bau von Josef Hoffmann aus dem Jahr 1934. Das Bauwerk repräsentiert einen österreichischen Staat, der zu diesem Zeitpunkt bereits auto ritär im System des Austrofaschismus regiert wurde. Hoffmanns erster Entwurf für einen österreichischen Pavillon datiert weit zurück ins Jahr 1913, also in die Zeit der k. u. k. Mon archie. Von diesem Entwurf sind 20 Jahre später die Bogen motive geblieben, die 1913 eine Loggia zum Kanal bilden soll ten und 1934 den Durchgang durch den Pavillon flankieren, halb Fassade, halb Element des Innenraums. Der skulpturale Schmuck der Portaleinfassungen, den Hoffmann für das Projekt 1934 vorgesehen hatte, reduzierte sich budgetbedingt auf ein Sgraffito auf dem hofseitigen Rahmen, das Menschen bei der Arbeit zeigte und als Reminis zenz auf den austrofaschistischen Ständestaat nach 1945 entfernt wurde. Knapp zehn Jahre später erhielt Josef Hoffmann Gelegenheit, den Pavillon an die Moderne heranzuführen. Im ursprünglichen Projekt war als hinterer Abschluss des Pavillons eine niedrige Mauer geplant, die jedoch nie ausgeführt wurde. Hoffmann protestierte gegen den Staketenzaun, den man stattdessen installiert hatte und konnte durchsetzen, dass 1938 eine Abschlussmauer errichtet wurde. Aus der offenen Situation wurde ein gut proportionierter, geschlossener Innenhof, dessen Wände mit denselben horizontalen Kanneluren im Putz überzogen waren wie die übrigen Fassaden. Auch der Belag des Hofs mit Betonplatten im Raster von rund 90 cm stammt aus dieser Zeit. Im Jahr 1954 erhielt Hoffmann den Auftrag zu einer Neugestaltung, die bewusst mit der Symmetrie der Anlage brach: Die kannelierte Hofmauer wurde abgerissen und der nach hinten erweiterte Hof durch eine glatte Mauer geschlossen, die im Grundriss einem Kreissegment folgt; linker Hand erhielt der Hof ein Flugdach aus Stahlbeton mit einer kreisrunden Öffnung für einen Baum. Ins Zentrum des Hofs setzte Hoffmann dem Zeitgeschmack entsprechend ein großes, nierenförmiges Wasserbecken. Exakt 20 Jahre nach seiner Errichtung im
elEcTioNs
Erweiterung 1954 Josef Hoffmann Grundriss und Schnitt
35
Ständestaat durfte der Pavillon nun für die Zweite Republik sprechen: Wir gehören dazu. Wir sind in der Nachkriegs moderne angekommen. Fast zeitgleich erfuhr auch das Parlamentsgebäude in Wien seine bisher größte bauliche Veränderung. Im Jahr 1945 bei Luftangriffen schwer beschädigt, wurde es von den Architekten Max Fellerer und Eugen Wörle restauriert und 1956 – ein Jahr nach der Wiedererlangung der völkerrechtlichen Unabhängigkeit Österreichs – seiner Bestimmung übergeben. Auch hier haben die Architekten – ähnlich wie Josef Hoffmann bei seinem Erweiterungsprojekt in Venedig – ein vorsichtiges Bekenntnis zur Moderne abgegeben. Während der Großteil der beschädigten Gebäudeteile rekonstruiert und nur in Details modernisiert wurde, entschloss man sich für das Herz des Parlaments – den Plenarsaal – zu einer modernen Gestaltung, die nur die gröbsten Vorgaben des alten Saals berücksichtigte. Die Genese dieses Projekts ist – wie Nott Caviezel in seinem Text auf Seite 142 darlegt – bei Weitem nicht so gut aufgearbeitet, wie es für die nun wieder anstehende Sanierung nötig wäre. Ohne diese Aufarbeitung wird der Denkmalschutz zu einer Gefahr für das Projekt: Er findet bei einem Monu mentalbau dort seine Grenze, wo die Erinnerung an die Geschichte einer Institution in Konflikt gerät mit der Ermahnung, ihre Utopien nicht zu vergessen. Wenn aus den Dokumenten hervorgeht, wie intensiv bis 1956 um die Gestaltung der Stirnwand des Saals gerungen wurde, und sich schließlich der aus Stahl getriebene Bundesadler gegen alle Vorschläge der Architekten durchsetzte, an dieser Stelle »das Volk« – auf Tapisserien oder als Skulpturen – sichtbar werden zu lassen, wird der Konflikt mit dem Denkmalschutz offensichtlich. Nach dessen Logik ist der Bundesadler als historisches Element unbedingt erhaltungswürdig. Aber kann er noch die aktuellen Utopien einer Demokratie repräsentieren? Unser ursprünglicher Plan, die Frage der angemessenen Repräsentation demokratischer Institutionen anhand des gerade laufenden Verfahrens für die Sanierung des Österreichischen Parlamentsgebäudes zu behandeln und dessen Ergebnisse im Kontext internationaler Beispiele zu präsentieren, ließ sich aufgrund von Terminverschiebungen im Verfahren nicht realisieren. Geblieben sind die Fragen, die uns in der Vorbereitung der Ausstellung beschäftigten: 36
Wie spricht Monumentalarchitektur? Welche Mittel stehen ihr zur Verfügung? An welche Adressaten richtet sie sich? Und wie könnten – über 200 Jahre nach der Unabhängigkeitserklä rung der usa und der Französischen Revolution – die Räume einer fortgeschrittenen Demokratie aussehen, die nicht mehr im Monumentalen Halt suchen muss? Das Parlament der Parlamente Eine Recherche über die Parlamentsbauten der Welt erschien uns als notwendiger Einstieg in die Thematik. Schon die oberflächliche Analyse ihrer Dimension, Geometrie und städtebaulichen Lage ergibt ein vielstimmiges Bild von Verwandtschaften. Die Recherche gestaltete sich schwieriger als erwartet, da für die Mehrzahl der Objekte kaum Planmaterial ver fügbar war. In Lehrveranstaltungen an der tu Wien machte sich einer Gruppe von 60 Studierenden über mehrere Monate an die mühsame Aufgabe, aus öffentlich zugänglichem Bildund Planmaterial möglichst präzise Informationen zu Form, innerer Organisation und städtebaulicher Lage zu ermitteln. Das Ergebnis waren dreidimensionale cad-Modelle und Lage pläne in einheitlichem Maßstab, die als Grundlage für den Modellbau und die Publikation verwendet wurden. Die Suche nach der geeigneten Abstraktion der Darstellung war eine wesentliche Problemstellung. Bei allen Unschärfen, die bei einer solchen Methode unvermeidlich sind, konnte auf diese Weise zum ersten Mal eine vergleichbare Zusammenstellung über die nationalen Parlamentsbauten der Welt erstellt werden. Wenn Bruno Latour im »Parlament der Dinge« fordert, auch nicht-menschlichen Wesen eine Stimme zu geben, muss das auch für die Parlamente als funktionelle und symbolische Orte gelten. Zu einem Parlament der Parlamente zusammengeführt, berichten sie über ihre architektonisch-formalen Beziehungen. Säulen, Giebel und Kuppeln sind bis in die Gegenwart beliebte Elemente. Die Formensprache des Klassizismus war offenbar für die Mehrheit der Parlamente maß gebend, was umso erstaunlicher ist, als fast zwei Drittel der derzeit genutzten Gebäude aus den letzten 50 Jahren stammen. Die Rückkoppelungen auszuloten, die hier am Werk sind, würde tief in die Thematik kultureller Hegemonien, (post)
eLITes
37
Probehängung November 2013
kolonialer Strukturen und ihrer langsamen Aushöhlung führen. Für die Ausstellung haben wir uns darauf beschränkt, die Hüllen der Parlamentsbauten in einer einheitlichen Form als Modelle im Maßstab 1:500 zu präsentieren. Um 90 Grad gekippt und im Raster an die Wand appliziert, verlieren sie ihre gravitätische Monumentalität. In dieser Position verleiht ihnen ihre Symmetrie etwas Maskenhaftes, und in Summe werden sie zu einem Ornament, das aus den Wänden zu wachsen scheint. Der Raum zwischen den Wänden bleibt frei und steht für Veranstaltungen zur Verfügung, unter anderem für eine gemeinsam mit den Herausgebern der italienischen Architekturzeitschrift San Rocco organisierte Diskussionsreihe. Vor dem Hintergrund des Plenums der Parlamente bietet sie Gelegenheit, Meinungen zum Verhältnis von Raum und Politik auszutauschen und die durch die Ausstellung ange regte Reflexion zu erweitern. Die Ordnung, in der die Parlamente ihren Platz an der Wand finden, hat uns lange beschäftigt. Letztlich blieb es bei der alphabetischen Reihung nach den Anfangsbuchstaben der Ländercodes, die eine morphologisch zufällige Verteilung ergab. Innerhalb dieser Ordnung wurden die Modelle nach ästhetischen Gesichtspunkten geringfügig rearrangiert. 38
Eine Tendenz in Richtung Entropie zeigen auch die »Länderfahnen«, die sich zur Markierung auf der stirnseitig im Raum angebrachten Weltkarte befinden und als Leitsujet für die visuelle Kommunikation der Ausstellung dienten: Was auf den ersten Blick wie eine Nationalflagge wirkt, ist in Wahrheit ein Diagramm der Farbanteile auf der jeweiligen Fahne. Integraler Teil der Ausstellung ist – so wie die »Fahnen« – der von buero bauer grafisch gestaltete Katalog. Er ist wie ein Farbfächer konzipiert und führt zu jedem Parlament Informationen zu den Ländern und ihren Parlamenten zusammen. Neben einem kurzen Text, einer Axonometrie des Gebäudes und den Basisdaten zum Projekt finden sich hier auch ein Lageplan und statistische Informationen zum jeweiligen Land. Als Fächer erlaubt er dem Leser, beliebige eigene Typologien auszufalten, nach Jahren, Stilen oder Kontinenten. Stimmen aus dem Twittergarten Als Gegenpol zum architektonischen Pathos im Hauptraum des Pavillons befindet sich im Hof ein aleatorisch organisierter Freiraum, der den Besuchern zuerst als grüne Wand erscheint und sie dann in einen Kokon aus Blättern einhüllt. Der Beitrag der Landschaftsarchitekten Maria Auböck und János Kárász führt die Arbeit Josef Hoffmanns an der Modernisierung des Pavillons weiter: Der quadratische Betonraster wird aufgebrochen, Pflanzen überwinden die Mauer und siedeln sich hier in einem Muster an, das sich aus unterschiedlichen Dichten und Durchblicken entwickelt. Die für die Biennale ausgewählten Gehölze kommen aus aller Welt, sind teils schon in verschiedenen Ländern heimisch, teils gelten sie noch als interessante Exoten: Parrotia persica, Punica granatum, Acer palmatum viridis »Dissectum«, Lagerstroemia indica, Nerium oleander, Cercis siliquastrum, Gleditisa triacanthos »Skyline«, Acer buergerianum. Für Auböck und Kárász ist dieser Garten eine Metapher für aktuelle Formen der Willens- und Meinungsbildung, die sich schwarmartig formieren – atmosphärisch aufgeladen, zeitlich begrenzt, im Widerspruch wachsend: »Stellen Parlamente den gesellschaftlichen Raum für ein fest verankertes Ritual dar, entfaltet sich hier ein floating space,
EmPIRe
39
der erst durch die Bewegung des eindringenden Besuchers definiert wird. Dieses Erleben in Bewegung ist ein Kernthema der Landschaftsgestaltung, das Gartenkünstler seit Jahr hunderten beschäftigt. Eine Brücke zur Geschichte der Landschaftsarchitektur bilden die Gärten der Aufklärung im 18. Jahrhundert, denen dieses Phänomen der Wahrnehmung durch Bewegung zugrunde liegt. Das Wachstum der Bäume ergänzt diese kinetische Erfahrung durch eine extrem ver langsamte Bewegung. So entsteht ein befristetes Gehäuse mit einem anderen Ordnungsprinzip – geprägt durch dichte Nähe, durch Licht und Schatten, durch laute und leise Passagen. Es bietet sich eine Suggestion des Sich-verlierens: ein anregender Ort zum Nachdenken, Verweilen, zur Pflege der Begegnung. Was wir sehen und betreten ist die Aufhebung des Ortsüblichen, des vermeintlich Authentischen. Die großen Bodenplatten des Hofes weichen den wuchernden jungen Bäumen, das formale Gefüge scheint leicht gekippt, überformt, wird unbestimmter.« Integriert in diesen Garten ist eine interaktive akustische Installation von Kollektiv|Rauschen, die das Konzept des aleatorischen Raums in einem noch flüchtigeren Medium fortsetzt. Sie beschäftigt sich mit dem politischen Diskurs in sozialen Medien wie Twitter, Facebook und anderen Netz werken. Der Garten wird zum Trägermedium für Diskussionen, Gespräche, Demonstrationen und Proteste, die auch in einen direkten Dialog mit dem Pavillon als einem Repräsentanten der Staatsmacht treten: »Exzerpte, Textfetzen, Hashtags, Themen, Topics, Banalit äten aus dem www wurden von uns kompiliert und von native speakern eingesprochen. Diese Aufnahmen bilden eine Grundlage für unsere Komposition. Ergänzt werden sie durch Audiosamples, Protestgeheul, Sprechchöre, Demonstrationslärm, die in direkter »Kommunikation« mit der »demokra tischen« Repräsentation des Haupthauses stehen, darauf reagieren und teilweise vehement dagegen protestieren. Wir nähern uns dem Garten auch als Phänomen und Symbol an, indem wir kompositorisch von Naturphänomenen wie Regen, Feuer und Vogelschwärmen ausgehen. Aus dieser Wall of Sound schälen sich die akustischen Äußerungen der unterschied lichen Protestbewegungen heraus. Ein wichtiger Bestandteil dieser Komposition ist die interaktive Ebene – über den 40
Twitter-Account des österreichischen Pavillons kann sich der Besucher live ins Geschehen einmischen. Mit Hilfe eines text-to-speech-Programmes wird der Tweet in gesprochene Sprache verwandelt.« Technisch nutzt die Installation eine Kombination aus gewöhnlichen und parametrischen (Richt-)Lautsprechern, um die Besucher in die Auseinandersetzung hineinzuziehen. Je weiter sie in den Garten vordringen, desto direkter sind sie einzelnen Stimmen ausgesetzt. Kollektiv|Rauschen sieht sich mit dieser Installation als neutraler Vermittler, der nicht kommentiert und keine Stellung bezieht. Die Installation ist ein Versuch der Darstellung. Ihre Position im Klangfeld der ungeduldigen Massen müssen die Besucher selbst bestimmen. Im Bilderstrom Während die 196 Parlamente im Hauptraum der Ausstellung beinahe wie eine Sammlung von Totenmasken gezeigt werden, geht es in den beiden Nebenräumen um die Komplexität, die sich entfaltet, sobald man ein Projekt im Kontext seiner Geschichte genauer betrachtet. Die Auswahl der beiden Projekte basiert auf einer Ähnlichkeit der Konstellation: Das Parlamentsgebäude in Wien, entworfen vom Dänen Theophil Hansen, und das Projekt für das Parlament Albaniens in Tiran, entworfen vom Österreicher Wolf D. Prix, Coop Himmelb(l)au. Zwei »ausländische« Star-Architekten sind hier am Werk, die nationale Repräsentationsbauten schaffen. Im Falle von Coop Himmelb(l)au wird aus Gründen der Ver gleichbarkeit ein ausgeführtes Projekt gezeigt, das Konferenzzentrum in Dalian, das von der Dimension her das Wiener Parlament problemlos in seiner Hülle unterbringen könnte. Präsentiert werden beide Baugeschichten in Form von Bilderströmen, die in historischen und aktuellen Sequenzen Hintergründe zu den Projekten liefern: Vorgängerbauten, Pläne, Skizzen und Modelle, Eindrücke von den Baustellen. Dazu kommen historische Momente, an denen die Monu mentalbauten über sich hinauswachsen, wie etwa das Parlament in Wien bei der Ausrufung der ersten Republik, bei der es sich präsentiert wie eine Inszenierung der berühmten Illustration zu Hobbes Leviathan.
EtHnICitY
41
Ausrufung der Republik Wien 1918
Der aktuelle Zustand des Wiener Parlaments wird in einer filmischen Sequenz von Vera Kumer vorgestellt, die mit Studierenden der tu Wien eine anatomische Untersuchung des Hansen’ schen Baus unternommen hat: »Nach der Auflösung des Raumes während der Aufnahme über die schrittweise Bewegung des Messers (der Kamera) durch den Körper (den Raum) werden die Medien Film und Fotografie anschließend durch die Überlagerung der Schnittbilder entlang jener Achsen verbunden, die zuvor über die Bewegung durch den Raum definiert wurden. Die Bildkom position der einzelnen Kader besteht aus mehreren Teilen einer menschlichen Perspektive. Pro Schritt im Raum werden mehrere Blickwinkel in einem Einzelbild zusammengefügt. Die Bildkomposition entspricht hier der sensorischen und kognitiven Perzeption des Menschen, der einen Raum durchschreitet und dabei die räumlichen Zusammenhänge und die Morphologie des Raumes bildlich erfährt. Das gezeigte Video stellt eine filmische Bestandsaufnahme des Wiener Parlaments zwischen Juni und Oktober 2013 dar, die den Betrachter sequenziell entlang klar definierter Achsen führt, die aus der inneren Morphologie des Gebäudes und dessen Raumabfolgen abgeleitet wurden.« Präsentiert wird das Material auf mehreren parallel bespielten Bildschirmen, die über den Köpfen der Besucher installiert sind. Ihre Kuppelformen verweisen auf die vielen ähnlichen Motive, die sich im Parlament der Parlamente im 42
Nebenraum finden. Monitore wechseln sich in diesen Installationen ab mit Spiegeln, die den Besuchern ihr eigenes Bild entgegenhalten, während sich die monumentalen Formen im Strom der Bilder auflösen. In dieser Spiegelung, wie in der Eingriffsmöglichkeit in die Klanginstallation, werden schließlich die Repräsentierten präsent und müssen sich fragen, ob Architektur noch dazu taugt, ihr Repräsentiertsein zu repräsentieren. Die Antwort, so darf man vermuten, hängt nicht allein von den Objekten ab, sondern von der subjektiven Einbildungskraft. Ein architek tonisches Element wie ein Bogen kann einfach ein Bogen sein. Für den Dichter Heinrich von Kleist war ein Bogen, wie in einem Brief an seine Verlobte aus dem Jahr 1800 nachzulesen ist, mehr: »Warum dachte ich, sinkt wohl das Gewölbe nicht ein, da es doch keine Stütze hat? Es steht, antwortete ich, weil alle Steine aufeinmal einstürzen wollen – und ich zog aus diesem Gedanken einen unbeschreiblichen erquickenden Trost, der mir bis zu dem entscheidenden Augenblicke immer mit der Hoffnung zur Seite stand, daß auch ich mich halten würde, wenn Alles mich sinken läßt.« Die Wände des Pavillons mit den Parlamentsmodellen, die Videoobjekte an den Decken der Nebenräume und der aufgebrochene und bepflanzte Boden im Hof: Die den drei Dimensionen entsprechenden Grundelemente der Architektur werden zu Ausstellungsflächen, zwischen denen sich ein neuer Raum aufspannt, das Plenum der Orte der Macht.
expEndiTuRes
43
Andreas Balon Monument | Moment Fotoessay
façAde
45
46
foUnDatIon
48
gENEriC
49
gOveRnmeNt
51
52
hApPInesS
53
54
hiEraRchy
55
56
homELess
58
iDeoloGy
59
60
indePendEnCe
61
inTeRim
InVeStOrs
LandmaRk
laWmaKerS
70
liQuId dEmOcrAcy
71
lIOnS
Alfred J. Noll Repräsentation der Repräsentation?
1 Seit Immanuel Kant (1724 – 1804) gehen wir davon aus, dass unsere Vorstellung der Dinge, wie sie uns gegeben werden, sich nicht nach diesen Dingen an sich selbst richtet, son dern dass sich diese Gegenstände vielmehr als Erscheinungen nach unserer Vorstellungsart richten. Repräsentation ist also nicht abbildende Reproduktion, sondern Konstruktion oder Schöpfung|Bildung| Formung, die stets der Vermittlung durch Vorstellungen bedarf, sei es durch innere Bilder oder durch (objektivierte) symbolische Formen, und sie ist zu gleich Einbildung (Imagination) von als existierend ange nommenen Sachverhalten, die anders als »präsentiert« situativ bedeutungslos wären. In Repräsentationen bilden wir Wissen, und insofern enthält Repräsent ation immer Elemente von Selbstpräsentation.
I. Es ist gewiss misslich und stilistisch wenig elegant, sich zunächst der Bedeutung des Wortes »Repräsentation« versichern zu müssen, aber bekanntlich changiert der Begriff je nach seiner Verwendung nicht unerheblich. Repräsentation fungiert als Schlüsselbegriff sowohl in der Politikwissenschaft, in der Staatslehre, in der Theologie als auch in der Ästhetik, ist dort aber mit je unterschiedlichen Traditionen und Konnota tionen verbunden. Wir wollen uns für unseren Zusammenhang weitestgehend frei halten von den fachlichen Spezifika und formulieren hier – dem allgemeinen Sprachgebrauch entlang – recht allgemein: Repräsentation macht ein reales externes Etwas durch Akte des Bewusstseins präsent, wobei mit gedacht ist, dass (Re-)Präsentationen immer die Form von Vorstellungen haben und stets durch Zeichen, Symbole und Begriffe vermittelt sind. Repräsentationen leisten Stellvertretung in Vorstellungen und|oder Darstellungen; etwas repräsentieren heißt etwas vergegenwärtigen, Repräsentation macht etwas präsent, das abwesend ist bzw. in der Weise des Repräsentiertseins in der Außenwelt (so) nicht existiert.1 Auf Einzelheiten kommt es hier nicht an, es gibt durchaus verschiedene Repräsentationslehren. Das ist so, weil die Art und Weise der Repräsentation völlig abhängt von den Vorstellungen, die man sich von ihr macht, etwa nach der Art: Wenn die Demokratie abwesend ist, ist sie nicht gegenwärtig; sie wird nur im Parlament vergegenwärtigt gedacht, vorge stellt, unterstellt. Eine solche Vorstellung kann sich aufdrängen, sie kann von einer unbezweifelten Überlieferung oder allgemeinen Überzeugung gesetzt oder institutionalisiert sein – nichts hindert aber, sie zu leugnen, die Gruppenmeinung zu verwerfen oder ungläubig zu sein. »Repräsentation« ist nicht selbständig existenziell (sie ist nicht »ontisch«), sie hat kein feststehendes und feststellbares Wesen, sie ist bloßer Gegenstand von Vorstellungen.
74
2 Zum Thema (wenn auch zeitgebunden) bis heute instruktiv: vid. Gerhard Leibholz, Das Wesen der Repräsentation unter besonderer Berücksichtigung des Repräsentativsystems. Ein Beitrag zur allgemeinen Staats- und Verfassungs lehre (Berlin: Walter de Gruyter, 1929).
Die titelgebende Frage nach der »Repräsentation der Repräsentation« geht davon aus, dass sich in der parlament arischen Demokratie politische Repräsentation realisiert, also eben jene Vergegenwärtigung des abwesenden Repräsentierten (des als demokratischer Souverän gedachten »Volkes«) durch den bzw. im Repräsentanten (Abgeordneten) vor dem beobachtenden Dritten und die dadurch begründete verbindliche Handlungsbefugnis des Repräsentanten für den Repräsentierten. Entscheidend ist dabei, dass der repräsent ative Vorgang vom Dritten (dem regelmäßig die Angelobung obliegt) als solcher erkannt wird und weder Repräsentierter noch Repräsentant sich ausdrücklich gegen diese Annahme wenden. Instrumente, mit welcher unsere Verfassung das Prinzip der Repräsentation de jure realisiert, sind die Teilhabe aller an der Bestellung der Repräsentanten in Form von allgemeinen und gleichen Wahlen, die Darstellung einer nationalen Einheit (Nationalrepräsentation), oder auch die Ungebundenheit des Mandats und Gewissensbindung des Repräsentanten.2 In einer zunächst ganz anders anmutenden Weise ist von Repräsentation die Rede, wenn wir danach fragen, ob sich das gerade skizzierte demokratische Repräsentativsystem durch bauliche Artefakte repräsentieren lässt. Sicherlich werden wir diese Frage umstandslos bejahen können, wenn wir der lateinischen Wortbedeutung folgend etwa einem Parlament oder einem Rathaus ein »Wieder gegenwärtig machen«, ein »Sich darbieten«, eine Vergegenwärtigung und darum insbesondere eine »Verkörperung« repräsentativer Tätigkeiten von Volksvertretern ablesen. Den Begriff der Repräsentation aber so zu verwenden hieße, ihn vorschnell einer Eigentümlichkeit berauben, denn eigentlich findet dadurch eine Identitätssetzung statt, bei der sich die Beziehung zwischen Darstellendem (dem Gebäude) und Dargestelltem (das Tätigsein der Volksvertreter) in der bloß gegenständ lichen phänomenalen Reproduktion erschöpft; beide »meinen« dasselbe: jenes (das Gebäude) weist nur auf jene (die Volks vertreter) hin. Die Frage nach der »Repräsentation der Repräsentation« zielt freilich wesentlich darauf ab, zu erkunden, ob sich die Spezifik politischer Repräsentation in einer bestimmten Eigentümlichkeit der Baulichkeit repräsentiert.
MaJoRITy
75
3 vid. Karl Marx, »Der 18. Brunaire des Louis Bonaparte«, in: mew 8 (Berlin: Dietz, 1960) S. 173: » (…) der parlamentarische Kretinismus, der die Ange steckten in eine eingebildete Welt festbannt und ihnen allen Sinn, alle Erinnerung, alles Verständnis für die rauhe Außenwelt raubt…«. In der gegenwärtigen politischen Debatte ist es vornehmlich Jacques Rancière, der die Theatralität im politischen Denken betont; vid. dazu jüngst Benjamin Wihstutz, »Der Streit um die Bühne. Theatralität im politischen Denken von Jacques Rancière«, in: M. Doll, O. Kohns (Hg.), Die imaginäre Dimension der Politik (München: Fink, 2014) S. 229 ff.
II. Das Parlament, zunächst verstanden als politische Institution, lässt sich historisch als die Konstitution jenes Ortes beschreiben, an dem die geregelte Ausübung der mit der Staatsange hörigkeit verbundenen Rechte stattfinden kann. Um einen Staat zu bilden, braucht es einen juristischen Raum (verstanden als Gesamtheit von Bürgern, die durch Rechte und Pflichten mit dem Staat und untereinander verbunden sind), und es benötigt einen Ort des organisierten Konsenses bzw. einen Ort eines geregelten Dissenses. Der politische Witz des Parlaments liegt in seiner Qualität als sozialer und symbolischer Institution. Wir alle wissen, dass im Parlament der gesellschaftliche Konsens nicht hergestellt und dass der in der Gesellschaft bestehende Dissens nicht adäquat zum Ausdruck gebracht wird – aber das Parlament könnte doch immerhin der Ort sein, an dem dies geschieht. Das Parlament ist eine politische Institution. Unser Leben endet, die Institution besteht weiter (zumindest im Normalfall). Institutionen sind organisierte Bereiche des Vertrauenswürdigen; sie organisieren Vertrauen, sie schaffen einen orga nisierten Glauben an eine kollektive Fiktion, die wiederum von diesem Glauben als real anerkannt wird und eben dadurch (!) real wird. Vom Parlament zu sagen, es sei eine kollektive Fiktion, besagt einerseits, dass es ein Parlament mit den skizzierten Funktionen gibt, aber es besagt auch, dass es nicht so existiert, wie man glaubt. Natürlich ist das Parlament seit dem 19. Jahrhundert auch ein Ort, an dem die Kämpfe zwischen Gruppen, Interessen oder Klassen geregelt ablaufen (parlamentarische Auseinandersetzung sind in hohem Grad »organisiert«), und diese Form des »Kampfes« hat zur Folge, dass alle Konflikte außerhalb des Parlaments schnell mit dem Stigma des Halbkriminellen versehen werden (die öffentliche Auseinandersetzung um das »Streikrecht« oder die apo sind schöne Beispiele dafür). Das aber ist eben nur die eine Seite der Wirklichkeit. Schon Karl Marx (1818 –1883) hat diese »Parlament arisierung« des politischen Lebens zutreffend mit dem Theater verglichen: ein kollektives Trugbild, dem die Bürger erliegen, gleichsam ein Schattentheater, das die eigentlichen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen verdeckt.3 Es ist ein Zeichen der Zeit, dass wir uns meist nicht über die Inhalte parlamentarischer 76
Diskussionen ereifern, sondern die grottenschlechte Auf führung beklagen. Bei aller Vehemenz aber, mit der man das Parlament denunziert, zeigt sich doch in der Realität, dass es ein Ver trauen in diese Institution gibt. Das Parlament als Institution – ist es erst einmal organisiert – funktioniert wie ein Mechanis mus, und in der Rede über das Parlament versammeln sich deshalb Meinungen und Behauptungen, die wie regelmäßige, repetitive, konstante, automatische Prozesse anmuten. Das Parlament, verstanden als Parlamentsgebäude, ist das petri fizierte Ergebnis dieses sozialen Automatismus. III. Nun sind die unberechtigten (aber auch die berechtigten) Illusionen des 19. Jahrhunderts verdampft (das Fernsehen ist die Ersatzform des Parlaments geworden); der politische Raum hat sich definitiv verschoben. Das Parlament war gedacht als der juristisch konstituierte und juristisch kontrol lierte Raum, in dem die gesellschaftlich-politischen Konflikte thematisiert, ausgetragen und geregelt werden (sollen),
MaRgiNalisaTion
sodass die offizielle Politik genau das wäre, was im Parlament zur Sprache kommt. Dem lag die Vorstellung zugrunde, dass der Bürger im modernen Sinn des Wortes ein Recht auf Teil nahme an dem politischen Spiel hat (womit das allgemeine »Wahlrecht« postuliert ist), und dass er in gewissem Sinn auch die Pflicht hat, am politischen Spiel teilzunehmen (daraus resultierte ehedem die »Wahlpflicht«, die zwischenzeitig fast überall abgeschafft wurde). Die Teilnahme am politischen Spiel hatte freilich seit jeher Voraussetzungen, durch die die Teilnahmemöglichkeiten an diesem Spiel beschränkt werden. Es ist durchaus zweifelhaft, ob der Parlamentarismus demokratische Teilhabe (um eine euphemistische Vokabel zu verwenden) tatsächlich erweitert hat – viele Indizien sprechen eher dafür, anzunehmen, dass zwar die Zusammensetzung der politischen Eliten sich über die Zeit gewandelt hat, dass es aber immer noch ein typisches Merkmal des politischen Raums ist, nur von einigen wenigen bevölkert zu werden, und dass die Schritte und das 77
4 Pierre Bourdieu, Über den Staat. Übersetzt von H. Brühmann, P. Willim (Berlin: Suhrkamp, 2014), S. 617. 5 ibid., S. 621.
Getöne der wenigen, ihre Bewegungen und ihre Entschei dungen in diesem Raum weitestgehend losgelöst von den Vorstellungen der Bevölkerung erfolgen. Noch skeptischer wird man die Möglichkeiten beurteilen, dass es in naher Zukunft zu einer qualitativ oder auch nur quantitativ erweiterten Teilnahme der Bevölkerung an den Bewegungen im politischen Raum kommen wird. Dem Parlamentarismus selbst und seiner willkürlichen Definition des Parlamentarismus sind seine Teilnahmebeschränkungen immer schon inhärent, und mit Pierre Bourdieu (1930 – 2002) können wir sagen, dass das Spiel schon gelaufen ist, sobald es als solches definiert ist 4. Erst wenn man sich dies klarmacht, kann man die vielfältigen (und nicht selten überaus einfältigen) Versuche verstehen, das »Volk« in das (parlamentarisch-politische) Spiel hineinzuziehen. Es sind allesamt (untaugliche) Versuche, wenn man danach trachtet,durch Fernsehsendungen wie etwa »Hohes Haus« oder »Tage der Offenen Tür« im Parlament selbst oder auch durch »Parlamentsführungen« die Teilhabe der Bürger am Parlamentarismus oder gar deren »Sinn für Staatlichkeit« (Hanno Rauterberg) zu erhöhen – allzu offensichtlich ist, dass diese kosmetischen und|oder spektakelhaften Anstrengungen nicht wirklich dazu führen (können), das Volk in das parlamentarische Spiel eintreten zu lassen, gar nicht davon zu reden, dass es auf diese Art nicht gelingt, dass das Volk an der Sache Gefallen und Geschmack an der politischen Illusion findet. »Wenn Sie nicht ein Minimum an Chancen in einem Spiel haben, spielen Sie nicht. Man braucht ein Mindestmaß an Chancen im Spiel, um Lust am Spielen zu haben« 5. Der Parlamentarismus gibt uns diese Chance nicht, also spielen wir nicht mit. Für unseren Zusammenhang sind zwei Aspekte dieser Skizze von näherem Interesse: Parlamente als herausragende Bauwerke geben der politischen Gemeinschaft gleichzeitig das pathetische Versprechen wie die scheinbare Selbstvergewisserung, dass sich hier eine »Maschine« in monumentaler Größe realisiert hat, die dafür sorgt, die in der Verfassungsurkunde de jure versprochene Republik auch de facto tag täglich Wirklichkeit werden zu lassen. Der hohe Symbolgehalt des Bauwerks resultiert sowohl aus der vereinbarten »Heiligkeit« des Versprechens wie aus der Ungewissheit darüber, ob man dieses Versprechen auch einlösen kann. 78
Gerade weil der Parlamentarismus historisch eine sich stets dynamisch wandelnde Antwort gibt auf Fragen der Art: »Wieviel muss man dem Volk geben, damit sie die Herrschenden in Ruhe lassen?«, »Reicht es, das Volk ›teilnehmen‹ zu lassen, damit die Herrschenden von den einfachen Leuten in Ruhe gelassen werden?«, genau deswegen muss ein Parlament als Symbol des Staates jene außerordentliche Macht zum Ausdruck bringen, die eine geordnete Welt hervorbringen kann, ohne notwendigerweise Befehle zu geben und ohne ständig Zwang auszuüben. Natürlich weiß man, dass ein Symbol, so groß seine bauliche und historische Kraft auch sein mag, als solches nicht imstande ist, politische Wandlungen zu bewerkstelligen (und vielleicht sollte man es deshalb von vornherein unterlassen, den damit verbundenen Avancen entsprechen zu wollen); aber gerade weil man das weiß, mutet es zunächst gar nicht erstaunlich an, dass in fast allen europäischen Staaten parla mentarische Monumentalbaukunst bewahrt wurde und wird, die ihre Wurzeln in Gesellschaftsordnungen hat, in denen Macht nicht demokratisch-repräsentativ, sondern konstitutio 6 Heinrich Klotz, »Ikonologie einer Hauptstadt – Bonner Staats architektur«, in: Martin Warnke (Hg.), Politische Architektur in Europa vom Mittelalter bis heute. Re- präsentation und Gemeinschaft (Köln: DuMont, 1984), S. 399 ff., hier S. 400. 7 vid. dazu Jörg Stabenow, Eine kaiserliche Residenz als republikanisches Staatssymbol: der Hradschin in Prag, in: Werner Telesko et al. (Hg.), Die Wiener Hofburg und der Residenzbau in Mittel europa im 19. Jahrhundert. Monarchische Repräsen tation zwischen Ideal und Wirklichkeit (Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2010) S. 205 ff.
megAlOmaNIaC
nell ausgeübt wurde. »Im Bereich ästhetischer Repräsentation wirken die Herrschaftsformen weiter, die die politische Repräsentation der ersten Demokratien gerade nicht wahrhaben wollten«6. Und wo in bewusster Übernahme überkommenen Baubestandes versucht wurde, das Vorhandene demokratisch »aufzuladen« und solcherart eine Neukodierung des Baues zu versuchen, da blieb es letztlich bei einer nationalstaatlichen Aneignung von bestehenden Monumentalbauten, wie etwa bei der Prager Burg 7, ohne dass man dabei freilich der Gefahr der Musealisierung entkommen wäre. Damit wird ein »ästhetische Rätsel« angesprochen: Wa rum findet man sich in der repräsentativen Demokratie damit ab, sich baulich von anachronistischen Monumentalbau werken repräsentieren zu lassen? Dieses Rätsel löst sich, wenn man politisch den Parlamentarismus als notorisch unein gelöstes Versprechen erkennt und wenn man überdies davon ausgeht, dass es den politischen Repräsentanten in der parlamentarischen Demokratie durchwegs an der Zuversicht fehlt, 79
8 vid. dazu auch Alfred J. Noll, »(Re-)Präsenta tionsleistungen des Baulichen«, in: ögfa (Hg.), UmBau 25: Architektur im Ausverkauf (Salzburg: Anton Pustet, 2010), S. 84 ff. 9 vid. dazu grundlegend Stuart Hall, »Das Spektakel des ›Anderen‹«, in: J. Koivisto, A. Merkens (Hg.), in: ders., Ideologie – Iden- tit ät – Repräsentation. (= Ausgewählte Schrif- ten 4), (Hamburg : Argument, 2004), S. 108 ff.
durch ihr Wirken und Werken das inhärente Versprechen auf Teilhabe des Volkes realisieren zu können. Schon das österreichische Bürgertum im letzten Drittel des vorvorigen Jahrhunderts wünschte sich nichts sehnlicher, als dass Kaiser Franz Josef doch das Parlament betreten und einweihen solle – und während weltgeschichtlich auf der Tagesordnung stand, wie man sich rasch der unnötigen Monarchen ent ledigen könnte, und sie manchmal um einen Kopf kürzer machte oder ins Exil trieb, da war man in Österreich darüber beleidigt, dass der Kaiser gerade einmal den Rohbau besichtigte, alsdann aber in der Hofburg sitzen blieb und sich nicht weiter um das Parlament bekümmerte. Bis heute geben unsere Abgeordneten sich unreflektiert damit zufrieden, dass Franz Joseph, in dem krönenden Tympanon über dem Zentralportikus des Parlamentsgebäudes dargestellt als römischer Imperator, die Kronländer mit bittender Geste dazu einlädt, gemeinsam mit ihm zu regieren – angesichts des tatsächlichen Geschichtsverlaufs eine nachgerade lächerliche Allegorie. Wie auch immer: Gebäude und Objekte repräsentieren nicht von allein, sondern ihnen kann eine repräsentative Funktion und eine repräsentative Macht nur dann zugeschrieben werden, wenn sie in den Zusammenhang von polit ischer Macht, Rechtsanspruch und Ästhetik eingebunden sind.8 Um den genauen Stellenwert und die Funktion der jeweiligen Repräsentationsleistung eines Gebäudes auszuloten, müsste man die vielfältigen Verbindungen von Repräsentation, Differenz und Macht ausloten. Die Macht der Repräsentation besteht darin, zu kennzeichnen, zuzuweisen und zu klassifizieren, es geht immer um symbolische Macht, um eine rituali sierte Form des Ausschlusses. Dabei ist Macht nicht nur im Sinne physischen Zwangs oder ökonomischer oder geschlechtlicher Ausbeutung zu verstehen, sondern auch im umfassenderen kulturellen oder symbolischen Sinne – womit eingeschlossen ist, jemanden oder etwas auf eine bestimmte Art und Weise (innerhalb eines bestimmten »Repräsentations regimes«) zu repräsentieren. Es geht also immer darum, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie verschiedene Praktiken der Repräsentation (etwa Stereotypisierung) die Ausübung symbolischer Macht ermöglichen.9
80
10 Man muss sich bewusst machen, dass unser heutiger demokratische Repräsentant von jenen representatives kommt, die im englischen Par lament unter Edward I. die Grafschaften und Städte vertreten, um mit dem König über dessen Steuerforderungen zu reden! Bis zum Reform Act von 1867 und dem Representation of the People Act von 1928 (mit dem Großbritannien zum ersten Mal eine vollwertige, for male Massendemo kratie wurde) war es ein langer Weg! 11 Carl Schmitt, Römischer Katholizismus und politische Form (1923), (Stuttgart: Klett-Cotta 1954). vid. Ernst-Wolfgang Böckenförde, »Der Begriff des Politischen als Schlüssel zum staatsrechtlichen Werk Carl Schmitts«, in: Ernst-Wolfgang Böckenförde Recht – Staat – Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatskunde und Verfassungsgeschichte (Frankfurt|M.: Suhrkamp, 1991),S. 363 ff.
Was aber wird durch ein Parlament symbolisiert ? In der repräsentativen Demokratie ist uns der Feind abhanden gekommen (es ist eine Eigenheit der Demokratie, dass die Repräsentanten an die Stelle des Herrschers rücken), unsere »Vertreter« repräsentieren uns nicht mehr gegen den unserer Delegierung unbedürftigen Herrscher, sondern sie sind nur noch in ihrem Erscheinen als öffentliche Personen unsere Repräsentanten.10 Die repräsentative Demokratie ist an die Stelle des Königs getreten, kann und darf sich aber nicht darstellen, und eben deshalb wurde immer wieder versucht, den Begriff der Repräsentation für den Staat zu monopolisieren, was nur mittels Überblendung von parlamentarischer Volksrepräsentanz und monarchischer Epiphanie zu bewerkstelligen war.11 Mit anderen Worten: Die repräsentative Demokratie beruht ihrer Struktur und ihrem Versprechen nach auf einem Darstellungsverzicht, weil sie ihre Legitimation doch aus der wechselseitigen Interessenverrechnung beziehen will; und deshalb hat die repräsentative Demokratie schon von ihrer Wurzel her ein Repräsentationsdefizit. Konsequent weiter gedacht führt dies zum Postulat der Repräsentaionsunbedürf tigkeit westlicher Demokratien – aber das können weder Gesellschaft noch Politik durchhalten: Unter den Gesellschaftsmitgliedern entstehen immer wieder Regungen, gegen die poli tischen Repräsentanten eine eigene Kultur der Repräsentation zu beanspruchen, in der alles das möglich ist, was die repräsentative Demokratie faktisch oder im Grundsatz vorenthält (»Wir sind das Volk!«); Das politische System wiederum ist ebenso verzweifelt wie erfolglos auf der Suche nach unbefangener Bildlichkeit – und bewahrt dabei die aus dem konstitutio nell gemilderten Absolutismus überkommene ästhetische Repräsentation gerade deshalb, weil von den politischen Eliten (nicht ganz zu Unrecht) vermutet wird, dass die in und durch Monumentalbauten aus vergangenen Zeiten zur Schau gestellte Symbolik eine ist, die nicht mit zeit- oder gar tagespolitischen Opportunitätserfordernissen konfligieren kann – und so spaziert man gerne zum Portikus, lächelt dabei den geflügelten Englein zu, die ihre Schwäne reiten (Kandelaber) und wandelt dann unter Apollon, Athene, Zeus und Hera (oberes Vestibül) in die Säulenhalle, um auf Chimären Platz zu nehmen.
mIGRaNt
81
12 Einer offenen Diskus sion darüber, was an stelle absolutistischer Monumentalbauwerke zu treten hätte, wäre das politisches System nicht gewachsen; das weiß man, und deshalb ist es schlechterdings unvorstellbar, dass ein einmal errichtetes Parlament abgerissen und durch einen Neubau er setzt würde! Parlamentsgebäude lassen sich nur dann errichten, wenn sich Politik und Gesellschaft darüber einig sind, dass das Alte zu vernichten ist und dass das Neue an seine Stelle zu treten hat – und dabei können wir völlig beiseite lassen, dass »staatliche Politik zumeist damit beschäftigt (ist), Machtverhältnisse zu erkennen, zu entwerfen, zu gestalten und zu implementieren« (was Diskussionen verunmöglicht), und dass es im Bereich der Architektur überdies fachspezifische Faktoren gibt, die den »Stillstand« fördern. vid. Markus Miessen: Albtraum Partizipation. Übersetzt von R. Voullié (Berlin: Merve, 20129), S. 39 und S. 75.
Die Bewahrung des baulichen Bestandes (des architekto nischen status quo) imaginiert solcherart Sicherheit, und die politischen Eliten erhoffen aus einer derartigen Bestandswahrung einen Vertrauensgewinn – oder sehen in der Bewah rung und Instandhaltung des schon Vorhandenen doch ein probates Gegenmittel, gegen den sich ubiquitär zeigenden Vertrauensverlust.12 Unschwer ist aus der Übernahme politisch anachronistisch gewordener ästhetischer Repräsentation eine Beeindruckungsstrategie abzulesen, die aus der überkom menen staatlichen Symbolik Gewinn auch unter veränderten politischen Verhältnissen erzielen will. Natürlich kann man die Sache auch von der anderen Seite her betrachten: Anfang des 20. Jahrhunderts bekamen die Kräfte der Massen eine breitere (politische) Repräsentation im Staat – allerdings um den Preis, ein untergeordnetes und nicht führendes oder gar hegemoniales Element zu bleiben. Die Beständigkeit ästhe tischer Repräsentation soll uns daran erinnern, es wird Per sistenz geschaffen und der drohenden Kontingenz abgehütet. So wie sich das Finanzbürgertum des 19. Jahrhunderts ungeniert aus dem Fundus aristokratischer Repräsentationsmotive bediente, so bediente sich die schwache österreichische Demokratie nach 1918 konstitutioneller Staatssymbolik – ohne sich davon je wieder lösen zu können. Man sollte jedoch weiter fragen: Wenn der klassizistische Parlamentsbau symbolhaft gegen den monarchischen Herrscher gerichtet war, gegen wen wendet er sich heute? IV. Der bürgerliche Verfassungsstaat hat sich aller positiven Utopien und seiner in den Anfangstagen inhärenten emanzipatorischen Intentionen völlig entledigt. Im besten Fall wird der status quo entlang verfassungsgesetzlicher Vorgaben administriert – die Einrichtungen des Verfassungsstaates mögen sich in vielerlei Hinsicht bewährt haben, dass sich aber aus ihnen heraus etwas Innovatorisch-Humanes entwickeln könnte, das ist der Realität dieser Institutionen jedenfalls bis auf Weiteres nicht ablesbar. Emanzipation und gesellschaftliche Autonomie lassen sich nur noch außerhalb der staatlichen Instanzen, Organe und Einrichtungen finden. Der Befund ist jedoch ambivalent, weil sich gerade außerhalb staatlicher Einrichtungen mitnichten die »Gesellschaft der Freien und 82
Gleichen« (Karl Marx) ausbreitet, sondern sich ein Jammert al immerwährender Prekarität für immer mehr (gerade noch) Beschäftigte abzeichnet. Mangelnde politische Einflussmög lichkeiten, zunehmende Prekarisierung und Kommerzialisierung (fast) aller Lebensbereiche und das Gefühl, den Unwägbarkeiten der internationalen Wirtschafts- und Finanzmarktentwicklung ohnmächtig und in immer mehr Fällen ungefedert und unmittelbar ausgesetzt zu sein, lassen »Öffentlichkeit«, verstanden als politische Form des Bewusstseins, und »Engagement«, verstanden als zuversichtlich auf eine bestimmte (politische) Zielerreichung ausgerichtetes individuellen Handeln, als interessenskonforme Instrumente poli tischen Miteinanders und politischer Auseinandersetzungen untauglich erscheinen. Gleichzeitig wird uns, wenn schon nicht eingeredet, so doch mit staatstragender Miene bedeutet, dass es den politischen Eliten immer nur darum ginge, das Allgemeinwohl zu befördern, und dass alles, was getan oder unterlassen wird, sich gegenüber der Notwendigkeit der Umstände zu recht fertigen habe. All unsere Repräsentanten (und diejenigen, die es noch werden wollen, allemal) versichern uns, dass sie alle vertreten, keine Sonder- und|oder Partialinteressen beflügeln, und dass wir alle uns durch sie repräsentiert sehen – und wichtiger noch: fühlen! – sollen. Das aber ist eine Chimäre – niemand vertritt uns, fast alle aber haben zuneh mend das Gefühl, sie würden getreten. Der Parlamentarismus und das Modell demokratischer Repräsentation zehren immer noch von einem liberalen Vernunftglauben, wie er am prägnantesten wohl vom konservativen Engländer Edmund Burke (1729 –1797) zum Ausdruck gebracht wurde: »Parliament is not a congress of ambassadors from different and hostile interests; which interests each must maintain, as an agent and advocate, against other agents and advocates; but parliament is a deliberative assembly of one nation, with one interest, that of the whole; where, not local purposes, not local prejudices ought to guide, but the general good, resulting from the general reason of the whole. You choose a member indeed; but when you have chosen him, he is not a member of Bristol, but he is a member of parliament.« 13
mOnUMent
13 Edmund Burke, Speech to the Electors of Bristol, 03.11.1774, zit. nach: R. Andrews (Hg.), New Penguin Dictionary of Quotations, (London: Penguin Books, 2006), S. 226.
83
14 Jan-Werner Müller, Das demokratische Zeit alter. Eine politische Ideengeschichte Europas im 20. Jahrhundert. Übersetzt von M. Adrian (Berlin: Suhrkamp, 2013), S. 23. 15 Slavoj Žižek, The Year of Dreaming Dangerously (London, New York: Verso, 2012), S. 23.
Dies aber ist pure Fiktion, eine Fiktion freilich, die sich – ungeachtet aller politischen Erfahrungen der letzten 200 Jahre – durchaus zu halten und als Ideologie die Wahrnehmung und Realität aller Gesellschaftsmitglieder weiterhin zu beein flussen vermag, obwohl sich spätestens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr eine Krise der Repräsentation herausstellte, sodass eigentlich gar nicht klar war, wer hier repräsentiert wurde und welche Arten von politischen Ansprüchen innerhalb des bestehenden politischen Systems erhoben und miteinander in Einklang gebracht werden sollten. Der liberale Gedanke jedenfalls, dass a) der Staat im Dienste der Gesellschaft stehen soll, dass b) die Gesellschaft wiederum ihre Bedürfnisse und Wünsche am besten in Par lamenten auszudrücken vermag, und dass c) diese Parlamente sich in der Hand von verantwortungsvollen Honoratioren mit sicherem Sinn für das Allgemeinwohl befinden sollen – dieser Gedanke konnte als einigermaßen realitätsnah nur in einer bestimmten historischen Epoche des 19. Jahrhunderts und während einigermaßen stabiler wirtschaftlicher, sozialer und politischer Verhältnissen angesehen werden: »Das Zeit alter der Sicherheit war auch das Zeitalter des Parlamentarismus.« 14 Mit der Sicherheit ist es aber vorbei. Und weil man über die Ursachen dieses Wandels und die damit einhergehenden politischen und wirtschaftlichen Interessen nicht sprechen möchte, wird von der führenden politischen Personage und deren Mitgliedern unentwegt versucht, sich ebenso lautstark wie unverbindlich als je allein tauglicher Vertreter von Allgemeininteressen zu präsentieren. Von Slavoj Žižek stammt die kluge Beobachtung: »The standard way of disavowing an antagonism and presenting one’s own position as the representation of the All is to project the cause of the antagonism onto a foreign intruder who stands for the threat to society as much, for the anti-social element, for its excremental excess.« 15
84
16 Kari Jormakka, »Architecture for Sale«, in: ögfa (Hg.), UmBau 25: Architektur im Ausverkauf (Salzburg: Anton Pustet, 2010), S. 81 ff., hier S. 83.
V. Man könnte das Thema fortspinnen und differenzierter skizzieren. Für unseren Zusammenhang wollen wir aber die Fragestellung in eine Richtung akzentuieren, wie sie von Kari Jormakka (1959–2013) gestellt wurde: »Can society still use architecture to represent its values?«16 Man mag dazu stehen wie man will, man kann darüber verzweifelt sein oder sich davon enthusiasmieren lassen: Unserer Gesellschaft bleibt nichts anderes übrig, als ihre Normativität aus sich selbst zu schöpfen. Was von den »großen Erzählungen« übrig geblieben ist, hat für die meisten Mit glieder der Gesellschaft an handlungsanleitender Verbindlichkeit verloren, nur noch selten prägen die Milieus der Herkunft in verbindlicher Weise die persönlichen Vorstellungen des Erlaubten und Ersehnten, und ganz generell fehlt es an allgemein anerkannten ethischen und moralischen Normen und es besteht ein ubiquitäres Defizit an Urteilsfähigkeit und an Gewissheit des in Überzeugungen gründenden Wissens. Wie sollen vor diesem Hintergrund allgemein verbindliche Maßstäbe formuliert werden können? Wohlmeinende Rechtsphilosophen schlussfolgern aus dieser Beschreibung gerne, dass weder eine Weltanschauung noch eine Ethik, weder eine Religion noch eine Partei berufen sei, innerhalb einer Kultur oder mit interkulturellem Geltungsanspruch ein ein ziges Verständnis von Recht und Staat zu oktroyieren und allgemeine Zustimmung zu verlangen. Demokratie verlange deshalb nach formalen, den Weltinterpret ationen gegenüber neutralen Prinzipien der Würde, Gleichheit, der Gerechtigkeit und der Allgemeinheit des Rechts, wie sie sich in den Grund- und Menschenrechten Ausdruck verschaffen – und zum Schutz dieser Rechte bedürfe es eben des Staates, woraus sich wiederum ein »Menschenrecht auf den Staat« (Robert Alexy) ableiten ließe. Aber lassen sich daraus Werte ableiten, die sich baulich repräsentieren lassen? Denkt man an die peinigende Kommerzialisierung unseres Alltages, an die zunehmende Prekarisierung unserer Arbeitsverhältnisse, an die potenzielle Überwachung all unserer Lebensregungen, an die fortgesetzte Irrationalität unserer Gesellschaft beim Stoffwechsel mit der
muLtiETHnic
85
17 vid. Gottfried Kerscher, Architektur als Repräsentation. Spätmittelalterliche Palastbaukunst zwischen Pracht und zeremoniellen Voraussetzungen. Avignon – Mallorca – Kirchenstaat (Tübingen, Berlin: Wasmuth, 2000). 18 Zum Bedeutungswandel der Repräsentation in der parlamentarischen Demokratie. vid. auch Niels Werber, »Stich wort: ›Repräsentation | repräsentativ‹«, in: K. Barck et al. (Hg.), Ästhetische Grundbegriffe, Band 5: Postmoderne – Synästhesie (Stuttgart, Weimar: Metzler, 2003), S. 265 ff., hier besonders S. 269. 19 vid. Ernst Cassirer, Das mythische Denken (= Philosophie der sym bolischen Formen, Band 2) (Darmstadt: Wissenschaftliche Buch gesellschaft, 1994), S. 72 ff., besonders. S. 73: »(… ) alle sonstigen geistigen Eigen schaften und Vermögen erscheinen dem mythischen Denken in irgen dein bestimmtes ding liches Substrat gebunden.« 20 Der gegenwärtige Zu stand ist meines Erach tens knapp und zuverlässig zusammengefasst von Karin Priester, »Governance in Europa: Auf dem Wegin die Postdemokratie?«, in: Blätter für deutsche und internationale Politik (4|2014), S. 99 ff.
Natur und an viele andere Missstände mehr, dann wäre doch überdies der Versuch, den Postulaten wohlmeinender Rechtsphilosophen und besoldeter Sonntagsredner baulich Ausdruck zu verleihen, wiederum nur ein ideologisches Manöver. Gottfried Kerscher hat in seiner groß angelegten Studie über »Architektur als Repräsentation« 17 unter anderem nachgewiesen, dass sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im päpst lich-höfischen Leben Rangordnungen ausdifferenzierten und gleichzeitig abstrakte Strukturen herausbildeten, die im höfischen Leben verankert waren – und daraus entwickelten sich zu einem gewichtigen Teil die Bauaufgaben repräsentativer Palastkunst, sodass die höfische Entwicklung vermittelt auf die Raumordnung einwirkte. Architektur zeigt sich hier als Reflex gesellschaftlicher Beziehungen. Diese Beziehungen waren aber sowohl ihrem Charakter als auch ihrer konkreten Ausformung nach von undiskutierbarer Verbindlichkeit für die jeweiligen Akteure – und sie hatten (wenn auch durchaus vermittelt) einen transzendentalen Bezugspunkt in den funktionalen Erfordernissen des päpstlichen Hofes. Dieses Modell lässt sich jedoch heute im Verhältnis von politischer Form (der aktuellen Konfiguration politischer Macht) und baulicher Formung (Parlament) nicht mehr anwenden. Die Voraussetzungen haben sich geändert – und damit ist nicht nur die Instrumentalisierung der »Künste« zur Visualisierung von Herrschaft genau in dem Maße obsolet geworden, wie die zeremonielle Form öffentlicher Repräsentation heute (weitgehend) verschwunden ist 18, sondern damit ist auch der Modus der Repräsent ation generell gefährdet. Das Bestehen oder besser: der Glaube an das Bestehen einer Verbundenheit zwischen dem Repräsentanten und dem oder den Repräsentierten ist eine Voraussetzung der Repräsentation. Dieser Glaube ergibt sich aber nicht von selbst. Man ist darauf angewiesen, die Gültigkeit der Vergegenwärtigung etwa eines »demokratischen Geistes« oder einer »repubika nischen Idee« (um nur zwei naheliegende Beispiele zu nennen) einsichtig zu machen, ohne sie im strengen Sinn beweisen zu können. Das ist umso problematischer, je geringer die Vereinfachung gestattende und sogar fordernde historische Distanz ist, je ungewisser ein Urteil über die Sonderung des Wichtigen vom Unwichtigen bleibt und je weitertragend und 86
21 Eben deshalb war es für Wolf D. Prix bedeutsam, darüber zu berichten, dass das neue Parlament in Tirana »die Simulta neität von konkurrierenden, politischen Konzepten innerhalb einer demokratischen Gesellschaft« in das Konzept »übersetzt«. vid. Der Standard vom 25.03.2011, http://derstandard. at/1297821491791/Archi tektur-Coop-Himmel blau-baut-das-neuealbanische-Parlament, (25.04.2014). Einerlei, was man von der bau lichen »Übersetzung« halten mag, damit wird die Ideenbedürftigkeit eines Parlamentsneubaues gut illustriert. – Ein anderes Beispiel wäre das von Enric Miralles und Benedetta Tagliabue entworfene Schottische Parlament in Edinburgh, nachdem die Schotten 1997 ihr eigenes Parlament durch Volksabstimmung erkämpften. 22 vid. Ernesto Laclau, »Macht und Repräsentation«, in: Ernesto Laclau, Emanzipation und Differenz. ü. v. O. Marchart (Wien: Turia + Kant, 2002), S. 125 ff. vid.: Ernesto Laclau, »Demokratie zwischen Autonomie und Heteronomie«, in: O. Enwezor et al. (Hg.), Demokratie als unvollendeter Prozess (Documenta11_ Plattform1) (Ostfildern: Hatje Cantz, 2002), S. 437 ff., besonders S. 445 ff.
schwerwiegend die Folgen sind, die man aus der Repräsenta tion zieht (oder ziehen will). Die Herkunft der Repräsentations vorstellung aus dem »mythischen Denken«, dem »eine eigen tümliche Verdinglichung«, eine Substanzialisierung von Ideen, Geistern, Abstraktionen und allen Vorstellungsgegenständen wesentlich war 19, legt es natürlich nahe, sie durch ein Bauwerk zu repräsentieren. Weil man die Idee der Demokratie vor dem Hintergrund der tatsächlichen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Entwicklung nicht einsichtig machen kann20, setzt die Politik mit selbstlegitimatorischer Absicht auf die Evidenz des baulich Vorhandenen; und der Verweis auf das Vorhandene, die Persistenz des Überkommenen stellt – auch ohne gesonderte Argumentation – eine implizite Beeindruckungs strategie dar, der mit Argumenten nicht beizukommen ist. Nur ein »neuer Glaube« könnte den Antrieb geben, das Alte zu schleifen, nur eine neue Idee könnte auch baulich Neues schaffen.21 Aber diese »neue Idee«, die ja auch eines gesellschaftlichen Subjektes bedürfte, das die Idee dann zu realisieren sucht, die gibt es nicht – so enden alle Debatten immer wieder in einer Art Gegenwartsbewältigung durch Wiederherstellung der Vergangenheit. Man wird nicht missachten dürfen, dass es Budgetzwänge gibt, und dass pragmatische Gründe stets dafür sprechen, das je Vorhandene nach den Zwecken des Tages zu nutzen – aber in der Sache selbst geht es nicht darum. Es ist berechtigt, davon zu sprechen, dass Repräsentation stets eine Doppelbewegung zwischen dem Repräsentanten und dem Repräsentierten beinhaltet, dass also stets beide Seiten etwas zum Repräsentationsprozess beizutragen haben, ohne dass es möglich wäre, einer von ihnen eine letztinstanzliche Priorität einzuräumen.22 Repräsent ation kann durchaus miss lingen, wenn diesen Erfordernissen nicht entsprochen wird – und Repräsentation muss misslingen, wenn es zwischen Repräsentiertem und Repräsentanten keinerlei Bewegung mehr gibt. Wer sich mit dem Alten abfindet, der bekommt nichts Neues. Walther Rode, (1878–1934), ein leider vergessener Pamphletist der 1. Republik, hat unmittelbar beim Niedergang der Habsburger-Monarchie die Zustände in Wien gnadenlos ins Visier genommen: »Ich führe die große Aufmachung, die in den obersten Staatsämtern, aber auch bei Banken und anderen
nATIoNal
87
23 Walther Rode, »Wien und die Republik«, in: Walther Rode: Wien und die Republik und andere Aufmerksamkeiten, hrsg. und mit einem Anhang versehen von A. J. Noll, (Wien: Czernin, 2011), S. 7 ff., hier S. 25 f. 24 Vittorio Magnago Lampugnani, Die Moder- nität des Dauerhaften. Essays zu Stadt, Architek- tur und Design. Aus dem Italienischen von M. Kahn (Frankfurt|M.: Fischer, 2000), S. 87.
öffentlichen Anstalten herrschte, auf jene Auffassung des Kaisers als düsteren Divus Caesar Augustus zurück, auf dessen gepflegte Gottähnlichkeit und auf den anachronistischen Prunk des spanisch-burgundischen Hofbetriebes. Man denke nur an die weiten Wege durch großartige Hallen und teppichbelegte Prachtsäle, die man etwa im Finanzministerium oder im Ministerium des Inneren vom Portier bis zum Vor zimmer-Pintsch Sr. Exzellenz des Herrn Ministers zurückzu legen hatte. Ich bin der Anschauung, daß die Weiterführung der Beherrschung Deutschösterreichs von diesen alten Stellen der Großartigkeit aus ein Hindernis für die ökonomische Neueinrichtung unserer kleinen Republik mit ihren beschränkten Verhältnissen sein wird. Rationell und unseren Bedürf nissen strikt angepasst, ließe sich die Zentralverwaltung unseres neuen Vaterlandes vielleicht am besten von einem Orte wie Vöcklabruck bewerkstelligen.« 23 Das von Walther Rode Ausgesprochene gilt mutatis mutandis auch für das Parlamentsgebäude – und jenseits ökonomischer Überlegungen. Zwar ist Architektur scheinbar immer schon von vornherein auf eine stabilisierende Rolle hin verpflichtet, und es ist gerade der physische Bestand eines Objekts, der den Entwurf in eine kulturelle Instanz verwandelt. Es ist aber gerade die »kulturelle Instanz« des Baulichen, die zu problematisieren wäre. Natürlich leben wir immer im Überkommenen. Aber Vittorio Magnago Lampugnani hat zu Recht gewarnt: »Wer das eigene Universum in ein großes Gedächtnis verwandelt, löscht es aus«24. Immer stellt sich auch die Frage: Was wollen wir vergessen, was sollen wir vergessen? Die Antwort auf diese Frage würde aber eine selbstgewisse Haltung über die eigene politische und kulturelle Identität voraussetzen. Nur eine derartige Haltung könnte uns die Zuversicht schaffen, auf diese Frage auch eine Antwort geben zu können. Staatliche Politik wird sich in Österreich auf absehbare Zeit nicht auf der Höhe des damit postulierten Reflexions niveaus bewegen – und die gebetsmühlenartig wiederholte Rede von den Budgetnöten und Sachzwängen tut ihr Übriges. Vielleicht sollten wir uns in einer derartigen Situation dennoch einer Erkenntnis anvertrauen, die uns Deyan Sudjic als Quintessenz seiner Analyse des Schottischen Parlaments neubaues 1998 überbracht hat: »Kleine Länder, die kreatives 88
25 Deyan Sudjic, Der Architekturkomplex. Monumente der Macht. Aus dem Englischen von K. Schreiner (Düsseldorf: Patmos, 2006), S. 212 f.
Talent, wo es auch herkommen mag, fördern, um eine Architektur hervorzubringen, die unverkennbar ihre eigene ist, vermitteln ein Selbstvertrauen, das eindrucksvoller ist als eine mit Mühe formulierte Definition der Identität (…) Architektur ist die sichtbarste (kulturelle Form) von allen und der macht vollste Ausdruck einer nationalen Identität, ganz einfach weil man sie einsetzen kann, um glaubwürdig nationale Institutionen zu schaffen.«25 Parlamentarische Identität könnte dann aus der Doppelbewegung zwischen dem, was auf Bestand gerichtet ist, und denjenigen, die mit der steten Veränderung leben müssen, entstehen – und die Repräsentierten hätten dann einen Ort, in dem und durch den sie sich als beständig repräsentiert erfahren könnten.
nEO-
89
Jens Kastner Postdemokratische Räume
1 Bruno Latour, Das Parlament der Dinge. Für eine politische Ökologie. Übersetzt von Gustav Roßler (Frankfurt|M.: Suhrkamp, 2010), S. 85.
Es sind nicht allein menschliche Akteure und Akteurinnen, sondern bereits die Dinge, die ihre Spuren hinterlassen und damit einen sozialen und politischen Raum konstituieren. Dabei ziehen sie diese Spuren quer durch die alten, »modernen« Raumaufteilungen, in denen auf der einen Seite die Wissenschaft (mit ihrer Frage danach, wie die Welt ist) und auf der anderen Religion und Politik (mit jener danach, wie sie sein soll) in verschiedenen Zimmern betrieben und verhandelt wurden. An die Stelle von diesen getrennten, »zwei Versammlungsorten“ 1 müsste schließlich auf Drängen der Objekte, das »Parlament der Dinge« als neue Form der Versammlung treten. So jedenfalls beschreibt der Soziologe Bruno Latour seine wissenschaftskritische Vision, und sie ließe sich auch als Einwurf in die Debatte um postdemokratische Räume lesen. Denn in Latours Ansatz werden nicht nur verschiedene epistemologische und politische Fragestellungen radikalisiert, sondern er steht mit seinen zentralen Motiven des Verteilens und Versammelns auch für einen gegenwärtigen Trend in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften: Im Zuge dieser aktuellen Entwicklungen, die als topologische Wende oder auch als spatial turn beschrieben wurden, werden nämlich die sozialtheoretischen wie politischen Bedeutungen der (Kon stitution von) Räumlichkeit einerseits und die von Praktiken des Versammelns, Partizipierens und Aufteilens andererseits beschrieben, hervorgehoben und|oder eingeklagt. Solche Wenden entstehen immer im Wechselverhältnis von wissen schaftsinternen und außerwissenschaftlichen Entwicklungen und Ereignissen. Es weisen also neue Erkenntnisse und Forschungsergebnisse darauf hin, dass ein Gegenstand, in diesem Fall der Raum, nicht oder nicht angemessen konzeptualisiert wurde. Und es passieren Dinge außerhalb der Wissenschaften, die diese aber dennoch dazu zwingen, ihre bisherigen Ergebnisse, vielleicht sogar die Methoden, zu überdenken und zu verändern. Konkret scheinen hier also Auf- und Verteilungen sowie Bedingungen und Effekte gesell90
2 »Sozialwissenschaftlich beschreibbar ist das Objekt nicht als Faktum«, erläutert Oliver Marchart den Einsatz Latours, »sondern nur durch Entfaltung jener Spur, die es als Ding gezogen hat, nämlich im Moment der konfliktorischen Neuzusammensetzung eines Relationenensembles.« Oliver Marchart, Das unmögliche Objekt. Eine postfundamentalistische Theorie der Gesellschaft (Berlin: Suhrkamp, 2013), S. 155.
schaftlicher Teilhabe sich verschoben und verändert zu haben, so dass sich etwas gedreht und gewendet hat. Sind nun die drängenden Dinge und Objekte 2, von denen Latour schreibt, möglicherweise Indizien für solch eine außerwissenschaftliche Entwicklung? Kündigt sich hier, wenn nicht nur die Menschen vertreten sein wollen, sondern auch die Gegenstände Zugang und Repräsentation verlangen, nicht eine Verfasstheit des Raumes an, die über die bisher gekannte Demokratie hinausgeht ? Haben wir es, kurz gefragt, also gegenwärtig mit postdemokratischen Räumen zu tun? Was aber sind postdemokratische Räume, wodurch zeichnen sie sich aus und wie müssen sie begriffen werden? Geprägt wurde der Begriff der Postdemokratie von dem Politik wissenschaftler Colin Crouch. Er diskutiert einige Symptome, die das Präfix »Post« vor der normativ verstandenen Vorstel lung von Demokratie, den Regierungsformen im modernen, westlichen Wohlfahrtsstaat, rechtfertigen soll. So streicht er etwa den Einflussgewinn privilegierter Eliten, das Kappen der Verbindung zwischen Modernisierung und der Verringerung sozialer Ungleichheit, den Verlust der politischen (nationalen) Identität sowie die Personalisierung und »Showbusinessie rung« der politischen Sphäre als typische Anzeichen des postdemokratischen Zustands heraus. Crouch bearbeitet aber keine raumtheoretische Fragestellung. Auch scheint ihm die räumliche Dimension seines Gegenstandes trotz spatial turn nicht sonderlich diskutierenswert. Im Kapitel über das Unternehmen als neues Modell für Institutionen aller Art schildert er allerdings eine Szene, die durchaus auch als Antwort auf die Frage gelesen werden könnte, was denn postdemokratische Räume sein könnten: »Stellen wir uns vor, eine lokale Schulbehörde verkündet, sie habe sich – angesichts der Ergebnisse der Marktforschung und mit dem Ziel der Kosten-Nutzen-Optimierung – an die Marketingberater einer Supermarktkette gewandt und sie um Hilfe bei der effizienteren räumlichen Anordnung der Schulen gebeten. Man werde nun die meisten Schulen schließen und eine kleine Zahl neuer Schulen eröffnen – an Autobahnan schlussstellen. Studien hätten gezeigt, daß der kleine Prozent
nuclEAr
91
3 Colin Crouch, Post- demokratie. Übersetzt von Nikolaus Gramm (Frankfurt|M.: Suhrkamp, 2008), S. 55 f.
satz von Schülern, deren Eltern kein Auto haben, höchstwahrscheinlich ohnehin nur schwache Leistungen erbringen würde. Somit könne man davon ausgehen, daß sich – ganz abgesehen von den beträchtlichen Kostenersparnissen, die sich aus der Schließung vieler Schulen ergäben – die Punktzahl der Stadt in den school league tables (d. h. in den Ranglisten, in denen die Schulen in einzelnen Städte miteinander verglichen werden) verbessern, wenn diese weniger leistungs fähigen Jugendlichen die Schulen nicht länger besuchen.« 3 Crouch spielt hier das Beispiel einer Raumgestaltung durch, das auf die Charakteristika der postdemokratischen Kon stellation hinweisen soll. Prägend für diese Merkmale ist hier offensichtlich die Ausrichtung an ökonomischen Kriterien. Gemeinwohl oder allgemeine Zugänglichkeit und Repräsen tation spielen keine Rolle mehr. Insofern – und vorausgesetzt, die Position von Colin Crouch ist keine kuriose Einzelmeinung, sondern selbst Beispiel für eine ganze Reihe zeitdiagnostischer Kritiken – stehen wir bei der Frage nach post demokratischen Räumen vor einer widersprüchlichen, vielleicht sogar paradoxen Situation: Genau in der Zeit, in der laut Crouch (und vielen anderen) der Sozialstaat abgebaut wird und im Zuge dessen auch die von ihm verwalteten und als »öffentlich« deklarierten Räume durch Privatisierungen suk zessive verschwinden, erlebt in den Sozial- und Kulturwissenschaften mit dem spatial turn eine Wende ihre legitimierende Drehung, die gerade auf den allgemeinen Konstruktions charakter von Räumen abhebt. Nicht nur, dass Räume nicht als per se existent, als stabil und statisch, sondern als per manent zu schaffend betrachtet werden: Es wird bei der topologischen Wende zudem davon ausgegangen, dass längst nicht nur ExpertInnen mit diesen Raumkreationen beschäftigt sind, sondern dass der Konstruktionscharakter insofern ein allgemeiner ist, als dass eben alles Mögliche an der Raumerschaffung mitwirkt. Das Schaffen von Räumen spannt sich vom ersten individuellen Blick auf Masaccios »Dreifaltigkeit« (1425|28), der Dank zentralperspektivischer Darstellung die Zweidimensionalität der Fläche ignorieren konnte, über die Pointierung des Blicks als schlechthin konstitutiv für die Kunst, bis hin zum kollektiven Geflecht von Sozialisation, Berufswahl, Karriereverläufen und Legitimationskämpfen, 92
4 Felicitas Thun-Hohenstein, Performanz und ihre räumlichen Bedingungen. Perspektiven einer Kunstgeschichte. (Wien,Köln, Weimar: Böhlau, 2012), S. 90. 5 vid. Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. (Neuwied, Berlin: Luchterhand, 1962).
die den sozialen Raum im Sinne Pierre Bourdieus konstituieren. Diese Verschaltung von individuell-ästhetischen und kollektivsoziologischen Raumkonzepten macht letztlich auch die Grundlagen des spatial turns aus. Und sie legt inhaltlich Ubiquität und allgemeine Zugänglichkeit von und zu Raumkonstruk tionen nahe. Es scheint darin eine Art Demokratisierung zum Ausdruck zu gelangen, die unter anderem von den künstlerischen Avantgarden mit erkämpft wurde: »Es geht um die Schaffung von Räumen, in denen Erfahrungen gemacht werden können. Diese Erfahrungen sind aus der Tradition der Avantgarde heraus nicht systemaffin, sondern handeln von Refle xion, Analyse, Kritik und neuen Erkenntnisperspektiven.« 4 Diese Betonung von Partizipation, bewusster und unbewusster Teilhabe, durch allgemeine und alltägliche (statt spezifisch architektonisch-stadtplanerischer) Praxis, steht also jener der politischen Entdemokratisierung entgegen. Dieser Rückgang, oder eher dieser Rückbau an Demokratie wird im Grunde schon seit Jürgen Habermas’ »Strukturwandel der Öffentlichkeit« (1962) konstatiert und seit der Durchsetzung neoliberaler Politikkonzepte beklagt.5
oCcUPy
Wenn nun beide Entwicklungen für sich genommen plausibel erscheinen, sich aber zugleich widersprechen, ist die Frage, ob, und wenn ja, wie sie miteinander zu vermitteln sind. Wie also soll diese widersprüchliche Situation gehandhabt werden? Und kann schließlich die Vorstellung von postdemokratischen Räumen gleichermaßen Tendenzen fassen, die sowohl den Abbau von Demokratie (im Zuge der Neoliberalisierung) als auch die Ausweitung der Demokratie (im Hinblick auf das Drängen der Dinge und die Ausweitung kritischer Reflexionsräume) beschreibt ? Um diese Ambivalenz postdemokratischer Räume abzu decken, bedarf es zunächst eines erweiterten Demokratie begriffes, als Crouch ihn anbietet. Und darüber hinaus muss das Verständnis der Räumlichkeit, das der spatial turn mit sich bringt, zugleich konkreter und allgemeiner gefasst werden. Das bedeutet, Raum nicht einfach nur als sozial konstruiert zu verstehen, sondern auch zu fragen, wie dieser Raum hergestellt, wie er stabil gehalten und wie er verändert wird. Es ist also wichtig, die Frage nach Stabilisierungs- und Dynamisie93
6 Jacques Rancière, Der Hass der Demokratie. Übersetzt von Maria Muhle (Berlin: August, 2011), S. 101. 7 Zur Kritik an der Posi tion Rancières vid. Jens Kastner, Der Streit um den ästhetischen Blick. Kunst und Politik zwischen Pierre Bourdieu und Jacques Rancière (Wien: Turia + Kant, 2012). 8 Jacques Rancière, S. 61.
rungsprinzipien zu stellen. Vor dem Hintergrund der geschilderten Widersprüchlichkeit muss ganz grundsätzlich fest gehalten werden: Die allgemeine Konstitution von Räumen existiert zwar, aber sie ist keine allgemein gleiche. Verschie dene AkteurInnen, AgentInnen und|oder AktantInnen sind in unterschiedlicher Art und Weise und auch unterschiedlich wirkmächtig und effektiv daran beteiligt. Ein analytischer Blick, der die »Demokratie« als normatives Ideal anlegt, muss diese Ungleichverteilung in Betracht ziehen. Er muss also nicht erst den Niedergang der Demokratie in einer bestimmten Form, sondern die Beschaffenheit der Demokratienorm selbst hinterfragen. Anders gesagt: Crouch geht längst nicht weit genug, wenn er die realpolitische Demokratie in den west lichen Ländern von der Nachkriegszeit bis in die 1970er-Jahre als Standard setzt. Demokratie ist weit mehr als die staat lichen Apparate und die Institutionen der Industrie- und Dienstleistungsnationen, die mit dem Begriff gemeinhin beschrieben werden. Demokratie müsste sich grundsätzlich, wie etwa Jacques Rancière vorschlägt, durch egalitäre Beziehungen auszeichnen. Und diese sind weder in einer Natur der Dinge begründet, noch von historischen Notwendigkeiten oder in irgendeiner institutionellen Form garantiert. Die Demo kratie ist laut Rancière einzig der »Konstanz ihrer eigenen Handlungen anvertraut.« 6 Man muss nun nicht die gesamte Konzeption von Politik bzw. dem Politischen bei Rancière teilen, um ihn gegen die Verkürzungen eines institutionellen Demokratieverständ nisses ins Feld zu führen.7 Was sich mit Rancière hier vor allem deutlich machen lässt, ist zweierlei: Dass erstens Demokratie als Matrix, vor deren Hintergrund Beschreibungen vorgenommen und|oder Forderungen erhoben werden, immer als eine erst zu schaffende konzipiert sein müsste. Sie ist keinesfalls mit »der Forderung nach mehr staatlicher Intervention gleichzusetzen«.8 Die Legitimierung politischen Handelns über das »Volk«, das praktische Eintreten für »echte« oder »reale« Demokratie, die im Namen der Demokratie geführten Kriege, solche Phänomene ließen sich ansonsten nur im Hinblick auf das Gelingen der Verwaltung der (sozialen) Ungleichheit hin beschreiben – was ja bei Crouch auch durchscheint, dem das Keynesianische Modell in dieser Hinsicht besser erscheint als das neoliberale – und nicht in Bezug auf 94
deren Abschaffung. Zweitens ist die Rede von der »Postdemokratie« folglich nur bedingt nützlich, weil sie – trotz der Polyvalenzen, die das Präfix »Post« im sozial- und kulturwissenschaftlichen Labeling mit sich führt – eben doch suggeriert, es ließe sich ein nachgereihter, anschließender Zustand beschreiben. Für etwas, das erst im Kommen ist, ist das allerdings ein kaum durchführbares Unterfangen. Es sei denn, man würde den erweiterten Demokratiebegriff auch auf den der Postdemokratie ausweiten. Man würde also mit Postdemokratie nicht nur das Wegbrechen des Wohlfahrtsstaates und die Enttäuschung der mit seiner Ausge staltung verbundenen Hoffnungen bezeichnen, sondern auch Praktiken und Visionen, die nicht nur das Verschwundene und Zerstörte der Vergangenheit in Betracht zögen, sondern auch die Offenheit des Kommenden. Nicht nur der Niedergang von erkämpftem Bestand, sondern auch die Potenziale von Gegenwart und Zukunft. Als postdemokratisch ließen sich dann beispielsweise jene egalitären Beziehungen beschreiben, von denen Rancière spricht, gerade weil sie an bislang als demokratisch bezeichnete Modelle anknüpfen und über sie hinausgehen. Die der »Konstanz ihrer Handlungen« verpflichtete Demokratie ist dann insofern eine Postdemokratie, als sie nach wie vor die Beteiligung aller als Anspruch hat, sich mit den bisherigen institutionellen Arrangements aber nicht zufrieden gibt. Und schließlich erst recht nicht mit deren Zerstörung.
oPpoSiTiOn
9 vid. stellvertretend für eine ganze Reihe von Publikationen zum Thema: Anika Mattisek, Die neoliberale Stadt. Diskursive Repräsentationen im Stadtmarketing deutscher Großstädte (Bielefeld: transcript, 2008).
Bezogen auf das Beispiel von Crouch und die vielen Analysen der »neoliberalen Stadt« 9 müsste der Begriff der postdemokratischen Räume dann auch jene Aufteilungen und Mobilisierungen umfassen, die sich gegen die privatisierte, kommer zialisierte Urbanisierung formieren: »Rebellische Städte« etwa in den Worten David Harveys, oder auch »Territorien des Widerstands«, wie Raúl Zibechi sie nennt. Harvey, Sozialwissenschaftler und nach Verlagsangaben »der meistzitierte Geograf der Welt«, schildert zwar ähnlich wie Crouch zunächst ebenfalls Prozesse des Demokratieabbaus, der Entrechtung und der »Akkumulation durch 95
10 David Harvey, Rebellische Städte. Vom Recht auf Stadt zur urbanen Revolution (Berlin: Suhrkamp, 2013), S. 106. 11 ibid., S. 59. 12 Martina Löw: Soziologie der Städte.(Frankfurt|M.: Suhrkamp, 2008), S. 78. 13 Raúl Zibechi, Territorien des Widerstands. Eine politische Kartografie der urbanen Peripherien Lateinamerikas. Übersetzt von Kirsten Achtelik und Huberta von Wangenheim (Hamburg: Assoziation A, 2011), S. 32.
Enteignung«10, die mit den neoliberalen Deregulierungs- und Privatisierungspolitiken einhergingen und -gehen. Er ordnet diese Entwicklungen zudem in den Kontext urbaner Krisen ein und untersucht deren spezifisch städtischen Grundlagen und Effekte. Seine Analyse ist allerdings auch getrieben von der Haltung, andere und gerechtere (d. h. auch demokratische) Formen der »Kontrolle über die Produktion und Nutzung von Kapitalüberschüssen«11 und damit der Gestaltung des Raumes seien unabdingbar. Dementsprechend fokussiert er nicht nur immer wieder soziale Bewegungen – etwa diejenigen für ein »Recht auf Stadt« –, sondern weist die geschilderten Entwicklungen insgesamt als stets umkämpfte aus. Sie sind die Ergebnisse von vielschichtigen sozialen, politischen, kulturellen und ökonomischen Auseinandersetzungen und als solche sind sie auch keine unumkehrbaren oder abge schlossenen Fakten. Und solche Kämpfe um die städtischen Modernisierungen finden nicht an klaren Fronten statt, an denen sich zwei diametral gegensätzliche Kombattanten, etwa die Agenten des Finanzkapitals und die basisdemokratischen sozialen Bewegungen, gegenüberstünden. Sie sind verworrener, widersprüchlicher, komplizierter. Soziale Kämpfe betreffen auch nicht bloß die Städte als konkrete Orte und kulturelle »Sinnprovinzen«12. Sie umfassen sämtliche Situa tionen und Topografien, in denen unterschiedliche Haltungen hinsichtlich der Bedeutung des vorgefundenen Sozialen auf einander prallen – eine »Sinnprovinz« ist demnach also auch keine ruhige, vormoderne Landschaft, die zum Ausruhen einlädt, sondern hier geraten verschiedene Arten und Weisen, den Dingen und Geschehnissen Sinn zu geben, aneinander. Das muss nicht immer physisch sein. Im Gegenteil, dass soziale Kämpfe an innerstädtischen Barrikaden kulminieren, kommt zwar vor, ist aber eher die seltene Ausnahme. Auch Raúl Zibechi, Sozialwissenschaftler und Journalist aus Uruguay, hat urbane Kämpfe untersucht und soziale Kon stellationen beschrieben, die mit dem hier vorgeschlagenen Begriff postdemokratischer Räume gefasst werden können. Zibechi widmet sich städtischen Peripherien in Lateinamerika. Er schildert dabei in Einklang mit Crouch und Harvey die Auswirkungen des neoliberalen Angriffs auf die wohlfahrtsstaatlichen Standards. Allerdings sieht er diese wesentlich 96
14 ibid, S. 145. 15 Die nicht zuletzt seit dem Thatcherismus evidente Basis rechts populistischer Posi tionen innerhalb der unteren Klassen und Stadtviertel – auf die etwa Theoretiker wie Stuart Hall immer wieder hingewiesen haben – ist mit dem Ansatz von Zibechi nicht zu fassen. In Bezug auf Fragen des Raumes plädiert Hall für ein komplexeres Bild der modernen Stadt als eines mit »mannigfaltigen und sich überlappenden Räumen und entsprechend komplexen Mustern der Interaktion und Verteilung von Aktivitäten, Ressourcen und Haltungen. Verschiedene Praxen teilen sich dieselben urbanen Räume. Allerdings sind auch die Abgrenzungen heftiger geworden und tiefer verankert.« Stuart Hall, »Die Stadt: kosmopolitische Versprechungen und multikulturelle Realitäten.« in: Stuart Hall, Populismus – Hegemonie – Globa lisierung. Ausgewählte Schriften 5. (Hamburg: Argument , 2014), S. 193. Zur aktuellen Debatte vid. Helmut Kellershohn, Jobst Paul (Hg.), Der Kampf um Räume. Neoliberale und extrem rechte Konzepte von Hegemonie und Expansion (Münster: Unrast, 2013).
skeptischer vor allem als Befriedungsinstrumente der herrschenden Eliten, die seit der Durchsetzung des Neoliberalismus selbst noch in den Sozialprogrammen der progressiven Regierungen der 2000er-Jahre ihre Fortsetzungen erfahren hätten. Darüber hinaus hätten viele gesellschaftliche Sektoren überhaupt weder vom Wohlfahrtsstaat noch von den Sozialprogrammen profitiert. Diese vernachlässigten, ja abgehängten Schichten befänden sich geografisch nicht bloß auf dem Land, sondern auch – und in wachsendem Ausmaß – in den großen Städten. Im Sinne des spatial turn geht auch Zibechi davon aus, dass Orte nicht einfach existieren, sondern dass es sich auch bei städtischen Räumen um ein Beziehungssystem handelt, »das sich in einem Territorium ausdrückt oder kondensiert«13. Viele der verdichteten Formen von Beziehungen, die Zibechi in den Slums, Favelas und Vorstädten auffindet, sind zwar ökonomisch, keinesfalls aber moralisch, sozial oder kulturell verarmt. Sie seien bloß »anders«, es seien »Räume der Differenz« entstanden, »in denen Lebensformen existieren, die sich von denen der Stadt des Kapitals unterscheiden.«14
OrnATE
Wenn Zibechi – mehr noch als Harvey – hier und da zu allzu dualistischen Darstellungen neigt und eine Gegenüber stellung der Lebensweisen und -bereiche der Marginalisierten auf der einen und des Bürgertums und der Eliten auf der anderen Seite weder analytisch, geschweige denn hinsichtlich seiner Gut-Böse-Wertung immer plausibel erscheint,15 ist sein Ansatz doch für die Frage nach postdemokratischen Räumen in doppelter Hinsicht bedeutsam. Dennoch ist zum einen gerade die Gegenüberstellung von verschiedenen Existenzweisen von Bedeutung, auch wenn sie an manchen Stellen zu schematisch gerät. Denn sie macht deutlich, dass auch die Raumkonstitutionen von sehr unterschiedlichen materiellen Voraussetzungen ausgehen. Wie Harvey leitet auch Zibechi das raumtheoretische Augenmerk also auf widerständige, oppositionelle, eigensinnige Praktiken. Damit sind nicht nur konkret gegen neoliberale Politiken orga nisierte Aktionen gemeint, sondern viel weitergehend jene Praxisformen, die sich mit dem dominanten Normen- und Wertekanon inkompatibel zeigen. 97
16 In der Hauptstadt des gleichnamigen, südwestlichen mexikanischen Bundesstaates Oaxaca kam es im Sommer zu einem von weiten Teilen der Bevölkerung getragenen Aufstand gegen die Regierung. Die so genannte »Kommune von Oaxaca« entfaltete sich stark im innerstädtischen Raum und hatte mit dem Zeltlager streikender Lehrerinnen und Lehrer auf dem zentralen Platz, dem Zócalo, begonnen. Um einen Platz im Stadtkern ging es auch in den Protesten gegen die Umgestaltung des GeziParkes in Istanbul im Sommer 2013. 17 vid. Michael Baxandall, Die Wirklichkeit der Bilder. Malerei und Erfahrung im Italien des 15. Jahrhundert. Übersetzt von Hans Günter Holl (Frankfurt|M.: Suhrkamp, 1984), S. 56 f. 18 ibid., S. 57.
Harvey und Zibechi ergänzen damit die Analysen von Crouch und anderen um Elemente, die für postdemokratische Räume ebenfalls konstitutiv sind. Zum anderen fokussieren beide auch analytisch auf die Bedingungen der Herstellung von Räumen. Dabei sind sie jedoch dort am überzeugendsten, wo sie die unterschiedlichen Ressourcen zur und die sich widersprechenden Ansprüche an die Gestaltung von Räumen nicht als Wesensmerkmale sozialer Gruppen essenzialisieren, sondern als umkämpfte Tatsachen darstellen. Damit liefern sie nämlich auch eine Ant wort auf die oben gestellte Frage nach dem Dynamisierungsprinzip von Räumen: Es sind die Kämpfe, die das wesentliche, dynamisierende Prinzip von Raumkonstitutionen ausmachen. Das verbindet urbane Räume schließlich auch mit Kunst räumen. Die impliziten Raumkonzepte von Masaccio über Malewitsch bis zur Minimal Art setzten sich nicht von selbst um. Erfahrungs- und Reflexionsräume im Angesicht künst lerischer Arbeiten waren – auch wenn das im Vergleich mit den Auseinandersetzungen um den Zócalo von Oaxaca 2006 oder den Straßenschlachten um den Gezi-Park in Istanbul 2013 vermessen klingt16 – hart erkämpft. Bereits für die Renaissance hatte der Kunsthistoriker Michael Baxandall darauf hingewiesen, dass die neue Malweise sich jene Blicke, die ihre Neuerung überhaupt wahrnehmen konnten, erst erschaffen musste. Er beschreibt die visuellen Erfahrungen grund sätzlich als zugleich strukturiert und variabel.17 Die Kunst schaffenden mussten also an den Strukturiertheiten ansetzen und die Variabilität erweitern. Die »visuelle Kompetenz« des Publikums, so Baxandall, habe daher das Medium der Maler sein müssen.18 Nun waren gerade jene Bereiche, die in den westlichen Gesellschaften seit dem Quattrocento als »Kunst« bezeichnet werden, insgesamt sicherlich alles andere als demokratisch: sehr bürgerlich, stark auf hohe Bildungsgrade angewiesen, geradezu elitistisch. Bis heute ist die Kunst also eher ein vordemokratischer gesellschaftlicher Bereich als einer, dem man das Präfix »Post« vor seinen Demokratiegehalt zuschreiben würde. Dennoch, da das »Post« in Postdemokratie ja nicht bloß auf einen anschließenden Zustand verweist, sondern auf Kon tinuität und Bruch, kann hier auf die permanenten, nicht nur 98
avantgardistischen Versuche rekurriert werden, Brüche her beizuführen. Nicht nur der Bruch mit vorherigen Mal- und Gestaltungsweisen, sondern auch das Aufbrechen gewohnter Seh- und Sichtweisen und das Durchbrechen von Klassenschranken in Produktion und Rezeption von Kunst sind Teil der Kunstgeschichte. Die ausgeweitete Partizipation und die neuen Versammlungsweisen, die innerhalb des Kunstfeldes und von bestimmten Stadtteilen aus erprobt und durchgesetzt werden, müssen ebenso als Teilbereiche postdemokratischer Räume verstanden werden wie Crouchs Schulen am Autobahnzubringer. Post demokratische Räume müssen tatsächlich solch gegenläufige Entwicklungen fassen. Denn sie sind kein Label zur Beschreibung von Zuständen, sondern bezeichnen umkämpfte Prozesse. Sie existieren einerseits nur in actu, in der »Konstanz ihrer Handlungen«, sind andererseits aber – und das muss letztlich auch Rancière entgegengehalten werden –, stets in ihrem Voraussetzungsreichtum zu beschreiben. Nur, weil Räume sich auch in »Sinnstrukturen« konstituieren, heißt das weder, dass sie sich ohne Weiteres jeden Tag aufs Neue erschaffen lassen, noch, dass alle Formen von Räumlichkeit gleich wahrscheinlich sind. Wenn, wie Martina Löw schreibt, die »Sinnstrukturiertheit« von Städten – und Räumen insgesamt – auf »in materiellen wie autoritativen Ressourcen abgesichertem Handeln«19, beruht, müssen eben nicht nur das Handeln, sondern auch die unterschiedlichen Zugänge zu diesen Ressourcen analytisch wie politisch in Betracht gezogen werden. Ob die zur Repräsentation und Partizipation drängenden Leute, Gegenstände und Dinge dann in Parlamenten versammelt aufzufinden sind, oder doch eher in asambleas oder Räten, ist eine andere Frage.
pALAce
19 Martina Löw, S. 74.
99
Harald Trapp Orte der Versammlung 1 vid. Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, Lernen von Las Vegas, Zur Ikonographie und Architektursymbolik der Geschäftsstadt (Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg, 1979). 2 ibid., S. 19. 3 vid. Richard Rorty, The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method (Chicago: University of Chicago Press, 1992). 4 vid. Peter Eisenman, Eisenman’s six point plan, vom 21.05.2008, http://www.bdonline. co.uk/news/eisenmanssix-point-plan/3113 560.article (21.04.2014).
Die Versprachlichung der Architektur durch die Rückkehr zu »Ikonographie und Architektursymbolik« (wie es im Untertitel von »Lernen von Las Vegas«1 heißt), die das vermeintliche Versagen der Moderne in der Kommunikation mit der Gesellschaft überwinden sollte, ist gescheitert. Denn die Reduktion architektonischer Formen auf Mittel der Repräsentation, also Zeichen, machte sie zur flachen Verfügungsmasse einer Kultur der Bilder. Schon Venturi hatte auf diesen Wirkungsverlust des Raums hingewiesen: »Derartige Architektur der Zeichen und Stile ist durchaus anti-räumlich; es ist die Architektur einer Kommunikation, die den Raum nicht mehr gelten lassen will. Der Kommunikationsaspekt dominiert über die räumlichen Eigenschaften der Architektur und der Umwelt.«2 Es stellt sich heraus, dass die Architektur durch ihren linguistic turn3 zwar eine gewisse Autonomie und Vielfalt in der Gestaltung erreichen konnte, sich dafür in einer Art negativer Dialektik jedoch das angestrebte Ziel einer besseren Lesbarkeit ins Gegenteil verkehrte. Die mit dem Computer entworfenen Bauten, so Eisenman, tragen keine kulturelle Bedeutung mehr, sie beziehen sich auf nichts anderes als auf sich selbst oder die Prozesse ihrer Herstellung.4 Ihre Formen sprache eignet sich zwar für das nervöse Aneignungsbe dürfnis des Konsums, kann aber komplexere soziale Auf gaben weder angemessen organisieren noch repräsentieren. In den Bauten der politischen Macht trifft diese Krise der architektonischen Repräsentation auf einen Vertrauensverlust in die repräsentative Demokratie, weil viele Bürger die zunehmend komplizierten politischen Entscheidungsprozesse nicht mehr nachvollziehen können und wollen. Abnehmende Wahlbeteiligung, zunehmende Erfolge populistischer Par teien und wachsendes allgemeines Desinteresse an politischen Fragen lassen Zweifel an den traditionellen Formen politischer Repräsentation aufkommen. Parlamente sind sowohl Institutionen, als auch Gebäude, sie sind die architek tonische Repräsentation politischer Repräsentation. Sie sind sowohl Apparate zur Meinungsbildung, als auch staatliche 100
Monumente und damit die symbolische Repräsentation eines Gemeinwesens. Als architektonischer Nachweis einer repräsentativen Regierungsform stehen sie für deren Mängel ebenso wie für die symbolische Simulation demokratischer Verhältnisse in Staaten, die entscheidende Kriterien dafür nicht erfüllen. So treffen in den Parlamentsgebäuden zwei problematische Entwicklungen aufeinander, die, wie sich zeigen wird, auf eigentümliche und nicht zufällige Art miteinander verschränkt sind: eine Krise der politischen und eine Krise der architektonischen Repräsentation.
5 Niklas Luhmann, Die Politik der Gesellschaft (Frankfurt|M.: Suhr kamp, 2002), S. 325. 6 ibid., S. 326. Luhmann bindet durch die Identifikation von Körper und sacrum den sterblichen, physischen an den mystischen, transzendenten Körper des Monarchen und verweigert damit die Trennung, die Lefort vorgeschlagen hat.
Repräsentation als Herrschaft Herrschaft setzt eine Unterscheidung von Ganzem und Teilen voraus und: »(...) Wo immer ein Ganzes aus Teilen besteht, findet man herrschende und beherrschte Teile.«5 Diese Differenz, so Luhmann, wurde in der europäischen Geschichte seit dem Mittelalter in der Figur des Monarchen aufgelöst, der die Herrschaft im eigentlichen Sinne des Wortes »verkörperte«. »Dabei ist durchaus an den Körper des Monarchen zu denken und nicht etwa an seine Entscheidungsleistungen, denn nur der Körper (nicht die Ent scheidungen) des Monarchen kann als ein sacrum verstanden werden. Die Tötung des Monarchen in der französischen Revolution ist daher als eine der großen historischen Amputationen zu begreifen, die Entscheidungen notwendig macht und mehr und mehr die Sinnfrage aufkommen läßt.«6 Auch deswegen vollzieht sich der eigentliche Bruch zwischen der Tradition und dem modernen Parlamentarismus mit der Französischen Revolution. Es ist die Umstellung von einem Objekt, mehr noch: einem Ding, dem Körper des Monarchen, auf ein System von Versammlungen und Gremien, deren Herrschaftsan spruch nun aus dem »Allgemeinen Willen« der Individuen, ihrer volonté générale, abgeleitet werden soll. Damit das möglich wird, muss sich Politik als eigenständiges, sich selbst organisierendes System ausdifferenzieren. Das macht es notwendig, einen modus operandi für diese Selbstorganisation zu entwickeln und die Entscheidungsgewalt neu zu verteilen. So entstand nicht nur das Problem, wer den Monarchen als Souverän ersetzen sollte, sondern es musste auch ein Verfahren
ParTies
101
7 ibid., S. 350. 8 ibid.,S. 329. 9 vid. Peter Sloterdijk, Sphären III, Schäume (Frankfurt|M.: Suhrkamp, 2004) S. 607.
gefunden werden, die unterschiedlichsten Interessen der jenigen, die noch kurz zuvor Untertanen waren, als gemein samen Willen zu artikulieren und entscheidungsfähig zu machen. Daraus ergab sich das Paradoxon, die mit der Modernisierung einhergehende Individualisierung in Versamm lungen zu organisieren. Denn Individuen verfolgen diverse Interessen, die der Abstimmung bedürfen, wenn es um die Verfassung oder Erhaltung der Gesamtgesellschaft geht. »Daß politische Herrschaft auf die Individualität derer, die vorher ›Untert anen‹ gewesen waren, gegründet wurde, mag zunächst verblüffen und hat in der Tat zu schwierigsten Problemen der organisatorischen Umsetzung geführt, die zum Teil durch eine Veränderung des Verständnisses von ›Repräsentation‹ gelöst wurden.«7 Die durch die Beseitigung des Körpers des Monarchen not endige neue Art der Legitimation greift auf das im Rechts w wesen bereits vorhandene Verfahren der Repräsentation zurück. »Repräsentation heißt dabei zunächst: für andere bindend sprechen zu können; dann aber auch: etwas nicht Anwesendes vertreten zu können, und schließlich: etwas Nichtsichtbares darstellen zu können.«8 In Luhmanns Defi nition sind alle Formen angesprochen, in denen Repräsen tation in Parlamenten in ihrer Doppelbedeutung als funktio nierende Versammlung und architektonisches Monument vorkommt. Die »Vertretung der Nicht-Anwesenden« verweist auf die repräsentative Versammlung und die Repräsentierten, die zumindest physisch nicht präsent sein können, »für andere bindend sprechen zu können« auf die Delegation der Stimme der Individuen an einen Repräsentanten und die »Darstellung des Nichtsichtbaren« auf die Zeichenhaftigkeit, durch welche die Versammlung und ihr Gebäude in der Gesellschaft sichtbar wird. Die Differenzierung des sozialen Systems in individuelle, diverse Interessen und ihre »Rekom bination in ko-operativen Ensembles«, so Sloterdijk, wirft unmittelbar räumliche und architektonische Fragen auf. 9 Denn die Interessen werden zu Stimmen, die aus Gründen der Durchführbarkeit von Debatten und Abstimmungen in Repräsentanten gebündelt werden müssen. Die Stimmen der Einzelnen werden damit durch Wahlen über Mandatare an einen Ort und in einen Raum abgeordnet. Dort sollen sie sich 102
in Versammlungen artikulieren können: Nicht umsonst leitet sich der Begriff des Parlaments von parlare – reden, sprechen, sich verständigen – ab.
10 vid. Artikel 20 des deutschen Grundgesetzes: »Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus«. 11 Niklas Luhmann, S. 357. 12 ibid., vid. S. 355.
Als Gegenbegriff zur Repräsentation fungiert das Volk als die Gesamtheit aller repräsentierten Individuen. In Demokratien geht von ihm alle Staatsgewalt aus10. Demokratie, die die Asymmetrie von Herrschaft, also die Aufteilung in Herrscher und Beherrschte, eigentlich überwinden will, beschreibt damit, so Luhmann, einen Widerspruch: Die Herrschaft des Volkes über das Volk. »Die Paradoxie wird in die Utopie der Unterschiedslosigkeit (Gleichheit) des Unterschiedlichen (des frei durch sich selbst bestimmten Individuums) umgesetzt. Die Kommunikationsform ist dann: Kritik, die sich selbst auf der Basis dieser Prämisse eine Daueraufgabe zuspricht. Sie macht sich strukturell in der Form einer elitären Differenzierung bemerkbar: Nur wenige von vielen befassen sich aktiv mit Kritik und Protest. Nur fehlt diesen neuen maiores et meliores partes die Rückversicherung in der Differenzstruktur der Gesellschaft. (...) Das Volk steigt aus.«11 Die über die Abgabe ihrer Stimmen hinausgehenden Erwartungen der Individuen werden in der öffentlichen Meinung kondensiert. Deren Einfluss auf Entscheidungen ermöglicht dem politischen System eine höhere Beweglichkeit gegenüber den sich zwischen den Wahlen rasch ändernden gesellschaftlichen Anforderungen.12 Doch »Kritik und Protest« beschränkten sich bisher auf eine Minderheit engagierter und informierter Individuen. Die Möglichkeiten der mobilen und über das Internet vernetzten Kommunikation suggerieren eine Resozialisierung der Individualität jenseits der Repräsentation. Jede Stimme kann direkt verbreitet und gehört werden. Entgegen optimistischer Annahmen dürfte aber auch die über diese Kommunikationsformen organisierte öffentliche Meinung noch nicht von der Mehrheit der Individuen gebildet werden; gleichwohl werden deren Beteiligungs- und Eingriffschancen gegenüber den traditionellen Medien (die ja selbst eine repräsentativ organisierte Öffentlichkeit bilden) wesentlich erhöht.
pEopLe
103
13 Peter Sloterdijk, S. 609 f. 14 Marcel Detienne, Comparing the Incomparable (Stanford: Stanford University Press, 2008), S. 82.
Parlament als Plenum Das moderne Parlament verdankt seine Entstehung und Ausformung weniger dem britischen Vorbild, als vielmehr den Generalversammlungen der Französischen Revolution. In diesen entstand nach den ersten mehr oder weniger spontanen Treffen und der Wanderung durch unterschiedliche Tagungslokale sofort eine intensive Diskussion über die räumliche Organisation ihrer Versammlung, die Sloterdijk wie folgt zusammenfasst: »Zur Souveränität der ersten Assemblée, die ihre Arbeit bis zum 30. September 1791 fortsetzte (...) gehört von Anfang an die Freiheit zur ad-hoc-Bestimmung des Tagungslokals – ein Vorgang, der in der Terminologie der Subversiven im 20. Jahrhundert Umfunktionierung heißen wird. Von ihr muß schon wenige Tage später Gebrauch gemacht werden, als der Tiers État eine Zusammenkunft in der Kirche des Heiligen Ludwig zu Versailles improvisierte – es ist die historische Sitzung, auf welcher sich ein großer Teil des Klerus mit dem Dritten Stand vereinigte; dann von Neuem im Herbst 1789 mit dem Umzug der Nationalversammlung in die Pariser Salle du Mànege, die Reitschule der Tuilerien, die hastig für die Bedürfnisse der Konstituante hergerichtet wurde. Im Mai 1793 übersiedelte die Versammlung, jetzt als Konvent, ins Schloß der Tuilerien, wo inzwischen nach den Plänen des Künstlers Gisors ein Sitzungssaal in der Form eines halb elliptischen Amphitheaters mit 700 Sitzen für die Abgeord neten und 1400 Plätzen für Zuschauer eingerichtet worden war.«13 Auf die Umnutzung nahezu beliebiger, rein durch ihre Dimension und Lage geeigneter Räume folgte eine intensive Auseinandersetzung über den Zusammenhang zwischen der Repräsentation des allgemeinen Volkswillens und der räumlichen Anordnung der Abgeordneten. Die Versammlung gleichberechtigter Vertreter des Volkes zur Debatte allgemeiner Anliegen war neu und darf nicht verwechselt werden mit Versammlungen, in denen jeder Beteiligte sich bewusst ist, aus welcher Position in der gesellschaftlichen Hierarchie er sie führt.14 Darin liegt der grund sätzliche Unterschied zwischen einer Volksversammlung und Ständeparlamenten oder Oberhäusern. Zwei Faktoren erschienen der Generalversammlung deshalb von entscheidender Bedeutung: die wechselseitige Hörbarkeit und die wechselseitige Sichtbarkeit aller Abgeordneten. Diese Hervorhebung 104
15 ibid., S. 84 f. 16 ibid., S. 86.
der Person des Abgeordneten war in den klassischen Ver sammlungstypen nicht bekannt, da die Autorität des Redners zumeist über die Vermittlung von Symbolen, an die das Recht, zu sprechen gebunden war, verliehen wurde. »Ever since Homer’s day (...) anyone wishing to speak would advance into the middle and there grasp the skeptron or sceptre that con ferred authority on his discourse, his opinion, or his advice, which was required imperatively to bear on what the Odyssey explicitly calls ›public business‹ (...).«15 In der französischen Nationalversammlung wird nicht nur das Volk souverän, sondern mit ihm das vernunftbegabte Individuum, dessen wachsende Autonomie die treibende Kraft der gesellschaft lichen Rationalisierung ist. Das erste egalitäre Plenum als Vollversammlung der Repräsentanten aller Bürger entsteht aus dieser Entwicklung zur Individualisierung. Obwohl seine räumliche Form letztendlich weitgehend jener klassischer Vorbilder entspricht, war sie nicht das Resultat einer bloßen Übernahme antiker Traditionen, sondern Ergebnis einer Grundsatzdiskussion über die bestmögliche Organisation von Debatte und Konsensbildung. Der Abgeordnete und Architekturtheoretiker Quatremère de Quincy schlug, so Detienne, schon 1791 eine halbelliptische Anordnung der Versammlung vor. Dabei maß er neben den Sichtbeziehungen der Akustik eine besondere Bedeutung zu, denn die Stimme jedes Abgeordneten sollte in normaler Lautstärke gehört werden können. Auf diese Weise sollten die Aggressionen, die mit dem Anheben der Stimme oder schließlich dem Brüllen verbunden sind, vermieden werden. »This was the first time an egalitarian space was suggested, but the explicit request was for all present to be able to see and hear, so that nobody needed to shout for, as one of them pointed out, ›a man who shouts puts himself in a forced state and, that very account, is prone to violence, (...) and he communicates that disposi tion of his to all those listening to him‹.«16 Heurtin weist darauf hin, dass die Vielzahl der Reden in der auf eine möglichst breite Beteiligung angelegten Nationalversammlung die Versammelten schon bald überforderte. Das führte zu der auch von Rousseau unterstützten Anregung, die wechselseitige
poLItbUEro
105
17 Jean-Philippe Heurtin, »The Circle of Discussion and the Semicircle of Criticism«, in: Bruno Latour, Peter Weibel (Hg.), Making Things Public, Atmospheres of Democracy, (Karlsruhe : zkm – Center for Art and Media, Cambridge mass: mit Press, 2005) S. 764 f.
Sichtbarkeit der Abgeordneten für ein Plenum der Blicke zu nutzen, also Übereinstimmung durch den Austausch von Blickbeziehungen herzustellen. So fordert der Jakobiner Sismond am 27. Juli 1792: »›We want no more speeches, no more correspondence, what we want is silent sittings, where each divines from the eyes of the others what is to be done, and where all that is needed is to relate to the expression in those 765 eyes.‹«17 In stummen Sitzungen sollte durch die transparente Unmittelbarkeit der Blicke eine Gemeinschaft der Herzen und des Geistes erzielt werden, die eine tiefer wirkende Willensbildung versprach, als der Versuch, durch den Austausch von Argumenten zu einer Übereinstimmung zu gelangen. Da dieser Vorschlag den Prinzipien rationaler Debatte und der Herstellung von Mehrheiten durch die überzeugende Kraft guter Gründe widersprach, wurde er nicht weiter verfolgt; sein Beispiel zeigt aber, in welcher Breite die Debatte über die Möglichkeiten der Herstellung von Konsens geführt wurde. Historisch hat sich – außer im Einflussbereich des konfrontativen britischen Modells – die Form des Amphitheaters für das Plenum von Parlamenten weitgehend durchgesetzt. Der Halb- oder Dreiviertelkreis ist dadurch zum Symbol für Demokratie und zu deren räumlicher Legitimation geworden, obwohl er keineswegs mehr den Anforderungen eines zeit genössischen, überwiegend »arbeitenden« und weniger »redenden« Parlaments entspricht. Die räumliche Repräsen tation der Versammlung als Gleichverteilung der Abgeord neten scheint wichtiger zu sein, als die funktionalen Erfordernisse des parlamentarischen Betriebs in dem die legislative Arbeit sich zunehmend in Ausschüsse und Arbeitskreise ver lagert. Seit Akustik und Sichtbarkeit in Versammlungsräumen eine Frage der Technik und weniger des Raumes geworden sind und die Sitzungen durch Medien übertragen werden, sind es die Kamerapositionen, die bestimmen, an welche für sie nicht sichtbaren Blicke Parlamentarier sich wenden. Durch die Präsentation jeweils eines Abgeordneten erfährt das Sichtbare gegenüber dem Hörbaren eine weitere Aufwertung, wodurch äußerliche Faktoren wie das Aussehen und die Körpersprache häufig mehr Gewicht bekommen als die in den Reden zunehmend verborgenen politischen Inhalte. Zudem ist diese Kommunikation einseitig, da das zum Publikum 106
18 Matthias Kolb, »Rückkehr der Kapitalismuskritiker«, in: Sued- deutsche Zeitung Nr.99, 28.|29.04.2012, S. 7. »Alles hängt davon ab, was am 1. Mai (…) passiert«, so der amerikanische OccupyVordenker Mark Greif über Führungspersönlichkeiten, Massen mobilisierung und die Kunst der Selbstdarstellung.
zerstreute Volk vor den Empfangsgeräten keine Möglichkeit hat, zu reagieren. Die Verbreitungsmöglichkeiten der indi vidualisierten Massenkommunikation, etwa Twitter oder Facebook, setzen eine Reaktion auf dieses Defizit frei: die Repräsentierten werden präsent. Einerseits hat die Mobilisierung durch die unzensierte und unmittelbare Verbreitung von Ereignissen eine neue Qualität bekommen. Im Unterschied zu den Fernsehreportagen während der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung oder des Vietnamkriegs ist es, so Mark Greif, Vordenker der Occupy-Bewegung, »(...) als würden die Bilder direkt zu uns sprechen.«18 Doch viel entscheiden der ist es, dass die neuen Medien prinzipiell jedem Einzelnen die Teilnahme an der Kommunikation und damit Willens bildung innerhalb des Mediums selbst bieten. Politische Phänomene wie der sogenannte arabische Frühling oder die Unruhen in der Türkei zeigen, dass die Organisation von Volksmengen oder die Artikulation von Protesten sich deshalb wieder des Textes bedienen, weil er als Kurzmitteilung massenhaft versendet und empfangen werden kann. Es entstehen Debatten außerhalb der institutionalisierten Sphäre von öffentlicher Meinung und Politik, die in wesentlich kürzerer Zeit ein wesentlich größeres Publikum erreichen und aktiv einbeziehen, als bisherige Formen außerparlamentarischer Versammlung (wie Demonstrationen, Kundgebungen etc.). Die Reaktion des politischen Systems, etwa in der Person des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan, direkt in diese neuen Formen der Kommunikation einzugreifen, zeigt die Nervosität, die eine solche Verweigerung der Repräsent ation und die mit ihr verbundene Ver schiebung der Machtverhältnisse bei den gewählten Volks vertretern erzeugt.
poPulaTioN
Parlament als Monument Was nach der Französischen Revolution zunächst eine Frage des Versammlungsortes und der räumlichen Anordnung der Repräsentanten war, entfaltete innerhalb kurzer Zeit selbst den Drang zur symbolischen Repräsentation: »(...) von 1789 an wurden zahlreiche Entwürfe für würdige Tagungsgebäude der Nationalversammlung angefertigt, in der Regel aus An107
19 Peter Sloterdijk, S. 610. 20 Etienne Louis Boullée, Architecture. Essais sur l’art, hg. v. Jean Marie Pérouse de Montclos, übersetzt von Rodney Stringer (Paris: Éditions Hermann, 1968), S. 52. 21 Renate Wagner-Rieger, Mara Reissberger, »Theophil von Hansen«, in: Renate Wagner-Rieger (Hg.): Die Wiener Ringstrasse, Bild einer Epoche. Die Bauten und ihre Architekten, Band VIII (Wiesbaden: Steiner, Graz: Böhlau, 1980), S. 115.
laß von akademischen Wettbewerben, die meisten im heroischklassizistischen Stil, nicht wenige bereits in monumentalen Dimensionen, als könne sich die Republik formal nur im Dekor eines römischen Imperiums erklären (...).19 Die Architektur des modernen Parlaments zerfällt also bereits in ihren Anfängen in eine Organisation der Repräsentation und eine Re präsentation der Repräsentation, die sich in Dimension und Dekor auszudrücken versucht. Schon die sogenannte Revo lutionsarchitektur besteht auf einem moralischen Motiv des Monuments, wohl um den Zerfall der alten Ordnung zumindest formal kompensieren zu können. Architektur müsse Charakter haben, so Boullée: »The immediate impression gained is the view of a monument of architecture born of the formation of its whole. The ensuing feeling constitutes its character. What I call putting character into a work is the art of employing in any production all means appropriate and relative to the subject in question – so that the spectator shall experience no other feelings than those which the subject must bear, that are essential to him and to which he is susceptible.«20 Noch hundert Jahre später sahen die Architekten des Klassizismus die relativ neue Bauaufgabe des Parlaments vor allem als Chance, die abnehmende Bedeutung der klerikalen und feudalen Architektur zu kompensieren. So war Hansens Österreichisches Reichsratsgebäude in Wien von Anfang an eher als Monument gedacht, denn als Apparat politischer Repräsentation. »Wenn die Griechen die größte Entfaltung der Kunst im Tempel verwirklichten, die Römer im Forum, die christliche Zeit in Kirchen, ›so ist in unserer Zeit ein neues Monument hinzugekommen, wo sich die Aufmerksamkeit der Völker concentriert: das Parlament‹.«21 Folgt man diesem Gedanken, so ist ein Parlament als griechischer Tempel, wie der Reichsrat in Wien, eine Art altes Monument als neues Monument, was viel über die Bereitschaft und die Kompetenz aussagt, sich mit den raumorganisatorisch völlig neuen Anforderungen dieser Bauaufgabe auseinanderzusetzen. Die einheitsstiftende, symbolische Kraft des Monuments in den Vordergrund zu stellen, entsprach dabei der wenig entwickelten österreichischen Demokratie in einer zerfallenden, multinationalen Monarchie. Hansen ging es beim Österreichischen Reichsrat um die »Aufmerksamkeit der Völker« und die 108
22 vid. Emil Kaufmann, Von Ledoux bis Le Corbusier, Ursprung und Entwicklung der autonomen Architektur (Leipzig, Wien: Rolf Passer, 1933). 23 Theophil Hansen, zit. nach Renate Wagner-Rieger, Mara Reissberger S. 115. 24 Henri Lefebvre, The Production of Space, (Oxford: Blackwell Publishing, 1991), S. 220. 25 ibid.
ästhetische Verblendung eines rationalen Typus von Macht, und weniger um die möglichst wirkungsvolle Organisation einer gesetzgebenden Versammlung. Wenn, wie Kaufmann meint, die Moderne mit der Revolutionsarchitektur beginnt, dann könnte man Historismus und Klassizismus als eine erste Postmoderne verstehen, in der der Schein wieder wich tiger wurde als das Sein, indem das Bild und damit die Repräsentation sich vor die Nutzung schiebt.22 Das würde auch erklären, warum Hansen einen Überfluss an plastischer und malerischer Ausstattung für notwendig erachtete, die aus dem Reichsrat eine Art begehbares Bilderbuch machte. »›Die Architektur an und für sich, wenn auch noch so richtig und gefällig durchgeführt, wird bei diesem Bauwerk für sich allein nicht die Befriedigung gewähren, welche sie im Verein mit ihren Schwestern, der Skulptur und der Malerei hervorzurufen im Stande ist‹.«23 Die geschichtliche Funktion von Monumenten, so Lefebvre, war es, für alle Mitglieder einer Gesellschaft ein Bild dieser Mitgliedschaft zu erzeugen. Monumente waren »representations of space and representational space« in
posTdEmocRacy
einem.24 Sie fungierten als kollektive Spiegel und dienten letztendlich der Erzeugung eines Konsenses »(...) and this in the strongest sense of the term, rendering it practical and concrete.«25 Das Monument konnte, auf einer praktischeren und konkreteren Ebene als etwa die politische Willensbildung, Übereinstimmung erzeugen, indem sich jeder in ihm erkannte. Im 20. Jahrhundert, so Lefebvre, sind Monumente nicht länger nur Symbole oder Zeichen, aber auch nicht mehr nur Objekte oder Ansammlung von Objekten. Sie sind bestimmt durch das, was in ihnen stattfinden kann und werden zu einem Möglichkeitsraum für Ereignisse, der erst durch seine Nutzung zur Wirkung kommt. »A monument is neither an object nor an aggregation of diverse objects, even though its ›objectality‹, its position as a social object, is recalled at every moment, perhaps by the brutality of the materials or masses involved, perhaps, on the contrary, by their gentle qualities. It is neither a sculpture, nor a figure, nor simply the result of material procedures. The indispensable opposition 109
26 ibid., S. 224. 27 Peter Sloterdijk, S. 614. 28 ibid., S. 619 f.
between inside and outside, as indicated by thresholds, doors and frames, though often underestimated, simply does not suffice when it comes to defining monumental space. Such a space is determined by what may take place there, and con sequently by what may not take place there (prescribed|proscribed, scene|obscene).«26 Ein Monument ist ein soziales Objekt, dessen Dinglichkeit immer präsent ist, aber erst dadurch wirksam wird, dass sie einen Raum einräumt für Ereignisse, die Gemeinschaft stiften: Es ist ein Bühne (»scene«). Die dieser Definition zugrunde liegende Theorie der sozialen Produktion von Raum machte Lefebvre zu einem der Weg bereiter der außerparlamentarischen Opposition im Europa der Sechzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts. In deren Gefolge entstanden einerseits neue politische Parteien, andererseits aber auch neue Formen der politischen Partizipation, des bürgerlichen Widerstands und Volksbegehrens. Die Architektur allerdings beschränkt sich in dieser Interpretation auf die Bereitstellung von Kontexten für soziale Ereignisse, mit einem ähnlichen Wirkungsverlust, wie ihn die Reduktion auf Zeichen mit sich bringt. Die Inszenierung – um beim Bild des Theaters zu bleiben – des Verhaltens der Beteiligten wird wichtiger als deren objektive räumliche Ausstattung und Repräsentation. Ähnliche Probleme hatte schon die französische Nationalversammlung, als sie versuchte, echte Vollversammlungen einzuführen27. Ein solches Plenum war zur damaligen Zeit nur durch die Anwesenheit aller Stimmbe rechtigten möglich, und solche Massenveranstaltungen erwiesen sich als kontraproduktiv für die Herstellung eines »Allgemeinen Willens« (Volonté générale). Das Projekt des Föderationsfests von 1790 machte klar »(...) dass es die ›Masse‹, die ›Nation‹ oder das ›Volk‹ als Kollektivsubjekt nur in dem Maß geben kann, wie die physische Versammlung dieser Größen zum Gegenstand kunstgerechter Inszenierung wird – von der Mobilisation zur Teilnahme über die Affektregie im Stadion und die Bindung der ›Massen‹aufmerksamkeit durch faszinogene Spektakel bis zu der vom Bürgergardisten überwachten Auflösung der heimkehrenden Menge.«28 In solchen Fällen tritt die Architektur gegenüber der Organi sation der Teilnehmer zurück und wird als Stadion zum bloßen Behälter, der allenfalls zur Komprimierung der 110
29 ibid., S. 621. 30 Levi R. Bryant, The Democracy of Objects (Ann Arbor: Open Humanities Press, 2011), S. 21 f. 31 vid. Bruno Latour, Das Parlament der Dinge Für eine politische Ökologie (Frankfurt|M.: Suhrkamp, 2010). 32 ibid., S. 236 f.
Versammelten und als akustischer Verstärker benötigt wird. Denn zum einen entwickeln Massen eine eigene Dynamik, zum anderen animieren sie zu aggressiver Agitation, die den Austausch von Meinungen nahezu unmöglich macht. In solchen Situationen entsteht dann die schon von Rousseau befürchtete »Autopoiesie des Lärms«, denn: »Wo eine diskrete Abstimmung nicht möglich ist, führt auch die kollektive Abbrüllung zu psychopolitisch relevanten Ergebnissen.«29 Parlament als Objekt Doch unabhängig von ihrer Nutzbarkeit und Monumentalität sind Gebäude, und also auch Parlamente, Objekte. Sie be setzen einen bestimmten Ort, haben eine Masse, Materialität und eine Reihe weiterer Eigenschaften, die nicht durch Wahrnehmung oder gesellschaftliche Interaktion hergestellt sind. Lefebvres Monument ist ein soziales Objekt und dadurch abhängig von seiner Produktion durch soziale Interaktion. Aber Objekte sind autonom, so die Theoretiker der Objekt ontologie wie Bryant und Harman, und lassen sich nicht auf Repräsentation reduzieren, denn »(...) this frame of thought treats the object in terms of the subject. The object here is not an object, not an autonomous substance that exists in its own rights, but rather a representation. As a consequence of this, all other entities in the world are treated only as vehicles for human contents, meanings, signs, or projections.«30 Latour, einer der wichtigsten Vertreter der objektorientierten Philosophie, spricht von einem »Parlament der Dinge«, in dem keine Objekte, sondern »nicht-menschliche Wesen« gleichberechtigt mit handelnden Individuen vernetzt sind.31 »Das Ziel des Spiels besteht nicht darin, Subjektivität auf Dinge zu übertragen oder Menschen als Objekte zu behandeln oder Maschinen als soziale Akteure zu betrachten, sondern die Subjekt-Objekt-Dichotomie ganz zu umgehen und stattdessen von der Verflechtung von Menschen und nichtmenschlichen Wesen auszugehen.«32 Interessanterweise bezieht sich auch Bryant auf eine Metapher der Versammlung, indem er seine zentrale theoretische Abhandlung zur Ontologie von Objekten The Democracy of Objects nennt. Darin geht er allerdings noch einen Schritt weiter als Latour und besteht darauf,
pOveRty
111
33 Levi R. Bryant, S. 62 f. 34 Marcel Detienne, S. 91.
dass Objekte ihre Eigenschaften nicht aus ihren Relationen zu Menschen oder anderen Objekten beziehen, sondern selbst deren Grund sind. Denn die Frage der menschlichen Wahrnehmung von Objekten sei keine Frage über deren Sein, sondern lediglich eine über unseren Zugang zu ihnen.33 Eine solche Betrachtungsweise würde architektonischen Monumenten wie Parlamentsgebäuden eine Wirkung zusprechen, die vor ihren Eigenschaften als Symbol und Behälter läge. Sie würde vor der Sphäre der Repräsentation bei der Präsenz von Objekten ansetzen und könnte erklären, warum diese Bauten im Falle von Demonstrationen und Volksauf ständen zu einem bevorzugten Ziel der Besetzung werden. Denn dieser physisch-räumliche Vorgang könnte, anders als die Demonstration, die sich gegen die Repräsentation richtet und, wie schon ihr Name andeutet, auf symbolischer Ebene agiert, als eine Interaktion von Objekten (Körpern) mit einem Objekt gelesen werden. Das widerspricht der herkömmlichen Interpretation des symbolischen Charakters solcher Aktionen. Natürlich bekommt jede Handlung, wie auch jedes Objekt, in einer sozialen Kommunikation Bedeutungen zugewiesen. Doch Besetzer, so könnte man annehmen, wollen ursprünglich weder das Symbol umdeuten, noch den Versammlungsraum nutzen oder umnutzen, sondern als Objekte auf ein Objekt wirken. Denn die physische Besetzung von Orten durch Objekte ist mit den frühesten Formen der Versammlung verbunden und wurde zum Ursprung dessen, was heute noch Stadt heißt. »Just as an orator holding a sceptre would advance to the central point of the assembly, those Greek warriors, on their return from a victorious expedition, would make their way to the same central point to lay down their booty, known as the ›common fund‹ and consisting of items possessed in common, all of which would be designated by the word that, at the political level, would come to mean ›city‹, or to be more precise, a place of politics.«34 Während in verbalen Sprachen objektlose Zeichen zu kom plexen Strukturen verbunden werden, bleibt Architektur objektgebunden, damit schwerfälliger und auf einem niedrigeren Abstraktionsniveau. Eine Sprache der Architektur kann auch deshalb nicht primär als Zeichensystem angelegt werden, weil Zeichen an sich raumlose Formen sind. Deswegen 112
35 Graham Harman, Circus Philosophicus (Winchester uk, Washington usa: Zero Books, 2010), S.74.
ist die ausschließliche Gleichsetzung architektonischer Formen mit Zeichen irreführend. Architektonische Formen sind zunächst Objekte und wirken durch Präsenz, nicht durch Interpretation. »While the fashionable doctrine today is that things are real only by virtue of having effects, in fact the re verse is true: they can have effects because they are real.«35 Versteht man Architektur als komplexes soziales System, so kommunizieren in ihr Bewegungsformen von Körpern mit Formbewegungen anderer raumbildender Objekte. Die ent stehenden architektonischen Formen sind primär durch die Unterscheidung zwischen Innen und Außen definiert, welche vermittels Schließung und Erschließung geregelt wird. Auch das architektonische System Parlament kann nach dieser Definition mehr oder weniger anschlussfähig für seine Nutzung sein. Wie das Beispiel der Wettbewerbsausschreibung für den Umbau des Österreichischen Nationalrats von Hansen zeigt, sind eine erhöhte Zugänglich- und Erreichbarkeit ein zentraler Anspruch parlamentarischer Arbeit, sowohl für die politisch-administrativen Abläufe, als auch für die Einbeziehung der Öffentlichkeit.
PrEsIdeNt
Protest artikuliert sich zumeist im vorarchitektonischen Raum, als Versammlung von Individuen an öffentlichen Orten. Doch auch die räumliche Kommunikation zwischen Ort und Versammlung beginnt auf der Ebene von Körpern. Wie die jüngsten Beispiele aus New York, Kairo und Istanbul zeigen, führen deren Bewegungsformen relativ unmittelbar zum Anschluss von Form bewegungen: Es entstehen provisorische Architekturen wie Zelte, Bühnen, Stände, Buden. Deshalb erscheint es nicht nur logisch, sondern zwingend, dass jüngste Formen des politischen Widerstands den öffentlichen Raum nicht nur benutzen, sondern zu dessen Besetzung aufrufen und sich sogar danach benennen: Occupy. Sie reagieren damit auf einen Verlust, der offensichtlich durch eine physische, nicht bloß symbolische Reorganisation kompensiert werden soll. Die zunehmende Privatisierung des öffentlichen Raums, die gated communities der Wohlhabenden und die Aufrüstung der Grenzen zwischen armen und reichen Ländern sind nur möglich mit einem Instrument arium an Grenzen, Zäunen und 113
Mauern, die als physische Barrieren gegen die andrängenden Körper der Auszuschließenden eingesetzt werden. Auf diese Formen der Präsenz reagiert die Besetzung, als Bewegung von Objekten, in diesem Fall Menschen, die gegebenenfalls entfernt werden müssen, um den besetzten Ort beziehungsweise das besetzte Objekt aus dieser Interaktion zu befreien. Da Orte Voraussetzung für jede menschliche Zusammenkunft sind, wird mit deren zunehmender Privatisierung das egalitäre Prinzip, das seit der Französischen Revolution Grundlage der politischen Willensbildung ist, in Frage gestellt.
36 Matthias Kolb, S. 7. 37 Wobei in diesem besonderen Fall die Fläche auf einem gesonderten Grundstück liegt.
Die nicht mehr funktionierende Repräsentation schlägt sich auch räumlich nieder; vielleicht hat das Versagen von Politik und Architektur den gleichen Ursprung. Die Versammlungsfreiheit jenseits der Repräsent ation, die physische Versammlung, ohne die anscheinend die virtuelle nicht auskommt, wählt nicht das Parlament, nicht die Architektur, sondern den öffentlichen Raum, den Platz, die Straße oder den Park zu ihrem Ort. »Das wichtigste Mobilisierungsinstrument in den frühen Zeiten von Occupy wie auch in Kairo und Madrid war wie schon so oft in der Geschichte der physische Ort. Das Miteinander gab dem Protest die Energie.«36 Die Repräsentation der Nicht-Repräsentierten verlagert ihre Versammlungen in den öffentlichen Raum. Sie beginnt auf der Ebene von Objekten, auch wenn sich ihre Organisation und Kommunikation über die neuen sozialen Medien ent wickelt. Wie bizarr das Nebeneinander dieser verschiedenen Modi der Interaktion sein kann, zeigt das Beispiel der kon kreten und medialen Entstehung der Occupy-Bewegung im Zuccotti-Park in Manhattan. Dieser scheinbar öffentliche Raum ist nicht das Ergebnis kommunaler Planung, sondern verdankt seine Existenz der Veränderung des New Yorker Baurechts Anfang der 1960er-Jahre. Seitdem kann bei einem Neubau die zulässige Gebäudehöhe überschritten werden, wenn als Kompensation ein Teil des zu bebauenden Grundstücks öffentlich zugänglich gemacht wird. Dieser Raum bleibt jedoch im privaten Eigentum, ist also nicht wirklich öffentlich, sondern ein privately owned public space (pops). So entstand 1968 im Tausch gegen zusätzliche Geschosse für ein neues Hochhaus des us-Steel-Konzerns der Liberty Plaza Park als »öffentliche Grünfläche im privaten Eigentum«37. 114
38 vid. Lisa W. Foderaro, »Privately Owned Park, Open to the Public, May Make Its Own Rules.« in: The New York Times,13.10.2011, S. A26. 39 Levi R. Bryant, S.69.
Nachdem die Immobiliengesellschaft Brookfield Office Properties das Gebäude im Jahr 2006 übernahm, wurde der dazuge hörige Park aufwendig restauriert und nach deren Vorstandsvorsitzendem Zuccotti benannt. Wahrscheinlich ohne genau zu wissen, dass es sich um ein Privatgrundstück mit nur ein geschränkten öffentlichen Nutzungsrechten handelte, be setzten Aktivisten auf dem Höhepunkt der Finanzkrise diesen »Park«, der einer der wenigen öffentlichen Orte in Downtown Manhattan zu sein schien, aber den Namen des Vorstands vorsitzenden der Immobiliengesellschaft trägt, der er gehört. Absurderweise kam das paradoxe Rechtskonstrukt des Parks den Besetzern zugute. Da dort weder die städtische Parkverordnung, noch das Hausrecht des Eigentümers gilt, gab es keine rechtliche Handhabe, sie zu vertreiben. Die New York Times überschrieb einen Artikel zum Zuccotti-Park deshalb mit Privately Owned Park, Open to the Public, May Make Its Own Rules.38 Vielleicht zeigt sich hier, was Bryant im übertragenen Sinne meint, wenn er von einer »Demokratie der Objekte« spricht, die eine Erweiterung der Definition der Akteure auch im politischen Prozess notwendig machen würde:
pRoTectoRatE
»Consequently, we must not say that an object has its qualities or that qualities inhere in an object, nor above all that objects are their qualities, but rather in a locution that cannot but appear grotesque and bizarre, we must say that qualities are something an object does.«39
115
Peter Androsch Gegner, Personen, Wesen Gedanken zum Parlament als agonistischer Raum
1 vid. http://www.social net.de/rezensionen/ 10657.php, (02.04.2014)
Der Begriff des agonistischen Raums, wie ihn Chantal Mouffe und Ernesto Laclau in ihren Arbeiten geprägt haben, trägt in sich die grundsätzliche Anerkennung des Gegners, die Akzeptanz seiner Existenz. Aus antagonistischen »Feinden« sollen agonistische »Gegner« werden, die gerade durch den unversöhnlichen Kampf um Hegemonie verbunden und nicht getrennt sind. Indem sie sich einen gemeinsamen symbolischen Raum teilen, fühlen sie sich derselben politischen Gemeinschaft zugehörig und anerkennen daher die Legitimität ihrer Opponenten. Der Verzicht auf das Ziel der totalen Herrschaft, also auf die Vernichtung des »Feindes«, prägt diesen agonis tischen Raum.1 Reden Diese Akzeptanz muss eine Akzeptanz des Gegners als Person sein. Die Person ist ein klingendes Wesen, ein »Durch-Klinger« wie es wörtlich im Lateinischen heißt. (Wobei die persona die Maske des Schauspielers war, durch deren Mundöffnung das Wort entweichen konnte.) Im agonistischen Raum wird der Gegner daher als etwas Klingendes anerkannt und wahrgenommen. Wesentlich ist, dass Schallwellen in die Person eindringen und aus der Person austreten. Wesentlich ist also, was klingt. Wesentlich ist, was Stimme hat: das zoon phonetikon. Sei es der Dornbusch, sei es der Wolf, der Spiegel, der Wind, oder was auch immer – wie viele Beispiele aus der Kulturgeschichte zeigen. Ein Wesen muss klingen, und nur was klingt, und nur was redet, was stimmt, ist wesentlich. Im antagonistischen Kampf geht es dagegen um die Auslöschung des Feindes und damit um die Auslöschung seines Klangs: um das »Mundtotmachen«. Dem Feind wird abgesprochen, eine Person zu sein.
116
Hören Gleichzeitig ist die Person auch ein zoon akustikon, ein hörendes Wesen, das den eindringenden Klang, die eindringenden Schallwellen aufnimmt und verarbeitet. Der Entwurf des agonistischen Raums bedingt, den Gegner – so wie sich selbst – als hörende Existenz zu akzeptieren. Denn nur so ist der Gegner in der Lage, das Sprechen der anderen aufzufangen, aufzunehmen. Wahrzunehmen? – Vielleicht, jedenfalls ist die Aufnahme von Schallwellen und deren Dechiffrierbarkeit notwendig, um den Opponenten überhaupt zu erkennen. Im antagonistischen Kampf dagegen ist die Fähigkeit des Hörens zweitrangig. Denn ob der Feind eine Meinung wahr nehmen kann, ist beim Ziel seiner Auslöschung unerheblich. Hier ginge es vor allem um das »Taubmachen«. Erinnern Den Klang des anderen aufzunehmen, bedeutet aber auch, an ihn denken zu können. Denn nichts anderes ist denken, als den gedachten Klang eines gedachten Wortes zu memorieren. So wie ein Kind die Sprache als Nachahmung des erlauschten Klanges sich selbst erschafft, so bleibt »(über etwas) denken« immer, einen Klang als Repräsentation in einen inneren Raum zu stellen, zu er-innern. Der innere Raum spiegelt den äußeren Klangraum als Vor-stellungs-raum, als Reflexion, als Klangpositiv. So gesehen ist der agonistische Raum auch ein Erinnerungsraum. Im antagonistischen Raum geht es dagegen um die Auslöschung der feindlichen Existenz und dann um die Aus löschung der Erinnerung an sie.
pUBLIc
Orientieren Der agonistische Raum bedingt mit der Akzeptanz des Gegners als Person auch die Akzeptanz seiner Position. Denn der Oppo nent kann nur als solcher fungieren, wenn seinein Relation zur eigenen Position im Raum erkennbar ist. Somit ist die Kenntnis des Raumes in allen seinen relevanten Eigenschaften die Bedingung für die Positionierung respektive Oppositio nierung. Die Wahrnehmung von Volumen, Form, Material und Oberfläche des Raums braucht es, um Verhältnisse und 117
Beziehungen herstellen zu können. Position und Opposition sind also räumliche Zuordnungen, die das zoon akustikon vornimmt, und zu denen es sich verhält und auf welche es sich bezieht. Und wie nimmt es sie wahr? Primär durch Schall, durch Reflexion von Schallwellen an den Raumbegrenzungen. Der agonistische Raum ist gekennzeichnet durch vielfältige Reflexion. Er bietet dem hörenden Wesen eine klare Orientierung. Im antagonistischen Raum dagegen ist die Desorientierung des Feindes Gebot, nicht zuletzt durch Verunklärung von Posi tionen, Verhältnissen und Beziehungen durch Schallreflexion.
2 vid. Peter Androsch, Florian Sedmak, Jürgen Wiesner, »Das menschengerechte Schallwellenmeer. Von der Lärmvermeidung zur Akustischen Raumplanung«, in: Informa tionen zur Raumentwicklung, Heft 3, 2013 (Bonn: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, 2013).
Souveränität Die Akzeptanz des Gegners bedeutet also die Akzeptanz eines Wesens, dem folgende Potenzen räumlich und zeitlich zugebilligt werden: Reden, Hören, Erinnern, Orientieren. Aber die unaufgehobene Gegnerschaft im agonistischen Raum erfordert unentwegte Positionierungen, also das Wissen, wo der Gegner sich aufhält und wo er sich nicht aufhält. Dieses Wissen ist das Wissen über die nicht einsichtigen Teile des Raumes, also über das »hinter dem Rücken«. Und dieses Wissen liefert Schall, genauer gesagt – auch hier – die Schallreflexion an den Raumbegrenzungen.2 Ohne vielfältige Reflexion entsteht Unsicherheit mit allen vorhersehbaren Folgen wie Gereiztheit und Aggression. Neben Reden, Hören, Erinnern und Orien tieren macht daher nur dieses Wissen die Person souverän, selbstbestimmt, also sicher über die räumlichen Beziehungen. Der antagonistische Raum verweigert die grundlegenden Informationen über den nicht einsichtigen Raum. Er verhindert, dass wir »um die Ecke« und rundum hören können, und verunsichert dadurch existenziell. Parlament Auch wenn der agonistische Raum als symbolischer – auch innerer? – Raum gedacht wird, ist er als Ausgangspunkt für Überlegungen über die Bauform des Parlaments ergiebig. Denn die Notwendigkeiten, die sich aus der Akzeptanz des Gegners ergeben, bedingen das Programm für die räumliche Gestaltung. Ein Parlament muss Reden, Hören, Erinnern, Orientieren und personale Souveränität auf höchstem Niveau ermöglichen. Und das bedeutet den Primat der Akustik als Gestaltungs prinzip des parlamentarischen Raumes.
118
Wie kann gewährleistet werden, dass die Rede eines (einzelnen) Menschen von vielen anderen gehört und verstanden wird ? Die antiken Architekten wussten dafür zu sorgen. Ihre Strategien für Tempel und Amphitheater legten zu allererst Wert auf die Verständlichkeit der Sprache, ob vom zoon politikon, dem Schauspieler, oder dem von den Göttern erzählenden Priester. Ganz anders in Romanik und Gotik: Der gregorianische Choral sollte sich wie ein göttliches Fluidum in den Raum ergießen. Denn die Ortung der Quelle des Schalls wäre schon Anmaßung gegen Gott gewesen, weil die Quelle ja er selbst wäre. Er durfte aber nicht geschaut und erkannt, also personalisiert werden. Hier ging es um das Gegenteil als in der Antike, also explizit nicht um Sprachverständlichkeit, sondern um Überwältigung durch das Mysterium. So gesehen ist der gregorianische Raum ein autoritärer, antagonistischer. Aber unabhängig ihrer Zielsetzungen wussten diese Archi tekten, dass Schall durch die vier Instrumente Volumen, Form, Material und Oberfläche gestaltet wird und Schalleigenschaften immanente Raumeigenschaften sind. Die meist simplen und banalen Konzepte der heutigen Bau- und Raum akustik wollen keine akustischen Ziele erreichen, sondern sind vor allem Verhinderungs strategien.3 Denn den revolutionären Veränderungen von Baumaterialien und -methoden wird selten Rechnung getragen. Große, harte Flächen aus Glas, Beton, Metall oder beschich tetem Holz zeitigen akustisch problematische Wirkungen: einerseits unerwünschte Verstärkungseffekte, andererseits uniforme Schallreflexionen und damit mangelhafte Raum information. Dem wird versucht beizukommen durch – meist an der Decke angebrachte – große, Schall absorbierende Flächen. Durch hoch reflektierende versus hoch absorbierende Flächen entstehen »extremistische« Sphären, die den Raum akustisch verzerren und einer anthropologischen oder gar »inklusiven Akustik« Hohn sprechen. Auch wenn Nachhallzeit und Lautstärke damit – auf dem Papier – auf ein genehmigungsfähiges Maß gebracht werden, entstehen Räume, die nicht der agonistischen Auseinandersetzung dienen, sondern dem »Mundtot- und Taubmachen«, der Desorientierung und der Verunsicherung.
pYrAMid
3 vid. Peter Androsch, »Wir schützen uns zu Tode. Schallschutz ohne Ende oder akustische Raumplanung?« in: Lärmbekämpfung. Zeitschrift für Akustik, Schallschutz und Schwingungstechnik. Organ der Deutschen Gesellschaft für Akustik (dega) Nr. 2|11, (Düsseldorf: Springervdi-Verlag, 2011).
119
4 vid. Antonio Gramsci, Gefängnishefte (Hamburg: Argument, 1991 – 2002). Gramscis Theorie kann als gemeinsamer Bezugspunkt der Idee des agonistischen Raums und der Idee der akustischen Hegemonie angesehen werden: »…Und de facto lag die Bedeutung von Gramsci für uns darin, dass er uns erlaubte, einen nicht ökonomistischen Marxismus auszu arbeiten ...«, meint Chantal Mouffe in einem Gespräch mit Ian Angus. vid. http://www. episteme.de/htmls/ Mouffe-LaclauHegemonie-Macht. html (02.04.2014). 5 vid. Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft (Frankfurt| M.: Suhrkamp, 1982). 6 Jacques Attali, Noise: The Political Economy of Music (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985).
Herrschaft: Theorie der akustischen Hegemonie Wenn also der akustische Raum, und damit der architekto nische, in der Lage ist, mundtot, taub, desorientiert und verunsichert zu machen, dann rücken Schall und Raum un vermittelt in den Fokus der politischen Betrachtung: als Sphäre, Medium und Instrument von Herrschaft. Das akus tische Ereignis breitet sich horizontal und vertikal zu einer Klangsphäre aus, ohne die gesellschaftliche Hegemonie nicht grundgelegt und entfaltet werden könnte. Gäbe es eine Theorie der akustischen Hegemonie, dann würde sie sich vornehmen, im Akustischen die Spuren der Herrschaftsverhältnisse in der Gesellschaft zu erkennen und die feinen Klanggewebe sichtbar zu machen, die sie ausmachen und in welchen sich die Gesellschaft verhaspelt und verhängt und der Einzelne zappelt wie in einem Spinnennetz. Eine Theorie der akustischen Hegemonie würde sich einreihen in eine Trias aus der »Theorie der kulturellen Hegemonie« von Antonio Gramsci4 aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts, aus Pierre Bourdieus »Die feine Unterschiede «5 und würde diese fortschreiben im Hörbaren, als Rekapitulation des gesellschaftlichen Status des Einzelnen im Klang. Hier sähen wir auch Jacques Attalis Repräsentationsgedanken 6, ausgedrückt über die Epochen der Geschichte bis zur lähmenden Lärmfrage der Gegenwart und den immer gleichen Hintergrundmusiken im kapitalistischen Waren- und Dienstleistungsgetriebe. Und immer wieder kämen wir auf der Suche nach der Herrschaftspotenzialität akustischer Ereignisse zum Kern, zur Magie des Klangs. Er wirkt mit und gegen die Zeit, a-, ja, antichronologisch. Klang deutet mit der und gegen die Zeit. Ein Ton deutet den vorhergehenden (um), genauso wie ein Wort am Ende des Gedichts den Sinn des Vorhergehenden umkehren kann. Ganz pragmatisch: Schall verbindet Raum und Zeit. Er informiert mit einer Geschwindigkeit von 343m|sek über Orte im drei dimensionalen Raum, die wir durch die Auswertung der Schall-Laufzeit identifizieren können. Und Klang informiert uns auch über Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsver änderung (Extrembeispiel: Dopplereffekt). Er informiert – bewertet also, bringt in Form – über Ereignisse, die vorbei sind. Sein Bedeutungsraum dehnt sich also mit der Zeit und gegen die Zeit aus. 120
7 vid. Klaus Theweleit, Männerphantasien Band 1 – Frauen, Fluten, Körper, Geschichten (München: Piper, 1995). 8 vid. Peter Androsch, »Im Schallwellenreich«, in: SpurenMusikzeitung für Gegenwart ( Schwaz: 2010).
Das Schallwellenmeer Die Luft, die uns umgibt, schwingt als beständiges Schall wellenmeer. Imposante siebzehneinhalb Meter Länge hat die tiefste Schallwelle, die der Mensch hören kann. So lange wie vier pkw oder ein großer Truck! Das Schallwellenmeer in seiner Räumlichkeit und Körperlichkeit schafft, strukturiert und vermittelt Raum und stellt in ihm Beziehungen im ursprünglichen Sinne her. Durchaus ähnlich zu denken wie Theweleits Flüssigkeitsparadigma.7 Wir nehmen aber nicht bewusst wahr, dass wir in diesem Schallwellenmeer schwimmen wie Fische. Auch denen ist die Existenz des Fluidums nicht bewusst. Gäbe es eine Theorie der akustischen Hegemonie, dann sähen wir die Verantwortung jener Schallwellenschöpfer, die unsere personale Existenz bestimmen, von unserer akustischen Lebensumgebung bis zu unserem Denken, das wir als gedachten Klang des gedachten Wortes in unseren Köpfen tragen.8 Somit ist die Gestaltung dieses Meeres eine hegemoniale Tätigkeit. Diese führen zu einem großen Teil Architekten aus, weil sie die Bedingungen der Wellen formen, indem sie die Begrenzungen des Meeres formen. Wie in einem Lavoir, in dem das Wasser schwappt: Nichts anderes passiert mit Schall im Raum. Und der Mensch ist mitten drinnen existenziell davon abhängig.
RacIAL
Hörsamkeit: Schall, Körper, Raum Wallace Clement Sabine (1868–1919) versuchte, die »Hörsamkeit« von Räumen zu verbessern, wofür er als Erster Kenngrößen für akustische Phänomene entwickelte. Die Sabine’sche Gleichung für die Nachhallzeit ist eines der wichtigsten Werkzeuge für die quantitative Beschreibung der Akustik eines Raumes. Im 20. Jahrhundert wuchs die Überzeugung, dass die Welt des Klangs mittels elektroakustischer Apparate steuerbar würde. Mikrophone, Recorder, Verstärker und Lautsprecher hielten Einzug in Auditorien, Fabriken, Büros, aber auch in Privatwohnungen. Gleichzeitig wuchs die Überzeugung, dass die Methode von Sabine die Akustik von Räumen mess- und prognostizierbar mache. Diese Überzeugung blieb nicht ohne Folgen: Während sich die technische, quantitative Akustik entwickelte, verkam 121
9 Bell war ein Gehör losenlehrer, der als (Mit)-Erfinder des Telefons gilt. Dezibel, die Einheit für Schalldruck, setzt sich zusammen aus Dezi und bel. Diese Silbe geht eben auf den Schotten Bel(l) zurück, weil Dezibel erstmals in der Telefonie als Maß verwendet wurde. Heute wird das Dezibel – vor allem in der Form von dB(A) – als Maßeinheit für »Lärm«Messungen herangezogen.
die Architektur zur tauben Disziplin. Die Bundesrepublik Deutschland errichtete nach 1945 gleich zwei Mal ein Parlament, das seinem eigentlichen Zweck, dem Reden, nicht gerecht wurde. Sowohl der Bau von Günter Behnisch in Bonn – »Das größte Elend aber bietet die Akustik«, Spiegel 1993 – als auch der Reichstag in Berlin sind akustisch mangelhafte Bauten. Sie stehen exemplarisch. Sie müssten die höchsten akustischen Standards aufweisen, um auch die höchsten demokratischen Standards erfüllen zu können. Und sind nicht sanierbar. Da wären wir bei Alexander Graham Bell (1847–1922) 9, nach dem die Maßeinheit Dezibel benannt ist. Die technische Akustik schreibt Schallabsorber meist deswegen vor, weil durch Reflexion an Glas, Beton, Metall und beschichtetem Holz eine Vervielfachung der Lautstärke evoziert wird. Dadurch würden die Bauten nicht mehr genehmigungsfähig. Deshalb werden Absorber(flächen) mit den reflektierenden Flächen »gegengerechnet« zu Werten, die in der Realität gar nicht existieren. Insofern hat Dezibel einen eminenten Einfluss auf die mangelhaften Innenverhältnisse. Entgegen einem weit verbreiteten Irrtum nützt die Oberflächen-Nachrüstung nichts, einfach weil akustische Be dingungen durch Volumen, Form, Material und Oberfläche gestaltet sind. Nein, es wird meist noch schlimmer, weil durch extreme Absorption Orientierungsmöglichkeit durch Reflexion verloren geht. Darum behindern solche Bauten blinde oder sehbeeinträchtigte Menschen, sie verlieren eine widerspruchsfreie Sinnesintegration (vgl. Seekrankheit). Den anderen tut es auch nicht gut. Damit ist einmal mehr gezeigt, dass architektonische von akustischer Gestaltung nicht zu trennen ist. Demokratie »Eine Stimme haben und Gehör finden«, könnten wir als den essenziellen Wert einer Demokratie ansehen. Dieser Wert sollte für alle gelten und allen zugänglich sein. Es braucht also eine weit gefasste akustische Barrierefreiheit, noch besser eine »inklusive Akustik«. Sie müsste von Beginn an daran denken, dass alle Menschen – seien sie alt, krank, jung, schwach, stark, beeinträchtigt – im Raum reden, hören, denken, sich orien tieren und souverän bewegen können. Eine anthropologische 122
10 vid. http://www.grund risse.net/grundrisse26/ VonderHarmlosigkeit radikalerDemokratie. htm (03.04.2014).
Bau- und Raumakustik müsste die Verantwortung für die akustischen Verhältnisse an die Architektur zurückgeben. Als Kind der Akustik ist sie dieser Aufgabe sicher gewachsen: agonistische Räume zu schaffen, in welchen selbstbestimmte Personen ihre gesellschaftlichen Anliegen verhandeln und eine gemeinsame Wirklichkeit erkämpfen können. Oder sollte es vielleicht gar um eine ganz andere Frage gehen? Benjamin Opratko schließt seine Rezension des Buches Diskurs – radikale Demokratie – Hegemonie. Zum politischen Denken von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe folgendermaßen: »Um ihre Diskurstheorie für linke Theorie und Praxis fruchtbar zu machen, müsste sie in Bezug zur Leitfrage Antonio Gramscis – in dessen Tradition der Postmarxismus sich gerne sieht – gestellt werden: ›Will man, dass es immer Regierte und Regierende gibt, oder will man die Bedingungen schaffen, unter denen die Notwendigkeit der Existenz dieser Teilung verschwindet ?‹ Hier fehlt nicht nur die Antwort, viel schlimmer noch: Nach Lektüre der meisten in diesem Band ver sammelten Beiträge würde eine solche Frage wohl niemandem einfallen.«10 Dann stünde erst recht die große Herausforderung für die Architektur bevor: Was würde das Verschwinden von Regierten und Regierenden bedeuten? Was wären dann die Parlamente? Agonistisch? Anarchisch? Anarchistisch? Oder gar verschwunden?
reCESsIon
123
Ita Heinze-Greenberg Nation und Stil Zur Formfindung parlamentarischer Repräsentation im 19. Jahrhundert
1 Neil Leach, »Architecture or revolution«, in: ders. (Hg.), Architecture and revolution. Contemporary perspectives on central and eastern europe (London, New York: Routledge, 1999), S. 112 f.
Prolog: »architecture parlante« Architecture ou Révolution: Der ursprünglich so angedachte Titel des vielleicht einflussreichsten Manifestes des 20. Jahrhunderts Vers une Architecture pointiert die Überzeugung seines Autors, über Architektur seien bahnbrechende Gesellschaftsprozesse nachhaltiger zu lancieren als durch politische Taten.1 Eine Möglichkeit der Beweisführung für die stärkeren Argumente der Architektur im diskursiven Wettstreit mit der Politik ergab sich für Le Corbusier, als der erste Ministerpräsident der kurz zuvor aus der kolonialen Abhängigkeitentlassenen Indischen Union ihn mit dem Auftrag einer neuen Hauptstadt für den Punjab betraute. Chandigarh sollte Jawaharlal Nehrus’ Vision einer egalitären indischen Gesellschaft architektonisch umsetzen und sie mithin aufbauen. Der Masterplan sah die Anlage einer Planstadt vor, bei der das Regierungsviertel sich als gesonderter Sektor zum restlichen Metropolbereich wie der Kopf zum Volkskörper verhielt. Le Corbusier konzentrierte
Le Corbusier Entwurf für die fosse de la considération mit dem Monument der Offenen Hand Chandigarh 1951 (ausgeführt 1985)
124
2 Der zusätzlich geplante Gouverneurspalast wurde nicht ausgeführt. 3 Norbert Huse, Le Corbusier. Mit Selbst zeugnissen und Bilddokumenten (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt , 7. Aufl. 1999), S. 107.
sich auf die Planung des Kapitols mit den markanten Gebäuden für die der Gewaltentrennung in der Demokratie entsprech enden Staatsorgane: Parlament, Justizpalast und dem der Exekutive zugehörender Sekretariatsgebäude.2 Den Regierungsbauten fügte er ein weiteres Bauwerk hinzu: einen um mehrere Meter abgesenkten, offenen Hof, der über eine Rampe und eine ihr gegenüberliegende Treppe erschlossen wird. Eine mittig eingestellte erhöhte Redner bühne und zwei ihr zugeordnete Sitzränge für Publikum lassen die Funktion der Anlage schnell erkennen: Sie gilt der Ausübung des wichtigsten Grundgesetzes der Demokratie – der Freiheit der Meinungsäußerung. Hier ist jeder Bürger eingeladen, seine (auch gegen die Staatsgewalten gerichtete) Position öffentlich kundzutun. Wie ein freigelegtes Fundament wirkt Le Corbusiers fosse de la considération und übersetzt damit den Gedanken der Basisdemokratie unmttelbar in die Sprache der Architektur. Der Blick von hier ist unverstellt, der Redner steht unter freiem Himmel und scheint nur diesem verpflichtet. Die übereck gestellten Sitzränge eröffnen zwei unterschiedliche Perspektiven auf ihn: Frontalansicht und
rEligioUs-conSerVatiVe Profil. Es gibt immer mindestens zwei Ansichten von einem Gegenstand, so heißt die Botschaft des Architekten. Hinter der Kanzel wird dem Volk als Souverän die Stange gehalten: Einer Standarte gleich ragt eine riesige geöffnete Hand über einen körperhaften Kasten hinaus, der den Auftritt des Redners optisch rahmt und dem Ort eine fast sakrale Überhöhung verleiht. Gleichsam zur Redemeldung oder Abstimmung erhoben wirkt die Hand, dreht sich zugleich wie ein Wetterhahn im Wind und zeigt so symbolisch den Stand der (Staats-) Dinge an. Le Corbusier hat die riesige, 16 Meter messende, metallene Skulptur, die sich hoch in den Raum über den versenkten Platz erhebt und weithin auf dem großflächigen Kapitol sichtbar ist, zum »Denkmal Chandigarhs«3 erklärt. Man hat den Segens- und Friedensgestus Buddhas in ihr gesehen, eine offene Hand zierte auch die Flagge des Indischen Nationalkongresses, der führenden Bewegung des Indischen Unabhängigkeitskampfes. Le Corbusier selbst nannte sie ein Zeichen der Harmonie, sowie des Gebens und 125
4 Norma Evenson, Chandigarh (Berkeley, Los Angeles, ca: University of California Press, 1966), S. 86 – 87. 5 Willy Boesiger (Hg.), Le Corbusier. Oeuvre complète, Volume 6, 1952–57, 13. Aufl. (Basel: Birkhäuser, 1995), S. 92. 6 Thomas Hobbes, Leviathan or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil (1651), in dt. Übersetzung: Lothar R. Waas (Hg.), Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bür- gerlichen Staates. Reihe Suhrkamp Studien bibliothek, Band 18 (Berlin: Suhrkamp, 2011).
Nehmens im politischen Miteinander.4 Seine Symbolik schöpft aus nationalen wie universellen Quellen und bedient sie gleichzeitig. Ihre eigentliche politische Botschaft mit erzieherischem Impetus erteilt die erhobene Hand im Kontext der fosse de la considération. Meist als »Ort der Besinnung«5 übersetzt, lässt er sich direkter noch als »Grundfeste der Achtung« verstehen. Was hier zur »Be-Achtung« gegeben wird, ist die auf der etymologischen Herleitung beruhende Bedeutung des Begriffs »Parlament« von parlare, reden. Die erhobene Hand übernimmt das Mandat der ständigen Mahnung an die Fundamente der Demokratie: Hier meldet sich das Volk zu Wort ! Nation und Geschichte Gründungshauptstädte oder Regierungssitze, die – wie Chandigarh – auf einer tabula rasa verortet wurden, sind eher in der Minderzahl. Sie zeugen oft von einer durch Fremdoder Eigenverschuldung belasteten nationalen Vergangenheit, im Fall von Indien nicht zuletzt vom Ausverkauf der eigenen Kulturwerte durch die vorherige koloniale Besetzung. Ein geschichtsloser Ort steht für die Idee eines Neuanfangs, verbunden mit der Hoffnung auf eine unbelastete Zukunft. In der Regel jedoch wurden die Koordinaten für wichtige nationale Standorte nach ihrer geschichtlichen Bedeutung be messen und abgesteckt. In Europa sind Nationenbildung und Historismus, beide Erzeugnisse des 19. Jahrhunderts, in ihren Entstehungsursachen eng miteinander verwoben. Als Urszene der politischen Moderne gilt die öffentliche Exekution Louis XVI. am 21. August 1793 in Paris. Die Tötungsart der Enthauptung hätte kaum symbolischer sein können: Das absolutistische Staatswesen, wie es – nirgends eindrucksvoller – im Frontispiz zu Thomas Hobbes’ Leviathan6 darge stellt ist, zeigt den Souverän als geistig und weltlich dominierendes und regierendes Haupt, dessen Körper aus »einver leibten« Untertanen zusammengesetzt ist. Die Dekapitation des Königs auf der Place de la Révolution hinterließ – in sinnbildlicher Übertragung – einen kopflosen Volkskörper. Damit dieser nicht desorientiert in seine individuellen Einzelglieder zerfiel, brauchte es neben politischen Strukturen wirkungsvolle soziale Konstruktionen des Zusammenhalts. Die Freiheit der Vielen musste in einer geordneten Ganzheit organisiert, sowie auf eine einheitliche Basis und unter ein schützendes 126
Frontispiz Thomas Hobbes’ Leviathan or the Matter, Forme and Power of Commenwealth Ecclesiastical and Civil 1651
Dach gestellt werden. Für den Zusammenschluss der emanzi pierten Bürger zu einer eingeschworenen Solidargemeinschaft setzte sich das Konstrukt der Nation durch. Als zugkräftiger kollektiver Identitätsstifter erwies sich dabei neben einer gemeinsamen Sprache die Schaffung von gemeinsamer Geschichte. Wenngleich der Begriff der Nation weit in die vorbürger liche Zeit zurückgeht – so wurden beispielsweise die Studier enden der ersten Universitäten gemäß ihren unterschiedlichen Herkunftsregionen nach nationes eingeschrieben –, erhielt er erst in der Aufklärung, und verstärkt nach der Französischen Revolution, seine heutige, die Gesamtheit und Souveränität des Staatsvolkes betonende Bedeutung. Die Begriffe Staat und Nation sind in der Folge mitunter schwer voneinander abzugrenzen und werden oft synonym verwendet. Der amerikanische Politikwissenschaftler Karl Wolfgang Deutsch definierte Nation ironisch als »eine Gruppe von Menschen, die durch einen gemeinsamen Irrtum hinsichtlich ihrer Abstammung und eine gemeinsame Abneigung gegen ihre Nachbarn geeint ist.«7 Ungeachtet des lakonischen Sarkasmus, der nicht zuletzt den Erfahrungen des Nationalismus des 20. Jahrhunderts geschuldet ist, finden sich in dieser Definition beide konstitutiven Merkmale der nationalen Gruppenbildung: Einverleibung und Ausgrenzung.8 Als der Begriff der Nation im heutigen Sinn noch jung und nicht faschistisch kompromittiert war, unterzog ihn Immanuel Kant –
rEpLiCa
7 Karl Wolfgang Deutsch, zit.n. Klaus von Beyme, Die Kunst der Macht und die Gegenmacht der Kunst. Studien zum Spannungsverhältnis von Kunst und Politik (Frankfurt|M.: Suhrkamp, 1998), S. 221. 8 vid. ibid.
127
9 ibid., S. 230. 10 Kant 10, zit. nach Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, 1889 (München: dtv Taschenbuchausgabe, 1999), Band 13, S. 425 – 426. 11 vid. Eric Hobsbawm, Terence Ranger, The Invention of Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 2013). 12 vid. Eva-Maria Landwehr, Kunst des Historismus (Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2012), S. 10–14. 13 Johann Joachim Winckelmann, Geschichte der Kunst des Altertums (Dresden: Waltherische Hof-Buchhandlung, 1764). Zeitnah erschienen Übersetzungen in franzö sischer (1766, 1781 und 1793|94) und in italienischer (1779 und 1783) Sprache. 14 Klaus von Beyme, S. 232.
er selbst verstand sich »unter bestirntem Himmel« als Welt bürger – einer kurzen, eher beiläufigen Erläuterung. Die exklusive Gebärde, die typisch für den Spätnationalismus wird 9, fehlt seiner Definition: »diejenige menge oder auch der theil derselben, welche sich durch gemeinschaftliche abstammung für vereinigt zu einem bürgerlichen ganzen erkennt, heiszt nation.« 10 »Abstammung« über die verwandtschaftliche Herkunft hinaus im erweiterten, abstrakten Sinn gedacht als kulturelles Erbe, als Überlieferung von Ideen, Überzeugungen, Verhaltensmustern, Konventionen, Brauchtum führt zum historistischen Weltbild des 19. Jahrhunderts, das den Menschen als geschichtliches Wesen fest in seinen Traditionen verankerte. Am Wendepunkt zwischen Feudalismus und Demokratie bekam die Vergangenheit einen neuen Wert: Sie beschränkte sich nicht mehr allein auf die höfische Gesellschaft, sondern sie gehörte nun allen. Über sie wurden kollektive Emotionen transportiert, die sich für das Projekt der Nationenbildung als instrumentalisierbar erwiesen. Die Perzeption einer gemeinsamen Geschichte – inklusive erfundener Traditionen 11 – stellte sich als stärkstes Bindemittel für den Zusammenhalt oftmals heterogener ethnischer Gruppen unter dem Dach der Nation dar. Nationenbildung und Historismus lieferten sich gegenseitig ihre konstituierenden positivistischen Argu mente.12 Wenngleich auf Autonomie bedacht, konnte auch die Kunstgeschichte vom gesteigerten Interesse des Zeitgeistes an der Geschichte profitieren und sich um 1800 als wissenschaftliche Disziplin etablieren. Die Stilgeschichte, mit der sich die Kunstwissenschaft als akademisches Fach instituierte, machte über die historische Kategorisierung charakteristischer Erscheinungsformen unterschiedlicher Epochen und geografischer Räume dieselben als Bedeutungsträger im nationalen Kontext verfügbar. Johann Joachim Winckelmann, mit dessen bahnbrechender Publikation Geschichte der Kunst des Altertums von 1764 die Geschichten der Kunstgeschichte meist beginnen, trug zunächst durch seine Kanonisierung der Antike maßgeblich zu ihrer weit verbreiteten Rezeption bei.13 Dem Klassizismus, oft als letzter gesamteuropäischer Stil verstanden,14 wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Nationalromantik an die Seite gestellt, die sich der Suche nach Ausdrucksformen verschrieb, die dem jeweils spezifischen Volkscharakter gerecht würden. 128
15 Jean de La Bruyère, Les Caractères de Théophraste traduits du grec avec Les Caractères ou les moeurs de ce siècle (Paris: Lefèvre, 1688). 16 Charles Le Brun, Études schématiques d‘expressions, extraits de la Méthode pour apprendre à dessiner les passions. Anonymer Herausgeber (Leipzig: Kleefeld, 1802). 17 Anonym, Handwörterbuch der Seelenmahlerei: zum gemeinnützigen Gebrauch, besonders für Zeichner, Mahler und Liebhaber charakteristischer und allegorischer Darstellungen; nebst 52 in Kupfer gestochenen Köpfen, die vorzüglichsten Gemüthsbewegungen und Leidenschaften betreffend, von Le Brun (Leipzig: Kleefeld, 1802). 18 vid. Thomas Kirchner, »Franz Xaver Messerschmidt und die Kon struktion des Ausdrucks« in: Maraike Bückling (Hg.), Die phantastischen Köpfe des Franz Xaver Messerschmidt (München: Hirmer, 2006), S. 266 – 281. 19 Johann Caspar Lavater, Physiognomische Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe, vier Bände (Leipzig, Winterthur: Weidmanns Erben und Reich, und Heinrich Steiner und Compagnie, 1775 – 78).
Charakter und Form Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen innerem Wesen und äußerer Erscheinungsform interessierte bereits die Antike. Mit der um 400 v. Chr. von dem griechischen Arzt Hippokrates von Kos entwickelten Temperamentenlehre, die den Melancholiker, Choleriker, Sanguiniker und Phleg matiker unterscheidet, lag die erste Persönlichkeitstypologie vor. Die Beschreibung von dreißig Charaktertypen des griechischen Naturphilosophen Theophrastos von Eresos wurde im Frankreich unter Louis XIV. wiederentdeckt. Der Moralist Jean de La Bruyère übersetzte sie ins Französische und er weiterte sie durch Studien aus seinem eigenen Umfeld.15 Sein Zeitgenosse, der als Maler, Architekt und Innenausstatter des Königs tätige Charles Le Brun verfasste eine post mortem erschienene Méthode pour apprende à dessigner les passions.16 Der Publikation waren 52 Kupferstiche mit Gesichtsstudien zum Ausdruck unterschiedlicher Leidenschaften beigegeben, die von einer derart nachhaltigen Expressivität bei gleich zeitiger Präzision in der Wiedergabe der Erscheinung waren, dass sie noch über 100 Jahre später der Illustration eines in
ReprEsentaTion
Leipzig erschienenen Handwörterbuchs der Seelenmahlerei dienten.17 Eine ähnlich starke Wirkung erzielten die grimassierenden »Charakterköpfe« des deutsch-österreichischen Bildhauers Franz Xaver Messerschmidt. Sie stehen in einer Linie mit den zahlreichen physiognomischen Theorien der Aufklärung, von denen René Descartes’ Traité des passions de l‘âme von 1649 sicher die bekannteste ist, die sich um die Erklärung der menschlichen Natur an der Schnittstelle zwischen Körper und Seele bemühten.18 Ging es bei Descartes, Le Brun und Messerschmidt eher um eine Systematik des Affektausdrucks, also um die emotionale Regung und ihren spontanen mimischen Ausdruck,so bezog sich der Zürcher Reformpriester Johann Caspar Lavater auf die unveränderlichen Gesichtszüge. Auf seine zwischen 1775 und 1778 erschienener vier Bände der Physiognomischen Fragmente erhob er den Anspruch einer Wissenschaft, mit der zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe der Charakter des Menschen aus den Linien seiner Kopfsilhouette abgeleitet werden könne.19 129
Neun erdichtete Silhouetten zur Prüfung des physiognomischen Genies aus: Physiognomische Fragmente 1772 Johann Kaspar Lavater
20 Anonym, Unter suchungen über den Charakter der Gebäude; über die Verbindung der Baukunst mit den schönen Künsten, und über die Wirkungen, welche durch dieselbe hervorgebracht werden sollen (Leipzig: Joh. Philipp Haugs Wittwe, 1788). 21 ibid.,S. 11; vid. Hanno-Walter Kruft, Einführung zum Faksimile-Neudruck der Ausgabe Leipzig 1788. (Nördlingen: Uhl, 1986) 22 ibid., S. 13.
Gebäudeprofile aus: Untersuchungen über den Charakter der Gebäude 1788 Anonym
Zehn Jahre später erschien anonym ein relativ schmaler Band von knapp 200 Seiten, den man auf den ersten Blick aufgrund formaler Ähnlichkeiten im Aufbau bis hin zu den spärlich eingestreuten Abbildungen geneigt ist, Lavater zuzuschreiben: Die Untersuchungen über den Charakter der Gebäude; über die Verbindung der Baukunst mit den schönen Künsten, und über die Wirkungen, welche durch dieselbe hervorgebracht werden sollen übertrugen die Physiognomik des Zürcher Pfarrers auf die Baukunst.20 Der Charakter eines Gebäudes wird gleich zu Beginn der Publikation einfach und ohne weitere Umschweife als jene Eigenschaft definiert, »wodurch es eine merkliche Wirkung auf unser Herz thut.«21 Der Eindruck des Bauwerks auf seinen Betrachter wird durch den nach außen getragenen Charakter seines Bewohners komplementiert: »Wenn ich mir das Haus eines Bürgers denke, scheint es mir eine der edelsten Eigenschaften seines Charakters zu seyn, daß die Façade nicht lügt. Ich verlange den Besitzer eines Hauses in dem Zustand zu finden, den die Außenseite desselben ankündigt.«22 Das Wechselspiel von Ausdruck des Bewohners und Eindruck des Betrachters erinnert an die sensualistische Wirkungsästhetik mit edukativem Impetus der zeitgleichen französischen Revolutionsarchitekten, insbesondere an Claude-Nicolas Ledoux’ Planungen für die Idealstadt Chaux. Hier wird in extremster Konsequenz jedem Gebäude ein eindeutiger Charakter 130
Claude-Nicolas Ledoux Entwurf für das Haus eines Schleusenwärters Idealstadtprojekt Chaux 1804
zugewiesen, der über seine Form transportiert wird: Das Haus des Holzfällers assoziiert rohe Baumstämme, das Haus des Reifenmachers wird an einer kreisrunden Fassade erkenntlich, durch das Haus des Flussinspektors ergießt sich ein Wasserfall. Diese sich selbst aussprechende Architektur trägt zur Festigung der sozialen Stellung des einzelnen Menschen im sich gerade herausbildenden Staaten- und Wertesystem bei.23
rEvolt
23 vid. Winfried Nerdinger, Klaus Jan Philipp, Revolutionsarchitektur – ein Aspekt der europäischen Architektur um 1800 (München: Hirmer, 1990), S. 30 f.
Nation und Stil Bei der Suche nach der Ausdrucksform einer ganzen Nation verband sich im frühen 19. Jahrhundert die Charakterlehre mit dem Historismus. Über den Rekurs auf eine für den jeweiligen Volkscharakter als spezifisch und signifikant ange nommene geschichtliche Epoche und deren Erscheinungsform sollte nationale Identität evoziert werden, die der Stärkung bestehender oder auch noch zu bildender kollektiver Zusammenschlüsse diente. In mehreren Ländern gleichzeitig geschah dies über eine Neubewertung der Gotik als Nationalstil. Neben der europaweiten Antiken-Rezeption des Klassi zismus, die Italien und Griechenland als die Wiegen der westlichen Kultur auswiesen, versuchten sich Frankreich, England und Deutschland über eine Aufwertung ihres eigenen Erbes 131
24 vid. Johann Wolfgang von Goethe, Von Deutscher Baukunst (1773), in: Johann Wolfgang von Goethe. Berliner Ausgabe, hg. v. Siegfried Seidel, Band 19, Kunsttheore tische Schriften und Übersetzungen (Berlin, Weimar: Aufbau, 1960), S. 29 – 38. 25 Norbert Huse (Hg.), Denkmalpflege. Deutsche Texte aus drei Jahrhunderten (München: C.H. Beck, 1984), S. 39.
zu positionieren. Dies geschah über eine Aufarbeitung des Mittelalters, insbesondere zunächst der gotischen Baukunst. Sie ging mit einer berechtigten Sorge um den Erhalt der großen, vom Verfall bedrohten Kathedralen einher. Die sich um 1800 etablierende Denkmalpflege war jedoch in den seltensten Fällen Selbstzweck, sondern verband sich gerne mit nationalen und politischen Zielen. In Deutschland wird die Gotikbegeisterung sehr früh mit der 1773 gedruckten Lobrede Goethes auf den Erbauer des Straßburger Münsters angesetzt. Das gotische Bauwerk wurde von dem jungen Dichter als vom dogmatischen, klassischen Kanon der Akademien unabhängig empfunden und entsprach damit den Freiheitsbestrebungen des Sturm und Drang. Die patriotische Konnotation des Goethetextes drückt sich programmatisch in dessen Titel aus. Von Deutscher Baukunst spricht zudem – expressis verbis – den Italienern wie Franzosen einen eigenen derartig genialen architektonischen Höhepunkt ab.24 Diese Fehleinschätzung, insbesondere im Hinblick auf die französische Gotik, bestimmte dennoch das größte nationale Projekt, das Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts lancierte: den Weiterbau des 1248 begonnenen, aber Anfang des 16. Jahrhunderts eingestellten Baus des Kölner Doms. Nirgends sonst ist »die Verwandlung einer Ruine in ein Nationaldenkmal (...) so dramatisch und folgenreich ver laufen.«25 Über ein Dreivierteljahrhundert hinweg, in dem tief greifende außen- und innenpolitische Veränderungen die Fronten in Deutschland immer wieder neu absteckten und
Der Dom zu Köln 1824 vor dem Beginn des Weiterbaus Zeitgenössischer Stahlstich
132
26 Joseph Görres, »Aufruf zur Vollendung des Kölner Doms (Rheinischer Merkur, 14.11.1814), abgedruckt in: Norbert Huse (1984), S. 45–47. 27 vid. Bernd Wördehoff, »Denkmal der gemischten Ehe«, in: Die Zeit, Ausgabe 37, 04. 09. 1992, http://www.zeit.de/ 1992/37/denkmal-dergemischten-ehe (14.04.2014). 28 Leonard Ennen: Der Dom zu Köln. Von seinem Beginn bis zur Vollendung (Köln: M. DuMontSchauberg, 1880), S. 5. 29 Norbert Huse (1984), S. 46 f.
die gesellschaftlichen Kräfte stets neu verteilten, wurde das gigantische Unternehmen am linken Rheinufer unter wechselnden Vorzeichen für nationale Ziele instrumentalisiert. Das ehrgeizige Projekt, das zunächst unter dem Vorzeichen konservatorischer Intentionen von lokalpatriotischen Mittelalterverehrern begonnen hatte, erhielt nach der Befreiung von der napoleonischen Herrschaft zunehmend nationalen Symbolcharakter: »In seiner trümmerhaften Unvollendung, in seiner Verlassenheit ist es ein Bild gewesen von Teutschland seit der Sprach- und Gedankenverwirrung; so werde es denn auch ein Symbol des neuen Reiches, das wir bauen wollen.« 26 Die 1842 erfolgte Grundsteinlegung zum Weiterbau nutzte der Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV., unter Wonnentränen »den Brudersinn aller Deutschen« beschwörend, zur Stärkung seiner eigenen Position im Rheinland.27 Die Feiern zur end gültigen Fertigstellung des Doms im Herbst 1880 dienten Kaiser Wilhelm I. als Mittel zur öffentlichen Repräsent ation und als identitätsstiftendes Instrument des neun Jahre zuvor gegründeten deutschen Reiches. Der Kölner Stadtarchivar kommentierte, das Ereignis sei »der gerechte Stolz des deutschen Volkes, das erhebendste Denkmal deutschen Geistes, das schönste Erzeugniss deutscher Kraft, der vollendetste Ausdruck deutschen Selbstvertrauens, die höchste Blüthe deutscher Kunstthätigkeit.« 28 Längst war bekannt, wenngleich zu Beginn geheim gehalten, dass es sich bei dem Kölner Dom um einen Nachfolgebau der Kathedrale von Amiens handelte, warum ihn Viollet-Le-Duc schon 1854 als Quasi-Exportartikel in den Kanon der franzö sischen Baudenkmäler aufgenommen hatte. Zur Rechtfer tigung des gigantischen Kölner Projekts an sich und seiner deutschnationalen Bedeutung half nur ein Konstrukt, das alle Register der Vaterlandsliebe zog und damit gleichzeitig die Erbfeindschaft zu Frankreich bediente. Der gotische Baustil sei erst vom deutschen Geist wirklich erkannt und durch drungen; das, was sich in Frankreich auf niederer Entwicklungsstufe habe ausbilden können, sei erst durch ihn mit tieferer Bedeutsamkeit gefüllt und zur Blüte geführt worden.29 In Bayern, wo unter Ludwig I. vorwiegend dem Klassizismus gehuldigt wurde, machte sich indes sein Sohn Maximilian II. kurz nach seiner Thronbesteigung für die
rUInS
133
30 August Hahn, Der Maximilianstil in München. Programm und Verwirk- lichung (München: Hein Moss, 1982), S. 21. 31 ibid., S. 25. 32 vid. »Hubertus Günther, »Die Salomonische Säulenordnung. Eine unkonventionelle Erfindung und ihre historischen Umstände«, in: Journal of the International Association of Research Institutes in the History of Art, 15, 12 . 01. 2011, Abschnitt 46 – 48.
Erfindung eines eigenen deutschen Stils stark. Anklänge an den »altdeutschen« gotischen Stil waren zwar erwünscht, aber die neue deutsche Bauart sollte »keinem der schon bestehen den Baustile speziell« angehören, sondern gänzlich neu aus dem vorhandenen historischen Stilrepertoire entwickelt werden.30 Ein 1850 international (!) ausgeschriebener Wett bewerb brachte keine wirklich interessanten Ergebnisse, aber eine für den politischen Kontext durchaus nennenswerte Eingabe, die – außer Konkurrenz – aus Berlin kam. Der Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. schickte einen Entwurf, der die Bauweise bayerischer Alpenhäuser auf Steinarchitektur übertrug und verwies damit den Bayernkönig in seine bayerischen Grenzen.31 Die Erfindung eines neuen, eigenen Stils hatte schon Louis XIV. fasziniert, der 1671 einen Wettbewerb für eine französische Säulenordnung ausschreiben ließ. Der Entwurf Charles Le Bruns, der den Säulenstamm wie bei einer Palme ausbildete, geht vermutlich auf das königliche Preisausschrei ben zurück. Vor ihm hatte sich schon Philibert de L’Orme an einer französischen Nationalordnung versucht: eine Säule, deren Schaft den Besonderheiten des französischen Stein materials Rechnung trug.32 Der Entwurf nationaler Varianten der kanonischen Ordnungen blieb auch für die politische Moderne reizvoll. Exemplarisch sei hier an die mit Maiskolben und Tabakblättern verzierten Kapitelle von Benjamin Latrobe und Thomas Ustik Walter für das amerikanische Kapitol erinnert oder die »sowjetische Ordnung« mit Hammer und Sichel an der russischen Botschaft in Berlin.
Benjamin Henry Latrobe Brief an Thomas Jefferson vom 05. 11. 1816 Entwurf eines Kapitells mit Tabakblättern
134
33 Klaus von Beyme, S. 351. 34 Adolf Arndt, Demokratie als Bauherr, Rede 1960 in der Akademie der Künste (Berlin: Archibook, 1984). 35 Napoleon bezog den Louvre wieder; Napoléon III. vollen dete den Bau weitgehend in der heutigen Form; seit 1876 dient der Bau ausschließlich als Museum.
Parlament und Repräsentation »Repräsentation bedeutet eine Einschränkung des demo kratischen Prinzips der Volkssouveränität.«33 Angesprochen ist hier die politische Repräsentation, also die Vertretung einer Gruppe durch einzelne Repräsentanten. Wie aber verhält es sich mit derjenigen Repräsentation, die das standesgemäße Auftreten meint, und ihrem Verhältnis zum demokra tischen Prinzip der Volkssouveränität? Hier ist oft argumentiert worden, dass die Demokratie ein schlechter Bauherr sei. Sie führe zur Anonymisierung der schöpferischen Kräfte durch verselbstständigte Bauverwaltungen oder unpersönliche Gre mien ohne individuelle Verantwortung und brächte in Folge nur banales Mittelmaß hervor. Das aber hieße, hier würde sich die obige Aussage in ihr Gegenteil verkehren: Das demokratische Prinzip der Volkssouveränität bedeutet eine Einschränkung der Repräsentation. Darauf hat Adolf Arndt in seiner berühmt gewordenen Rede über »Demokratie als Bauherr« von 1960 eine grundlegende Antwort gegeben, die gleichzeitig eine Forderung beinhaltet: »Eine Demokratie ist nur so viel wert, wie sich ihre Menschen Wert sind, dass ihnen ihr öffentliches Bauen wert ist.«34 Im nachrevolutionären Frankreich standen den sich gerade konstituierenden Volksvertretungen Paläste zur Verfügung. Die Geschichte der Parlamentsbauten beginnt nicht mit Neubauten, sondern mit der Nutzung bestehender historischer Gebäude. In Paris wurde während der ersten Jahre nach der Revolution von 1789 das gesamte, von Louvre und Tuilerienpalast beherrschte Stadtzentrum umgewidmet. Die Bauten des Königs wie auch die Adelspaläste wurden für die neuen republikanischen Institutionen requiriert. Der Louvre, der neben Versailles die operative und ideelle Schaltstelle der absolutistischen Monarchie dargestellt hatte und große Teile der königlichen Kunst sammlung bewahrte, wurde bereits im Jahr der Hinrichtung Louis XVI. 1793 der Öffentlichkeit als Museum zugänglich gemacht.35 Das Palais du Luxembourg, Anfang des 17. Jahrhunderts im Auftrag von Maria de’ Medici erbaut und danach Wohnsitz verschiedener Mitglieder der königlichen Familie, ist seit 1800 Sitz des Senats, der zweiten parlamentarischen Kammer Frankreichs. Besonders deutlich wurde die Strategie
sESsioN
135
Assemblée Nationale mit dem 1806 unter Napoleon ausgeführten Eingangsblock mit Portikus (Aufnahme von 2011)
36 Dietrich Erben, »Umsturz der Politik und Umbau der Stadt: Paris unter Napoleon I.«, in: transition, Nr. 9, 2002, S. 143.
der Umwidmung beim Palais Bourbon, dem heutigen Sitz der Assemblée nationale, der ersten Kammer des französischen Parlaments. Das Gebäude war in den 20er-Jahren des 18. Jahrhunderts als maison de plaisance für die legitime Tochter Ludwig XIV., Louise Françoise de Bourbon, erbaut worden. Mit Ehrenhof und gestaffelten Pavillonanbauten war es nach Süden zum eleganten Adelsquartier ausgerichtet, rückwärtig im Norden zog sich ein Gartenstreifen entlang des Seine-Quais. 1792 wurde das Gebäude verstaatlicht und als Sitz des Rates der Fünfhundert umgenutzt. 1806 erfolgte unter Napoleon als Teil seiner Umgestaltungspläne für ein monumentaleres Paris der auf die Seine ausgerichtete mäch tige blockhafte Anbau mit klassizistischem Portikus, der über die Seine und den Place de la Concorde, dem Hinrichtungsplatz Louis XVI. und Marie Antoinettes, hinweg mit dem gleichzeitig entstehenden Ehrentempel der Madeleine korrespondiert. Die Neuausrichtung des Gebäudes demon striert eine symbolhafte Abkehr vom Adelsquartier. Darüber hinaus wird durch die monumental gesteigerte Fassade der Arbeit des hier tätigen Corps législatif ein Denkmal gesetzt: »Die Tempelfront erscheint regelrecht als eine architektonische Würdigung der sicherlich bedeutendsten politischen Leistung dieser Körperschaft in der Regierungszeit Napoleons, der 1804 abgeschlossenen Kodifikation und Vereinheitlichung des Zivilrechts im Code civil des Français.«36
136
37 Die Ausführungen zur Geschichte des Kapitols in Washington d.c. basieren, wenn nicht anders angegeben, auf: Louis Craig (Ed.), The Federal Presence. Architecture, Politics, and Symbols in United States Govern ment Building (Cambridge, mass.: mit Press, 1978). 38 ibid., S. 29. 39 ibid.
Wie in Frankreich, so wurde auch das Parlament Italiens in umgebauten historischen Palästen installiert, sehr viel später geschah dies auch in Griechenland. Der erste Staat, der einen Neubau für die beiden Kammern seines Parlaments, für das House of Representatives und den Senate vorsah, waren die usa.37 Dies lag zum einen sicher daran, dass keine adäquaten histo rischen Bauten zur Verfügung standen, zum anderen an der Ortswahl des Regierungssitzes. Nach der Ratifizierung der Verfassung 1788 diente zunächst New York als provisorische Hauptstadt, danach für zehn Jahre Philadelphia. Im Residence Act von 1790 wurde ein nur sporadisch bebautes Sumpfgebiet von zehn mal zehn Kilometer Größe am Potomac Fluss, halb zu Virginia,halb zu Maryland gehörend, als Ort der neuen Hauptstadt designiert. Für die infrastrukturelle und bauliche Herrichtung gab man sich zehn Jahre Zeit. 1792 wurde ein Wettbewerb für das Kapitol ausgeschrieben, publiziert als bescheidene Kleinanzeige in den Tageszeitungen, nur mit den räumlichen Erfordernissen – »a conference room, a room for the representatives, a lobby ...«38 – als Vorgaben, ohne stilistische Angaben. Später wurde Thomas Jefferson mit den Worten von der »republikanischen Einfachheit« zitiert. 17 Wettbewerbsprojekte wurden eingereicht; fast alle hatten sich des klassischen Formenvokabulars bedient, mit dem über den Bezug zur Athener Demokratie sowie zur römischen Republik demokratische Werte verbunden wurden. Der Autor des Gewinnerentwurfs war ein Arzt, der sich nebenher auch noch als Maler und Architekt betätigte. Ausgebildete Architekten hatte das Land damals noch nicht vorzuweisen. Von George Washington, der in der Jury saß, ist überliefert, dass er den Plänen des Siegers »grandeur, simplicity and convenience« bescheinigte.39 Bis hierher liest sich der Ablauf wie eine typische Pioniergeschichte. Der Entwurf wurde dann aber doch einige Jahre später von Benjamin Henry Latrobe, einem aus England eingewanderten und in London ausgebildeten Architekten überarbeitet. Ferne Anleihen an die fran zösische Revolutionsarchitektur werden seiner Begeisterung für Claude-Nicolas Ledoux zugeschrieben, dessen Arbeiten er auf einer Grand Tour durch Europa kennenlernte. Die Aus führung erfolgte durch Charles Bulfinch, der als erster in
ShoUTing
137
Benjamin Henry Latrobe Perspektivische Ansicht des Kapitols Aquarell 1810
Bundeshaus Bern
40 ibid., S. 136. 41 Monica Bilfinger, Das Bundeshaus in Bern (Bern: Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, 2009), S. 5.
den usa geborener Architekt gehandelt wird. Der Bau erwies sich bald nach seiner Fertigstellung als zu klein und wurde ab 1851 durch Thomas Ustik Walter mit ausladenden Seitenflügeln und der riesigen, an St. Peter erinnernden, sich hoch über den Bau erhebenden Kuppel erweitert. Von »republi kanischer Einfachheit« ist hier nichts mehr zu spüren. Während des Bürgerkrieges ordnete Abraham Lincoln den Weiterbau der Kuppel an und lud ihn mit symbolischer Bedeutung auf: »When the people see the dome rising it will be a sign that we intend the union to go on.«40 Die Rotunde, der zentrale und größte Bauteil des gesamten Gebäudes, dient über ein weihevoll überfrachtetes, ikonografisches Programm ausschließlich der Konstruktion von amerikanischer Geschichte und der Huldigung ihrer Präsidenten, die ihren Höhepunkt in der von einem zweitrangigen italienischen Maler inszenierten Apotheose Washingtons im Zentrum der Kuppel findet. Das Bundeshaus in Bern mit seinen beiden Kammern nach amerikanischem Modell erlebte eine ähnliche bauliche Entwicklung wie das Kapitol. Der zwei Jahre nach Inkraft treten der schweizerischen Bundesverfassung zunächst für ein Bundesrathaus ausgeschriebene Wettbewerb von 1850 stand noch unter der Prämisse der Sparsamkeit, »unnütze Pracht und übertriebene Dimensionen sind zu vermeiden.«41 138
Nach Erweiterungen des Baus um einen zusätzlichen Ver waltungstrakt und das zentrale Parlamentsgebäude, die mit zwei Folgewettbewerben einhergingen, wurde 1902 ein Bundeshaus eingeweiht, das weniger bescheiden ausgefallen war als das wenige Jahrzehnte zuvor fertiggestellte Kapitol. Für die seitlichen Flügelbauten wurde ein ihrer Funktion angepasster schlichter Rundbogenstil gewählt; bei dem Mittelteil, der die Versammlungsräume des Nationalrats und des Ständerats beherbergt, wurde mit deutlich repräsentativem Anspruch stilistisch auf die Renaissance zurückgegriffen und der Haupteingang mit einem Portikus ausgezeichnet. In Anlehnung an das Washingtoner Vorbild wurde auch hier eine zentrale Kuppel zur Nobilitierung und optischen Zentrierung des Baus eingesetzt, allerdings überspannte sie keinen würdevollen Raum, sondern kam über dem zwischen beiden Ratskammern befindlichen Vestibül zu liegen. Dem Archi tekten Hans Wilhelm Auer gelang es jedoch, dem Treppenhaus in Anlehnung an die Pariser Oper eine theatralische Grandeur zu verleihen, die er wie in der Rotunde des Kapitols mit einem historischen Bild- und Skulpturenprogramm zur Geschichte der Schweiz auflud und zu einem Nationaldenkmal stilisierte, das jeder Rat auf seinem Weg zur Versammlung durchschreiten muss: »Die architektonische Inszenierung weist den Volksvertretern die Rolle von Priestern zu, die mit der parlamentarischen Handlung die Nation immer wieder neu stiften.«42 In London lässt sich der zwischen 1840 und 1860 erfolgte Bau der Houses of Parliament nicht ohne die lange parlament arische Tradition der Briten und ohne den Vorgängerbau denken. Der im Herbst 1834 zu großen Teilen abgebrannte Palace of Westminster, in dem das House of Lords und das House of Commons ihren Sitz hatten, bestimmte den Standort des neuen Parlamentsgebäudes sowie die Stildebatte. Vorschläge für die Verlegung an einen anderen Ort wurden mit Vehemenz von der Öffentlichkeit bekämpft und auch die kurzzeitig von den Anhängern des Klassizismus vertretenen Argumente, die Gotik sei nicht mehr angemessen für ein modernes Parlament, fanden keine nachhaltige Unterstützung. Die Gotik wurde auch hier mit dem eigenen englischen Kulturerbe verbunden,
slAvERy
42 »Der Bund als Bauherr« in: Inventar der neueren Schweizer Architektur 1850–1920. Band 2 (Zürich: Orell Füssli, 1986), S. 389 – 395, hier: S. 393.
139
Die Zerstörung der houses of parliament durch den Brand am 16.10.1834 von Abbington Street aus gesehen
43 Setzt man für die Demokratisierung das Frauenwahlrecht als Grundvoraussetzung an, so muss diese Aussage auf fast alle Regierungen im 19. Jahrhundert erweitert werden. 44 Zur Geschichte des Deutschen Reichstagsgebäudes, vid. Paul Wallot, Das Reichstagsgebäude in Berlin (Berlin: Komet, 2009; Reprint der Ausgabe von 1897). Michael S. Cullen, Uwe Kieling, Der Deutsche Reichstag. Geschichte eines Parlaments (Berlin: Argon, 1992). 45 Günther Schefbeck, »Theophil Hansen und das Wiener Parlamentsgebäude«, in: 120 Jahre Parlamentsgebäude (Wien: 2003), S. 12. 46 zit. nach Carl E. Schorschke, Wien. Geist und Gesellschaft im Fin de Siècle (Frankfurt|M.: Fischer, 1982), S. 39.
während der Klassizismus als Import aus Frankreich abgelehnt wurde. Diese Position verband sich mit dem Wunsch, die Reste des verbrannten Baus zu wahren. Das erstarkende Interesse an der Denkmalpflege lässt sich in Großbritannien einmal mehr als Gegenbewegung zur fortgeschrittenen Industrialisierung verstehen. Die Wettbewerbsausschreibung legte die Neogotik, alternativ ihre Spielart, den Tudorstil, als Bedingung fest. Im 19. Jahrhundert entstanden die meisten Parlamentsbauten zu einem Zeitpunkt vorparlamentarischer Regime, als die Repräsentativsysteme noch nicht demokratisiert waren.43 Berlin und Wien seien hier exemplarisch genannt. Planung und Ausführung vom Berliner Reichstags- und Wiener k.k. Reichsratsgebäude waren in beiden Fällen vom good will der regie renden Monarchen abhängig. Wilhelm I. achtete eifersüchtig darauf, dass die Kuppel des Reichstagsgebäudes nicht höher würde als die seines Schlosses und sein Nachfolger Wilhelm II. hatte keine Scheu, das Parlament als »Reichsaffenhaus« zu schmähen.44 In der Donaumetropole scheint Franz Joseph I. selbst bei der direkten Auftragsvergabe an den Architekten seine Hand im Spiel gehabt zu haben.45 In Berlin wie in Wien liefen die Genehmigungsverfahren über die Schreibtische der Kaiser. Stilistisch blieben beide Bauten hinsichtlich eines nationalen Bezugs indifferent. Der Eklektizismus, den Paul Wallot wählte, schloss alles ein und ließ damit alles offen. Der Philhellene Theophil Hansen begründete seine Wahl zugunsten des universellen klassizistischen Formenvokabulars mit einem erzieherischen Anspruch. Er glaubte, »diese edlen klassischen Formen müssten auf die Volksvertreter mit unwiderstehlicher Kraft erhebend und idealisierend wirken.«46 140
47 Klaus-Peter Gast, Le Corbusier. Paris – Chandigarh (Basel, Berlin, Boston: Birk häuser, 2000), S. 150 f. 48 Stephan Trüby, »ExArchitekturen|ExitArchitekturen: Über Stress, Memoaktivität und kulturelle Transmission«, in: Stephan Trüby, Exit-Architektur. Design zwischen Krieg und Frieden (Wien, New York: Springer, 2008), S. 15 – 26, hier S. 15 – 17.
Epilog: »…afterwards our buildings shape us.« Hinter Le Corbusiers Planungen für Chandigarh hatte eine ebensolche Hoffnung auf edukative Wirksamkeit gestanden. Das Monument der Offenen Hand wurde erst 1985 ausgeführt. Der abgesenkte Hof mit Rednerpult und Sitzrängen wurde offensichtlich nie in der von Le Corbusier intendierten Funk tion genutzt. Er verliert sich in der Weite der Gesamtanlage, und Skulpturen als westlich-abstrakte Zeichen waren der indischen Kultur fremd. Für die Einwohner von Chandigarh, die auf dem Regierungsgelände ihrer Arbeit nachgingen, bestand keine Ausdrücklichkeit oder Dringlichkeit, diesen Ort aufzusuchen.47 Als das britische Unterhaus 1941 von einer deutschen Bombe zerstört wurde, plädierte Winston Churchill für einen originalgetreuen Wiederaufbau, obwohl der Anlass sich anbot, den längst zu klein gewordenen Raum, in dem nicht mehr alle Abgeordneten Platz fanden, zu vergrößern. »First we shape our buildings,« so das stets kolportierte Zitat des Pre miers, »and afterwards our buildings shape us.« Viel bemerkenswerter jedoch war sein psychologisches Argument, eine »Dramaturgie der Gedrängtheit« unterstreiche vorzüglich die dringenden Angelegenheiten des Staates: »Parlamentarier, die sich in Türen und Gängen quetschen, um einen begehrten Blick in den überfüllten Debattiersaal zu erhaschen, (garantieren) (...) einen angemessenen ›sense of crowd and urgency‹.«48
spLENdId
141
Nott Caviezel Prunk und Prestige, Funktionalität und Eleganz Das Wiener Parlamentsgebäude und sein Plenarsaal
1 Sanierung Parlament, Quo vadis?, Folder der Parlamentsdirektion, Wien, im Dezember 2013.
Wenn heute das Facility-Management Bauvorhaben unter dem Aspekt ihrer Lebenszyklen betrachtet, stehen ökonomische Kriterien im Vordergrund. Die Sache muss sich rechnen und über einen bestimmten Zeithorizont hinweg Rendite ab werfen. Nun besteht ja die Welt nicht aus lauter Neubauten. Zahlreich sind Gebäude, die den historischen Bestand aus machen, darunter viele, die ihre rein rechnerisch vorgesehene Lebensdauer schon lange überschritten haben und trotzdem immer noch da und nach wie vor in Verwendung sind, oft sogar in ihrer angestammten Nutzung. Nachhaltig sollen Gebäude sein, ökonomisch, ökologisch und sozial, wobei die oberste Maxime der Wirtschaftlichkeit meist im Vordergrund steht. Weniger populär sind im Diskurs der Nachhaltigkeit die kulturellen Dimensionen, obwohl sie – zumindest was das Bauliche anbelangt – meistens anschaulich und evident sind. Allein schon die Existenz historischer Gebäude beweist, dass diese in mehrfacher Weise und ohne viel Dazutun seit Langem bereits (kulturell) nachhaltig sind. So auch das österreichische Parlamentsgebäude in Wien, dessen Sanierung in nächster Zeit angegangen wird. Sieht man von den Wiederaufbauarbeiten nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs ab, wurde die Substanz des Gebäudes noch nie »umfangreich saniert«.1 Bekanntlich geht eine Sanierung über die Instandsetzung hinaus und sieht in Hinblick auf eine Modernisierung in der Regel auch tiefer greifende Maßnahmen vor, die bei Denkmalen wie dem Par lamentsgebäude und anderen denkmalpflegerisch relevanten Bauten zuweilen auch problematisch sein können. Dass am Dr. Karl Renner-Ring 3 eine Pinselsanierung nicht ausreicht, ist angesagt. Aber davon später.
142
2 http://www.parlament. gv.at (05.04.2014) 3 f+p Architekten, werner consult, Gesamtkonzept Parlament, Gesamtkonzept zur Sanierung und Nutzung des Parlaments, Jänner 2011. 4 Vasko+Partner Inge nieure, Entscheidungsgrundlage Sanierung Parlament (Wien, November 2013). 5 Sanierung Parlament, Weg frei für die »Nachhaltige Sanierung«, Folder der Parlamentsdirektion (Wien, Februar 2014). 6 Vasko+Partner Inge nieure, S. 18.
Wer das riesige, im »hellenistischen« Stil errichtete Gebäude umschreitet, wer sich in seinem weitläufigen Innern umsieht oder sich die Stockwerkgrundrisse vor Augen führt, mag vom Umfang der geplanten Arbeiten eine Ahnung bekommen. Einschließlich der Rampe ist es gemäß Angaben seines Erbauers Theophil Hansen 151,68 Meter lang und 132,72 Meter breit, es soll 1.600 Räume mit 920 Fenstern zählen, und man geht auf 1.000 Metern Spannteppich.2 Allein solche Angaben beeindrucken, wenn man bedenkt, dass ein großer Teil dieser Substanz Gegenstand der Sanierung sein soll. Nach einer längeren Vorgeschichte mit einem missglück ten oder zumindest unschön verlaufenen und nach Abschluss widerrufenen Wettbewerb zur Neugestaltung des Nationalratssaals zeigte sich aufgrund vertiefter Untersuchungen der Gebäudesubstanz, dass das Parlamentsgebäude einer Generalsanierung bedarf. Verschiedenen Gutachten, Studien und Berichte zu spezifischen Themen fanden Eingang in ein mehr als 500 Seiten starkes Gesamtkonze pt Parlament, das seinerseits ein Gesamtsanierungs- und ein Gesamtnutzungskonzept zusammenführt.3 Auf dieser eindrücklichen Grund lage wurde 2013 die Entscheidungs- grundlage Sanierung Parlament erarbeitet, welche unterschied liche mögliche Sanierungsvarianten würdigt und miteinander vergleicht.4 Im Januar 2014 entschied sich schließlich die Präsidialkonferenz des Nationalrats für die Variante »Nachhaltige Sanierung« (Kostendeckel 352 Mio. € – wenn es dabei bleibt), welche die »Instandsetzung sowie die sofortige Umsetzung von Verbesserungen im Betrieb, in den Abläufen und in den Funktionen des Gebäudes, unter anderem durch die Nutzung vorhandener Raumreserven und die Steigerung der Energieeffizienz«.5 Die »Nachhaltige Sanierung« enthält gegenüber der einfachen »Grundsanierung« zusätzliche Module wie etwa das Modul »Ausbaustandard Neumobiliar«.6 Wenn das nur ein gutes Omen ist … Die grundsätzlich denkmal verträglichste Minimalvariante »Instandsetzung« inklusive Herstellung von aktuellen gesetzeskonformen Standards (errechnete Kosten 280,7 Mio. €) wurde ebenso wie die teuerste Variante »Architektonisches Zeichen«, die als »Symbol für den Parlament arismus im 21. Jahrhundert« eine Veränderung des
SpRing
143
7 vid. Anm. 1 8 Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege, Leitsätze zur Denkmalpflege in der Schweiz (Zürich: vdfHochschulverlag, 2007), S. 25.
äußeren Erscheinungsbildes nach sich gezogen hätte, verworfen.7 So weit, so gut. Noch reden wir von einem Konzept und nicht von einem Projekt. Der große Rahmen ist abgesteckt, die konkreten Maßnahmen sind weitgehend bezeichnet, während Detailbearbeitung und Ausführung freilich noch offen sind. Der noch zu bestimmende Generalplaner soll es dann richten. Norm und Ausnahme In der ganzen Betriebsamkeit rund um die umfassende Sanierung des Parlaments scheint die anlässlich des erwähnten Wettbewerbs zur Neugestaltung des Nationalratssaals entfachte Diskussion über die Art und Weise, wie die Ertüchtigung des Nationalratssaals erfolgen soll, ziemlich ins Abseits geraten zu sein. Ganz laut gebärden sich im Gesamtkonzept die Mängel am bautechnischen Zustand, ungenügende bauund sicherheitstechnische Einrichtungen, Brandschutz- und Evakuierungskonzept sowie die barrierefreie Erschließung, um nur die wichtigsten der angeführten Gründe für eine Sanierung zu nennen. Das Gespenst der Normen und Kennzahlen geht um, oft der Feind historischer Gebäude, es drohen hohe zivil- und strafrechtliche Risiken, denen sich verständlicherweise niemand aussetzen möchte. Wir haben uns diese im historischen Bestand häufig inadäquaten und zerstöre rischen Standards selbst auferlegt. Dabei wird vergessen, dass Normen – auch bauliche Normen – eben den Normalfall regeln und nicht den Ausnahmefall, was historische Gebäude oft sind. Von Fall zu Fall soll deshalb bei Maßnahmen an historischen Gebäuden eingehend geprüft werden, ob auf das Einhalten einer Norm ganz oder teilweise verzichtet werden muss, oder ob das Normenziel durch andere geeignete Schritte erreicht werden kann. Kompensatorische Maßnahmen, die Veränderung oder Einschränkung der Nutzung eines Objekts oder organisatorische Vorkehrungen lösen gar manche Probleme.8 Mitunter sind es derartige Vorstellungen von der Normalität, die im Umfeld des Außergewöhnlichen – im konkreten Fall im Bereich des Parlamentsgebäudes – ziemlichen Schaden anrichten können. Die differenzierte Betrachtung der Sachlage im Falle des Parlamentsgebäudes ist aufschlussreich, da wir es hier seit den 1950er-Jahren mit einem Gebäude zu tun haben, dessen wesentlicher Wert im Neben- und Mit144
9 Barbara Riedl, Ideen aus Karton. Drei Modelle zum Plenarsaal des Wiener Parlaments, Bericht, Wien, im Jänner 2014. 10 Frau Mag. Barbara Riedl und Frau di Andrea Schenk von der Parlamentsdirek tion danke ich für die Einsicht in die genannten Unterlagen sowie für die bereitwillige und unkomplizierte Unterstützung. Ebenso danke ich Herrn Anton Habrich (Parlament, Abteilung Hochbau), der mir den Zugang zum Planmaterial im Parlamentsarchiv ermöglichte. 11 Bundesimmobiliengesellschaft, eu-weiter, offener, zweistufiger, anonymer Realisierungswettbewerb mit anschließendem Verhandlungs- verfahren für die Vergabe von Generalplanerleistungen zur Erlangung von baukünstlerischen Vorentwurfskonzepten für die Neugestaltung des Nationalratssaals des österreichischen Parlaments, Wien, Jänner 2008; die Verfahrensbestimmungen, das Raum- und Funktionsprogramm und die Protokolle der beiden Jurysitzungen zur ersten und zweiten Wettbewerbsstufe sind abzurufen bei http://www.architektur wettbewerb.at/data/ media/med_binary/ original/1200041072. pdf (05.04.2014)
e inander von baulichen Zeugen aus der Bauzeit 1874–1883 und des 1945–1956 erfolgten Wiederaufbaus durch die Architekten Max Fellerer (1889–1957) und Eugen Wörle (1909–1996) begründet ist. Es ist deshalb unumgänglich, den Beitrag beider Epochen, ebenso des späten 19. Jahrhunderts und der Nachkriegszeit gebührend zu würdigen und baulich entsprechend sorgfältig zu behandeln. Fellerer & Wörle restaurierten im Parlament und ergänzten beschädigte Teile im Stil und im Sinne des Hansen-Baus, so etwa die zentrale Säulenhalle. Sie bauten aber vor allem neu, neben dem neuen Nationalratssaal eine ganze Reihe weiterer Räumlichkeiten, die im Krieg zerstört oder beschädigt worden waren. Die umfangreichen Arbeiten, die sich inklusive Planung über ein Jahrzehnt hin zogen, sind aktenmäßig weitgehend belegt und im Parla mentsarchiv greifbar, leider aber nur auszugsweise bekannt und kaum aufgearbeitet. Eine im Entstehen begriffene Dissertation von Frau Mag. Barbara Riedl mag diesem Mangel Abhilfe schaffen. Im Auftrag der Parlamentsdirektion untersuchte und restaurierte sie zusammen mit Mag. Letizia Fischer drei im Parlamentsarchiv aufbewahrte Modelle des Nationalratssaals und hielt ihre Erkenntnisse in einem hochinteressanten Bericht zuhanden der Auftraggeberin fest.9 Davon wird weiter unten noch die Reden sein.10
SQuAre
Authentizität und Ambiente Doch blicken wir zurück ins Jahr 2008, als die Bundesimmobiliengesellschaft (big) den bereits genannten Realisierungswettbewerb zur Neugestaltung des Plenarsaales des Nationalrates und der angrenzenden Bereiche auslobte. Im »Raumund Funktionsprogramm (Stand Oktober 2007)« war immerhin schon in der Präambel zu lesen, dass der nr-Saal des Parlaments »unter Wahrung seiner Authentizität (Architektur der Wiederaufbau-Phase Fünfzigerjahre) und der seither gegebenen Identifizierung innerhalb der Bevölkerung an die zeitgemäßen Anforderungen angepasst werden« soll.11 Im selben Abschnitt ist auch die Rede von der »Bewahrung des seit 50 Jahren vertrauten Ambiente des Saales«. Das ist zu schaffen, selbst wenn man den explizit hohen Anspruch auf Wahrung der Authentizität ernst nimmt. Ernüchternd ist dann aber 145
Innenansichten Historische Aufnahmen
Blick in den neuen Plenarsaal kurz nach seiner Fertigstellung
Hintere Plätze im Plenum des neuen Plenarsaals. Die Architekten Fellerer & Wörle haben bis zum letzten Ausstattungs detail alles entworfen und aufeinander abge stimmt, von der Wandverkleidung über das Mobiliar bis hin zu den Beleuchtungskörpern und den Beschlägen.
Unterer Balkon mit Logen für den Bundespräsidenten, das Diplomatische Corps, Ehrengäste und die Mitglieder des Bundesrates, Kabinen für Rundfunk und Fernsehen bzw. Journalisten. Obere Galerie mit Sitzund Stehplätzen für Besucherinnen und Besucher
Den aus getriebenem Stahl gefertigten Adler mit Bundeswappen für die Stirnwand schuf der Bildhauer Rudolf Hoflehner.
146
12 ibid. 13 vid. Anm. 9, Raumund Funktionsprogramm, S. 48–49. 14 f+p Architekten et al., S. 297. 15 vid. Anm. 9, Raumund Funktionsprogramm, S. 49. 16 Der Plenarsaal des Österreichischen Nationalrats im Parlament (Max Fellerer & Eugen Wörle, 1955|56). Konservatorische Bestandsaufnahme. Zustandsbewertung und Maßnahmenempfehlung. Materialkatalog, Universität für angewandte Kunst, Institut für Konservierung und Restaurierung, September 2010; unter der Leitung von o.Univ.Prof. Mag. Dr. Gabriela Krist; Konzept, Projekt- und Schriftleitung: Dr. Martina GriesserStermscheg.
die Tatsache, dass in den Beurteilungskriterien in der Reihenfolge ihrer Bedeutung »Denkmalpflege« nach der baukünst lerischen Lösung, der funktionalen Lösung und der ökologisch-ökonomischen Lösung abgeschlagen erst an vierter Stelle aufgelistet ist.12 Diese Wertung der Kriterien bot jedenfalls keinen Anreiz, dem Leitgedanken nach Wahrung der Authentizität das nötige Gewicht zu verleihen, im Gegenteil. Diese Ausgangslage erklärt, warum es trotz edler Bekenntnisse zur Authentizität der fünfziger Jahre zu drei prämierten Projekten kam, die, zusätzlich zu räumlichen Veränderungen, über weite Strecken gerade die subtile Materialität und Farbigkeit des bestehenden Saals gewissermaßen ausgelöscht hätten und mit seinem besonderen Ambiente nichts anfangen konnten. Zum einen widerspiegelten die Resultate den in den Wettbewerbsvorgaben breit angelegten Interpretationsspielraum, den die Jury auch großzügig ermaß, zum anderen waren die »Vorgaben des Denkmalschutzes« alles andere als restriktiv.13 Die damaligen Vorgaben wurden unverändert in das aktuelle nun gültige Gesamtkonzept übernommen, obwohl seit 2010 eine wissenschaftlich fundierte Bestandsauf-
steEL&glaSs
nahme und Zustandsbewertung eine Überarbeitung dieser Vorgaben nahelegt (siehe unten).14 Würde man alle Zugeständnisse, die der Denkmalschutz macht, ausreizen, bliebe vom authentischen Saal von Fellerer & Wörle nicht mehr viel. Für den Saal geradezu fatal ist meines Erachtens, dass aus der Sicht des Denkmalschutzes die hochwertige Möblierung im Saal »komplett erneuert« – sprich entsorgt und ersetzt – werden kann.15
Vermutungen und Erkenntnisse Leider erst zwei Jahre nach dem Wettbewerb zur Neugestaltung des Nationalratssaals entstand am Institut für Konservierung und Restaurierung der Universität für angewandte Kunst eine akribisch und höchst kompetent durchgeführte konservatorische Bestandsaufnahme und Zustandsbewertung des Plenarsaals.16 Die darin aufgespannte Untersuchung des Saalraums und seiner zugehörigen umliegenden Räume, der festen Ausstattung und des Mobiliars samt 147
17 Konservatorische Bestandsaufnahme, S. 132. 18 Gutachten über die Sanierung des Nationalrats sitzungssaals im Parlamentsgebäude, von di Dr. Rant, gz 972, Stand 24.2.2009, zit. nach Konservatorische Bestandsaufnahme, Anm. 300. 19 Der Vertrag zwischen der Republik Österreich und Fellerer & Wörle über die Leitung des Wiederaufbaus wurde am 26. September 1945 verfertigt. Zit. nach Barbara Riedl, S. 58 f. 20 Ich danke Frau Mag. Monika Platzer und Frau Mag. Katrin Stingl vom Architekturzentrum Wien für die Hilfe und die Einsicht in die entsprechenden Ordnungsmappen des Nachlasses von Eugen Wörle. Ich danke meiner Assistentin MMag. Birgit Knauer und Mag. Monika Platzer, die im Rahmen eines Wahlseminars an meiner Abteilung »Denkmalpflege und Bauen im Bestand« der tu Wien eine Gruppe Studierender bei der Aufnahme des erwähnten Nachlasses von Eugen Wörle betreuten.
konstruktions- und materialtechnischer Analysen belegen einerseits einen erstaunlich subtil aufeinander abgestimmten Akkord der verwendeten (kostbaren!) Materialien, ihrer Farbigkeit und Verarbeitung, andererseits eine bis ins letzte Detail durchdachte Konstruktion der einzelnen Bauteile, von den auch akustisch ausgeklügelten Wandverkleidungen über die Möbel bis zu den Beschlägen und Beleuchtungskörpern. Um es vorweg zu nehmen: Die genannte Untersuchung beurteilt den Zustand der Oberflächen und der Ausstattung des Nationalratssaals dank vorbildlicher Wartung und Pflege als sehr gut.17 Einzig den Zustand des äußeren Glasdachs hatte bereits ein früheres Gutachten als schlecht bezeichnet,18 zudem hat das Verschleißprodukt Teppich seine Lebensdauer überschritten. Aufmerksamen Besucherinnen und Besuchern des Plenarsaals bleibt sein über alles betrachtet sehr guter Zustand denn auch nicht verborgen. Wer entwerferisch und handwerklich hohe Qualität zu schätzen weiß, wird diese im Plenarsaal bis in Kleinigkeiten hinein vorfinden und sie hier bestaunen können. Der Wiederaufbau des Parlamentsgebäudes hatte für die Republik Österreich selbstverständlich einen sehr hohen Stellenwert. Deshalb betraute sie die beiden hoch angesehenen und verdienten Architekten Fellerer & Wörle mit dem Auftrag. Bis heute sind keine Hinweise bekannt, wonach für diese Aufgabe ein Wettbewerb veranstaltet worden wäre. Nicht weiter erstaunlich ist, dass sich das Architektengespann angesichts dieses bedeutenden und großen Auftrags bereits ab September 1945 und über ein ganzes Jahrzehnt eingehend und intensiv mit der Aufgabe befasste. Ein Zusatzvertrag vom 22. Juli 1946 belegt schließlich, dass Fellerer & Wörle von Beginn an ausdrücklich auch für »die endgültige Lösung aller neu herzustellenden Ausstattung und Einrichtung« verantwortlich waren.19 Vom Umfang des Auftrags, der die Architekten ebenso baulich und gestalterisch bis hin zum Möbeldesign forderte, zeugen die vielen Schriftstücke und Pläne im Parlamentsarchiv, und ergänzend dazu ein ebenfalls umfangreiches Konvolut an Plänen sowie Planskizzen und Zeichnungen zum Projekt Nationalratssaal im Nachlass von Eugen Wörle im Architekturzentrum Wien.20 Im Jahr 2010 vermeldete die Konservatorische Bestands aufnahme, dass 1954 beim Modell-Atelier Josef Jirasek 148
21 Konservatorische Bestandsaufnahme, S. 8. 22 Barbara Riedl, S. 43. 23 ibid., S. 7.
»sogar ein Modell des neuen geplanten Saales in Auftrag gegeben« worden sei, es befinde sich heute jedoch nicht mehr im Parlament, der Verbleib sei leider unklar.21 Einem Mitarbeiter des Technischen Museums ist zu verdanken, dass dieses Präsentationsmodell im Maßstab 1:20, das bereits am 2. August 1956 mit dem Segen des damaligen Nationalratsprä sidenten Felix Hurdes dem Technischen Museum Wien für seine Schausammlung überlassen worden war, dort wieder aufgefunden wurde.22 Zweifellos brachte die Diskussion rund um die geplante Sanierung des Parlaments, vor allem aber die eingehende Beschäftigung der Universität für angewandte Kunst mit dem Bestand des Nationalratssaals drei weitere Modelle wieder ins Bewusstsein, deren Existenz im Parlament zwar bekannt war, aber bislang keine große Beachtung gefunden hatte.23 Barbara Riedl hat die einzelnen Modelle anlässlich der Restaurierung im Detail untersucht. Es ist hier nicht der Ort, diese Analysen im Einzelnen zu referieren. In unserem Zusammenhang ist wichtig zu wissen, dass es sich um drei so genannte Guckkastenmodelle im Maßstab 1:50 handelt, die an der als Deckel ausgeführten Decke sogar über
StreEt fIGhTing mEn eine künstliche Beleuchtung mit Glühbirnen verfügten. Durch eine große Öffnung an der Vorderseite blickt man ins Halbrund mit den Sitzreihen für die Abgeordneten, eine kleine Öffnung an der Rückseite erlaubt den Einblick von hinten zur hohen Stirnwand hinter dem Präsidium. Die drei Modelle haben einen unterschiedlichen und doch vergleichbaren Detaillierungsgrad und gehören zur Kategorie der Entwurfs- oder Ausführungsmodelle in unterschiedlichen Planungsstadien. Es handelt sich also eindeutig nicht um Präsentationsmodelle. Während zwei der Modelle – nach der Zählung von Riedl die Modelle I und II – den verbreiteten Typ des überlängten halbkreisförmigen Plenums mit einem geraden Abschluss zeigen (so wie der Saal auch gebaut wurde), präsentiert das Modell III einen querrechteckigen Grundriss mit einem Plenum, das sich wie im englischen Parlament in zwei großen Blöcken gegenübersitzt. Dass dabei Präsidium und Regierung seitlich platziert bleiben, ist für ein Parlament wenig praktikabel. Gemäß Riedl hatte diese Variante, an der 149
Modelle
Das Modell II mit einer klassizistisch anmutenden kolossalen Stützenreihe entspricht den frühesten Entwürfen und war vermutlich noch bis 1953 im Gespräch.
Das Modell III zeigt eine Variante mit rechteckigem Sitzfeld für Abgeordnete nach englischem Vorbild, die erst 1953 eingebracht, aber bereits 1954 wieder fallen gelassen wurde.
Das Modell I kommt dem schließlich ausgeführten Plenarsaal sehr nahe. Trotz einiger Abweichungen im Detail illustriert es jedoch augenfällig das Bestreben der Entwerfer nach einem modernen Ausdruck in reduzierter Formensprache. Die Stirnwand fehlt.
150
24 ibid, S. 66. 25 ibid., S. 86. 26 Friedrich Achleitner, »Das Büro der Demokratie«, in: Die Zeit online vom 21.05.2008, (05.04.2014).
Fellerer und Wörle keinen Gefallen fanden, erst 1953 Nationalratspräsident Hurdes eingebracht.24 Verschiedene Gründe, unter anderem auch der Umstand, dass mit der Rechteckform die noch vorhandenen Substrukturen des halbkreisförmigen Vorgängersaals nicht wiederverwendet werden konnten und zusätzliche Abtragungs- und Fundierungsarbeiten zusätzliche Kosten verursacht hätten, beförderten den Entscheid, das englische Vorbild fallen zu lassen. Wie sehr sich die politischen Verantwortlichen um das Gelingen ihres neuen Parlamentssaals bemühten, belegt auch eine Reise, die Parlamentsdirektor Roman Rosiczky und Ministerrat Josef Krzisch im Januar 1954 nach Straßburg und Bonn unternahmen, um dort das 1950 fertiggestellte Europahaus (1977 abgebrochen) bzw. das 1948|49 von Hans Schwippert gebaute Bundeshaus (1987 abgebrochen) zu besichtigen.25 Laut Friedrich Achleitner, der in einem Artikel Eugen Wörle zitiert, sei Rosiczky in Tat und Wahrheit der einzige gewesen, der sich interessiert und aktiv für ihr Projekt eingesetzt hätte, wogegen die Bundesregierung nur an einer möglichst raschen Inbetriebnahme des Plenarsaals interessiert gewesen wäre und sich wenig um architektonische Fragen gekümmert hätte.26 Dem Schreibenden war bereits vor dem Abschluss der Studie von Barbara Riedl bei der Sichtung der Pläne und Skizzen zum Nationalratssaal, welche im Architekturzentrum auf bewahrt werden, aufgefallen, wie sehr die Architekten um architektonische und gestalterische Lösungen gerungen hatten. Zahlreich sind nämlich die Blätter, die sich mit der großen Form des Saales auseinandersetzen. Etliche Varianten skizzieren beispielsweise unterschiedliche Sitzordnungen im Plenum und Varianten für das Podium oder erkunden Gestalt und Ausführung anderer Elemente und Bauteile. Die Wiederent deckung, Restaurierung und erste Erforschung der drei Modelle im Parlamentsarchiv durch Barbara Riedl liefert nun ergänzend dazu und in Wechselwirkung neue Elemente zum Verständnis des Entwurfsprozesses und der letztend lichen Ausführung. Unabhängig voneinander, mit unterschiedlichen Ziel setzungen und unterschiedlichen Rahmenbedingungen konvergieren die Beobachtungen von Barbara Riedl und des
sTYlE
151
Schreibenden zu einem klaren Konsens, wonach aufgrund so vieler erstmals wirklich zu Rate gezogener Quellen und neuer Erkenntnisse im Zusammenspiel mit der ebenso im Grundsatz wie in vielen Spezialfragen höchst aufschluss reichen Bestandsaufnahme durch die Universität für angewandte Kunst eigentlich eine erneute Bewertung des bestehenden Saales von Fellerer & Wörle erfolgen muss. Besonders dringlich scheint dies in Bezug auf die Vorgaben des Denkmalschutzes notwendig zu sein, die vor sieben Jahren – also vor der obgenannten Bestandsaufnahme – ausgegeben und nicht mehr verändert wurden und inzwischen nicht mehr genügen.
27 Einen, wenn auch nicht ganz aktuellen, aber guten Einstieg in das Thema bieten die beiden Sammelbände Martin Warnke (Hg.), Politische Architektur in Europa vom Mittelalter bis heute, Repräsentation und Gemeinschaft (Köln: DuMont, 1984) und Ingeborg Flagge, Wolfgang Jean Stock (Hg.), Architektur und Demokratie, Bauen für die Politik – von der amerikanischen Revolution bis zur Gegenwart (Stuttgart: Hatje, 1992).
Demokratie und Ringen um ihre Repräsentation Die Frage, welche Bautypen und Bauformen in der Lage sind, die Demokratie anschaulich und angemessen zu verkörpern, ist nicht neu. Untersuchungen zur »politischen Architektur« haben sich jedoch überwiegend nicht mit dem Bauen für die Demokratie, sondern vielmehr mit der Architektur als Ausdruck der Macht beschäftigt.27 Hansen berief sich in Wien mit seinem Gebäude auf griechische Vorbilder und somit auf das alte Griechenland als Wiege der Demokratie. Die diktatorische Ideologie des Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg demolierten dann auch in Österreich und Wien gleichermaßen demokratische Institutionen und deren bauliche Repräsentanten und Symbole. Nach den langen Jahren un heilvoller Nazi-Emphase ging man nach Kriegsende leerem Pathos auf Distanz. In der Architektur wurden gängige Würdezeichen wie kolossale Säulen und Pilaster, Skulpturen im Geruch faschistischer Pathosformeln und plakative Monumentalität möglichst gemieden. Wie sehr Fellerer &Wörle im Entwurfsprozess zum neuen Nationalratssaal mit dieser kurz nach dem Krieg so präsenten Stimmung gerungen haben, wird bei genauerer Betrachtung der Entwurfsskizzen und vollends in zwei der Modellen im Parlamentsarchiv offenbar. Vereinfacht stellte sich die Frage, in welcher Weise die Gestaltung des neu zu errichtenden Nationalratssaals die Würde des Raums und seiner Funktion als Ort demokratischer Auseinandersetzung anschaulich ausdrücken sollte. Die neu erstandene Demokratie, die nach der Besatzungszeit mit dem Staatsvertrag vom 15. Mai 1955 auch völkerrechtlich im 152
28 Barbara Riedl, S. 72.
unabhängigen und neutralen Österreich wiederhergestellt wurde, sollte ebenso unmissverständlich nichts mehr mit den vorangegangenen Jahrzehnten gemein haben und auch in ihren architektonischen Zeichen und Symbolen, im baulichen Ausdruck den Aufbruch in eine neue, bessere und demokra tische Zeit signalisieren. So überrascht es nicht, dass vor allem im Nachlass von Eugen Wörle im Architekturzentrum Wien zahlreiche signierte und datierte Zeichnungen aus der Hand von Wörle und Fellerer diese Recherche eindrücklich dokumentieren. Der hier gegebene Raum ist zu knapp, um im Einzelnen auf diese gestalterische Auseinandersetzung einzu gehen. In einem ersten Anlauf hat dies Barbara Riedl bereits getan und wird es in der laufenden Dissertation über Fellerer & Wörle und das Parlament noch vertiefen. In Anbetracht der erhaltenen Skizzen und Entwürfe scheint Eugen Wörle im gestalterischen Entwurfsprozess die wichtigere Rolle gespielt zu haben.28 Offenkundig ist – um nur auf wenige Charakteristika der entwerferisch ausgeloteten Architektur einzugehen – die Frage, ob der Raum als Nacherzählung des verlorenen originalen Saals und aus dem gängigen Repertoire der Würdeformeln schöpfend wiederum mit monumentalen Säulen oder Stützen auszustatten sei oder nicht. Dafür sprach die allseits verstandene Tradition der Säule als mehrfach konnotiertes Element, das auf Würde und Rang hinweist, dagegen wiederum die Gefahr, mit der Verwendung von monumen talen Säulen oder Stützen wieder in das Fahrwasser des überwundenen Pathos antidemokratischer Ideologien zu geraten (die entsprechenden Skizzen sind, soweit datiert, alle im Jahr 1948 entstanden). Nicht wenige Zeichnungen versuchen mit Säulenstel lungen an der Stirnwand und|oder entlang dem Halbrund des Plenums über die Geschosse der vorgesehenen Galerien zu arbeiten. Genauer genommen handelt es sich um frei stehende, schlanke zylindrische Stützen, die in gewissen Varianten mit Statuen bekrönt sind. In Verbindung mit der sonst flächig gehaltenen Raumschale bewirken diese auch konstruktiv eingesetzten Bauteile eine eindeutig noble und in ihrer zurückhaltenden Verwendung erhabene Stimmung. Ganz anders und im gestalterischen Umfeld ihrer Zeit eindeutig moderner
sYmBol
153
Entwürfe Zahlreiche, im Nachlass von Eugen Wörle im azw aufbewahrte Skizzen von Eugen Wörle und Max Fellerer zeigen, wie die Ent werfer im Laufe des Entwurfsprozesses von traditionellen Vorstellungen mit klassizistischer Instrumentierung unter Verwendung von Kolossalordnungen, Statuen, Pinienzapfen, ja sogar Vorhängen zu einer modernen Auffassung einer reduzierten Formensprache fanden. Bis zuletzt scheint die Frage »mit oder ohne Stützen« aktuell gewesen zu sein.
Die ersten beiden Skizzen, sig. »ew 48« und Skizzen 3 und 4, sig. »mf 48«, knüpfen mit ihren Stützen an das Repertoire von Hansens Bau an.
Raum in etwa wie ausgeführt mit Projekt Bundesadler
154
Skizzen 5 und 6, nicht signiert, vermutlich Eugen Wörle, zeigen einen nahezu identischen Entwurf in zeitgemäß moderner Gestaltung, einmal mit einmal ohne quadratische Stützen. Die Stirnwand zeigt noch eine Figurengruppe. Offenbar war 1954 noch nicht beschlossen, dass anstelle dieser Gruppe der Bundesadler an die Stirnwand kommen sollte (Riedl, S. 83).
wirken alle Entwürfe, die ohne überlängte Säulen arbeiten. Beeindruckend sind die offensichtlichen Anstrengungen der Entwerfer, namentlich von Eugen Wörle, unter Ausschluss monumentaler Stützenreihen dennoch einen von Ernst und Würde durchdrungenen Raum für die Demokratie zu schaffen. Dies gelingt ihm bereits zeichnerisch in fein unterschiedener Variierung einzelner Bauteile, wie der Anordnung und Beschaffenheit der umlaufenden Galerien und ihrer Brüstungen oder der Gestaltung der hohen, fein ziselierten Stirnwand zwischen zwei Risaliten. Die Dynamik der Rundungen im Raum und der allseits präsente Rhythmus in der Gestaltung, der ebenso in der großen Form der einfachen Stirnwand oder in der Anordnung der Sitzreihen im Plenum wie in der Ausformung untergeordneter Bauteile bis hin zu kleinen Ausstattungsdetails wirken überzeugend. Der etwas plakative Gegensatz eines klassischen versus modernen Ansatzes scheint sich in den stützenfreien Entwürfen, die dann mutatis mutandis auch realisiert wurden, gleichsam aufzuheben. Im ausgeführten Nationalratssaal ist das Klassische im Modernen aufgehoben und umgekehrt. Wie in den Entwürfen angelegt, vermochten dies Fellerer & Wörle weitab jeden kleinbürgerlichen Miefs oder anbiedernder oder gar kitschiger klassischer Formensprache im realisierten Saal auch meisterhaft umzusetzen.
trADITIon
29 Konservatorische Bestandsaufnahme, S. 82 f.
Bis ins Letzte durchdacht und gestaltet Bei der Sichtung der vielen Hundert Zeichnungen und Pläne zum Wiederaufbau des Parlamentsgebäudes und namentlich des Plenarsaals fällt auf, dass von den Architekten keine Maßnahme und – den in Stahl getriebenen Bundesadler von Rudolf Hoflehner ausgenommen29 – die Gestaltung von kaum einem Ausstattungsstück aus der Hand gegeben wurde. Das im Zusammenhang mit dem Parlamentsgebäude öfters und zurecht verwendete Prädikat »Gesamtkunstwerk« muss zweifelsfrei auch für die Neubauten, die neuen Einrichtungen und vor allem für den Plenarsaal von Fellerer & Wörle gelten. Der stilsichere Umgang mit einem damals wie heute noch modern wirkenden Formenrepertoire sowie der gekonnte Einsatz weniger, aber edler und exquisit verarbeiteter Materialien 155
Details Architekten Fellerer & Wörle Wiederaufbau Parlament
Uhr an der Brüstung der 1. Galerie Herrenhaus Saaltrakt Plan I d 1895 Maßstab 1:1 gezeichnet von »Ledl« und »Lang« am 17. Februar 1956.
Schnitt durch die 1. Galerie mit Klappsesseln Herrenhaus Saaltrakt Plan I e 1814, Maßstab 1:10 gezeichnet von »Ledl« am 9. Dezember 1955.
Deckenleuchte mit geschliffenenen Glaskugeln für die Besprechungszimmer beim Sitzungssaal Herrenhaus Plan I e 1610 Maßstab 1:1 gezeichnet von »L.« am 21. März 1955.
156
30 ibid., S. 93–98, 130.
beeindruckt. Vom traditionell noblen Nussbaumfurnier bis hin zu den schwarzen »Formica«-Schichtstoffplatten für die Pulte der Abgeordneten, von den mit Rindsleder überzogenen Drehsesseln im Plenum bis zu den Stahlrohrklappsesseln für Besucher und Journalisten auf den Galerien, deren Sitzschalen und Rückenlehnen aus Kunstharzpressholz, dem sogenannten »Durofol«, gefertigt sind und gemäß Bestandsaufnahme einen außerordentlich guten Zustand aufweisen,30 gehen die aufeinander abgestimmte feste Ausstattung und das Mobiliar in eine raffinierten Synthese auf, die mit der großen räumlichen Form und ihrer Zweckbestimmung im überzeugenden Einklang steht. Von alledem muss (wie erwähnt mit Ausnahme des Teppichs) gar nichts ausgewechselt oder erneuert werden, weil der schlechte Zustand es erfordern würde. Der Verlust auch nur geringfügiger Einzelteile würde die austarierte Gestaltung und den für die Entstehungszeit so typischen und deshalb kostbaren Ausdruck des Raums mit seinen hochwertigen und handwerklich mit größter Sorgfalt behandelten Materialien zerstören. Es wurden nicht nur Möbel, wie etwa Stühle und Rauchtische oder das mit einer motorisierten Hebevorrichtung ausge rüstete Rednerpult oder die Stenografentische samt Beleuch tungskörper entworfen, auch kleinere Objekte und Accessoires wie z. B. schwenkbare Kleiderhaken für die Garderobe im Zwischengeschoß, Ziergitter, Notbeleuchtungsscheinwerfer wurden gezeichnet – und im Maßstab 1:1 – jede einzelne kleine Glaskugel der Beleuchtungskörper in den Besprechungszimmern! Plan I d1895 im Parlamentsarchiv zeigt im Maßstab 1:1 die Uhr in der Mitte der Brüstung der ersten Galerie. Man konnte diese Zeitmaschine damals kaum moderner und gewissermaßen zeitloser gestalten: Zwei fast gleich lange, längs gefaltete Zeiger und zwölf im Kreis angeordnete elliptische Punkte, welche die Stunden bezeichnen – Architekten Max Fellerer & Eugen Wörle, gezeichnet am 17.02.1956 von Ledl und Lang. Dem zu Unrecht immer vorgebrachten Urteil, der Plenarsaal sei – typisch österreichisch – in seinem Entwurf und in seiner Gestaltung unentschieden und wenig originell, nicht mutig und müsse deswegen auch gestalterisch überformt werden, ist heute entschieden zu widersprechen.
tRaNsITion
157
31 Judith Eiblmayr und Iris Meder (Hg.), Moderat modern. Erich Boltenstern und die Baukultur nach 1945, Kat. Ausst. (Salzburg: Anton Pustet, 2005). 32 Gabriele Kaiser, »Gelassene Eleganz«, in: Stefan Oláh (Hg.), Österreichische Architektur der Fünfziger Jahre. Fotografiert von Stefan Oláh (Salzburg: Anton Pustet, 2011), S. 160–165. 33 Hans Wilhelm Auer (1847–1906, Studium bei Semper in Zürich, dann bei Hansen in Wien), erbaute 1894–1902 das Parlamentsgebäude in Bern; 1874–1883 hatte er im Auftrag von Hansen den Bau des Parlaments in Wien geleitet. 34 Roland Rainer, »Sitzungssaal im Österreichischen Parlament«, in: Der Bau, Bauund Architekturzeitschrift (11. Jg., Heft 7|8, 1956), S. 170–176, S. 170.
Auch das viel verwendete Prädikat »moderat modern« trifft meines Erachtens für den Plenarsaal aus den Fünfzigerjahren nicht zu.31 Sehr viel trefflicher ist da Gabriele Kaisers Charak terisierung »gelassene Eleganz«.32 Auch die vielgescholtene schlechte Qualität früher Nachkriegsbauten trifft für den Plenarsaal nachgewiesenermaßen überhaupt nicht zu. Nein, es handelt sich beim Plenarsaal schlicht um eine Inkunabel der österreichischen Nachkriegsarchitektur, deren Qualitäten heute im europäischen Kontext ziemlich alleine da stehen. Nun mündet der Text eines Schweizers, der als Gast in Österreich an der Technischen Universität Denkmalpflege lehren darf, in ein Plädoyer für die möglichst uneingeschränkte Erhaltung dieses bedeutenden Bauwerks. Der Schreibende kommt aus dem Land, das 1902 ein neues, von Hans Wilhelm Auer entworfenes und gebautes Parlamentsgebäude erhielt, das nach langwierigen Streitereien und Planungen zur Zeit seiner Fertigstellung zumindest stilistisch aber bereits passé war.33 Neidisch blickt der Schreibende auf Wien, wo aus der Not kriegerischer Zerstörungen das bedeutende Parlamentsgebäude von Hansen in den Fünfzigerjahren ein kongeniales, ergänzendes Implantat erhielt, das zur Zeit seiner Fertigstellung in vielen Belangen seiner Zeit voraus war und deshalb noch heute frisch wirkt. Architekturgeschichtlich betrachtet und unter dem Eindruck unbedingt vorhandener Denkmalwerte handelt es sich aus der Sicht des neidischen Schweizers beim Plenarsaal von Fellerer & Wörle um ein Denkmal erster Güte, dem nur ein höchst sorgfältiger konservatorischer Umgang mit seiner Substanz gerecht wird. Roland Rainer hatte 1956 den Saal als »ernst und klar, fast durchsichtig, sachlich und höchst gediegen« beschrieben. Die Architekten hätten »eine Übereinstimmung von Konzept, Detail und Ausführung und eine Ausführungsqualität erreicht, wie man sie eindrucksvoller lange nicht gesehen« habe. »An dieser Arbeit hätte Adolf Loos seine Freude gehabt – er würde wenig anders gemacht haben«.34 Dem hat der nachgeborene Schweizer nichts hinzuzufügen. Das zur Zeit seiner Fertigstellung wenig moderne Parlamentsgebäude in Bern ist ein Jahrhundert später ein um fassend geschütztes und gepflegtes Denkmal, das aber nach wie vor voll funktioniert und intensiv genutzt wird. Hier in Wien mag der Hinweis genügen, dass die jüngste Ertüchtigung 158
35 Bundeshaus, Umbau und Sanierung Parlamentsgebäude Bern, 2006–2008 (Bern: Bundesamt für Bauten und Logistik, bbl, 2008). Aeby & Vincent –Parlamentsgebäude Bern, Adrian Scheidegger (Hg.), Markus Jakob (Text) Alexander Jaquemet und Adrian Scheidegger (Foto grafie) (Bern: Stämpfli, 2009).
des Gebäudes, namentlich des großen Nationalratssaals mit allen seinen Erfordernissen an Klima, Elektronik und einer vernünftigen Barrierefreiheit mit Erfolg und ohne nennenswerte Beeinträchtigung der historischen Substanz durch geführt werden konnte.35 Dies ist unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Grundregeln im doppelten Sinne mit Gewinn und deshalb nachhaltig und mit Respekt vor einer hervorragenden Leistung der Architekten Fellerer & Wörle und der damaligen Auftraggeber zweifelsohne auch in Wien möglich. Ein halbes Jahrhundert nach seiner Errichtung gebührt dem kostbaren Gesamtkunstwerk der österreichischen Nachkriegsmoderne unbedingte Fürsorge und ein umfassender Schutz. Anzustreben ist eine behutsame und intelligente (bau)technische Ertüchtigung. Im Übrigen wird eine Auf frischung Wunder wirken und ebenso dem großzügigen Raum wie seiner bedeutenden Ausstattung die einzigartige Stimmung bewahren. Das meint jedenfalls der neidische Gast.
tUmultUOus
159
Dank
Diese Ausgabe des UmBau geht auf eine Initiative des Vorstands der ögfa zurück, der mir im Juni 2013 den Vorschlag machte, keinen »normalen« Katalog zur Architekturbiennale zu produzieren, sondern eine Sonderausgabe des UmBau. Für die Frage, wieviel Architektur die Macht braucht und wie viel Macht die Architektur, ist der UmBau tatsächlich das richtige Medium. Dass es viele Möglichkeiten gibt, dieses Thema zu bearbeiten, ist klar, und ich danke der ögfa und ihrem Vorstand, insbesondere Gabu Heindl als Vorsitzender, dass sie mir in dieser Hinsicht völlig freie Hand gelassen haben. In der Auswahl der Beiträge habe ich versucht, eine wichtige Tradition der ögfa hoch zu halten, nämlich nicht nur Architekten zu Wort kommen zu lassen. Daher kommen die Beiträge in diesem UmBau vor allem aus anderen Disziplinen: Rechts- und Kulturwissenschaften, Soziologie, Kunstgeschichte und Musikwissenschaften. Mein besonderer Dank gilt den Autorinnen und Autoren, die sich dem Thema mit großer Offenheit auf teilweise fremden Terrain genähert haben. Bei der Suche nach Struktur und Autoren für dieses Heft haben mich Martina Kögl und Walter Chramosta unterstützt. Ich danke für die informativen Gespräche, auch wenn ich nicht alle Anregungen aufgenommen habe. In der Produktionsphase des UmBau war Katharina Brandl meine Assistenz. Ich danke ihr für die perfekte Arbeit in Recherche, Lektorat und Organisation. Für Satz und Layout war, wie schon bei den letzten Ausgaben des UmBau, Gerda Palmetshofer verantwortlich. Sie hat mit Humor und guten Nerven wesent lichen Anteil daran, dass dieser UmBau in der bewährten Qualität trotz knappem Zeitplan realisiert werden konnte. Das »Projekt Biennale« ist die Grundlage des vorliegenden UmBau, und Dank gebührt daher allen, die an diesem Projekt Anteil hatten. Das sind an erster Stelle die Studierenden der tu Wien, die über zwei Semester Recherchearbeit zu den Parlamenten der Welt geleistet haben. Das sind die Kollegen an der Abteilung für Gebäudelehre an der tu Wien, die teilweise aktiv involviert waren und teilweise wohlwollend zugelassen haben, dass beträchtliche zeit liche Ressourcen unserer Abteilung in dieses Projekt geflossen sind. Ich danke insbesondere Florian Sammer und Kathrin Schelling, die sich mit umso mehr Begeisterung in die Recherche gestürzt haben, je schwieriger sich die Suche nach brauchbaren Unterlagen zu den Parlamenten einzelner Länder gestaltete. Ebenfalls in der Recherche, aber vor allem in der aufreibenden Organisation war Daniela Hahn die Stütze des Projekts. Doris Grüssinger betreute die Finanz- abwicklung und das Backoffice mit Ruhe und Präzision. Gebaut wurden die 196 Modelle in der Werkstätte der Firma General Laser teilweise in Handarbeit, teilweise in 3d-Druckverfahren. Ich danke deren Chef Ivan Tochev für die Gelassenheit, mit der er diesen Großauftrag zeitgerecht bewältigt hat. Die Ausstellung, die wir in Venedig zeigen, ist weder Werkschau noch reine Themenausstellung. Sie versammelt im Pavillon, der mit seinem Hof selbst Ausstellungsobjekt ist, die Sammlung der Parlamente der Welt verbunden mit Beiträgen aus mehreren künstlerischen Richtungen. Ich danke den Beteiligten, dass sie sich mit ihren Arbeiten an die Vorgaben des Konzepts angepasst haben. Maria Auböck und Janos Kárász hätten einen Grünraum schaffen können, der schon auf den ersten Blick nicht gewachsen, sondern gestaltet aussieht. kollektiv|rauschen (Sebastian Bauer, Christian Schröder, Samuel Schaab und Markus Taxacher) hätten ihren Klangraum stärker in den Vordergrund spielen können, Coop Himmelb(l)au die Präsentation von Modellen einfordern. Vera Kumer hätte auf Projektionen bestehen können, statt unsere Bildschirmkuppeln als Träger für ihre Arbeit zu verwenden. Markus Zimmermann hat – unterstützt von Moritz Haase – seine Kreativität in die Technik und Dramaturgie
160
dieser Kuppeln investiert, ohne seinen weitergehenden Konzepten allzu sehr nachzutrauern. Das buero bauer, zuständig für die grafische Gesamtkonzeption des Biennalebeitrags, hat unsere schrittweise Reduktion an grafischen Elementen im Ausstellungsraum nicht ohne Bedenken, aber letztlich verständnisvoll hingenommen. Eine tragende Rolle im Team hatte Thomas Amann, der von den ersten konzeptionellen Überlegungen über Fragen der Gestaltung und Konstruktion bis zur Leitung des Aufbaus als kongenialer Partner mitgewirkt hat. Das Aufbauteam, das er für Venedig zusammengestellt hat –Joachim Hackl, Stephan Ebert, Matthias Kogler, Klaus Molterer, Georg Molterer – hat den Aufbau mit großer Gelassenheit und Präzision gemeistert. Unterstützt wurde es dabei von Troels Bruun, der den Pavillon und seine Eigenheiten genauso gut kennt wie jene der Handwerker in Venedig. Dass dieser UmBau etwas anders aussieht als die früheren, wird nicht nur Abonnenten auffallen. Die Interventionen auf dem Titel und im Kern stammen vom buero bauer, wo neben Erwin Bauer besonders Stephan Göschl für seine ebenso kreative wie professionelle Arbeit zu danken ist. Die englischen Begriffe, die in die rechten Seiten des UmBau eingreifen, stammen aus dem Begriffspool der zweiten, ebenfalls vom buero bauer gestalteten Publikation, die wir zur Ausstellung erarbeitet habe: ein Katalog, der Zeichnungen und Daten zu 196 Parlamentsbauten der Welt auffächert. An der Recherche und den Texten für diesen Katalog haben neben Katharina Brandl Margarete Lengger und Andrea Lehsiak mitgewirkt, an den Reinzeichnungen Philipp Ohlmeier und Julia Klaus. Wir danken dem Birkhäuser Verlag, insbesondere Herrn Ulrich Schmidt für seine wertvollen Kommentare zu beiden Publikationen. Gerade im Kontext einer Biennale ist die Kommunika tion nach außen eine wichtige Aufgabe. Ich danke Ana Berlin von Ana Berlin Communications für ihre exzellente Pressearbeit und nicht zuletzt dafür, dass sie uns mit Andreas Balon einen Fotografen empfohlen hat, dessen Arbeit uns so überzeugt hat, dass wir ihm schließlich auch die Verantwortung für den Fotoessay in diesem UmBau übertragen haben. Die Homepage nach einem Entwurf von buero bauer entwickelte kalbeck media, dessen Chef Daniel Kalbeck ich auch für die Konzeption des Wiki zum Thema »Orte der Macht« danke. Für die Gestaltung und Organisation der inhaltlichen Vermittlung im Pavillon über die Laufzeit danke ich Isabelle Blanc, Ilaria Vernier und Chiara Riccardi von Toikoi – Erzäh lende Räume. Zu danken ist schließlich den Unterstützern des Projekts, allen voran den beiden zuständigen Ministern Claudia Schmied und ihrem Nachfolger Josef Ostermayer sowie den Beamten der Kunstsektion im Bundeskanzleramt, die sich nicht zuletzt von der Idee überzeugen ließen, die bevorstehende Hofsanierung für eine temporäre Begrünung zu nutzen. Den Sponsoren des Projekts, die im vorliegenden UmBau auf den Seiten 4 und 5 genannt sind, danke ich herzlich für ihre Kooperation und für ihr Interesse an unserem Projekt. Der abschließende und größte Dank gilt Harald Trapp, der den BiennaleBeitrag praktisch von Beginn an gemeinsam mit mir konzipiert und seine lang jährige Erfahrung in der Ausstellungsgestaltung in das Projekt eingebracht hat. Ich hoffe, dass man dem Ergebnis anmerkt, wie viel Vergnügen uns diese Arbeit gemacht hat.
uNoFficIaL
Christian Kühn
161
Anhang Biografien Bildnachweis Backlist
162
Biografien Peter Androsch ist Komponist, Musiker, Forscher und Autor. Seit Beginn der 1990er-Jahre intensive kompositorische Tätigkeit in den Feldern Musiktheater, Multimedia, Orchester, Kammermusik, Chor, Elektroakustik, Bühnenund Filmmusiken. Von 2006 bis 2010 Musika lischer Leiter von Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas. Gründer und Leiter von Hörstadt – Labor für Akustik, Raum und Gesellschaft. Nott Caviezel ist Professor für »Denkmalpflege und Bauen im Bestand« an der tu Wien. Studien in Freiburg ch (Kunst- und Architekturgeschichte, Denkmalpflege), 1983–1986 Leitung Nationales Forschungsprogramm 16 »Methoden zur Erhaltung von Kulturgütern«, 1987–1995 Direktor der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, ab 1995 Forschungsprojekte und Lehraufträge (Univ. Bern und Lausanne), 2002–2011 Chefredaktor werk, bauen + wohnen, seit 2009 Präsident Eidg. Kommission für Denkmalpflege. Ita Heinze-Greenberg ist Senor Scientist am Institut für Geschichte und Theorie der Architektur der eth Zürich (Lehrstuhl Professur Tönnesmann). Studium der Kunstgeschichte und Philosophie in Bonn, Dissertation über das Thema Erich Mendelsohn. Bauten und Projekte in Palästina 1934–1941. Forschungs- und Lehrtätigkeit zwischen 1984 und 1997 am Technion in Haifa, Israel. Danach folgten Forschungsprojekte als freie Autorin in Süddeutschland sowie Dozententätigkeiten an der Universität Augsburg und der tu München. Jens Kastner ist Kunsthistoriker und Soziologe und lehrt an der Akademie der bildenden Künste Wien. Zuletzt erschien von ihm Der Streit um den ästhetischen Blick. Kunst und Politik zwischen Pierre Bourdieu und Jacques Rancière (Wien: Verlag Turia + Kant, 2012). Weitere Veröffentlichungen in diversen Zeitungen und Zeitschriften zu Sozialen Bewegungen, Cultural Studies und zeitgenössischer Kunst. Seit 2005 koordinierender Redakteur von Bildpunkt. Zeitschrift der ig Bildende Kunst. Christian Kühn ist Professor am Institut für Architektur und Entwerfen der tu Wien mit Schwerpunkt Bildungsbau. Architekturkritiker für Die Presse« sowie für Fachjournale, unter anderem Architektur- und Bauforum, archithese und arch+. 1995–2000 im Vorstand der ögfa – Österreichi-
163
sche Gesellschaft für Architektur, seit 2000 Vorstand der Architekturstiftung Österreich. Mitglied des Beirats für Baukultur im Bundeskanzleramt und des Denkmalbeirats. Seit 2008 Studiendekan der Studienrichtung Architektur an der tu Wien. Alfred J. Noll ist seit 1992 Rechtsanwalt in Wien und Univ.-Prof für Öffentliches Recht und Rechtslehre, spezialisiert auf Medien- und Urheberrecht sowie auf Kunstrestitutionsrecht. Er ist Gründer und Mitherausgeber des Journal für Rechtspolitik, Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der Zeitschrift Medien und Recht, Ausschussmitglied der Wiener Rechtsanwaltskammer seit 2004 sowie Mitglied der Österreichischen Juristenkommission. Harald Trapp ist Ausstellungsarchitekt (mak, Künstlerhaus Wien, Kunsthalle Bonn, Biennale Venedig), Lehrender an der School of Architecture (University of East London, uk) und Universitäts assistent am Institut für Architektur und Entwerfen der tu Wien, Abteilung Gebäudelehre. Studium der Soziologie (München), Architektur (Wien, London, Stuttgart), Promotion (tu Wien).
viOlEnCe
Gabu Heindl ist Architektin in Wien (gabu Heindl Architektur), Vorstandsvorsitzende der ögfa – Österreichische Gesellschaft für Architektur und Lehrende an der Akademie der Bildenden Künste Wien. Realisierungen öffentlicher Kulturund Sozialbauten sowie Forschungsarbeit und Publikationen zur Kritik postfordistischer Arbeitsräume und neoliberaler Stadtplanung als Monographien und in Fachzeitschriften wie jae, Umbau, Volume, dérive. Mitglied im Architekturbeirat der Bundesimmobiliengesellschaft (big).
Wolf D. Prix ist Design Principal und ceo von Coop Himmelb(l)au. Er studierte Architektur an der tu Wien, an der Architectural Association in London und am Southern California Institute of Architecture (sci-Arc) in Los Angeles. Wolf D. Prix zählt zu den Erfindern der Architekturrichtung des Dekonstruktivismus. Die Einladung zur Ausstellung Deconstructivist Architecture im moma New York im Jahr 1988 bedeutete den internationalen Durchbruch für Coop Himmelb(l)au.
Bildnachweis
S. 27, alle: © Ministry of Urban Development and Tourism, Technical Central Archive of Construction S. 28, oben: © gemeinfrei (Wikimedia Commons) S. 28, Mitte: © Coop Himmelb(l)au S. 28, unten: © Markus Pillhofer S. 29, beide: © isochrom S. 30: © Coop Himmelb(l)au S. 31, oben: © Coop Himmelb(l)au S. 31, unten: © Markus Pillhofer S. 33, oben: © Markus Pillhofer S. 33, unten: © Fotograf unbekannt, gemeinfrei (Wikimedia Commons)
S. 146, oben: © Architekturzentrum Wien, Inv. Nr. N09-098-005-F, Foto: Prof. Madenksy, Repro N. Caviezel S. 146, Mitte links: © Architekturzentrum Wien, Inv. Nr. N09-098-007-F, Foto: Prof. Madenksy, Repro N. Caviezel S. 146, Mitte rechts: © Architekturzentrum Wien, Inv. Nr. N09-098-005-F, Foto: Prof. Madenksy, Repro N. Caviezel S. 146, unten: © Architekturzentrum Wien, Inv. Nr. N09-098-005-F, Foto :Prof. Madenksy, Repro N. Caviezel S. 150, alle: Parlamentsarchiv, © Papierrestaurierung Hirschengasse S. 154, oben: Skizzen © Architekturzentrum Wien, Foto N. Caviezel S. 154, unten: Skizze, nicht sig. und nicht dat., © Parlamentsarchiv, Foto: N. Caviezel S. 156, alle: © Parlamentsarchiv, Foto: N. Caviezel
S. 34: © Christian Kühn S. 34: Archiv Christian Kühn S. 38: © Christian Kühn S. 42: © Nationalbibliothek ÖNB Wien, 117.760-B
Trotz intensiver Recherche konnten die Urheberrechte nicht in jedem Fall zweifelsfrei geklärt werden. Sollten etwaige Rechte bestehen, bitten wir um Mitteilung.
S. 10: © Christian Kühn S. 14, oben: © Ahmed Abd El-Fatah, gemeinfrei (Wikimedia Commons) S. 14, unten: © Sherif9282, gemeinfrei (Wikimedia Commons)
S. 44–72: © Andreas Balon S. 124: © Le Corbusier, Entwurf für die fosse de la considération mit dem Monument der Offenen Hand, Chandigarh, 1951 (ausgeführt 1985) © FLC Paris | Bildrecht Wien, 2014
S. 127: © Publikation Thomas Hobbes (1651), gemeinfrei (Wikimedia Commons) S. 130, links: © Publikation J. C. Lavater (1772), gemeinfrei S. 130, rechts: © Publikation Anonym (1788), gemeinfrei S. 131: © Claude Nicolas Ledoux, gemeinfrei (Wikimedia Commons) S. 132: © Publikation: Max Hasak, Der Dom zu Köln, 1911 gemeinfrei (Wikimedia Commons) S. 134: © The Thomas Jefferson Papers, Manuscript Division, Library of Congress S. 136: © Fotograf unbekannt, gemeinfrei (Wikimedia Commons) S. 138, oben: © Aquatinata von Thomas Sutherland, 1825, after Benjamin Henry Latrobe, Private Collection, © Bridgeman Berlin S. 138, unten: © Foto: Dodo von den Bergen, gemeinfrei (Wikimedia Commons) S. 140: © Caroline Shenton, Privatsammlung, uk
164
We would be pleased to hear from any copyright holder who could not be traced.
Backlist UmBau 26 2013 eur 22,00 Status Quo Vadis Die Zukunft der Architektur als Prognose und Programm A Prospectus on the Future of Architecture
um bau 10
1986
vergri=en
um bau 9
1985
vergri=en
um bau 8
1984
eur 8,80
UmBau 25 2010 eur 22,00 Architektur im Ausverkauf Auf dem Weg zu einer Ökonomie des ÜberRusses Architecture for sale Towards an Economy of Excess
um bau 6|7
1983
vergri=en
um bau 5
1981
eur 6,60
um bau 4
1981
eur 6,60
um bau 3
1980
vergri=en
um bau 2
1980
vergri=en
um bau 1
1979
vergri=en
UmBau 24 2009 eur 19,00 Strategien der Transparenz Zwischen Emanzipation und Kontrolle Strategies of Transparency Between Emancipation and Control UmBau 23 2007 eur 24,00 Di=us im Fokus Haare, Schlamm oder Schmutz zum Beispiel. Focus on blur Hair and mud and dirt, for example. UmBau 22 2005 Wettbewerb! Competition! UmBau 21 2004 Learning from Calvin Klein
eur 10,90
UmBau 20 2003 Morality and Architecture Architektur und Gesellschaft
eur 10,90
eur 10,90
UmBau 19 2002 eur 10,90 Diagramme, Typen, Algorithmen UmBau 18 Im Sog des Neuen
2001
vergri=en
um bau 17
2000
eur 18,90
um bau 16|15
1997
eur 18,90
um bau 14
1993
eur 13,10
um bau 13
1991
eur 10,20
um bau 12
1990
vergri=en
um bau 11
1987
vergri=en
165
Sonderpublikationen Umsicht 2 1997 Ernst Beneder – Zugänge
eur 16,00
UmSicht 1 1997 Andreas Fellerer, Jiri Vendl UnErhörte Entwürfe
eur 16,00
voTE
Der UmBau erscheint seit 1979 als interdisziplinäre Zeitschrift, die sich nicht auf die zeichnerische und bildliche Präsentation von Architektur beschränkt, sondern Hintergründe und Zusammenhänge sichtbar machen möchte. Alle nicht vergri=enen Publikationen sind zu den genannten Preisen zuzüglich Spesenersatz über das Sekretariat der ögfa zu beziehen. Von den vergri=enen Heften sind dort zum Selbst kostenpreis plus Spesen Fotokopien erhältlich. Weitere Informationen und Inhalt der Hefte auf unten genannter Webseite unter »Publikationen«. ögfa Österreichische Gesellschaft für Architektur • 1090 Wien | Liechtensteinstraße 46a|5 Telefon und Fax (+43-1) 319 77 15 offi[email protected] www.oegfa.at
WoRlD Die alphabetische Reihe von Begriffen stammt aus dem Vokabular der Beschreibungstexte zu den bei der Biennale im österreichischen Pavillon gezeigten 196 nationalen Parlamentsgebäuden.

![Praxishandbuch Angiographie Spektrum der Diagnostik und Interventionen [2., Aufl. 2008. Kartonierte Sonderausgabe 2014]
9783662448908, 3662448904, 9783798517646](https://dokumen.pub/img/200x200/praxishandbuch-angiographie-spektrum-der-diagnostik-und-interventionen-2-aufl-2008-kartonierte-sonderausgabe-2014-9783662448908-3662448904-9783798517646-h-6600442.jpg)


![Praxishandbuch Angiographie Spektrum der Diagnostik und Interventionen [2., Aufl. 2008. Kartonierte Sonderausgabe 2014]
9783662448908, 3662448904, 9783798517646](https://dokumen.pub/img/200x200/praxishandbuch-angiographie-spektrum-der-diagnostik-und-interventionen-2-aufl-2008-kartonierte-sonderausgabe-2014-9783662448908-3662448904-9783798517646.jpg)