Kardinal Rodolfo Pio da Carpi und seine Reform der Aegidianischen Konstitutionen [1 ed.] 9783428467082, 9783428067084
109 13 24MB
German Pages 208 Year 1989
Polecaj historie
Citation preview
Schriften zur Rechtsgeschichte Band 45
Kardinal Rodolfo Pio da Carpi und seine Reform der Aegidianischen Konstitutionen Von
Christiane Hoffmann
Duncker & Humblot · Berlin
CHRISTIANE HOFFMANN
Kardinal Rodolfo Pio da Carpi und seine Reform der Aegidianischen Konstitutionen
Schriften zur Rechtsgeschichte Heft 45
Kardinal Rodolfo Pio da Carpi und seine Reform der Aegidianischen Konstitutionen
Von Christiane Hoffmann
Duncker & Humblot * Berlin
CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek Hoffmann, Christiane: Kardinal Rodolfo Pio da Carpi und seine Reform der Aegidianischen Konstitutionen / von Christiane Hoffmann. — Berlin: Duncker u. Humblot, 1989 (Schriften zur Rechtsgeschichte; H. 45) Zugl.: Frankfurt, Univ., Diss., 1987 ISBN 3-428-06708-8 NE: GT
Alle Rechte vorbehalten © 1989 Duncker & Humblot GmbH, Berlin 41 Satz: Hagedornsatz, Berlin 46 Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin 61 Printed in Germany ISSN 0720-7379 ISBN 3-428-06708-8
Vorwort Kardinal Rodolfo Pio da Carpi ist eine der hervorragendsten und bedeutendsten Persönlichkeiten des sechzehnten Jahrhunderts. Nach dem Tode Papst Pauls IV. gehörte er zu den Kardinälen, die im Geiste schon die dreifache Krone auf ihrem Haupte sahen. Bereits unter Papst Paul III. hatte er viele hohe und ehrenvolle Ämter inne. Seitdem ist er einer der einflußreichsten Kardinäle geblieben. Er war ein erfahrener Diplomat und verfügte über staatsmännischen Weitblick sowie außergewöhnliche administrative Fähigkeiten. In der Inquisitions-Kongregation, im Konsistorium und überall an der Kurie erscheint er als einer der tätigsten, unterrichtetsten und gewissenhaftesten Kardinäle. Sein Leben ist musterhaft. Er ist einer der ersten gewesen, die an der Kurie den Ruf nach Reform haben hören lassen. Dennoch ist bisher keine Darstellung über ihn und seine Reform der Aegidianischen Konstitutionen erschienen, die in den Jahren ab 1539 durchgeführt wurde. Vielmehr beschäftigten sich die bisherigen Arbeiten mit seinem berühmten Vorgänger, Kardinal Aegidius Albornoz, und den Aegidianischen Konstitutionen von 1357. Die vorliegende Arbeit soll daher die Person von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi sowie seine Reform der Aegidianischen Konstitutionen näherbringen. Zur Verdeutlichung der Reform wurde eine Gegenüberstellung der letzten gedruckten prä-carpensischen Ausgabe der Constitutiones Aegidianae von Venedig 1540 sowie der ersten gedruckten carpensischen Ausgabe von Rom 1543-1545 vorgenommen. Da die Ausgabe Rom 1543-1545, deren Frontispiz das Wappen der Familie Pio ziert, die einzige amtliche Ausgabe ist, wurde sie der späteren, wenn auch glossierten Ausgabe von Venedig 1571 vorgezogen. Ferner wurde die von Pietro Sella im Jahre 1912 besorgte Edition der Aegidianischen Konstitutionen berücksichtigt. An dieser Stelle möchte ich sehr herzlich Herrn Professor Dr. Dr. h. c. Adalbert Erler für die vielen Anregungen und die freundliche Ermutigung, dieses Thema zu bearbeiten, danken. Weiterhin danke ich Herrn Professor Dr. Gero Dolezalek, Herrn Professor Dr. Ruggero Maceratini, Herrn Dr. Emanuele Conte und Herrn Dr. Uwe Kai Jacobs für ihre Unterstützung und Hilfe. Christiane
Hoffmann
Inhaltsverzeichnis
I. T e i l Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
11
II. T e i l Die Aegidianischen Konstitationen
42
1. Kardinal Aegidius Albomoz und die politische Lage im Kirchenstaat zu seiner Zeit
42
2. Aegidius Albornoz und Rodolfo Pio da Carpi — Ein Vergleich beider Persönlichkeiten 57 3. Die Entstehung der Aegidianischen Konstitutionen und ihre Verkündung auf dem parlamentum generale zu Fano im Jahre 1357
58
4. Übersicht über den Aufbau und den Inhalt des Gesetzbuches von 1357
65
5. Überblick über die Provinzverwaltung des Kirchenstaates nach den Aegidianischen Konstitutionen von 1357
76
6. Die Fortentwicklung der Aegidianischen Konstitutionen seit ihrer Verkündung im Jahre 1357
81
ΙΠ. T e i l Kardinal Rodolfo Pio da Carpi nnd die Aegidianischen Konstitntionen
100
1. Die Reformkommission des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi
100
2. Das Breve Papst Pauls III. vom 10.9.1544
110
3. Die Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Kardinal Rodolfo Pio da Carpi 4. Kardinal Rodolfo Pio da Carpi — Kompilator oder Legislator?
112 153
5. Überblick über den Inhalt der Zusätze von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi .. 173
8
Inhaltsverzeichnis
6. Der Geltungsbereich der Aegidianischen Konstitutionen unter Berücksichtigung der Zusätze von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi 176 7. Die Aufhebung der Aegidianischen Konstitutionen samt den Zusätzen von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi durch das Motuproprio Papst Pius' VIL vom 6. Juli 1816 183 Schlußbemerkung Zeittafel zu dem Leben von Rodolfo Pio da Carpi
188 189
Literatur und Quellen
192
Personenregister
204
Abkürzungen Abt. Anm.
Art. Aufl. Bd. Bearb., bearb. Const. adiectae Const. Aeg. Cost, ders. d. h. f. ff Fn. HRG
Abteilung Anmerkung Artikel Auflage Band Bearbeiter, bearbeitet
Constitutiones adiectae Constitutio(nes) Aegidiana(e) Costituzioni derselbe das heißt folgend folgende Fußnote Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, hrsg. von Adalbert Erler und Ekkehard Kaufmann unter philologischer Mitarbeit von Ruth Schmidt-Wiegand, Berlin 1971 ff. Hrsg., hrsg. Herausgeber, herausgegeben Historische Zeitschrift HZ Jahrhundert Jh. Kap. Kapitel m. E. meines Erachtens MIÖG Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichte n. a. non attribuita, non attribuibile Nr. Nummer Rdnr. Randnummer RISG Rivista italiana per le scienze giuridiche Rom. Hist. Mitt. Römische Historische Mitteilungen S. Seite sc. scilicet Sp. Spalte u. ä. und ähnliches vgl. vergleiche Vol. Volumen (Band) ζ. B. zum Beispiel zit. zitiert ZRG Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte GA Germanistische Abteilung KA Kanonistische Abteilung RA Romanistische Abteilung Ergänzend sei auf das „Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache", bearbeitet von Hildebert Kirchner und Fritz Kastner, 3. Aufl., Berlin 1983, hingewiesen.
I. Teil
Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi Rodolfo Pio da Carpi wurde am 22. Februar 15001 in Carpi als Sohn des Lionello II. und der Maria Martinengo 2 geboren. Er gehörte der Familie Pio, einem der vornehmsten und ältesten Adelsgeschlechter Italiens, an 3 . Ihr Herrschaftssitz war das in der fruchtbaren Ebene südlich des Po gelegene Carpi 4 . Dort sieht man noch heute das stattliche Schloß der Pio, an dem vom 14. bis zum 16. Jahrhundert gebaut wurde 5 . Der Bruder Lionellos II. und damit der Onkel Rodolfos war Alberto III. Er war aus der Familie Pio der letzte Herrscher der Grafschaft Carpi, da die Franzosen, mit denen er verbündet war, in der Schlacht von Pavia am 24. 2. 1525 von Karl V. geschlagen wurden 6 . Der Kaiser nahm kurz darauf die 1
B. Katterbach, De Cardinali Rodulpho Pio de Carpo, in: Archivum Franciscanum Historicum, 1923, S. 557, schließt dieses Geburtsdatum zutreffend aus der Grabinschrift Rodolfo Pios in der Kirche Trinità dei Monti in Rom; abweichend hiervon J. Lestocquoy, Correspondance des Nonces, S. XXXIII, der den 24. 2. 1500 als Geburtsdatum Rodolfos angibt; Wicki, Rodolfo Pio da Carpi, in: Miscellanea Historiae Pontificiae, Vol. XXI, S. 243 ff. (245), und P. Paschini, Art. „Pio da Carpi" in: Enciclopedia Cattolica, Bd. IX (1952) Sp. 1490, nennen den 2. 5. 1500 als Geburtsdatum; P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. XXIII, gibt lediglich „febbraio 1500" an. 2 So P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. XXIII; J. Wicki, Rodolfo Pio da Carpi, in: Miscellanea Historiae Pontificiae, Vol. XXI, S. 243 ff. (245); P. Paschini, Art. „Pio da Carpi" in: Enciclopedia Cattolica, Bd. IX (1952) Sp. 1490; dagegen gibt J. Lestocquoy, Correspondance des Nonces, S. XXXIII, den Namen der Mutter Rodolfos mit „Marthe Martinengo" an; dies ist unzutreffend, wie sich U. Fiorina, Inventario dell'archivio Falcò Pio di Savoia, S. 53, entnehmen läßt. 3 A. Erler, Albornoz, S. 32 Fn. 87; L. Cardella, Memorie storiche de'cardinali, Bd. 4, S. 173. Näheres über die Familie Pio bei H. Semper, F.O. Schulze, W. Barth, Carpi, ein Fürstensitz der Renaissance; ebenso bei U. Fiorina, Inventario dell'archivio Falcò Pio di Savoia; L. Simeoni, Art. „Pio di Carpi" in: Enciclopedia Italiana, Bd. 27 (1935-1943) S. 310; E. Mattaliano, L'autonomia del territorio di Carpi, in: Società, politica e cultura a Carpi ai tempi di Alberto III. Pio, S. 385 ff. 4 Carpi liegt 18 km nördlich von Modena. Nach H. Semper, F.O. Schulze, W. Barth, Carpi, ein Fürstensitz der Renaissance, Vorrede, gleicht die Umgebung des Städtchens „einem großen, blühenden und lachenden Garten, in Folge der ununterbrochenen Reihen von Obstbäumen und Ulmen, mit denen die Weinreben girlandenförmig sich vermählen". Vgl. auch F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom, 13. und 14. Buch, S. 503. 5 Näheres über das Schloß der Pio in Carpi, das eine Längenausdehnung von 103 m besitzt, bei H. Semper, F. O. Schulze, W. Barth, Carpi, ein Fürstensitz der Renaissance, S. 40fìf.; A. Sorbelli, Art. „Carpi-Monumenti", in: Enciclopedia Italiana, Bd. IX (19311939) S. 141 f.
12
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
Grafschaft Carpi in Besitz und belehnte mit ihr gegen Zahlung von 100 000 Goldscudi am 8. 4. 1530 Alfonso d'Esté, Herzog von Ferrara 7 . Alberto III. war berühmt wegen seiner Sammlung griechischer, lateinischer und hebräischer Bücher, war ein Freund von Ariost und hatte den Ruf, ein ausgezeichneter Theologe zu sein. Gleich vielen anderen streng kirchlich gesinnten Gelehrten war er ein Gegner des Erasmus von Rotterdam 8 . Wegen seiner Bildung und Gelehrsamkeit erhielt Alberto III. am 11. 7. 1509 von Kaiser Maximilian I. das Recht, Doktoren in allen Wissenschaften zu ernennen 9. Rodolfo hatte daher in seinem Onkel und in seinem Vater Lionello, die beide eine ausgezeichnete Erziehung bei Aldo Manuzio erhalten hatten 10 , zwei vortreffliche Lehrer, und dies an einem Hof, an dem sich der Humanismus und die Renaissance in Kunst und Literatur durchsetzten 11. Es entsprach wohl dem Wunsch seiner Familie und besonders dem seines Onkels Alberto, ihn für die geistliche Laufbahn zu bestimmen. Schon in jungen Jahren, nämlich 1516, wurde Rodolfo Pio Ritter von Jerusalem, Prior und Komtur der Kirche San Lorenzo von Colorno in dem Gebiet von Montecchio in der Diözese Parma, und am 6. 3. 1517 erhielt er das Benefizium der Kirche Santa Trinità in Ferrara 12 . Nachdem er an der Universität von Padua den Doktorgrad in Philosophie und Theologie erworben hatte 13 , ging er nach Rom, um seine humanistischen und juristischen Kenntnisse zu vervollständigen 14 . Durch 6
Über Alberto Pio III. als Herrscher und Staatsmann sowie über seine Schicksale vgl. bei H. Semper, F. O. Schulze, W. Barth, Carpi, ein Fürstensitz der Renaissance, S. 3 ff. — Näheres über die Schlacht von Pavia, insbesondere die Gefangennahme von König Franz I. von Frankreich am 24. 2. 1525 bei A. Erler, Der Loskauf Gefangener, S. 88 ff. 7 Carpi blieb unter dem Hause Este bis zum Jahre 1796 und genoß unter dessen Regierung Friede und volle Autonomie. Im Jahre 1796 kam die Stadt und Landschaft Carpi an Modena; vgl. H. Semper, F. O. Schulze, W. Barth, Carpi, ein Fürstensitz der Renaissance, S. 15-18, und E. Mattaliano, L'autonomia del territorio di Carpi, in: Società, politica e cultura a Carpi ai tempi di Alberto III. Pio, S. 385 ff. (393). 8
P. Paschini, Art. „Pio da Carpi", in: Enciclopedia Cattolica, Bd. I X (1952) Sp. 1490; L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. 4, 2. Abt., S. 472. 9 H. Semper, F. Ο. Schulze, W. Barth, Carpi, ein Fürstensitz der Renaissance, S. 6. Hierbei ist anzumerken, daß die Familie Pio schon von jeher den schönen Künsten zugetan war. So hielt sich der große Petrarca zwischen 1350 und 1360 an dem Hofe der Pio in Carpi auf; M. Gräfin Lanckoronska, Vorwort zu Francesco Petrarca, Sonette an Madonna Laura, S. 7. 10 Alberto Pio hatte schon in seiner Jugend Aldo Manuzio in Carpi aufgenommen; aus dem Schüler wurde er dann der Beschützer dieses großen Typographen und Reformators des Buchdrucks. Aldo widmete ihm im Jahre 1495 seine Ausgabe des Aristoteles; vgl. F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom, 13. und 14. Buch, S. 252 und S. 503. 11 P.G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X I I I . 12 P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X I I I . 13 F. Lanzoni, La controriforma, S. 30; J. Wicki, Rodolfo Pio da Carpi, in: Miscellanea Historiae Pontificiae, Vol. X X I , S. 243 ff. (245). 14 P.G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X I I I .
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
seinen Onkel Alberto, der als Gesandter des französischen Königs Franz I. bei Papst Klemens VII. weilte und dem der Papst großes Wohlwollen schenkte 15 , wurde Rodolfo Pio am päpstlichen Hofe eingeführt und kam so mit der diplomatischen und kulturellen Welt von Rom in Berührung 16 . Seine kirchliche Laufbahn begann er als Geheimkämmerer von Papst Klemens V I I . 1 7 . Rodolfo Pio war 28 Jahre alt, als er am 13. 11. 1528 zum Bischof von Faenza in der Romagna ernannt wurde 18 . Papst Klemens VII. beabsichtigte damit die Festigung seiner Autorität in diesen Grenzgebieten des Kirchenstaates, in denen die Familie Pio ehemals ihre Besitztümer hatte 19 . Gleich vielen anderen italienischen Bischöfen dieser Zeit residierte Rodolfo Pio nicht in seiner Diözese, sondern ließ sie durch seinen Vikar Matteo Mengari verwalten 20 . Im Dezember 1529 hielt sich Rodolfo Pio in Florenz auf. Allerdings ist nicht bekannt, in welcher Mission er dort tätig war. Möglicherweise sollte er im Auftrag von Papst Klemens VII. die heftigen Unstimmigkeiten zwischen dieser Republik und der Familie Medici, aus der der Papst stammte und die nach dem Sacco di Roma aus Florenz vertrieben worden war 2 1 , friedlich beilegen. Vielleicht sollte er aber auch Malatesta Baglione, den Verteidiger der florentinischen Republik, in geheimen Verhandlungen zum Verrat an Florenz verleiten 22 . Offenbar war es jedoch eine delikate Angelegenheit, die das große Vertrauen des Papstes in Rodolfo Pio beweist. Als Gesandter Königs Franz I. genoß Graf Alberto Pio III. am französischen Hof großes Ansehen 23 . Es war daher für Papst Klemens VII. wohl naheliegend, dessen Neffen Rodolfo am 26. 7. 1530 als außerordentlichen Nuntius 2 4 zu 15
H. Semper, F.O. Schulze, W. Barth, Carpi, ein Fürstensitz der Renaissance, S. 15. P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X I I I . 17 J. Lestocquoy, Correspondance des Nonces, S. X X X I I I ; F. Lanzoni, La controriforma, S. 30. 18 P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. XXIV.; ebenso A. Pieper, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen, S. 86, und W. Friedensburg, Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Erg. Bd. 1530-31, S. 107; etwas ungenau P.B. Gams, Series episcoporum, S. 689. 19 J. Lestocquoy, Correspondance des Nonces, S. X X X I I I . 20 J. Lestocquoy, Correspondance des Nonces, S. X X X I I I . — Auf Matteo Mengari folgte Francesco Silvagni und sodann Girolamo Paffi; vgl. F. Lanzoni, La controriforma, S. 30f., 43 und 140. 21 Näheres hierzu bei L. v. Ranke, Die Geschichte der Päpste, S. 54, sowie H. Kühner, Das Imperium der Päpste, S. 258. 22 P.G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. XXIV. 23 H. Semper, F.O. Schulze, W. Barth, Carpi, ein Fürstensitz der Renaissance, S. 15; P.G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. XXIV. 24 Der Titel „Nuntius" und „Legatus" war ursprünglich keineswegs eine distinktive Benennung für die Abgesandten der Kurie, sondern vielmehr in lateinischen Aktenstücken neben anderen Bezeichnungen wie „Internuntius" allgemein gebräuchlich. Erst in der Zeit der Entwicklung der ständigen Gesandtschaften, d. h. ab ungefähr 1500, vollzog 16
14
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
König Franz I. zu senden. Rodolfo Pios Auftrag bestand darin, dem französischen König zur Befreiung seiner beiden Söhne aus der Gefangenschaft zu gratulieren 25 und ihn zu bitten, den Kaiser zum Abzug seiner Truppen aus Italien zu bewegen, da der Papst eine Vormacht Karls V. fürchtete 26 . A m 28. 11. 1530 kehrte Rodolfo Pio von dieser Mission wieder nach Rom zurück 27 . In der folgenden Zeit betraute ihn Papst Klemens VII. mit weiteren wichtigen diplomatischen Aufgaben. So ernannte er Rodolfo Pio am 27. 5. 1533 zum Nuntius bei Karl III., Herzog von Savoyen, um von diesem die zeitweise Überlassung der Stadt und Festung Nizza für die Zusammenkunft mit König Franz I. zu erwirken 28 . Die unerwartete Anfrage des Papstes brachte den Herzog von Savoyen in ernste Schwierigkeiten. Zum einen fürchtete er, sich mit dem Kaiser, der diese Begegnung des Papstes mit dem französischen König nicht gerne sah, zu verfeinden. Zum anderen hegte er den Verdacht, daß Klemens VII. und Franz I. die Unterredung lediglich als Vorwand benutzten, um ihn zu betrügen und ihm Nizza wegzunehmen. Rodolfo Pio gelang es nicht, den Widerstand Karls III. zu überwinden. Selbst die zweite offizielle Anfrage des Papstes vom 27. 6. 1533, die Übergabe der Stadt Nizza an den Bischof von Faenza nicht zu verzögern, konnte den Herzog von Savoyen nicht dazu bewegen, den so bedeutenden Teil seines Herzogtums für diese Unterredung zu überlassen 29. Der weiteren Anweisung des Papstes folgend, reiste Rodolfo Pio nach Frankreich weiter, um mit König Franz I. über die Einzelheiten der Begegnung zwischen ihm und Klemens VII. zu verhandeln. A m 11.6. 1533 kam er am französischen Hofe an, der zu dieser Zeit in Lyon residierte 30 . Er hielt sich dort bis ungefähr Juli 1533 auf 3 1 . Den Berichten der venezianischen Gesandten sich mit dem Worte „Nuntius" jene Einschränkung auf die Vertreter des Papstes, die nicht dem Kardinalskollegium angehörten. Als außerordentliche Nuntien wurden wiederum diejenigen bezeichnet, die mit besonderen Aufträgen betraut waren; so A. Pieper, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen, S. 9ff.; vgl. auch A. Erler, Kirchenrecht, Kap. 45. 25 W. Friedensburg, Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Erg. Bd. 1530-31, S. 107, und A. Pieper, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen, S. 86. — Näheres über die Gefangennahme Königs Franz I. bei der Schlacht von Pavia am 24. 2. 1525, seine Freilassung gegen Gestellung seiner beiden ältesten Söhne als Geiseln sowie über deren Befreiung nach dem Damenfrieden von Cambrai am 3. 8. 1529 bei A. Erler, Der Loskauf Gefangener, S. 90 ff.; vgl. auch W. Goez, Grundzüge der Geschichte Italiens, S. 286 ff. 26 P.G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. XXIV. 27 C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 3, S. 211 Fn. Faventin 3. 28 Vier Breven des Papstes vom 27. 5. 1533, die die Ernennung Rodolfo Pios zum Nuntius bei Karl III. enthalten, befinden sich im Archivio Falcò Pio di Savoia in der Biblioteca Ambrosiana in Mailand; vgl. U. Fiorina, Inventario dell'archivio Falcò Pio di Savoia, S. 128, Nr. 524 (2). 29 P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. XXV. 30 J. Lestocquoy, Correspondance des Nonces, S. XXXIV.; vgl. auch Α. Pieper, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen, S. 87 und S. 87 Fn. 2.
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
zufolge muß seine Tätigkeit am französischen Hofe sehr erfolgreich gewesen sein 3 1 a . Wie aus der Geschichte bekannt ist, fand die Zusammenkunft zwischen Klemens VII. und Franz I. im Oktober 1533 in Marseille statt 32 . Ob Rodolfo Pio hierbei zugegen war, ist nicht belegt. Er kehrte jedoch mit dem Papst am 12. 11. 1533 nach Rom zurück 33 . Schon in dieser Zeit bewährte sich Rodolfo Pio als Gesetzgeber. Überzeugt von der Notwendigkeit der sittlichen Erneuerung der Kirche, förderte er noch vor dem Konzil von Trient in seiner Diözese Faenza die Reform der kirchlichen Disziplin und der weltlichen Gewohnheiten. So hielt er dort im August 1533 durch seinen Vikar Matteo Mengari eine bedeutende und berühmte Diözesansynode a b 3 4 und ließ auf ihr am fünften Tage neue Konstitutionen „leggere e pubblicare" 35 . Er ordnete an, daß diese Konstitutionen einen Monat später in Kraft treten sollten, ferner, daß jeder Geistliche verpflichtet sei, eine Abschrift dieser Bestimmungen zu besitzen und daß diese Konstitutionen zur Vermeidung von Zweifeln und Zweideutigkeiten in Vulgare zu verfassen seien, da in jener Zeit der größte Teil der Geistlichen in Faenza des Lateinischen nicht mächtig oder nur wenig mit dieser Sprache vertraut war 3 6 — Bestimmungen und Formulierungen, die an Buch V I Kapitel 27 der Aegidianischen Konstitutionen erinnern. Unter dem Titel „Constitutione et Ordinatione Synodale della Citate et diocese Faventina di commissione del Reverendissimo et Illustrissimo Signore el S. Rodolpho Pio benemerito vescovo de dieta Citate e diocese celebrate per el Reverendo miser Matheo Mengario doctore faventino in tempotate (temporale) et spirituale vicario e locotenente generale in ditta citate e sua diocese e vescovato feliciter" wurden die neuen Konstitutionen am 5. 9. 1539 von Francesco Rosso da Valentia in Ferrara gedruckt 37 . Sie bestanden aus 60 kurzen Kapiteln, die in zwei Teile aufgespalten waren. In dem ersten Teil der Konstitutionen wandte sich Rodolfo Pio gegen die Laster des Klerus, in dem zweiten Teil behandelte er die Verwaltung und den Gebrauch der Sakramente 31
A. Pieper, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen, S. 87 und S. 208. J. Lestocquoy, Correspondance des Nonces, S. XXXIV. 32 Näheres hierzu bei L. v. Ranke, Die Geschichte der Päpste, S. 58 sowie bei H. Kühner, Das Imperium der Päpste, S. 259 ff. 33 C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 3, S. 211 Fn. Faventin. 3; J. Lestocquoy, Correspondance des Nonces, S. XXXIV. 34 F. Lanzoni, La controriforma, S. 3Iff. — Auch Papst Paul III., der Nachfolger Papst Klemens VII., hatte als Bischof von Parma im Jahre 1519 eine Diözesansynode abgehalten, was in dieser Zeit äußerst selten war; so C. Capasso, Paolo III. (1534-1549), Bd. I, S. 54. 35 F. Lanzoni, La controriforma, S. 32. 36 F. Lanzoni, La controriforma, S. 32 f. 37 F. Lanzoni, La controriforma, S. 32 f. 31a
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
16
sowie die Pflichten der Pfarrer 38 . Die große Bedeutung dieses Gesetzeswerkes Rodolfo Pios liegt darin, daß er es zehn und mehr Jahre vor der Eröffnung des Konzils von Trient verfaßte und daß seine Bestimmungen oftmals strenger als diejenigen des Tridentinums waren 39 . Aus diesem Grunde wird Rodolfo Pio als die Seele der vortridentinischen Reform bezeichnet40. Wegen seines energischen Charakters und seines diplomatischen Geschicks, das er bei den beiden Missionen in Frankreich bewiesen hatte, sowie wegen seiner dabei gewonnenen Kenntnisse über die französischen Verhältnisse wurde Rodolfo Pio am 9. 1. 1535 von Papst Paul III. aus dem Hause Farnese, dem Nachfolger Papst Klemens VII., erneut nach Frankreich gesandt 41 . M i t ausschlaggebend mag hierfür noch gewesen sein, daß Paul III. eine innige Freundschaft mit Rodolfo Pio verband und der Papst ihm großes Vertrauen und Achtung entgegenbrachte 42. A m 4. 2. 1535 befand sich Rodolfo Pio auf seiner Reise in Genua, am 11. 2. in Lyon, am 14. 2. in Nivers, und am 17. 2. 1535 traf er am französischen Hofe ein, der nun in Saint-Germain-en-Laye residierte 43 . Er löste dort den Nuntius des verstorbenen Papstes Klemens VII., Cesare Trivulzio, Bischof von Como und Bruder des Kardinals Agostino, ab. Rodolfo Pios Sendung umfaßte mehrere Aufträge: Er sollte König Heinrich VIII. von England entgegenarbeiten, die Neutralitätspolitik Papst Pauls I I I . 4 4 verteidigen und, wenn möglich, eine Unterstützung, auf jeden Fall aber die Duldung Frankreichs für die kaiserlich-päpstliche Aktion gegen den Piratenkapitän Chaireddin, genannt Barbarossa 45, erreichen. Hauptsächlich betraf Rodolfo Pios Sendung jedoch die Frage des Konzils 4 6 .
38
F. Lanzoni, La controriforma, S. 33 ff. P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. XXXII. 40 V. Schweitzer, Art. „Faenza", in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. III (1959), Sp. 1337. 41 W. Friedensburg, Nuntiaturberichte aus Deutschland, Bd. I, 1, S. 22; C. Capasso, Paolo III. (1534-1549), Bd. I, S. 84 und 105; L.D. d'Attichy, Flores Historiae, Bd. III, S. 218. 42 C. Capasso, Paolo III. (1534-1549), Bd. I, S. 84. 43 J. Lestocquoy, Correspondance des Nonces, S. XXXIV; allerdings geben A. Pieper, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen, S. 99, und C. Capasso, Paolo III. (1534-1549), Bd. I, S. 105 Fn. 1, den 19. 2. 1535 als Tag der Ankunft Rodolfo Pios am französischen Hofe an; dies ist jedoch unzutreffend, denn in dem Brief Rodolfos an Ambrogio Ricalcati aus Saint-Germain vom 19. 2. 1535, abgedruckt bei P.G. Baroni , La nunziatura in Francia, S. 94, heißt es: „... Hora la intenderà per questa com'io gionsi qui alli 17 ... " 44 Zu der Neutralitätspolitik Pauls III. vgl. H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Paul III.", S. 245. 45 Näheres hierzu bei W. Goez, Grundzüge der Geschichte Italiens, S. 292. 46 Hinsichtlich der Aufträge Rodolfo Pios vgl. i/. Jedin, Geschichte des Konzils, Bd. 1, S. 242f.; A. Pieper, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen, S. 99f.; C. Capasso, Paolo III. (1534-1549), Bd. I, S. 104. 39
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
Als Neffe eines durch den Kaiser aus seiner Herrschaft vertriebenen Fürsten von König Franz I. äußerst freundlich, ja familiär aufgenommen, bemerkte Rodolfo Pio schon nach wenigen Tagen, daß am französischen Hofe eine äußerst feindselige Stimmung gegen den Kaiser herrschte. Der Haß, schrieb er am 22. 2. 1535, vier Tage nach seiner Antrittsaudienz, ist so gewachsen, daß der König es in allem geradezu darauf anlegt, den Kaiser zu ärgern 47 . An eine Förderung des Unternehmens gegen Chaireddin Barbarossa war nicht zu denken. Frankreich verhandelte ganz offen mit ihm, und Rodolfo Pio mußte froh sein, daß die geheime Unterstützung, die man dem Piratenkapitän zuteil werden ließ, nicht in offene Zusammenarbeit überging. Die Frage des Konzils traf in Frankreich ebenso auf Widerstände. König Franz I. fürchtete nämlich die Wiederherstellung der Autorität Karls V. im Reiche, wenn auf einem Konzil der religiöse Ausgleich zustande komme. Er war daher ein entschiedener Gegner des Konzils, vermied jedoch eine offene Ablehnung. Er erklärte sogar Rodolfo Pio gegenüber, er sei einer solchen Versammlung sehr geneigt, allein der Kaiser gehe darauf aus, sie nur an einem Orte stattfinden zu lassen, wo er Herr sei, was Frankreich nicht zugeben könne 48 . Diese Schwierigkeit wurde dann von französischer Seite immer wieder hervorgehoben, um einer festen Zusage zu entgehen. Rodolfo Pio war in seinen Gegenvorstellungen unermüdlich, und so erreichte er zuletzt nach langwierigen Verhandlungen, daß der König bedingungsweise seine Zustimmung zu Mantua gab 4 9 . Papst Paul III. sagte daraufhin am 4. 6. 1536 das Konzil an und beauftragte Rodolfo Pio mit der Verkündung der Bulle und der Mitteilung an den König von Frankreich 50 . Der im Sommer 1536 zwischen Franz I. und Karl V. ausgebrochene Krieg um das Herzogtum Mailand gab dem französischen König jedoch wiederum einen erwünschten Vorwand, und so erklärte er am 5. 9. 1536 gegenüber Rodolfo Pio, in den gegenwärtigen Kriegsläuften sei es den Prälaten seines Reiches unmöglich, nach Mantua zu kommen. Als Rodolfo Pio durch Breve vom 3. 4. 1537 von seinem Amt in Frankreich abberufen wurde und sich Anfang Mai 1537 bei König Franz I. verabschiedete, sprach sich dieser ihm gegenüber noch entschiedener gegen Mantua aus 51 . Rodolfo Pio war auf seiner Rückreise am 2. 6. 1537 in Lyon und hielt am 7. 7. 1537 seinen feierlichen Einzug in Rom 5 2 . 47
H. Jedin, Geschichte des Konzils, Bd. 1, S. 242. L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. V. S. 52ff.; ebenso H. Jedin, Geschichte des Konzils, Bd. 1, S. 243; W. Friedensburg, Nuntiaturberichte aus Deutschland, Bd. I, S. 66. 49 L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. V, S. 54; vgl. auch W. Friedensburg, Nuntiaturberichte aus Deutschland, Bd. I, S. 66 Fn. 2. 50 A. Pieper, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen, S. 100. 51 L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. V, S. 67f. und S. 71 Fn. 3. 52 A. Pieper, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen, S. 101 Fn. 1; nach A. Pieper, S. 100, ist Rodolfo Pio als ordentlicher Nuntius in Frankreich zu bezeichnen, da 48
2 Hoffmann
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
18
Während dieser letzten Nuntiatur in Frankreich, genau am 22. 12. 1536, wurde Rodolfo Pio auf Wunsch von König Franz I. zum Kardinal erhoben 53 . Dies kam für ihn sicherlich nicht unerwartet, denn den Gerüchten zufolge, die am päpstlichen und französischen Hofe beharrlich in Umlauf waren, mußte er bereits im Konsistorium vom 21. 5. 1535 benannt worden sein. Zudem hatte schon Papst Klemens VII. erwogen, Rodolfo Pio die Kardinalswürde zu verleihen, allein es entstand gegen ihn eine starke Strömung von Seiten der kaiserlichen Partei, da er für franzosenfreundlich gehalten wurde 54 . Zusammen mit Rodolfo Pio erhielten den Kardinalspurpur u. a. so berühmte Persönlichkeiten wie Reginald Pole, Erzbischof von Canterbury, Giovanni Pietro Carafa, der spätere Papst Paul IV., Giovanni Maria del Monte, der spätere Papst Julius III., Jacobo Sadoleto, Bischof von Carpentras und Christoforo Jacobazzi, Bischof von Cassano und Auditor der Rota 5 5 . Meist haben literarisch gebildete Männer von Paul III. den Purpur empfangen, und man darf behaupten, daß vielleicht nie eine solche Schar ausgezeichneter Kardinäle den Heiligen Stuhl umgeben hat 5 6 . Nach seiner Ankunft in Rom erhielt Rodolfo Pio am 23. 7. 1537 als Kardinalpriester den Titel der römischen Kirche S. Pudenziana. In der Folgezeit wechselte er mehrmals die Titelkirche; so wurde ihm am 28. 11. 1537 S. Prisca, am 24. 9. 1543 S. demente und am 17. 10. 1544 S. Maria in Trastevere übertragen 57 . In dem Konsistorium vom 19. 12. 1537 wurde Kardinal Rodolfo Pio da Carpi — oftmals auch nur als Kardinal Carpi oder Carpi bezeichnet — von Papst Paul III. zum Legaten 58 bei König Franz I. ernannt 59 . Auch dieses Mal umfaßte
er während dieser zweijährigen Gesandtschaft stets dem französischen Hofe folgte. Die Nuntiaturberichte Rodolfo Pios aus dieser Zeit sind abgedruckt bei P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, und / . Lestocquoy, Correspondance des Nonces en France. 53 C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 3, S. 26, und J. Lestocquoy, Correspondance des Nonces, S. X X X I V . 54 P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X V I . 55 C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 3, S. 26f. 56 Α. ν. Reumont, Geschichte der Stadt Rom, Bd. III, 2. Abt. S. 491. 57 C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 3, S. 27; J. Lestocquoy, Correspondance des Nonces, S. X X X I V Fn. 15. 58 Seit Gregor VII. ernannten die Reformpäpste meist Kardinäle, vereinzelt auch Kappeliane, zu Legaten, die sie, oft gegen starken Widerstand der örtlichen kirchlichen und weltlichen Gewalten, in die verschiedenen Länder mit bestimmten Aufträgen oder zur Wahrnehmung der gesamten primatialen Rechte entsandten. Sie haben die päpstliche Sache gegenüber Königen und Fürsten, Bischöfen und Äbten, vor Konzilien, Reichs- und Hoftagen, in der Mission und bei Kreuzzügen vertreten und sind die eigentlichen Wegbereiter des päpstlichen Primats geworden; so Η. E. Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte, § 28 V; vgl. auch A. Wynen, Die päpstliche Diplomatie, §§11 und 15. 59
Durch diese erneute Sendung Rodolfo Pios an den französischen Hof wird die Annahme C. Capassos, Paolo III. (1534-1549), Bd. I, S. 321, widerlegt, der Kardinal sei
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
19
seine Sendung mehrere Aufträge. Er sollte den Regenten überreden, den mit Karl V. am 16. 11. 1537 zu Monzon abgeschlossenen dreimonatigen Waffenstillstand in einen dauernden Frieden zu verwandeln, ferner Franz I. um Unterstützung bei der Einberufung des Konzils bitten und dessen Zustimmung für eine Begegnung mit dem Kaiser in Nizza erwirken 60 . Rodolfo Pio reiste zusammen mit Kardinal Christoforo Jacobazzi, der als Legat für den kaiserlichen Hof in Spanien ernannt worden war, am 23. 12. 1537 von Rom ab 6 1 . A m 30. 12. 1537 waren die beiden Legaten in Bologna, am 3. 1. 1538 in Asti, und am 13. 1. 1538 hatten sie gemeinsam bei König Franz I . i n Montpellier Audienz. Noch am gleichen Tage reiste Kardinal Jacobazzi weiter nach Barcelona, wohin der Kaiser seine Residenz verlegt hatte. A m 17. 1. 1538 traf er dort ein. In seiner ersten Audienz bei Karl V. sah der Kardinal, daß der kaiserliche Hof ernsthaft die Vermittlung des Papstes wünschte. Demgegenüber war der Empfang Rodolfo Pios am französischen Hofe eher kalt 6 2 . In ihm regte sich daher der Verdacht, man habe etwas geplant, um ihm und dem Papst zu schaden. Er beabsichtigte deshalb sogar, um Erlaubnis für seine Abreise zu bitten und auf den ihm übertragenen Auftrag zu verzichten. Daß er seinen Vorsatz der sofortigen Rückkehr nach Rom dann doch aufgab, ist lediglich dem raschen Einschreiten des Connétable von Frankreich, Anne de Montmorency 63 , und des Kardinals Lorena zu verdanken 64 . Die nun folgenden Unterhandlungen Rodolfo Pios mit Franz I. gestalteten sich äußerst schwierig. Ohne eine Begegnung mit dem Kaiser offen abzulehnen, benutzte der König jedes Mittel, um den Frieden, der den französischen Interessen schädlich war, zu verhindern und die Pläne des Papstes zu durchkreuzen. In dem Feldzug gegen die päpstliche Politik sparte man seitens des französischen Hofes nicht an Unhöflichkeiten und Herausforderungen. Insbesondere dort nicht mehr erwünscht gewesen, und man habe ihn deshalb im April 1537 unter dem Vorwand von dringenden Angelegenheiten nach Rom zurückberufen. Es ist vielmehr davon auszugehen, daß Papst Paul III. die Absicht hatte, Rodolfo Pio in dem bevorstehenden Konzil mit Aufgaben zu betrauen; so P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X V I . 60 P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X X V I ; A. Pieper, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen, S. 115. 61 L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. V, S. 194 und S. 194 Fn. 6. 62 C. Capasso, Paolo III. (1534-1549), Bd. I, S. 478f. und S. 479 Fn. 1; A. Pieper, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen, S. 115f. 63 Zwischen Rodolfo Pio und Anne de Montmorency muß m. E. ein freundschaftliches Verhältnis bestanden haben. Dafür spricht einmal die geschilderte Begebenheit und außerdem auch, daß Rodolfo Pio nach dem Tode seines Onkels, des Fürsten Alberto III. am 9. 1. 1531 in Paris, den Connétable von Frankreich mit Schreiben vom 27. 1. 1531 um Hilfe und Protektion am französischen Hof bat; P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X I V und S. X X I V Fn. 14. 64
2*
C. Capasso, Paolo III. (1534-1549), Bd. I, S. 483.
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
20
gegen Rodolfo Pio bildete man geradezu einen Klatsch aus bösartigen Unterstellungen und Beschuldigungen, was wohl vornehmlich das Werk der französischen Gesandten in Rom und des Kardinals Trivulzio war. In einem Schreiben vom 1. 5. 1538 an Anne de Montmorency beklagte sich nämlich Rodolfo Pio über die französischen Oratoren und über Kardinal Trivulzio wegen der schlechten Amtsführung, die ihm bei dem König geschadet habe 65 . U m welche bösartigen Unterstellungen es sich hierbei handelte, läßt sich nicht bestimmen. Es müssen aber äußerst unwürdige Dinge gewesen sein, denn der Papst reagierte sehr heftig, kaum daß er Kenntnis davon erlangte. Er nahm seinen Repräsentanten offen in Schutz und rügte die französischen Oratoren, die sich an seinem Hofe aufhielten. Er veranlaßte sie sogar, in Frankreich um ihre Abberufung zu ersuchen, was allerdings nur einem von ihnen, nämlich George de Selve, Bischof von Lavaur, gewährt wurde 66 . Eine Depesche des Kardinals Tournon de la Chambre an Rodolfo Pio vom 10. 5. 1538 bringt jedoch etwas Licht in die Angelegenheit. In einem sehr heftigen Ton wird Rodolfo Pio darin beschuldigt, sich durch Ausnutzung seines Amtes als Legat am französischen Hof einen kompromittierenden Brief angeeignet und seine diplomatischen Dienste absichtlich zum Nachteil für Frankreich und den Frieden entwickelt zu haben 67 . Dieser Zwischenfall führte dazu, daß die Beziehungen Rodolfo Pios zu dem französischen Hofe von offenem Mißtrauen geprägt waren 68 . Es erhebt sich daher die Frage nach seiner bisherigen politischen Einstellung gegenüber Frankreich. Angesichts des einstigen Bündnisses seiner Familie mit den Franzosen 69 sowie seiner Ernennung zum Kardinal auf Wunsch des französischen Königs 7 0 liegt der Schluß nahe, daß Rodolfo Pio zunächst der französischen Partei innerhalb des Kardinalskollegiums nahestand, denn Franz I. beabsichtigte wohl kaum, die kaisertreuen Kardinäle zu vermehren. Erwiesen ist dies allerdings nicht. Es steht jedoch fest, daß Rodolfo Pio in der zweiten Hälfte seiner politischen Karriere der kaiserlichen Partei angehörte. Karl V. nannte ihn Protektor seiner Königreiche und des Kaiserreiches 71. 65
P.G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X V I I und S. X X V I I f . Fn. 35. P.G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X V I I . 61 P.G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X V I I f . 68 So warnte Rodolfo Pio wenige Monate später den jungen und unerfahrenen Kardinal Alessandro Farnese, Neffe und Sekretär Papst Pauls III., der im Jahre 1539 in außerordentlicher Mission mit Kardinal Marcello Cervini zu Franz I. und Karl V. gesandt worden war, keinen Klatsch und keine unnützen Kommentare hervorzurufen, sich zwischen den beiden Höfen in bestmöglicher Weise zu bewegen, aber den Franzosen zu mißtrauen und sich näher an den Kaiser zu halten; so P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X V I I I ; C. Capasso, Paolo III. (1534-1549), Bd. II, S. 10. 66
69
Vgl. S. 11. Vgl. S. 18. 71 J. Lestocquoy, Correspondance des Nonces, S. X X X I V ; vgl. auch P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X X I I I f.; Rodolfo Pio förderte zudem das Königreich von Schottland, und zwar sowohl unter der Regierung Jakobs V. als auch dessen Tochter Maria Stuart. In dem Archivio Falcò Pio di Savoia befindet sich ein Schreiben von 70
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
Im April 1538, auf seiner Rückreise vom französischen Hof, wurde Rodolfo Pio zusammen mit Kardinal Jacobazzi zu dem Herzog von Savoyen gesandt, um die Überlassung der Stadt Nizza für die Begegnung zwischen Karl V. und Franz I. zu erwirken. Jene erneute Anfrage des Papstes brachte den Herzog wie schon 1533 in große Verlegenheit. War er damals jedoch wegen seines ausgedehnten Herzogtums geachtet und sogar gefürchtet, so war er jetzt schwach und gedemütigt, da ihm nach dem Einfall der Franzosen und auch der Spanier gleichsam nur die Stadt Nizza geblieben war. Der Papst hoffte daher, daß die Sendung von zwei so erlauchten und berühmten Kardinälen wie Rodolfo Pio und Christoforo Jacobazzi den Herzog bestimmen würde, seiner Forderung nachzukommen 72 . Papst Paul III. hatte bereits am 23.3.1538 die Reise nach Nizza angetreten 73. Obwohl er in Lucca die unangenehme Nachricht erhielt, daß der Herzog von Savoyen wegen der Übergabe des als päpstliche Residenz in Aussicht genommenen Kastells von Nizza Schwierigkeiten bereite, setzte er schon am 8. 4. seine Reise nach Piacenza fort. Der Papst, der in Piacenza die heilige Woche und Ostern feierte, wollte dort die Entscheidung wegen der Überlassung des Kastells von Nizza und die Ankunft der Kardinallegaten Rodolfo Pio und Jacobazzi abwarten. Diese sollten bereits am 25. 4. 1538 eintreffen; allein infolge der Verhandlungen über das Kastell verzögerte sich ihre Ankunft um einige Tage. Nachdem die beiden Kardinallegaten am 28. 4. angelangt waren und Paul III. die Nachricht erhielt, daß der Herzog von Savoyen die Festung von Nizza zur Verfügung stelle, zeigte er wieder mehr Hoffnung auf Erreichung des Friedens und reiste nach Nizza weiter. Kurz darauf erhoben sich jedoch die mißtrauischen Einwohner von Nizza und verweigerten die Übergabe des Kastells, so daß die Zusammenkunft nicht in der Stadt selbst, sondern lediglich in ihrer Nähe abgehalten wurde. Papst Paul III., der in einem einsamen und unbequemen Franziskanerkloster außerhalb der Stadt wohnte, erreichte nach langwierigen und mühsamen Verhandlungen endlich, daß am 18. 6. 1538 ein Waffenstillstand von zehn Jahren zwischen Karl V. und Franz I. zustande kam 7 4 . Rodolfo Pio war bei den Verhandlungen in Nizza nicht zugegen. Es ist jedoch zum großen Teil seinem unermüdlichen Einsatz zum Gelingen der Pläne des Papstes zu verdanken, daß diese Einigung erzielt werden konnte 75 . Man darf daher sagen, daß die Legation von 1537 bis 1538 die Krönung seiner diplomatischen Erfolge war 7 6 . Königin Maria von Schottland vom November 1547, gerichtet an „Reverendissimo Domino Cardinali de Carpis rerum regni nostri promotori". 72 P.G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X V I I I f. — Ob hier ein Öffnungsrecht bestand und der Herzog von Savoyen gar verpflichtet war, dem Papst das Kastell von Nizza zur Verfügung zu stellen, konnte nicht festgestellt werden; vgl. W. ν . Groote, Art. „Öffnungsrecht (befestigter Plätze)", in: HRG, Bd. 3 (1984), Sp. 1225 ff. 73 A. Pieper, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen, S. 116. 74 L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. V, S. 197ff.; H. Kühner, Das Imperium der Päpste, S. 263 ff.
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
22
Schon bald aber wurde Rodolfo Pio mit einer neuen großen Aufgabe betraut. A m 21. 4. 1539 7 6 a ernannte ihn Papst Paul III. zum päpstlichen „Legaten de latere" 77 in der Mark Ancona. Dieses Amt war von außerordentlicher Bedeutung. Ancona, eines der Kerngebiete des Kirchenstaates 78 und infolge seiner geographischen Lage strategisch äußerst wichtig, war wegen der fortgesetzten Streifzüge der Türken und Piraten, aber besonders wegen der Gärung, die in der Stadt um sich griff, Gegenstand der besonderen Aufmerksamkeit des Papstes. Die Anconitaner konnten jene Zeit nicht vergessen, in der sie noch selbständig und vom apostolischen Stuhle unabhängig waren, da sie erst am 20. 9. 1532 mit dem Kirchenstaat vereinigt und der unumschränkten Herrschaft des Papstes unterworfen wurden 79 . Hinzu kam, daß Kardinal Benedetto di Accolti, dem von Papst Klemens VII. sodann Ancona für den Preis von 20 000 Dukaten übertragen und die Titel Rektor und Legat a latere der anconitanischen Mark verliehen wurden, wegen seiner Mißwirtschaft in dieser Stadt bei ihren Einwohnern eine schlechte Erinnerung hinterlassen hatte 80 . 75
C. Capasso, Paolo III. (1534-1549), Bd. I, S. 481 Fn. 2. J. Lestocquoy, Correspondance des Nonces, S. XXXV. 76a So C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 3, S. 27 Fn. 11; unzutreffend dagegen P.G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. XXIX, der den 14. 8. 1539 angibt. Wie sich nämlich aus dem Breve Papst Pauls III. vom 21. 4. 1539, das in der römischen Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen von 1543-1545 abgedruckt ist, entnehmen läßt, war Rodolfo Pio schon zu dieser Zeit Legat in der Mark Ancona. Es heißt dort: „Pavlvs Episcopus Seruus Seruorum Dei Dilecto Filio Rodulpho tituli Sanctae Priscae Praesbitero Cardinali de Carpo nuncupato in Prouincia nostra Marchiae Ancon itanae ac Ciuitatibus ... apostolicae sedis legato, ac pro nobis, & Romana Ecclesia in Spiritualibus, & temporalibus generali Vicario Salutem & apostolicam benedictionem. Cum nos hodie te in Prouincia nostra Marchiae Anconitanae ac Ciuitatibus, Terris, Castris, & locis, Massae Trebariae & Presidatus Farfensi nec non Asculi, legatum de latere,... Datum Romae apud sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Quingentesimo trigesimo non. oundecimo Calendas Maii, Pontificatus nostri Anno Quinto". — Etwas ungenau bei R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 25, der lediglich das Jahr der Ernennung Rodolfo Pios, 1539, angibt. 77 Die Kardinallegaten wurden seit Papst Alexander III. als legati a latere, d. h. „Legaten von der Seite oder der Umgebung des Papstes weg" bezeichnet. Dies bedeutet, ihnen wurde die Vertretung der Person des Papstes gleichsam als ein anderes Ich (alter Ego) übertragen. Sie besaßen weitgehende päpstliche Vollmachten in jurisdiktioneller Hinsicht; so H.E. Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte, § 28 V; A. Wynen, Die päpstliche Diplomatie, § 11; H. Schwendenwein, Das neue Kirchenrecht, S. 177. — Der Begriff des Legatus de latere dürfte demjenigen des Legatus a latere entsprechen. 78 Näheres über Ancona bei J.-F. Leonhard, Die Seestadt Ancona im Spätmittelalter, S. 125. 79 S. Sugenheim, Geschichte der Entstehung und Ausbildung des Kirchenstaates, S. 431 ff.; M. Brosch, Geschichte des Kirchenstaates, 1. Bd., S. 120. 80 Kardinal Accolti trieb es so arg, daß Papst Paul III., der Nachfolger Klemens VII., ihn wegen der größten Ausschreitungen (er hatte unter anderem fünf schuldlose Bürger hinrichten lassen) auf sieben Jahre verbannte und mit einer Geldstrafe belegte; so M. Brosch, Geschichte des Kirchenstaates, 1. Bd., S. 120 f.; P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. XXIX Fn. 43. 76
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
Rodolfo Pio widmete sich mit großem Eifer der Verwaltung Anconas und der Marken. Er residierte in Macerata 81 , das seit dem 14. Jahrhundert Sitz des päpstlichen Legaten in der Mark Ancona mit dem Appellationsgericht sowie der päpstlichen Münzprägestelle war 8 2 . Von seiner peinlich genauen Art zu regieren, aber auch von seinem Streben, die zum Teil veraltete Verwaltung zu reformieren, zeugt die umfangreiche Sammlung von Briefen, Bekanntmachungen, Berichten, Genehmigungen und anderen veröffentlichten Akten, die in dem Archivio Falcò Pio di Savoia in der Biblioteca Ambrosiana aufbewahrt wird. Darunter fand ich auch eine Bekanntmachung seines Vizelegaten, des literarisch gebildeten, apostolischen Protonotars Niccolò Ardinghello vom 25. 10. 1539, dem Rodolfo Pio alle, mit einem solchen Amt verbundenen Befugnisse, Rechte und Pflichten verliehen hatte 83 . Ferner fand ich darunter zwei Bekanntmachungen seines Vaters Lionello Pio. Der Kardinal hatte ihn nämlich am 27. 3. 1540 zum Locumtenens der Mark Ancona ernannt und ihm damit die Verwaltung dieser Provinz übertragen 84 . Als Erinnerung an ihn und sein Wirken kündete in dem Bogen des apostolischen Palastes in Ancona das Familienwappen der Pio mit der Inschrift „Leonellus Pius Carpe Praesidi suo erexit" 85 . Im Rahmen dieser Arbeit stellt sich jedoch vor allem die Frage nach Rodolfo Pio als Gesetzgeber. Seine juristische Begabung zeigt sich zweifellos in der Überarbeitung und Erneuerung der Aegidianischen Konstitutionen, die dem Kirchenstaat so viel Gutes gebracht hatten, nun aber in einigen Teilen als veraltet angesehen werden mußten. Von Papst Paul III. durch Breve vom 21. 4. 1539 mit weitreichenden Befugnissen und Privilegien ausgestattet, reformierte Rodolfo Pio mit Hilfe einer Kommission von sechzehn namhaften Juristen innerhalb von vier Jahren dieses Gesetzeswerk des Kardinals Aegidius Albornoz. Die Revision wurde von Papst Paul III. gebilligt und durch die Konstitution „Ex debito pastoralis officii" am 10. 9. 1544 in Kraft gesetzt. In dieser Form — und darin zeigt sich die besondere Leistung Rodolfo Pios — haben die Aegidianischen Konstitutionen bis 1816 gegolten. Erst am 6. Juli dieses Jahres wurden sie durch das Motuproprio Papst Pius VII. „Quando per
81 Dies läßt sich aus den im Archivio Falcò Pio di Savoia befindlichen Briefen und Bekanntmachungen Rodolfo Pios aus der Zeit vom Juni 1539 bis zum September 1540 entnehmen, da sie sämtlich in Macerata verfaßt wurden; gestützt wird dies auch durch ein Schreiben des Kardinals Alessandro Farnese an Rodolfo Pio vom 5. 6. 1540, das nach Macerata gesandt wurde. Dieses Schreiben befindet sich ebenfalls im Archivio Falcò Pio di Savoia; vgl. U. Fiorina, Inventario dell'archivio Falcò Pio di Savoia, S. 129 Nr. 525 (2). 82 G. Castellani, Art. „Macerata, Storia", in: Enciclopedia Italiana, Bd. X X I (193442), S. 774; vgl. auch F. Große-Wietfeld, Justizreformen im Kirchenstaat, S. 93. 83 Näheres über Niccolò Ardinghello bei M. Rosa, Art. „Ardinghelli, Niccolò", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 4 (1962), S. 30ff. 84 Auch das Ernennungsschreiben Rodolfo Pios vom 27. 3. 1540 wird im Archivio Falcò Pio di Savoia aufbewahrt; vgl. auch U. Fiorina, Inventario dell'archivio Falcò Pio di Savoia, S. 24 und S. 108 Nr. 468 (1). 85
P.G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X X und S. X X X Fn. 49.
24
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
ammirabile" außer Kraft gesetzt86. Die Aegidianischen Konstitutionen werden jedoch weiter unten im Zusammenhang behandelt. Besondere Aufmerksamkeit schenkte Rodolfo Pio während seiner Legation auch dem Bauwesen in Ancona, wodurch er eine unauslöschliche Spur hinterlassen hat. So trieb er im Auftrag des Papstes 15 000 Skudi ein, die er zur Befestigung Anconas gegen die Türken verwandte 87 . Ende 1542 88 endete die Legation Rodolfo Pios in der Mark Ancona. Er wurde abgelöst von dem portugiesischen Kardinal Michael de Silva, der jedoch nicht als Legat, sondern als „locumtenens Pontificis in Marchia" mit außerordentlicher Machtbefugnis nach Ancona ging 8 9 . Was war der Grund für die Beendigung seiner Legation? Pier Giovanni Baroni 90 vermutet, daß zwischen den Einwohnern Anconas und dem Legaten Uneinigkeiten herrschten, zu deren Schlichtung Rom habe eingreifen müssen. Er stützt dies auf eine „Instruttione al cardinale di Carpi per le cose d'Ancona quanto all'administratione pecuniaria" des Kardinals Alessandro Farnese, Neffe und Sekretär Papst Pauls III., vom 22. 2. 1542. Diese Instruktion enthalte Empfehlungen an Kardinal Pio darüber, wie man wirtschaftlich und politisch die Stadt verwalten müsse. Dabei seien jedoch oftmals Einzelheiten aufgeführt, die für eine Person mit so großer Erfahrung, wie Rodolfo Pio es war, überflüssig erscheinen. So lese man dort unter anderem, daß die Gemeinde verpflichtet werde, von ihren Einnahmen die gewöhnlichen Ausgaben der Stadt sowie die außergewöhnlichen und notwendigen zu begleichen und dann den Rest zum öffentlichen Wohl für die Errichtung von Mauern, Befestigungen, die Reinigung des Hafens und andere Dinge, die dem Papst notwendig erscheinen, zu verwenden. Pier Giovanni Baroni vermutet weiterhin, daß Rodolfo Pio auf das Einschreiten Roms sodann den Wunsch geäußert habe, seine Stelle verlassen zu dürfen. Dies ist jedoch nicht erwiesen und erscheint zudem auch fraglich. In dem Archivio Falcò Pio di Savoia befindet sich ein Diplom Rodolfo Pios für Gabriele Gallo und seine Söhne Vincenzo, Francesco und Battista vom 30. 10. 1542 91 . Der Kardinal trägt darin den Titel „Rodulphus Pius S. Prise. S. R. E. Presbr. Cardinalis de Carpo Provincie 86 Α. Erler, Albornoz, S. 32 ff. — Näheres über das Motuproprio vom 6. 7. 1816 bei F. Große-Wietfeld, Justizreformen im Kirchenstaat, S. 56ff. 87 L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. V, S. 765 Fn. 1 ;P.G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X I X f.; auch L. Cardella, Memorie storiche de'cardinali, Bd. 4, S. 176. 88 P.G. Baroni, La nunziatura in Francia, X X I X f . ; R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 25; — Daß die Legation erst Ende 1542 endete, habe ich einem Diplom Rodolfo Pios vom 30. 10. 1542 entnommen, da er darin noch als Legat der Mark Ancona bezeichnet wird. Dieses Diplom, auf das später noch eingegangen wird, befindet sich im Archivio Falcò Pio di Savoia; vgl. U. Fiorina, Inventario dell'archivio Falcò Pio di Savoia, S. 128 Nr. 524 (3). 89
P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X X I . — Näheres zu Kardinal Michael de Silva bei C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 3, S. 27 und S. 27 Fn. 11. 90 P.G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X X f . 91 Vgl. Fn. 88.
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
Marchie Anconitan. de latere Legatus". Daraus folgt, daß Rodolfo Pio noch Ende Oktober 1542 Legat in der Mark Ancona war. Hätte aber tatsächlich der von Baroni erwähnte Vorfall im Februar 1542 die Beendigung seiner Legation herbeigeführt, so wäre dies sicherlich schon kurze Zeit danach geschehen. Naheliegender ist daher vielmehr, daß Rodolfo Pio durch die weiteren bedeutenden und ehrenvollen Aufgaben und Ämter, die ihm in der Zwischenzeit übertragen worden waren, in Rom sehr in Anspruch genommen wurde. Daraus erklärt sich auch, daß er im März 1540 seinem Vater Lionello die Verwaltung der Mark Ancona übertragen hat. So hatte ihn am 12. 8. 1541 Papst Paul III., der sich im August dieses Jahres nach Lucca begab, um mit dem Kaiser zusammenzutreffen, für die Zeit seiner Abwesenheit zum Legaten für Rom ernannt 92 . A m 9. 1. 1542 wurde Rodolfo Pio das Amt des Kämmerers übertragen 93 . Im Februar 1543 ließ Papst Paul III., der am 26. 2. 1543 Rom verlassen hatte, um sich zunächst in Busseto erneut mit Karl V. zu treffen und um sodann in Bologna dem Konzilsort näher zu sein, wiederum Rodolfo Pio als Legaten für Rom zurück 94 . Diese zweite Legation ist von wesentlich größerer Bedeutung als die erste und zeigt auch wieder das große Vertrauen des Papstes in den Kardinal, denn sie fiel in eine sehr schwere und unruhige Zeit. Die Seeräuber des Chaireddin Barbarossa, Herrscher von Algerien und Admiral der Flotte von Soliman dem Großen, hatten nämlich erneut die italienischen Küsten überfallen. Sie plünderten und verwüsteten, wo man ihnen nicht mit der Waffe entgegentrat, und bedrohten sogar Rom 9 5 . Das diplomatische Geschick Rodolfo Pios und seine politische Weitsicht zeigen sich in seiner Denkschrift an den Kaiser von 1543, in der es zur Aussöhnung Karls V. und Franz I. um den Besitz an dem strategisch bedeutsamen Herzogtum Mailand ging. In dem „Discorso del rev. card, di Carpi del 1543 a Carlo V Cesare del modo del dominare" heißt es: „Der Kaiser müsse nicht Graf, Herzog, Fürst, er müsse nur Kaiser sein wollen: nicht viele Provinzen, sondern große Lehnsleute müsse er haben. Sein Glück habe aufgehört, seit er Mailand in Besitz genommen. Man könne ihm nicht raten, es an Franz I. zurückzugeben, dessen Länderdurst er damit nur reizen würde; aber auch behalten dürfe er es nicht. Deshalb allein habe er Feinde, weil man von ihm argwöhne, er suche sich fremder Länder zu bemächtigen. Vernichte er diesen Argwohn, gebe er Mailand an einen besonderen Herzog, so werde Franz I. keine Anhänger mehr finden; er dagegen, der Kaiser, werde Deutschland und Italien für sich haben, seine Fahnen zu den entferntesten Nationen tragen und seinen 92 P. Paschini, Art. „Pio da Carpi", in: Enciclopedia Cattolica, Bd. I X (1952), Sp. 1491 ; L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. V, S. 456 und 456 Fn. 6; vgl. auch F. Dittrich, Gasparo Contarmi, S. 786. 93 C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 3, S. 97 Fn. 1. 94 L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. V, S. 486; P. Paschini, Art. „Pio da Carpi", in: Enciclopedia Cattolica, Bd. I X (1952), Sp. 1491. 95 P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X X I ; ebenso L. Cardella, Memorie storiche de'cardinali, Bd. 4, S. 174.
26
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
Namen der Unsterblichkeit zugesellen"96. Da Rodolfo Pio somit dem Kaiser nahelegte, Mailand weder den Franzosen zu überlassen noch für sich zu behalten, sondern vielmehr einem Dritten zu verleihen, schien es Karl V. ein guter Ausweg, dieses Herzogtum seinem Schwiegersohn Ottavio Farnese, dem Enkel Papst Pauls III. zu übertragen. Schon früher hatte der Papst darauf hingedeutet 97 . Diese ehrenwerte und würdevolle Lösung für die alte Frage des Besitzes an dem Herzogtum Mailand weist Rodolfo Pio nicht nur als einen der treuesten Anhänger des Kaisers im heiligen Kollegium aus, sondern verdeutlicht auch seine Haltung gegenüber Papst Paul III. und dem Hause Farnese, das durch seine Denkschrift mittelbar begünstigt wurde. Rodolfo Pio war unter allen Kardinälen mit dem Papst am vertrautesten 98. Sein Verhalten war immer sehr würdevoll, und seine Beziehungen zu dem Hause Farnese, insbesondere aber zu Papst Paul III., waren stets durchdrungen von aufrichtiger Ergebenheit, nie von serviler und blinder Unterwerfung. Dies wird darin deutlich, daß Rodolfo Pio in dem Konsistorium vom 12. und 17. August 1545 mit den anderen Kardinälen offen den Vorschlag des Papstes mißbilligte, Parma und Piacenza an dessen Sohn Pier Luigi Farnese zu verleihen. Nachdem Rodolfo Pio jedoch seine Kritik an dieser neuen päpstlichen Politik geäußert hatte, unterwarf er seine Meinung zuletzt der höheren Einsicht des Papstes, während einige andere, wie Kardinal Carafa, ihre aufrührerische Haltung bewahrten und es ablehnten, die Schöpfung des Herzogtums Parma und Piacenza gegen Abtretung von Camerino und Nepi an den Heiligen Stuhl anzuerkennen 99. Ebenso waren die Beziehungen Rodolfo Pios zu den Nachfolgern Papst Pauls III. Er kam allen päpstlichen Tätigkeiten nach, die er für richtig hielt, tadelte aber jene, die er für die Kirche und den Kirchenstaat als schädlich erachtete. So mißbilligte er offen den von Papst Paul IV., aus dem Hause Carafa, beabsichtigten Krieg gegen die Spanier, ohne die Gefahr zu achten, dadurch möglicherweise die Zuneigung dieses so impulsiven Papstes zu verlieren. Zu diesem Verhalten wurde Rodolfo Pio nicht etwa durch Parteilichkeit bewogen, sondern vielmehr durch seine aufrichtige Liebe zum Frieden 100 . 96
Zitiert nach L. v. Ranke, Die Geschichte der Päpste, S. l l l f . ; ebenso bei L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. V, S. 490, und teilweise auch bei C. Capasso, Paolo III. (1534-1549), Bd. II, S. 284 Fn. 1 — Nach L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. V, S. 490 Fn. 2, befindet sich der „Discorso del rev. card, di Carpi ... " in der Biblioteca Corsini zu Rom η. 443; drei weitere Exemplare befinden sich in der Nationalbibliothek zu Paris (Cod. Ital. 10075, n. 3; 10076, n. 14 und Cod. 1067 [St. Viktor]) und ein viertes in der Vatik. Bibliothek (Cod. Orb. 855 f. 66 f.). 97 L. v. Ranke, Die Geschichte der Päpste, S. 112; L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. V, S. 490. 98 L. v. Ranke, Die Geschichte der Päpste, S. 111. 99 P.G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X X I f . ; L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. V, S. 527. 100 P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X X I I ; vgl. auch L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VI, S. 433.
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
Auch beanstandete Rodolfo Pio das gewaltsame Vorgehen des Nachfolgers Pauls IV., Pius' IV., gegen die Familie Carafa und deren beide Mitglieder im Kardinalskollegium. In dem Konsistorium vom 25. 10. 1560 erhob er seine Stimme zugunsten der Carafa und verlangte laut Gerechtigkeit, während Papst Pius IV. mit erregten Worten sein Vorgehen verteidigte 101 . Rodolfo Pio war daher kein Kardinal, der sich jedem beliebigen Wunsch des Papstes beugte, sondern ein Mann, der nie die eigenen Gedanken verbarg, selbst wenn es von dem Papst übel aufgenommen werden und ihm zum Nachteil gereichen konnte. Während all dieser Zeit vernachlässigte Rodolfo Pio seine pastoralen Aufgaben und Pflichten nicht. Er war ein reformeifriger Kirchenfürst. Dies wurde schon durch die Diözesansynode von 1533 in seinem Bistum Faenza sichtbar 102 . Da ihm besonders an der Belehrung und Besserung des Volkes gelegen war, sandte er mehrere Prediger und Missionare nach Faenza. Bernardino Ochino, einer der berühmtesten Bußprediger dieser Zeit 1 0 3 , weilte mehrmals in dieser Stadt und wurde von ihren Einwohnern bewundert und gerne gehört. Auf Wunsch Rodolfo Pios predigten in Faenza außerdem Bruder Bonaventura Costazaro, Pater Claudio Le Jay, einer der ersten Anhänger von Ignatius von Loyola, sowie Pater Pasquale Broet 1 0 4 . 1544 verzichtete Rodolfo Pio zugunsten seines Bruders Teodoro auf die Diözese Faenza. Er behielt sich aber einen Teil der Einnahmen des Bistums vor, ebenso die Verleihung aller Benefizien sowie die Rückkehr in den Besitz des Bistums für den Fall, daß Teodoro vor ihm versterben sollte. Er wurde daher bezeichnet als „perpetuo amministratore della chiesa e vescovado di Faenza, perpetuo collatore di tutti i beneflcii della città e diocesi di Faenza" 105 . Diese Bedingungen wurden in dem Breve, mit dem Papst Paul III. am 10. 10. 1544 106 Teodoro zum Bischof von Faenza ernannte, im einzelnen festgelegt. Rodolfo Pio glaubte, auf diese Weise der Diözese Faenza einen Bischof zu geben, der dort auch residiere. Er wurde mit seinem edlen Vorschlag jedoch bitter enttäuscht. Kaum hatte Teodoro die Verwaltung der Diözese angetreten, so geriet er mit dem Domkapitel in Streit. Er verließ daher seinen Sitz und kehrte nach Meldola in der Romagna zu seinem Vater Lionello zurück 1 0 7 , der dort die Herrschaft inne 101
P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X X I I ; Näheres hierüber bei L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VII, S. 116f. und S. 124. 102 Vgl. S. 15 f. 103 F. Lanzoni, La controriforma, S. 47 ff. — Näheres über Bernardino Ochino weiter unten; vgl. aber auch A. Haidacher, Geschichte der Päpste in Bildern, S. 354. 104 F. Lanzoni, La controriforma, S. 52 und S. 56; J. Wicki, Rodolfo Pio da Carpi, in: Miscellanea Historiae Pontificiae, Vol. X X I , S. 243 ff. (256). 105 F. Lanzoni, La controriforma, S. 103. 106 So F. Lanzoni, La controriforma, S. 103; ebenso P.B. Gams, Series episcoporum, S. 689; dagegen gibt P.G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X X I I I , den 19. 10. 1534 als Datum der Ernennung Teodoros an; es muß sich jedoch insoweit um einen Druckfehler handeln, da sich Baroni auf S. X X X I I I Fn. 65 auf F. Lanzoni, S. 103, bezieht. 107
F. Lanzoni, La controriforma, S. 103 f.
28
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi 108
hatte . Nach dem Tode Teodoros am 26. 11. 1561 trat Rodolfo Pio wieder in den vollen Besitz der Diözese Faenza ein. Einige Monate später, am 18. 3. 1562, verzichtete er jedoch erneut, und zwar zugunsten eines seiner Höflinge und Hausfreundes Giambattista Sighicelli von Bologna. Auch dieses Mal behielt er sich 600 Scudi jährlich vor, außerdem die Einnahmen aus der Verleihung der Benefizien und die Rückkehr für den Fall vorzeitigen Abtretens des Nachfolgers 109 . Zusammenfassend läßt sich daher sagen, daß Rodolfo Pio die Diözese Faenza von 1528 bis zu seinem Tode entweder selbst oder mit Hilfe seiner Verwandten und Untergebenen verwaltete. 1546 wurde Rodolfo Pio durch den Einfluß Kaiser Karls V. zum Bischof von Girgenti, dem heutigen Agrigent 1 1 0 ernannt, das er bereits seit dem 10. 10. 1544 verwaltete. 1558 fügte König Philipp II. von Spanien den Einnahmen dieses Bistums ein jährliches Einkommen von 10 000 Scudi hinzu. Was mag König Philipp zu diesen freigebigen Zuwendungen bewogen haben? Pier Giovanni Baroni 111 vermutet zwei Beweggründe, nämlich zunächst die Achtung gegenüber einem der treuesten Anhänger der kaiserlichen Partei im Kardinalskollegium, mehr aber noch die Berechnung, aus der Gunst einer so einflußreichen Persönlichkeit, wie Rodolfo Pio es war, bei Bedarf Vorteile ziehen zu können. A m 10. 11. 1549 starb Papst Paul III. In dem nun folgenden Konklave standen sich innerhalb des Kardinalskollegiums zwei politisch interessierte Parteien gegenüber, die Kaiserlichen und die französisch Gesinnten. Unter dem 20. 11. 1549 hatte sich Kaiser Karl V. gegenüber seinem Gesandten in Rom betreffs der Papstwahl ausgesprochen. Vor allem wäre ihm der Dominikaner Juan Alvarez de Toledo, Oheim des Herzogs von Alba und Bruder des Vizekönigs von Neapel, genehm gewesen; sollte aber dessen Wahl nicht möglich sein, so wünschte er als nächsten Carpi, dann Pole, Morone oder Sfrondato 112 . Rodolfo Pio — er ist jetzt 49 Jahre alt — war somit einer der Hauptkandidaten der kaiserlichen Partei für die höchste Würde auf Erden! Die französische Partei indessen lehnte diese Kandidaten entschieden ab 1 1 3 . Nach monatelangen Parteistreitigkeiten und 60 Wahlgängen wurde schließlich 108
Durch die Bulle Papst Klemens VII. vom 31. 3. 1531 erhielt Lionello Pio die Investitur von Sarsina, Meldola, Polenta, Caminata, Coglianello, Ranchio und dem Kastell von S. Feiice; vgl. U. Fiorina, Inventario dell'archivio Falcò Pio di Savoia, S. 108 Nr. 468 (2). — Abbildungen der eindrucksvollen Festung von Meldola, die in der Nähe von Forli gelegen ist und auf der Rodolfo Pio des öfteren bei seinen Angehörigen weilte, finden sich bei D. Ber ardi, A.C. Ramelli, M. Foschi, F. Montevecchi, G. Ravaldini, S. Venturi, Rocche e castelli, Bd. 2 (1971), S. 280fî. 109
F. Lanzoni, La controriforma, S. 121 f. Agrigent, auf der Insel Sizilien gelegen, wurde bis 1927 Girgenti genannt; so E. Meuthen, Art. „Agrigento", in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. I (1957), Sp. 209. 111 P.G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X X I I I . 112 L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VI, S. 6 ff. und S. 9. 113 L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VI, S. 25. 110
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
am 7. 2. 1550 Kardinal Giovanni Maria Ciocchi del Monte zum Papst gewählt und am 22. 2. als Julius III. gekrönt 1 1 4 . Rodolfo Pio, der sich für Kardinal del Monte einsetzte, war wegen einer Erkrankung am Tag der Wahl in der Paulinischen Kapelle nicht zugegen 115 . Schon kurz darauf, am 21.2.1550, wurde Rodolfo Pio von dem neu gewählten Papst als „gubernator perpetuus" von Alatri, in der Provinz Campania-Marittima, bestätigt und mit apostolischer Autorität bekräftigt. Dieses Breve Julius' I I I . 1 1 6 ist von besonderem Interesse, deutet es nach den Ausführungen von Pier Giovanni Baroni 117 doch darauf hin, daß in dem Konklave, in dem Papst Julius III. gewählt wurde, die anwesenden Kardinäle einige Städte und Kastelle des Kirchenstaates unter sich ausgelost haben müssen. Rodolfo Pio fiel auf diese Weise die Stadt Alatri zu. Von diesem Vorfall hat sich außer dem Breve Papst Julius III. vom 21. 2. 1550 bisher kein anderes Zeugnis gefunden. Bezeichnend ist jedoch, daß diese Urkunde kaum vierzehn Tage nach der Wahl Julius III. verfaßt wurde. Es ist daher anzunehmen, daß dem künftigen Papst durch eine Wahlkapitulation der Kardinäle aufgegeben worden war, die während der Sedisvakanz unter ihnen ausgelosten Städte und Kastelle zu bestätigen 118 . In Alatri 1 1 9 verbrachte Rodolfo Pio mehrere Tage dieses Jahres, wahrscheinlich, um sein neues Benefizium in Besitz zu nehmen. Sein Aufenthalt dort bereitete ihm viel Freude, wie er Paolo Giovio 1 2 0 in einem Brief vom 20. 9. 1550 mitteilte. M i t diesem berühmten Gelehrten und Historiker, der der Verfasser der bekannten „Historiae sui temporis" und einiger Biographien ist, verband ihn eine innige Freundschaft schon aus der Zeit vor seinen Nuntiaturen in Frankreich, da die ersten zwischen ihnen ausgetauschten Briefe, die eine große Vertraulichkeit widerspiegeln, auf diese Zeit zurückgehen 121 . Aus den Kopien einiger Urkunden des Archivio Falcò Pio di Savoia 122 ist zu entnehmen, daß Rodolfo Pio im Sommer 1551 ein weiteres hohes Amt 114
H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Julius III.", S. 145. L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VI, S. 33. 116 Dieses Breve vom 21.2.1550 ist unterzeichnet von Blosius, d. h. von dem päpstlichen Sekretär Blosio Palladio. Das rote Siegel Papst Julius' III. ist gut erhalten. Das Breve wird in dem Archivio Falcò Pio di Savoia in der Biblioteca Ambrosiana aufbewahrt; vgl. U. Fiorina, Inventario dell'archivio Falcò Pio di Savoia, S. 128 Nr. 524 (2). 117 P.G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X X I V . ne v g i pm g. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X X I V . 115
119
Näheres über Alatri, das auf einer sanften Erhebung gelegen ist und seit dem Ende des 14. Jahrhunderts dem Kirchenstaat angehörte, bei R. Amalgià, G. Lugli, G. Falco, Art. „Alatri", in: Enciclopedia Italiana, Bd. I I (1929), S. 82f. 120 Näheres über Paolo Giovio bei W. Durant, Kulturgeschichte der Menschheit, Bd. 8, S. 259. 121 P.G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X X I V f . 122 Vgl. U. Fiorina, Inventario dell'archivio Falcò Pio di Savoia, S. 128f. Nr. 525 (2).
30
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
erwartete, nämlich die Legation des Patrimonium S. Petri mit dem Sitz in Viterbo. Nachdem er noch in Rom am 19. 6. 1551 Ambrogio Spinola zum Vizelegaten der Stadt Viterbo ernannt und unter dem 22. 6. 1551 einige Anordnungen getroffen hatte, brach er nach Viterbo auf. A m 24. 6. 1551 erreichte er die Stadt, und am folgenden Tag hielt er unter dem Jubel der Einwohner seinen feierlichen Einzug in Viterbo. Anhand der Datierung seiner zahlreichen Anordnungen, die in dem Archivio Falcò Pio di Savoia in Kopie aufbewahrt werden 123 , läßt sich erkennen, daß er bis September 1551 in Viterbo weilte, die folgenden Monate, wahrscheinlich bis Mai 1552, wiederum in Rom verbrachte und sich von Juli bis September 1552 erneut in Viterbo aufhielt. Da Rodolfo Pio bei Papst Julius III. in hohem Ansehen stand, wurde ihm schon bald wieder eine wichtige Mission übertragen. Noch während sich der Kardinal in Viterbo befand, ernannte ihn Julius III. in dem Konsistorium am 9. 9. 1551 zum Legaten bei Kaiser Karl V . 1 2 4 . Gleichzeitig wurde Kardinal Verallo zum Legaten bei König Heinrich II. von Frankreich ernannt. Die Sendung der beiden Kardinallegaten an den kaiserlichen und den französischen Hof umfaßte den schwierigen Auftrag, einen dauerhaften Frieden zwischen den beiden mächtigsten Herrschern der Christenheit zu vermitteln 125 . AmlO. 9. 1551 teilte der Papst Rodolfo Pio seine Ernennung zum Legaten bei dem Kaiser mit und bat ihn, nach Rom zurückzukehren 126 . Als er dort kurz darauf eintraf, zeigte sich, daß er von der Erkrankung, die ihn bereits in dem letzten Konklave gequält hatte, noch nicht genesen war. Er konnte deshalb die Reise zu Karl V. nicht antreten 127 . An seiner Stell« ging sodann im Oktober 1551 Pietro Camaiani, Bischof von Fiesole, an den kaiserlichen H o f 1 2 8 . 123
Vgl. U. Fiorina, Inventario dell'archivio Falcò Pio di Savoia, S. 128 f. Nr. 525 (2). In einem Schreiben Papst Julius' III. an Kardinal Girolamo Dandino vom 9. 9.1551 heißt es: „Nel consistoro d'hoggi havemo creato legato al Imperatore il cardinale de Carpi et al Re il cardinale Verallo ..."; zitiert nach J. Lestocquoy, Correspondance des Nonces, Dandino, della Torre et Trivultio, S. 528. Dies wird zudem bestätigt durch die Nuntiaturberichte des Kardinals Girolamo Dandino an Girolamo Martinengo vom 26. 9. 1551, bearb. von H. Goetz, Nuntiaturberichte aus Deutschland, 16. Bd. 1533-1559, S. 73, und des Erzbischofs von Montepulciano, Giovanni Ricci, an den Bischof von Fano, Pietro Bertano, vom 13. 9. 1551, bearb. von G. Kupke, Nuntiaturberichte aus Deutschland, 12. Bd. 1533-1559, S. 67f. — Unrichtig daher J. Wicki, Rodolfo Pio da Carpi, in: Miscellanea Historiae Pontificiae, Vol. X X I , S. 243 ff. (245), und P. Paschini, Art. „Pio da Carpi" in: Enciclopedia Cattolica, Bd. IX (1952), Sp. 1492, die beide angeben, Rodolfo Pio sei im September 1551 als Legat nach Frankreich gesandt worden. 124
125
Vgl. H. Lutz, Nuntiaturberichte aus Deutschland, 13. Bd. 1533-1559, S. X V I I . G. Kupke, Nuntiaturberichte aus Deutschland, 12. Bd. 1533-1559, S. 68 Fn. 1. 127 So der Nuntiaturbericht des Erzbischofs von Montepulciano, Giovanni Ricci, an den Bischof von Fano, Pietro Bertano, vom 16. 9. 1551, bearb. von G. Kupke, Nuntiaturberichte aus Deutschland, 12. Bd. 1533-1559, S. 69ff.; vgl. auch den Nuntiaturbericht von 126
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
In der folgenden Zeit finden sich zahlreiche Briefe an Rodolfo Pio, die Zeugnis geben von seiner hohen Stellung und seiner einflußreichen Persönlichkeit, so u. a. von König Philipp II. von Spanien, König Franz II. von Frankreich, Maximilian, Erzherzog von Österreich und König von Böhmen, König Sebastian von Portugal, König Sigismund von Polen, Margarete von Österreich, Herzogin von Parma, sowie Caterina, Prinzessin von Portugal 129 . Auch erhielt Rodolfo Pio weitere kirchliche Würden. A m 29. 11. 1553 wurde er zum Kardinalbischof von Albano, am 11. 12. 1553 von Frascati (Tusculum) und am 29. 5. 1555 von Porto erhoben. A m 18. 5. 1562 wurde er schließlich Kardinalbischof von Ostia und Dekan des Kardinalskollegiums 130 . Unter all seinen Werken als Kirchenfürst ist seine Tätigkeit als Protektor der Santa Casa di Loreto besonders hervorzuheben. Schon seit seiner anconitanischen Legation bemühte sich Rodolfo Pio sehr um dieses berühmte Heiligtum, das zu einem der vier bedeutendsten Wallfahrtsorte der Christenheit wurde 1 3 1 . So wohnte er während seines Aufenthaltes in Loreto im Oktober 1539 viele Male den Sitzungen des Gemeinderates bei, um in die Angelegenheiten der Stadt und des Heiligtums Ordnung zu bringen. Als Zeichen der Dankbarkeit ließ die Gemeinde in dem prioralen Palast sein Wappen in Marmor einmeißeln und eine Bronzebüste von ihm aufstellen 132 . An dem Konzil von Trient war Rodolfo Pio kaum beteiligt. Er nahm weder an den Sitzungen noch an den Verhandlungen teil. Dennoch zählte er zu den reformeifrigen Kirchenfürsten. Stets unterstützte er die strengere Strömung des Kardinalskollegiums. Zudem stand er mit einigen Konzilsteilnehmern in Briefverkehr, so u. a. mit Cornelio Musso, Bischof von Bertonoro sowie dem Tridentiner Kardinal Christoforo Madruzzo, und ließ auf diese Weise das Konzil seine Meinung wissen. Auch nahm er an den römischen Kundgebungen der Wiedereröffnung und der Schließung des Konzils teil. Insbesondere setzte er sich für die Wiederaufnahme des Konzils ein, nachdem es 1552 von Papst Julius III. suspendiert worden war, aber mit jener Mäßigung, die ihm eigen war und die er vornehmlich als einflußreiches Mitglied der römischen Inquisition zeigte 133 . Kardinal Girolamo Dandino an Girolamo Martinengo vom 26. 10. 1551, bearb. von H. Goetz, Nuntiaturberichte aus Deutschland, 16. Bd. 1533-1559, S. 74ff. 128 G. Kupke, Nuntiaturberichte aus Deutschland, 12. Bd. 1533-1559, S. 115 Fn. 1. 129 Vgl. U. Fiorina, Inventario dell'archivio Falcò Pio di Savoia, S. 128 Nr. 524 (6-47). 130 C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 3, S. 27; ebenso/. Lestocquoy, Correspondance des Nonces, S. X X X V I Fn. 18. 131 Näheres über dieses berühmte Heiligtum, das in der Mark Ancona gelegen ist, bei S. Ν eher, Art. „Loreto" in: Kirchenlexikon, Bd. 3 (1893), Sp. 145 ff. 132 Dieses Wappen Rodolfo Pios wurde 1798 wie alle Wappen und Denkmäler, die an die Zeit der Monarchie und der Aristokratie erinnerten, von der Revolutionsarmee Napoleons zerstört; M. Leopardi, Annali di Recanati, Bd. II, S. 183 und S. 183 Fn. (n); P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. XXXV. 133 P.G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X X V f .
32
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
Schon unter Papst Paul III., der durch eine Bulle vom 21.7.1542 das gesamte Inquisitionswesen neu gestaltet und in Rom eine Zentralbehörde für alle Länder geschaffen hatte, gehörte Rodolfo Pio der Kommission zur Reinerhaltung des Glaubens a n 1 3 4 . Unter dem nachfolgenden Papst Julius III., der wiederholt persönlich an den Sitzungen der römischen Inquisition teilnahm, bekleidete Rodolfo Pio seit Februar 1551 das hohe Amt des Generalinquisitors 135 , ebenso unter Papst Paul IV., der die Wiederherstellung des alten Glaubens als vorrangigste Pflicht erachtete und es sich daher nicht nehmen ließ, sogar bei allen Hauptsitzungen der Inquisition zu erscheinen; letztere wollte er auf das schärfste angewandt wissen 136 . Sein Nachfolger, Papst Pius IV., betraute Rodolfo Pio und vier weitere Kardinäle gleich in seinem ersten Konsistorium mit der Führung der Inquisitionsgeschäfte und stattete das Glaubensgericht durch Erlaß vom 14. 10. 1562, in dessen Überschrift Rodolfo Pio namentlich genannt ist, mit neuen Vollmachten aus 1 3 7 . Bemerkenswert ist auch das Wirken Rodolfo Pios als Kardinalprotektor der Jesuiten und der Franziskaner. Wann er zum Kardinalprotektor der Gesellschaft Jesu ernannt wurde, steht nach den erhaltenen Dokumenten nicht fest. Aus einer Erwähnung des Ordenshistorikers Orlandini läßt sich jedoch schließen, daß Rodolfo Pio dieses Amt mindestens seit 1544 inne gehabt haben muß 1 3 8 . Daß man den richtigen Mann für diese Aufgabe berufen hatte, geht aus vielen Zeugnissen hervor. Rodolfo Pio war ein großer Freund der jungen Gesellschaft Jesu, der den Orden in der Emilia, Romagna und auf Sizilien einführte. Man kann sogar sagen, daß er schon an der Gründung der Gesellschaft einen nicht unerheblichen Anteil hatte. Nachdem nämlich Papst PaulIII. Anfang September 1539 dem von Ignatius von Loyola eingereichten Entwurf der Ordensverfassung die mündliche Bestätigung erteilt hatte, sprach sich der einflußreiche Kardinal Giovanni 134
L. ν . Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. V, S. 710f. und S. 711 Fn. 1; F. Lanzoni, La controriforma, S. 75. 135 L. ν . Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VI, S. 161; vgl. auch Wicki, Rodolfo Pio da Carpi, in: Miscellanea Historiae Pontificiae, Vol. X X I , S. 243 ff. (261). 136 L. ν . Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VI, S. 508 f.; L. v. Ranke, Die Geschichte der Päpste, S. 124 und 135. 137 L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VII, S. 509. 138 Der Ordenshistoriker Orlandini erwähnt Rodolfo Pio als Protektor der Gesellschaft Jesu zum ersten Mal in einem Nebensatz beim Jahre 1544, ohne zu sagen, von wann an dieses Amt bestand. Ignatius selber nennt in einem Brief vom 6. 5. 1545 an P. Simon Rodriguès den Kardinal Rodolfo Pio da Carpi „nuestro protector, corno quien està al cabo de todas las cosas que a la Comparila convienen para maior gloria divina". Aus einem späteren Brief vom 19. 5. 1548 an P. Broet, wahrscheinlich von dem Sekretär Polanco verfaßt, ist zu vernehmen, daß Rodolfo Pio „omnium consensu" zum Protektor gewählt wurde, „siendo Maestro Ignatio y acâ todos tanto del cardenal de Carpi, y specialmente Maestro Ignatio tiene con él servitud y amor, etc.", so J. Wicki, Rodolfo Pio da Carpi, in: Miscellanea Historiae Pontificiae, Vol. X X I , S. 243 ff. (244); H.Jedin, Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. IV, S. 471.
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
Guidiccioni grundsätzlich gegen jede Ordensneugründung aus. Er war sogar der Meinung, man sollte die bereits bestehenden Orden auf vier beschränken. Lediglich der Vermittlung Rodolfo Pios war die Beseitigung dieses Hindernisses zu verdanken, und so gelang am 27. 9. 1540 mit der Bulle „Regimini militantis ecclesiae" die Approbation der Gesellschaft Jesu 139 . Da die Aufgaben des Ordensprotektors nicht genau umschrieben waren, findet man bei Rodolfo Pio eine zum Teil nicht erwartete vielfaltige Tätigkeit vor. Offensichtlich nahm er sein Amt sehr ernst und führte den ihm zugewiesenen Auftrag gewissenhaft aus. Hierfür seien nur zwei Beispiele angeführt, die sich auf päpstliche Dokumente beziehen. So wurden zwei Abschriften des Breves Papst Pauls III. vom 3. 6. 1545, das den Patres die Erlaubnis gab, zu predigen, die Beichte abzunehmen, Gelübde umzuwandeln usw., „cum testimonio card, de Carpi" angefertigt. Ferner war Rodolfo Pio an dem Breve Papst Julius III. „Sacrae Religionis" vom 22. 10. 1552 beteiligt, das die früheren Gnaden bestätigte und weitere Privilegien hinzufügte 140 . Der Kardinal war aber nicht nur Protektor des Ordens, sondern auch einer Anzahl Werke, die von Ignatius von Loyola ins Leben gerufen wurden. So wird er 1543-1544 als „protector de la casa de las mugeres peccadoras", auch „Compania de la Gratia" genannt, erwähnt. Aufgabe der Compania war es, die Gründung der Casa di S. Marta, ein Heim für gefallene Frauen, auf Dauer zu sichern 141 . M i t fünf anderen Kardinälen gehörte Rodolfo Pio ab Juli 1552 weiterhin zu den „protectores et defensores Collegii Germanici". Er machte sich um die Gründung dieses Hauses sehr verdient, gab bei einer Sammlung unter den Kardinälen 40 Goldskudi 1 4 2 und bemühte sich, bei anderen Kirchenfürsten die versprochenen Spenden einzuziehen, was nicht ohne Plage und zum Teil mit Abweisung geschah. Bei allem guten Willen gelang es jedoch dem Kardinalprotektor zu Lebzeiten nicht, die Fundation des Deutschen Kollegs sicherzustellen 1 4 3 .
139
A. Haidacher, Geschichte der Päpste in Bildern, S. 356. J. Wicki, Rodolfo Pio da Carpi, in: Miscellanea Historiae Pontificiae, Vol. X X I , S. 243 ff. (247). 140
141
L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. V, S. 401. Bei A. Haidacher, Geschichte der Päpste in Bildern, S. 384, ist die Liste mit den Namen und Unterschriften der Kardinäle, die sich zur finanziellen Unterstützung des neu gegründeten Deutschen Kollegs (Germanikum) der Gesellschaft Jesu verpflichtet haben, abgebildet. Sie haben ihre Namen mit der Höhe des Betrages in Goldskudi auf dieser Liste eigenhändig vermerkt. Der Name Rodolfo Pios erscheint an dritter Stelle. — Näheres über die Vorgeschichte und Gründung des Deutschen Kollegs bei P. Schmidt, Das Collegium Germanicum in Rom und die Germaniker, S. 12 ff. 142
143
J. Wicki, Rodolfo Pio da Carpi, in: Miscellanea Historiae Pontificiae, Vol. X X I , S. 243ff. (255); auch L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VI, S. 170f. 3 Hoffmann
34
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
Obwohl Rodolfo Pio der Gesellschaft Jesu so viele gute Dienste erwiesen hatte, überwog bei der Ordensleitung nach seinem Tode die Meinung, der Gesellschaft keinen neuen Kardinalprotektor zu geben: zunächst, um sich ganz dem Papst zur Verfügung zu stellen, und dann auch, um möglichst alle Kardinäle in gleicher Weise als Freunde zu haben. Somit ist Rodolfo Pio der erste und letzte Kardinalprotektor der Gesellschaft Jesu gewesen144. Daneben war er seit dem 1. 1. 1541 bis zu seinem Tode auch Kardinalprotektor der Franziskaner 145 . In dieser Eigenschaft hatte er 1542 in der Angelegenheit Bernardino Ochinos zu walten. Der asketisch strenge Ochino, Generalvikar des jungen Kapuzinerordens, wurde in ganz Italien gleichsam als Heiliger verehrt und ob seiner zündenden Bußpredigten gefeiert. Als er sich jedoch der Rechtfertigungslehre Luthers zuwandte und deshalb eine päpstliche Vorladung vor die Inquisition nach Rom erhielt, floh er in die reformierte Schweiz 146 . Infolge dieser aufsehenerregenden Flucht erhielt Rodolfo Pio von Papst Paul III. und dem Kardinalskollegium den Auftrag, sämtliche Obern des Kapuzinerordens nach Rom zu berufen, sie hinsichtlich der Reinheit des Glaubens eingehend zu vernehmen und von den Ergebnissen hierüber zu berichten. Rodolfo Pio führte diesen Auftrag äußerst gewissenhaft aus. Es gelang ihm damit nicht nur, den Kapuzinerorden vor seiner Aufhebung zu bewahren, sondern auch aufzuzeigen, daß die gegen die Kapuziner erhobenen Beschuldigungen unbegründet waren und lediglich von dem Neid anderer Orden herrührten 147 . Den Höhepunkt seines Lebens erreichte Rodolfo Pio aber in dem Konklave nach dem Tode Papst Pauls IV. (18. 8. 1559); hier war er der päpstlichen Würde zum Greifen nahe. Wie schon nach dem Tode Papst Julius III. und dessen Nachfolgers Marcellus II. war Rodolfo Pio auch in diesem Konklave wiederum an der Spitze der Kandidatenliste der spanischen Partei 148 . Da diese Liste nämlich so lange in Geltung zu bleiben pflegte, bis sie — durch Wahl oder Tod des Kandidaten — in sich erloschen oder ausdrücklich widerrufen war, galten 144 J. Wicki, Rodolfo Pio da Carpi, in: Miscellanea Historiae Pontificiae, Vol. X X I , S. 245 ff. (264). 145 Das Ernennungsbreve Papst Pauls III. vom 1.1.1541 ist veröffentlicht bei B. Katterbach, De Cardinali Rodulpho Pio de Carpo, in: Archivum Franciscanum Historicum, 1923, S. 557. 146 A. Haidacher, Geschichte der Päpste in Bildern, S. 354. 147 L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. V, S. 372; P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X X V I . 148 Das Kardinalskollegium teilte sich in zwei große Parteien: eine französische und eine spanische. Neben Spanien und Frankreich kam diejenige katholische Großmacht, die dem Namen nach die erste, der Macht nach aber die letzte war, nämlich das mit dem Hause Österreich verbundene Kaisertum, wenig in Betracht. Kaiser Ferdinand I. betrieb in Rom keine selbständige Politik, sondern Schloß sich ganz den Spaniern an. Sein Hauptanliegen war lediglich, daß ein Papst gewählt werde, der ihn anerkenne; so Th. Müller, Das Konklave Pius IV., S. 29.
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
35
die Kandidaten Karls V. auch weiterhin als solche König Philipps II. von Spanien. Somit war es ganz selbstverständlich, daß der inzwischen 59jährige, hochangesehene und einflußreiche Kardinal Rodolfo Pio, der seit so langer Zeit schon Kandidat der Spanier war, an der Spitze von deren Liste erschien 149 . König Philipp II. bestätigte dies zudem nochmals in einer ausführlichen Instruktion an seinen Gesandten Don Juan de Figueroa, in der er Rodolfo Pio ausdrücklich an erster Stelle für die Papstwahl benannte 150 . Dagegen schärfte König Franz II. von Frankreich seinem Gesandten in Rom, dem Bischof von Angoulême, ein, daß man alles tun solle, um Rodolfo Pio auszuschließen151. Unter den vierzig Wählern, die am 5. 9. 1559 das Konklave bezogen, waren nur elf französisch gesinnt. Die Gegenpartei gedachte deshalb sofort am Abend des folgenden Tages ihr Übergewicht zu benützen, indem sie ohne förmliche Abstimmung per acclamationem den Kardinal Rodolfo Pio zum Papst zu erheben und so dem Konklave ein rasches Ende zu machen versuchte. Der Plan scheiterte jedoch an der Uneinigkeit der spanischen Partei. Ihr Führer, Kardinal Guido Ascanio Sforza von Santa F i o r a 1 5 1 a war nämlich insgeheim gegen Rodolfo Pio, obwohl dieser der Hauptkandidat der Spanier war. Er hatte sich von Kardinal Ippolito d'Esté von Ferrara für ein Übereinkommen gewinnen lassen, wonach Santa Fiora versprach, die Wahl des Pio zu hindern, während
149
Th. Müller, Das Konklave Pius IV., S. 86. In dieser Instruktion Philipps II., die Don Juan de Figueroa bei seiner Ernennung zum Gesandten in Rom am 25. 9. 1558 erhielt, heißt es: Der Gesandte möge als seine allerwichtigste Aufgabe betrachten, bei der nächsten Sedisvakanz die Papstwahl im spanisch-katholischen Sinne zu betreiben. Er, der König, wünsche nach wie vor, daß ein Papst gewählt werde, der eifrig bedacht sei auf den Dienst Gottes und das Wohl und die Beruhigung der Christenheit, der die religiösen Irrungen und Zwistigkeiten ausrotten und am Weitergreifen hindere, der sich der so dringend notwendigen Reform zuwende, und der die Christenheit und besonders das durch Kriege so schwer heimgesuchte Italien in Frieden und Einigkeit erhalte. Gegenüber diesen Forderungen müsse man sogar die Geneigtheit eines Kandidaten, speziell spanische Interessen zu vertreten, hintansetzen. Nachdem der König so die leitenden Gesichtspunkte festgestellt hatte, nannte er seine Kandidaten in folgender Reihenfolge: Carpi, Morone, Puteo, Medici und Araceli; vgl. Th. Müller, Das Konklave Pius IV., S. 84f. 150
151 König Franz II. wünschte, wie schon seine Vorgänger Franz I. und Heinrich II., einen französisch gesinnten Kardinal als Papst. Sollte dies jedoch nicht zu erreichen sein, so wollte er jemanden ohne Ehrgeiz und ohne feindliche und außergewöhnliche Pläne; vgl. Th. Müller, Das Konklave Pius IV., S. 74f. und S. 74 Fn. 2. 151 a Guido Ascanio Sforza von Santa Fiora wurde Ende 1518 als Sohn der mit dem gleichnamigen Grafen verheirateten Tochter Pauls III., Costanza, geboren. A m 18. 12. 1534 wurde er von Papst Paul III. zum Kardinal erhoben. Im März 1537 wurde er Legat von Bologna und der Romagna, am 22. 10. 1537 Camerarius, am 6. 4. 1541 Patriarch von Alexandrien. Er starb am 6. 10. 1564. Ausführlich über Kardinal Guido Ascanio Sforza von Santa Fiora bei G. P. Picotti, Art. „Sforza", in: Enciclopedia Italiana, Bd. X X X I (1936-1944), S. 571-575 (573); L. ν. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. V, S. 101 Fn. 1; C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 3, S. 25.
*
36
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
sich Este für die Kardinäle Giovanni Angelo de Medici und Ercole Gonzaga von Mantua, die beide ebenfalls zur spanischen Partei gehörten, verwenden sollte 152 . Was waren die Gründe für ein solches Wahlbündinis gegen Rodolfo Pio? Kardinal Este war ein erbitterter und unversöhnlicher Feind Rodolfo Pios, da letzterer es nicht vergessen konnte, daß sein Geschlecht vor einem Menschenalter die Grafschaft Carpi an das Haus Este verloren hatte. Es war daher zu befürchten, daß er als Papst alles versuchen werde, um den alten Besitz seines Hauses dem Herzog von Ferrara wieder abzugewinnen. Es mußte aber nicht nur diesem Fürsten, sondern auch den anderen italienischen Fürstenhäusern, die zum Teil durch nahe Verwandte im Kardinalskollegium vertreten waren, höchst unerwünscht sein, daß es deswegen wieder zu kriegerischen Verwicklungen in Oberitalien kommen sollte. Sie hatten alle somit ein berechtigtes Interesse daran, daß Rodolfo Pio nicht gewählt wurde 1 5 3 . Kardinal Guido Ascanio Sforza von Santa Fiora hatte zudem mehrere persönliche Gründe, die ihn von Rodolfo Pio abhielten. Zunächst fürchtete er, daß ein Krieg in Oberitalien auch die Grafschaft Santa Fiora in Mitleidenschaft ziehen könnte. Des weiteren war es in seinen Augen keine Empfehlung für diesen Kandidaten, daß er von seinen Feinden, den Kardinälen Carlo Carafa und Alessandro Farnese, so sehr begünstigt wurde. Schließlich wurde Santa Fiora durch ein Eheversprechen zwischen seinem Bruder und der Schwester Rodolfo Pios bestimmt. Da die Verhandlungen hierüber nicht recht vorangingen und beide Teile damals nicht wußten, woran man eigentlich sei, fürchtete Santa Fiora, der stolze Rodolfo Pio werde als Papst durch Zurückweisung dieses Eheplanes das Haus Santa Fiora beschimpfen 154 . Der Versuch einer plötzlichen Erhebung Rodolfo Pios konnte also keinen Erfolg haben, und man mußte sich bequemen, das Konklave in der gewöhnlichen Weise abzuhalten. Bei diesem Hin- und Herstreiten kam die Bewegung für Rodolfo Pio nicht vom Flecke; seine Siegeszuversicht schlug daher in Mutlosigkeit um, so daß er nach einigen Tagen alle weiteren Versuche aufgab und bei den Abstimmungen auffallend in den Hintergrund geriet 155 . Als nun Kardinal Este vor Rodolfo Pios Wahl sicher war, begann er sofort an die eigene Wahl zu denken. Man ließ daher am 18. September auf der Gegenseite wieder die Kandidatur Rodolfo Pios erscheinen, um so Kardinal Este zu zwingen, aus Angst vor Rodolfo Pio in Medicis oder Gonzagas Wahl einzuwilligen. Infolgedessen erhielt Rodolfo Pio mit einemmal 14 und 16 Stimmen. A m Nachmittag des 20. September glaubte man sogar, daß es mit 152
L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VII, S. 21 f. Th. Müller, Das Konklave Pius IV., S. 60; vgl. auch L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VII, S. 17. 154 Th. Müller, Das Konklave Pius IV., S. 117f. und S. 118 Fn. 2, gibt ausführlich die Motive an, die Kardinal Guido Ascanio Sforza von Santa Fiora bestimmten. 155 L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VII, S. 21 ff.; Th. Müller, Das Konklave Pius IV., S. 114. 153
I. Teil: D s Leben des Rodolfo Pio da Carpi
seiner Erhebung durch allgemeine Huldigung ernst werde; viele Kardinäle kamen, wie es schien in dieser Absicht, in der Paulinischen Kapelle zusammen. Allein auch die Gegner stellten sich ein und harrten bis in die Nacht, so daß Rodolfo Pios Aussichten wieder schwanden 156 . Bei der unversöhnlichen Hartnäckigkeit, mit der sich die beiden ungefähr gleich starken Parteien einander gegenüberstanden, schien sich die Wahl ins Unabsehbare hinausschieben zu wollen. Hinzu kam, daß die spanische Partei innerlich zerklüftet und sich über ihre Stellung zu Kardinal Ercole Gonzaga nicht im Klaren war 1 5 7 . Erst nach dessen Rücktritt war die Einheit der spanischen Partei äußerlich wiederhergestellt. A m 14. November wurde daher beschlossen, mit Rodolfo Pios Kandidatur einen erneuten Versuch zu machen. Es geschah. Aber bei den Franzosen stieß Rodolfo Pio wiederum auf so entschiedenen Widerstand, daß ihm die Kardinäle Carlo Carafa, Christoforo Madruzzo, Alessandro Farnese und Guido Ascanio Sforza von Santa Fiora am 19. November erklärten, weitere Bemühungen seien zwecklos. Rodolfo Pio nahm die Eröffnung entgegen „wie ein Heiliger"; seinetwegen, sagte er, möge man das Konklave nicht hinausziehen, er wolle der Wahl des Würdigsten nicht im Wege stehen 158 . Noch einmal streckte Rodolfo Pio jedoch seine Hand nach der dreifachen Krone aus. In der Nacht vom 14. zum 15. Dezember beschlossen die Kardinäle Farnese, Santa Fiora und Carafa, am nächsten Morgen nochmals für ihn vorzugehen. Nicht lange nachher ertönte das ganze Konklave von dem Rufe: Carpi! Carpi! und von vielen Kardinälen wurde er zum Papst ausgerufen. Doch gelang es Kardinal Este schnell genug, sich seiner Anhänger zu versichern und eine genügend große Anzahl von Kardinälen in der Sixtinischen Kapelle zu versammeln. Als die Freunde Rodolfo Pios eine so geschlossene und starke Schar von Gegnern vorfanden, gaben sie jede weitere Bemühung auf 1 5 9 . Was damals in Rodolfo Pio vorging, als er sich der höchsten Würde auf Erden so nahe sah, ist nicht bekannt. Er hatte nun jedoch den Gipfel seiner Karriere erreicht. Als amtsältester Kardinalbischof und damit Dekan des Kardinalskollegiums wurde er von allen geachtet und geehrt. Von Papst Pius IV., der am 25. 12. 1559 den Papstthron bestiegen hatte, und den Herrschern der christlichen Länder wurden ihm noch viele Privilegien verliehen. So erhielt er durch eine Bulle Pius' IV. vom 13. 1. 1563 die Erlaubnis, Juwelen, Festschmuck und auch päpstliche Paramente nach eigenem Belieben gebrauchen zu dürfen 1 6 0 .
156
L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VII, S. 24. L. ν. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VII, S. 27f. und S. 31. 158 L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VII, S. 38. 159 Th. Müller, Das Konklave Pius IV., S. 213; ebenso L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VII, S. 45. 160 Vgl. U. Fiorina, Inventario dell'archivio Falcò Pio di Savoia, S. 128 Nr. 524 (4); P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X X V I I . 157
38
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pi da Carpi
Eines der letzten Anliegen Rodolfo Pios war die Gründung des römischen Seminars. Im Herbst 1563 wurde eine Kardinalskommission dafür eingesetzt und Rodolfo Pio war „el principal dellos". Es war ihm aber nicht vergönnt, die Eröffnung des Seminars im Februar 1565 noch zu erleben 161 . Nach langer und schwerer Krankheit starb er am 2. 5. 1564 in Rom. Paolo Gualterio von Arezzo 162 schrieb in den Konsistorialakten über ihn: „Die Martis secunda Maii hora X X I I obiit Romae in aedibus Pallavicinorum in Campo Martio, quas ad vitam suam conductas tenebat, Reverendissimus D. Rodulphus Pius de Carpo, Cardinalis episcopus Ostiensis, sacri collegii Cardinalium decanus, vir magnae virtutis, doctrinae ac prudentiae ... et magnae etiam apud omnes gratiae et auctoritatis, agens annum sexagesimum quintum a 24 februarii praeteriti die citra; obiit autem ex longissima podagrarum aegritudine, quae diu illum torserat et praesertim in ultimis quatuor vitae suae mensibus, in quibus ita doloribus propter crurum et pedum eruptiones confectus et afflictus fuit, ut neque cibum sumere, neque loqui, neque dormitare unquam sine dolore potuerit, quam vitae afïlictionem Christiane tulit." Sein verdienstvolles und erfülltes Leben von 64 Jahren läßt sich kurz zusammenfassen in 36 Jahre des Episkopats, 28 Jahre des Kardinalats und die Teilnahme an vier Konklaven. Papst Pius V., der als Kardinal mit Rodolfo Pio eng befreundet w a r 1 6 3 , ließ ihm zum Angedenken sowie als Zeichen der Achtung und der Verehrung in der Kapelle San Michele in der Kirche Trinità dei Monti in Rom ein Grabmonument aus weißem Marmor von Papadopuli errichten 164 . Das eindrucksvolle und reichverzierte Grabmal, in dem der Kardinal im Alter sehr würdevoll dargestellt ist, befindet sich noch heute gegenüber von dem seiner Mutter 1 6 5 . Die in ihren Worten gewaltige Grabinschrift lautet:
161 Der Palast, in dem Rodolfo Pio gewohnt hatte, wurde nach seinem Tode für 600 Goldscudi von den Patres „ad seminarii opus" gemietet; J. Wicki, Rodolfo Pio da Carpi, in: Miscellanea Historiae Pontificiae, Vol. X X I , S. 245 ff. (260); L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VII, S. 351. 162 Zitiert nach B. Katterbach, De Cardinali Rodulpho Pio de Carpo, in: Archivum Franciscanum Historicum, 1923, S. 557; vgl. auch C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 3, S. 27 Fn. 14. — Über Paolo Gualterio von Arezzo bei H. Laemmer, Zur Kirchengeschichte des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts, S. 137 und S. 138; G. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, Bd. VII, Teil 2, S. 406. 163 P. Paschini, Art. „Pio da Carpi" in: Enciclopedia Cattolica, Bd. I X (1952), Sp. 1492. — Kardinal Antonio Michele Ghislieri wurde am 7. 1. 1566 zum Papst gewählt und am 17. 1. 1566 als Pius V. gekrönt. A m 22. 5. 1712 wurde er durch Papst Klemens XI. heiliggesprochen; vgl. H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Pius V.", S. 264f. 164 P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X X V I I . — Ein Teil des Grabmals mit der Büste Rodolfo Pios ist abgebildet bei J. Lestocquoy, Correspondance des Nonces, S. X X X I I . 165 J. Lestocquoy, Correspondance des Nonces, S. X X X V I .
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
„RODVLPHO PIO CARD. CARPEN. PRINCIPI SENAT. AMPLISSIM A ECC. D E I MVNERIBVS S I N G V L A R I PRVDENTIA PERFVNCTO IVRIS ECCLESIASTICI DEFENSORI A GRATIA TERRORE VOLVPTATV ILLECEBRIS ET ADVERSIS CASIBVS AEQVE INVICTO AD BENEFICENTIAM NATO IN SVMMA GRAVITATE IVCVNDISSIMO"165a. U m die Persönlichkeit Rodolfo Pios vollständig zu würdigen, ist es notwendig, an seine berühmte Bibliothek und sein Interesse an der Kunst zu erinnern. Als Erbe der kostbaren Büchersammlung seines Onkels, des Fürsten Alberto III., besaß Rodolfo Pio laut dem Verzeichnis, das sein Sekretär und Bibliothekar Latino Latini mit Guido Lolio und Marco Antonio Bentivoglio nach seinem Tode 1564 anfertigten, 1514 lateinische Werke, davon 195 Handschriften, und 161 griechische Codices, die teilweise einst dem Historiker Lorenzo Valla gehört hatten. Weiterhin umfaßte seine Bibliothek arabische und hebräische Werke sowie solche in Vulgare, ferner Buchdrucke von Aldo und Paolo Manuzio, die oftmals eine Widmung an den Kardinal oder seinen gelehrten Onkel enthielten 166 . Dieses große Vermögen Rodolfo Pios zu schätzen, ist unmöglich. Es mag jedoch der Hinweis genügen, daß sein Onkel Alberto III. schon 800 Goldscudi nur für den Erwerb der Bibliothek Lorenzo Vallas ausgegeben hatte; darunter befand sich auch der berühmte Codex des Vergil aus dem 5. Jahrhundert, der heute in der Biblioteca Laurenziana aufbewahrt wird 1 6 7 . Im Geiste der Renaissance liebte es Rodolfo Pio, sich mit schönen Dingen zu umgeben und in prunkvollen Palästen zu leben 168 , die er mit antiken Kunstwerken einrichtete. Sein Palast auf dem Marsfeld in Rom, seine Villa am Monte Cavallo (Quirinal) 169 mit den sogenannten Carpensischen Gärten und der von seinem i65a p ü r Mitteilung der Grabinschrift danke ich sehr herzlich Herrn Dr. HansChristoph Dittscheid von der Bibliotheca Hertziana in Rom. 166 Das „Inventario della libreria tanto latina come greca, arabica, caldea e vulgare ...", im Jahre 1564 von Guido Lolio, Latino Latini und Marco Antonio Bentivoglio zusammengestellt, befindet sich im Archivio Falcò Pio di Savoia; vgl. U. Fiorina, Inventario dell'archivio Falcò Pio di Savoia, S. 129 Nr. 526 (4-5). — Einzelheiten über die Bibliothek Rodolfo Pios auch bei G. Mercati, Appunti per la storia della biblioteca di Alberto e di Rodolfo Pio di Carpi, in: Ders., Codici latini Pico Grimani Pio ..., Studi e testi, 1975, S. 39 ff. 167 P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X X V I I ; vgl. auch H. Semper, F. Ο. Schulze, W. Barth, Carpi, ein Fürstensitz der Renaissance, S. 20. 168 Von 1537 bis 1547 bewohnte Rodolfo Pio den großen Palast Cardelli, den Papst Julius III. später zur Residenz seines Bruders umbauen und ausschmücken ließ: L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VI, S. 296; L. ν . Pastor, Die Stadt Rom zu Ende der Renaissance, S. 98 f. 169 Der Quirinal war fast ganz von Gärten, Weinbergen, Ölhainen und Landhäusern besetzt. Schon Pomponius Laetus und Piatina, der Bibliothekar Papst Sixtus' IV., hatten
40
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
Onkel Alberto III. ererbte Weinberg waren von eindrucksvoller Schönheit und der Residenz eines Herrschers würdig. Die reichen Kunstsammlungen Rodolfo Pios umfaßten außer hellenischen und römischen Statuen und Reliefs auch Kleinbronzen, Terrakotten, Vasen und anderes antikes Hausgerät sowie daneben Gemälde auf Holz und Leinwand von Raffael, Sebastiano del Piombo und Cima da Conegliano. Die kleineren Gegenstände dieser Sammlung, von der der Bolognese Ulisse Aldrovandi eine begeisterte Schilderung entwirft, befanden sich fast alle in dem Palast des Kardinals auf dem Marsfeld. Die Marmorstatuen waren fast sämtlich in der Villa untergebracht, deren prächtig geschmückte und weit ausgedehnte Gärten Aldrovandi als das Paradies auf Erden rühmte 1 7 0 . Wegen seines Kunstverständnisses war es daher wohl naheliegend, Rodolfo Pio als Mitglied der Kommission für den Bau von St. Peter auszuersehen, um dessen Vervollständigung er sich sehr bemühte. M i t Michelangelo, der ab 1546 das Amt des obersten Bauleiters von St. Peter bekleidete, war er in Freundschaft verbunden 171 . Kurz vor seinem Tode, nämlich am 24. 4. 1564, errichtete Rodolfo Pio ein Testament, in dem er seinen Vater Lionello und seinen Bruder Alberto als Universalerben einsetzte. Hinsichtlich seiner griechischen Bibliothek verfügte er, sie zur Tilgung seiner Schulden zu verkaufen, die lateinische vermachte er seinem Sekretär und Bibliothekar Latino Latini. In einem Kodizill vom folgenden Tage, dem 25. 4. 1564, schenkte er den Codex des Vergil dem Vatikan und den berühmten Kopf des Marcus Iunius Brutus dem Senat von R o m 1 7 2 . Sofort nach dem Tode Rodolfo Pios wurde im Auftrag der Kardinäle Giovanni Morone, Alessandro Farnese, Carlo Borromeo — es ist derselbe, der später heiliggesprochen wurde —, Michele Alessandrino und Guido Ascanio Sforza von Santa Fiora als Testamentsvollstrecker ein ausführliches Verzeichnis all seiner Güter, die sich in dem Palast und in der Villa befanden, angefertigt 173 . sich auf dem wegen seiner gesunden Luft geschätzten Hügel Landhäuser und Gärten angelegt, ebenso die Kardinäle Prospero Colonna und Oliviero Carafa; L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VI, S. 292. 170 L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VI, S. 292; A. Haidacher, Geschichte der Päpste in Bildern, S. 348; P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. X X X V I I I . Die Beschreibung Aldrovandis von den Carpensischen Gärten ist wiedergegeben bei P. Partner, Renaissance, Rome, 1500-1559, S. 191. 171 In einem an Rodolfo Pio gerichteten Brief vom 13.9.1560 gab Michelangelo seinem Erstaunen Ausdruck, daß selbst der Kardinal dem Gerede seiner Feinde Glauben schenke, er könne als 86jähriger seine Pflichten nicht mehr erfüllen; L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. VII, S. 611; P. G. Baroni, La nunziatura in Francia, S. XXXV. 172 U. Fiorina, Inventario dell'archivio Falcò Pio di Savoia, S. 25. — Das Testament und das Kodizill Rodolfo Pios befinden sich im Original im Archivio Falcò Pio di Savoia; vgl. U. Fiorina, Inventario dell'archivio Falcò Pio di Savoia, S. 129 Nr. 526 (3). Einzelheiten des Testamentes auch bei L.N. Cittadella, Notizie relative a Ferrara, Bd. 1, S. 551 f.
I. Teil: Das Leben des Rodolfo Pio da Carpi
Das Verzeichnis ist sachlich und ohne jede lobrednerische Absicht erstellt; es ist darin lediglich die Sorge zu spüren, von dem Gemälde des Raffael bis hin zu den unbedeutenden Dingen alles genau zu erfassen und jedem Gegenstand einen Wert zuzuordnen. Ein Porträt Rodolfo Pios, gemalt von Sebastiano del Piombo, befindet sich im Kunsthistorischen Museum in Wien 1 7 4 . Es stellt den Kardinal, bekleidet mit der Moiré-Mozzetta, im Alter von ungefähr vierzig Jahren dar. Indem Sebastiano del Piombo auf die Wiedergabe der Hände Rodolfo Pios und auch von Requisiten verzichtet, wird alle Aufmerksamkeit des Betrachters auf den Kopf des Porträtierten gelenkt. Sein Blick ist nicht auf den Betrachter, sondern in die Ferne auf ein festes Ziel gerichtet. Auf seinem Gesicht spiegeln sich Milde und Güte, ebenso aber auch Beherrschung und Willensstärke wider. Durch die Schlichtheit des Porträts wird die ungewöhnliche Ausstrahlung dieses bedeutenden Kardinals offenbar, der in seinen Werken weiterlebt.
173 Dieses Verzeichnis wird im Archivio Falcò Pio di Savoia aufbewahrt; vgl. U. Fiorina, Inventario dell'archivio Falcò Pio di Savoia, S. 129 Nr. 526 (4-5). 174 Das Bild wurde früher für ein Porträt des Kardinals Antonio Pucci gehalten, von E. Suida, Sebastiano del Piombo, in: The Art Quarterly, Vol. I X (1946), S. 283 ff., jedoch auf Grund einer bezeichneten Kopie im Kastell Pio sowie einer Medaille mit dem Porträt Rodolfo Pios im Kunsthistorischen Museum in Wien richtig identifiziert. Neuerdings vertritt M. Hirst, Sebastiano del Piombo, S. 90 Fn. 3, und ders., A book on Sebastiano del Piombo, Arte Veneta, in: Rivista di Storia dell' Arte, Annata X X X I V , S. 230, die Ansicht, das genannte Porträt stelle möglicherweise Papst Klemens VII. dar und stamme von Francesco Salviati. Dies erscheint jedoch zweifelhaft, da M. Hirst auf die überzeugenden Argumente E. Suidas nicht eingeht und sich mit diesen nicht auseinandersetzt, sondern lediglich Vermutungen äußert, ohne irgendwelche Beweise anzuführen.
II. T e i l
Die Aegidianischen Konstitutionen U m die Reform der Aegidianischen K o n s t i t u t i o n e n durch K a r d i n a l R o d o l f o Pio da Carpi sowie ihre Bedeutung für den Kirchenstaat hinreichend würdigen zu können, ist es geboten, zunächst auf die Entstehungsgeschichte u n d die E n t w i c k l u n g dieses Gesetzes einzugehen, vor allem aber a u f die Person, nach der es benannt ist, nämlich K a r d i n a l Aegidius A l b o r n o z . 1. Kardinal Aegidius Albornoz 1 7 5 und die politische Lage im Kirchenstaat zu seiner Zeit Aegidius A l b o r n o z — sein spanischer N a m e lautet G i l Alvarez de A l b o r n o z 1 7 6 — wurde u m das Jahr 1 3 0 0 1 7 7 i n Cuenca i n Neukastilien als Sohn des 175 Ausführlich hierzu A. Erler, Albornoz, S. 11 ff.; W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 45 ff.; H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 18 ff.; F. F. Jimenez, El cardenal Albornoz; ferner J. Beneyto Pérez, El cardenal Albornoz, canciller de Castilla y Caudillo de Italia; F. Filippini, I l cardinale Egidio Albornoz; E. Dupré Theseider, Art. „Albornoz", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 2 (1960), S. 45-53; L. Cardella, Memorie storiche de' cardinali, Bd. 2, S. 174ff. — Von den älteren Biographen des Albornoz seien erwähnt: J. G. Sepùlveda, De vita et rebus gestis Aegidii Albornotii Canili S. R. E. Cardinalis libri très (hierbei ist anzumerken, daß Sepùlveda, ein spanischer Theologe, lange Jahre im engen geistigen Verkehr mit Fürst Alberto III., dem Onkel Rodolfo Pios, an dessen Hof in Carpi zubrachte; so H. Semper, F. O. Schulze, W. Barth, Carpi, ein Fürstensitz der Renaissance, S. 31); F. Stefano, Historia della vita e gesti del Cardinale Egidio Albornoz; Chevalier de Lescale, La vertù resuscitée ou la vie du cardinal Albornoz surnommé père de l'Eglise; weitere Nachweise bei W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 45 Fn. 32 ff.; P. Colliva/ S. Claramunt, Catàlogo de las obras presentadas en la exposición de libros albornocianos, in: Studia Albornotiana X I I (1972), S. 723-736; F. Urgorri Casado, Las primeras biografîas espanolas del cardenal D. Gii de Albornoz, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 141-173. 176 Nach einer älteren Meinung in der Literatur lautet der spanische Name „ G i l Alvarez Carillo de Albornoz", so H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 18, C. Capasso, Art. „Albornoz", in: Enciclopedia Italiana, Bd. 2(1929), S. 211-212(211); ebenso G. M. Pouy Marti, Art. „Albornoz", in: Enciclopedia Cattolica, Bd. I (1948), Sp. 715-716 (715) und G. Mollai, Les Papes d'Avignon, S. 147. Dagegen sind A. Strnad, Besprechung Erler, Albornoz, in: Rom. Hist. Mitt. 14 (1972), S. 221-224 (222 Fn. 48), R.G. Villoslada, Besprechung Erler, Albornoz, in: Archivum Historiae Pontificiae 9 (1971), S. 446, und E. Dupré Theseider, Art. „Albornoz", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 2 (I960), S. 45-53 (45), der Ansicht, der Beiname „Carillo" beruhe auf einem Irrtum. Dies dürfte zutreffend sein. Nach S. de Μοχό, Los Albornoz. La elevación de un linaje y su expansion dominical en el siglo XIV, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 17 - 80 (39) und P. Partner, The Lands of St Peter, S. 340 Fn. 1, hatte Aegidius Albornoz einen Bruder namens Âlvar Garcia de Albornoz. Dessen Tochter, Urraca Gómez de Albornoz, heiratete
1. Albornoz und die politische Lage im Kirchenstaat
43
Garcia Älvarez de Albornoz und der Teresa de Luna geboren. Seine Familie zählte zu den edelsten und reichsten des Landes 178 . Ob Albornoz durch seinen Vater ein Nachkomme König Alfons' V. von Leon und durch seine Mutter des Königs Jakob von Aragón w a r 1 7 9 , ist allerdings nicht erwiesen 180 . Die ErzieGómez Carillo, der um 1422 lebte. Damit wurden erstmals die beiden Familiennamen Albornoz und Carillo verbunden. Zum Angedenken an die Verwandschaft mit Aegidius Albornoz und seiner angesehenen Familie nannte sich dieser Zweig sodann Carillo de Albornoz; vgl. S. de Μοχό, Los Albornoz. La elevación de un linaje y su expansion dominical en el siglo X I V , in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 17-80 (53, 62f. und 79), und L. Sierra Nava, Las memorias históricas del bibliotecario del cardenal Lorenzana sobre Gil de Albornoz (1778-1800), in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 175-211 (186). 177 So A. Erler, Albornoz, S. 11; ders. Besprechung von: El Cardenal Albornoz y el Colegio de Espana I - III. Hg. von Evelio Verdera y Tuells (Studia Albornotiana 11-13), in: Z R G (KA) 60 (1974), S. 434-437 (434); ebenso W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 45, C. G. Fürst, Besprechung Erler, Albornoz, in: Z R G (KA) 89 (1972), S. 441 f., und J.B. Villiger, Art. „Aegidius (Gii) Älvarez Albornoz", in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 1 (1957), Sp. 190, da das genaue Geburtsjahr von Albornoz nicht bekannt ist. J. Beneyto Perez, El cardenal Albornoz, S. 32, sowie F. Campo, Besprechung Erler, Albornoz, in: Estudio Augustiano 7 (1972), und F.F. Jimenez, El cardenal Albornoz, S. 6, geben 1295 als das Geburtsjahr an. Etwas ungenauer ist A. Strnad, Besprechung Erler, Albornoz, in: Rom, Hist. Mitt. 14 (1972), S. 221-224 (222), der die Meinung vertritt, Albornoz sei vor dem Jahre 1300, wahrscheinlich schon im letzten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts geboren; so auch E. Dupré Theseider, Art. „Albornoz", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 2 (1960), S. 45-53 (45). Dagegen ist H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 18, der Auffassung, Albornoz sei wohl nicht lange nach dem Jahre 1300 geboren. K. W. Nörr, Besprechung Erler, Albornoz, in: Ztschr. f. evang. Kirchenrecht 17 (1972), S. 329f., und C. Capasso, Art. „Albornoz", in: Enciclopedia Italiana, Bd. I I (1929), S. 211-212 (211), geben als Geburtszeitpunkt die ersten Jahre des 14. Jahrhunderts an. P. Coltiva, Il cardinale Albornoz, S. 2 f. Fn. 2, bezeichnet unter Hinweis auf die Forschungen von Saez und dessen Mitarbeiter von dem Istituto di storia medievale dell'Università di Barcellona das Jahr 1303 als Geburtsjahr. G. M. Pou y Marti, Art. „Albornoz", in: Enciclopedia Cattolica, Bd. I (1948), Sp. 715-716 (715), nennt 1310. L. Cardella, Memorie storiche de' cardinali, Bd. 2, S. 174 ff. (174), enthält sich jeglicher Angabe über das Geburtsjahr. 178
S. de Μοχό, Los Albornoz. La elevación de un linaje y su expansion dominical en el siglo X I V , in: Studio Albornotiana X I (1972), S. 17-80 (44). — Näheres über die Familie Albornoz bei S. de Μοχό, Lös Albornoz. La elevación de un linaje y su expansion dominical en el siglo XIV, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 17-80, und A. Boscolo, Documenti aragonesi sulla famiglia Alvarez d'Albornoz, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 81-89. 179
Vgl. G. M. Pou y Marti, Art. „Albornoz", in: Enciclopedia Cattolica, Bd. I (1948), Sp. 715-716 (715); C. Cardella, Memorie storiche de' cardinali, Bd. 2, S. 174ff. (174); H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 18. — Aus dem Adelsgeschlecht de Luna, aus dem Albornoz' Mutter entstammte, war auch Pedro de Luna, der am 28. 9. 1394 zum Nachfolger für Avignon gewählt und am 11. 10. 1394 als Papst Benedikt X I I I . gekrönt wurde. Benedikt war zunächst innerhalb der Kirche sehr erfolgreich, insbesondere wohl, weil er die profilierteste Persönlichkeit unter den Päpsten dieser Zeit war.-1409 wurde er von dem Pisaner Reformkonzil zum Gegenpapst erklärt und abgesetzt; H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Benedikt (XIII.)", S. 37f. 180 Weitere Nachweise hierzu bei W. Weber, Ecclesiae, S. 46 Fn. 37.
Die Constitutiones Sanctae Matris
44
II. Teil: Die Aegidianischen Konstitutionen
hung des jungen Albornoz leitete zunächst Pedro Egidio, Dekan des Domkapitels zu Cuenca und sodann sein Onkel aus der mütterlichen Familie, Eximinus (Jiménez) de Luna, Erzbischof von Saragossa, später von Tarragona 181 . Nach dem Studium der Rechtswissenschaft an der Universität von Toulouse, an der möglicherweise Etienne Aubert, der spätere Papst Innozenz VI., sein Lehrer w a r 1 8 2 , erwarb Albornoz dort den kanonistischen Doktorgrad. Nach Spanien zurückgekehrt, wurde er durch seinen mächtigen Onkel Eximinus de Luna, nunmehr Erzbischof von Toledo, am Hofe König Alfons' X I . von Kastilien eingeführt 183 . Schon bald genoß Albornoz in hohem Grade die Freundschaft und das Vertrauen des Königs 1 8 4 . Dies zeigt sich darin, daß er 1335 in den Kronrat aufgenommen wurde 1 8 5 . Durch den Einfluß seines Onkels Eximinus wurde Albornoz ferner Mitglied des Toledaner Kathedralkapitels sowie nach dem Ableben seines Onkels am 13. 5. 1338 Erzbischof von Toledo und als solcher Primas von Spanien und Kanzler des Königreichs Kastilien. Papst Benedikt X I I . bestätigte diesen Akt. Damit war Albornoz nach dem König die erste und einflußreichste Person des Reiches 186 . Schon zu dieser Zeit stellte Albornoz seine juristischen und gesetzgeberischen Fähigkeiten unter Beweis. Auf drei Provinzialsynoden, nämlich im Mai 1339 in Toledo sowie im April 1345 und im April 1347 in Alcalà, erließ er mehrere Konstitutionen für den Bereich des kirchlichen und des weltlichen Rechts 187 . Wie er selbst 1339 aussprach, folgte er dabei dem Leitgedanken, lieber die alten Gesetze energisch fortzuführen, als viele neue zu schaffen — ein Grundsatz, der auch in den nach ihm benannten Konstitutionen von 1357 wiederkehrt. 181
A. Erler, Albornoz, S. 11 — Eximinus de Luna war seit 5. 7. 1296 Erzbischof von Saragossa, erhielt am 26. 3. 1317 den Erzstuhl von Tarragona und am 17. 8. 1328 den von Toledo; so C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 1, S. 153, 479 und 487. 182 A. Strnad, Besprechung Erler, Albornoz, in: Rom. Hist. Mitt. 14 (1972), S. 221 -224 (222); F.F. Jimenez, El cardenal Albornoz, S. 8. — Etienne Aubert lehrte Rechtswissenschaft an der Universität von Toulouse. So war er im Jahre 1335 nach urkundlichen Zeugnissen „legum professor" zu Toulouse; vgl. hierzu E. Werunsky, Italienische Politik Papst Innocenz VI. und König Karl IV. in den Jahren 1353-1354, S. 61 und S. 61 Fn. 6; H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Innozenz VI.", S. 113. 183
Nach A. Erler, Albornoz, S. 13, findet sich 1335 das erste urkundliche Zeugnis für die Anwesenheit und für das Gewicht des Albornoz am Hofe des Königs. Unter Hinweis auf J. Beneyto Perez, El cardenal Albornoz, canciller de Castilla y Caudillo de Italia, S. 47, 48, vermutet er jedoch, daß die Wirksamkeit des Albornoz weiter zurückreicht. 184 H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 20. 185 A. Strnad, Besprechung Erler, Albornoz, in: Rom. Hist. Mitt. 14 (1972), S. 221 -224
(222).
186 Α. Erler, Albornoz, S. 12, 13; W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 46; A. Strnad, Besprechung Erler, Albornoz, in: Rom. Hist. Mitt. 14 (1972), S. 221-224 (222f.); C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 1, S. 487; H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 20. 187 A. Erler, Albornoz, S. 12; W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 46; H. J. Wurm, Cardinal Albornoz. Vgl. auch D. W. Lomax, El catecismo de Albornoz, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 213-233 (216f.).
1. Albornoz und die politische Lage im Kirchenstaat
45
Hingegen ist nicht erwiesen, ob Albornoz darüber hinaus an dem Ordeniamento von Alcalà von 1348, einem spanischen Gesetzeswerk, mitgewirkt hat. Es wird jedoch vermutet 188 . Neben den politischen und kirchlichen Aufgaben widmete sich Albornoz in besonderem Maße der Kriegsführung. Es war nämlich die Zeit, in der das christliche Spanien erbittert gegen die Mauren in Andalusien kämpfte. So begleitete Albornoz 1339 König Alfons XI. in die Schlacht von Granada. Von Papst Benedikt X I I . bald darauf zum päpstlichen Legaten ernannt 189 , nahm Albornoz 1340 erneut an einem Kreuzzug gegen die Mauren teil. Nachdem er auf dem Schlachtfeld bei Tarifa die heilige Messe gefeiert und, umgeben von seinen Priestern, die Krieger zum Kampfe ermutigt hatte, errangen die verbündeten Könige von Kastilien und Portugal am 30. 10. 1340 an dem Flusse Salado, unweit von Algeciras, jenen glänzenden und viel gerühmten Sieg über das Heer Abdul Hassans, des Königs von Marokko, und des Sultans von Granada 190 . Schon kurz darauf wurde Albornoz mit einer neuen bedeutenden Aufgabe betraut. Als Gesandter König Alfons XI. ging er 1341 zu König Philipp VI. von Frankreich, dem ersten Valois, der in Paris residierte. Albornoz' Mission, die wahrscheinlich bis August 1343 währte, war von Erfolg gekrönt: durch geschickte Unterhandlungen erwirkte er von dem französischen König die gewünschte finanzielle Unterstützung zur Fortsetzung des Krieges gegen die Mauren, wodurch im März 1344 die Einnahme der wichtigen Seestadt Algeciras ermöglicht wurde 1 9 1 . Nachdem 1344 ein Waffenstillstand mit den Mauren geschlossen war, wurde Albornoz erneut zu hohen staatlichen Missionen herangezogen. So brachte er am 1. 7. 1345 in Leon den Vertrag über die Verheiratung des Kronprinzen Pedro I., genannt der Grausame, mit Bianca von Navarra zustande, der allerdings von König Alfons XI. anfangs 1346 zugunsten einer Verbindung mit der englischen Prinzessin Johanna verworfen wurde. Da diese auf dem Wege 188
A. Erler, Albornoz, S. 12 und 14f. Während all dieser Zeit weilte Albornoz des öfteren auch an dem päpstlichen Hof zu Avignon; J. Trenchs Odena, Albornoz y Avinón: Relaciones con la Câmara Apostòlica (1325-1350), in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 263-286 (269f., 274f. und 278f.). 190 A. Erler, Albornoz, S. 13; H.J . Wurm, Cardinal Albornoz, S. 21; auch J. Gautier Dalché, A propos d'une mission en France de Gil de Albornoz: opérations navales et difficultés financières lors du siège d'Algésiras (1341-1344); in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 247-263 (249). 191 Ausführlich hierzu J. Gautier Dalché, A propos d'une mission en France de Gii de Albornoz: opérations navales et difficultés financières lors du siège d'Algésiras (13411344), in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 247-263 (250); E. Werunsky, Italienische Politik Papst Innocenz VI. und König Karl IV., S. 66 f.; H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 21. — Nach L. Cardella, Memorie storiche de' cardinali, Bd. 2 S. 176, umfaßte die Sendung des Albornoz auch den Auftrag, eine Vertiefung der Feindschaft zwischen dem französischen und dem englischen Königreich zu verhindern. 189
II. Teil: Die Aegidianischen Konstitutionen
46
nach Kastilien jedoch verstarb, kam dank der unermüdlichen Verhandlungen von Albornoz am 3. 6. 1353 doch noch die auch von dem Papst erwünschte Ehe zwischen Pedro und Bianca von Navarra zustande 192 . Der Tod König Alfons' XI. am 26. 3. 1350 bildet einen tiefen Einschnitt in dem Leben von Albornoz 1 9 3 . Da er in der Hauspolitik Alfons' X I . dessen Mätresse, dona Leonor de Guzmân, eine Persönlichkeit aus alter bedeutender Familie, unterstützt hatte 1 9 4 , lud er den Zorn des Thronerben Pedro I. auf sich. Albornoz verlor nicht nur seine Staatsämter, vielmehr suchte der junge König ihm sogar sein persönliches Eigentum zu nehmen 195 . Wohl auf Einladung Papst Klemens' VI., der am 7. 5. 1342 einstimmig zum Nachfolger Papst Benedikts X I I . gewählt worden w a r 1 9 6 , nahm Albornoz 1350 in Avignon Aufenthalt 1 9 7 . Damit beginnt sein italienischer Lebensabschnitt. Noch in demselben Jahr, am 17. 12. 1350, wurde Albornoz in den Kardinalsrang erhoben mit dem Titel von San demente in R o m 1 9 8 . Den Regeln des kanonischen Rechts entsprechend gab er daraufhin das Erzbistum Toledo auf 1 9 9 . Nachdem sich Albornoz in Avignon zunächst dem Studium des Rechts gewidmet hatte, leitete er von Dezember 1352 bis April 1353 das hohe Amt der päpstlichen Poenitentiarie 200 . Doch schon bald sah sich Albornoz vor seine eigentliche Lebensaufgabe gestellt, nämlich die Wiederherstellung des Kirchenstaates in Italien. Auf Grund des Avignonesischen Exils der Päpste, das unter Klemens V. im Jahre 1309 begonnen hatte und durch die fortwährende Residenz der Päpste in Avignon sowie deren deutliche Abhängigkeit zur französischen Politik gekennzeichnet war, begann der Kirchenstaat sich aufzulösen. Als Beute von aufsteigenden Vasallen oder benachbarten Fürsten war er in zahlreiche unabhängige Herrschaften zerfallen. Es herrschten anarchische Zustände 201 . Diese wurden 192
A. Erler, Albornoz, S. 14. König Alfons XI. starb während der Belagerung Gibraltars an der Pest; A. Erler, Albornoz, S. 15. 194 Mätressen waren im Umkreis der damaligen Fürsten nicht ungewöhnlich. Dona Leonor weilte bereits am Hofe Alfons' XI., als Albornoz' Onkel Eximinus de Luna dort als Ratgeber des Königs wirkte und seinen Neffen bei Hofe einführte. Eine moralische Einflußnahme wäre für Albornoz undenkbar gewesen, zumal der Papst selber von dona Leonor wußte und schwieg; A. Erler, Albornoz, S. 16. 195 A. Erler, Albornoz, S. 16. 196 H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Klemens VI.", S. 164ff. 197 A. Strnad, Besprechung Erler, Albornoz, in: Rom. Hist. Mitt. 14 (1972), S. 221 -224 (223); P. Partner, The Lands of St Peter, S. 340. 198 C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 1, S. 18. 199 A. Erler, Albornoz, S. 17. 200 A. Erler, Albornoz, S. 17; E. Göller, Die päpstliche Pönitentiarie, 1. Bd., 1. Teil, S. 35. 193
1. Albornoz und die politische Lage im Kirchenstaat
47
zudem durch die Ausbreitung der Pest gefördert, die aus dem Orient eingeschleppt worden war und seit 1348 nun Italien und den größten Teil Europas heimsuchte. Eine lebhafte Schilderung des Schwarzen Todes und seiner verheerenden Folgen gibt Boccaccio für Florenz in seinem Dekameron 202 . Die hauptsächlichsten Tyrannenherrschaften, die um die Mitte des 14. Jahrhunderts zur Zeit des größten Verfalls der weltlichen Macht der Kirche auf deren Gebiet bestanden, waren folgende: 1. Das Geschlecht der Prefetti di Vico beherrschte Vico, Viterbo, Orvieto, Toscanella, Corneto (das heutige Tarquinia), Civitavecchia, Rispampano, Terni, Narni, Amelia, Marta, Canina, Vetralla und Bieda, kurz den größten Teil des Patrimonium beati Petri in Tuscia und der Grafschaft Sabina; 2. die Malatesta beherrschten außer Rimini noch Fano, Pesaro, Fossombrone in der Romagna, dann in den Marken Senigallia, Ascoli, Osimo, Ancona, Jesi, Recanati und viele andere kleine Städte; 3. das Geschlecht der Montefeltro besaß Urbino samt Gebiet sowie Cagli; 4. die Familie Chiavelli herrschte in Fabriano; 5. die der Ismeducci in San Severino; 6. die Varano in Camerino; 7. die Familie da Montemilone hatte den Ort gleichen Namens und Tolentino in der Mark an sich gebracht; 8. die Familie della Cima besaß die Signorie in Cingoli; 9. die Simonetti herrschten in Jesi; 10. die Familie Malucci in Macerata; 11. die Gabrielli in Gubbio (in Umbrien); 12. die Trinci in Foligno; 13. die Ottoni in Matelica; 14. die de Mogliano in Fermo; 15. die Alidosi in Imola (in der Romagna); 16. die Manfredi in Faenza; 17. die mächtigen Ordelaffi in Forlì, Forlimpopoli, Cesena, Meldola, Bertinoro und Castrocaro; 18. die Familie Polenta in Ravenna, Cervia und Polenta 203 ; 19. die Brancaleoni waren Herrscher in dem größten Teil der Massa Trabaria; 20. die Gaetani hatten einen großen Länderbesitz in der Campania und Marittima mit dem Hauptort Sermoneta. Endlich besaßen 21. die Visconti (Erzbischof Giovanni) Bologna und Gebiet. Nur die letzteren sowie die Varano in Camerino, die Alidosi in Imola und schließlich die Markgrafen von Este als 201 H,-J.Becker, Art. „Kirchenstaat", in: HRG, Bd. 2 (1978), Sp. 824-831 (826); H. Tüchle, Art. „Kirchenstaat", in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 6 (1962), Sp. 260-265 (262f.); W. Goez, Grundzüge der Geschichte Italiens, S. 223ff.; H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Avignonesisches Exil", S. 27. 202 G. Boccaccio, Das Decameron (vor der ersten Novelle), der als Augenzeuge eine ausführliche Schilderung der Seuche gibt. Vgl. auch W. Weber, Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 44; K. Hampe, Herrschergestalten des deutschen Mittelalters, S. 260. 203 Bei Dante, Die göttliche Komödie, Hölle X X V I I , 40-45, heißt es hierzu: „Es steht Ravenna wie vor alten Zeiten Unter Polentas Adler noch, dem alten, Daß seine Schwingen sich ob Cervia breiten. Die Stadt, die lange Prüfung ausgehalten, Und dann gehäuft Franzosenleichen streute, Sieht über sich heut grüne Pranken walten." Mit der Stadt, die eine lange Prüfung ausgehalten habe, ist Forli gemeint, das von den Montefeltro aus französischer Belagerung entsetzt, jetzt von der Familie Ordelaffi, die im Wappen einen grünen Löwen auf goldenem Grunde führte, beherrscht wurde.
48
II. Teil: Die Aegidianischen Konstitutionen
Herren v o n Ferrara waren v o m Papst i n ihrer Herrschaft anerkannt u n d erfreuten
sich des Titels „päpstlicher V i k a r e " . A l l e übrigen wurden als
Usurpatoren angesehen 2 0 4 . Angesichts dieser Lage entschloß sich Papst Innozenz V I . , der nach Papst Klemens V I . a m 3 0 . 1 2 . 1 3 5 2 den Heiligen Stuhl bestiegen h a t t e 2 0 5 , den Kirchenstaat i n Italien wiederherzustellen. M i t dieser großen Aufgabe betraute er A l b o r n o z . A m 30. 6. 1353 wurde der K a r d i n a l durch eine päpstliche Bulle z u m Legaten für Italien m i t Ausnahme des Königreichs Sizilien (Neapel) sowie der Inseln Sardinien u n d Korsica ernannt u n d m i t weitgehenden Befugnissen ausgestattet 2 0 6 . Danach war er bevollmächtigt, alle Widersacher u n d Rebellen durch E x k o m m u n i k a t i o n u n d Interdikt, durch Entsetzung v o n A m t u n d W ü r d e n zu strafen, u n d zwar ohne Gültigkeit der A p p e l l a t i o n an den Heiligen Stuhl. A u c h sollten alle wie immer lautenden u n d w e m immer verliehenen päpstlichen Privilegien die freie M a c h t v o l l k o m m e n h e i t des Legaten keineswegs beeinträchtigen. I n einer zweiten Bulle v o m gleichen Tage wurde A l b o r n o z das A m t eines Generalvikars i n temporalibus i n den der römischen Kirche mittelbar oder unmittelbar unterworfenen Ländern ü b e r t r a g e n 2 0 7 . I n dieser Ermächti204
E. Werunsky, Italienische Politik Papst Innocenz VI. und König Karl IV., S. 57; H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 4f. 205 H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Innozenz VI.", S. 113. 206 Die Bulle Papst Innozenz* VI. vom 30. 6. 1353 ist abgedruckt bei A. Theiner, Codex diplomaticus, Bd. I I Nr. 242. — Als die Territorien, Gegenden und Orte, in denen Albornoz alle aus den Befugnissen eines päpstlichen Legaten fließende Amtsgewalt unbeschränkt ausüben sollte, wurden in der Bulle vom 30. 6. 1353 im Besonderen genannt: Die Lombardei, die Patriarchate von Aquileja und Grado, die Erzbistümer Mailand, Ravenna, Genua, Pisa, Spalato, Ragusa, Antivari (in Albanien) und Zara, sowie die bezüglichen Kirchenprovinzen, d. h. die diesen Erzbistümern untergebenen Suffraganbistümer, ferner die Städte und Diözesen von Pavia, Piacenza, Ferrara, Perugia, Orvieto, Trient, Rieti, Terni, Narni und Città di Castello, weiter die Provinzen von Tuscien und der Mark Treviso, und die Ländereien der römischen Kirche, nämlich die Mark Ancona, Massa Trabaria, Stadt, Diözese und Distrikt Urbino, die Romagna, das Herzogtum Spoleto, die Sabina, das Patrimonium beati Petri in Tuscia, Campania und die Marittima, sowie die dazwischen liegenden Territorien, seien sie nun der römischen Kirche mittelbar oder unmittelbar unterworfen; vgl. E. Werunsky, Italienische Politik Papst Innocenz VI. und König Karl IV., S. 67f. Fn. 4. 207 Diese zweite Bulle Papst Innozenz* VI. vom 30. 6. 1353 ist abgedruckt bei A. Theiner, Codex diplomaticus, Bd. I I Nr. 243. Ferner ist sie in Buch I Kap. 1 der Aegidianischen Konstitutionen wiedergegeben, vgl. P. Sella, Cost. I l , S. 4-7. — Während in der ersten Bulle die Legatenvollmacht, die Befugnis zur Stellvertretung des Papstes in geistlichen und weltlichen Dingen erteilt wird und in bezug auf ihre ganze territoriale Ausdehnung skizziert ist, bezieht sich die zweite ganz besonders auf die dem Legaten als Generalvikar des Papstes in temporalibus zustehende, also weltliche Gewalt in den der römischen Kirche untergebenen Gebieten: die gesamte Administration der letzteren wird ihm hier übertragen. Dies zeigt sich darin, daß in dieser zweiten Bulle hinsichtlich der Strafen für Rebellen und Feinde der Kirche nicht von Exkommunikation und Interdikt, sondern nur von „amotionis, privationis, depositionis etc. sententiae" die Rede ist. Zudem wird in der ersten Bulle nur auf päpstliche Privilegien Bezug genommen, die ungültig sein sollen, wenn sie der dem Legaten erteilten Vollmacht widersprechen; dagegen wird in der
1. Albornoz und die politische Lage im Kirchenstaat
49
gung erhielt er unter anderem die volle Jurisdiktion i n den genannten Gebieten u n d deren oberste Verwaltung. A l b o r n o z sollte dadurch die M a c h t haben, „alles ungerechter Weise i n Besitz Genommene denen, die den Besitz desselben sich anmassen, zu entreissen" 2 0 8 . M i t diesen weitgehenden Vollmachten, die das große Vertrauen des Papstes i n die Begabung, die Tatkraft u n d die Reife der Entschlüsse seines Legaten widerspiegeln, sowie m i t G e l d m i t t e l n 2 0 9 u n d einem geringen Heer ausgestattet, brach A l b o r n o z a m 13. 8. 1353 v o n A v i g n o n nach Italien a u f 2 1 0 . M i t t e September 1353 erreichte er M a i l a n d 2 1 1 . D o r t wurde er v o n dem Erzbischof G i o v a n n i Visconti, dem mächtigsten Gebieter Oberitaliens, feierlich empfangen 2 1 2 .
zweiten Bulle von solchen Privilegien nicht nur der Päpste, sondern auch der Kaiser gesprochen; vgl. E. Werunsky, Italienische Politik Papst Innocenz VI. und König Karl IV., S. 69 f. und S. 70 Fn. 1. 208 Zitiert nach E. Werunsky, Italienische Politik Papst Innocenz VI. und König Karl IV., S. 71. 209 J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, S. 94 f. U m Albornoz in den Stand zu setzen, ein so wichtiges Projekt, wie es die Unterwerfung der Tyrannen in den Territorien der Kirche war, auszuführen, befahl Papst Innozenz VI. die Erhebung des Zehnten in der ganzen christlichen Welt. Die Mächte Europas waren jedoch zu sehr in Krieg verwickelt und dadurch zu erschöpft, um den apostolischen Stuhl finanziell zu unterstützen. Deutschland allein anwortete der Aufforderung des Papstes, indem es Subsidien anstatt des Zehnten leistete. Dies war natürlich nicht ausreichend, nur eine unbedeutende Anzahl Söldner konnte mit so geringen Mitteln gewonnen werden. In Briefen vom 1. 8. 1353 empfahl daher der Papst den Legaten den Großen und Herren Italiens, dem Erzbischof Giovanni Visconti, Cangrande della Scala Herrn von Verona, den Markgrafen Aldobrandino von Este und Giovanni von Montferrat, Jacob von Savoyen, Franz und Jacob von Carrara, den Dogen Andreas Dandulo von Venedig und Giovanni de Valente von Genua, dann den Kommunen von Florenz, Pisa, Siena und Perugia, denen allen gleichlautende päpstliche Empfehlungsbriefe übersandt wurden. Sie alle sollten Albornoz bei der Ausführung seiner Mission aus Ehrfurcht vor dem apostolischen Stuhl alle Art von Hilfe und Beistand leisten sowie allen seinen Berichten unbedingten Glauben schenken; E. Werunsky, Italienische Politik Papst Innocenz VI. und König Karl IV., S. 78 f. Die vorbezeichneten Empfehlungsbriefe Papst Innozenz4 VI. sind abgedruckt bei A. Theiner, Codex diplomaticus, Bd. I I Nr. 249 und bei E. Säez und J. Trenchs Odena, Diplomatario de cardenal Gil de Albornoz, Cancilleria Pontificia (1351-1353), Nr. 421 S. 393 f. Zur Veranschaulichung sei hier angeführt, daß allein die Kriegsausgaben für die Rückeroberung des Patrimonium beati Petri und der Mark Ancona von Juni 1353 bis März 1355, d. h. während einem Jahr und zehn Monaten, laut einer kurzen Berechnung des Thesaurars Angelo Tavernini 233 000 Fiorini betrugen; so G. Gualdo, I libri delle spese di guerra del cardinale Albornoz, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 577-607 (604). Zu den Kriegsausgaben auch Κ. H. Schäfer, Die Ausgaben der Apostolischen Kammer unter Benedikt XII., Klemens VI. und Innozenz VI. (13351362), S. 573 f., 610, 612, 748. 210 A. Erler, Albornoz, S. 17; E. Dupré Theseider, Egidio de Albornoz e la riconquista dello Stato della Chiesa, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 433-459 (449). 211 E. Dupré Theseider, Egidio de Albornoz e la riconquista dello Stato della Chiesa, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 433-459 (499). 212 A. Erler, Albornoz, S. 17f.
4 Hoffmann
50
II. Teil: Die Aegidianischen Konstitutionen
V o n M a i l a n d zog A l b o r n o z über Pisa, Florenz, Siena u n d Perugia nach M o n t e f i a s c o n e 2 1 3 , das als einzige Stadt i m P a t r i m o n i u m beati Petri i n Tuscia der römischen Kirche treu geblieben w a r 2 1 4 . M i t t e Dezember 1353 langte A l b o r n o z an diesem Orte a n 2 1 5 . D a Montefiascone zudem strategisch äußerst vorteilhaft gelegen w a r 2 1 6 , schlug der Legat hier sein Hauptquartier auf für die Unternehmungen gegen den vornehmlichsten Feind, den er zu bekämpfen hatte, G i o v a n n i I I I . d i V i c o 2 1 7 . Dieser residierte i n jener Zeit i n O r v i e t o 2 1 8 u n d suchte seine Tyrannis, die ohnehin schon bis v o r die Tore Roms reichte, auch auf die ewige Stadt selbst auszudehnen 2 1 9 . 213 Hierzu das Itinerar des Legaten bei S. Claramuni / J. Trenchs, Itinerario del cardenal Albornoz en sus legaciones italianas (1353-1367), in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 369-432 (375). — Die Korrespondenz von Albornoz aus den Jahren 1353 bis 1367, beginnend am 15. 9. 1353 in Mailand, findet sich bei J. Glénisson/G. Mollai, Correspondance des Légats et Vicaires-Généraux Gil Albornoz et Androin de la Roche (1353 -1367). 214
E. Werunsky , Italienische Politik Papst Innocenz VI. und König Karl IV., S. 84 und 87f.; W. Goez, Grundzüge der Geschichte Italiens, S. 229. 215 Dies ergibt sich sowohl aus dem Itinerar des Kardinals Albornoz, S. Claramunî / J. Trenchs, Itinerario del cardenal Albornoz en sus legaciones italianas (1353-1367), in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 369-432 (372 und 375), als auch aus seiner Korrespondenz, die im November 1353 noch aus Perugia herrührt, J. Glénisson / G. Mollai, Correspondance des Légats et Vicaires-Généraux Gil Albornoz et Androin de la Roche (1353-1367), S. 18. Unzutreffend daher E. Werunsky, Italienische Politik Papst Innocenz VI. und König Karl IV., S. 87 f., der Oktober 1353 als Ankunft des Legaten in Montefiascone angibt. Vgl. hierzu auch P. Pariner, The Lands of St Peter, S. 341. 216 „Der Ort war klein, seine Befestigungen unbedeutend. Aber die ragende Lage auf der Hochebene, welche zwischen dem See von Bolsena und dem Berge von Viterbo so die Abdachung nach dem Meere gegen Toscanella, Montalto, Coraeto zu wie das Thiberthal von Orvieto und von der Mündung der Chiana bis zur Grenze der römischen Campagna beherrscht, dabei die offene Verbindung mit Toscana machten das Städtchen zum sichern Mittelpunkt politisch-militärischer Unternehmungen"; zitiert nach E. Werunsky, Italienische Politik Papst Innocenz VI. und König Karl IV., S. 88. 217
Das mächtige Geschlecht der Prefetti di Vico war im Norden von Rom ansässig, benannt nach dem Ort dieses Namens, der gegen 37 Miglien von Rom hinter Ronciglione liegt. Der Präfekt der Stadt übte bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts den Blutbann in Rom aus. Mit der Entwicklung der städtischen Freiheit ging jedoch auch diese Gerichtsbarkeit an den Senat über, und der Titel des Präfekten wurde ein leerer Name. Seit Mitte des 13. Jahrhunderts war die Würde in dem Geschlechte derer von Vico erblich, welche aus Viterbo stammten. Der Gründer der Macht des Hauses war Pietro di Vico, ein eifriger Ghibelline zu den Zeiten Konradins, durch Wildheit und Grausamkeit berüchtigt. Gleichen Sinnes waren seine Nachkommen, Raubritter der wildesten Art, die von ihrem Wohnsitz, in Vico, aus sich der tuscischen Besitzungen der römischen Kirche zu bemächtigen suchten. Giovanni di Vico brachte die Macht des Hauses auf den höchsten Punkt; durch Ermordung seines illegitimen Bruders Faziolo (1338) bahnte er sich den Weg zur Gewaltherrschaft über Viterbo, die er 1343 an sich riß, eroberte dann auch Vetralla, Bieda, Rispampani und andere Orte; E. Werunsky, Italienische Politik Papst Innocenz VI. und König Karl IV., S. 54f. Fn. 2; A. Erler, Albornoz, S. 18. 218
A. Erler, Albornoz, S. 18. Dies ist einem Briefe Papst Innozenz' VI. vom 25. 8. 1353 zu entnehmen, in dem er den Römern die Sendung des Kardinals Albornoz meldet. Dieser Brief ist abgedruckt bei A. Theiner, Codex diplomaticus, Bd. I I Nr. 254. 219
1. Albornoz und die politische Lage im Kirchenstaat
51
Albornoz begann mit Verhandlungen. Diese schienen zunächst auch von Erfolg gekrönt, denn Giovanni di Vico versprach dem Kardinal, dem päpstlichen Befehl zu gehorchen und alle Städte und Burgen zurückzugeben, die er der Kirche entrissen hatte. Da sich der Präfekt jedoch plötzlich weigerte, der Aufforderung des Legaten, nach Montefiascone zu kommen, Folge zu leisten, scheiterten die Friedensverhandlungen. Giovanni di Vico widerrief daraufhin alle seine Versprechungen, die er offensichtlich nur zum Schein abgegeben hatte, um Albornoz in Sicherheit zu wiegen. Diese Treulosigkeit des Präfekten war der Grund des nun ausbrechenden Krieges 220 . A m 10. 3. 1354 begann Albornoz seine Offensive gegen Giovanni di Vico und unternahm den Angriff auf die Stadt Orvieto. Nachdem der Legat das in der Nähe von Orvieto gelegene Kloster San Lorenzo delle Donne genommen hatte, gelang ihm noch in demselben Monat die erste wichtige Eroberung, nämlich die von Toscanella. Dort setzte er den vormaligen Tribun von Rom, Niccolò di Lorenzo, genannt Cola di Rienzo 221 , als Stellvertreter ein 2 2 2 . Giovanni di Vico geriet zusehends in Bedrängnis. Hinzu kam, daß sich die Römer, die mit geradezu enthusiastischer Zuneigung an Cola di Rienzo hingen, dem Papst unterwarfen und Albornoz in dem Kampf gegen den Präfekten unterstützten 223 . Da sein Fall unaufhaltbar war, gab Giovanni di Vico im Juni 1354 auf. In dem am 5. 6. 1354 zu Montefiascone abgeschlossenen Vertrag erkannte der Präfekt die Oberhoheit der römischen Kirche des Papstes über Viterbo und Corneto an. Vetralla durfte der Präfekt behalten, allerdings wurde dem Papst ein Optionsrecht hierauf gegen Zahlung von 16 000 Goldgulden eingeräumt. Als Sicherheit für die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages mußte Giovanni di Vico seinen legitimen Sohn Battista als Geisel stellen 224 . A m 10. 6. 1354 verzichtete der Präfekt außerdem für immer und unwiderruflich auf seine Rechte über Orvieto zugunsten der römischen Kirche 2 2 5 . Im Triumph und unter den großen Freudenbezeugungen der Bürger zog Albornoz daraufhin gemeinsam mit Giovanni di Vico in Orvieto ein 2 2 6 . In demselben Monat Juni 1354 gelang es Albornoz ferner, den Beherrscher von Gubbio in Umbrien zu unterwerfen und diese Stadt samt Gebiet wieder 220
Ausführlich hierzu A. Erler, Albornoz, S. 18f.; auch E. Werunsky, Italienische Politik Papst Innocenz VI. und König Karl IV., S. 94ff.; H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 46ff. 221 Näheres über Cola di Rienzo bei W. Goez, Grundzüge der Geschichte Italiens, S. 228 f., und P. Partner, The Lands of St Peter, S. 332ff. 222 A. Erler, Albornoz, S. 19; E. Werunsky, Italienische Politik Papst Innocenz VI. und König Karl IV., S. 107. 223 E. Werunsky, Italienische Politik Papst Innocenz VI. und König Karl IV., S. 109ff. 224 Einzelheiten des Vertrages vom 5. 6. 1354 bei A. Theiner, Codex diplomaticus, Bd. I I Nr. 267. 225 A. Theiner, Codex diplomaticus, Bd. I I Nr. 268. 226 A. Erler, Albornoz, S. 19; E. Werunsky, Italienische Politik Papst Innocenz VI. und König Karl IV., S. 119. 4*
52
II. Teil: Die Aegidianischen Konstitutionen
unter die Oberhoheit der römischen Kirche zu bringen. Ebenso gelang i h m ohne Schwierigkeiten i m Februar 1355 die Unterwerfung des Herzogtums S p o l e t o 2 2 7 . Jene bedeutenden Ergebnisse erlaubten es A l b o r n o z , sich n u n der M a r k Ancona, einem der Kerngebiete des Kirchenstaates, zuzuwenden. Diese sollte zunächst den Malatesta v o n R i m i n i entrissen w e r d e n 2 2 8 . N a c h langen Kämpfen, die m i t dem Beginn des Jahres 1355 ihren A n f a n g genommen h a t t e n 2 2 9 , wurde a m 2. 6. 1355 i n G u b b i o ein Vertrag zwischen den Malatesta u n d A l b o r n o z geschlossen, durch den erstere alle ihre Städte, Burgen, Festungen u n d Ortschaften i n der M a r k Ancona, Romagna u n d Massa Trabaria unter die päpstliche Oberherrschaft zurückstellten 2 3 0 . A l s Anerkennung dieser Erfolge wurde A l b o r n o z Ende 1355 v o n Papst Innozenz V I . z u m Bischof des suburbikarischen Bistums der Sabina erhoben. Hierdurch rückte der Legat i n die Reihe der Kardinalbischöfe a u f 2 3 1 . Das genaue D a t u m seiner Ernennung ist nicht bekannt. Während A l b o r n o z am 8. 12. 1355 noch Kardinalpriester v o n San d e m e n t e genannt wird, führt er 227 E. Werunsky, Italienische Politik Papst Innocenz VI. und König Karl IV., S. 127 und 129; E. Dupré Theseider, Egidio de Albornoz e la riconquista dello Stato della Chiesa, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 433-459 (451). 228 Näheres bei J.F. Leonhard, Die Seestadt Ancona im Spätmittelalter, S. 212ff.; P.J. Jones, The Malatesta of Rimini and the Papal State, S. 73 ff.; H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 71 ff. Weiterführend E. Saracco Previdi, L'Albornoz e Macerata. Un esempio della politica albornoziana nelle Marche, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 635-648 (639 ff.) und G. Franceschini, Il cardinal legato Egidio d'Albornoz e i conti Montefeltro, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 649-680. 229 H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 75. — Da Papst Innozenz VI. mit zwei Erlassen vom 31. 1. 1355 (abgedruckt bei A. Theiner, Codex diplomaticus, Bd. I I Nr. 288 und 289) Albornoz und den Kardinalbischof von Ostia um den Vollzug der Kaiserkrönung Karls IV. ersucht hatte, erhebt sich die Frage, ob der Legat wirklich am 5. 4. 1355 die Kaiserkrönung in Rom vollzogen und damit den Kriegsschauplatz in der Mark Ancona verlassen hat. Entgegen F. F. Jimenez, El cardenal Albornoz, S. 23, wird dies von A. Erler, Albornoz, S. 22ff., unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte zutreffend verneint. Bestätigt wird dies zudem durch das Itinerar von Albornoz, nach dem der Legat zur Zeit der Kaiserkrönung in Foligno weilte; so S. Claramunt/ J. Trenchs, Itinerario del cardenal Albornoz en sus legaciones italianas (1353-1367), in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 367-432 (381). Dementsprechend heißt es bei K. Hampe, Herrschergestalten des deutschen Mittelalters, S. 279, auch lediglich, daß die Kaiserkrönung von einem bevollmächtigten Kardinal vollzogen wurde. Ebenso R. Schneider, Karl IV. (1346-1378), in: Kaisergestalten des Mittelalters, S. 257-276 (265). 230 Einzelheiten des Vertrages vom 2. 6. 1355 bei A. Theiner, Codex diplomaticus, Bd. I I Nr. 303; vgl. auch H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 87ff.; J.F. Leonhard, Die Seestadt Ancona im Spätmittelalter, S. 218 und P.J. Jones, The Malatesta of Rimini and the Papal State, S. 76 f. 231 A. Erler, Albornoz, S. 17. — Sein Vorgänger war daselbst Kardinal Bertrand de Deux, der am 21. 10. 1355 verstorben war; C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 1, S. 16. Von ihm rühren einige Konstitutionen her, die Albornoz sodann in sein Gesetzeswerk von 1357 für den Kirchenstaat übernommen hat; so A. Diviziani, Fonti delle costituzioni egidiane. Le costituzioni di Bertrando de Deuc del 1336 per la Marca di Ancona e per il Ducato di Spoleto, S. X I I ff.
1. Albornoz und die politische Lage im Kirchenstaat
53
bereits am 4. 1. 1356 den neuen Titel „episcopus Sabinensis" 232 . In späteren Quellen und Glossen wird er oftmals auch „dominus Sabinensis" genannt 233 . Nach der Unterwerfung der Mark Ancona beschloß Albornoz, mit seinem Heer in die Romagna einzurücken, um die Manfredi und Ordelaffi zu bekriegen. Die weiteren Einzelheiten in dem politischen und kriegerischen Ringen des Legaten würden den Rahmen dieser Arbeit sprengen 234 . Es ist jedoch zu erwähnen, daß die beiden Brüder Bernardin und Guido von Polenta, Signoren von Ravenna und Cervia, im Frühjahr 1356 mit der Kirche Frieden schlossen235. Die Manfredi gaben nach schweren Kämpfen im Herbst 1356 ihren Widerstand auf. Zudem war mit Recht anzunehmen, daß auch Francesco Ordelaffi, der letzte von den Tyrannen des Kirchenstaates, sich bald der Kirche werde beugen müssen 236 . Albornoz hatte somit im Jahre 1357 den weitaus größten Teil des Kirchenstaates wieder unter päpstliche Herrschaft gebracht. Überall dort, wo er im ersten Anlauf eine funktionsfähige Verwaltung der Kurie nicht einrichten konnte, hatte er die örtlichen Signorien zu Vikaren der römischen Kirche ernannt. Auf diese Weise konnten alle alten Ansprüche gewahrt und neue Übergriffe eingedämmt werden 237 . Besonders schwierig gestalteten sich allerdings noch die Auseinandersetzungen um den Besitz an Bologna. Papst Innozenz VI., der gegen den entschiedenen Rat von Albornoz eine friedliche Verständigung mit Bernarbò Visconti suchte 238 , schickte zu diesem 232
A. Theiner, Codex diplomaticus, Bd. I I Nr. 317 und 318. Unzutreffend daher E. Dupré Theseider, Art. „Albornoz", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 2 (I960), S. 45-53 (45), der Dezember 1356 als Zeitpunkt der Ernennung Albornoz' zum Kardinal angibt. 233 A. Erler, Albornoz, S. 17. 234 Ausführlich hierzu H. J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 99 ff.; F. Filippini, I l cardinale Egidio Albornoz, S. llOff. 235 H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 105. 236 H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 112f. 237 W. Goez, Grundzüge der Geschichte Italiens, S. 230; W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 28; vgl. auch S. Sugenheim, Geschichte der Entstehung und Ausbildung des Kirchenstaates, S. 276. 238 Papst Klemens VI. hatte Bologna am 28. 4. 1352 dem Erzbischof Giovanni Visconti von Mailand unter dem Titel eines päpstlichen Vikars überlassen. Nach dessen Tod am 5. 10. 1354 fiel die Stadt zunächst an Matteo und nach dessen Tod an Bernarbò Visconti. A m 17. 4. 1355 erklärte sich jedoch Giovanni da Oleggio zum Selbstherrscher Bolognas. Bernarbò Visconti, der keineswegs gewillt war, auf die Stadt zu verzichten, zettelte mehrere Verschwörungen gegen die Herrschaft Oleggios an. Dieser trat deshalb mit Albornoz in Verbindung, um Bologna der unmittelbaren Herrschaft der Kirche zurückzustellen. Bernarbò Visconti, der von diesen Verhandlungen Kenntnis erhalten hatte und natürlich das Vikariat über Bologna erhalten wollte, suchte nun wieder Annäherung an den Papst; so H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 145ff.; P.Partner, The Lands of St Peter, S. 346.
54
II. Teil: Die Aegidianischen Konstitutionen
Zweck am 28. 2. 1357 einen zweiten Gesandten nach Italien, Androin de la Roche, Abt von Cluny. A m 1. 4. 1357 traf Albornoz in Faenza mit Androin zusammen und erfuhr hier von dessen konkurrierender Mission. Hierüber erbittert, ersuchte Albornoz den Papst um seine Rückberufung nach Avignon. Innozenz VI. nahm das Gesuch sofort an, bat den Kardinal aber, bis zur vollständigen Einarbeitung von Androin de la Roche in Italien zu verbleiben 239 . U m vor seiner Abreise die innere Ordnung und Sicherheit in den zurückeroberten Gebieten des Kirchenstaates sicherzustellen, rief Albornoz auf den 29. 4. 1357 in Fano ein allgemeines Parlament — generale parlamentum — zusammen, auf dem die nach ihm benannten Konstitutionen verkündet wurden 2 4 0 . Dieses bedeutende Gesetzeswerk wird weiter unten noch ausführlich behandelt. Kurze Zeit nach dem Parlament in Fano trat Albornoz seine Rückreise nach Avignon an. A m 23, 10. 1357 traf er am päpstlichen Hof ein 2 4 1 . Der Kardinal gönnte sich jedoch auch jetzt keine Ruhe. Wie schon 1350 übernahm Albornoz von November 1357 bis Oktober 1358 wiederum das Amt des Großpönitentiars 2 4 2 . Aber schon bald war seine erneute Anwesenheit in Italien erforderlich. Die Mission des Androin de la Roche war nämlich gescheitert. M i t einer Bulle vom 18. 9. 1358 wurde Albornoz daher in seine alten Rechte wieder eingesetzt 243 . A m 6. 10. 1358 brach der Kardinal zum zweiten Mal nach Italien auf 2 4 4 . Zunächst setzte er den Kampf gegen Francesco Ordelaffi fort, nachdem Androin de la Roche dem energischen Widerstand dieses Tyrannen von Forli nicht gewachsen war und daher Ende 1357 die Belagerung Forlis aufgegeben hatte. Im Juli 1359 fiel die Stadt. Damit hatte der lange und hartnäckige Krieg gegen Francesco Ordelaffi sein Ende erreicht 245 .
239 A. Erler, Albornoz, S. 19 f.; E. Dupré Theseider, Egidio de Albornoz e la riconquista dello Stato della Chiesa, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 433-459 (452f.); J. Glènisson / G. Mollai, Correspondance des Légats et Vicaires-Généraux Gil Albornoz et Androin de la Roche (1353-1367), S. 129 Fn. 1. 240 Während die Versammlung in Fano tagte, brach in Cesena ein Aufstand aus. Einige Bürger der Stadt bemächtigten sich der Stadttore und ließen die päpstlichen Truppen ein, die in kurzer Zeit die Unterstadt nahmen. A m 27. 5. 1357 ergab sich auch die Oberstadt von Cesena; so A. Erler, Albornoz, S. 20; H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 117ff. 241
S. Claramunt IJ. Trenchs, Itinerario del cardenal Albornoz en sus legaciones italianas (1353-1367), in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 369-432 (388ff.). 242 A. Erler, Albornoz, S. 20; E. Göller, Die päpstliche Pönitentiarie, 1. Bd., 1 Teil, S. 91; E. Dupré Theseider, Egidio de Albornoz e la riconquista dello Stato della Chiesa, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 433-459 (453). 243 A. Erler, Albornoz, S. 20. 244 A. Erler, Albornoz, S. 20. 245 Näheres hierüber bei H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 129ff.; P. Partner, The Lands of St Peter, S. 349.
1. Albornoz und die politische Lage im Kirchenstaat
55
Das vornehmlichste Problem war jedoch weiterhin Bologna. Die bisherige Politik des Papstes gegenüber Bernarbò Visconti wurde nun aufgegeben. Als Giovanni da Oleggio, der in Bologna herrschte, den schweren Angriffen des Visconti auf die Stadt nicht länger standhalten konnte, Schloß er in den ersten Tagen des März 1360 mit Albornoz einen Vertrag und übergab Bologna mit seinem Gebiet der Kirche 2 4 6 . Damit begann ein jahrelanger, unerbittlicher Krieg, in dem Bernarbò Visconti der Kirche Bologna zu entreißen suchte. Nach ununterbrochenen und zermürbenden Kämpfen kam am 3. 3. 1364 der langersehnte Friede zustande: Der Visconti verzichtete gegen Zahlung von 500 000 Gulden auf die Stadt und das Gebiet von Bologna 247 . Da die päpstliche Oberherrschaft in allen Gebieten des Kirchenstaates nunmehr wieder anerkannt wurde und Albornoz somit seine Aufgabe in Italien vollendet hatte, ersuchte er im März 1364 Papst Urban V., der am 6. 11. 1362 als Nachfolger von Papst Innozenz VI. den Papstthron bestiegen hatte 2 4 8 , um seine Erlaubnis zur Rückkehr nach Avignon 2 4 9 . Der Papst lehnte diese Bitte seines Legaten jedoch mit Schreiben vom 13. 4. 1364 250 ab, da der Frieden wegen erneuter Unruhen in den zurückeroberten Gebieten noch der Festigung bedürfe, ehe der Kardinal nach Avignon zurückkehren könne. Zugleich ernannte er Albornoz zum päpstlichen Legaten im Königreich Sizilien diesseits und jenseits der Meerenge, über das die Kirche die Oberhoheit hatte 2 5 1 . Im Frühjahr 1367 war die Unterwerfung des gesamten Kirchenstaates glücklich vollendet 252 . Papst Urban V. verschloß daher sein Ohr dem immer stürmischeren Drängen nicht, das ihn durch die Feder Petrarcas vor die Frage stellte, ob er die kurze Spanne seiner Lebenszeit lieber im Sündenpfuhl Avignons verharren oder sich nach Rom, das vom Blute und den Gebeinen der Märtyrer erfüllt sei, zurückwenden wolle 2 5 3 . A m 30. 4. 1367 brach Urban V. von Avignon auf und erreichte auf dem Seeweg am 3. 6. 1367 Corneto, das heutige Tarquinia. Hier trat der nunmehr 67jährige Albornoz seinem Papst kniefällig entgegen 254 . Dem Kardinal war es jedoch nicht vergönnt, den größten Triumph seines Wirkens zu erleben und Papst Urban nach Rom zu geleiten: A m 23. 8. 1367, nur wenige Wochen nach der Landung des Papstes in Corneto, starb Albornoz in Castel Belriposo bei Viterbo 2 5 5 . 246 Α. Erler, Albornoz, S. 20; H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 144ff. und 149; F. Filippini, Il cardinale Egidio Albornoz, S. 205 ff. 247 Ausführlich hierzu J.H. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 151 ff. 248 H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Urban V.", S. 316. 249 H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 192. 250 Dieses Schreiben des Papstes vom 13. 4. 1364 ist abgedruckt bei A. Theiner, Codex diplomaticus, Bd. I I Nr. 389; vgl. auch H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 192ff. 251 Näheres über diese Legation bei F. Filippini, I l cardinale Egidio Albornoz, S. 375 ff.; H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 198ff. 252 A. Erler, Albornoz, S. 21. 253 K. Hampe, Herrschergestalten des deutschen Mittelalters, S. 281. 254 A. Erler, Albornoz, S. 21.
56
II. Teil: Die Aegidianischen Konstitutionen
Zwei Monate später, am 16. 10. 1367, zog Papst Urban V. sodann unter dem Jubel der Einwohner in Rom ein 2 5 6 . Albornoz' Leichnam wurde in der Kirche San Francesco zu Assisi in der Kapelle der Heiligen Katharina beigesetzt. Doch schon 1372 wurde sein Körper gemäß testamentarischer Verfügung des verstorbenen Kardinals in die Kapelle des Heiligen Ildefons in der Kathedrale zu Toledo überführt. Dort ruht er noch heute in einem reichgeschmückten Sarkophag an der Seite seiner Vorgänger und Nachfolger in der spanischen Primatenwürde 257 . U m die Vielseitigkeit von Albornoz hinreichend zu würdigen, ist zu erwähnen, daß er sich in besonderem Maße den religiösen Orden widmete 258 . Er war Kardinalprotektor des Ordens der „Fratrum Servorum beatae Mariae Virginis" 2 5 9 . Vor allem aber unterstützte er den Franziskanerorden. Seine Verbundenheit mit dieser Glaubensgemeinschaft zeigt sich vornehmlich in seinem letzten Willen vom 29. 9. 1364, in dem er bestimmte, zunächst in der Kirche San Francesco zu Assisi beigesetzt zu werden 260 . Von der großen, machtvollen Herrscherpersönlichkeit des Albornoz künden nicht nur sein Gesetzeswerk, die „Constitutiones Aegidianae". Auch das von ihm selbst gegründete und noch heute an der von ihm erwählten Stelle befindliche Kolleg der Spanischen Nation an der Universität Bologna, das er in seinem letzten Willen vom 29. 9. 1364 stiftete und reich dotierte, um jungen Spaniern die Möglichkeit zu geben, ihr Rechtsstudium an einer der angesehensten Hohen Schulen zu vollenden, bezeugt das Interesse dieses Mannes für die 255 So zutreffend A. Erler, Albornoz, S. 21; ebenso F.F. Jimenez, El cardenal Albornoz, S. 29, und B. Guillemain, La Sacré Collège au temps du cardinal Albornoz (13501367), in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 355-368 (364). Unrichtig dagegen Λ. Strnad, Besprechung Erler, Albornoz, in: Rom. Hist. Mitt. 14 (1972), S. 221 -224 (224), der unter Hinweis auf E. Dupré Theseider, Art. „Albornoz", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 2 (1960), S. 45-53 (51), das Bollwerk „Bùonriposo" als Sterbeort von Albornoz angibt. In dieser Literaturstelle von E. Dupré Theseider handelt es sich wohl um ein Versehen, da es bei E. Dupré Theseider, Egidio de Albornoz e la riconquista dello Stato della Chiesa, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 433-459 (458) ebenfalls „Belriposo" heißt. 256
A. Erler, Albornoz, S. 22. Α. Erler, Albornoz, S. 22; A. Strnad, Besprechung Erler, Albornoz, in: Rom. Hist. Mitt. 14 (1972), S. 221 -224 (224). — Abbildung der Tomba des Albornoz bei F. Filippini, I l cardinale Egidio Albornoz, S. 449. Ein Gips-Abguß nach seiner Grabplatte in der Kathedrale zu Toledo befindet sich im Papst-Palast zu Avignon. Hierauf hat mich Herr Prof. Dr. Dr. Adalbert Erler freundlicherweise aufmerksam gemacht. Ein Porträt des Kardinals ist auf dem Schutzumschlag des Werkes von A. Erler, Albornoz, abgebildet. 257
258
C. Piana, Il cardinale Albornoz e gli Ordini religiosi, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 481-519 (517ff.). 259 C. Piana, I l cardinale Albornoz e gli Ordini religiosi, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 481-519 (483). 260 C. Piana, Il cardinale Albornoz e gli Ordini religiosi, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 481-519 (483, 509f.).
2. Aegidius Albornoz und Rodolfo Pio da Carpi — ein Vergleich
57
Pflege und Förderung der Wissenschaft 261 . Es kann sich daher zu Recht rühmen, das älteste Kolleg seiner Art in Europa zu sein 262 . Das Interesse von Albornoz an der Wissenschaft zeigt sich aber auch darin, daß er — selbst während der kriegerischen Auseinandersetzungen — eine bedeutende, zumal an wertvollen juristischen Handschriften reiche, Bibliothek sammelte 263 . 2. Aegidius Albornoz und Rodolfo Pio da Carpi — Ein Vergleich beider Persönlichkeiten Obwohl Rodolfo Pio da Carpi ungefähr 200 Jahre nach Aegidius Albornoz lebte, zeigen sich in ihrer Vita erstaunlich viele Parallelen. Man kann sogar fast sagen, daß ihre Lebensläufe oftmals zum Verwechseln ähnlich sind. Sowohl Aegidius Albornoz als auch Rodolfo Pio da Carpi entstammen einem alten Adelsgeschlecht mit machtvollen und einflußreichen Verbindungen, die ihnen im späteren Leben häufig nützlich waren. Beide wurden jeweils durch den Onkel in frühen Jahren für die kirchliche Laufbahn bestimmt. Sowohl Aegidius Albornoz als auch Rodolfo Pio waren ihren Päpsten treu ergeben und erhielten im Dienst der Kirche hohe Würden. Ferner verfügten beide in gleichem Maße über ein außergewöhnliches diplomatisches Geschick und weilten jeweils als Gesandter am Hof des französischen Königs. Auch widmeten sich beide mit Eifer den kirchlichen Aufgaben. So hielt Albornoz mehrere Provinzialsynoden ab, Rodolfo Pio seine berühmte Diözesansynode in Faenza. Weiterhin war den beiden Kirchenfürsten gemeinsam, daß sie verschiedene religiöse Orden unterstützten, vornehmlich den der Franziskaner. Darüber hinaus pflegten beide geistige Interessen und waren jeweils Besitzer einer erlesenen Bibliothek. Ferner waren sie ein Freund und Förderer der Wissenschaften. So gründete Albornoz das Spanische und Rodolfo Pio das Deutsche Kolleg in Rom. Ein Unterschied zwischen diesen beiden Persönlichkeiten besteht allerdings darin, daß Albornoz im Kriegswesen erfahren war und an Feldzügen zur Wiederherstellung des Kirchenstaates teilnahm. 261 Das testamentarisch gestiftete Kolleg wurde fünf Jahre nach dem Tode von Albornoz nach den Plänen des Matteo Gattaponi da Gubbio erbaut, des Vertrauensarchitekten des Kardinals. Es ist im wesentlichen noch das heutige Gebäude in der Via Collegio di Spagna 4. Ein Bild von dem stimmungsreichen Innenhof des Spanischen Kollegs in Bologna geht Band X I I (1972) der Studia Albornotiana voraus; vgl. A. Erler, Besprechung von: El Cardenal Albornoz y el Colegio de Espana I - III, Hg. von Evelio Verdera y Tuells (Studia Albornotiana X I - X I I I ) , in: ZRG (KA) 60 (1974), S. 434-437 (434 f.). — Band X I I (1972) der Studia Albornotiana ist völlig dem Spanischen Kolleg gewidmet. Näheres über das Kolleg aber auch bei J. Beneyto, Albornoz, fundador, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 199-211 (204ff.). 262 A. Erler, Albornoz, S. 21; A. Strnad, Besprechung Erler, Albornoz, in: Rom. Hist. Mitt. 14 (1972), S. 221-224 (224). 263 S. Sugenheim, Geschichte der Entstehung und Ausbildung des Kirchenstaates, S. 294 f.
58
II. Teil: Die Aegidianischen Konstitutionen
Auch wenn Rodolfo Pio in der Schlacht von Parma im Jahre 1551 das Amt eines Feldkommissars ausgeübt haben soll 2 6 4 , so war er doch weitaus weniger als Albornoz mit Kriegsangelegenheiten befaßt. Durch die ungewöhnliche Verbindung von diplomatischen und administrativen Talenten haben sowohl Aegidius Albornoz als auch Rodolfo Pio da Carpi Großes vollbracht. Ihre juristischen Fähigkeiten haben beide an dem einen Gesetzeswerk unter Beweis gestellt, den Aegidianischen Konstitutionen. 3. Die Entstehung der Aegidianischen Konstitutionen und ihre Verkündung auf dem parlamentum generale zu Fano im Jahre 1357 Die Aegidianischen Konstitutionen von 1357 sind das Gesetzgebungswerk des Kardinals Aegidius Albornoz, durch das die innere Sicherheit und Ordnung in den wiedereroberten Gebieten des Kirchenstaates auf Dauer sichergestellt werden sollten. Der offizielle Titel dieses Gesetzbuches lautet „Liber Constitutionum Sanctae Matris Ecclesiae" 265 . Später wurde es oftmals auch nur „Constitutiones Aegidianae" genannt 266 . Dieses Gesetzgebungswerk des Kardinals war um so notwendiger, als es zu dieser Zeit kein einheitliches Gesetzbuch für alle Provinzen des Kirchenstaates gab 2 6 7 . Die vielen unterschiedlichen Statuten der Städte, die Gewohnheitsrechte der einzelnen Landesteile sowie die zahlreichen Erlasse der Päpste, Legaten und Rektoren, die oftmals durch spätere Erlasse wieder aufgehoben oder abgeändert wurden 2 6 8 , hatten eine unübersichtliche und verwirrende Rechtslage geschaffen, so daß eine einheitliche Verwaltung und Rechtspflege unmöglich war 2 6 9 .
264 A. Biondi, Alberto Pio nella pubblicistica del suo tempo, in: Società, politica e cultura a Carpi ai tempi di Alberto I I I Pio, S. 95 ff. (128 f.). 265 A. Erler, Albornoz, S. 27; über die Vorarbeiten hierzu, insbesondere über das parlamentum generale zu Montefiascone von 1354, A. Erler, Albornoz, S. 28 f. 266 ψ Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 49, mit Hinweis auf den 1576 in Venedig erschienenen Kommentar des Virginius Boccatius a Cingulo zu Const. Aeg. V 25 ( = V 12 in der Fassung von 1357), der den Titel „Constitutionum Aegidianarum seu Marchiae Anconitanae, Cap. Vt minorum, XXV. lib. V dilucida Commentarla in decern Glossas digesta, continentia quaestiones utiles in praxi et theorica, quae versa pagina indicantur. A Verginio de Boccatiis a Cingulo, Iurisconsul. Clarissimo, et in Romana Curia causarum Patrono, nunc primum in lucem edita". 267
Α. Erler, Albornoz, S. 27; W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae,
S. 49; 268
So hatte Papst BonifazVIII. zur Regelung der Gerichtsverfassung und des Appellationsverfahrens drei wichtige Gesetze erlassen: „Romana mater ecclesie" (1295) für die Campania und Marittima, „Licet merum" (1300) für das Patrimonium beati Petri in Tuscia und „Celestis patris familias" (1303) für die Mark Ancona. Die letzte wurde bereits nach wenigen Monaten mit der Begründung, daß sie ohne Rat der Kardinäle erlassen worden sei, von Papst Benedikt XI., der am 22. 10.1303 zum Nachfolger von
3. Entstehung und Verkündung der Aegidianischen Konstitutionen
59
Zwar hatte der Neffe von Papst Johannes XXII., Bertrand de Deux, Erzbischof von Embrun und später Kardinalbischof der Sabina 270 , im Jahre 1336 den Versuch unternommen, allgemeine und einheitliche Statuten zu erlassen. Doch schon 1337 wurden sie von Canhardo de Sabaltrano, dem damaligen Rektor der Mark Ancona, als „pro magna parte non utilia, sed nociva" bezeichnet271. Albornoz sah sich daher zwanzig Jahre später vor die Aufgabe gestellt, den überkommenen und geltenden Rechtszustand zunächst genau zu überprüfen. Bei vielen Verordnungen der Legaten und Rektoren war es nämlich ungewiß, ob und in welchem Umfang sie noch Geltung hatten, ebenso aber auch, von wem sie stammten: „... visa multitudine constitutionum rectorum et officialium ecclesie in dictis provinciis et terris, de quarum plurium per vetustatem primarii non reperiuntur auctores . . . " 2 7 2 . Diese Prüfung wurde von einer Kommission unter dem Vorsitz von Albornoz durchgeführt. In seinem Prooemium zu den Aegidianischen Konstitutionen heißt es: „... per nos et non nullos iurisperitos et legum doctores et expertos viros, quos ad hec vocavimus, , . . " 2 7 3 . Die genaue Zusammensetzung dieser Kommission und die Namen ihrer Mitglieder sind nicht bekannt. Im Gegensatz zu Kardinal Rodolfo Pio da Carpi, der in seinem Decretum anläßlich der Reform der Aegidianischen Konstitutionen von 1544 die 16 Mitglieder seiner Reformkommission namentlich aufführt, schweigt sich Albornoz hinsichtlich seiner Reformkommission hierüber aus. Er teilt in seinem Prooemium lediglich mit, daß sie aus „iurisperiti et legum doctores et experti viri" zusammengesetzt Bonifaz VIII. gewählt worden war, „communicato fratrum nostrorum Consilio auctoritate" in der Constitutio „ I n supreme dignitatis" (1304) wieder aufgehoben; so A. Wolf, Die Gesetzgebung der entstehenden Territorialstaaten in Europa, S. 713; näheres über die Päpste Bonifaz VIII. und Benedikt XI. bei H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Bonifaz V I I I . " , S. 45 ff., und Art. „Benedikt XI.", S. 35. 269 E. Erler, Albornoz, S. 27; H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 238. 270 Bei F. Filippini, Il cardinale Egidio Albornoz, S. 427, der in diesem Zusammenhang Kardinal Bertrando del Poggetto angibt, handelt es sich offenbar um eine Verwechslung. Näheres über Bertrand de Deux bei P. Partner, Art. „Bertrando di Deux (Deaulx)", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 9 (1967), S. 642ff.; L. Cardella , Memorie storiche de' cardinali, Bd. 2, S. 146ff.; C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 1, S. 16; A. Diviziani, Fonti delle costituzioni egidiane. Le costituzioni di Bertrando de Deuc del 1336 per la Marca di Ancona e per il Ducato di Spoleto, S. V i l i . 271 A. Theiner, Codex diplomaticus, Bd. I I Nr. 47; vgl. auch Α. Erler, Albornoz, S. 27; V. La Mantia, Storia della legislazione italiana, I, Roma e Stato romano, S. 335. 272 Const. Aeg. Prooemium (P. Sella, Cost., S. 1, Zeile 17 bis 19). Ein ähnlicher Hinweis findet sich aber auch in einigen Konstitutionen des Albornoz selbst, so in Const. Aeg. I I 13 („inveterata consuetudo, cuius inicium ignoratur, et antique constitutiones, quarum ignorantur auctores, ..." (P. Sella, Cost., S. 68, Zeile 9 und 10) und in Const. Aeg. I I I 1 („Consuetudo antiqua, cuius non reperitur inicium, et veteres constitutiones successive per rectores et officiales ecclesie confirmate, quarum primi non reperiuntur auctores et exigencia comodi provincialium ..." (P. Sella, Cost., S. 123, Zeile 26 bis 29). 273
Const. Aeg. Prooemium (P. Sella, Cost., S. 1, Zeile 23 bis 25).
60
II. Teil: Die Aegidianischen Konstitutionen 274
war . Es ist jedoch davon auszugehen, daß zu seiner Reformkommission sein Kanzler Enrico de Sessa, Professor beider Rechte u n d v o n A l b o r n o z beauftragter A u d i t o r 2 7 5 , sowie seine beiden Kappellane u n d A u d i t o r e n Juan Martinez de la Sierra v o n Salamanca u n d Luca de Petracchis v o n A q u i l a g e h ö r t e n 2 7 6 . Wahrscheinlich sind auch sein A u d i t o r Benedetto d i Fermo u n d der Jurist G i o v a n n i da Siena zu den Mitgliedern zu z ä h l e n 2 7 7 . A l b o r n o z ging bei seinem Gesetzgebungswerk i n der Weise vor, daß er aus den vorhandenen Erlassen u n d Verordnungen das Unnütze, Überflüssige u n d Widersprüchliche ausschied, während er das Bewährte übernahm u n d entsprechend den örtlichen u n d zeitlichen Bedürfnissen neue Bestimmungen hinzufügte: „ . . . I n quo (sc. u n o novo volumine), utilibus inde receptis, inutilibus, supervacuis et contrariis resecatis, novisque iuribus secundum opportunitatem locorum, t e m p o r u m et negociorum inventis, constitutiones eque, honeste, utiles et portabiles, degeste c u m o m n i mansuetudine, continentur, , . . " 2 7 8 . 274
Vgl. hierzu P. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 177ff. F. Filippini, Il cardinale Egidio Albornoz, S. 429; Α. Erler, Albornoz, S. 27; W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 50; vgl. auch J.-F. Leonhard, Die Seestadt Ancona im Spätmittelalter, S. 221. 276 P. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 181 und 183. 277 So F. Filippini, Il cardinale Egidio Albornoz, S. 429, ihm folgend A. Erler, Albornoz, S. 27; W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 50. Dagegen ist P. Colliva, I l cardinale Albornoz, S. 182 und S. 182 Fn. 50, der Ansicht, daß Benedetto di Fermo keinesfalls der Reformkommission des Albornoz angehört habe. Der Auditor sei in den Dokumenten dieser Zeit nicht erwähnt, und die beiden Briefe von Albornoz an Benedetto di Fermo stammten erst aus der Zeit der zweiten Legation des Kardinals, nämlich vom 2. 11. 1361 und vom 27. 1. 1363. Dies schließt m. E. indessen nicht aus, daß Benedetto di Fermo nicht schon früher für Albornoz und damit auch in seiner Reformkommission tätig war. Dabei ist anzumerken, daß F. Filippini, Il cardinale Egidio Albornoz, S. 427, als Datum des zweiten Briefes Albornoz' an den Auditor den 26. 5. 1363 angibt. Welches der beiden Daten zutreffend ist, konnte nicht festgestellt werden. 275
278 Const. Aeg. Prooemium (P. Sella, Cost., S. 2, Zeile 1 bis 5). Diese Vorgehensweise erinnert an Justinian, denn in der Einleitungskonstitution zum Codex Iustinianus „Haec, quae necessario" heißt es: „... Quibus specialiter permisimus resecatis tarn supervacuis, quantum ad legum soliditatem pertinet, praefationibus quam similibus et contrariis, praeterquam si iuris aliqua divisione adiuventur, illis etiam, quae in desuetudinem abierunt, certas et brevi sermone conscriptas ex isdem tribus codicibus, novellis etiam constitutionibus leges componere..."; Corpus iuris civilis, Vol. 2, Codex Justinianus, hrsg. von P. Krüger, S. 1. Als einheitliche Kodifikation aus bewährtem altem und neuem Recht, doch unter Ausscheiden des veralteten, stellen sich auch die Konstitutionen von Melfi Friedrichs II. von Hohenstaufen dar; in der Vorrede dekretiert der Kaiser wie folgt „(nostri nominis sanctiones) cassatis ... legibus et consuetudinibus his nostris constitutionibus adversantibus, quasi iam antiquatis, inviolabiliter ab omnibus in futurum precipimus observari. in quas precedentes omnes regum Sicilie sanctiones et nostras iussimus esse transfusas, ut ex his, que in presenti constitutionum nostrarum corpore minime continentur, robur aliquod nec auctoritas aliqua in iudiciis vel extra iudicia possint assumi"; zitiert nach Α. Erler, Albornoz, S. 29 Fn. 75. Ähnlich heißt es auch in der Promulgationsbulle „Sacrosanctae" von Papst Bonifaz VIII.: „... decretales huiusmodi diligentius fecimus recenseri, et tandem, pluribus ex
3. Entstehung und Verkündung der Aegidianischen Konstitutionen
61
So übernahm Albornoz in sein Gesetzeswerk außer einigen Bullen und Konstitutionen der Päpste Urban IV., Bonifaz VIII., Johannes X X I I . , Benedikt XII., Klemens VI. und Innozenz V I . 2 7 9 auch einzelne Verordnungen der Kardinäle Napoleon Orsini 2 8 0 und Bertrand de Deux 2 8 1 . Napoleon Orsini war ein Neffe von Papst Nikolaus I I I . 2 8 2 . A m 16. 5. 1288 wurde er von Papst Nikolaus IV. zum Kardinaldiakon von S. Adriano erhoben 2 8 3 . Vom 27. 5. 1300 bis zum 28. 5. 1301 war er Legat Papst Bonifaz VIII. in ipsis, quum vel temporales, aut sibi ipsis vel aliis iuribus contrariae, seu omnino superfluae viderentur, penitus resecatis, reliquas, quibusdam ex eis abbreviatis, et aliquibus in toto vel in parte mutatis, multisque correctionibus detractionibus et additionibus, prout expedire vidimus, factis in ipsis, in unum librum cum nonnullis nostris constitutionibus ... redigi mandavimus, et sub debitis titulis collocali", zitiert nach W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 50f.; dort auch weitere Beispiele auf S. 51. 279 Papst Urban VI., Const. Aeg. I 7 (P. Sella, Cost., S. 14, Zeile 20 bis S. 16, Zeile 12); Papst Bonifaz VIII., Const. Aeg. I I 9 (P. Sella, Cost., S. 57, Zeile 26 bis S. 58, Zeile 12), I I 25 (P. Sella, Cost., S. 103, Zeile 1 bis 7), IV 8 (P. Sella, Cost., S. 145, Zeile 15 bis 23); Papst Johannes X X I I . , Const. Aeg. I 8 (P. Sella, Cost., S. 16, Zeile 13 bis S. 19, Zeile 15), I 9 (P. Sella, Cost., S. 19, Zeile 16 bis S. 20, Zeile 29), I 10 (P. Sella, Cost., S. 21, Zeile 1 bis S. 22, Zeile 33); Papst Benedikt XII., Const. Aeg. I 11 (P. Sella, Cost., S. 23, Zeile 1 bis S. 28, Zeile 30); Papst Klemens VI., Const. Aeg. I 12 (P. Sella, Cost., S. 29, Zeile 1 bis S. 30, Zeile 26), I 13 (P. Sella, Cost., S. 31, Zeile 1 bis 29); Papst Innozenz VI., Const. Aeg. 11 (P. Sella, Cost., S. 4, Zeile 1 bis S. 7, Zeile 36), I 2 (P. Sella, Cost., S. 8, Zeile 1 bis S. 9, Zeile 6), I 3 (P. Sella, Cost., S. 9, Zeile 7 bis S. 10, Zeile 23), 14 (P. Sella, Cost., S. 10, Zeile 24 bis S. 12, Zeile 7), 15 (P. Sella, Cost., S. 12, Zeile 8 bis S. 13, Zeile 26); 16 (P. Sella, Cost., S. 13, Zeile 27 bis S. 14, Zeile 19), 114 (P. Sella, Cost., S. 32, Zeile 1 bis S. 33, Zeile 4), 115 (P. Sella, Cost., S. 33, Zeile 5 bis S. 34, Zeile 12), 116 (P. Sella, Cost., S. 34, Zeile 13 bis S. 35, Zeile 15), I 17 (P. Sella, Cost., S. 35, Zeile 16 bis S. 36, Zeile 22). 280 Const. Aeg. I I 1 4 (P. Sella, Cost., S. 71, Zeile 11 bis 14), I I 1 6 (P. Sella, Cost., S. 75, Zeile 15 bis S. 76, Zeile 28), I I 2 0 (P. Sella, Cost., S. 94, Zeile 9 bis 25). In der Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen in italienischer Sprache von Paolo Colliva, abgedruckt in seinem Werk „ I I cardinale Albornoz", S. 529 bis 725, finden sich die Bestimmungen des Kardinals Napoleon Orsini in I I 6 (S. 547f.), I I 14 (S. 563 f.), I I 16 (S. 567f.) und I I 21 (S. 583); vgl. hierzu auch P. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 232 Fn. 61. 281 Const. Aeg. I I 3 (P. Sella, Cost., S. 43, Zeile 23 bis S. 44, Zeile 5), I I 6 (P. Sella, Cost., S. 52, Zeile 21 bis S. 53, Zeile 10), I I 14 (P. Sella, Cost., S. 70, Zeile 1 bis S. 71, Zeile 10), I I 19 (P. Sella, Cost., S. 87, Zeile 6 bis S. 92, Zeile 19), I I 27 (P. Sella, Cost., S. 106, Zeile 24 bis S. 107, Zeile 21), I I 32 (P. Sella, Cost., S. 116, Zeile 5 bis 19), IV 13 (P. Sella, Cost., S. 149, Zeile 15 bis S. 152, Zeile 21), IV 23 (P. Sella, Cost., S. 169, Zeile 22 bis S. 170, Zeile 17), IV 24 (P. Sella, Cost., S. 170, Zeile 18 bis S. 171, Zeile 37), IV 52 (P. Sella, Cost., S. 192, Zeile 1 bis 19), V I 2 (P. Sella, Cost., S. 209, Zeile 9 bis 30). In der Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen in italienischer Sprache von Paolo Colliva, abgedruckt in seinem Werk „ I I cardinale Albornoz", S. 529 bis 725 finden sich die Bestimmungen des Kardinals Bertrand de Deux in I I 3 (S. 539), I I 6 (S. 547), I I 14 (S. 562f.), I I 20 (S. 577f.), I I 28 (S. 594f.), I I 33 (S. 602), IV 16 (S. 637), IV 19 (S. 646ff.), IV 23 (S. 652), IV 24 (S. 653), IV 51 (S. 677), V 2 (S. 695). 282 L. Cardella, Memorie storiche de' cardinali, Bd. 2, S. 33; F. Bock, Art. „Orsini, Neapoleone", in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 7 (1962), Sp. 1242. 283 P. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 547 Fn. b; C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 1, S. 11; L. Cardella, Memorie storiche de' cardinali, Bd. 2, S. 36. Davon abweichend gibt C.A. Willemsen, Kardinal Napoleon Orsini, S. 3, als Datum der Ernennung den 15. 5. 1288 an.
62
II. Teil: Die Aegidianischen Konstitutionen
der M a r k Ancona, dem D u k a t v o n Spoleto u n d Perugia. Später wurde i h m das A m t des Rektors i n der Sabina ü b e r t r a g e n 2 8 4 . N a p o l e o n Orsini w i r d daher i n der jeweiligen I n t i t u l a t i o der v o n i h m verfaßten i n den Aegidianischen K o n s t i t u t i o nen inserierten Bestimmungen wie folgt bezeichnet: „Neapoleo t i t u l i sancti A d r i a n i diaconus Cardinalis rector Marchiae A n c o n i t a n a e " 2 8 5 . Bertrand de Deux wurde a m 26. 8. 1323 v o n Papst Johannes X X I I . 2 8 6 z u m Erzbischof v o n E m b r u n ernannt. Nachdem er sich i n mehreren schwierigen politischen Missionen bewährt hatte, folgte zwischen dem 4. u n d 6. M a i 1335 seine Ernennung z u m „ N u n t i u s et R e f o r m a t o r " 2 8 6 a der „Terrae Ecclesiae" i n Italien. D o r t promulgierte er 1336 auf den Parlamenten einzelner Provinzen seine bereits erwähnten K o n s t i t u t i o n e n 2 8 7 . A m 18. 12. 1338 wurde Bertrand de Deux v o n Papst Benedikt X I I . , der a m 20. 12. 1334 z u m Nachfolger Johannes' X X I I . gewählt worden war, z u m Kardinalpriester v o n S. M a r c o kreiert. Zehn Jahre später, a m 4. 11. 1348 ernannte i h n Papst Klemens V I . z u m Kardinalbischof der S a b i n a 2 8 8 . Bertrand de Deux w i r d daher i n der I n t i t u l a t i o seiner v o n A l b o r n o z übernommenen K o n s t i t u t i o n e n bezeichnet m i t dem Titel „ B o n e memorie dominus Bertrandus episcopus Sabinensis, d u m esset archiepis-
284 So P. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 547 Fn. b; C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 1, S. 11 Fn. 2; L. Cardella, Memorie storiche de' cardinali, Bd. 2, S. 33; C.A. Willemsen, Kardinal Napoleon Orsini, S. 7 bis 10. Ungenau dagegen R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 8, der lediglich angibt, daß Napoleon Orsini in zwei Epochen Legat gewesen sei, nämlich in 1289 und von 1298 bis 1301. — U m den Frieden in Italien wiederherzustellen und den Kampf zwischen den Guelfen und Gibellinen beizulegen, wurde Napoleon Orsini am 15. 2. 1306 von Papst Klemens V. zum Legaten „in provinciis Tuscie Romaniole, Marchie Tarvisine, necnon insularum Sardinie et Corsice, archiepicopatus (sie) et provincie Januensis et nominatim in Aquilegiensi et Gradensi patriarchatibus, necnon in toto archiepiscopatu et provincia Ravenne et Ferrariensi civitate et diocesi ac Venetiarum partibus" ernannt und mit wichtigen Privilegien und weitgehenden Vollmachten ausgestattet. A m 8. 3. 1306 trat Napoleon Orsini von Avignon aus seine Reise nach Italien an. Erst am 12. 6. 1309 kehrte er nach Avignon zurück. Näheres über diese Legation bei A. Eitel, Der Kirchenstaat unter Klemens V., S. 23 ff., nach dem auch der obige Ausschnitt aus der Ernennungsurkunde vom 15. 2. 1306 zitiert wurde (S. 23f.) und C.A. Willemsen, Kardinal Napoleon Orsini, S. 26 bis 52; vgl. auch C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 1, S. 11 Fn. 2. 285
So in den unter Fn. 280 aufgeführten Konstitutionen. Näheres über Papst Johannes X X I I . bei H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Johannes X X I I . " , S. 129ff. 286a £ ) e r Tifai „reformater" begegnet nur dort, wo außerordentliche Umstände auch außerordentliche und weitestgehende Vollmachten verlangten; A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, S. 469. 287 Ygi F n 270 und 271. Hierzu auch G. Ermini, I parlamenti dello stato della chiesa, S. 89 und 91. 288 Ausführlich über Bertrand de Deux bei P. Partner, Art. „Bertrando di Deux (Déaulx)", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 9 (1967), S. 642 ff.; L. Cardella, Memorie storiche de' cardinali, Bd. 2, S. 146 ff.; C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 1, S. 16; R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 9; P. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 306f. und S. 306 Fn. 181. 286
3. Entstehung und Verkündung der Aegidianischen Konstitutionen
63
copus Ebredunensis et terrarum ecclesie reformator per sedem apostolicam deputatus, . . . " 2 8 9 . Albornoz wollte ein für die gesamten Provinzen des Kirchenstaates einheitliches Gesetzbuch schaffen, um damit die Rechtseinheit und Rechtssicherheit in den Gebieten des Kirchenstaates zu erreichen. Dies drückt sich schon in dem Titel seines Gesetzbuches aus: Liber Constitutionum Sanctae Matris Ecclesiae. U m dies zu gewährleisten, ordnete Albornoz an, daß mit der Verkündung seines Gesetzbuches alle früheren Gesetze, welche in dasselbe nicht aufgenommen worden waren, außer Kraft treten sollten 290 : „Mandamus igitur ipsas constitutiones, in presenti contentas volumine, per omnes rectores, populos et officiales et personas alias inviolabiliter observari, alias constitutiones quorumcumque rectorum et officialium dictarum provinciarum et terrarum ecclesie, in dictis locis et parlamentis editis, in hoc volumine non insertas, cassantes et viribus vacuantes" 291 . Als Beispiel hierfür sei die Romana Mater Papst Bonifaz 4 V I I I . vom 28. 9. 1295 angeführt, in deren Verfügungen die Kompetenzen des Provinzrektors hinsichtlich seiner Gerichtsbarkeit zugunsten der Kommunen abgegrenzt wurden. Die Kommunen wußten diese Constitutio Bonifaciana denn auch wohl zu schätzen, und so mußte es sie besonders empören, als mit Inkrafttreten der Aegidianischen Konstitutionen die Bonifaciana gleichsam aufgehoben wurde 2 9 2 . Das nach diesen Grundsätzen geschaffene Gesetzbuch ließ Albornoz auf einem parlamentum generale 293 zu Fano in den Marken im Hause des Galeotto Malatesta 294 während dreier Tage 2 9 4 a gegen Ende April bis Anfang Mai 1357 295 289
So in den unter Fn. 281 aufgeführten Konstitutionen.
290
A. Erler, Albornoz, S. 30. 291 Const. Aeg. Prooemium (P. Sella, Cost., S. 2, Zeile 22 bis 27). 292 Die Kommunen rebellierten 1366 offen gegen diese Neuordnung, allein sie unterlagen. Dennoch versuchten sie weiterhin, über die Konstitutionen des Albornoz zurück zur Bonifaciana zu gelangen — Alatri argumentierte, es sei unangemessen, die für die Mark Ancona und den Dukat von Spoleto geschaffenen Aegidianischen Konstitutionen auf die Verhältnisse dieser armen Provinz zu übertragen —, und sie erreichten im Jahre 1376 auch tatsächlich, daß Papst Gregor XI. die Bonifaciana durch seinen Vikar, Kardinal Francesco Teobaldeschi, bestätigen ließ. Papst Bonifaz IX. verkündete die Bonifaciana am 12. 6. 1400 noch einmal für die ganze Campania-Marittima. Das ungeklärte Nebeneinander der Aegidianischen Konstitutionen und der Romana Mater bzw. Bonifaciana konnte nicht ohne verwirrende Folgen bleiben. Wo sich der Wortlaut der beiden Konstitutionen widersprach, hielten sich die Kommunen an die Bonifaciana, der Rektor an die Constitutiones Aegidianae. Ausführlich hierzu A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, S. 486ff. 293
Eingehend zu der Entwicklung, Funktion und Bedeutung der Parlamente bei G. Ermini, I parlamenti dello stato della chiesa; A. Marongiu, L'istituto parlamentare in Italia; ders., Medieval Parliaments; D. Cecchi, Il parlamento e la congregazione provinciale della Marca di Ancona. 294 ρ Filippini, Il cardinale Egidio Albornoz, S. 426.
64
II. Teil:
ie Aegidianischen Konstitutionen
vor allen Rektoren sowie vielen Adligen, Bischöfen und Prälaten vortragen 296 . Albornoz wählte hierfür wohl gerade diesen Zeitpunkt, da er im März 1357 durch die Mitteilung Papst Innozenz VI. von der Sendung des Androin de la Roche erfahren hatte und sich daher unvermutet am Ende seines Auftrags in Italien fühlte. Eine seiner ersten Entscheidungen muß es daher gewesen sein, seine Konstitutionen so schnell wie möglich zu verkünden 297 . Hierbei erhebt sich die Frage, ob die Konstitutionen auf dem parlamentum generale zu Fano auch beraten oder förmlich angenommen wurden. Bei Albornoz heißt es hierzu in Buch V I Kap. 27 der Aegidianischen Konstitutionen lediglich: „... easdem (sc. constitutiones) in parlamento publico quo ipsas edimus et firmamus legi fecimus et publice divulgari" 2 9 8 . Der Codex Angelicus beschränkt sich ebenfalls auf die Mitteilung „publicate et lecte fuerunt supradicte constitutiones in generali parlamento Fano celebrato" 299 . Es ist somit nirgends die Rede von einer Beratung, einer „approbatio" oder gar von einem Widerspruch. Dem würde aber auch schon eine so autokratische Form der Gesetzgebung, wie der Erlaß von Konstitutionen, widersprechen 300 . Hinzu kommt, daß Albornoz wegen der Beendigung seiner Legation und seiner baldigen Abreise nach Avignon die Konstitutionen so schnell wie möglich verkünden wollte. Eine Beratung hätte sein Gesetzgebungswerk möglicherweise in Frage gestellt, zumindest aber zeitlich verzögert. Ferner ist daran zu erinnern, daß das parlamentum generale zu Fano lediglich drei Tage dauerte 301 und während dieser Zeit die Nachricht von dem Aufstand in Cesena in die Versammlung hineinplatzte. Sofort brachen Galeotto Malatesta und einige andere Große des 294a Dies ist einem Schreiben Papst Innozenz VI. an Albornoz vom 6. 5. 1357 zu entnehmen, in dem es heißt: „... et quod huiusmodi Parlamentum, quod per tridum durare debebat, ...", zitiert nach P. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 191. 295 So A. Erler, Albornoz, S. 29f. und S. 30 Fn. 77 unter Hinweis auf den Codex Ottobonianus 1402 der Vatikanischen Bibliothek, der als Daten des parlamentum generale „die ultima aprilis, secunda et tertia maji" nennt; vgl. auch Const. Aeg. Prooemium (P. Sella, Cost., S. 1, Zeilen 8 und 9). Davon abweichend A. Marongiu, L'istituto parlamentare in Italia, S. 172, der ohne nähere Begründung angibt, daß das Parlament zwischen dem 29. April und dem 1. Mai 1357 abgehalten worden sei. — Soweit J.F.Leonhard, Die Seestadt Ancona im Spätmittelalter, S. 224, das Jahrl355 angibt, handelt es sich offensichtlich um einen Druckfehler, da er auf S. 227 selbst das Jahr 1357 nennt. 296 Diese erste Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen mit dem Urtext ist nicht mehr erhalten; F. Filippini, Il cardinale Egidio Albornoz, S. 426. 297 P. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 185. 298 Const. Aeg. V I 27 (P. Sella, Cost., S. 234, Zeile 25 bis 26). 299 Zitiert nach A. Erler, Albornoz, S. 30. 300 Α. Erler, Albornoz, S. 32. Als „Konstitutionen" oder „constitutiones" wurden Gesetze von besonderer Wichtigkeit bezeichnet, namentlich Kaisergesetze. Diese gingen allen anderen Rechtsnormen vor und konnten ihrerseits nur durch kaiserliche Konstitutionen aufgehoben werden; vgl. A. Erler, Art. „Konstitution, constitutio" in HRG, Bd. 2 (1978), Sp. 1119-1122 (1119f.). 301
Vgl. S. 63 und Fn. 294a.
4. Übersicht über Aufbau und Inhalt des Gesetzbuches von 1357
65
Landes mit der gesamten Kavallerie nach Cesena auf 3 0 2 . Wegen dieses politischen Ereignisses war sicherlich das anfängliche Interesse an dem Gesetzgebungswerk des Albornoz zurückgegangen 303. Zudem war die Versammlung nun nicht mehr vollzählig, und wegen der Vorbereitungen für die Niederschlagung des Aufstandes in Cesena verblieb wohl kaum noch genügend Zeit, um die Konstitutionen zu beraten. Aus dem Rückblick auf das parlamentum generale zu Fano im Jahre 1357 ergibt sich daher, daß die Konstitutionen des Albornoz dort nicht beraten worden sind, sondern tatsächlich nur „lecte et publicate" 304 . Die Konstitutionen sind dort nur „gewiesen" worden 3 0 5 . Das Gesetzgebungswerk des Albornoz setzte sich sofort durch, denn bereits im Oktober 1357 nimmt das Rechnungsbuch des Angelo Tavernini, Thesaurar im Patrimonium beati Petri in Tuscia, mit den Worten „secundum formam novarum constitutionum" darauf Bezug 306 . 4. Übersicht über den Aufbau und den Inhalt des Gesetzbuches von 1357 Obwohl die Aegidianischen Konstitutionen der Form und der Entstehung nach „Constitutiones" sind, entsprechen sie ihrem materiellen Inhalt nach den italienischen „Statuta" 3 0 7 . Wie viele von diesen ist auch das Gesetzeswerk des Albornoz in sechs Bücher eingeteilt. Allen vorangestellt ist ein Prooemium. Darin erklärt Albornoz, daß diese sechs Bücher als eine in sich geschlossene Einheit zu betrachten sind: „... unum novum volumen presentium nostrarum constitutionum pro honore ecclesie fieri iussimus. In quo, utilibus inde receptis, inutilibus, supervacuis et contrariis resecatis, novisque iuribus secundum oportunitatem locorum, temporum et negociorum inventis, constitutiones eque, honeste, utiles et portabiles, degeste cum omni mansuetudine, continentur, sub congruis ordinibus et tytulis collocate ac distribute per debitum ordinem in sex libris" 3 0 8 . Die einzelnen Bücher sind in Kapitel eingeteilt, denen jeweils eine kurze und klare Überschrift (Rubrica) vorangestellt ist. Die Anzahl und die Länge der Kapitel sind jedoch unterschiedlich. So enthält Buch I insgesamt 17 Kapitel, Buch I I 37 Kapitel, die meist sehr umfangreich sind, Buch i i i umfaßt 24 recht kurze Kapitel, Buch IV gar 55 Kapitel, Buch V lediglich 16 und Buch V I 27 Kapitel. 302 A. Erler, Albornoz, S. 2 0 ; / / . / . Wurm, Cardinal Albornoz, S. 117ff.; vgl. auchS. 62 Fn. 240. 303 P. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 204. 304 A. Erler, Albornoz, S. 32; D. Cecchi, I l parlamento e la congregazione provinciale, S. 102. 305 A. Erler, Albornoz, S. 32. 306 A. Theiner, Codex diplomaticus Bd. I I Nr. 338 (S. 369 unter „Die X I I I . Octobris"). Vgl. auch A. Erler, Albornoz, S. 31. 307 A. Erler, Albornoz, S. 44. 308 Const. Aeg. Prooemium (P. Sella, Cost., S. 1, Zeile 25 bis S. 2, Zeile 6).
5 Hoffmann
66
II. Teil:
ie Aegidianischen Konstitutionen
Wie die meisten italienischen Statuten beginnen auch die Aegidianischen Konstitutionen von 1357 mit dem Verfassungsrecht. In den Kapiteln 1 bis 6 3 0 9 des ersten Buches sind die Vollmachten für Albornoz enthalten, die allesamt von Papst Innozenz VI. herrühren und dem Kardinal die Verwaltung des Kirchenstaates sowie die Gesetzgebungsbefugnis übertragen 310 . In den Kapiteln 7 bis 17 folgen Konstitutionen verschiedener Päpste, geordnet nach der Reihenfolge ihres Pontifikats: Kapitel 7 enthält die Konstitution eines Papstes Urban 3 1 1 , die Kapitel 8 bis 10 stammen offensichtlich von Papst Johannes X X I I . 3 1 2 , das K a p i t e l l l von Papst Benedikt X I I . 3 1 3 , die Kapitel 12 und 13 von Papst Klemens V I . 3 1 4 und schließlich die Kapitel 14 bis 17 von Papst Innozenz V I . 3 1 5 . Zweifel könnten sich allerdings bei dem Namen Urban ergeben. Handelt es sich hierbei um Papst Urban IV., der von 1261 bis 1264 den Papstthron innehatte 316 , oder um Papst Urban V., der im Jahre 1362 zum Papst gewählt worden war 3 1 7 ? Die Datierung der Konstitution selbst gibt kaum Aufschluß. Dort heißt es lediglich: „Datum apud Urbem Veterem, ante cathedralem ecclesiam, die X I I I I . decembris, pontificatus nostri anno secundo" 318 . Es kann sich jedoch nur um Papst Urban IV. handeln, da Papst Urban V. erst am 28. 9. 1362, d. h. nach Verkündung der Aegidianischen Konstitutionen, zur Herrschaft gelangt war 3 1 9 . Zudem wird dies auch durch Kapitel 22 des VI. Buches bestätigt, in dem 309
Const. Aeg. I 1-6 (P. Sella, Cost., S. 4 bis S. 14, Zeile 19). Die Vollmacht für Albornoz vom 30. 6. 1353, die in Buch I Kap. 1 der Aegidianischen Konstitutionen wiedergegeben wird, ist auch nachzulesen bei A. Theiner, Codex diplomaticus, Bd. II Nr. 243 sowie bei E. Säez und J. Trenchs Odena, Diplomatario del cardenal Gil de Albornoz, Cancilleria Pontificia (1351-1353), Nr. 275 S. 259ff. Die in Buch I Kap. 2 enthaltene Vollmacht für Albornoz vom 19. 8. 1353 kann auch bei E. Säez und J. Trenchs Odena, Diplomatario de cardenal Gil de Albornoz, Cancilleria Pontificia (1351-1353), Nr. 462 S. 430f., nachgelesen werden, die in B u c h i Kap. 6 enthaltene Vollmacht vom 8. 12. 1355 bei Theiner, Codex diplomaticus, Bd. I I Nr. 317. 311 Const. Aeg. I 7 (P. Sella, Cost., S. 14, Zeile 20 bis S. 16, Zeile 12). 312 Const. Aeg. I 8-10 (P. Sella, Cost., S. 16, Zeile 13 bis S. 22, Zeile 33). 313 Const. Aeg. I 11 (P. Sella, Cost., S. 23, Zeile 1 bis S. 28, Zeile 30). 314 Const. Aeg. 112-13 (P. Sella, Cost., S. 29, Zeile 1 bis S. 31, Zeile 30); die in Kap. 13 enthaltene Konstitution vom 8. 5. 1352 ist auch abgedruckt bei A. Theiner, Codex diplomaticus, Bd. I I Nr. 222. 315 Const. Aeg. 114-17 (P. Sella, Cost., S. 32, Zeile 1 bis S. 36, Zeile 22). Die in Kap. 14 enthaltene Konstitution vom 1. 6. 1353 ist ebenfalls wiedergegeben bei A. Theiner, Codex diplomaticus, Bd. I I Nr. 238, die in Kap. 15 enthaltene Konstitution vom 15. 7. 1353 bei A. Theiner, Codex diplomaticus, Bd. I I Nr. 247. 316 Näheres über Papst Urban IV. bei H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Urban IV.", S. 315 f. 317 Ausführlicher über Papst Urban V. bei H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Urban V.", S. 316. 318 Const. Aeg. I 7 (P. Sella, Cost., S. 16, Zeile 11 und 12). 319 Zu Recht weist A. Erler, Albornoz, S. 46 f., daraufhin, daß bei der Datierung „apud urbem veterem" nur die Stadt Orvieto gemeint sein kann, in der Papst Urban IV. zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Konstitution nach dem Itinerar weilte. 310
4. Übersicht über Aufbau und Inhalt des Gesetzbuches von 1357
67
ausdrücklich auf die Konstitution Papst Urbans IV. im I. Buch Bezug genommen wird 3 2 0 . All dies verdeutlicht, daß Albornoz in das erste Buch seiner Konstitutionen ausschließlich päpstliche Erlasse aufgenommen hat. In seinem Prooemium zu den Konstitutionen erklärt der Kardinal hierzu: „... in sex libris. In quorum primo continentur littere commissionum nobis factarum per summum pontificem, que tangunt potestatem nostre legacionis et vicariatus et circa constitutiones edendas; deinde constitutiones papales, quas in dictis libris invenimus, quarum alique, licet (de) aliqua dictarum provinciarum faciat mencionem et de aliquibus non, tarnen ipsas ad omnes dictas provincias et terras ecclesie prorogamus" 321 . Indem Albornoz diese großen Papsterlasse geschlossen beieinander und an den Anfang des Gesetzbuches stellte, mag er einmal aus Pietät gegenüber den letzten Päpsten gehandelt haben. Sicherlich wollte er hierdurch seinem Gesetzeswerk aber auch ein besonderes Gewicht verleihen 322 und damit verdeutlichen, daß seine Gesetze auf Grund seiner weitreichenden Vollmachten mit dem Willen des Papstes in Einklang stehen und daher genauestens befolgt werden müssen. Diese Einheit des ersten Buches wird jedoch später von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi durch seine Reform der Aegidianischen Konstitutionen von 1544 durchbrochen. Es werden auch nicht päpstliche Erlasse in das erste Buch aufgenommen. Doch hierauf wird noch später bei der Behandlung der weiteren Entwicklung der Konstitutionen von 1357 sowie deren Reform durch Rodolfo Pio da Carpi einzugehen sein. In Buch II, das zwar nicht von der Anzahl, aber von dem Umfang seiner 37 Kapitel den längsten Teil der Aegidianischen Konstitutionen von 1357 ausmacht, ist das Ämterwesen geregelt: „ I n secundo libro continentur constitutiones pertinentes ad rectores et officiales et iura publica deferenda et conservanda" 323 , sagt Albornoz in dem Prooemium. Bei der Durchsicht des zweiten Buches fallt auf, daß bei einigen Konstitutionen weder der Verfasser noch das Datum ihrer Entstehung angegeben sind 3 2 4 . Es handelt sich hierbei wohl um ältere Bestimmungen, deren Autor unbekannt ist. Einige Konstitutionen stammen von Kardinal Napoleon Orsini 3 2 5 , einige von Bertrand de Deux 3 2 6 und zwei gar von Papst Bonifaz V I I I . 3 2 7 . Dies ist aus 320
Const. Aeg. V I 22 (P. Sella, Cost., S. 227ff. [230] Zeile 5 bis 7). Const. Aeg. Prooemium (P. Sella, Cost., S. 2, Zeile 6 bis 12). 322 So A. Erler, Albornoz, S. 47. 323 Const. Aeg. Prooemium (P. Sella, Cost., S. 2, Zeile 12 bis 14). 324 So z. B. Const. Aeg. I I 1 (P. Sella, Cost., S. 38 ff.), I I 2 (P. Sella, Cost., S. 41 ff.), I I 4 (P. Sella, Cost., S. 45ff.), I I 28 (P. Sella, Cost., S. 108), I I 34 (P. Sella, Cost., S. 117f.), I I 37 (P. Sella, Cost., S. 121). 325 Siehe Fn. 280. 326 Siehe Fn. 281. 321
5*
68
II. Teil: Die Aegidianischen Konstitutionen
der jeweiligen Intitulatio erkennbar. Oftmals hat Albornoz diesen Konstitutionen eine eigene Bestimmung angefügt. Diese beginnen sodann mit „Adicientes , . . " 3 2 8 oder „Huic constitutioni addicimus . . . " 3 2 9 . Die meisten Konstitutionen des zweiten Buches stammen jedoch von Albornoz. Sie werden eingeleitet mit der Intitulatio „Egidius sabinensis episcopus, apostolice sedis legatus et domini pape vicarius" 330 . Hinsichtlich des Inhaltes von Buch I I sei kurz erwähnt, daß Kapitel 1 den Amtseid des rector provincie enthält, Kapitel 2 handelt „De numero et distinctione officialium cuiuscumque provincie". Kapitel 4 handelt von den Pflichten der Beamten wie Unbestechlichkeit, Residenzpflicht usw. Weiterhin sind geregelt in Kapitel 7 das Amt des Marschalls, in Kapitel 13 das Gebührenwesen und in Kapitel 18 das Gefangniswesen. Kapitel 27 enthält das Verbot von Kastellbauten ohne Genehmigung des Papstes, Kapitel 30 das Verbot der Ausfuhr von Lebensmitteln aus der Provinz 331 und Kapitel 34 das Verbot der Wiedererrichtung des Kastells Montesoffio 332 . Kapitel 36 schließlich gebietet, das päpstliche Wappen gemeinsam mit dem örtlichen Wappen an Toren und Palästen sowie auf allen Fahnen und Siegeln anzubringen 333 . Buch III enthält Bestimmungen für den geistlichen Bereich. Es handelt sich dabei jedoch nicht so sehr um inneres Kirchenrecht, sondern eher um Staatsaufsicht gegenüber dem Klerus 3 3 4 . So erklärt Albornoz in seinem Prooemium hierzu: „ I n tercio libro continentur constitutiones pertinentes ad officium rectorum et iudicum super spiritualibus" 335 . 327
Const. Aeg. I I 9 (P. Sella, Cost., S. 57 f.) und I I 25 (P. Sella, Cost., S. 103). Const. Aeg. I I 3 (P. Sella, Cost., S. 44, Zeile 7), I I 2 0 (P. Sella, Cost., S. 94, Zeile 16), I I 27 (P. Sella, Cost., S. 107, Zeile 22 und 23). 329 Const. Aeg. I I 19 (P. Sella, Cost., S. 92, Zeile 20) u. I I 25 (P. Sella, Cost., S. 103, Zeile 8). 330 So z. B. Const. Aeg. I I 7 (P. Sella, Cost., S. 57f.), I I 8 (P. Sella, Cost., S. 55ff.), II10 (P. Sella, Cost., S. 59ff.), I I 11 (P. Sella, Cost., S. 65ff.), I I 12 (P. Sella, Cost., S. 66ff), I I 13 (P. Sella, Cost., S. 68 ff), I I 17 (P. Sella, Cost., S. 77ff.), I I 18 (P. Sella, Cost., S. 82ff.), I I 19 (P. Sella, Cost., S. 84) usw. 331 Von dem Getreidehandel im Kirchenstaat während des 17. und 18. Jahrhunderts handelt ausführlich L. dal Pane, Lo stato pontificio e il movimento riformatore del settecento, S. 557 ff. 332 Ebenso wie späterhin die Stadt Forlimpopoli hatten sich die südöstlich von Fano gelegene Burg und Kommune von Montesoffio (Mondolfo), auch Mondoffo genannt, in der Mark Ancona, gegen die kirchliche Oberhoheit empört und mußten dafür den Zorn des Albornoz reichlich erfahren. Er ließ dieselben vollständig zerstören. Albornoz ordnete sodann an, daß die Burg und Kommune von Montesoffio, das den Malatesta angehangen hatte, wegen „excessus" und „resistentia" nie wieder aufgebaut werden dürfen. Die Einwohner müssen ohne Mauer in der Ebene wohnen; diesen Ort ließ der Legat „Villa iustitiae" nennen; vgl. A. Erler, Albornoz, S. 53 und S. 53 Fn. 160; H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 138. 328
333 334 335
Vgl. A. Erler, Albornoz. S. 48. A. Erler, Albornoz, S. 48. Const. Aeg. Prooemium (P. Sella, Cost., S. 2, Zeile 14 bis 16).
4. Übersicht über Aufbau und Inhalt des Gesetzbuches von 1357
69
Das Buch besteht aus 24 kurzen Kapiteln, die allesamt keine Intitulatio enthalten und ihren Verfasser daher nicht erkennen lassen. Auffallig sind allerdings 14 Konstitutionen, die jeweils mit „Item" beginnen 336 . Ob es sich hierbei um frühere, unbekannte Bestimmungen handelt, die von Albornoz in sein Gesetzeswerk übernommen wurden, oder ob sie von einem einzelnen Mitarbeiter des Kardinals herrühren, ist nicht bekannt. Aus den Regelungen dieses Buches seien nur hervorgehoben Kapitel 1 „De officio rectoris seu auditoris super spiritualibus", Kapitel 5 „De modo deferendi Corpus Christi ad infirmos et illud referendi", Kapitel 13 „De pena clericorum tenentium concubinam publicam" und Kapitel 14 „De pena clericorum arma portantium". In Buch /Fsind in 55 Kapiteln der Strafprozeß sowie das materielle Strafrecht geregelt: „ I n quarto (sc. libro continentur) constitutiones pertinentes ad correctionem maleficiorum, in quo cum levitate et mansuetudine sunt limitate pene quasi in omnibus et singulis malleflciis et non ni (si) pauche comisse arbitrio iudicantis" 337 . Auch in diesem Buch ist der Verfasser der einzelnen Konstitutionen zumeist nicht genannt, so daß es sich hier ebenfalls um ältere Vorschriften handeln dürfte. Lediglich einige Bestimmungen geben durch ihre Intitulatio zu erkennen, daß sie von Bertrand de Deux 3 3 8 herrühren. Eine Konstitution stammt namentlich von Albornoz 3 3 9 , eine andere von Papst Bonifaz V I I I . 3 4 0 . Soweit Albornoz diesen Vorschriften eine eigene anfügt, ist dies durch die einleitenden Worte „Cui constitucioni addicimus" 341 oder „Addicimus constitucioni predicte" 342 hervorgehoben. Auffällig ist auch in Buch IV wiederum eine in sich geschlossene Gruppe von 7 Konstitutionen, die jedoch nicht wie in Buch I I I jeweils mit „Item", sondern stets mit „Si quis" beginnen 343 . Über die Herkunft dieser Bestimmungen ist nichts bekannt. Gemäß dem Brauch der älteren Zeit beginnt Buch IV mit dem Strafprozeßrecht. So handelt Kapitel 1 „De modo procedendi super malleficiis", Kapitel 2 regelt „ I n quibus casibus possit per inquisitionem ex officio procedi"; Kapitel 3 bestimmt, daß jede Stadt einen vereidigten Denunziator halten muß: „De denumptiatoribus deputandis et habendis continue per universitatem". Von 336 Const. Aeg. I I I 6 bis 19 (P. Sella, Cost., S. 125, Zeile 27 bis S. 129, Zeile 9); ebenso aber auch Const. Aeg. I I I 22 (P. Sella, Cost., S. 130, Zeile 26 bis S. 133, Zeile 12) und I I I 24 (P. Sella, Cost., S. 134, Zeile 1 bis S. 135, Zeile 22). 337 Const. Aeg. Prooemium (P. Sella, Cost., S. 2, Zeile 16 bis 19). 338 Siehe Fn. 281. 339 Const. Aeg. IV 16 (P. Sella, Cost., S. 155, Zeile 23 bis S. 158, Zeile 3). 340 Siehe Fn. 279. 341 Const. Aeg. IV 8 (P. Sella, Cost., S. 145 Zeile 24). 342 Const. Aeg. IV 39 (P. Sella, Cost., S. 184, Zeile 27); Const. Aeg. IV 52 (P. Sella, Cost., S. 192, Zeile 20). 343 Const. Aeg. IV 28 bis 34 (P. Sella, Cost., S. 178, Zeile 7 bis Seite 181, Zeile 26).
70
II. Teil:
ie Aegidianischen Konstitutionen
Bedeutung ist auch Kapitel 6, das „De preventione", d. h. von dem Kompetenzkonflikt handelt. Da im Mittelalter oftmals mehrere Gerichte zugleich die Zuständigkeit für sich in Anspruch nahmen (so ζ. B. ein höheres kirchliches sowie ein niederes lokales) und das Gericht zuständig war, das sich zuerst mit der Sache befaßt hatte, wurde bisweilen mißbräuchlich, „pro forma", geladen, um auf diese Weise die Prävention zu begründen. Diesen Mißbräuchen tritt Kapitel 6 entgegen 344 . Ab Kapitel 17 folgt das materielle Strafrecht. Die Rubricae dieser Bestimmungen beginnen zumeist mit den Worten „De pena". An erster Stelle rangiert ein Staatsverbrechen: „De pena eligentium vel assumentium aliquem imperatorem, regem vel potestatem in terris ecclesie". Überhaupt stehen in diesem Buch die Delikte gegen den Staat und die öffentliche Ordnung im Vordergrund. Bei der Aufzählung der gemeinen Verbrechensbestimmungen ist eine innere Ordnung nur bei den gegen Leib und Leben gerichteten Vergehen ersichtlich. Ansonsten sind sie ohne erkennbares System aneinandergereiht 345. So handelt z. B. Kapitel 45 „De pena nominantium iniuriose partem guelfam vel guibillinam", Kapitel 46 „De prohibita portatione armorum" und Kapitel 47 „De pena destruentis domos sine licentia rectoris". Kapitel 54 gar hat mit dem Strafrecht im eigentlichen Sinne nichts zu tun, sondern gibt bei Geldstrafen Maßstäbe für die Umrechnung von einer Währungseinheit in die andere 346 . Obwohl Buch IV von der Anzahl seiner Konstitutionen das umfangreichste ist, enthält es nicht das gesamte Strafrecht. Schon äußerlich beginnen viele Rubricae anderer Bücher ebenfalls mit den Worten „De pena". Es seien hier nur aus Buch I I I die Kapitel 8 „De pena admictentium publicum excomunicatum vel interdictum", Kapitel 9 „De pena excomunicati vel suspensi immiscentis se divinis", Kapitel 13 „De pena clericorum tenentium concubinam publicam" und Kapitel 14 „De pena clericorum arma portantium" sowie aus Buch V I die Kapitel 16 „De pena notarli recusantis recipere registrum de appellatione et presentatione licterarum" und Kapitel 22 „De pena innovantium aut aliquod facientium contra appellantes sive appellare volentes ad curiam generalem provincie" angeführt. Darüber hinaus enthalten noch viele Vorschriften an ihrem Ende eine Sanctio, mithin eine „pena" 3 4 7 . Buch V handelt überwiegend vom Zivilprozeß. Albornoz erklärt in seinem Prooemium hierüber: „ I n quinto (sc. libro continentur) constitutiones pertinen344
A. Erler,
Albornoz, S. 49; vgl. auch A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat,
S. 485. 345 346 347
W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 55. W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 55. A. Erler, Albornoz, S. 50.
4. Übersicht über Aufbau und Inhalt des Gesetzbuches von 1357
71
tes ad officium iudicum civilium" 3 4 8 . M i t lediglich 15 Kapiteln, die allesamt keine Intitulatio enthalten, ist es das kürzeste Buch. Von seinem Inhalt ist zu erwähnen, daß Kapitel 1 „De officio et iurisdictione iudicis causarum civilium" handelt, Kapitel 2 „De modo procedendi in causis civilibus et non excedentibus summam. c. soldorum", Kapitel 6 handelt „De procuratoribus dandis petenti et eorum salario" und Kapitel 7 bestimmt „Quod iudei non possint esse procuratores". In einigen Vorschriften des fünften Buches klingt jedoch materielles Recht an. So handelt z. B. Kapitel 12 „De modo et forma servanda in contractibus minorum", Kapitel 13 „De contractibus simulatis". Die geringe Menge materiellen Zivilrechts ist wohl damit zu erklären, daß dieses teils örtliches Statutarrecht, teils Gewohnheitsrecht, teils lus commune war und politisch nur wenig von Bedeutung schien 349 . In Buch VI schließlich ist in 25 Kapiteln die Appellation geregelt: „ I n sexto et ultimo (sc. libro) continentur constitutiones pertinentes ad officium iudicum appellationum et in hoc volumine perfectio continetur" 3 5 0 . Auch in diesem Buch enthalten sämtliche Kapitel keine Intitulatio. Eine Ausnahme bildet lediglich Kapitel 2, das mit den Worten „Bone memorie dominus Bertrandus, episcopus Sabinensis, dum esset archiepiscopus Ebredunensis et reformator in terris predictis ecclesie, , . . " 3 5 1 beginnt und damit Bertrand de Deux als Verfasser zu erkennen gibt. Dieser Bestimmung hat Albornoz eine eigene angefügt, die mit den Worten „Illud autem adiciendo declaramus quod, . . . " 3 5 2 eingeleitet wird. Die sehr ausführliche und präzise Regelung der Appellation über 25 Kapitel erklärt sich aus politischen Gründen. Mächtige Kommunen und Signori suchten nämlich oft, ihre durch Privileg oder Usurpation verselbständigte kommunale Gerichtsbarkeit auch auf die Berufungsinstanz auszudehnen und die Appellation an die curia generalis zu verhindern 353 .
348
Const. Aeg. Prooemium (P. Sella, Cost., S. 2, Zeile 19 bis 20). Α. Erler, Albornoz, S. 50f. 350 Const. Aeg. Prooemium (P. Sella, Cost., S. 2, Zeile 20 bis 22). 351 Const. Aeg. V I 2 (P. Sella, Cost., S. 209, Zeile 12 bis 14). 352 Const. Aeg. V I 2 (P. Sella, Cost., S. 209, Zeile 31). 353 Α. Erler, Albornoz, S. 51; Α. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, S. 462ff. U m die Appellation an die curia generalis zu verhindern, wurde sie von den Kommunen oft schlicht verboten. Oftmals griffen die Kommunen auch zu weniger direkten, aber doch wirksamen Maßnahmen; sie verboten dem Appellierenden das Verlassen des Ortes ohne Genehmigung des Magistrats oder eröffneten nach seiner Rückkehr von der curia sofort einen neuen Prozeß gegen ihn in der gleichen Sache; sie schüchterten ihn ein und schadeten ihm an Leib und Gut; sie stellten Unterlagen und Zeugen nicht zur Verfügung oder übernahmen doch die Verteidigung der „pars appellata" an der curia; sie verhinderten eine Berufung durch sofortige Ausführung des Urteils oder gewährten bei sofortiger Erlegung der Strafsumme gar einen Rabatt von einem Drittel, um die Kurie des Rektors zu schmälern und die Verurteilten an der Appellation zu hindern; so A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, S. 465 f. 349
72
II. Teil:
ie Aegidianischen Konstitutionen
Von den Bestimmungen des sechsten Buches sei hier nur kurz erwähnt, daß Kapitel 1 „De officio et iurisditione iudicis appellationum et quod ad ipsum et ad rectorem possit libere appellari" handelt. Kapitel 2 bestimmt „Quod non appelletur, ad papam obmisso medio et quid de appellationibus interpositis ad rectorem". In Kapitel 16 wird „De pena notarli recusantis recipere registrum de appellatione et presentatione licterarum" gehandelt. Die beiden letzten Kapitel des sechsten Buches, Kapitel 26 und 27, betreffen nicht mehr die Appellation. Sie bilden gleichsam den Abschluß des ganzen Gesetzbuches. So regelt Kapitel 26 die Frage, welche Norm bei Widersprüchen innerhalb der Aegidianischen Konstitutionen den Vorrang haben soll: „De diversis iuribus et constitutionibus que debent in observantiam prevalere". Diese Vorschrift gibt sodann folgende Ordnung an: „ A d tollendam omnem exceptionis et dubitationis materiam, statuimus quod quociens iura et constitutiones seu eorum dispositione(s) reperirentur contraria vel diversa, prius serventur constitutiones papales locales, inserte et registrate in presenti volumine, secundo constitutiones nostre in eodem inserte volumine, tercio constitutiones bone memorie domini Bertrammi episcopi Sabinensis, quas suis locis inter has constitutiones nostras inseri fecimus sub congruis titulis, quarto laudabiles et antique consuetudines provincie, que tarnen non sint a iure prohibite, nec dictis constitutionibus adversantes, quinto iura canonica et ultimo iura civilia observentur" 354 . An erster Stelle werden somit die in das Gesetzbuch aufgenommenen päpstlichen Konstitutionen genannt, sodann die darin inserierten „constitutiones nostre", d. h. diejenigen von Albornoz selbst. A n dritter Stelle folgen schließlich die inserierten Konstitutionen von Bertrand de Deux. Zweifel ergeben sich allerdings, wie die Konstitutionen des Kardinals Napoleon Orsini einzuordnen sind. Stehen sie mit denen von Bertrand de Deux auf einer Stufe oder gar mit denen von Albornoz? Zweifel bestehen auch hinsichtlich der Konstitutionen, die ihre Herkunft nicht verraten. Gilt dann der zuletzt genannte Gesetzgeber für alle folgenden Kapitel bis zur Nennung eines neuen Namens 355 ? Die weiteren, ab „quarto" folgenden Regelungen befassen sich nicht mehr mit den Widersprüchen innerhalb des Gesetzbuches, sondern mit den Gesetzeslücken und deren Ausfüllung. Hierzu sollen zunächst die alten Gewohnheitsrechte der jeweiligen Provinz herangezogen werden, sofern sie „laudabiles" sind und nicht „a iure prohibite, nec dictis constitutionibus adversantes". Danach soll das kanonische Recht (iura canonica) und erst an letzter Stelle das römische Recht (iura civilia) 3 5 6 ergänzend Anwendung finden. 354
Const. Aeg. V I 26 (P. Sella, Cost., S. 233, Zeile 23 bis S. 234, Zeile 3). Α. Erler, Albornoz, S. 55, läßt diese Frage offen. 356 Zu dem Begriffspaar ius civile — ius canonicum — sei folgendes vermerkt: Das kanonische Recht war von jeher als ein Zweig der Theologie betrachtet worden, und es gab dafür zahlreiche Sammlungen lange vor der Wiederherstellung des römischen Rechts. Erst 355
4. Übersicht über Aufbau und Inhalt des Gesetzbuches von 1357
73
Hierbei fallt auf, daß die örtlichen Statuten des Kirchenstaates in dieser Vorschrift nicht erwähnt werden. Sind sie daher unter die Gewohnheitsrechte der Provinzen einzureihen? Aufschluß hierüber könnte Buch I I Kapitel 19 geben, das die Rubrica „De statutis et ordinamentis terrarum" 3 5 7 trägt. Diese Konstitution enthält wichtige Bestimmungen über die kommunale Gesetzgebungsbefugnis und die Geltungskraft örtlicher Statuten. Darin heißt es unter anderem: „ I n quocumque statuto et consuetudine . . . " 3 5 8 und „... consuetudines (re)probantes et singula statuta . . . " 3 5 8 a . Die Statuten werden hier also neben den Gewohnheitsrechten genannt. Einen weiteren Anhaltspunkt bildet folgende Glosse des Thomas Diplovataccius zum Corpus iuris civilis: „et ideo Bononiae est statutum, quod deficientibus statutis et consuetudinibus judex debeat judicare secundum jura Romana, . . . " 3 5 8 b . Auch hier werden die Statuten neben den Gewohnheitsrechten aufgeführt. Ihnen kommt der gleiche Rang wie den Gewohnheitsrechten zu. Das römische Recht ist beiden gegenüber nachrangig. Indem jedoch die Statuten eigenständig neben den Gewohnheitsrechten genannt werden, handelt es sich um verschiedene, voneinander unabhängige Rechtsnormen. Den Statuten kommt demnach eine selbständige Bedeutung zu. Infolgedessen sind sie nicht unter die Gewohnheitsrechte der Provinzen einzureihen. Es ist daher davon auszugehen, daß Albornoz in seinem Kapitel 26 des sechsten Buches die Statuten bewußt nicht aufgeführt hat und die Statuten bei Widersprüchen und Gesetzeslücken innerhalb der Aegidianischen Konstitutionen keine Anwendung finden sollen. Dies wird auch durch die Regelungen in als letzteres gegen die Mitte des zwölften Jahrhunderts durch die Schule von Bologna wieder neues Leben erhalten hatte, wurde von dem Kamaldulensermönch Gratian in Bologna eine neue Sammlung der Quellen des kanonischen Rechts angelegt. Diese war von den vorhergehenden Sammlungen nicht wesentlich verschieden, und es ist wohl aus dem Ort und der Zeit ihrer Entstehung zu erklären, daß sich ihr Ansehen weiter verbreitete und länger hielt. Es war daher ganz natürlich, daß durch die Nachahmung der blühenden Legistenschule auch das Dekret des Gratian zum Gegenstand eines mündlichen Vortrages gemacht wurde. So waren also von jetzt an in Bologna eigentlich zwei Rechtsschulen vorhanden, deren Scholaren zwar stets ein unzertrenntes Ganzes bildeten, deren Lehrer aber in der Regel völlig getrennt waren. In den ersten Jahrhunderten kam es nämlich nur als seltene Ausnahme vor, daß jemand zugleich Lehrer oder auch nur Doktor beider Rechte wurde. Späterhin war diese Verbindung häufiger, allein die Kollegien der Doktoren in beiden Schulen blieben weiterhin getrennt. Wer zu dieser neuen Rechtsschule gehörte, hieß Canonista, Decretista und Decretalista, welche Ausdrücke gleichbedeutend waren; vgl. F. C. v. Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, Bd. III, S. 514ff.; F. Merzbacher, Art. „Corpus iuris canonici" in: HRG, Bd. 1 (1971), Sp. 637640 (638). 357
Const. Aeg. I I 19 (P. Sella, Cost., S. 84, Zeile 1 bis S. 94, Zeile 8). Const. Aeg. I I 19 (P. Sella, Co^t, S. 85, Zeile 27 bis 28). 358a Const. Aeg. I I 19 (P. Sella, Cost., S. 86, Zeile 2 bis 3). 358b 2i tj ert ρ Q v Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, nach Bd. V, S. 297 Fn. e. 358
74
II. Teil:
ie Aegidianischen Konstitutionen
Buch I I Kapitel 19 bestätigt. Darin wird nämlich grundsätzlich das Recht der Kommunen anerkannt, eigene Statuten oder Stadtgesetze zu erlassen. Diese müssen sich aber im Einklang mit den Aegidianischen Konstitutionen befinden. Statuten, welche im Widerspruch zu diesen erlassen worden sind oder in Zukunft erlassen werden, sind nichtig und unwirksam: „... omnia statuta, contra ipsas (sc. éditas constitutiones inventas) et contra quascumque alias constitutiones generales insertas in presenti volumine éditas et edendas cassamus et irritamus et viribus vacuamus et nullius volumus esse m o m e n t i . . . " 3 5 8 c . U m diese Übereinstimmung zu gewährleisten, ist angeordnet, daß jede Gemeinschaft sowohl ihre neu zu erlassenden als auch ihre bereits bestehenden Statuten vorlegen muß, um sie von dem Rektor der Provinz oder dem von ihm beauftragten Richter durchsehen, prüfen sowie ausdrücklich und im Einzelfall billigen zu lassen (visa, cognita et inspecta et expresse ac singulariter approbata) 3 5 8 d . Die nicht approbierten Statuten und Ordnungen sowie alle Maßnahmen, die auf Grund dieser geschehen, werden für ungültig und ipso iure nichtig erklärt 3 5 8 6 . Der Grund dafür, daß die Statuten in Kapitel 26 des sechsten Buches von Albornoz nicht genannt werden und daher bei Gesetzeslücken innerhalb der Aegidianischen Konstitutionen keine Anwendung finden sollen, mag wohl darin liegen, daß der Geltungsbereich der Statuten örtlich auf enge Kreise beschränkt w a r 3 5 8 f , und sie zumeist auch unterschiedliche Regelungen enthielten. Infolgedessen wäre bei der Ausfüllung von Gesetzeslücken innerhalb der Aegidianischen Konstitutionen durch die örtlichen Statuten die Rechtseinheit im Kirchenstaat oftmals nicht gewahrt. In Buch V I Kapitel 26 fallt weiterhin auf, daß Albornoz in dieser Konstitution auf einen in der Rechtsgeschichte oft bezeugten Behelf in Zweifelsfällen und bei Rechtslücken verzichtet, nämlich das Gebot zur Einholung eines Entscheides des Herrschers. Die Rangordnung der Rechtsnormen in Buch V I Kapitel 26 ist somit endgültig 359 . Durch die Reform des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi hat diese Vorschrift eine tiefgreifende Änderung erfahren: Die Rangfolge der Normen wurde geändert. Deshalb soll dieses Kapitel weiter unten noch einmal ausführlich behandelt werden.
358c
Const. Aeg. I I 19 (P. Sella, Cost., S. 84, Zeile 16 bis 19). Const. Aeg. I I 19 (P. Sella, Cost., S. 84, Zeile 19 bis 26). Vgl. hierzu auch W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 108 ff., und U. Santarelli, Osservazioni sulla „potestas statuendi" dei Comuni nello Stato della Chiesa (a proposito di Const. Aeg., II, 19), in: Studia Albornotiana X I I I (1973), S. 67-83 (76). 358e Const. Aeg. I I 19 (P. Sella, Cost., S. 85, Zeile 3 bis 6). 358d
358f 359
F. C. υ. Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, Bd. I I I , S. 421. A. Erler, Albornoz, S. 57.
4. Übersicht über Aufbau und Inhalt des Gesetzbuches von 1357
75
Kapitel 27, das die Rubrica „De robore constitutionum presentis voluminis et copia ipsarum recipienda per terras" führt, ist das letzte Kapitel des sechsten Buches. Mit dieser Schlußvorschrift wird gleichsam ein Bogen zu den Papsterlassen des ersten Buches gespannt, die die Vollmachten für Aegidius Albornoz enthalten. In Kapitel 27 des sechsten Buches kommt nun das Selbstverständnis des Kardinals in bezug auf seine Mission zum Ausdruck. Seine Gesetzgebung beruht allein auf der päpstlichen Vollmacht, nicht etwa auf einem Beschluß des parlamentum generale zu Fano 3 6 0 . In Kapitel 27 heißt es: „Tanto maior legum debet esse auctoritas quanto ipsarum editor est maiori potestate dotatus. Cum igitur ex dispositione apostolice sedis non solum piene legacionis, sed eciam vicariatus summi pontificis ... geramus officium et ipsius domini pape ... representemus personam plenumque robur omnibus constitucionibus huius nostre compilacionis omni auctoritate qua fungimur impartimur, mandantes ipsas ab omnibus inviolabiliter observari' 361 . Dadurch verleiht Albornoz seinem Gesetzeswerk noch einmal ein besonderes Gewicht. Die erlassenen Bestimmungen sind von allen unverletzlich einzuhalten. U m den Bestand und die Verbreitung seines Gesetzeswerkes im Kirchenstaat zu sichern, ordnet Albornoz in Kapitel 27 weiterhin an, daß es nur dem Papst, dessen Kardinallegaten und Vikar erlaubt sei, in dem Gesetzbuch enthaltene Konstitutionen ganz oder teilweise aufzuheben oder abzuändern. Da das Gesetzeswerk zu seiner Befolgung allgemein auch bekannt sein mußte, die einmalige Weisung dieser Bestimmungen auf dem parlamentum generale zu Fano hierzu jedoch nicht ausreichte, bestimmt Albornoz ferner, daß die Konstitutionen bei Vermeidung empfindlicher Strafen innerhalb von zwei Monaten in allen Provinzen und Gemeinden in öffentlicher Versammlung (in eorum parlamento publice vel saltem in generali Consilio) bekanntzugeben und in der Volkssprache auszulegen sind (exponi faciant in vulgari). Zudem soll eine Abschrift der Konstitutionen in die örtlichen Statutenbücher aufgenommen werden und darin unablässig verbleiben (in libris statutorum suorum scribi et inseri faciant et in ipsis libris continue permansuras 362 ). Die Veröffentlichung ist Albornoz oder dem Rektor der Provinz innerhalb von fünf Tagen durch öffentliche Urkunde anzuzeigen. Diese, in Kapitel 27 enthaltene Vorschrift, wurde von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi bei seiner Reform der Aegidianischen Konstitutionen vollständig gestrichen. Doch auch dies soll später noch eingehender behandelt werden. 360
A. Erler, Albornoz, S. 51 und S. 52. Const. Aeg. V I 27 (P. Sella, Cost., S. 234, Zeile 6 bis Zeile 14). 362 Diese Vorschrift, daß die Konstitutionen mit den lokalen Statuten zu vereinigen seien, ist befolgt worden. So sind der gedruckten Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen Rom 1543-1545 die Statuten von Bologna vorangestellt. Diese Ausgabe, die sich in der Universitätsbibliothek in Tübingen befindet, wird später noch eingehend behandelt werden. Weitere Beispiele hierzu bei A. Erler, Albornoz, S. 31. 361
76
II. Teil:
ie Aegidianischen Konstitutionen
5. Überblick über die Provinzverwaltung des Kirchenstaates nach den Aegidianischen Konstitutionen von 1357 Der Kirchenstaat gliederte sich verwaltungsmäßig auch zu der Zeit v o n Aegidius A l b o r n o z i n die f ü n f Provinzen, die sich i m Laufe des 13. Jahrhunderts herausgebildet hatten: die C a m p a n i a - M a r i t t i m a , das P a t r i m o n i u m beati Petri i n Tuscia, der D u k a t v o n Spoleto, die M a r k A n c o n a u n d die R o m a g n a 3 6 3 . A n der Spitze jeder Provinz stand als höchster Beamter der Rektor 364. Er residierte an der curia generalis, dem obersten Gerichtshof u n d der obersten Verwaltungsbehörde der Provinz u n d leitete darin die Verwaltung sowie die weltliche u n d geistliche 3 6 5 Gerichtsbarkeit der i h m anvertrauten Territorien. Zugleich war er auch Oberbefehlshaber über die Truppen der P r o v i n z 3 6 6 . Der R e k t o r war nicht nur befugt, die Beamten seiner curia zu ernennen. Vielmehr pflegte er auch die Beamten der K o m m u n e n (potestates et officiales) zu bestimmen u n d auszuwählen, so daß keiner es wagen durfte, ohne seine Erlaubnis ein A m t anzunehmen u n d auszuüben 3 6 7 . U m etwaigen Mißbräuchen dieser weitgehenden Vollmachten u n d Befugnisse vorzubeugen, durfte kein R e k t o r das A m t i n seiner Heimatprovinz ausüben oder hierzu berufen w e r d e n 3 6 8 . Die Amtszeit des Rektors war nicht allgemein festgelegt; sie währte vielmehr stets usque ad beneplacitum n o s t r u m 3 6 9 . 363
Kleinere Verwaltungsbezirke wie Sabina und Massa Trabaria sowie einige Städte, die keiner dieser Provinzen zugerechnet wurden, konnten daneben eigens aufgeführt werden: so Ferrara, Bologna, Città di Castello oder Perugia; aber auch Benevent und die 1348 von Papst Klemens VI. erworbene Stadt Avignon mitsamt der Grafschaft Venaissin (seit 1274 päpstlich) gehörten zu dem Kirchenstaat, vgl. A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, S. 453; H. Tüchle, Art. „Kirchenstaat", in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 6 (1962), Sp. 260-265 (263). Dagegen gliedert sich der Kirchenstaat nach H.-J. Becker, Art. „Kirchenstaat", in: HRG, Bd. 2 (1978), Sp. 824-831 (826), in 7 Provinzen, da er auch Benevent und Bologna neben den vorbezeichneten fünf Provinzen als eigenständige Provinzen zählt. 364
Das in der Folgezeit herrschende System weitflächiger Legationen war am Ende des 14. Jahrhunderts noch nicht in Übung. Nur ausnahmsweise wurde zu dieser Zeit eine Provinz von einem Legaten regiert. Erst im Laufe des 16. Jahrhunderts wurde die Legation zu der vorherrschenden Einrichtung im Kirchenstaat; vgl. A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, S. 454; H.-J. Becker, Art. „Kirchenstaat", in: HRG, Bd. 2 (1978), Sp. 824831 (826). — Ausführlich über die Provinzverwaltung des Kirchenstaates F. Ermini, Gli ordinamenti politici e amministrativi nelle „Constitutiones Aegidianae" in: RISG 15 (1893), S. 69-94 und S. 196-240; 16 (1893), S. 39-80 und S. 215-247. 365 Unter Papst Bonifaz IX., dessen Pontifikat von 1389 bis 1404 währte, hatte der Rektor, der nun zumeist Laie war, nur noch die weltliche Gerichtsbarkeit; der rector in spiritualibus et temporalibus wurde zur Ausnahme; vgl. A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, S. 454. 366 Ohne die Einwilligung durfte keine Truppe aufgestellt werden oder die Grenze passieren; vgl. A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, S. 456. 367 Const. Aeg. I I 20 (P. Sella, Cost., S. 94). 368 Const. Aeg. I I 4 (P. Sella, Cost., S. 45 ff.). 369 A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, S. 457.
5. Überblick über die Provinzverwaltung des Kirchenstaates
77
Der zweithöchste Beamte der Provinz war der Thesaurar 370. In seinen Händen lag die gesamte Finanzverwaltung. Er zog unter anderem die Steuern der Provinz, die Zölle und die Strafgelder ein, die neben dem Ertrag der konfiszierten Güter wohl eine der reichsten Einnahmequellen waren, und besoldete die Beamten 371 . Unterstützt von einem Notar hatte er alle Einnahmen und Ausgaben in einem Rechnungsbuch zu registrieren 372 und dieses von Zeit zu Zeit der apostolischen Kammer in Rom zur Überprüfung vorzulegen 373 . Daneben kamen dem Thesaurar noch einige andere Aufgaben zu, die nicht unmittelbar mit dem Finanzwesen in Zusammenhang standen. So waren ihm die Siegelführung in geistlichen Angelegenheiten sowie in Zivil- und Appellationssachen 373a , die Kerkeraufsicht 374 und die Terminbestimmung in dem Sindikatsprozeß 375 übertragen. Der Thesaurar war nicht dem Rektor der Provinz unterstellt, sondern ausschließlich der apostolischen Kammer in Rom verantwortlich. In einer Vielzahl von Fällen konnte der Rektor sogar nur simul et concorditer mit dem Thesaurar handeln 376 . Ebenso wie bei dem Rektor gab es auch bei dem Thesaurar keine bestimmte Amtsdauer. Seine Ernennung erfolgte ebenfalls usque ad beneplacitum nostrum 3 7 7 . Zur Ausübung seines Amtes diente dem Rektor die curia generalis. Ihre vornehmste Aufgabe war die Verwaltung der Gerichtsbarkeit. Ihre wichtigsten Beamten waren vier Richter, die iudices curie generalis 378. Einer von ihnen, der
370
Das Amt des Thesaurars entwickelte sich im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts und wurde von da ab zu einer ständigen Einrichtung. Dies war das Werk von Papst Gregor X., der am 8. 4. 1272, d. h. nur zwölf Tage nach seiner Konsekration, Ruffino da Stradiliano von Piacenza zum Thesaurar der Mark Ancona, Massa Trabaria und Urbino ernannte. Von dieser Zeit an war das Amt des Thesaurars in der Mark Ancona ohne Unterbrechung besetzt. Die Romagna hatte einen Thesaurar, seitdem sie päpstliche Provinz wurde (1278), der Dukat von Spoleto und das Patrimonium beati Petri in Tuscia nicht später als 1280 und 1290 und die Campania-Marittima sowie die Sabina ab 1303; vgl. D. Waley, The Papal State in the Thirteenth Century, S. 106 f. 371 Α. Esch, Bonifaz I X r und der Kirchenstaat, S. 457; A. Eitel, Der Kirchenstaat unter Klemens V., S. 65 und 68. 372 Auszüge aus den Rechnungsbüchern des Angelo Tavernini, Thesaurar im Patrimonium beati Petri in Tuscia in den Jahren 1351 bis 1363, sind abgedruckt bei A. Theiner, Codex diplomaticus, Bd. I I Nr. 338 und Nr. 339. Darin wird unter dem 13. 10. 1357 sogar auf die Aegidianischen Konstitutionen Bezug genommen; vgl. S. 65 und Fn. 306. 373 Vgl. A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, S. 457. 373a Der Thesaurar und sein Notar hatten zwei Siegel: das sigillum curie spiritualium in den geistlichen Angelegenheiten, das sigillum curie generalis in den Zivil- und Appellationssachen; so Const. Aeg. I I 10 (P. Sella, Cost., S. 63, Zeile 15 bis 24). 374 Const. Aeg. I I 18 (P. Sella, Cost., S. 82f.). 375 Const. Aeg. I I 22 (P. Sella, Cost., S. 96f.). 376 In Const. Aeg. 111 (P. Sella, Cost., S. 23 ff.), die die Rubrica „Constitutiones super reditibus et bonis ecclesie prohibentes inter rectores et thesaurarios quaestiones" führt, sind diese Fälle genannt; vgl. auch A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, S. 459. 377 A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, S. 459.
78
II. Teil: Die Aegidianischen Konstitutionen
iudex super spiritualibus, urteilte in den geistlichen Angelegenheiten 379 . Er mußte Kleriker und des kanonischen Rechts kundig sein 380 . Der zweite trug die Bezeichnung iudex causarum appellationum und war mit den an die Kurie gelangten Appellationssachen betraut 381 . Der dritte war Strafrichter und trug die Bezeichnung iudex causarum criminalium. Der vierte schließlich, der iudex causarum civilium, war für die Zivilsachen zuständig 382 . Außerdem standen dem Rektor bei der Ausübung seines Amtes drei weitere Richter zur Seite, die ihren Sitz außerhalb der curia generalis an anderen Orten der Provinz hatten. Sie hießen indices presidatuum 383 und waren hinsichtlich ihrer Zuständigkeit für erstinstanzliche Straf- und Zivilsachen den iudices curie generalis gleichrangig. Lediglich einige schwierige und bedeutsame Rechtsangelegenheiten wie Grenzstreitigkeiten zwischen Gemeinden, Streitigkeiten über Lehenssachen und dergleichen waren von ihrer Zuständigkeit ausgenommen und den iudices curie generalis vorbehalten 384 . Dem Rektor und seinen sieben Richtern waren insgesamt vierundzwanzig Notare beigeordnet 385 , die unter anderem die Akten zu führen und öffentliche Urkunden abzufassen hatten. Zwei von ihnen standen dem Rektor, vier dem iudex causarum criminalium und je drei den übrigen Richtern zur Verfügung 386 . Auch die Richter und Notare durften ihr Amt nicht in der Provinz ausüben, in der sie geboren waren oder ihren ständigen Wohnsitz hatten. Der Rektor konnte hiervon jedoch in bestimmten Fällen einen Dispens erteilen 387 . Ihre Amtsdauer 378
Const. Aeg. I I 2 (P. Sella, Cost., S. 41, Zeile 18 bis 19). Von ihrem Amt handelt Const. Aeg. I I 5 (P. Sella, Cost., S. 48 ff.), das die Rubrica „De officio quatuor iudicum curie generalis Marchie. Hec constitutio ad omnes provincias extenditur" führt. — Spätestens seit dem Pontifikat von Papst Gregor IX. standen dem Rektor der Provinz bei der Ausübung seines Amtes Richter zur Seite. Zunächst gab es nur einen Richter in jeder Provinz, aber schon gegen Ende des 13. Jahrhunderts nahm deren Anzahl zu. So amteten in der Mark Ancona 1279-1280 zwei Richter, denen jedoch kein ausschließlicher Aufgabenbereich zugeteilt war. Wenige Jahre später kam ein dritter für die Appellationssachen hinzu. In der Romagna waren die zwei Richter mit den Straf- und Zivilsachen betraut. Ab 1304 findet sich diese Kompetenzeinteilung auch in der Mark Ancona und dem Patrimonium beati Petri in Tuscia; vgl.D. Waley, The Papal State in the Thirteenth Century, S. 108. 379
Vgl. Const. Aeg. I I I 2 (P. Sella, Cost., S. 124): De officio iudicis super spiritualibus. Const. Aeg. I I 2 (P. Sella, Cost., S. 41, Zeile 21 bis 23). 381 Vgl. Const. Aeg. V I 1 (P. Sella, Cost., S. 208 f.): De officio et iurisditione iudicis appellationum ... 380
382 Vgl. Const. Aeg. V 1 (P. Sella, Cost., S. 195 f.): De officio et iurisdictione iudicis causarum civilium. 383 Von ihrem Amt handelt Const. Aeg. I I 6 (P. Sella, Cost., S. 52f.), das die Rubrica „De officio iudicum presidatuum" führt. 384 ψ \y eber, D j e Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 60. 385 Const. Aeg. I I 2 (P. Sella, Cost., S. 41, Zeile 17). 386 Const. Aeg. I I 2 (P. Sella, Cost., S. 42, Zeile 5 bis 17). 387 Const. Aeg. I I 2 (P. Sella, Cost., S. 43, Zeile 8 bis 13).
5. Überblick über die Provinzverwaltung des Kirchenstaates
79
betrug ein Jahr. In Ausnahmefallen konnte sie der Rektor auf höchstens zwei Jahre verlängern 388 . Die Durchführung der Prozesse sowie die Ausführung und Vollstreckung der Urteile erforderten aber noch eine Vielzahl weiterer Beamter und Amtspersonen, so u. a. die in einem Kolleg mit eigenen Statuten und Privilegien organisierten advocati et procuratores curie generalis** 9. Ihre Aufgabe bestand darin, die Parteien bei der Prozeßführung zu unterstützen. Dabei oblag dem advocatus die Beratung und dem procurator die Vertretung im Prozeß 390 . Die advocati et procuratores hatten etliche Privilegien. So durften sie samt ihren Angehörigen vor keine andere Kurie als die curia generalis des Rektors der Provinz geladen und nur dort belangt werden. Ihre Folterung oder Einkerkerung durfte nur auf ausdrücklichen Befehl des Rektors geschehen. Ferner waren sie von öffentlichen Dienstleistungen und Abgaben weitestgehend befreit 391 . Eine besondere Aufgabe kam den advocati et procuratores fìsci sowie dem procurator ad négocia zu. Letzterer wurde durch den Rektor und den Thesaurar eingesetzt. Er hatte die für die römische Kirche konfiszierten Güter zu verwalten 392 . Den advocati et procuratores fisci oblag zudem die Beratung und Vertretung der Armen, ohne daß sie hierfür ein Honorar nehmen durften 3 9 3 . Die Ladung sowie die sonstigen littere des Rektors und seiner Richter wurden den Parteien und Straftätern durch besondere Boten, die bayuli, überbracht 394 . Diese hatten bei der Ausübung ihres Amtes zum Zwecke ihrer Legitimierung als Amtsperson auf dem Kopf ein rotes Barett mit dem Schlüsselwappen der Kirche zu tragen 395 . 388
Const. Aeg. I I 2 (P. Sella, Cost., S. 43, Zeile 13 bis 17). Vgl. Const. Aeg. I I 15 (P. Sella, Cost., S. 71 ff.): De advocatis et procuratores curie generalis. In diesem Kapitel werden die statuta quoque et consuetudines des Kollegs bestätigt (P. Sella, Cost., S. 72, Zeile 6 und 7). 390 ψ Weber, D i e Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 62. 389
391
Const. Aeg. I I 15 (P. Sella, Cost., S. 72, Zeile 7 bis 23). Vgl. Const. Aeg. I I 14 (P. Sella, Cost., S. 70, Zeile 22 bis 27), das die Rubrica „De procuratore et advocato fisci ad causas camere et pauperum et procuratore ad negotia camere" führt. 393 Const. Aeg. I I 14 (P. Sella, Cost., S. 71, Zeile 12 bis 14). 394 Von ihrem Amt handelt Const. Aeg. I I 17 (P. Sella, Cost., S. 77 ff.), das die Rubrica „De bayulis et precone" trägt. — Von lat. baiulus-Lastträger. Das Wort taucht im Mittelalter in verschiedenen Formen (z. B. auch baillivus, bajulus, balius u. ä., franz. bailli, engl, bailiff) und Bedeutungen auf und bezeichnet bisweilen auch den Träger der niederen Gerichtsbarkeit; vgl. G. Dilcher, Art. „ballivus" in: H R G Bd. 1 (1971), Sp. 287288 (287); A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, S. 485 ff.; D. Waley, The Papal State in the Thirteenth Century, S. 109. 392
395
Const. Aeg. I I 17 (P. Sella, Cost., S. 77, Zeile 27 bis S. 78, Zeile 3). Der bayulus geriet bei der Ausübung seines Amtes oftmals in Bedrängnis, da der Groll über die vorgelegte Ladung häufig an ihm ausgelassen wurde. So war im 14. Jahrhundert die Unsitte verbreitet, den Boten zum Aufessen der zu überbringenden Briefe zu zwingen. Dies soll auch Guillaume de Grimoard, dem Abt des St. Victorklosters zu Marseille, der
80
II. Teil: Die Aegidianischen Konstitutionen
Als einer der wichtigsten Beamten der curia generalis ist noch der marescallus zu erwähnen. Er hatte auf Anordnung des Rektors, des Strafrichters oder auch des Thesaurars die Urteile in Strafsachen zu vollstrecken 396 . Des weiteren oblag es ihm, die Gebannten und Verurteilten zu verfolgen und festzunehmen. Hierbei standen ihm regelmäßig sex équités et sex pedites zur Verfügung 397 . Nach Ablauf ihrer Amtszeit hatten sich die Beamten der curia generalis und die von der Kirche eingesetzten Magistrate dem gefürchteten Sindikatsprozeß zu unterziehen, in dem sie sich für ihre Amtsführung verantworten mußten 398 . Der Rektor bestellte den sindicator generalis oder mehrere sindici , vor die jedermann Beschwerden bringen konnte, und deren Untersuchungen dann zur Entlastung oder zur Verurteilung des Beamten führten 399 . Zum Abschluß des Überblicks über die Provinzverwaltung des Kirchenstaates ist noch auf das parlamentum generale einzugehen, das von dem Rektor oder dem Thesaurar regelmäßig, aber auch nach Gutdünken, einberufen werden konnte. Alle episcopi et prelati, clerici et religiosi, civitates, universitates et loca, potestates seu rectores et nobiles, die geladen waren, hatten an dem parlamentum teilzunehmen. Die Vernachlässigung dieser Pflicht wurde mit Strafe geahndet 400 . Die Einberufung eines parlamentum generale war eine der ersten Amtshandlungen eines jeden neuen Rektors, einmal, um seinen Untertanen seine Ernennung und seine Befugnisse bekanntzugeben, zum anderen aber auch, um in unmittelbaren Kontakt zu seinen Untertanen, insbesondere den Oberen der Provinz, zu treten und ihren Treueeid entgegenzunehmen401. Ansonsten ließ
später als Papst Urban V. den apostolischen Stuhl bestieg, und seinem Begleiter widerfahren sein. Als Gesandter Papst Innozenz' VI. an Albornoz war Guillaume de Grimoard nach Italien gegangen und im Jahre 1361 damit beauftragt gewesen, Bernabo Visconti zum Frieden zu bewegen. „Sie begegneten ihm und seiner zahlreichen militärischen Begleitung auf einer Brücke des Lambroflusses, und überreichten ihm auf dieser die ihnen mitgegebenen Schreiben des Heiligen Vaters, deren Inhalt dem Visconti so mißfiel, daß er nach Durchlesung derselben jene mit grimmigen Blicken fragte: ob sie lieber essen oder lieber trinken wollten? Die beiden Geistlichen, wohl wissend, mit wem sie es zu thun hatten, und voll Angst auf den Überfluß von Getränk blickend, der unter ihren Füßen fluthete, wählten das Erstere, und wurden hierauf von Bernabo gezwungen, die ihm überreichten Pergamente nebst den daran hängenden bleiernen Siegeln bis auf das letzte Stückchen zu verspeisen"; S. Sugenheim, Geschichte der Entstehung und Ausbildung des Kirchenstaates, S. 286f.; vgl. auch H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 180, sowie W. Sellen, Art. „Ladung" in: H R G Bd. 2 (1978), Sp. 1336-1350 (1337). 396 Über das Amt des marescallus unterrichtet Const. Aeg. I I 7 (P. Sella, Cost., S. 54f.). — Erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts hatte jede Provinz einen Marschall. In der Mark Ancona wird ein solcher erstmals im Jahre 1275 erwähnt; vgl. D. Waley, The Papal State in the Thirteenth Century, S. 108 und S. 108 Fn. 6. 397
Const. Aeg. I I 7 (P. Sella, Cost., S. 54, Zeile 11 bis 19). Hierüber handelt Const. Aeg. I I 22 (P. Sella, Cost., S. 96ff.); De syndicatione officialium curie. 399 Α. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, S. 461. 400 Const. Aeg. I I 23 (P. Sella, Cost., S. 100 Zeile 3 bis 16). 398
6. Die Fortentwicklung der Aegidianischen Konstitutionen
81
der Rektor das parlamentum einberufen, um seine Anordnungen bekanntzumachen 4 0 2 , aber auch, um seine Untertanen zur militärischen Hilfe aufzurufen, die für die Verteidigung der Provinz unentbehrlich war 4 0 3 . Nach alledem stellt sich die Frage, wie sich die Aegidianischen Konstitutionen von 1357 und damit auch die in ihnen geregelte Provinzverwaltung in der Folgezeit gestalteten. Blieben sie starr und unverändert bestehen oder waren sie Wandlungen unterworfen? Dieser Frage soll in dem nun folgenden Kapitel nachgegangen werden, da nur auf diese Weise der Rechtszustand zum Zeitpunkt der Reform Rodolfo Pios herausgearbeitet und damit seine gesetzgeberische Leistung gewürdigt werden kann. 6. Die Fortentwicklung der Aegidianischen Konstitutionen seit ihrer Verkündung im Jahre 1357 Schon sechs Jahre nach ihrer Verkündung, nämlich am 27. 2. 1363, ließ Albornoz durch seinen Auditor auf einer publica audientia in der Kirche San Antonio in Ancona sechs Zusätze — „Constitutiones adiectae" — und am 16. 3. 1363 zu Fermo vier weitere Zusätze verkünden 404 . A m 3. und 20. 4. 1364 kamen nochmals zwei Novellen in Form von Briefen Albornoz' an den damaligen Rektor der Marken, Giovanni da Oleggio 405 , hinzu 4 0 6 . Was mag der Grund dafür gewesen sein, daß Albornoz sein Gesetzeswerk um einige Novellen ergänzte? Einmal führte wohl die Eile, in welcher die umfangreiche Gesetzgebungsarbeit hatte vollendet werden müssen, dazu, daß nicht immer mit der erforderlichen Genauigkeit gearbeitet worden war. Zum größeren Teil 401 G. Ermini, I parlamenti dello stato della chiesa, S. 82 und S. 83; P. Partner, The Papal State under Martin V, S. 109. 402 A. Eitel, Der Kirchenstaat unter Klemens V., S. 63; G. Ermini, I parlamenti dello stato della chiesa, S. 84. 403 G. Ermini, I parlamenti dello stato della chiesa, S. 95. 404 Constitutiones adiectae (P. Sella, Cost., S. 236 bis 244); A. Erler, Albornoz, S. 31 f.; H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 239; F. Filippini, Il cardinale Egidio Albornoz, S. 426 und 427; Β. Brandi, Le Constitutiones S. M. Ecclesiae del Cardinale Egidio Albornoz, in: Bollettino dell' Istituto Storico Italiano Nr. 6 (1888), S. 37-61 (38); P. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 208 und S. 208 Fn. 2. Etwas ungenau V. La Mantia, Storia della legislazione italiana, I, Roma e Stato romano, S. 337, und F. Ermini, Gli ordinamenti politici e amministrativi nelle „Constitutiones Aegidianae", in: RISG 15 (1893) S. 69-94 (78), die angeben, die zehn Zusätze von Albornoz seien sämtlich in Ancona verkündet worden. 405
A m 3. 4. 1360 war Giovanni da Oleggio von Albornoz zum Rektor der Marken ernannt worden; H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 150. 406 A. Erler, Albornoz S. 32; H.J. Wurm, Cardinal Albornoz, S. 239; F. Filippini, II cardinale Egidio Albornoz, S. 427; V. La Mantia, Storia della legislazione italiana, I, Roma e Stato romano, S. 337. — Der Erlaß einer Konstitution durch ein Schreiben an einen hohen Beamten hat Vorläufer im Kodex und in den Novellen Justinians. Albornoz, der zum Erlaß von Konstitutionen ermächtigt ist, folgt offenbar diesen Beispielen; A. Erler, Albornoz, S. 32. 6 Hoffmann
II. Teil:
82
ie Aegidianischen Konstitutionen
allerdings dürften in den Zusätzen Regeln statuiert sein, für welche erst bei der praktischen Anwendung der Konstitutionen von 1357 ein Bedürfnis hervorgetreten war. Eine Parallele hierzu findet sich in den Konstitutionen von Melfi, die Friedrich II. im September 1231 in Melfi für sein sizilisches Königreich erlassen und bis zum Jahre 1247 um eine beachtliche Anzahl von Novellen ergänzt hat 4 0 7 . Die Constitutiones adiectae von Albornoz wurden in mehreren Kapiteln unmittelbar an Buch V I der Aegidianischen Konstitutionen angefügt 408 . Jedem Kapitel ist eine kurze Rubrica vorangestellt. Außer Kapitel 1 und 9 der Constitutiones adiectae von Albornoz, die jeweils mit der Intitulatio „Egidius, episcopus Sabinensis, apostolice sedis legatus ac terrarum et provinciarum Romane ecclesie in Ytalia consistencium vicarius generalis" 409 eingeleitet werden, beginnen sie stets mit „Item". Inhaltlich betreffen die Constitutiones adiectae unterschiedliche Rechtsmaterien. So enthalten die Kapitel 1 bis 3 weitere Bestimmungen zu der Appellation, die Kapitel 7 und 8 betreffen das Amt des Rektors. Sofern sich eine Constitutio adiecta auf eine vorhergehende Konstitution bezieht, wird genau angegeben, auf welche Bestimmung sie Bezug nimmt: Kapitel 1 der Constitutiones adiectae von Albornoz verweist auf die „constitucio situata in sexto libro constitutionum nostrarum, sub rubrica: „de appellatione", que incipit: „antiquis constitucionibus ut plurimum iacturam inferat et gravamen" " 4 1 ° , Kapitel 2 der Constitutiones adiectae auf die Konstitution „contenta in dicto libro constitucionum nostrarum, maxime ilia que incipit: „quia invenimus quam plures, situata in quarto libro" " 4 n . Kapitel 4 der Constitutiones adiectae bezieht sich auf die Konstitution „in tercio capitulo quarti libri constitutionum per nos editarum, que incipit: „ne maleficia occultentur" 6 6 4 1 2 , Kapitel 7 der Constitutiones adiectae auf „constitucionem illam, situatam in sexto libro constitucionum nostrarum, que incipit: „bone memorie etc." " 4 1 3 und schließlich Kapitel 9 der Constitutiones adiectae auf die „constitutionem illam situatam in secundo libro constitucionum nostrarum, que incipit: „executorum multitudinem" " 4 1 4 . 407 ff. Dilcher, Art. „Melfi, Konstitutionen von" in: HRG, Bd. 3 (1984), Sp. 470-476 (470 und 472). 408 Constitutiones adiectae (P. Sella, Cost., S. 236 bis 244). 409 Constitutiones adiectae von Albornoz, Kapitel 1 (P. Sella, Cost., S. 237 Zeile 2 bis
4). 410
Constitutiones adiectae von Albornoz, Kapitel 1 (P. Sella, Cost., S. 237 Zeile 11 bis
13). 411
18). 412
Constitutiones adiectae von Albornoz, Kapitel 2 (P. Sella, Cost., S. 238 Zeile 16 bis Constitutiones adiectae von Albornoz, Kapitel 4 (P. Sella, Cost., S. 239 Zeile 24 bis
25). 413
Constitutiones adiectae von Albornoz, Kapitel 7 (P. Sella, Cost., S. 241 Zeile 20 bis S. 242 Zeile 2). 414 Constitutiones adiectae von Albornoz, Kapitel 9 (P. Sella, Cost., S. 242 Zeile 29 bis 30).
6. Die Fortentwicklung der Aegidianischen Konstitutionen
83
I n der Folgezeit blieb es jedoch nicht bei diesen Zusatzkonstitutionen des A l b o r n o z . Vielmehr kamen ständig neue Novellen v o n Päpsten u n d Legaten zu den Aegidianischen K o n s t i t u t i o n e n hinzu. Diese Constitutiones adiectae w u r den i n der fast chronologischen Reihenfolge ihrer Verfasser u n d ihres jeweiligen Erlasses, aber ohne systematische Ordnung, i m Anschluß an Buch V I immer wieder hinten angefügt. A u s diesem Grunde werden die Constitutiones adiectae i n dem Codex Vaticanus latinus 11 498 sogar als „liber V I I " bezeichnet 4 1 5 . Der erste Legat, der nach A l b o r n o z einige Novellen zu den Aegidianischen K o n s t i t u t i o n e n erließ, war K a r d i n a l Anglico de Grimoard, auch G r i m a l d i d i Grisac genannt. Er entstammte einer angesehenen französischen Adelsfamilie u n d war der jüngere Bruder v o n Guillaume de G r i m o a r d 4 1 6 , der a m 6. 11. 1362 als U r b a n V. den Papstthron bestieg 4 1 7 . 415 Bei diesem Codex handelt es sich um eine Papierhandschrift. Er umfaßt 105 Blätter in moderner Zählung und enthält einige Datierungen, die späteste von 1459. Es handelt sich somit um eine späte Handschrift, die bereits im Zeitalter des Buchdruckes entstanden ist; A. Erler, Albornoz, S. 39ff. — Ausführliche Beschreibungen der von den Aegidianischen Konstitutionen überlieferten Handschriften bei A. Erler, Albornoz, S. 36 bis 43; B. Brandi, Le Constitutiones S. M. Ecclesiae del cardinale Egidio Albornoz, in: Bollettino dell' Istituto Storico Italiano, Nr. 6 (1888), S. 37 bis 61 (40 ff.); ders., Nuovi manoscritti delle „Constitutiones Aegidianae", in: Bollettino dell' Istituto Storico Italiano, Nr. 10 (1891), S. 17 bis 29; L. Zdekauer, Sui frammenti di due manoscritti delle Costituzioni Egidiane nell' Archivio Notarile di Macerata, in: Archivio Giuridico „F. Serafini", Nuova Serie Vol. IV. (1899), S. 347 bis 351; P. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 441 ff.; vgl. D. Cecchi, Le Costituzioni albornoziane e la loro validità in un documento del 1479, in: Studia Albornotiana X I I I (1973), S. 123 bis 154; J. Ruysschaert, Les manuscrits vaticans des „Constitutiones Aegidianae": Jalons pour leur histoire, in: Studia Albornotiana X I I I (1973), S. 155 bis 160. Die erste gedruckte Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen erschien 1473 in Jesi, die zweite 1481 in Perugia. Es handelt sich hierbei um Wiegendrucke. Es folgten sodann die Ausgaben von Perugia 1502, Forlì 1507, Perugia 1522, Faenza 1524 und Venedig 1540. Es sind dies die prä-carpensischen Ausgaben der Aegidianischen Konstitutionen. Die carpensischen Ausgaben sind die von Rom 1543-1545 und Venedig 1571 mit den reichen Anmerkungen von Gaspare Cavallini; diese Ausgabe hat vier Neuauflagen gefunden: Venedig 1572,1585,1588 und 1605. Eine ausführliche Beschreibung dieser Drucke findet sich bei F. Raffaelli, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, bibliotecnicamente descritte in tutte le loro edizioni, in: Archivio storico per le Marche e Γ Umbria, Bd. I (1884), S. 82 bis 99, und Bd. I I (1885), S. 63 bis 102; C. Chelazzi, Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani, dal medioevo fine del secolo 18 der Biblioteca del Senato della Repubblica, Vol. IV, S. 214ff.; B. Brandi, Le Constitutiones S. M. Ecclesiae del cardinale Egidio Albornoz, in: Bollettino dell' Istituto Storico Italiano, Nr. 6 (1888), S. 37 bis 61 (46ff.); A. Erler, Albornoz, S. 36f.; Gesamtkatalog der Wiegendrucke, hrsg. von der Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Bd. I, S. 400; P. Colliva, II cardinale Albornoz, S. 494 ff. 416
G. Franceschini, Il cardinale Anglico Grimoard e la sua opera di legato nella regione Umbro-Marchigiana, in: Bollettino della Deputatione di Storia Patria per l'Umbria, LI, 1954, S. 45-72 (46); A. Ciacconio, Vitae et res gestae pontificium romanorum et S.R.E. cardinalium, Bd. I I (1677), Sp. 561; L. Cardella, Memorie storiche de'cardinali, Bd. 2, S. 208 f. 417 H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Urban V.", S. 316. 6*
84
II. Teil: Die Aegidianischen Konstitutionen
A m 18. 9. 1366 wurde Anglico de Grimoard zum Kardinalpriester von San Pietro in Vincoli kreiert und kurz darauf zum Kardinalbischof von Albano erhoben 418 . Nach dem Tode von Albornoz erhielt er als dessen Nachfolger am 15. 11. 1367 die Vollmachten eines Vicarius Generalis in allen Gebieten des Kirchenstaates 419 . Auf Grund dieser Vollmachten erließ Anglico de Grimoard drei Zusatzkonstitutionen zu dem Gesetzbuch von Albornoz, von denen die ersten beiden am 1. 12. 1369 in Rom und die letzte am 12. 12. 1369 in Bologna promulgiert wurden 4 2 0 . Sie tragen die Überschrift „Constitutiones domini Albanensis". Jeder dieser drei Constitutiones adiectae ist eine kurze Rubrica vorangestellt. Das erste und das dritte Kapitel, in dem eine Bestimmung von Albornoz über die Mitgift aufgehoben wird, beginnen mit der Intitulatio „Anglicus miseratione divina episcopus Albanensis terrarum et provinciarum sanctae romanae ecclesiae, citra regnum Siciliae, in Italia consistentium, vicarius generalis" 421 . Als nächstes folgen die „Constitutiones domini Petri cardinalis legati". Es handelt sich hierbei um 6 Konstitutionen des französischen Kardinals Pierre d'Estaing, auch Petrus de Stagno oder de Stanno genannt, die die Seitenüberschrift CON. DO. PE. tragen 422 . Pierre d'Estaing, der aus einer alten französischen Fürstenfamilie stammte, wurde am 7. 6. 1370 von Papst Urban V. zum Kardinalpriester mit dem Titel von S. Maria in Trastevere ernannt und am 17. 1. 1372 von dessen Nachfolger, Papst Gregor XI., mit dem Amt des Vicarius Generalis in der Romagna und der Mark Ancona betraut 423 . Demgemäß lautet die Intitulatio, die das erste Kapitel seiner Constitutiones adiectae einleitet, „Petrus miseratione divina tituli sanctae Mariae in transtiberim presbyter Cardinalis, in nonnullis provinciis, & terris sanctae romanae ecclesiae in Italia consistentibus, pro domino nostro Papa & ipsa ecclesia vicarius generalis" 424 .
418 G. Franceschini, Il cardinale Anglico Grimoard e la sua opera di legato nella regione Umbro-Marchigiana, in: Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, LI, 1954, S. 45-72 (46 und 49). 419 Die Ernennungsbulle Papst Urbans' V. ist abgedruckt bei A. Theiner, Codex diplomaticus, Bd. I I Nr. 431; P. Compagnoni, La reggia Picena, Teil I, S. 227f. 420 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 48b bis 49a; vgl. auch A. Erler, Albornoz, S. 40; P. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 479; R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 17. 421 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 48 b Zeile 23 bis 25 und S. 49a Zeile 8 bis 9. 422 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 49 a ff. 423 R. Darricau, Art. „Estaing (Pierre d')", in: Dictionnaire de biographie française, Bd. 13 (1975), Sp. 65-67; A. Ciacconio, Vitae et res gestae pontificium romanorum et S.R.E. cardinalium, Bd. I I (1677), Sp. 571-572; L. Cardella, Memorie storiche de' cardinali, Bd. 2, S. 224f.; P. Compagnoni, La reggia Picena, Teil I, S. 232. 4 Const, adiectae, Venedig 1540, S. a Zeile bis 4 .
6. Die Fortentwicklung der Aegidianischen Konstitutionen
85
Kapitel 6 seiner Constitutiones adiectae, das sich auf Kapitel 3 der Constitutiones adiectae von Albornoz bezieht, schließt mit dem Hinweis, daß diese sechs Zusatzkonstitutionen am 8. 7. 1373 in Bologna promulgiert wurden 4 2 5 . Hieran schließen sich die „Constitutiones decern edite per reverendissimum dominum Gabrielem tituli sancti Clementis presbyterum Cardinalem Senensem Marchie Anconitane & pro sanctissimo domino nostro Martino Papa V. & ecclesia legatum" 4 2 6 . Es sind dies die Zusatzkonstitutionen von Gabriel Condulmer, dem späteren Papst Eugen I V . 4 2 7 . Gabriel Condulmer, ein Neffe Papst Gregors XII., erhielt am 9. 5. 1408 von Papst Martin V. den Kardinalspurpur. A m 3. 1. 1420 wurde er zum „Vicarius in temporalibus" mit den Vollmachten eines Legaten de latere in der Mark Ancona ernannt 428 . Seine Konstitutionen, die zumeist mit „Item" beginnen, wurden am 6. 11. 1420, am Fest des heiligen Leonhard, „lectae & approbate in generali parlamento omnium provincialium in civitate Ancone celebrato" 429 . Eine weitere Konstitution wurde am 8. 10. 1422, ebenfalls in Ancona, verkündet 430 . Ähnlich wie in Buch V I Kapitel 27 der Aegidianischen Konstitutionen wird in einem abschließenden Kapitel vom 3. 12. 1420 unter der Rubrica „De robore dictarum constitutionum" die allgemeine Verbreitung und Bekanntmachung dieser Zusatzkonstitutionen des Gabriel Condulmer „etiam in vestrorum statutorum volumine" durch Pietro da Force, locumtenens thesauriae & camerae romanae ecclesiae, angeordnet 431 . Diese Anordnung wird ebenso wie diejenige in Buch V I Kapitel 27 der Aegidianischen Konstitutionen von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi später gestrichen.
425
Const, adiectae, Venedig 1540, S. 50 a Zeile 32 bis 34. Const, adiectae, Venedig 1540, S. 49 b Zeile 16 bis 18. 427 Gabriel Condulmer wurde am 3. 3. 1431 zum Papst gewählt und am 11. 3. 1431 als Eugen IV. gekrönt; näheres über ihn bei H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Eugen IV.", S. 60ff. 428 C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 2, S. 4 und S. 4 Fn. 6; L. Cardella, Memorie storiche de' cardinali, Bd. 2, S. 342; H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Eugen IV.", S. 60; P. Compagnoni, La reggia Picena, Teil I, S. 307; P. Partner, The Papal State under Martin V., S. 109. 426
429
Const, adiectae, Venedig 1540, S. 49b Zeile 18 bis 20. — Da Gabriel Condulmer bereits 1420 diese Konstitutionen als Legat der Mark Ancona erlassen hat, ist die Angabe bei L. Cardella, Memorie storiche de' cardinali, Bd. 2, S. 342, nach der dem Kardinal erst 1424 die Legation in der Mark Ancona übertragen worden sei, unrichtig. 430 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 50a Zeile 53 und 54; vgl. auch R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 18. Die Konstitutionen des Gabriel Condulmer stehen in der Ausgabe Venedig 1540 nicht geschlossen beieinander. Vielmehr werden sie entgegen der chronologischen Reihenfolge von einigen Constitutiones adiectae des Albornoz sowie den Constitutiones adiectae von Anglico de Grimoard u. Pierre d'Estaing unterbrochen. 431 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 50a Zeile 55 bis S. 50 b Zeile 22.
86
II. Teil: Die Aegidianischen Konstitutionen
Die Constitutiones adiectae des Gabriel Condulmer, die die Seitenüberschrift CON. DO. GAB. tragen, beginnen zumeist mit „Item". Anders als bei den Zusatzkonstitutionen von Albornoz ist bei ihnen nicht angegeben, auf welche Bestimmung der Aegidianischen Konstitutionen sie sich beziehen. Eine Ausnahme bildet lediglich Kapitel 3, das auf die Vorschrift „in quarto libro de rap tu mulierum" verweist 432 . Im Anschluß hieran beginnen die „Constitutiones Reverendissimi domini Bononiensis", denen ein Prooemium, beginnend mit der Intitulatio „Philippus miseratione divina tituli sanctae Susanne presbyter Cardinalis Bononiensis in provincia Marchiae Anconitanae pro sancta romana ecclesia & sanctissimo domino nostro domino Nicolao Papa quinto, apostolicae sedis legatus", vorangestellt ist 4 3 3 . Zweifelhaft ist, wer sich hinter diesem Titel verbirgt. So könnte es sich um Kardinal Philippus Carafa aus dem alten neapolitanischen Adelsgeschlecht der Carafa handeln, der allgemein „cardinalis bononiensis" genannt wurde und am 28. 9. 1378 von Papst Urban VI. das Amt des Legaten „in Lombardiae et Marchiae Trivisanae partibus" erhielt 434 . Da Philippus Carafa jedoch nie Kardinalpriester mit dem Titel von S. Susanna in Rom war 4 3 5 , kann er hier nicht gemeint sein. Ebenso ist auch die Annahme von Paolo Colliva 436 unrichtig, es handele sich um Kardinal Philippus de Rufinis. Zwar erhielt dieser bei seiner Ernennung zum Kardinalpriester am 28. 9. 1378 den Titel der römischen Kirche S. Susanna 437 . Entgegen den Angaben von Paolo Colliva 438 wurde Philippus de Rufinis aber nie „dominus Bononiensis" genannt. Zudem schließt auch der Hinweis in dem Prooemium dieser Constitutiones adiectae auf Nikolaus V., der am 6. 3. 1447 zum Papst gewählt worden w a r 4 3 9 , sowohl Kardinal Philippus Carafa als auch Kardinal Philippus de Rufinis aus. Es kann sich daher nur um Philippus Calandrini di Sarzana, Bischof von Bologna handeln, der am 20. 12. 1448 von 432
Const, adiectae, Venedig 1540, S. 46 (auf Grund eines Druckfehlers als S. 49 angegeben) b Zeile 42. 433 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 50 b Zeile 23 bis 26. 434 A. Strnad, Art. „Carafa, Philippo", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 19 (1976), S. 545-547 (546); vgl. auch C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 1, S. 22, L. Car della, Memorie storiche de' cardinali, Bd. 2, S. 281 ff., und A. Ciacconio, Vitae et res gestae pontificium romanorum et S.R.E. cardinalium, Bd. I I (1677), Sp. 647f. 435 Philippus Carafa erhielt am 28. 9. 1378 als Kardinalpriester den Titel der römischen Kirche S. Martino ai Monti, so Α. Strnad, Art. „Carafa, Philippo", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 19 (1976), S. 545-547 (546) und C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 1, S. 22. 436
P. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 475 und 480. C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 1, S. 22; A. Ciacconio, Vitae et res gestae pontificium romanorum et S.R.E. cardinalium, Bd. I I (1677), Sp. 644; L'Abbé Migne, Dictionnaire des Cardinaux, Sp. 1485. 438 P. Colliva, I l cardinale Albornoz, S. 475 und 480. 439 H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Nikolaus V.", S. 228. 437
6. Die Fortentwicklung der Aegidianischen Konstitutionen
87
Papst Nikolaus V., seinem Halbbruder, zum Kardinalpriester mit dem Titel von S. Susanna erhoben worden war 4 4 0 . Im Jahre 1450 wurde er zum Legat der Mark Ancona ernannt 441 . Während seiner Legation erließ Philippus Calandrini 21 Zusatzkonstitutionen zu dem Gesetzbuch des Albornoz. Eine weitere Zusatzkonstitution, die am 1.1. 1450 in Macerata verkündet wurde, bildet Kapitel 22 seiner Constitutiones adiectae. Diese betreffen den Zivil- und Strafprozeß, aber auch die Bestrafung der Verbrecher. Zumeist wird in den Zusatzkonstitutionen des Philippus Calandrini angegeben, auf welche Bestimmung der Aegidianischen Konstitutionen sie Bezug nehmen und welche konkrete Vorschrift abgeändert oder klargestellt werden soll. Dies geschieht jedoch nicht durch die Nennung des jeweiligen Buches und Kapitels, sondern durch die Wiedergabe der Rubrica und der Einleitungsformel der betreffenden Konstitution. So heißt es z. B. in Kapitel 11 der Constitutiones adiectae des Philippus Calandrini: „Constitutioni sub rubrica forma qualiter procedatur super appellationibus incipit sancimus. A d declarationem eius . . . 4 4 4 4 2 (dies ist Buch V I Kapitel 6 der Aegidianischen Konstitutionen) und in Kapitel 12 seiner Constitutiones adiectae: „Constitutioni sub rubrica de appellationibus interponendis, que incipit: quia per appellationum. Addendo volumus . , . " 4 4 3 . Es handelt sich hierbei um Buch V I Kapitel 8 der Aegidianischen Konstitutionen. Bemerkenswert ist auch, daß sich die Kapitel 11 und 22 der Constitutiones adiectae des Philippus Calandrini auf die Constitutiones adiectae des Kardinals Pierre d'Estaing beziehen. Auf die Constitutiones adiectae von Kardinal Philippus Calandrini folgen diejenigen des „reverendissimi domini Papiensis." Es sind dies die Zusatzkonstitutionen von Johannes de Castillione (Castiglione), den Papst Kalixtus III. am 17. 12. 1456 zum Kardinalpriester mit dem Titel von S. demente kreierte. Zugleich erhielt er die Erlaubnis, das Episkopat von Pavia beizubehalten. Im Jahre 1458 wurde Johannes de Castillione von Papst Pius II. zum päpstlichen Legaten in der Mark Ancona ernannt 444 . Demgemäß lautet die Intitulatio in dem Prooemium, das auch seinen Constitutiones adiectae vorangestellt ist, folgendermaßen: „Joannes de Castelliono miseratione divina tituli sancti Clementis presbyter Cardinalis Episcopus Papiensis & 440 C. Gennaro, Art. „Calandrini, Filippo", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 16 (1973), S. 450-452 (450); C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 2, S. 11; L'Abbé Migne, Dictionnaire des Cardinaux, Sp. 609-610. 441 C. Gennaro, Art. „Calandrini, Filippo", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 16(1973), S. 450-452 (450); L'Abbé Migne, Dictionnaire des Cardinaux, Sp. 609-610. 442 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 51b Zeile 30 bis 31. 443 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 52 a Zeile 5 bis 6. 444 E. Petrucci, Art. „Castiglioni, Giovanni", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 22 (1979), S. 156-158 (157): L'Abbé Migne, Dictionnaire des Cardinaux, Sp. 643; L. Cardella, Memorie storiche de' cardinali, Bd. 3, S. 129; C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 2, S. 12; A. Ciacconio, Vitae et res gestae pontificium romanorum et S.R.E. cardinalium, Bd. I I (1677) Sp. 994.
88
II. Teil:
ie Aegidianischen Konstitutionen
provincie Marchie Anconitane massetrabarie & presidatus Farfensis & nonnullorum aliorum locorum de latere legatus, & in spiritualibus, & in temporalibus vicarius generalis, necnon gentium armorum sanctissimi domini nostri Pii divina Providentia Pape secundi & sanctae romanae ecclesiae dux, & commissarius generalis" 445 . Johannes de Castillione erließ eine seiner Zusatzkonstitutionen am 19. 10. 1458, eine andere wurde am 5. 4. 1459 in Macerata erlassen. Seine weiteren 17 Constitutiones adiectae „fuerunt rogati in anno domini M.CCCC.LIX. inditione sexta & die. XI. mensis novembris in publica audientia palatii civitatis Macerate" 446 . Sie handeln unter anderem von dem Rektor und seinen Beamten, von den Verbrechern und den Verbannten sowie von der Appellation. Ein Kapitel trägt die Rubrica „De robore constitutionum praedictarum" 447 . Die meisten seiner Zusatzkonstitutionen beginnen jeweils mit „Item". Sie geben genau an, auf welches Kapitel der Aegidianischen Konstitutionen sie sich beziehen. So beginnt z. B. Kapitel 1 der Constitutiones adiectae von Johannes de Castillione, das die Rubrica „De vita & honestate Rectoris" trägt, wie folgt: „ I n primis constitutioni Egydii sub rubrica de vita & honestate & habitu rectoris & suorum officialium in secundo libro constitutionum que incipit quia ut iura testantur. Addimus ... 4 4 4 4 8 . Der Anfang von Kapitel 2 lautet „Item constitutioni de officio marescalli. Addendo statuimus . . . 4 4 4 4 9 oder derjenige von Kapitel 10 „Item constitutioni de responsione fienda positionibus in quinto libro 4 4 4 5 0 . Zwei der Zusatzkonstitutionen von Johannes de Castillione, die Kapitel 6 und 8, nehmen auf die Zusatzkonstitutionen eines Vorgängers Bezug, nämlich auf die des domini Bononiensis, also von Kardinal Philippus Calandrini. In Kapitel 6 der Constitutiones adiectae heißt es danach: „Item constitutioni de sindicatu officialium. Addendo declaramus sub constitutione praedicta includi ... Addentes etiam constitutionibus Reverendissimi domini Bononiensis in eo, ... 4 4 4 5 1 und in Kapitel 8: „Item constitutioni forma qualiter procedatur. Et constitutioni de appellationibus interponendis in sexto libro & additionibus quo ad dictas constitutiones Reverendissimi domini Bononiensis, tunc in eadem provincia legati de latere ... 4 4 4 5 2 . Das bedeutet, Kapitel 8 der Constitutiones adiectae des Johannes de Castillione bezieht sich auf Buch V I Kapitel 9 und 12 der Aegidianischen Konstitutionen sowie auf Kapitel 11 und 12 der Constitutiones adiectae des Philippus Calandrini. 445 446 447 448 449 450 451 452
Const, Const, Const, Const, Const, Const, Const, Const,
adiectae, adiectae, adiectae, adiectae, adiectae, adiectae, adiectae, adiectae,
Venedig Venedig Venedig Venedig Venedig Venedig Venedig Venedig
1540, 1540, 1540, 1540, 1540, 1540, 1540, 1540,
S. 53 a Zeile 38 bis 42. S. 53 b Zeile 1 und 2. S. 55b Zeile 53. S. 53 b Zeile 4 bis 5. S. 53 b Zeile 11. S. 54b Zeile 48. S. 54a Zeile 2 und Zeile 22. S. 54a Zeile 35 bis 37.
6. Die Fortentwicklung der Aegidianischen Konstitutionen
89
Schon an dieser Stelle läßt sich erkennen, welch eine unübersichtliche Gesetzeslage zu der Zeit Rodolfo Pios bestand und wie bedeutend seine Leistung war, all dies zu sichten und zu bereinigen, zumal sich die Zusatzkonstitutionen einiger Verfasser nicht nur auf das Gesetzeswerk des Albornoz selbst, sondern auch auf die Zusatzkonstitutionen ihrer Vorgänger bezogen und damit die Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen zum Teil wiederum abänderten. Doch auch nach den Constitutiones adiectae des Johannes de Castillione folgten noch zahlreiche Zusatzkonstitutionen weiterer Verfasser. So kommt als nächstes unter Kapitel 20 die Bulle „ A d retinendas" von Papst Pius 7/. 4 5 3 gegen die Mörder, Banditen und wegen Mordes Verurteilten vom 28. 2. 1461 454 . Unmittelbar daran schließt sich eine Constitutio seines Nachfolgers Papst Paul 7/. 4 5 5 vom 15. 9. 1465, die in Form eines Briefes an Kardinal Latino Orsini, Bischof von Albano und apostolischer Legat in der Mark Ancona 4 5 6 , abgefaßt ist 4 5 7 . Der Papst befiehlt darin, die Konstitutionen der Mark Ancona zu befolgen. Hierauf folgt ein Breve von Papst Paul II. an Marino Orsini, Erzbischof von Tarent und Gubernator der Mark Ancona vom 12. 5. 1466 458 , in dem der Papst anordnet, seine Bulle vom 18. 3. 1466 „super muneribus non recipiendis" zu veröffentlichen. Nach diesem Breve ist die vorbezeichnete Bulle, die mit den Worten „Munera exercere" beginnt, vollständig wiedergegeben 459. Daran anschließend findet sich ein Vermerk, daß die zuvor genannten Bullen am 28. 5. 1466 „publicatae & lectae fuerunt ... in civitate Maceratae in audientia publica , . . " 4 6 0 . 453 Enea Silvio Piccolomini wurde am 19. 8. 1458 zum Papst gewählt und am 3. 9. 1458 als Pius II. gekrönt. Er war einer der bedeutendsten Humanisten auf dem Papstthron und hat als Gelehrter und Schriftsteller sein Jahrhundert wesentlich beeinflußt. 1444 schrieb er seine berühmte und vielgelesene Liebesnovelle „Euryalus und Lukrezia" ganz im höfischweltlichen Stil der Zeit. Näheres über ihn bei H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Pius II.", S. 260 bis 262; Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, S. 214; H. Kühner, Das Imperium der Päpste, S. 230 bis 233. 454
Const, adiectae, Venedig 1540, S. 56b Zeile 34. Pietro Barbo, Nepot Eugens IV. wurde am 30. 8. 1464 zum Papst gewählt und am 16. 9. 1464 als Paul II. gekrönt. Seine bekannte Freigiebigkeit und Prunkliebe wogen in keiner Weise das literarisch gebildete Flair seines Vorgängers auf, zumal Paul II. noch nicht einmal das Latein beherrschte. Durch seine Förderung entstand jedoch die erste Buchdruckerei in Rom; vgl. H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Paul II.", S. 242 f.; H. Kühner, Das Imperium der Päpste, S. 233 bis 235. 455
456 Latino Orsini, der aus dem gleichnamigen berühmten Adelsgeschlecht stammte, wurde am 20. 12. 1448 von Papst Nikolaus V. in den Kardinalsrang erhoben und von Papst Paul II. zum Legaten der Mark Ancona ernannt. Ausführlich über Latino Orsini bei L. Cardella, Memorie storiche de* cardinali, Bd. 3, S. l l l f . ; C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 2, S. 11 ; A. Ciacconio, Vitae et res gestae pontificium romanorum et S. R. E. cardinalium, Bd. I I (1677), Sp. 971. 457 458 4
Const, adiectae, Venedig 1540, S. 57 b Zeile 10. Const, adiectae, Venedig 1540, S. 57 b Zeile 28, 29. Const, adiectae, Venedig 1540, S. 5 Zeile bis 5 .
II. Teil: Die Aegidianischen Konstitutionen
90
A n dieser Stelle endet die erste Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen von Jesi aus dem Jahre 1473 4 * 1 . Daraus erklärt sich wohl, daß in den folgenden Ausgaben der Aegidianischen Konstitutionen die Zählung der Kapitel wieder von vorne beginnt. Die nun folgende Bulle von Papst Paul II. vom 1.3. 1467, die die Rubrica „De bonis ecclesiae non alienandis" trägt und mit den Worten „Ambitiöse cupiditati" beginnt, wird daher als Kapitel 1 bezeichnet 462 . Die unter Kapitel 2 wiedergegebene, ebenfalls von Papst Paul II. herrührende Bulle mit der Rubrica „Executoria supradictarum bullarum" müßte bei einer strengen chronologischen Reihenfolge schon zuvor aufgeführt sein, da sie vom 11.5. 1465 datiert ist 4 * 3 . Es folgen nun in den Kapiteln 3 bis 8 mehrere Breven und Bullen von Sixtus' IV., der am 9.8. 1471 als Nachfolger Pauls II. zum Papst gewählt wurde 4 6 4 . Das erste Breve verfügt gleichsam die Einführung des Podestà von Fabriano und ist datiert aus Foligno vom 27. 9. 1476 4 6 4 a . Unmittelbar im Anschluß daran beginnt ein Schreiben des bereits erwähnten Marino Orsini, nunmehr Kardinalbischof von Tusculum und päpstlicher Kämmerer, vom 6. 6. 1477, mit dem er die Bulle Sixtus' IV. „De non visitando terras nisi semel aut bis ex causa & prohibitione sportularum ad certam usque metam" vom 7. 7. 1472, die mit den Worten „Sicut nostris" beginnt, mitteilt 4 0 5 . In Kapitel 5 kommt eine Bulle Sixtus' IV. vom 21. 6. 1477, die an die beiden Kommissare Johannes Andreas de Gemaldis und Silvester de Maluicini gerichtet ist und eine Untersuchung über den Verlauf der Regierung in der Mark Ancona und der Romagna auferlegt 466 . Es folgt ein Breve Sixtus' IV. vom 2. 9. 1477 „Maximi omnibus potentatibus Italiae quibus de causis movit se contra comitem Carolum" 4 6 7 . Hier schließt sich eine sehr umfangreiche Bulle Sixtus' IV. vom 30. 5. 1478 „Super reformatione cancellane legati rectoris & thesaurarii & observatione constitutionum & prohibitionum..." a n 4 6 8 . Soweit sich diese Bulle 460
Const, adiectae, Venedig 1540, S. 58 a Zeile 57 bis 59. R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 20. 462 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 58b Zeile Iff. 463 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 58 b Zeile 34ff. und S. 59 a Zeile 5 bis 6. 464 Sixtus IV. entstammte der verarmten adeligen Familie der della Rovere und hat die päpstliche Würde nicht ohne Bestechung erhalten. In einem schrankenlosen Nepotismus überschüttete er seine Familie mit Würden und Gütern. Dies führte zu Zerwürfnissen mit den italienischen Staaten und auch zu Unruhen im Kirchenstaat. Die kurialen Finanzen wurden durch häufige Ablässe, Erhöhung der Pfründenbesteuerung und Vermehrung der käuflichen Ämter aufgestockt; J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, S. 98 f.; H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Sixtus IV.", S. 297f., L. v. Ranke, Die Geschichte der Päpste, S. 28 f. 461
4643 465 466 467
Const, adiectae, Venedig 1540, S. 59 a Zeile 7 und Zeile 21 bis 22. Const, adiectae, Venedig 1540, S. 59 a Zeile 23 bis S. 59 b Zeile 30 und 40 sowie 41. Const, adiectae, Venedig 1540, S. 59b Zeile 42 bis S. 60a Zeile 33. Const, adiectae, Venedig 1540, S. 60 a Zeile 36 bis S. 60b Zeile 45.
6. Die Fortentwicklung der Aegidianischen Konstitutionen
91
auf einzelne Bestimmungen der Aegidianischen Konstitutionen bezieht, ist auch hier das entsprechende Kapitel angegeben. So heißt es z.B. ... Et dictae constitutioni secundi libri sub rubrica quarta, de vita, & honestate, ac habitatione rectoris & suorum officialium dum prohibet familiares rectorum & gubernatorum familiaritate durante, & ea finita infra annum ad aliquod officium assumi, eadem auctoritate adiicimus . . . t < 4 6 9 oder „ . . . i n constitutione secundi libri praedicti sub rubrica de viagiis iudicum officialium & maiorum commissionum salaria ut accepimus frequenter exceduntur, inhibemus legatis..."470. Die letzte, in Kapitel 8 wiedergegebene Bulle Sixtus' IV. vom 28. 4. 1480 trägt die Rubrica „Contra homicidas" und beginnt mit den Worten „Deo & hominibus abhominabiles" 471 . I m Anschluß daran folgt unter Kapitel 9 das Mandat des Angelo Lupi de Cavis, Bischof von Tivoli und locumtenens in der Mark Ancona 4 7 2 vom 27. 10. 1480, die vorbezeichnete Bulle Sixtus IV. zu veröffentlichen und zu befolgen 473 sowie das Mandat der „magnificorum dominorum priorum" von Fabriano an die „publicos banditores" zur Veröffentlichung dieser Bulle mit der „relatio dictae publicationis" 474 . A n dieser Stelle müßte die erste Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen von Perugia von 1481 enden 475 , da die nun folgenden Constitutiones adiectae wiederum mit Kapitel 1 beginnen. Zunächst kommt ein Breve von Papst Sixtus IV. vom 17. 12. 1477 476 „De cautione praestanda per appellantes a condemnationibus camerae apostolicae" 4 7 7 . Sodann folgt ein Dekret des bereits erwähnten Angelo Lupi de Cavis vom 8. 6. 1475 „super offensis officialium per iudices curiae generalis, & per alium cognoscendis" 478 mit der „Confirmatio supra dicta decreti" durch Sixtus IV. vom 17. 12. 1478 479 . Unter Kapitel 3 ist eine weitere Bulle Sixtus' IV. vom 30. 5. 1478 wiedergegeben 480. 408 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 60b Zeile 46 bis S. 62a Zeile 23. Diese Bulle ist auch abgedruckt bei A. Theiner, Codex diplomaticus, Bd. I I I Nr. 317. 460
Const, adiectae, Venedig 1540, S. 61a Zeile 59 bis S. 61b Zeile 2. Const, adiectae, Venedig 1540, S. 61b Zeile 23 bis 25. 471 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 62a Zeile 24 und 25 sowie S. 63 a Zeile 20 und 21. 472 Angelo Lupi de Cavis war Doktor beider Rechte. Er war u. a. auch Gubernator von Perugia; C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 2, S. 275 Fn. Tiburtin. 1 und S. 291. 473 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 63 a Zeile 22 bis 43. 474 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 63 a Zeile 44 bis S. 63 b Zeile 8. 475 R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 21. 476 Soweit in den Const, adiectae, Venedig 1540, S. 63 b Zeile 25 das Jahr M C C C C L X X X V I I . angegeben ist, handelt es sich um einen Druckfehler, da Sixtus IV. bereits am 12. 8. 1484 verstorben ist; H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung, S. 128; vgl. auch R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 21 und S. 21 Fn. 22. 470
477 478
Const, adiectae, Venedig 1540, S. 63 b Zeile 10. Const, adiectae, Venedig 1540, S. 63b Zeile 26 und 27 sowie S. 64a Zeile 27 und 28.
92
II. Teil:
ie Aegidianischen Konstitutionen
Auch an dieser Stelle wird wieder deutlich, wie unübersichtlich die Gesetzeslage wegen des fortwährenden Anfügens weiterer Constitutiones adiectae an Buch V I zu der Zeit Rodolfo Pios gewesen sein muß und welch bedeutende Aufgabe ihm oblag, dies zu überarbeiten und das geltende Recht von dem überflüssigen zu scheiden. Kardinal Rodolfo Pio da Carpi hatte jedoch nicht nur die bisher aufgeführten Zusatzkonstitutionen zu sichten, vielmehr kamen noch zahlreiche weitere hinzu. Unter Kapitel 4 folgt eine Konstitution des „Agnellus sedis apostolicae prothonotarius camerae clericus ac Marchiae gubernator & vicarius generalis cum potestate legati de latere & c . " 4 8 1 . Diese Constitutio, die allgemein unter der Bezeichnung „Constitutio Angelina" bekannt w a r 4 8 2 , trägt kein Datum. Man weiß jedoch, daß Agnellus im Jahre 1486 sein Amt in der Mark Ancona antrat, während bereits 1487 Giuliano Della Rovere di Savona, Kardinalpriester mit dem Titel von S. Pietro in Vincoli, der spätere Papst Julius II., als Legat in diese Provinz kam 4 8 3 . Diese Konstitution des Agnellus setzt sich aus mehreren Bestimmungen zusammen, die unterschiedliche Rechtsmaterien betreffen, so unter anderem den Zivilprozeß, die Appellation, das Ämterwesen, und oftmals mit „Item" beginnen 484 . Ein Vorläufer hierfür findet sich in den Konstitutionen von Melfi. Auch dort sind in einer Reihe von Konstitutionen in Wirklichkeit mehrere Vorschriften unter einer Zählziffer vereinigt 485 . Als weiteres folgen die Zusatzkonstitutionen des „Joannes episcopus albanensis sanctae romanae ecclesiae Cardinalis Andagavensis in provincia marchiae anconitanae, & nonnullis aliis locis apostolicae sedis legatus, ac pro eadem sancta romana ecclesia in spiritualibus & temporalibus vicarius generalis" vom 15. 12. 1487 486 . Es handelt sich hierbei um den französischen Kardinal Jean Balue (Giovanni Balves). Er wurde am 5. 6. 1467 von Papst Paul II. zum Bischof von Angers ernannt und am 18. 9. 1467 in den Kardinalsrang mit dem Titel der römischen Kirche S. Susanna erhoben 487 . Er wird daher oftmals als „Cardinalis Andegavensis" bezeichnet. A m 31. 1. 1483 wurde er zum Kardinalbishof von Albano ernannt und einige Jahre später als Legat in die Mark Ancona 479 480 481 482 483 484 485
Const, adiectae, Venedig 1540, S. 64a Zeile 17ff. Const, adiectae, Venedig 1540, S. 64a Zeile 29 ff. Const, adiectae, Venedig 1540, S. 64b Zeile 9 und 10. R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 22. R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 22. Z. B. Const, adiectae, Venedig 1540, S. 65 a Zeile 13, 20, 26. H. Dilcher, Art. „Melfi, Konstitutionen von", in: HRG, Bd. 3 (1984), Sp. 470-476
(473). 486
Const, adiectae, Venedig 1540, S. 65 b Zeile 4 bis 6 und S. 65 b Zeile 3; vgl. auch R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 22. 487 P. Paschini, Art. „Balue, Giovanni", in: Enciclopedia Cattolica, Bd. I I (1949), Sp. 761-762 (762); M. Prévost, Art. „Balue, Jean", in: Dictionnaire de biographie française, Bd. 5 (1951), Sp. 16-19 (17); C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 2, S. 15.
6. Die Fortentwicklung der Aegidianischen Konstitutionen
93
e n t s a n d t 4 8 8 . Er verwaltete sein A m t dort sehr erfolgreich, denn es gelang i h m , die ständig wiederkehrende Zwietracht i n dieser Provinz zu schlichten 4 8 9 . Die Zusatzkonstitutionen des Kardinals Balue betreffen zumeist das Ä m t e r wesen. Sie sind i n 13 K a p i t e l unterteilt, denen ein Prooemium vorangestellt ist, u n d beginnen oftmals m i t „ I t e m " oder „Statuimus quoque & o r d i n a m u s " 4 9 0 . D i e erste Zählziffer ist jedoch nicht 1, sondern i n Fortsetzung der vorangegangenen Constitutiones adiectae geht es weiter m i t K a p i t e l 6. N o c h vor dem Prooemium ist unter K a p i t e l 5 ein Breve Papst Innozenz VIII. 491 v o m 15. 12. 1487 wiedergegeben, das die A p p r o b a t i o der K o n s t i t u t i o n e n des Kardinals Balue e n t h ä l t 4 9 2 . I m Anschluß an diese Constitutiones adiectae ist das P r o t o k o l l über deren Veröffentlichung i n Macerata abgedruckt. Dieses enthält den Brief des Johannes Deduc (De Duchis), Bischof v o n C o r o n i n Griechenland u n d locumtenens generalis i n der M a r k A n c o n a v o m 18. 1. 1488, m i t dem die Veröffentlichung der Zusatzkonstitutionen angeordnet u n d sodann die Relatio über die Veröffentlichung selbst angegeben wird493. Es folgt i n K a p i t e l 19 eine K o n s t i t u t i o n des eben erwähnten Johannes Deduc, episcopus Coronensis v o m 1. 5. 1489, „Super celebratione festivitatum & registris f i e n d i s " 4 9 4 , „lecta & publicata i n plena audiencia" i n M a c e r a t a 4 9 5 . 488 P. Paschini, Art. „Balue, Giovanni", in: Enciclopedia Cattolica, Bd. I I (1949), Sp. 761 - 762 (762). Soweit Paschini darin jedoch angibt, daß Kardinal Balue im Jahre 1490 als Legat in die Mark Ancona gegangen sei, ist dies unzutreffend, da der Kardinal zu dieser Zeit bereits Legat gewesen sein muß. Seine Zusatzkonstitutionen wurden nämlich bereits im Jahre 1487 erlassen und nach der Intitulatio seines Prooemiums trägt er bereits zu dieser Zeit den Titel eines Legaten in der Mark Ancona; vgl. Fn. 486. 489 P. Paschini, Art. „Balue, Giovanni", in: Enciclopedia Cattolica, Bd. I I (1949), Sp. 761 - 762 (762). Ausführlich zu Kardinal Balue auch L. Cardella, Memorie storiche de' cardinali, Bd. 3, S. 165ff.; M. Prévost, Art. „Balue, Jean", in: Dictionnaire de biographie française, Bd. 5 (1951), Sp. 16-19; A. Ciacconio, Vitae et res gestae pontificium romanorum et S.R.E. cardinalium, Bd. I I (1677), Sp. 1464 ff. 490
M i t „Item" beginnen ζ. Β. die Kapitel 10,11,12,15,16,17 und 18, mit „Statuimus quoque & ordinamus" ζ. B. die Kapitel 7, 8 und 14 der Zusatzkonstitutionen des Kardinals Balue. 491 Papst Innozenz VIII. wurde 1432 als Sproß der angesehenen Genueser Familie Cibo geboren. A m 29. 8. 1484 wurde er als Nachfolger Sixtus' IV. zum Papst gewählt. Während seines Pontifikats ging es ihm jedoch nur um den Genuß der Macht und um den Erwerb großer Geldmassen. Hatte Sixtus IV. das Geld durch den Verkauf aller geistlichen Gnaden und Würden beschafft, so errichteten Innozenz V I I I . und sein Sohn Franceschetto Cibo eine Bank der weltlichen Gnaden, wo gegen Erlegung von hohen Taxen Pardon für Mord und Totschlag zu haben war. Von jeder Buße kamen 150 Dukaten an die päpstliche Kammer und, was darüber ging, an Franceschetto. Rom wimmelte daher namentlich in der letzten Zeit dieses Pontifikats von protegierten und nicht protegierten Mördern; J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, S. 100f.; H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Innozenz V I I I . " , S. 114f.; vgl. auch N. Machiavelli, Geschichte von Florenz, S. 546. 492 493
Const, adiectae, Venedig 1540, S. 65a Zeile 44 bis S. 65b Zeile 3. Const, adiectae, Venedig 1540, S. 66 b Zeile 29 bis 67 a Zeile 10.
94
II. Teil: Die Aegidianischen Konstitutionen
Anschließend beginnt eine Konstitution von Antonio di Santa Maria da Monte Ferraro, apostolischer Protonotar und Sekretär in der Mark Ancona sowie locumtenens generalis für den Kardinallegaten Johannes Paul Orsini 4 9 6 . Diese Constitutio, in der wiederum mehrere Vorschriften enthalten sind, trägt kein Datum. Man kann dies jedoch ungefähr bestimmen, da Antonio di Santa Maria im Jahre 1493 in der Mark Ancona tätig war und im Jahre 1495 bereits sein Nachfolger, der Evangelist Bagarotti, das Amt des locumtenens inne hatte 4 9 7 . Von ihm stammt denn auch die folgende Konstitution vom 9. 12. 1495, die ebenfalls verschiedene Vorschriften in sich vereint 498 . Anschließend folgt ein Breve von Papst Alexander VI. 499 vom 9. 8. 1493, das am 21. 5. 1495 veröffentlicht wurde und sich auf die Appellation bezieht 500 . In dem folgenden Kapitel 23 sind wiederum Bestimmungen des Evangelisten Bagarotti, „provinciae marchiae Anconitanae locumtenens", wiedergegeben, die am 25. 4. 1495 „lectae & publicatae fuerunt ... in prima audientia" 501 . Die beiden nächsten Kapitel enthalten verschiedene Vorschriften von Papst Alexander VI. in Form von Breven an den locumtenens der Mark Ancona 5 0 2 . Des weiteren ist in Kapitel 26 ein Brief des Kardinaldiakons di S. Giorgio und päpstlichen Kämmerers vom 15. 12. 1500 aufgeführt, der gerichtet ist an die „spectabilis viris procuratoribus & notariis taxatoribus patrociniorum procuratorum curiae generalis Marchiae amicis carissimis" 503 . An dieser Stelle endet die Ausgabe Perugia 1502 der Aegidianischen Konstitutionen 504 . Daher beginnt die Zählung der nun in der Ausgabe Venedig 1540 folgenden Constitutiones adiectae wiederum mit Kapitel 1. Dieses sowie 494
Const, adiectae, Venedig 1540, S. 67 a Zeile 11. Const, adiectae, Venedig 1540, S. 67b Zeile 16 bis 18. 496 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 67b Zeile 23. 497 R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 22. 498 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 68 a Zeile 40 bis S. 68 b Zeile 21. 499 Alexander VI., der am 11. 8. 1492 auf den Päpstlichen Stuhl gelangte, war eine typische Führerpersönlichkeit der Renaissance; begabt und skrupellos, arbeitsam und unermüdlich setzte er sich für die Förderung seiner Familie, aber ebenso der päpstlichen Herrschaft ein. Niccolo Machiavelli sagt in seinem Werk „Der Fürst", S. 80, über ihn, daß er „wie keiner seiner Vorgänger zeigte, welche Überlegenheit ein Papst durch Geld und Waffengewalt erringen konnte". Wenn er damit auch nicht die Größe der Kirche, sondern die seines Sohnes, des Herzogs Cesare Borgia bezweckte, kam, was er tat, doch der Kirche zugute, die nach seinem Tode und dem Untergang von Cesare Borgia die Früchte seiner Mühen erntete. So N. Machiavelli, Der Fürst, S. 80; J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, S. 102f.; H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Alexander VI.", S. 20f., L. v. Ranke, Die Geschichte der Päpste, S. 29 ff. 500 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 68b Zeile 22ff. 501 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 69 a Zeile 1 bis 54. 502 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 69a Zeile 55 und S. 70a Zeile 13. 503 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 70 a Zeile 32. 504 R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 23. 495
6. Die Fortentwicklung der Aegidianischen Konstitutionen
95
die K a p i t e l 2 u n d 3 enthalten Breven v o n Papst Julius II., der a m 31. 10. 1503 als Nachfolger Alexanders V I . a u f den Päpstlichen Stuhl gelangte 5 0 5 . Das erste, das „ D e cessionibus b o n o r u m & indutiis quinquem i n curiam R o m a n a m obten." handelt, ist datiert v o m 8. 9. 1 5 0 7 5 0 6 . K a p i t e l 2 trägt die Rubrica „ C o n t r a homicidas" u n d ist i n F o r m eines Briefes an A n t o n i o Flores, Erzbischof v o n A v i g n o n u n d Gubernator der M a r k A n c o n a 5 0 7 , v o m 29. 12. 1510 abgefaßt 5 0 8 . K a p i t e l 3 schließlich enthält ein Breve Julius I I . v o m 16. 6. 1506, das an Niccolo Calcaneo, einem Beamten der M a r k Ancona, gerichtet ist u n d v o n der A p p e l l a t i o n i n Strafsachen h a n d e l t 5 0 9 . K a p i t e l 4, i n dem ein Breve Papst Klemens VII. 510 an Johannes Jacobus, Bischof v o n Albenga u n d Gubernator der M a r k A n c o n a v o m 6. 5. 1530 wiedergegeben ist, bezieht sich auf das vorhergehende Breve Papst Julius' I I . 5 1 1 u n d ebenfalls auf die A p p e l l a t i o n i n Strafsachen 5 1 2 . Wegen dieses Sachzusammenhanges wurde hier w o h l ausnahmsweise auf die chronologische Reihenfolge verzichtet u n d das Breve Klemens V I I . an dieser Stelle eingefügt.
505 Julius II., aus der Familie della Rovere, fand bei seinem Amtsantritt den Kirchenstaat bereits mächtig vor: die ganze Romagna war ihm einverleibt, die römischen Barone waren bezwungen und die Macht der Parteien dank Alexander VI. gebrochen. Ferner fand er neue Geldquellen erschlossen, die man vor Alexander nicht gekannt hatte. Diese Politik setzte Julius II. nicht nur fort, sondern baute sie noch weiter aus: er beschloß, Bologna für sich zu gewinnen, die Macht Venedigs zu brechen sowie die Franzosen aus Italien zu vertreiben. Alle diese Unternehmungen glückten ihm, was ihm um so mehr Ruhm eintrug, als er alles nur tat, um die Macht der Kirche zu mehren, nicht die irgendeines einzelnen. Die Parteien der Orsini und Colonna hielt er wie seine Vorgänger in Schranken; so N. Machiavelli , Der Fürst, S. 80; N. Machiavelli, Discorsi, S. 79 f., 315,364,399; vgl. auch H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Julius II.", S. 143 f.; L. v. Ranke, Die Geschichte der Päpste, S. 31 ff.; J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, S. 109 ff. 506
Const, adiectae, Venedig 1540, S. 70 b Zeile 5 sowie 38 und 39. Antonio Flores (Afflores), Doktor beider Rechte, wurde am 26. 8. 1496 zum Bischof von Castellamare (Stabiensis) und am 4. 12. 1503 zum Erzbischof von Avignon erhoben. Von 1509 bis 1511 war er Gubernator der Mark Ancona; R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 24; C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 2, S. 265 und Bd. 3, S. 140. 508 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 70b Zeile 42 sowie S. 71a Zeile 56 und 57. 509 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 71b Zeile 2 und 18. 510 Giulio de' Medici wurde am 19. 11. 1523 als Nachfolger Leos X. zum Papst erkoren und sieben Tage später als Klemens VII. gekrönt. Ihm widmete Niccolò Machiavelli sein Werk „Geschichte von Florenz". Dies ergibt sich aus N. Machiavelli, Geschichte von Florenz, S. 7 ff. Über Klemens VII. wurde bereits in Teil I dieser Arbeit im Zusammenhang mit Kardinal Rodolfo Pio da Carpi berichtet. Näheres über Papst Klemens VII. bei H.Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Klemens VII.", S. 167 f.; L. von Ranke, Die Geschichte der Päpste, S. 50ff.; J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, S. 114 ff. 507
511 1
Const, adiectae, Venedig 1540, S. 71b Zeile 32. Const, adiectae, Venedig 1540, S. b Zeile .
96
II. Teil:
ie Aegidianischen Konstitutionen
Die unter Kapitel 5 folgende Konstitution ist von dem bereits erwähnten Antonio Flores vom 2. 1. 1510 und trägt die Rubrica „Contra deosculantes mulieres" 513 . In den folgenden Kapiteln 6 bis 19 finden sich die Constitutiones adiectae von Sigismundus de Gonzaga „princeps & Marchio miseratione divina sanctae romanae ecclesiae, sanctae Mariae nostrae diaconus Cardinalis Mantuanensis. Necnon in provincia Marchiae Anconitanae ac civitatibus, terris, & castris & locis Massetrabariae praesidatus Farfensis & Asculi sedis apostolicae legatus de latere, ac pro S. d. n. Leone Papa X. & sanctae Romanae ecclesiae in spiritualibus, & temporalibus, generalis vicarius" 5 1 4 . Ihnen vorangestellt ist zunächst die Approbatio von Papst Leo X. vom 20. 5. 1513 515 und sodann ein Prooemium des Kardinals vom 15. 5. 1513 516 . Seine Constitutiones adiectae befassen sich mit unterschiedlichen Rechtsmaterien, so u. a. mit der Appellation in Strafsachen, mit dem Ämterwesen und Strafdelikten. Soweit sich seine Zusatzkonstitutionen auf die Aegidianischen Konstitutionen oder gar vorhergehende Constitutiones adiectae beziehen, ist dies, wie auch bei vielen vorhergehenden Verfassern, genau angegeben. In Kapitel 10 heißt es z. B.: „Mandamus constitutionem Egidii Episcopi Sabinensis sub dicta rubrica in ultima sua additione, servari, . . . " 5 1 7 oder in Kapitel 16: „... teneantur, constitutioque sub rubrica de salario & mercede scripturarum notariorum bancarum in libro addi. ad. car. 54 incipien. ad removendam & c. in omnibus suis partibus, inviolabiliter observari volumus , . . " 5 1 8 . Diese letzte Konstitution bezieht sich auf Kapitel 11 der Constitutiones adiectae von Johannes de Castillione. Die letzte Constitutio adiecta von Kardinal Sigismundus de Gonzaga trägt die Rubrica „De observantia generalium & specialium constitutionum" 519 . In Kapitel 14 bestätigt der Kardinal eine Bulle Papst Alexanders VI. vom April 1493, die in dem folgenden Kapitel 15 wiedergegeben ist 5 2 0 .
513
Const, adiectae, Venedig 1540, S. 71b Zeile 47 und S. 72 a Zeile 45 und 46. Const, adiectae, Venedig 1540, S. 72b Zeile 19 bis 23. — Kardinal Sigismundus de Gonzaga stammte aus der gleichnamigen, berühmten Fürstenfamilie aus Mantua. Nachdem er am 1. 12. 1505 von Papst Julius II. zum Kardinal mit dem Titel von S. Maria Nuova erwählt worden war, wurde er im Jahre 1509 zum Legaten in der Mark Ancona ernannt. Dieses Amt hatte er inne bis 1517; So R. Foglietti , Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 23 f.; L. Cardella, Memorie storiche de' cardinali, Bd. 3, S. 322; A. Ciacconio, Vitae et res gestae pontificium romanorum et S.R.E. cardinalium, Bd. 3 (1677), Sp. 262; L'Abbé Migne, Dictionnaire des Cardinaux, Sp. 1021; C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 3, S. 12 und S. 12 Fn. 1 und 2 sowie S. 140. 514
515
Const, Const, 517 Const, 518 Const, 519 Const, 520 Const, Zeile 1. 516
adiectae, adiectae, adiectae, adiectae, adiectae, adiectae,
Venedig Venedig Venedig Venedig Venedig Venedig
1540, S. 72a Zeile 48 bis S. 72b Zeile 16f. 1540, S. 72 b Zeile 19 und Zeile 56 f. 1540, S. 73 a Zeile 48 f. 1540, S. 74 b Zeile 32 bis 34. 1540, S. 75a Zeile 24. 1540, S. 73 b Zeile 49 f. Die Bulle selbst beginnt S. 74a
6. Die Fortentwicklung der Aegidianischen Konstitutionen
Unter Kapitel 20 folgen zwei Breven von Papst Leo X. und 25. 1. 1521 datiert sind 5 2 2 .
97
521
, die vom 12. 6. 1514
Die nun folgenden Constitutiones adiectae tragen in der Ausgabe Venedig 1540 keine Zählziffern mehr. Die erste dieser Vorschriften ist von Bernardino Castellarlo, Bischof von Casale Monferrato und Gubernator der Mark Ancona 5 2 3 vom November 1531 und handelt von dem Verkauf von Olivenöl, Korn und Wein 5 2 4 . Im Anschluß daran beginnen die Zusatzkonstitutionen von Papst Paul III. 525. Die erste, die in Form eines Briefes abgefaßt und vom 11.1. 1536 datiert ist 5 2 6 , enthält mehrere Vorschriften, die jeweils mit „Item" beginnen. Wie bereits erwähnt, findet sich dies auch in den Konstitutionen von Melfi 5 2 7 . Die weiteren Constitutiones adiectae von Papst Paul III. vom 28. 7. 1536 sind meist recht umfangreich und regeln vorwiegend das Ämterwesen. Sie handeln z. B. „De auditoribus & eorum officio & de sportulibus" 528 , „De marescallo" 529 , „De advocatis & procuratoribus, & eorum salariis, & officio" 5 3 0 oder „De notariis & eorum officio" 5 3 1 . M i t dieser Vorschrift sowie den Angaben über die Drucklegung schließt die Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen von Venedig 1540. Sie ist die letzte gedruckte Ausgabe des Gesetzbuches von Albornoz vor der Reform von Rodolfo Pio da Carpi. Da die Constitutiones adiectae nicht nur die Bestimmungen der Aegidianischen Konstitutionen zum Teil abänderten, ergänzten oder gar aufhoben, sondern auch viele Zusatzkonstitutionen vorhergehender Verfasser abänderten, ergänzten oder aufhoben, herrschte zu der Zeit Rodolfo Pios im Kirchenstaat 521 Giovanni de' Medici, Sohn von Lorenzo il Magnifico, dem Niccolò Machiavelli sein Werk „Der Fürst" widmete, wurde am 9. 3. 1513 zum Papst gewählt und zehn Tage darauf als Leo X. inthronisiert. Er fand das Papsttum auf dem Gipfel der Macht und versuchte vornehmlich, diese zu wahren, worüber er jedoch die kirchlichen Anliegen und Erfordernisse aus den Augen verlor; vgl. hierzu H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Leo X.", S. 202f.; J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, S. 112f.; L. v. Ranke, Die Geschichte der Päpste, S. 44ff.; N. Machiavelli, Der Fürst, S. 81. 522 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 75a Zeile 53 bis S. 75b Zeile 19 und S. 75b Zeile 20 bis S. 76 a Zeile 40. 523 Bernardino Castellano „de la Barba" wurde am 13. 1. 1525 zum Bischof von Casale Monferrato ernannt. A m 1. 7. 1531 erhielt er die Befugnisse eines Vizelegaten in der Mark Ancona, so C. Eubel, Hierarchia catholica, Bd. 3, S. 170 und S. 170 Fn. 3 und 5. 524 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 76a Zeile 41 bis S. 76b Zeile 30. 525 Über Paul III., der am 13. 10. 1534 den Papstthron bestieg, finden sich bereits in Teil I dieser Arbeit Ausführungen und Literaturhinweise. 526 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 76 b Zeile 31 und S. 77 a Zeile 59 und 60. 527 Vgl. H. Dilcher, Art. „Melfi, Konstitutionen von", in: HRG, Bd. 3 (1984), Sp. 470476 (473). 528 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 77 b Zeile 46. 529 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 78 a Zeile 7. 530 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 78 a Zeile 36. 531 Const, adiectae, Venedig 1540, S. 78 b Zeile 34.
7 Hoffmann
II. Teil:
98
ie Aegidianischen Konstitutionen
eine unübersichtliche und verwirrende Gesetzeslage. Welche Verordnungen der Päpste, Legaten und Rektoren waren noch in Kraft, welche veraltet oder bereits aufgehoben? Hinzu kommt, daß es neben den zuvor im einzelnen aufgeführten, gedruckten Constitutiones adiectae noch weitere Zusatzkonstitutionen gab, so ζ. B. diejenigen von Benedetto di Accolti di Arezzo, Kardinalpriester mit dem Titel von S. Eusebio und Erzbischof von Ravenna, der am 8. 7. 1532 von Papst Klemens VII. zum Legaten in der Mark Ancona ernannt wurde 5 3 2 . Über ihn war bereits in Teil I dieser Arbeit zu hören 5 3 3 . Ferner hat auch Giulio Soderini, Bischof von Xanten, und Gubernator der Mark Ancona im Jahre 1536 534 mehrere Zusatzkonstitutionen zu dem Gesetzbuch von Albornoz erlassen. Zudem habe ich in der Biblioteca Ambrosiana in Mailand Kopien zahlreicher „Bandi" von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi gefunden, die er als Legat in der Mark Ancona erlassen hat und die ebenfalls zu dieser Zeit in Kraft waren 535 . Einige dieser Bandi, die wegen des schlechten Erhaltungszustandes der Kopien zum Teil nur schwer lesbar sind, stammen aus dem Jahre 1539, die meisten jedoch aus dem Jahre 1540. Bei einem Bando, das kein Datum enthält, aber wahrscheinlich im Mai 1539 erlassen wurde 5 3 6 , fällt auf, daß auch hier, wie schon bei den Konstitutionen von Melfi 5 3 7 , mehrere Vorschriften vereinigt sind, die jeweils mit „Item" beginnen. So finden sich in diesem Bando Verbote gegen den Gebrauch und das Tragen von Waffen, gegen das Versammeln bewaffneter Männer und anderes, aber auch mehrere Gebote, die Strafprozesse schleunig zu beenden, die Brücken, Straßen und Quellen auszubessern, und vieles mehr 5 3 8 . Diese unklare Gesetzeslage führte im gesamten Kirchenstaat zu einer großen Rechtsunsicherheit. Oftmals bestanden Zweifel, ob ein Gesetz Anwendung 532 Näheres über Kardinal Benedetto di Accolti, der literarisch sehr gebildet war und von dem das Werk „Historia Gotefridi" verfaßt wurde, bei E. Massa, Art. „Accolti, Benedetto, il Giovane", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 1 (1960), S. 101-102; L. Cardella, Memorie storiche de' cardinali, Bd. 4, S. 80ff.; G. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, Bd. 7, Teil 3, S. 237ff.; A. Haidacher, Geschichte der Päpste in Bildern, S. 157; R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 24. 533
s. S. 22. Giulio Soderini wurde um das Jahr 1488 geboren. A m 23. 5. 1514 wurde er zum Bischof von Xanten ernannt. Er starb am 30. 7. 1544. Th. Frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527), S. 392; R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 24. 535 Vgl. U. Fiorina, Inventario dell' archivio Falcò Pio di Savoia, S. 128 Nr. 525 (2). 536 Dies läßt sich aus einer Vorschrift in dem Bando entnehmen, in der den Notaren aufgetragen ist, die angefertigten Schriften bis zum 15. 6. 1539 bekanntzumachen; vgl. U. Fiorina, Inventario dell' archivio Falcò Pio di Savoia, S. 128 Nr. 525 (2), S. 23 der Kopie. 537 Vgl. H. Dilcher, Art. „Melfi, Konstitutionen von", in: HRG, Bd. 3 (1984), Sp. 470476 (473). 538 Vgl. U. Fiorina, Inventario dell' archivio Falcò Pio di Savoia, S. 128 Nr. 525 (2), S. 15 f., 18, 21 und 23 der Kopie. 534
6. Die Fortentwicklung der Aegidianischen Konstitutionen
99
539
finde oder gar bereits außer Kraft getreten sei . U m diesen heillosen Zustand zu beenden, wurde Kardinal Rodolfo Pio da Carpi ausersehen, das Gesetzeswerk von Aegidius Albornoz zu überarbeiten und zu erneuern. Wie sein großer Vorgänger im Jahre 1357, sah sich Rodolfo Pio zweihundert Jahre später vor dieselbe schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe gestellt, all die im Kirchenstaat vorhandenen Gesetze und Vorschriften auf ihre Fortgeltung hin zu untersuchen.
539 Als Beispiel sei hier angeführt Kapitel 11 der Constitutiones adiectae von Kardinal Philippus Calandrini. Dieses wurde erlassen zu „Constitutioni sub rubrica forma qualiter procedatur super appellationibus incipit sancimus". Die nun folgende Disposition beginnt mit dem motivierenden Nebensatz „ A d declarationem eius quod saepenumero in dicta nostra curia generali in dubio revocatum est, ...". Const, adiectae, Venedig 1540, S. 51 b Zeile 30 bis 32. 7*
III. Teil
Kardinal Rodolfo Pio da Carpi und die Aegidianischen Konstitutionen 1. Die Reformkommission des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi Die Durchführung der Reformarbeiten an den Aegidianischen Konstitutionen erfolgte keinesfalls in der Weise, daß Rodolfo Pio da Carpi jede Änderung des Gesetzeswerkes selbst verfaßte und niederschrieb. Als Kirchenfürst und damit hochgestellte Persönlichkeit mit Rang und Namen übertrug der Kardinal diese Arbeit vielmehr einer Kommission von 16 namhaften Juristen, die er leitete und der er seine Anweisungen gab, wie die Reform zu erfolgen habe. Auch dies erinnert wieder deutlich an Kardinal Aegidius Albornoz, der bei der Schaffung seines Gesetzeswerkes im Jahre 1357 ebenfalls einer Kommission vorstand. Ist man jedoch hinsichtlich der Mitglieder der Kommission von Albornoz auf Vermutungen angewiesen, da der Kardinal sie in seinem Prooemium zu den Aegidianischen Konstitutionen nicht namentlich nennt 5 4 0 , so führt Rodolfo Pio da Carpi in seinem Decretum, das der carpensischen Ausgabe der Constitutiones Aegidianae vorangestellt ist, die Namen der 16 Mitglieder seiner Reformkommission im einzelnen auf: „Accersitis igitur Joanne Baptista Ciappardello, Papyrio Virginio, Fabio Alavolino, Juliano Brolio, Octavio Ferro, Bartholomeo Appogio, Philippo Gyptio, Angelo Androtio, Francisco Jardino, Joanne Baptista Graccono, advocatis eius provinciae clarissimis, nec non Francischino Rodolphino, Leonardo Mancinello, Leonardo Blancutio, Joanne Baptista Fideli, disertis causarum Patronis, una cum praeclaris assessoribus nostris, Bernardino Ruffo, & Nicoiao Farfaro, quorum scientia, atque sollertia omnia confìcerentur, "541
Über diese Personen ist nicht mehr viel bekannt. Zu ihren Lebzeiten waren sie jedoch namhafte und berühmte Juristen der Mark Ancona, denn Rodolfo Pio bezeichnet sie in seinem Decretum als „advocati eius provinciae clarissimi", sowie als „diserti causarum Patroni". Bei seinen beiden praeclari assessores, Bernardino Ruffo und Nicoiao Farfaro, rühmt er deren Wissen und Gewandtheit. Die Mitglieder der Reformkommission Rodolfo Pios waren somit weithin bekannte, glänzende advocati und Juristen der Mark Ancona, die auf Grund 540
Siehe S.59f. Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, Decretum des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi, S. 2b der nicht numerierten Seiten, Zeile 22 bis 28. 541
1. Die Reformkommission des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi
101
ihrer Tätigkeit über große praktische Erfahrung verfügten. Aus der Auswahl dieser Personen läßt sich daher entnehmen, daß Rodolfo Pio die Überarbeitung der Aegidianischen Konstitutionen nach den Bedürfnissen des Landes und seiner Zeit ausrichten und ein praxisnahes Werk schaffen wollte. So ist Bartolomeo Appoggio , der der Reformkommission des Kardinals angehörte, ein berühmter Rechtsanwalt gewesen. Er wurde in Appignano, wahrscheinlich in den letzten Tagen des 15. Jahrhunderts, geboren. Sein genaues Geburtsdatum ist jedoch nicht bekannt 5 4 2 . Nachdem er von seinen Eltern eine ausgezeichnete Erziehung erhalten hatte, wählte der junge Appoggio die juristische Laufbahn. Als Doktor beider Rechte übte er in Macerata die Advokatur aus 5 4 3 . Er war wohl ab 1535 advocatus curialis, denn in einem Protokoll vom 27. 7. 1535 wird er unter den Mitgliedern des Collegium Advocatorum Curialium von Macerata aufgezählt 544 . Schon rasch erwarb er sich in der ganzen Provinz den Ruf eines tüchtigen Rechtsanwaltes und eines gelehrten Juristen 545 . Bartolomeo Appoggio bekleidete mehrere hohe Ämter in seiner Heimatstadt Appignano sowie in anderen Städten der Marken. Er war zwischen 1545 und 1564 mehrere Male Bannerherr von Appignano. 1548 wurde ihm das Amt des Gubernators von Fano übertragen. 1550 begab er sich als Abgeordneter der Provinz im Auftrag der Kommune von Monte Cassiano zusammen mit Francisco Jardino (Giardini), einem ausgezeichneten Juristen, der ebenfalls der Reformkommission Rodolfo Pios angehörte 546 , zu Papst Julius III. nach Rom, um die Abtretung dieser Stadt an Kardinal Girolamo Verallo zu verhindern 547 . A m 5. 6. 1560 findet man ihn auf einer Congregatio Provincialis unter den 19 Teilnehmern als Orator und damit als Abgeordneten der Kommune von A p p i g n a n o 5 4 7 3 . Von den juristischen Arbeiten Appoggios ist nichts erhalten 548 . Giovanni Accorroni 549 nimmt jedoch an, daß die Statuten von Appignano, die 1538 veröffentlicht und in Kraft gesetzt wurden, das Werk Appoggios sind. Der 542 F. Liotta, Art. „Appoggio, Bartolomeo", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 3 (1961), S. 637-638 (637); G. Accorroni, Bartolomeo Appoggio, S. 8. 543 G. Accorroni, Bartolomeo Appoggio, S. 8, 17, 25. 544 G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" di Paolo IV. del 18 Maggio 1557, S. 52 Fn. 57. 545 F. Liotta, Art. „Appoggio Bartolomeo", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 3 (1961), S. 637-639 (637). 540 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, Decretum des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi, S. 2 b der nicht numerierten Seiten, Zeile 24. 547 F. Liotta, Art. „Appoggio, Bartolomeo", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 3 (1961), S. 637-638 (637); G. Accorroni, Bartolomeo Appoggio, S. 9, 12. 547 a D. Cecchi, Il parlamento e la congregazione provinciale della Marca di Ancona, S. 53 f. Fn. 81. 548 F. Liotta, Art. „Appoggio, Bartolomeo", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 3 (1961), S. 637-638 (637). 549 G. Accorroni, Bartolomeo Appoggio, S. 20 ff.
102
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
Beitrag, den dieser berühmte Jurist zu der carpensischen Reform der Aegidianischen Konstitutionen geleistet hat, kann leider nicht mehr festgestellt werden 550 . Eine elegante Rede in Latein, die Bartolomeo Appoggio anläßlich der Ankunft von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi in Macerata gehalten hat und die noch 1790 in der Biblioteca Picena vorhanden war, ist heute bedauerlicherweise nicht mehr aufzufinden 551 . Das genaue Datum und der Ort seines Todes sind nicht bekannt. Bartolomeo Appoggio muß jedoch zwischen Ende März 1568 und dem 14. 5. 1569 gestorben sein, denn am 17. 3. 1568 wird er letztmalig namentlich erwähnt, während in einer Urkunde vom 14. 5. 1569 bereits von seinen Erben die Rede ist 5 5 2 . Über Joannes Baptista Ciappardellus, ein weiteres Mitglied der Reformkommission Rodolfo Pios, ist nur wenig bekannt. Aus einer Aufzeichnung läßt sich jedoch entnehmen, daß er ebenfalls advocatus curialis in Macerata war und am 27. 7. 1535 an einer Versammlung des Collegium Advocatorum Curialium dieser Stadt teilgenommen hat. Als ältere advocati curiales stellten er und Papyrio Virginio, der auch dieses Amt bekleidete und später der Reformkommission Rodolfo Pios angehörte, dem Prior des Kollegiums, Ottavio Ferro, einen neuen advocatus curialis vor, dessen Name jedoch nicht genannt wird 5 5 3 . Papyrio Virginio , von dem eben schon die Rede war, wird bereits in einer Urkunde vom 4. 1. 1528 als „Clarissimus Doktor Dominus Papirius Virginius de Macerata, Advocatus curialis" erwähnt 554 . Er war Doktor beider Rechte und erhielt viele ehrenvolle Aufgaben. So wurde er am 2. 3. 1530 als Dritter einer Kommission von vier Rechtsgelehrten ernannt, der außer ihm Dominus Antonius Pelicanus, Simon Giardinus und Francischinus Rodulfini, auch ein Mitglied der Reformkommission Rodolfo Pios, angehörten und die mit der Klärung einer Steuerfrage betraut war. Als Consiliator in dem „Concilium Credentiae" 555 vom 16. 9. 1530 wurde Papyrio Virginio als „Excellentissimus Juris Utriusque Doctor" bezeichnet 556 . Nach dem Tode von Antonio Francesco 550 F. Liotta, Art. „Appoggio, Bartolomeo", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 3 (1961), S. 637-638 (637). 551 G. Accorroni, Bartolomeo Appoggio, S. 10. — In der Biblioteca Comunale „MozziBorgetti" in Macerata befindet sich eine Bulle Papst Pauls III. von 1546, die an Bartolomeo Appoggio gerichtet ist; vgl. A. Adversi, Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, Vol. C, Band I und II, S. 421 Nr. 1105. 552
G. Moschetti , I l catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 210 und S. 212ff. 553 G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 52f. sowie S. 52f. Fn. 57. 554 Hierbei handelt es sich um ein Protokoll des Notars Cesare di Ser Giulio vom 4. 1. 1528; vgl. G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 51. 555 Das „Concilium Credentiae" nahm im 16. und 17. Jahrhundert oft die Stelle des „Consiglio generale" für die Ernennung der Parlamentäre ein; vgl. D. Cecchi, II parlamento e la congregazione provinciale della Marca di Ancona, S. 52 f. Fn. 80.
1. Die Reformkommission des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi
103
Pelicani übernahm er am 15. 8. 1531 die Leitung der Advocatum Communis ad vitam. A m 19. 10. 1534 wurde er mit einigen anderen cives ausersehen, eine Denkschrift für seine Heiligkeit, Papst Paul III., zu verfassen, um darin dem neuen Oberhaupt der Kirche zu seiner Wahl zu gratulieren und um den Papst von der Notwendigkeit zu überzeugen, die Kommune von Macerata von Steuern sowie Abgaben zu befreien und ihre alten Privilegien zu bestätigen 557 . Ferner ist bekannt, daß Papyrio Virginio im Jahre 1540 anläßlich der Eröffnung des Studium generale in Macerata mit der Unterrichtung „ A d primam cathedram ordinariam juris civilis de mane pro annis tribus continuis sequentibus incipiendis Cal. Novembris proximi futuri ... cum salario quatuor centum florenorum monetae Marchiae videlicet bolonenos quadraginta pro quolibet floreno" betraut wurde 5 5 8 . Über Giuliano Brolio ist aus einem Protokoll des Notars Cesare di Ser Giulio di Montalto vom 9. 12. 1527 zu entnehmen, daß er aus Monticulo (Montecchio) stammte und zu dieser Zeit das Amt des iudex bekleidete 559 . Ottavio Ferro, ein weiteres Mitglied der Reformkommission Rodolfo Pios, war eine sehr vielseitig begabte Persönlichkeit. Er war ein ausgezeichneter Jurist, ein geschickter Politiker und zugleich ein namhafter Dichter. Aufgrund seiner vielfältigen Fähigkeiten war er im Laufe seines Lebens mit zahlreichen ehrenvollen Aufgaben und Ämtern betraut. 1541 war er Gubernator von Terracina und Kastellan jener Festung. Später war er locumtenens generalis von Spoleto, Viterbo und dem Patrimonium, Gubernator von Camerino, Auditor von Bologna sowie Kommissar und Vizelegat in der Romagna. Er starb, während er als Auditor Papst Pauls IV. an dem Konzil von Trient teilnahm 560 . Für den Rechtshistoriker stellt sich jedoch in besonderem Maße die Frage nach der juristischen Tätigkeit Ottavio Ferros. Er war Doktor beider Rechte und genoß in der gesamten Provinz der Mark Ancona einen außerordentlichen Ruf als Rechtsgelehrter. Ebenso wie Papyrio Virginio wurde er im Jahre 1540 anläßlich der Eröffnung des Studium generale in Macerata „ad primam cathedram ordinariam juris civilis de sero" für dieselbe Zeit und für dasselbe Salär wie dieser ernannt 561 .
556 G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 51 f. 557
G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 52. 558 G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 53 und S. 81 f. Fn. 11. 559 G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 177 Fn. 31. 560 A. Adversi, D. Cecchi, L. Paci, Storia di Macerata, Bd. II, S. 170. 561 G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 81 Fn. 11.
di di di
di
104
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
Als in Macerata auf Grund widriger Umstände die Handelspreise für die notwendigen Dinge des täglichen Lebens stiegen und die Steuern auf die Einnahmen aus diesen Handelsgeschäften ausgedehnt werden sollten, wurde am 28. 10. 1558 von dem Concilium Credentiae eine Kommission von vier cives eingesetzt, die eine Regelung für den Verkauf, für gerechte Warenpreise und für die Bestrafung der Zuwiderhandelnden festlegen sollte. Diese Kommission leitete kein geringerer als der Excellentissimus Jureconsultus Dominus Octavius Ferrus 562 . In einem Verzeichnis vom 29. 10. 1558 ist er neben Franciscus Giardinus und Joannes Baptista Bracchonus, die ebenfalls der Reformkommission Rodolfo Pios angehörten, als advocatus curialis aufgeführt 563 . Von Filippo Gyptio (auch Gipzio, Gizzi oder Gessi) ist bekannt, daß er 1534 mit drei anderen cives zum Deputatus Provinciae Marchiae in der Congregatio Provinciae Marchiae ernannt wurde, einem dezentralisierten Organ des Kirchenstaates, das von dem Gubernator der Marken einberufen wurde 5 6 4 . Angelo Androtio (Androzio), ein weiteres Mitglied der Reformkommission Rodolfo Pios, war ein berühmter Rechtsgelehrter, der aus Montecchio stammte. Von ihm ist zu berichten, daß er im Februar 1546 Bartolomeo Appoggio während seiner Abwesenheit von Macerata als advocatus curialis vertrat 5 6 6 . Francisco Jardino (Giardini), Legum Doctor, war Professor an dem Lehrstuhl für das ius civile der Universität von Macerata, die durch die Bulle Papst Pauls III. vom Juli 1540 gegründet worden war. Er hatte diesen Lehrstuhl für viele Jahre, mindestens jedoch von 1543 bis 1556, inne 5 6 6 . Daneben hatte er aber noch viele andere Aufgaben, von denen zum Teil schon die Rede war. A m 7. 8. 1555 wurden Dominus Franciscus Giardinus legum doctor, Dominus Baptista Bracconus iureconsultus, Dominus Leonardus Mancinellus und Pietro Compagnoni beauftragt, den beiden Oratoren für Rom, Marino Mattei und Camillo Bonamico, genaue Anweisungen für ihre Aufgaben zu erteilen 567 . Joannes Baptista Braccono, der ebenfalls der Reformkommission Rodolfo Pios angehörte 568 , war ein in der gesamten Mark Ancona bekannter und 562 G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terratum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 83 Fn. 11. 563 G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 83 Fn. 11. 564 G. Moschetti, I l catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bólla „Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 177f. 565 G. Accorroni, Bartolomeo Appoggio, S. 12. 566 G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 216, S. 219 Fn. 77. 567 G. Moschetti, I l catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 217. 568 In dem Decretum Rodolfo Pios, das der carpensischen Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen vorangestellt ist, wird sein Name fälschlicherweise mit Graccono angege-
1. Die Reformkommission des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi
105
berühmter Rechtsgelehrter. Anläßlich der Eröffnung des Studium generale in Macerata im Jahre 1540 erhielt der „Clarissimus J. U. Doctor Dominus Johannes Baptista Bracchonus ad extraordinariam lecturam juris civilis pro diebus festivis et diebus vacationum in primo loco, pro eodem tempore ... cum salario florenorum ducentorum..." 5 6 9 . Im Jahre 1544 war er der erste, der an der Universität seiner Heimatstadt Macerata kanonisches Recht las 5 7 0 . In einer Urkunde vom August 1540 wird Joannes Baptista Braccono als „vir insignita prudentia et legali doctrina decoratus ad legendum ordinarium Civilium de sero" bezeichnet 571 . Francischino Rodolphino war procurator curialis und ebenfalls ein namhafter Rechtsgelehrter der Mark Ancona. Wie schon erwähnt, wurde er am 2. 3. 1530 mit drei anderen Juristen, darunter Papyrio Virginio, mit der Klärung einer Steuerfrage beauftragt 572 . Ein weiteres Mitglied der Reformkommission Rodolfo Pios war Leonardo Mancinello (Mancinelli), ein ausgezeichneter Jurist, der in seinem Leben mit vielen schwierigen und bedeutenden Aufgaben betraut wurde. Aus den notariellen Protokollen seiner Zeit ist zu entnehmen, daß er bereits in jungen Jahren procurator curialis war: „Die Dominico 18 Octobris 1517. Julianus Nicolai Juliani omni meliori modo etc. constituit veros et legitimos procuratores Dominum Leonardum Nellum de Civitanova, Dominum Franciscum Silvanum et Dominum Leonardum Mancinellum de Macerata in solidum in omnibus causis tarn civilibus quam criminalibus tarn in Curia Generali quam in Curia Potestatis Macerate . . , " 5 7 3 . Durch seinen Ruf als geschickter und umsichtiger Jurist wurde er oft unter den reformatores der Statuten von Macerata genannt. A m 4. 9. 1555 erhielt er mit 3 anderen Juristen von dem Concilium Credentiae den Auftrag „ad eligendum vicum pro habitationibus hebreorum" 574 . Doch schon am 22. 4. 1558 wurde ihm eine weitere bedeutende Aufgabe übertragen, die der Erwähnung bedarf. Er wurde für eine Kommission mit weiteren 18 Mitgliedern „ad reformandum et renovandum novum regimen" auserwählt, nachdem die Obersten der Verwaltung von Macerata die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer solchen Reform festgestellt hatten 5 7 5 . A m 22. 12. 1558 ben; vgl. Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, S. 2b der nicht numerierten Seiten, Zeile 24. 569 G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 82 Fn. 11. 57 0 A. Adver si, D. Cecchi, L. Paci, Storia di Macerata, Bd. II, S. 53. 57 1 G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 216. 57 2 G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 51 f. 57 3 G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 215 und S. 215 Fn. 60. 57 4 G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 215 und 217.
106
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
wurden die Magnifici Domini Priores für die Monate Januar und Februar 1559 ernannt, und der erste unter ihnen war Dominus Leonardus Mancinellus 576 ! Als Krönung seines Lebens, das er stets dem öffentlichen Wohl gewidmet hatte, erhielt Leonardo Mancinello eine litera testimoniale, in der man ihm ein „plenum testimonium de virtutibus et probatae vitae" erteilte 577 . Das genaue Datum seines Todes ist nicht bekannt. Leonardo Mancinello muß jedoch nach dem Januar 1559 verstorben sein, denn in den bisher aufgefundenen Urkunden wird er letztmalig am 10. 1. 1559 erwähnt 578 . Über Bernardino Ruffo , der ebenfalls der Reformkommission Rodolfo Pios angehörte, habe ich die Abschriften von zwei Urkunden in der Biblioteca Ambrosiana in Mailand gefunden. Die erste ist ein Schreiben Rodolfo Pios an Bernardino Ruffo vom 9. 5. 1539. Daraus ist zu entnehmen, daß Bernardino Ruffo Doktor beider Rechte und Auditor generale für die gesamte Mark Ancona war. Kardinal Rodolfo Pio da Carpi lobt in diesem Schreiben sein Wissen und seine Erfahrung und hebt seine Verdienste hervor 5 7 9 . Bei der zweiten Urkunde handelt es sich um ein Schreiben Rodolfo Pios an Bernardino Ruffo vom 25. 11. 1539, das Anordnungen und Befugnisse „super Re frumentaria" enthält 5 8 0 . Aus alledem ergibt sich, daß die Mitglieder der Reformkommission Rodolfo Pios sehr berühmte Juristen und Rechtsgelehrte waren, die in der gesamten Provinz der Mark Ancona in hohem Ansehen standen. Zugleich fallt auf, daß sie offensichtlich nicht nur in der Reformkommission des Kardinals, sondern vielfach auch in anderen Kommissionen zusammen tätig waren und auch mit anderen Aufgaben gemeinsam betraut wurden. Weiteren Aufschluß hierüber gibt ein Protokoll des Notars Cesare di Ser Giulio vom 27. 7. 1535 über eine Versammlung des Collegium Advocatorum Curialium von Macerata, in dem es wie folgt heißt 5 8 1 : „Die X X V I I Julii 1535. Congregato Collegio Advocatorum infrascriptorum videlicet D. Octavius Ferrus Prior Collegii, Dns. Joannes Baptista Ciappardellus, D. Papirius Virgineus, D. Philippus Giptius., 575 Die 19 Auserwählten waren aus dem Stand der populäres; G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 218 und S. 218 Fn. 77. 57 6 G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 220. 57 7 G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 221. 57 8 G. Moschetti, I l catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 221. 579 Vgl. U. Fiorina, Inventario dell' archivio Falcò Pio di Savoia, S. 128 f. Nr. 525 (2), S. 47 f. der Kopie. 580 Vgl. U. Fiorina, Inventario dell' archivio Falcò Pio di Savoia, S. 128f. Nr. 525 (2), S. 49 der Kopie. 581 Zitiert nach G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 52 Fn. 57.
1. Die Reformkommission des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi
107
D. Bartholomeus Appogius, D. Julianus Brolius, D. Angelus Androtius, D. Franciscus Jardinus, D. Joannes Baptista Bracconus, D. Joannes Antonius (sic), D. Michael Recchius e presentans totum Collegium Advocatorum ..." In einem weiteren Protokoll des Notars Cesare di Ser Giulio vom 9. 1. 1536 über eine Versammlung des Collegium Advocatorum et Procuratorum der curia generalis der Mark Ancona sind folgende Personen aufgezählt 582 : „ADVOCATI: 1. Dominus Johannes Ciappardellus. 2. Dominus Papirius Virgineus. 3. Dominus Philippus Giptius. 4. Dominus Julianus Brolius. 5. Dominus Franciscus Jardinus. 6. Dominus Johannes Baptista Braconus. 7. Dominus Octavius Ferrus. 8. Dominus Angelus Androctius. 9. Dominus Johannes Antonius de Amandula." Bei den 23 procuratores sind genannt an zweiter Stelle Dominus Franciscus Rodolfinus, an dritter Stelle Dominus Leonardus Mancinellus und an fünfter Stelle Dominus Leonardus Blancutius. All dies sind Namen, die schon aus der Reformkommission von Rodolfo Pio bekannt sind. Aus diesen Protokollen läßt sich daher schließen, daß der Kardinal neben seinen beiden assessores Bernardino Ruffo und Nicoiao Farfaro sämtliche, zumindest aber die meisten advocati der curia generalis, die zu seiner Zeit im Amt waren, und einige procuratores der curia generalis mit der Überarbeitung der Aegidianischen Konstitutionen beauftragt hat. Da diese Personen somit an der Kurie in Macerata tätig waren, ist weiterhin davon auszugehen, daß die Kommission von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi auch in Macerata tagte. Dies wird dadurch gestützt, daß der Legat der Mark Ancona und so auch Rodolfo Pio seinen Sitz in Macerata hatte und hier das Zentrum der Provinzverwaltung war. Nachdem nun untersucht wurde, wie sich die Reformkommission von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi im einzelnen zusammensetzte und wo sie die Arbeiten an den Aegidianischen Konstitutionen durchführte, bleibt noch zu klären, wann die Kommission tätig war. Paolo Colliva 583 geht davon aus, daß die Überarbeitung der Aegidianischen Konstitutionen von 1539 bis 1544 durchgeführt wurde. Sicherlich hat die Reformkommission Rodolfo Pios ihre Tätigkeit im Jahre 1539 aufgenommen, denn der Kardinal wurde von Papst Paul III. am 21. 4. 1539 zum päpstlichen 582 Zitiert nach G. Moschetti, Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, S. 178f. 583 P. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 502.
108
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
Legaten „de latere" in der Mark Ancona ernannt und am 21. 4. 1539 mit weitreichenden Befugnissen und Privilegien ausgestattet 584 . Infolgedessen ist davon auszugehen, daß er unmittelbar nach seinem Amtsantritt die bereits im einzelnen genannten 16 Rechtsgelehrten für seine Kommission auswählte und sie mit der Reform der Aegidianischen Konstitutionen betraute. A m 10. 9. 1544 wurde die Revision von Papst Paul III. gebilligt und durch die Bulle „Ex debito pastoralis officii" in Kraft gesetzt 585 . Es erscheint jedoch fraglich, daß die Reformarbeiten tatsächlich erst in diesem Jahr beendet wurden. Die Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen von Rom 1543 -1545, die als erste die carpensischen Zusätze enthält, bringt etwas Licht in die Angelegenheit. Diese einzige römische und auch einzige amtliche Ausgabe der Constitutiones Aegidianae 586 scheint nämlich zu zwei Zeitpunkten gedruckt worden zu sein: Die ersten 24, nicht numerierten Seiten der Ausgabe, die das Frontispiz, das Druckprivileg Pauls III. für Francisco Priscianese, das Decretum von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi, die vier Breven Papst Pauls III. vom 21.4. 1539, 10. 9. 1544, 30. 7. 1538 und 11.1. 1536 sowie eine systematische und alphabetische Tabula enthalten, schließen mit den Worten „ D . Hieronyma de Cartularijs excudebat Romae in Platea Parionis M . D . X L V . Mense Ianuario" 5 8 7 sowie einem Brief von Marius Favonius Spoletinus celeberrimo Patronorum, Causidicorumque, ac Tabellionum, Agri Picaeni Collegio S.P.D. 5 8 8 , aus dem zu entnehmen ist, daß er von Rodolfo Pio mit der Korrektur des Druckes beauftragt wurde. Die unmittelbar folgenden 148 numerierten Seiten, auf denen die 6 Bücher mit den Konstitutionen wiedergegeben sind, enden mit den Worten „Romae in aedibus Francisci Priscianensis M D X L I I I . " 5 8 9 . Die Gründe für diese Verfahrensweise sind nicht bekannt. Zwar meint Filippo Raffae Ili 590, Francisco Priscianese habe auf Grund der Privilegien, die ihm durch Motuproprio Papst Pauls III. verliehen wurden 5 9 1 , der Witwe des 584 585 586
Vgl. S. 22 und 23. Vgl. S. 23.
P. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 501 f. Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, S. 24a der nicht numerierten Seiten, Zeile 56. 588 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, S. 24b der nicht numerierten Seiten. 589 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, S. 148a. 590 F. Raffaelli, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, bibliotecnicamente descritte in tutte le loro edizioni, in: Archivio storico per le Marche e per Γ Umbria, Bd. I I (1885), S. 85. 591 Dieses Motuproprio Papst Pauls III. ist in den Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, auf Seite 2 a der nicht numerierten Seiten abgedruckt. Der Florentiner Francisco Priscianese erhielt darin das Privileg, die „Egidianas constitutiones, cum novis additionibus diligenter recognitis, & hactenus non impressis" zu drucken. Zugleich wurde darin allen anderen verboten, für den Zeitraum eines Decenniums diese Konstitutionen ohne die ausdrückliche Erlaubnis des Franciscus Priscianese zu drucken, zu verkaufen oder auch nur zum Verkauf anzubieten. 587
1. Die Reformkommission des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi
109
Baidassare de Cartularijs erlaubt, die von ihm im Jahre 1543 gedruckten Konstitutionen als ihre eigene Ausgabe herauszugeben und zum Verkauf anzubieten, um auf diese Weise ihr Unglück zu mildern, das durch den Tod ihres Gemahles über sie hereingebrochen war 5 9 2 . Dies erscheint jedoch wenig überzeugend. Naheliegender ist vielmehr, daß Francisco Priscianese auf Grund seines Druckprivilegs die „Egidianas constitutiones, cum novis additionibus diligenter recognitis, & hactenus non impressis" 593 im Jahre 1543 druckte, um sie sodann Papst Paul III. zur Durchsicht und zur Erteilung der Approbatio vorzulegen. Nachdem der Papst diese Konstitutionen durch seine Bulle vom 10. 9. 1544 in Kraft gesetzt hatte, wurden im Januar 1545 von Hieronyma de Cartularijs die ersten 24, nicht numerierten Seiten der Ausgabe gedruckt, in denen unter anderem das Decretum des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi und die zuvor erwähnte Bulle Papst Pauls III. vom 10. 9. 1544 wiedergegeben sind. Zudem wurde das Werk im ganzen von Hieronyma de Cartularijs zusammengesetzt 594 . Dies vielleicht, weil Francisco Priscianese zu jener Zeit aus irgendwelchen Gründen verhindert war und diese letzte Arbeit an der Ausgabe selbst nicht erledigen konnte. Wenn nun aber die von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi reformierten Aegidianischen Konstitutionen bereits im Jahre 1543 von Francisco Priscianese gedruckt waren, dann muß sein Gesetzeswerk zu dieser Zeit bereits fertig und die Arbeit seiner Reformkommission beendet gewesen sein. Dies findet eine Stütze auch darin, daß Rodolfo Pio nur bis Ende 1542 Legat in der Mark Ancona war 5 9 5 . Daraus ergibt sich — entgegen Paolo Colliva —, daß die Kommission unter der Leitung von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi an der Revision der Aegidianischen Konstitutionen von 1539 bis Ende 1542 arbeitete.
592
Hieronyma de Cartularijs war mit Baidassare de Cartularijs verheiratet, der 1543 in Rom verstarb. 1540 waren sie von Perugia nach Rom gezogen, um dort die Buchdruckerkunst auszuüben; F. Raffaelli, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, bibliotecnicamente descritte in tutte le loro edizioni, in: Archivio storico per le Marche e per l'Umbria, Bd. I I (1885), S. 82; P. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 502 Fn. 150. 593
Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, S. 2a der nicht numerierten Seiten, Zeile 4
bis 6. 594
Soweit aus dem mir vorliegenden Abzug einer Fotografie der römischen Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen von 1543 -1545 erkennbar ist, dürfte schon auf Grund des unterschiedlichen Druckes zu entnehmen sein, daß dieses Werk zu zwei Zeitpunkten gedruckt wurde: Auf den ersten 24, nicht numerierten Seiten, die von Hieronyma de Cartularijs im Januar 1545 gedruckt wurden, sind die Buchstaben um einiges kleiner als auf den nachfolgenden 147, von Francisco Priscianese im Jahre 1543 gedruckten Seiten. Zudem sind in dem ersten Teil einige Anfangsbuchstaben mit phantasievollen Blütenranken und Ornamenten verziert. Dagegen sind in dem zweiten Teil jeweils die Anfangsbuchstaben der sechs Bücher in kunstvolle Bildmotive eingebettet. 595 Vgl. S. 24 f.
110
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
2. Das Breve Papst Pauls I I I . vom 10. 9. 1544 Die Konstitutionen des Kardinals Aegidius Albornoz wurden auf einem parlamentum generale zu Fano während dreier Tage gegen Ende April bis Anfang Mai 1357 vor allen Rektoren, vielen Adligen, Bischöfen und Prälaten „lecte et publicate" 5 9 6 . Bei dem Reformwerk von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi hört man dagegen von alledem nichts. Aus einem Verzeichnis der Parlamente bei Dante Cecchi 597 ist zu entnehmen, daß ein parlamentum am 27. 1. 1538 in Macerata, ein weiteres möglicherweise im Jahre 1541 in Macerata und das nächste dann erst am 19. 12. 1556 in Macerata stattgefunden hat. Da die Reformarbeiten Rodolfo Pios zu den Aegidianischen Konstitutionen im Jahre 1538 noch gar nicht begonnen hatten, im Jahre 1541 noch nicht beendet und 1556 schon seit über zehn Jahren abgeschlossen waren, ist davon auszugehen, daß die Constitutiones Carpenses auf keinem parlamentum generale „lecte et publicate fuerunt". Vielmehr wurde das Werk Rodolfo Pios durch das Breve Papst Pauls III. „Ex debito pastoralis officii" vom 10. 9. 1544 in Kraft gesetzt. Das Breve ist überschrieben mit den Worten „Paulus. PP. I I I . " und beginnt mit der Publicatio „ A d perpetuam rei memoriam" 5 9 8 . Es folgt eine Arenga, nach der dieses Breve zitiert wird, nämlich „Ex debito pastoralis officii" 5 9 9 . In der Narratio schildert der Papst die Umstände, die die Überarbeitung der Aegidianischen Konstitutionen erforderlich machten: „... Cum itaque (sicut accepimus) nuper cum constitutiones, per bonae memoriae Egidium tunc tituli Sancti Clementis olim Presbyterum Cardinalem, tunc in humanis agentem & in certis civitatibus & provinciis Sanctae Romanae Ecclesiae subditis Apostolicae sedis de latere Legatum & Vicarium generalem, salubrem directionem civitatum, & provinciarum earundem concernentes. Necnon reliquae leges, sanctiones, & ordinationes per diversos alios ipsarum Provinciarum pro Romana Ecclesia praedicta vicarios, & gubernatores editae, & per eundem Egidium Cardinalem suis, adiunctae, & in sex libros redactae, & partitae, ob diversarum aliarum sanctionum & decretorum, per varios gubernatores Apostolicos, ac etiam per literas nonnullorum Romanorum Pontificum nostrorum praedecessorum pro rerum & temporum qualitatibus, praesertim ad usum Provinciae nostrae 596 597
s. S. 63 f. D. Cecchi, Il parlamento e la congregazione provinciale della Marca di Ancona,
S. 203. 598
Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543 -1545, S. 5 a der nicht numerierten Seiten, Zeile 20 und 21; dieses Breve ist auch abgedruckt bei L. Cherubini, Magnum Bullarium Romanum, Bd. I Nr. 17, S. 726. 599 Päpstliche Bullen werden grundsätzlich nach der Arenga zitiert (z. B. „Unam sanctam" von 1302, „ I n Coena Domini" von 1627, „Pastor aeternus" von 1870); F. Merzbacher, Art. „Arenga", in: HRG, Bd. 1 (1971), Sp. 217-218. Ausführlich zu der Arenga H. Fichtenau, Arenga. Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformen, Graz/Köln 1957 ( M I Ö G Ergänzungsband XVIII).
2. Das Breve Papst Pauls III. vom 10. 9. 1544
111
Marchiae Anconitanae postmodum editorum, & praedictis Egidianis adiunctorum, seu alligatorum, dubia, repugnantias, absurditates, & confusiones in Iudiciis, & negociis, inter dilectos filios dictae Provinciae homines in varios sensus interpretarentur, & minus clare intelligerentur, ex quo homines Provinciae huiusmodi multiplicum litium involucris, dispendiis, & incommodis afficiebantur, & involvebantur , . . " 6 0 0 . Weiterhin führt Papst Paul III. aus, daß Kardinal Rodolfo Pio da Carpi in seinem Auftrag die angefügten Constitutiones und Extravagantes bereinigte, berichtigte sowie in sechs Büchern ordnete, und erteilt sodann diesem Werk des Kardinals seine Approbatio: „... Dilectus filius noster Rodulphus tituli Sancti Clementis tunc Sanctae Priscae Presbyter Cardinalis de Carpo nuncupatus, cupiens Provinciae, & hominum praedictorum sublevamini providere, & litibus ac differentiis, pro posse iter praecludere, de mandato nostro etiam tunc dictae Provinciae Agentibus, id saepius a nobis efflagitantibus, singularum etiam additarum constitutionum, ac extravagantium praedictarum repurgationis, & repartitionis cognitione, nonnullis curiae generalis eiusdem Provinciae Peritis demandata, illas repurgare, corrigere, & elucidiores ac faciliores reddere in librosque sex ordinatim redigere, & collocare, nonnullis suis opportune interpositis decretis optime curaverit. Nos laudabilem dicti Rodulphi Cardinalis operam in Domino plurimum commendantes, cupientesque, prout nostro incumbit pastorali officio providere, quod constitutiones sie reformatae, & in faciliorem sensum redacte tamque utiles & necessariae omnino adimpleantur, & in viridem transeant observantiam. Easdem egidianas constitutiones per praefatum Rodulphum Cardinalem, sive eius Agentes, & ad id deputatos, purgatas, emendatas, elucidatas, mutatas, alteratas, additas & in dictos sex libros redactas, suisque locis, & ordinibus collocatas, omniaque & singula alia in ipsis sex libris contenta, quae praesentibus pro sufficienter ex praessis, & insertis haberi volumus, ac inde secuta quaecunque tenore praesentium perpetuo confirmamus & approbamus, ac rata, & grata habemus,... futuris temporibus in eadem provincia observari debere , . . " 6 0 1 . Ebenso wie Albornoz wollte demnach auch Rodolfo Pio kein völlig neues Gesetzbuch schaffen, sondern die Constitutiones seines großen Vorgängers mit den später angefügten Constitutiones adiectae anderer Verfasser bereinigen, verbessern, klarstellen, abändern, ergänzen und wieder in sechs Büchern geordnet herausgeben. In dieser Methodik wird erneut die Parallele zu Albornoz deutlich. Wie bei diesem ging auch die Absicht Rodolfo Pios darauf, neben echten Novellen das alte, bewährte Recht zu übernehmen und das Unnütze, Überflüssige und Veraltete auszuscheiden 6013 . Dies wird dadurch gestützt, daß 600
Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543 -1545, S. 5 a der nicht numerierten Seiten, Zeile 28
bis 45. 601
Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543 -1545, S. 5 a der nicht numerierten Seiten, Zeile 45 bis S. 5 b der nicht numerierten Seiten, Zeile 16 und 20. 601 a
V g l
p
n
278.
112
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
der Kardinal sein Werk in seinem Decretum als eine „novam Egidiani codicis compilationem" 602 bezeichnet. Auch hier folgt er dem Beispiel seines berühmten Vorgängers Albornoz, der in Buch V I Kapitel 27 der Aegidianischen Konstitutionen von 1357 von den Konstitutionen „huius nostre compilacionis" 603 spricht. 3. Die Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Kardinal Rodolfo Pio da Carpi Nach Beendigung der Reformarbeiten von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi waren die Constitutiones adiectae, die in der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 33 Blätter umfaßten und im Anschluß an Buch V I von Blatt 45 b bis Blatt 78 b abgedruckt waren, entfallen. Die carpensische Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen besteht wie ehedem aus sechs Büchern, in die die Constitutiones adiectae nunmehr jedoch integriert sind: „Easdem egidianas constitutiones per praefatum Rodulphum Cardinalem, sive eius Agentes, ... in dictos sex libros redactas ..Z' 6 0 4 . Um die Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Kardinal Rodolfo Pio erkennen und sein gesetzgeberisches Werk würdigen zu können, soll im folgenden eine Gegenüberstellung geboten werden; und zwar der letzten prä-carpensischen Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen von Venedig 1540, der „Constitutiones Marchiae Anconitanae. Noviter ab omnibus erroribus atque mendis expurgatae, cum Additionibus antiquis", und der ersten carpensischen Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen von Rom 1543-1545, den „Constitutiones recognitae, ac novissime impressae. Cum privilegio Pauli Papae III. Pontificis M a x i m i " 6 0 5 . Zur Erläuterung dieser Synopse sei vorab kurz vermerkt, daß die Konstitutionen, die Rodolfo Pio von Albornoz unverändert in sein Reformwerk übernommen hat, bei den beiden Ausgaben auf gleicher Höhe wiedergegeben werden. Sofern Rodolfo Pio an eine solche übernommene Bestimmung eine oder mehrere Constitutiones adiectae seiner Vorgänger oder gar von sich selbst angefügt hat, wird dies auf der Seite der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545 durch die Angabe des Namens des jeweiligen Verfassers dieses 602 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, S. 2b der nicht numerierten Seiten, Zeile 28 f. 603 Const. Aeg., V I 27 (P. Sella, Cost., S. 234 Zeile 12). 604 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, Breve Papst Pauls III. vom 10. 9. 1544, S. 5 b der nicht numerierten Seiten, Zeile 10 bis 12. 605 Eine Gegenüberstellung der prä-carpensischen und der carpensischen Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen haben bereits V. La Mantia, Storia della legislazione italiana, I, Roma e Stato romano, S. 339, und P. Colliva , I l cardinale Albornoz, S. 245 ff., versucht. Ihr Anliegen erschöpft sich jedoch darin, aufzuzeigen, welche der Konstitutionen von 1357 auch nach der Reform von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi noch fortgalten. Auf die Integration der Constitutiones adiectae in die Aegidianischen Konstitutionen von 1357 sowie auf die Zusätze von Rodolfo Pio gingen sie nicht ein. Dies soll daher mit der folgenden Gegenüberstellung geschehen.
3. Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Rodolfo Pio
113
Zusatzes verdeutlicht. Bestimmungen Rodolfo Pios oder seiner Vorgänger, die als eigene K a p i t e l neu eingefügt wurden, sind i n der Gegenüberstellung der beiden Ausgaben daran erkennbar, daß an der entsprechenden Stelle der präcarpensischen Ausgabe Venedig 1540 kein K a p i t e l aufgeführt ist. Prä-carpensische Ausgabe Venedig 1540
Carpensische Ausgabe Rom 1543-1545
Buch
Buch
I
I
Kap. i
Kap. 1
Konstitution Papst Innozenz' VI. vom 30. 6. 1353 Kap. 2 Konstitution Papst Innozenz' VI. vom 19. 8. 1353
Konstitution Papst Innozenz' VI. vom 30. 6. 1353 Kap. 2 Konstitution Papst Innozenz' VI. vom 19. 8. 1353
Kap. 3 Konstitution Papst Innozenz4 VI. vom 4. 9. 1355
Kap. 3 Konstitution Papst Innozenz' VI. vom 4. 9. 1355
Kap. 4 Konstitution Papst Innozenz' VI. vom 4. 9. 1355
Kap. 4 Konstitution Papst Innozenz' VI. vom 4. 9. 1355
Kap. 5 Konstitution Papst Innozenz' VI. vom 4. 12. 1355
Kap. 5 Konstitution Papst Innozenz' VI. vom 4. 12. 1355
Kap. 6 Konstitution Papst Innozenz' VI. vom 8. 12. 1355
Kap. 6 (deficit)
Kap. 7 Konstitution Papst Urbans IV. vom 14. 12. 1262 Kap. 8 Konstitution Papst Johannes' X X I I . vom 25. 9. 1318
605a
Konstitution des Joannes Cardinalis Papiensis ( = Johannes de Castillione) vom 19. 10. 1458 Kap. 7 (deficit) Konstitution Papst Pius' II. vom 28. 2. 1461 Kap. 8 (sed I , 1 4 ) 6 0 5
a
Konstitution Papst Sixtus' IV. vom 28. 4. 1480
Die Hinweise „sed ...", wie hier z. B. „sed I, 14", sollen verdeutlichen, daß eine solche Konstitution der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 zwar wörtlich in das Reformwerk Rodolfo Pios übernommen wurde, aber in der carpensischen Ausgabe Rom 1543 -1545 an einer anderen Stelle aufgeführt ist. So ist hier die in der prä-carpensischen Ausgabe in Buch I Kapitel 8 wiedergegebene Konstitution Papst Johannes' X X I I . vom 25. 9. 1318 in der carpensischen Ausgabe nicht in Buch I Kapitel 8, sondern in Buch I Kapitel 14 zu finden. 8 Hoffmann
114
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
Kap. 9 Konstitution Papst Johannes' X X I I . vom 6. 12. 1318
Kap. 9
Kap. 10 Konstitution Papst Johannes' X X I I . vom 23. 1. 1322
Kap. 10 (sed I, 15)
Kap. 11 Konstitution Papst Benedikt X I I . vom 2. 8. 1341
Kap. 12 Konstitution Papst Benedikt X I I . vom 16. 1.1338 Kap. 13 Konstitution Papst Benedikt X I I . vom 6. 4. 13.. (7) 607 Kap. 14 Konstitution Papst Innozenz' VI. vom 31. 5. 1353 Kap. 15 Konstitution Papst Innozenz' VI. vom 15. 6. 1353
(deficit) Konstitution des Angelus Episcopus Tiburtinus ( = Angelo Lupi de Cavis, Bischof von Tivoli) vom 27. 10. 1480
Konstitution Papst Innozenz4 VI. vom 15. 6. 1353 Kap. 11 (sed I, 19) Konstitution Papst Sixtus' IV. vom 30. 5. 1478 606 /Verum quia nos Rodulphus Pius Cardinalis de Carpo, qui supra Legatus Kap. 12 (sed I, 20) Konstitution Papst Innozenz4 V I vom 15. 7. 1353 Kap. 13 (sed I, 16) Konstitution Papst Sixtus' IV. vom 21. 6. 1477 Kap. 14 (sed I, 17) Konstitution Papst Johannes X X I I . vom 25. 9. 1318 Kap. 15 (sed I, 10) Konstitution Papst Johannes X X I I . vom 23. 1. 1322
606 In der Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen von Rom 1543-1545, S. 12a Zeile 20, ist diese Konstitution datiert aus dem Jahre M. CCCC L X X X V I I I . Hierbei handelt es sich offensichtlich um einen Druckfehler, denn das Pontifikat Sixtus' IV. währte vom 9. 8. 1471 bis zum 12. 8. 1484; so H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung, S. 128. Aus der Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen von Venedig 1540, in der diese Konstitution Sixtus' IV. bei den Constitutiones adiectae auf Seite 64 a, b abgedruckt ist, läßt sich jedoch auf S. 64b Zeile 7 die richtige Jahreszahl, nämlich M. CCCC L X X V I I I , entnehmen. 607
Die Jahreszahl dieser Konstitution ist ungewiß. In Const. Aeg. 113 der Ausgabe Venedig 1540, S. 7 Zeile 52 heißt es: „... pontificatus nostri anno X . " Nach H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung, S. 127, währte das Pontifikat Benedikts X I I . vom 20. 12. 1334 bis zum 25. 4. 1342, also weniger als 10 Jahre.
3. Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Rodolfo Pio Kap. 16 Konstitution Papst Innozenz' VI. vom 15. 7. 1353
115
Kap. 16 (sed I, 12) Konstitution Papst Benedikt X I I . vom 6. 4. 13.. (7) 608
Kap. 17 Konstitution Papst Innozenz' VI. vom 29. 7. 1353
Kap. 17 (sed I, 21) Konstitution Papst Innozenz' VI. vom 31. 5.1353
Kap. 18 Konstitution Papst Gregors XI. vom 25. 6. 1373
Kap. 18 (sed I, 22) Verum quia nos Rodulphus Pius Cardinalis de Carpo, qui supra Legatus/... ex additionibus Gabrielis ( = Gabriel Condulmer) ... Kap. 19 Konstitution Papst Benedikt X I I . vom 2. 8. 1341 Kap. 20 Konstitution Papst Benedikt X I I . vom 16. 1. 1338 Kap. 21 Konstitution Papst Innozenz' VI. vom 29. 7. 1353 Kap. 22 Konstitution Papst Gregors XI. vom 25. 6. 1373
Buch
II
Buch
II
Nos Rodulphus Pius de Carpo Cardinalis, & Legatus Kap. 1 Egidius
Kap. 1 Egidius
Kap. 2 Egidius j . . . antiquam consuetudinem
Kap. 2 Egidius j . . . antiquam consuetudinem ... / Nos Rodulphus Pius Cardinalis & Legatus/Joannes Cardinalis Andegavensis ( = Jean Balue)/Papst Paul III./nos Rodulphus Pius Cardinalis/Sigismundus de Gonzaga/nos Rodulphus Pius Cardinalis, & Legatus
Kap. 3 Egidius / Bertrandus
Kap. 3 Egidius / Bertrandus / Joannes de Castelliono/Nos Rodulphus Pius de Carpo Cardinalis, & Legatus
608
8*
Vgl. Fn. 607.
116
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
Kap. 4 Egidius / Bertrandus
Kap. 4 Egidius / Bertrandus / Gabriel Senensis ( = Gabriel Condulmer)/Joannes de Castelliono/Papst Sixtus IV./Papst Paul II./Nos Rodulphus Pius Cardinalis & Legatus
Kap. 5 Egidius / Bertrandus
Kap. 5 Egidius / Bertrandus / Nos Rodulphus Pius Cardinalis & Legatus
Kap. 6 Egidius
Kap. 6 Egidius
Kap. 7 Bertrandus
Kap. 7 Bertrandus
Kap. 8 Bertrandus
Kap. 8 Bertrandus
Kap. 9 Neapoleo
Kap. 9 Neapoleo/Nos Rodulphus Pius Cardinalis, & Legatus
Kap. 10 Egidius
Kap. 10 Egidius/Joannes de Castelliono/Joannes Cardinalis Andegavensis ( = Jean Balue)/Julianus Soderinus de Florentia ( = Giulio Soderini)/Nos Rodulphus Pius Cardinalis & Legatus/Papst Paul IIL/Sigismundus de Gonzaga/Nos Rodulphus Pius Cardinalis, & Legatus
Kap. 11 Egidius
Kap. 11 Egidius
Kap. 12 Papst Bonifaz VIII.
Kap. 12 Nos Rodulphus Pius Cardinalis, & Legatus/Papst Bonifaz V I I I . /
Kap. 13 Egidius Kap. 14 Egidius
Egidius 609 Kap. 13 Egidius/Joannes de Castelliono/Philippus Cardinalis Bononiensis ( = Philippus Calandrini di Sarzana) / Agnellus / Joannes Cardinalis Andegavensis ( = Jean Balue)/Nos Rodulphus Pius Cardinalis, & Legatus
609 In der carpensischen Ausgabe Rom 1543 -1545 werden unter Kapitel 12 die beiden Kapitel 12 und 13 der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 zusammengefaßt. Dadurch verschieben sich die Zählziffern der folgenden Kapitel. So trägt das in der präcarpensischen Ausgabe folgende Kapitel die Zählziffer 14, während das in der carpensischen Ausgabe folgende Kapitel die Zählziffer 13 trägt.
3. Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Rodolfo Pio
117
Kap. 15 Egidius
Kap. 14 Egidius
Kap. 16 Egidius
Kap. 15 Egidius/Philippus Cardinalis Bononiensis ( = Philippus Calandrini di Sarzana)/Anglicus Episcopus Albanensis ( = Anglico de Grimoard)/Papiensis episcopus ( = Joannes de Castelliono) / Joannes Cardinalis Andegavensis ( = Jean Balue)/Papst Paul III.
Kap. 17 Egidius
Kap. 16 Egidius / Joannes de Castelliono / Nos Rodulphus Pius de Carpo Cardinalis & Legatus /Julianus Soderinus de Florentia ( = Giulio Soderini)/Benedictus Cardinalis Ravennatensis ( = Benedetto di Accolti)/Nos Rodulphus Pius Cardinalis, & Legatus
Kap. 18 Egidius/Inveterata consuetudo ... et antiquissime constitutiones ...
Kap. 17 Egidius/Inveterata consuetudo ... et antiquissime constitutiones ...
Kap. 19 Bertrandus
Kap. 18 Bertrandus/Philippus Cardinalis Bononiensis ( = Philippus Calandrini di Sarzana)
Kap. 20 Bertrandus
Kap. 19 Bertrandus
Kap. 21 Neapoleo
Kap. 20 Neapoleo / Nos Rodulphus Pius de Carpo Cardinalis & Legatus
Kap. 22
Kap. 21 ... Egidius ... ex variis constitutionibus antiquis ... ... ex multis antiquis constitutionibus ... I ... Statuta quoque & consuetudines ...
Ex multis antiquis constitutionibus . . . / . Statuta quoque & consuetudines ... Kap. 23
(Egidius)
Kap. 22 Nos Rodulphus Pius de Carpo Cardinalis & Legatus/ (Egidius)
Kap. 24 (Egidius)
Kap. 23 Egidius
Kap. 25 Item consuetudinem sequentes antiquam
Kap. 24 Item consuetudinem sequentes antiquam ... / nos Rodulphus Pius Cardinalis Legatus
118
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
Kap. 26 Egidius
Kap. 25 Egidius
Kap. 27 Egidius
Kap. 26 Egidius Kap. 27 Joannes Cardinalis Andegavensis ( = Jean Balue)/Nos Rodulphus Pius Cardinalis Legatus Kap. 28 Egidius 6 1 0 /Nos Rodulphus Pius Cardinalis & Legatus/Latinus Cardinalis Ursinus ( = Latino Orsini)/Joannes Cardinalis Papiensis ( = Joannes de Castelliono) Kap. 29 Antonius de Sancta Maria / Evangelista Bagarottus/Nos Rodulphus Pius Cardinalis & Legatus Kap. 30 Julianus Soderinus de Florentia ( = Giulio Soderini) Kap. 31 Anglicus Episcopus Albanensis ( = Anglico de Grimoard)/Papst Sixtus IV./Evangelista Bagarottus / Benedictus de Accoltis, Cardinalis Ravennatensis ( = Benedetto di Accolti)/Nos Rodulphus Pius Cardinalis & Legatus
Kap. 28 Neapoleo
Kap. 32 Neapoleo
Kap. 29 Neapoleo
Kap. 33 Neapoleo
Kap. 30 n. a. 6 1 1
Kap. 34 n. a./Joannes de Castelliono
Kap. 31 EgidiusI... constitutionis Bonifaciane ...
Kap. 35 Egidius/... constitutionis Bonifaciane ... / Sigismundus de Gonzaga / Papst Paul III.
Kap. 32 Egidius / Bertrandus
Kap. 36 Egidius / Bertrandus /
610 In diesem Kapitel 28 der carpensischen Ausgabe ist eine Constitutio adiecta von Albornoz wiedergegeben, die in der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 unter Kapitel 35 der Constitutiones adiectae, S. 46, abgedruckt ist. 611 611 n. a. = „non attribuita" und „non attribuibile".
3. Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Rodolfo Pio Kap. 33 η. a.
n. a. 6 1 2
Kap. 34 Bertrandus
Kap. 37 Bertrandus /
Kap. 35 n. a.
Kap. 36 Neapoleo Kap. 37 Egidius
119
n. a. 6 1 3 /Gabriel Cardinalis Senensis ( = Gabriel Condulmer)/nos Rodulphus Pius (deficit) Kap. 38 Egidius /Nos Rodulphus Pius Cardinalis & Legatus Kap. 39614 Joannes Cardinalis Andegavensis ( = Jean Balue)
Kap. 38 Egidius/... quam vis ... tarn felicis recordations domini Bonifacii pape octavi quam etiam ceterorum legatorum apostolicae sedis & rectorum & reformatorum ... constitutiones edite reperiantur ...
Kap. 40 Egidius/... quamvis ... tam felicis recordationis domini Bonifacii pape octavi quam etiam ceterorum legatorum apostolicae sedis & rectorum & reformatorum ... constitutiones edite reperiantur .. ./Joannes de Castelliono/cit. Philippus Cardinalis Bononiensis ( = Philippus Calandrini di Sarzana) / Joannes Cardinalis Andegavensis ( = Jean Balue)/Papst PaulIII.
Kap. 39 Egidius/Papst Bonifaz V I I I .
Kap. 41
Kap. 40 Bertrandus
Kap. 42 Bertrandus/Joannes de Castelliono/Nos Rodulphus Pius Cardinalis & Legatus Kap. 43 Papst Bonifaz VIII.
Kap. 41 Papst Bonifaz VIII.
Egidius/Papst Bonifaz V I I I .
612 In der carpensischen Ausgabe sind die Kapitel 32 und 33 der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 unter der Zählziffer 36 zusammengefaßt. 613 In der carpensischen Ausgabe sind die Kapitel 34 und 35 der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 unter der Zählziffer 37 vereinigt und unmittelbar hintereinander wiedergegeben. 614 In der carpensischen Ausgabe Rom 1543 -1545 liegt hier ein Druckfehler vor, denn dieses Kapitel trägt ebenfalls die Zählziffer 38. In der Fortsetzung dessen trägt das im Anschluß daran folgende Kapitel die Zählziffer 39, obwohl es in Wirklichkeit die Zählziffer 40 haben müßte. Hier wird jedoch die richtige Zählung eingehalten und der oben genannte Druckfehler außer acht gelassen.
120
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
Kap. 42 Egidius
Kap. 44 Egidius
Kap. 43 Bertrandus
Kap. 45 615 Bertrandus
Kap. 44 Egidius
Kap. 46 Egidius
Kap. 45 Egidius
Kap. 47 Egidius Kap. 48 Sigismundus de Gonzaga/Nos Rodulphus Pius Cardinalis & Legatus Kap. 49 Benedictus Cardinalis Ravennatensis ( = Benedetto di Accolti)
Kap. 46
Kap. 50
Egidius / Bertrandus
Egidius / Bertrandus
Kap. 47 Egidius / Bertrandus / cit. Papst Innozenz VI. Kap. 48 Bertrandus
Kap. 51 Egidius / Bertrandus / cit. Papst Innozenz VI. (deficit)
Kap. 49 Egidius
(deficit)
Kap. 50 Egidius
Kap. 52 Egidius
Kap. 51 Egidius
Kap. 53 Egidius / Gabriel Cardinalis Senensis ( = Gabriel Condulmer)
Kap. 52 n. a.
Kap. 54 n. a.
Kap. 53
Kap. 55
n. a./cit. Papst Innozenz VI.
n. a./cit. Papst Innozenz VI.
Buch
III
Buch
III
Kap. 1 Consuetudo antiqua ... et veteres constitutiones ...
Kap. 1 Consuetudo antiqua ... et veteres constitutiones ...
Kap. 2
Kap. 2 n. a.
615 An dieser Stelle wird der Druckfehler in Kap. 39 der Ausgabe Rom 1543-1545 wieder behoben, denn dieses Kapitel trägt der tatsächlichen Zählung entsprechend in der Ausgabe Rom 1543-1545 auch die Ziffer 45.
3. Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Rodolfo Pio Kap. 3 n. a.
Kap. 3 ex decreto praelibati Reverendissimi de Carpo additur .../ n. a.
Kap. 4 n. a.
Kap. 4 n. a.
Kap. 5 n. a.
Kap. 5 n. a.
Kap. 6 n. a.
Kap. 6 n. a.
Kap. 7 n. a.
Kap. 7 n. a.
Kap. 8 n. a.
Kap. 8 n. a.
Kap. 9 n. a.
Kap. 9 n. a.
Kap. 10 n. a.
Kap. 10 n. a.
// n. a.
121
Kap. 11 n. a. Kap. 12 Ex ordine praelibati Reverendissimi, & illustrissimi de Carpo & additur constitutio felicis recordationis Gabrielis Cardinalis Senensis ( = Gabriel Condulmer) Kap. 13 Ex ordine praelibati Reverendissimi, & illustrissimi de Carpo additur constitutio felicis recordationis ... domini Bononiensis ( = Philippus Calandrini di Sarzana)
Kap. 12 n. a./cit. Papst Gregor X.
Kap. 14 n. a./cit. Papst Gregor X.
Kap. 13 n. a.
Kap. 15 n. a.
Kap. 14 n. a.
Kap. 16 n. a.
Kap. 15 n. a.
Kap. 17 n. a. / Ex decreto praelibati Reverendissimi, & illustrissimi de Carpo additur, quod ...
Kap. 16 n. a.
Kap. 18 n. a.
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
122 Kap. 17 n. a.
Kap. 19 n. a./Ex ordine, & arbitrio praelibati illustrissimi de Carpo additur, quod ...
Kap. 18 n. a.
Kap. 20 n. a. Kap. 21 Ex decreto praelibati Reverendissimi, & illustrissimi de Carpo additur ...
Kap. 19 n. a.
Kap. 22 n. a./Ex decreto praelibati Reverendissimi de Carpo additur & declaratur ... Kap. 23 Gabriel Cardinalis Senensis ( = Gabriel Condulmer)/Et ex decreto praelibati Reverendissimi & illustrissimi domini de Carpo ... additur praefata constitutio felicis recordationis quondam Gabrielis
Kap. 20 n. a.
Kap. 24 n. a.
Kap. 21 n. a.
Kap. 25 n. a.
Kap. 22 n. a./litt. Papst Johannes X X I I .
Kap. 26 n. a./litt. Papst Johannes X X I I .
Kap. 23 n. a.
Kap. 27 n. a. Kap. 28 Ex decreto & deliberatione praelibati Reverendissimi, & illustrissimi domini de Carpo, & Legatus additur constitutio felicis recordationis quondam Gabrielis Cardinalis Senensis ( = Gabriel Condulmer)
Kap. 24 n. a.
Kap. 29 n. a.
Buch
Buch
Kap. 1 n. a.
IV
IV
Kap. 1 n. a. Kap. 2 Anglicus Albanensis ( = Anglico de Grimoard)
3. Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Rodolfo Pio Kap. 2
123
Kap. 3 n. a. Kap. 4 Philippus Cardinalis Bononiensis ( = Philippus Calandrini di Sarzana)
Kap. 3
Kap. 5 n. a. Kap. 6 (Egidius) 616 Kap. 7 Philippus Cardinalis Bononiensis ( = Philippus Calandrini di Sarzana) Kap. 8 Rodulphus Pius presbyter Cardinalis de Carpo Marchiae Legatus
Kap. 4 n. a.
Kap. 9 n. a.
Kap. 5 n. a. /... sequentes antiquam consuetudinem & constitutiones antiquas ...
Kap. 10 n. a. /... sequentes antiquam consuetudinem 617 & constitutiones antiquas ...
Kap. 6618
Kap. 11 Kap. 12 (Egidius)/(Egidius)
Kap. 7 n. a.
Kap. 13 n. a.
Kap. 8 Papst Bonifaz VIII.
Kap. 14 Papst Bonifaz VIII. Kap. 15 Papst Julius II. Kap. 16 Rodulphus Pius presbyter Cardinalis de Carpo in provincia Marchiae Legatus
616 In diesem Kapitel 6 der carpensischen Ausgabe ist eine Constitutio adiecta von Albornoz wiedergegeben, die in der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 unter Kapitel 32 der Constitutiones adiectae, S. 46, abgedruckt ist. 617 In der carpensischen Ausgabe Rom 1543 -1545 liegt hier wohl ein Druckfehler vor, denn es heißt dort „constitutionem" anstelle richtigerweise „consuetudinem". 618 In der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 liegt ein Druckfehler vor, da dieses Kapitel die Zählziffer 5 anstelle von 6 trägt. Nach dieser unrichtigen Zählung geht es in dem folgenden Kapitel mit der Zählziffer 6 weiter.
124
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
Kap. 9
Kap. 17 Kap. 18619 Egidius Kap. 19 Papst Sixtus IV.
Kap. 10
Kap. 20 Kap. 21 Rodulphus Pius presbyter Cardinalis de Carpo, provinciae Marchiae Anconitanae Legatus
Kap. 11 n. a.
Kap. 22 n. a. Kap. 23 Kap. 24 Sigismundus de Gonzaga
Kap. 12 n. a.
Kap. 25 n. a.
Kap. 13 n. a.
Kap. 26 n. a.
Kap. 14 n. a.
Kap. 27 n. à.
Kap. 15 Egidius
Kap. 28 (Egidius)
Kap. 16 Bertrandus/... varias & diversas constitutiones ...
Kap. 29 Bertrandus/... varias & diversas constitutiones ... Kap. 30 Joannes presbyter Cardinalis ( = Joannes de Castelliono) Kap. 31 Gabriel Cardinalis Senensis ( = Gabriel Condulmer) Kap. 32 Joannes Cardinalis Papiensis ( = Joannes de Castelliono)
619 Die Kapitel 17 und 18 der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545 bilden in der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 eine einzige Konstitution, die in Kapitel 9 wiedergegeben ist. 620 Diese Konstitution wurde aus Kapitel 9 der prä-carpensischen Ausgabe entnommen und in der carpensischen Ausgabe unter Kapitel 23 als eigenständige Konstitution wiedergegeben.
3. Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Rodolfo Pio
125
Kap. 33 Papst Pius II. Kap. 34 Papst Sixtus IV. Kap. 35 Sigismundus de Gonzaga
Kap. 18 n. a. /... in constitutione papali ...
Kap. 36 Rodulphus Pius presbyter Cardinalis de Carpo in provincia Marchiae Anconitanae Legatus Kap. 37 n. a. Kap. 38 n. a. /... in constitutione papali ...
Kap. 19 Bertrandus
Kap. 39 Bertrandus
Kap. 20 n. a. /... multas constitutiones & varias promulgatas .../cit. Papst Johannes X X I I . I, 8
Kap. 40 n. a. /... multas constitutiones & varias promulgatas .../cit. Papst Johannes X X I I . I, 8
Kap. 17 n. a.
Kap. 41 Papst Johannes X X I I .
Kap. 21 n. a.
Kap. 42 Sigismundus de Gonzaga/Papst Alexander VI. Kap. 43 n. a. Kap. 44 Rodulphus Pius presbyter Cardinalis de Carpo, in provincia Marchiae Anconitanae Legatus.
Kap. 22 n. a.
Kap. 45 n. a. Kap. 46 Papst Johannes X X I I .
Kap. 23 Bertrandus
Kap. 47 Bertrandus
Kap. 24 Bertrandus
Kap. 48 Bertrandus
Kap. 25 n. a./... in constitutione Papali ...
n. a. /... in constitutione Papali ...
Kap. 49 Kap. 50 Angelus episcopus Tiburtinus ( = Angelo Lupi de Cavis, Bischof von Tivoli)
126
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen Kap. 51 Papst Sixtus IV.
Kap. 26 n. a.
Kap. 52 Rodulphus Pius presbyter Cardinalis de Carpo, in provincia Marchiae Anconitanae Legatus Kap. 53 n. a.
Kap. 27 n. a.
Kap. 54 n. a.
Kap. 28 n. a. /... iura legis Corneliae
Kap. 55 n. a. /... iura legis Corneliae ...
Kap. 29 n. a.
Kap. 56 n. a.
Kap. 30 n. a.
Kap. 57 n. a.
Kap. 31 n. a.
Kap. 58 n. a.
Kap. 32 n. a.
Kap. 59 n. a. Kap. 60 Rodulphus Pius presbyter Cardinalis de Carpo, in provincia Marchiae Anconitanae de latere Legatus
Kap. 33 n. a.
Kap. 61 n. a.
Kap. 34 n. a.
Kap. 62 n. a.
Kap. 35 n. a.
Kap. 63 n. a.
Kap. 36 n. a.
Kap. 64 n. a.
Kap. 37 n. a.
Kap. 65 n. a.
Kap. 38 n. a.
Kap. 66 n. a.
Kap. 39 n. a.
Kap. 67 n. a
Kap. 40 n. a.
Kap. 68 n. a.
Kap. 41 Bertrandus
Kap. 69 Bertrandus Kap. 70 Gabriel Senensis ( = Gabriel Condulmer)
3. Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Rodolfo Pio
127
Kap. 71 Rodulphus Pius presbyter Cardinalis de Carpo, provinciae Marchiae Legatus Kap. 72 Antonio Flores, Archiepiscopus Avinionensis Kap. 42 n. a.
Kap. 73 n. a.
Kap. 43 n. a. 6 2 1
Kap. 74 n. a. Kap. 75 n. a.
Kap. 44 n. a.
Kap. 76 n. a. Kap. 77 Rodulphus Pius presbyter Cardinalis de Carpo, in provincia Marchiae Anconitanae Legatus 78 621a
Kap. 45 n. a.
Kap. n. a.
Kap. 46 n. a.
Kap. 79 n. a.
Kap. 47 n. a.
Kap. 80 n. a. Kap. 81 (Egidius) 622 Kap. 82 Sigismundus de Gonzaga
Kap. 48 n. a.
Kap. 83 Rodulphus Pius presbyter Cardinalis de Carpo in provincia Marchiae Anconitanae Legatus Kap. 84 n. a. Kap. 85 Gabriel Senensis ( = Gabriel Condulmer)
621 Die Konstitution in Kapitel 43 der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 wurde in der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545 in zwei selbständige Konstitutionen aufgespalten, die in den Kapiteln 74 und 75 wiedergegeben sind. 621a Auf Grund eines Druckfehlers, der sich auch in der Zählung der folgenden Kapitel von Buch IV fortsetzt, trägt dieses Kapitel unrichtigerweise ebenfalls die Ziffer 77. 622 In diesem Kapitel ist eine Constitutio adiecta von Albornoz wiedergegeben, die in der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 in Kapitel 34 der Constitutiones adiectae, S. 49, abgedruckt ist.
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
128
Kap. 86 (Gabriel Condulmer) Kap. 49 n. a.
Kap. 87 n. a.
Kap. 50
Kap. 88 n. a. Kap. 89 Papst Alexander VI.
Kap. 51 n. a.
Kap. 90 n. a.
Kap. 52 Bertrandus
Kap. 9Î Bertrandus
Kap. 53
Kap. 92 n. a. Kap. 93 (Philippus Cardinalis Bononiensis = Philippus Calandrini di Sarzana) Kap. 94 (Philippus Cardinalis Bononiensis = Philippus Calandrini di Sarzana) Kap. 95 (Philippus Cardinalis Bononiensis = Philippus Calandrini di Sarzana) Kap. 96 (Philippus Cardinalis Bononiensis = Philippus Calandrini di Sarzana)
Kap. 54 n. a.
Kap. 97 n. a.
Kap. 55
Kap. 98 n. a. Kap. 99 Rodulphus Pius presbyter Cardinalis de Carpo in provincia Marchiae Anconitanae de latere Legatus
Buch
V
Buch
V
Kap. 1 n. a.
Kap. 1 n. a.
Kap. 2 n. a.
Kap. 2 n. a.
Kap. 3 n. a. /... De edicto divi Adriani tollendo
Kap. 3 n. a. /... De edicto divi Adriani tollendo
3. Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Rodolfo Pio
129
Kap. 4 Philippus Cardinalis Bononiensis ( = Philippus Calandrini di Sarzana)/Nos Rodulphus Cardinalis Legatus Kap. 5 Antonius de sancta Maria ( = Antonio di Santa Maria da Monte Ferraro) Kap. 4 n. a.
Kap. 6 n. a. Kap. 7 Ex constitutione Angelina ( = Agnellus)
Kap. 5 n. a.
Kap. 8 n. a.
Kap. 6 n. a.
Kap. 9 n. a.
Kap. 7 n. a.
Kap. 10 n. a. Kap. 11 (Philippus Cardinalis Bononiensis = Philippus Calandrini di Sarzana)
Kap. 8 n. a.
Kap. 12 n. a.
Kap. 9 n. a.
Kap. 13 n. a. Kap. 14 Joannes Cardinalis Andegavensis ( = Jean Balue)/Antonius de sancta Maria ( = Antonio di Santa Maria da Monte Ferraro) Kap. 15 Antonius de sancta Maria ( = Antonio di Santa Maria da Monte Ferraro) / Evangelista Bagarottus Kap. 16 Angelus sedis apostolicae prothonotarius ( = Agnellus) Kap. 17 Joannes Cardinalis Andegavensis ( = Jean Balue)/Nos Rodulphus Cardinalis Legatus Kap. 18 Rodulphus Cardinalis Legatus
9 Hoffmann
130
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
Kap. 10 n. a.
Kap. 19 n. a./Joannes Cardinalis Papiensis ( = Joannes de Castelliono)/n. a. Kap. 20 Julianus Xantonensis ( = Giulio Soderini)
Kap. 11 n. a.
Kap. 21 n. a. Kap. 22 n. a. Kap. 23 Rodulphus Cardinalis Legatus
Kap. 12 n. a.
Kap. 24 Benedictus Cardinalis Ravennatensis ( = Benedetto di Accolti)/Papst Paul III. Kap. 25 n. a./Nos Rodulphus Cardinalis Legatus
Kap. 13 n. a.
Kap. 26 n. a.
Kap. 14 n. a.
Kap. 27 n. a./Nos Rodulphus Cardinalis Legatus
Kap. 15 n. a. Kap. 16 n. a.
(sed III, 21) Kap. 28 n. a./Nos Rodulphus Cardinalis Legatus Kap. 29 (Rodulphus Cardinalis Legatus) Kap. 30 (Rodulphus Cardinalis Legatus) Kap. 31
Buch
VI
Kap. 1 Antiquis constitutionibus iuri consonis
(Rodulphus Cardinalis Legatus) Buch
VI
Kap. 1 Antiquis constitutionibus iuri consonis Kap. 2 Egidius 6 2 3 /n. a.
623 Dieses Kapitel enthält eine Constitutio adiecta von Albornoz, die in der präcarpensischen Ausgabe Venedig 1540 in Kap. 29 der Constitutiones adiectae wiedergegeben ist.
3. Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Rodolfo Pio
131
Kap. 3 Petrus presbyter Cardinalis sanctae Mariae in Transtyberim ( = Pierre d' Estaing) Kap. 4 Gabriel Cardinalis Senensis ( = Gabriel Condulmer) Kap. 2 Bertrandus
Kap. 5 Bertrandus
Kap. 3 n. a.
Kap. 6 n. a.
Kap. 4 n. a.
Kap. 7 n. a.
Kap. 5 n. a.
Kap. 8 n. a.
Kap. 6 n. a.
Kap. 9 n. a. Kap. 10 Ex constitutione Angelina ( = Agnellus)/n. a. Kap. 11 Rodulphus Pius Cardinalis Legatus, & vicarius
Kap. 7 6 2 4 n. a.
Kap. 12 n. a./ Philippus Cardinalis Bononiensis ( = Philippus Calandrini di Sarzana)
Kap. 8 n. a.
Kap. 13 n. a.
Kap. 9 n. a.
Kap. 14 n. a./Nos Rodulphus Cardinalis Legatus
Kap. 10 n. a.
Kap. 15 n. a.
Kap. 11 n. a.
Kap. 16 n. a./n. a. Kap. 17 Egidius 625
624
In der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 liegt hier ein Druckfehler vor, denn dieses Kapitel trägt die Zählziffer 8 anstelle richtigerweise die Zählziffer 7. In dem folgenden Kapitel geht es dem Druckfehler entsprechend dann mit Kapitel 9 weiter. 625 In diesem Kapitel ist eine Constitutio adiecta von Albornoz wiedergegeben, die in der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 in Kap. 31 der Constitutiones adiectae abgedruckt ist. *
132
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
Kap. 12 n. a.
Kap. 18 n. a.
Kap. 13 n. a.
Kap. 19 n. a.
Kap. 14 n. a.
Kap. 20 n. a.
Kap. 15 n. a.
Kap. 21 n. a.
Kap. 16 n. a.
Kap. 22 n. a. Kap. 23 Joannes de Duchis Episcopus Coronensis ( = Johannes Deduc)
Kap. 17 n. a.
Kap. 24 n. a./n. a.
Kap. 18 n. a.
Kap. 25 n. a.
Kap. 19 n. a.
Kap. 26 n. .a.
Kap. 20 n. a.
Kap. 27 n. a./n. a.
Kap. 21 n. a.
Kap. 28 n. a. Kap. 29 Philippus ( = Philippus Calandrini di Sarzana)
Kap. 22 n. a./cit. Papst Urban IV, I, 7
Kap. 30 n. a./cit. Papst Urban IV, I, 7
Kap. 23 n. a.
Kap. 31 n. a.
Kap. 24 n. a.
Kap. 32 n. a.
Kap. 25 n. a.
Kap. 33 n. a./Nos Rodulphus Legatus Kap. 34 Papst Alexander V I / Sigismundus Cardinalis Gonzaga ( = Sigismundus de Gonzaga) Kap. 35 Rodulphus Pius Cardinalis Legatus
3. Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Rodolfo P i o 1 3 3 Kap. 36626 Rodulphus Pius Cardinalis Legatus Kap. 37 Rodulphus Pius Cardinalis Legatus Kap. 26 (Egidius)
Kap. 38 (Egidius)
Kap. 27 (Egidius)
(deficit)
Durch diese Gegenüberstellung der prä-carpensischen und der carpensischen Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen wird deutlich, daß durch die Integration der Constitutiones adiectae die Anzahl der Kapitel in den einzelnen Büchern zum Teil erheblich zugenommen hat. So wurde Buch I von 18 auf 22, Buch I I von 53 auf 55, Buch I I I von 24 auf 29, Buch IV von 55 auf 99, Buch V von 16 auf 31 und Buch V I von 27 auf 38 Kapitel erweitert 627 . Ferner ist aus dieser Gegenüberstellung zu ersehen, daß sich außer in Buch I sowie in Buch V 15, die Reihenfolge der Konstitutionen nicht geändert hat. Vielmehr wurden unter Beibehaltung der Systematik die Constitutiones adiectae als neue Kapitel eingefügt oder an übernommene Bestimmungen angefügt. Einige Konstitutionen der prä-carpensischen Ausgabe wurden kassiert, so unter anderem das bedeutende Kapitel 27 in Buch V I mit der Rubrica „De robore constitutionum praesentis voluminis & copia ipsarum recipienda per terras". Weiterhin läßt sich anhand dieser Gegenüberstellung erkennen, welche Kapitel der prä-carpensischen Ausgabe mit denen der carpensischen Ausgabe korrespondieren. Als Beispiel sei hier Buch IV angeführt, bei dem die Konstitution mit der Rubrica „De poenis ad quam monetam intelligantur" in Kapitel 54 der prä-carpensischen Ausgabe völlig gleichlautend in Kapitel 97 der carpensischen Ausgabe übernommen wurde; die Konstitution mit der Rubrica „De maleficiis in quibus non est per constitutiones determinata poena" in Kapitel 55 der prä-carpensischen Ausgabe wurde in Kapitel 98 der carpensischen Ausgabe übernommen 628 . Auch ist aus dieser Gegenüberstellung ersichtlich, welches Buch der carpensischen Ausgabe die meisten Zusätze, insbesondere von Kardinal Rodolfo Pio da 626
Dieses Kapitel der carpensischen Ausgabe Rom 1543 -1545 trägt die Zählziffer 37 anstelle der richtigen Zählziffer 36, da offenbar ein Druckfehler vorliegt. 627 Soweit Buch I der Aegidianischen Konstitutionen von 1357 lediglich 17 Kapitel umfaßt, ergibt sich dies daraus, daß später unter der Zählziffer 18 die Konstitution Papst Gregors XI. vom 15. 6. 1373 eingefügt wurde. Buch I I der Aegidianischen Konstitutionen von 1357 bestand aus nur 37 Kapiteln, die in der Folgezeit jedoch in mehrere Kapitel aufgeteilt wurden, so daß sich dann 53 Kapitel ergaben. 628 Const. Aeg. IV 54, Ausgabe Venedig 1540, S. 37, und Const. Aeg. IV 97, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 122; ferner Const. Aeg. IV 55, Ausgabe Venedig 1540, S. 37, und Const. Aeg. IV 98, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 122.
134
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
Carpi aufweist. Daraus läßt sich dann herleiten, bei welchen Materien sich der Kardinal vornehmlich einschaltet. Schließlich zeigt diese Gegenüberstellung der prä-carpensischen und der carpensischen Ausgabe, daß Buch I zwar um einige Papsterlasse erweitert, nunmehr aber auch nicht päpstliche Konstitutionen darin aufgenommen wurden. So ist in Kapitel 6 eine Constitutio adiecta von Johannes de Castillione wiedergegeben, in Kapitel 9 von Angelo Lupi de Cavis und in Kapitel 18 von Gabriel Condulmer, dem späteren Papst Eugen IV. In Kapitel 11 ist ein Zusatz von Rodolfo Pio da Carpi angefügt, ebenso findet sich in Kapitel 18 ein Zusatz des Kardinals. Nach Ansicht von Raffaele Foglietti 629 ist das Werk Rodolfo Pios und seiner Reformkommission nicht befriedigend ausgefallen und mit schwerwiegenden Mängeln behaftet. Trifft dies jedoch zu? Immerhin ist Filippo Ermini 630 der Meinung, daß jene Arbeit Fogliettis nicht frei von Ungenauigkeiten sei. Raffaele Foglietti 631 stellt unter anderem die Frage, ob es Rodolfo Pio gelungen sei, ein geordneteres Gesetzbuch zu schaffen. Er weist dies zurück mit der Begründung, es seien Konstitutionen des Kardinals in Buch I aufgenommen worden, in dem nach der Intention von Albornoz nur päpstliche Erlasse enthalten sein sollten. Es ist daher zu prüfen, ob die Systematik von Albornoz, die päpstliche Gesetzgebung am Anfang seines Werkes in Buch I geschlossen beieinander darzustellen 632 , durch die Überarbeitung Rodolfo Pios durchbrochen wurde. Bei einer näheren Untersuchung der nicht päpstlichen Konstitutionen in Buch I der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545 wird deutlich, daß es sich bei Kapitel 9 um das Mandat von Angelo Lupi de Cavis, Bischof von Tivoli, handelt, die unter Kapitel 8 eingefügte Bulle von Papst Sixtus IV. vom 28. 4. 1480 zu veröffentlichen und zu befolgen. Zugleich ist in Kapitel 9 das Mandat der „magnificorum dominorum priorum" von Fabriano an die „publicos banditores" zur Veröffentlichung dieser Bulle mit der „relatio dictae publicationis" wiedergegeben 633. Damit übernimmt Rodolfo Pio diese Bestimmungen in der Reihenfolge, in der sie unter den Constitutiones adiectae der präcarpensischen Ausgabe Venedig 1540 abgedruckt sind. Dort liest man nämlich unter Kapitel 8 die Bulle Papst Sixtus' IV. vom 28. 4. 1480 und in dem sich unmittelbar anschließenden Kapitel 9 das Mandat von Angelo Lupi de Cavis mit der „relatio dictae publicationis" 634 . Rodolfo Pio hat daher bei diesen 629
R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 26ff. F. Ermini, Gli ordinamenti politici e amministrativi nelle „Constitutiones Aegidianae", in: RISG 15 (1893), S. 69-94 (79 Fn. 2). 631 R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 28. 632 Vgl. A. Erler, Albornoz, S. 47. 633 Const. Aeg. I 8 und 9, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 8 ff. 634 Const, adiectae, Ausgabe Venedig 1540, S. 62aff.; vgl. auch S. 91 dieser Arbeit. 630
3. Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Rodolfo Pio
135
Bestimmungen die in den Constitutiones adiectae vorgegebene Ordnung beibehalten und sie vollständig in Buch I seines Reformwerkes übernommen. Die Konstitution von Johannes de Castillione in Kapitel 6 des ersten Buches der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545, die durch die Intitulatio „Joannes Cardinalis Papiensis" eingeleitet w i r d 6 3 5 , enthält die „Revocatio litterarum salui conductus homicidis quomodolibet concessarum" 636 . Sie steht in Zusammenhang mit der in Kapitel 5 abgedruckten Konstitution Papst Innozenz' VI., die die Rubrica „Quod Legatus possit componere super homicidio" trägt 6 3 7 . Dieser Papsterlaß ist gleichsam die Ermächtigungsgrundlage für dié nachfolgende „Revocatio" des Legaten Johannes de Castillione. Dadurch, daß diese beiden Konstitutionen hintereinander in Buch I enthalten sind, wird verdeutlicht, daß Johannes de Castillione zum Erlaß der „Revocatio" von päpstlicher Seite ermächtigt und diese daher wirksam und zu beachten ist. In Kapitel 18 ist die Constitutio adiecta von Gabriel Condulmer „De executoribus mittendis pro censibus, & affictibus & de modo servando in mittendo" 6 3 8 wiedergegeben, der jedoch keine Intitulatio vorangestellt ist. Vielmehr ist aus den einführenden Worten Rodolfo Pios zu entnehmen, daß die nun folgende Konstitution „ex additionibus Gabrielis" herrührt 6 3 9 . Sie steht sachlich mit der in dem vorhergehenden Kapitel enthaltenen Konstitution Papst Innozenz' VI. „De processibus factis propter census non solutos, sive affictus, ut non tollantur, nisi vocato thesaurario 44640 in Zusammenhang. Sie betreffen die gleiche Rechtsmaterie. Die beiden Zusätze Rodolfo Pios in Buch I beginnen jeweils mit der Intitulatio „Verum quia nos Rodulphus Pius Cardinalis de Carpo, qui supra Legatus 44641 . Der Zusatz des Kardinals in Kapitel 11 ist unmittelbar angefügt an die in diesem Kapitel zuvor wiedergegebene Konstitution Papst Sixtus' IV. vom 30. 5. 1478 „Quod consanguinei compellantur ad redimendum bona damnatorum" 6 4 2 und mildert diese Bestimmung ab: „... Iccirco rigorem, & modum praedictum moderantes, auctoritate, qua fungimur, decernimus exactiones huiusmodi, quatenus mitius fieri, ac benignius executioni mandari" 6 4 3 . 635
Const. Aeg. I 6, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 6a Zeile 15. Const. Aeg. I 6, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 6 a ff. Diese Konstitution korrespondiert mit Kapitel 19 der Constitutiones adiectae von Johannes de Castillione auf S. 56 der Ausgabe Venedig 1540. 636
637
Const. Aeg. I 5, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 5 b f. Const. Aeg. I 18, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 16 b f. Diese Konstitution ist in der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 in Kapitel 16 der Constitutiones adiectae von Gabriel Condulmer, S. 48, abgedruckt. 638
639
Const. Aeg. I 18, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 16 b Zeile 1 u. 3. Const. Aeg. I 17, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 16 a. 641 Const. Aeg. I I I , Ausgabe Rom 1543-1545, S. 12 a Zeile 21, und Const. Aeg. 118, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 16b Zeile 1. 640
642 643
Const. Aeg. I I I , Ausgabe Rom 1543-1545, S. I I b . Const. Aeg. I 11, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 12a Zeile 26-28.
136
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
Der Zusatz Rodolfo Pios in Kapitel 18 bezieht sich auf die bereits erwähnte, in demselben Kapitel enthaltene Konstitution Gabriel Condulmei-s 644 . Hierdurch wird deutlich, daß Rodolfo Pio in Buch I zwar einige nicht päpstliche Erlasse aufgenommen hat. Zugleich ist aber auch erkennbar, daß sich diese Bestimmungen auf päpstliche Konstitutionen des ersten Buches beziehen und mit diesen in einem rechtlichen Zusammenhang stehen. Ferner ist zu bedenken, daß Rodolfo Pio das erste Buch zudem um mehrere Papsterlasse erweitert hat, so von Pius II. und Sixtus IV. Auch nach der Reform des Kardinals setzt es sich fast ausschließlich aus päpstlichen Konstitutionen zusammen. Infolgedessen ist davon auszugehen, daß die Intention von Albornoz, in Buch I die päpstliche Gesetzgebung geschlossen beieinander darzustellen, um auf diese Weise dem Gesetzbuch ein besonderes Gewicht zu verleihen, von Rodolfo Pio und seiner Reformkommission bewahrt wurde. Entgegen Raffaele Foglietti steht dem nicht entgegen, daß die Bestimmungen der vorbezeichneten Verfasser in Buch I Eingang gefunden haben. Wegen ihres rechtlichen Zusammenhanges gehören sie gleichsam zu den päpstlichen Konstitutionen des ersten Buches, auf die sie sich jeweils beziehen. Aus diesem Grunde wäre es wohl kaum sinnvoll gewesen, nur um der Beibehaltung einer bestimmten Ordnung willen diese Konstitutionen nicht in Buch I aufzunehmen und an späterer Stelle ohne jeden Bezug einzufügen. Dies hätte dem Anliegen Rodolfo Pios, durch seine Reform ein klareres und übersichtlicheres Gesetzbuch zu schaffen, widersprochen. Durch das Einfügen der Konstitutionen von Angelo Lupi de Cavis, Johannes de Castillione, Gabriel Condulmer und seiner eigenen Zusätze ist dies Rodolfo Pio jedoch gelungen: „... quod constitutiones sie reformatae, & in faciliorem sensum redactae, tamquam utiles, & necessariae omnino adimpleantur . . , " 6 4 5 . Er selbst bekräftigt dies noch einmal in seinem Prooemium, das zu Beginn von Buch I I der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545 wiedergegeben ist: „NOS Rodulphus Pius de Carpo Cardinalis, & Legatus, omnes constitutiones Primo Libro ab Egidio olim Episcopo Sabinensi Legato compilatas diligenter collocandas censuimus. Ipsis que veteribus constitutionibus non nullas ab aliis iam additas, sed in diversis locis dispersas, ut materia ipsa, & ratio postulabat, loco suo accommodavimus" 6 4 5 3 . Weiterhin bemängelt Raffaele Foglietti 646 an dem Reformwerk Rodolfo Pios, daß einige Konstitutionen des ersten Buches nochmals in Buch IV wiedergegeben seien. Er hält dies für unnütz, für ohne jeglichen Sinn. Trifft dies jedoch zu?
644
Const. Aeg. I 18, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 16bf. Dies ist aus dem Breve Papst Pauls III. vom 10. 9. 1544 entnommen; Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, S. 5 b der nicht numerierten Seiten, Zeile 8 bis 9. 645a Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543 -1545, Prooemium des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi vor Buch II, S. 21 b Zeile 5 bis 11. R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 2 . 645
3. Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Rodolfo Pio
137
Untersucht man die einzelnen Constitutiones adiectae und forscht man nach, an welchen Stellen der sechs Bücher sie in die carpensische Ausgabe ein- bzw. angefügt wurden, so stellt man fest, daß einige Zusätze dort tatsächlich mehrmals Eingang gefunden haben. Die folgende Übersicht soll dies verdeutlichen: Carpensische Ausgabe Rom 1543-1545 Const. Const. Const. Const.
I 6 I 7 I 8 111
= = = =
Const. Const. Const. Const.
Const. Const. Const. Const. Const.
I I 10 I I 13 II15 I I 35 I I 37
= = = = =
Const. I I 35 Const. I I 1 5 Const. I I 13 Const. I I 10 Const, I I I 23 und Const. IV 84
IV IV IV IV
32 33 34 19
Const. I l l 23
= Const. I I 37 und Const. IV 84
Const. Const. Const. Const. Const.
= = = = =
IV IV IV IV IV
19 32 33 34 84
Const. 111 Const. I 6 Const. I 7 Const. I 8 Const. I I 37 und Const. I l l 23.
Das bedeutet, daß die in Buch I Kapitel 6 der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545 aufgenommene Constitutio adiecta von Johannes de Castillione nochmals vollständig in Buch IV Kapitel 32 dieser Ausgabe abgedruckt ist 6 4 7 . Allerdings wurde die Rubrica abgeändert, denn in I 6 lautet sie „Revocatio litterarum salui conductus homicidis quomodolibet concessarum" 648 . Dagegen trägt diese Konstitution in IV 32, ebenso wie in der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540, die Rubrica „Contra homicidas bannitos & condemnatos" 649 . Es stellt sich somit die Frage, was die Gründe dafür gewesen sein mögen, diese Constitutio adiecta des Johannes de Castillione zweimal in die carpensische Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen einzufügen? Wie bereits dargelegt, wurde sie von Rodolfo Pio in Buch I aufgenommen, da in der vorhergehenden Konstitution I 5 gleichsam die Ermächtigungsgrundlage für diese „Revocatio" enthalten ist und dadurch ihre Wirksamkeit hervorgeho647 Const. Aeg. 16, Ausgabe Rom 1543 -1545, S. 6 a ff., und Const. Aeg. IV 32, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 94b f. Diese Konstitution korrespondiert mit Kap. 19 der Constitutiones adiectae von Johannes de Castillione, S. 56 der Ausgabe Venedig 1540. 648 Const. Aeg. I 6, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 6a Zeile 13 u. 14. 649 Const. Aeg. IV 32, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 94b Zeile 5.
138
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
ben werden sollte. Zugleich ist aber auch zu bedenken, daß diese Konstitution materiellrechtliche Regelungen hinsichtlich der Mörder, der Gebannten und der Verurteilten enthält. Die Strafrechtsnormen sind jedoch vornehmlich in Buch IV zusammengefaßt. U m ein klares, übersichtliches Gesetzbuch zu schaffen, war es daher geboten, diese Constitutio adiecta wegen ihres strafrechtlichen Gehaltes in Buch IV zusätzlich einzufügen. Rodolfo Pio und seine Reformkommission wählten hierfür richtigerweise das Kapitel 32. Indem diese Konstitution Regelungen „contra homicidas bannitos & condemnatos" enthält, bildet sie von ihrer Rechtsmaterie her eine Art Bindeglied zwischen den vorhergehenden Kapiteln, die „De bannitis & condemnatis pro maleficio" 650 sowie „De bannitis ad mortem non receptandis" 651 handeln, und den nachfolgenden Kapiteln, die die „Constitutio Pii Secundi Pontificis Maximi contra homicidas & bannitos & condemnatos pro homicidiis" 6 5 2 sowie die „Bulla Sixti Papae IUI. Pontificis Maximi contra homicidas" 653 enthalten. In ähnlicher Weise verhält es sich mit den Konstitutionen von Papst Pius II. vom 28. 2. 1461 sowie von Papst Sixtus IV. vom 28. 4. 1480 und vom 30. 5. 1478. Die erstgenannte Bestimmung wurde von Rodolfo Pio in Buch I Kapitel 7 der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545 mit der Rubrica „Abdicatio a Legatis, & Gubernatoribus facultatis remittendi homicidas, & eisdem concedendi saluos conductus cum nonnullis aliis provisionibus contra homicidas" 654 aufgenommen. Zugleich ist sie nochmals in Buch IV Kapitel 33 dieser Ausgabe wiedergegeben. Dort trägt sie allerdings eine andere Rubrica, nämlich „Constitutio Pii Secundi Pontificis Maximi contra homicidas & bannitos & condemnatos pro homicidiis" 6 5 5 . Die Konstitution Papst Sixtus' IV. vom 28. 4. 1480 hat in Buch I Kapitel 8 Eingang gefunden und ist mit der Rubrica „Approbatio constitutionis praemissae" 656 überschrieben. Das bedeutet, daß sie sich auf die vorbezeichnete Konstitution Papst Pius' II. bezieht. Auch dieser Papsterlaß ist nochmals in Buch IV wiedergegeben und wegen seines engen rechtlichen Zusammenhangs mit der Bestimmung von Papst Pius II. unmittelbar im Anschluß an diese in Kapitel 34 abgedruckt. Allerdings wurde auch hier die Rubrica abgeändert, so daß sie nunmehr „Bulla Sixti Papae IUI. Pontificis Maximi contra homici650
Const. Aeg. IV 29, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 91b ff. Const. Aeg. IV 31, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 94a, b. 652 Const. Aeg. IV 33, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 95 bff. 653 Const. Aeg. IV 34, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 96 a ff. 654 Const. Aeg. 17, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 7a Zeile 10 bis 13. Diese Konstitution korrespondiert mit Kapitel 20 der Constitutiones adiectae von Papst Pius II., das auf S. 56 f. der Ausgabe Venedig 1540 abgedruckt ist. 655 Const. Aeg. IV 33, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 95 b ff. 656 Const. Aeg. I 8, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 8 b Zeile 11. Diese Konstitution korrespondiert mit Kapitel 8 der Constitutiones adiectae von Papst Sixtus IV., das auf S. 62 der Ausgabe Venedig 1540 wiedergegeben ist. 651
3. Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Rodolfo P i o 1 3 9
das" 6 5 7 lautet und dadurch in besonderer Weise auf ihren materiellrechtlichen Inhalt hinweist. Schließlich wurde von Rodolfo Pio die Konstitution Papst Sixtus' IV. vom 30. 5. 1478 in Buch I Kapitel 11 der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545 eingefügt. Sie trägt die Rubrica „Quod consanguinei compellantur ad redimendum bona damnatorum" 6 5 8 . Diese Konstitution wurde ebenfalls noch einmal in Buch IV aufgenommen, und zwar in Kapitel 19 mit der Rubrica „Quod consanguinei, & affines ad quartum gradum ad emendum bona condemnatorum: & quod parentes teneantur ad integram legitimam filiorum condemnatorum"659. Aus alledem ist zu ersehen, daß diese Konstitutionen einen verfassungsrechtlichen Aspekt enthalten bzw. päpstliche Erlasse darstellen und deshalb in Buch I aufgenommen wurden. Gleichzeitig vereinigen sie aber auch materielles Strafrecht in sich. Dies wird durch die Abänderung der Rubricae deutlich hervorgehoben. U m ein klares und übersichtliches Gesetzbuch zu schaffen, war es daher geboten, diese Konstitutionen nochmals in Buch IV wiederzugeben. Aber noch einige weitere Constitutiones adiectae wurden mehrmals in die sechs Bücher der carpensischen Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen aufgenommen. So findet man in Buch I I Kapitel 10, das mit der Rubrica „De officio Marescalli" 660 überschrieben ist, neben den Bestimmungen von Albornoz sowie anderer Verfasser eine Constitutio adiecta von Sigismundus de Gonzaga, die nochmals vollständig in demselben Buch in Kapitel 35 im Anschluß an eine Konstitution von Albornoz abgedruckt ist. Dort trägt sie allerdings die Rubrica „De custodia carceris & captivorum" 6 6 1 . Bei einer näheren Untersuchung dieser Constitutio adiecta stellt man fest, daß sich Sigismundus de Gonzaga hiermit einmal gegen den Amtsmißbrauch des Marschalls wendet, von den Gefangenen unerlaubte und unmäßige Einnahmen zu erheben. Zugleich regelt er darin das Gefangniswesen, indem er dem Marschall aufgibt, alle Gefangenen in das öffentliche Gefängnis einzuweisen. Daraus wird deutlich, daß diese Constitutio adiecta zwei verschiedene Rechtsmaterien betrifft, nämlich zum einen das Amt des Marschalls und zum anderen das Gefangniswesen. Infolgedessen wurde sie von Rodolfo Pio in der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545 sowohl in Buch I I Kapitel 10, das „De 657
Const. Aeg. IV 34, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 96 a ff. Const. Aeg. I I I , Ausgabe Rom 1543-1545, S. 12 b Zeile 7 bis 8. Sie korrespondiert mit Kapitel 3 der Constitutiones adiectae, das auf S. 64 der Ausgabe Venedig 1540 abgedruckt ist. 658
659
Const. Aeg. IV 19, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 88 a und b. Const. Aeg. I I 10, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 30bff., 32b. Diese Konstitution korrespondiert mit der Constitutio adiecta von Sigismundus de Gonzaga in Kapitel 19 auf S. 74 f. der Ausgabe Venedig 1540. 661 Const. Aeg. I I 35, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 57 a. 660
140
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
officio Marescalli" handelt, als auch in Buch I I Kapitel 35, das die Regelungen „De custodia carceris & captivorum" enthält, eingefügt. In gleicher Weise verhält es sich mit der Constitutio adiecta von Philippus Calandrini di Sarzana, die in der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 in Kapitel 3 seiner Zusätze wiedergegeben ist 6 6 2 . Diese Konstitution handelt von den Reisegeldern der Richter der Kurie oder deren Notare, die mit Erlaubnis des Legaten oder des Rektors zur Ahndung von Straftaten durch die Provinz reiten. Ferner wird darin bestimmt, daß diejenigen, die reiten, in Schriftstücken zu Händen des Notars der Kurie dem Thesaurar jede Vorstellung von dem Ort, den Personen und dem Grund, aus dem sie zu reiten und sich zu entfernen beabsichtigen, mitteilen müssen. Nach ihrer Rückkehr sind sie gehalten, in Schriftstücken dem Thesaurar von ihren Ermittlungen unter Angabe des Tages und der Rückkunft zu berichten. Da diese Constitutio adiecta von Philippus Calandrini sowohl die Reisegelder der Richter als auch diejenigen der Notare regelt, wurde sie von Rodolfo Pio in der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545 in Buch I I Kapitel 15 eingefügt, das die Konstitution des Albornoz mit der Rubrica „De viaticis iudicum, officialium, & maiorum commissionum salariis" 663 enthält, und gleichzeitig mit dem Hinweis „... In materia solutionum, & officiorum notariorum curiae generalis posuit Philippus Cardinalis Bononiensis , . . " 6 6 4 nochmals in Buch I I Kapitel 13 aufgenommen, das „De salario, & mercede sripturarum notariorum bancarum 665 handelt. Schließlich hat auch eine Constitutio adiecta von Gabriel Condulmer gleich mehrmals Eingang in die carpensische Ausgabe gefunden, nämlich in Buch I I Kapitel 37, in Buch I I I Kapitel 23 und in Buch IV Kapitel 84. Diese Konstitution handelt davon, daß der Klerus keine Steuern zu entrichten hat, und belegt jede civitas mit Strafe, die einen Geistlichen zu Steuern, Abgaben oder Wegegeldern nötigt. Dadurch wird deutlich, daß sie drei Rechtsgebiete berührt: das Steuerrecht, das Recht des Klerus sowie das Strafrecht. Infolgedessen wurde diese Constitutio adiecta des Gabriel Condulmer einmal in Buch I I Kapitel 37 an eine Konstitution von Albornoz angefügt, die „De gabellis, & dativis" 6 6 5 a handelt. Sodann wurde sie in Buch I I I , das die Bestimmungen für den geistlichen Bereich enthält, in Kapitel 23 unter der Rubrica „De gabellis non soluendis per ecclesiasticas personas" 6 6 5 b aufgenommen. Zuletzt wird sie wegen ihres straf662 663 664 665
Const, Const. Const. Const.
adiectae, Ausgabe Venedig 1540, S. 50 b f. Aeg. I I 15, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 42 a f. Aeg. I I 13, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 34bff., S. 36b Zeile 18 und 19. Aeg. I I 13, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 34b.
665a Const. Aeg. I I 37, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 60 a ff. Diese Konstitution korrespondiert mit Kapitel 4 der Constitutiones adiectae von Gabriel Condulmer, die auf S. 46 der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 abgedruckt ist. 665b Const. Aeg. I I I 23, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 77 b.
3. Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Rodolfo Pio
141
rechtlichen Inhalts nochmals in Buch IV Kapitel 84, ebenfalls unter der Rubrica „De gabellis non soluendis per personas ecclesiasticas666 wiedergegeben. Aus dieser Gegenüberstellung ist zu ersehen, daß einige Constitutiones adiectae verschiedene Rechtsmaterien betreffen und deshalb mehrmals in die carpensische Ausgabe eingefügt wurden. U m keine neuen Zweifel aufkommen zu lassen und um ein klares, übersichtliches und geordnetes Gesetzbuch zu schaffen („... quod constitutiones sie reformatae, & in faciliorem sensum redactae , . . " 6 6 7 ) , nahm Rodolfo Pio diese Zusätze jeweils an den Stellen auf, an denen die entsprechende Rechtsmaterie geregelt wird. Wegen der mehrfachen Wiederholungen mag man dies heute als umständlich und überflüssig empfinden. Dabei darf aber nicht übersehen werden, daß man ein solches Gesetzeswerk nicht mit heutigen Maßstäben messen darf, sondern vielmehr unter Berücksichtigung der damaligen Weltanschauung und Geisteshaltung betrachten muß. Auf die Gesetzgebungstechnik und Gesetzesterminologie dieser Zeit soll an späterer Stelle noch eingegangen werden. Die übrigen Constitutiones adiectae der verschiedenen Verfasser wurden, soweit sie in die carpensische Ausgabe Eingang gefunden haben, nur ein einziges Mal eingefügt. Dies geschah in der Weise, daß ihnen jeweils eine Art von Intitulatio vorangestellt wurde, in der ihr Verfasser genannt wird. Oftmals ist auch angegeben, auf welches Kapitel der Aegidianischen Konstitutionen sie sich beziehen, so daß erkennbar ist, ob sie an der vorgesehenen Stelle eingefügt wurden. Da einige Constitutiones adiectae von verschiedenen Verfassern auf dieselbe Konstitution Bezug nehmen und eine Zusatzkonstitution des öfteren die eines Vorgängers abändert, fügte Rodolfo Pio sie hintereinander jeweils an die Konstitution an, auf die sie sich beziehen. Wie aus der Gegenüberstellung der prä-carpensischen und der carpensischen Ausgabe zu ersehen ist, findet man dies besonders häufig in Buch II, in dem das Ämterwesen behandelt wird. So heißt es in Kapitel 15 des zweiten Buches, das die Rubrica „De viaticis iudicum, officialium, & maiorum commissonum salariis" trägt: „... Egidius Episcopus Sabinensis apostolicae sedis Legatus, & domini nostri Papae Vicarius. Quanquam viagia & absentationes iudicum & officialium rectoris a loco curiae ... Cognito per Philippum Cardinalem Bononiensem tunc Legatum, constitutionem praemissam non totale adhibuisse remedium circa materiam praedictorum, ipse addendo eidem constitutioni fecit quandam additionalem legem in praefata provincia, dum inter alias suas constitutiones in Capitulo tertio, de praemissis viaticis iudicum, & notariorum no vi ter pertractavit: & dum de viagiis iudicum,· & notariorum constitutionem posuit, sub Rubrica, De viagiis iudicum, quae incipit: Quanquam viatica, 666
Const. Aeg. IV 84, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 119a. Zitiert aus dem Breve Papst Pauls III. vom 10. 9. 1544, Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, S. 5 b der nicht numerierten Seiten, Zeile 8 bis 9. 667
142
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
addidimus, quod, quotiescunque contigerit iudices curiae, vel ipsorum notarios equitare per provinciam pro aliquo malefìcio, delicto, crimine, seu excessu, de licentia domini Legati, sive rectoris provinciae ... Anglicus Episcopus Albanus, & similiter Legatus decernendo, statuit in quibus casibus iudices possint equitare & in constitutione prima suarum additionum titulando, dixit pro quibus maleficiis iudices debeant equitare & disponendo postmodum, posuit haec verba: Anglicus miseratione divina Episcopus Albanensis terrarum & provinciarum sanctae Romanae Ecclesiae citra regnum Siciliae in Italia consistentium Vicarius generalis, ad perpetuam rei memoriam. U t gravaminibus, & oneribus nimiis occurramus ... Déclara vit etiam Papiensis Episcopus, tunc temporis Legatus, constitutionem Egidii, dum loquebatur de florenis duobus auri, quod intelligeretur de duobus monetae & in Capitulo tertio suarum constitutionum titulato similiter de viagiis iudicum, hoc modo disposuit, videlicet: Item constitutioni de viaticis iudicum, in qua quidem addimus, & illam declaramus, ... Circa equitationes iudicum, & eorum discessus Joannes Episcopus Albanus similiter Marchiae Legatus in Capitulo septimo suarum additionum infra scripto modo legem condidit, in Rubrica, Quod iudices non equitent sine licentia, & sedeant ad bancum, Statuimus quoque, & ordinamus, quod iudices curiae dictae provinciae ... Sanctissimus dominus noster Paulus Papa Tertius, qui adhuc vitam trahit incolumen & aetherea pascitur aura in suo brevi sub data Romae apud S. Petrum, sub anulo Piscatorie undecimo Januarii M D X X X V I , in quadam particula dicti brevis circa viatica dictorum iudicum, ac audientium, aliorum que commissariorum sic observari mandavit. videlicet: ITEM, quod auditores, & iudices . . . t t 6 6 8 . Rodolfo Pio hat somit an die Konstitution des Albornoz „De viagiis iudicum officialium & maiorum commissionum salariis" 669 , die wörtlich übernommen wurde, zunächst Kapitel 3 der Constitutiones adiectae des Philippus Cardinalis Bononiensis (Philippus Calandrini di Sarzana) angefügt 670 , das ausdrücklich auf die Bestimmung des Albornoz verweist, sodann Kapitel 1 der Constitutiones adiectae des Anglicus Episcopus Albanus (Anglico de Grimoard) 6 7 1 , gefolgt von Kapitel 3 der Constitutiones adiectae des Papiensis Episcopus (Johannes de Castillione) 672 sowie Kapitel 7 der Constitutiones adiectae des Joannes Episcopus Albanus (Jean Balue) 673 . Zuletzt folgt eine Bestimmung Papst Pauls III., die aus seinem Breve vom 11.1.1536 entnommen wurde 6 7 4 . 668 Const. Aeg. I I 15, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 42 a ff., insbesondere bei Egidius S. 42a Zeile 29 bis 31, Philippus Cardinalis Bononiensis S. 42b Zeile 16 bis 26, Anglicus Episcopus Albanus S. 43 a Zeile 3 bis 10, Papiensis Episcopus S. 43 a Zeile 32 bis 37, Joannes Episcopus Albanus S. 43 a Zeile 39 bis S. 43 b Zeile 3, Papst Paul III. S. 43 b Zeile 14 bis 19. 669
In der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 ist diese Konstitution des Albornoz in I I 16, S. 13 a bis 13 b zu finden. 670 671 672 673
Const, Const, Const, Const,
adiectae, adiectae, adiectae, adiectae,
Ausgabe Ausgabe Ausgabe Ausgabe
Venedig Venedig Venedig Venedig
1540, 1540, 1540, 1540,
S. 50b Zeile 50. S. 48 b Zeile 22. S. 53 b Zeile 18. S. 65b Zeile 27.
3. Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Rodolfo Pio
143
Auch in anderen Kapiteln ist Rodolfo Pio auf diese Weise verfahren, indem er Konstitutionen der prä-carpensischen Ausgabe wörtlich übernommen und die entsprechenden späteren Zusätze angefügt hat. Als weitere Beispiele seien hier die folgenden Bestimmungen angeführt: Const. Aeg. I I 18 mit der Rubrica „De advocato & procuratore fisci, ad causas camerae, & pauperum": „... Bertrandus Episcopus Sabinensis dum erat archiepiscopus Ebredinensis & reformater." 675 Es folgt die wörtliche Wiedergabe der Konstitution des Bertrandus, der sich folgender Zusatz anschließt: „Cum autem saepenumero contingebat in praefata provincia fieri syndicatus officialium, & privatae eiusdem provinciae personae, licet iustam praetenderent causam, abstinebant propter verecundiam, vel metum ab porrectione querelarum, vel ex aliis causis. Hoc cognito Philippus Cardinalis Bononiensis Legatus huic constitutioni addidit infra scriptam suam legem in sexto Capitulo suarum additionum, dum in Rubrica dixit, De advocato & procuratore fiscali interveniendo in syndicatu iudicum, & officialium gratis in nigro vero hoc modo: In syndicatu vero iudicum . . . 6 7 6 . Const. Aeg. I I 40 mit der Rubrica „De sindicatu officialium": „Egidius Episcopus Sabinensis apostolicae sedis legatus, & domini nostri Papae Vicarius" 6 7 7 . I m Anschluß an die wörtlich aufgenommene Konstitution des Albornoz sind folgende Zusätze angefügt: „Joannes de Castelliono posuit circa syndicatum officialium aliam constitutionem infra scripti tenoris, videlicet. Item constitutioni de syndicatu officialium addendo , declaramus sub constitutione praedicta ... Statuit Joannes Episcopus Albanus Marchiae Legatus constitutionem hoc modo, videlicet. Item ut magistratus civitatum, ... Sanctissimus dominus noster Papa Paulus Tertius in quodam suo brevi saepissime allegato confirmando praemissa, statuit hoc modo, videlicet: Item, quod auditores & iudices ordinarli debeant stare ad syndicatum . . . 6 7 8 . Const. Aeg. I I 53 mit der Rubrica „De privilegiis terrarum, & iurisdictionem praetendentium, ut registrentur": „Egidius Episcopus Sabinensis, apostolicae 674 Const, adiectae, Ausgabe Venedig 1540, S. 76b Zeile 31, insbesondere S. 77a Zeile 3. 675 Const. Aeg. I I 18, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 46 a und S. 46 b. 676 Const. Aeg. I I 18, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 46b Zeile lOff. Diese Bestimmung korrespondiert mit Kapitel 6 der Constitutiones adiectae des Philippus Calandrini die Sarzana, die auf S. 51 a Zeile 37 der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 abgedruckt ist. 677
Const. Aeg. I I 40, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 62a. Const. Aeg. I I 40, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 63 b, insbesondere bei Joannes de Castelliono S. 63 b Zeile 14 bis 17, Joannes Episcopus Albanus S. 64a Zeile 8 bis 10, Papst Paul III. S. 64a Zeile 21 bis 24. Die Constitutio adiecta von Johannes de Castillione ist in der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 in Kapitel 6 seiner Zusätze auf S. 54 a Zeile 1 bis 26 wiedergegeben, diejenige des Joannes Episcopus Albanus (Jean Balue) in Kapitel 16 auf S. 66 b Zeile 1 bis 10. Die Bestimmung Papst Pauls III. wurde aus seinem Breve vom 11. 1. 1536, S. 76 b und S. 77 a Zeile 20 entnommen. 678
144
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
sedis Legatus, & domini nostri Papae Vicarius" 6 7 9 . Es schließt sich hier das wörtliche Zitat der Konstitution des Albornoz an, die mit den Worten „Beneficia Romanorum Pontificum, . . . " 6 8 0 beginnt und der die folgende Constitutio adiecta angegliedert ist: „... Simili modo Gabriel Cardinalis Senensis Legatus posuit constitutionem huius tenoris, videlicet. Item monemus omnes & singulas communitates ... iuxta vim & tenorem constitutionis generalis secundi Libri constitutionum sub Rubrica, De privilegiis, quae incipit, Beneficia Romanorum Pontificum, & caetera. Illa vero privilegia , . . " 6 8 1 . Const. Aeg. V I 12 mit der Rubrica „De appellationibus interponendis a iudicibus generalibus provinciae celeri ter expediendis" 682 . Die in diesem Kapitel enthaltene Konstitution, die keine Intitulatio enthält und mit den Worten „Quia per appellationum diffugia" 6 8 3 beginnt, wurde von Rodolfo Pio vollständig übernommen. Im Anschluß an diese Bestimmung heißt es: „... Huic constitutioni bonae memoriae Philippus Cardinalis Bononiensis Legatus addendo statuii propter brevitatem termini , . . " 6 8 4 . Anhand dieser Beispiele läßt sich erkennen, daß Rodolfo Pio die Constitutiones adiectae seiner Vorgänger jeweils an die Konstitutionen des Albornoz bzw. an die von diesem übernommenen Bestimmungen angefügt hat, auf die sie zum Teil sogar durch Angabe des Buches sowie des Kapitels ausdrücklich Bezug nehmen. Dadurch ist es Kardinal Rodolfo Pio da Carpi gelungen, Ordnung und Klarheit in dem Gesetzbuch wiederherzustellen. Dieses Ziel der Reform kommt auch in dem Decretum des Kardinals zum Ausdruck, das seinem Gesetzeswerk vorangestellt ist: „... ut constitutiones ipse ordinem continerent, ac eam espolitionem (sie) reeiperent, . . . " 6 8 5 . Soweit sich die Constitutiones adiectae auf keine bestimmte Konstitution in den Büchern I bis V I beziehen, wurden sie von Rodolfo Pio in der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545 als ein eigenes Kapitel in einem der sechs Bücher jeweils an der Stelle eingefügt, an der die entsprechende Rechtsmaterie behandelt wird. Die Kapitel werden durch eine Art von Intitulatio eingeleitet, aus der der Verfasser dieser Zusatzkonstitution zu entnehmen ist. So heißt es ζ. B. in Buch I I Kapitel 27, das die Rubrica „Quod citationes ad instantiam 679
Const. Aeg. I I 53, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 71b. Const. Aeg. I I 53, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 71b Zeile 22. 681 Const. Aeg. I I 53, Ausgabe Rom 1543 -1545, S. 72 a Zeile 5 ff. Diese Zusatzkonstitution korrespondiert mit Kapitel 10 der Constitutiones adiectae des Gabriel Condulmer, die auf S. 47 a und 47 b der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 wiedergegeben ist. 682 Const. Aeg. V I 12, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 136 b. 683 Const. Aeg. V I 12, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 136 b Zeile 9. 684 Const. Aeg. V I 12, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 137a Zeile 8 und 9. Dieser Zusatz korrespondiert mit Kapitel 12 der Constitutiones adiectae des Philippus Calandrini di Sarzana, das auf S. 52a Zeile 4 bis 8 der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 zu lesen ist. 685 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, Decretum des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi, S. 2 b der nicht numerierten Seiten, Zeile 15 und 16. 680
3. Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Rodolfo P i o 1 4 5
curialium taxentur" trägt: „Bonae memoriae Joannes Cardinalis Andegavensis in Marchia Legatus in suis additionibus statuit, quod . . . " 6 8 6 . Kapitel 4 in Buch IV mit der Rubrica „Quod iudex procedendo per inquisitionem mittat copiam ad cameram" lautet: „Philippus presbyter Cardinalis Bononiensis, dum in provincia Marchiae Legatus esset, constitutionem quandam edidit in hac forma. Cum autem per querelam . . . " 6 8 7 . Als weiteres Beispiel sei Buch V Kapitel 14 genannt, das die Rubrica „De non procedendo contra contumaces ad tenutam, nisi facta fide de credito" trägt. Dieses Kapitel wird eingeleitet durch die Intitulatio „Joannes Cardinalis Andegavensis dum vixit, existens Legatus in Marchia, inter suas constitutiones edidit infra scriptam, videlicet, INSUPER quum saepe contingat , . . " 6 8 8 . In Buch V I Kapitel 23 mit der Rubrica „De celebratione festivitatum, & registris fiendis" heißt es: „Joannnes de Duchis Episcopus Coronensis dum vixit existens locumtenens in provincia Marchiae constitutionem infra scriptam edidit: videlicet, Solicitudo nobis commissi "689
Lediglich in Buch IV der carpensischen Ausgabe ist den Zusatzkonstitutionen in Kapitel 93 „Contra blasfemantes Deum, & Virginem & iurantes" 690 , Kapitel 94 „Quae intelligatur causa criminalis 691 , Kapitel 95 „De informationibus maleficiorum mittendis ad cameram per iudices spiritualium & maleficiorum & eorum notarios" 6 9 2 , Kapitel 96 „De protestatione fienda per procuratorem fisci iudicibus, & notariis" 6 9 3 sowie in Buch V Kapitel 11 „Quod iudaei possint fieri procuratores ad constituendum christianos" 694 keine Intitulatio vorangestellt. Durch einen Vergleich dieser Zusätze mit denjenigen in der präcarpensischen Ausgabe Venedig 1540 stellt man jedoch fest, daß es sich hierbei um Constitutiones adiectae von Philippus Calandrini di Sarzana handelt 695 . 686
Const. Aeg. I I 27, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 50a Zeile 1 bis 3. In der präcarpensischen Ausgabe Venedig 1540 ist diese Konstitution in Kapitel 12 der Constitutiones adiectae des Joannes Cardinalis Andegavensis (Jean Balue), S. 66a, abgedruckt. 687 Const. Aeg. IV 4, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 82 b Zeile 22 bis 26. Diese Bestimmung korrespondiert mit Kapitel 7 der Constitutiones adiectae des Philippus Calandrini di Sarzana auf S. 51 a der Ausgabe Venedig 1540. 688 Const. Aeg. V 14, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 127a Zeile 19 bis 23. Diese Konstitution ist in der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 in Kapitel 12 der Constitutiones adiectae des Joannes Cardinalis Andegavensis (Jean Balue) auf S. 66 a wiedergegeben. 689 Const. Aeg. V I 23, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 141a Zeile 27 bis 31. Diese Bestimmung entspricht Kapitel 19 der Constitutiones adiectae des Johannes Deduc, S. 67 a der Ausgabe Venedig 1540. 690 Const. Aeg. IV 93, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 121a Zeile 6 und 7. 691 Const. Aeg. IV 94, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 121a Zeile 20. 692 Const. Aeg. IV 95, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 121b Zeile 1 bis 3. 693 Const. Aeg. IV 96, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 121b Zeile 21 und 22. 694 Const. Aeg. V 11, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 126a Zeile 20 und 21. 695 Const. Aeg. IV 93, Ausgabe Rom 1543 -1545, entspricht Kapitel 16 der Constitutiones adiectae des Philippus Calandrini di Sarzana auf S. 52a der Ausgabe Venedig 1540; 10 Hoffmann
146
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
Warum enthalten diese Zusatzkonstitutionen in der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545 keine Intitulatio? Der Grund hierfür ist nicht bekannt. Möglicherweise handelt es sich bei diesen Kostitutionen jedoch um überkommenes Recht, so daß Rodolfo Pio bewußt auf die Intitulatio verzichtet hat. Soweit auch in Buch IV Kapitel 86 der carpensischen Ausgabe, das „De non imponendo novas gabellas, & pedagia" 696 handelt, kein Verfasser angegeben ist, mag dies daran liegen, daß man aus dem vorhergehenden Kapitel 85 Gabriel Condulmer als Urheber erkennen kann 6 9 7 . In Buch V ist in Kapitel 29 „Quod auditores & iudices non expediant causas extra curiam" 6 9 8 , in Kapitel 30 „De allegationibus non fiendis voce per advocatos, nisi aliter eis fuerit iniunctum" 6 9 9 und in Kapitel 31 „De observatione constitutionis super praescriptione instrumentorum hebraeorum & usurariorum" 700 ebenfalls keine Intitulatio enthalten. Aus dem vorhergehenden Kapitel 28 sowie dem Inhalt dieser Konstitutionen kann man jedoch entnehmen, daß sie von Rodolfo Pio herrühren 701 . Kardinal Rodolfo Pio da Carpi hat jedoch nicht nur die Constitutiones adiectae seiner Vorgänger gesichtet, bereinigt und, soweit sie nicht kassiert wurden, in das Gesetzbuch des Albornoz integriert. Vielmehr hat er auch eigene Zusätze geschaffen. Sie befinden sich in den folgenden Kapiteln der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545: Buchi
Kapitel 11 und 18;
Buch I I
Kapitel 2,3,4,5,9,10,12,13,16,20,22,24,27,28,29,31,37,38,42, 48;
Buch i l i
Kapitel 3, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 28;
Const. Aeg. IV 94, Ausgabe Rom 1543-1545, entspricht Kapitel 13 der Constitutiones adiectae des Philippus Calandrini auf S. 52a der Ausgabe Venedig 1540; Const. Aeg. IV 95, Ausgabe Rom 1543-1545, entspricht Kapitel 4 der Constitutiones adiectae des Philippus Calandrini auf S. 51 a der Ausgabe Venedig 1540; Const. Aeg. IV 96, Ausgabe Rom 1543 -1545, entspricht Kapitel 5 der Constitutiones adiectae des Philippus Calandrini auf S. 51a der Ausgabe Venedig 1540; Const. Aeg. V I I , Ausgabe Rom 1543-1545, entspricht Kapitel 10 der Constitutiones adiectae des Philippus Calandrini auf S. 51 b der Ausgabe Venedig 1540. 696 Const. Aeg. IV 86, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 119 a Zeile 15 und 16. Diese Konstitution stimmt wörtlich überein mit der Constitutio adiecta des Gabriel Condulmer in Kapitel 8, S. 47a, der Ausgabe Venedig 1540. 697 Const. Aeg. IV 85, Ausgabe Rom 1543 -1545, S. 119 a Zeile 1 u. 2, trägt die Rubrica „De gabellis non soluendis per personas ecclesiasticas" und korrespondiert mit Kapitel 4 der Constitutiones adiectae des Gabriel Condulmer, abgedruckt auf S. 46 b der Ausgabe Venedig 1540. 698 Const. Aeg. V 29, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 132a Zeile 5 und 6. 699 Const. Aeg. V 30, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 132a Zeile 19 und 20. 700 Const. Aeg. V 31, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 132a Zeile 28 und 29. 701 Vgl. R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 27.
3. Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Rodolfo Pio
Buch IV
Kapitel 8, 16, 21, 36, 44, 52, 60, 71, 77, 83, 99;
Buch V
Kapitel 4, 17, 18, 23, 25, 27, 28, (29, 30, 31);
Buch V I
Kapitel 11, 14, 33, 35, 36, 37.
147
Buch I enthält daher mit lediglich zwei Zusätzen Rodolfo Pios die wenigsten Zusätze. Dagegen weist Buch I I mit 20 Zusatzkonstitutionen des Kardinals die meisten auf. In Buch I I I befinden sich 9 Constitutiones adiectae Rodolfo Pios, in Buch IV 11, in Buch V 10 und in Buch V I 6. Zwar ist Raffaele Foglietti 101 a der Ansicht, daß in Buch V I auch in den Kapiteln 2, 10, 16, 24 und 27 Zusätze Rodolfo Pios enthalten seien. Dies kann aus diesen Bestimmungen, die ihre Herkunft nicht verraten, jedoch nicht entnommen werden. Die Zusätze Rodolfo Pios sind leicht zu erkennen, da sie jeweils durch eine Art von I n t i t u l a t i o eingeleitet werden. Eine Ausnahme bilden lediglich die bereits erwähnten Kapitel 29, 30 und 31 in Buch V. Wie bereits dargelegt, lautet die Intitulatio in den Kapiteln 11 und 18 des ersten Buches der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545: „Verum quia nos Rodulphus Pius Cardinalis de Carpo, qui supra Legatus .. . " 7 0 2 . In Buch I I wird als Intitulatio „Nos Rodulphus Pius de Carpo Cardinalis & Legatus . . . " 7 0 3 oder „Nos Rodulphus Pius Cardinalis & Legatus ,.." 7 0 4 · angegeben. In Buch i i i werden die Zusätze Rodolfo Pios eingeleitet mit den Worten „Ex decreto praelibati Reverendissimi de Carpo additur . . . " 7 0 5 oder „Ex ordine praelibati Reverendissimi & illustrissimi de Carpo additur.. . " 7 0 6 . In Kapitel 19 des dritten Buches heißt es gar „Ex ordine, & arbitrio praelibati illustrissimi de Carpo additur .. . " 7 0 7 und in Kapitel 28 des dritten Buches „Ex decreto & deliberatione praelibati Reverendissimi & illustrissimi domini de Carpo, & Legatus additur . . . " 7 0 8 . In Buch IV ist den Bestimmungen Rodolfo Pios die Intitulatio „Rodulphus Pius presbyter Cardinalis de Carpo Marchiae Legatus" 709 oder „Rodulphus Pius presbyter Cardinalis de Carpo in provincia Marchiae Anconitanae Legatus" 710 vorangestellt. In Buch V werden die Konstitutionen Rodolfo Pios 7oia ^ Foglietti,
Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 31.
702
Const. Aeg. 111, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 12a Zeile 21, und Const. Aeg. 118, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 16 b Zeile 1. 703 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, I I 3, S. 25a; I I 16, S. 44b; I I 20, S. 47a; I I 22, S. 48 b. 704 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, I I 2, S. 23 b; I I 4, S. 27 b; I I 5, S. 29 a; I I 9, S. 30b.; I I 10, S. 32aund 33a; I I 12, S. 34a; I I 13, S. 37b; I I 16, S. 45b; II24, S. 49a; I I 27, S. 50a; I I 28, S. 50b; I I 29, S. 51 a; I I 31, S. 53b; I I 37, S. 61 b; I I 38, S. 62a; I I 42, S. 65b; I I 48, S. 68 b. 705 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, I I I 3, S. 75a; I I I 17, S. 76b; I I I 21, S. 77a; I I I 22, S. 77b; I I I 23, S. 77b. 706 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, I I I 12, S. 76a; I I I 13, S. 76a. 707 708 709
10*
Const. Aeg. I I I 19, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 77a. Const. Aeg. I I I 28, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 79b. Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, IV 8, S. 83b; IV 71, S. 115b.
148
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
mit der Intitulatio „Nos Rodulphus Cardinalis Legatus" 711 eingeleitet. In Buch V I lautet die Intitulatio seiner Zusätze „Rodulphus Pius Cardinalis Legatus, & vicarius" 7 1 2 , „Nos Rodulphus Cardinalis Legatus" 713 , „Nos Rodulphus Legatus" 714 oder „Rodulphus Pius Cardinalis Legatus" 715 . Auffällig ist hierbei, daß die Intitulationen der Zusätze Rodolfo Pios verschieden sind und von Buch zu Buch erheblich voneinander abweichen. Möglicherweise lassen sich dadurch Rückschlüsse auf die Arbeitsweise der Reformkommission des Kardinals ziehen. Über die Tätigkeit und das Vorgehen der 16 Kommissionsmitglieder ist nichts bekannt. Man weiß nicht, ob sie alle gleichzeitig an den sechs Büchern gearbeitet haben. Ferner ist nicht bekannt, ob und gegebenenfalls wo und in welchen Abständen sie sich getroffen haben, um den Fortgang der Reformarbeiten zu besprechen und aufeinander abzustimmen. Auf Grund der unterschiedlichen Intitulationen zu den Bestimmungen Rodolfo Pios läßt sich jedoch vermuten, daß die 16 Kommissionsmitglieder in mehrere Unterkommissionen eingeteilt waren. Jede Unterkommission war sodann mit der Überarbeitung eines oder auch mehrerer Bücher der Aegidianischen Konstitutionen betraut. Wegen des Gleichklanges der Intitulationen in den Büchern II, V und V I liegt der Schluß nahe, daß diese von einer Gruppe überarbeitet wurden, während die Bücher I, I I I und IV jeweils von einer anderen Gruppe reformiert sein dürften. Dem steht nicht entgegen, daß die Intitulationen zu den Bestimmungen der anderen Verfasser in sämtlichen Büchern gleichlautend sind, denn diese Intitulationes waren bereits in den prä-carpensischen Ausgaben der Aegidianischen Konstitutionen vorhanden und konnten daher übernommen werden. Indem die Zusätze Rodolfo Pios jeweils durch eine Intitulatio eingeleitet werden, stellt sich die Frage nach ihrem weiteren formalen Aufbau. Gleichen sie darin ebenso wie die Konstitutionen des Albornoz den mittelalterlichen Herrscherurkunden (Herrscherkonstitutionen) 716 ? Eine I n s e r ì p t i o , die den Empfänger der Urkunde nennt, enthalten die fünf Konstitutionen Papst Innozenz V I . 7 1 7 , in denen die Vollmachten für Albornoz 710 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, IV 16, S. 87b; IV 21, S. 88b; IV 36, S. 98 b; IV 44, S. 104b; IV 52, S. 109b; IV 60, S. 112b; IV 77, S. 117a; IV 83, S. 118b; IV 99, S. 122a. 711 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, V 4, S. 124b; V 17, S. 128b; V 18, S. 128b; V 23, S. 130a; V 25, S. 131a; V 27, S. 131b; V 28, S. 131b. 712 Const. Aeg. V I 11, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 136a. 713 Const. Aeg. V I 14, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 137b. 714 Const. Aeg. V I 33, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 146b. 715 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, V I 35, S. 147a; V I 36, S. 147b; V I 37, S. 147b. 716 Vgl. A. Erler, Albornoz, S. 68. Näheres über Text und Protokoll von Urkunden bei H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre, Bd. 1, S. 47 f. 717
Const. Aeg. I Kapitel 1 bis 5 (P. Sella, Cost., S. 4 bis 13) sowie Const. Aeg. 11 bis 5, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 2 a bis 6a.
3. Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Rodolfo P i o 1 4 9
umschrieben sind und die Kardinal Rodolfo Pio in sein Gesetzeswerk wörtlich übernommen hat 7 1 8 : „Dilecto filio Egidio tituli sancti Clementis presbytero Cardinali, apostolicae sedis Legato salutem, & apostolicam benedictionem" 719 . Nach Adalbert Erler 720 soll damit die Legitimität des Gesetzeswerkes klargestellt werden. Eine Parallele hierzu findet man in dem Breve Papst Pauls III. vom 21. 4. 1539, das die Vollmachten Rodolfo Pios angibt. Es enthält die folgende Inscripto: „Dilecto Filio Rodulpho tituli Sanctae Priscae Praesbitero Cardinali de Carpo nuncupato in Provincia nostra Marchiae Anconitanae ac Civitatibus, Terris, Castris, & locis, Massae Trabariae, & Presidatus Farfensi necnon Asculi, apostolicae sedis legato ac pro nobis, & Romana Ecclesia in Spiritualibus, & temporalibus generali Vicario Salutem & apostolicam benedictionem" 721 . Dadurch soll Rodolfo Pio als Bevollmächtigter klar erkennbar sein und die Legitimität seines Reformwerkes hervorgehoben werden. Eine Inscriptio enthalten in der carpensischen Ausgabe zum Beispiel auch die Bulle Papst Sixtus IV. in B u c h i Kapitel 13 („Dilectis flliis magistro Joanni Andreae de Gemaldis Notario, & cubiculario nostro, & Sylvestro de Maluicinis canonico Ecclesiae Collegiatae sancti Sixti Viterbiensis, in Marchia Anconitana, & Romandiolae provinciis, syndicis, & commissariis nostris salutem, & apostolicam benedictionem" 722 ) sowie das Breve Papst Johannes X X I I . in Buch I I I Kapitel 26 („Dilecto filio Amelio praeposito Bellimontis gubernatori ordinis sancti Augustini Vallionensis diocesis, cappellano nostro, Marchiae Anconitanae rectori salutem, & apostolicam benedictionem" 723 ). Die Zusätze Rodolfo Pios enthalten jedoch keine Inscriptio. Für den Rechtshistoriker ist von besonderer Bedeutung, ob die „Additiones Carpenses", wie die Zusätze des Kardinals späterhin genannt werden 724 , eine 718
Die sechste Konstitution Papst Innozenz' VI. mit der Rubrica „De cassatione offitialium (sie) et statutorum factorum per terras et usurpando cognitionem appellationum que pertinent ad ecclesiam et ad eius officiates", die eine Vollmacht von Albornoz enthält, ist in die carpensische Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen nicht übernommen worden. 719 Const. Aeg. 12, 3, 4, 5, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 3 b Zeile 26 bis 28, S. 4a Zeile 23 bis 25, S. 4b Zeile 30 bis 32, S. 5b Zeile 2 bis 4. Die Inscriptio in Const. Aeg. I 1 ist ausführlicher. 720 A. Erler, Albornoz, S. 68 f. 721 Breve Papst Pauls III. vom 21. 4. 1539 auf S. 3 a der nicht numerierten Seiten in der Ausgabe Rom 1543-1545, Zeile 1 bis 11. 722 Const. Aeg. 113, Ausgabe Rom 1543 -1545, S. 12 b Zeile 29 bis 33. Das Kapitel trägt die Rubrica „Bulla Sixti Papae Quarti, quod Gubernatoribus & Thesaurariis non liceat de maioribus condemnationum gratiis excedere sex florenos: in minoribus vero tertiam partem". 723 Const. Aeg. I I I 26, Ausgabe Rom 1543 -1545, S. 78 b Zeile 35 bis 38. Dieses Kapitel trägt die Rubrica „Quod episcopi, & caeteri praelati, & religiosi teneantur servare excommunicationes, & interdicta". In der prä-carpensischen Ausgabe Venedig 1540 ist diese Konstitution auf S. 25 in Kapitel 22 des dritten Buches wiedergegeben. Sie wurde von Rodolfo Pio wörtlich übernommen.
150
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
A r e n g a oder P r ä a m b e l haben. Die Präambel ist ein Vorspruch, der bei Gesetzen das Motiv des Gesetzgebers aussprechen und damit eine Leitlinie für die Auslegung geben kann. Der Sache nach ist sie von der Arenga kaum zu trennen 725 . Wie Adalbert Erler feststellte 726 , enthält bei den Konstitutionen des Albornoz fast jedes Kapitel eine Arenga bzw. Präambel. Findet sich dies auch bei den Zusätzen Rodolfo Pios? Bei der Durchsicht seiner Bestimmungen sieht man, daß er diesen zum Teil ebenfalls eine Arenga bzw. Präambel vorangestellt hat. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel liest man in Buch I I Kapitel 3, das „De audientia danda per rectorem, & eius officiates" handelt: „... diligenter perspicientes aliorum Rectorum constitutiones, tempore, quo fuerant sancitae, nedum utiles, & necessarias, verum etiam sanctissimas existimari, nunc vero propter temporum varietatem, nimiam que vivendi licentiam, aliquid in eis esse, quod iure desyderari possit propterea, cum quae de novo emergunt, novo indigeant auxilio, novam hanc constitutionem edidimus, . . . " 7 2 7 . Als weiteres Beispiel sei die Arenga bzw. Präambel zu dem Zusatz Rodolfo Pios in Buch I Kapitel 11 angeführt, das die Rubrica „Quod consanguinei compellantur ad redimendum bona damnatorum" trägt: „Verum quia nos Rodulphus Pius Cardinalis de Carpo, qui supra Legatus, experientia testante vidimus, & comperimus per sedem apostolicam pro temporum varietate huiusmodi, potestatem alienandi bona confiscata quandoque indultam thesaurariis pro tempore existentibus, qui inhaerentes verbis supra scriptae constitutionis, iuxta ipsius vigorem ad exactionemintegramprocedunt.. , " 7 2 8 . In Buch I I Kapitel 16, das „De executoribus, & executionibus" handelt, lautet die Arenga bzw. Präambel zu dem Zusatz Rodolfo Pios: „... visis videndis, habita que diligenti informatione super praemissis: & viso etiam, quod modo satis maiora viatica solvantur, quam antiquis temporibus praenarratorum rectorum, & de latere Legatorum, decernimus, & statuimus , . . " 7 2 9 . Die gesetzgeberischen Motive in 724 Vgl. Aegidianae Constitutiones cum additionibus Carpensibus nunc denuo recognitae, et a quampluribus erroribus expurgatae, cum glossis non minus doctis quam utilibus prestantissimi viri Gasparis Cabalimi de Cingulo Iurisconsulti Picentis. Cum Indice tarn Capitulorum quam Glossarum locorum insignium. Cum Privilegiis Summi Pontificis Et Senatus Veneti. Venetiis M D L X X I ; zitiert nach R. Raffaelli, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, bibliotecnicamente descritte in tutte le loro edizioni, in: Archivio storico per le Marche e per l'Umbria, Bd. I I (1885), S. 63-102 (88). 725 A. Erler, Art. „Präambel", in: HRG, Bd. 3 (1984); Sp. 1848-1850 (Ì848f.); vgl. auch F. Merzbacher, Art. „Arenga", in: HRG, Bd. 1 (1971), Sp. 217-218. 726 A. Erler, Albornoz, S. 69; ferner A. Erler, Art. „Präambel", in: HRG, Bd. 3 (1984), Sp. 1848-1850 (1849). 727 Const. Aeg. I I 3, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 25 a Zeile 27 bis 33. Der Zusatz Rodolfo Pios ist an einige Bestimmungen seiner Vorgänger, die in diesem Kapitel enthalten sind, angefügt. 728 Const. Aeg. I I I , Ausgabe Rom 1543-1545, S. 12 a Zeile 21 bis 26. Zuvor ist in diesem Kapitel die Konstitution Papst Sixtus' IV. vom 30. 5. 1478 wiedergegeben. 729 Const. Aeg. I I 16, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 45 b Zeile 4 bis 7. Vor der Additio Rodolfo Pios sind mehrere Bestimmungen seiner Vorgänger abgedruckt.
3. Änderungen der Aegidianischen Konstitutionen durch Rodolfo P i o 1 5 1
den Arengen der Zusätze Rodolfo Pios werden jedoch weiter unten nochmals ausführlicher behandelt. Die eigentliche Rechtsnorm beginnt mit der D i s ρ os i t i o . Sie ist Ausdruck des gesetzgeberischen Willens und gibt an, welche Anordnung im Einzelfall getroffen wird. In der Regel wird sie durch Formulierungen wie „statuimus", „statuimus et ordinamus", „statuimus, decernimus et declaramus", und ähnliches eingeleitet 730 . Diese Wendungen findet man sehr häufig auch bei den Zusätzen Rodolfo Pios, worauf an späterer Stelle noch eingegangen wird. Ebenso wie bei den Konstitutionen des Albornoz wird auch bei den Bestimmungen Rodolfo Pios die Dispositio oftmals mit einem motivierenden Nebensatz eingeleitet. So heißt es in den Additiones Carpenses ζ. B.: „... Et propterea ad omne dubium removendum declaramus , . . " 7 3 1 , „Declaramus ad tollendas dubietates . . . " 7 3 2 , „... Ut dubitationis materia, quam alias in curia fuisse nobis relatum fuit, tollatur: volumus, & declaramus . . . " 7 3 3 , „Quoniam saepe dubitatum fuisse nobis relatum fuit, , . . " 7 3 4 , „... Volentes igitur omnem dubitationem tollere .. . " 7 3 S , und „... Decernimus, ut dubitationis materia, quae alias fuisse in curia dicitur, tollatur . . . " 7 3 6 . Zuweilen ist der Dispositio in den Zusätzen Rodolfo Pios eine N a r r a t i ο vor angestellt. Darin werden Übelstände geschildert, die durch den folgenden Rechtssatz abgestellt werden sollen 737 . Als Beispiel sei hier die Narratio in der Bestimmung Rodolfo Pios in Buch I I Kapitel 20 angeführt, das die Rubrica „Quod advocatus, & procurator fisci sit procurator pauperum" trägt: ... cognoscentes, praesertim tempestate nostra, advocatum, & procuratorem fisci magis impendere operam offensionibus pauperum, quam defensionibus, aut saltern minus diligenter, quam deberent, eorum praesertim pauperum carceratorum, praefatae constitutioni addentes ordinamus,.. . " 7 3 8 . Als weiteres Beispiel sei die Narratio zu dem Zusatz Rodolfo Pios in Buch V I Kapitel 37 genannt, das mit der Rubrica „Quod curiales sint in omnibus, & per omnia cives in omnibus civitatibus, terris, & locis provinciae" überschrieben ist: „... Licet per bonae memoriae Egidium Sabinensem legatum fuerit statutum, quod communitates provinciae non possint aliquid contra curiales statuere, & omnia statuta sie facta sint ipso iure nulla, & reprobata: & curiales ipsi in his, ad quae tenerentur, non potuissent, nisi ut cives gravari: tarnen sicut ad aures nostras pervenit multas communitates in fraudem dictarum 730
A. Erler, Albornoz, S. 69; W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 71 und S. 77 f. 731 Const. Aeg. I I 24, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 49 b Zeile 1 und 2. 732 Const. Aeg. I I 31, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 53b Zeile 10. 733 Const. Aeg. IV 16, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 87b Zeile 4 bis 5. 734 Const. Aeg. IV 52, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 109a Zeile 35 bis S. 110a Zeile 1. 735 Const. Aeg. IV 60, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 113 a Zeile 11. 736 Const. Aeg. IV 71, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 115b Zeile 13 und 14. 737 Zu der Narratio vgl. W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 72; H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre, Bd. 1, S. 48. 738 Const. Aeg. I I 20, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 47 a Zeile 23 bis 26.
152
III. Teil: Rodolfo Pio und-die Aegidianischen Konstitutionen
constitutionum, damnum que curialium ipsorum varias edidisse leges, & pacta, quod ipsi curiales quovis quaesito colore non possint bona stabilia emere, habere, tenere, & possidere in eorum civitatibus, terris, & locis: ipsos que curiales fore, & esse forenses, & pro forensibus haberi & reputari. Nos volentes huiusmodi fraudibus obviare, & ipsos curiales, qui sub nostra protectione existunt, tueri, & in eorum privilegiis conservare, hac praesenti nostra constitutione statuimus, ..." 739. Im Anschluß an die Dispositio findet sich in einigen Bestimmungen Rodolfo Pios eine S a n e t i ο oder P o e n f o r m e l . Diese lautet z.B. in B u c h i l i Kapitel 19, das „De pignorantibus vasa sacra, vel ornamenta ecclesiastica, & ea reeipientibus" handelt: „... contrafacientes incidant in poenam decern ducatorum auri , . . " 7 4 0 . In dem Zusatz Rodolfo Pios in Buch IV Kapitel 71, dem die Rubrica „De poena stuprantis virginem nondum viripotentem" vorangestellt ist, sind Dispositio und Sanctio gleichsam in einem Satz enthalten: „... siquis violenter virginem nondum viripotentem deflora verit, seu stupraverit, ... puniatur." 7 4 1 Ein weiteres Beispiel für eine Sanctio in einer Bestimmung Rodolfo Pios ist Kapitel 44 in Buch IV, das die Rubrica „De repressaliis non concedendis contra subditos rectoris provinciae, praeterquam ab ipso rectore" trägt. Darin heißt es: „... tarn impetrantes, quam exequentes rectoris arbitrio puniantur, semper saluis poenis in proxima constitutione contentis" 742 . Anhand dieser Beispiele läßt sich erkennen, daß die Additiones Carpenses in ihrem Aufbau der strengen Urkundenform 743 kaum folgen. Die einzelnen Urkundenteile wie Arenga bzw. Präambel, Narratio, Dispositio und Sanctio gehen oftmals ineinander über, ihre Grenzen sind oft fließend und verwischt. Einige Bestimmungen Rodolfo Pios bestehen sogar lediglich aus einer Art von Intitulatio und der Dispositio. So heißt es z. B. in Buch I I Kapitel 4, das „De vita, & honestate, & habitatione rectoris, & suorum officialium" handelt: „... NOS Rodulphus Pius Card. & mandavimus." 744
Legatus ante dictus observari
Vornehmlich in den Kapiteln von Buch IV sind zahlreiche Einschübe und Interpolationen (Redaktionen) festzustellen, deren Herkunft nicht erkennbar ist. Wurden sie von Rodolfo Pio verfaßt? Welcher Zweck kommt ihnen zu? Sollen sie gar den ursprünglichen Inhalt einer Norm wiederherstellen, der im Laufe der Zeit verwässert und abgeändert wurde? Diesen Fragen kann hier jedoch nicht nachgegangen werden, da ihre Beantwortung einen Vergleich der 739 740 741 742 743
Const. Aeg. V I 37, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 147b Zeile 30 bis S. 148a Zeile 6. Const. Aeg. I I I 19, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 77a Zeile 13 und 14. Const. Aeg. IV 71, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 115b Zeile 14 bis 17. Const. Aeg. IV 44, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 105 a Zeile 1 und 2. Zu der Urkundenform vgl. H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre, Bd. 1,
S. 47f. 744
Const. Aeg. I I 4, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 27b Zeile 29 und 30.
4. Kardinal Rodolfo Pio da Carpi — Kompilator oder Legislator?
153
erhaltenen Handschriften sowie der gedruckten Ausgaben der Aegidianischen Konstitutionen erfordern würde. 4. Kardinal Rodolfo Pio da Carpi — Kompilator oder Legislator? Im Mittelalter herrschte die Auffassung vom alten, guten Recht 7 4 5 . Ein Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift galt nur dann als gut, wenn sein oder ihr hohes Alter nachweisbar war. Kraft und Wert des Rechts lagen in seiner Bewährung durch lange Geltungsdauer. Älteres Recht war nach mittelalterlichem Rechtsdenken daher besseres Recht. Das Recht war von Gott vorgebildet und als solches zeitlos und von Anfang an da 74 ^. Es wurde nicht künstlich geschaffen, es konnte nur als vorhandenes, aber dem trüben Sinn des Menschen nicht immer gegenwärtiges gefunden, ans Licht gebracht werden 747 . Auch in der Zeit seiner Verdunkelung bestand das Recht unverbrüchlich fort. Die Auffassung vom Vorrang des Alten entsprach einem allgemeinen Lebensgefühl des Mittelalters. Man war gegen Neues und gegen Neuerer, die leicht in die Nähe des Ketzers gerückt wurden 7 4 8 . So heißt es in Liber Extra 1.4.9.: „Novitates plerumque discordiam pariunt" 7 4 9 . Neues Recht, das heißt die Veränderung und Ergänzung des überkommenen und bestehenden Rechts, war aber auch zu jener Zeit wie zu allen Zeiten notwendig. Wie konnte man zu dieser Rechtserneuerung gelangen? Auf was konnte man das neue Recht stützen? Die Vorstellungen vom alten, guten Recht konnten die Veränderungen nicht erleichtern, sondern mußten sich ihnen widersetzen. Wie Adalbert Erler 750 erstmals dargelegt hat, fand die mittelalterliche Gesetzgebung ihre Rechtfertigung in der necessitas. In der Berufung auf 745 F. Kern, Recht und Verfassung im Mittelalter, in H Z 120 (1919), S. 1 - 79 (3 f.). Diese Auffassung wurde ebenso im weltlichen wie im kirchlichen Bereich vertreten; so R. Sprandel, Über das Problem neuen Rechts im frühen Mittelalter, in: ZRG (KA) 79 (1962), S. 117 bis 137 (118). 746
F. Kern, Recht und Verfassung im Mittelalter, in H Z 120 (1919), S. 1-79 (3 ff.); W. Ebel, Geschichte der Gesetzgebung in Deutschland, S. 12 f. A. Erler, Necessitas als Impuls der Rechtserneuerung, in: La Formazione Storica del Diritto Moderno in Europa, S. 113 bis 122 (114); vgl. auch R. Sprandel, Über das Problem neuen Rechts im frühen Mittelalter, in: ZRG (KA) 79 (1962), S. 117-137 (116 f.); H. Krause, Dauer und Vergänglichkeit im mittelalterlichen Recht, in Z R G (GA) 75 (1958), S. 206-251 (206f.). 747 Das im Einzelfall „gefundene", aus dem unbewußt bleibenden Gesamtvorrat rechtlicher Vorstellungen geschöpfte („Schöffen"!) Urteil war die erste Erscheinungsform des germanischen Rechts; so W. Ebel, Geschichte der Gesetzgebung in Deutschland, S. 15; vgl. auch F. Kern, Recht und Verfassung im Mittelalter, in H Z 120 (1919), S. 1 -79 (14). 748 H. Krause, Dauer und Vergänglichkeit im mittelalterlichen Recht, in: Z R G (GA) 75 (1958), S. 206-251 (210). 749 Zitiert nach A. Erler, Necessitas als Impuls der Rechtserneuerung, S. 113. 75 0 A. Erler, Albornoz, S. 74ff.; A. Erler, Necessitas als Impuls der Rechtserneuerung, S. 114ff.; A. Erler, Art. „Präambel", in HRG, Bd. 3 (1984), Sp. 1848-1850 (1849f.).
154
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
diese konnte der Gesetzgeber der Zeit auf eine lange und reiche Tradition zurückgreifen. Schon das klassische römische Recht hat die rechtserzeugende Kraft der necessitas erkannt und anerkannt. In den Digesten des Modestinus (D.I.3.40) heißt es: „omne ius aut consensus fecit aut necessitas constituit aut firmavit consuetudo" 751 . Diesen Gedanken hat Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen aufgegriffen. A n dem Triumphtor des Kaisers in Capua, das heute allerdings zerstört ist, befand sich in einem Rund ein gewaltiger Frauenkopf, der die „Justitia Caesaris" darstellte und von vier weiblichen Gestalten umgeben war, die der Bonner Kunsthistoriker C. A. Willemsen als Provisio, Ratio, Lex und Necessitas deutete 752 . Dieser bildlichen Allegorie entsprechend steht das legislatorische Schaffen Friedrichs II. ganz unter dem Eindruck der necessitas. In dem Prooemium seiner Konstitutionen von Melfi heißt es: „Sicque ipsa necessitate cogente, nec minus divine provisionis instinctu, principes gentium sunt creati, per quos posset licentia scelerum coerceri" 753 . Bei der christlichen Legitimation des Herrschers zur Gesetzgebung kam noch ein weiterer Aspekt hinzu, nämlich der der „diversitas temporum" 7 5 4 . Der Wandel der Zeit macht eine Abänderung des alten Rechts notwendig. Der Formel der „diversitas temporum", die in den mittelalterlichen Quellen häufig wiederkehrt, begegnet man bereits in dem Prolog zu der Synode von Aschheim im Jahre 756. Darin wird auf die „diversitas temporum" und die „diversa necessitas componendi", das heißt der Streitschlichtung, hingewiesen 755 . Ferner sei der Dictatus Papae Gregors VII. von 1075 angeführt, nach dem es dem römischen Bischof erlaubt war, „pro temporis necessitate novas leges condere" 756 . Daneben steht jedoch noch ein anderer Aspekt im Vordergrund: die steigende Bosheit der Menschen, die „crescens malitia". A n ihr ist die „diversitas 751
Corpus iuris civilis, V o l l , Modestinus D.I.3.40, hrsg. von P.Krüger/ Th. Mommsen. Näheres über die necessitas bei römischen Juristen bei Th. Mayer-Maly, Gemeinwohl und Necessitas, in: Festschrift für A. Erler, S. 135 -145. Bereits in der Antike kam der necessitas große Bedeutung zu. Sie ist verwandt mit der griechischen Ananke, der Moira, die manchmal über, oftmals aber auch unter dem höchsten Gott ihren Rang hat. In dem Weltbild der Stoa finden wir die Idee der ewigen Notwendigkeit. Als weiteres Beispiel sei angeführt, daß Horaz von der „dira necessitas" spricht. Bei Livius hören wir von den „necessitates publicae", d. h. von der Staatsnotwendigkeit, die gesetzliche Maßnahmen fordert. Vgl. A. Erler, Albornoz, S. 77. Siehe auch K. Kluxen, Die necessità als Zentralbegriff im politischen Denken Machiavellis, in: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, Bd. X X (1968), S. 14-27 (18). 752
Vgl. A: Erler, Albornoz, S. 78; A. Erler, Necessitas als Impuls der Rechtserneuerung, S. 115. 753 Zitiert nach A. Erler, Albornoz, S. 78; vgl. auch J. Pichler, Necessitas, S. 60. 75 4 A. Erler, Necessitas als Impuls der Rechtserneuerung, S. 116; A. Erler, Albornoz, S. 77. 75 5 R. Sprandel, Über das Problem neuen Rechts im frühen Mittelalter, in: ZRG (KA) 79 (1962), S. 117-137 (129). 756 Zitiert nach A. Erler, Albornoz, S. 77.
4. Kardinal Rodolfo Pio da Carpi — Kompilator oder Legislator?
155
temporum" erkennbar, denn die steigende Ungerechtigkeit und das Überhandnehmen des Unrechts sind im Mittelalter Zeichen für die „diversitas temporum", die neue Gesetze notwendig macht 7 5 7 . In der legislativen Bewältigung des Alltags wurden die „crescens malitia" und „necessitas" den neuen Bestimmungen oftmals jedoch nur als sinn-entleerte Formeln vorangestellt. Man begnügte sich als Begründung mit der bloßen „utili tas" 7 5 8 . Wegen der Gefahr von Ausweitungen forderte die gegenläufige Bewegung, daß die „utilitas" wenigstens „evidens" sein müsse. So erklärt Thomas von Aquino in seiner Summa theologica I a I I a e qu. 97 art. 3, daß das bestehende Recht nicht schon deshalb geändert werden dürfe, weil eine Neuerung besser wäre, sondern nur, wenn eine dringende Notwendigkeit vorliege, oder wenn „maxima et evidens utilitas communis" gegeben sei 759 . Die Voraussetzungen für mittelalterliche Rechtserneuerung im Wege der Gesetzgebung sind somit „necessitas" und „evidens utilitas communis", d. h. das Gemeinwohl. Dabei stellt sich die Frage, ob man auch in den Konstitutionen des Albornoz und sodann in denjenigen Rodolfo Pios solche Formeln wie „crescens malitia", „diversitas temporum", „evitatio scandali" oder „utilitas communis" findet und dadurch Rückschlüsse auf das gesetzgeberische Selbstverständnis ziehen kann. Bei der Durchsicht der Aegidianischen Konstitutionen von 1357 fallt auf, daß Albornoz seine Gesetze sehr häufig mit der „crescens malitia" begründet. So heißt es in Buch I I Kapitel 26: „Licet adversus occupatores terrarum ecclesie in Ytalia consistentium tarn per constitutiones nonnullorum summorum pontificum quam aliorum multipliciter sit provisum, hominum tarnen incessa crescente malicia cogimur, in quantum nobis est possibile, insuper novas adhibere medelas , . . " 7 6 0 . Auch in seinen Constitutiones adiectae führt er eine solche Begründung an: „... Quia iuxta instabilis temporis qualitatem actus disponuntur humani, plerumque contingit ut quod fuerit ante consulte provisum, varietate temporis succedente et hominum crescente malicia, tendat ad noxam, decet non incongrue présidentes statuta edita, que obesse percipi pocius quam prodesse, in melius reformare et ne ulterius obesse valeant providere . . . " 7 6 1 . 757
Vgl. A. Erler, Necessitas als Impuls der Rechtserneuerung, S. 116ff. A. Erler, Necessitas als Impuls der Rechtserneuerung, S. 118. 759 Zitiert nach A. Erler, Necessitas als Impuls der Rechtserneuerung, S. 118. — Etwas ungenau J. Pichler, der in seinem Werk „Necessitas" auf S. 65 angibt, das Ziel selbst, das Gemeinwohl, sei noch kein selbständiger Berufungsgrund zur Rechtserzeugung: es sei „per necessitatem" verankert. Dagegen heißt es bei Thomas von Aquino, Summa theologica I a I I a e qu. 97 art. 2, S. 355, „quod leges sunt mutandae: non tarnen pro quacumque melioratione, sed pro magna utilitate vel necessitate, ut dictum est". 75 8
760 Const. Aeg. I I 26 (P. Sella, Cost., S. 103 Zeile 16 bis 20. Diese Bestimmung wurde von Rodolfo Pio in die carpensische Ausgabe Rom 1543-1545 wörtlich in Buch I I Kapitel 44 übernommen.
156
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
Albornoz rechtfertigt seine Rechtsreform von 1357 aber nicht nur mit der „crescens malitia" und der „varietas temporis", die der „diversitas temporum" gleich gesetzt werden kann, sondern auch mit der „utilitas". In Buch I I I Kapitel 1 der Aegidianischen Konstitutionen von 1357 liest man nämlich: „Nos igitur vero, videntes evidentem utilitatem mutationis sive revocationis consuetudinis et constitutionis sive revocationis consuetudinis et constitutionis huiusmodi, ipsas pro evitatione scandali et bono publico duximus applicandas" 762 . Albornoz folgt damit dem Beispiel seiner Vorgänger, denn schon Papst Johannes X X I I . führt die „crescens malitia" als Gesetzesmotivation a n 7 6 3 . In ähnlicher Weise begründet Papst Benedikt X I I . seine Rechtserneuerung „ad vitandas fraudes et malicias tollendas" 764 . Papst Innozenz VI. verwendet die Formel „ad utilitatem ac prosperum & tranquillum statum patrimonii" 7 6 5 , und der unbekannte Verfasser der Konstitution in Buch IV Kapitel 50 begründet seine Rechtsreform mit den Worten „ad communem utilitatem hominum et habitancium provinciarum ordinamus atque mandamus . . . " 7 6 6 . Indem Albornoz den Erlaß seiner zahlreichen Konstitutionen unter Verwendung der vorbezeichneten Begriffe begründet, folgt er mittelalterlicher Denkweise. Anlaß seiner Gesetzgebung sind öffentliche Mißstände, die nach gesetzgeberischen Maßnahmen rufen. Dadurch wird deutlich, daß das Problem des neuen Rechts im Mittelalter, und auch bei Albornoz, vor allem demjenigen Bereich angehört, der heute als „öffentliches Recht" bezeichnet wird. Der Ort der Rechtserneuerung ist aber nicht nur das Verfassungsrecht, sondern auch die Sphäre der Verwaltung. Wie Adalbert Erler 767 betont, ist der mittelalterliche Gesetzgeber daher immer auch Staatsmann. Auch bei Albornoz vereinen sich die Charakterzüge des Staatsmannes und des Gesetzgebers. Wie für jeden Gesetzgeber liegt auch für ihn die „necessitas" vor allem auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Seine Gesetze sind Staatslenkungsgesetze. Einer modernen Terminologie entsprechend, könnte man sie zum großen Teil auch als Maßnahmegesetze bezeichnen, Gesetze der Störungsabwehr im Gegensatz zu den beharrenden
761
Const, adiectae (P. Sella, Cost., S. 237 Zeile 4 bis 10). Const. Aeg. I I I 1 (P. Sella, Cost., S. 124 Zeile 8 bis 12). Diese Konstitution wurde von Rodolfo Pio in die carpensische Ausgabe Rom 1543-1545 wörtlich in Buch i i i Kapitel 1 übernommen. 763 Const. Aeg. I 8 (P. Sella, Cost., S. 16 Zeile 16). In der carpensischen Ausgabe Rom 1543 -1545 findet sich diese Bestimmung in Buch I Kapitel 14. Weiterhin Const. Aeg. 110 (P. Sella, Cost., S. 21 Zeile 8). Diese Konstitution ist in der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545 in Buch I Kapitel 15 abgedruckt. 762
764 Const. Aeg. I 11 (P. Sella, Cost., S. 26 Zeile 28 und 29). Rodolfo Pio hat diese Konstitution in die Ausgabe Rom 1543-1545, Buch I Kapitel 19 wörtlich übernommen. 765 Const. Aeg. I 1 (P. Sella, Cost., S. 7 Zeile 1 bis 2). In der carpensischen Ausgabe Rom 1543 -1545 ist diese Konstitution ebenfalls in Buch I Kapitel 1 wiedergegeben. 766 Const. Aeg. IV 50 (P. Sella, Cost., S. 191 Zeile 2 bis 4). Rodolfo Pio hat diese Bestimmung in Buch IV Kapitel 87 der Ausgabe Rom 1543-1545 wörtlich übernommen. 76 7 A. Erler, Necessitas als Impuls der Rechtserneuerung, S. 119.
4. Kardinal Rodolfo Pio da Carpi — Kompilator oder Legislator?
157
Rechtsgesetzen, deren innere Legitimität darin liegt, daß sie die konstruktive rechtliche Ordnung des staatlichen oder städtischen Lebens darstellen 768 . Gilt dies auch für die fast zweihundert Jahre später entstandenen Zusätze Rodolfo Pios? War dieser bedeutende Kardinal ebenso wie Albornoz ein Staatsmann und Gesetzgeber oder darf man ihn lediglich als Kompilator ansehen? Wie schon bei Albornoz muß auch hier zunächst untersucht werden, ob und gegebenenfalls welche Motivationen Rodolfo Pio seinen Zusätzen vorangestellt hat. Bei der Durchsicht seiner Additiones fallt einmal auf, daß einige von ihnen gar keine Begründung enthalten. Sie ordnen nur an, daß die Bestimmung eines anderen Verfassers zu beachten sei. So heißt es in Buch I I Kapitel 4 der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545 im Anschluß an eine Konstitution von Papst Paul II: „... NOS Rodulphus Pius Cardinalis & Legatus ante dictus observari mandavimus" 769 . Daraus läßt sich der Rückschluß ziehen, daß diese Bestimmung Papst Pauls II. im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten, in jedem Falle aber nicht mehr befolgt worden war. Für Rodolfo Pio ergibt sich daher die Notwendigkeit, die Beachtung dieser päpstlichen Norm noch einmal in besonderer Weise einzuschärfen. Oftmals waren die Constitutiones adiectae seiner Vorgänger aber auch in Widerspruch zueinander oder mißverständlich und unklar. Hier greift Rodolfo Pio ein, indem er durch eine Zusatzbestimmung die Zweifel und die Ungewißheit beseitigt und damit die Rechtssicherheit wiederherstellt. Dies wird durch Formeln wie „Declaramus ad tollendas dubietates ..." 7 7 °, „statuimus, quod quotiescunque contigerit dubitari . . . " 7 7 1 , „ U t dubitationis materia, quam alias in curia fuisse nobis relatum fuit, tollatur: . . . " 7 7 2 , „Quoniam saepe dubitatum fuisse nobis relatum fuit . . . " 7 7 3 , „Volentes igitur omnem dubitationem tollere, . . . " 7 7 4 und „Decernimus, ut dubitationis materia, quae alias fuisse in curia dicitur, tollatur, . . . " 7 7 5 verdeutlicht. Wie schon Albornoz 7 7 6 , so schildert Rodolfo Pio in seinen Zusätzen aber auch häufig einen konkreten Mißstand, der eine Gesetzesreform erfordert. So liest man z. B. in Buch IV Kapitel 99 der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545: „... Quia saepius evenit, quod aliqua pars poenae deliquentium, sive fraudan-
76 8
A. Erler, Albornoz, S. 80; A. Erler, Necessitas als Impuls der Rechtserneuerung,
S. 119. 769 770 771 772 773 774 775 77 6
S. 76.
Const. Aeg. I I 4, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 27 b Zeile 29 und 30. Const. Aeg. I I 31, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 53b Zeile 10. Const. Aeg. I I 37, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 61b Zeile 17. Const. Aeg. IV 16, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 87b Zeile 4 bis 5. Const. Aeg. IV 52, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 109b Zeile 35 bis S. 110a Zeile 1. Const. Aeg. IV 60, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 113 a Zeile 11. Const. Aeg. IV 71, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 115b Zeile 13 und 14. A. Erler, Albornoz, S. 79; W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae,
158
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
tium cameram apostolicam officialibus, executoribus, & accusatoribus, sive delatoribus applicatur: & facta compositione per delinquentes, sive fraudantes, aut contravenientes bandimentis, & ordinibus Legati, Vicelegati, sive Gubernatoris cum thesaurario, officiates, executores, accusatores, & delatores huiusmodi recusant quo ad partem ipsis applicandam, velie acquiescere compositioni factae cum thesaurario: & pro rata eorum partes accipere totius integrae poenae partem rigorose petentes: . . . " 7 7 7 . Auch wenn sich Rodolfo Pio nicht ausdrücklich auf die „crescens malitia" beruft, so ergibt sich für ihn die Notwendigkeit zur Schaffung seiner Zusätze aus der „varietas temporum". So heißt es in Buch I Kapitel 11 der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545: „Verum quia nos Rodulphus Pius Cardinalis de Carpo, qui supra Legatus, experienta testante vidimus & comperimus per sedem apostolicam pro temporum varietate huiusmodi, . . . " 7 7 8 . Sehr deutlich wird dies zudem in Buch I I Kapitel 3 ausgesprochen: „Nos Rodulphus Pius de Carpo Cardinalis, & Legatus, diligenter perspicientes aliorum Rectorum constitutiones, tempore, quo fuerant sancitae, nedum utiles, & necessarias, verum etiam sanctissimas existimari, nunc vero propter temporum varietatem, nimiam que vivendi licentiam, aliquid in eis esse, quod iure desyderari possit, propterea, cum quae de novo emergunt, novo indigeant auxilio, novam hanc constitutionem edidimus .. , " 7 7 9 . Der Formel der „varietas temporum" begegnet man bei Rodolfo Pio weiterhin in Buch I I Kapitel 10 7 8 0 , das „De officio Marescalli" handelt, und in seinem Prooemium vor Buch I I 7 8 1 . Der Kardinal bringt damit zum Ausdruck, daß der Wechsel der Zeiten eine Änderung der Aegidianischen Konstitutionen dringend verlangt und notwendig macht. Er spricht dies nochmals ausdrücklich in seinem Decretum aus, das vor Buch I der carpensischen Ausgabe Rom 1543 -1545 abgedruckt ist: „... ac propterea muneris nostri esse duximus, dum eidem provinciae praeessemus, ipsius constitutiones illustriores reddere quo ad fieri posset, ac tempora efflagitarent, . . . " 7 8 2 . Rodolfo Pio beruft sich jedoch nicht nur auf die „varietas temporum", sondern auch auf die „utili tas": „... quanto cognovimus concernere provincialium utilitatem . . . " 7 8 3 . Damit verwendet er zwar nicht den Begriff der „evidens utilitas communis", wie er bei Albornoz vorgefunden wurde. Aber selbst dieser erwähnt in seinen Konstitutionen die „provinciarum, & provincialium utilitas" 7 8 4 sowie die „publica utilitas et honor ecclesie et statum provincie" 7 8 5 . 777
Const. Aeg. IV 99, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 122a Zeile 32 bis S. 122b Zeile 7. Const. Aeg. I 11, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 12a Zeile 21 bis 23. 779 Const. Aeg. I I 3, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 25 a Zeile 27 bis 33. 780 Const. Aeg. I I 10, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 30b Zeile 22. 781 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, Prooemium des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi vor Buch II, S. 21 b Zeile 22. 782 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, Decretum des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi, S. 2 b der nicht numerierten Seiten, Zeile 9 bis 11. 783 Const. Aeg. I I 5, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 29a Zeile 38 bis 39. 778
4. Kardinal Rodolfo Pio da Carpi — Kompilator oder Legislator?
159
Infolgedessen könnte man daran denken, daß die „utilitas provincialium", jedenfalls bei den Bestimmungen von Albornoz und Rodolfo Pio, mit der „utilitas communis" sinnverwandt ist, zumal sich auch die „utilitas provincialium" auf eine Art von Allgemeinheit bezieht, nämlich die „provinciales". Dies bedarf einer eingehenden Untersuchung, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch nicht vorgenommen werden kann. Neben den bereits angegebenen Begriffen erwähnt Rodolfo Pio auch die „necessitas". In seinem Decretum vor Buch I der Aegidianischen Konstitutionen führt er dazu aus: „... ut unde quaque Egidianus codex, pro meritis consertissimus legeretur ordine, in primis adhibito, ac plerisque necessitate, etiam exigente insertisque, , . . " 7 8 6 . Dieser Überblick über die gesetzgeberischen Beweggründe, insbesondere der „varietas temporum", läßt bereits erkennen, daß auch Rodolfo Pio der mittelalterlichen Denkweise folgt. Wie für Albornoz ist auch für ihn die Staatsnotwendigkeit ein Leitmotiv seiner Reform der Aegidianischen Konstitutionen. Dies ist nicht verwunderlich. Zwar möchte man, wie Johannes W. Pichler 787 ausführt, auf Grund der staatsrechtlichen Entwicklung meinen, daß die Gesetzgebung im 16. Jahrhundert keiner anderen Begründung bedarf, als der des gesetzgeberischen Wollens. Gerade diese Erwartung wird von den Quellen aber nicht erfüllt. Mehr denn je ist das Recht von der obersten bis zur untersten Ebene von Erklärungen und Begründungen durchdrungen 788 . Hierzu finden sich zahlreiche Beispiele in den Constitutiones adiectae, die im 16. Jahrhundert zu den Aegidianischen Konstitutionen erlassen wurden. So gibt Papst Alexander VI. als Gesetzesmotivation einmal „ad quietem & pacem illius provinciae" 789 an. In einer anderen Konstitution beruft er sich auf die „crescens malitia": „... quod in terris eidem Romanae Ecclesiae mediate, vel immediate subiectis, dierum crescente malitia, sic assueta nequitia malorum mentes hominum exerevit, . . . " 7 9 0 . Papst Leo X. verwendet als Gesetzesmotivation die Formel „pro quiete & tranquillitate istius provinciae nostrae Marchiae Anconi784
Const. Aeg. I I 1 (P. Sella, Cost., S. 38 Zeile 24 und 25). Diese Konstitution ist in der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545 in Buch I I Kapitel 1 auf S. 21b ff. abgedruckt. 785 Const. Aeg. I I 1 (P. Sella, Cost., S. 40 Zeile 3 bis 4). — Der Begriff der „utilitas publica" wird bereits im römischen Recht verwandt, vgl. Th. Mayer-Maly, Gemeinwohl und Necessitas, in: Festschrift für Adalbert Erler, S. 135-145 (138, 141, 143). 786 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, Decretum des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi, S. 2b der nicht numerierten Seiten, Zeile 11 bis 13. 787 J. Pichler, Necessitas, S. 78. 788 J. Pichler, Necessitas, S. 78. 789 Const, adiectae, Ausgabe Venedig 1540, S. 69b Zeile 4. 790 Const, adiectae, Ausgabe Venedig 1540, S. 74a Zeile 12 bis 13. Die Konstitution Papst Alexanders VI. wurde von Rodolfo Pio wörtlich in die carpensische Ausgabe Rom 1543-1545 übernommen und befindet sich dort in Buch IV Kapitel 42, S. 103 a ff.
160
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen 791
tanae . . . " . Kardinal Sigismundus de Gonzaga bezieht sich ebenfalls auf die „crescens malitia": „... tarnen cum in dies ita hominum malitia excreverit, ut plura homicidia, plura que scelera in dies & passim perpetrarentur, . . . " 7 9 2 . Als weiteres Beispiel seien die Konstitutionen von Papst Paul III. erwähnt. In einer Bestimmung führt er als Begründung das Matthäuswort „ad evitanda scandala" 793 an, in einer anderen stützt er sich auf „crescente in die malitia hominum" 7 9 4 . Da nach mittelalterlichem Rechtsdenken nur neu gesetztes Recht zu seiner Legitimierung einer Begründung bedurfte, während altes Recht seine Legitimität bereits in sich selbst trug, kann man überall da, wo einer Konstitution eine Gesetzesmotivierung vorangestellt ist, auf Grund der mittelalterlichen Gesetzestechnik auf eine Gesetzesneuerung schließen 795 . Demnach darf man annehmen, daß immer dann, wenn Rodolfo Pio seinen Zusätzen eine Begründung vorangestellt hat, es sich nicht um übernommenes Rechtsgut, sondern um originelle Gesetzgebung handelt. Er ist dann nicht nur Kompilator, sondern auch Legislator. Weiteren Aufschluß hierüber könnte eine Untersuchung seiner Gesetzesterminologie geben. Nach den Ausführungen Wolf gang Webers 796 haben neuere Untersuchungen ergeben, daß scheinbar belanglose Begriffsschattierungen in vielen Fällen doch Ausdruck besonderer gesetzgeberischer Überlegung sind 7 9 7 . I m folgenden sollen daher die Begriffe untersucht werden, mit denen Rodolfo Pio den Kern seiner Bestimmungen einleitet und seine Gesetzgebungstätigkeit umschreibt. A m häufigsten begegnet man in seinen Zusätzen den Begriffen „mandare", „statuere", „decernere", „ordinäre", „declarare" und „addere" 7 9 8 . Des öfteren 791 Const, adiectae, Ausgabe Venedig 1540, S. 75 a Zeile 56. — Der Frage der „quies" und der „tranquillitas" geht St. Gagner, Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung, S. 131 f., nach. 792 Const, adiectae, Ausgabe Venedig 1540, S. 73 a Zeile 4 bis 5. Diese Konstitution wurde von Rodolfo Pio in die carpensische Ausgabe Rom 1543 -1545 wörtlich in Buch IV Kapitel 35, S. 98 a, übernommen. 793 Const, adiectae, Ausgabe Venedig 1540, S. 78a Zeile 18. — Ausführlich zu der „evitatio scandali" bei A. Erler, Albornoz, S. 79; St. Gagnér, Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung, S. 133 f. und S. 283. 794 Const, adiectae, Ausgabe Venedig 1540, S. 78 b Zeile 35. 795 ψ Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 82. 796 ψ Webert D j e Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 82f. 797 Zu dem Topos des „renovare leges" siehe G. Dilcher, Gesetzgebung als Rechtserneuerung, in: Festschrift für Adalbert Erler, S. 13-35. Die Begriffe „reformare" und „reformatio" als Topoi der Rechtsbesserung werden behandelt von R. Schulze, Art. „Reformation (Rechtsquelle)", in: H R G (26. Lieferung 1986), Sp. 468-472. Zu den Termini „legem ponere" und „legem condere" siehe St. Gagnér, Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung, S. 256ff. und S. 267 ff.
798 Wegen der Häufigkeit dieser Begriffe ist es nicht von Nutzen, alle Stellen anzuführen, an denen sie zu finden sind. Es sollen daher nur einige Beispiele herausgegrif-
4. Kardinal Rodolfo Pio da Carpi — Kompilator oder Legislator?
161
finden sich auch Formulierungen wie „velie", 7 9 9 , „iubere" 8 0 0 , „ducere" 8 0 1 , „extendere" 802 , „corrigere" 803 , „sancire" 8 0 4 und „adicere" 805 , vereinzelt aber auch „renovare" 806 , „innovare" 8 0 7 , „reformare" 808 , „edere" 8 0 9 , „constituere" 810 und „moderare" 811 . Überwiegend werden sie in der ersten Person des Plural, Präsens, gebraucht, so zum Beispiel „mandamus", „statuimus", „decernimus", „declaramus", „ordinamus" oder „volumus", oftmals aber auch in der Partizipialform wie „moderantes", „volentes" oder „innovantes". Isoliert betrachtet erscheinen die meisten dieser Wendungen für die vorliegende Untersuchung wertneutral. „Mandare" und „ordinäre" haben die Bedeutung von „anordnen", „befehlen", „statuere" die von „festsetzen", „bestimmen". „Decernere" und „iubere" bedeuten „verordnen", „beschließen", „declarare" „klar darlegen", aber auch „verkünden", „ducere" „bestimmen". „Sancire" kann „bekräftigen" oder „festsetzen", „bestimmen", „verordnen" bedeuten. „Velie" schließlich kann die Bedeutung von „wollen" und „bestimmen" haben. fen werden. In den Zusätzen Rodolfo Pios in der Ausgabe Rom 1543 -1545 trifft man den Begriff „mandare" an in I I 2 (S. 23b Zeile 21), I I 3 (S. 27b Zeile 30), V 4 (S. 124b Zeile 2), V I 35 (S. 147b Zeile 1 -2), den Begriff „statuere" in I I 13 (S. 37b Zeile 40), I I 16 (S. 45b Zeile 7), IV 21 (S. 88 b Zeile 33), den Begriff „decernere" in I I 22 (S. 48 b Zeile 16), I I 48 (S. 68b Zeile 29), V I 37 (S. 148a Zeile 6), den Begriff „ordinare" in I I 22 (S. 48b Zeile 16), IV 21 (S. 88 b Zeile 33), V I 36 (S. 147 b Zeile 19), den Begriff „declarare" in I I 24 (S. 49 b Zeile 2), I I 31 (S. 53b Zeile 10), IV 16 (S. 87b Zeile 5) und den Begriff „addere" in I I 27 (S. 50a Zeile 9), I I I 3 (S. 75a Zeile 2) und V 17 (S. 128b Zeile 12). 799
Z. B. Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, I I 2 (S. 24a Zeile 3), I I 9 (S. 30b Zeile 6), V 4 (S. 124b Zeile 2). 800 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543 -1545, Prooemium des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi vor Buch I I (S. 21 b Zeile 26), I I 22 (S. 48 Zeile 14). 801 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543 -1545, Prooemium des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi vor Buch I I (S. 21 b Zeile 23), I I 10 (S. 32a Zeile 38), I I 13 (S. 34b Zeile 37), I I 16 (S. 44b Zeile 29). 802 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, I I 5 (S. 29a Zeile 35), I I 9 (S. 30b Zeile 5), IV 36 (S. 98a Zeile 29), V I 14 (S. 137b Zeile 22). 803 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, I I 13 (S. 38a Zeile 15), I I 16 (S. 44b Zeile 30). 804 Const. Aeg. Ausgabe Rom 1543-1545, I I 13 (S. 38 a Zeile 23), V 29 (S. 132 a Zeile 11). 805 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, I I 10 (S. 30b Zeile 21), V I 14 (S. 137b Zeile 21 bis 22). 806 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, Decretum des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi, S. 2b der nicht numerierten Seiten, Zeile 17. 807 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, I I 48 (S. 68b Zeile 18), V I 33 (S. 146b Zeile 6 und 7). 808 Const. Aeg. I I 16, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 44b Zeile 30. 809 Const. Aeg. I I 3, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 25 a Zeile 33. 810 Const. Aeg. I I 13, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 38 a Zeile 23. 811 Const. Aeg. I 11, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 12a Zeile 26. 11 Hoffmann
162
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
Lediglich bei den Begriffen „mandare" und „ducere" fallt auf, daß Rodolfo Pio sie in seinen Zusätzen oftmals auch in der ersten Person des Plural, Imperfekt, gebraucht, also zum Beispiel „mandavimus" und „duximus". Geht man dem nach, so erkennt man, daß die Bestimmungen des Kardinals, die diese Begriffe enthalten, mit Constitutiones adiectae vorhergehender Verfasser, die Rodolfo Pio in das Gesetzbuch des Albornoz integriert hat, in Zusammenhang stehen. Er verwendet die Begriffe „mandavimus" und „duximus" in seinen Zusätzen zumeist dann, wenn er besonders zum Ausdruck bringen möchte, daß auf seine Anordnung hin die Konstitution eines Vorgängers an einer bestimmten Stelle inseriert wurde oder eine übernommene Bestimmung eines Vorgängers befolgt werden solle. So heißt es in Buch I I Kapitel 2 der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545 vor einer Konstitution von Kardinal Jean Balue: „... NOS Rodulphus Pius Cardinalis & Legatus predictus invenimus in quibusdam additionibus editis ab Joanne Episcopo Albano Cardinali Andagunensi tunc temporis eiusdem provinciae Legato, fuisse illud idem iterato prohibitum: & nedum in iudicibus, & notariis, verum etiam in ipsius provinciae Mareschallis. Quam vero constitutionem cum sua Rubrica hic apponi mandavimus, & est talis: . . . " 8 1 2 . In Buch I I Kapitel 4 der carpensischen Ausgabe liest man im Anschluß an die wörtlich übernommenen Konstitutionen von verschiedenen Vorgängern: „... Quas constitutiones sic (ut praemittitur) registratas multum commendavimus: & tanquam iuri, & rationi consonas, NOS Rodulphus Pius Cardinalis & Legatus ante dictus observari mandavimus" 813 . Als weiteres Beispiel sei Buch I I Kapitel 10 angeführt: „... In primis ipsam Sabinensem primaevam constitutionem mandavimus in hoc opere registrari,.. , " 8 1 4 . Weiterhin heißt es in diesem Kapitel im Anschluß an eine Konstitution von Julianus Soderinus de Florentia, Episcopus Santonensis: „... Quod breve NOS Rodulphus Pius Cardinalis, & Legatus praedictus, quia in praemissa Santonensi constitutione bis de ea mentio facta fuit, duximus registrare hic, , . . " 8 1 5 . Als letztes Beispiel sei Buch I I Kapitel 13 erwähnt, in dem zunächst eine Konstitution von Albornoz wörtlich wiedergegeben ist. Ihr sind folgende Worte vorangestellt: „Materiarum similium subordinando rubricas, praefatus Egidius Episcopus Sabinensis praeinsertum titulum, De salario, & mercede scripturarum notariorum bancarum posuit: tranciando postmodum in suo nigro salaria, & mercedes notariorum bancarum iudicum tarn ipsius curiae generalis, quam praesidatum infra scripta constitutione: quam cognoscentes satis in parte utilem, huic operi inferendam duximus: & est talis: . . . " 8 1 6 . Deutlichere Auskunft für die Frage, ob Rodolfo Pio auch als Legislator bezeichnet werden kann, geben jedoch die folgenden Wendungen in seinen 812 813 814 815 816
Const. Const. Const. Const. Const.
Aeg. Aeg. Aeg. Aeg. Aeg.
II II II II II
2, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 23 b Zeile 16 bis 21. 4, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 27b Zeile 28 bis 30. 10, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 30b Zeile 22 bis 24. 10, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 32a Zeile 36 bis 38. 13, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 34b Zeile 32 bis 38.
4. Kardinal Rodolfo Pio da Carpi — Kompilator oder Legislator?
163
Zusätzen, von denen bereits kurz die Rede war: „extendere" hat die Bedeutung von „ausdehnen", „erweitern", „corrigere" von „berichtigen", „verbessern". „Moderare" bedeutet „beschränken", „edere" „herausgeben". „Adicere" und „addere" haben die Bedeutung von „hinzufügen", „reformare" von „umgestalten", „verwandeln" und „renovare" sowie „innovare" von „erneuern". Wie Wolfgang Weber 817 ausgeführt hat, kommt dem Wort „innovare" im wesentlichen eine zweifache Bedeutung zu: Es umschreibt einerseits das „Erneuern" im Sinne einer Wiederholung und erneuten Einschärfung von bereits Vorhandenem, andererseits das „Neuern" im Sinne der Schaffung von etwas gänzlich Neuem. Obwohl dem Begriff „innovare" im Zusammenhang mit Gesetzgebung überwiegend die Bedeutung von Neuschaffung unter Abänderung des bisher Vorhandenen beigemessen wurde 8 1 8 , bedient sich Albornoz dieses Wortes, um eine alte Konstitution in Erinnerung zu rufen und erneut einzuschärfen. Dies wird zum Beispiel deutlich in Buch I I Kapitel 19 der Aegidianischen Konstitutionen von 1357, in dem es heißt: „... Infrascriptas eciam constitutiones dudum per dominum Bertrandum reformatorem éditas, quibusdam additis innovamus" 819 . Im Anschluß hieran sind vier Konstitutionen von Bertrand de Deux wörtlich wiedergegeben. Auch bei Papst Leo X. findet man den Begriff „innovare" in diesem Sinne. Er gebraucht ihn, um die Aegidianischen Konstitutionen zu bestätigen und ihre unverletzliche Beobachtung einzuschärfen: „... A d bonum vero et quietum regimen civitatum, ac locorum omnium Romanae ecclesiae subiectorum constitutiones bonae memoriae Aegidii episcopi Sabinensis olim éditas innovamus, easque inviolabiliter servari praecipimus et mandamus" 820 . Wie verwendet jedoch Rodolfo Pio den Begriff „innovare"? Die Durchsicht seiner Zusätze zeigt, daß auch er sich immer dann dieses Wortes bedient, wenn er die Bestätigung und Einschärfung einer alten Konstitution beabsichtigt. So heißt es in Buch I I Kapitel 48 der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545, das „De examine notariorum faciendo" handelt: „SIGISMUNDUS Gonzaga olim en ψ Weberf Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 84. 818
Beispiele hierzu bei W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 85. Const. Aeg. I I 19 (P. Sella, Cost., S. 87 Zeile 4 bis 5). — Weitere Beispiele für die Verwendung des Begriffes „innovare" bei Albornoz bei W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 86 f. 820 Aus der „Bulla reformationis curiae" von Papst Leo X. von dem Concilium Lateranense V (1512-1517), Sessio IX, aus dem Jahre 1514, abgedruckt in: J. Alberigo, P. Joannou, C. Leonardi, Ρ. Prodi, Conciliorum oecumenicorum decreta, S. 599 Zeile 6 bis 10. — Die Aegidianischen Konstitutionen waren zuvor bereits durch die Bulle Papst Sixtus IV. vom 30. 5. 1478 bestätigt worden. Diese ist abgedruckt bei A. Theiner, Codex diplomaticus, Bd. I I I Nr. 417, aber auch bei L. Cherubini, Magnum Bullarium Romanum, Bd. I Nr. 4, S. 425 ff. Späterhin wurden die Aegidianischen Konstitutionen nochmals von Papst Paul III. in seiner Bulle vom 30. 7. 1538 bestätigt, die bei L. Cherubini, Magnum Bullarium Romanum, Bd. I Nr. 17, S. 725 f. abgedruckt ist. Dabei ist anzumerken, daß mir das Magnum Bullarium Romanum leider nur in der Ausgabe von 1655 zugänglich war. 819
11*
164
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
Cardinalis & Legatus Constitutionen! posuit de examine notariorum, quam NOS Rodulphus Pius Cardinalis & Legatus innovamus, observari que mandamus, & est talis: . . . " 8 2 1 . Es folgt nun die wörtliche Wiedergabe der Bestimmung von Kardinal Sigismundus de Gonzaga. In Buch V I Kapitel 33 lautet es: „... innovantes punire, & multare secundum formam constitutionis praecedentis, etiam ex officio, vel ad partis instantiam, prout maluerit" 8 2 2 . Gleichbedeutend mit „innovare" verwendet Albornoz den Begriff „renovare" 823 . Auch Rodolfo Pio gebraucht dieses Wort, allerdings nur in seinem Decretum, das dem ersten Buch der carpensischen Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen vorangestellt ist. Darin verwendet er es jedoch gleich zweimal. Zunächst spricht Rodolfo Pio von den Konstitutionen des Albornoz und rühmt ihren Nutzen „eo praesertim tempore quo Picenus ager, ac universa Italia omnem fere humanitatem, una cum legibus deperdiderat, ut sub Egidio primum eluxerit legum renovatarum consuetudo . . . " 8 2 4 . A n späterer Stelle erklärt er, „ut constitutiones ipse ordinem continerent, ac eam espolitionem (sic) reeiperent, ex qua omnis antiquitatis obumbratio renovaretur,.. , " 8 2 5 . Aus dem Zusammenhang wird daher deutlich, daß Rodolfo Pio ebenso wie Albornoz den Begriff „renovare" in dem Sinne von „bestätigen" und „bekräftigen" gebraucht. Die Wençlung „reformare" findet man in den Zusätzen Rodolfo Pios lediglich an einer Stelle, nämlich in Buch I I Kapitel 16, das „De executoribus & executionibus" handelt. In den Rechtsquellen des Mittelalters steht „reformare" häufig in Parallele zu „meliorare" oder zu Worten wie „renovare", „reviviscere" und „renasci" 826 . Albornoz verwendet das Wort „reformare" im Sinne einer Neugestaltung oder Verbesserung bisheriger Vorschriften 827 . Diese Bedeutung kommt dem vorbezeichneten Begriff auch bei Rodolfo Pio zu, denn in seinem 821
Const. Aeg. I I 48, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 68b Zeile 16 bis 18. Const. Aeg. V I 33, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 146b Zeile 7 bis 9. 823 v g l ψ Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 87, unter Angabe von Belegstellen. Ausführlich zu dem Begriff „renovare leges" G. Dilcher, Gesetzgebung als Rechtserneuerung, in: Festschrift für Adalbert Erler, S. 13-35. 822
824 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, Decretum des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi, S. 2 b der nicht numerierten Seiten, Zeile 4 bis 7. 825 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, Decretum des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi, S. 2 b der nicht numerierten Seiten, Zeile 15 bis 17. 826 R. Schulze, Art. „Reformation (Rechtsquelle)", in: H R G (26. Lieferung 1986), Sp. 468-472 (468). — In diesem Zusammenhang sei auch auf den Begriff „reformatio" hingewiesen. Die wachsende Rechtsunsicherheit im 15. Jahrhundert ließ vor allem auch in bezug auf das säkulare Recht den Ruf nach Reformen erschallen. Dies führte dazu, daß auf dem Gebiet der Zivilgesetzgebung „reformatio" schließlich zum Synonym für „Gesetz" wurde. Seit Mitte des 15. Jahrhunderts traten zahlreiche Rechts„Reformationen" in Kraft; vgl. J. Weiß, Art. „Reformation", in: H R G (26. Lieferung 1986), Sp. 459-468 (460). 827 ψ Webert D j e Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 89, unter Angabe einer Belegstelle.
4. Kardinal Rodolfo Pio da Carpi — Kompilator oder Legislator?
165
Zusatz in Buch I I Kapitel 16 heißt es im Anschluß an eine Konstitution von Johannes de Castillione: „... Verumtamen NOS Rodulphus Pius de Carpo Cardinalis, & Legatus praedictus cognoscentes per veram experientiam additionem praedictam non esse ex omni parte proficuam praedictis provincialibus, & quandam consuetudinem, quam potius abusum nominamus, non fuisse, nec esse utilem, dum erat consuetum transmitti executores équités a quinque florenis monetae supra, in hunc modum tarn ipsam additionem, quam ipsam malam consuetudinem duximus reformandam, & corrigendam . . . " 8 2 8 . Indem Rodolfo Pio hier zur Beseitigung eines Mißstandes die Bestimmung von Johannes de Castillione „verbessert", wird deutlich, daß der Begriff „reformare" auf eine originelle Neuerung des Kardinals hinweist. Ebenso verhält es sich mit „corrigere", das in dem zuletzt genannten Zusatz Rodolfo Pios bereits erwähnt wurde 8 2 9 . In gleicher Weise läßt der Begriff „extendere" auf eine Rechtsneuerung schließen. Rodolfo Pio gebraucht diese Wendung, um eine bisherige Vorschrift auch auf einen anderen Personenkreis oder auf eine weitere, neue Fallgestaltung auszudehnen. Dies ist besonders in Buch I I Kapitel 5 der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545 erkennbar, das die Bestimmung „De officio quatuor iudicum curiae generalis" enthält: „... Et quia etiam ipsos auditores ex aliqua légitima causa impediri possunt, quominus tribunali, & causis agitandis, & expediendis intersint, praefatam Egidii constitutionem cum praemissa nostra suppletione extendimus, & locum habere volumus in omnibus & per omnia in ipsis auditoribus rectoris ..." 8 3 °. Als weiteres Beispiel sei Buch I I Kapitel 9 erwähnt. Darin heißt es im Anschluß an eine Konstitution von Kardinal Napoleon Orsini: „... NOS Rodulphus Pius Cardinalis, & Legatus praedictus a paritate rationis arguentes, extendimus, locum que sibi vendicare volumus in Gubernatoribus, Locumtenentibus, commissariis . . . " 8 3 1 . Demgegenüber verwendet Rodolfo Pio den Begriff „moderare", um die Vorschrift eines Vorgängers einzuschränken. So heißt es in Buch I Kapitel 11: „... Iccirco rigorem, & modum praedictum moderantes, auctoritate, qua fungimur, decernimus . . . " 8 3 2 . Durch den Gebrauch von „addere" oder „adicere" kennzeichnet Rodolfo Pio eigene Zusätze, die er übernommenen Konstitutionen seiner Vorgänger anfügt. So heißt es zum Beispiel in Buch I I Kapitel 10 der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545: „Posuit successive Egidius Episcopus Sabinensis, Legatus & Vicarius ante dictus constitutionem cum sua rubrica, De officio Marescalli: cui constitutioni quaedam pernecessaria adiicere volentes, cum secundum varieta828 829 830 831 832
Const. Const. Const. Const. Const.
Aeg. Aeg. Aeg. Aeg. Aeg.
I I 16, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 44b Zeile 23 bis 30. I I 16, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 44b Zeile 30. I I 5, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 29 a Zeile 32 bis 36. I I 9, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 30b Zeile 4 bis 7. I 11, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 12a Zeile 26 bis 27.
166
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
tem temporum, statuta quoque variantur humana . . . " 8 3 3 . Im Anschluß an eine wörtlich übernommene Konstitution von Kardinal Napoleon Orsini liest man in Buch I I Kapitel 20: „... NOS vero Rodulphus Pius de Carpo Cardinalis, & Legatus praedictus cognoscentes, praesertim tempestate nostra, ... praefatae constitutioni addentes ordinamus, quod .. . " 8 3 4 . Als weiteres Beispiel sei Buch I I Kapitel 27 erwähnt, in dem sich an eine Bestimmung von Kardinal Jean Balue ein Zusatz Rodolfo Pios anschließt, der wie folgt eingeleitet wird: „... Cui constitutioni addendo dicimus NOS Rodulphus Pius Cardinalis Legatus .. . " 8 3 S . In Buch I I I Kapitel 3 begegnet man der Wendung: „Ex decreto praelibati Reverendissimi de Carpo additur . . . " 8 3 6 und in Buch V Kapitel 18 heißt es: „... Addimus tarnen, quod . . . " 8 3 7 . Ferner lautet es in Buch V I Kapitel 14 im Anschluß an eine wörtlich übernommene Konstitution, deren Verfasser jedoch nicht erkennbar ist: „... Huic constitutioni NOS Rodulphus Cardinalis Legatus adiiciendo, dicimus.. , " 8 3 8 . Schließlich sei als letztes Beispiel Buch V I Kapitel 33 angeführt, in dem im Anschluß an eine wörtlich übernommene Bestimmung, deren Verfasser nicht genannt wird, folgender Zusatz angeführt ist: „... Huic constitutioni addendo dicimus & statuimus NOS Rodulphus Legatus, quod . . . " 8 3 9 . Die hierbei auffallende Häufung der Termini „dicimus & statuimus" findet sich auch in anderen Zusätzen Rodolfo Pios. Der Anschaulichkeit halber seien hier einige angeführt: „statuimus & ordinamus" 8 4 0 , „decernimus & ordinamus" 841 , „statuimus & declaramus" 842 , „volumus & mandamus" 843 , „statuimus, decernimus & declaramus" 844 . Wahrscheinlich wollte Rodolfo Pio auf diese Weise seinen Bestimmungen einen besonderen Nachdruck verleihen. Zuletzt ist auf den Begriff „edere" hinzuweisen, den der Kardinal gebraucht, um eine eigene Bestimmung zu kennzeichnen. Dies wird deutlich in Buch I I Kapitel 3 der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545: „... novam hanc constitutionem edidimus, ut , . . " 8 4 5 .
833 834 835 836 837 838 839
Const. Const. Const. Const. Const. Const. Const.
Aeg. Aeg. Aeg. Aeg. Aeg. Aeg. Aeg.
I I 10, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 30b Zeile 19 bis 22. I I 20, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 47 a Zeile 22 bis 23 und Zeile 26. I I 27, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 50a Zeile 9 und 10. I I I 3, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 75 a Zeile 2. V 18, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 128b Zeile 36. V I 14, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 137 b Zeile 21 und 22. V I 33, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 146b Zeile 1 und 2.
840 Ζ. B. Const. Aeg. I I 5, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 28 a Zeile 35 und 36; Const. Aeg. I I 13, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 37 b Zeile 49; Const. Aeg. IV 36, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 98 a Zeile 28; Const. Aeg. V I 11, Ausgabe Rom 1543-1545, Zeile 15. 841 Ζ. B. Const. Aeg. I I 22, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 48 a Zeile 16. 842 Ζ. B. Const. Aeg. IV 99, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 122b Zeile 8. 843 Ζ. B. Const. Aeg. V 4, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 124b Zeile 2; Const. Aeg. V 25, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 131a Zeile 16. 844 Ζ. B. Const. Aeg. V I 37, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 148 a Zeile 5 und 6. 845 Const. Aeg. I I 3, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 25 a Zeile 32 und 33.
4. Kardinal Rodolfo Pio da Carpi — Kompilator oder L e g i s l a t o r ? 1 6 7
Zusammenfassend läßt sich aus der Untersuchung der Terminologie Rodolfo Pios entnehmen, daß er einmal Vorschriften seiner Vorgänger übernimmt und integriert. Dies wird insbesondere durch die Begriffe „innovare", „renovare" sowie „mandare" und „ducere" in der ersten Person des Plural, Imperfekt, wie „mandavimus", „duximus" verdeutlicht. Ebenso schafft er aber auch originelle Neuerungen. Diese werden insbesondere durch die Termini „reformare", „corrigere", „extendere", „moderare", „addere", „adicere" und „edere" eingeleitet. Das Ergebnis der terminologischen Untersuchung vermittelt somit einen anschaulichen Eindruck von der Vorgehensweise Rodolfo Pios. Sie entspricht auch der Vorstellung, die er selbst von seiner Aufgabe hatte. Diese umschreibt er nämlich in seinem Decretum wie folgt: „... ad hanc novam Egidiani codicis compilationem nosmet accinximus, quam duce Deo diligentia quadam adhibita breve sumus assecuti, singulis proprio loco dispositis, ad faciliorem studio forum lectionem, demptis his quae ab usu recesserant, & adiectis quae novo usui ad vénérant, , . . " 8 4 0 . Infolgedessen unterscheidet Rodolfo Pio drei Bereiche seiner Tätigkeit: 1. singulae proprio loco disponere, 2. demere quae ab usu recesserant, 3. adicere quae novo usui advenerant. Der erste Bereich betrifft die Übernahme und Ordnung nützlicher und bewährter Vorschriften. Der zweite Bereich umfaßt die Beseitigung nutzloser und unbrauchbarer Vorschriften. Der dritte Bereich hat die tatsächlichen Neuerungen Rodolfo Pios zum Gegenstand. Diese Reihenfolge, die eine innere Systematik offenbart, erinnert an das Gesetzgebungsvorgehen von Albornoz, das er in ähnlicher Weise in seinem Prooemium umschreibt: „... unum novum volumen presentium nostrarum constitutionum pro honore ecclesie fieri iussimus. In quo, utilibus inde receptis, inutilibus, supervacuis et contrariis resecatis, novisque iuribus secundum oportunitatem locorum, temporum et negociorum inventis, constitutiones eque, honeste, utiles et portabiles, degeste cum omni mansuetudine, continentur, sub congruis ordinibus et tytulis collocate ac distribute per debitum ordinem in sex libris" 8 4 7 . Hierdurch wird deutlich, daß sich sowohl bei Albornoz als auch bei Rodolfo Pio in der Reihenfolge der aufgezählten Tätigkeitsbereiche eine Steigerung von der Übernahme hergebrachter Normen über die Bereinigung bis zur völligen 846
Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, Decretum des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi, S. 2 b der nicht numerierten Seiten, Zeile 28 bis 32. 847 Const. Aeg., Prooemium (P. Sella, Cost., S. 1 Zeile 25 bis S. 2 Zeile 6).
168
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
Neuschaffung von Gesetzen zeigt. Indem Rodolfo Pio ungefähr zweihundert Jahre nach Albornoz diesem berühmten Vorgänger folgt und bei der Bewältigung seiner gesetzgeberischen Aufgabe in gleicher Weise wie er vorgeht, läßt sich eine konservative Gesetzgebungskunst erkennen. Wie einigen Arengen der Zusätze Rodolfo Pios zu entnehmen war, ist das Motiv für seine originellen Gesetzesneuerungen die „varietas temporum". Der Wandel der Zeiten macht die Reform der Aegidianischen Konstitutionen sowie die Schaffung neuer Gesetzeszusätze notwendig. Da Rodolfo Pio zum einen die alten, bewährten Vorschriften des Albornoz übernimmt und bereinigt sowie die Constitutiones adiectae seiner Vorgänger an der vorgesehenen Stelle in das Gesetzeswerk integriert, ist er Kompilator. Indem er zum anderen aber auch originelle Gesetzesneuerungen schafft und mit großem Geschick und Gespür in das Gesetzbuch des Albornoz einfügt, ist der Kardinal zugleich Legislator. Wie Adalbert Erler 848 ausgeführt hat, empfinden wir, die wir im Zeitalter der Kodifikationen leben, die gesetzgeberischen Maßnahmen der Vergangenheit als primitives Flickwerk. Selbst das berühmte Werk des Albornoz ist ja keine wirkliche Kodifikation, sondern eine nur systematisch geordnete Summe von Einzelgesetzen 8 4 8 a . Nur wo Störungen auftraten, setzte man einen Flicken auf. Auch Rodolfo Pio verfahrt in dieser Weise. Er will nicht ein völlig neues Gesetzbuch schaffen, sondern die Konstitutionen des Albornoz, soweit sie noch nützlich sind, bewahren: „... Sic igitur cunctis in Picena provincia huiusmodi colende atque, observande sese exhibent, ut sub tanto Pontificae constitutiones Egidianae, no viter renate, videantur" 8 4 9 . So untersucht Rodolfo Pio jede einzelne Konstitution auf ihren Nutzen, übernimmt sie sodann unverändert oder korrigiert sie oder fügt ihr eine eigene, neue Vorschrift hinzu. Er beseitigt damit Einzelstörungen. Seine Gesetze sind, modern gesprochen, Maßnahmegesetze. Rodolfo Pio ist daher ebenso wie Albornoz nicht nur Gesetzgeber, sondern auch Staatsmann 850 . 848
A. Erler, Necessitas als Impuls der Rechtserneuerung, S. 120. 848 α F ü r djg Antike sei auf die Novellen Justinians verwiesen, die ebenfalls aus einzelnen ergangenen Gesetzen zusammengestellt worden waren. Der Schwabenspiegel war nach der Vorstellung Sebastian Münsters eine Kodifikation, zusammengestellt aus vielen nach und nach ergangenen Kaiserkonstitutionen. Diese einzelnen Konstitutionen nannte er ihrerseits wieder Landrechte. Sebastian Münster wußte nämlich nicht, daß der Schwabenspiegel eine Privatarbeit darstellte. Auch war ihm die Bezeichnung „Schwabenspiegel" noch nicht bekannt; ausführlich hierzu A. Erler, Der Schwabenspiegel in der Kosmographie Sebastian Münsters, in: Festschrift für Gustaf Klemens Schmelzeisen, S. 85-100 (87 f.). Ferner sei auf die Reichsexekutionsordnung verwiesen, die sich aus Bestandteilen verschiedener Reichsabschiede zusammensetzte; J. Mielke, Art. „Reichsexekutionsordnung", in: H R G (27. Lieferung 1986), Sp. 565-567 (565). 849 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, Decretum des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi, S. 2 b der nicht numerierten Seiten, Zeile 34 bis 36. 850 Hierbei ist anzumerken, daß die mittelalterlichen Gesetzgeber nicht immer Juristen waren; vgl. A. Marongiu, Albornoz, legislatore, in: Studia Albornotiana X I I I (1973),
4. Kardinal Rodolfo Pio da Carpi — Kompilator oder Legislator?
169
Daß Rodolfo Pio ein Gesetzgeber ist und sich als solcher versteht, zeigt sich unter anderem in seiner Änderung der bedeutsamen Vorschrift des Albornoz in Buch V I Kapitel 26 der Aegidianischen Konstitutionen von 1357. Dieses Kapitel, das darin die Rubrica „De diversis iuribus et constitutionibus que debent in observantiam prevalere" 851 trägt, regelt die Frage, welche Norm bei Widersprüchen innerhalb der Aegidianischen Konstitutionen den Vorrang haben soll. Wie bereits dargelegt, 852 nennt Albornoz in seiner Bestimmung an erster Stelle die in das Gesetzbuch aufgenommen päpstlichen Konstitutionen, sodann die eigenen Konstitutionen und an dritter Stelle die inserierten Konstitutionen von Bertrand de Deux: „... prius serventur contitutiones papales locales, inserte et registrate in presenti volumine, secundo constitutiones nostre in eodem inserte volumine, tercio constitutiones bone memorie domini Bertrammi episcopi Sabinensis . . . " 8 5 3 . Die weiteren, ab „quarto" folgenden Regelungen befassen sich mit der Ausfüllung von Gesetzeslücken. Hierzu sollen zunächst die Gewohnheitsrechte der jeweiligen Provinz, sodann das kanonische Recht (iura canonica) und zuletzt das römische Recht (iura civilia) herangezogen werden. Rodolfo Pio übernimmt diese Norm des Albornoz und inseriert sie in seinem Werk in Buch V I Kapitel 38. Damit bildet sie die Schlußvorschrift der carpensischen Ausgabe. Ohne eine Begründung zu geben, ändert Rodolfo Pio diese Bestimmung des Albornoz jedoch ab, indem er die Rangfolge der Rechtsquellen abwandelt: „ A d tollendam omnem exceptionem, & suspitionis materiam statuimus, quod quoties iura, & constitutiones, & eorum dispositiones reperirentur contraria, & adversa, prius serventur constitutiones papales insertae, & registratae in praesenti volumine: secundo constitutiones Egidii, & domini Bertrandi: tertio constitutiones nostrae: quarto constitutiones provinciae non adversantes has constitutiones, & a iure non prohibitas: quinto iura canonica: ultimo iura civilia observentur" 854 . Daraus ist zu entnehmen, daß den in das Gesetzbuch übernommenen päpstlichen Konstitutionen auch weiterhin der erste Rang vorbehalten bleibt. A n zweiter Stelle folgen die Konstitutionen des Albornoz, denen Rodolfo Pio die Bestimmungen des Bertrand de Deux gleichstellt. Zwar nennt er Kardinal Bertrand de Deux erst nach Albornoz. Da er jedoch beide Verfasser unter „secundo" aufführt, gibt er zu erkennen, daß sie auf einer Stufe stehen und ihre Konstitutionen den gleichen Rang haben. Damit hat Rodolfo Pio die Bestimmungen des Bertrand de Deux, die bei Albornoz erst an dritter Stelle genannt werden, im Rang angehoben. Infolgedessen gehen die S. 27-45 (30). Über Albornoz als Gesetzgeber und Staatsmann siehe A. Erler, Albornoz, S. 80ff.; A. Marongiu, Albornoz, legislatore, in: Studia Albornotiana X I I I (1973), S. 2745; A. Marongiu, Il cardinale d'Albornoz e la ricostruzione dello Stato pontificio, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 463-480 (467 ff.). 851 Const. Aeg. V I 26 (P. Sella, Cost., S. 233 Zeile 21 und 22). 852 853 854
Siehe S. 72 ff. Const. Aeg. V I 26 (P. Sella, Cost., S. 233 Zeile 25 bis 29). Const. Aeg. V I 38, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 148a Zeile 17 bis 23.
170
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
Konstitutionen dieser beiden Verfasser seinen eigenen vor, die erst unter „tertio" folgen. Die Gründe dafür, daß Rodolfo Pio seine Bestimmungen denen des Albornoz und Bertrand de Deux nachgehen läßt, sind nicht bekannt. Einmal mag er aus Pietät gegenüber seinen beiden großen Vorgängern gehandelt haben. Möglicherweise klingt hier aber auch die bereits erwähnte Auffassung vom alten, guten Recht an, dem der Vorrang gebührt. Indem Rodolfo Pio seinen eigenen Konstitutionen jedoch eine eigene Rangstelle einräumt, gibt er zu erkennen, daß er ein Gesetzgeber ist und sich als solcher versteht. Dem kann nicht entgegengehalten werden, daß er sein Werk an anderer Stelle lediglich als „nova compilatio Egidiani codicis" 855 bezeichnet. Wie bereits untersucht, ist Rodolfo Pio nämlich zugleich ein Kompilator. Hinzu kommt, daß auch Albornoz sein Gesetzbuch eine „compilatio" 8 5 6 genannt hat. Ähnlich wie Albornoz, der in seiner Vorschrift in Buch V I Kapitel 26 nicht angibt, wie die Konstitutionen des Kardinals Napoleon Orsini zu behandeln sind, spricht auch Rodolfo Pio nicht aus, welcher Rang den Bestimmungen seiner Vorgänger, wie z. B. des Gabriel Condulmer, Philippus Calandrini di Sarzana, Johannes de Castillione oder Jean Balue zukommen soll. Stehen sie mit denen von Rodolfo Pio auf einer Stufe oder gar mit denen von Albornoz und Bertrand de Deux? Ferner läßt Rodolfo Pio, ebenso wie Albornoz, völlig ungeklärt, wie die Konstitutionen zu behandeln sind, die ihren Verfasser nicht verraten. Das Selbstverständnis Rodolfo Pios als Gesetzgeber zeigt sich des weiteren darin, daß er die bedeutsame Schlußvorschrift des Albornoz in Buch V I Kapitel 27 der Aegidianischen Konstitutionen von 1357 gänzlich kassiert. Wie bereits erwähnt 8 5 7 , hatte Albornoz in diesem Kapitel, das mit der Rubrica „De robore constitutionum presentis voluminis et copia ipsarum recipienda per terras" 858 überschrieben ist, die unverletzliche Beachtung der erlassenen Konstitutionen angeordnet. Ferner hatte er darin bestimmt, daß es nur dem Papst, dessen Kardinallegaten und Vikar erlaubt sei, in dem Gesetzbuch enthaltene Bestimmungen ganz oder teilweise aufzuheben oder abzuändern. Schließlich hatte Albornoz zur Einbürgerung des Gesetzes angeordnet, daß es trotz der bereits in Fano erfolgten Bekanntmachung zusätzlich binnen zwei Monaten in allen Provinzen und Gemeinden veröffentlicht und auf italienisch erklärt werden solle. Zudem seien die Konstitutionen überall in das örtliche Statutenbuch einzutragen. Hierüber sei eine notarielle Urkunde aufzunehmen, die binnen einer Frist von fünf Tagen an Albornoz oder den Rektor der Provinz 855
Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, Decretum des Kardinals Rodolfo Pio da Carpi, S. 2b der nicht numerierten Seiten, Zeile 28 u. 29. 856 857 858
Const. Aeg. V I 27 (P. Sella, Cost., S. 234 Zeile 12). Siehe S. 75. Const. Aeg. V I 27 (P. Sella, Cost., S. 234 Zeile 4 bis 5).
4. Kardinal Rodolfo Pio da Carpi — Kompilator oder L e g i s l a t o r ? 1 7 1
einzureichen sei. Dieses Kapitel enthält somit transitorische und dauernd geltende Vorschriften. Dies hat Adalbert Erler 859 bereits ausgeführt. Aus welchen Gründen hat Rodolfo Pio diese Vorschrift jedoch aufgehoben? Er selbst gibt hierüber keine Auskunft. Indem Albornoz mit dieser Konstitution die Veröffentlichung seines Gesetzeswerkes in allen Provinzen und Gemeinden binnen einer Frist von zwei Monaten anordnete sowie die Vorlage einer notariellen Urkunde über die Eintragung seiner Bestimmungen in das örtliche Statutenbuch binnen einer Frist von fünf Tagen verlangte, handelt es sich um eine einmalige Weisung. Auf Grund der gesetzten Fristen war diese Vorschrift noch im Jahre 1357 zu erfüllen, so daß sie danach erledigt war und man ihrer nicht mehr bedurfte. Wie schon erwähnt, setzte sich das Gesetzbuch des Albornoz auch tatsächlich sofort durch, denn bereits im Oktober 1357 nahm das Rechnungsbuch des Thesaurars Angelo Ta vernini darauf Bezug 860 . Aus diesen Gründen hat Rodolfo Pio die Übernahme dieser Vorschrift wohl für überflüssig erachtet und sie kassiert. Daraus erklärt sich aber noch nicht, warum Rodolfo Pio auch die beiden anderen, in diesem Kapitel enthaltenen Bestimmungen, nämlich daß diese Konstitutionen unverletztlich zu beachten seien und nur von einem Papst, dessen Kardinallegaten oder Vikar aufgehoben oder abgeändert werden dürfen, gestrichen hat. Diesen Bestimmungen kommt eine dauernde Geltung zu. Von daher erscheint ihr Wegfall zunächst nicht einsichtig. Die Durchsicht der carpensischen Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen von Rom 1543-1545 zeigt jedoch, daß die darin inserierten Konstitutionen Papst Pauls III. vom 30. 7. 1538 und vom 10. 9. 1544 die unverletzliche Beachtung der Aegidianischen Konstitutionen und der Bestimmungen Rodolfo Pios anordnen. So heißt es in der Konstitution Papst Pauls III. vom 30. 7. 1538, die die Rubrica „De confirmatione Egidianarum constitutionum" trägt: „... auctoritate apostolica tenore praesentium ex certa scientia approbamus, & confirmamus, easque (sc. Egidianas constitutiones) tarn in Urbe, quam provinciis, civitatibus, terris, & locis praedictis, etiam specialis commissionis per omnes cuiuscunque dignitatis, status, gradus, & conditionis extiterint, perpetuis futuris temporibus, inviolabiliter observari debere, , . . " 8 6 1 . In dem Breve Papst Pauls III. vom 10. 9. 1544 lautet es: „... Easdem egidianas constitutiones per praefatum Rodulphum Cardinalem, sive eius Agentes, & ad id deputatos, purgatas, emendatas, elucidatas, mutatas, alteratas, additas, & in dictos sex libros redactas, suisque locis, & ordinibus collocatas, omniaque & singula alia in ipsis sex libris contenta, quae praesentibus pro sufficienter expraessis, & insertis haberi volumus, ac inde secuta quaecunque tenore praesentium perpetuo confirmamus, & approbamus, 859
A. Erler, Albornoz, S. 115. Siehe S. 65. 861 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, Konstitution Papst Pauls III. vom 30. 7. 1538, S. 6 a der nicht numerierten Seiten, Zeile 28 bis 32. Diese Bulle ist auch nachzulesen bei L. Cherubini, Magnum Bullarium Romanum, Bd. I Nr. 17, S. 725 f. 860
172
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
ac rata, & grata habemus, praesentisque scripti patrocinio consolidamus, illaque omnia, singula in quibusuis causis etiam specialis commissionis vigore commissis, ac tribunalibus, & iudiciis perquoscunque iudices, & personas cuiuscunque dignitatis, status, gradus, ordinis, conditionis excellentiae, & praeeminentiae existentibus perpetuis futuris temporibus in eadem provincia observari debere , . . " 8 6 2 . Wegen dieser Bekräftigungen und Anordnungen des Papstes, die Aegidianischen Konstitutionen unverletzlich zu beachten, hat Rodolfo Pio die entsprechende Bestimmung des Albornoz in Buch V I Kapitel 27 wohl als überflüssig erachtet. Im Wege der Bereinigung ist sie daher in Wegfall geraten. Die weitere, in Buch V I Kapitel 27 enthaltene Bestimmung des Albornoz, daß die Konstitutionen in seinem Gesetzbuch nur von dem Papst, dessen Kardinallegaten oder Vikar aufgehoben oder abgeändert werden dürfen, hat Rodolfo Pio möglicherweise deshalb nicht übernommen, weil ohnehin nur der Papst sowie die von ihm durch Vollmacht ermächtigten Personen befugt waren, diese Bestimmungen aufzuheben oder abzuändern 863 . A u f die eingangs gestellte Frage, ob Rodolfo Pio da Carpi als Kompilator oder Legislator bezeichnet werden kann, ist somit zusammenfassend zu sagen, daß dieser bedeutende Kardinal und Staatsmann wegen der Übernahme und Ordnung der alten, bewährten Vorschriften ein Kompilator ist. Indem er jedoch auch neue Gesetze erläßt, ist er zugleich Legislator. Durch die gesetzgeberischen Erklärungen und Begründungen, die er seinen Zusätzen oftmals voranstellt, folgt er mittelalterlicher Denkweise. Da er aber ohne jegliche Begründung die bedeutsame Vorschrift in Buch V I Kapitel 26 der Aegidianischen Konstitutionen von 1357 abändert und diejenige in Buch V I Kapitel 27 vollständig kassiert, spürt man bereits die Zeit des Vor-Absolutismus. Es deutet sich daher in Rodolfo Pio gleichzeitig ein Selbstverständnis von gesetzgeberischer Machtvollkommenheit an.
862 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, Breve Papst Pauls III. vom 9. 10. 1544, S. 5 b der nicht numerierten Seiten, Zeile 10 bis 20. 863 Der Gedanke der Gesetzgebungsgewalt des Papstes tauchte schon früh auf. Im Dictatus Papae Gregors VII. hat er bereits einen deutlichen Niederschlag gefunden. Die einzelnen Entwicklungsphasen sollen hier nicht behandelt werden. M i t Gratian drang jedoch die Auffassung durch, daß der Papst den canones Rechtskraft und Autorität verleihe, daß er Recht setzen könne. Das römische Recht mit seinen Normen über die volle und alleinige Gesetzgebungshoheit des Kaisers hatte auf die Entfaltung der entsprechenden kirchlichen Lehren Einfluß. Im gleichen Jahrhundert, in dem im weltlichen Bereich unter Rückgriff auf die Vorstellungswelt der Spätantike dem Kaiser mindestens gedanklich eine Herrschaft über das Recht zuwuchs, vollendete sich die unumschränkte Gesetzgebungsgewalt des Papstes. In demselben Maße, in dem dieser Herr über die canones wurde, fiel ihm auch die volle Dispositionsgewalt über die Privilegien zu. So, wie ein Gesetz vom Papst aufgehoben oder abgeändert werden konnte, sollte auch jedes Privileg von ihm aufgehoben bzw. widerrufen werden können; vgl. H. Krause, Dauer und Vergänglichkeit im mittelalterlichen Recht, in: ZRG (GA) 75 (1958), S. 206-251 (234f.).
5. Übersicht über den Inhalt der Zusätze von Rodolfo Pio
173
5. Übersicht über den Inhalt der Zusätze von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi Es stellt sich nun die Frage nach dem materiellen Inhalt der Zusätze Rodolfo Pios und damit, welche Änderungen er materiellrechtlich durch seine Neuerungen bewirkt hat. Die Beantwortung dieser Frage bereitet jedoch Schwierigkeiten, denn dafür wäre zunächst eine exegetische Behandlung des Gesetzesinhaltes der Aegidianischen Konstitutionen in allen Büchern und Kapiteln erforderlich. Wie Adalbert Erler 864· dargelegt hat, ist eine solche bisher niemals versucht worden. Da man somit für die Aufschließung des Gesetzesinhaltes der Aegidianischen Konstitutionen sowie der Zusätze Rodolfo Pios nicht nur die Verfassungsgeschichte, das Strafrecht, das Verfahrensrecht, das materielle Zivilund Strafrecht des italienischen Spätmittelalters beherrschen, sondern auch vergleichende italienische Statutenforschung betrieben haben müßte, geht dies über den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinaus. Es soll daher im folgenden lediglich eine Übersicht über die wichtigsten Materien gegeben werden, in die sich Rodolfo Pio eingeschaltet hat. Wie schon erwähnt, befinden sich in Buch I der carpensischen Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen lediglich zwei Zusätze des Kardinals, nämlich in Kapitel 11, das die Rubrica „Quod consanguinei compellantur ad redimendum bona damnatorum" trägt, und in Kapitel 18, das „De executoribus mittendis pro censibus, & affictibus: & de modo servando in mittendo" handelt. In dem ersteren mäßigt er die Strenge der vorhergehenden Konstitution Papst Sixtus' IV. und mildert diese ab: „... rigorem, & modum praedictum modérantes, ... decernimus ..., quatenus mitius fieri . . . " 8 6 5 . Dies erinnert an Albornoz, der in seinem Prooemium milde Gesetze verspricht: „... constitutiones eque, honeste, utiles et portabiles, degeste cum omni mansuetudine . . . " 8 6 6 . Die meisten seiner Zusätze hat Rodolfo Pio zu Buch I I erlassen. Damit hat er den Schwerpunkt seiner Reform auf das Verfassungsrecht, auf die Überarbeitung des hohen Ämterwesens gelegt. So findet man in Buch I I der carpensischen Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen Zusätze Rodolfo Pios in Kapitel 2 „De numero, & distinctione officialium curiae rectoris generalis provinciae Marchiae", in dem er anordnet, daß die Amtszeit der Richter und Notare nie zwei Jahre überschreiten dürfe 8 6 7 , in Kapitel 3 „De audientia danda per rectorem, & eius officiales", in dem er bestimmt, daß alle Provinzbewohner ihre Wünsche auf der Audienz des Rektors und seiner Beamten öffentlich vortragen dürfen 868 , in Kapitel 4 „De vita, & honestate, & habitatione rectoris, & suorum 864
A. Erler, Albornoz, S. 44. Const. Aeg. I 11, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 12a Zeile 26 bis 28. 866 Const. Aeg., Prooemium (P. Sella, Cost., S. 2 Zeile 3 bis 5). Ausführlich zu „mansuetudo" und „limitatio" A. Erler, Albornoz, S. 82ff. 867 Vgl. F. Ermini, Gli ordinamenti politici e amministrativi nelle „Constitutiones Aegidianae", in: RISG 15 (1893), S. 196-240 (210). 868 Ygi ρ E r m i n i t Gli ordinamenti politici e amministrativi nelle „Constitutiones Aegidianae", in: RISG 15 (1893), S. 196-240 (215). 865
174
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
officialium". Weitere Zusätze Rodolfo Pios enthalten in Buch I I die Kapitel 5 „De officio quatuor iudicum curiae generalis", Kapitel 9 „De appellationibus cognoscendis per iudices praesidatuum", in dem er die Vorschriften, die die iudices presidatuum betreffen, auf die gubernatores, locumtenentes und commissarii der Provinz erstreckt 869 , Kapitel 10 „De officio Marescalli", in dem er anordnet, daß der marescallus wegen der hohen Besoldungsausgaben nicht mehrere vicemarescalli, sondern nur einen einzigen vicemarescallus oder locumtenens ernennen dürfe 8 7 0 , Kapitel 12 „De solutionibus notariorum thesaurarii", Kapitel 13 „De salario, & mercede scripturarum notariorum bancarum", Kapitel 16 „De executoribus, & executionibus" und Kapitel 20 „Quod advocatus, & procurator fisci sit procurator pauperum". In seinem Zusatz in dem letztgenannten Kapitel bekämpft Rodolfo Pio den Mißstand, daß die advocati und procuratores fisci, denen die Beratung und Vertretung der Armen obliegt, ohne daß sie hierfür ein Honorar nehmen dürfen, mehr Mühe auf die Verletzung der Armen als auf deren Verteidigung verwenden oder daß sie diese weniger sorgfältig ausüben als sie es müßten. Ferner ordnet Rodolfo Pio in dieser Vorschrift aus besonderer Barmherzigkeit mit den armen Eingekerkerten an, daß der Rektor der Provinz jede Woche am Freitag die Gefangnisse zu besuchen und jeden einzelnen Gefangenen nach seiner Sache zu befragen habe 8 7 1 . In Buch I I sind weiterhin Zusätze Rodolfo Pios enthalten in Kapitel 22 „Quod nullus de collegio possit recipi in fideiussorem pro aliquo casu civili vel criminali", Kapitel 24 „Quod pro litteris Sigillis & scripturis Collegiati nil persoluant", Kapitel 27 „Quod citationes ad instantiam curialium taxentur", Kapitel 28 „De solutionibus patrociniorum pro causis ordinariis", Kapitel 29 „De solutionibus patrociniorum super instrumentis in forma camerae", Kapitel 31 „De sportulis, & ipsarum sportularum solutionibus", Kapitel 37 „De gabellis & dativis", Kapitel 38 „De ambasciatoribus mittendis per terras ad curiam", Kapitel 42 „De securitate venientium ad curiam" und Kapitel 48 „De examine notariorum faciendo". In Buch I I I der carpensischen Ausgabe Rom 1543-1545 findet man Bestimmungen Rodolfo Pios in Kapitel 3 „De modo procedendi in causis spiritualibus", Kapitel 12 „Contra usurarios christianos" und Kapitel 13 „Quod iudex spiritualium contra usurarios possit per inquisitionem procedere". In den beiden zuletzt genannten Kapiteln ordnet Rodolfo Pio an, eine Konstitution des Gabriel Condulmer bzw. des Philippus Calandrini di Sarzana einzufügen, die sodann auch wiedergegeben werden. Des weiteren enthalten in Buch I I I Zusätze Rodolfo Pios die Kapitel 17 „Quod clerici non incedant post tertium sonum campanae", Kapitel 19 „De pignorantibus vasa sacra, vel ornamenta ecclesia869 Vgl. F. Ermini, Aegidianae", in: RISG 870 Vgl. F. Ermini, Aegidianae", in: RISG 871 Vgl. F. Ermini, Aegidianae", in: RISG
Gli ordinamenti politici e amministrativi nelle „Constitutiones 15 (1893), S. 196-240 (219). Gli ordinamenti politici e amministrativi nelle „Constitutiones 16 (1893), S. 39-80 (55). Gli ordinamenti politici e amministrativi nelle „Constitutiones 15 (1893), S. 196-240 (239).
5. Übersicht über den Inhalt der Zusätze von Rodolfo Pio
175
stica, & ea recipientibus", Kapitel 21 „Quod clerici non admittantur ad procurationem", Kapitel 22 „Quod clerici non recipiant contractum in fraudem collectarum: & de poena contrafacientium", Kapitel 23 „De gabellis non soluendis per ecclesiasticas personas" und Kapitel 28 „De matrimoniis". Auch in dem zuletzt erwähnten Kapitel handelt es sich lediglich um die Anordnung des Kardinals, eine Konstitution des Gabriel Condulmer einzufügen. ι
In Buch IV, in dem das Strafprozeßrecht und das materielle Strafrecht geregelt sind, befinden sich Bestimmungen Rodolfo Pios in Kapitel 8 „Quod mensis praefixus uni versi tatibus ad inquirendum, currat a die scientiae delicti", Kapitel 16 „Declaratio quod pater admittatur pro suo interesse pro filio homicida, & in omnibus casibus in proxima constitutione expressis", Kapitel 21 „De commissione testium in causis criminalibus", Kapitel 36 „Quod homicida notorius, licet non bannitus, possit impune offendi", Kapitel 44 „De represaliis non concedendis contra subditos rectoris provinciae, praeterquam ab ipso rectore", Kapitel 52 „Moderatio, seu declaratio super offensis officialium", Kapitel 60 „Quod poena delationis armorum confundatur cum poena insultus" und Kapitel 71 „De poena stuprantis virginem nondum viripotentem". Die in dem zuletzt genannten Kapitel 71 enthaltene Vorschrift Rodolfo Pios verdient besondere Beachtung. Der Kardinal stellt darin die Vergewaltigung einer Jungfrau unter Strafe und droht für diese Tat die Todesstrafe an: „... quod siquis violenter virginem nondum viripotentem defloraverit, seu stupraverit, poena mortis naturalis ita, & taliter, quod anima a corpore separetur, & si fuerit vilis persona, furca suspendatur in exemplum, & pro publica vindicta, puniatur" 8 7 2 . Auffällig ist hier, daß Rodolfo Pio diese harte Strafe verhängt, da die Aegidianischen Konstitutionen des Albornoz von 1357 in der Verwendung der Todesstrafe sehr zurückhaltend sind. Ausdrücklich drohen sie diese nur für homicidium und Giftmord an, wobei sie im letzteren Falle auf die Strafe des homicidium verweisen 873 . Weiterhin findet man in Buch IV der carpensischen Ausgabe Zusätze Rodolfo Pios in Kapitel 77 „De poena singularis personae rumpentis pacem", Kapitel 83 „Quod domus rumpentis pacem destruatur" und Kapitel 99 „Quod hi, quibus pars aliqua poenae applicatur, non possint petere nisi pro rata compositionibus factae cum thesaurario". In Buch V, das überwiegend vom Zivilprozeß handelt, sind Bestimmungen Rodolfo Pios enthalten in Kapitel 4 „De modo procedendi, quando apparent apodissae privatae manu debitoris", Kapitel 17 „De observatione terminorum Angelinae per commissarios apostolicos", Kapitel 18 „De capitulis admittendis ne causae in longum protelantur", Kapitel 23 „De diebus iuridicis servandis", Kapitel 25 „Quae forma sit servanda in alienationibus, & contractibus minorum", Kapitel 27 „De non faciendo contractum cum ilio, cui interdicta fuerit 872 873
Const. Aeg. IV 71, Ausgabe Rom 1543-1545, S. 115b Zeile 14 bis 17. Vgl. hierzu W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 132.
176
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
bonorum administratio" und Kapitel 28 „De actis, & instruments productis quali ter restituantur: & de termino ad accipiendam copiam." Die folgenden drei Kapitel enthalten keine Intitulatio. Wie jedoch bereits untersucht, wurden sie von Rodolfo Pio verfaßt 874 . Kapitel 29 handelt davon, „Quod auditores, & iudices non expediant causas extra curiam", Kapitel 30 „De allegationibus non fiendis voce per advocatos, nisi aliter eis fuerit iniunctum" und Kapitel 31 „De observatione constitutionis super praescriptione instrumentorum hebraeorum, & usurariorum". Buch VI, in dem die Appellation geregelt ist, enthält lediglich sechs Bestimmungen Rodolfo Pios. Man findet sie in Kapitel 11 „De eodem super desertione", Kapitel 14 „Quod appellationis remedio non possit renunciari", Kapitel 33 „Quod quis cognoscere debet contra innovantes, appellatone pendente, vel impedientes appellantes, aut eorum fideiussores", Kapitel 35 „De appellationibus interponendis a sententiis capitalibus", Kapitel 36 „Quod a sententiis, & gravaminibus commissariorum apostolicorum generalium ad rectorem provinciae libere possit appellari, & recurri" und Kapitel 37 „Quod curiales sint in omnibus, & per omnia cives in omnibus civitatibus, terris, & locis provinciae". 6. Der Geltungsbereich der Aegidianischen Konstitutionen unter Berücksichtigung der Zusätze von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi Albornoz hatte sein Gesetzgebungswerk für alle Provinzen und Gebiete der Kirche erlassen. U m die Geltung seiner Konstitutionen für den gesamten Kirchenstaat auszudrücken, gab er seinem Gesetzbuch den Namen „Liber Constitutionum Sanctae Matris Ecclesiae" 875 . Dementsprechend erklärte er in dem Prooemium seines Werkes von 1357, daß er die in Buch I aufgenommenen päpstlichen Erlasse auf alle Provinzen und Gebiete der Kirche ausdehne: „... deinde constitutiones papales, quas in dictis libris invenimus, quarum alique, licet (de) aliqua dictarum provinciarum faciat mencionem et de aliquibus non, tarnen ipsas ad omnes dictas provincias et terras ecclesie prorogamus . . . " 8 7 6 . Da die Aegidianischen Konstitutionen im 15. Jahrhundert wohl nicht genügend beachtet wurden, ordnete Papst Paul II. mit Breve vom 15. 9. 1465 ihre genaue Befolgung an. Er nannte sie darin jedoch „Constitutiones provinciae nostrae Marchiae Anconitanae" 877 . Obwohl der Titel der ersten gedruckten 874
Vgl. auch R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 31. A. Erler, Albornoz, S. 30; vgl. auch R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 6f.; V. La Mantia, Storia della legislazione italiana, I, Roma e Stato romano, S. 462 Fn. 1. 875
876
Const. Aeg., Prooemium (P. Sella, Cost., S. 2 Zeile 9 bis 12). Const, adiectae, Ausgabe Venedig 1540, Breve Papst Pauls II. vom 15. 9. 1465, S. 57b Zeile 13. 877
6. Der Geltungsbereich der Aegidianischen Konstitutionen
177
Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen, die im Jahre 1473 in Jesi hergestellt wurde, wiederum „Liber constitutionum sancte matris ecclesie editarum per reverendissimum in Christo patrem dominum Egidium episcopum Sabinensem apostolice sedis legatum et domini nostri pape vicarium" 8 7 8 lautete, erhielten die folgenden gedruckten Ausgaben von Perugia 1481,1502 und 1522, Forli 1507 und Venedig 1540 den Namen „Constitutiones Marchie Anconitane ..." bzw. „Constitutiones Marchiae Anconitanae . . . " 8 7 9 . Eine Ausnahme bildet lediglich die Ausgabe Faenza 1524. Sie trägt nämlich den Titel „ I n nomine Sancte et individue trinitatis: Constitutionum editarum per Reverendissimum Patrem et Dominum D. Aegidium Episcopum Sabinensem, Apostolicae Sedis Legatum, et Domini Papae Vicarium" 8 8 0 , schließt jedoch mit den Worten „Expliciunt Constitutiones Marchiae Anchonitanae .. . " 8 8 1 . Eine Änderung tritt bei der Ausgabe Rom 1543-1545 ein, die als erste die Additiones Carpenses enthält. Ihr Name lautet erstmals „Aegidianae Constitutiones". Dem folgen die Ausgaben Venedig 1571, 1572, 1585, 1588 und 1605 882 . Was mag der Grund dafür gewesen sein, daß der von Albornoz gewählte Titel nicht beibehalten, sondern in einschränkender Weise in „Constitutiones Marchiae Anconitanae" abgeändert wurde? Raffaele Foglietti 883 führt als Begründung an, daß der größte Teil der Konstitutionen des Albornoz in der Mark Ancona und für die Mark Ancona erlassen worden sei und daß man auch die späteren Constitutiones adiectae für diese Provinz verkündet habe. Dem steht jedoch entgegen, daß Albornoz sein Gesetzbuch für alle Provinzen und Gebiete der Kirche erlassen und dies durch den Namen seines Werkes, nämlich „Liber Constitutionum Sanctae Matris Ecclesiae", zum Ausdruck gebracht hat. Infolgedessen darf man wohl davon ausgehen, daß der Geltungsbereich der Aegidianischen Konstitutionen erst im Laufe der Zeit zurückgegangen ist und sich schließlich auf die Mark Ancona 878
So B. Brandi, Le Constitutiones S. M. Ecclesiae del cardinale Egidio Albornoz, in: Bollettino dell' Istituto Storico Italiano Nr. 6 (1888), S. 37-61 (46); F. Raffaelli, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, bibliotecnicamente descritte in tutte le loro edizioni, in: Archivio storico per le Marche e per l'Umbria, Bd. I (1884), S. 82-99 (85). 879 Β. Brandi, Le Constitutiones S. M. Ecclesiae del cardinale Egidio Albornoz, in: Bolletino dell'Istituto Storico Italiano Nr. 6 (1888), S. 37-61 (51 ff.); F. Raffaelli, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, bibliotecnicamente descritte in tutte le loro edizioni, in: Archivio storico per le Marche e per l'Umbria, Bd. I (1884), S. 82-99 (93 ff.) und Bd. I I (1885), S. 63-102 (63 ff.); P. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 496ff. 880 F. Raffaelli, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, bibliotecnicamente descritte in tutte le loro edizioni, in: Archivio storico per le Marche e per l'Umbria, Bd. I I (1885), S. 63-102 (69). 881 F. Raffaelli, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, bibliotecnicamente descritte in tutte le loro edizioni, in: Archivio storico per le Marche e per l'Umbria, Bd. I I (1885), S. 63-102 (70). 882 P. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 503 f. 883 R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, S. 7.
12 Hoffmann
178
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
beschränkte 884 . Dies wird dadurch bestätigt, daß Papst Sixtus IV. mit seiner Bulle vom 30. 5. 1478 die Geltung der Aegidianischen Konstitutionen sowie der Constitutiones adiectae auf den gesamten Kirchenstaat ausdehnte: „... statuimus et ordinamus, quod qui nunc sunt et pro tempore erunt in provinciis, civitatibus, terris, castris et locis predictis deputati Legati etiam de Latere, Gubernatores, et eorum Locumtenentes teneantur et debeant firmiter et inviolabiliter observare, et quantum in eis est per alios, ad quos spectat, tenaciter observari facere omnes et singulas provinciales constitutiones predictas a summis Pontificibus predecessoribus nostris ac Legatis, ut prefertur, éditas, et dudum per bone memoriae Aegidium Episcopum Sabinensem in eisdem provinciis, civitatibus, terris, castris et locis Apostolice Sedis Legatum ... quatenus ad eos adaptari possint, absque tarnen preiudicio statutorum et consuetudinem Urbis, civitatum, terrarum et locorum specialis commissionis ... volumus, ac mandamus illas in eisdem Urbe, Civitatibus, Terris et locis specialis commissionis sicut in provinciis firmiter observari..." 885 . Da die praktische Geltung der Aegidianischen Konstitutionen außerhalb der Mark Ancona auch noch im 16. Jahrhundert von freiheitsliebenden Magnaten und Kommunen immer wieder bezweifelt oder gar verneint wurde 8 8 6 , betonte Papst PaulIII. in seiner Bulle „Officii nostri debitum" vom 30.7.1538 nochmals nachdrücklich die allgemeine Geltung dieses Gesetzeswerkes: „... approbamus & conflrmamus, easque (sc. Egidianas constitutiones) tarn in Urbe, quam provinciis, civitatibus, terris & locis praedictis, etiam specialis commissionis per omnes cuiuscunque dignitatis, status, gradus, & conditionis extiterint, perpetuis futuris temporibus, inviolabiliter observari debere . . . " 8 8 7 . Galt dies aber auch für das Reformwerk Rodolfo Pios mit seinen Zusätzen? Papst Paul III. erklärt hierzu in seinem Breve „Ex debito pastoralis officii" vom 10. 9. 1544: „... Easdem egidianas constitutiones per praefatum Rodulphum Cardinalem, sive eius Agentes, & ad id deputatos, purgatas, emendatas, elucidatas, mutatas, alteratas, additas, & in dictos sex libros redactas, suisque locis, & ordinibus collocatas ... confirmamus, & approbamus ... futuris temporibus in eadem provincia observari debere . . . " 8 8 8 . 884 V. La Mantia, Storia della legislazione italiana, I, Roma e Stato romano, S. 462, Fn. 1; W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 32. 885 L. Cherubini, Magnum Bullarium Romanum, Bd. I Nr. 4, S. 425f.; diese Bulle Papst Sixtus IV. vom 30. 5. 1478 ist ferner abgedruckt bei A. Theiner, Codex diplomaticus, Bd. I I I Nr. 417. — Anzumerken ist, daß als Datum dieser Bulle bei V. La Mantia, Storia della legislazione italiana, I, Roma e Stato romano, S. 462, versehentlich der 28. 5. 1478 angegeben wurde. 886 F. Ranieri, Gesetzgebung in Italien, in: Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, II. Bd., 2. Teilband, S. 140; A. Erler, Albornoz, S. 33. 887 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, Konstitution Papst Pauls III. vom 30. 7. 1538, S. 6 a der nicht numerierten Seiten, Zeile 29 bis 32. Diese Bulle ist auch abgedruckt bei L. Cherubini, Magnum Bullarium Romanum, Bd. I Nr. 17, S. 725 f.
6. Der Geltungsbereich der Aegidianischen Konstitutionen
179
Weiteren Aufschluß gibt die Glosse des Gaspare Cavallini zu dem Prooemium Rodolfo Pios vor Buch II. Dort heißt es: „Rodulfus Pius cardinalis de Carpo amplissimus, hic dum Marchiae legatus de latere esset, has constitutiones emendali ac compilari mandavit, cum quibusdam additionibus ad provincialium commodum et utilitatem ut apparet in earum confirmatione Pauli III. per breve sub data anni 1544, ut sic dubitari non posset, quin eius additiones extra provinciam non serventur, sed solum Aegidianae Constitutiones, quas idem Paulus III. ad beneficium subditorum Sedis Apostolicae approbavit per breve sub data anni 1538, et in iure hoc clarum est, quod constitutiones locales non ligant nisi loca in quibus vigent ... Et hae constitutiones sunt municipale provinciae Marchiae et non universale ius, quia unaquaeque provincia suo sensu abundat . . . " 8 8 9 . Aus dem Breve Papst Pauls III. vom 10. 9. 1544 sowie der vorbezeichneten Glosse des Gaspare Cavallini ergibt sich somit, daß die Zusätze Rodolfo Pios außerhalb der Mark Ancona keine Geltung hatten und nicht zu beachten waren. Vielmehr galten nur die Aegidianischen Konstitutionen, die von Papst Paul III. in seiner Bulle „Officii nostri debitum" vom 30. 7. 1538 nochmals bestätigt worden waren, außerhalb der Mark Ancona und damit im gesamten Kirchenstaat. Das Reformwerk Rodolfo Pios war infolgedessen ausschließlich auf die Mark Ancona beschränkt, während der prä-carpensische Gesetzestext auch weiterhin für alle Provinzen und Gebiete der Kirche galt 8 9 0 . Durch die Bulle Papst Sixtus'V. 8 9 1 vom 15. 3. 1589 könnte dies jedoch geändert worden sein. In dieser Bulle, in der der Papst die Rangfolge 888 Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545, Breve Papst Pauls III. vom 10. 9. 1544, S. 5 b der nicht numerierten Seiten, Zeile 10 bis 20. Dieses Breve ist auch nachzulesen bei L. Cherubini, Magnum Bullarium Romanum, Bd. I Nr. 17, S. 726. 889 Aegidianae Constitutiones cum additionibus Carpensibus nunc denuo recognitae et quampluribus erroribus expurgatae, cum glossis non minus doctis quam utilibus praestantissimi Viri Gasparis Cabalimi de Cingulo Jurisconsulti Picentis — Cum indice tarn Capitulorum quam Glossarum locorumque insignium, Ausgabe Venedig 1588, Glosse zu dem Prooemium Rodolfo Pios vor Buch II, S. 40. eoo Ygi ρ Colliva, Un recente libro tedesco sulle „Constitutiones" dell'Albornoz, in: Studia Albornotiana X I I I (1973), S. 173-181 (178): P. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 487. — A. Erler, Albornoz, S. 36, ist der Ansicht, daß die Aegidianischen Konstitutionen möglicherweise sogar über die Grenzen des Kirchenstaates hinaus als Vorbild gedient haben. Er beobachtete nämlich beim Studium der Statuten von Predappio eine teilweise wörtliche Übereinstimmung zwischen einzelnen Kapiteln dieser Statuten und den Aegidianischen Konstitutionen. 891 Feiice Peretti, der aus ärmsten Familienverhältnissen entstammte, wurde am 24. 4. 1585 zum Papst gewählt. Er nannte sich Sixtus V. Er war in seinem ganzen Wirken einer der wichtigsten Vertreter der Katholischen Reform nach dem Konzil von Trient. 1586 gab er dem Kardinalskollegium einen neuen Rahmen und setzte seine Höchstzahl auf 70 Kardinäle fest. 1588 schuf Sixtus V. ständige Kardinalskongregationen, die in Zukunft die kurialen Verwaltungsaufgaben tragen sollten. Sie waren in ihren wesentlichen Momenten identisch mit den noch heute bestehenden Kongregationen. In Rom bewährte sich Sixtus V. als Bauherr. Er war der Baumeister des barocken Rom, das noch heute die 12*
180
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
verschiedener Gesetzgebungen festlegt, heißt es wie folgt: „Déclarantes quod in futurum in omnibus provinciis, civitatibus, terris et locis Status nostri praedicti quicumque gubernatores, etiam cardinales et legati praedicti, aut alii officiales, teneantur in primis et ante omnia, quoad causas criminales praedictas, constitutionibus, ordinationibus et litteris Romanorum Pontificum nostrorum praedecessorum atque nostris, et in casibus in quibus ipsae nihil disponunt, statutis locorum, si, ut praefertur, valide et efficaciter confirmata fuerint, inviolabiliter inhaerere et parere; quod si ea valida non extiterint, debeant iudicare, procedere, absolvere, condemnare et sententias ferre iuxta tenorem constitutionum provinciae Marchiae a bonae memoriae Paulo Papa tertio, similiter praedecessore nostro, per eius, sub data die χ mensis septembris pontificatus sui anno X, expeditas litteras confirmatarum, quas Pauli tertii praedecessoris nostri litteras per praesentes approbamus et innovamus. In reliquis vero banna et edicta in ipsis provinciis, civitatibus et locis pro tempore publicata observentur" 892 . In dieser Bulle ordnet Papst Sixtus V. somit an, daß in allen Provinzen und Gebieten des Kirchenstaates verschiedene Gesetzgebungen, die er im einzelnen nennt, in einer bestimmten Rangfolge einzuhalten sind. Indem der Papst bei diesen Gesetzgebungen unter anderem auch die Constitutiones provinciae Marchiae, wie die Aegidianischen Konstitutionen oftmals genannt werden, aufzählt und zugleich auf das Breve Papst Pauls III. vom 10. 9. 1544 verweist, in dem dieser das Reformwerk Rodolfo Pios billigt und in Kraft setzt, könnte dies dahingehend zu verstehen sein, daß die von dem Kardinal überarbeiteten Constitutiones Aegidianae mit seinen Zusätzen im gesamten Kirchenstaat gelten sollen. Eine solche Auslegung erscheint jedoch fraglich. Untersucht man nämlich einige Entscheidungen der Gerichte, so wird deutlich, daß die Geltung der Konstitutionen Rodolfo Pios außerhalb der Mark Ancona immer wieder abgelehnt wurde. Als Begründung wurde zumeist angeführt, daß er lediglich Legat in der Mark Ancona gewesen sei und sich seine Jurisdiktion daher nur auf dieses Gebiet beschränkt habe 8 9 3 . Eine Ausdehnung des Geltungsbereiches seiner Konstitutionen sei nicht erfolgt. So liest man zum Beispiel in einer Entscheidung der Sacra Rota Romana vom 25. 6. 1621: „... nec Stadt wesentlich prägt. Für das neue Erblühen Roms sorgte er aber vor allem durch den Bau von Wasserleitungen, die eine Besiedlung auch der Hügel dieser Stadt ermöglichten; daß sie noch heute Bestandteil der städtischen Wasserversorgung sind, macht ihre Bedeutung unmißverständlich sichtbar; H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Sixtus V.", S. 299ff. 892 Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum, Taurinensis editio, Band IX (1865) Nr. 144, S. 73-81 (79). 893 Soweit Rodolfo Pio in seinem Decretum, das der carpensischen Ausgabe der Aegidianischen Konstitutionen Rom 1543-1545 vorangestellt ist, den Titel eines „agri picaeni, de latere legatus" trägt, ist anzumerken, daß Picenum lediglich eine andere Bezeichnung für die Mark Ancona ist; vgl. P. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 34 Fn. 79; W. Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, S. 49 Fn. 47. Ausführlich über Picenum auch A.N. Modona, Art. „Piceno", in: Enciclopedia Italiana, Bd. X X V I I (1935-1943), S. 157-158, sowie H. Nissen, Italische Landeskunde, 2. Bd., 1. Hälfte, S. 407ff.
6. Der Geltungsbereich der Aegidianischen Konstitutionen
181
in dicta Civitate (Fulginatense) habet locum Constitutio Marchiae lib. 5 cap. 25. in ea parte in qua fuit extensa ad mulieres per Cardinalem Carpensem, quia dicta extensio Cardinalis non obligat extra Provinciam Marchiae, cum solum in illa esset legatus, & iurisdictionem habet, ut apparet ex secunda approbatione Pauli III. . . . " 8 9 4 . Als weiteres Beispiel sei die Entscheidung der Sacra Rota Romana vom 26. 1. 1632 angeführt: „... & Additio, quae loquitur de Mulieribus, sit Cardinalis Carpensis, quae non habet locum extra Provinciam Marchiae, ut apparet ex secunda approbatione Pauli III. . . . " 8 9 S . Ferner heißt es in der Entscheidung der Sacra Rota Romana vom 26. 11. 1633: „... Aegidiana autem nihil disponit circa contractus mulierum; & Constitutio Carpensis dat quidem certas formulas pro mulieribus contrahentibus, sed cum Rodulphus Cardinalis Carpensis solum Picaeni Legatus esset, ejus Constitutiones non egrediuntur Picaenum, nec a fei. ree. Paulo III. fuerunt extensae ultra Legationem ejusdem Cardinalis Carpensis, prout extendit, seu potius confirmavit Constitutiones Aegidianas; Aegidius quippe Cardinalis Carilus pro tota Italia, dum Summi Pontifices degerent Avenione, Legatus fuit constitutus, unde merito in toto Statu Ecclesiastico servantur ejus Constitutiones" 896 . Desweiteren sei auf die Entscheidung der Sacra Rota Maceratensis vom 16. 5. 1664 hingewiesen: „... (sc. Carpensis Constitutio) non servari in Civitate Anconae, in qua fuit confectum instrumentum dictae transactionis, quia Cardinalis Carpi nullam habebat Jurisdictionem in dicta Civitate, ut dare patet in Breve legationis registrato in principio dictarum Constitutionum ...; nec ejus Additiones fuerunt extensae a Paulo Tertio ultra ejus legationem" 897 . Schließlich sei als letztes Beispiel die Entscheidung der Sacra Rota Romana vom 9. 5. 1674 genannt, in der es heißt: „... neque (sc. Constitutio) Carpensis, quae non extenditur ultra Provinciam Marchiae" 8 9 8 . Demgegenüber wurde die Geltung der Aegidianischen Konstitutionen von Albornoz für den gesamten Kirchenstaat von den Gerichten wiederholt bestätigt. Ein Beispiel wurde in der bereits erwähnten Entscheidung der Sacra Rota Romana vom 26. 11. 1633 aufgezeigt. Als weiteres Beispiel sei aus den Decisiones aureae causarum sacri palatii apostolici diejenige vom 23. 5. 1552 genannt: „Constitutio Aegidiana habet locum in civitate Avinionensis ... Praeterea licet Aegidius fecerit illam constitutionem propter Provinciam Marchiae, tarnen Sixtus Papa Quartus extendit illas constitutiones ad omnes terras ecclesiae, & cum civitas Avinionensis sit sub potestate Ecclesiae, videtur 894
P. Rubeus (Hrsg.), Sacrae Rotae Romanae Decisiones Recentiores, Partis quartae, Tomus secundus, Decisio 304 num. 9. 895 P. Rubeus (Hrsg.), Sacrae Rotae Romanae Decisiones Recentiores, Pars sexta, Decisio 88 num. 8. 896 P. Rubeus (Hrsg.), Sacrae Rotae Romanae Decisiones Recentiores, Pars sexta, Decisio 237 num. 14, 15, 16. 897 H. Vinciolus (Hrsg.), Decisiones S. Rotae Maceratensis, Decisio 18 num. 21. 898 J.B. Compagno (Hrsg.), Sacrae Rotae Romanae Decisiones Recentiores, Partis decimaeoctavae, Tomus primus, Decisio 391 num. 5.
182
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
dicendum, quod veniat in illa extensione Sixti potius per viam comprehensionis, quam extensionis" 899 . Dieser Überblick über einige Gerichtsentscheidungen darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sich hierbei um Einzelfallentscheidungen handelt. Sie zeigen jedoch, daß sich die Frage nach dem Geltungsbereich der Constitutiones und Additiones Rodolfo Pios des öfteren gestellt hat und man offensichtlich versuchte, die Bestimmungen des Kardinals auch außerhalb der Mark Ancona anzuwenden. Daraus darf man wohl den Schluß ziehen, daß das Reformwerk Rodolfo Pios in Einzelfallen nicht nur in der Mark Ancona, sondern zudem in den anderen Gebieten des Kirchenstaates Anwendung gefunden hat. Zur Fortgeltung der Aegidianischen Konstitutionen sowie der Additiones Carpenses hat ein weiterer Umstand beigetragen, nämlich die eingehende Glossierung derselben durch den bereits erwähnten Gaspare Cavallini. Lange Zeit glaubte man, daß dies ein Pseudonym sei, hinter dem sich der große französische Jurist Charles Dumoulin verberge 900 . Cavallini hat jedoch wirklich gelebt 901 . Er wurde um 1530 in Cingoli geboren und studierte in Pavia, Macerata, Perugia und schließlich in Bologna. Dort erwarb er den juristischen Doktorgrad. Außer dem „Tractatus de evictionibus", Venedig 1571, dem Sammelwerk „Milleloquium juris", Venedig 1575, den Glossen zu den Konstitutionen von Melfi sowie einer wissenschaftlichen Arbeit zu dem „Droit coutumier" gehören die Glossen zu den Aegidianischen Konstitutionen zu seinen Hauptwerken 902 . Seine Glosse zu diesem Gesetzbuch ist nach Art moderner Anmerkungen dem Gesetzestext nachgestellt. Sie knüpft an einzelne Worte des Textes an. Wie bei den Postglossatoren ist die Verknüpfung von Wort und Text oftmals jedoch ganz äußerlich, so daß mit dem Anliegen des Gesetzgebers kein Sinnzusammenhang mehr besteht 903 . Durch seine wiederholten Auflagen hat der Kommentar des Gaspare Cavallini zu der Dauerhaftigkeit der Aegidianischen Konstitutionen sowie der Additiones Rodolfo Pios beigetragen, denn diese blieben in Kraft bis zu ihrer Aufhebung durch Motuproprio Papst Pius' VII. im Jahre 1816.
899 P.A. Ver alius (Hrsg.), Decisiones aureae causarum sacri palatii apostolici, Pars Prima, Decisio 226 num. 1 und 4. 900 So C.G. Jöcher, Allgemeines Gelehrtenlexikon, 3. Teil, S. 591. 901 J.-L. Thireau, Charles du Moulin (1500-1566), S. 34 Fn. 94. 902 Ausführlich über Gaspare Cavallini und seine Werke H.-J. Becker, Art. „Cavallini (Caballino), Gaspare", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 22 (1979), S. 773-774; A. Erler, Albornoz, S. 34f. 903 Α. Erler, Albornoz, S. 35.
7. Aufhebung der Aegidianischen Konstitutionen durch Pius VII.
183
7. Die Aufhebung der Aegidianischen Konstitutionen samt den Zusätzen von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi durch das Motuproprio Papst Pius9 VII. vom 6. Juli 1816 Die Umwälzungen, welche die „Römische Republik" (1798-1799) mit sich brachte, gaben wohl den Anstoß zu dem großen Reformwerk, das mit dem ersten Regierungsjahre Pius4 V I I . 9 0 4 begann. A m 30. 10. 1800 erließ er die berühmte Konstitution „Post diuturnas". Das Ziel derselben, „Restauration" und Reform, ist in der Vorrede des Gesetzes ausgesprochen, nämlich „formas et regendi rationes a Nostris praedecessoribus sapientissime stabilitas et longo usu et multorum saeculorum experientia comprobatas, quantum fieri potest, retinere et conservare; non ita tarnen, ut persuasum Nobis non sit, interdum convenire eas induci mutationes, quas singulorum, universorumque utilitas ob rerum, ac temporum conversiones expostularet" 905 . Somit sollte die alte Ordnung im Kirchenstaat wiederhergestellt, zugleich aber eine Reform des Staatswesens durchgeführt werden 906 . Dies zeigt, daß die Reformbewegung im Kirchenstaat schon lange vor der französischen Herrschaft einsetzte, große Ziele hatte und auch Großes erreicht hätte, wenn nicht die politischen Wirrnisse der folgenden Jahre und eben die französische Invasion selbst das begonnene Werk unterbunden hätten. Inzwischen begannen nämlich die Franzosen, ein Territorium nach dem anderen zu besetzen, bis im Jahre 1809 der ganze Kirchenstaat eingezogen und dem napoleonischen Kaiserreich und dem Königreich Italien (der übrige Teil mit den schon 1796 der cisalpinischen Republik einverleibten Gebieten) angegliedert war. Die Niederlage Napoleons in der Völkerschlacht bei Leipzig am 16./19. 10. 1813 und sein Sturz wurden für Papst Pius VII. zur Befreiung aus seiner Zwangslage, und er konnte am 25. 5. 1814 wieder in Rom einziehen 907 . Die Territorien, über die der Papst 1814 seine Oberhoheit ausüben konnte und die als die Länder der „prima ricupera" bezeichnet werden, waren außer Rom mit der Comarca die alten Provinzen Marittima und Campania, Sabina, Patrimonio (Viterbo, Civitavecchia), Umbria (Perugia, Spoleto) und Urbino (Urbino, Pesaro). Die Marken und die Legationen blieben von den neapolitani904
A u f Grund der Erleichterungen für die Papstwahl, die Pius VI. 1797/98 wegen der Napoleonischen Kriege erlassen hatte, fand das Konklave nach seinem Tode im Kloster S. Giorgio maggiore in Venedig statt. Dort wurde am 14. 3. 1800 nach einem viermonatigen Konklave Barnaba Luigi Conte Chiaramonti, Professor der Theologie, zum neuen Papst gewählt und am 21. 3. 1800 als Pius VII. inthronisiert. Ihn erwartete die Aufgabe, die Kirche an die neue Situation in Europa heranzuführen. Ausführlich hierzu H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Pius VII.", S. 271 ff. 905
Zitiert nach F. Große-Wietfeld, Justizreformen im Kirchenstaat, S. 20. Ausführlich zu den beabsichtigten Reformen von 1800 F. Große-Wietfeld, Justizreformen im Kirchenstaat, S. 20 ff. 907 Vgl. F. Große-Wietfeld, Justizreformen im Kirchenstaat, S. 28; H. Stadler, Päpste und Konzilien, Art. „Pius V I I . " , S. 273. 906
184
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
sehen bzw. österreichischen Truppen besetzt 908 . Bereits am 4. 5. 1814 grüßte Pius VII. von der Grenze des Landes, aus seiner Geburtsstadt Cesena, seine Untertanen und kündigte die Ankunft seines Delegaten, des apostolischen Protonotars Agostino Rivarola, in Rom an. Gemeinsam mit einer von dem Papst ernannten Staatskommission sollte er zur Bildung einer vorläufigen Regierung schreiten. Da viele unter dem französischen Regime gelitten hatten und deshalb ebenso wie alle von der streng konservativen Gesinnung die völlige Wiederherstellung der früheren Verhältnisse begehrten, stellte Agostino Rivarola durch Edikt vom 13. 5. 1814 das pontifikale Regierungssystem wieder her. Das gesamte französische Recht, bürgerliche und peinliche Gesetzgebung, Prozeßordnung und Handelsrecht wurden in den Herrschaften des Heiligen Stuhles für „auf ewig abgeschafft" erklärt und die alte Gesetzgebung wiederhergestellt, wie sie in dem Augenblick bestanden hatte, als die päpstliche Regierung aufhörte. Eine Ausnahme bildete lediglich das Hypothekenrecht: „ I I Codice Napoleone Civile, e di Commercio, il codice penale, e di procedura rimangono da questo momento aboliti in tutti i domini della S. Sede senza derogare intanto all' attuale sistema ipotecario, che corrisponde all' antica intavolazione. È similmente da questo momento richiamata in osservanza l'antica legislazione civile, e criminale, e l'antica prattica vigente all' epoca della cessazione del governo Pontificio" 9 0 9 . Damit war auch die Geltung der Aegidianischen Konstitutionen wiederhergestellt. All dies war jedoch nicht im Sinne des staatsklugen, einer gemäßigt liberalen Richtung angehörigen Kardinalstaatssekretärs Herkules Consalvi, der zu dieser Zeit auf dem Wiener Kongreß weilte 9 1 0 . Durch die Wiener Schlußakte vom 9. 6. 1815 kamen an den Kirchenstaat wieder die drei Legationen (Bologna, Ferrara und Romagna) sowie die Marken mit Camerino, Benevent und Ponte Corvo zurück. Sie werden als die Gebiete der „seconda ricupera" bezeichnet. Endgültig verloren blieben die Territorien von Avignon, Venaissin und die Gebiete links des Po 9 1 1 . Als Consalvi somit erfolggekrönt vom Wiener Kongreß zurückkehrte, erließ er am 5. 7. 1815 ein Edikt über die vorläufige Verwaltung
908
F. Große-Wietfeld, Justizreformen im Kirchenstaat, S. 29 Fn. 2. Zitiert nach F. Große-Wietfeld, Justizreformen im Kirchenstaat, S. 30; vgl. auch A.J. Nürnberger, Papsttum und Kirchenstaat, Bd. 1, S. 112; L.v. Ranke, Historischbiographische Studien, S. 97. 910 Herkules Consalvi, dessen Name mit dem Pius' VII. eng verbunden ist, wurde am 8. 6. 1757 in Rom geboren. Er war schon frühzeitig außerordentlich gebildet und nicht bloß des Lateinischen völlig mächtig, sondern auch in der Dichtkunst geübt. Im Jahre 1789 trat Consalvi als Votante oder Richter ins Tribunal der Signatura, und im Dezember 1792 ernannte ihn Pius VI. zum Uditore della Sacra Rota Romana. Von dessen Nachfolger, Papst Pius VII., wurde Consalvi am 11. 8. 1814 zum Kardinal erhoben und wenig später zum Staatssekretär befördert. Die Priesterweihen nahm Consalvi jedoch niemals. Ausführlich über ihn und seine Verdienste bei J. L. S. Bartholdy, Züge aus dem Leben des Cardinais Hercules Consalvi, S. 4 ff. 911 F. Große-Wietfeld, Justizreformen im Kirchenstaat, S. 41 Fn. 2. 909
7. Aufhebung der Aegidianischen Konstitutionen durch Pius VII.
185
der neuen Provinzen. Es leitet eine neue Ära in der Gesetzgebung des Kirchenstaates ein und ist der Vorläufer der mit dem Jahre 1816 einsetzenden allgemeinen Um- und Neubildung der Verwaltung des Kirchenstaates. Der staatsmännischen Einsicht Consalvis konnte es nicht entgehen, daß in den neuerdings dem Kirchenstaat einverleibten Gebieten, die zum größten Teil nahezu 20 Jahre unter französischer Verwaltung und Rechtspflege gestanden hatten, die Wiedereinführung der alten vor 1798 herrschenden Regierungsformen eine Unmöglichkeit sein würde. Er suchte deshalb zwischen den früheren und den von den Franzosen geschaffenen Rechtszuständen zu vermitteln, so stark auch die an den alten Einrichtungen zäh festhaltende Gegenströmung war. Sein Edikt vom 5. 7. 1815 trägt daher auch ein ganz anderes Gepräge als die Bestimmungen Rivarolas für die Territorien der „prima ricupera". Der Grundzug desselben kennzeichnet sich in der Beibehaltung der französischen Regierungsformen und -Organisationen, auch wenn der Inhalt dieser Formen großenteils ein anderer werden mußte. A u f dem Gebiete des Rechts mußte es jedoch einschneidende Änderungen geben. Der Code Napoléon wurde aufgehoben und „le leggi del Diritto Romano", d. h. das jus commune an seine Stelle gesetzt, allerdings mit bedeutenden „modificazioni". Das partikuläre Recht wurde nicht ausdrücklich aufgehoben, es wurde aber auch nicht ausdrücklich bestätigt. Es sollte daher, wenn auch in veränderter Rangordnung, ebenfalls noch Anwendung finden 912. Durch das Edikt Consalvis vom 5. 7. 1815 war der Kirchenstaat somit nunmehr hinsichtlich der Verwaltung und der Rechtspflege in zwei Teile geteilt. In den Territorien der ersten „ricupera" war fast völlig der Zustand wiedereingeführt, der vor der französischen Invasion herrschte. In den Gebieten der zweiten „ricupera" war dagegen das jus commune als Einheitsrecht eingeführt, wenn auch mit einigen Einschränkungen, die zum Teil das französische Recht aufrecht erhielten. Das partikuläre Recht, und damit auch die Aegidianischen Konstitutionen, sollten ebenfalls noch Anwendung finden, allerdings in untergeordneter Rangfolge. In der öffentlichen Verwaltung blieb in den Provinzen der zweiten „ricupera" das französische System bestehen; und in der Rechtspflege übernahm man dort die französische Gerichtsverfassung 913. Durch das Motuproprio „Quando per ammirabile" vom 6. 7. 1816 wurde dieser unselige Zustand beendet und das Prinzip der Einheit und Einheitlichkeit im Kirchenstaat verwirklicht. In der längeren Vorrede, die in ihrer ehrlichen Offenheit und diplomatischen Gewandtheit ein Meisterstück staatsmännischer Kunst darstellt, läßt Consalvi Papst Pius VII. sagen: „Einheit und Gleichförmigkeit müssen die Grundlagen einer jeden politischen Institution sein. Schwerlich können ohne dieselben die Regierungen fest, die Völker glücklich werden. Eine Regierung kann um so mehr für vollkommen gelten, je mehr sie sich dem Systeme der Einheit nähert, das von Gott sowohl in der Natur als in
912 913
F. Große-Wietfeld, F. Große-Wietfeld,
Justizreformen im Kirchenstaat, S. 41 ff. Justizreformen im Kirchenstaat, S. 52.
186
III. Teil: Rodolfo Pio und die Aegidianischen Konstitutionen
dem Gebäude der Religion befolgt ward. Unser Staat, nach und nach durch die Vereinigung verschiedener Herrschaften gebildet, enthielt ein Aggregat von Gebräuchen, Gesetzen, Privilegien von großer Mannigfaltigkeit, so daß eine Provinz häufig der anderen fremd, zuweilen sogar in der nämlichen Provinz ein Stadtgebiet dem anderen entgegengesetzt war. Die Päpste, unsere Vorgänger, und wir selbst im Anfang unseres Pontifikats haben jede Gelegenheit benutzt, die verschiedenen Zweige der Verwaltung auf das Prinzip der Einheit zurückzuführen. Allein das Zusammentreffen mit mancherlei Interessen, der Widerstreit gegen die alten Gewohnheiten und alle die Hindernisse, die man zu finden pflegt, sobald man das Bestehende zu verändern sucht, haben die Ausführung dieses Werkes bis jetzt verhindert" 914 . „ Die göttliche Vorsehung, sagt er weiter, welche die menschlichen Dinge dergestalt leitet, daß aus dem größten Unglück zahlreiche Vortheile entspringen, scheint gewollt zu haben, daß die Unterbrechung der päpstlichen Regierung zu einer vollkommeneren Form derselben den Weg bahnen sollte" 9 1 5 . Dasselbe sei nicht nur nützlich („utile"), sondern sogar notwendig („nesessaria"). In einem großen Teile der neuerdings wiedererlangten Provinzen habe die Trennung vom Heiligen Stuhl die alten Einrichtungen fast vergessen lassen; in ihnen sei die Rückkehr zur alten Ordnung unmöglich. Aus den Gründen der Einheit und Einförmigkeit ergebe sich aber die Notwendigkeit, die im größeren Teile des Staates eingeführten Neuerungen auf den ganzen Staat auszudehnen. Es sei das Gebot der Stunde, den kostbaren Augenblick auszunutzen, der von der göttlichen Vorsehung vorbereitet zu sein scheine, um zu einem allgemeinen und uniformen System im ganzen Staate zu schreiten. Für diese Gesetzesarbeit stellt Papst Pius VII. drei Richtlinien auf, nämlich einmal die möglichste Beschleunigung der Arbeit, sodann die möglichste Einhaltung des Prinzips der Einförmigkeit und schließlich den Grundsatz, die alten Einrichtungen, soweit das mit den zuvor erwähnten Ideen vereinbar sei, beizubehalten („conservare"), ohne jedoch jene Änderungen auszuschließen, welche die Nützlichkeit („utilità") und die öffentlichen Erfordernisse („i bisogni publici") nach solch außerordentlichen Zeiten („straordinarie vicende") es verlangten 916 . Auch hier findet man somit wieder die Begriffe „utilitas" und „necessità". U m für den gesamten Kirchenstaat ein einheitliches Recht zu schaffen, und damit die allgemein herrschende Rechtsunsicherheit und Rechtsverwirrung zu beseitigen, wurde durch das Motuproprio Papst Pius VII. das partikuläre Recht gänzlich abgeschafft und das jus commune zum Einheitsrecht für den gesamten Kirchenstaat erhoben: „Tutte le leggi municipali, statuti, ordinanze, riforme, sotto qualunque titolo, ο per mezzo die qualunque autorità emanate in qualsivoglia luogo dello stato, comprese ancora quelle pubblicate per un particolare distretto, respettivamente sono abolite; a riserva di quelle, che 914
Zitiert nach L.v. Ranke, Historisch-biographische Studien, S. 82f. Zitiert nach L.v. Ranke, Historisch-biographische Studien, S. 82. pie Ygi ρ Große-Wietfeld, Justizreformen im Kirchenstaat, S. 57. 915
7. Aufhebung der Aegidianischen Konstitutionen durch Pius VII.
187
contengono provvedimenti relativi alla coltura del territorio, al corso delle acque, ai pascoli, ai danni dati nei terreni, e ad altri simili oggetti r u r a l i " (art. 1 0 2 ) 9 1 7 . D a m i t waren auch die Aegidianischen K o n s t i t u t i o n e n samt den Zusätzen R o d o l f o Pios vollständig abgeschafft.
917 Zitiert nach F. Große-Wietfeld, Justizreformen im Kirchenstaat, S. 75. — Aus dem jus commune heraus sollte das neue bürgerliche Gesetzbuch für den Kirchenstaat geschaffen werden. Für die Arbeit des ersten Entwurfes der Gesetze hatte sich Consalvi des fähigsten juristischen Kopfes vergewissert, den der Kirchenstaat aufzuweisen hatte, des landesflüchtigen Abbate Vincenzo Bartolucci. Er war von Geburt Römer und konnte auf eine zwanzigjährige Dienstzeit in der Apostolischen Kammer hinweisen. Bereits im Jahre 1798 war er jedoch zur „Römischen Republik" übergegangen, und als Napoleon im Jahr 1809 das römische Königreich gründete, machte er ihn zum Präsidenten des neuerrichteten Appellationsgerichtshofes in Rom. Im Jahre 1811 wurde Bartolucci kaiserlicher Staatsrat. Papst Pius VII. lehnte Bartolucci zunächst ab, da er sich zweimal als Verräter erwiesen habe. Consalvi benötigte diesen ausgezeichneten Juristen jedoch wegen seiner Fähigkeiten und auch wegen seiner Erfahrung und Kenntnisse im französischen Recht. Bartolucci wurde daher von dem Papst zurückgerufen und in seine früheren Ämter wiedereingesetzt. Bei der Ausarbeitung des Motuproprio vom 6. 7. 1816 trug er die Hauptlast. Ferner stand er an der Spitze der Kommission zur Ausarbeitung des bürgerlichen Gesezbuches; so F. Große-Wietfeld, Justizreformen im Kirchenstaat; S. 65 ff.; C. Vaso Ii, Art. „Bartolucci, Vincenzo", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 7 (1965), S. 4-5.
Schlußbemerkung In der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch unternommen, das Werk von Kardinal Rodolfo Pio da Carpi zu würdigen. Bisher hatten er und sein Wirken stets im Schatten seines berühmten Vorgängers Aegidius Albornoz gestanden, seine Reform der Aegidianischen Konstitutionen wurde stets nur am Rande erwähnt. Dies geschah jedoch zu Unrecht. Rodolfo Pio hat nicht nur das Gesetzgebungswerk von Albornoz überarbeitet und durch das geschickte Einfügen der Constitutiones adiectae seiner Vorgänger ein einheitliches, in sechs Bücher eingeteiltes Gesetzbuch wiederhergestellt. Er hat auch eigene Zusätze und Konstitutionen geschaffen. Ebenso wie Justinian 918 und auch Albornoz hatte er zwar nie die Absicht, ein eigenes Gesetzbuch zu machen, sondern, wie er selbst ausspricht, lediglich eine neue Kompilation des Codex Egidianus. Durch die Auswahl der Constitutiones adiectae und Bestimmungen, die er sodann in die sechs Bücher der Aegidianischen Konstitutionen einfügte, sowie durch die Schaffung eigener Gesetze, die seine Besonnenheit und seine staatsmännische Umsicht offenbaren, geht er über dieses Ziel jedoch weit hinaus. Indem sein Werk bis 1816, wenn vielleicht auch nicht im gesamten Kirchenstaat, in Geltung gestanden hat, zeigt sich seine Bedeutung. Kardinal Rodolfo Pio da Carpi ist daher ein großer Staatsmann und Gesetzgeber des Kirchenstaates und, wie es in seiner Grabinschrift heißt, der „defensor iuris ecclesiastici".
918 F. C.v. Savigny, Juristische Methodenlehre, S. 32; vgl. auch R. Schmidt-Wiegand, Jacob Grimm und das genetische Prinzip in Rechtswissenschaft und Philologie, S. 3.
Zeittafel zu dem Leben von Rodolfo Pio da Carpi 1500,22. 2. Rodolfo Pio da Carpi geboren. 1503, 18. 8. Tod des Borgia-Papstes Alexander VI. 1503,22. 9. Beginn des Pontifikats Papst Pius III. 1503, 18. 10. Tod Papst Pius III. 1503, 31. 10. Beginn des Pontifikats Papst Julius II. 1513,21. 2. Tod Papst Julius II. 1513, 11. 3. Beginn des Pontifikats Papst Leos X. aus dem Hause Medici. 1515, 1. 1. Tod König Ludwigs X I I . von Frankreich, Regierungsantritt Franz I. 1516
Rodolfo Pio da Carpi wird Ritter von Jerusalem, Prior und Komtur der Kirche San Lorenzo von Colorno.
1517, 6. 3. Rodolfo Pio erhält das Beneflzium der Kirche Santa Trinità in Ferrara. 1519, 12. 1. Tod Kaiser Maximilians I. 1519,28. 6. Karl I. von Spanien wird in Frankfurt a. M. zum Römischen König gewählt und zum Kaiser designiert: Karl V. 1521, 1.12. Tod Papst Leos X. 1522, 9. 1. Beginn des Pontifikats Papst Hadrians VI. 1523, 14. 9. Tod Papst Hadrians VI. 1523, 19. 11. Beginn des Pontifikats Klemens VII. aus dem Hause Medici. 1525, 24. 2. Schlacht von Pavia und Gefangennahme König Franzi, durch Kaiser Karl V. Die Familie Pio verliert die Grafschaft Carpi an den Kaiser. 1527, 6. 5. Sacco di Roma; Papst Klemens VII. Gefangener in der Engelsburg. 1528, 13. 11. Ernennung Rodolfo Pios zum Bischof von Faenza in der Romagna. 1529,
12. Rodolfo Pio im Auftrage Papst Klemens VII. in Florenz.
1530, 24. 2. Kaiserkrönung Karls V. in Bologna; letzte Krönung durch einen Papst. 1530, 8. 4. Alfonso d'Esté, Herzog von Ferrara, wird von Karl V. mit der Grafschaft Carpi belehnt. 1530, 26. 7.
Erste Nuntiatur Rodolfo Pios bei König Franz I von Frankreich.
1530, 28. 11. Rodolfo Pio kehrt nach Rom zurück. 1532, 13. 12. Zweite Begegnung des Papstes mit Kaiser Karl V. in Bologna. 1533, 27. 5. Zweite Nuntiatur Rodolfo Pios bei König Franz I. von Frankreich; zuvor bei Karl III., Herzog von Savoyen.
190
Zeittafel zu dem Leben von Rodolfo Pio da Carpi
1533,
8. Rodolfo Pio hält in Faenza mittels seines Vikars Matteo Mengari eine Diözesansynode ab.
1533,
10. Zusammenkunft zwischen Papst Klemens VII. und König Franzi, von Frankreich in Marseille.
1533, 12. 11. Rodolfo Pio kehrt mit Papst Klemens VII. nach Rom zurück. 1534, 25. 9. Tod Papst Klemens VII. 1534, 13. 10. Beginn des Pontifikats Papst Pauls III. aus dem Hause Farnese. 1535, 9. 1. Dritte Nuntiatur Rodolfo Pios bei König Franz I. von Frankreich. 1536, 22. 12. Rodolfo Pio wird zum Kardinal erhoben. 1537, 7. 7. Rodolfo Pio kehrt wieder nach Rom zurück. 1537, 19. 12. Legation Rodolfo Pios bei König Franz I. von Frankreich. 1538, 18. 6. Papst Paul III. bringt in Nizza persönlich einen Waffenstillstand zwischen Kaiser Karl V. und König Franz I. von Frankreich zustande. 1539, 21. 4. Ernennung Rodolfo Pios zum päpstlichen Legaten de latere in der Mark Ancona. 1540, 27. 3. Rodolfo Pio ernennt seinen Vater Lionello zum Locumtenens der Mark Ancona. 1540, 27. 9. Bestätigungsbulle der Gesellschaft Jesu. 1541, 1. 1. Rodolfo Pio wird Kardinalprotektor der Franziskaner und bleibt es bis zu seinem Tode. 1541, 12. 8. Ernennung Rodolfo Pios zum Legaten für Rom während der Abwesenheit Papst Pauls III. 1541, 13. 9. Begegnung Papst Pauls III. mit Kaiser Karl V. in Lucca. 1542, 9. 1. Rodolfo Pio erhält das Amt des Kämmerers. 1542, 21. 7. M i t der Bulle „Licet ab initio" wird die vom Heiligen Offizium geleitete römische Inquisition begründet. 1542 1543,
Ende der Legation Rodolfo Pios in der Mark Ancona. 2. Ernennung Rodolfo Pios zum Legaten für Rom während der erneuten Abwesenheit Papst Pauls III.
1543, 21. 6. Begegnung Papst Pauls III. mit Kaiser Karl V. in Busseto. 1543 1543
Rodolfo Pio verfaßt seinen berühmten Discorso an Kaiser Karl V. Rodolfo Pio wird zum Kardinalprotektor der Compania de la Gratia ernannt. 1544, 10. 9. Papst Paul III. setzt durch die Konstitution „Ex debito pastoralis officii" die von Rodolfo Pio da Carpi reformierten Aegidianischen Konstitutionen in Kraft. 1544, 10. 10. Rodolfo Pio verzichtet zugunsten seines Bruders Teodoro auf das Bistum Faenza. 1544
Ernennung Rodolfo Pios zum Kardinalprotektor der Gesellschaft Jesu.
1545, 13. 12. Eröffnung des neunzehnten allgemeinen Konzils in Trient: Beginn der Gegenreformation.
Zeittafel zu dem Leben von Rodolfo Pio da Carpi 1546
Rodolfo Pio wird Bischof von Girgenti, dem heutigen Agrigent, auf Sizilien.
1547, 31. 3. Tod König Franz I. von Frankreich; Regierungsantritt Heinrichs II. 1549, 10. 11. Tod Papst Pauls III. 1550, 7. 2. Beginn des Pontifikats Papst Julius III. 1550, 21. 2. Bestätigung Rodolfo Pios als „gubernator perpetuus" von Alatri durch Papst Julius III. 1551, 1551
2. Rodolfo Pio erhält das Amt des Generalinquisitors. Sommer, Ernennung Rodolfo Pios zum Legaten für das Patrimonium S. Petri mit dem Sitz in Viterbo.
1551, 25. 6. Feierlicher Einzug Rodolfo Pios in Viterbo. 1551, 9. 9. Ernennung Rodolfo Pios zum Legaten bei Kaiser Karl V.; wegen Krankheit konnte er die Reise an den kaiserlichen Hof jedoch nicht antreten. 1551,
9. Rodolfo Pio kehrt von Viterbo nach Rom zurück.
1552, 28. 4. Unterbrechung des Konzils in Trient. 1552,
7. Rodolfo Pio reist nach Viterbo und kehrt erst im September 1552 wieder nach Rom zurück.
1552,
7. Rodolfo Pio wird zum Kardinalprotektor des Deutschen Kollegs in Rom ernannt.
1555, 23. 3. Tod Papst Julius III. 1555, 9. 4. Beginn des Pontifikats Papst Marcellus II. 1555, 1. 5. Tod Papst Marcellus II. 1555, 23. 5. Beginn des Pontifikats Papst Pauls IV. aus dem neapolitanischen Adelsgeschlecht der Carafa. 1556, 12. 9. Kaiser Karl V. legt die Kaiserkrone nieder; Ferdinand I. von Österreich wird Kaiser. 1558, 21. 9. Tod Karls V. 1559, 10. 7. Tod König Heinrichs II. von Frankreich; Regierungsantritt Franz' II. 1559, 18. 8. Tod Papst Pauls IV. 1559, 14. 12. Rodolfo Pio der päpstlichen Würde zum Greifen nahe. 1559, 25. 12. Beginn des Pontifikats Papst Pius IV. 1560, 5. 12. Tod König Franz II. von Frankreich; Regierungsantritt Karls IX. 1562, 18. 1. Wiedereröffnung des Konzils in Trient. 1563, 4. 12. Schlußsitzung des Konzils in Trient. 1564, 24. 4. Rodolfo Pio errichtet sein Testament. 1564, 25. 4. Rodolfo Pio verfaßt ein Kodizill. 1564, 2. 5. Tod Rodolfo Pios da Carpi in Rom.
Literatur und Quellen Accorroni, Giovanni: Bartolomeo Appoggio, Macerata 1900. Adversi, Aldo/ Cecchi, Dante /Paci, Libero: Storia di Macerata, Band II, Macerata 1972. Adversi, Aldo: Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, Volume C, Band I und II, Macerata, Biblioteca Comunale „Mozzi-Borgetti", Florenz 1981. Aegidianae Constitutiones: recognitae, ac novissime, impressae. Cum privilegio Pauli Papae III. Pontificis Maximi — Romae, D. Hieronyma de Cartulariis excudebat, 1545 (e in fine): Romae, In aedibus Francisci Priscianensis, 1543 (zit.: Const. Aeg., Ausgabe Rom 1543-1545). — cum additionibus Carpensibus nunc denuo recognitae et quampluribus erroribus expurgatae, cum glossis non minus doctis quam utilibus praestantissimi Viri Gasparis Cabalimi de Cingulo Jurisconsulti Picentis. - Cum indice tarn Capitulorum quam Glossarum locorumque insignium. - Venetiis, s.t., 1588. Alberigo, Josepho/7oa««ow, Perikle-P./ Leonardi, Claudio /Prodi, Paulo (Hrsg.): Conciliorum oecumenicorum decreta, edidit Centro di Documentazione Istituto per le Scienze Religiose - Bologna, Basel/Barcinone/Freiburg /Rom 1962. Amalgià, Roberto I Lugli, Giuseppe ! Falco, Giorgio: Art. „Alatri", in: Enciclopedia Italiana, Bd. I I (1929), S. 82f. Attichy, Ludovicus Donius d': Flores Historiae Sacrii Collegii S.R.E. Cardinalium. Lutetiae Parisiorum, Band III, 1660. Baroni, Pier Giovanni: La nunziatura in Francia di Rodolfo Pio, 1535-1537, Bologna 1962. Bartholdy, J.L.S.: Züge aus Stuttgart/Tübingen 1824.
dem
Leben
des
Cardinals
Hercules
Consalvi,
Becker, Hans-Jürgen: Art. „Kirchenstaat", in: HRG, Band 2 (1978), Sp. 824-831. — Art. „Cavallini (Caballino), Gaspare", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 22 (1979), S. 773-774. Beneyto, Juan: Albornoz, fundador. Perduración de la obra del Cardenal en la Politica y especialmente en el Colegio, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 199-211. Beneyto Perez, Juan: El cardenal Albornoz, canciller de Castilla y Caudillo de Italia, Madrid 1950. Berardi, Domenico / Rame Ili, Antonio Cassi / Foschi, Marina / Montevecchi, Ferruccio/ Ravaldini, Gaetano j Venturi, Sergio: Rocche e castelli di Romagna, Band 2, Bologna 1971. Biondi, Albano: Alberto Pio nella pubblicistica del suo tempo, in: Società, politica e cultura a Carpi ai tempi di Alberto I I I Pio, atti del convegno internazionale (Carpi, 1921 Maggio 1978), Padua 1981, S. 95-132.
Literatur und Quellen
193
Boccaccio, Giovanni: Das Dekameron, München 1965. Bock, Friedrich: Art. „Orsini, Neapoleone", in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 7 (1962), Sp. 1242. Boscolo, Alberto: Documenti aragonesi sulla famiglia Alvarez de Albornoz, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 81-89. Brandi, Brando: Le Constitutiones S. M. Ecclesiae del Cardinale Egidio Albornoz, in: Bollettino dell'Istituto Storico Italiano Nr. 6 (1888), S. 37-61. — Nuovi manoscritti delle „Constitutiones Aegidianae", in: Bollettino dell'Istituto Storico Italiano Nr. 10 (1891), S. 17-29. Bresslau, Harry: Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, Band 1 und 2, 3. Aufl., Berlin 1958. Brosch, Moritz: Geschichte des Kirchenstaates, 1. Band, 16. und 17. Jahrhundert, Gotha 1880. Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum, Taurinensis editio, Band IX (1865). Burckhardt,
Jakob: Die Kultur der Renaissance in Italien, 10. Aufl., Stuttgart 1976.
Campo, F.: Besprechung Erler, Albornoz, in: Estudio Augustiano 7 (1972). Capasso, Carlo: Paolo III. (1534-1549), Band I, Messina 1924. — Paolo III. (1534-1549), Band II, Messina 1923. — Art. „Albornoz", in: Enciclopedia Italiana, Bd. I I (1929), S. 211-212. Cardella, Lorenzo: Memorie storiche de' cardinali della Santa Romana Chiesa, Band 2, Rom 1792. — Memorie storiche de' cardinali della Santa Romana Chiesa, Band 4, Rom 1793. Castellani, Giuseppe: Art. „Macerata, Storia", in: Enciclopedia Italiana, Bd. X X I (193442), S. 774. Cecchi, Dante: Il parlamento e la congregazione provinciale della Marca di Ancona, Milano 1965. — Le Costituzioni albornoziane e la loro validità in un documento del 1479, in: Studia Albornotiana X I I I (1973), S. 123-154. Chelazzi, C.: Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani, dal medioevo alle fine del secolo 18 der Biblioteca del Senato della Repubblica, Vol. IV, Rom 1958. Cherubini, Laerzio: Magnum Bullarium Romanum, ab Leone Magno usque ad S. D. N. Innocentium X. Opus absolutissimum Laertii Cherubini praestantissimi Jurisconsulti Romani; Et à D. Angelo Cherubino Monacho Cassinensi nunc denuò Illustratum & Recensitum Editio novissima. Tomus primus Lugduni 1655. Ciacconio, Alfonso: Vitae et res gestae pontificium romanorum et S. R. E. cardinalium, ab initio nascentis Ecclesiae usque ad dementem IX. Ρ. Ο. M., Band I - I V , Rom 1677. Cittadella, Luigi Napoleone: Notizie amministrative, storiche, artistiche relative a Ferrara, Band 1, Ferrara 1868. 13 Hoffmann
194
Literatur und Quellen
Claramunt, Salvador j Trenchs, José: Itinerario del cardenal Albornoz en sus legaciones italianas (1353-1367), in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 369-432. Colliva, Paolo: Un recente libro tedesco sulle „Constitutiones" dell' Albornoz, in: Studia Albornotiana X I I I (1973), S. 173-181. — Il cardinale Albornoz, lo stato della chiesa, le „Constitutiones Aegidianae" (13531357) con in Appendice il testo volgare delle costituzioni di Fano dal ms. Vat. Lat. 3939, (Studia Albornotiana X X X I I ) , Bologna 1977 (zit.: P. Colliva, I l cardinale Albornoz). Colliva, Paolo/Claramunt, Salvador: Catàlogo de las obras presentadas en la exposición de libros albornocianos, in: Studia Albornotiana X I I (1972), S. 725 ff. Compagno, Joanne Baptista (Hrsg.): Sacrae Rotae Romanae Decisiones Recentiores, Partis decimaeoctavae, Tomus primus, Complectens Annos M . D C . L X X I I I . & M . D C . LXXIV., Venedig 1716. Compagnoni, Pompeo: La reggia Picena overo de presidi della Marca. Historia universale. Teil I, Macerata 1661. Constitutiones Marchiae Anconitanae: Noviter ab omnibus erroribus atque mendis expurgatae, cum Additionibus antiquis. Novissime autem quaedam novae additiones adiectae fuerunt usque in presentem diem, praesertim Julii II. et Pauli III. Summorum Pontificum, quae numquam alias ab ullo typographo impressae fuerunt. - Venetiis, impensis Nob. viri D. Nicolai de Aristotele, 1540 (zit.: Const. Aeg., Ausgabe Venedig 1540). Dal Pane, Luigi: Lo stato pontificio e il movimento riformatore del settecento, Mailand 1959. Dante, Alighieri: Die göttliche Komödie, herausgegeben von Dr. Erwin Laaths, München 1983. Darricau, R.: Art. „Estaing (Pierre d')", in: Dictionnaire de biographie française, Bd. 13 (1975), Sp. 65-67. Dilcher, Gerhard: Gesetzgebung als Rechtserneuerung. Eine Studie zum Selbstverständnis der mittelalterlichen Lage, in: „Rechtsgeschichte als Kulturgeschichte", Festschrift für Adalbert Erler, herausgegeben von Hans-Jürgen Becker, Gerhard Dilcher, Gunter Gudian, Ekkehard Kaufmann und Wolfgang Sellert, Aalen 1976, S. 13-35. — Art. „ballivus", in: HRG, Band 1 (1971), Sp. 287-288. Dilcher, Hermann: Art. „Melfi, Konstitutionen von", in: HRG, Band 3 (1984), Sp. 470476. Dittrich, Franz: Gasparo Contarmi, 1483-1542, Eine Monographie. Braunsberg 1885. Diviziani, Antonio: Fonti delle costituzioni egidiane. Le costituzioni di Bertrando de Deuc del 1336 per la Marca di Ancona e per il Ducato di Spoleto, Savona 1923. Dupré Theseider, Eugenio: Art. „Albornoz", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 2 (1960), S. 45-53. — Egidio de Albornoz e la riconquista dello Stato della Chiesa, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 433-459. Durant, Will und Ariel: Kulturgeschichte der Menschheit, Band 8, Glanz und Zerfall der italienischen Renaissance, Frankfurt am Main/Berlin/Wien 1981.
Literatur und Quellen
195
Ebel, Wilhelm: Geschichte der Gesetzgebung in Deutschland, 2. erweiterte Auflage, Göttingen 1958. Eitel, Anton: Der Kirchenstaat unter Klemens V., Berlin und Leipzig 1907. Erler, Adalbert: Aegidius Albornoz als Gesetzgeber des Kirchenstaates, Berlin 1970 (zit.: A. Erler, Albornoz). — Besprechung von: El Cardenal Albornoz y el Colegio de Espana I - III. Hg. von Evelio Verdera y Tuells (Studia Albornotiana X I - X I I I ) . Publicaciones del Real Colegio de Espana en Bologna. Cometa, Zaragoza 1971 -1973. 726 bzw. 742 bzw. 708 S. in: Z R G (KA) 60 (1974), S. 434-437. — Der Loskauf Gefangener, Berlin 1978. — Kirchenrecht. Ein Studienbuch. 5. Aufl., München 1983. — Art. „Konstitution, constitutio", in: HRG, Band 2 (1978), Sp. 1119-1122. — Art. „Präambel", in: HRG, Band 3 (1984), Sp. 1848-1850. — Necessitas als Implus der Rechtserneuerung, in: La Formazione Storica del Diritto Moderno in Europa. Atti del Terzo Congresso internazionale della società Italiana di Storia del diritto, vol. I, S. 113-122, Florenz 1977. — Der Schwabenspiegel in der Kosmographie Sebastian Münsters, in: „Arbeiten zur Rechtsgeschichte", Festschrift für Gustaf Klemens Schmelzeisen, Stuttgart 1980, S. 85-100. Ermini, Filippo: Gli ordinamenti politici e amministrativi nelle „Constitutiones Aegidianae", in: RISG 15 (1893), S. 69-94, und S. 196-240; 16 (1893), S. 39-80 und S. 215247. Ermini, Giuseppe: I parlamenti dello stato della chiesa dalle origini al periodo albornoziano, Rom 1930. Esch, Arnold: Bonifaz IX. und der Kirchenstaat. Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Band 29, Tübingen 1969. Eubel, Conradus: Hierarchia catholica medii aevi, Band 1, 2. Aufl., Münster 1913. — Hierarchia catholica medii aevi, Band 3, Münster 1910. Feine, Hans Erich: Kirchliche Rechtsgeschichte, 5. Aufl., Köln/Graz 1972. Fichtenau, Heinrich: Arenga. Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformen, Graz/Köln 1957 (MIÖG Ergänzungsband XVIII). Filippini,
Francesco: Il cardinale Egidio Albornoz, Bologna 1933.
Fiorina, Ugo: Inventario dell' archivio Falcò Pio di Savoia, Vicenza 1980. Foglietti,
Raffaele: Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, Macerata 1881.
Franceschini, Gino: I l cardinal legato Egidio d'Albornoz e i conti di Montefeltro, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 649-680. — Il cardinale Anglico Grimoard e la sua opera di legato nella regione UmbroMarchigiana, in: Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, LI, 1954, S. 45-72. Frenz, Thomas: Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471 -1527). Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Band 63, Tübingen 1986. 13*
196
Literatur und Quellen
Friedensburg, Walter (Bearb.): Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-1559 nebst ergänzenden Aktenstücken, 1. Band, Nuntiaturen des Vergerlo 1533-1536, Gotha 1892. — (Bearb.): Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-1559 nebst ergänzenden Aktenstücken, 1. Ergänzungsband 1530-1531, Legation Lorenzo Campeggios 1530-1531 und Nuntiatur Girolamo Aleandros 1531, Tübingen 1963. Fürst, Carl Gerold: Besprechung Erler, Albornoz, in: ZRG (KA) 89 (1972), S. 441 f. Gagnér, Sten: Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung, Uppsala 1960. Gams, Pius Bonifacius: Series episcoporum ecclesiae catholicae, 2. Aufl., Leipzig 1931. Gautier Dalchè, Jean: A propos d'une mission en France de Gii de Albornoz: opérations navales et difficultés financières lors du siège d'Algésiras (1341-1344), in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 247-263. Gennaro, Clara: Art. „Calandrini, Filippo", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 16 (1973), S. 450-452. Glénisson, Jean/Mollai, Guillaume: Correspondance des Légats et Vicaires-Généraux Gil Albornoz et Androin de la Roche (1353-1367), Bibliothèque des Ecoles Françaises d'Athènes et de Rome, Paris 1964. Göller, Emil: Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung unter Pius V., 1. Band, 1. Teil, Rom 1907. Goetz, Helmut (Bearb.): Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-1559 nebst ergänzenden Aktenstücken, 16. Band, Nuntiatur des Girolamo Martinengo (1550-1554), Tübingen 1965. Goez, Werner: Grundzüge der Geschichte Italiens in Mittelalter und Renaissance, Darmstadt 1984. Gregorovius, Ferdinand: Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter vom V. bis XVI. Jahrhundert, Dreizehntes und vierzehntes Buch, Darmstadt 1963. Groote, W. von: Art. „Öffnungsrecht (befestigter Plätze)", in: HRG, Bd. 3 (1984), Sp. 1225-1227. Große-Wietfeld, Franz: Justizreformen im Kirchenstaat in den ersten Jahren der Restauration (1814-1816), in: Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft (Sektion für Rechts- und Staatswissenschaft) 61 (1932). Grotefend, Hermann: Taschenbuch der Zeitrechnung, 12. verbesserte Auflage, Hannover 1982. Gualdo, Germano: I libri delle spese di guerra del cardinale Albornoz in Italia conservati nell' Archivio Vaticano, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 577-607. Guillemain, Bernard: La Sacré Collège au temps du cardinal Albornoz (1350-1367), in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 355-368. Haidacher, Anton: Geschichte der Päpste in Bildern, Heidelberg 1965. Hampe, Karl: Herrschergestalten des deutschen Mittelalters, 4. unveränd. Nachdruck der beim Verlag Quelle & Meyer erschienenen 6., von Hellmut Kämpf durchgesehenen und um einen Literaturanhang erweiterten Auflage, Heidelberg 1955, Darmstadt 1984.
Literatur und Quellen
197
Hirst , Michael: A Book on Sebastiano del Piombo, in: Arte Veneta, Rivista di Storia dell'Arte, Annata X X X I V , 1980, S. 230. — Sebastiano del Piombo, Oxford 1981. Jedin, Hubert (Hrsg.): Handbuch der Kirchengeschichte, Band IV, Basel/Wien 1967. — Geschichte des Konzils von Trient, Band I, Der Kampf um das Konzil, 3. Aufl. 1977. Jimenez, Fernando Flores: El cardenal Albornoz, Temas espanoles, Nr. 481, Madrid 1967. Jöcher, Christian Gottlieb: Allgemeines Gelehrtenlexikon, 3. Teil, Leipzig 1751. Jones, P. J.: The Malatesta of Rimini and the Papal State, A Political History, Cambridge 1974. Katterbach, Bruno: De Cardinali Rodulpho Pio de Carpo protectore O. F. M . nominato anno 1541, in: Archivum Franciscanum Historicum, 1923, S. 557f. Kern, Fritz: Recht und Verfassung im Mittelalter, in: H Z 120 (1919), S. 1-79. Kluxen, Kurt: Die necessità als Zentralbegriff im politischen Denken Machiavellis, in: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, Band X X (1968), S. 14-27. Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke: Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Bd. I, Leipzig 1925. Krause, Hermann: Dauer und Vergänglichkeit im mittelalterlichen Recht, in: ZRG (GA) 75 (1958), S. 206-251. Krüger, Paul: Corpus iuris civilis, Volumen 2, Codex Iustinianus, Berlin 1906. Krüger, Paul/Mommsen, Theodor: Corpus iuris civilis, Volumen 1, Institutiones, Berlin 1911. Kühner, Hans: Das Imperium der Päpste, Frankfurt am Main 1980. Kupke, Georg (Bearb.): Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533 -1559 nebst ergänzenden Aktenstücken, 12. Band, Nuntiaturen des Pietro Bertano und Pietro Camaiani (15501552), Berlin 1901, unveränderter Nachdruck Frankfurt 1968. Laemmer, Hugo: Zur Kirchengeschichte des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts, Freiburg im Breisgau 1863. La Mantia, Vito: Storia della legislazione italiana, I, Roma e Stato romano, Rom /Turin /Florenz 1884. Lanckoronska, Maria Gräfin: Vorwort zu Francesco Petrarca, Sonette an Madonna Laura, Stuttgart 1961. Lanzoni, Francesco: La controriforma nella città e diocesi di Faenza, Faenza 1925. Leonhard, Joachim-Felix: Die Seestadt Ancona im Spätmittelalter; Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Band 55, Tübingen 1983. Leopardi, Monaldo: Annali di Recanati con le leggi e i costumi degli antichi recanatesi, herausgegeben von Romeo Vuoli, Band I und II, Varese 1944. Leseale, Chevalier de: La vertù resuscitée ou la vie du cardinal Albornoz surnommé père de l'Eglise. Dédiée à monseigneur le cardinal de Richelieu, Paris 1629. Lestocquoy, Jean: Correspondance des Nonces en France, Carpi et Ferrerio, 1535 -1540, et Legations de Carpi et de Farnèse, Rom /Paris 1961.
198
Literatur und Quellen
— Correspondance de Nonces en France, Dandino, della Torre et Trivultio (1546 -1551), Rom/Paris 1966. Liotta, Filippo: Art. „Appoggio, Bartolomeo", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 3 (1961), S. 637-638. Lomax, Derek W.: El catecismo de Albornoz, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 213233. Lutz, Heinrich (Bearb.): Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-1559 nebst ergänzenden Aktenstücken, 13. Band, Nuntiaturen des Pietro Camaiani und Achille de Grassi, Legation des Girolamo Dandino (1552-1553), Tübingen 1959. Machiavelli,
Niccolò: Der Fürst, Stuttgart 1969.
— Discorsi. Gedanken über Politik und Staatsführung, 2., verbesserte Auflage, Stuttgart 1977. — Geschichte von Florenz, Zürich 1986. Marongiu, Antonio: L'istituto parlamentare in Italia dalle origini al 1500, Rom 1949. — Medieval Parliaments, A comparative study, London 1968. — I l cardinale d'Albornoz e la ricostruzione dello Stato pontificio, in: Studia Albornitiana X I (1972), S. 463-480. — Albornoz, legislatore, in: Studia Albornotiana X I I I (1973), S. 27-45. Massa, Eugenio: Art. „Accolti, Benedetto, il Giovane", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 1 (1960), S. 101-102. Mattaliano, Emanuele: L'autonomia del territorio di Carpi dagli inizi al passaggio sotto il dominio Estense, in: Società, politica e cultura a Carpi ai tempi di Alberto III. Pio, atti del convegno internazionale, (Carpi, 19-21 Maggio 1978) Padua 1981, S. 385-393. Mayer-Maly, Theo: Gemeinwohl und Necessitas, in: „Rechtsgeschichte als Kulturgeschichte", Festschrift für Adalbert Erler, herausgegeben von Hans-Jürgen Becker, Gerhard Dilcher, Gunter Gudian, Ekkehard Kaufmann und Wolfgang Sellert, Aalen 1976, S. 135-145. Mercati, Giovanni: Appunti per la storia della biblioteca di Alberto e di Rodolfo Pio di Carpi, in: Ders., Codici latini Pico Grimani Pio e di altra biblioteca ignota del secolo X V I esistenti nell'Ottoboniana e i codici greci Pio di Modena con una digressione per la storia dei codici di S. Pietro in Vaticano, Studi e testi, 75, Città del Vaticano, 1938, S. 39-74. Merzbacher, Friedrich: Art. „Arenga", in: HRG, Band 1 (1971), Sp. 217-218. — Art. „Corpus iuris canonici", in: HRG, Band 1 (1971), Sp. 637-640. Meuthen, Erich: Art. „Agrigento", in: Lexikon für Theologie und Kirche, Band 1 (1957), Sp. 209. Mielke, J.: Art. „Reichsexekutionsordnung", in: H R G (27. Lieferung 1986), Sp. 565 - 567. Migne, M. L'Abbé: Dictionnaire des Cardinaux, contenant des notions générales sur le cardinalat, Paris 1857. Modona, Aldo Neppi: Art. „Piceno", in: Enciclopedia Italiana, Bd. X X V I I (1935-1943), S. 157-158.
Literatur und Quellen
199
Mollai, Guillaume: Les Papes d'Avignon, Paris 1924. Moschetti, Guiscardo: Il catasto di Macerata dell' anno 1560 e la bolla „Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 Maggio 1557, Pubblicazioni della facoltà giuridica dell' università di Napoli, CLX III, Neapel 1978. Μοχό, Salvador de: Los Albornoz. La elevación de un linaje y su expansion dominical en el siglo XIV. in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 17-80. Müller, Theodor: Das Konklave Pius IV. 1559, Gotha 1889. Neher, Stephan Jakob: Art. „Loreto", in: Kirchenlexikon, Band 8 (1893), Sp. 145 ff. Nissen, Heinrich: Italische Landeskunde, 2. Band. Die Städte. Berlin 1902. Nörr, Knut Wolfgang: Besprechung Erler, Albornoz, in: Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht 17 (1972), S. 329 f. Nürnberger, August Josef: Papsttum und Kirchenstaat, Band 1: Vom Tode Pius VI. bis zum Regierungsantritt Pius IX. (1800-1846), Mainz 1897. Partner, Peter: The Lands of St Peter, The Papal State in the Middle Ages and the early Renaissance, Berkeley /Los Angeles 1972. — Renaissance, Rome, 1500-1559. A Portrait of a Society, Berkeley/Los Angeles/ London, 1976. — The Papal State under Martin V. The administration and government of the temporal power in the early fifteenth century. London 1958. — Art. „Bertrando di Deux (Déaulx)", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 9 (1967), S. 642 ff. Paschini, Pio: Art. „Pio da Carpi, famiglia", in: Enciclopedia Cattolica, Bd. IX (1952), Sp. 1490 und 1491. — Art. „Balue, Giovanni", in: Enciclopedia Cattolica, Bd. I I (1949), Sp. 761-762. Pastor, Ludwig von: Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, Band IV, 2. Abteilung, Adrian IV. und Klemens VII., 11., unveränderte Aufl., Freiburg i.B. 1956. — Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, Band V, Paul III. (15341549) 13. Aufl., Freiburg i.Br. 1956. — Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, Band VI, Julius III., Marcellus II. und Paul IV. (1550-1559), 13., unveränderte Auflage, Freiburg i.Br. 1957. — Die Stadt Rom zu Ende der Renaissance, 1. bis 3. Auflage, Freiburg im Breisgau 1916. Petrucci, Franca: Art. „Castiglioni, Giovanni", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 22 (1979), S. 156-158. Piana, Celestino: I l cardinale Albornoz e gli Ordini religiosi, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 481-519. Pichler, Johannes W.: Necessitas. Ein Element des mittelalterlichen und neuzeitlichen Rechts. Dargestellt am Beispiel österreichischer Rechtsquellen. Berlin 1983. Picotti, Giovanni Battista: Art. „Sforza", in: Enciclopedia Italiana, Bd. X X X I (19361944), S. 571-575.
200
Literatur und Quellen
Pieper, Anton: Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen, Freiburg im Breisgau 1894. Pou y Marti, Giuseppe M.: Art. „Albornoz", in: Enciclopedia Cattolica, Bd. I (1948), Sp. 715-716. Prévost, M.: Art. „Balue, Jean", in: Dictionnaire de biographie française, Bd. 5 (1951), Sp. 16-19. Raffaelli, Filippo: Le Constitutiones Marchiae Anconitanae, bibliotecnicamente descritte in tutte le loro edizioni, in: Archivio storico per le Marche e per l'Umbria, diritto da M. Faloci Pulignani, G. Mazzatinti, M . Santoni, Bd. I, Foligno 1884; S. 82-99, Bd. II, Foligno 1885, S. 63-102. Ranieri, Filippo: Gesetzgebung in Italien, in: Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, II. Band, Neuere Zeit (1500-1800), Das Zeitalter des gemeinen Rechts, 2. Teilband, Gesetzgebung und Rechtsprechung, Veröffentlichung des Max-Planck-Instituts, herausgegeben von Helmut Coing, München 1976. Ranke, Leopold von: Die Geschichte der Päpste. Die Römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten. München/Wiesbaden. — Historisch-biographische Studien, Leipzig 1877. Reumont, Alfred von: Geschichte der Stadt Rom, Band III, 2. Abt., Berlin 1867. Rosa, Mario: Art. „Ardinghelli, Niccolò", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 4 (1962), S. 30 ff. Rubeus, Paulus (Hrsg.): Sacrae Rotae Romanae Decisiones Recentiores, Partis quartae, Tomus secundus, ab anno M . D C . X V I I I . usque ad annum M . D C . XXIV., Venedig 1716. — (Hrsg.): Sacrae Rotae Romanae Decisiones Recentiores, Pars sexta, ab anno M . D C . X X X I usque ad annum M . D C . XXXIV., Venedig 1716. Ruysschaert, José: Les manuscrits vaticans des „Constitutiones Aegidianae": Jalons pour leur histoire, in: Studia Albornotiana X I I I (1973) S. 155-160. Säez, Emilio / Trenchs Odena, José: Diplomatario del cardenal Gii de Albornoz, Cancilleria Pontificia (1351-1353), Barcelona 1976. Santarelli, Umberto: Osservazioni sulla „potestas statuendi" dei Comuni nello Stato della Chiesa (a proposito di Const. Aeg. II, 19), in: Studia Albornotiana X I I I (1973), S. 6783. Saracco Previdi, Emilia: L'Albornoz e Macerata. Un esempio della politica albornoziana nelle Marche, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 635-648. Savigny, Friedrich Carl von: Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, Band III, Darmstadt 1956, unveränderter, fotomechanischer Nachdruck der 2. Ausgabe von 1834. — Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, Band V, Darmstadt 1956, unveränderter, fotomechanischer Nachdruck der 2. Ausgabe von 1850. — Juristische Methodenlehre, Stuttgart 1951.
Literatur und Quellen
201
Schäfer, Karl Heinrich: Die Ausgaben der Apostolischen Kammer unter Benedikt XII., Klemens VI. und Innozenz VI. (1335-1362). Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung 1316-1378. In Verbindung mit ihrem historischen Institut in Rom, herausgegeben von der Görres-Gesellschaft, III. Band. Paderborn 1914. Schmidt, Peter: Das Collegium Germanicum in Rom und die Germaniker. Zur Funktion eines römischen Ausländerseminars (1552-1914). Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Band 56, Tübingen 1984. Schmidt-Wiegand, Ruth: Jabob Grimm und das genetische Prinzip in Rechtswissenschaft und Philologie. Marburger Universitätsreden. Veröffentlichungen des Präsidenten (Reihe A). Heft 12. Hitzeroth / Marburg 1987. Schneider, Reinhard: Karl IV. (1346-1378), in: Kaisergestalten des Mittelalters, hrsg. von Helmut Beumann, München 1984, S. 257-276. Schulze, Rainer: Art. „Reformation (Rechtsquelle)", in: H R G (26. Lieferung 1986), Sp. 468-472. Schweitzer, Vinzenz: Art. „Faenza", in: Lexikon für Theologie und Kirche, Band 3 (1959), Sp. 1337. Schwendenwein, Hugo: Das neue Kirchenrecht, 2. Aufl. Graz/Wien/Köln 1983. Sella, Pietro (Hrsg.): Costituzioni Egidiane dell' anno MCCCLVII, Rom 1912 (zit.: P. Sella, Cost.). Sellert, Wolfgang: Art. „Ladung", in: HRG, Band 2 (1978), Sp. 1338-1350. Semper, Hans/Schulze, F. O. /Barth, W.: Carpi, ein Fürstensitz der Renaissance, Dresden 1882. Sepùlveda, Juan Gines: De vita et rebus gestis Aegidii Albornotii Canili S. R. E. Cardinalis libri très, Rom 1521. Sierra Nava, Luis: Las memorias históricas del bibliotecario del cardenal Lorenzana sobre Gil de Albornoz (1778-1800), in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 175-211. Simeoni, Luigi: Art. „Pio di Carpi", in: Enciclopedia Italiana, Bd. X X V I I (1935-1943), S. 310. Sorbelli, Albano: Art. „Carpi - Monumenti", in: Enciclopedia Italiana, Bd. IX (19311939), S. 141 f. Sprandel, Rolf: Über das Problem neuen Rechts im frühen Mittelalter, in: ZRG (KA) 79 (1962), S. 117-137. Stadler, Hubert: Päpste und Konzilien, Kirchengeschichte, Personen, Ereignisse, Begriffe, Hermes Handlexikon, Düsseldorf 1983. Stefano, Francesco: Historia della vita e gesti del Cardinale Egidio Albornoz, Bologna 1590. Strnad, Alfred: Besprechung Erler, Albornoz, in: Römische Historische Mitteilungen 14 (1972), S. 221-224. — Art. „Carafa, Filippo", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 19 (1976), S. 545547.
Literatur und Quellen Sugenheim, S.: Geschichte der Entstehung und Ausbildung des Kirchenstaates, 1854. Suida, William E.: Clarifications and Identifications of works by Venetian Painters, I. Sebastiano del Piombo, in: The Art Quarterly, Volume IX, 1946, S. 283 ff. Theiner, Augustin: Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis. Recueil de documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des états du Saint-Siège extraits des archives du Vatican, 3 Bände, Rom 1861 /62 (unveränderter Nachdruck Frankfurt am Main 1964). Thireau, Jean-Louis: Charles du Moulin (1500-1566), Genf 1980. Thomas von Aquino: Opera omnia, ed. R. P. Joannis Nicolai, Volumen II: Summa theologica, Parma 1853. Tiraboschi,
Girolamo: Storia della letteratura italiana, Band VII, Teil 2, Rom 1784.
Trenchs Odena, José: Albornoz y Avinón: Relaciones con la Câmara Apostolica (13251350), in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 263-286. Tüchle, Hermann: Art. „Kirchenstaat", in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 6 (1962),, Sp. 260-265. Urgorri Casado, Fernando: Las primeras biografias espanolas del cardenal D. Gii de Albornoz, in: Studia Albornotiana X I (1972), S. 141-173. Vasoli, Cesare: Art. „Bartolucci, Vincenzo", in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 7 (1965), S. 4-5. Ver alius, Paulus Aemilius (Hrsg.): Decisiones Aureae Causarum Sacri Palatii Apostolici, Pars prima. Venedig 1626. Villiger, Johann Baptist: Art. „Aegidius (Gil) Alvarez Albornoz", in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 1 (1957), Sp. 190. Villoslada, Ricardo G.: Besprechung Erler, Albornoz, in: Archivum Historiae Pontificiae 9 (1971), S. 446. Vinciolus, Hyacinthus (Hrsg.): Decisiones S. Rotae Maceratensis, Macerata 1713. Waley, Daniel: The Papal State in the Thirteenth Century, London 1961. Weber, Wolfgang: Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae des Kardinals Aegidius Albornoz von 1357 unter besonderer Berücksichtigung der Strafrechtsnormen, Aalen 1982. Weiß, J.: Art. „Reformation", in: H R G (26. Lieferung 1986), Sp. 459-468. Werunsky, Emil: Italienische Politik Papst Innozenz VI. und König Karl IV. in den Jahren 1353-1354, Wien 1878. Wicki, Josef: Rodolfo Pio da Carpi, erster und einziger Kardinalprotektor der Gesellschaft Jesu, in: Miscellanea Historiae Pontificiae, Vol. X X I (1959), S. 243 ff. Willemsen, Carl Arnold: Kardinal Napoleon Orsini (1263-1342). Historische Studien, herausgegeben von Dr. Emil Ebering, Heft 127, Berlin 1927, Nachdruck Vaduz 1965. Wolf, Armin: Die Gesetzgebung der entstehenden Territorialstaaten in Europa, in: Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, erster Band, Mittelalter, München 1973.
Literatur und Quellen
203
Wurm, Hermann Joseph: Cardinal Albornoz der zweite Begründer des Kirchenstaates, Paderborn 1892. Wynen, Artur: Die päpstliche Diplomatie, Freiburg im Breisgau 1922. Zdekauer, Lodovico: Sui frammenti di due manoscritti delle Costituzioni Egidiane nell' Archivio Notarile di Macerata, in: Archivio Giuridico „Filippo Serafini", Nuova Serie Vol. IV. (1899), S. 347-351.
Personenregister Abdul Hassan, König von Marokko 45 Accolti, Benedetto di 22, 98, 117, 118, 120, 130 Agnellus 92, 116, 129, 131 Alavolino, Fabio 100 Albornoz, Aegidius (Gil Alvarez de) 5, 23, 42-58, 59 ff., 63 ff., 66, 67 ff., 70, 71, 72 ff., 75, 76, 80, 81 ff., 84, 85, 86, 87, 89, 98, 99, 100, 110, 111 f., 115., 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 127, 130, 131, 133, 134, 139, 140, 141 f., 143 f., 146, 148 f., 150, 151, 155 ff., 158 f., 162, 163, 164, 167 f., 169, 170 ff., 173, 175, 176, 177, 181, 188 Albornoz, Âlvar Garcia de 42 Albornoz, Garcia Alvarez de 43 Albornoz, Urraca Gómez de 42 Aldrovandi, Ulisse 40 Alessandrino, Michele 40 Alexander III., Papst 22 Alexander VI., Papst 94, 95, 96, 125, 128, 132, 159, 189 Alfons V., König von León 43 Alfons XI., König von Kastilien 44, 45, 46 Alidosi, die 47 Amandula, Johannes Antonius de 107 Androin de la Roche 54, 64 Androtio, Angelo 100, 104, 107 Antonio di Santa Maria da Monte Ferraro 94, 118, 129 Appoggio, Bartolomeo 100, 101 f., 104, 107 Araceli, Kardinal 35 Ardinghello, Niccolò 23 Ariost 12 Aubert, Etienne siehe Innozenz VI. Bagarotti, Evangelist 94, 118, 129 Baglione, Malatesta 13 Balue, Jean 92 f., 115, 116, 117, 118, 119, 129, 142, 143, 145, 162, 166, 170 Barbo, Pietro siehe Paul II. Bartolucci, Vincenzo 187 Benedetto di Fermo 60
Benedikt XI., Papst 58 Benedikt XII., Papst 44, 45, 46, 61, 62, 66, 114, 115, 156 Benedikt XIII., Papst 43 Bentivoglio, Marco Antonio 39 Bertano, Pietro 30 Bertrand de Deux 52, 59, 61, 62 f., 67, 69, 71, 72, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 126, 128, 131, 143, 163, 169 f. Bianca von Navarra 45 f. Blancutio, Leonardo 100, 107 Boccaccio, Giovanni 47 Bonamico, Camillo 104 Bonifaz VIII., Papst 58 f., 60, 61, 63, 67, 69, 116, 119, 123 Bonifaz IX., Papst 63, 76 Borgia, Cesare 94 Borromeo, Carlo 40 Braccono, Joannes Baptista 100, 104 f., 107 Brancaleoni, die 47 Broet, Pasquale 27, 32 Brolio, Giuliano 100, 103, 107 Calandrini di Sarzana, Philippus 86 f., 88, 99, 116, 117, 119, 121, 123, 128, 129, 131, 132, 140, 142, 143, 144, 145 f., 170, 174 Calcaneo, Niccolò 95 Camaiani, Pietro 30 Canhardo de Sabaltrano 59 Carafa, Carlo 36, 37 Carafa, Giovanni Pietro siehe Paul IV. Carafa, Oliviero 40 Carafa, Philippus 80 Carillo, Gómez 43 Cartularijs, Baidassare de 109 Cartularijs, Hieronyma de 108 f. Castellarlo, Bernardino 97 Castillione, Johannes de 87 ff., 96, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 130, 134, 135, 136, 137, 142, 143, 165, 170 Caterina, Prinzessin von Portugal 31 Cavallini, Gaspare 83, 150, 179, 182
Personenregister Cervini, Marcello 20 Cesare di Ser Giulio di Montalto 102, 103, 106, 107 Chaireddin Barbarossa 16 f., 25 Chiaramonti, Barnaba Luigi Conte siehe Pius VII. Chiavelli, Familie 47 Ciappardellus, Joannes Baptista 100, 102, 106 f. Cibo, Franceschetto 93 Cima da Conegliano, Giovanni Battista 40 Cima, della, Familie 47 Cola di Rienzo 51 Colonna, Prospero 40 Condulmer, Gabriel, später Papst Eugen IV. 85 f., 115, 116, 119, 120, 121, 122, 124, 127, 128, 131, 134, 135, 136, 140, 144, 146, 170, 174, 175 Consalvi, Herkules 184 f., 187 Costazaro, Bonaventura 27 Dandino, Girolamo 30 f. Dandulo, Andreas, Doge von Venedig 49 Deduc, Johannes 93, 132, 145 Diplovataccius, Thomas 73 Dumoulin, Charles 182 Erasmus von Rotterdam 12 Estaing, Pierre d' 84 f., 87, 131 Este, Markgrafen von 12, 36, 47 Este, Aldobrandino d' 49 Este, Alfonso d' 12, 189 Este, Ippolito d' 35 ff. Eugen IV., Papst, siehe auch Gabriel Condulmer 85, 89, 134 Farfaro, Nicoiao 100, 107 Farnese, Alessandro 20, 23, 24, 36 f., 40 Farnese, Costanza 35 Farnese, Ottavio 26 Farnese, Pier Luigi 26 Favonius Spoletinus, Marius 108 Ferdinand I., Kaiser 34, 191 Ferro, Ottavio 100, 102, 103 f., 106 f. Fideli, Joannes Baptista 100 Figueroa, Juan de 35 Flores, Antonio 95, 96, 127 Force, Pietro da 85 Franz I., König von Frankreich 12, 13 ff., 17, 18 ff., 21, 25, 35, 189, 190, 191 Franz II., König von Frankreich 31, 35, 191
205
Friedrich I I von Hohenstaufen, Kaiser, 60, 82, 154 Gabrielli, die 47 Gaetani, die 47 Gallo, Battista 24 Gallo, Francesco 24 Gallo, Gabriele 24 Gallo, Vincenzo 24 Gattaponi da Gubbio, Matteo 57 Gemaldis, Johannes Andreas de 90, 149 Ghislieri, Antonio Michele siehe Pius V. Giardinus, Simon 102 Giovanni da Siena 60 Giovio, Paolo 29 Gonzaga, Ercole 36 f. Gonzaga, Sigismundus de 96,115,116,118, 120, 124, 125, 127, 132, 139, 160, 163 f. Gratian 73, 172 Gregor VII., Papst 18, 154, 172 Gregor IX., Papst 78 Gregor X., Papst 77, 121 Gregor XI., Papst 63, 84, 115, 133 Gregor XII., Papst 85 Grimoard, Anglico de 83 f., 85, 117, 118, 122, 142 Grimoard, Guillaume de siehe Urban V. Gualterio, Paolo 38 Guidiccioni, Giovanni 33 Guzman, dona Leonor de 46 Gyptio (Gipzio, Gizzi oder Gessi), Filippo 100, 104, 106 f. Hadrian VI., Papst 189 Heinrich II., König von Frankreich 30, 35, 191 Heinrich VIII., König von England 16 Horaz 154 Ignatius von Loyola 27, 32, 33 Innozenz VI., Papst 44, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 66, 80, 113, 114, 115, 120, 135, 148, 149, 156 Innozenz VIII., Papst 93 Ismeducci, Familie 47 Jacob, König von Aragón 43 Jacobazzi, Christoforo 18, 19, 21 Jakob, Herzog von Savoyen 49 Jakob V., König von Schottland 20 Jardino (Giardini), Francisco 100, 101, 104, 107
206
Personenregister
Johanna, englische Prinzessin 45 Johannes XXII., Papst 59, 61, 62, 66, 113, 114, 122, 125, 149, 156 Julius II., Papst 92, 95, 96, 123, 189 Julius III., Papst 18, 29, 30, 31 f., 33, 34, 39, 101, 191 Justinian, Kaiser 60, 81, 168, 188 Kalixtus III., Papst 87 Karl IV., Kaiser 52 Karl V., Kaiser 11, 14, 17, 19, 20, 21, 25 f., 28, 30, 35, 189, 190, 191 Karl IX., König von Frankreich 191 Karl III., Herzog von Savoyen 14, 21, 189 Klemens V., Papst 46, 62 Klemens VI., Papst 46, 48, 53, 61, 62, 66, 76 Klemens VII., Papst 13 ff., 16, 18, 22, 28, 41, 95, 189, 190 Klemens XI., Papst 38 Laetus, Pomponius 39 Latini, Latino 39, 40 Le Jay, Claudio 27 Leo X., Papst 95, 96, 97, 159, 163, 189 Livius 154 Lolio, Guido 39 Lorena, Giovanni 19 Ludwig XII., König von Frankreich 189 Luna, Eximinus (Jiménez) de 44, 46 Luna, Pedro de siehe Benedikt XIII. Luna, Teresa de 43 Lupi de Cavis, Angelo 91, 114, 125, 134, 136 Luther, Martin 34 Machiavelli, Niccolò 94, 95, 97 Madruzzo, Christoforo 31, 37 Malatesta, die 47, 52, 68 Malatesta, Galeotto 63, 64 Malucci, Familie 47 Maluicini, Silvester de 90, 149 Mancinello (Mancinelli), Leonardo 100, 105 f., 107 Manfredi, die 47, 53 Manuzio, Aldo 12, 39 Manuzio, Paolo 39 Marcellus II., Papst 34, 191 Margarete von Österreich 31 Maria Stuart, Königin von Schottland 20 f. Martin V., Papst 85 Martinengo, Girolamo 30, 31
Martinengo, Maria 11 Martinez de la Sierra, Juan 60 Mattei, Marino 104 Maximilian I., Kaiser 12, 189 Maximilian, Erzherzog von Österreich und König von Böhmen 31 Medici, Giovanni Angelo de' siehe Pius IV. Medici, Giovanni de' siehe Leo X. Medici, Giulio de' siehe Klemens VII. Medici, Lorenzo de* (il Magnifico) 97 Mengari, Matteo 13, 15, 190 Michelangelo Buonarotti 40 Modestinus 154 Mogliano, de, Familie 47 Monte, Giovanni Maria del siehe Julius III. Montefeltro, Geschlecht 47 Montemilone, da, Familie, 47 Montferrat, Giovanni von 49 Montmorency, Anne de 19, 20 Morone, Giovanni 28, 35, 40 Münster, Sebastian 168 Musso, Cornelio 31 Napoleon I. 31, 183, 187 Nikolaus III., Papst 61 Nikolaus IV., Papst 61 Nikolaus V., Papst 86 f., 89 Ochino, Bernardino 27,34 Oleggio, Giovanni da 53, 55, 81 Ordelaffi, die 47, 53 Ordelaffi, Francesco 53, 54 Orlandini, Nikolaus 32 Orsini, Johannes Paul 94 Orsini, Latino 89, 118 Orsini, Marino 89, 90 Orsini, Napoleon 61 f., 67, 72, 116, 117, 118, 119, 165, 166, 170 Ottoni, die 47 Paffi, Girolamo 13 Palladio, Blosio 29 Papadopuli 38 Paul II., Papst 89, 90, 92, 116, 157, 176 Paul III., Papst 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 97, 102, 103, 104, 107 f., 109, 110 f., 115, 116, 117, 118, 119, 130, 136, 142, 143, 149, 160, 163, 171 f., 178-181, 190, 191 Paul IV., Papst 5, 18, 26, 32, 34, 103, 191
Personenregister Pedro I. der Grausame, König von Kastilien 45 f. Pedro Egidio 44 Pelicani, Antonio Francesco 102 f. Peretti, Feiice siehe Sixtus V. Petracchis, Luca de 60 Petrarca, Francesco 12, 55 Philipp II., König von Spanien 28, 31, 35 Philipp VI., König von Frankreich 45 Piccolomini, Enea Silvio siehe Pius II. Pio, Familie 11 f., 36 Pio, Alberto III. 11 f., 13, 19, 39, 40, 42 Pio, Alberto 40 Pio, Lionello II. 11, 12, 23, 25, 27, 28, 40, 190 Pio, Rodolfo 5, 11-41, 42, 57 f., 59, 67, 74, 75, 81, 85, 89, 92, 95, 97 ff., 100-109, 110, 111, 112, 113-133, 134-138, 140-144, 146-152, 155-172, 173-176, 178, 179, 180, 181, 182, 187, 188, 189-191 Pio, Teodoro 27 f., 190 Piombo, Sebastiano del 40, 41 Pius II., Papst 87, 89, 113, 125, 136, 138 Pius III., Papst 189 Pius IV., Papst 27, 32, 35, 36, 37, 191 Pius V., Papst 38 Pius VI., Papst 183, 184 Pius VIL, Papst 23, 182, 183 f., 185 ff. Platina, Bartolomeo 39 Poggetto, Bertrando del 59 Polanco, Juan de 32 Pole, Reginald 18, 28 Polenta, Familie 47 Polenta, Bernardin von 53 Polenta, Guido von 53 Priscianese, Francisco 108 f. Pucci, Antonio 41 Puteo, Giacomo 35 Raffael 40, 41 Ricalcati, Ambrogio 16 Ricci, Giovanni 30 Rivarola, Agostino 184, 185 Rodolphino, Francischino 100,102,105,107 Rodriguès, Simon 32 Rosso da Valentia, Francesco 15 Rovere di Savona, Giuliano Della siehe Julius II. Ruffino da Stradiliano 77 Ruffo, Bernardino 100, 106, 107 Rufinis, Philippus de 86
207
Sadoleto, Jacobo 18 Salviati, Francesco 41 Scala, Cangrande della 49 Sebastian, König von Portugal 31 Selve, George de 20 Sepùlveda, Juan Gines 42 Sessa, Enrico de 60 Sforza von Santa Fiora, Guido Ascanio 35 f., 37, 40 Sfrondato, Francesco 28 Sighicelli, Giambattista 28 Sigismund, König von Polen 31 Silva, Michael de 24 Silvagni, Francesco 13 Simonetti, die 47 Sixtus IV., Papst 39, 90 f., 93, 113, 114, 116, 118, 124, 125, 126, 134, 135, 136, 138 f., 149, 150, 163, 173, 178 Sixtus V., Papst 179 f. Soderini, Giulio 98, 116, 117, 118, 130,
162 Spinola, Ambrogio 30 Tavernini, Angelo 49, 65, 77, 171 Teobaldeschi, Francesco 63 Thomas von Aquino 155 Toledo, Juan Alvarez de 28 Tournon de la Chambre, Francesco de
20 Trinci, die 47 Trivulzio, Agostino 16 Trivulzio, Cesare 16, 20 Urban IV., Papst 61, 66 f., 113, 132 Urban V., Papst 55 f., 66, 79 f., 83, 84 Urban VI., Papst 86 Valente, Giovanni de, Doge von Genua 49 Valla, Lorenzo 39 Varano, die 47 Verallo, Girolamo 30, 101 Vico, di, die 47, 50 Vico, Battista di 51 Vico, Faziolo di 50 Vico, Giovanni III., di 50 f. Vico, Pietro di 50 Virginio, Papyrio 100, 102 f., 105, 106, 107 Visconti, die 47 Visconti, Bernarbò 53, 55, 80 Visconti, Giovanni 49, 53 Visconti, Matteo 53

![Der deutsche Strafprozeß und seine Reform: Kritik und Vorschläge [Reprint 2021 ed.]
9783112433140, 9783112433133](https://dokumen.pub/img/200x200/der-deutsche-strafproze-und-seine-reform-kritik-und-vorschlge-reprint-2021nbsped-9783112433140-9783112433133.jpg)


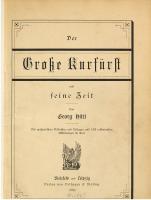



![Pausanias der Perieget: Untersuchungen über seine Schriftstellerei und seine Quellen [Reprint 2018 ed.]
9783111495989, 9783111129785](https://dokumen.pub/img/200x200/pausanias-der-perieget-untersuchungen-ber-seine-schriftstellerei-und-seine-quellen-reprint-2018nbsped-9783111495989-9783111129785.jpg)
![Der Notweg: Seine Geschichte und seine Stellung im heutigen Recht [Reprint 2022 ed.]
9783112671924, 9783112671917](https://dokumen.pub/img/200x200/der-notweg-seine-geschichte-und-seine-stellung-im-heutigen-recht-reprint-2022nbsped-9783112671924-9783112671917.jpg)
![Kardinal Rodolfo Pio da Carpi und seine Reform der Aegidianischen Konstitutionen [1 ed.]
9783428467082, 9783428067084](https://dokumen.pub/img/200x200/kardinal-rodolfo-pio-da-carpi-und-seine-reform-der-aegidianischen-konstitutionen-1nbsped-9783428467082-9783428067084.jpg)