Jüdische Lebenswelten in Spielfilmen und Fernsehspielen: Filme zur Geschichte der Juden von ihren Anfängen bis zur Emanzipation 1871 [Reprint 2012 ed.] 9783110952124, 9783484340350
This study leaves aside films on the Holocaust to concentrate on the portrayal of Jewish life and milieus in Antiquity,
206 4 18MB
German Pages 281 [300] Year 1993
Polecaj historie
Table of contents :
1. Einleitung: Gegenstände, Zielsetzungen und Methoden der Untersuchung
2. Vom nicht wahr-genommenen Juden: Die Präsentation von Juden der biblischen Zeit auf Leinwand und Bildschirm
2.1. Analyse von Filmen und Fernsehspielen zum Frühjudentum im genrespezifischen und literarhistorischen Zugriff
2.2. Jüdische Figuren in Spielfilmen und Fernsehspielen zur Geschichte des jüdischen Volkes in seinen Anfängen und in der Antike
2.3. Jüdische Figuren in Spielfilmen und Fernsehspielen nach Themen des Neuen Testaments und darauf fußender Erzählliteratur
3. Luther ohne Juden
3.1. Jüdische Figuren in fiktionalen Produktionen über das Mittelalter
3.2. Zur symptomatischen Ausklammerung des Problemfeldes “Die Reformation, Luther und die Juden” in historischen Filmen, Dokumentarspielen und Fernsehspielen
4. Die Legende vom Golem in Literatur und Film: Über den Stummfilm DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM und das mittelalterliche Ghetto
4.1. Der Golemmythos in der Literatur
4.2. GOLEM-Filme von Paul Wegener und anderen Filmemachern
5. Dreimal “Jud Süß”: Die filmische Verwertung der Literatur über den Hoffaktor Joseph Süß Oppenheimer
5.1. Forschungsergebnisse über Joseph Süß Oppenheimer
5.2 Spielfilme und Fernsehspiele über “Jud Süß”
6. Spielfilme und Fernsehspiele zur jüdischen Emanzipation im 18. und 19. Jahrhundert
6.1. Spielfilme
6.2 Fernsehspiele
7. Begegnung mit Tewjes Welt im Spiegel jiddischer Filme
7.1. Zur Analyse von Filmen über Juden in Osteuropa vor dem Ausbruch des modernen Antisemitismus
7.2. Ein Emanzipationsfilm der Stummfilmzeit: DAS ALTE GESETZ
7.3. Die Adaptionen klassischer jiddischer Literatur über russische Dorf- und Schtetljuden
7.4. Zwischenbilanz
7.5. Joseph Greens Musikfilme als Spiegelbild polnischer Schtetlexistenz
8. Schlußbemerkungen: Die durch Filme vermittelten Bilder von den jüdischen Wegen aus dem Ghetto geben nur Facetten der Wirklichkeit wieder
Literaturverzeichnis
Register der Film- und Fernsehproduktionen
Citation preview
MEDIEN
IN FORSCHUNG + UNTERRICHT Serie A Herausgegeben von Dieter Baacke, Wolfgang Gast, Erich Straßner in Verbindung mit Wilfried Barner, Hermann Bausinger, Hermann K. Ehmer, Helmut Kreuzer, Gerhard Maletzke Band 35
Dietmar
Pertsch
Jüdische Lebenswelten in Spielfilmen und Fernsehspielen Filme zur Geschichte der Juden von ihren Anfängen bis zur Emanzipation 1871
Max Niemeyer Verlag Tübingen 1992
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Pertsch, Dietmar: Jüdische Lebenswelten in Spielfilmen und Fernsehspielen : Filme zur Geschichte der Juden von ihren Anfängen bis zur Emanzipation 1871 / Dietmar Pertsch. - Tübingen : Niemeyer, 1992 (Medien in Forschung + Unterricht : Ser. A ¡ Bd. 35) NE: Medien in Forschung und Unterricht / A ISBN 3-484-34035-5
ISSN 0174-4399
© Max Niemeyer Verlag GmbH & Co. KG, Tübingen 1992 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Printed in Germany. Druck: Weihert-Druck, Darmstadt.
Inhaltsverzeichnis
1.
2.
Einleitung: Gegenstände, Zielsetzungen und Methoden der Untersuchung
1
Vom nicht wahr-genommenen Juden: Die Präsentation von Juden der biblischen Zeit auf Leinwand und Bildschirm
6
2.1. Analyse von Filmen und Fernsehspielen zum Frühjudentum im genre spezifischen und literarhistorischen Zugriff
6
2.2. Jüdische Figuren in Spielfilmen und Fernsehspielen zur Geschichte des jüdischen Volkes in seinen Anfangen und in der Antike
10
2.2.1.
Thematische Schwerpunkte in Filmen zu Ereignissen des Frühjudentums
10
2.2.2.
Hebräer oder Juden
11
2.2.3.
Schlußfolgerungen
16
2.3. Jüdische Figuren in Spielfilmen und Fernsehspielen nach Themen des Neuen Testaments und darauf fußender Erzählliteratur 2.3.1. 2.3.2.
3.
Das Genre des Jesus-und Apostelfilms Zum antijüdischen Stereotyp in Spielfilmen und Fernsehspielen über die Zeit Jesu
Luther ohne Juden
17 17 22 28
3.1. Jüdische Figuren in fiktionalen Produktionen über das Mittelalter
28
3.2. Zur symptomatischen Ausklammerung des Problemfeldes "Die Reformation, Luther und die Juden" in historischen Filmen, Dokumentarspielen und Fernsehspielen
30
4.
Die Legende vom Golem in Literatur und Film: Über den Stummfilm DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM und das mittelalterliche Ghetto 42
4.1. Der Golemmythos in der Literatur
42
VI
4.1.1.
Das Rabbi-Löw- und Beschützermotiv in der Golemsage
4.2. GOLEM-Filme von Paul Wegener und anderen Filmemachern 4.2.1. 4.2.2. 4.2.2.1. 4.2.2.2. 4.2.2.3. 4.2.3.
Filmhistorischer Überblick DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM DER GOLEM als Ghettofilm Das Ahasvermotiv im GOLEM Legendenstoffes DER GOLEM als Weiterentwicklung eines jüdischen Legendenstoffes REVOLUTION IN FRANKFURT - ein Ghettofernsehspiel?
Dreimal "Jud Süß": Die filmische Verwertung der Literatur über den Hoffaktor Joseph Süß Oppenheimer 5.1. Fosschungsergebnisse über Joseph Süß Oppenheimer
45 46 46 48 52 54 56 57
5.
5.2
64
5.1.1. Die Figur des "Jud" Süß Oppenheimer: 5.1.1.1. Curt Elwenspoeks Biographie Jud Süß Oppenheimer 5.1.1.2. Selma Sterns Jud Süß als Beitrag zur deutschen und jüdischen Geschichte 5.1.1.3. Ergänzungen und Korrekturen des Süß-Bildes durch Heinrich Schnee 5.1.1.4. Barbara Gerbers Analysen von zeitgenössischen "JudSüß"-Medien als "agitatorisch-propagandistisches Steuerinstrument" 5.1.2. Das System der Hofjuden oder Hoffaktoren 5.1.3. Das (Frankfurter) Ghetto
65 65
Spielfilme und Fernsehspiele über "Jud Süß"
77
5.2.1. 5.2.1.1 5.2.1.2. 5.2.1.3. 5.2.2. 5.2.2.1.
78 78 79
JUD SÜSS Filmautoren und Filminhalt "Die" Juden als propagandistisches Angriffsziel des Films JUD SÜSS als Dokument des (anti-)jüdischen Stereotyps . JEW SUESS Zur literarischen Vorlage (1): Feuchtwangers geschichtsphilosophische und literarische Konzeption seines Romans Jud Süß 5.2.2.2. Zur literarischen Vorlage (2): Feuchtwangers jüdische Figuren seines Romans Jud Süß 5.2.2.3. Harlans JUD SÜSS - eine Feuchtwanger-Adaption? 5.2.2.4. Leitende Fragestellungen für die Analyse von Literaturverfilmungen mit Judendarstellungen
68 70 70 72 74 76
91
91 95 98 99
VII 5.2.2.5. Produktionsbedingungen und Intentionen des JEW SUESS im Vergleich mit der Feuchtwanger-Vorlage 5.2.3. JOSEPH SÜSS OPPENHEIMER 5.2.3.1. Das Genre des (Fernseh-)Dokumentarspiels 5.2.3.2. JOSEPH SÜSS OPPENHEIMER als auf Vergangenheitsaufarbeitung ausgerichtetes Dokumentarspiel über württembergische Hofjuden 6.
104 104 107
Spielfilme und Fernsehspiele zur jüdischen Emanzipation im 18. und 19. Jahrhundert
6.1. Spielfilme
6.2
100
116 116
6.1.1. Stummfilme 6.1.1.1. JISKER
116 116
6.1.2. Tonfilme 6.1.2.1. OLIVER TWIST
119 120
Fernsehspiele
126
6.2.1.
Produktionen der Jahre 1951-1977 JAQUES OFFENBACH FERDINAND LASSALLE
126 127 128
6.2.2.
Produktionen der Jahre 1978-1991
130
6.2.2.1. 17 Sätze über die jüdische Emanzipation 133 6.2.2.2. Über den Grad der Verarbeitung von Forschungsergebnissen in fiktionalen Produktionen zur jüdischen Emanzipation 139 6.2.2.3. JOHANN SEBASTIAN BACHS VERGEBLICHE REISE INDEN RUHM 144 6.2.2.4. FREUNDE IN PREUSSEN - ODER OB EIN EDLER JUDE ETWAS UNWAHRSCHEINLICHES SEI 146 6.2.2.5. DAS SCHÖNE IRRE JUDENMÄDCHEN 152 6.2.2.6. Jüdische Figuren der Emanzipationszeit in der Programmform der Fernsehserie: 155 ICH, CHRISTIAN HAHN 155 CHRISTIAN ROTHER - BANKIER FÜR PREUSSEN 158
Vili 6.2.2.7. Die Instrumentalisierung jüdischer Banditen zur Verstärkung von Judenfeindschaft: AKTENMÄSSIGE NACHRICHT VON DER WIDER JOHANN CHRISTOPH KROP ANGESTELLTEN UNTERSUCHUNG UND DESSEN VERURTEILUNG 6.2.2.8. Eine Literaturadaption über jüdisches Leben der Voremanzipationszeit: DIE JUDENBUCHE 6.2.2.9. Auswirkungen der Revolution von 1848 auf jüdisches Leben: LENZ ODER DIE FREIHEIT 6.2.2.10. Zwei Fernsehspiele über Heinrich Heine: DIE ZWEITE VERTREIBUNG AUS DEM PARADIES HEINRICH HEINE 7.
Begegnung mit Tewjes Welt im Spiegel jiddischer Filme
161
164 166 171 172 175 185
7.1. Zur Analyse von Filmen über Juden in Osteuropa vor dem Ausbruch des modernen Antisemitismus
185
7.2. Ein Emanzipationsfilm der Stummfilmzeit: DAS ALTE GESETZ
187
7.3. Die Adaptionen klassischer jiddischer Literatur über russische Dorf- und Schtetljuden
196
7.3.1.
7.3.2. 7.3.2.1. 7.3.2.2. 7.3.2.3.
Mendeles Roman Fischke, der Lahme und Hirschbeins Theaterstück Grine Felder als amerikanisch-jiddische Tonfilme: DI KLJATSCHE und GRINE FELDER
196
Verfilmungen von Theaterstücken Jakob Gordins: DER JIDISCHER KENIG LIR GOT, MENTSCH UN TAJWL ON A HEYM
201 201 203 204
7.3.3. Verfilmungen von Romanen Scholem-Alejchems 7.3.3.1. Die Figur des Tewje als Urtyp des russischen Dorfjuden in einem vermarkteten Medienereignis 7.3.3.2. TEVYE (oder TEVYA) 7.3.3.3. TEVYA UND SEINE TÖCHTER 7.3.3.4. TEVJE UND SEINE SIEBEN TÖCHTER 7.3.3.5. Jüdische Ghettowelt in zwei sowjetischen Stummfilmen nach Scholem-Alejchem: JIDISCHE GLIKN und MOTL PEJSI DEM CHASNS
205 206 209 211 213
213
IX 7.3.3.6. FIDDLER ON THE ROOF 7.3.4.
218
Die Legende vom Dybuk als polnisch-jiddischer Tonfilm: DER DIBEK 219
7.4. Zwischenbilanz
223
7.5. Joseph Greens Musikfilme als Spiegelbild polnischer Schtetlexistenz 7.5.1. MAMELE 7.5.2. YIDL MITN FIDL 7.5.3. DER PURIMSCHPILER 7.5.4. A BRIVELE DER MAMEN
224 225 225 228 229
8.
Schlußbemerkungen: Die durch Filme vermittelten Bilder von den jüdischen Wegen aus dem Ghetto geben nur Facetten der Wirklichkeit wieder 235
Literaturverzeichnis Register der Film- und Fernsehproduktionen
238 267
Vorwort
Schreiben über jüdische Lebenswelten ist Beschreibung eines noch längst nicht ans Ziel gekommenen Lernprozesses. Die ersten Lektionen wurden dem Kind aufgegeben: die Judentumslektion, als es am Morgen des 9. November 1938 auf dem Schulweg an den schwelenden Trümmern der Synagoge seiner ostpreußischen Heimatstadt vorüberkam, die Filmanalyselektion, als es sich nach einer Gesangsdaibietung am 20. April 1942 mit der manipulierten Propagandafassung der Naziwochenschau konfrontiert sah, die Theologielektion, als man ihm vielleicht an seinem dreizehnten Geburtstag - zum erstenmal eine Bibel zeigte und diese als "von den unser deutsches Volk seit jeher betrügenden Juden verfaßt" ausgab. Aber damals gingen von diesen einprägsamen Lehrstücken noch keine Impulse aus. Die vorliegende Arbeit stellt ein Teilergebnis von Studien auf dem Lernweg der jüdisch-christlichen und und jüdisch-deutschen Begegnung dar. Sie ist eine einerseits um die knappe Hälfte gekürzte und andererseits durch Einbeziehung erstmalig zugänglich gemachter Filme, die im Rahmen der Berliner Ausstellung "Jüdische Lebenswelten" zu sehen waren, ergänzte Fassung meiner Dissertation. Das Promotionsverfahren wurde im Fachbereich Philosophie und Sozialwissenschaften Π der Freien Universität Berlin am 19.12.1990 abgeschlossen. Zu danken habe ich Prof. Dr. F.-W. Marquardt, Geschäftsführendem Direktor des Instituts für Evangelische Theologie mit dem Fachgebiet Religionsgeschichte, Institut für Judaistik (WE 1), Prof. Dr. K. Prümm vom Fachbereich Kommunikationswissenschaften und Prof. Dr. J. Hoppe sowie meinen Kollegen Helmut Oertel, Oberschulrat am Pädagogischen Zentrum Berlin, und Helmut Ruppel, Kirchenschulrat am Institut für Katechetischen Dienst Berlin. Ohne Hilfe bei der mühseligen Materialbeschaffimg hätte die Arbeit in der vorliegenden Form nicht geschrieben werden können; stellvertretend für die im Vorwort der Dissertation aufgeführten Personen, Fernsehsendeanstalten, Verleiher, Archive und anderen Institutionen bedanke ich mich vor allem bei Frau Lorenz und Frau Jensky von der Bibliothek der Deutschen Film- und Fern sehakademie Berlin sowie bei Herrn Fischer, Frau Geue und Herrn Richter von der Bibliothek der Landesbildstelle Berlin. Der größte Dank aber gilt meine Frau Heidi Peitsch, die die jahrelange Mehrbelastung neben meiner vollen Berufstätigkeit und meinen anderen Verpflichtungen mit bewundernswerter Selbstlosigkeit getragen hat. Dir widme ich dieses Buch. Berlin, am 30.4.1992, dem Jom ha Shoah (Holocaust-Gedenktag) Dietmar Peitsch
1.
Einleitung: Gegenstände, Zielsetzungen und Methoden der Untersuchung
In den 47 Jahren seit dem Ende des zweiten Weltkrieges wurden auf dem Territorium der heutigen Bundesrepublik Deutschland ca. 27 000 Spielfilme und seit 1951 etwa 10 000 Fernsehspiele ausländischer und inländischer Produktionen öffentlich vorgeführt oder ausgestrahlt.1 Aber nur knapp 500 dieser 37 000 fiktionalen Produktionen, die in allen Epochen der Geschichte spielen, also vom Altertum bis zur Gegenwart reichen, enthalten nach unseren quantitativen und qualitativen Analysen jüdische Figuren.3 Die meisten von ihnen behandeln die Shoah, die versuchte Auslöschung des jüdischen Volkes durch die Nationalsozialisten.3 Dazu gehören einige bemerkenswerte deutsche Produktionen, die wenige Jahre nach der Befreiung vom nationalsozialistischen Unrechtssystem entstanden sind: EHE IM SCHATTEN von Kurt Maetzig (1947), IN JENEN TAGEN von Helmut Käutner (1947), LANG IST DER WEG von Herbert B. Fredersdorf und Marek Goldstein (1948), MORITURI von Eugen York (1948). Diese frühen deutschen und einige Hollywoodfilme wie THE GREAT DICTATOR von Charly Chaplin (1940), aber auch DDR-Produktionen wie STERNE und PROFESSOR MAMLOCK von Konrad Wolf (1958 und 1961), NACKT UNTER WÖLFEN von Frank Beyer (1962) und jüngere international renommierte Spielfilme wie LE DERNIER METRO von Franpois Truffaut (1980) und AU REVOIR, LES ENFANTS von Louis Malle (1987) - sie alle vermitteln den
1 2 3
Hochrechnungen nach Angaben in LIF, LIF 87/88 u. LIF 89/90 sowie Hickethier 1980, 68 Vgl. Tabellen 2, 4 u. 5 in der Dissertation des Verfassers: Pertsch 1990, 50, 67, 68-70 Das Verbrechen an den Juden wird häufig mit dem Terminus "Holocaust" umschrieben. Diese Formulierung ist nicht unbeeinfluBt von der Breitenwirkung der gleichnamigen amerikanischen Fernsehserie, wie auch einige Jahre später die zögernde Ablösung des eher unglücklichen Terminus "Holocaust" durch die angemessenere Bezeichnung "Shoah" auf eine mehrteilige dokumentarische Fernsehserie, nämlich den Film SHOAH von Claude Lanzmann, mit zurückzuführen sein dürfte. Der Terminus "Holocaust" bedeutet "Ganzverbrennung" eines Tier- oder Menschenopfers (griech. holokauteo bzw. holokautos) und ist in der altgriechischen Kult- bzw. Opferpraxis oft bezeugt. In englischen Bibelübersetzungen ve« Gen 22,13 und Ex 24,5 wird der von Luther mit "Brandopfer" übersetzte Ausdruck als "holocaust" benannt. Die Bezeichnung für ein Gott wohlgefälliges kultisches Sühneopfer wurde durch Bedeutungsverschiebung zur Umschreibung von "Ganzvernichtung" und zum Fachausdruck für den nationalsozialistischen Genozid an den Juden (vgl. Strauss 1985a, 215; speziell zur Etymologie: Leonhard 1979 u. Abel 1985). Viele jüdische und christliche Theologen vermeiden wegen dieser ursprünglich kultischen Komponente das Wort "Holocaust" und ersetzen es durch den biblischen Terminus (aus dem Buch Kohelet) "Shoah" = "großes Unheil, Katastrophe", der von einem hebräischen Verb mit der Bedeutung "hinwegtun, auslöschen, wegnehmen" abgeleitet wird. Siehe auch Bethge 1988, 4f., I animanti 1986.
2 Eindruck, als bestünde jüdisches Leben im Spiegel von Spielfilmen nur aus Produktionen über die NS-Judenverfolgung. Diese in etwa 80 Spielfilmen behandelte so zentrale Thematik wurde in 65 Fernsehspielen fortgeführt - man denke nur an die amerikanische Fernsehserie HOLOCAUST aus dem Jahre 1978, an den biographischen Fernsehfilm über Simon Wiesenthal RECHT NICHT RACHE (1989) oder an Egon Monks DIE BERTINIS (1988) nach Ralph Giordanos Roman. So war - korrespondierend mit anderen Medien - ein Bild entstanden, das Juden vornehmlich als Opfer des Genozids zeichnete. Tatsächlich lassen sich aber Spielfilme und Fernsehspiele mit jüdischen Figuren einem breiteren Themenspektrum zuordnen als der Holocaust-Thematik im engeren Sinne. Schon 1949 schrieb Fritz Kortner ein Drehbuch über das Schicksal eines Überlebenden der Shoah als eines Opfers des wieder auflebenden Antisemitismus in der Bundesrepublik (DER RUF von Joseph von Baky). Bis heute sind ein halbes Hundert Produktionen in dieser Themengruppe "Folgen der Shoah/ Antisemitismus nach 1945" entstanden. Aber auch Filme über Probleme der jüdischen Identität in der Gegenwart bzw. über die Akkulturation von Juden in der modernen europäischen und amerikanischen Gesellschaft wurden und werden produziert. Schließlich kann der Komplex von fiktionalen Produktionen über jüdische Lebenswelten nach der Shoah durch Kino- und Fernsehfilme über Menschen in Israel und den Israel-Palästinenser-Konflikt abgerundet werden. Die Linie von der Shoah als der Bezugsgröße von Judendarstellungen in Film und Fernsehen läßt sich in die Gegenwart wie in die Vergangenheit hinein ausziehen. Der Untertitel der vorliegenden Untersuchung weist eindeutig in die Vergangenheit. Die Begrenzung der Untersuchungsobjekte auf Spielfilme und Fernsehspiele, deren Handlungen in dieser fast dreitausend Jahre umfassenden Zeitspanne von den Anfangen des jüdischen Volkes bis zum formellen Abschluß der Emanzipation von Juden in Mitteleuropa um 1871 spielen, unser Verzicht also auf Analyse von Filmen über die Zeit des deutschen Kaiserreiches, der Weimarer Republik und der Hitlerdiktatur, hat mehrere Gründe. Einmal ist das Material von 500 Filmen zu umfangreich, um es nur in einem auf 300 Seiten limitierten Buchreihenband darstellen zu können. Zum anderen wurden Judendarstellungen in Filmen und Fernsehspielen bewußt aus jenen Geschichtsepochen untersucht, die im nationalsozialistischen Propagandafilm wegen ihres ausgeprägten Antisemitismus eine verhängnisvolle Rolle gespielt haben - hier sei nur an JUD SÜSS von Veit Harlan (1940) und DIE ROTHSCHILDS von Erich Waschneck (1940) erinnert.4 Ein Untersuchungsziel der Arbeit ist durch die Fragestellung bestimmt, welche Bilder von Juden und Deutschen, von Juden und Christen gezeichnet werden. Andere Leitfiragen lauten: Wie differenziert ist die Präsentation der jüdischen Filmfiguren, oder wie häufig unterliegt man einer stereotypisierenden Darstellung, etwa der Fortschreibung des Negativklischees vom "gefahrlichen" Juden mit seinen
4
Hollstein 1971; Albrecht 1969; Film im 3. Reich 1979; Courtade/Cadars 1975; Drewniak 1987
3 Spielarten des "Christenfeindes", des "Sittenverdeibers", des "Händler- und Wucher"-Typs, des "rassisch Minderwertigen", des ambivalenten Klischees vom Ahasver oder auch des Positivklischees vom guten Juden, vom frommen Juden und von der schönen Jüdin? Wie stark wirken antisemitische Bilder des NS-Films auch bei jungen Filmemachern nach, die nach 1945 alles andere als antisemitische Filme drehen wollten, aber unbewußt solche Klischees möglicherweise übernommen haben?5 Oder haben Filmemacher "gelernt" und Gegenbilder entworfen, so daß ihre Art der Darstellung vielleicht sogar einen Beitrag zur Abwehr des Antisemitismus leistet?4 Gibt es z.B. - statt einer ausschließlich auf die Verfolgung und Ermordung von Juden fixierten Darstellungsweise - auch historische Filme über eine Kooperation von Juden und Christen, Juden und Deutschen? Tritt also an die Stelle der Präsentation von "Vergegnungsgeschichte" (Martin Buber) auch die Präsentation von Begegnungsgeschichte?7 In die einzelnen Kapitel der Untersuchung werden gelegentlich Diskurse eingeschoben. Sie sind u.E. relevant für das Gespräch - mit dem Judentum über die im Laufe seiner Geschichte wechselnden Definition der jüdischen Identität - mit der Antisemitismusforschung über die Befunde gegenwärtiger latenter und manifester Judenfeindschaft sowie über die Chancen für eine Revision verfestigter antisemitischer Vorurteile - mit der Literaturwissenschaft über die Adaptionsproblematik, d.h. die Geschichte und damit die wechselnden Stadien der Literaturverfilmung - mit der Film- und Fernsehwissenschaft über die Bedeutung verschiedener Genres des Films und des Fernsehens, der Soziologie des Films und der Methoden der Filmgeschichtsschreibung und schließlich - innerhalb der Theologie über den christlich-theologischen Antijudaismus und dessen Ablösung durch eine im wesentlichen den Christen aufgetragene und auch von einer Minderheit engagiert praktizierte christlich-jüdische Begegnung. Unsere qualitative Auswertung der Spielfilme und Fernsehspiele über jüdische Lebenswelten bis 1871 ist mehr den traditionellen Analyseformen der von literaturund kunstwissenschaftlichen Methoden ausgehenden Werkanalyse unter Einschluß sozialwissenschaftlicher Untersuchungsweisen verpflichtet und benutzt bei den Inhaltsanalysen auch quantifizierende Verfahren. Sie bezieht neuere Modelle der
6
7
Die Untersuchung variiert damit Fragestellungen, die für die deutschsprachige Literatur von Schmelzkopf 1983 und H. M. Müller 1984 entwickelt worden waren. Aus Platzgründen müssen wir hier auf die Diskussion einer Grundsatzfrage zur Antisemitismusund Medienforschung verzichten, ob nämlich Spielfilme und Fernsehspiele mit Judendarstellungen überhaupt einen Beitrag zur Abwehr des Antisemitismus leisten können. Vgl. dazu Peitsch 1990, 498-514. Buber 1986, 10. Zur Abwehr einer die martyriologischen Züge der jüdischen Geschichte betonenden Geschichtsschreibung vgl. Bruer 1991, 26.
4 semiotischen Filmanalyse und der Kommunikationsanalyse noch nicht ein.8 Sie ist auch nur ansatzweise den jüngsten Verfahren der Filmgeschichtsschreibung verpflichtet.9 Ihr Ansatz könnte als problemorientierte Film- und Fernsehanalyse mit ideologiekritischem Akzent unter dem leitenden Erkenntnisinteresse der jüdisch-christlichen Begegnung beschrieben werden.10 Außer Publikationen über den nationalsozialistischen Spielfilm mit jüdischen Figuren11 gibt es u.W. noch keine unserer Untersuchung vergleichbare Arbeit, in der Spielfilme und Fernsehspiele, die nach 1945 in der heutigen Bundesrepublik gelaufen waren, systematisch unter dem Aspekt gesichtet wurden, wie jüdische Figuren und jüdische Thematik in diesen Produktionen gestaltet wurden. Bei einem solchen ersten Versuch liegt der Schwerpunkt erkennbar auf der Wertung der Inhalte von Kino- und Fernsehfilmen. Zur Materialaufbereitung wurde die Darstellungsform der historiographischen Narrativik12 mit eingeschobenen Tabellen und Exkursansätzen gewählt, weil diese Mischform der Intention, einen kritischen Überblick über den Bestand von fiktionalen Kino- und Fernsehfilmen mit Judendarstellungen zu geben, u.E. entgegenkommt. Thematisch gliedert sich die Untersuchung in ein Vorspiel über das jüdische Altertum ("Vom nicht wahrgenommenen Juden") und einen aus fünf Kapiteln bestehenden Hauptteil, der von der Lutherzeit bis ins 19. Jahrhundert reicht ("Der Weg aus dem Ghetto"). Unsere Analysen umfassen die von der Hebräischen Bibel überlieferten Anfinge der jüdischen Geschichte, die Ereignisse in Mittelalter und Neuzeit bis zum formellen Abschluß der deutschen Emanzipationsgesetzgebung 1871 sowie die etwa zur gleichen Zeit spielenden Situationen im osteuropäischen jiddischen Schtetl. Die Chronologie jüdischer Geschichte reicht also bis in die Zeit unmittelbar vor dem massiven Ausbruch des modernen Antisemitismus. Sie ermöglicht damit einen für die christlich-jüdische und deutsch-jüdische Beziehungsgeschichte besonders relevanten Zeitraum, bei dem sich prüfen läßt, welche Ereignisse vom Film aufgegriffen und welche trotz der folgenreichen Wirkungsgeschichte ausgeklammert wurden. Die gewählte zeitliche Ordnung ist aus der Sicht derfilmischenHistoriographie problematisch, denn Filmgeschichte ist an die - in der Regel linear erzählte Chronologie des Films gebunden. Eine Geschichte der Judendarstellung im Film müßte demnach mit dem ersten Stummfilm beginnen, in dem jüdische Figuren unabhängig von der im Film dargestellten historischen Epoche - auftreten. Da uns aber interessiert, welches Judenbild auf Leinwand und Bildschirm in Deutschland nach 1945 vermittelt wurde, werden fast nur diejenigen wenigen Stummfilme mit jüdischen Figuren behandelt, die im Kino oder im Fernsehen gezeigt worden sind.
8 9 10 11 12
Methoden der Film- und Femsehanalyse 1979, 7-23; Filmanalyse interdisziplinär 1988 Bestandsaufnahme 1987 Petuchowski/Thoma 1989 Vgl. Anm.4. Faulstich 1988a, 45-55
5 Um nun trotz Beibehaltung der für unsere Absichten unerläßlichen Gliederung nach Epochen der jüdisch-christlichen und jüdisch-deutschen Beziehungsgeschichte die traditionelle lineare Chronologie der Filmgeschichtsschreibung zu berücksichtigen, haben wir in den Hauptkapiteln die Tabellen und die Filmanalysen nach den Entstehungszeiten der Filme geordnet.
2.
Vom nicht wahr-genommenen Juden: Die Präsentation von Juden der biblischen Zeit auf Leinwand und Bildschirm
2.1. Analyse von Filmen und Fernsehspielen zum Frühjudentum im genrespezifischen und literarhistorischen Zugriff Dieser Extrakt aus der an anderer Stelle1 detailliert vorgetragenen Analyse des Judenbildes in Kino- und Fernsehfilmen über das biblische Israel basiert zunächst auf der Untersuchung von 21 zwischen 1929 und 1984 produzierten Tonfilmen und 3 Fernsehspielen zur Geschichte des jüdischen Volkes in seinen Anfangen und in der Antike.2 Diese Produktionen sind vorwiegend nach Stoffen und Figuren der Hebräischen Bibel entstanden. Es handelt sich bei diesen Filmen nach Texten des Alten Testaments meist um populäre amerikanische oder italienische Monumentalfilme aus den fünfziger und sechziger Jahren, die - z.B. unter den deutschen Synchrontiteln "Die zehn Gebote", "Samson und Delilah", "David und Goliath", "Sodom und Gomorrah" - bis heute ihren festen Platz im öffentlichrechtlichen und im privaten Fernsehen haben. Das Grundmaterial des anschließenden Kapitels über jüdische Figuren in fiktionalen Produktionen nach Texten des Neuen Testaments und darauf fußender Erzählliteratur sind Jesus- und Apostelfilme, die zwischen 1935 und 1989 entstanden sind: 31 Tonfilme und 18 Fernsehspiele.3 Auch in dieser Gruppe besteht der größere Teil der Produktionen
1 2
3
Peitsch 1990, 83-165 Tonfilme (Originaltitel, Land, Entstehungsjahr): NOAK'S ARK (USA 1929), SAMSON AND DELILAH (USA 1949), DAVID AND BATHSEBA (USA 1951), LA REGINA DI SABA (Ital. 1952), THE PRODIGAL (USA 1955), ADAM Y EVA (Mex. 1956), THE TEN COMMANDMENTS (USA 1957), GIUDETTA E OLOFERNE (Ital./Frkr. 1958), ERODE IL GRANDE (Ital./Frkr. 1958), DAVID E GOLIA (Ital. 1959), SOLOMON AND SHEBA (USA 1959), ESTER E IL RE (Ital. 1959), THE STORY OF RUTH (USA 1960), SODOMA E GOMORRA (Ital./Frkr. 1961), IL VECCHIO TESTAMENTO (Ital. 1962), LA BIBBIA (Ital. 1964), IN DER GLUT DES MITTAGS /BR Dtschld./Ital./Span. 1970), MOSES UND ARON (BR Dtschld. 1974), JACOB (Ital. 1975), WHOLLY MOSES (USA 1980), KING DAVID (USA 1984); Fernsehfilme: GIDEON (BR Dtschld.: WDR 1966), MOSES (Engl./Ital. 1975), THE ANTAGONISTS bzw.MASADA (USA 1980). Detailliertere Angaben: Peitsch 1990, 160-165 Tonfilme: THE LAST DAYS OF POMPEJI (USA 1935), GOLGOTHA bzw. ECCE HOMO (Fikr. 1935), FABIOLA (Ital./Frkr. 1948), QUO VADIS (Ital. 1951), THE ROBE (USA 1953), BARABBAS (Schwed. 1953), DEMETRIUS AND THE GLADIATORS (USA 1954), THE SILVER CHALICE (USA 1954), THE MYSTERIES OF THE ROSARY (USA 1957), NAZARIN (Mex. 1958), LA SPADA E LA CROCE (Ital. 1958), BEN HUR (USA 1959),
7 aus in HollywocxJ oder Cinecitta/Rom aufwendig hergestellten und auch wiederholt im Fernsehen ausgestrahlten Ausstattungsfilmen wie "Quo vadis", "König der Könige" oder "Das Gewand". Es gibt aber auch respektablere Versuche, diesen bunten Bilderbogenfilmen von Jesus und seinen Jüngern, von Bekehrungs- und Wunderspektakeln andere Filmformen und Sujets an die Seite zu stellen; erinnert sei z.B. an "Das erste Evangelium: Matthäus" von Pasolini, "Die Geschichte der Apostel" und "Der Messias" von Rossellini, "Jesus Christ Superstar" von Jewison und "Die letzte Versuchung Christi" von Scorsese oder an Filme, die die christliche Interpretation konterkarieren wie die Arbeiten von Bunuel, Schepitkow und Achternbusch. Insgesamt aber stellen wir für die Präsentation von Juden der biblischen Zeit in Film und TV die These auf: Eine widerspruchsfreie Verlebendigung der Geschichte des jüdischen Volkes von seinen Anßngen bis zum Zeitalter der Mischna und des Talmuds durch historische Spielfilme ist quantitativ und qualitativ bisher in keiner Phase der Filmgeschichte konstatierbar. Wohl gibt es Spielfilme, die in der Zeit der Anfänge Israels spielen, in deren Mittelpunkt die Patriarchen der Bibel stehen, deren Handlung in das östliche Nildelta Ägyptens verlegt wird, die im Verlauf einer prächtig aufgeputzten Filmstory Ereignisse des Exodus und der Offenbarung vom Berg Sinai berühren oder die nur scheinbar private Begebenheiten im Leben von Königen wie David und Salomo vorführen, die mit Hilfe aufwendiger technischer Verfahren und Legionen kostümierter Statisten Schlachtenpanoramen aus persischer, griechischer und römischer Zeit entwerfen. Aber keiner dieser Filme gestaltet unter theologischer oder historischer Zielsetzung Glauben und Leiden Israels in seiner
THE SILVER CHALICE (USA 1954), THE MYSTERIES OF THE ROSARY (USA 1957), NAZARIN (Méx. 1958), LA SPADA E LA CROCE (Ital. 1958), BEN HUR (USA 1959), THE BIG FISHERMAN (USA 1959), KING OF KINGS (USA 1961), BARABA (Ital. 1961), PONZIO PILATO bzw. PONCE PILATE /Ital./Frkr. 1961), LA RICOTTA (Ital. 1962), THE GREATEST STORY EVER TOLD (USA 1963), IL VANGELO SECONDO MATTEO (Ital. 1964), LA VOIE LACTEE (Frkr./Ital. 1968), GODSPELL (USA 1972), JESUS CHRIST SUPERSTAR (USA 1973), JESUS VON OTTAKRING (Österr. 1975), THE PASSOVER PLOT (Isr./USA 1975), WOSHOZDENIE (UdSSR 1976), JESUS (USA 1979), MONTY PYTHON'S LIFE OF BRIAN (Engl. 1979), DAS GESPENST (BR Dtschld. 1982), L'INQUIESTA (Ital./BR Dtschld. 1986), SEOUL JESU (Korea 1986), THE LAST TEMPTATION OF CHRIST (USA 1988), JESUS DE MONTREAL (Kan. 1989); Fernsehfilme: SIMON (D = BR. Dtschld.: NWDR 1954), SIMON (D: NWDR 1960), EIN GEWISSER JUDAS (D: SWF 1958), MICHAS WEG NACH BETHLEHEM (D: NDR 1962), PONTIUS PILATUS (D: ZDF 1966), ATTI DEGLI APOSTOLI (Ital. 1969), DER MANN AM STRICK (D: ZDF 1970), EIN STERN GEHT AUF AUS JAKOB (D: ZDF 1972), PILATUS UND ANDERE (D: ZDF 1972), IL MESSIA (Ital./Frkr. 1975), GESÙ DI NAZARETH bzw. JESUS OF NAZARETH (Ital./Engl. 1977), THE NATIVITY (USA 1978), THE LAST DAYS OF POMPEJI (USA/Ital./Engl. 1984), A.D. - ANNO DOMINI (USA/Ital. 1984), EIN KIND MIT NAMEN JESUS (Ital/D 1988), VERTEIDIGUNGSREDE DES JUDAS (D: SWF 1988), MRZONK bzw. TAGTRAUM (Polen/D: Ν 1989?) Vgl. Pertsch 1990, 166-247, 248-257
8
Frühgeschichte und in der Zeit des Ersten Tempels bis zur Babylonischen Gefangenschaft. Keiner läßt jüdische Religion, politische und soziale Geschichte des jüdischen Volkes von der Epoche der hellenistischen Königreiche bis hin zur Römerherrschaft transparent werden. Keiner thematisiert das Verhältnis von Juden und Christen seit der Wirksamkeit Jesu von Nazaret.4 Keiner stellt jüdisches Denken, jüdische Kultur auch nach dem Großen Aufstand am Ende der zweiten Tempelperiode dar. Soweit sich die Filmwissenschaft überhaupt mit Spielfilmen nach Stoffen des Alten und Neuen Testaments beschäftigt, interpretiert sie diese überwiegend als Filme eines spezifischen Genres, obwohl eine eindeutige Genrezuweisung schwierig ist. Man kann diese Produktionen als historische Spielfilme (genauer: als "historische Abenteuerfilme", "historische Ausstattungs- oder Kostümfilme"), vielleicht auch als "religiöse Filme", "Bibelfilme" oder "Bibelverfilmungen" bezeichnen. Nach unseren Erkenntnissen läßt sich das Genre des historischen Films zur Charakterisierung nicht nur vieler der 52 untersuchten Filme mit Motiven zur Geschichte des biblischen Israel verwenden, sondern darüber hinaus zur Analyse jener zahlreichen Filme mit jüdischen Figuren, die innerhalb der Geschichte des nachbiblischen Judentums spielen. Dabei ist es wichtig, immer danach zu fragen, ob der historische Film in seiner traditionellen narrativen Form, in seiner spezifisch realistischen Erzählweise, in seiner auf Identifikation des Rezipienten mit den Figuren angelegten Struktur Lernprozessen zur Aufarbeitung der eigenen Geschichte, speziell der christlich-jüdischen Vergegnungs- und Begegnungsgeschichte, forderlich sein kann. R. Rother plädiert dafür, "gegenüber jeder narrativen und 'sinnfälligen' Aufbereitung von Geschichte [durch den Historienfilm, D.P.] mißtrauisch zu werden", weil an die Stelle des Begreifens der Vergangenheit ihr Erleben als Gegenwart getreten sei; aber erst wo keine "Nähe" suggeriert werde, könne der Film zum Mittel historischer Erkenntnis werden.5 Filmemacher wie Kluge, Straub und Huillet, aber auch Syberberg haben in ihrer je eigenen Sprache Gegenmodelle zur Darstellung von deutscher Geschichte im Film entworfen, das klassische Erzählmuster des historischen Films als Gewebe aus fiktiver Familiengeschichte und realer politischer Geschichte konterkariert. Ihre Filme waren eine Kampfansage an das "Story-Kino der Erzähl-ZelluloidKunst des narrativen Films als einzig herrschende^] Form."6 Aber gerade dieses Kino der realistisch-narrativen Nachkonstruktion beherrscht Leinwand und Bildschirm. Die Bilder von Auschwitz, die haften bleiben, sind nicht die Bilder von Lanzmanns SHOAH (dessen Breitenwirkung in Deutschland gering war), sondern von Greens und Chomskys HOLOCAUST; die Vorstellung von einem Hoffaktor dürfte bei der älteren Generation der deutschen Kinogänger durch
4
5 6
Bei der Schreibweise biblischer Eigennamen richten wir uns nach den Loccumer Richtlinien (Ökumenisches Verzeichnis 1983). Rother 1989, 38 Syberberg 1979, 11
9 Harlans JUD SÜSS, die von von den Anfängen des jüdischen Volkes durch de Milles THE TEN COMMANDMENTS geprägt sein. Anton Kaes hat in seinem wegweisenden Buch über die "Wiederkehr der Geschichte als Film" auf die Entschärfung des Grauens von Auschwitz durch die Einebnung in eine narrative Form hingewiesen.7 Das gilt für jeden Film und jedes Fernsehspiel mit jüdischen Figuren. Die Selektierung, Strukturierung und Veränderung des historischen Materials durch den Film - so Kaes - führe zur Sinnstiftung via Film, zum Ersatz der historischen Erfahrung durch die filmische Repräsentation: Wie lange wird es dauern, bis auch die jüngste deutsche Vergangenheit aus dem Bereich der Erfahrung und Erinnerung endgültig ins Reich der Bilder hinübergleitet und zu einem Kinomythos wird?8
Ausgehend von den verschiedenen Filminterpretationsmethoden, die W. Faulstich vorgestellt hat,9 sicher auch beeinflußt von der Einbindung des historischen Films in den Zusammenhang von Produktion und Verkauf von Waren,10 lassen sich Filme über das biblische Israel auch als "Produktgeschichte", als "komplexer Prozeß von technischen, ästhetischen, politischen, wirtschaftliche Entwicklungsfaktoren" interpetieren, wie Faulstich/Korte ihr Konzept des jüngsten Versuchs einer Filmgeschichte beschrieben haben.11 Wir dagegen wollen auf tradierte geistesgeschichtlich-hermeneutische Verfahren nicht verzichten, um herauszu- finden, ob in den Filmen vom Typ THE TEN COMMANDMENTS oder QUO VADIS jüdische Religion und jüdische Geschichte transparent wird. Deshalb fragen wir, ob diese Filme lediglich im genrespezifischen Zugriff als Historienfilme interpretiert werden sollten, oder ob sie sich mit dem Zugriff der literarhistorischen Interpretation nicht ebenfalls, womöglich noch besser, erschließen lassen. Zwar hat die neuere Forschung über die Literaturadaption in Film und Fernsehen u.E. bisher nur außerbiblische Texte berücksichtigt,12 aber da einmal biblisch-theologische Hermeneutik sich seit dem Aufkommen der historisch-kritischen Forschung auf die Sprache und Verstehenswelt von Texten konzentriert und zum zweiten die "Interpretation des Films im Lichte seiner Buchvorlage als ein legitimer [...] Ansatz" gilt,13 dürfte sowohl von Seiten der Theologie als auch unter den Fragestellungen der Film- und Fernsehforschung die moderne historiographische Methode eine zweite wichtige Zugriffsweise zur Erschließung von Filmen nach biblischen und außerbiblischen Texten darstellen. Werner und Rose Waldmann unterscheiden drei Kategorien der Literaturadaption:14
7 8 9 10 11 12 13 14
Kaes 1987, 198f. Kaes 1987, 209 Faulstich 1988a, Filmgeschichte schreiben 1988, Faulstich 1988b, 9-19 Haug 1971, Bächlin 1945 Fischer Filmgeschichte 1990, 7f. Literaturverßlmungen 1989, 35f. Faulstich 1988a, 45 Waldmann/Waldmann 1980, 112f.
10 1. die Ausbeutung der Literatur als bloße Stoffvorlage zur Herstellung von Konsumware, wobei der Inhalt unter weitgehender Verwendung der originalen Dialoge und mit Hilfe einer Off-Erzählstimme simpel unter Vernachlässigung "der literarischen Einmaligkeit und der historischen Substanz" nacherzählt wird 2. die Vorstellung bedeutender literarische Werke durch eigenwillige bis extrem subjektive mediengerechte Interpretation, also nicht durch planes Nacherzählen und mechanisches Bebildern (wenn der Sinn der Vorlage erfaßt wird, erfüllt eine solche Adaption ihrer Auffassung nach gleichwohl den Anspruch der Werktreue) 3. die Transponierung eigener Werke durch einen zeitgenössischen Autor in das Medium des Films und Fernsehens. Dies Drei-Kategorien-Schema der (Fernseh)-Literaturadaption läßt sich auf alle Filme und Fernsehspiele mit jüdischen Figuren übertragen, also auch auf die fiktionalen Produktionen, die in biblischer Zeit spielen. Waldmanns Kategorie 1 beschreibt neun Zehntel aller Kino- und Fernsehfilme nach Stoffen der Bibel. Man könnte diesen Filmtyp auch als "Bibelßlm " bezeichnen. Dem gegenüber wäre dann die "Bibelverñlmung " der anspruchsvolleren Kategorie 2 zuzuordnen. Dabei ist zu bedenken, daß auch die gelungenen Beispiele dieser Kategorie, z.B. die Arbeiten von Rossellini und Pasolini, noch stark der Texttreue-Ideologie verpflichtet sind und nur wenige Filme und Femsehspiele den Mut zu einem konterkarierenden Umgang haben wie z.B. die Arbeiten von Bunuel und Walter Jens.
2.2. Jüdische Figuren in Spielfilmen und Fernsehspielen zur Geschichte des jüdischen Volkes in seinen Anfängen und in der Antike
2.2.1. Thematische Schwerpunkte in Filmen zu Ereignissen des Frühjudentums Wenn man untersucht, welche Zeitabschnitte aus der Geschichte der Juden in der Antike in fiktionalen Produktionen dargestellt werden, so fallt auf, daß nur 2 der 24 von uns analysierten Filme und Fernsehspiele ihren Filmstoff außerbiblischen Quellen entlehnen. Die Hebräische Bibel ist also Hauptstofflieferant der Filmautoren. Nach der oben getroffenen Unterscheidung von Bibelverfilmungen und Bibelfilm erfolgt die Präsentation jüdischer Geschichte in ihren Anfangen fast nur durch die Kategorie 1 der Literaturadaption, also den Bibelfilm. Dabei werden ganz unterschiedliche thematische Schwerpunkte gesetzt, die in Filmen dargestellten (biblischen) Ereignisse korrespondieren also selten mit deren Relevanz für die frühe Geschichte des jüdischen Volkes. Die Anfänge Israels vor der Landnahme, d.h. die in der Bibel erzählten Geschichten über die Patriarchen in Kanaan, über Israel in Ägypten, über den Exodus und die Offenbarung vom Berg Sinai, sind wiederholt durch Spielfilme nach biblischen Stoffen ausschnitthaft gezeigt worden, z.B. in SODOMA E Gomorra, THE TEN COMMANDMENTS oder der Abrahamsepisode von LA
11 BIBBIA. Vom Einbruch in Kanaan, der Seßhaftwerdung und der Richterzeit interessierten die Filmemacher außer einem Gideon-Fernsehspiel nur die "Samson und Delilah"-Episode; der Kampf gegen die Philister war nur in Form von "David und Goliat"-Filmen präsent. Samuel erscheint lediglich als Nebenfigur in DavidFilmen und in der Vorgeschichte eines Jesusfilmes. Die Epoche des vereinten Königreiches dagegen bot Anlaß für die Herstellung einer Anzahl von Filmen über Rut, David und Salomo. Filmisch unergiebig erschien den Produzenten die Zeit der zwei Reiche. Vom Niedergang, dem Wiederaufstieg und der Zerstörung des Königreiches Israel, vom Reich Juda bis zum Untergang Jerusalems und zur Babylonischen Gefangenschañ gibt es lediglich einen historischen Abenteuerfilm. So wie die Ereignisse zur Zeit des Ersten Tempels, die Babylonische Gefangenschaft und die Restauration also nur punktuell durch biographisch angelegte Legendenfilme angedeutet werden, bleibt auch die Zeit des Zweiten Tempels praktisch von einer filmischen Realisation ausgeklammert. Ob es sich um die Anfange des Judentums im babylonischen Exil, um die persische oder griechische Zeit handelt - ein Film wie ESTHER E IL RE ist die einzige Produktion über eine so ereignisreiche Geschichtsperiode Palästinas unter der Herrschaft der hellenistischen Königreiche, über das Gesellschafts- und Regierungssystem Judäas unter den Ptolemäern. Die Phase über die Dekrete gegen die jüdische Religion und den Hasmonäeraufstand fand ebenfalls nur in einem historischen Abenteuerfilm - IL VECCHIO TESTAMENTO - eine mehr als problematische Entsprechung. Auch die politische, religiöse und soziale Geschichte Judäas unter der Römerherrschaft spiegelt sich - wenn man von den weiter unten zu behandelnden Jesus- und Christenverfolgungsfilmen absieht - nur dürftig in dem Abenteuerfilm ERODE IL GRANDE wider. Der Aufstand mit seinem heroischen Ende in Masada war zwar Gegenstand eines mehrteiligen Fernsehfilms, davon wurde aber in der Bundesrepublik nur ein Zusammenschnitt ausgestrahlt. Vom Diaspora-Aufstand 115-117 und vom Großen Aufstand unter Bar Kochba 132-135 gibt es keine Filme. Auch über die letzte, ca. 500 Jahre umfassende Epoche des rabbinischen oder talmudischen Judentums, also die Zeit bis 640, wurde nicht ein einziger Spielfilm gedreht.
2.2.2. Hebräer oder Juden Statt der aus Platzgründen hier nicht wiederholbaren detaillierten Analysen von ausgewählten fiktionalen Produktionen zur frühen jüdischen Geschichte ziehen wir das Resümee aus der Fragestellung, ob in diesen Filmen die Figuren der Hebräischen Bibel (oder anderer Stofflieferanten) nur als Hebräer einer abgeschlossenen biblischen Epoche dargestellt oder auch schon als gegenwärtige Juden mit einer zweitausendjährigen Leidensgeschichte transparent werden bzw. ob das gewählte Genre das Aufzeigen solcher Bezüge geradezu verhindert, somit Aufklärung untergräbt.
12 In Cecil Β. de Milles berühmtem historischen Ausstattungsfilm THE TEN COMMANDMENTS nehmen Juden den überragenden Platz im Figurenensemble ein. Sowohl als Gruppe wie auch als einzelne werden sie kompositorisch den Ägyptern gegenübergestellt. Jedes Alter, jedes Geschlecht ist vertreten. Ihre soziale Schichtung und ihre Berufe werden durch den Sklavenstatus eingeengt: Lastenträger und Arbeiter in den Ziegeleien sind am häufigsten vertreten, aber auch Steinmetze und deren Zuarbeiter werden gezeigt. Ihr Aussehen wird nicht auf einen womöglich durch "Rassemerkmale" verengten ethnischen Typus beschränkt. Trotz ihrer "Knechtsgestalt" treten sie in den Ägyptenszenen als aufrechte, gefaßte, zuversichtliche, innerlich freie Menschen auf. In den Auszugsszenen gelingt es sogar, trotz der Trivialfilmingredienzien (Sprecherpathos, aufdringlicher musikalischer Untermalung) ein beeindruckendes, sympathisches Bild der Juden in all ihrer Vielfalt zu geben. Dennoch: den theologischen Dimensionen des biblischen Dekalogthemas wird der Film in keiner Phase gerecht. Die Figur des Mose wird auf die eines Freiheitskämpfers reduziert. Die Rekonstruktion der ägyptischen Bilderwelt ganz im Stil der Ägyptenrezeption des Historismus mildert die Schwächen des Historienfilms nicht. "Kamera-Realität"15 wird fast nirgends hergestellt - außer in den Szenen, in denen das jüdische Volk ins Bild kommt. Dann gelingt - im Gegensatz zu fast allen anderen Bibelfilmen - eine positive Judendarstellung. Sie ist aber nur unter der Voraussetzung wirksam, daß der Zuschauer in den Israeliten der TEN COMMANDMENTS die Ahnen heutiger jüdischer Menschen erkennt. Aber eben dies strebt der Film nicht an. Die Unmöglichkeit, Ereignisse und Gestalten jüdischer Geschichte mit dem Genre des Abenteuer- und Ausstattungsfilms der fünfziger und sechziger Jahre darzustellen, gilt für alle Geschichtsepochen des jüdischen Volkes. So konnte und wollte der vor dem Seßhaftwerden der Israeliten in Kanaan spielende italienische Film SODOMA E GOMORRA von Aldrich und Leone nicht etwa einen Eindruck von jener Zeit vermitteln, als die Erzväter mit ihren Familien und Herden noch in Kanaan umherzogen. Die Filmemacher veränderten vielmehr die literarische Vorlage zu einem mit Horrorfilmelementen durchsetzten kriegsverherrlichenden Sex-, Crime- und Sensation-Spectaculum, das den Intentionen des Textes diametral entgegengesetzt ist. Der Film gibt ein höchst problematisches Bild von den Israeliten: Aus der überschaubaren Gruppe friedlicher Nomaden der Bibel wird ein schlagkräftiges Heer, wie es erst in der Epoche "Von der Landnahme zur Staatenbildung" bestanden haben dürfte. Lot avanciert zum charismatischen Heerführer und Richter im Stile der Rettergestalten aus der Zeit während und nach der Landnahme. Die theologische Konzeption der Vätergeschichten mit der Verheißung des Segens, des Bundes und des Erblandes wird durch eine falsche "Jehova"-Formel mit allgemeinhumanitärer Attitüde (Sklavenbefreiung) ersetzt. Sodom ist im Gegensatz zur biblischen Interpretation als "Beispiel tiefster Verkommenheit" (Verwilderung der Rechtsprechung, Hoffart, Nahrungsüberfluß, sorglose Ruhe, Ehebruch, 15
Kracauer 1985, 115-118
13 Lügnerei und Unbußfertigkeit)16 nur eine Art Maschinenpark zur Sklavenfolterung. Die Sodomerzählung wird zu einem Italowestern, der mit den Gestalten und Geschehnissen der Bibel nur noch den Namen gemein hat. Parallelen zur Gegenwart werden nicht gezogen. Wesentlich näher am biblischen Text ist LA BIBBIA von John Huston, der erste und einzig fertiggestellte Film einer groß angelegten vierteiligen Reihe von in sich abgeschlosenen Spielfilmen über zentrale Geschichten der gesamten Bibel. So ungleichmäßig die einzelnen Teile des Films sind, so heben sich beispielsweise die Sequenzen über die früheste Epoche der Geschichte Israels vor der Landnahme, also die Abrahamsgeschichten, von den sonstigen AT-Filmen dadurch ab, daß sie eigenständige Transponierungen der Hebräischen Bibel sind, das erzählte Geschehen also nicht vom Neuen Testament her interpretiert wird. Hier gelingt in den Alltagsszenen - mit einigen Einschränkungen - eine filmische Deutung jüdischer Geschichte in ihren Anlangen, eine Erinnerung an die nomadische Zeit der Vorfahren der Israeliten, wie sie die Sagen der Genesis erzählen. Ob eine Verbindungslinie von den Israeliten dieses Films zu heutigen Juden gezogen werden sollte, bleibt allerdings mehr als zweifelhaft, auch wenn mißglückte optische Klischees (die Porträtierung von Noachs Frau in einer Weise, wie man die "Mamen", die Mutter in jiddischen Filmen der dreißiger Jahre, zeichnete) dies nahelegen. In Theologie und Geschichte ist es üblich, vom Volk der jüdischen Bibel, des Alten Testaments, in dem Zeitabschnitt zwischen Landnahme und Babylonischen Exil als "Israel" zu sprechen. Danach - während der Zeit des Zweiten Tempels entstand das Judentum; das Volk Israel wird - unbeschadet der Tatsache, daß es sich immer als "Israel" bekannt hat - nun als das Judenvolk, als die Judenschaft bezeichnet.17 Es wäre nun folgerichtig, wenn die Filme, die in der Zeit seit dem Babylonischen Exil spielen, das Volk des Bundes als "Juden" bezeichneten statt wie vorher meist als "Hebräer". Da aber bis auf die Bibelverfilmung des KING DAVID die in der jüdischen Antike spielenden Filme eben doch nur "Sandalenfilme" sind,18 Action-Filme in historischen Kostümen, ohne wirkliches Interesse an der Geschichte der Juden sowohl als Angehörige des Volkes wie auch als Zugehörige zur religiösen Gemeinschaft, bleiben Juden in "Antikfilmen"19 schemenhaft, sind nur Spielanlaß, Vorwand für Schlachtenpanoramen zu Fuß und Pferd, mit Pfeil, mit Bogen oder Schwert. Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden: Die typisierten Figuren der in der Regel biblische Stoffe benutzenden standardisierten historischen Abenteuerund Ausstattungsfilme der fünfziger und sechziger Jahre mit ihren weithin genormten Handlungsmustern ließen keinen Raum für eine individualisierende Darstellung. Die Ausschlachtung der Bibel als bloße Stofflieferantin für
16
17 18 19
von Rad 1952, 185
Taschenhxikon Religion und Theologie 1974, Fritze/Seeßlen/Weil 1983, 67 Fritze/Seeßlen/Weil 1983, 66
II, 130 u. Rendtoiff 1985, 6
14 Massenproduktionen verhinderte eine differenzierte Wahrnehmung biblischer Gestalten im Adapbonsprozeß und erst recht die Erkenntnis, daß "Israel" als "Volk des Bundes" sich nicht auf seine historische Position begrenzen läßt, sondern die "Hebräer" des Alten Testaments die Mütter und Väter heutiger Juden sind. Wenn nach 1945 das Thema "Christen und Juden" selbst in den Kirchen kaum zur Sprache kam und das "traditionelle Überlegenheitsbewußtsein des christlichen Theologen"20 auf Jahre hinaus den Dialog erschwerte, so ist es nicht verwunderlich, daß amerikanische und italienische Filmemacher, die bestenfalls noch Residuen christlicher Tradition in die typisierten Menschenbilder ihrer Ware verpackten, in ihren Figuren aus dem biblischen Steinbruch keinen Juden wahrnahmen. Ein anderes, gleichwohl problematisches Bild ergibt sich aus der Analyse jener Filme zur frühen jüdischen Geschichte, die in den siebziger und achtziger Jahren nach dem Abklingen der Massenproduktionen von Bibelfilmen - entstanden. Wir ziehen das Fazit aus der Untersuchung der Kinofassung einer Fernsehserie über Masada und einer Bibelfilmparodie. Der bis heute ungebrochene Symbolwert der Ruinenstätte Masada am Toten Meer unterstreicht den Wechsel des jüdischen Selbstverständnisses: vom verachteten, unter Pogromen sich duckenden Juden zum kämpferischen Israeli. Auf dieser Linie liegen auch die meisten fiktionalen Darstellungen im Roman und Film, die die mehrschichtigen historischen und theologischen Beweggründe für den Jüdischen Krieg, den "Großen Aufstand" insgesamt vernachlässigen und als einziges Motiv nur das Freiheitsstreben des jüdischen Volkes zugrundelegen. Diesem Muster folgen der Roman THE ANTAGONISTS von Ernest Κ. Gann und das danach produzierte gleichnamige Serial.21 Es gibt keine Genese des Aufstandes, legt den Akzent nicht auf die überlieferten Geschehnisse, schildert eher beiläufig die Techniken des Angriffes und der Verteidigung, gestaltet kaum die Empfindungen der Soldaten, Gefangenen und Hilfstruppen, sondern sein Interesse an dieser fiktiven Geschichte ist das Aufeinandertreffen der beiden "antagonists", des römischen Statthalters Silva und des jüdischen Verteidigers Eleasars. Das Skandalon dieses Masadafilmes besteht nicht in seinen gestalterischen Schwächen und der Verengung der Geschichte eines Volkes zum rhetorischen Zweikampf der beiden Protagonisten, sondern in der Umdeutung des Widerstandes: Sieger ist nicht der schon im Vorspann als "umstrittener Führer" bezeichnete Eleasar, dessen berühmte Rede der Film ebenso in toto gestrichen hat wie die Akte der Selbsttötung, sondern Silva. Der Wettstreit der "antagonists" endet mit dem etwas geschmälerten Sieg des Realpolitikers Silva über den angeblich nur auf die eigene Ehre erpichten Eleasar. Diese US-Film-Korrektur der Überlieferung ist in israelischer Sicht eine fatale Fehlinterpretation des jüdischen Selbstverständnisses. Zwar ist der Film nicht als antisemitisches Tendenzstück angelegt. Aber selbst wenn man Silva und Eleasar gleicherweise als positiv
30 21
Rendtorff 1989, 10 Gann 1972
15 interpretiert ansieht, biegt man den Opfertod jüdischer Menschen auf Masada zur Sinnlosigkeit um und demontiert nicht nur heutiges israelisches, sondern jüdisches Selbstverständnis zweier Jahrtausende.22 Der Überdruß am Genre des religiösen Ausstattungs- und Abenteuerfilms hatte sich 1979 und 1980 in zwei Parodien des Bibelfilms Luft gemacht, die allerdings weit unter den Möglichkeiten der Gattung blieben, weil die satirische, kritische und polemische Absicht nicht ausgeschöpft wurde. Der Film WHOLLY MOSES von Gary Weiss travestiert den biblischen Text über Sodom und Gomorra. Er ist ein Mixtum compositum aus gagreichem Handlungsablauf und einer Persiflage des American Way of Life, der Konsumgesellschaft und der Holy-Land-TourismusReisen. Massiv parodiert er biblische Sprache, biblische Figuren und biblische Wunder. Milde persifliert er einige Verhaltensweisen heutiger nicht-orthodoxer (amerikanischer) Juden. Seine Hauptfigur Herschel ist kein Hebräer, sondern ein amerikanischer Jude der Gegenwart, der sich in die Rolle eines jüdischen Sklaven des Altertums hineinträumt. WHOLLY MOSES scheint eine Verbindungslinie vom Volk Gottes der Hebräischen Bibel zu gegenwärtigen Juden zu ziehen. Tatsächlich aber dreht der Film die Beziehung um, indem er Formmittel und Figuren des biblischen Textes mit einer gegenteiligen Intention nachahmt: Ein dem Glauben an Jahwe entfremdeter, nur noch äußerlich die Rituale befolgender, in mißliche Situationen geratender, junger tolpatschiger Jude schlägt sich mehr schlecht als recht durchs Leben, sucht mühsam seine Identität und seinen Lebenssinn. Dieser Herschel ist in der Rahmenhandlung ein amerikanischer Professor für Judaistik, der wie immer nach einer mißlungenen Liebesaffare eine Reise bucht und diesmal versehentlich in Israel landet, in der Haupthandlung dagegen ein hebräischer Sklave, dessen eigener Lebensweg ständig den von Mose kreuzt. Zwiespältig wirkt diese Zentralfigur im Hinblick auf die Darstellung ihres Judeseins. Zwar liegt dem Film eine diskreditierende Absicht offenbar fern, allenfalls gestattet sich die Regie einen u.U. selbstironisch zu verstehenden milden Spott; andererseits aber wird diese jüdische Figur aus Stereotypen zusammengesetzt, die in anderen Zusammenhängen und Akzentsetzungen dem Arsenal der klassischen Judenfeindschaft, ja dem biologischen (rassistischen) Antisemitismus seit dem 19. Jahrhundert angehören: Herschel ist das kleine, dunkelhaarige, mit keinen ebenmäßigen Gesichtszügen ausgestattete, geschäftige und geschäftstüchtige (wenn auch nicht erfolgreiche), wortreich debattierende, ständig seine Unschuld beteuernde, sich aus den Affären windende, immer in Bewegung befindliche, zu amourösen Wortspielen und Taten bereite, alles und jedes ironisierende, respektlos das Heilige in Zweifel ziehende, penetrant und verschlagen auf seinem Recht bestehende, nach Niederlagen immer wieder auftauchende, sich allen Situationen anpassende, nicht totzukriegende Individuum.
22
Filmbeobachter 5/81 (Rezension von Wolfgang J. Fuchs)
16 2.2.3. Schlußfolgerungen Qualitative Analysen von 24 Spielfilmen und Fernsehspielen ermöglichen eine Verifizierung der Eingangshypothese von der fehlenden Verlebendigung jüdischer Geschichte durch das Genre des historischen Ausstattungs- und Abenteuerfilms. Sie bestätigt die Praktizierung der traditionellen narrativen filmischen Erzählweise, die "Theaterhaftigkeit" ebenso wie die fast durchweg fehlende Akzentsetzung auf das Gestaltungsmittel der "Kamera-Realität". Als Ergebnis läßt sich konstatieren, daß das Bemühen um Authentizität nur durch das Arrangement von kostümierten Schauspielern in einer rekonstruierten Szenerie im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit der uns betreffenden und betroffen machenden Geschichte ein Weg in die Sackgasse ist. Es wird deutlich, daß die Filmemacher in der Regel die literarische Vorlage unbefangen als Steinbruch für die Dramaturgie von Historienfilmen benutzten, es also keineswegs ihre Intention war, die Texte für die Erhellung jüdischer Geschichte zu verwenden. Die Sagen der Hebräischen Bibel und die Berichte der jüdischen Geschichtsschreiber wurden von ihnen nicht als Erzählungen über das Volk Israel und über die Judenheit erkannt und deshalb auch nicht entsprechend gestaltet. Damit entgingen sie der Versuchung, Judendarstellungen durch die Verwendung von Stereotypen zu simplifizieren, was später in den Filmen über Ereignisse des jüdischen Mittelalters bzw. der frühen Neuzeit bis hin zur Präsentation gegenwärtiger Juden zum Problem werden sollte. Die Historienfilme nach Sujets der Hebräischen Bibel unterlagen in den beiden Jahrzehnten des klassischen Bibelfilmgenres den Standards der Massenproduktion. Ihr Warencharakter führte zur Internalisierung aller jener Produktionsmerkmale, Inszenierungstechniken und Figurenzeichnungen, die der vorgeschriebenen Distribution dienten. Eine Problematisierung als Befragung von biblischen Texten über deren theologische Intentionen fand nicht statt, eine Mea-res-agiturInterpretation von Filmen nach Texten der Hebräischen Bibel war undenkbar selbst nach dem Abklingen der Bibelfilmphase. Die Filmfiguren wurden auch in den neueren Filmen mit ihrer veränderten Erzählweise nicht als Juden, erst recht nicht als Volk mit einer zweitausendjährigen Leidenszeit vorstellt, jüdische Geschichte wurde weder als Ante-Shoah noch als Post-Shoah erzählt. Daß die klassischen amerikanischen Bibelfilme sich nicht ernsthaft mit Religion, Geschichte und Kultur der Juden auseinandersetzten, auch wenn sie weitestgehend Produktionen jüdischer Produzenten und Regisseure waren, hängt mit der von Ilan Avinar beschriebenen "Eskamotierung alles Jüdischen" durch jüdische und nichtjüdische Filmemacher in den USA bis zu den sechziger Jahren zusammen: Sie ist auf die Assimilationstendenzen der jüdischen Filmpioniere, den Antisemitismus der damaligen amerikanischen Gesellschaft und auf die McCarthy-Verfolgungswelle zurückzuführen.2® Weil bis auf eine Ausnahme die Filmfiguren nicht als Juden identifiziert wurden, war den Filmemachern die Erkenntnis und filmische Gestaltung des schon 23
Avisar 1991, 203-210, Zitat 206
17
damals existierenden Phänomens des theologische Antijudaismus bzw. des politisch-ökonomisch-sozialen Antisemitismus in der Antike und seiner Auswirkungen - angefangen vom Judenhaß als Antwort auf die Ausbreitung des jüdischen Glaubens bis hin zu den antijüdischen Dekreten der Hellenisten, des Hadrian und dann des zur Staatsreligion erhobenen Christentums - offenbar unbekannt.24 Kein Regisseur nahm die judenfeindlichen Hetzrufe der byzantinischen Kirchenfiirsten des 4. Jahrhunderts, etwa des Bischofs Johannes Chrysostomos, den man als den größten Prediger der griechischen Kirche bezeichnet hat, oder des Bischofs Gregor von Nyssa, eines Kirchenvaters und Heiligen der katholischen Kirche, zum Anlaß, die Anfange des theologisch motivierten Antisemitismus, des Antijudaismus, in Szene zu setzen. So war in keinem Film zu hören, was Gregor von Nyssa über die Juden predigte: Sie sind Mörder des Herrn, Totschlager der Propheten, hafierfüllte Rebellen gegen Gott; sie treten das Gesetz mit Füßen, leisten der Gnade Widerstand und verschmähen den Glauben ihrer Väter. Sie sind Statisten des Teufels, eine Rasse von Schlangen, Verräter, in ihrem Gehirn verdunkelte Verleumder, pharisäischer Sauerteig, eine Versammlung von Dämonen, verflucht, verabscheuungswürdig, Feinde von allem, was schön ist.25
2.3. Jüdische Figuren in Spielfilmen und Fernsehspielen nach Themen des Neuen Testaments und darauf fußender ErzähUiteratur
2.3.1. Das Genre des Jesus- und Apostelfilms Bereitete es schon Schwierigkeiten, in den nach Stoffen der Hebräischen Bibel gedrehten Filmen die dort auftretenden Figuren der "Hebräer" als Vorfahren
24
25
In der Forschung wird nicht durchgehend zwischen 1. Antijudaismus (AJ) als Abneigung gegen Juden im Altertum und Mittelalter bzw. Judenfeindschaft aus christlich-theologischen Gründen und 2. Antisemitismus (AS) als der im 19. Jahrhundert aufgekommenen biologisch-rassistischen Judendiskríminienmg und -Verfolgung unterschieden. Häufig (z.B. Riirup 1987a, Castritius 1984, Breuer 1988, Klinkenberg 1988) benutzt man den Terminus AS als Oberbegriff für die von der Antike bis zur Gegenwart reichende Judenfeindschaft. Rürups Einschätzung, die Einführung des Terminus AJ sei "praktisch erfolglos geblieben" (1987a, 114), vermögen wir im Hinblick auf die breite Diskussion innerhalb der Theologie des christlich-jüdischen Dialogs nicht zu teilen. Wir verwenden den Terminus AJ zur Kennzeichnung einer primär christlichtheologisch motivierten Judenfeindschaft wie z.B. in der evangelischen Theologie Marquardt 1988,86 und Rendtorff 1989, 21. In der katholischen Theologie wird häufig zwischen dem a) traditionellen AJ (dem "paganen spätantiken AJ' in Petuchowski/Thoma 1989, 17 oder dem "vorchristlich-heidnischen AJ" bei Kiing 1991, 190 und dem b) kirchlichen AJ (Petuchowski/Thoma 1989,17) oder christlichen AJ (Küng 1991, 195f.) unterschieden. Poliakov 1977, I, 21
18 heutiger Juden zu identifizieren, so trat in den nach den Evangelien und der Apostelgeschichte des Neuen Testaments gedrehten Filmen und Fernsehspielen eine weitere Erschwernis hinzu. Jetzt wurden die Juden aus der Umwelt Jesu immer schon als künftige Christen gesehen und damit ihres Judeseins häufig entkleidet. Was fiir die Zeichnung der Jünger und Apostel galt, traf in noch größerem Maße auf die Darstellung Jesu selbst zu. Für den jungen Martin Luther war es - wie der Titel seiner Schrift aus dem Jahre 1523 ausweist - noch selbstverständlich, "Daß Jesus Christus ein geborener Jude sei". Den Filmautoren und Regisseuren von Jesusfilmen, die entsprechend der traditionellen christlichen Dogmatik Jesus als den "von den Juden ans Kreuz geschlagenen" Christus, als den Sohn Gottes und Herrn der Kirche interpretierten, war diese Sicht des frühen Luther ebenso fremd wie die des Rabbiners Leo Baeck, der 1901 dem evangelischen Theologen Adolf von Harnack entgegnet hatte: Die meisten Darstellungen des Lebens Jesu unterlassen es, darauf hinzuweisen, daß Jesus in jedem seiner Züge durchaus ein echter jüdischer Charakter ist, daß ein Mann wie er nur auf dem Boden des Judentums, nur dort und nirgendwo anders, erwachsen konnte. Jesus ist eine echt jüdische Persönlichkeit, all sein Streben und Tun, sein Denken und Fühlen, sein Sprechen und Schweigen, es trägt den Stempel jüdischer Art, das Geprage jüdischen Idealismus, des Besten, was es im Judentum gab und gibt, aber nur im Judentum damals gab. Er war ein Jude unter Juden.26
Die Produkte der Filmindustrie zwischen 1895 und 1975, ja teilweise bis hinein in die unmittelbare Gegenwart, standen dagegen in der Tradition der römischgriechischen Gestalt des Christentums, in der das Judesein Jesu "verpönt war und es nicht anging, Jesus als Juden zu erwähnen",27 geschweige denn, eine Christologie als "Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Juden" zu formulieren.28 Die Regisseure der Hollywood- oder Italo-Jesusfiguren erlagen zudem überwiegend dem Hang, ihrem Verständnis von Heiligkeit dadurch Tribut zu zollen, daß sie generell das Menschsein Jesu zugunsten einer ausgespielten Gloriolendarstellung des Gottessohnes zurücknahmen und damit die Interaktion Jesu mit seiner Umwelt zusätzlich verkürzten. Ihre Filme waren Christusfilme, sie stellten also Jesus als den im Glanz des Sterns von Bethlehem praktisch schon vor seiner Auferstehung erhöhten, kaum noch irdischen, anbetungswürdigen Herrn und Gottessohn dar. Einige filmkünstlerisch bedeutsame Arbeiten folgten dieser Konvention nicht, sondern hatten unter Verwendung der manchmal verfremdeten, z.B. ins Surrealistische gewendeten Jesusfigur religons- und sozialkritische Tendenzen. Dies zeigte sich besonders - unabhängig von der künstlerischen Qualität - an der letzten, bis in die Gegenwart reichenden Jesusfilmwelle, bei der entweder die "Sache Jesu" nur indirekt erschlossen oder in der Regel gar nicht mehr vorgegeben wurde, auch nur annäherungsweise den missionarischen Anspruch des Neuen Testaments zu erfüllen, sondern die Jesusfigur eher Auslöser für eine
26 27 28
Baeck 1975, 118 Volken 1983, 26 Marquardt 1990
19 intellektuelle, kritische Auseinandersetzung mit den Grundsätzen der christlichen Religion und ihrer Vertreter im Laufe der Kirchengeschichte war oder als Folie modernen Lebensgefuhls benutzt wurde. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß die letzten, diesmal gleich (auch) für das Fernsehen bzw. den Videomarkt produzierten "Mehrteiler" wieder auf die Linie der Historienfilme einschwenkten. Bei diesem Typ der Jesusfilme interessierten sich die Filmemacher primär nur für die äußeren verfilmbaren Daten des Lebens Jesu: für Geburt, Kindheit und Taufe, für die Schauplätze seiner Wirksamkeit, für das optisch Wahrnehmbare der Predigten und Heilungen, für Jesu Passion und Tod, aber dann auch als gravierendste methodische Grenzüberschreitung für die Verfilmung der Auferstehung. Jesu Gottesanschauung und Sendungsbewußtsein, das Problem der Messianität Jesu und seine Hoheitstitel wurden je nach Durchsetzungsfahigkeit der theologischen Berater und nach Berücksichtigung des Markts durch den Produzenten additiv zitiert. Das Verhältnis des "historischen Jesus" zum "Christus des Glaubens" wurde ausgeklammert. Fragestellungen der christlichen Theologie blieben marginal. Erkenntnisse jüdischer Theologen sind den Szenaristen und Regisseuren von Jesusfilmen insgesamt fremd. Das jüdische Jesusbild, "die Betonung seiner [Jesu, D.P.] Torah-Frömmigkeit, seine national-religiöse Sendung, sein Widerstand gegen Heidenmission und schließlich sein eindeutiges Menschentum" (in Abgrenzung zu der dem Christentum vorgeworfenen "posthumen Vergöttlichung")29 wird in den klassischen und in den modernen Jesusfilmen nicht gestaltet, weil es nicht in das gewohnte Klischee der Historienfilme mit ihrer pseudochristlichen Dogmatik paßt. Zeitgenössische Juden in den Jesusñlmen erscheinen selten als zentrale Handlungsträger, sondern fast immer bloß als Statisten, Volksmenge, Hintergrundakteure, die sich nur selten als Farbe gebende Gruppe formieren: zu Murrern, Jublern, Gegnern. In der letzten Formation wären dann auch Spuren antijüdischer Akzente der Evangelien erkennbar, auch wo diese Antijudaismen in der filmischen Gestaltung vermieden wurden: "die" Juden als Verweigerer, Verblendete, Verstrickte, Verworfene. Noch ein zweiter Umstand reduziert, ja eliminiert das Judesein des Volkes Israel in Jesusfilmen. Wenn in ihnen bibeltreue Israeliten die Glaubenserfahrung der Hebräischen Bibel artikulieren, zitieren sie diese Worte des Alten Testaments im Wortlaut der Lutherbibel und grundsätzlich als Voraussage auf Jesus, den Christus. Buch und Regie tun ein übriges, die Worte der Bibel durch gestelzte Redeweise, durch Spotlights und Gegenlichtaufnahmen, somit gewissermaßen filmoptisch gesperrt gedruckt und musikalisch untermalt, schon als gehöhte, Christum treibende Kernsätze zu zitieren. Die Vermarktung der Bibel zur Produktion, Distribution und Rezeption von historischen Filmen weist im Hinblick auf die Wahl der beiden "Testamente" nur geringe Unterschiede auf: Schon in der Stummfilmzeit spielte es für die Technik ® Lapide 1976, 83
20 und die Inszenierung keine Rolle, ob ein Stoff des Alten Testaments, des Neuen Testaments oder der "religiösen" Belletristik (z.B. THE LAST DAYS OF POMPEJI) als Steinbruch für die zunehmend standardisierten Produktionen mit ihren typisierten Figuren benutzt wurde. Die Subspezies des "historischen Abenteuerfilms", des "historischen Ausstattungsfilms", des "Legendenfilms" und der "Klassikerverfilmung"'0 waren in allen drei Fällen vertreten. Schien in der frühen Stummfilmzeit die Auswahl der alttestamentlichen Sujets mehr den Typ des Abenteuerfilms zu begünstigen, so neigte man bei den neutestamentlichen Historienfilmen dazu, Elemente des Legendenfilms einzuarbeiten. Mit der Perfektionierung der Produktion bildete sich aus marktstrategischen Gründen schon in der klassischen Stummfilmzeit der Trend zum historischen Ausstattungsfilm heraus. Er galt für alle drei Gruppen der Stoffvorlagen im gleichen Maße und beherrschte das Medium bis in die siebziger Jahre. Wie die Produktionen zur frühen jüdischen Geschichte lassen sich auch die Filme nach NT-Texten und darauf fußender Erzählliteratur in zwei große Gruppen gliedern: die Monumentalfilme Hollywoods und Roms, die meist als historische Ausstattungsfilme produziert wurden, und die weniger einheitliche Gruppe des Postbibelfilms der letzten zwanzig Jahre. Aber schon die erste Gruppe stellt keinen monolithischen Block dar. Neben den hagiographisch gehöhten Kolossalbibelfilmen (KING OF KINGS, THE GREATEST STORY EVER TOLD), den ebenso aufwendig produzierten Literaturadaptionen (QUO VADIS, BEN HUR) und den historischen Abenteuerfilmen über Gladiatoren, Märtyrer und Apostel (THE ROBE, DEMETRIUS AND THE GLADIATORS, THE BIG FISHERMAN) gab es auch den sich dem Monumentalformat sperrenden "kleinen" Jesusfilm, die Schwarzweiß-Produktion mit Kammerspielcharakter, die ambitionierte Verkündigungs-Literaturadaption im Film (BARABBAS) oder Fernsehen (SIMON, EIN GEWISSER JUDAS), die sozialkritisch provokant nach den Konsequenzen der Verkündigung fragenden Spielfilme (LA RICOTTA, IL VANGELO SECONDO MATTEO). Diese Untergruppe mit den beiden Pasolinifilmen leitet zum zweiten Komplex des Postjesusfilms über. Zu ihnen gehören religionskritische, eine Sendungsideologie konterkarierende Filme (LA VOIE LACTEE), Transponierungen der Jesuserzählungen in den Musical- und Opernfilm (GODSPELL, JESUS CHRIST SUPERSTAR, EIN STERN GEHT AUF AUS JACOB), Verfremdungen und Aufbrechen des Harmoniebedürfhisses von Zuschauern durch radikale Umsetzung des historischen Jesus in die Gegenwart (PILATUS UND ANDERE, JESUS VON OTTAKRING, DAS GESPENST, SEOUL JESU), Verfilmungen biblischer Bücher unter Vermeidung des typischen Historienfilmgenres (ATTI DEGLI APOSTOLI, IL MESSIA), aber auch Rückfálle in den Stil des Historienfilms (GESÙ DI NAZARETH, THE LAST DAYS OF POMPEJI, THE LAST TEMPTATION OF CHRIST) oder gar in eine fundamentalistische Abfilmung der Bibel (JESUS). Den Protest gegen überkommene Sichtweisen
30
Bucher 344-346
21
signalisieren eine Jesusfilmpersiflage (MONTY PYTHON'S LIFE OF BRIAN) und eine Uminterpretation der Evangelien (THE PASSOVER PLOT). Von den 22 jüngsten (zwischen 1969 und 1989 hergestellten) Filmen wurden 13 auch oder ausschließlich für das Fernsehen produziert (von den letzten acht Produktionen ab 1982 waren nur zwei Kinofilme!). Unter ihnen gab es Fernsehspiele mit der Standardlänge von anderthalb bis zwei Stunden, einige Mehrteiler mit mindestens 60 Minuten pro Folge, aber auch knapp halbstündige Serien als typische Vorabendproduktionen. Ebenso vielfältig waren die Gattungen dieser TV-Spiele: Zu sehen waren u.a. eine Familienserie mit Intrigenkumulation (THE LAST DAYS OF POMPEJI), ein Kriminalfilm (L'INQUIESTA), ein Fernsehmonolog als Literaturadaption (VERTEIDIGUNGSREDE DES JUDAS), ein Kinderfilm (EIN KIND ΜΓΓ NAMEN JESUS), ein historischer Apostelfilm (A.D. - ANNO DOMINI). Dazu gehörten auch mehrteiligen Historienspiele, die sich von den historischen Ausstattungsfilmen nur durch den Wegfall der Ballettszenen und die Zurückdrängung der farbenprächtigen Prunkkostüme zugunsten einer auf monochrome Bildwirkung ausgerichteten Farbigkeit unterschieden, dafür aber die Exotik der Original Schauplätze und die Opulenz von betont schönen Einstellungen und exorbitanten darstellerischen Leistungen in den Dienst der alten Sache stellten. Der historische Ausstattungsfilm über Jesus ist passé. Er wird von stilistisch und inhaltlich vielfaltigeren Fernsehproduktionen abgelöst, ohne dadurch den früheren Rangplatz in der Unterhaltungsindustrie wiedergewonnen zu haben. Ähnlich den Jesusfilmen sind auch die meisten nach dem Tode Jesu spielenden Ausstattungsfilme über das Leben der Apostel und die Leiden der christlichen Märtyrer aus der Zeit der Verfolgung in der römischen Kaiserzeit nicht an einer primär den neutestamentlichen Texten verpflichteten Darstellung interessiert. Im Mittelpunkt steht in der Regel nicht ein Apostel, sondern die zentrale Figur dieser Apostel-, Märtyrer- und Gladiatorenßlme ist der aus allen Kämpfen siegreich hervorgehende Held, dessen Mut, kriegerisches Geschick und Charakterstärke mit der Verschlagenheit des niedergehenden Heidentums und dem Sittenverfall Roms kontrastiert und der auch da, wo er unterliegt, doch den moralischen Sieg (des Christentums) davonträgt. Die Verbindung zu dem in seiner Dramaturgie verwandten Typ der Jesusfilme wird durch Einblendung von Jesusreminiszenzen der nahezu obligatorischen Randfiguren Petrus oder Paulus hergestellt, deren hagiographische Funktion nur als Nimbusträger, als religiöse Autorität und in dem weihevollen Rezitieren feierlicher Texte besteht, die den biblischen Worten nachempfunden sind. Die Darstellung der Apostel folgt den Kreationen in der frühchristlichen Kunst, vor allem der Traditionen ihrer Kopftypen (Paulus: Kahlkopf, Petrus: Lockenkopf). Daß die Apostel und die übrigen Christen der frühen Kirche geborene Juden sind, daß Konflikte zwischen jüdischer Herkunft und christlichem Glauben, zwischen den jungen nichtjüdischen Christen und den Judenchristen entstanden (Stichwort: die Polemik des Paulus gegen die Auferlegung der Beschneidung bei zum Christentum übergetretenen Nichtjuden), daß das positive Reden vom eigenen christlichen Glauben zur Abwertung des
22 Glaubens der Juden führte und der theologische Antijudaismus hier eine seiner Wurzeln hat;31 dies alles ist nicht Gegenstand der Apostel- und Märtyrerfilme aus der Zeit der Christenverfolgungen in der römischen Antike. Nicht die jüdische Glaubenswelt wird vorgeführt, auch nicht das Eingepfropftsein des Christusglaubens in den jüdischen Stamm thematisiert, sondern die Bekehrungsgeschichte eines tapferen und edlen römischen Offiziers angesichts Cäsarenwahns und Christengemetzels in den Arenen liefert das "christliche" Alibi für die opulente Zurschaustellung aufwendiger Bauten, kostümierter Statistenmassen und circensischer Sensationen im BEN-HUR-Stil. Zusammenfassend läßt sich konstatieren: Jesusfilme und Jesusfernsehspiele, Apostelfilme und Apostelfernsehspiele haben sich im Laufe der Film- und Fernsehgeschichte in thematischer und gestalterischer Hinsicht weniger gewandelt als die filmische Erzählweise bei anderen Sujets. Die Nouvelle Vague am Ende der fünfziger Jahre und die sie im deutschen Kino fortsetzende Machart des Jungen Deutschen Films der sechziger Jahre haben nicht nachhaltig im biblischen Historienfilm ihre Spuren hinterlassen. Eine Reflexion über filmisches Erzählen, ein Diskurs über das Filmemachen als Bestandteil von Jesusfilmen, ein "Mißtrauen gegenüber den eigenen Bildern"'2, ein Abrücken von der Dramaturgie des historischen Films als einer Faktizitätsvortäuschung deutet sich erst spät in den achtziger Jahren an: in einem koreanischen Spielfilm und in einem polnischen Fernsehspiel. Beide (SEOUL JESU und MRZONK) lassen offen, ob die Jesusfigur Realität, Imagination, Fiktion oder Projektion ist, und beide bringen die soziale Wirklichkeit, die Probleme heutiger Gesellschaft stärker ein, als es in den Erzählmustern des altmodischen Bibelfilms der Fall war.
2.3.2. Zum antijüdischen Stereotyp in Spielfilmen und Fernsehspielen über die Zeit Jesu Antijüdische Topoi wie jener über eine "Schuld der Juden" am Tode Jesu und antijudaistische Stereotype sind aus folgenden Gründen nicht auf den Konsum von Jesus- und Apostelfilmen zurückzuführen:" - Der theologische Antijudaismus als "Sieg der Ecclesia über die Synagoge" hat seit knapp hundert Jahren (seit dem Vordringen des politisch-rassistisch-
31 32 33
Stegemann 1980, 117 Kaes 1987, 11 Vgl. Tabelle 1 am Kapitelschluß (Seite 27). Die Formulierung der Stereotype geht weitgehend auf die Kategorien bei folgenden Autoren zurück: Degani 1985, 3-16; H.M. Müller 1984, 1319; Schmelzkopf 1983, lf.; Knilli 1986, 115f. Vgl. auch Bergmann/Erb 1991, 312 u. 50-57. Über die Entwicklung des AS in der Bundesrepublik im Zusammenhang mit der Entwicklung einerseits des christlich-jüdischen Dialogs, andererseits der Produktion u./o. der Distribuierung von fiktionalen Produktionen mit jüdischen Figuren vgl. Peitsch 1990, 15-82.
23 ökonomischen Antisemitismus) nicht mehr den gleichen Stellenwert wie in den Jahrhunderten nach den Kreuzzügen. - Die nach 1945 produzierten Jesusfilme haben einen manifesten Antisemitismus bewußt vermieden, indem sie den Konflikt Jesu mit den Pharisäern und den privilegierten Jerusalemer Priestergeschlechtern nirgends zur Auseinandersetzung mit "den Juden" generalisierten und simplifizierten. Deshalb findet sich von den negativen Klischees der Judendarstellung in den Jesus- und Apostelfilmen nur ein einziges: das des Christenfeindes, und zwar vornehm- lieh in der Spezifizierung des Christusfeindes.34 Ambivalente Stereotype tauchen in Tonfilmproduktionen nicht mehr auf. Positivklischees der Judendarstellung finden sich nur am Rande, etwa in der äußerlichen Typisierung von Juden als alten und weisen Männern (z.B. in der Figur des Gamaliel) oder schönen und aparten Jüdinnen (in fast allen Jesusfilmen). Dennoch ist nicht auszuschließen, daß Spielfilme und Fernsehspiele über Juden und Christen zur Zeit Jesu sehr wenig zu einer differenzierten Sicht Jesu und seiner "leiblichen Brüder"35 beigetragen haben. Das hängt auch damit zusammen, daß von den 49 fiktionalen Produktionen im Grunde nur 4 jüdische Traditionen berücksichtigten: 1. Der amerikanisch-israelische Film THE PASSOVER PLOT ("Jesus von Nazareth") von Michael Campus, 1975, ist der einzige Spielfilm, der Jesus als Juden und Messias, nicht aber als Gottessohn, zeigt. Er wird als der sein Volk liebende (also nicht verwerfende), predigende, die jüdischen Gesetze und Vorschriften einhaltende jüdische Lehrer gezeigt, der gemeinsam mit dem Volk das "Schma Jisrael" betet und dazu die Gebetsriemen angelegt hat, der auch auch fröhlich mit den Fröhlichen ist und nach einer Beschneidungsfeier eine Brithmila tanzt. Die Darstellung des Pessachfestes als "Fest der Freiheit des Volkes Israel"36 in der von Israel eingehaltenen Reihenfolge der Mahlzeit (erst Wein, dann Brot)37 macht auch hier wieder deutlich: THE PASSOVER PLOT ist der einzige Jesusfilm, der Jesus als den nach den Geboten der Thora lebenden Juden zeigt. Viele Züge dieses Films mit seinen beeindruckenden Bildern und seinen aussagekräftigen Großaufnahmen entsprechen dem Jesusbild, wie es etwa die jüdischen Theologen Ben-Chorin, Flusser und Lapide gezeichnet haben.38 Der Film bringt sich allerdings um seine Wirkung, indem er im zweiten Teil weitgehend dem gleichnamigen Buch des gleichnamigen jüdischen Gelehrten Hugh
54
35 36 37 38
Auf Grund unserer systematischen Untersuchung von 48 zwischen 1935 und 1990 produzierten Spielfilmen und Fernsehspielen nach Themen des Neuen Testaments ist es uns aber nicht möglich, folgendem Fazit im Neuen Lexikon des Judentums 1992, 147 zuzustimmen: 'In den beliebten 'Bibelfilmen' wurde oftmals die Leidensgeschichte Jesu kombiniert mit dem tradierten negativen Judenbild des Christentums. " Lapide 1976, 49 Marquardt 1986, 7 Flusser 1982, 64 Ben-Chorin 1970 u. 1986; Flusser 1968 u. 1982; Lapide 1976, 1980 u. 1987; Lapide/Lutz 1979
24 J. Schonfield folgt:39 Um als Messias anerkannt zu werden, habe Jesus seinen Scheintod selbst eingeplant, sei bei der Kreuzigung in Ohnmacht gefallen, nach einem Tag erwacht und dann doch an den erlittenen Wunden gestorben - eine These, die nach Ben-Chorins Literaturbericht schon öfter vertreten worden ist.40 Eine Korrektur antijüdischer Topoi zeigt sich in der Interpretation der Verantwortung für den Kreuzestod Jesu: Nicht "die Juden" sind schuldig, sondern Pilatus ist schuld, daß er Jesus wegen dessen geplanten Aufstandes verurteilt habe. 2. Das mehrteilige, 1984 in internationaler Coproduktion entstandene Fernsehspiel A.D. - ANNO DOMINI (Anno Domini - Der Kampf der Märtyrer) von Stuart Cooper über das Leben und Leiden der Apostel von der Auferstehung Jesu bis zum Tod von Petrus und Paulus ist der erste Film des Apostel- und Märtyrergenres, der nicht nur Christen, sondern auch Juden als Verfolgte des Imperium Romanum darstellt. Der Film bemüht sich erfolgreich, einige weitverbreitete Denkklischees bei der Darstellung der frühen Christen bzw. des Frühjudentums zu vermeiden oder sie zu reduzieren. Er legt Wert darauf, das Aufgepfropftsein der jungen Christengemeinde auf den jüdischen Stamm deutlich werden zu lassen. Er spielt zu einer Zeit, in der das Urchristentum sich noch nicht endgültig vom Judentum und den Juden absondert, sondern noch im Judentum jener Zeit steht und die paulinische Theologie noch nicht als entscheidender Grund für die innere und äußere Trennung bewußt wird. Diesem Bild entspricht die Zeichnung des Paulus, der ja auch nach dem Damaskuserlebnis jüdischer Theologe geblieben ist bzw. "zugleich echter Jude und echter Christ war"41 und sich als Apostel des eines Gottes, Schöpfers von Juden und Heiden verstand, der sich von seinen Israel-Brüdern, vom Israel-Volk nicht abwandte.42 So wird sein Bekenntnis zu Jesus im Film auch nicht als eine Verdammung des jüdischen Weges hingestellt. ANNO DOMINI spielt kurz nach jener vielleicht nur zwei Jahrzehnte umfassenden Phase,43 in der die erste Generation der Christengemeinde sich noch vieler Gemeinsamkeiten mit dem Judentum, auf jeden Fall aber der sie tragenden Wurzel bewußt war. Die Trennung war noch nicht endgültig vollzogen, die Verfluchung der Judenchristen in den Synagogen, die Abfassung der Traktate "Adversus Iudaeos"44 stand noch bevor. Es war nicht zu erwarten, daß ANNO DOMINI schon eine differenzierte Darstellung von Juden und Judentum in der Lebenswirklichkeit des Imperium Romanum gab und in den Spielhandlungen das Verhältnis von römischem Staat und dessen ihn tragender Klasse zur Judenheit entfaltete, geschweige denn die Wurzeln von Judenhaß und Judenfeindschaft sorgfaltiger bloßlegte als nur mit den Stichwörtern von römischem Kaiserkult und
3
' Schonfield 1965 u. 1969 Ben-Chorin 1970, 12-21 41 Marquardt 1986, 91 42 Ben-Chorin 1980, 11 43 Noethlichs 1988, 42 44 Frank 1981, 30-45 40
25 jüdischem Proselytismus.45 Zu sehr ist die Auffassung vom Leben in der römischen Antike und erst recht deren kommerzielle Verwertung in Historienfilmen und -fernsehspielen noch an Vorstellungen von Christenverfolgungen gebunden, als daß jüdisches Eigenleben sorgfaltig thematisiert werden kann. 3. Im Nachmittagsprogramm des ZDF lief das 1988 von Italien und der Bundesrepublik produzierte, von Franco Rossi inszenierte vierteilige Fernsehspiel EIN KIND MIT NAMEN JESUS. Es schildert die gefahrvolle Flucht des siebenjährigen Jesus mit Maria und Joseph nach Ägypten und wieder zurück nach Nazaret. Unter Verwendung apokrypher Evangelien entstand ein dramatischphantastischer Kinder- und Abenteuerfilm, in dem das Kind Jesus Wunder tut und Visionen seines eigenen Schicksals hat. So problematisch die Jesuserzählung ist, gelingt dem Film doch dank seiner sorgfaltigen Milieuzeichnung ein glaubwürdiges Bild antiken jüdischen Glaubenslebens und jüdischer Solidarität. 4. Die wohl wichtigste Judendarstellung der jüngeren Fernsehgeschichte über ein biblisches Thema paßt überhaupt nicht in das Genre der Jesus- und Apostelfilme. Dieser 1988 vom Südwestfunk Baden-Baden produzierte, von Walter Jens verfaßte und Gustav-Adolf Bähr inszenierte halbstündige Fernsehmonolog VERTEIDIGUNGSREDE DES JUDAS mit Bruno Ganz in der Titelrolle ist die Adaption einer 1975 umfangreicheren Arbeit des Autors.46 Der Gegenstand dieses Fernsehspiels ist vordergründig der Versuch einer Rehabilitation der zum antisemitischen Stereotyp umgeformten Person des biblischen Judas bei der Passion Jesu: Er habe die Rolle des Verräters aus Liebe zu Jesus und mit dessen Einverständnis übernommen, um dadurch die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen zu beweisen. Zugleich reflektiert der Monolog die zweitausendjährige Verdammungsgeschichte der Figur des Judas bis hin zum antisemitischen Zerrbild. Er stellt das Judesein Jesu in den Zusammenhang mit der Shoah: Ja, ja - ich bin ein Jude. Aber der [Judas deutet auf das Kruzifix] war es auch, verdiente den gelben Fleck, hatte wie ich das "J" in seinem Ausweis gehabt und ums Verbot gewußt, sich nicht im öffentlichen Park auf einer Bank niederzusetzen. Den hätten sie genau so wie mich ins Gas gejagt, Jesus den Juden, Judas den Juden!
Von allen Filmen und Fernsehspielen mit jüdischen Figuren der biblischen Zeit ist Walter Jens' VERTEIDIGUNGSREDE das einzige Werk, in dem der theologische Antijudaismus zu einem zentralen Thema wird. Das Fernsehspiel hat seine besondere Funktion als Anstoßmaterial für den christlich-jüdischen Dialog und als Denkimpuls für eine veränderte, die bis dato vorherrschenden Stereotypen konterkarierende Präsentation von Juden in Bibelfilmen. In seiner Aufzählung von Stereotypen, die auch nach 1945 von der "Bewußtseinsindustrie" weiter benutzt wurden, nennt Friedrich Knilli in der Rubrik "Biblische Charaktere, Juden der Legende, der Literatur und der Geschichte" nach
45 w
Castritius 1984, 15-40 Jens 1975
26 Ahasver und Belschazzar auch Christus.47 In der Tat: Das auffälligste Stereotyp der Jesusfilme ist die Figur Jesu Christi. Bis hin zu Scorseses LAST TEMPTATION OF CHRIST verbreitet die Art seiner Präsentierung nicht die Erkenntnis, "daß unser Herr Jesus Christus ein auferstandener Jude" sei48, sondern sehr häufig das Stereotyp vom fast nicht mehr irdischen Außergewöhnlichen inmitten einer Welt von unscharf gezeichneten Feinden. Ein solches vorherrschendes Klischee ist nicht frei von antijudaistischen Komponenten, es trägt somit nichts zur Abwehr des Antisemitismus in der Bundesrepublik bei.
47
*
Knilli 1986, 116 Marquardt 1983, 133f.
27 Tabelle 1
ANTIJÜDISCHE TOPOI UND STEREOTYPE 1.
Antyüdische Topoi
1.1. Der theologische Antijudaismus der christlichen Kirchen - Kollektivschuld der Juden an Jesu Leiden und Sterben (Gottesmordthese) - jüdische Gotteslästerung, jüdischer Haß, jüdische Rachsucht - Unglauben, Verstocktheit, Blindheit - Auflehnung gegen Gottes Wort, Schriftverdrehung, Pharisäerheuchelei - Gesetzesreligion, Erwählungsdünkel, Werkgerechtigkeit - Juden als Teufelskinder und Teufelsdiener 1.2. Die Umformung religiöser Elemente in wirtschaftliche und soziale Motive - Jüdische Eigenschaften: Haß, Geldgier, Geiz - jüdische Knechtsmoral: faul, böse, verräterisch - jüdische Verbrechernatur: Blutdurst, Vergeltungsmoral (Hostienschändungen, Ritualmorde, Brunnenvergiftungen) 2.
Das jüdische Stereotyp als Ausformung antyüdischer Topoi
2.1. -
Negativklischees Christenfeinde Sittenverderber: geile Frauenverführer, unfähige Liebhaber skrupellose Händler und Wucherer rassisch Minderwertige: zersetzend, destruktiv, nihilistisch, wehrunwillig, marxistisch, parasitär, kapitalistisch - jüdische Männer: häßlich, abstoßend, gestikulierend, tänzelnd, guttural - jüdische Frauen: Vamps
2.2. Ambivalente Klischees - Ahasvertyp: uralt bzw. alterslos, flüchtig, verfolgt, verflucht - Personifizierungen dieser Klischees als literarische Figuren: Ahasver, Golem, Shylock 2.3. Positivklischees - begehrenswerte, schöne und geheimnisvolle Jüdinnen - weise und alte Juden - Gestalten der Hebräischen Bibel (Ester, Judit, Salomo, David), des Neuen Testaments (Jesus) und außerbiblischer Literatur (Nathan der Weise)
3. Luther ohne Juden
3.1. Jüdische Figuren in fiktionalen Produktionen über das Mittelalter Hatte der Einleitungsteil über Spielfilme und Fernsehspiele mit Judendarstellungen, die zur Zeit des jüdischen Altertums bzw. zur Zeit des Alten und des Neuen Testaments spielen, die Überschrift "Vom nicht wahr-genommenen Juden", so läßt sich der nun folgende, die Kapitel 3 bis 8 umfassende Hauptteil als "Der Weg aus dem Ghetto" beschreiben. In ihm werden jüdische Figuren in fiktionalen Produktionen über Mittelalter und Neuzeit bis zur Jüdischen Emanzipation analysiert. Von verschwindend geringen Ausnahmen abgesehen, wird die Geschichte der Juden im Mittelalter in Spielfilmen und Femsehspielen nicht thematisert. Jüdische Figuren dürften sich nur in der Form von sechs Klassikerverfilmungen eingeprägt haben: den fünf Studioinszenierungen und einer in Israel gedrehten Fernsehfassung von Lessings Schauspiel NATHAN DER WEISE. Die mit dem Aufstieg des Christentums einsetzende religiös motivierte Judenfeindschaft, der Antijudaismus, wird ebensowenig wie die wirtschaftlich argumentierende Judenfeindschaft gestaltet, und erst recht nicht finden sich Szenen auf Leinwand und Bildschirm, die das Selbstverständis des Judentums oder gar desen Mißdeutung interpretieren. Die Problematik der "christlich-jüdischen Beziehungsgeschichte" (Awerbuch) ist über die Reformationszeit hinaus kein zentraler Gegenstand in Spielfilmen und Fernsehspielen, sondern kann immer nur aus Randszenen einiger weniger Filme erschlossen werden.1 Auch wenn wir das Mittelalter gemäß der Chronologie jüdischer Geschichte als die tausendjährige Zeitspanne von 632 bis zur zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bezeichnen oder gar diese Epoche bis ins 18. und 19. Jahrhundert verlängern,2 lassen sich nur sehr wenige Judendarstellungen über diese Zeitspanne in fiktionalen Kino- und Fernsehfilmen ab 1945 registrieren. Osterland rechnete 1970 in seiner soziologischen Untersuchung des Filmangebots der Jahre 1949 bis 1964 von 537 vor der Jahrhundertwende spielenden Kinofilmen nur 133 (5,8% des Gesamtangebots) diesem Zeitabschnitt zu.3 Ähnliche Daten ergeben sich bei Fernsehspielen. Hickethier hat 1980 in seiner umfassenden Analyse des Fernsehspiels der Bundesrepublik herausgefunden, daß von 2410 untersuchten
1 2
3
Awerbuch 1984, 77 Ben-Sasson (1979, II) grenzt das Mittelalter bis zum Zusammenbruch der Sabbatäer-Bewegung ein, dagegen läßt Trepp (1987, 65-69) die jüdische Neuzeit erst nach dem Sieg der Aufklärung beginnen. Osterland 1970, 190 (Anzahl der untersuchten Filme: 2281 Stück)
29 Literaturadaptionen zwischen 1951 und 1977 (sie betrugen 58,7% der in diesem Zeitraum in der Bundesrepublik produzierten 4400 Fernsehspiele) 112 (5,4%) zwischen 1500 und 1799 spielen.4 Würde man die untersuchten Produktionen bis 1991 hochrechnen, käme man auf knapp 500 Titel, von denen aber nur ca. 10 gewichtige Judendarstellungen enthalten; das wären 2% des Angebots oder bestenfalls - wenn man die mehrteiligen Fernsehspiele auf die übliche Kinospielzeit von anderthalb Stunden umrechnete - 3%. Die Herausbildung antisemitischer Stereotype (abgekürzt häufig nur als "jüdisches"5 Stereotyp bezeichnet) von der Antike an, wo Juden als aussätziger, verbrecherischer, zersetzender Fremdkörper diffamiert wurden, bis zum von kirchlicher Tradition gespeistem Antijudaismus des Hochmittelalters wurde niemals zum Sujet historischer Filme. (Aber ebensowenig wurde getaltet, daß Juden und Christen trotz dieser Ausbrüche von Judenhaß fast ein Jahrtausend lang in Deutschland auch friedlich und fruchtbar miteinander gelebt haben.) Kein nach 1945 gezeigter Kino- und kein Fernsehfilm, dessen Handlung im Mittelalter spielt, erwähnt oder gestaltet die Vorwürfe der Hostienschändung, des Ritualmordes, der Brunnenvergiftung, des unsittlichen Lebenswandels, der Böswilligkeit, des Lügens und Betrügens, keiner führt die antijudaistisehen Thesen vieler Predigten, Schriften und Theaterspiele von der Züchtigung und Verwerfung der Juden wegen der Ablehnung Jesu als Messias vor, die dann seit dem "Schicksalssommer"6 von 1096 das Massaker der Kreuzzüge auslösten. Wären Spielfilme alleiniges Indiz für jüdische Existenz im Mittelalter, so gäbe es kein gesellschaftliches und kulturelles Leben der Juden, keine Sefardim und Ashkenasim, keine Auswirkungen des religiösen Judenhasses, keine Inquisition und Vertreibung der Juden aus Spanien und damit auch kein Marranenproblem, keine Angriffe eines Johannes Pfefferkorn und Martin Luther in Deutschland. U.W. ist nur ein einziges Fernsehspiel zu nennen, das von den eben beschriebenen jüdischen Lebens- und Leidensformen des Mittelalters einen Nachklang spüren läßt, nämlich DAS SCHÖNE. IRRE JUDENMÄDCHEN von Dietrich Feldhausen und Götz Fischer, das uns noch im 6. Kapitel ausführlicher beschäftigen wird. In der Epoche der Emanzipation, zur Zeit Friedrichs II. und Maria Theresias spielend, führt es die Nachfahren einer portugiesischen jüdischen Familie vor, die während der Inquisition wie zahllose andere spanische und portugiesische Juden in den Status der Neuchristen, der "Conversos", geflüchtet war, dennoch - wie sich der fromme Vater bitter erinnert - diskriminiert, als "Marranos" (Verdammte oder Schweine) beschimpft, "verleumdet, verleugnet und schließlich doch vertrieben wurde."7 In einer zweiten Szene wird eine andere Version des christlichen Antijudaismus in diesem Fernsehspiel vorgeführt: die
4 5 6 1
Hickethier 1980, 93 Degani 1985, 4 Poliakov 1977, I, 36 Ben-Sasson 1979, II, 241-250, 285-287, 299-317, 333-384; Poliakov 1981, IV; Leroy 1987; Marcu 1991; Schulin 1981; Eckert 1981, I, 210-264, Awerbuch 1985
30 jahrhundertealte Anschuldigung gegenüber den "abtrünnigen" Juden, sie seien ungläubig, worunter in polemischer Engführung verstanden wurde, sie glaubten nicht an Jesus Christus. Der Irrsinn des schönen Judenmädchens Esther, das aus Liebeskummer in einer Art Kurzschlußhandlung als erneute Conversa in ein Kloster geflüchtet war, wird durch jene grausame Prüfung der argwöhnischen Äbtissin eingeleitet, als Novizin in die Litanei einzustimmen: "Lasset uns beten für die ungläubigen Juden!"
3.2. Zur symptomatischen Ausklammerung des Problemfeldes "Die Reformation, Luther und die Juden" in historischen Filmen, Dokumentarspielen und Fernsehspielen Die Elimination jüdischen Schicksals in historischen Spielfilmen und Fernsehspielen über die Reformation ist ein besonders instruktives Beispiel für die Verdrängung der Thematik "Juden im Zeitalter der Reformation - der Reformator und die Juden" und wird wegen seiner Wirkungsgeschichte hier eingeschoben, obwohl dieses Kapitel dem Thema der Untersuchung im wörtlichen Sinne nicht zu entsprechen scheint, weil ja keine jüdischen Figuren in Lutherfilmen vorkommen. Man braucht nur die bisherigen Lutherfilme von der Stummfilmzeit bis zu den Jubiläumsfernsehproduktionen in Ost und West aus Anlaß des 500. Geburtstages des Reformators im Hinblick auf Luthers Stellung zu den Juden zu untersuchen, um die mangelnde Differenzierung des Lutherbildes im Film zu erkennen. Es geht dabei keineswegs ausschließlich um das Verhältnis Luthers zu Juden und Judentum seiner Zeit, denn die Wurzeln des Antisemitismus reichen nicht nur bis zu dem Mann in Wittenberg. Zwar ist es ein beliebtes Verfahren in biographischen Spielfilmen, Fernsehspielen und Dokumentarspielen, an der jeweils zum Titelhelden erkorenen Figur zeitgebundene Themen festzumachen, aber trotz der verhängnisvollen Wirkungsgeschichte der judenfeindlichen Äußerungen Luthers vor allem ab 1537 müssen diese doch einerseits im Zusammenhang seiner Theologie, andererseits als eine den Menschen Luther zwar nicht entlastende, dennoch typische Grundeinstellung im Zeitalter von Humanismus und Reformation generell gesehen werden.8 Aber eben um das Ansprechen dieses komplexen Problemfeldes, sei es an der Figur Luther, sei es an anderen historischen oder fiktiven Gestalten, drückt man sich herum bzw. es gerät das Them - bei Berücksichtigung der Produktionsverhältnisse wie der immer noch zu geringen Kenntnis entsprechender Forschungsergebnisse - einfach nicht in den Blick. Daß der in der Weimarer Republik produzierte evangelische Konfessionsfilm LUTHER - EIN FILM DER DEUTSCHEN REFORMATION von Hans Kyser aus dem Jahre 1927, der seinerzeit zu Spannungen zwischen dem deutschen Protestantismus und Katholizismus geführt hatte, weil dieser Film-Luther nicht nur 8
Oberman 1983, 125
31 von seinen katholischen Kritikern "als deutschnationale Symbolfigur zur Einigung des Nachkriegsprotestantismus"9 empfunden wurde, keinen christlichen Antijudaismus vertritt, weil er auf Zitate aus Luthers judenfeindlichen Texten verzichtete, mag ihm noch als Vorzug angerechnet werden. Andererseits gibt er, ganz im Geist des "deutschen Luther"10 inszeniert, keinen Impuls zur Aufarbeitung des diffizilen Verhältnisses zwischen Luther und den Juden. Dasselbe gilt dann für den ersten Tonfilm, den im Auftrag der amerikanischen lutherischen Kirchen 1953 als amerikanisch-deutsche Coproduktion von Irving Pichel unter deutscher theologischer Fachberatung (Pfarrer Peter Heinemann) stehenden und an den historischen Stätten gedrehten Spielfilm MARTIN LUTHER. Unbeschadet seines Spielfilmcharakters stellt der Film seine Szenen nicht als fiktiv, sondern suggestiv mit dem Anspruch der Wirklichkeit dar: So sei es gewesen!11 Luther wird als Vorbild für Glauben und Leben der zuschauenden Christen vorgeführt. Luther erscheint als ein Glaubensheros, der in den verschiedensten Situationen seit seinen Mönchstagen - in der Auseinandersetzung mit Tetzel, beim Studium der Schrift, bei der Verkündigung der 95 Thesen und der Verbrennung der Bannandrohungsbulle, auf dem Reichstag zu Worms ("Hier stehe ich!"), in Predigt, Katechismusstunde und in der Ehe - von der Kraft des gewaltigen Lutherchorals erfüllt ist: "Ein feste Burg ist unser Gott!" In der filmischen Darstellung schlägt die certitudo des Reformators in die securitas der "So-war-es"-Dramaturgie um. Der im Jahr nach seiner Uraufführung von fünf Millionen Besuchern in der Bundesrepublik (weltweit von sechzig Millionen) gesehene Film erhielt das Steuerbegünstigungsprädikat "wertvoll" und die Bewertung der evangelischen Filmgilde als "bester Film des Monats März 1954". Bei seiner europäischen Erstaufführung in Hannover erklärte Landesbischof Lilje, der Film biete "eine redliche Erzählung einer großen Epoche der deutschen Geschichte", und die Komprimierung sei glücklich gelöst worden;12 dabei hatte man beispielsweise die bereits gedrehten Szenen aus dem Bauernkrieg in der Endfassung weggelassen, "um die entscheidenden menschlichen Auseinandersetzungen möglichst überzeugend herauszuarbeiten."13 Der Sekretär des Lutherischen Weltbundes in Genf, Lundquist, sagte zu dem Film, er habe "Geschichte gemacht" und weites öku-
9
10
11 12 13
LIF 2346 nach Martin Luther: Zum Wkndel des Luther-Bildes in der Geschichtsschreibung und im Film 1983, 63f. Ginzel 1985, 191-196. Daß auch die meisten Juden in der Weimarer Republik und noch nach 1933 nicht die antijudaistischen Äußerungen Luthers kritisch verarbeiteten, laßt sich z.B. an einem Abriß der Geschichte des deutschen Judentums ablesen, den Julius Bab 1939 im Exil verfaßte: "Daß mit dem Werk Luthers jedenfalls in Deutschland Aufklarung und Toleranz begannen und damit zum ersten Mal die Möglichkeit einer Judenemanzipation dämmerte - das ist kein Zweifel." (Bab 1988, 30) Albrecht 1962, 6f Spandauer Voltsblatt, Berlin, 6.3.54 Der Tag, Berlin, 25.3.54
32 menisches Interesse in allen Teilen der Welt geweckt,14 was 1957 Proteste katholischer Kirchen und die anschließende Herausnahme aus dem bereits angekündigten Programm der Fernsehstation der "Chicago Tribune" sowie Gegenproteste der Protestanten nicht ausschloß. Konfessionell gegensätzliche Einschätzungen des Films waren auch in Deutschland spürbar. Keine der 29 im Medienkundlichen Pressearchiv der Landesbildstelle Berlin gesammelten Zeitungskritiken vermerkt das Fehlen von Passagen über Luthers Einstellung zu den Juden, ebenso wie G. Albrecht, der spätere Filmbeauftragte der Evangelischen Kirche, in seiner 1962 veröffentlichten Dissertation über "Probleme des religiösen Films" weder in der vorangestellten Biographie Luthers noch in den Einzelanalysen des Films darauf Bezug nimmt.15 Auch die vom Evangelischen Film-Beobachter zusammengestellten Diskussionsvorschläge eliminieren Luthers Verhältnis zu den Juden.16 Offenbar kommt hier die eine Traditionslinie des Lutherbildes zum Zuge, die bis in die jüngsten Fernsehproduktionen reicht und die Oberman so beschreibt: "[...] der kühne Reformator, der befreiende Theologe, der sprachgewaltige Deutsche - diese Gestalt ist 'judenftei'."17 Die 450jährige Wiederkehr der Reformation gab entgegen den üblichen Produktionspraktiken bei bevorstehenden Jubiläen offenbar keinen Impuls zur Herstellung von Luther-TV-Spielen in dem damals noch verhältnismäßig jungen Medium Fernsehen, denn die miteinander konkurrierenden Sender der ARD und des ZDF griffen zwar beide zu dem ergiebigen Stoff, aber jeweils einige Jahre vor oder nach dem Jubiläum, und beide schlugen verschiedene Wege ein. Das ZDF setzte auf das damals noch hoch im Schwange befindliche Genre der Dokumentarspiele, "die naiv-naturalistisch historische Ereignisse im Studio reproduzieren",18 während die ARD dem Typus des Originalfernsehspiels bzw. der Literaturadaption den Vorzug gab. 1964 produzierte die Bavaria im Auftrag des WDR ein Fernsehspiel von Leopold Ahlsen, dem Autor der in den fünfziger und sechziger Jahren sehr gefragten, formal traditionellen Bühnenstücke Philemon undBaukis, Raskolnikoff und Sie werden sterben, Sire. Wenn wir von dem erst später einsetzenden Genre der Bibelfernsehspiele absehen, stoßen wir mit Ahlsens Lutherfernsehspiel DER ARME MANN LUTHER19 zum erstenmal auf die in unserer Untersuchung sehr häufig vertretene Spezies der Literaturadaptionen, denn Ahlsens Fernsehspiel war vorher als Hörspiel produziert worden und wurde 1967 auch als Theaterstück angeboten.20 Der "arme Mann" ist der angefochtene Luther, der in seiner
14 15 16 17 18 19 20
Spandauer Volksbiatt, Berlin, 6.3.54 Albrecht 1962, 61-106 EFB 11/54 Oberman 1983, 125 Waldmann 1980, 68 Ahlsen 1968 Zu dem Verfahren des multimedialen Schreibens vgl. Prümm 1980, 54-74
33 Sterbestunde auf wichtige Stationen seines Lebens zurückblickt und am Ende die Gewißheit der Gnade erhält. Die Menschen, denen er begegnet, sind mehr symbolisch-allegorische Figuren als reale Menschen: der Vater, der Kaiser, der Kardinal, der Bruder, der Mönch. Die historischen Persönlichkeiten (Staupitz, Erasmus, Hutten, Sickingen, Müntzer) fungieren in Momentaufnahmen als Ideenträger. Das Volk bleibt Staffage; es besteht aus Bürgern und Bauern, Juden kommen nicht vor. Sechs Jahre später (1970) sendete der WDR in englischer Originalfassung in seinem Dritten Programm eine von der London Westend TV aufgezeichnete Studioinszenierung des Theaterstückes LUTHER von John Osborne, dem zur gleichen Zeit international erfolgreichen englischen Dramatiker (Look back in Anger, The Entertainer). Peter Zadeck, der 1962 das Stück in Bremen inszeniert hatte, deckte, wie Ernst Wendt in seiner Kritik nicht nur die Bremer Inszenierung, sondern zugleich das Stück selbst interpetierte,21 das überreizte Gewissen eines Mannes auf, der mit zerstörerischer geistiger Kraft sich selber martert und den Kampf gegen die Übel, die Dunkelheit seines Jahrhunderts in seiner tief verwundbaren, unruhigen Seele austrägt.
Sie deutet damit schon an, daß im Zentrum des Stückes trotz vieler auch theologisch und historisch stimmiger Partien des zweiten Aktes doch das Psychogramm des leidenden Mannes Luther steht, die Erkenntnis seines Versagens im Bauernkrieg - sie ist die gelungenste Szene des Stückes - im räsonnierenden Individualismus Luthers und in der forcierten Suche nach seiner Identität wieder aufgehoben wird. Wäre dieser Bauernkriegsszene eine damit durchaus vergleichbare Sequenz über die theologisch zu begründenden antijudaistischen Irrtümer des Reformators gefolgt, so müßte man nicht wie Hugh Ridley fragen, "warum Osborn seitdem [seit Blick zurück im Zorn, D.P.] an den wesentlichen Problemen der Zeit vorbeigeschrieben hat."22 Zwischen diesen beiden WDR-Literaturadaptionen entstand 1968 das ZDFFernsehdokumentarspiel DER REFORMATOR von Günther Sawatzki in der Inszenierung von Rudolf Jugert. Auch in dieser Produktion wurde auf eine Darstellung des Verhältnisses Luthers zur Judenheit und zum Judentum verzichtet.23 Das Dokumentarspiel bot einen auf die Zeit zwischen 1517 und 1530 begrenzten Ausschnitt der Ereignisse, im einzelnen: Ablaßhandel Tetzeis in Jüterborg, Leipziger Disputation Luther - Eck, Verhör durch Cajetan, Schutz durch den Landesherrn Friedrich den Weisen, Reichstag zu Worms, Junker Jörg auf der Wartburg, Luthers Ehe mit Katharina von Bora, Reichstag zu Ausgsburg. Tenor des Spiels: nicht Spaltung der Kirche, sondern Erneuerung. 21 22 23
Wendt 1962 Ridley in KLFO, 8.Nlg„ 9 Nach telefonischer Mitteilung des ZDF-Redakteurs Otto Hermann Schneider an den Verfasser. Eine Besichtigung des Fernsehspiels scheiterte aus technischen und finanziellen Gründen. Alle schriftlichen Unterlagen incl. Drehbuch sind lt. Schneider wie bei manchen dieser älteren Produktionen vernichtet worden, so daß eine Analyse unterbleiben mußte. Angaben zum Inhalt nach Zeutzschel u. Martin Luther: Zum Wandel des Luther-Bildes ... 1983, 111-115
34 Hatten die beiden ersten Lutherspielfilme und die beiden ersten Literaturadaptionen im Fernsehen mit ihrer weitgehenden Ausklammerung der politischen, sozialen und ökonomischen Verhältnisse auch den Problembereich "Luther und die Juden" ausgeblendet, so durfte man gespannt sein, ob die Großproduktionen zum "ersten Lutheqahr nach dem Holocaust"24 die Erkenntnisse einer "Theologie nach Auschwitz"25 berücksichtigen und damit auch den verdrängten und tabuierten Komplex über Luthers Stellung zu den Juden verarbeiten würden. In den letzten Jahren war bei einer Gruppe evangelischer und katholischer Theologen die Erkenntnis gewachsen, daß man nicht mehr wie in der Reformationszeit die Juden als das ungehorsame Israel ansehen konnte, das sich von der Kirche als dem wahren Israel getrennt habe, weil eine solche Sichtweise Ausfluß eines Judenhasses war, den zwar Humanismus und Reformation nicht erfunden, aber doch "vorausgesetzt" hatten.26 Statt weiterhin zu tabuisieren, daß es außer der Arbeit des frühen Luther Daß Jesus Christus ein geborener Jude sei (1523) spätere antijudaistische Lutherschrifien gegeben hat, deren aus dem Kontext gelöste Einzelzitate oder auch deren Titel (z.B. die Schrift von 1543 Von den Juden und ihren Lügen) nur als Schmähschriften interpretierbar zu sein schienen, untersuchten nun die einen dauerhaften christlich-jüdischen Dialog anstrebenden jüdischen und christlichen Theologen einerseits den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Schriften Luthers und der judenfeindlichen Literatur der Epoche, andererseits die Folgen von Luthers Äußerungen in Wort und Schrift. Ansätze zu einer differenzierten Kritik von Luthers Einstellung zur Judenheit waren bei jüdischen Historikern schon im 19. Jahrhundert erkennbar. Hatte z.B. Heinrich Graetz in seiner ab 1853 erschienenen Volkstümlichen Geschichte der Juden Luthers Rat von 1523, daß man an den Juden "der christlichen Liebe Gesetz üben und sie freundlich annehmen, mit lassen werben und arbeiten" müsse, noch als ein Wort gerühmt, "wie es die Juden seit einem Jahrtausend nicht gehört hatten", so interpretierte er die "leidenschaftliche, giftige Schrift" von 1543 sachlich und psychologisch (Luther sei in zunehmendem Alter sehr verbittert gewesen bzw. "Das war zuviel für ihn"),27 lieferte damit aber unbewußt den Verharmlosem einen Vorwand des Verrechnens von einer projüdischen Schrift mit den antijüdischen Schriften, worauf Kremers, Siegele-Wenschkewitz und Klappert zu Recht hingewiesen haben.28 Daß es sich aber in der Gegenüberstellung der Lutherschriften von 1523 einerseits und 1537-43 andererseits nicht einfach um eine "Wandlung" handelte, wie z.B. 1960Kupisch, 1961 Stöhr, 1963 Kampmann, 1981 Deppermann annahmen und was 1991 auch Küng mit seinen antithetischen Formeln "Anwalt der Juden"/ "Anwalt der Gewalt" wieder aufnimmt, zeigten die der Kontinuitätskonzeption verpflichteten Studien von Harder, Maurer, Bohn und
24 25 26 27 28
Die Juden und Martin Luther 1985, S. XIII Auschwitz - Krise der christlichen Theologie 1980 Obennan 1983, 14 Graetz 1985, V, 202 u. 262 Die Juden und Martin Luther 1985, z.B. 13
35 Brosseder sowie die Arbeiten von Ehrlich und Siegele-Wenschkewitz, die besonders auf die nicht auszublendende und schon zu Luthers Zeiten begonnene Wirkungsgeschichte den Akzent gesetzt haben, eine Sichtweise, die sie mit Poliakov teilen und die Eingang selbst in populärwissenschaftliche Werke gefunden hat.29 Die zuletzt genannten Autoren vertreten vielmehr die These von einer gleichbleibenden, allenfalls nur leicht modifizierten Einstellung Luthers in seinen Schriften über die Juden: Luthers Auffassung, daß das Heil für (eine Minderheit der) Juden nur in ihrer Bekehrung zu Christus liegen könne und die bisherige Gestalt des Christentums ihnen den Weg zum verheißenen Messias = Jesus Christus versperrt habe, weil Juden so schimpflich behandelt worden seien, spiegelt sich in der Titulierung der Juden als "Blutsfreunde, Vettern und Brüder unseres Herrn". In dieser Schrift von 1523 empfiehlt Luther den Christen der Reformation, daß sie die Juden "freundlich annehmen" sollen, um ihnen zu ermöglichen, "christliches Leben zu hören und zu sehen", d.h. Bekanntschaft mit dem nun vom Gesetz gereinigten Evangelium zu machen. Auch hier ist also schon deutlich die Bedeutung des "Bei und um uns sein" der Juden herauszuhören: Abkehr von der Thora! Wo das trotz aller Barmherzigkeit, Geduld und allen Warnungen nicht geschehe, die Einladung zu Jesus Christus ausgeschlagen werde, wo jüdische Lehre weiterhin leugne, daß der Mensch nicht durch eigene Lebensführung gerecht gemacht werden könne, sondern allein von der Gnade Gottes abhängig sei, da müsse dann die "scharfe Barmherzigkeit" der Obrigkeit greifen, da trete dann an die Stelle der "dogmatischen Religionspolemik" die "politische Judenfeindschaft" des Kirchenpolitikers, der den "Staatsschutz für den kirchlichen Alleinwahrheitsanspruch" empfiehlt30: Vernichtung jüdischer Häuser und Synagogen, jüdischer Gebet- und Lehrbücher, Verbot jüdischer Lehre und jüdischer Gottesdienste sowie jeder Form des Handels und der Straßenbenutzung, Anordnung von Zwangsarbeit für junge Juden und Jüdinnen, schließlich - wie in zahlreichen Staaten Europas und vielen anderen Territorien Deutschlands - die Vertreibung ( Von den Juden und ihren Lügen, 1543). Luthers unveränderte theologische Grundüberzeugung war die These von der notwendigen Bekämpfung des Judaismus. Darunter verstand er das Festhalten an der jüdischen Gesetzesreligion, am toten Buchstaben der Gesetzlichkeit, der das Evangelium, die Kirche, die junge Reformation zu verderben drohe. Alle antigöttlichen Mächte, seien es Römer, Türken, Heiden, Häretiker oder ungetaufte Juden, gehören in diesen antijudaistischen Zusammenhang. Solche theologische Linie verbindet die Judenschriften von 1523 bis 1543. Die "Wandlung" Luthers besteht in den Konsequenzen für Juden seiner Zeit und künftiger Generationen ,
29
30
Über die Diskontinuitäts- und Wandlungsthese sowie die Kontinuitätskonzeption s. Meier 1988, 260-264. Vgl. auch Kupisch 1960, 69-88; ders. 1962, 79-86; Kampmann 1963, 41-47; Deppennann 1983, 110-130; Stöhr 1985, 89-108; Harder 1986, 47-58; Maurer 1988, I, 362452; Bohn 1980, 51-68; Ehrlich 1985, 47-65; Brosseder 1985,109-135; Siegele-Wenschkewitz 1985, 351-367; Küng 1991, 230-234; Pertsch 1983, 78-80; Keller 1966, 329-332 Bienert 1982, 136, 146, 154f.
36 nämlich in der "Umwandlung des theologischen Antijudaismus in gnadenlose politische Judenfeindschaft".31 Die bis zum "Lutheijahr 1983" entstandenen Lutherfilme und -fernsehspiele klammerten, wie wir gesehen haben, die jüdische Thematik aus. Das mag mit der zu geringen Sensibilität gegenüber dem Problembereich zusammenhängen, aber auch mit der kaum zu lösenden Problematik, in der knappen Spanne von 90 Minuten Laufzeit drei miteinander zusammenhängende Themenkreise innerhalb eines biographischen Spielfilms zu visualisieren: - die politische, wirtschaftliche und soziale Lage der Judenschaft in Deutschland zur Zeit der Reformation - Luthers von der Frühzeit bis zu den späten Streitschriften einheitliche theologische Konzeption gegenüber der Judenheit - Luthers aus seiner kirchenvaterähnlichen Position eines Dogmenwächters und Kirchenpolitkers abgeleitete Forderungen an die christliche Obrigkeit und deren Auswirkungen auf die religiöse, soziale und politische Lage der Judenschaft in der Zeit der Reformation und danach.32 Die z.T. mit äußerster Grobheit vorgetragenen Forderungen Luthers, die in Predigten der Gemeinde und in Briefen den Landesherren als politisch notwendiges Handeln vorgestellt wurden, sind insgesamt von den evangelischen Fürsten nicht erfüllt worden, obwohl Sachsen sich "rühmen" konnte, "judenfrei" zu sein.33 Ob Luther die methodischen Konsequenzen seiner theologisch-kirchenpolitischen Argumentationskette durchdacht hatte, wissen wir nicht, aber von der Notwendigkeit einer mit "scharfer Barmherzigkeit" zu vollziehenden Scheidung von Christen und Juden war er überzeugt. Daß die katastrophale Wirkungsgeschichte seiner Überlegungen bis ins 20. Jahrhundert reicht, soll am Ende dieses Kapitels an einem filmischen Beispiel demonstriert werden. Mit Sicherheit wäre es selbst den mehrteiligen Lutherfernsehfilmen des Jahres 1983 nicht möglich gewesen, das globale "Luther-und-die Juden"-Thema auch nur annähernd differenziert zu gestalten. Aber wurden Impulse gesetzt? Es gelang zwar dem fünfteiligen (insgesamt siebeneinhalbstündigen) DDR-Fernsehfilm MARTIN LUTHER von Hans Kohlus (Szenarium) und Kurt Veith (Regie), der sich als "künstlerischer Beitrag zur nationalen Lutherehrung 1983" verstand, das ausgewählte Jahrzehnt von 1517 bis 1527 in wesentlichen Stationen der Biographie Luthers und der Entwicklung der Reformation von der Ablehnung des Ablaßhandelns über das Verhör durch Cajetan in Augsburg, die Disputation mit Eck in Leipzig, den Auftritt Luthers auf dem Reichstag zu Worms bis zur Heirat mit Katharina von Bora so vorzuführen, daß die bisher in der DDR-
31
32 33
Siegele-Wenschkewitz 1985, 361. Luther selbst hat körperliche Gewalt und Tötung von Juden nicht angeregt oder gutgeheißen (Ausnahme; Tischrede vom Frühjahr 1943, zit. bei Bienert 1982): "Luther wies nicht den Weg nach 'Auschwitz'" (Bienert, 152). Zur Diskussion Bienert/Brosseder vs. Ehrlich s. Pertsch 1990, 270-273 Maurer 1988, I, 363-427 Kupisch 1962, 86f.
37 Geschichtsschreibung überproportional akzentuierte revolutionäre Traditionslinie (Bauernkrieg und Müntzer) sich angemessen in diesen Bilderbogen einfügte. Es wurden aber weder die antijüdischen Forderungen der Bundschuhbewegung und des Deutschen Bauernkrieges noch die Eingaben des Sprechers der Judenschaft, Josel von Rosheim, Bauern- oder Handwerkertätigkeiten statt des "schweren Jochs" der Zinsgeschäfte ausüben zu dürfen (womit sich eine wirtschaftliche neben der religiösen Wurzel des Judenhasses im frühen 16. Jahrhundert belegen läßt)34 szenisch gestaltet, noch der eine oder andere Aspekt der drei angeführten Themenkreise aufgenommen und entfaltet. Veith und Kohlus drängten die hagiographischen Elemente des Reformatorbildes zurück, korrigierten es aber nicht so stark, daß Luthers antijudaistische Auffassung zur Sprache kam, zumal der Theologie Luthers nicht das primäre Interesse der Filmemacher galt. Insofern leistete die vor der Wende in der Bundesrepublik nur von den Dritten Programmen der ARD ausgestrahlte Fernsehserie keinen Beitrag zur Wahrnehmung des Problemfeldes "Die Reformation, Luther und die Juden" und damit für eine gegen den Antisemitismus gerichtete Aufklärungsarbeit. Somit konnten sich die Hoffnungen auf eine angemessene Gestaltung der Judenthematik in der Reformation nur noch auf den westdeutschen Femsehbeitrag des ZDF richten, zumal der Regisseur dieses dreieinhalbstündigen Zweiteilers MARTIN LUTHER. Rainer Wolffhardt, durch die Inszenierung eines "Jud-Süß"Fernsehspiels seine Eignung für das komplexe Problemfeld gezeigt und Theodor Schübel (Buch) als Autor historischer Theaterstücke und Fernsehspiele bereits einschlägige Erfahrungen gesammelt hatte. Aber leider wies das ausschließlich in und vor der lutherischen Lorenzkirche in Nürnberg gedrehte und an dem für geistliche Film- und Fernsehspektakel reservierten Datum des Karfreitages und Ostersonntages gesendete Televisionsdiptychon nicht nur viele liebgewonnene Lutherlegenden wie die effektvollen Szenen des laut hallenden Thesenanschlags an der Wittenberger Schloßkirchentür, der Schlußsentenz zu Worms ("Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, amen!") und der telegenen Verbrennung der Bannandrohungsbulle Leos X. auf. Es verzichtete auf manche nicht unwichtigen Figuren wie Melanchthon und Eck, typisierte andere statt zu charakterisieren (Tetzel, Cajetan, Leo). Vor allem vermochte es den politischen, sozialen und geistigen Hintergrund bestenfalls anzudeuten. Und so fehlten eben auch in diesem Fernsehfilm Luthers theologisch begründete antijudaistische Auslalle, seine Fehleinschätzung der Juden als Aufrührer und falsche Ausleger des Alten Testaments.35 Dabei wäre es verhältnismäßig leicht gewesen, von der Figur des recht gut getroffenen, durch Lambert Hamel kongenial verkörperten Luther in seiner politischen Naivität, seinem Unverständnis für soziale Zusammenhänge und seiner geringen Kenntnis von Judentum und Juden36 ausgehend, den Reformator als
34 35
*
Deppermann 1983, 114f. Harder 1986, 53 Schreiner 1985, 58-71
38
"einen Menschen des Mittelalters"37 zu zeichnen, der von dessen antijüdischen Stereotypen besetzt war. Eben dieses in Lutherfilmen nicht angesprochene jüdische Stereotyp hat in der Antisemitisforschung großes Gewicht. Ob Poliakov durchgehend in seiner Geschichte des Antisemitismus, Lapide in fast allen seinen Schriften39, K.S. Frank in seinem Beitrag über die Polemik der Alten Kirche gegen die Juden40, D. Mertens41 und F. Graus42 über Judenpogrome im 11./12. und 14. Jahrhundert - in allen diesen Arbeiten wird deutlich, daß eine durch christliche Theologie begründete Judenfeindschaft lange nachwirkende Stereotype bildete, die zweifellos Einstellungen zu Juden in der Reformationszeit und danach negativ verstärkten. Da wir uns mit der Konstanz dieses Stereotyps im Laufe unserer Untersuchung wiederholt befassen müssen, sei Deganis Überblick über die zur Zeit Luthers virulenten generalisierenden antijüdischen Urteile an dieser Stelle referiert.43 Als alteingewurzelte Elemente gelten die "Kollektivschuld an Jesu Leiden und Sterben", der "Gottesmord", der "jüdische Haß". Hinzu kommen die "Gotteslästerung" der Juden, ihr "Unglauben", ihre "Verstocktheit" und "Blindheit", ihre "Auflehnung gegen Gottes Wort". Juden werden als "Teufelskinder und -diener" ihrer menschlichen Qualitäten entkleidet, ihre "Unreinheit und Gefährlichkeit" förderte die Judenangst, die von Christen empfohlene "Verachtung der Juden" unterstrich ihre Rechtlosigkeit als Folge des "Sieges der Ecclesia über die Synagoge". Nach den Kreuzzügen wurden die anfänglich rein religiösen Elemente ("Schrifitverdrehung" als Vorwand für das Verbot des Talmuds) zugunsten wirtschaftlicher und sozialer Motive verlassen und Juden als "Wucherer" stigmatisiert, Judas Ischariots Verrat wurde mit "jüdischen Eigenschaften wie Haß, Geldgier und Geiz" erklärt, die auch wirtschaftliche Unfreiheit der Juden mit ihrer Eigenschaft als "faule, böse und verräterische Knechte" begründet. Ihr in angeblichen Hostienschändungen, Ritualmorden und Vergiftungen sich artikulierender "Blutdurst", ihr "Verbrechertum" und ihre "Mordsucht" fände die Entsprechung in ihrer "häßlichen Gestalt" und ihrem "fremdartigen Auftreten" wie Gestikulieren, tänzelndem Gehen und gutturaler Sprache. Diesen Lasterkatalog kann man mit Lapide noch durch eine zweite Verleumdungsliste ergänzen: "Zinswucher, Habgier, 'Pharisäerheuchelei', Judasnatur, frauenfeindlicherPatriarchalismus, Gesetzesreligion, blutige Vergel-tungsmoral, Rachsucht, Erwählungsdünkel, Werkgerechtigkeit"44, Begriffe, deren Wurzeln zweifelsfrei größtenteils in die Vorlutherzeit reichen. Jüdische Stereotype und ihre Auswirkung auf Luther wurden, wie wir gesehen haben, auch in den jüngsten TV-Produktionen nicht thematisiert. Film und 57 38
" 40 41 42 43 44
Harder 1986, 48 Poliakov 1977, 1978, 1979, 1981, 1983, 1988a, 1988b (I-VII) Lapide 1976, 1980, 1984, 1985, 1987 Frank 1985, 30-46 Mertens 1985, 46-67 Graus 1985, 68-84 Degani 1985, 3-16; vgl. auch Tabelle 1 Lapide 1987, 8
39 Jüdische Stereotype und ihre Auswirkung auf Luther wurden, wie wir gesehen haben, auch in den jüngsten TV-Produktionen nicht thematisiert. Film und Fernsehen haben die Chance, die im Gedenkjahr in Kirche und Öffentlichkeit so gut wie ausgeklammerte Problematik "Die Reformation und die Juden" aufzugreifen, nicht genutzt. Es mag sein, daß das in Bezug auf die Einstellung zu den Juden defizitäre Lutherbild der Lutherfilme in der Sorge der Filmemacher begründet war, das Thema nicht differenziert genug gestalten zu können und sich womöglich den Vorwurf des Antisemitismus einzuhandeln. Schließlich waren schon einmal judenfeindliche Texte in einem Spielfilm an dramaturgisch bedeutsamer Stelle eingefügt worden, um damit im Handlungsablauf den Widerstand der Bevölkerung gegen die Herrschaft "der" Juden - personifiziert in der Gestalt eines einflußreichen Hoffaktors - zu begründen und mit dem Vorwurf der "Rassenschande" zu vermengen. 1940 ließen die Drehbuchautoren Veit Harlan, Eberhard Wolfgang Möller und Ludwig Metzger in dem berüchtigten antisemitischen Film JUD SÜSS das in der Figur des Landschaftskonsulenten Sturm verkörperte arische Volk dem Herzog von Württemberg unterbreiten: "Schickt den Juden weg und haltet zu uns Schwaben [= Deutschen, D.P.]!" In der Filmszene begründet Sturm dem Herzog und der Delegation der "Landschaft" seinen Appell45: Wenn Eure hochfürstliche Durchlaucht sich schon nicht an die Verfassung halten, so sollten Euer Durchlaucht sich doch wenigstens an Luthers Rat halten, und der sagt [Sturm liest vor): "Darum wisse, du lieber Christ, daB du neben dem Teufel keinen giftigeren Feind hast denn einen rechten Juden. Ich will dir meinen treuen Rat geben, erstlich, daB man ihre Synagogen und Schulen mit Feuer anstecke, zum anderen, daß man ihnen nehme alle ihre Betbüchlein und Talmudisten, darin solche Abgötterei und Lug gelehrt wird, zum dritten, daß man ihnen den Wucher verbiete, zum vierten [•••V46
In seinen Rechtfertigungs- und Reinwaschmemoiren, in denen der Regisseur und Co-Autor Veit Harlan sich fast als Widerstandskämpfer gegen die Herstellung des JUD SÜSS aufspielt, will er das Lutherzitat zunächst aus dem Drehbuch gestrichen haben, weil "Luther so etwas niemals gesagt haben könne", habe den "gräßlichen Satz" aber stehen lassen müssen, nachdem Goebbels ihm den Originalwortlaut gezeigt hatte.47 Auf die antisemitische Propagandawirkung des JUD-SÜSS-Films werden wir im 5. Kapitel noch näher eingehen. Der Verweis auf Luther, den Julius Streicher im Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß exemplarisch als Kronzeuge für alle postfaschistischen Antisemiten anführte,48 dürfte die antisemitischen Effekte des Films verstärkt haben. Umso nötiger wäre es gewesen, in einer TV- oder Filmdarstellung Luthers nach Auschwitz nicht Lutherhagiographie zu betreiben,
45
Nach den beiden Filmprotokollen von Maurer/Radevagen 1983 u. Hollstein 1971 In den Anmerkungen zu ihrem Filmprotokoll weist Hollstein (1971, 355) die bis auf den Anfang und die Reihenfolge wörtliche Übereinstimmung der Filmrede mit dem lutherischen Original nach. " Harlan 1966, llOf. 48 Kupisch 1962, 78f.; Deppennann 1983, 110 m
40 sondern auch Luthers Haltung zur Judenheit wie deren fatale Wirkungsgeschichte differenziert zu zeigen. Das ist jedoch unterblieben. Dieses Stück Trauerarbeit hat im Film noch nicht angefangen. Der jüdische Theologe und Wegbereiter des christlich-jüdischen Dialoges Schalom Ben-Chorin beginnt seinen so verständnisvollen Aufsatz über Luther und die Juden nicht von ungefähr mit dem Ausziehen der verhängnisvollen Linie vom 10. November 1483 zum 10. November 1938 sowie mit dem Herstellen der Verbindung zwischen Luthers Pamphlet und der Verwirklichung dieses Programms durch die Nationalsozialisten.49 Evangelische Publikationen aus dem Pogromerinnerungsjahr 1988 über das Verflochtensein, die Verstrickung evangelischer Theologie und Kirche angesichts der Shoah im 20. Jahrhundert verweisen auf die "jahrhundertealten antijüdischen theologischen Vorprägungen".50 Das meint, daß die bis zu den antijudaistischen Elementen im Neuen Testament reichende Schuldverflochtenheitslinie immer über Luther fuhrt, der jüdische Menschen in ihrem tiefsten Wesen wohl nicht wahrgenommen hat. Lutherfilme, die sich immer gerne als dem evangelischen Protestantismus verpflichtet ausgeben, haben ebenso wie die nur auf Reproduktion des "kulturellen Erbes" angelegten "Lutherehrungen" die jüdische Thematik verdrängt. So beginnt denn die Präsentation jüdischer Menschen und jüdischen Schicksals im Mittealter erst mit einem Film, der sich um die historische, im Mittelpunkt zahlreicher Legenden stehende Figur des Maharal von Prag rankt, jenes jüdischen Theologen und Kabbalisten Löwe Juda Ben Bezalel, der als der Hohe Rabbi Low in dem Ruf eines Wundertäters stand und auch einen Golem geschaffen haben soll.
4
' Ben-Chorin 1988, 135 Bethge 1988, 7. Ähnlich Marquardt (1988,74f.), der "die Situation radikaler Fraglichkeit von Theologie" in den Zusammenhang mit den "Judenmorde[n] unseres Jahrhunderts und ihre[n] von Theologie und Kirche zu verantwortenden Voraussetzungen und Folgen" rückt.: "Erst langsam beginnt eine Besinnung darauf, wie tief Christen durch antijüdische Elemente der neutestamentlichen Christusverkündigung, - durch ihre Auslegung in Dogmen und Theologien der Kirche, - durch den praktischen Gebrauch, den die Kirche während anderthalb Jahrtausenden im Abendland davon machte, und schließlich: durch ihre Widerstandslosigkeit gegen die Verbrechen, die darauf fußten, verflochten sind in Schuld."
50
41 Tabelle 2 CHRONOLOGIE LUTHER
DER
SPIELFILME
UND
FERNSEHSPIELE
ÜBER
ORIGINALTITEL Regisseur; Herstellungsland; Produktion, Produktionsjahr Kurzcharaktensierung
LUTHER - EIN FILM DER DEUTSCHEN REFORMATION Hans Kyser; Deutschland; Cob Films, 1927 Während der Stummfilmzeit mit Eugen Klopfer in der Titelrolle produzierter Spielfilm, der im Stil des deutschen Filmexpressionismus ungebrochenen Protestantismus mit Nationalismus verband und zu erheblichen Spannungen zwischen den Konfessionen führte.
MARTIN LUTHER Irving Pichel; BRD/USA: Luther-Film/Lutheran Church, 1953 Historisch-biographischer Spielfilm mit Niall McGinnis in der Titelrolle, der die Reformation als eine der entscheidenden Epochen der (Kirchen-)Geschichte und Luther als Vorbild für Glauben und Leben der Christen hinstellt. Auch dieser Film führte zu Kontroversen.
DER ARME MANN LUTHER Franz Peter Wirth; BRD: WDR/Bavaria, 1965 Femsehspiel von Leopold Ahlsen mit Hans Dieter Zeidler in der Titelrolle. Der sterbende Luther blickt auf Stationen seines Lebens zurück, in denen sein Gewissen gefordert wurde, und stirbt in der Gewißheit der Gnade. Kein Historienfilm, sondern Stationenendrama einer religiösen Entwicklung.
DER REFORMATOR Rudolf Jugert; BRD: ZDF, 1968 Fernsehdokumentarspiel von Günther Sawatzki mit Christian Rode in der Titelrolle. Die Ereignisse von 1517 bis 1530 (vom Thesenanschlag über die Wartburgzeit bis zum Reichstag von Augsburg) werden in Spielszenen nachgestellt. Luther erscheint als der Reformator, der nicht die Kirche spalten, sondern erneuem wollte.
LUTHER England: London Westend TV; WDR III, 1969 TV-Studioinszenierung des gleichnamigen Theaterstückes von John Osborne als Psychogramm eines Mannes, der sich mit seinem Gewissen herumschlägt und seine Identität sucht. Die historischen Ereignisse sind nur die Folie für die Darstellung seines Gewissenskampfes. Das in der englischen Originalsprache belassene Fernsehspiel wurde 1970 nur im III. Programm des WDR gesendet.
MARTIN LUTHER Rainer Wolffhardt; BRD: ZDF/Eikon, 1983 Femsehspiel in zwei Teilen von Theodor Schübel mit Lambert Hamel in der Titelrolle (1 .Teil: Vor dem Bruch mit den kirchlichen Autoritäten, 2. Teil: Wartburg, Bauernkrieg, Heirat). Der Film versucht, Konflikte Luthers auch Fehlentscheidungen - und bisher in Filmen eliminierte Ereignisse (Müntzer!) ohne den So-war-es-Anspruch des Dokumentarspiels darzustellen, was ihm aber nur teilweise gelingt.
MARTIN LUTHER Kurt Veith; DDR: Dtsch. Fernsehfunk. West:III.Progr.,1983 Fernsehfilm in fünf Teilen von Hans Kohlus über das Jahrzehnt von 1517- 1527 mit Ulrich Thein in der Titelrolle. Wesentliche Stationen von der Bekämpfung des Ablaßhandels bis zur Heirat mit Katharina von Bora werden in beeindruckenden, unpolemischen Sequenzen gestaltet, Hagiographie wie Denunziation gleichermaßen vermieden.
4.
DIE LEGENDE VOM GOLEM IN LITERATUR UND FILM: Über den Stummfilm DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM und das mittelalterliche Ghetto
Nur fünf nach 1945 in der Bundesrepublik gezeigte fiktionale Produktionen mit jüdischen Figuren stellen das (christliche) Spätmittelalter bzw. die frühe Neuzeit in den Zusammenhang mit der jüdischen Geschichte: eine Fernsehinszenierung von Shakespeares Bühnenstück THE MERCHANT OF VENICE, ein Fernsehspiel über die Erstürmung des Frankfurter Ghettos 1614, zwei Produktionen über Süß Oppenheimer und ein schon 1920 von Paul Wegener gedrehter Spielfilm über den Golem, die geheimnisvolle Figur jüdischer Mystik und Legende.1 Bevor wir auf diesen Film eingehen, müssen wir zum besseren Verständnis des historischen und literarischen Hintergrundes das Basiswissen über den Golem, den Maharal und die literarische Verwertung der Golemsage rekapitulieren, zumal die bisherigen filmhistorischen Beiträge2 die theologische und historische Dimension des Themas gar nicht oder nur unzureichend berücksichtigten.
4.1. Der Golemmythos in der Literatur Der Gymnasialkonrektor Johann Jacob Schudt erzählt "mit historischer Feder" 1714 in seinem scheinbar objektiven und judenfreundlichen, de facto aber zutiefst judenfeindlichen Buch Jüdische Merkwürdigkeiten im 31. Kapitel seines 6. Buches " Von der Franckfurter und anderer Juden Cabbalistischen Händeln" die Golemsage in einer Fassung, die auf einen hundert Jahre älteren Text zurückgeht3: Eine andere Zauberei haben sie, welche Hamor Golim4 genennt wird: da machen sie ein Bild von Laymen einem Menschen gleich, zischpem und brumlen demselben etliche Beschwerungen in die Ohren, davon dann das Bild gehet... Daher nennen die Juden ein solch Bild Golem, weil es die äusserliche Gestalt eines Menschen hat, auch gehen und allerley Wercke verrichten kann, aber nicht reden, so stehet ausdrücklich im Thalmud Sanhédrin Gemara ... Sie machen nach gewissen gesprochenen Gebeten und gehaltenen Fast-Tagen die Gestalt eines Menschen von
1
2 3 4
Titel: DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM; Regie: Paul Wegener, Carl Boese; Buch: Paul Wegener, Henrik Gateen; Produktionsland: Deutschland 1920; Produktion: Ufa; Titelrolle: Paul Wegener; Wiederaufführung: 7.4.1973 (WDR) Kracauer 1979, 37-39, 121f. u. 579f.; Eisner 1975, 50-52; Prodolliet 1967; Ledig 1989 Rosenfeldt 1934, 39; Scholem 1954, 284 Hamor Golim" = "Chemor Golim", d.h. die hebräische Übersetzung des jiddischen "Leimener Golem" oder "laymen" bzw. "Leimen" (hebr. chemor = Lehm), s. Rosenfeld 1934, 40
43 Thon oder Leimen, und wenn sie Schern Hamphorasch [den Gottesnamen, D.P.] darüber sprechen, wird das Bild lebendig und ob es wohl selbst nicht reden kan, versteht es doch, was man redet und ihm befiehlt, verrichtet auch allerley Hausarbeit; an die Stirn des Bildes schreiben sie Emet oder Emmes, wie sie es ausreden, d.i. Wahrheit; es wächst aber ein solch Bild täglich, und da es anfänglich gar klein, wird es endlich größer als alle Haußgenossen, damit sie ihm aber seine Krafft, dafür sich alle im Haus fürchten müssen, benehmen mögen, so löschen sie geschwind den ersten Buchstaben an dem Wort an seiner Stirn aus, daß nur das Wort meth (oder wie es sie es aussprechen mes) d.i. todt übrig bleibt, wo dieses geschehen, fallt der Golem über einen Hauffen und wird in den vorigen Thon oder Leim resolviret.5
Einhundert Jahre später (1808) stößt Jakob Grimm auf diese bei Schudt und anderen aufgezeichnete polnische Golemsage und erzählt sie fast genauso, greift aber für den Schluß auf eine andere Quelle zurück: Einem ist sein Golem aber einmal so hoch geworden und hat ihn aus Sorglosigkeit immer wachsen lassen, daß er ihm nicht mehr an die Stirn hat reichen können. Da hat er aus der großen Angst den Knecht geheißen, ihm die Stiefel auszuziehen, in der Meinung, daß er ihm beim Bücken an die Stirn hat reichen können. Dies ist auch geschehen, und der erste Buchstabe glücklich ausgetan worden, allein die ganze Leimlast fiel auf den Juden und erdrückte ihn.6
Beide Fassungen gehören nach den Forschungen von B. Rosenfeldt, deren 1932 abgeschlossenes Manuskript noch 1934 in Nazideutschland veröffentlicht werden konnte, und seit 1931 von G. Scholem, der einen Aspekt seiner 1954 erschienenen umfangreichen Untersuchungen im Jahre 1965 bei der Einweihung des Großcomputers "Golem 1 " in Rehovot/Israel aktualisierte7, zur ersten Traditionslinie der Golemsage. Sie dürfte ihren Ursprung in der Bibel haben, wo das hebräische Wort "Golem" ein einziges Mal, nämlich in Psalm 139,16 vorkommt und dort das Formlose, Unfertige, noch im Zustand des Werdens Befindliche oder die ungestaltete Masse bedeutet: "Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war."8 Aber erst im 12. Jahrhundert taucht er als Terminus technicus für einen durch Magie und die "Eingabe" der Buchstabenkombination des Gottesnamens erschaffenen künstlichen Menschen in der jüdischen Mystik, d.h. in der Literatur der deutschen Kabbala, auf. Der Golemmythos des talmudischen Zeitalters und die zahlreichen Varianten auch aus gnostischen Strömungen sind nach Scholem9 und Rosenfeldt10 durch folgende, einander beeinflussende oder ablösende zehn Aspekte gekennzeichnet: - Golemsschöpfung als Nachahmung der göttlichen Schöpfung Adams (Urstoff Erde) - Unvollkommenheit der menschlichen Golemschöpfung durch die Sprachlosigkeit/ Seelenlosigkeit des Golem
5 6 7 8 9 10
Schudt 1922, 206f. Rosenfeld 1934, 41 Scholem 1962, 77-86 Übersetzung der Bibel im heutigen Deutsch (Die Gute Nachricht) 1983 Scholem 1954, 235-280 Rosenfeld 1934, 3-41
44 - Prinzip der Schöpfung künstlicher Lebewesen durch magische oder mystische Rezepte = Kenntnis des Gottesnamens und geistige Durchdringung des Buches Jezirah (des Buches der Schöpfung) - Vorstellung von einer Weltschöpfung Gottes nach bestimmten Buchstabenzusammensetzungen des hebräischen Alphabets - Anwendung der Erfassung der Geheimnisse des Kosmos durch das Medium Sprache: Golemschöpfung durch Rezitation von Buchstabenkombinationen = Golemritual - Gefahr des durch Menschenhand geschaffenen künstlichen Wesens als Kreation eines neuen Gottes und Versinken der Welt im Irrglauben - Verwerfung des Golemschöpfers durch Gott (Dekalog: Ex 20,3 "Du sollst keine anderen Götter haben neben mir") - Gefahrdung des Golemschöpfers durch sein eigenmächtig gewordenes Geschöpf - Aufrichten einer Schranke durch das Emeth(Wahrheit)-meth(tot)-Motiv als Text auf der Stirn oder unter der Zunge des Golem (auch in der Version "JHWH Elohim Emeth = Gott ist Wahrheit") = Ohnmacht des hybriden Menschen vor Gott - Einbindung des Golem in das jüdische Gesetz (ob er z.B. einer der zehn für den Gottesdienst notwendigen Männer sein dürfe, ob er am Sabbath geschaffen werden und arbeiten dürfe). Die anderen, z.T. erst relativ jungen, ebenfalls einander überschneidenden Aspekte der Golempraxis wie das Homunculus(Automaten)-Motiv, das Faust- oder Künstlermotiv (Ringen nach Selbsterlösung), das Übermenschmotiv, die Vorstellung vom Golem als "materialisierte Kollektivseele des Ghetto"11 bleiben hier außer Betracht, weil es uns bei der Zusammenstellung vor allem darum ging, die jüdische Tradition der Golemsage zu verdeutlichen, um dann auch den GOLEM-Film damit vergleichen zu können. Es zeigt sich nämlich an Rosenfeldts Untersuchungen über die Verwertung der Golemsage in der Literatur, daß ihre jüdische Gestalt zur Gegenwart hin immer mehr verblaßt.12 Von der Romantik bis zum Expressionismus analysierte die Autorin 28 Literaturwerke. Diese 8 Gedichte (z.B. von Droste-Hülshoff, Storm, Liliencron), 8 Prosaskizzen, Erzählungen und Novellen (darunter von Achim von Arnim, E. Th. A. Hoffmann), 5 Sagen bzw. Sagennacherzählungen, Märchen und Legenden, 2 Romane (darunter der berühmte Golem von Meyrink) und 5 Dramen bzw. Opernlibretti (etwa von Hebbel) oder Filmerzählungen geben zwar nach Rosenfeldts Interpetation in der Literaturepoche der Romantik den Golem als Wirklichkeit aus, erfassen ihn danach aber nur noch symbolisch, kulturhistorisch und historischrational, sehen ihn als Verkörperung der Mechanisierung, als Gespenst oder heben gar ein erotisches Moment hervor. Dabei ist es bemerkenswert, daß die neun jüdischen Autoren, die wie Auerbach in seinem Spinozaroman und Rathenau in seiner Legende Rabbi Eliesers Weib 11 12
Scholem 1954, 236 Rosenfeld 1934, 42-176
45 (außerdem die Schriftsteller Kompert, Tendlau, Philippson, Kaiisch, Münzer, J. Heß und J. Singer) jüdisches Milieu und chassidische Sichtweise in viel stärkerem Maße als die nichtjüdischen Autoren bewahren, etwa den Gegensatz von Golem und Schöpfer hervorheben oder hinter einer rationalistischen Auffassung des Stoffes die religiöse durchschimmern lassen. Einige von ihnen verfolgen eine aufklärerische, gegen den Antisemitismus gerichtete Tendenz, andere wollen jüdisches Leben im Bilde festhalten oder drücken in ihrer Bearbeitung Zionssehnsucht aus.
4.1.1. Das Rabbi-Löw- und Beschützermotiv in der Golemssage Wenn man die neueren Versionen des Golemmythos einschließlich der von Rosenfeld noch nicht berücksichtigten literarischen Arbeiten liest, etwa Ε. E. Kischs Reportage "Dem Golem auf der Spur", Ben-gavriels Roman Das Haus in der Karpfengasse, die Kinderbücher von E. Petiska {Der Golem) und P.Rugill (The Return of the Golem) oder Friedrich Torbergs gleichnamige Erzählung (Golems Wiederkehr) bis zu den jüngsten Golemversionen von Elie Wiesel und Isaac Bashevis Singer13, so tauchen bei fast allen zwei neue Motive auf: die Verknüpfung der Sage mit einer Persönlichkeit des 16. Jahrhunderts, nämlich dem "Hohen Rabbi Low" von Prag , und die Funktion des Golem als Retter vor den Feinden der Juden. Beide scheinen auf eine Golemlegende "Die Wunder des Rabbi Low" und einen Brief von Rabbi Low aus dem Jahre 1583 zurückzugehen, die Ch. Bloch aus dem Hebräischen übersetzt bzw. gefunden haben will. G. Scholem hat Blochs Text als Bearbeitung einer Version von Juda Rosenberg aus dem Jahre 1909 erkannt, die ihrerseits die Erzählung eines unbekannten chassidischen Autors ist, der sie nach den Ritualmordprozessen von 1880 und 1890 verfaßt haben dürfte.14 Vor dem 19. Jahrhundert gibt es offenbar keine schriftliche Überlieferung über die Verknüpfung des Golemmotivs mit Prag und dem mit der kabbalistischen Tradition überhaupt nicht verbundenen historischen Rabbi Low, die heutzutage conditio sine qua non aller Golemsagen zu sein scheint. Rosenfeld mutmaßt, daß drei Faktoren die Entstehung von Rabbi-Löw-Sagen befördert haben: 1. die für den 16. Februar 1592 verbürgte Unterredung des der Mystik und Magie zuneigenden Kaisers Rudolf Π. mit dem Rabbiner und Herrscher (Maharal) der Prager Judenschaft, also die Tolerierung eines Juden durch die Staatsmacht, 2. das Fehlen von Zeugnissen über den Inhalt des Gesprächs und 3. die Übertragung des Magiemotivs von einer auf eine andere Person. In diesen Golemsagen mit Rabbi Low als Zentralfigur tritt der Maharal als eine Art jüdischer Faust auf. Er kann im Vertrauen auf Gott (also nicht mit Hilfe des Teufels!) Wunder tun, auch einen 13
14
Kisch 1979, 41-55; Ben-gavriel 1958, 268-287; Petiska 1987; Rugffl 1979; Torberg 1968; Wiesel 1985; Singer 1988 Bloch 1920; Scholem 1954, 22f.
46 Golem schaffen, der nun seinerseits im Prager Judenviertel mit der Alt-Neuschul als ihrem Zentrum der Beschützer der Juden wird und sie z.B. gegen den (zuerst bei Bloch, später bei Wiesel auftretenden) fanatischen Mönch Taddäus verteidigt. Der Golem als Schutz und Schild gegen die sich an der Ritualmordlüge delektierenden Judenfeinde handelt jedoch niemals aus eigener Machtvollkommenheit, sondern ist immer vom Maharal, seinem gottesfurchtigen Meister, abhängig. 4.2. GOLEM-ffilme von Paul Wegener und anderen Filmemachern
4.2.1. Filmhistorischer Überblick Nach der Rekapitulation der Golemsage in der Literatur beschäftigen wir uns nun mit den Golemfiguren des Films. Im Mittelpunkt der Golemdarstellungen steht für unsere Thematik zweifellos Paul Wegeners Stummfilm aus dem Jahre 1920 DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM. Er bildet das Ende einer Art Stummfilmtrilogie über die Golemlegende; denn Wegener, Schauspieler an Max Reinhardts Deutschem Theater in Berlin, ein Filmemacher mit deutlicher Vorliebe für die Gestaltung phantastischer Visionen, Inszenator der "Entfesselung unbekannter Kräfte, die undeutlich als die des eigenen Unterbewußtseins erkennbar sind"15, hat zwischen 1913 und 1920 außer einer romantischen Doppelgängergeschichte (DER STUDENT VON PRAG) und einem HOMUNCULUS-Film noch zwei weitere Golemversionen gedreht: den offenbar zweitrangigen Streifen DER GOLEM UND DIE TÄNZERIN und als Kopfsatz 1915 - gemeinsam mit Henrik Galeen - den Film DER GOLEM. Er spielt weder unter Juden noch im Mittelalter, von Rabbi Low wird nur als dem Erfinder einer Zauberformel berichtet. Der GOLEM wird zum Gegenwartsstoff: Arbeiter graben in einer alten Prager Synagoge einen Schacht und finden eine Statue aus Lehm, die sie zu einem Antiquitätenhändler bringen. Der liest in einem alten Buch die Formel des Rabbiners, erweckt den Koloß zum Leben und bedient sich seiner als Roboter. Als der Golem sich in die Tochter des Antiquitätenhändlers verliebt, flieht das Mädchen. Der Golem, seine Einsamkeit erkennend, wird zum außer Kontrolle geratenen, alles zerstörenden Ungeheuer, bis er vom Turm fallt und zerschellt. Außer diesen drei Wegener-Film-Golems, von denen uns der letzte, der einzige nach 1945 im Kino und Fernsehen gezeigte, gleich beschäftigen wird, gibt es noch weitere Verfilmungen der Golemlegende. So wurde 1936 ein französischer Tonfilm LE GOLEM produziert, den der erfolgreiche Regisseur Julien Duvivier in Prag mit dem bedeutenden jüdischen von den Nazis 1942 im KZ umgebrachten
15
Gregor/Patalas 58. Über den Theatermann Wegener: Theater-Lexikm 1983, Sp. 1379-81; Jhering 1942, 108-114. Über Wegeners Filmarbeit: Bucher 849f.; Möller 1954; Cmegraph, "Paul Wegener". Über den Zusammenhang der drei GOLEM-Filme Wegeners: Ledig 1989, 128-139
47 Schauspieler Harry Baur inszenierte. Dieser Film ist 1956 nur in geschlossenen Veranstaltungen der "Freunde der Gilde deutscher Filmkunsttheater" gezeigt worden. Die einzige dem Verfasser vorliegende Kritik (Der neue Film, Wiesbaden, 27.2.56) mag einen Eindruck davon geben, wie weit der Film von den Golemsagen der jüdischen Quellen und dem jüngeren Rabbi-Löw-Kaiser-RudolfSagenzyklus entfernt ist, wie er - darin Wegener ähnlich - eine Liebesgeschichte einfügt, aber das Motiv vom Streiter gegen die Judenfeinde aufnimmt und zum Rächer- und Monstermotiv hin erweitert: ...Pest, Hungersnot und qualvolle Tyrannei herrschen im Prag Rudolf des Zweiten, und die jüdische Gemeinde bekommt alle Not doppelt zu spüren. Ihr kümmerliches Leben im Ghetto ist jedoch von einer einzigen großen Hoffnung erfüllt: der Golem, diese zu Stein gewordene Urkraft, wird in der Stunde der allergrößten Gefahr zu neuem Leben erwachen und fürchterlich richten. Rudolf II. betrachtet die steinere Figur als persönlichen Feind und setzt alles daran, sich ihrer zu bemächtigen. Den Rabbiner Jakob läßt er foltern, um hinter des Golems Geheimnis zu kommen - vergeblich. Der junge Jude hat das magische Zeichen, das den steinernen Riesen zum Leben erwecken kann, seiner geliebten Rachel anvertraut, und sie ist es, die die blutgierigen Löwen nicht scheut und vordringt zum Golem, um das Zeichen über dessen linker Braue zu schlagen. Und Golem schreitet durch die Stadt - Ketten brechend, Säulen, Mauern, den ganzen Palast stürzend. Die ränkevollen Verfolger der bedrängten Judenschaft werden ihrem gerechten Tode zugeführt ...
Eine Generation später (1966) wurde noch einmal ein französischer Spielfilm LE GOLEM inszeniert, diesmal als Fernsehfilm von Jean Kerchbron, danach gab es eine israelische Produktion von Dan Eldad und 1972 von Jaroslav Balik die Umwandlung des Golem zum Fräulein Golem (in dem tschechischen Film SLECNA GOLEM). Nur noch als Begriff und Gleichnis, nämlich für die sinnentleerte, mechanische Existenz einer auf die Computerstimmen der "Weltfreizeitzentrale" reagierenden Menschheit vor der Einführung der Einstundenwoche im Jahr 2312 erscheint der Golem im Titel des satirisch-utopischen Fernsehspiels DREHT EUCH NICHT UM, DER GOLEM GEHT UM von Dieter Waldmann (Buch) und Peter Beauvais aus dem Jahre 1971 (SWF). Nicht in den Golemkontext gehört Gerd Angermanns (Buch) und Kurt Hoffmanns Verfilmung des oben erwähnten Romans DAS HAUS IN DER KARPFENGASSE (Bundesrepublik Deutschland, 1965): Der Film enthält zwar in der Kauders-Sequenz eine Szene auf dem Prager Jüdischen Friedhof mit Gebet zum Hohen Rabbi Low, er spielt wie Torbergs Golemerzählung in dem von den Deutschen besetzten Judenviertel; aber das Schlußkapitel, in dem die Nazis aus Furcht vor dem Golem fliehen, wurde nicht in den Film transponiert. Das Golem-Motiv wird vom Film in immer neuen Formen und inhaltlichen Varianten adapiert. 1986 ist der Golem in dem amerikanischen Science-fictionActionfilm MIAMI GOLEM von Martin Herbert ein Retortenwesen, das zum personifizierten Bösen heranwächst und deshalb von einem Fernsehreporter und dessen außerirdischen Freunden vernichtet wird. 1991, der vorläufige Endpunkt der filmischen Golem-Schöpfungen, bringt die Präsentation eines weiblichen Golem, der als "Geist des Exils" im heutigen Paris Beschützer der Exilanten und Vagabunden wird. Der israelische Filmemacher Amos Gitai schlägt mit seinem GOLEM, L'ESPRIT D'EXIL (Frankreich 1991) den Bogen zurück zu den
48 kabbalistischen Anfangen des Golem-Mythos, zum Weltgestaltungswerk des JeziraBuches mit seiner Zahlenmystik des Sefirot, jener zehn Zahlenelemente, durch deren Beschwörung am Anfang des Films der Maharal den Golem schafft. Gital versuchte, einen Golem-Film ohne folkloristische Elemente zu drehen, indem er in einem dokumentarischen Filmstil moderne Szenen der Entwurzelung und rassistischen Aggression präsentiert, die er in einen Handlungszusammenhang mit den biblischen Figuren Ruth und Naemi stellt und diese wiederum durch Rezitation von Texten der hebräischen Bibel und der Kabbala in den Zusammenhang mit tradierten jüdischen Lebenswelten rückt.
4.2.2. DER GOLEM. WIE ER IN DIE WELT KAM Doch konzentrieren wir uns nun auf Paul Wegeners Film DER GOLEM, WIE ER IN DIE Welt kam. Hatten wir bei der Analyse der Lutherfilme mit ihrer Abstinenz von jüdischer Thematik und jüdischen Figuren auf die (anti-)jüdischen Stereotype hingewiesen, so ist nun die erste große Judendarstellung in einem Film, der sich offenbar noch heute eines gewissen Zuspruchs erfreut16, auch darauf hin zu untersuchen, wie weit das in Jahrhunderten herausgebildete und propagierte jüdische Stereotyp noch im GOLEM-Film nachwirkt. Degani17 hat daran erinnert, daß der durch hohe Ghettomauern von den Christen abgeschlossene "gefährliche" Jude auch als der "gefoppte", der lächerlich gemachte Jude vor allem durch das spätmittelalterliche "indirekte Propagierungsmittel" der Passionsspiele präsentiert und dabei das schon genannte fremdartige Auftreten des Juden, seine Körpersprache und Kleidung, um komischer Wirkungen willen verzerrt, vergröbert, groteskisiert wurde. Zusammen mit den von der Judas-Ischariot-Figur abgeleiteten Stereotypen der Geldgier, des Schacherns und den erwähnten theologischen Klischees entstand so im geistlichen Spiel des Mittelalters ein judenfeindliches Gemisch, das zusätzlich von der "direkten judenfeindlichen Hetze" der satirischen Literatur, mancher Fastnachtspiele, vieler judenfeindlicher Flugblätter, Streitschriften, Predigten, Aufrufen und Verordnungen verstärkt wurde.18 Aus der als Materialsammlung sehr nützlichen, wegen ihrer nationalsozialistischen Grundeinstellung aber mit äußerster Vorsicht zu genießenden Dissertation von E. Frenzel Die Gestalt des Juden auf der neueren deutschen Bühne, die die theatralischen Judengestaltungen zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert in der Formel "Der Jude als Bösewicht" zusammenfaßt, läßt sich ableiten, daß die Diffamierung von Juden auf der Bühne bis zur Reformation reichte, dann
16
17 18
Er wird - in einer nachsynchronisierten Musikfassung - z.B. regelmäßig in einem Berliner Kino gezeigt, das sich auf die Vorführung von Filmklassikern spezialisiert hat. Degani 1985, 3-16 Zu den Stereotypen des religiösen Schauspiels vgl. Poliakov 1978, II, 30
49 aber unter Luthers Einfluß, der jede Profanisierung der Gestalt Jesu und jede Aktualisierung der "Judenfrage" untersagt hatte, für fast 150 Jahre nahezu verschwand.19 Dennoch dürften das Stereotyp des habgierigen Juden, die ins Burleske, Karikaturhafte gesteigerte Darstellung von Wortschwall, Redetempo, Redefluß und Gestik, von Anpreisungs- und Verkaufstechniken, zusammen mit dem Fastnachtsspielmotiv des betrogenen Betrügers auch in jenen anderthalb Jahrhunderten zwischen 1520 und 1770 nachgewirkt haben. Die Propagierung des modernen Antisemitismus von Glagau über Marr, Stöcker, Treitschke bis Schüler, Naudh, Dühring u.a., dessen Anfange der 1874 geborene Wegener gerade in seinen Jugendjahren intensiv erlebt haben mußte, könnten sehr wohl ihren Niederschlag in seinem GOLEM von 1920 gefunden haben. Schließlich hatte es ja schon damals antisemitische Filme gegeben wie THE ALIEN'S INVASION (Die fremde Invasion, 1906), in dem sein Regisseur Cecil Hepworth behauptete, die aus Osteuropa kommenden Juden nähmen den Engländern die Arbeit weg20, und die Gestaltung jüdischer Thematik ohne antisemitische Tendenz war in jenen Stummfilmjahren wohl nur aus den Anfangen der polnischen Kinematographie bekannt, denn die während des ersten Weltkrieges produzierten Filme wie JUDE ABRAHAM SUCHT SEINE TOCHTER waren offenbar stark von einer antirussischen Blickrichtung beeinflußt.21 Würde Wegener die nach den Massakern in das Ghetto gedrängten Juden wie die meisten zeitgenössischen Chroniken als "räuberisch", als "Ausplünderer von groß und klein" schildern22 oder ihr Dilemma als wegen des Steuerdrucks und des Loskaufs von der Blutbeschuldigung vom Geldverdienen Abhängige? Würde er ihre durch Anschuldigungen, Schmähungen, Beleidigungen gedrückte Existenz oder auch ihre Bereitschaft zum Martyrium, ihre unter dem Leidensdruck ins Strenge, fast Klösterliche gewendete Religiosität zu erfassen versuchen? Würde er die äußeren Bedingungen eines Lebens im Ghetto, deren Regelungen und Einengungen, den Kontrast zum Christenleben schildern, die Spannung zwischen Eintönigkeit und Normierung auf der einen und relativem Schutz, Genügsamkeit und gottesfürchtiger Existenz auf der anderen Seite? Würde sein Spielfilm trotz der Konzentration auf die Entwicklung der Fabel die sozialen, rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen jüdischen Lebens in den Städten zu gestalten versuchen, und sei es nur in Äußerlichkeiten wie in dem Zwang zum Tragen des Judenabzeichens? Die Inhaltsangabe des Films beantwortet bereits einige dieser Fragen. Rabbi Low, der in den Zwischentiteln immer nur als "großer Meister" tituliert wird, hat auf Grund seiner astrologischen Beobachtungen ein großes Unglück für die Menschen im Judenviertel Prags vorausgesagt und ermahnt die Gemeinde, die 19 20 21 22
Frenzel 1940, 20 Toeplitz II, 41 Toeplitz II, 163 Poliakov 1978, II, 55
50 ganze Nacht zu "Jehova" zu beten. Der Kaiser hat nämlich ein Dekret erlassen: WIDER DIE JUDEN, SO UNSEREN HERRN GEKREUZIGT HABEN, DIE HEILIGEN FESTE MISSACHTEN, IHREN MITMENSCHEN NACH GUT UND LEBEN TRACHTEN UND DADURCH DEN FRIEDEN UNSERER TREUEN UNTERTANEN VERLETZEN. Der Junker Florian wird beauftragt, den kaiserlichen Erlaß dem Vorstand der jüdischen Gemeinde, dem Rabbi Jehuda, zu überbringen. Dem gelingt es, den Boten des Kaisers zu bewegen, mit ihm zum Meister Low, dem "Herz und Mund unserer Gemeinde", zu gehen. So lernt Florian Miriam, die schöne junge Tochter Rabbi Löws, kennen, und ohne Wissen Löws verlieben sich die beiden jungen Leute ineinander. Low, der inzwischen, "um mein Volk zu retten", in einer für sein Vorhaben günstigen Gestirnenkonstellation mit der Formung des Golem aus Lehm begonnen hat, bittet um eine Audienz beim Kaiser, die ihm unter der Bedingung gewährt wird, auf dessen Fest ein "Schauspiel seiner magischen Künste" zu geben. Nachdem der Rabbi seinen Famulus in das Geheimnis der Golemherstellung eingeweiht, durch Bücherstudium und Geisterbeschwörung das Zauberwort "AemAet" erfahren, dies auf einen Pergamentstreifen geschrieben und in eine Kapsel auf der Brust des Golem eingesetzt hat, wird die Statue lebendig (vgl. Foto Nr.5). Als Diener des Rabbi spaltet der Golem Holz, schöpft Wasser aus dem Brunnen, holt Gemüse vom Kaufmann und begleitet den Rabbi zum kaiserlichen Fest, wo sein Meister vor den Augen des Kaisers "die Patriarchen vorbeiziehen" lassen und dadurch die Kenntnis des Kaisers von seinem Volk verbessern will. Als aber die Bedingung nicht eingehalten wird, bei der Geistererscheinung nicht zu lachen (bei der Beschwörung von "Ahasver, dem ewigen Juden" bricht alles in Lachen aus), senkt sich die Decke des Palastes auf die zahlreichen Menschen herab, dem Kaiser wird angst ("Rette mich, und ich gewähre deinem Volk Gnade!"), und Rabbi Low läßt den Golem die Decke stützen. Während nun die Ghettostadt Gott für die Aufhebung des Judendekretes dankt, die Thoralade zur Synagoge geführt und eine gewaltige Schar von Schofarhörnern geblasen wird, entdeckt der eifersüchtige Famulus, daß die von ihm angebetete Miriam einen Liebhaber hat, und hetzt den wutschnaubenden Golem, der schon einmal sogar gegenüber dem Rabbi rebellisch geworden war, auf die Liebenden. Der Junker wird von ihm erschlagen, die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt, Miriam entführt. Während alle vor dem Golem fliehen, ist ein kleines Kind stehengeblieben. Der gerührte Golem nimmt es auf den Arm, das Kind dreht an der Kapsel, der Golem fallt um. Die Juden versammeln sich um die leblose Statue, der Rabbi ruft zum Gebet: "Dankt Jehova, daß er zum drittenmal sein Volk gerettet hat!" Danach ziehen die Juden in ihr Ghetto zurück, die Tür schließt sich. In Großaufnahme erscheint als Schlußeinstellung der Davidstern. Eine Interpretation des GOLEM hat zu berücksichtigen, daß alle WegenerVersionen des Legendenstoffes nicht mehr der handwerklichen, sondern schon der industriellen Filmproduktion angehörten und damit den Gesetzen des Marktes unterlagen. Seit mit der Etablierung des Filmimperiums Pathé 1912 in Frankreich
51 der Übergang zur industriellen Produktion vollzogen wurde23, war ein Filmregisseur nicht mehr ein autonomer Künstler und Experimentator, sondern ein von kommerziellen, marktstrategischen Vorentscheidungen Abhängier, der ein Industrieprodukt zu fertigen hatte, das unter distributiven Gesichtspunkten dem Zuschauergeschmack Rechnung zu tragen hatte. Aus Wegeners Aufsatz "Die künstlerischen Möglichkeiten des Films" und anderen seiner Aufzeichnungen24 geht allerdings nicht hervor, daß sich Wegener des Marktcharakters seiner Arbeiten bewußt war. Der GOLEM von 1920 gehört mit zu den eindrucksvollsten deutschen Stummfilmen. Seinen Platz in der Geschichte der Filmkunst hat er nicht nur gefunden, weil der Geist der Beschwörerszene vor der Belebung der Golemstatue in seiner äußeren Gestalt akkurat Murnaus zwei Jahre später gedrehten NOSFERATU vorwegnimmt, weil die Titelfigur Modell für zahlreiche Filmmonster gestanden hat, weil die Wirkung des Films wie in dem 1919 entstandenen Film DAS KABINETT DES DR. CALIGARI von Robert Wiene von der Lichtführung und Ausstattung ganz entscheidend bestimmt wird (bei Wiene durch die expressionistischen Prospekte, bei Wegener durch die phantastischen Bauten des Architekten Hans Poelzig, jenen auf dem Ufa-Freigelände in Tempelhof aus Holz, Stroh und Lehm errichteten 57 Häusern, die eine Hauptstraße und zwei Nebenstraßen säumen und am Ende laut Drehbuch in Flammen aufgehen). Vor allem nämlich gibt der Film nach Meinung vieler Filmhistoriker die Stimmung wieder, die Spiegelbild der deutschen Mentalität, einer Flucht aus der Selbstverantwortung in den Mystizismus, in Irrationalität und Schicksalhaftigkeit ist.25 Wenn man den Film allerdings primär unter den Gesichtspunkten analysiert, aus welchen Motiven er sich zusammensetzt, wieweit er die jüdische Golemlegende der Kabbala bzw. des 19. Jahrhunderts ins Filmische umsetzt, welche Sicht er vom mittelalterlichen Ghetto gibt, wie er jüdische Figuren aus Literatur und Geschichte präsentiert, verschieben sich solche Bewertungsmaßstäbe etwas. Dramaturgisch ist der Film ein Mixtum compositum verschiedener Golemlegenden. Aus der von Schudt mitgeteilten Fassung der "polnischen Juden", d.h. der Chelmer Legende des 16. Jahrhunderts, übernimmt Wegener nur den Anfang des Emethmotivs; alle anderen neun Aspekte der frühen jüdischen Sagen, zumindest in ihrer religiösen Bedeutung, fehlen. Die Tetragamm-Magie wird durch einen an die populären Schwarze-Kunst-Praktiken der Faustsagen erinnernden Hokuspokus mit Astartebeschwörungen ersetzt. Aus dem Rabbi-Löw-Sagenkreis stammen die Beschwörung der biblischen Patriarchen und die Stützung der Hradschindecke durch den Golem, seine Dienerfunktionen und seine Zuordnung zum Maharal. Rabbi Low wird bei Wegener mehr als Astrologe, Astronom und
23 24 25
Toeplitz I, 47-49 Möller 1954, 102-113, 13-37, 94-101 Sadoul 156; Eisner 1975, 50; Kracauer 116
52 Zauberer vorgeführt denn als Rabbiner seiner Gemeinde; er weiß sich aber als die verehrte oberste Autorität der Prager Judenschaft seinem Volk verpflichtet. Damit entspricht die Darstellung weitgehend dem Rabbi-Löw-Schema der Legenden und ist somit meilenweit entfernt von dem finster-verkniffenen Fanatismus, mit dem Werner Krauss zwanzig Jahre später die Löw-Figur in dem Veit-Harlan-Film JUD SÜSS ausstattet. Das Motiv-Sammelsurium des Drehbuchs, das durch die Erfindung einer Liebesgeschichte ergänzt und durch das Revoltenmotiv aus einem Golemdrama des Jahres 1908 von Arthur Holitzscher komplettiert wird, führt Rosenfeld, die nicht den Film, sondern nur die Wegener-Nacherzählung kannte26, zu einer sehr kritischen Bewertung des Textes, die sich dem Film gegenüber nicht aufrechterhalten läßt. Vor allem aber ist diese einzige filmische Darstellung des (jüdischen) Mittelalters wegen ihrer jüdischen Figuren und ihres jüdischen Milieus von größerem Aussagewert als nur eine Kategorisierung des Golem als "der selbst zum Tyrann gewordene Automat"27 oder eine Etikettierung des Films als "Porträt der mittelalterlichen Zauberwelt"28. 4.2.2.1. DER GOLEM als Ghettofilm Die Bauten von Hans Poelzig in Wegeners Film (vgl. Foto Nr. 4 im Bilddokumentationsteil) kombinieren Märchen- und Realismuselemente: Sie präsentieren einerseits eine märchenhafte mittelalterliche Zauberwelt (Architektur als magischer Raum, vgl. die Szenenfotos im Bilddokumentationsteil), andererseits aber auch die eingeengte, ja bedrängte Lage der Juden auf deutschem Boden, wie sie auf Grund ihrer mittelalterlichen Verfassung bis zum Beginn der Emanzipation bestand, wird vorgeführt: örtlich, sozial, rechtlich, kulturell und religiös von der Umwelt geschieden. Alle Juden des Films tragen das Judenabzeichen, jene seit dem 4. Laterankonzil von 1215 verordnete äußerliche Kenntlichmachung der Juden zur Unterscheidung von den Christen: den seit etwa 1350 in Deutschland allgemein verbindlichen gelben Ring am Gewand und den spitzen Judenhut. Sie sind von den Christen geschieden, und zwar nicht nur durch ihre Absonderungsgesetze. Auch wenn der Terminus "Ghetto" nicht fallt, wird doch deutlich, daß die Judenstadt im GOLEM nicht ein freiwillig gewähltes Judenviertel ist, wie es seit dem Altertum bekannt ist: der Zusammenschluß der meist gehaßten Minderheit der Juden sowohl wegen der Gemeinsamkeit ihrer rechtlichen, religiösen und wirtschaftlichen Interessen als auch zur Abwehr von Angriffen in besonderen Quartieren nahe dem inmitten der Stadt gelegenen Markt mit seinem lebhaften Verkehr, in der Nähe der Schutz gewährenden Burg oder neben der Synagoge. Sondern es ist das seit dem Ende des 13. Jahrhundert entstandene, durch Mauern und verschließbare Tore von der christlichen Umgebung abgesperrte
26 27 28
Wegener 1921 Sadoul 156 Bucher 304
53 Ghetto, hier im Film nicht nur nachts, sondern ständig geschlossen, der Zugang vom Turmwächter kontrolliert. Ohne Kenntnis der geschichtlichen Entwicklung mag für den Zuschauer der Ghettocharakter der Wegenerschen Judenstadt nicht unbedingt mit Händen zu greifen sein, zumal bis auf den heutigen Tag die Begriffe Ghetto und Judenstadt häufig synonym verwendet werden und aus dem Bewußtsein verschwunden ist, daß es zu Anfang der jüdischen Siedlung in Europa auch eine Phase des fast spannungsfreien Zusammenlebens von Juden und Christen gegeben hat und das Wohnen von Juden in einem gesonderten Viertel von der Mehrheit der Juden bis hin zur Emanzipation der Aufklärungszeit geduldet und gewünscht wurde. Das Ghetto des Films ist nicht das Prager Ghetto, wie es J. Prinz ein Jahr vor der "Reichspogromnacht" des 9. November 1938 noch hat beschreiben können29, es ist auch nicht inmitten der Altstadt gelegen, wie Haumann hervorhebt30. Es ging dem Architekten Poelzig nicht um akribische Dokumentation, aber wenn man die Fotos alter Ghettos" und die hebräischen Buchmalereien von Gebäuden und Menschen zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert32 mit dem Film vergleicht, fallt auf, wie sehr es ihm gelang, die drangvolle Enge des wegen Ausdehnungsverbots in die Höhe gebauten Ghettos zu gestalten; so wie auch Wegener nicht nur das Äußere der Menschen wiederzugeben wußte, sondern die Furcht vor Pogromen in die Gesten der einzelnen und die Bewegungen der Massen ebenso zu bannen wußte wie die Inbrunst ihrer Gebete, den Schmerz über den Verlust ihrer Habe, den Jubel über die Abwendung von Gefahren. Auf die nahegelegene Darstellung des Ghettos als einer extrem fremd anmutenden abgeschlossenen Welt verzichtete Wegener. Eine soziologischpsychologische Deutung, daß die jahrhundertelangen Absonderungen und Verfolgungen hier unverständliche, womöglich abstoßende Gebräuche und Eigenarten herausgebildet hätten, lag ebensowenig in seinem Interesse wie die Visualisierung des im 19. Jahrhundert erhobenen Vorwurfs der "jüdischen Nationalabsonderung" .33 Besonders eindrücklich arbeitete der Regisseur den Gegensatz zwischen der Arroganz des seiner Macht bewußten, im Gespräch mit Juden sich gelangweilt gebenenden, prächtig gekleideten, mit kecker Feder am Hut verzierten Kaiserboten und die Abhängigkeit der stets demütig gebückten, fast unterwürfig den Saum seines Mantels berührenden entrechteten Juden heraus. Eine karikatureske,
29 30
31
32 33
Prinz 1937, 197-272 Haumann 1985, 209 Z.B. im Reprint des Jüdischefn] Lexikonfs] von 1927, in der Encyclopaedia Judaica von 1931, der Universal Jewish Encyclopedia in Ten Volumes, New York 1941 und der Encyclopaedica Judaica, Jerusalem 1971 oder auch im Fotoband Ein Ghetto im Osten: Wim, Reprint Berlin 1984. Vgl. auch Vilimkova 1990, vor allem 7-43 Metzger 1983 Sterling 1956, 179-181
54 diffamierende Judendarstellung wußte Wegener zu vermeiden. Wie die verschiedenen Unterwürfigkeitsgesten der beiden Rabbiner des Films muß auch die Großaufnahme der begehrend sich öffnenden Finger des vor Christen meist gebückt stehenden Torwächters, in die der Junker nacheinander drei Geldstücke fallen läßt, um so in das Ghetto und zu seiner Liebsten zu gelangen, nicht als die "typische" Geste des Schacherns mißdeutet werden. Konventionell und dem Stereotyp des schönen jungen Judenmädchens verpflichtet ist dagegen die Zeichnung der Rabbinertochter Miriam, wenngleich sie in einer Szene das Jessicamotiv der aufbegehrenden, die Ghettowelt der Juden zu verlassen drohenden und zum Christentum überzulaufenden Renegatin andeuten darf. Aber es bleibt im Film bei einer Geste, die nur als Trotz der verliebten Tochter gegenüber dem Vater gedeutet werden kann, nicht etwa als Aufruhr gegenüber der patriarchalischen Machtbefugnis des Rabbi, nicht als rational vollzogene Abkehr vom Glauben der Väter, nicht als Beginn eines Dialogs zwischen den Religionen, nicht als emanzipatorischer Prozeß des Sichöffenens gegenüber neuen Ideen im Sinn der noch darzustellenden jüdischen Emanzipation, auch nicht als Beginn der "Zerrissenheit des emanzipierten Juden"'4, die dann schließlich in den von Theodor Lessing 1930 beschriebenen "jüdischen Selbsthaß" führte.35 Wiederum an William Shakespeares Kaufmann von Venedig denkt man auch bei Ernst Deutsch, dem später so berühmten Nathan- und Shylockdarsteller, wenn er als Famulus vor Eifersucht rast ("Hat nicht auch ein Jude Hände, Gliedmaßen, Werkzeuge, Sinne, Neigungen, Leidenschaften?"). Dennoch wäre die Bewertung der Ghettosequenzen als ausschließliche Dokumentation oder gestaltende Paraphrasierung jüdischen Glaubens eine Fehlinterpretation. So wie Rabbi Low nicht nur als jüdischer Gelehrter, sondern immer auch als Magier vorgestellt wird (er beschwört die "Patriarchen" als Väter des Glaubens ebenso wie Astarte = "Astaroth", die palästinensisch-syrische Fruchbarkeitsgöttin), hat die Ghettowelt doppelte Funktion. Sie ist Wohnviertel von Juden und magischer Raum (E. Ledig spricht in ihrer GOLEM-Analyse vom Ghetto als "magischem System"3®). Bezeichnenderweise wird nicht Jahwe angebetet, sondern " Jehova". Asteroth, Ahasver, Jehova sind immerauch Chiffren für magische "Grenzüberschreitung" (Ledig). Auch das die Belebung der fertig geformten Golemfigur einleitende Hexagramm des Davidsterns in Großaufnahme (die Kapsel an der Golembrust hat ebenfalls Hexagrammform) ist offensichtlich mehr magisches Zeichen als das offizielle Signum der jüdischen Gemeinde. 4.2.2.2. Das Ahasvermotiv im GOLEM Auf der gleichen Linie liegt die Gestaltung des Ahasvermotivs. Im Volksbuch vom Doktor Faust läßt der Magier auf Wunsch des Kaisers Gestalten der Antike 34 35 36
Poliakov 1986, VI, 56 Lessing 1984 Ledig 1989, 160
55
erscheinen. In einer ähnlichen Szene der Golemsage treten die jüdischen Patriarchen auf, die "Erzväter" des Volkes Israel: Abraham, Isaak und Jakob sowie dessen Söhne. Wegener verkürzt die Trickeinblendung von dem zunächst in der Totale wandernden Gottesvolk nach einem entsprechenden Zwischentitel auf die Präsentation einer Figur in Großaufnahme vor der erst erstaunten und furchtsamen, dann schallend lachenden Festgesellschaft: des Ewigen Juden Ahasver. Er enthält sich dabei aller antisemitischen Ausfalle, erzählt also nicht die judenfeindlich verfälschte Fassung der Legende vom Schuster Ahasver, welcher den nach seiner Verurteilung unter seinem Kreuz beladenen, erschöpften, nach einem Ausruhplatz sich umsehenden Jesus von seinem Haus wegstieß, so daß dieser ihm zugerufen haben soll: "Ich will hier stehen und ruhen, du aber sollst gehen, bis ich wiederkomme." Diese im Gegensatz zum nicht antijudaistischen Volksbuch von 1602 (Kurtze beschreibung und Erzehlung von einem Juden mit Namen Ahasvérus) stehende Vorstellung vom ewig wandernden Juden, der seine schwere Schuld Jesu gegenüber bis zu dessen Wiederkehr abzubüßen habe, wurde nicht nur zur judenfeindlichen Metapher für das wegen der Kreuzigung Christi zerstreute jüdische Volk.37 Es erfuhr auch eine projüdische, von Juden selbst aufgenommene Bedeutungsverbesserung, indem der Ewige Jude Synonym für das ewige jüdische Volk wurde.38 Wegener interpretiert offenbar Ahasver als tragische, erniedrigte und beleidigte Figur. Er scheint seinen Ahasver, der aus der Tiefe des Bildes nach vorne kommt, sich scheu, flüchtig und verängstigt nach allen Seiten umsieht, als Bild für das verfolge jüdische Volk zu verwenden.39 Wenn der Kaiser und seine Gäste bei der Beschwörungsszene in ihrer Ignoranz in Lachen ausbrechen, kann das Sichherabsenken der Hradschindecke über sie als Strafe für die Verspottung der Juden gedeutet werden. Für eine Interpretation Ahasvers als bedrängtes Glied des jüdischen Volkes spricht auch, daß der sich vom Zug der Israeliten zum Vordergrund hin lösende "wandering jew" zusätzlich mit neutestamentlichen Gestalten konfrontiert wird: Die Figurengruppe im Vordergrund erinnert sowohl an die Weisen aus dem Morgenland wie an Maria und Joseph mit dem Jesuskind auf der Flucht nach Ägypten.40 Einem heutigen Publikum wird andererseits der in extremer Verknappung präsentierte Ahasver sich nur schwer als jüdische Figur erschließen lassen. Deswegen ist auch eine Interpetation der Ahasverszene einzig als magischer Akt denkbar. Die Unentschiedenheit Wegeners - ist Rabbi Löws Ahasverbeschwörung
37 38
39
40
Schudt 1922, 491. Zur judenfeindlichen Verfälschung der Legende vgl. BÍleanú 1991, 15-43 Jüdisches Lexikon 1986, I, Sp. 161. Das Wandermotiv ist in seiner Herleitung aus dem Exodus-Buch keineswegs eo ipso judenfeindlich zu interpretieren. Die 'Spannung von Wanderschaft und Seßhaftigkeit" erklärt F.-W. Marquardt als den "Exodus-Geist des Judentums", indem er H. G. Adlers Definition des Jüdischen ("die Wanderschaft als das charakteristisch Jüdische") zitiert (Marquardt 1966, 217). Mayer 1981,315: "Er steht für ein theologisches Schicksal, nicht für irgendeine jüdische Singularexistenz. " Ledig 1989, 210f.
56 jüdisches oder magisches Signum? - steht offenbar in der Tradition der Populärgraphik des 19. Jahrhunderts, wo die Gestalt des ewigen Juden "in der Regel weder allgemein negativ noch speziell als Jude gezeichnet wird."41 Im zeitgenössischen Kontext dürften die Ahasverszenen ähnliche ambivalente Wirkungen gehabt haben. Es darf nämlich vermutet werden, daß ein gewisser Teil des Kinopublikums von 1920 die Ahasverchiffre noch kannte und trotz der zurückhaltenden Inszenierung Wegeners zum ersten mit der antijudaistischen Deutung des Judas Ischarioth und zum zweiten mit jenen weithin judenfeindlichen Partikeln füllte, die seit Beginn des 19. Jahrhunderts als Ahasvermotiv bei Goethe, Schubart, Schlegel, Brentano, Chamisso, Gutzkow und den Gebrüdern Grimm in Deutschland, aber auch in England (Byron, Shelley, Wordsworth) und Frankreich (Sue) im Schwange waren. Das Ahasvermotiv markiert einen der Übergänge vom theologischen Antijudaismus zum rassistischen Antisemitismus; denn der "Ewige Jude", "Le Juif errant", "The wandering Jew" personifiziert schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts die jüdische "Race", den "Fremdkörper" unter den Völkern, wie es aus der ersten Nummer einer Zeitung gleichen Namens (Le Juif errant, journal, 1843) hervorgeht: Der umherirrende Jude ist [...] die jüdische Rasse, die auf ewig unter die Völker zerstreut ist, ohne sich doch mit ihnen vermischen zu können und ohne mit ihnen verschwistert zu werden; diese Rasse lebt einsam und allein unter den Völkern der Erde und erfüllt so die Prophezeiungen von der göttlichen Verfluchung.42
Das 1920 längst herausgebildete ambivalente Ahasverstereotyp dürfte im Verein mit den seit 1878 grassierenden virulenten antisemitischen Strömungen folglich beim Zuschauer der Ahasverszene des GOLEM damals eine möglicherweise antisemitische Reminiszenz erweckt haben, anders als es beim Zuschauer in der Bundesrepublik heute der Fall ist. 4.2.2.3. DER GOLEM als Weiterentwicklung eines jüdischen Legendenstoffes Wir hatten gefragt, ob Wegeners GOLEM Spuren judenfeindlicher Tradition enthalte, und können diese Frage nun verneinen. Wegeners Golemvariante ist trotz starker Anleihen an die überlieferten Sagenmotive eine selbständige Weiterentwicklung der Legende. Sie nimmt weder die mittelalterliche talmudischkabbalistische Interpretation noch das als Reaktion auf die Blutbeschuldigungen des 19. Jahrhunderts herausgebildete chassidische Beschützermotiv vom Golem als Helfer gegen die Judenfeinde auf. DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM ist kein historischer Dokumentarspielfilm über das Stadtbild, die Berufsstruktur und die Lebensbedingungen der Juden im Ghetto des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Synagoge ist der historischen "Schul" nur nachempfunden, die anderen zentralen Gebäude wie die "Mikwe" (das rituelle Bad für Frauen), der "Cheder"
41 42
Dittmar 1987, 351 Poliakov 1987, VI, 149-165; Zitat 153
57 (die religiöse Elementarschule) und die "Jeschiwa" (die Schule für Talmudstudien) kommen nicht vor. Die Bewohner - neben einigen Großkaufleuten vor allem die Masse der ärmlichen Kleinhändler, aber auch die Funktionsträger in der Khilla (Gemeinde) - werden bis auf die zentralen Figuren nicht individualisiert. Den Regisseur Wegener interessieren keine historischen Tableaus, er hat seine Lust am Geschichtenerzählen und vernachlässigt deshalb manche Details. So bleiben beispielsweise die konkreten Bestimmungen und Auswirkungen des kaiserlichen Dekrets gegen die Juden im Ungewissen. Es muß in Erinnerung gerufen werden, daß Wegener keinen gegen den Antisemitismus gerichteten Aufklärungsfilm drehen wollte, sondern ein Produkt für ein Publikum herstellte, das für sein Eintrittsgeld die aus anderen Wegenerfilmen bekannte und erwartete Ware mit dem Etikett "Märchenhaftes Mittelalter, Mystizismus und Monstergrusical" zu erwerben trachtete und der Filmemacher offenbar gewillt war, dem weitgehend zu entsprechen. Und doch schafft dieser Film Anmutungen von jüdischem Schicksal im wahrhaft finsteren Mittelalter, dem noch finstere Holocaustzeiten folgen sollten. So ist er nicht nur ein Dokument der Filmgeschichte, sondern kann bei entsprechender didaktischer Einführung, Vorbereitung und Auswertung auch als wertvolles Dokument des Einflusses und der Nachwirkung jüdischer Geistes- und Sozialgeschichte interpretiert werden. Zwar irrt Kracauer, wenn er die Beziehung des Rabbi zum Golem so versteht, als ob hier "die Vernunft sich der rohen Gewalt als eines Werkzeuges zur Befreiung der Unterdrückten" bediene, aber er dürfte mit der Gesamteinschätzung des Films im zeithistorischen Kontext recht haben, daß er nämlich für den Versuch steht, "die dunklen Hemmungen und unbekannten Impulse, von denen das Kollektivbewußtsein besessen war, zu überwinden."43
4.2.3. REVOLUTION IN FRANKFURT, - ein Ghettofernsehspiel? Folgt man der Geschichte der Juden im Deutschland des 16. und 17. Jahrhunderts, so könnte man außer Wegeners GOLEM das 1979 produziertes ZDF-Fernsehspiel REVOLUTION IN FRANKFURT über den sog. Fettmilch-Aufstand, der die Erstürmung und Plünderung des Frankfurter Ghettos zum Thema hat, ebenfalls als einen Ghettofilm bezeichnen. Knapp hundert Jahre nach Luthers Thesenanschlag, nämlich 1614, kam es in Frankfurt am Main zu Gruppenspannungen zwischen den Bewohnern des Ghettos und den nichtjüdischen Zünften. Die Ereignisse werden häufig - wegen einer gewissen Nähe zur Lutherzeit - unter die Reformationsgeschichte subsumiert.44 Wir haben auf eine Zuordnung zum Lutherkapitel verzichtet, weil es sich bei diesem Handwerkerangriff auf das Ghetto primär nicht
43
44
Kracauer 1979, 122 u. 121. Zur Kritik an Kracauer wegen Vernachlässigung der politischen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Aspekte der Filmhistografie vgl. Albrecht 1969, 5f. Poliakov 1978, II, 139; Wurmbrand/Roth 1980, 258; Ben-Sasson 1979, II, 325f; Graetz 1985, V, 362-366
58 um ein durch die theologischen Fragen bestimmtes Verhältnis von Kirche und Synagoge handelte und eben auch nicht um einen Konflikt zwischen jüdischen Ghettobewohnern und den christlichen Zünften, sondern zunächst einmal um Spannungen zwischen dem Volk, dessen Judenfeindschaft sich zu "offenem Judenhaß"45 steigerte, und den Patriziern, die mit Unterstüzung des Kaisers die Juden zu schützen suchten. Graetz und Poliakov beschreiben anschaulich das judenfeindliche Klima in der Stadt, wie es sich in den gesetzlichen Bestimmungen der Judenstättigkeit (den Bedingungen des Wohnrechts für Juden unter einschneidenden Beschränkungen) und anderen diffamierenden Vorschriften niedergeschlagen hatte. Die Gegensätze zwischen Patriziern und Zünften um ihre jeweiligen Privilegien gingen auf Kosten der Juden. Die Zünfte hatten eine Beschränkung der Zahl der jüdischen Einwohner und eine Minderung des Zinssatzes gefordert. Eine geheime Kommission hatte einen Judenplan aufgestellt, der die Ausweisung jedes Juden mit einem geringeren Vermögen als 15 000 Goldstücken und eine Zwangsanleihe sowie andere judenfeindliche Maßnahmen für die Verbleibenden vorsah.4® Als sechzig Juden demgemäß die Stadt verlassen mußten, der Kaiser und der Magistrat aber diese Ausweisung annullierten, rückte der den Zünften vorstehende Lebkuchenbäcker Vincenz Fettmilch mit einem Mob Aufsässiger gegen das Ghetto vor. Die Juden verteidigten sich vergeblich. Dreizehn Stunden lang tobte und plünderte die Fettmilchbande. 1500 Juden versammelten sich verängstigt auf dem Friedhof. Schließlich erlaubte (!) ihnen Fettmilch, die Stadt zu verlassen; aber während und nach der Ausweisung ging die Plünderung weiter.47 Der Kaiser stellte übrigens die Ordnung wieder her, der Fettmilchaufstand wurde niedergeschlagen, der Anführer mit seiner Bande hingerichtet, die Ausweisung widerrufen, die Gruppe der vertriebenen Juden feierlich wieder in die Stadt zurückgeholt. Eine Verfilmung dieser Ereignisse ist als Historienfilm, als Lehrstück, als Prozeßrekonstruktion, als subjektives Leidensstück der Betroffenen und in mancher anderen Spielart denkbar, ein didaktischer Tenor dabei kaum abweisbar. Einsichten über die Mechanismen bei der Bildung von Vorurteilen, etwa in der Form der Produktion eines "chimärischen Judenbildes"48 wären relativ leicht herstellbar. Zeitgenössische Dlustrationen49 verführen geradezu zur "Nachstellerei".
45
46 47
48
49
Ben-Sasson 1979, II, 325; Zum "Fettmilch-Aufstand" auch Jüdisches Lexikon 1986, II, Sp. 634-636; Schuder/Hirsch 1988, 645-652 Ben-Sasson 1979, II, 326 Nach anderer Darstellung beschrankte sich die Plünderung auf die Synagoge und einige Häuser, außerdem sei nur die Hälfte der 3000 in Frankfurt wohnenden Juden ausgewandert. G. Müller 1988, I, 467. Vgl. auch Schudt 1922, 53-57 Vgl. das Modell der antisemitischen Wahrnehmung gesellschaftlicher Realitäten bei Strauss/Kampe 1985, 18-23 Kupferstich von Georg Keller in Ben-Sasson 1979, II, Tafel 37, Kupferstich von Johann Gottfried (d.i. Abelinis) in Goethes Aus meinem Leben.Dichtung und Ytbhrheit. Goethe 1985,XVI, 161
59 Wie würde das ZDF bei seiner Version vorgehen, und welche Intention würde es verfolgen - etwa gar in der sich distanzierend-entschuldigenden Art, mit der Goethe "die unglücklichen Menschen" (er meinte damit nicht etwa die Juden, sondern Fettmilch und seine Kumpane) bedauerte?50 Oder würden antisemitische Spuren dieses primär auf wirtschaftlicher Konkurrenz und Verteidigung des absinkenden Prestiges beruhenden Aufstandes aufgezeigt werden? (Schließlich hatte ja die geheime Kommission vor dem Losbrechen des Sturms auf das Ghetto gefordert, die nicht ausgewiesenen Juden müßten sich jede Woche eine christliche Predigt anhören, Fettmilch hatte sich als neuer Judenverfolger Haman gerühmt und seine Bande sich am Verbrennen der Thorarollen delektiert.) Würde man zu gestalten versuchen, warum es im frühen 17. Jahrhundert bei der ungleichen Verteilung der politischen und wirtschaftlichen Gewichte noch nicht zu einer Begegnung zwischen Juden und Christen, sondern nur zu eng begrenzten wirtschaftlichen Beziehungen und zu einer entschiedenen geistigen Auseinandersetzung kam? (Die Einschränkungen, denen Juden durch die Judenordnungen jener Zeit ausgesetzt waren, sind ja nicht nur ein Hinweis auf die Duldung der Juden aus materiellen Gründen, sondern belegen - trotz der fortgeschrittenen "Eingliederung [der Juden, D.P.] in die politische Gemeinschaft der sie umgebenden Christen"51 - sowohl die Furcht vor Kontakten und Missionierungen als auch den allmählich wachsenden Einfluß von Juden, indem diese z.B. 1595 den Kaiser veranlassen konnten, daß er in Frankfurt Luthers Schrift Von den Juden und ihren Lügen - das "ärgerliche, schamlose Schmachbuch" - zur Vermeidung von Aufruhr konfiszieren ließ.52) Oder schließlich: Würde man auf die Problematik des geistig-kulturellen Ghettos oder auf dessen Funktion als Finanzzentrum zu sprechen kommen? Würde also das Fernsehspiel von Heinrich Leippe mit dem etwas sonderbaren Titel REVOLUTION IN FRANKFURT 53in der Inszenierung des renommierten Fritz Umgelter54 ein aufklärerisches eindimensioniertes Bild von jüdischem Leiden im Ghetto um 1600 oder gar eine anspruchsvoll differenzierte, womöglich sogar widerspruchsvolle Schilderung der Ereignisse bieten? Die Genrebezeichnung "Historisches Spiel" - sie findet sich in Zeutzschels Fernsehspielarchiv ebenso wie in der ZDF-Vorschau55 - läßt vermuten, daß REVOLUTION IN FRANKFURT kein Dokumentarspiel ist, sondern eine nicht-
50 51
52 53
54
55
Goethe 1985, XVI, 160 Müller 1988, I, 464. Vgl. ebd.(S. 456f.) die Auszüge aus den hessisch-dannstädtischen Judenordnungen von 1585-1695 Müller 1988, I, 463 REVOLUTION IN FRANKFURT, Regie: Fritz Umgelter, Buch: Heinrich Leippe, Prod.: Elan/ZDF BR Dtschld. 1979 Umgelter hat zwischen 1954 und 1977 91 oft hoch gelobte Femsehspiele (häufig nach eigenem Drehbuch, darunter viele Literaturverfilmungen, z.B. AM GRÜNEN STRAND DER SPREE) inszeniert. Vgl. Femsehspiele in der ARD 1952-1972 und Femsehspiele 1973-1977 Zeutzschel 08105; ZDF-Fernsehspiel XXIII, 85
60 dokumentarische Narration, eine erdichtete Geschichte, bei der es dem Autor keineswegs auf die sachrichtige Wiedergabe des Belegten, des Dokumentarischen also, ankam, sondern wo er seine Fabel entfaltete, um seine "Botschaft" in Souveränität gegenüber dem Quellenbefund zu verkünden. Und in der Tat geht dies Fernsehspiel auf ein Schauspiel des Autors zurück, der "sich in der Wahl seiner Pointen oder dramatischen Verknüpfungen nicht durch irgendwelche feststehende gewußte Fakten behindern lassen" wollte.56 Nun ist REVOLUTION IN FRANKFURT nicht als Fernsehspiel, als Literaturadaption, sondern innerhalb der Sparte "Dokumentarspiel" gesendet worden, es muß sich also an dem für dieses Genre aufgestellten Kriterium der "Treue zur Historie"57 messen lassen. Diese mangelnde Treue hat zu einer schon erstaunlich zu nennenden Umproportionierung der jüdischen Thematik und zu einer bedenklichen Umakzentuierung der Figur des Fettmilch geführt. REVOLUTION IN FRANKFURT bietet kein aufklärerisches Bild von jüdischem Leiden im Ghetto, z.B. nach dem zeitgenössischen Vintz-Hanß-Lied des Elchanan Helen über den "bösen Schalk" und "Volksverführer" Fettmilch.58 Vielmehr tritt das Ghetto in Wort und Bild nirgends in Erscheinung (von der "Judengaß" ist einmal die Rede); das Fernsehspiel ist entgegen unsern eingangs geäußerten Vermutungen kein Ghettofilm. Es bringt aber auch keine differenzierte Schilderung der wirklichen Ereignisse, sondern erzählt nur die Fabel von einem tapferen, selbstbewußten Bürger ("ein ordentlicher Mann, gradaus, verläßlich, ohne Falsch", vielleicht sogar "einer von denen, die was bewegen in der Welt", "wie der Hutten, für die Freiheit und für die Gerechtigkeit"), der zwar ein bißchen hitzig ist, aber doch eine gute Sache vertritt; das Selbstbewußtsein der übrigen Bürger im Kampf für die Erringung von Privilegien zu stärken, die Abhängigkeit von den Patriziern und dem Klerus zu mildern, kurz: Fettmilch wird als Vorkämpfer der Demokratie hingestellt, der scheitert, weil die Machtverhältnisse und die herrschenden Vorurteile wider ihn sind. Privilegien, "Freiheite" hätten nur "die Jude, die Christusmörder". Diese Kritik an den Juden ("Die Wurzel von allem Übel und aller Beschwer in dieser Stadt ist der Judenwucher") geht aber im Fernsehspiel nicht auf Fettmilch, sondern auf die Demagogie eines Advokaten zurück. Sie wird auch eher beiläufig geäußert, ist ein additum, keine causa der Konflikte. Die Position der Juden als Kammerknechte des Kaisers wird in ihrer an Schulfunk erinnernden Doziererei nicht deutlich, ihre mißliche Rolle als Geldbeschaffer für den Kaiser wird nicht gestaltet - trotz der Figur eines redlichen jüdischen Geldverleihers, der durch den Judenhaß fast ruiniert wird. Dies ist aber weder eine zentrale Szene, noch wird Fettmilch als Motor und Organisator der judenfeindlichen Ausschreitungen gezeigt, im Gegenteil: Mit einem Rabbiner führt er einen partnerschaftlichen
"Antwortbrief des Redakteurs der Sendung, Dr. Franz Neubauer, vom 3.8.88 an den Verfasser. Vgl. Neubauer 1984, 68-74 57 Neubauer 1984, 78 58 ZDF-Fernsehspiel ΧΧΠΙ, 86ff.
61 Gedankenaustausch, hält den Wiederausbruch von Pogromen für unmöglich und hat ein gewisses Verständnis für die Nöte der Juden mit ihrem Zinsgeschäft. Entgegen der Quellenlage ist er an allen Ausschreitungen unschuldig. Im Fernsehspiel ist weder die Rede vom oben erläuterten Judenplan noch vom Sturm auf das Ghetto. Zwei Dutzend Statisten in der Rolle von Bürgern murren, skandieren im Sprechchor ("Zu End ist unsere Geduld. Die Jude sind an allem schuld"), und ein paar Juden geraten - so der Tenor des Spiels - etwas in Bedrängnis. Der Pogrom wird also verharmlost, die nur im Dialog genannte Ausweisung als Entschluß der Juden zur Auswanderung hingestellt. Der brave Fettmilch, der entgegen den durchweg konservativ, ja reaktionär gezeichneten Geistlichen (dem katholischen Bischof, den evangelischen Pfarrern und auch dem Rabbiner) zur Veränderung der Verhältnisse beitragen wollte, stirbt wegen seines Widerstandes gegen die Patrizier mit einigen seiner Kumpane auf dem Schafott, und der Zuschauer darf sie mit Goethe bedauern: "Die unglücklichen Menschen!" In zweierlei Hinsicht allerdings vermag das TV-Spiel wirtschaftspolitische Konflikte, die für die alten Reichsstädte, also auch Frankfurt, typisch waren, wenigstens anzudeuten: das Fortbestehen des mittelalterlichen Zunftgeistes, der an der Ausschaltung jeglicher Konkurrenz der Juden mit christlichen Handwerkern und Kaufleuten interessiert war59, und - dies gelingt besser - die innerstädtischen Konflikte zwischen Patriziat und Zünften, bei denen der Judenhaß zur Kanalisierung des Volkszorns willkommen war.60 Leider gelang es nicht, diesen Aspekt zu einem Lehrstück über die Mechanismen bei der Entstehung von Vorurteilen und ihre Auswirkungen gegenüber der Minorität zu gestalten. Lediglich die Mechanismen der Pogromeskalation und der Rollenverteilung bei Exzessen gelangten zur Darstellung: aktive Beteiligung der untersten Klassen, meist der Opfer der Gesellschaft, und vornehme Zurückhaltung der aufwiegelnden Bürger, die sich für zu fein dünken, selbst Hand anzulegen. Nach dem gleichen Muster haben sich nach E. Sterling noch 1819, 1830, 1834, 1844 und 1848 die arrivierten Judenfeinde verhalten.61 Nirgends geht die Darstellung über eine stereotype Judenpräsentation hinaus. Außer Komparserie werden nur zwei jüdische Figuren vorgeführt: zunächst ein Geldverleiher, korrekt im Kaftan mit Judenabzeichen (Ring) und Kippa, selbstverständlich in seinem Arbeitsraum beim Geldzählen an der Rechenmaschine und beim Eintragen ins Kontobuch nachts im Kerzenschein sowie beim Disput über Zins und Kapital, wobei er beschwörend-resignierend die Hände hebt und in seine Rede Floskeln wie "Dem Ewigen sei's geklagt", "Gott erleuchte sie" oder "Herr meines Lebens" flicht und dezent jiddelt; und als zweite Figur ein leicht schwäbelnder Rabbiner, salbadernd, dozierend, weltmännisch, auf den Schutz des Kaisers und nicht Gottes hoffend, bei der Versammlung der Juden rhetorisch den Talmud zitierend.
59 60 61
Graupe 1977, 114f. Breuer 1988, 82 Sterling 1956, 179-181
62 Nein, dies frei fabulierende Fernsehspiel bzw. dieses geschichtsklitternde Dokumentarspiel zeigt weder die Lage in der Frankfurter Judengasse zwischen 1612 und 1616 noch trägt es zu einer differenzierten Sicht jüdischer Figuren bei. Die Rolle des Geldverleihers und Finanziers Löb Schmuch bleibt ganz dem Stereotyp des jüdischen Geldmannes verhaftet, auch wenn sich der Darsteller Herbert Weicker um eine sympathische Zeichnung bemüht. In einer Szene mit ihm wird auf einen anderen jüdischen Geldkaufmann verwiesen: auf Oppenheimer. Ihm und seiner Präsentation in den Medien gilt nun unser Interesse.
5. DREIMAL "JUD SÜSS": Die filmische Verwertung der Literatur über den Hoffaktor Joseph Süß Oppenheimer
Der mühsame Weg aus dem Ghetto in Deutschland nach Luther und nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation war für einige Juden mit Hilfe des Kapitals möglich, das die absolutistischen Fürsten für ihre den Versailler Riten nachgeäffnete Hofhaltung und ihre politischen Pläne so dringend benötigten. Wer unter den Juden "durch Geschicklichkeit und Zähigkeit"1 zu Reichtum gekommen war, sich durch Bildung und Wohlerzogenheit als gesellschaftlich opportun erweisen konnte und die Qualifikation eines erfahrenen Finanzmannes, Administrators, Juweliers und Heereslieferanten erworben hatte, wer seine über die Duodezstaaten bis ins Internationale hinausreichenden Verbindungen nutzte, wer aber auch die Selbstverleugnung besaß, angesichts der Arroganz und der Launen seines adligen Herren demütig und bescheiden, dienstfertig und höflich, gewissenhaft und treu zu sein, kurz: als Untertan sich zu bewähren, konnte von den Beschränkungen frei werden, denen der Großteil der Juden unterworfen war. Wenn er die Gunst und das Vertrauen des Herrschers erworben hatte, dann wurde ihm gestattet, das Ghetto zu verlassen, den gleichen Lebensstil wie die Aristokraten zu pflegen, seinen Reichtum zu mehren und andere Juden in seiner Nachbarschaft sich ansiedeln zu lassen, so daß dort neue jüdische Gemeinden entstehen konnten.2 Das Bild, das sich ältere Kinobesucher von dieser Klasse der Hoffaktoren oder allgemeiner: der Hofjuden machten, ist durch einen kommerziell sehr erfolgreichen, wie alle Historienfilme mit viel Trivialelementen durchsetzten, melodramatischen Unterhaltungsfilm über einen wegen "Rassenschande" verurteilten Hoffaktor geprägt: Der von Goebbels befohlene, von Veit Harlan, E. W. Müller und L. Metzger willig geschriebene und von Harlan eifrig inszenierte Spielfilm JUD SÜSS zieht seinen Effekt aus einer Stereotypenmixtur. Er prägte die Vorstellung vom Gegensatz zwischen der schmutzigen Ghettowelt und der verschwenderischen Prachtentfaltung des Hofen, von "dem" Juden als Aufsteiger, seiner Metamorphose vom jiddelnden Trödler und Pfandleiher mit Pejes, Bart, Kippa und Kafitan zum eleganten, einflußreichen Höfling. Er hat wesentlichen Anteil an der Dämonisierung "des" Juden als Blutsauger, skrupellos seine Macht ausnutzender, geldgieriger Verdeiber aufrechter, braver Männer und Frauenehre
1 2
Poliakov 1978, II, 129 Wurmbrand/Roth 1980, 304
64 in den Schmutz ziehender Lüstling, gegen den nur noch eins hilft: Ausweisung oder Vollzug der Todesstrafe.3
5.1. Forschungsergebnisse über Joseph Süß Oppenheimer
Über diesen berüchtigsten aller Nazifilme gibt es eine immense Literatur. Seit Anfang der achtziger Jahre untersucht an der Technischen Universität Berlin unter Leitung von Friedrich Knilli eine Lehr- und Forschungsgruppe an Hand der Mediengeschichte des Joseph Süß Oppenheimer die "Entstehung und Entwicklung des Unterhaltungsgenres und Feindbildes", worüber bereits ein "Preprint zur Medienwissenschaft" erschienen ist.4 S. Zielinskis aus dem gleichen "Lehr- und Forschungsprojekt ' Jud Süß'" hervorgegangene Arbeit über den Spielfilmregisseur Veit Harlan nennt im Literaturverzeichnis 737 Titel (davon allein 513 PeriodikaArtikel über Harlan und den Schwurgerichtsprozeß 1949/50).5 Andere Publikationen sind gefolgt.6 Wir können uns angesichts der Materiallage kurz fassen (zumal der seit dem Verbot einer Vorführung gemäß Entscheidung der Alliierten Militärregierung seit 1945 in Deutschland verbotene Film in einer öffentlichen Vorführung nicht mehr zu sehen war), müssen aber Harlans Arbeit zum Vergleich mit anderen Film- bzw. Fernsehfassungen des gleichen Stoffes heranziehen. Dabei beschränken wir uns im wesentlichen auf die Juden- und Ghettodarstellungen. Vorher müssen wir aber die Forschungsergebnisse über den historischen Joseph Süß Oppenheimer, das System der Hoffaktoren an deutschen Fürstenhöfen und das Frankfurter Ghetto im 18. Jahrhundert referieren.
3
4
5 6
Auf die Dämonisierung des Hoffaktorenbildes nicht nur durch Überlieferung, Legende und Roman, sondern ausdrücklich auch durch den Film macht im Rahmen der Geschichtsschreibung erstmalig m.E. Kampmann (1963,63) aufmerksam. Zum kommerziellen Erfolg des Films: Unter den 30 erfolgreichsten deutschen Spielfilmen der Jahre 1940-42 steht JUD SÜSS nach einer Aufstellung des Instituts für Konjunkturforschung, 1943, an 6. Stelle (Der Film im Dritten Reich 1979, 251). Vor ihm rangieren als "P-Filme" in der nicht unumstrittenen Kategorisierung von Albrecht (P-Filme: Filme mit , manifester politischer Funktion ohne Rücksicht auf den sonstigen Inhalt und ihre Grundhaltung) nur noch DIE GROSSE LIEBE (Rangplatz 1), WUNSCHKONZERT (Rangplatz 2) und ANNELIE (Rangplatz 5). Nach der von Albrecht vorgeschlagenen Umrechnung des Einspielergebnisses auf die Besucherzahl haben in dieser Zeit 21 Millionen Besucher den JUD SÜSS-Film gesehen, der erstplazierte Zarah-Leander-Film hatte gar nicht sehr viel mehr Besucher, nämlich 27,7 Mio. Zu Unterscheidung von P-Filmen von nP-Filmen (alle Filme mit nur latenter politischer Funktion) vgl. Albrecht 1969, 104-11 und Lowiy 1991, 25-31 Knilli u.a. 1983. Zu internationalen und intermedialen Vermarktung des Jud-Süß-Stoffes: Holocaust zur Unterhaltung 1982, 11-15; Knilli 1985, 49-52; Knilli/Zielinski 1983 Zielinski 1981 Z.B. zur Filmgeschichte: Toeplitz IV u. Drewmak 1987
65
5.1.1. Die Figur des "Jud" Süß Oppenheimer Hoffaktoren als Vorboten der Emanzipation durch Assimilation sind in der Literatur jüdischer Historiker erst in diesem Jahrhundert intensiver behandelt worden. Der berühmteste Hofjude, Joseph Süß Oppenheimer, war in den zwei Jahren vor und nach seiner Hinrichtung Gegenstand zahlloser Flugblätter und Schmähschriften. Danach wurde er fast zwei Jahrhunderte lang in fünfzig Abenteuerromanen, Volksbüchern, phantasievollen Lebensbeschreibungen, antijüdischen Pamphleten und historischen Romanen vermarktet, ohne daß aber dabei das Archivmaterial, vor allem über seinen Prozeß, ausgewertet wurde. Erst seit 1874 gibt es eine Süßforschung, die sich nicht nur auf Überlieferungen stützt, sondern auch auf Prozeßakten und andere Dokumente. Die vier wichtigsten Arbeiten des 20. Jahrhunderts - in deutlich aufsteigender Linie hinsichtlich ihrer Fundierung durch archivalische Quellen - stammen von C. Elwenspoek (1926), S. Stern (1929), H. Schnee (1963) und B. Gerber (1990). 5.1.1.1. Curt Elwenspoeks Biographie Jud Süß Oppenheimer Elwenspoeks flüssig geschriebene, populärwissenschaftliche Biographie,7 deren Untertitel noch an die Trivialliteratur der Barockzeit anknüpft, streut zahlreiche der charakteristischen Spottgedichte in seine Darstellung, die vor allem durch die farbige Schilderung des damaligen Hoflebens, der Feste und Amouren Süß Oppenheimers und seiner Leidenszeit mit Kerkerhaft, Prozeßverlauf und Hinrichtung ihren Wert erhält, aber nicht in allen zitierten Quellen verläßlich ist,8 auch nicht den im Titel formulierten Anspruch einlöst, "sämtliche Akten" berücksichtigt zu haben. Sein Versuch, "die menschliche Persönlichkeit Oppenheimers mit ihren Schwächen und Vorzügen zu zeichnen", erfolgt nicht sine ira et studio, sondern ist "von einer gewissen Sympathie für den Menschen" erfüllt,9 setzt sich also bewußt von einem judenfeindlichen Tenor ab, wie er z.B. schon im Titel einer Schrift aus dem Todesjahr Oppenheimers anklingt: "Leben, Übelthaten und gerechtes Urteil des berichtigten Erzschelmen und Diebs Juden Süß Oppenheimers ...". Auch Elwenspoek räumt der nur drei Jahre dauernden Hoffaktorentäitgkeit unter dem Herzog Carl Alexander von Württemberg den weitesten Raum ein, nachdem er die Diskrepanz zwischen Oppenheimers Angabe des Geburtsjahres (1698 oder 1699) und denen der zeitgenössischen Biographien (1692) damit erklärt hat, daß der Hoffaktor so das Gerücht seiner unehelichen Abstammung von dem Generalfeldmarschalleutnant von Heidersdorf widerlegen wollte, weil formell noch
1 8
'
Elwenspoek 1926 Angermann 1984, 13 ; Gerber 1990, 24 Elwenspoek 1926,6
66 immer das Gesetz in Kraft war, das "die fleischliche Vermischung" zwischen Juden und Christen für beide Teile mit dem Tode bedrohte.10 Zwischen Herzog und Hoffaktor bestand nach Elwenspoek eine "persönliche, gefühlsmäßige Bindung", da beide die gleiche "rücksichtslose Kühnheit" besaßen und sich "im abenteuerlich Gewagten, in der grenzenlosen Hochspannung ihrer Entwürfe" trafen.11 Süß war dem Herzog im politischen, wirtschaftlichen und privaten Bereich unentbehrlicher Helfershelfer, als Wirtschafts- und Finanzpolitiker seiner Zeit "vielleicht um zwei Jahrhunderte voraus"12: Organisator des Münzwesens, Verbesserer der Staatsfinanzen, gut verdienender Bankier und Pretiosenhändler, Kavalier, Lebemann und Hofherr, dessen Status als reich gewordener, landfremder Jude, als Vertrauter und "Privatratgeber"13 des katholischen Herzogs die evangelischen Stände empörte, zumal der "Finanzrat" wichtige Posten mit seinen "Kreaturen" besetzte und seine Erfindungsgabe für immer neuere, immer wirkungsvollere Steuern und Staatseinnahmen schier unerschöpflich schien. Das ausgebeutete Volk interessierte nicht die Intelligenz und Kultiviertheit, der enorme Heiß des "Schnell- und Vielarbeiters ersten Ranges"14, es scherte sich nicht um die Abhängigkeit Oppenheimers von seinem Herzog; es sah nur mit Abscheu den Reichtum, die rauschenden Feste und die "Fleischessünden" eines anscheinend Mächtigen, der die hübschen Bittstellerinnen wie die Damen der guten Gesellschaft durch sein Schlafzimmer passieren ließ. Was den adligen christlichen Herren gut war, durfte "dem" Juden doch nicht billig sein:15 Meidet ungehenckte Diebe, Ist ein Jude noch so groß, Würdigt ihn nicht eurer Liebe, Blößet ihm nicht euren Schooß, was geschieht, laßt's christlich sein, Kommt ein Jude, saget nein.
Süß dürfte von den Rekatholisierungsplänen des Herzogs, die durch einen militärischen Umsturz eingeleitet werden sollten, nur wenig gewußt haben. Als es zu Entfremdungen zwischem dem Herzog und seinem Hoffaktor gekommen war, warnte Oppenheimer allerdings die Protestanten. Am Tage des geplanten Umsturzes starb Carl Alexander überraschend am "Schlagfluß". Süß wurde verhaftet, fast gelyncht, auf die Festung Hohenneuffen abgeführt. Der "Volkszorn" machte sich in antijüdischen Hetzgedichten Luft. Eins beginnt so: Hinaus mit dir aus Stuttgardts Mauren, Verdammter Jud, verfluchter Süß! Der Teuffei wird nun dich bedauren,
10 11 12 13 14 15
Elwenspoek 1926, 18 Elwenspoek 1926, 32 Elwenspoek 1926, 35 Elwenspoek 1926, 49 Elwenspoek 1926, 82 "An das tugendhafte Frauenzimmer", Spottgedicht aus dem Jahre 1738, Elwenspoek 1926, 112
67 Der dich ins Land, zum Schaden, schmiß.'6
Man leitete gegen Oppenheimer den Prozeß ein. Angeklagt wurde er wegen Hochverrat, Majestätsbeleidigung, Betrug, Amtserschleichung, Münzvergehen, Simonie und Hurerei. Elwenspoek hebt hervor, daß bis auf eine Ausnahme in der Kommission nur persönliche Feinde Oppenheimers saßen, nach seiner Überführung auf die Festung Hohenasperg der kommandierende Major den in ein ungeheiztes Loch in Ketten Eingekerkerten als den "Hebräer, die Bestie" bezeichnete, dieser zunächst in einen Hungerstreik trat, dann nur noch rituelle Speisen zu sich nahm, wöchentlich zwei bis drei Tage fastete. Süß erhielt einen Pflichtverteidiger, mit dem er erst nach vielen Mühen schriftlichen Kontakt aufnehmen konnte. Katholische und evangelische Geistliche unternahmen wiederholte Bekehrungsversuche, doch Süß erklärte; "Seine Religion zu ändern, ist eine Sache für einen freien Menschen, aber einem Gefangenen steht das übel an." Der Prozeß war nach Elwenspoek "eine höchst unappetitliche Komödie", bei der man "auf der Grundlage des Rechtes ... nicht an ihn [Süß, D.P.] herankonnte", bei dem "für keinen der erhobenen Anklagepunkte irgendein Beweis erbracht worden" sei, so daß der Professor Johann Heinrich Harpprecht als einziger gegen die Verurteilung gestimmt und erklärt habe, man "könne den Angeklagten zum Tode nicht verurteilen, man solle ihm seinen Raub, soweit er erwiesen, abnehmen und ihn aus dem Herzogtum verbannen."17 Auch das Gesetz gegen die geschlechtliche Vermischung eines Juden mit Christinnen wollte man mit Rücksicht auf die angesehenen christlichen Familien nicht anwenden. Um von den ebenfals angeklagten nichtjüdischen württembergischen Beamten abzulenken, mußte die Volkswut auf einen Fremdling gelenkt werden, so sei denn die Verurteilung des Süß "ein politischer Mord" gewesen.18 Abschließend schildert Elwenspoek detailliert das Ende Oppenheimers: seinen körperlichen Verfall, aber auch seine Rückkehr zum Glauben der Väter, die Urteilsverkündigung, bei der er seine Unschuld beteuert und die Richter verflucht habe, den Abschied von Vertretern der jüdischen Gemeinde in der Zelle, den Zug zum Galgen mit dem darüber hängenden eisernen Vogelkäfig für den Vogler als Umschreibung für das vulgäre Verb von Oppenheimers Fleischessünden, das Hinaufsteigen auf die 52 Sprossen der Leiter, wobei der Verurteilte ununterbrochen das "Schma Jisrael" betete, und den Tod auf dem von 1200 Soldaten abgesperrten Marktplatz, der von sensationslüsternen Zuschauern überquoll.
16
17 ,e
Elwenspoek 1926, 133. Zum verderblichen Einfluß der Druckerzeugnisse bis hin zu Streichers Stürmer gilt Breuers These: "Die Geschichte der Druckmedien ist von Anfang an auch die Geschichte der Einschärfung der Topoi des Judenhasses, der antisemitischen Propaganda." Breuer 1988, 86. Über die Rezeption vor allem der zeitgenössischen "Jud-Süfl"-Haßliteratur vgl. Gerber 1990. Elwenspoek 1926, 152. Das "Gutachten" Harpprechts im Original gesperrt. Elwenspoek 1926, 155
68 5.1.1.2. Selma Sterns Jud Süß als Beitrag zur deutschen und jüdischen Geschichte Die jüdische Historikerin Selma Stern schildert den Lebenslauf des "Jud Süß" ähnlich.19 Der Fortschritt ihrer Arbeit gegenüber Elwenspoek besteht in der Aufnahme von zahlreichen, die Hälfte des Buches füllenden Aktenstücken und in der differenzierten Beschreibung der Leistungen Oppenheimers: - als Hof- und Kríegs&ktor Nach den Anfangen seiner geschäftlichen Tätigkeit als Großkaufmann in der typischen Verflechtung von Waren- und Geldhandel leiht er als Hofjude dem Prinzen-, später dem Herzogpaar große Geldsummen, liefert kostbare Kleider und Juwelen, reist als Informant seines Herrn im Lande umher, fungiert als politischer Beamter. - als Residen?" Der Herzog, der sich der autokratischen Herrschaft der württembergischen Stände nur unwillig beugte und sein politisches Programm - Vormachtstellung im Süden mit Hilfe eines noch zu gründenden starken stehenden Heeres - durchsetzen wollte, brauchte Geld, um die Schuldenlast seines Vorgängers abzutragen und seine politischen Ziele zu erreichen; dafür standen ihm nur die Erträge aus Domänen und Regalien zu, während die eigentlichen Steuern von den Ständen, der "Landschaft", selbständig verwaltet wurden und seinem Einfluß entzogen waren. Der Resident Süß sollte die Umorganisation der Staatseinnahmen bis hin zur Beherrschung der Finanzverwaltung des Landes vorantreiben. - als Ratgeber Zwecks Erschließung neuer Geldquellen ließ sich Karl Alexander von seinem Residenten über ein Projekt zur Verbesserung des Pulver- und Salpeterwesens, die Einführung eines gewinnträchtigen "Anzeigezettels", d.h. eines offiziellen Verordnungsblattes, die Umbesetzung von wichtigen Minister- und Räteposten, die Umgestaltung des Kassenwesens und die Revision der Hofordnung beraten. - als Mercantilist Zur Verbesserung der landesherrlichen Einnahmen durch Erteilung von Privilegien und Monopolen plante Süß eine Porzellanmanufaktur, errichtete eine Tabakmanufaktur, veranlaßte die Gewährung eines Salzmonopols, eines Ledermonopols, eines Weinmonopols, verbot die Einfuhr ausländischen Biers, erhielt für sich selbst das Privileg, im eigenen Hause Hazardspiele treiben zu lassen, führte staatliche Lotteriestellen ein und versuchte die Gründung einer württembergischen Staatsbank.
" 20
Stem 1929 Ein Residententitel war eine Stufe höher als der Faktorentitel. Der Prinz Karl Alexander hatte Oppenheimer noch als Schatullenverwalter und Agent, dann als hessischen Hof- und Kriegsfaktor angestellt; als Herzog von Württemberg ernannte Karl Alexander seinen Hofjuden zum Residenten (Stem 1929, 20-44).
69 - als Finanñenrat Alle fiskalischen Maßnahmen Oppenheimers galten der Vermehrung des Fiskus, aber erst seine Steuerpolitik "gestaltet seinen Namen zum Symbol gewissenloser Erpressung und schamloser Geldgier."21 Der Herzog, der auch ohne Einwilligung der Stände auf seinem Recht zur Steuererhebung bestand, führte auf Rat Oppenheimers eine an Süß abzuliefernde Taxe von allen Württembergern mit fester Besoldung ein, den sog. "Judengroschen" oder "Höllengroschen", ferner eine Schutz-, Schirm- und Vermögenssteuer, befahl eine Abgabe von den Einkünften aus dem Kirchengut und aus der Erbschaft von Waisenkindern. Daß er Oppenheimer zum Geheimen Finanzienrat ernannte und ihm das Gratialamt unterstellte, wo man gegen Abgaben an die herzogliche Kasse und zusätzlich auch an Süß Titel, Ämter und Stellungen erwerben konnte, erbitterte das Volk ebenso wie die Ansiedlungserlaubnis für acht jüdische Familien und die Ernennung Oppenheimers zum Kabinettsfiskal, dessen Behörde durch Denunziationen Gesetzesbrecher aufspüren und den angedrohten Prozeß zugunsten hoher Geldstrafen niederschlagen sollte. - als Kaufmann Da Oppenheimer nach Meinung Sterns kein Finanzminister, kein staatlicher Beamter war, sondern auch als Politiker stets der Warenhändler und Bankier blieb, seine Aufmerksamkeit in gleicher Weise auf den privaten wie den öffentlichen Bereich verteilte, kam es zu "unheilvollen" Verknüpfungen bei seinen Geschäften als Hoflieferant, Kriegslieferant und Juwelenhändler. - als Münzpolitiker Süß, der seine Laufbahn als Gold- und Silberlieferant begonnen und als Direktor der Württember Münze beendet hatte, der sich wegen Münzfälschung als der schwersten aller gegen ihn erhobenen Anklagepunkte verteidigen mußte, konnte sich nach Stern von dem Vorwurf der Ausprägung zu schlechter Scheidemünzen entlasten. - als Politiker Stern spricht von der "beinahe schwärmerischen Freundschaft"22 zwischen Karl Alexander und Süß sowie von "nicht aufgeklärten Ursachen" für die Lockerung dieses Freundschaftsbundes, begründet sie aber letztlich doch mit unterschiedlichen politischen Zielsetzungen: Oppenheimer wollte den "harte[n], nüchterne[n] Polizeiund Machtstaat des aufgeklärten Absolutismus"23 und "indirekt durch Hebung der Finanzen, der Wirtschaft, der Industrie und des Handels, das Volk reicher und glücklicher machen"24, zugleich hoffte er, daß dieser absolutistische Staat "den Juden insgesamt Anteil an ihren eingeborenen Rechten"25 gewährte, während der Herzog sich als Vorkämpfer der Gegenreformation verstand und "einen großen
21 22 23 24 25
Stern Stern Stern Stem Stern
1929, 1929, 1929, 1929, 1929,
83 142 146 147 148
70 revolutionären Plan zur Einführung der katholischen Religion in Württemberg und zum Sturz der landständischen Verfassung" ausarbeitete. Die Biographie Sterns versteht sich laut Untertitel als ein "Beitrag zur deutschen und jüdischen Geschichte". Für die Autorin ist Süß "der erste und bis auf Lassalle fast der einzige Jude, der bewußt, wenn auch in engem Bereich, in den Gang der deutschen Geschichte eingreift"26, sie möchte ihn als "schaffende und schöpferische Persönlichkeit"27 verstehen, als einen Menschen, der durch den "Dualismus der äußeren Lebensformen" wie durch "Zwiespältigkeit und Zerrissenheit der innersten Natur" geprägt ist,28 der als schon assimilierter Jude "in seinem Lebensgefühl und seinem Lebensrhythmus ein Mensch der Barockzeit ist."29 5.1.1.3. Ergänzungen und Korrekturen des Süß-Bildes durch Heinrich Schnee Die Entwürfe von Elwenspoek und Stern ergäben jeder für sich auch großartige Sujets für einen Film, ein Fernsehspiel oder - bedingt - eine Fernsehserie. Sie böten Grundlagen für geschlossene, in sich glaubwürdige Gegenmodelle zu Harlans Nazifilm, auch da, wo sie mit neueren Erkenntnissen der Forschung nicht mehr übereinstimmen. Denn die jahrzehntelange akribische Auswertung der archivalischen Quellen durch H. Schnee30 erfordert einige Korrekturen an den beiden Süß-Oppenheimer-Biographien, die in der notwendigen Kürze hier nachgetragen werden wollen. 1. Der Freiherr von Heidersdorff könnte sehr wohl Oppenheimers Vater gewesen sein.31 2. Eine Residentenstelle war keine diplomatische Würde dritter Ordnung, sondern hatte "beamtenrechtlichen Charakter", so daß Oppenheimer im Prozeß zu
76
27 28 w 30
31
Stern 1929,2. Ähnlich Ettinger 1980, III, 14f:"... ein Hofjude, der selbst politische Konzepte entwarf und deren Durchführung leitete", Süfl als "Hauptplaner der radikalen Reformen im Land. " Die politische Eigentätigkeit Oppenheimer schwächt Schnee (19S5, 189) wieder ab: "... das einzige Beispiel, wo ein Hoffaktor als Werkzeug des Fürsten [!] und aus eigenem Machtstreben bewußt in die Politik eingreift ..." Auch Gerber (1990, 100-102) bestätigt, daß Süß durch seine politische Tätigkeit über alle Hoffinanziers seiner Zeit herausrage, aber als Politicus "zugleich Hofmann" war. Stern 1929, 3 Stern 1929, 133 Stern 1929, 137 Schnee beschränkte sich nicht auf die Erforschung des Hoffaktors Süß Oppenheimers, sondern verfaßte zwischen 1953 und 1963 mehrbändige Studien zur Geschichte des Hoffaktorentums in Deutschland. Schnee 1963, IV, 110-113. Allerdings hat diese Feststellung eine antisemitische Komponente, wenn Schnee an anderer Stelle (19SS, III, 201) erklärt: "... eine arische Abstammung väterlicherseits würde die einzigartigen Erfolge [des Hoffaktors Süß, D. P.] einigermaßen erklären." Auch Gerber (1990, 25) konstatiert eine "unterschwellig antisemitisch[e]" Tendenz bei Schnee. Noch schärfer urteilt Bnier (1991,30): "ein verbissener Antisemit." Vgl. Katz 1986, 247, Anm.5
71 Unrecht behauptete, nur als privater Ratgeber fungiert zu haben. Er wohnte vielmehr - mit Unterstützung des Herzogs - als Diplomat außerhalb des Ghettos, brachte vor seiner Wohnung das herzogliche Wappen an, wurde als Resident vereidigt, erhielt eine Dienstanweisung und wurde besoldet.32 3. Der Titel "Geheimer Finanzienrat" war keine leere Form. Auch wenn es den Finanzminister im heutigen Sinn noch nicht gab, so war Oppenheimer "nicht nur tatsächlich der Finanzminister, sondern der ungekrönte Herrscher des Landes", oder wie Schnee später zusammenfaßte, "der allmächtige Innenminister". Er bezog eines der höchsten Gehälter unter den Beamten der Rentkammer: 2356 fl (ein Geheimrat erhielt im 18. Jahrhundert in der Regel 1200 fl) und hat auch entgegen den Behauptungen - unterschriebene schriftliche Anweisungen an nachgeordnete Behörden erlassen." 4. Von seinen Amouren, in denen Oppenheimer "alle Hoffaktoren Deutschlands übertrifft", kann nicht "in romantischer Verklärung" als nur von heimlichen Liebesstunden die Rede sein.34 5. Es trifft nicht zu, daß Karl Alexander in Württemberg die katholische Konfession einführen wollte.35 6. Die Unordnung der Finanzen vor Oppenheimers Tätigkeit war nicht so gravierend.36 7. Das Urteil gegen Oppenheimer wurde einstimmig (mit der Stimme von Prof. Harpprecht!) gefaßt, auf Harpprecht geht auch der Vorschlag zurück, Oppenheimer nach der Exekution in einem Käfig aufzuhängen, und zwar nur, "damit der Leichnam von den Israeliten nicht entwendet werden könne."37 Besondere Aufmerksamkeit müssen wir noch dem letzten Revisionspunkt Schnees schenken. Der Autor erklärt abschließend, Prozeß und Urteil seien nicht gegen den "verhaßten Juden" gerichtet, "sondern nach den sehr sachlich und gewissenhaft geführten Protokollen gegen einen verhaßten Politiker, der mit seiner Politik Schiffbruch erlitten hatte. "38 Der Archivforscher urteilt unter ausdrücklicher alleiniger Berücksichtigung der Strafjustiz im absoluten Fürstenstaat, er lehnt Vergleiche mit dem 19. und 20. Jahrhundert ab. Auch Elwenspoek und Stern schilderten Aufstieg und Sturz Oppenheimers unter den Bedingungen des Absolutismus. Aber sie machten immer das judenfeindliche Umfeld deutlich, hier verkörpert in den protestantischen Ständen und ihrer christlich-nationalen Vertretung der "Landschaft". Im bisherigen Verlauf unserer Arbeit haben wir herauszustellen versucht, welche Auswirkungen die christliche Tradition der Judenfeindschaft, der Antijudiasmus, auf Denken und Handeln von Menschen
32 33 34 35 36 37 38
Schnee Schnee Schnee Schnee Schnee Schnee Schnee
1963, 1963, 1963, 1963, 1963, 1963, 1963,
IV, 120-124, 288. Dazu auch Gerber 1990, 72-91, 107-118 133f. 142f. 145 146f. 208f. 284
72 gehabt haben. Die württembergische Süß-Oppenheimer-Flugschriftenliteratur mit ihrer durchgehend judenfeindlichen Tendenz ist ein beredtes Zeugnis dafür und dürfte sich - den Protokollnotizen zum Trotz - sehr wohl in den Köpfen der Ankläger eingenistet haben. "Der Jude Süß": allein die Wortverbindung dokumentiert die Wirkungsgeschichte von Judenfeindschaft bis zur Gegenwart. Die Instrumentalisierung von Antisemitismus für eine ständische Restauration untersucht die jüngste "Jud-Süß"-Forschungsarbeit: 5.1.1.4. Barbaras Gerbers Analysen von zeitgenössischen "Jud-Süß"-Medien als "agitatorisch-propagandistisches Steuerungsinstrument"39 Die Geschichte des Süß Oppenheimer interpretiert Gerber als den außergewöhnlichen Aufstieg eines Juden, der sich vom hergebrachten Judentum innerlich losgelöst und an die nichtjüdische Kultur in einem Ausmaß angeglichen hat, wie es keiner der zahlreichen Hofjuden seiner Zeit tat. Der als bekennender Jude gestorbene "Frühassimilant"40 ist Gegenstand einer sozialgeschichtlichen Untersuchung des an ihm sich stellenden Aufstiegsproblems. Die Analyse von Zeitungen und Zeitschriften, vor allem jedoch der Flut von Flugblättern und Flugschriften aus der Zeit unmittelbar vor und nach Oppenheimers Hinrichtung deckt die Rollen auf, die den Juden von den ständisch orientierten Verfassern der Schmähschriften zugewiesen wurden, um sie aus dem System gesellschaftlicher Aufstiegsmöglichkeiten des fürstlichen Absolutismus wieder hinauszudrängen. Während die Autoren der Flugschriften den Gruppenaufstieg der Juden abzuwehren suchten, indem sie Oppenheimer als Prototyp des Hoffaktors zu ihrer Zielscheibe machten, wetteiferten die (Hof-)Juden und speziell Süß verstärkt um Fürstengunst. Im Zuge ihrer angestrebten Entghettoisierung waren sie bereit, sich den Bedingungen der Höfe unterzuordnen. Der mit dem Hoffaktorentum beginnende neue Abschnitt der jüdisch-deutschen Geschichte wird von den " JudSüß" -Schriften nicht gesehen, geschweige denn akzeptiert. Durch eine Diffamierungs- und Kriminalisierungsstrategie mit Stereotypisierungen protestiert die "Jud-Süß"-Rezeption im Sinne der ständischen Ordnung gegen Oppenheimers Tätigkeit, stellt ihn und die Judenschaft als "Parasiten" und Schädlinge am christlichen Gemeinwesen dar. Sie polemisiert gegen die Aufhebung von Einschränkungen für Hofjuden und den Prestigezuwachs bevorrechtigter Juden sowie andere Veränderungen im jüdischen Sozialsystem (z.B. den "standesungemäßen Aufwand" Oppenheimers). Gegen jede Mobilität gerichtet, wendet sie sich gegen die Ausnahmeerscheinung Oppenheimers als eines jüdischen Politicus, Günstlings und Cavaliers, indem sie zur Abwehr solcher Herstellung etwa seine Ehrentitel ironisiert und die traditionale Definition "des" Juden als Dieb und Betrügers beibehält, die Rolle des Hofmanns in die des Hofnarren ummünzt oder
39 40
Gerber 1990, 281 Gerber 1990, 22
73 "in bildungsbezogenen Argumentationsfiguren das antijüdische Paradigma der Abwehr des Aufstiegs Oppenheimers"41 fixiert. "Jud-Süß"-Texte perpetuieren die mittelalterliche antijudaistische Doktrin von der Kammerknechtschaft der Juden. Gerbers Fragestellung, "wie Menschen der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sich zum Problem der Standesveränderung innerhalb des Ständegefüges ihrer Zeit stellten"42, belegt die starre Haltung zeitgenössischer "Jud-Süß"-Interpreten zum sozialen Aufstieg. Aus einer als "christlich" ausgewiesenen Grundhaltung bekämpften viele von ihnen das "säkulare Bekenntnis eines Menschen, der nicht mehr 'homo religiosus1 ist und sich die Freiheit der Bestimmung über sein soziales 'Los' nimmt."43 Oppenheimers Aufstiegswillen wird demgemäß als "jüdischer Hochmut" attackiert. Einer nicht transzendenten, sondern mehr säkularen und damit differenzierteren, weniger antisemitisch akzentuierten Betrachtungsweise sind dagegen die neuzeitlichen Medien Zeitung und Zeitschrift verpflichtet, welche die höfische Aufwärts- und Abwärtsmobilität nicht verschweigen, sondern sich darauf einlassen, wenngleich auch sie Oppenheimers Aufstieg - nun als entfesselte Ehrsucht, als unmoralisches Fortkommen - kritisieren. Gegen solche zutagetretenden Desakrilisierungs-, Entgottungs- und Entchristlichungstendenzen wehrt sich emphatisch die christliche Gelegenheitsliteratur des Pietismus. Die Historia des "Jud Süß", dem "Werkzeug des Teufels", ist ihr, z.B. in den Predigten Georg Conrad Riegers, Exemplum für die Widerstände auf dem Heilsweg zur Erkenntnis Gottes.44 Unsere additive Vorgehensweise bei der ausführlichen Darstellung einer JosephSüß-Oppenheimer-Biographie an Hand der vier wichtigsten Arbeiten in Form eines Literaturberichts statt einer knappen Zusammenschau sollte die Intentionen, die inhaltlichen Akzentsetzungen und die jeweiligen Forschungsergebnisse verdeutlichen. Der Umfang schien uns wegen Oppenheimers immenser Bedeutung als alle Sparten der Hoffaktorentätigkeit abdeckender, in das Odium der Vermengung amtlich-öffentlicher und privater Aufgaben geratener Hoijude, als Aufstiegsprototyp der Entghettoisierung, als Symbolfigur des Antisemitismus, der durch Mythologisierung "zum Typus des Juden schlechthin" wird,45 und wegen der vielfaltigen Vermarktung als Medienereignis gerechtfertigt. Unser Verfahren soll darüber hinaus den kritischen Vergleich mit den drei Verfilmungen des Stoffes erleichtern. Dazu bedarf es vorher noch zweier weiterer Schritte.
41 42 43 44 45
Gerber 1990, 235 Gerber 1990, 147 Gerber 1990 164 Gerber 1990, 240-250 Kampmann 1963, 70
74 5.1.2. Das System der Hofjuden oder Hoffaktoren Relativ kurz können wir uns bei der Einordnung Oppenheimers in das Gesamtsystem der Hoffaktoren fassen, weil der Stuttgarter Hoffaktor keine Sonderform, sondern gewissermaßen eine Zusammenfasung der Tätigkeiten von Hofluden in den deutschen Staaten bildet. Hofluden sind fürstliche Kammerknechte. Im mittelalterlichen, vom kirchlichen Recht beherrschten Staat waren sie zwar schon geduldete, weil nützliche Teilnehmer am Wirtschaftsleben und Finanzquelle der Herrscher, aber als angeblich am Tode Jesu Schuldige zur ewigen Knechtschaft Verdammte nur Sache, nur Objekt der Fürsten. Auch der durch Privilegien aus der Gesamtheit der armen, verfolgten Juden herausgehobene einzelne Geldhändler war erst kaiserlicher, dann - vor allem seit der Herausbildung der Landessouveränität fürstlicher Kammerknecht, Unfreier, Abhängiger. Das ihm gewährte Schutzprivilegium wurde zum "Ausbeutungsprivilegium".46 Diese Hofluden (mit amtlichem Titel: "Hoffaktoren" 47 ), "eine Art jüdische Aristokratie"48, waren nach dem Dreißigjährigen Krieg, in dem sie als unentbehrliche Heereslieferanten und Münzunternehmer der Herrscher und als Trödler für die Soldaten weniger Verfolgungen ausgesetzt waren als in anderen Jahrhunderten und daher auch Kapital besaßen, die jüdischen Beauftragten der Fürsten bei der Schaffung einer Administration in den Kleinstaaten, bei der Durchführung einer den Aufbau industrieller Unternehmen fördernden Wirtschaftspolitik gemäß den Theorien des Merkantilismus gegen die den neuen politischen und wirtschaftlichen Ideen Widerstand leistenden Patrizier.49 Meist waren sie (weiterhin) Heeres- und Hoflieferanten, manchmal speziell von Luxusartikeln, häufig Silberlieferanten und Münzpräger, wobei besonders die Verringerung des Edelmetallgehalts der Münzen zwecks Erzielung eines hohen "Schlagschatzes" (Münzgewinns) den Juden zur Last gelegt wurde.50 Ihre Abhängigkeit von den Fürsten, ihre Beziehungen zu den Machthabern waren allgemein höchst komplex. Zwar konnte die Stellung eines Hoffaktors zu einem kometenhaften Aufstieg führen, zwar gab es unter den wohl Tausenden von Hofluden, die in den über dreihundert deutschen deutschen Staaten häufig Karriere und mehr oder weniger Vermögen machten, auch manchmal ein Verhältnis zum Herrscher mit hohem Grad an Vertrautheit, wohl gelangten einige Juden zur Macht und konnten (dennoch) ihre Zugehörigkeit zur Judenheit bewahren, aber oft war das Gerücht von der durch jüdisches Geld ausgeübten
* 47
48
* 50
Bohn 1980, 51 Der Titel "Hofjude" wurde vom 18. Jahrhundert an durch zahlreiche spezielle, genau abgestufte Titel ersetzt. Schnee 1955, III, 204-207 Kampmann 1963, 65 Ettinger 1980, III, 13 Gerber 1990, 68: "Stereotyp des betrügerischen Münzers"
75
Macht nur Ausfluß antisemitischer Einstellungen: "Juden waren manchmal nur die Marionette, an deren Fäden der christliche Kapitalist zog".51 Auch der einflußreiche Hofjude war eben Jude, von Ausweisungen bedroht, wenn er nicht mehr nützlich war, ein Erfolgreicher, weil Tüchtiger und Angepaßter, oft nur auf Zeit und ohne Erben. Poliakov weist darauf hin, daß kein Hoffaktor eine Dynastie gegründet habe, viele (ehemalige) Hofjuden im Elend endeten und der Prozeß des "Jud Süß" "wie ein Symbol für das Schicksal eines Hofjuden" erscheine.52 Wegen der Übernahme des damals an den Fürstenhöfen Europas üblichen Bestechungssystems, wegen ihrer gegen Gilden und Zünfte gerichteten Maßnahmen im Auftrag der Fürsten, den Kampf zwischen Ständetum und Absolutismus, wegen ihres Festhaltens an der Religion der Väter (viele Hoffaktoren betrieben ein eifriges Talmudstudium), wegen der als Ausbeutung empfundenen Steuermaßnahmen wurden Hoffoktoren als Juden und Fremdlinge abgelehnt, obwohl sie in der Regel nicht der Kleiderordnung unterstanden und überwiegend auch nicht mit "Jud" als Teil ihres Namens tituliert wurden. Andererseits gelang es manchem Hoffaktor, den für ihn allein geltenden Schutzbrief auf Söhne und Schwiegersöhne zu übertragen, anderen, einen Generalgeleitbrief zu erhalten, der auch der Witwe und den Töchtern das Niederlassungsrecht gewährte, als nächste Stufe das Generalprivileg verliehen zu bekommen, was einer Gleichstellung mit den Staatsbürgern nahekam, dann das Naturalisierungspatent zu erhalten, was Hoffaktoren amtlich zu Staatsbürgern machte, bis dann nach 1800 die Verleihung staatsbürgerlicher Rechte an die Juden dekretiert wurde. Da diese Privilegien nur einer zahlenmäßig verschwindend geringen Gruppe der Judenschaft in Deutschland zugutekam, ist H. Schnee, dem wir in dieser Passage gefolgt sind, nur bedingt zuzustimmen, wenn er "Hoffaktoren als Wegbereiter und Vorkämpfer der Judenemanzipation" bezeichnet.53 Der Einfluß der Hoftaktoren sowie der Bankiers und Großhändler sollte nicht überschätzt werden,54 zumal ihr Einfluß, ihre Anpassungsbereitschaft und Loyalität sowie ihrNeid weckender vertrauter Umgang mit ihren adligen Herren "die Aversionen und den Haß gegen die Juden insgesamt eher bestärkt" haben,55 vielleicht auch, weil ihre Macht auf ihren Staatsgeschäften und noch nicht auf ihren privaten Unternehmungen beruhte.56 Hoftaktoren sind nicht Vorkämpfer der
51 52 53
54
55 x
Poliakov 1983, 34 Poliakov 1978, Π, 132 Schnee 1955, m , 185. Katz (1986, 39-43, 247) hält dieses Fazit Schnees für eine unkritische SchluBfolgerung aus einzelnen (richtig gesammelten) Materialien. Gerber (1990,52) schwenkt dagegen mehr auf Schnees Linie ein, wenn sie durch die Hoffaktorentätigkeit "auf längere Sicht" die "Erweiterung des beruflichen Spektrums" von Juden konstatiert. Toury (1977, 154) faßt beide Gruppen als "Adelsbürger" zusammen und gibt dieser Bezeichnung den Vorrang vor Schnees Kategorie. Breuer 1988, 84 Über den Hoffaktor als "jüdischen Staatsbankier" und seine Weiterentwicklung vgl. Arendt 1962, 17-47
76 Emanzipation, sondern Zeichen des bevorstehenden Wandels (J. Katz), eines einsetzenden epochalen Paradigmenwechsels (H. Küng).57
5.1.3. Das (Frankfurter) Ghetto Vor der Analyse der drei Filme über Süß Oppenheimer dürfte es nun noch zweckmäßig sein, die im Zusammenhang mit dem GOLEM-Film begonnenen Skizzierungen des mittelalterlichen Ghettos fortzuführen und vorerst im Hinblick auf die Situation im Frankfurter Ghetto des 18. Jahrhunderts knapp zu ergänzen, denn alle Oppenheimer-Filme enthalten einige Ghettoszenen. Schon der GOLEM spielte nicht mehr in dem seit dem Altertum als platea Iudeorum bekannten, durch freiwilligen Zusammenschluß entstandenen Judenviertel, jenem Bezirk oder anfangs nur jener Gasse in den mittelalterlichen Städten, wo Juden gerne zusammenlebten, um "unberührt von fremden Einflüssen, ihre Eigenart zu erhalten sowie ihre religiösen und kulturellen Güter zu pflegen"58 bzw. "to live in a way that would enable it to keep its laws and customs and defend itself from hostile attacks if need be."59 Das Ghetto, dessen Bezeichnung wohl auf das 1516 entstandene und so benannte Judenviertel von Venedig zurückgeht, ist im Gegensatz zum Jüdischen Viertel ein auf Veranlassung der Christen von ihnen abgesonderter, ja abgeschlossener, durch Mauern nachts total verschlossener Bezirk, wobei aber die Einschließung nun trotz dieser Zwangsmaßnahme nicht von allen Juden als lästig und diskriminierend, sondern immer noch als ein gewisser Schutz vor Angriffen des Pöbels und Abschirmung vor fremden Kultureinflüssen empfunden wurde.60 War der Kontakt der Juden mit Christen auf den Bereich des Handels und der Geldgeschäfte beschränkt, was auch negative Auswirkungen auf Inhalte und Formen der Kommunikation hatte,61 mußten Juden nach den Kreuzzügen und der Reformation als unerwünschte Konkurrenz der christlichen Kaufleute ihr wirtschaftlichen Erfolge mit zunehmenden Anfeindungen bezahlen, so bedeutete vielen von ihnen die zwanghafte kulturelle und soziale Abkapselung des Ghettolebens auch eine positiv empfundene Einbettung in die jüdische Traditionsgmeinschaft, selbst wenn das ihre Flexibilität gegenüber neuen Situationen auf die Dauer einschränken sollte.62 Von der Enge der Frankfurter
57
Katz 1986, 39ff.; Küng 1991, 237-242 Encyclopaedia Judaica 1937, VII, 389 59 Encyclopaedica Judaica Jerusalem 1971, 81. Ähnlich The Universal Jewish Encyclopedia New York 1941, 598 60 Encyclopaedica Judaica Jersusalem 1971; Universal Jewish Encyclopedia New Yoek 1961 und Jüdisches Lexikon Berlin 1927 61 Wiith 1975, 27 ® Steinchen 1982, 42. Ebenso kritisch wie Steinchen bewertet Poliakov (1978, II, 56) die "Entstehung einer hermetisch abgeschlossenen Gesellschaft" als den "endgültigen Rückzug der Juden auf sich selbst. " 58
77 Ghettostraße mit ihren fünf bis sechs Stockwerke hohen Häusern, der Angst der Juden vor Pogromen, der physisch-psychischen Eingeschlossenheit ihrer dreitausend Bewohner und doch dem Gefühl eines "umfriedeten, heimischen Lebens" gibt J. Prinz ein anschauliches Bild. Er schildert die Hantierungen vor den Häusern: der Tuch-, Leinwand-, Kleider-, Buch- und Juwelenhändler, der Trödler und Wechsler, der Lebensmittelhändler, Bäcker und Metzger, der vier Nachtwächter, zwei Spielleute, zehn Lehrer und einiger Rabbiner, den fünf Vorbetern und einem Schulklopfer, den je zwei Ärzten, Rechtsgelehrten und Schreibern.63 Zusammengepfercht bei wenig Licht und Luft, Feuersbrünsten und ansteckenden Krankheiten ausgesetzt, war das Ghetto ein gefährdeter Mikrokosmos, der sich nur langsam veränderte. Den Ideen der Aufklärung folgte man im Ghetto sehr widerstrebend: Die Haskala, die jüdische Aufklärung, wurde keineswegs von allen getragen, vielmehr von Rabbinern sogar bekämpft.64 Dennoch hat sie zur Befreiung der Ghettoeinwohner und zur Abtragung der Ghettomauern geführt. Der Exodus der Juden aus dem Ghetto wurde "eine Wende in der jüdischen Geschichte",65 auch wenn er neue Konflikte brachte, die bis zum Holocaust der Nazis führten.
5.2. Spielfilme und Fernsehspiele über "Jud Süß" Unser Thema ist nicht die Geschichte antisemitischer Spielfilme im sog. Dritten Reich, nicht die Theorie des Films im Nationalsozialismus und auch nicht die Propagandawirkung des Nazispielfilms JUD SÜSS. Aber einige Fakten müssen erinnert werden, um die Judendarstellungen des Harlan-Films JUD SÜSS und des sechs Jahre vorher entstandenen britischen Films JEW SUESS von Lothar Mendes mit dem einzigen Jud-Süß-Film vergleichen zu können, der öffentlich in der Bundesrepublik gelaufen ist: mit Gerd Angermanns und Rainer Wolffhardts Fernsehdokumentarspiel JOSEPH SÜSS OPPENHEIMER. Zwischen der "Reichspogromnacht" von 1938, der Entfesselung des Zweiten Weltkrieges sowie der Errichtung eines mörderischen Vernichtungsbezirkes, der aller Vergleiche mit dem mittelalterlichen Ghetto spottet, nämlich des Warschauer Ghettos der Nazis, auf der einen Seite und der Vorlage von Maßnahmen zur systematischen "Vernichtung der jüdischen Rasse" ("Endlösung") bei der Wannseekonferenz von 1942 auf der anderen Seite liegt 1940 die Aufführung der drei "klassischen" antisemitischen Filme der Nazizeit DIE ROTHSCHILDS, JUD SÜSS und DER EWIGE JUDE, alle drei offenbar schon auf der Reichstagssitzung
63 64
65
Prinz 1937, 177, 161-195 Nach Arendt (1962,20) hat die rabbinische Orthodoxie in der Emanzipation nur den Entzug verbriefter Rechte gesehen. Katz 1986, 7
78 vom 30.1.39 durch Hitler angekündigt:66 Die beiden ersten Produktionen waren Spielfilme über historische jüdische Persönlichkeiten, der dritte Film, eine propagandistische Montage aus ganz unterschiedlichem Filmmaterial, das auch Spielfilmaufnahmen enthielt, wurde als "Dokumentarfilm über das Weltjudentum" ausgegeben.
5.2.1. JUDSÜSS 5.2.1.1. Filmautoren und Filminhalt Der Nazifilm JUD SÜSS basiert nicht, wie der Schriftsteller Lion Feuchtwanger 1947 irrtümlich annahm,67 auf dessen gleichnamigem erfolgreichen historischen Roman, sondern auf einem Treatment des Drehbuchautors Ludwig Metzger, das seinen pamphletistisch antisemitischen Gehalt zunächst durch den Autor des Films DIE ROTHSCHILDS, Eberhard Wolfgang Möller, und dann durch den Regiseur Veit Harlan erhielt, aber auch ganz wesentlich - in zahlreichen Regie- und Drehbuchsitzungen - von Goebbels bis hin zur Besetzung mitbestimmt wurde. Die Filmhandlung, die wie die historischen Ereignisse zwischen 1733 und 1738 spielt, benutzt und verändert nur zwei wirklich in damaliger Zeit lebende Persönlichkeiten: Oppenheimer, der im Film fast immer nur als "(Jud) Süß" bezeichnet wird, und den Herzog Karl Alexander. Alle anderen Figuren sind freie Erfindungen, auch wenn einige Namen der Württemberger Historie entlehnt oder wie die Figur des Hohen Rabbi Low aus einer hundertfiinfzig Jahre entfernten Epoche von Prag nach Stuttgart übertragen wurden. Im Film schickt der soeben als konstitutioneller Herzog von Württemberg vereidigte Karl Alexander einen ihm ergebenen Adligen nach Juwelen zu dem Frankfurter Ghettojuden Süß Oppenheimer, der als Entgelt für seine Dienste trotz der von den mächtigen Landständen verhängten Judensperre für sich Wohnrecht in Stuttgart durchsetzt. Süß legt seine Ghettoexistenz ab, wird eleganter Höfling, Finanzier und einflußreichster Berater des Herzogs: Er paktiert mit dem Adel gegen die Bürger und deren Instrument, die Landstände. Er überredet mit Hilfe des angesehenen Astrologen und mächtigen Rabbiners Low den Herrscher zu einem Staatsstreich, mit Unterstützung seiner Soldaten die verfassungsmäßigen Landstände aufzulösen und sich zum absoluten Souverän zu machen. Sein Preis besteht im Zuwachs an Macht, Geld und Gewalt: Süß läßt sich die Straßen Württembergs verpfänden und durch seinen Sekretär Levi das Volk aussaugen.
w
a
Hollstein 1971, 62. Zum EWIGEN JUDEN vgl. die kommentierte Bibliographie bei Ähren 1991, 31-38 Feuchtwanger 1984a, 735-739. Auch noch im 1958 verfaBten Nachwort zur Neuauflage des Romans wird der Irrtum wiederholt. Ebenso falsch bei Estermann 1956, 115 und Kiadlers Literatur Lexikon 1969, V, 124 (korrigiert dagegen in Kiadlers Neues Literatur Lexikon 1989, V, 516).
79 Wer von den Bürgern sich ihm in den Weg stellt, wird weggeräumt: Ein Schmied wird gehenkt, die Tochter seines entschiedenen Gegenspielers von Süß vergewaltigt (sie begeht daraufhin Selbstmord), deren Ehemann gefoltert, deren Vater in den Keller geworfen. Nach der nun generellen Aufhebung der Judensperre strömen die Juden in die Stadt. Die erbitterte Bevölkerung formiert sich zum Widerstand ("Der Jude muß weg! Der Jude muß weg!"). Die Armee verweigert dem judenhörigen Herzog den Gehorsam, so daß der geplante Staatsstreich mißlingt. Der Herzog stirbt an einem Schlaganfall. Süß wird von einem mit den Bürgern gemeinsame Sache machenden Adligen verhaftet. Er winselt vergeblich um sein Leben, das Gericht spricht ihn schuldig: "So aber ein Jude sich mit einer Christin fleischlich vermenget, soll er durch den Strang vom Leben zum Tode gebracht werden." Zusammen mit der Vollstreckung des Urteils verkünden die Landstände den Judenbann: "Alle Juden haben innerhalb dreier Tage Württemberg zu verlassen." 5.2.1.2. Die Juden als propagandistisches Angriffsziel des Films D. Hollstein hat in ihrer Analyse des Films die durchgehende Kontrastierung von "Juden" und "Ariern"68 als Stilprinzip eines in fetal vollkommener Weise der nationalsozialistischen Rasseideologie dienenden Propagandafilms beschrieben und interpretiert: Die Arier des Films sind in der Überzahl Idealtypen der für die Reinheit des Blutes kämpfenden und siegenden Nationalsozialisten, die Juden ein fremdes, entartetes, zersetzendes, egoistisches, feiges Volk, das nach der Macht über die Nichtjuden strebt, das Land überschwemmen und durch Vermischung mit Ariern Rassenschande treiben will. Wer als Arier wie der Herzog auf die Juden hört, weil er nicht sittlich gefestigt ist, wer nicht die Kraft hat, sie aus dem Lande zu jagen, hat sein Daseinsrecht verwirkt. Ihr Deutschen, ihr arischen Völker, so die Botschaft des Films, laßt euch das zur Warnung sein und wehrt euch gegen das Uijudentum der Ghettowelt wie gegen die getarnten Juden!69 Veit Harlan hatte nach 1945 die Schamlosigkeit, vor seinem Schwurgerichtsprozeß, in dem er sich wegen "Verbrechens gegen die Menschlichkeit" zu verantworten hatte und bei dem es zu beschämenden antisemitischen Vorfällen kam, an den ehemals deutschen, danach amerikanischen Rabbiner Dr. Prinz zu schreiben.70 In diesem Brief vom 24.7.48 nimmt er seinen JUD SÜSS gegen den Vorwurf, ein das Judentum verleumdender und zum Pogrom aufrufender Hetzfilm 68 m
70
Hollstein 1971, 76-108 Im Vorbereitungsstadium von JUD SÜSS hatte der Regisseur Harlan nach einer "Inspektionsreise" zu polnischen Ghetti über eine geplante Purimfestsequenz berichtet, in der er das "Uijudentum, wie es damals war und wie es sich heute noch ganz rein in dem einstigen [!] Polen erhalten hat," auftreten lassen wollte, und erklart: "Im Gegensatz zu diesem Uijudentum steht nun der Jud Süß, der elegante Finanzberater des Hofes, der schlaue Politiker, kurz: der getarnte Jude." (Der Fito Nr.3 vom 20.1.1940, 30) Prinz ist der Verfasser des in unserer Arbeit wiederholt genannten Buches Das Leben im Ghetto.
80 zu sein, in Schutz; der Film sei "keine Hetze, sondern Darstellung des jüdischen Problems mit künstlerischen Mitteln, kein verzerrtes Bild, sondern Aussprache des Wesentlichen, Menschlichen."71 In seinem autobiographischen Rechtfertigungsversuch fünfzehn Jahre später gibt sich Harlan mit der Attitüde eines die gesellschaftliche Verantwortung negierenden Künstlers als der vom "Teufel" Goebbels zur Regie von JUD SÜSS gezwungene, um sein Leben fürchtende Mann aus, den Goebbels auch mit dem Versprechen beschwichtigt habe, er wolle "keinesfalls einen menschenunwürdigen antisemitischen Film produzieren".72 Diese Berufung auf den Notstand war eine Wiederholung des Harlan von persönlicher Schuld freisprechenden Prozeßurteils: Zwar sei der Film JUD SÜSS ein Mittel der rassischen Verfolgung, aber nicht der Künstler selbst an dessen antisemitischer Wirkung schuld, sondern vielmehr der Nationalsozialismus, personifiziert in seinem Propagandaminister.73 Die überwiegende Zahl der sich mit dem "Fall Harlan" beschäftigenden Arbeiten folgte dem befremdlichen Justizfreispruch nicht, stellte vielmehr die Mittäterschaft und Verantwortlichkeit der Filmemacher deutlich heraus wie z.B. Prinz in seiner Antwort auf den Harlanbrief: Wenn auch nur ein einziger [Jude, D.P.] durch Ihren Film gelitten hätte und in den Tod gehetzt worden wäre, wäre das Grund genug, die Menschen, die Ihre Künstlergabe in den Dienst der Henker gestellt haben, vor das Tribunal des Rechtes zu zitieren.74
Die nach 1945 erschienenen ausführlichen Einzelanalysen und die Abhandlungen über Spielfilme und Regisseure im Nationalsozialismus, die Filmgeschichten und Nachschlagewerke sind sich in der Bewertung von JUD SÜSS als eindeutig antisemitisch einig.75 Unterschiedliche Auffassungen gibt es nur hinsichtlich der Beurteilung der Filmgattung (monolithischer Propagandafilm oder Mischform aus Unterhaltung und Propaganda) sowie der Funktion des Regisseurs, ob er als künstlerisches Individuum der eigentliche Filmgestalter, der auf ideologische Vorgaben reagierende und sie bündelnde Spielleiter oder der in den auch im Nationalsozialismus weitestgehend nach ökonomischen Bedingungen diktierten Verwertungsprozeß der Ware Film eingebundene und für die profitable
71 72 73
74 75
Leiser 1978, 144 Harlan 1966, 28, 95, 100 Zu den beiden Verfahren des Schwurgerichtsprozesses 1949 und des Revisionsverfahrens von 1950 vgl. Zielinski 1981, 42-66. Auch eine 45minütige Fernsehsendung "Jud Süß"- Veit Harlans Film von 1940 ... von Karl-Heinz Meier u. Ulrich Gabriel in der Reihe "Aspekte extra" (ZDF, 13.2.84) geht darauf ein, befragt als Zeitzeugen den Publizisten Ralph Giordano, den Schauspieler Gustav Fröhlich und den ehemaligen Pressesprecher des Hamburger Senats, Erich Lüth. Leiser 1978, 145f. Leiser 1978, 77-79; Courtade/Cadars 1975, 183ff; Wulf 1964, 9ff., 396-408; Hollstein 1971; Drewniak 1987, 312-316; Zielinski/Maurer 1983, 19-56; Knilli/Zielinski 1983, 99-121; Zielinski 1981; Gregor/Patalas 154; Sadoul 243; Toeplitz IV,214-217; Reclam 271; Bucher 388, Cinegraph "Veit Harlan" D lf.(Dort erschien 1990 in der 15. Lf. der m.E. erste längere Essay, von Norbert Grob, in dem Harlans Filmarbeit nicht nur unter dem Vorzeichen seiner "politischen Verstrickung" analysiert wird.)
81
Verwertung verantwortliche Organisator ist.76 Wenn man dieser Auffassung einen größeren Stellenwert einräumt als z.B. Hollstein, so merkt man, daß die Figur des Süß keineswegs zur kompletten Dämonisierung "des" Juden schlechthin geriet. Er besitzt immer noch menschliche Züge, ist im Sinne nationalsozialistischer Propaganda noch zu charmant, zu wenig servil, scheint die Tochter des Landschaftskonsulenten tatsächlich zu lieben. Manche seiner schlimmen Taten lassen sich mehr auf verschmähte Liebe als auf "rassische Minderwertigkeit" zurückführen, und in den Schlußszenen würde er vielleicht nicht nur Abscheu, sondern auch etwas Mitleid wecken, wenn nicht die übrigen Elemente des Films eben doch eine insgesamt nahezu unüberbietbare massive antisemitische Wirkung besäßen, die nicht auf einer künstlerischen Gesamtleistung beruhte, sondern auf einer äußerst geschickten Kompilation fast aller antisemitischen Stereotype. Gerade weil sich sehr beachtliche Darsteller wie Ferdinand Marian, Werner Krauss und Heinrich George - nach anfanglich scheinbarem oder anscheinendem Sträuben gegen die Rolle - zur Verfügung gestellt haben, teils leicht gebrochene, teils raffiniert typisierte Figuren mit Leben zu füllen, weil hier Gut und Böse simpel gegenübergestellt wurde, was auch die leitmotivische Musik (deutsches Volkslied versus "fremdländische" jüdische Motive) unterstützte, gerade weil der Film in Kameraführung, Bauten, Kostümen, Darstellerführung (Massenszenen!) handwerklich gediegen der primitiven Positiv-Negativ-Dramaturgie des Films diente, wurde er trotz seiner perfiden Tendenz von den Zuschauern besser angenommen, als das bei einem nur hingepfuschten Propagandafilm der Fall gewesen wäre. So konnte es sich Harlan im Vertrauen auf die antisemitische Grundtendenz erlauben, bei einzelnen Szenen mit jüdischen Sujets auf eine diffamierende, denunzierende Inszenierung zu verzichten. Erst im Kontext wirken diese Szenen vom keineswegs düster oder schmutzig abstoßend dargestellten Frankfurter Ghetto oder die authentisch anmutenden Gesänge der jüdischen Gemeinde beim Synagogengottesdienst mit dem Umzug der Thorarollen auf den schon antisemitisch konditionierten Zuschauer abstoßend,77 weil die Gleichung "fremd = jüdisch = undeutsch = feindlich" unterbewußt intemalisiert wurde. Die Anweisung des Ministers Goebbels an die Presse, JUD SÜSS und die beiden anderen 1940er judenfeindlichen Produktionen nicht als "antisemtisch" anzukündigen,78 hatte da nur noch die Funktion einer flankierenden Maßnahme. Wo der Titeldarsteller Marian das antisemtische Klischee nicht deutlich genug produzierte, wirkte eben Werner Krauss; wo auch das nicht ausreichte, leisteten
76
77
78
Die letzte Position, die vor allem die theoretischen Ansätze von Haug 1971 und Bächlin 1974 aufnimmt, findet ihre deutliche Entsprechung in den Arbeiten von Knilli und Zielinski. Hollstein (1971, 80,97), Wulf (1964, 398,400), Leiser (1978, 142) und Drewniak (1987, 311) weisen, z.T. unter Verwendung zeitgenössischer Quellen, darauf hin, daß Harlan in Polen Studien gemacht, jüdische Statisten von dort für seinen Film mitgebracht bzw. einzelne Szenen dort in Polen gedreht habe. Wulf 1964, 400
82 Drehbuch und Regie "Überzeugungshilfe". Betrachten wir dazu einige Judendarstellungen etwas genauer. Oppenheimer, in der Sprache Harlans "der getarnte Jude" (vgl. den Wechsel im äußeren Erscheinungsbild vom Ghettojuden zum Hofluden: Foto Nr.6 und 7 im Bilddokumentationsteil), hat wenig mit der historischen Figur gemein. Von seinem Wirken als Resident, Merkantilist, Heereslieferant und Münzpolitiker ist überhaupt nicht die Rede (lediglich in einer Ständehausszene - 251. Einstellung bei Maurer/Radevagen - gibt es einen generalisierenden Angriff auf Oppenheimers Steuermaßnahmen: "Der Jude hat die Hand auf der Münze, auf dem Salz, auf Bier, auf dem Wein, ja sogar auf dem Getreide"). Seine Tätigkeiten als Ratgeber und Finanzienrat werden, verglichen mit den Darstellungen bei Elwenspoek und Stern, nur pauschaliert umschrieben (so fallt z.B. einmal der Terminus "Fiskalamt", ohne daß irgend eine Vorstellung von dieser Behörde geweckt wird). Die im Film genannten Anklagepunkte gegen Süß ("Erpressung, Wucher, Ämterhandel, Unzucht, Kuppelei und Hochverrat"79) sind größtenteils in der diesem Vorwurf vorangegangenen Filmhandlung nicht entfaltet worden, sie stimmen mit den historischen Anklagepunkten nur teilweise überein. Den Filmemachern waren sie offenbar nicht so wichtig wie die beiden folgenden, für die nationalsozialistische Ideologie verwertbareren "völkischen" und "blutsmäßigen" Schuldzuweisungen: 1. "Unser Volk [Hervorhebung durch D.P., zu ergänzen: hat] Schande, Schaden, Leid durch ihn an Leib und Seele erlitten." (604. Einstellg.) 2. Der Jude hat sich mit einer Christin "fleischlich vermenget", d.h. "Rassenschande" getrieben und deren vielfache künftige Praktizierung dadurch begünstigt, daß auf seine Tätigkeit hin (Süß: "Ich mach die Tür auf für euch alle") die Aufhebung der Judensperre erfolgte, also Juden "wie die Heuschrecken über unser Land kommen." (607. Einstellg.) Die beiden letzten "Verbrechen" nehmen sich wie ein filmischer Kommentar zu den Nürnberger "Rassegesetzen" aus. Sie werden durch die Vorführung der genannten antisemitischen Stereotype "kriecherische Anpassung", "Gesten- und Worteüberschwang", "Reichtum", "Machthunger", "Bosheit" und "Feigheit" komplettiert. Hatte die Jud-Süß-Figur die dramaturgische Funktion der Verknüpfung von Familientragödie und Staatsaffare und die ideologische (antisemitische) Funktion der Demaskierung "des" (assimilierten) Juden von raffinierter Tarnung, Verführung und Vergewaltigung des einzelnen wie des Volkes, so lieferten die übrigen Judenrollen ds Films, die von dem Schauspieler Werner Krauss dargestellt wurden, mehr das Material für den vulgären Antisemitismus Julius-Streicherscher Provenienz.
79
Vgl. S. 313 in dem leider nicht vollständigen Filmprotokoll von Hollstein (1971, 270-314), das im Hinblick auf die Beschreibung des Optischer ausführlicher und damit hilfreicher ist als die detaillierte WortprotokoUierung der nur durch fortlaufende Numerierung und die EinstellungsgröBen ergänzte Fassung von Maurer/Radevagen.
83
Krauss will sich seiner Autobiographie zufolge seiner Mitwirkung am Film dadurch entzogen haben wollen, daß er die seiner Meinung nach unerfüllbare Forderung gestellt habe, alle Judenrollen des Films außer der des Süß Oppenheimer zu spielen.80 Goebbels aber, wenn man Harlan folgen will, soll es sehr interessant gefunden haben, daß Krauss, wie sein Regisseur überlieferte, gewissermaßen "das jüdische Volk" spielen wollte.81 In der Tat: Die mit äußerster Intensität verkörperten Rollen stellten "das jüdische Volk" dar - in solch einem Zerrspiegel, daß diese Leistung des Werner Krauss ganz wesentlich das antisemitische Bild des Films prägte.82 Seine nachträgliche Schutzbehauptung, das Vorbild seiner Judenrollen sei die Darstellungsweise des vom jüdischen Habimahtheater gedrehten Films DER DYBBUCK, ist völlig aus der Luft gegriffen.83 Allein drei Figuren spielte Krauss in der Ghettosequenz: Zuerst verkörperte er den Schächter Isaak, einen kräftigen Mann mittleren Alters im grauen Arbeitskaftan und mit blutbefleckter Schürze, an der er sein Messer abwischt, dunkel und wirr Haare und Vollbart, dunkel das Käppchen, finster das Gesicht. Auf den Ruf "Isaak!" schwenkt die Kamera mit den Augen des Schächters von dessen Laden zum ersten Stock, wo sich neben einer jungen Frau ein (ebenfalls von Krauss gespielter) halbblinder Greis mit schlohweißem Bart und ebensolchem Haar auf die Fensterbrüstung lehnt. Mümmelnd in seiner Zahnlosigkeit, quäkend, senil kichernd und doch zugleich wach, lüstern, listig und arrogant kontrastiert er mit dem gutturalen, sonoren Organ des anderen, der aber, gleichfalls jiddelnd, ebenso verschlagen und hämisch wirkt, gierig bloß darauf wartend, daß der vornehme, reich gekleidete Fremde, der soeben ins Haus von Süß Oppenheimer eingetreten ist, dort ausgenommen wird: Greis: Isaak, was willen eigentlich de feine goyimsche Pinkel bei unserem Oppenheimer? Schachter: Was de frogst ieberhaupt. Greis: Ach jei-i, meinssen du Geld? Schachter: Nu, ñich.
80 81 82 83
Krauss 1958, 199-209 Harlan 1966, 103-106 Toeplitz 1983, IV, 216 Der Film, den Krauss im Propagandaministerium gesehen hatte, dürfte ebenso wie der von ihm erwähnte YIDL ΜΓΓΝ FIDL einer der in Polen bzw. den USA gedrehten jiddischen Filme gewesen sein (entweder DER DYBEK, Polen 1937, Regie: Michael Waszynski, oder A VILNA LEGEND/DEM REBINS KOJECH, USA 1933, dessen Rahmenhandlung in der Inszenierung von George Roland den Dybuk-Stummfilm TKIES KAF von Zygmunt Turkow aus dem Jahre 1924 umschließt, vgl. Das jiddische Kino 1982, 111 u. 114, sowie darin den Ausatz von G. Koch, 20-22). Darstellungsstil und Intention dieser Judendarstellungen des jiddischen Kinos sind völlig unvereinbar mit Krauss' Interpretation. Das gleiche gilt von der Darstellungsweise des Habima(h), das 1926 in Berlin mit An-Skis "Dybuk" gastiert hatte. Das Habimah spielte übrigens 1933 eine hebräische Bühnenversion von Feuchtwangers Roman Jud Süß in Tel Aviv (nach Theater heute 2/88, 25), nachdem 1929 Maurice Schwartz, der Regisseur und Hauptdarsteller des wohl berühmtesten jiddischen Kinofilms TEVYE, eine jiddische Bühnenfassung des Schauspiels für sein Jiddisches Theater in New York hergestellt hatte.
84 Greis: Aber, aber, aber - er wird ihm nischt ge-iben! Schächter: Er wird ihm ge-iben, er wird, viel wird er ihm ge-iben, weil er hat Kappchen. Er soll ihm ge-iben, damit wir kennen ne-imen, ne-imen, ne-imen!84
Außer diesen Karikaturen von Ghettojuden - den einzigen, die in der Ghettosequenz, von Süß abgesehen, eine Sprechrolle haben und schon deshalb vom Zuschauer als typisch empfunden werden dürften - spielt Krauss noch zwei umfangreichere Judenrollen: Oppenheimers Sekretär Levi und den Rabbi Low. Alle vier Juden sind Typen, keine Charaktere, sämtlich ohne Entwicklungsmöglichkeiten, denn sie sollen gemäß der NS-Ideologie Stereotypen sein und zu stereotypen Vorstellungen von Juden führen. Gleichwohl enthält das Filmmonstrum Levi, dieser antisemitische Homunkulus, diese judenfeindliche Spottgeburt aus Dreck und Feuer, in sich eine ganze Typologie von Judendarstellungen, je nachdem, welche Funktion ihm die Drehbuchautoren als Oppenheimers Untergebenen zugedacht haben. In allen Variationen soll er aber den Typ des jiddelnden, unzivilisierten, schmutzigen, sich in Sprache, Aussehen und Gehabe vernachlässigenden vorassimilierten Juden verkörpern. Zuerst öffnet er als Sekretär des Oppenheimer aus der Frankfurter Judengasse dem Abgesandten Karl Alexanders die Tür, und mit seinem ersten Blick ist das antisemitische Porträt skizziert; neugierig-aufmerksam, in gebückter Haltung taxierend, dienstbeflissen den Weg weisend und dabei doch wieder verstohlen abschätzend, ungepflegtes Haar unter dem Käppi, dürftiger, wirrer Vollbart, armseliger Kaftan. Der Zuschauer soll denken: eine gefahrlich-lauemde, falsche Kreatur aus der Judengasse. Er verwandelt sich nicht wie sein Herr Oppenheimer zum assimilierten Juden, er bleibt die gestikulierende, tänzelnde, abstoßend den Kaftan schürzende, seine Gegner nachäffende Schreiberseele des Ghettos. Wenn der Film-Süß den Bart geschoren, die Kippa abgesetzt, den Kaftan mit dem eleganten Höflingsrock vertauscht (Foto Nr. 6 und 7), seinen Stuttgarter Palast nicht mehr wie im Ghetto mit dem weithin sichtbaren hebräisch geschriebenen Bibelspruch geschmückt, den Glauben der Väter also gegenüber der höfischen Umwelt ein für alle Mal abgelegt hat, so macht Levi diese Abkehr vom Ritus nicht mit, wenn es auch nicht Gott ist, den er fürchtet, sondern nur die Vorhaltungen des Rabbiners: Biste verrickt, Joseph? Bart willste dir schneiden, Pejes willste dir schneiden, e Kaftan willste nich mehr trogen? Haste nich Moire vorm Rebbe?85
Der emanzipierte Oppenheimer hat um der leichteren Befriedigung seines Machthungers und seiner Geldgier willen fast total die jiddische Sprache des Ghettos in ihrem Melos, ihrer Phrasierung und ihrem Duktus mit dem durch modisch-elegante Wendungen barokkisierten Hochdeutsch vertauscht (nur vor Geschäftsabschlüssen kriegen einzelne Worte einen kaum merklichen jiddelnden Klang), Levi aber bleibt nicht nur in der jiddischen Rede konservativ. Ihm genügt auch außerhalb des Ghettos in einem erweiterten Wirkungskreis die Rolle als
84 85
Bild 5 im Filmprotokoll Hollstein 1971, 272 bzw. Sequenz 8 bei Maurer/Radevagen 1983, 83f. Bild 6 bei Hollstein, Sequenz 9 bei Maurer/Radevagen
85 Diener seines Herrn, als Mephistopheles, Unterteufel, Beelzebub: Er ist der Verwalter, der die Straßen- und Brückengelder kassiert, der Maître de plaisir, der auf dem Ball die Türen zu den verschwiegenen Salons öffnen und schließen läßt, der Beisitzer bei Verhören, der seinen Genuß darin findet, mit der Schlauheit, Verschlagenheit, Gerissenheit und der limitierten Macht "des" Juden die Arier anzukläffen wie der Hund den Mond. Aber nach dem gleichen ideologischen wie dramaturgischen Schema ist er auch der Übertölpelte und der verächtliche Feigling. Schächter, Greis und Sekretär waren die selbstgewählten Besetzungswünsche des Werner Krauss. Seine vierte Rolle war von Anfang an der Besetzungsauftrag des Propagandaministers Goebbels: Krauss sollte den Rabbi Low spielen, und er tat es auch. Er spielte nicht den Rabbi Low der Golemlegende, den sein Volk beschützenden Weisen, sondern den gemäß Drehbuch teuflisch-gefahrlichen absolutistischen Machthaber des Weltjudentums (Foto Nr.7), die wohl perfideste Dämonisierung eines Rabbiners in der Filmgeschichte. Dieser Low ist ein hinkender, dahinschlurfender, schwer auf seinen Stock gestützter massiger Greis, scheinbar hinfallig und doch ein brutal zuschlagender, Menschen bedrängender, keinen Widerspruch duldender, dabei berechnender und rechnender Machtmensch, eine respekteinflößende theologische Autorität, die die Menschen durchschaut, Oppenheimers Abkehr vom Glauben der Väter erkennt, benennt, tadelt und Süß zur Umkehr ruft, in seiner sezierenden Intellektualität aber den Zuschauer abstößt, genauer: abstoßen soll. Denn Low wird nicht als der vergeistigte Gelehrte und Gemeindeleiter dargestellt, sondern als verschlagener, schlauer Ghettojude, dessen Jiddisch wie Slang klingt, dessen Tadel ständig in primitive Bewunderung des Süßschen Reichtums und der Süßschen Geschäftspraktiken umschlägt, der sein Wissen als Astronom zu astrologischen Tricks, seine Erkenntnisse als Theologe zur Rechtfertigung der Lüge, seine Position als Gemeindeleiter zum Ausbau von Macht mißbraucht. Dem Zuschauer soll klar werden: Die Religion der Juden ist ebenso Humbug wie dieser Mann, der da ständig mit Gebetsschal und Kippa herumläuft und dessen flinke, unruhige Äuglein doch alles andere als religiöse Versenkung verraten, nicht echt ist; ihre Riten sind fremd und befremdend (wie kann man im Gotteshaus tanzen!), sie dienen nur der Kaschierung ihrer Weltherrschaftsgelüste. Low hat dazu den Schlüssel: "Willste herrschen über die Gojim, beherrsche ihr Geld!" Die Wirkung der Rabbi-Löw-Szenen dürfte allerdings geringer gewesen sein als vom Propagandaministerium erhofft: In den Analysen und Einzelabhandlungen des Films nach 1945 spielen sie - wenn überhaupt - eine völlig untergeordnete Rolle, in den Interviews des Verfassers mit Besuchern des Films vor 1945 war spontan nie von dieser Figur die Rede, und auch auf Nachfragen konnte der Low nur mühsam erinnert werden. Offenbar erschwerte die theologische und historische Unwissenheit der Besucher, speziell über den Rabbi-Löw-Mythos, den Zugang auch zu der Filmfigur, so daß die antisemitische Karikatur nicht haften blieb. Der Film JUD SÜSS enthält fast keine Szene, in der nicht von Juden die Rede ist - auch wo sie nicht als Figuren auftreten, wo nur Auswirkungen ihres Handelns
86 und Reaktionen auf ihr Handeln vorgeführt werden. Der Film endet mit der Niederlage der historischen Titelfigur, aber er zielt auf die Juden des nationalsozialistischen Herrschaftsgebietes, denen die Verkündung der " Endlösung" noch bevorsteht. Die Juden als Gruppe sind es, die gemeint sind, der Tod des Süß ist das Vorspiel des Genozids. So läßt sich die antisemtische Tendenz des Films vielleicht noch klarer als bei den von namhaften Darstellern verkörperten Spielfiguren an den (überwiegend jüdischen) mißbrauchten Kleindarstellern und Komparsen exemplifizieren. Der erste Jude des Films, der ins Bild tritt, eröffnet die Ghettosequenz:86 Die Kamera schwenkt von den dem ovalen Emblem des Süßschen Hauses mit dem hebräischen Segensspruch und den klein daneben geschriebenen Initialen "J.S.O." über den Abgesandten Remchingen zum Kutscher und gibt zwischen beiden den Blick auf die schmale Judengasse mit einigen umherstehenden Juden frei. Einer von ihnen kommt vom Bildhintergrund nach vom (Nahaufnahme) gewatschelt: ein krummbeiniges, schmächtig-armseliges Wesen mit Kippa und Peies, das neugierig-dreist, unverschämt grinsend seinen Blick von einem zum anderen wandern läßt. "So fängt es an!" will die Regie suggerieren, und so endet es: mit dem Einzug der Juden in die Stadt, inszeniert als eine Sequenz der Bedrohung.87 Eingeleitet durch Trommelwirbel in Großaufnahme (in Wirklichkeit Abschluß der Erhängungsszene eines gegen Süß opponierenden "rechten deutschen Mannes", hat sie auch die Funktion der Ouvertüre, des Alarmzeichens für das Folgende), zieht der lange Judenzug durch das Stadttor: die einen zu Fuß in Grüppchen, die anderen den Wagen begleitend, Sack und Pack schleppend, schließlich die auf den Wagen zwischen ihrem Kram Sitzenden - ein ungeordneter Haufen, das Chaos, das von der deutschen Ordnung gebändigt wird, den Spalier bildenden Soldaten und der Bevölkerung (soll man an die damals doch als positiv empfundene "Gasse" denken, durch die der Delinquent Spießruten laufen muß, weil er nicht hören wollte?). Die erste Einstellung erfaßt den Zug von hinten, die zweite - deutlicher werdend, die Bedrohung verstärkend - von vorne; da sieht man Juden in gestreiften Kleidern, so daß sich Assoziationen an abgeurteilte Sträflinge einstellen, was durch die dunkel-drohende Musik, über der in der dritten Einstellung ein Diskant eines jüdischen Kantors, der bedrohlich fremdländisch von "Jisroel" singt, verstärkt wird. In der letzten Einstellung wird für die, die immer noch nicht verstanden haben, durch die Szene im Ständehaus Artikulationshilfe geleistet: "Zu Hunderten ziehen die Juden in die Stadt," und schließlich: "Wie die Heuschrecken kommen sie über unser Land." Nicht der einzelne, "der Jud" ist gemeint. Im Sinne der eine rassistische "Reinheit des Blutes" vertretenden Naziideologie folgerichtig endet der Film nicht mit dem Einzelschicksal des Jud Süß Oppenheimer, sondern mit der Nutzanwendung des Ariers an die Nachgeborenen:
86 87
41 Einstellung im Filmprotokoll von Maurer/Radevagen 246.-250. Einstellung (33. Sequenz) bei Maurer/Radevagen, 27. Bild bei Hollstein
87 Für ganz Württemberg gilt hiermit der Judenhass ... Mögen unsere Nachfahren [die Adressaten des Films von 1940ff, D.P.] an diesem Gesetz ehern festhalten, auf daß ihnen viel Leid erspart bleibe an ihrem Gut und Leben und an dem Blut [!] ihrer Kinder und Kindeskinder.
5.2.1.3. JUD SÜSS als Dokument des (anti-)jüdischen Stereotyps JUD SÜSS ist kein historischer Film, sondern eine raffinierte Symbiose von kitschigem Melodram und sadistischer Propaganda.88 Seine in die Liebesschnulze und Pseudohistorie eingebettete Diffamierung von Juden ist Programm für die Gegenwart des Nationalsozialismus. Wie die Juden im Film angeredet werden und wie über sie gesprochen wird, ist Ausdruck nationalsozialistischer Judenpolitik. Wir verstehen also JUD SÜSS als ein Dokument des (anti-)jüdischen Stereotyps: Juden werden von den sich qua Rasse überlegen dünkenden Ariern gedutzt und verächtlich von oben nach unten behandelt (54.-60. Einstellung).89 Ein "rechter Deutscher" erkennt auch den assimilierten Juden sofort und verweist ihn in seine Schranken (98.-102.). Er redet nicht von ihm als individueller Persönlichkeit, sondern in diffamierend zu verstehender Generalisierung: "der Jude" (145.,177.,251. u.a.) oder unter Verzicht auf den Artikel haßerfüllt: "Jude" (163., 242.), schärfer: "Jud" (422.) bzw. "Hebräer" (225.) oder auf noch kürzere Formel gebracht: "Scheißkerl" (329.), "Lümmel" (478), "Bürschchen" (480) und "Saujude" (476.). Das Tun eines Juden wird als "Menschenschinderei" abqualifiziert (173.). Wer sich mit ihm einläßt, ist eine "Judenhure" (241.) oder ein "Judenknecht" (551.). Kinder solcher "blutschänderischer" Beziehungen (wenn "der Jude sein säuisches Wesen" treibt, 270.) sind "Judenkinder" (321.). Wo Juden als Gruppe toleriert werden, sind sie alles kahlfressendes und deshalb zu vertilgendes Ungeziefer ("Heuschrecken", 251.), "Feinde" der Christen und "Wucherer" (Lutherzitat: 267.f.). Ihre Rede ist "dreckiges, stinkendes Gewäsch" (346.), ihr "talmudisches Judengehirn brütet Bubenstücke" aus (348.), ihre Ideen sind "Judengedanken" (409.), ihre grundsätzlich gefälscht erscheinenden Elaborate sind geschrieben "von der Hand des heimtückischen Juden" (440). Als Süß verhaftet wird, tituliert ihn die Personifizierung des aufrechten Ariers bzw. des jungen deutschen Volkes als "Mörder" (582.), als er vor Gericht sitzt, faßt der Vorsitzende seine Verachtung in dem Wort zusammen: "der unselige Jude!" (594.) Solche Dialogpartikel dürften das Stereotyphafte der antisemitischen Judendarstellung unterstreichen. Noch ausgeprägter aber tritt das jüdische Stereotyp durch die Umsetzung des Szenariums mit Hilfe der Inszenierung, der schauspielerischen Leistungen, des Schnitts und der Musik zutage. Szene für Szene, Sequenz für Sequenz werden die antisemitischen Stereotype entfaltet. Beispielsweise suggeriert der Film ein eng begrenztes Spektrum jüdischer
88
89
Auf die sich von anderen Nazifilmen nicht unterscheidende " Vermittlungsstrategie" des JUD SÜSS haben vor allem Zielinski/Maurer in ihrer Interpretation (1983, besonders S. 55f.) aufmerksam gemacht. Einstellungsnummern nach dem FilmprotokoU von Maurer/Radevagen 1983, 74-199
88 Tätigkeiten: Juden sind Krämer(seelen) = geldgierige Schacherer (54.), Schächter = Quäler, Drahtzieher oder Nichtstuer. Sie sind dreckig, schmierig, speckig an Leib und Seele, ungepflegt auch in ihrer Sprache (die Ghettofiguren in der Interpretation durch W. Krauss). Juden kaschieren ihre fehlende Heimatliebe mit Weitläufigkeit (91.f.). Juden verstellen sich: Ihre Unterwürfigkeit und ihr Entgegenkommen, ihre scheinbare Geduld durch Gewähren von Zahlungsaufschub darf nicht über ihre Geldgier täuschen (109.-112., 122.-127.). Solange sie an der Macht sind, legen sie nicht ihre Maske ab (574.). Juden sind miteinander "versippt" und beherrschen dadurch leichter die Nichtjuden (129.). Wo sie sich einmal festgesetzt haben, ist nicht gegen sie anzukommen (371.). Die Rechenfertigkeit von Juden ist Ausdruck ihres berechnenden Wesens (131.-138.). Die Klugheit von Juden ist nicht Intelligenz, sondern hat einen Zug egoistischer Bauernschläue und dient der Erweiterung ihrer Machtposition (145.). Juden sind unbarmherzig, hochmütig, grausam und gewalttätig (150.-173.), kurz: "der" Jude ist ein Bösewicht. Juden arrangieren sexuelle Ausschweifungen und delektieren sich daran (186.-207.). Ihr lüsterner Sinn steht nach Rassenschande (210., 252.) und Verschmutzung deutschen Blutes (254.). Ihre angehäuften verborgenen, sagenhaften Reichtümer (51.) sind nicht ehrlich verdient, sondern erspielt, ergaunert (215.-224.). Juden sind unverschämt (232.), frech (329.). Sie bedrohen den Bestand der Volkswirtschaft (251.), des Blutes und der Nation (251., 254.,264.), und deshalb müssen nach Luthers Rat ihre Religionsschriften und Synagogen verbrannt, ihre Geschäftspraktiken verboten werden (267.-271.), denn ihre Religion zielt auf Beherrschung der Völker der Erde (293.) Ihr Gott hat im Grunde nichts mit dem Gott der Christen gemein, denn er ist nur ein "Gott der Rache", dessen (einziges) Gebot "Auge um Auge, Zahn um Zahn" lautet (514.), was nicht deutschem Wesen entspricht ("Das ist nicht unsere Art", 607.). Juden lügen, sie interpretieren die Bibel nur zu ihrem Nutzen (296.),säen Zwietracht und verpesten die Luft (329.). Juden in leitenden Positionen oder mit rechtsprechenden Funktionen widersprechen dem Gefühl von Recht und Ehre (334., 445.), sie foltern den einzelnen (512.) wie das Volk, aber wenn man ihnen die Macht nimmt, sind sie feige (544.,596.). Ihnen ist nichts heilig außer ihren Interessen und ihrem Profit (422.). Sie sind Fremde, denen das Wohlergehen der Nation und des Landes nichts bedeutet (411.). Juden kann man nur aus tiefster Seele mißtrauen (422.), sie sind verantwortungslos (595.), in ihnen regt sich kein Gewissen (599.). Ein Volk, dem Leid erspart werden will, muß den Beschluß fassen, alle Juden zu verbannen (622.). Für die qualitative Bewertung des jüdischen Stereotyps ist auffallig, daß der von uns relativ ausführlich beschriebenen Gruppe der Juden quantitativ ein ziemlich geringer Raum im Film eingeräumt wird. Knilli hat in seiner "explorativen Analyse einiger [Film-]Einstellungsdaten" ausgerechnet,90 daß die drei Gruppen Adlige, Bürger und Juden im Zeitverhältnis 3:2:1 vorgeführt werden, also der
90
Knilli 1983a, 57-67
89 Adel eine dreiviertel Stunde, das Bürgertum (Volk) eine halbe und die Judengruppe nur eine Viertelstunde auf der Leinwand zu sehen ist, bei einer Addition aller Groß- und Nahaufhahmen bzw. nur der Nahaufhahmen die Bürger (nicht der Adel und erst recht nicht die Juden) bevorzugt werden. Die Einzelfigur Jud Süß erhält allerdings die bei weitem meisten Einstellungen und die längste Zeit aller Groß- und Nahaufhahmen. Diese auch in den meisten Schlußfolgerungen sehr bemerkenswerte optische Analyse bezieht sich nur auf Einstellungen von jeweils einer einzelnen Person, berücksichtigt also nicht Nahaufhahmen, wo mehrere Personen zu sehen sind. Die akkustische Seite des Films (Sprache, Musik) war nicht Gegenstand der Untersuchung. Bild und Ton sind aber für die qualitative Analyse entscheidend und lassen Eindrücke, die durch die Auszählung nur von Groß- bzw. Nahaufhahmen entstanden sind, korrekturbedürftig erscheinen (die Figuren Herzogin, Jungfer Tausendschön und Minna Fiebelkorn erweisen sich dann als absolute Randfiguren, wogegen Rabbi Low, der in der optischen Analyse mit nur drei Großaufnahmen und überhaupt keiner Nahaufnahme vertreten ist, durch den Text und die Montage seiner Einstellungen mit denen von Süß, dem Herzog und der Gruppe der Sabbat feiernden Juden in den beiden Löw-Sequenzen eindeutig eine zentrale Position erhält). Die Akzentsetzung unserer Analyse auf die jüdischen Figuren und die antisemitischen Passagen des Films gemäß unserem Untersuchungsziel erscheint uns somit nicht als "Phänomen der selektiven Wahrnehmung".91 Wir hielten es sogar für gerechtfertigt, bei der Auflistung der jüdischen Stereotype auch solche Bezeichnungen der Herzogsfigur aufzunehmen, die zunächst nicht judenfeindlich interpretiert werden müssen ("Lümmel", "Bürschchen", "Scheißkerl"), aber im nachhinein unter Ablösung von der konkreten Filmszene eine Verstärkung des antisemitischen Stereotyps beinhalten. Halten wir also fest: JUD SÜSS bündelt das jahrhundertealte jüdische Stereotyp aus Altertum und Mittelalter (in seinen Ausprägungen als religiös motivierte, wirtschaftlich argumentierende und politisch-ideologisch motivierte Judenfeindschaft) bis zur biologisch motivierten Judenfeindschaft der Neuzeit unter Verwendung der siebenhundertjährigen Judenrollentradition des Theaters ganz im Sinne der rassistischen NS-Ideologie.92 Im Rahmen eines die Genres des
" 92
Knilli 1983a, 67 In Elisabeth Frenzeis ebenfalls 1940 erschienenem Buch Judengestalten auf der deutschen Bühne, das sich auf weite Strecken trotz seiner detaillierten Materialkenntnisse als ganz dem Ungeist der NS-Zeit verhaftet erweist, wird im ersten Abschnitt über jüdische Figuren des 13. Jahrhunderts schon der "Jude als Bösewicht" vorgestellt, seine Sprache, "das Übermaß an Redseligkeit und Gestik" (S.13) als Spottanlaß benannt, so daß sich als zweiter Typ der "komische Jude" (24) anschließt, der überlistet, verprügelt und in Situationen versetzt wird, bei denen der Zuschauer seiner Schadenfreude Raum geben kann oder besser: soll (32). Im 18. Jahrhundert ist dann die "Geldgier" der Kernpunkt der negativ-komischen Bühnendarstellung (34), hinzu kommen "Verstellung", "Unterwürfigkeit", "Erpressung", "Taktlosigkeit" (35), "Egoismus", "Mißtrauen", "Konkurrenzneid", "internationale Veijudung - (Juden]: ein Volk von Unterdrückten, das neidisch und rachsüchtig empordrängt" (36). Der Bühnen-Jude wird als "Angsthase" typisiert, ein die Gesetze nicht Einhaltender, "der seinen Gott um den Sinn
90 Melodrams, des historischen Kostüm- und Kriminalfilms benutzenden Unterhaltungsfilmes wird ein antijüdisches Panoptikum, ein so perfides Kabinett des Antisemitismus vorgeführt, wie es innerhalb eines einzigen Films gar nicht zu goutieren wäre, wenn es nicht durch seine Verpackung auch andere Kinobedürfhisse befriedigte und damit genießbar, ja bekömmlich und wohlschmeckend machte und dem an Stars und anderen Kinoingredienzien interessierten Publikum verlockend erschien. Zwecks profitabler Verwertung des Films mußten keine Zwangsvorstellungen organisiert werden. Der charmante Ferdinand Marian, die Baby-Doll-Söderbaum, wegen ihrer zahlreichen Kinoselbstmorde im feuchten Element als "Reichswasserleiche" verspottet, der populäre Staatsschauspieler Heinrich George, die Verwandlungskünste des Werner Krauss, die zur Schau gestellte deutsche Redlichkeit und Biederkeit des Eugen Klopfer, an dessen frühere Frankfurter Jud-Süß-Bühnendarstellung sich kaum jemand erinnert haben dürfte, und nicht zuletzt auch die Melodramregie Veit Harlans lockten 27 Millionen Besucher an die Kinokasse. Gerade diese Kinoelemente - Lion Feuchtwanger umschreibt sie als "ein bißchen Tosca"93 dürften die antisemitische Wirkung des Films verstärkt haben (mehr als bei den beiden anderen NS-Produktionen des Jahres 1940 DER EWIGE JUDE und DIE ROTHSCHILDS). JUD SÜSS wurde zum nationalsozialistischen AntisemitismusFilm par excellence. Wegen dieser Schlüsselstellung haben wir ihn, auch wenn er nach dem Zusammenbruch des Naziregimmes nicht mehr öffentlich vorgeführt wurde, als zentralen Bezugspunkt unserer Untersuchung interpretiert. Judendarstellungen im Kino und Fernsehen der Bundesrepublik könnten versucht haben, Gegenmodelle zu dieser demagogischen Judenpräsentation zu entwerfen. Ob es ihnen gelang, die Reproduktion von Spielarten des jüdischen Stereotyps zu vermeiden, ist eines der Untersuchungsziele.
93
seiner Gebote betrügt", er erhält ein "gedrücktes, kriecherisches Wesen", wird zum "Intriganten" (38), er hat "eine gewisse geschäftige Freude, ... seine Hand beim Binden und Lösen im Spiele zu haben" (39). Er erscheint "wie eine schicksalhafte böse Macht, als ein Vorbote unabwendbaren Unheils" (40). Wir haben für unsere Zusammenstellung nur die einleitenden anderthalb Kapitel bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, also der Lebenszeit Oppenheimers, berücksichtigt. Frenzeis Buch, das auch Feuchtwangers "Jud Süß" im Stückeverzeichnis aufführt, aber nicht interpretiert, reicht bis in die dreißiger Jahre unseres Jahrhunderts. Es schließt mit der Analyse jenes Stückes, das die literarische Vorlage für den anderen berüchtigten antisemitischen NS-Historienfilm DIE ROTHSCHILDS bildete: mit Eberhard Wolfgang Möllers Schauspiel "Rothschild siegt bei Waterloo" (1934). Frenzel sieht dessen Verfahren der Judendiffamierung "als den für uns einzig möglichen" Weg an: "den Weg, den schädlichen Einfluß des Judentums in der Geschichte aufzuzeigen" (258). Dieser Eberhard Wolfgang Möller, und damit schließt sich der Kreis, ist einer der drei Drehbuchautoren des Nazifilms JUD SÜSS! Feuchtwanger 1984a, 526
91 5.2.2. JEWSUESS 5.2.2.1. Zur literarischen Vorlage (1): Feuchtwangers geschichtsphilosophische und literarische Konzeption seines Romans Jud Süß Das JUD-SÜSS-Syndrom verhinderte nach 1945 jahrzehntelang eine Neuinszenierung des Oppenheimer-Stoffes. Trotz des enormen Verkaufserfolges des Jud-Süß-Romans von Lion Feuchtwanger (bis 1990 insgesamt über 3 Millionen Exemplare,94 darunter 90 000 Taschenbücher in der Bundesrepublik) und zahlreicher Vorarbeiten, Treatments und Drehbuchentwürfe von Peter Lilienthal, Friedhelm Ebel und Egon Geis, ja sogar der Lizenzvergabe von Martha Feuchtwanger, der Witwe des Autors, für eine Coproduktion des deutschen, britischen und französischen Fernsehens,95 war zwar nach sechzig Jahren erstmals das "Jud-Süß"-Stück des 1942 im Lodzer KZ verstorbenen Paul Kornfeld zu lesen und zu besichtigen,96 aber ein neuer Film oder ein neues Fernsehspiel nach Feuchtwangers Drama von 1917 oder nach seinem Roman von 1925 ist nicht entstanden. Es gibt nur eine britische Verfilmung aus dem Jahre 1934 von Lothar Mendes, die Goebbels 1939 dem Regisseur Veit Harlan und anderen Mitarbeitern des Nazifilms JUD SÜSS vorführen ließ und die bei Harlan angeblich "eine deuüiche antisemitische Wirkung" hinterließ.97 Mit solcher Deutung steht Harlan allein. Die Originalfassung dieses Films JEW SUESS ist in der Bundesrepublik nur in Sondervorfiihrungen, z.B. 1973 in einer Seminarveranstaltungsreihe in der Westberliner Akademie der Künste gemeinsam mit dem Harlan-Film JUD SÜSS oder 1992 als Begleitprogramm zur Berliner Ausstellung "Jüdische Lebenswelten" zu sehen gewesen. Eine deutsche Synchronisation oder Untertitelung ist nicht erfolgt, die Sprachbarriere verhinderte einen breiten Einsatz im Kino oder Fernsehen. Der Film ist praktisch unbekannt geblieben, er darf aber in unserer Untersuchung trotz der bisher ausgeschlossenen Breitenwirkung einen dem Thema angemessenen Rang beanspruchen. JEW SUESS fußt auf dem Roman Feuchtwangers, der für sein schon 1922 abgeschlossenes Manuskript die oben genannten Sekundärquellen von Schnee, Stern, Elwenspoek und Gerber nicht benutzen konnte, sondern sich auf die "recht spärliche" Biographie von Manfred Zimmermann aus dem Jahre 1874 stützte.98 Seine Aussagen über den Roman, die sich in einigen autobiographischen Skizzen finden, versagen sich einer ausschließlich gegen den Antisemitismus gerichteten Interpretation. Im zweiten Teil seines grundlegenden Werkes aus dem Nachlaß über "Größe und Grenzen der historischen Dichtung" begründet Feuchtwanger die
M
Hochrechnung nach Köpke 1983 und anderen Feuchtwangerbiographien (s.u. Anm. 109) Knilli/Zielinski 1983, 100-107 96 Stiickabdruck und Rezension der Nürnberger Aufführung in Theater heule 2/88. Vgl. auch Pazi 1985, 100-121 " Harlan 1966, 96 * Feuchtwanger 1984a, 381 95
92 historische Einkleidung durch Schriftsteller mit dem Motiv der Distanz, der Vermeidung allzu großer Nähe." Zwei Jahre nach Erscheinen seines Jud-SüßRomans bot der Zweiundvierzige eine Formel für seine schriftstellerische Arbeit an: ... versuchend, ein Gemeinsames zu finden, eine Linie, die meine Bücher an mich, an mein Leben und aneinander bindet, einen Generalnenner: dann glaube ich, trotz aller scheinbaren Differenzen doch immer nur ein Buch geschrieben zu haben: das Buch von dem Menschen, gestellt zwischen Tun und Nichttun, zwischen Macht und Erkenntnis.100
Feuchtwanger, der sich nicht als deutscher oder als jüdischer, sondern als internationaler Schriftsteller fühlte101, der dieJudenheit als eine Geistesrichtung mit der Fähigkeit der Assimilation auffaßte und Israel als einen Pufferstaat, der politise h und weltanschaulich immer lavieren mußte,102 war davon überzeugt, daß die Grenzen der Völker und "Rassen" langsam verschwinden würden und man keine klare Demarkationslinie ziehen könne "zwischen dem, was jüdisch ist und dem, was nicht"; seinen Büchern würde man schwerlich eine "projüdische Tendenz" nachweisen können, deshalb habe er nichts von den üblen Eigenschaften und Taten des Juden Josef Süß Oppenheimer unterschlagen.103 Er habe weder den Mann Josef Süß retten noch eine antisemitische Legende zerstören wollen, sondern eben sein zentrales geschichtsphilosophisches Thema vom Weg des weißen, des westöstlichen Menschen über die europäische Lehre von der Macht bis zur Lehre Asiens vom Nichtwollen und Nichttun gestalten wollen: Das Gleichnis dieses westöstlichen Menschen erblickte ich in dem Manne Josef Süß, in seinem heftigen Ergreifen und in seinem überzeugten Sichfallenlassen, in seinem wilden Tun und in seinem gelassen-kräftigen Nichttun.'04
Daß eine solche philosophische Konzeption nicht mit der Flucht aus der Geschichte gleichbedeutend sein muß, erhellt seine Entfaltung dieses Zitats in dem 1935 geschriebenen Aufsatz "Vom Sinn und Unsinn des historischen Romans". Dort berichtet Feuchtwanger, daß er seine Idee ursprünglich an einer jüdischen Persönlichkeit der Zeitgeschichte, nämlich an Walther Rathenau, gestalten wollte,105 der übrigens im gleichen Jahr von Antisemiten ermordet wurde, in dem Feuchtwanger seinen Roman vom Schicksal des Juden Josef Süß Oppenheimer beendete. Im Roman selbst legt sich Feuchtwanger gar nicht auf den Antagonismus vom Tun und Nichttun fest, sondern in seinem kühnen Bild vom ewigen Israel sind es drei Wellen, die über das winzige Land und über das "kluge, kleine, tapfere Volk" fluten und ineinander münden: "die helle, rauschende vom Wollen
" 100
101
102 103 104 105
Feuchtwanger 1984b, 140 Feuchtwanger entfaltet 1927 (1984a, 360) diese Problemstellung: "Tun und Nichttun, Macht und Verzicht, Asien und Europa, Buddha und Nietzsche." Feuchtwanger 1984a, 362. Ein Jahr vorher hatte er so formuliert: "Mein Hirn denkt kosmopolitisch, mein Heiz schlägt jüdisch" (ebd., 379). Feuchtwanger 1984a, 460 Feuchtwanger 1984a, 364 Feuchtwanger 1984a, 381 Feuchtwanger 1984a, 497
93 und Tun, die heiße, glühende vom herrischen Nicht-dem-Tod-sich-Fügen, die milde, dunkle vom Verströmen und Verzichten." Ihnen allen hält es stand: Es ist nicht dumm, es wehrt sich nicht gegen das Unmögliche; es duckt sich, wenn eine Welle gar zu hoch einherkommt, und es läßt sich ruhig bis über den Scheitel überspülen. Aber dann taucht es wieder hoch und schüttelt sich ab und ist da. Es ist zähe, aber nicht töricht obstinat. Es gibt sich allen Wellen hin, doch keiner ganz. Nimmt sich aus den drei Strömungen, was ihm tauglich scheint, paßt es sich an. 106
Ebenso ist auch die Titelfigur des Romans nicht die in Resignation, Depression und Kontemplation sich verlierende, in das "selige, willenlos Vergleiten, Verströmen"197, sondern die sowohl noch angesichts des Galgens sich nicht in den Tod fügende ("Er reckte sich, seine Steifheit war weg, er schlug um sich, wehrte sich verzweifelt"108) als auch das Wollen und Tun bejahende ("... und [Süß] schreit zurück:'Eins und ewig ist Jahwe Adonai'").109 Feuchtwanger, der einer 1555 aus Feuchtwangen vertriebenen Familie entstammte, hatte mit einer Arbeit über Heines "Rabbi von Bacherach" promoviert, lehnte aber den ihm empfohlenen Habilitationsplan wegen des ihm nahe gelegten Übertritts zum Christentum ab. Der Freund und Mitarbeiter Brechts, Verfasser des ersten Anti-Hitler-Romans (Erfolg) sowie einer Trilogie über den Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der nach dem "Aufstand der Dummheit" von den Nazis ausgebürgert und dessen Schriften verbrannt wurden, hat in zwei wichtigen, auch verfilmten Emigrationsromanen und einigen seiner historischen Romane eine viel deutlichere antifaschistische Position bezogen als in seinen meisten Arbeiten vor der Nazidiktatur.110 Das belegen auch die Schriften von Georg Lukacz, der in seinen Arbeiten über die Grundlagen einer marxistischen Ästhetik den historischen Roman für die wichtigste Gattung einer gegen den Nationalsozialismus gerichteten Literatur hielt und sich intensiv dabei mit Feuchtwanger auseinandergesetzt hat, indem er z.B. in dessen Jud Süß die "liberale Verherrlichung des Kompromisses", die Zeichnung "positiver Gestalten nur als tragische oder tragikomische Helden" kritisierte, seine späteren historischen Romane indessen als "Gegenbild zur Barbarei des 'Dritten Reiches"' rühmte.111 Bei seinem Erscheinen (1925) schien sich jedenfalls Feuchtwangers Jud Süß weder für eine Apologie noch für ein gegen den Antisemitismus gerichtetes Buch 106
107 108 IM 1,0
Feuchtwanger , Jud Süß .Taschenbuchausgabe o.J., 432. John Milful (1986, 217) will Feuchtwangers "Drei-Stufen-Modell" auch als "Deutung der jüdischen Existenz in der Diaspora" verstanden wissen: Assimilation als Vorbedingung zur Läuterung, die dritte Stufe "weniger eine Wiederentdeckung der jüdischen Identität als ihre Transzendierung". Feuchtwanger, Jud Süß, 428 Feuchtwanger, Jud Süß, 517 Feuchtwanger, Jud Süß, 517 Vgl. die versch. Feuchtwangerbiographien: Jeske/Zahn 1984, 80ff.;Sternburg 1984, 206ff.; Jaretzky 1984, 50ff.; Pischel 1984, 81ff.; Skierka 1984, 80ff. Für unsere Thematik von besonderer Relevanz als grundlegende Aufsätze: Scheibe 1984; Milful 1986 Lukacs 1963, 215-221
94 als verwertbar zu erweisen, hätte Feuchtwanger in seinem Artikel "Über 'Jud Süß"' nicht eine Schlußbemerkung angefügt, die noch eine andere Interpretation als die eines Gleichnisses vom Tun und Nichttun zuläßt: Wenn Sie aber aus den Menschen und Geschehnissen meines Werkes einen anderen Sinn und ein anderes Leben herausgelesen haben, dann lassen Sie sich bitte ja nicht beirren durch das, was ich Ihnen soeben sagte. Halten Sie vielmehr den von Ihnen gefundenen Sinn für den rechten. Ein Buch, ein richtig gewachsenes Buch, wird fertig erst durch den Leser. Es hat nicht einen einzigen Sinn, es hat so viele Sinne, als es Leser hat." 2
Offenbar haben viele Leser einen solchen anderen Sinn gefunden, und Feuchtwanger selbst deutete 1941 in seinem berühmten "Offenen Brief' an jene Berliner Schauspieler, die an dem Nazifilm JUD SÜSS mitgewirkt hatten, die Neubewertung Oppenheimers schon an, indem er für seine Romanfigur Partei ergriff: der Roman sei "die Geschichte jenes Juden, von dem Sie alle wußten, daß er ein großer Mann war".113 In seinem Aufsatz aus dem Jahre 1958 "Vom Schicksal des Buches 'Jud Süß'" erklärt er dann eine der Ursachen für den Erfolg des Werkes mit der Vorahnung und typischen Darstellung der "antisemitischen Regungen, die dann später zu jenen schauerlichen Ausbrüchen führen sollten."114 Die zeitgenössischen jüdischen Rezensionen differieren in der Einschätzung des Romans nach der von dem jeweiligen Presseorgan vertretenen Position115; aber ob es sich um die durch Akkulturation assimilierten, um die orthodoxen oder um die zionistischen jüdischen Gruppierungen der zwanziger Jahre handelte: Sie alle machen sich kaum Feuchtwangers geschichtsphilosophische These vom Weg des westöstlichen Menschen zum Nichttun zu eigen, sondern interpretieren den Roman viel stärker als eine Auseinandersetzung Feuchtwangers mit den unterschiedlichen Flügeln des Judentums seiner Zeit, wie sie auch in den verschiedenen Judengestalten des Romans (bei Süß, Landauer, Gabriel) wiederkehren, und mit dem Antisemitismus, wie er Feuchtwanger tagtäglich begegnete und nur leicht verändert dann im Roman gestaltet wurde. Nicht die Geschichtsphilosophie, sondern die Romantheorie Feuchtwangers verhalf dem Roman zu seiner großen Popularität und Wirkung, daß nämlich die Verfasser historischer Dichtung "auch immer nur Zeitgenössisches aussagen wollen, ihr Verhältnis zur eigenen Zeit, ihr erlebtes Erkennen, wieviel von der Vergangenheit in der eigenen Zeit atmet."116 Vordergründig beruhte der Bucherfolg sicherlich auf der Gestaltung der Interesse weckenden Figur eines Rokokojuden am Württemberger Fürstenhof mit seinem Festhalten am Judentum. Feuchtwanger selbst interessierte wahrscheinlich stärker "der Übergangscharakter dieser Epoche zwischen Antisemitismus und Toleranz, zwischen feudalistischer und bürgerlich-kapitalistischer Lebensweise"1 aber dieser historische Jud Süß ist ebenso auch eine Folie für Gegenwärtiges: "Jud
112 113 114 115 116 1,7
Feuchtwanger 1984a, 382 Feuchtwanger 1984a, 529 Feuchtwanger Jud Süß, Anhang zur Taschenbuchausgabe Lühe 1984, 90-99 Feuchtwanger 1984b, 129 Köpke 1983, 80 u. Sierka 1984, 73
95 Süß gibt das Beispiel jüdischer Selbsterkenntnis, das Beispiel, wie ein Mensch den eigentlich jüdischen Weg findet.1"18 Ein aufmerksamer Leser nach dem Holocaust wird über den Vergleich des historischen Jud Süß mit den Entwürfen jüdischen Selbstverständnisses in der Weimarer Republik hinaus aber in dem Roman - vor allem in dessen Pogromsequenzen - immer die Vorabspiegelung der Judenverfolgung und -Vernichtung unter dem Nationalsozialismus sehen. 5.2.2.2. Zur literarischen Vorlage (2): Feuchtwangers jüdische Figuren im Roman Jud Süß Gemäß unserer Intention, die Wirkungen jüdischer Figuren im Film zu untersuchen, beschränken wir uns statt einer differenzierten Analyse des Romans, zu der eine ganze Anzahl Arbeiten vorliegt,119 auf eine knappe Interpretation eben dieser jüdischen Gestalten, zumal der Ablauf der äußeren Handlung sich im großen und ganzen an die historischen Fakten anlehnt. Die von Klussmann erläuterte kunstvolle Komposition des Romans in Darstellung und Deutung der Figuren auf den fünf Ebenen der äußeren Personenbeschreibung, des Gespräches und (inneren) Monologs, der erzählenden Darstellung, des Erzählerkommentars und der indirekten Charakterisierung hebt aus dem nichtjüdischen Figurenarsenal (dem Herzog Karl Alexander, seiner Frau, seiner Mätresse, den katholischen und protestantischen Kirchenführern) und mehreren jüdischen Randfiguren vier zentrale jüdische Gestalten heraus: Jud Süß und seine Tochter Naemi, den Rabbi Gabriel und den württembergischen Hoffaktor Landauer.120 Als wichtigste jüdische Nebenfiguren müssen noch der unschuldig wegen Ritualmord angeklagte Händler Seligmann, Oppenheimers Mutter und sein zum Christentum übergetretene Bruder genannt werden. Aussehen und Verhalten des Süß entsprechen schon bei der Einführung der Figur dem bei Elwenspoek, Stern und Schnee beschriebenen Bild des assimilierten Hofjuden: Stattlich, bartlos, modisch, fast ein wenig geckenhaft gekleidet, saß aufrecht, besah [Josef Süß, D.P.], den Blick rastlos, scharf, rasch jedes Detail [...]. Den elegant geschnittenen hirschbraunen Rock, silberbordiert, aus allerfeinstem Tuch, die zierlich und präzis gekrauste und gepuderte Perücke, die zärtlich gefalteten Spitzengamaschen. [...] Süß Oppenheimer, dem die Unternehmungslust und die Lebensgier so unbändig aus den großen, rastlosen kugeligen Augen brannte. Das also war die neue Generation (S. 15).121
Ihr wird die alte Generation der Hoffaktoren gegenübergestellt, die am orthodoxen Glauben äußerlich festhält, aber im Grunde nur gierig ist, "sich aus dem Kuchen Welt sein mächtig Teil herauszufresen" (S.17):
118
Köpke 1983, 85 "» Köpke 1983, 76-85; von Sternburg 1984,197-200; Kindlers üteraturlexHon 1968, IV, Sp. 123125 bzw. Kindlers Neues Literatur Lexikon 1989, V, 515f.; von der Lühe 1984, 90-99; Klussmann 1984, 94-120; Pischel 1984, 62-69 120 Klussmann 1984,103 121 Seitenangaben nach der Taschenbuchausgabe des Romans Jud Süß bei Fischer 1987
96 Isaak Landauer trug jüdische Tracht, Schläfenlocken, Käppchen, Kaftan, schütteren Ziegenbart, rotblond verfärbt. Ja, er trug sogar das Judenzeichen, das ein Jahrhundert vorher im Herzogtum eingeführt war, ein Jagdhorn und ein S darüber [...] Er wußte, es gab nur eine Realität auf dieser Welt: Geld [...] aus Geld kam alles und zu Geld wurde alles, und alles ließ sich in Ziffern ausdrücken. Er, Isaak Landauer, wußte das, er saß mit an den Quellen [...]. Aber er war nicht so töricht, diese seine Macht herauszukrahen, er hielt sie heimlich [...]. (S. 14-16)
Landauer, in Wirklichkeit Isaak Simon aus Landau und daher Landauer genannt, ist als württembergischer Hoffaktor des späteren Herzogs Karl Alexander archivalisch belegt, gesichert ist auch, daß er in Wildbad, wo Feuchtwanger seinen Roman beginnen und fast alle wichtigen Figuren in dieser Ouvertüre aufeinandertreffen läßt, Süß mit Karl Alexander bekannt machte.122 Von den weiter oben beschriebenen Tätigkeiten Oppenheimers finden sich auch die meisten im Roman wieder: zu Anfang Warenhandel, Wechselgeschäfte, Geldleihe in Verbindung mit der Ernennung zum Hoffaktor und Schatullenverwalter Karl Alexanders, später dann wird er "dem Herzog Geld schaffen, und durch Geld Weiber, Soldaten, Gloire" (S. 119), also Steuerentwürfe vorlegen, Monopolvorschläge machen, Rekrutierungen vorantreiben, den Bestand der Armee und der Hofhaltung sichern, Ämter und Titel "verschachern", ein Fiskalamt einsetzen, die Administration kontrollieren, Glücksspiele einrichten, den eigenen Kommerz mit Juwelen ausbauen und den Einfluß der Landschaft schwächen. Ganz auf der Linie Elwenspoeks und Sterns ist Süß immer nur Bankier und Berater mit dem Titel eines Geheimen Finanzienrats, hat er kein Staatsamt inne, achtet er streng auf die "Solidität seiner Münzgebarung" (S. 165), spielt er nur eine geringe Rolle bei den Katholisierungsplänen des Herzos, erscheinen also die späteren Anklagepunkte durch die Handlungsentwicklung als ungerechtfertigt. Doch wichtiger als die nuancierte Schilderung von Oppenheimers Tun als Ratgeber, Merkantilist, Kaufmann, Münzpolitker, Finanzienrat und Politiker ist Feuchtwanger der Entwurf des Süßschen Psychogramms durch das dominierende literarische Mittel der Kontrastierung, wie es Klussmann in seiner Analyse des Romans herausgearbeitet hat:123 Der Hofjude Süß als "Spiegelbild seines Herzogs"124 durch Demonstration von Luxus, Entfaltung und Ausbau von Macht ohne Rücksicht auf Integrität, Würde, psychische und physische Unverletzlichkeit der Person der von ihm Beherrschten, ja im brutalen Zugriff gerade deren Verletzung von Gut und Leben einkalkulierend, ist seinem Feudalherren an Intelligenz, Rhetorik, Attraktivität und Rastlosigkeit überlegen. Feuchtwanger läßt ihn - im Gegensatz zum Herzog, dessen Fortschreiten nur im erstrebten Zugewinn von amouröser, militärischer und territorialer Macht besteht - in die Sturzflut seiner drei Wellen vom Wollen und Tun, vom Nicht-dem-Tod-sich-Fügen, vom
122 123
124
Schnee 1963, IV, 117 Klussmann 1984, 103: Süß, Landauer und Gabriel bilden nach ihm eine "deutliche Oppositionsstruktur mit mehrfacher Entgegensetzung. " Klussmann 1984, 108
97 Verströmen und Verzichten tauchen, dabei die ganze Skala der Gefühle von Liebe, Rache, Haß auskosten. Aber dieser unaufhörlich Tätige, die Spielzüge seiner Kontrahenten Beobachtende, Durchkreuzende, Schlagende ist selber auch Spielfigur. Klussmann hat auf die dominierende Rolle des Rabbi Gabriel aufmerksam gemacht, der die Entscheidungen des Süß in einigen Gelenkstellen des Handlungsgefüiges beeinflußt: der seine Tochter Naemi ins Spiel bringt, der Süß wider alle politische Vernunft veranlaßt, in einer Pogromsituation den Juden Seligmann zu retten, der seine Mutter bekennen läßt, daß Süß' Vater kein Jude, sondern der christliche Feldmarschall-Leutnant von Heydersdorff ist (was Schnee in seinen Forschungen in Abhebung von Stern ja auch durchaus konzidiert und was für Feuchtwanger geradezu der Angelpunkt wird: Die Machtlüsternheit des Süß ist Erbteil des Christen, nicht des Juden!). Gabriel, äußerlich nicht als Jude zu erkennen, ist im Roman die Personifizierung des religiösen Judentums, weswegen Süß sich gegen ihn wehrt: Der assimilierte Hofmann sträubt sich gegen die Heimholung ins Judentum, noch dazu ein Judentum, das wie bei Gabriel immer einen Zug ins Mystische hat, mit der Kabbala, dem Buch Zohar und dem Pseudomessias Schabbetaj Zbi (Sabbatai Zwi, bei Feuchtwanger wie bei Heinrich Graetz: Zewi) in Zusammenhang gebracht wird, mehr noch: Rabbi Gabriel, "der Kabbaiist" mit seinen magischen Fähigkeiten, der Unheimliche, Mächtige, allein durch sein bloßes Auftreten mit dem Odium der Astronomie, Astrologie und Alchemie behaftet, rückt durch das Geschwätz der Leute in die Nähe der mittelalterlichen Sagengestalt des Ewigen Juden, wie sie schon im GOLEM aufgetreten war. Diese Mystifizierungen sind nur retardierende Momente und Umschreibungen für den argen Weg der Erkenntnis des Süß, der mit dem vergessenen Hebräisch auch seine Quellen vergessen hat und sich dagegen wehrt, daß sein so aktives Leben vom Rabbi als eitel und Haschen nach Wind angesehen wird ("[...] des Süß Leben sei kein Leben. Sei vor sich selber und der eigenen Leere fliehende Zappelei" S. 286). Der Umschwung zurück zum Judentum, der Verzicht auf ein billiges Leben durch ein Bekenntnis zur Religion seines christlichen Vaters wird nun eingeleitet durch eine der rührendsten Figurenkonstellationen Feuchtwangers, eine Inkarnation der Frauen der Hebräischen Bibel von Ester bis Rut, nämlich durch Naemi, die junge, schöne Tochter des Josef Süß, fast keine Menschenfigur von Fleisch und Blut, eher eine Gestalt der Poesie und des positiven jüdischen Stereotyps: jung, schön, dunkel, unschuldig, unberührt, Verkörperung des Reinen, der Seele des Volkes wie der Religion. Ihr Opfer - sie flieht vor den Nachstellungen des Herzogs auf das Dach ihres Dornröschenmärchenhauses im dunklen Wald (!) und stürzt dabei zu Tode - löst erst eine raffiniert eingefädelte hefte Reaktionskette des Süß aus, der der Herzog erliegt, so daß er, vom Schlag gerührt, sterbend den Triumph- und Rachegesang des beleidigten Vaters anhören muß, dann verebbt die Welle vom Sich-nicht-Fügen. Nicht wie in der biographischen Literatur und den Verfilmungen verwandelt sich Süß unter den Haftbedingungen vom assimilierten Juden zum Ghettojuden; schon der Tod seiner Naemi hat die auch äußerliche
98 Rückverwandlung ausgelöst. Süß initiiert seine eigene Verhaftung, wird während seines Prozesses zum sein Judentum nun erst begreifender und ergreifender, dann bekennender Märtyrer, der das christliche Erbteil seines Vaters von sich weist und erneut Sohn seiner jüdischen Mutter, also Jude wird. Er widersteht allen Bekehrungsversuchen zum Christentum, er hat sich durchgerungen - man denkt an Franz Rosenzweigs Entschluß "Ich bleibe also Jude"125 - und stirbt nach einem letzten Rettungsversuch der Judenheit mit dem Ruf: "Eins und ewig ist der Jahwe Adonai." Die Gemeinde der Juden hat Süß betend auf der Hinrichtung begleitet, den Leichnam vom Galgen gestohlen, ihn bestattet: Sie senkten den Sarg in den Grund. Der Solitar13* war am Finger des Toten, unter seinem Haupt das kleine Häuflein Erde von der Erde Zions. Im Chor antworteten sie dem Vorbeter: "Eitel ist und vielfaltig ist und Haschen nach Wind ist die Welt; doch eins und ewig ist der Gott Israels, das Seiende, Überwirkliche, Jahve." Dann rissen sie Gras aus und warfen es hinter sich. Und sie sprachen: "Wir gedenken, daß wir Staub sind." Dann wuschen sie sich die Hände in fließendem, damonenscheuchendem Wasser und verließen den Friedhof. (521)
5.2.2.3. Harlans JUD SÜSS - eine Feuchtwanger-Adaption? Bildete Feuchtwangers Roman nun etwa doch - und sei es in wenigen Elementen eine Vorlage für den Goebbels-Harlan-Film JUD SÜSS?127 Die Frage ist, was schon aus der Interpretation der (jüdischen) Figuren hervorgegangen sein dürfte, entschieden zu verneinen. Von den nichtjüdischen Personen kommen fünf Randfiguren sowohl bei Feuchtwanger als auch im Harlan-Film vor: Der Offizier von Remchingen ist bei Feuchtwanger ein judenfeindlicher, die Katholisierungspläne des Herzogs mit großer Machtfülle unterstützender General, bei Harlan ein judenfreundlicher und deshalb von Putschisten erschossener Offizier. Der im Harlanfilm als deutschbiederer, d.h. "nationalsozialistischer" Gefolgsmann auftretende Obrist von Röder erscheint bei Feuchtwanger nur als der aus zeitgenössischen Flugblättern mit einem unsäglichen Reim in Erinnerung bleibender Anführer des Verhaftungskommandos. Von Feuchtwangers intigrierendem Bruderpaar von Neuffer (der eine Kammerdiener des Herzogs, der andere Minister) ist bei Harlan die Charge eines Dieners übriggeblieben. Der bei Harlan eine Hauptrolle spielende Sturm findet sich auch bei Feuchtwanger, dort ist er allerdings eine völlig blasse Figur - trotz seines Präsidententitels. Allenfalls wurde ein Personenname (Sturm) mit einem Titel (Landschaftskonsulent, so lautet der Titel des Ministers Neuffer) kombiniert und diese Figur dann in den Harlanfilm übernommen. Nur in Feuchtwangers dem Roman vorangegangenen Schauspiel aus
125 126
171
Vgl. Hoppe o.J. (1989), 28-44 Der Solitär ist jener herrliche Edelstein Oppenheimers, der Symbol seines Reichtums und seiner Macht, seines Triumphes über den Herzog, aber auch Gegenstand des Neides und der Gier seiner Gegner war. Vgl. z.B. die Irrtümer von Feuchtwanger, Estermann u.a. (s. Anm. 67)
99 dem Jahre 1917 128 fallen Titel (Landschaftskonsulent) und Name (Sturm) zusammen; in der kurzen Szene opponiert Sturm nur gegen die Katholisierungspläne seines Herzogs. Bleibt als letztes demnach die Figur eines stummen farbigen Dieners, eines Mulatten, der in beiden Werken gleichen Titels umherhuscht. Wenn man überhaupt einen Diebstahl geistigen Eigentums durch Harlan und Konsorten konstatieren will, ist es eine auch hier wieder in ihr Gegenteil verdrehte Passage unmittelbar vor der Verkündung des Todesurteils: Drei Rabbiner versuchen den nach dem Tode des Herzogs bestallten Herzogadministrator von der Notwendigkeit zu überzeugen, das Todesurteil zu verhindern. Der Rabbiner aus Frankfurt fuhrt als Entschuldigung an, was Harlan dann zur Beschuldigung pervertierte: Reb Josef Süß Oppenheimer ist gestanden vornean unter den Juden, er ist geboren aus einer alten, angesehenen Familie. Was er getan hat, wird man sagen, hat die ganze Jüdischheit getan. Wenn man ihn wird aufhenken und die Christen, seine Konsorten, gehen frei herum, wird man sagen, die Judenheit ist schuld an allem, und es wird kommen neuer Haß und Verfolgung und Bosheit über die ganze Judenheit. (S.500)
5.2.2.4.
Leitende Fragestellungen für die Analyse von Literaturverfilmungen mit Judendarstellungen
So problematisch die Analyse von nur einigen jüdischen Figuren des Feuchtwangerromans ist - die Aktionen und Reaktionen der in einem ebenso weiten Spektrum gezeigten katholischen, evangelisch-kirchlichen und pietistischschwärmerischen Christen im Buch gehörten eigentlich dazu, und erst dann würde die "mehrdeutige Differenziertheit in der Gestaltung ... bei nichtjüdischen und jüdischen Figuren" 129 als das übergeordnete Stilprinzip Feuchtwangers klar erkennbar sein - so dürften schon diese andeutenden Charakterisierungen klargemacht haben, daß es völlig ausgeschlossen ist, einen 521 Seiten langen, an Figuren und Situationen überreichen Roman in einen Spielfilm von normaler Spieldauer zu verwandeln. Davon abgesehen, ist die vielbeschworene Werktreue bei der Transponierung eines literarischen Werks in ein anderes Medium (Literaturadaption) eine contradictio in adiecto bzw. ein Verkennen der filmischen Eigengesetzlichkeit und ein Beharren auf einem überholten Alleinvertretungsanspruch literarischen Erzählens. Zu fragen ist also nur: - Welche Handlungsstränge und welche Figuren sind verändert worden? - Welche Folgen hat das für Aussageabsicht und filmische Erzählstruktur? - Inwiefern folgen die Filmemacher (dies als Generalisierung aller die Endgestalt des Films/Fernsehspiels prägenden Mitarbeiter, d.h. nicht nur des Regisseurs) den Intentionen des Autors bzw. welche (andere) Filmidee scheinen sie verwirklicht zu haben?
128 129
Feuchtwanger 1984c, 253-336 von Hofe 1985, 59
100 - Welche jüdischen Figuren des Films mit welchen "Botschaften" sind erkennbar? - Ist es vorstellbar, daß der Film einen Beitrag zur Abwehr des Antisemitismus in der Bundesrepublik Deutschland heute leistet?
5.2.2.5. Produktionsbedingungen und Intentionen des JEW SUESS im Vergleich mit der Feuchtwanger-Vorlage Ohne den fünf Leitfragen unserer Untersuchung sklavisch zu folgen, beziehen wir sie jetzt auf den englischen Spielfilm JEW SUESS von Lothar Mendes aus dem Jahre 1934. Der Regisseur Mendes, der eine Zeitlang Schüler des berühmten Theaterleiters und Regisseurs Max Reinhardt war (wie übrigens Veit Harlan auch)130, hat das Drehbuch seines Films nicht selbst geschrieben, sondern drei Autoren anvertraut (Dorothy Farnum, A.R. Rawlinson, Heinrich Fraenkel), über die es im Vorspann nur heißt, daß ihr Buch auf den gleichnamigen Roman von Lion Feuchtwanger zurückgehe. Wahrscheinlich kannten sie aber, wie aus der Umwandlung der Figuren, vor allem der Magdalene Sibylle Weißensee, hervorzugehen scheint, eine äußerst erfolgreiche englische Dramatisierung des Feuchtwangerromans und des Feuchtwangerschauspiels von Ashley Dukes, die 1929 Premiere gehabt hatte.131 An ihr lernten sie wohl auch die Vereinfachung und Verdichtung des Riesenstoffes. Die Produktionsbedingungen des englischen Films lassen sich nicht mit denen des Nazifilms vergleichen. Während Harlans Auftragswerk 1,9 Millionen RM kosten durfte (im gleichen Produktionsjahr 1940 lagen nur die Herstellungskosten von Willi Forsts OPERETTE höher)132, war das Budget von JEW SUESS deutlich niedriger.133 Es dürfte das Verdienst des Filmproduzenten Michael Balcon, der fünfzig Jahre lang "zu einer vorwärtstreibenden Kraft im englischen Film" gehörte,134 gewesen sein, den Film durchgestanden zu haben, obwohl er nicht die ursprüngliche Konzeption realisieren konnte, ihn als " kommerzielle^] Historienfilm großen Stils"135 zu produzieren. Opfer hat dem Vernehmen nach auch der Träger der Titelrolle, der berühmte expressionistische Schauspieler Conrad Veidt, gebracht, damals in englischen wie deutschen Ateliers beschäftigt, der - schon aus persönlichen Gründen am Thema interessiert (seine Frau war Jüdin) - bereits 1933 einen Film THE WANDERING JEW in England gedreht hatte und unbedingt die
130 131 132 133
134 135
Zielinski 1985, 147 Ritchie 1985, 122-133 Film im Dritten Reich 1979, 251 Atkinson 1987. Die Angaben bei Atkinson (zwischen 12 000 und 25 000 Pfd.) und Knilli/Zielinski 1983, 119 (125 000 Pfd.) differieren, aber Zielinskis Bearbeitung dieses Aufsatzes ein Jahr später (Zielinski 1985) rückt wieder in die Nähe von Atkinsons Schätzungen. Bucher 62 Zielinski 1985, 136
101 Süß-Rolle spielen wollte. Der Völkische Beobachter, das "Zentralorgan der NSDAP", kritisierte daraufhin Veidt in der Ausgabe vom 23.11.34, er sei "menschlich nicht mehr würdig, daß auch nur ein Finger in Deutschland sich zu seinem Lobe rührt."136 Als "Weg aus dem Ghetto" haben wir den Hauptteil unserer Arbeit apostrophiert. Die Eingangssequenz von JEW SUESS scheint eine solche Möglichkeit auszuschließen. Mendes zeigt ausführlich die bedrückenden, engen Verhältnisse des Frankfurter Ghettos (vgl. Foto Nr.9). Durch Zwischentitel wird zunächst auf die Intoleranz des Jahrhunderts und dann auf den aus dem Ghetto stammenden Joseph Süß Oppenheimer verwiesen als einen, der trotz seiner "human frailty" und seines "unfinished work" durch seine "story" lebendig blieb: Süß wird nicht als Ausbeuter und nicht als Retter in der Not angekündigt, sondern als Schwacher, Gescheiterter, der seine Sache nicht zu Ende bringen konnte, der aber, wie die anschließende Szenenfolge erhellt, in der Tradition seines Volkes und dessen Glauben zu Jahwe steht (Foto Nr. 8). Die Kamera blickt durch das Fenster eines Cheder, der hebräischen (Knaben)-Elementarschule, wo der Melammed, der Schullehrer, einen Schüler Exodus 3,17 aufsagen läßt ("Ich habe gesagt: Ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen ... in ein Land, darin Milch und Honig fließt"), zeigt dann - gewissermaßen die Zusage konterkarierend - Elend, Enge und Mühsal in der Judengasse, verbunden mit der zweifelnden Anfrage des Schülers, ob denn diese Worte auch ihnen gelten und warum sie hier leben müßten: "Why can't we leave the Getto?" Der Lehrer korrigiert: Die Alternative sei nicht innerhalb des Ghettos Armut und außerhalb des Ghettos Reichtum, sondern stets sei ihnen aufgetragen, den Lohn ihres Erbes zu zahlen. "Wer sind wir, daß wir Zweifel haben am Wege des Herrn; vielleicht werden eines Tages die (GhettoBauern zerbröckeln wie die Mauern von Jericho, und alle Welt wird ein Volk sein!" Und wieder blickt die Kamera auf die Menschen des Ghettos. Dieses Leitmotiv "Perhaps some day walls will crumble ... and all the world will be one people" erscheint nicht nur im Prolog, sondern auch im Epilog. In der letzten Einstellung des Films wird es als der die Zuschauer entlassende Schlußtitel mit intendierter Bedeutungserweiterung präsentiert: Die "walls" sind nicht mehr die Mauern des Ghettos, sondern die Mauern zwischen Völkern und Religionen. Zwischen den Botschaften des Filmanfangs und -endes rollte die Story ab: die Geschichte von Jew Suess, dem Finanzberater des Herzogs Karl Alexander, der sich dem gewalttätigen Fürsten anpaßt, um seinen Machtanspruch durchzusetzen, der Kompromisse macht, die von ihm geliebte Frau opfert, seinen Glauben, seine Menschlichkeit und seine Integrität verleugnet und erst ganz am Ende, nach dem Tod der Tochter, nach dem Versuch, seine Rache zu befriedigen, im Angesicht des Todes zum Glauben der Väter zurückfindet. Diese Hofgeschichte blendet aber immer wieder zurück ins Ghetto mit den Händlerrufen, dem Gewimmel der Armen und Gewerbetreibenden als dem Ort, von dem Süß seinen Ausgang
136
Cinegraph Lg.
4, "Conradt Veidt", D 2
102 genommen hat, an den er sich erinnert und der seinen Charakter und seine Handlungen geformt hat. Das Ghetto erscheint als Refugium (Sabbatfeierszene), als Metapher für Armut und Plage, aber auch als Objekt christlichen Judenhasses (Pogromszene: "Down with the Jews!"). Ein im Feuchtwangerroman sehr bedeutsamer, in drei Abschnitten sich steigernder Handlungsstrang, die Ritualmordanschuldigung gegenüber dem ahnungslosen jüdischen Händler Jecheskel Seligmann, eine der anschaulichsten Schilderungen von Judenfeindschaft in Form von Blutbeschuldigungen in der erzählenden Literatur überhaupt, wird im Film ins Ghetto verlegt. In der Perspektive des Joseph Süß ist das Ghetto aber auch die Stätte seines Triumphes: Hier huldigen ihm die Juden wegen der Befreiung des Seligmann, hier trifft der mächtige Finanzienrat in einer rührenden Szene mit seiner im Ghetto lebenden Mutter zusammen. Insgesamt also wird das Ghetto im Film ambivalent gesehen: Schreckensviertel, Fluchtort, Stätte des Leidens, der Armut, der harten Arbeit, der erzwungenen (räumlichen) Beschränkung, Ort der Abschirmung von dem (christlichen) Pöbel und der Gewalt, zugleich aber auch Ziel dieser Angriffe, Platz der Gemeinschaft, des Lernens und Glaubens. Eine Reflexion über die Ghettoexistenz, seines Ursprungs und seiner Zukunft findet allerdings bis auf die Schülerfrage am Anfang des Films ebensowenig statt wie eine differenzierte Darstellung der sozialen Verhältnisse. Zielinski hat in einer kultursoziologischen Analyse, vor allem an Hand der Anfangs- und Schlußsequenzen, die "antisemitische Kulturware" Veit Harlans dem "philosemitischen Kunstwerk" von Lothar Mendes gegenübergestellt. Der Nazifilm rücke "die 'arischen' Protagonisten, die nicht-jüdischen Lebensverhältnisse, die Probleme des Adels und der Bürger" ins Zentrum. Dagegen seien in JEW SUESS "Ausgangs- und Fluchtpunkt der Geschichte die Probleme und Konflikte der jüdischen Identität (Oppenheimers) und der Lebenssituation der Juden im allgemeinen."137 In der Tat stand - ein Jahr nach Hitlers Machtantritt, dem ersten großen Nazijudenboykott vom 1.4.33 und der Bücherverbrennung auch von Feuchtwangers Werken am 10.5.33 - JEW SUESS nicht als bloße Literaturverfilmung zur Debatte, sondern - wie Atkinson in seiner Kritik vom 10.10.34 schrieb: "Höchstwahrscheinlich wird die Welt ganz allgemeinen diesen Film im Lichte der deutschen Ereignisse interpretieren. "138 Während in Nazideutschland die antisemitische Propagandamaschine schon auf Hochtouren lief, Pogromstimmung sich ausbreitete, Juden das Land verließen, drehten Balcon und Mendes einen Oppenheimer-Film, der bewußt einen Beitrag zur Abwehr des Antisemitismus leisten wollte, was beispielsweise durch die Einblendung von interpretierenden Schrifttafeln unterstrichen wurde. Diese Intention erforderte aber deutliche Korrekturen sowohl am Bild des historischen Oppenheimer als auch an Feuchtwangers Jud-Süß-Interpretation. Die verschiedenen geschäftlichen Praktiken des Hoffaktors, seine Tätigkeiten als Resident, Merkantilist, Münzpolitiker, Kaufmann und Politiker, interessierten
157 138
Zielinski 1985, 137; vgl. auch Knilli/Zielinski 1983 Atkinson 1987
103 die Drehbuchautoren nicht. Nur Oppenheimers Wirken als Ratgeber und Finanzienrat wird unbeschönigt dargestellt. Ökonomische und soziale Bezüge des Themas werden radikal gekappt. Die Aufstiegsproblematik als Angleichung an die nichtjüdische höfische Kultur interessiert nicht. Alltagsschilderungen finden sich nur in den Ghettoszenen. Auch die Figur des Mannes Süß wird eindimensional gefaßt, sein Privatleben "gereinigt": Die vielen Amouren werden ersatzlos gestrichen, Süß wird zum fast treuen Liebhaber seiner Mätresse. Feuchtwangers geschichtsphilosophische Konzeption vom Weg des westöstlichen Menschen, seine Drei-Wellen-Theorie, ist einer gegenteiligen Sicht gewichen; es geht jetzt nur noch darum, was der Romanautor als Intention in Abrede gestellt hatte: die antisemitische Legende zu zerstören. Feuchtwangers Vielseitigkeit, sein Facettenreichtum werden durch eine konventionelle Dramaturgie mit eindeutigem Rollenschema vereinfacht: Sympathie und Antipathie, fast gänzlich ohne Zwischentöne, werden in didaktischer Absicht zugeteilt. Offenheit, kontroverse Diskussionsmöglichkeit, wie sie Feuchtwanger in seinem Artikel "Über 'Jud Süß'" als legitimes Leseverhalten empfohlen hatte,139 sind nicht gefragt. Der im Film dargestellte Weg des Süß ist deshalb von fast schon wieder beeindruckender Schlichtheit: Ein rücksichtslos um des eigenen Gewinns und Ansehens willen ausbeuterischer, seinem Fürsten höriger Hofmann entdeckt Schritt für Schritt seine jüdische Identität (Befreiung des Seligmann, Tod der Tochter) und bekennt sich als Sohn eines christlichen Vaters und einer jüdischen Mutter (Übernahme der Heydersdorffthese) zum Judentum, worin ihn weder der Prozeß noch das Todesurteil wankend machen. Durch die Darstellungskunst Conrad Veidts gewinnt diese geradlinige Entwicklung vom egoistischen Agnostiker zum überzeugten Juden, die in der Betonung jüdischen Stolzes nicht frei von (positiver) Stereotypisierung ist, Überzeugungskraft. Ebenso verkürzt werden die übrigen jüdischen Figuren Feuchtwangers. Ihre dramaturgische Funktion besteht nun einzig und allein darin, die Identitätsfindung der Titelfigur zu erleichtern. Rabbi Gabriel ist nur noch hoheitsvoller, strenger, ins Parabelhafte erhöhter Rabbi, Landauer ein frommer jüdischer Kaufmann, Naemi (im Film: Naomi) liebreizendes Opfer. Die Charakterisierung droht in Typisierung umzuschlagen. Dennoch ist der Film beeindruckend. Er zeichnet sich durch große inszenatorische Geschlossenheit von der Grundidee über die Dramaturgie, die Schauspielerführung, die Darstellerleistungen bis hin zur Kamerakomposition aus. Es ist unbestritten, daß es ihm überzeugend gelang, jüdisches Lebensgefühl, jüdische Thoratreue und jüdische Lebenssituationen vor der Emanzipation zu demonstrieren.
139
Feuchtwanger 1984, 382
104 5.2.3. JOSEPH SÜSS OPPENHEIMER Nach 1945 hat es verschiedene Versuche gegeben, das Jud-Süß-Thema erneut, nun als Fernsehfilm zu produzieren.140 Nur ein Projekt wurde fertiggestellt: das ursprünglich als Feuchtwangeradaption vorgesehene, aber wegen nicht zu erlangender Verfilmungsrechte14' dann als "nach Originalprozeßakten" gedrehte ZDF-Dokumentarspiel JOSEPH SÜSS OPPENHEIMER aus dem Jahre 1984 von Gerd Angermann und Rainer Wolffhardt, zwei in diesem Genre erfahrenen Fernsehleuten.142 5.2.3.1.Das Genre des (Fernseh-)Dokumentarspiels Mit dieser zunächst zweiteilig vorgesehenen, aus Kostengründen dann auf Normallänge (90') reduzierten Fernsehproduktion stoßen wir in unserer Chronologie der Judendarstellungen in Film und Fernsehen wie auch bei unserem Vergleich der Jud-Süß-Filme erstmalig auf eine Gattung, die nebem dem (Original)-Fernsehspiel seit Jahrzehnten den Sendern hilft, ihren Stoffhunger zu stillen. Das (Fernseh-)Dokumentarspiel, das auch unter den Bezeichnungen "Szenische Dokumentation", "Semidokumentation" oder "faction" rangiert(e),143 wird nicht nur in diesem Kapitel eine Rolle spielen, so daß zunächst seine Theorie, Struktur und Geschichte im Anschluß an die relevante Literatur knapp rekapituliert werden müssen.144 Die Präsentation von Realität in einer eher berichtenden als dramatisch inszenierenden Weise, die Verwendung von Kamera und Schnitt für die Wiedergabe der Wirklichkeit in dokumentarischen Stilformen zieht sich durch die Geschichte des Kinofilms, z.B. als die Brüder Lumière vor bald einem Jahrhundert ihre Umwelt zu filmen begannen, als Walter Ruttmann 1927 mit BERLIN, SYMPHONIE EINER WELTSTADT den Alltag Berlins in einer rhythmischen Montage wiedergab, als etwa zur gleichen Zeit Robert Flaherty in NANOOK OF 140
Knilli/Zielinski (1983, 107) nennen Projekte von Peter Lilienthal, Friedhelm Ebel, Artur Brauner, Egon Eis und 1982 den Plan des Südwestfunks, 1984 eine deutsch-englischfranzösische Coproduktion zu starten. "" Auskunft des Produzenten Dr. Schaumann von der Dtsch. Buch-Gemeinschaft, Berlin an den Verfasser im Gespräch vom 16.12.87 142 Angermann hat nach Berichten über die Berliner Pressekonferenz des ZDF am 24.1.84 über 30, vornehmlich auf historischen Berichten fußende Drehbücher geschrieben, darunter das unsere Thematik behandelnde DAS HAUS IN DER KARPFENGASSE. Rainer Wolffhardt inszenierte lt. Angaben der Register Nr. 11 und IS des Deutschen Rundfunkarchivs 66 Fernsehspiele, häufig nach literarischen Vorlagen, darunter die für unsere Thematik relevanten DER HAUPTMANN VON KÖPENICK, SANSIBAR, JACOBOWSKY UND DER OBERST, KAISERHOFSTR. 12, DER FRIEDEN IN UNSERER STADT, EINE JUGENDLIEBE, DER MITBÜRGER, SABINA ENGLENDER. 143 Delling 1975, 117 u. 1976, 78-103 144 Hickethier 1979, 53-71; ders. 1980, 281-289; Waldmann 1977, 62-82; Waldmann/Waldmann 1980, 89-98; Koebner 1973, 79-95; Delling 1982, 44-48
105 THE NORTH und MAN OF ARAN den Kampf des Menschen mit der Natur in eben dieser Natur gestaltete oder im sowjetischen Revolutionsfilm Dsiga Wertow in seiner Wochenschau KINO-PRAWDA das (gestaltete) Dokument an die Stelle der Inszenierung setzte, als der italienische Neorealismus in den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges den einfachen Menschen in seiner tristen Umgebung statt den Star zum Helden machte, als sich - ebenfalls seit dem Kriege - der "britische Dokumentarismus"145 durchsetzte. Einflüsse des dokumentarischen Theaters (Kipphardt, Hochhuth, Weiss)144, vielleicht sogar der Versuch, den Herausforderungen der NS-Prozesse (Eichmann in Jerusalem, Auschwitz in Frankfurt) zu begegnen und sich wenigstens ansatzweise mit der jüngsten deutschen Geschichte auseinanderzusetzen, ganz sicher aber der Stoffbedarf führten das Fernsehen Anfang der sechziger Jahre dazu, eine sich vom Fernsehspiel unterscheidende Programmform zu kreieren, eben das vom Publikum mit hohen Einschaltquoten belohnte Dokumentarspiel. Obwohl auch Sendeanstalten der ARD, z.B. der Süddeutsche Rundfunk, sich diesem Typus eines die Realität dokumentierenden Spiels öffneten und damit renommierte Regisseure reüssierten (vgl. die Arbeiten von Egon Monk für das Femsehen), propagierte, erprobte und strapazierte vor allem das ZFD die neue Programmform, bis nach einer fast zwei Jahrzehnte langen Konjunkturphase in Mainz die Sparte Dokumentarspiel als selbständige Hauptabteilung aufgelöst wurde und die Kritik schon 1980 das Dokumentarspiel nur noch als eine "geschichtliche Episode"147 betrachtete und damit Wolfgang Bruhns euphorische, überall in der Literatur zitierte Position relativierte.148 Entgegen seiner Bezeichnung verwendet das Femsehdokumentarspiel seit längerem kaum noch eingeblendete Dokumentaraufnahmen oder gar ganze Dokumentarsequenzen, sondern benutzt das Original (Bild, Film, Text) nur als Zitat bzw. als nachgebildetes, neuinszeniertes Zitat, als Ausgangsmaterial, das nach den Gesetzen der Dramaturgie szenisch aufbereitet, also zum Fernsehspiel wird, weswegen W. Hammerschmidt mit einigem Recht behaupten konnte, daß der ZDF-Hauptredaktion Dokumentarspiel "die Funktion einer zweiten Fernsehabteilung zugefallen" sei.149 Somit unterscheidet sich das Dokumentarspiel von den üblichen Fernsehspielen nur dadurch, daß die Fabel auf einem historisch belegten Geschehen basiert, wobei man gerne auf "Sensationsprozesse, politische Affaren, Spionagefalle, auf die Biographien politischer oder militärischer Berühmt-heiten, von Anarchisten, Attentätern etc." zurückgriff.150 Ob - wie vornehmlich in den sechziger Jahren - die Spielhandlung durch Kommentare unterbrochen wurde oder man eine die kritische Distanz des Zuschauers stärker ausschaltende durchgehende Spielhandlung benutzte, stets versuchte man durch Wahl der Schauspieler nach
145 M 147 148 149 150
Gregor/Patalas 269-278 DokumentarliteratUT 1973, vor allem die Aufsatze von G. Dahlmüller u. K. Buselmeier Waldmann/Waldmann 1980, 91 Bruhn 1967, 157-163 Hammerschmidt 1981, 3f. Hickethier 1980, 283
106 äußerlicher Ähnlichkeit, durch Akribie in Kostüm und szenischem Arrangement und durch eine Reader1 s-Digest-Fassung der Historie in Spionagefälldramaturgie den Zuschauern die Authentizität der so präparierten Geschichte vorzugaukeln. Dies Verfahren hat mehr Kritiker als Anhänger gefunden: Delling spricht vom "Authentizitätsschwindel der Dokumentarspiele" und der "Identitätslüge", Knilli von der "Augenzeugenideologie", Koebner vom "Schein der Authentizität" und Hickethier von "Täuschung", die man auch noch als staatsbürgerliche Bildung feierte.151 Nur selten gelang es, die Distanz an die Stelle der Suggestion zu setzen, die Illusion aufzubrechen, einen kritischen Gegenwartsbezug herzustellen. Nach der Phase einer stark polemisch geführten Abwertung des scheinbar überproportional gepflegten Genres hat F. Neubauer in seiner erkenntnistheoretisch gestützten Monographie sich nicht nur seinerseits mit den Hauptkritikern des Dokumentarspiels intensiv auseinandergesetzt, sondern zu Recht auf einige gültige Aspekte hingewiesen. Seine Definition des Dokumentarspiels als eines im Hinblick auf den Inhalt nicht-fiktionales, also "ein mit Authentizität ausgestattetes Spiel"152 erweist sich als ebenso verwertbar wie die Abgrenzung zum Dokument (größere Affinität zum Emotionalen durch "gefühlvolles Miterleben", leichtere Identifikation des Zuschauers durch erlebbares Handeln, leichtere Rekonstruktion von Sachverhalten durch Konkretisierung infolge der Dramatisierung von Geschichte)153 und zum nicht-dokumentarischen Spiel, d.h. zur Dichtung (wo die Fakten zwar nur dienende Funktion gegenüber der Story haben, gleichwohl Dichtung und Wahrheit nicht Gegensätze, sondern einander ergänzende Ebenen sind)154. Das Insistieren auf der Legitimität reiner Fakten vermittlung - selbst von Detailinformationen - als Voraussetzung für die Erzielung von Sinnverständnis begründet seine positive Einschätzung des Dokumentarspiels in seiner bildenden Wirkung für die Gewinnung von Erkenntnisfortschritt. Er bezweifelt die Berechtigung des Vorwurfs, das Dokumentarspiel verzichte auf "emanzipatorische Aufklärung des Bürgers" (so Delling) und seine Fakteninformation könne "zur ideologischen Indoktrination mißraten".155 Vielmehr setzt er auf "ein Mindestmaß an Vertrauen in den Kommunikationspartner"156, letztlich damit auf Mündigkeit des Zuschauers. Damit sie zum Zuge kommen kann, muß der Rezipient auf die Faktizität des Dargestellten bauen können. Für Aufbr und Regisseur käme es deshalb darauf an, daß auch die nachkonstruierten Szenen nicht die historische Wahrheit denunzieren. Dieses Postulat scheint umso wichtiger, als so manche Dokumentarspielverfasser
151 152 153 154
155 156
Delling 1975, 120f.; Knilli 1971, 13f.; Koebner 1973, 81; Hickethier 1980, 285 Neubauer 1984, 2 Neubauer 1984, 63 An anderer Stelle (75f.) - bei der Unterscheidung von realistischem, historischem und dokumentarischem Spiel - bietet Neubauer als Grundmarkierung an, daß "realistische Spiele glaubhafte, historische Spiele zum Teil belegbare, dokumentarische Spiele belegte Geschichte erzählen" (Hervorhebung durch D.P.)."Hier wird nicht erfunden, sondern nachempfunden'' (86). Vgl. auch Neubauer, S. 68 Neubauer 1984, 56f. Neubauer 1984, 58
107 gerade dagegen verstoßen, die Grenzen zwischen Fernsehspiel und Dokumentarspiel also fließend erscheinen. 5.2.3.2. JOSEPH SÜSS OPPENHEIMER als auf Vergangenheitsaufarbeitung ausgerichtetes Dokumentarspiel über württembergische Hofjuden Der Fernsehfilm JOSEPH SÜSS OPPENHEIMER ist sowohl nach sendeeigenen Aufassungen157 als auch nach den eben genannten Kriterien ein Dokumentarspiel. Er unterscheidet sich allerdings in einer Hinsicht auffallig von den meisten Produkten des Genres. Sein Autor Gerd Angermann hat sorgfältig recherchiert und offensichtlich nicht nur behauptet, die zeitgenössischen Prozeßakten gelesen zu haben. Außerdem kann man aus der Analyse und dem dabei von uns erstellten Protokoll des Films schließen, daß der Autor bis auf die Arbeiten von Schnee die relevante Sekundärliteratur von Zimmermann über Elwenspoek bis Stern durchgearbeitet hat. Eine Fülle von sachrichtigen Informationen ist in den Film eingebracht worden: Angermann hat sich über die Biographie der Titelfigur, die Konflikte des katholischen Herzogs mit der evangelischen Landschaft sowie über die Behinderungen und Anfeindungen von Juden im absolutistischen Württemberg sachkundig gemacht. Von allen drei Jud-Süß-Filmen bemüht sich das Dokumentarspiel am eindringlichsten, nahezu enzyklopädisch, alle Ämter und Titel Oppenheimers anzuführen: den Schatullenverwalter und Kabinettsfiskal, den Oberhof- und Kriegsfaktor, den Geheimen Finanzienrat, den Agenten der Herzogin; er zeigt die Geld- und Warenbeschaffungsaktivitäten vom Einführen frischer Austern für den Hof über die Geldleihe Zehntausender von Gulden, das Versorgen des Heeres mit Infanterie- und Dragonerzelten bis zur Einführung von Monopolen (Gold- und Silberlieferung, Münz- und Lederpacht, Stempelpapier-, Spielkarten- und Eisenhandel, Tabakmanufaktur); er führt den Reichtum des Süß vor: seine zwei Häuser in Ludwigsburg und Stuttgart, die Gründung eines Handelshauses, seine Juwelengeschäfte. Er demonstriert den Aufstieg von Wildbad an über die Beherrschung der Stuttgarter Gesellschaft, seine Erfolge bei Frauen, seine Heiratsund Nobilitierungspläne bis zum Konflikt mit dem Herzog und dessen Tod, seinen Niedergang mit Verhaftung, Zuchthausleiden bis zur Verkündung des Todesurteils am Schluß des Films (die Hinrichtung wird ausgespart). Was die Verantwortung Oppenheimers für seine Taten angeht, so macht sich der Drehbuchautor Angermann ganz die in den Gerichtsakten belegten Aussagen des Angeklagten und deren Interpretation durch Elwenspoek und Stern zu eigen: Süß wäre nie Beamter gewesen, habe auch als Resident nur den gewöhnlichen Eid geleistet und alle seine Projekte zur Prüfung durch die Organe der Regierung empfohlen, alle Erlasse seien ordnungsgemäß von den württembergischen Beamten bearbeitet, vom Kanzler gegengezeichnet und vom Herzog unterschrieben worden.
157
Presseheft des ZDF zur Erstsendung am 14.2.1984
108 Einen nicht geringen Stellenwert hat im Film die Einstellung des Joseph Süß Oppenheimer zu seiner Religion und seinem Volk, Widerspiegelung der historischen Situation der jüdischen Traditionsgemeinschaft, die sich allmählich auf die große Wende der Emanzipation vorbereitet. Angermann und Wolffhardt zeichnen Oppenheimer als den im Schutz der politisch Mächtigen (weitestgehend) erfolgreich nach Macht und Ansehen Strebenden, der vom "Vorzeichen des Wandels" profitiert und in vielen Verhaltensweisen die politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und religiöse Umgestaltung der jüdischen Traditionsgemeinschaft vorwegnimmt.158 So wird Süß in der 7. Sequenz als der mit großer Selbstverständlichkeit Austern schlürfende Weltmann vorgeführt, der auf die verwunderte Frage des kaiserlichen Feldmarschalls, ob "ihm das nicht von seiner Religion verboten" sei, einen aufgeklärten Standpunkt einnimmt: Ich bin Jude, das ist richtig, Hoheit. Aber ich selber möchte mich lieber als Volontär aller Religionen bezeichnen. Wer war schon im Himmel und hat den lieben Gott gesehen?
Bei Geschäften und Gesprächen mit jüdischen Partnern gibt er sich als Jude zu erkennen, setzt aber alles daran, die Judenstättigkeit auf ein Wohnrecht auch außerhalb des Ghettos auszudehnen. Auftreten, Redeweise und Aussehen sind Ausdruck einer äußerlich vollkommenen Assimilation, die er auch auf seinen Mitarbeiter Levi ausdehnt, der - ebenso wie der württembergische Hojude Landauer - sich europäisch kleidet bzw. kleiden muß, dem aber dieser Anpassungsprozeß nicht in seiner Sprache gelingt. Landauer (von dem jüdischen Schauspieler Buddy Elias gespielt), ist der jüdische Gegenpol zu Süß, das konservative Korrektiv, das weder die finanzpolitischen Praktiken seines Geschäftsfreundes billigt ("Der Jud soll treiben Handel, aber soll die Finger lassen von der Politik", 28. Sequenz) noch den gesellschaftlichen Aufstieg ("Seid Ihr meschugge, Süß!? Noch nie is e Jud geadelt worden!", 35. Sequenz). Gewonnener Einfluß und Stolz lassen Süß zwar gegen den herzoglichen Rat die Taufe ablehnen (37. Sequenz), auch einer wohlmeinenden älteren Freundin gegenüber bekräftigt er diese Auffassung (42. Seqenz), aber gegenüber der Geliebten, wankend geworden, mißt er der Taufe nur noch einen formalen Wert zu ("Was ist dabei? Man bekreuzigt sich, und sie besprengen einen ein bißchen mit Wasser, das ist alles", 44. Sequenz). Erst in der Verfolgung, am Ende seines Wirkens und Lebens vollzieht sich der Lemprozeß einer entschiedenen Rückkehr ins Judentum: Bei seinem ersten Verhör nennt er seine Religion ("Ich bin Jude, geborener Jude", 46. Sequenz), beim Bekehrungsversuch im Kerker durch einen evangelischen Pfarrer spricht er die - im ersten Satz auch archivalisch belegten Worte: "Seine Religion zu ändern, ist Sache eines freien Menschen, einem Gefangenen steht das schlecht an. Ich bin ein Jud und bleib ein Jud. Ich würde kein Christ werden, selbst wenn ich römischer Kaiser werden könnte" (62. Sequenz), und in der Schlußeinstellung, als er von den Henkersknechten weggeschleift wird, schreit er das "Schma 'Jisrael"-Gebet.
158
Katz 1986, 39-42
109 An vielen Stellen des Films wird versucht, die bedrängte Situation von Juden in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts darzustellen. So ist wiederholt davon die Rede, daß es Juden nicht gestattet ist, außerhalb des Ghettos zu wohnen. Schon in der 3. Sequenz zahlt Süß Douceurs, wie man euphemistisch die Schmiergelder nannte, um dies Verbot zu umgehen, und in der 26. Sequenz ergeht an ihn durch den Magistrat der Stadt Frankfurt die dringende Aufforderung, seinen Wohnsitz wieder in der Judengasse zu nehmen. Eine andere Szene (22. Sequenz) belegt das Verbot für Juden, ein Haus zu kaufen, und die Praktiken ihrer Umgehung durch Strohmänner. Als besonders krasses Beispiel wird in der 29. Sequenz gezeigt, wie Juden, die im Ausland Angehörige auf einem jüdischen Friedhof bestatten wollen, den Leichnam verzollen müssen. Vorgeführt wird auch, daß einem Juden die Eheschließung mit einer Christin nur bei seiner vorangegangenen Taufe gestattet ist, daß Juden keine Räte werden dürfen, eine strikte Beschränkung der Judeneinwanderung bestand und auf die "leibliche Vermischung" von Juden und Christen die Todesstrafe stand. Ebenso bemüht sich Angermann, Judenfeindschaft von Christen zu verdeutlichen. Dies kommt in der pejorativen Verwendung des Worte "Jude" zum Ausdruck. Unser Protokoll des Films läßt eine Eskalation judenfeindlicher Äußerungen erkennen. Die Formierung von Judendiskriminierung ist an der Zunahme abwertender Formulierungen erkennbar. Kritisiert die Landschaft Anfang der 21. Sequenz noch die Ernennung "des Herrn Süß", so verschärft sich der Ton der gleichen Szene: Erst wird die "Ernennung des Juden" abgelehnt, dann Süß als "der Jud'" pauschaliert. In der 21. Sequenz wird ein Jude als "Itzig" bezeichnet, dann als "gerissener, skrupelloser Jud" (31. Sequenz). Später (53. Sequenz) ist vom "geilen Jud", von "jüdischer Frechheit" (54. Sequenz), schließlich von "Bestie", "Kanaille" und "Mauschel" (58. Sequenz) die Rede. Judenfeindschaft tritt schließlich in der Prozeßführung zutage: in der Formulierung der Anklage, den unmenschlichen Haftbedingungen und in den Behinderungen des Verteidigers in seiner Berufsausübung. So scheint es, als sei Angermanns und Wolffhardts JOSEPH SÜSS OPPENHEIMER die im Presseheft des ZDF angekündigte wirkungsvolle "Korrektur einer Fälschung", der gelungene Versuch, das Dilemma eines Hoffaktors und die Leiden des Inhaftierten zu verdeutlichen (vgl. Fotos Nr. 10 und 11 der Bilddokumentation). Die gegenüber dpa geäußerten Befürchtungen des Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Heinz Galinski, der einen für die Produktionsbegleitung vorgesehenen Fachberater der Jüdischen Gemeinde wieder zurückgerufen hatte, weil ihm die Tendenz des ZDF-Films nicht bekannt sei und es "viel zu früh ist, einen solchen Film zu zeigen"159, schienen sich also nicht zu bewahrheiten. Das zugegebenermaßen etwas dünne Presseecho war freundlich, die Blätter verwendeten dabei ausführlich die Materialien des 24 Seiten starken Presseheftes. Dennoch kann nicht übersehen werden, daß die Schwächen des
159
z.B. am 16.12.83 in der Frankenpost, Hof, ebenso in der Frankfurter Rundschau
110 Genres Dokumentarspiel mit seiner Abhakmentalität eben auch auf JOSEPH SÜSS OPPENHEIMER zutreffen. (Man "ruft die Vergangenheit ins Gedächtnis, um Geschichte durch die Nacherzählung wie jeden anderen Stoff zu verbrauchen, zu erschöpfen und die Vergangenheit damit zu den Akten zu legen."160) Der Sensationsprozeß um die historische Berühmtheit vermittelt nicht Betroffenheit, gibt keinen Impuls zur Mea-res-agitur-Erkenntnis im Hinblick auf gegenwärtigen Antisemitismus in der Bundesrepublik. Bezüge zum Naziregime und zur aktuellen politischen Situation werden nur in zwei Szenen offensichtlich: bei der Zurschaustellung von Oppenheimers auf dem Marktplatz angeketteten Geliebten mit dem umgehängten Schild "Hofjudenhure Luciane Fischerin" (56. Sequenz) und bei der Zwangsernährung des in den Hungerstreik getretenen Süß (58. Sequenz). Penibel auf Sachrichtigkeit getrimmte Kostüme, Bauten und Masken stellen die Illusion einer Authentizität her, die weitestgehend unberührt läßt. Die Fülle der zu vermittelnden historischen Kenntnisse von ermüdender Gleichförmigkeit, so daß die eine - oft nur verbal vermittelte - Information die andere erschlägt, verstellt die Vorstellungskraft des Zuschauers. Offenbar wollten der Autor und sein Regisseur alles vermeiden, was eine lediglich umgepolte Harlansche Melodramatik ergeben hätte, aber sich ebenso wohl auch von der Dramaturgie des "philosemitischen Kunstwerks" JEW SUESS absetzen, wie aus dem Bericht der Stuttgarter Zeitung über die Berliner ZDF-Pressekonferenz hervorgeht.161 Ihre Alternative war eine fast ganz auf lehrhaftes Wort ausgerichtete Folge von 64 unterkühlten kurzen Sequenzen in überdeutlicher Schulfunkmanier, deren redliche didaktische Intention darin bestand, alles zu vermeiden, was antsemitische Vorurteile hätte reaktivieren können. Dabei gerieten aber viele Figuren, ob Süß (dargestellt von Jörg Pleva) oder Landauer, der Herzog (Manfred Krug), die Herzogin oder die Geliebte Luciane Fischer, nicht zu Menschen in ihrem Widerspruch, zu gebrochenen Charakteren, mit denen man sich hätte identifizieren können, sondern zu Thesenträgern. So wurde Süß Oppenheimer fast zu einer nur noch lauteren Persönlichkeit von großen Pflichteifer, die auf dem einzigen ihr möglichen Weg aus dem Ghetto, nämlich der Hoffaktorenexistenz, scheitert. So sachrichtig auch die historischen Fakten der einzelnen Sequenzen sind, die Einebnung der Figuren, die simple Anknüpfungsdramaturgie (wovon am Schluß der einen Szene die Rede ist, wird zu Beginn der nächsten Szene gezeigt), die gedrechselte Sprache mit ihrem bemühten Zeitkolorit und die Unfähigkeit, das Jiddische auch nur annähernd wiederzugeben, nehmen dem Fernsehspiel viel von der beabsichtigten Wirkung. Und der einzige über das Dokumentarspiel hinausreichende Einfall, dem Fernsehspiel eine Art Einleitung und (wiederholt optisch und akkustisch eingeblendetes) Leitmotiv zu geben (ein jüdischer Trödler Sigfrit Steiner - fahrt mit dem elfjährigen Jossele Süß Oppenheimer an einem Weinberg vorbei und gibt ihm den talmudischen Rat: "Umkreise, umkreise den
161
Koebner 1975, 46 "Wie der Teufel vor dem Weihwasser hütete er [Angermann, D.P.] sich dabei nach eigener Aussage vor philosemitischer Schönfärberei."
Ill Weinberg, aber komm ihm nicht zu nah"), gerinnt im nachhinein zur unbeabsichtigten fatalen Moral der Selbstbescheidung, der Abkehr von "jüdi-schem" Hochmut und Emanzipationsanspruch. Wir beschließen das Oppenheimerkapitel mit der Auflistung aller bis 1990 in der Bundesrepublik präsentierten Filme und Fernsehspiele mit jüdischen Finanziers, Bankiers und Unternehmern, die die Linie jüdischer Hoffaktoren bis zur Gegenwart ausziehen. Da die Entwicklung des jüdischen Geldhandels eine wichtige Rolle in der christlich-jüdischen/deutsch-jüdischen Beziehungsgeschichte spielt, da auch in der antisemitischen Filmpropaganda der Nazis diese Problematik von entscheidender Bedeutung ist, wäre es denkbar gewesen, alle eine solche Thematik behandelnden Kino- und Fernsehfilme zusammenzufassen und das Stereotyp des jüdischen Finanziers in seinen verschiedenen Ausprägungen zu analysieren. Wegen unserer Entscheidung, jüdische Filmfiguren nach der Chronologie der christlich-jüdischen " Vergegnung1,162 bis zum Abschluß der Emanzipationsgesetzgebung zu untersuchen, haben wir davon an dieser Stelle Abstand genommen. Wir können hier nur den Niederschlag des Stereotyps in den Kurzcharakterisierungen der in der Bundesrepublik produzierten oder distribuierten fiktionalen Produktionen andeuten. Mit dem Fernsehspiel JOSEPH SÜSS OPPENHEIMER endet auch der Bericht über die Darstellung von Ghetti in den vor 1871 spielenden Filmen. In Angermanns und Wolffhardts Fernsehfilm ist das Frankfurter Ghetto praktisch nicht mehr präsent. Die Variation der Ghettoisierungspolitik seit dem Ende des 8. Jahrhunderts in der Form von Plänen für die Errichtung von Judenkolonien, die vornehmlich als Segregationsforderung von Gegnern der Judenemanzipation erhoben wurde,163 findet keinen Eingang in die Filme über die jüdische Emanzipation. Erst die Spielfilme und Fernsehspiele über den Überfall der Nazis auf Polen nehmen das Ghettothema wieder auf: als Gestaltung von jüdischem Widerstand und jüdischem Sterben im Warschauer Ghetto.
162
163
Buber 1986,10: "Später habe ich mir das Wort 'Vergegnung' zurechtgemacht, womit etwa das Verfehlen einer wirklichen Begegnung zwischen Menschen bezeichnet war." Erb/Bergmann 1989, 136-173
112 Tabelle 3
Jüdische Hoffaktoren, Bankiers und Spielfilmen und Fernsehspielen
Unternehmer
als
Figuren
in
TITEL Regisseur; Produktionsland , Produktionsgesellschaft, Produktionsjahr Kurzcharakterisierung
1. Nationalsozialistische Propagandafilme ROBERT UND BERTRAM Hans H. Zerlett; Deutschland, Tobis, 1939 In der Verfilmung der Posse von Gustav Raeder aus dem Jahre 1865 verschärft der Regisseur und Autor Zerlett die Szenen mit der komischen Figur eines neureichen jüdischen Bankiers des 19. Jahrhunderts zur antisemitischen Abrechnung mit "den" Juden. JUD SUESS Veit Harlan; Deutschland, Terra, 1940 Der Hoffaktor Joseph Süß Oppenheimer als perfide gezeichnete Titelfigur eines antisemitischen Melodrams, das die historischen Vorgänge zwischen 1733 und 1738 in Württemberg dazu benutzt, im Rahmen eines Unterhaltungsfilms die nationalsozialistischen "Nürnberger Gesetze" und die Pogrome der "Endlösung" zu rechtfertigen. DIE ROTHSCHILDS Erich Waschneck; Deutschland, Ufa, 1940 Antisemitische Spielfilmchronik der jüdischen Bankiersfamilie Rothschild zwischen 1806 und 1815, die das Zusammenwirken des Seniorchefs Mayer Amschel Rothschild in Frankfurt mit seinen Söhnen Nathan in London und James in Paris zur Denunziation ihrer Geschäftspraktken benutzt und als Verschwörung des "Weltjudentums" hinstellt.
2. Nach 1945 vorgeführte oder produzierte Kino- oder TV-Spielfilme JEW SUESS Lothar Mendes England, Gaumont British, 1934 Engagierte, gegen den Antisemitismus gerichtete Verfilmung des Romans von Lion Feuchtwanger über den Hoffaktor Joseph Oppenheimer, seinen Aufstieg, seine Verstrickungen und sein Bekenntnis zum Judentum angesichts seines gewaltsamen Todes. AFFÄRE BLUM Erich Engel; Deutschland (Sowj. Zone), DEFA, 1948 Die freie Nachgestaltung des authentischen Magdeburger Kriminalprozesses von 1926 gegen einen jüdischen Fabrikanten, der verdächtigt wurde, seinen Buchhalter ermordet zu haben, gehört zu den herausragenden deutschen Nachkriegsfilmen über die Wurzeln des Antisemitismus.
113 AFFÄRE BLUM Robert A. Stemmle; BRD, SWF, 1962, Dokumentarspiel von Robert A. Stemmle (nach seinem Roman, Schauspiel, Filmmanuskript und Hörspiel). Remake des berühmten DEFA-Films in einem westdeutschen Fernsehstudio. GELD - GELD - GELD Eugen York; BRD, ZDF, 1965 Dokumentarspiel von Fred Denger über eine gegen die britische Währungsstabilität gerichtete Geldfalschungskation der Nazis. Nebenrolle: jüdischer Bankier als Opfer. WALTHER RATHENAU Franz Peter Wirth; BRD, SDR/Bavaria, 1967 Das Dokumentarspiel über den jüdischen Industriellen und Politiker versucht im Rahmen der Sendereihe "Das Attentat" unter Aussparung der Titelfigur die Hintergründe seiner Ermordung am 24.S.1922 durch antisemitische Gruppen darzustellen. SCHATTEN DER ENGEL Daniel Schmid; BRD, Albatros, 1976 Textkonforme Verfilmung des Theaterstücks Der Müll, die Stadt und der Tod von R.W. Fassbinder mit der ambivalent gezeichneten Figur eines durch Grundstücksspekulationen reich gewordenen Frankfurter Juden. Die antisemitischen Textpassagen der Gegenfigur und der Prostituiertenmord durch den leidenden Juden disqualifizierten das Theaterstück zum wohl beriichtigsten Antisemitismusskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte. Der Film geriet trotz der Gefahr einer Verstärkung bestehender antisemitischer Vorurteile und der in ihm zutagegetretenen antijüdischen Stereotype nicht in gleicher Starke in die Auseinandersetzung über Bühnentext und Aufführungsboykott. HEINRICH HEINE Klaus Emmerich; BRD, ZDF, 1978 In dem biographischen Dokumentarspiel von Herbert Knopp werden als Nebenfiguren authentisch gestaltete Porträts zweier zeitgenössischer Bankiers vorgeführt: Heines Onkel Salomo und der Baron James Rothschild IN EINEM JAHR ΜΓΓ 13 MONDEN R.W. Fassbinder; BRD, Tango/Pro-ject, 1978 In einer Nebenrolle dieser Transsexuellentragödie tritt ein zwielichtiger jüdischer hetereosexueller Bordellbesitzer und Immobilienspekulant auf; eine jener Unternehmerfiguren Fassbinders, die die durch KZ-Erfahrungen erlittenen Brüche ihrer Existenz in irritierender Weise präsentieren. REVOLUTION IN FRANKFURT Fritz Umgelter; BRD, ZDF, 1979 Dokumentarspiel über Konflikte zwischen Zünften und Patrizieren im Frankfurt des Jahres 1614, bei denen die Juden des Ghettos zum Sündenbock gestempelt wurden (sog. "Fettmilchaufstand"). In einer Nebenrolle wird das Positivstereotyp eines jüdischen Geldverleihers vorgeführt. FREUNDE IN PREUSSEN Rolf Busch; BRD, ZDF, 1980 Das Femsehspiel von Heiner Michel über die Freundschaft zwischen Mendelssohn und Lessing zeigt in einer Nebenrolle Mendelssohns Arbeitgeber, den Fabrikanten Bernhard, in einer weitgehend authentischen, wenn auch aus didaktischen Gründen leicht idealisierten Weise.
114 EXIL Egon Günther; BRD, WDR, 1981 Die 5. Folge ("Gingold") der siebenteiligen Adaption des Feuchtwanger-Romans über die Position der Intellektuellen, die als Nazigegner in Paris an einer Emigrantenzeitung arbeiten, präsentiert die eindrucksvolle Figur eines Verlegers in einer Mischung jüdischer Stereotype und differenzierter Charakterzeichnung. DIE GESCHWISTER OPPERMANN Egon Monk; BRD, ZDF, 1982 Feuchtwangers Porträt einer großbürgerlichen jüdischen Familie in Deutschland zwischen Ende 1932 und Mitte 1933 zeigt Egon Monk in seiner Adaption des gleichnamigen Romans als "Mechanik der Machtergreifung Hitlers am Beispiel der Abwicklung eines Geschäfts". Den dritten der Oppermannbrüder, den Möbelfabrikanten Martin Oppermann, zeichnet Monk als ahnungslosen Deutschen, der zum Objekt nationalsozialistischer Willkür wird. HOTEL POLAN UND SEINE GÄSTE Horst Seemann; DDR, Dtsch. Fernsehfunk, 1982 (NDR III, 1984) Die Adpation des Romans Bohemia, mein Schicksal von Jan Koplowitz zeigt zunächst den Aufstieg eines jüdischen Böhmen vor dem 1. Weltkrieg zum Hotelunternehmer und dann die Verfolgung durch die Nazis bis zum Holocaust. Der dreiteilige Fernsehfilm präsentiert einen jüdischen Kapitalisten unter 'Benutzung fast aller Positiv- und Negativklischees. Die Ausstrahlung des dritten Teils führte im Westen trotz einiger vom NDR vorgenommener Schnitte zu Protesten wegen "antisemitischer Propaganda". DIE ZWEITE VERTREIBUNG AUS DEM PARADIES Karl Fruchtmann; BRD, Radio Bremen, 1983 In dem zweiteiligen biographischen Fernsehfilm über Heinrich Heine werden in Nebenrollen zwei Kapitalisten vorgestellt: Heines Onkel, der Bankier Salomon Heine, und die literarische Figur des katholisch gewordenen reichen Juden Gumpelino aus Heines Platensatire Die Bäder von Lucca. JOSEPH SÜSS OPPENHEIMER Rainer Wolffhardt; BRD, ZDF/Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1984 Dokumentarspiel über den Hoffaktor Süß Oppenheimer auf der Basis der historischen Gerichtsakten, der sich um sorgfaltige, vorurteilsfreie Darstellung des Lebens und Wirkens Oppenheimers und der bedrängten Situation von Juden in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts bemüht. ICH, CHRISTIAN HAHN Detlef Rönfeldt; BRD, SWF, 1985 Die zwölfteilige Fernsehserie über die Sozialisation eines armes Schneidermeistersohns in einer süddeutschen Grafschaft des 18. Jahrhunderts führt in Nebenrollen den jungen Bankier Meyer Rothschild, den späteren Seniorchef der jüdischen Bankiersfamilie, als sympathischen jungen Finanzexperten und einen nicht weniger sympathisch gezeichneten korrekten, alten Bankier als Finanzberater eines verschuldeten Grafen vor. LENZ ODER DIE FREIHEIT Dieter Berner; BRD, SWF, 1986 Vierteiliges Fernsehspiel nach dem Roman von Stefan Heym über die Badische Revolution von 1849, in der neben den historischen Personen wie Brentano, Goegg, Struwe, Engels und der dem Publizisten Carl Schurz nachempfundenen Titelfigur ein konservativer jüdischer Bankier und
115 dessen emanzipierte Tochter nicht nur dramaturgisch Hauptrollen spielen, sondern auch unterschiedliche jüdische Positionen im 19. Jahrhundert verkörpern. VÄTER UND SÖHNE Bernhard Sinkel; BRD, WDR, 1986 Vierteiliges Ferasehspiel über Aufstieg und Niedergang einer deutschen Industriellenfamilie zwischen 1911 und 1947, die marktbeherrschende Stellung des Konzerns (I.G.Farben) und seine unheilvolle Rolle in zwei Weltkriegen wegen der Herstellung von Giftgas und Zyklon Β (Auschwitz!). In dieser Mischung aus Industriegeschichte, Zeitgeschichte (Antisemitismus) und Familiengeschichte ist eine zentrale tragische Figur der Bankier Bernheim, der als deutschnational eingestellter Jude trotz seines verhängnisvollen Paktierens mit der politischen Rechten in Auschwitz endet. CHRISTIAN ROTHER - BANKIER FÜR PREUSSEN Peter Deutsch; BRD, SFB, 1987 Die Femsehserie von Wolfgang Kirchner über den Leiter des preußischen Finanzwesens zur Zeit Friedrich Wilhelms III. präsentiert auch drei (leicht idealisiert dargestellte) jüdische Bankiers; Rothers zum Christentum konvertierten Assistenten und späteren Nachfolger Bloch sowie zwei Mitglieder der Finanzdynastie Rothschild; Nathan und Amschel Mayer. BEBEL UND BISMARCK Wolf-Dieter Panse; DDR , Dtsch. Fernsehfunk, 1987 Als wichtige Nebenfigur des dreiteiligen Fernsehfilms wird mit großer historischer Treue der letzte deutsche Hoffaktor vorgeführt: Bismarcks konservativer finanzpolitischer Ratgeber, der jüdische Bankier Gerson von Bleichröder.
6.
Spielfilme und Fernsehspiele zur jüdischen Emanzipation im 18. und 19. Jahrhundert
6.1. Spielfilme Die Ideen der Aufklärung und der Toleranz als geistige Grundlagen der Emanzipation der Juden sowie die Emanzipationsvorgänge und -bewegungen innerhalb der im Aufstieg befindlichen bürgerlichen Gesellschaft in der Übergangszeit von der vorindustriellen zur modernen Gesellschaft waren bis auf verschwindend wenige Ausnahmen kein Thema in der Geschichte des Films.
6.1.1. Stummfilme Aus der Stummfilmzeit sind u.E. nur zwei deutsche Spielfilme zu nennen, die den Aufbruch eines jungen Mensche aus dem Ghetto thematisieren: - In einer Randszene von Paul Wegeners GOLEM versucht die verführte Rabbinertochter aus Liebe zu einem Christen das Ghetto zu verlassen. Ihr romantischer Fluchtversuch ist kein emanzipatorischer Akt, denn der Film beschwört eher vorindustrielles christliches Mittelalter als einen Aufbruch in die moderne Gesellschaft. - Im Film DAS ALTE GESETZ von E.A. Dupont löst sich ein Rabbinersohn aus seiner bisherigen Umwelt, einem galizischen Schtetl, und schlägt die erfolgreiche Karriere eines bürgerlichen deutschösterreichischen Schauspielers in Wien ein. Dieses herausragende Beispiel einer kulturellen Emanzipationsbewegung, das wir im Zusammenhang mit der osteuropäischen Sonderentwicklung im nächsten Kapitel interpretieren werden, gehört zu den raren Beispielen einer nicht auf den Stummfilm beschränkten differenzierten Gestaltung der jüdischen Emanzipation. Als dritter Stummfilm muß eine österreichische Produktion angeführt werden, die stärker noch als der GOLEM die Gegenposition zur Kapitelüberschrift thematisiert, nämlich die Ausgangslage von Juden in Deutschland und Österreich vor der Emanzipation: 6.1.1.1. JISKER/ YIZKOR (Gedenket) Während die deutschen Produktionen DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM und DAS ALTE GESETZ in der Epoche des Stummfilms eher singulare
117 Nathan und eines Ghettoromans von Karl Emil Franzos ist noch der nach 1871 spielende Pogromfilm DIE GEZEICHNETEN von Carl Theodor Dreyer diesem Erzählkreis hinzuzurechnen), hat es neben vereinzelten sowjetischen Spielfilmen mit jüdischen Figuren in drei Ländern regelrechte Zentren des jüdischen Films gegeben: in den USA, in Polen und - allerdings dort von geringerer Relevanz - in Österreich. In Wien, wo nach Beginn des Ersten Weltkrieges die dort lebenden 175 000 Juden durch den Zuzug von 75 000 mittellosen jüdischen Flüchtlingen aus Galizien auf eine viertel Million anwuchsen, wurden kommerziell sehr erfolgreiche jiddische Stummfilme produziert wie der Historienfilm THEODOR HERZL und die Komödie MISRACH UN MAREW (anderer Titel: OST UND WEST).1 Dessen Regisseur Sidney M. Goldin (1880-1935) inszenierte ein Jahr später 1924 - den einzigen (österreichischen) jiddischen Film, der in der Zeit vor der rechtlichen Gleichstellung der Juden in Mitteleuropa spielt: JISKER. In seiner Gestaltung ist der Film konventionell. Man merkt dem Drehbuch von Harry Sekler die Herkunft von dessen gleichnamigen Theaterstück an. Die Fabel mit einer für manche jiddischen Filme typischen Rahmenhandlung (ein gesetzestreuer Jude erzählt eine zur Bewältigung von Gegenwartsproblemen relevante Geschichte) ist trivial: Leybke, ein jüdischer Förster, der mit Kreyndl, der Tochter eines jüdischen Wirtshausbesitzers, verlobt ist, erwehrt sich der Annäherungsversuche der Tochter seines Dienstherren, des Grafen Czaki. Nach dem Modell der in Gen 39 erzählten Geschichte von Josef und der Frau des Hofbeamten Potifar beschuldigt ihn die verschmähte Komteß der Vergewaltigung: "Vater, er versuchte, mich zu küssen!" Der darob am Tag seiner Hochzeit verhaftete Leybke kann mit Hilfe seiner christlichen Freunde aus dem Gefêngnisturm entweichen, Kreyndl heiraten und dem Ratschlag des Rabbi gemäß mit seiner jungen Frau fliehen. Er erfahrt, daß zehn Männer der Gemeinde an seiner Statt in den Turm geworfen werden sollen, wenn er sich nicht stellt, liefert sich aus, wird arretiert und gedemütigt. Den Rettungsversuch der Komtesse auf Kosten seiner Frau weist er zurück, so daß die Verschmähte sich durch Gift entleibt. Trotz aller Bemühungen seiner Glaubensgenossen, aber auch christlicher Theologen wird er von dem beleidigten Grafen zum Tod des Lebendig-Begraben-Werdens verurteilt. Der neben Ida Kaminska in Warschau bedeutendste jiddischeTheaterleiter, der Regisseur und Schauspieler Maurice Schwartz (1890-1960), die zentrale Gestalt des amerikanischen jiddischen Theaters, hatte 1923 Harry Seklers Jisher in New York herausgebracht. 1924, bei seinem Gastspiel in Wien, adaptierte Goldin die Inszenierung mit Schwartz in der Hauptrolle für den Film. Abgesehen von dem nach 1933 in Deutschland nicht wieder aufgeführten Stummfilm JUDITH TRACHTENBERG, den Henrik Galeen, Mitarbeiter von Paul Wegeners erster GOLEM-Version, 1920 nach dem gleichnamigen Roman von Karl Emil Franzos inszeniert hatte, ist JISKER oder "Gedenket" der einzige vor 1871 im Milieu des
Hoberman 1991, 69-71; als Vorabdruck unter dem Titel "Jenseits von Galizien, diesseits von Hollywood: Der jiddische Film aus Wien" in Babylon 8/91, 116-132
118 Ostjudentums angesiedelte Spielfilm, der die Konflikte von Juden unter einer nichtjüdischen Obrigkeit aus jüdischem Blickwinkel thematisiert. Emanzipatorische Tendenzen werden bestenfalls unter ökonomischen Gesichtspunkten angedeutet (der jüdische Förster avanciert - offenbar aus Prestige- und Verdienstgründen zum Leiter der gräflichen Wache), im übrigen wird eine innerhalb der christlichmonarchistischen Umwelt geschlossene jüdische Lebensform mit den in ihr geltenden, vom Film nicht in Frage gestellten moralischen, ethischen und religiösen Normen vorgeführt. Sie ist durch den Gehalt des jiddischen, hebräischen und deutschen Filmtitels geprägt: Jisker = Yizkor = Gedenket. Gedenke, erinnere dich, daß Gott mit deinen Vätern und dadurch auch mit dir einen Bund geschlossen hat (Gen 9,15), gedenke des Sabbattages, daß du ihn heiligst (Ex 20,8), gedenket, daß der Herr euch aus dem Land (Ägypten) befreit hat, in dem ihr Sklaven gewesen seid (Ex 13,3). Und direkt oder übertragen auf den jüdischen Status der Figuren des Films JISKER bezogen: Vergiß nicht, daß du ein Jude bist, handle wie ein Jude, erinnere dich daran, den Glauben der Väter nicht preiszugeben und dich nicht mit den Goyim in eine Mischehe einzulassen. Nach der Shoah sind die Jisker-Tafeln des Judentums qualitativ und quantitativ entscheidend erweitert worden: Yad Vashem (hebr. "Denkmal und Gedachtnisstätte") dokumentiert die Errichtung eines Gedenksteins, eines Jizkor-Mals für die Märtyrer des jüdischen Volkes, die den Naziverbrechen zum Opfer gefallen sind. Der jüdische Festkalender (Israels) verbindet in jedem Frühjahr Pessach, das Fest der Freiheit, mit dem Shoah-Gedenken: Unmittelbar an das Fest zum Gedenken an die Befreiung der Israeliten aus ägyptischer Gefangenschaft ("Auch du warst in Ägypten") schließt sich Jom ha Shoah, der "Gedenktag an den Holocaust und an das Heldentum" an. Ethos und Last des Shoah-Gedenkens gestaltete der israelische Filmemacher Eyal Sivan 1990 in seinem Film IZKOR -SKLAVEN DER ERINNERUNG.
Es fallt auf, daß der Film JISKER in seinen Paraphrasen des "Gedenket"-Motivs auf jegliche Polemik gegenüber einem christlichen Antijudaismus verzichtet. Der Konflikt wird nicht zwischen Christen und Juden ausgetragen, sondern zwischen der staatlichen Obrigkeit bzw. deren Dienern und den Juden. SchwarzweißKontraste in der Personenzeichnung, Heroisierung der Zentralfigur des jüdischen Märtyrers, Benutzung des Einschärfungswortes "Gedenket" zur doktrinären Waffe, wörtliche Thorazitate verschmäht der Film. Es gibt Freundschaften zwischen den Fronten, Gesten der Versöhnung, Ansätze zur psychologischen Charakterzeichnung statt Typisierung, Verzicht auf ausgespielte Märtyrerleiden. Wenn man durch die romantisch-triviale Machart des Unterhaltungsmediums hindurchsieht, kann man die Erkenntnis gewinnen, daß diese filmische Selbstdarstellung des Judentums die antisemitischen Stereotypenbündel des angeblichen jüdischen Erwählungsdünkels, der Werkgerechtigkeit und der jüdischen Gesetzesreligion widerlegt.
6.1.2. Tonfilme Tonfilme präsentierten das Hineingezogenwerden von Juden in die weltliche Zivilisation - wenn man von der im nächsten Kapitel zu behandelnden Sonderform des jiddischen Kinos absieht - nur innerhalb des Genres des historischen Films.
119 Figuren als antisemitische Provokation beurteilt worden.2 Auch wäre es nicht verantwortbar gewesen, Literaturadaptionen mit ambivalenten oder gar offen antisemitischen Judenbildern in den Verleih zu bringen.3 1980 scheiterte z.B. nach einjähriger Vorbereitungszeit die aufwendige Verfilmung von Gustav Freytags Roman Soll und Haben infolge des Einspruchs des WDR-Intendanten. Der Regisseur R. W. Fassbinder hatte offenbar bei seinem Projekt eine Ableitung der nationalsozialistischen antisemitischen Ideologie aus den bürgerlichen Wertvorstellungen des 19. Jahrhunderts und deren verhängnisvolle Weiterführung bis in die bundesrepublikanische Gegenwart geplant.4 Obwohl mit der Serie Freytags Antisemitismus untersucht werden sollte, war wohl nicht von der Hand zu weisen, daß die dazu benutzten Judendarstellungen (etwa von der Ghettoexistenz) ihrerseits antisemitische Klischees hätten befördern können. 6.1.2.1. OLIVER TWIST Solche antisemitischen Stereotypen in der Personenzeichnung waren nicht nur zu befürchten, sondern wurden sogar benutzt, und zwar in dem einzigen in (West-) Deutschland distribuierten ausländischen Film, dessen Handlung zur Zeit der Emanzipationsbewegung spielt: in OLIVER TWIST (Regie: David Lean, England 1948). Bei dessen Aufführung 1949 in Berlin kam es zu Protestaktionen, deren Ausmaß nur mit denen gegen den Wiederauftritt des wenig später entnazifizierten Schauspielers Werner Krauss zu vergleichen war. Auf diesen Film, dessen jüdische Figuren, die Ereignisse bei seiner deutschsprachigen Erstaufführung und das Presseecho wollen wir näher eingehen. Oliver Twist, der 1838 gegen die Grausamkeit britischer Armengesetze verfaßte, bis heute populäre Roman von Charles Dickens über den "Weg eines Fürsorgezöglings" (Untertitel) mit seiner eindringlichen Schilderung englischen Alltagslebens - des gehobenen Bürgermilieus wie der Straßenszenen in der Großstadt - läßt seinen passiven, allzu edlen Helden (das Kind Oliver Twist) in der Londoner Unterwelt auf den Hehler Fagin, das Haupt einer Bande von Taschendieben, treffen. Fagin ist in diesem sowohl melodramatischen wie sozialkritischen Roman "mit seiner starken Betonung des Rührenden und Schrecklichen und der Schwarz-Weiß-Zeichnung unglaublich bös- oder gutartiger Menschen"5 zwar der Exponent des Schrecklichen, unangenehm, widerwärtig, wird aber nicht dämonisiert. Trotz vieler genau beobachteter Realismusdetails und seiner polemischen Sozialkritik hat der Roman stark märchenhafte Züge. Aber 2
3 4 3
Noch 1987 mußte in einer deutschen Femsehserie (CHRISTIAN ROTHER - BANKIER FÜR PREUSSEN) die Figur von Nathan Rotschild nachsynchronisiert werden, weil der Produzent wegen des historisch verbürgten jiddischen Idioms eine antisemitische Wirkung befürchtete (Gespräch des Verfassers mit dem Autor des Films). Von ähnlichen Aversionen gegen die Verwendung des Jiddischen berichtet landmann 1988,5. Horch 1985, 106-139 Fassbinder 1984, 36-39; Kaes 1987, 94-97; Jansen 1983, lOOf. Wolpers 1980, 137
120 keineswegs märchenhaft ist die Zeichnung des aktiven Bösewichts. Fagin ist der Geburt nach Jude, wird fast nur als solcher betitelt und mit antijüdischen Stereotypen ausgestattet, zu denen auch gehört, daß er sich in seinen Essensgewohnheiten wie in seinen Einstellungen und Taten von den Grundsätzen der Thora gelöst hat (er verzehrt Schweinewiirste). Bereits im ersten Satz, mit dem ihn Dickens seinem Lesepublikum im achten Kapitel vorstellt, ist das judenfeindliche Klischee bis zur äußerlichen Typisierung perfekt: In einer Bratpfanne, die mit einem Strick gebunden über dem Feuer hing, lagen ein paar Würste, und darüber gelehnt, eine große Gabel in der Hand, stand ein uralter, vertrockneter Jude, sein schurkisches Gesicht mit den abstoßendsten Zügen von der Welt von rotem Kraushaar beschattet.'
In den nächsten Sätzen wird das Porträt vervollkommt: "Der Jude" hat "einen lauernden Blick", "grinst", "kichert", sticht mit der Gabel nach den von ihm ausgebeuteten Jungen in seiner Bande (von der einer ebenfalls als Jude gezeichnet wird), jiddelt (wie der Übersetzer G. Meyrink Präger Juden in seinem Golem jiddeln ließ) oder spricht in jüdisch idiomatischen Wendungen ("Weigeschrieen, Gott über die Welt ... Nancyleben, das is e Gerechtigkeit?"), feixt, betrachtet gierig-verstohlen die Juwelen seiner Diebesbeute, gibt sich als Geizhals, Menschenverächter, Rohling, raffinierter Lügner und Täuscher zu erkennen. Die antisemitische Wirkung dieser Figur, die P. Paucker gleicherweise als "Buhmann für Kinder" und als "ein schillernder, entstellter Shylock" charakterisiert,7 wird auch durch das am Schluß des Romans - vor Fagins Hinrichtung - initiierte Mitleid nicht aufgehoben. Zwar wird er jetzt nur noch "Fagin", nicht mehr "Jude" genannt, zwar ist erkennbar, daß er mit den jüdischen Gemeindevertretern nichts mehr zu schaffen haben will, da er sie mit Flüchen wegjagt, als sie am Morgen des Hinrichtungstages bei ihm beten wollen, aber gibt er sich damit nicht umso mehr als (abtrünniger) Jude zu erkennen? Der Diebesroman ist bisher dreizehnmal vom Film adaptiert worden, davon seit 1909 neunmal als Stummfilm.8 OLIVER TWIST ist das einzige Beispiel eines Spielfilms mit einer zentralen jüdischen Figur aus dem Zeitalter der Jüdischen Emanzipation, der im Ausland, statt wie bisher in Deutschland, spielt. In den beiden letzten Literaturverfilmungen (von Clive Donner 1983 und von Carol Reed - als Adaption des Musicals von Lionel Bart - 1968) wurde die Figur des Fagin derart umgemodelt, daß sie nichts mehr mit dem Juden von Charles Dickens gemein hat, Donner verlieh ihr sogar "Züge von Weisheit und Güte"9. Im Fernsehen der Bundesrepublik liefen zwei verschiedene Produktionen: der gerühmt-berüchtigte Spielfilm von David Lean in einer radikal gekürzten Fassung und 1967 im Dritten Programm des WDR die Originalfassung des siebenteiligen BBC-Fernsehspiels von Constance Cox.
6 7 8 9
Dickens o.J.,59 Paucker 1985, 116 Von Gebsattel 1969, V,Sp. 934-936 u. 1989. IV, 648f. Grob 1983, 449
121 Die seinerzeit berühmteste Verfilmung - von David Lean, dem "vielleicht professionellsten Regisseur Englands nach dem Zweiten Weltkrieg"10 - ist unter ästhetischen Kriterien nicht von epochemachendem Rang, findet in Filmgeschichten (z.B. von Gregor/Patalas oder Sadoul) und Nachschlagewerken (Bucher) eher beiläufig Erwähnung, wird aber auch nicht unter ideologiekritischen Gesichtspunkten behandelt, obwohl doch der Regisseur die Hehlerfigur Fagin mit allen Attributen antisemitischer Typologie ausstattete, auch wenn er sie im Dialog nicht als Jude bezeichnete." Zwar ist - im Gegensatz zum Ausland, wo der Film in der Originalfassung gezeigt wurde - OLIVER TWIST nur wenige Tage in seiner antisemitische Effekte und Gegendemonstrationen auslösenden Originallänge in Deutschland, nämlich in Berlin (West), gezeigt worden, doch der Lehrstückcharakter der u. W. bisher noch nicht dargestellten Begleitumstände und Argumentationsebenen in den verschiedenen Presseorganen veranlaßt uns, die damaligen Ereignisse verhältnismäßig ausführlich darzustellen. Nach Kriegsende hatten die westlichen Alliierten in ihren Besatzungszonen alle vor 1945 gedrehten deutschen und zahlreiche ausländische Filme mit dem Ziel geprüft, daß nicht Filme ins Kino gelangten, die u.a. "die Ideologie des Nationalsozialismus, des Faschismus oder der Rassenunterschiede verherrlichten", d.h. antisemitische Ideologie verbreiteten.12 Aus Pleyers Untersuchungen geht hervor, daß der britische Film OLIVER TWIST der amerikanischen und der französischen Zensur nicht vorgelegen hat. Bei der britischen Zensur kam es zu einem der seltenen Doppelentscheide, d.h. der Film wurde zweimal mit unterschiedlichem Ergebnis geprüft: Er wurde zuerst nicht zugelassen, nach der zweiten Prüfung aber doch freigegeben.13 Dieser Entscheid ist, gemessen an der großen Zahl von 339 durch die Briten nicht freigegebenen Filme, erstaunlich. Das Skandalon der Vorführung dieses judenfeindliche Affekte mit Sicherheit auslösenden Films führte zu Protestschreiben der Berliner und der Wiener Jüdischen Gemeinde, des Zentralrats der Juden in Deutschland, des europäischen Büros des Weltjüdischen Kongresses in London, zu Krawallen, Kundgebungen, Demonstrationen und massivem Polizeieinsatz in Berlin. Er entfachte eine Pressekampagne, die in der deutschen Nachkriegsfilmgeschichte ohne Beispiel ist: Seit der deutschen Erstaufführung des Films am 20. Februar 1949 im Berliner Filmtheater "Die Kurbel" erschienen zwischen dem 21.2. und dem 13.3.1949 75 Nachrichten, Berichte, Kommentare und (insgesamt zwei) Rezensionen.14 Eine zweite Phase der publizistischen Auseinandersetzung knapp zwei Jahre später reichte vom 13.12.50 mit dem Protest der
10 11
12 13 14
Bucher 449 Nach LIF 2835. Eine Besichtigung der in der Berliner Erstaufführung gespielten Fassung bzw. der später geschnittenen Teile war nicht möglich, weil diese nicht archviert wurden. Pleyer 1965, 23-27; Kreimeier 1989, lOf. Pleyer 1965, 445 Die Angaben und Wertungen fußen auf den im "Medienkundlichen Pressearchiv der Landesbildstelle Berlin'' gesammelten Zeitungsauschnitten.
122 Allgemeinen Wochenzeitung der Juden gegen den Plan des Verleihs J. A. Rank, den Film auch in der Bundesrepublik zu zeigen, und mit den Reaktionen auf die Freigabe des Films durch die Filmselbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) nach Schnittauflagen bis zum 2.10.76, als der erstmalig am Nachmittag von Heiligabend (!) 1974 im Fernsehen gezeigte Film wiederholt wurde. Jetzt überwogen die Rezensionen (33 in insgesamt 47 Artikeln), die zum größten Teil, nämlich in 24 Filmkritiken, auf die Judendarstellungen im Film gar nicht eingingen, sondern den Film wie eine völlig unpolitische Adaption behandelten. Wo in den restlichen neun Kritiken auf die Vorgeschichte (Proteste, Schnittauflagen der FSK) Bezug genommen wurde, blieb es meist bei einer verharmlosenden Captatio benevolentiae, wurde Dickens gegen den Vorwurf des Antisemitismus in Schutz genommen, weil ja nur sein Illustrator George Cruikshank Fagin die "antisemitische Nase" gegeben habe {LübeckerNachrichten, 5.9.51), räumte man dem Zentralrat der Juden in Deutschland einen "besonderen, naturgemäß engen Blickwinkel" als "noch verständlich" ein und warnte vor "Hysterie" (Der neue Film, Wiesbaden, 29.10.51), wehrte sich gegen den Vorwurf einer "antisemitischen Verzerrung" und die Einwände der Jüdischen Wochenzeitung wegen der Wirkung des Films: "Man traut also dem Publikum nicht... Wir fragen nicht ohne Grund: Wie lange noch?" Artikel von John Briggs vom 27.3.51, keine Angabe des Presseorgans), man wünschte sich also wie in der ersten Phase der Auseinandersetzung "ruhige, normale Zeiten": "Wir wollen endlich zu innerer Ruhe und Verständigung kommen, den Grundvoraussetzungen für innere seelische, geistige und kulturelle Gesundung" (Fortschritt, 5.3.49). Daß die meisten Rezensionen Fagin als jüdische Figur nicht wahrnahmen, geht auf die erheblichen Schnitte zurück, die mit der Prüfung durch die inzwischen gegründete FSK zusammenhingen: Der ursprünglich 3155 m lange Film wurde vom damaligen Verleih in einem seinerzeit typischen Akt der Selbstzensur der FSK in einer "um etwa 500 Meter gekürzten Version" zur Prüfung vorgelegt, so daß die FSK dem Verleih nur "noch einige wenige weitere Schnitte auferlegte, die schließlich zu der Endlänge der freigegebenen Fassung von 2582 m führte".15 Eine zusätzliche Entschärfung des Antisemitismusvorwurfs bezweckte die Einfügung eines salbungsvoll gesprochenen Prologs in die Verleihfassung: Der Film wird als international rezipierte Literaturverfilmung eingeführt, der "Reichtum an Geschehnissen" im Roman als "Tragikomik, Spott, versöhnender Humor" definiert. Dann wird das Figurenarsenal unter Verwendung von Illustrationen der Erstausgabe vorgestellt. Fagin wird unauffällig in die Mitte und auch nicht allein, sondern mit einem Kind der Diebesbande placiert und knapp als "der Jude" bezeichnet. Der Kommentar wehrt eine realistische Deutung der Personen ab: "Sie muten uns alle an wie Gestalten aus einer unwirklichen Welt", der Regisseur habe "die Figuren noch grotesker gestaltet". Der Prolog schließt mit der Behauptung, Lean habe "es erreicht, daß wir uns am Ende des Films zu der hohen Absicht des
13
Antwortbrief der FSK vom 15.9.89 auf Anfragen des Verfassers
123 Dichters Dickens bekennen müssen." Welches diese Absicht sei, wird nicht ausgeführt. Doch gelungen ist es den Bearbeitern mit geradezu verblüffender Perfektion, die antisemitischen Stellen so vollständig zu eliminieren, daß OLIVER TWIST nur noch die Geschichte vom armen, geschundenen Waisenknaben ist, der nach einem märchenhaften Zwischenspiel unter Schurken und Mörder gerät, aber glücklich davonkommt, so daß die poetische Gerechtigkeit siegt. Fagin, gespielt von Alec Guiness, ist in dem gegenüber dem Original 25 Minuten kürzeren Film kein Mörder und Mordanstifter mehr, auch kein mit "Jude" angeredeter Verbrecher, sondern nur noch ein finsterer Hehler, ein alter, häßlicher Mann mit großer Nase. So kann beispielsweise die Berliner Zeitung Der Tag in ihrer Besprechung vom 12.12.51 beruhigt zur Tagesorndung übergehen, ohne gezwungen zu sein, Judenhaß, Judenmord und die Shoah überhaupt zu erwähnen. Diese Verdrängungstechnik ist symptomatisch für die Rezensionen des nun "judenfreien" OLIVER TWIST in der Ära Adenauer: Der englische Film, der hier 1949 Anlaß zu heftigen Protesten und Kundgebungen gegeben hatte und darum zurückgezogen werden mufite, wurde jetzt in der Kurbel in veränderter Form gezeigt. Die Szenen und [sie!] jene grauenhafte Figur der Londoner Unterwelt mit den damals karikaturistisch so übertriebenen Zügen sind auf ein Mindestmaß reduziert worden. Die Erscheinung wirkt nun nicht mehr so aufreizend wie früher. Im Publikum regt sich kein Widerspruch. Man nahm den Film schweigend auf, erschüttert von dem Leidensschicksal des kleinen Knaben. Die allgemeine humane Tendenz trat nun klar hervor, schien nicht mehr verdunkelt durch ein rassistisches Zerrbild, das im übrigen vom großen Dichter Dickens noch von dem ausgezeichneten Regisseur David Leyn [sie!] als politische Exponierung gedacht war ... Fl. K.
Die in dieser Filmkritik genannten "Proteste und Kundgebungen" vom Februar 1949 bezogen sich nicht auf die Demonstrationen gegen den wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit angeklagten Naziregisseur Veit Harlan und dessen Versuche, seinen antisemitischen JUD SÜSS durch Berufung auf OLIVER TWIST zu rechtfertigen, sondern auf die Protestdemonstrationen von Besuchern des damals noch ungekürzten Films während einer Nachmittagsveranstaltung in der "Kurbel" und von Demonstranten vordem Filmtheater, die das Kino zu stürmen versuchten, sowie auf ein Protestschreiben an die britische Militärregierung, das von dem damaligen Oberbürgermeister Ernst Reuter, dem Rektor der Freien Universität E. Redslob, dem Stadtverordneten Prof. Landsberg, der Schauspielerin Hilde Körber und anderen unterzeichnet worden war und das die Absetzung des Films wegen der "Zerrgestalt eines Juden" forderte. Im Laufe der Auseinandersetzung wurde in einem großen Teil der westlichen Presse der Eindruck erweckt, als ob die etwa siebzig jüdischen Demonstranten lästige, aufgehetzte Ausländer seien, denen gegenüber Fremdenhaß psychologisch verständlich sei. Man sprach von "rund hundert polnischen Juden" bzw. einem "Stoßtrupp von dreißig Polen", "DPs", "ein paar Dutzend fremdländische[n] Gestalten [...], die sich vor dem Theater zusammenrotteten, aufgebracht gestikulierten und schwer verständliche Reden führten" und die "in weitem Maße von jüdischen Kreisen angeführt [zu ergänzen: wurden, D.P.], die auch sonst am Kurfurstendamm zu
124
sehen sind und dort, allerdings mit Recht, auf wenig Sympathie stoßen. Es handelt sich vielfach um Juden aus UNRRA-Lagern, die vor einiger Zeit aus Berlin abtransportiert und illegal wieder nach Berlin gekommen sind." Die Jüdische Gemeinde selbst gab den Presseberichten zufolge unterschiedliche Stellungnahmen ab: Rabbiner Schwarzschild "bedauerte die Unbeherrschtheit seiner Glaubensgenossen außerordentlich" (Kurier), Erich Borchardt von der Jüdischen Gemeinde habe erfolgreich versucht, Zwischenfalle zu verhindern; andere Mitglieder erklärten, Juden seien an den Demonstrationen nicht beteiligt gewesen. Heinz Galinski registrierte enttäuscht, daß harte judenfeindliche Worte gefallen seien, die Bevölkerung den antisemitischen Film nicht abgelehnt habe, sondern die Vorstellungen fast ausverkauft gewesen seien und sich darin auch heute noch die unveränderte Einstellung eines Teils der deutschen Bevölkerung zeige (Sozialdemokrat, Neues Deutschland). Während der Tagesspiegel die Aufführung des Films als "grobe Geschmacklosigkeit" bezeichnete, der Sorìaldemokrat über die Straßenschlachten vor 2000 Schaulustigen berichtete, daß die Polizei "sich unter dem Beifäll der deutschen Bevölkerung gegen den Ansturm der Demonstranten mit ihrem Knüppel wehrte", formulierten die kommunistischen Blätter Vorwärts, Tägliche Rundschau, Berliner Zeitung und Neues Deutschland Imperative wie "Halt dem Antisemitismus!" und verglichen den Einsatz der "Stumm-Polizei" in der "Frontstadt" mit '"Stürmer'-Szenen". Insgesamt wurden die Proteste und Demonstrationen weitestgehend als unerfreuliche Aktionen von Ausländern und Fremden,z.B. Israelis und Polen, bewertet. Der Anschein wurde erweckt, als handle es sich nicht um Proteste, die mit dem Holocaust in Verbindung zu bringen seien.16 Zusammenfassend läßt die Auseinandersetzung um OLIVER TWIST erkennen, daß die damaligen Filmkritiker der Tagespresse nahezu ausnahmslos einer entpolitisierten ästhetischen Rezension das Wort redeten, differenzierte Analysen schon aus Raumgründen nicht vorgenommen wurden, "Vergangenheitsbewältigung" nur floskelhaft erfolgte und die Existenz von Juden nur im Rahmen einer kulturellen Assimilation nach der Jakob-Wassermann-Devise "Mein Weg als Deutscher und Jude"17 vorstellbar schien.
16
17
In seinem Antwortschreiben auf Anfragen des Verfassers nach der Zusammensetzung der damaligen Demonstrantengruppe(n) antwortete H. Galinski vom Vorstand der Jüdischen Gemeinde zu Berlin am 11.1.89, daß es sich "um Mitglieder der Jüdischen Gemeinde zu Berlin ohne unterschiedliche Darstellungen" gehandelt habe. Wassermann 1984, 35ff
125
6.2. Fernsehspiele
6.2.1. Produktionen der Jahre 1951-1977 Der fast totalen Ausklammerung jüdischer Emanzipationsthematik im deutschen Filmverleihangebot ab 1945 entspricht die Zurückhaltung in den fiktionalen Sendungen des Fernsehens der Bundesrepublik. Zumindest gilt das für die ersten 26 Jahre seines Bestehens. Juden ñgurierten in den Originalfemsehspielen als Opfer nationalsozialistischer Politik oder als Objekte zaristischer Verfolgungen. In den Literaturadaptionen wurde die Emanzipationsthematik ebenfalls ausgeklammert, wenn man von den fünf Na fAan-Fassungen mit ihren zahlreichen Wiederholungen absieht. Die Lebensschicksale von Juden vor 1871, ihr Kampf für die Emanzipation, ihr Ringen um Akkulturation wurden nicht gestaltet. Bei der Betonung des Biographischen, der Vorliebe für die Sendeform des Dokumentarspiels hätte es nahegelegen, wenigstens einige der berühmten Persönlichkeiten jüdischer Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts außer den erst ab 1978 präsentierten Mendelssohn, Börne und Heine vorzustellen, z.B.: - den Berliner Vertreter der jüdischen Emanzipation David Friedländer und den Berliner Bankier Daniel Itzig - die Jüdinnen der "Berliner Salons" Henriette Herz, Dorothea Mendelssohn und Rahel Levin - Zunz, Gans und Moser als Gründer des "Vereins für Kultur und Wissenschaft der Juden" - Gabriel Riesser als bedeutenden liberalen Vertreter der jüdischen Emanzipation in Deutschland und Mitglied (Vizepräsident) der Frankfurter Nationalversammlung - Abraham Geiger und Samson Raphael Hirsch als Führer der jüdischen Reformbewegung - Moses Montefiori, den Philantropen und engagierten Gegner der Reformbewegung, der in zahlreichen Ländern gegen die Unterdrückung von Juden intervenierte - die Politiker und Parlamentarier Johann Jakoby, Eduard Lasker und Ludwig Bamberger - Moses Hess mit seiner Rückwendung vom assimilatorisch gesinnten Frühsozialisten zur jüdischen Tradition und seinem protozionistischen Engagement.18 Nur drei dieser sechzehn jüdischen Persönlichkeiten sind Frauen. Wenn man als Juden nicht nur diejenigen definiert, die die Speisegesetze und die Heiligung des Sabbat (schabbat) befolgen bzw. noch der Kultusgemeinde angehören, son-
18
Zusammenstellung nachGraetz 1985, VI, 142-329; Elbogen 1967, 17-68; Maier/Schäfer 1981; Bürger auf Widerruf 1989
126 dem auch die, "die von der Umwelt als Juden angesehen wurden"19, stehen Henriette Herz, Dorothea Mendelssohn und Rahel Levin (Varnhagen) zu Recht in dieser Liste, obwohl sie Christinnen geworden waren. Gerade an diesen aus dem Judentum hervorgegangenen Frauen ließe sich in Fernsehspielen die Rolle der Frau bei der jüdischen Emanzipation in Deutschland exemplarisch diskutieren.20 Das Schicksal einer Jüdin der Emanzipationszeit wurde jedoch im Fernsehen erstmals 1984 gezeigt. Aber auch der Weg männlicher Juden aus dem Ghetto in die bürgerliche Gesellschaft war zunächst kein Gegenstand des Fernsehens. Vielmehr wurden zwischen 1951 und 1977 u.E. nur (insgesamt!) zwei Fernsehspiele produziert, in denen assimilierte Juden vorgeführt werden, die sich entweder schon gar nicht mehr als Juden zu erkennen gaben oder deren Akkulturation so weit fortgeschritten war, daß auch nicht mehr ein Hauch des jiddischen Idioms oder ein anderes Partikel ihrer osteuropäischen Herkunft zu erkennen war, sie also als ganz und gar in westliche Kultur, Zivilisation und Gesellschaft integriert vorgeführt wurden. Diese jüdischen Persönlichkeiten waren Jacques Offenbach und Ferdinand Lassalle. 6.2.1.1. JACQUES OFFENBACH Das vom Studio Hamburg produzierte, am 13.6.1969 in der Inszenierung Rudolf Jugerts gesendete Fernsehspiel JACQUES OFFENBACH ist kein Musikfilm. Das "Lebensbild" von Henri Iversen und Peter Krönig über den Aufstieg Offenbachs bis zu seinem Tod konzentriert sich auf das Wirken des Theaterleiters Offenbach, auf sein zähes Bemühen, die Lizenz für ein kleines Theater zu erringen und dies so auszubauen, daß er seine Chance mit Erfolg nutzen und seinen musikalischen Triumphzug beginnen kann. Das Dokumentarspiel mit dem seit den fünfziger Jahren oft zur Darstellung edler Juden eingesetzten Pinkas Braun in der Titelrolle verzichtet vollständig darauf, Offenbachs Assimilierungsprozeß zu zeichnen, jüdische Thematik auch nur anzusprechen. Die zwei, drei Stellen im Drehbuch,21 aus denen auf Offenbachs jüdische Herkunft geschlossen werden kann, dürften bei der Sendung nahezu untergegangen sein: Einmal erklärt ein Neider: "Aber was wollen Sie - wenn schon der Kaiser die Musik dieses Juden aus Köln goutiert", ein anderes Mal mokiert sich Offenbach über (jüdische?) "Landsleute", die mit ihm "Geschäfte" machen wollen, und benutzt idiomatische Wendungen ("mauscheln, "Schnorrer"). Sie dürften gar nicht mehr als judaistische loci aufgefallen sein. "Der Jude" ist abgewaschen, eine Thematisierung von jüdischer Emanzipation abgewehrt worden.
" 20 21
Gekürzte Definition im Anschluß an Grab 1988,3 (vgl. auch Grab 1991,185-199) Exemplarisch bei LeVinson 1989 und Arendt 1984 S. 62, 89, 112. Die Genehmigung zur Besichtigimg des Femsehspiels wurde vom ZDF mit Hinweis auf technische und rechtliche Probleme nicht erteilt.
127 6.2.1.2. FERDINAND LASSALLE Auch das zweite, nur wenig später entstandene biographische Fernsehspiel über eine berühmte jüdische Persönlichkeit begrenzte radikal "die jüdische Frage", wie Bruno Bauer schon vor seiner Kontroverse mit Marx die Emanzipation von Juden genannt hatte. Der Kritik am konventionellen Dokumentarspiel mit seiner "So-war-es"-Ideologie schien 1970 Georg Marischka Rechnung zu tragen, als er für das ZDF das Fernsehspiel FERDINAND LASSALLE schrieb, das auf eine "Imitation der äußeren Realität"22 in Form einer durchkomponierten Chronologie der äußeren Ereignisse verzichtete, stattdessen die Biographie Lassalles in einzelne Spielszenen auflöste, die innerhalb der Sendung komplexweise von einem Expertenteam diskutiert wurden. Die verschiedenen Fassungen des Drehbuchs mit den Spielszenen, den Dialoglisten der Diskussionsrunde und den Bearbeitungen dieser beiden aufeinander bezogenen Teile in einer Komposition von über einem Dutzend Spiel- und Kommentarabschnitten2' lassen erkennen, daß Marischka mit Erfolg bemüht war, nicht die Extravaganzen und Liebesaffaren Lassalles ins Zentrum zu stellen (wie etwa Hans Habe in seinem /asm/n-Dlustriertenaufsatz "Ferdinand Lassalle - Lohnt es sich, für eine Frau zu sterben?"), sondern bei aller Betonung der biographischen Aspekte Lassalles politischer Tätigkeit und seiner Stellung zur Arbeiterfrage den ihr gebührenden ersten Rang zu geben.24 Daß Lassalles Staatstheorie und seine ökonomische Theorie, sein Revolutions- und sein Demokratiebegriff weniger präzis gefaßt wurden als sein politisches Programm und seine politische Taktik oder als die unterschiedlichen Konzepte von Marx und Engels auf der einen, von Lassalle auf der anderen Seite, schien nicht weiter ins Gewicht zu fallen, da ja die Expertenrunde die Spielszenen hätte kommentieren, interpretieren und ergänzen können bzw. sollen. Eine Analyse und Kritik des politischen Verhaltens Lassalles als Gründer der sozialdemokratischen Bewegung in Deutschland und der Auswirkungen auf gegenwärtige politische Fragestellungen an Hand der einzelnen Spielszenen erfolgten aber gar nicht. Die Diskutanten - der damalige Bundesverteidigungsminister Helmut Schmidt als stellvertretender SPDVorsitzender, der Politologe Eugen Kogon, der Arbeitsrechtler Thilo Ramm und die Historikerin Frolinde Baiser - kannten nämlich die von Helmut Ashley inszenierten Fernsehspielsequenzen Marischkas überhaupt nicht, sondern die im Studio Bonn separat aufgenommene Round-Table-Diskussion wurde anschließend segmentiert, Marischka schlug dem ZDF-internen Gesprächsleiter, dem Historiker und späteren Leiter der ZDF-Dokumentarspielabteilung Friedrich A. Krummacher überleitende Texte vor, diese Zwischentexte wurden aufgenommen, und das Ganze
22 23
24
Delling 1982, 42 Anstelle der nicht mehr greifbaren Semidokumentation wurden die dem Verfasser vom Drehbuchautor zur Verfügung gestellten Textunterlagen herangezogen. Grabing 1977, 50-58; Massing 1986, 160 -165
128 wurde dann am 21.7.1972 gesendet. Damit erhielten aber die Spielszenen wieder den Anspruch des Geschehenen, nicht des Fiktionalen.25 Die Drehbuchfassung des LASS ALLE-Dokumentarspiels bestätigt unsere These, daß im deutschen Fernsehspiel bis 1977 historische jüdische Figuren der Emanzipationszeit in ihrem Judesein nicht diskutiert werden. Marischka greift lediglich einige Aspekte erzählend, nicht aber problematisierend heraus: Lassalles Französisierung seines Familiennamens (der Vater Chaim hatte sich noch "Lassai" geschrieben) läßt er von Bismarck mit Überraschung, von einem Arbeiter mit Kopfschütteln registrieren; in der Marx-Engels-Sequenz des Fernsehspiels werden Friedrich Engels' antisemitische Lassalletitulierungen ("Herr Baron Itzig", "Herr Jiddle Braun" [Lassalles Großvater Braun war Rabbiner gewesen]) im Dialog mit Marx geäußert; der Graf Hatzfeld darf seine Aggressionen gegen den Liebhaber seiner Frau mit der Verbalinjurie "Dieser Judenbengel aus Breslau!" äußern und Lassalle selbst seine Abweisung durch den Prof. von Dönniges mit der bitteren Bemerkung quittieren: "Einen Schwiegersohn jüdischer Religion bekommen einen Jid, einen Jiddelach! - das kann man Herrn von Dönniges tatsächlich nicht zumuten!" Solche eingeflochtenen Äußerungen sind weder eine differenzierte Charakterisierung noch geben sie Impulse zur Reflexion von Lassalles Position im Lichte seiner jüdischen Abstammung, zumal alle diesbezüglichen relevanteren Details seines Lebens im Dokumentarspiel nicht gestaltet, geschweige denn erwähnt werden:26 die Ergebenheit des jungen Mannes gegenüber der Religion und dem Volk seiner Väter (vgl. die Tagebücher des Vierzehn- und Fünfzehnjährigen), seine Träume von der Befreiung des Judentums mit der Waffe in der Hand, seine Anteilnahme an der Ritualmordaflare von Damaskus, die Verabscheuung jener Juden, die durch ihr ehrloses Verhalten ihr Volk der Verachtung preisgaben, seine positiven Erinnerungen an die religiösen Zeremonien im Elternhaus, sein Leipziger Beitritt zu einem jüdischen Wohltätigkeitsverein, sein Interesse an der jüdischen Reformbewegung, bis dann der Umschwung erfolgte und Lassalle offensichtlich nur noch wenig für Judentum und jüdische Religion übrig hatte, ja sein Zorn und seine Wut - ein frühes Zeugnis jüdischen Selbsthasses? - in offenen Judenhaß umschlugen: Ich liebe die Juden gar nicht, ich hasse sie sogar ganz allgemein. Ich sehe in ihnen nichts als die äußerst entarteten Söhne einer großen, langst vergangenen Zeit. Diese Menschen haben in den Jahrhunderten ihrer Versklavung die Eigenschaften von Sklaven angenommen.27
Das Interesse des Drehbuchautors Marischka ging also nicht dahin, das Psychogramm eines Menschen zu entwerfen, der in seiner Jugend durch sein
23
26
27
Auf die aus dem Text erkennbare problematische Diktion der gesamten Sendung als Folge der Verschmelzung unterschiedlicher Sprachebenen sowohl innerhalb der Spielszenen als auch der gesamten Sendung gehen wir nicht ein, weil hierzu die Kenntnis der Ausstrahlung unumgänglich ist. Vgl. aber die Kritik von Walter Jens vom 28.7.72. Juden und Judentum in deutschen Briefen 1984, 282-288; Poliakov 1987, VI, 213; Silberner 1962, 160-180 zitiert bei Silberner 1962, 176
129 Judentum geprägt wurde, dann aber - ohne je formell die jüdische Gemeinschaft zu verlassen - eine Entwicklung durchlief, die als "Gegenstück" zum Lebenslauf seines Weggefahrten Moses Hess interpretiert werden kann.28 Fernsehspiele der fünfziger und sechziger Jahre waren offenbar noch nicht in der Lage, problematische, gebrochene Persönlichkeiten der Emanzipationszeit - seien es Juden oder Judenfeinde - so zu zeichnen, daß durch eine nicht semidokumentarische, nichtaristotelische Gestaltung Problembewußtsein geschaffen und Impulse zur selbständigen, auch kontroversen Denkarbeit gesetzt wurden. (Daß dies bis Ende der achtziger Jahre noch nicht gelang, zeigen alle bisherigen Richard-WagnerFilme und -Fernsehspiele, die nicht einmal in der Lage waren, Wagner als Vorboten des Antisemitismus zu zeichnen, geschweige denn, die Vielschichtigkeit dieses Phänomens überhaupt anzudeuten.29
6.2.2. Produktionen der Jahre 1978-1991 Eine differenzierte Sicht jüdischer Figuren und zugleich deren Einbettung in den Vorgang der Emanzipation begann erst 1978 im Fernsehen der Bundesrepublik, also etwa zeitgleich mit dem Erfolg der HOLOCAUST-Fernsehserie. Nun wurde die Rechtssituation der Juden im 18. und 19. Jahrhundert Hintergrund oder zentrales Thema einer kleinen Gruppe von Fernsehspielen. In verschiedenen Sendeformen - als Dokumentarspiel, als biographisches Spiel, als Literaturadaption und als Fernsehserie des Vorabendprogramms - wurde das Thema punktuell behandelt. (Die Zahl von zehn Sendetiteln erhöht sich, wenn man die Aufzeichnungen von Theateraufführungen, vor allem von Lessingstücken wie dem "Nathan", hinzurechnet.) Nur Sendungen, die einen größeren Handlungszeitraum umfassen und eine längere Spieldauer aufweisen, in der Regel also die mehrteiligen Fernsehspiele, sind dabei überhaupt in der Lage, den tiefgreifenden Wandlungsprozueß in den jüdischen Gemeinschaften der westeuropäischen Länder, nämlich die Veränderungen des gesetzmäßigen Status, der Berufsausübung sowie der religiösen Überzeugungen, der Gewohnheiten und der Formen gesellschaftlichen und religiösen Lebens am Verhalten der Spielfiguren exemplarisch deutlich zu machen, oder sogar die jeweiligen Aspekte dieser gesellschaftlichen Revolution, wie sie sich in den verschiedenen Bezeichnungen -
28 29
Juden und Judentum in deutschen Briefen 1984, 282 MAGIC FIRE ("Frauen um Richard Wagner"), Regie: William Dieterle, USA 1955; LUDWIG II., Regie: Helmut Käutner, Bundesr. Deutschland 1954; WAHNFRIED, Regie: Peter Patzak, Bundesr. Deutschland 1987. Katz 1985; Katz 1989, 174-193; Poliakov 1988, VI, 237-265; Zelinsky 1983; Juden und Judentum in deutschen Briefen 1984, 323-339; Philipp 1988, II, 192-294
130 Naturalisierung, bürgerliche Verbesserung, Reform, Amalgamierung, Assimilation, Emanzipation - niederschlagen,'0 hervorzuheben. Wenn wir uns die Situation der Juden in Deutschland zu Beginn der Aufklärung, den Verlauf der ersten Reformen, die Wechselbäder von Napoleon bis zum Wiener Kongreß, die Rückschläge im Zeitalter der Restauration und der Reaktion, die Ansätze im Vormärz und die Auswirkungen des Revolutionsjahres 1848 vergegenwärtigen, wird deutlich, daß diese wenigen Fernsehproduktionen auch nicht im entferntesten in der Lage sind (und es auch gar nicht anstrebten), jüdische Existenz innerhalb des gesamten Spektrums von Akkulturation bzw. Assimilation im Vorfeld des sich formierenden Antisemitismus an exemplarischen Fällen gültig zu gestalten; einmal ganz abgesehen davon, daß diese deutschen Fernsehspiele verständlicherweise nur - bis auf die Heinrich-Heine-Mehrteiler Ereignisse in Deutschland darstellten, die wesentlichen Impulse, Konflikte und weitreichenden Geschehnisse der jüdischen Emanzipation im übrigen Westeuropa und die Folgen der Haskala sowie den Chassidismus in Osteuropa also ausklammerten. Die Eckdaten unseres Kapitels, 1750 und 1871, stimmen mit der Handlungszeit der Fernsehspiele zur jüdischen Emanzipation ungefähr überein: 1747 reist Bach nach Berlin, 1864 stirbt Lassalle. Sie entsprechen aber nur mit Einschränkungen den zeitlichen Einteilungen der Historiker, Theologen, Publizisten usw. Diese setzten in ihren Periodisierungen den Beginn der Judenemanzipation meist auf 1770 (J. Katz und H.G. Adler), 1780 (R. Rürup, R. Erb und W. Bergmann) oder 1789 (H. Graetz, W. Grab) fest, falls sie nicht die etwa 1750 beginnende Vorgeschichte mit dazurechnen (W. Kampmann, K.H. Rengstorf, U. Bohn, K. Kupisch) oder (nach Bruers Forschungsbericht) den Verfall der jüdischen Traditionsgemeinschaft noch früher ansetzen; wogegen andere (S. Ettinger) den Terminus erst für jene Zeit benutzen, in der er im aktiven Sprachgebrauch zu registrieren war, also seit 183031 Wenn wir die frühen Dokumentarspiele über Offenbach und Lassalle ausklammern, kommt J. Toury den Eckdaten der nun zu besprechenden deutschen Fernsehspiele über die jüdische Emanzipation am nächsten: er fixiert - bei allen konstatierten Unterschieden in Beginn und Verlaufstempo nach Ort und Staat - den "jüdischen Verbürgerungsprozeß" zwischen 1749 und 1848.32 Die geringe Anzahl von Fernsehspielen und Filmen über Themen der jüdischen Emanzipation läßt uns bei deren Analysen sowohl auf Rürups Untergliederung nach den beiden Hauptphasen 1780-1815 und 1840-1870 verzichten als auch auf die differenzierte Fünf-Etappen-Einteilung Bruers (178030 31
32
Katz 1986, Iff; Holoczek 1985, 131 Katz 1986; Adler 1987; Rürup 1987a; Graetz 1985, VI; Kampmann 1963; Rengstorf 1988, II, 129-176; Bohn 1980; Kupisch 1960; Ettinger 1979, ΙΠ, 94-168; Erb/Bergmann 1989; Bruer 1991, 30-32 Toury 1977, 141. Auch für Hamburger und Sterling stellt 1848 eine Zäsur dar: Bei Hamburger (1968, 6-19) reicht die erste Emanzipationsperiode von 1808 bis 1847, bei Sterling (1956) ist das Eckdatum 1850 (allerdings setzt die Autorin den Akzent nicht auf die JE, sondern die "Frühgeschichte des Antisemitismus).
131 1815 Beginn, 1815-1847/48 Restauration, 1848-1850 Revolution, 1850-1860 Restauration, 1860-1869 Liberalisierung). Damit umgehen wir auch eine Festlegung des in der Literatur noch stärker umstrittenen Endpunkts der Emanzipation, der mit dem Abschluß der entsprechenden Gesetzgebung ja nicht identisch ist." Wie weit spiegelt sich nun der Verlauf der jüdischen Emanzipation in diesen Fernsehspielen, was für ein Bild von Juden wird gezeichnet? Entspricht es in seinen belegten wie in seinen fiktiven Gestalten den Schwerpunkten der historischen Entwicklung? Trägt es durch seine Gestaltung zur Abwehr jener auf christlichem Boden so gut gedeihenden Vorurteile bei, die in der ersten Phase der jüdischen Emanzipation bei allem Fortschrittsoptimismus doch stets virulent waren, in der anschließenden Restaurationsepoche - aufzeigbar an der Hep-HepBewegung" von 1819 - erneut ausbrachen und dann auch in der nächsten Phase nicht verschwanden?34 Um vor übertriebenen Hoffnungen zu warnen, muß daran erinnert werden, daß Fernsehspiele und Spielfilme zum Thema Judentum und Antisemitismus wie alle anderen (nicht nur fiktionalen) Produktionen nicht Medien eines zentral aufgestellten Curriculums mit verbindlichen Lernzielen sind, sondern von einzelnen Produktionsgesellschaften für den Markt gefertigt wurden, es somit zu Überschneidungen wie auch zu umfangreichen blinden Flecken kommen kann. Der für die Frühgeschichte der Emanzipation so charakteristische "Wechsel von vorwärtstreibenden und zurückhaltenden Kräften"35 kann und darf im Film nicht lehrbuchartig ausgebreitet, sondern nur punktuell thematisiert und am Lebensschicksal der Figuren erfahrbar gemacht werden. Dennoch wäre es wünschenswert, wenn sich in den Handlungsabläufen der Femsehspiele einige der folgenden Grundtatsachen und Entwicklungslinien spiegelten, die wir hier kurzgefaßt, z.T. unter Beibehaltung der von einander abweichenden Akzentsetzungen, aber ohne Kennzeichnung der Unterschiede des Wandlungsprozesses in den einzelnen Ländern und Gemeinden auflisten: 6.2.2.1. 17 Sätze über die jüdische Emanzipation in Mitteleuropa (JE) 1. Die sich in Schüben und unterschiedlichen Tempi in den verschiedenen Lebensbereichen vollziehende JE ist Teil der umfassenden politischen, sozialen
33
34
35
D. Claussen (1987,18) schiebt beispielsweise unter Berücksichtigung der geographischen Entwicklungsunterschiede in Europa den Zeitpunkt der völlig rechtlichen Gleichstellung der Juden bis zur Oktoberrevolution hinaus. Für Deutschland markiert wohl der 16.4.1871 (Übernahme des Bundesgesetzes von 1869 für das gesamte Reichsgebiet) den Abschluß der Emanzipationsgesetzgebung, nicht aber die Gleichstellung der Juden de facto; vgl. Rürup 1870,36f. oder Bruer 1991, 32, der seiner Periodisierung nach der rechtlichen Gleichstellung der Juden als sechste Phase die der neu aufkommenden Judenfeindschaft hinzufügt. "Judenfeindschaft ist ein Spezifikum der christlichen Völker; Antisemitismus gedeiht auf christlichem Boden." Gollwitzer 1981, 50. Vgl. auch: Gollwitzer 1962, 249-274; 1988, 8-35, 63ff. Zur Zunahme von Judenfeindschaft gerade seit der Aufklärungsepoche und infolge der Durchsetzung moderner Rationalitat vgl. Katz 1989. Liebeschütz 1977,2
132 und kulturellen Emanzipationsbewegungen seit den Menschenrechtserklärungen von 1776/89, der Revolution von 1789 und der liberalen Bewegung ab 1830.36 Sie ist Ausdruck eines "Paradigmenwechsels des Judentums", einer "Änderung der Gesamtkonstellationen von Überzeugungen, Werten [und] Verfahrensweisen".37 Es gilt nicht mehr das "rabbinisch-synagogale Paradigma" des jüdischen Mittelalters mit Thorareligion und weitgehender Partikulation auch angesichts des christlichen Antijudaismus, sondern durch die europäische Aufklärung kommt es zu einem epochemachenden Umbruch jüdischer Lebens-, Gesetzes- und Glaubensformen, zum Auszug aus dem Ghetto, zur jüdischen Aufklärung, zu Identifikationskrisen und zu einer neuen Gesamtkonstellation, dem "Assimilations-Paradigma", das wiederum andere, damit konkurrierende Paradigmen auf den Plan ruft.38 2. JE als Akkulturationsprozeß hin zur rechtlichen Gleichstellung und sozialen Integration wurde im 19. Jahrhundert häufig mit absoluter Assimilation als "völlige^] Absorbierung der Juden"39 statt mit wechselseitiger Auseinandersetzung und Beeinflussung bis hin zur Angleichung definiert. Die Verschmelzung der beiden z.T. verkürzt verwendeten Begriffe "Emanzipation" und "Assimilation", die Akzeptanz von Assimilation im Bewußtsein der jüdischen und nichtjüdischen Bevölkerung als ein wohl notwendiger und freiwilliger Verzicht auf das eigene jüdische religiöse und kulturelle Leben, d.h. die Koppelung von "Rechtsgewährung mit kultureller Angleichung"40 bis hin zur Gewinnung einer neuen Identität als "deutscher Kulturbürger"41 sowie die Konfrontation mit der Ideologie vom christlichen Staat in der Restaurationszeit und der Reaktion nach 1848 hatten nachhaltige Folgen. Sie bewirkten faktisch die "Auflösung des Judentums"42 oder doch die "Entwertung jüdischer Inhalte"43 bzw. - andere Interpretation - "keineswegs die Auflösung der jüdischen Gemeinschaft, sondern ihre Umgestaltung von Grund
36
37 38 39
40 41 42
43
Rürup 1987a, 13, 46; Möller 1980, 137, 148f; Erb 1987, 102; Kircher 1973, 23-86; Adler 1987, 39; Ettinger 1980, III, 71; Poliakov 1983, V, 185-198. Auf die Unterschiede zwischen den beiden Typen der kontinentalen und der angelsächsischen JE (Toury 1992,132) gehen wir hier nicht ein, weil wir unsere Zusammenfassung von Forschungsergebnissen auf Fernsehspiele beziehen, die nur im kontinentalen Europa und zwar vorwiegend innerhalb der Grenzen des Deutschen Bundes spielen. Küng 1991, 16f u. passim - im Anschluß an die Paradigmentheorie von Kuhn 1976, 186 Küng 1991, 168-271 Katz 1982, S. VIII. Vgl. auch Scholem 1962,33: Germanismus als "Prozeß des Aufbruchs der Juden von sich selbst hinweg" oderH. Mayer 1981,329: "Verzicht auf den Ursprung zugunsten der Umwandlung" Graupe 1977, 163 Herzig 1980, 261 Rürup 1987a, 30. Schärfer, an die eigene jüdische Adresse gerichtet: "die entschlossene Verleugnung der jüdischen Nationalitat", "die Selbstaufgabe der Juden" (Scholem 1962, 25 u. 26) Graupe 1977, 103. Ahnlich Wiesel(1987,146): "... haben wir unsere neu erworbenen Bürgerrechte benützt, um unser Judentum abzustreifen, statt es voll zur Entfaltung zu bringen. ... Statt unsere Identität zu festigen, haben wir sie ihrer Substanz entleert."
133 auf"44, z.B.: 1. die Herausbildung der "besondere[n] Individualität, [des] deutschen Juden, [des] 'Aschkenasi'"45, 2. den "Aufbruch in die deutsche und europäische Kultur" als ein zur Modernisierung und zu Einfluß führender "Gesta]twandel"44 oder 3. die Ausbildung eines "neuen gegen die Leidensgeschichte rebellierenden Geschichtsbewußtseins" und das Verlangen nach durch Mündigkeit gekennzeichneten "Rollenwechselfs] in der Geschichte der Juden"47 3. JE ist mit der Auflösung ständischer Ordnungen und der Heranbildung der bürgerlichen Gesellschaft das Ergebnis einer wirtschaftlichen und politischen "Doppelrevolution"48, anders gewendet: einer gesellschaftlichen Revolution.49 4. JE steht sowohl im Zusammenhang mit bürgerlichen Deklarationen (wie den Menschen- und Bürgerrechten), Forderungen (nach politischer Freiheit und Verfassung) und Überzeugungen (Mündigkeit und Selbstbestimmung)50, mit Zielen des Absolutismus (wie der Zurückdrängung der Stände und der Zunftreform)51 als auch mit engagiert vorgetragenen Zukunftsvorstellungen, Bildungskonzeptionen und Erziehungsprogrammen gebildeter jüdischer Aufklärer, die auch aus der Tradition jüdischer Erziehung, das Lernen zu lernen, schöpften52. JE ist gleicherweise mit dem Wirken jüdischer liberaler und radikaler Politiker verknüpft, die die Gedanken der Freiheit, der Menschen- und Bürgerrechte, aber auch die revolutionären Ideen einer neuen Gesellschaft (in der Juden als Gruppe überflüssig wären) auf dem literarischen und publizistischen Sektor mit Vehemenz vortrugen und sich aktiv an den Revolutionen von 1848/49 beteiligten.53 5. JE ist nicht allein der von Nichtjuden getragenen philantropischen Aufklärungsdoktrin mit ihrem in einer noch intoleranten Gesellschaft geforderten, aber nur teilweise praktizierten Grundwert der Toleranz zu verdanken54, sondern ist auch wesentlich das Ergebnis der jüdischen Aufklärung, der Haskalah, die ihrerseits nicht als plötzliche revolutionäre Wende in Erscheinung tritt, sondern eine über hundertjährige Vorgeschichte hat (beide Aufklärungszweige ermöglichten nur einer sehr kleinen Minderheit den Anschluß an die im Übergang befindliche
44 45
46 47
48 49 50 51 52
53 54
Katz 1986, 12; vgl. auch Ettinger 1980,III,69f. Stem 1962, 1,1, S. VII.Eine äußerst kritische Bewertung der "deutsch-jüdischen Symbiose" dagegen bei Scholem 1982, 8ff„ 12ff.t 20ff. Liebeschütz/Paucker 1977, S. VII Allerhand 1980,5. Ähnlich bilanziert Reichmann (o.J. = 1956, 18): Die durch fortschreitende Assimilation an die Umwelt sich ständig vermindernde Ungleichheit der emanzipierten Judenheiten habe nicht zu einem Verlust der jüdischen Identität geführt, sondern Juden hätten sich "überall als mehr oder minder deutlich von der Umwelt unterscheidbare Gruppen erhalten." Riinip 1987a, 13 Katz 1986, 13 Rürup 1987a, 13 Möller 1980, 137 Schoeps 1986, 23; Katz 1986, 70ff; Kurzweil 1987, 1-27; Toury 1977, 174-199; Carlebach 1977, 58-68 Toury 1966, 28-68; Grab 1991, 21 Kopitzsch 1980, 29-35 u. d. Diskussion 86-90
134 Gesellschaft) und des Kampfes der nächsten Generation von sich mit dem Deutschtum identifizierenden Juden um die Gleichberechtigung.55 6. JE ist ein Produkt des sozialen Wandels, der Kritik an der gegenwärtigen menschenunwürdigen Lage der Juden und der Einsicht in die Notwendigkeit einer veränderten Judenpolitik durch den Staat.56 Sie zielt in den meisten Vorstellungen der nichtjüdischen Aufklärer nicht auf eine einseitige wirtschaftliche Ausbeutung, sondern hat ihren Verlautbarungen nach das Wohl der einzelnen (privilegierten!) Juden wie das Allgemeinwohl im Sinn. "Bürgerliche Verbesserung der Juden" (Dohm) meint: Juden sollten glückliche und nützliche Glieder der bürgerlichen Gesellschaft werden.57 7. Juden waren in der agrarischen Bedarfsdeckungsgesellschaft von der Produktion materieller Güter ausgeschlossen. Insgesamt erfüllten sie - von den Reichen bis zu den in Armut Lebenden - "nützliche" ökonomische Funktionen.58 Jüdische Existenz im allseits reglementierenden absoluten Territorialstaat zu Beginn der JE, in der Übergangszeit von der vorindustriellen zur modernen Gesellschaft ist kaum durch die für den Staat besonders nützliche Oberschicht gekennzeichnet, sondern durch die Masse der minderbemittelten und armen, meist negativ bewerteten, durch Rechtsbeschränkungen gekennzeichneten, vorwiegend vom Hausier-, Leih- und Trödelhandel lebenden, kollektiv haftenden Juden als von der Staatsgewalt abhängige Untertanen, nicht aber als Glieder der bürgerlichen Gesellschaft.59 Dreiviertel der Juden in Deutschland waren am Rande des Existenzminimums, und 10 % von diesen gehörten zu den von Territorium zu Territorium abgeschobenen, leicht zu kriminalisierenden Betteljuden.60 Ein jüdisches Proletariat reduzierte sich schnell infolge sozialen Aufstiegs in die bereitwillig rezipierte bürgerliche Kultur.61 8. Ziel der "aufgeklärt-etatistischen" JE in Deutschland ist die Änderung der jüdischen Lebensbedingungen durch Befreiung von traditionellen Rechtsbeschränkungen und eine "bürgerliche Verbesserung", welche die moralische Vervollkommensfähigkeit der Juden einschließt, in einem langwierigen Erziehungsvorgang.62 Beabsichtigt ist die Verschmelzung der Juden mit den " Christen", d.h. Aufgabe der religiösen jüdischen Identität durch Umgestaltung religiöser Traditionen bzw. Abwendung von ihnen,63 Aufhebung des Sondercharakters der jüdischen Gemeinden, Ankoppelung an ein von der biblischen Basis weitgehend
55
Graupe 1977, 41-47, 227-253; Allerhand 1980, 20 Rürup 1987a, 17 57 Möller 1980, 121 u. Diskussion 150ff. 58 Grab 1987, 140f. 59 Rürup 1987a, 18; Katz 1986, 82 u. 119; Poliakov 1983, V, 14-22; 1987, VI, 197-203; Graupe 1977, 109-111; Sterling 1956, 22-35; Kopitzsch 1980, 29-32; Touiy 1977, 142-153; Reichmann 1956, 73-85 ® Heizig 1980, 243-246; Touiy 1977, 147-150; Kircher 1973, 15-22; Sterling 1956, 35-39 61 Heizig 1980, 251-262 u. Diskussion 263f. 62 Rürup 1987a, 23; Katz 1986, 81f. ° Katz 1986, 76f. 56
135 entleertes, formelhaftes Christentum der Konventionen des gebildeten Bürgertums. Staatliche Judenpolitik wollte keine abgeschlossene Judengruppe mehr dulden.64 9. Die angestrebte, aus einem Überlegenheitsdünkel gespeiste Idee der "bürgerlichen Verbesserung" als Wandel jüdischer Lebensverhältnisse durch gelenkte Änderung der Erwerbsverhältnisse, d.h. der Berufsstruktur in der Regel ohne sozialen Aufstieg, hatte nur begrenzten Erfolg. Sie lieferte zwar den Nachweis der jüdischen Fähigkeit zur Ausübung von Ackerbau, Handwerk und in der schmalen Oberschicht - Wissenschaft, aber die meisten Juden hielten doch an den traditionellen, d.h. früher jahrhundertelang vorgeschriebenen jüdischen Berufen fest.65 In den Städten entwickelte sich die jüdische Finanztätigkeit im aufkommenden privaten Bankgewerbe (Kreditbeschaffungen) sowie in der während der Pionierzeit florierenden Unternehmertätigkeit weiter. Ein schmales jüdisches Großbürger- und Honoratiorentum bildete sich heraus, dessen Bedeutung im Bankwesen und Handel zeitweise weit über den prozentualen jüdischen Anteil an der Gesamtbevölkerung hinausging.66 10. JE wurde durch die Konzeption einer nur allmählichen, stufenweisen Emanzipation als eines Erziehungsvorganges (im Gegensatz zum französischen "liberal-revolutionären" Modell als einem einmaligen Rechtsakt), durch die Uneinheitlichkeit der Lösungsversuche in den verschiedenen deutschen Staaten und die fehlende Koordination mit anderen (unvollkommenen) Emanzipationsvorgängen beeinträchtigt.67 Eine solche Koordination wurde in der Frühgeschichte des Antisemitismus geradezu befürchtet: JE könne auch die Emanzipation der Frauen und des Proletariats nach sich ziehen.68 JE ist nicht ins Volksbewußtsein gedrungen, weil sie "von oben oktroyiert, nicht aber von unten erkämpft" wurde.69 11. Die Entwicklung der JE im 18. Jahrhundert von ghettoartiger Existenz der Juden bis zur teilweisen Eingliederung in ihre Umgebung, "vielleicht der größte Umschwung in der europäischen Geschichte überhaupt", führte zur "Auflösung der (jüdischen] Traditionsgesellschaft" im Umfeld einer "halbneutralen ['christlichen', D.P.] Gesellschaft"70 und erschütterte das vorkapitalistische jüdische Selbstbild einer "festgefugten jüdisch-nationalen Identität".71
64
Katz 1986, 101-110; Graupe 1977, 163ff. ® Riirup 1987a, 31-34; Katz 1986, 74ff, 195-210; Erb 1987, 99-120; Ettinger 1980, III, 85-93 66 Toury 1977, 233-241, dagegen Arendt 1962, 22-24; Bruer 1991, 245-252 67 Rürup 1987a, 38-45; Erb/Bergmann 1989, 36-65 ® Sterling 1956, 125 u. Anm. 149 69 Jörg Dieter Kogel in der Diskussion über Möller 1980, 152.Ähnlich Grab (1991,38): Die JE in Deutschland und Österreich unterscheide sich von der in den Niederlanden, in England, den Vereinigten Staaten und Frankreich dadurch, daß sie "nicht von unten erkämpft, sondern von oben gnädig gewährt worden war." 70 Katz 1986, 15, 39-69 71 Clausen 1987, 60. Ähnlich Holoczek (1985, 176): "Der bürgerlichen Einordnung in die Gesellschaft hatte die Selbstaufgabe des Judentums vorauszugehen. " Vgl. auch die Schilderung von Julius Bab (1988, 46-51) über die Spannung zwischen "Konversion ohne Hemmung" und Fortdauer der "jüdischen Tradition".
136 12. JE wurde wesentlich durch die sich durchsetzende allgemeine Säkularisierung der Gesellschaft gefördert, in der nun sowohl Kirche als auch Synagoge als Institutionen eine "vergleichsweise geringe Rolle" spielen, obwohl Aufstieg in Spitzenpositionen fast nur durch die Annahme der christlichen Taufe ermöglicht wurde. Die scheinbar erneut einsetzende Verchristlichung erwies sich als "christlich-religiös getarnte Verbrämung eines Verweltlichungsprozesses".72 13. Jüdische Aufklärer setzten die Säkularisierung ihrerseits durch eine "Sprachsäkularisierung" (Verachtung und Verbannung des Jiddischen) fort, die eine auch von deutschen Beamten geteilte Verachtung der jüdischen Einwanderer aus Osteuropa ausdrückte und später zum Standardrepertoire des Antisemitismus gehörte.73 14. Erschwerungen, Verzögerungen und Rückschläge der JE ergaben sich durch den Widerstand der von antisemitischen Stereotypen, dem Vorurteil von der jüdischen "Unverbesserlichkeit" und der "Abneigung gegen den wirklichen oder scheinbaren jüdischen Typus" besetzten, meist ihr (tatsächlich nur formelles) Christentum gegen jüdische Integration ins Feld führenden Nichtjuden. Verstärkt wurden sie im Zusammenhang mit dem erwachenden deutschen Nationalgefühl durch den alles Fremde, d.h. in erster Linie alles Jüdische abwehrenden Mythos vom Volk.74 Eine starke Wurzel des Antisemitismus war auch der metaphysische Dualismus in der Philosophie zu Beginn des 19. Jahrhunderts: "Christlichgriechischer Geist ist Inbegriff des Guten und Schönen, der Ordnung und des Lichts. Alttestamentlich-jüdischer Geist ist Ausdruck des Bösen und Fremden, des Unheimlichen und Finsteren."75 Die Verbreitung völkischer, antiliberaler und judenfeindlicher Ideen setzte mit der industriellen Entwicklung als Reaktion auf die Erschwerung des Konkurrenzkampfes und als Abwehrhaltung gegen das Eindringen von Juden in das Sozialgefiige ein; sie wurde durch patriotische Vereine, christlich-germanische Konservative, von Deklassierung bedrohte Kleinbürger und Adlige sowie durch nationalistische Geistliche und Gelehrte gefördert und blieb bis über den Zeitpunkt der rechtlichen Gleichstellung der Juden hinaus wirksam.76 Die Segregationsforderungen, Vernichtungsvorstellungen und Entmenschlichungsmetaphern der radikalen Judengegner berechtigen dazu, den Begriff des "Antisemitismus" schon auf die Spätphasen der JE anzuwenden.77 15. Die an die Thora gebundenen "orthodoxen" Juden verringerten sich quantitativ und in ihrem Einfluß infolge
72 73 74
75 76
77
Dentine 1988, II, 177f., 203 Graupe 1977, 96f„ 113f.; Carlebach 1977, 69-76; Bruer 1991, 139f. Katz 1986, 94-103; Ettinger 1980, III, 94-110; Adler 1987, 56-58; Poliakov 1983, V, 29f„ 68f., 199-214; Dentine 1988, II, 182-213 Kraus 1962, 87 Touiy 1966, 158-184; Sterling 1956, 118ff.; Reichmann 1956, 21f. u. 81 ("Die Angst vor der Konkurrenz begleitet den Kampf gegen die Juden als standiges Leitmotiv"); Poliakov 1987, VI, 106-119; Brandt 1984, 103-111; Bruer 1991, 318-342 Erb/Bergmann 1989, Einltg. u. passim
137 a) der aus der Synagoge flüchtenden aufgeklärten Konvertiten, die teils aus Überzeugung, teils aus Heuchelei, meist aber ohne große ideologische Rechtfertigung - zumal in der häufig nur noch in weltlich-ästhetischer Bildung groß gewordenen zweiten Generation - zu einem verwässerten Christentum übergingen, das lediglich als kultureller, historischer und gesellschaftlicher Faktor angesehen wurde78 b) der aufgeklärten jüdischen Reformer, die sich für den Übergang von traditionell-jüdischen zu mehr weltlichen Inhalten bzw. Schulfächern sowie für die Lockerung religiöser Vorschriften einsetzten, um "die jüdische Gesellschaft aus ihrer kulturellen Isolation zu befreien"79, Erziehungsprogramme entwarfen, reformierte jüdische Schulen und Reformgemeinden gründeten ("Reformjudentum") bzw. die Idee eines liberalen Judentums verfochten.80 16. Die Übernahme bzw. Modifikation philosophischer und theologischer Erkenntnisse der Aufklärung (Vernunftoptmismus, Deismus, natürliche Religion) durch jüdische Aufklärer sowie deren politischer Kampf zur Herbeiführung der Gleichberechtigung zerstörte weithin die Einheit von jüdischer Kultur und Religion, gefährdete durch die "religiöse Wertblindheit" (H. J. Schoeps) teilweise die jüdische Identität und verflüchtigte unter kantischem Einfluß die Religion zur bloßen Ethik. Judentum wurde vor allem für Intellektuelle trotz eines bescheidenen und kurzfristigen gegenläufigen kulturpolitischen Programms zunehmend peripher, bis dann ein neues jüdisches Geschichtsbewußtsein entstand, das die Gedanken der Entwicklung, der Distanz und des Ziels der Geschichte in sich vereinte,81 dadurch auch den Verfall des religiös fundierten Wertsystems in der Phase des Zusammmentreffens von JE, Säkularisation und Industrialismus aufzuhalten strebte.82 17. Die Erwartung der meisten nichtjüdischen Befürworter der JE, jüdische Religion künftig als bloße Glaubensgemeinschaft ("Konfession") definieren zu können, Juden also nicht mehr als Volk zu akzeptieren "öder wenigstens als Gemeinschaft, die sich durch gemeinsame Herkunft und kulturelles Erbgut konstituierte"83, führte auf Seiten der Juden zur Praktizierung unterschiedlicher Modelle der Integration/ Akkulturation/ Assimilation. Einerseits entstand ein patriotisch-deutsches Judentum, das sich nach einem Jahrhundert Akkulturation nicht mehr als Gast in einem Wirtsvolk verstand, sondern eben zu dieser
78
79 80
81 82 83
Katz 1986, 119-139; Graupe 1977, 166ff. Die Angaben über die Anzahl der Konversionen divergieren: Lt. Poliakov (1987, VI, 63f.) breiteten sie sich "wie eine Epedemie" aus; lt. Hamburger (1968, 7, Anni.3) war "ihre Zahl [incl. der Dissidenten und Kinder christlicher Eltern jüdischer Abstammung] zu keiner Zeit größer als etwa 0 , 1 % der deutschen Bevölkerung. " Katz 1986, 175 Kurzweil 1987, 1-22; Katz 1986,140-194; Ettinger 1980, ΙΠ, 73-80; Adler 1987,64-72;, Bohn 1980, 66-68; Graupe 1977, 132-141; Trepp 1987, 65, 71; Küng 1991, 259-271 Graupe 1977, 104-107, 134-152, 169-199 - z.T. vs. Katz 1986, 159-178, 230ff Reichmann 1956, 87 Katz 1986, 229
138 Gesellschaft gehörig - vgl. die Verse von Erich Fried: "Sie waren nicht nur wie ihr / sie waren ein Teil von euch"84 - und sorgsam darauf bedacht war, sich von ihr nicht zu unterscheiden, folglich in seiner politischen Orientierung viel stärker dem konstitutionellen Lager als den Radikalen zuneigte. Andererseits entwickelten sich auch unter den "religiösen" Juden der Ortsgemeinden verschiedene Grade der Annäherung an die Umwelt, was z.B. an den Reaktionen auf Gottesdienstreformen ablesbar ist, die teils als Anpassung an den Geschmack der nichtjüdischen Umwelt, teils als notwendige Korrektur wegen fehlender Bildungsvoraussetzungen bewertet wurden. Divergenzen zwischen den Gesetzestreuen und den Reformjuden blieben bis über die Phase der fortschreitenden JE hinaus bestehen. Zunächst innerhalb der Reformbewegungen entstanden die Radikalen, die vollständig mit den talmudischen Satzungen brachen, zwar ζ. T. die Taufe als "gesellschaftlichen Zwangsakt" absolvierten, dann aber auf der Basis der wissenschaftlichen Religionskritik ihr Judentum nur als bedeutungsloses Herkunftsmerkmal interpretierten und liberale, konservative oder orthodoxe Juden heftig angriffen.85 Bis zum Beginn der NS-Herrschaft, ja bis zur Shoah "wurde die Diskussion um Deutschtum und Judentum, Reform und Orthodoxie, Eingliederung und verschiedene Möglichkeiten der Bewahrung des 'Jüdischen' von weit auseinanderliegenden Positionen geführt." 86 Diese Spannungen verminderten insgesamt die jüdische Solidarität (das jüdische Kollektivbewußtsein).87 Sie erschwerten auch die Wahrnehmung von Juden in ihrer dreifachen Existenz: als religiöse, kulturelle und ethnische Gemeinschaft. Die zu geringen Anstrengungen, antijüdische Vorurteile in der Mehrheitsbevölkerung dauerhaft zu überwinden, führten zu ihrer Übertragung in die entstehende moderne Gesellschaft.88 6.2.2.2. Über den Grad der Verarbeitung von Forschungsergebnissen in ñktionalen Produktionen zur jüdischen Emanzipation Wenn man die 17 Sätze auf die Fernsehspiele mit gleicher Thematik bezieht, lassen sich nur die wenigsten dieser Grundlinien in den TV-Produktionen 84
85 86 87
88
Fried 1988, in: Aus Nachbarn wurden Juden: Ausgrenzung und Selbstbehauptung 1933-1942, 5. Ganz in diesem Sinne interpretiert die Herausgeberin H. Rosenstrauch die "verräterische Formel 'Juden und Deutsche'" als ein bis heute bestehendes Indiz der "Ausgrenzung" (S. 9), wogegen zwei andere jüdische Herausgeber eines zur gleichen Zeit und aus gleichem Anlaß geschriebenen Buches bewuBt die beiden Begriffe "Deutsche" und "Juden" als Ausdruck fur die Zugehörigkeit zu von einander deutlich unterschiedenen "Kollektiven" gegeneinandersetzen (Reichspogromnacht: Vergangenheitsbewältigung aus jüdischer Sicht 1988,7) Sterling 1956, 47-52; Claussen 1987, 21; Toury 1966, 16-46; Küng 1991, 259- 271 Aus Nachbarn wurden Juden 1988, l l f . Graupe 1977, 200-232; Trepp 1987, 65-71. Dem widerspricht Ehe Wiesel (1987, 192) in seinem "Plädoyer für die Überlebenden" im Hinblick auf den Zeitpunkt: Jüdische Solidarität sei bis zu den Tagen vor der "Endlösung" mit Erfolg praktiziert worden, Hann erst wurden zu seiner Bestürzung den Alliierten und "den glücklichen, in Sicherheit befindlichen Juden ihre in Not befindlichen Brüder gleichgültig." Rürup 1987b, 467-478
139 wiederfinden. Nicht zu erwarten war, daß übergreifende Gesichtspunkte wie das Eingebettetsein der jüdischen Emanzipation in andere Emanzipationsbewegungen oder gar die Ahnung von einem Paradigmenwechsel sich am Lebensbeispiel einzelner jüdischer Figuren würde festmachen lassen (Satz 1). Am ehesten noch spiegeln sich in den Femsehspielen Erkenntnisse über die soziale und wirtschaftliche, z.T. auch über die kulturelle Ausgangssituation (Satz 7). Das Hauptinteresse gilt Figuren aus der jüdischen Oberschicht (Satz 9): Bankiers und ihren gebildeten Kindern, Schriftstellern und Philosophen (Heine, Mendelssohn). Allerdings werden auch Juden der Pauperität vorgeführt: ein verarmter Mediziner, ein Trödler; selbst das Problem der in die Kriminalität gefallenen pauperisierten Juden ist Gegenstand eines Fernsehspiels. Das etwas naive Grundmodell aller Fernsehspiele dieses Abschnitts ist - bei respektablen Abweichungen von diesem Grundmuster - das der Kommunikation und Interaktion von "assimilierten" Juden und nichtjüdischen Mitgliedern der Gesellschaft, das Aufzeigen von Hochmut, Unverständnis und Reglementierungen durch die nichtjüdische Umwelt, die Leidensfahigkeit, Standhafügkeit und Durchsetzungsfahigkeit edler Juden, das Bündnis von edlen Juden mit edlen Nichtjuden, offenbar verstanden als Vorabspiegelung eines auf die Gegenwart übertragbaren Grundmusters ohne die erforderliche Trauerarbeit über den Genozid. Dabei fallt auf, daß das Stichwort "Emanzipation" als Terminus technicus in einem wie auch immer ausgeführten Sinne bis auf die Ausnahme einer PartizipPerfekt-Form ("emanzipiert") ebensowenig vorkommt wie in den beiden nichtnazistischen fiktionalen Produktionen über Joseph Süß Oppenheimer im vorangegangenen Kapitel. Völlig fehlt - wenn man von Heines als Mitglied des "Vereins für Cultur und Wissenschaft der Juden" gehaltener Rede in einem der beiden Heine-Spiele absieht - die szenische Aufarbeitung der Assimilationsproblematik als einer Gefahr des Identitäts- und Substanzverlustes (Satz 2,11, 16). Zwar ist das Thema eines Fernsehspiels die (badensche) Revolution, aber man kann nach Besichtigung der zehn Produktionen die veränderte Rolle von Juden zwischen 1747 und 1856 weder als Ergebnis einer gesellschaftlichen Revolution bezeichnen noch vermag man den Zusammenhang der jüdischen Emanzipation mit den Menschenrechtsproklamationen oder gar mit politischen Forderungen und den (widerrufenen) Auswirkungen von Verfassungsparagraphen zu erkennen, den Walter Jens am Beispiel des § 34 der Verfassung der Französischen Republik von 1793 hergestellt hat.89 Allerdings wird in den biographischen Fernsehspielen über Mendelssohn und Heine ein Zusammenhang der Emanzipation mit den Bildungskonzeptionen der (jüdischen) Aufklärung sichtbar (Satz 3-5). Überhaupt keine Rolle spielen in den fiktionalen Produktionen die nichtjüdischen Aufklärer und ihre Konzeptionen zur "bürgerlichen Verbesserung
89
Jens 1988. Der § 34 lautet: "Um Unterdrückung der gesamten Gesellschaft handelt es sich, wenn auch nur ein einziges ihrer Glieder unterdrückt wird. Um Unterdrückung jedes einzelnen Gliedes handelt es sich, wenn die Gesamtgesellschaft unterdrückt wird."
140 der Juden" als ein mittel- bis langfristiges, ausschließlich dem Staatsinteresse dienendes, nur bewilligtes Erziehungsprogramm zur Abkoppelung der Juden von ihrer Nation und ihren religiösen Traditionen (Satz 6, 8, 10). Daß der Weg der Juden aus dem Ghetto als eine der mit dem Preis der Auflösung ihrer sozialen und religiösen Überlieferung bezahlten größten Umschwünge ihrer und der europäischen Geschichte (Satz 11) nicht erkennbar wird, liegt daran, daß das Ghetto nicht in den Blick gerät (in dem herausragenden Film über die Freundschaft zwischen Lessing und Mendelssohn ist die Judengasse bestenfalls eine x-beliebige Vorstadtstraße an der Stadtmauer) und die Abstreifung der Ghettofesseln im Verhalten von Juden nur erahnbar ist. Wenn die jüdischen Figuren hochdeutsch statt jiddisch sprechen, wenn der Kampf gebildeter jüdischer Aufklärer gegen das Jiddische, die Abqualifizierung dieser Volks- und Umgangssprache (Satz 13) nicht angesprochen wird, so mag das in der nicht ganz unberechtigten Sorge begründet sein, daß - wie die genannten Beispiele aus Harlans JUD SÜSS belegen dürften - das Jiddische immer noch als Zeichen einer kulturellen Rückständigkeit interpretiert werden könnte, obwohl z.B. gerade die gegenwärtige Wertschätzung von Tonträgern mit jiddischen Liedern auch andere Einschätzungen zuläßt. Der Problembereich der Konversion als Entréebillet und Säkularisierungsindiz (Satz 12, 15, 17) wurde in drei biographischen Fernsehspielen thematisiert: zweimal emphatisch (in den beiden Fernsehspielen über Heine), einmal kritisch problematisierend (in einer Randszene des romanhaften vierteiligen Fernsehspiels von Peter Wekwerth FLUG DES FALKEN über die Jugend von Friedrich Engels.90 Auf die sich herausbildenden und im Laufe der nächsten Jahrzehnte sich verstärkenden Flügelkämpfe zwischen konservativ-orthodoxen und liberalen Juden oder auf die bis in die Gegenwart hinein kontrovers beurteilte Erscheinungsform des "deutschen Juden" (Satz 16, 17) geht man - bis auf Ansätze im Mendelssohnund im ZDF-Heine-Fernsehspiel - nicht ein. Im Grunde werden nur zwei Typisierungen von "assimilierten" Juden der Emanzipationszeit präsentiert: der sich herausbildende Ashkenasi, der in die deutsche Bildungswelt hineingewachsene oder gar schon als Teil der deutschen Gesellschaft sich verstehende und trotzdem von ihr mit Skepsis und Abwehr betrachtete, nur wenig vom deutschen Bildungsbürgertum sich unterscheidende "nichtreligiöse" Jude und zweitens der ebenfalls die Sprache, die Kleidung, die Umgangsformen seiner Umwelt perfekt beherrschende, gebildete Glaubensjude, dessen ungebrochene Frömmigkeit vornehmlich durch das Stereotyp seiner Andacht im Gebetsmantel signalisiert wird. Die individuellen psychologischen Konflikte, die Zweifel und Widerstände des eigenen Integrationsprozesses werden
90
FLUG DES FALKEN, DDR: Deutscher Fernsehfunk, 1985 (Ausstrahlung in der Bundesrepublik 1989, Eins plus). Da das Ferasehspiel keine jüdischen Figuren enthält und bis auf die genannte Randszene für unsere Thematik irrelevant ist, wird es nicht gesondert interpretiert und erscheint auch nicht in unserer Chronologie (Tabelle 4).
141 ebenso wenig thematisiert wie die sich nun immer stärker herausbildende Vielfeit jüdischer Existenz. Die politischen Orientierungen der meisten Juden, die widerstreitenden Vorstellungen zur Lösung der "Judenfirage" seit dem Vormärz bei den Orthodoxen mit ihrem jüdischen Traditionalismus und passivem Loyalismus auf der einen, bei den gemäßigten Liberalen mit ihrem Willen zur Beseitigung des christlichständischen Staats- und Regierungssystems bei gleichzeitigem Festhalten an der Konzeption eines freiheitlichen geeinten Deutschlands auf der anderen Seite (was die Grundlage einer "Weggemeinschaft" zwischen den Juden und den deutschen Liberalen bildete)91, wird in keinem der Femsehspiele angesprochen. Lediglich die fortschrittlich-radikalen Lösungsmodelle von Jacoby bis Börne, von Heine bis Marx, schimmern durch. Die meisten für die jüdische Emanzipation typischen Ereignisse und Persönlichkeiten werden in den Fernsehspielen nicht getaltet. Vorgänge der Emanzipationsgesetzgebung wie die Vorgeschichte während des Vormärzes, der Revolution und in den Reaktionsjahren, aber auch der nach 1856 beginnende Umschwung und Beginn der gesetzlichen Emanzipation - wir können hier vorgreifen, weil in den in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts spielenden Produktionen die jüdische Emanzipation nicht mehr zum Sujet wird - erscheinen hier ebenso wenig wie in den letzten Jahren vor der rechtlichen Gleichstellung im Norddeutschen Bund und im Deutschen Reich.92 Soweit man nicht die Alltagsschicksale kleiner Leute nach dem didaktischen Prinzip "Geschichte von unten" darstellt, sondern sich für die im Genre des biographischen Films beliebten herausragenden Persönlichkeiten entscheidet, wird der gesamte Emanzipationskomplex an den beiden Zentralfiguren Moses Mendelssohn und Heinrich Heine abgehandelt. Diese lobenswerte (Aus-)Wahl sollte jedoch nicht vergessen lassen, welche berühmten Dichter, Theologen, Publizisten, Politiker, Staatsrechtler, Philosophen, Monarchen, welche Männer und Frauen mit ihren oft weitreichenden Akzentuierungen des Emanzipationproblembereichs eben nicht zu Figuren von Filmen und Fernsehspielen über die Emanzipation im deutschen Sprachraum wurden, angefangen bei dem Preußenkönig Friedrich Π., dessen sich in seinem "Revidierten General-Judenreglement" von 1750 dokumentierende restriktive Judenpolitik in den Jubiläumsfernsehproduktionen zu dessen 200. Todestag ausgeklammert wurde,93 wie auch der andere Monarch, Joseph Π., mit seinem Toleranzedikt von 1782 nicht zur Figur von Filmen oder Fernsehspielen über die Emanzipation wurde. Das erklärt sich im zweiten Beispiel über den österreichischen Herrscher auch mit lokalen Gründen, weil wegen der bedauerlichen Begrenzung auf deutsche Verhältnisse in Sendungen des Fernsehens
" 92
93
Touiy 1966, 31 Vgl. Toury 1977,277-361. Siehe aber auch die einschlägigen Kapitel/Abschnitte bei Graupe 1977, 226-241; Rengstorf 1988, II, 129-176; Dentine 1988, II, 177-221; Katz 1986, passim; Graetz 1985, VI, passim; Kampmann 1963, 98-224 Bruer 1991, 69-93
142
auch die übrigen außerdeutschen wichtigen Ereignisse und Figuren aus der Frühzeit nicht gestaltet wurden. Man denke nur an die ersten Anzeichen und folgenden Kontroversen in Nordamerika, England (Toland), Frankreich (Pascal, Voltaire und Abbé Grégoire) sowie in Holland (Spinoza). Wenn wir für den deutschen Raum nur die wichtigsten Namen nennen, ohne aus Platzgründen ihre jeweilige oft schillernde Rolle und ihren in unserem thematischen Zusammenhang bisweilen dubiosen Nachruhm darzustellen, so sind das in der Mendelssohnzeit zunächst drei in ihren Motiven redliche, in ihren Wirkungen und ihrem Ansehen von jüdischen Zeitgenossen und Nachfahren außerordentlich (zu) hoch geschätzte Persönlichkeiten: Christian Wilhelm Dohm mit seinem Aufruf zur "bürgerlichen Verbesserung der Juden", Wilhelm von Humboldt und Friedrich Schiller. Dann aber vermißt man auch Mendelsssohns törichten Herausforderer Johann Caspar Lavater,94 den als Freund Mendelssohns bekannten, das Judentum aber offensichtlich heftig angreifenden Immanuel Kant, die Judenfeinde Fichte, Schopenhauer und Fr. J. Stahl, die in ihrem Verhältnis zum Judentum so problematischen Theologen Herder und Schleiermacher, die wegen ihres Mythos vom Volk so folgenreichen "Künder" Ε. M. Arndt und den Turnvater Jahn.95 Von den Juden der Aufklärungszeit fehlen die Schüler Mendelssohns wie Wessely und Friedländer. Wohl gewinnt einer der Berliner Salons mit Rahel Levin (Varnhagen) als ihrem geistigen Zentrum in einem Heine-Fernsehspiel Leben; aber von den anderen berühmten Jüdinnen der Romantik, von Henriette Herz, Fanny Lewald, Fanny von Arnstein, von der bewegend-typischen Problematik einer wohl nicht nur äußerlichen Flucht aus der Religion der Väter in ein kulturprotestantisches oder katholisches Christentum erfahrt man nichts.96 Auch das Janusköpfige der Romantik - einerseits die Fusion von Romantik und Judenfeindschaft, andererseits die romantischen Salons als "vollkommenste Beispiele eines vorurteilslosen gesellschaftlichen Verkehrs zwischen Juden und Nichljuden"97 - gewinnt nicht Gestalt. Ebenso fehlen bis auf Börne und Marx Politiker jüdischer Abstammung (Veit, Weil und der schon genannte patriotische Riesser, Vorbild für viele assimilierte deutsche Juden bis in die Tage der Weimarer Republik).98 Andererseits kommt es keineswegs auf die Fülle der Gestalten und Ereignisse an. Wenn es den zehn Fernsehspielen über die erste Hälfte der jüdischen Emanzipation gelungen sein sollte, jüdische Figuren so zu präsentieren, daß in ihnen ein Stück Sozial- und Geistesgeschichte der Juden in Deutschland transparent 94
Schoeps 1984, 115-128 Vgl. z.B. Bruer 1991, 174-196; Grab 1991, 41-72; Katz 1989, 55-77, 197-200 96 Die fiktive Begegnung Schelling - Engels im Salon der Fanny von Arnstein in einer Szene aus Wekwerths FLUG DES FALKEN gibt nur Lokalkolorit, die Gestalt der Fanny bleibt "Schall und Rauch". " Reichmann 1956, 96 (vgl. auch 159-167). Femer: Bruer 1991, 211-225; Schanze 1988, 133150, Hertz 1991, 17, 245 98 Kampmann 1963, 131-224; Graupe 1977, 226-257; Poliakov 1987, VI, 69-105, 184-196, 216236; Arnsberg 1991, 81-104 *
143 und ein Impuls zum die eigene Existenz nicht ausklammernden Nachdenken über die Beziehungen von Juden und Nichtjuden bis in unsere Gegenwart nach der Shoah gesetzt würde, so wäre das viel. Dies zu untersuchen, ist die Aufgabe der anschließenden Einzelanalysen, deren jeweiliger Umfang sich nach dem eingeschätzten Stellenwert richtet, allerdings durch die Gesamtanlage begrenzt wird, so daß die Fernsehspiele über Mendelssohn und Heine nicht so detailliert analysiert werden können, wie es wünschenswert erscheinen mag. Die Reihenfolge der Interpretationen richtet sich weitgehend nach der Chronologie der deutschen Geschichte: Auf Fernsehspiele, die im Zeitalter des Absolutismus - zunächst in Preußen, dann in Süddeutschland bzw. zur Zeit der französischen Vorherrschaft in Deutschland - spielen, folgen Fernsehspiele, in denen die Auswirkungen der Revolution und schließlich des Revolutionsjahres 1848 einen mehr oder weniger großen Einfluß auf die Biographie der Hauptfiguren haben. Die Abfolge der Interpretationen wird auch durch drei verschiedene Programmformen bestimmt: Zunächst analysieren wir Dokumentarspiele, dann Vorabendserien und schließlich mehrteilige Fernsehspiele. Wir verzichten also auf eine Chronologie nach der Produktionszeit, weil sich in dem Produktionszeitraum die Erzählweisen des Fernsehens, bezogen auf die zehn Fernsehspiele, nicht gravierend verändert haben. Zwar fallt auf, daß das älteste Beispiel, das Heine-Dokumentarspiel von 1978, eine lineare Dramaturgie aufweist, bei der eine kurze biographische Szene der nächsten folgt, während spätere Fernsehspiele ein kunstvolleres Montageprinzip mit Rückblenden und Mischung verschiedener Stilebenen vertreten, dabei aber im großen und ganzen chronologisch voranschreiten, andererseits gehören die Fernsehspiele ganze unterschiedlichen Genres bzw. Programmformen an, die sich miteinander nur schwer vergleichen lassen. Eine gewisse Gemeinsamkeit der acht nicht für das Vorabendprogramm produzierten Fernsehspiele besteht darin, daß die ungebrochene Augenzeugenideologie des Dokumentarspiels einer differenzierteren Darstellungsweise durch Kommentierung und Aus-der-Rolle-Fallen der Darsteller gewichen ist, daß die Fernsehspiele sich als literarische Fernsehspiele in fiktionalem Gestus zu erkennen geben. 6.2.2.3. JOHANN SEBASTIAN BACHS VERGEBLICHE REISE IN DEN RUHM 1747. Auf seiner beschwerlichen Reise im offenen Postwagen von Leipzig nach Berlin, wo er dem König vorspielen will, hat der alternde, schon etwas hinfällige Johann Sebastian Bach, den außer der Sorge um das tägliche Brot für seine Familie, außer dem ständigen Ärger mit seinen akademischen Vorgesetzten und über die unbefriedigenden Leistungen der Musiker und des Knabenchores an der Thomaskirche nur seine Musik interessiert, zwei ihn irritierende Erlebnisse: Eben noch hat eine berittene preußische Militärstreife ein Zigeunerlager am Wegrand niedergemacht, als ein auf der Landstraße mit seiner jungen Frau und seinem
144 kleinen Kind daherziehender, in friderizianische Tracht gekleideter Mann, mit einem Bündel auf dem Rücken, sich ehrfürchtig vor dem Postillon verneigt und in gepflegtem Hochdeutsch bittet, aufsitzen zu dürfen. Den gesamten geforderten Preis für die Reise bis Berlin kann er nicht bezahlen, doch bequemt sich der Kutscher, ihn bis Potsdam mitzunehmen. Als aber beim Einstiegen die junge Frau ihrem Mann etwas in Jiddisch mitteilt, herrscht der Kutscher ihn an: "So ist das also: Juden seid ihr! Ihr habt wohl geglaubt, ihr könntet zum üblichen Fahrpreis wie Christenmenschen reisen. Juden zahlen Aufpreis, und das nicht zu knapp bei der Post!" Und so nimmt sie der Postillon nur bis Wittenberg mit. Unterwegs, als sie wegen eines Hindernisses halten müssen und der Jude Bachs Sohn, den Musiker Friedemann Bach, vor einem schweren Unglück durch einen herabstürzenden Baum bewahrt und ihm fachmännisch einen Verband anlegt, erfahrt Friedemann nähere Umstände aus dem Leben seines armen Reisebegleiters. "Abraham ist Doktor gewest bei uns im Schtetl", erzählt die Frau, und der Mann begründet: "Wir mußten fort. Sie haben das Ghetto abgerissen. Sie wollten keine Juden mehr bei uns daheim." Er tröstet sich damit, daß es ihm in Berlin besser gehen werde. Aber daraus wird vorerst nichts. In Wittenberg verwehrt ihm der Postillon die Weiterreise: Sein Geld sei abgefahren, nur gegen den gehörigen Aufpreis könne er mitreisen. Friedemann gibt dem Juden ein Almosen für eine warme Suppe. Mit unbewegtem Gesicht (Großaufnahme) schaut der Jude Abraham ins Weite. Während die Kutsche abfahrt, streift den Juden ein (teilnahmsloser?) Blick des alten Bach. Nur zwei, drei Szenen in dem anderhalbstündigen westdeutschen, aber in der DDR gedrehten ZDF-Fernsehspiel JOHANN SEBASTIAN BACHS VERGEBLICHE REISE IN DEN RUHM von Heiner Michel (Regie: Victor Vicas) aus dem Jahre 1980, das bei seiner Erstausstrahlung 4,41 Millionen Zuschauer erreichte," sind diese wenigen Minuten doch wie ein gelungenes Vorspiel zur jüdischen Emanzipation. Einige ihrer Themen werden intoniert: der mühselige Weg aus dem Ghetto als zum Teil unfreiwillige Wanderbewegung aus den östlichen Landgemeinden in die großen Städte100 (hier auch aufgezeigt in der unterschiedlich gelungenen Überwindung der Sprachbamere als Akkulturationsleistung und in der Suche nach neuen Erwerbsmöglichkeiten), die Widerstände gegen die gesellschaftliche Integration, die Auspowerung der Juden durch staatliche Gesetzgebung, die Auswirkungen der verschärften, eher judenfeindliche Züge annehmenden Judenpolitik unter den Nachfolgern des Großen Kurfürsten, die den "vergleiteten" Juden Schutz gewährten und ihnen Preußen als Einwanderungsland attraktiv machten, die armen Leute hingegen durch Verhinderung einer jüdischen Bevölkerungsvermehrung außer Landes drängten.101 Ge-
" 100 101
Zur gleichen Zeit lief in der ARD der damals bereits im Kino ausgewertete Pasolini-Film DAS ERSTE EVANGELIUM - MATTHÄUS mit der fast doppelt so hohen Sehbeteiligung von 8,8 Millionen Zuschauem (ARD und ZDF: Das Sehverhalten in Femsehhaushalten 14/80). Toury 1977, 9-68 Holoczek 1985, 135; Bnier 1991,20
145 glückt ist auch die nichtverbale Gestaltung von Haltungen und Einstellungen: die willfährige Befolgung der Judengesetze durch die Diener des Staates, das Schweigen, Wegblicken oder die Mitleidsgesten in Ansehung von Unrecht gegenüber Minoritäten (im Falle J. S. Bachs vielleicht auch: die Begrenztheit des Genies gegenüber den Forderungen des Tages), die Wehrlosigkeit von Juden gegenüber Rechtsbeschränkungen, die Diskrepanz zwischen jüdischen Leistungen und mangelnder Anerkennung und schließlich die jüdische "Nächstenliebe'* zu Nichtjuden, d.h. die durch die Thora geforderte und praktizierte Hilfe der Starken gegenüber dem Schwachen. Heiner Michels Drehbücher wollen offensichtlich nicht als Vorlagen für jene Dokumentarspiele gelten, denen man Authentizitätsschwindel und Augenzeugenideologie vorgeworfen hatte. Wenn sein Darsteller des Johann Sebastian Bach wiederholt die Perücke abnimmt und sich als Kommentator an das Publikum wendet, soll das wohl eher eine distanzfördernde Funktion haben. Andererseits besteht der Autor Michel auf seinem Recht, seine Story so zu erzählen, daß sie seinen dramaturgischen und sicher auch didaktischen Intentionen nützlich ist. Deshalb würde er wohl den wahrscheinlich auf ihn gemünzten Vorwurf zurückweisen, es sei nicht in sein Belieben gestellt, "ob Johann Sebastian Bach geehrt in Potsdam aufgenommen worden ist oder als verkanntes Genie dort eine Abfuhr erlitten hat"102, zumal seine den Anekdoten zuwiderlaufende Interpretation von der Begegnung zwischen Friedrich Π. und Bach als "persönliche Katastrophe" des Thomaskantors nach umfangreichen historischen Studien und archivalischen Quellen erfolgte.103 Michel nimmt für sich in Anspruch, sich nicht "an das Gewußte und Belegbare" zu binden,104 sondern seine historischen Spielfiguren so zu arrangieren, daß sie - statt detailtreu das Faktische zu rekonstruieren - Anmutungen der Wirklichkeit aus der Perspektive der Gegenwart geben, Impulse und Problemeröffnungen zur "Daseinserhellung, Daseinserfüllung und Daseinsbewältigung"105 zeigen wollen. Allerdings - und darin hat Neubauer recht - wäre es wünschenswert, wenn man dem Fernsehpublikum in der Ansage oder im Vorspann mitteilte, daß es sich bei solchen Fernsehproduktionen nicht um szenische Gestaltung authentischer Ereignisse, sondern um Spiele "frei nach den Fakten" handelte.106 6.2.2.4. FREUNDE IN PREUSSEN ODER OB EIN EDLER JUDE ETWAS UNWAHRSCHEINLICHES SEI Während der Postillon und die jüngeren Passagiere in der eben geschilderten Szene den auf den Weg gestürzten Baum wegräumen, läßt die Regie den von
102 103 104 105 106
Neubauer 1984,80 Michel o.J.,90-93 Neubauer 1984, 80 Heimann 1963, 6 Neubauer 1984, 80
146 seiner Perücke befreiten Bachdarsteller die Reise nach Berlin als eine Fahrt in eine "junge Militärdespotie" schildern. Ähnlich sieht H. Michel Preußen auch in seinem zweiten Film mit jüdischen Figuren FREUNDE IN PREUSSEN ODER OB EIN EDLER JUDE ETWAS UNWAHRSCHEINLICHES SEI. Wie die VERGEBLICHE REISE wurde dieser Fernsehfilm wiederum in Kooperation zwischen dem ZDF und der DDR-Filmgesellschaft DEFA produziert. Die Sehbeteiligung war - gemessen an den Sehgewohnheiten und Verdrängungsmechanismen des bundesdeutschen Fernsehpublikums - mit 2,17 Millionen Zuschauern ähnlich respektabel wie beim Bachfilm. (Zum Vergleich: Die in derselben Sendewoche in der ARD gelaufene mehrteilige, mit dem Publikumsliebling Curd Jürgens besetzte Literaturadaption COLLIN erreichte 8,77 Millionen Zuschauer.107) Das Fernsehspiel, diesmal ohne eine die Handlung unterbrechende Kommentierung, schildert die Freundschaft der beiden "Grenzüberschreiter"108 Moses Mendelssohn und Gotthold Ephraim Lessing, den mühseligen Beginn der Emanzipation von Juden in Preußen, die Verstrickungen in Schuld auch bei einem leidenschaftlichen deutschen Vorkämpfer der Versöhnung nach einem ähnlich didaktisch-dramaturgischen Prinzip wie beim BACH-Film, das der Drehbuchautor auf die Formel gebracht hat: "Dieser Film beruht auf Dokumenten, aber er besteht aus Erfindungen." Am gravierendsten sind zwei solcher Erfindungen: 1. Michel läßt Lessing sein auch als Studioinszenierung einer Bühnenaufführung im Fernsehen gezeigtes frühes, für Judenemanzipation und Toleranz eintretendes Theaterstück "Die Juden" in Leipzig mit der heruntergekommenen Theatertruppe der Neuberin proben.109 Das gibt dem Fernsehautor die Gelegenheit, die Schauspieler und Lessing über die Grundidee des Stückes und den Realitätsbezug der Bühnenfiguren ("Ob ein edler Jude etwas Unwahrscheinliches sei") diskutieren zu lassen, ob z.B. die erhoffte Akzeptanz des Stückes durch die Zuschauer als Voraussetzung für die wirtschaftliche Sanierung der Truppe einen versöhnlichen Schluß erfordere oder ob das dramaturgische Prinzip Lessings, nämlich die Korrektur der judenfeindlichen Vorstellungen durch Präsentation eines uneingeschränkt rechtschaffenen Juden, einen Lernzuwachs des Publikums garantiere. Diese Diskussion, die nicht trocken akademisch ist, sondern durch das Herausfallen der probenden Schauspieler aus ihren Rollen und die Wiederaufnahme der Kontroverse in den Streitgesprächen Lessings mit seinen Vater dramaturgisch geschickt geknüpft wird, trägt nicht nur zur Erhellung der
107
108 109
Nach Heft 50/81 Das Sehverhalten in Ferasehhaushalten (vgl. Anm. 98) fiel FREUNDE IN PREUSSEN gegenüber zwei zur gleichen Zeit in der ARD ausgestrahlten kürzeren Programmen ab, zunächst einer politischen Sendung über den "europäisch-amerikanischen Dialog" (DAS ATLANTISCHE MISSTRAUEN, Sehbeteiligung 5,92 Mio) und dann einer Nummernsendung (RUDIS TAGESSCHAU: 12,35 Mio). Jens 1988 Tatsachlich fand die erste (Laienspiel-)Aufführung der "Juden" (durch Studenten) wohl erst 1776/77 in Göttingen statt, in Leipzig wurde das Stück fast vierzig Jahre spater als im Fernsehspiel datiert, nämlich kurz vor 1788 erstmalig aufgeführt. (Kopitzsch 1980, 40f)
147
Einstellungen über Juden in der Frühzeit der Emanzipation bei. Sie entspricht ebenso Ergebnissen der literaturwissenschaftlichen Diskussion über Lessings gegen das auch damals aktuelle Problem der Judenfeindschaft gerichtete Stück, mit dem die erste nicht diffamiert gezeichnete jüdische Figur die deutsche Bühne betrat und das ein Voibereiter der Emanzipation war, unbeschadet seines für das bürgerliche Drama typischen Tugendbeweisbauplans und seines Moralitätsideals in der Figurenzeichnung.110 2. Gegen Schluß des Fernsehfilms läßt der Drehbuchautor seinen Lessing in einer etwa fünfzehn Jahre später spielenden Szene als Gouvernementssekretär des Generals von Tauentzien agieren. Zwar war der historische Lessing viereinhalb Jahre in dieser Stellung tätig111, nicht belegt ist aber, wie es der Film vorführt, daß Lessing dabei die Ausweisung deijenigen Juden aus Breslau zu organisieren hatte, die über die von Friedrich Π. auf zwölf Familien limitierte Zahl hinausgingen. Der Autor begründet im Programmheft die Konstruktion seiner Szene überzeugend damit, daß Lessing in Juden immer nur die edlen einzelnen gesehen habe im Gegensatz zu dem "lüderlichen Gesindel, welches auf den Jahrmärkten herumstreift."112 Michel führt also Lessing, den Freund Mendelssohns, nicht als uneingeschränkt positiv zu sehenden Heros einer allgemeinen Emanzipation der Juden vor, sondern auch als einen in seiner öffentlichen Sphäre Scheiternden, für Vertreibung von Juden aus Gehorsam Mitverantwortlichen, der mit Widerwillen, aber ohne Widerstand in Schuld verstrickt wird.113 Der Autor war sich bewußt, daß diese für ihn "nach Auschwitz unumgängliche" Erfindung "auf einige Empörung stoßen" werde.114 Nun ist zwar eine solche erdichtete Szene über einen edlen Menschen, der gleichwohl die Opfer von Austreibung ohne Solidarität allein gelassen hat und für sein Versagen eine Art Befehlsnotstand geltend macht, eine sehr typische deutsche Erzählung über die Täter und Wegschauer bei Pogromen und bei Abschiebungen von Asylsuchenden, aber der von Michel erhoffte didaktische Impuls dürfte relativ wirkungslos gewesen sein. Der Transfer auf Ereignisse von Zeitgeschichte stellt sich deshalb nicht ein, weil das ohne vorherigen Hinweis auf die freie Erfindung einzelner Szenen gesendete Fernsehspiel als Dokumentarspiel, mithin als neues Detail der Biographie Lessings, wohl mißverstanden wird und deshalb keinen Mea-res-agitur-Effekt bewirken kann.115
110
111 112
1,3 114 115
Bamer 1985, 52-77; Barnsr 1982, 189-209; Lessing 1968; Mayer 1981, 332-344; "Die Juden" (Kindlers Literatur Lexikon) 1968, IV, Sp. 102-104 bzw. Kindlers Neues Literatur Lexikon 1990, X, 318f. ; Wierlacher 1974, 137-160; Stenzel 1986, 114-126; Simon 1979, 37-40; Juden und Judentum in deutschen Briefen aus drei Jahrhunderten 1984, 52-86 Lessing-Chronik 1979, 43-47 Das Fernsehspiel im ZDF, Heft 35, 12. Vgl. dort auch Michels dramaturgisch-didaktisches Prinzip des Zusammenhangs von Dokument und Erfindung. Vgl. Werner 1982, 83-102, u. Carmely 1982, 177-188 Michel O.J., 90-93 Vgl. die Ausführungen über Dichtung und Wahrheit im Dokumentarspiel bei Neubauer 1984, 68-74.
148 Die übrigen Lessingszenen entsprechen den Fakten: der heftige Disput des Zwanzigjährigen mit dem Vater, der ihm vorwirft, daß "ein Comoedienschreiber kein guter Christ seyn könne", 1754 die Begegnung von Lessing und Mendelssohn, der Beginn der literarischen Partnerschaft, die Rolle Nicolais als Dritter im Bunde, Lessings Spielleidenschaft, seine Kritik an den Zuständen in Preußen, Mendelssohns dankbarer Rückblick auf die Gemeinsamkeiten zwischen ihm und Lessing. Die drei Grundzüge aller Lessingschen Arbeiten, wie sie F. Kopitzsch benannt hat - sein unermüdliches Eintreten für den kritischen Diskurs, seine Beurteilung von Menschen nach ihrem Verhalten und nicht nach ihrer Herkunft, Religion oder Protektion, seine Toleranz als Anerkennung von Andersdenkenden und Andersgläubigen -116 prägen auch das Lessingbild des Fernsehspiels. Daß Michel dabei die Grenzen Lessings (in derfiktivenJudenausweisungsszene) zeigt, wird beispielsweise dadurch gestützt, daß K. Carmely in ihrem Aufsatz über das Verhältnis der Aufklärer zu Juden ihrer Zeit kritisch fragt, warum Lessing Mendelssohn bei dessen drohender Ausweisung aus Preußen wegen eines Artikels in den Literaturbriefen nicht beigestanden habe.117 Die Freundschaft zwischen Lessing und Mendelssohn wird nicht pathetisch überhöht, sondern als gegenseitige Achtung gestaltet. Kontroversen, die in den harmonisierten populären Darstellungen fehlen, in der Forschung aber sehr wohl registriert werden,118 bleiben jedoch unerwähnt. Im Mittelpunkt des Fernsehspiels aber steht der "erste wirklich moderne Jude"119, der - wie es Leo Baeck in seinen Delitzsch-Vorlesungen 1955 formulierte - "das Beste und Reinste jenes Jahrhunderts war", der in die Welt der Aufklärung und Vernunft eintreten, die jüdische Mystik "in die rationale Welt einfügen" sollte und diese Aufgabe "als erster, in seiner Zeit fest als einziger begriffen hat"120: Moses Mendelssohn (vgl. die Fotos Nr. 12 und 13 der Bilddokumentation). Drehbuchautor und Regisseur (Heiner Michel, Rolf Busch)121 waren wie in allen auf Authentizität gerichteten Dokumentarspielen erfolgreich darum bemüht, auch die äußere Gestalt des Helden getreu zu porträtieren, dabei seine körperlichen Mängel (Buckel und Stottern) aber nur anzudeuten. Sie zeigen den Eintritt des frommen zwanzigjährigen Mendelssohn in die Welt der Aufklärung, sein entbehrungsreiches Leben in den zwölf Jahren bis zu seiner Eheschließung im wesentlichen streng
116 1,7 118 119 120 121
Kopitzsch 1980, 35f. Carmely 1982, 179 Bourel 1985, 33-50 Küng 1991, 249 Baeck 1956, 20f. Lt. Registerband Nr. 11 u. 15 des Dtsch. Rundfunkarchivs hat Busch bis 1977 20 Fernsehspiele inszeniert, darunter die Egon-Monk-Produktion über die Judenverfolgung 1943 in Dänemark WIE EIN HIRSCHBERGER DÄNISCH LERNTE (1968) und zuletzt lt. Zeutzschel das Fernsehspiel DER TISCH über die Aufklärung eines Massakers an den jüdischen Bewohnern einer polnischen Kleinstadt im Zweiten Weltkrieg (1981). Heiner Michel, Redakteur von "Kirche und Leben evangelisch" im ZDF, ist vor dem Bach- und dem Mendelssohn-Film durch die kritische Familienserie UNSER WALTER (1974) bekannt geworden.
149 nach den Quellen.122 Im einzelnen führen sie folgende Stationen vor: den Einfluß des späteren Arztes Aaron Salomon Gumpertz auf Mendelssohns Bildung und Lebenslauf, Mendelssohns Tätigkeit als Hauslehrer der Kinder und als Angestellter des Seidenfabrikanten Isaak Bernhard, die Bekanntschaft mit Lessing und Nicolai sowie ihre gemeinsame literarische Tätigkeit, Mendelssohns Shakespeareübersetzungen und seine Besprechungen von Neuerscheinungen, zugleich sein Leben als Buchhalter bei Bernhard, seine Vorladung zum Verhör beim Generalfiskal von Uhden und die drohende Ausweisung aus Preußen, die bürokratischen Erschwernisse zur Erlangung der Heiratserlaubnis. Das Fernsehspiel schließt mit dem Resümee des gerade Verheirateten über die Lage der Judenheit (noch hat Mendelssohn nicht den Preis der Berliner Akademie der Wissenschaften erhalten, noch ist er kein privilegierter Schutzjude, Dohms Schrift Über die bürgerliche Verbesserung der Juden wird erst neunzehn Jahre später erscheinen): Von aller bürgerlichen Ehre entfernt und zur niedrigsten Stufe hinabgestoßen, die die Stände des gesitteten Lebens unterscheiden, können wir die Talente und Fähigkeiten, die uns die milde Natur in so reichem Maße wie den übrigen Kindern gegeben, weder ausbilden noch anwenden. Wo Künste und Wissenschaften blühen, müssen wir in Barbarei zurückbleiben. Man tut alles Mögliche, uns zu unnützen Bürgern zu machen, wirft uns aber vor, daß wir nicht nützlich genug sind. Wer die Zunge oder die Feder rühren kann, borgt sie zur Verspottung eines Volkes, das man durch alle möglichen Anstalten hat verächtlich zu machen versucht. Ihr fragt mich, wie wir sollen sein. Die Frage ist wohl: Wen läBt man uns sein?'23
Auch dieser scheinbar pathetische Epilog gerät nicht zur papiernen Rede. Durch das Fenster dringen die Hep!-Hep!-Rufe des Pöbels124, und an die Mendelssohnrede werden ein Wort- und ein Bildimpuls gesetzt. Der Wortimpuls: Mendelssohns Frau Fromet sagt zögernd: "Wir haben doch Freunde"; der Bildimpuls: ein die historische Figur mit der Nazizeit und den noch nicht aufgearbeiteten Problemen in der Gegenwart verknüpfender Schlußtitel (wie alle als "Denkzettel" eingefügten fünf Inserts mit einem kontrastierenden Militärmarschmotiv "Fridericus rex" unterlegt): Von den zehn Kindern des Moses Mendelssohn erlebten sechs das Erwachsenenalter. Vier von ihnen traten zum Christentum über. Nur zwei blieben Juden. Wir wissen nicht, wie viele seiner Nachkommen die Massenmorde des deutschen Antisemitismus im 20. Jahrhundert überlebten.
Was das Fernsehspiel auszeichnet, ist die Vermeidung von Hagiographie zugunsten eines aufklärerischen Impetus. Es vermittelt gestalte Informationen und Denkanstöße. Die ante-emanzipatorische Situation Berliner Juden unter Friedrich Π.125
122
123
124
125
Vgl. Schoeps 1979; Knobloch 1979; Kampmann 1963, 98-111; Keller 1979, 398-408; Bohn 1979, 26-36; Bnier 1991, 108-117; Kleßmann 1990, 13-41 Bis auf wenige Angleichungen an heutigen Sprachgebrauch und einen kurzen eingeschobenen Satz ist diese Rede ein Zitat aus Mendelssohns Gegenbetrachtungen über Bonnets Palingenesie (vgl. Rengstorf 1988, II, 144). Vorgriff auf die sog. "Hep-Hep-Krawalle" ab 1819. Vgl. das judenfeindliche Flugblatt "Unser Kampfgeschrey sei Hepp! Heppü Heppü! Aller Juden Tod und Verderben, Ihr müßt fliehen oder sterben." (Dantine 1988, Π, 183) Vgl. Stern 1971, III/l, 1-10; Schieder 1986, 99-101; Bruer 1991, 69-93
150
wird deutlich herausgearbeitet: durch kritische Tischgespräche zwischen Lessing, Mendelssohn, Nicolai und Gumpertz über den (einseitig negativ beurteilten) Preußenkönig (dessen "unsinnigen Krieg", "anmaßendes französisches Literatentum", "Ausbeutung" und "Despotismus" sowie sein "neues, kannibalisches [Juden-]Gesetz") und in Szenen über Friedrichs Judengesetzgebung und deren Auswirkungen: Man sieht den jungen Mendelssohn in panischer Flucht vordem "Hep! Hep!" rufenden Pöbel, man wird Zeuge, wie der Generalfiskal von Uhden seinen Sekretär drei gebückt vor ihm stehenden Mitgliedern der jüdischen Gemeinde seinen neuen "Toleranz-Erlaß" vorlesen läßt.126 (Spiegelbildlich findet sich eine ähnliche Judenausweisungsszene - die schon erläuterte Lessingszene - im vorletzten Teil des Films.) Man sieht als Konsequenz des Judenreglements die jüdischen Büttel, die die Häuser ihrer eigenen Glaubensgenossen auf Anweisung der Obrigkeit durchsuchen, und die preußischen Grenadiere, die an der Stadtgrenze die Juden malträtieren, man erlebt die Anmaßung preußischer Offiziere und Kanzlisten in deren Diensträumen. Man wird gewahr, wie Mendelssohn gleich allen preußischen Juden die nicht weiterverkäuflichen (hier lebensgroßen) Porzellanaffen der Königlichen Porzellanmanufaktur erwerben muß.127 Aber Juden werden nicht nur als Objekte, sondern auch als Subjekte preußisch-deutscher Geschichte gezeigt, wie es in den zahlreichen, schon genannten Szenen über literarische Produktion, über Kooperation von Juden und Nichtjuden und über die Diskussion zu frühemanzipatorischen Ereignissen vorgeführt wird. Von unseren 17 Sätzen über die jüdische Emanzipation findet sich in dem eine Generation früher spielenden Fernsehspiel schon eine Vorahnung: der Aufbruch in die deutsche und europäische Kultur (Satz 2), der Einfluß bürgerlicher Deklarationen auf jüdische Aufklärung (Satz 4), der Bildungsoptimismus (Satz 4) und in zwei Szenen auch die Anfrage über eine vielleicht notwendige, vielleicht verhängnisvolle Aufgabe der religiösen Identität (Satz 2, 8, 11). Wie in einem Brennspiegel wird dies Themenbündel der jüdischen Emanzipation schon in einer relativ frühen Szene des Fernsehspiels, das wir wegen seiner Relevanz und gelungenen Gestaltung überproportional ausführlich vorgestellt haben, zusammengefaßt: Der Hauslehrer Mendelssohn erläutert dem Fabrikanten Bernhard, warum dessen Söhne (nicht nur) Englisch, Französisch, Latein und Mathematik lernen müssen:
126
127
Dieser alle zentralen Punkte preußischer Judengesetzgebung zusammenfassende "ToleranzErlaß" ist wiederum eine auf Dokumenten beruhende Erfindung Michels, also kein Auszug aus dem Edikt "Confirmatio Privilegii der hiesigen Judenschaft" vom 20.5.1714 (Freund 1912, II, 5-14), dem General-Reglement vom 29.9.1730 (ebd., 15-22) oder Friedrichs II. berüchtigten Revidierten General-Privilegium und Reglement vom 17.4.1750 (ebd., 22-60; Auszüge auch in Juden in Berlin 1988,34-38). Der "Toleranz-Erlaß" des Femsehspiels geht offenbar auf Berichte des Generalfiskal von Uhden vom 27.3. und 19.4.1743 zurück (vgl. Stem 1971,111,2, 21-48 = Nr. 16, 17 u. 19). Bruer 1991, 73
151 Mendelssohn: Weder haben sie die Kultur und Bildung unserer jüdischen Schriftgelehrten noch sind sie in der Geisteswelt der aufgeklärten Deutschen zu Hause. Die deutsche Sprache vor allem werden sie mit aller Gründlichkeit lernen müssen, besser und reiner als deutsche Kinder. Hin Jude muß in allem besser sein, wenn er nur als der Geringste akzeptiert werden will. Bernhard: Moses Ben Mendel, Er ist ein Traumer. Als Jiden wird man meinen Sehnen kaum erlauben, anderes zu tun, als ihre Väter getan haben. "Geisteswelt der Deutschen", sagt .E Meine Sehne kennen froh sein, wenn man ihnen gestattet, meine Manufaktur weiter zu betreiben, wenn man se nich aus der Stadt jagt. Wozu also all die gelehrsamen Sachen? Mendelssohn: Es wird die Zeit kommen, da werden die Judrai die gleichen Rechte haben wie alle Menschen in diesem Land. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Wir brauchen Gelehrte, Ärzte, Lehrer. Wir brauchen auch Philosophen, Poeten, Musiker. Bernhard: Das heißt, Er will sie anders machen, als ihre Väter waren. Fremd sollen se werden ihrem Volk und ihrer Iberlieferung, und Er will se fihren in die Welt der Deutschen, in der man sie als Fremde verachten wird. Mendelssohn: Oh nein, das mein' ich nicht. Das darf nie schehen. Unsere Kinder müssen ganz Deutsche werden und doch ganz Juden bleiben, dem Gott unserer Väter, gelobt sei er, treu und Freunde gewinnen in diesem Land. 13 Das wird schwer werden. Das wird nur gehen, wenn die Deutschen uns achten lernen. Aber wir müssen ihnen Grund dazu geben, tausend Gründe.
6 . 2 . 2 . 5 . D A S S C H Ö N E IRRE J U D E N M Ä D C H E N Preußen und Juden (diesmal Juden in Frankfurt, nicht in Berlin) spielen die Hauptrollen in dem dritten Fernsehspiel über die Flucht aus dem Ghetto in der Frühphase der jüdischen Emanzipation: Eine junge Jüdin verläßt ihre jüdische Umwelt, folgt einem leichtsinnigen preußischen Werbeoffizier, konvertiert aus Liebeskummer und zerbricht schließlich an den persönlichen Konflikten: sie wird wahnsinnig. Die Sehbeteiligung des am 8 . 2 . 1 9 8 4 im Ersten Programm gezeigten Femsehspiels des Südwestfunks D A S S C H Ö N E IRRE J U D E N M Ä D C H E N , das mit seinem Titel ein positives jüdisches Stereotyp aufgriff und damit vielleicht auch Erwartungen weckte, lag bei 5 , 0 8 Millionen, war also anfangs halb so hoch wie im Kontrastprogramm des ZDF, w o in der gleichen Zeit zunächst eine Olympiasendung lief (AUFTAKT IN D E N ZDF-OLYMP: 10,75 Mio) und danach die Serie D E N V E R - C L A N , die die fast dreifache Zuschauermenge des A R D Fernsehspiels, nämlich 14,13 Mio, erreichte. Das Fernsehspiel geht auf zwei jener Lebensläufe zurück, die der Schauspieler, Theaterdichter und Unterhaltungsschriftsteller Christian Heinrich Spieß (1755-
13
Diese Wertung Mendelssohns als jüdischer Aufklarer wird in einzelnen jüngeren Forschungen zugunsten seiner Einschätzung als Wegbereiter und Ideologe der Assimilation zurückgedrängt (vgl. Azriel Sholet nach Bnier 1991,31), wogegen andere (z.B. Bruer 1991, 108-117) betonen, daß der in der deutschen Kultur lebende Mendelssohn trotz seiner Versuche, die jüdische Kultur mit dem Rationalismus in Einklang zu bringen, nicht vom Judentum abrückte, sondern bei aller Kritik an Amtsautoritäten offen für es eintrat. Vgl. auch Schoeps 1979, 128-146.
152 1799), Begründer des deutschen Schauerromans, gesammelt und gemäß seiner Vorrede in der Absicht nacherzählt hat, damit dem Leser ein vergleichbares Schicksal zu ersparen: Spieß, der drei Jahre vorher Biographien der Selbstmörder herausgegeben hatte, wollte mit seinem neuen Band Biographien der Wahnsinnigen129 (1795) nicht nur beim Leser Mitleid wecken, sondern "vorzüglich beweisen, daß es ... in unserer Macht steht, ähnliches Unglück zu verhindern"130 (was allerdings auf ihn selbst nicht zutraf: der Autor wurde wahnsinng). Nun interessiert uns die literaturgeschichtliche Seite, etwa die Typologie des Trivialromans der Spätaufklärung oder das Phänomen der Narrheit als "irritierendes Thema des sog. Vernunftzeitalters" weniger als die Frage, ob Judenfeindschaft des 18. Jahrhunderts thematisiert wird, die Opfer des Wahnsinns Opfer der Gesellschaft waren (wie W. Pomies vermutet)131, also die Psychologie des Wahnsinns ansatzweise in Gesellschaftskritik übergeht. Das aber ist bei der literarischen Vorlage schlichtweg zu verneinen. Die (Schauer-)"Geschichte der Esther L." (so der Originaltitel) benutzt das Judesein der Titelfigur nur für die Exposition: Die siebzehnjährige gebildete Tochter eines reichen jüdischen Kaufmanns verliebt sich in einen sie ebenso heftig begehrenden nichtjüdischen Offizier und entsagt ihm auf Wunsch ihres Vaters. Der Kaufmann stirbt, der Geliebte hat angeblich eine andere geheiratet. Die enttäuschte Jungfrau nimmt den Schleier und verspricht dem Kloster nach ihrem Tode ihr ererbtes Vermögen. Der Geliebte taucht wieder auf, die Novizin flieht mit ihm und heiratet protestantisch. Der Mann bringt in seiner Spielleidenschaft das gesamte Vermögen durch und stirbt in einem Duell. Die junge Schwangere wird von den um ihr Vermögen geprellten Nonnen gejagt, gefangengenommen, eingekerkert, man schafft nach der Geburt ihr Kind fort: sie wird wahnsinnig. Eine milde Fürstin - deus ex machina erbarmt sich ihrer und nimmt die seit Jahren umherirrende Wahnsinnige auf."Die Unglückliche ward nach einem halben Jahr krank, und eine heftige Lungenentzündung endete ihr Leben." Von einer "Begegnung des jüdischen mit dem christlichen Glauben", gar von einer Préfiguration des "Typ[s] der emanzipierten, der gebildeten Frau, die wenig später den Mittelpunkt der romantischen Schule machen sollte", wie Promies im Nachwort ausführt,132 kann keine Rede sein. Die Biographie konterkariert die vernunftoptimistische Vorrede: Entsetzen angesichts der fiktional gestalteten Wirklichkeit breitet sich aus, Mitleid via Horror wird propagiert, die prästabilierte Harmonie scheint auf schwachen Füßen zu stehen,133 aber all das ist nicht ausformuliertes ethisches Programm, sondern modisches Accessoire. Ganz anders nun das Fernsehspiel "nach Motiven [!] aus den Biographien der Wahnsinnigen", das wir schon im dritten Kapitel als einziges filmisches Beispiel
129 130 131 132 133
Spieß 1966, 88-181 Spieß 1962,7 Promies 1974, E, Sp. 176f. bzw. 1991, XV, 836f. Spieß 1966, 322 Vgl. M. Beaujeans 1980, 323f.
153 für die Marranenthematik angeführt hatten. Der Autor Dietrich Feldhausen behält die hanebüchene Story bei, aber er interpretiert sie sozialgeschichtlich. Er erzählt nicht von Esther L., sondern von der Jüdin Esther Lopez, die inmitten einer hier katholischen judenfeindlichen Umwelt lebt. Feldhausen, der auch der Drehbuchautor der bemerkenswerten Robert-Walser-Adaption DER GEHÜLFE (Regie: Thomas Koerfer) war, und der Regisseur Götz Fischer bemerken Judenfeindschaft, konkretisieren die Personen (sie haben Familiennamen, Titel und Berufe) und Handlungsorte (der Film spielt in Frankfurt, nicht in "F."). Ihnen geht es nicht um das Nacherzählen eines Schauerromans, sondern um das genaue Hinsehen, um die Schilderung eines Lebenslaufes in konkreten Situationen. So beginnt der Film mit einer eindringlichen Folge von Großaufnahmen über Esthers Vorbereitungen zum Schabbat und die gemeinsame Feier mit ihrem Vater. Doch er hebt die Einsichten in jüdische Lebenswelten immer dann wieder auf, wenn er wie schon gleich zu Anfang beim Zitieren der Vorrede von C. H. Spieß - zu sehr der literarischen Vorlage folgt oder wenn er in einem Stilgemisch die weitgehend realistisch erzählten Passagen mit Visionen der Esther kombiniert, die offenbar den später ausbrechenden Wahnsinn vorbereiten sollen, aber oft nur Karikaturen der Hofgesellschaften mit ihren hochgetürmten Perücken und überfahl geschminkten Grimassen sind - analog den grotesken Flügelhauben und schwarz geschminkten Larven der Nonnen. Beides paßt nicht recht zusammen: die in Genremalerei liebevoll-akribisch wiedergegebene Welt der jüdischen reichen Oberschicht und die in expressionistisch grellen Farben gemalten Karikaturen der sich spreizenden preußischen Aristokratie bzw. der bedrohliche, dämonische Reigen machtlüsterner Nonnen bei der judenfeindlichen Karfreitagsliturgie von 1570: "Lasset uns beten für die treulosen Juden." 1 " In ähnlicher Weise werden mit dem Stilmittel der Groteske die sich vor Belästigungen abschirmenden Herrscher wiedergegeben: Die auf einer riesigen Krinoline thronende Maria Theresia schützt sich bei der Audienz durch einen "Judenparavent", der ihr Antlitz vor den jüdischen Besuchern verbirgt, und Friedrich Π. entzieht sich seinen Bittstellern durch die Meute seiner kläffenden Windhunde. Fischers Inszenierungsstil verdeutlicht die Intention: dem Zuschauer die Gefahren und Versuchungen vorzustellen, denen sich das intakte voremanzipatorische orthodoxe Judentum in einer aggressiv judenfeindlichen Umwelt ausgesetzt sah, und es erkennen zu lassen, daß das Sichöffnen, d.h. die Aufnahme nichtjüdischer Elemente in seine bisher geschlossene, nicht erschütterte Glaubens- und Lebenswelt eine Existenzgefahrdung darstellt. Der Vater der Titelfigur, der sephardische reiche Jude Lopez, hat die Bildung der nichtjüdischen Umwelt, deren Umgangs- und Lebensformen amalgamiert und gibt sie auch unbedenklich seiner europäisch gebildeten, wie er perfekt deutsch sprechenden Tochter Esther ("Neue Noten aus Paris!") weiter. Dabei bleibt seine Glaubenswelt unangetastet, auch alle
134
Erst das Missale Romanum vom 26.3.1970 ersetzte nach mehreren vorangegangenen Korrekturen seit 1948 die antijudaistische Formel durch eine takt- und respektvolle Fürbitte. Textvergleich in Die Kirchen und das Judentum 1988, 56-60
154 Riten werden sorgsam beachtet. Äußerlich praktiziert die Tochter ebenfalls alle religiösen Gebräuche, singt und betet mit, wünscht "Gut' Schabbes", hat aber im Gegensatz zu ihrem Vater nicht die geringsten Bedenken, am Schabbat ins preußische Lager zu gehen und den treuen Hausknecht Wilhelm von den Soldaten fireizukaufen. In ihrer Liebe zu dem preußischen Grafen spielt ihre Religion keine Rolle, sie hat sich derart vom Judentum gelöst, daß auch die spätere Konversion zum Katholizismus sie nicht zu beschweren scheint. Erst im Klosterkerker entsinnt sie sich der Gebete ihres Vaters, betet hebräisch vor dem Kruzifix: Dir Irresein läßt sich als Folge ihres Irrewerdens an der Religion der Väter interpretieren. Die auch im Fernsehspiel als Motto zitierte Vorrede von C. H. Spieß ("daß jeder derselben [Unglücklichen] der Urheber seines Unglücks war, daß es folglich in unserer Macht steht, ähnliches Unglück [Abirren vom Glauben der Väter", D.P.] zu verhindern", scheint eine Tendenz des Films nahezulegen, den Akkulturationsprozeß der Emanzipation höchst kritisch einzuschätzen, die Umgestaltung religiöser Traditionen als eine Katastrophe zu deuten. Dies wird durch die krasse Sympathie- und Antipathieverteilung noch verstärkt: Die Vertreter der Aristokratie in Staat und Kirche werden bis auf den versagenden Helden Friedrich, der einen gebrochenen Charakter darstellen darf, negativ gezeichnet, die Juden positiv. Die sich vom Judentum abgewendet hatte, ist in Wahnsinn verfallen, der Vater, der unwillentlich diese Abwendungstendenzen gefördert hatte, gestorben; nur die treu zum Glauben stehenden Juden, die Symbolfiguren religiöser jüdischer Identität, leben noch: der brave Knecht und der gesellschaftlich wie geschäftlich nicht ganz so hoch gestiegene andere jüdische Kaufmann und Geldverleiher Jehoschua. Hatte er nicht den Freund Lopez vor der Assimilation und einer nicht talmudgemäßen Ausbildung der Tochter gewarnt: Ich sage dir, gib auf dein Estherle acht! ... Sollen sie sich küssen, sind junge Leute. Aber er is e Goj! Sie hat dir ersetzen sollen den Sohn. Nu, is es e Wunder, daß er is e Goj? Warum hast du dein Estherle nicht langst verheiratet! Sie hat studieren sollen Sprachen, sie hat machen sollen Musik, nu will se heiraten e Goj!
Eben dieser orthodoxe Jude ist es, der - folgerichtige Abwandlung der literarischen Vorlage, wo am Ende eine Aristokratin verklärend eingreift - in seiner Kutsche (mit dem braven Wilhelm auf dem Kutschbock) die irre alte Esther aufnimmt (ins Judentum zurückführt?): "Estherle, endlich - ich hole dich heim!" 6.2.2.6. Jüdische Figuren der Emanzipationszeit in der Programmform der Fernsehserie Läßt sich DAS SCHÖNE IRRE JUDENMÄDCHEN als emanzipationsfeindlich bzw. als den tragischen Abschirmversuch gegenüber sozialem Wandel interpretieren, so zeigt unser nächstes Beispiel ICH, CHRISTIAN HAHN die positive Rolle von Juden bei der Sozialisation eines nichtjüdischen Jugendlichen. Die Südwestfunkproduktion aus dem Jahre 1985 unterscheidet sich gattungsmäßig von allen anderen zur Zeit der beginnenden jüdischen Emanzipation spielenden TVStücken:
155 Sie ist eine im Vorabend- bzw. Nachmittagsprogramm gesendete Femsehspielserie - ein Genre, das allein schon wegen des Sendezeitpunkts als Teil des Zwei-Stunden-Werbeblocks vor 20 Uhr und wegen des Ausstrahlungsmodus (ICH, CHRISTIAN HAHN besteht aus 13 einmal wöchentlich gesendeten Folgen von je 23 Minuten Spieldauer) von der Fernsehkritik der Tages- und Wochenzeitungen nicht für voll genommen wird.135 Dagegen spielt das Genre bei der Fernsehforschung in Einzelanalysen und in übergreifenden Untersuchungen zu den Formen des Fernsehspiels - als Serie bzw. Familienstück - eine nicht unwichtige Rolle,136 zumal es auch für die Sender selbst als Teil des Werbeprogramms eine ergiebige Finanzierungsquelle ist. Familienserien im Fernsehen, deren Figuren die Personen einer Familie sind und deren Handlungsort primär die Familienwohnung ist, die sich zugleich aber auch an die Familie als Konsument richten, von den Großeltern bis zu den Enkeln rezipiert werden (sollen), deren Seid-nett-zueinander-Ideologie der Verklärung der - mit Adorno zu sprechen - "Familienbande" dient, erfreuen sich bei den Produzenten wie bei den Konsumenten in ihrer verharmlosenden Idyllenheiterkeit und mit ihren apolitischen Pseudokonflikten großer Beliebtheit. Die Zustimmung gilt auch jenen Varianten der Familienserien, die statt der Idylle den Kleinkrieg präsentieren, wo nicht das Gute, sondern das Ekel obsiegt. Die kritische Sozialwissenschaft und Publizistik sowie die engagierte Fernsehforschung konstatieren dagegen energisch die Defizite dieser konventionell gebauten Warenproduktion, werfen ihr de facto "eine ideologische und praktische Absicherung der bestehenden Produktions- und Verteilungsverhältnisse, Ordnungsund Machtstrukturen" vor.137 Nun ist sowohl bei den Fernsehserien des Frühabendprogramms nach 20 Uhr, die einen Querschnitt durch nahezu alle Berufssparten der besser Verdienenden vom Unternehmer bis zum Kreuzberger Rechtsanwalt und Trollinger trinkenden schwäbischen Pfarrer bieten, wie auch in den oft wesentlich kürzeren Vorabendserien inzwischen ein zumindest in programmatischen Erklärungen erkennbarer Wechsel in Richtung auf "Themen mit Widerhaken, Realitätsnähe und eine eingängige Sprache in Wort und Bild" angesagt; gefragt seien "Konzepte, die hinter dem menschlichen Einzelschicksal die bestimmenden Kräfte einer Gesellschaft und einer Epoche erkennbar werden lassen."138 K. Hickethier vermutet wohl zu Recht, daß die Sender ein solches neues Serienkonzept der
135
134
157 138
Weder verfassen die professionellen TV-Kritiker in der Regel darüber eine Rezension noch erscheinen Femsehserien dieses Umfangs in den Titellisten der Archive und Bibliotheken (Faustregel z.B. bei der DFFB: "Als Fernsehspiel gilt in unserer Kartei, was langer als eine halbe Stunde ist"). Zwar ermittelt die GFG-Femsehforschung die Sehbeteiligung bestimmter Vorabendserien, zu ICH, CHRISTIAN HAHN liegen jedoch keine Daten vor. Vgl. Die Unterhaltung der deutschen Fernsehfamilie 1971; Hickethier 1975, 136-168; Delling 1976, 46-77; Waldmann 1980, 112-132; Wichterich 1979; Waldmann/Waldmann 1980, 85-89; Durzak 1982, 74-79 Wichterich 1979, 16 Prager 1974
156 allgemeinen Thematisierung von sozialen Problemen wegen der großen ökonomischen Bedeutung des Vorabend-Werbeprogramms für die Einnahmen der Sender entwickelt haben, also am Konsum dieser Sendungen sehr interessiert sind und darauf dringen, durch die Hereinnahme sozialer Versatzstücke den Unterhaltungswert dieser Serien zu erhöhen.139 Jedenfalls greifen Serien seit den siebziger Jahren realistischere Alltagssituationen und sozialkritische Motive verstärkt auf, wobei die Mehrzahl von ihnen das dramaturgische Prinzip der ausschließlich individuellen Konfliktbewältigung beibehält, familiale Lösungsstrategien zum Modell für gesellschaftliche Prozesse erhebt. Daneben gibt es aber auch Ansätze, unter Beibehaltung des Familienrahmens Lernprozesse politischen Handelns als Einsicht in notwendige gesellschaftliche Veränderungen und Wandlungen eigener Einstellungen zur Überwindung von Vorurteilen gegenüber Randgruppen, Minderheiten und sozial Benachteiligten zu initiieren (Beispiele: Fassbinders ACHT STUNDEN SIND KEIN TAG, Michels UNSER WALTER). Wenn eine Vorabendserie wie ICH, CHRISTIAN HAHN nun einen Kleideijuden des 18. Jahrhunderts zum Sozialisationsagenten eines vierzehnjährigen Schneidersohns in einer süddeutschen Grafschaft macht (vgl. Foto Nr. 14), scheint das ein solcher impulssetzender "Widerhaken" zu sein. Wenn darüber hinaus die zentrale Obrigkeitsfigur dieser Serie, "unser gnädiger Herr Graf', als amouröser Tunichtgut und bankerotter Betrüger demaskiert wird, scheint die Serie sogar in den Bahnen des Beaumarchais zu wandeln. Andererseits bleiben die Versatzstücke der Familienserie bestehen: ausführliche Entfaltung kleinbürgerlichen Bewußtseins, Verengung des Gesellschaftsbildes auf die Familienperspektive, konservative Grundhaltung, Anpreisung von Harmoniestreben und Idylle, Typisierung der Figuren. Die 1985 von zwei erfahrenen Serienautoren, Hans-Georg Thiemt und Hans-Dieter Schreeb,140 verfaßte und vom Südwestfunk in Coproduktion mit der SRG hergestellte, mit z.T. namhaften Darstellern besetzte und von Detlef Rönfeldt inszenierte Serie fallt insofern aus dem Rahmen, als die Beschränktheit der beiden präsentierten Figurengruppen - der schurkischen Obrigkeit und ihrer Helfershelfer sowie der einfaltigen Untertanen - den Zuschauer zur kritischen Distanzierung von den verkündeten Maximen herausfordert. Als Identifikationsobjekte bieten sich für jüngere Zuschauer nur der Titelheld oder die eindeutig positiv gezeichnete, wenn auch von den Personen der Handlung zunächst nicht durchgehend so bewertete Figur des jüdischen Trödlers Blaustein an, die allerdings nicht in allen Folgen auftritt. Greifen wir zur Verdeutlichung der Position des vom Trödelhandel lebenden Juden im Figurenensemble die 5. Folge ("Die Verwirrung") heraus: Der vierzehnjährige Christian erhält von der angehimmelten gleichaltrigen Komtesse ein Zettelchen zugesteckt. Da er nicht lesen kann, will er's nun lernen, aber der Magister Kratz, der Leiter der Lateinschule, verlangt Schulgeld, das Christians Vater, der Schneidermeister Hahn, nicht ausgeben will. Als Christian
139 140
Hickethier 1980, 138-140 Netenjakob 1973, 261f.
157 vom Vater seines Freundes, dem Dekan, erfährt, daß er soeben mit dem jüdischen Trödler, dem "Sackjuden", eine "ersprießliche Disputation über geistige Fragen" hatte, will Christian den Juden bewegen, ihm Unterricht zu geben. Der wehrt mit dem Hinweis ab, er sei kein Lehrer. Erst als Christian den Trödler durch Diebstahl von dessen Esel zu erpressen versucht, dann Gewissensbisse kriegt und sich in eine lebensgefahrliche Situation begibt, aus der er noch einmal davonkommt, wendet sich das Blatt. Der Vater entschuldigt sich bei dem Juden, der beim Schneider einen neuen Kaftan bestellt und, gerührt vom Wissensdurst des Jugen, ihm kostenlos Unterricht zu geben verspricht. Nachdem die ersten vier Folgen das Klischee des Familienpatriarchen (nach dem Muster der Serien DIE FAMILIE HESSELBACH oder EIN HERZ UND EINE SEELE) ins 18. Jahrhundert verlegt haben und die Sozialkritik sich lediglich auf die Person des ständig in Geldnöten und Amouren verwickelten Grafen konzentrierte, ohne daß die Feudalismuskritik die Schwankelemente gefährdete, kommt in dieser 5. Folge eine Komponente hinzu, die die Serie in all ihrer Simplizität und Klischeehaftigkeit dennoch für die Abwehr von Antisemitismus durch Aufklärung im Rahmen einer Unterhaltungssendung geeignet macht. Denn trotz des Stereotyps vom armen und doch edlen, d.h. makellosen Juden wird die Figur des Blaustein in ihrer sozialen Stellung als am Rande des Dorfes lebender Trödler, ihrer Bewertung durch die Umwelt (Christians Vater: "Willst du uns zum Gespött der Leute machen? Zum Sackjuden rennt der. Wir sind Christenmenschen, wir haben mit denen nichts zu schaffen!" Christians Freund: "He, Jud! Wo bleibt deine Reverenz, Jud? Eine Jude muß einem Christenmenschen die Reverenz erweisen, dafür ist er ja Jude ...") und ihrem Aussehen (er trägt den Kaftan bzw. bei der Andacht den Gebetsmantel, vgl. Bilddokumentationsteil) zutreffend geschildert. Stereotype in der sprachlichen Präsentation sind auf ein Minimum reduziert (nur manchmal wird in typischer jiddischer Diktion das Verb vorgezogen: "Wenn er so nachjagt dem Wissen ..."). Die Figur des Blaustein folgt in einer niederen sozialen Schicht dem positiven Judenbild Gellerts und des frühen Lessing. Aus didaktischen Gründen wird Blaustein als charakterlich Höherstehender und als einziger Mann mit Durchblick gezeichnet, der positiv auf die christliche Umwelt einwirkt, die ihm in einer Mischung aus Respekt und Vorurteilen begegnet: Dekan: Ist ja erstaunlich dieser Sackjude... Ein Philosoph steckt in dieser Krämerseele. Lutz: Aber ein tückisches Wesen hat er. Dekan: Das will ich nicht hören, Lutz. Naja, er hat einen fremden Glauben und eine verschlossene Art. Aber tückisch - nein! Er ist ein belesener Mann.
Die Linie der erstaunten Wahrnehmung menschlicher Qualitäten bei Juden nach anfanglicher Ablehnung gemäß überlieferter Vorurteile setzt sich bei der Präsentierung der übrigen Juden der Serie fort. Jüdische Bezugsfigur des Grafen ist nicht wie bei den Dorfbewohnern der Trödler Blaufuß, sondern "der Jude" ist in seiner Perspektive ein Geldverleiher, ein Geldwechsler mit hohem Zinsfuß, der ihm "im Nacken sitzt", dem er "die letzten Kreuzer geben" müsse und den der Film auch ohne daß dabei das antijüdische Wucherstereotyp verwendet wird - bei seinen Geschäften zeigt. Juden sind es, die die Betrugsmanöver des Grafen aufdecken und
158 die Wende auch im Leben des vierzehnjährigen Christian Hahn bewirken: Der lernt einen jungen Kaufmann kennen, der in Frankfurt ein Bankgeschäft eröffnen will. Dieser sympathische junge blonde Mann in jüdisch-orthodoxer Kleidung (nach dem Gesetz der Familienserie tritt er als Blausteins Neffe auf) war im nationalsozialistischen Film neben Jud Süß die schlimmste antisemitische Hetzfigur, geradezu die Inkarnation eines jüdischen Kapitalisten (in der Sprache der Nazis: der "jüdisch-englischen Plutokratie"), nämlich der Seniorchef der Bankfamilie Rothschild.141 Die Einfuhrung des zwanzigjährigen Meyer Rothschild (17441812) in eine 1760 spielende Familienserie ist keine rationale Antisemitismusaufarbeitung, aber immerhin ein beachtenswertes Zeichen. Mitglieder der Bankiersfamilie Rothschild spielen auch eine Rolle in der ebenfalls für den Werbeblock des Vorabendprogramms produzierten, später in das reguläre Abendprogramm übernommenen Fern sehserie CHRISTIAN ROTHER BANKIER FÜR PREUSSEN von Wolfgang Kirchner.142 In den sieben von Peter Deutsch inszenierten 50minütigen Folgen entwirft der Autor ein Lebensbild des Präsidenten der Preußischen Seehandlung und faktischen Leiters des preußischen Finanzwesens, Christian Rother. Unter der Fachberatung von Wolfgang Radtke, des Verfassers des Standardwerks über die Preußische Seehandlung,143 schildert Kirchner die Karriere eines hohen preußischen Beamten in der Zeit des Vormärz und dessen offenbar fiktiven Nischen mit ihren Amouren und Querelen.144 Er verknüpft sie mit der Entwicklung der Königlichen Seehandlung, einer der beiden staatlichen Geldanstalten Preußens, und den Kontroversen um ihre Daseinsberechtigung zwischen 1818 und 1848. Kirchner bemüht sich, die besondere staatsrechtliche Stellung der Seehandlung als ein nur der Krone (Friedrich Wilhelm ΙΠ. und IV.) unterstehendes, dem Mitspracherecht der Volksvertretung aber entzogenes Institut herauszuarbeiten, deren Maßnahmen zur Verbesserung der ökonomischen Struktur Preußens deutlich zu machen und diesen wirtschaftspolitischen Komplex mit einer Spielhandlung zu verbinden. Dadurch will er die Aktivitäten der Seehandlung zur Förderung der Industrie sinnfällig machen und die ihrer Zeit weit vorauseilenden Maßnahmen der Seehandlung als das besondere Engagement Rothers herausstellen. Die offenbar aus dramaturgischen Gründen vorgenommenen Abweichungen von den in den Biographien Rachel/Wallichs und
141
142
143
144
DIE ROTHSCHILDS, Regie: Erich Waschneck, Deutschland 1940, vgl. Tabelle 3. 16mmStudienkopie im Deutschen Institut für Filmkunde, Wiesbaden. Erstausstrahlung als Vorabendserie im Regionalprogramm des SFB Mai u. Juni 1987, Wiederholung im Juni 1989 ab 20.15 Uhr in Eins plus Radtke 1981; ders. 1987. Vgl. auch; Ehrenberg 1925; Rachel/Wallich 1967, 200-272; Schnee 1961; Corti 1971; Trende 1938 Weder finden sich in der Literatur entsprechende biographische Daten noch entspricht das Kirchnersche Bild eines unwiderstehlichen Frauenliebhabers der Charakterisierung Rothers durch Radtke (1987,24): "unbestechlicher preußischer Beamter ... exzellenter Fachmann auf nationalökonomischem Gebiet, überzeugender Verhandlungsführer, unermüdlicher Arbeiter mit einer schier unerschöpflichen Arbeitskraft und immenser Produktivität".
159 Radtkes mitgeteilten Personen, Ereignissen und Daten erweisen sich für die Erzählweise einerfiktionalenSendung eher als vorteilhaft. Andererseits haben die Intrigen und Kabalen einen mehr privatistischen (der "Dallas"-Fernsehseriendramaturgie angenäherten) Zuschnitt. Der aus der Literatur zu gewinnende Eindruck von nationalen, ja übernationalen Transaktionen und politischen Entscheidungen stellt sich in der Fernsehserie etwas mühsam ein. Von den aus der amerikanischen Programmpraxis bekannten und auch die Programmformen in der Bundesrepublik beeinflussenden drei Hauptsparten der Fernsehserie, den auf einer Literaturvorlage aufbauenden "miniseries", dem dramatischen Rührstück der "soap operas" und dem "serial" mit seinen Merkmalen des gleichbleibenden Personals, Handlungsortes und des Zeitrahmens, ist CHRISTIAN ROTHER ebenso wie ICH, CHRISTIAN HAHN der letzten Gruppe zuzurechnen. Dieses Serial gehört trotz einer gewissen Affinität zur Darstellung privater Querelen nicht zu dessen privater Sonderform der "Familienserie", sondern läßt sich besser dem Sondertyp der "Dokumentarspielserie" zurechnen.145 Die gegenüber ICH, CHRISTIAN HAHN doppelt so lange Spieldauer der einzelnen Folge erlaubt eine differenziertere Plotentwicklung und Charakterdarstellung. Hatte schon ICH, CHRISTIAN HAHN auf affirmative Darstellung sozialer Konstellationen weitgehend verzichtet, sondern begonnen, den sozialen Alltag realistisch aufzuarbeiten, so verzichtet CHRISTIAN ROTHER vollends auf die Darstellung der Idylle einer heilen (Biedermeier-)Welt und der unkritischen Präsentation seines (Titel-)Helden. Sie zeigt Rother als Menschen in seinem Widerspruch, der in der Durchsetzung seiner politischen, technologischen und sozialen Ziele Zwängen unterliegt, Kompromisse mit der (bürgerlichen) Herrschaft macht und notwendige demokratische Prozesse nur verzerrt wahrnimmt. Leider wird bei den jüdischen Figuren der Fernsehserie von einer ähnlich differenzierten Darstellung wenig Gebrauch gemacht. Grundsätzlich positiv ist die Zeichnung von Mitgliedern der Rothschildfamilie zu bewerten, wenn man sie mit der Typologie des jüdischen Bankiers als "Ausbeuter des Volkes" in nationalsozialistischen Propagandafilmen vergleicht. Der Bankier war dort schon rein zahlenmäßig von allen Berufen am häufigsten vertreten (von zwölf jüdischen Hauptpersonen in antisemitischen Spielfilmen waren fünf Bankiers)146 und sollte offensichtlich Vorurteile von der Macht "der" Juden durch Beherrschung der Banken und von ihrer nur teilweise geglückten Assimilation verstärken. Hollstein hat in ihrer Untersuchung der NS-Stereotypisierung von jüdischen Figuren auf die Strategie des paarweisen Auftritts von Juden (ein assimilierter Jude wird von einem Ghettojuden akkompagniert) in Propagandafilmen mit dem Ziel der Demaskierung des "getarnten" (assimilierten) Juden hingewiesen.147 Offenbar wirkt die Furcht vor einer ähnlich diskriminierenden Darstellung auch in der CHRISTIAN ROTHER-Fernsehserie noch nach: Man wagt nicht, Nathan oder Amschel Mayer
145 146
Durzak 1982, 76f. Hollstein 1971, 186 Hollstein 1971, 188
160
Rothschild "jiddeln" zu lassen, wie man andererseits auch nicht Christian Rothers Logenbeitritt oder seine Förderung durch preußische Freimaurer in die Filmbiographie übernimmt (schließlich hatte Adolf Trende 1938 in eindeutig nationalsozialistischer Tendenz Briefe Rothers unter dem Titel Im Schatten des Freimaurer- und Judentums herausgegeben). Wie nicht anders zu erwarten war, finden sich keinerlei antisemitische Züge in den Szenen mit den beiden Rothschilds. Sie werden als fähige, kooperationswillige, verständnisvolle Finanzexperten vorgeführt. Auf Porträtähnlichkeit nicht nur im äußeren Erscheinungsbild wird verzichtet. Wohl wieder aus dramaturgischen Gründen werden nur zwei Kontakte Rothers mit auch nur zwei Mitgliedern der Rothschilddynastie vorgeführt.148 Die religiöse Dimension fehlt nahezu ganz; es geht aus den Szenen nicht hervor, daß die Rothschilds zu den ganz wenigen Hoffaktorenfamilien gehörten, die dem Glauben ihrer Väter treu geblieben waren und sich unermüdlich auch für das Wohl ihrer Glaubensbrüder einsetzten. Der für die "fünf Frankfurter" geradezu konstitutive, über die traditionelle Mischpokenverbundenheit weit hinausgehende Zusammenhalt der Brüder als einer der wichtigsten Gründe ihres Aufstiegs konnte schon deshalb nicht gezeigt werden, weil die Figur des Rother es in der Femsehserie immer nur mit einem Rothschild zu tun hat.149 Daß darüber hinaus die Freundschaft (nicht nur die achtungsvolle Geschäftsverbindung) zwischen Α. M. von Rothschild und Chr. von Rother zugunsten der Entfaltung von Freundschaften zwischen Rother und telegenen Frauen in der Fernsehserie ungestaltet blieb, kann nur mit Bedauern konstatiert werden. Außer den zwei Rothschilds läßt Kirchner noch eine dritte authentische Person jüdischer Herkunft auftreten: den Mitarbeiter ("Agenten") Rothers, August Friedrich Bloch. Er gehört zu den in allen sieben Folgen in zentralen Szenen auftretenden, dem Autor offensichtlich wichtigen Handlungsträgern. Auch hier wandelt Kirchner die Figur ab, entfernt alle als judenfeindlich mißzuverstehenden Züge und Daten: Aus dem "getauften Juden" macht er einen gebildeten, vornehmen Ashkenasi, der "den alten Glauben abgelegt" hat, aber selbstbewußt keinen Grund sieht, dem Willen des preußischen Königs zu entsprechen, "einen guten christlichen Namen" als Vorbedingung für die Nobilitierung anzunehmen (der historische Abraham Bloch hatte mit der Taufe die Vornamen August Wilhelm gewählt). Die Beziehungen des historischen Bloch zu Freimaurern entfallen ebenso wie Hinweise auf seine Vergangenheit als "verkrachter Spekulant und jahrelang lästiger Supplikant".150 Die Charakterisierung durch Radtke ("eine
148
149
150
Der historische Rother stand mit den Pariser, Frankfurter, Wiener und Londoner Rothschilds im Briefwechsel (vgl. Rothers Briefe bei Trende 1938). In der Forschung wird allerdings die Beziehung Rothers zu Mitgliedern der Rothschildfamilie unterschiedlich beurteilt: teils als "Schmeichelei" und "Freundschaftsversichemng" (Rachel/Wallich 1967, 203), teils als wiridiche "Freundschaft" (Radtke 1981, 295). Rachel/Wallich 1967, 268
161 äußerst schillernde Persönlichkeit")151 und Rachel/Wallich ("höchst gewandt und brauchbar, dabei sicher nicht ungebildet"152) benutzt Kirchner dazu, die Figur zwar wie in der Forschung als schillernd, loyal und klug, zudem ein bißchen geckenhaft hinzustellen, aber in seinen ökonomischen Zielvorstellungen als den in seinen Methoden unorthodoxen, dem Wirtschaftsliberalismus verpflichteten Neuerer gegenüber dem staatsdirigistischen Prinzipien huldigenden Rother gegenüberzustellen. Nirgends verfällt die Fernsehserie in antisemitische Stereotypisierung, aber sie eliminiert radikal auch jüdische religiöse Tradition, jüdisches Zusammengehörigkeitsbewußtsein, jüdische Familienbindung, jüdische Leidenserfahrung. Wäre nicht an relativ versteckten Stellen die Bemerkung gefallen, daß Bloch einmal wegen seines jüdischen Namens Schwierigkeiten gehabt habe und daß er es abgelehnt habe, sich taufen zu lassen, so könnte er als beliebiger, eleganter, attraktiver, gut zu Pferde sitzender und ewig junger Bonvivant der Biedermeierzeit gelten. Der im Ansatz richtige Verzicht auf die Zuordnung Blochs zu angeblichen jüdischen ("Rasse"-)Merkmalen, das Kappen aller geschichtlichen und theologischen Bezüge und die völlige Herauslösung aus seiner Familie erschweren es dem Betrachter, in Bloch die Figur eines aus dem Judentum ausgetretenen, akkulturierten Zeitgenossen der Emanzipation zu erkennen.153 6.2.2.7. Die Instrumentalisierung jüdischer Banditen zur Verstärkung von Judenfeindschaft: AKTENMÄSSIGE NACHRICHT VON DER WIDER JOHANN CHRISTOPH KROP ANGESTELLTEN UNTERSUCHUNG UND DESSEN VERURTEILUNG Die positive Zeichung von (edlen) Juden der Fernsehserien ICH, CHRISTIAN HAHN und CHRISTIAN ROTHER mag dem Genre des Familienstücks und dessen schlichter Figurenzeichnung entlehnt sein. Sie gleicht der Gestaltung des Shylock durch den bedeutenden jüdischen Schauspieler Ernst Deutsch, der nach seiner Rückkehr aus der Emigration den Nathan, den Profesor Bernhardt kreierte und - 1957 - Shakespeares Juden in Venedig als einen "sympathieweckenden, gleichsam im Wege der Wiedergutmachung"154 korrigierten Antibösewicht spielte. Aber es gab, wie Hans Meyer überzeugend darlegt, neben den Hoffaktoren auch die "kleinen Leute unter den Juden": die Trödler, Hausierer und Schwindler, neben den Hofjuden auch die jüdischen Hehler; seit dem Barockzeitalter war ein gesellschaftlich dreigeteiltes Bild von Juden vorherrschend: des Hofjuden, des
151 152 153
154
Radtfce 1981, 343 Rachel/Wallich 1967, 296 Auch in seinem "Buch zum Film" (Kirchner 1987), mit dem Kirchner bei der Mehrfachverwertung seines Textes das Drehbuch zu einem fiktiven Tagebuch Rothers umgearbeitet hat, werden die Typen der drei jüdischen Finanziers und Börsenfachleute Nathan Rothschild, Amschel Mayer Rothschild und August Friedrich Bloch nicht dazu verwendet, Problembewußtsein über die Lage von Juden der Emanzipatìonszeit zu wecken. Meyer 1981, 329
162 Kleinbürgertums im Ghetto und der "undurchdringliche^ deutsch-jüdischefn] Unterwelt."155 Poliakov beschreibt das Auftauchen von jüdischen Banditen als eine Ausnahmeerscheinung, aber doch als ein "zutiefst charakteristisches und seltsames Phänomen", das die Außenseiterrolle, die Pariastellung und die Doppelexistenz von der Gesellschaft Paroli bietenden Juden belegt, die am Tag meist ein geregeltes Leben führten, des Nachts (aber nie am Schabbat und an den jüdischen Festtagen!) Raubzüge in rein jüdischen oder in "jüdisch-christlichen" Banden mit ihrer Sondersprache, dem Rotwelsch der Gauner, unternahmen.156 Katz interpretiert dagegen den jüdischen Betrüger und Verbrecher als den Typ des "gescheiterten Juden", der - ähnlich dem zum Christentum Übergetretenen - oft keiner Gemeinde mehr angehört und deren Normen als für sich nicht mehr gültig betrachtet.157 Ähnlich stellt ihn Graupe in seinem Kapitel "Auflockerungserscheinungen im 17. Jahrhundert" in die Nachbarschaft der Betteljuden, die kein Niederlassungsrecht in der Gemeinde oder im Territorium hatten.158 Einer im 20. Jahrhundert spielenden Variante dieser jüdischen Banditen werden wir in dem LeoneFilme ONCE UPON A TIME IN AMERIKCA begegnen. Doch vorerst bleiben wir im 18. Jahrhundert. Ob es sich um die ökonomisch stärkste oder um die sozial am tiefsten stehende Gruppe, um Hoffaktoren oder Banditen handelte, beide besaßen nach Scholem eine "Gemeinsamkeit": Sie "hatten mit den Deutschen auf eine in beiden Fällen lebensgefährliche Weise zu tun."159 Die "Arbeitsmethode" jüdischer Banditen läßt sich etwa im Gegensatz zu anderen Räubern und Verbrechern im Deutschland des 18. Jahrhunderts - wie folgt beschreiben: Mit der Ausbildung der Kleinstaaten in Deutschland im 18. Jahrhundert, mit der Häufung von Grenzen, die zu überschreiten waren, bildeten sich offensichtlich jüdische Banden heraus, die "grenzüberschreitend arbeiteten", die sehr weit entlegene Möglichkeiten für ihre Beutezüge ausmachten, bis dorthin ausschwärmten, interessanterweise nicht für den eigenen Bedarf stahlen - das war bei christlichen Banden noch sehr viel häufiger - sondern die Beute ab Ware betrachteten und richtig nach kaufmännischen Geschäftsprinzipien überlegten: Was haben wir an Unkosten, was haben wir an Auflagen, wieviel kommt letztendlich für jeden dabei heraus? Es waren, so sagt man, hauptsächlich Banden, die - wenn es irgend ging - keine Gewalt gegen Personen anwandten, sondern die ausschließlich und gezielt auf eine möglichst ertragreiche Beute aus waren. Es ist sehr interessant, wenn man dagegen die christlichen Banden sieht: Sie sind fast zunftmäßig organisiert, sie haben genaue Rituale und auch Gesellenprüfungen, bis jemand richtiges selbständiges Mitglied sein darf. Dann haben sie eine Hierarchie: Der Oberste hat absolut das Sagen, dagegen kann kein Widerspruch erhoben werden. [Und die jüdischen Banden waren dagegen demokratischer?] Ja, wenn man so will, so ist es. Übrigens hat man sich vereinzelt für bestimmte Zwecke christliche Hilfsdienste geholt; aber in der Regel machte man es selber.
155 156 157 158 159
Meyer 1981, 328, 330 Poliakov 1978, II, 133f Katz 1986, 37 Graupe 1977, 41f. Scholem 1982, 23
163 Dieser Text stammt nicht aus einem Printmedium über jüdische Banden in der Zeit der Emanzipation, sondern wird in dem 1984 von Rainer Horbelt inszenierten SFB-Fernsehspiel AKTENMÄSSIGE NACHRICHT VON DER WIDER JOHANN CHRISTOPH KROP ANGESTELLTEN UNTERSUCHUNG UND DESSEN VERURTEILUNG gesprochen.160 Er ist eines der vier Interviews, die die Historikerin Stefi Jersch-Wenzel im Verlauf der Handlung dem ständig die Spielszenen kommentierenden Moderator gibt. Das Dokumentarspiel benutzt die Texte einer 1774 erschienenen gleichnamigen Chronik ("Actenmässige Nachricht von der wider Johan Christoph Krop angestellten Untersuchung...") zur Rekonstruktion eines historischen Mordfalls in Form von Lokalterminen mit Polizisten der Bundesrepublik, einem Kommentator und kostümierten Schauspielern: Am 30. Mai 1773 waren in Lemgo ein Gastwirt, seine Frau und seine Magd ermordet aufgefunden worden, und das Fernsehspiel versucht nun, in nachgespielten Szenen an historischen Plätzen, durch Expertenbefragungen, Tatortbesichtigungen, Statements der von Schauspielern dargestellten Zeugen und Mutmaßungen eines im heutigen Straßenanzug zwischen den historischen Figuren agierenden Moderators über den Hergang der Tat die Motive für die Mordanklage gegenüber dem Bettler und Vagabunden Johann Christoph Krop herauszuarbeiten. Dieses Puzzle eines über zweihundert Jahre zurückliegenden Kriminalfalls konzentriert sich nicht auf die beliebte Krimifrage: "Wer war der Täter?", sondern die filmische Rekonstruktion eines Kriminalprozesses, bei dem die Akteure den Wortlaut der Chronik von 1774 benutzen, der Darsteller der Titelfigur aber wiederholt aus seiner Rolle schlüpft, indem er z.B. den Gebrauch von Folterwerkzeugen demonstriert und sich dabei mit dem alle Szenen begleitenden, sie unterbrechenden und kommentierenden Moderator unterhält, hat andere, didaktische Intentionen: Das Fernsehspiel will begründen, daß der in schlechte Gesellschaft geratene Krop wegen der im Lippeschen Lemgo grassierenden Judenfeindschaft den ermittelnden Behörden als Mörder willkommen war. Denn Krop sah - nach dem Wortlaut der Chronik - "einem Juden sehr ähnlich und hat alles Böse der jüdischen Denkungsart an sich." (Auf die Visualisierung einer solchen rassistischen Stereotypisierung läßt sich das Femsehspiel nicht ein.) Der Tatverdächtige wird mit jüdischen Banditen in Verbindung gebracht und die Existenz eines marginalen jüdischen Banditenwesens zur Verstärkung des Antisemitismus instrumentalisiert. Die AKTENMÄSSIGE NACHRICHT mit ihren in den Handlungsablauf eingefügten Historikerbefragungen über Hofjuden, Schutzjuden, Betteljuden und jüdische Diebesbanden zeigt die lebensgefährliche Wirkung antisemitischer Vorurteile (Krop wird am Ende hingerichtet). Sie ist ein Dokumentarspiel über die Situation der Juden, bevor die Emanzipation in Lippe greift. Sie konterkariert die zu Beginn zitierte "Moral" der zeitgenössischen Chronik, "den gemeinen Mann zu warnen, sich vor alle Gemeinschaft mit bösen Leuten und Diebesrotten, vor
Die AKTENMÄSSIGE NACHRICHT lief nur in der "Nordkette" der Dritten Programme, deren Sendungen nicht zur Erhebung von Einschaltquoten und Sehbeteiligung erfaßt werden.
164 allem Juden, sorgfaltig zu hüten." Obwohl - außer in eingeblendeten zeitgenössischen Illustrationen - keine Juden als Fernsehspielfiguren präsentiert werden, stehen sie doch im Laufe des Dokumentarspiels plastisch vor Augen, auch die jüdischen Banditen, obwohl sie eine mehr marginale Rolle spielen (im zweiten Teil des Fernsehspiels wird Krop verdächtigt, Mitglied solcher jüdischen Diebesbanden zu sein, beschuldigt seinerseits die Juden, und die Chronik berichtet über das Treiben einer solchen Judenbande). Wenn in zwei fiktionalen und fiktiven Szenen des Schlußteils Philipp August, der Fürst zu Lippe, auftritt und dem Magistrat von Lemgo eine fiskalische Strafe auferlegt, weil gegen seine ausdrücklichen Anweisungen die Chronik einen Passus über die "Schädlichkeit und Bosheit der Juden" enthält, so macht diese Sequenz deutlich, welch hoch geschätzte Einnahmequelle die Schutzgelder und zahlreiche andere von den Juden geforderten Abgaben für die Obrigkeit waren. In keinem anderen Fernsehspiel über die Vorformen und Anfange der jüdischen Emanzipation sind die wirtschaftlichen Faktoren der staatlichen Judenpolitik auf der einen und die Vorurteilsstrukturen der Bevölkerung gegen die Juden auf der anderen Seite in ihrer Verwobenheit so entfaltet worden wie in diesem Dokumentarspiel. Seine aufklärerische Wirkung darf allerdings wegen seiner dem durchschnittlichen Fernsehpublikum ungewohnten, gewisse intellektuelle Anforderungen stellenden Dramaturgie wohl nicht überschätzt werden. 6.2.2.8. Eine Literaturadaption über jüdisches Leben der Voremanzipationszeit: DIE JUDENBUCHE Vier Jahre vor seiner AKTENMÄSSIGEN NACHRICHT - 1980 - hatte Rainer Horbelt mit seinem Fernsehspiel DIE JUDENBUCHE schon einmal einen Kriminalfall aus dem Westfalen des 18. Jahrhunderts für das Fernsehen bearbeitet. Der Autor und Regisseur war dabei ähnlich vorgegangen: Er hatte den von ihm gekürzten Text seiner literarischen Vorlage, der Novelle der Annette von DrosteHülshoff, weitestgehend im Wortlaut belassen und den Handlungsablauf durch informierende Texte unterbrochen, hier allerdings nicht durch die Statements einer Professorin, sondern durch Dialoge zwischen der Droste und dem mit ihr befreundeten Levin Schücking als Handlungsfiguren. Durch milieugetreue Inszenierung von Alltagsverrichtungen wie Kühetränken und Brotbacken im originalen Kolorit (die Innenaufnahmen waren fast ausschließlich im Westfälischen Freilichtmuseum entstanden) war es ihm gelungen, die inneren Vorgänge des Drosteschen " Sittengemäldes aus dem gebirgichten Westfalen" mit der Anschauung der äußeren Vorgänge in Übereinstimmung zu bringen. Wie in der AKTENMÄSSIGEN NACHRICHT ist auch in der Judenbuche von einer Judenbande die Rede. Der Mord an einem Juden, die Solidarität von Juden mit der Witwe des Erschlagenen, der Kauf der Buche, unter der man den Ermordeten gefunden, durch Juden, die Einkerbung der hebräischen Inschrift, der Titel der Novelle - diese Aspekte scheinen es jedoch nicht zu rechtfertigen, Annette von Drostes Prosawerk als eine Arbeit zu interpretieren, die ihren Rang
165 primär aus der jüdischen Thematik herleitet. In der Literaturgeschichte wird häufig unter Rekurs auf den katholischen Glauben der Autorin - vielmehr bei der Judenbuche auf die christlich-moralische Ebene in der inneren Struktur der Erzählung hingewiesen, auf die Abhängigkeit menschlicher Existenz von außermenschlichen Mächten, auf die Interpretation des Menschen als sittlichreligiöses Wesen, das zum Mörder werden kann, wenn es seine Bindung an Gott verliert. Erst dann wird von der "Kette aus erbbiologischen, sozialen und psychologischen Faktoren" gesprochen, die den Mord des Friedrich Mergel erklären.161 Gert Sautermeister differenziert noch stärker: Er deutet die Erzählung in ihrer Verknotung widersprüchlicher individueller, gesellschaftlicher und metaphysisch-magischer Schuldzuweisungen als "Bewußtseinsspiegel einer Zeit, die den gesellschaftlichen Lebensweg des Individuums mit divergierenden hergebrachten und modernen, irrationalen und rationalen, religiösen und sozialen Deutungsmustern zu begreifen sucht."162 Diese Vielschichtigkeit kann das Fernsehspiel nur reduziert widerspiegeln. Es akzentuiert geradezu die voremanzipatorische Befindlichkeit von Juden, indem alle im Droste-Hülshoff-Text enthaltenen Judenpassagen nicht nur ungekürzt übernommen, sondern im Fernsehspiel entfaltet werden. Was bei der Droste allenfalls ein Schlaglicht auf antijudaistische Vorurteile wirft, nämlich die negative Kollektivhaltung des Dorfes gegenüber den Juden als "Schelme" und "Betrüger", wird bei Horbelt zu Bild- und Textpassagen geweitet, die antisemitische Einstellungen breiter Bevölkerungsschichten belegen und erläutern, etwa durch einen zusätzlichen Dialog zwischen Margaret Mergel und ihrem Sohn Friedrich: Friedrich: Und vom Aaron, was sagt sie [die Hülsmeyer, D.P.] vom Aaren? Margaret: Dem elenden Juden? Na, Schulden haben sie bei ihm, das ganze Dorf über hundert Taler und über Jahresfrist. Friedrich: Warum schimpfen sie alle über den Juden? Er kauft ihr Holz, er leiht ihnen Geld, wenn sie es brauchen. Margaret: Und doch ist er ein Jud, ein elender Blutsauger!
Andere Ergänzungen sind das Skandieren der Verbalinjurie "Saujud! Saujud! Saujud!" durch die Hochzeitsgäste, als Aaron den Friedrich zum Bezahlen der ausstehenden zehn Taler für die ihm verkaufte Uhr auffordert (vgl. Foto Nr. 15), oder das bittere Statement eines jüdischen Trauergastes über die nahezu ausweglose Situation von Juden als Untertanen des Landesherren und Gläubiger von Christen. Differenzierter als in der Vorlage wird auch die Figur des Freiherrn von Haxthausen (bei der Droste: "Herr von S.") im Verhältnis zu seinem "Schutzjuden", dessen Angehörigen, Freunden und Dienern gezeichnet. Der Freiherr weiß sich sehr wohl für sie verantwortlich, versteht ihre Gebräuche, z. B. ihren Beerdigungsritus, aber besteht bei ihrer "bürgerlichen Verbesserung" auf Durchsetzung seiner obrigkeitlichen Normen: "Ich will, daß sie sich an unsere Gesetze halten." Die Adaption der berühmten Novelle, die ja ihrerseits die 161 162
Walbiner 1973, S. XXVII Sautermeister 1985, 94f. Vgl. auch Ewig 1989, 877f. bzw. 1964, Sp. 104-106
166 Bearbeitung einer Chronik nach Gerichtsakten ist, durch das Fernsehen macht deutlich, daß die in Verwirrung geratenen Begriffe von Recht und Unrecht auch im Kontext der jüdisch-deutschen und jüdisch-christlichen Beziehungen gesehen werden müssen. Daß darüber hinaus die Präsentation der jüdischen Figuren frei sowohl von antijudaistischen wie philosemitischen Stereotypen ist, erhöht die Relevanz des Fernsehspiels für die Aufarbeitung der jüdisch-christlichen Begegnungsgeschichte erheblich. Allerdings wohl nicht im Interesse des Filmemachers lag es, die als abgesonderte ethnische und religiöse Gruppe charakterisierten Juden von dem Odium des Geheimnisvollen und Fremdartigen zu befreien. Wenn Aarons Witwe in der Gebetsversammlung der wegen eines Gewitters furchtsamen Christen auftaucht, so beten diese gerade den Anfang des Johannesevangeliums. Sie beten es zwar nicht in einer antijudaistischen Weise als Dokument der Trennung zwischen Juden und Christen. Aber wenn die den Kreis nicht betretende, an der Tür lehnende Jüdin "Gerechtigkeit!" für ihren Mann fordert, so erscheint ihre Interpretation von Gerechtigkeit, wie sie sich durch Gestik und Sprachduktus ausweist, als eine andere Gerechtigkeit denn die der Christen. Und die hebräische Inschrift an dem Schicksalsort der Judenbuche ("Wenn du dich diesem Ort nahest, so wird es dir ergehen, wie du mir getan hast") wird zum Bannfluch eines alttestamentarischen Rachegottes, der "Auge um Auge, Zahn um Zahn" fordert. Dies um die Dimension der Liebe und des Erbarmens verkürzte und verfälschte Gottesbild als Widerspiegelung christlicher Fehlinterpretation des Judentums wird im Fernsehspiel nicht korrigiert. Insofern zeigt es auch die Einkerbungen der Vergegnungsgeschichte von Juden und Christen. 6.2.2.9. Auswirkungen der Revolution von 1848 auf jüdisches Leben Die jüdische Emanzipation ist keineswegs der einzige Emanzipationsvorgang im 19. Jahrhundert, und sie steht im Zusammenhang mit politischen und sozialen Entwicklungen der Gesamtgesellschaft.163 Dies läßt sich an der Revolution von 163
Rünip (1987a, 44-46) verweist auf Heine, der 1828 die Emanzipation der Frankfurter Juden in eine Reihe mit allen unterdrückten Völkern, ja mit der sich 1789 von der Aristokratie losreißenden ganzen Welt stellt. Der Terminus "Emanzipation" wurde sogar gegen die JE verwendet, wenn z.B. 187S der Antisemit Viktor von Istóczy zur "Emanzipation der Ungarn" als "Befreiung Ungarns von der [angeblichen, D. P.] Eroberung durch die Juden" aufrief (Elbogen 1967, 18S) oder der preußische Abgeordnete von Thadden statt der JE die "Emanzipation der Christen vom Judentum" forderte (Sterling 1956, 122; siehe auch Holoczek 198S, 131, der JE als "Folgeproblem der bürgerlichen Gesellschaft" interpretiert und den Begriff "Emanzipation" schon ab 1820 als Terminus technicus für die "Kennzeichnung des neueren Geschichtsprozesses der Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft" verwendet sieht). Differenzierter muß dagegen die negative Charakterisierung der Juden durch Karl Marx gesehen werden, die z.B. als "Abrechnung mit seiner Vergangenheit [...] und mit sich selbst" verstanden wurde (Poliakov 1987, VI, 235). Wenn Marx "die Emanzipation vom Schacher und vom Geld, also vom praktischen realen Judentum" postulierte und erklärte, die JE in ihrer
167
1848 darlegen. Die unmittelbaren Ereignisse des für die jüdische Emanzipation so hochbedeutsamen Jahres 1848 wurden nicht in einem Film oder Fernsehspiel gestaltet, weder der Barrikadenkampf für Demokratie, Freiheit und Gleichheit in Berlin und Wien, an dem der Blutzoll von Juden, gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil überproportional hoch war,164 auch nicht die so heftigen Judenverfolgungen des gleichen Jahres, noch das Praktizieren des Prinzips der Gleichheit 1848/49 im Parlament der Frankfurter Paulskirche, wo fünfzehn bzw. siebzehn Männer jüdischer Abstammung, unter ihnen der Vizepräsident Dr. Gabriel Riesser, mitarbeiteten165 und wo die "revolutionäre Emanzipationsgesetzgebung"166 zur Verabschiedung der Grundrechte des deutschen Volkes mit dem Artikel V ("Durch das religiöse Bekenntnis wird der Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte weder bedingt noch beschränkt") führte. War schon die gesamte Epoche des Vormärz bis auf einige Szenen in den beiden Fernsehspielen über Heine ausgeklammert worden, so blieben auch die Auswirkungen der Revolution des Jahres 1848 auf das europäische Judentum in Spielfilmen und Fernsehspielen ungestaltet: etwa die Rückschläge in Preußen, dann 1867 die Annahme einer Resolution gegen die Diskriminierung aus religiösen Gründen und schließlich die Verabschiedung des Gesetzes des Norddeutschen Bundes vom 3. Juli 1869 ("Alle noch bestehenden, aus der Verschiedenheit des religiösen Bekenntnisses hergeleiteten Beschränkungen der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte werden hierdurch aufgehoben"). Dennoch können wir nun am Ende dieses Kapitels drei Fernsehspiele nennen, in denen mittelbar die Auswirkungen der Revolution von 1848 auf jüdische
164
1(3
166
letzten Bedeutung sei "die Emanzipation der Gesellschaft [bzw. "der Menschheit"] vom Judentum", so steckt hinter dieser Polemik die Einbindung der "Judenfrage" in die Frage nach der Stellung des Menschen im Staat und der bürgerlichen Gesellschaft; aber noch nicht thematisiert wird der Gedanke einer Überwindung des Kapitalismus zugunsten einer Gesellschaftsform, für die der "Wechsel" als der "wirkliche Gott der Juden" keine Relevanz mehr zu haben braucht (Marx 1957, 347-377). Zumindest umstritten sei demnach, ob in der frühen Marxschrift Kapitalismus und Judentum gleichgesetzt werden oder nicht vielmehr (ansatzweise) Kaptalismus und Christentum (Clausen 1987, 69). Z.B. waren mindestens 10 der 231 in Berlin gefallenen Barrikadenkämpfer Juden (Grab 1991, 111). Das politische Engagement von Juden ab 1848 für die rechtliche Gleichstellung läßt sich an der Zahl von 750 deutschen Juden in Parlamenten, Stadtverordnetenversammlungen, staatsbürgerlichen Vereinen u.ä. gut ablesen, ebenso wie an der Zahl von mindestens 130 Juden ab aktiven Teilnehmern an bewaffneten Zusammenstößen, ohne daß dies natürlich ein Indiz für die Bejahung der Revolution durch die Mehrheit der Juden ist (Touiy 1966, 47f.). Auch schwankt die Bewertung der Juden von 1848 hinsichtlich ihres Einflusses auf die Demokratisieningsprozesse. Z.B. beurteilt Elbogen die politische Aktivität der Juden, anders als nach ihm Grab, wesentlich zurückhaltender: "Juden als Väter der Revolution" hinzustellen, sei eine "spatere judenfeindliche Legende" und "Ubertreibung" (Elbogen 1967, 38f.). Auch Sterling weist auf den Wunsch der meisten jüdischen Liberalen nach Ruhe, Ordnung und Stabilität sowie die Tendenz hin, Freiheit nur auf den gesetzlich offenstehenden Wegen zu erreichen (Sterling 1956, 48). Rürup 1987a, 34
168 Figuren dargestellt werden. Als erstes gehört dazu der von Dieter Berner inszenierte vierteilige SWF-Fernsehfilm LENZ ODER DEE FREIHEIT (Buch: Hilde Berger und Dieter Berner), der bei der Erstausstrahlung 1986 je nach Fernsehfolge eine Sehbeteiligung zwischen 4,3 und 8,4 Millionen hatte.167 Dieser Film schildert den Verlauf der Badenschen Revolution, der einzigen vorübergehend erfolgreichen demokratischen Revolution in der deutschen Geschichte, die Ereignisse um den Versuch, eine Volksregierung aufzustellen, die scheitert, weil wie Stefan Heym, der Autor der literarischen Vorlage, meint - die Revolution zu spät versucht habe, zur Verteidigung der Freiheit eine Diktatur zu errichten,168 während sie doch wohl deshalb scheitern mußte, weil von Anfang an die Übermacht von Österreich und Preußen zu groß war.169 Nun geht es dem Fernsehspiel weniger um die Vorführung eines Kaleidoskops der badenschen Revolutionsprominenz als um die Spiegelung der Ideen von Revolution und Emanzipation (im weiteren Sinne) in den Köpfen und Herzen vorwiegend fiktiver Gestalten (auch die Titelfigur Lenz ist trotz ihrer Flucht aus der eingeschlossenen Festung Rastatt keine Carl-Schurz-Kopie, sondern in ihr fließen verschiedene, auch nicht-prominente Figuren zusammen)170. LENZ ODER DIE FREIHEIT ist eine Literaturadaption. Sie folgt dem gleichnamigen Roman von Stefan Heym, der 1933 als Sozialist und Jude Nazideutschland verlassen mußte und den Roman 1964 in London unter dem Titel The Lenz Papers, in der DDR 1963 als Die Papiere des Andreas Lenz. Roman und schließlich 1965 in München unter dem Titel Lenz oder Die Freiheit. Ein Roman um Deutschland veröffentlichte.171 Besonders die letzte Titelfassung deutet an, daß es dem Autor in seinem Roman nicht um die als Verbindung von fiction and facts verfaßte Gestaltung eines nur badischen Ereignisses ging, sondern er verstand sein Buch als "ein gesamtdeutsches, wenn nicht europäisches [Ereignis zum] Themenkomplex Freiheit-Revolution-Diktatur-Sozialismus-Demokratie"172; es ist aber auch ganz wesentlich "Teil der Auseinandersetzung des Schriftsteller S. H. mit seiner Zeit und daher, das geht Hand in Hand, mit sich selber."173 Deshalb ist es nicht lff?
168 169
170 171
172 173
Teil 1 AUFBRUCH, 5.10.86: 6,03 Mio (ZDF-Kontrast: MELODIEN FÜR MILLIONEN: 15,27 Mio); Teü 2 AUF MESSERS SCHNEIDE, 8.10.: 8,37 Mio (ZDF: 1. KENNZEICHEN D: 4,93 Mio, 2. RETTE MICH,WER KANN: 9,33 Mio); Teil 3 KLARE FRONTEN, 12.10.: 4,95 Mio (ZDF: 1. GUSTL BA YRHAMMER in WEISSBLAUE GESCHICHTEN: 17,86 Mio, 2. HEUTE: 11,87 Mio); Teü 4 DIE EIGENE HAUT, 19.10.: 4,30 Mio (ZDF: 1. KEIN ALIBI FÜR EINE LEICHE: 18,45 Mio, 2. DENVER-CLAN: 13,53 Mio) Heym 1986, 12 Vgl. das Studiogesprach der Historiker Th. Nipperday, E. Jäckel, M. Stürmer, H.-U. Wehler, des Literatur- und Medienwissenschaftlers Th. Koebner und des Produzenten G. Rohrbach unter Leitung von P. Schulze-Rohr vom SWF am 17.4.88 in "Eins plus" anläßlich der Wdh. des Fernsehspiels; ferner: Riihrup 1987a, 46-92 Fenske 1986, 110 Seitenangaben nach der Lizenzausgabe der Büchergilde Gutenberg, Frankfurt/M., Wien, Zürich 1966 Heym 1986, 10 Heym 1988, 665f.
169 von ungefähr, daß zwei wichtige Personen seines vielfigurigen Romans Juden sind. Im Zentrum des Buches steht die Titelfigur, der revolutionäre Soldat Lenz, zwischen zwei Frauen: Josepha, der Dirne aus dem Volk, und Lenore, der gebildeten Tochter des jüdischen Bankiers Einstein. Die Entwicklung des Soldaten Lenz - akkompagniert von den historischen Köpfen der badischen Revolution (Becker, Brentano, Goegg, Gustav und Amalie Struve, nicht zu vergessen Friedrich Engels) sowie den Gegenspielern, Mitläufern, Überläufern, Unentschlossenen, Zuschauern, den gegnerischen Heeren und Volksvereinen - findet ihre Entsprechung in der Entwicklung des Bauernsohnes Christoffel: beim ersten die politische Ernüchterung eines Idealisten, beim zweiten die politische Bewußtwerdung.174 In eben diesen Zusammenhang gehören die beiden jüdischen Figuren des Romans und des Fernsehspiels (denn Dieter Berner verzichtete in seiner Literaturadaption auf radikale Änderungen, sah seine "Hauptaufgabe ... in Kürzung und Neustrukturierung für vier [ursprünglich drei, D. P.] Filmteile" 175 ). Stefan Heym identifiziert sich nicht mit einem orthodoxen oder liberalen religiösen Judentum, er gehört zu jener seit der Emanzipation gewachsenen Mehrheit, für die das Judentum anscheinend ohne Bedeutung ist, die sich nur als dem Judentum entstammend versteht.176 Aber er gehört zu den Autoren, die die Erfahrung jüdischen Exils und die Behinderung intellektueller Arbeit durchlitten haben und diese Erfahrung in ihre Bücher, Aufsätze und Interviews einbringen,177 so auch in seinen Lenz-Roman. Heyms Roman und das ihm folgende Fernsehspiel gestalten nicht die mühselige Emanzipation der Juden in Baden, ihre rechtliche und soziale Lage, erinnern nicht an die Hep-Hep-Bewegung von 1819 und die reaktionären Gegenbewegungen nach dem badischen Reformlandtag von 1831. Sie zeigen weder Brentanos energische Bemühungen um die volle Gleichstellung der Juden (obwohl Brentano eine der Hauptfiguren im Roman und Film ist) noch die Judenverfolgungen von 1848 oder
174 175
116
177
Wolfschütz 1878 Der Wiener Theater- und Filmregisseur Dieter Bemer hat lt. Register des Dtsch. Rundfunkarchivs (Femsehspiele 1973-77,2) in dem genannten Zeitraum 8 Fernsehspiele inszeniert; seine bekannteste Regiearbeit war danach der Mehrteiler ALPENSAGA. In seiner LENZ-Literaturadaption folgt er der Heymschen Mischung von "aufklärerischer Dimension" mit einer "Abenteuer- und Liebesgeschichte", der "Darstellungsform konzentrierter realistischer Szenen mit beispielhaftem Inhalt" (Berner 1986, 17). Vgl. die Antwort auf die Interviewfrage in der SFB-Femsehsendung vom 20.8.88 AUTOREN ALS ZEITZEUGEN: DER GEPLANTE FRIEDEN, 3: DER SCHRIFTSTELLER STEFAN HEYM von Marlinde Krebs: "Fühlten Sie sich als Amerikaner oder als amerikanischer Jude?" Antwort: "Nein, ich fühlte mich als Amerikaner." Siehe auch die autobiographische Schilderung seiner Beschneidung, die offensichtlich nicht als Zeichen des Bundes, als Merkmal der Zugehörigkeit zu Jahwe oder zur israelischen Kultgemeinde verstanden wird: "... und wenige Tage später wird er, wie sich's gehört, beschnitten, vom Lehrer Sommerfeld und mit dem Daumennagel, knips, ab." (Heym 1988, 5) Vgl. seine vor der Vereinigung entstandenen Romane Der König David Bericht, 1972, und Ahasver, 1981, oder seinen Vortrag "Über Juden und Christen", 1986
170 die unbefriedigenden Auswirkungen der Revolution von 1849 auf die Judenemanzipation. Die Beteiligung von Juden an den republikanischen Aufständen in Baden, teils aus Überzeugung, teils unter Druck, aber auch auf der Seite der Loyalisten in der Karlsruher Bürgerwehr,178 der Vorwurf von Anhängern der Dynastie, die Revolution sei eine "Judenverschwörung" und nicht Struve, sondern ein Jude namens Löwenstern der Führer der Freischaren,179 werden in den Roman und das Fernsehspiel ebensowenig aufgenommen wie die bemerkenswerte Tatsache, daß in diesem als liberal eingeschätzten Staat kein Jude einen Landtagssitz erringen konnte.180 Das Interesse der Fernsehmacher ist es wohl vielmehr, an zwei jüdischen Figuren, dem Bankier Einstein und seiner Tochter Lenore, die unterschiedlichen Positionen von zwei akkulturierten, aufgeklärten Juden der Oberschicht, wenn man will: von zwei deutschen jüdischen Intellektuellen zum Fortschritt, zum Sozialismus und zur Revolution darzustellen: Der Bankier, der in all seinem kapitalistischen Kalkül, seiner Geschäftstüchtigkeit, seiner bedenkenlosen Aufgeschlossenheit gegenüber modernen Investitionsmethoden und Investoren, seiner menschlichen Integrität gegenüber der Tochter und in seinem Realismus politisch doch eindeutig reaktionär ist, dabei in seiner Gebrochenheit menschlich anrührt (was sicher auch auf das Konto des Schauspielers Otto Mächtlinger geht), steht für jene typische Gruppe von wohlhabenden Juden und Nichtjuden, "die in den politischen Kämpfen in ihrer großen Mehrheit auf der Seite der gemäßigten Liberalen und der [die Revolution bekämpfenden, D.P.] großherzoglichen Regierung gestanden hatten."181 Die Tochter dagegen, ebenso emanzipiert, selbstbewußt, klug, schön, ganz dem Positivstereotyp jüdischer Frauen zugehörig ("Ihre ovale Stirn, die Augen, uralt durch die Weisheit ihrer Rasse und doch der Leidenschaft fähig, die aristokratischen Hände", Roman, S. 61) ist - ihrer zweifachen Randposition als Frau und Jüdin zum Trotz - die sich energisch der Revolution Öffnende und damit der dritten sich abzeichnenden Außenseiterposition Zuneigende: dem Proletariat. Lenore Einstein, die aus der vorgeschriebenen Rolle Fallende,182 wird bei all ihrem jugendlichen Liebreiz zum Urbild der jüdischen Intellektuellen, der in vielfacher Weise sich Emanzipierenden, aber auch zum Urbild der jüdischen Emigrantin. Im Fernsehfilm fehlen viele radikale Züge des Romans, so wie auch die Figur von Karl Marx weggefallen ist und alle Bemerkungen Einsteins eliminiert wurden, daß seine jetzt erreichte Position doch in der Kontinuität jüdischen Schicksals steht ( "'Für Juden', lächelte er, 'die durch Tausende von Jahren hindurch nichts als geschlagen, getreten, bespuckt worden sind, gibt es nur zwei Möglichkeiten: entweder reich oder Rebell zu werden'", Roman, S. 57).Aber es fehlt nicht die
178 179 180 181 182
Touiy 1966, 51 Sterling 1956, 156 Toury 1966, 60 Rürup 1987a, 84 Koebner 1986, 22
171 Sichtbarmachung der Ursache jener Emigration von 1849 und der ab 1933: der Mord durch den Pöbel auf der Straße, hier an einem vom Mob für einen Spion gehaltenen Professor gestaltet, und es fehlt im Femsehspiel auch nicht der bittere Kommentar der Leidenserfahrung: "Immer, wenn die Welt, in der sie leben, ihnen nicht zusagt, hauen sie die Juden."
6.2.2.10. Zwei Fernsehspiele über Heinrich Heine Heinrich-Heine-Fernsehsendungen nach Auschwitz werden der Verwurzelung des Poeten im liberalen Judentum die unbedingt gebührende große Aufmerksamkeit zollen, ohne daß sie zur Hagiographie verkommen dürfen, zur penetranten "Ehrenrettung" werden oder gar die Widersprüche der Gestalt Heines aufzuheben suchen, indem sie etwa ein altmeisterliches Bild vom vorromantischen deutschen Dichter malen (denn Heine stand sein Leben lang "im Spannungsfeld von Judentum und Politik"183). Selbst wenn sie als "Zweiteiler" die doppelte Spieldauer zur Verfügung haben, werden sie unabhängig von ihrem Genre als Dokumentarspiel oder als mehr literarisches Fernsehspiel immer nur subjektiv gefärbte Bruchstücke einer Biographie vorzeigen können. Die von uns vorgenommene zeitliche Anbindung der Heine-Produktionen an das Revolutionsjahr 1848 darf nicht überschätzt werden: 1848 verstärkte sich Heines Erkrankung mitten während der Revolutionsereignisse so sehr, daß der Dichter von nun an nicht mehr die Wohnung seines Pariser Exils verlassen konnte, sondern an seine "Matratzengruft" gefesselt war.184 Dennoch hat er, der sein Leben lang als der jüdische Außenseiter für die kritische Wahrnehmung sozialer Ungerechtigkeit sensibilisiert war und sich für soziale Reformen engagierte, die von ihm ersehnte und prophezeite, zugleich in ihren Methoden verabscheute Revolution in Paris und Berlin aufmerksam verfolgt, wenn auch dann in ihrem letztlich unbefriedigenden Ergebnis kritisch beurteilt.185 Wollte man einen Idealkatalog jener thematischen Aspekte zusammenstellen, die in einem Fernsehspiel zur Korrektur der frühen antisemitischen Verzerrungen des Heinebildes besonders geeignet sind, so wären sie aus jenen Arbeiten zu filtern, die im Mittelteil unserer Heine-Literaturliste zusammengestellt sind: ReichRanicki, Katz, Kircher, Rosenthal, Schlingensiepen, R. L. Jacobi, Prawer haben die vielfältigen Beziehungen Heines zu den Juden seiner Umwelt und zu den jüdischen Figuren seines Werkes sowie seine wechselvollen religiösen Ansichten,
183 184
185
Grab 1992, 11 und passim Zugrunde gelegte Literatur: Hadecke 1985; Kopelew 1981; Marcuse 1967;Eulenberg 1947;Raddatz 1979; Heinrich Heine: Epoche, Werk, Wirkung 1980; Reich-Ranicki 1989, 5891 bzw. 1981, 150-163; Katz 1989, 174-193; Schlingensiepen 1981; Prawer 1985, 78-108; Rosenthal 1973; Kircher 1973; Jacoby 1978; Victor 1953; Mayer 1981, 207-223; Na'aman 1981, 18-31; Grab 1992; Poliakov 1987, VI, 204-210; Juden und Judentum in deutschen Briefen 1984, 215-230 Vgl. Grab 1992, 167-210
172 Verlautbarungen und Überzeugungen, seine ebenso widersprüchlichen bzw. dialektischen Beziehungen zum Judentum untersucht. Sowohl im Hinblick auf Heines Taufe wie auf die Rückkehr zu Grundüberzeugungen der jüdischen Religion in seiner letzten Lebensphase entwickeln diese Autoren deutlich voneinander abweichende Schlußfolgerungen. Kaum einer besteht auf monokausalen Argumentationen bzw. einer Verabsolutierung der jüdischen Komponente.18® Ein Film, der solches versuchte, wäre einfaltig. Die Problematik eines filmischen Heine-Charakterporträts besteht darin, Heines literarisches Rollenspiel, das Insgesamt von Posen, Maskierungen, Selbststilisierungen, Selbstverspottungen, Selbstcamouflage wie auch von Freimut und Offenheit, Selbstbewußtsein und Selbstgefühl nicht zu einer vordergründigen Biographie einzuebnen,187 dem ironischen, zerrissenen, tragischen jüdischen Dichter vielmehr differenziert zu begegnen, gleichzeitig aber auch innerhalb einer solchen gestalteten Filmbiographie zur Erkenntnis zu führen, daß die "widerspruchsvolle und höchst zwiespältige Wirkungsgeschichte seines Werkes in Deutschland ... mit Heines Judentum zu tun hat."188 Das alles ist auch in einem vierstündigen Fernsehspiel nicht zu leisten. Wie weit es aber ansatzweise gelang, ob der Dichter selbst und seine jüdischen Zeitgenossen wie Börne, Gans und Marx nach einem Begriff von Isaac Deutscher als "Non-Jewish Jews"189 porträtiert wurden, ob auch antijudaistische und antisemitische Angriffe auf Heine, dessen Verteidigungsstrategien sowie dessen "Kampf für die Emanzipation der Menschheit"190 gestaltet wurden, soll wenigstens in den Grundlinien dargestellt werden. Beginnen wir mit Karl Fruchtmanns 1983 vom Radio Bremen produzierten Fernsehspiel DIE ZWEITE VERTREIBUNG AUS DEM PARADIES, dessen erster Teil von 3,53 Millionen und dessen zweiter Teil von 1,52 Millionen Zuschauern gesehen wurde.191 Der in Thüringen geborene Karl Fruchtmann, der die Konzentrationslager bei Chemnitz und in Dachau überlebte und nach seiner Entlassung 1937 in das damalige Palästina auswanderte, wo er auch (nach Gründung des Staates Israel) bis 1958 lebte, ist seit 1963 Theater- und Femsehregisseur in der Bundesrepublik Deutschland.192 Er stellt seinen Heinrich-Heine-Film, der weniger ein Dokumentar-
186 187 188 189 190
192
Vgl. Kirchers Besprechung des Buches von Jacobi: Heine-Jahrbuch 1980, 265 Vgl. Hädecke 1985, 14-17 Reich-Ranicki 1989, 90 Clausen 1987, 60 Kircher 1973, 138ff. Kontrastprogramm des ZDF am 30.11.83 bei Teil I: 1.ZDF-MAGAZIN 6,4 Mio, 2. HEUTEJOURNAL 7,96 Mio, 3. DENVER-CLAN 13,3 Mio; am 4.12.83 bei Teü II: DER MANN AUS SUEZ = 14,71 Mio Nach einer Filmographie von Radio Bremen hat er in über 30 Ferasehspielen Regie geführt, darunter auch bei zahlreichen Literaturadaptionen von Ostrowski) bis Jurek Becker und Siegfried Lenz. Besonders große Aufmerksamkeit haben die nach seinen eigenen Drehbüchern inszenierten Femsehspiele und Dokumentarfilme (die Grenzen sind fließend) über jüdische
173 spiel als ein literarisches Fernsehspiel ist, in dem die biographischen Szenen mit gestalteten literarischen Texten kombiniert werden, zunächst in den antijudaistischen Kontext der Zeit. So läßt er das Fernsehspiel mit einer überlang ausgespielten Judenverfolgungsszene beginnen: Von einem Reiter verfolgt, laufen halbnackte, einen alten Mann im Gebetsmantel tragende schweißüberströmte Juden zum Ergötzen der Zuschauer in einer Arena um die Wette. Die Montage aus Großaufnahmen, Naturgeräuschen, Barockmusik und Heinezitat ist symptomatisch für den Inszenierungsstil: ein Gemisch aus szenisch aufbereiteten Details und einer monologischen Blütenlese von häufig aus dem Zusammenhang gerissenen Prosaarbeiten Heines (der Harzreise, den BäderfnJ von Lucca, den Memoiren), seiner Verssatire Deutschland: Ein Wintennärchen oder einem Potpourri einiger (vom Darsteller des Heine höchstselbst vorgetragenen) Einzelgedichten bis hin zu "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten" - dies ersetzt Aufklärung, Einsicht und Anteilnahme durch verschwommene Anmutungen. Das sich so anspruchsvoll gebende Fernsehspiel entspricht den einleitend genannten Kriterien für eine auf unsere Zeit bezogene TV-Heine-Darstellung überhaupt nicht. Die Zitate, die das Judentum in Heines Leben offenbar charakterisieren sollen, geraten entweder als nur schmückendes Aphorismenbeiwerk zum Selbstzweck, oder sie bleiben einem Zuschauer, der z.B. den Streit zwischen Heine und Platen nicht kennt, völlig nebulose Hans-Wurstiaden wie die Gumpel-Gumpelino/Hirsch-Hyazinth-Szenen. Auch die teils überhöht pathetisch, teils satirisch vorgetragenen Szenen aus Heines Leben (Taufe, Nordseeaufenthalt, finanzielle Abhängigkeit von Onkel Salomon, Begegnung mit St.-Simonisten - unter denen es in Wirklichkeit, ohne daß das im Fernsehspiel auch nur angedeutet wird, zahlreiche Juden gab,193 Zusammentreffen mit Crescentia Mirat und dem Ehepaar Marx (vgl. Foto Nr. 17), später - auf dem Krankenbett - mit Lassalle und der Mouche) sind oft nur maniristisch bebilderte Monologe bzw. hölzern dialogisierte Zitatmixturen. Nur manchmal blitzt in den stilisierten, kostümierten, aber merkwürdig ins Zeitlose gewendeten Szenen eine Spur heutigen Lebensgefühls auf wie in den St.-Simonisten- und den ersten Mathilde-Szenen. Dann aber versteigt sich Fruchtmann in eine als "symbolischen
Schicksale unter dem Nationalsozialismus mit ihren Folgen bis in die Gegenwart errungen: KADDISCH NACH EINEM LEBENDEN, DER MANN AUF MEINEM RÜCKEN, ZEUGEN, EIN EINFACHER MENSCH. In seinem Femsehspiel über Dreyfus TROTZDEM stand nicht mehr das Opfer im Zentrum, sondern es ging "um den Intellektuellen und seinen Kampf um die Macht" (Fruchtmann). Poliakov 1987, VI, 167-169. Bei der positiven Einschätzung des Judentums durch die Saint-Simonisten als "sozial-religiöses Prinzip" und des Juden als einem "schöpferischen Faktor" ware es folgerichtig gewesen, wenn innerhalb des langen Statements eines SaintSimonisten im ersten Teil des Fernsehspiels auch die führende Rolle von Juden in der frühsozialistischen Bewegung ihren Platz gefunden hätte - das war aber nicht der Fall (vgl. das Kapitel "Die Saint-Simonisten" bei Silberner 1962, daraus - S. 13f. -auch die Zitate).
174
Realismus"194 ausgegebene und unerträglich kitschige Groß- und Nahaufnahmenmontage von weißen Frauenleibern, blitzenden Beilen, schwarzen Schaftstiefeln auf malerisch hingestreckten Körpern oder Wasserfluten, die über Steintreppen bürstende nackte Menschen fließen und nach einem zu Militärmusik aus der Hundehütte kriechenden und salutierenden Gefesselten schließlich in die Vision eines Berges von unbekleideten, gestapelten Menschen münden, bis die Schnittfolge sich als Bildassoziation zu Kaput VII aus dem Wintermärchen entpuppt, das Heine einem hier unbedarften Karl Marx und dessen Frau Jenny rezitiert (Foto Nr. 17). Die Interpretation dieses Kapitels, die Marx in einem geradezu verblüffenden Vulgärmarxismus zum besten gibt, die (belegte) Rettung des Marxsäuglings durch Heine und das die Szene abschließende Gesangstrio Marx-Jenny-Heine zu einem Text aus Kaput I ("Ein neues Lied, ein besseres Lied") ist nicht frei von unfreiwilliger Komik. Und eine schier unerträgliche Mischung aus Krankheitsklagen, Judentumsreflexionen und Revolutionsabgesang ist dann im zweiten Teil der Dialog mit Lassale, dem in der Schlußpassage die inzwischen sattsam bekannten, einander ablösenden Gedichterezitationen von Heine und der Mouche folgen, gekrönt durch den Auftritt eines Gesangsquartetts, das Schubert atonal verfremdet. Die so ambitionierte Mixtur aus Heinezitaten und den Stichwörtern der Dialogpartner endet in Larmoyanz. Erkennbar wird jedoch aus der Montage literarischer Texte mit biographischen Szenen Fruchtmanns Absicht, die verhängnisvolle Rolle der restaurativen Deutschtümelei und der Apotheose einer christlichen Monarchie zu schildern, denen gegenüber sich die aus der Französischen Revolution stammenden Ideen der Liberalität und Rationalität nicht durchsetzen konnten195, so daß die Germanomanie als die Ideologie von christlich-germanischem Konservativismus den Nährboden für den nach Auschwitz führenden Judenhaß bildete. Allerdings sind die Kabarettszenen mit dem aus seiner Hundehütte kriechenden, salutierenden deutschen Krieger und die aus nackten Menschenleibern gebildete Gaskammermetapher dafür ungeeignet. Die monokausale Betrachtungsweise, die fehlende Unterscheidung von traditionellem und modernen Antisemitismus und das Ausblenden aller sozialen Bezüge verstärken nur den negativen Eindruck eines peinlich-outrierten Lebende-Bilder-Stellens. Eine gänzlich andere Dramaturgie als die des Fruchtmann-Films und einen wohltuend sich davon abhebenden nüchternen Inszenierungsstil bei akribischer, dennoch atmosphärisch dichter Milieuzeichnung und ausnahmslos vorzüglichen darstellerischen Leistungen hat das über fünf Jahre ältere, ebenfalls etwa vierstündige Heine-Dokumentarspiel des ZDF HEINRICH HEINE von Herbert
194
Nach einer in der Frankfurter Rundschau vom 30.11.83 zitierten Darstellung, auf die sich auch Reich-Ranicki in seinem FAZ-Verriß vom 6.12.83 ("... dieser Heineverschnitt, dieser primitive und zugleich prätentiöse Film, ... diese Katastrophe") bezieht Töme 1987, 12; Sterling 1956, 118-127
175 Knopp (Buch) und Klaus Emmerich (Regie).196 Dessen erster Teil DAS LEBEN IST WEDER ZWECK NOCH MITTEL: DAS LEBEN IST EIN RECHT konnte sich am Neujahrstag 1978 mit 1,4 Millionen Zuschauem gegenüber den 23,94 Millionen Zuschauern des ARD-TATORT nur sehr schwach behaupten; dessen zweiter Teil UNTER JEDEM GRABSTEIN LIEGT EINE WELTGESCHICHTE erreichte tags darauf 3,12 Millionen Zuschauer.1*7 Enthält das einen Zeitraum von fünfzehn Heinelebensjahren umfassende ARD-Fernsehspiel außer dem erwähnten einen Dutzend Literaturbebilderungen, Visionen, Träumen, Rückblenden und der anderhalbstündigen Moribundenquälerei über die Matratzengruft nur fünf biographische Szenen (mit eingestreuten Literaturzitaten), so werden im ZDFDokumentarspiel fast fünfzig Jahre aus dem Leben Heines nacherzählt. Jede der dreißig im Durchschnitt achtminütigen biographischen Szenen ist durch einen sachlich informierenden Sprechertext miteinander verbunden. Trotz dieser schlichten Dramaturgie einer linear erzählten Chronologie fasziniert der penibel die Handlungsräume rekonstruierende oder durch die Wahl der Außenaufnahmen authentisch anmutende Film wegen seiner gediegenen Faktenkenntnis und gleichwohl anrührenden Gestaltung, vor allem aber wegen des Verzichts auf eine simplifizierende, alle Ecken und Kanten, alle Widersprüche einbügelnde Heine-Porträtierung, die auch nicht der Gefahr erliegt, eine Reader'sDigest-Fassung seiner Biographie zu geben. In fast jeder Szene, die einen neuen Namen einführt (Amalie, Babette, Mathilde und George Sand; A.W. Schlegel, Campe, Cotta, Chopin und Laube) gelingt es, eine Figur lebendig werden zu lassen, die weder nur Stichwortgeberin noch Textzitiererin ist, sondern ihr geistiges und soziales Umfeld sichtbar werden zu lassen, die Ideen und Gegenströmungen zu zeigen. Konflikte, Fehler, Schwächen eines Menschen in seinem Widerspruch werden nicht verschwiegen, der Jahrmarkt eigener und seiner Kommunikationspartner Eitelkeiten wird sichtbar. Die genannten Kriterien für eine Heinedarstellung, nämlich die Facetten seiner Persönlichkeit zu entfalten, Posen, Maskierungen und Rollenspiele seiner selbst erkennbar zu machen, sind weitgehend berücksichtigt worden. Das Dokumentarspiel rehabilitiert "den Juden Heine", ohne in einen fetalen Post-45er-Philosemitismus zu verfallen. Es zeigt, so ergänzungsbedürftig wie auch immer, "Heinrich Heines jüdische Porträtgalerie" in beeindruckender Vielfalt emanzipierte, ihre Umwelt prägende Juden: Rahel Varnhagen (vgl. Foto Nr. 16) in ihrem berühmten Berliner literarischen Salon,198 James Rothschild, den Pariser
196
Klaus Emmerich, Theater-, Film- und Fernsehregisseur, hat außer Bühneninszenierungen, z.B. in Berlin und München, zwischen 1972 und 1980 sieben Fernsehspiele und Filme inszeniert. Herbert Knopp schrieb zwischen 1970 und 1976 fünf Fernsehspiele, darunter Literaturadaptionen von Puschkin und Robert Wolfgang Schnell. 197 ARD-Kontrastprogramm: 1. DAS MITLEID IST GESTORBEN 5,09 Mio, 2. MEIN LIEBER MANN 7,2 Mio. Bisher hat das HEINE-Dokumentarspiel drei Wiederholungen erlebt (April 1979, November 1979, November 1988). '* Drewitz 1984, 48-72, Juden und Judentum in deutschen Briefen 1984, 116-191, Feilchenfeldt 1984, 77-99; Arendt 1984; Bruer 1991, 221-225, Hertz 1991 passim
176 Bankier, der schon in mehreren Fernsehspielen zur Emanzipation eine Rolle gespielt hat (fördernd in ICH, CHRISTIAN HAHN, hemmend in LENZ) und dessen Frau Betty, schließlich die Mischpoke Heine: Salomon, Karl, Lottchen und Gustav. Statt Christen zu verkrampften Thesenträgern zu verzeichnen (wie in der ZWEITEN VERTREIBUNG AUS DEM PARADIES) wird hier - in einer unpolemischen, von Trauer und Mitgefühl geprägten Szene - Heines Taufintermezzo über den Erwerb eines Entrébillets in die europäische Kultur als die tragische Fortsetzung der Szene über Heines Tätigkeit im "Verein für Cultur und Wissenschaft der Juden" dargestellt. Im Disput mit Eduard Gans sind wesentliche Grundlinien der jüdischen Emanzipation wiederzuerkennen (vgl. unseren 2., 9., 11., 15. und 16. Satz). Zugleich belegen sie einen der Periodenwechsel in Heines Beziehung zur jüdischen Religion: nach Jacobis dialektischem Dreierschritt von der These (Jude zu sein und als Jude zu leben) zur Antithese (Ablehnung aller Religionen, besonders heftig der jüdischen), nach Rosenthal die religiöse Wandlung von einer Periode größeren Interesses am jüdischen Glauben (Hinwendung zum "Reformjudentum", Mitarbeit im "Verein für Cultur und Wissenschaft der Juden") zur durch die Lehren Hegels und die Einflüsse der StSimonisten von 1832 bis 1848 reichenden atheistischen Periode. Eine ähnliche Entwicklung konstatiert Kircher, der Heines Mitgliedschaft im Berliner Culturverein als dessen Ziel interpretiert, sich für die Emanzipation der Juden einzusetzen, und nach dem Scheitern seiner Bemühungen um deren Akkulturation trotz der "Zäsur" der Taufe den Kampf für die Emanzipation der Menschheit auf eine seiner Fahnen schreibt. Daß Heine den Terminus "Emanzipation" in den Jahren seiner Kritik an den "positiven Religionen" nicht mehr auf die jüdische Emanzipation bezieht, geht sehr schön aus der 24., im Salon der George Sand spielenden Szene hervor. Hier ist es, wie dargestellt, das einzige Mal, daß in einem der Fernsehspiele über jüdische Emanzipation überhaupt das Wort fallt, aber bezeichnenderweise nicht als programmatisches Nomen. Auf das ironische Angebot der George Sand, ihr 101. Liebhaber zu werden, reagiert Heine spöttisch: "Ich bin bereits emanzipiert!" Die Culturvereinszene macht deutlich, wie wenig die eine bürgerliche Verbesserung der Juden proklamierenden christlichen Staatsrechtler bereit waren, den Juden des beginnenden 19. Jahrhunderts ein Eigenrecht zuzugestehen, und erklärt augenfällig, welche Zwänge für Juden bestanden, um "glückliche und nützliche Glieder" der bürgerlichen Gesellschaft zu werden. Dabei ist es bedauerlich, daß das mit Harry Heines Erfahrungen von Judenfeindschaft in der katholischen Grundschule einsetzende Dokumentarspiel darauf verzichtete, den Wechsel von Chaim zu Betty zu gestalten, d.h. vom Großvater Chaim, dem orthodoxen "kleinen Juden mit dem großen Bart" zur Mutter, die die Familie, in der offenbar jiddi sch gesprochen wurde, aus den inneren Bindungen ans Judentum löste. Das Fehlen einer solchen Szene verhindert die Erkenntnis, daß die Emanzipation Heines als Entwertung jüdischer Inhalte und Gewinnung einer neuen Identität als Kulturbürger nicht erst mit dem Namenswechsel von Harry zu
177 Heinrich begann. Gut gelang es dagegen, in der Schlußszene Heines berühmte Proklamation von seiner Heimkehr zu Gott als die eines verlorenen Sohnes, der zu lange bei den Hegelianern die Schweine gehütet habe (nach Jacobi: die Synthse = Gewinnung von Toleranz und Humanität, nach Rosenthal: die Rückkehr zum Monotheismus/Deismus, nach Kirchner: die Wandlung zum Glauben) in all ihrer Ambivalenz stehen zu lassen. Es spricht für das Fernsehspiel, gerade weil es dem Judentum Heines einen unaufgebbaren Stellenwert beimißt, daß die Figuren der jüdischen Porträtgalerie nicht immer nur auf ihr Judentum hin interpretiert werden, sondern auf den zentralen Punkt in ihrer Beziehung zu Heine. So war es sehr richtig, Börne, den "heimlichen, feindlichen Bruder"199, vor allem als sozialistischen, revolutionären Antipoden zu zeigen, ohne daß Heines Sympathie für eine sozialistische Veränderung der Gesellschaftsordnung unterschlagen wird. Im Gegensatz zur Geschwätzigkeit und Banalität der für Heines Annäherung an Sozialismus und Kommunismus stehenden Lassalle- und Marx-Szenen in der ZWEITEN VERTREIBUNG wird in den drei entsprechenden Szenen des HEINEDokumentarspiels (Zwist mit Börne und zwei Szenen über die Pariser Revolution von 1848) viel genauer Heines zwiespältige Beziehung zum Komplex RevolutionKommunismus-Sozialismus entfaltet. Vor allem aber - und dies begründet unsere Entscheidung, das HEINE-Fernsehspiel von Knopp und Emmerich entgegen der filmischen Chronologie an den Schluß des Kapitels zu setzen - stellt es die Figuren in den Zusammenhang mit der Aufklärung und der - nicht nur jüdischen Emanzipation. In seinem ein Jahr später mit dem gleichen Heinedarsteller Christoph Bantzer von Franz Joseph Wild inszenierten Fernsehspiel DER TEUFEL LEBT NICHT MEHR.MEIN HERR! über die fiktive Begegnung im Totenreich zwischen Lessing und Heine (vgl. Foto Nr. 18) läßt Walter Jens den geschliffenen Dialog der beiden mit dem Plan enden, gemeinsam ein Faustdrama zu schreiben. Sie stellen sich vor: einen "Faust aus dem Frankfurter Ghetto". Sie konzipieren Faust als Juden, mit jenem Juden eigenen "Wirklichkeitssinn, mit Mystizismus gepaart", sie entwerfen einen jüdischen Faust aus "Realismus und Prophetie". Das Totengespräch von Walter Jens endet mit dem Sieg der Aufklärung, zumindest unten im Totenreich, im Hades, wo es unter den Büchern gut ist: "Denn oben", resümiert der Heine des Walter Jens, "wo man Bücher verbrennt - und das tut man - verbrennt man am Ende auch Menschen." Der Aufklärer Lessing protestiert: "Das wird nie mehr geschehen. Der Teufel lebt nicht mehr, mein Herr! Dafür ist gesorgt [...]. Freilich - wetten würde ich nicht."200
m
200
Reich-Ranicki 1980, 151 bzw. 1989, 61. Über die Beziehungen Börnes zu Heine siehe auch: Touty 1966, 41-45 Jens 1980, 53-64. Das halbstündige Femsehspiel des Bayerischen Rundfunks und des Schweizerischen Femsehens "DER TEUFEL LEBT NICHT MEHR, MEIN HERR!" EIN TOTENGESPRÄCH ZWISCHEN HEINE UND LESSING wurde im Januar 1979 ausgestrahlt.
178
Im Fernsehspiel HEINRICH HEINE von Knopp und Emmerichs ist der Sieg der Aufklärung noch unsicherer, ist die Emanzipation noch nicht abgeschlossen. Aber das Fernsehspiel zeigt doch wenigstens ansatzweise den mühseligen Weg aus dem Ghetto als fortwährenden Kampf gegen Ungleichbehandlung, Dummheit, Arroganz, Unwissenheit und Aberglauben, gegen Judenfeindschaft und Vorurteile. Es läßt ahnen, daß zum Zeitpunkt von Heines Tod dieser Kampf noch nicht entschieden ist. Weder durch die ersten Erfolge der Emanzipation im Hinblick auf die Verbesserung von Bildung und Erziehung und die damit in Gang gesetzte Akkulturation noch durch die formelle Gleichstellung 1869 bzw. 1871 wird die Judenfeindschaft beendet. Sie wird nur verlagert. Denn mitten in einer Epoche der vergleichsweisen Ruhe und Stabilisierung, der fortschreitenden Integration, der Besserung der ökonomischen Lage der Juden und des Wachsens jüdischen Selbstbewußtseins war 1844 der kritische Aufsatz Zur Judenfrage von Karl Marx erschienen.201 Der aus einer Rabbinerfamilie stammende, aber in seinem Judentum nur "ein akzidentielles Moment der Herkunft"202 sehende, damals 25jährige Marx forderte darin unter gesellschaftskritischer Zielsetzung zwar bedingungslos die Judenemanzipation; aber er erkannte das Volk seiner Väter weder als Volk noch als Nation noch als Religionsgemeinschaft. Bei isolierter Betrachtung der später heftig inkriminierten Stellen schien er es sogar mit antisemitischem Vokabular zu diffamieren.203 Zwar wurde dieser später von Hans Mayer als Zeugnis des jüdi-
201 302 203
Marx 1957, 347-377. Vgl. auch Silberner 1962, 8. Kapitel, vor allem 119-127 Meyer 1981, 11 Vgl. den Abschnitt über Marx in Anm. 162. Zu seiner 'Judenfrage" als Gegenstand der Antisemitismusforschung siehe auch: Poliakov 1987, VI, 216-236; Massing 1986, 165-168; Friedenthal 1981, 224-237; Claussen 1987, 58-81;; Schuder/Hirsch 1988, 68-73; Katz 1989, 158-174. Eine gültige Präsentation von Karl Marx als Figur eines Spielfilms oder Fernsehspiels gerade im Hinblick auf die jüdische Thematik steht noch aus; denn in den beiden Fernsehfilmen, die den jungen Marx in jeweils nur einer Szene (mit Heine bzw. Engels) vorführen, spielt dessen Stellung zur "Judenfrage" keine Rolle, also weder in Fruchtmanns H) ZWEITE VERTREIBUNG AUS DEM PARADIES noch in Wekwerths FLUG DES FALKEN. Dabei wäre der vierteilige DDR-Film über Engels (vgl. Anm. 89) von seiner Chronologie her gesehen durchaus geeignet gewesen, die Kontroversen der Junghegelianer jüdischer Herkunft wie Marx mit den nichtjüdischen Linkshegelianem wie Bauer, Strauß und Gutzkow über die "Enttheologisierung des christlich-jüdischen Religionsverhältnisses" (Sterling 1956, 102-117) anzusprechen, zumal Bauer und Gutzkow als Figuren vorkommen, Strauß in den Dialogen des jungen Engels als richtungweisend für seinen Einstieg in die wissenschaftliche Religionskritik genannt wird und der Film mit der Begegnung von Marx und Engels etwa im Jahr des Erscheines der Judenfrage schließt. Andererseits darf nicht verkannt werden, daß eine filmische Gestaltung des Bauer-Marx-Diskurses über die Theorie einer gerechten Gesellschaft mit ihrer Speerspitze gegen den christlichen Staat und das kapitalistische Profitsystem, in das Juden als Opfer und Nutznießer mit eingebunden waren, sowie über die Entfaltung der Emanzipation der Menschheit, die die Religionen mit ihren Streitigkeiten und damit die "Judenfrage" überflüsig machten, dem Gegenstand kaum gerecht würde, solange es nur beim simplen Bebildern von Dialogen bliebe.
179 sehen Selbsthasses interpretierte Aufsatz damals wenig beachtet.204 Aber dann drei Jahre nach Heines Tod - erschien eine unvergleichlich giftigere Publikation, nämlich die unter dem Pseudonym H. Naudh herausgebrachte, ständig neu aufgelegte Ouvertüre des rassistischen Antisemitismus: die Schrift Die Juden und der deutsche Staat.205 Abschließend sei noch auf ein charakteristisches Nebenergebnis unserer Untersuchungen von Fernsehspielen zur jüdischen Emanzipation hingewiesen. Wir haben exemplarisch in diesem Kapitel, in dem fast ausschließlich Fernsehproduktionen statt wie sonst auch Kinospielfilme analysiert wurden, die Einschaltquoten bzw. die Sehbeteiligung der Femsehspiele und des Kontrastprogramms (der zur gleichen Zeit im anderen Kanal des öffentlich rechtlichen Fernsehens ausgestrahlten Sendungen) überprüft, soweit sie in den wöchentlichen Publikationen der GfK oder teleskopie erschienen sind.206 Als Ergebnis ist festzuhalten, daß diese vom Thema bzw. teilweise auch von den Produktionskosten her herausragenden Fernsehfilme zwar immer eine respektable Zahl von Menschen erreichten, nämlich mindestens anderthalb Millionen Zuschauer, dies aber von jeder durchschnittlichen Fernsehunterhaltungssendung, sei es die Folge einer USSerie, eine Talkshow, ein Quiz oder ein Kriminalfilm, weit in den Schatten gestellt wurde (bei unseren Beispielen war die Sehbeteiligung am Kontrastprogramm ζ. T. 17mal so hoch). Aber selbst wenn auf dem anderen Kanal anscheinend weniger attraktive Sendungen wie politische Studiogespräche angeboten wurden, war die Sehbeteiligung bei Fernsehspielen mit jüdischer Thematik weitaus schwächer. Diese Produktionen erreichten also immer nur eine Minderheit, im Vergleich mit dem weltweit von mehreren hundert Millionen Menschen und in der Bundesrepublik immerhin noch pro Folge von 10,41 bis 15,38 Millionen gesehenen HOLOCAUST-Fernsehspiel keineswegs eine gute Sehbeteiligung.207 Aber gerade auch die HOLOCAUST-Rezeption in der Bundesrepublik macht deutlich, daß hier das Interesse an Filmen über jüdische Schicksale keineswegs besonders hoch ist, selbst wenn man in Rechnung stellt, daß der populäre US-Mehrteiler nur im " Minderheitenkanal" der Dritten Programme gelaufen ist. Denn mit seiner Einschaltquote lag HOLOCAUST in der Bundesrepublik nur an 17. Stelle der Weltrangliste (nach Ländern wie Peru, Griechenland, Finnland, Neuseeland, Australien und Ekuador). Die schwache Sehbeteiligung bei Fernsehspielen zur jüdischen Emanzipation schmälert nicht deren Relevanz, hütet aber vor einer quantitativen Überschätzung der Wirksamkeit solcher Programmformen, zumal seit der
204
205 206
207
Mayer 1981, 378. Zur Debatte über den "jüdischen Selbsthaß" vgl. Th. Lessing 1984, ders. 1987, 69-77; Mayer 1971, 94-120; Schoeps 1986, 200-217 (kontrovers dazu die biograph. Einleitung von Hans Stern aus Th. Lessing 1987, 7-48) Vorurteile gegen Minderheiten 1978, 79-81 Gfk-Fernsehforschung: Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung, Nürnberg. Vor 1985 wurde die Sehbeteiligung in einer von der teleskopie-Gesellschaft für Femsehzuschauerforschung, Bonn hergestellten Veröffentlichung ARD und ZDF: Das Sehverhalten in Fernsehhaushalten veröffentlicht. Zahlenangaben hier und folgend nach Holocaust zur Unterhaltung 1982, 13, 214f.
180 Einführung des Kabelfernsehens und der damit Platz greifenden Aufsplitterung der Zuschauerzahlen die Rezeption anspruchsvoller Sendungen deutlich zurückgegangen ist.208
30(1
Krüger 1988, 558f.; Darschin/Frank 1988, 214-288
1*
Bilddokumentation: Charakteristische Standfotos aus Filmen und Fernsehspielen
Die Reihenfolge der Fotos entspricht der Abfolge der Kapitel: Nr. 1-2: Vom nicht wahrgenommenen Juden I: Jüdische Figuren in Spielfilmen zur Geschichte des jüdischen Volkes in seinen Anfängen und in der Antike (THE TEN COMMANDMENTS, 1956; WHOLLY MOSES, 1980) Nr. 3: Vom nicht wahrgenommenen Juden 11: Jüdische Figuren in Spielfilmen nach Themen des Neuen Testaments (THE GREATEST STORY EVER TOLD, 1963) Nr.4-5: Die Legende vom Golem in Literatur und Film, hier: der Stummfilm DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM, 1920 Nr. 6-11: Dreimal "Jud Süß": - JUD SÜSS, Deutschland 1940 - JEW SUESS, England 1934 - JOSEPH SÜSS OPPENHEIMER, Deutschland 1984 Nr. -
12-18: Fernsehspiele aus Deutschland zur jüdischen Emanzipation: FREUNDE IN PREUSSEN, 1981 ICH - CHRISTIAN HAHN, 1985 DIE JUDENBUCHE, 1980 HEINRICH HEINE, 1978 DIE ZWEITE VERTREIBUNG AUS DEM PARADIES, 1983 "DER TEUFEL LEBT NICHT MEHR, MEIN HERR!", 1979
Nr. -
19-28: Begegnung mit Tewjes Welt im Spiegel jiddischer Filme: DAS ALTE GESETZ, 1923 GR1NE FELDER, 1937 GOT, MENTSCH UN TAJWL , 1950 J1DISCHE GLIKN, 1925 DER DIBEK, 1937 YIDL ΜΓΓΝ FIDL, 1936 DER PURIMSCHPILER, 1937 A BRIVELE DER MAMEN, 1938
Nr.l: Amerikanische und italienische Bibelfilme verdrängen in der Regel die Erkenntnis, daß die Hebräer des Alten Testaments die Ahnen heutiger Juden sind: THE TEN COMMANDMENTS
Nr.2.: Nur in Parodien von Bibelfilmen - wie hier in WHOLLY MOSES - wird eine Verbindungslinie von der Antike zu Juden und Arabern der Gegenwart gezogen.
3* Nr. 3: Die klassischen Bibelfilme der vierziger bis sechziger Jahre nach Stoffen des Neuen Testaments präsentieren nicht den Juden Jesus von Nazaret, sondern meist einen schon vor seiner Auferstehung erhöhten, kaum noch irdischen Herrn und Gottessohn - hier: THE GREATEST STORY EVER TOLD mit Max von Sydow.
4*
DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM von Paul Wegener: kabbalistische Beschwörung als Überwindung realer Bedrückung Nr. 4: Die bizarre, nicht realistische Schtetlwelt als magischer Raum
Nr. 5: Rabbi Low (Albert Steinrück) zeigt seinem staunenden Famulus (Ernst Deutsch) den von ihm erschaffenen Golem (Paul Wegener).
5*
Nr. 6: Der antisemitische Propagandafilm JUD SÜSS suggeriert das Stereotyp vom geldgierigen Ghettojuden: Oppenheimer (Ferdinand Marian) und sein Sekretär Levi (Werner Krauss).
ψ
Nr.7: Das Stereotyp vom Rabbiner ("Rabbi Low") als absolutistischer Machthaber des Weltjudentums und vom Hoffaktor als Personifizierung des raffenden jüdischen Kapitals: Werner Krauss und Ferdinand Marian in JUD SÜSS
6* Nr. 8 und 9: JEW SUESS als projüdisches Gegenbild zum antisemitischen JudSüß-Stereotyp: Der für seine Glaubensgenossen eintretende Hoffaktor (Conrad Veidt) in einem um Realismus bemühten Ghettomilieu
η* Nr. 10 und 11: Das Fernsehdokumentarspiel JOSEPH SÜSS OPPENHEIMER versucht, ein realistisches Bild vom Dilemma des Hofjuden (Manfred Krug als Herzog und Jörg Pleva in der Titelrolle) und vom Leiden des Inhaftierten zu zeichnen.
8*
Nr. 12 und 13: Der mühselige Beginn der Emanzipation und des Dialogs: Lessing (J. Spitzer) und Mendelssohn (M. Pan) als FREUNDE IN PREUSSEN, Mendelssohn und seine Frau Fromet (Ruth Reinecke)
Nr. 14: Ein jüdischer Trödler (Franz Boehm) als "Sozialisationsagent" eines Christenjungen und als Dialogpartner eines evangelischen Pfarrers: Jüdischchristliche Begegnung im 18. Jahrhundert in der 13-teiligen Fernsehserie des SWF-Vorabendprogramms ICH - CHRISTIAN HAHN
Nr. 15: Literaturverfilmungen zur Erhellung der jüdisch-deutschen und jüdischchristlichen Beziehungsgeschichte. Hier: Harry Raymon als Jude Aaron und Roland Teubner als Friedrich Mergel in der Droste-Hülshoff-Adaption DIE JUDENBUCHE
10* Nr. 16-18: Dreimal Heinrich Heine in literarischen Fernsehspielen: Dispute - zwischen dem jungen Schriftsteller (Christoph Bantzer) und Rahel Varnhagen (Rosemarie Fendei): HEINRICH HEINE
- zwischen dem Dichter (Wolfgang Hinze) und Karl Marx mit dessen Frau Jenny: DIE ZWEITE VERTREIBUNG AUS DEM PARADIES
11* - zwischen den Dichterkollegen Heine (Christoph Bantzer) und Lessing (Martin Benrath) im Totenreich: "DER TEUFEL LEBT NICHT MEHR, MEIN HERR!"
Nr. 19: Gesellschaftliche Assimilation als Teil der Emanzipation. Der Rabbi nersohn (Ernst Deutsch) begegnet der Erzherzogin (Henny Porten): DAS ALTE GESETZ
Nr. 20: Das Stereotyp der ihre Kinder im Schtetl tröstenden Mame, hier: GRINE FELDER
Nr.21: Transponierung der Hiob- und Faustsage in die teils realistische, teils romantisch verklärte Welt des Schtetls: GOT, MENTSCH UN TAJWL
13* Nr. 22: Der gesetzestreue Jude bei der Weitergabe seines Thorawissens: Maurice Schwartz in seiner berühmten TEVYE-Version des Romans von Schalom-Alejchem
Nr. 23: JIDISCHE GLIKN, einer der wenigen jiddischen Filme aus der Frühphase der Sowjet-Union, in der jüdisches Milieu, nicht aber jüdische Glaubenswelt dargestellt werden durfte
14* Nr. 24 und 25: Die chassidisch geprägte Legende vom Dybuk: Der polnische Tonfilm DER DIBEK gilt als der berühmteste jiddische Film, der ekastatische Frömmigkeit, Wunderrabiwirken, Todesmystik und eine romantische Liebesgeschichte in einen spätexpressionistischen Erzählstil zu bannen wußte.
Nr. 26: Klezmermusik im Schtetl: Der Musikfilm YIDL ΜΓΓΝ FIDL
Nr. 27: die "prinzessn von a kleyn jiddisch shtetl" und ihr Tate: Die dem 20. Jahrhundert zugewandte Esther und der in der Ghettomentalität des 19. Jahrhunderts befangene Alte in der Musikkomödie DER PURIMSCHPILER
16* Nr. 28: Die Mamen in ihrem vergeblichen Kampf um den Bestand der Mischpoke: Lucy Gehrman im letzten polnischen Film Joseph Greens vor dem Einmarsch der Nazis: A BRIVELE DER MAMEN
Bildnachweis Stiftung Deutsche Kinemathek: Nr. 1, 2, 3, 8, 19 Bundesarchiv/Filmarchiv: Nr. 4, 5, 6, 7, 9, 22 ZDF-Bilderdienst: Nr. 10, 11, 12 13, 16 Radio Bremen: Nr. 17 Südwestfunk: Nr. 14 Bayerischer Rundfunk: Nr. 15, 18 Freunde der deutschen Kinemathek: Nr. 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28
181
Tabelle 4 Fernsehspiele über die Anfänge der jüdischen Emanzipation TITEL Regisseur; Sender, Produktion, Erstsendedatum Kurzcharakterisierung
NATHAN DER WEISE Karl Heinz Stroux; NWRV, 30.1.56 Studioinszenienmg mit Emst Deutsch in der Titelrolle nach einer Aufführung des Deutschen Schauspielhauses Hamburg
NATHAN DER WEISE Leopold Lindtberg; OR/F, 26.3.64 Österreichische Studioinszenierung mit Emst Deutsch in der Titelrolle nach einer Aufführung des Burgtheaters Wien
NATHAN DER WEISE Franz Peter Wirth; ZDF, 17.9.67 Fernsehspiel mit Kurt Ehrhardt (vgl. AFFAIRE BLUM ) nach Lessings Schauspiel
DER KAUFMANN VON VENEDIG Otto Schenk; WDR u. ORF, , 2.3.69 Das Shakespearestück als Femsehspiel nach Schenks Bühneninszenierung mit Fritz Kortner, der den Shylock nicht zur Wiedergutmachungsfigur veredelt, sondern in seiner befremdlichen Außenseiter-Ghetto-Existenz präsentiert. Kongeniale Vorwegnahme von Hans Mayers Interpretation des Juden Shylovk als "Phänotyp für die gescheiterte jüdische Emanzipation" (Mayer 1981a, 315)
JACQUES OFFENBACH Rudolf Jugert; ZDF, Studio Hamburg, 13.6.69 Das "Lebensbild" des Komponisten von H. Iversen u. P. König konzentriert sich auf das Wirken des Theaterleiters Offenbach. Es verzichtet vollständig auf die Darstellung der Assimilation bzw. Akkulturation des "naturalisierten" Juden.
DIE JUDEN Gerald Syszkowitz; OR/F 2.12.70 Österreichische Studioinszenierung des Lessingstücks nach einer Aufführung des Schauspielhauses Graz
182
NATHAN DER WEISE Friedo Sölten Deutscher Fernsehfunk/DDR, 25.12.70 Studioinszenienmg des Lessingschauspiels mit Wolfgang Heinz nach einer aufführung des Deutschen Theaters in Berlin/DDR, ab 9.4.71 in den Dritten Programmen von WDR, HR, SDR/SR/SWF wiederholt
FERDINAND LASSALLE Helmut Ashley; ZDF, Intertel, 22.7.72 Das Dokumentarspiel von Georg Marischka kombiniert biographische Spielszenen mit Diskussionsrunden von Politikern, Politologen und Historikern der Gegenwart. Das Wirken des Arbeiterführers Lassalle und seine Affäre mit der Gräfin Hatzfeld hat gegenüber einer Darstellung seiner Akkulturation in der Emanzipationszeit eindeutig den Vorrang.
HEINRICH HEINE Klaus Emmerich; ZDF, Bavaria Atelier, 1. u. 2.1.78 Zweiteiliges Dokumentarspiel mit Christoph Bantzer über Heines Leben von seiner Kindheit bis zu seinem Tod. Das in 30 Einzelszenen gegliederte Fernsehspiel gibt ein zutreffendes Charakterbild Heines, ist zuverlässig in den gestalteten Fakten und beleuchtet angemessen die Situation eines emanzipierten jüdischen Schriftstellers seiner Zeit.
NATHAN DER WEISE Oswald Döpke; SFB, 12.1.79 In Israel gedrehtes, einziges nicht im Studio produziertes Fernsehspiel nach dem Lessingstück mit Werner Hinz in der Titelrolle.
"DER TEUFEL LEBT NICHT MEHR, MEIN HERR!" EIN TOTENGESPRÄCH ZWISCHEN HEINE UND LESSING Franz Joseph Wild; Bayerischer Rundfunk/Schweiz. Femsehen, 14.1.79 In seinem geschliffenen Fernsehdialog läfit Walter Jens im Hades Lessing und Heine ihre Argumente über den Sinn der Existenz, des Schreibens und über das Wesen der Dichtung austauschen. Die Figur des jüdischen Dichters wird in vielen Facetten seiner Persönlichkeit lebendig.
JOHANN SEBASTIAN BACHS VERGEBLICHE REISE IN DEN RUHM Victor Vicas; ZDF, Allianz/DEFA, 4.4.80 In drei Szenen des Dokumentarspiels von Heiner Michel erlebt der alte Bach auf seiner Reise nach Berlin das Elend eines annoi mitreisenden Juden.
DIE JUDENBUCHE Rainer Horbelt; Bayerischer Rundfunk, Helikon-Film, 29.11.80 Horbelts weitestgehend wortgetreue Adaption der Novelle von Annette Droste-Hülshoff über einen Mord an einem jüdischen Händler im Westfalen des 18. Jahrhunderts entfaltet die voremanzipatorische Befindlichkeit von Juden und deckt judenfeindliche Vorurteile auf.
183
FREUNDE IN PREUSSEN Rolf Busch; ZDF, Allianz/DEFA, 7.12.81 Die Freundschaft zwischen Mendelssohn und Lessing und der müshselige Beginn der Emanzipation von Juden in Preußen, die von Heiner Michel weitgehend nach Dokumenten, z.T. auch in erfundenen Szenen erzählt wird, zeichnet ein beeindruckendes Bild von Mendelssohn und seinen Leistungen.
DIE ZWEITE VERTREIBUNG AUS DEM PARADIES Karl Fruchtmann; Radio Bremen, 30.11. u. 4.12.83 Das zweiteilige Fernsehspiel kombiniert biographische Szenen aus den letzten fünfzehn Jahren Heinrich Heines mit Rezitationen und szenischen Arrangements seiner Werke, zitiert ausführlich Heines Stellung zum Judentum, findet aber als ambitioniert-pathetisches Mixtum compositum nicht zu einem überzeugend Erzählstil.
DAS SCHÖNE IRRE JUDENMÄDCHEN Götz Fischer; SWF, 8.2.84 Das Femsehspiel von Dietrich Feldhausen verwendet eine zeitgenössische Selbstmörderbiographie von Chr. H. Spieß.Es erzählt die tragische Geschichte einer emanzipierten jungen Jüdin inmitten einer katholischen judenfeindlichen Umwelt über deren Liebe zu einem der Spielleidenschaft verfallenen preußischen Offizier.
AKTENMÄSSIGE NACHRICHT VON DER WIDER JOHAN CHRISTOPH KROP ANGESTELLTEN UNTERSUCHUNG Rainer Horbelt, SFB, 12.7.84 Szenische Rekonstruktion eines Kriminalfalls aus dem Jahre 1773 unter Verwendung einer zeitgenössischen Chronik mit einem die Handlung begleitenden Moderator und eingeblendeten Historikerbefragungen; Verurteilung eines für einen Juden gehaltenen Gauners infolge vorherrschender Judenfeindschaft.
NATHAN DER WEISE Johannes Schaaf; ORF u. ZDF, 29.7.84 Studioinszenierung des Lessingstückes mit Hans Schulze nach einer Aufführung der Salzburger Festspiele
ICH, CHRISTIAN HAHN Detlef Rönfeldt; SWF, 4.10.85ff. Die aus zwölf je 23-minütigen Folgen bestehende Serie zeigt die Sozialisation eines armen Schneidermeistersohnes im 18. Jahrhundert, wobei dem Dreizehnjährigen ein jüdischer Trödler hilft.
184 LENZ ODER DIE FREIHEIT Dieter Berner; SWF, 5.,6.,12. u. 19.10.1986 Vierteiliges Femsehspiel nach dem Roman über die Badensche Revolution von 1849, in dem neben den historischen Personen auch ein konservativer jüdischer Bankier und dessen emanzipierte Tochter nicht nur dramaturgische Hauptrollen spielen, sondern auch unterschiedliche jüdische Positionen verkörpern. Eindrucksvolle Literaturadaption nach Stefan Heym.
CHRISTIAN ROTHER - BANKIER FÜR PREUSSEN Peter Deutsch; SFB/ARG-TV, 7.5.87 Siebenteilige Fernsehspielserie über den leitenden preußischen Finanzbeamten und dessen staatsdirigistische ökonomische Politik zur Zeit des Vormärz. Die Segmente der Serie über Nathan und Amschel Mayer Rothschild sowie den jüdischen Mitarbeiter Rothers sind frei von antisemitischem Einschlag, streben andererseits keine Weckung von Problembewußtsein über die Lage von Juden zur Emanzipationszeit an.
DER KAUFMANN VON VENEDIG Peter Zadek; ORF/3Sat, 1990 Die Produktion des Wiener Burgtheaters kappt sämtliche Bezüge zur historischen jüdischen Emanzipation und verlegt die Handlung konsequent in die Gegenwart.
NATHAN DER WEISE Margot Thy ret (Fernsehregie); ORB, 27.5.92 Fernseheinrichtung einer Bühneninszenierung von Friedo Solter am Deutschen Theater in Berlin aus dem Jahre 1989 mit Otto Mellies in der Titelrolle
7. Begegnung mit Tewjes Welt im Spiegel jiddischer Filme
7.1. Zur Analyse von Filmen über Juden in Osteuropa vor dem Ausbruch des modernen Antisemitismus Das mittelalterliche jüdische Ghetto in Deutschland bzw. Mitteleuropa verschwand um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Silbermann sieht zwar darin "ein sichtbares Zeichen" jüdischer Gleichberechtigungschancen, setzt aber trotz der formellen Gleichstellung der Juden im Jahre 1869 bzw. 1871 die "Vollendung der Judenemanzipation in Deutschland" erst in der Weimarer Republik an.1 J. H. Schoeps spricht im Hinblick auf das abrupte Ende der deutsch-jüdischen Weggemeinschaft durch die nationalsozialistische Judenverfolgung gar von der "mißglückten Emanzipation"2, eine auch von anderen Autoren gezogene Schlußfolgerung, die E. Reichmann als "Emanzipations-Defaitismus" schon 1956 zu widerlegen trachtete.3 E. Sterling verweist auf den nach der Auflösung der Ghetti erhobenen Vorwurf der jüdischen "Nationalabsonderung", der nicht nur gegenüber den liberalen, an der deutschen Kultur partizipierenden Juden galt.4 Der Kampf der Juden um ihre rechtliche und gesellschaftliche Gleichberechtigung mußte also trotz gewisser Erfolge fortgesetzt werden.5 Unsere ursprüngliche Absicht, an Hand von Filmen und Fernsehspielen zu prüfen, ob die Darstellungen deutscher Juden in ñktionalen Produktionen, die zwischen 1856 und 1871 spielen, Elbogens Einschätzung bestätigen, daß es sich dabei um eine durch "Optimismus, Idealismus, Liberalismus" geprägte Aufbauphase gehandelt habe, wogegen das jüdische Leben in den folgenden Jahren durch "Pessimismus, Materialismus, Nationalismus" unterwühlt worden sei,6 ließ sich nicht realisieren. Bekanntlich wurde nämlich nur ein einziges Fernsehspiel (FERDINAND LASSALLE) über diesen Zeitabschnitt produziert. Es scheint uns deshalb ratsam, den Blick abschließend auf jene seit einigen Jahren nostalgisch verklärt rezipierte Welt der in Osteuropa lebenden aschkenasischen Juden zu richten, die in den zu Beginn der Emanzipation spielenden deutschen Fernseh-
1 2 3 4 5
6
Silbermann 1984a, 24 Schoeps 1990, 13-30 Reichmann 1956, 13 Sterling 1956, 13 Reichmann 1956, 17: "Die Emanzipation löste die Judenfrage nicht, sondern verlegte ihr Spannungszentnun von der rechtlichen auf die gesellschaftliche Ebene. " Elbogen 1967, 33f
186 spielen nur in einer Randszene des Fernsehspiels JOHANN SEBASTIAN BACHS VERGEBLICHE REISE IN DEN RUHM vorgekommen waren. Dort hatte der alte Bach eine Begegnung mit einem umherziehenden armen Juden, dessen Frau dem Komponisten erklärte: "Abraham ist Doktor gewest bei uns im Schtetl." Das Schlüsselwort "Schtetl"7 löst meist die Assoziationskette Schtetl - Chagall Anatevka - Ostjude aus, Anlaß genug zu untersuchen, wie Film und Fernsehen im Laufe ihrer Geschichte diese Vorstellungen aufgegriffen, verarbeitet, verändert haben, wie weit diese filmischen Bilder durch die historische Realität gedeckt werden, ob die Erzählweisen geeignet waren, antisemitische Vorurteile zu bestätigen oder zu korrigieren. Wie Trude Maurer herausgearbeitet hat, ist der Terminus "Schtetl" positiv besetzt, und auch der Begriff "Ostjude" wird jetzt unbefangen gebraucht, obwohl er von seiner Herkunft her eher negative Konnotationen haben müßte, weil er sich mit der deutschen Okkupation im Ersten Weltkrieg durchsetzte und Ostjuden als Ghettojuden im Gegensatz zu den akkulturierten deutschen Juden als "schmutzig, laut, roh, unsittlich, kulturell rückständig galten".8 Die Nazispielfilme DIE ROTHSCHILDS und JUD SÜSS sowie der NS-Kompilationsfilm DER EWIGE JUDE haben bei der Herausbildung dieses Stereotyps einen verhängnisvollen Einfluß gehabt, so daß es von besonderem Interesse sein dürfte zu untersuchen, wie weit in der Bundesrepublik gelaufene "Schtetl-Filme" ähnliche Stereotype benutzten oder realistische, humane Gegenbilder entwarfen. Vorausgeschickt seien zwei Vorbemerkungen: Wir verzichten auf eine vorangestellte Sachanalyse (Literatur vgl. Anm. 7) und integrieren notwendige Sachergänzungen in die Interpretation der Einzelfilme. Wir begrenzen die Auswahl der Filme weitestgehend auf jene Produktionen, deren Handlung der Anlage der Arbeit gemäß bis etwa 1871 spielt (Ausnahmen gestatten wir uns aus Gründen des Kontrasts bzw. des Ausblicks auf folgende Entwicklungen oder wenn die filmische Adaption einer im 19. Jahrhundert spielenden literarischen Vorlage in spätere Zeit verlegt wurde). Die geringe Anzahl von Film- und Fernsehproduktionen über jene Ostjuden, die in der Zeit zwischen 1848 und 1871 gelebt haben, begründet unseren Verzicht auf eine Interpretation der Filme streng nach der Entstehungszeit. Wir beginnen - hier
7
8
Die Schreibweise des osteuropäischen jüdischen Kleinstadtchens wechselt in der Literatur: Außer "Schtetl" oder "schtetl" sind in Übersetzungen jiddisch schreibender polnischer, russischer, rumänischer oder amerikanischer Autoren beinahe alle denkbaren phonetischen Formen (Shtetl, Stetl, Städtl, Städtel, Stätel) gebräuchlich. Zugrunde gelegte Literatur: Zborowski/Herzog 1991; Riff 1987, 115-139; Katz 1982,166-184; Das Ostjudentum 1981; Hauptmann 1988, II, 639-667; Haustein 1988, II, 453-482; Weinzierl 1988, II, 483-531; Löwe 1985, 184-208; Ettinger 1980, III, 49-64, 111-125, 144-152; Pollack 1984; Dohm 1991; Spira 1981, 71-86; Elbogen 1967,69-101, 120-148; Maurer 1986, 11-44; Graupe 1977, 313-328; Rozenblit 1989; Bayerdörfer 1985, 211-236; Ydit 1983, 51-78; Brandt 1981,7-61; Howe 1984; Shulman 1974; Koch 1982, 13-34; Claussen 1982, 35-80; Brumlik 1982, 87-96; Kugelmann 1982, 97-101 Maurer 1986, 12
187 stimmt die filmische Chronologie noch - mit der Analyse des jiddischen Stummfilms DAS ALTE GESETZ aus dem Jahre 1923. Bei einem Voranschreiten nach der Filmhistoriographie müßten die jiddischen Stummfilme der zwanziger Jahre und dann jene etwa zehn oder fünfzehn Jahre später entstandenen jiddischen Tonfilme folgen, die noch vor der Vernichtung der jüdischen Kultur in Osteuropa produziert worden waren (z.B. YIDL ΜΓΓΝ FIDL, DER PURIMSCHPILER oder TEVYE), und den Abschluß würden die nach der Shoah entstandenen Produktionen der Jahre 1962, 1967 und 1971 (TEVJA UND SEINE TÖCHTER, TEVJE UND SEINE SIEBEN TÖCHTER, FIDDLER ON THE ROOF) bilden. Wir ändern die filmchronologische Gliederung zugunsten einer topographischen und gattungsmäßigen Strukturierung: Nach der Interpretation des in der österreichischen Donaumornarchie spielenden Stummfilms DAS ALTE GESETZ behandeln wir die im zaristischen Rußland spielenden Verfilmungen klassischer jiddischer Literatur von Mendele über Scholem-Alejchem bis Anski. Unser letzter Abschnitt faßt vier Filme einer besonderen Gattung zusammen, nämlich des jiddischen Musikfilms. Er führt nicht mehr den russischen Dorfjuden, sondern den polnischen Schtetljuden vor. Diese von der Filmhistoriographie abweichende Gliederung scheint uns noch aus einem zweiten Grund gerechtfertigt: Es handelt sich um drei Filme, die kurz vor der Vernichtung des polnischen Judentums durch die Nazis in der Republik Polen gedreht wurden.
7.2. Ein Emanzipationsfilm der Stummfilmzeit: DAS ALTE GESETZ Hatten wir die Filminterpretationen über den Weg der Juden Mitteleuropas aus dem Ghetto mit einem Ghettostummfilm begonnen, so steht nahezu am Ende unserer Untersuchungen ebenfalls ein Stummfilm.9 Beide Filme verlegen ihre Handlung - im Unterschied zum Gros der in Deutschland spielenden Filme aus dem Zeitalter der jüdischen Emanzipation - in das Herrschaftsgebiet der österreichischen Habsburger. In Paul Wegeners GOLEM bleiben die Juden in ihrem Präger Judenviertel. Der Versuch des christlichen Junkers, die Rabbinertochter zu verführen und in seine Welt zu entführen, scheitert. Die geschlossene jüdische Gesellschaft ist noch intakt, die Thora - das Gesetz, die Weisung - bleibt in Geltung. In Ewald Duponts drei Jahre später gedrehtem Film DAS ALTE GESETZ (1923) hat die Thora zwar für fast alle Juden des galizischen Schtetls weiterhin normative Kraft; aber die zentrale Figur Baruch, der erwachsene Sohn des Rabbiners, verläßt aus eigenem Entschluß die Mischpoke,
'
Sein Regisseur, Autor und Produzent Ewald André Dupont (1891-1956) zählt "schon Anfang der 20er Jahre zur ersten Garnitur deutscher Filmregisseure" (Cinegraph, Lg. 1, D 1). Seit 1933 arbeitete der jüdische Filmemacher ausschließlich in den USA. Von seinen 26 Stummfilmen hat er mit dem ALTEN GESETZ und von seinen 23 Tonfilmen mit TWO WORLDS ("Zwei Welten", 1930) jüdische Lebenswelten thematisiert.
188 die patriarchalisch orientierte jüdische Familie. Baruch (der Film lief auch unter dem Titel BARUCH) wendet sich einer Welt zu, wo nicht mehr das alte Gesetz gilt, sondern andere Gesetze ebenso absoluten Gehorsam heischen: die Hofetikette in der österreichischen Großstadt Wien und das Gesetz der Bühne (vgl. Foto Nr. 19 im Bilddokumentationsteil). Baruch wird Hofschauspieler am Burgtheater. Spielte der GOLEM lange Zeit vor Beginn der jüdischen Emanzipation (der historische Kern der Golemsage ist auf die Zeit von Kaiser Rudolf Π., also zwischen 1576 und 1609, anzusetzen), so wird die Handlung des Dupontfilms in die Zeit um 1860, unmittelbar vor ihren formellen Abschluß, verlegt (die rechtliche Gleichstellung der Juden in Mitteleuropa erfolgte in Österreich 1866, in Ungarn 1867, in Galizien ebenfalls 1867). Im Gegensatz zum GOLEM spielt DAS ALTE GESETZ bis auf eine Ausnahme keine herausragende Rolle in der Filmgeschichtsschreibung und in Nachschlagewerken, es wird meist (wenn überhaupt) nur im Werkverzeichnis oder in Anmerkungen, noch dazu fehlerhaft,10 erwähnt. Das dürfte darauf zurückzuführen sein, daß die Originalfassung des Films offenbar verschollen ist. Ob das Verschwinden mit der "Machtergreifung" der Nazis 1933 und Duponts Judesein im Zusammenhang steht, war nicht zu ermitteln. Erst zu den Berliner Filmfestspielen 1986 hat die Stiftung Deutsche Kinemathek von Lothar Schwab eine neue Fassung aus Kopien der Filmarchive in Moskau, Stockholm, Brüssel, Washington und Paris erarbeiten lassen.11 Duponts berühmtes Werk VARIETE (1925), der faszinierend durch Kamera und Montage ins Bild umgesetzte Kammerspielfilm über eine triviale Eifersuchtstragödie aus dem Zirkusmilieu, wurde von Kiacauer, Arnheim, Sadoul, Gregor/Patalas, Toeplitz und in den Filmführem eingehend analysiert, DAS ALTE GESETZ dagegen nur von Lotte Eisner. Sie rühmt das "außergewöhnliche Feingefühl", das "Kamera-Auge E. A. Duponts", seine Fähigkeit, Nuancen bewegt wiederzugeben, sie schimmernd zu beleben, seine Licht-und-Schatten-Palette unendlich reizvoll zu variieren, [...] das Fluten des Helldunkels durch Aufsetzen von in Schwarz-Weiß-Kopien noch fühlbaren Farbmomenten zu beleben. Der leuchtende Reichtum von sich wandelnden, verfließenden Impressionen entzückt das Auge.12
10
Kracauer (1979, 303) bezeichnete DAS ALTE GESETZ als Duponts "ersten Film" (nach der Filmographie in Cinegraph hatte Dupont vorher Drehbücher zu 18 Spielfilmen geschrieben und bei 22 Filmen Regie geführt - darunter 1918 einen FERDINAND LASSALLE); Sadoul (1982, 235) ist Baruch ein Sanger, und die mannliche Hauptrolle wird mit einem falschen Darsteller benannt; im Filmführer Deutsche Spielfilme von den Anfangen bis 1933 (1988, 331) wird DAS ALTE GESETZ als "historisch-biographischer Film" aufgeführt; Toeplitz' Inhaltsangabe (I, 428: "die Geschichte über ein galizisches Getto und das Leben der Schauspieler am kaiserlichen Theater in Wien") laBt eher an einen Dokumentarfilm als an einen Spielfilm denken. " Deutsches Institut für Filmkunde 1986,19. Der Vorspann dieser gegenüber der lllminütigen Zensurkopie nur um 3,4 Min. kürzeren Fassung nennt darüber hinaus eine Kopie des Staatl. Filmarchivs der DDR als Vorlage. 12 Eisner 1975, 277-283 (Zitate: 277f.)
189 Verstärkt wird der Eindruck einer gelungenen optischen Impression durch die Dramaturgie und den Montagerhythmus als ein Nach- und Gegeneinander der in sich vielfältig gegliederten vier Handlungsebenen und Schauplätze: - der geschlossenen jiddischen Glaubens- und Lebenseinheit des Schtetl mit einem patriarchalischen Rabbiner - des possenhaft präsentierten Satyrspiels der fahrenden Komödianten mit der zentralen Groteskfigur eines Schmierendirektors striesischen Zuschnitts (umwerfend komisch von Jacob Tiedtke verkörpert) - der elegisch-lyrischen, bisweilen (unfreiwillig?) komischen großen Welt des Hofes (mit der Heroine Henny Porten als der auf ihre Liebe zu dem jungen Hofschauspieler verzichtenden Erzherzogin: Foto Nr. 19) und schließlich - der dank seines dominanten Direktors Heinrich Laube unter dem Gesetz von Pflichterfüllung und Arbeitseinsatz bis zum letzten stehenden Welt des Wiener Burg theaters. Zusammengehalten werden die vier Welten, von denen Schmiere und Hof eher sekundär sind, Schtetl und Hoftheater dagegen als die miteinander konkurrierenden Gesetzeswelten häufig (z.B. bei der Vorbereitung auf Jom Kippur bzw. eine Burgtheaterpremiere) gegeneinandergeschnitten sind, durch die Figur des Rabbinersohns (Ernst Deutsch). Wir legen den Hauptakzent unserer Interpretation nicht auf die kulturhistorisch bedeutsame, überwiegend korrekte Präsentation dreier unterschiedlicher Formen des Theaters im 19. Jahrhundert (der jüdischen Purimspieler, der Wanderschauspieler und des Wiener Burgtheaters unter der künstlerischen Direktion von Heinrich Laube)13, sondern auf die jüdischen Figuren, die nicht nur in der Schtetlsequenz die zentralen Gestalten des Films sind. Daß das Ostjudensujet des Films nicht als leicht zu goutierender Romantizismus oder unverbindliche Nostalgie mißverstanden wurde, sondern der historische Stoff als mutiger Zugriff auch auf Probleme der jungen Weimarer Republik interpretiert werden konnte, erhellt die Rezension in einer der für die Frühgeschichte der Filmkritik so relevanten linksbürgerlichen Kulturzeitschriften.14 In Siegfried Jacobsohns Weltbühne vom 27.3.1924 schreibt Frank Aschau: Der Film wagt sich in ein sehr gefährliches Terrain, das von allen Seiten bedroht ist, zum Beispiel: vom Zorn frommer Juden, die hier einige ihrer Gebräuche dargestellt sehen vor einem profanen und vielleicht feindseligen Publikum; von dem Gründlichkeitsfanatismus gebildeter und gelehrter Juden, die lieber wollen, daß gar nichts mitgeteilt wird als einiges; von den Leuten, für die alles, was mit Ostjuden zu tun hat, der Gegenstand eines abergläubischen Entsetzens, der Verachtung oder hysterischer Furcht ist; von wilden, kriegerisch veranlagten Hakenkreuzlern; und so weiter. Ein Landstrich, wo außerdem noch zu fürchten sind die lauwarmen Sturzbäche eines sentimentalen Familiensinnes sowie die Lanzenspitzen eines apologetischen Heroismus, der unbefangene Betrachter in überstürzte Fluchten jagt. Allen
13
14
Vgl. Gregor 1933, 712-715, 641-647; Theater-Lexikon 1983, Sp. 240f„ 799-801; Fechter 1956, I, 394-396; kontrovers Grab 1992, 201f. Heller 1990, 25-45
190 solchen Gefahren wird hier getrotzt und ein angenehmes Gebilde geschaffen, das einige Kenntnisse vermittelt und geeignet ist, zu Erkenntnissen anzuregen.
DAS ALTE GESETZ ragt aus jener nicht unbeträchtlichen Anzahl von fiktionalen Stumm- und Tonfilmen über osteuropäische Juden, eingeschlossen die Juden in Österreich-Ungarn, hervor, die in der Film- und Fernsehgeschichte in drei mehr oder weniger geschlossenen Komplexen zu verzeichnen sind: - in der Stummfilmzeit, wo man schon seit 1911 in Rußland und Polen jiddische Bühnenstücke abfilmte und mit manchmal auch jiddischen Zwischentiteln versah15 - in der frühen Tonfilmzeit der dreißiger Jahre, wo man für jiddisch sprechende Rezipienten in Polen und den USA Filme produzierte, die unter dem Stichwort "Das jiddische Kino" durch die Retrospektive des Frankfurter Filmmuseums im Jahre 1982 bekannt und des Filmbegleitprogramms der Freunde der Deutschen Kinemathek zur Berliner Ausstellung "Jüdische Lebenswelten" 1992 ergänzt wurden, und zuletzt - nach der Shoah, wo ebenfalls Kinofilme, häufiger aber Fernsehspiele produziert wurden, die überwiegend Literaturadaptionen berühmter Autoren wie Scholem-Alejchem, Isaak Babel, Joseph Roth oder Isaac Bashevis Singer waren. Die fiktionalen Kino- und TV-Produktionen über das Ostjudentum spielen größtenteils vor oder nach der Jahrhundertwende, meistens sogar schon zum Zeitpunkt ihrer Entstehung als Stummfilme in der zwanziger oder als Tonfilme in den dreißiger Jahren. Lediglich DAS ALTE GESETZ sowie die Verfilmungen von Mendele und Anski verlegen ihre Handlung eindeutig schon in die Zeit vor 1871. Der Dupontfilm DAS ALTE GESETZ läßt erkennen, wie wenig das übliche Drei-Phasen-Schema bei der geschichtlichen Darstellung der Emanzipation (nach Greive unterscheiden wir die Perioden der ankündigenden Emanzipation 17401789, der rechtlichen Durchsetzung der Emanzipation 1789-1878 und der Krise und Infragestellung der Emanzipation 1878-1933)16 auf die osteuropäische Entwicklung anzuwenden ist: Der Rabbiner Mayer des galizischen Schtetls dieses Films und mit ihm der größte Teil seiner Gemeinde verharrt noch in den tradierten Normen vor der Haskala (anders gewendet: In den osteuropäischen Gebieten konnte sich die rabbinische Orthodoxie gegen die in West- und Mitteleuropa längst erfolgreiche Haskala behaupten)17; sein Sohn Baruch überwindet in wenigen Monaten mit seiner individuellen Migration das Entwicklungsgefalle zwischen Ostjudentum und assimiliertem westeuropäischem Judentum. War die Entwicklung in Österreich und Ungarn auch ähnlich wie in Deutschland verlaufen (Fortschritte durch die Revolution von 1848/49, dann Zurücknahme der gewährten Rechte in einer reaktionären Phase, schließlich Umschwung in den sechziger Jahren), so bestanden doch erhebliche Unterschiede zwischen den "westlichen" assimilierten Juden und den sich der jüdischen Aufklärung verschließenden, in festgefügten traditionellen
15 16 17
Loewy 1982, 10 Greive 1980,151 Bruer 1991, 23
191 Lebensformen beharrenden Gemeinden vor allem in Galizien. In jener historischen Landschaft im Norden der Karpaten, die 1772 mit der ersten polnischen Teilung an Österreich gefallen war, lebten zwar Juden "in Massen"18 (um 1900 gab es nach einer von Pollack mitgeteilten inoffiziellen Statistik 810 000 Juden)19, aber sie stellten inmitten der 47 % Polen und 45 % Ukrainer nur eine Minderheit von zunächst 6 % dar. (Allerdings kam es zu nicht unbeträchtlichen territorialen und ethnischen Fluktuationen). Die tausendjährige Geschichte der osteuropäischen Juden ist primär eine Geschichte der Juden in Polen, in Litauen und Rußland. Dort, und nicht im österreichischen Galizien, spielen auch die 122 Filme des schon erwähnten jiddischen Kinos der dreißiger Jahre. (Galizien ist meist Schauplatz der sieben Verfilmungen von Werken des dort geborenen Joseph Roth, der wie der fiktive Baruch Mayer seinen Weg von Galizien nach Wien nahm). Manche jenseits der österreichischen Grenze (in Rußland, Polen, Rumänien) das Leben der jüdischen Gemeinden belastenden Probleme und Konflikte, die teils mit der vom Staat zunächst befohlenen und beaufsichtigten, dann aber wieder abgeschafften Selbstverwaltung, teils mit den Kontroversen zwischen orthodoxen und messianischen Strömungen, zwischen den Chassidim und der Vertretern der Haskala zusammenhingen, traten in Galizien weniger in Erscheinung. Auch waren die judenfeindlichen Praktiken im sog. "Ansiedlungsrayon" des Zarenreiches mit der Pressung Zwölfjähriger zum Militärdienst hier unbekannt. Umso bedrückender war außer der vielfach unbeschreiblichen Armut die Situation im Nationalitätenstreit, weil Juden im Vielvölkerstaat Österreich jeweils als "Komplicen der anderen Seite" beschuldigt wurden, so daß in Galizien wie in fast allen Teilen Osteuropas "der Antisemitismus zum integralen Bestandteil des Nationalismus wurde."20 Davon ist im Film so gut wie nichts zu sehen. Baruch erlebt Judenfeindschaft nur während seiner Lehrzeit bei den fahrenden Komödianten, so in dem abfalligen Zwischenruf eines Höflings, während der Schauspieler der Wanderbühnentruppe in einer Shakespearevorstellung vor der Erzherzogin agiert: "Seht euch das an: ein Romeo mit jüdischen Schläfenlocken!" Nach einem zweiten Spottwort ("Der Romeo vom Stamme Asra!") distanziert sich die Familie des Wanderbühnendirektors von Baruch, sie kaschiert den künstlerischen Mißerfolg durch Seitenhiebe auf den jüdischen Darsteller ("Und mit so einem muß man auftreten! ", "Direktor des Burgtheaters hätte ich werden können - ohne die verdammten Locken!") Die in der "Romeo-und-Julia"-Sequenz thematisierte Judenfeindschaft mit ihren Folgen erscheint als Vorurteil der unteren Mittelschicht bzw. der selbst deklassierten "Fahrenden". Sie wird durch die Anteilnahme und die spätere Protektion der einflußreichen, sich über den Gruppenzwang der Hofgesellschaft hinwegsetzenden Großherzogin unterbunden. Die Bekanntschaft mit der
18
" 20
Elbogen 1967, 69 Pollack 1984, 19 Riff 1987, 133f.
192 Aristokratin verstärkt die Karriere- und Akkulturationswünsche des jungen galizischen Juden, er ist bereit, durch Assimilation den Preis für den gesellschaftlichen Aufstieg zu zahlen. Dies belegt eine eindrückliche Schnittfolge des Films: Der vor einem prächtigen Spiegel seine Pejes prüfend anschauende Baruch (Großaufnahme)/ Insert: "Baruch Mayer"/ Dialog im Schtetl zwischen dem Synagogendiener und seiner Tochter Esther, Baruchs Braut, die auf den Geliebten wartet/ Wieder Großaufnahme von Baruch im Spiegelbild, der seine Schlafenlocken abschneidet und sein Haar modisch bürstet/ Insert: "Der k. u.k. Hofschauspieler"
Dupont läßt in seinem Film nichts über die Lebensbedingungen von Juden in Wien verlauten, wo sein nie wieder angepöbelter und äußerlich als Jude nicht mehr erkennbarer Held anschließend eine steile Theaterkarriere macht, von Erfolg zu Erfolg eilt, den Anpassungs- und Akkulturationsprozeß perfekt durchlaufen hat und mit seiner Frau Esther als ein angesehener, wohlhabender Bürger des späten Wiener Biedermeier lebt. Diese in der deutschen Produktions- und Verleihgeschichte einmalige , nicht diffamierende Gestaltung der Assimilation eines Juden aus dem Zeitalter der Emanzipation von der Ghettoexistenz bis zur fast vollständigen Verschmelzung und Angleichung an die Zivilisation und Kultur der Umwelt würde ausreichen, um neben seinen ästhetischen Qualitäten den religions- und kulturgeschichtlichen Rang des Films zu begründen. Denn in deutschen historischen Filmen über die Emanzipationsepoche war bekanntlich der Assimilationsprozeß von Juden nur unter antisemitischem Blickwinkel gezeigt worden (in JUD SÜSS und DIE ROTHSCHILDS). Der andere herausragende Beitrag des Films zum Verständnis des Judentums ist die Zeichnung des Schtetls und seiner Bewohner. DAS ALTE GESETZ ist unseres Wissens der einzige deutsche vor dem Ausbruch des modernen Antisemitismus im ostjüdischen Milieu der Donaumonarchie spielende Stummñlm. Allerdings ist es eine etwas geschönte Welt, die Dupont (und die Regisseure ostjüdischer Filme nach ihm) zeigen: Die "Häßlichkeit und der Schmutz des Städtchens" sowie die "bis zur Absurdität maßlose, groteske Armut"21 werden nicht vorgeführt. So enthält also der Film keine Bilder, aus denen die politische und wirtschaftliche Situation der Juden im Heimatdorf Baruchs hervorgeht; nichts "verlautet" über die Reaktion von Gemeindegliedern auf Judenfeindschaft und Emanzipationsvorstellungen von Nichtjuden ihrer Zeit, so als ob dies sieben Jahre vor dem Abschluß der Emanzipationsgesetzgebung für Galizien kein Thema mehr sei. (Dezidierter sollte Dupont sieben Jahre nach dem ALTEN GESETZ in seinem während des Ersten Weltkrieges spielenden Tonfilm TWO WORLDS das Thema des Antisemitismus behandeln.)22
21 22
Sperber 1974, 18 u. 21 Hollstein 1971, 28f. u. 241f.
193 Auch die Berufsstruktur damaliger Juden in jenen galizischen Kleinstädten bleibt verborgen. So wie nicht gezeigt wird, daß sich alles um "pamose", also um Erwerb und Lebensunterhalt drehte,23 scheint auch keiner in Baruchs Heimatdorf ein Gewerbe zu haben (ganz abgesehen davon, daß es in Galizien außer den traditionellen jüdischen Berufen auch jüdische Arbeiter im Erdölgebiet um Drohobycz, dem "galizischen Pennsylvanien" und der "galizischen Hölle" gab). Anzeichen für die in der Literatur vielfach beschriebene "Rückbesinnung auf die schöpferische Kraft der eigenen Kultur"24 sind ebenfalls nicht zu entdecken, sondern im Hause des Rabbi eher eine starre Abkehr von ihr, ebensowenig Andeutungen einer politischen Aufklärung und sich formierender Kritik an den sozialen Zuständen. Jedoch relativieren sich solche Einschränkungen gerade gegenüber dem ALTEN GESETZ, weil nicht intensiv genug daraufhingewiesen werden kann, daß im Stummfilm, wo die "sprachlich-verbale Komponente im Vergleich mit der Bildsprache in der Regel überhaupt keine oder nur eine sehr geringe Rolle spielt"25, es gar nicht möglich ist, so differenzierte Akkulturationsprozesse bildlich zu gestalten oder gar Zwischentitel damit zu überladen. Dennoch ist die Welt eines galizischen Schtetls bei aller problematischen Eingrenzung nur auf die familiären Ereignisse im Haus eines Rabbiners sowie auf einige jüdische Bräuche und Feste weitgehend authentisch nachgestaltet worden. Vor allem beeindruckend ist die differenzierte Wiedergabe jüdischer Riten und Symbole.26 In Wegeners GOLEM, dem anderen Stummfilm über eine Judenstadt, waren jüdische Rituale nur pauschal ohne Anbindung an konkrete Feiern und Feste als bloßer Flehgestus der die Arme emporreckenden anonymen Menge eingeblendet worden. Hier bei Dupont wird das Purim-Friedensfest sowohl in seinem zeitlichen Ablauf wie in den zahlreichen einzelnen Bräuchen der Purimfeier fast dokumentarisch genau gefilmt, dabei aber geschickt mit dem Handlungsablauf verwoben: Man sieht den Synagogendiener noch vor Sonnenaufgang von Haus zu Haus gehen und die Gläubigen mit einem Holzklopfer zum Gebet wecken. Man erlebt das Morgengebet in der mit der Heiligen Lade, der Bimah, den Kandelabern, dem Betpult, den Sitzbänken und der Weiberschul authentisch eingerichteten Synagoge un später dann am Abend das Vorlesen der Esterschriftrolle mit dem Ratschenspektakel der Kinder ("Hammanklopfen"). Man sieht, wie das Purimgebäck gebacken wird, wie man sich gegenseitig Geschenke schickt, wie man Umzüge veranstaltet, sich kostümiert und Purimspiele aufführt. Ebenso sorgfältig gestaltete Szenen blendet Dupont vom Schabbat, vom Versöhnungstag Jom Kippur mit dem Kol-Nidre-Gebet und vom Paschafest
23 24 25 M
Pollack 1984, 22 u. 29-43 Koch 1982, 14 Faulstich 1988, 10 De Vlies 1982; Landesmann 1987; Jüdisches Fest, jüdischer Brauch 1985; Rink 1988; Geis 1977, 17-123; Hirsch 1982; Lau 1988; Petuchowski 1984
194 (Pessach) ein. Auch diese Einstellungen werden kontrastierend mit der Haupthandlung, der Schauspielertätigkeit des Baruch, verknüpft: Inserts mit entsprechenden Einstellungen: "In der Synagoge werden zu Beginn des hohen Fests die Lichter angezündet."/ "Im Burgtheater werden vor der Vorstellung die Kronleuchter angezündet."/ Im Nebenraum der Synagoge betet Rabbiner Mayer vor dem Gottesdienst./ In seiner Garderobe betet Baruch Mayer vor seinem Auftritt als Hamlet.
Man könnte annehmen, daß ein 1923 gedrehter Film die Eindringlichkeit jüdischer Gottesdienste und den Gefuhlsreichtum des Betens mit Leidenserfahrungen von Pogromen, antisemitischen Blutbeschuldigungen und der Verweigerung gesellschaftlicher Anerkennung auch nach 1871 verknüpft. Hier enthält sich der Film auffällig einer politischen Stellungnahme. Es sei denn, man interpretiert den emanzipatorischen Schluß des Films - der Rabbiner, der seinen Sohn wegen dessen Schauspielerlaufbahn als verloren eingestuft hatte, akzeptiert am Ende dessen Entscheidung - nicht nur als Aufklärungsphilosophie, sondern als gesellschaftlich relevantes Handeln. Aber der SchluB ist doch wohl eher ein eingeschränktes, illusionistisches Emanzipationsmodell: der glücklich vollzogene Akkulturationsprozeß des Sohnes als rechtliche Gleichstellung und konfliktfreie, harmonische Integration in die Wiener Gesellschaft bei gleichzeitigem Verbleiben in der Mischpoke und Anerkennung der in ihr praktizierten chassidischen Frömmigkeit. Die klassischen von Ettinger beschriebenen Verhaltensmodelle von Juden gegenüber einer sie umgebenden nichtjüdischen Gesellschaft werden noch nicht praktiziert: Der Jude sagt sich nicht von seiner Herkunft, den historischen Traditionen und seiner Religion los, Assimilation wird nicht mit Glaubenswechsel erkauft; Emanzipation bedeutet für ihn nicht aktive Teilnahme an einer durchgreifenden Veränderung der bestehenden Ordnung und auch nicht Exodus aus der europäischen Gesellschaft.27 DAS ALTE GESETZ steht - bewußt oder unbewußt - in der Traditionslinie des jiddischen Films. Es nimmt in der Wahl des Sujets, der Figuren und deren Bewertung, in der indirekten Thematisierung der Migration von Ost nach West und in der Herausstellung chassidischer Frömmigkeit als Verweigerung einer Öffnung zur Welt vielfaltig die bekannteren jiddischen Tonfilme der dreißiger Jahre vorweg. Mit dem jiddischen Kino verwandt scheint auch die Vorliebe für melodramatische Sequenzen, etwa in der rühr- und tränenseligen Abhandlung des Vater-Sohn-Konflikts und dessen Auflösung als Symbiose von alter chassidischer Frömmigkeit und der aus der gleichen Quelle gespeisten neuen Faszination des Buches in der Spielart der theatralischen Sendung. Wenn man bei diesem Stummfilm einmal vom Fehlen des jiddischen Idioms und der "Musik als dem konstitutiven Moment des jiddischen Films"28 absieht, kann man DAS ALTE GESETZ als Urtyp des jiddischen Films - wenn auch ohne dessen oft sozialkritische Komponente - bezeichnen. Ganz besonders trifft das auf
27 28
Ettinger 1980, 6f. Koch 1982, 29
195 die Präsentation des Figurenarsenals zu. Noch hat die Mame, die sich für den Familienzusammenhalt aufopfernde Mutter, nicht die zentrale Stellung. Noch fehlt der Schadchen, der emsige Heiratsvermittler. Noch bilden Hochzeitfeste, Kaddischsagen, Geburt und Tod nicht die Pfeiler der Handlung. Aber sonst sind das Figurenensemble und die Ideologie der Mischpokendarstellung schon komplett. Da sind zunächst die Hauptfiguren: der über die Gemeinde und die Familie autokratisch herrschende und doch so weiche Rabbi (von dessen Kompetenzen und Pflichten Dupont nur seine Funktion im Synagogengottesdienst vorführt) und sein aufbegehrender, sich mit Gewissenskämpfen vorübergehend aus der Tradition lösender, seiner neuen Leidenschaft sich pathetisch hingebender und doch der Familie und dem Glauben verbunden bleibender Sohne - eine Paraderolle für den damals schon berühmten 33jährigen Ernst Deutsch in seiner 37. Filmarbeit. (Eine Variante des Vater-Sohn-Konflikts, sogar wiederum als Gegensatz zwischen Rabbiner und Künstler, wurde nur vier Jahre später mit dem ersten Tonfilm der Filmgeschichte THE JAZZSINGER, 1927 produziert.) Unter den Nebenfiguren ist zunächst die sich in ihre traditionelle Rolle schickende, auf den Bräutigam wartende hübsche Braut zu nennen. Interessanter aber sind jene Figuren, die einen - wenn auch beschränkten - Einblick in Gemeindeämter, Gemeindestruktur und soziale Organisation der jüdischen Gemeinde geben. Da DAS ALTE GESETZ nicht in der Großstadt spielt, kommt ein Chasan, ein Kantor, als Leiter der Gottesdienste nicht vor. ein Lehrer (Melamed), ein Gemeindesekretär, ein Thoraschreiber treten ebensowenig in Erscheinung wie der den Verkauf von koscherem Fleisch, die Herstellung von koscherem Wein und die Mazzotbäckerei kontrollierende rituelle Aufseher, der Schomer. Auch andere typische Schtetlfiguren werden nicht gezeigt: der Fleischer, Schächter und häufig auch Beschneider, der Schadchen (Heiratsvermittler), der Wasserträger und der Kesselflicker, der Hausierer und der Trödler, die Wäscherinnen und die Lastträger - sie alle werden in den jiddischen Tonfilmen eine mal größere, mal kleinere Rolle spielen. Aber es gibt den Schammes, den Küster, oder wie es in den Zwischentiteln heißt, den Synagogendiener, der mit der Haupthandlung als Vater der Braut verknüpft wird. Fritz Richard (nicht, wie häufig in der Literatur: Werner Krauss)29 spielt den Schammes Nathan mit einer solchen Prägnanz, daß man glaubt, Bilder eines Dokumentarfilms über osteuropäische Juden zu sehen. Die andere wichtige Nebenfigur ist der Schnorrer. Sie signalisiert die religiöse Pflicht des Almosengebens für jeden frommen Juden (10 % seines Vermögens soll er für Wohltätigkeitszwecke ausgeben), z.B. die durchreisenden Armen zu einer warmen Mahlzeit einzuladen. So praktiziert es auch der Rabbi Mayer im Film. Durch die Wahrnehmung seiner sozialen Verantwortung deckt er gleichzeitig seine Informationsdefizite; denn die umherziehenden Armen oder Schnorrer waren wichtige Nachrichten- und Klatschübermittler. Die Darstellung des Schnorrers Ruben Pick ist ein Kabinettstück des Schauspielers Robert Garvison; er vermag 29
Z.B. im DIF/SDK-Verleihkatalog Nr. 1 und in Cinegraph
196 das Possenhaft-Verschmitzte mit einem Stich ins Unverschämte ebenso wie die echte Bedürftigkeit, die Ehrlichkeit der Gesinnung und die Versöhnung stiftende Herzlichkeit dieser Figur überzeugend auszudrücken. Die Schnorrerszenen zeigen darüber hinaus die Solidarität von Juden in der Fremde und die Kraft zum Bekenntnis der religiösen Überzeugung: Als man dem schon berühmten Hofschauspieler Baruch den Besuch des Schnorrers meldet, läßt er sich eben nicht verleugnen oder kapselt sich mit ihm von der Dienerschaft ab, sondern er steht zu ihm mit all seiner früheren Herzlichkeit. Man kann hier von einem Gegenbild zu dem in der Literatur jeglicher Couleur immer wieder entworfenen Klischee vom schachernden, schnorrenden und sich überall durchmogelnden, auf ungesetzliche Weise zu Reichtum kommenden Juden sprechen.
7.3. Die Adaptionen klassischer jiddischer Literatur über russische Dorfund Schtetyuden Der jiddische Film im engeren Sinn umfaßt jene meist mit jiddischen Zwischenbzw. Untertiteln versehenen oder in jiddischer Sprache hergestellten Filme, die für ein jiddisch sprechendes Publikum produziert wurden oder/und jiddische Lebenswelten in Österreich-Ungarn, in Rußland oder Polen zeigen. Spielte der deutsche Stummfilm DAS ALTE GESETZ in der Donaumonarchie, so wenden wir uns jetzt den Darstellungen des jüdischen Lebens im zaristischen Rußland zu. Bei einer streng historiographischen Vorgehensweise, etwa mit dem Ziel, die Entwicklung des jiddischen Kinos von seinen ältesten Stummfilmen bis zu den jüngsten Produktionen in jiddischer Sprache vorzuführen,®0 müßten wir unter Mißachtung unseres zeitlichen Rahmens erst die Stummfilm- und danach die Tonfilmproduktionen analysieren. Wir beschränken uns stattdessen auf die Interpretation der Verfilmungen klassischer jiddischer Literatur in der Reihenfolge der Geburtsdaten ihrer Autoren. Deshalb beginnen wir mit der Adaption zweier Romane Mendeles, also mit dem Tonfilm DIE KLJATSCHE/FISHKE DER KRUMER, stellen dann die Verfilmungen von Romanen Scholem-Alejchems vor und beenden dieses Kapitel mit der Analyse der Dybuk-Adapúon Anskis.
7.3.1. Mendeles Bettlerroman Fischke der Lahme als amerikanisch-jiddischer Tonfilm Mendele Moicher Sforim, zu deutsch "Tröster, der Bücherverkäufer", wie sich Sholem Jakob Abramowitsch, 1835-1917, nannte, wurde von Scholem-Alejchem ehrerbietig Sejde, Großvater der jiddischen Literatur, genannt. Er gilt als der 30
Vgl. Hoberman 1991
197
Autor, der sich der ostjiddischen Volkssprache als Ausdrucksmittels der anspruchsvollen Literatur bediente, was vor ihm die russischen Verfechter der Haskala abgelehnt hatten. Der zuerst nur in hebräisch schreibende Dichter des Ghettos, der Epiker jüdischer Armut, der gegen Korruption und Heuchelei in den Gemeindeleitungen anschreibende Satiriker wollte verstanden werden und schrieb darum jiddisch. Der gläubige Jude Mendele, in jungen Jahren Talmudschüler und zugleich schon Aufklärer, in späteren Lehrer und weiterhin Maskilim, Verfechter der Aufklärung, lebte in einem Land, das nur vorübergehend in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf den Beginn oder gar einen Sieg der Gleichberechtigung der Juden hoffen durfte. Von einer Zeitverzögerung der jüdischen Emanzipation wie im österreichischen Galizien läßt sich hier nicht sprechen, weil noch im 20. Jahrhundert das Russische Reich als einzige Großmacht in Europa seine jüdischen Untertanen nicht emanzipiert hatte, sondern jüdische Gesetzgebung immer judenfeindliche Gesetzgebung war, was zum Exodus vieler Juden aus den Gebieten führte, die erst nach den polnischen Teilungen an Rußland gefallen waren. Um das Jahr 1894 lebte in Rußland fast die Hälfte aller Juden der Welt, nämlich 5,2 Millionen, das sind 4 % der Gesamtbevölkerung, zwangsweise zusammengedrängt in den Kleinstädten und Flecken der fünfzehn Gouvernements West- und Südrußlands, die ihnen als sog. "Ansiedlungsrayon" zugewiesen worden waren. Auch in dem russischen Rayon war die (Zwangs-)Siedlungsform von Juden die der Schtetlexistenz (wie überwiegend auch im österreichischen Galizien). Hier aber korrespondieren die Bilder, die durch den Dupontfilm DAS ALTE GESETZ, die Mendeleverfilmung und später die vier Tewjefilme evoziert werden, in einem entscheidenden Punkt nicht mit der historischen Wirklichkeit: Sie verlagern vielleicht, weil sie die Geschichte einer Mischpoche erzählen - die Handlung in wenige Häuser, bestenfalls in eine Gasse des Schtetls. Anders als die noch zu interpretierenden Filme von Joseph Green und die Menachem-Mendel-Adaption von Alexander Granowskij vernachlässigen sie den Unterschied zwischen den jiddischen Siedlungsformen "Dorf" und "Schtetl". Sie benutzen den Terminus "Schtetl", zeigen jedoch nicht Bilder von dieser typischen jüdischen Kleinstadt, sondern bestenfalls von einem Marktflecken, tatsächlich aber vom jiddischen Dorf. Der gern als Urbild des Schtetlbewohners bezeichnete Tewje in Scholem-Alejchems gleichnamigen Roman lebte im Dorf. Bildbände mit Reproduktionen der zwischen 1935 und 1939 mit versteckter Kamera in Polen, Litauen, Lettland, Ungarn und der Tschechoslowakei von Roman Vishniac aufgenommenen Fotografien oder den von Leon Brandt im Archiv der ersten jüdisch-sozialistischen Arbeiterbewegung Osteuropas (Bund-Archiv, jetzt New York) aufgefundenen undatierten Fotos geben dem gegenüber viel stärker die Atmosphäre des eigentlichen Schtetls wieder; dagegen erinnern Shulman Fotos aus den zwanziger Jahren häufig mehr an Situationen im Dorf als im Schtetl.31 Wegen der in den genannten Filmen zum Teil wohl
31
Vishniac 1983; Brandt 1981; Versunkene Welt 1984; Shulman 1974. Die nicht-fiküonalen Fernsehfilme, z.B. BILDER AUS DER ERINNERUNG von Jerome Bandanes, Regie: Yosh Waletzky (N 3, 15.12.87) oder WUS GEWEJN ... ES WAR EINMAL von Robert Hartmann
198 auch aus Kostengründen vom Sditeti zum Dorf reduzierten Bauten und der gewählten Bildausschnitte wird die drangvolle Enge der Städte nicht bewußt. So kann auch die historische, durch zaristische Willkürmaßnahmen bewirkte Umkehrung der Stadt-Land-Proportion und der Berufspyramide des übrigen Rußlands in den meisten dieser Filme nicht in Erscheinung treten, nämlich: - 82 % der Juden Gesamtrußlands vegetierten zusammengepfercht in Städten und Marktflecken; nur 18 % lebten auf dem flachen Lande. - Drei Viertel der Juden waren in Handel, Handwerk und Industrie beschäftigt. - Die totale Überbesetzung von Handel und Handwerk durch Juden führte zu bitterster Armut der jüdischen Bevölkerung. (Die 6 % der Juden, die sich als bevorzugte Gruppe außerhalb des Ansiedlungsrayons niederlassen durften, lassen wir hier unberücksichtigt.) Das aus dieser Diskriminierung resultierende literarische Programm Mendeles, der zum Opponenten der hierarchischen Oligarchie wurde, läßt sich gut an den beiden jiddischen Titeln des Films THE LIGHT AHEAD/DI KLJATSCHE/ FISCHKE DER KRUMER von Edgar G. Ulmer, USA 1939, aufzeigen.32 Der 1873 erschienene Roman Die Kljatsche (deutsch Die Mähre) ist eine "aufklärerische Allegorie auf die Judenheit als Sündenbock der Menschheit und zugleich ein aus dem Gedankengut der Haskala [...] schöpfender Aufruf zu jüdischer Selbstbesinnung."33 Die Titelfigur, ein in eine Mähre verwandelter Prinz, repräsentiert das gequälte und mißhandelte jüdische Volk, gepeinigt und verhöhnt von anderen Pferden (d.h. Völkern), vom "Tierschutzverein" (Regierung), der in einer schneidenden Satire auf das Dohmsche Rezept zur "bürgerlichen Verbesserung der Juden" empfiehlt, "der Mähre das verfilzte Haar wegschneiden [zu] lassen [... und] durch Bildung die Lage zu verbessern" (Roman, S. 115f.), bedrängt aber auch - im Auftrag des Satans! - von (jüdischen) "Wohltätern". Trotz seines aus dem Roman übernommenen Titels findet sich im Film auch nicht ein Anklang an die Satire, eine Transponierung seiner Bilder, geschweige denn - als Vision oder Traum - ein Zitat oder irgendeine Form der Adaption. Näher an der literarischen Vorlage müßte demnach der Film als Fischke der krumer sein. Dieser 1869 in jiddischer, 1888 (als Das Buch von den Bettlern) in hebräischer Sprache erschienene Ich-Roman, der aus der Perspektive des mit seinem Karrengaul und Bücherwagen übers Land ziehenden Buchhändlers Mendele erzählt wird, hat als Rahmenhandlung die Begegnung zweier Berufskollegen, die einander mit Humor, Selbstverspottung und sichtbarer Lust am Fabulieren ihre Erlebnisse und Begegnungen mit anderen Juden erzählen, vor allem die Geschichte vom armen, hinkenden Krüppel Fischke, der die blinde Hödel geheiratet hat und
32
33
(N 3: 17.6., 19.6., 1.7.87) enthalten meist das gleiche Fotomaterial wie die Bildbände, ergänzen es aber durch (wenige) instruktive andere Aufnahmen. Edgar G. Ulmer aus Wien (1904-1972) war in Deutschland vor 1933 im Theater Mitarbeiter von Max Reinhardt, im Film von Fritz Lang, F.W. Murnau und Robert Siodmak. Zwischen 1933 und 196S inszenierte er zahlreiche Filme in den USA, darunter die jiddischen Produktionen GRINE FELDER, JANKL DER SCHMID und AMERIKANER SCHADCHEN. Best 1971, IV, Sp. 569f. bzw. 1990, XI, 529f.
199 mit ihr in einer Bande brutaler, widerwärtiger, sich kriminalisierender Bettler von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt zieht. Hödels Verwandlung in die zänkische, ihren Mann verachtende Vettel, die mit dem Bandenchef gemeinsame Sache macht, die Prügel und seelischen Grausamkeiten lassen den erbarmenswerten, aber auch erbärmlichen Fischke sich in die andere outlaw der Bande, ein von ihr einstmals aufgelesenes, nun schamlos ausgenutztes buckliges Findelkind, verlieben. Ins Zentrum der Handlung gerät damit die Schilderung dieser amour fou, die geschickt mit dem Erzählrahmen von den beiden Buchhändlern verknüpft wird. Ulmers Film ist in seiner Gestaltung ein enttäuschendes B-Picture, das in wackligen Bühnenkulissen mit kaum beweglicher Kamera und in konventioneller Einstellungsabfolge quasi Theaterszenen abfilmt und die Sequenzen mit einer besonders an den Nahtstellen technisch primitiven und schematischen Mixtur aus Mahlers 1. Sinfonie und Klezmermusik untermalt. Ihr dramaturgischer Grundeinfall besteht in der allegorischen Abfolge von Nachtszenen, die erst - dem amerikanischen Titel gemäß - am Schluß dem Tageslicht weichen. Von der literarischen Vorlage übernimmt der Film nur winzige Handlungs- bzw. Figurenelemente und schönt die Charaktere zu gefalligen Typen (bei Mendele dagegen werden auch die positiven Unterschichtvertreter wie Fischke und die Bucklige nicht idealisiert, sondern sind gebrochene, an Leib und Seele zerbrochene Charaktere). Er modelt die Story zur sentimentalen Liebesgeschichte zwischen dem hübschen, wegen eines Beinbruchs leider etwas hinkenden Ghettojingele und dem liebenswerten, schönen, edlen, wenn auch blinden Ghettomädele um. Dennoch ist das Bild, das vom Schtetl (auch hier wieder nur im Ausschnitt einer "Dorf-Straße präsentiert) und seinen Bewohnern, von den HaskalaVertretern und der orthodoxen Gemeinde-(Stadt-)Verwaltung gezeichnet wird, für die Situation jüdischer Gemeinden in Rußland während der Mitte des 19. Jahrhunderts wohl nicht untypisch und enthält eine ganz im Geiste des Maskilim Mendele deutlich vorgetragene Kritik an der jüdischen Orthodoxie, die als geldgierig, gesetzlich und abergläubisch hingestellt wird: Sie hortet ihre 100 000 Rubel, mit denen sie allenfalls das Dach der Synagoge neu decken lassen will, weigert sich aber, hygienische Maßnahmen zur Eindämmung der Cholera zu treffen. Diese wird vielmehr als Strafe Gottes wegen des Verstoßes gegen die Sabbatheiligung interpretiert (Hödel und einige andere junge Mädchen hatten im verseuchten Fluß am Schabbat gebadet). Als Abwehrmaßnahme gegen das Vordringen der Cholera praktiziert sie den Brauch der Cholerahochzeit, daß nämlich Krüppel, Bettler oder Strolche männlichen und weiblichen Geschlechts zwischen den Gräbern des Friedhofs zwangsgetraut werden, um dadurch die Seuche abzuschrecken (diesmal sind es Fischke und Hödel, die als die Rangniedersten der Gemeinde zum Hochzeitsritual verpflichtet werden und dadurch - Glück im Unglück = Happy-End - heiraten können). Diese Zeichnung der Gemeindeleitung könnte als antisemitisches Stereotyp gedeutet werden, wäre sie nicht eine inneijüdische Kritik und würde sie nicht durch die positive Zeichnung der Haskalavertreter neutralisiert. Die fortschrittlichen Juden tragen ihre Kritik äußerst moderat vor und greifen nicht einen Rabbiner an, sie treten nicht aus der Gemeinde aus und beugen sich letztlich (noch) den
200 Entscheidungen der Oberen. Die positive Vaterfigur des Films, der Bücherverkäufer Reb Mendele, deutet aber den Rollen- und Machtwechsel an: Er wird als eine Art säkularisierter Rabbi respektiert, d.h. nicht die Funktionärsposition, sondern die moralische und intellektuelle Qualifikation entscheidet über den Wert eines Menschen. Mendele ist eher aufgeklärter Psychologe als gläubiger Jude, der seinen Mitmenschen ihren Glauben nicht nehmen möchte, sie aus therapeutischen Gründen in ihrer Glaubenspraxis bestätigt: Ja, Fischke, singe und bete. Ob Er euch anschauen wird, weiß ich nicht; aber deine Seele wird sich wohler fühlen.
Im Film bedarf es schon nicht mehr eines Rabbiners. Krankheit, Gebrechen sind nicht Schicksal oder Strafe Gottes, sie können vielleicht geheilt werden. In der Schlußszene des Films begleitet Mendele die glücklich Neuvermählten hinaus bis zur Landstraße, dann trennen sich ihre Wege. Mendele weist Hödel und Fischke den Weg aus der Enge des Schtetls zur großen Stadt (Odessa), "wo man nicht wie im Mittelalter lebt", wo es Krankenhäuser gibt, in denen "auch vielleicht Gott helfen wird". Mendele ermuntert: "Habt Hoffnung! Geht, Kinder, geht, zum besseren Morgen!" Mendeles Gebet in diesem nach der deutschen Pogromnacht des 9. November 1938 in den USA produzierten Film setzt noch Gott als Dialogpartner voraus, aber der Weg ist nicht mehr weit bis zu jener jüdischen Theologiekritik nach der Shoah, der "mit Auschwitz alle Denkmöglichkeiten von Gott, Mensch und moralischer Ordnung zerstört seien."34 So spricht Mendele Gott an: Seit vielen tausend Jahren schaust du auf sie nieder, siehst ihr Elend und ihr Leid, und du schweigst. Schweigst seit so vielen tausend Jahren und hörst ihre Seufzer. Hörst ihr Stöhnen bei den Massakern und Verfolgungen. Und du schweigst. [...] Wie lange kann man zusehen und schweigen? Wie lange noch werden sie uns martern? Wann wird es ein Ende geben?
Auch die andere Literaturverfilmung Ulmers, der zwei Jahre früher entstandene, sehr populäre Film GRINE FELDER/GREEN FIELDS endet optimistisch, ja folkloristisch, den Gesetzen der Trivialkomödie entsprechend - hier mit einer Doppelhochzeit: Talmudstudent heiratet jüdische Bauerntochter, Bauernsohn heiratet Tochter des Nachbarn. GRINE FELDER ist die Verfilmung des gleichnamigen Theaterstücks von Perez Hirschbein (1880-1948), eines damals wichtigen Vertreters der modernen (säkularen) jiddischen Literatur, der zugleich Leiter der ersten ernstzunehmenden jiddischen Theatertruppe Rußlands (1908-1910 in Odessa) war. Hirschbeins Stücke sind bestimmt durch "melancholische[n] Symbolismus" und "mit Realismus gepaarte Mystik", zugleich Kampfansagen gegen "Aberglauben und traditionsgebundenen Zwang".35 Auf dieser Linie liegt auch die gänzlich aus Außenaufnahmen bestehende Adaption von Edgar G. Ulmer, der sich erst wegen des Numerus clausus an den Wiener Gymnasien seiner jüdischen Herkunft bewußt wurde und dem zunächst die jiddische Kultur völlig fremd war. (Entgegen seinem Co-Regisseur Jacob Ben-Ami beherrschte er auch
34 35
Marquardt 1988, 126-147 (Zitat 126) Stemberger 1977, 168
201 nicht die jiddische Sprache.) Er wollte sich bei seiner Inszenierung von Maurice Schwartz und Joseph Green absetzen und das Bild einer unorthodoxen Jiddischkeit vermitteln: "...mit Würde, keinen Schund - nicht mit diesen Bärten, mit denen sie wie Verrückte aussehen."36 Diese Präsentation von Juden ohne Schläfenlocken, Gebetsriemen und Gebetsmänteln sowie die Darstellung einer Mame als Urtyp jiddischer Mütterlichkeit (vgl. Foto Nr. 20 der Bilddokumentation) bestimmt den Film, der sich eng an die Vorlage hält. Er folgt einer durch die Haskala, auch durch einen popularisierten Chassidismus geprägten mystischen Auffassung vom Judentum: "Das Licht der Wahrheit brennt überall." Diese Überzeugung veranlaßt den Helden, den Studenten Levy Yitzschok, zum Abbruch eines nur formalisierten Talmudstudiums nach dem Muster rabbinischer Schriftgelehrsamkeit. Er verläßt die Jeschiva und beginnt seine Wanderung durch die grünen Felder Rußlands. Die "Stadt der frommen Juden", die überall liegen kann, entdeckt er auf einem russischen Bauernhof, bei einfachen Menschen, bei einem jungen Mädchen. Nicht mehr das Talmudstudium steht an erster Stelle der Wertehierarchie; Kopf- und Feldarbeit, Thorastudium und körperliche Anstrengung sind gleichberechtigt, und Landbesitz (säkularisierte Zionssehnsucht?) steht ganz oben in der Werteskala: "Ein Mann ohne Land ist kein Mann." Neben den Tewje-Filmen sind die "Grünen Felder" Ulmers der deutlichste filmische Hinweis auf die Existenz des russischen Doljuden im Gegensatz zum Stadtjuden, wobei diese Figuren ihre eigenen Minderwertigkeitskomplexe gegenüber den zivilisierteren, gebildeteren Stadtjuden durch die von ihnen gelebte Gelöstheit, Offenheit, Natürlichkeit und Echtheit der Beziehungen Lügen strafen. Trotz der Simplizität der Plotentwicklung und seiner entwaffnenden Naivität ist dieser Film vom freien, glücklichen jüdischen Bauern eine eindringliche Widerlegung des antisemitischen Stereotyps, daß Juden zu Ackerbürgern nicht tauglich seien.
7.3.2. Verfilmungen von Theaterstücken Jakob Gordins
7.3.2.1. DER JÜDISCHER KENIG LIR Während die osteuropäische jiddische Erzählliteratur des 19. Jahrhunderts - vor allem die Arbeiten von Sforim, Peretz und Schalom-Alejchem - in Deutschland auch einem nicht jiddisch sprechenden Konsumentenkreis bekannt wurden, setzte sich das jiddische Drama - eines Abraham Goldfaden und eines Jakob Gordin -
36
Peter Bogdanovich, Interview mit Edgar G. Ulmer, 1974. Deutsche Übersetzung in: Filmprogramm Nr. 34 der Freunde der Deutschen Kinemathek (Jüdische Lebenswelten, 15.1.-24.4.1992, Berliner Filmfestspiele)
202 weithin nur beim jiddisch sprechenden Publikum durch . Der Popularität der gennanten Autoren bei diesem Abnehmerkreis ist es zuzuschreiben, daß auch der jiddische Film auf die literarisch nicht übermäßig bedeutungsvollen Theaterstücke zurückgriff und sie nahezu wörtlich, d.h. konventionell für das neue Medium adaptierte. Kann Goldfaden (1840-1908), der als Begründer des jiddischen Theaters (in Rumänien, später in Rußland) gilt, wohl nur eine Platz als Wegbereiter der von den Purimspielen abgeleiteten jiddischen Bühne in Anspruch nehmen, so ist Gordin (1853-1909), der wie Goldfaden nach Amerika ausgewandert war, erfolgreicher und trotz seiner schlichten Dramaturgie und seines didaktischen Grundtons (seine über siebzig Stücke waren "melodramatisch, tendenziös und moralisierend")37 in seinen Absichten und Wirkungen relevanter. Er bearbeitete deutsche und andere europäische Stücke (z.B. Nathan der Weise und Kabale und Liebe) für die jiddische Bühne. In seinen Dramen, die Vorlagen der Weltliteratur von Euripides, Calderón, Shakespeare, Schiller, Grillparzer bis zu Gerhart Hauptmann in jiddisches Milieu transponierten, gestaltete er, der 1879 eine "Biblische Bruderschaft" gegründet hatte, den Übergang von einem orthodoxen zu einem enddogmatisierten und entritualisierten Judentum, das sich gleichwohl "auf die ethischen Prinzipien der Thora stützte",38 dabei aber auch von Ideen Leo Tolstoi beeinflußt war. Joseph Seiden bzw. Zeiden (1892-1970), einer der ersten und einer der letzten Produzenten und Regisseure jiddischer Filme, hat zwei der bekanntesten Theaterstücke Gordins für den amerikanischen jiddischen Tonfilm adaptiert. 1935 produzierte und inszenierte er den Film DER JIDISCHER KENIG LIR (THE YIDDISH KING LEAR) nach Gordins Stück aus dem Jahre 1892. Zwar wird die Handlung des in Wilna, Petersburg und Jerusalem spielenden Films in das Entstehungsjahr des Bühnenstücks verlegt, doch ist dies Datum eher zufallig; nichts weist auf die Pogrome am Ende des 19. Jahrhunderts in Rußland hin, die Pilgerreise eines frommen Juden nach Palästina könnte ebensogut zwei Jahrzehnte früher angesetzt werden. Scheinbar bleibt der Film ganz im traditionellen jüdischen Milieu und im Rahmen einer uneingeschränkt geltenden jüdischen Frömmigkeit: King Lear ist hier einfrommerjüdischer Geschäftsmann, der gemäß der im Midrasch genannten Bedeutung Jerusalems (In Jerusalem beten ist soviel wie vor dem Thron der göttlichen Herrlichkeit stehen) eine Pilgerreise nach Palästina antritt. Zuvor hat er sein Vermögen in grenzenloser Vertrauensseligkeit seinen ältesten Töchtern und seinem Schwager anvertraut, die es veruntreuen und verschleudern, so daß der Vater verarmt und die Tragödie sich vollenden würde, wenn nicht die aufgeklärte, im Sinn traditioneller Frömmigkeit skandalös emanzipierte jüngste Tochter (sie studierte gegen den Willen des Vaters, und noch dazu ausgerechnet Medizin) den Vater aufgenommen hätte. Die Auseinandersetzung des Vaters mit seinen Töchtern, speziell die Transponierung des
37 38
Starnberger 1977, 160 Best, " Der jidischer Kenig Lir", Kindlers Neues Literatur Lexikon 6, 668f bzw. Kindlers Literatur Lexikon, Erg.-Bd., 598
203 Shakespeareschen Lear-Cordelia-Motivs ins Milieu der osteuropäischen Jiddischkeit, demonstriert nicht einen bloßen Generationenkonflikt, sondern verdeutlicht die Kluft zwischen den von den Eltern praktizierten traditionellen religiösen Normen und den modernen Lebenswerten der Kinder. David Moscheies, der blinde jiddische König Lear, wird wieder sehend, d.h. er macht einen Lernprozeß durch: Er erkennt, daß seine Tochter Toibele (wie Shakespeares Cordelia) dem Geist der Thora (der Forderung derKindesliebe) mehr entspricht als die buchstabentreue "fromme" Verwandtschaft.
7.3.2.2. GOT, MENTSCH UN TEJWL Shakespeares Lear wird zum rührseligen Happy-End vergröbert. In seinem vorletzten Film, zehn Jahre später produziert, als es nach der Shoah kaum noch ein jiddisch verstehendes Publikum mehr gibt, inszeniert Seiden eine Faust- und Hiob-Paraphrase: GOT. MENTSCH UN TAJWL (God, Man, and Devil). Der Film wird trotz der Mitwirkung bekannter jiddischer Schauspieler, die das Stück schon erfolgreich auf der Bühne gespielt hatten, und trotz der Beibehaltung des popilären Milieus des jiddischen Schtetls (vgl. Foto Nr. 21) ein Mißerfolg.39 Gleichwohl ist sein Sujet bemerkenswert: Eingeleitet durch ein Vorspiel im Himmel, wo Gott den von ihm gerufenen Teufel nach seinem "fromen Mentsch" Herschel Dubrowner fragt und ihm der mit Gott über die Korrumpierbarkeit der Menschen wettende Teufel zur Antwort gibt, er solle Herschel mit Geld versuchen, das werde ihn zerstören, rollt die Tragödie ab. In der Verkleidung eines schmierigen Hausierers tritt der Teufel in der traditionellen Mephistomaske und mit einem die Handlung kommentierenden diabolischen Gelächter auf. Er überredet den von der Familie und der Gemeinde wegen seiner Frömmigkeit und Sparsamkeit verehrten Thoragelehrten dazu, ein 50 000er Glückslos zu kaufen. Der Pakt mit dem Teufel, der sich als Reb Uriel einnistet, verändert Verhalten und Charakter des Frommen: Er kauft auf den Rat Satans eine Fabrik zur Herstellung von Gebetsschals und beutet sowohl die ehemals selbständigen Weber wie die Armen der Gemeinde als unterbezahlte, bis in die Nacht arbeitende Lohnempfänger aus. Er drängt seinen das Verhalten des Sohnes kritisierenden alten Vater aus dem Haus, er läßt sich von der ihm treuen, aber kinderlosen Ehefrau scheiden und heiratet seine junge Nichte. Er verstrickt sich mehr und mehr, kann am Ende nicht einmal mehr die geliebte Violine spielen und hängt sich auf. Herschel Dubrowner ist kein jiddischer Hiob, Seidens Film kein Lehrstück chassidischer Frömmigkeit. Der Thoraschreiber und Thoragelehrte, als der der Knecht Gottes eingeführt worden war, praktiziert eine eher rituelle Frömigkeit,
39
Eric Arthur Goldmann, Wbrld History of the Yiddish Cinema, New York 1979, Auszug in: Filmprogramm 77 der Freunde der Deutschen Kinemathek, Begleitprogramm zur Ausstellung "Jüdische Lebenswelten" 1992
204 der Teufel vollendet nur seine Loslösung von einer Traditionsgesellschaft, deren Normen sich im Film auf den Zusammenhalt der Familie (Respektierung des Vaters, der Ehefrau) und den verantwortlichen Umgang mit dem Geld reduzieren. Herschels Schuld ist nicht Sünde als Sonderung, Absonderung von Gott, auch nicht der Verlust eines thoragemäßen Umgangs mit Hab und Gut, sondern Verweigerung sozialen Verhaltens (seinen Glaubensgenossen schlägt er ab, ihnen Geld zur Gründung einer Genossenschaft zu leihen und zwingt sie so zur Beibehaltung ihres Sklavenstatus als Abhängige und Ausgebeutete). GOT, MENTSCH UN TAJWL ist "eine Form chassidisch geprägter KapitalismusKritik".40 7.3.2.3. ON A HEYM Wäre es unsere Absicht, eine Chronologie des jiddischen Films in Osteuropa vor dem Zweiten Weltkrieg zu verfassen, so müßte die dritte der Gordin-Adaptionen unser Tewje-Kapitel, vielleicht sogar unser Buch beschließen, denn dieser Film ON A HEYM / BEZDOMNI (Without a Home) ist der letzte jiddische Film, der vor dem Einmarsch der von den Nazis geführten deutschen Truppen in Polen gedreht wurde.41 Sein Regisseur und Hauptdarsteller Aleksander Marten wurde ein Opfer der Shoah. ON A HEYM entfernt sich offenbar am weitesten von seiner literarischen Vorlage, dem gleichnamigen Theaterstück von Jacob Gordin aus dem Jahre 1907. Im Sujet und Milieu, im Habit seiner Figuren rückt der Film nahe an seine Entstehungszeit heran, so daß er nur sehr bedingt in den zeitlichen Rahmen unserer Untersuchung gespannt werden kann, eher deren Ende markiert. Der emanzipatorische Anspruch der Haskala - in den beiden anderen Gordinadaptionen unübersehbar - scheint verloren. Der Aufbruch des Fischers Avreymel Rivkin aus dem Ghetto wird, nachdem einer seiner Söhne ertrunken ist, zur überstürzten, psychologisch wenig motivierten Flucht nach Amerika. Marten, der nur kurze Zeit vor Beginn der Dreharbeiten nach dem "Anschluß" Österreichs an das Deutsche Reich Hitlers nach Polen emigriert war, enthält sich in seinem Film aller aktuellen und historischen Bezüge, so daß auch nicht im entferntesten der Antisemitismus oder der Antijudaismus als Auswanderungsmotiv interpretierbar ist.42 Das dreiaktige Kintoppdrama, ausschließlich im Atelier gedreht - Außenräume werden durch primitive Modelle und Montage von Dokumentarmaterial angedeutet - , gewinnt kulturgeschichtlichen Rang nur durch seine Sicht der Migra-
* 41
42
Koch 1982, 25 Folgerichtig schloB die bisher umfangreichste Retrospektive des jüdischen Films in Deutschland, die von den Freunden der Deutschen Kinemathek (in Zusammenarbeit mit der Berliner Festspiele GmbH) über ein Vierteljahr lang als Begleitprogramm der Ausstellung Jüdische Lebenszeiten veranstaltet wurde, am 26. April 1992 mit der Vorführung dieses Films. Vgl. Hobennan 1991, 293
205 tìonsthematik, aber eben keineswegs durch dessen verkitschte, sentimentale Gestaltung. (Wesentlich überzeugender gelang das Joseph Green in seinem Film A BRIVELE DER MAMEN, vgl. Kapitel 7.5.4.) Akt I, in Polen spielend, beschreibt die Sehnsüchte, Träume, Utopien der Mischpoke, die sich auf den Nenner bringen lassen: "Alles ist möglich in Amerika." Bemerkenswert ist, daß auch der gesetzestreue Vetter Fishl, der - eine Seltenheit im jiddischen Film wiederholt bei seiner häuslichen Andacht mit Gebetsriemen gezeigt wird, vom Auswanderungsfieber angesteckt wird und seine Vokabeln im gleichen Gebetsrhythmus wiederholt wie vorher seine Psalmen. Akt Π pendelt in seinen Szenen zwischen Amerika und Polen hin und her, zwischen Avreymels New Yorker Job als Tellerwäscher, der dabei auf die schmachtenden Mame-Lieder einer von ihm in platonischer Liebe verehrten Sängerin hört und der im Schtetl auf die Überfahrt-Tickets für sich, den dreizehnjährigen Sohn und den orthodoxen Vater wartenden Ehefrau Bas Scheve. Akt ΠΙ mit der nun äußerlich in New York vereinten und schnell "amerikanisierten" Familie ergeht sich in resignativem Lamento: on a heym in der innerlich nicht angenommen neuen Heimat. Alles zerschlägt sich: Fishl kriegt nicht den begehrten Kantorsjob in der Synagoge. Der alte Vater klagt: "Hier in Amerika fühlen sie nicht den Geist des Schabbat." Avreymel wäscht ewig seine Teller und hält sich von Tisch und Bett der Familie getrennt. Bas Scheve grämt sich und wartet. Der Sohn verläßt die Familie und wird, weil er sein Gepäck ins Wasser geworfen hat, als tot angesehen, was die Mutter in geistige Umnachtung treibt (von der berühmten Ida Kaminska, der einzigen interessanten und überzeugenden Schauspielerin des Ensembles, souverän interpretiert). In einem unsäglichen Happy-End eilt der Sohn ans Krankenbett Schlußeinstellung: gemeinsame Schabbatfeier.
7.3.3. Verfilmungen von Romanen Scholem-Alejchems Im Unterschied zu den Romanen des Mendele Moicher Sforim ist das epische und dramatische Werk des Scholem-Alejchem (eigentlich: Scholem Rabinowitsch, 1859-1916) recht bekannt geworden. Die von ihm beschriebenen armen Juden Rußlands unterscheiden sich von denen des nur vierzehn Jahre älteren Mendele durch eine noch deutlichere Tendenz zur Veränderung. Sie sind dabei, sich von ihrem Dorf oder Marktflecken zu lösen und den Aufbruch in die Moderne zu wagen, in die Stadt (insofern hat die filmische Adaption des eben skizzierten Fischke-Romans mehr Elemente Scholem-Alejchems als Mendeles). Viele von ihnen verlieren den Boden der Realität unter ihren Füßen, werden wie seine Romanfigur Menachem Mendel "Luftmenschen", die sich in Spekulationen veriren. Aber sie können ihr Scheitern in einer Mischung von Fatalismus und tradierter gläubiger Hoffnung reflektieren, ja ironisieren. Die Gestalten ScholemAlejchems sind geprägt durch ihren (bitteren) Humor, der sie auch in verzweifelten Situationen, unter der Last der Sorgen fast nie zusammenbrechen, sondern immer wieder hoffen läßt.
206 Die mehr tragische Variante des sich um ein bißchen mehr Glück mühenden Luftmenschen , die sich trotz aller Schicksalsschläge an die Glaubenskraft orthodoxer Jüdischkeit gebunden weiß, ist in der berühmten Figur des Milchmannes Tewje verkörpert. Mit Verfilmungen der Romane über Tewje, über Menachem Mendel und über den Kantorsohn Moti wollen wir uns nun im einzelnen befassen. 7.3.3.1. Die Figur des Tewje als Urtyp des russischen Dorfjuden in einem vermarkteten Medienereignis Bisher wurde der 1894 erschienene Roman Tewje der Milchiger (deutsch: Tewje, der Milchmann) viermal verfilmt. Ein Vergleich der verschiedenen Adaptionen ist nicht ganz unproblematisch. Die Filme gehören ganz verschiedenen Phasen der Film- und Fernsehgeschichte an; Produktionsbedingungen, Erzählweisen und Rezeptionshaltungen wechseln von Film zu Film. Deswegen soll wenigstens ansatzweise gezeigt werden, wie sich eine berühmte Traditionsquelle - die Figur aus einem jiddischen Roman der Weltliteratur - unter wechselnden Bedingungen verändert, in welchem Maße die jeweilige Filmgestalt noch Einsichten und Erkenntnisse über das Judentum als religiöse, kulturelle und ethnische Gemeinschaft zu vermitteln vermag und ob die jeweilige Film- oder Femsehfassung darüber hinaus vielleicht sogar geeignet ist, einen Beitrag zur Abwehr des Antisemitismus zu leisten. Es handelt sich um folgende Produktionen: - den wegen einer Fernsehausstrahlung auch in der Bundesrepublik sehr bekannten jiddischen Film TEVYE oder TEVYA von Maurice (Morris) Schwartz, dem Drehbuchautor, Regisseur und Gestalter der Titelrolle aus dem Jahre 1939 - das vom WDR in der Bundesrepublik produzierte Fernsehspiel von Arnold Perl (deutsch von M. Y. Ben-Gavriel) TEVYA UND SEINE TÖCHTER in der Regie von Gerhard Klingenberg, 1962 - den in deutsch-israelischer Coproduktion gedrehten Film aus dem Jahre 1967 TEVYE UND SEINE SIEBEN TÖCHTER, inszeniert von Menahem Golan - die britische Verfilmung des gleichnamigen Musicals von Joseph Stein mit der Musik von Jerry Bock FIDDLER ON THE ROOF; England 1971, durch Norman Jewison. Deren Adaptionsquelle, der Roman von Scholem-Alejchem, hat generell in der jüdischen Literatur - und innerhalb dieser in der Epoche der jiddischen Literatur einen herausragenden Rang.43 Tewjes mit ironischer Brechung geschildertes, letztlich unerschütterliches, mit Bitterkeit und Humor gemischtes, in Armut und Erniedrigung sich bewährendes Vertrauen auf Gott angesichts der ihn treffenden Hiobsbotschaften und sein häufig mißbrauchtes Vertrauen zu den Mitmenschen
43
Das Ostjudentum, 1981, 38-38; Madison 1976, XVIII, 297-310; Best 1971, VI, Sp. 2544f. bzw. 1991, XV, 10; Ders., 1968, IV, Sp. 2438f. bzw. 1991, XV, 8f.; Brod 1962, 240-253
207 lassen ihn über sein individuelles Schicksal hinaus als Repräsentanten des leidenden jüdischen Volkes erscheinen: Die Hauptsache ist aber Gottvertrauen: der Jude muß hoffen und immer hoffen! Und wenn er dabei zugrundegeht? Nun, dazu sind wir ja eben Juden auf der Welt .. , 44
Die Romangestalt des mit Gott und der Welt um ein bißchen mehr Gerechtigkeit hadernden kleinen Mannes mit seinem zugleich bitter und stolz gesprochenen Bekenntnis "Mit Gottes Hilfe bin ich ein armer Mann" - dieses "Synonym jiddischen Wesens zwischen Tragik und Komik"45 - wurde zur Leitfigur jiddischer Literatur und nach 1960 zu einem vermarkteten "Medienereignis": Wiederauflage des Romans (zusätzlich in einem Buchclub und in einer Buchreihe), Welterfolg als Musical (" Anatevka"), Verfilmung des Musicals, Inszenierung eines Fernsehspiels, Wiederaufführung des Tewjefilms von 1939 im Fernsehen, Ausstrahlung der Musicalverfilmung im Fernsehen, Adaption des Romans mit dem Musicalstar Shmuel Rodensky in deutsch-israelischer Gemeinschaftsproduktion als deutsche TV-Erstaufführung. Wenn wir in einem ersten Schritt nach der von Faulstich beschriebenen historiographischen Methode den Traditionszusammenhang der vier Tewje-Filme mit dem Tewje-Buch untersuchen,44 so lallt auf, daß die Szenaristen den Stoff der literarischen Vorlage in ganz unterschiedlicher Weise benutzen: Von den sieben Episoden des Romans verwendet der eine Filmautor nur eine einzige Geschichte, der andere wählt drei Episoden aus, und zwar fast genau in der Reihenfolge, wie sie Scholem-Alejchem erzählt, ein dritter stellt eine total verkürzte Reader1 sDigest-Fassung aus den äußeren Ereignissen von fünf Episoden in veränderter Abfolge dar, und der letzte der Drehbuchautoren geht gar nicht mehr direkt auf den Romanautor zurück, sondern adaptiert lediglich die drei Scholem-AlejchemEpisoden verwertende Musicalfassung. Darüber hinaus schließen die drei Kinofilme mit einer im Roman nicht enthaltenen (zusätzlichen) Szene, einer Pogrom- und Ausweisungssequenz (die arabischen Ziffern der folgenden Tabelle geben die filmische Reihenfolge der Kapiteladaptionen an):
44 45 46
Scholem-Alejchem 1962, 10, ähnlich 26f. Brandt 1981, 42 Faulstich 1988a, 45-48
208 Tabelle 5 Der Tewje-Romanstoff ais Steinbruch für Tewje-Filme Titel des Romankapitels / Inhalt des Kapitels
Titel des Films /FS
3 OS ω ω η a: h h I. Der Haupttreffer Der von Pech verfolgte arme jüdische Fuhrmann Tewje hat einmal im Leben Glück: Er transportiert auf seinem klapprigen Wagen zwei Frauen, die sich im Wald verirrt haben, bis zu ihrer Sommerfrische und wird von deren Familie dafür so reich belohnt,daß er von nun an mit Milch und Käse hausieren kann. II. Ein Hereinfall Der rastlose, erfindungsreiche Menachem Mendel, ein heruntergekommener weitläufiger Verwandter, überredet Tewje, sich an einem Spekulationsgeschäft zu beteiligen. Tewje verliert all sein bißchen Geld. III. Kinder von heute Tewjes älteste Tochter Zeitel schlägt die von ihrem Vater arrangierte Vernunftheirat mit dem wohlhabenden, älteren Fleischer zugunsten der Liebesheirat mit dem armen, jungen Schneider aus und gewinnt dafür Tewjes Unterstützung. IV. Hödel Die schöne und belesene Tochter Hödel durchkreuzt Tewjes und des Schadchens Pläne: Sie heiratet einen jungen Revolutionär und folgt ihm in die sibirische Verbannung. V. Chawe Tewje löscht den Namen seiner Tochter Chawe und jede Erinnerung an sie aus, denn sie hat das Judentum verlassen und den jungen christlichen DorfSchneider geheiratet. VI. Sprinze Auch seine vierte Tochter verliert Tewje: Sie nimmt sich das Leben, als ihr aus einer schwerreichen Familie stammender Geliebter sie aus Familienrücksichten verläßt. VII. Tewje fährt ins Heilige Land Als Tewjes Frau Golde stirbt, heiratet seine Tochter Bejlke, um den Vater zu versorgen, einen steinreichen Geschäftsmann, der aber aus Geschäftsrücksichten darauf besteht, daß Tewje wegzieht.
ω c J oí S α ω μ χ fr· ί-
209 7.3.3.2. TEVYE (oder TEVYA) Auch die Verarbeitung der Traditionsquellen erfolgte mit ganz unterschiedlichen Wahrnehmungspotentialen und Zugriffsintentionen. Der älteste Tewjefilm, TEVYE oder TEVYA ("Tewje, der Milchmann", USA 1939)47 von Maurice Schwartz (Regie, Buch, Hauptrolle), nur zwölf Jahre nach dem Epochenwechsel vom Stummfilm zum Tonfilm entstanden, steht in der Tradition der Verfilmungen amerikanischer Broadwaymusicals, verwendet aber die Folkloreelemente sparsamer als Joseph Green. Er scheint mehr der Linie von Frank Capras "neuem Optimismus" zu folgen, jenen idealistischen Filmen über Roosevelts New-DealÄra mit ihrem sozialkritischen Touch und der amerikanischen Kleinbürgerideologie vom Glauben an die Macht des Guten. Sein Erzählduktus ist gegenüber Capra noch herber, realistischer, verschließt sich aller falschen Harmonie, läßt die Bilder nicht zu fataler Beschwörung einer Idylle verkommen. Auffallig ist der sehr sparsame Gebrauch der Großaufnahme.48 Schwartz, damals zugleich Leiter des New Yorker Jiddischen Theaters, inszeniert und spielt für ein kleinbürgerliches Publikum, für jiddisch sprechende amerikanische Juden, die neuen Einwanderer der dreißiger Jahre aus Europa und die zum Teil schon seit mehreren Generationen in den USA ansässigen, aber immer noch jiddisch sprechenden oder wenigstens verstehenden Mitbürger. Seine Tewje-Adaption ist nicht nur eine künstlerische Darstellung des jüdischen Alltagsmenschen, der die Kraft zur Lebensbewältigung aus der Thora schöpft und diese Gesetzesfreude an die junge Generation weitergibt (vgl. Foto Nr. 22 der Bilddokumentationl) - so hat ihn Scholem-Alejchem mit Humor und Zuversicht auch in Situationen äußerster Not geschildert - sondern bei aller Nostalgie immer auch ein Bild des leidenden, geschmähten, verfolgten Juden nach dem Beginn der Vernichtung des osteuropäischen Judentums durch die Nazis in Polen. Das erklärt die Konzentration des gesamten Films auf nur eine Episode: die unglückselige Liebesgeschichte zwischen Chawe, der Tochter des jüdischen Milchmannes, und Fedje, dem christlichen Dorfschreiber, also über die problematischen Beziehungen zwischen Christen und Juden, über die ständigen Religionsdebatten mit dem orthodoxen Priester, ob der Messias mit Jesus schon gekommen sei oder noch erwartet werde. Der Konflikt Tewjes nach Chawes Hochzeit zwischen seiner Treue zur Thora, die ihm zwar noch erlaubt, Kaddisch über die für die Judenheit gestorbene Tochter zu sagen, und der Liebe des Vaters, die dem Religionsgesetz zum Trotz Erbarmen und Verzeihen fordert, wird das auch den Film beherrschende Thema. (In den späteren Verfilmungen wird die Chawe-Geschichte nur verkürzt und entschärft adaptiert.)
47
48
Besichtigte Schmalfilmfassung des DIF (Deutsches Institut für Filmkunde, Wiesbaden) in jiddischer Sprache mit englischen Zwischentiteln (wie alle in diesem Kapitel erwähnten Tonfilme des jiddischen Kinos) G. Koch (1982, 24) vermutet darin die Absicht, "nach Möglichkeit die Integrität des menschlichen Körpers im Bild zu haben. "
210 Ergreifend spielt Maurice Schwartz den Schmerz des Vaters über die aus dem Judentum ausgetretene, zum Christentum konvertierte Tochter aus. "Ich habe meinen Leuten erklärt, daß Chawes Name überhaupt nicht mehr genannt werden darf - es gibt keine Chawe mehr! Ausgelöscht und fertig!" heißt es im Roman. Die Untertitel des Films sind kaum verhaltener: We 've lost a child. We 'II sit and cry, and then forget about her. As if she were dead. I want no mention of the name Khawe. She 's dead. God, where are you?
Die Trennung ist im Film, der den Buchmonolog Tewjes in einer etwas vordergründigen, fast mechanischen Weise bebildert, scheinbar genauso endgültig; im Roman wie im Film spielt Tewje nur mit dem Gedanken zu verzeihen, sein Kind wieder in die Arme zu nehmen. Erst in der Schlußsequenz erfindet Maurice Schwartz eine versöhnliche, für die Rührseligkeit jiddischer Filme typische Auflösung des Konflikts: die Tochter ist es, die zurückkehrt, die in der Stunde der Gefahr, der Verfolgung, des Pogroms ihren christlichen Mann verläßt und die jüdische Solidarität praktiziert: die Kraft der Mischpoke, aber auch des Glaubens der Väter ist größer als die Bindung an den geliebten Mann: "I was wrong. Your old faith is deeper and greater." Die schlimmen Erfahrungen mit den Schwiegereltern, Chawes De-facto-Status als "jüdische" Magd im christlichen Haus, haben wohl den Entschluß befördert. Der Schluß des Films (er verwendet den Titel des letzten Romankapitels) ist offensichtlich eine Resonanz auf die zeitgeschichtlichen Ereignisse in Deutschland 1938/39. Bei Scholem-Alejchem heißt es noch: "Es ist, Gott sei Dank, ruhig, von Pogromen hört man nichts" (S. 193). Schwartz verlegt die Handlung der Abschlußsequenz offensichtlich in die Zeit um 1881, als eine Welle von Pogromen die russischen Juden heimsuchte, so daß die kontinuierliche Emigration von jährlich 7500 Juden zwischen 1820 und 1870, von 40 000 in den siebziger Jahren, nun zu einem Massenexodus, vor allem nach Amerika, anschwoll.49 Obwohl die Szene von der Vertreibung durch die russischen Behörden ganz im Kolorit der russischen Zarenzeit inszeniert wird, ist der Genozid des 20. Jahrhunderts auf beklemmende Weise ebenso präsent wie das Nachdenken der Emigranten über das Fluchtziel: Tewje, seine Kinder und Enkelkinder verlassen auf ihrem Panjewagen das Dorf. Die Emigration nach Amerika wird erwogen und verworfen: "To America? What would I do there? They don't know my language, and I don't know theirs." Tewje, dem durch den Chassidismus geprägten frommen Juden, dem ersten "Zionisten" in unserer jüdischen Porträtgalerie, ist der Weg klar: "We '11 go to the Holy Land." Die ostjüdischen Figuren in den nur kurze Zeit später spielenden Verfilmungen der Romane Joseph Roths werden in andere Emigrationsländer ziehen: nach Österreich, nach Frankreich, nach Deutschland und von dort meist weiter nach Amerika. Die der literarischen Vorlage folgende Emigration Tewjes nach Palästina ist also nicht die einzige Migrationsrichtung. Andere Filme des jiddischen Kinos lassen ihre Figuren in das kapitalistische Gelobte Land Amerika ziehen, so auch
49
Howe 1984, 9
211 Joseph Green in seinem letzten Film A BRIVELE DER MAMEN, wobei er auf alle illusionistische Schönfärberei verzichtet: Der Vater verkommt, die Tochter kehrt enttäuscht zurück, und nur der Sohn steigt auf der Leiter des Erfolgs empor. Tewjes Abschied von seiner bisherigen Welt ist trotz des sein Prinzip Hoffnung signalisierenden Reiseziels nicht ohne Wehmut und Bitterkeit. Es ist erstaunlich, wie dieser jiddische Film sich den Regeln des zeitgenössischen, nicht nur jiddischen Musikfilms weithin verweigert und dennoch unter Verwendung der überkommenen Dramaturgie sein Publikum gefunden hat, weil er nämlich über und durch die literarische Figur Erfahrungen, Befürchtungen und Hoffhungen seiner Adressaten artikulieren konnte. Damit spiegelt der Film auch für ein heutiges Publikum Einstellungen und Verhaltensweisen wider, die - ausgehend von einem sowohl singulären wie auch exemplarischen Fall - in der Verpackung des Genres "Jiddisches Kino" recht differenzierte Einsichten in die Situation von Ostjuden vermitteln. 7.3.3.3. TEVYA UND SEINE TÖCHTER Alle späteren in der Bundesrepublik bekanntgewordenen Adaptionen des Tewjestoffes wurden erst nach 1960 produziert. Ihnen fehlt das jiddische Idiom, denn sie wurden in deutscher, amerikanischer oder hebräischer Sprache aufgenommen. Das von Gerhard Klingenberg 1962 inszenierte WDR-Fernsehspiel TEVYA UND SEINE TÖCHTER ist technisch gesehen fast vollständig noch der ersten Phase des Femsehspiels der Bundesrepublik zuzurechnen, als man die Produktionsform der Live-Sendung praktizierte: Nach vorangegangenen theaterähnlichen Proben mit verschieden postierten Kameras nahm man das LiveSpiel hintereinander zur geplanten Sendezeit auf, mischte gleichzeitig die Bilder und strahlte sie über den Sender aus. Im TEVYA-Spiel wurden außer den live gedrehten Szenen aber für die Rückblenden schon Filmeinspielungen verwendet. Der Autor der Tewje-Adaption, Arnold Perl, schrieb zwei Jahre später ein weiteres Fernsehspiel für den WDR nach einem Stoff von Scholem-Alejchem (DIE HÖHERE SCHULE, Regie: Wilhelm Semmelroth, 1964). Beide Fernsehspiele stammen aus jener TV-Periode, in der das junge Medium seine künstlerische Legitimität durch Betonung von "Intimität" und "Kammerspielcharakter" mit "Bevorzugung von Nah- und Großaufnahmen, wenige[n] Personen auf dem Bildschirm und dem Verzicht auf schnelle und komplexe Bewegungsabläufe"50 zu beweisen trachtete. Klingenbergs Inszenierung legt das Schwergewicht auf die Schauspielerführung; das beredte Spiel der Darsteller in theaterähnlichen Kulissen vor einem dunklen (unbeleuchteten) Hintergrund trägt den Text. Es fallt bei beiden Inszenierungen der Szenarien von Arnold Perl auf, daß die Hauptfiguren von jüdischen Schauspielern verkörpert wurden (Tewje von Alfred Balthoff, Aaron Katz von Martin Berliner, die weibliche Hauptrolle spielte in beiden Fällen Ida Ehre). Offenbar versprach 50
Hickethier 1980, 42
212 man sich davon eine Erhöhung der Authentizität. Ein Vergleich des Drehbuchs und des Fernsehspiels mit der Romanvorlage macht außerdem deutlich, wie sehr der Autor um "Werktreue" bemüht war: Er ließ bei den drei von ihm ausgewählten Episoden die Handlungsführung und die Aussageabsicht zunächst unangetastet, bearbeitete sie lediglich durch die Verwendung von Rückblenden und modulierte den Text sprachlich, indem er ihn in der Wortwahl wie in der Begrifflichkeit heutigem Sprachgebrauch durch Einfuhrung von Termini wie "Sozialismus", "Agitator", "Religiosität" oder "Ghetto" anpaßte. Diese enge Auslegung von Literaturverfilmung hatte wohl den Vorteil, daß die Schilderung einer jüdischen Welt im Übergang, der Erschütterungen jüdischen Lebens im zaristischen Rußland in der Sicht Scholem-Alejchems fast ohne Verkürzung oder Verbiegung gelang. Die Abfolge der drei "Akte" macht die Einbindung der Tewje-Familie in die politische Geschichte Rußlands deutlich: Wird zunächst nur das Leben des armen Fuhrmanns geschildert, der einmal einen Haupttreffer landen und seine ökonomische Situation etwas verbessern kann, zeigt der zweite Teil über die Liebesheirat der ältesten Tochter mit dem armen Schneider Leid und Glück noch in einer ghettoähnlichen jüdischen Familien-Enklave, so bricht mit der Adaption der dritten Geschichte die politische Wirklichkeit in die nur scheinbar abgeschirmte Welt ein: Tewjes Tochter Hödel heiratet einen Revolutionär und folgt ihm in die sibirische Verbannung. Der Regisseur arbeitete sorgfältig die schon in Perls Textfassung des dritten Romankapitels angelegte Gegenüberstellung der Werte des traditionellen Judentums und des Sozialrevolutionären Engagements der jungen russischen Juden heraus. Mit Tewjes Frage an den sozialistischen Schwiegersohn "Eure neue Welt: wird sie Respekt haben vor ungesäuerten Broten am Osterfest und vor dem Sabbatbrot am Freitagabend?" und dessen zögernder Antwort ("Väterchen Zar nimmt. Den Juden nimmt Väterchen Zar, sperrt ihn ins Ghetto, segnet ihn mit Pogromen") erweitert Perl den Scholem-Alejchem-Text. Er unterstreicht mit dem Schluß des Fernsehspiels, daß nicht die Darstellung des Gegenübers von antijudaistischer christlicher Ideologie und jüdischer Abwehr sein Interesse an der Literaturadaption ist, sondern die Befragung der Werte traditioneller Religiosität und der Praxis revolutionären Handelns. Die Eliminierung aller Verweise auf den christlichen Antijudaismus dürfte die Akzeptanz der Literaturverfilmung als eines bloß literarisch-historischen Fernsehspiels über Juden im alten Rußland erleichtert haben. 7.3.3.4. TEVJE UND SEINE SIEBEN TÖCHTER Unerheblich, ja teilweise peinlich in ihrer folkloristischen, sentimentalen Verflachung sind die beiden letzten Tewjeverfilmungen, so daß sie nur summarisch aufgeführt werden. Zwar kombinieren die Drehbuchautoren Chaim Hefer bzw. Joseph Stein (nach seinem eigenen Musical) ihre jeweiligen Adaptionen der Scholem-Alejchemschen Traditionsquelle wie schon Maurice
213 Schwartz mit einem Pogrom- und Austreibungssegment, aber ihre Verarbeitungen zum Kommerzfilm folgen gänzlich anderen Traditionen. Der israelische Regisseur Menahem Golan51 übernimmt in seinem Film TEVJE UND SEINE SIEBEN TÖCHTER. Bundesrepublik Deutschland/Israel 1967, zwar viele Episoden der Scholem-Alejchemschen Geschichtenfolge, benutzt sie aber nur zu einem äußerlichen Handlungsgerüst von gradlinig erzählten Aktionen und zu Aneinanderreihungen von effektvoll ausgeleuchteten trivialen Atelier-Genrebildchen nach dem Muster "Herzergreifende lyrische Bilder aus dem jüdischen Rußland der Zarenzeit". Sein Interesse ist wohl weniger die Herstellung einer Literaturadaption mit Kunstanspruch als vielmehr die Ablieferung einer für den Tageskonsum bestimmten, handlungs- und stimmungsreichen, glatt polierten Unterhaltungsware. In ihm vermag allenfalls die Verkörperung der Titelgestalt des Films durch den bekannten israelischen Schauspieler Shmuel Rodensky ein gewisses Interesse zu wecken, selbst wenn dessen starke Statur dem literarischen Urbild ("Er starb beinahe vor Hunger") nicht unbedingt entspricht, wohl aber die Anlage der Figur in ihrer Mischung aus Aufklärung und Gottvertrauen.
7.3.3.5. Jüdische Ghettowelt in zwei sowjetischen Stummfilmen nach ScholemAlejchem: JIDISCHE GLIKN und MOTL PEJSI DEM CHASNS Besonders auffallig wird Golans Technik der Einebnung vielschichtiger Figuren in der Umformung der zweiten Scholem-Alejchem-Geschichte ("Ein Hereinfall", vgl. auch Tabelle 5). Der "Luftmensch" Menachem Mendel ist bei Golan nur ein erfolgloser betrügerischer Spekulant, bei Scholem-Alejchem dagegen, wie Otto F. Best ausführt, gleich Tewje eine typische Ausprägung des ostjüdischen Charakters, gewissermaßen das Gegenbild zum schicksalsergebenen Tewje, nämlich der rastlos planende und erfinderische Mensch, der stets auf der Suche nach dem großen, seine Misere wendenden Geschäft ist. Er ist "ein ironisierender Abglanz des großen Themas der eschatologischen Hoffnung, überhaupt des utopischen Prinzips im jüdischen Leben."52 Die kongeniale Adaption des Menachem-Mendel-Romans durch einen Stummfilm aus dem Jahre 1925 wurde erst 1990 einem breiteren deutschen Publikum zugänglich gemacht. Unter dem Titel "Jüdisches Glück" zeigte das ZDF eine rekonstruierte, restaurierte und musikalisch bearbeitete Fassung, deren Interpetation wir hier zusammen mit einem anderen sowjetischen Stummfilm aus thematischen und filmhistorischen Gründen einschieben: Beide Filme adaptieren
51
52
Die deutschen Titel seiner in der Bundesrepublik gelaufenen, zwischen 1966 und 1985 produzierten Filme wie "Der Schlappschwanz", "Höllenkommando", "Der Gangsterboss von New York", "Nina, die Killermaschine" usw. deuten auf sein bevorzugtes Sujet hin. Auch seine zweite Adaption jiddischer Literatur - THE MAGGICAN OF LUBLIN nach dem Roman von Isaac Bashevis Singer - folgt dieser Grundlinie. Best 1978, IV, Sp. 243f. bzw. 1991, XV, 8
214
die jiddische Porträtgalerie Scholem-Alejchems. Der erste Film variiert das Menachem-Mendel-Thema des Tewjeromans, indem er Teile eines älteren selbständigen Romans über den Luftmenschen Mendel benutzt; der zweite Film geht ebenfalls auf literarische Texte zurück. Er gehört zu den raren Beispielen des sowjetischen Films der Stalinära, in denen noch jüdische Lebenswelten gestaltet werden durften. JIDISCHE GLKN/JEWREJSKOJE STSCHASTJE (Jüdisches Glück) Der Filmtitel JIDISCHE GLKN ist ein Hinweis sowohl auf die Adressaten - es hat schon in der Stummfilmzeit ein breites jüdisches Publikum in Rußland gegeben, ihm zuliebe wurde auch eine Fassung des Films mit jüdischen Untertiteln hergestellt - als auch auf die künstlerischen Produzenten: - das Moskauer Jiddische Akademische Theater - dessen Leiter, den Regisseur Alexander Granowski , der diesen Film inszenierte, - das jiddische Ensemble, allen voran den Titeldarsteller Solomon Michoels, - Marc Chagall, damals Theatermaler des Moskauer Jiddischen Theaters, - Isaak Babel, den Autor der Zwischentitel.53 An diesem einzigen in der Sowjet-Union 1925 entstandenen Spielfilm des berühmten avantgardistischen Regisseurs und Theaterleiters Alexander Granowski (eigentlich: Abraham Ozark) lassen sich die Schwierigkeiten jüdischer Filmemacher bei jiddischen Filmproduktionen unter der Diktatur Stalins aufzeigen. Wegen seiner jüdischen Thematik wurde der Film nach nur wenigen Aufführungen verboten. Granowski kehrte infolge des immer stärker werdenden Antisemitismus in der Stalinära nach einer erfolgreichen Westeuropa-Tournee seines Ensembles 1928 nicht wieder nach Moskau zurück. Der Star seines Theaters, Solomon Michoels, zeitweise sein Nachfolger, war zwar weiterhin sehr populär, konnte aber im jüdischen Theater immer weniger jiddische Stücke durchsetzen, erhielt auch nur selten Filmrollen (er spielte z.B. in einer sowjetischen Verfilmung von Feuchtwangers Roman Die Geschwister Oppenheimer). Trotz seiner antifaschistischen Überzeugung -1942 verlas er einen Aufruf zur Verteidigung der Sowjet-Union im "Großen Vaterländischen Krieg": "Juden ans Gewehr!" - wurde er 1948 von KGB-Agenten ermordet. 1952 wurde das Jüdische Theater geschlossen.
53
Über Granowski, Michoels u. ihr jiddisches Theater vgl. die ZDF-Dokumentation ES WAR NICHT SPIEL, ES WAR LEBEN. DAS MOSKAUER JÜDISCHE AKADEMISCHE THEATER von Alexander Bohr, Alexander Klein u. Hans Peter Kochenrath, ZDF, 13.4.1990; über "Jüdisches Glück" in der ZDF-Programmvorschau (ZDF 4/90, 10-13); über das jiddische Theater, speziell in Moskau (in der Literatur schwankt die Bezeichnung: "Staatliches Jüdisches Kammertheater" oder "Moskauer Jüdisches Akademisches Theater") vgl. Theater-Lexikon 1983, Sp. 540, 701; über Chagall im Jiddischen Theater versch. Beiträge im Ausstellungskatalog Marc Chagall: Die russischen Jahre 1906-1922, 94-106, 107-129
215 JÜDISCHE GLKN spielt in Berditschew, einst dem Zentrum des Ostjudentums in der Ukraine. Dort entstanden die Außenaufnahmen, aber ebenso in Odessa, wohin auch Scholem-Alejchem einen großen Teil der Handlung verlegt hatte. Hier erprobte der Kameramann Eduard Tissé die optischen Wirkungen, die sich durch das Auf- und Absteigen des Menachem-Mendel-Darstellers auf der riesigen Odessaer Freitreppe ergeben und die ein Jahr später, nach seiner Arbeit für Eisensteins BRONENOSEZ POTJOMKIN ("Panzerkreuzer Potemkinn) als die vielleicht berühmtesten Einstellungen der Filmgeschichte um die Welt gingen.54 In seiner ersten Kameraarbeit auf der Odessaer Hafentreppe marschieren nicht die auf eine Mutter schießenden Kosaken herunter, sondern Menachem Mendel eilt als Schadchen, als Heiratsvermittler, beflügelt die Treppe hinauf zur Braut. Auf der Mole zieht nicht die Odessaer Bevölkerung am Leichnam eines revolutionären Matrosen vorbei, sondern in einer Traumsequenz kann der "König aller Schadchen beider Hemisphären" eine tadellose Ladung Bräute in weißen Kleidern ("Das ist Ware für Rothschild!") nach Amerika einschiffen und damit den bräutelosen "Freiem der Vereinigten Staaten" das Ende ihrer Qualen verkünden. Diese ironische Kapitalismuskritik im Stil der sowjetischen Avantgarde der zwanziger Jahre findet sich nicht in Scholem-Alejchems 1882 erschienenem Menachem-Mendel-Roman. Überhaupt wurden nur einzelne Motive übernommen, und mit der filmischen Adaption lediglich des Milieus, einiger Figuren und Situationen entfiel auch die reizvolle Komposition eines Briefromans, der Kontrast zwischen den hochtrabenden Worten Mendels mit den nimmermüden Projekten, Phantasien und Illusionen eines in die weite russische Welt geflüchteten Ehemanns und den nüchternen, skeptischen, realistischen Antworten der daheim gebliebenen Ehefrau. Von der "Karriere" Mendels - Makler, Händler, Spekulant, Schriftsteller, Schadchen - und seinem Absturz in die Hungerlohnexistenz eines kleinen Agenten zeichnet der Film nur die Stationen des Versicherungsagenten, des Miederwarenhändlers und des Heiratsvermittlers nach und schildert sie als mühevolles, entbehrungsreiches und doch von Illusionen, Selbstbetrug oder auch Hoffnung beflügeltes Voranschreiten "auf den krummen Wegen des jüdischen Glücks". Von dem Lebensrhythmus eines bei aller Hochstapelei gläubigen orthodoxen Juden, der trotz aller Geschäfte den Schabbat hält, in die Synagoge geht, seine Gebete verrichtet und in seinen Briefen nie veräumt, Glaubensfloskeln einzuflechten, findet sich im Film gar nichts mehr. Aber jüdisches Milieu, jüdische (Hochzeits-) Traditionen - etwa die Vorbereitungen zu einer Fischmahlzeit (vgl. Foto Nr.23 der Bilddokumentation) - und der Grundzug des rastlos planenden, ständig in Bewegung und auf der Suche befindlichen Juden Mendel Menachem sind erhalten geblieben. J. Hoberman deutet Mendel als "ein [für die sowjetische Propaganda, D.P.] nützliches Sinnbild der jüdischen Notlage unter dem Zaren",55 ohne daß
54
55
Nach M. Gejser (Solomon Michoels, Moskau 1991, entnommen dem Filmprogramm Nr.l der Freunde der Deutschen Kinemathek, Berlin, "Jüdische Lebenswelten" 15.Januar - 26.April 1992) wurde JIDISCHE GLIKN parallel zu "Panzerkreuzer Potemkin" gedreht. Hoberman 1991,93: "a useful emblem for the Jewish plight under the tsars"
216
jedoch entsprechende optische Signale im Film erkennbar wären. Die Atmosphäre des jüdischen Dorfes(!) mit ihren jüdischen Menschen wirkt zeitlos, so daß der Film bis auf die Traumsequenz mit Fug und Recht auch in unser Kapitel über russische und polnische Juden vor der Emanzipation und zur Zeit der beginnenden Assimilation eingeordnet werden darf. Zusammen mit den Stummfilmen DAS ALTE GESETZ von E. A. Dupont und dem zu Anfang des 20. Jahrhunderts spielenden Pogromfilm DIE GEZEICHNETEN von Carl Theodor Dreyer gehört Alexander Granowskis JIDISCHE GLKN zu den bedeutendsten Werken des jiddischen Stummfilms. MOTL PEJSI DEM CHASNS/SWOS SLJOSY (Moti der Kantorsohn) Weniger berühmt, weil so gut wie unbekannt, ist der von Alexander Granowskis Regieassistent und Co-Autor beim "Jüdischen Glück" Grigori GritscherTscherikower inszenierte späte jiddische Stummfilm MOTL PEJSI DEM CHASNS aus dem Jahre 1928.56 Quellen des Films sind zwei Scholem-Alejchem-Romane: "Der verkischeñer schnajder" (die absurde Geschichte vom Ghettoschneider, der auf Drängen seiner Frau eine Ziege kauft, die ihm unbemerkt wiederholt mit einem Ziegenbock vertauscht wird, so daß der geprellte Schneider darob den Verstand verliert) und der Anfang des epischen Fragments Moti Pejsi Dem Chasns, seines letzten, auch in Deutschland verlegten Romans,57 der aus der Perspektive eines Neunjährigen den Weg aus dem Ghetto ("Von daheim nach Amerika") und die ersten Schritte nach der Auswanderung ("Masi Tow, wir sind schon in Amerika!") schildert. Im Film ist Moti als etwa sechsjähriger Knabe im Gegensatz zu seinem erwachsenen Bruder Elihu eine bloße Randfigur. So wird auch nicht die literarische Technik der Ich-Erzählung auf den Erzählmodus des Films - z.B. durch eine subjektive Kamera - übertragen. Auf den ersten Blick fügt sich MOTL PEJSI DEM CHASNS in den Rahmen der Verfilmungen Scholem-Alejchemscher Figuren, erzählt von den vergeblichen tragikomischen Versuchen des Schneiders Perchik, eine milchspendende Ziege vom Marktflecken in sein Dorf zu treiben und, da es in einen Ziegenbock "verhext" wurde, den Fall vom Rabbinergericht klären zu lassen, sowie von den ebenso mißglückten Bemühungen der jungen Luftmenschen aus seiner Mischpoche, der quälenden Armut zu entfliehen: Elihu, sein Freund Pinje und seine Tochter Frejda stellen erst Kwas, dann Tinte her, die sie an Mann und Frau bringen wollen. Aber anders als in vielen jiddischen Filmen wird keine verklärte, sentimentalisierte Schtetlwelt präsentiert, sondern der Ablösungsprozeß geschieht auch mit einem "Blick zurück im Zorn". Perchiks
56
51
Er wurde erst 1991 vom National Center for Jewish Films, Waltham, MA, USA, restauriert und in Deutschland erstmalig u.W. 1992 im Filmbegleitprogramm zur Berliner Ausstellung "Jüdische Lebenswelten" gezeigt. Der russische Originaltitel wurde vom National Center mit "Laughter Through Tears" (Lachen ohne Tränen) übersetzt. Moti der Kantorsohn (Frankfurt/Main) bzw. Der Sohn des Kantors (Berlin/DDR), beide 1965
217 Ziegenkauf hat parabelhafte Momente der Absurdität, Elihus Versuche, Tinte engros in einem Dorf zu verkaufen, wo niemand solche Mengen benötigt, um einen Brief an den ausgewanderten Onkel in Amerika zu schreiben, mutet wie eine Sisyphusarbeit an. Während Scholem-Alejchems Roman vom Zyklus der täglichen Gebete und des durch die jüdischen Feiertage geprägten hebräischen Kalenders durchtränkt ist, wird die Präsentation orthodoxer Frömmigkeit im Film als bloß formelhaft charakterisiert, ja in Frage gestellt, z.B. wenn der kleine Moti nicht verhindert, daß das von ihm beaufsichtigte Kind aus dem Tallis und den Tefíllin eine Puppe bastelt, wenn die Knaben im Cheder toben und ihr Gebet unter der Aufsicht des Rabbiners erkennbar nur ein Plappem ohne Inhalt ist, wenn das Rabbinergericht in Gezänk ausartet. Bezeichnenderweise werden die Rabbiner im Zwischentitel als "Funktionäre" tituliert. Die oberste Autorität ist nicht der Rabbiner (es kommt sogar zu einem Aufstand von Arbeitern gegen ihn), sondern die Staatsmacht, verkörpert in einem dicken, jähzornigen Polizisten, der sich zwar ein bißchen bestechen läßt, aber doch ein treuer, unbarmherziger Diener seines Staates ist. 1928 in der Stalinära gedreht, wird die Darstellung der jüdischen Lebenswelt zum Zweck einer postumen Abrechnung mit der Zarenherrschaft benutzt (zeitlich ließe sich der Film gut in den Rahmen der von uns beleuchteten Epoche vor, aber ebenso auch nach 1871 einordnen). Hoberman ist zuzustimmen, der in MOTL PEJSI DEM CHASNS die "Thematik des Klassenkonflikts" gestaltet sieht.58 Folgerichtig schließt der Film in seiner sozialkritischen, antizaristischen Tendenz mit einem Ausweisungssegment: Da der Schneider mit seiner Ziegenaffare Aufruhr verbreitet und ein in Auftrag gegebener Uniformrock eines antisemitischen zaristischen Offiziers bei der Tintenherstellung gelitten hat, muß der Schneider mit der ganzen Familie, mit seinem wenigen Sack und Pack das Dorf verlassen. Der erzwungene Abschied läßt noch nicht den Pogrom und die Migration in den Westen heraufdämmern. Er verschiebt aber Scholem-Alejchems Humor zum agitatorischen Proletariersturm auf den Rabbiner, der bloß durch die Macht der zaristischen Polizei eingedämmt wird. Nur noch wenige Luftmenschenattitüden haben sich die Gestalten bewahrt, die Armut des russischen Juden bleibt spürbar, aber seine zwischen Gottergebenheit, Resignation und Zuversicht schwankende Religiosität, wie sie in den Worten von Motls Mutter zum Ausdruck kommt ("Ein Jude muß immer sagen: Gam se letojwe - auch das ist zum Guten"59), die Bindung an das Judentum, an die Mischpoche, an die Gemeinde sind verblaßt, und damit hat sich dieser Film in weiten Teilen schon von SchalomAlejchems Tewjewelt entfernt. Mit dem MOTL-Film Gritscher-Tscherikowers wird der Niedergang des jiddischen Films in der Sowjet-Union offenbar, nämlich die Instrumentalisierung jiddischer Kultur für die propagandistischen Zwecke stalinistischer Politik. Noch in drei Produktionen des staatlichen sowjetischen Films kommen jüdische Figuren
58 59
Hoberman 1991, 129 Scholem-Alejchem 1965, 168
218 vor (wir behandeln sie nur summarisch, weil die Filmhandlung weit nach dem für uns eine Grenze setzenden Jahr 1871 spielt), aber von Film zu Film verblaßt die Eigenständigkeit jiddischer Kultur immer mehr: In dem Stummfilm JEGO PREWOSCHODITELSTWO (Seine Exzellenz bzw. Der Gouverneur, 1928) von Grigori Roschal, in formaler Hinsicht eine in der Nachfolge Eisensteinscher Revolutionsfilme stehende expressionistische Bildmontage über das Attentat eines jüdischen Arbeiters auf den imperialistischen Gouverneur von Wilna im Jahre 1905, werden Judenbilder nur noch in zwei Spielarten gepreßt. Entweder sind Juden im Solde des Imperialismus stehende bougeoise Elemente (zur Verdeutlichung der unheiligen Allianz von Kapitel und Macht wird der Rabbi von dem gleichen Darsteller wie dem des diktatorischen Gouverneurs gespielt) oder aber revolutionäre Proletarier ohne Bindung an ihre ethnische, religiöse und kulturelle Herkunft. In den beiden Tonfilmen des 1932 wird die Heimkehr von jüdischen Emigranten in die sozialistische Heimat aller Werktätigen propagiert: GORISONT (Horizont) von Lew Kuleschow zeigt, wie ein unter der Zarenherrschaft in die USA ausgewanderter Jude, der dort zum Spitzel gegen die Gewerkschaften gepreßt werden soll, während des Ersten Weltkrieges gegen die Bolschewiki kämpfen muß, bis er seinen Klassenstandpunkt begreift und zu ihnen überläuft. Die gleiche Tendenz drückt schon der Titel des letzten "jiddischen" Films der Sowjet-Union aus: NOSN BEKER FORT AHEJM (Die Rückkehr des Nathan Becker) in der Inszenierung von Boris Schpis und Raschel Milman. Das religiöse Judentum ist hier nur noch eine Sache von Greisen im zerfallenden Schtetl, aber für qualifizierte Facharbeiter (auch wenn sie ihrer Herkunft nach Juden sein mögen) ist die Heimkehr aus dem krisengeschüttelten Amerika ein Akt der Solidarität und der Teilhabe am sozialistischen Aufbauwerk (als salbadernder greiser Vater des Nathan Becker wird hier Solomon Michoels, der Hauptdarsteller aus JIDISCHE GLQCN, mißbraucht).
7.3.3.6. FIDDLER ON THE ROOF Kehren wir zurück zur Analyse der vier Fassungen des Tewje-Stoffes nach Scholem-Alejchems Roman. Nur noch als instruktives Beispiel für die Vermarktung von spektakulären Medienerfolgen, hier speziell mit Hilfe eines Films im Schlepptau eines erfolgreichen Musicals, ist die handwerklich perfekte, konventionelle filmische Transponierung des gleichnamigen Musicals durch Norman Jewison anzuführen.60 Die Bilder seines Films FIDDLER ON THE ROOF ("Anatevka"), England 1971,
60
Norman Jewison, geb. 1926, zunächst für das Fernsehen in Kanada, in London und New York tatig, hat seit 1967 ca. 20 Kinofilme gedreht: erfolgreiche musikalische Komödien, gesellschaftskritische Spielfilme (IN THE HEAT OF THE NIGHT; 1967) und Literaturverfdmungen (JESUS CHRIST SUPERSTAR, 1977, OTHER PEOPLE'S MONEY, 1991).
219 sind bei ihrem Bemühen um Realismus der Melodramatik des Bühnenmusicals konträr. Der Film ist ein Mixtum compositum aus Folklore, Sentiment und Realismus um die tragikomische Figur des in Gottergebenheit um Gerechtigkeit räsonierenden Tewje. Die Haupteinwände gegen Jewisons Konzept richten sich gegen das Aufnahmeverfahren und den Inszenierungsstil. Der dreistündige 70mmPanavision-Breitwandfilm mit seinem 6-Kanal-Ton ist einer der für die sechziger und siebziger Jahre typischen Versuche, durch teure, überdimensionale Kolossalfilme den Konkurrenten Femsehen aus dem Felde zu schlagen. Der Film verwendet seine Herstellungskosten von 42 Millionen DM zu einem pompösen romantischen Spectaculum mit Folklore-Show-Einlagen. So problematisch schon die Transponierung des Romans in ein Musical war, die erneute Verwandlung des nichtrealistischen Bühnenmusicals in eine Authentizität vortäuschende reale Szenerie (der Film wurde in einem jugoslawischen Dorf gedreht) zerstört in seinem Gigantismus sowohl den Musicalstil wie das Sujet und Milieu der Tewjewelt. Jewison glaubte, die besten Voraussetzungen für die Inszenierung zu haben: Ich bin Presbyterianer, und mein Name, den man mit Judensohn" übersetzen könnte, ist britisch-irisch und von "Jewettson" abgeleitet. Ich habe aber meine ganze Jugend mit jüdischen Freunden verbracht und glaube, ihre Sitten und Gebrauche besser zu kennen als mancher glaubige Jude.61
Aber FIDDLER ON THE ROOF IST KEIN JIDDISCHER Film. Es kommen in ihm lediglich Figuren vor, die ukrainische Juden vorstellen sollen.
7.3.4. Die Legende vom Dybuk als polnisch-jiddischer Tonfilm: DER DIBEK/DYBUK ("Der Dibbuk"! Polen 1937 Die Adaptionen einiger klassischer Prosawerke des Mendele Moicher Sforim und des Scholem-Alejchem durch den Film haben jiddische Lebenswelten der Zarenzeit trotz ihres sentimental-romantischen Filters immer auch unter dem aufklärerischen, schon säkularisierten Blickwinkel ihrer Autoren als eine Welt im Wandel und Aufbruch präsentiert. Fast in keiner dieser Arbeiten ist aber ein Nachklang der Verschärfung der internen Auseinandersetzungen in den jüdischen Gemeinden und der rigiden Judenpolitik Rußlands unter Nikolaus I. mit seinen barbarischen Versuchen zur Zwangsintegration zu spüren, wie sie aus den Kantonisten-Dekreten und Klassifikationsplänen, den Maßnahmen zur Errichtung staatlicher Schulen, Besteuerung traditioneller jüdischer Tracht, Abschaffung der autonomen jüdischen Gemeindeorganisationen, aber auch aus der wenig geänderten Politik Alexanders Π. mit der Errichtung des Ansiedlungsrayons und der Begünstigung bloß der "nützlichen" Juden ablesbar sind. Daß sich die Mehrzahl
61
Stuttgarter Zeitung, 24.9.70
220 der Gemeinden der Emanzipation verschloß, daß die Rabbinen der einflußreichen (litauischen) Gelehrtenhierarchie sich dem Einfluß mystizistischer Gärungen erwehrten, daß Sabbatianer, Kabbalisten und die Vertreter des Chassidismus im Ostjudentum prägenden Einfluß gewannen, daß man von einer Blüte der jüdischen Mystik sprechen konnte, läßt sich nur an einem jiddischen Film exemplifizieren, der nach dem berühmten Theaterstück Der Dibbuk entstanden war. Dessen Verfasser, der Ethnologe, Sozialrevolutionär und Literat S. An-Ski (eigentlich Schiomo Seinwel Rappaport, 1863-1920), hatte sich nach dem Besuch einzig des Chewer, der jüdischen Elementarschule für fünf- bis neunjährige Knaben, als junger Erwachsener autodidaktisch gebildet, Russisch und Hebräisch gelernt, die Aufklärungsliteratur studiert, die Schneiderei, Buchbinderei und das Schmiedehandwerk erlernt, um die Bauern zu revolutionieren. Als längere Zeit in Paris lebender Sozialrevolutionär, der sich innerlich von seinem Judentum längst gelöst hatte, wurde er in Opposition zum berüchtigten antisemitischen DreyfußProzeß und später zum aufflammenden polnischen Antisemitismus wieder zum Juden. Er nahm zunächst Verbindung zum "Bund", der jüdisch-sozialistischen Bewegung in Polen, auf, kehrte in seine Heimat zurück, erforschte dann jahrelang die ostjüdische Folklore und gründete die "Jüdische Ethnologische Gesellschaft" in Petersburg. Nach der Oktober-Revolution floh er nach Wilna und setzte bis zu seinem Tod 1920 seine ethnologischen und literarischen Studien fort.62 Wie Mendele und Scholem-Alejchem schrieb er zunächst russisch, dann jiddisch. Seine bühnenwirksame Dramatisierung der chassidischen Dybuksage kreist um jene "neben der rabbinischen und den religiös-philosophischen Strömungen als dritte geistig-religiöse Kraft innerhalb des Judentums" bekannte mystisch-spekulative Bewegung, die unter dem Namen "Kabbala" als esoterische Lehre der jüdischen Tradition angesehen wird und auf die Kenntnis der Geheimnisse der Gottheit zielt.63 An-Skis "dramatische Legende" schöpft nicht aus der theoretischen, sondern der praktischen Kabbala, ihrer popularisierten und transformierten Weiterfuhrung im Chassidismus, einer pietistischen und sozialen Bewegung des orthodoxen Judentums, die in Osteuropa von dem Mystiker und Exorzisten Rabbi Israel Baal Schern begründet worden war. Auch in An-Skis Drama sind die gnostischen und pantheistischen Züge des kosmischen Gottesbildes eines Baal Schern Tow allenthalben spürbar, aber in einer Akzentverschiebung vom zentralen Anliegen des Chassidismus, der "Erlangung der communio mit Gott"64 hin zur Magie, zum Exorzismus, zur Nachbarschaft mit der Golemlegende. So wie der Baal Schern Tow bei An-Ski nur als locus classicus für die Heilung vom Einfluß böser Geister angeführt wird, werden Kabbala und Chassidismus als eher bedrückende, einengende, in Verzweiflung und Tod führende Existenzweise osteuropäischen
62 63
w
Undmann 1989, 117-125; Hobennan 1991, 8; Theaterlexikon 1983, 44 Petuchowski/Thoma 1989, 191. Vgl. auch Scholem, Judaica 1-IV, vor allem I, 165-206); Küng 1991, 223-229; Ettiner 1980, 49-64 Scholem 1986, 183
221 Judentums vorgeführt. Dennoch ist das Dibbuk-Drama kein Aufklärungsstück über die schädlichen Folgen des Aberglaubens an Geisterbeschwörungen, sondern eine ergreifende jüdische Dichtung über die Macht des Magischen, über den mystischen Glauben von Chassidim an Erlösungsformeln auf dem Hintergrund von Judenpogromen, hier des Kosakenhetmans Chmjelnizki im 17. Jahrhundert. Die Volksmystik des Chassidismus mit ihrer pantheistischen Grundannahme, daß Gott die gesamte Schöpfung, auch die Materie, durchdringt und selbst das Böse eine niedrige Stufe des Guten ist, daß der Mensch zur Einheit mit Gott durch ekstatische Begeisterung zu dringen vermag, daß die auch von Geistern der Toten bevölkerte Welt durch die Exorzismen der Wunderrabbis wieder in richtige Bahnen gelenkt werden kann, wird bei An-Ski nicht philosophisch abgehandelt, sondern in einem poetischen und tragischen Kunstwerk gestaltet. Die in den zwanziger Jahren zunächst von der Wilnaer Truppe in Warschau, dann am Moskauer Habimahtheater (Regie: Wachtangow), in Berlin an Max Reinhardts Deutschem Theater (Regie: Berthold Viertel) und in Frankfurt (Regie: Max Ophüls), 1979 im Hamburg, 1981 und 1992 von der Schaubühne gespielte Exorzismustragödie, die außer in Waszynskis Film von 1937 auch in einer Studioinszenierung im ZDF (1968) zu sehen war, kreist um die spätjüdische Figur des Dybuk oder Dibbuk (hebr. " Anhaftung"), den Geist eines Toten, der sich, um vor der Verfolgung böser Geister Ruhe zu finden, an den Leib eines Lebenden heftet, so daß der vom Dybuk heimgesuchte Mensch als "besessen" erscheint. Manchmal wird der Dybuk auch als böser Geist bezeichnet. Nur einem Baal Schern, einem Wundertäter, kann es gelingen, durch bestimmte Zeremonien (Exorzismen) den Dybuk auszutreiben. Im Drama wie im Film ist der Dybuk kein böser Geist, sondern ein zunächst in persona vorgeführter armer Talmudschüler, der sich in Lea, die tugendhafte Tochter eines vermögenden Juden verliebt hat und aus Verzweiflung stirbt, als Leas Vater seine Tochter einem anderen (reichen) jungen Mann zur Frau gibt, obwohl er schon vor der Geburt Leas und Chanans (im Film: Chanon) die beiden einander versprochen hatte. Der Exorzismus durch einen Rebbe hat nur scheinbaren Erfolg: Der Dybuk verläßt den Körper der sterbenden Braut, die Seelen Leas und Chañas vereinigen sich in der Stunde ihres Todes. Der Dybbuk ist bei An-Ski also kein Spuk und die dramatische Legende kein Grusical, sondern die poetische Kraft des Stückes beruht darauf, daß der Dibbuk und das Mädchen Lea nicht Gegner (Totengeist und Opfer) sind, sondern zwischen ihnen eine tiefe innere Beziehung besteht,65 so daß das Exorzismus-Sujet zur Liebestragödie wird. Die dramatische Legende wurde entgegen den akribisch naturalistischen Bühnenanweisungen An-Skis meist als Mysterienspiel inszeniert, losgelöst von Zeit und Raum, als expressionistisches Parabelspiel ekstatischer Gläubigkeit und vordergründig kabbalistischer Magie. Es ging ihr nicht darum, ein realistisches Bild jüdischer Charaktere oder der drei Typen jüdischer Frömmigkeit vorzuführen, wie sie Gerschom Scholem als "talmid chacham" (rabbinischer
65
vgl. Landmann 1989, 103
222 Gelehrter), "zaddik" (Gerechter) und "chassid" beschrieben hat,66 sondern darum, einen Mythos vom Eingreifen übernatürlicher Mächte im phantastischen Kolorit des chassidischen Judentums zu gestalten. Hier setzt auch Waszynskis vorwiegend mit jüdischen Schauspielern gedrehter Film DER DffiEK - im Femsehen: "Der Dibbuk" - an (vgl. Fotos Nr. 24 und 25 der Bilddokumentation). 67 Auch er will kein rein realistisches Bild der Ghettowelt zeichnen; denn die Außenaufnahmen (von Kazimierz) spielen keine zentrale Rolle, die Bilder von Feldern und Hohlwegen, von Sturm, Wasserfluten und Bootskentern sind nur Metaphern für die Seelenzustände der Figuren; und die Handlungsorte - einerseits der Schtetlausschnitt mit der Synagoge, dem Haus des reichen Juden Sender und dem rituellen Bad, andererseits der jüdische Friedhof sind Theaterkulissen, die eine mehr stilisierende Funktion haben. Einen Realismusschub gewinnt der Film hingegen durch die Bearbeitung von An-Skis Handlungskurve mit der dort sich erst fast zum SchluB enthüllenden Rahmenstory von den schon vor ihrer Geburt einander Versprochenen, während der Film die Liebesgeschichte ebenso breit ausspielt wie das ad occulos geführte Versprechen der Väter und die moralische Schuld Senders wegen des gebrochenen Gelübdes. Sehr realistisch getroffen sind auch die Figuren des Chassiden und Wunderrabbis, des Synagogendieners und einiger anderer Randfiguren. Durch die Realismusfolie hindurch gewinnt aber die Phantastik Konturen, die Beschwörung einer ins Mythische gesteigerten kabbalistischen und chassidischen Welt, die Selbstentäußerung durch das rhythmische sich Hin-und-Her-Wiegen der Betenden, die rituellen Tänze der Männer und der Frauen sowie die Sologesänge der Figuren (selbst der gottesdienstliche Gesang eines seinerzeit sehr bekannten polnischen Kantors hat etwas Theaterhaftes). Die geistige Mitte des Films, auch bühnenmäßig das Zentrum des Szenenbildes, ist das von Anski übernommene Motiv vom heiligen Grab, das inmitten der Dorfstraße liegt: Als 1648 Chelmnickis Kosakenhorden das Dorf überfielen, ermordeten sie auch ein schon unter der Chupa, dem Traubaldachin, stehendes Brautpaar. Der Tod der einander Versprochenen, einander in Liebe Zugetanen, bei der Hochzeitszeremonie Verschiedenen wird sich wiederholen. Vor dem Grab tanzt der Tod eng umschlungen mit Lea, vor dem Grab tritt der fromme Bote (das Schicksal) aus dem Nichts, vor dem Grab befällt der Dybuk die Braut. Mögen diese parabelhaften Einstellungen überzogen, ein überdeutliches Mysterienspiel sein, möge der Satansbund des Talmudschülers hinter die geistige Dimension der literarischen Vorlage zurückfallen, möge die dargestellte chassidische Lebenswelt nur eine Lebensform russisch-polnischer Juden vor der Emanzipation widerspiegeln, so hat sie doch einen hohen Authentizitätsgrad und eine sehr
66 67
Scholem 1984, 262-286 Michaf Waszynski (1904-1965), Regisseur von etwa 40 polnische Spielfilmen unterschiedlichsten Genres, inszenierte in der UdSSR ab 1941 gegen das Naziregime gerichtete Dokumentarfilme mit Spielfilmeinlagen, war nach 194S auch Produzent in Italien, Spanien und den USA (vgl. Hobermann 1991, 282-285; Toeplitz 1983, 325f, 329).
223 schlüssige Gestaltungsform. Dies alles berechtigt dazu, den DIBEK als die Apotheose des jiddischen Films zu bezeichnen. Die Qualitäten des DIBEK treten besonders hervor, wenn man sie mit einer Variation des gleichen Themas vergleicht, die 1924 von Zygmunt Turkow nach dem gleichnamigen Bühnenstück TKIES-KAF (Der Schwur) von Perez Hirschbein inszeniert wurde. Auch dort hatten zwei Väter geschworen, ihre Kinder miteinander zu verheiraten, aber der eine, geldgierige, hatte den Schwur nicht gehalten, obendrein den Besitz der Witwe seinen verstorbenen ehemaligen Freunde an sich genommen, so daß die Kinder nicht die erwählten und auch geliebten Partner erhalten, sondern andere Partien eingehen sollen. Das Happy-End wird hier durch zahlreiche Deus-ex-machina-Effekte bewirkt: Der Prophet Eliah greift in verschiedenen Erscheinungsformen so in das Geschehen ein, daß der fromme Jeshiwa-Student Jakob, obwohl er in seiner Verliebtheit längst eine totalen Assimilationsprozee in Kleidung und Auftreten durchgemacht hat, seine geliebte Rachel erhält. Die Analyse der beiden Milieus, der orthodoxen Dorf- und der assimilierten Stadt-Juden, wird allerdings durch die vor uns liegende Gestalt des Films, in dem zahlreiche Darsteller des jiddischen Theaters in Warschau (EsterRachel Kaminska, die "Mutter des jiddischen Theaters", und ihre ebenso berühmte Nachfolgerin Ida Kaminska) mitwirkten, erschwert; denn 1933 entstand aus dem Stummfilmmaterial unter dem Titel A VILNA LEGEND/DEM REBNS KOJECH in den USA wurde eine vergröbernde jiddische Tonfassung mit einem eingefügten Batlen, dem ostjüdischen Spaßmacher und Geschichtenerzähler, der die Handlung erklärt, kommentiert und manchmal peinlich verwitzelt.
7.4. Zwischenbilanz Die Interpretation von acht Filmen zur ostjüdischen Thematik aus ganz verschiedenen Produktionsjahren - zwischen 1923 und 1971 - erlaubt es, mit aller Vorsicht ein Teilergebnis vorzutragen. Eine zunehmend differenziertere Gestaltung des ostjüdischen Milieus innerhalb der Tonfilmentwicklung ist auf der Basis der bisher vorliegenden Materialien nicht zu konstatieren. Auch wenn wir hier die zu einer Späteren Zeit spielenden Adaptionen der Romane Joseph Roths in den Fernsehfilmen Kehlmanns und Wickis, den PROZESS von G. W. Pabst und die jüngeren Produktionen über jüdische Schicksale zwischen 1900 und 1914 im österreichischen Galizien (AUSTRIA; FÜRCHTE DICH NICHT, JACOB!; YENTL) beiseitelassen, hat es doch den Anschein, als ob die Kraft zur (filmischen) Gestaltung jener inzwischen ausgelöschten Welt mit der Vergrößerung des zeitlichen Abstandes immer mehr abnimmt. Die Scholem-Alejchem-Hausse in der Bundesrepublik dauerte nur ein Jahrzehnt (die letzte Adaption im Femsehen war 1970 Boris Blachers Oper 200 000 Taler nach Scholem-Alejchems Stück Das große Los in der Regie von Gustav Rudolf Sellner). Dupont, Granowski, Gritscher-Tscherikower, Michel
224 Waczynski, Maurice Schwartz und Joseph Green, der Regisseur der gleich noch zu analysierenden jiddischen Musikfilme, schöpften - bei aller Unterschiedlichkeit ihrer filmischen Mittel - offenbar noch aus einer lebendigen Tradition. Sie gestalteten Gegenwärtiges, auch wenn ihre Stoffe Vergangenes reproduzieren. Ihre Renaissance des Ostjudentums hat hervorragenden kulturhistorischen Wert und ist - im Gegensatz zu den beiden jüngsten Tewje-Adaptionen - in hohem Maße geeignet, filmhistorisch reizvolle Kenntnisse sowie geschichtliche und theologische Einsichten durch Begegnung mit einer gestalteten Tewjewelt zu vermitteln.
7.5. Joseph Greens Musikfibne als Spiegelbild polnischer Schtetlexistenz Die sechs Scholem-Alejchem-Produktionen haben sich von Film zu Film immer weiter von den vielschichtigen Figuren Scholem-Alejchems und dessen differenzierter Sicht ostjüdischer Existenz entfernt. Zudem sind sie immer stärker an die Gegenwart herangerückt: von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis etwa 1905. Die Zeit changiert auch in den vier zwischen 1930 und 1940 entstandenen Filmen Joseph Greens. Mit ihnen wenden wir uns einer Subspezies von polnischen Produktionen des jiddischen Kinos zu. (Eine Analyse des Gros jiddischer Gegenwartsfilme aus den dreißiger Jahren paßt nicht in den zeitlichen Zusammenhang unserer Untersuchung.) Joseph Green ist nicht nur einer der beiden Regisseure, sondern auch einer der beiden Produzenten der unter seinem Namen firmierenden Warschauer Green-Film-Produktion.68 Unter den über hundert, z.T. verschollenen Filmen des jiddischen Kinos spielt er eine Sonderrolle: Bis auf einen Film sind seine Arbeiten nach Originaldrehbüchern entstanden, und alle seine Produktionen sind nicht nur wie alle jiddischen Tonfilme mit Musik getränkt, sondern regelrechte Musikfilme. Seine folkloristischen musikalischen Komödien sind zunächst typisch für den von Musik erfüllten jiddischen Kulturbereich. Sie folgen aber auch zeittypischen Gestaltungsformen des jungen Musiktonfilms der dreißiger Jahre,69 und sie verleugnen nicht die "Liaison zwischen jiddischer Tradition und amerikanischer Broadway- und Musicaldramaturgie."70 Andererseits sind sie trotz und innerhalb dieser Wahrnehmungsweisen des Genres Zeugnisse authentischer jiddischer Kultur (Green: "Ein jiddischer Film sollte sowohl Volksbräuche und ethnische Authentizität beinhalten als auch soziale Ungerechtigkeit enthüllen. Ein solcher Film sollte auch die Werte unserer Kultur
w
70
Deshalb folgen wir auch der Klassifizierung des Deutschen Filmmuseums Frankfurt (Das jiddische Kino, 1982), das immer von den "Filmen Joseph Greens" spricht, wahrend Toeplitz (1972, I, 378) "Jozéf Green" stets als zweiten Coregisseur einstuft. Günther (1982, 67) verweist auf die übernationalen, genretypischen Ingredienzien des Musikfilms: Musiknummern, Situationskomik und Romantik. Koch 1982, 30
225 und unsere Sprache unverfälscht darstellen; vor allem muß er unterhaltsam sein"71). Die jiddischen Filme Greens vermitteln innerhalb des Rahmens fiktionaler Literatur Nicht-Fiktionales, sie präsentieren inszenierte Dokumente ostjüdischen Lebens, "ostjüdische Kultur", und zwar nicht durch die Message des Films, die herausgestellte "Ex-cathedra"-Botschaft, sondern durch genau beobachtete, aparte - a part gefilmte - plötzlich aufbrechende Realitätsbeobachtung (Günther spricht von "Authentizität in kontingenten Alltagsmomenten"72). Verstärkt wird der Eindruck des Authentischen durch die Besetzung mit jüdischen Schauspielern, die sich entweder in New York oder in Warschau, z.B. in dem berühmten jiddischen Ensemble der Kaminska, auf den offenbar traditionellen chassidischen Darstellungsstil spezialisiert hatten. Damit eignet ihnen wie allen hier analysierten jiddischen Filmen ein besonders hoher Stellenwert für die Abwehr des Antisemitismus, weniger durch die Schildung zeitgenössischer Judenfeindschaft als vielmehr durch eine lebendige, eingängige und instruktive Vergegenwärtigung ostjüdischer Religion, Kultur, sozialer und i.w.S. politischer Situationen und Entwicklungen. Die Analyse der Green-Produktionen im Rahmen einer Untersuchung jüdischer Figuren in ñktionalen Produktionen, die bis zum Abschluß der jüdischen Emanzipationsgesetzgebung 1871 spielen, wäre streng genommen nur zulässig, wenn Greens Filme auch innerhalb dieses zeitlichen Rahmens spielten. Das ist nicht der Fall. Dennoch läßt sich an ihnen u.E. besonders gut das Phänomen der sich im Ostjudentum ändernden Einstellung zur Ghettomentalität beobachten, nämlich den in unterschiedlicher Intensität und unterschiedlichem Tempo vollzogenen Wechsel von eigensinnigem Sich-Festklammern an den überlieferten Lebensformen im geliebten Schtetl über die Öffnung gegenüber neuen Einflüssen bis zum Aufbruch in eine neue Zeit und den Vollzug von Akkulturationsleistungen.
7.5.1. MAMELE In denen der Exposition dienenden Sequenzen der Greenfilme scheint die Zeit stillgestanden zu sein. Zwar benennt der Filme MAMELE/MATECKA (in den USA auch: "Little Mother"), 1938, mit seiner ersten Einstellung - einem langsamen Schwenk in der Totalen über die Industrielandschaft von Lòdi - und der folgenden Großaufnahme des Schwungrads einer Dampfmaschine den Ort der Handlung. Er enthält sich aber aller politischen, ökonomischen und sozialen Konkretisierungen, etwa jener Reihe sozialer Spannungen wie 1892 des Lódzer Aufstandes und ersten allgemeinen Streiks in Polen oder 1905 des Arbeiteraufstandes, der einen der Höhepunkte der russischen Revolution darstellte.
71
72
Vgl. die Statements Greens in: Loewy, Ronny, Hans Peter Kochenrath u. Walter Schobert. Das jiddische Kino. Ein Filmforum. ZDF 1983, 45' Günther 1982, 64
226 Stattdessen leitet der Schnitt vom Schwungrad auf die von der Trägerin der Titelfigur gedrehte Kaffemühle den Rückzug aus deralität des Zentrums der polnischen Textilindustrie in die verklärt gesehene, immer noch leicht ghettoähnliche Welt des Schtetls mit seinen Privatkonflikten ein. Der Film verweilt bei den kaum den Veränderungen der Zeit unterworfenen Figuren wie dem Bäcker, Händler, Schuster, Trödler und Musikanten und den liebevoll detailliert geschilderten Angehörigen der Mischpoke als den zentralen Gestalten eines der Selbstvergewisserung des Familienbestandes dienenden Spiels. Die Kamera gibt den Blick frei auf die geschlossene Welt einer Schtetlstraße (einer am Rande Warschaus errichteten Kulisse!) und in ihr - als box in the box - auf die gebastelte Laubhütte mit den Sukkot feiernden Schtetlbewohnem oder als Durchblick durch pittoreske Architekturelemente auf die im Chewer betenden Knaben. Zumindest in den Anfangsszenen wird das Schtetl des 19. Jahrhunderts beschworen, erst nach und nach werden die Kostüme moderner. Eine in die Kulissenwelt geschobene Luxuslimousine erscheint wie ein modernistischer Fremdkörper innerhalb einer in der Vergangenheit spielenden Geschichte, bis dann endlich klar wird: MAMELE soll in den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts spielen. Die Fabel von dem ein Aschenputteldasein führenden Mámele, der sich für die Mischpoke aufopfernden, Mutterstelle vertretenden Schwester, nimmt den erwarteten verdienten Ausgang: Havche kriegt ihren Schlesinger, den sich vom schmachtenden "Schtetl-Tauber" zum Konzertmeister mausernden Musikanten. Der Film, den Hoberman mit vollem Recht als ein im Grunde genommen "comic melodrama" und eine "saga of maternal (or Jewish) misery" bezeichnet hat,"schließt mit einer fast aus der Zeit gelösten, lang ausgespielten Hochzeitsszene. Aber alles bleibt im Hinblick auf den Ablösungsprozeß der Titelfigur in der Schwebe: Die Rückkehr in die Familie ist ebenso denkbar wie der karrierebedingte Abschied aus dem Schtetl.
7.5.2. YIDL ΜΓΓΝ FIDL Ähnlich in der Balance zwischen gestern und heute, dabei viel überzeugender sowohl in der Entwicklung der Story als auch in den hier sorgfaltig dramaturgisch vorbereiteten Musiknummern ist Greens frühester Musikfilm YIDL ΜΓΓΝ FIDL/JUDEL GRA NA SKRZYPCACH (in den USA auch: YEDDLE WITH HIS FIDDLE/CASTLES IN THE SKY), 1936. Auch in der Milieuzeichnung ist der Film viel realistischer. Er wurde nicht in künstlich errichteten Bauten gedreht, sondern die Außenaufnahmen entstanden in der polnischen Stadt Kazimierz an der Weichsel.74 YIDL ΜΓΓΝ FIDL macht die Musik selbst zum Thema. Nachdem die Mutter gestorben ist und die Schtetlwohnung gekündigt wurde, ziehen die auf der Geige ihren Lebensunterhalt fiedelnde Yidl, als Junge verkleidet, und ihr Kontrabaß spielender Vater in die Welt hinaus. Sie wollen als Straßenmusikanten
73 74
Hoberman 1991, 290 Heute der VIII. Bezirk der Stadt Krakow/Krakau
227 ihr Brot verdienen, müssen sich der Konkurrenz (eines Klarinetten- und Geigenduos) erwehren, machen dann aber gemeinsame Sache, bis die Gruppe zerfällt (vgl. Foto Nr. 26 der Bilddokumentationl). Nur eine schafft den Aufstieg: Yidl wird Broadwaystar. YIDL mit seiner aus der Handlung sich entwickelnden Musiknummern, mit seiner Nostalgie und Authentizität vermittelnden Darstellungsweisen, seinen in den Dorf- und Landstraßensequenzen bei aller Rückwendung zur verklärend gesehenen Vergangenheit doch auch realistisches Milieu reproduzierenden Einstelllungen unterscheidet sich wohltuend von dem zwei Jahre später produzierten amerikanischen Musikfilm YANKEL DER SCHMID. Dessen Regisseur Edgar G. Ulmer stellt in dieser halb komischen, halb tragischen Adaption des gleichnamigen Theaterstücks von David Pinski über den Seitensprung eines Dorfschmieds die Titelfigur seines SINGING BLACKSMITH (amerikanischer Filmtitel) wie einen Opernstar alter Prägung einlach an die Rampe und läßt ihn da statuarisch seinen Belcanto-Bariton abliefern. Mag YANKEL auch durch die Titelfigur eines kräftigen Schmieds das antijüdische Stereotyp vom aller körperlichen Arbeit abholden Trödler und Händler positiv zu durchbrechen, so ist der Film doch nur ein konventioneller Abgesang auf russische Dorfjudenmentalität. Er strebt nicht nach einer die Verhältnisse ändernden Sichtweise, nach einem Weg aus dem Ghetto, sondern nach Reproduktion einer nostalgisch interpretierten Ghettomentalität ohne den religiösen Nährboden des Judentums: Glück ist Bewahrung der Ghettowelt, ist Verzeihung und Versöhnung im familialen Bereich. Anders als die Ulmersche ist die Greensche Sichtweise jüdischer Lebenswelten: Sie mischt jiddische Volksmusik und Broadwaymedodien, die Welt des Schtetls und die des Dorfes, die Geborgenheit der Heimat und den Aufbruch aus ihr, Naturidylle und Kleinstadtarmut, viel Situationskomik und viel (Liebes-) Romantik, "Milieu und Aufstiegswunsch"75, mühseligen Anfang und rauschenden Erfolg mit Tourneen und Luxusdampfer. Zwischen diesen Polen bewegt sich der schon in der Zeit der Entstehung nostalgische, die eigene Schtetlexistenz bei allem realistischen Zugriff in ein verklärendes Licht des Abschieds (drei Jahre vor dem Überfall der Nazis!) tauchende Film. Auch er wird - wie der zwei Jahre später produzierte Greenfilm MAMELE - durch die hinreißend komische, aber ihre Begabung auch bis in die letzte Mimik ausspielende Molly Picon zusammengehalten. (Die Besetzung der Hauptrolle in einem in Polen produzierten und auch in den USA distribuierten Film mit einem Star der New Yorker jiddischen Bühne ist wieder ein Hinweis auf die Absatzgebiete der jiddischen Filme: die jiddisch sprechende Bevölkerung in Polen und Amerikas.) YIDL scheint wie MAMELE Jahrzehnte zu raffen: Die bettelarmen Musikanten im Hinterhof und auf der Landstraße gehören durch die Vorführung des typischen ostjüdischen Figuren- und Berufsarsenals in nur einem halben Dutzend klassischer
75
Koch 1982, 29
228 Handlungsräume (Markt, Straße, Wohnstube, Küche, Wirtshaus - religiöses Milieu wie Cheder und Synagoge werden ausgeklammert) der Schtetlexistenz aus der Mitte des 19. Jahrhunderts an. Die Schlußsegmente dagegen signalisieren durch die Verwendung von Bildsymbolen wie Luxusdampfer, Kontrakt oder Abendkleid die Gegenwart der Produktionszeit, zugleich aber wieder den Rückgriff auf die Vergangenheit, denn die Erfolge des Bühnenstars Yidl beruhen auf der Reproduktion ihrer die Gegenwart und Vergangenheit des Schtetls nostalgisch vergoldenden Lieder.
7.5.3. DER PURIMSCHPILER Auch der dritte Film von Joseph Green, DER PURIMSCHPILER/ ΒΓ,ΑΖΕΝ (in USA auch: THE JESTER), 1937, scheint nur ins 19. Jahrhundert zurückzublicken. Hier ist die Kleinstadt ganz in die galizische Landschaft eingebettet. Der Film beginnt mit der Ernte übervoller Obstbäume durch lachende junge Mädchen. Er schließt mit der gleichen Kameraeinstellung: Die Bäume sind leer. Er schwenkt über die Felder, die Landstraßen, die Dörfer. Er führt das bekannte Figuren- und Architekturensemble der Greenschen Schtetlwelt vor: den von Juden in traditioneller bzw. zeitloser Kleidung belebten Markt, die Gassen, die Innenräume. Es wechseln nur die Berufe und Feste: Nach den Schneidern sind es hier die Schuster, auf Sukkot folgt Purim. (Im letzten Greenfilm A BRIVELE DER MAMEN wird man sich um den Pessachtisch versammeln). Der Zirkus, der da ins Schtetl zieht und das Leben der Filmhelden verändert, ist ein Wanderzirkus, wie es ihn im frühen 20., aber auch schon im 19. Jahrhundert gegeben hat. Hätte nicht der Panjewagen Gummiräder und entspräche nicht die Frisur der Heldin dem Schönheitsideal der zwanziger und dreißiger Jahre, so ließe sich der PURIMSCHPILER mühelos in die unserem Kapitel entsprechende Epoche versetzen, zumal die Titelfigur ganz dieser Schtetlexistenz verhaftet bleibt: Der arbeitslose Getsel, der auf der Suche nach einer Beschäftigung von Schtetl zu Schtetl wandert, seine von Melancholie und Liebesschmerz wie eingefrorene Trauermine nur kurze Zeit hinter der Maske des zum Vergnügen der Honoratioren agierenden, possenreißenden Purimspielers verbergen kann, schafft es nicht, sich aus dieser Welt der festgefügten Ordnung zu lösen. Der Versuch des Narren, der angebeteten Esther in die moderne Welt des Vaudeville zu folgen, überfordert ihn als Kleinstadtbewohner und Laiendarsteller. Getsel bleibt bei seinen Rollen, bei seiner Ghettomentalität, er verzichtet auf die seiner Natur nicht gemäße Emanzipation und Akkulturation. Esther dagegen (Song: "die prinzessn von a klejn jiddish stetl") repräsentiert die sich partiell von der Tradition lossagende, assimilationswillige, vom 19. ins 20. Jahrhundert sich wendende Aufsteigerin (vgl. Foto Nr. 27 ). Auch sie wird nach dem Muster Greenscher Musikfilme Varieté- oder Broadwaystar, der nur noch zum flüchtigen Erinnerungsbesuch einen Abstecher ins Schtetl macht.
229 7.5.4. A BRIVELE DER MAMEN Es ist auffallig, wie Green in seinen Filmen YIDL ΜΓΓΝ FIDL, DER PURIMSCHPILER und schließlich A BRIVELE DER MAMEN/ LIST DO MATKI (in USA auch: A LETTER TO MOTHER), 1938, die Emanzipation als eine (Teil-)Auflösung der jüdischen Traditionsgesellschaft vorführt, in der die religiöse Tradition kaum noch oder gar nicht mehr diskutiert wird (vgl. Satz 12 und 16 über die jüdische Emanzipation). Das von den Emanzipierten zurückgelassene Sditeti = Ghetto ist nur noch der Ort der Kindheit, die emotionale Bindung daran nur noch Ausdruck der Bindung an die Mischpoke. Die drei Greenfílme zeigen - ohne programmatische Attitüde - Akkulturation als Verschmelzung von tradierter Kultur, modernem Lebensgefühl und aktuellem Konsumgeschmack, was jeweils an den Musikeinlagen gut erkennbar ist. Die dem Klezmer, der traditionellen Volksmusik der osteuropäischen Juden, entstammenden, nur von Geige oder Klarinette begleiteten Lieder des Schtetl werden nun von den zu Stars kreierten Aufsteigern aus der Ghettowelt als Vaudevillenummern mit großem Orchester vorgetragen. Die Intimität der Songs wird zum Broadwayauftritt perfektioniert und vergröbert, als Schtetlideologie vermarktet. A BRTVELE DER MAMEN, der letzte der Greenfilme, thematisiert und problematisiert als Endpunkt der Entwicklung die Auflösung der Mischpoke und die Auswanderung nach Amerika.76 Auch die aufopferungsvolle Mamen, die bei allen Hiobsbotschaften tapfere Mutter der vom Schicksal geschlagenen Familie, kann deren Zerfall nicht aufhalten (vgl. Foto Nr. 28). Eine romantische Verklärung des Schtetls findet nicht mehr statt. Die Handlung setzt kurz vor dem Ersten Weltkrieg im von Migranten gelichteten Schtetl ein. Wenn sich die Familie um den Pessachtisch versammelt, ist der Platz des nach Amerika gegangenen Vaters leer. Der jüngste Sohn stellt die traditionellen Fragen, der älteste übernimmt den Part des Vaters. Der Krieg zerschlägt die Familie vollends, die Tochter ist weggezogen, der ältere Sohn wird Soldat, der jüngere wandert nach Amerika aus, wo der auf die Stufe des mit Socken handelnden Straßenverkäufers gesunkene Vater inzwischen verstorben ist. Zwar bietet Green noch ein in der Gegenwart spielendes Music Happy End an (der im Krieg verschollene Sohn ist in Amerika ein berühmter Sänger geworden, die ebenfalls nach Amerika ausgewanderte Mutter hört ihn im Konzert jenes Lied singen, das der Vater einst im Schtetl komponiert hatte), aber hinter dieser sentimentalen Szene verbirgt sich die wehmütige Reminiszenz an der Verfall der Mischpoke und den Verlust des Schtetls. Gestaltung von Judenfeindschaft, die fest alle Tewjefilme in einer Pogromszene thematisiert hatten, schien sich mit dem Programm des Genres Greenscher Musikfilme nicht zu vertragen. Auch der letzte Film der Schtetltetralogie, der am intensivsten soziale Authentizität vermittelte (Winfried Günther gesteht ihm gar
76
Vgl. Trepp 1991, 40-51; Hödl 1991, 71-122
230 neorealistische Qualitäten zu)77, nimmt nicht die Thematik des modernen - auch polnischen! - Antisemitismus im eigenen Land und jenseits der Westgrenze Polens auf. Als der 1938 in Polen gedrehte Film A BRIVELE DER MAMEN am 14.9.1939 seinen US-Kinostart mit der New Yorker Premiere erlebte, hatte die Hitlerarmee bereits den größten Teil Polens in ihre Gewalt gebracht, war die Schtetlwelt verbrannt, waren die Juden verhaftet, gefangen oder getötet worden, war die Jiddischkeit ausgelöscht worden; in Warschau, Xódz und in anderen polnischen Orten sollten ganz andere Ghetti entstehen. Eine neue Chiffre war erschienen, ein neues Menetekel war hervorgekommen: die Shoah, der Holocaust.
77
Günther 1982, 74
231 Tabelle 6 Jiddische Schtetlwelt im Emanzipationszeitalter Chronologie jiddischer Spielfilme und Fernsehspiele über Ghetti in Polen und Rußland, deren Handlung etwa bis zum Jahre 1871 reicht oder etwa zu dieser Zeit spielen könnte TITEL Regisseur; Herstellungsland, Produktion und Produktionsjahr Kurzcharakterisierung
DAS ALTE GESETZ E.A. Dupont; Deutschland, Comedia-Film, 1923 Stummfilm über die Emanzipation in Österreich. Ein Rabbinersohn verläßt sein galizisches Schtetl und wird Schauspieler am Wiener Burgtheater. Lebendige Schilderung der Lebens- und Glaubensformen des Ostjudentums, eindringliche Gestaltung der Emanzipationsthematik als Ablösungsprozeß ohne radiakalen Bruch mit der Tradtiion
TKIES-KAF Zygmunt Turkow; Polen , Meteor, 1924 Stummfilm über das Eingreifen überirdischer Mächte in die Schicksale zweier Familien: Der Prophet Eliah korrigiert in mancherlei Gestalt die schlimmen Folgen eines gebrochenen Schwurs, so daB die schon vor ihrer Geburt einander versprochenen Liebenden doch noch heiraten können. Die Happy-End-Paraphrase des Dybukmotivs, das zugleich die beiden Welten des orthodoxen und des assimlierten Judentums präsentiert, ist heute nur noch unter dem Titel DEM REBNS KOJECH/A VILNA LEGEND in der jiddischen Tonfassung von 1933 mit der eingefügten Rahmenhandlung eines jiddischen Geschichtenerzählers erhalten.
JISKER/YISKOR (Gedenket) Sidney M. Goldin; Österreich, Jüdische Kunstfilm-Gesellschaft, 192S Stummfilmadaption eines historischen Theaterstücks über das Märtyrerschicksal eines jüdischen Försters im 18. Jahrhundert, der gegen die Intrigen der Grafentochter seiner jüdischen Verlobten und dem Glauben der Vater die Treue hält und deshalb vom beleidigten Grafen zum Tode verurteilt wird. Trotz seiner trivialen Machart ein thematisch bedeutsamer Film, der die Normen einer geschlossenen jüdischen Lebenswelt vor dem Wirksamwerden der Haskala vorführt.
JIDISCHE GLIKN/ JEWREJSKOJE SCHTSCHASTJE (Jüdisches Glück) Alexander Granowski; UdSSR, Goskino, 1925 (Erstsendung BRD: ZDF 13.4.1990) Stummfilm nach Motiven des Romans Menacbem Mendel und Schewe-Scheindel von ScholemAlejchem über die Träume und Hofhungen eines kleinen jüdischen Versicherungsagenten auf der (vergeblichen) suche nach dem großen Glück. Bedeutendes Dokument eines jiddischen Spielfilms der Stalin-Ära, dem es gelingt, die Atmosphäre russischen jüdischen Lebens des 19./20. Jahrhundertsjenseits der Emanzipation nicht nur zu konservieren, sondern zugleich auch ironisch-liebevoll zu durchbrechen.
232 MOTL PEJSI DEM CHASNS/SKWOS SUOSY/STRANIZY PROSCHLOGO (Moti, der Kantorsohn/Lachen durch Tränen/Kapitel der Vergangenheit) Grigori Gritscher-Tscherikower; UdSSR, WUFKU, 1928 Sozialkritische Verfilmung von Motiven zweier Romane Scholem-Alejchems. Der jiddische Stummfilm zeigt die vergeblichen, absurden Versuche eines Ghettoschneiders und seiner Mischpoche, sich durch allerhand tragikomische Unternehmungen von der drückenden Armut zu befreien. Er gerät in die Mühlen der zaristischen Polizei und wird am Ende ausgewiesen.
DER JIDISCHER KENIG LIR/THE JIDDISH KING LEAR Joseph Seiden und Harry Tomaschefsky, USA 1935 Adaption einer Theaterinszenierung des gleichnamigen aufklärerischen Bühnenstücks von Jacob Gordin, der Elemente von Shakespeares Lear— Drama in ein Schtetl des 19. Jahrhunderts verlegt hat: Ein frommer Jude wird während seiner Pilgerreise nach Jerusalem von seinen älteren Töchtern schamlos ausgenutzt, ausgerechnet die emanzipierte (jüngste) Tochter hält dem Vater die Treue.
YIDL ΜΓΓΝ FIDL/JUDEL GRA NA SKRZYPACH (Yiddle with his Fiddle/Castles in the Sky/Jidl mit der Fiedel) Joseph u.Jan Nowina-Przybylski; Polen, Green-Film, 1936 Jiddischer Musikfilm. Bettelanne jüdische Straßenmusikanten ziehen in Polen von Schtetl zu Schtetl, ein Mitglied der Truppe, die als Junge verkleidete Yidl, wird zum Star. Der Film befriedigt mit seiner Mischung aus Musik, Situationskomik und Romantik das Unterhaitungsbedürfnis der Rezipienten. Sein kulturgeschichtlicher Rang beruht auf der genauen Alltagsbeobachtung der Menschen des jiddischen Schtetls vor seiner Vernichtung durch die Nazis.
DER PURIMSCHPILER/BLAZEN (The Jester) Joseph Green und Jan Nowina Przybylski; Polen, Green-Film, 1936 Jiddischer Musikfilm. Arbeitsloser, melancholisch-schüchterner junger Mann, der während des Purimf estes in einem burlesken Spiel aus sich herausgehen kann, verliebt sich in ein talentiertes, schönes junges Mädchen, verliert es aber an einen anderen. Der Film thematisiert die romantisch gezeichnete Ghettomentalität und den Wunsch nach Beendigung der Misere: Die einen brechen aus dem Schtetl aus und schaffen den Aufstieg, die anderen kehren in die Geborgenheit der durch tradierte Formen geprägten Heimat zurück.
DER DIBEK/DYBUK (The Dybuk/Der Dibbuk) Michael Waszynski, Polen 1937 Die berühmte dramatische Legende von Salomon Anski als Renaissance der mittelalterlichen mystisch-kabbalistischen Vorstellung vom Dybuk, dem Geist eines Toten, der sich an den Leib eines Lebenden anhaftet, erscheint dem heutigen Betrachter wie die Beschwörung orthodoxen Judentums und des klassischen jiddischen Films, der hier in seiner Bindung an die literarische Vorlage auf emanzipatorischen Aufbruch verzichtet und in einer beeindruckenden stilisierten Filmsprache sich ganz auf die Entfaltung der tragischen Fabel konzentriert.
233 GRINE FELDER/GREEN FIELDS Edgar G. Ulmer; USA 1937, Collective Film Im Rahmen einer jiddischen Literaturverfilmung intoniert der Film die Veränderung der orthdoxen Wertehierarchie: Neben das Talmudstudium tritt gleichberechtigt die körperliche Arbeit. Die romantische Komödie von der Liebe eines Jeshivastudenten zu der Tochter eines jüdischen Bauern lenkt zugleich den Blick auf die von antisemitischer Propaganda bezweifelten Qualifikation von Juden zur Landarbeit.
MAMELE/MATECKA (Little Mother) Joseph Green und Konrad Ton; Polen, Green-Film, 1938 Jiddischer Musikfilm. Die wie eine Mutter für ihre Geschwister und den Vater sorgende, von allen ausgenutzte größere Schwester kriegt am Ende doch noch ihren Märchenprinzen. Genrebild vom "täglichen Kram" im jiddischen Schtetl (Lodz) mit hier nur angespielter Aufstiegsthematik ohne Bruch zur bisherigen, nostalgisch verklärten Ghettowelt.
A BRIVELE DER MAMEN/LIST DO MATKI (A Letter to Mother/Ein Brief an die Mutter) Joseph Green und Leo Trystan; Polen, Green-Film, 1938 Jiddischer Musikfilm mit neorealistischen Zügen über den Verfall der Mischpoche, der jüdischen Familie, infolge der allmählichen Auswanderung aus dem Schtetl nach Amerika. Das durch das Genre vorgegebene Happy-End verschleiert kaum den artikulierten Schmerz über den Verlust des Schtetls und die Auflösung der Familie, bietet auch kein geschöntes Bild von der jüdischen Migration.
ON A HEYM/BEZDOMMI (Without a home) Aleksander Marten; Polen 1939 Der letzte jiddisch-polnische Film vor Auslöschung der jiddischen Kultur in Polen durch die Nazis. Verfilmung eines Theaterstücks von Jacob Gordin über den psychologisch und ökonomisch (nicht politisch!) bedingten Abschied von Polen: Eine Fischerfamilie wandert nach Amerika aus, ohne dort heimisch werden zu können.
DI KLJATSCHE/FISCHKE DER KRUMER (The Light Ahead) Edgar G. Ulmer; USA, Carmel Prod., 1939 Eine romantische Liebesgeschichte im Schtetl über ein behindertes junges Paar wird mit moderat vorgetragener Kritik an einer unsozial und abergläubisch eingestuften orthodoxen Gemeindeleitung verknüpft. Auch in seiner sentimentalen Verpackung läBt der nach Motiven aus Erzählungen von Mendele Moicher Sforim gedrehte Film die Ablösungstendenzen von orthodoxer Jüdischkeit klar hervortreten.
TEVYE/TEVYA (Tewje, der Milchmann) Maurice Schwartz, USA, Maymon Film, 1939 Jiddische Literaturverfilmung einer Episode des jiddischen Romans vom Scholem-Alejchem über den armen Milchmann in Ruß land um 1870, der mit Gottvertrauen und Humor die ihn und seine Familie treffenden Schicksalsschlage erträgt. Der Film verbindet zeitadäquate Milieuschilderung eines jüdisch-russischen Dorfes und die Schilderung der Konflikte zwischen Christen und Juden mit einer überzeitlichen Porträtierung des leidenden und verfolgten Juden.
234 GOT, MENTSCH UN TEJWL (bzw. TAJVEL)/ GOD, MAN AND DEVIL Joseph Seiden, USA/Kanada 1950 Eine in ein Schtetl des 19. Jahrhunderts verlegte Hiob- und Faust-Paraphrase nach dem gleichnamigen Schauspiel von Jacob Gordin: Die Tragödie eines vorbildlich frommen Juden, der vom Teufel erfolgreich mit Geld versucht wird und sich am Ende aus Scham über seine Ausbeutung der Mitmenschen das Leben nimmt, trägt seine aufklärerische Kritik am unsozialen Verhalten in Form eines Volksstücks vor.
TEVYA UND SEINE TÖCHTER Gerhard Klingenberg;, BRD, WDR, Sendung am 15.3.1962 Fernsehspiel von Arnold Perl. Werkgetreue Verfilmung von drei Episoden des Tewje-Romans von Scholem-Alejchem in jener durch Intimität und Kammerspielcharakter geprägten frühen Phase der Live-Sendungen des deutschen Femsehens. Durch die Besetzung der Hauptrollen mit jüdischen Schauspielern versucht das Fernsehspiel, Authentizität des Dargestellten und überzeitliche Gültigkeit jüdischer Leidensexistenz zu verbinden.
TEVJE UND SEINE SIEBEN TÖCHTER Menachem Golem, BRD/Israel, CCC/Noah, 1967 Anspruchsloser Kommerzfilm nach dem äußeren Handlungsgerüst des Romans von ScholemAlejchem als Bilderbogen über jüdisches Familienleben im alten Rußland. Weder die Schlußszene eines Pogroms noch die Besetzung mit einem populären Darsteller erhebt den Film über die Belanglosigkeit einer melodramatischen Familiengeschichte.
FIDDLER ON THE ROOF Norman Jewison, England, Mirisch, 1971 Aufwendige Verfilmung des gleichnamigen Musicals von Joseph Stein (Musik: Jerry Bock), das seinerseits don Roman von Scholem-Alejchem über den Milchmann Tewje und dessen mit Bitterkeit und Humor gemischtem Gottvertrauen trotz aller ihn bedrängenden Elendsituationen folgt. Kolossalfonnat und vordergründig realistischer Inszenierungsstil verhindern, daß Tewje über sein individuelles Schicksal hinaus als Repräsentant des leidenden jüdischen Volkes erscheint.
8. Schlußbemerkungen
Die durch Filme vermittelten Bilder von jüdischen Lebenswelten geben nur Facetten der Wirklichkeit wieder. Rückblickend auf einige Filme mit ostjüdischen Figuren über deren Weg aus dem Ghetto läßt sich im Hinblick auf eine Leitfrage unserer Untersuchung, ob sich nämlich ein antijüdisches Stereotyp in nichtnationalsozialistischen Filmen vor, während und nach der Nazizeit herausgebildet hat, ein positives Ergebnis über alle die Ghettothematik behandelnden fíktionalen Produktionen herausstellen: Nirgends finden sich Zementierungen des jüdischen Ghettostereotyps im Stile jener nationalsozialistischen Filmpropaganda, wie sie die Inhaltsangabe des Illustrierten Film-Kuriers Nr. 3152 zum "Dokumentarfilm über das Weltjudentum" DER EWIGE JUDE, Deutschland 1940, Regie: Fritz Hippler, enthüllt: Der Film beginnt mit einem eindrucksvollen Streifzug durch die jüdischen Ghettos in Polen. Er führt uns hinein in die jüdischen Behausungen, die man nach unseren Begriffen nicht mehr als Wohnungen ansprechen kann. In diesen schmutzstarrenden Räumen lebt und betet ein Volk,das sich seinen Unterhalt nicht durch Arbeit, sondern durch Schachern und Gaunern verdient. Vom kleinen Bengel bis zum Greis stehen sie in den Straßen und handeln und feilschen. Durch klare Trickbilder wird klargestellt, wie das jüdische Rassengemisch in Kleinasien entstand und von da aus die ganze Welt überschwemmte. Eine verblüffende Parallele dazu sehen wir in den Wanderwegen der Ratten, die die Schmarotzer und Giftträger unter den Tieren, wie es die Juden unter den Menschen sind. - Der Jude hat sich in seinem Äußeren stets an seine Gastvölker anzupassen verstanden. Nebeneinanderstellungen der gleichen Judentypen, zuerst als Ostjude mit Kaftan, Bart und Peies, und dann als glattrasierter westeuropaischer Jude beweisen schlagend, mit welchen Mitteln er die arischen Völker getäuscht hat. Unter dieser Maske gewann er immer mehr Einfluß in arischen Kulturnationen und gelangte zu immer höheren Stellungen. Aber sein inneres Wesen konnte er nicht wandeln.1
Stattdessen wird die insgesamt etwas vereinfachte, manchmal nostalgisch leicht geschönte Ghettowelt als ein durch die Leitlinien der Religiosität, Humanität, Soziabilität und Solidarität geprägter Kosmos gezeichnet. Wie ein Vergleich des Ghettomilieus im Spielfilm mit Motiven und Figuren in nichtfiktionalen Filmen, auf zeitgenössischen Fotos und in den Schilderungen der Belletristik erhellt, dürften dessen visuelle Elemente wesentlich durch die Tradition der jiddischen Literatur und durch die realen jüdischen Personen aus der Umwelt der Filmemacher (Scheunenviertel in Berlin, Lower East Side, Hester Street u.a. in New York, Straßenbilder in Warschau, ΧΔdz, Krakau usw.) geprägt sein. Das verleiht den Alltagsszenen der bis etwa 1940 entstandenen Filme einen
Der "Illustrierte Film-Kurier" war das Filmprogramm, das beim Besuch eines Films an der Kasse zum Verkauf auslag. Text der Inhaltsangabe bei Hollstein 1971, 109
236 außergewöhnlich hohen Authentizitätsgrad. Unbestritten dürfte sein, daß auch die nach der Auslöschung der Ghetti entstandenen fiktionalen Produktionen sich an der genannten realistischen erzählenden Literatur und den visuellen Dokumenten der Vorkriegszeit in hohem Maße orientiert haben. Dennoch muß der Wert der in den letzten Kapiteln positiv hervorgehobenen Filme und Fernsehspiele für die Bildung von Vorstellungen über das Ostjudentum wie allgemein über die Wege von Juden aus dem Ghetto vor allem aus zwei Gründen relativiert werden. Zum einen betrifft es den Bekanntheitsgrad der jiddischen Filme. Bis zum sechsten Kapitel haben wir bis auf verschwindende Ausnahmen (JEW SUESS) nur Produktionen analysiert, die über das kommerzielle Angebot in Kinos oder über Programme der Femsehanstalten rezipiert werden konnten. Im letzten Kapitel sind wir von dieser Linie abgewichen, weil wir auf einige für unsere Thematik besonders wichtige Filme nicht verzichten wollten, die noch nicht im Kino oder Fernsehen gelaufen waren.2 Bilder von ostjüdischen Lebenswelten wurden also nur im bescheidenen Maße vermittelt. Die zweite Einschränkung ergibt sich, wenn man die in den fiktionalen Produktionen vermittelten Bilder von jüdischen Welten mit der historischen Bandbreite von Integrations- und Aufklärungskonzepten auf der einen, von Abschließungs- und Verweigerungsstrategien auf der anderen Seite vergleicht. Eine kritische Durchmusterung etwa der Fernsehspiele des 6. Kapitels ließe den Schluß zu, daß es in der Sicht dieser Produktionen - entgegen der Realität - in Mitteleuropa offenbar keine Ghetti mehr gegeben hat. Und auch in Österreich und Rußland was war der Ansiedlungsrayon anderes als ein riesiges Fünf-Millionen-Ghetto! gab es bedeutend mehr Vorstellungen über den Weg aus dem Ghetto bzw. über das Verharren in einer Ghettomentalität, als aus den wenigen Filmen des 7. Kapitels geschlossen werden kann. So hat Jost Hermand in der literarhistorischen Einleitung zu seiner Anthologie deutschsprachiger Ghettogeschichten aus dem 19. Jahrhundert,5 die auch Romane und Erzählungen aus der Ukraine und Galizien behandelt, daraufhingewiesen, wie stark die Konflikte in den Ghetti zwischen den beiden Grundhaltungen des Aufbruchs und des Verweilens ihren Niederschlag in der deutschsprachigen jüdischen Literatur gefunden haben. Während die landläufige Vorstellung über Ghetti der Ostjuden fast immer mit der festgefügten orthodoxen Glaubenswelt assoziiert wird, erscheint in einer großen Anzahl der auf Liberalität und Emanzipation drängenden Erzählungen das Ghetto als etwas Feindliches, Bedrohliches. Nicht die Vertreter der Orthodoxie, sondern die Freigeister werden da zu Zentralfiguren; christliche und jüdische Religionsformen werden verdammt. Rabbis sind nicht mehr Autoritäten, sondern werden als engstirnig gezeichnet. (Diese kritische Ablösung von der jüdischen orthodoxen Normierung haben bei unseren Beispielen lediglich die jiddischen Filme MOTL PEJSI DEM CHASNS und DI KUATSCHE angedeutet.) Nur wenige Autoren
2
3
DAS ALTE GESETZ, MOTL PEJSI DEM CHASNS, DYBUK, DER PURIMSCHPILER, MAMELE, DI KUATSCHE Geschichten aus dem Ghetto 1987, 7-21
237 befürworten in der weiteren Entwicklung den Zionismus, ganz wenige den Sozialismus. Die meisten von ihnen setzen auf liberale Akkulturation, einige auf die Verbindung von jüdischem Glauben mit deutschen Traditionen und deutschen Lebensformen. Sichtbar verstärkt sich der Trend zur deutschen Bürgerlichkeit, eine Tendenz, die der 1848 in Rußland geborene Karl Emil Franzos im Vorwort zu seinem Roman Der Pojaz sehr präzis beschreibt. Sie sollte das deutsche Judentum in seiner überwältigenden Mehrheit auf Jahrzehnte prägen - bis zu seinem fast vollendeten Genozid: Das deutsche Nationalgefuhl, das mich erfüllt, das auch ich mein Leben lang betätigt habe, ist mir von Kindheit auf eingeprägt worden. Ich war noch nicht drei Käse hoch, als mir mein Vater bereits sagte: "Du bist deinerNationalität nach kein Pole, kein Ruthene, kein Jude - du bist ein Deutscher." Aber ebenso oft hat er mir schon damals gesagt: "Deinem Glauben nach bist du ein Jude."Mein Vater erzog mich wie mein Großvater ihn erzogen, in denselben Anschauungen, sogar zu demselben Endzweck, ich sollte meine Heimat nicht in Galizien finden, sondern im Westen.4
Spielfilme und Fernsehspiele mit Judendarstellungen über die Epoche weiter zunehmender Assimilation von Juden nach ihrer formellen rechtlichen Emanzipation von 1869 bzw. 1871 spiegeln relativ selten die Hoffnung auf ein Gelingen ihres zähen Kampfes um gesellschaftliche Gleichberechtigung (man denke etwa an die historische Figur des Bankiers Bleichröder in BEBEL UND BISMARCK von Wolf-Dieter Panse, 1987). Öfter zeigen sie die Angriffe des erstarkenden modernenen Antisemitismus auf die jüdischen Lebenswelten in Europa (z.B. DIE GEZEICHNETEN von Carl Theodor Dreyer, 1921, DER PROZESS von G. W. Pabst, 1948, oder mehrere Produktionen über die "Affäre Dreyfus") und die Reaktion von Juden durch Migration nach Amerika (HIOB von Michael Kehlmann, 1978, HESTER STREET von Joan Micklin Silver, 1974) oder nach Palästina (WENN IHR WOLLT, IST ES KEIN MÄRCHEN von Imo Moszkowicz, 1973). Aber noch scheint die jüdische Emanzipation nicht mißglückt.
4
Franzos 1988, 6
238
Literaturverzeichnis
Abel, Walther. "Holocaust". Evangelische Sammlung 5/85, 21 Abenteuer Revolution: Der SWF-Film LENZ ODER DIE FREIHEIT. München: TR-Verlagsunion, 1986 Adler, H. G. Die Juden in Deutschland: Von der Außdärung bis zum Nationalsozialismus. München: Piper, 1987 Adorno, Theodor. "Erziehung nach Auschwitz". Erziehung zur Mündigkeit. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1970, 88-104 Ahlsen, Leopold. Der arme Mann Luther. Gütersloh: Mohn, o.J. Ähren, Yizhak, Stig Hornshoj-Moller u. Christoph B. Melchers. "Der ewige Jude ": Wie Goebbels hetzte. Untersuchungen zum nationalsozialistischen Propagandaßlm. Aachen: Alano, 1990 Albersmeier, Franz-Josef. "Einleitung: Von der Literatur zum Film. Zur Geschichte der Adaptationsproblematik". Literaturverßlmungen. Hg. Franz-Josef Albersmeier u. Volker Roloff. Frankfurt/M.: Suhrkamp Taschenbuch, 1989, 15-37 Albrecht, Gerd. Nationalsoäalistische Filmpolitik Eine soziologische Untersuchung über die Spielßlme des Dritten Reichs. Stuttgart: Enke, 1969 Allerhand, Jacob. Das Judentum in der Außdärung. Stuttgart, Bad Cannstatt: Fromann-Holzboog, 1980 Angermann, Gerd. "'Jud Süß' - Korrektur einer Fäschung". Joseph Süß Oppenheimer: Geschichte und Geschichten um eine historische Gestalt. Mainz: Zweites Deutsches Fernsehen, 1984, 5-14 Anski, S. Der Dybuk Berlin: Ost und West - Leo Winz, 1921 An-Ski, Der Dibbuk. Dramatische Legende in vier Bildern. Hg. Horst Bienek Mit Materialien. Frankfurt/M.: Insel, 1989 Antisemitismus: Von der Judenfeindschañ zum Holocaust. Hg. Herbert A. Strauss u. Norbert Kampe. Bonn: Bundeszentrale für polit. Bildung, 1985 ARD und ZDF. Das Sehverhalten in Fernsehhaushalten. Bonn: teleskopie Gesellschaft für Zuschauerforschung, 14/1980 Arendt, Hannah. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaß. Frankßirt/iA.: Büchergilde Gutenberg, 1962 Arendt, Hannah. Rahel Vamhagen: Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik. München, Zürich: Piper 1984 Amheim, Rudolf. Film als Kunst. München: Hanser, 1974 Arnsberg, Gad. "Gabriel Riesser als deutsch-jüdischer Intellektueller und liberaler Ideologe". Menora 2: Jahrbuch ñir deutsch-jüdische Geschichte. München, Zürich: Piper, 1991,81-104 Atkinson, G. A. "Mut zu Jew Suess". Berlin und das Kino: Filme in der Emigration. Hg. Freunde der deutschen Kinemathek 1987
239 Auschwitz - Krise der christlichen Theologie: Eine Vortragsreihe. Abhandlungen zum christlich-jüdischen Dialog, Hg. Helmut Gollwitzer, 10. München: Kaiser, 1980 Avisar, Dan. "Die Mischpoche von Hollywood: Juden vor und hinter der Kamera". Jüdische Lebenswelten: Essays. Hg. Andreas Nachama [et al.]. Berliner Festspiele, Frankfurt/M.: Jüd. Verlag, Suhrkamp, 1991, 203-220 Awerbuch, Marianne. "Judentum im 16. und 17. Jahrhundert zwischen Inquisition und Reformation". Judentum und Antisemitismus von der Antike bis zur Gegenwart. Hg. Thomas Klein [et al.]. Düsseldorf: Droste, 1984, 77-102 Awerbuch, Marianne. Zwischen Hoßhung und Vernunñ: Geschichtsdeutung der Juden in Spanien vor der Vertreibung am Beispiel Abra vanéis und Ibn Vegas. Berlin: Kirche und Judentum, 1985 Bab, Julius. Leben und Tod des deutschen Judentums. Berlin: Argon, 1988 Bächlin, Peter. Film als Ware. Frankfurt/M.: Fischer Athenäum, 1975 Baeck, Leo. Von Moses Mendelssohn zu Franz Rosenzweig: Typen jüdischen Selbstverständnisses in den letzten beiden Jahrhunderten. Stuttgart: Kohlhammer, 1958 Baeck, Leo: Das Wesen des Judentums. Wiesbaden: Fourier, 1985 Baleanu, Avram Andrei. "Die Geburt des Ahasver". Menora 2: Jahrbuch für deutsch-jüdische Geschichte. München, Zürich: Piper, 1991, 15-43 Baleanu, Avram Andrei. "Ahasvérus, der ewige Jude", in: Neues Lexikon des Judentums 1992, 19-22 Barner, Wilfried. "Lessings 'Die Juden' im Zusammenhang seines Friihwerks", in: Humanität und Dialog 1982, 189-210 Barner, Wilfried. "Vorurteil, Empirie, Rettung. Der junge Lessing und die Juden". Juden und Judentum in der Literatur. München: Deutscher Taschenbuch Verl., 1985, 52-77 Bayerdörfer, Hans-Peter. "Das Bild des Ostjuden in der deutschen Literatur". Juden und Judentum in der Literatur. München: Deutscher Taschenbuch Verl., 1985, 211-236 Beaujean, Marion. "Frauen-, Familien-, Abenteuer- und Schauerroman". Deutsche Literatur: Eine Sozialgeschichte. V. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verl., 1980, 216-228 Belke, Ingrid. "Siegried Kracauer: Ein Kritiker der Kultur in der Weimarer Republik". Juden als Träger bürgerlicher Kultur in Deutschland. Hg. Julius H. Schoeps. Stuttgart, Bonn: Burg, 1989,281-310 Ben-Chorin, Schalom. Bruder Jesus: Der Nazarener in jüdischer Sicht. München: Deutscher Taschenbuch Verl., 1986 Ben-Chorin, Schalom. Jesus im Judentum. Wuppertal: Theol. Verl. Rolf Brockhaus, 1970 Ben-Chorin, Schalom. Paulus: Der Völkerapostel in jüdischer Sicht. München: Deutscher Taschenbuch Verl., 1980
240 Ben-Chorin, Schalom. Weil wir Brüder sind: Zum christlich-jüdischen Dialog heute. Gerlingen: Bleicher, 1988 Ben-gavriel, M. Y. Das Haus in der Karpfengasse. Berlin: Volk und Welt, 1968 Benjamin, Walter. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduäerbarheit. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1975 Ben-Sasson, Haim Hillel. Geschichte des jüdischen Volkes, Π: Vom 7.-17. Jahrhundert: Das Mittelalter. München: Beck, 1979 Berg, Helmut O. Fernsehspiele nach Erzählvorlagen. Düsseldorf: Bertelsmann Univers. Verl., 1972 Bergmann, Werner u. Rainer Erb. Antisemitismus in der Bundesrepublik Deutschland: Ergebnisse der empirischen Forschung von 1946-1989. Opladen: Leske + Budrich, 1991 Bemer, Dieter. "Wie durch ein Brennglas", in: Abenteuer Revolution 1986, 1719 Best, Otto F. "Di Kljatsche", in: Kindlers Literatur Lexikon, IV, Sp.2569f. bzw. Kindlers Neues Literaturlexikon, XI, 529f. Best, Otto F. "Menachem Mendel", in: Kindlers Literatur Lexikon, IV, Sp. 2438f. bzw. Kindlers Neues Literaturlexikon, XV, 8f. Best, Otto F. "Tewje der Milchiger", in: Kindlers Literatur Lexikon, VI, Sp. 2544f. bzw. Kindlers Neues Literatur Lexikon, XV, 10 Bethge, Eberhard. "Schoah (Holocaust) und Protestantismus", in: Der Holocaust und die Protestanten 1988, 1-37 Bilder schreiben Geschichte: Der Historiker im Kino. Hg. Rainer Rother. Berlin: Wagenbach, 1991 Bienert, Waither. Martin Luther und die Juden: Ein Quellenbuch mit zeitgenössischen Illustrationen, mitEiniuhrungenundErläuterungen. Frankfurt/M.: Evang. Verlagswerk, 1982 Bloch, Chajim. Der Prager Golem: Von seiner "Geburt" bis zu seinem "Tod". Berlin: Benjamin Harz, 1920 Bohn, Ursula. "Einblicke in die Geschichte der Juden in Deutschland vom 13. bis 19. Jahrhundert". Juden in Deutschland: Zur Geschichte einer Hoffnung. Hg. Peter von der Osten-Sacken. Berlin: Inst. Kirche u. Judentum, 1980, 51-68 Bourel, Dominique. "Die Kontroversen zwischen Lessing und Mendelssohn um die Ewigkeit der Höllenstrafen". Lessing und der Kreis seiner Freunde. Hg. Günther Schulz. Heidelberg: Lambert Schneider, 1985. Brandt, Hartwig. "Stufen der Judenemanzipation im 18. und 19.Jahrhundert". Judentum und Antisemitismus von der Antike bis zur Gegenwart. Hg. Thomas Klein [et al.]. Düsseldorf: Droste, 1984, 103-111 Brandt, Leon. "Yiddisch - eine untergehende Welt, eine untergehende Kultur". Abschied von Tewjes Welt: Lebensbilder aus dem jiddischen Städtel. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1981, 7-61
241 Breuer, Dieter. "Antisemitismus und Toleranz in der frühen Neuzeit. Grimmelshausens Darstellung der Vorurteile gegenüber den Juden". Judentum, Antisemitismus und europäische Kultur. Hg. Hans Otto Horch. Tübingen: Francke, 1988, 77-96 Brod, Max. "Nachwort", in: Scholem-Alejchem. Tewje der Milchmann 1962, 240253 Brosseder, Johannes. "Luther und der Leidensweg der Juden", in: Die Juden und Martin Luther - Martin Luther und die Juden 1985, 109-135 Bruer, Albert A. Geschichte der Juden in Preußen (1750-1829), Frankfurt, New York: Campus, 1991 Bruhn, Wolfgang. "Die Illusion des Authentischen: Das Dokumentarspiel". Fernsehen in Deutschland, I. Red. Christian Longolius. Mainz: v. Hase & Koehler, 1967, 157-163 Brumlik, Micha. "Das schtetl. Heimat der Luftmenschen", in: Das jiddische ino 1982, 87-96 Buber, Martin. Begegnung: Autobiographische Fragmente. Heidelberg: Lambert Schneider, 1986 Buber, Martin. Das dialogische Prinzip. Heidelberg: Lambert Schneider, 1984 Buchers Enzyklopädie des Films. Hg. Liz-Anne Bawden, Bearb. Wolfram Tichy. Luzern/Frankfurt/M.: Bucher, 1977 Buddecke, Wolfram u. Jörg Hienger. "Verfilmte Literatur: Probleme der Transformation und der Popularisierung. Filmtheorie und Filmanalyse. LiLi, 36. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1979, 12-30 Buselmeier, Michael u. Karin. "Zur Dialektik der Wirklichkeit: Dokumentarische Fernsehsendungen", in: Dokumentarliteratur 1973, 96-119 Carlebach, Julius. "Der Säkularisierungsprozeß in der Erziehung", in: Das Judentum in der Deutschen Umwelt, 1977, 58-68 Carmely, Klara. "Wie aufgeklärt waren die Aufklärer im Bezug auf Lessing und die Juden?", in: Humantität und Dialog, 1982, 177-188 Castritius, Helmut. "Die Haltung Roms gegenüber den Juden in der ausgehenden Republik und der Prinzipatsstreit". Judentum und Antisemitismus von der Antike bis zur Gegenwart. Hg. Thomas Klein [et al.]. Düsseldorf: Droste, 1984, 15-40 Cinegraph: Lexikon zum deutschsprachigen Film. Hg. Hans-Michael Bock. München: text + kritik, 1984ff. Claussen, Detlev. Grenzen der Außdärung: Zur gesellschañlichen Geschichte des modernen Antisemitismus. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verl., 1987 Claussen, Detlev. "A naje welt. Jüdische Westemigration und jiddisches Kino", in: Das jiddische Kino, 35-52 Corti, E.C.C. Die Rothschilds: Des Hauses Auistieg, Blütezeit und Erbe. Neubearb. von Walter Gong. Frankfurt/M.: Societas, 1971 Courtade, Francis u. Pierre Cadars. Geschichte des Films im Dritten Reich. München, Wien: Hanser, 1975
242
Dahlmüller, Götz. "Nachruf auf den dokumentarischen Film: Zur Dialektik von Realität und Fiktion", in: Dokumentarliteratur 1973, 67-78 Dantine, Wilhelm. "Frühromantik, Romantik, Idealismus", in: Kirche und Synagoge 1988, Π, 177-221 Darschin, Wolfgang u. Bernward Frank. "Tendenzen im Zuschauerverhalten: Fernsehgewohnheiten und Fernsehreichweiten im Jahre 1987". Media Perspektiven 4/88, 214-288 Degani, Ben-Zion. "Die Formulierung und Propagierung des jüdischen Stereotyps in der Zeit vor der Reformation und sein Einfluß auf den jungen Luther", in: Die Juden und Martin Luther - Martin Luther und die Juden 1985, 3-44 Dehn, Günther. "Glaubenskrieg um einen Spielfilm: Luther-Produktion erregte vor 30 Jahren die Gemüter", in: Martin Luther: Zun Wandeides Luther-Bildes in der Geschichtsschreibung und im Film 1983, 75-94 Delling, Manfred. Bonanza & CO: Fernsehen als Unterhaltung und Politik - Eine kritische Bestandsaußiahme. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verl., 1976 Delling, Manfred. "Das Dokument als Illusion", in: Das Fernsehspiel Möglichkeiten und Grenzen 1975, 115-136 Delling, Manfred. "Dokumentarspiel", in: Sachwörterbuch des Femsehens 1982, 44-48 Deppermann, Klaus. "Judenhaß und Judenfreundschaft im frühen Protestantismus", in: Die Juden als Minderheit in der Geschichte 1985, 110-130 Deutsche Spielßlme von den Anlangen bis 1933: Ein Filmfìihrer. Hg. Günther Dahlke u. Günter Karl. Berlin: Henschel, 1988 Deutsches Institut für Filmkunde (DIF), Stiftung Deutsche Kinemathek (SDK). Verleihkatalog, I. Red. Hans Helmut Prinzler u.a. Frankfurt/M., Wiesbaden, Berlin: DIF, SDK, 1986 De Vries, S. Ph. Jüdische Riten und Symbole. Wiesbaden: Fourier, 1982 Dickens, Charles. Oliver Twist. Schriften Π/2. Berlin: Paul Franke, o.J. Dittmar, Peter. "Christliche Restauration und Antijudaismus: Aspekte der Kunst derdeutschen Romantik", in: Antisemitismus und jüdische Geschichte... 1986, 329-364 Dohm, Verena. Reise nach Galizien: Grenzlandschafien des alten Europa. Frankfurt: S. Fischer, 1991 Dokumentarüteratur. Hg. Heinz Ludwig Arnold u. Stephan Reinhardt. München: text + kritik, 1973 Drewitz, Ingeborg. Berliner Salons: Gesellschañ und Literatur zwischen Aufklärung und Industriezeitalter. Berlin: Haude & Spener, 1984 Drewniak, Boguslaw. Der deutsche Film 1938-1945: Ein Gesamtüberblick Düsseldorf: Droste, 1987 Durzak, Manfred. "Fernsehserie", in: Sachwörterbuch des Fernsehens 1982, 74-79 Eckert, Willehad Paul. "Hochmittelalter. Katholischer Humanismus", in: Kirche und Synagoge 1988, I, 210-264 Ehrenberg, Richard. Die Fugger, Rothschild, Krupp. Jena: G. Fischer, 1925
243
Ehrlich, Ernst Ludwig. Geschichte der Juden in Deutschland. Düsseldorf: Schwann, 1957 Ehrlich, Ernst Ludwig. Geschichte Israels von den Anlangen bis zur Zerstörung des Tempels (70 n. Chr.). Berlin, New York: de Gruyter, 1980 Ehrlich, Ernst Ludwig. "Luther und die Juden", in: Antisemitismus: Von der Judenfeindschañ zum Holocaust 1985, 47-65 Eisner, Lotte H. Die dämonische Leinwand. Hg. Hilmar Hoffmann u. Walter Schobert. Frankfurt/M.: Kommunales Kino, 1975 Elbogen, Ismar. Ein Jahrhundert jüdischen Lebens: Die Geschichte des neuzeitlichen Judentums. Hg. Ellen Littmann. Frankfurt/M.: Europ. Verlagsanst., 1967 Elbogen, Ismar u. Eleonore Sterling. Die Geschichte der Juden in Deutschland. Frankfurt/M.: Athenäum, 1988 Elghazali, Saad R. Literatur als Femsehspiel: Veränderungen literarischer Stoffe im Fernsehen. Hamburg: Hans Bredow Institut, o.J. (1966) Elwenspoek, Curt. Jud Süß Oppenheimer: Der große Finanzier und galante Abenteurer des 18. Jahrhunderts. Stuttgart: Süddeutsches Verlagshaus, 1926 Encyclopaedia Judaica: Das Judentum in Geschichte und Gegenwart. Red. J. Klatzkin, I. Elbogen [et al.]. 7 Bd. Berlin: Eschkol, 1931 epd Film. Zeitschriñ des Evang. Pressedienstes. Hg. Gemeinschaftswerk der Evang.Publizistik. Frankfurt/M. 1983ff. Erb, Rainer. "Warum ist der Jude zum Ackerbürger nicht tauglich? Zur Geschichte eines antisemitischen Stereotyps", in: Antisemitismus und jüdische Geschichte 1987, 99-120 Erb, Rainer u. Werner Bergmann. Die Nachtseite der Judenemanzipation: Der Widerstand gegen die Integration der Juden in Deutschland 1780-1860. Berlin: Metropol, 1989 Estermann, Allted. Die Verßlmung literarischer Werke. Bonn: Bouvier, 1956 Ettinger, Shmuel. Geschichte des jüdischen Volkes, ΠΙ: Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart: Die Neuzeit. München: Beck, 1980 Eulenberg, Herbert. Heinrich Heine. Berlin: Aufbau-Verlag, 1947 Evangelischer Film-Beobachter. Hg. Gemeinschaftswerk der Evang. Publizistik. München 1948-1971 Ewig, Steffen. "Die Judenbuche: Ein Sittengemälde aus dem gebirgichten Westfeien", in: Kindlers Literatur Lexikon 1964, IV, Sp. 104-106 bzw. Kindlers Neues Literatur Lexikon 1989, IV, 877f. Fassbinder, Rainer Werner. Filme befreien den Kopf. Essays und Arbeitsnotizen. Hg. Michael Töteberg. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verl., 1986 Faulstich, Werner. Einñihrung in die Filmanalyse. Tübingen: Narr, 1980 Faulstich, Werner. "Filmanalyse als Filmgeschichte: Prinzipien einer konstruktivistischen Filmgeschichtsschreibung", in Filmgeschichte schreiben 1989, 153-162
244 Faulstich, Werner. Die Filminterpretation. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988a Faulstich, Werner. "Kleine Geschichte der 'Filmanalyse1 in Deutschland". Filmanalyse interdisziplinär: Beiträge zu einem Symposion an der Hochschule fur Bildende Künste Braunschweig. Hg. Helmut Körte u.Werner Faulstich. LiLi, 15. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988b Fechter, Paul. Das europäische Drama: Geist und Kultur im Spiegel des Theaters, 3 Bd. Mannheim: Bibliograph. Institut, 1956 Feilchenfeldt, Konrad. "'Berliner Salon' und Briefkultur um 1800", in: Juden in der deutschen Literatur 1984, I, 77-99 Fenske, Thomas. "Köpfe der Revolution", in: Abenteuer Revolution 1986,108-112 Fernsehen in Deutschland, 3 Bd. Red. Christian Longolius. Mainz: Hase & Koehler, 1967, 1969 u. 1973 Fernsehfbrschung - Fernsehkritik LiLi: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, Beiheft 11. Hg. Helmut Kreuzer. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1980 Fernsehsendungen und ihre Formen: Typologie, Geschichte und Kritik des Programms in der Bundesrepublik Deutschland. Hg. Helmut Kreuzer u. Karl Prümm. Stuttgart: Reclam, 1979 Das Fernsehspiel: Möglichkeiten und Grenzen. Hg. Peter von Rüden. München: Fink, 1975 Fernsehspiele in der ARD 1952-1972, 2 Bd. Zusammengest. u. bearb. von Achim Klünder u. Hans-Wilhelm Lavies. Hg. Dt. Rundfunkarchiv, 11. Frankfurt/M. 1986 Fernsehspiele 1973-1977, 2 Bd. Zusammengest. u. bearb. von Achim Klünder. Hg. Dt. Rundfunkarchiv, 15. Frankfurt/M., 1984 u. 1986 Feuchtwanger, Lion. Ein Buch für meine Freunde. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verl., 1984a Feuchtwanger, Lion. Das Haus der Desdemona oder Größe und Grenzen der historischen Dichtung. Hg. Fritz Zschech. München, Wien: Langen/Müller, 1984b Feuchtwanger, Lion. "Josephus-Trilogie", bestehend aus den Romanen Der jüdische Krieg, Die Söhne, Der Tag wird kommen. Berlin, Weimar: AufbauVerlag, 1983 Feuchtwanger, Lion. JudSüß. Roman. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verl., o.J. Feuchtwanger, Lion. Jud Süß. Schauspiel. Berlin: Aufbau-Verlag, 1984c Filmbeobachter. Hg. Gemeinschaftswerk der Evang. Publizistik. Frankfurt/M., 1976-1983 film-dienst. Hg. Kath. Institut f. Medieninformation e.V. in Zusammenarb. mt. der Kath. Filmkommission für Dtschld., Köln 1947ff. Filmgeschichte schreiben: Ansätze, Entwürfe und Methoden - Eine Dokumentation der Tagung der GFF1988. Hg. Knuth Hickethier. Berlin: Sigma Bohn, 1989
245 Film - Geschichte - Wirklichkeit. Red. Geschichtswerkstatt Hannover. Hamburg: Ereignisse, 1989 Film im Dritten Reich: Eine Dokumentation. Hg. Gerd Albrecht. Karlsruhe: Schauburg + Doku, 1979 Film und Fernsehen in Forschung und Lehre, XI. Red. Helga Belach u. Helmut Körte. Hg. Hochschule für Bildende Kunst Braunschweig u. Stiftung Dt.Kinemathek Berlin, 1988 Film und Femsehen: Materialien zur Theorie, Senologie und Analyse der audiovisuellen Massenmedien. Hg. Manfred Brauneck. Bamberg: Buchner, 1980 Filmkritik. Red. Enno Patalas [et al.]. München: Filmkritik, 1956-1974 Fischer Film Almanach 1980 [ff.]: Filme, Festivals, Tendenzen. Seit 1982 Hg. Walter Schobert [et al]. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verl. Fischer Filmgeschichte. Bd 2f. Hg. Werner Faulstich u. Helmut Körte. Frankñirt/M.: Fischer Taschenbuch Verl., 1990f. Flusser, David. Jesus in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Hg. Kurt Kusenberg. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verl., 1968 Flusser, David. Die letzten Tage Jesu in Jerusalem. Das Passionsgeschehen aus jüdischer Sicht. Bericht über neueste Forschungsergebnisse. Stuttgart: Calwer, 1982 Frank, Karl Suso. "'Adversus Judaeos' in der alten Kirche", in: Die Juden als Minderheit in der Geschichte 1985, 30-46 Franzos, Karl Emil. Der Pojaz: Eine Geschichte aus dem Osten. Nachwort: Jost Hermand.Frankfurt/M.: Athenäum, 1983 Frenzel, Elisabeth. Judengestalten auf der deutschen Bühne: Ein notwendiger Querschnitt durch 700 Jahre Rollengeschichte. München: Deutscher Volksverlag, 1940 Freund, Ismar. Die Emanzipation der Juden in Preußen: Ein Beitrag zur Rechtsgeschichte der Juden in Preußen. Π.: Dokumente. Berlin: Poppelauer, 1912 Fried, Erich. "Diese Toten". Aus Nachbarn wurden Juden: Ausgrenzung und Selbstbehauptung 1933-1942. Hg. Hazel Rosenstrauch. Berlin: Transit, 1988, 5 Fritze, Christoph, Georg Seeßlen u. Claudius Weil. Der Abenteurer: Geschichte und Mythologie des Abenteuer-Films. Grundlagen des populären Kinos, 9. Hg. Bernhard Roloff u. Georg Seeßlen. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verl., 1983 Gann, Ernest Κ. Der Kampf um Masada: Lorbeer fur die Besiegten. München: Knaur, 1972 Gebsattel, Jerome. "Oliver Twist", in: Kindlers Literatur Lexikon 1969, V, 934936 bzw. Kindlers Neues Literatur Lexikon 1989, IV, 648f. Geschichte der Juden: Von der biblischen Zeit bis zur Gegenwart. Hg. Franz J. Bautz. München: Beck, 1987 Geschichten aus dem Ghetto. Hg. Jost Hermand. Frankfurt/M.: Jüdischer Verlag bei Athenäum, 1987
246 Ein Ghetto im Osten: mina. 65 Bilder von M. Vorobeichic. Berlin: Ed. Hentrich, Frölich & Kaufmann, 1984 Ginzel, Günther B. "Martin Luther: 'Kronzeuge des Antisemitismus'", in: Die Juden und Martin Luther - Martin Luther und die Juden 1985, 191-210 Glatzer, Nahum Norbert. Geschichte der talmudischen Zeit. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verl., 1981 Goethe, Johann Wolfgang. Aus meinem Leben - Dichtung und Wahrheit. Sämtl. Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe, Hg. Karl Ritter [et al.], XVI. München: Hanser, 1985 Gollwitzer, Helmut. "Außer Christus kein Heil? (Joh. 14,6)"; "Das Judentum als Problem der christlichen Theologie". Auch das Denken darf dienen: Aufsätze zu Theologie und Geistesgeschichte, Π. Hg. Friedrich-Wilhelm Marquardt. München: Kaiser, 1988, 8-35; 63-81 Gollwitzer, Helmut. "Christentum und Judentum: Die Juden unter den Christen". Juden in Preußen: Ein Kapitel deutscher Geschichte. Dortmund: Harenberg, 1981, 49-51 Gollwitzer, Helmut. Forderungen der Freiheit: Au&ätze und Reden zur politischen Ethik. München: Kaiser, 1962, 249-268 Gottes Augapfel: Beiträge zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden. Hg. Edna Brocke u. Jürgen Seim. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verl., 1988 Grab, Walter. Der deutsche Weg der Judenemanzipation 1789-1938. München, Zürich: Piper, 1991 Grab, Walter. Heinrich Heine als politischer Dichter. Frankfurt/Main: Büchergilde Gutenberg, 1992 Grab, Walter. Die jüdische Antwort auf den Zusammenbruch der deutschen Demokratie 1933. Berlin: Gedenkstätte deutscher Widerstand, 1988 Grab, Walter. "Der preußisch-deutsche Weg der Judenemanzipation", in: Geschichte der Juden 1987, 140-164 Graetz, Heinrich. Volkstümliche Geschichte der Juden, 6 Bd. Reprint. München: Deutscher Taschenbuch Verl., 1985 Graupe, Heinz Mosche. Die Entstehung des modernen Judentums: Geistesgeschichte der deutschen Juden 1650-1942. Hamburg: Buske, 1977 Graus, Frantisek. "Judenpogrome im 14. Jahrhundert: Der Schwarze Tod", in: Die Juden als Minderheit in der Geschichte 1985, 68-84 Grebing, Helga. Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung: Ein Überblick München: Deutscher Taschenbuch Verl., 1977 Gregor, Joseph. Weltgeschichte des Theaters. Zürich: Phaidon, 1933 Gregor, Ulrich. Geschichte des Films ab 1960. München: Bertelsmann, 1978 Gregor, Ulrich u. Enno Patalas. Geschichte des Films. Gütersloh: Mohn, 1962 Greive, Hermann. Die Juden: Grundzüge ihrer Geschichte im mittelalterlichen und neuzeitlichen Europa. Darmstadt: Wissenschaftl. Buchgesellsch., 1980 Grob, Norbert. "Bieder". Filmkritik. Die Zeit, Hamburg, 30.12.83
247 Grob, Norbert. "Veit Harlan", in: Cinegraph, E 1-20 Hädecke, Wolfgang. Heinrich Heine: Eine Biographie. München, Wien: Hanser, 1985 Hamburger, Ernest. Juden im öffentlichen Leben Deutschlands: Regierungsmitglieder, Beamte und Parlamentarier in der monarchischen Zeit 1848-1918. Tübingen: Mohr, 1968 Hammerschmidt, Wolfgang. "Reizwort Dokumentarspiel". Das Fernsehspiel im ZDF, 33. Mainz: ZDF, 1981, 3f. Hans, Jan u. Rainer Zimmer. "Literaturverfilmung im Fernsehen", in: Film und Femsehen: Materialien 1980, 480-491 Harder, Günther. Kirche und Israel: Arbeiten zum christlich-jüdischen Verhältnis. Hg. Peter von der Osten-Sacken. Berlin: Institut Kirche und Judentum, 1986 Harlan, Veit. Im Schatten meiner Filme. Gütersloh: Mohn, 1966 Haug, Wolfgang Fritz. Kritik der Warenästhetik. Frankfurt/M.: Suhrkamp Taschenbuch Verl., 1971 Haumann, Heinz. "Das jüdische Prag (1850-1914)", in: Die Juden als Minderheit in der Geschichte 1985, 209-230 Hauptmann, Peter. "Russische Christenheit und Ostjudentum", : Kirche und Synagoge 1988, Π, 639-667 Haustein, Ulrich. "Das Verhältnis von Juden und Polen", in Kirche und Synagoge 1988, II, 453-482 Hebel, Franz. "Menschenfreundliche Kultur: Moses Mendelssohns gegenwärtige Bedeutung", in: Juden in der deutschen Literatur 1984, I, 59-76 Heimann, Paul. "Zur Bildungsrelevanz des deutschen Femsehens". Das Fernsehen in unserer Gesellschañ und Bildungswelt. Berlin: Selbstverl. Landesbildstelle Berlin, 1963, 2-9 Heine-Jahrbuch 1980. 19. Jg. Hg. Joseph Kruse. Heinrich-Heine-Institut der Landeshauptstadt Düsseldorf. Hamburg: Hoffmann & Campe, 1981 Heinrich Heine: Epoche, Werk, Wirkung. Hg. Jürgen Brummak. München: Beck, 1980 Heller, Heinz B. "Massenkultur und ästhetische Botschaft. Zur Geschichte und Funktion der deutschen Filmkritiker vor 1933". Die Macht der Filmkritik: Positionen und Kontroversen. Hg. Norbert Grob u. Karl Prümm. München: text + kritik,1990, 25^4 Herzig, Arno. "Das Problem der jüdischen Identität in der bürgerlichen Gesellschaft", in: Deutsche Aufklärung und Judenemanrìpation 1980, 243-263 Heschel, Abraham J. Die Erde ist des Herrn: Die innere Weltder Juden in Osteuropa. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1985 Heym, Stefan. Ahasver. München: Bertelsmann, 1981 Heym, Stefan. "Die Geschichte wäre anders verlaufen, wenn ...", in: Abenteuer Revolution 1986, 10-16 Heym, Stefan. Der König David Bericht. Berlin: Der Morgen, 1976
248 Heym, Lenz oder die Freiheit: Ein Roman um Deutschland. Frankfurt/M., Wien, Zürich: Büchergilde Gutenberg, 1968 Heym, Stefan. Nachruf. München: Bertelsmann, 1988 Heym. "Über Juden und Christen". Kirche und Israel, 1/86, 16-25 Hickethier, Knut. "Das Fernsehspiel"; "Literatur und Film". Literatur in der Bundesrepublik bis 1967. Hg. Ludwig Fischer. München: Deutscher Taschenbuch Verl., 1986, 585-610 Hickethier, Knut. Das Fernsehspiel der Bundesrepublik Themen, Form, Struktur, Theorie und Geschichte 1951-1977. Stuttgart: Metzler, 1980 Hickethier, Knut. "Fiktion und Fakt. Das Dokumentarspiel und seine Entwicklung bei ZDF und ARD", in: Fernsehsendungen und ihre Formen 1979, 53-71 Hickethier, Knut. "Probleme der Fernsehgeschichte - Überlegungen zu ihrer Konstruktion und Rekonstruktion", in: Fernsehforschung und Femsehkritik 1980, 13-35 Hickethier, Knut. "Unterhaltung in Fortsetzungen: Fernsehspielserien im Vorabendprogramm", in: Das Fernsehspiel: Möglichkeiten 1975, 53-71 Hickethier, Knut u. Joachim Paech. "Einleitung: Zum gegenwärtigen Stand der Film- und Fernsehanalyse. Methoden der Film- und Fernsehanalyse. Stuttgart: Metzler, 1979 Hildebrandt, Dieter,Lessing: Biographie einer Emanzipation. München, Wien: Hanser, 1979 Hirsch, Leo: Jüdische Glaubenswelt. Basel: Goldschmidt, 1982 Historikerstreit: Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvemichtung. München: Piper, 1987 Hoberman, J. Bridge of Light: Yiddish Film Between Two Worlds. New York: The Museum of Modern Art, Schocken Books, 1991 Hödl, Klaus. "Vom Shtetl an die Lower East Side ": Galizische Juden in New York Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 1991 Hofe, Harold von. "Feuchtwanger, das Judentum und die Dritte Aufklärung", in: Lion Feuchtwanger: "... für die Vernunft" 1985,53-63 Hollstein, Dorothea. Antisemitische Filmpropaganda: Die Darstellung des Juden im nationalsorìalistischen Spielñlm. Berlin: Verl. Dokumentation, 1971. Taschenbuchausg.: "Jud Süß " und die Deutschen: Antisemitishe Vorurteile im nationalsozialistischen Spielñlm. Frankfurt/M.: Ullstein, 1983 Hollstein, Dorothea. "Dreimal Jud Süß - Zeugnisse schmählichster Barbarei: Hauffs Novelle, Feuchtwangers Roman und Harlans Film in vergleichender Betrachtung", in: Juden und Judentum in der Literatur 1985, Π, 42-54 Der Holocaust und die Protestanten: Analysen einer Verstrickung. Hg. Jochen Christoph Kaiser u. Martin Greschat. Frankfurt/M.: Athenäum, 1988 Holocaust zur Unterhaltung: Anatomie eines internationalen Bestsellers Forschungsreportagen. Hg. Friedrich Knilli u. Siegfried Zielinski. Berlin: Elefanten Press, 1982
249 Holzer, Horst. Medien in der BRD: Entwicklungen 1970-1980. Köln: Pähl Rugenstein, 1980 Hoppe, Joachim. "Neues Denken - Neues Leben: Eine Einführung in das Leben von Franz Rosenzweig." Gott hat sein Volk nicht verstoßen: Beiträge zum jüdisch-christlichen Dialog. I. Kirchliche Bruderschaft Sachsens. O.O, o.J.(1989) Horch, Hans Otto. "Judenbilder in der realistischen Erzählliteratur. Jüdische Figuren bei Gustav Freytag, Berthold Auerbach und Wilhelm Raabe". Juden und Judentum in der Literatur. Hg. Herbert A. Strauss u. Christhard Hoffmann. München: Deutscher Taschenbuch Verl., 1985, 106-139 Howe, Irving. "Die Last des Daseins und die Leidenschaft des Lebens: Über die Welten des osteuropäischen Judentums". Versunkene Welt. Katalog. Hg. Joachim Riedl. Wien: Jewish Welcome Service, 1984, 11-22 Huder, Walter. "Über Lion Feuchtwanger; Aulklärung und Herausforderung", in: Lion Feuchtwanger: "...fur die Vernunñ" 1985, 19-25 Humanität und Dialog: Lessing und Mendelssohn in neuer Sicht. Hg. Ehrhard Bahr [et al.]. München: text + kritik, 1982 Isakson, Folke u. Leif Fuhrhammar. Politik und Film. Ravensburg: Otto Maier, 1974 Jacoby, Ruth L. Heinrich Heines jüdisches Erbe. Bonn: Bouvier, 1978 Jansen, Peter W. "Interview". Rainer Werner Fassbinder. Reihe Film,2. Hg. Peter W. Jansen [et al.]. München, Wien: Hanser, 1983 Jaretzky, Reinhold. Lion Feuchtwanger in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verl., 1984 Jens, Walter. Der Fall Judas. Stuttgart: Kreuz Verl., 1975 Jens, Walter. Juden und Christen in Deutschland: Drei Reden. Stuttgart: Radius 1989 Jens, Walter ("Momos"). "Mainzer Zynismus". Die Zeit. Hamburg, 28.7.1972 Jens, Walter. Nathan der Weise aus der Sicht von Auschwitz: Juden und Christen in Deutschland. Zur Erinnerung an den 30. Januar 1933. Vortrag. Hamburg: Freie Adademie der Künste, 1983 Jens, Walter. "'Der Teufel lebt nicht mehr, mein Herr!' Ein Totengespräch zwischen Heine und Lessing". Die Hören. Hannover. 3/1980 Jens, Walter. "Widerruf der Aufklärung: Von derBücherverbrennung zur Endlösung". Der Tagesspiegel. Berlin, 9.11.1988 Jeske, Wolfgang u. Peter Zahn. Lion Feuchtwanger oder der arge Weg der Erkenntnis. Stuttgart: Metzler, 1984 Jhering, Herbert. Von Joseph Kainz bis Paula Wessely: Schauspieler von gestern und heute. Heidelberg, Berlin, Leipzig: Hüthig, 1942 Das jiddische Kino. Hg. Hilmar Hoffmann u. Walter Schobert. Frankfurt/M.: Deutsches Filmmuseum Frankfurt, 1982 "Die Juden". Lustspiel von Lessing, in: Kindlers Literatur Lexikon 1968, IV, Sp. 102-104 bzw. Kindlers Neues Literatur Lexikon 1990, X, 318f.
250 Die Juden als Minderheit in der Geschichte. Hg. Bernd Martin u. Emst Schulin. München: Deutscher Taschenbuch Verl., 1985 Juden in Berlin 1671-1945: Ein Ijesebuch. Mt. Beitr. von Annegret Ehmann [et al.]. Berlin: Nicolai, 1988 Juden in der deutschen Literatur. Hg. Heinz-Dieter Weber. Der Deutschunterricht 4/84 u. 3/85. Velber: Friedrich, 1984 u. 1985 Juden in der Weimarer Republik Hg. Walter Grab u. Julius H. Schoeps. Stuttgart, Bonn: Burg, 1986 Die Juden in ihrer mittelalterlichen Umwelt. Hg. Alfred Ebenbauer u. Klaus Zatloukal. Wien: Böhlau, 1991 Juden in Preußen: Ein Kapitel deutscher Geschichte. Dortmund: Harenberg, 1981 Juden und Judentum in der Literatur. Hg. Herbert A. Strauss u. Christhard Hoffmann. München: Deutscher Taschenbuch Verl., 1985 Juden und Judentum in deutschen Briefen aus drei Jahrhunderten. Hg. Franz Kobler. Königstein/Ts.: Jüd. Verlag Athenäum, 1984 Die Juden und Martin Luther - Martin Luther und die Juden: Geschichte, Wirkungsgeschichte und Herausforderung. Hg. Heinz Kremers [et al.]. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1985 Judenfeindschaâ: Darstellung und Analysen. Hg. Karl Thieme. Frankfurt/M.: Fischer Bücherei, 1963 JudenfeindschaA im 19. Jahrhundert: Ursachen, Formen und Folgen. Hg. Peter von der Osten-Sacken. Berlin: Institut Kirche u. Judentum, 1982 Judentum, Antisemitismus und europäische Kultur. Hg. Hans Otto Horch. Tübingen: A. Francke, 1988 Das Judentum in der Deutschen Umwelt 1800- 1850: Studien zur Frühgeschichte der Emanzipation. Hg. Hans Liebeschütz u. Amold Paucker. Tübingen: Mohr, 1977 Jüdische Existenz und die Erneuerung der christlichen Theologie: Versuch der Bilanz des christlich-jüdischen Dialogs fur die Systematische Theologie. Hg. Martin Stöhr. München: Kaiser, 1980 Jüdische Merkwürdigkeiten ("Jüdischer Merckwürdigkeiten vorstellende Was sich Curieuses und denckwürdiges in den neuern Zeiten bey einigen Jahr-Hunderten mit denen in alle IV Theile der Welt sonderlich durch Teutschland zerstreueten Juden zugetragen ..." Frankfurt u. Leipzig MDCC XIV). Photomech. Nachdruck. Berlin: Louis Lamm, 1922 Jüdisches Fest - jüdischer Brauch. Hg. Friedrich Thierberger. Nachdruck der Erstaufl. von 1937. Königstein/Ts.: Jüdischer Verlag bei Athenäum, 1985 Jüdisches Leben in Deutschland seit 1945. Hg. Micha Brumlik [et al.]. Frankfurt/M.: Jüd. Verl. bei Athenäum, 1986 Jüdisches Lexikon: Ein enzyklopädisches Handbuch des jüdischen Wissens in vier Bänden. Begr. von Georg Herlitz u. Bruno Kirschner. Nachdruck d. 1. Aufl. Berlin 1927. Frankfurt/M.: Jüd. Verlag bei Athenäum, 1986 Kaes, Anton. Deutschlandbilder: Die Wiederkehr der Geschichte als Film. München: text + kritik, 1987
251 Kampen, Wilhelm van. "Film und Geschichte: Versuch einer Bestandsaufnahme". Geschichte in der Öffentlichkeit. Stuttgart: Klett, 1979, 283-294 Kampmann, Wanda. Deutsche und Juden: Studien zur Geschichte des deutschen Judentums. Heidelberg: Lambert Schneider, 1963 Die katholische Kirche und das Judentum: Dokumente von 1945-1982. Hg. Klemens Richter. Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1982 Katz, Jacob. Aus dem Ghetto in die bürgerliche Gesellschañ: Jüdische Emanzipation 1770- 1870. Frankfurt/M.: Jüd. Verlag bei Athenäum, 1986 Katz, Jacob. Richard Wagner: Vorbote des Antisemitismus. Königstein/Ts.: Jüd. Verl. Athenäum, 1985 Katz, Jacob. Vom Vorurteil bis zur Vernichtung: Der Antisemitismus 1700-1933. München: Beck, 1989 Katz, Jacob. Zur Assimilation und Emanzipation der Juden: Ausgew. Schriñen. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschf., 1982 Keller, Werner. Und wurden zerstreut unter alle Völker: Die nachbiblische Geschichte des jüdischen Volkes. München, Zürich: Knaur, 1979 Kindlers Literatur Lexikon. 7 Bd. Dtsch. Red.: Wolfgang Einsiedel u. Gert Wörner. Zürich: Kindler, 1965-1974 Kindlers Neues Literatur Lexikon. 20 Bd. Hg.: Walter Jens. München: Kindler, 1988ff. Kirche und Synagoge: Handbuch zur Geschichte wn Christen und Juden Darstellung mit Quellen. Hg. Karl Heinrich Rengstorf u. Siegfried Kortzfleisch. Taschenbuchausg., 2 Bd. München: Deutscher Taschenbuch Verl. 1988 Die Kirchen und das Judentum: Dokumente von 1945 bis 1985. Hg. Rolf Rendtorff u. Hans Hermann Henrix. Paderborn: Bonifatius, München: Kaiser, 1988 Kircher, Hartmut. Heinrich Heine und das Judentum. Bonn: Bouvier, 1973 Kirchner, Wolfgang. Bankier für Preußen. Berlin: Nicolai, 1987 Kisch, Egon Erwin. Nichts ist erregender als die Wahrheit: Reportagen aus vier Jahrzehnten. Hg. Walter Schmieding. 2 Bd. Frankfurt, Wien, Zürich: Büchergilde Gutenberg, 1979, 1/41-55 Kleßmann, Eckart. Die Mendelssohns: Bilder aus einer deutschen Familie. Zürich, München: Artemis, 1990 KLFG: Kritisches Lexikon zur ßremdsprachigen Gegenwartsliteratur. Hg. Heinz Ludwig Arnold. München: edition text + kritik, 1984ff. KJJG: Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Hg. Heinz Ludwig Arnold. München: edition text + kritik, 1978ff. Klinkenberg, Hans Martin. "Verschiedene Antisemitismen und Versuche ihrer Überwindung", in: Judentum, Antisemitismus und europ. Kultur 1988, 71-81 Klussmann, Paul Gerhard. "Lion Feuchtwangers Roman 'Jud Süß': Gedichtete Psychologie und prophetischer Mythos des Juden". Lion Feuchtwanger - Werk und Wrkung. Hg. Rudolf Wolff. Bonn: Bouvier, 1984
252
Knilli, Friedrich. "Die Gemeinsamkeit von Faschisten und Antifaschisten gegenüber dem NS-Film JUD SÜSS (1940)", in: Knilli [et al.], JUD SÜSS: Filmprotokoll... 1983, 57-67 Knilli, Friedrich. "Die Judendarstellungen in den deutschen Medien", in: Antisemitismus nach dem Holocaust 1986, 115-132 Knilli, Friedrich, "Kritik der Augenzeugenideologie": Fernsehen und Film. Red. Egon Netenjakob, Henning Rischbieter. Velber: Friedrich, 3/71, 13f. Knilli, Friedrich. "Zur Sache", in: Lion Freuchtwanger: "...fur die Vernunft" 1985, 49-52 Knilli, Friedrich, Thomas Maurer, Thomas Radevagen u. Siegfried Zielinski. JUD SÜSS: Filmprotokoll, Programmheñ und Einzelanalysen. Hg. Friedrich Knilli u. Siegfried Zielinski. Berlin: Volker Spiess, 1983 Knilli, Friedrich u. Siegfried Zielinski. "Lion Feuchtwangers 'Jud Süß' und die gleichnamigen Filme von Lothar Mendes (1934) und Veit Harlan (1940). text + kritik, Heft 79/80: Lion Feuchtwanger. München: text + kritik, 1983, 99121 Knobloch, Heinz. Herr Moses in Berlin: Auf den Spuren eines Menschenfreundes. Berlin: Der Morgen, 1979 Koch, Gertrud. "Auf halbem Weg zum Engel des Vergessens", in: Das jiddische Kino 1982, 13-34 Koebner, Thomas. "Das Bild beginnt langsam farbig zu werden", in: Abenteuer Revolution 1986, 20-31 Koebner, Thomas. "Die deutsche und die österreichische Literatur". Zwischen den Kriegen. Hg. Thomas Koebner. Neues Handbuch der Literaturwissenschañ, 20. Wiesbaden: Athenaion, 1983, 289-334 Koebner, Thomas. "Das Fernsehspiel - Themen und Motive", in: Das Fernsehspiel: Möglichkeiten und Grenzen 1975, 20-65 Koebner, Thomas. "Zur Typologie des dokumntarischenFernsehspiels", in: Dokumentarliteratur 1973, 79-95 Koelbl, Herlinde. Jüdische Portraits: Photographien und Interviews. Frankfurt/M.: Fischer, 1989 Köpke, , Wulf. Lion Feuchtwanger. München: Beck, text + kritik, 1983 Kopelew, Lew. Ein Dichter kam vom Rhein: Heinrich Heines Leben und Leiden. Berlin: Severin und Siedler, Quadriga, 1981 Kopitzsch, Franklin. "Lessing und seine Zeitgenossen im Spannungsfeld von Toleranz und Intoleranz", in: Deutsche AußdärungundJudenemanñpatin 1980, 29-35, 86-90 Kosny, Witold. "Der polnische Positivismus". Europäischer Realismus. Hg. Reinhard Lauer. Neues Handbuch der Literaturwissenschañ, XVII. Wiesbaden: Athenaion, 1980, 369- 384 Kracauer, Siegfried. Theorie des Films: Die Errettung der äußeren Wirklichkeit. Hg. Karsten Witte. Frankfurt/M.: Suhrkamp Taschenbuch Verl., 1985
253 Kracauer, Siegfried. Von Caligari zu Hitler: Eine psychologische Geschichte des deutschen Films. Hg. Karsten Witte. Frankftirt/M.: Suhrkamp, 1979 Krauss, Werner. Das Schauspiel meines Lebens: einem Freund erzählt. Stuttgart: Goverts, 1958 Kreimeier, Klaus. Kino und Filmindustrie in der BRD: Ideologieproduktion und KlassenwirMichkeit nach 1945. Kronberg: Scriptor, 1973 Kreimeier, Klaus. "Die Ökonomie der Gefühle: Aspekte des deutschen Nachkriegsfilms", in: Zwischen Gestern und Morgen 1989, 8-32 Kritische Stichwörter zur Medienwissenschaß. Hg. Werner Faulstich. München: Finck, 1979 Krüger, Udo Michael. "Kulturelle Indikatoren in der Fernsehrealität von Fictionsendungen: Ausgewählte Ergebnisse einer Pilotstudie", in Media-Perspektiven 9/88 Krusche, Dieter. Reclams Fihnßihrer. Stuttgart: Reclam, 1987 Kruschewski, Christiane. Gestaltungsfbrmen in Roman und Film: Vergleich der Aussagebereiche von Roman und Film im Hinblick auf die Möglichkeit der Verßlmung. Münster. Diss. 1956 Kuchenbuch, Thomas. Filmanalyse: Theorien, Modelle, Kritik. Köln: Prometh, 1978 Küng, Hans. Das Judentum. München, Zürich: Piper, 1991 Kugelmann, Cilly. "Di jiddische mischpoche", in: Das jiddische Kino 1982. 97101 Kuhn, Thomas S. Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Frankfurt/M. Suhrkamp Taschenbuch Verl., 1988 Kupisch, Karl. Das Volk der Geschichte: Randbemerkungen zur Geschichte der Judenfrage. Berlin, Stuttgart: Lettner, 1960 Kupisch, Karl. "Wurzeln des Antisemitismus: Das christliche Zeitalter", in: Der ungekiindigte Bund 1962, 79-86 Kurzweil, Zwi Erich. Hauptströmungen jüdischer Pädagogik in Deutschland von der Außdärung bis zum Nationalsozialismus. Frankfurt/M.: Diesterweg, 1987 Landmann, Salcia. "Dibbuk-Exorzismen in der jüdischen Tradition." u. "'Der Dibbuk' von An-Ski. Zur Aufführungsgeschichte." In: An-Ski, Der Dibbuk 1989, 85-138 Landmann, Salcia. Jiddisch: Das Abenteuer einer Sprache. Frankfurt/M.: Ullstein, 1988 Landesmann, Peter. Die Juden und ihr Glaube: Eine Gemeinschafi im Zeichen der Thora. München: Nymphenburger, 1987 Lanske, Hermann. Der biographische Film. Wien, Diss. 1949 Lanzmann, Claude. Shoah. Düsseldorf: Ciaassen, 1986 Lapide, Pinchas. Am Scheitern hofìèn lernen: Erfahrungen jüdischen Glaubens für heutige Christen. Gütersloh : Mohn, 1985 Lapide, Pinchas. Die Bergpredigt: Utopie oder Programm? Mainz: Grünewald, 1984
254
Lapide, Pinchas. Er predigte in ihren Synagogen: Jüdische Evangelienauslegung. Gütersloh: Mohn, 1980 Lapide, Pinchas. Er wandelte nicht auf dem Meer: Ein jüdischer Theologe liest die Evangelien. Gütersloh: Mohn, 1984 Lapide, Pinchas. Ist das nicht Josephs Sohn? Jesus im heutigen Judentum. Stuttgart: Calwer, München: Kösel, 1976 Lapide, Pinchas. Wer war schuld an Jesu Tod? Gütersloh: Mohn, 1987 Lapide, Pinchas u. Ulrich Lutz. Der Jude Jesus: Thesen eines Juden, Antworten eines Christen. Zürich, Einsiedeln, Köln: Benziger, 1979 Lapide, Pinchas u. Carl Friedrich von Weizsäcker. Die Seligpreisungen: Ein Glaubensgespräch. Stuttgart: Calwer, München: Kösel, 1985 Lau, Israel M. Wie Juden leben: Alltag, Glaube, Feste. Gütersloh: Mohn, 1988 Lauffs, Manfred. Walter Jens. München: Beck, text + kritik, 1980 Leroy, Beatrice. Die Sephardim: Geschichte des iberischen Judentums. München: Nymphenburger, 1987 Lessing, Gotthold Ephraim. Die Juden. Hg. Franz Hebel. Paderborn: Schöningh, 1968 Lessing Chronik: Daten zu Leben und Werk. Zusammengest, von Gerd Hillen. München, Wien: Hanser, 1979 Lessing, Theodor. Der jüdische Selbsthaß. Mt. e. Essay von Boris Groys. München: Mattes & Seitz, 1984 Lessing, Theodor. Wortmeldungen eines Unerschrockenen. Hg. Hans Stern. Leipzig, Weimar: Kiepenheuer, 1987, 69-76 Levinson, Pnina Navè. Was wurde aus Saras Töchtern? Frauen im Judentum. Gütersloh: Mohn, 1989 Lexikon des Internationalen Films: Das komplette Angebot in Kino und Fernsehen seit 1945. 10 Bd. Hg. Kath. Inst. f. Medieninf. u. Kath. Filmkomm. f. Dtschld. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verl., 1987 Lexikon des Internationalen Films: Das komplette Angebot in Kino, Femsehen und auf Video 1987/1988. Hg. Kath. Inst. f. Medieninf. u. Kath. Filmkomm. f. Dtschld. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verl., 1989 Lexikon des Internationalen Films: Das komplette Angebot in Kino, Fernsehen und auf Video 1989/1990. Hg. Kath. Inst. f. Medieninf. u. Kath. Filmkomm. f. Dtschld. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verl., 1991 Liebeschütz, Hans. "Judentum und deutsche Umwelt im Zeitalter der Restauration", in: Das Judentum in der Deutschen Umwelt 1977, 1-54 Liebeschütz, Hans u. Arnold Paucker. "Vorwort", in: Das Judentum in der Deutschen Umwelt 1977, VII-EX lion Feuchtwanger: "... fur die Vernunñ, gegen Dummheit und Gewalt. Hg. Walter Huder u. Friedrich Knilli. Berlin: publica, 1985 Literatur in den Massenmedien: Demontage von Dichtung? Hg. Friedrich Knilli [et al.]. München, Wien: Hanser, 1976
255 Löwe, Heinz-Dietrich. "Antisemitismus in der ausgehenden Zarenzeit", in: Die Juden als Minderheit in der Geschichte 1985, 184-208 Loewy, Ronny. "Zwei Welten, ein Kino: Vorbemerkungen zu Retrospektive und Buch", in: Das jiddische Kino 1982, 7-12 Lowry, Stephen. Pathos und Politik: Ideologie im Spielfilm des Nationalsozialismus. Tübingen: Niemeyer, 1991 Lühe, Barbara von der. "Lion Feuchtwangers Roman 'Jud Süß' und die Entwicklung des jüdischen Selbstbewußtseins in Deutschland". Lion Feuchtwanger: Werk und Wirkung. Hg. Rudolf Wolff. Bonn: Bouvier, 1984, 46-54 Lukacz, Georg. Essays über Realismus. Berlin: Aufbau-Verlag, 1948 Maier, Johann u. Peter Schäfer. Kleines Lexikon des Judentums. Stuttgart: Kath. Bibelwerk, Konstanz: Christi. Verl.-Anstalt, 1981 Malamat, Abraham. "Ursprünge und Frühgeschichte". Geschichte des jüdischen Volkes, I, Hg. Haim Hillel Ben-Sasson. München: Beck, 1978, 3-114 Marc Chagall: Die Russischen Jahre 190&1922. Schirn Kunsthalle Frankfurt, 16.6.-8.9.1991. Ausstellungskatalog, 90-139 Marcu, Valeriu. Die Vertreibung der Juden aus Spanien. Mt. e. Nachwort von Andrei Corba. München: Matthes & Seitz, 1991 Marcuse, Ludwig. Heinrich Heine in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verl., 1967 Marquardt, Friedrich-Wilhelm. Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Juden: Eine Christologie, I. München: Kaiser, 1990 Marquardt, Friedrich-Wilhelm. Die Entdeckung des Judentums Sir die christliche Theologie: Israel im Denken Karl Barths. München: Kaiser, 1966 Marquardt, Friedrich-Wilhelm. Die Gegenwart des Auferstandenen bei seinem Volk Israel: Ein dogmatisches Experiment. München: Kaiser, 1983 Marquardt, Friedrich-Wilhelm. Die Juden und ihr Land. Gütersloh: Mohn, 1986 Marquardt, Friedrich-Wilhelm. Von Elend und Heimsuchung der Theologie: Prolegomena zur Dogmatik Minchen: Kaiser, 1988 Martin Luther: Zum Wandel des Luther-Bildes in der Geschichtsschreibung und im Film. Hg. Johannes Horstmann. Schwerte: Kath. Akademie, 1983 Marx, Karl. "Zur Judenfrage". Marx, Karl u. Friedrich Engels. Werke. I. Berlin: Dietz, 1957, 347-377 Massing, Paul W. Vorgeschichte des politischen Antisemitismus. Frankfurt/M.: Syndikat, 1986 Maurer, Thomas u. Thomas Til Radevagen. "Protokoll des Spielfilms JUD SÜSS (1940)", in: Knilli [et al], "JUD SÜSS" 1983, 71-202 Maurer, Trude. Ostjuden in Deutschland 1918-1933. Hamburg: Christians, 1986 Maurer, Wilhelm. "Die Zeit der Reformation", in: Kirche und Synagoge 1988,1, 363-452 Mayer, Hans. Außenseiter. Frankfurt/M.: Suhrkamp Taschenbuch Verl., 1981
256
Mayer, Hans. "'Kommen Sie, Cohn!: Das Bild des Juden in der deutschen Literatur". Begegnung mit dem Judentum. Hg. Bernhard Rübenach. Stuttgart, Berlin: Kreuz, 1981, 327-352 Mayer, Hans. Literatur in der Übergangszeit. Berlin: Volk u. Welt, 1949, 31-51 Mayer, Hans. "Der Weise Nathan und der Räuber Spiegelberg: Antinomien der jüdischen Emanzipation in Deutschland". Lessings Nathan der Weise. Hg. Klaus Bohnen. Darmstadt: Wiss. Buchgesellsch. 1984, 350-373 Media Perspektiven. Hg. i.A. der Arbeitsgem. Rundfunkwerbung. Red. MarieLuise Kiefer [et al.]. Frankfurt/M., 1977ff. Meier, Kurt. "Die 'Judenfrage' im historischen und theologischen Horizont des deutschen Protestantismus seit 1945: Ein Literaturbericht", in: Der Holocaust und die Protestanten 1988, 241-269 Mendele Mojcher Sforim. Fischke der Lahme: Bettlerroman. Übers. Hubert Witt. Leipzig: Reclam, 1978 Mendele Mojcher Sforim. Die Mähre. Stuttgart: Ed. Weitbrecht, 1984 Mendele Mojcher Sfurim. Fischke der Krumme. Der Wunschring·. Zwei Romane. Übers. Alexander Eliasberg. Ölten u. Freiburg: Walter, 1961 Mertens, Dieter. "Christen und Juden zur Zeit des ersten Kreuzzuges", in: Die Juden als Minderheit in der Geschichte 1985, 46-67 Metzger, Thérèse u. Mendel. Jüdisches Leben im Mittelalter nach illuminierten hebräischen Handschriñen vom 13. bis 16. Jahrhundert. Würzburg: Arena/Popp, 1983 Michel, Heiner. "Der Autor zum Drehbuch". Das Fernsehspiel im ZDF, 28, 90-93 Milfull, John. "Juden, Christen und andere Menschen. Sabbatianismus, Assimilation und jüdische Identität in Lion Feuchtwangers Roman 'Jud Süß". Im Zeichen Hiobs: Jüdische Schriñsteller und deutsche Literatur im 20. Jahrhundert. Hg. Gunter Grimm u. Hans-Peter Bayerhöfer. Frankfurt/M.: Athenäum, 1986, 213-222 Möller, Horst. "Aufklärung, Judenemanzipation und Staat. Ursprung und Wirkung von Dohms Schrift 'Über die bürgerliche Verbesserung der Juden", in: Deutsche Außdärung und Judenemanzipation 1980, 119-154 Möller, Kai. Paul Wegener - sein Leben und seine Rollen. Hamburg: Rowohlt, 1954 Müller, Gerhard. "Protestantische Orthodoxie", in: Kirche und Synagoge 1988, 453-504 Müller, Heidy M. Die Judendarstellung in der deutschsprachigen Erzählprosa (1945-1981). Königstein/Ts.: Forum Academicum i. d. Verlagsgr. Athenäum/ Hain/ Hanstein, 1984 Muth, Heinrich. "Der historische Film: Historische und und filmische Grundprobleme". Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 11/55,670-684, u. 12/55, 738-751 Na'aman. Shlomo. "Heinrich Heine als zentrales Problem einer LassalleBiographie".Heine-Jahrbuchl968.Kg.Htinúch-Heinc-Archiv Düsseldorf, Hamburg: Hoffmann u. Campe, 1968, 18-31
257
Nau, Peter. Zur Kritik des Politischen Films: Sechs analysierende Beschreibungen und ein Vorwort "Über Filmkritik". Köln: Du Mont, 1968 Netenjacob, Egon. "Die 'Bestseller'-Autoren des deutschen Fernsehens. Ein Bericht", in: Fernsehen in Deutschland, ΠΙ, 1973, 201-224 Neubauer, Franz. Geschichte im Dokumentsrspiel. Paderborn, München, Wien, Zürich: Schöningh, 1984 Neues Lexikon des Judentums. Hg. Julius H. Schoeps. Gütersloh/München: Bertelsmann Lexikon Verlag, 1992 Noethlichs, Karl Leo. "Judentum und römischer Staat", in: Judentum, Antisemitismus und europäische Kultur 1988, 35-50 Noth, Martin. Geschichte Israels. Berlin: Evang. Verlagsanst. 1954 Oberman, Heiko A. Wurzeln des Antisemitismus: Christenangst und Judenplage im Zeitalter von Humanismus und Reformation. Berlin: Severin und Siedler, 1981 Ökumenisches Verzeichnis der biblischen Eigennamen nach den Loccumer Richtlinien. Hg. Bibelwerk/Biblisch-pastorale Arbeitsstelle der Berliner Bischofskonferenz. Berlin u. Altenburg: Evang. Hauptbibelgesellsch., 1983 Opatschu, Josef. Bar Kochba - Der letzte Aufstand. Stuttgart: Weitbrecht im K. Thienemann Verl., 1986 Osten-Sacken, Peter von der. Grundzüge einer Theologie im christlich-jüdischen Gespräch. München: Kaiser, 1981 Osterland, Martin. "Geschichte und Politik im Film", in: Film und Fernsehen: Materialien 1980, 383-392 (Teilabdruck von Osterland 1970) Osterland. Gesellschañsbilder in Filmen: Eine soziologische Untersuchung des Filmangebots der Jahre 1949-1962. Stuttgart: Enke, 1970 Das Ostjudentum: Einfuhrungen, Studien, Erzählungen und Lieder. Hg. Peter von der Osten-Sacken. Berlin: Institut Kirche und Judentum, 1981 Paech, Joachim. Literatur und Film. Stuttgart: Metzler, 1988 Paucker, Pauline. "Jüdische Gestalten im englischen Roman des 19. Jahrhundert", in: Juden und Judentum in der Literatur 1985, 106-139 Paul Wegener: Sein Leben und seine Rollen. Eingerichtet von Kai Möller. Hamburg: Rowohlt, 1954 Pazi, Margerita. "Zwei kaum bekannte Jud-Süß-Theaterstücke (P. Kornfeld und M. Avi-Shaul)", in: Lion Feuchtwanger: ...fur die Vernunñ 1985, 100-121 Pertsch, Dietmar. "Erinnerung in Schmerz und Zorn: Spurensuche nach dem Holocaust auf den Berliner Filmfestspielen". Berliner Sonntagsblatt 13/89 Pertsch, Dietmar. "Judendarstellungen in Spielßlmen und Fernsehspielen: Untersuchungen ßktionaler Produktionen zur Geschichte des jüdischen Volkes von dessen Anfängen bis zur Emanzipation in Mitteleuropa". Diss. Berlin, 1990 Pertsch, Dietmar [et al.]. Kleines Lexikon der Reformation: Themen, Personen, Begriffe. München: Deutscher Taschenbuch Verl., 1983 Petuchowski, Jakob J. u. Clemens Thoma. Lexikon der jüdisch-christlichen Begegnung. Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1989
258
Philipp, Franz-Heinrich. "Protestantismus nach 1848", in: Kirche und Synagoge 1988, Π, 192-294 Pischel, Joseph. Lion Feuchtwanger: Versuch über Leben und Werk. Frankfurt/M.: Röderberg, 1984 Pleyer, Peter. Deutscher Nächkriegsßlm 1946-1948. Münster: Fahle, 1965 Pleyer, Peter. Nationale und soziale Stereotypen im gegenwärtigen deutschen Spielßlm. Institut für Publizistik der Univ. Münster. Als Ms gedruckt, 1968 Poliakov, Léon. Geschichte des Antisemitismus. I: Von der Antike bis zu den Kreuzzügen, 1977; Π: Das Zeitalter der Verteufelung und des Ghettos, 1978; ΙΠ: Religiöse und sonale Toleranz unter dem Islam, 1979; IV: Die Marranen im Schatten der Inquisition, 1981; V: Die Außdärung und ihre judenfeindliche Tendenz, 1983; VI: Emanäpation und Rassenwahn, 1987; VII: Zwischen Assimilation und "Jüdischer Weltverschwörung", 1988, VIH: Am Vorabend des Holocaust, 1988. I-VI Worms: Heintz, VD-Vffl Frankfurt/M.: Jüd. Verlag Athenäum Pollack, Martin: Nach Galizien: Von Chassiden, Huzulen, Polen und Ruthenen. Eine imaginäre Reise durch die verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina. Wien, München: Brandstätter, 1984 Prager, Gerhard. "Sechs anfechtbare Thesen zur Problematik der Fernsehserie". Das Fernsehspiel im ZDF, 4. Febr. 1974, 2 Prawer, Siegbert S. "Heinrich Heines jüdische Porträtgalerie", in: Juden und Judentum in der Literatur 1985 , 78-105 Prinz, Joachim. Das Leben im Ghetto: Jüdisches Schicksal in Sinf Städten. Berlin: Löwe, 1937 Prodolliet, Ernest. "Der Golem: Ein Beitrag zur vergleichenden Filmgeschichte". Die Tat, Zürich, 29.7.1967 Prokop, Dieter. Materialien zur Theorie des Films. München: Fischer Ahtenäum, 1974 Prokop, Dieter. Soziologie des Films. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verl., 1982 Promies, Wolfgang. "Biographien der Wahnsinnigen", in: Kindlers Literatur Lexikon 1974, Erg.-Bd., Sp. 176f. bzw. Kindlers Neues Literatur Lexikon 1991, XV, 836f. Prümm, Karl. "Das Buch nach dem Film: Aktuelle Tendenzen des multimedialen Schreibens bei Tankred Dorst und Heinar Kipphardt". Fernsehforschung Femsehkritik. Hg. Helmut Kreuzer. LiLi, Beiheft 11, Göttingen; Vandenhoeck & Ruprecht, 1980, 54-74 Prümm, Karl. "Historiographie einer Epochenschwelle: Der Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm", in: Filmgeschichte schreiben 1989, 93-102 Prümm, Karl. "Vom Buch zum Fernsehfilm (und umgekehrt). Varianten der Literaturverfilmung", in: Fernsehsendungen und ihre Formen 1979, 94-114
259 Rachel, Hugo u. Paul Wallich. Berliner Großkauäeute und Kapitalisten, ΠΙ: Übergangszeit zum Hochkapitalismus 1806-1856. Hg. Johannes Schultze [et al.]. Berlin: de Gruyter, 1967 von Rad, Gerhard. Das erste Buch Mose: Genesis Kapitel 1-25,18. ATD/Neues Göttinger Bibelwerk 2/3. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1952 Raddatz, Fritz J. Heine: Ein deutsches Märchen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verl., 1979 Radtke, Wolfgang. Die preußische Seehandlung zwischen Staat und Wirtschañ in der Frühphase der Industrialisierung. Berlin: Colloquium, 1981 Radtke, Wolfgang. Die preußische Seehandlung. Berlin: Nicolai, 1987 (Teil 2 der Biographie Christian Rother von W. Kirchner ebd.) Rainer Werner Fassbinder. Reihe Film, Π, Hg. Peter W. Jansen u. Wolfram Schütte. München, Wien: Hanser, 1987 Reich-Ranicke, Marcel. Über Ruhestörer: Juden in der deutschen Literatur. Stuttgart: Dtsch. Verlagsanst., 1989 Reichmann, Eva G. Die Flucht in den Haß: Die Ursachen der deutschen Judenkatastrophe. Frankfurt/M.; Europ. Verlagsanst. o.J. (1956) Rendtorff, Rolf. Das Alte Testament: Eine Einführung. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verl., 1985 Rengstorf, Karl Heinrich. "Der Kampf um die Emanzipation", in: Kirche und Synagoge 1988, Π, 129-176 Ridley, Hugh, "John Osborne", in: KLFG, 8. Nig., 1-10 Riff, Michael. "Das osteuropäische Judentum", in: Geschichte der Juden 1987, 115-139 Rink, Marion. "Was habt ihr da Zur einen Brauch? " Jüdische Riten und Feste. Schöneberger Hefte, Sonderbd. Frankfurt/M.: Evang. Presseverband in Hessen und Nassau, 1988 Ritchie, James. "Die Jud-Süß-Dramatisierung von Ashley Dukes", in: Lion Feuchtwanger: "...ñirdie Vernunft" 1985, 122-133 Rohrbacher, Stefan u. Michael Schmidt. Judenbilder: Kulturgeschichte antijüdischer Mythen und antisemitischer Vorurteile. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch, 1991 Rosen, Klaus Henning. "Vorurteile im Verborgenen: Zum Antisemitismus in der Bundesrepublik Deutschland", in: Antisemitismus: VonderJudenfeindschaAzum Holocaust 1985, 256-279 Rosenfeldt, Beate. Die Golemsage und ihre Verwertung in der Literatur. Breslau: Hans Priebatsch, 1934 Rosenthal, Ludwig. Heinrich Heine als Jude. Frankfurt/M., Berlin, Wien: Ullstein, 1973 Rozenblit, Marsha L. Die Juden Wiens 1867-1914: Assimilation und Identität. Wien, Köln, Graz: Böhlau, 1989 Rürup, Reinhard. Emanzipation und Antisemitismus: Studien zur "Judenfrage" der bürgerlichen Gesellschaä. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verl., 1987a
260 Rürup, Reinhard. "Emanzipation und Antisemitismus: Historische Verbindungslinien", in: Antisemitismus: Von der Judenfeindschaft zum Holocaust 1985, 8898 Rürup, Reinhard. "Emanzipationsgeschichte und Antisemitismusforschung: Zur Überwindung antisemitischer Vorurteile", in: Antisemitismus undjüdische Geschichte: Studien 1987b, 467-478 Rugill, Peter. The Return of the Golem: A Chanuka Story. New York: Holt, Rinehard, Winston, 1979 Sachwörterbuch des Fernsehens. Hg. Helmut Kreuzer [et al]. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982 Sadoul, Georges. Geschichte der Filmkunst. Erw. dtschsprach. Ausg., Red. Hans Winge. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verl., 1982 Sander, L. Gilman. "'Ebrew and Jew': Moses Mendelssohn and the Sense of Jewish Identity", in: Humanität und Dialog 1982, 67-82 Sautermeister, Gert. "Deutsche Erzählprosa der Restaurationszeit". Neues Handbuch der Literaturwissenschañ, XVI: Europäische Romantik III. Wiesbaden: Aula, 1985, 81-118 Saxer, Ulrich. "Literatur in der Medienkonkurrenz", in Media Perspektiven 12/77, 673-85 Schäfer, Peter. Geschichte der Juden in der Antike: Die Juden Palästinas von Alexander dem Großen bis zur arabischen Eroberung. Stuttgart: Kath. Bibelwerk, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1983 Schanze, Helmut. "Dorothea geb. Mendelssohn, Friedrich Schlegel, Philipp Veitein Kapitel zum Problem Judentum und Romantik", in: Judentum, Antisemitismus und europäische Kultur 1988, 133-150 Schanze, Helmut. "Das Theater nützt dem Fernsehen. Nützt das Fernsehen dem Theater? Zur bisherigen Adaption der Dramen- und Theatertradition im Fernsehen der Bundesrepublik", in: Fernsehsendungen und ihre Formen 1979, 115-125 Schauer, Hermann Ernst. Grundprobleme der Adaption literarischer Prosa durch den Spielñlm. Diss, Berlin/DDR, 1965 Scheuer, Helmut. "Biographische Sendungen", in: Sachwörterbuch des Fernsehens 1982, 31-33 Schieder, Theodor. Friedrich der Große: Ein Königtum der Widersprüche. Berlin: Ulisein, 1986 Schlingensiepen, Ferdinand. Heinrich Heine als Theologe: Ein Textbuch. München: Kaiser, 1981 Schmelzkopf, Christiane. Zur Gestaltung jüdischer Figuren in der deutschsprachigen Literaturnach 1945. Hildesheim, Zürich, New York: Olms, 1983 Schmitthenner, Walter. "Kennt die hellenistisch-römische Antike eine 'Judenfrage'?", in: Die Juden als Minderheit in der Geschichte 1985, 9-29
261 Schnee, Heinrich. Die Hofñnanz und der moderne Staat: Geschichte und System der Hofiàktoren an deutschen Fürstenhö&n im Zeitalter des Absolutismus. Nach archivalischen Quellen. Berlin: Duncker & Humblot. I: Die Institution des Hofìkktorentums in Brandenburg-Preußen, 1953; ΠΙ: Die Institution des Hofìkktorentums in den geistlichen Staaten Norddeutschlands, an kleinen norddtsch. Fürstenhöfen im System des absoluten Fürstenstaates, 1955; IV: Hofìkktoren an süddeutschen Fürstenhö&n nebst Studien zur Geschichte des Hofìkktorentums in Deutschland, 1963. Schnee, Heinrich. Rothschild: Geschichte einer Finanzdynastie. Göttingen, Berlin, Frankfurt/M.: Musterschmidt, 1961 Schneider, Irmela. "Die Diskussion um das Fernsehspiel: Versuch einer Bestandsaufnahme". Film- und Fernsehforschung. Hg. Helmut Kreuzer. LiLi, 29. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1978, 101-126 Schoeps, Hans-Joachim. Jüdisch-chrístliches Religionsgespräch in neunzehn Jahrhunderten. Mt. e. Nachw. von Edna Brocke. Königstein/Ts.: Jüd. Verl. Athenäum, 1984 Schoeps, Julius H. Leiden an Deutschland: Vom antisemitischen Wahn und der Last der Erinnerung. München, Zürich: Piper, 1900 Schoeps, Julius H. Moses Mendelssohn. Königstein/Ts.: Jüd. Verlag in Athenäum, 1979 Schoeps, Julius H. "Der ungeliebte Außenseiter: Zum Leben u. Werk des Philosophen und Schriftstellers Theodor Lessing", in: Juden in der Weimarer Republik 1986, 200-217 Schoeps, Julius H. Über Juden und Deutsche: Historisch-politische Betrachtungen. Stuttgart, Bonn: Burg, 1986 Scholem, Gershom. Judaica I. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1986, 165-206 Scholem, Gershom. Judaica II. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1982, 7-11, 2046, 7786 Scholem, Gershom. Judaica ΠΙ: Studien zurjüdischen Mystik. Frankfurt/M. : 1987 Scholem, Gershom. Judaica IV. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1984, 262-286 Scholem, Gershom. "Die Vorstellung vom Golem in ihren tellurischen und magischen Beziehungen". Eranos-Jahrbuch 1953. Hg. Olga Fröbe-Kapteyn. Zürich: Rhein, 1954, 235-289 Scholem-Alejchem. Menachem Mendel und Scheine-Scheindel: Briefe von und nach Galizien. Nördlingen: Greno, 1987 Scholem-Alejchem. Der Sohn des Kantors. Berlin: Volk und Welt, 1965 Scholem-Alejchem. Tewje, der Milchmann. Frankfurt/M., Zürich, Wien: Büchergilde Gutenberg, 1962 Schonfield, HughJ. The Passover Plot: New light on the history of Jesus. London: Hutchinson, 1965 Schonfield, Hugh J. Planziel Golgatha: Neue Erkenntnisse der Leben-Jesu-Forschung. Aldingen: WIRschaft, 1969
262 Schreiner, Stefan. "Was Luther vom Judentum wissen konnte", in: Die Juden und Martin Luther - Martin Luther und die Juden 1985, 58-71 Schuder, Rosemarie u. Rudolf Hirsch. Der gelbe Fleck Wurzeln und Wirkungen des Judenhasses in der deutschen Geschichte. Köln: Röderberg/PahlRugenstein, 1988 Schudt, Johann Jacob, Jüdische Merkwürdigkeiten, siehe: Jüdische Merkwürdigkeiten Schulim, Ernst. "Die spanischen und portugiesischen Juden im 15. und 16. Jahrhundert. Eine Minderheit zwischen Integrationszwang und Verdrängung", in: Die Juden als Minderheit in der Geschichte 1985, 88-109 Shulman, Abraham. The Old Country. New York: Charles Scribner's Sons, 1974 Sie saßen und tranken am Teetisch: Anlange und Blütezeit der Berliner Salons 1789-1871. Hg. Rolf Strube. München, Zürich: Piper, 1991 Siegele-Wenschkewitz, Leonore. "Wurzeln des Antisemitismus in Luthers theologischem Antijudaismus?", in: Die Juden und Martin Luther - Martin Luther und die Juden 1985, 351-367 Silbermann, Alphons. "Stichworte zur Emanzipation der Juden in Deutschland", in: Joseph Süß Oppenheimer: Geschichte und Geschichten 1984a, 22-26 Silbermann, Alphons. Der ungeliebte Jude: Zur Soziologie des Antisemitismus. Zürich: Interfrom, 1981 Silbermann, Alphons. Was ist jüdischer Geist? Zur Identität der Juden. Zürich: Interfrom, Osnabrück: Fromm, 1984b Silberner, Edmund. Sozialisten zur Judenfrage: Ein Beitrag zur Geschichte des Sozialismus vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis 1914. Berlin: Colloquium, 1962 Simon, Ernst. "Lessing und die jüdische Geschichte", in: Toleranzheute 1979, 3740 Singer, Isaac Bashevis. "Foreword", in: The Old Country 1974 Singer, Isaac Bashevis. Der Golem: Eine Legende. München, Wien: Hanser, 1988 Skierka, Volker. Lion Feuchtwanger: Eine Biographie. Berlin: Quadriga, 1984 Sperber, Manès. Die Wasserträger Gottes: All das Vergangene. Wien: Europa, 1974 Spieß, Christian Heinrich. Biographien der Wahnsinnigen. Hg. Wolfgang Promies. Neuwied, Berlin: Luchterhand, 1966, 88-129, 130-181 Spira, Leopold. Feindbild "Jud": 100 Jahre politischer Antisemitismus in Österreich. Wien, München: Locker, 1981 Stegemann, Ekkehard. "Der Jude Paulus und seine antijüdische Auslegung", in: Auschwitz - Krise der christlichen Theologie" 1980, 117-139 Steinchen, Renate. " Vom Ghetto an die Wasser von Manhattan: Russische Juden unterwegs auf der Suche nach einer neuen Identität im Amerika der Jahrhundertwende". Diss. Berlin 1982 Stemberger, Günter. Geschichte der jüdischen Literatur: Eine Einfuhrung. München: Beck, 1977
263 Starnberger, Günter. Das klassische Judentum: Kultur und Geschichte der rabbinischen Zeit (70 n.Chr. bis 1040 n.Chr.). München: Beck, 1979 Stemberger, Günter. Midrasch: Vom Umgang der Rabbinen mit der Bibel. Einführung, Texte, Erläuterungen. München: Beck, 1988 Stemberger, Günter. Der Talmud: Einführung, Texte, Erläuterungen. München: Beck, 1982 Stendahl, Krister. Der Jude Paulus und wir Heiden: Anlagen an das abendländische Christentum. München: Kaiser, 1978 Stenzel, Jürgen. "Idealisierung und Vorurteil: Zur Figur des 'edlen Juden1 in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts". Juden in der deutschen Literatur: Ein deutsch-israelisches Symposium. Hg. Stéphane Moses u. Albrecht Schöne. Frankfurt/M.: Suhrkamp Taschenbuch Verl., 1986, 144-126 Sterling, Eleonore. Er ist wie du: Aus der Frühgeschichte des Antisemitismus in Deutschland (1815-1850). München: Kaiser, 1956. Sterling, Eleonore. Judenhaß: Die Anlange des politischen Antisemitismus in Deutschland (1815-1850). München: Kaiser, 1956. Stern, Menahem. "Die Zeit des Zweiten Tempels", in: Geschichte des jüdischen Volles 1978, I, 231-276 Stern, Selma. Jud Süß: Ein Beitrag zur deutschen und zur jüdischen Geschichte. Berlin: Akademie-Verl., 1929 Stern, Selma. Der Preußische Staat und die Juden, ΙΠ,Ι: Die Zeit Friedrich des Großen: Darstellung. Tübingen: Mohr, 1971 Sternburg, Wilhelm von. Lion Feuchtwanger: Ein deutsches SehnAstellerleben. Königstein/Ts.: Athenäum, 1984 Stöhr, Martin. "Martin Luther und die Juden", in: Die Juden und Martin Luther Martin Luther und die Juden 1985, 89-108 Stoffers, Wilhelm. Juden und Ghetto in der deutschen Literatur bis zum Ausgang des Weltkrieges. Ny m wegen: Wächter, 1939 Strategien der Filmanalyse: Zehn Jahre Münchner Filmphilologie - Prof. Dr. Klaus Kanzog zum 60. Geburtstag. Hg. Ludwig Bauer [et al.]. München: Schaudig, Bauer, Ledig, 1987 Strauss, Herbert A. "Akkulturation als Schicksal. Einleitende Bemerkungen zum Verhältnis von Juden und Umwelt", in: Juden und Judentum in der Literatur 1985, 9-26 Strauss, Herbert A. "Der Holocaust: Reflexionen über die Möglichkeiten einer wissenschaftlichen und menschlichen Annäherung", in: Antisemitismus: Von der Judenfeindschaft zum Holocaust" 1985, 215-233 Strauss, Herbert A. "Juden und Judenfeindschaft in der frühen Neuzeit", in: Antisemitismus: Von der Judenfeindschaft mm Holocaust 1985, 66-87 Strauss, Herbert A. u. Norbert Kampe. "Einleitung", in: Antisemitismus: Von der Judenfeindschaft zum Holocaust 1985, 9-28 Taschenlexikon Religion und Theologie. I-IV. Hg. Erwin Fahlbusch. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1974
264 Theater heute. Hg. Erhard Friedrich, Red. Hennig Rischbieter u.a. Hannover, (später) Velber, Berlin. 1960ff. Toeplitz, Jerzy. Geschichte des Films. Berlin: Henschel. I: 1895-1928(1915); Π: 1928-1933(1976)·, ΙΠ: 1934-1939(1979)·, IV: 1939-1945(1983); V: 1945-1953 (1991) Törne, Volker von."Zur Entstehung des politischen Antisemitismus im 19. Jahrhundert in Deutschland: Vorgeschichte und Folgen, in: Judenfeindschañ im 19. Jahrhundert 1982, 9-19 Toleranz heute: 250 Jahre nach Mendelssohn und Lessing. Hg. Peter von der Osten-Sacken. Berlin: Institut Kirche und Judentum, 1979 Torberg, Friedrich. Golems Wederhehr und andere Erzählungen. Frankfurt/M.: Fischer, 1968 Toury, Jacob. "Der Eintritt der Juden ins deutsche Bürgertum", in: Das Judentum in der Deutschen Umwelt 1977, 139-242 Toury, Jacob. "Emanzipation und Assimilation", in: Neues Lexikon des Judentums 1992,133f. Toury, Jacob. Die politischen Orientierungen der Juden: Von Jena bis Weimar. Tübingen: Mohr, 1966 Toury, Jacob. Soziale und politische Geschichte der Juden in Deutschland 18471871: Zwischen Revolution, Reaktion und Emanzipation. Düsseldorf: Droste, 1977 Traudisch, Francois. "Das Luther-Bild in deutschen Filmen", in: Martin Luther: Zum Wandel des Lutherbildes... 1983, 37-45 Trende, Adolf. Im Schatten des Freimaurer- und Judentums: Ausgewählte Stücke aus dem Briefwechsel des Ministers und Che& der preußischen Bankinstitute Christian Rothers .Berlin: Verlag der deutschen Arbeitsfront, 1938 Trepp, Leo. Die amerikanischen Juden: Proßl einer Gemeinschaü. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer, 1991 Trepp, Leo. Die Juden: Volk, Geschichte, Religion. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verl., 1987 Der ungekündigte Bund: Neue Begegnung von Juden und christlicher Gemeinde. Hg. Dietrich Goldschmidt u. Hans-Joachim Kraus. Stuttgart: Kreuz Verl., 1962 Die Unterhaltung der deutschen Fernseh&milie: Ideologiekritische Kurzanalysen von Serien. Hg. Friedrich Knilli. München: Hanser, 1971 Versunkene Welt. Hg. Joachim Riedl. Wien: Welcome Service, 1984 Victor, Walther. Marx und Heine: Tatsache und Spekulation in der Darstellung ihrer Beziehungen. Berlin: Henschel, 1953 Vilimková, Milada. Die Prager Judenstadt. Hanau: Dausien, 1990 Vishniac, Roman. Verschwundene Welt. München, Wien: Hanser, 1983 Volken, Laurenz. Jesus der Jude und das Jüdische im Christentum. Düsseldorf: Patmos, 1985
265 Vorurteile gegen Minderheiten: Die Anlange des modernen Antisemitismus am Beispiel Deutschlands. Hg. Hans-Gert Oomen u. Hans-Dieter Schmid. Arbeitstexte f. d. Unterricht. Stuttgart: Reclam, 1978 Walbiner, Rudolf. "Einleitung". Droste-Hülshoffs Werke in einem Band. Bibliothek deutscher Klassiker. Berlin, Weimar: Aufbau-Verl., 1973 Waldmann, Werner. Das deutsche Fernsehspiel: Ein systematischer Überblick. Wiesbaden; Athenaion, 1980 Waldmann, Werner u. Rose Waldmann. Einführung in die Analyse von Fernsehspielen. Tübingen: Narr, 1980 Wassermann, Jakob. Deutscher und Jude: Reden und Schriften 1904-1933. Hg. Dierk Rodewald. Heidelberg: Lambert Schneider, 1984. Weber, Heinz-Dieter. "Bemerkungen über Assimilation und jüdische Identität", in: Juden in der deutschen Literatur 1984, 5-15 Wegener, Paul. Der Golem, wie er in die Welt kam: Eine Geschichte in fünf Kapiteln. Berlin: Scherl, 1921 Weinzierl, Erika. "Katholizismus in Österreich", in: Kirche und Synagoge 1988, Π, 483-531 Weltliteratur im 20. Jahrhundert. I-V. Hg. Manfred Brauneck. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verl., 1981 Wendt, Ernst. "Osbornes Luther", in: Theater heute 10/62 Werner, Hans-Georg. "Zum Verhältnis zwischen 'öffentlicher' und 'privater' Sphäre im dichterischen Weltbild Lessings", in: Humanität und Dialog 1982, 83-102 Wichterich, Christa. Unsere Nachbarn heute Abend Familienserien im Fernsehen. Frankfurt, New York: Campus, 1979 Wiesel, Elie. Das Geheimnis des Golem. Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1985 Wiesel, Elie. Jude heute: Erzählungen, Essays, Dialoge. Wien: Hannibal, 1987 Wirth, Louis, The Ghetto. Reprint von 1928. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1956 Wolfschütz, Hans. "Stefan Heym", in: KLG 14. Nlg.,1-14 Wolpers, Theodor. "Der Realismus in der englischen Literatur". Neues Handbuch der Literaturwissenschaft, XVII: Europäischer Realismus. Wiesbaden: Athenaion, 1980, 89-184 Wulf, Joseph. Theater und Film im Dritten Reich. Gütersloh: Bertelsmann, 1964 Wurmbrand, Max i. Zusammenarb. mit Cecil Roth. Das Volk der Juden: 4000 Jahre Kampf ums Überleben. Dreieich: Abi Melzner, 1980 Yadin, Ygael. Massada: Der letzte Kampf um die Festung des Herodes. Hamburg: Hoffmann u. Campe, 1967 Ydit, Max Meier. "Schadchen, Schul und Schammes: Aus dem osteuropäischen Gemeindeleben", in: Beter und Rebellen 1983, 51-58 Zborowski, Mark u. Elizabeth Herzog. Das Schtetl: Die untergegangene Welt der osteuropäischen Juden. München: Beck: 1991 ZDF-Fernsehspiel. Hg. Zweites Deutsches Fernsehen. Mainz
266 Zeutzschel, Günter. Das Fernsehspiel-Archiv. Karlsruhe: Rhein-Verlag Günter Zeutzschel, 1966ff. Zielinski, Siegfried. "Antisemitische Kulturware versus philosemitisches Kunstwerk: Aspekte einer Gegenüberstellung der Filme 'Jud Süß1 von Veit Harlan (1940) und 'Jew Suess' von Lothar Mendes (1934)", in: Lion Feuchtwanger. "...Sir die Vernunä" 1985, 134-150 Zielinski, Siegfried. Veit Harlan: Analysen und Materialien zur Auseinandersetzung mit einem Film-Regisseur des deutschen Faschismus. Frankfurt: R.G. Fischer, 1981 Zielinski, Siegfried. "Der Videomarkt im zehnten Jahr: Bestandsaufnahme und neue endenzen - besonders im Hinblick auf die Software (1)", in: MediaPerspektiven 7/88, 507-516 Zielinski, Siegried u. Thomas Maurer. "Bausteine des Spielfilms JUD SÜSS (1940)", in: Knilli [et al.], JUD SÜSS 1983, 19-56 Zimmermann, Moshe. '"Lessing contra Sem'. Literatur im Dienste des Antisemitismus". Juden in der deutschen Literatur. Ein deutsch-israelisches Symposium. Hg. Stéphane Moses u. Albrecht Schöne. Frankfurt/M.: Suhrkamp Taschenbuch Verl., 1986, 179-193 Zur Geschichte der Juden im Deutschland des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit. Hg. Alfred Heit. Stuttgart: Hiersemann, 1981 Zwischen Gestern und Morgen: Westdeutscher Nachkriegsßlm 1946-1962. Hg. Hilmar Hoffmann u. Walter Schobert. Frankfurt/M.: Deutsches Filmmuseum, 1989
267
Register der Film- und Fernsehproduktionen
ACHT STUNDEN SIND KEIN TAG 156 A.D. - ANNO DOMINI, s. ANNO DOMINI - DER KAMPF DER MÄRTYRER AFFÄRE BLUM (1948) 112 AFFÄRE BLUM (1962) 113 AKTENMÄSSIGE NACHRICHT VON DER WIDER JOHAN CHRISTOPH KROP ANGESTELLTEN UNTERSUCHUNG 162-165, 183 THE ALIEN'S INVASION 49 DAS ALTE GESETZ 116, 187-196, 197, 231 ANNO DOMINI - DER KAMPF DER MÄRTYRER 21, 24-25 THE ANTAGONISTS 14-15 DER ARME MANN LUTHER 32-33, 41 ATTI DEGLI APOSTOLI 7, 20 AU REVOIRS LES ENFANTS 1 AUSTERIA - DAS HAUS AN DER GRENZE 224 BARABBAS 20 BEBEL UND BISMARCK 115,237 BEZDOMMI, s. ON A HEYM BEN HUR (1959) 20, 22 BERLIN - SYMPHONIE EINER WELTSTADT 104 DIE BERTINIS - CHRONIK EINER HAMBURGER FAMILIE 2 LA BIBBIA 10, 13 THE BIG FISHERMANN 20 BLAZEN, s. DER PURMISCHPILER Ein Brief an die Mutter, s. A BRIVELE DER MAMEN A BRIVELE DER MAMEN 228, 229-230, 233 CASTLES IN THE SKY, s. YIDL MITN FIDL CHRISTIAN ROTHER - BANKIER FÜR PREUSSEN 115, 158-161, 184 DAVID E GOLIA 4,11 David und Goliath, s. DAVID E GOLIA DEMETRIUS AND THE GLADIATORS 20 DEM REBNS KOJECH 223 LE DERNIER METRO 1 DER DIBBUK bzw. DER DIBEK, s. DYBUK DREHT EUCH NICHT UM, DER GOLEM GEHT UM 47 DYBUK 83, 219-223, 232 EHE IM SCHATTEN 1 ERODE E IL GRANDE 11 ESTHER E IL RE 11
268 DER EWIGE JUDE 77, 90, 186, 235 EXIL 114 DIE FAMILIE HESSELBACH 157 FERDINAND LASSALLE 127-130, 182, 185 FIDDLER ON THE ROOF 187, 206, 218-219, 237 FISCHKE DER KRUMER, s. DIE KUATSCHE FLUG DES FALKEN 140 FREUNDE IN PREUSSEN 113, 146-152, 183 FÜRCHTE DICH NICHT, JAKOB 224 Gedenket; s. JISKER DER GEHÜLFE 153 GELD - GELD - GELD 113 Die Geschichte der Apostel, s. ΑΤΉ DEGLI APOSTOLI DIE GESCHWISTER OPPERMANN 114 DAS GESPENST 20 DIE GEZEICHNETEN 117, 237 GESÙ DI NAZARETH 20 Das Gewand, s. THE ROBE EIN GEWISSER JUDAS 20 GODSPEL 20 DER GOLEM (1915) 46 LE GOLEM (1936) 46-50 LE GOLEM (1966) 47 GOLEM, L'ESPRIT D'EXIL 4748 DER GOLEM UND DIE Tänzerin 46 DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM 46, 48-57, 76, 116, 187f., 193 GORISONT 218 GOD, MAN AND DEVIL, s. GOT, MENTSCH UN TAJWL GOT, MENTSCH UN TAJWL 203-204, 234 THE GREAT DICATOR 1 THE GREATEST STORY EVER TOLD 20 GREEN FIELDS, s. GRINE FELDER GRINE FELDER 200-201, 233 Grüne Felder, s. GRINE FELDER DAS HAUS IN DER KARPFENGASSE 47 HEINRICH HEINE 113,175-179,182 EIN HERZ UND EINE SEELE 157 HESTER STREET 237 HIOB 233 HOLOCAUST 2,8, 129 HOTEL POLAN UND SEINE GÄSTE 114 ICH - CHRISTIAN HAHN 114, 155-158, 160, 183 IN EINEM JAHR MIT 13 MONDEN 113
269 IN JENEN TAGEN 1 L'INQUffiSTA 21 IZKOR - SKLAVEN DER ERINNERUNG 118 JACQUES OFFENBACH 126, 181 Jankl der Schmied, s. YANKEL DER SCHMID THE JAZZ SINGER 195 JEGO PREWOSCHODITELSTWO 218 THE JESTER, s. DER PURIMSCHPILER JESUS 20 JESUS CHRIST SUPERSTAR 7, 20 JESUS VON OTTAKRING 20 JEW SUESS 77, 91, 100-103, 110, 112, 119, 235 JEWREJSKOJE SCHTSCHASTJE, s. JIDISCHE GLKN JIDISCHE GLIKN 214 216, 218, 231 DER JIDISCHER KENIG LIR 201- 203, 232 JIDL ΜΓΓ DER FIEDEL, s. YIDL ΜΓΓΝ FIDL JISKER 116-118,231 JOHANN SEBASTIAN BACHS VERGEBLICHE REISE IN DEN RUHM 144-146, 147, 183, 186 JOSEPH SÜSS OPPENHEIMER 77, 104, 107-111,114 JUDEL GRA NA SKRZYPACH, s. YIDL ΜΓΓΝ FIDEL DIE JUDEN 181 DIE JUDENBUCHE 164-166, 182 JUD SÜSS 2,9,39, 63, 77, 78-90, 91, 94, 98f„ 112, 119, 186, 192 Jüdisches Glück, s. JIDISCHE GLKN DAS KABINETT DES DR. CALIGARI/DAS CABINETT DES... 51 Kapitel der Vergangenheit, s. MOTL PEJSI DEM CHASNS DER KAUFMANN VON VENEDIG (1969) 42, 181 DER KAUFMANN VON VENEDIG (1990) 184 EIN KIND ΜΓΓ NAMEN JESUS 21, 25 KING OF KINGS 7, 20 DIE KLJATSCHE 196-200, 232, 233, 236 König der Könige, s. KING OF KINGS Lachen durch Tränen, s. MOTL PEJSI DEM CHASNS LANG IST DER WEG 1 THE LAST DAYS OF POMPEJI (1935) 20 THE LAST DAYS OF POMPEJI (1984) 20, 21 THE LAST TEMPTATION OF CHRIST 7, 26 LENZ ODER DIE FREIHEIT 114, 168-171, 183 A LETTER TO MOTHER; s. A BRIVELE DER MAMEN Die letzte Versuchung Christi, s. THE LAST TEMPTATION OF CHRIST THE LIGHT AHEAD, s. DI KLJATSCHE LIST DO MATKI, s. A BRIVELE DER MAMEN LITTLE MOTHER, s. MAMELE
270 LUTHER 33, 41 LUTHER - EIN FELM DER DEUTSCHEN REFORMATION 30-31, 41 MAMELE 225-226, 233 MAN OF ARAN 105 MARTIN LUTHER (1953) 31-32, 41 MARTIN LUTHER (1983, BRD) 37-38, 41 MARTIN LUTHER (1983, DDR) 36-37, 41 MATECKA; s. MAMELE IL MESSIA 7, 20 Der Messias, s. IL MESSIA MIAMI GOLEM 47 MONTY PYTHON'S LIFE OF BRIAN 21 MORITURI 1 Moti der Kantorsohn, s. MOTL PEJSI DEM CHASNS MOTL PEJSI DEM CHASNS 216-218, 232, 236 MRZONK 22 NACKT UNTER WÖLFEN 1 NANNOK OF THE NORTH 104, 105 NATHAN DER WEISE (1956) 28, 126, 181 NATHAN DER WEISE (1964) 28, 126, 181 NATHAN DER WEISE (1967) 128, 126, 181 NATHAN DER WEISE (1970) 28, 126, 182 NATHAN DER WEISE (1979) 28, 126, 182 NATHAN DER WEISE (1984) 28, 126, 183 NATHAN DER WEISE (1989/92) 184 NOSFERATU 51 NOSN BEKER FORT AHEJM 218 OLIVER TWIST 119-124 ON A HEYM 204-205, 233 ONCE UPON A TIME IN AMERICA 162 THE PASSOVER PLOT 20, 23-24 PILATUS UND ANDERE 20 PROFESSOR MAMLOCK 1 DER PROZESS 224, 237 DER PURIMSCHPILER 187, 232 QUO VADIS 7, 9, 20 DEM REBNS KOJECH 223 RECHT, NICHT RACHE: DIE GESCHICHTE DES SIMON WIESENTHAL 1 DER REFORMATOR 33, 41 REVOLUTION IN FRANKFURT 57-62, 113 LA RICOTTA 20 THE ROBE 7, 20 ROBERT UND BERTRAM 112
271 DIE ROTHSCHILDS 2, 77, 78, 90, 112, 119, 186, 192 DER RUF 2 SAMSON AND DELILAH 4 SCHATTEN DER ENGEL 113 DAS SCHÖNE IRRE JUDENMÄDCHEN 29-30, 151 155, 183 SEOUL JESU 20, 22 SHOAH 8 SIMON - UM DIE NEUNTE STUNDE 20 The Singing Blacksmith, s. YANKEL DER SCHMID SLECNA GOLEM 47 SODOMA E GOMORRA 4,10, 11 Sodom und Gomorra, s. SODOMA E GOMORRA STERNE 1 EIN STERN GEHT AUF AUS JAKOB 20 STRANIZY PROSCHLOGO, s. MOTL PEJSI DEM CHASNS DER STUDENT VON PRAG 45 SWOS SLJOSY, s. MOTL PEJSI DEM CHASNS THE TEN COMMANDMENTS 4, 9, 10, 12 DER TEUFEL LEBT NICHT MEHR, MEIN HERR - Ein Totengespräch zwischen Heine und Lessing 177f., 182 Tewje, der Milchmann, s. TEVYE TEVYE bzw. TEVYA 187, 206, 209-211, 233 TEVJE UND SEINE SIEBEN TÖCHTER 187, 206, 213, 234 TEVYA UND SEINE TÖCHTER 187, 206, 211-213, 234 THEODOR HERZL 117 TKIES-KAF 223, 231 TWO WORLDS 192 UNSER WALTER 157 VÄTER UND SÖHNE 115 IL VANGELO SECONDO MATTEO 7, 20 VARIETÉ 188 IL VECCHIO TESTAMENTO 11 VERTEIDIGUNGSREDE DES JUDAS 21, 25 A VILNA LEGEND 223 LA VOIE LACTÉE 20 WALTHER RATHENAU - ANATOMIE EINES ATHENTATS 113 THE WANDERING JEW 100 WENN IHR WOLLT, IST ES KEIN MÄRCHEN 237 WHOLLY MOSES 13 WITHOUT A HOME, s. ON A HEYM YANKEL DER SCHMID 227 YENTL 224 THE YIDDISH KING LEAR , s. DER JIDISCHER KENIG LIR YEDDLE WITH HIS FIDDLE, s. YIDL ΜΓΓΝ FIDL
272 YIDL ΜΓΓΝ FIDL 187, 226-228, 232 YIZKOR, s. JISKER Die zehn Gebote, s. THE TEN COMMANDMENTS DIE ZWEITE VERTREIBUNG AUS DEM PARADIES 114, 172-175, 183


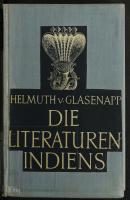


![Geschichte der Kunst: Von der altchristlichen Zeit bis zur Gegenwart [Neu durchgesehene Aufl., Reprint 2022]
9783112641408](https://dokumen.pub/img/200x200/geschichte-der-kunst-von-der-altchristlichen-zeit-bis-zur-gegenwart-neu-durchgesehene-aufl-reprint-2022-9783112641408.jpg)




![Jüdische Lebenswelten in Spielfilmen und Fernsehspielen: Filme zur Geschichte der Juden von ihren Anfängen bis zur Emanzipation 1871 [Reprint 2012 ed.]
9783110952124, 9783484340350](https://dokumen.pub/img/200x200/jdische-lebenswelten-in-spielfilmen-und-fernsehspielen-filme-zur-geschichte-der-juden-von-ihren-anfngen-bis-zur-emanzipation-1871-reprint-2012nbsped-9783110952124-9783484340350.jpg)