Güter und Ungüter: Eine Freundesgabe für Gerhard Merk zum 60. Geburtstag [1 ed.] 9783428470891, 9783428070893
135 55 13MB
German Pages 161 Year 1991
Polecaj historie
Citation preview
Güter und Ungüter Eine Freundesgabe für Gerhard Merk
Güter und Ungüter Eine Freundesgabe für Gerhard Merk zum 60. Geburtstag
herausgegeben von
Hans Gerd Fuchs, Alfred Klose und Rolf Kramer
Duncker & Humblot · Berlin
CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Güter und Ungüter: eine Freundesgabe für Gerhard Merk zum 60. Geburtstag I hrsg. von Hans Gerd fuchs ... Berlin: Duncker und Humblot, 1991 ISBN 3-428-07089-5 NE: Fuchs, Hans Gerd [Hrsg.]
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, für sämtliche Beiträge vorbehalten © 1991 Duncker & Humblot GmbH, Berlin 41 Fotoprint: Wemer Hildebrand, Berlin 65 Printed in Germany ISBN· 3-428-07089-5
VORWORT Auch heute noch ist es die herrschende Meinung in der Nationalökonomie, daß ein Gut das ist, was von den Menschen nachgefragt und im Produktionsprozeß erzeugt wird. Es stiftet immer einen Nutzen. Mehr auszusagen überschreite die Grenze dieser Disziplin. Gar die wirksame Nachfrage nach nicht "rein" ökonomischen Gesichtspunkten kritisch zu sichten, sei eine "Urteilsanmaßung". Entsprechend ist auch die Berechnung des Sozialproduktes eine bloße quantitative Aufstellung des Erzeugten geblieben. Daß diese "positive" (richtiger: ideologisch-positivistische) Sicht der Dinge zutiefst inhuman und letztlich ein Zerrbild des Wirtschaftens ist, hat Gerhard Merk in seinen Vorlesungen, Seminaren und Lehrbüchern oft genug deutlich hervorgehoben. Er tat dies bereits zu einer Zeit, als so gut wie niemand von derartiger Besinnung hören wollte und man daher bei diesem Thema gelangweilt oder verärgert abwinkte. Sehr tief ist Gerhard Merk in seiner iin Jahre 1985 bei Duncker & Humblot erschienenen Schrift "Grundbegriffe der Erkenntnislehre für Ökonomen" solchen Überlegungen nachgegangen. Jenes schlichte Lehrbuch (es wurde auch ins Polnische übersetzt) begründet anschaulich die Notwendigkeit von Werturteilen auch in der Ökonomik. Es leitet darüber hinaus einsichtig entsprechende Maßstäbe her. In Zusammenhang mit den damit verbundenen Kontroversfragen hat Ger~ard Merk immer wieder den Begriff "Ungüter" gebraucht. In einem Beitrag zur WeilerFestschrift 1989 hat er diesen Terminus näher umrissen. Dies sowie den 60. Geburtstag von Gerhard Merk am 8. Mai 1991 nahmen wir, seine Freunde, zum Anlaß, auf jenes höchst wichtige, aktuelle und auch noch in weiterer Zukunft entscheidende Thema näher einzugehen.
Wir hoffen, damit der Besinnung auf das Grundanliegen der Wirtschaft und der sie reflektierenden Wissenschaften einen Schritt weitergeholfen zu haben. Die Herausgeber
INHALT Zur Defmition der Ungüter Von Doris Böggemann, Essen
Gibt es Ungüter? Eine philosophische Annäherung an das Problem Von Karl Heinz Grenner, Wetter ... . . ..... . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. ...
11
Ungüter und ethische Verantwortung Von Friedrich Beutter, Luzem .. .. . .... .. ...... .. .. .. . ... .. ... . . . . . . . . . .... ... . .. .
23
Tugend zwischen "Gut" und "Ungut" Von Ludwig Watzal, Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Ethische Grenzen bei der Herstellung und Verwendung von Gütern Von Rolf Kramer, Berlin . . . .. ... ... ...... .... .. . . . . . . . . . . . . ..... .......... .. ... . ..
47
Das rechtliche Verbot der Ungüter Von Alfred Klose, Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Ungüter und Gesundheit Von Lotbar Schneider, Regensburg .. . . .. .... .. .. ... . . ... . . . . . . . . . . . . . . ......... ..
77
Umlegung und Vermeidung von Ungütem- eine Herausforderung für Politik und Wirtschaft im Umgang mit der naturalen Umwelt Von Heribert Lehenhofer, Wien ... . . . .. .. .. . . . . . . . . . . ........ .. . . . . . . . . . . . . .. . . ..
89
VIII
Inhalt
Die Messung von Ungüterwirkungen Von Heinz Steinmüller, München . . . . . ............ ......... .. .... .. . . . ... ........
113
Der Beitrag der Erziehung zur Einschränkung der Ungüter Von Manfred Hermanns, Harnburg ...............................................
129
Verzeichnis der Autoren ....... .. .. ....... ... . . . .. ........ .. . . ....... .. ...... ........
147
Sachwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149
ZUR DEFINITION DER UNGÜTER Von Doris Böggemann, Essen
In seinem Beitrag zur Festschrift für Rudolf Weiler hat sich Gerhard Merk bemüht, Ungüter nach verschiedenen Seiten hin näher zu umreißen.1 Daran möchte ich anknüpfen und erstens Schwierigkeiten bei einer Definition des Begriffes Ungut aufzeigen, zweitens eine akzeptable und doch treffende Begriffsbestimmung versuchen sowie drittens eine zweckmäßige, auch dem "Laien" verständliche Einteilung der Ungüter einführen.
A. Möglichkeit einer Definition Um leicht aufkommenden Mißverständnissen vorzubeugen, will ich einige Fachbegriffe der Logik vorstellen. Mit Merk verstehe ich unter einem Begriff (conceptus, notio) eine Denkeinheit, in der Eigenschaften und Zusammenhänge (beide: Merkmale; notae) von Gegenständen erfaßt sind. 2 Der Begriff ist die "simplex apprehensio rei in mente facta. 103 Gegenstand (Ding, Objekt; objectum) ist dabei alles, was zur Kenntnis genommen, vorgestellt oder gedacht wird, und worüber man Urteile (als Aussagen über das logische Verhältnis von Begriffen zueinander) bildet.4 Sprachliches Zeichen des Begriffes ist seine Benennung (Terminus, Wort). Der Begriffist das Gedachte (species intelligibils). Die Benennung 1
Gerhard Merk: Konßiktstau durch Ungüter, in: Alfred Klose, Heribert Franz Köck und Herbert Schamheck (Hrg.): Frieden und Gesellschaftsordnung. Festschrift für Rudolf Weiler zum 60. Geburtstag. Berlin (Duncker & Humblot) 1988, S. 197-211.
2 Siehe Gerhard Merk: Grundbegriß'e der Erkenntnislehre für Ökonomen. Berlin (Duncker & Humblot) 1985, S. 12. 3 Siehe Sebastian Huber: Logik und Noetik im Geiste des hl. Thomas von Aquin. Paderborn (Schöningh) 1906, S. 11. 4
Siehe Gerhard Merk: Grundbegriffe der Erkenntnislehre, S. 95 (Übersicht 18).
2
Doris Böggemann
ist das Zeichen des Gedachten, der "sonus articulatus ex intentione &liquid significandi prolatus. " 5 Die Definition gibt an, was ein Gegenstand ist. Definieren heißt, einen Begriffinhaltlich durch bereits bekannte Begriffe zu beschreiben. 6 Mit Merk halte ich die Definition der Ungüter grundsätzlich für möglich und für dringend nötig, ohne behaupten zu wollen, daß es eine "vollkommene" Begriffsbestimmung gäbe. Als in der Politikberatung tätige Sozialwissenschaftlerin weise ich aber alle Behauptungen zurück, die Dinge der wirtschaftlich-technischen Realität seien nicht erkennbar oder nicht begrifllich bestimmbar oder gar bloß Widerspiegelungen des individueRen Bewußtseins. Das Denken kann sicherlich die Erscheinungen des sozialen Lebens erfassen. Inwieweit dabei Einschränkungen vorzunehmen sind, mögen die erkenntnistheoretischen Schulen diskutieren. 7 Anzumerken bleibt, daß an diesen Diskussionen Techniker und Ökonomen so gut wie gar nicht beteiligt sind. Sobald sich diese mit Logik befassen- wie unser Freund Gerhard Merk in seiner "Erkenntnislehre" geht die Diskussion vom Verschwommenen, Ambiguösen zum Konkreten, vom sprachlich Vagen zum Begreiflichen.
B. Definition der Güter In der internationalen ökonomischen Literatur herrscht Einigkeit darüber, daß -Güter zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse taugliche Dinge sind, die den Gegenstand des Tausches und einer wie immer auch gearteten Preisbildung bilden. Bedürfnis ist "das Erstreben eines subjektiven Wohlfahrtszuwachses, der nur durch wirtschaftliches Handeln erreicht werden kann. " 8 Der BegriffGüter ist ein AJJgemeinbegriff. Von mehreren realen Einzelgegenständen wird ausgesagt, daß ein Merkmal in allen Gütern verwirklicht ist. Diese Washeit (quidditas) als universale directum ist die Fähigkeit zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Damit ist das Sosein des Inhalts des Begriffes Güter als eine akzidentielle Eigenschaft ausgedrückt, nämlich 5 Siehe Sebastian Huber: Logik und Noetik, S. 19. 6 Siehe Gerhard Merk: Grundbegriffe der Erkenntnislehre, S. 13 f. 7 Siehe hierzu ausführlicher Joseph de Vries: Denken und Sein. Ein Aufbau der Er-
kenntnistheorie. Freiburg i. Br. (Herder) 1937, insbes. S. 141-297. 8 Gerhard Merk: Programmierte Einführung in die Volkswirtschaftslehre, Bd. 1. Wiesbaden (Gabler) 1973, S. 53.
Zur Definition der Ungüter
3
als Tauglichkeit zur Bedü:rfnisbefriedigung. Mit anderen Worten: es handelt sieh um eine bloße Deskriptivdefinition, die ein Objekt ledigliclt nach einer Zweckursache (Tauglichkeit zur Bedü:rfnisbefriedigung) beschreibt.9 Nimmt man mit Merk die Washeit des Güterbegriffes genauer unter die Lupe, 10 so bedeutet Bedürfnisbefriedigung Erseugung von Einzelwohl. Das Gut dient zunächst dem einzelnen Menschen zur persönlichen Lebenserfiillung. Über diesen Effekt hinaus wirkt es dann auch gemeinwohlfördernd, wie Merk in der zitierten Abhandlung ausführlieh begründend darlegt. Nun gilt es an dieser Stelle vor einem naheliegendm Fehlschluß zu warnen. Man könnte negativ definieren: was kein Einzelwohl erzeugt, ist ein Ungut. Aber die Washeit des Güterbegriffes als eine bloß auf die Zweckursache (Bedürfnisbefriedigung) gerichtete akzidentielle Eigenschaft erlaubt eine solehe Folgerung nicht! Denn der Begriff Güter sagt über deren Natur (Wesen; essentia) gar nichts aus. Es werden weder physische noch metaphysische Bestandteile des Begriffes Güter in der vorgestellten Definition angegeben. Anders ausgedrückt: was Güter "an sieh", ihrer "Natur" nach sind, definiert die Ökonomik nicht. Sie nennt nur eine zufällige, "un"-wesentliche Eigenschaft als Merkmal. Ein Gut ist daher in seinen trennbaren Teilen (physisch) genauso wenig definiert wie als differentia specificata, nämlich in dem Sein, das dem Gut zukommt (metaphysisch). 11 Es läßt sich allenfalls sagen, daß Dinge ohne die Zweckursache "Bedürfnisbefriedigung" Nicht-Güter sind.
C. Definition der Ungüter Wenn man mit Merk die Bedürfnisbefriedigung zu Recht dem Einzelwohlzuwachs gleichsetzt, so läßt sich aus dem begriffsbestimmenden Merkmal des Begriffes Güter (der Zweckursache) auch das wesentliche Merkmal für den Begriff Ungüter erkennen. Ungüter sind Dinge, die dem Einzelwohl schaden. Weil aber Einzelwohl und Gemeinwohl voneinander abhängig sind, läßt sich auch definieren: Ungüter sind Dinge, die dem Einzelwohl und dem Gemeinwohl schaden. 9 Siehe Sebastian Huber: Logik und Noetik, S. 16. 10 Siehe Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 201 f. 11 Siehe Sebastian Huber: Logik und Noetik, S. 12.
4
Doris Böggemann
Im Unterschied su Merk12 versichtet diese Definition völlig aul den Begriff Bedürfnisbefriedigung und damit auf die ökonomische Wohlstandsänderung. Dieser Versicht scheint mir angebracht, um subjektive Komponenten aus der Betrachtung auszuschließen. Der Begriff Bedürfnis aber ist ein soleher subjektiver Begriff. Merk gießt ihn durch einen "Trick" in den (scheinbar) objektiven Terminus Verwendung um. Es ist augenscheinlich, daß die gegebene Definition - genau wie die analog konstruierte Bestimmung des Begriffes Güter - weder die physisehe noch die metaphysische Seite eines Unguts beschreibt. Sie läßt die Frage nach dem Wesen des Unguts völlig offen und beschränkt sieh lediglich auf eine äußere Wirkung. nämlich dem Einzelwohl su schaden. Diese sunäehst begriffslogische Festlegung erweist sieh als sachlich, als ökonomisch durchaus gerechtfertigt. Ein Ding mag zwar in seinen trennbaren Teilen zutreffend und genauestens definiert sein; beispieJsweise Cocain in seiner Strukturformel. Aber mit einer solchen Wesensdefinition hat man für die ökonomische Fragestellung gar nichts gewonnen. Ist doch bekannt, daß Cocain einmal als Gut (als Medizin), sum andern als Ungut (als SuehtmiUel) erscheinen kann. Einzig und allein eine äußere Wirkung, nämlich einem bestimmten Zweck (dem Einzelwohl) su dienen oder nicht, kennzeichnet das Cocain als Gut oder Ungut. Nun muß ich noch die Behauptung begründen, daß der Begriff Einzelwohl im Gegensatz zum Begriff Bedürfnis ein objektiver Begriff sei. Dies ergibt sieh negativ zum ersten schon formallogisch aus der Definition. Bedürfnis ist immer Gefühl eines Mangels in jedweder Intensität- bis hin zur Sucht. Einzelwohl hingegen ist ein vorgegebenes, genau bestimmbares naturhaftes Trachten des Menschen.
"Ziel eines jeden Menschen ist es, sieh su entfalten, sieh selbst su verwirklichen: sein Wohl su erreichen. Der Einzelne möchte zum Vollen kommen; er strebt danach, seine Anlagen (alles bei der Geburt in die Welt Mitgebrachte) als Person ausformen su können: sieh zu vervollkommnen. Das ist ersiehtlieh in seine Natur (sein Wesen) hineingelegt. Natur bezeichnet dabei das durch die Geburt Entstandene, Urwüchsige, Vorgegebene. Es meint den inneren Bauplan: die Eigen=Art, wie sie jedem Menschen aufgrund seiner Individualität vom Ursprung her als ihn besonders kennzeichnende Veranlagung zukommt und als zielleitende Kraft (Entelechie) des Werdens und Lebens wirkt." 13 12 Siehe Gerhard Merk: Konßiktstau durch Ungüter, S. 202. 13 Gerhard Merk: Grundbegriffe der Erkenntnislehre, S. 64.
Zur Definition der Ungüter
5
Darauf hinsuweisen ist, daß Gerhard Merk in Anlehnung an Oswald von Nell-Breuning und andere14 den Begriff Einzelwohl (bonum individuale) genauer in Einseigut (Privatgut) als Zielbegriff und Einzelwohl (Privat wohl) als Mittelbegriff trennt. Einseigut ist die persönliche Selbstverwirklichungjedes Menschen. Einzelwohl ist die der Selbstverwirklichung dienende willentliche Lebensgestaltung des Individuums. 15
D. Soziale Dimension der Ungüter Wenn ich in enger Anlehnung an Merk definiere: Ungüter sind Dinge, die dem Einzelwohl schaden, so muß meines Erachtens gegen Merk auch gefolgert werden, daß sie in jedem Falle ebenso dem Gemeinwohl schaden. Dies folgt aus der Interdependenz von Einzelwohl und Gemeinwohl. Merk unterscheidet auch beim Gemeinwohl (bonum commune) wieder den Zielaspekt vom Mittelaspekt. Das Gemeingut besteht "im Falle der Gesellschaft als Ganzes ( ... ) im leiblichen und geistigen Wohlergehen aller Menschen bei Selbstverwirklichung des Einzelnen." 16 Es ist nun offenkundig, daß dann, wenn einzelne Menschen sich durch Ungüter Schaden zuiugen, diese durch ihre Entscheidung auch das alle umgreifende Wohlergehen der Gesellschaft (die sich ja aus einzelnen Menschen zusammensetzt) behindern. Das Gemeinwohl kennzeichnet "die richtige Verfaßtheit in Hinblick auf die Verwirklichung des Zieles: die Gemeingliederung" . 17 Zwei Aspekte unterscheidet Merk: die Gemeingliede2:ung als organisatorische Sicht und das zum zielleitenden Handeln iuhrende Zusammenbringen, Ausrichten und Zusammenhalten sämtlicher Gesellschaftsmitglieder. die organisierende Sicht. Auch hier ist ohne weiteres erkennbar, daß dieses zielleitende Handeln nicht erreicht werden kann, wenn einige Mitglieder der Gesellschaft sich selbst Schaden zuiugen. Mit Gerhard Merk kann man daher sagen:" Einzelwohl und Gemeinwohl hängen ersichtlich voneinander ab. Das Einzelwohl der Glieder (etwa: Kinder, Unternehmen) trägt das Gemeinwohl des Ganzen (im Beispiel: Familie, Volkswirtschaft). Dieses seinerseits aber ermöglicht und fördert 14 Siehe Eberhard Welty OP: Herders Sozialbtechismus. Bd. 1: Grundfragen und
Grundkräfte des sozialen Lebens, 4. Auß. Freiburg, Basel, Wien (Herder) 1963. S. 64 f. 15 Siehe Gerhard Merk: Grundbegriffe der Erkenntnislehre, S. 64 (Übersicht 7). 16 Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 200. 17 Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 201.
6
Doria Böggemann
das Einzelwohl der Glieder." 18 Daraus folgt aber, daß die Nachfrage nach Ungütern notwendig und in jedem Falle auch eine soziale Folgewirkung haben muß. Diese Konsekution kann relativ gering sein (einer von einer Million nimmt Rauschgift) oder relativ gewichtig sein (einer in einer Familie von vier Mitgliedern nimmt Rauschgift). Aber aus der Tatsache der Gemeinverstrickung als ein in der Wirklichkeit vorhandener Sachverhalt verbietet sieh logisch eine bloß auf das Individuum bezogene Betrachtungsweise der Ungüter. Hinweisen möchte ich darauf, daß es natürlich auch direkt und primär das Gemeinwohl beeinträchtigende Ungüter gibt. Diese sind dann aber ex eonsequenti auch einzelwohlsehädigend. Als Beispiel sei die Sucht "wichtiger" (sprich: prestigebedürftiger) Persönlichkeiten genannt, selbst kleinere Wegstrecken nur mit dem Flugzeug zurückzulegen. Die Abgase der Flugzeuge schädigen alle Menschen der Erde. Der Fluglärm rund um die Flughäfen beeinträchtigt die dort wohnenden Menschen erheblich. Überdies sind gute 40 Prozent der An- und Abflüge auf dem Flughafen Frankfurt Inlandsflügel
E. Objektivitätskriterien Aus der gegebenen und begründeten Definition Ungüter sind Dinge, die dem Einzelwohl und dem Gemeinwohl schaden, lassen sieh entferntere und nähere konkrete Kriterien: das heißt: genau anspreehbare Gegenstände (Objekte) ableiten. Einmal kann man das aus dem AllgemeinbegrifF "Dinge", zum andern aus dem AllgemeinbegrifF "Einzelwohl". Ding (Gegenstand, Objekt) kann etwas Greifbares, Faßbares und Lagerungsfähiges sein, wie etwa Alkohol oder Zigaretten.19 Es handelt sieh in diesem Fall in Bezug auf die Definition der Ungüter um sachliche Ungüter. Niehtgreifbare, nichtfaßbare und im Regelfall auch nicht lagerungsfahige Dinge, wie etwa überlaute Diskomusik oder ziellosm Autofahren, sind in Hinblick auf die hier zu erläuternde Definition nichtsachliche Ungüter. Letztere sind nur negativ zu den sachlichen Ungütern abgegrenzt, analog zu den Waren und Dienstleistungen der Ökonomik. Daß unter nichtsachliehe Ungüter auch Erscheinungen wie raseher Modewechsel gezählt werden 18 Gerhard Merk: Konßiktstau durch Ungüter, S. 201. 19 Siehe Gerhard Merk: Konßiktatau durch Ungüter, S. 202.
Zur Definition der Ungüter
7
können, zeigt Merk an einem sehr einprägsamen Beispiel in der Festschrift für Alfred Klose. 20 Einzelwohl als Oberbegillf gliedert sieh diehotomiseh in Einze)gut als Zielbestimmung und Einze]gliederung als Weg zur Verwirklicltung des Einzelgutes. Einzelgut als Ziel eines jeden Menschen meint die persönliche Selbstverwirklicltung. Diese setzt die körperliche und geistige Funktionsfiihigkeit gleichsam als materiellEn Unterbau voraus. Gegenstände, welche primär der körperliehen Lebenskraft des Menschen schaden, sind leib-schädigende Ungüter. Was in erster Linie die geistige Gesundheit beeinträchtigt, sind geist-schädigende Ungüter. Das Wort "primär", "in erster Linie" trägt der Tatsache Rechnung, daß aus naturwissenschaftlicher Sicht eine geistige Krankheit auch eine körperliche Auswirkung hat und viee versa. Aus Gründen der Vereinfachung bleibe ich bei der Zweiteilung Leib-Geist; unter "Geist" subsumiere ich auch die "Seele". Kleinere Gruppen, denen Merk ein eigenes Einzelgut zuschreibt und als Beispiel einen Sportverein oder Betrieb nennt, 21 werden durch Ungüter durch und über ihre Mitglieder beeinträchtigt. - An für sich genügte es, bloß "leibliche" bzw. "geistige" Ungüter zu sagen, weil in dem Begriff Ungut das Schädigende ja per definitionem schon enthalten ist. Ich denke aber auch an die praktische Verwendung der Termini. Da scheint es besser, das Hendiadioyn hinzunehmen und dem logisch korrekten den sprachlich klareren Terminus vorzuziehen. Einze)gliederung ist die der Selbstverwirklichung dienende, willentliche Lebensgestaltung des Menschen bzw. kleinerer Gruppen. Was deren zielleitende Gestaltung hindert, ist ein ordnungs-schädigendes Ungut. Zu dieser Art der Ungüter gehört auch alles, was der Gemeinwohlerreichung (der Gemeinwohlgliederung) schadet. 22
F. Einteilung der Ungüter In Abweichung zu Merk gelange ich damit zu einer anderen Einteilung der Ungüter, definiert als Gegenstände, die dem Einzelwohl und dem Gemeinwohl schaden. 20 Siehe Treugott Stillingsfreund ( = Gerhard Merk): Stillingiana Alfrediana. Einige nachtodliehe Begegnungen mit Johann Heinrich Jung-Stilling. Dlic 1988, S. 51 ff. 21 Siehe Gerhard Merk: Konß.iktstau durch Ungüter, S. 201. 22 Siehe Gerhard Merk: Konß.iktstau durch Ungüter, S. 204 (Übersicht 2).
8
Doris Böggemann
Ich unterscheide nach der spezifischen Dift'erenz (dift'erentia specificata) der schädigenden Objekte sachliche Ungüter und nichtsachliche Ungüter. Nach dem geschädigten Objekt durch die Ungüter teile ich ein in leibschädigende Ungüter, geist-schädigende Ungüter und ordnungs-schädigende Ungüter. Die Definition beruht hier letztlich auf einer zufälligen Eigenschaft (accidens separabile) der schadenverursachenden Dinge, nämlich den Leib, den Geist oder die Lebensordnung zu beeinträchtigen. Das "bedingte Gut" bei Merk23 ist ein (nichtsachliches) ordnungsschädigendes Ungut. Das "bedingte Ungut" erweist sich im Lichte dieser Einteilung als (nichtsachliches) leilrschädigendes Ungut. Das "neutrale Ungut" ist ein (nichtsachliches) geist-schädigendes Ungut und das "reine Ungut" ist ein (sachliches) leilrschädigendes Ungut. Sicher ist die hier entwicklete trichotomische Einteilung der Ungüter -zumindest von der Praktikabilität der Unterscheidung und Benennung her beurteilt - klarer und übersichtlicher als die von Merk entwickelte Division. Merk kompliziert durch seine in die Definition hineingenommene -meines Erachtens unnötige- Unterscheidung von Individualschaden und Sozialschaden die Begrift'sbestimmung - wie er selbst auch indirekt eingesteht. 24 Diese Kritik soll aber nicht meine Achtung, ja auch Bewunderung vor der gedanklichen Leistung von Gerhard Merk verdecken. Denn ich habe keine klarere und überzeugendere sowie auch logisch und sozialphilosophisch bessere Abhandlung zu den Ungütern gefunden. 23 Siehe Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 204 (Übersicht 3: Unterschiedliche Güter und Ungüter). Dort wird wie folgt unterschieden:
Die Wohlstandsveränderung infolge der Güterverwendung ist für den Einzelnen positiv negativ negativ negativ
Benennung
die Gesellschaft negativ positiv indifferent negativ
bedingtes Gut bedingtes Ungut neutrales Ungut reines Ungut
24 Siehe Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 208.
Zur Definition der Ungüter
9
G. Intensität der Ungüter Ungüter, definiert als Dinge, die dem Einzelwohl und dem Gemeinwohl schaden, haben auch eine intensive Dimension, das heißt: sie wirken in unterschiedlicher Stärke. Darauf ist Merk nicht expressis verbis eingegangen. Rein logisch ist das Merkmal "schaden" in der vorgestellten Definition unbestimmt. Auch die eingeführte Unterscheidung in Personenschaden (noxa in personam) in Form von körperlichem Schaden (vitium) oder geistigem Schaden einerseits und Sachschaden (noxa in rem) als Hinderung der ziellätenden Lebensgestaltung (beim ordnungs-schädigenden Ungut) andrerseits sagt über Grade der Schädigung nichts aus. Nun ist sicherlich die Trichotomie "leicht", "mittel", "stark" auch auf den Schaden anwendbar. Der Techniker, der Arzt, der Ökonom und jeder Mensch im Alltag wird zunächst nach diesem Raster, nach dieser Kriterienkette einen entstandenen Schaden einschätzen. Eine Komparabilität - zumindest in ordinaler Folge wie hier2 5 - läßt sich wohl in jedem Falle vornehmen, wenngleich keine Mensurabilität, also keine exakte größenmäßige Erfassung, weil es im Regelfall keinen objektiven Maßstab gibt. Ein Ungut, das leichten Schaden verursacht, nenne ich leichtes Ungut (antibonum mite). Einen mittleren Schaden bringendes Ungut heiße ich mäßiges Ungut (antibonum moderatum). Ist die Schadensintensität stark, so nenne ich es schweres Ungut (antibonum {orte). Bei dieser Einteilung fehlt allerdings der Zeitaspekt. Es kann sein, daß etwa die Verwendung bestimmter Treibgase in Sprühflaschen jetzt nur als mäßiges Ungut betrachtet wird, dies aber längerfristig zu einem schweren Ungut wird. Es gilt also bei den Intensitätsangaben stets den Zeitbezug beizufügen. Ist ein Ungut jetzt oder später (wann später?) als leicht, mittel oder schwer einzuschätzen? Es fehlt ferner- wie bereits hervorgehoben- bei dieser rein formalen, komparativen Unterscheidung der objektive Maßstab der Beurteilung. Dieser muß in Abhängigkeit von der Art des Unguts gesehen und wenn möglich - entsprechend eingeführt werden. Etwa ist das ziellose Autofahren auf unserem Straßennetz ab einer gewissen Anzahl von 25
Siehe die analogen Ausführungen zum Nutzen bei Gerhard Merk: Mikroökonomik. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz (Kohlhammer) 1976, S. 34. - Das Werk ist überdies eine beachtliche logische und erkenntnistheoretische Bereicherung der ökonomischen Lehrbuchliteratur, erst recht im Vergleich zu den sonst meist platten, den Vorfragen des Erkenntnisaktes gegenüber blinden Fachbüchern der Ökonomik.
10
Doris Böggemann
Fahrzeugen objektiv als schweres Ungut zu klassifiziexen. Ähnliches gilt für das Verhalten eines Kettenrauchers, der täglich 80 Zigaretten "genießt".
H. Zusammenfassung
In Anlehnung an Gerhard Merk möchte ich meine Gedanken in einer Übersicht zusammenfassen. Was ich jedoch ausdrücklich nicht behaupten möchte ist, daß nun meine Definition und Division der Ungüter der Weisheit letzter Schluß sei! Es ist zu begrüßen, daß sich im Rahmen dieser Festschrift Wissenschaftler verschiedener Disziplinm. mit diesem Problem beschäftigen - das erste Mal, soviel mir bekannt ist. Wenn sich daraus nur wenige Anregungen für ein wissenschaftlich bisher nicht bewältigtes Problem ergeben, so lohnt sich - über den Anlaß dieser Festschrift hinaus -die Mühe der Kontributoren.
ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT Definition: Ungüter sind Dinge, die dem Einzel- und dem Gemeinwohl schaden. Einteilung nach der Gegenständlichkeit der Ungüter: sachliche Ungüter nichtsachliche Ungüter Einteilung nach dem Gegenstand des Schadens: leib-schädigende Ungüter geist-schädigende Ungü ter ordnungs-schädigende Ungüter Einteilung nach der Intensität des Schadens: leichte Ungüter mäßige Ungüter schwere Ungüter
GIBT ES UNGÜTER? Eine philosophische Annäherung an das Problem
Von Karl Heinz Grenner, Wetter
A. Der Ausgangspunkt: Volkswirtschaftliche Feststellungen
In einer Festschrift, in deren Beiträgen Grundsatzfragen der Konßiktforsehung erörtert werden, hat Gerhard Merk einen anregenden Aufsatz verö:ff'entlieht, dessen Zielrichtung es ist, die gesellschaftliehe Wirkung des Gebrauchs von Ungütern darzustellen. 1 In seinen Ausführungen geht Merk das Problem von der volkswirtschaftliehen Seite aus an und legt dabei den in der Volkswirtschaftslehre gängigen Güterbegriff zugrunde: "Güter (goods) in diesem Sinne sind zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse taugliche Mittel, die Gegenstand des Tausches und einer bestimmt gearteten Preisbildung sind." 2 Solehe Güter zu besitzen und zu genießen, mehrt den Wohlstand -sei es bei einzelnen oder/und in der Gesellschaft insgesamt. Wohlstandsänderung wird als ökonomisch meßbar angenommen. So erscheint es nur folgerichtig, wenn für den Fall, daß durch die Verwendung eines Guts eine Wohlstandsminderung erfolgt, dieses "Gut" mit dem Begriff' "Ungut" belegt wird. Durch die Anführung und Gruppierung von Beispielen der Wohlstandsänderung für den einzelnen wie für die Gesellschaft gelangt Merk zu einer eindrucksvollen Außistung und Definition von je drei Arten von Gütern und Ungütern. 1
Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, in: Alfred Klose, Heribert Franz Köck und Herbert Schamheck (Hrg.): Frieden und Gesellschaftsordnung. Festschrift für Rudolf Weiler zum 60. Geburtstag. Berlin (Duncker & Humblot) 1988, S. 197-211.
2 Gerhard Merk, Konfliktstau durch Ungüter, S. 200; vgl. auch ebenda, S. 202 und
Erich May: Das Wirtschaftsgut. Kritische Analyse der steuerlichen Lehre vom Wirtschaftsgut aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Wiesbaden (Gabler) 1970, S. 14-22.
12
Karl Heinz Grenner
"Reines Ungut" bewirkt sowohl f'ür den einzelnen als auch f'ür die Gesellschaft eine völlig negative Wohlstandsänderung. Im vorgestellten Zusammenhang ist also die Feststellung eines f'ür das Einzelwohl wie in bestimmten Fällen auch f'ür das Gemeinwohl kostenverursachenden Schadens maßgebend f'ür die Definition der Ungüter, nicht dagegen die subjektive oder kollektive Einschätzung einer Sachefeines Sachverhalts als Unwert. Merk legt seiner Bestimmung von Gütern und Ungütern einen rein wirtschaftswissenschaftlichen Maßstab zugrunde. "Das Wesen (die Natur, quiddity) des Gutes selbst"- und so könnte man hinzufügen: das Wesen des Unguts selbst- "bleibt dabei ganz außer Betracht." 4 Merk kommt es auf die feststellbare Wirkung an. Jedoch wird an einigen Stellen der Beispielaufzählung und der daraus abgeleiteten Feststellung, ob Gut oder Ungut, auch deutlich, daß die positive oder negative Wirkung, die bei Merk f'ür die Unterscheidung zwischen Gut und Ungut maßgeblich ist, entscheidend vom Tun einzelner Menschen abhängt. 5 Auch unter volkswirtschaftlichen Aspekten ist bei der Bestimmung der Güter wie der Ungüter also offenbar nicht vom Tun des Menschen abzusehen. Wenn dem so ist, dann mag es angebracht sein, die volkswirtschaftliche Untersuchung zum Anlaß zu nehmen, dem interessanten Thema "Ungüter" auch mit philosophischen Überlegungen aus Metaphysik und Ethik sich zu nähern. In diesem Zusammenhang bieten sich dann etwa folgende Leitfragen an: Gibt es überhaupt wesenhaft Ungüter? Wie ist in der philosophischen Tradition über den Unterschied zwischen dem Positivum (Gut) und dem Negativum (Ungut) gedacht worden- wenn es denn überhaupt ein Seiendes geben könnte, das von Natur aus, wesenhaft, nicht gut wäre? Sind Bedingungen denkbar und aufweisbar, unter denen ein Gut sich so verändert, daß es mit einer gewissen Berechtigung als "Ungut" angesehen werden könnte? Entsprechenden Überlegungen soll in diesem Beitrag Raum gegeben werden. Einige Anregungen f'ür das Wirtschaften und und den verantwortlichen Umgang mit Gütern werden dann den Abschluß bilden.
3 Vgl. in diesem Band Doris Böggemann: Zur Definition der Ungüter, S. 3 ff.
4 Gerhard Merk, Konfliktstau durch Ungüter, S. 203. 5 Gerhard Merk, Konfliktstau durch Ungüter, S. 202: Für Individualnutzen und Gesellschaftsfolgenutzen (wie deren Gegenteil) ,.ist die individuelle Entscheidung des Verbrauchers Ausgangspunkt."
Gibt es Ungüter?
13
B. Blick in die philosophische Tradition
In unserer Sprache ist "das Gute" ein substantiviertes Adjektiv. In einem ähnlich gelagerten Fall drückt die Sprache das entsprechende Substantiv mit dem Begriff "Schönheit" aus. Vergleichbar müßte also der Begriff "Gutheit" verwendet werden. Doch dieses Wort ist ungebräuchlich. Aber auch der Begriff "das Gute" ist hauptsächlich ein Begriff des philosophischen Sprechens geblieben, wenn auch durchaus mit Bezielmngen zum und in Wechselwirkung mit dem Sprachgebrauch des Alltags und der Literatur. Die Zuschreibung der bejahenswerten Qualität "gut" kann - anders als bei anderen Eigenschaften - auf eine sehr große und unterschiedliche Schar von Trägern einer mit "gut" bezeichneten Eigenschaft hin erfolgen. Sie lenkt aber über die Vielfalt der Eigenschaftsträger hinaus den Blick auf die gemeinte Qualität selbst, auf das Gute an sich, das alle Seinsgattungen oder Kategorien überschreitet. Doch kennt der philosophische Sprachgebrauch nicht nur eine absolute Bedeutung des Begriffs "gut". Er verwendet ihn auch in einer relativen (besser: relationalen) Bedeutung. In seiner absoluten Bedeutung kommt das Gute eines Wesens oder Dings dem Begriff der Vollkommenheit nahe. Gut ist etwas dann, wenn es ganz oder in hohem Maße das ist, was es sein kann. Das Sein eines Wesens oder Dings kann in der Tradition nur als ein Zu-Seiendes gedacht werden; und in diesem Sinne bedeutet Gut-sein dann die Erfüllung, die Verwirklichung der in einem Seienden angelegten Möglichkeiten: seine Vollendung. Diese aber als möglich zu erkennen, setzt das Gute als Prinzip aller Seinserkenntnis voraus.
So jedenfalls ist es seit den Anfingen der abendländischen Philosophie von Sokrates su lernen und aus Platon heranzulesen gewesen. 6 Das Gute ist noch "jenseits der Seinsheit, die es an Alter und Macht überragt." 7 Durch diese von Platon vorgestellte Verbindung des Seins mit dem Guten wurde das Seinsdenken unseres Kulturraumes "onto-agathologisch" geprägt. 8 6 V gl. das 6. Buch von Platons Dialog "Politeia", das vom" Wissen des Guten" handelt (503e-509d) in: Platon: Sämtliche Werke, 2.Bd. Berlin (de Gruyter) o.J., S. 236-245. Zum Ganzen vgl. Helmut Kuhn: Artikel "Das Gute", in: Handbuch philosophischer Grundbegriffe, hrg. von Hermann Kringset al., Bd. II. München (Kösel) 1973, S. 657--677; derselbe: Artikel "Gute, das", in: Staatslexikon der Görresgesellschaft, 7. Aufl., Bd. 2. Freiburg (Herder) 1986, Sp. 1153-1155; Maximilian Forschner: Artikel "Gute, das", in: Lexikon der Ethik, 3. Auß., hrg. von Ottfried Höffe. München (Beck) 1986, s. 95-97. 7 Platon: Politeia, 509b (in der in Anm. 6 genannten Platon-Ausgabe in etwas anderer, aber sinngleicher Übersetzung: S. 244). 8 Helmut Kuhn, Das Gute, S. 665.
14
Karl Heinz Grenner
Daran änderte auch die aristoteli!lche Kritik an Platon grundsätzlich nichts. Gerade weil das Gute in das Sein eingeschmolzen und als Seinsziel oder Telos gedacht wurde, blieb der Begriff des Guten auch bei Aristoteles und der von ihm und Platon abstammenden metaphysischen Tradition "ontologisch omnipräsent. " 9 Zwar wurde das Gute in der aristoteli!lchen Differenzierung des Begriffs zu dem in den verschiedenen Lebens- und Wissenschaftsbereichen Erstrebten. Aber gerade deswegen konnte Aristoteles am Anfang seiner Nikomachisc:hen Ethik sagen, daß "das Gute mit Recht bestimmt wird als das, wonach alles strebt." Die christliche Tradierung dieser philosophischen Position hält bis weit über die Hochscholastik hinaus daran fest, daß das Seiende gut und in einem ordo amoris begehrenswert ist. Aber diese Auffassung wird vom Gottesglauben her noch tiefer fundiert. Bibel und christliche Theologie weisen das Sein als gute Schöpfung, als Spur des guten Schöpfers, aus; und die Vernunft, die weiterhin das ordnende Prinzip des gut gelebten Lebens für den einzelnen wie für jegliche Form menschlicher Gesellung bleibt, wird nach christlicher Anschauung gelenkt und überformt von der Agape, in der Gottes- und Menschenliebe untrennbar verbunden sind. Diese Tradition bestimmt sich also als eine affirmative Ontologie. "Sein" und "das Gute" entsprechen einander. Alles Sein ist gut. Das Gute ist SeinstUlle und Seinsverwirklichung; das Gegenteil, das Schlechte, ist Seinsmangel, ist Unvollkommenheit, ist Seinszerstörung. "Eine vollkommene Unvollkommenheit, ein Schlechtes an sich, ist undenkbar." 10 Da Seiendes bejahenswert und seiner Zielrichtung nach als Zu-Seiendes erkennbar ist, wird es im Leben des Menschen zu einer zu verwirklichenden Aufgabe, deren normative Konkretisierung in der Regel freilich unter den Bedingungen der Geschichtlichkeit zu erfolgen hat. Die abendländische ethische Tradition war und ist vom einigermaßen erkennbaren Zusammenhang von Sein und Sollen überzeugt.11 Der Mensch kann ihn bejahen 9 Helmut Kuhn, Das Gute, S. 667.
10 Helmut Kuhn, Das Gute, S. 670. 11 Erst das philosophische Denken der Neuzeit löste diesen Zusammenhang auf, in-
dem es das Seiende in seiner puren Gegenständlichkeit zu sehen sich anschickte, den Menschen den Dingen gegenüberstellte und das Gute in die Innerlichkeit des beherrschenden menschlichen Subjekts zurückdrängte: z.B. in den reinen Willen, in die biologisch oder soziologisdt definierte Gattungszugehörigkeit, in die Willkür des wertenden Individuums. Es wundert nicht, daß unter diesen Voraussetzungen die Frage nach "dem Sinn von Sein" sich vehement aufdrängte. Sie brauchte früher nicht gestellt zu werden, da sie durch die metaphysische Verzahnung des Seinsbegriffs mit dem Guten prinzipiellschon beantwortet war. Im jetzigen Zeitalter des Positivismus, das vom Ideal der Wissenschaftlichkeit beherrscht ist und darum dem Anspruch der
Gibt es Ungüter?
15
und entsprechend handeln; dann ist das Gute das, was sein soll. In seiner Freiheit kann der Mensch aber hinter der ihm sich stellenden Aufgabe auch zurückbleiben - nicht nur aus Mangel an Kraft, sondern auch aus bewußter Zurückweisung und versuchter Verfälschung der Aufgabe. Wo immer er aber etwas zu genießen oder zu tun begehrt, wird er es unter der Wunschgestalt des Guten, "sub specie boni", begehren. Hier wird erkennbar, daß vom Guten sinnvoll auch in relativer (besser: relationaler) Bedeutung gedacht und gesprochen wird. Zum einen meint dies: das Gute ist gut für jemanden. Diese Relation geht.über das Kognitive - etwa: daß jemand das Gute erkennt und anerkennt - hinaus. Die Relation ist von praktischer Art: Etwas wird als Gutes gewollt, erstrebt, begehrt, geliebt. Schlimm, wenn das so subjektivierte Gute objektiv sich nur als ein Schein-Gutes oder als Gut minderen Stellenwerts in der Güterordnung herausstellt.
Zum anderen meint der relativefrelationale Charakter des Guten: daß etwas gut zu etwas anderem ist, d.h. also, daß etwas funktional tauglich ist als Mittel zur Erreichung eines bestimmten Zwecks. In dieser Hinsicht kann ein Mittel sehr wohl gut sein, auch wenn der damit angestrebte Zweck selbst nicht gut genannt zu werden verdient. Bemerkenswert ist ferner, daß es die Abfolge von guten Mitteln und guten Zwecken gibt, die dann selbst wieder Mittel zu weiteren, evtl. höheren guten Zwecken werden, usw. 12 Im Hinblick darauf wird einsichtig, daß eine solche Mittel-ZweckStufung zur bewußten Wahrnehmung der Güterordnung beiträgt. 13 Die relationale Bedeutung aber relativiert das Gute nicht, sondern hierarchisiert es. Die Wertrangordnung der Güter entspricht der Abstufung ihrer Seinsqualität. Von dieser Überzeugung aus kann eine materiale Güterethik sogar Verständnis für die Anliegen der modernen Wertphilosophie entwickeln. Wahrheit nicht ausweichen kann, hat die technologische Vernunft des Menschen ihm viel an Wissen und Besitz eingebracht. Aber unausweichlich erhebt sich gerade jetzt auch wieder die Frage nach dem Wissen des Guten und nach den wahren Gütern. 12 Helmut Kuhn: Das Gute, S. 658 f. nennt zur Veranschaulichung: "das Gut-sein der
Ziegel dient dem Bau, das Gut-sein des Baus ergibt sich aus seiner Angemessenheit an seine besondere Bestimmung, etwa: einer Schule als Unterkunft zu dienen, das Gut-sein der Schule bemißt sich nach der Erfüllung ihres Zwecks, der im Lernen besteht, und so fort."
13 Wie am eben genannten (Anm. 12) Beispiel sich zeigt, sind die "Güter" keineswegs
alle materieller Art. Neben den Sachgütern gehören auch Dienstleistungen zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse unter den Begriff" Güter" subsumiert ( vgl. auch Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 202).
16
Karl Heinz Grenner
Sie mochte sieh nicht damit abfinden, daß Seiendes im positivistischen Sinne nur als res extensa, als Erfahrungswirklichkeit ohne innere Wesensnotwendigkeit verstanden wurde. Gegen diese Auffassung betonte die Wertphilosophie die an Sachen und Personen aufscheinenden Werte. In ihrem Idealismus nahm sie dabei in Kauf, daß Wirklichkeit und Werte meist unverbunden nebeneinander je für sieh wahrgenommen und reflektiert werden. Vom philosophischen Erbe her und zum Vorteil für den Aufbau einer realistischen Ethik aber gibt es die Möglichkeit, ernst zu machen mit der Erkenntnis und praxisleitenden Motivation, daß das Sein von seinem Innersten her werthaft und ein Wert von seinem Innersten her seinshaft ist, sieh also nicht bloß einer subjektiven Bezielmng verdankt. Aus der Sieht einer eher scholastischen Philosophie ist" Wert" dann zu beschreiben "als das Sein selbst, insofern es kraftseines Gehaltes eine Vollkommenheit bedeutet und so das Streben anlockt. Der Normcharakter des Wertes wurzelt in den mit dem Sein gegebenen Wesensgeseblimkeiten, die für das Einzelding maßgebend sind, und letztlieh darin, daß dem Sein der unbedingte Vorrang vor dem Nichtsein zukommt." 14 Damit schließt sieh der Kreis dieser Einsichtnahme in die philosophische Tradition. Zum einen vermag sie, die so gesehiehtsprägend gewirkt hat, die Überzeugung von der Gutheit des Seins in der Fülle seiner Güter kräftig zu bestärken und erzeugt so eine argumentative Sperre gegen die Konzipierung des Begriffs "Ungut". Zum anderen hilft die der Selbsterfahrung zugängliche und in der philosophischen Tradition überlieferte Erkenntnis einer Güter- und Wertrangordnung, die verschiedenen Güter-/Wertarten wahrzunehmen und zu besehreiben. 15 Die gängige Auflistung unterscheidet aufsteigend wirtschaftliche, vitale, geistige und religiöse Güter/Werte (oder: Annehmlichkeits-, Vital-, Kulturund Helligkeitswerte), die in sieh selbst wertvoll (Selbst- oder Eigenwerte) sind und nicht bloß deshalb, weil sie zu anderem nützen (Nutz- oder Dienstwerte). Zum geistigen Wertbereich zählt u.a. das sittlich Gute, das sieh dem Menschen zu seiner Erfüllung aufgegeben darstellt. Im 14 Johannes Lotz: Artikel., Wert", in: Philosophisches Lexikon, hrg. von Walter Brug-
ger, 8. Auß. Freiburg (Herder) 1961, S. 378-380. Vgl. auch ebenda: Artikel .,Wertphilosophie", S. 380 f. Wenn Erich May: Das Wirtschaftsgut, S. 16 urteilt, .,daß der Gutscharakter keine den Gütern anhaftende Eigenschaft, sondern eine SubjektObjekt-Beziehung ist", dann bezieht er sich mit seinen Gewährsleuten (siehe ebenda Anmerkungen 2 und 3) letztlich auf einen das Ding als res extensa definierenden Positivismus in Verbindung mit einer subjektivistisch-dualistischen Wertphilosophie utilitaristisdler Prägung.
15 Vgl. Nikolaus Monzel: Katholische Soziallehre, Bd. 1: Grundlegung. Köln (Bachern)
1965, S. 372-387: Wesenszusammenhänge der Verantwortlichkeitsarten.
Gibt es Ungüter?
17
sittlichen Urteilen und Handeln wird dies Aufgabe angegangen. Neben der sittlichen Gestaltung des personalen Selbstseins, des Mitseins mit anderen Lebewesen und der Bemühung um die Verwirklichung der anderen geistigen Werte gilt der Umgang mit ökonomischen Gütern als sittliches Bewährungsfeld. Dieser Kategorie der ökonomischen Güter können heute auch die sog. freien Güter und die öffentlichen Güter sugeordnet werden, da sie in ihrem Bestand abnehmen, also knapp werden, und/oder erhebliche Kosten für ihre Bewahrung und Bereitstellung verursachen. 16 Bei unserem Blick in die philosophische Tradition sind swei Aspekte besonders stark hervorgetreten: das wesenhafte Gutsein des Seins und die sittliche Verantwortung des Menschen für die Verwirklichung des Guten. Von diesen Aspekten aus ergibt sich die philosophische Auskunft in Sachen "Ungüter". Sie hat darauf hinsuweisen, daß in den Fällen, da negative Merkmale im Zusammenhang mit der Verwendung ökonomischer Güter wahrgenommen werden, diese Negativitäten nicht den Gütern an sich sukommen und es von daher nicht su rechtfertigen ist, von "Ungütern" zu sprechen. Vielmehr sind es vom Menschen herbeigeführte Situationen oder ist es die von ihm sittlich unwertig (unsittlich) bewerkstelligte Verwendung ökonomischer Güter, einschließlich der Dienstlemtungen, durch welche die Güter in ihrer Zweckbestimmung tangiert und bis sur Pervertierung alteriert werden, ohne jedoch ihre eigentliche Wesensausrichtung und ihre vom Gutsein geprägte Qualität su verlieren.
C. Konsequenz für die Begriffsbildung
Gerhard Merk hat bei seiner Beschreibung der "Ungüter" dargelegt, daß sie in gewissen Fällen swar kurzfristig der individueUen Bedürfnisbefriedigung dienen mögen, aber auf die Dauer sumindest den individuellen und - beim "reinen Ungut" - auch den gesellschaftlichen Wohlstand negativ beeinflussen, also schädigenP Seine "Ungüter" erfüllen mitnichten den Zweck von Gütern. Doch, wie die von Merk dargelegten Beispid.e erkennen lassen, liegt der Grund für die Nichterfüllung des eigentlichen Zwecks der Güter nicht in diesen selbst, sondern in der von Menschen veranstalteten Art und Weise des Umgangs mit Gütern. 18 Damit bestäti16 Vgl.
J. Heinz Müller: Artikel"Güter, wirtschaftliche", in: Staatslexikon der Görresgesellschaft, 1. Auß., Bd. 2. Freiburg (Herder) 1986, Sp. 1155-1158.
17 Gerhard Merk: Konßiktstau durch Ungüter, S. 204 und S. 205. 18 Dies ist auch noch beim "Fall6: reines Ungut" (Gerhard Merk: Konßiktstau durch
Ungüter, S. 204) aufweisbar.
18
Karl Heinz Grenner
gen Merks Schilderungen indirekt das im vorigen Abschnitt von mir Ausgeführte. Ausgehend von verschiedenen, die Güter tangierenden menschlichen Umgangsweisen mit ihnen möchte ich daher andere Bezeichnungen für gemeinsam erkannte und der weiteren Beachtung empfohlene Sachverhalte vorschlagen. Um die feststellbaren Negativitäten bei Güterverwendungen zu bezeichnen, aber auch um die menschliche Verantwortung zu markieren, spreche ich von: I. einer Situation nicht gemäßen Gütern; II. mißbrauchten Gütern; 111. pervertierten Gütern. Zu 1.: Als Beispiel für Güter, die einer bestimmten Situation nichtgemäß sind, kann eine klassische Stelle bei Aristoteles herangezogen werden. Um das Phänomen des teils freiwilligen und des teils unfreiwilligen Tuns zu veranschaulichen, erinnert er an "Güter, die man bei einem Seesturm über Bord wirft. Schlechthin freiwillig tut das niemand, dagegen um sich und die Anderen zu retten, tut es jeder, der Vernunft besitzt." 19 Die Güter, um die es in diesem Beispiel geht, sind und bleiben wirtschaftliche Güter. Aber sie sind als solche in der angenommenen Situation des Seesturms für die SchifFsbesatzung überhaupt nicht nützlich. Sollte das SchifF, mit dem sie transportiert werden, untergehen, dann können die Güter ihren eigentlichen Zweck nicht erfüllen. Ihr weiteres Verbleiben an Bord wird nach Einschätzung der seemännischen Fachleute, wenn dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Verlust des SchifFes und zum Schiftbrüchigwerden der Mannschaft beiträgt, gemäß Gerhard Merks Terminologie dem Wohlstand der einzelnen und der Gesellschaft schaden. Aber sind diese betrefFenden Güter deswegen in diesem Fall und in ähnlichen Situationen "reine Ungüter", was gemäß Merks Definition behauptet werden müßte?- Sie sind und bleiben Güter, die aber einer bestimmten Situation nicht gemäß sind. Zu II: Hier möchte ich auf die Kategorie mißbrauchte Güter hinweisen. Nach Thomas von Aquin gibt es für den Menschen neben dem schlechthin Guten auch Schein-Gutes, das deswegen nicht wahres Gut ist, weil es den Menschen von seinem erstrangigen Zielgut, der Freude in Gott, wegiuhrt. 20 Allgemein aber ist mit dem Aquinaten anzunehmen, daß es 19
Aristoteles: Nikomachische Ethik, 1110a; hier: Philosophische Bibliothek, 2.Aufl. Bd. 5. Leipzig (Kröner) 1911, S. 39. Thomaa von Aquin kommentiert dies zustimmend: Sententia libri Ethicorum 111, I, 1. Es handelt sich bei Aristoteles um ein Beispiel dafür, wie in einer bestimmten Situation die Furcht vor größeren Übeln den freiwilligen Charakter einer Handlung beeinftußt. V gl. Deutsche Thomas-Ausgabe, Bd. 21. Heidelberg (Kerle) 1964, S. 71.
20 Thomas von Aquin: Summa theologica (= S.th.) 11-11 23.7.c, Deutsche ThomasAusgabe, Bd. 17 A. Heidelberg (Kerle) 1959, S. 27. Vgl. auch S.th. 1-11 114.10.c, Deutsche Thomas-Ausgabe, Bd. 14. Heidelberg (Kerle) 1955, S. 239 f.
Gibt es Ungüter?
19
für den Menschen auch wahres Gut gibt. Es leitet seine Qualität von der Tatsache ab, daß seine Konkretisierungen auf das erstrangige Ziel des Menschen ausgerichtet werden können und seiner Erreichung dienen. Solche konkreten Güter nütlen dem Menschen von ihrer unmittelbaren Zielbestimmung her auf vielerlei Weise. Aber es ist durchaus möglich, daß etwas, das in sich betrachtet ein wahres Gut ist, zu etwas Schlechtem wird, weil Menschen damit Mißbrauch treiben. Thomas von Aquin nennt als Beispiele, wo dies geschehen kann, Reichtum und Ehren. 21 Der Mißbrauch eines Gutes, z.B. des Reichtums, schadet dem einzelnen viellächt nicht einmal direkt, sondern eher im Hinblick auf die Verfehlung seines letzten Ziels; und was die infragekommende Wohlstandsminderung der Gesellschaft anbelangt, so ist u.U. das wirtschaftliche Gleichgewicht nicht tangiert, wohl aber viellei::ht das Gemeinwohl- und zwar z.B. durch offenkundige, erkennbare Ungerechtigkeiten und die daraus resultierende psychische und physische Beeinträchtigung vieler. Es zeigt sich, daß bei diesem Beispid und vielen anderen Fällen eine rein ökonomische Einstufung der Güter nach dem Gesichtspunkt der Nutzen- oder Schadensverursachung nicht zufriedenstellend ist. Auf eine sittliche Bewertung kann nicht verzichtet werden, weil erst sie das Tun von Menschen, den entscheidenden Agenten des Gesellschaftsprozesses, in die Betrachtung einbezieht und ihm gerecht zu werden versucht. Sollte es bei Menschen im Umgang mit Gütern zu Mißbrauch (abusus) gekommen sein, so bleibt aufgrund von philosophischen Überlegungen festzuhalten, daß dadurch die Güter ihren Gütercharakter nicht verloren haben. Sie sind nicht zu "Ungütern" geworden. Natürlich wird es Fälle von Gütermißbrauch geben, bei denen die einzelnen Mißbraucher Wohlfahrtsminderungen erleiden. Ob die Gesellschaft dabei einen irgendwie gearteten positiven Nutzen erfahren oder gar nicht davon betroffen sein kann, wie Merks Definitionen des "bedingten Unguts" und des "neutralen Unguts" behaupten, mag diskutiert und kann auch anders gesehen werden. 22 Zu 111: Mit dem Begriff des pervertierten Guts soll abschließend darauf hingewiesen werden, daß durch Mißbrauchstaten von Menschen Güter 21 Thomas von Aquin: Summa theologica 11-1158.10 ad 2, Deutsche Thomas-Ausgabe, Bd. 18. Heidelberg (Kerle) 1953, S. 50. V gl. auch S.th. 1-11 59.3.c, Deutsche ThomasAusgabe, Bd. 11. Heidelberg {Kerle) 1940, S. 192:., Was zur Erhaltung des Leibes beiträgt, (ist) ein Gut für den Menschen, wenn auch nicht das Höchste, denn der Mensch kann schlechten Gebrauch davon machen." 22 V gl. den Beitrag von Doris Böggemann in diesem Band, die aus der Interdependenz von Einzelwohl und Gemeinwohl folgert, daß durch ein "Ungut" immer beide geschädigt werden.
20
Karl Heinz Grenner
so pervedied werden können, daß - mag ihre Bereitstellung einzelnm noch Nutzen erbringen - ihr Gütercharakter bei der verbrauchenden Verwendung überhaupt nicht mehr zutage treten kann, ja, geradezu sich ins Gegenteil verkehrt (pervertiert). Zu denken ist hier z.B. an die Bestandteile, materiellm Güter und Dienstleistungen, die der Bereitstellung von Massenvernichtungsmitteln dienen und dabei durchaus Einzelnutzen herbeiführen, wohingegen die aktive, verbrauchende Verwendung, ihr Einsatz als Waft"e, dem Einzelwohl wie dem Gemeinwohl in größtem Ausmaß Schaden zufügt.
D. Einige Anregungen Die letztlich immer knappen wirtschaftlichen und sog. "freien" Güter wie Wasser, Atemluft und Wind sind ex definitione in sich tauglich zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse oder Zwecke und damit auch tauglich zur Wohlstandsmehrung. Durch unsittliche, d.h. nicht auf das wahre Gute ausgerichtete Zwecksetzung können Güter- wie ich zu zeigen versucht habe - von Menschen mißbraucht und pervertiert werden, so daß individueUer und/oder gesellschaftlicher Mißnutzen/Schaden entsteht. Wie aber könnte unter Einbeziehung der vorstehenden Überlegungen individueRer und gesellschaftlicher Schaden vermieden oder eingedämmt werden? Einige Anregungen für ein Wirtschaften, das sich wirtschaftsethischem Urteilen und Handeln nicht verschließt, seien in diesem Sinne noch angefügt.
I. Ethische Selbstbeschränkung der Werbung Immer wieder ist auf die besondere ethische Verantwortung aller Werbenden hinzuweisen. Aus Einsicht sollten sie darauf verzichten, bei den Konsumenten Bedürfnisse zu wecken und/oder zu steigern, deren Befriedigung erfahrungsgemäß häufig nur durch Mißbrauch von Gütern versucht wird. Besonders zu nennen wären hier die Güter, deren Mißbrauch zu Süchten, zur Verschwendung knapper Ressourcen und zur Relativierung von Kulturwerten führt.
Gibt es Ungüter?
21
II. Staatliche Einschränkungen und Verbote Der durch Werbung geförderte e:uessive Mißbrauch von Gütern verursacht nicht nur individueUe Wohlstandsminderung, sondern auch sehr erhebliche gesellschaftliche Schadensfolgekosten in zweistellig«r Milliardenhöhe. Deshalb sind um des Gemeinwohls willen auch staatliche Einschränkungen oder Verbote in Betracht zu ziehen. Sie wären zu planen und durchzusetzen oder auch gegen den Druck von Interessenten beizubehalten, um die Werbung für bestimmte Produkte und den freien Vertrieb gewisser Güter, die in der Regel su Mißbrauch Anlaß geben, zu zügeln und die Produktion pervertierter Güter gänzlich zu unterbinden.
111. Motivierende Erziehung Die Fremd- und Selbsterziehung muß die positive Wohlstandsänderung zugunsten des individuellen und gesellschaftlichen Wohls erstreben helfen. Dabei darf sie die Anstrengungen nicht bagatellisieren, die erforderlich sind und sein werden, um dieses Ziel zu erreichen. Ein Bewußtseinswandel ist vonnöten, um zu bewirken, daß mit den sog. "freien" Gütern sorgsamer umgegangen wird. Es müßte sieh die Erkenntnis durchsetzen, daß auch sie ihren "Preis" haben. Ähnlich verhält es sieh mit den öffentlichen Gütern. Beispiele sind die Verkehrswege, die allen zur Verfügung stehen, und die allgemeine Sicherheit. Ihre Bereitstellung und Mehrung wird wie selbstverständlich erwartet. Aber die Zahlungsbereitschaft der Bürger für diese Güter, für die es so gut wie keinen Markt und dementsprechend keine der üblichen Marktsignale gibt, wird sieh kaum steigern lassen, wenn es im demokratischen Gemeinwesen nicht gelingt, motivierende Einsichten in die Zusammenhänge zu wecken und so zu sorgsamerem Umgang mit diesen Gütern anzuregen. Nicht die subjektiven Präferenzen allein sollten hier dominieren. Vielmehr müßte die Bejahung des Gemeinwohls Leitgedanke für den verantwortliehen Umgang mit allen Gütern sein.
IV. Neue Aufgaben für Theorie und Praxis Wirtschaftswachstum ist bisher in Theorie und Praxis wohl hauptsächlich unter seinem quantitativen Aspekt gesehen und angestrebt worden.
22
Karl Heinz Grenner
Doch muß wegen der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsbedeutung23 auch dem qualitativen Aspekt stärker als bisher Aufmerksamkeit geschenkt werden. Was sur Lebensqualität - gemessen an objektiven Parametern - gehört und beiträgt, sollte vermehrt Thema der Wirtschaftswissenschaften werden. Die Beachtung, Reflexion und Prüfung wirtschaftsethischer Anregungen und damit die Kooperation der Disziplinen müßte intensiver gestaltet werden.24 Von den erzeugten und in Umlauf gebrachten Wirtschaftsgütern wäre zu wünschen, daß sie nach Art und Qualität so eindeutig wohlfahrtsförderlich sich erweisen möchten, daß es nur sehr schwer möglich wäre, sie mißbräuchlich oder gar pervertierend su nutzen. Dieses und noch viel mehr, was der Kultivierung und Ethik der Güterbereitstellung und -Verwendung dient, darf in zunehmendem Maße aber nicht nur verhältnismäßig wenigen Menschen in nationalen Volkswirtschaften zur Mehrung ihres Wohlstands verhelfen, sondern muß dem Welt-Gemeinwohl25 zugute kommen. Deshalb ist es erforderlich, die wirtschaftstheoretischen, -praktischen und politischen Anstrengungen erheblich zu steigern.
23
Vgl. den einen kritischen Überblick vennittelnden Vortrag von Wilhelm Krelle: Wirtschaftsethik und Ökonomie. Ergänzung oder Widerspruch oder beides?, in: Jahres- und Tagungsbericht der Görresgesellschaft 1989. Köln (Görres-Gesellschaft) 1990, S. 55-83. Das am Ende gebotene einschlägige Literaturverzeichnis ist durch folgende Hinweise zu ergänzen: Helmut Hesse (Hrg.): Wirtschaftswissenschaft und Ethik (Schriften des Vereins für Socialpolitik N .F., Bd. 171. Berlin (Duncker & H umblot) 1988; Rolf Kramer: Die christliche Verantwortung in der sozialen Marktwirtschaft. Stuttgart (Steinkopf) 1973.
24 V gl. Udo Ernst Simonis, Christian Leipert: Lebensqualität, Soziale Indikatoren und
alternative wirtschaftliche Entwicklung, in: Zwischen Wachstum und Lebensqualität. Wirtschaftsethische Fragenangesichts der Krisen wirtschaftlichen Wachstums (Forum Kirche und Gesellschaft, Nr. I, hrg. vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland). München (Kaiser) 1980, S. 25~9.
25 V gl. Bob Goudzwaard, Harry M. de Lange: Weder Armut noch Überßuß. Pladoyer für eine neue Ökonomie. München (Hanser) 1990.
UNGÜTER UND ETHISCHE VERANTWORTUNG Von Friedrich Beutter, Luzern
Ungüter werden von Gerhard Merk in seiner Veröffentlichung "Zur Begrenzung der Offensivwerbung" als solche Waren beschrieben, "die dem Menschen bei weitem mehr Nachteile denn Vorteile bringen" . 1 Der Absatz dieser Güter verschafft zwar bestimmten Unternehmungen hohen Gewinn und dem Fiskus reiche Steuereinnahmen (genannt werden Alkoholika und Tabak:fabrik:ate), der Verbrauch dieser Güter führe aber zu großen sozialen Nachteilen. Die gesellschaftlichen Kosten für Anti-Ungüter betragen nach Schätzungen etwa 8 Prozent des Volkseinkommens. Zu Buche schlagen hier z. B. die Hospitalisierungskosten für an Raucherkrebs Erkrankte und für Kinder, die nach übermäßigem Alkoholgenuß gezeugt wurden und für die wegen der dadurch verursachten embryonalen Schädigungen jährlich bis zu DM 100 000,- aufgewendet werden müssen. 2 Diese Verwendung, d. h. die Verschwendung von (knappen) Produktionsfaktoren zu menschenschädlichen Zielen verstößt nach Merk "eindeutig gegen das Personprinzip, gegen das Gesellschaftsprinzip, gegen das Gerechtigkeitsprinzip und dazu auch gegen das Wohlfahrtsprinzip". 3 Mit dem Thema Ungüter ist somit zusammen mit der ökonomischen eine ethische Problematik angesprochen, die in den folgenden Darlegungen auf ihre personal- bzw. individualethische Dimension befragt werden soll. Dies erscheint noch dringlicher im Blick auf die Abhandlung von Gerhard Merk über "Kontliktstau durch Ungüter" .4 Hier wird offenkundig, 1 Gerhard Merk: Zur Begrenzung der Offensivwerbung. Berlin (Duncker & Humblot)
1977, S. 86 (Volkswirtsdtaftliche Schriften, Heft 267).
2 Gerhard Merk: Zur Begrenzung der Offensivwerbung, S. 86. 3 Gerhard Merk: Zur Begrenzung der Offensivwerbung, S. 87. V gl. auch die in Anmer-
kung 12 genannte Arbeit.
4 Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, in: Airred Klose et
al. (Hrg.): Frieden und Gesellschaftsordnung. Festschrift für Rudolf Weiler zum 60. Geburtstag. Berlin (Duncker & Humblot) 1988, S. 197 ff.
24
Friedrich Beutter
daß im Wirtschaftsprozeß nicht nur Positives produziert und Positives zum Ge- und Verbrauch angeboten wird, sondern - nicht selten Negatives. Diesen Sachverhalt will der Ausdruck "Ungut" festhalten, das so beschrieben wird: "Ein Gut, dessen Verwendung beim Einzelnen eine Minderung seines Wohlstands verursacht, ist ein Ungut (bad). " 5 In der Nutzenkategorie ausgedrückt, die das Maß für eine individuell gelungene Bedürfnisbefriedigung darstellt, entsteht durch die Verwendung eines Ungutes ein Mißnutzen für die betrefFende Person, der für diese einen Schaden darstellt. In der Regel bewirken Ungüter dadurch auch schädigende und belastende Wirkungen in der gesamten Gesellschaft. Einzelne Menschen oder einzelne Gruppen von Menschen schädigen sieh nicht nur selber durch Ungüter, sondern wälzen Schäden in die gesamte Gesellschaft über, die dann von der Allgemeinheit übernommen werden müssen (Sozialkosten). Man wird daher Doris Böggemann zustimmen können, die in ihrem Beitrag in der hier vorliegenden Festschrift "Zur Definition der Ungüter" 6 zusammenfassend festhält: "Ungüter sind Dinge, die dem Einzelwohl und dem Gemeinwohl schaden." Blickt man auf hervorstechende Bereiche, in denen sich der "Konfliktstau durch Ungüter" heute besonders bemerkbar macht (Drogenszene, Industrien und hohes Verkehrsaufkommen mit Abgas- und Lärmentwicklung, Verkehrsunf8lle, verschmutzte Gewässer durch Industrien, SchifFfahrt, Landwirtschaft und Haushalte), dann zeigen die Einzelwohl- und Gemeinwohlschäden die bedrohlich weitere Dimension der Umweltschäden, insbesondere an Wäldern, bislang fruchtbaren Böden sowie an Meeren und Seen. Dies deutet die derzeit weltweite und menschheitsumfassende Verflochtenheit der Ungüterproblematik an. Der Grundsatz der Interdependenz, der gegenseitigen Verßechtung und Abhängigkeit von jedem Einzelnen mit allen und allem kann auf der Ebene der Einzelperson weder zureichend erkannt, geschweige denn gelöst werden. Dennoch ist es wichtig, die Dimension des Einzelmenschen zu durchleuchten, um einige Aspekte zu erheben, die zum Abbau von Ungüterschäden beim Einzelnen und durch den Einzelnen führen.
5 Gerhard Merk: Konßiktstau durch Ungüter, S. 203. 6 Doris Böggemann: Zur Definition der Ungüter, in diesem Band, S. 3.
Ungüter und ethische Verantwortung
25
A. Die Einzelperson im Einflußbereich von Gütern und Ungütern In den elementaren Bedürfnissen nach Nahrung, Kleidung, Wohnung, Kultur- und Zivilisationsgütern findet sich der einzelne Mensch innerhalb einer gegebenen politischen und wirtschaftlichen Verfassung mit geltenden Gesetzen, bestimmtem Stand von Wissenschaft, Forschung und Technik. Durch Erziehung, Schulung und berufliche Ausbildung gelangt er in jahrelangem Lernen, Üben und Erfahren in Situationen und Positionen, in denen von ihm auch die Kenntnis und Unterscheidung von Gütern und Ungütern erwartet wird. Auf beide stößt er nahezu täglich, nicht nur im wirtschaftlichen Bereich. Es sind nicht bloß materielle Dinge, die darauf zu prüfen sind, ob sie dem leiblichen Wohl nützen oder schaden. Nichtmaterielle Güter und Ungüter verlangen in gleicher Weise eine Überprüfung. Zurecht schlägt Doris Böggemann vor, zwische~ "leilr schädigenden" und "geist-schädigenden Ungütern" zu unterscheiden. Zu letzteren zählt sie auch seelische Ungüter. In den humanwissenschaftlichen, vor allem psycho-somatischen medizinischen Erkenntnissen ist erfahrungsgemäß die leiblich-geistig-seelische Ganzheit eines Menschen betroffen, wenn Güterentscheidungen vom Einzelnen getätigt oder auch gewohnheitsmäßig und unkritisch aus der Mitwelt übernommen werden. Es ist nicht unwichtig, an dieser Stelle auf den Bereich des Religiös-Spirituellen hinzuweisen, der in Mitleidenschaft gezogen ist, wo die genannten Entscheidungen für Güter und/oder Ungüter fallen. Es kann sich schließlich eine Beeinträchtigung der gesamten Lebensordnungeines Menschen breitmachen. Doris Böggemann spricht in diesem Sinne von "ordnungsschädigenden Ungütern". Diese können - je nach Intensität - in leichten, mäßigen oder schweren Formen auftreten und dann auch die Lebensführungskunst eines Menschen mehr oder weniger beeinträchtigen. Aus diesen Einblicken ist zu erkennen: Der je unterschiedlich persönliche Umgang mit Gütern und Ungütern stellt vor die genuin ethische Grundfrage: Was soll ich tun? Wie ist insbesondere mein Verhältnis zu Ungütern zu sehen und zu gestalten? Welche Kriterien und Maßstäbe für lebensförderliches statt lebensschädigendem Verhalten durch Ungüter verdienen Vorzug?
26
Friedrich Beutter
B. Die ethische Grundfrage Die ethische Grundfrage, was ich als Einzelner tun soll, damit das Gute vom Bösen und Schlechten unterschieden und das Gute als erstrebenswert erkannt und anerkannt wird, erhebt - trotz pluraler ethischer Systementwürfe - den Anspruch gener&lisierbar zu sein. Thomas von Aquin (1224/25 - 1274) hat es in seiner Zeit in der Übernahme der Auffassung aus der Nikomachischen Ethik des Anstoteies (384/3 v.C. 322/21 v.C.) so formuliert: Das Gute ist im eigentlichen Sinne etwas, das erstrebenswert ist. 7 Die auf das Handeln ausgerichtete praktische Vernunft kann es erkennen und wird von der eigenen Gewissensanlage (Ur-Gewissen) daraufhin eingefordert. Eine bekannte neuzeitliche ethische Grundorientierung mit Anspruchscharakter für alle Menschen dürfte im sog. .,Kategorischen Imperativ" vorliegen, der in mehrfachen Formulierungen von lmmanuel Kant ( 1724 - 1804) verfaßt wurde. Eine Fassung lautet: .,Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde. " 8 Mit Bezug auf Ungüter ist nach dem bisher Gesagten erkennbar: Für alle Menschen gilt das ethische Postulat, Ungüter mit ihrem Schädigungsund Zerstörungspotential aus der eigenen Lebensführung fernzuhalten. Das ist leichter gesagt als getan, wird oft dagegen gehalten. Nicht zu unrecht.
C. Das Böse als Gebrochenheits-Dimension des Menschen Zur ethischen Grundbefindlichkeit der menschlichen Existenz gehört ihr Eingebundensein in das Gute und in das Böse. Zum Menschen gehört seine Fähigkeit zum Guten und zum Bösen. Das ethische Gute betrifft 7 Thomas von Aquin: De malo I, 1 c: " ... bonum proprie est aliquid in qu&ntum est appetibile ... bonwn est quod omnia appetunt ... omne agens agit propter finem et propter aliquid bonwn." V gl. Thomas von Aquin: Über die Sittlichkeit der H&ndlung, eingeleitet von Robert Spaemann. Weinheim (Beltz) 1990, S. 3 ff. (Collegia, philosophische Texte) sowie Josef Pieper: Die Wirklichkeit und das Gute, 7. Aufl. München (Kösel) 1963, S. 68 f., S. 91 f. 8 lmm&nuel K&nt: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: Werke, hrg. von WH-
helm Weischedel, Bd. 4. Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1983, S. 51.- Für die weiteren Formulierungen des Kategorischen Imperativs siehe Hans J. Miink: Der Freiburger Moraltheologe Ferdinand Gemini&n Wanker (1758 bis 1824) und lmm&nuel Kant. Düsseldorf (Patmos) 1985, S. 52 (Moraltheologische Studien, Historische Abteilung, Bd. 10).
Ungüter und ethische Verantwortung
27
den Menschen in seinem Kern und in seiner Tiefe und begründet seinen persönlichen Wert. Durch das Wollen und Tun des Guten wird er selbst gut, ganz und heil. Das ist wichtiges Kennzeichen seiner schöpferischen Freiheit, die als menschliche Freiheit Offenheit iur alles meint. Im Grunde meint sie Freiheit iur das Gute; sie enthält aber als menschliche Freiheit auch die Wahlmöglichkeit iur das Böse. Die gleiche menschliche Freiheit, die sich als Befreiung zum Guten kundtun soll, kann das Böse wählen. Das Böse, das Ungute, das Übel (malum) erscheint im Gewand des Erstrebenswerten, obgleich es zerstörerisch wirkt, Mängel und 'Schäden und die Tendenz zur Vernichtung menschlicher Existenz hat. Von diesen Einsichten aus hat Aurelius Augustinus (354 - 430) das Böse als Raub beschrieben, der nur an einem Guten geschehen kann. 9 Dies macht den Umgang mit Ungütern als Übel so schwierig. Ungüter werden fälschlich als Güter erstrebt, weil ihr Ungutes entweder nicht erkannt oder durch mangelnde Sorgfalt im Streben nach Gutem verdunkelt und verwirrt aufscheint. Das Ungute an Ungütern bleibt dennoch, und es wird in bösen Erfahrungen virulent, in Schädigungen an der leiblichseelisch-geistig-sprirituellen Existenz des Menschen.
I. Das Verhängnis des Bösen Dies macht auf eine Tiefen-Dimension des Bösen aufmerksam, die man als Verstricktsein in böses Denken und Tun bezeichnen muß, die vor jeder persönlichen, freiheitlichen und willentlichen Stellungnahme den Menschen in seinen Bann zieht und ihn zum Mitläufer und Mittäter macht. Wir alle werden in eine vom Bösen verschlechterte Welt hineingeboren. Johannes Gründel nennt dieses Phänomen "transpersonal", weil vorjeder persönlich zurechenbaren Schuld der einzelne Mensch in das Böse "als strukturales Geschehen, als schicksalhafte Unheilsmacht" 10 hineinverwoben ist. 9
Aurelius Augustinus: Contraadversarium legis I, 5: "Non est ergo malum nisi privatio boni." (Corpus Christianorum, Series Latina XLIX (Rom) 1985, S. 40). Siehe auch Thomas von Aquin: De malo I, 1 c: " ... malum non est aliquid ... est ipsa privatio alicuius particularis boni."
10 Johannes Gründel: Das Verständnis von Sünde und Schuld in geschichtlicher Ent-
wicklung, in: Ansehn Hertz et al. (Hrg.): Handbuch der Christlichen Ethik, Bd. 3. Freiburg (Herder) 1982, S. 152 sowie derselbe: Schuld und Versöhnung. Mainz (Griinewald) 1984, S. 108 ff. (Topos-Taschenbücher, Bd. 129). Vgl. auch Hans Halter: Wie böse ist das Böse? Zürich (Benziger) 1988, S. 19; hier wird das Böse als "Lebensverhinderung im menschlichen Alltag" beschrieben.
28
Friedrich Beutter
Dieses Böse ist nicht völlig unpersönlich und auch nicht abschiebbar auf ungerechte und ungute Strukturen. Es wirkt in jedem Irrtum, jeder Trägheit, in Flucht vor Verantwortung, Abschieben von Schuld auf andere, in einem schlecht bzw. mangelhaft gebildeten Gewissen. In der Erbschuldoder Erbsündenlehre liegt der Versuch vor, dieses Verhängnis ätiologisch zu deuten.
II. Die personale Dimension des Bösen
Freiheitlich-willentlicher Widerspruch gegen das Gute (theologisch als Nein zu Gott "Sünde" genannt) ist jene Schuld, die vom Einzelnen zu verantworten ist im Maß seiner freiheitlichen Entscheidung. Ohne Freiheit keine Schuld. Schuldvorwurf aus dem eigenen Gewissen aufsteigend, aus der "Mitte der Person" 11 , kann und soll richtig und zutre:ft'end das Ausmaß der Abweichung vom Guten angeben. Wie aber kann der Einzelne sicher sein über das von ihm Entschiedene, wenn er sich über den Inhalt seines Gewissensanrufes derart irren kann, daß er davon überzeugt ist, er soll eine konkrete Entscheidung tre:ft'en, die aber objektiv Ungutes von ihm verlangt, und er es nicht als solches, sondern als Gutes zu erkennen vermeint? Das sogenannte unüberwindlich irrende Gewissen verpflichtet den zum Handeln aufgerufenen Menschen wie das wahre und richtige Gewissen, weil es keine andere persönliche Handlungsregel gibt. An diesem Phänomen ist eine letzte Unsicherheit erkennbar, die wegen des Eingebettetseins in das Verhängnis des Bösen vom einzelnen Menschen in bestimmten Situationen nicht leicht zu durchschauen und zu beheben ist. Es kommt hinzu weil damit verbunden-, daß kulturspezifische und geschichtlich bedingte gesellschaftliche Verzerrungen in der Sicht des Guten manches Ungute in besserem Licht erscheinen lassen, als es in Wirklichkeit ist. Als ein Ergebnis aus diesen Überlegungen darf festgehalten werden: Die Unterscheidung von Gütern und Ungütern hat es in der Theorie leichter als in der Praxis des (ethischen) Umganges mit ihnen. Dennoch ist ein unentschiedener Relativismus, ein Indi:ft'erentismus oder gar Pessimismus nicht am Platze. Vieles an Ungutem ist mit kritischer, d. h. unterscheidender Vernünftigkeit erkennbar und behebbar. 11 Rudolf Hofmann: Gewissen- Mitte der Person, 2. Auß. Freiburg (Herder) 1980, S.
5 ff. (Antwort des Glaubens, Heft 8).
Ungüter und ethische Verantwortung
29
D. Maßstäbe und Kriterien f"ür das Verhalten gegenüber Ungütern Praktische Maßstäbe und Kriterien sind auf verschiedenen Ebenen antreflbar.
I. Verantwortung f"ür gesunde Lebensf"tihrung Auf der Erfahrungsebene ist an erster Stelle der Maßstab "Gesundheit" zu nennen. Diese wird - meist unreßektiert - als Tatkraft und Frische erfahren, als Kraft zum Leben aus den eigenen leiblich-seelischgeistigen Kräften, mit denen Pläne und Aufgaben in genügendem Maße erf"ullt werden können. Gesundheit ist den einen mit einer stabilen Konstitution, anderen mit konstitutionellen Schwächen anvertraut; niemand hat sie unverletzbar zuhanden. Gesundheitsbedrohung kann aus klimatischen und umweltschädigenden Faktoren, aus gesellschaftlichen Mängeln der Gesundheitsvorsorge (ge:f&hrliche Arbeitsplätze), Überborden gesellschaftlich geduldeter (Un-)Sitten (Alkoholismus, Tabakmißbrauch, Drogenabhängigkeit) u. a. erfolgen. Stets betrifft sie konkrete Einzelmenschen und Gruppen, die durch gesellschaftliche Maßnahmen Gesundheitsschutz beanspruchen dürfen. Gesundheit ist ein Prozeß im Leben des einzelnen Menschen, der nicht selten zugleich mit Krankheit zusammen existieren kann, so daß "Gesundheit als Idee von Kontrast und Ergänzung" 12 begriffen wird. Der einzelne Mensch bleibt im Rahmen seiner Möglichkeiten für seine gesundheitliche Verfassung verantwortlich. Im Blick auf das reichhaltige Angebot an Gütern und Ungütern soll er nach dem ihm zurnutbaren Wissen um die eigene Steuerung und Sorge für seine Gesundheit das ihm Förderliche wählen und Schädliches fernhalten. Hierbei ist die Unterscheidung in bedingte, neutrale und reine Ungüter hilfreich. 13 Sich überarbeiten, seine Kräfte erschöpfen und somit Raubbau an seiner Gesundheit betreiben, ist ein bedingtes Ungut, weil in diesem Fall der einzelne Mensch Mißnutzen, die Gesellschaft aber Wohlstandszuwachs er:f&hrt. Neutral kann man ein Ungut für einen Einzelnen nennen, der im Sommer seinen Urlaub nehmen muß, den er lieber im Winter hätte. Die Gesellschaft ist dadurch nicht negativ betroffen. Als reines Ungut dagegen 12 Dietrich von Engelhardt: Artikel "Gesundheit", in: Albin Eser et al. (Hrg.): Lexikon
Medizin, Ethik, Recht. Freiburg (Herder) 1989, S. 411.
13 Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 203 f.
30
Friedrich Beutter
ist z. B. jenes Übermaß an Rauehen zu bezeicllnen, das schwer krank und erwerbsunfähig macht und zum Tode führt. Die Gesellscllaft muß für medizinische Behandlung knappe Krankenversicllerungsmittel als AntiUngüter einsetzen. In ähnlicller Weise ist an Übermaß an Alkoholkonsum oder Drogeneinnahme zu denken, das abhängig macht und sehließlicll zur Selbstzerstörung führt, weil das für die verantwortungsvolle Gestaltung der eigenen Gesundheit notwendige Prinzip der Korrekturfähigkeit des Verhaltens nicht mehr greift. Korrektur-Unfähigkeit als mit eigenen Kräften nicht mehr behebbare Abhängigkeit ist so zu einer Krankheit geworden. 14 Am Beginn eines solchen persönlicllkeitszerstöreriscllen Prozesses sind nicht selten vorhandene Umkehr- und Korrekturmöglichkeiten vertan worden. Das Sprichwort: "Wehre den Anfängen" hat nach wie vor Bedeutung. Die seit der antiken Tradition der vier Kardinaltugenden gültige Haltung von "Zucht und Maß" (griech. sophrosyne, lat. temperantia) gibt Haltepunkte dafür, an Ungütern nicht zu zerschellen. Ziel und Sinn der Temperantia ist "die innere Ordnung des Menschen", und Zucht meint: "in sieh selber Ordnung verwirklicllen." 15 Die Kräfte der Selbstbewahrung, Selbstbehauptung und Selbsterfüllung sollen aktiviert werden; den Kräften der SelbstzeiStörung soll Einhalt geboten werden. Das Verantwortungsverhalten für die eigene gesundheitliche Verfassung erhebt Anspruch auf Beachtung nicht nur für den Kreis der Konsumenten, sondern auch für den der Produzenten, denen die Unverantwortlicllkeit z. B. von "offensiver Werbung" 16 im Sinne der Betörung und Überlistung von Kunden eingescllärft werden muß, auch durch gesellschaftliclle Sanktionen und reehtlicll wirksame Verbote.
II. Selbstverwirklichung Neben der Orientierung an der förderlichen Gestaltung der eigenen Gesundheit wird der Maßstab der Selbstverwirklichung heute mit hoher Dringlicllkeit betont. 14 V gl. Sebastian Scherer et al. (Hrg.): Drogen wtd Drogenpolitik: ein Handbuch. Frankfurt am Main (Campus) 1989, S. 5 ff. sowie Josef Eisenburg (Hrg.): Sucht. Ein Massenphänomenals AlarmsignaL Düsseldorf (Patmos) 1988, S. 10 ff. (Schriften der Katholischen Akademie in Bayern, Bd. 126). 15 Josef Pieper: Zucht wtd Maß, 9. Auß. München (Kösel) 1964, S. 17. Vgl. derselbe:
Das Viergespann. Freiburg (Herder) 1970, S. 206 (Herder- Bücherei, Bd. 361).
16 Gerhard Merk: Zur Begrenzwtg der Offensivwerbwtg, S. 92 - 109.
Ungüter und ethische Verantwortung
31
Für Gerhard Merk ist es "offensichtlich, daß Ungüter den Einzelnen ... in seiner Selbstverwirklichung hemmen." 17 Dabei wird nicht übersehen, daß der Einzelne nur innerhalb der konkreten Gesellschaft, in der er lebt, und durch die in ihr kulturspezifischen Lebensmöglichkeiten zu seiner Selbstverwirklichung gelangen kann. Diese Bedingtheiten sind es vor allem, die zu unterschiedlichen Akzentuierungen in der Sicht der Selbstverwirklichung führen. Das Wort Selbstverwirklichung ist durch Carl Gustav Jung geprägt worden und von ihm als Synonym für Individuation verwendet worden.18 Die breite Resonanz, die dieses Programmwort heute hat, ist dem Bedürfnis zu verdanken, den einzelnen Menschen trotz den vielfiü.tigen gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und technischen Verßechtungen zum eigenen Selbst gelangen zu lassen, in dem er seine Identität und Authentizität zu leben vermag. Seine Originalität soll vor allem in persönlichen nahen Beziehungen spontan und kreativ erlebt werden. Diese Stichworte lassen erkennen, daß das Interesse an Selbstverwirklichung heute stark vom Widerspruch gegen die Anonymisierung, Manipulierung, Funktionalisierung und Technisierung der Lebenswelt in Industriegesellschaften geprägt ist, und als Korrektiv gegen Entfremdungen und Entpersonalisierungstendenzen das individuelle Selbstsein der Person anstrebt. Die vielfiü.tigen Motivschichten haben das Verständnis von Selbstverwirklichung weithin diffus werden lassen und nicht selten zu Verengungen geführt, die den einzelpersönlichen Horizont zu stark betonten und Anliegen des mitmenschlichen und solidarischen Mit- und Füreinander in den Hintergrund drängen. Mit guten Gründen betont Konrad Hilpert die notwendige Unterscheidung von "Selbstverwirklichung als Selbstbezogenheit" und "Selbstverwirklichung als Ausweitung und Vertiefung der Persönlichkeit" .19 Im ersteren Verständnis stellt sich der Einzelne zu sehr in den Vordergrund und ins Abseits von Verbindlichkeiten gegenüber anderen Menschen und gesellschaftlich notwendigen Aufgaben. In der zweiten Bedeutung zeigt sich die einzelne Person darum besorgt, ihren Selbststand eingebunden in die mitmenschlichen Beziehungen und in die organische und anorganische Umwelt so zu gestalten, daß die eigenen Verwirklichungsmöglichkeiten der Persönlichkeitsreifung und zugleich der solidarischen Förderung der Mit- und Umwelt dienen. 17 18
Gerhard Merk: Konßiktstau durch Ungüter, S. 205; siehe auch S. 200 f.
19
Konrad Hilpert: Selbstverwirklichung, S. 18.
Konrad Hilpert: Selbstverwirklichung. Chancen, Grenzen, Wege. Mainz (Grünewald) 1987, s. 12.
32
Friedrich Beutter
In diesem Sinne soll Selbstverwirklichung als lebenslanger Prozeß menschenwürdigen und wertvollen humanen Lebens im Rahmen der allen Menschen zukommenden Menschenwürde und Menschenrechte gelingen. Zurecht nennt Gerhard Merk das Einzelwohl (Privatwohl) "eine der Selbstverwirklichung dienende, willentliche Lebensgestaltung des Menschen." 20 Es darf nur eingebunden in das Gemeinwohl aller seine verantwortliche Formgebung erfahren. Der einzelne Mensch ist hier besonders an die sog. Goldene Regel gebunden, die als humanes Ethos bereits bei dem ältesten griechischen Geschichtsschreiber Herodot (um 490 v.C.- 420/25 v.C.) und im asiatischen Raum im Konfuzianismus nachweisbar ist. In den biblischen Schriften ist sie sowohl im Alten (Tobit 4,15) wie im Neuen Testament (Matthäus 7,12; Lukas 6,31) enthalten und lautet in der positiven Formulierung der Bergpredigt: "Alles, was ihr von anderen erwartet, daß tut auch ihnen." 21 Selbstverwirklichung des leiblichen verfaßten Menschen reicht tief in den Bereich der materiellm und nichtmateriellen ökonomischen Güterwelt. Sie ist täglich angewiesen auf "Lebensmittel", die aus der menschlichen wirtschaftlichen Aktivität stammen und die - wie eingangs dargelegt - die Optimierung von Gütern und die Minimierung von Ungütern verlangt. Die Wahl von Ungütern ist stets eine Behinderung oder gar Verunmöglichung von Selbstverwirklichung und zieht in jedem Falle schädigend andere Menschen hinein, so daß auch sie Behinderungen ihrer Selbstverwirklichung erfahren. Dies behält seine Gültigkeit, auch wenn man sagen muß, daß "Selbstverwirklichung (ein) nie abgeschlossener Prozeß" 22 bleibt. Als menschliche Aufgabe ist die Vollendung des Guten im irdischen Leben unabschließbar und nicht erreichbar. Ohne diesen Gesichtspunkten weiter - vor allem hinsichtlich glaubensmäßig transzendenter eschatologischer Linien - nachgehen zu können, zeigen sich Ungüter nicht nur als unvereinbar mit den Zielen der Selbstverwirklichung. Sie rufen auch die Frage wach nach Wert und Sinn, hier insbesondere des ökonomischen Verhaltens in Produktion und Konsumtion. 20 Gerhard Merk: Grundbegriffe der Erkenntnislehre für Ökonomen. Berlin (Duncker
& Humblot) 1985, S. 64.
21 Georg Strecker: Die Bergpredigt. Ein exegetischer Kommentar, 2. Auß. Göttingen
(Vandenhoeck & Ruprecht) 1985, S. 155 ff.
al. (Hrg.): Katholisches Soziallexikon. lnnsbruck, Wien, München (Tyrolia) und Graz, Wien, Köln (Styria) 1980, Sp. 2534 f.
22 Joharmes Messner: Artikel "Selbstverwirklichung" in: Alfred Klose et
Ungüter und ethische Verantwortung
33
111. Vorrang des Werterlebens Wenn man Wert als eine objektive Eigenschaft begreift, die es möglich macht, "daß der Gegenstand geschätzt wird (Schätsbarkeit, 'objektiver Wert')" 23 und daraus folgend Werte im ökonomischen Sinn zueinander mittels eines allgemein anerkannten Maßstabes (Geld) in ein (objektives) Verhältnis gesetzt werden, das in der Regel in Preisen ausgedrückt ist, dann liegt die Aufgabe des Einzelnen darin, sich selber ein bewertendes Urteil zu bilden, welche Bedeutung er bestimmten Gegenständen beilegt (Wertschätzung, "subjektiver Wert"). Die grundlegende Aufgabe für den Einzelmenschen besteht darin, das Werthaltige in Gütern richtig zu beurteilen und das Unwertige bzw. Minderwertige in Ungütern richtig einzuschätzen. Das Präferenzverhalten für das Werthaltige im Bereich der ökonomischen Güter und Dienstleistungen enthält bereits eine Vorentscheidung für das einzelpersönlich mögliche Gelingen der gesundheitlichen Verfassung und einer persönlichkeitsfOrdernden Selbstverwirklichung. Peter Koslowski verlangt in diesem Zusammenhang: "Das Wollen und Streben müssen imstande sein, zwischen Gütern und Wertqualitäten nicht nur ökonomisch, sondern auch ethisch und ästhetisch zu entscheiden." 24 Die verschiedenen Wertqualitäten richtig wahrzunehmen und zu nutzen, ist also nicht allein ein rationales ökonomisches Kalkül. Insbesondere im Blick auf das Ziel der Selbstverwirklichung reicht die Werterfassung weit darüber hinaus. Max Scheler hat mit seinen Wertmodalitäten, die vom Angenehmen zum Nützlichen, Edlen und Heiligen aufsteigen, eindrücklich darauf hingewiesen, 25 daß zum Gelingen eines wahrhaft menschlichen Lebens eine Wertsymphonie gehört, die durchaus durch Vermittlung ökonomischer Werte des Angenehmen und Nützlichen gefördert werden kann, die aber Werte der Gerechtigkeit und Liebe, der Freundschaft und Güte, der Friedensbereitschaft und Toleranz, der Solidarität und Hilfsbereitschaft umfassen muß. Dafür bedarf es der Erlebnisfähigkeit des Menschen für alles Werthaltige, das eingeübt werden kann. Es ist offenkundig, daß die genannten hoben und umfassenden menschlichen Werte den ökonomischen Werten ihren Platz zuweisen. Arthur 23
Gerhard Merk: Konßiktstau durch Ungüter, S. 206.
24 Peter Koslowski: Wirtschaft als Kultur. Wirtschaftskultur und Wirtschaftethik in
der Postmoderne. Wien (Passagen) 1989, S. 121 (Edition Passagen, Bd. 27).
25 Max Scheler: Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer
Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus, 6. Auß. Bonn (Bouvier) 1980, S. 122 ff. (Gesammelte Werke, Bd. 2).
34
Friedrich Beutter
Rich hat diesen Zusammenhang mit dem Grundsatz unterstrichen, in der Sozial- und Wirtschaftsethik könne und dürfe die "Sachgemäßheit nie ihr leitendes oder gar einziges Prinzip sein." 26 Bei aller Sachbezogenheit müsse beharrlich das Menschengerechte im Sachgemäßen aufgespürt werden. Das Sachgemäße ist an das Menschengerechte gebunden. Dies drückt sich bei ihm in dem fundamentalen Satz aus: "Es kann nicht wirklich menschengerecht sein, was nicht sachgemäß ist, und nicht wirklich sachgemäß, was dem Menschengerechten widerspricht. " 27 Ökonomische Werte sind also eingebunden in humane ethische und kulturelle Werte. Wo Ungüter im ökonomischen Bereich überhandnehmen, wird das Werterfassen und Stellungnehmen zu Werten empfindlich gestört. Ungüter gaukeln Werte vor, die Unwerte sind. Im Erfassen von Werten gibt es keine Beliebigkeit. Dies liegt darin begründet, daß Werte nicht beliebige subjektive Schöpfungen des Menschen, sondern in ihrem Wertegehalt ähnlich vorgegeben sind wie das unbeliebig Gute. 28 Es liegt am Menschen, seine Erlebnis- und Verstehensfähigkeit am Werthaitigen zu orientieren. Wo Ungüter überhandnehmen, ist auch die Gefahr der Orientierungslosigkeit gegeben.
E. Schlußbemerkungen Es ist ein anerkennenswertes Verdienst von Gerhard Merk, auf die Problematik von Ungütern innerhalb des ökonomischen Lebensbereiches in Produktion und Verbrauch vielfältig hingewiesen zu haben. Daß Ungüter nicht leicht aus dem wirtschaftlichen Geschehen zu verdrängen sind, ist mit dem irdisch verfaßten Menschsein verbunden, das zum Guten und Unguten, zu Werten und Unwerten fähig ist. Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817), ein Mann von Weltweisheit und eine der berühmtesten Persönlichkeiten seiner Zeit (auf dessen Werk Gerhard Merk seit Jahren aufmerksam macht), hat über den Branntwein, dem er nicht sehr wohl gesonnen war, dennoch geschrieben: "Die Polizey darf das Consumo des Branteweins und das Brennen desselben nicht verhindern, sondern sie muß es so leiten, wie es das allgemeine Beste erfordert, so daß 26 Arthur Rich: Wirtschaftsethik. Grundlagen in theologischer Perspektive, 2. Aufl.
Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus) 1985, S. 73.
27 Arthur Rich: Wirtschaftsethik, Bd. II. Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus) 1990, S.
174.
28 Peter Koslowski: Wirtschaft als Kultur, S. 123.
Ungüter und ethische Verantwortung
35
das Brod nicht dadurch vertheuert werde. Dann muß sie für seine Güte und für billige Preiße sorgen." 2 9 In freiheitlichen Gesellschaften gehört die freiheitli:he und selbstverantwortliche Lebensgestaltung zu den Grundwerten und Grundrechten. Wie gefährdend Ungüter im Leben des Einzelmens:hen und der Gesellschaft sich auswirken können, ist aus den vorstehenden Überlegungen deutlich geworden. Gefahren erkennen heißt die Möglichkeiten, sie zu bannen und zu überwinden, zu ergreifen. Das Sprichwort: "Gefahr erkannt, Gefahr gebannt" kann hier Hilfen bieten. Ein wichtiger Teil des Gemeinwohles besteht darin, daß staatliche und kirchliche Institutionen wie auch die gesellschaftsgestaltenden Verbände sich dieser Aufgaben annehmen. In gleicher Weise wichtig ist die Förderung der freiheitli:hen Verantwortung der Einzelperson, die sich als verantwortliche Freiheit zum Guten und Werthaitigen erweisen soll.
29 GerhardMerk: Jung-Stilling-Lexikon Wirtschaft. Berlin (Duncker& Hurnblot) 1987,
s. 15.
TUGEND ZWISCHEN "GUT" UND "UNGUT" Von Ludwig Watzal, Bonn
"Für die Religion steht Gott am Anfang der Erkenntnis, für die Naturwissenschaft am Ende." Solche Einsicht Max Plancks möchte man sich auch für die Politikwissenschaft wünschen. Doch diese Disziplin hat sich von transzendenten Aussagen so gründlich verabschiedet, daß sie nur noch das Meßbare als die einzige Wirklichkeit anerkennt. Die Meß-Ergebnisse werden dann von der Wissenschaft nur noch in ein widerspruchsfreies System gebracht. Überspitzt könnte man formulieren, daß der Sinn eines Satzes in der Methode seiner Verifikation liegt. Dieser generelle Vorwurf trifFt auch die Disziplin des hier zu Ehrenden: die Ökonomik. Nach Aristoteles befindet sich unser Freund Gerhard Merk in jenem Lebensabschnitt, in dem Erfahrung und Wissenschaft sich zur Weisheit verbünden. Von diesem Punkt aus kann man nur noch in höhere Gefilde emporsteigen. Es sei aber gleich mit Thomas von Aquin eingewendet, daß man die Klugheit nicht von Natur aus besitzt, sondern sie resultiert aus der Erfahrung. Bei der Klugheit handelt es sich also um ein Gut. Was aber ist ein Gut? Was konstituiert es? Was macht es zu einem Ungut?
A. Das Gute und die Güter Gut, das Gute, das Gut (to agaton, bonum) steht in enger Beziehung zur Wirklichkeit, und diese bildet das Fundament des Guten. Dem Sein der Wirklichkeit tritt das Sollen gegenüber; denn das Gute ist das, was sein soll. Sokrates: hat zuerst die Frage nach dem Wesen des Guten gestellt und es als das zum glücklichen Dasein (Eudaimonia) Führende bezeichnet. Auch Platon geht von diesem Verständnis aus. Er unterscheidet drei Arten des Guten bzw. der Güter: 1. solche Güter, die wir aus Liebe zu ihnen selbst besitzen möchten;
38
Ludwig Watzal
2. solche Güter, die wir um ihrer selbst als auch ihrer Folgen willen mögen, und 3. solche Güter, die wir nur wegen ihrer Folgen erstreben, obwohl sie uns lästig erscheinen. Platon bevorzugt die zweite Art, worunter er auch die Tugend der Gerechtigkeit subsumiert. Er verweist aber darauf, daß es über die Tugenden hinaus noch ein höchstes Gut gebe. Aristoteles kritisiert die vielseitige Verwendung des Guten bei Platon. Weit fassend, definiert er das Gute als "das, wonach alles strebt". Einschränkend bestimmt er dies aber nur als das dem Menschen zukommende Strebevermögen. Aristoteles entwirft eine Güterpyramide, an deren Spitze das "höchste Gut" steht. Dieses höchste Gut ist nur wegen seiner eigenen Qualitäten zu wählen, jedoch niemals eines anderen Gutes wegen. Auch Aristoteles sieht in der Eudaimonia das höchste Gut. Er bestimmt es von der Tugend des Menschen aus, die in der hervorragenden Ausübung seiner Fähigkeiten liegt, nämlich im Gebrauch seiner Vernunft.
B. Kriterien f"tir das Gute und Böse Das Christentum hat das Ziel des höchsten Gutes ins Transzendente verlagert. Die Verwirklicllung des Guten ist nicht die Erfüllung eines immanenten Ideals, sondern ein Gebot Gottes. Entscheidungsinstanz für das Gute (und das Böse) ist das Gewissen. Das höchste Gut stellt nach Augustinus Gott dar. Auf ihn hin ist alles Streben ausgerichtet. Das Streben des Menschen nach Vollkommenheit kommt quasi seiner Vergöttlichung gleicll. Es liegt in seinem Willen, ob er dieses Ziel erreichen will, d.h. ob er sich für das Gute oder das Böse entscheidet. Auch Thomas von Aquin sieht im freien Willensakt den Kristallisationspunkt für die Entscheidung zwischen Gut und Böse. Diese Wahlfreiheit gründet nach dem Aquinaten in der absoluten Gutheit Gottes. Thomas sieht das Gute in dreifacher Hinsicht: -
als Selbstwert wegen seiner Schönheit, lustvoll in seiner Verbindung mit dem Streben und nützlich für ein zugeordnetes Ziel.
Modern gewendet heißt dies, daß sich jeder Sachverhalt in verschiedenen Wertaspekten zeigt. Ein Wald als ökonomisches Gut z.B. für Erholungszwecke; als Objekt der Forschung; als Stimmungsträger für Künstler, etc.
Tugend zwischen "Gut" und "Ungut"
39
C. Relativierung des Guten Bei Thomas Hobbes erfuhr das Gute einen Bedeutungswandel, der das Ansichsein des Guten radikal zerstört. Gut sind solche Dinge, die erstrebt werden. Es ist sinnlos, von einem Gut schlechthin zu reden. Gut ist relativ zu Person, Ort und Zeit. Gleichwohl unterscheidet Hobbes zwischen wahrem und scheinbarem Gut. Scheinbare Güter sind solche, die vordergründig als erstrebenswert erscheinen, deren Folgenjedoch ein Übel implizieren. Das wahre Gut kann nur durch vorausschauende Überlegungen gefunden werden. Auch Barueh Spinoza vertritt die Relativität des Guten. Gut und schlecht gibt es nicht von Natur aus, sondern nur im Verstand des Menschen. Kant bindet das Gut an die Autonomie des Subjekts und erklärt es aus dem Selbstbezug des Willens. Friedrich Niebsche betrachtet alles das als Gut, was die Macht im Menschen erhöht. Der Gegensatz dazu ist nicht böse, sondern schlecht, weil er aus der Schwäche resultiert.
D. Tugenden und das Gute Was ist nun das Ziel des Staates und der Menschen? Die Tradition war sich einig darin, daß das Ziel in der Ermöglichung eines guten und glücklichen Lebens liegt. Das Glück setzt aber nach Aristoteles ethische Vollkommenheit und ein Vollmaß des Lebens voraus. Durch ein tugendhaftes Leben ist diese ethische Vollkommenheit zu erreichen. Ein Ziel der Politikwissenschaft muß es deshalb sein, Tugenden zu lehren und ihre Bedeutung für Staat, Gesellschaft und Individuen aufzuzeigen. Im folgenden soll deshalb den Fragen nachgegangen werden, inwieweit Tugenden Güter, Un-Tugenden aber Ungüter sind. Hier soll die These aufgestellt werden, daß es sieh im allgemeinen bei Tugenden um Güter handelt. Um dies zu verifizieren, soll auf die Definition von Gerhard Merk zurückgegriffen werden: Ein Gut ist ein "Sein (Person oder Sache), das um seines Wertes wegen tatsächlich geschätzt, begehrt und deshalb auch erstrebt wird." Ein Ungut ist demnach jenes Ding, das einem Individuum schadet. Somit haben wir uns auch hier eng an die Definition von Gerhard Merk angelehnt. Wie verhalten sich im Lichte dieser Definition die Tugenden? Sind sie ein für allemal Güter, oder können sie sich im Laufe der Zeit zu Ungütern wandeln? Tugenden sind in unserer sogenannten "postmodernen" Zeit außer Mode gekommen. Wer kann heute noch etwas mit der Tugend der Besonnenheit, Demut, Weisheit, Bescheidenheit, Großmut, Klugheit, Tapferkeit, Wahrhaftigkeit, Gelassenheit oder Treue anfangen? Diese Tugenden oder
40
Ludwig Watzal
Werte gelten weithin als antiquiert, überholt, ja gar als reaktionär. Werte und Tugenden wie Individualität, Durchsetzungs- und Stehvermögen, Flexibilität, vielleicht noch Solidarität sind gefragt. Wie steht es zum Beispiel mit der Demut? Wer weiß denn, was sie bedeutet? Ist sie ein Gut? Ein Ungut vielleicht, weil sie nur aus einem christlich-religiösen Kontext 1u verstehen ist? Das Wort Tugend (gr. arete) bedeutete Tüchtigkeit, Tauglichkeit oder etwas Bestes lU sein. Dies traf nicht nur auf den Menschen, sondern auch auf Tiere und Sachen zu. Eine ähnliche Bedeutung hat das Wort auch im Deutschen. Es kommt von "taugen" und meinte ebenfalls die Tüchtigkeit im allgemeinen und nicht im moralischen Sinne. Virtus im Lateinischen entspricht unserem Wort der Tugend. Es kommt von vir (Mann) her. Tugend ist also gleichbedeutend mit Männlichkeit oder solchen Eigenschaften. Was ist das Wesen der Tugend? Nach der Einteilung der Philosophie gehört Tugend in die Ethik, in jenen Bereich der praktischen Philosophie, die vom richtigen Verhalten des Menschen in der Welt handelt. Die Ethik selber gliedert sich in die Güter-, Tugend- und Pflichtlehre. Jede von ihnen nimmt den ethischen Bereich des Ganzen in Angriff. Die Tugendlehre untersucht solche Grundhaltungen, die die sittliche Vollkommenheit des Menschen konstituieren. Der sittliche Charakter der Tugenden besteht darin, daß sie erst vom Menschen in ihrer Freiheit hervorgebracht werden müssen. Sie sind das "Sediment", das sich bei wiederbaltem sittlichen Verhalten des Menschen bildet. Die Tugenden unterliegen selbstverständlich Wandlungen: sie verändern sich im Laufe der Jahrhunderte. So kamen mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert neue, die sogenannten "bürgerlichen" Tugenden auf. Dazu gehören Ordnungsliebe, Reinlichkeit, Sparsamkeit, Pünktlichkeit, Fleiß und Arbeitsamkeit. Diese bürgerlichen Tugenden kamen zur Blüte, als sich das Bürgertum von aristokratischer und theologischer Vorherrschaft löste. Dies bedeutet jedoch nicht, daß diese Tugenden nicht schon vorher bestanden haben. Aber erst jetzt, wo der Mensch sich mit knappen Mitteln eine Existenz aufzubauen gezwungen ist, entwickelt sich ein Verständnis für diese Art der Tugenden. Wir wollen uns hier nicht mit den bürgerlichen Tugenden befassen, die von uns in je anerzogener Form verinnerlicht worden sind, sondern vielmehr mit den Kardinaltugenden, die eine sittliche Grundhaltung verlangen, die ohne ständige Übung nicht zu erreichen ist. Zu diesen Kardinaltugenden zählen die Besonnenheit, die Tapferkeit, die Weisheit (Klugheit) und die Gerechtigkeit.
Tugend zwischen "Gut" und "Ungut"
41
E. Die Tugend der Besonnenheit Besitzen einige Menschen von Natur aus gewisse Tugenden, durch die sie ihre Ziele erreichen oder ihre Urteile über die Ziele begründen können? Die rechten Ziele des Lebens stehen fest (fines autem recti humanae vitae sunt determinati); die Mittel, um diese Ziele zu erreichen, dagegen nicht. Ihre Verschiedenheit wird durch die Verschiedenheit der Menschen und ihrer Aufgaben bestimmt. Es ist also ein Akt der Klugheit, die Mittel zur Erreichung der Ziele besonnen zu wählen. Wir sind nun bei der ersten der klassischen Tugenden, der Besonnenheit angelangt. Diese Tugend scheint heute fast in Vergessenheit geraten zu sein. Nicht Besonnenheit scheint gefragt zu sein, sondern Hektik und Aggressivität in der Erreichung seiner Ziele. Die Besonnenheit wird heute nicht mehr als eine selbstverständliche Grundlage eines sittlichen Lebens betrachtet. Wer will heute noch ein sittliches Leben führen? Was ist das überhaupt? Ein erfülltes Leben wird in unserer Gesellschaft mit einem hedonistischen Leben und einem ausschweifenden Lebenswandel gleichgesetzt. Die Sophrosyne (Besonnenheit) wird von Platon der Triebstruktur des Menschen zugerechnet; und er versteht darunter das Vermögen, die sinnlichen Begierden in Grenzen zu halten, damit sie keine Macht über den Menschen erlangen. Die Besonnenheit stellt demnach ein Gut dar. Ihr Gegenteil, die Unbesonnen]J.eit, wäre somit als Ungut zu bezeichnen. Unbesonnen handelt der Mensch, der sofort seinen Impulsen nachgibt. Dadurch geUi.hrdet er sein Leben. Der Unbesonnene setzt sich Gefahren aus, weil er diese vorher nicht abgewogen hat. Der Unbesonnene gilt als leichtsinnig. Leichtsinn und Unbesonnenheit sind menschliche Mängel, sprich: Ungüter. Äußerlich ist die Besonnenheit auf das Handeln gerichtet, innerlich dagegen auf den Zustand der Seele. Sich besinnen bevor man handelt - so kommt man zur Besonnenheit. Sie ist deshalb in der Nähe der Vernunft anzusiedeln. Besonnenheit und Vernunft hängen eng miteinander zusammen. Damit ist ein Orientierungspunkt erreicht, von dem aus die Bedeutung der Vernunft für das sittliche Leben des Menschen neu bedacht werden kann.
F. Die Tugend der Tapferkeit Für Aristoteles liegt die Tugend im Einhalten des rechten Maßes. Die schwer innezuhaltende Mitte kann als Schnittpunkt zwischen Gut und
42
Ludwig Watzal
Ungut gedeutet werden. Eine Tugend, die diese Grenze symbolisiert, ist die Tapferkeit. Sie hängt eng mit Entscheidungen zusammen, die oft dem Irrationalismus zugerechnet werden, denn sie schwankt nach Anstoteies zwischen Tollkühnheit und Feigheit. Sowohl Platon als auch Anstoteies haben die Tapferkeit dem kriegerischen Bereich zugeordnet, insbesondere bei der mittelbaren Bedrohung des Lebens. Aristoteles hat daneben noch auf die "bürgerliche Tapferkeit" verwiesen. Dazu zählt das Eintreten für eine Überzeugung, auch wenn sie dem anderen nicht behagt und derjenige fürchten muß, daß er sich dadurch selbst schädigt. Diese Tugend ist gerade im politischen Leben wenig ausgebildet: dort zählt Fle:ribili.tät, Geschmeidigkeit und Opportunismus. Es gibt nur wenige Politiker, die den Mut haben, sich dem allgemeinen Trend zu widersetzen. Deshalb ist es umso wichtiger, daß die Tugend der Tapferkeit im geistig-sittlichen Leben gepßegt wird. Die Bedeutung von Tapferkeit läßt sich besonders an ihrem Gegenteilder Feigheit- verdeutlichen. Feige ist derjenige, der der Angst nachgibt und vor einer Gefahr zurückweicht. Tapferkeit dagegen muß man erringen. Sie ist eine sittliche Haltung, die die Feigheit bewußt unterdrückt.
G. Die Tugend der Weisheit Die Tugend der Weisheit ist heute fast aus der Mode gekommen, denn nirgendwo findet man noch den Weisen. Oder haben sie sich in die Klöster verkrochen? Auch dort sind sie rar geworden. Es gibt zwar viele "kluge Ratschläge"; diese haben aber wenig mit Weisheit zu tun. Heute sind die "fünf Weisen" zu Wirtschaftsprofessoren degeneriert. Mit den Weisen der Antike haben sie nichts gemein. Wo findet man also Weisheit oder den Weisen? Allgemeinhin wird Philosophie als Weisheitslehre übersetzt. Also müßten alle Philosophen Weisheitslehrer sein. Dem ist aber leider nicht so! Zur Weisheit gehört eine lange Erfahrung. Sie ist nur alten Menschen zugänglich. Sie können sine ira et studio beraten und vom Besonderen des Einzelfalles absehen und das Allgemeine verbalisieren. Weisheit ist somit die Fähigkeit des Verstehens, gepaart mit der Güte des Herzens. Eine solche Weisheit findet man noch am ehesten bei den alten Seelenführern der Orthodoxen Kirche Rußlands und Griechenlands. Eine Variante der Weisheit ist die Klugheit. Aristoteles nennt sie eine fürstliche Tugend. Der Kluge ist gemäß der Lehre des Abendlandes nicht nur bloß der "Taktiker", der weiß, wie man eine Sache erfolgreich zu Ende
Tugend zwischen "Gut" und "Ungut"
43
bringt. Klugheit meint die Sachlichkeit dessen, der sich von der Realität und der Einsicht in den Sachverhalt bestimmen läßt. Klugheit setzt also scharfes Denken voraus. Sie hat aber auch eine praktische Seite. Klug ist, wer sich im Leben zurechtfindet, wer die Umstände übersieht und sie auszunutzen vermag. Die prudentia meint die Kunst des Vorhersehens. Auch im Deutschen heißt es: "Der kluge Mann baut vor." Der Kluge denkt nur an seinen eigenen Vorteil. Aristoteles behauptet, daß sich die Klugheit nicht aufs Gemeinwohl, sondern nur auf das eigene Wohl bezieht. Klugheit ist aber nicht gleich Schlauheit; diese ist ein Ungut. Schlau ist der, welcher die Dummheit oder die Schwäche des anderen Menschen ausnutzt. Der Schlauheit haftet etwas Verschlagenes an; sie will den Augenblick ausnutzen. Weisheit und Klugheit sind jedoch Güter, die im praktisch-politischen Handeln heute mehr denn je gefordert sind. Ein an Sachzwängen orientiertes pragmatisches Handeln ist kurzsichtig und wird den Problemen nicht gerecht. Von einem richtigen Handeln kann man nur dann sprechen, wenn der Mensch teilhat am ewigen Gesetz. Dies geschieht durch die Wahrheiten der Iex aeterna, die durch die Iex naturalis in menschliches Handeln umgesetzt werden können. Durch diese Fähigkeit zeichnet sich der Mensch als Mensch aus, daß er nämlich von der participatio divini luminis in rationali creatura lebt.
H. Die Tugend der Gerechtigkeit
Zum Schluß soll noch von der obersten Tugend - der Tugend der Gerechtigkeit- gesprochen werden. Schon von Platon ist überliefert, daß Jedem das Seine zu geben ist. Der Gedanke des "suum cuique" ist zum Gemeingut des Abendlandes geworden. Unter der Gerechtigkeit versteht Thomas von Aquinjene "Haltung (habitus), kraftderen einer standhaften und beständigen Willens einem Jeden sein Recht zuerkennt". Mit der Definition des heiligen Augustinus läßt sich wissenschaftlich dagegen weniger anfangen: "Gerechtigkeit ist jene Ordnung der Seele, wodurch es geschieht, daß wir niemandes Knecht sind - es sei denn Gottes allein." In der Bibel werden die Gerechten mit den Guten und die Ungerechten mit den Schlechten gleichgesetzt. "Der Fluch des Herrn liegt auf dem Hause des Frevlers, doch den Wohnsitz des Gerechten segnet er" (Sprüche 3,33). Und im Neuen Testament heißt es: "Der Herr läßt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse, und läßt es regnen über Gerechte und Ungerechte" (Matthäus 5,45). Wie kam es zu dieser Parallele? Der sittlich Gute steht im Einklang mit der göttlichen Rechtsordnung und wird deshalb Gerechter genannt.
44
Ludwig Watzal
Schon seit Platon wird versucht, eine Theorie der Gerechtigkeit als Maßstab des Handeins aufzustellen. Neben den klassischen Formen der Gerechtigkeit (iustitia legalis, iustitia distributiw. und iustitia commutativa) diskutiert man u.a. über Bedürfnis-, Chancen-, Leistungs- und Besitzstandsgerechtigkeit. Dabei gerät immer häufiger das Recht in Konftikt mit den Gerechtigkeitstheorien. Selbst der ehrgeizige Versuch John Rawls konnte diese Spannung nicht lösen. Die Durchsetzung einer reinen Formalgerechtigkeit, ohne dabei Barmherzigkeit walten zu lassen, ist nach Thomas von Aquin eine "Grausamkeit". Und in der Summacontra Gentes gibt er zu bedenken: "Durch Gebote der Gerechtigkeit den Frieden und die Eintracht unter den Menschen wahren zu wollen ist unzulänglich, wenn nicht unter ihnen die Liebe Wurzel schlägt." Wie schwer das "suum cuique" in politisches Handeln umzusetzen ist, zeigen uns die täglichen Auseinandersetzungen der politisch Verantwortlichen. Bedeutet "Jedem das Seine", daß jeder das Gleiche bekommen soll, wie es die sozialistischen Theoretiker fordern; oder bedeutet es, daß jeder nach seinem Stand oder Fähigkeiten seinen gerechten Lohn erhalten soll, wie es von konservativer Seite verlangt wird? Wir wollen nur noch kurz einen anderen Aspekt der Gerechtigkeit beleuchten, an den man nicht sofort denkt: Was bedeutet Gerechtigkeit im Verhältnis Gottes zum Menschen. Wie wird hier das "suum cuique" interpretiert? Im strengen Sinne kann es das reddere suum cuique im Verhältnis Gottes zum Menschen nicht geben, denn Gott schuldet dem Menschen nichts. Obwohl Gott jedem Menschen das ihm zustehende gibt, so ist der doch nicht Schuldner in unserem Verständnis. Er verfügt über den Menschen nach Thomas von Aquin cum magna reverentia. Gerechtigkeit kann es nur zwischen solchen Menschen geben, die gleichrangig sind; zwischen jenen, die es nicht sind, kann es auch keine Gerechtigkeit geben, lehrte uns schon Thomas von Aquin.
I. Wahrheit und Liebe Abschließend möchten wir auf die Einsicht Max Plancks zurückkommen. Implizit ist darin die Frage nach der Wahrheit aufgeworfen. Gerade der Wissenschaftler hat sich die Wahrheitsfrage beständig zu stellen. Sie stellt für ihn quasi die oberste Tugend dar. Die Wissenschaft sollte für ihn nur Medium auf dem Weg zur sogenannten "absoluten Wahrheit" sein. Doch was ist Wahrheit? Wie läßt sie sich finden und realisieren?
Tugend zwischen "Gut" und "Ungut"
45
Ein trauriges Kennzeichen unserer "postmodernen" Gesellschaft ist es, daß der Mensch nichts mehr mit dem Phänomen des Ewigen anfangen kann. Die auf Konsum zugeschnittene Massenkultur hat seine Seele verstümmelt; sie hat ihm den Weg zu den Grundfragen seiner Existenz verbaut. Es ist ihm nicht mehr bewußt, daß er ein gesittigtes Wesen ist. Doch ein Wissenschaftler darf nicht taub gegenüber dem Ruf der Wahrheit bleiben. Es gibt verschiedene Formen der Wahrheit, ja heutzutage sogar "Wahrheitstheorien": ein problematischer Begriff, der hier einfach so hingenommen wird. Der Sinn religiöser Wahrheit liegt in der Hoffnung auf ein Leben in Gottes Herrlichkeit. Doch der Mensch kann die Wahrheit nur in Liebe erkennen, wie wir aus 1. Korinther 13 wissen. Wenn ein Mensch auch mit Engelszungen redet, hätte aber die Liebe nicht, so wäre er eine klingende Schelle. Auch wenn Weissagungen, Sprache und die Erkenntnis aufhören würden, wird es die Liebe niemals tun. Um zur rechten Erkenntnis zu kommen, muß sich also Wahrheit mit Liebe verbinden. Ist eine solche Forderung in unserer "postmodernen" Zeit völlig realitätsfremd?
ETHISCHE GRENZEN BEI DER HERSTELLUNG UND VERWENDUNG VON GÜTERN Von Rolf Kramer, Berlin
A. Mikroökonomische Güterentscheidung I. Güter und Ungüter
Güter und Dienstleistungen sollen bestimmte Bedürfnisse bzw. eine in Geld zu bewertende Nachfrage befriedigen. Sie stiften einen ökonomischen Nutzen. Indessen kann die Herstellung und Verwendung der Güter für den einzelnen wie für die Gesellschaft gleichzeitig einen Schaden bedeuten. Ein solches "Gut", durch das der einzelne oder die Gesellschaft (bei seiner Herstellung oder Verwendung) Schaden erleidet, kann nach Gerhard Merk als ein "Ungut" bezeichnet werden. 1 Üblicherweise spricht man in der ökonomischen Literatur eher von "Übel". Damit sind dann Waren und Dienstleistungen gemeint, die sich auf den einzelnen und/oder Gesellschaft schädlich auswirken, mindestens eine Minderung des Wohlstandes herbeiführen. Ob eine Ware oder Dienstleistung ein "Gut" ist, dem ein ökonomischer Wert beigemessen wird, läßt sich am leichtesten an dem Tauschverhältnis gegenüber einem anderen "Gut" ablesen. In der Tauschbarkeit der Güter zeigt sich ihr Wert. Meßbar ist er (meistens viel einfacher) über den in Geld bewerteten Preis, über den die Güter (relative Güter und auch Übel/Ungüter) hinsichtlich ihres Wertes geschätzt bzw. nachgefragt werden. Dabei geht es nicht um die Wertschätzung eines Gutes durch den einzelnen, sondern vielmehr um das Verhältnis der Güter zueinander. 1 Vgl. Doris Böggemann: Zum Begriff der Ungiiter, in diesem Band, S. 1 ff.
48
Roll Kramer
Der subjektive Wert eines Gutes könnte allein unter dem Gesichtspunkt gemessen werden, daß es nur dem einzelnen und keinem Menschen sonst dient. Die Bewertung kann auch von der Gesellschaft vorgenommen werden, und das bedeutet: wir haben es neben einer individueUen zugleich mit einer sozialen Bewertung zu tun. In der Anlehnung an Gerhard Merks Grundstruktur kann von einem vierfachen Schema ausgegangen werden. Die Güterverwendung kann vom einzelnen als positiv oder negativ beurteilt werden; die entstehenden Güter sind dann unterschiedlich zu kennzeichnen. 2 Sind die Güter für
1 2a
2b
3
den einzelnen die Gesellschaft positiv positiv positiv negativ 3 Der Eigennutz eines Gutes bringt nicht einen Gesamtnutzen hervor (Gebrauch eines Autos) negativ I positiv SelbstzeiStörerisches Handeln kann zum Nutzen der Allgemeinheit geschehen (Aufforsten bei gleichzeitiger Überbeanspruchungder eigenen Person) negativ I_ negativ Der Drogenabhängige macht sich zwar krank; aber er bringt gleichzeitig die Gesellschaft in den Zugzwang, gegen die Drogenabhängigkeit etwas unternehmen zu müssen
Kennzeichnung Güter relative Güter
relative Güter
reine Ungüter/Ubel
2 Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, in: Allred Klose et al. (Hrg.): Frieden
und Gesellschaftsordnung. Festschrift für Rudolf Weiler zum 60. Geburtstag. Berlin (Duncker & Humblot) 1988, S. 204.
3 Nach Emil Küng (Wohlstand und Wohlfahrt. Von der Konsumgesellschaft zur Kul-
turgesellschaft. Tübingen (Mohr-Siebeck) 1972 S. 42) heißen 2a und 3 auch "Kollektivübel" oder "public bads" als Gegenstück zu den "public goods" oder den "Kollektivgütem".- Gerhard Merk geht in seinem Aufsatz "Konfliktstau durch Ungüter" von einer sechsfachen Grundstruktur aus. Er fügt nämlich je eine Position hinzu, in der er von einem für die Gesellschaft indifferenten Gut ausgeht, das er hinsichtlich der Wohlstandsänderung für den einzelnen einmal als positiv, das andere Mal als negativ beurteilt. In diesen Fällen kommt es für ihn zu "neutralen" Gütem bzw. Ungütem. Zwischen bedingte und unbedingte Güter bzw. Ungüter noch neutrale Güter bzw. Ungüter einzuschieben, stellt sich als äußerst subjektiv dar; dies kann als instabile Bewertung heute so und morgen anders ausfallen.
Ethische Grenzen bei der Herstellung und Verwendung von Gütern
49
Bei der Unterscheidung von bedingtem Gut und bedingtem Ungut (hier: 2a + 2b), die Merk vorschlägt, um darauf aufmerksam zu machen, daß eine positive (bzw. negative) Verwendung der Güter beim einzelnEn gleichzeitig zu einer negativen (bzw. positiven) Folge in der GesellschaCt Cühren kann, ist der Unterschied in der GesellschaCt dadurch bedingt, daß in dem ersten Fall sogenannte soziale Kosten entstehen, die von der Allgemeinheit getragen werden müssen. Im zweiten Falljedoch übernimmt das Individuum die Kosten selbst oder zahlt Cür den ihm entstandenen Schaden. In diesem Zusammenhang jedoch wäre zu überlegen, ob nicht bei einem Gut mit individuellem Nutzen und gleichzeitigem gesellschaCtlichen Schaden von einem Übel geredet werden müsse. Aber Cür den einzelnEn gilt, daß ihn seine egoistischen Interessen etwaige kollektive Übel in Kauf nehmen lassen. "Indem er ein Kollektivübel hervorruft, schafft oder produziert er privates Gut. Nicht aus Bosheit oder schlechter Absicht trägt der Autofahrer seinen Teil zum Smog bei. Es ist keine bewußte Planung, die ihn anderen Schaden zuCügen läßt; wenn wir von den gegebenen Handlungsmöglichkeiten ausgehen, können wir sagen, daß der Schaden, den er durch sein Verhalten verursacht, ein Nebenprodukt seiner individuellen Nutzenmaximierung ist". 4 In vielen Fällen hängt es von der Quantität ab, ob man von einem Gut oder bereits von einem Übel sprechen muß. EinzelabS.lle im Park bedeuten im allgemeinen noch nicht Übel; sie werden es erst bei einer entsprechenden Menge. Statt von bedingten Gütern oder bedingten Ungütern wäre es richtiger, von relativen Gütern zu sprechen. Buchanan verweist jedoch darauf, daß "aus dem Blickwinkel des individuellen Nutzenblküls" gesehen, jede Einschränkung des "individuellen Verhaltens ein 'Übel' darstellt". 5
II. Die ökonomischen Prinzipien Werner Sombart hat von bestimmten Wirtschartsgesinnungen gesprochen, in denen die Wirtschaftssubjekte WirtschaCt betreiben.6 Daraus 4
James M. Buchanan: Die Grenzen der Freiheit. Zwischen Anarchie und Leviathan. Tübingen (Mohr-Siebeck) 1984, S. 173.
5 James M. Buchanan: Die Grenzen der Freiheit, S 157. 6 Werner Sombart: Der moderne Kapitalismus. Historisch-systematische Darstellung des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von seinen Anf""angen bis zur Gegenwart. Berlin (Duncker & Humblot) 1922. Bd. I, S. 13 f., S. 24 f. sowie Bd. 11/1, S. 23 fl'.
50
Roll Kramer
lassen sich verschiedene Zwecksetlungen wirtschaftlichen Handeins unterscheiden. Jede Epoche, so meint er, wird von der ihr eigenen Wirtschaftsgesinnung beherrscht. 7 Dabei sind vor allem zwei große Zielsetzungen zu unterscheiden: Das Bedarfsded:ungsprinzip, wenn die Menschen nur ihren "naturalen Bedarf" decken wollen, und das Erwerbsprinzip, wenn sie einen möglichst großen Gewinn anstreben.8 Beide Prinzipien sind keineswegs zu trennen. Das eine schließt nicht unbedingt das andere aus. Das einzelne Wirtschaftssubjekt will meistens beides. Indem es allgemein den Bedarf deckt, macht es einen entsprechenden Gewinn. Das ökonomische Handeln, das sur Herstellung und zum Vertrieb eines Gutes bzw. eines Ungutes führt, kann durch die beiden mikroökonomischen Prinzipien der Rentabilität und der Wirtschaftlichkeit beschrieben werden. Im Prinzip der Rentabilität geht es um die Erzielung eines Gewinnes, oft um seine Optimierung. Mit der GewinnerzieJung ist gleichsam die subjektive Seite des Unternehmens angesprochen. Denn es ist die Absicht des Unternehmers, durch sein Handeln einen ihm angemessenen bzw. möglichst großen Gewinn zu erzielen. Durch das ökonomische Prinzip soll die bestmögliche Produktion bei gegebenem Mitteleinsatz erreicht werden. Das bedeutet, mit möglichst geringen Mitteln eine gesetzte bzw. angestrebte Ausbringung zu erlangen. Das Wirtschaftlichkeitsprinzip gilt dementsprechend auch als Prinzip eines sparsamen Umgangs mit den vorhandenen Mitteln. Auch bei den relativen Gütern muß dieses Prinzip der Wirtschaftlichkeit Beachtung finden. Denn es geht um die Ausbringung von Gütern, die zum Bedarf des einzelnen bzw. der Gesellschaft gehören. Die Frage stellt sich allerdings, ob das Prinzip der Wirtschaftlichkeit auch bei der Produktion und dem Vertrieb von Übeln wahrgenommen werden muß. Da aber von vornherein nicht immer feststeht, ob ein Gut zu einem Übel geworden ist bzw. als ein solches von den Menschen angesehen wird, wird in vielen Fällen - gleichsam automatisch - das Prinzip der Wirtschaftlichkeit praktiziert, um nicht nur einen Gewinn, sondern einen möglichst hohen Ausstoß bei sparsamer Mittelverwendung zu erzielen.
ITI. Externe Kosten Über den subjektiven Ansatz des Wirtschaftlichkeitsprinzips hinaus gibt es im ökonomischen Denken auch eine objektive Seite. Es geht um 7 Werner Sombart: Der moderne Kapitalismus, Bd. 1/1, S. 25. 8 Werner Sombart: Der moderne Kapitalismus, Bd. 1/1, S. 14.
Ethische Grenzen bei der Herstellung und Verwendung von Gütem
51
einen möglichst geringen Aufwand und um die Vermeidung von externen Kosten, die entstehen, wenn Wirtschaften auf Kosten der Allgemeinheit praktiziert wird. Die schädlichen Folgen, die beim Wirtschaften zu Lasten der gegenwärtigen und der kommenden Generation auftreten, müssen reduziert werden. Güter, die bereits während der Produktion oder beim Vertrieb Schaden hervorrufen oder solche, deren schädliche Folgekosten von der Allgemeinheit getragen werden, können nicht ohne weiteres zur Produktion "freigegeben" werden. Das gilt auch in einer marktwirtschaftliehen Ordnung, die dem Produzenten und Konsumenten ein Höchstmaß an Freiheit zusichert. So dürfen weder von der pharmazeutischen Industrie Arzneimittel ungeprüft auf den Markt gebracht werden, noch dürfen die Konsumenten aus ihrer Souveränität heraus selbst wählen, welches Arzneimittel sie frei auf dem Markt kaufen wollen. Beim Güterangebot wie auch bei der Güternachfrage sind ethische Grenzen gesetzt. Im Zeitalter der ökologischen Probleme gehört dazu auch der Schutz der Gemeinschaft. Dabei müßte das Verursacherprinzip zum Tragen kommen. Wer der Gemeinschaft und der Umwelt Schäden zufügt, hat für die Beseitigung der Schäden aufzukommen. Inwieweit der Produzent die dafür auftretenden Kosten wiederum auf den Endverbraucher abwälzen kann, ist eine Frage der Marktchancen.
B. Makroökonomische Entscheidungsinstanz
I. Die Ordnungspolitik Der Begriff der Ordnung ist im ökonomischen Schrifttum nicht eindeutig bestimmt. 9 Nach Friedrich von Hayek stellt Ordnung keinesfalls einen Norm- oder Wertbegriff dar, sondern vielmehr einen "Tatsachenbegriff wie irgendein anderer wissenschaftlicher Begriff" . 10 Dagegen wird hier der Ordnungsbegriff der Wirtschaft in der Weise verstanden werden, daß durch sie "die vielfältigen ökonomischen Handlungen aufeinander abgestimmt werden sollen" . 11 Als wichtigste Aufgaben eines solchen Ord9
Gerhard Merk: Die Begriffe Prozeßpolitik, Struktwpolitik und Ordnungspolitik, in: Jahrbuch für Sozialwissenschaften, Bd. 26 (1975), S. 203 ff.
10 Friedrich A. v. Hayek: Freiburger Studien. Gesammelte Aufsätze. Tübingen (Mohr-
Siebeck) 1969, S. 166.
11 Gerhard Merk: Prozeßpolitik, Struktwpolitik und Ordnungspolitik, S. 207 f.
52
Rolf Kramer
nungssystems gelten: Marktabstimmung, Produktionsbestimmung, Faktorzuteilung, Güterverteilung, Investitionslenkung, Beschäftigung. 12 Die Ordnungspolitik ist dabei die Einwirkungsmöglichkeit und Beeinflussung der jeweiligen Organisationsform der Volkswirtschaft. Sie erstreckt sieh insonderheit auf zwei untersehiedliclte Bereiclte, auf das Wirtschaftssystem und auf die Wirtsehaftsstruktur.
1. Das Wirtschaftssystem
Die Wirtschaftsordnung wird als übergeordneter Begriff verstanden, aber mit dem des Wirtschaftssystems gleicltgesetzt. Danach fallen Marktwirtschaft und zentralistische Planwirtschaft sowohl unter den Begriff des Systems wie der Ordnung. Wirtschaftsordnungen werden von den durch gesellschaftspolitische Grundentscheidungen vorgegebenen Wertevorstellungen geprägt und geregelt. Der Ordnungsbegriff wird hier also gegen Hayek als Norm- oder Wertbegriff verstanden. Individualisierung, Freiheit und Eigentumsgarantie sind die Kennzeichen der Marktwirtschaft; kollektivistische Entscheidungen, Planungen, sozialistischer Eigentumsbegriff prägen die zentral geleitete Verwaltungswirtschaft. Die Soziale Marktwirtschaft stellt ein marktwirtschaftliches Ordnungssystem dar, das dem Markt verpflichtet ist. Ihre soziale Komponente bringt eine Einschränkung dieser marktwirtschaftliehen Ordnung, insofern sie anthropologische und soziale Ergänzungen berücksichtigt. Denn sie soll eine Ordnung verwirkliclten, in der das Prinzip der Freiheit auf dem Markt mit dem des sozialen Ausgleichs verbunden wird. 13 Die soziale Komponente der Sozialen Marktwirtschaft muß jeweils von neuem besonders auf Grund gesellschaftlicher und wertbezogener Veränderungen bestimmt oder ergänzt werden. Von daher ist auch eine Erweiterung des Sozialen denkbar. Darauf hat Müller-Armack bereits sehr früh in der Gestalt seiner Zwei-Phasen-Theorie der Sozialen Marktwirtschaft hingewiesen. Als erste Phase bezeicltnete er die Jahre von 1948 bis ca. 1962. Dann setzte die zweite Phase ein. In dieser sollte die Soziale Marktwirtschaft die gesellschaftspolitischen Ziele zu Beginn der sechziger Jahre aufgreifen. Dazu gehörten damals- nach Müller-Armack: 12 Gerhard Merk: Prozeßpolitik, Strukturpolitik und Ordnungspolitik, S. 208. 13 V gl. Allred Müller-Annack: Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Studien und Konzepte zur Sozialen Marktwirtsmart und zur Europäischen Integration, 2. Auß. Bern (Haupt) 1976 (Beiträge zur Wirtschaftspolitik, Bd. 4).
Ethische Grenzen bei der Herstellung und Verwendung von Gütern
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
53
Umweltschutz, Gliederung des Wohn-, Siedlungs-, Verkehrs- und lndustrieraumes, die Sicherung des Selbständigwerdens und des Selbständigbleibens, die Streuung der Vermögensbildung und die Aufrechterhaltung der Wihrungsstabilität, stabilitätskonformer Sparerschutll, Ausbau der sozialen Sicherung und der sozialen Selbsthilfe, Bildungsinvestitionen, Verstärkung einer in ihrer Freiheit gesicherten Forschungspolitik usw. 14
Die soziale Gestaltung der Sozialen Marktwirtschaft war keine ein für alle Male feststehende Größe. Im Gegenteil, es wurde eine Einflußnahme auf die Wirtschaftspolitik durch die Gesellschaft gefordert. Darum verstand Müller-Armack auch die Soziale Marktwirtschaft als eine "evolutive Ordnung, in der es neben dem festen Grundprinzip, daß sich alles im Rahmen einer freien Ordnung zu vollziehen hat, immer wieder nötig ist, Akzente neu zu setzen gemäß den Anforderungen einer sich wandelnden Zeit." 15
2. Die Wirtschaftsstruktur Der Begriff der Ordnung wird heute vielfach auch mit dem Begriff der Wirtschaftsstruktur gleichgesetzt. Andere Ausdrücke für diese Vorstellung von Ordnung sind: Datenkrans und Rahmenordnung. Diesen Begriffen liegen Größen oder Daten su Grunde, die den wirtschaftlichen Ablauf gestalten bzw. bestimmen. Sie sind von außen vorgegeben und sollen als so verstandene "Daten" nicht direkt vom wirtschaftlichen Ablauf beeinflußt werden. Unter dem Begriff des Datenkranzes ist eine Struktur 1u verstehen, die im wirtschaftlichen Ablauf mit festen Faktoren rechnet. Die gesamtwirtschaftlichen Daten stellen solche Einflußgrößen dar, "die den ökonomischen Kosmos bestimmen, ohne selbst unmittelbar von ökonomischen Tatsachen bestimmt 1u sein" 16 • Walter Eucken sieht solche gesamtwirtschaftlichen Größen in der Natur, der Arbeit, den Bedürfnissen, dem 14 Alfred Müller-Annack: Genealogie der sozialen Marktwirtschaft. Frühschriften und
weitenuhrende Konzepte, 2. Aufl. Bern (Haupt) 1981, S. 310; vgl. S. 174 (Beiträge zur Wirtschaftspolitik, Bd. 34).
15 Alfred Müller-Annack: Genealogie der sozialen Marktwirtschaft, S. 15. 16 Walter Eucken: Die Grundlagender Nationalökonomie. Berlin, Heidelberg, New York
(Springer) 1958, S. 156 (Enzyklopädie der Rechts- und Sozialwissenschaft N.F., Abteilung Staatswissenschaft).
54
Rolf Kramer
technischen Wissen oder in der rechtlichen oder sozialen Organisation gegeben. Für die Wirtschaftspolitik sind das gegebene Faktoren, die von außen dem Ökonomen, der Gesellschaft, dem Gesetzgeber, der Exekutive, der Rechtsprechung vorgegeben sind. Für den Wirtschaftsethiker dagegen sind sie keine Daten, die unveränderbar sind. Vielmehr stellen sie solche Größen dar, die in Verbindung mit den gesamtgesellschaftlichen Kräften gestaltet werden können. 17 Was heute in dem Ordnungsrahmen der Wirtschaftsstruktur gilt, ist möglicherweise morgen bereits überholt. Der Ordnungsrahmen kann nur gestaltbare Potenz darstellen.
II. Individual- und Gemeinwohl im Verhältnis zu den Gütern und Ungütern Das Einzelwohl ist auf den einzelnen Menschen ausgerichtet. Sein Inhalt besteht darin, daß sich das Individuum entfalten, seine Lebenserfiillung finden und sich im Leben verwirklimen kann. Es steht unter der Zielsetzung, daß der einzelne das ihm eigene Wohl erreicht. Das Individuum lebt nicht allein, sondern ist auf bestimmte Ziele ausgerichtet, die es gemeinsam mit anderen erreichen will. Deshalb besteht über das Einzelwohl hinausgehend ein durch das Wohl einzelner herbeigefiihrtes Gemeinwohl. Aber dieses ist mehr als die Summe der Einzelwohle. Das Gemeinwohl umfaßt zwei Bereime, nämlich (a) das Gemeingut. Nach der Enzyklika Mater et Magistra Johannes XXIII. ist damit eine Auffassung des Gemeinwohls zu verstehen, die sich niederschlägt im "Inbegriff jener gesellschaftlichen Voraussetzungen, die den Menschen die volle Entfaltung ihrer Werte ermöglichen oder erleichtern" . 18 (b) Die Gemeingliedemng oder die Gemeinwohlordnung. Sie hat die zielltitende Organisation aufzustellen, damit die Mitglieder des sozialen Gebildes auf das gemeinsame Ziel hin zusammengefiihrt und zusammengehalten werden. Die Gemeingliederung ist darum eine organisatorische Größe, die als das Mittel zum Ziel zu kennzeimnen ist. Das Gemeingut wird auch als inhaltlimer, das Gemeinwohl als organisatorischer Wert aufgefaßt. 19 17 Vgl. Doris Böggemann: Zur Definition der Ungüter, S. 4 ff.
18 Papst Johannes XXIII.: Mater et Magistra. Rundschreiben über die Ordnung des
gesellschaftlichen Lebens der Gegenwart im Sinne der christlichen Gebote vom 15. Mai 1961, Nr. 65.
19 Eberhard Welty OP: Herders Sozialkatechismus. Bd. 1: Grundfragen und Grundkräf-
te des sozialen Lebens. Freiburg (Herder) 1961, S. 64.
Ethische Grenzen bei der Herstellung und Verwendung von Gütern
55
Dementsprechend will auch Gerhard Merk unter dem Oberbegriff' des Einzelwohles als Zielbegriff das EinseJgut (des Menschen Selbstentfaltung) und seine EinseJgliederung (die sur Selbstverwirklichung dienende organisatorische VerfaBtheit des Menschen) subsumieren.20 Das Einzelwohl umfaBt also sowohl das Einseigut wie auch die Einzelgliederung. Zwischen dem Wohlstand des einzelnm und seinem Wohl besteht ein unmittelbarer Zusammenhang. Der Wohlstand weist auf den ökonomischen Zustand des einzelnen hin, sein Wohl stellt das allgemeine gesellschaftliche Wohlbefinden dar. Der einzelne erfährt in seinem Wohlstand eine Begrenzung, wenn er Güter in sein Leben einbezieht, die eine negative Wirkung ausüben. Sie können nicht nur einen Verlust an Wohlstand bedeuten, sondern auch das individueRe gesellschaftliche Wohl verringern. Reine Ungüter legen bei Produktion und Verwendung der Gesellschaft soziale Kosten auf, die bei der Knappheit der Mittel zu einem Mißbrauch der Ressourcen führen. Dieser entsteht zunächst bei der Herstellung und Verwendung der Güter und anschließend bei der Beseitigung der entstandenen Schäden. Das gängigste Beispiel ist die Produktion von Drogen. Sie bedeutet reine Vergeudung der Ressourcen. Außerdem müssen die Schäden, die beim einzelnen entstehen, von der ganzen Gesellschaft getragen werden.
C. Die ethische Urteilstindung bei dem Umgang mit Gütern und Ungütern (Übeln)
I. Ethik und Ökonomie 1. Im allgemeinm läuft die Diskussion zwischen Ethik und Ökonomie so ab, daB die Ethik die Vorherrschaft gegenüber der Ökonomie behauptet. Man spricht von einer "Domestizierung der Ökonomie durch die Moral". 21 Aber auch der andere Weg, die Ethik aus dem Wesen der Ökonomie heraus su begründen, wird eingeschlagen. Dann wird Ethik als Unterstützung der 20 Gerhard Merk: Grundbegriffe der Erkenntnislehre für Ökonomen. Berlin (Duncker
& Humblot) 1985, S. 64.
21 Karl Homann: Die Rolle ökonomischer Überlegungen in der Grundlegung der Ethik, in: Helmut Hesse (Hrg.): Wirtscha.ftswissensc:haft und Ethik. Berlin (Duncker &
Humblot) 1989, S. 216 (Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Bd. 171).
56
Rolf Kramer
egoistischen Interessen benutst. 22 Gegenüber diesem, den Utilitaristen nahestehenden Versuch, den ökonomischen Egoismus zu rechtfertigen, erhebt sieh die Stimme der klassischen Ökonomie sowie der katholischen und evangelischen Sozialethik. Die theologischen Ansätze zum Verhältnis von Ökonomie und Ethik gehen von der Überordnung der Ethik aus und streben eine "Domestizierung des Egoismus" 23 an, zumindest verlangen sie seine Begrenzung. Das bedeutet auch Beschränkung der Freiheit des einzelnen. Denn wo diese beschnitten wird, oder der einzelne sie in Selbstbeschränkung begrenzt, kommt es zu einer ethischen Steuerung des Wirtsehaftens. 2. Ungüter (Übel) und relative Güter können mit ihren sozialen Kosten und Wohlstandsminderungen nicht immer von vornherein als negativ eingestuft werden. Die Produktion eines Autos, das dem Menschen Mobilität, ein bestimmtes Maß an Freiheit vermittelt und eine intensivere Nutzung seiner Freizeit ermöglicht, wird erst zur Bedrohung, wenn mittels seiner Benutzung die Luft verpestet, die Landschaft zubetoniert wird, und die Menschen mit der gewonnenen Mobilität und Freiheit nichts oder nichts Rechtes anzufangen wissen. Der Wechsel von der Güter- zur Ungüterseite setzt dort ein, wo aus dem Nutzen Schaden wird, wo aus dem Usus ein Abusus entsteht. Wird der Nutzen eines Gutes nur dem einzelnen und der Schaden bzw. seine Beseitigung als soziale Kosten der Gemeinheit zugerechnet, so entsteht ein Mißverhältnis. Das ist nur schwer ökonomisch, eher gesetzlich (politisch) und ethisch (erzieherisch) lösbar. Ökonomisch ist mit den Ungütern (Übeln) so umzugehen, daß die sozialen Lasten und die externen Kosten vom Verursaeher getragen werden müssen (siehe oben). Ob vom Staat oder durch den Gesetzgeber in der Gesellschaft gegen sie eingeschritten werden muß, darf nicht eine Frage von absoluten oder prozentualen Größenordnungen sein, sondern stellt sieh vom grundsätzlichen Standpunkt aus als eine Wertfrage. Was ist letztlich das zu schützende Gut? Mit dem Verursacherprinzip stellt sieh freilich auch die Frage nach seiner Durehsetzbarkeit. Diese hängt von der Möglichkeit ab, die Kosten nicht nur an den Verursaeher weiterzuleiten, sondern darüber hinaus für diesen, sie auf den Konsumenten zu überwälzen. Eine Umverteilung der Kosten aber ist abhängig von der Marktmaeht. Außerdem stellt sieh die 22 Karl Homann: Die Rolle ökonomischer Überlegungen in der Grundlegung der Ethik, s. 218. 23 Karl Homann: Die Rolle ökonomischer Überlegungen in der Grundlegung der Ethik, s. 217.
Ethische Grenzen bei der Herstellung und Verwendung von Gütern
57
Frage, welche Umweltkosten welchem Produkt und von welchem Produzenten sureehenbar sind? 24 Der Druck der Interessenorganisationen wird dann trots eventuell vorhandener individueller Einsichten den Umverteilungsversuch zu Lasten der Mitglieder dieser Interessenorganisationen zu verhindern wissen und andere "Schuldige" suchen. Ob Güter zu Ungütern (Übeln) werden, und wie mit ihnen umzugehen ist, ist vor allem eine ethische Frage und damit eine meta-ökonomische Aufgabe. Die ethische Entscheidung, ob ein Gut ein Übel ist, ist abhängig von der Wertvorstellung der Gesellschaft - und das heißt heute: von der Mehrheit der Gesellschaft und von der Meinungsbildung der politisch Mächtigen. Hierauf jedoch können externe Kräfte Einfluß ausüben. Dabei tragen auch die Kirehen mit Verantwortung.
II. Ethische Kriterien 1. Wirtschaften kann als wirtschaftliches Handeln bezeidlnet werden, dessen Ziel es ist, den Unterhalt der Menschen zu sichern und ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Insofern kann man von einer Dienstfunktion der Wirtschaft sprechen. Ihr Wert besteht nicht in ihrer Autonomie, sondern allein in der Eriullung dieses Dienstes. Die Stillung der Bedürfnisse liegt nicht nur in der Produktion von materie11m Gütern. Ökonomisches Handeln erstreckt sieh auf den ganzen Bereidl menschliehen Daseins, also auf die materiellen Bedürfnisse ebenso wie auf die Güter des geistigen, sittlichen, spirituellen und religiösen Lebens. 25 Wirtschaft als Dienstfunktion soll dem Menschen helfen, sein Leben zu meistern.
2. Nach der Enzyklib. Mater et Magistra Johannes XXIII. ist der Mensch Träger, Schöpfer und das Ziel aller gesellschaftliehen Einrichtungen. 26 In der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes wurden diese Gedanken wieder aufgenommen. Vom Menschen als einer Person wird gesagt, daß er "Wurzelgrund, Träger und Ziel aller gesellschaftliehen Institutionen" ist. 27 In anderer Formulierung wird ausgedrückt, daß der Mensch "Urheber, Mittelpunkt und Ziel aller Wirtschaft" ist. 28 24 Wie hoch ist der Anteil der Kosten für den Straßenbau, der dem Produkt Auto
oder Motorrad bzw. speziell dem Fahrer zuzurechnen ist? Welche Erkrankungen der Lunge sind ohne weiteres dem Genuß von Tabakwaren zuzuerkennen?
25
Zweites Vatikanische Konzil: Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute, Gaudium et Spes, Nr. 64.
26 Papst Johannes XXlll.: Materet Magistra, Nr. 219. 27 Gaudium et Spes, Nr. 25. 28
Gaudium et Spes, Nr. 360.
58
Rolf Kramer
Man würde diese Aussagen mißverstehen, wenn daraus isolierte, einseitige, individuelle Strukturen abgeleitet würden. Die Wirtschaft ist nicht auf den einzelnEn Menschen hin ausgerichtet, als könnte er allein auf dieser Welt leben, sondern sie wird nach Mater et Magistra29 gerade auch verstanden als ein Mitsein mit anderen.30 Es muß eine wechselseitige Dienstbarkeit und ein Dialog mit Brüdern stattfinden.31 3. Verbunden mit der Forderung nach Mitmenschlichkeit muß die nach Humanität gesehen werden. Eine mitmenschliche Gesellschaft ist auf den Dialog, auf das Miteinandersein angewiesen. Egozentrisches und individuelles Denken 11erstört die so11iale Verbindung mit den anderen. Nur indem der Mensch mit anderen "ist", ist er auch wahrhaft menschlich. Darum gehört zur Wirtschaft und IIU ihrer Personalstruktur die Mitmenschlichkeit und zugleich die Wahrnehmung der Humanität. Die Auswahl und das Angebot von Gütern und Dienstleistungen hat auf dem ökonomischen Markt der Mitmenschlichkeit zu entsprechen. Die Teilhabe des Menschen an den Gütern dieser Welt gehört zur Wahrnehmung der Humanität. Die Forderung nach einer angemessenen Teilhabe aller Menschen an den Gütern dieser Welt wird in der Partizipation angesprochen. Auch der Benachteiligte soll die Chance erhalten, am Reichtum und damit an den materiellEn Dingen auf der Erde teilzuhaben. Da die Humanität des Menschen in der göttlichen Ebenbildlichbit des einzelnen Menschen besteht, unterscheidet sieh die Humanität des Armen nicht von der des Reichen. Seine Mitmenschlichkeit indessen zeigt sieh darin, daß er ein Gemeinwesen, ein ens soeiale ist. 4. Das ökonomische Handeln steht unter der Forderung eines sachgemäßen und zugleich menschengerechten Entscheidens. Das Sachgemäße ist nicht unter ethischen Gesichtspunkten nach gut oder böse zu beurteilen. Sachgemäßheit hat etwas damit zu tun, daß eine Sache richtig oder falsch und nicht gut oder böse angesehen wird. Die Sachgemäßheit unter ökonomischem Gesichtspunkt lautet, inwieweit eine Produktion nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit erfolgt. Auch die Produktion von "relativen" Gütern hat auf der Basis dieses ökonomischen Prinzips zu erfolgen. Denn immerhin ist von vornherein keineswegs die Grenze von einem Gut zu einem Ungut (Übel) IIU erkennen. 5. Das wirtschaftliche Prinzip ist zum Schutz der Ressourcen auch bei der Produktion von Ungütern (Übeln) zu berücksichtigen. Unter Einsatz 29 Papst Johannes XXlll.: Materet Magistra, Nr. 219. 30
Gaudiwn et Spes, Nr. 25.
31 Gaudiwn et Spes, Nr. 25.
Ethische Grenzen bei der Herstellung und Verwendung von Gütern
59
von geringen Mitteln wird versucht, einen höchstmöglichen Ausstoß zu erreichen. Solange auf den Ungütermärkten Wettbewerb herrscht, wird sowohl das Prinzip der Sachgemäßheit wie das der Wirtschaftlichkeit angewandt werden. Unter diesem Gesichtspunkt kann eine Regulierung der Produktion nur wie auf den Gütermärkten durch entsprechende Nachfrage erfolgen. Der Preis stellt die Austauschrelation zwischen der Nachfrage und dem Angebot auch bei sozial schädlichen oder gar verderblidten Gütern dar. Artbur Rich hat eine Zuordnung des Sachgemäßen zum Menschengerechten hergesteRt. Er meint, "daß nicht wirklich menschengeredtt sein könne, was nicht sachgemäß ist, und nicht wirklidt sachgemäß, was dem Menschengerechten widerstreitet. " 32 Aber es ist gerade die Frage, ob nicht trotz aller Sachgemäßheit das Menschengerechte (Humanität) zu kurz kommen kann? Das wirklich Sachgemäße muß doch keineswegs unbedingt auch das Menschengerechte sein. Umgekehrt ist zu fragen, ob das Menschengerechte immer auch das Sachgemäße ist? Menschengerechtes kann durchaus auch Unsachgemäßes sein! Freilidt kann sich das Sachgemäße und das Menschengerechte ergänzen. Aber beides kann als Forderung an das wirtschaftliche Handeln nicht unbedingt und zugleim erfüllt werden. Ökonomisch sachgemäß hergesteRte Drogen sind keinesfalls auch gleich menschengerecht hergesteRte Produkte. Die Sachgemäßheit eines Produktes ist keinesfalls von vornherein schon etwas, was auch als menschengerecht gelten kann. Die sachgerechte Anordnung einer Computerskala muß nicht unbedingt auch schon eine menschengerechte sein. Umgekehrt gilt, daß ein menschengeredttes Auto anderen Sachanforderungen unterliegt als ein streng sachgemäß produziertes (z.B. im Hinblick auf den Luftwiderstand oder die Kraftübertragung usw.). Das Menschengerechte muß also nicht unbedingt dem Sachgemäßen entsprechen.
D. Rückblick und Ausblick Im marktwirtschaftliehen System entscheidet der Nachfragende über das Angebot auf Grund der Abwägung seines Bedarfs, seines Einkommens und des Preises des Gutes. Diese Entscheidung betrifft Güter wie Ungüter. Dementsprechend werden danach auch die relativen Güter ausgewählt. 32 Artbur Rieb: Wirtschaftsethik. Grundlagen in theologischer Perspektive, 2. Auß. Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus) 1985, S. 81.
60
Roll Kramer
Freilich darf nicht verkannt werden, daß der Kaufanreis nicht allein vom Käufer ausgeht; auch der Anbieter, der Produzent etwa, initiiert die Produktion auf Grund seines Auftretens am Markt. Er kann seinerseits auch durch Intensivierung der Werbung etwaige Produktionsausweitung vorantreiben. Würde man beide Marktpartner beim Austausch allein lassen, dann wird zwar wettbewerbsbedingt langfristig eine kostengünstige Produktion ersielt werden. Aber die Frage, ob die Produktion bestimmter Gütern und Dienstleistungen verantwortbar ist, kann von keinem der Partner allein und endgültig entschieden werden. Hier müssen andere Kräfte in der Gesellschaft antreten und die ethische Verantwortung wahrnehmen. Das gilt auch für den Gesetzgeber. Indessen, auch diese Gruppen können die Entscheidung allein nicht vollziehen. Denn auch sie sind abhängig von meta-ökonomischen Vorerwägungen und Entscheidungen. Sie werden auf der Basis religiöser und/oder humaner Verantwortung die notwendigen Grenzen in der ök~ nomischen Produktion setzen bzw. die Unterscheidung von Gütern und Ungütern vornehmen. Denn es ist Aufgabe der Gesellschaft, selbst die Grenzen festzulegen. Soll die Verantwortung gegenüber dem Schöpfer, gegenüber der lebendigen Schöpfung, der toten Materie und gegenüber der Gesellschaft wahrgenommen werden, dann ist das keine ökonomische, sondern eine ethische Frage. Darum müssen Werte und Maßstäbe der Ökonomie als Daten vorgegeben und festgelegt werden. Erst daraufhin kann produziert bzw. ökonomisch gehandelt werden. Was also lebtlieh ein Gut oder Ungut (Übel) ist, kann nicht die Ökonomie, sondern nur die Wertevorstellung der Gesellschaft bestimmen. Diese steht nicht ein für alle Male fest, sondern kann sich - auch kursfristig- ändern. Das hat der Wertewandel in der Gesellschaft des letzten Jahrhunderts gezeigt. Dies ist s.B. an der Einstellung eines großen Teils unserer Bevölkerung in der Abwägung der Güter bei der Behandlung umweltfreundlicher bzw. umweltschädlicher Güter zu sehen, etwa bei Spraydosen, beim Problem der Verpackungsentsorgung oder bei der Bewertung der atomaren Energie. Bei allen diesen Fragen tut sich die gegenwärtige Gesellschaft deshalb so schwer, weil sie sich auf keine objektive, überparteiliche und alle Teile der Bevölkerung umfassende Autorität des Glaubens, des Denkens und/oder der kulturellen Verpflichtung einigen kann. Das Suchen in den USA und in der Bundesrepublik nach einer ethischen Konzeption der Wirtschaft läßt sich wohl am besten dadurch kennzeich-
Ethische Grenzen bei der Herstellung und Verwendung von Gütern
61
nen, daß die Fragen nach einer Unternehmer- und Unternehmensethik vielgestaltig diskutiert werden. Auch die beiden großen christlichen Konfessionen bieten in ihren sozialen Enzykliken und Denkschriften Hinweise und einige, die Richtung bestimmende Ansatzpunkte sur Entscheidung. Die unterschiedlichen sozialen Prinzipien können dabei hilfreich sein zu regeln, inwieweit die Wirtschaft der Mitmenschlichkeit und der Humanität dient. Sie muß diesen Grundlagen entsprechen. Denn Sachgerechtigkeit allein kann nicht das letzte Ziel sein, zumal diese Ungerechtigkeit und Unordnung im sozialen Gefüge erseugen kann. Sie kann außerdem nicht zwischen dem ethisch Nichtigen bzw. Verantwortbaren und dem, was nicht mehr zu tragen ist, unterscheiden. Insofern bedarf das wirtschaftliche Handeln der von außen kommenden, also der meta-ökonomischen Steuerung. Denn der Sinn des Wirtschaften& kann nicht allein darin bestehen, Bedürfnisse zu befriedigen und das Leben der Menschen mit notwendigen Existenzmitteln und Luxusgütern zu versorgen. Es bedarf gesellschaftlicher Regulative, die darüber entscheiden, ob es im einzelnen Fall überhaupt zu einem Produzieren von Waren oder zum Erstellen von Leistungen kommen darf, oder ob darauf verzichtet werden muß um des Menschen willen. Allerdings wird es heute immer schwerer, zum entsprechenden Konsens zu kommen.
DAS RECHTLICHE VERBOT DER UNGÜTER Von Alfred Klose, Wien
A. Zum Grundproblem Karl Jaspers hat angesichtsder bedrohlichen Entwicklungen in unserem Jahrhundert die Tatsache herausgestellt, daß heute immer mehr die Sorge um das Menschsein selbst das zentrale Zukunftsproblem darstelle. Es kündige sieh die Möglichkeit an, daß der Mensch sieh selber verliere, die Menschheit teils unmerklich, teils durch gewaltsame Katastrophen in eine Nivellierung und Mechanisierung gerate, in ein Leben ohne Freiheit und Erfüllung. 1 Nach Tschernobyl drohen weitere atomare Gefahren. Das Ozonproblem und die fortschreitende Vergiftung des Grundwassers durch Schadstoffe, die ungelösten Probleme des Sondermülls und nicht zuletzt die Expansion des Rauschgiftkonsums stellen unabsehbare Gefahren dar; Alkoholismus und krebsauslösende Genußmittel zerstören die Gesundheit zahlloser Menschen und ihrer Nachkommen. Immer deutlicher zeigt sich, daß der Mensch viele Güter erzeugt, die entweder grundsätzlich gef.8.hrlich sind oder aber nur in kleinen Mengen für den Konsum geeignet sind. Folgt man der von Doris Böggemann in dem einleitenden Artikel dieser Festschrift gegebenen Definition der Ungüter, so zeigt sich die Problematik rechtlicher Steuerungsmöglichkeiten sehr deutlich. Schon die Einteilung in leib-schädigende, geist- und ordnungs-schädigende Ungüter überzeugt uns, daß eine einheitliche rechtspolitische Linie nicht denkbar ist. Die gewiß sehr relative Differenzierung in leichte, mäßige und schwere Ungüter kann in gewissem Umfang weiterfUhren. So werden schwere Ungüter wie Kokain und Heroin von den allgemein zugänglichen Märkten durch Rechtsverbote fernzuhalten sein; für pharmazeutische Zwecke werden manche Drogen in einem abgrenzbaren Marktsystem zugänglich sein. Die Praxis zeigt, wie schwer solche Ziele durch Rechtsverbote erreichbar 1 Karl Jaspers: Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. München (Piper) 1955, S. 143.
64
Alfred Klose
sind. Leichte und mäßige Ungüter wie Alkohol und Nikotin werden eher durch steuerliche Belastungen und in gewissem Umfang durch begrenzte Verbreitungsbeschränkungen (so an Kinder und Jugendliche) in ihren schädlichen Wirkungen einzugrenzen sein. Wie steht es aber mit jenen Schäden, die durch übermäßigen Gebrauch an sich "neutraler" Güter entstehen, etwa durch Überdüngung mit nitrathaltigen StofFen, die das Grundwasser vergiften? Hier ergeben sich wieder ganz andere Ansatzpunkte. Vor allem stellt sich für uns die Frage, ob wir alle diese Probleme unter der Thematik der Ungüter behandeln sollen. Wir können Doris Böggemann darin folgen, daß Ungüter Dinge sind, die dem Einzelwohl und dem Gemeinwohl schaden. Der Gesetzgeber wird vor allem dann gefordert sein, wenn die gemeinwohlbedrohenden Wirkungen sehr deutlich hervortreten. In seiner Botschaft zum Weltfrieden 1990 nennt Papst Johannes Paul II. solche Bedrohungen durch Ungüter: Überdimensionierte Gasprodukte aus der Verbrennung von fossilen EnergiestofFen, weiters den Gebrauch einiger Arten von Unkrautvertilgungs- und Kühlmitteln wie von Spraygas. 2 Gerade diese Beispiele zeigen, daß aber die Kennzeichnung als Ungüter immer wieder Schwierigkeiten bereitet. Carl Friedrich von Weizsäcker hat sehr nachdrücklich hervorgehoben, daß wir Lösungen näherkommen, wenn wir uns bewußt sind, daß auf bestimmte ökonomische Güter verzichtet werden muß, auch wenn sie an sich zugänglich sind, wenn sie durchaus nicht knapp sind.3 Das eigentliche Problem bei manchen Ungütern sind die Spätfolgen, die uns erst allmählich bewußt werden. Für den Gesetzgeber wird die Notwendigkeit zum EingrifF gerade aber dann gegeben sein, wenn die Gemeinwohlschädigung mitteloder längerfristig erwiesen ist. Nicht alle schädlichen Spätfolgen wird der Gesetzgeber je verhindern können, wenn es nur um das Einzelwohl geht. So wird Alkoholmißbrauch unabhängig von der Gesetzgebung der einzelnen Staaten immer möglich sein, wenn auch etwa in islamischen Ländern mit sehr strengen Verbreitungsbeschränkungen seltener.
B. Wirtschaftsordnung und Rechtsordnung Die marktwirtschaftliche Ordnung kann ohne grundsätzlich freie Konsumwahl nicht bestehen. Schon Walter Eucken hat auf die Gefahren 2 Botschaft Seiner Heiligkeit Papst Johannes Paul II. zur Feier des Weltfriedenstages
am 1. Jänner 1990. Sonderpublikation der Kathpress Wien 16/1989, S. 7.
3 Carl Friedrich von Weizsäcker: Wachstum und Lebenssinn- Altemative Rationa-
litäten. Referat beim Bergedorfer Gesprächskreis zu Fragen der industriellen Gesellschaft am 3. November 1978. Harnburg 1978, S. 9.
Das rechtliche Verbot der Ungüter
65
aufmerksam gemacht, die nicht nur für die Wirtschaftsordnung, sondern auch für den Rechtsstaat bei umfassender Lenkung des Konsums gegeben sind. So stellt Walter Eucken fest, daß mit der Gesamtentscheidung für eine weitgehende Realisierung der Zentralverwaltungswirtschaft der Rechtsstaat nicht mehr gesichert werden kann. 4 Die Fülle der Gebote und Verbote wird für den einzelnen nicht mehr überschaubar. Inzwischen hat das Versagen der östlichen Planwirtschaften und haben die damit verbundenen Freiheitsbeschränkungen diese These von Eucken verifiziert. Bei der Beschränkung bzw. dem Verbot der Ungüter geht es aber nicht um eine Totaländerung der Wirtschaftsordnung, sondern um nur in einzelnen Sektoren wirksame Konsumbeschränkungen. Diese dürfen freilich nicht unterschätzt werden! Ökosoziale Marktwirtschaft bedeutet echte Konsum- und Produktionsbeschränkungen, wenn sie nicht nur als politisches Schlagwort verstanden wird. Gerhard Merk stellt fest, daß Einzelwohl als OberbegrifF zunächst als Einzelgut das Ziel eines jeden Menschen meine. Dies bestehe darin, sieh zu entfalten. Darunter versteht Merk die persönliche Lebenserfüllung, die Selbstverwirklichung. 5 Gerade diese Möglichkeiten erfahren aber gewisse Begrenzungen. So wird der heute noch so stark wachsende Autound Flugverkehr mit den gegebenen EnergiestofFen auf der Rohölbasis keine Zukunft haben. Noch bleibt ungewiß, wieweit rechtlich wirksame Verkehrsbeschränkungen notwendig sein werden. Sicher ist, daß die größeren Städte allmählich daran gehen müssen, durch Fußgängerzonen und Verkehrsverbote der Luftverunreinigung entgegenzuwirken. Es werden in nicht wenigen Bereichen unserer Volkswirtschaften Konsumbegrenzungen notwendig sein. Gerade die Beispiele aus dem Verkehrssektor machen deutlich, daß die rechtlich wirksamen Beschränkungen mit dem BegrifF "Ungut" nur sehr teilweise zum Ziel kommen. So ist nicht das Auto oder Flugzeug Ungut, letztlich wohl auch nicht der Alkohol an sich. Es geht immer wieder um die Bekämpfung des Mißbrauchs, um die rechtliche Steuerung gewisser gemeinwohlwidriger Formen des Überkonsums. Die marktwirtschaftliche Ordnung verlangt weitgehende Freiheitsrechte hinsichtlich Produktion und Konsum; der Rechtsstaat ist auf Grundrechtsordnungen begründet, die gleichfalls Freiheitsbeschränkungen nur im In4 Walter Eucken: Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Harnburg (Rowohlt) 1988, S. 92
(rowohlts enzyklopädie, Bd. 81).
5 Gerhard Merk: Konßiktstau durch Ungüter, in: Alfred Klose et al. (Hrg.): Frieden
und Gesellschaftsordnung. Festschrift für Rudolf Weiler zum 60. Geburtstag. Berlin (Duncker & Hwnblot) 1988, S. 201.
66
Alfred Klose
teresse des Gemeinwohls zulassen. Gerade aber aus der Sicht eben dieser Grundrechte, der Menschenrechte, wird auch die Notwendigkeit deutlich, durch Rechtsverbote von Ungüter-Mißbrauch das Leben, das Recht auf das Leben zu schützen. Dieses Recht auf das Leben wird in der für die Menschenrechtsziele so bedeutsamen Enzyklib. des Papstes Johannes XXIII. Paeem in terris sehr nachdrücklich hervorgehoben; es wird immer mehr zum integrierten Bestandteil moderner Staatsverfassungen. Wollen wir das Leben des einzelnen Menschen, der Menschen der heutigen wie der nächsten Generationen wirksam schützen, dann müssen wir auch eine weitgehende Modifizierung der marktwirtschaftliehen Ordnung durch Produktions- und Konsumbeschränkungen in Kauf nehmen sowie diese bewußt durchsetzen. Die politischen Parteien, die heute zukunftsweisende Umweltprogramme erstellen, weisen immer wieder auf die gewaltigen Umweltschäden hin, die unter den gegebenen wirtschaftlichen Verhältnissen auftreten. Nur selten wird dabei von Ungütern im eigentlichen Sinn gesprochen. Ein solches seltenes Beispiel stellt das "Freiheit'ü::he Manifest zur Gesellschaftspolitik" 1973 der Freiheittimen Partei Österreichs dar. Dieses spricht von der Notwendigkeit, die Verbrauchsgewohnheiten neu zu durchdenken; die Zukunft der Menschheit und die Güte ihrer Lebensbedingungen würden weitgehend davon bestimmt, ob es gelingt, durch maßvollen Gebrauch und möglichste Wiederverwendung von Rohsto:ft'en eine Verknappung zu vermeiden. Das Programm nennt dann als Ungüter etwa umweltfeindtime Hausbrandanlagen.6 Es wird zu einer zukunftsweisenden Aufgabe des Gesetzgebers, jene Produktions- und Konsumbeschränkungen festzulegen, die (bei Aufrechterhaltung des Grundsatzes einer freien Konsumwahl) doch sehr deutliche und wirksame Grenzen der entsprechenden Entscheidungen im Produktions- und Konsumprozeß dort fixieren, wo dies das Gemeinwohl verlangt. Es geht dabei nicht um technikfeindliche Grundhaltungen, sondern um eine Nutzung der Möglichkeiten des technischen Fortschritts für die Bewältigung der Lebensprobleme des Menschen und der menschlichen Gesellschaft von heute und morgen.
C. Rechtsordnung und Verantwortung Johann Heinrich Jung-Stilling hat eine sehr verständliche Einteilung der Güter vorgenommen: Als notwendige Befriedigungsmittel bezeichnet 6 Freiheitliches Manifest zur Gesellschaftspolitik 1973. Wien 1973, Kap. VII.
Das rechtliche Verbot der Ungüter
67
er solche, die zum Wesen des Menschen gehören; nützliche sind jene, wodurch der Mensch vollkommener und glücklicher werde; schädlich werden jene Güter genannt, die dem einzelnm und allgemeinen Besten entgegenwirken. Es ist die Orientierung am Gemeinwohl, die uns zur Abgrenzung der Ungüter dienen kann. 7 Noch deutlicher versucht Jung-Stilling in seiner Kritik einer luxuriösen Lebensweise eine Abgrenzung der Ungüter. Er bezeichnet als Luxus die Verschwendung nützlicher Befriedigungsmittel zu sinnlichem Vergnügen, wodurch das einzelne Beste mehr behindert als geiordert werde. Weil damit vielfach anderen Menschen notwendige Befriedigungsmittel entzogen werden, ist der Luxus auch für das "allgemeine Beste", das Gemeinwohl, nachteilig.8 Auch aus diesen Überlegungen wird deutlich, daß es nicht um eine starre Abgrenzung der Ungüter gehen kann, sondern um die Einschränkung von bestimmten Konsumformen: um eine sinnvolle Konsumethik also, die sich letztlich an Gemeinwohlzielen orientiert. Gerhard Merk kennzeichnet J ung-Stilling als "frommen Aufklärer", der die Macht des Bösen im Menschen wohl kennt, ihre Kraft und Stärke aber unterschätzt. 9 So mag es sein, daß für Jung-Stilling die Hoffnung auf eine Konsumethik stärker war als auf eine entsprechende Gesetzgebung zur Einschränkung der schädlichen Wirkungen der Ungüter. Es ist ein Kennzeichen des christlich geprägten Sozialdenk:ens, daß immer wieder diese Hoffnung auf die Einsicht des Menschen in die Folgen seines Handeins zum Ausdruck kommt. Als Beispiel mag der Österreichische Sozialhirtenbriefvom Mai 1990 dienen, der etwafür den Umweltschutz sehr viel von dieser Einsicht des verantwortungsbewußten Christen erhofft. So wird in diesem Dokument betont, daß die Verantwortung für Schöpfung, Natur und Umwelt zu den persönlichen Pflichten des Einzelmenschen gehöre. Im persönlichen Lebensstil, im selbstkritischen Gebrauch der technischen Mittel, in der sparsamen Verwendung von Rohstoffen und Energie, im sorgfältigen Umgang mit Schadstoffen, in der Vermeidung von Abfällen, welche die Umwelt belasten, entscheide sich bereits ein wesentlicher Teil der Verantwortung für Natur und Umwelt. Ohne eine 7 Johann Heinrich Jung-Stilling: System der Staatswirthschaft. Marburg (Neue academische Buchhandlung) 1792, S. 44. 8 Johann Heinrich Jung-Stilling: System der Staatswirthschaft, S. 495 f. 9 Gerhard Merk: Jung-Stilling. Ein Umriß seines Lebens. Kreuztal (verlag die wieland-
schmiede) 1989, S. 181.
68
Alfred Klose
kritische Selbstprüfung und Umkehr auf der persönlichen Ebene lasse sich die ökologische Frage nicht menschengerecht lösen. 10 Diese typisch christliche Grundeinstellung verdient hohe Anerkennung. Dennoch steht es angesichts der Fehlentwicklungen im Bereich von Natur und Umwelt, die heute immer mehr katastrophale Dimensionen annehmen, außer Zweifel, daß wir mit den noch so ernsten moralischen Appellen nicht durchkommen. Wir brauchen eine wirksame Umweltschutzgesetzgebung, für die der Begriff' der Ungüter zumindest in gewissem Sinn richtungweisend sein kann. Es geht dabei gewiß nicht in erster Linie um Produktionsverbote, sondern um den umfassenden Versuch, die Konsumenten zu einem mehr gemeinwohlorientierten Verhalten zu bringen, die schädlichen Auswirkungen wirksam zu begrenzen und ein Umdenken in der Ordnungspolitik einzuleiten. Die "ökosoziale Marktwirtschaft" ist heute zu einem beliebten Schlagwort vieler Politiker geworden. Daß damit eine wesentliche Einschränkung der freien Marktwirtschaft verbunden ist, daß vor allem unpopuläre Maßnahmen der Belastung schadstoffintensiver Produkte damit verbunden sind, wird diesen Politikern vielfach nicht bewußt. Die Ethik der modernen Welt ist zu einem großen Teil Umweltethik geworden: von hier drohen der Menschheit und dem Einzelnen die größten Gefahren. Dabei darf gewiß (wie auch der ÖSterreichische Sozialhirtenbrief betont) nicht alles vom Staat erhofFt werden. Es gelte auch hier das Subsidiaritätsprinzip, das Grundgesetz der gestuften Selbsthilfe: Gemeinden, Sozi~verbände und andere Vereinigungen sind in bedeutendem Umfang mitverantwortlich, vor allem die politischen Parteien. Diese Überlegungen machen deutlich, daß den Rechtsverboten der Ungüter gewisse Grenzen gesetzt sind. Es geht, wie aus den Beiträgen dieser Festschrift wohl deutlich hervorgeht, um ein Zusammen wirken sozialpädagogischer, sozialethis:her und gesellschaftspolitischer Bemühungen in allen Bereichen, wobei die Funktion der Rechtspolitik auf nationaler wie internationaler Ebene klarer als bisher herausgearbeitet werden muß. So ist die Umweltschutzgesetzgebung wohl in allen Staaten der Weltsoweit überhaupt vorhanden - noch unzureichend und vielfach wenig effizient.
10 Sozialhirtenbrief der katholischen Bischöle Österreichs vom 15. Mai 1990. Wien 1990, s. 30 f.
Das rechtliche Verbot der Ungüter
69
D. Die internationale Kooperation in der Rechtspolitik Die komplexen Probleme der Wiedervereinigung Deutschlands lassen sich heute erst nur sehr begrenzt analysieren. Zu den schwierigsten Fragen wird die Angleichung in den Fragen der Umweltschutzgesetzgebung gehören. Ganz allgemein sind etwa die mit den fossilen Brennstoffen verbundenen Ungüter in den osteuropäischen Staaten besonders lästig. Eine wohl nicht unbegründete Angst besteht heute in Westeuropa, nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, daß sich Atomkraftwerke in Osteuropa angesichts einer fragwürdigen Technologie als Ungüter erweisen könnten. Luftverunreinigung etwa läßt sich nicht an Staatsgrenzen aufhalten. So ist das Sterben böhmischer Wälder infolge schadstoffintensiver Industrieproduktion auch in Grenzgebieten Bayerns und Österreichs spürbar, zumindest in Form stärker sichtbarer Waldschäden. Internationale Kooperation in allen diesen Fragen wird immer wichtiger. Es zeigen sich gerade an solchen Beispielen die begrenzten Möglichkeiten einer isolierten nationalen Gesetzgebung zur Einschränkung von Ungüterschäden. Besonders deutlich wird dies dort, wo es um jene schweren Ungüter im Sinne von Doris Böggemann geht, die durch eindeutige Rechtsverbote aus dem allgemeinen nationalen wie internationalen Marktverkehr gezogen werden sollen. Bei der Wiener UNO-Konferenz im Dezember 1988 über eine Konvention gegen den Rauschgifthandel hat der Vertreter des Vatikans Giovanni Ceirano enge wirksame Koordination der nationalen wie der internationalen Maßnahmen gegen den Rauschgifthandel verlangt. Nationale Gesetzgebung reicht nicht aus, wenn aufinternationaler Ebene der politische Wille fehlt, die Rauschgiftmafia wirksam zu bekämpfen. Noch ist das Rauschgiftgeschäft eine "Wachstumsbranche" mit ebenso grauenhaften Dimensionen wie mit enormen Gewinnen. Die Verbindung von politischer Korruption und gewissenloser Profitgier beschränkt sich nicht auf einige lateinamerib.nische Staaten. Ceirano hat bei der Konferenz auf die Notwendigkeit harter Maßnahmen (wie verschärfte Strafbestimmungen gegen den Drogenhandel, Verbesserung der Kooperation zwischen Justiz und Sicherheitsbehörden und Konfiskation von Gewinnen aus dem illegalen Drogenhandel) hingewiesen. 11 Drakonische Strafen bei Übertretung der Produktions- und Verbreitungsverbote der illegalen Drogen müßten in allen Ländern nicht nur vorgesehen, sondern auch realisiert werden. Der Drogenmißbrauch ist eine der schwerwiegendsten Verfallserscheinungen unserer Gesellschaft; er bedroht das Leben und Einzelwohl zahlloser, vor allem junger Menschen. 11 Kathpress, Wien am 15. Dezember 1988, Nr. 247 19/88.
70
Allred Klose
Internationale Kooperation effektiver Art hat auch die ,.Europäische Ökumenische Versammlung Frieden in Gerechtigkeit" in Basel im Mai 1989 verlangt, nicht nur in Fragen der allgemeinen Friedenspolitik, sondern besonders im Umweltbereich. Ungüter wie die immer wieder genannten fossilen Brennstoffe durch die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen (Sonne, Wasser, Wind) zurückzudrängen, wurde von der Konferenz als vordringlich angesehen.12 Auch im Europarat wurden in letzter Zeit die Bemühungen verstärkt, die Rechtslage im Umweltschutzbereich in den einzelnen Staaten zu analysieren und Möglichkeiten einer besseren Koordination zu prüfen. Ziel ist ein Übereinkommen im Jahr 1991. Der ÖSterreichische Bundeskanzler Franz Vranitzky hat sich für eine internationale Charta ausgesprochen, die eine ,.Ökologisierung" unserer Gesellschaft anstreben sollte. Vorsorgender Umweltschutz sollte an die Stelle nachträglicher Korrekturen treten, die Altlastensanierung müßte effizienter werden und klate Verantwortungsbereiche wären festzusetzen. 13 Immer wichtiger wird der Erfahrungsaustausch zwischen den Regierungen in Fragen der Umweltpolitik. Insbesondere die schweren Ungüter können nur durch internationale Vereinbarungen aus den normalen Märkten herausgezogen werden.
E. Qualitätspolitik als Chance Qualitätspolitik umfaßt die Ziele und Maßnahmen, die zur Förderung der Qualitätssteigerung in der Wirtschaft gesetzt werden. Insbesondere geht es dabei um die Festlegung bestimmter Qualitätskriterien und die Verleihung entsprechender Qualitätszeichen (Gütezeichen), die nach den in den einzelnen Branchen und Wirtschaftszweigen vorhandenen Richtlinien, Satzungen und Qualitätsnormen vergeben werden. Es genügen allgemeine gesetzliche Grundlagen. Sehr viel kann im Rahmen der Autonomie der Wirtschaftsorganisati onen (etwa der Handelskammern) geschehen. Wichtig ist, daß es hier um die Aufgabe einer rechtlichen Normierung mit dem Ziel geht, das Entstehen von Ungütern zu verhindern. Es sollen insbesondere jene Qualitätsminderunge n vermieden werden, die ,.normale" Produkte zu Ungütern machen. So werden etwa Düngemittel durch zu starken Nitratgehalt getahrlich für die Grundwasserversor12 Dokwnent über die "Europäische ökwnenische Versammlwtg Frieden in Gerechtig-
keit" Basel 1989. Publikation der ÖSterreichischen Kommission "Justitia et Pax". Wien 1989, S. 45.
13 Die Presse (Wien) vom 31. August 1989, S. 5.
Das rechtliche Verbot der Ungüter
71
gung. Andererseits können ge&hrliche Produkte, die sieh als Ungüter erst allmählich erweisen, durch die technologische Entwicklung "neutralisiert" werden. Wenn etwa Experten auf die Ge&hrlichkeit der Halogenwasserstoffe hinweisen, erscheinen Substitutionsformen bei den entsprechenden Produktionsverfahren und den Einsatzstoffen geboten. 14 Das Interesse der Konsumenten wendet sieh weitgehend umweltfreundlicheren Produkten zu. Exakte Produktdeklarationen, soweit erforderlich auf gesetzlicher Basis, stellen weitere Möglichkeiten einer Qualitätspolitik zur Begrenzung schädlicher Wirkungen von Ungütern dar, die eben durch die bessere Information der Konsumenten zumindest teilweise durch die deklarierten umweltfreundlicheren Güter ersetzt werden. Für manehe Unternehmen wird es schon wegen drohender Abwanderung von Mitarbeitern notwendig, eine Qualitätssteigerung durch umweltfreundlichere Produkte zu erreichen. Gesundheitliehe Belastungen sind immer wieder bei der Produktion schadstoffintensiver Ungüter gegeben. Auch lehnen beständig mehr Arbeitnehmer aus Grundsatzerwägungen eine Mitwirkung an der Erzeugung von Ungütern ab. So wird eine efliziente Qualitätspolitik für stetig mehr Unternehmen zu einer unbedingten Notwendigkeit. Aus allen diesen Gegebenheiten erwachsen der Marktwirtschaft neue Chancen. In diesem Sinn ist die ökosoziale Marktwirtschaft zugleich auch eine qualitative. Es zeigt sich eben eine verstärkte Nachfrage nach qualitativ besseren, haltbaren, reparaturfähigen Produkten und wiederverwertbaren Materialien. Daraus entstehen gewiß auch wichtige Aufgaben einer zukunftsweisenden Unternehmensethik, aber auch solche einer umweltbewußten Reehtspolitik.
F. Einzelwohl und Lebensqualität Nicht nur alternative Bewegungen, sondern immer mehr jüngere Sozialkritiker (insbesondere die einer ehristliehen Weltanschauung verbundenen) sehen wohl nicht in erster Linie die Einkommensentwicklung, sondern "die Erzeugung von Lebensqualität als das eigentliche Ziel jeder gesellschaftlichen Tätigkeit" an. In diesem Sinn müßte "umfassendes menschliches Wohlbefinden die eigentliche Zielgröße jeder Sozial-, Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik sein." 15 Es wäre so gesehen auch Aufgabe einer ge14 ÖGUT-Infonnationen, Wien 4/1990, S. 21. 15 Christo! Gaspari: Artikel "Lebensqualität", in: Alfred Klose et al. (Hrg.): Katholisches Soziallexikon. lnnsbruck, Wien, München (Tyrolia) und Graz, Wien, Köln (Styria) 1980, Sp. 1625 ff.
72
Alfred Klose
meinwohlorientierten Rechtspolitik:, schädliche Auswirkungen der Ungüter für das Einzelwohl der Menschen einzuschränken. Der ÖSterreichische Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen hat in einer Studie im Jahr 1976 zukunftsweisende Aspekte einer Wohlfahrtsentwick:lung umschrieben. Er geht dabei von einem Schema menschlicher Grundbedürfnisse aus, wie Nahrung, lebensweder Umwelt, körperlicher Sicherheit und einem übersehaubaren Lebensbereich. 16 Aufgabe einer Gesetzgebung, welche die negativen Folgen der Ungüter einschränken will, wären so gesehen etwa eine strenge Lebensmittelgesetzgebung, welche schadstoffintensive Nahrungsmittel verbietet, weiters die Realisierung einer modernen Umweltschutzgesetzgebung, schließlich Schutzbestimmungen gegen Drogenmißbrauch, gegen Verkauf von Waffen an Jugendliche oder unzuverlässige Personen und vieles mehr. Es ist deutlich, daß die Verwirklichung eines hohen Wohlfahrts- und Wohlstandsniveaus nicht allein durch derartige gesetzliche Maßnahmen im Sinne der Ungüter-Bek:ämpfung erfolgen kann: eine entsprechende Einkommens- und Sozialpolitik ist neben vielen anderen Maßnahmen gleichfalls erforderlich. Nicht zuletzt geht es auch um die Bildungs- und Kulturpolitik:. Will man den "geist-schädigenden" Ungütern (im Sinne der Definition von Doris Böggemann) entgegenwirken, dann geht es auch um die Möglichkeit einer breiten Förderung geistig-kultureller Tätigkeit, um die Nutzung der kreativen Chancen möglichst vieler Menschen. Drogenmißbrauch ist nicht nur die Folge einer wirksamen Werbung einer Mafia, sondern auch das Ergebnis destruk:tiver Tendenzen einer primitiven und nivellierenden Behandlung dieses Themenbereiches in manchen Medien. In der Ablehnung einer "bürgerlichen" Gesellscltaft verwenden manche Autoren fragwürdige Klischees zur Rechtfertigung einer "Apologie der Negation". Hans Peter Thurn versteht die im engeren Sinn kulturellen Bereiche als die wichtigste Chance für die Selbstverwirklichung des Menschen. 17 Diese Chance besteht wohl vor allem für Personen, die kritisches Bewußtsein mit hohem persönlichen Ethos verbinden. Es geht letztlich auch bei der Thematik der Ungüter um Umweltqualität im weitesten Sinn. Heribert Lehenhofersieht in dieser Umweltqualität einen entscheidenden Bestandteil auch der volkswirtschaftlichen Wohlfahrt. Lange Zeit sei sie im Über:lluß vorhanden gewesen, heute wird sie immer 16 Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen: Qualitative Aspekte der wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Entwicklung. Wien (Selbstverlag) 1976, S. 62 ff.
17
Hans Peter Thurn: Soziologie der Kultur. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz (Kohlhammer) 1976, S. 71.
Das rechtliche Verbot der Ungüter
73
knapper. 18 So müssen wir vor allem in der einschlägigen Gesetzgebung und Rechtspolitik alles daransetzen, einer Expansion der Ungüter entgegenzuwirken und qualitative Zielsetzungen in allen Bereichen der Politik deutlicher herauszusteHen.
G. Schlußfolgerungen Die Verwirklichung der Gemeinwohlziele verlangt in jeder Gesellschaft Opfer von den einzelneiL In der zukünftigen so komplexen nachindustriellen Gesellschaft werden diese Opfer relativ groß sein. Dies gilt nicht nur in finanzieller Hinsicht. Es geht auch um Einschränkungen der persönlichen Freiheit, ja auch um die Verwirklichung einer in Teilbereichen harten Strafgesetzgebung. Vital Schwander weist daraufhin, daß es zum richtigen Verständnis der Strafrechtsentwicklung wichtig sei, in großen Zeiträumen zu denken, weil sich in ihnen die großen Ideen kundtun, welche das Strafrecht grundlegend umgestalten. 19 So sind die Probleme der schweren Ungüter (wie ganz allgemein die Umweltbedrohung) Gegebenheiten, die strafrechtlich neu zu durchdenken sind. Wer Giftstoffe unsachgemäß entsorgt, gefährdet das menschliche Leben und ist daher mit Strafsanktionen zu bedrohen, wie sie bei Mord oder Totschlag vorgesehen sind. Es geht also nicht nur um strenge Verbote des sinnwidrigen Umganges mit Ungütern, sondern auch um entsprechende Sanktionen, die sich nicht auf Geldstrafen beschränken dürfen. Die verantwortungslose Art, wie heute weithin Sondermüll "entsorgt" wird, erreicht vielfach verbrecherische Dimensionen, die auch nicht durch Unwissenheit entschuldbar sind. Wer mit gefährlichen Stoffen umgeht, muß die entsprechenden Kenntnisse erwerben. Firmen, die grobe Umweltdelikte begehen, müssen mit Sanktionen rechnen, die ihr weiteres Verbleiben am Markt in Frage stellen. Rechtsverbote drastischer Art sind in diesem Sinn nicht nur für die schweren Ungüter wie Rauschgift und gesundheitsschädigende Drogen notwendig, sondern auch für jene Ungüter, die als Sondermüll aus der normalen Produktion von Gütern welcher Art auch immer anfallen. Insofern gibt es eine allgemeine Grundregel für die Ungüter-Gesetzgebung. 18 Heribert Lehenhofer: Umweltschutz durch Markt oder Staat? in: Gerhard Merket
al. (Hrg.): Die soziale Funktion des Marktes. Festschrift für Alfred Klose. Berlin (Duncker & Humblot) 1988, S. 117 ff.
19 Vital Schwander: Entwicklungstendenzen des heutigen Strafrechts, in: Theodor Tc:r
mandl (Hrg.): Der Einfluß des katholischenDenkensauf das positive Recht. Wien (Braumüller) 1970, S. 105 ff.
74
Alfred Klose
Wenn wir nach der Intensität des Schadens vorgehen, so werden wir nur in gewissen Grenzen zwischen mäßigen und leichten Ungütern unterscheiden können. Auf jeden Fall wird es hier eher um finanzielle (steuerliche) Belastungen als um Rechtsverbote gehen. Diese sind aber in gewissem Umfang auch möglich, etwa Ausweitung der Rauchverbote in Ämtern und Verkehrsmitteln. Hohe Verbrauchssteuern können fühlbare Konsumbeschränkungen bewirken. Wir müssen allmählich aber aufstrengere Umweltstandards übergehen, wenn wir der bedrohlichen Tendenz einer lebensbedrohenden Luft- und Wasserverschmutzung entgegenwirken wollen. So wird sich der Kreis der schweren Ungüter allmählich auszuweiten haben. Die Immissionsschutzgesetzgebung ist in diesem Sinn laufend zu verschärfen. Luftreinhaltung, Gewässerschutz und Lärmschutz sind heute entscheidende gemeinwohlorientierte Grundziele der Gesellschaftspolitik, denen Vorrang vor Wirtschaftswachstum zukommt. Gerade weil das Recht auf Leben im Mittelpunkt aller Grundrechte steht und naturrechtlich einen Höchstrang aufweist, stellen die Bedrohungen des menschlichen Lebens bei den so wichtigen Gütern wie Luft und Wasser so enorme Gefahren dar. Sie rechtfertigen alle notwendigen Konsumbeschränkungen ebenso wie jene Produktionsverbote von Ungütern, die schwerwiegende schädliche Folgen haben. Artbur Fridolin Utz antwortet auf die Frage nach den natürlichen Interessen des Menschen in der Richtung, daß die westlichen Denker das Eigentumsinteresse stark in den Vordergrund gerückt haben, die Marxisten das Interesse an der Selbstverwirklichung durch Arbeit. 20 Heute ist es einfach das Interesse, angesichts der weltweiten Umweltzerstörung überleben zu können; den Kindern und den Nachkommen, den zukünftigen Generationen den Lebensraum dieser Erde sicherzustellen. Wie beim Strafrecht, so geht es auch bei den Grundrechten um einen weitreichenden Wandel. Konsumbeschränkungen und einzelne Produktionsverbote von Ungütern sind durchaus gerechtfertigt; die damit verbundenen Freiheitsbeschränkungen müssen im Interesse des Einzelwohls des konkreten Menschen wie des Gemeinwohls in Kauf genommen werden. Diese Erde als den dem Mensch gegebenen Lebensraum zu erhalten und Zerstörungen entgegenzuwirken, wird zur vordringlichen politischen 20 Artbur Fridolin Utz: Ethische und soziale Existenz. Gesammelte Aufsätze aus Ethik
und Sozialphilosophie. Walherberg (Institut für Gesellschaftswissenschaften) 1983, s. 405.
Das rechtliche Verbot der Ungüter
75
Aufgabe unserer Gesellschaft. Das rechtliche Verbot der schweren Ungüter kann dabei gewiß nicht alle Probleme lösen, aber einen wesentlichen Beitrag zu dieser großen Aufgabe unserer Gesellschaft leisten.
UNGÜTER UND GESUNDHEIT Von Lothar Schneider, Regensburg
A. Was sind "Ungüter"?- als Antwort ein Gleichnis Noch bevor das ameribnische Militärflugzeug "F 16" in Dienst gestellt wurde, rühmten bereits die Fachleute seine hervorragenden Flugeigenschaften. Noch nie, so war immer wieder zu hören, habe es ein Flugzeug gegeben, das so leicht und sicher enge Kurven fliegen könne wie diese "F 16". Das war ein hohes Lob aus der Sicht der Techniker. Und so konnte es nicht ausbleiben, daß von allen Seiten große Erwartungen an die neue Maschine geknüpft wurden. Kein Wunder, daß auch die Testpiloten der "Air Force" ihrerseits zeigen wollten, was in diesem "Kurvenflieger" alles stecke. Doch bereits während der ersten Flüge unter Manöverbedingungen, bei denen die Feuerkraft der Bordwaffen getestet werden sollte, kam es zu einem verhängnisvollen Zwischenfall. Einer der Piloten schoß sich dabei selber ab! Wie war das möglich? Was war passiert? Kurz vor Beendigung eines Flugtests wurde noch einmal die restliche scharfe Munition während eines Steigfluges der Maschine "schräg" in den Himmel geschossen. Dann zog der Pilot die Maschine in einer äußerst engen Kurve herunter in Richtung auf den heimatlichen Stützpunkt. Dabei kreuzte er - tragischer Weise - die parabeUörmige Flugbahn seiner soeben abgefeuerten Bordraketen und- schoß sich so selber ab! Diese Begebenheit kann ein Bild dafür sein, was hier mit Bezug auf Gerhard Merk 1 unter" Ungütern" verstanden sein soll: Wenn ein Produkt, mag es im ersten Augenblick noch so attraktiv erscheinen, über kurz oder 1
Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, in: Allred Klose et al. (Hrg.): Frieden und Gesellschaltsordnung. Festschrift für Rudolf Weiler zum 60. Geburtstag. Berlin (Duncker & Humblot) 1988, S. 197- 211.
78
Lotbar Schneider
lang 2 der Gesundheit eines Menschen schadet (und dies nur zu oft ganz erheblich), man sieh also bildhaft gesprochen mit diesem Produkt "selber abschießen" kann, dann handelt es sieh in dieser Hinsicht um ein "Ungut". Dabei ist es ofFensichtlich nicht entscheidend, wieviel Zeit zwischen dem Zünden der "Munition" und dem "Einschlag" liegt; auch nicht, ob es nur eines einzigen Schusses bedarf oder erst einer Reihe von TrefFern, bis das "Flugzeug Gesundheit" völlig zum Absturz gebracht ist, während es zwischenzeitlieh "nur" ins Trudeln gerät. Auch ist es für jemanden, der weiß, daß im Grunde alles miteinander zusammenhingt, wenig sinnvoll, wenn man für den Fall, daß die Maschine durch ein modernes Fallschirmsystem voll gerettet werden kann (und "nur" der Pilot seinen rechten Arm verloren bitte), sagen würde: der Schaden sei für ihn eine reine Privatangelegenheit. Ist doch ein persönlich behinderter Testpilot immer auch ein Verlust für die Gemeinschaft als Ganzes. Folglich wird man sagen müssen, den "rein privaten" Schaden gibt es in Wirklichkeit überhaupt nicht, denn jede "private" Schädigung eines einzelnen, fügt immer auch der Gemeinschaft Schaden zu. Entsprechendes gilt auch umgekehrt. Denn eine geschädigte Gemeinschaft führt immer auch zu einem Verlust für den einzelnen. Alle Dinge sind untereinander "vernetzt", 3 sind miteinander verbunden, ja sogar "rückgekoppelt"!
B. Gibt es "hundertprozentige" Ungüter? Das soeben Gesagte gilt auch für die Grenze "zwischen" Gütern und Ungütern. Denn, so wird man mit Gerhard Merk sagen können, bei Gütern im wirtschaftlichen Sinne handelt es sieh nicht um "irgendwelehe den Dingen anhaftende Eigenschaften". Gleiches läßt sich auch vom Nutzen sagen, der "keine dem Gut anhaftende Eigenschaft" ist, "sondern eine Beziehung (Hervorhebung durch den Verf.) zwischen Menschen und Gut" 4 • Entsprechend liegt auch die Gefahr eines "Ungutes" keineswegs schon isoliert im" Ungut" selbst vor wie in einem festverschnürten Paket, sondern wird erst in einer falschen Beziehung zum Menschen ins Leben gerufen. So kann eine Droge in großen Mengen den Tod eines Menschen bewirken; in kleinen Mengen jedoch kann sie der Arzt einsetzen, um Leben zu retten. 2 Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 205. 3 V gl. Lotbar Schneider: Soziale Vemetzung. Elemente für eine christliche Gesell-
schaftslehre. Regensburg (Pustet) 1988.
4 Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 206.
Ungüter und Gesundheit
79
Damit aber gibt es eigentlich keine ein für allemal auszumachende Grenze zwischen einem "Gut" und einem "Ungut". Diese Überlegungen kann man durch eine Abbildung von Günter Schulz 5 näher veranschaulichen, der aus der Sicht des Ingenieurs die so erfolgreichen Methoden der Technik für das gesamte menschliche Denken nutzbar machen will. In seiner "Vierer-Regel" zeigt Schulz am Beispiel "Höflichkeit/Unhöflichkeit" wie man das vermeintlich eindeutige Gegenüber, ja Gegeneinander- von "schwarz" und "weiß", "richtig" und "falsch", ,ja" und "nein" 6 - durch Differenzierung zu einer "höheren Lösung" führen kann. Einfacher Verstand
Höflichkeit .. Richtof
+
Geistiger Verstand Vierer· Regel
Höflichkelt Unterwerfung hönicht Anpassung nicht richtig richtig
Unhöflichkeit höfliche Selbst· Überheblichkeit behauptung falsch nicht falsch
~~ Gleichzeitigkeit der Gegensitze
Einfacher und geistiger Versland Aus all diesen Überlegungen geht aber zugleich indirekt hervor, daß es ein hundertprozentiges Ungut wohl kaum geben wird, es sei denn, daß alle Bezielmngen völlig falsch gerieten. Das ist allerdings ziemlich unwahrscheinlich. 5 V gl. Günter Schulz: Einleitung und Optimierung kreativer Denkprozesse, Deutscher
Verband für Schweißtechnik (DVS), Nr. 54 (1979), S. 1-16.
6 V gl. Lotbar Schneider: Subsidiäre Gesellschaft -
Erfolgreiche Gesellschaft. Irnplikative und analoge Aspekte eines Sozialprinzips, 3. ergänzte Aufl. Paderborn (Sch& ningh) 1990, S. 87.
80
Lothar Schneider
C. Die Menge beeinflußt die Qualität Wenn man aber im Leben kaum auf "hundertprozentige Ungüter" treffen dürfte, so wird die Frage bedeutsam: Wieviel Prozent eines Ungutes kann man sich denn noch guten Gewissens leisten, ohne daß die "Gesamtbilanz der Gesundheit" dadurch gefährdet wird? Wo liegen also die Grenzwerte im Umgang mit Ungütern? Eine Frage, die angesichts der umweltbelasteten Nahrungsmittel heute viele Menschen bewegt und politisch von großer Bedeutung ist.
D. Zwei Übertreibungen gilt es zu vermeiden Die eine Übertreibung könnte man mit dem bekannten Warnhinweis "Vorsicht Gift" kennzeichnen. Um Wählerstimmen in Leverkusen zu gewinnen, hatten erst kürzlich "Die Grünen" auf eine große Plakattafel die Analyse des dortigen Trinkwassers aufgetragen. Für den naturwissenschaftlich ungeschulten Laien schien dies im ersten Augenblick eine Schreckensbotschaft besonderer Art zu sein. "All das trinken wir mit dem täglichen Wasser! Sogar Arsen, also ein hochgefährliches Gift, ist darunter!" 7 Doch zwei Informationen fehlten auf dieser Plakattafel im Wahlkampf: Wären alle die "Verunreinigungen" nicht im Trinkwasser, sondern wäre chemisch reines Wasser im Leitungsnetz, also H2 0, so wäre das für den Menschen tatsächlich lebensgef&hrlich, weil die Halbdurchlässigkeit der Zellwände nicht mehr funktionieren würde. Ferner: die zulässigen Grenzwerte waren alle erheblich unterschritten. Von einer Gefahr durch das Trinkwasser konnte keine Rede sein. Ansonsten wären ja wohl die vielen Chemiker Leverkusens (dort ist der Standort eines weltberühmten Unternehmens der Chemischen Industrie) zum Schutze ihrer Familien tätig geworden. Die zweite Übertreibung beruht auf einer Fehleinschätzung der Natur und ihrer Kräfte. Hier wird der Natur bloß Gutes zugeschrieben nach dem Motto: "Die Natur macht alles richtig."
7 V gl. auch die Analysenwerte des Trinkwassers einer bayrischen Stadt: Alles klar mit dem Regensburger Wasser, in: tag + nacht, Familienzeitschrift'tler REWAG SWR, Heft 1 (1990), S. 4:
Ungüter und Gesundheit
81
Wer aus leicht zu durchschauenden Gründen nach dem Motto: "Das System" 8 und "die anderen" sind an allem Schuld, vor allem die Führenden in Politik und Wirtschaft für Umweltbelastungen verantwortlich machen will, der hat verständlicherweise ein großes Interesse daran, daß nicht die "Natur selber" Entscheidendes "falsch macht". Denn, nur wenn die "Natur selbst" alles "richtig" macht, kann sie als echtes "Vorbild" und unangefochtener Maßstab gelten. Ja, sie ist dann das "Anti-Ungut" 9 schlechthin.
Analysenwerte des REWAG-Trinkwassers
Vergleich der gesetzlichen Grenzwerte nach der Trinkwasserverordnung REWAG-Trinkwasser Substanz
GrenzGemessene Konzentration Konzentration (Mittelwerte mg/1) (mg/1)
Arsen 0,04 < 0,01 Blei 0,04 < 0,01 Cadmium 0,005 < 0,001 Chrom 0,05 < 0,01 Cyanid 0,05 < 0,01 Fluorid 1,5 0,09 Nickel 0,05 < 0,01 Nitrat 50 25 Nitrit 0,1 < 0,02 Quecksilber 0,001 < 0,0002 Polycyclische, aromat. Kohlenwasserstoffe 0,0002 < 0,000015 organ. Chlorverb. - 111 Trichlorethan u. a. 0,025 < 0,0003 organ. Chlorverb. - Tetrachlorkohlenstoff 0,003 < 0,0001 •nn Pflanzenschutzmittel u. PCB, PCT einzeln 0,0001 •nn PCB, PCT insgesamt 0,0005 Aluminium 0,2 < 0,05 Ammonium 0,5 < 0,02 Eisen 0,2 < 0,005 Kalium 12 1,6 Magnesium 50 15 0,05 Man~an < 0,005 Natrium 150 4,8 Sulfat 240 34 •nn =nicht nachweisbar = kleiner als (Beispiel:< 0,01 d.h. der Wert ist kleiner als 0,01) < 8 Hierzu sagt Dieter Knust in seinem Kommentar: "Umwelt-Fortschritte", in: Kölnische Rundschau, 23. Juli 1990, S. 4: "Immer mehr Bundesbürger reagieren inzwischen ausgesprochen allergisch auf jene Super-Ökologen und Systemveränderer, die mit Schlagworten und Parolen angeblich unsere bedrohte Umwelt schützen wollen, dabei aber wohl doch in erster Linie ihre Ideologien von einer neuen Gesellschaft durchsetzen möchten. Doch längst weiß der Wähler, daß mit den iminer neuen, undifferenzierten Forderungen nach Abschaffung des Autos, Einschränkung des Flugverkehrs und dem totalen Verbot der Anwendung von künstlichen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln die anstehenden Probleme nicht lösbar sind." 9 Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 207.
82
Lothar Schneider
Deshalb hat die folgende Meldung wohl keine gute Chance in die großen Schlagzeilender veröfFentlichten Meinung aufgenommen zu werden. Sie lautet: "In bis zu hundert Jahre alten Eisschichten in Grönland fanden dänische Geophysiker Ablagerungen des Blei-Isotops 210. Die größten Bleimengen stammen dabei nicht von den Bleiniederschlägen nach AtomwafFentests seit den fünfziger Jahren. In Eisschichten dieses Alters konnten keine erhöhten Bleiwerte nachgewiesen werden. Die größten Bleimengen wurden vielmehr in Lagen ermittelt, die auf die Zeit zwischen 1886 und 1930 datiert wurden. Als wahrscheinliclle Ursache nennen die Forscher die häufigen Vulkanausbrüche in diesem Zeitraum. Eine weitere natürliche Quelle von Blei 210 liegt in der Troposphäre, wo ständig aus der Erdhuste und den Ozeanen aufgestiegene Radon-222-Isotope zerfallen. Fossile BrennstofFe und Tetraethyl-Bleiverbindungen (Antiklopfmittel im Benzin) haben nur einen geringen Anteil an den Bleiablagerungen." 10 Um Mißverständnisse zu vermeiden: hier soll nicht die von Menschen zu verantwortende Versehrnutzung der Umwelt verharmlost oder gar geleugnet werden. Es soll allerdings deutlich gemacht werden, daß die oft unausgesprochene Behauptung, die "Natur" macht alles richtig, überaus kurzsichtig ist. Im Gegenteil, die größten uns bekannten Katastrophen waren Natur-Katastrophen 11 -und sie könnten es wieder werden! Hierfür ein Beispiel. Das Aussterben der Dinosaurier erklären der Nobelpreisträger Luis Alvarez von der Kalifornisehen Universität in Berkeley, und dessen Sohn Walter, Professor und Geophysiker wie der Vater, mit dem Einschlag eines riesigen Himmelskörpers, der vor 65 Millionen Jahren in die Oberfläche der Erde einen Krater von 100 bis 150 km Durchmesser riß. Durch den Einschlag aufgewirbelter Staub sorgte auf der Erde für todbringende Dunkelheit. Immer wieder datieren Forscher Meteoritenkrater gehäuft in einem Turnus von 26 bis 30 Millionen Jahren. Als Auslöser für Bombardements von Himmelskörpern auf die Erde wird der "Durchgang unseres Sonnensystems durch das Dickicht der Milchstraßenebene" angesehen. 12 Sollten eines Tages 13 unsere Weltraumforscher mit den allermodern10 Blei im Ewigen Eis, in: Bild der Wissenschaft, Juli 1990, S. 87.- Siehe zu ökonomi-
schen Folgen der Ideologie des Neo-Pessimisus auch John S. Lazar: Goldhortung in den Vereinigten Staaten im Spiegel der Anlageliteratur, in: Hans Gerd Fuchs (Hrg.): Gold. Rohstoff, Hortungsobjekt, WährungsmetalL Frankfurt (Knapp) 1981, S. 125 ff.
11 Lissabon: Ein Erdbeben erschüttert die Geisteswelt. Die Katastrophe 1755 brachte
die Aufklärer um ihren Optimismus, in: Mittelbayerische Zeitung, 31. Juli 1990.
12 Dingolfinger Anzeiger: Killerplaneten wird Sauriersterben angelastet, 18. Juli 1990.
13 Vgl. Mittelbayerische Zeitung: Hundert Meter langer Asteroid droht auf die Erde zu stürzen - Australischer Wissenschaftler: Kollision in zwei Jahren möglich, 20.
Ungüter und Gesundheit
83
sten Fernrohren einen Kometen oder Asteroiden auf Kollisionskurs mit der Erde entdecken, dann bliebe der Menschheit viellei::ht folgende rettende Möglichkeit: Interkontinentale Atomraketen werden diesem Himmelskörper entgegengeschossen, um ihn aus der Bahn zu bringen. Damit würde sich das nicht selten anzutreffende Schwarz-weiß-Bild: "die Natur" spendet uns "Güter", "Ungüter" produziert der Mensch, geradezu umkehren! Doch solche Überlegungen sind für alle die unbequem, welche die Natur am liebsten an die Stelle Gottes rücken möchten. Zwar benützt man heute gerne den Begriff der Schöpfung, zeigt dann aber bereits mit dem daran geknüpften Appell "Schöpfung bewahren", wohin die Reise gehen soll. Über eine "Kinderbewahranstalt" würde man heute wohl zurecht nur lachen oder sogleich weinen. Bewahren genügt keineswegs, wie ja auch das Gleichnis von den Talenten zeigt. 14 Die Bibel fordert uns auf, die Schöpfung, gemäß Gottes Auftrag, verantwortungsbewußt zu gestalten, und zwar zum wahren Nutzen des Menschen!
E. Kleiner Schaden- großes Glück Während im Bereich der Öffentlichkeit und bei der Darstellung der Leistungen der uns umgebenden Natur die soeben angesprochenen Überzeichnungen auf Schritt und Tritt zu beobachten sind, gilt für den Bereich des im engeren Sinne Privaten oft die genau gegensätzliche Tendenz. Hier gilt leider immer wieder: "Mein Bauch gehört mir!" Dieser Satz, der die öffentliche- vor allem kirchliche (!)- Verantwortungsanmahnung ganz grundsätzlich zurückweist, findet sich nicht selten im Munde derer, die mit besonderem Eifer für Umweltbewußtsein kämpfen. Dieser Satz erscheint dann wie ein Unterfall eines (unausgesprochenen) allgemein gültigen Mottos: "Meine Gesundheit gehört mir." Und nicht selten wird damit als Lebensprogramm verbunden: "Lieber kurz und intensiv als lange und fad." Dabei ist immer wieder eine "Strategie der Selbsttäuschung" zu beobachten, die man recht oft von Rauchern etwa mit folgenden Worten so vernehmen kann: "Dann sterbe ich eben fünf Jahre früher und habe dafür gut gelebt." - Bei richtiger Einschätzung der Lage jedoch müßte diese Aussage allerdings nur zu oft vö11ig anders lauten. Etwa so: "Dann sterbe August 1990. 14 Siehe Matthäus 25,14 ff.
84
Lotbar Schneider
ich eben sehn Jahre früher, und die vieltaltigen gesundheitlichen Behinderungen während der letzten zwanzig Lebensjahre nehme ich bewußt in Kauf." Bei dieser - leider - traurigen Erkenntnis verkehrt sieh dann plötzlich die so sehr geschönte "Glüek-Sehaden-Bilans" ins Negative.
F. "Ungut"-Feld: Tabak- Nahziel: Genuß
Vom einzelnen Raueher her gesehen erscheint der Tabakkonsum als ein höchst privater Genuß. Er wird selbst von Kritikern in der Regel solange toleriert, als dadurch der Nichtraueher nicht gezwungen wird, den "vom anderen erzeugten Rauch einatmen zu müssen". 15 Auf der öffentlichen Ebene jedoch gilt es, Tatsachen wahrzunehmen, auf die wir alle gemeinsam eine Antwort finden werden müssen, ohne den einzelnen, der auf seinem Lebensweg zum Raueher geworden ist, persönlich zu verurteilen. So hat "die Weltgesundheitsorganisatnn ... das Rauehen zum Risikofaktor Nr. 1 erklärt. Allein für die Bundesrepublik Deutschland gibt die Regierung für ein einziges Jahr (1974) die Zahl der auf Rauehen zurückzuführenden Todesf8lle mit 140 000 an. Von den 23 700 an Lungenkrebs Gestorbenen waren 98 Prozent Raueher!" 16 An den Folgen des Rauehens sterben laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation zur Zeit jährlich "2, 7 Millionen Menschen, in absehbarer Zukunft könnten es zehn Millionen im Jahr sein". Daß keineswegs "nur" der Lungenkrebs auf den Raueher wartet, sondern eine ganze Reihe von Todesursaehen, darunter vor allem der Herzinfarkt, findet immer wieder Erwähnung. Was viele allerdings so gut wie gar nicht wissen, ist die Tatsache, daß "pro Jahr noch über 10 000 Amputationen wegen rauchbedingter Getaßverschlüsse" 17 hinzukommen. Was für persönliches Leid verbirgt sieh alleine hinter diesen wenigen Zahlen? Konsequenterweise werden vor allem in den USA - und in Europa jetzt auch in Frankreich - gesetzliche Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung ergriffen.l 8 Bei uns ist noch vielen Menschen unbekannt, daß 15 Roland Schmid: Die fürchterlichen Folgen des Zigarettenrauchens, in: Rheinischer
Merkur, 9. März 1990.
16 Rüdiger und Margit Dahlke: Die Psychologie des blauen Dunstes. Be-Deutung und
Chance des Rauchens. München (Droemer Knaur) 1989, S. 13 (Knaur Taschenbuch Esoterik, 4214).
17 Mittelbayerische Zeitung: Rauchen kostet Millionen Menschenleben, 31. Mai 1990. 18 V gl. Kölnische Rundschau: Die USA und die Raucher, 13. Mai 1990. Ferner ebenda: Franzosen soll die Freude am Tabak vergehen. Schäcfstes Anti-Rauebergesetz der Welt, 8. Juni 1990. Auch die folgenden wörtlichen Zitate in diesem Abschnitt sind
Ungüter und Gesundheit
85
Zigarettenrauch tausendmal mehr Staubteilchen enthält als der dichteste je gemessene Smog. Bereits zehn in einem großen Wohnzimmer gerauchte Zigaretten bringen zudem "den Formaldehydgehalt auf das Dreifache des zulässigen Höchstwertes." Kein Wunder, daß sich "der volkswirtschaftliche Schaden aus dem Rauchen ... für das Jahr 1974 zu 50 bis 60 Milliarden DM" errechnet. Ob dabei bereits die Folgekosten des Passivrauchens mitveranschlagt sind, wird man wohl bezweifeln müssen. "In den Jahren von 1960 bis 1979 stieg der bundesdeutsche Jahreszigarettenverbrauch von 77,7 auf 141 Milliarden Stück, was ... einer Erhöhung des Tageskonsums von 11 auf 21 Stück entspricht; Anfang der achtziger waren es schon 30 Stück. Pro Jahr wird in der Bundesrepublik eine Milliarde DM für Zigarettenwerbung ausgegeben, 750 000 Automaten machen die Zigaretten überall, jederzeit und für jeden ohne (Alters-) Unterschied verfügbar." Hierzu schweigt die "Umweltdiskussion" so gut wie völlig. Eine rühmliche Ausnahme machte erst kürzlich der Hamburger Senat. 19 Ansonsten aber sind die Parteien in unserem Lande auf diesem "Problemfeld Nr.1" nahezu untätig. Sollte es etwa daran liegen, daß die 18 Millionen bundesdeutscher Raucher fast durchweg im wahlberechtigten Alter sind? Diesen hochbrisanten Problemen muß sich eine füreinander verantwortlich wissende Gesellschaft im gemeinsamen Gespräch stellen. Dabei geht es nicht - wie bereits gesagt - um Klage und noch weniger um Anklage einzelner, sondern um Klärung und Umgestaltung zum Besseren, vor allem in Hinblick auf die nachwachsende Generation, damit ihr ein "Aufwachsen ohne Tabak" 20 ermöglicht wird. Ansonsten wird man das ganze hier angesprochene Gebiet als ein "volkswirtschaftliches Ungut" bezeichnen müssen, in dessen Folge wir uns schließlich "gemeinsam abschießen".
dieser Quelle entnommen. 19 Parlamentsmehrheit für Rauchverbot in Hamburg, in: Kölnische Rundschau, 7. Juni 1990. 20 So lautete das Motto des Weltnichtrauchertages der WHO am 31. Mai 1990.
86
Lothar Schneider
G. Andere "Ungut"-Felder Entsprechendes gilt für die Problemfelder Alkohol 21 , Drogen und Rauschgift. 22 Es gilt aber auch für die unverantwortlich hohe Zahl von über zwei Millionen Verkehrsunf8llen pro Jahr in der Bundesrepublik Deutschland, 23 der durch Disco- und durch sonstigen Lärm Belasteten, der Sonnenbad- und "Sonnenbank"- geschädigten Hautkrebskandidaten. Es gilt für die Belastungen durch FCKW und andere Ozon-Killer, für Schwefeldioxid wie durch Kohlenmonoxid, für Auto- wie lndustrieabgase, für Hausbrand wie für Spraydosen24 •
H. Der "Gipfel" der Ungüter Der Gipfel aller Ungüter im Hinblick auf die "Gesundheit" ist allerdings die Tötung von kleinen Menschen im Schoß ihrer Mütter. Wenn im Wirtschaftswunderland Bundesrepublik Deutschland die Zahl dieser Abtreibungen mit jährlich 200 000 Kindern angegeben werden muß, dann wird hier nun unzweideutig ein Ungut-Feld von erschreckendem Ausmaß offenbar. Welche "Alibi-Indikationen" müssen im einzelnen herhalten, um die Basis aller Menschenrechte, das Recht auf Leben, anderen "Zielen" nachzuordnen! Hier müssen die Christen nach Perestroika rufen und, ohne die vielleicht in einer seelischen Notlage sich befindende Mutter zu verurteilen, nach einem Weg aus dieser Sackgasse suchen. Strafbestimmungen alleine dürften allerdings kaum ausreichen, um die Lage zu wenden. Hilfen aller Art, besonders auch durch die Kirchen, sollten gesucht und lebensnah angeboten werden. Auch ein verbesserter Familienlastenausgl6ch gehört in dieses Hilfspaket.
21 V gl. Neue Anti-Alkohol-Kampagne in den USA bereits erfolgreich, in: Kölnische Rundschau, 9. Juni 1990 sowie Gerhard Merk: Zur Begrenzung der Offensivwerbung. Berlin (Duncker & Humblot) 1977, S. 86 (Volkswirtschaftliche Schriften, Heft 267). 22 Vgl. Trauriger Rekord: 553 Rauschgifttote im ersten Halbjahr, in: Mittelbayerische Zeitung, 11. Juli 1990. 23 V gl. Der Autokrieg. Wenn ganz normale Bürger plötzlich durchdrehen, in: Kölnische Rundschau, 7. Juli 1990. 24 Vgl. Spray war giftig- Manager bestraft. BGH bestätigt Urteil im Erdal-Prozeß, in: Leverkusener Rundschau, 7. Juli 1990.
Ungüter und Gesundheit
87
I. Abschließende Gedanken
"Gesundheit" steht auf der Wunschliste für Lebensglück "ganz oben". Wer je einer Radiosendung mit Geburtstagsglückwünschen zugehört hat, weiß, daß Omas und Opas "vor allem Gesundheit und Wohlergehen" von Kindern und Enkelkindern gewünscht wird. Ein sinnvoller Wunsch! Allerdings sollte man dann schon in jungen Jahren darauf achten, daß einem selbst aus guten Gaben keine Ungüter werden. Um dieses Ziel möglichst gut su erreichen, bedarfunser Leben vor allemder Rückbindung an Gott. Denn von ihm, "vom Vater des Lichtes, kommt lauter gute Gabe, lauter vollkommenes Geschenk". 25
25 Jakobus 1,17.
UMLEGUNG UND VERMEIDUNG VON UNGÜTERN - eine Herausforderung für Politik und Wirtschaft im Umgang mit der naturalen Umwelt
Von Heribert Lehenhofer, Wien
A. Einleitende Vorbemerkungen Der Sozialhirtenbrief der katholischen Bischöfe Österreichs vom Mai 1990 verweist in einem Abschnitt über "Schöpfung, Natur und Umwelt" 1 auf die wiederkehrende Aussage im biblischen Schöpfungsbericht "Und Gott sah, daß es gut war" (1. Mose 1, ständig). Diese gute Schöpfung übergab Gott dem Menschen, daß er sie "bebaue und behüte" (1. Mose 2, 15). Daraus folgt das Recht des Menschen, diese Erde in Dienst zu nehmen, und sie dient ihm "mehr Mensch zu werden". Der Glaube an die Erschaffung der Welt und der Menschen durch Gott schließt eine "Ermunterung der menschlichen Vernunft und Freiheit, die in der Anfangsgestalt der Welt eingeschlossenen Möglichkeiten im Verlauf der Geschichte auszukundschaften und soweit als möglich durchzusetzen" 2 mit ein. Der Mensch ist in die natürliche Umwelt hineingebunden. Dieser mit der Schöpfung gegebene Auftrag verbindet sich mit der Verpflichtung, diese Welt so weiterzuentwickeln, daß eine geeignete Lebensbasis für die sich weiter entfaltende menschliche Gemeinschaft und für künftige Generationen bleiben kann. 3 1 Sozialhirtenbrief der katholischen Bischöfe Österreichs, hrg. vom Sekretariat der Österreichischen Biachofskonferenz, Wien 1990, Abschnitt 11./7: "Schöpfung, Natur und Umwelt", S. 28-32. 2 Alfons Auer: Umweltethik. Ein theologischer Beitrag zur ökologischen Diskussion. Düsseldorf (Patmos) 1984, S. 195. Vgl. auch Alfred Klose: Die Katholische Soziallehre. Thr Anspruch und ihre Aktualität. Graz, Wien, Köln (Styria) 1979, Kapitel: "Wirtschaftswachstum ohne Umweltzerstörung", S. 93-96. 3 Siehe Alfred Klose: Die Katholische Soziallehre, S. 93 f.
90
Heribert Lehenhofer
Diese Indienstnahme der Erde führte aber auch zu dem, was Gerhard Merk, dem diese Festschrift gewidmet ist, mit dem Begrift" "Ungüter" bezeichnet hat, 4 die sowohl dem Einzelwohl als auch dem Gemeinwohl Schaden zufügen. 5 Eine Zeitungsnotiz6 berichtet, daß Vegetationsschäden keine neue Erscheinung unserer Zeit seien. Wissenschaftler vermuten schon in der Bronzezeit in waldreichen Tälern der erzhaltigen Gebirge Waldschäden in unmittelbarer Umgebung von Erzhütten. Plinius der Ältere berichtete kurz nach Christi Geburt in seiner "Historia naturalis" von Vegetationsschäden. In einem Bericht aus Spanien weist der Grieche Strabon darauf hin, Silberschmelzöfen am besten in großen Höhenlagen zu bauen, um den beim Verhütten entstehenden Rauch möglichst wirksam abzuführen. Weiters sind in den Chroniken aus dem 14. Jahrhundert Berichte über Rauchschäden durch Hüttenwerke oder Gießereien zu finden. 7 Nach dem Zweiten Weltkrieg, einer Zeit des wirtschaftlichen Wiederaufbaues und einer weltweit expandierenden Industrie, wurde das Wirtschaftswachstum zu einem erstrangigen Ziel der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Dieser Industrialisierungsprozeß hat aber zu Umweltzerstörungen geführt. Bedroht sind der Lebensraum in Großstadtregionen, 4 Siehe Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, in: Alfred Klose et al. (Hrg.):
Frieden und Gesellschaftsordnung. Festschrift für Rudolf Weiler zum 60. Geburtstag. Berlin (Duncker & Humblot) 1988, S. 197-211.
5 Siehe Doris Böggemann: Zur Definition der Ungüter, in diesem Band, S. 1 ff.
6 Auch die alten Römer kannten Waldsterben, in: Kleine Zeitung, Graz, 30. März
1986, Nr. 75, S. 11; lt. freundlicher Mitteilung der Redaktion vom 4.9.1986 stammt der Beitrag aus dem Presse- und Informationsdienst "Forschungsinitiative gegen das Waldsterben", Heft 1/86. Der Autor ist Peter Müller vom Forschungszentrum Seibersdorf. - Nicht nur auf Waldsterben stoßen wir bei historischen Untersuchungen, sondem auch auf Schadstoffeinwirkungen bei Kunstwerken wie im Falle von St. Karl Borromäus (Volders, Tirol) vor 200 Jahren. Siehe Helmut Richard: Historische S02-Belastungen im lnntal, in: Zeitschrift für Archäometrie 1/3, S. 108-113. Danach sind Belastungen durch Schadstoffe , insbesondere durch S02, nicht ausschließlich ein Phänomen des 20. Jahrhunderts, sondem haben in Gebieten mit lang zurückreichender handwerklicher und industrieller Tradition bereits früher mehr auf Bauund Kunstwerke eingewirkt, als dies allgemein bewußt ist. Luftverschmutzung durch S02, aufgezeigt am Beispiel von Tiroler Bergbaugebieten, ist ein weit in die Vergangenheit zurückreichendes Problem; weiters sind die Schäden durch S02 in diesen Gebieten wesentlich größer als bisher angenommen wurde.
7 V gl. Adolf Heinrich Hobel: Die historische Entwicklung des Umweltschutzes, in: Gesellschaft und Politik 1/86, Schriftenreihe des Instituts für Sozialpolitik und Sozialreform (Dr. Karl Kummer-Institut) 22. Jahrgang, S. 23-28. "Tatsächlich wurden schon im Altertum und im Mittelalter verschiedene Umweltschutzmaßnahmen, zum Teilsogar weitgehenden Umfangs, getroffen. Ich möchte nur daran erinnem, daß im Jahre 1301 ausgerechnet in London der Verbrauch der Kohle als Hausbrand durch ein Gesetz beschränkt wurde, weil die Abgase unerträglich geworden waren" (ebda. s. 23).
Umlegung und Vermeidung von Ungütem
91
die Wasserversorgung; es kommt ferner zu Luftverunreinigung in Industriezonen und zu konzentrierter Wärmeentwicklung in Verkehrsknotenpunkten. Weiters kommt es in weiten Bereichen zu einem rücksichtslosen Abbau begrenzt vorhandener Rohstoffe. Diese Gegebenheiten erfordern eine Revision des Wachstumszielesunter Berücksichtigung der Umwelt als Lebensgrundlage des Menschen. Alfred Klose betont in seinem Beitrag, daßangesichtsweltweiter Umweltzerstörungen, um überleben zu können und künftigen Generationen den Lebensraum dieser Erde sicherzustellen "Konsumbeschränkungen und einzelne Produktionsverbote von Ungütern" durchaus gerechtfertigt sind.8 B. Ökologische Problematik
Als Gründe für eine Anzahl von ökologischen Problemen wären anzuführen: 1. die Möglichkeiten zur Umweltbeeinflussung sind größer geworden und die damit verbundenen Risken wurden lange Zeit als gering erachtet oder nicht wahrgenommen; 2. in unserem System können gesamtwirtschaftlicher Nutzen und individuelles Gewinnstreben auseinanderklaffen und 3. gesamtwirtschaftliche Zielvorstellungen. 9 Im Zusammenhang mit der ökologischen Problematik zeigt das Bruttosozialprodukt als alleiniges Maß für den Wohlstand einer Volkswirtschaft deutliche Schwächen. I. Ausgewählte Beispiele lür Umweltbeeinträchtigungen und Umweltschäden
Voraussetzungfür wirksame Umweltmaßnahmen im politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen und ökonomischen Bereich zum Schutz, zur Erhaltung und Wiederherstellung der Umwelt ist die Kenntnis der Umweltsituation. Schon der Club of Rome sah fünf Determinanten, die das globale Weltsystem tragen, aus dem Gleichgewicht geraten: Bevölkerungswachstum, Industrialisierung und Kapitalbildung, Ernährungslage, Rohstoffgewinnung und Umweltverschmutzung. 10 Um die ökologische Krise zu analysieren, muß man Fragen nach Ursachen, Dimensionen und Tendenzen dieser 8 Siehe Alfred Klose: Das rechtliche Verbot der Ungüter, in diesem Band, S. 68. 9 Nach Manfred Deistler: Ist die Wirtschaft schuld?, in: Mensch- Umwelt- Schöpfung, hrg. von der Katholischen Aktion Österreichs. Wien 1985, S. 16 f. 10 Denis Meadows et
al.: Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt) 1972. Siehe auch Ka-
92
HeribertLehenhorer
Krise stellen. Das Verhältnis zwischen Mensch und Natur ist gestört, aber nicht zeiStört. Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit zeigen bereits Ansätze zu einerneuen Grundeinstellung gegenüber der Natur; man spricht bereits von einem "Menschenrecht auf eine lebenswerte Umwelt". In einer Bestandsaufnahme sind zuerst die Umweltbeeinträchtigung von Boden, Luft und Wasser sowie durch Lärm, sodann die Probleme des Abfalls und schädlicher Chemikalien und schließlich die Umweltgeiährdung für Tiere und Pflanzen als Konsequenz der aufgezählten Beeinträchtigungen angeführt. 11
II. Steigende Umweltschäden in den Alpen
Naturkatastrophen häufen sich in letzter Zeit auch in den Tälern der Alpen, wie Nachrichtenmeldungen und Zeitungen berichten.U Schon 1984 hat der Deutsche Alpenverein in seiner "Katastrophenkarte" gewarnt: "Wenn der Bergwald stirbt, bedrohen Steinschlag, Rutschungen, Muren und Lawinen die Täler im Alpenraum." 1987 verwüsteten Muren und reißende Wildbäche das Stubaital in Tirol. In den französischen Alpen forderte die Überschwemmung eines Campingplatzes Menschenleben. Eine weitere Katastrophe ereignete sich in diesem Sommer im italienischen Veltlintal: Erdmassen des Pizzo Copetto stürzten zu Tal und begruben etwa 30 Menschen unter sich; rund 1600 Bewohner mußten evakuiert werden. Auch diese Naturkatastrophen sind weitgehend hausgemacht. Der geschädigte Bergwald, durch Luftverschmutzung in Mitleidenschaft gezogen, verliert zunehmend seine Schutzfunktion und kann nicht mehr als Wasserspeicher dienen; folglich haben Lawinenabgänge und Erdrutsche freie Bahn. Die Übererschließung zahlreicher Schiregionen und die damit verbundenen Waldrodungen werden mit als Hauptgrund der Umweltschäden angeführt. Progressives Waldsterben, exzessiver Tourismus bis hinaus in die Gletscherregionen beschleunigen Lawinen- und Murenabgänge. Ein talyse Umweltgruppe Köln (Hrg.): Umwelt-Lexikon. Köln (Kiepenheuer & Witsch) 1985, S. 109 sowie Aurelio Peccei: Die Zukunft in unserer Hand. Gedanken und Reß.exionen des Präsidenten des Club of Rome. München ( Goldmann) 1983 ( Goldmann Sachbü:her 11342). 11 Siehe Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen der Paritätischen Kommission für
Preis- und Lohnfragen in Wien (Hrg.): Umweltpolitik. Wien (Selbstverlag) 1986 (künftig zitiert: Beiratstudie).
12 Profil Nr.32 vom 10. August 1987, S. 44-47 und Kleine Zeitung vom 21. August 1987, s. 22 f.
Umlegung und Vermeidung von Ungütern
93
Seminar der "Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik" im Oktober 1986 hat sich eingehend mit diesen Problemen im Zusammenhang mit dem Fremdenverkehr auseinandergesetzt. 13
111. Bevölkerungswachstum und Verstädterung in der Dritten Welt Daß der Mensch der eigentliche "Störfaktor" im "ökosystemaren Zusammenhang" ist, hängt auch mit dem Bevölkerungswachstum zusammen, der zum Ressourcenverbrauch wie zur Umweltbelastung führt. "Der Bevölkerungsdruck ist eine Hauptursache der rücksichtslosen Konkurrenz des Menschen gegenüber seiner natürlichen Umwelt." 14 Für Bonecker ist dies aber nicht nur eine quantitative, sondern vor allem eine qualitative, geistige Frage, die Frage nach dem Wert menschlichen Lebens. Die große Mehrheit der 1984 weltweit etwa 10 Millionen Flüchtlinge sind nicht vor direkter politischer Verfolgung geflüchtet, sondern verließen ihre Heimat auf der Suche nach einem Überlebensraum. Eine nur auf kurzfristigen Nutzen ausgerichtete Bewirtschaftung führte zu einer Umweltzerstörung katastrophalen Ausmaßes (so in Teilen von Afrika) und löste eine Welle von Kon:flik:ten und Flüchtlingsbewegungen aus. Die Autorender 1984 in London vorgelegten Earthscan-Studie "Umweltzerstörung und Konflikte" führen die Hungerunruhen der letzten Jahre in den Städten Kairo, Tunis, Casablanca, Bombay und Rio de Janeiro auf den Mechanismus exportierter Landwirtschaftsgüter, Erosion und dadurch knapper sowie teurer Lebensmittel zurück. 15 Wenn der jährliche Verlust an fruchtbarem Ackerland durch Erosion und Desertifikation nicht gestoppt werden kann, dann werden Hungerkatastrophen nach dem Bericht "Global 2000" 16 nicht auf die Sahelzone 13 Pressestimmen zum Seminar der ÖGUT (Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik) in Obergurgl/Ötztal (Tirol) vom 14.-17. Oktober 1986; in: Technik und Umwelt, hrg. vom Bundesministerium für Bauten und Technik, Nr. 11/86, S. 4-8. 14 Martin Honecker: Schöpfungsbewahrung aus theologischer Perspektive, in: Protokoll der 21. Hohenheimer Umwelttagung 1989, S. 44. Vgl. auch Manfred Kemper: Das Umweltproblem in der Marktwirtschaft. Berlin (Duncker & Hurnblot) 1989, S. 9. 15 Vgl. Earthscan Hintergrund-Dokument Nr.40: Umweltzerstörung und Konflikte, S. 78 f. sowie Hermann Klosius: Flucht vor der Umweltkrise, in: EPN - Entwicklungspolitische Nachrichten, Nr. 5 (Mai 1987), S. 9 f. 16 Siehe Global2000. Bericht an den ehemaligen Präsidenten der USA Jimrny Carter, in: Blätter des Informationszentrums Dritte Welt, Nr. 125 (Mai 1985) S. 23 und ÖIE-Infomappe, 26.
94
Heribert Lehenhofer
beschränkt bleiben. Durch den Verlust von landwirtschaftlich genutzten Böden sind Millionen Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und ziehen entweder in fruchtbarere Zonen oder wandern in die Metropolen der Dritten Welt. Die Verstädterung in diesen Gebieten ist u.a. eine Konsequenz der ökologischen und wirtschaftlichen Misere auf dem Land. Der Verlust der Lebensgrundlage vieler Bauern also treibt die ländliche Bevölkerung in die Städte. War 1950 Buenos Aires die einzige Millionenstadt in der Dritten Welt, so zählten 1980 schon 22 Städte über eine Million Einwohner. 17 In der Hoffnung auf Arbeit und bessere Lebensbedingungen zieht es einen Großteil der Umweltflüchtlinge in die Städte.
C. Ethische Verantwortung des Menschen f"Ur Umwelt und Schöpfung 18 Der Mensch ist das einzige Wesen in der Welt, das Verantwortung übernehmen kann. Er muß die Gesetzlichkeiten und Sinngestalten der Natur erkennen und sie für die Entfaltung seines persönlichen und gemeinschaftlichen Lebens einsetzen. Konkrete Gestalten eines ökologischen Bewußtseins sind: Ehrfurcht vor der Natur und Genügsamkeit. Ökologisches Bewußtsein und ökologische Betroffenheit verändern die Wirklichkeit noch nicht. Konsequenzen müssen zu ökologischem Handeln führen. Neben der Identität und der Solidarität gehört auch die Einbindung in die naturale Umwelt zu den grundlegenden Dimensionen menschlichen Daseins. Die Natur soll dem Menschen dienen, nicht aber von diesem zerstört werden. 17 Hermann Klosius: Flucht vor der Umweltkrise, S. 7-10 sowie" ... und die Städte wachsen", in: ÖIE-Infomappe, 51:
Mexico City Groß-Bombay Groß-Kairo Buenos Aires Rio de Janeiro
1960
1970
1975
1988
2000
2010
4,9 4,1 3,7
8,6 5,8 5,7
10,9 7,1 6,9 -
19,4 8,24 13,2 9,9 9,01
31,6 19,1 16,4
32,1 21,0 15,9 12,5 16,5
-
-
-
-
Quelle: Global 200 (Anm. 16), Tab. 13-9; für 1988: Der Fischer Weltalmanach 1989. Frankfurt (Fischer) 1989 und Prognose für 2000: Kleine Zeitung vom 23. August 1987, s. 25. 18 Alfons Auer: Umweltethik, S. 71-89.
Umlegung und Vermeidung von Ungütem
95
I. Der biblische Schöpfungsauftrag 19 Nach dem Zeugnis der Bibel und der Überzeugung des jüdischchristlichen Glaubens trägt der Mensch Verantwortung für Tiere und Pfianzen. "Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch, und herrseht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen" (1. Mose 1,27 f.). Der Auftrag der "Herrschaft" über die nichtmenschliche Natur erlaubt dem Menschen nicht die gnadenlose Ausbeutung der Natur, sondern verpfiichtet ihn, Gottes Verwalter auf Erden zu sein. Ein Verwalter aber ist rechenschaftspfiichtig. In 1. Mose 2,15 ist dieser Auftrag umschrieben, daß Gott den Menschen in den Garten Eden gesetzt habe, um diesen Garten zu bebauen und zu bewahren. 2 Kultivierung der Natur und Schutz der Lebewesen ist Absicht des biblischen Schöpfungsauftrages.
°
II. Schöpfungsglaube und Schöpfungsbewahrung 21 Wiederholt wird angesichts negativer ökologischer Folgen gerade der christlich-jüdische Schöpfungsglaube als Verursacher der Umweltprobleme angegriffen. 22 Schon bald nach dem Bewußtwerden der Umweltkrise wurde 19 Martin Honecker: Schöpfungsbewahnmg aus theologischer Perspektive, S. 39--51.Honeelter stellt in seinen Ausführungen fünf Fragen: 1. Trägt der Mensch überhaupt Verantwortung für Tiere und Pflanzen? 2. Hat das Christentum in der Wahrnehmung dieses Auftrages (1. Mose 2,15) zur Schöpfungsbewahnmg in seiner Geschichte versagt? 3. Gilt der Schöpfungsauftrag an den Menschen heute noch, oder hat nicht vielmehr die Entwicklung uns in die Lage versetzt, in der der Mensch nicht mehr der Verwalter, sondem bloß noch der Störenfried ist, weil er das Gleichgewicht ökologischer Systeme zerstört? 4. Worin bestehen denn Aufgaben und Grenzen der Verantwortung des Menschen für Pflanzen und Tiere im einzelnen? Und: 5. Die Frage nach den Voraussetzungen der Verantwortung. Von wessen Verantwortung reden wir überhaupt? 20 "Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden,
damit er ihn bebaue und hüte" (1. Mose 2,15).
21 Martin Honecker: Schöpfungsbewahrung aus theologischer Sicht, S. 41-43. 22 Siehe hierzu Johann Millendorfer: Artikel "Umweltschutz", in: Alfred Klose et al.
(Hrg.): Katholisches Soziallexikon. hmsbruck, Wien, München (Tyrolia) und Graz, Wien, Köln (Styria) 1980, Sp.3093-3099; Lynn White jr.: The historical Roots of our Ecologic Crisis, in: Science Nr. 155 (1967), Deutsche Übersetzung: Die historischen Ursachen unserer ökologischen Krise, in: Michael Lohmann (Hrg.): Gefährdete Zukunft. Prognosen angloamerikanischer Wissenschaftler. München (Deutscher
96
Heribert Lehenhorer
der Vorwurf erhoben, daß diese Krise selbst das wirkungsgeschiehtliehe Produkt des ehristliehen Schöpfungsglaubens sei. Bezogen wurde dieser Vorwurf auf den göttlichen Auftrag: "Macht euch die Erde untertan" (1. Mose 1,28). Dieser Satz aus dem ersten Schopfungsbericht ist heute ein "Reizwort" geworden. 23 Die Bibel wurde oft nur benutzt, um menschliche Herrschaftsgelüste zu rechtfertigen. In zweiter Linie sei diese Umweltkrise auch die Auswirkung der Entmythologisierung einer einstmals von numinösen Kräften und Gestalten bewohnten Welt. Diese Welt ist nämlich für die Bibel weder göttlich und dämonisch, sondern von Gott geschaffen, ein Geschöpf wie der Mensch selbst. Vor nichts in der Welt brauehe sich der Mensch zu fürchten; sie wird ihm von Gott, seinem einzigen Herrn, zum "Bewahren und Beherrschen" anvertraut. Der amerikanisehe Historiker Lynn White jr. hat 1966 diese Diskussion um das Verhältnis von Christentum und Natur eröffnet. Eine undifferenzi.erte Antwort, die dem Christentum die Alleinschuld an der ökologischen Krise zuschreibt, scheint nicht möglich. Man könne es aber auch nicht von jeder Mitschuld freisprechep. Der jüdisch-ehristliehe Schöpfungsglaube wurzelt in einer nahezu 3000jährigen Tradition, 24 die wissenschaftlich-technische Zivilisation aber Taschenbuch-Verlag) 1973; Günter Virt: Umwelt- Eine Gewissensfrage? Analyse, Visionen, Folgerungen, in: Dolores M.Bauer und Günter Virt: Für ein Lebensrecht der Schöpfung. Salzburg (Otto Müller) 1987, S. 18 f., S. 16 ff.; Carl Amery: Das Ende der Vorsehung. Die gnadenlosen Folgen des Christentums. Harnburg (Rowohlt) 1974 (rororo sachbücher 6874); Medard Kehl: Sympathie zur Schöpfung. Die Umweltkrise als Gesprächsraum, in: Entschluß 42 (1987), Heft 1, S. 34 ff.; Konrad Hilpert: Aufmerksamkeit und Sorge für die Schöpfung. Schuldgeschichte des Christentums?, in: Orientierung 51 (1987) Nr. 17, S. 184; Florian Kunter: Quousque tandem ... ?, in: Vorrang Leben. Gefahren für Biosphäre, Mensch und Menschenwürde. Publikation des Vororts Mercuria in Wien. Wien 1988, S. 11-17; Academia, Zeitschrift für Politik und Kultur 39 (1988), Heft 5, S. 6-8 sowie Norbert Lohfink: Israels Ethos und der Bestand der Schöpfung. Zu Hos 4,1-3, in: Entschluß 45 (1990), Heft 1, S. 8-11. 23 Siehe Medard Kehl: Sympathie zur Schöpfung, S. 34 ff. sowie derselbe: Fern auf fremder Erde, in: Entschluß 45 (1990), Heft 1, S. 5 ff. 24 Die aus der Umwelt des Alten Orients übernommenen Aspekte des Schöpfungsglau-
bens bieten auch die Grundlagen biblischen Glaubens, erhalten aber durch die JahweErfahrung Maßstab und eine personal-geschichtswirlcsame Ausprägung. Schöpfungsglaube als Transzendenzglaube, Betroffenheit vom numinösen Charakter der Natur ist im Orient weitverbreitete Grundlage jeden Glaubens. Dies ist auch Grundvoraussetzung jeder biblischen Gotteserfahrung; nur auf Grund des religiösen Charakters der Welt kann auch Geschichte als Wirken Gottes gedeutet werden. Die Wurzeln des Schöpfungsglaubens reichen mindestens ins dritte Jahrtausend, besser wohl überhaupt in menschheitliches religiöses Suchen und Fragen. - V gl. Hans Heinrich Schmid: Altorientalische Welt in der alttestamentlichen Theologie. Zürich (Theologischer Verlag) 1974, S. 9--30 und: Maria Riebl und Arnold Stiglmair: Kleine Bibelkunde zum Alten Testament. 3. Auß. lnnsbruck, Wien, München (Tyrolia) 1984, S. 28-33, s. 69--71.
Umlegung und Vermeidung von Ungütern
97
ist erst 500 Jahre jung. An der Schwelle zur Neuzeit wurde eine Arbeitsteilung swischen Theologie (Glaube) und Wissenschaft vorgenommen und naturwissenschaftliche Erkenntnisse als dem Glauben widersprechend surückgewiesen (vgl. Gallilei). Heute besteht kaum mehr ein Widerspruch zwischen Glaube und Wissenschaft. Der Glaube hat mit Gott zu tun, die Wissenschaft mit Naturgesetzen. Diese Trennung von Glaube und Wissenschaft machte die neue Epoche der Neuzeit möglich; damit waren aber auch verheerende Folgen verbunden. Diese Trennung geschah anfangs im Sinne einer Arbeitsteilung und Kompetenzabgrenzung. Solange die Träger der Wissenschaft gläubige Menschen waren, konnten Glaube und Wissenschaft einander ergänzen. Dann wurde Naturwissenschaft immer weltlicher, sodaB es zwischen beiden Bereichen zur Entfremdung bis feindseligEr Ablehnung kam. Die Theologiefühlte sich in eine Abwehrstellung gedrängt; ihr Inhalt (das Heil) wurde weltlos. Die Verselbständigung der Wissenschaft führte zu einem neuen Selbstbewußtsein. Der Mensch erlebte sich als Beherrscher und "Besitzer der Natur". Mit der Berufung auf 1. Mose 1,27 f. wird betont, daß naturwissenschaftliches Wissen technische Macht über die Natur bedeute, und zwar als praktische Anwendung des biblischen Auftrags. Der Wissensdrang konzentrierte sich auf die Natur. Descartes unterscheidet zwischen einer "denkenden Sache" (res cogitans) und einer "gedachten Sache" (res cogita). Der Begriff "Sache" entspricht der neuen Haltung. Alles wird zur Sache. Auch das Schicksal der Natur ist damit besiegelt. Sie ist geistlos, tot, einfach Materie. Sie lallt heraus aus der "Schöpfung", wie nachher aus dem Glauben. Das neue rationalistische und mechanistische wissenschaftliche Bewußtsein gewinnt an Bedeutung.25 Der Prozeß der Mechanisierung des Weltbildes beseitigte die Hemmschwellen gegen die Umweltausbeutung, die wesentlicher Bestandteil der organischen Naturauffassung gewesen waren. 26 "In den drei Jahrhunderten, in denen der Mechanismus zur philosophischen Ideologie der westlichen Kultur geworden ist, hat die Industrialisierung, verbunden mit der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, Charakter und Qualität des menschlichen Lebenssinnes in tiefgreifender Weise verändert. "27 25 V gl. Heinz Robert Schlette: Die Mechanisierung der Welt. Zu Carolyn Mercha.nts
Buch "Der Tod der Natur", in: Orientierung 53 (1989), Nr. 6, S. 64-68; Carolyn Merchant: Der Tod der Natur. Ökologie, Frauen und neuzeitliche Naturwissenschaft. München (Beck) 1987, S. 113-141.
26 Carolyn Mercha.nt: Der Tod der Natur, S. 124 ff. 27 Carolyn Merchant: Der Tod der Natur, S. 276.
98
Heribert Lehenhorer
111. Menschliche Umweltverantwortung 28
Die Unabhängigkeit zum eigentlich Göttlichen macht die Natur zum Gott-losen Ort und zum benutzbaren Gegenstand. Der Mensch verstand seine Gottebenbildlichkeit als Beauftragung zur Herrschaft und verlor dabei2 9 das Bewußtsein für das, was Voraussetzung für menschliche Umweltverantwortung30 ist sowie auch für den Zusammenhang, den wir mit den nichtmenschlichen Lebewesen gemeinsam haben. Ethisches Handeln betrifft nicht nur die zwischenmenschliehe Dimension, sondern alle Formen und Bereiche menschlichen Handelns. Unbegrenzte Expansion stellt eine Perversion des Schöpfungsauftrages an den Menschen dar, weil ein "Mehr-Haben" und nicht ein "Mehr- Sein" erstrebt wird. Bloß äußere Weltverwirklichung ohne Beachtung der vorgegebenen Sinnziele sowie der optimalen Entfaltung des Menschlichen geht am Schöpfungsauftrag vorbei. Der Mensch hat sich auch der grundsätzlichen Begrenztheit menschlicher Möglichkeiten bewußt zu werden. Was ist nun in 1. Mose 1,28 dem Menschen aufgetragen und was nicht? Er soll die Welt" beherrschen"; aber nicht in autonomer Selbstbestimmung, sondern als verantwortlicher Mitgestalter Gottes. Der Mensch hat die Verpflichtung, diesen seinen Lebensraum auch für künftige Generationen zu erhalten und nicht zu zerstören, dessen er zur Befriedigung von leiblichen und seelischen Grundbedürfnissen sowie zur Erhaltung seiner Anlagen bedarf. Diese unsere Umwelt ist Teil der Schöpfung, die wir erhalten und weiterentwickeln müssen. 31 Was sind nun die Voraussetzungen für menschliche Umweltverantwortung?32 Die Ausübung von Verantwortung hat immer mit Macht zu tun. Der biblische Schöpfungsauftrag verleiht dem Menschen Macht über Pflanzen und Tiere. Erfahrungsgemäß kann aber Macht mißbraucht werden. Mißbrauch von Macht kann wieder nur durch Kontrolle verwehrt werden. Folglich sind alle in der Gesellschaft mit unterschiedlichen Kompetenzen 28
Siehe hierzu auch Martin Honecker: Schöpfungsbewahrung aus theologischer Perspektive, S. 46 ff.
29 Siehe Dorothee Sölle: Lieben und arbeiten. Eine Theologie der Schöpfung. Stuttgart (Kreuz-Verlag) 1985, S. 35.
30 Siehe Martin Honecker: Schöpfungsbewahrung aus theologischer Perspektive, S. 48 ff. 31 Siehe hierzu Karl Hönnann: Artikel "Welt", in: derselbe (Hrg.): Lexikon der christ-
lichen Moral. lnnsbruck, Wien, München (Tyrolia) 1976, Sp. 1705 f. sowie Johannes Messner: Artikel "Naturrecht", in: Katholisches Soziallexikon (Anm. 22), Sp. 18901901, hier Sp. 1893 f.
32 Siehe auch Martin Honecker: Schöpfungsbewahrung aus theologischer Perspektive,
s. 48 ff.
Umlegung und Venneidung von Ungütem
99
und verschiedenen Zuständigkeiten bis hin zu jedem Einzelnen auf Umweltverantwortung angesprochen: vom Einzelnen über die Gesellschaft bis zu den Trägern der Wirtschaft und Politik im Staat. Ein Nichtchrist kann sich verantwortlich wissen vor seinen Mitmenschen jetzt und in künftigen Generationen.33 Verantwortung erfordert die Bereitschaft zur Selbstbeschränkung, keiner von uns ist verantwortlich für die Schöpfung insgesamt, wohl aber für einen kleineren oder größeren Bereich unserer Umwelt.34 Eingriffe in die Schöpfung sind nicht schon deswegen zulässig, bloß weil der Mensch dessen fähig ist, sondern bedürfen einer vernünftigen Begründung. Der Mensch darf nicht alles, was er kann! 35
IV. Friede mit Gott- Friede mit der Schöpfung Papst J ohannes Paul li. hat zu Jahresbeginn 1990 an die Verantwortung der Menschheit für die ganze Schöpfung, aber auch an den notwendigen Schutz des Ungeborenen erinnert. Der Papst verwies auf seine Botschaft zum Weltfriedenstag: "Friede mit Gott dem Schöpfer - Friede mit der ganzen Schöpfung". 36 Darin hatte er betont, daß die ökologische Krise ein moralisches Problem sei und die moralische Krise der heutigen GesellsclJ.aft widerspiegle. Die Achtung vor dem Leben und der Würde der menschlichen Person sei die "fundamentale inspirierende Norm" eines gesunden wirtschaftlichen, industriellen und wissenschaftlichen Fortschritts.37 Nach dem biblischen Schöpfungsbericht sollten die Menschen ihre Herrschaft über die Erde mit Weisheit und Liebe ausüben. Der Papst hat darin den "Mangel an Achtung vor dem Leben" als moralische Wurzel für die weltweite Umweltverschmutzung bezeichnet und eine "Erziehung zur ökologischen Verantwortung" gefordert. Es muß dem christlichen Menschen bewußt sein, daß es auf unserer Erde ein großes vernetztes System gibt, in dem wir zusammenhängen und voneinander abhängig sind. Menschliches Zusammenleben ist nur 33 Martin Honecker: Schöpfungsbewahrung aus theologischer Perspektive, S. 49. 34 Martin Honecker: Schöpfungsbewahrung aus theologischer Perspektive, S. 49 f.
35 Siehe hierzu Alfred Klose: Der Mensch darf nicht alles, was er kann, in: Katholische
Aktion Österreichs (Hrg.): Mensch- Umwelt- Schöpfung. Wien 1985, S. 18.
36
Botschaft Seiner Heiligkeit Papst Johannes Paul II. zur Feier des Weltfriedenstages am 1. Jänner 1990: Friede mit Gott dem Schöpfer - Friede mit der ganzen Schöpfung, in: Wiener Diözesanblatt 128 (1990), S. 1-5, sowie Kathpress Sonderpublikation 16/1989.
37
V gl. auch Martin Honecker: Schöpfungsbewahrung aus theologischer Perspektive, S. 44 ff. (Abschnitt: "Ehrfurcht vor dem Leben").
100
Heribert Lehenhofer
dann möglich, wenn nicht nur ein einziger gesellschaftlicher Bereich im Vordergrund steht. Es geht um einen Interessenausgleich aller in Einklang mit dem Gemeinwohl, dem gemeinsamen Interesse und Wohl der in einer Gemeinschaft verbundenen Menschen. Verwirklicltung ist für den einzelnen ebenso ~otwendig wie für kleinere und größere Gemeinscltaften. Rücksichtsloses Durchsetzen von Sonderinteressen einzelner oder von Gruppen gegen die Gemeinwohlinteressen ist abzulehnen.38 Dies gilt ebenso für die Bewältigung von Umweltproble men- nicht nur bei uns, sondern auch in der Dritten Welt. "Macht euch die Erde untertan" wird recht verstanden sein auf dem Hintergrund eines "Weltgemeinwohls".
D. Umweltpolitis che Perspektiven39 Die Zerstörung der Umwelt ist nicht ein frei schwebender Prozeß, sondern Auswirkung gestörten und entordneten Menschseins. Wirtschaft und Technik sind nicht Selbstwerte sondern Dienstwerte, im Dienste menschlicher Selbstverwirklichung. Wirtschaft und Technik sind auf die optimale Entfaltung des Menschen in seinen sozialen und naturalen Gegebenheiten hingeordnet.
I. Umweltpolitik im Dienste des Gemeinwohls Zur Regulierung der Umweltprobleme durch den Menschen ist eine verantwortungsvolle Politik nötig. Rudolf Weiler stellt die Frage nach den zur Verfügung stehenden Regelungsmechanismen.40 Das sind einmal das ökologische Diktat, oder der Zwang, oder die "rein individualistisch marktwirtschaftliche Lösung, das Ökonomistische Modell". Dieses wird aber den Forderungen ebenfalls nicht gerecht, "weil nicht genügend die Grenzen des Wettbewerbs abgesichert erscheinen, wenn der kurzfristige Marktvorteil entscheiden soll". Es werden Rahmenbedingungen ähnlich derer des sozialen Netzes der Sozialen Marktwirtschaft auch für den Schutz Siehe Alfred Klose: Christ und Politik. Ein Lexikon. Wien (Arbeitsgemeinsch aft der Diözesansekretaria te der CUI'Sillobewegung in Österreich) 1982, S. 57 f. sowie Gerhard Merk: Grundbegriffe der Erkenntnislehre für Ökonomen. Berlin (Duncker & Humblot) 1985, S. 72 f. 39 Vgl. hierzu Alfons Auer: Umweltethik, S. 95-104 und Beiratstudie (siehe Anm. 11), S. 13-39 (Abschnitte: "Umweltbeeinträch tigungen, Schadstoffe und Schäden" sowie "Bisherige Maßnahmen zur Verminderung der Umweltbelastunge n"). 38
40 V gl. Rudolf Weiler: Ökologische Ethik, in: Gesellschaft und Politik ( Schriftenreihe des Institutes für Sozialpolitik und Sozialreform)· 22 (1986), Heft 1, S. 5-9.
Umlegung und Venneidung von Ungütern.
101
der naturalen Umwelt zu schaffen sein. In Fragen der Umweltpolitik muß also auch auf den sozialpartnerschaftliehen Konsens hingewiesen werden, bei dem marktwirtschaftliehe Nutzung mit Rahmenbedingungen in den Dienst des Gemeinwohls gestellt wird.
II. Ordnungspolitik: Marktwirtschaft41 Die Marktwirtschaft stellt ein optimales Interessensausgleichsverfahren für den Menschen dar, der als unvollkommenes Geschöpf auf Kompromisse angewiesen ist. Als "Soziale Marktwirtschaft" ist dieses Verfahren mit andern Regelungsmechanismen durchsetzt und somit selbst wieder ein im Interesse des Gemeinwohls erzielter Kompromiß. 42 Wir sehen es daher als gerechtfertigt und in Anbetracht der auf eine Lösung harrenden Probleme für vordringlich an, dieses Verfahren durch entsprechende Rahmenbedingungen nicht nur in seinem bestehenden Anwendungsbereich zu bewahren, sondern zur Lösung weiterer gesellschaftlich wesentlicher Bereiche nutzbar zu machen. Neben dem Modell einer "Sozialen Marktwirtschaft" mit ihrem "Leitbild für die Gestaltung des Wirtschaftslebens durch den Menschen mit dem Ziel, diesen Kulturbereich in seinen Dienst zu stellen" 43 , bietet für einen Interessenausgleich auch die Katholische Soziallehre mit ihren Prinzipien wie z.B. Gemeinwohl, Subsidiarität, Solidarität und sozialer Gerechtigkeit ein realitätsnahes Instrumentarium zur Konfliktbewältigung. Sie hat immer schon die sinnvolle Nutzung der wirtschaftlichen Möglichkeiten hervorgehoben und betont, die Natur solle dem Menschen dienen, nicht aber von diesem zerstört werden; auch gehe es um die Verantwortung für die Menschen in der Zukunft. 44 Gefordert wird ein menschliches Maß, dem auch sanfte und angepaßte Technologien entsprechen. Wenn der Mensch 41 Siehe hierzu auch Bern.d Lötsch: Vom Leben lemen, in: Mensch -
Umwelt Schöpfung (Anm. 9), S. 12 f. sowie ÖVP-Umwelt- und Wirtschaftsprogramm mit dem Entwurffür eine "ökosozialen Marktwirtsmaft"; näheres unten.
42 Vgl. Heribert Lehenhofer, Ferdinand Staudinger, Peter Waschiczek: Wirtschaftsethik. Das Gewissen in der Wirtschaftspolitik, hrg. von Alfred Klose. Wien 1984, S. 77-80, insbes. S. 80 (Schriftenreihe "Sicherheit und Demokratie", Bd. 7) sowie Gerhard Merk: Grundbegriffe der Erkenntnislehre für Ökonomen, S. 88, S. 90 (Übersicht 16).
43
Wolfgang Schmitz (Hrg.): Was macht den Markt sozial? Die Grundzüge der Sozialen Marktwirtschaft, 2. Auß. Wien (Verein für Sozial- und Wirtschaftspolitik) 1982, S. 9.
44 Alfred Klose: Die Katholisdle Soziallehre, S. 93-96 (Abschnitt: "Wirtschaftswachstum ohne Umweltzerstönmg").
102
Heribert Lehenhofer
sich dem Anspruch der Natur verweigert, dann bewirkt er Ungüter und Zerstörung in der Natur und in sich selbst.45
111. Modell "Ökosoziale Marktwirtschaft" Die Rahmenbedingungen für die Marktwirtschaft müßten entsprechend verbessert werden. Die geglückte Verschmelzung von marktmäßigen und politischen Entscheidungen hat sum Erfolg der Marktwirtschaft geführt. Von ihrer Konzeption her ist die Soziale Marktwirtschaft auch zur Koordination und Verschmelzung ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte geeignet. Es geht um einen ökologischen Rahmen für die Marktwirtschaft, mit dessen Hilfe wirtschaftliche Tätigkeit und Wirtschaftswachstum so geformt werden, daß sie das ökologische Gleichgewicht nicht mehr gefährden. Wir sind uns bewußt, daß die Realisierung dieser Aufgabe unermeßlich schwierig ist; daß aber die bisherige Entwicklung immerhin dafür spricht, daß die Marktwirtschaften ungleich mehr (wenn auch zu wenig) für den Umweltschutz getan haben, als die sozialistischen Planwirtschaften. Ausgehend vom marktwirtschaftliehen Prinzip war die Soziale Marktwirtschaft ein erfolgreicher Weg zwischen planwirtschaftlichem Sozialismus und schrankenlosem Wirtschaftsliberalismus. Bei politischen Parteien findet die Umweltpolitik einen starken Niederschlag.46 Eine Weiterentwicklung und Ergänzung der erfolgreichen Sozialen Marktwirtschaft zu einer "Ökosozialen Marktwirtschaft", so die ÖVP-Dokumente, könnte die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen bewältigen. Eine zukunftsorientierte Umweltpolitik müßte sich auffolgende Prinzipien stützen: 1. das Vermeidungsprinzip, 2. das Verursacherprinzip und 3. das Vernetzungsprinzip. 45 V gl. Alfons Auer: Umweltethik, S. 63 sowie Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 211.
46 Siehe: Ökosoziale Marktwirtschaft. Neu denken. Für Wirtschaft und Umwelt. Lei-
tantrag zum Zukunftsparteitag der Österreichischen Volkspartei am 24./25. November 1989. Graz (Broschüre der ÖVP); Starke Wirtschaft- Gesunde Zukunft. Das ÖVP-Wirtschaftsprogramm. Vorgelegt am 30. März 1990 anläßlich des ÖVPWirtschaftskongresaes in Wien (Broschüre); Das Umweltprogramm der Österreichischen Volkspartei. Vorgelegt anläßlich der Umweltkonferenz am 31.Mai 1990 (Broschüre); Zeitbombe Wohnung. Der Umweltschutz im Haushalt. Hrg. vom SPÖ-Umweltbüro, o.J. (Broschüre). - Die Sozialistische Partei Österreichs unterhält ein eigenes Umweltbüro, welches vor kurzem die genannte Broschüre herausgab. Der Ratgeber will versuchen, Umwelt-Bewußtsein zu wecken bzw. weiter zu verstäcken und dadurch die Bürger zu veranlassen, mit unserer Natur und Umwelt verantwortungsvoller umzugehen.
Umlegung und Venneidung von Ungütern
103
Das Prinzip der Vermeidung drückt aus: es ist effizienter und billiger, wenn Schäden von vornherein vermieden werden, als diese nachträglich mühsam zu sanieren. Günter Virt47 nennt dies das "Vorsorgekriterium", wonach die Vorsorge zur Vermeidung von Umweltschäden Vorrang hat vor der nachträglichen Beseitigung von Schäden. Durch das Verursacherprinzip soll der Verursachet für Umweltschäden zur Verantwortung gezogen werden; diese sind vor allen anderen haftbar zu machen. Eng verbunden mit dem Verursachet ist auch der Nutznießer zu sehen, der durch Nutzung von Ungütern indirekt auch Umweltschäden verursacht oder den Nutzen der Verbesserung der Umweltqualität genießt. Dies wird bei der Kostenfrage noch anzusprechen sein. Das Prinzip der Vernetzung zeigt schließlich, daß Umweltziele nicht mittels Einzelmaßnahmen, sondern nur durch Maßnahmenpakete erreicht werden können, so etwa die koordinierte Senkung aller gefährlichen Schadstoffe bei allen nennenswerten Verursachern. Als umweltpolitisches Instrument zur Umsetzung dieser Grundsätze in die Praxis sollte das Modell der ,.Ökosozialen Marktwirtschaft" dienen. Zuerst muß geprüft werden, ob die umweltpolitischen Ziele mit marktwirtschaftlichen Maßnahmen erreicht werden können, bevor zusätzliche Verbote und Gebote eingeführt werden - nach dem Grundsatz: soviel Markt wie möglich und nur soviel Staat wie nötig! Das Modell der "Ökosozialen Marktwirtschaft" ergänzt die strenge Anwendung des Verursacherprinzips mit Anreizen zu umweltgerechtem Verhalten, unterstützt das Vorsorgeprinzip und möchte einen sparsamen Umgang mit den Ressourcen bewirken. Umweltgerechtes Verhalten muß billiger sein als Umweltbelastung; daher sind auch finanzielle Anreize für den Umweltschutz nötig. Marktwirtschaftlicher Umweltschutz verlangt jedoch auch nach Verboten und Auflagen im notwendigen Ausmaß, vor allem aber auch nach einer wirksamen Kontrolle. Da die meisten Umweltprobleme grenzüberschreitend sind - dies beweist uns jüngst die Öffnung in Osteuropa - ist internationale Zusammenarbeit besonders wichtig und hat Vorrang vor kleinräumigen Regelungen.48 Verantwortliche Umweltpolitik erfordert die Zusammenarbeit aller Verursachet mit den Betroffenen, der Hersteller mit den Verbrauchern, 47 Günter Virt: Umwelt- Eine Gewissensfrage, S. 16-38, hier S. 23 f. 48 Siehe Günter Virt: Umwelt- Eine Gewissensfrage?, S. 19 (Kooperationskriterium).
104
Heribert Lehenhofer
und zwar auf allen verschiedenen Ebenen und Bereichen der Politik bis hin zur internationalen Kooperation. Es gilt zwischen dem Ziel des Umweltschutzes und anderen Zielen zu einer Interessensahwägung zu kommen. In diesem Sinne könnte die "Soziale Marktwirtschaft" zu einer "Ökosozialen Marktwirtschaft" erweitert werden.
E. Zur Finanzierung umweltpolitischer Ziele
I. Zurechnung von Umweltkosten Die Finanzierung der umweltpolitischen Ziele stellt eines der wichtigsten ökonomischen Probleme in der Wirtschaftspolitik heute dar. Bei der Verwirklichung umweltpolitischer Ziele sind als Finanzierungsprinzipien 1. das Verursacherprinzip und 2. das Gemeinlastprinzip zu beachten. Grundsätzlich soll vom Verursacherprinzip ausgegangen werden, das Gemeinlastprinzip aber nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommen, so, wenn die Verursachung bereits in der Vergangenheit liegt oder andere wirtschaftliche und soziale Ziele dies gebieten. Dies bedeutet, daß es vor allem auch Aufgabe der privaten Wirtschaftssubjekte ist, die Umweltbedingungen so zu gestalten, daß größtmögliche Schonung der Umweltressourcen im Rahmen der wirtschaftlichen Prozesse gewährleistet ist; und daß die öffentliche Hand nur dort eingreift, wo ersteres nicht möglich ist oder erzwungen werden soll. Der Vorrang des Verursacherprinzips49 bedeutet, daß Eingriffe der öffentlichen Hand (Gebote, Verbote, Abgaben, Subventionen usw.) auf Internalisierung der durch Produktion oder Konsum entstehenden externen Kosten der Umweltbelastung ausgerichtet sind. Durch die Internalisierung von Umweltkosten nach dem Verursacherpinzip sind der Wirtschaft richtige Kostensignale zu geben. Dadurch kann ein umweltgerechteres und gleichzeitig wirtschaftlicheres Verhalten bei Konsumenten und Produzenten erreicht werden. 50 Soll der Umweltschutz wirksamer werden, dann sind auch bessere Technologien und dafür wieder zusätzliche Finanzmittel für umweltbedingie Investitionen vonnöten. 49 Siehe Beiratstudie, S. 199.
50 Siehe ÖVP-Wirtschaftsprogramm, S. 6. V gl. auch Manfred Kemper: Das Umweltpro-
blem in der Marktwirtschaft, S. 33 sowie Gerhard Merk: Konfliktstaudurch Ungüter, s. 209 f.
Umlegung und Venneidung von Ungütem
105
Umweltqualität ist ein ganz entschiedener Bestandteil der volkswirtschaftlichen Wohlfahrt und wurde lange Zeit, da anscheinend im Überßuß vorhanden, als "freies Gut " gehandhabt. Wenn ein Gut aber knapp wird, dann kommt es zu Knappheitsfolgen. Sinn des Wirtschaften& ist es, diese Knappheitsfolgen weniger drückend zu machen. 5 1 Nach dem Verursacherprinzip soll nun derjenige, der die Knappheitsfolgen verursacht, in Höhe des Knappheitspreises belastet werden. Er wird so mit dem knappen Gut selbstverantwortlich umgehen. Gerade dies bezweckt die Marktwirtschaft; sie funktioniert, indem man dem Einzelnen seine eigene wirtschaftliche Verantwortung tragen läßt. Auf freien Märkten werden Knappheiten durch Preise wiedergegeben. So steigt der Preis bei staatlicher Verknappung der zulässigen Umweltbelastung. Der höhere Preis entmutigt die Nachfrage nach umweltbelastenden Produkten, wodurch wiederum weniger Umweltbelastung eintritt. Absatzschwierigkeiten ermutigen andererseits die Produzenten, umweltschonendere Verfahren zu entwickeln. Die Effekte einer persönlich interessierten Suche nach größtmöglichen Kosteneinsparungen im Marktprozeß werden nicht beeinträchtigt, wenn die Behörde nicht bestimmte Techniken, sondern nur bestimmte Standards vorschreibt. Weiters kann Letztere beim Vorschreiben auch noch so genau spezifizierter, bester Techniken sehr bald überfordert sein. 5 2 Auch bei der Zunahme der Ausgaben für den Umweltschutz wird die Förderung der Eigeninitiative billiger sein als die überwiegende Direktfinanzierung durch die öffentliche Hand.
51 Siehe Beiratstudie, S. 203 und S. 244 f. sowie Karl H.Steinhöfier: Kommunale Um-
weltpolitik. Wien (Bundeswirtschaftskammer) 1974, S. 82-86 (Schriftenreihe für Kommunalpolitik und Kommunalwissenschaft, hrg. von der Bundeswirtschaftskammer, Heft 2), weiters Günter Virt: Umwelt- eine Gewissensfrage?, S. 24 und Holger Bonus: Instrumente einer ökologieverträglichen Wirtschaftspolitik, in: Hans C. Binswanger et al. (Hrg.): Wirtschaft und Umwelt. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz (Kohlhammer) 1981, S. 85 sowie Manfred Kemper: Das Umweltproblem in der Marktwirtschaft, S. 8 f. - Mein Freund Gerhard Merk sehe mir nach, wenn ich von "freien Gütem" spreche: dieser tief eingewurzelte Tenninus ist sicher logisch nicht ganz sauber; siehe Gerhard Merk: Programmierte Einführung in die Volkswirtschaftslehre, Bd. 1. Wiesbaden (Gabler) 1973, S. 42.
52 Siehe Beiratstudie, S. 188 f.
106
Heribert Lehenhofer
II. Für ein "qualitatives" Wirtschaftswachstum53 Auch Alfred Klose sieht eine Weiterentwicklung der ordnungspolitischen Ziele, wobei zu den "traditionellen wirtschaftspolitischen Grundzielen der Geldwertstabilität, des wirtschaftlichen Wachstums und der Vollbeschäftigung" das in unserer Zeit "so wichtige Ziel der Erhaltung einer lebenswerten Umwelt" hinzukommt. 54 Es geht um eine optimale Vereinbarkeit alldieser Ziele. Umweltschutzinduzierte technologische Entwicklungen können durchaus Wachstumsimpulse auslösen, wenngleirh auch gewisse Maßnahmen zur Umweltverbesserung nicht als produktiv im traditionellen Sinne anzusehen sind. Gerade aber mit dem Ziel des Umweltschutzes ist die Wichtigkeit des technischen Fortschritts zur Problemlösung und Impulssetzung für Wachstum und Strukturwandel zu betonen. Da diese Technologien eher arbeitsintensiv sind, können Umweltschutzausgaben wiederum als Instrument der Beschäftigungspolitik dienen. Es kann nicht darum gehen, wirtschaftliches Wachstum als solches abzulehnen bzw. abzuschaffen, sondern den qualitativen Aspekten der wirtschaftlichen Entwicklung stärker als bisher Rechnung zu tragen. Ein Wachstumsbegriff, erweitert um den Aspekt des "qualitativen" Wachstums, ist dann auch geeignet, den Umweltschutz mit seinen Zielen einzubeziehen. Somit ist auch kein prinzipieller Gegensatz zwischen Umweltschutz und Vollbeschäftigung gegeben. In einer Neuorientierung der wirtschaftspolitischen Ziele ist die Bedeutung des Zieles der Vollbeschäftigung nach wie vor unbestritten. Das damit verbundene Wachstumsziel soll nach Alfred Klose "längst nicht mehr im Sinne eines größtmöglichen Wirtschaftswachstums ausgelegt werden, sondern im Sinne jenes Optimums an wirtschaftlichem Wachstum, das sich eben in einer möglichst gut erhaltenen Umwelt vollzieht". 55 Gerade der Wettbewerb, der wirtschaftliches Wachstum hervorbringt, ist ein optimales Entdeckungsverfahren für zukünftige Techniken und zukünftige Bedürfnisse. Er sollte unter entsprechenden Rahmenbedingungen mit Umweltschutzzielen auch für die Lösung der betreffenden und anstehenden Probleme eingesetzt werden. 53 Vgl. hierzu auch Beiratstud.ie, S. 237-240. 54 Alfred Klose: Unternehmerethik. Heute gefragt? Linz (Veritas) 1988, S. 22, S. 69 fl.,
S. 117, S. 131 und S. 134 (Soziale Perspektiven, Bd. 3).
55 Alfred Klose: Umweltpolitik und gesellschaftspolitische Positionen. Unveröffentlich-
tes Manuskript (maschinschriftlich), S. 8. Siehe auch Beiratstud.ie, S. 239 sowie zum Begriff des Wachstums-Optimums Gerhard Merk: Programmierte Einführung in die Volkswirtschaftslehre, Bd. 3. Wiesbaden (Gabler) 1974, S. 188 f.
Umlegung und Venneidwtg von Ungütern
107
III. Abgehen vom Verursacherprinzip Umweltgüter wurden bislang als "freie Güter" betrachtet, da sie im Überfluß vorhanden zu sein schienen, schon gar nicht als Wirtschaftsgüter gehandelt wurden und somit keinen Marktpreis hatten. 56 Der Wandel im Wertbewußtsein und die Sorge breitester Bevölkerungsschichten vor nicht wieder gutzumachenden Umweltschäden drängen nach Lösungen der offenen Umweltprobleme. Hinsichtlich der Kostenrechnung wurden drei Prinzipien formuliert57 :
1. das Verursacherprinzip, 2. das Nutznießerprinzip und 3. das Gemein-
lastprinzip.58 Nach dem Verursacherprinzip soll der Verursacher von Umweltbeeinträchtigungen die von ihm verursachten Kosten tragen. Beim Nutznießerprinzip soll der, der den Nutzen der Verbesserung der Umweltqualität genießt, der Kostenträger sein. Beim Gemeinlastprinzip wird weder der Verursacher noch der Begünstigte, sondern die öffentliche Hand zur Kasse gebeten. Vereinfachend könntenVerursacher-und Nutznießerprinzip gegenüber dem Gemeinlastprinzip in stärkerem Konnex gesehen werden. Bei der Finanzierung des Umweltschutzes ist primär und grundsätzlich vom Verursacherprinzip auszugehen. 59 Es ergeben sich aber auch Grenzen und begründete Ausnahmen für die Anwendung des Verursacherprinzips, wenn dies unmöglich oder unzweckmäßig ist. 60 Eine Umöglichkeit besteht, wenn die Quelle der Umweltbeeinträchtigung im Ausland liegt und der ausländische Verursacher nicht bereit ist, die Kosten zu übernehmen; weiters wenn es nicht möglich ist, eindeutige Zurechnungen zu finden oder die Nichtanwendung aus wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Gründen angezeigt erscheint (etwa bei erforderlichen Umweltmaßnahmen größeren Ausmaßes, welche die wirtschaftliche Leistungskraft von Unternehmen bis hin zu deren Existenz gef&hrden; Arbeitskräfte freigesetzt werden müßten usw.). Die Unzweckmäßigkeit für eine Anwendung des Verursacherprinzips ist aber dann gegeben, wenn sie in bestimmten Fällen volkswirtschaftlich ineffizient ist oder sie mit 56 Vgl. Manfred Kemper: Das Umweltproblem in der Marktwirtschaft, S. 8 f. 57 Siehe Karl H. Steinhößer: Kommunale Umweltpolitik, S. 82. 58 Vgl. Das Umweltprogramm der ÖVP (Anm. 46), S. 1. 59 Siehe Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 209; Beiratstudie: S. 199 f., S.
203 wtd S. 244 f.; Karl H. Steinhöfler: Kommwtale Umweltpolitik, S. 82-86 (bes. auch die Anmerkungen 110 wtd 111); Wolfgang Schmitz (Hrg.): Was macht den Markt sozial?, S. 30 sowie Günter Virt: Umwelt- Eine Gewissensfrage?, S. 24.
60 Siehe Beiratstudie, S.
s. 83 f.
245 f. sowie Karl H. Steinhöfler: Kommwtale Umweltpolitik,
108
Heribert Lehenhofer
Nachteilen verbunden wäre, welche die Vorteile überwiegen (z.B. zu hohe Administrationskoste n). Nur in solchen Fällen tritt dann das sogenannte Gemeinlastprinzip anstelle des Verursacherprinzips, wobei die Kosten für die Umweltsanierung die öffentliche Hand (aus Steuermitteln) zu tragen hat; so auch bei der Durchführung bestimmter Maßnahmen (z.B. Kläranlagen) oder bei Subventionierung von Produzenten oder Produkten, welche aber am ehesten noch als Umstellungserleichterungen gerechtfertigt erscheinen.61 Am besten werden umweltpolitische Ziele durch eine Kombination von privaten und öfFentlichen Ausgaben erreichbar sein. Das Gemeinlastprinzip sollte eben nur subsidiär und als letzter Ausweg in Finanzierungsfragen gewählt werden. Beide, Verursacher-und Gemeinlastprinzip, dienen aber vorwiegend der Finanzierung bereits eingetreten~ oder laufend entstehender Umweltschäden. IV. Instrumente der Umweltpolitik62 Im Instrumentarium der Umweltpolitik sind die kompetenzrechtlichen Grundlagen für die Erlassung und Vollzielmng einschlägiger Rechtsnormen an erster Stelle zu nennen. Von entscheidender Bedeutung ist weiters eine Umweltplanung sowie Gebote und Verbote und zivilrechtliche Umweltschutzmaßnahmen. Nach Manfred Kemper werden als wichtigste umweltpolitische Instrumente die A uflagenlösung, als die am häufigsten praktizierte Form der Umweltpolitik; die Abgabenlösung mit verschiedenen Varianten als zweites Mittel und die Zertifikatelösung als drittes Instrument betrachtet. Diese wirtschaftspolitischen Maßnahmen des Staates sollen die Einhaltung ökologischer Rahmenbedingungen gewährleisten, um eine bestimmte Mindestqualität der Umwelt zu erreichen bzw. zu erhalten, welche mit dem ökologischen Gleichgewicht vereinbar ist. 1. Umweltauflagen
Umweltauflagen machen dem Verursacher von umweltbelastenden SchadstofFen Verhaltensvorschriften in Form von Geboten oder Verbo61 Siehe Beiratstudie, S. 200 f., S. 245.
62 V gl. hierzu Beiratstudie, S. 155-236 sowie Manfred Kemper: Das Umweltproblem in
der Marktwirtschaft, S. 33-44 und S. 103- 113.
Umlegung und Venneidung von Ungütem
109
ten. Bei Geboten ist ein bestimmtes umweltbelastendes Verhalten jedoch in verringertem Ausmaß - "noch" erlaubt, bei den Verboten jedoch völlig untersagt.
2. Umweltabgaben Umweltabgaben werden auch als" Umweltqualitätsabgaben" bezeichnet und sind Geldleistmgen an das öfFentlich-rechtliche Gemeinwesen in Form von Steuern, Gebühren oder Beiträgen. Abgaben können dann wieder in Finanzierungsabgaben und Lenkungsabgaben unterschieden werden. Eine Umweltabgabe kann z.B. der Finanzierung eines Umweltfonds dienen. Dagegen dient die Lenkungs- oder Anreizfunktion in der Umwelt~ litik zur "ökonomischen Bestrafung" umweltschädigenden Verhaltens. Es bleibt jedoch die Möglichkeit gegeben, diese Abgabe durch umweltfreundliche Maßnahmen zu umgehen. Ein weiterer Bereich der Umweltabgaben sind die Produktabgaben, welche "die Herstellung und den Verbrauch bestimmter RohstofFe und Produkte" einschränken sollen, "die entweder knapp oder umweltschädigend sind. " 63
3. Umweltzertifikate Abgaben, Zertifikate und Kompensationslösungen gehören zu den marktwirtschaftlich orientierten Ansätzen der Umweltpolitik, wenn auch mit gewissen Einschränkungen. Nach Manfred Kemper kommt die Zertifikatel&ung einer reinen marktwirtschaftliehen Lösung sehr nahe. Ausgangspunkt des Instruments der Emissionszertifikate ist die Festlegung von Emissionsnormen und jeweils vereinbarten Emissionsvolumen für eine bestimmte Region. Diese Emissionskontingente werden dann gestückelt in Zertifikaten verbrieft. Die so verbrieften SchadstofFemissionsrechte für die verschiedenen SchadstofFe gestatten den Betrieben die Emission in einer bestimmten Höhe. Diese Zertifikate sind auch zwischen den Betrieben innerhalb einer abgegrenzten Region frei bande/bar. Will jemand Betriebsveränderungen oder Betriebsgründungen durchführen, die mit zusätzlichen Emissionen verbunden sind, dann muß er sich zusätzliche Zertifikate beschafFen. Hingegen können bei Anlagenstillegungen, bei umweltfreundlichen Produktionsveränderungen oder Installation von SchadstofF-Reduktionstechniken Zertifikate wieder frei werden. Nun soll 63
Manfred Kemper: Das Umweltproblem in der Marktwirtschaft, S. 37.
110
Heribert Lehenhafer
ein Markt für Umweltzertifib.te mit Handel und Preisbildung entstehen, der auch wie eine Börse organisiert sein könnte. Ein Emittent wird seine Vermeidungskosten mit dem Preis der Zertifikate vergleichen. Liegen seine Grenzvermeidungskosten unterhalb des Zertifikatepreises, so wird er sich zu einer Schadstoffreduktion entschließen. Er erspart den zusätzlichen Erwerb von Zertifikaten oder kann sogar eigene verkaufen, um die Schadstoffreduktion weiter zu finanzieren. Sind die Zertifikate billiger als die Maßnahmen zur Schadstoffreduktion, dann wird der Emittent Zertifikate hinzukaufen. Manfred Kemper kommt zu dem Schluß, daß die Zertifikate von den Unternehmen gehalten werden, welche die höchsten Vermeidungskosten haben. "Damit führt eine solche Zertifikatelösung zu volkswirtschaftlich minimalen Kosten der Emissionsvermeidung und somit zu einer effizienten Allokation der Umweltressourcen." 64 In der Beurteilung der umweltpolitischen Instrumente sind Auflagen und Zertifikate den Öko-Abgaben überlegen. In der Praxis steht der Effizienz von Auflagen "die Gefahr von erheblichen Vollzugsdefizitm" entgegen. Aufgrund der "geringeren Eingriffserfordernisse und Vollzugsaufgaben der Behörden" sind schließlich die Zertifikate zu bevorzugen.65 F. Teilnahme am Wirtschaftsprozeß im Horizont unserer Verantwortung66 Die Frage der Verantwortbarkeit menschlicher Arbeit an der Natur sowie die Probleme wissenschaftlichen und technischen Fortschritts sind vom Bild des Menschen sowie von der Entfaltung seiner Persönlichkeit gemäß der ihm eingestifteten existentiellen Lebenszwecke her zu stellen und zu beantworten. Auf Grund individuellen Erlebens weiß der Mensch, daß er sich den Forderungen des Gewissens nicht einfach entschlagen kann. Moralisch betrachtet würde er sonst sein wahres menschliches Sein verleugnen, seine menscheneigene Würde verletzen. Diesem Erlebnis entspricht als Pflicht die Notwendigkeit einer entsprechenden Handlungsweise. Als moralische Basis der Pflicht kann die menschliche Verantwortung angesprochen werden: das Wissen darum, daß man als Mensch für seine Handlungen selbst 64 Manfred Kemper: Das Umweltproblem in der MarktwirtBChaft, S. 44. 65 Manfred Kemper: Das Umweltproblem in der MarktwirtBChaft, S. 114. 66 Vgl. hierzu Heribert Lehenhofer, Friedrich Staudinger, Peter Waschiczek: Wirt-
schaftsethik, S. 14-20, S. 3Q-34.
Umlegung und Vermeidung von Ungütern
111
verantwortlich ist und ebenso für die Entfaltung seiner sittlichen Anlagen, seines Charakters. Dieses Verantwortungsbewußtsein korrespondiert unmittelbar mit der Willensfrä.heit. Mit dieser6 7 ist für den Menschen verbunden, daß er, im Gegensatz zum Tier, seine Verhaltensanweisungen nicht nur vorgefertigt von der Natur bekommt; sondern mit Hilfe seiner Vernunft seine, die eigene Natur bestimmenden körperlichen und geistigen Triebe, die ihnen innewohnenden Zwecke und erst daraus das Gute erkennen kann als die für den Menschen von seiner Natur geforderte Seinsvollkommenheit (Sittlichkeit).
Sittlichkeit besteht demnach in der von der Natur des Menschen geforderten Ordnung seines Lebens. Bestimmungsgrund der Sittlichkeit ist die Triebrichtigkeit, näherhin die Übereinstimmung des Verhaltens mit den in den Trieben vorgezeichneten Zwecken. Vorgezeichnet ist somit einerseits die Erkenntnis von der Wirklichkeit der Triebanlagen der menschlichen Natur und andererseits die Selbstbestimmung des Menschen als das, was sein soll. Dabei ist davon auszugehen, daß dem Menschen sein Lebenssinn erkennbar ist als Erfüllung der in seiner Natur vorgezeichneten Zwecke. Sie sind demnach wesenhafte Lebenszwecke68 des Menschen. Diese "existentiellen Lebenszwecke" haben Wertcharakter. Praktisch bedeutet gerade diese Erkenntnis eine weitgehende Übereinstimmung menschlicher Interessenlagen mit moralisch Gutem. Eine wirtschaftsethische Forderung ist der Kapitaleinsatz von größerem Geldvermögen, um dadurch wieder Arbeit und Einkommen zu schaffen und zu sichern: sowohl unter dem Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit als auch unter dem, daß ein vernünftiges Risiko einzugehen ist. Bei der Frage der Ertragsverwendung ist ebenfalls auf die soziale Gerechtigkeit Bedacht zu nehmen. Unmittelbar abhängig ist die Antwort aber davon, wie jeweils die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung einzuschätzen ist. Dabei ist auch auf die Verantwortung für die belebte und die unbelebte Natur achtzugeben. Eine letzte Frage zielt auf die Produktionsethik, die Pßicht, das Produktionskapital für wertechten Bedarfzu verwenden, nicht mit Schwächen und Leidenschaften zu spekulieren und den Ertrag nicht aus sozialschädlichem Konsum (Ungütern) zu erzielen. 69 67 Siehe hierzu Johannes Messner: Ethik. Kompendium der Gesamtethik. hmsbruck, Wien, München (Tyrolia) 1955, S. 32 f., S. 58 ff. 68
Siehe Johannes Messner: Ethik, S. 48 ff.
69 Siehe zu diesem Themenkreis Gerhard Merk: Zur Begrenzung der Offensivwerbung.
Berlin (Duncker & Humblot) 1977, S. 40 ff. (Volkswirtschaftliche Schriften, Heft 267) sowie Friedrich Beutter: Zur Wirtschaftsethik, in: Schweizerische Kirchenzeitung 148 (1980), Nr. 4, S. 61 f. und Ambrosius K. Ruf OP: Werbung und Ethik, in: Die Neue Ordnung 33 (1979), S. 232.
DIE MESSUNG VON UNGÜTERWIRKUNGEN Von Heinz Steinmüller, München
A. Eigenschaften von Ungütern Mit der ihm eigenen Prägnanz definiert Gerhard Merk in aller Kürse: "Ein Gut, dessen Verwendung beim einzelnen eine Minderung seines Wohlstands verursacht, ist ein Ungut (bad)." 1 Wählt man zunächst lediglich diese Definition zum Ausgangspunkt für weitere Überlegungen, so fragt man sich unweigerlich, wer ein Interesse an der Verwendung 2 eines derartigen (schädlichen) Gutes haben kann. Es wird sich wohl um Güter handeln, deren wohlstandsmindernde Eigenschaft der Verwender nicht kennt. Es wäre etwa zu denken an den Verzehr kontaminiertet Nahrungsmittel. Die Verwendung erfolgt unwissentlich; unvollkommene Information ist die Ursache. Da diese Unvollkommenheit im Zeitablauf abgebaut wird, sei es durch eigene Erfahrungen oder durch entsprechende Information von dritter Seite, so ist die ökonomische Relevanz dieser Art von Ungütern begrenzt und eher ein temporäreswenn auch in einer Volkswirtschaft wiederkehrendes - Phänomen. Eine weitere Ursache für die Verwendung von Ungütern könnte darin zu suchen sein, daß diese unfreiwill~ erfolgt - so etwa das Einatmen schadstoffbelasteter Luft. Die von Merk vorgestellte Definition der Ungüter läßt auch diese Interpretation zu. Seine begriffliche Abgrenzung 1 Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, in: Allred Klose, Heribert Franz Köck und Herbert Schamheck (Hrg.): Frieden und Gesellschaftsordnung. Festschrift für Rudolf Weiler zum 60. Geburtstag. Berlin (Duncker &. Humblot) 1988, S. 197-211, s. 203. 2 Gerhard Merk versteht unter Verwendung den Oberbegriff für V ernrauch und Gebrauch in der üblichen wirtschaftswiBBenschaftlichen Definition. V gl. dazu Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 202.
114
Heinz Steinmüller
ist somit weit genug, um wesentliche Aspekte der Umweltproblematik zu subsumieren. Doch beides, die unwissentliche und die unfreiwillige Verwendung, stellt Merk nicht in den Mittelpunkt seiner Überlegungen zu Ungütern - ganz im Gegenteil. Ihm geht es um die wissentliche und freiwillige Verwendung von Gütern, die beim Verwender zu einem Schaden, einem Mißnutzen, einer Minderung des Wohlstands führt. Diese Güter sind ökonomische Güter (Sachgüter, Dienstleistungen, Nutzungen); sie besitzen einen (ökonomischen) Wert, d.h. ihr Preis ist größer null. Merk denkt bei der Verwendung dieser Güter vornehmlich an die Konsumtion. Das zeigen die Beispiele, die er wählt: Tabak und Alkohol. Er schließt aber den Einsatz von Ungütern im Rahmen der Produktion nicht generell aus. 4 Daß sich ein Wirtschaftssubjekt wissentlich und freiwillig Schaden zufügt, erscheint zunächst geradezu paradox. Ein derartiges selbstschädigendes Verhalten entbehrt nicht nur jeder Vernunft (ist arational), es ist geradezu wider jede Vernunft (ist irrational) - und dennoch ist es weit verbreitet. Dieses Paradoxon löst sich jedoch auf, wenn man erfährt, daß bei der Verwendung von Ungütern Handlungen gemeint sind, die "im Augenblick zwar nützlich, auf die Dauer aber schädlich sein können". 5 Somit ist eine wesentliche Eigenschaft von Ungütern, daß sie dem Verwender in der Periode der Verwendung (und möglicherweise auch in den anschließenden Perioden) Nutzen stiften, ihm hingegen in späteren Perioden schaden. Über die Dauer der Perioden sowie über die zeitliche Abfolge von Perioden, in denen Nutzen, und solchen, in denen Schäden entstehen, ist dabei zunächst nichts ausgesagt. Dieser duale Charakter der Ungüter im Hinblick auf den Wohlstand ihrer Verwender kommt in dem Wort Genuß-Gifte hervorragend zum Ausdruck, wenn auch Ungüter mehr Güterarten umfassen als lediglich die sogenannten Genußgifte. Liest man die Definition der Ungüter von Merk sorgsam, so wird folgendes deutlich. Ein Gut ist nicht ein Ungut k:raft seiner Natur, sondern aufgrund seiner Verwendung. Es wird zum Ungut aufgrund seiner fehlerhaften Bezielmng zum einzelnen Menschen, zum Verwender. Kein 3 Der Frage, ob es sich auch um freie Güter (wie die o.g. schadstoßbelastete Luft) handeln kann, geht Merk nicht nach. Das ist verständlich, denn sie trifft nicht sein Anliegen. - Siehe zu den freien Gütern auch Gerhard Merk: Programmierte Einführung in die Volkswirtschaftslehre, Bd. 1. Wiesbaden (Gabler) 1973, S. 42, Antwort (11). 4 Vgl. Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 202. Zu denken wäre etwa an
die Verwendungproduktivitätssteigernder Hormonpräparate in der Tiermast mit der Folge eines Absatzrückgangs nach Bekanntwerden dieser Maßnahme.
5 Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 205.
Die Messung von Ungüterwirkungen
115
Gut ist ein Ungut, sondern es tut ungut. 6 Es sind die schadenbringenden Wirkungen bei seiner Verwendung, die es zu einem Ungut werden lassen. Damit ist die Frage aufgeworfen, welche Aspekte/Merkmale der Verwendung geeignet sind, ein Gut zu einem Ungut werden zu lassen. Zu nennenist hier zunächst die Gebrauchs- und Verbrauchsmengesowie die Häufigkeit bzw. die Dauer der Verwendung. Der regelmäßige "Genuß" von Alkohol in großen Mengen über viele Jahre führt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu Gesundheitssehäden. Die Aussage von Paracelsus- sola dosis facit venenum-kennzeichnet diesen Sachverhalt treffend. Sie hat im Hinblick auf Ungüter generelle Bedeutung. Ein weiterer Aspekt ist daneben ein Komplex von Sachverhalten, den man mit dem Begriff Rahmenbedingungen umschreiben kann. Die Aufnahme von Zucker kann für einen Diabetiker in einer bestimmten Situation (Unterzuek:er) lebensrettend, in einer anderen Situation (Überzuek:er) gesundheitsge:fährdend sein. Die Rahmenbedingungen bei der Verwendung eines Gutes können darüber entscheiden, ob es nutzenstiftende oder schadenbringende Wirkung hat. Dabei lassen sieh diese Rahmenbedingungen nach einer Vielzahl von Dimensionen differenzieren - etwa persönliche, sachliche, räumliche, zeitliche, situative u.v.a.m. Die schädliche Wirkung, aus der sieh der Ungutcharakter ableitet, kann mit zeitlicher Verzögerung eintreten. Die Ursache-Wirkungsverkettungen können äußerst vielschichtig und komplex gelagert sein. Erst das Zusammenwirken mehrerer Ursachen führt möglicherweise zu einer bestimmten Schädigung. Diverse Erkrankungen sind hierfür Beispiele. Vor dem Hintergrund der dargestellten Faktoren (Menge, Häufigkeit und Dauer der Verwendung, Rahmenbedingungen, Wirkungsverkettungen und -Verzögerungen) ist das Verhalten des Verwenders die entscheidende Determinante dafür, daß ein Gut zum Ungut wird. Die Frage, inwieweit es sieh dabei um ein (sicherlich nur vordergründiges) Rationalverhalten handelt, sei zurückgestellt. Abschließend ist noch auf eine Eigenschaft der Ungüter kurz einzugehen, die für die Messung ihrer Wirkungen von großer Bedeutung ist. Es ist das die Tatsache, daß die mit der Verwendung eines Ungutes 6 Es wird nicht verkannt, daß in praxi Güter häufig
sowohl nutzenbringende als auch schadenstiftende Eigenschaften haben. Gerade in diesem Fall entscheidet aber in besonders hohem Maße das Verantwortungsbewußtsein bei ihrer Verwendung, welche der beiden Komponenten in ihrer Wirkung überwiegt. Siehe hierzu auch Gerhard Merk: Programmierte Einführung in die Volkswirtsmaftslehre, Bd. 1, S. 39, Aufgabe
(22).
116
Heinz Steinmüller
einhergehende Wohlstandsänderung für den einzelnen (negativ) von der für die Gesellschaft (indifFerent oder positiv) abweichen kann. 7 Zunächst ist festzuhalten, daß jede Verschlechterung des Wohlstands eines einzelnen ceteris paribusauch eine Verschlechterung des Wohlstands der Gesellschaft bedeutet, deren Mitglied der einzelne ist. Das folgt aus der Erkenntnis des Pareto-Optimums. Es muß jedoch genau beachtet werden, daß dieser Aussage die Ceteris-paribus-Annahme zugrunde liegt. Schwierig gestaltet sich die Beurteilung der Wohlstandsänderung dann, wenn der Verschlechterung beim einzelnen eine Verbesserung bei anderen Gesellschaftsmitgliedt'%n (einem Mitglied, mehreren, allen Mitgliedem) gegenübersteht. Gleiches gilt, wenn in der Gruppe "andere Gesellschaftsmitglieder' Verbesserungen und Verschlechterungen gleichzeitig (wenn auch bei unterschiedlichen Personen) auftreten. Eine Aussage über die Wohlstandsänderung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit setzt in diesen Fällen einen interpersonellen Nutzenausgleich voraus.l3
B. Konsequenzen f"ür die Messung von Ungütern Geht man von der Überlegung aus, daß Güter durch ihre Verwendung und die dabei auftretenden Wirkungen zu Ungütern werden, so könnte man daraus vorschnell den Schluß ziehen, lediglich die Messung von Ungüterwirkungen sei problemadäquat. Was man messen muß, hängt jedoch ganz von der jeweiligen Fragestellung und von dem zugrundegelegten Erklärungszusammenhang (Theorie) ab. Es lassen sich durchaus Fragestellungen finden, welche die Messung von Verbrauchsmengen (je Zeiteinheit) von Gütern zweckmäßig erscheinen lassen, die häufig als Ungüter Verwendung finden (etwa Alkohol, Zigaretten - aber auch Zucker und Salz wären hier zu nennen). Aufschlußreicher als Durchschnittswerte (z.B. Verbrauch pro Kopf und Jahr) sind dabei Maße, die etwas über die Verteilung (personal, regional, zeitlich) aussagen. Angaben über Mengen, aber auch etwa Umsätze können in Längs- und Querschnittsvergleichen ausgewertet werden und so zu intertemporalen Vergleichen herangezogen werden. Den zentralen Ansatzpunkt für eine Messung stellen jedoch die Wirkungen von Ungütern dar. Da diese Wirkungen "eine Einbuße gegenüber 7 Vgl. Gerha.rd Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 204 (Übersicht 3). 8 Vgl. zu dieser Problematik Rudolf Möller: Interpersonelle Nutzenvergleiche. Wis-
senschaftliche Möglichkeit und politische Bedeutung. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1983 (Abh. z.d. Wirtsch. Staatswiss., Bd. 21) sowie die dort angegebene umfangreiche Literatur.
Die Messung von Ungüterwirkungen
117
einer vorgegebenen, ungestörten Wohlfahrtssituation bedeuten" ,9 kann man sie auch als Schäden bezeichnen. Das Spezifikum bei den hier betrachteten Schäden liegt darin, daß sie auf einer gestörten/fehlerhaften Verwendung von Gütern beruhen. Dieses Fehlverhalten weist ein breites Spektrum von Ausprägungen auf: Unvernunft, Fahrlässigkeit, Leichtsinn, Versehen. Merk geht es um ein freiwilliges und wissentliches Fehlverhalten. Er schränkt also dieses Spektrum ein. Damit taucht das kaum lösbare Problem auf, aus der Gesamtheit der Schäden nicht nur diejenigen zu eliminieren, die etwa auf höhere Gewalt oder Vorsatz zurückgehen, sondern auch diejenigen, die auf Leichtsinn, Versehen und Unwissenheit zurückzuführen sind. Schäden konkretisieren sich einzelwirtschaftlich gesehen in zusätzlichen, in der Regel unerwarteten Ausgaben sowie in Einnahmeausfällen und in Verlusten von Vermögen (Geld-, Sach- und Humanvermögen). Ebenso bedeutsame, wenn auch schwer quantifizierbare Schäden bestehen in verringerten Chancen und Gelegenheiten sowie einer geringeren Lebensqualität. 10 Die volkswirtschaftlichen Schäden bestehen in verringertem Wohlstand, einer Verschwendung von Produktionsfaktoren, höheren Faktor- und Güterpreisen. Diesen Sachverhalt arbeitet Merk klar heraus.11 Die Ermittlung von durch Fehlverhalten bedingten Schäden wird dadurch erschwert, daß weit verästelte Ursache-Wirkungsketten vorliegen. Es ist nicht nur der primäre Schaden infolge eines Fehlverhaltens zu erfassen, sondern ebenso sekundäre, tertiäre usw. Schäden. Der Prozeß dieser Schadensausbreitung ist kaum erforscht. Die Wirkungsverkettungen laufen auf unterschiedlichen Schienen: ( 1) wirtschaftliche Interdependenz, (2) personale Inzidenz, (3) zeitliche Abfolge, (4) räumliche Diffusion. Infolge der Komplexität dieser Ursache-Wirkungszusammenhänge wird es im Ernstfall äußerst schwierig, aufgetretene Schäden danach zu systematisieren, ob sie durch fehlerhafte Verwendung von Gütern oder durch sonstige Faktoren verursacht wurden. Die Existenz von Wirkungsverzögerungen stellen hierbei eine weitere Erschwernis dar. 9 Walter Karten: Artikel "Schaden, Betriebswirtschaftliche Bewertung", in: Dieter Farny, Elmar Helten, Peter Koch, Reimar Schmidt (Hrg.): Handwörterbuch der Versicherung. Karlsruhe (Verlag Versicherungswirtsmaft) 1988, S. 735. 10 Es wird nicht verkannt, daß Schäden auch positive Folgewirkungen haben können,
etwa Sammlung von Erfahrungen ("Aus Schaden wird man klug"), Umgestaltung der Lebenspläne, Hinwendung zu Gott.
11 Vgl. Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 207.
118
Heinz Steinmüller
C. Probleme und Möglichkeiten der Messung von Ungüterwirkungen
I. Grundlagen des Messens
Unter Messen versteht Merk die "eindeutige Zuordnung von Zahlen zu Sachverhalten (Abbildungen) nach bestimmten Regeln. Die zugeordneten Zahlen müssen Aussagen über ein 'größer' oder ein 'kleiner' der entsprechenden Sachverhalte gestatten" . 12 Diese Regeln können vorsehen, daß in den angegebenen Zahlen lediglich eine Rangordnung der Sachverhalte zum Ausdruck kommt (ordinales Messen). Bei kardinalem Messen werden darüber hinaus die Abstände/Unterschiede zwischen den Sachverhalten erfaßt. Neben Ordinalskalen und Kardinalskalen werden auch Nominalskalen zur Messung herangezogen. Sie ermöglichen eine klassenbegrifßiche Zuordnung von Zahlen zu Objekten/Sachverhalten.13 Die Güte der Messung wird durch ihre Validität und Reliabilität beschrieben. Validität (Gültigkeit) besagt, daß der tatsächlich gemeinte Sachverhalt erfaßt wird. Reliabilität (Zuverlässigkeit) ist gegeben, wenn die Messung keine Zufallsergebnisse liefert, sondern Resultate, die bei Wiederholungsmessungen erneut auftreten. Validität und Reliabilität sind stetige Merkmale in dem Sinn, daß sie graduell unterschiedliche Ausprägungen haben.
II. Messung des Mißnutzens von Ungütern
Nutzen wird gemeinhin als Maß für die Bedürfnisbefriedigung gesehen, die aus der Verwendung von Gütern erwächst. 14 Nutzen stellt die positive Veränderung des Wohlstands dar; Wohlstand wird in diesem Zusammenhang als Bestandsgröße verstanden. Mißnutzen wäre demnach eine negative Wohlstandsänderung, also spiegelbilllieh im negativen Ausprägungsraum zu definieren. 12 Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 206. 13 Vgl. dazu Stanley Smith Stevens: Mathematics, Measurement, and Psychophysics,
in: ders. (Hrg.): Handbook of Experimental Psychology. New York, London (Wiley) 1951, S. 1-49, S. 22 f. sowie Walter Gutjahr: Die Messung psychischer Eigenschaften. Köln (Kiepenheuer & Witsch) 1971, S. 25.
14 So auch Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 202.
Die Messung von Ungüterwirkungen
119
Die Frage, ob Nutzen meßbar ist oder nicht, wurde in der Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen unterschiedlich beantwortet. 15 Seine Meßbarkeit wird heute weitgehend eingeräumt. Dieser Sachverhalt findet in der vorsichtigen und deshalb treft"enden Formulierung von Merk seinen Niederschlag: "Er sei als meßbar angenommen ..." 16 • Die Vertreter der Pardianischen Wohlfahrtsökonomik halten lediglich eine ordinale Nutzenmessung für zulässig. Möglichkeiten auch für eine kardinale Messung sehen W. E. Armstrong 17, J. von Neumann/0. Morgenstern18 sowie J. Tinbergen19 • Diese Arbeiten sind als tastende Versuche zu werten, zu einem objektiven kardinalen Nutzenmaßstab zu gelangen. Ein praktikables Meßverfahren steht nicht zur Verfügung. Es ist zu fragen, ob überhaupt eine objektive kardinale Meßgröße für den subjektiven Sachverhalt Nutzen gefunden werden kann. Die Verwendung, der "Genuß" eines Gutes und seine unguten Wirkungen liegen häufig zeitlich weit auseinander. Somit geht es im Zusammenhang mit der Messung des Mißnutzens von Ungütern um zwei Probleme. Ein erstes Problem ergibt sich aus der Notwendigkeit, den intrapersonellen Mißnutzen intertemporal zu messen. Eine sinnvolle Messung bedingt einen über die Zeit konstanten Maßstab. Daß Nutzenfunktionen im Zeitverlauf unverändert bleiben, ist schlechterdings unrealistisch; eine problemadäquate Mißnutzenmessung ist somit nicht möglich. Das zweite Problem resultiert aus dem Geflecht der Ursache-Wirkungsverkettungen. Dem momentanen Zusatznutzen durch die Verwendung des Gutes sind die negativen und die gegebenenfalls positiven Wirkungen in allen Folgeperioden gegenüberzustellen. Das setzt eine eindeutige Zuordnung von Ursache und Wirkung voraus. Das ist in praxi ein äußerst schwieriges Unterfangen. Es ist das eine quaestio factorum, die nur aus der Empirie heraus gelöst werden kann. Zur Lösung des ersten Problems, der Intertemporalität des Nutzenvergleiclts, hilft auch der auf Eugen von Böhm-Bawerk zurückgehende 15 Zu den unterschiedlichen LehnDeinungen bezüglich der Meßbarkeit von Nutzen vgl.
Wilhehn Weber, Erich Streissler: Artikel ,.Nutzen", in: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Bd. 8. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht), Stuttgart (Gustav Fischer), Tübingen (Mohr-Siebeck) 1964, S. 1-19, S. 5 ff. sowie Gerhard Merk: Mikroökonomik. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz (Kohlhammer) 1976, S. 32-34.
16 Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 202. 17 V gl. Willia.m E. Annstrong: Utility and the Theory of Welfare, in: Oxford Economic Papers, Bd. 3 (1951), S. 259--271. 18 Vgl. John von Neumann, Oskar Morgenstern: Spieltheorie und wirtschaftliches Verhalten. Würzburg (Physica) 1973. 19 V gl. Jan Tinbergen: lncome Distribution. Analysis and Policies. Amsterdam, Oxford
(North-Holland) 1976.
120
Heinz Steinrniiller
Gedanke der Minderschätzung zukünftiger Bedürfnisse20 nicht weiter. Nach dieser Ansicht werden gegenwärtige Ereignisse höher eingeschätzt als zukünftige. Überträgt man diesen Sachverhalt auf Ungüter, so kann man eine tendenzielle Minderschätzung zukünftiger Schäden und somit eine systematische Unterschätzung von Risiken als quasi der Natur des Menschen entsprechende Einstellung konstatieren. Bei der Messung von Ungüterwirkungen geht es ja nicht um eine (im Sinne von Böhm-Bawerk) fehlerhafte Diskontierung21 von Nutzen, sondern um eine Saldierung von anfänglichem Nutzen und späterem Mißnutzen. Eine derartige intertemporale Nubensaldierung ist jedoch nur über eine kardinale Nutzen- bzw. Mißnutzenmessung möglich. Angesichts dieser zentralen Problematik tritt die Frage des Zeithorizonts {life-cycle, extended life-cycle) in den Hintergrund. Als Ergebnis ist festzuhalten, daß eine Messung des individuenen (intrapersonellen) Mißnutzens von Ungüterwirkungen einen intertempcr ralen und kardinalen Nutzen- bzw. Mißnutzenvergleich erfordert. Hierfiir geeignete, d.h. auf die Realität anwendbare Verfahren liegen nicht vor. Dieses Ergebnis präjudiziert das Urteil über die Möglichkeit einer Messung des gesellschaftlichen Mißnutzens von Ungüterwirkungen. Zu den obigen Anforderungen käme noch die Notwendigkeit eines interpersonellen Nutzen- bzw. Mißnutzenvergleichs. Interpersonelle Nutzenvergleiche gel. ten als noch weniger möglich als intertemporale Vergleiche. 22 Als weiteres ungelöstes Problem käme hinzu, das Gewicht der individueRen Nutzenbzw. Mißnutzenvorstellung in der kollektiven Wohlfahrtsfunktion zu bestimmen. Auf die Notwendigkeit, alle Wirkungsverästelungen zu ermitteln, um sie in die Bewertung einzubeziehen, wurde bereits hingewiesen.
111. Messung von Ungüterwirkungen im Rahmen der Volkswirtschaftlich en Gesamtrechnung Es liegt nahe zu prüfen, wie die (negativen) Wirkungen von Ungütern in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung berücksichtigt werden können. Bei dem gegenwärtigen Berechnungsmodus erhöhen Ausgaben zur Besei20 Vgl. Eugen von Böhm-Bawerk: Positive Theorie des Capitals. lnnsbruck (Wagner)
1889.
21 Aber auch über die Summe der abdiskontierten periodischen Nutzen läßt sich kein zu-
verlässiger intertemporaler Wohlstandsindikator gewinnen. V gl. dazu Charles Blackorby, David Donaldson, David Maloney: Consumer's Surplus and Welfare Change in a SimpleDynamicModel,i n: Review ofEconomic Studies,Bd. 51 (1984), S. 171-176.
22 V gl. Rudolf Möller: Interpersonelle Nutzenvergleiche, S. 120.
Die Messung von Ungüterwirkungen
121
tigung von Schäden23 das Sozialprodukt. Die Forderung, dieses zu korrigieren und den Aussagegehalt der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zu erweitern, erscheint durchaus berechtigt. Derartige Bestrebungen, durch eine veränderte Ausgestaltung dieses volkswirtschaftlichen Rechenwerkes den Aussagegehalt zu verbessern, sind keineswegs neu. Bereits in den vierziger Jahren hat diese Debatte einen ersten Höhepunkt erreicht. Seit dieser Zeit ist man von Seiten der Wissenschaft, aber auch der praktischen Statistik bemüht, die vorhandene Gliederung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zu einer umfassenden Universalrechnung auszuweiten. Diese soll geeignet sein, eine Vielzahl unterschiedlicher Fragestellungen zu beantworten. Dabei ist die Gefahr unverkennbar, daß damit ein Kompilat entsteht, "das allen Zwecken dienen soll und keinem wirklich dienen kann". 24 Als wesentliche Fragestellungen an die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung sind zu nennen: 25 1) Messung der gesamtwirtschaftlichen Endnachfrage und der Gesamtproduktion, 2) Messung der gesamtwirtschaftlichen effektiven Nachfrage, 3) Messung eines gesamtwirtschaftlichen Einkommens und Abbildung seiner Verteilung, 4) Abbildung der gesamtwirtschaftlichen Finanziemngsstruktur, 5) Abbildung der gesamtwirtschaftlichen Produk:tionsstruktur, 6) Messung des volkswirtschaftlichen "Erfolges" eines Sektors, 7) Messung der Veränderung der Gesamtwohlfahrt. Eine Berücksichtigung von Ungüterwirkungen erscheint zunächst im Rahmen der Frage 6 (Messung des wirtschaftlichen Erfolges der Wirtschaftssektoren) sinnvoll und geboten. 26 Dabei ist Erfolg als positive Veränderung des sektoradäquaten Reinvermögens zu verstehen. Voraussetzung für eine Berücksichtigung der Ungüterwirkungen im Rahmen 23 Gerhard Merk spricht in diesem Zusammenhang von Ausgaben für Anti-Ungüter. V gl. Gerhard Merk: Konfliktstau durch Ungüter, S. 209, sowie derselbe: Grundlehren der Nationalökonomik, Bd. 1. Frankfurt (Knapp) 1975, S. 11. 24 Gottfried Bombach: Staatshaushalt und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, in:
Finanzarchiv, Bd. 17 (1956/1957), S. 344-357, S. 347.
25
So Hans W. Holub: Reichweite und Konsistenz der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, in: Jahrbuch für Sozialwissensmaft, Bd. 29. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) (1978), S. 70---87, S. 73.
26 Der von Beckerman vertretenen extremen Position wird nicht gefolgt. Er formuliert lapidar: "H they (Güter, d.V.) are wanted they are wanted, and that is the end of the matter." (Wilfred Beckerman: In Defense of Economic Growth. London (Cape) 1974, s. 87.)
122
Heinz Steinmüller
dieser Fragestellung ist es, daß der für die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung konstitutiven Logik der doppelten Buchführung entsprochen wird. Alle Vorgänge sind in einem geschlossenen Gesamtkreislauf zu sehen und abzubilden. Da es sich aber bei den Positionen, in denen sich der Mißnutzen aufgrund von Ungüterwirkungen konkretisiert, vielfach um nichtmarktliehe Posten handelt (z.B. Verlust an Lebensqualität und Chancen), ist es nahezu unmöglich, entsprechende Gegenbuchungen vorzunehmen. An dieser Hürde scheitert auch das theoretisch durchaus fundierte und praxisnah ausgearbeitete Verfahren von Nordhaus und Tobin,27 den realen Pro-Kopf-Endkonsum von Haushalten zu messen. Eine weitere Hürde ist die bereits angesprochene Notwendigkeit der Kenntnis sämtlicher Auswirkungen der Verwendung von Ungütern. Mit diesem Problem hat man auch zu kämpfen, wenn man versucht, Ungüterwirkungen im Rahmen der Frage 7 (Messung der Veränderung der Gesamtwohlfahrt) zu berücksichtigen. Die wesentliche Erschwernis bereitet hier der BegrifF Wohlfahrt. Selbst wenn man Pigou28 folgt und Wohlfahrt aufihren ökonomischen Gehalt (economic welfare, Wohlstand) reduziert, so hilft das nicht weiter. "Die prinzipielle Indeterminiertheit des BegrifFs kann somit die Tatsache verdeutlichen, daß 'Wohlstand' als gesellschaftliches Finalziel für verschiedene inhaltliche Ausprägungen ofFen ist." 29 Weitere Probleme bestehen darin, daß für die Wohlstandsmessung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung Verteilungs- und Qualitätsüberlegungen eine zwingende Notwendigkeit sind. 30 Darüber hinaus ist die Basierung auf die gemeinsame Maßgröße Geldeinheiten erforderlich; und es muß nicht nur die tatsächliche erbrachte Leistung (etwa eines Krankenhauses), sondern auch die Bereitstellung dieser Leistung kostenmäßig berücksichtigt werden. Damit kommt man zu dem enttäuschenden Ergebnis, daß die "Einbeziehung außermarktmäßiger wohlstandsrelevanter Transaktionen nicht zielSihrend ist". 31 Es ist Josef Rabl zuzustimmen, wenn er formuliert: 27 Vgl. William Nordhaus, James Tobin: Is Growth Obsolete?, in: National Bureau of 28 29
Economic Research, General Series 96. New York (Colwnbia University Press) 1972, s. 1-80. V gl. Arthur Cecil Pigou: The Economic of Welfare, 4. Auß. London (Macmillan) 1962, s. 11. Christian Leipert: Unzulänglichkeiten des Sozialprodukts in seiner Eigenschaft als Wohlstandsmaß. Tübingen (Mohr-Siebeck) 1975, S. 10 (Schriften zur Angewandten Wirtschaftsforschung, Bd. 34).
Daraufweist Tinbergenhin (Jan Tinbergen: Wirtschaftspolitik. Freiburg (Rombach) 1968, s. 50 ff.). 31 Josef Rabl: Das Sozialprodukt als Wohlstandsmaß. Problematik- Kritik- Alternativen. Wien (Verb. d. Wissenschaft!. Gesellschaften Österreichs) 1980, S. 220.
30
Die Messung von Ungüterwirkungen
123
"Eine sinnvolle Lösung kann nach Ansieht des Verfassers nicht darin liegen, daß dem herkömmlichen Sozialprodukt-Konzept Aufgaben aufgelastet werden, die mit dem Wesen dieses Konzepts nur schwer vereinbar sind, sondern darin, daß das traditionelle Sozialprodukt auf ein Informationsinstrument zur deskriptiven Erfassung der Leistungserstellung beschränkt wird. " 32 IV. Messung von Ungüterwirkungen durch Soziale Indikatoren Aufgrund der dargestellten Ergehnisse ist zum Zweck der Wohlfahrtshzw. Wohlstandsmessung im Zusammenhang mit Ungütern nach einem alternativen Informationssystem zu fragen. Es soll geprüft werden, inwieweit sieh Soziale Indikatoren zur Messung von Ungüterwirkungen eignen. Ein Vorteil der Sozialen Indikatoren ist darin zu sehen, daß die gemessenen Sachverhalte nicht in einem geschlossenen Kreislauf abgebildet werden müssen. Darüber hinaus können unterschiedliche Maßeinheiten verwendet werden. Eine Mehrdimensionalität der Messung ist also möglich. Die Sozialindikatorenbewegung hat sieh im wesentliehen drei Aufgaben gesetzt: (1) Dauerbeobachtung des sozialen Wandels, (2) Prognose und Steuerung mit Hilfe theoretisch fundierter Modelle, (3) Wohlfahrtsmessung durch Prohleminformation.33 Bezüglich der Messung von Ungüterwirkungen ist die dritte Aufgabe (Wohlfahrtsmessung) einschlägig. Als Bezugsrahmen könnte die Gesellsehaft als Gesamtheit oder das Individuum gewählt werden; auch die Wohlfahrt unterschiedlicher sozialer Gruppen könnte sieh für eine Untersuchung eignen. Die Schwierigkeiten liegen dabei allgemein gesehen weniger in der Datengewinnung, sondern vor allem in ihrer Interpretation und der damit verbundenen - häufig politisch motivierten - Manipulation. Die spezifischen Probleme bei der Messung von Ungüterwirkungen über Soziale Indikatoren sind darin zu sehen, daß Wohlstandseinbußen ja nicht nur konstatiert werden müssen; sie müssen kausal dem fehlerhaften Umgang mit Gütern zugeordnet werden. Dazu ist eine detaillierte Kenntnis der 32 Josef Rabl: Das Sozialprodukt als Wohlstandsrnaß, S. 220. 33 V gl. zu diesen Aufgaben sowie zu einem Überblick über die Thematik der Sozialen
Indikatoren Hans J. Krupp, Wolfgang Zapf: Artikel.,Indikatoren, soziale Il" in: Willi Albers, et al. (Hrg.): Handwörterbuch der WirtschaCtswissenschaCt, Bd. 4. Stuttgart, New York (Gustav Fischer), Tübingen (Mohr-Siebeck), Göttingen, Zürich (Vandenhoeck & Ruprecht) 1978, S. 119-133 sowie die dort angegebene äußerst umfangreiche Literatur.
124
Heinz Steinmüller
Wirkungsverkettungen erforderlich. Somit besteht ein erster Schritt in der Erstellung einer Fehlverhaltensrechnung.
V. Fehlverhaltensrechnungen als Verfahren zur Messung von Ungüterwirkungen Im folgenden soll am Beispiel der Fehlernährung dargestellt werden, wie eine Fehlverhaltensrechnung zur Messung von Ungüterwirkungen erstellt werden kann. Es geht dabei um die Ermittlung der Kosten der Fehlernährung. 34 Diese resultieren aus den Fehlernährungswirkungen Krankheit, Invalidität und Tod. Auch hier tritt - wie erwartet - das Problem der Zuordnung von Ursache und Wirkung auf. "Zum einen gibt es nicht die ernährungsabhängigen Krankheiten schlechthin; vielmehr werden viele Krankheiten in einem größeren oder kleineren Maße durch Fehlernährung -wie auch durch weitere Faktoren- verursacht, wobei der Grad der Ernährungsabhängigkeit wissenschaftlich nicht immer exakt zu bestimmen sein wird. Zum anderen bleibt die Frage, auch wenn die Kosten ausgewählter (ernährungsabhängiger) Krankheiten im Rahmen einer vorgegebenen Methodik ermittelt werden können, in welcher Höhe die Kosten tatsächlich der Fehlernährung zuzuschreiben sind oder durch eine Umstellung der Ernährung vermieden werden können." 35 Als Kostenarten werden verstanden: direkte, indirekte und psychosoziale Kosten. 36 Diese Kosten treten bei den unmittelbar und mittelbar betroffenen Personen auf. Die direkten Kosten beinhalten den Ressourcenverbrauch für Leistungen des Gesundheitswesens; die indirekten Kosten ergeben sich aufgrund einer Bewertung des Ressourcenverlustes, d.h. des Verlustes an menschlicher Arbeitskraft infolge ernährungsabhängiger Krankheit, Invalidität und ernährungsbedingten Todes. Aufgrund der Kostenerfassungsprobleme wurden in der hier vorgestellten Studie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nicht alle Kostenkomponenten berücksichtigt. Die Bewertung des Ressourcenverbrauchs wurde zu Opportunitätskosten, die des Ressourcenverlustes mit Hilfe der Humankapitalmethode vorgenommen.37 Bei den Kostenschätzungen wurden die im Berichtsjahr (1980) angefallenen Kosten für vorhandene Krankheitsfälle 34 Vgl. zum folgenden Deutsche Gesellschaft für Emährung (Hrg.): Emährungsbericht 1988, Frankfurt am Main (Deutsche Ges. für Emährung) 1988, S. 42 ff. 35 Deutsche Gesellschaft für Emährung: Emährungsbericht 1988, S. 42. 36
V gl. dazu die Fußnote auf Tabelle 1 (Deutsche Gesellschaft für Emährung: Emährungsbericht 1988, S. 65).
37 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Emährung: Emährungsbericht 1988, S. 49.
Die Messung von Ungüterwirkungen
Tabelle 1
125
Direkte, Indirekte und psychosoziale Kosten von Krankheit, Invalidität und vorzeitigem Tod
Krankheit/lnvalidität/Tod A. Unmittelbar betroffene Personen
I. Direkte Kosten
1. Kernkosten•)
- Prävention - Behandlung - Rehabilitation - Pßege 2. zusätzliche Kosten - Diätkost, Kauf von Gesundheitsbüchern, Fahrten zum Arzt, Wertminderung und Verlust von Eigentum usw.
11. Indirekte Kosten 1. Indirekte Kosten lnfolge von Morbidität
- Arbeitsunfähigkeit, verminderte Funktionserfüllung usw. ·1 - Berufswechsel, verpaßte Aufstiegschancen usw. 2. Indirekte Kosten lnfolge von Mortalität•) - Ressourcenverlust durch vorzeitigen Tod
111. Psychosoziale Kosten
1. psychosoziale Kosten als nicht gemessene volkswirtschaftliche Kosten - Verminderung der Produktivität ohne Arbeitsunfähigkeit, Berufswechsel usw. 2. psychosoziale Kosten l.e.S. - vermindertes Selbstwertgefühl, Angst vor Krankheit und Tod, Leid usw.
8. Mittelbar betroffene Personen I. Direkte Kosten
1. Kernkosten fallen nicht an; soweit allerdings die psychosozialen Auswirkungen bel diesen vorerst nicht von Krankheit/lnvalidität/Tod Betroffenen einen Krankheits- oderTodeslall hervorrufen, erfolgt ein Wechselln die Gruppe der unmittelbar Betroffenen 2. zusätzliche Kosten - s. auch unter A.
11. Indirekte Kosten Indirekte Kosten infolge von Morbidität und Mortalität - Zeitaufwand zur Pflege Kranker und Sterbender usw.
111. Psychosoziale Kosten
1. psychosoziale Kosten als nicht gemessene volkswirtschaftliche Kosten - Berufswechsel, ohne daß der Betreffende selbst krank ist usw. 2. psychosoziale Kosten l.e.S. - vermindertes Selbstwertgefühl, Angst vor Krankheit und Tod, Leid usw.
, DIMe KootenbN..,...IIile werden in -vor1legenden UntersuchUng berücksichtigt.
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (Hrsg.),
Ernährungsbericht 1988, Frankfurt am Main 1988,
S.65
126
Heinz Steinmüller
erfaßt. Die Gesamtkosten beliefen sich 1980 auf annähernd 42 Mrd. DM (vgl. Tabelle 2).
D. Schlußbemerkung Für eine Fehlverhaltensredtnung bieten sich weitere Lebensbereiche an, für die diese analog durchzuführen wäre: Freizeit, Erholung, Verkehr, Umwelt, Arbeit, Bildung, Bauen und Wohnen sowie soziales Leben. Gerhard Merk kommt das große Verdienst zu, dargestellt zu haben, daß die Verwendung von Gütern mit individueRen, volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schäden verbunden sein kann. Fehlverhalten/Unvernunft erscheint somit als wesentliche Determinante von Schäden generell. Somit kann die Arbeit von Gerhard Merk auch als ein Beitrag zu einer - bislang nicht existierenden - Allgemeinen Schadenstheorie (Noxologie) gesehen werden.
Todesfälle
')
2
7
9
10
4
8805 41,70
3871
33
684
.,
1883 25,65
482
10
1 88 1
4
68
8
14 2 13
4 11
3
1
173 72
12 10 5
7
9
3 4 26
11
8
8854
165
12 1689 15
1024 40
1181
33 80 520 172 3351
103
27831 31,10
~
9
14 4 11
2 7
3
12 13 8 6 I
10
Quelle: Deutsche Gesellschaft fUr Ernährung (Hrsg.), Ernährungsbericht 1988, Frankfurt am Main 1988, 5.66
-
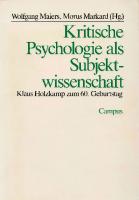

![Rechtstheorie in rechtspraktischer Absicht: Freundesgabe zum 70. Geburtstag von Friedrich Müller [1 ed.]
9783428525904, 9783428125906](https://dokumen.pub/img/200x200/rechtstheorie-in-rechtspraktischer-absicht-freundesgabe-zum-70-geburtstag-von-friedrich-mller-1nbsped-9783428525904-9783428125906.jpg)
![Rechtsnorm und Rechtswirklichkeit: Festschrift für Werner Krawietz zum 60. Geburtstag [1 ed.]
9783428479061, 9783428079063](https://dokumen.pub/img/200x200/rechtsnorm-und-rechtswirklichkeit-festschrift-fr-werner-krawietz-zum-60-geburtstag-1nbsped-9783428479061-9783428079063.jpg)
![Existenz und Kooperation: Festschrift für Ingtraud Görland zum 60. Geburtstag [1 ed.]
9783428479078, 9783428079070](https://dokumen.pub/img/200x200/existenz-und-kooperation-festschrift-fr-ingtraud-grland-zum-60-geburtstag-1nbsped-9783428479078-9783428079070.jpg)
![Worte und Werte: Bruno Markwardt zum 60. Geburtstag [Reprint 2018 ed.]
9783110826180, 9783110003345](https://dokumen.pub/img/200x200/worte-und-werte-bruno-markwardt-zum-60-geburtstag-reprint-2018nbsped-9783110826180-9783110003345.jpg)
![Roma et Romania: Festschrift für Gerhard Ernst zum 65. Geburtstag [Reprint 2010 ed.]
9783110911909, 9783484503915](https://dokumen.pub/img/200x200/roma-et-romania-festschrift-fr-gerhard-ernst-zum-65-geburtstag-reprint-2010nbsped-9783110911909-9783484503915.jpg)

![Wagnis Mensch werden: Eine theologisch-praktische Anthropologie. Festschrift für Klaus Kießling zum 60. Geburtstag [1 ed.]
9783666703270, 9783525703274](https://dokumen.pub/img/200x200/wagnis-mensch-werden-eine-theologisch-praktische-anthropologie-festschrift-fr-klaus-kieling-zum-60-geburtstag-1nbsped-9783666703270-9783525703274.jpg)
![Linguistik und Deutsch als Fremdsprache: Festschrift für Gerhard Helbig zum 70. Geburtstag [Reprint 2010 ed.]
9783110925760, 9783484730526](https://dokumen.pub/img/200x200/linguistik-und-deutsch-als-fremdsprache-festschrift-fr-gerhard-helbig-zum-70-geburtstag-reprint-2010nbsped-9783110925760-9783484730526.jpg)
![Güter und Ungüter: Eine Freundesgabe für Gerhard Merk zum 60. Geburtstag [1 ed.]
9783428470891, 9783428070893](https://dokumen.pub/img/200x200/gter-und-ungter-eine-freundesgabe-fr-gerhard-merk-zum-60-geburtstag-1nbsped-9783428470891-9783428070893.jpg)