Genossenschaften in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft [1. ed.] 9783958322462
372 74 3MB
German Pages 299 [301] Year 2022
Polecaj historie
Table of contents :
Cover
Vorwort: Bindung und Freiheit
I Gilden und Zünfte im Hohen Mittelalter und das Ende der Zünfte in Europa
Kommune, Gilden und Zünfte im Mittelalter: die Gegenwart der Vergangenheit?
Sind die historischen Handwerkszünfte Vorbilder für das moderne Genossenschaftswesen in Deutschland?
Kulturwissenschaftliche Reflexionen über soziale Gruppen in der mittelalterlichen Gesellschaft: Tönnies, Simmel, Durkheim und Max Weber
II Gründer»väter« der Soziologie über Solidarismus, Berufsmoral und Genossenschaften, oder: die Wiederentdeckung des Mittelalters
Wesenwille. Über eine soziologische Aporie bei Ferdinand Tönnies und Max Weber
Émile Durkheim: Berufsmoral, Solidarismus und Gilden. Ein Rekonstruktionsversuch
Dear Beatrice. The never written memoir of a guild socialist
Drei Morgen Land und eine Gilde: Der berufsständige Gedanke im Distributismus Chestertons und Bellocs. Ein Essay
Luhmanns Mittelalter
Mein »Mittelalter«
III Genossenschaften in Gegenwart und Zukunft
Merkmale und Besonderheiten der italienischen Genossenschaften
Genossenschaften als Organisationen sozialer Transformation und Entwicklung. Von Italien lernen
Sozialgenossenschaften in Polen
Bürgerstiftungen. Das genossenschaftliche Prinzip der Selbsthilfe
Warum sich Seniorengenossenschaften gründen
»Die waren völlig überrascht, dass da plötzlich wieder ein Bäcker kommt« – Von der gegenwärtigen Dynamik traditionellen Gesellenwanderns
Autorinnen und Autoren
Citation preview
Georg Kamphausen (Hg.)
GENOSSENSCHAFTEN in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
VELBRÜCK WISSENSCHAFT
Georg Kamphausen (Hg.) Genossenschaften
Unserem Kollegen und Freund Jerzy Kaczmarek (13.12.1964–7.4.2021) in dankbarer Erinnerung gewidmet
Genossenschaften in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Herausgegeben von Georg Kamphausen
VELBRÜCK WISSENSCHAFT
Erste Auflage 2022 © Velbrück Wissenschaft, Weilerswist 2022 www.velbrueck-wissenschaft.de Printed in Germany ISBN 978-3-95832-246-2 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Inhalt
Georg Kamphausen Vorwort: Bindung und Freiheit . . . . . . . . . . . . 9
I Gilden und Zünfte im Hohen Mittelalter und das Ende der Zünfte in Europa Knut Schulz Kommune, Gilden und Zünfte im Mittelalter: die Gegenwart der Vergangenheit? . . . . . . . . . . . 15 Arnd Kluge Sind die historischen Handwerkszünfte Vorbilder für das moderne Genossenschaftswesen in Deutschland? . . . 37 Otto Gerhard Oexle Kulturwissenschaftliche Reflexionen über soziale Gruppen in der mittelalterlichen Gesellschaft: Tönnies, Simmel, Durkheim und Max Weber . . . . . . . 48 II Gründer»väter« der Soziologie über Solidarismus, Berufsmoral und Genossenschaften, oder: die Wiederentdeckung des Mittelalters Johannes Weiß Wesenwille. Über eine soziologische Aporie bei Ferdinand Tönnies und Max Weber . . . . . . . . . 97 Michael Schmid Émile Durkheim: Berufsmoral, Solidarismus und Gilden. Ein Rekonstruktionsversuch . . . . . . . . . . . . . 105 Christiane Mossin Dear Beatrice. The never written memoir of a guild socialist . . . . . . . . 145
Julian Voth Drei Morgen Land und eine Gilde: Der berufsständige Gedanke im Distributismus Chestertons und Bellocs. Ein Essay . . . . . . . . . . . 175 Otto Gerhard Oexle Luhmanns Mittelalter . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Niklas Luhmann Mein »Mittelalter« . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
III Genossenschaften in Gegenwart und Zukunft Oscar Kiesswetter Merkmale und Besonderheiten der italienischen Genossenschaften . . . . . . . . . . 205 Susanne Elsen Genossenschaften als Organisationen sozialer Transformation und Entwicklung. Von Italien lernen . . . 229 Jerzy Kaczmarek Sozialgenossenschaften in Polen . . . . . . . . . . . . 240 Thomas Horn Bürgerstiftungen. Das genossenschaftliche Prinzip der Selbsthilfe . . . . . . 250 Silvia Wiegel Warum sich Seniorengenossenschaften gründen . . . . . . 257 Markus Römer »Die waren völlig überrascht, dass da plötzlich wieder ein Bäcker kommt« – Von der gegenwärtigen Dynamik traditionellen Gesellenwanderns . . . . . . . . 271 Autorinnen und Autoren . . . . . . . . . . . . . . 295
»Alle Erkenntnis der Kulturwirklichkeit ist (…) stets eine Erkenntnis unter spezifisch gesonderten Gesichtspunkten. Wenn wir von dem Historiker und Sozialforscher als elementare Voraussetzung verlangen, dass er Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden könne, und dass er für diese Unterscheidung die erforderlichen »Gesichtspunkte« habe, so heißt das lediglich, dass er verstehen müsse, die Vorgänge der Wirklichkeit – bewusst oder unbewusst – auf universelle ›Kulturwerte‹ zu beziehen und danach die Zusammenhänge herauszuheben, welche für uns bedeutsam sind. Wenn immer wieder die Meinung auftritt, jene Gesichtspunkte könnten dem ›Stoff selbst entnommen‹ werden, so entspringt das der naiven Selbsttäuschung des Fachgelehrten, der nicht beachtet, dass er von vornherein kraft der Wertideen, mit denen er unbewusst an den Stoff herangegangen ist, aus einer absoluten Unendlichkeit einen winzigen Bestandteil als das herausgehoben hat, auf dessen Betrachtung es ihm allein ankommt.«
Max Weber
8
Georg Kamphausen
Vorwort Bindung und Freiheit Wie ist gesellschaftliche Ordnung in einer Struktur relativer Strukturlosigkeit möglich? Gibt es neben der öffentlichen (staatlichen, ökonomischen) Ordnung auch eine Ordnung des privaten Lebens? Was bedeutet bürgerliche Selbständigkeit im Kontext eines Wohlfahrtstaates, der heute an seine Grenzen stößt? Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Individualisierung für die Flexibilisierung sozialer Zugehörigkeiten? Immer lauter wird die Frage, was moderne Gesellschaften überhaupt noch zusammenhält, welche »Ligaturen« (Dahrendorf) und »liens« (Tocqueville) zwischen den Menschen bestehen. Angesichts knapper öffentlicher Kassen sind es vor allem die Genossenschaften des »Dritten Sektors«, die besondere Potentiale bei der Übernahme und Absicherung bestimmter kommunaler Aufgaben zu bieten scheinen. Ob ein solches bürgerschaftliches Engagement nur Lückenbüßer, Platzhalter oder Ersatz staatlichen Handelns sein kann, ist deshalb fraglich, weil die Rolle des Bürgers als politisches Subjekt ungeklärt bleibt. Heute ist der Begriff der Genossenschaft vor allem ein Sehnsuchtsbegriff, ein Hinweis auf enttäuschte Hoffnungen, auf romantische Reminiszenzen. Der Begriff bezeichnet nicht nur eine rechtlich geregelte Wirtschaftsorganisation, er lässt immer noch den emotionalen Mehrwert durchhören, dem man heute eher skeptisch gegenübersteht. Dass sich nahezu alle europäischen Soziologen des 19. Jahrhunderts mit den Themen Gilde und Zunft befassten, führt zu der überraschenden Einsicht, dass sich hinter der historischen Variabilität des Genossenschaftsbegriffs eine anthropologische Konstante verbirgt, die beinahe bei allen Gründern der Soziologie, wie auch bei den englischen Gildensozialisten, zu einem bestimmenden Thema wurde. Denn wer von Genossenschaften spricht, darf von Zünften und Gilden nicht schweigen. Es geht aber im vorliegenden Tagungsband nicht um eine romantische Verklärung des Mittelalters, sondern um einen Sachverhalt, dem bereits Émile Durkheim mit großem Nachdruck Ausdruck verliehen hat: Im Alter und der Beständigkeit der Zünfte und Korporationen sah er den Beweis, dass sie ihre Existenz nicht etwa zufälligen, akzidentiellen Eigenheiten einer bestimmten Staatsform verdankten, sondern auf Ursachen von allgemeiner und fundamentaler Bedeutung zurückgehen. 9
GEORG KAMPHAUSEN
Ihre gewaltsame Unterdrückung sei eine »morbide Erscheinung«1 gewesen. Es ist kein Zufall, dass die Mehrzahl der Klassiker der Soziologie den Beginn des europäischen Bürgertums in den Stadtgründungen des Mittelalters sahen und insbesondere die englischen Gildensozialisten sich mit großer Leidenschaft dem Thema Kommune gewidmet haben. Otto Gerhard Oexle hat in vielen seiner Arbeiten deutlich gemacht, warum es sich hier um eine Kernfrage der Soziologie handelt. Es sind vor allem jene Gruppen, die durch eine ausdrückliche Verbrüderung konstituiert werden, also durch den bewussten und willkürlichen Zusammenschluss der Individuen auf der Grundlage ihrer Gleichheit. Die Geschichte gerade dieser Gruppen ist es, so Oexle, die den Zusammenhang von Mittelalter und Moderne sichtbar werden lässt. »Denn vor allem hier, wo Menschen sich im sozialen Handeln nach selbst gesetzten Zielen ›verbrüdern‹, lassen sich langfristige und bedeutende geschichtliche Wirkungen sozialen Handelns beobachten.2 Im Personenverbandsstaat des Mittelalters, also vor der Herausbildung der zentralisierten Territorialstaaten und der damit einhergehenden Trennung von Staat und Gesellschaft, öffentlich und privat, kommt es zur Gemeindebildung, die sich gegen die herkömmlichen Herrschaftsformen etabliert, »bei genossenschaftlicher Organisation aber fundamental auf Herrschaft basiert«3. Das Ziel dieser Gemeinde ist die gute Ordnung, die sich als politische Korporation herausbildet. Gemeinde ist daher nicht nur Nachbarschaft, sondern ein Gebilde, das erst durch die Beziehungen zu einem, eine Vielzahl von Nachbarschaften umfassenden, politischen Gemeinschaftshandeln gestiftet wird. Freundschaft in diesem politisch-rechtlichen Sinne bildet letztlich die Basis aller genossenschaftlichen Vereinigungen, von den Zünften über die frühen Universitäten bis hin zur dörflichen und städtischen Gemeinde. Um einen Eindruck davon zu vermitteln, »wie elementar für die Menschen des Mittelalters das Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit und Gruppenbildung war, genügt es darauf hinzuweisen, wie häufig sie sich trotz der eindringlichen Verbote der weltlichen wie geistlichen Obrigkeit durch gegenseitige Eide Hilfe und Unterstützung versprachen – und so zu ›Verschwörern‹ wurden«4. In England war die Rezeption der 1 Émile Durkheim: Physik der Sitten und des Rechts, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1991, S. 34. 2 Otto Gerhard Oexle: Kulturwissenschaftliche Reflexionen über soziale Gruppen (in diesem Band), hier S. 68. 3 Michael Sonntag: »Herrschaft und Genossenschaft: Zur Geschichte der Gemeinde als ›politische Gemeinschaft‹«, in: Journal für Psychologie, 1995, Band 3, Heft 2, S. 23–41, hier S. 25. 4 Gerd Althoff: Verwandte, Freunde und Getreue. Zum politischen Stellenwert der Gruppenbindungen im frühen Mittelalter, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1990, S. 8. Der Eid ist, nach den Worten Max
10
VORWORT: BINDUNG UND FREIHEIT
mittelalterlichen Gilden ganz ähnlich wie auf dem Kontinent, aber doch ganz anders. Hier stritt eine Reihe von Theoretikern für den Übergang zu einem sozialistischen System auf der Grundlage von Ideen, die sich erheblich von denen des kontinentalen Sozialismus und Kommunismus unterschieden. Der britische Liberalismus bereicherte den marxistischen Materialismus und wandte sich gegen die reduktiven Merkmale von Klassenanalyse und historischem Determinismus. Zu nennen sind hier vor allem Autoren wie G.D.H. Cole, aber auch so extravagante Theoretiker wie Gilbert Keith Chesterton und Hilaire Belloc. Die Beiträge im dritten Teil des vorliegenden Bandes zeigen jedenfalls, dass die Verbindung von Mediävistik, Soziologiegeschichte und einer gegenwartsbezogenen Genossenschaftsforschung überaus fruchtbar sein kann. Denn auch in den gegenwärtigen Genossenschaften geht es um das Problem des Verhältnisses von Bindung und Freiheit. Ein Wort des Dankes zum Schluss: Danken möchte ich der Hanns Martin Schleyer- und der Nixdorf Stiftung für ihre finanzielle Unterstützung. Großen Dank schulde ich den Teilnehmern der Tagung für ihre Geduld bei der Herausgabe dieses Bandes. Die bereits publizierten Arbeiten von Otto Gerhard Oexle und Niklas Luhmann sowie die zusätzlich eingeworbenen Aufsätze von Julian Voth und Christiane Mossin ergänzen die Beiträge einer im November 2019 stattgefundenen Tagung an der Universität Bayreuth um wesentliche Aspekte. Für die Erteilung der Wiederabdruckgenehmigung der Arbeiten von Oexle und Luhmann danke ich dem Oldenbourg Verlag und der Löwenklau-Gesellschaft (Rechtshistorisches Journal). Ohne die Unterstützung einer Vielzahl von Studierenden hätte weder die Tagung durchgeführt noch die Publikation des vorliegenden Buches realisiert werden können. Dem Verlag Velbrück Wissenschaft gilt mein Dank für sein Interesse an einer eher ungewöhnlichen Präsentation des Genossenschaftsthemas. Aus verschiedensten Gründen haben wir uns dazu entschlossen, nicht nur die an dieser Stelle wieder abgedruckten Arbeiten, sondern auch die Tagungsbeiträge in ihrem jeweils gewählten Format zu belassen. Im Interesse der Lesbarkeit haben wir auf geschlechtsbezogene Formulierungen verzichtet. Selbstverständlich sind immer Frauen und Männer gemeint, auch wenn explizit nur eines der Geschlechter angesprochen wird. Der Herausgeber und die Mitorganisatoren der Tagung möchten das entstandene Werk dem Kollegen und Freund Jerzy Kaczmarek widmen, der plötzlich und unerwartet am 7.4.2021 verstorben ist.
Webers, »eine der universellsten Formen aller Verbrüderungsverträge«, d.h. aller Formen des Kontrakts; vgl. Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft, Studienausgabe, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1972, S. 402.
11
I Gilden und Zünfte im hohen Mittelalter und das Ende der Zünfte in Europa
Knut Schulz
Kommunen, Gilden und Zünfte im Mittelalter: die Gegenwart der Vergangenheit? Die mit dieser Themenstellung umrissene Aufgabe ist nicht nur erschreckend groß, sondern zugleich auch verlockend, weil sie zum einordnenden Vergleich mit anderen Wertmaßstäben und Ansätzen herausfordert.1 Ich bin, wie Sie wissen, Historiker, noch schlimmer: Mediävist, also von Hause aus eigentlich Quellenfetischist, habe mich hier und nun aber mit Theoretikern und Systematikern auseinanderzusetzen, die oftmals allgemeine Strukturen und Zusammenhänge zu erfassen suchen, aber nicht so häufig auf lateinische Texte zurückgreifen. Dennoch bin ich optimistisch, einerseits angesichts Ihres Interesses an dieser Zusammenarbeit und andererseits meiner eigenen Vorarbeiten auf dem Gebiet der mittelalterlichen Stadt des Okzidents,2 die um die Einordnung in unterschiedliche Bezüge bemüht sein mussten; eigentlich gute Voraussetzungen, um voneinander profitieren und ein gutes Gespräch führen zu können. Beginnen möchte ich mit Hinweisen auf die an Ergebnissen zu unserer Thematik so reiche Rechtsgeschichte der Deutschen Rechtsschule, allen voran mit Otto von Gierke und seinem Klassiker über »Das deutsche Genossenschaftsrecht« in vier Bänden (1868–1913).3 Seit Karl Friedrich Eichhorn (1781–1854)4 und Wilhelm Eduard Wilda (1800– 1856)5 kann diese Forschungsrichtung mittlerweile auf eine 200jährige Geschichte zurückblicken und ist immer noch aktuell.6 Vorrangig soll hier jedoch die seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erblühende Soziologie und Politologie in das Blickfeld gelangen, und zwar in erster Linie mit Max Weber (1864–1920) und seiner Analyse der mittelalterlichen Stadt und der Entstehung des Bürgertums in ihren Auswirkungen 1 Geringfügig erweiterte und mit Fußnoten versehene Fassung des am 1.11.2019 gehaltenen Tagungsvortrags. Als breit angelegte Orientierung vgl. man das gewichtige Werk von Eberhard Isenmann (2012, bes. Kap. 2: Stadtbürger. Stadtrecht und Stadtverfassung, S. 133–280). 2 Vgl. Schulz 1992/1995 und Schulz 2008. 3 Gierke 1863–1913. 4 Eichhorn 1843. 5 Wilda 1838/1964. 6 Vgl. Stradal 1971.
15
KNUT SCHULZ
auf die Gegenwart.7 Wie diese verschiedenartigen Ansätze und Impulse in das moderne Geschichtsbild und möglicherweise in das Bewusstsein der Politik Eingang und dort Beachtung gefunden haben, wird die abschließend zu diskutierende und wohl am schwierigsten zu entscheidende Frage sein. Also erst einmal zu Otto von Gierke (1841–1921) und seiner Analyse des Genossenschaftswesens. Als prägendes Element der germanischen und deutschen Geschichte glaubte dieser das genossenschaftliche Prinzip erfassen zu können, das zwar unterschiedlich stark hervortrat, aber immer wieder zur Geltung gelangte, wenn auch in Konkurrenz zu Phasen herrschaftlicher Präponderanz.8 Im Gegensatz zu den Vertretern des römischen Rechts9 sah er die Grundlagen und wesentlichen Linien der Fortentwicklung in den – wie es damals hieß – germanistischen Traditionen, die zwar vom 8. bis 11. Jahrhundert von der Königs- und Adelsherrschaft überlagert wurden, um dann vom 11. bis zum 15. Jahrhundert den Umschwung zu freien Einungen zu erleben,10 die auf dem Gedanken des Genossenschaftswesens aufbauten und ihre eigentliche Ausprägung in der städtischen Kommune erlangten.11 In dem entfalteten Zunftwesen des Spätmittelalters erreichten sie, so Weber, dann oftmals ihre volle Blüte.12 Abgelöst wurde diese Entwicklung durch die frühneuzeitlichen Fürstenstaaten und den Absolutismus in den folgenden drei Jahrhunderten (16.–18. Jahrhundert) mit der herrschaftlichen Einbindung der Zünfte als »Korporationen«, wie sie nun – stärker kontrolliert und mit begrenzten Aufgabenzuweisungen versehen – zu charakterisieren seien.13 Es folgte schließlich die Ausbildung »freier Assoziationen« im 19. und frühen 20. Jahrhundert in Gestalt genossenschaftlicher Verbände und Gruppen, nicht zuletzt zum Zweck gemeinsamer Interessenwahrnehmung, was sich nun auch auf die Ebene von Staat und Volk erstrecken und zu einem »Gemeinbewusstsein« und »Gemeinwillen« beitragen konnte.14 Somit sei Otto von Gierke auf seine Weise als »ein Wegbereiter des modernen Sozialstaates«15 oder als »altfränkischer Prophet des modernen freiheitlichen Sozialstaates« anzusehen (so Gerhard Dilcher),16 wo rin wohl eine gewisse Distanz gegenüber einer allzu positiv akzentuierten genossenschaftlichen und »volksgeistigen« Tradition anklingt. 7 Weber 1999 und Weber 2013, dazu Weber 2009. 8 Vgl. Dilcher 2012. 9 Vgl. Söllner 1990. 10 Vgl. Kroeschell 1971. 11 Vgl. Schulz 1992/1995: 1–19. 12 Vgl. Weber 1999: 199 f. und 234 ff. 13 Vgl. Oexle 1982. 14 Boldt, Hans 1982: 12. 15 Ebd.: 21. 16 Ebd.: 22, Anm. 17.
16
KOMMUNE, GILDEN UND ZÜNFTE IM MITTELALTER
Besondere Verdienste hatte sich Otto von Gierke im Rahmen seiner Studien zum Genossenschaftswesen um die Herausarbeitung von Begriff und Funktion der mittelalterlichen Gilden erworben.17 Mit neuen Akzentuierungen folgten ihm Hans Planitz (1882–1954) und zuletzt Otto Gerhard Oexle (1939–2016), die dem Gildebegriff eine erweiterte Bedeutung und Aussagekraft zuerkennen wollten, dabei allerdings an gewisse Grenzen stießen.18 Dies gilt etwa für den Versuch von Planitz, den Prozess der frühen Stadtwerdung auf die Tatkraft von Gilden freier Fernkaufleute zurückzuführen und den Gildebegriff auf die Kommune, die mittelalterliche Stadtgemeinde insgesamt auszudehnen.19 Noch konsequenter hat Oexle diese inhaltliche Ausweitung in seinem 1996 und erneut 2011 veröffentlichten Aufsatz unter dem Titel »Gilde und Kommune. Über die Entstehung von ›Einung‹ und ›Gemeinde‹ als Grundformen des Zusammenlebens in Europa« in eigenwilliger Weise vollzogen, indem er ihre Ursprünge in der Landgemeinde des 9./10. Jahrhunderts entdeckt zu haben meinte.20 Schon die Parallelisierung der Begriffe Gilde und Kommune lässt aufhorchen, denkt man bei Gilde doch primär an die Bildung einer speziellen, gleich orientierten Gruppe zur Wahrnehmung und Sicherung gemeinsamer Interessen, seien sie religiöser, wirtschaftlicher, besonders geselliger und schutz- und unterstützungsgewährender Art.21 Natürlich konnten einige dieser Aufgaben in ähnlicher Weise auch von einer Stadtgemeinde wahrgenommen werden, aber zustande gekommen und zielorientiert war letztere nun einmal als politischer Verband, der sich als Rechtsgemeinschaft, wenn auch von gesellschaftlich deutlich differenzierten Bürgern, und zugleich als Wehrgemeinschaft verstand und sich vor allem einem Freiheits- und Selbstständigkeitsideal verpflichtet fühlte.22 Schließlich muss es einen Sinn ergeben, unterschiedliche Begriffe zu verwenden, wie im Fall von Kommune und Gilde; deren Gleichsetzung vermittelt nicht nur Unklarheit, sondern eher Verwirrung als Gewinn. Während die Begriffe »Gilden« – »Zünfte« – »Bruderschaften« eine mittelalterliche Herkunft und einen dementsprechenden Akzent haben, nämlich jeweils in Verbindung mit Formen von Geselligkeit und gegenseitiger Hilfe auf die Bereiche von Handel – Handwerk – Religion Bezug nehmen, wären vorrangig Begriffe wie »Vereine« – »Parteien« 17 Vgl. Kroeschell 1971. 18 Planitz 1940 und Planitz 1954. 19 Vgl. Planitz 1940. 20 Oexle 1996. 21 Vgl. Fouquet 2012, der im Wesentlichen der Auffassung von Otto Gerhard Oexle folgt. 22 Vgl. Isenmann 2012: 207–216.
17
KNUT SCHULZ
– »Verbände«23 zu wählen, wenn moderne Zusammenschlüsse von Personen gemeint sind, wobei kleinere Gruppen aktuell gern spezifische Bezeichnungen wählen. Übergeordnet und von Dauerhaftigkeit, da als lateinischer Begriff in die Sprache der Politik übernommen, ist hingegen der Terminus der Kommune, wenn auch mittlerweile mit einer Akzentverschiebung oder Verallgemeinerung im Sinn von Gemeinde/gemeindlich schlechthin. Der spezifische mittelalterliche Wortinhalt von »Einung« im städtischen Bürgerverbund mit persönlicher Freiheit und politischer Selbstbestimmung als Ziel und Inhalt klingt dabei nicht mehr oder kaum noch durch. Im Folgenden werde ich mich der Kommune des Mittelalters zuwenden, wie es mir nahegelegt worden ist, wohl nicht zuletzt, um diesen umfassenden, bis in die Gegenwart weisenden Sachverhalt inhaltlich vorzustellen oder wenigstens zu skizzieren, gerade auch in seinen Varianten und Veränderungen. Max Weber als der große Vermittler und Impulsgeber zwischen der Geschichtswissenschaft und Politologie, speziell in der Bewertung und Einordnung der Kommune des Mittelalters, soll dabei die besondere Aufmerksamkeit gelten. In seiner viel diskutierten Analyse der mittelalterlichen Stadt (in seinem Spätwerk »Wirtschaft und Gesellschaft«) heißt es bei ihm: »Die Städte sind nicht, wie man vielfach geglaubt hat, ›aus den Gilden entstanden‹, sondern – in aller Regel – umgekehrt die Gilden in den Städten […] Denn die Gilden waren auch nicht mit der conjuratio, der Stadteinung, identisch.«24 Max Weber hatte bei seiner Analyse dieses Prozesses der Kommunebildung das Beispiel Köln vor Augen gehabt. Anfangs sei dabei die sogenannte Kölner Richerzeche, also die Vereinigung bzw. Gilde der reichen und einflussreichen Führungspersönlichkeiten der Stadt seit 1149, durchaus impulsgebend gewesen, könne und dürfe deshalb aber nicht mit der Kommune gleichgesetzt oder verwechselt werden. In manchen der frühen – als Vorbilder herausragenden – Kommunen des 11./12. Jahrhunderts in Nordeuropa, an denen sich Max Weber als für die Fortentwicklung letztlich entscheidend orientiert hat, war es tatsächlich in der Entstehungsphase zu einer Führung durch eine gildemäßig organisierte Gruppe gekommen, die man als stadtadlig (jedoch nicht zum alten Adel gehörig ) charakterisieren kann.25 Zugleich war diese in der Regel erfahren in der Ausübung von Gerichtsbarkeit und Verwaltung sowie im Wirtschaftsmanagement, aber auch selbst in Finanz- und Handelsgeschäften tätig.26 Die Initiatorengruppe ist jedoch nicht isoliert zu sehen, 23 Vgl. Hardtwig 1990, Beyme 1978 und Schulze 1998. 24 Weber 1999: 136. 25 Schulz 1968b/2008 und Schulz 1991/2008. 26 Ebd.; ders. (1973/2008).
18
KOMMUNEN, GILDEN UND ZÜNFTE IM MITTELALTER
sondern nur über den Vorgang der gemeindlichen Einung und Gestaltung der Verfassung in der weiteren Entwicklung zu begreifen.27 Diese »optimi«, »meliores«, »sapientiores«, oder wie sie anfangs bewundernd genannt wurden, verloren bald ihre Geschlossenheit und bildeten dann rivalisierende Fraktionen, deren Kämpfe im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts in der Regel dazu führten, dass sie zwar nicht ihren gesellschaftlichen, wohl aber politischen Vorrang einbüßten und nur noch eine Sonderrolle in der neu und anders strukturierten Kommune bewahrten oder zugewiesen bekamen.28 Dafür seien nur kurz die Beispiele der »Psitticher« und »Sterner« in Basel, der »Müllenheim« und »Zorn« in Straßburg oder der »Greifen« und »Freunde« in Köln genannt, um diesen Wandel anzudeuten und gegebenenfalls darauf später zurückzukommen.29 Darüber hinaus, so betont es Max Weber nachdrücklich, ist die Rolle des stadtgesessenen Adels in Italien gegenüber demjenigen in Nordeuropa grundverschieden gewesen, was einen der wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der Fortentwicklung von Politik und Wirtschaft dieser Städte und ihrer Kommunalstruktur ausgemacht habe.30 Ich habe nun meinerseits bei der Erörterung der Entstehung des europäischen Bürgertums unter anderem am berühmten Beispiel von St. Omer in Flandern (damals sehr bekannt und weit ausstrahlend nach England, Flandern und Norddeutschland) sowohl Verbindung als auch Differenz von Gilde und Kommune untersucht,31 und zwar vor allem aufgrund der beiden zentralen Quellenzeugnisse, nämlich des Gildestatuts der Kaufleute von St. Omer von etwa 1100 und des zweifachen Stadtrechtsprivilegs für diese Kommune von 1127/28.32 Die Gilde, die übrigens nach Aussage ihrer Satzung durchaus nicht einmal alle Kaufleute am Ort umfasste, regelte vorrangig die rechtliche Absicherung und gegenseitige Unterstützung auf den Handelsfahrten sowie die verbindliche gemeinschaftsstiftende Funktion des großen Gildefestes. Dieses wurde in der Gildehalle auf dem Marktplatz über zwei Tage und Nächte hinweg gefeiert, übrigens auch religiös.33 Darüber hinaus seien, wie es später heißt, überschüssige Gelder aus der Gildekasse für das Gemeinwohl (communi utilitati) wie Straßen, Tore, Stadtmauer oder für die Armenfürsorge zu verwenden.34 Allerdings geht die anfangs auch erkennbare rechtliche Zuständigkeit (Marktkontrolle) der Gilde bald (1151) 27 Schulz 1968a. 28 Schulz 1985/2008. 29 Schulz 1991/2008. 30 Weber 1999: etwa 127–134 und öfter. 31 Schulz 1992/1995 Kap. IV/4 und IV/5: 119–131. 32 Espinas/Pirenne 1901 und Vercauteren 1938 Nr. 127: 293–299. 33 Schulz 1992/1995: 125. 34 Ebd.: 124.
19
KNUT SCHULZ
an die Kommune in Gestalt von Schöffenkolleg und Geschworene (iura eber ti) über, sodass die Gildehalle zum Rathaus wurde.35 Wie es Max W schon am Kölner Beispiel richtig erkannt hatte, konnte die Gilde auch hier zwar als die Vereinigung einflussreicher Honoratioren, wie er sie nannte, anfangs eine Initiativ- und Führungsrolle wahrnehmen, aber zur Stadtgemeinde und Kommune gehörten dort wie auch in St. Omer alle Bürger, die ihre persönliche Freiheit – im gemeinsamen Handeln der communitas – erst einmal erlangen mussten.36 Aber dies ist ein »weites Feld« und kann hier nur angedeutet werden. Die Kommunebewegung war – wie ich es einst formuliert habe und hier noch einmal betonen möchte – »ein Vorgang sui generis«; sie vermittelte »die Dimension des Politischen« der Gemeinde.37 Wenden wir uns nun in einem zweiten größeren Schritt erneut Max Weber zu. Dabei können uns allerdings nur zwei seiner Grundbeobachtungen näher interessieren, nämlich zum einen, und zwar abschließend nur kurz resümierend, die Besonderheit der okzidentalen Stadt des Hoch- und Spätmittelalters in ihrer weiteren Wirksamkeit, also in der Moderne, und zum anderen, gleich hier im Anschluss, die Formen legitimer Herrschaft. Max Weber unterschied zwischen »drei reinen Typen legitimer Herrschaft«,38 nämlich folgenden: 39 1. Solchen »rationalen Charakters: auf dem Glauben an die Legalität gesatzter [also rechtlich fixierter] Ordnungen und des Anweisungsrechts der durch sie zur Ausübung der Herrschaft Berufenen ruhen[d] (legale Herrschaft)40 – oder 2. traditionalen Charakters: – auf dem Alltagsglauben an die Heiligkeit von jeher geltender Traditionen und die Legitimität der durch sie zur Autorität Berufenen ruhen[d] (traditionale Herrschaft),41 – oder endlich 3. charismatischen Charakters: auf der außeralltäglichen Hingabe an die Heiligkeit oder die Heldenkraft oder die Vorbildlichkeit einer Person und der durch sie offenbarten oder geschaffenen Ordnungen (charismatische Herrschaft)«.42 – Stichwort: »Es steht geschrieben, ich aber sage Euch!«
35 Ebd.: 126. 36 Schulz 1971/2008 und Groten 1984. 37 Schulz 1992/1995: 128. 38 Weber 1922 und Weber 2005. 39 Weber 2013, Kap. III: Die Typen der Herrschaft. 1. Die Legitimitätsgeltung: 449–455. 40 Ebd. 2. Die legale Herrschaft mit bureaukratischem Verwaltungsstab: 455–468. 41 Ebd. 3. Traditionale Herrschaft: 468–490. 42 Ebd. 4. Charismatische Herrschaft: 490–497.
20
KOMMUNEN, GILDEN UND ZÜNFTE IM MITTELALTER
Was aber ist bei Max Weber »nichtlegitime Herrschaft«? Die Antwort lautet: Die in der okzidentalen Stadt des Hoch- und Spätmittelalters auf dem Weg der coniuratio oder Schwurverbrüderung durch die Kommune oder Stadtgemeinde errungene Herrschaft, die – so sollte und könnte man wohl ergänzen – auf einem usurpatorischen und emanzipatorischen Vorgang beruhte, letztlich die Vorstufe des modernen Staates darstellte.43 In einem am 25. Oktober 1917 in Wien gehaltenem, aber unveröffentlichten Vortrag, über den ein Bericht in der Neuen Freien Presse Wien vom 26. Oktober 1917 Auskunft gibt, findet sich unter anderem folgende Aussage: »Schließlich ging er zu der Darlegung über, wie die moderne Entwicklung der okzidentalen Staatswesen durch das allmähliche Entstehen eines vierten Legitimitätsgedankens charakterisiert war, derjenigen Herrschaft, welche wenigstens offiziell ihre eigene Legitimität aus dem Willen der Beherrschten ableitet. Sie ist in ihren Anfangsstadien noch weit entfernt von allen modernen demokratischen Gedanken. Ihr spezifischer Träger aber ist das soziologische Gebilde der okzidentalen Stadt, welche sich von allen stadtartigen Gebilden anderer Zeiten und Völker schon in der Art ihrer Entstehung und ihres soziologischen Sinnes im Altertume ebenso wie im [frühen] Mittelalter unterscheidet. Sie ruht in ihren höchst entwickelten Exemplaren ursprünglich darauf, daß ein Wehrverband der Stadtbürger als Schwurbrüderschaft sich zusammenschließt und durch Beamte sich selbst verwaltet«.44 Diese Gedanken Max Webers sind hinsichtlich der Besonderheit und Wirkungskraft der seit dem 12. Jahrhundert sich voll entwickelnden Stadt, besonders der Gewerbestadt Nordeuropas,45 so vertraut, dass man keinen Grund haben kann, an der Richtigkeit dieser Mitschrift zu zweifeln. Allerdings ist ihre Zuordnung zu der vierten Herrschaftsform und nicht ihrer Vorstufe als Abart der charismatischen Herrschaftsausübung mit einem genialen und/oder demagogischen Führer an ihrer Spitze überraschend, zumal es im letzten Satz der Mitschrift heißt: Diese Art von »Stadt und die durch sie zuerst entwickelte Art der Politik und Wirtschaftspolitik [bildet] die dritte unentbehrliche historische Komponente 43 Ders. (2005), Kap. III. Probleme der Staatssoziologie, Editorischer Bericht, 745–751. 44 Ebd., Text des Wiener Vortrags in der Neuen Freien Presse vom 25. Oktober 1917, 752–756, hier 755 f. 45 Weber 1999: 100: »Im auffallendsten Gegensatz namentlich zu den asiatischen Zuständen stand nun die Stadt des mittelalterlichen Okzidents, und zwar ganz speziell die Stadt des Gebiets nördlich der Alpen, da wo sie in idealtypischer Reinheit entwickelt war.« Weiterhin heißt es ebd. 289: »Die mittelalterliche Stadt war unter der Herrschaft der Zünfte ein ganz außerordentlich, viel stärker in der Richtung des Erwerbs durch rationale Wirtschaft orientiertes Gebilde als irgendeine Stadt des Altertums, solange die Epoche der unabhängigen Polis dauerte.«
21
KNUT SCHULZ
der modernen politischen Herrschaftsformen«.46 Die Sache ist, wie wir noch sehen werden, im Wesentlichen klar, nur die wechselweise Zuordnung zu der dritten oder angeblich vierten Stufe bleibt rätselhaft: Ist nun die Kommune als genossenschaftlich und kapitalistisch handelnde Bürgerstadt des späteren Mittelalters als Stufe 3b nur ein Ausdruck der charismatischen Herrschaftsform gewesen oder unter 4a als Vorstufe der neuen Kategorie moderner westeuropäischer Staatlichkeit mit den Merkmalen Demokratie und Kapitalismus zuzuordnen? Die letztgenannte Vorstellung, nämlich die der gänzlich neu strukturierten Stadt des 12. bis 15. Jahrhunderts als Vorstufe der Moderne – möglicherweise im Übergang von 3b zu 4a – steht bei Max Weber in vieler Hinsicht im Vordergrund, bei allen Abstrichen und Einschränkungen, die in dieser Hinsicht bei ihm zu finden sind, wie als Beispiel von Max Weber: Rudolf Brun von Zürich (1336), * 1300/1310–† 1360.47 Aber wie und mit welchem Ergebnis ist dieser als Umbruch zu bezeichnende Wandel konkret zustande gekommen und verlaufen? Zur Verdeutlichung möge im Folgenden das eine oder andere aussagekräftige Beispiel dienen, wofür ich auf mein Buch unter dem Titel »Denn sie lieben die Freiheit so sehr…« Kommunale Aufstände und Entstehung des europäischen Bürgertums im Hochmittelalter« verweisen kann.48 Dieser Untersuchung verdanke ich ja auch zum guten Teil die Einladung zu dieser Tagung. Zuerst eine kurze Erklärung zu dem als Buchtitel benutzten Zitat! Der Autor, Otto von Freising, der berühmte Chronist und Verfasser der »Gesta Friderici«, der »Taten Friedrich Barbarossas«, war staufischer Reichsbischof, Bruder König Konrads III. und Onkel des Kaisers Friedrich Barbarossa; er hatte also schon um die Mitte des 12. Jahrhunderts seine scharfsinnige Analyse und Bewertung des neuartigen Städtewesens und Bürgertums Oberitaliens vorgenommen. 49 Dabei stellte er fest, dass die herausragende Städtelandschaft der Lombardei bekanntlich nach den dort siedelnden Langobarden benannt sei, die aus »Skandinavien« und wohl von der Unterelbe ursprünglich stammend über Pannonien (Ungarn) nach Italien gelangt und dort sesshaft geworden seien. Wegen der ihnen eigenen genossenschaftlichen Stärke und durch ihre Vermischung mit der ansässigen römisch-italienischen Bevölkerung seien sie in der urbanen Kultur dort heimisch geworden. So hätten sie, wie wir schlussfolgern dürfen und sollen, germanische Kraft und römische Kultur in ihrer Lebensform miteinander verbunden, sodass sie die Freiheit so sehr lieben (denique libertatem tantopere affectant, ut potestatis insolentiam 46 Weber 2005: 756. 47 Largiadèr 1936. 48 Vgl. Schulz 1992/1995. 49 Schmale 1965.
22
KOMMUNEN, GILDEN UND ZÜNFTE IM MITTELALTER
fugiendo consulum potius quam imperantium regantur arbitrio)50, dass sie sich jedem Übergriff der Gewalt entziehen und lieber von (selbst gewählten und jährlich wechselnden) Konsuln als von Herrschern regieren lassen. Dabei beachten sie ihr Gleichheitsprinzip, indem sie die Konsuln aus den drei Ständen wählen, den Kapitanen (dem Stadtadel), den Valvassoren (ritterlichen Amtsträgern) und auch den normalen Bürgern, also den Handwerkern, die man im Übrigen dringend braucht, um das den Städten unterworfene Umland, den Contado, zu beherrschen. Hie rin sieht der kluge Verfasser eine weitere Besonderheit dieser spezifischen Genossenschaftsstruktur, dass, wie er schreibt, »junge Leute der unteren Stände und auch Handwerker, die irgendein verachtetes mechanisches Gewerbe betreiben, zum Rittergürtel und zu höheren Würden [zugelassen werden], während die übrigen Völker solche wie die Pest von den ehrenvolleren und freieren Beschäftigungen ausschließen«.51 Um sogleich fortzufahren: Ex quo factum est, ut ceteris orbis civitatibus divitiis et potentia premineant – »So kommt es, daß sie an Reichtum und Macht die übrigen Städte der Welt übertreffen«. Dabei verweigern sie jedoch ihren Herrschern den Gehorsam, woraus, wie Otto von Freising es sieht, beiden Seiten großer Schaden und Nachteil erwachse.52 In diesem Quellenzitat und ähnlichen Textpassagen Ottos von Freising sowie anderen Zeugnissen aus derselben Zeit ist vieles an Beobachtungen enthalten, was Max Weber auf analytischem Weg an Beurteilungskriterien ermittelt hat. Bei zahlreichen Autoren jener Epoche, die über Entwicklungen und Ereignisse dieser Art berichten, ist 1. – um damit zu beginnen – das Erstaunen über das Verlangen nach Freiheit, die Freiheitsliebe spürbar, wenn auch dieses Verhalten vielfach im kritischen oder gar ablehnenden Sinne bewertet wird.53 Über die möglichen Gründe für den starken Freiheitsdrang wird abschließend nochmals zu sprechen sein, denn dieser Impuls ist wohl gegenüber anderen Komponenten dominant, aber am schwersten erklärbar. 2. betont Otto von Freising, dass die in den Stadtgemeinden stark ausgeprägte ständische Abstufung zugunsten einer politischen Gleichstellung aufgegeben worden ist, indem auch einfache Handwerker als Konsuln und Amtsträger herangezogen oder sogar zu Rittern erhoben wurden, um somit die militärische Kraft zur Beherrschung des Contado dieser Stadtstaaten zu garantieren. 3. Am wichtigsten im Sinne von Max Weber ist aber wohl die Schlussfolgerung, die Otto von Freising – wenn auch bedauernd und zugleich bewundernd – zieht: »So kommt es, daß sie [= die lombardischen Kommunen] an Reichtum und Macht die übrigen Städte der Welt 50 Ebd.: 308. 51 Ebd.: 309. 52 Ebd.: 308/310 und 309/311. 53 Schulz 2005.
23
KNUT SCHULZ
übertreffen«.54 Dies sind – in anderer Akzentuierung und Begrifflichkeit – auch die Faktoren, die Max Weber für den Prozess der Kommunebildung und die okzidentale Stadt des späteren Mittelalters benennt, und zwar als Grundlage für die Entwicklung zum modernen Staatswesen und zur differenzierten, kapitalistischen Wirtschaftsform mit Marktorientierung und Konkurrenzkampf.55 Knapp zehn Jahre nach Abfassung der »Gesta Friderici« sollte sich zeigen, wie treffsicher Otto von Freising diese urbane Entwicklung in Oberitalien und ansatzweise auch in Deutschland eingeschätzt hatte. Denn 1166/67 formierte sich die Lega Lombarda, der große lombardische Städtebund, mit Mailand, Cremona und Venedig an der Spitze, um der Dominanz der traditionellen Herrschaftsträger, zumal des Kaisers aus dem Norden, aber auch der lokalen feudalen Gewalten, Paroli zu bieten und ihnen eine eigene Welt der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber- oder zumindest an die Seite zu stellen.56 Friedrich Barbarossa verfolgte mit neuer imperialer Energie das entgegengesetzte Ziel, sodass zwei kaum vermittelbare Prinzipien aufeinander prallten. Beide Seiten benötigten – so viel war von vornherein klar – alle militärischen Kräfte, die für sie erreichbar waren, und ebenso eine ideologische und mehr noch eine juristische Grundlage, die ihre jeweilige Position überzeugend, ja unangreifbar erscheinen lassen musste. Für den Kaiser wurde es das nun in neuer Form und vor allem mit geschulter Gelehrsamkeit dargebotene Kaiserrecht des Codex Justiniani, wie ihn die Rechtsgelehrten der bald berühmtesten Rechtsschule des Abendlandes in Bologna neu entdeckt hatten und nun darlegten. Der Ort, an dem dies 1158 vorgeführt wurde, war Roncaglia, zwischen Cremona und Piacenza in der Poebene gelegen, die Rechtsform, in der dies geschah, das sogenannte Regalienweistum, das die Grundlage aller Rechte aus der imperialen Hoheit herleitete, und zwar angefangen mit dem der Gesetzgebung, Militärhoheit, Gerichtsbarkeit, besonders auch den Finanzen, also von Steuern, Abgaben, Münze, Zoll etc.57 Insgesamt waren es genau die Befugnisse, über die die Städte zum Teil schon länger verfügten und womit und woraus sie ihre Auf- und Ausgaben bestritten, wofür sie aber vielfach keine nachweisbare Legitimation besaßen. In Roncaglia hatte der Kaiser 54 Schmale 1965: 309/311. 55 Abramowski 1966: 116: »Und weiterhin gehörte Webers Sympathie den Anfängen des Kapitalismus, freilich nicht des antiken Beute-, Sklaven- und Steuerpächterkapitalismus, sondern des auf dem Boden der mittelalterlichen Stadt vorbereiteten und von den westeuropäischen Industriestaaten zum System entwickelten rationalen, bürgerlich-friedlichen Gewerbekapitalismus.« 56 Giesebrecht 1888 und Schulz 1992/1995, Kap. VII: Der lombardische Städtebund von 1167–1183: Eine gesteigerte Form der Kommune?: 187–216. 57 Ebd.: 198 f.
24
KOMMUNEN, GILDEN UND ZÜNFTE IM MITTELALTER
gleichzeitig sein Heer versammelt, sozusagen als Treffpunkt des militärischen Aufgebots aus dem Norden und der Vasallen aus Italien, und damit ein eindrucksvolles Schauspiel der wiedergewonnenen staufischen Hoheit über Nord- und Mittelitalien inszeniert. So schien die Voraussetzung dafür geschaffen, um die kaiserliche Hoheit wieder herzustellen und die kommunale Entwicklung in ihre Schranken zu verweisen. Aber die Dinge entwickelten sich beim nächsten Italienzug anders als geplant.58 Unmittelbar nach der Kaiserkrönung in Rom wurde 1167 der Großteil des Reichsheeres durch eine Malariaseuche dahingerafft, was die lombardischen Städte als Fingerzeig Gottes deuteten und zum Widerstand und zur Errichtung des großen Städtebundes der Lega Lombarda im Jahr 1168 schritten, während der Kaiser Oberitalien schleunigst verlassen musste. An die Spitze der vereinigten oberitalienischen Städte traten nun ein Rektorenkolleg und ein Parlament mit der Machtvollkommenheit, Rechtsfragen zu entscheiden und neu zu gestalten, die wesentlichen militärischen und finanziellen Beschlüsse zu fassen, Bündnisse und Verträge, unter anderem mit dem Papsttum, zu schließen und die »Freiheit« entschlossen, das heißt: mit allen militärischen Mitteln zu verteidigen.59 Dabei berief man sich außerdem auf das Gewohnheitsrecht, also die Tradition, wie sie seit langem praktiziert und auch vom Kaiser stillschweigend anerkannt worden sei. Die nach sechsjähriger »Verschnaufpause« besonders in den Jahren 1174, 1175, 1176 und 1177 folgenden erbitterten Kämpfe und Verhandlungen müssen hier übergangen werden, allerdings mit einer Ausnahme, der Erwähnung der kaiserlichen Niederlage von Legnano 1175, als die vereinten Militärverbände der Lega Lombarda an diesem Ort letztlich einen glorreichen Sieg errangen.60 Drei Bemerkungen sind dazu anzufügen: 1. Den Sieg verdankten die Lombarden, wie allseits betont wird, den vier Carrocci, also den von den Ochsen gezogenen Fahnenwagen, die nicht von den Rittern zu Pferd, sondern von den einfachen Fußkämpfern, dem popolo minuto, meist Handwerkern, sehr tapfer verteidigt wurden.61 2. Die Nachricht vom Sieg wurde von den Lombarden und speziell von Mailand mit dem damals neuartigen Hinweis auf »Italia« und »Patria« mündlich wie schriftlich jubelnd verkündet, und zwar zur Sicherung von »Concordia«, »Pax« und »Justitia«.62 Besonders von der Eintracht war – von kurzfristigen Aufwallungen abgesehen – in den folgenden 600– 700 Jahren allerdings wenig zu hören und zu sehen, vielmehr blieb die Rivalität und oftmals die erbitterte Feindschaft zwischen den bisherigen 58 Ebd.: 201/203. 59 Ebd. Kap. VII/4: Selbstverständnis der Lega: Libertas und Patria: 211–216. 60 Popolo e stato 1970. 61 Fonseca 1971. 62 Schulz 1992/1995, wie Anm. 59.
25
KNUT SCHULZ
Bundesgenossen bestimmend. 3. Dennoch war der Sieg von Legnano bis in die Gegenwart das erstrebenswerte Symbol für die ersehnte Einigkeit Italiens und diente seit dem Risorgimento bei der späten Staatsbildung als Vorbild.63 Kaiser Friedrich Barbarossa und sein Enkel Kaiser Friedrich II. bissen sich trotz Teilerfolgen im Kampf gegen die in sich zerstrittene Lega Lombarda letztlich die Zähne aus.64 Dies gibt zu der gewagten Bemerkung Anlass, dass die Städteregion Oberitaliens auch heute noch alle anderen Städte (sagen wir: Italiens) »überragt«, wie es sinngemäß bei Otto von Freising heißt. Ähnliches gilt übrigens nicht nur für Ober italien, sondern für fast alle der damals hervortretenden bedeutenden Städtelandschaften, die immer noch die Nase vorn haben.65 Richtet man den Blick noch kurz in den für Weber wichtigeren nord europäischen Raum, in das Deutsche Reich, und zwar auf den sogenannten Rheinischen Städtebund von 1254 bis 1256/57, dann zeigt sich hier ein im großen Maßstab souverän handelndes Bürgertum, und zwar sowohl in der räumlichen Ausdehnung als auch gesellschaftlich, wirtschaftlich und militärisch sowie sogar reichspolitisch mit einem eigenen Konzept.66 Die Initiative ging vom Rhein-Main-Dreieck, das heißt von Mainz, Worms, Speyer und Frankfurt aus, erfasste sogleich auch den Oberrhein bis zum Bodensee – Straßburg, Basel, Zürich – und rheinabwärts die Städte bis Köln mit Ausstrahlungen in die Niederlande, sodann die westfälische Städteregion bis in den zentralen Hansebereich, Niedersachsen, Thüringen, Hessen und Franken sowie Würzburg, Nürnberg und Regensburg, zum Teil auch Reichsfürsten und große Adlige miteinbeziehend.67 Das primäre Ziel war es, das politische Chaos nach dem Aussterben der Staufer zu bändigen, den Frieden – notfalls auch mit militärischen Mitteln – zu erzwingen, eine domus pacis aus Spenden der Bürger zu errichten, verbindliche reichsrechtliche Beschlüsse zu fassen und durchzusetzen, Wirtschaft, Finanzen, Handel neu zu regeln und zu sichern, Bauern, Pfahlbürger, Minderheiten und Arme zu schützen und letztlich das Reich mit klaren Entscheidungen wieder zu stabilisieren.68 Gewiss, dieses großangelegte Handlungsprogramm ist nicht umgesetzt worden, aber das Bürgertum war als selbstständiger neuer Faktor im Konzert der Kräfte in Erscheinung getreten, auch wenn Dauerhaftigkeit in dieser Form nicht 63 Vignati 1886/1969. 64 Maurer 1987 (vgl. bes. Voltmer, Ernst, ebd. 97–116). 65 Man denke etwa an die Städte am Rhein von der Schweiz bis zur Mündung, an Flandern/Niederlande, an Süddeutschland und im Norden an den Hanseraum. 66 »Propter culturam pacis« (1986), ebd. Voltmer, Ernst, 117–143. – Freitag, Werner/Johanek, Peter (2009), ebd. Schulz, Knut, 17–39. 67 Ebd.: 15, Karte der beteiligten Städte. 68 Weinrich 1983 Nr. 5: 12–27: Akten des Rheinischen Bundes.
26
KOMMUNEN, GILDEN UND ZÜNFTE IM MITTELALTER
zu erwarten war, einzelne Städtegruppen aber weiterhin miteinander kooperierten und agierten.69 Max Weber sah wohl neben der problematischen Rolle des Adels und den ewigen Sozialkonflikten und Kämpfen in den Kommunen Italiens darin einen wesentlichen Grund für seine vorrangige Orientierung an nordeuropäischen und besonders den klassischen deutschen Beispielen, wie Straßburg, Freiburg im Breisgau, Frankfurt am Main und Köln, die seine berühmten Zeitgenossen – etwa Gustav Schmoller,70 Karl Bücher,71 Friedrich Keutgen72 und Friedrich Lau73 – damals im Auge gehabt hatten. Hinzu kam bei ihm ein weiterer Grund, wie ihn Günter Abramoski schon 1966 knapp und klar formuliert hatte.74 Was man als Mittelalterhistoriker in der Argumentation von Max Weber jedoch vermisst, ist die Frage danach, was die engagierten Wortführer der Kommunebewegung in ihrer Zeit zur Legitimitätsfrage gedacht und gesagt haben; denn dieses Moment war natürlich schon damals ein zentraler Punkt der Rechtfertigung, besonders gegenüber der stark daran Anteil nehmenden Öffentlichkeit. Dieses essential gilt es deshalb nochmals aufzugreifen, wie es in den zahlreichen darüber verfassten Quellenzeugnissen geschieht.75 Schon die Art der Polemik und der Kämpfe bei dem oft heftigen Streit um die Kommune mit vielen Toten auf beiden Seiten erscheint vielfach rechtfertigungsbedürftig. Im mittelalterlichen Normensystem und Sprachgebrauch sind aus dem jeweiligen aktuellen Geschehen heraus folgende Kategorien der Legitimität den Weberschen hinzuzufügen:76 1. Berufung auf Göttliches Recht und Kritik am Kirchenrecht, 2. Eingrenzung von Kaiser- und Fürstenrecht, 3. Kampf gegen die Tyrannis und Inanspruchnahme des Widerstandrechts und 4. Durchsetzung des Wahlrechts der Bürger bzw. seiner Repräsentanten. 1. Vor allem anderen steht selbstredend das Göttliche Recht mit dem jedermann vertrauten Bibelwort der Schöpfungsgeschichte: »Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn«, also ebenbildlich geschaffen zu Freiheit und Selbstbestimmung, ohne 69 Ruser 1979. 70 Schmoller 1922 (Aufsatzsammlung). 71 Bücher 1886. 72 Keutgen 1903. 73 Lau 1898. 74 Vgl. Abramowski 1966, wie Anm. 55. 75 Vgl. Schulz 1992/1995: 11–17. 76 Ebd. Schlußbetrachtung und Ausblick: 275–278.
27
KNUT SCHULZ
Zwang und Knechtschaft.77 In diesem Zusammenhang ist – einmal etwas abweichend – auf Eike von Repgow, den Verfasser des Sachsenspiegels von etwa 1230 zu verweisen, der anknüpfend an das Zitat aus der Schöpfungsgeschichte die verbreitete Unfreiheit als eine unerhörte Verletzung des göttlichen Willens erbittert kritisierte.78 Das mit dem Sachsenspiegel eng verbundene Magdeburger Recht hat als das am weitesten verbreitete mittelalterliche Stadtrecht diesen Vorwurf noch bekannter und populärer gemacht, als er ohnehin schon vertraut war.79 Konkret richtete sich die Kritik bei den zahlreichen kommunalen Erhebungen gegen manche Kirchenfürsten und deren Amtsträger, gegen Unterdrückung, Knechtsdienste, Abgaben, die Einforderung des Kopfzinses, gegen eherechtliche und erbrechtliche Leistungen, die in die Wirtschafts- und Lebensform der neuen Urbanität nicht mehr passten.80 Verschiedene Beispiele für die brutale Ermordung von Erzbischöfen bei solchen Ereignissen sind wohlbekannt oder ließen sich anführen, so etwa 1111 die Erhebung von Laon und 1159 diejenige in Mainz.81 2. Auch die Herrschaftsrechte von Kaisern, Königen und weltlichen Fürsten wurden bei solchen Auseinandersetzungen oftmals angezweifelt oder zurückgewiesen bzw. als nur übergeordnete, vermittelnde Zuständigkeit akzeptiert. Die Herrschaftsausübung nahmen hingegen mehr und mehr die Kommunen selbst in die Hand. Sie beriefen sich dabei teils auf ältere Privilegien, teils auf das Gewohnheits- und Satzungsrecht eigener Kompetenz, während etwa die lombardischen Städte dem Herrscher nur drei genauer bemessene Rechte zuerkannten, nämlich die einmalige Finanzleistung des fodrum, die oberste Gerichtsbarkeit in besonders schweren Konflikten und gelegentliche militärische Dienste von Vasallen.82 Die Kommune von Rom ging deutlich noch einen Schritt weiter und stellte provokant die rhetorische Frage: »Von wem denn sonst als vom ›Populus Romanus‹ hat der Kaiser die Krone und die Herrschaftsgewalt«? und verlangte für die Unterstützung Geldzahlungen, allerdings ohne Erfolg.83 3. Die Berufung auf das Widerstandsrecht gegen herrschaftliche Tyrannis und Vertragsbruch war ebenfalls eine mehrfach benutzte Grundlage der eigenen Legitimierung. Dieses Prinzip fand in die Magna Charta von London von 1215/1216 Eingang und behauptete dort einen 77 Bibel 1985 Genesis 27. 78 Eckhardt 1973 Landrecht III 42 § 6, S. 228: »Na rechter warheit so hevet egenscap [= »Eigenschaft«: Knechtschadt/Unfreiheit] begin van dwange [= Zwang] unde van venknisse unde van unrechter gewalt, de men van aldere in unrechte gewonheit getogen hevet unde nu vor recht hebben wel«. 79 Vgl. neuerdings Lück 2017: 90 f. 80 Schulz 1982/2008. 81 Ebd.: 63/65 und 178/180. 82 Vgl. Brühl 1989. 83 Schulz 1992/1995: 152–159, bes. 155.
28
KOMMUNEN, GILDEN UND ZÜNFTE IM MITTELALTER
wichtigen Platz.84 Schon 90 Jahre früher ist dieser Gedanke bei der Erhebung der Städte Flanderns 1126/1127 kraftvoll zum Einsatz gebracht worden, und zwar einerseits gegenüber dem neuen Grafen als Landesherrn, den die vereinigten Städte wegen Vertragsbruchs und der Unfähigkeit, die Interessen des Landes zu vertreten, abgesetzt und gegen einen neu gewählten ausgetauscht hatten.85 Andererseits hatten sie dem König von Frankreich die Hoheitsrechte über Flandern verweigert mit dem Argument, dass ihm als Oberlehnsherrn nur militärische Leistungen seiner Vasallen zuständen, aber keine Herrschaft über Flandern.86 4. Der im Hochmittelalter allgemeine Verbreitung findende Wahlgedanke, etwa bei der Papstwahl oder zum Teil bei der Königswahl, wurde in den bürgerlichen Kommunen geradezu die Legitimationsgrundlage schlechthin, wenn auch des Öfteren in reduzierter oder entstellter Form (etwa in Gestalt von Kooptationen etc.), aber immerhin mit gewähltem Bürgermeister/Schultheißen und Ratsherren als Repräsentanten an der Spitze.87 Bei einem Herrscherwechsel war der Stadtrat zwar verpflichtet, zusammen mit der Bürgergemeinde dem neuen Fürsten einen Treueid zu leisten, hatte umgekehrt aber auch Anspruch auf die Bestätigung seiner Privilegien und Herrschaftsrechte durch diesen.88 Alle diese Vorstellungen und Rechtsformen, dies sei einschränkend betont, fanden zwar durchaus nicht durchgängig Anwendung, aber wie es die zuvor angeführten Städtenamen und Städtelandschaften erkennen lassen, gingen sie gerade in den bedeutenden Kommunen nie ganz verloren, sondern blieben ein Grundprinzip, auf das man sich immer wieder berief, besonders bei größeren Konflikten innerhalb der Bürgergemeinde und mehr noch bei den entscheidenden Auseinandersetzungen mit Fürsten und Adel.89 Im Übrigen war das bonum commune, das Gemeinwohl, wohl fast jedermann so vertraut, dass man es kaum noch zu übersetzen brauchte, sondern sich beiderseits gern darauf berief. Gegenüber dem häufiger bei heutigen Autoren anzutreffenden Vorwurf mangelhafter oder fehlender »Demokratie« in spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Städten führt der von Klaus Schreiner und Ulrich Meier 1994 herausgegebene und auch mitverfasste Band über »Stadtregiment und Bürgerfreiheit …« überzeugend vor Augen, dass eine »konsensgestützte Herrschaft« mit der Garantie vom »vivere civile«, also dem Schutz vor Unterdrückung und der Sicherung freiheitlicher Grundprinzipien, von den nicht direkt beteiligten Bürgern oder der nur gelegentlich 84 Ebd.: 239–245. 85 Sproemberg 1939: 31–88. 86 Schulz 1992/1995 Kap. IV: 115–119. 87 Ebel 1958. 88 Pitz 1990. 89 Schreiner/Meier 1994, bes. Einleitung: 11–34.
29
KNUT SCHULZ
herangezogenen Bürgergemeinde als eine durchaus akzeptierte Herrschaftsform gesehen wurde.90 Wie ist nach alledem nun im dritten und abschließenden Teil – ganz kurz – der Bezug zur Gegenwart herzustellen? Nicht unbedingt zu der heutigen, unserer Gegenwart, sondern derjenigen von Max Weber im Kaiserreich, besonders um 1900 und darüber hinaus am Ende und kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Zur Bewältigung dieser Aufgabe scheinen mir zwei – wenigstens skizzenhafte – Klarstellungen erforderlich zu sein. Einerseits nämlich eine Erklärung dafür, wie nach Webers Vorstellung sich die hoch‑/spätmittelalterlichen Vorgaben auf die Entwicklungen und Strukturen der folgenden Jahrhunderte, also des frühmodernen Staates bis zur Französischen Revolution und mehr noch der Umwälzungen des 19. Jahrhunderts ausgewirkt haben. Dazu sei hier nach der oben vorgenommenen Weberschen Einordnung der mittelalterlichen Stadt nur eine kurze ergänzende Bemerkung angefügt: Die Entwicklung des mittelalterlichen Städtewesens und der Stadtstaaten war räumlich, politisch und wirtschaftlich um 1500 an ihre Grenzen gelangt.91 Der frühmoderne Fürstenstaat strebte demgegenüber nach territorialer und auch konfessioneller Geschlossenheit, errichtete ein zentrales Rechts- und Verwaltungssystem (Bürokratie), schuf ein staatlich organisiertes Heerwesen und begann in die Handels- und Wirtschaftsabläufe dirigistisch einzugreifen und zum Teil an der überseeischen Expansion zu partizipieren.92 Der große Umbruch, der sich daran anschloss, erschöpft sich zwar nicht in den Stichworten Industrialisierung und Nationalstaatlichkeit, muss aber hier als Andeutung genügen.93 Wichtiger erscheint mir in unserem Kontext der zweite Punkt, nämlich die Frage nach den persönlichen politischen Vorstellungen Max Webers, gerade auch in ihren zeitbedingten Veränderungen, sowie seinen Zielen und Konzeptionen für das Deutsche Reich. Dazu abschließend in aller Kürze oder Verkürzung: Seit der grundlegenden Untersuchung von Wolfgang J. Mommsen zu »Max Weber und die deutsche Politik 1890–1920« von 1959 und 197494 wissen wir über die Grundlagen und Veränderungen der durchaus engagierten Position Webers und seiner zahlreichen Stellungnahmen zu diesem Gegenstand detailliert Bescheid. Max Weber war Zeit seines Lebens ein nationalstaatlich denkender Mann, ein Patriot, der das Deutsche Reich in der Rolle einer aufstrebenden Großmacht sah, deren Aufgabe es sei, durchaus in weltpolitische Dimensionen auszugrei90 Ebd. 1994. 91 Schulz 2010 Kap. VI: Ausblick auf die Entwicklung bis zum Ende des 18. Jahrhunderts: 261–269. 92 Ebd. 93 Schneider 1988. 94 Mommsen 1959/1974.
30
KOMMUNEN, GILDEN UND ZÜNFTE IM MITTELALTER
fen, als »nationaler Machtstaat« aufzutreten,95 wie es in seiner Freiburger Antrittsrede von 1895 heißt, also wohl nur im Sinn expansiver wirtschaftlicher und politischer Interessenwahrnehmung und Einflussnahme. Von daher ist es auch zu verstehen, dass Weber sich im Sinn seiner Kategorie einer charismatischen Legitimität die Dominanz einer zielgerichtete Entschlossenheit ausstrahlenden Persönlichkeit an der Spitze des Staates, in »selbstverantwortlicher Führerschaft«, vorstellen und wünschen konnte.96 Wie sein Vater, der Stadtrat in Berlin war, zeitweise Mitglied im Reichstag und Preußischen Abgeordnetenhaus gewesen ist, gehörte Max Weber im Kaiserreich der Nationalliberalen Partei an und trat mit vielen politischen Stellungnahmen grundsätzlicher Art hervor. In der Umbruchphase des Krieges, wie sie sich Ende 1917 abzuzeichnen begann, beteiligte er sich lebhaft an der Diskussion um die Verfassung und Gestalt des auf neuer Grundlage zu errichtenden Nationalstaates und wurde nun Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei an der Seite Friedrich Naumanns. Nun sind diese politischen Äußerungen von Max Weber gewiss nicht ohne Auswirkungen auf seine historischen Analysen und Schlussfolgerungen in seinen Schriften geblieben. Der mündige Staatsbürger stand nach diesem politischen Konzept vor der Aufgabe, sich für den neuen Nationalstaat mit aller Kraft zu engagieren. Aber diese Fragen sollten und können besser Zeithistoriker und Politologen beantworten. Persönlich würde ich gern, wenn Sie es gestatten, abschließend nochmals auf mein Buch von 1992 über die »Entstehung des europäischen Bürgertums« zurückgreifen, wo ich unter Verweis auf Max Weber in der kommunalen Bewegung des Mittelalters einen für die Entwicklung Europas entscheidenden Umbruch gesehen habe, »ohne den unsere heutige Gesellschaftsform, Kultur und Denkweise nicht begreifbar wären.« Daraus resultieren »lang wirksame Verhaltensmuster wie bürgerliches Selbstverständnis und Kulturbewusstsein, Eigenverantwortlichkeit und Eigeninitiative, politisches Denken und Handeln in Gruppen und als Gemeinschaft.«97 Man kann nur hoffen, dass solche Komponenten stark und wirksam genug sind, um damit politisch integrativ auf den europäischen Gedanken und die fortbestehende Einheit hin zu wirken.
Literatur Abramowski, Günter (1966): Das Geschichtsbild Max Webers. Universalgeschichte am Leitfaden des okzidentalen Rationalisierungsprozesses. Stuttgart: Ernst Klett. Beyme, Klaus von (1978): »Partei, Faktion«, in: Reinhart Koselleck/Otto 95 Mommsen 1972. 96 Ebd.: 85. 97 Schulz 1992/1995: 4/5.
31
KNUT SCHULZ
Brunner/Werner Conze (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 4, Stuttgart: Klett-Cotta, S. 677–733. Bibel (1985): Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers. Mit Apokryphen. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Boldt, Hans (1982): »Otto von Gierke«, in: Hans-Ulrich Wehler (Hg.): Deutsche Historiker VIII. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Brühl, Carlrichard (1989): »Fodrum«, in: Lexikon des Mittelalters IV. München/Zürich: Artemis, Sp. 601/602. Bücher, Karl (1886): Die Bevölkerung von Frankfurt am Main im 14. und 15. Jahrhundert (= Sozialstatistische Studien, 1). Tübingen: H. Laupp. Dilcher, Gerhard (2012): »Gierke, Otto von (1841–1921)«, in: Albrecht Cordes/Hans-Peter Haferkamp/Bernd Kannowski/Heiner Lück/Heinrich de Wall/Dieter Werkmüller/Ruth Schmidt-Wiegand (Hg.): Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (zukünftig: HRG), 2. Aufl., Bd. II, Berlin: Erich Schmidt Verlag, Sp. 375–379. Ebel, Wilhelm (1958): Der Bürgereid als Geltungsgrund und Gestaltungsprinzip des deutschen mittelalterlichen Stadtrechts. Weimar: Böhlau. Eckhardt, Karl August (1973): Sachsenspiegel Landrecht. Hrsg. von Karl August Eckhardt (= Monumenta Germaniae Historica. Fontes iuris germanici antiqui. Nova series. Tomi I pars I). 3. durchgesehene Aufl. Göttingen/ Berlin/Frankfurt: Musterschmidt 1973. Eichhorn, Karl-Friedrich (1843): Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte 1. 5., verbesserte Ausgabe, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Espinas, Georges/Henri Pirenne (Hg.) (1901): Les coutumes de la gilde marchande de Saint-Omer, in: Le Moyen Age, 2. Serie, 5 (1901), Paris: E. Bouillon, S. 187–196. Fonseca, Cosimo Damiano (Hg.) (1971): I problemi della civiltà comunale. Atti del Congresso storico internationale per lʼVIIIo centenario della prima Lega Lombarda (Bergamo, 4–8 settembre 1967), Bergamo. Fouquet, Gerhard (2012): »Gilde«, in: HRG, 2. Aufl., Bd. II, Sp. 383–386. Freitag, Werner/Johanek, Peter (Hg.) (2009): Bünde – Städte – Gemeinden. Bilanz und Perspektiven der vergleichenden Landes- und Stadtgeschichte (= Städteforschung, A/77), Köln/Weimar/Wien: Böhlau. Gierke, Otto von (1863–1913): Das deutsche Genossenschaftsrecht. 4 Bde., Berlin: Weidmannsche Buchhandlung. Giesebrecht, Wilhelm (1888): Geschichte der deutschen Kaiserzeit. Bd. V,2: Friedrichs I. Kämpfe gegen Alexander III., den Lombardenbund und Heinrich den Löwen, Leipzig: Duncker & Humblot. Groten, Manfred (1984): »Die Kölner Richerzeche im 12. Jahrhundert. Mit einer Bürgermeisterliste«, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 48 (1984), S. 34–85. Hardtwig, Wolfgang (1990): »Verein«, in: Reinhart Koselleck/Otto Brunner/ Werner Conz (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 6, Stuttgart: Klett-Cotta, S. 789–829. 32
KOMMUNEN, GILDEN UND ZÜNFTE IM MITTELALTER
Isenmann, Eberhard (2012): Die deutsche Stadt im Mittelalter 1150–1550. Stadtgestalt, Recht, Verfassung, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft, Wien/Köln/Weimar: Böhlau. Keutgen, Friedrich (1903): Ämter und Zünfte. Zur Entstehung des Zunftwesens, Jena: Gustav Fischer. Kroeschell, Karl (1971): »Einung«, in: HRG, 1. Aufl., Bd. I, Sp. 910–912. Largiadèr, Anton (1936): Bürgermeister Rudolf Brun und die Zürcher Zunft revolution, Zürich: Gebr. Leemann & Co. Lau, Friedrich (1898): Entwicklung der kommunalen Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln bis zum Jahr 1396, Bonn: H. Behrendt. Lück, Heiner (2017): Der Sachsenspiegel. Das berühmteste Rechtsbuch des Mittelalters, Darmstadt: Lambert Scheider. Maurer, Helmut (1987): Kommunale Bündnisse Oberitaliens und Oberdeutschlands im Vergleich. Hrsg. von Helmut Maurer (= Vorträge und Forschungen 33), Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag. Mommsen, Wolfgang J. (1959/1974): Max Weber und die deutsche Politik 1890–1920. Tübingen 1959. 2., überarb. und erw. Aufl., Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). Mommsen, Wolfgang J. (1972): »Max Weber«, in: Hans-Ulrich Wehler (Hg.): Deutsche Historiker III. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 65–90. Oexle, Otto Gerhard (1982): »Die mittelalterliche Zunft als Forschungsproblem. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte der Moderne«, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 118 (1982), S. 1–44. Oexle, Otto Gerhard (1996): »Gilde und Kommune. Über die Entstehung von »Einung« und »Gemeinde« als Grundformen des Zusammenlebens in Europa«, in: Theorien kommunaler Ordnung in Europa. Hrsg. von Peter Blickle (= Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 36), München: R. Oldenbourg Verlag, S. 75–97. Pitz, Ernst (1990): »Untertanenverband, Bürgerrecht und Staatsbürger in Mittelalter und Neuzeit«, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 126 (1990), S. 263–282 Planitz, Hans (1940): »Kaufmannsgilde und städtische Eidgenossenschaft in niederfränkischen Städten im 11. und 12. Jahrhundert«, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanische Abteilung 60 (1940), S. 1–116. Planitz, Hans (1954): Die deutsche Stadt im Mittelalter von der Römerzeit bis zu den Zunftkämpfen. Graz/Köln: Böhlau. Popolo e stato (1970): Popolo e stato in Italia nell’età di Federico Barbarossa. Alessandria e la Lega Lombarda. Relazioni e comunicazioni al XXXIIIo congresso storico subalpino per la celebrazione dell’VIIIo centenario della fondazione di Alessandria. Alessandria 6-7-8-9 ottobre 1968. Turin. »Propter culturam pacis« (1986): »Propter culturam pacis«. Der Rheinische Städtebund von 1254/56. Katalog zur Landesausstellung in Worms, 24. Mai – 27. Juni 1986. Koblenz 1986. Ruser, Konrad (Hg.) (1979): Die Urkunden und Akten der oberdeutschen 33
KNUT SCHULZ
Städtebünde vom 13. Jahrhundert bis 1549. Bd. I: Vom 13. Jahrhundert bis 1347, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Schmale, Franz-Josef (1965): Otto von Freising und Rahewin: Gesta Frederici seu rectius Cronica. Die Taten Friedrichs oder richtiger Cronica. Übersetzt von Adolf Schmidt (†), hrsg. von Franz-Josef Schmale (= Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, 17), Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Schmoller, Gustav (1922): Deutsches Städtewesen in älterer Zeit, Bonn/Leipzig: Kurt Schroeder. Schneider, Hans-Peter (1988): »Der Bürger zwischen Stadt und Staat im 19. Jahrhundert«, in: Res publica. Bürgerschaft in Stadt und Staat, Berlin: Duncker & Humblot, S. 143–160/178. Schreiner, Klaus/Ulrich Meier (1994): Stadtregiment und Bürgerfreiheit. Handlungsspielräume in deutschen und italienischen Städten des Späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit (= Bürgertum. Beiträge zur europäischen Gesellschaftsgeschichte, 7), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Schulz, Knut (1968a): Ministerialität und Bürgertum in Trier. Untersuchungen zur rechtlichen und sozialen Gliederung der Trierer Bürgerschaft vom ausgehenden 11. bis zum Ende des 14. Jahrhunderts (= Rheinisches Archiv, 66). Bonn: Ludwig Röhrscheid. Schulz, Knut (1968b/2008): »Die Ministerialität als Problem der Stadtgeschichte. Einige allgemeine Bemerkungen, erläutert am Beispiel der Stadt Worms«, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 32 (1968), S. 184–219; wieder in: ders. (2008), S. 131–170. Schulz, Knut (1971/2008): »Richerzeche, Meliorat und Ministerialität in Köln«, in: Hugo Stehkämper (Hg.): Köln, das Reich und Europa. Abhandlungen über weiträumige Verflechtungen der Stadt Köln in Politik, Recht und Wirtschaft im Mittelalter (= Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln, 60), Köln: Paul Neubner, S. 149–172; wieder in: Schulz, Knut (2008), S. 199–220. Schulz, Knut (1973/2008): »Die Ministerialität in rheinischen Bischofsstädten«, in: Erich Maschke/Jürgen Sydow (Hg.): Stadt und Ministerialität. Protokoll der IX. Arbeitstagung des Arbeitskreises für südwestdeutsche Stadtgeschichtsforschung, Freiburg i.Br. 13.–15. November 1970 (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, B/76), Stuttgart: W. Kohlhammer, S. 16–42; wieder in: Schulz, Knut (2008), S. 171–198. Schulz, Knut (1982/2008): »Zensualität und Stadtentwicklung im 11./12. Jahrhundert«, in: Bernhard Diestelkamp (Hg.): Beiträge zum hochmittelalterlichen Städtewesen (= Städteforschung, A/11), Köln/Wien: Böhlau, S. 73–93; wieder in: Schulz, Knut (2008), S. 106–130. Schulz, Knut (1985/2008): »Patriziergesellschaften und Zünfte in den mittelund oberrheinischen Bischofsstädten«, in: Berent Schwineköper (Hg.): Gilden und Zünfte. Kaufmännische und gewerbliche Genossenschaften im frühen und hohen Mittelalter (= Vorträge und Forschungen, 29), Sigmaringen: Jan Thorbecke, S. 311–335; wieder in: Schulz, Knut (2008), S. 221–248. 34
KOMMUNEN, GILDEN UND ZÜNFTE IM MITTELALTER
Schulz, Knut (1991/2008): »Stadtadel und Bürgertum vornehmlich in oberdeutschen Städten im 15. Jahrhundert«, in: Reinhard Elze/Gina Fasoli (Hg.): Stadtadel und Bürgertum in den italienischen und deutschen Städten des Spätmittelalters (= Schriften des Italienisch-Deutschen Instituts in Trient, 2). Berlin: Duncker & Humblot, S. 161–181; wieder in: Schulz, Knut (2008), S. 249–269. Schulz, Knut (1992/1995): »Denn sie lieben die Freiheit so sehr …«. Kommunale Aufstände und Entstehung des europäischen Bürgertums im Hochmittelalter, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2. verbesserte Auflage Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Schulz, Knut (2005): »Die Reaktion auf die frühe kommunale Bewegung vom Ende des 11. bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts«, in: Hans-Joachim Schmidt (Hg.): Tradition, Innovation, Invention. Fortschrittsverweigerung und Fortschrittsbewusstsein im Mittelalter (= Scrinium Friburgense, 18). Berlin/New York: de Gruyter, S. 335–360. Schulz, Knut (2008): Die Freiheit des Bürgers. Städtische Gesellschaft im Hoch- und Spätmittelalter. Hrsg. von Matthias Krüger. Darmstadt: wbg Academic. Schulz, Knut (2010): Handwerk, Zünfte und Gewerbe. Mittelalter und Renaissance. Darmstadt: wbg Academic. Schulze, Reiner (1998): »Verbände«, in: HRG, 1. Aufl., Bd. V, Sp. 662–666. Söllner, A. (1990): »Römisches Recht in Deutschland«, in: HRG, 1. Aufl., Bd. IV, Sp. 1126–1132. Sproemberg, Heinrich (1939): »Erwachen des Staatsgefühls in den Niederlanden. Galbert von Brügge«, in: L’organisation corporative du Moyen Age à la fin de l’Ancien Régime, Bd. 2, Löwen: Bureaux du Recueil, S. 31–88. Stradal, H. (1971): Artikel »Gilde«, in: HRG, 1. Aufl., Bd. I, Sp. 1687–1692. Vercauteren, Fernand (1938): Actes des comtes de Flandre, 1071–1128. Brüssel: Palais des académies. Vignati, Cesare (1886/1969): Storia diplomatica della Lega Lombarda. Mailand 1886, ND Turin 1969. Weber, Max (1922): »Die drei Typen der legitimen Herrschaft. Eine soziologische Studie«, in: Preußische Jahrbücher 187,1 (1922), S. 1–12. Weber, Max (1999): Gesamtausgabe. Abtl. I: Schriften und Reden. Bd. 22: Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte. Nachlaß. Teilbd. 5: Die Stadt. Hrsg. von Wilfried Nippel, Tübingen: Mohr-Siebeck. Weber, Max (2005): »Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft (Editorischer Bericht und Text)«, in: Gesamtausgabe. Abtl. I: Schriften und Reden. Bd. 22: Wirtschaft und Gesellschaft. Teilbd. 4: Herrschaft. Hrsg. von Horst Baier et al., Tübingen: Mohr-Siebeck, S. 717–725 und S. 726–742. Weber, Max (2009): Gesamtausgabe. Abtl. I: Schriften und Reden. Bd. 24: Wirtschaft und Gesellschaft. Entstehungsgeschichte und Dokumente. Dargestellt und hrsg. von Wolfgang Schluchter, Tübingen: Mohr-Siebeck. Weber, Max (2013): Gesamtausgabe. Abtl. I: Schriften und Reden. Bd. 23: Wirtschaft und Gesellschaft. Soziologie. Unvollendet 1919–1920. Hrsg. 35
KNUT SCHULZ
von Knut Borchardt, Edith Hanke und Wolfgang Schluchter, Tübingen: Mohr-Siebeck. Weinrich, Lorenz (Hg.) (1983): Quellen zur Verfassungsgeschichte des Römisch-Deutschen Reiches im Spätmittelalter (= Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, 33), Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Wilda, Wilhelm Eduard (1838/1964): Das Gildenwesen im Mittelalter, Berlin 1831, 2. Aufl. 1838, ND Aalen: Scientia Verlag 1964.
36
Arnd Kluge
Sind die historischen Handwerkszünfte Vorbilder für das moderne Genossenschaftswesen in Deutschland? Im Folgenden soll am Beispiel Deutschlands gefragt werden, ob die Handwerkszünfte der Frühen Neuzeit auf die Entstehung der heutigen Genossenschaften eingewirkt haben und ob sie geeignet sind, Anregungen zur Gestaltung der genossenschaftlichen Zukunft zu geben. Indem sie Rohstoffe gemeinsam einkauften, Produkte auf Messen absetzten, teure Werkzeuge für ihre Mitglieder bereithielten oder ergänzende Werkstätten (zum Beispiel Mühlen) betrieben, traten Zünfte wie Handels- oder Produktionsgenossenschaften auf. Am heutigen Maßstab gemessen war die Zunft selbst jedoch keine Genossenschaft, denn seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gelten die Grundsätze der Freiwilligkeit und Offenheit, also die Möglichkeit, in eine Genossenschaft ohne Druck ein- und wieder aus ihr auszutreten, als Charakteristikum von Genossenschaften. Zwangsvereinigungen wie Berufsgenossenschaften, welche Träger der betrieblichen Unfallversicherung in Deutschland sind, oder Wiesenentwässerungsgenossenschaften tragen zwar die Bezeichnung einer Genossenschaft in ihrem Namen, sind aber im Grunde öffentliche Einrichtungen. Genau das waren die Zünfte der Frühen Neuzeit. In ihnen herrschte der Zunftzwang: Alle Angehörigen einer Berufsgruppe und eines Gebietes mussten Mitglied einer bestimmten Zunft sein, sonst durften sie ihren Beruf nicht ausüben. Die Tradition des Rechtshistorikers Otto von Gierke, der die deutschen Genossenschaften bis ins frühe Mittelalter zurückverfolgen wollte, benutzt einen weiteren Genossenschaftsbegriff, der die Partizipation aller Genossen in idealtypischer Gleichheit betont. Wer wie Gierke Genossenschaften vor der Mitte des 19. Jahrhunderts benennt, verwischt allerdings oft die Unterscheidung zur Gemeinde; ein prominentes Beispiel dafür ist die sogenannte Markgenossenschaft, eine gemeindliche Organisation der Grundstücksnutzung. Nur wenige ältere Unternehmungen lassen sich als Genossenschaften im heutigen Sinne charakterisieren, etwa genossenschaftliche Backhäuser, Mühlen, Wald-Feldbau-Systeme wie die Hauberge im Siegerland oder frühe Berggewerkschaften. Einer der Begründer der modernen Genossenschaften in Deutschland, Hermann Schulze aus Delitzsch bei Leipzig, nach parlamentarischem Gebrauch Schulze-Delitzsch genannt, der sein Mitteilungsblatt »Innung der Zukunft« nannte, sah hier sehr klar: Er stellte sich mit den nach 37
ARND KLUGE
seinem »System« gegründeten Genossenschaften zwar in die Tradition der Zünfte, die in Schulzes preußischer Provinz Sachsen »Innungen« hießen, machte jedoch deutlich, dass es einen charakteristischen Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft gebe. Indem er nach Krankenkassen und gewerblichen Bezugs- und Absatzgenossenschaften sein Augenmerk den Vorschussvereinen zuwandte, einer Genossenschaftsart, die es vor dem 19. Jahrhundert nicht gegeben hatte, machte Schulze den Bruch mit der Vergangenheit noch markanter. Für Schulze, dem der Mainstream der deutschen Genossenschaften folgte, waren Unabhängigkeit vom Staat (ausgedrückt in der Formel »Selbsthilfe statt Staatshilfe«) und damit Freiwilligkeit unverzichtbare Elemente des Genossenschaftswesens. Die im Mittelalter entstandenen Zünfte erlebten während der Frühen Neuzeit ihren quantitativen Höhepunkt. Fast überall in Europa gab es Zünfte in mehr oder minder großer Dichte. Allein in Deutschland existierten mehrere 10.000 Zünfte. Die typische Zunft hatte ein oder zwei Dutzend Mitglieder, die demselben Handwerksberuf und derselben Stadt angehörten, es gab aber auch Zünfte anderer Größe oder anderen beruflichen oder geografischen Zuschnitts. Das Modell Handwerkszunft wurde auf andere Berufsgruppen wie Bettler oder Prostituierte und politische Systeme, die sogenannten Zunftverfassungen, übertragen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert wurden die Zünfte in Europa abgeschafft, während sie in anderen Teilen der Welt gelegentlich bis ins frühe 20. Jahrhundert existierten. Für Aufstieg und Fall der Zünfte war neben wirtschaftlichen Bedingungen ihr Verhältnis zur Öffentlichen Hand entscheidend. Zünfte nutzten der Öffentlichen Hand, indem sie öffentliche Aufgaben übernahmen, die von den winzigen und oft ehrenamtlichen Verwaltungen nicht geschultert werden konnten. Sie wurden beseitigt in dem historischen Moment, in dem der Staat diese Aufgaben selbst wahrnehmen konnte und wollte bzw. aus liberaler Überzeugung auf die Aufgabenwahrnehmung verzichtete. Zünfte waren multifunktionale Einrichtungen. Der Kern ihrer Aufgaben war wirtschaftlicher, marktordnender Natur. Zünfte regelten das Verhalten der Anbieter auf den Märkten, etwa die Wahl des Verkaufsplatzes oder die erlaubte Werbung, bestimmten die Art der Produkte und ihre Herstellungsweisen, regulierten Im- und Export von Rohstoffen und Waren und den Zwischenhandel, kontrollierten die Qualität, setzten Preise, Löhne und Angebotsmengen fest. Nicht jede Zunft übte sämtliche dieser Aufgaben aus, aber der genannte Katalog beschreibt einen Aufgabenbestand, der typischerweise Zünften übertragen wurde. Außerdem hatten viele Zünfte Aufgaben, die man heute als politisch, kommunal, staatlich, religiös oder sozial bezeichnen würde. Sie beteiligten sich an der Selbstverwaltung der Kommunen, beispielsweise durch 38
SIND DIE HISTORISCHEN HANDWERKSZÜNFTE VORBILDER?
Mitgliedschaft im äußeren oder weiteren Rat oder in der Zunftverfassung, traten im Militär, bei der Nachtwache, der Feuerwehr und dem Steuereinzug als Gruppe auf oder stellten Dienstleistungen zur Verfügung, für die sie aufgrund des Berufes ihrer Mitglieder prädestiniert waren: Metzger hielten Pferde für den Postverkehr bereit, Bäcker legten Getreidevorräte für Notfälle an. In Bürgerkämpfen um die politische Teilhabe am Stadtregiment wirkten Zünfte maßgeblich mit. Während sie im Spätmittelalter oftmals mehr Mitspracherechte erlangten, mussten sie während der Frühen Neuzeit, vor allem im 18. Jahrhundert, Rückzugsgefechte führen und in Kauf nehmen, dass ihre Mitwirkungsmöglichkeiten und ihre administrative und judikative Autonomie beschnitten wurden. Aus der Gründungsphase des Zunftwesens, in der viele Zünfte aus Gebetsbruderschaften hervorgingen, rührte die enge Verbindung mit Kirche und Religion. Der Wunsch nach sozialer Reputation ließ Zunfthandwerker zu christlichen Moralaposteln werden, wobei man neben perfekten Christen auch lässigere Gläubige unter den Zunfthandwerkern beobachtet. Die religiösen Tätigkeiten der Zünfte waren neben der Selbstverwaltung der Meister und Gesellen der zweite bedeutende Anknüpfungspunkt für Brauchtum. Ein Punkt, der hier besonders interessiert, sind die sozialen Aufgaben der Zünfte. In der Literatur werden sie lobend hervorgehoben, sogar von denen, die sonst kein gutes Haar an den Zünften lassen. Man sah darin etwas Besonderes für die vorindustrielle Zeit und einen Vorläufer der Sozialversicherung. Dabei ging die Sozialfürsorge der Zünfte kaum über das hinaus, was zur Aufrechterhaltung des Zunftsystems erforderlich war. Die Quittung für eine Leibrente, die einer Kölner Witwe im 15. Jahrhundert von der Goldschmiedezunft ihres Mannes gezahlt wurde, ist eine einmalige Ausnahme in der Überlieferung. Nur die reichen Kölner Goldschmiede konnten sich so etwas leisten, eine durchschnittliche Zunft war dazu nicht in der Lage. Goldschmiede waren zwar Handwerker, hatten aber eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Position wie Bankiers. Witwen durften normalerweise nach dem Tod ihres Mannes eine Zeitlang dessen Betrieb aufrecht halten, sollten dann aber einen Berufsangehörigen heiraten, der den Betrieb fortführte. Hier ging es weniger um die Sicherung der Witwe als um die des Betriebes. In dieselbe Richtung zielte die Fürsorge der Zünfte für ihre Gesellen, junge Männer oder Jugendliche, die auf ihrer Wanderschaft fern von zu Hause ihre Herkunftsfamilie entbehren mussten. Die Zunft kümmerte sich um Disziplinierung und Geselligkeit in der Gesellen-Bruderschaft und um Hilfe im Krankheitsfall, allerdings nur, solange der Geselle einem Betrieb angehörte, und nicht, wenn er auf der Landstraße unterwegs war. In einem Notfall musste der Geselle zunächst sein Vermögen aufbrauchen, erst dann schritt die Zunft ein. Bei der Wanderschaft wurden Gesellen unterstützt, indem man ihnen Kost und Logis anbot, falls sie 39
ARND KLUGE
an einem Ort keine Arbeit fanden; ansonsten hätten viele Gesellen keine Wanderschaft antreten können, die aber für den überregionalen Ausgleich des Arbeitsangebotes zwingend erforderlich war. Lehrlinge erhielten von der Zunft keine Hilfe, da für sie kurzfristig der Meisterhaushalt und langfristig ihre Herkunftsfamilie einspringen mussten. Meister und ihre Familien sollten infolge von Zunftordnung und Heirat eigentlich vor Armut geschützt sein. Trat der »worst case« trotzdem ein, gewährte die Zunft ihrem Mitglied vielleicht einen Überbrückungskredit oder einen Platz im Hospital; verbreitet war das nicht, da man normalerweise erwartete, dass sich der Meister selbst absicherte (durch Heirat, Immobilienerwerb oder den Einkauf in einem Hospital) oder die Kirche oder Kommune ihm halfen. Gingen die Zunftkollegen bei der Beerdigung eines Meisters oder Gesellen mit oder übernahmen sie sogar die Beerdigungskosten, so erwiesen sie nicht nur einem verstorbenen Mitglied die Ehre, sondern wahrten vor allem die soziale und ökonomische Reputation der Zunft, die man bei einem Armenbegräbnis hätte in Zweifel ziehen können. Natürlich gab es auch arme Zunftangehörige, doch wollte man das nicht an die große Glocke hängen. Mit Pierre Bourdieu spricht man vom »symbolischen Kapital der Ehre«, das in politisches, soziales oder Geldkapital eingetauscht werden konnte. Die häufigen Sammlungen für abgebrannte Berufskollegen anderer Städte dienten ebenfalls der Stabilisierung des Zunftsystems, während sich fast keine wohltätigen Leistungen ohne Bezug zum Zunftsystem in den Rechnungen der Zünfte finden lassen. An der Unterstützungskassenbewegung seit dem 17. Jahrhundert beteiligten sich wie viele andere auch Zünfte. Unterstützungskassen kümmerten sich um Kranken- oder Sterbegeld, Heirats- und Aussteuerbeihilfen und Unterstützungen für Invaliden, Witwen und Waisen. Zahlungen an diese Kassen waren manchmal verpflichtend für alle Zunftmitglieder. Als die liberale Kritik an den Zünften im 19. Jahrhundert zunahm, waren Unterstützungskassen ein Rückzugsort des Zunftwesens, bewiesen sie doch ihren Kritikern die gesellschaftliche Nützlichkeit der Zünfte. Ohne Unterstützungskassen wären mehr Menschen der öffentlichen Armenfürsorge zur Last gefallen. Allerdings überlebten die Unterstützungskassen das Ende des Zünfte nur kurz: Mit dem Hilfskassengesetz von 1876 wurden sie in die Sozialversicherung integriert. Infolge der Reichsversicherungsordnung von 1911 verwandelten sich Unterstützungskassen in »Ersatzkassen« der gesetzlichen Krankenversicherung, während andere zu privaten Zusatzversicherungen wurden. Seit dem deutschen Kaiserreich von 1871 dominiert der Staat die soziale Absicherung derart, dass in und neben der Sozialversicherung nur schwache genossenschaftliche Elemente entstehen konnten. Von den Unterstützungskassen der Zünfte gingen keine Impulse auf freie Sozialgenossenschaften aus. 40
SIND DIE HISTORISCHEN HANDWERKSZÜNFTE VORBILDER?
Andere historische Linien führen Zünfte zu Brauchtumsresten wie Traditionsvereinen, religiösen Bruderschaften oder den Zimmerleuten, die in »Kluft« auf Wanderschaft gehen. Nicht jede Zunft löste sich auf, als die Gewerbefreiheit eingeführt wurde. In Bayern ließ das Gewerbsgesetz von 1825 die Zünfte in einer geminderten Form bestehen, die als Brücke zu den jüngeren Innungen dienen konnte. In Preußen blieben nach der Einführung der Gewerbefreiheit 1810 ehemalige Zünfte als freie Innungen bestehen. Als sich der Staat wieder einer intensiveren Gewerbepolitik zuwandte, ließ er 1881 aus freiwilligen Innungen öffentlich-rechtliche Körperschaften werden, die sich bis heute vor allem der Lehrlingsausbildung widmen. Nach mancherlei Vorstufen, die bis ins 17. Jahrhundert reichen, wurden im Jahr 1900 Handwerkskammern flächendeckend verpflichtend eingeführt, gewissermaßen halbstaatliche Lobbyeinrichtungen der Handwerker, die ebenfalls mit Ausbildungsfragen befasst sind. Was den Meistern ihre Innungen und Handwerkskammern wurden – Interessenverbände –, waren Gewerkschaften für die Gesellen. Die frühe Gewerkschaftsbewegung, deren Anfänge man in Deutschland in der Revolution von 1848 verortet, entstand aus der Gesellenbewegung. Gesellen brachten Organisationserfahrungen und Kontakte mit, und die Gewerkschaften zahlten ihnen Wander- und Streikgelder und errichteten Unterstützungskassen und Arbeitsnachweise. Seit den 1890er Jahren sah sich der dominierende sozialistische Gewerkschaftszweig allerdings als Bestandteil der Arbeiterbewegung. Mit dem Aufstieg der Industrie und der organisierten Arbeiterbewegung wurden Handwerksgesellen zu einer Minderheit in den Gewerkschaften. Noch einmal konnten die Gewerkschaften vom Zunfterbe profitieren, als sie dazu übergingen, Tarifverträge abzuschließen. Gesellen waren die ersten Lohnarbeiter gewesen, die feste Entlohnung (als Zeit- oder Stücklohn), feste Arbeitszeiten und Kündigungsmodalitäten kannten. Das Wissen um die Regelung von Arbeitsbedingungen konnten die Gewerkschaften aus der Zunftvergangenheit übernehmen. Trotz mehrerer Liberalisierungswellen sind in Deutschland bis heute Marktregulierungen wie Ladenöffnungszeiten, Werbeverbote oder bestimmte Arten der Kartelle vorhanden, wie sie ähnlich in der Zunftepoche existierten. Wenn einige Frühsozialisten und mit ihnen der frühe Schulze von einer Gesellschaft aus Produktivgenossenschaften träumten, so scheint das ein Reflex der Zunftgeschichte zu sein, denn dass man den Markt nicht sich selbst überlassen sollte, war für diese Denker so selbstverständlich wie für die Zünfte einer frühneuzeitlichen Stadt. Kommen wir zum Fortleben zünftiger Traditionen in den modernen Genossenschaften. Vom Einerseits und Andererseits Hermann Schulzes in seiner Formulierung von der »Innung der Zukunft« war bereits die Rede. Schulze verarbeitete mit seinen frühen Gründungen Anregungen, 41
ARND KLUGE
die Victor Aimé Huber, ein Berliner Professor, von frühen Genossenschaften des Auslandes vermittelt hatte, außerdem vereinzelte genossenschaftliche Traditionen Deutschlands und seine Erfahrungen als Patrimonialrichter und 48er-Revolutionär. Zünfte waren für ihn wie für seine Zeitgenossen des liberalen Zeitalters und später die Kathedersozialisten der Historischen Schule kein Vorbild, sondern das dominante Gegenbild. Noch in einem jüngst erschienenen Buch der renommierten Oxforder Professorin für Wirtschaftsgeschichte Sheilagh Ogilvie findet sich die Zunftkritik des 19. Jahrhunderts in erweiterter und verschärfter Form wieder. Nach Ogilvie nutzten Zünfte ihre Macht, um den Profit zu maximieren, Außenseitern zu schaden, den Zutritt zu versperren sowie Antisemitismus, Frauen- und Fremdenfeindlichkeit zu fördern. Die Qualitätskontrolle durch Zünfte war, wo sie existierte, ineffektiv genauso wie die Ausbildung des Nachwuchses. Zünfte waren innovationsfeindlich. Sie brachten der Gesellschaft keine Vorteile, sondern verminderten das Wirtschaftswachstum. Trotz ihrer eklatanten Nachteile existierten die Zünfte Jahrhunderte, weil sie korrupten Machthabern halfen, die Gesellschaft auszubeuten. Schließlich verschwanden die Zünfte in einigen europäischen Ländern, weil die Herrschenden erkannten, dass sie ohne Zünfte noch mehr Profit erzielen konnten. Wo dies nicht der Fall war (z. B. in Deutschland), bedurfte es langer, bitterer sozialpolitischer Konflikte, um die Zünfte abzuschaffen. Soweit Ogilvie, die Erkenntnisse der neueren Forschung weitgehend ignoriert. Aber bei derartigen Ansichten über Zünfte ist es kein Wunder, dass die Gründungsväter der modernen Genossenschaften wenig Lust verspürten, sich in die Zunfttradition einzureihen. Um Hermann Schulze zu zitieren: »Nicht rückwärts in alte längst beseitigte Zustände, die zu der übrigen Welt um uns nicht passen, die ja unterdessen auch nicht stillegestanden ist, sondern vorwärts führt der Weg zum Ziel.«1 Dabei muss man mehrere Ausnahmen machen. Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der Bürgermeister im Westerwald war, experimentierte in Heddesdorf bei Neuwied mit einem Multifunktionsverein. Der Heddesdorfer Wohltätigkeits-Verein sollte gleichzeitig Kredite vergeben, verwahrloste Kinder bessern, entlassenen Sträflingen Arbeit geben und eine Volksbibliothek führen. Neben Zinsen und Gebühren nahm er Spenden. Soziale und wirtschaftliche Aufgaben in einem Verein und die enge Beziehung des Vereins zur Gemeindeverwaltung erinnern an die Kon struktion der Zünfte. Das Vorhaben scheiterte jedoch, weil der soziale Zweig verdorrte; die Spender waren nach einiger Zeit nicht mehr bereit, Zuschüsse zu leisten. Nachdem eine sparkassenähnliche Idee am Einspruch der Regierung gescheitert war, wandte sich Raiffeisen schließlich der Konzeption Schulzes zu. Diese sah Genossenschaften auf streng 1 Thorwart 1909: 520
42
SIND DIE HISTORISCHEN HANDWERKSZÜNFTE VORBILDER?
ökonomischer Basis ohne Wohltätigkeitsaspekte vor, die sich jeweils einem einzigen Aufgabenfeld widmeten. Die Genossenschaft an sich sei wohltätig, meinte Schulze, zusätzlicher Wohltätigkeitsbestrebungen bedürfe es nicht. Eine Kombination mehrerer Zwecke in einer Organisation und eine starke soziale Ausrichtung findet man vorzüglich bei Lebens- und Gütergemeinschaften, die sich aber nicht auf das Zunftwesen berufen, sondern auf religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen. In bedeutenden Gewerbestädten war die Multifunktionalität der Zünfte Ausdruck eines Handwerkermilieus, das außer den bereits genannten Funktionen Geselligkeit, sozialen Status, repräsentative Kleidung und das Auftreten der Mitglieder bei öffentlichen Veranstaltungen einschloss. In der Mitte des 19. Jahrhunderts waren die traditionalen Milieus verblasst, bevor sich mit spezifischen Organisationen wie Vereinen, Versicherungen, politischen Parteien, Gewerkschaften und nicht zuletzt Genossenschaften erneut Milieus bildeten mit ihrem Höhepunkt während der Weimarer Republik. Arbeiter, rheinische Katholiken, Beamte und auch (weniger ausgeprägt) Handwerker konnten sich von der Wiege bis zur Bahre in milieuspezifischen Kreisen bewegen. Die »Volksgemeinschaft« der Nationalsozialisten und die Veränderungen der Nachkriegszeit ließen diese Milieus verschwinden. Wenn in der jüngeren Vergangenheit neue Milieus entstanden, zum Beispiel die Alternativökonomie der 1980er Jahre, so waren diese klein und kurzlebig, aber stets mit Genossenschaftsgründungen versehen, die zusätzlich zu ihren ökonomischen Funktionen stark emotional aufgeladen waren. Man denke nur an die Ökobank. Eine andere Ausnahme ist die berufliche Ausrichtung der modernen Genossenschaften. Hermann Schulze zielte auf dieselbe Klientel, die Mitglied der Zünfte gewesen war, die selbstständigen Handwerker. Sein Begriff des »Arbeiters« schließt Handwerker und Industriearbeiter ein. Im Laufe der Zeit wurden aus Handwerker-Vorschussvereinen zunächst Kreditgenossenschaften kleiner Selbstständiger und später allgemeine Mittelstandsbanken. Ausschließliche Handwerkergenossenschaften, wie Bezugs- und Absatzgenossenschaften, hatten es gegenüber den berufsübergreifenden Genossenschaften aus ökonomischen Gründen auf Dauer schwer. Eine weitere Ausnahme betrifft die Struktur des Genossenschaftswesens, und zwar die äußere wie die innere Struktur. Sowohl moderne Genossenschaften als auch historische Zünfte sind grundsätzlich lokale, mindestens aber regionale Einrichtungen. Die typische Zunft war an eine Stadt gebunden, wenn es auch – auf dem Land – Zünfte mit größeren Einzugsbereichen gab. Die ersten modernen Genossenschaften entstanden in Klein- und Mittelstädten oder Kirchspielen, bevor sie sich infolge von Fusionen zu regionalen Instituten entwickelten. In kleinen Einheiten kennt man sich und kann die wirtschaftliche Zuverlässigkeit des 43
ARND KLUGE
Geschäftspartners gut einschätzen. Die Beziehungen der Mitglieder untereinander sind persönlich-direkt. Je größer der Einzugsbereich wird, desto oberflächlicher und seltener werden die persönlichen Kontakte, bis das personale Prinzip durch bürokratische Verfahrensweisen ersetzt wird. Inwieweit Zünfte in großen Gewerbezentren, die mehrere hundert Mitglieder hatten, diesen Punkt erreicht haben, ist bislang unerforscht. Genossenschaften mit zehn- oder hunderttausenden Mitgliedern, wie sie heutzutage verbreitet sind, sind längst nicht mehr persönlich geprägt. Die Selbstverwaltung der Zünfte und der frühen modernen Genossenschaften ist die direkte Demokratie, die in Vollversammlungen aller Mitglieder ausgeübt wird. Der Ablauf der Sitzungen ist standardisiert und ritualisiert. Während bei den Zünften Teilnahmezwang herrschte, ist die Teilnahme an der Versammlung einer Genossenschaft freiwillig. Hier wie dort sind alle Teilnehmer grundsätzlich gleichberechtigt, in der Praxis lassen sich aber fast immer Mitglieder mit mehr oder weniger Einfluss feststellen. Ämter bleiben oft lange in einer Hand. Große Zünfte führten Ausschüsse und Wahlmänner ein, große Genossenschaften haben Vertreterversammlungen. Während in den Zünften oft die Obrigkeiten Einfluss auf die Versammlungen nahmen, ist eine der wichtigsten Personen einer genossenschaftlichen Versammlung der Verbandsprüfer. Bei den Zünften spricht man von Oligarchisierung, bei heutigen Genossenschaften von Managementdominanz. Ein Resultat beider Tendenzen ist die Aushöhlung der Mitgliederdemokratie. Hermann Schulze übernahm das Regional- und das Demokratieprinzip für die modernen Genossenschaften. Sie entsprachen seiner liberalen Weltanschauung, waren zweckmäßig, und er kannte sie sicherlich von den örtlichen Vereinen an seiner Wirkungsstätte Delitzsch. Selbstverständlich kannte er Zünfte, die es in Deutschland ja noch bis 1869 gab, wenn auch im preußischen Delitzsch nicht mehr, aber noch bis 1861 im nahen Leipzig. Neben den Vereinen (und weit mehr als die Gemeinden) transportierten die Zünfte die Prinzipien Regionalität und Demokratie durch die Epochen bis in das 19. Jahrhundert. Das bedeutet nicht, dass Zunftmitglieder besonders gute Demokraten gewesen wären, doch immerhin waren demokratische Spielregeln und Abläufe bekannt und eingeübt, auf welche Demokraten des 19. und des 20. Jahrhunderts zurückgreifen konnten. Das lange 19. und das kurze 20. Jahrhundert waren Epochen der Ideologien. Die modernen Genossenschaften ordneten sich den großen Ideologien ein, sie gehörten zu liberalen, christlich-sozialen, konservativen oder sozialistischen Bewegungen mit deren zahllosen Unter- und Nebenzweigen. Während sich die charismatischen Gründerväter »Systemstreitigkeiten« lieferten, verblassten die Weltanschauungen spätestens in der zweiten Generation der Funktionäre. Politische und wirtschaftliche Krisen und die Logik von Interessenverbänden veranlassten die Verbände, ihre 44
SIND DIE HISTORISCHEN HANDWERKSZÜNFTE VORBILDER?
weltanschaulichen Positionen aufzugeben und Stück um Stück zu Einheitsverbänden zu fusionieren. Die Mitglieder der Genossenschaften waren von vornherein wenig an Weltanschauung interessiert, sondern eher an günstigen Zinsen, einer Rückerstattung zu Weihnachten oder einer preisgünstigen und unkündbaren Wohnung. Seit Schulzes Zeiten werden immer wieder Klagen laut über ausschließlich an kurzsichtigen Vorteilen oder Dividenden interessierte Mitglieder, die keine »richtigen« Genossenschafter seien. Die Zahl der Idealisten unter den Genossenschaftern – die es auch gab – blieb klein, der oft beschworene »Genossenschaftsgeist« ist stets der Geist einer Minderheit geblieben. An dieser Stelle treffen sich moderne Genossenschaften mit historischen Zünften, in denen es ebenfalls Schwierigkeiten mit dem Zusammenhalt gab. Einig war man sich oftmals lediglich darin, Bewerber, die sich nicht dagegen wehren konnten, mit den Kosten der Zünfte zu belasten, indem man hohe Eintrittsgebühren von ihnen verlangte. Wer es trotz aller Widrigkeiten in die Zunft geschafft hatte, musste die unbeliebtesten Posten übernehmen, die zu vergeben waren, zum Beispiel die Zahlungsrückstände säumiger Mitglieder eintreiben, Botendienste verrichten oder bei Festen die Mitmeister bewirten. Trotz ihres ideologischen Überbaus kommen moderne Genossenschaften in ihrer täglichen Arbeit gewöhnlich ohne Weltanschauung aus. Der Leiter des Reichsverbandes der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften, Wilhelm Haas, formulierte das Paradigma der meisten Genossenschaften in einer bekannten Sentenz im Jahr 1905: »Die genossenschaftliche Idee ist eine eminent ethische und sittlich erhabene, die Wirkung des Genossenschaftswesens ist eine überaus charitative und sozial bedeutungsvolle, aber die dazwischen liegende genossenschaftliche Arbeit des Tages hat einen durchaus materiellen, nüchternen und rein ökonomischen Charakter, dessen Nichtbeachtung auf Abwege führt.«2 So wird weltanschaulicher Streit unter den Mitgliedern vermieden und alle Kraft auf das ökonomische Tagesgeschäft konzentriert. Obwohl häufig Bismarcks Verdikt der Genossenschaften als »Kriegskassen der Demokratie« zitiert wird, begannen in der Mitte der 1850er Jahre überall Staatsverwaltungen, Genossenschaften zu unterstützen. Sogar Produktivgenossenschaften nach dem Sozialisten Ferdinand Lassalle erhielten Mittel – aus dem deutschen Kaiserhaus. Baugenossenschaften wurden zum Träger des sozialen Wohnungsbaus, bevor dieser Ausdruck existierte. Eine Spezialgesetzgebung schuf in den 1860er Jahren die Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft. Der Staat gründete selbst Genossenschaften für seine Bediensteten, zum Beispiel für die große Zahl schlecht bezahlter Mitarbeiter von Post und Bahn. Dies war nur möglich auf der Basis strikter politischer Neutralität der Genossenschaften der liberalen, konservativen und christlichen 2 Feineisen 1956: 82
45
ARND KLUGE
Richtungen gegenüber dem Staat. Wenn die Regime wechselten – vom Kaiserreich zur Demokratie zur nationalsozialistischen Diktatur und wieder zur Demokratie –, passten sich die Genossenschaften der herrschenden Lehre an. Die Mittelstandsdoktrin, die das liberale, konservative und christliche Genossenschaftswesen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts als Leitlinie vertraten, war anpassungsfähig genug, um den Regimewechseln zu folgen. Sozialdemokratisch orientierte Konsumgenossenschaften hatten es schwerer, wurden aber seit dem späten Kaiserreich geduldet. Ihnen machten die Nationalsozialisten den Garaus, bevor sie nach 1945 neu entstehen durften. Diese Zusammenhänge erklären, warum moderne Genossenschaften in keine politischen Machtkämpfe verwickelt wurden, wie sie für die Zünfte typisch waren. In der Demokratie sind politische Aufstände überflüssig, weil es legale Wege der politischen Einflussnahme gibt, und im autoritären Kaiserreich und der totalitären Diktatur zog man sich auf die Rolle des Mittelstandslobbyisten zurück. Das 19. Jahrhundert hat sich bewusst von den Zünften abgewandt, die man (mit einem gängigen Schlagwort der Obrigkeiten) für allerlei »Missbräuche« verantwortlich gemacht hat. Statt der Zwangsorganisation Zunft wurde die freiwillige Genossenschaft geschaffen, die mit weltanschaulichen Horizonten aufgeladen wurde, welche dem Zunftzeitalter fremd gewesen waren. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse hatten sich naturgemäß von der Frühen Neuzeit zum Industriezeitalter stark gewandelt. Trotzdem nahm man sich in Deutschland Organisationsformen der Zünfte wie den Regionalismus und die direkte Demokratie zum Vorbild und knüpfte bei der charakteristischen Klientel der Zünfte, den Handwerkern, an. Insofern ist ein Einfluss des Zunftwesens auf die Entstehung der modernen Genossenschaften nicht zu leugnen. Inzwischen haben sich die Genossenschaften weit von ihren Ursprüngen in der Mitte des 19. Jahrhunderts entfernt. Was damals dem Zunftwesen glich, ist nur noch rudimentär vorhanden. Nach Überwindung der weltanschaulichen Phase ist man allerdings gegenwärtig wieder bei dem pragmatischen, rein nach Vorteilen für die Mitglieder suchenden Ansatz der Zünfte angekommen. Obwohl heutzutage – von Sheilagh Ogilvie abgesehen – das Zunftwesen nicht mehr verdammt, sondern ausgewogener betrachtet wird, wird wohl niemand auf die Idee kommen, es wieder einzuführen. Inspirationen für die Geschäftspolitik einer Genossenschaft lassen sich aus der Zunftgeschichte nicht ziehen. Falls sich heutige Genossenschaften an der Historie ein Beispiel nehmen, dann nicht an der der Zünfte, sondern an genossenschaftlichen Experimenten früherer Zeiten und anderer Länder.
46
SIND DIE HISTORISCHEN HANDWERKSZÜNFTE VORBILDER?
Literatur Hans-Jürgen Goertz (Hg.) (1984): Alles gehört allen. Das Experiment Gütergemeinschaft vom 16. Jahrhundert bis heute, München: Beck. Faust, Helmut (1977): Geschichte der Genossenschaftsbewegung. Ursprung und Aufbruch der Genossenschaftsbewegung in England, Frankreich und Deutschland sowie ihre weitere Entwicklung im deutschen Sprachraum, 3. Auflage, Frankfurt am Main: Knapp. Feineisen, Adalbert (1956): Wilhelm Haas. Gestalter einer großen Idee, Neuwied: Raiffeisendruckerei. Kluge, Arnd (1991): Geschichte der deutschen Bankgenossenschaften. Zur Entwicklung mitgliederorientierter Unternehmen (Schriftenreihe des Instituts für bankhistorische Forschung, 17), Frankfurt am Main: Knapp. Kluge Arnd (2007): »Genossenschaften in der Geschichte« in: Thomas Brockmeier/Ulrich Fehl (Hg.), Volkswirtschaftliche Theorie der Kooperation in Genossenschaften (Marburger Schriften zum Genossenschaftswesen, 100), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 3–38. Kluge, Arnd (2009): Die Zünfte, 2. Auflage, Stuttgart: Franz Steiner Verlag. Kluge, Arnd (2015): »Zunftrechnungen als Quellen der Mentalitätsgeschichte des alten Handwerks« in: Anke Keller/Ralf Schürer (Hg.), Die Zunft zwischen historischer Forschung und musealer Repräsentation. Beiträge der Tagung im Germanischen Nationalmuseum, 30. Mai bis 1. Juni 2013 (Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, 39), Nürnberg: Verl. des Germanischen Nationalmuseums, 26–45. Ogilvie, Sheilagh (2019): The European Guilds. An Economic Analysis, Princeton/Oxford: Princeton University Press. Thorwart, Friedrich (Hg.) (1909): Hermann Schulze-Delitzsch’s Schriften und Reden, I. Band, Berlin: Guttentag.
47
Otto Gerhard Oexle
Kulturwissenschaftliche Reflexionen über soziale Gruppen in der mittelalterlichen Gesellschaft Tönnies, Simmel, Durkheim und Max Weber* 1
I. Die Definition der Moderne in der Deutung des Mittelalters – ein Problem der Moderne »Im Mittelalter«, so heißt es in einem der bekanntesten Werke der europäischen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts, »im Mittelalter lagen die beiden Seiten des Bewußtseins – nach der Welt hin und nach dem Innern des Menschen selbst – wie unter einem gemeinsamen Schleier träumend oder halbwach. Der Schleier war gewoben aus Glauben, Kindesbefangenheit und Wahn; durch ihn hindurchgesehen erschienen Welt und Geschichte wundersam gefärbt, der Mensch aber erkannte sich nur als Rasse, Volk, Partei, Korporation, Familie oder sonst in irgendeiner Form des Allgemeinen. In Italien zuerst verweht dieser Schleier in die Lüfte; es erwacht eine objektive Betrachtung und Behandlung ... der sämtlichen Dinge dieser Welt überhaupt; daneben aber erhebt sich mit voller Macht das Subjektive; der Mensch wird geistiges Individuum und erkennt sich als solches«. Jeder Historiker kennt diesen berühmten und unendlich oft zitierten Text. Er stammt aus Jacob Burckhardts Werk über ›Die Kultur der Renaissance in Italien‹ von 1860.1 Burckhardt wollte mit diesen Sätzen die »Ausbildung« des »modernen Menschen« bezeichnen. Er tat dies, indem er Mittelalter und Moderne in einen kontradiktorischen Gegensatz brachte. Der Gegensatz wird konstituiert über die Frage von Bindung und Freiheit des Individuums, und zwar in zweifacher Hinsicht: einerseits geht es um die geistige Bindung des Individuums an die Autoritäten 2
* Zuerst erschienen: Otto Gerhard Oexle, Kulturwissenschaftliche Reflexionen über soziale Gruppen in der mittelalterlichen Gesellschaft: Tönnies, Simmel, Durkheim und Max Weber, in: Die okzidentale Stadt nach Max Weber. Zum Problem der Zugehörigkeit in Antike und Mittelalter. Hrsg. v. Christian Meier (HZ, Beiheft, N. F. 17), München 1994, 115–159. 1 Jacob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien (Gesammelte Werke, Bd. 3). Darmstadt 1955, 89.
48
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
des Glaubens, andererseits um die soziale Bindung des Individuums an die Mächte der Gemeinschaft. Die Auflösung dieser beiden Bindungen bedeutete für Jacob Burckhardt den Übergang vom Mittelalter zur Moderne, die »Ausbildung« des »modernen Menschen«. Über denselben kontradiktorischen Gegensatz von Mittelalter und Moderne hat sich Burckhardt erneut am Beginn der l880er Jahre geäußert, jetzt aber in einem völlig anderen, nämlich im gerade entgegengesetzten Sinn.2 »Die jetzige europäische Menschheit«, so Burckhardt 1882, »hat in Gestalt des Mittelalters wenigstens eine lange Jugend gehabt«. Und noch deutlicher 1884: »... das Mittelalter war die Jugend der heutigen Welt ... Was uns lebenswert ist wurzelt dort«. Denn die moderne Kultur, so Burckhardt noch einmal 1884, sei im »Niedergang« begriffen, für den das Mittelalter nicht verantwortlich sei. Im Gegensatz zur Moderne sei das Exemplarische am Mittelalter vor allem, daß es »eine Zeit der selbstverständlichen Autoritäten« war, also nicht ausgeliefert den »Wogen der Majoritäten von unten herauf«, denen die moderne Kultur »verfallen« sei. Exemplarisch wird für Burckhardt also jetzt das Mittelalter als der Gegensatz schlechthin zu jenen Prozessen und zu jenen Lebensmächten seiner Zeit, die er als ein Verhängnis, als auflösend und destruktiv empfand: »Beständige oder beständig drohende Nationalkriege«, die »Zwangs- und Massenindustrie mit tödlicher Konkurrenz«, »Kredit und Kapitalismus«. Und: hätten die Menschen des Mittelalters »schon nur die Steinkohlen ausgebeutet, wie es jetzt geschieht, wo wären wir?« Die »Kunde vom Mittelalter« gehöre deshalb »mit zum Teuersten ..., was wir besitzen«. Ja, die dominanten Kräfte der Moderne empfand Burckhardt 1884 geradezu als »Feinde des Mittelalters«, nämlich: »Der eilige Sieg der Naturwissenschaften«, der »unbedingte Verkehr der fernsten und nächsten Völker«, die »industrielle Ausbeutung der Welt«, die »nivellierende Gleichheit«. Burckhardts diametral entgegengesetzte Äußerungen über den Gegensatz von Mittelalter und Moderne von 1860 und vom Anfang der 1880er Jahre repräsentieren ein Deutungsschema der Geschichte, das bereits seit dem Beginn eben der Moderne, also seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert und dem Beginn des 19. Jahrhunderts vielfältig in Erscheinung trat3 und das bis heute, auch in der Geschichtswissenschaft4, unausgesetzt in 3
4
5
2 Jacob Burckhardt, Über das Mittelalter (1882/84), in: Ders., Weltgeschichtliche Betrachtungen. Historische Fragmente aus dem Nachlaß (Gesamtausgabe, Bd. 7). Berlin/Leipzig 1929, 248–255. Vgl. Rudolf Stadelmann, Jacob Burckhardt und das Mittelalter, in: Historische Zeitschrift 142, 1930, 457–515. 3 Vgl. Otto Gerhard Oexle, Das entzweite Mittelalter, in: Die Deutschen und ihr Mittelalter. Hrsg. v. Gerd Althoff. Darmstadt 1992, 7–28 und 168–177. 4 Otto Gerhard Oexle, Das Bild der Moderne vom Mittelalter und die moderne Mittelalterforschung, in: Frühmittelalterliche Studien 22, 1990, 1–22.
49
OTTO GERHARD OEXLE
Erscheinung tritt. Es erörtert Mittelalter und Moderne, indem es erstens Mittelalter und Moderne in einer wechselseitigen und unaufhörlichen polaren Spannung, als einen absoluten Gegensatz deutet. Die Beziehung zwischen den beiden Epochen wird dabei konstituiert durch das Problem des Fortschritts. Es geht nämlich um die Frage, ob die Überwindung des Mittelalters einen Fortschritt darstellt (Burckhardts These von 1860) oder ob nicht vielmehr der Fortschritt der Moderne, gemessen am Mittelalter, sich als Unglück erweist (Burckhardts These von 1882/84). Und diese Frage nach der Beurteilung des Fortschritts im Zeichen des Gegensatzes von Mittelalter und Moderne wird, zweitens, erörtert am Pro blem der geistigen und sozialen Bindungen des Individuums. Das heißt: es geht um die Frage, ob die Sprengung der Fesseln, die das Individuum im Mittelalter an Glauben und Autoritäten und an die Mächte der Gemeinschaft banden, ein Fortschritt war oder vielmehr einen Verlust bedeutete: den Beginn nämlich der geistigen und sozialen Bindungslosigkeit des Individuums in der Moderne. Der Wandel in den Auffassungen Burckhardts von 1860 zu 1884 hat seine Begründung deshalb in der Geschichte des Fortschrittsgedankens, nämlich in jenem Zusammenbruch des Fortschrittsparadigmas, der sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, vor allem in den 1870er Jahren vollzog.5 Diese Feststellung führt unmittelbar zum Thema dieser Abhandlung. Denn auch die Anfänge jener sozialwissenschaftlichen Wende seit den l880er Jahren, mit der in Europa eine neue Epoche der Kulturwissenschaften begann, das Œuvre von Ferdinand Tönnies (1855–1936), von Georg Simmel (1858–1918), von Emile Durkheim (1858–1917) und von Max Weber (1864–1920), ist konstituiert durch die Kritik am Fortschrittsparadigma. Die »Verwissenschaftlichung der Soziologie« war offenbar ursächlich verknüpft mit dem »Verlust des Fortschrittsglaubens«; »es scheint ...«, so jüngst H. J. Dahme, »als ob gerade das Infragestellen von Fortschritt und die theoretische Verarbeitung dieser Fragestellung für die Entwicklung der modernen Soziologie konstitutiv war«.6 Die Bedeutung des Vorgangs liegt dabei darin, daß die Kritik am Fortschritt als 6
7
5 Heinz Jürgen Dahme, Der Verlust des Fortschrittsglaubens und die Verwissenschaftlichung der Soziologie. Ein Vergleich von Georg Simmel, Ferdinand Tönnies und Max Weber, in: Simmel und die frühen Soziologen. Nähe und Distanz zu Durkheim, Tönnies und Max Weber. Hrsg. v. Otthein Rammstedt. Frankfurt am Main. 1988, 222–274. Vgl. auch Klaus Christian Köhnke, Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus. Die deutsche Universitätsphilosophie zwischen Idealismus und Positivismus. Frankfurt am Main 1986, 327ff. Dieser Zusammenbruch des Fortschrittsparadigmas drückt sich überaus deutlich auch in der Kunst aus: Franz Zelger, Arnold Böcklin. Die Toteninsel. Selbstheroisierung und Abgesang der abendländischen Kultur. Frankfurt am Main 1991. 6 Dahme, Der Verlust des Fortschrittsglaubens (wie Anm. 5), 233. Darin liegt auch der Gegensatz zur älteren Soziologie eines Marx, Comte und
50
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
Kritik an der Moderne, an der modernen Gesellschaft, an der modernen Kultur hier nicht wie bei Jacob Burckhardt in einer »pessimistischen Gegenwartsanalyse« endete, sondern daß vielmehr die »Skepsis gegenüber der eigenen gesellschaftlichen Gegenwart« transformiert wurde in neue wissenschaftliche Konzepte und Fragestellungen, die denn auch weitgehend bei allen genannten Autoren begegnen: die Definition des Gegenstands der Soziologie; der Entwurf einer neuen Auffassung von Wissenschaft und wissenschaftlicher Erkenntnis; das Interesse an Religion als einem »Sinnstiftungs- und Deutungssystem, das notwendige, aber andere Funktionen erfüllt als z.B. das Wissenschaftssystem«.7 Der vergleichende Blick auf die Klassiker des soziologischen Denkens, die zugleich eine Neuorientierung der Kulturwissenschaften im Ganzen heraufgeführt haben, soll im Folgenden erweitert werden durch einige Hinweise auf Sachverhalte, die in den bisherigen Erörterungen nicht berücksichtigt wurden. Sie betreffen erstens die Tatsache, daß auch bei den genannten vier Autoren, wie bei Burckhardt, die Reflexion über die Moderne aufs engste verknüpft ist mit der Reflexion über das Mittelalter, daß auch hier Moderne und Mittelalter in einer polaren Spannung gedacht werden, welche die Entfaltung der Urteile über die Moderne wesentlich steuert, – und umgekehrt.8 Zweitens ist darauf zu achten, daß auch hier überall die Frage nach der Gesellschaft formuliert wird als Frage nach den Gruppen, denen das Individuum zugehört, als Frage nach dem Verhältnis von Individuum und Gruppe. Und eben dies ist es, was sich in einer Form vollzieht, die ihrerseits konstituiert ist durch die mitgedachte Polarität von Mittelalter und Moderne. 8
9
II. Mittelalterliche Gemeinschaft und moderne Gesellschaft: Ferdinand Tönnies Die Darstellung hat mit F. Tönnies zu beginnen, nicht nur, weil er der Älteste der in Frage stehenden Soziologengeneration ist. Wichtiger ist, daß Spencer und deren »linearem Fortschrittskonzept« (ebd.). Hier auch das folgende Zitat. 7 Heinz Jürgen Dahme/Otthein Rammstedt, Die zeitlose Modernität der soziologischen Klassiker. Überlegungen zur Theoriekonstruktion von Emile Durkheim, Ferdinand Tönnies, Max Weber und besonders Georg Simmel, in: Georg Simmel und die Moderne. Hrsg. v. Dens. Frankfurt am Main 1984, 449–478, 456ff.; das Zitat 461. 8 Über dieses Problem anhand eines aktuellen Beispiels: Otto Gerhard Oexle, Luhmanns Mittelalter, in: Rechtshistorisches Journal 10, 1991, 53–66. Wie wenig das Problem anerkannt und überhaupt erkannt wird, zeigt die Replik auf diesen Beitrag: Niklas Luhmann, Mein »Mittelalter«, ebd. 66–70.
51
OTTO GERHARD OEXLE
er in seinem Werk den Gegensatz von Mittelalter und Moderne im Zeichen der Problematik von Individuum und Gruppe zuerst und mit größter Prägnanz formuliert und damit die weiteren Erörterungen des Themas aufs stärkste geprägt hat. Es handelt sich um jenen systematischen Traktat mit dem Titel ›Gemeinschaft und Gesellschaft‹, dessen erster Entwurf von 1880/81 datiert9 , der in erster Auflage 1887 erschien10 , worauf 1912 eine zweite11 und in der Folge bis zum Tode des Autors noch sechs weitere Auflagen folgten. Tönnies bezeichnete sein Buch als den »Versuch einer neuen Analyse der Grundprobleme des sozialen Lebens«.12 Das Werk gilt als der Beginn der Soziologie in Deutschland13 , ja sogar als einer der »Ursprungsorte« der modernen Soziologie überhaupt.14 Der Verfasser hat sein Buch allerdings nicht für Soziologen oder Historiker geschrieben: »Das Werk war für Philosophen bestimmt«, wie er später feststellte.15 Es handelt sich um eine Analyse und Kritik der Gegenwart und »der ganzen neuzeitlichen Epoche«, als deren »unterscheidendes Merkmal« der »Rationalismus und die rationale Mechanisierung der Produktion, ja der ›Welt‹« im Ganzen bestimmt wird.16 Mit dem Begriffspaar ›Gemeinschaft‹ und ›Gesellschaft‹ stellte der Verfasser »zwei Typen sozialer Verhältnisse« einander gegenüber, wurzelnd in »zwei Typen individueller Willensgestaltungen«.17 ›Gesellschaft‹ galt ihm dabei als Inbegriff aller »rationalen Rechtsverhältnisse« und 10
11
12
13
14
15
16
17
18
9 Alfred Bellebaum, Ferdinand Tönnies, in: Klassiker des soziologischen Denkens, Bd. 1: Von Comte bis Durkheim. Hrsg. v. Dirk Käsler. München 1976, 232–266, 235ff. Vgl. Cornelius Bickel, Ferdinand Tönnies. Soziologie als skeptische Aufklärung zwischen Historismus und Rationalismus. Opladen 1991, 58ff. 10 Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und Socialismus als empirischer Culturformen. Leipzig 1887. Über die Theorie der Moderne bei Tönnies: Arthur Mitzman, Sociology and Estrangement. Three Sociologists of Imperial Germany. New Brunswick/Oxford 1987, 39ff. Treffend nannte A. Mitzman, Tönnies und German Society (s. u. Anm. 31, 507) Tönnies »one of the key fi gures in the history of german social thought«. 11 Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie. Nachdruck Darmstadt 1972. 12 Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887 (wie Anm. 10), XVII. 13 Bellebaum, Ferdinand Tönnies (wie Anm. 9), 262. 14 Cornelius Bickel, Ferdinand Tönnies’ Weg in die Soziologie, in: Simmel und die frühen Soziologen (wie Anm. 5), 86–162, 115. Über Umformungen und Wirkungen des ›Gemeinschafts‹-Theorems in der modernen Soziologie Robert A. Nisbet, The Sociological Tradition. London 1967, 47ff. 15 Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, 1912 (wie Anm. 11), XXVI. 16 Ebd. XXXVII. 17 Ebd. XXXV.
52
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
aller (diesen zugrundeliegenden) »rationalen Sozialverhältnisse«, die auf »Kontrakten«, auf »Verträgen der Individuen« beruhen und deshalb »künstlich« sind. »Aber keineswegs lassen sich alle rechtlichen Verhältnisse und Verbindungen nach dieser Formel konstruieren; gerade die ursprünglichen, immer fortwirkenden, familienhaften nicht«18 , die Gemeinschaften also. Menschliches Zusammenwirken wird somit unter zweierlei Formen begreifbar: »entweder als reales und organisches Leben ... – dies ist das Wesen der Gemeinschaft, oder als ideelle und mechanische Bildung – dies ist der Begriff der Gesellschaft ... Alles vertraute, heimliche, ausschließliche Zusammenleben ... wird als Leben in Gemeinschaft verstanden. Gesellschaft ist die Öffentlichkeit, ist die Welt. In Gemeinschaft mit den Seinen befindet man sich, von der Geburt an, mit allem Wohl und Wehe daran gebunden. Man geht in die Gesellschaft wie in die Fremde«.19 ›Gemeinschaft‹ wird deshalb verstanden »als ein lebendiger Organismus, Gesellschaft als ein mechanisches Aggregat und Artefact«.20 »Gemeinschaftliches Leben ist gegenseitiger Besitz und Genuß, und ist Besitz und Genuß gemeinsamer Güter«.21 Gemeinschaft realisiert sich als »Gemeinschaft des Blutes, als Einheit des Wesens, entwickelt und besondert sich zur Gemeinschaft des Ortes, (die) im Zusammen-Wohnen ihren Ausdruck hat, und diese wiederum zur Gemeinschaft des Geistes als dem bloßen Miteinander-Wirken und Walten in der gleichen Richtung, im gleichen Sinne«.22 Diese Arten der Gemeinschaft hängen unter sich aufs engste zusammen und sind wechselseitig ineinander involviert. Ihre Grundformen sind Verwandtschaft, Nachbarschaft und Freundschaft. »Verwandtschaft hat das Haus als ihre Stätte und gleichsam als ihren Leib; hier ist Zusammenwohnen unter einem schützenden Dache; gemeinsamer Besitz und Genuß der meisten Dinge, insonderheit Ernährung aus demselben Vorrate, Zusammensitzen an demselben Tische; hier werden die Toten als unsichtbare Geister verehrt, ... – Nachbarschaft ist der allgemeine Charakter des Zusammenlebens im Dorfe, wo die Nähe der Wohnstätten, die gemeinsame Feldmark oder auch bloß die Begrenzung der Äkker, zahlreiche Berührungen der Menschen, Gewöhnung aneinander und vertraute Kenntnis voneinander verursacht; gemeinsame Arbeit, Ordnung, Verwaltung notwendig macht; ... – Freundschaft wird von Verwandtschaft und Nachbarschaft unabhängig als Bedingung und Wirkung einmütiger Arbeit und Denkungsart; daher durch Gleichheit und Ähnlichkeit des Berufes oder der Kunst am ehesten gegeben. 19
20
21
22
23
18 Ebd. 19 Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887 (wie Anm. 10), 3f. 20 Ebd. 5. 21 Ebd. 27. 22 Ebd. 16. Das Folgende 16ff.
53
OTTO GERHARD OEXLE
Solches Band muß aber doch durch leichte und häufige Vereinigung geknüpft und erhalten werden, wie solche innerhalb einer Stadt am meisten Wahrscheinlichkeit hat; und die so durch Gemeingeist gestiftete, gefeierte Gottheit hat hier eine ganz unmittelbare Bedeutung für die Erhaltung desselben (sc. des Bandes), da sie allein oder doch vorzugsweise ihm eine lebendige und bleibende Gestalt gibt«. Die Stadt wiederum erscheint Tönnies als ein Gefüge von Gemeinschaften: »Innerhalb der Stadt aber treten, als ihre eigentümlichen Erzeugnisse oder Früchte, wiederum hervor: die Arbeits-Genossenschaft, Gilde oder Zunft; und die Kultgenossenschaft, Brüderschaft, die religiöse Gemeinde: diese zugleich der letzte und höchste Ausdruck, dessen die Idee der Gemeinschaft fähig ist«.23 Haus und Familie, Dorf und Stadt, Gilde, Zunft und Bruderschaft sind für Tönnies die grundlegenden Gestaltungsformen von Gemeinschaft und sie sind deshalb »die bleibenden Typen des realen und historischen Lebens überhaupt«, gekennzeichnet durch »den sozialen Willen als Eintracht, Sitte, Religion«.24 Ist ›Gemeinschaft‹ das Verbunden-Sein »trotz aller Trennungen«, so ist ›Gesellschaft‹ demgegenüber das Getrennt-Bleiben »trotz aller Verbundenheiten«.25 Gesellschaft ist ein durch »Konvention und Naturrecht« geschaffenes »Aggregat«, von Tönnies begriffen als »eine Menge von natürlichen und künstlichen Individuen, deren Willen und Gebiete in zahlreichen Beziehungen zueinander und in zahlreichen Verbindungen miteinander stehen, und doch voneinander unabhängig und ohne gegenseitige innere Einwirkungen bleiben«; in der Gesellschaft ist »ein jeder für sich allein, und im Zustande der Spannung gegen alle übrigen. Die Gebiete ihrer Tätigkeit und ihrer Macht sind mit Schärfe gegeneinander abgegrenzt, so daß jeder dem anderen Berührungen und Eintritt verwehrt, als welche gleich Feindseligkeiten geachtet werden. Solche negative Haltung ist das normale und immer zugrunde liegende Verhältnis dieser Macht-Subjekte gegeneinander, und bezeichnet die Gesellschaft im Zustande der Ruhe. Keiner wird für den anderen etwas tun und leisten, keiner dem anderen etwas gönnen und geben wollen, es sei denn um einer Gegenleistung oder Gegengabe willen, welche er seinem Gegebenen wenigstens gleich achtet«.26 Gesellschaft ist also gekennzeichnet durch Warenproduktion und Warentausch, durch den Gebrauch des Geldes, durch Handel und Verkehr, durch Markt, und »Kontrakt«, d. h. den »Tausch als gesellschaftlichen Akt«.27 ›Gesellschaft‹ bedeutet also auch Differenzierung, Arbeitsteilung, Rationalität, das Vorherrschen der Zwecke, die 24
25
26
27
28
23 Ebd. 27. 24 Ebd. 282 und 289. 25 Ebd. 46. 26 Ebd. 60 und 46. 27 Ebd. 54.
54
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
Auflösung ›gemeinschaftlicher‹ Bindungen, den Verlust von Bindungen, Solidaritäten und Normen überhaupt. Die typischste Erscheinungsform von ›Gesellschaft‹ ist die Steigerung der Stadt zur »Großstadt«. 28 Die Großstadt – als Handelsstadt, Fabrikstadt, Hauptstadt oder Weltstadt – ist »typisch für die Gesellschaft schlechthin«: »je allgemeiner der gesellschaftliche Zustand in einer Nation oder in einer Gruppe von Nationen wird, desto mehr tendiert dieses gesamte ›Land‹ oder diese ganze ›Welt‹ dahin, einer einzigen Großstadt ähnlich zu werden«. An die Stelle von »Eintracht, Sitte, Religion« treten hier »Konvention, Politik, öffentliche Meinung«.29 Kennzeichnend ist vor allem die Ablösung gemeinschaftlicher »Sitte und Religion« durch die gesellschaftliche »Konvention«, welcher nur der »Schein der Sittlichkeit« eignet.30 Und aus dieser Feststellung leitete Tönnies eine Aufgabe für den modernen Staat ab. Denn es sei doch evident, daß »irgendwelche vermehrte Erkenntnis« die Menschen nicht »freundlicher, unegoistischer, genügsamer« mache, und ebenso, daß »abgestorbene Sitte und Religion nicht durch irgendwelchen Zwang oder Unterricht ins Leben zurückgerufen werden könne«. Deshalb müsse der Staat, »um sittliche Mächte und sittliche Menschen zu machen und wachsen zu lassen«, die Bedingungen dafür schaffen oder zumindest »die entgegengesetzten Kräfte aufheben«. Deshalb forderte Tönnies 1887 die »Vernichtung« der Gesellschaft durch den Staat: »Der Staat, als die Vernunft der Gesellschaft, müßte sich entschließen, die Gesellschaft zu vernichten«.31 Die Beispiele für die historischen Realisierungen von ›Gemeinschaft‹ und von ›Gesellschaft‹ deuten nun bereits darauf hin, daß mit der Gegenüberstellung der beiden Typen sozialer Verhältnisse nicht nur eine aktuelle Beurteilung der modernen Gesellschaft gemeint war, sondern daß Tönnies dieses Urteil auf eine historische Theorie und eine Deutung der Geschichte gründete und ihm damit eine eigentümliche Dynamik vermittelte. »Zwei Zeitalter«, so schreibt Tönnies am Ende seines Buches von 1887, »stehen ... in den großen Kulturentwicklungen einander gegenüber: 29
30
31
32
28 Ebd. 282ff. 29 Ebd. 289. 30 Ebd. 286. 31 Ebd. 287. Der Passus wurde in der zweiten Auflage von 1912 (s. Anm. 11, 249) geändert und dabei zugleich gemildert und verschärft: »Der Staat, als die Vernunft der Gesellschaft, müßte sich entschließen, die Gesellschaft zu vernichten, oder doch umgestaltend zu erneuern. Das Gelingen solcher Versuche ist außerordentlich unwahrscheinlich«. Zu den Unterschieden zwischen der ersten und der zweiten Auflage von ›Gemeinschaft und Gesellschaft‹ Arthur Mitzman, Tönnies and German Society, 1887–1914: From Cultural Pessimism to Celebration of the Volksgemeinschaft, in: Journal of the History of Ideas 32, 1971, 507–524.
55
OTTO GERHARD OEXLE
ein Zeitalter der Gesellschaft folgt einem Zeitalter der Gemeinschaft«.32 Es handelt sich hierbei im wesentlichen um eine Gegenüberstellung von Mittelalter und Moderne. Mit ihrer Hilfe wollte Tönnies »die Strömungen und Kämpfe verstehen, welche von den letzten Jahrhunderten aus bis in das gegenwärtige Zeitalter und über dessen Grenzen hinaus sich erstrekken«.33 Das Mittelalter geriet Tönnies dabei zur Idealgestalt sozialer Verhältnisse: »Ohne zur Gläubigkeit und zum Feudalismus zurückkehren zu wollen«, wollte er doch im Mittelalter »das Vorwalten einer positiven und organischen Ordnung« erkennen, während an der Neuzeit – »ohne doch Wissenschaft, Aufklärung, Freiheit zu verleugnen« – ihr wesentlich »negativer und revolutionärer Charakter« kritisiert wird.34 ›Gemeinschaft‹ ist also nicht nur der ältere, sondern auch der höher stehende Typus sozialer Verhältnisse. ›Gesellschaft‹ ist für Tönnies infolgedessen schließlich nur »der gesetzmäßig-normale Prozeß des Verfalls aller ›Gemeinschaft‹«.35 Die Neuzeit galt ihm zwar einerseits als die »Fortsetzung des Mittelalters«, insofern nach seiner Auffassung »alles das, was wir als Kulturfortschritt kennen und so oft gepriesen finden«, irgendwie im Mittelalter wurzelt: »Zunahme und Verdichtung der Bevölkerung, besonders der Städte, hohe Entwicklung des Handels, der die Erdteile verbindet, Aufkommen der großen Industrie, gewaltiger Fortschritt der Wissenschaft, und im Zusammenhange damit der Technik; Vermehrung und Verfeinerung der Bedürfnisse, der Lebensweisen, der Sitten – weitere Entfernung von der Roheit, Armut und Einfalt ursprünglichen Volkslebens«. Aber: die Neuzeit »ist außerdem, und in dem, etwas ganz anderes im Verhältnis zum Mittelalter. Sie enthält und bedeutet eine Umkehr, eine Umwälzung und Erneuerung, ein neues Prinzip, wodurch der Unterschied zum 33
34
35
36
32 Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887 (wie Anm. 10), 288f. 33 Ebd. 294. 34 Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, 1912 (wie Anm. 11), XXXI. 35 Ferdinand Tönnies, Soziologische Studien und Kritiken. Erste Sammlung. Jena 1925, 71. Tönnies wollte mit diesem Urteil explizit an Karl Marx’ ökonomische Kritik der Moderne anknüpfen, den er als den »merkwürdigsten und tiefsten Sozialphilosophen« würdigte (1887, wie Anm. 10, XXVII) und neben H. Maine (›Ancient Law‹, 1861) als einen seiner Haupt-Anreger bezeichnete. Es ist deshalb keineswegs ein »ideologisches Mißverständnis« der Gedanken von Tönnies, wenn man seine Gegenüberstellung von ›Gemeinschaft‹ und ›Gesellschaft‹ »mit positiven und negativen Wertungen« versieht, wie Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918, Bd. 1: Arbeitswelt und Bürgergeist. München 1990, 670, behauptet. Tönnies selbst hat diese Wertung von Moderne und Vormoderne unendlich oft vorgetragen. Man vergleiche dazu auch seine Äußerungen aus der Zeit nach 1918: Oexle, Das Mittelalter und das Unbehagen an der Moderne (s. u. Anm. 39).
56
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
Gegensatz wird. Die Neuzeit ist die Revolution – nicht nur im politischen, sondern in jedem Sinne«, so Tönnies 1913. Deshalb tragen für Tönnies »alle Gebilde der Neuzeit« (und er meinte damit vor allem die Moderne seit dem Ende des 18. Jahrhunderts) »mehr oder minder und, je neuer desto mehr, ... die Züge des Unlebendigen in und an sich. Es sind mechanische Gebilde: sie haben keinen Wert, außer in bezug auf ihren Zweck, den äußeren Vorteil, den sie gewähren, sie entspringen der kalten kalkulierenden Vernunft: der Nutzen ist ... das große Idol der Zeit. Eben darin liegt auch die überwältigende Größe dieser Gebilde; sie stellen in der Tat Triumphe des menschlichen Geistes dar. Nicht ohne Grund sind wir stolz auf diese mächtige europäische Zivilisation des 19. und 20. Jahrhunderts, unter der wir doch leiden und seufzen. Sie hat unserem Leben vieles geraubt: Ruhe, Würde, Sinnigkeit und gar viel von der stillen Schönheit, die wir hie und da noch in einem Dorfe oder einer kleinen Stadt ahnend empfinden«, – obwohl sie zugleich »unser Gedankenleben und dadurch auch unser Gemütsleben mit ungeheuren Spannungen erfüllt, ... weil wir den großen intellektuellen Genuß haben, weiter zu schauen, als je ein Zeitalter vor uns vermochte«. Aber gleichwohl ist Tönnies’ Gesamturteil über die Moderne im Zeichen des Gegensatzes von ›Gemeinschaft‹ und ›Gesellschaft‹ völlig eindeutig: »Die moderne Kultur ist in einem unaufhaltsamen Zersetzungsprozeß begriffen. Ihr Fortschritt ist ihr Untergang«.36 Tönnies’ Buch von 1887 deutete und kritisierte die eigene Zeit in jenem historischen Moment, in dem das Fortschrittspathos der vorangegangenen Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts zerrann und in dem die zunehmende Rationalisierung und Differenzierung, die Verwissenschaftlichung und Technisierung, die Positivierung und Historisierung der Welt von vielen als zunehmend unerträglich, ja als ein Unglück empfunden wurden.37 Aus diesem Grunde erwies sich Tönnies Jugendwerk von 1887 nicht nur als ein außerordentlich erfolgreiches, sondern auch als ein außerordentlich folgenreiches Buch. Auf den mit dem Begriffsgegensatz von Gemeinschaft und Gesellschaft verbundenen Wertungen beruhte die ungewöhnliche Wirkung und die rasche Vulgarisierung des Theorems von Tönnies in Deutschland während der folgenden Jahrzehnte, seit 1890 und vor allem seit 1918, innerhalb der Kulturwissenschaften wie in der Öffentlichkeit. Vor allem der Begriff der ›Gemeinschaft‹ wurde hier, wie Theodor Geiger schon 1931 scharfblickend feststellte, in pragmatischer 37
38
36 Ferdinand Tönnies, Individuum und Welt in der Neuzeit, in: Weltwirtschaftliches Archiv 1, 1913, 37–66, 37 und 66. 37 Vgl. Otto Gerhard Oexle, ›Historismus‹. Überlegungen zur Geschichte des Phänomens und des Begriffs, in: Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft. Jahrbuch 1986, 119–155, 125ff. und Annette Wittkau, Historismus. Zur Geschichte des Begriffs und des Problems. Göttingen 1992, 59ff.
57
OTTO GERHARD OEXLE
Umdeutung »zur Parole einer kulturell-gesellschaftlichen Wiedergeburt im Kampf gegen die bürgerliche Zivilisation des 19. Jahrhunderts«, zum »Kampfruf jener Elemente des Bürgertums, die der sozialen Revolution mißtrauten, aber der angeblich erstarrten Formen überdrüssig waren«.38 Es war die Parole der sogenannten »konservativen Revolution«, die an das Theorem von ›Gemeinschaft‹ und ›Gesellschaft‹ anknüpfte und die sich deshalb schon am Beginn der zwanziger Jahre vielfach zugleich mit dem Begriff des ›Neuen Mittelalters‹ verband.39 39
40
III. Der Verlust des Mittelalters und der Preis der Moderne: Georg Simmel Nur kurze Zeit nach dem Erscheinen von Tönnies’ Werk und noch am Ende der 1880er Jahre begann G. Simmel mit der Arbeit an seiner Theorie und Philosophie der Moderne.40 Er hat sie 1900 unter dem Titel ›Philosophie des Geldes‹ veröffentlicht.41 Das Geld ist für Simmel das deutlichste Symbol, das typischste Kennzeichen der »modernen Kultur«, der »modernen Zeit«, des »modernen Lebens«. Denn das Geld verweise am deutlichsten darauf, daß der moderne Mensch »die Wirklichkeit, die konkrete, historische, erfahrbare Erscheinung der Welt«, in einem »absoluten Fluß« erfährt. Das Geld repräsentiert für Simmel den »absoluten Bewegungscharakter der Welt«, die ständige Veränderung und 41
42
38 Theodor Geiger, Art. ›Gemeinschaft‹, in: Handwörterbuch der Soziologie. Hrsg. v. Alfred Vierkandt. Stuttgart 1931, 173–180, hier 175. 39 Dazu Otto Gerhard Oexle, Das Mittelalter und das Unbehagen an der Moderne. Mittelalterbeschwörungen in der Weimarer Republik und danach, in: Spannungen und Widersprüche. Gedenkschrift für František Graus. Sigmaringen 1992, 125–153. 40 Über Simmels Philosophie der Moderne: David Frisby, Fragments of Modernity. Theories of Modernity in the work of Simmel, Kracauer and Benjamin. Cambridge/Oxford 1985, 38ff.; Ders., Soziologie und Moderne: Ferdinand Tönnies, Georg Simmel und Max Weber, in: Simmel und die frühen Soziologen (wie Anm. 5), 196–221. Zu Simmel neuerdings Heinz Jürgen Dahme, Soziologie als exakte Wissenschaft. Georg Simmels Ansatz und seine Bedeutung in der gegenwärtigen Soziologie. 2 Bde., Stuttgart 1981; außerdem die beiden Sammelbände ›Georg Simmel und die Moderne‹ (wie Anm. 7) und ›Simmel und die frühen Soziologen‹ (wie Anm. 5) sowie zuletzt François Leger, La pensée de Georg Simmel. Contribution à l’histoire des idées en Allemagne au début du XXE siècle. Paris 1989. 41 Georg Simmel, Philosophie des Geldes (Gesammelte Werke, Bd. 1). Berlin 1977. Dazu zuletzt Leger, La pensée de Georg Simmel (wie Anm. 40), 43ff. und 83ff.
58
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
Bewegung, den Übergang, die »Nicht-Dauer«,42 es repräsentiert den modernen »Heraklitismus«, wie er sich auch in der Kunst der Moderne ausdrücke.43 Das Geld ist »nichts als Träger einer Bewegung, in dem eben alles, was nicht Bewegung ist, völlig ausgelöscht ist, es ist sozusagen actus purus, es lebt in kontinuierlicher Selbstentäußerung aus jedem gegebenen Punkt heraus und bildet so den Gegenpol und die direkte Verneinung jedes Fürsichseins«.44 Dieser Sachverhalt wird auch von Simmel erörtert in der Gegenüberstellung von Mittelalter und Moderne. Und wiederum geht es um das Problem der Freiheit und der Bindung des Individuums. Denn das Geld hat »eine ganz neue Proportion zwischen Freiheit und Bindung« entstehen lassen. Es ist einerseits »Mittel und Rückhalt der persönlichen Freiheit«, es bewirkt und bedeutet deshalb die »Herausarbeitung des Individuellsten«, die »Unabhängigkeit der Person« und die »Selbständigkeit ihrer Ausbildung«, – zugleich aber auch deren »Nivellierung« und »Ausgleichung« und »die Herstellung immer umfassenderer sozialer Kreise durch die Verbindung der Entlegensten unter gleichen Bedingungen«.45 Es bewirkt und bedeutet ferner auch eine »unvergleichliche Objektivität« in den »sachlichen Lebensinhalten«. Denn »in der Technik, den Organisationen jeder Art, den Betrieben und Berufen gelangen mehr und mehr die eigenen Gesetze der Dinge zur Herrschaft und befreien sie von der Färbung durch Einzelpersönlichkeiten«. Dieser Sachverhalt sei genuin neuzeitlich. Die Neuzeit sei es, die »Subjekt und Objekt« in dieser Weise »gegeneinander verselbständigt« habe.46 Gerade darin zeige sich aber nun der Gegensatz zwischen der im Zeichen der Geldwirtschaft konstituierten Moderne zu den »naturalwirtschaftlichen Zeiten«, zum Mittelalter. Denn »im Mittelalter findet sich der Mensch in bindender Zugehörigkeit zu einer Gemeinde oder zu einem Landbesitz, zum Feudalverband oder zur Korporation; seine Persönlichkeit war eingeschmolzen in sachliche oder soziale Interessenkreise, und die letzteren wiederum empfingen ihren Charakter von den Personen, die sie 43
44
45
46
47
42 Simmel, Philosophie des Geldes (wie Anm. 41), 582f. 43 So bei Rodin: dazu Georg Simmel, Rembrandt. Ein kunstphilosophischer Versuch (1916). Nachdruck München 1985, 130ff., bes. 134f. Vgl. auch J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, Simmel und Rodin, in: Ders., Epochengrenzen und Kontinuität. Studien zur Kunstgeschichte. München 1985, 289– 305. 44 Simmel, Philosophie des Geldes (wie Anm. 41), 583. 45 Georg Simmel, Das Geld in der modernen Kultur (1896), in: Ders., Schriften zur Soziologie. Eine Auswahl. Hrsg. und eingeleitet von Heinz Jürgen Dahme und Otthein Rammstedt. Frankfurt am Main 1983, 78–94, 82f. 46 Ebd. 78.
59
OTTO GERHARD OEXLE
unmittelbar trugen. Diese Einheitlichkeit hat die neuere Zeit zerstört«.47 Simmel verdeutlicht dies an dem Gegensatz zwischen der mittelalterlichen Zunft (Korporation) und der modernen Assoziation48: »Die mittelalterliche Korporation schloß den ganzen Menschen in sich ein; eine Zunft der Tuchmacher war nicht eine Assoziation von Individuen, welche die bloßen Interessen der Tuchmacherei pflegte, sondern eine Lebensgemeinschaft in fachlicher, geselliger, religiöser, politischer und vielen sonstigen Hinsichten. Um so fachliche Interessen sich die mittelalterliche Assoziation auch gruppieren mochte, sie lebte doch ganz unmittelbar in ihren Mitgliedern, und diese gingen restlos in ihr auf. Im Gegensatz zu dieser Einheitsform hat nun die Geldwirtschaft jene unzähligen Assoziationen ermöglicht, die entweder von ihren Mitgliedern nur Geldbeträge verlangen oder auf ein bloßes Geldinteresse hinausgehen. Dadurch wird einerseits die reine Sachlichkeit in den Vornahmen der Assoziation, ihr rein technischer Charakter, ihre Gelöstheit von personaler Färbung ermöglicht, andererseits das Subjekt von einengenden Bindungen befreit, weil es jetzt nicht mehr als ganze Person, sondern in der Hauptsache durch Hingeben und Empfangen von Geld mit dem Ganzen verbunden ist«.49 Oder noch einmal in anderer Formulierung: Im Gegensatz zur mittelalterlichen Korporation als einem ganzheitlichen Lebensverband biete die moderne Assoziation als ein partikulärer Zweckverband dem Individuum die Möglichkeit, »objektive Zwecke« zu fördern oder zu genießen, ohne daß diese »Verbindung irgendeine Bindung mit sich brächte«. Denn das Geld »hat den Zweckverband zu seinen reinen Formen entwickelt, jene Organisationsart, die sozusagen das Unpersönliche an den Individuen zu einer Aktion vereinigt und uns die Möglichkeit gelehrt hat, wie sich Personen unter absoluter Reserve alles Persönlichen und Spezifischen vereinigen können«.50 Man erkennt also, wie auch Simmel in seiner ›Philosophie des Geldes‹ die Moderne über deren Gegensatz zum Mittelalter definiert und dabei zugleich über den Gegensatz unterschiedlicher Formen der Gruppenbildung, den Gegensatz von ›Korporation‹ und ›Assoziation‹ präzisierend zu beschreiben versucht.51 48
49
50
51
52
47 Ebd. 48 Zu dieser Problemkonstellation des Gegensatzes von ›Korporation‹ und ›Assoziation‹ seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert und deren Gestaltung und Umgestaltung im 19. und 20. Jh. Otto Gerhard Oexle, Die mittelalterliche Zunft als Forschungsproblem. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte der Moderne, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 118, 1982, 1–44, 18ff., 22ff. u. ö. 49 Simmel, Das Geld in der modernen Kultur (wie Anm. 45), 79f. 50 Georg Simmel, Philosophie des Geldes, in: Das freie Wort 1, 1901/02, 170– 174, 172; wieder in: Ders., Philosophie des Geldes (Gesamtausgabe, Bd. 6). Frankfurt am Main 1989, 721. 51 Diese Prägung des Gegensatzes von ›Korporation‹ und ›Assoziation‹ geht wesentlich auf F. J. Stahl zurück, s. Oexle, Die mittelalterliche Zunft als
60
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
In diesem Interesse an dem Problem von Freiheit und Bindung des Individuums und an den unterschiedlichen Formen der Bindung in Gruppen – in Mittelalter und Moderne gegensätzlich verstanden – wurzelt auch Simmels Programm einer Soziologie, deren Grundeinsicht ist, daß »der Mensch ... in seinem ganzen Wesen und allen Äußerungen dadurch bestimmt (ist), daß er in Wechselwirkung mit anderen Menschen lebt«, und deren Grundproblem deshalb die Frage nach den »Formen der Vergesellschaftung« darstellt.52 Dies kann hier nur andeutend benannt werden.53 Es ist dies das Thema von Simmels sogenannter ›großer‹ Soziologie von 1908. Sie interessiert sich für die Beziehungen und Formen, in denen die Menschen sich vergesellschaften, für die »in unzähligen verschiedenen Arten sich verwirklichende Form«, in der die Individuen auf Grund ihrer Interessen »zu einer Einheit zusammenwachsen und innerhalb deren diese Interessen sich verwirklichen«. Als ›Gesellschaft‹ wird dabei zum einen verstanden der »Komplex vergesellschafteter Individuen« im Ganzen, zum anderen auch »die Summe jener Beziehungsformen, vermöge deren aus den Individuen eben die Gesellschaft im ersten Sinne wird«.54 Das Phänomen der ›Gesellschaft‹ wird also wesentlich über soziale Gruppen definiert. So deutlich Simmel in seiner Theorie der Formen der Vergesellschaftung auch den schlichten Gegensatz von (mittelalterlicher) ›Gemeinschaft‹ und (moderner) ›Gesellschaft‹ hinter sich läßt und so wenig er Tönnies’ Wunsch nach einer »Vernichtung« der modernen Gesellschaft teilt, – auch Simmels Beurteilung der Moderne und der modernen Kultur ist deutlich pessimistisch.55 Denn er akzentuiert den Gegensatz zwischen der objektiv gegebenen Zunahme der dinglichen Kulturgüter (»Geräte, Verkehrsmittel, die Produkte der Wissenschaft, der Technik, 53
54
55
56
Forschungsproblem (wie Anm. 48), 20ff., obwohl inzwischen O. Gierke in seinen Darlegungen über die (mittelalterliche) ›Einung‹, die (frühneuzeitliche) ›Korporation‹ und die (moderne) ›Assoziation‹ Terminologie wie Wahrnehmung der Geschichte sozialer Gruppen völlig verändert hatte, s. ebd. 25ff. und 28ff. Vgl. auch Otto Gerhard Oexle, Otto von Gierkes ›Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft‹. Ein Versuch wissenschaftsgeschichtlicher Rekapitulation, in: Deutsche Geschichtswissenschaft um 1900. Hrsg. v. Notker Hammerstein. Stuttgart 1988, 193–217. 52 Georg Simmel, Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung (Gesammelte Werke, Bd. 2). 5. Aufl. Berlin 1968. Das Zitat ebd. 2. 53 Vgl. Antonius M. Bevers, Dynamik der Formen bei Georg Simmel. Eine Studie über die methodische und theoretische Einheit eines Gesamtwerkes (Sozialwissenschaftliche Abhandlungen der Görres-Gesellschaft, Bd. 13). Berlin 1985. 54 Simmel, Soziologie (wie Anm. 52), 5 und 8. 55 Frisby, Soziologie und Moderne (wie Anm. 40), 207ff.
61
OTTO GERHARD OEXLE
der Kunst«) auf der einen Seite, während auf der anderen Seite die »subjektive Kultur«, die »Kultur der Individuen ... keineswegs in demselben Verhältnis vorgeschritten, ja vielfach sogar zurückgegangen« sei.56 Dieser Pessimismus ist, wie bei Tönnies, so auch bei Simmel begründet in einer historischen Reflexion über den Gegensatz von Moderne und Mittelalter. 57
IV. Mit der Korporation des Mittelalters gegen die Anomien der Moderne: Emile Durkheim Auch im Œuvre von E. Durkheim findet sich die Reflexion über diesen Gegensatz in prominentem Zusammenhang: in Durkheims Buch ›De la division du travail social‹ (›Über soziale Arbeitsteilung‹) von 1893, dessen wichtigste Intentionen Durkheim im Vorwort zur zweiten Auflage des Werkes von 1902 zusätzlich verdeutlicht hat.57 Thema des Buches ist die rechtliche und moralische »Anomie«58, also die Willkür und Regellosigkeit des modernen Lebens, insbesondere des wirtschaftlichen Lebens der Moderne. Durkheim beklagte den rudimentären Zustand vor allem der Berufsmoral (»morale professionnelle«) und verwies deshalb auf die Bedeutung berufsspezifischer Gruppen in der Geschichte. »Damit die Anomie ihr Ende findet, muß also eine Gruppe existieren oder sich bilden, in der sich das Regelsystem herausbilden kann, das augenblicklich fehlt«; denn ›Anomie‹ entsteht dadurch, daß es an bestimmten Stellen der Gesellschaft an Gruppen fehlt, die konstituiert sind, um das gesellschaftliche Leben zu regeln.59 Die Idealform einer solchen Gruppe ist auch für Durkheim die Zunft, die mittelalterliche Korporation. Die Korporation muß deshalb »wieder« eine »öffentliche Einrichtung« 58
59
60
56 Georg Simmel, Die Arbeitsteilung als Ursache für das Auseinandertreten der subjektiven und der objektiven Kultur (1900), in: Ders., Schriften zur Soziologie (wie Anm. 45), 95–128, 97. 57 Emile Durkheim, De la division du travail social. 11. Aufl. Paris 1986. Die Zitate im Folgenden nach der deutschen Übersetzung: Ders., Über soziale Arbeitsteilung. Frankfurt am Main 1988. Die Empfehlung der vormodernen Korporation als Heilmittel gegen die Übel der Moderne findet sich auch in Durkheims Buch ›Le suicide‹ von 1897. 10. Aufl. Paris 1986, 434ff. 58 Vgl. Steven Lukes, Emile Durkheim. His Life and Work. Stanford/Calif. 1985, 137ff., 265ff.; Philippe Besnard, L’anomie, ses usages et ses fonctions dans la discipline sociologique depuis Durkheim. Paris 1987, 21ff.; Werner Gephart, Strafe und Verbrechen. Die Theorie Emile Durkheims. Opladen 1990. 59 Durkheim, Über soziale Arbeitsteilung (wie Anm. 57), 45f. Ebenso Ders., Le suicide (wie Anm. 57), 440.
62
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
werden – so seine Forderung.60 Die historische Vergangenheit der Korporationen, die ja am Ende des Ancien Regime und in der Revolution beseitigt wurden, sei kein Argument dagegen, im Gegenteil. Es handle sich ja keineswegs darum, »die alten Korporationen, so wie sie im Mittelalter bestanden haben, künstlich wieder ins Leben zu rufen«; und ebensowenig handle es sich darum, zu erfahren, »ob die mittelalterliche Institution in ihrer alten Form zu unseren zeitgenössischen Gesellschaften genau paßt«; vielmehr gehe es darum, festzustellen, ob »die Bedürfnisse, die sie befriedigte, nicht etwa für alle Zeiten gültig sind, und diese Institution sich nur den jeweiligen Gegebenheiten entsprechend« verändern müßte, um ihnen (sc. den modernen Gesellschaften) zu genügen.61 Die Korporation der Antike und vor allem die des Mittelalters war, so argumentierte Durkheim weiter, »die Antwort auf dauerhafte und tiefe Bedürfnisse. Besonders die Tatsache, daß sie, nachdem sie ein erstes Mal (gemeint ist: in der Spätantike) verschwunden war, aus sich selbst heraus und in einer neuen Form wiedererstanden ist (nämlich im Mittelalter), nimmt dem Argument jeden Wert, daß ihr gewaltsames Verschwinden am Ende des vorigen (sc. des 18.) Jahrhunderts als Beweis gelte, daß sie mit den neuen Bedingungen des kollektiven Lebens (nämlich in der Moderne) nicht mehr harmonierte«.62 Die Erinnerung an die mittelalterliche Korporation sei also keineswegs ein »historischer Anachronismus«, vielmehr habe diese »in unserer gegenwärtigen Gesellschaft« eine »bedeutende Rolle« zu spielen. Der Grund dafür lag für Durkheim nicht in dem ökonomischen Nutzen, sondern vor allem in dem »moralischen Einfluß, den sie haben könnte«; Durkheim sah in der Korporation »vor allem die moralische Kraft, die die individuellen Egoismen zügeln« kann und »im Herzen der Arbeiter ein lebhafteres Gefühl ihrer Solidarität erhalten und das Gesetz des Stärkeren daran hindern kann, sich derart brutal auf die gewerblichen und kommerziellen Beziehungen auszuwirken«.63 Die Exemplarität der antiken und vor allem der mittelalterlichen Korporation lag für ihn also darin, daß sie eine »moralische Rolle« gespielt hat, daß sie ein »moralisches Milieu« erzeugt hat, weil sie eine »religiöse Vereinigung«, eine »religiöse Gemeinschaft« (»un collège religieux«) war: »Wie die Familie der Ort war, an dem sich die Moral und das Recht des Hauses entwickelt haben, so ist die Korporation der natürliche Ort, innerhalb dessen sich die professionelle Moral und das professionelle Recht entwickeln mußten«.64 61
62
63
64
65
60 Ders., Über soziale Arbeitsteilung (wie Anm. 57), 47. 61 Ebd. 48. 62 Ebd. 50. Von allen Zerstörungen am Ende des Ancien Régime ist für Durkheim die Auflösung der Zünfte die einzige, »die man bedauern muß«: Le suicide (wie Anm. 57), 439. 63 Durkheim, Über soziale Arbeitsteilung (wie Anm. 57), 51. 64 Ebd. 51ff. und 59.
63
OTTO GERHARD OEXLE
Um »Vorurteile« zu zerstreuen, »und um zu zeigen, daß das korporative System nicht nur eine Institution der Vergangenheit ist«, bemühte sich Durkheim zugleich, wenigstens anzudeuten, welche Wandlungen dieses System »durchmachen muß und kann, um sich den modernen Gesellschaften anzupassen«, und zumindest auch anzudeuten, »auf welche Weise sich das korporative System in der Vergangenheit entwickelte und welches die Ursachen für die hauptsächlichen Veränderungen waren, denen es unterworfen war«; denn dann könne man, »in Kenntnis der Bedingungen, in denen sich die europäischen Gesellschaften heute befinden, mit einiger Sicherheit voraussagen, was aus ihm werden wird«.65 Die dazu notwendigen vergleichenden Studien seien noch nicht unternommen worden und »im Vorübergehen« auch nicht zu bewerkstelligen. Durkheim deutete nur an, daß die Korporation in der Antike einen »eher religiösen und weniger professionellen Charakter« hatte, aber auch durch ihre eher marginale Stellung im Ganzen der Gesellschaft geprägt war. »Einen ganz anderen Platz nahm sie in den Gesellschaften des Mittelalters ein«. Denn von Anfang an »stellt sie den normalen Rahmen jenes Bevölkerungsteils dar, der schließlich eine so bedeutende Rolle im Staat spielen sollte: des Bürgertums oder des Dritten Standes. Denn in der Tat sind Bürger und Handwerker lange Zeit ein und dasselbe«. So seien denn schließlich auch die Korporationen der Handwerker zur »Grundlage der Kommunalverfassung« geworden. Denn die Kommune, die bürgerliche Stadtgemeinde, war »eine Vereinigung der Korporationen«. Auf diese Weise wurde die Korporation die »Grundlage eines ganzen politischen Systems, das aus der Gemeindebewegung hervorgegangen ist«, sie wurde – mit anderen Worten – ein »elementarer Rahmen« für »unsere heutigen Gesellschaften«. Wenn aber, in der Vergangenheit, die Rolle der Korporation um so »lebenswichtiger« wurde, je mehr sich Handel und Gewerbe entwickelten, dann sei es »völlig unwahrscheinlich, daß neue ökonomische Fortschritte die Wirkung haben sollten, ihr jede Daseinsberechtigung zu entziehen«. Durkheim beschloß seine Überlegungen mit Vorschlägen dazu, was die Korporation werden muß, wie sie sich verändern muß, »um ihren Rang unter unseren öffentlichen Institutionen wieder einzunehmen«66 : an die Stelle der kommunalen Korporationen des Mittelalters müsse eine »nationale Korporation« treten, mit vielfältigen und komplexen Kompetenzen, damit sie »zur Basis oder zu einer der wesentlichen Basen unserer politischen Organisation« werden könne, »zum elementaren Bestandteil des Staates ... , zur fundamentalen politischen Einheit«. Denn dies sei die Zukunft der (mittelalterlichen) Korporation in der (modernen) Gesellschaft: »le principal rôle des corporations serait, dans l’avenir comme dans le passé, de régler les fonctions sociales et, plus spécialement, les fonctions économiques, de les tirer, par conséquent, de l’état 66
67
65 Ebd. 60. Die folgenden Zitate 60ff. 66 Ebd. 64ff.
64
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
d’inorganisation où elles sont maintenant«.67 Die mittelalterliche Korporation, die Zunft also, wird die Regellosigkeiten der Moderne regeln, sie wird die moderne Gesellschaft aus dem Zustand der Unordnung herausführen. Von diesem Standpunkt aus erweist es sich auch als konsequent, daß Durkheim sein Programm einer modernen Sozialwissenschaft, nämlich die Erforschung sozialer Gruppen im Hinblick auf die ihnen eigentümlichen Mentalitäten und Denkformen und durch diese, in seinem letzten Buch über ›Les formes élémentaires de la vie religieuse‹ (1912) nicht an den Gesellschaften der Moderne, sondern an vormodernen Gesellschaften entwickelt hat.68 Eine Konsequenz davon war, daß die folgenreiche Übertragung der sozialwissenschaftlichen Fragestellungen Durkheims in den Bereich der Geschichtswissenschaft in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts in Frankreich vor allem eine Angelegenheit der Mediävisten und der Frühneuzeit-Historiker war und bis heute im Grunde geblieben ist. Dieser Sachverhalt hat in Deutschland noch neuerdings Kritik provoziert, eine Reaktion, die ebensowohl der Begründung wie der Berechtigung entbehrt.69 Denn bekanntlich hat, metaphorisch gesprochen, die deutsche Wissenschaft in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts ihre Durkheims gehabt, aber sie hatte weder unter den Mediävisten noch unter den Neuzeithistorikern – wenn man von einer Ausnahme: Otto H intze nämlich, absieht – einen Marc Bloch.70 In diesem Sachverhalt liegt Stoff zum Nachdenken. 68
69
70
71
V. Max Weber: Die Modernität des Mittelalters Auch in der Mitte des Œuvres Max Webers steht bekanntlich eine Theorie der Moderne.71 Sie kann hier nicht Gegenstand der Erörterung sein. 72
67 Durkheim, Le suicide (wie Anm. 57), 440. 68 Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse. 6. Aufl. Paris 1979. Vgl. Sabine Jöckel, »Nouvelle Histoire« und Literaturwissenschaft. 2 Bde. 2. Aufl. Rheinfelden 1984. 69 Otto Gerhard Oexle, Das Andere, die Unterschiede, das Ganze. Jacques Le Goffs Bild des europäischen Mittelalters, in: Francia 17, 1990, 141–158, 142f. 70 Vgl. Otto Gerhard Oexle, Ein politischer Historiker: Georg von Below (1858– 1927), in: Deutsche Geschichtswissenschaft um 1900 (wie Anm. 51) 283–312; Ders., Marc Bloch et la critique de la raison historique, in: Marc Bloch aujourd’hui. Histoire comparée et Sciences sociales. Hrsg. v. Hartmut Atsma/André Burguière. Paris 1990, 419–433. 71 Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique. Paris 1967, 497ff., bes. 564ff.; Wilhelm Hennis, Max Webers Fragestellung. Studien zur Biographie des Werks. Tübingen 1987; Frisby, Soziologie und Moderne (wie Anm. 40), 214ff.; Detlef J. K. Peukert, Max Webers Diagnose der Moderne. Göttingen 1989; Hartmann Tyrell, Worum geht es in der ›Protestantischen Ethik‹? Ein
65
OTTO GERHARD OEXLE
Vielmehr geht es auch hier darum, anzudeuten, wie Weber seine Theorie der Moderne in unabdingbarer und eigentümlicher Weise mit dem Mittelalter verknüpft und wie auch bei Weber das Problem des Verhältnisses von Mittelalter und Moderne mit der Frage nach der geschichtlichen Bedeutung sozialer Gruppen verbunden ist. Und auch Weber arbeitete dabei mit denselben Materien wie Tönnies, Simmel und Durkheim: auch bei ihm ging es um Gilde, Zunft und Stadt, um Korporation und Assoziation, um Kommune und Bürgertum. Aber: Weber formulierte im Blick auf diese Probleme und Phänomene andere Fragen und er gelangte infolgedessen zu anderen Antworten. Erstens: Ausgangspunkt Webers ist nicht (wie bei Tönnies, Simmel und Durkheim) die kontrastierende Gegenüberstellung von Mittelalter und Moderne. Weber fragt vielmehr nach der Verknüpfung zwischen beiden. Weber geht es nicht (wie Tönnies) um eine grundsätzliche Kritik an der Moderne mittels eines dieser normativ gegenübergestellten Mittelalters. Es geht ihm nicht (wie Simmel) darum, in einem Vergleich von Moderne und Mittelalter gewissermaßen die Kosten des Modernisierungsprozesses nachzuweisen. Es geht ihm auch nicht (wie Durkheim) darum, die »Anomien«, die Desorganisation in der modernen Gesellschaft durch Anwendung mittelalterlicher Formen der Gruppenbildung und ihrer spezifischen ›Ethik‹ zu therapieren. Webers Thema ist vielmehr: die Darstellung der Genese der okzidentalen Moderne in einer vom Mittelalter ausgehenden Perspektive. Es geht ihm darum, zu zeigen, was das Mittelalter zur Entstehung der Moderne beigetragen hat, – eine Fragestellung, die in der Folge Otto Hintze und Marc Bloch aufgegriffen und weitergeführt haben.72 Und zweitens: Auch Webers Erörterung des Problems von Mittelalter und Moderne ist (wie bei Tönnies, Simmel und Durkheim) mit dem Thema der sozialen Gruppen in der Gesellschaft verbunden. Aber auch dieses Thema wird bei Weber in ganz anderer Form erörtert. Während Tönnies mit Gemeinschaft und Gesellschaft das Mittelalter und die Moderne einander kontradiktorisch gegenüberstellt,73 wird dieser Gegensatz bei Max Weber aspektiv aufgelöst.74 Denn nicht von Gemeinschaft 73
74
75
Versuch zum besseren Verständnis Max Webers, in: Saeculum 41, 1990, 130–177. 72 Otto Hintze vor allem in seiner großen Abhandlung über ›Weltgeschichtliche Bedingungen der Repräsentativverfassung‹ von 1931, Marc Bloch in seinem Buch ›La sociéte féodale‹ von 1939/40. 73 Ähnlich die Gegenüberstellung von ›Korporation‹ und ›Assoziation‹ bei Simmel, s. o. Anm. 48 und 51. 74 Zur ›Aspektivität‹ wissenschaftlicher Erkenntnis bei Max Weber vgl. Otto Gerhard Oexle, Die Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus. Bemerkungen zum Standort der Geschichtsforschung, in: HZ 238, 1984, 17– 55, bes. 30ff.; Ders., ›Wissenschaft‹ und ›Leben‹. Historische Reflexionen über Tragweite und Grenzen der modernen Wissenschaft, in: GWU 41, 1990, 145–
66
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
und Gesellschaft spricht Weber, sondern von Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung. »Vergemeinschaftung« soll dabei »eine soziale Beziehung heißen, wenn und soweit die Einstellung des sozialen Handelns auf subjektiv gefühlter (affektueller oder traditionaler) Zusammengehörigkeit der Beteiligten beruht«. Von ›Vergesellschaftung‹ hingegen soll die Rede sein, »wenn und soweit die Einstellung des sozialen Handelns auf rational (wert- oder zweckrational) motiviertem Interessenausgleich oder auf ebenso motivierter Interessenverbindung beruht«; insbesondere beruhe ›Vergesellschaftung‹ auf »rationaler Vereinbarung durch gegenseitige Zusage«. Diese Aspektivität in der Wahrnehmung von ›Vergemeinschaftung‹ und ›Vergesellschaftung‹ erlaubt nun die grundlegende Wahrnehmung des Sachverhalts, daß – wie Weber ausdrücklich feststellt-, die große Mehrzahl sozialer Beziehungen sowohl den Charakter der Vergemeinschaftung als auch den der Vergesellschaftung hat.75 In dieser Betrachtung von Gruppen in der Geschichte, nicht unter dem Gesichtspunkt von ›Gemeinschaft‹ oder ›Gesellschaft‹, sondern unter dem Gesichtspunkt von ›Vergemeinschaftung‹ und ›Vergesellschaftung‹ als Aspekte aller sozialer Gruppen, eröffnet sich Weber seine außerordentlich fesselnde Perspektive für die Beantwortung der Frage nach der Verknüpfung des Mittelalters mit der Moderne, für seine Frage nach der Begründung der Moderne im Mittelalter. Er gewinnt nämlich jetzt die Möglichkeit, soziale Gruppen im Mittelalter nicht nur als ›Gemeinschaften‹ oder als bloße ›Vergemeinschaftungen‹, das heißt im Blick auf die von den Mitgliedern subjektiv gefühlte Zusammengehörigkeit, sondern auch als ›Vergesellschaftungen‹ zu begreifen, das heißt: als Ausdrucksformen rationalen sozialen Handelns, das auf Interessenwahrnehmung, Interessenausgleich und Interessenverbindung beruht, auf Rationalität, Vereinbarung, Gegenseitigkeit und ›Kontrakt‹.76 Es sind dies vor allem jene Gruppen, die durch eine »ausdrückliche Verbrüderung« konstituiert werden77, durch den bewußten und willentlichen Zusammenschluß der Individuen, auf der Grundlage ihrer Gleichheit.78 76
77
78
79
161; Ders., Von Nietzsche zu Max Weber: Wertproblem und Objektivitätsforderung der Wissenschaft im Zeichen des Historismus, in: Rechtsgeschichte und theoretische Dimension. Hrsg. v. Claes Peterson (Rättshistoriska Studier 15). Lund 1990, 96–121. Zu dem damit bezeichneten grundlegenden Wandel in der Theorie der historischen Erkenntnis auch: Wolfgang Hardtwig, Geschichtsreligion – Wissenschaft als Arbeit – Objektivität. Der Historismus in neuer Sicht, in: HZ 252, 1991, 1–32. 75 Max Weber, WuG, 21f. 76 Weber verwendet (wie Tönnies) den rechtsromanistischen Begriff des ›Kontrakts‹. Ihm entspricht in der mittelalterlichen Quellensprache der Begriff des ›pactum‹. 77 Weber, WuG, 417. 78 Zur genaueren Bezeichnung sozialer ›Gleichheit‹ in der Vormoderne wäre der Begriff der ›Parität‹ zu verwenden; vgl. Gerhard Dilcher, Die
67
OTTO GERHARD OEXLE
Die Geschichte gerade dieser Gruppen ist es, die den Zusammenhang von Mittelalter und Moderne sichtbar werden läßt. Denn vor allem hier, wo Menschen sich im sozialen Handeln nach selbst gesetzten Zielen »verbrüderten«, lassen sich langfristige und bedeutende geschichtliche Wirkungen sozialen Handelns beobachten. Für sie hat sich Weber besonders interessiert. Vor allem zwei Formen dieser Art von Gruppenbildung im Mittelalter hat Weber berücksichtigt: die monastischen Kommunitäten, die »Asketengemeinschaften« des okzidentalen Mönchtums, und die »Schwureinung« oder »Eidverbrüderung«, die Formen der »Conjuratio«, welche im Mittelalter als Gilde, Zunft, Bruderschaft und vor allem in der Gestalt der Stadtkommune entgegentritt. Webers Darlegungen über das okzidentale Mönchtum und über die geschichtlichen Wirkungen der »innerweltlichen Askese« und der »rationalen Leistungen« monastischer »Asketengemeinschaften« auf der Grundlage einer disziplinierten, »methodischen Lebensführung« müssen hier beiseitegelassen werden, – Darlegungen übrigens, deren Relevanz die Forschung noch nicht anerkannt und noch weniger sich zu eigen gemacht hat; das ist deshalb zu bedauern, weil sich daraus eine andere als die derzeit allgemein akzeptierte Auffassung von der Entstehung des spätantiken und des mittelalterlich-okzidentalen Mönchtums und von seinen geschichtlichen Wirkungen ergeben könnte.79 Die folgenden Überlegungen beschränken sich also auf Webers Reflexionen zu Schwureinung und Verbrüderung. 80
VI. Die städtische Kommune: Vergesellschaftung, Verband, Anstalt, Rechtsgenossenschaft, Schwureinung und Verbrüderung Webers Ausführungen über Conjuratio, Schwureinung, Eidverbrüderung haben ihren Angelpunkt in jener umfangreichen (und wohl unvollendeten) Abhandlung, die – vielleicht 1911/13 verfaßt – erst 1921, also postum veröffentlicht wurde, und zwar unter dem Titel ›Die Stadt‹.80
81
genossenschaftliche Struktur von Gilden und Zünften, in: Gilden und Zünfte. Hrsg. v. Berent Schwineköper (Vorträge und Forschungen 29). Sigmaringen 1985, 71–111, 74. 79 Dazu demnächst Otto Gerhard Oexle, Das Mönchtum. Entstehung und Wirkung einer Lebensform (in Vorbereitung). 80 Max Weber, Die Stadt. Eine soziologische Untersuchung, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 47, 1920/21, 621–772. Vgl. auch den Textabdruck (unter einem anderen Titel) in: WuG, 727–814. Zur Datierung auf 1911/13 vgl. Wolfgang Schluchter, Religion und Lebensführung, Bd. 2: Studien zu Max Webers Religions- und Herrschaftssoziologie. Frankfurt am Main 1988, 395, Anm. 34 und 626ff.
68
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
Ziel dieser Untersuchung war es, wie Weber in einem Brief an Georg von Below vom 21. Juni 1914 erläuterte, »das, was der mittelalterlichen Stadt spezifisch ist«, herauszuarbeiten »durch die Feststellung: was anderen Städten (antiken, chinesischen, islamischen) fehlte«.81 Webers Vorgehensweise war dabei die einer »mehrdimensionalen, idealtypischen Annäherung«.82 Sie galt einerseits der Unterscheidung der okzidentalen Stadt der Antike und des Mittelalters von den Städten außerhalb der okzidentalen Kultur, andererseits der Unterscheidung der mittelalterlichen Stadt von der antiken, worauf es vor allem ankam. Denn: die mittelalterliche Stadt, nicht die antike ist es nach Weber, die für den »modernen Kapitalismus« und für den »modernen Staat« zwar »keineswegs die allein ausschlaggebende Vorstufe und gar nicht ihr Träger war«, gleichwohl aber »als ein höchst entscheidender Faktor ihrer Entstehung ... nicht wegzudenken ist«.83 In der Verfolgung dieser Erkenntnisziele wurde die Abhandlung »eines der überzeugendsten Anwendungsbeispiele des idealtypischen Vorgehens ..., bei dem die außerordentliche historische Differenziertheit und die Mehrdimensionalität der Typenbildung ganz besonders deutlich werden«.84 Auch hier wollte Weber mit seinen Idealtypen keineswegs die historische Wirklichkeit »einfangen«, – dieser Gedanke lag ihm auch hier »so fern wie möglich«.85 Er wollte vielmehr mit Hilfe idealtypischer Begriffe die empirische Forschung anleiten und der Hypothesenbildung den Weg weisen. Dieses Verfahren bewährte sich gerade in der Untersuchung komplexer historischer Gemengelagen und langfristiger, vielschichtiger historischer Wandlungsprozesse86 , wie sie auch die Geschichte des Phänomens der Stadt im Okzident und in anderen Kulturen zeigt. Die Darlegungen beruhen auf einigen wenigen idealtypischen Gegenüberstellungen.87 Die Stadt überhaupt ist, in allen Kulturen, die Weber beobachtet, Marktort, also Sitz von Handel und Gewerbe, und sie ist Festung.88 Auch die okzidentale Stadt ist dies, aber sie ist, im Gegensatz 82
83
84
85
86
87
88
89
81 Abgedruckt in: Georg von Below, Der deutsche Staat des Mittelalters. 2. Aufl. Leipzig 1925, XXIV. 82 Dirk Käsler, Max Weber, in: Klassiker des soziologischen Denkens, Bd. 2: Von Weber bis Mannheim. Hrsg. v. Dems. München 1978, 40–177, 64. 83 Weber, Die Stadt (wie Anm. 80), 727. Vgl. Ders., WuG, 788. Den Zitaten aus ›Die Stadt‹ wird im Folgenden die entsprechende Stelle aus ›Wirtschaft und Gesellschaft‹ (nach der 5. Aufl. von 1972) in Klammern angefügt. 84 Käsler, Max Weber (wie Anm. 82), 66. 85 Weber, WuG, 124 86 Käsler, Max Weber (wie Anm. 82), 137. 87 Vgl. Song-U Chon, Max Webers Stadtkonzeption. Eine Studie zur Entwicklung des okzidentalen Bürgertums. Göttingen 1985. 88 Weber, Die Stadt (wie Anm. 80), 637, 645f. (WuG, 736, 741).
69
OTTO GERHARD OEXLE
dazu, noch mehr: sie hat nämlich die »Qualität ... eines anstaltsmäßig vergesellschafteten, mit besonderen und charakteristischen Organen ausgestatteten Verbandes von ›Bürgern‹, welche in dieser ihrer Qualität einem nur ihnen zugänglichen gemeinsamen Recht unterstehen, also ständische ›Rechtsgenossen‹ sind. Diese Eigenschaft als einer ständisch gesonderten ›Polis‹ oder ›Commune‹ war, soviel bekannt, in allen anderen Rechtsgebieten, außer den mittelländischen und okzidentalen, nur in den Anfängen vorhanden«.89 Webers bedeutsame Definition verdient eine eingehende Analyse. Die okzidentale Stadt erweist sich ihr zufolge als ein Phänomen, in dem sich verschiedene Merkmale und Dimensionen komplementär ergänzen und wechselseitig durchdringen.90 Die okzidentale Stadt ist demnach (1) eine Form der »Vergesellschaftung«, d.h. sie beruht auf Interessenwahrnehmung und Interessenausgleich, auf wert- und zweckrationaler Vereinbarung, auf der Gegenseitigkeit von Zusagen, auf Konsens und ›Kontrakt‹.91 Sie ist sodann (2) ein »Verband«, das heißt eine Vergesellschaftung, die nach außen »geschlossen« ist und nach innen regulierend wirkt, so nämlich, daß »die Innehaltung ihrer Ordnung garantiert wird durch das eigens auf deren Durchführung eingestellte Verhalten bestimmter Menschen: eines Leiters und, eventuell, eines Verwaltungsstabes«.92 Die okzidentale Stadt ist außerdem (3) eine »anstaltsmäßige« Vergesellschaftung, eine »Anstalt«; das heißt: sie ist ein »vereinbarter Verband«, dessen »gesatzte Ordnungen innerhalb eines angebbaren Wirkungsbereiches jedem nach bestimmten Merkmalen angebbaren Handeln (relativ) erfolgreich oktroyiert werden« können.93 Anders gesagt: der städtische »Verband« ist begründet auf einem räumlichen, einem territorialen Substrat, das er mit seiner Ordnung überzieht und durchdringt, er ist eine ›Gebietskörperschaft‹, – im Gegensatz zum »Verein«, dessen »gesatzte Ordnung« allein für den in ihm zusammengeschlossenen Personenkreis Geltung beansprucht.94 Die okzidentale Stadt beruht also zugleich (4) auf einer 90
91
92
93
94
95
89 Ebd. 650 (743). 90 Song-U Chon, Max Webers Stadtkonzeption (wie Anm. 87), 41, nennt davon nur drei Elemente, nämlich die »politische Autonomie«, den »Anstaltscharakter« und die »Stadtbürgerschaft als ein ›gesonderter Bürgerstand‹«, was die Definition Webers um entscheidende Dimensionen verkürzt. 91 S.o. Anm. 76. 92 Weber, WuG, 23ff. und 26. 93 Ebd. 28. 94 Ebd. Dieser Unterscheidung von ›Verein‹ und ›Anstalt‹ entspricht im Blick auf das Mittelalter der Unterschied zwischen ›Gilde‹ und ›Kommune‹; vgl. Gerhard Dilcher, Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune (Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte NF 7). Aalen 1967,
70
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
»gesatzten Ordnung«, das heißt einem »gemeinsamen Recht«, dem »städtischen Sonderrecht«.95 Es impliziert, analog zur Gleichheit in der Vertragschließung der Vergesellschaftung, die Rechtsgleichheit der »Rechtsgenossen« untereinander, die »allgemeine sakrale und bürgerliche Rechtsgleichheit«.96 Aus dieser ergibt sich unmittelbar und kausal (5) eine »ständische Qualität«. Das heißt: aus dem Sonderrecht der städtischen Rechtsgenossen ergibt sich die Entstehung eines Bürger-Standes mit den jeder Ständebildung eigentümlichen Merkmalen, nämlich »Konnubium, Tischgemeinschaft, Solidarität nach außen«.97 Außerdem sind mit dem Verbandscharakter verbunden und als Merkmale zu erkennen (6) »Autonomie und Autokephalie«.98 Das heißt, die okzidentale Stadt ist ein Verband, dessen Ordnung nicht durch Außenstehende (heteronom) »gesatzt« wird, »sondern durch Verbandsgenossen kraft dieser ihrer Qualität«, und dessen Leiter und Verwaltungsstab nicht durch Außenstehende bestellt wird, sondern »nach den eigenen Ordnungen des Verbandes«99 ; das bedeutet die Verwaltung der Stadt »durch Behörden, an deren Bestellung die Bürger als solche irgendwie beteiligt waren«.100 Dazu gehört auch die Bestellung eines eigenen Gerichts. Dies ist jedoch noch nicht alles. Denn (7): dieser Verband von Bürgern der »vollentwickelten antiken und mittelalterlichen Stadt (war) vor allem ein als Verbrüderung konstituierter oder so gedeuteter Verband«.101 Dies war es wesentlich, was die Stadt zur ›Gemeinde‹ machte.102 Der Charakter der Stadtgemeinde als einer »Verbrüderung« drückt sich auch (8) in Religion und Kult aus; sie hat ihr »religiöses Symbol«, den »Verbandskult der Bürger«.103 Wichtig für den Charakter der Stadtgemeinde als Verbrüderung ist, daß sie (9) eine »schwurgemeinschaftliche Verbrüderung« ist, daß sie also aus einer wechselseitigen ›Verschwörung‹, aus einer Einung hervorging, die 96
97
98
99
100
101
102
103
104
158ff.; Otto Gerhard Oexle, Gilde und Kommune im frühen Mittelalter (in Vorbereitung). 95 Weber, Die Stadt (wie Anm. 80), 642 (739). 96 Ebd. 651 (744). Vgl. Weber, WuG, 23: »Der an einer geschlossenen Beziehung Beteiligte soll Genosse, im Fall der Regulierung der Beteiligung aber, sofern diese ihm Chancen appropriiert, Rechtsgenosse genannt werden«. – Über die Bedeutung des Sonderrechts (›gewillkürten‹ Rechts) s. u. Abschnitt VIII. 97 Weber, Die Stadt (wie Anm. 80), 651 (744). Vgl. die Definition von ›Stand‹ (im Gegensatz zu ›Klasse‹) in: WuG, 179f. und 534f. 98 Weber, Die Stadt (wie Anm. 80), 637 (736). 99 Ders., WuG, 26f. 100 Ders., Die Stadt (wie Anm. 80), 637 (736). 101 Ebd. 650 (744). 102 Ebd. 658 (748). 103 Ebd. 650 (744). Vgl. dazu in diesem Band den Beitrag von E. Voltmer.
71
OTTO GERHARD OEXLE
durch einen promissorischen Eid konstituiert war.104 Schließlich erwähnt Weber ein weiteres Moment, das man den bereits genannten an die Seite stellen muß, nämlich (10) das »Bewußtsein« der Stadtbürger von alledem, ihre eigene »Deutung« der Verbrüderung, ihre »Anschauung« davon.105 Hierin wird der Charakter der städtischen Gemeinde auch als einer ›Vergemeinschaftung‹ deutlich. Dieses Phänomen der okzidentalen Stadt als Bürgerverband, Stadtgemeinde, Verbrüderung, die ein Stadtbürger-Recht und eben dadurch auch ein Stadtbürgertum mit ständischer Qualität hervorbrachte, findet sich, nach Weber, nun einerseits in anderen Kulturen als der okzidentalen nicht oder nur in Ansätzen.106 Dafür lassen sich verschiedene Gründe benennen. Im Alten Orient, in Ägypten, Indien und China war die Stadt »Festung« und Amtssitz der Herrscher oder der herrscherlichen bzw. königlichen Behörden, deren »bureaukratische Herrschaft« die Entstehung autonomer Stadtgemeinden und städtischer Sonderrechte unterbunden habe. In China haben außerdem die starken Bindungen des Individuums an Verwandtschaft und »Sippe« die Entstehung von 105
106
107
104 Ders., Die Stadt, 658 (748). Zur »Verbrüderung« auch unten Abschnitt VIII. Über den Zusammenhang von ›Verbrüderung‹ (fraternitas) und Schwureinung im Fall der Kommune s. die unter Anm. 136 bis 138 angegebenen Titel. Der von K. Schreiner erhobene Vorwurf, Weber habe die Begriffe ›Coniuratio‹ und ›Verbrüderung‹ willkürlich und quellenfern vermengt und den Begriff der ›Brüderlichkeit‹ in den der ›Coniuratio‹ »hineininterpretiert«, entbehrt deshalb der Begründung. Über ›Brüderlichkeit‹ und ›Coniuratio‹ im Fall der Gilde vgl. Otto Gerhard Oexle, Die mittelalterlichen Gilden: ihre Selbstdeutung und ihr Beitrag zur Formung sozialer Strukturen, in: Soziale Ordnungen im Selbstverständnis des Mittelalters, Bd.1, Hrsg. v. Albert Zimmermann (Miscellanea Mediaevalia 12/1). Berlin/New York 1979, 203–226; Ders., Conjuratio und Gilde im frühen Mittelalter. Ein Beitrag zum Problem der sozialgeschichtlichen Kontinuität zwischen Antike und Mittelalter, in: Gilden und Zünfte (wie Anm. 78), 151–214, passim. 105 Ders., Die Stadt (wie Anm. 80), 650, 652f. (744). Die Bedeutsamkeit des Bewußtseins-Moments, d. h. des Innewerdens der ›Vergemeinschaftung‹ im Sinne der »subjektiv gefühlten (affektuellen oder traditionalen) Zusammengehörigkeit« (s. o. Anm. 75) für Webers Definition betonte auch Käsler, Max Weber (wie Anm. 82), 64. 106 Dazu bes. Ders., Die Stadt (wie Anm. 80), 637ff. (736ff.). Vgl. auch 641f., 655f. (738f., 746f.). Vgl. ferner 651 über das »Fehlen der magisch-animistischen Kasten- und Sippengebundenheit der freien Stadtinsassen … In China war es die exogame und endophratrische Sippe, in Indien … überdies noch die endogame und tabuistisch exklusive Kaste, welche jeglichen Zusammentritt zu einer auf allgemeiner sakraler und bürgerlicher Rechtsgleichheit, Konnubium, Tischgemeinschaft, Solidarität nach außen, ruhenden Stadtbürgervergesellschaftung hinderten …« (744).
72
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
Verbrüderung verhindert, in Indien die Existenz der Kasten, die zwar nicht die Entstehung von »Berufsverbänden, Gilden und Zünften« verwehrte, wohl aber auf Grund der »Fremdheit« der Kasten gegeneinander und der »rituellen Absonderung« der Berufe voneinander »jede Verbrüderung hemmte« und damit die Entstehung eines Bürgertums ebenso ausschloß wie die einer Stadtgemeinde: »Im Okzident fehlten ... die Tabuschranken des indisch-äquatorialen Gebiets und die totemistischen, ahnenkultischen und kastenmäßigen magischen Klammern der Sippenverbände, welche in Asien die Verbrüderung zu einer einheitlichen Körperschaft hemmten«.107 Gegenüber der antiken Stadt ist aber zugleich andererseits die mittelalterliche Stadt »in speziellem Sinn« eine »schwurgemeinschaftliche Verbrüderung«.108 Ihre nach Weber auch in der Antike feststellbaren Elemente sind im Mittelalter gewissermaßen gesteigert und prägen sich viel deutlicher aus: »Die Entstehung des autonomen und autokephalen mittelalterlichen Stadtverbandes ... mit seinem verwaltenden Rat und ihrem ›Konsul‹ oder ›Majer‹ oder ›Bürgermeister‹ an der Spitze ist ein Vorgang, der sich von aller nicht nur asiatischen, sondern auch antiken Stadtentwicklung wesenhaft unterscheidet«.109 Worin ist dieser »wesenhafte« Unterschied begründet? Weber nennt zwei Momente. Erstens ist die mittelalterliche Stadt im Gegensatz zur antiken »von Anfang an« eine schwurgemeinschaftliche Verbrüderung, während die antike nur »zunehmend eine anstaltsmäßige ›Gemeinde‹« wurde: »Die mittelalterliche Stadt ... war ein ›commune‹ von Anfang ihres Bestehens an, einerlei, wie weit man sich dabei den Rechtsbegriff der ›Korporation‹ als solchen sofort zum klaren Bewußtsein brachte«.110 Auch fehlten in der mittelalterlichen Stadt die »gentilicischen Verbände und Phratrien« und überhaupt alle Arten von »sippenexklusiven religiösen und magischen Banden«, von »tabuistischen und totemistischen Bindungen«. Vielmehr trat im Mittelalter der Stadtbürger »wenigstens bei Neuschöpfungen als Einzelner in die Bürgerschaft ein. Als Einzelner schwur er den Bürgereid. Die persönliche Zugehörigkeit zum örtlichen Verband der Stadt, und nicht die Sippe oder der Stamm, garantierte ihm seine persönliche Rechtsstellung als Bürger«.111 Den Grund dafür sieht Weber in der im Mittelalter gegebenen »kirchengemeindlichen Vollwertigkeit« des Einzelnen: diese »kirchengemeindliche Vollwertigkeit«, nicht, wie in der Antike, die »rituell vollwertige Sippe«, war »Voraussetzung der Qualifikation zum Bürger«. Die Vollwertigkeit des Einzelnen, die in 108
109
110
111
112
107 Ebd. 653 (745). 108 Ebd. 658 (748). 109 Ebd. 660 (749). 110 Ebd. 653 (745). 111 Ebd. 653f., 656 (745, 747).
73
OTTO GERHARD OEXLE
der schwurgemeinschaftlichen Verbrüderung mit anderen zusammen den Einzelnen handlungsfähig machte, beruhte darauf, daß das Christentum den Verwandtschaftsverbänden aller Art »jegliche rituelle Bedeutung«, genommen hat112 : »Die Christengemeinde war ihrem innersten Wesen nach ein konfessioneller Verband der gläubigen Einzelnen, nicht ein ritueller Verband von Sippen«.113 »Endgültig« habe das Christentum »alle Sippenbande« in ihrer religiösen Bedeutsamkeit »entwertet und zerbrochen«. Und die »oft recht bedeutende Rolle, welche die kirchliche Gemeinde bei der verwaltungstechnischen Einrichtung der mittelalterlichen Städte gespielt hat«, sei deshalb auch zu bewerten als »eines von vielen Symptomen für das starke Mitspielen dieser, die Sippenbande auflösenden und dadurch für die Bildung der mittelalterlichen Stadt grundlegend wichtigen Eigenschaften der christlichen Religion«.114 Diese Differenz zur Antike mit ihrer zumindest noch in Resten vorhandenen »sakralen Exklusivität der Sippen gegeneinander und nach außen« deutet Weber als »eine Folge des historisch denkwürdigen, von Paulus im Galaterbrief115 mit Recht in den Vordergrund gerückten Vorgangs in Antiochien, wo Petrus mit den unbeschnittenen Brüdern (rituelle) Speisegemeinschaft pflegte ... Die sippenlose Plebs setzte (sc. in der antiken Stadt) die rituelle Gleichstellung im Prinzip durch. In den mittelalterlichen, zumal in den mittel- und nordeuropäischen Städten bestand diese Abschwächung von Anfang an ...«.116 Deshalb schließlich die vielzitierte Äußerung Webers an anderer Stelle, ebenfalls mit Hinweis auf den Brief des Apostels an die Galater, über die »Sprengung der rituellen Kommensalitäts-Schranken«, über »die Entstehung der von Paulus triumphierend wieder und wieder gefeierten christlichen ›Freiheit‹, das hieß: der internationalen und interständischen Universalität seiner Mission«. Denn: »Die Abstreifung aller rituellen Geburts-Schranken für die Gemeinschaft der Eucharistie, wie sie in Antiochia vor sich ging, war auch – hingesehen auf die religiösen Vorbedingungen – die Konzeptionsstunde des ›Bürgertums‹ des Occidents, wenn auch dessen Geburt, in den revolutionären ›conjurationes‹ der mittelalterlichen Städte, erst mehr als ein Jahrtausend später erfolgte. Denn ohne Kommensalität, christlich gesprochen: ohne gemeinsames Abendmahl, war eine Eidbrüderschaft und ein mittelalterliches Stadtbürgertum gar nicht möglich«.117 Die prinzipielle Aufhebung aller durch Religion, Recht oder Verwandtschaft konstituierten, ständi113
114
115
116
117
118
112 Ebd. 657 (747). 113 Ebd., mit dem wichtigen Zusatz: »Daher blieben die Juden von Anfang an außerhalb des Bürgerverbandes«. 114 Ebd. 654 (746). 115 Gal. 2,11ff. 116 Weber, Die Stadt (wie Anm. 80), 652f. (745). 117 Max Weber, GARS II, 39.
74
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
schen Unterscheidungen ist die Voraussetzung für die Entstehung von Schwureinung und Verbrüderung und einer neuen, durch diese geschaffenen ständischen Qualität. Das zweite Moment, das in Webers Auffassung die mittelalterliche Stadt als Stadtgemeinde von der antiken unterscheidet, ist die Tatsache, daß die Bürger der mittelalterlichen Stadt ökonomische Interessen verfolgten, während, im Gegensatz dazu, »die antike Stadt primär eine Siedlungsgemeinschaft von Kriegern« war: »Die antike Polis war eine Kriegerzunft«; der antike Bürger war »in erster Linie Soldat«; die »spezifisch antike Stadt« war, »und zwar je mehr das spezifisch Antike hervortritt, desto mehr, primär politisch und militärisch orientiert«.118 Die »spezifische mittelalterliche Stadt« hingegen war »bürgerliche gewerbliche Binnenstadt, war überhaupt primär ökonomisch orientiert«; der Bürger der mittelalterlichen Stadt war, als Kaufmann und Handwerker, »homo oeconomicus«, er war »ökonomisch zunehmend am friedlichen Erwerb durch Handel und Gewerbe interessiert«, im Gegensatz zum antiken Bürger als einem »homo politicus«.119 Noch einmal anders gesagt: der »Vollbürger« der antiken Stadt ist ein vom Grundbesitz, also von der Arbeit anderer lebender »stadtsässiger ländlicher Grundrentner«; allein dadurch ist er ›abkömmlich‹ und also »amtsfähig«. Der Bürger der mittelalterlichen Stadt jedoch lebt von Handel und Gewerbe, das heißt: er arbeitet selbst. Damit hat Weber – neben der durch das Christentum religiös begründeten Gleichheit – ein zweites Merkmal der Unterscheidung der mittelalterlichen Gesellschaft von der antiken herausgehoben, das hier eine Rolle spielt, nämlich die Wertschätzung der körperlichen Arbeit, die ebenfalls auf die sozialen Grundnormen des Christentums und den dadurch gegenüber der Antike konstituierten Wertewandel zurückzuführen ist.120 Es ist zu fragen, inwieweit Webers Auffassung von der okzidentalen Stadt die Verhältnisse in der griechischen und römischen Antike trifft121 oder inwieweit sie nur eine vom Mittelalter ausgehende Projektion, eine »Transportierung« von Begriffen und Phänomenen des Mittelalters in die Antike darstellt.122 Akzentuiert man dies, so stellt sich um so dringlicher die Frage danach, ob Webers Reflexionen über die Entstehung, die 119
120
121
122
123
118 Ders., Die Stadt (wie Anm. 80), 659, 697, 762f., 754 (749, 771, 809f., 804). 119 Ebd. 756 (805). Das folgende Zitat 768 (812). 120 Vgl. zuletzt den Sammelband Jacqueline Hamesse/Colette Muraille-Samaran (Hrsg.), Le travail au Moyen Age. Une approche interdisciplinaire. Louvainla-Neuve 1990. 121 Dazu die Beiträge von H. Bruhns, J. Martin, Ch. Meier und W. Nippel in diesem Band. [Bezieht sich auf Ort der Erstveröffentlichung, der Hrsg.] 122 So Wilfried Nippel, Die Kulturbedeutung der Antike. Marginalien zu Weber (wie Anm. 174), 115. Vgl. auch den Beitrag von W. Nippel in diesem Band.
75
OTTO GERHARD OEXLE
Geschichte und den Charakter der Stadtkommune des Mittelalters zutreffen.
VII. Neuere Kontroversen über Max Webers Abhandlung ›Die Stadt‹ Bekanntlich wurde Webers Abhandlung, wiederum unter dem Titel ›Die Stadt‹, in die von Marianne Weber betreute, postume Ausgabe von ›Wirtschaft und Gesellschaft‹ übernommen. Im Gegensatz dazu rückte J. Winckelmann seit der von ihm herausgegebenen vierten Auflage dieses Werks von 1956 denselben Text unter die Überschrift ›Die nichtlegitime Herrschaft (Typologie der Städte)‹.123 Dieser Titel wurde von Winckelmann der Disposition ›Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte‹ von 1914 entnommen124 , ein Abschnitt, für den Webers Text ›Die Stadt‹, der Annahme Winckelmanns zufolge, geschrieben sein könnte.125 Die seit 1956 damit gesetzte Behauptung, daß Weber das Phänomen der Stadt und die Grundlegung des modernen Bürgertums im Mittelalter unter dem Begriff der ›nichtlegitimen Herrschaft‹ zusammengefaßt habe, hat in der Folge vielfache Kontroversen ausgelöst und zu weitgehenden Vermutungen über Webers wissenschaftliche Ansichten wie politische Absichten und Haltungen veranlaßt. So hat zum Beispiel Otto Brunner mit Hinweis auf diesen Begriff der ›nichtlegitimen Herrschaft‹ dargelegt, daß Webers Begriffe der Herrschaft und der Legitimität an die »bestimmte geschichtliche Situation« der Moderne, der nachrevolutionären Situation des 19. Jahrhunderts gebunden seien und nicht in ältere Epochen hineinprojiziert werden dürfen. Webers Begriff von ›Legitimität‹ sei ein »recht junger«; in ihm sei offenbar »das Modell des neuzeitlichen Staats« und vor allem des modernen Staats mit dem Monopol des legitimen Zwangs wirksam, das für die älteren Epochen verfehlt sei. Denn »die Auseinandersetzungen zwischen Bürgergemeinde und Stadtherrn und innerhalb der Bürgergemeinden und unzählige andere Kämpfe dieser Art waren nicht Revolte oder Revolution im modernen Sinn, sondern Kampf um wirkliches oder vermeintliches Recht, Widerstand gegen Unrecht«. Damit sei, 124
125
126
123 Weber, WuG, 727ff. 124 Vgl. Winckelmann, Max Webers hinterlassenes Hauptwerk (wie Anm. 125), 168f. 125 Vgl. Johannes Winckelmann in: WuG, XXVII (Vorwort zur vierten Auflage), mit Hinweis auf ebd. 827, wo der von Weber »gemeinte Sinn der Kategorie der ›nichtlegitimen Herrschaft‹« dargelegt sei, was indessen nicht der Fall ist. Ferner Johannes Winckelmann, Max Webers hinterlassenes Hauptwerk: Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte. Tübingen 1986, 146; vgl. 13. Dazu Schluchter, Religion und Lebensführung (wie Anm. 80), 394ff., 597ff.
76
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
nach und gegen Weber, die Frage nach dem »Durchbruch zur modernen Welt« erst eigentlich zu stellen und zu beantworten.126 Noch weiter ging Dolf Sternberger mit der Kritik daran, daß Weber bei seiner Untersuchung der mittelalterlichen ›Conjuratio‹ diese als »illegitim« bezeichnet habe (»illegitim nämlich in Hinsicht auf die vorgängige Herrschaft von Bischöfen oder Grafen oder sonstigen Stadtherren«) und daß es ihm dabei »nicht für einen Augenblick in den Sinn« gekommen sei, »daß hier eigentümliche Legitimationsgründe vorliegen«. 127 Weber sei es »schlechterdings nicht in den Sinn« gekommen, »daß es gerade diese ›Assoziation‹, ›Föderation‹ oder ›Konjuration‹ der Bürger sein könnte, welche ihr Gemeinwesen legitimierte und welche einen Typus bürgerlicher Regierung begründete, der seine eigene Legitimität in sich trüge«. Und so sei Weber bedauerlicherweise »eben niemals dahin gelangt, in den Ursprüngen und Zwecken solcher Revolutionen oder Usurpationen selber die Elemente einer neuen und andersartigen Spezies von legitimer Regierung zu erkennen«. Seine »Stadt« liege »außerhalb der Grenzen aller Legitimität«. Der Grund dafür: »Webers generelle Fixierung an ›Herrschaft‘«, seine »Vexiertheit von ›Herrschaft‹«. Freilich ist schon Sternberger selbst bei seiner Kritik durchaus aufgefallen, daß dies eigentlich recht merkwürdig sei, da es doch Webers Intention war, die Einzigartigkeit der okzidentalen Stadt und insbesondere der mittelalterlichen Stadt aus nichts anderem als aus ihrem Charakter als ›conjuratio‹ zu begründen. Trotzdem hat jüngst Klaus Schreiner Sternbergers Kritik an Webers Auffassung von der »Illegitimität bürgerlicher Verbandsbildung« und »bürgerlichen Handelns« noch einmal aufgegriffen, erweitert und bestätigt.128 Weber sei überzeugt gewesen » von der Illegitimität bürgerlichen Handelns in den städtischen Revolutionen des 11. und 12. Jahrhunderts«. »Bürgerliche Selbstregierung aufgrund gegenseitiger Vereinbarung« habe nach Webers Auffassung »zum Zeitpunkt ihres Entstehens der Rechtmäßigkeit« entbehrt. Weber habe sich offenkundig außerstande gesehen, »das Aufbegehren mittelalterlicher Bürger mit einem materialen Wertgrund in Zusammenhang zu bringen, 127
128
129
126 Otto Brunner, Bemerkungen zu den Begriffen ›Herrschaft‹ und ›Legitimität‹ (1962), in: Ders., Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte. 2. Aufl. Göttingen 1968, 64–79; die Zitate 71, 74f., 79. 127 Dolf Sternberger, Max Weber und die Demokratie, in: Ders., ›Ich wünschte ein Bürger zu sein‹. Neun Versuche über den Staat. Frankfurt am Main 1967, 93–113, die Zitate 106ff. 128 Klaus Schreiner, Die mittelalterliche Stadt in Webers Analyse und die Deutung des okzidentalen Rationalismus, in: Max Weber, der Historiker. Hrsg. v. Jürgen Kocka. (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 73) Göttingen 1986, 119–150; die Zitate 128. Die Kritik Schreiners wurde weitergeführt von Jaroslav Kudrna, Kommentar zu K. Schreiners Beitrag, ebd. 151–157.
77
OTTO GERHARD OEXLE
der es ermöglicht hätte, bürgerlicher Herrschaft bereits im Ursprung glaubens- und anerkennungswürdige Rechtmäßigkeit zuzubilligen«. Den Grund sah Schreiner in Webers Verzicht auf werttheoretische Reflexion, in seinem Rechtspositivismus, im Formalismus seines Rechtsbegriffs und in seinem Postulat der Wertfreiheit. Schreiner folgerte messerscharf: »Wer sich auf einen rein formalrechtlichen Standpunkt zurückzieht, ergreift Partei für die jeweils Herrschenden«.129 Deshalb habe sich Weber auch die Werturteile der staufischen Kaiser und ihrer gegen die Stadtautonomie gerichteten Erlasse zu eigen gemacht und sich auf die Seite jener mittelalterlichen Theologen geschlagen, welche die bürgerlichen Schwurverbände als illegitim verurteilten. Damit aber werde Webers fragwürdiger eigener politischer Standort beleuchtet. Denn: »Der Vorwurf bürgerlicher Illegitimität bedeutete zugleich Distanz zum Wertekanon der Bürger, die für eine von vielen getragene Ordnung der Freiheit kämpften. Unfähigkeit, den Wertvorstellungen hochmittelalterlicher Bürger legitimitätsstiftende Kraft zuzubilligen, ging einher mit zeit- und standortgebundener Sympathie für eine ›plebiszitäre Führerdemokratie‹. Ein ursprüngliches Recht zum Verfassungswandel schrieb Weber nur charismatisch begabten Führernaturen zu«.130 Die Berechtigung zu diesen Urteilen und den aus ihnen abgeleiteten Wertungen ist zu bezweifeln und zwar aus mehreren Gründen131 , von denen nur drei näher erörtert seien. Erstens: Eine Abhandlung mit dem Titel ›Die nichtlegitime Herrschaft‹ läßt erwarten, daß dieser Begriff im Text irgendeine Rolle spielt, daß 130
131
132
129 Schreiner, Die mittelalterliche Stadt (wie Anm. 128), 130. Eine andere Auffassung von Webers Begriff der ›Wertfreiheit‹ in den Anm. 74 genannten Beiträgen. Zur Berechtigtheit des gegen Weber immer wieder erhobenen Vorwurfs des Positivismus und Formalismus vgl. Fritz Loos, Zur Wert- und Rechtslehre Max Webers. Tübingen 1970. 130 Schreiner, Die mittelalterliche Stadt (wie Anm. 128), 130. Schreiners Ausführungen münden ein in ein gegen Weber gerichtetes Plädoyer zugunsten von Hugo Preuß (›Die Entwicklung des deutschen Städtewesens‹. 1906), der »unbehelligt durch methodische Skrupel, als entschlossener Demokrat an den Gemeinsinn und den Freiheitswillen mittelalterlicher Stadtbürger, die sich seit dem 11. Jahrhundert zu freien Einungen zusammengeschlossen hatten, um die Macht adliger Herren zu brechen«, erinnert habe. 131 Außer den im Folgenden genannten Gründen ist (1) darauf hinzuweisen, daß die Genese von Webers ›Wirtschaft und Gesellschaft‹ schwierige textund werkgeschichtliche Probleme aufwirft, über die in der Weber-Forschung noch kein Konsens erzielt wurde, und daß die »Datierung und Zuordnung des Textes ›Die Stadt‹ ... mit zu den schwierigsten Editionsproblemen« gehört (Schluchter, Religion und Lebensführung (wie Anm. 80), 395, Anm. 34). Ferner ist (2) mit W. J. Mommsen daran zu erinnern, daß es in Webers Typologie der Herrschaft den Begriff der ›nichtlegitimen Herrschaft‹ eigentlich
78
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
dieser Begriff zumindest irgendwo im Text erläutert wird. Dies ist indessen nicht der Fall. Der Begriff der ›nichtlegitimen Herrschaft‹ oder ›illegitimen Herrschaft‹ kommt in dem unter dem Titel ›Die Stadt‹ publizierten Text, der in der Erstausgabe von 1921 immerhin 150 Druckseiten umfaßt, nicht vor.132 Dies spricht nicht dafür, daß der 1921 publizierte Text ›Die Stadt‹ mit dem Titel ›Die nichtlegitime Herrschaft‹ richtig ru briziert ist. Dies spricht auch nicht dafür, daß aus dieser Titelzuschreibung, die vorerst nicht als legitim gelten kann, weitreichende Bewertungen des Textes und der angeblichen Einstellungen Max Webers zum Bürgertum abgeleitet werden dürften. Zweitens: Eine Interpretation der Abhandlung ›Die Stadt‹, »die sich streng an den Text hält«133 , kann nicht übersehen, daß Weber die Entstehung der Stadtkommune im Mittelalter (am italienischen Beispiel) ausdrücklich als einen Akt dargestellt hat, in dem es nicht nur darum ging, der »teils feudalen, teils präbendalen Appropriation der Herrschaftsgewalten« durch Adel und Kirche eine eigene Herrschaft mit eigener Legitimität entgegenzustellen134 , sondern zunächst und vor allem da133
134
135
»nicht geben kann« und, von dem einen (von J. Winckelmann herbeigeführten) Auftauchen in ›Wirtschaft und Gesellschaft‹ abgesehen, auch nicht gibt. Denn »in dem Maße, in dem die Legitimitätsbasis einer Herrschaft schwindet, schwindet auch die Chance, für Befehle Gehorsam zu finden«: so Wolfgang J. Mommsen in einer Diskussion über ›Max Weber und die Machtpolitik‹, in: Max Weber und die Soziologie heute. Hrsg. v. Otto Stammer. Tübingen 1965, 136. Ebenso Speer, Herrschaft und Legitimität (wie Anm. 134), 160. Anders gewendet: der Begriff der ›nichtlegitimen Herrschaft‹ ist in sich widersprüchlich, er ist ein hölzernes Eisen, er enthält eine ›contradictio in adjecto‹ (so auch Schreiner, Die mittelalterliche Stadt (wie Anm. 128), 126). Der daraus abzuleitende Vorwurf ist aber nicht gegen Weber, sondern gegen seine Kritiker zu richten. Außerdem hat Weber (3) seit 1917 (dazu Schluchter, Religion und Lebensführung (wie Anm. 80), 473) als viertes Element seiner Typologie der Herrschaft die ›demokratische Legitimität‹ (aufgrund der Wahl der »Gemeinde«) eigens erörtert; s. WuG, 156. 132 Die einzige Textstelle, in der der Begriff ›illegitim‹ auftaucht, ist diese: »Der italienische Popolo war ein politischer Begriff: eine politische Sondergemeinde innerhalb der Kommune, im eigentlichsten Wortsinn ein Staat im Staate, der erste ganz bewußt illegitime und revolutionäre politische Verband« (Weber, Die Stadt (wie Anm. 80), 705; WuG, 776). Die Wortverbindung (»bewußt illegitim und revolutionär«) zeigt, daß Weber auch in diesem Fall nicht eine objektive rechtliche Illegitimität dieser »Sondergemeinde« bezeichnen will, sondern ihr Bewußtsein der Illegitimität bei der Schaffung und Behauptung eigener Legitimität. 133 Schreiner, Die mittelalterliche Stadt (wie Anm. 128), 128. 134 Treffend deshalb Heino Speer, Herrschaft und Legitimität. Zeitgebundene Aspekte in Max Webers Herrschaftssoziologie (Soziologische Schriften, Bd. 28). Berlin 1978, 161: »So kann Illegitimität für Max Weber immer nur relativer
79
OTTO GERHARD OEXLE
rum, der Unfähigkeit dieser Herrschaftsträger zur Aufrechterhaltung und Sicherung der ›öffentlichen‹ Ordnung und der daraus resultierenden »Anarchie«135 eine eigene Ordnung entgegenzustellen: »Massenhafte Herrschaftsansprüche stehen, einander kreuzend, nebeneinander. Bischofsgewalten mit grundherrlichem und politischem Inhalt, viskontile und andere appropriierte politische Amtsgewalten, teils auf Privileg teils auf Usurpation beruhend, große stadtsässige Lehensträger oder freigewordene Ministerialen des Königs oder der Bischöfe (capitani), landsässige oder stadtsässige Untervasallen (valvasalles) der capitani, allodialer Geschlechterbesitz verschiedensten Ursprunges, massenhafte Burgenbesitzer in eigenem und fremdem Namen, als privilegierte Stände mit starker Klientel von hörigen und freien Schutzbefohlenen, berufliche Einigungen der stadtsässigen Erwerbsklassen, hofrechtliche, lehenrechtliche, landrechtliche, kirchliche Gerichtsgewalten nebeneinander«. In gerade diesen Kontext hat die neuere mediävistische Forschung die Entstehung der lombardischen Stadtkommunen im 11. Jahrhundert gestellt136 und dabei genauer erkennen können, warum bei diesen »letztlich eine religiöse Idee« die »Grundlage der Kommune« war, nämlich die Idee der caritas, dilectio, fraternitas und unanimitas.137 Dasselbe gilt für die Entstehung der Kommune im nördlichen Frankreich in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, die Weber in seine Betrachtungen nicht einmal einbezogen hat138 , deren Genese sich aber gerade mit Webers Ansatz noch heute idealtypisch sehr treffend beschreiben läßt. Man lese dazu 136
137
138
139
und temporärer Art sein: sie ist Illegitimität gegenüber einem konkreten Herrschaftsrecht, das Legitimität für sich in Anspruch nimmt und als legitim geglaubt wird«. Vgl. auch Schluchter, Religion und Lebensführung (wie Anm. 80), 463ff. Stefan Breuer, Max Webers Herrschaftssoziologie (Theorie und Gesellschaft, Bd. 18). Frankfurt/New York 1991, 183ff. folgt eher den Wertungen K. Schreiners, beachtet dabei jedoch nur die historische Genese der Stadt im deutschen Mittelalter und deren Deutung von seiten der deutschen Verfassungsgeschichte (H. Jakobs, P. Moraw). 135 Weber, Die Stadt (wie Anm. 80), 662 (750). Hier auch das folgende Zitat. 136 Dilcher, Stadtkommune (wie Anm. 94); Hagen Keller, Die Entstehung der italienischen Stadtkommunen als Problem der Sozialgeschichte, in: Frühmittelalterliche Studien 10, 1976, 169–211. 137 Hagen Keller, Einwohnergemeinde und Kommune: Probleme der italienischen Stadtverfassung im 11. Jahrhundert, in: HZ 224, 1977, 561–579, 569ff. Dazu auch Dilcher, Stadtkommune (wie Anm. 94), 187: »Am Anfang der Kommune steht also eine neuerliche geistige Bewegung, die nach der Zeit der Auflösung wieder konstruktive Kräfte auf den Plan rief«. 138 Albert Vermeesch, Essai sur les origines et la signification de la commune dans le Nord de la France (Xle et Xlle siècles). Heule 1966. Weber hielt Italien für die »eigentliche Heimat der conjurationes« (Weber, Die Stadt (wie Anm. 80), 662).
80
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
im Einzelnen etwa den Quellenbericht über die Entstehung der ältesten Kommune in Nordfrankreich, der Kommune von Le Mans (1070); er zeigt genau das, was Weber generell feststellte: den Versuch einer Behauptung gegen Verhältnisse der Desorganisation in der Errichtung einer vereinbarten eigenen Ordnung.139 Die neuere Forschung hat deshalb die nordfranzösischen Kommunen des 11. Jahrhunderts nicht nur als Rechts-Ordnungen, sondern auch als Friedens-Ordnungen gekennzeichnet, die diese ihre Friedens-Ordnung zugleich nach außen, in der Aufstellung eines kommunalen Heeresaufgebots durchzusetzen versuchten140 , und sie hat zugleich den Zusammenhang der kommunalen Bewegung der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts mit der vorangegangenen Friedensbewegung der ersten Jahrhunderthälfte unterstrichen141 : »La loi communale est avant tout une paix« (A. Vermeesch).142 Aber auch für die italienischen Kommunen gilt der Zusammenhang von ›Kommune‹ und ›pax‹: pax ist ein »Synonym für coniuratio« (G. Dilcher).143 Die Kommune als eine Rechts-, Friedens- und Herrschaftsordnung gegen Verhältnisse der Desorganisation hat aber bereits Weber in ihren einzelnen Dimensionen umfassend zu beschreiben versucht144 , mit dem Hinweis nämlich auf die »positiven Ziele« der Eidverbrüderung: die Verbindung »zu Schutz und Trutz, zu friedlicher Streitschlichtung untereinander, und zur Sicherung einer den Interessen der Stadtinsassen entsprechenden Rechtspflege«; die »Monopolisierung der ökonomischen Chancen«; die »Fixierung der Pflichten gegen den Stadtherrn« und die »militärischen Organisationen«. Es geht also – in Webers Auffassung – keineswegs um den Gegensatz von (kommunaler) Illegitimität und (herrschaftlicher) Legitimität, sondern ausdrücklich um die Etablierung einer vereinbarten, durch die Träger der Kommune selbst »gesatzten« Ordnung in einer Situation, in der die von den bisherigen Trägern von Herrschaft verbürgte ›öffentliche‹ Ordnung hinfällig und damit fragwürdig 140
141
142
143
144
145
139 Dazu Vermeesch, Essai (wie Anm. 138), 81ff. 140 Ebd.; Dilcher, Stadtkommune (wie Anm. 94), 153ff. 141 So vor allem Vermeesch, Essai (wie Anm. 138). 142 Ebd. 179; ebd. 180: »La commune est avant tout une institution de paix«. Vgl. auch die auf der Arbeit von Vermeesch beruhende Definition der Kommune von Joachim Deeters, Die Kölner Coniuratio von 1112, in: Köln, das Reich und Europa (Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln 60). Köln 1971, 125–148, 140: »Communiae sind Friedensordnungen, die alle Beteiligten durch Eidschwur und bewaffnetes Aufgebot gewährleisten. Setzt man die Elemente dieser Definition ein wenig um, erhält man als Definition einer Coniuratio: sie ist die Schwurvereinigung (oder Eidgenossenschaft), in der die Schwörenden sich verpflichten, eine bestimmte Rechts- und Friedensordnung einzuhalten und nach außen zu verteidigen«. 143 Dilcher, Stadtkommune (wie Anm. 94), 144. 144 Weber, Die Stadt (wie Anm. 80), 663 (751).
81
OTTO GERHARD OEXLE
geworden war, weil sie den von ihr zu erwartenden Schutz nicht mehr bot. Dies war ja schon zuvor das zentrale Thema und die Ursache der kirchlich etablierten und verbürgten Gottesfrieden gewesen. Im Rahmen von Webers Typologie der Herrschaft und der Legitimität kann man die von der Stadtkommune geschaffene Legitimität idealtypisch eindeutig dem Typus der »legalen Herrschaft kraft Satzung« zuordnen; es handelt sich um eine Legitimität, die auf Vereinbarung beruht.145 Drittens: ein anderes Bild als das von D. Sternberger und K. Schreiner skizzierte ergibt sich auch, wenn man die Ausführungen des Textes ›Die Stadt‹ in den Zusammenhang von Webers Religionssoziologie, Rechtssoziologie und Herrschaftssoziologie einordnet. Diese Kontexte erschließen sich über zwei Schlüsselbegriffe: den der ›Willkür‹ und den der ›Verbrüderung‹. 146
VIII. ›Willkür‹ und ›Verbrüderung‹ (1) Es ist, wie schon angedeutet, nach Weber ein wesentliches Kriterium, das die mittelalterliche Stadt von der antiken unterscheidet, daß die Entstehung des Stadtverbandes nicht, wie in der Polis, das Ergebnis einer allmählichen Umbildung darstellt, sondern vielmehr das Ergebnis einer »originären Usurpierung«, einer »usurpatorischen Neuerung«, einer »revolutionären Usurpation«.146 Ergibt sich nun für Weber aus diesem Sachverhalt der »revolutionären Usurpation« die Illegitimität der bürgerlichen Gemeinde im Mittelalter? Keineswegs, im Gegenteil. Weber zeigt vielmehr gerade, wie die bürgerliche Gemeinde eben durch ihre »revolutionäre Usurpation« ihre eigene Legitimität schafft. Weber zeigt also genau das, was Brunner, Sternberger und Schreiner ihm vorwerfen, nicht erkannt zu haben. Die spezifische ›Legitimität‹ der städtischen Conjuratio ergibt sich nämlich gerade daraus, daß die »schwurgemeinschaftliche Verbrüderung« – wie oben bereits angedeutet – ein nur ihr eigentümliches, ein spezifisches gemeinsames Recht hervorbringt. Es hat den Charakter eines »Sonderrechtsinstituts«, das eben als ein »Verhältnis unter den Vereinbarenden selbst« seine Rechtswirkungen entfaltet, auch wenn es Dritte nicht bindet.147 Es steht als vereinbartes, ›gewillkürtes‹, partikuläres Recht im Gegensatz zum ›allgemeinen‹ Recht von der Art des Landrechts, des königlichen Rechts, des Kirchenrechts. Es ist, wie dieses, 147
148
145 Max Weber, Soziologische Grundbegriffe (1921), und Ders., Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft (1922), in: Ders., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. 5. Aufl. Tübingen 1982, 541ff. und 475ff. Zur ›demokratischen Legitimität‹ vgl. oben Anm. 131. 146 Weber, Die Stadt (wie Anm. 80), 660f. (749f.). 147 Dazu Weber, WuG, 416f.
82
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
»gesatztes« Recht, und als solches begründet es auch seinerseits »legale Herrschaft«; im Gegensatz zu diesem ist es aber nicht »oktroyiertes«, sondern »paktiertes« Recht.148 Im Mittelalter war dieser Unterschied wohlbekannt149 ; er wurde erörtert z. B. im Blick auf das von Kaufmannsgilden des 11. Jahrhunderts geschaffene Sonderrecht, das als ›voluntas‹ der königlichen ›lex‹ gegenüberstand. Daraus ergab sich als Feststellung eines Zeitgenossen über das Sonderrecht solcher Gildekaufleute: iudicia non secundum legem sed secundum voluntatem decernunt, was als objektive Feststellung und als Vorwurf zugleich gemeint war; dieses Recht galt als »Willkür«-Recht, im doppelten Sinn dieses Wortes.150 Eine andere begriffliche Fassung des Unterschieds, die seit dem Beginn des Frühmittelalters begegnet, ist die Unterscheidung von ›lex‹ und ›consuetudo‹; auch ›consuetudo‹ ist im Frühmittelalter eine Bezeichnung für das ›gewillkürte‹ Sonderrecht von Kaufmannsgilden.151 Im Hochmittelalter ist ›consuetudo‹ auch die Bezeichnung für das Recht der Stadtkommunen, und auch hier gab es im 12. und 13. Jahrhundert ausgedehnte (kanonistische) Kontroversen über die Legitimität von ›consuetudo‹ im Verhältnis zur ›lex‹.152 Max Weber erörtert das Problem der ›Willkür‹ in der Rechtssoziologie, in dem Abschnitt über ›Die Formen der Begründung subjektiver Rechte‹.153 Er will dabei vor allem darauf aufmerksam machen, daß das 149
150
151
152
153
154
148 Vgl. ebd. 125: »Die legale Herrschaft beruht auf der Geltung der folgenden untereinander zusammenhängenden Vorstellungen, l. daß beliebiges Recht durch Paktierung oder Oktroyierung rational, zweckrational oder wertrational, orientiert (oder: beides) gesatzt werden könne mit dem Anspruch auf Nachachtung mindestens durch die Genossen des Verbandes, regelmäßig aber auch: durch Personen, die innerhalb des Machtbereichs des Verbandes (bei Gebietsverbänden: des Gebiets) in bestimmte von der Verbandsordnung für relevant erklärte soziale Beziehungen geraten oder sozial handeln . . . «. 149 Vgl. Wilhelm Ebel, Die Willkür. Eine Studie zu den Denkformen des älteren deutschen Rechts (Göttinger rechtswissenschaftliche Studien, Bd. 6). Göttingen 1953. 150 Dazu Otto Gerhard Oexle, Die Kaufmannsgilde von Tiel, in: Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa, Bd. 6. Hrsg. v. Herbert Jankuhn/Else Ebel (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-hist. KI., Dritte Folge, Nr. 183). Göttingen 1989, 173–196, bes. 187ff. 151 Ebd. 189f. 152 Vgl. Jürgen Sydow, Kanonistische Überlegungen zur Geschichte und Verfassung der Städtebünde des 12. und 13. Jahrhunderts, in: Kommunale Bündnisse Oberitaliens und Oberdeutschlands im Vergleich. Hrsg. von Helmut Maurer. (Vorträge und Forschungen 33) Sigmaringen 1987, 213–230, 221ff. 153 Weber, WuG, 397ff.
83
OTTO GERHARD OEXLE
Verhältnis zwischen Sonderrechten und allgemeinen Rechtsregeln in der vor-modernen Vergangenheit »erheblich« anders war als in der Moderne. In der Moderne sei man gewohnt, alle Sonderrechtsinstitute zu betrachten unter dem Gesichtspunkt der »Vereinheitlichung und Rationalisierung des Rechts in Verbindung mit der offiziellen Monopolisierung« des Rechts durch den Staat. Ganz anders sei jedoch die »Art, wie die Vergangenheit Sonderrecht gegenüber den allgemeinen Rechtsregeln zuließ«.154 Im Gegensatz zur Moderne nämlich entstand in der vor-modernen Vergangenheit Sonderrecht als ›Willkür‹, als ›gewillkürtes Recht‹, d. h. als ein »durch Tradition oder vereinbarte Satzung ›ständischer‹ Einverständnisgemeinschaften bzw. vergesellschafteter ›Einungen‹ in autonom gesatzten Ordnungen (geschaffenes) Recht«. Und Weber fügt ausdrücklich hinzu: »Daß ›Willkür‹ (gewillkürtes partikuläres Recht im eben erwähnten Sinn) das ›Landrecht‹ (das allgemeine, sonst gültige Recht) ›bricht‹ (ihm vorgeht), war ein fast universell geltender Grundsatz ... Die politische Anstalt«, so Weber weiter, »hat freilich fast überall den Anspruch erhoben und meist durchgesetzt, daß diese Sonderrechte nur kraft ihrer Zulassung in Geltung bleiben und also auch nur soweit, als sie es erlaubt«. Und Weber fügt die wichtige Feststellung hinzu: »Ganz ebenso wie sie die ›Gemeinde‹ zu einem von der politischen Anstalt mit bestimmten Vollmachten ausgestatteten heteronomen Verband gestempelt hat«. Jedoch: »Dies war in beiden Fällen nicht der ursprüngliche Zustand. Die Summe alles innerhalb eines gegebenen Gebiets oder Personenkreises geltenden Rechts war vielmehr in großen Bestandteilen durch autonome Usurpationen verschiedener gegeneinander selbständiger Einverständnisgemeinschaften oder vergesellschafteter Einungen geschaffen und fortgebildet, zwischen denen der stets erneut erforderliche Ausgleich entweder durch gegenseitige Kompromisse geschaffen oder durch die Macht überragender politischer oder kirchlicher Gewalten oktroyiert wurde«. ›Gewillkürtes‹ Sonderrecht hat demnach einen Doppelcharakter: es ist ebensowohl eine »Usurpation«, wie es zugleich, als ein durch Vereinbarung (Paktierung) geschaffenes, »gesatztes« Recht, aus sich selbst heraus legitim ist, – legitim für den Kreis derer, die es geschaffen haben. Und für dieses Recht gilt nach Weber nicht nur, daß es aus sich selbst heraus legitim ist, was von seiten der kirchlichen und politischen Anstalten stets bestritten wird, sondern auch, daß es gegenüber dem staatlichen oder kirchlichen (»oktroyierten«) Recht auch die ältere und ursprüngliche Rechtsform darstellt. Mit dieser Feststellung macht Weber darauf aufmerksam, daß die »Vereinheitlichung und Rationalisierung des Rechts« im Zusammenhang mit der »Monopolisierung der Rechtsschöpfung« durch den modernen Staat das Ergebnis eines historischen Prozesses ist und daß deshalb auch die von diesem historischen Ergebnis ausgehenden und von 155
154 Ebd. 416f. Hier auch die folgenden Zitate.
84
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
ihm suggerierten Wahrnehmungsweisen gerade dieses geschichtlichen Prozesses historisch vermittelt und bedingt sind. Damit wird beides: die Monopolisierung der Rechtsschöpfung durch den modernen Staat und die davon geprägte Sichtweise eben dieses Prozesses, historisch relativiert. Eben dadurch aber schafft Weber die Möglichkeit, die andersartigen Zustände vor-moderner Gesellschaften und ihrer gruppenbezogenen Sonderrechtsinstitute zunächst in ihrer Eigentümlichkeit zu erkennen, sie sodann von denen der Moderne zu unterscheiden, und schließlich zugleich die Aufmerksamkeit auf die Frage zu lenken, wie sich das eine aus dem anderen entwickelt hat. Es ist die »staatliche Anstalt«, vor allem in der »modernen Welt«, die das gewillkürte Sonderrecht, geschaffen durch Personenverbände mit ständischer Qualität, »völlig negiert«.155 Denn der »Rechtsbegriff der ›staatlichen Anstalt‹« stehe immer »in einem grundsätzlichen Gegensatz«, zum Teil in einem »so schroffen Gegensatz« zum gewillkürten Recht, daß die Möglichkeit von Sonderrecht dadurch überhaupt negiert werde, ebenso wie es im Rahmen des modernen Staats »›legitime‹ Gewaltsamkeit ... nur noch insoweit gibt, als die staatliche Ordnung sie zuläßt oder vorschreibt«.156 Im Gegensatz dazu sieht Weber die mittelalterliche Gesellschaft gekennzeichnet durch die Polarität verschiedener Rechtsbildungen und Rechtskreise und die Interessenkonkurrenz ihrer Träger.157 Damit hat er zugleich die Frage nach dem Verhältnis 156
157
158
155 Ebd. 418f. Diese moderne, vom modernen Staat her orientierte Wahrnehmung des mittelalterlichen Rechts erscheint in verdinglichter Form z. B. in der ›Rechtssoziologie‹ Niklas Luhmanns (3. Aufl. Opladen 1987), welche die Idee der ›Positivierung‹ des Rechts im wesentlichen exklusiv der Moderne zuschreibt. Zur Kritik daran bes. Joachim Rückert, Autonomie des Rechts in rechtshistorischer Perspektive (Schriftenreihe der Juristischen Studiengesellschaft Hannover, Bd. 19). Hannover 1988, 16ff. 156 Weber, WuG, 30. Weber stützt sich bei diesen Überlegungen offensichtlich auf O. v. Gierkes Ansatz der polaren Spannung von ›Herrschaft‹ und ›Genossenschaft‹, vgl. Oexle, Otto von Gierkes ›Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft‹ (wie Anm. 51). 157 Vgl. Sten Gagnér, Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Iuridica Upsaliensia, Bd. 1). Stockholm/Uppsala/Göteborg 1960, der jedoch seinerseits neben der bedeutenden Rolle der ›staatlichen‹ Gesetzgebung und der »gesetzespositivistischen Umwälzung« des Hochmittelalters durch die ›staatlichen‹ Kodifikationen die Bedeutung der ›gewillkürten‹ und ebenfalls ›gesatzten‹ Sonderrechtsbildungen sozialer Gruppen nicht beachtet hat. Zu den ›staatlichen‹ Kodifikationen vgl. Armin Wolf, Die Gesetzgebung der entstehenden Territorialstaaten, in: Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Bd. 1. Hrsg. v. Helmut Coing. München 1973, 517–800; Ders., Gesetzgebung und Kodifikationen, in: Die Renaissance der Wissenschaften im 12. Jahrhundert. Hrsg. v. Peter Weimar. Zürich 1981, 143–171.
85
OTTO GERHARD OEXLE
von ›Einung‹ und ›Anstalt‹ im Hinblick auf das Problem von Legitimität oder Nicht-Legitimität des Sonderrechts vergesellschafteter Einungen eindeutig beantwortet. In der Moderne, im Zeichen des Anstaltsstaates, ist diese Frage völlig anders zu beantworten als im Mittelalter. Dies ist das Ergebnis eines historischen Prozesses, der Mittelalter und Moderne trennt und zugleich das Mittelalter als konstituierendes Element mit der Moderne verbindet. Weber erinnert deshalb an einzelne Phasen dieses Prozesses, etwa daran, wie der »bürokratische Fürstenstaat der Neuzeit die überkommenen korporativen Selbständigkeiten sprengte«, also »Gemeinden, Zünfte, Gilden, Markgenossenschaften, Kirchen, Vereine aller denkbaren Art seiner Aufsicht unterwarf, konzessionierte, reglementierte und kontrollierte und alle nicht konzessionierten Rechte kassierte und so der Theorie der Legisten: daß alle Verbandsbildung selbständige Gesamtrechte und Rechtspersönlichkeit nur kraft der Funktion des Princeps haben könne, die Herrschaft über die Praxis überhaupt erst ermöglichte«. Ebenso erinnert Weber an die Assoziationsverbote der Französischen Revolution, die »im Umkreis ihrer bleibenden Einwirkung jede Korporationsbildung nicht nur, sondern auch jede Art einer nicht für ganz eng begrenzte Zwecke ausdrücklich konzessionierten Vereinsbildung und alle Vereinsautonomie überhaupt zerstört« hat.158 Natürlich habe das moderne Recht des Anstalts-Staats letztlich nicht »jegliche Vereinsautonomie und alle Rechtspartikularitäten« vernichtet. Im Gegenteil: dieser Staat hat sogar eine »Fülle« von Rechtspartikularitäten neu geschaffen. Aber diese moderne Vereinsautonomie wird eingeordnet in »eine ... prinzipiell auf formaler ›Rechtsgleichheit‹ beruhende Anstalt«159 ; und das bedeutet: die Autonomie von ›Vereinen‹ ist anerkannt, sie ist damit legitim, aber sie ist zugleich eine »durch Rechtsregeln eng begrenzte Autonomie«. Außerdem ist diese Autonomie der modernen Vereine »formal allgemein zugänglich« und kann »von beliebigen Personen geschaffen werden«, und dem entspricht die »Herstellung von schematischen Ermächtigungen für jedermann, gewillkürtes Recht durch private sachliche Rechtsgeschäfte bestimmter Art zu schaffen«. Damit ist die Autonomie ständischer Einungen mitsamt ihrer auf »Eigenmacht« beruhenden, »durchweg individuellen Entstehung gewillkürten Rechts« ausgelöscht. Den ›Vereinen‹ der Moderne eignet deshalb nicht mehr die Fähigkeit zur Entfaltung ständischer Qualität. Gerade die den Vereinen und Assoziationen der Moderne fehlende ständische Qualität war es aber, die von der mittelalterlichen Coniuratio jene gewaltigen historischen Wirkungen ausgehen ließ, die sie auf die Moderne hin und als ein Faktor im Prozess der ›Modernisierung‹ entfaltet hat. 159
160
158 Weber, WuG, 435f. 159 Ebd. 419. Hier auch das folgende Zitat.
86
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
Nicht die Illegitimität der stadtbürgerlichen Coniuratio ist also Webers Thema, sondern deren durch ›revolutionäre Usurpation‹ geschaffene Legitimität, die sich in einer Vielzahl konkurrierender Legitimitäten zu behaupten hatte. Im Mittelalter gab es nicht das Macht-Monopol und Legitimitätsmonopol des modernen Staates, sondern vielmehr Machtkonkurrenz und Legitimitätskonkurrenz; hier stand »Herrschaft gegen Herrschaft, Legitimität gegen Legitimität«.160 Dies eröffnet den Blick auf die spezifische Dynamik der Kultur des mittelalterlichen Okzidents und es eröffnet zugleich den Blick auf wesentliche rechtliche und soziale Dimensionen der nachmittelalterlichen Modernisierungsprozesse, in denen die vergesellschafteten »ständischen Einungen« und »Einverständnisgemeinschaften« mitsamt ihrem gewillkürten Recht schließlich untergegangen sind, in denen sie aber doch erhebliche Wirkungen entfaltet und in die Moderne hinein freigesetzt haben. (2) Zentraler Aspekt der Beobachtung des Mittelalters bei Max Weber ist also die Konzentrierung auf das Phänomen des Kontrakts, der die Individuen zur Bildung von Gruppen veranlaßt. Kontraktverhältnisse sind auch in den modernen Gesellschaften vielfältig anzutreffen. Hier beziehen sie sich jedoch, so Weber, vorwiegend auf den wirtschaftlichen Gütererwerb, auf Güterverkehr und Markt, – im Gegensatz zu den »urwüchsigen Kontrakttypen«161 , die in früheren Epochen der Rechtsentwicklung weit verbreitet waren. Weber konstatierte demzufolge eine »tiefgreifende Wandlung des allgemeinen Charakters der freien Vereinbarung« in der Geschichte. Im Gegensatz zu den ökonomisch bestimmten ›Zweck-Kontrakten‹ der Moderne bezeichnet Weber die vormodernen Kontraktverhältnisse als ›Status-Kontrakte‹, Kontrakte also mit ständischer Qualität.162 Diese hatten zum Inhalt »eine Veränderung der rechtlichen Gesamtqualität, der universellen Stellung und des sozialen Habitus von Personen«. Weber bezeichnete Beziehungen dieser Art als »Verbrüderungsverträge«. Sich ›verbrüdern‹ heiße also nicht: daß man sich gegenseitig »für konkrete Zwecke« lediglich bestimmte »nutzbare Leistungen« gewährt oder in Aussicht stellt oder dergleichen, es heiße vielmehr: »daß man qualitativ etwas anderes ›wird‹ als bisher ... Die Beteiligten müssen eine andere ›Seele‹ in sich einziehen lassen«. Dies werde besonders deutlich ausgedrückt in der »Gewalt des Eides«, der eidlichen Selbstbindung, die zugleich eine bedingte Selbstverfluchung darstellt. Der Eid ist deshalb »eine der universellsten 161
162
163
160 Ebd. 714. 161 Ebd. 401. Hier auch die folgenden Zitate. 162 Es handelt sich hier, ähnlich wie bei Webers Unterscheidung von ›Vergemeinschaftung‹ und ›Vergesellschaftung‹ (gegenüber der Tönnies’schen von ›Gemeinschaft‹ und ›Gesellschaft‹), um eine Umformung der Unterscheidung von ›Status‹ und ›Kontrakt‹ bei Henry Sumner Maine, Ancient Law (1861), Nachdruck Gloucester 1970, 109ff.
87
OTTO GERHARD OEXLE
Formen aller Verbrüderungsverträge«163 , – und die durch Eid konstituierte Gruppe, die »Schwureinung« oder »Eidverbrüderung«, die Coniuratio, ist eine der wirkmächtigsten Formen der Gruppenbildung in der Geschichte. Erst in neuerer Zeit hat die historische Forschung – gewissermaßen diesen Hinweisen Max Webers folgend – sich eingehender mit der Geschichte der promissorischen Eide und ihrer sozialgeschichtlichen Wirkungen befaßt164 , insbesondere mit der Bedeutung des wechselseitig geleisteten, des gegenseitigen promissorischen Eides (»serment mutuel«), durch den sich die mittelalterlichen Schwureinungen konstituiert haben.165 Dieser Form der Gruppenbildung in der Geschichte hat gerade Weber große Aufmerksamkeit gewidmet. Schwurverbrüderung und Eidgenossenschaft sind nach Weber auch das zentrale Moment in der Geschichte des antiken Judentums, seiner Sozialstruktur, seiner Politik, seiner Bindung an Gott: Verbrüderungen »durchziehen« die Geschichte Israels.166 Und die Verbrüderung ist nicht nur die Form der okzidentalen Stadt als Stadtgemeinde, vor allem im Mittelalter, sondern auch ein wesentliches Moment des innerstädtischen Lebens167 : in der Vielheit beruflicher und religiöser Einungen zu gegenseitigem Schutz und gegenseitiger Hilfe in allen Notlagen, zur Verfolgung gemeinsamer, wirtschaftlicher wie politischer Interessen, zu gemeinsamer religiöser Betätigung.168 Auf der Ebene dieser Bildungen ist abermals die besondere Prägung des Okzidents zu erkennen. Zusammenschlüsse von Händlern und Handwerkern gibt es 164
165
166
167
168
169
163 Weber, WuG, 402. 164 Nach den grundlegenden Arbeiten von Wilhelm Ebel, Der Bürgereid als Geltungsgrund und Gestaltungsprinzip des deutschen mittelalterlichen Stadtrechts. Weimar 1958, und von Pierre Michaud-Quantin über den gegenseitigen promissorischen Eid (»serment mutuel«, s. die folgende Anm.) ist die Erforschung der Formen des promissorischen Eides und seiner sozialen Wirkungen neuerdings verstärkt in Gang gekommen: vgl. Lothar Kolmer, Promissorische Eide im Mittelalter (Regensburger Historische Forschungen, Bd. 12), Kallmünz 1989; André Holenstein, Die Huldigung der Untertanen. Rechtskultur und Herrschaftsordnung (800–1800) (Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte, Bd. 36). Stuttgart/New York 1991; Paolo Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente (Annali dell’Istituto storico italo-germanico, Monografia 15). Bologna 1992. 165 Pierre Michaud-Quantin, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen-Age latin (L’Eglise et l’Etat au Moyen Age, Bd. 13). Paris 1970, 233ff. 166 Weber, GARS III, 81ff. Das Zitat ebd. 82. 167 Weber, Die Stadt (wie Anm. 80), 667ff. (vgl. WuG, 753ff.); Ders., GARS I, 291ff.; Ders., GARS II, 35ff. 168 Vgl. die Beiträge in: Gilden und Zünfte (wie Anm. 78), und darin bes. Dilcher, Die genossenschaftliche Struktur (wie Anm. 78), 102ff.
88
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
natürlich auch in anderen Kulturen. Aber sie haben hier nicht den Charakter der Schwureinung und Verbrüderung. Wiederum ist es die Existenz von Kasten (in Indien) oder die Sippengebundenheit (in China) oder die Existenz starker Bürokratien (China), die dies verhindert haben, ebenso wie durch diese Faktoren die Entstehung städtischer ›Verbrüderungen‹ verhindert wurde.169 Denn: Das »Kastensystem ist seinem ›Geist‹ nach etwas ganz anderes als ein System von Gilden und Zünften«170 ; und: »Alle Verbrüderung aller Zeiten setzte Speisegemeinschaft voraus«.171 Was Weber hier beabsichtigt, ist eine Theorie der Bildung sozialer Gruppen in der Kultur des Okzidents oder anders: eine Theorie des Okzidents – nicht unter dem Aspekt der Klassen- oder Ständebildung und der Geschichte von Ständen und Klassen, sondern unter dem Gesichtspunkt der Entstehung, Bedeutung, Geschichte sozialer Gruppen im Prozeß des sozialen Handelns der Individuen. Und diese Theorie ist zugleich kulturvergleichend ausgerichtet: sie will die spezifische Struktur verschiedener Gesellschaften und die Art ihrer Veränderung in der Geschichte bestimmen im Blick auf die Formen der Bildung sozialer Gruppen und ihr Verhältnis zueinander. Eine Schlüsselstellung wird dabei der ›Verbrüderung‹ als einer ganz besonderen Form der Vergesellschaftung und Vergemeinschaftung zugewiesen. Dabei geht es (a) um die Beobachtung des Gegensatzes zwischen Gruppenbildung und ständischer Schichtung sowie um die Entstehung von neuen Ständen auf Grund der ständischen Qualität »gewillkürter Einverständnisgemeinschaften« auf der Grundlage einer ›Verbrüderung‹. Die Rolle der ›Verbrüderung‹ wird sodann (b) näher bestimmt durch die Beobachtung des Gegensatzes zwischen Gruppen, in denen sich das Individuum durch seine Geburt vorfindet (Familie, ›Haus‹, Geschlecht, Verwandtschaft), und solchen Gruppen, in denen es sich mit anderen Individuen verbindet, um selbst gesetzte Ziele zu verwirklichen.172 Die Bedeutung der ›Verbrüderungen‹, gesehen im Verhältnis zur Bedeutung von Familie und Verwandtschaft, kann dabei betrachtet werden als ein Indikator für das spezifische Profil einer Epoche, einer Kultur, – und zugleich als ein Faktor ständiger Wandlungen, als ein Faktor in der Geschichte dieser Kultur. Wenn von seiten der althistorischen Forschung jetzt festgestellt wird, daß in der römischen Kaiserzeit – im Gegensatz zu den Annahmen Max Webers – der Conjuratio, Verbrüderung und Stadtgemeinde keineswegs 170
171
172
173
169 Vgl. Weber, GARS I, 291ff. 170 Weber, GARS II, 36. 171 Ebd. 38. Vgl. Ders., Die Stadt (wie Anm. 82), 651 (WuG, 744): »Die Insassen einer indischen Stadt haben als solche gar keine Möglichkeit gemeinsamer Kultmahle, die chinesischen infolge ihrer Sippenorganisation und der alles überwiegenden Bedeutung des Ahnenkults keinen Anlaß dazu«. 172 Dies ist übrigens auch eine der durchgehenden Fragestellungen in Marc Blochs ›La société féodale‹ von 1939/40.
89
OTTO GERHARD OEXLE
eine zentrale Bedeutung zukommt, sondern vielmehr den Sozialgebilden des ›Hauses‹ und der Klientel173 , so liegt diese Erkenntnis trotz des ausdrücklichen Widerspruchs gegen Webers Thesen genuin auf der Linie von Webers Erkenntniszielen. Und erneut wirft diese Erkenntnis ein Licht auf die Besonderheit des okzidentalen Mittelalters, das offensichtlich durch die herausragende Bedeutung von Schwureinungen und Verbrüderungen charakterisiert wird. Die Sakralität des wechselseitig geleisteten promissorischen Eides erlaubte es dem Einzelnen, sich aus den verwandtschaftlichen und ständischen Bindungen zu lösen, in denen er sich vorfand, und ermöglichte es ihm zugleich, mit anderen intendierte neue soziale Bindungen einzugehen, denen sogar eine neue ständische Qualität eignen konnte. Zweifellos ist dies ein entscheidendes Moment, das die schon so oft festgestellte bemerkenswerte ›Dynamik‹ begründet hat, die für die Kultur des Okzidents so kennzeichnend ist. 174
IX. Konsequenzen Seit langem schon haben sich Althistoriker umfassend und intensiv mit dem Œuvre Max Webers auseinandergesetzt.174 »Max Weber war ohne Zweifel einer der bedeutendsten Althistoriker«, so stellte jüngst Christian Meier fest; denn für die Kenntnis und das Begreifen des griechisch-römischen Altertums habe Weber »so viel und so Wesentliches geleistet wie wenige andere«. Max Weber zu folgen, soweit man das könne, bedeute deshalb, »in wesentlichen Problemen unserer Wissenschaft die Laienhaftigkeit hinter sich zu lassen«.175 War Weber auch ein ebenso bedeutender Mediävist? Es kennzeichnet die Mediävistik, daß sie sich die Frage nicht einmal gestellt hat, wie auch die mediävistischen Beiträge in einem 175
176
173 Dazu bes. der Beitrag von J. Martin o. S. 95ff. 174 Vgl. u. a. Alfred Heuss, Max Webers Bedeutung für die Geschichte des griechisch-römischen Altertums, in: HZ 201, 1965, 529–556; Moses I. Finley, Max Weber und der griechische Stadtstaat, in: Ders., Quellen und Modelle in der Alten Geschichte. Frankfurt am Main 1987, 107–125. Zur neuesten Diskussion: Wilfried Nippel, Die Kulturbedeutung der Antike. Marginalien zu Weber, in: Max Weber, der Historiker. Hrsg. v. Jürgen Kocka (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. 73), Göttingen 1986, 112–118; Ders., Methodenentwicklung und Zeitbezüge im althistorischen Werk Max Webers, in: GG 16, 1990, 335–374; Jürgen Deininger, Die antike Welt in der Sicht Max Webers. München 1987; Ders., Die antike Stadt als Typus bei Max Weber, in: Festschrift Robert Werner (Xenia 22). Konstanz 1989, 269–289; Christian Meier, Max Weber und die Antike, in: Max Weber. Ein Symposion. Hrsg. Christian Gneuss/Jürgen Kocka. München 1988, 11–24. 175 Meier, Max Weber und die Antike (wie Anm. 174), 11 und 24.
90
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
unlängst erschienenen Sammelband über ›Max Webers Sicht des okzidentalen Christentums‹ unfreiwillig demonstrieren.176 Analoges gilt für Webers Abhandlung ›Die Stadt‹, die in der Mittelalterforschung wenig Beachtung fand und findet.177 Aber Webers Arbeiten zum Mittelalter betreffen nicht nur die Stadt und Stadtgemeinde, sie betreffen auch das darüber hinausgehende große Thema der sozialen Gruppen in der Geschichte des Okzidents und anderer Kulturen, ein Thema, das Weber schon mit seiner Dissertation 177
178
176 Wolfgang Schluchter (Hrsg.), Max Webers Sicht des okzidentalen Christentums. Frankfurt am Main 1988. Einer der mediävistischen Beiträge des Bandes (276–310) stellt sich die Aufgabe, »Cluny unter einem weberianischen Blickwinkel darzustellen« (276), andere versuchen, Sekten, Mönchsorden und Laienbruderschaften des Spätmittelalters mit Hilfe der Begriffe von Weber und E. Troeltsch zu deuten. Die zentralen Themen von Webers Sicht des Mittelalters sind also konsequent umgangen. Eine Ausnahme bildet der ungewöhnlich reichhaltige Aufsatz von Stefan Breuer, Der okzidentale Feudalismus in Max Webers Gesellschaftsgeschichte (437–475), bei dem es sich allerdings um den Beitrag eines Soziologen handelt. Wie wenig die Mediävistik mit Webers Sicht des okzidentalen Mittelalters anzufangen weiß, demonstriert erneut der Beitrag von Hans-Dieter Kahl, Was bedeutet: »Mittelalter«?, in: Saeculum 40, 1989, 15–38. 177 Dies demonstriert überdeutlich das Buch von Gudrun Gleba, Die Gemeinde als alternatives Ordnungsmodell (Dissertationen zur mittelalterlichen Geschichte, Bd. 7). Köln/Wien 1989. Man vergleiche auch das gegen Weber gerichtete, durchaus repräsentative Plädoyer des Mediävisten Karl Bosl, Der »soziologische Aspekt« in der Geschichte. Wertfreie Geschichtswissenschaft und Idealtypus, in: HZ 201, 1965, 613–630, bes. 625ff., der Webers Idealtypus der europäischen Stadt »Substanzlosigkeit« und bloßen Bezug zu Webers »eigener Gegenwart« vorwirft und demgegenüber das Verfahren des »wissenschaftlichen Historikers« lobt, »induktiv zu zeigen die lebendigen Entsprechungen innerhalb der nicht kausal zu begründenden Strukturen mit den möglichst ihren Quellen, jedenfalls ihrer Wirklichkeit entsprechenden Begriffen«. Im Gegensatz dazu: die Auseinandersetzung des Soziologen Stefan Breuer, Blockierte Rationalisierung. Max Weber und die italienische Stadt des Mittelalters, in: Archiv für Kulturgeschichte 66, 1984, 47–85. Eine exemplarische Auseinandersetzung und weiterführende Erörterung von Webers Abhandlung über die Stadt bietet auch der Rechtshistoriker Gerhard Dilcher, Rechtshistorische Aspekte des Stadtbegriffs, in: Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter, Teil 1. Hrsg. v. Herbert Jankuhn/ Walter Schlesinger/Heiko Steuer (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-Hist. Kl. Dritte Folge Nr. 83). Göttingen 1976, 12–32. Zur allgemeinen Rezeption von ›Die Stadt‹ einige Hinweise bei Arnold Zingerle, Max Webers historische Soziologie. Aspekte und Materialien zur Wirkungsgeschichte (Erträge der Forschung, Bd. 163). Darmstadt 1981, 146ff.
91
OTTO GERHARD OEXLE
aufgriff178 , weil es ein grundlegendes Thema der seit den 1880er Jahren im Aufbruch befindlichen neuen Kulturwissenschaften darstellte. Vor allem unter diesem Gesichtspunkt geht es in der Mediävistik wohl noch nicht so sehr darum, Max Weber zu überholen, als vielmehr erst einmal darum, ihn einzuholen. Dazu vier Stichworte. Erstens: Die mittelalterliche Gruppen-Kultur und ihre Transformation in der Neuzeit und zur Moderne hin werden bei Mediävisten wie bei Neuzeithistorikern derzeit noch ausschließlich mit Tönnies’ Gemeinschaftstheorem oder mit der ihm entgegengesetzten Emanzipationsthese Jacob Burckhardts von 1860 wahrgenommen.179 Max Weber bietet demgegenüber eine deutlich gehaltreichere Perspektive. Zweitens: Nicht die Fixierung an Herrschaft ist hierbei Webers Thema, wie man ihm vorgeworfen hat. Sein Thema ist vielmehr: Das von wertrationalen wie von zweckrationalen Motiven geleitete soziale Handeln der Individuen in Gruppen nach selbstgesetzten Normen und zur Verwirklichung vereinbarter Ziele. Weber beobachtet dieses Handeln der Individuen in Gruppen in einer weitreichenden geschichtlichen Perspektive, die Antike, Mittelalter, frühe Neuzeit und Moderne des Okzidents miteinander verknüpft und außerdem andere Kulturen vergleichend einbezieht. Dieser Ansatz übertrifft nach Inhalt und Reichweite auch vergleichbare neue, derzeit diskutierte Ansätze der Erforschung sozialer Gruppen, wie z. B. das französische Konzept der ›sociabilité‹, erheblich. Denn das auf alle Formen von ›sociabilité‹ gerichtete Forschungsinteresse unterscheidet einerseits nicht mehr die geschichtlich relevanten und wirkmächtigen Formen der Gruppenbildung von jenen, die nur eine eingeschränkte und auf die kleinen Gegebenheiten des Alltagslebens beschränkte Wirkung hatten. Damit verliert es andererseits aber auch den Blick für alle epochenspezifischen und diachronischen Differenzierungen und Wirkungen von Gruppen in der Geschichte.180 Drittens: Nicht ›Stände‹ (Adel, Bauern usw.) sind Forschungsgegenstand, sondern soziale Gruppen, die ihrerseits ständische Qualität hervorbringen. Dies impliziert eine andere sozialgeschichtliche Sicht der mittelalterlichen Gesellschaft, deren Tragweite umfassend zu erproben wäre, auch deshalb, weil eine Betrachtung der mittelalterlichen Gesellschaft 179
180
181
178 Max Weber, Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter. Stuttgart 1889. 179 Belege zu dieser Behauptung bei Oexle, Das entzweite Mittelalter (wie Anm. 3), 4ff. 180 Vgl. die programmatischen Ausführungen von Maurice Agulhon, La sociabilité est-elle object d’histoire?, in: Sociabilité et société bourgeoise en France, en Allemagne et en Suisse 1750–1850. Hrsg. v. Étienne François. Paris 1986, 13–23. Zur eigenartigen Genese des Konzepts der ›sociabilité‹ Ders., Vu des coulisses, in: Essais d’ego-histoire. Hrsg. v. Pierre Nora. Paris 1987, 9–59, 33ff.
92
KULTURWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN ÜBER SOZIALE GRUPPEN
nur unter dem Stände-Aspekt den Gegensatz zur Moderne zeigt, die Betrachtung der mittelalterlichen Gesellschaft unter dem Gruppen-Aspekt jedoch die Modernität des Mittelalters.181 Viertens: Weber macht darauf aufmerksam, daß die Deutungen historischer Phänomene mit der Geschichte eben dieser Phänomene kausal verbunden sind. Dies ist ein Element einer wirklich modernen Epistemologie der historischen Erkenntnis, dessen Anwendung im konkreten Forschungsprozeß freilich weithin noch nicht recht gelungen ist. Viel Stoff zum Nachdenken also, und vielleicht nicht nur für Mediävisten. 182
181 Dazu auch Oexle, Das entzweite Mittelalter (wie Anm. 3).
93
II. Gründer»väter« der Soziologie über Solidarismus, Berufsmoral und Genossenschaften, oder: die Wiederentdeckung des Mittelalters
Johannes Weiss
Wesenwille Über eine soziologische Aporie bei Ferdinand Tönnies und Max Weber 1. Unter den Gelehrten in seinem Umkreis, die sich teils schon lange vor, überwiegend aber im Zuge der Gründung der DGS (Deutsche Gesellschaft für Soziologie) als Soziologen verstanden, war nur einer, den Max Weber ohne Wenn und Aber immer als solchen anerkannte und schätzte: Ferdinand Tönnies. Als er in einem Brief an Heinrich Herkner vom 16. Mai 19091 den Verzicht auf eine führende Funktion in der DGS damit begründet, dass seine Mitwirkung hauptsächlich in einer »rücksichtslosen Kritik« derjenigen – namentlich genannten – Gründungsmitglieder (darunter »auch Simmel«) bestehen werde, die sich als Vertreter der Soziologie i.e.S. verstünden, fehlt Ferdinand Tönnies. Nicht Othmar Spanns Wirtschaft und Gesellschaft, worauf er sich in einer Simmel-Kritik stützt, und auch nicht Simmels Soziologie, sondern Gemeinschaft und Gesellschaft, das »dauernd wichtige Werk«, wird in der Vorbemerkung zum Kategorienaufsatz als Inspirationsquelle hervorgehoben. Und einen Vortrag zur »Moralstatistik«, den Tönnies 1908 auf einem Philosophiekongress in Heidelberg in Webers Anwesenheit hielt, nannte er in einem Brief das Beste, was er nach jenem Hauptwerk von Tönnies kenne2. Schließlich hatte er Tönnies schon 19093 geschrieben, dass er das ihm übersandte »Büchlein über die ›Sitte‹4« »mit »großem Interesse und Belehrung« gelesen habe. Einem zukünftigen Gedankenaustausch müsse vorbehalten bleiben zu klären, ob es bei bestimmten Passagen nur um »abweichende Formulierungen oder sachliche Differenz der Ansichten« gehe; im Übrigen handele es sich dabei »durchwegs um bloße Interpretation von Einzelfakten«. Von den »wichtigeren Dingen« seien ihm, Weber, nur Status und Funktion des Begriffs »Wesens-Wille« (sic Weber) unklar. Er spiele im vorliegenden Büchlein wie im Hauptwerk eine be1 MWG (= Max Weber-Gesamtausgabe, Tübingen: Mohr Siebeck 1984ff.) II/6: S. 121–123, hier S. 121. 2 MWG II/5: S. 654f. 3 am 29. August, MWG II/6: S. 237f. 4 Ferdinand Tönnies: Die Sitte, Frankfurt/Main: Rütten und Loening 1909; alle nachfolgenden Seitenangaben im Text beziehen sich auf dieses Buch.
97
JOHANNES WEISS
deutende Rolle – wegen seiner »heuristischen Kraft« (Weber), womöglich aber auch deswegen, weil er eine (entschieden positive) Wertung mit sich führe, in Webers Terminologie also ein »Wertbegriff« sei.
2. Auf diese Bemerkungen und Bedenken Webers komme ich zurück. Zuvor sei in aller Kürze daran erinnert, mit welcher Zurückhaltung sich Weber auf die Tönnies’sche Begrifflichkeit und Argumentationsweise einlässt – im Kategorienaufsatz und im überarbeiteten und noch zum Druck gegebenen Teil des Handbuch-Beitrags. Bei der im Kategorienaufsatz präsentierten Begrifflichkeit orientiert sich Weber, wie bekannt, nicht an Tönnies, vor allem wird dessen alles bestimmende Begriffsdichotomie nicht übernommen, ja nicht einmal erwähnt, das »Gemeinschaftshandeln« zum »spezifischen Objekt« bzw. Oberbegriff der Verstehenden Soziologie insgesamt erklärt. Allerdings wird man einen mittelbaren und nicht kenntlich gemachten Einfluss von Tönnies darin sehen müssen, dass a) das »Gesellschaftshandeln«, wenn auch als Unterbegriff, terminologisch spezifiziert und b) das Problem der Rationalisierung als wesentliches Thema der Soziologie konstatiert wird. Daran hätte Weber in den »soziologischen Grundbegriffen« da anschließen können, wo er – nach dem Grundbegriff »Kampf« und vor zwei weiteren Begriffsdichotomien (offene und geschlossene Beziehungen; Solidaritäts- und Vertretungsbeziehungen) – die grundbegriffliche Unterscheidung von »Vergemeinschaftung« und »Vergesellschaftung« einführt. Dazu bemerkt er, die eigene Terminologie (Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung eben) »erinnere« an die Unterscheidung von Tönnies, der ihr aber »für seine Zwecke alsbald einen wesentlich spezifischeren Inhalt gegeben« habe. Das ist sehr ungenau, ebenso Webers Zuordnung des zweckrationalen, aber auch des affektuellen und des traditionalen Handelns zur »Vergesellschaftung«, des wertrationalen zur Vergemeinschaftung. Tönnies selbst bezieht sich an späterer Stelle auf Webers Typologie und ordnet nur das zweckrationale Handeln der Gesellschaft zu, die übrigen drei Typen der Gemeinschaft. Es wäre falsch zu behaupten, Weber sei von der Tönnies-Dichotomie überhaupt nicht beeinflusst worden; sie hat ihn zweifellos inspiriert – und herausgefordert. Im Kategorienaufsatz fungiert sie unausgesprochen als gedanklicher Spannungsbogen, der die Heuristik der Begriffsdifferenzierung zwar nicht ausschließlich, aber erkennbar (und wesentlich) bestimmt. Und in den Grundbegriffen gibt es den ausdrücklichen Bezug auf Tönnies, so allerdings, dass der idealtypisch-heuristische (und 98
WESENWILLE
keinesfalls essentialistische) Sinn der Unterscheidung hervorgehoben wird, indem Weber die Nominalform der Begriffe durch ihre – Prozesse und Übergänge, nicht Zustände oder gar Wesenheiten bezeichnende – Verbalform ersetzt.
3. Wie wenig Weber in diesen grundsätzlichen und grundbegrifflichen Fragen den Eindruck erwecken möchte, er folge von Tönnies übernommenen Vorgaben, lässt auch die Art und Weise erkennen, in der er »Sitte« als soziologischen Grundbegriff einführt. Tönnies hatte der Sitte, wie bemerkt, ein eigenes Büchlein gewidmet, in dem sie als die wichtigste Realisierungsform von Gemeinschaft beschrieben wird. Dieses Büchlein wird von Weber zwar angeführt5, anders als die auch von Tönnies diskutierten Analysen Rudolf von Iherings6 aber nicht in die eigenen Überlegungen einbezogen. Ähnlich wie Tönnies bestimmt Weber die Sitte als »soziale Beziehung«, die sich durch eine »auf langer Eingelebtheit« beruhende »tatsächliche Übung« erhält, stellt ihr aber auf der gleichen Begriffsebene den durch eine entsprechende »Interessenlage« bedingten »Brauch« an die Seite, außerdem die »Mode«, bei der im genauen Gegensatz zur »Eingelebtheit« gerade die »Neuheit« eines entsprechenden Verhaltens als »Quelle der Orientierung« fungiere.7 Eine (womöglich bewusst gegen die Begriffsdichotomie von Tönnies gerichtete) begriffliche Diversifikation findet sich bei Weber auch, was die in diesem Zusammenhang zu unterscheidenden Formen der »Rationalisierung« betrifft: Neben einer »planmäßigen Anpassung an Interessenlagen«8 sei hier auch ein Übergang zur »Wertrationalisierung« denkbar, in »negativer« Wendung und »auf Kosten des affektuellen Handelns« aber auch die Umstellung auf ein »rein zweckrationales«.9
4. Die Sitte entspricht nach Tönnies auf der sozialpsychologischen Ebene dem, was er auf der individual-psychologischen »Gewohnheit« zu nennen vorgeschlagen hatte. Wie »Gewohnheit«, bemerkt er, habe auch 5 6 7 8 9
MWG I/23: S. 186. Rudolf von Iherings: Der Zweck im Recht, Leipzig: Breitkopf & Härtel 1877. MWG I/23: S. 180. Ebd.: S.182. Ebd.
99
JOHANNES WEISS
»Sitte« einen dreifachen Sinn – Tatsache, Norm und (diese schaffender) Wille. Das »Subjekt« dieses Willens, das die Sitte erzeugt und trägt, ist nach Tönnies, jedenfalls in letzter Instanz, das »Volk«, dieses verstanden als »Gemeinschaft« der Lebenden, der Toten und der Nachkommen (15). Die eigene Nachfrage »Wer ist das Volk?« beantwortet Tönnies, indem er die Schwierigkeit einer Antwort hervorhebt: »Das Volk ist ein geheimnisvolles Wesen, nicht leicht zu begreifen« (14). Fast von selbst verstehe sich, dass der »Volkswille« auf das »Leben« und das »Wohl« des Volkes gerichtet sei (16, vgl. 49) Und er sei als »allgemeines Wollen im Unterschiede und Gegensatz zum einzelnen« (ebd.) zumindest »der Idee nach« auch »ein notwendiges und vernünftiges« (ebd.). Das sei auch der Grund, weshalb er hier von »Wesenwille« gesprochen habe (17). Angesichts derart schwerwiegender Behauptungen einerseits, der von Tönnies betonten großen »Buntheit« und »Wirrsaal« der Erscheinungsformen von »Sitte« andererseits, ist der Mangel an gedanklicher Ordnung und Systematik seiner Darlegungen eklatant. Tatsächlich erklärt Tönnies es zur Aufgabe einer – an anderer Stelle durchzuführenden – »philosophischen Untersuchung« (meine Hervorhebung, J.W.), der Frage nachzugehen, »wo ... die Einheit der Sitte, das Gemeinsame und Wesentliche, das in all diesen Verschiedenheiten enthalten sein mag« (18), liege.
5. Einiges sei noch angeführt, weil es von der Sache her oder aus systematischen Gründen besonders wichtig erscheint. Was die Entstehung der Sitte betrifft, so ist sie nach Tönnies kein Produkt eines »gesetzgeberischen Willens«, entspringt nicht dem »Beschluss« eines einzelnen Herrschers oder einer Versammlung, entstehe vielmehr »durch die Übung, aus der Praxis«, gründe im »Herkommen«, in der »Überlieferung« (17). »Sitte bedeutet Zähmung, bedeutet Kultur« (61), deshalb meine geschichtlicher Wandel auf diesem Felde einen Übergang zur »edleren Sitte« (27). »Rohe Sitten« gebe es »massenhaft«, die Sitte aber habe »ihrer überwiegenden Richtung nach einen humanen Charakter« (41) – derart, dass sich am Ende die Frage stelle, ob es noch um Sitte gehe –»oder ist es die Moral, die Sittlichkeit?« Aus der engen Verbindung der Sitte mit religiösen, d.h. für Tönnies: abergläubischen, Vorstellungen ergeben sich typischerweise höhere, wirksamere Formen (der Sitte), der Toten- und Ahnenkult ist die »Sitte der Sitten« und zugleich der Anfang aller Religion (21), Sitte und Religion bilden die gemeinsame Wurzel des Rechts (34). 100
WESENWILLE
6. Derart beschreibt Tönnies die aus dem »allgemeinen Wollen« der Völker hervorgehende, deren Lebenserhaltung und Wohlergehen dienende und insofern den »wesentlichen Inhalt« des gemeinschaftlichen Daseins umschließende Sitte. Sie wird immer aufs Neue durch »Herkommen« und Überlieferung weitergegeben, indem sie in der geschichtlichen und kulturellen »Mannigfaltigkeit und Vielfalt« ihrer Erscheinungsweisen insgesamt immer »edlere« Formen annimmt. Und Tönnies deutet zumindest an, dass am Ende dieses Prozesses die Aufhebung der Sitte in die Sittlichkeit resp. Moral steht. Der letzte Abschnitt des Büchleins schließlich handelt von den Grenzen ihrer (der Sitte) Existenz und Wirksamkeit, Gültigkeit und Beschreibbarkeit. »Die Gesellschaft ... steht in einem gewissen notwendigen Gegensatz zur Sitte. Sie ist modern, sie ist gebildet, ist weltbürgerlich« (86). Zwar wäre eine Überwindung der herrschend gewordenen »gesellschaftlichen Zivilisation« möglich, sie bedürfte aber vor allem einer »Neugestaltung der ökonomischen Grundlagen« derart, »dass die natürliche Wechselwirkung von Produktion und Konsumtion wieder an die Stelle der Überherrschaft des beweglichen Kapitals, des Handels und Verkehrs träte« (87). Das »würde auch das Leben wieder stabiler, ruhiger, gesünder machen, es würde eine mit Bewusstsein gepflegte Sitte, wie eine ebenso gepflegte Kunst ermöglichen, würde sogar Religion zu neuem Leben als ›Weltanschauung‹ im Geiste der Wahrheit, oder besser: als Streben nach dem Geiste der Wahrheit und Verehrung ihrer Idee zu erwecken vermögen« (87f.). Der »andere Ausdruck der Gesellschaft« (gemeint ist wohl: neben der Ökonomie) sei, sagt Tönnies, der Staat, und er wirke »ganz analog zur Gesellschaft« (88) – insbesondere indem er »dem Fortschritt [diene], der Entwicklung freier Persönlichkeiten … auf Kosten des Volkes und seines gemeinschaftlichen, genossenschaftlichen Lebens« (ebd.). »Alles Heimatliche, Traute, Gemütliche verschwindet, das Individuum wird auf sich selbst gestellt« (87). Zwar seien Sitten »höchst unvollkommene, oft kindliche, zuweilen kindische Ausdrücke des Volksgeistes, aber sie [seien] des Volkes eigener Wille, dessen es sich freut, während der Wille der Obrigkeit, auch wenn er theoretisch konstruiert werden kann als ein vom Volke aus sich herausgesetzter (autorisierter), ihm als ein fremder gegenübertritt« (90). Deshalb werde »ein geistig reifer und stärker werdendes Volk ... wieder sein eigener Herr sein [wollen]«. »Es will im Staate sich selbst erkennen, sich in den Staat hineinbilden.« … Soweit dies gelingt, ist auch ein gewisses Wiederaufleben der Sitte möglich; soweit ihr nicht die Gesellschaft und ihr Zeitgeist entgegenwirken« (90). Die »unteren Klassen«, in denen sich (eigentlich) »das Wesen des Volkes ... mit seinen 101
JOHANNES WEISS
Tendenzen zu Eintracht und Sitte, zur ›Solidarität‹« (91) finde, nähmen allerdings »in ihrer fortschreitenden Befreiung und Entwicklung »resoluten Anteil an einer wissenschaftlichen Vernunft, welche immer am meisten, und am meisten unmittelbar die Tendenzen der Individualisierung begünstigt« (92).
7. Den Widerstreit seiner wissenschaftlichen und seiner sozio-politischen Position sah Tönnies vollkommen klar. Tatsächlich spricht er in dieser Hinsicht nicht nur von einem logischen Problem, einer Aporie eben, sondern einem existentiellen. Mancher »Denker und Forscher« möge darüber klagen, dass sich der Fortschritt in Gestalt der »Entwicklung freier Persönlichkeiten ... auf Kosten des Volkes und gemeinschaftlichen, genossenschaftlichen Lebens« vollziehe. Je mehr er aber die »innere Notwendigkeit« des Prozesses begreife, desto mehr werde seine Klage verstummen. »Aber einem Gefühle des Tragischen im Gange der Dinge braucht er nicht zu wehren« (88f.). Und gewiss überkam Tönnies, dem Sozialdemokraten, dieses »Gefühl des Tragischen« vornehmlich dann, wenn er, als Soziologe, beobachten musste, wie »in den unteren Klassen« das bei ihnen besonders ausgeprägte »Wesen des Volkes mit seinen Tendenzen zur Eintracht und Sitte, zur Solidarität« sich fortlaufend abschwächte (91). Hier sei, im Blick auf den (vielen Autoren, und so auch Tönnies), sehr wichtigen historischen Hintergrund des Genossenschaftswesens zitiert, was Tönnies über die »Auflösung der dörflichen Realgemeinde« »im Namen des wirtschaftlichen Fortschritts, der rationellen Landwirtschaft« sagt: »Wie Leben und Recht des Bauern, so war das des Bürgers, namentlich des Handwerkers, in Zunft und Stadtgemeinde, durch die Sitte beherrscht, die auf der Idee der natürlichen Eintracht, der Brüderlichkeit gegründet ist«. Und Tönnies setzt hinzu: »Der Geist der Sitte ist kommunistisch und bleibt es, trotz der Entwicklung des Privateigentums. Die individuellen Rechte sind innerhalb der Sitte nicht nackt und absolut: sie sind mehr zueinander als gegeneinander gekehrt« (89).
8. Worin liegt die Tragik des Ferdinand Tönnies? Allgemein gesprochen darin, dass er als Soziologe unter einer zureichenden soziologischen Theorie nur eine solche verstehen kann, die das Ganze des geschichtlich-gesellschaftlichen (und kulturellen) Lebens der modernen Menschheit 102
WESENWILLE
erfasst und ihm eine notwendige Entwicklung zuzuschreiben und streng wissenschaftlich zu sagen versteht, wann und inwiefern diese Entwicklung als Fortschritt zu gelten hat. Man tut Tönnies gewiss kein Unrecht, wenn man sagt, er habe sich, was einen solch umfassenden Begriff und Anspruch angeht, an Auguste Comtes Geschichts- und Gesellschaftstheorie orientiert, ergänzt um substanzielle (und im Doppelsinne materielle) Elemente der Marx’schen Geschichtsauffassung. Die Soziologie gilt hier als abschließende, das Wissen aller anderen Disziplinen aufnehmende und überhöhende Wissenschaft – berufen, der Aufforderung »Erkenne dich selbst!« endlich mit den Mitteln »positiven« (d.h. strikt empirischen, nützlichen und gegen alle prinzipiellen Einwände abgesicherten) Wissens zu entsprechen. Die Sicherheit und Reichweite dieser Soziologie war noch für Tönnies derart, dass er sich – gegen Webers Protest – erbot, mit ihren Mitteln nicht nur die prinzipielle Unterlegenheit der Monarchie zu erweisen, sondern auch die Unhaltbarkeit von religiösen Überzeugungen jeder Art.
9. (Exkurs) In seinem nachgelassenen, von Othmar Spann postum und als Fragment herausgegebenen Buch Die Entstehung der Soziologie (1928) 10 gibt Georg von Below eine außerordentlich kenntnisreiche Darstellung der Entstehung und Geschichte einer alternativen (auch nicht so, sondern etwa Gemeinschafts-Lehre genannten) »Soziologie«, die, aufklärungs-kritisch eingestellt und wesentlich von der Romantik, der historischen Rechtsschule und der historischen Nationalökonomie beeinflusst und multidisziplinär orientiert, nach Belows Urteil eine bessere, sachgerechtere Form eines Erkenntnisstrebens repräsentiere als die nach dem Vorbild der Naturwissenschaften aufgefasste und betriebene Disziplin (die es in Wahrheit gar nicht geben könne). Diese alternative resp. implizite Soziologie aber hatte, nach von Below, in der Vielfalt ihrer Erscheinungsformen einen und denselben Feind: Auguste Comte und seine Über-Soziologie.
10. Hätte Tönnies diese Kritik, wenn nicht über-, so doch wahr- und ernstgenommen, wäre ihm nicht jede Erfahrung von Aporie und Tragik erspart geblieben – Simmel und Weber kannten solche Erfahrung durchaus, auf 10 Jena: Gustav Fischer 1928.
103
JOHANNES WEISS
ihre Art –, wohl aber eine solche, die aus der – intellektuellen und praktischen – Alternativlosigkeit einer einmal übernommenen Erkenntnishaltung entsprang. Es ist vor allem die von Auguste Comte begründete und von ihm inspirierte höchst prätentiöse Soziologie, die Friedrich Jonas11 meint, wenn er sagt, in Deutschland sei die Soziologie aus einer »Kritik der soziologischen Erkenntnis hervorgegangen«. Das gilt jedenfalls für Simmel, Weber und andere Vertreter der »klassischen« deutschen Soziologie, nicht jedoch für Tönnies, den historisch ersten von ihnen. Und das Tragische seiner Stellung liegt darin, dass das, was ihn sozio-politisch und kulturell (mit Ausnahme der Religion ) tief bewegte und wovon er, überwiegend mit deutlicher Sympathie, in seinem Büchlein Die Sitte handelte, in der Gesellschaftslehre Comtes durchaus keinen Platz findet. Es verdankt sich dem Wesen- und nicht dem (bloßen) Kür-Willen, die ihm zugehörige Art von Sozialität ist die »gemeinschaftliche, genossenschaftliche«. Das kann nicht heißen, Tönnies habe viel besser in die von Below beschriebene »neue Bewegung« gepasst, welche »die allgemeinen Kräfte zur Anerkennung bringen [wollte], so denn auch alle Arten von Gemeinschaft, Volk und Staat, Stadt und Zunft« etc.12 – dies alles mit der »Tendenz, den Wert der Gemeinschaft zu betonen … statt [sie] aus menschlicher List und menschlichem Egoismus, also aus Einzelabsichten der Einzelnen herzuleiten«.13 Eine solche Einseitigkeit in der Wahrnehmung und Wertung dessen, was im Begriff der Modernisierung gefasst wird, gibt es bei Tönnies aber nicht. Nicht um deren Delegitimierung/Diskreditierung geht es ihm, sondern um den großen Preis, der für den mit der Modernisierung einhergehenden und von ihm mit Nachdruck behaupteten »Fortschritt« zu zahlen ist. Und es hat wohl mit der betonten Nüchternheit seiner Analyse zu tun, dass er dabei diesem so betonten Fortschritt mehr zu opfern bereit ist als nötig – und was an Gegenläufigem seinen eigenen sozio-politischen und moralischen Idealen eindeutig entspricht. Hierzu gehört, dass er die so außerordentlich wichtige und produktive Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft nicht nur als begrifflich-idealtypische Opposition, sondern als »Realrepugnanz« versteht, die auch eine eindeutige Entwicklungslogik hinsichtlich der historischen Abfolge impliziert: Auf Gemeinschaftliches folgt Gesellschaftliches, nie umgekehrt.
11 Geschichte der Soziologie, Bd.4, Hamburg: Rowohlt 1969. 12 Georg von Below, ebd.: S. 31. 13 Ebd.
104
Michael Schmid
Émile Durkheim: Berufsmoral, Solidarismus und Gilden Ein Rekonstruktionsversuch »Die Menschen können nicht zusammenleben, ohne sich zu verstehen, und folglich nicht, ohne sich gegenseitig Opfer zu bringen, ohne sich wechselseitig stark und dauerhaft zu binden. Jede Gesellschaft ist eine moralische Gesellschaft.« (Durkheim 1988: 285) »It is nevertheless true that respect for rules is the condition of all corporate action.« (Durkheim 1979: 160)
1. Vorbemerkung Ich werde versuchen, Émile Durkheims Auffassung über die geschichtsmächtige Rolle von Zünften und Gilden nachzuzeichnen. Da ich mit Talcott Parsons (Parsons 1991: 215) vermute, dass Durkheim nur deshalb auf Zünfte bzw. Berufsgenossenschaften und auf die dort beheimateten Formen der »Berufsmoral« zu sprechen kam, weil er auf diesem Weg ein für ihn wichtiges gesellschaftstheoretisches Problem lösen wollte, werde ich zunächst – um dessen Identifikation zu erleichtern und in gebotener Kürze – die Grundzüge der Durkheim’schen Gesellschaftsanalyse umreißen und hernach schildern, aufgrund welcher ihrer Vorgaben und Implikationen Durkheim darauf aus war, den Zünften eine einschlägige »Funktion« auch und zumal für moderne Gesellschaften zuzuweisen.
2. Das zentrale Problem der Durkheim’schen Gesellschaftstheorie Durkheims Gesellschaftsanalyse ist unter divergierenden Gesichtspunkten interpretiert worden (Parsons 1967: 3–34, Lukes 1975, König 1978, 105
MICHAEL SCHMID
Tyrell 1985, Stedman Jones 2001, Delitz 2013: 10ff., Müller 2019 u.a.). Ich denke aber, dass man keinen Fehler begeht, wenn man Durkheim in Anlehnung an Parsons (Parsons 1968: 301ff.)1, dem hierin viele gefolgt sind, als den Mitbegründer einer Integrations- oder Ordnungstheorie der Gesellschaft liest (Münch 1982: 281ff., Müller 1983, Tyrell 1985, Schluchter 2006: 130ff. u.a.). Diese Theorieform bemüht sich um die Erforschung der »strukturellen« Voraussetzung, unter denen es den Mitgliedern unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen gelingen kann, theoretisch explizierbare Abstimmungsmechanismen auszubilden und zu institutionalisieren, in deren Gefolge »gewisse Formen des moralischen Zwangs« (Durkheim 1991: 99) wirksam werden. Derartige Zwänge sollten darauf abzielen, »Ordnung und Friede« in und zwischen sozialen Gruppen (Durkheim 1988: 45, 56 u.a.) zu schaffen bzw. – allgemeiner gefasst – deren »Zusammenhalt« (Durkheim 1991: 18f.) zu begründen und durchzusetzen. Dass sich die betreffenden Analysen auf die Kausalbedeutung von Beziehungsformen und deren Verteilungsfolgen (Durkheim 1961, Durkheim 2009) für das menschliche Entscheidungshandeln konzentrieren und sich an den Gegebenheiten der zu Durkheims Zeiten durch Léon Walras und dessen Lehrstuhlnachfolger Vilfredo Pareto popularisierten Gleichgewichtsanalyse orientieren wollten2, ist für meine Themenstellung weniger wichtig als die Tatsache, dass Durkheim die gesuchten Mechanismen gesellschaftlicher Integration keinesfalls auf dem Feld der Herstellung bzw. des Austausches bedürfnisrelevanter (vor allem: materieller) Güter suchen wollte, wie dies die von ihm so genannten »Ökonomisten« (Durkheim 1988: 50 u.a.) vermutet hatten; Durkheim sah aber auch davon ab, sich den Aufbau und Erhalt geordneter Gesellschaftsverhältnisse als eine Wirkungsfolge militärscher oder freiwilliger »Assoziationen« zu denken, wie Herbert Spencer vorschlug (Spencer 1897a: 568–642), und er hat zudem darauf verzichtet, diese Mechanismen nach der ihnen zugrunde liegenden Produktions- bzw. Herrschaftsform zu untergliedern, wie dies in der Tradition Karl Marx’ und Max 1 In Wenzel 1990 wird der Ordnungsaspekt der Parsonstheorie vorbildlich herausgearbeitet. 2 Paretos entsprechende Vorschläge sind für die Soziologie mehr als wichtig geworden (vgl. Homans und Curtis 1934, S. 258ff.). Ich unterstelle, dass Durkheim die ökonomische Gleichgewichtsanalyse kannte und dass sie sich in seiner theoretischen Leitidee niederschlug, die Analyse von Gesellschaften unter Beachtung der »conditions of social stability« (Durkheim 1958, S. 234) betreiben zu sollen. Zur Geschichte und Systematik der Gleichgewichtsidee vgl. Willeke 1991 und Ingrao/Israel 1990. Die beiden zuletzt genannten Autoren konzentrieren sich auf die französische Geschichte der Gleichgewichtsidee und betonen aber auch die nachhaltige Bedeutung von Montesquieus »Geist der Gesetze«, den Durkheim mehr als genau kannte (vgl. Durkheim 1965).
106
ÉMILE DURKHEIM: BERUFSMORAL, SOLIDARISMUS UND GILDEN
Webers nahegelegen hätte. Stattdessen deutete er sie – wie man heute sagt – als »symbolisch codierte« (Parsons 1968: 310) bzw. »kulturelle« Mechanismen und damit als Prozesse, die darauf abstellen, den ordnungsbegierigen Gesellschaftsmitgliedern ein »gemeinsames Glaubensoder Vorstellungssystem« (Tyrell 1985, Durkheim 1981) zu verschaffen, oder wie es bei Durkheim selbst heißt: eine »conscience collective« aufzubauen (Durkheim 1967: 45–83, Durkheim 1981a: 368–380, Durkheim 1988: 129ff.) und damit eine allseits »geteilte«, sowohl kognitiv wie ethisch einschlägige Weltauffassung3. Die genauere Ausfertigung des damit umrissenen Vorhabens konfrontiert die Durkheim’sche Gesellschaftstheorie daraufhin mit der Frage, wie die Entstehungsbedingungen, der Verlauf und die Folgen jener Prozesse beschaffen seien, die die integrationsdienliche Einheit der menschlichen Weltsichten sicherstellen konnten bzw. wie die Untersuchung jener Umstände angelegt werden müsse, angesichts derer eine bislang gefestigte kollektive Bewusstseinslage unter Veränderungsdruck geraten konnte und mit welchen stabilitätsrelevanten Folgen deren Infragestellung verbunden sein mochte. Die verursachenden Faktoren derartiger Gefährdungen suchte und fand Durkheim – wenigstens zu Beginn seiner Karriere – in der Umgestaltung sozial-ökologischer (bzw. wie er sie nannte: »morphologischer«) Verteilungsstrukturen, wie dem Bevölkerungswachstum und Migrationsprozessen, Interaktionsdichteveränderungen, Verschiebungen der wechselseitigen (kommunikativen) Erreichbarkeit oder der Neuetablierung, Erweiterung und Umschichtung von Tätigkeitsfeldern, wohingegen sich Durkheim die zu erklärende Metamorphose der kollektiven »Denk- und Verhaltensregeln« (Schluchter 2006: 130) – durchaus in darwinscher Wendung seiner Fragestellung – als eine konkurrenzinduzierte Anpassung an diesen »strukturellen« Wandel vorstellen wollte. Dieser Anpassungsthese folgend sehen die Erbringer unterscheidbarer Arbeitsleitungen zu, einen Wirkungsbereich zu finden, innerhalb dessen sie dem Konkurrenzdruck eventueller Mitbewerber entgehen können (Durkheim 1988: 252f., 325f., 408 u.a.). Wie dies im 18. und 19. Jahrhundert verbreitet üblich war, verstand auch Durkheim die darauf abzielenden Gesellschaftsgeschichte als einen gerichteten evolutionären Prozess, in dessen Verlauf sich ein einmal erreichtes Gleichgewichtsverhältnis zwischen den gesellschaftlich relevanten Tätigkeiten 3 Ob man der Rekonstruktion von Durkheims Berufsgruppenauffassung einen guten Dienst erweist, wenn man (mit Durkheim) »das Soziale« – eben weil das Kollektivbewusstsein eine handlungsleitende Rolle spielt – durchweg als »imaginär« und »symbolisch« einordnet (vgl. Delitz 2013, S. 215), lasse ich unerörtert. Ebenso wenig Sinn macht es, die Herstellung einer koordinativen Gesellschaftsordnung als eine »Gegebenheit der Handlungssituation« einzuordnen, die es nicht empirisch, sondern allenfalls »konzeptionell« zu erforschen gelte (vgl. H.B. Schmid 2012).
107
MICHAEL SCHMID
und deren Regulationen aufzulösen droht, um es unter (wenigstens bisweilen erfolgreicher) Bearbeitung der Probleme, die durch den genannten sozial-strukturellen Wandel hervorgebracht worden waren, neuerdings zu gewinnen. Wie erinnerlich hat Durkheim in seinem Frühwerk über die »soziale Arbeitsteilung« zwei sich auf diese Weise ablösende »Gesellschaftsformen« – wie Marx gesagt hätte (Marx 1974: 9 u.a.) – unterschieden. Zum einen die sogenannten »primitiven« oder »segmentären« Gesellschaften (Durkheim 1988: 118ff.), die alle denselben (in letzter Instanz verwandtschaftsbasierten) Aufbau aufweisen. Ihre Bevölkerung ist nur wenig umfangreich und durch nur geringe Siedlungsverdichtungen gekennzeichnet, sie verfügen zudem ausschließlich über eine geschlechtliche bzw. den Altersunterschieden geschuldete Arbeitsteilung und sie wirtschaften infolge dieser Beschränkungen in der Nähe des Subsistenzniveaus; die hieraus resultierenden Nachteile werden indessen aufgewogen durch den Tatbestand, dass ihre Mitglieder eng vernetzt sind, dass alle ein »ähnliches« Kenntnisniveau bzw. Verhaltensrepertoire aufweisen und deshalb unter nur geringem Informationskostenaufwand gemeinsame kognitive wie moralische Überzeugungen ausbilden und deren eventuelle Nichtbeachtung ebenso kostengünstig überwachen können. In diesem Zusammenhang glaubte Durkheim zeigen zu können, dass sich derartige »primitive« Gesellschaften durch die drakonische Sanktionierung zumal moralischer Verfehlungen vor weitreichenden, gleichgewichtsdestabilisierenden »Verhaltensabweichungen« bewahren konnten. Der darin zum Ausdruck kommende Zwang der Verhältnisse war ihm Anlass für die Vermutung, dass akephale oder pristine Gesellschaften dieser Art sich durch die Existenz einer sogenannten »mechanischen Solidarität« kennzeichnen ließen, welche die Akteure, ohne ihnen eine Widerrede zu gestatten, auf die Beachtung und Befolgung verbindlicher Zielsetzungen und Verhaltensregeln verpflichtet. Durkheim hat verschiedentlich versucht, die Zweckdienlichkeit wie die Unvermeidlichkeit unterschiedlicher solcher ziel- und regelabsichernder Schutzmechanismen zu entdecken und zu erläutern, denen sich der dadurch zustande kommende »mechanisch-solidarische Zusammenhalt« verdankt, wobei der »Totemismus« (Durkheim und Mauss 1987), die Etablierung verhaltensdisziplinierender Sozialisationsprozesse (Durkheim 1977a4, Durkheim 1984) und die »rituellen« Formen der Vergemeinschaftung bzw. die daraus resultierende »effervescence collective«, in deren Gefolge 4 Zum Zeitpunkt seiner Beschäftigung mit der »Entwicklung der Pädagogik in Frankreich« unterschied Durkheim neben »segmentären« und »modernen« Gesellschaften auch eine »mittelalterliche« Gesellschaftsform, zog aber aus diesem erweiterten Katalog keine systematischen Konsequenzen für seine Betrachtungen zur Arbeitsteilung.
108
ÉMILE DURKHEIM: BERUFSMORAL, SOLIDARISMUS UND GILDEN
sich gruppenweite Verbundenheitsgefühle einstellen würden (Durkheim 1981: 269ff.), die gewichtigste Rolle spielten.5 Die »höheren« (oder »modernen«) Gesellschaften sollten sich demgegenüber durch andere Eigenheiten und damit durch eine veränderte Solidaritätsform kennzeichnen lassen (Durkheim 1988: 162ff.). Im Vergleich zu segmentären Gesellschaften weisen sie eine gesteigerte Arbeitsteilung, verlängerte Kommunikations- und Verkehrswege und ein entsprechend erhöhtes Interdependenz- bzw. Transaktionskostenniveau auf. Die misslichste Folge dieses Strukturwandels ist, dass sich die »mechanische« Einheitlichkeit des Kollektivbewusstseins, zumal infolge der Tatsache, dass die Gesellschaftsmitglieder in höchst verschiedenartigen und hochgradig singularisierten Tätigkeitsbereichen engagiert sind, aufzulösen droht, weil sich die Akteure weder persönlich gut kennen noch sich besonders kosteneinschlägig über die jeweiligen Lebensumstände ihrer Mitakteure informieren können und diese deshalb nur unter erhöhtem Aufwand mit moralischen Erwartungen zu erreichen und zu »überwachen« vermögen. Diese Auflösungserscheinungen schlagen sich in zwei – wie Durkheims Zeitdiagnose meinte – bislang unerfüllten und nicht ohne zusätzliche Maßnahmen bearbeitbaren Mängeln nieder. Zum einen erschweren moderne Gesellschaften es ihren Mitgliedern, zur Absicherung gesamtgesellschaftlich ausgreifender Wissens- und Moralbestände auf zumal religiös verbürgte Vorstellungen zurückzugreifen. Zwar glaubt Durkheim, im sogenannten »Kult der Person« (Durkheim 1988: 470) bzw. im »Kult des Menschen« (Durkheim 1986a: 60) wenigstens Reste eines den modernen Verhältnissen angemessenen »conscience collective« identifizieren zu können, das die Vernünftigkeit und Urteilskraft des Einzelnen und weniger die Gleichartigkeit aller betont, hielt aber die damit verbundenen Leitideen für zu abstrakt, als dass sie sich als unstrittige Steuerungsinstanz zur konflikteindämmenden Ausgestaltung alltäglicher Verkehrsprobleme verwenden ließen; denn weder lässt sich aus dieser »Sakralität des Individualismus« (Joas 1997: 196) ableiten, welche Beziehungsformen die Akteure zueinander aufbauen sollten, noch in welcher Weise diese zu regulieren sind (Müller 1983: 130f.). Parallel dazu wird ein zweiter Mangel moderner Gesellschaften sichtbar (Durkheim 1988: 118ff.). Zwar mag das überkommene Kollektivbewusstsein noch gemeinsam gültige Vorstellungen darüber enthalten, dass Mord und Totschlag, Körperverletzung, räuberischer Diebstahl, 5 Diese Idee, dass sich die gesellschaftliche Integration der rituellen, »performativ« geordneten Herstellung gemeinsamer Situationsdeutungen und Bewertungen verdanke, hat die kultursoziologische Forschung nachhaltig geprägt (vgl. für viele Joas 1997, Alexander et al. (eds.) 2006 u.a.); ebenso prägend für die weitere Entwicklung der Sozialtheorie war die benachbarte Idee, dass die Gesellschaftsmitglieder »sozialisiert« werden müssten.
109
MICHAEL SCHMID
Erpressung oder Gewaltausübung strafwürdige Verbrechen darstellen und, um einen Ausgleich zwischen Schuld und Sühne herzustellen, streng und strikt geahndet werden müssen (Durkheim 1988: 159); aber moderne Gesellschaften werden es sich kaum leisten können, die Verfolgung und Bestrafung derartiger Untaten der privaten Initiative der Geschädigten zu überlassen (Durkheim 1988: 165), ohne die Gefahr von Bürgerkriegen heraufzubeschwören. Auch stellt sich den Mitgliedern »höherer« Gesellschaften das Problem, dass die Menge »strafrechtlich« zu belangender Verhaltensformen ab- und die Häufigkeit privatvertraglicher Transaktionen zunimmt, deren immer möglichen Missbrauch oder Verletzung vermittels drakonischer Reaktionen zu regulieren als zunehmend unangemessen gilt und deren Ahndung stattdessen im Rahmen eines »restitutiven« Rechts betrieben werden muss (Gephart 1990: 56f., Gephart 1997: 360ff.). Die zu bearbeitende Frage ist demnach, wie und unter welchen Umständen die Mitglieder moderner Gesellschaften ihre Nachfrage nach Konfliktvermeidung und Vertragssicherheit bedienen (können). Tatsächlich lässt sich Durkheim zur Behandlung dieser Sachlage auf die als weitgehend ad hoc zu bezeichnende These ein, dass moderne Verhältnisse ohne die Existenz eines »Staates«6, der die rechtliche Betreuung gesellschaftlicher Transaktionen übernimmt, nicht bestehen können (Durkheim 1988: 256ff. und Durkheim 1991: 64–304); die neuzeitlichen Verkehrsverhältnisse werden nur dann konfliktfrei verlaufen, wenn es der Rechtsaufsicht des Staates gelingt, neben der Strafrechtspflege das Vertragswesen zum Generator und Träger allgemeinverbindlicher »Rechte und Verpflichtungen« werden zu lassen (Durkheim 1988: 269ff.)7. 6 Glaubt man einigen seiner Interpreten, dann hat Durkheim die Funktionalität des Staats für die (moralische und/oder rechtliche) Integration einer Gesellschaft im Verlauf seiner intellektuellen Karriere zunehmend nachdrücklicher hervorgekehrt (vgl. Lukes 1975, S. 268–276, Müller 1983, Meier 1987 u.a.). Dem steht entgegen, dass andere Deutungen diese Schwerpunktsetzung nicht zu entdecken vermögen (vgl. König 1978, Šuber 2012, Delitz 2013 u.a.). 7 Wie sich in der Folge der weiteren Entwicklung seiner Gesellschaftstheorie herausstellt, bemüht Durkheim staatliche Interventionen in allen weiteren Fällen, in denen die Gesellschaftsmitglieder nicht dazu in der Lage sind, gemeinsam verbindliche Regel zu entdecken, einzuführen und – vor allem – zu überwachen. Meine nachfolgende Rekonstruktion tut demgegenüber so, als verteidigte Durkheim die These, dass die Gesellschaftsmitglieder wenigstens zu Beginn der Evolution moderner Verhältnisse ohne staatliche Bewährungshilfen auskommen könnten. Jede Modellierung der Entstehung von Institutionen muss von dieser Annahme ausgehen, auch wenn vielen Sozialtheoretiker die Phantasie dafür fehlt sich vorzustellen, wie Akteure ihr Handeln aufeinander abzustimmen vermögen, ohne die Existenz institutioneller Regelungen bereits »vorauszusetzen«.
110
ÉMILE DURKHEIM: BERUFSMORAL, SOLIDARISMUS UND GILDEN
Ich möchte weder die Undurchsichtigkeiten von Durkheims Personenkult-These8 verfolgen noch den von ihm – zumindest im Frühwerk – nur lose angedeuteten Zusammenhang zwischen Regulationsnachfrage und Staatsentstehung erörtern9, sondern zur Hauptlinie meiner Rekonstruktion des Durkheim’schen Zunftverständnisses mit Hilfe der Frage zurückkehren, welche gesellschaftstheoretischen Folgerungen sich aus der obigen Darstellung »moderner« Gesellschaften ziehen lassen bzw. vor welches Problem Durkheims Sozialanalyse moderne Gesellschaften sich gestellt sieht und welche Lösung sie dafür anbietet. Ich denke, dass argumentative Um- und Abwege vermieden werden können, wenn man der folgenden Deutung der Durkheim’schen Position Kredit einräumt: Falls die These zutrifft, dass alle Gesellschaften vor der Aufgabe stehen, die Wechselorientierung der Akteure vermittels eines gemeinsamen Bewusstseins herzustellen und aufrechtzuerhalten, und wenn diese Anforderung als Hinweis darauf verstanden werden sollte, dass Gesellschaften ohne moralisch verbürgte Solidaritätsbande nicht bestehen können, so muss auffallen, dass moderne Gesellschaften mangels eines allseitig verbreiteten Kollektivbewusstseins bzw. einer nur schwach ausgeprägten, dem »Kult der Person« gewidmeten bzw. auf die Abwehr von Kapitalverbrechen ausgerichteten Schwundform offenbar daran gehindert sind, in vielen ihrer bestandserforderlichen Funktionsbereichen gemeinsame Ziele und gemeinsame Handlungsregulierungen ausfindig zu machen und deren allgemeinverbindliche Geltung festzuschreiben. Moderne Gesellschaften befinden sich demnach in der dauerhaften Gefahr, den Zustand der Ziel- und Regellosigkeit bzw. der »Anomie« – wie ihn Durkheim nennt – nicht verlassen zu können (Durkheim 1973: 329f., Durkheim 1975a: 171–254). Die damit angesprochenen Denk- und Verhaltensunsicherheiten besitzen mehrere Quellen und äußern sich in verschiedenen Formen (Durkheim 1973: 273ff., Durkheim 1988: 412–465), hindern die Gesellschaftsmitglieder indessen in allen Fällen daran, in »gesellige« 8 Müller 1988, S. 141ff. baut die Durkheim’sche Vorstellungen davon, was unter dem »modernen Individualismus« verstanden werden könnte, in eine bellaheske »Theorie der Zivilreligion« ein, wohingegen sich Pickering (1979, S. 12) darauf beschränkt, die Widersprüchlichkeit und Unbestimmtheit der »individuellen Repräsentationen« festzuhalten. Dem kundigen Leser kann sich aber auch die Einsicht eröffnen, dass Durkheims »Theorie der Person« all jene Frontstellungen bereinigen müsste, unter denen bereits der junge (wie der »reifere«) Hegel sich bemühen wollte, »Gemeinschaftsbindung und die Zunahme der individuellen Freiheit« zusammenzudenken (vgl. Honneth 2018, S. 28f., 175f. u.a.). 9 Dass an diesem Punkt offene Fragen zurückbleiben, hatte bereits Lukes (1973, S. 166) bemerkt, und Heike Delitz (2013, S. 110) bewertet Durkheims Auslassungen über die staatlich organisierte Rechtspflege als theoretisch nur schwer integrierbares »Umwegverfahren«.
111
MICHAEL SCHMID
Beziehungen (Durkheim 1988: 114) einzutreten, diese zum »Austausch an Gedanken und Gefühlen« (Durkheim 1991: 18) zu nutzen und sich im Gefolge der damit möglichen, gemeinsamen Ausrichtung ihres Denkens und Handelns als eine »Einheit« zu verstehen (Durkheim 1991: 42). In gegenläufiger Wendung bedeutet »Anomie« demnach, dass die Akteure offensichtlich weder dazu bereit noch befähigt sind, ihre individuellen oder privaten Bedürfnisse einer gemeinsam verbindlichen Zielsetzung unterzuordnen und zu diesem Zweck einsichtsvoll und in Anerkennung der berechtigten Interessen ihrer Mitakteure darauf zu verzichten, diese zu schädigen oder ungerecht zu behandeln. Wenn diese Diagnose stimmt, dann stellt sich (natürlich) die Anschlussfrage, ob die »höheren« Gesellschaften sich infolge dieser Unzulänglichkeiten auflösen bzw. ihre mögliche Entwicklung verfehlen werden oder ob, auf welche Weise und gegen welche Widerstände es ihren Mitgliedern gleichwohl gelingen kann, auch unter den veränderten »modernen« Strukturbedingungen, jene Verhältnisse ausfindig zu machen und herzustellen, die dem Aufbau solidarischer Beziehungen dienlich sind. Auf diese Nachfrage gibt Durkheim zwei unterschiedliche Antworten, die sich zugleich ergänzen und korrigieren, wobei freilich nur die zweite in das Themengebiet hineinführt, das mich im vorliegenden Zusammenhang zu interessieren hat10. Ich behandele deshalb die erste Antwort, die in etwa der folgenden Überlegung Raum verschafft, deshalb nur flüchtig: Vorweg wird die gesuchte »Solidarität« moderner Gesellschaften – wie bereits im Fall der »mechanischen« Solidaritätsform – als ein »moralisches Phänomen« (Durkheim 1988: 111) definiert11, das einem Zustand gemeinsamer Überzeugungen gleichkommt, der wiederum nur als eine überindividuelle »soziale Tatsache« identifiziert werden kann (vgl. hierzu Durkheim 1961: 105ff., Durkheim 1967: 84ff.). Streng parallel zum Geschehen in segmentären Gesellschaften gedacht, verdankt sich auch dieser neu zu etablierende Zustand des kollektiven Bewusstseins der Tatsache, dass die Akteure auch moderner Gesellschaften dazu in der Lage sein sollten, dauerhafte Beziehungen untereinander aufzubauen, deren gleichwohl immer möglichen Instabilitäten und Gefährdungen zum einen den 10 Die erste davon handelt Durkheim in seinem Buch »Über soziale Arbeitsteilung« ab und die zweite im berühmten Vorwort zur zweiten Auflage dieses Werkes (Durkheim 1988, S. 41–75), das in einigen Teilen wortgleich, in jedem Fall aber inhaltsidentisch ist mit den drei ersten Kapiteln seiner »soziologischen Vorlesungen«, die unter dem Titel »Physik der Sitten und des Rechts. Vorlesungen zur Soziologie der Moral« ins Deutsche übertragen wurden (vgl. Durkheim 1991, S. 9–63). 11 Das hat viele Kommentatoren dazu veranlasst, Durkheims Gesellschaftstheorie als eine »Theorie der Moralität« zu deuten (vgl. Parsons 1968, Wallwork 1972, König 1978, Müller 1983, Müller 2019, S. 127ff.).
112
ÉMILE DURKHEIM: BERUFSMORAL, SOLIDARISMUS UND GILDEN
Regulierungsbedarf abstecken, dem sich die Akteure gegenüber sehen, und die zum anderen zugleich dabei helfen, ihre Motivation aufzubauen und zu erhalten, sich den einmal etablierten Ziel- und Regelsetzungen entsprechend zu verhalten (Durkheim 1988: 162–286). Da sich – wie bereits verdeutlicht – »höhere« oder »moderne« Gesellschaften durch einen gesteigerten Grad der Arbeitsteilung auszeichnen (Durkheim 1988: 289–417), investiert Durkheim einigen Aufwand in den Beleg der These, dass die Arbeitsteilung (selbst) »eine Grundlage der sozialen Ordnung ist und immer mehr dazu wird« (Durkheim 1988: 86) und dass sich die gesuchte, den modernen Zeiten angepasste »organische Solidarität« – wie sie Durkheim bezeichnet12 – »spontan« und »geordnet« aus genau diesen, der gesteigerten Teilung der sozialen Arbeit entstammenden Strukturfolgen ergeben sollte (Durkheim 1988: 256ff., 445ff. u.a.). Möglich wird diese spontane Solidaritätsentwicklung durch die folgenden Wirkungsketten. Zum einen können die Akteure, trotz oder gerade wegen der zunehmenden Arbeitsteilung wissen, dass sie ihre Leistung nur dann erbringen können, wenn andere sie hierin durch komplementäre bzw. supplementäre Zulieferungen unterstützen, und ihnen zudem durch ihre Bereitschaft entgegenkommen, die ihnen ihrerseits angebotenen Leistungen zu akzeptieren und zu »konsumieren«. Aufgrund der damit entdeckten Leistungsinterdependenzen entsteht in jedem der beteiligten Akteure ein »Gefühl der Abhängigkeit« (Durkheim 1988: 429f.), das jede externe bzw. »top-down« angelegte, am Ende gewaltbasierte Steuerung der durch Tätigkeitsspezialisierungen gekennzeichneten Interaktionsverhältnisse – jedenfalls zu Beginn dieser Entwicklung – entbehrlich macht und in den Augen Durkheims dazu hinreicht, die Bereitschaft aller zu wecken, sich gegenüber ihren Mitstreitern solidarisch in dem Sinne zu verhalten, dass sie bereit sind und sich verpflichtet fühlen, die Leistungszuwendungen ihrer Ko-Akteure zu würdigen und zu erwidern. Allerdings traut Durkheim diesem Argument nicht wirklich, denn er ergänzt es durch den dreifachen Hinweis, dass sich das solidaritätsstiftende Gefühl der Abhängigkeit erst dann einstellen wird, wenn die jeweiligen Leistungsproduzenten die Tätigkeiten ihrer Mitakteure hinreichend 12 Hinter dieser Solidaritätssemantik verbirgt sich eine komplexe, für die französische Sozialtheorie höchst nachhaltige gesellschaftspolitische Doktrin, die ich an dieser Stelle nicht behandeln kann (vgl. hierzu Gülich 1991). Durkheims Verhältnis zum »revolutionären Syndikalismus« seiner Zeit, der den Klassenkampf im Zeichen des Solidarismus der Arbeiterschaft führen wollte, schildert Lukes 1975, S. 542–564. Auch die Klärung der theorieleitenden Differenz zwischen »mechanisch« und »organisch« erfordert einen Blick in die Mentalitätsgeschichte, den ich an dieser Stelle unterlasse, zumal sich nicht alle Kommentatoren dazu durchringen können, diese Unterscheidung für einen Ausdruck Descartesscher »clarté« zu halten (vgl. La Capra 1985, S. 84–89, Müller und Schmid 1988).
113
MICHAEL SCHMID
nachvollziehen, verstehen und deshalb deren Verdienste in angemessener Weise beurteilen können, wenn zudem die Kontakte zwischen den arbeitsteilig agierenden Akteuren häufig genug stattfinden, um solche Urteile – infolge der sich dadurch stabilisierenden Einblicke in die »fremden« Situationserfordernisse – plausibel erscheinen zu lassen, und wenn sich am Ende hieraufhin unter den Erbringern spezialisierter Tätigkeiten die Einsicht durchsetzt, dass sie ihre Leistungen zugunsten eines für alle erstrebenswerten Gesamtzwecks erbringen (sollten oder müssen)13. Die unter diesen (zusätzlichen) Umständen erreichbare Dauerhaftigkeit und Intensität der Beziehungen wiederum schlagen sich – so Durkheims nicht näher erläuterte Erwartung – in Gewohnheiten der wechselwirksamen Handlungsabstimmung nieder, und diese Gewohnheiten »(verwandeln) sich sodann in Verhaltensregeln« (Durkheim 1988: 435). Da die Entstehung und Durchsetzung solcher Regeln indessen bisweilen durch Inte ressenskonflikte behindert wird bzw. trotz ihrer Beachtung wirkungslos bleiben oder gar mit negativen Externalitäten verbunden sind und insoweit selbst zum Problem werden können, bedarf auch diese Betrachtung einer Ergänzung. Dieser entsprechend gewinnen die koordinierten Zielsetzungen und die zu deren Erreichung gemeinsam praktizierten Regeln nur dann ein die Beziehungsformen ordnendes Gewicht, wenn die Organisation des wechselwirksamen Leistungsaufwands »gerecht« erfolgt. In Durkheims Augen erfordert die Lösung dieses Problems, dass jeder der beteiligten Akteure die Rückzahlungen erhält, die dem Talent bzw. dem Arbeitseinsatz entsprechen, die er in seine Leistungserstellung investiert hatte (oder einzubringen gewillt war). Dies bedeutet, dass jedem die Arbeit zugeteilt werden kann, die seinen Fähigkeiten angemessen ist, und dass zudem jene bereit sind, ihre vergleichsweise Minderversorgung zu akzeptieren, eben weil sie infolge ihrer beschränkten Handlungskompetenzen nicht mehr zu verlangen befugt sind. Derartige Vorkehrungen sollen naheliegenderweise dem Tatbestand Rechnung tragen, dass nicht alle ausgegliederten Arbeitsgänge bzw. nicht jedes der separat organisierten Tätigkeitsfelder von gleicher Attraktivität sein werden, weshalb Durkheim offenbar von der Notwendigkeit ausgeht, die Benachteiligungseffekte des nicht ohne Auseinandersetzungen verlaufenden Wettbewerbs um die Allokation unterschiedlich lukrativer gesellschaftlicher Positionen zu moderieren bzw. zu rechtfertigen. Im Lichte des damit anklingenden Problems versteht sich dann auch, wenn Durkheim zu dessen erfolgreicher Austarierung einfordert, dass »bezüglich der äußeren Bedingungen des Kampfes eine absolute Gleichheit« (Durkheim 1988: 436) bestehen müsse. Aus diesem Bemühen, das Rennen um Status und Versorgungssicherheit unter gleichen Chancen zu starten, erklärt sich zudem 13 Die Verfolgung privater Zwecke, die es natürlich gibt, ist demnach in jedem Fall nachgerade nicht solidaritätsfördernd.
114
ÉMILE DURKHEIM: BERUFSMORAL, SOLIDARISMUS UND GILDEN
und endlich auch sein Vorschlag, das Erbrecht abzuschaffen (Durkheim 1991: 300 u.a.), bzw. seine Hoffnung, dass es »immer mehr an Bedeutung (verliert)« (Durkheim 1991: 241)14. Ich verzichte an dieser Stelle darauf, diese Thesen über die »spontane« Entstehung der »organischen Solidarität« aus der Arbeitsteilung ausgiebig zu kritisieren (vgl. dazu Müller und Schmid 1988, Schmid 1989, Schmid 1998: 93–117, Tyrell 1985 und Müller 2019: 61ff.) und beschränke mich auf den Hinweis, dass die Interdependenzannahme wie die Kontakthäufigkeitsthese allenfalls deren notwendigen Bedingungen ansprechen und keine hinreichenden (oder »ursächlichen«) bzw. dass die unterstellten Entstehungsprozesse der organischen Solidarität in zweifacher Hinsicht unvollständig modelliert sind. Zum einen kann Durkheim nicht zeigen, dass die gehäuften Kontakte zu ihren Mitakteuern und die sich deshalb verstärkenden Abhängigkeitsgefühle die Akteure tatsächlich dazu motivieren, sich zu deren Gunsten einzusetzen, statt irgendwelche anderen Reaktionen15 hervorzurufen, und zum anderen wird man nicht übersehen können, dass es ihm nicht gelungen ist, in widerspruchsfreier Weise die Kriterien auszumachen, die eine Theorie der Verteilungsgerechtigkeit für den Fall vorzuschlagen hätte, dass die Akteure – etwa in Erwartung von verteilbaren Kollektivgewinnen – tatsächlich bereit sein sollten, ihren Leistungsbeitrag zu erbringen (Schmid 1987, Müller 2019: 212). Dies zeigt sich darin, dass ihm entgangen zu sein scheint, dass sich seine Vorstellung, wonach sich die Gerechtigkeit von Leistungszuweisungen als Folge des Abgleichs von Talent und Leistungsertrag ergeben sollte, mit seiner gelegentlichen Verteidigung einer charitativen Ethik (Durkheim 1958, 55 u.a., Durkheim 1988: 477), die er durch die berühmte Forderung der Französischen Revolution nach »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« vorgegeben sieht (Müller 2000: 153), logisch nicht verträgt. Wichtiger für die nachfolgende Rekonstruktion der »zünftischen Berufsmoral« ist indessen, dass Durkheim seine Ausführungen durch seine Auffassung dessen erschwert, was er für die ordnungsrelevanten Eigenheiten bzw. Folgen der Arbeitsteilung hält. Ich muss kurz andeuten, worin deren Misslichkeit besteht, um plausibel zu machen, weshalb er sich am Ende dazu gedrängt sah, seine Lehre von der Berufsmoral als 14 Jens Beckert 2004 hat sich als einer der wenigen Soziologen dieses Themas der Vererbungsgerechtigkeit angenommen und führt es anhand neuerer Daten aus. Die Suspendierung des Erbrechts sorgt demnach für gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen. Wie der Wettbewerb organisiert werden muss und ob dessen Allokationsfolgen tatsächlich »gerecht« sind, sagt uns Durkheim nicht. 15 Proteste, Flucht, innerer Rückzug und Abwanderung, Verhandlungsforderungen und Koalitionen gegen Dritte, Betrügereien und die vorbehaltsvolle Heuchelei von Kooperationsbereitschaft und andere Reaktionen wären möglich.
115
MICHAEL SCHMID
eine zweite Antwort auf die Frage auszuformulieren, angesichts welcher Bedingungen Akteure unter modernen Verhältnissen solidarisch zu agieren bereit sind. Das angesprochene Fehlverständnis verdankt sich der Tatsache, dass Durkheim nicht bemerkt, dass er seine Ansicht darüber, was die »soziale Teilung der Arbeit« sein und bewirken mag und wie die Akteure auf diese Wirkungen reagieren können, durch eine bedauerliche Doppeldeutigkeit seines basalen Konzepts belastet. Wenn man von der »Teilung der Arbeit« liest, dann liegt die Vermutung nahe, Durkheim habe sich mit der Thematik beschäftige wollen, die in Adam Smiths »Wohlstand der Nationen« (Smith 1974: 9ff.) angesprochen worden war. Dieser Autor verstand die Teilung der Arbeit als »fachliche Spezialisierung«, womit er vornehmlich die Zerlegung eines – in »modernen« Zeiten nageliegender Weise industriell bzw. betrieblich organisierten – Herstellungsvorgangs in mehrere Teilabschnitte im Auge hatte, in deren Gefolge sich einesteils Effektivitäts- und Produktivitätszugewinne, anderseits aber auch Stumpfheit und Borniertheit des Arbeitsvollzugs einzustellen pflegen. Einen Weg aus der damit identifizierten Problemlage weisen zwei Maßnahmepakete. Zum einen war damit die Aufgabe des Leitungsmanagements eines Betriebes umrissen, die »vereinzelten« Arbeitsschritte zu einem Gesamtprodukt zusammenzuführen, und zum anderen drängte sich die Frage auf, ob sich durch die Umgestaltung der materialen Arbeitsbedingungen, durch Aufbesserung der Entlohnung oder durch Kompensationszugeständnisse die zu befürchtenden Arbeitsbelastungen mindern oder vermeiden ließen. Mit den Effektivitätssteigerungen, die man infolge der Arbeitszerlegung erwarten durfte, beschäftigt sich Durkheim nicht näher; demgegenüber diskutierte er die Frage der Zuträglichkeit der Arbeitsbedingungen im Dritten Buch seiner »Arbeitsteilung« (Durkheim 1988: 443ff.), betonte aber vornehmlich die Fragwürdigkeit, die mit dem Abschluss von Beschäftigungsverträgen verbunden zu sein pflegen, die er angesichts der damit verbundenen Ausbeutungsund Entfremdungsgefahren nicht als solidaritätsstiftend einstufen wollte. Ein weiteres Problem resultiert indessen nicht aus der Arbeitszerlegung, sondern aus der Arbeitsteilung im »weiteren« Sinne. In diesem Fall, der seit Herbert Spencer als »funktionale Arbeitsteilung« (Spencer 1897b: 340ff.) oder von Marx (Marx 1965: 371ff. u.a.) bis Schmoller (Schmoller 1890)16 als »soziale« bzw. »gesellschaftliche Arbeitsteilung« 16 Durkheim selbst stellt seinen Beitrag, indem er Schmoller zitiert, in dessen Denktradition (vgl. Durkheim 1988, S. 90f.), möchte aber – wie sein Kontrahent Spencer (vgl. Spencer 1897) – über sie hinausgehen, indem er in der Arbeitsteilung ein allgemeines Prinzip vermutet, das »organisatorische«, »funktionale« und »gesellschaftliche« Arbeitsteilung zusammenzusehen erlaubt. In welcher Weise und mit welchen Theoriefolgen diese
116
ÉMILE DURKHEIM: BERUFSMORAL, SOLIDARISMUS UND GILDEN
auf die Agenda der europäischen Sozialtheorie geraten war, geht es da rum zu klären, in welcher Weise der Gesamtbereich aller Tätigkeiten, die die Reproduktion eines Gesellschaftsverbandes erfordert, ausgestaltet sein müsse. Eine der unmittelbaren Folgen der Steigerung einer derartigen gesellschaftlichen oder eben: »sozialen« Arbeitsteilung besteht darin, dass sich kein Gesellschaftsmitglied sein Leben fürderhin alleine und ausschließlich mithilfe der Güter fristen kann, die es selbst herstellt; es muss deshalb darauf geachtet werden, dass jeder der vereinzelten Produzenten seinen Lebensunterhalt infolge der Möglichkeit sichern kann, dass die in Betrieben arbeitsteilig produzierten Güter als Fertig- oder Halbfertigprodukte anderen Akteuren, die ihrerseits auf eigene Kosten und entsprechend eigenrechtliche Leistungen bereitstellen, zur Verwendung angeboten bzw. zur Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt werden können. Zwar hätte man sich im Durkheim’schen Umkreis den damit fälligen Leistungsausgleich auch als eine Art »Gabentausch« organisiert vorstellen können (vgl. dazu Mauss 1978), was zumindest für die Zusammenführung betriebsintern erbrachter Leistungen nicht völlig abwegig wäre, aber für den Fall des Zwischenbrieblichen Leistungsabgleichs konnte Durkheim kaum übersehen, dass sich diese Form des Gütertransfers zumal unter den Produktions- und Vertriebsbedingungen »industrielle(r) Gesellschaften« (Durkheim 1988: 44) tatsächlich nicht durchgesetzt hatte; vielmehr pflegen privatrechtlich organisierte und arbeitsteilig produzierende Betriebe ihre jeweiligen (Teil-)Erzeugnisse auf Warenmärkten zum Kauf anzubieten. Dabei muss auffallen, dass sich dann, wenn der Marktzugang freigestellt bzw. tatsächlich möglich ist, Konkurrenzen nicht vermeiden lassen, deren Regulierungsbedürftigkeit zur durchweg offenen Frage werden muss (Vanberg 2008). Für den Fortgang meiner Überlegungen ist nun wegweisend, dass Durkheim bei seinem Versuch, den »Solidaritätscharakter« moderner, arbeitsteilig organisierter Gesellschaften zu kennzeichnen bzw. die »Ursachen« des solidarischen Handelns unter »modernen Bedingungen« zu identifizieren, an einen konkurrenzbasierten Markttausch der arbeitsteilig erbrachten Leistungen überhaupt nicht denkt. Vielmehr überzieht er die (von ihm sogenannten) »Ökonomisten«, die Tauschmärkte als die all selig machende Allokationsinstitution für Güter und Dienstleistungen zu verteidigen neigen, mit einer beißenden Kritik, indem er ihnen gegenüber – nicht anders als es Karl Marx tat – die Konflikthaftigkeit von Marktkonkurrenzen beklagt (Durkheim 1988: 43, 441ff.), die Gefahren der Über- wie der Unterproduktion beschwört (Durkheim 1991: 30), die unvermeidliche Selbstauflösung privater Verträge betont (Durkheim 1988: 263ff., Durkheim 1991: 254ff.), Märkte als »anarchische« Zusammensicht vorzunehmen ist, haben seine Kommentatoren nicht einhellig klären können (vgl. Rueschemeyer 1985).
117
MICHAEL SCHMID
(also als staatsferne und entsprechend »unregulierte«) Veranstaltungen desavouiert (Durkheim 1991: 23), den Zerfall der Marktgesellschaft in antagonistische Klassen beschreibt (Durkheim 1988: 51) und die weite Verbreitung der »erzwungenen Arbeitsteilung« nebst der damit verbundenen ausbeuterischen Externalitäten als eine Gefahr für den Bestand »höherer« Gesellschaften diagnostiziert (Durkheim 1988: 443ff.). Auch hält er es nicht für ein Anzeichen gesellschaftlicher »Gesundheit«, dass die Unstetigkeit des ökonomischen Lebens und zumal dessen »Anomie« zu gehäuften Selbstmorden zu führen pflegen (Durkheim 1973: 273ff.)17. Die beiden wichtigsten Folgerungen dieser Beurteilung sind zum einen, dass Durkheim »industrielle Gesellschaften« nicht zuletzt deshalb nicht als Marktgesellschaften auffassen möchte, weil er glaubt, dass sich im Rahmen von Konkurrenzmärkten ein solidaritätssichernder »moralischer Habitus« (Durkheim 1988: 44), ohne den auch diese Gesellschaftsformation nicht auszukommen vermag, gar nicht beschaffen lässt18. Und umgekehrt gilt die korollare These: Wenn Solidarität eine Folge der »Arbeitsteilung« sein soll, dann kann damit nur ein Verteilungsmechanismus angesprochen sein, der einer preisbasierten Allokation der Leistungs- und Güterproduktion durch individuelle Tauschakte auf einem Wettbewerbsmarkt buchstäblich nichts verdankt. Welche Organisationsform aber muss der von Durkheim beschworene Arbeitsteilungsprozess dann annehmen, wenn er unter derartig widrigen Bedingungen solidaritätsbeschaffend verlaufen soll? Ich denke, dass Durkheims nachgeschobene Antwort auf diese Frage (Durkheim 1988: 41ff., Durkheim 1991: 9ff.) dann verständlich ist, wenn man seine Weigerung zur Kenntnis nimmt, »Gesellschaften auf nichts als einen riesigen Handelns- und Tauschapparat (zu reduzieren)« (Durkheim 1986a: 55)19. Man sollte Durkheim deshalb nicht als einen Marktanalysten lesen, sondern als einen Genossenschaftstheoretiker 17 Und zusätzlich prägt das metawissenschaftliche Argument, das Durkheim gegen die »politische Ökonomie« vorträgt, wonach diese versuche, das Wirtschaftsgeschehen aus der verallgemeinerten ›Natur des Menschen‹ abzuleiten, ohne dabei auf irgendeine »Form der sozialen Ordnung« einzugehen (vgl. Durkheim 2009, S. 177), das distanzierte Verhältnis der Soziologie gegenüber der »Ökonomik« bis auf unsere Tage. 18 Diese und die Ergänzungsthese, wonach sich jedes bestehende »moralische Erbe« im Gefolge moderner Marktverhältnisse aufzulösen droht (vgl. Hirsch 1980, S. 167ff.), stehen ebenso im Zentrum der modernen Wirtschaftssoziologie wie sie der nicht abreißenden Kritik am »Neoliberalismus« zugrunde liegen (vgl. Beckert 1997). 19 Tatsächlich gibt uns Durkheim keinen Hinweis darauf, dass er den Diskussionsstand über die möglichen Modellierungen der verschiedenartigen Verhältnisse zwischen den mit- und gegeneinander konkurrenzierenden Leis tungsnachfragern und Produktanbietern kennt (vgl. Willeke 1961).
118
ÉMILE DURKHEIM: BERUFSMORAL, SOLIDARISMUS UND GILDEN
gesonderten Zuschnitts (Schmid 1989, Schmid 1998: 93–117). Als ein solcher stellt er sich Gesellschaft mithin und durchaus in Anklang an Max Webers Auffassung (Weber 1922: 26ff., 37f.) als einen (»regulierten«) Verband vor, zu dessen Gedeih und Fortkommen deren Mitglieder arbeitsteilige Leistungen erbringen und diese einander unter Wahrung gerechter Transaktionsverhältnisse zum Gebrauch anbieten, dies aber nicht in der Absicht, sich – im technischen Sinn der Markttauschtheorie (Ingrao/Israel 1990: 9) – einen privat nutzbaren »Profit« zu beschaffen, sondern um auf diese Weise ihre getrennt voneinander erarbeiteten und entsprechend spezialisierten Leistungen zur Erstellung eines von allen erwünschten Gutes zusammenzulegen (Vanberg 1982: 10ff., 67ff.)20. Genauer: Wenn man die Frage als beantwortet betrachtet, ob und unter welchen Umständen die Akteure sicherstellen können, dass sich ihre Leistungsbeiträge zu einem brauchbaren Gesamtergebnis »ergänzen«21, 20 Damit kommentiert Durkheim die Adam Smithsche Idee, »wonach die weithin verbreitete Neigung zum Handeln und Tauschen es ihnen (den arbeitsteilig organisierten Produzenten) erlaubt, die Erträge jeglicher Begabung gleichsam zu einem gemeinsamen Fond zu vereinen, von dem jeder nach seinem Bedarf das kaufen kann, was wiederum andere aufgrund ihres Talents hergestellt haben« (Smith 1974, S. 19). Durkheim und Smith scheinen sich einig zu sein, dass die Gesellschaftsmitglieder ihre Leistungen »poolen«; aber wie ich noch zeigen werde, kann sich Durkheim nicht an den Gedanken gewöhnen, dass die Entnahmelizenz im Recht besteht, ein »Gut« aus dem Poolangebot zu kaufen. D.h. der Durkheim’sche Pool ist nicht mit Waren gefüllt, sondern mit etwas anderem. 21 Komplementaritätssichernde Faktoren könnten die folgenden sein: a) Dass sich jede Arbeitsteilung in bereits solidarischen Gesellschaften entwickeln und ohne Solidaritätsverlust realisiert werden kann (Durkheim 1988, S. 335ff.), b) dass sich ein zentraler Koordinator, ohne dass dessen Einsetzung und/oder dessen Wirkungen Streit provoziert, um die Aufteilung und Allokation der diversen Tätigkeiten kümmert (vgl. Durkheim 1988, S. 345), c) dass die im Gefolge der Arbeitsteilung auftretenden Strukturveränderungen – auch die segensreichen – zwangsläufig bzw. notwendig entstehen (Durkheim 1988, S. 347), d) dass die Akteure die ihrer Arbeitsteilung entspringenden Unterschiede einem gemeinsamen, verallgemeinernden Gesichtspunkt unterordnen können (z.B. einer bereits vorhandenen Religion oder einer fehlerfrei übertragenen (moralischen) Tradition) (Durkheim 1988, S. 348ff.), e) dass die Wirksamkeit dezentralisierter, lokal organisierter Verhaltenskontrollen garantiert werden kann (Durkheim 1988, S. 360ff.) und darin eingeschlossen – und damit sind wir wieder bei meinem Thema – dass für die »Behinderung der individuellen Variationen durch die Organisation der Handwerkskörperschaften« gesorgt ist (Durkheim 1988, S. 365). Die Lis te a) bis d) enthält analytische, funktionalistische und unvollständige bzw. sachlich unsinnige Annahmen und/oder formuliert haltlose ad hoc-Thesen; wieweit e) wirksam ist, behandle ich hernach.
119
MICHAEL SCHMID
und wenn man voraussetzen darf, dass alle tatsächlich breit sind, ihren – wie oben umschrieben: »gerechten« – Anteil an den Mühen der Leistungsbereitstellung auf sich zu nehmen, und jeder Einzelproduzent von allen übrigen weiß oder vorwegnehmen kann, dass auch sie dazu bereit sind22, so dient das »Poolen« ihrer Leistungen keinen vordergründig »individuellen« oder »privatistischen« Verwertungsgesichtspunkten, sondern beschafft den zur »Zusammenfassung« (oder »Zusammenlegung«23) ihrer Ressourcen bereiten Akteuren ein »kollektives Gut« (Olson 1968) beziehungsweise, solange Erwerb und Gebrauch von entsprechenden Nutzungsrechten an Gruppenmitgliedschaften gebunden bleibt, ein sogenanntes »Club-Gut« (Hechter 1987, Landa 1997: 102ff., 117ff.). »Teilung der sozialen Arbeit«24 heißt unter dieser Bedingung, dass sich jeder der am Herstellungsgeschehen beteiligten Akteure– für alle Mitakteure sichtbar und glaubhaft – bereit erklärt, seine für die Erreichung des Gesamtzwecks oder wie Durkheim sagt: des »kollektiven« bzw. »gemeinsamen Zwecks« (Durkheim 1991: 28 und 29) erforderliche Teilleistung zu erbringen bzw. anderen zur Nutzung bereit zu stellen. Dieser gemeinsame Zweck, zu dessen Erfüllung diese Leistungszusammenlegung inszeniert wird, besteht in erster Linie – hierin folgt Durkheim den Vorgaben von Thomas Hobbes und John Locke – in der Schaffung friedlicher und freiheitssichernder Verkehrsformen25 (Durkheim 1988: 43, 45) und – in dieser Frage eher die Spuren von Karl Marx und Peter A. Kropotkin aufnehmend – in der Gewährleistung von Versorgungsicherheiten durch »gegenseitige Unterstützung« (Durkheim 1988: 69). Der hierauf entstehende Gesellschaftszustand definiert eine Opportunitätsstruktur, die deshalb – im 22 Durkheim nimmt also an, dass strategische Befürchtungen darüber, ob alle anderen »mitmachen«, keine Rolle spielen müssen. Das oben diskutierte Problem der »Gerechtigkeit« der Arbeitsteilung kann entsprechend als bewältigt vorausgesetzt werden und auf die Beteiligungsmotivation der »Mitarbeiter« ist Verlass. Die Literatur, in der das Gegenteil behandelt wird, ist unübersehbar geworden. 23 Mit diesem Begriff nehme ich den Durkheim’schen Begriff des »Kollektiven«, wie ich denke, in einem nahezu wörtlichen Sinne (von: »collectio«) auf. 24 Dies ist der Titel der ersten, nicht-überarbeiteten deutschen Ausgabe von Durkheims Dissertation von 1893. 25 Wenn diese Bestimmung dessen zutrifft, was die Akteure der Durkheim’schen Sozialanalyse als »gemeinsames Ziel« anstreben (sollten), dann geht Honneths kleiner Seitenhieb gegen Durkheim daneben, wonach letzterer übersehen habe, dass solche »gemeinsamen Ziele« einer ethischen Bewertung erfordern (vgl. Honneth 2018, S. 286). Für Durkheim versteht sich diese allerdings von selbst und muss nicht »anerkennungstheoretisch« eingeholt werden.
120
ÉMILE DURKHEIM: BERUFSMORAL, SOLIDARISMUS UND GILDEN
technischen Sinn des Begriffs (Pommerehne 1987: 5ff.) – einen Kollektivgutcharakter besitzt, weil das zur Verwertung anstehende Gemeingut unteilbar ist und weil jeder es zu konsumieren das Recht besitzt (oder, wenn auch mit unterschiedlichen Kosten verbunden, erwerben und nutzen kann), wenn es denn bereitgestellt wurde26. Oder anders formuliert: Die zur Debatte stehende Gelegenheitsstruktur zeichnet sich dadurch aus, dass jeder das Recht für sich in Anspruch nehmen darf, die zur Verfügung gestellten Opportunitäten (in unterschiedlichen Anteilen) zu konsumieren, dass aber zugleich keinem der beteiligten Akteur das Recht zusteht, Gebrauchschancen zu »privatisieren« und/oder andere davon auszuschließen, das öffentliche Gut ihrerseits zu nutzen. In dieser durch die Kombination von »Unteilbarkeit« und »Nichtausschließbarkeit« charakterisierten Situationslogik ist freilich die Dauergefahr enthalten, dass Akteure ihrer – von Durkheim jederzeit zugestandenen, wenn nicht sogar befürchteten27 – Neigung nachgeben, ihr Nutzungsrecht am allseits zugänglichen Kollektivgut auch dann in Anspruch zu nehmen, wenn sie zu dessen Bereitstellung keinen Beitrag geleistet haben oder haben leisten wollen, und dass sie zudem dem beständigen Anreiz ausgesetzt sind, das Kollektivgut in einem Ausmaß zu beanspruchen, das zu dessen »Übernutzung« führt (Olson 1968, Lichbach 1996, Lichbach 1998). Die Etablierungsumstände wie die Bewahrungsvoraussetzungen eines kollektiven Guts setzen 26 Die Inanspruchnahme eines solchen Rechts ist an andere Bedingungen geknüpft als die Nutzung jener »privaten Rechte«, welche den Entscheidungsbereich definieren, den Amartya Sen als »minimal liberty« bezeichnet (vgl. Sen 2002, S. 408ff., 592 u.a.). Alle Rechte verdanken ihre Existenz einer (gemeinsam verbindlichen) »social choice«, aber Privatrechte bestehen auch dort, wo Mitakteure keine gleichlautenden Ansprüche geltend machen können. 27 Durkheim verteidigt an verschiedenen Stellen eine psychologische Theorie, die er offensichtlich der ökonomischen Klassik wie der Neo-Klassik entlehnt, zu deren Gehalt gehört, dass die Akteure gewissermaßen »ihrer Natur nach« dazu neigen, mehr Güter nachzufragen als sie ohne Schädigung anderer (und ihrer selbst) nutzen können (vgl. Durkheim 1972, S. 31, 35 u.a., Durkheim 1991, S. 24), rechnet aber damit, dass geeignete erzieherische Maßnahmen auch »altruistische« Gefühle und eine entsprechende ›Moralität der Zurückhaltung‹ zur Gewohnheit werden lassen (vgl. Durkheim 1984, S. 245ff.). Dass er sich damit die (theoretische) Frage »einhandelt«, wie die Stabilitätsbedingungen dieser »vermischten« Motive modelliert werden können, sieht er wohl nicht; auch wollte er sich offenbar seinen moralischen Rigorismus, mit dem er die Unersättlichkeitsthese kommentiert, nicht durch die Einsicht nehmen lassen, dass das ökonomische Handlungsmodell zwar keine moralischen, wohl aber Budget-Beschränkungen kennt (vgl. Ingrao/Israel 1990, S. 19f.), über deren Moralitätsrelevanz nachzudenken nicht verboten ist.
121
MICHAEL SCHMID
die Nutzungsinteressenten somit regelmäßig und beständig der Gefahr aus, in einer »Tragödie der Allmende«28 zu enden, weil sie immerzu der Versuchung unterliegen, sich den Zugang zum gemeinsam erstellten Gut zu erschleichen bzw. als »Parasit« oder »Trittbrettfahrer« zu agieren, die die Leistungsvorgaben ihrer Genossen ausnutzen bzw. die dazu tendieren, ihren Abschöpfungsanteil auf deren Kosten auszuweiten29. Die Bewältigung von Verteilungstragödien der geschilderten Form erfordert demnach eine durchschlagskräftige, den Eigennutz einschränkende Maßnahme, deren Wirkungsreichweite daran gebunden ist, dass sie die beiden primären Probleme genossenschaftlicher Organisationsformen (Olsen 1968, Hardin 1982, Tuck 2008 und besonders: Ostrom 1990) zu lösen vermag: Zum einen das Problem, die Leistungsbeiträge aller potenziellen Nutzer abzusichern – und damit das sogenannte »Beitragsproblem« zu lösen – und zudem Zugangsregeln und Verteilungskriterien zu finden und durchzusetzen, anhand derer die jeweiligen individuellen Nutzungsformen und Nutzungsanteile (am Kollektivgut) verbindlich und ohne inkompatible Anspruchskonkurrenzen zu provozieren festgelegt werden können – also das »Verteilungsproblem« zu bearbeiten. Im Fall von Club-Gütern ist neben diesen beiden Problemen die zusätzliche Frage zu klären, in welcher Weise und unter welchen, nicht nur graduell unterschiedenen Umständen das kollektive Gut in »gemeinsamer Aktion« zu konsumieren ist30. Die von Durkheim durchgängig angemahnte solidaritätsbasierte Gruppenmoral, die dafür sorgen muss, dass alle Gesellschaftsmitglieder erkennen und anerkennen, dass sie ihren Mitberechtigten gegenüber verpflichtet sind, ihre jeweiligen Teilleistungsbeiträge zu erstellen und zudem die Nutzungs- bzw. Ertragsinteressen anderer zu achten und zu 28 Vgl. Garrett Hardin 1968. 29 Das würde dann nicht der Fall sein, wenn sich eine Brüderlichkeitsethik durchgesetzt hätte, wie sie Durkheim gelegentlich vorschwebt, und die den Leistungsträgern die Pflicht auferlegt, sich (auch) um jene zu kümmern, die – um ihr Leben zu fristen bzw. um nicht unterzugehen – Trittbrett fahren müssen. 30 Ob der erreichte Verteilungszustand Clubguteigenschaften besitzt, müsste sich danach bestimmen, ob das betreffende Gut nicht nur gemeinsam hergestellt und allen zugänglich gemacht werden muss, sondern zugleich (auch) gemeinsam zu konsumieren ist. Ich bin sicher, dass Durkheim diesen Aspekt zunächst nicht berücksichtigt hatte. Erst in seiner Religionssoziologie lassen sich entsprechende Stellen ausfindig machen (vgl. Durkheim 1981, S. 441– 555); Kulthandlungen und »Riten« entfalten ihre gesellschaftsintegrierende Wirkung erst und ausschließlich durch den gemeinsamen Vollzug (von Gottesdiensten, Festen, Opferfeiern und dergleichen), in dessen Gefolge alle wissen, dass sie Teilnehmer sind und von allen anderen unterstellen, dass auch sie dies wissen.
122
ÉMILE DURKHEIM: BERUFSMORAL, SOLIDARISMUS UND GILDEN
schonen, ergibt sich somit als eine der möglichen Antworten31 auf die Notwendigkeit, ein für alle mit segensreichen Folgen verbundenes »Gesamtinteresse« (Durkheim 1988: 56) gegen den vereinnahmenden Opportunismus der vereinzelten Gesellschaftsmitglieder zu schützen. Nur auf diese Weise lassen sich Konkurrenzgesellschaften in genossenschaftlich organisierte Nutzungsgemeinschaften transformieren.
3. Durkheims »Theorie« der Berufsgruppen Indem ich damit die Implikationen seiner Auffassung über die Integrationsbedingungen moderner Gesellschaften nachdrücklicher und – wie ich hoffe – präziser herauskehre als dies Durkheim selbst gelingen wollte, kann verständlich werden, weshalb er sich offenbar des Eindrucks nicht wirklich erwehren konnte, dass seine eingangs analysierte Erklärung der spontanen Entstehung organischer Solidaritäten aus dem Geist der Arbeitsteilung letztlich unzureichend geblieben war. Jedenfalls versteht sich hieraus sein Bemühen, im Rahmen seiner mehrfach gehaltenen »soziologischen Vorlesung« und in Form eines nachgereichten Vorworts zur zweiten Auflage seiner »Arbeitsteilung« seinem Publikum einen erneuten bzw. im Vergleich zu den wenigen Bemerkungen, die sich in der »Arbeitsteilung« nachlesen lassen (Durkheim 1988: 283–286), weit deutlicher ausformulierten Vorschlag darüber zu unterbreiten, wie man sich in Ergänzung und Spezifikation seiner anfänglichen Ausführungen das Entstehen einer »modernen«, gesellschaftsintegrierenden Solidaritätsform denken kann32. Was genau verbirgt sich hinter dieser Wendung? Dass Durkheim seine Suche nach einem alternativen Weg, auf dem moderne Gesellschaften sich als Solidaritätsgemeinschaften gründen könnten, zunächst wenigstens33, 31 Wie seine weiteren Ausführungen klarstellen, denkt er dabei nicht an eine »externe Lösung«, der zufolge eine interessierte »dritte Partei« sich der beiden Kollektivgutprobleme (erfolgreich) annimmt, sondern an eine Problembewältigung, die den Bedingungen der »Freiwilligkeit« und der »Selbsthilfe« genügt. Zu einigen der (Durkheims Überlegungen weiterführenden) Bedingungen, angesichts derer ein solcher Prozess der »Selbstorganisation« gelingen kann, vgl. Olson 1986. 32 Ich schließ mich damit der Deutungsthese von Hans-Peter Müller an, dass Durkheim die in der »Arbeitsteilung« ungelöst gelassenen Probleme zum Gegenstand seiner »Physik der Sitten« machen wollte (Müller 1991, S. 315). 33 Wie Lukes (1973, S. 178), Tyrell (1985), Müller (1983) und Parsons (1991, S. 227) gleichermaßen beobachten, gibt Durkheim das Problem der regelschaffenden Arbeitsteilung im Verlauf seiner späteren Theorienproduktion tatsächlich auf. Die Performanztechnik ritueller Zusammenkünfte,
123
MICHAEL SCHMID
nicht zum Anlass nimmt, seinen Erstversuch zu widerrufen (Durkheim 1988: 41), mag darin begründet sein, dass er die Bildung eines solidaritätsbeschaffenden »moralischen Milieus« (Durkheim 1991: 38) nach wie vor dadurch erschwert sieht, dass die Mitglieder moderner Gesellschaften den desintegrativen bzw. anomischen Folgen der Bevölkerungszunahme und der sich infolgedessen erweiternden Interdependenzverhältnisse, dem unvermeidlichen Zuwachs der Kommunikationen, den Konsequenzen der Ausdehnung der Märkte und der dadurch verursachten Transaktionskostensteigerungen ungeschützt ausgesetzt bleiben. Um angesichts dieser unveränderten Problemlage die Moralitätstauglichkeit neuzeitlicher Milieus zu identifizieren, setzt Durkheim indessen neu an und nimmt sich vor, eine umfassendere »Theorie der Moral« zu entwickeln, aus der er logisch ableiten kann, unter welchen Umständen solidaritätsorientiertes Handeln möglich wird. Im Erfolgsfall hätte Durkheim zeigen können, dass die Steigerung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung nur unter eng umrissenen Bedingungen die erwünschten Integrationseffekte nach sich zieht. Bedauerlicher Weise war es ihm verwehrt, dieses Projekt zu Ende zu führen (Šuber 2012: 42), und zu allem Unglück ist der erste Teil seiner Moralvorlesung, in der er dieses Vorhaben vorbereiten wollte, in den Wirren der Besatzungszeit während des zweiten Weltkriegs (oder hernach) verloren gegangen (Müller 2000: 166). Aber so viel steht fest (Müller 1991: 315–317, Durkheim 1986: 47): Wie üblich beginnt Durkheim auch seine neuerlichen theoretischen Überlegungen mit einer definitorischen Ausgrenzung des zu behandelnden Themenfelds und unterscheidet zu diesem Zweck »universelle« von »partikularen Regeln« (der Moral). Die erstgenannten unterteilt er sodann in die »Pflichten des Menschen gegenüber sich selbst« und in solche »gegenüber der Menschheit«. Die Partikularregeln hingegen erfahren eine Dreiteilung in eine »häusliche oder familiale Moral«, eine »berufliche Moral« und in eine »staatsbürgerliche Moral«. Es gibt demnach mehrere, offenbar teils hierarchisch, teils horizontal geordnete Quellen der Moral, und aus dem Zugeständnis, dass moderne Gesellschaften über ein eine Vielzahl unterschiedlicher Berufstätigkeiten zergliedertes »system of professions« (Abbott 1988: 86ff.) verfügen, wird man logisch folgern müssen, dass sie sich durch einen »moralischen Partikularismus« (Durkheim 1991: 15) auszeichnen. mit deren Hilfe sich – Durkheims späteren Überlegungen folgend – die solidaritätswichtigen Gemeinschaftsgefühle generieren lassen sollen (vgl. Durkheim 1981), basieren gerade nicht auf arbeitsteiligen Prozessen im anfänglichen Sinne, sondern auf interessensbündelnden »Zusammenkünften« und damit einer »action sociale« im Sinne der Sozialphilosophie des 18. Jahrhunderts. Gemeinsame Handlungen folgen diesem Verständnis nach einer »Konvention« (im Humeschen Sinne), wenn und solange alle ihre Zustimmung zu einer solchen Regel zu erkennen geben, indem sie sie beachten.
124
ÉMILE DURKHEIM: BERUFSMORAL, SOLIDARISMUS UND GILDEN
Damit liegt der Übergang zu dem mich interessierende Thema auf der Hand. Durkheim kommt auf die Bedeutung von Berufsverbänden und in der Folge auf die spezifische Funktionsgewichtigkeit von Zünften und Gilden deshalb zu sprechen, weil er in ihnen einen der – aus der Sicht der allgemeinen Rechte des Individuums und der Menschenrechte insgesamt gesehen – nachgelagerten Orte (neben der Familie und dem staatsbürgerlichen Handeln) vermutet, an dem sich eine der möglichen Formen einer »speziellen« Moral – die berufliche mithin – entwickeln kann34. Wie dies geschieht und mit welchen Folgen eine solche Entwicklung für die Solidaritätsintegration einer modernen Gesellschaft verbunden bleibt, ist dann die nachgelagerte Frage (Durkheim 1991: 15). Die Bedingungen der Moralentwicklung, auf die Durkheim angesichts dieser enggeführten Umstände stößt, sind in etwa die folgenden35: Zunächst gilt, dass Berufsgruppen ihre Mitglieder in lebenslanger Dauer (Durkheim 1973: 450) versammeln; sie sind infolgedessen dazu in der Lage, den genauen Wert der erbrachten Arbeitsleistungen oder produzierten Güter ebenso zu beurteilen wie den eventuellen Regulationsbedarf abzuschätzen, der mit ihrer (mehr oder minder spezialisierten und arbeitsteiligen) Herstellungsorganisation und Allokation verbunden sein mag. Diese Fähigkeit zur angemessenen Bewertung der Erträge und der Mängel beruflicher Tätigkeiten fehlt dem breiteren Publikum und auch der öffentlichen Meinung nachgerade deshalb, weil es den Mitgliedern moderner Gesellschaften infolge deren gesteigerter Arbeitsteilung immer schwerer fällt, die Übersicht über die zunehmende Fülle an Arbeitsbereichen und Arbeitstätigkeiten zu behalten. Oder in inverser Perspektive formuliert: Durkheim nimmt die zur Beschreibung pristiner Gesellschaften formulierte These von der »Ähnlichkeit« der Gesellschaftsmitglieder auf (Tyrell 1985: 217) und behauptet, dass die Akteure ihr gleichgelagertes Vermögen, die Internas beruflicher Tätigkeiten zu bedenken, mithin der Tatsache verdanken, dass sie – als Berufsgenossen bzw. in der Form von Berufsgenossenschaften organisiert – vergleichbaren, wenn nicht »identischen« Tätigkeiten (Durkheim 1973: 449) nachgehen. 34 Vgl. zusammenfassend Wallwork 1972, S. 98–103. Man sollte entsprechend Durkheim 1991 auch als einen Versuch lesen, den Zusammenhang zwischen den drei genannten Ebenen spezieller Moralität ausfindig zu machen, was durch den Tatbestand erschwert ist, dass man sich über die Moralbedeutung der Familie (vgl. etwa Durkheim 1981, S. 53ff.; man vgl. Wallwork 1972, S. 88–98 für eine Zusammenfassung der noch auffindbaren Quellen) und über die Bedingungen der »politischen Moralität« (vgl. Durkheim 1991 und kommentierend Müller 1983, S. 146ff. und Valjavec 1995, S. 192ff.) getrennt informieren muss. 35 Eine Kurzversion der nachfolgend dargestellten Überlegungen findet sich in einer Vorlesungsmitschrift, die in Durkheim 1975a, S. 217–220 abgedruckt ist.
125
MICHAEL SCHMID
Zudem kann die Berufsgruppe aufgrund ihrer überblickbaren, kontaktförderlichen Größe und Organisationsform36 auf kostengünstige Weise Sorge dafür tragen, dass die notwendigen berufsrelevanten Regeln gefunden und bekannt gemacht werden und dass deren Einhaltung – auch durch »Zwangsmittel« (Durkheim 1991: 20) – (aufgrund der geringen Gruppengröße: kostengünstig) kontrolliert werden kann. Die »Autorität« der Gruppe, deren Vorhandensein Durkheims Gesellschaftstheorie gerne als ein nicht weiter in Frage zu stellendes »Axiom« behandelt (Durkheim 2009: 173), generiert und schützt die betreffenden Regeln demnach und verleiht der betreffenden Berufsgruppe zugleich gegenüber der »Gesamtgesellschaft« eine »relative Autonomie« (Durkheim 1991: 17, Durkheim 1973: 464). Das impliziert, dass deren Selbstregulationsmacht vor staatlichen Interventionen bewahrt werden kann, ja muss (Durkheim 1973: 451). Tatsächlich sollte sich der Staat darauf beschränken, die individuellen Freiheitsrechte der Akteure – auch angesichts der jederzeit möglichen »action oppressive« von (verschiedengradig organisierten) Gruppen gegenüber ihren Mitgliedern (Durkheim 1975: 172ff.) – abzusichern und zu diesem Zweck die gerechte Ausfertigung von Verträgen und deren Einhaltung zu kontrollieren und damit den Erhalt von Eigentumsrechten zu garantieren und unstrittiges Schädigungsverhalten durch Restitutionsmaßnahmen bzw. durch Strafverfolgung auszugleichen bzw. zu unterbinden (Durkheim 1991: 64–306). Dieser Aufgabenkatalog sollte ohne Zweifel ergänzt und gestützt werden durch die Ausbildung einer die politischen Alltagsgeschäfte tragenden »staatsbürgerlichen Moral«; zu den denkbaren Aufträgen des Staats gehört aber mit Sicherheit nicht, die Details des zunehmend heterogeneren Wirtschaftsgebarens einregeln zu sollen. Jeder Versuch in dieser Richtung übersteigt – wie späterhin auch Friedrich von Hayek zu betonen nicht müde wird (Hayek 1991) – die Informationsbeschaffungskompetenzen und Durchsetzungsmöglichkeiten staatlicher Instanzen gleichermaßen (Durkheim 1991: 79 u.a.). Die Kostengünstigkeit der kommunikativen Gruppenverhältnisse, an die jede Moralausbildung anzuschließen hat (Durkheim 1984: 100ff.), verdankt sich im Weiteren – und auch in diesem Falle parallel zur Organisationsstruktur segmentärer Gesellschaften gedacht – dem engen »Zusammenhalt« bzw. der »Kohärenz« der Gruppenmitglieder untereinander (Durkheim 1991: 19), und diese Kohäsion wiederum entsteht aus deren gehäufter Interaktion, was sodann der Vereinheitlichung ihres Denkens und Fühlens den Weg ebnet und die Richtung weist und dadurch endlich die (ertragssteigernde) Abstimmung ihres Handelns erleichtert. Kollektive Handlungserfolge wirken angesichts dessen auch 36 Was Durkheim darüber vorträgt, wie diese Organisation aufgebaut ist, schildere ich später.
126
ÉMILE DURKHEIM: BERUFSMORAL, SOLIDARISMUS UND GILDEN
unter modernen Umständen auf die Erhaltung des (für die entsprechende Berufsgruppe typischen) Kollektivbewusstseins hin, dessen Auswirkungen ihrerseits weitere Abstimmungserfolge sichern. Auf diese sich selbst verstärkende Weise können »Traditionen« und »Gewohnheiten« des »Gemeinschaftslebens« (Durkheim 1991: 20) entstehen, die für jene Verhaltenssicherheiten sorgen, die der Marktkonkurrenz ebenso wenig entstammen können wie den unabwendbaren Willkürlichkeiten einer sozialistischen »Zentralisierung des ökonomischen Lebens« (Durkheim 1958: 74 u.a.). Auch die Entwicklung einer gemeinsamen Alltags- und Lebenswelt, wie sie infolge des kontaktintensiven Freizeitverhaltens der Zunftmitglieder, ihres Kunstkonsums und ihrer »geteilten ästhetischen Vergnügungen« (Müller 2019: 232) entstehen, fordern ein Gemeinschaftsgefühl ein, von dem Durkheim hofft, dass es sich sodann in die Berufssphäre verlängern lässt. Indem Akteure – wie immer unter Befolgung »sanktionsbewehrter Verhaltensregeln« (Durkheim 1991: 10) – auch im Bereich ihrer gemeinsam organisierten, außerberuflichen Lebenssphären lernen, ihr Handeln an schädigungsmindernden Verpflichtungen gegenüber ihren Mitmenschen zu orientieren, die sie alleine schon deshalb übernehmen, um die gemeinsamen Konsumziele der Gruppe (oder ihres »Clubs«) nicht zu gefährden oder gar zu verfehlen, können sie auch auf dem Feld ihrer Berufstätigkeit eigennützige Aktionen zugunsten eines »selbstlosen und opferbereiten Handelns« (Durkheim 1991: 24) unterbinden oder doch zurückdrängen. Alltägliche wie berufsspezifische Interaktionsformen der Gruppenmitglieder wirken somit beide und sich wechselwirksam verstärkend in Richtung auf die Ausbildung einer integrationszuträglichen Handlungsorientierung aller. In diesem Zusammenhang betont Durkheim einen weiteren Integrationseffekt. Das Erlernen einer disziplinierenden Berufsmoral (Durkheim 1991: 27f.)37 bzw. das Anerziehen der »Regeln der Berufspraxis durch fachliche Ausbildung« (Durkheim 2009: 175) fördert die Bereitschaft der Akteure, zur breitgefächerten »Regulierung und Moralisierung« des gesamten »Wirtschaftslebens« (Durkheim 1991: 25) beizutragen; der berufsspezifische Erwerb einer individuellen Moral der Zurückhaltung und des Verzichts auf die eigensinnige Durchsetzung privater Ziele besitzt demnach einen (weiteren) »Spill-over-Effekt«, der dafür sorgt, dass sich auch zwischen den Berufsgruppen das Zutrauen verbreitet, sich auf Transaktions- bzw. Leistungsangebote einzulassen. Offenbar bildet sich Durkheim ein, dass sich auf diesem Weg bestimmte dysfunktionale Formen des Gruppenhandelns wie der »Krieg zwischen den Produzenten« (Durkheim 1991: 29) oder »unregelmäßige Produktionen«38 (Durk37 Vgl. zur allgemeinen Bedeutung des indoktrinären Antrainierens disziplinförderlicher Handlungsdispositionen Durkheim 1984. 38 Wir würden heutzutage wahrscheinlich von »Wirtschaftszyklen« sprechen.
127
MICHAEL SCHMID
heim 1991: 30) ebenso einschränken oder vermeiden lassen wie das Aufkommen unkontrollierter individueller »Begehrlichkeiten« (Durkheim 1991: 29) oder überbordender »privater« und vor allem egozentrischer »Bedürfnisse« der einzelnen Akteure (Durkheim 1988: 334f.). Um die damit verbundenen Fehlentwicklungen zu unterbinden, werden Produktionsabsprachen und Bedürfnis- bzw. Konsumentenlenkung, Marktaufteilungen und Kartellbildung – über die moraldienlichen Effekte der Arbeitsteilung bzw. der Leistungszusammenlegung hinaus – zu moralisch zulässigen, derweil stabilitätsförderlichen bzw. Abstimmungskonflikte mindernden Interventionen. Da unterschiedliche Berufsgruppen zur Aufarbeitung ihrer verschieden gelagerten Tätigkeitsbereiche jeweils andere Regeln generieren (müssen), entspricht ihrer »funktionalen Differenzierung« zwar eine Art »moralischer Polymorphismus« (Durkheim 1991: 18), dessen aggregierten Kollektivfolgen gleichwohl und in der Summe darauf hinwirken, das »soziale Leben« (der Gesamtgesellschaft) zu stärken bzw. zu untermauern, das für Durkheim nach wie vor darauf ausgelegt ist, das »harmonisch vereinte Streben« aller Akteure und daraus folgend die »Vereinigung der Geister und der Willen zur Verwirklichung eines gemeinsamen Zieles« (Durkheim 1991: 29) sicherzustellen39. Die ständige und beständige Wiedergewinnung des »moralischen Gleichgewichts der Gesellschaft« (Durkheim 1991: 60) ergibt sich demnach als aggregierter bzw. emergenter Gesamteffekt eines vielteiligen Lern- und Adaptionsprozesses, der die Individuen über mehrere Ebenen ihrer »gemeinsame(n) Praktiken« (Durkheim 1991: 20) hinweg dazu verpflichtet, sich wechselseitig zu helfen und einander beizustehen. Durkheims Analyse folgend sind Berufsgruppen der geschilderten Art in den modernen Gesellschaften indessen nur wenig entwickelt und verbreitet (Durkheim 1991: 57) und die (noch) bestehenden »Fachverbände« (Durkheim 1973: 449) lassen nur mühevoll entdecken, unter welchen Bedingungen sie zu einem »moralischen Machtfaktor« werden könnten (Durkheim 1973: 452). Aber er beobachtet, dass »es in der Geschichte solche Berufsgruppen bereits gegeben hat, die Zünfte nämlich« (Durkheim 1991: 31), und er sucht plausibel zu machen, dass sie nicht nur in der »griechisch-lateinischen Antike« und im »Mittelalter« (Durkheim 1973: 453, ), sondern auch in den Gesellschaften der Jetztzeit eine die erforderlichen Verkehrsformen pazifizierende und ordnende bzw. die gesamte Wirtschaft gestaltende Regulationsrolle spielen 39 Das Verhältnis der Gruppenziele zu den gesamtgesellschaftlichen Zielen müsste dann zum Problem werden, dem ich hier nicht nachgehe. Müller 1983, S. 147 vermutet wahrscheinlich zurecht, dass die ausführlichere Behandlung (auch) dieses Problems der Tatsache zum Opfer fiel, dass Durkheim sein Interesse an den Reproduktionsbedingungen moderner Gesellschaften zugunsten »der Rückkehr zu den fernen und vagen Ursprüngen menschlicher Vergesellschaftung« verlor (Müller 1983, S. 146).
128
ÉMILE DURKHEIM: BERUFSMORAL, SOLIDARISMUS UND GILDEN
könnten, weshalb es sich lohnen sollte, sie »wiederzubeleben« (Durkheim 1991: 57) bzw. dort, wo sie von nurmehr randständiger Bedeutung sind, zu »reformieren« (Durkheim 1991: 40). Durkheim Verteidigung der moralischen Funktionalität zünftischer Berufsgruppen beschreitet dabei zwei Wege: Zum einen durchleuchtet er neben den organisatorischen vor allem die arbeitsfunktionalen Eigenschaften der Zünfte und deren Auswirkungen für eine geordnete Moralgenese. Zu diesem Zweck muss er der These entgegentreten, die Zünfte verdankten ihre Existenz ausschließlich ihrer Fähigkeit, »auf reine Nützlichkeit ausgerichtete Funktionen zu erfüllen« (Durkheim 1991: 35). Natürlich kann kein Zweifel darüber aufkommen, dass die Vertreter eines Berufsstandes sich immerzu auch deshalb zusammentun wollen, weil sie darauf aus sind, »ihre gemeinsamen Interessen« (Durkheim 1991: 36) – auch ohne dass dieses Vorhaben auch nur in der Regel durch das vorgelagerte staatliche Gesetz gestützt wäre (Durkheim 1991: 32) – zu wahren. Diese Bemühungen richten sich einesteils auf die Monopolisierung von Verkaufs- und Marktchancen und andererseits auf die Herstellung interner Wettbewerbsgleichheit, aber auch auf die »Erhaltung der Privilegien für die Meister« und damit auf die für alle Zunftgenossen einschlägige Moderation organisationsinterner Status- und Einkommenskonflikte (Durkheim 1991: 40). Zu diesen Maßnahmen des innerzünftischen Interessensausgleichs zählt dabei die Regulation der »wechselseitigen Pflichten der Meister und Gesellen« (Durkheim 1988: 54, Durkheim 1991: 39), aber auch das Gebot, Gesellen statt Familienmitglieder bzw. Nachbarn zu beschäftigen, um ersteren nicht ihr »Recht auf Arbeit« streitig zu machen (Durkheim 1988: 54), und darüber hinaus das Nachtarbeitsverbot und die »Sicherung von Qualitätsstandards« (Durkheim 1991: 39) bzw. die Garantie der »beruflichen Redlichkeit« (Durkheim 1988: 55). Die beiden zuletzt genannten Vorkehrungen sollen nachweislich die Belange jener schützen, die zünftisch produzierte Güter nachfragen, indem sie sie zu Nutznießern der moralischen Regulierung des binnenzünftischen Handelns werden lassen, wenn nicht sogar zu »assoziierten« Mitgliedern der zünftisch-moralischen Gemeinschaft. Zum anderen (und darüber hinaus) aber gibt Durkheim zu bedenken, dass Zünfte auch noch weitere Funktionen40 erfüllen, die jederzeit 40 Der derzeitig dominanten, zur Gänze »kultursoziologisch« eingefärbten Durkheim-Rezeption fällt in aller Regel nicht auf, dass Durkheim an dieser Stelle ein wichtiges Problem unerörtert lässt: das Verhältnis jener »sozialen« Funktionen zu den »ökonomischen« Bedingungen zünftischer Selbstreproduktion. Das gilt in besonderem Maß für die ausstehende Klärung der Frage nach der Bedeutung des »Gewinnstrebens als Motiv des Marktverhaltens der Gewerbetreibenden« (Willeke 1961, S. 22–27) in Relation zum (stadt-bürgerlichen) »Nahrungsprinzip« und den daran geknüpften Versorgungs- und Anspruchsideologien. Auch auf die Gestaltungskraft, mit der die
129
MICHAEL SCHMID
erklären können, weshalb sie sich mit Hilfe einer familialen bzw. einer Frömmigkeitssemantik beschreiben (Durkheim 1991: 36ff). Zu diesen neben- bzw. außerberuflichen Funktionen gehört zum einen, dass Zünfte regelmäßig als »religiöse Vereinigungen« (Durkheim 1988: 52, Durkheim 1991: 36) tätig wurden; die Zunftmitglieder wähnten sich als unter göttlichem Schutz stehend, und ein Teil ihrer performativen bzw. gemeinsinnstiftenden Tätigkeiten war auf dessen Gewährleistung gerichtet. Die damit verbundene Selbstvergewisserung, zum Club der Gerechten und Gottgefälligen zu gehören, fand ihre institutionelle Stütze vor allem darin, dass Zünfte als Ritual- oder Kultgemeinschaften tätig wurden, die ihrerseits ohne gemeinsame »Gastmähler« (Durkheim 1991: 37), »Feste« und »Opferfeiern« (Durkheim 1988: 52, Durkheim 1991: 36) nicht gepflegt und erhalten werden konnten; die absichtsvolle Öffentlichkeit dieser Bekundungen dient den Zunftmitgliedern somit – wie wir heute sagen – als (symbolische) »marker« ihrer von allen erwünschten, gemeinsamen Gruppenzugehörigkeit (Moffett 2019). Und überdies grenzten die damit umrissenen Mitgliedschaftsrechte Bereich und Umfang der charitativen Versorgungsleistungen ab, auf die die Genossenschaftsangehörigen rechnen durften, wie das Beschenken verarmter Zunftmitglieder mit »Geld und Lebensmitteln« (Durkheim 1991: 36), die Einrichtung und der Unterhalt von »Hilfskassen« (Durkheim 1991: 36) und die Bereitstellung und Pflege »gemeinsamer Begräbnisstätten« (Durkheim 1988: 52f., Durkheim 1991: 37). Durkheims These ist im vorliegenden Zusammenhang somit erneut, dass Zünfte neben Schutz- auch Geselligkeitsfunktionen erfüllten, wozu vor allem im Mittelalter noch die Aufgabe trat, ihren Mitgliedern einen außenwirksamen Ehrstatus – Max Weber hätte ihn als »ständische Lage« bezeichnet (Weber 1922: 176) – zu Konkurrenz auf die eventuelle Neigung der Zunftverantwortlichen einwirken mochte, es sich in »Monopolen« bzw. in »Kartellen« bequem zu machen, und auf die durchaus zwiespältige Rolle staatlicher Lenkungsmaßnahmen für die im vorliegenden Zusammenhang fälligen Allokationsprozesse (vgl. Willeke 1961, S. 93ff.) geht Durkheim nicht ein. Zugleich lässt er jedes Gespür für die Angemessenheit der Argumente vermissen, welche die (ökonomische) »Klassik« gegen die Monopolbestrebungen der Zünfte und deren Bemühungen vorgetragen hatte, der Konkurrenz zu entgehen (vgl. Willeke 1961, S. 107ff.). Das mag daran liegen, dass seine Erklärung der Entstehung der Arbeitsteilung ein solches Konkurrenzvermeidungsargument ganz unbefangen – und d.h. theorietechnisch gesehen gänzlich ad hoc – benutzt (vgl. Durkheim 1988, S. 325ff.). Durkheim hätte diese Themen kennen und zumindest zum Anlass nehmen können, sie in den Rahmen dessen einzuordnen, was er als die Bestimmungsgrößen gesellschaftlicher Solidarität zu behandeln wünschte; aber in seiner abgrundtiefen Verachtung der »Ökonomisten« nimmt er sich nicht nur an dieser Stelle das Recht, wesentliche Fragen der gesellschaftlichen Evolution unbeantwortet zu lassen.
130
ÉMILE DURKHEIM: BERUFSMORAL, SOLIDARISMUS UND GILDEN
vermitteln und gegenüber gruppenexternen Konkurrenten um die Verteilung der gesellschaftlichen Macht abzusichern (Durkheim 1991: 40). Wenn ich Durkheim nicht völlig missverstehe, vermutet er hinter der geschilderten multiplen, beruflichen wie außerberuflichen Funktionalität der Zünfte eine Art »List der Vernunft«, die darauf hinwirkt, dass sich Akteure, die ebenso augenfällig wie vordergründig an ihrem individuellen beruflichen Fortkommen interessiert sind und die sich deshalb aus durchaus egoistischen oder parteilichen Gründen zusammentun, genau damit das Interdependenz- und Kontaktmilieu schaffen, das ihre individuellen Eigensüchtigkeiten in letzter Instanz bändigt und ihr Handeln in ein Mittel zur Erreichung überindividueller »moralischer Zielsetzungen« (Durkheim 1991: 44) umwidmet (Durkheim 1988: 55f.). Zur Plausibilisierung seiner Vermutung, dass die Wiedererrichtung von Zünften auch modernen Gesellschaften zum Segen gereichen kann, untersucht Durkheim darüber hinaus die (historische) These, dass zünftig organisierte »Handwerkskollegien« (Durkheim 1991: 32), gerade weil sie das stete und in allen Zeiten gleich drängende Bedürfnis der moralischen Verhaltensregulation erfüllen können (Durkheim 1991: 34), ein beachtlich hohes Alter aufweisen und seit dem Altertum, auch nach langen Zeiten, in denen sie nicht nachweisbar waren, immer wieder auftauchen. Diese These impliziert andererseits, dass die Zünfte offenbar nicht unter allen denkbaren Umständen dazu in der Lage gewesen waren, ihre moralisch-regulatorische »Hauptfunktion« (Durkheim 1991: 40) zu erfüllen; darin sehen sie sich vor allem dann gehindert, wenn sie – statt in Eigenregie Selbsthilfe- und Versorgungsmaßnahmen ergreifen und verantworten zu können – etwa infolge des staatlich erzwungenen Einbaus handwerklicher Tätigkeiten in die Armee einer umfassenden staatlicher Kontrolle unterliegen, wie im alten Rom (Durkheim 1991: 32, 52f.). Zur Bedeutungslosigkeit neigen Zünfte aber auch insofern, als sie – wie im »ancien régime« – aufgrund ihrer vornehmlich lokalen Regulationswirkungen den Anschluss an die (außerstädtische, landesweit ausgreifende) Industrialisierung und damit verbunden an die zunehmende Globalisierung der wirtschaftlichen Austauschbeziehungen verloren (Durkheim 1988: 65, Durkheim 1991: 55f.) und sich statt dessen auf eine – nicht näher beschriebene, in jedem Fall – »sterile« (Durkheim 198: 65) und »wenig erträgliche Ordnungspolitik« (Durkheim 1991: 46) eingelassen hatten. »Die alte, streng lokal orientierte Zunft, die sich gegen jeden äußeren Einfluß abriegelt, war in einer moralisch und politisch geeinigten Nation zu einem Nonsens geworden« (Durkheim 1973: 453). Einzig im (frühen und hohen) Mittelalter hatten die Zünfte einen angemessenen Ausgleich ihrer verschiedenen Funktionen gefunden, als sie sich als ein Forum der wirtschaftlichen wie politischen Selbstorganisation des damals aufsteigenden stadtsässigen Bürgertums bzw. als entscheidungsgewichtige Mitglieder des »Dritten Standes« gleichermaßen 131
MICHAEL SCHMID
etablieren konnten (Durkheim 1988: 62, 64 u.a.); die Zunft wurde damit nicht nur zum weitgehend autonomen Regulator ihrer eigenen wirtschaftlichen Belange, sondern sie stellte im Rahmen dieser Selbstverwaltungsorganisation auch die »Grundlage der kommunalen Verfassung« bereit (Durkheim 1991: 54). Das sich daraus ergebende Zusammenspiel verdankte sich mithin einer Art isomorphem Gleichlaut der Strukturen, denn »… wie die Gemeinde eine Zusammenkunft von Zünften darstellte, so bildete die Zunft eine Gemeinde im Kleinen« (Durkheim 1991: 54). Diese Wechselstabilität ihrer Funktionen erreichten die Zünfte darüber hinaus und nicht zuletzt aufgrund ihrer Einbettung in die damalige »ständische Ordnung« (Durkheim 1991: 56) und aufgrund der Marktgründungspolitik des grundherrschaftlichen Adels, der die Kommunen als Steuereinkommensquelle zu schätzen wusste und sie entsprechend protektionierte. In der Summe all dessen – so die kühne Behauptung Durkheims41 – dienten die Zünfte als »Grundlage für das gesamte politische System« (Durkheim 1991: 55). In Erweiterung dieser Überlegungen folgert Durkheim, dass Zünfte unter den Bedingungen des modernen Industriestaats als »nationale Berufsgruppen« in erster Linie dann wiederbegründet oder neu belebt werden können, wenn sie dazu in der Lage und gewillt sind, ihre lokal-städtische bzw. regionale Ausrichtung zugunsten eines nationalen Engagements zu überwinden (Durkheim 1988: 70). Durkheim sieht in diesem Zusammenhang keine Hindernisse in dem Wunsch, dass die Berufsverbände zur Wahrung ihrer national ausgreifenden politischen Wirksamkeit Zwangsmitgliedschaften vorzusehen hätten (Durkheim 1991: 60), um auf diese Weise als ein zentrales und unstrittiges Entscheidungsforum dienen zu können, auf dem zumal Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen Ausgleich ihrer Interessen suchen sollten (Durkheim 1991: 61). Voraussetzung dafür wäre nur, dass beide Gruppen ihre »Vertreter« getrennt wählen können, was die verfassungsrechtlich verbindliche Etablierung eines entsprechenden Organisations- und Partizipationsverfahrens erforderlich macht. Durkheim hat insoweit keinerlei Einwände gegen diese Vorkehrung, als auch sie der Ausgestaltung eines »korporativen Systems« (Durkheim 1991: 59) dienen kann, mit dessen Hilfe das Wirtschaftsleben mit dem »Staat verbunden« werden kann (Durkheim 1991: 61)42. Als Vehikel dieser durchweg erwünschten Verbindung sollte sich – verallgemeinert betrachtet – eine Art staatlicher Rahmengesetzgebung empfehlen, denn die »berufsbezogene Gesetzgebung kann kaum 41 Über die genaueren Bedingungen der »Einbettung« der Zünfte in die Stadtund Landespolitik berichtet Kluge (2009, S. 398ff.) im Rahmen seiner Darstellung des »Abstiegs« des Zunftwesens. 42 Meier (1987) stellt die Argumente für und gegen einen politischen Korporatismus zusammen, die sich auf Durkheim beziehen könnten.
132
ÉMILE DURKHEIM: BERUFSMORAL, SOLIDARISMUS UND GILDEN
etwas anderes sein als ein Spezialfall der allgemeinen Gesetzgebung« (Durkheim 1991: 60), und diese obliegt den staatlichen Parlamenten ebenso wie die familienrechtlichen Steuerungsmaßnahmen (Durkheim 1981: 57) und die Bereitstellung des Regelwerks, das die »politische Verfasstheit der Gesellschaft« (Durkheim 1991: 119) und damit die »staatsbürgerliche Moral« definiert, von deren Wirksamkeit die gruppenübergreifende Einheit des nationalen Lebens abhängen sollte (Meier 1987: 191ff.). Dass Durkheim die hierin implizierte These für gültig hielt, wonach die Berufsgruppen ihre »politische Funktion« – auch, wenn nicht in vorderster Linie – darin gewinnen könnten, dass sie staatliches Handeln »entlasten« bzw. gar »ersetzen« (Durkheim 1973: 463), dürfte nicht völlig abwegig sein. Wie genau der Staat seine Koordinations- und Supervisionsfunktionen gegenüber den Berufsgruppen ins Spiel bringen sollte und welche organisatorischen bzw. moralischen Voraussetzungen dazu benötigt werden, bedarf einer eigenständigen Rekonstruktion, die ich hier nicht angehe (vgl. dazu eingehend Müller 1983, Meier 1987 oder Sintomer 2009); und welche Anteile der staatlichen Gesetzgebung auf welche Weise bzw. in welchem Umfang von den Berufsgruppen übernommen werden könnten, schildert unser Autor – jedenfalls mit Blick auf die politische Bedeutsamkeit der Zünfte – nur kurz und entsprechend ohne klare Umrisse. Sicher aber ist dreierlei: Zunächst gilt, dass sich die Wirtschafts- und Arbeitspolitik der Berufsgruppen in einen »demokratischen« Rahmen einfügen lassen muss (Durkheim 1991: 111–155, Meier 1987: 227ff., Müller 2019: 153–155, 232–234)43, wozu erforderlich wird, »… (dass) sich zwischen dem Staat und den Bürgern eine ganze Reihe von sekundären Gruppen schiebe« (Durkheim 1988: 71, Durkheim 1991: 57). Solche »Intermediäre« sollten dazu in der Lage und zugleich gewillt sein, die im Gefolge der französischen Revolution gefährlich nahe gerückte »Tyrannei« des Staates über die vereinzelten Individuen zu verhindern bzw. die zunehmenden, in allen Fällen gewaltbasierten Interventionen des Staats in das gesellschaftliche Leben zumindest »abzufedern« (Müller 1983: 151ff., Delitz 2013: 206). Dass dies in der Form eines auf Lokal- und Regionalebene gewählten »parlamentarischen Rats« oder eines »Miniaturparlaments« (Müller 1983: 153) zu geschehen hat, steht für Durkheim fest (Durkheim 1991: 58). Durkheim verteidigt also eine Art 43 Im Gegensatz zu Müller (2000, S. 162) halten Aron (1971, S. 76f.) und Giddens (1978, S. 59ff.) Durkheims Parlamentarismus- und Demokratieverständnis mit unseren heutigen Auffassungen nicht für vereinbar, weshalb man die These, die Zünfte seien ein begrüßenswerter Hort des demokratischen Denkens gewesen, mit einem Fragezeichen versehen müsste. Auch darf man der Vermutung Kredit einräumen, dass der Grad demokratischer Verfasstheit der Zünfte historisch kontingent und entsprechend variabel ist (vgl. Kluge 2009, S. 353ff.).
133
MICHAEL SCHMID
des demokratisch verfassten, berufskorporatistisch ausgerichteten Föderalismus‹ (Meier 1987)44. Zum weiteren liegt der lizensierte Aufgabenbereich von Berufsverbänden nachweislich vor allem darin, die Gesetzgebung für die Aushandlung und Kontrolle der Arbeitsverträge, für die Entlohnung der Beschäftigten, für den Arbeitsschutz, die Ausgestaltung der Hygienebedingungen und die gesetzliche Regulierung der Umstände zu übernehmen, unter denen Frauen- und Kinderarbeit zulässig erscheinen (Durkheim 1973: 451, Durkheim 1988: 73, Durkheim 1991: 62); zu den gouvernementalen Pflichten der zukünftigen Zünfte gehört zudem, sich um den Aufbau und die Betreuung der Renten- und der Krankenkassen zu kümmern, und endlich die (wahrscheinlich schiedsrichterlich organisierte) Schlichtung all jener Konflikte vorzunehmen, die in den gerade aufgelisteten Handlungsbereichen unvermeidbarer Weise anfallen. Alle Details dieser Verfassungsreform belässt Durkheim freilich undiskutiert; allenfalls steht für ihn fest, dass sich die Leitlinien dieser Regulierungs- und Moderierungsverfahren an den Besonderheiten der verschiedenartigen Industriezweige zu orientieren haben (Durkheim 1991: 62f.) und dass sie zudem von dem Bestreben getragen sein sollten, die Bereitstellung und Abstimmung von Arbeitsleistungen und die hernach zu vorzunehmende Verteilung des Arbeitsprodukts den Kriterien der kommutativen, kontributiven und distributiven Gerechtigkeit zu unterwerfen, um auf diese Weise eine Verfassungsform zu finden und in Geltung zu halten, die es dem Stärkeren erfolgreich verbietet, den Schwächeren zu »unterjochen« (Durkheim 1988: 47 u.a., Durkheim 1991: 23). In Ergänzung dazu sollte es den Berufsgruppen zudem überlassen bleiben, die Allokations- und Verteilungsprobleme, die sich zwischen ihnen auftun mögen, einer gerechten Lösung zuzuführen (Durkheim 1973: 455); auf die damit verbundenen Aushandlungsprobleme und die Aufgaben der Vertragskontrolle geht Durkheim im vorliegenden Zusammenhang nicht erneut ein. Und endlich kann sich Durkheim auch vorstellen, dass der Zusammenbruch bzw. der Niedergang von »Hausgemeinschaften«, innerhalb derer bislang die intergenerationelle Weitergabe des Kollektiveigentums organisiert wurde, dazu führen könnten, dass Berufskorporationen in die Rolle des Erben wie des Erblassers gleichermaßen eintreten (Durkheim 1988: 73f.); ob parallel dazu auch der Staat Kollektiveigentum ausbilden sollte und in welcher Weise er es bewirtschaften und intergenerationell weitergeben darf, wäre zu klären. In jedem Fall ist mit der Übernahme der Kollektiveigentumspflege durch Berufskorporationen eine Entwicklung angestoßen, an deren Ende letztere sich für die Erbringung von Leistungen und Funktionen zuständig halten dürfen, die 44 Wie Lukes (1975, S. 268) betont, kann man Durkheim weder als Vorbereiter des »faschistischen Korporatismus« lesen wollen, noch sollte man Durkheims Auslassungen als Ausdruck einer »medivial nostalgia« verstehen.
134
ÉMILE DURKHEIM: BERUFSMORAL, SOLIDARISMUS UND GILDEN
die Familie immer weniger bereitstellen bzw. erfüllen kann (Durkheim 1975: 35ff., 47 u.a.). Wie angedeutet, will Durkheim die Beantwortung der Frage, wie die selektive Ausgliederung und die Organisation aller dieser speziellen Aufgaben- bzw. Rechtsprechungsbereiche im Einzelfall institutionalisiert werden kann und sollte, nicht spekulativ vorwegnehmen, sondern der empirischen Erfahrung überlassen, die sich dann einstellen muss, wenn man den Weg einer einschlägigen Verfassungsreform zu beschreiten beginnt (Durkheim 1991: 63). Alvin Gouldner (1958: xvif.) vermutet deshalb, dass Durkheim infolge dieser unfraglich berechtigten Selbstbescheidung in der Tat keinen Mechanismus hat angeben können, vermittels dessen sein Vorschlag zur Re-etablierung einer »modernen« korporativen Verfassung in institutionstechnisch kontrollierbarer Weise hätte realisiert werden können, was am Ende die Vermutung stützen könnte, dass seine Auslassungen zur Friedens- und Stabilitätsdienlichkeit zumal (moderner) zünftischer Institutionen von allzu »übertriebenen Hoffnungen« (Delitz 2013: 96) getragen waren. Damit schließen sich auch rezente Beurteilungen der Durkheim’schen Gesellschaftsanalyse Gustav Schmoller an, der seine damalige Rezension von Durkheims Frühwerk mit der Bemerkung schloss, dass der besprochene Autor »auf den Flügeln eines moralischen Ideals allzu leicht (über die Unabwägbarkeiten der Arbeitsteilung) hinweggleitet« (Schmoller 1894: 288).
4. Statt einer Zusammenfassung Unter welchen Gesichtspunkten hatte sich Durkheim mit der Verfassung von »Zünften« und »Berufsgruppen« beschäftigt? Ich denke zur abschließenden und zusammenfassenden Klärung dieser Frage Kurt Meier folgen zu können, der drei Themenkomplexe unterschieden hatte, derer sich Durkheim hatte annehmen wollen (Meier 1987: 328): –
– –
Zunächst: »Welche Bedeutung haben Berufsgruppen für die Bereitschaft der sozialen Akteure, sich fügsam gegenüber normativen Zumutungen zu verhalten?« Sodann: »Welche Bedeutung haben die Berufsgruppen für die Genese normativer Muster?« Und endlich: »Von welchen Bedingungen hängt die Entstehung von Berufsgruppen ab?«
Ohne Zweifel hatte sich Durkheim in vordringlicher Weise für die in den institutionellen Vorgaben des »Kollektivbewusstseins« lokalisierbaren Bedingungen interessiert, unter denen sich Akteure bereitfinden bzw. sich dazu angehalten sehen, die normativen Erwartungen anderer 135
MICHAEL SCHMID
zu beachten, diese als Verpflichtung des eigenen Handelns zu »internalisieren« (Durkheim 2009: 175) und auf diese Weise zur handlungsleitenden »Gewohnheit« werden zu lassen. Das damit angesprochene Problem der »sozialen« oder »kulturellen Ordnung« stellt den auch wissenssoziologisch nutzbaren Leitgesichtspunkt der heute üblichen Gleichsetzung seiner Moral-, Milieu- und Gesellschaftstheorie dar (Šuber 2012, Delitz 2013 u.a.). Auch die zweite Frage hat er ausgiebig zu beantworten versucht, wenn er wiederholt die Ausgestaltung der beruflichen Partikularmoral und deren Funktionalität sowohl für die friedensstiftende Regulierung des berufsgruppeninternen Verkehrs als auch für die Herstellung erträglicher Transaktionsbedingungen zwischen den Berufsgruppen betont (Wallwork 1972: 98–103). Die dritte Frage hat er indessen weitgehend zugunsten von Beschreibungen zünftischer Organisationseigenheiten und deren Funktionen zurückgestellt. Eine historische Erklärung des facettenreichen, in die Antike und ins Hochmittelalter zurückreichenden Entstehungs- und Reproduktionsschicksals der Zünfte45 und deren Fernwirkungen auf die »Moderne« war nicht das Thema seiner Sozialtheorie, auch wenn kaum geleugnet werden kann, dass seine Untersuchung der Ordnungsdienlichkeit zünftischer Institutionen – wie in seinen »Regeln der Methode« gefordert (Durkheim 1961: 216) – durchaus (historisch) vergleichend angelegt war (Smelser 1976: 72–113); das wird deutlich, wenn wir sehen, wie Durkheims komparatistischen Analysen in erster Linie den Tatbestand in den Vordergrund rücken, dass Gilden, Genossenschaften, Berufsfachverbände, Korporationen, Zünfte, Handwerkerassoziationen, organisierte industrielle Interessen usf. eines jener drei partikularen »moralischen Milieus« exemplifizieren, in denen sich jener Zwang zu konformem Verhalten aufbauen und aufrecht erhalten lässt, der jeder gesellschaftlichen 45 Durkheim verankert »Zünfte«, »Genossenschaften« (Durkheim 1988, S. 52) bzw. »Korporationen« (Durkheim 1988, S. 60, 63 u.a.) zwar im »Handwerk« (Durkheim 1988, S. 51, 63 u.a., Durkheim 1991, S. 32, 52, 55 u.a.), im kaufmännischen Patriziat (Durkheim 1991, S. 55) bzw. – diese Liste erweiternd oder verallgemeinernd – in »Handel und Gewerbe« (Durkheim 1988, S. 64, Durkheim 1991, S. 53); aber entgegen seiner sonstigen, in den »Regeln der soziologischen Methode« (Durkheim 1961, S. 131ff. und anderswo vgl. Durkheim 2009) durch Textsperrungen nachdrücklich empfohlenen Vorgehensweise bemüht er sich um keine genaue »Definition« dieser Organisationsform und er diskutiert die These, dass diese Berufsverbände ihre Ordnungsfunktionen im Verlauf ihrer Geschichte unter ganz verschiedenen Voraussetzungen erfüllen (vgl. Müller 1983, S, 152), nicht sehr ausgiebig; darauf aber, dass sie ihre moralische Funktionalität in allen Fällen erfüllen können (sollten), hofft er ohne Zweifel uneingeschränkt (vgl. Durk heim 1988, S. 97).
136
ÉMILE DURKHEIM: BERUFSMORAL, SOLIDARISMUS UND GILDEN
Ordnungsbildung und dies zu allen Zeiten und in allen Teilbereichen einer jeden denkbaren Gesellschaftsformation zugrunde liegt46. Durkheims Würdigung zünftischer Vergemeinschaftungen diente – wie zu Beginn vermutet – vordringlich als ein ebenso beispielgebender wie bestätigender Beleg für die Lösung der zentralen Problemstellung seines »Forschungsprogramms« (Müller 1983, Müller 2019, Šuber 2012: 11) bzw. des »Durkheim-Paradigmas« (Delitz 2013: 212, 215 u.a.), das darauf ausgelegt war, der Frage nachzugehen, ob und wie sich die moralische Integration moderner Gesellschaften bewerkstelligen ließe. Deren erfolgreiche Bearbeitung sollte es den politisch verantwortlichen Denkern der »Dritten Republik«, zu denen sich Durkheim jederzeit selbst zählte, erlauben, der als dringlich eingestuften »Aufgabe« nachzukommen, »unser moralisches Erbe zu retten« (Durkheim 1986a: 68) bzw. und ausgreifender: ihrer »Pflicht (zu genügen), uns eine neue Moral zu bilden« (Durkheim 1988: 480)47. Eine solche Moral zielt in zwei Richtungen: Zum einen soll sie die im Gefolge der französischen Revolution um sich greifende Isolierung des Einzelnen gegenüber einem zur Allmacht neigenden Staat eindämmen und die Freiheitsrechte der einzelnen Gesellschaftsmitglieder sichern; zum anderen aber sollte die Akzeptanz einer gemeinverbindlichen Moral die Akteure dazu anregen und befähigen, jede eigensüchtige Bedürfnisverfolgung zu unterlassen, um sie statt dessen darauf einzuschwören, sich an der Bereitstellung überlebensnotwendiger »öffentlicher Güter« zu beteiligen. Soweit diese Forderungen den Bereich des wirtschaftlichen Handelns berühren, müssen sie ihren institutionellen Niederschlag in dessen genossenschaftlicher Verfassung finden (Schmid 1998); in deren Rahmen wird sich die überlebenswichtige gesellschaftlicher »Solidarität« aber nur dann einstellen, wenn Gesellschaften nicht als Marktgesellschaften organisiert werden müssen, sondern – wie es John Rawls (1979: 20f.) ausrückte – als ein »Unternehmen zur Förderung des gegenseiteigen Vorteils« dienen können. Dieser Nutzeneffekt – so Durkheims nachdrückliche Feststellung – wird sich nur im Gefolge allgemein anerkannter »Gerechtigkeitsvorstellungen« einstellen. Solidarität kann nur eine gerecht organisierte Gesellschaft aufbringen, was wiederum in einer 46 Dass es mithin der »mittelalterlichen Korporation gelingt, die Regellosigkeiten der Moderne zu regeln« (Oexle 1994, S. 131; meine Sperrung), ist nicht die Pointe der Durkheim’schen Analyse, denn diese verweist auf erforderliche funktionale Ergänzungen durch familiale bzw. staatliche Moralitäten. Das heißt indessen nicht, dass der Oexle keine faire bzw. brauchbare Darstellung der Durkheim’schen Ordnungsproblematik und dafür gibt, welche Bedeutung die Zünfte zu deren Bewältigung hatten. 47 Schon René König sah hierin die »Quintessenz« der Durkheim’schen Soziologie (König 1976, S. 329). Zum politischen Hintergrund des Durkheim’schen Denkens vgl. Šuber 2012, S. 43–61 und Müller 2019.
137
MICHAEL SCHMID
»kantianisch« anmutenden Pflichtmoral begründet sein wird (Wallwork 1972: 33ff.), deren allseits beachteten Maximen den Gefährdungen entgegentreten können sollen, die der wirtschaftlichen wie der sozialen Ordnung insgesamt daraus zuwachsen, dass die Akteure – wie im (radikalen bzw. »ökonomischen«) Liberalismus vorgedacht und verteidigt – den allzu ausufernden Anspruch erheben sollten, ohne Beachtung der (berechtigten) Bedürfnisse ihrer Mitstreiter, vornehmlich eigensüchtige Interessen zu verfolgen48. Der Aufbau eines moralischen Regelsystems ist dazu unabdingbar. Dabei »bleibt immer wahr: Der Respekt vor den Regeln ist die Voraussetzung allen gemeinschaftlichen Handelns« (Durkheim 1979: 160). Das wiederzubelebende zünftisch organisierte Wirtschaftsleben stellt für Durkheim eines jener sozialen Milieus bereit, in denen die Akteure – auch angesichts der Reproduktionserfordernisse »höherer« oder »moderner« Gesellschaften – lernen können, diesen Respekt aufzubringen und zu pflegen. Das jedenfalls war seine Hoffnung.
Literatur Abbott, Andrew (1988): The Systems of Profession. An Essay on the Division of Expert Labor, Chicago/London: The University of Chicago Press. Alexander, Jeffrey, Bernhard Giesen und Jeson L Mast (eds.): Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics and Ritual, Cambridge: Cambridge University Press. Aron, Raymond (1971): Hauptströmungen der Soziologie. Zweiter Band: Emile Durkheim, Vilfredo Pareto, Max Weber, Köln: Kiepenheuer & Witsch. Beckert, Jens (1997): Grenzen des Marktes. Die sozialen Grundlagen wirtschaftlicher Effizienz, New York/Frankfurt. Campus Verlag. Beckert, Jens (2004): Unverdientes Vermögen. Soziologie des Erbrechts, New York/Frankfurt: Campus Verlag. Delitz, Heike (2013): Émile Durkheim. Eine Einführung, Hamburg: Junius Verlag. Durkheim, Emile (1958): Socialism and Saint-Simon (Le socialisme), ed. by Alvin Gouldner, Yellow Springs, Ohio: The Antioch Press. 48 Ich zögere, diesen Befund, demzufolge das wirtschaftliche Leben, um Solidarität stiften zu können, einer genossenschaftlichen Organisation bedürfe, auf die Bereiche der Familie und des Staates zu übertragen. Die Hinweise, die sich Wallwork 1972, Müller 1983 oder Traugott (ed.) 2013 u.a. entnehmen lassen, verweisen in den beiden zuletzt genannten Fällen auf anders gelagerte Mechanismen. Wahrscheinlich zutreffend ist aber, dass Durkheim alle diese sozialen Milieus vermittels einer gemeinschaftsstiftenden Pflichtmoral reguliert sehen wollte.
138
ÉMILE DURKHEIM: BERUFSMORAL, SOLIDARISMUS UND GILDEN
Durkheim, Emile (1961): Regeln der soziologischen Methode, hrsg. und eingeleitet von René König, Neuwied/Berlin: Hermann Luchterhand Verlag. Durkheim, Emile (1965): Montesquieu and Rousseau. Forerunners of Sociology. Foreword by Henri Peyre, Ann Arbor: The University of Michigan Press. Durkheim, Emile (1967): Soziologie und Philosophie, Frankfurt: Suhrkamp Verlag. Durkheim, Emile (1972): Erziehung und Soziologie, Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann. Durkheim, Emile (1973): Der Selbstmord, Neuwied/Berlin: Luchterhand Verlag. Durkheim, Emile (1975): Textes 2. Religion, morale, anomie, ed. Victor Karady, Paris: Les éditions de minuit. Durkheim, Émile (1975a): Textes 3. Fonctions sociales et institutions, ed. Victor Karady, Paris: Les éditions de minuit. Durkheim, Emile (1977): Über die Teilung der sozialen Arbeit, eingeleitet von Niklas Luhmann, Frankfurt: Suhrkamp Verlag. Durkheim, Emile (1977a): Die Entwicklung der Pädagogik. Zur Geschichte und Soziologie des gelehrten Unterrichts in Frankreich, Weinheim/Basel: Beltz Verlag. Durkheim, Emile (1979): ›The moral greatness of France and the school of the future‹, in: Emile Durkheim: Essays on Morals and Education, edited and inroduced by W.S.F. Pickering, London/Boston/Henley: Routledge & Kegan Paul, S. 158–161. Durkheim, Emile (1981): Die elementaren Formen des religiösen Lebens (Überarbeiteter Nachdruck), Frankfurt: Suhrkamp Verlag. Durkheim, Emile (1981a): Der Dualismus der menschlichen Natur und seine sozialen Bedingungen, in: Friedrich Jonas (Hg.): Geschichte der Soziologie, Band 2: Von der Jahrhundertwende bis zur Gegenwart, Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 368–380. Durkheim, Emile (1982): Frühe Schriften zur Begründung der Sozialwissenschaften, hrsg. von Lore Heisterberg, Soziologische Texte 122, Neuwied/ Berlin: Luchterhand Verlag. Durkheim, Emile (1984): Erziehung, Moral und Gesellschaft. Vorlesung an der Sorbonne 1901/02, Frankfurt: Suhrkamp Verlag. Durkheim, Emile (1986): Einführung in die Moral, in: Hans Bertram (Hg.): Gesellschaftlicher Zwang und moralische Autonomie, Frankfurt: Suhrkamp Verlag, S. 33–50. Durkheim, Emile (1986a): Der Individualismus und die Intellektuellen, in: Hans Bertram (Hg.): Gesellschaftlicher Zwang und moralische Autonomie, Frankfurt: Suhrkamp Verlag, S. 54–70. Durkheim, Emile (1988): Über soziale Arbeitsteilung. Studie über die Organisation höherer Gesellschaften. Mit einer Einleitung von Nilas Luhmann und einem Nachwort von Hans-Peter Müller und Michael Schmid. Zweite (überarbeitete und korrigierte) Auflage, Frankfurt: Suhrkamp Verlag. Durkheim, Emile (1991): Physik der Sitten und des Rechts. Vorlesungen 139
MICHAEL SCHMID
zur Soziologie der Moral, hrsg. von Hans-Peter Müller, Frankfurt: Suhrkamp Verlag. Durkheim, Emile (2009): Die Soziologie und ihr Wissenschaftsbereich, in: Berliner Journal für Soziologie 19, S. 164–180. Durkheim, Emile/Marcel Mauss (1987): Über einige primitive Formen von Klassifikation. Ein Beitrag zur Erforschung der kollektiven Vorstellungen, in: Emile Durkheim: Schriften zur Soziologie der Erkenntnis, hrsg. von Hans Joas, Frankfurt: Suhrkamp Verlag, S. 169–256. Gephart, Werner (1990): Strafe und Verbrechen. Die Theorie Emile Durkheims, Opladen: Leske + Budrich. Gephart, Werner (1997): Gesellschaftstheorie und Recht. Das Recht im soziologischen Diskurs der Moderne, Frankfurt: Suhrkamp Verlag. Giddens, Anthony (1978): Durkheim. His Life, Work, Writings and Ideas, Hassocks: The Harvester Press. Gouldner, Alvin (1958): Introduction, in: Émile Durkheim, Socialism and Saint Simon, Yellow Springe: The Antioch Press, S. v–xxix. Gülich, Christian (1991): Die Durkheim-Schule und der französische Solidarismus, Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag. Hardin, Garrett (1968): The Tragedy of the Commons, in: Science 162, S. 1243–1248. Hardin, Russell (1982): Collective Action, Baltimore, ML: The Johns Hopkins University Press. Hayek, Friedrich A. von (1991): Der Weg in die Knechtschaft, München: Verlag Bonn Aktuell. Hechter, Michael (1987): Principles of Group Solidarity, Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press. Hirsch, Fred (1980): Die sozialen Grenzen des Wachstums. Eine ökonomische Analyse der Wachstumskrise, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag. Homans, George C./Charles P. Curtis, Jr. (1934): An Introduction to Pareto. His Sociology, New York: Howard Fertig. Honneth, Axel (2018): Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Mit einem neuen Nachwort. Zehnte Auflage, Berlin: Suhrkamp Verlag. Joas, Hans (1997): Die Entstehung der Werte, Frankfurt: Suhrkamp Verlag. Ingrao, Bruna/Giorgio Israel (1990): The Invisible Hand. Economic Equili brium in the History of Science, Cambridge, MA/London, UK: The MIT Press. Kluge, Arnd (2009): Die Zünfte, Stuttgart: Franz Steiner Verlag. König, René (1976): Émile Durkheim: Der Soziologe als Moralist, in: Dirk Käsler (Hg.): Klassiker des soziologischen Denkens, Band 1: Von Comte bis Durkheim, München: C.H. Beck Verlag, S. 312–364. König, René (1978): Emile Durkheim zur Diskussion. Jenseits von Dogmatismus und Skepsis, München: Carl Hanser Verlag. LaCapra, Dominick (1985): Emile Durkheim. Sociologist and Philosopher, Chicago/London: The University of Chicago Press. Landa, Janet Tai (1997): Trust, Ethnicity, and Idendity. Beyond the New 140
ÉMILE DURKHEIM: BERUFSMORAL, SOLIDARISMUS UND GILDEN
Institutional Economics of Ethnic Trading Networks, Contract Law, and Gift-Exchange, Ann Arbor: The University of Michigan Press. Lichbach, Mark I. (1996): The Cooperators’s Dilemma, Ann Arbor: The University of Michigan Press. Lichbach, Marl I. (1998): The Rebel’s Dilemma, Ann Arbor: The University of Michigan Press. Lukes, Steven (1973): Emile Durkheim. His Life and Work: A Historical and Critical Study, Harmondsworth: Peguin Books. Marx, Karl (1965): Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band: Der Produktionsprozess des Kapitals, Berlin: Dietz Verlag. Marx, Karl (1974): Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. (Rohentwurf) 1857–1858, Berlin: Dietz Verlag. Mauss, Marcel (1978): Die Gabe. Form und Funktion des Austausches in archaischen Gesellschaften, in: Marcel Mauss: Soziologie und Anthropologie, Band II. Gabentausch, Todesvorstellung, Körpertechniken, Begriff der Person, hrsg. von Wolf Lepenies und Henning Ritter, Berlin: Ullstein, S. 9–144. Meier, Kurt (1987): Emile Durkheims Konzeption der Berufsgruppen. Eine Rekonstruktion und Diskussion ihrer Bedeutung für die Neokorporatismus-Debatte, Berlin: Duncker & Humblot. Moffett, Mark W. (2019): Was ins zusammenhält. Eine Naturgeschichte der Gesellschaft, Frankfurt: S. Fischer Verlag. Müller, Hans-Peter (1983): Wertkrise und Gesellschaftsreform. Emile Durkheims Schriften zur Politik, Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag. Müller, Hans-Peter (1988): Social Structure and Civil Religion: Legitimation Crisis in a Late Durkheimian Perspective, in: Jeffrey Alexander (ed.): Durkheimian Sociology: Cultural Studies, Cambridge et al.: Cambridge University Press, S. 129–158. Müller, Hans-Peter (1991): Die Moralökonomie moderner Gesellschaften. Durkheims »Physik der Sitten und des Rechts«, in: Emile Durkheim: Die Physik der Sitten und des Rechts. Vorlesungen zur Soziologie der Moral, Frankfurt: Suhrkamp Verlag, S. 307–341. Müller, Hans-Peter (2000): Emile Durkheim (1858–1917), in: Dirk Käsler (Hg.): Klassiker der Soziologie 1. Von Auguste Comte bis Norbert Elias. Zweite Auflage, München: C.H.Beck Verlag, S. 150–170. Müller, Hans-Peter (2019): Das soziologische Genie und sein solides Handwerk. Studien zu Émile Durkheims Forschungsprogramm, Wiesbaden: Springer VS. Müller, Hans-Peter/Michael Schmid (1988): Arbeitsteilung, Solidarität und Moral. Eine werkgeschichtliche und systematische Einführung in die »Arbeitsteilung« von Emile Durkheim, in: Emile Durkheim: Über soziale Arbeitsteilung. Studie zur Organisation höhere Gesellschaften, Frankfurt: Suhrkamp Verlag, S. 481–532. Münch, Richard (1982): Theorie des Handelns. Zur Rekonstruktion der Beiträge von Talcott Parsons, Emile Durkheim und Max Weber, Frankfurt: Suhrkamp Verlag. 141
MICHAEL SCHMID
Oexle, Otto Gerhard (1994): Kulturwissenschaftliche Reflexionen über soziale Gruppen in der mittelalterlichen Gesellschaft: Tönnies, Simmel, Durkheim und Max Weber, in: Christian Meier (Hg.): Die okzidentale Stadt nach Max Weber. Zum Problem der Zugehörigkeit und Antike und Mittelalter, Historische Zeitschrift. Beihefte, Neue Serie, Bd. 17, München: R. Oldenbourg Verlag, S. 115–159. Olson, Mancur (1968): Logik des kollektiven Verhaltens, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). Olson, Mancur (1986): A Theory of Social Movements, Social Class, and Castes, in: Siegwart Lindenberg, James S. Coleman und Stefan Nowak (eds.): Approaches to Social Theory, New York: Russel Sage Foundation, S. 317– 337. Ostrom, Elinor (1990): Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge et al.: Cambridge University Press. Parsons, Talcott (1967): Durkheim’s Contribution to the Theory of Integration of Social Systems, in: Talcott Parsons: Sociological Theory and Modern Society, New York/London: The Free Press/Collier-Macmillan Ltd., S. 3–34. Parsons, Talcott (1968): The Structure of Social Action. Volume I: Marshall, Pareto, Durkheim, New York/London: The Free Press/Collier Macmillan Publishers. Parsons, Talcott (1991): The Early Essays. Edited and with an Introduction by Charles Camic, Chicago/London: The University of Chicago Press. Pickering, W.S.F. (1979): Introduction, in: Emile Durkheim: Essays on Mo rals and Education, edited by W.S.F. Pickering, London/Bosten/Henley: Routledge & Kegan Paul, S. 3–28. Pommerehne, Werner W. (1987): Präferenzen für öffentliche Güter, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). Rawls, Jon (1979): Eine Theorie der Gerechtigkeit. Übersetzt von Hermann Vetter, Frankfurt: Suhrkamp Verlag. Rueschemeyer, Dietrich (1985): Spencer und Durkheim über Arbeitsteilung und Differenzierung, Kontinuität oder Bruch?, in: Niklas Luhmann (Hg.): Soziale Differenzierung. Zur Geschichte einer Idee, Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 161–180. Schluchter, Wolfgang (2006): Grundlegungen der Soziologie. Eine Theoriegeschichte in systematischer Absicht. Band 1, Tübingen: Mohr Siebeck. Schmid, Hans Bernhard (2012): Wir-Intentionalität. Kritik des ontologischen Individualismus und Rekonstruktion der Gemeinschaft, Freiburg: Verlag Karl Alber. Schmid, Michael (1987): Arbeitsteilung und soziale Gerechtigkeit. Einige philosophische Bemerkungen zur Gesellschaftstheorie Emile Durkheims (unveröffentlichtes Skript). Schmid, Michael (1989): Solidarität und Arbeitsteilung. Bemerkungen zu Durkheims Theorie, in: Max Haller/J.-J. Hoffmann-Nowotny/Wolfgang Zapf (Hg.): Kultur und Gesellschaft. Verhandlungen des 24. Deutschen Soziologentags, des 11. Österreichischen Soziologentags und des 142
ÉMILE DURKHEIM: BERUFSMORAL, SOLIDARISMUS UND GILDEN
8. Kongresses der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie in Zürich 1988, Frankfurt: Campus Verlag, S. 518–531. Schmid, Michael (1998): Arbeitsteilung und Solidarität. Eine Untersuchung zu Émile Durkheims Theorie der sozialen Arbeitsteilung, in: Michael Schmid, Soziales Handeln und strukturelle Selektion. Beiträge zur Theorie sozialer Systeme, Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 93–117. Schmoller, Gustav (1890): Das Wesen der Arbeitsteilung und der sozialen Klassenbildung, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich 14, S. 45–105. Schmoller, Gustav (1894): Besprechung von Durkheims »De la division du travail social«, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich 18, S. 286–289. Sen, Amartya (2002): Rationality and Freedom, Cambridge, Mass./London, UK: The Belknap Press of Harvard University Press. Sintomer, Yves (2009): Emile Durkheim zwischen Republikanismus und deliberativer Demokratie, in: Berliner Journal für Soziologie 19, S. 205–226. Smelser, Neil J. (1976): Comparative Methods in the Social Sciences, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc. Smith, Adam (1974): Der Reichtum der Nationen, München: dtv. Spencer, Herbert (1897): Principles of Sociology in Three Volumes, Vol. 1, New York: D. Appleton and Company. Spencer, Herbert (1897a): Principles of Sociology in Three Volumes, Vol. 2, New York: D. Appleton and Company. Spencer, Herbert (1897b): Principles of Sociology in Three Volumes, Vol. 3, New York: D. Appleton and Company. Stedman Jones, Susan (2001): Durkheim Reconsidered, Cambridge: The Po lity Press. Šuber, Daniel (2012): Émile Durkheim, Konstanz: UVK. Tuck, Richard (2008): Free Riding, Cambridge, Mass./London, UK: Harvard University Press. Traugott, Mark (2013): Emile Durkheim on Institutional Analysis. Edited, Translated and with an Introduction by Mark Traugott, Chicago: Chicago University Press. Tyrell, Hartmann (1985): Emile Durkheim – Das Dilemma der organischen Solidarität, in: Niklas Luhmann (Hg.): Soziale Differenzierung. Zur Geschichte einer Idee, Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 181–250. Valjavec, Friedrich (1995): Émile Durkheim. Voraussetzungen und Wirkungen. Band 1: Kultursoziologische Aspekte. Münchener Ethnologische Abhandlungen, München: Akademischer Verlag München. Vanberg, Viktor (1982): Markt und Organisation. Individualistische Sozialtheorie und das Problem des korporativen Handelns, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). Vanberg, Viktor J. (2008): Wettbewerb und Regelordnung. Hrsg. von Nils Goldschmidt und Michael Wohlgemuth, Tübingen: Mohr Siebeck. Wallwork, Ernest (1972): Durkheim. Morality and Milieu, Cambridge, MA: Harvard University Press. 143
MICHAEL SCHMID
Weber, Max (1922): Grundriss der Sozialökonomik. III Abteilung: Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen: Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). Wenzel, Harald (1990): Die Ordnung des Handelns. Talcott Parsons’ Theorie des allgemeinen Handlungssystems, Frankfurt: Suhrkamp Verlag. Willeke, Franz-Ulrich (1961): Entwicklung der Markttheorie. Von der Scholastik bis zur Klassik, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
144
Christiane Mossin
Dear Beatrice The never written memoir of a guild socialist Introductory remarks Due to the unusual nature of the text to follow, a few introductory remarks shall be given, outlining the main ideas by which the text has been constructed. The text takes the form of a letter, written by a fictional sender who pursued her political dreams in the tumultuous second decade of 20th century London. This fictional sender (unnamed) adresses a likewise fictional recipient in 2021, with the hope that the experiences and dreams of her youth might speak to the 2020’s. Her dreams concerned, more specifically, ideas of pluralist democratic self-organization being the foundation of social order – dreams which found a temporary home in the guild socialist movement that blossomed in Britain during and just after WWI, but soon became homeless again as the movement collapsed in 1923–24. Her narrative encompasses, moreover, a range of political movements intermingling and battling with each other in the beginning of the 20th century. But why construct a semi-fictional text for the purpose of confronting the present with past horizons of political imagination? Firstly, the semi-fictional construction has made it possible for me to unfold the tumultuous manifold of early 20th century political move ments from the point of view of a human being striving to find a political answer to the social injustice she experiences. The narrative of the letter moves through four main stations: from the militant part of the suffragette movement to socialist suffragette groups (renouncing militancy), to Fabianism (dedicated to gradualist state-centered socialist reform) and finally to guild socialism (discarding centralism for pluralism).1 The way 1 Although this political journey is a fiction, it is not unlikely that a young woman of that period could have moved through these four political movements, searching for a »political home«. Many militant suffragettes renounced, at a later point, militancy, just as many suffragettes were, or became, associated with Fabianism or guild socialism. The letter will mention some of the historical figures who rebelled against the militant suffrage organisation WSPU from within, especially Sylvia Pankhurst. As for connections between suffragettes and guild socialism, Margaret Cole mentions
145
CHRISTIANE MOSSIN
in which these movements confronted as well as affected each other, and the dramatic inner tensions they all contained, amount to more than just coincidental historical circumstances. These battles, tensions and connections bore witness to fundamental political dilemmas haunting the activists of that era, such as: particularized agenda-setting versus comprehensive social visions; legal versus illegal activist methods; artistically inspired anarchism versus functional organization; democracy versus hierarchy; centralism versus pluralism. Arguably, these dilemmas are no less relevant today than in the early 20th century. Secondly, the semi-fictional construction allows me to play with the possibilities opened up by »ghost-writing«, in a particular sense. Political philosophy and literary studies, in particular, have seen the development of analytical strategies revolving around »ghost«-figurations. The »ghost« in question may be a literary character (like Hamlet’s father), or a historical event or phenomenon (like Marxism). In any case, »ghost«-analysis centers on opening the mind of the reader to a kind of repressed truth or justice-calling of the past, haunting the present like a ghost.2 – The narrative I have constructed is not quite as ambitious as that. Yet, the fictional sender of the letter is indeed envisioned as a ghost; in 2021 she is long-dead. She addresses the 2020’s with the conviction that something important has been forgotten: a historical possibility of pluralist self organization; a unique vision of social equality and freedom that died out much too quickly and was left like an unvisited ruin. When I – alive in 2021 – have set out to write her story, I have sought to situate myself in the tension between my own time and an unattainable past. Although this amounts to an impossible positioning, the attempt in itself to reach towards it has – so I hope – sensitized me to the ways in which past and present may open up to each other. It should be mentioned as well, that the name of the recipient of the letter, »Beatrice«, is meant to refer to an ambiguous spectrum of meaning. »Beatrice« refers, naturally, to the fictional recipient of the letter, a 100 year old woman who survived throughout the dramatic historical changes from 1921 to 2021. But this fictional character was named after a real historical person, Beatrice Webb, who, in partnership with her husband Sidney Webb, constituted the intellectual, ideological and organizational backbone of the Fabian Society throughout the first three decades of the 20th century. Beatrice Webb has later been recognized as the first person to formulate the principles of the British welfare state, explicitly, in her listing of members and associates of the guild socialist movement, »some of Sylvia Pakhurst’s working-class suffragettes«. Margaret Cole Growing up into Revolution (London, 1949), p. 71. 2 Such form of analysis is often referred to as »hauntology« – a term coined by Jaques Derrida in his Specters of Marx (New York, 2006).
146
THE NEVER WRITTEN MEMOIR OF A GUILD SOCIALIST
40 years in advance!3 On this basis, »Beatrice« refers not only to the fictional »Beatrice«, but to the welfare state as such – to the principles of social order which came out as the historical winner. Among the many political tensions and dilemmas dealt with in the letter, the opposition between state-centered social reformism (as advocated by the Webbs and the Fabian Society) and pluralist-socialist envisioning (as advocated by guild socialists and in particular G.D.H. Cole, the main theorist of guild socialism) plays the main part. It is the hope of the sender of the letter that the »Beatrice« of the present is not identical to the »Beatrice« of the past: that the »Beatrice« of the 2020’s (the person as well as the welfare state) may prove open to alternative principles of social order.The name »Beatrice« means, moreover, »the one who makes happy«. Finally, let me clarify the relationship between fictionalization and historical study: The recipient and the sender of the letter, as well as the woman referred to in the letter as ›your mother‹ are fictional. All other persons mentioned in the letter are real, historical figures. All details provided with respect to the lives of the latter are based on historical sources. Likewise, all information given on societal or political developments, including all mentioned organizations and the nature of their activities, is based on historical sources. All public events described in the letter correspond to real events (such as political meetings or theatre shows), just as the details provided with respect to times and places are historically accurate. The only events which are fictional are those relating exclusively to the narratives of the three fictional characters. Apart from historical works on the period, primary sources have been employed to a large extent. Sources and additional historical informa tion are provided in the notes.
Dear Beatrice I hope you will allow me to address you by your first name. Last time I wrote to you was in 1921. You were just a few weeks old, and I wanted to congratulate your mother on your arrival. I know she had expected your coming with hope and joy; and she named you after her political heroine, Beatrice Webb. Mrs Webb was among the most admired social researchers and political activists of her time; yet, she was not my heroine. I shall admit straight away: Only because I trust you have not developed into the exact image of your namesake, I am addressing this letter to you. 3 In her Minority Report, see note 45 below.
147
CHRISTIANE MOSSIN
In truth, this letter is even more awkward than the one I wrote to you in 1921. You may find it completely unjustified, like a letter from no where, and – although addressed to you – somehow vague in terms of its destination as well. But please trust my letter is carried by the most sincere hope: that a message across ages, dreams and disappointments, life and death may speak to the hibernating metamorphic aspirations of the recipient. Please trust, moreover, you are more than a coincidental recipient. You endured, and not just by simply surviving. You spend your recent 100-years birthday fundraising for the improvement of British health care for the most vulnerable during the coronavirus pandemic.4 So impressive that was! And yet, I ask: What became of the dreams for which your mother and I fought so terribly hard in the first decades of the 20th century; why would a society of the 21st century need such efforts? I expect you never saw the letter I wrote to you in 1921, nor ever heard about me. Sadly, in 1921, your mother and I had not been on spea king terms for six years. We had once been close friends, but parted over political disagreements. Through common acquaintances, I retrieved bits and pieces of information as to her life course over the years while hoping things would change. They did not; my letter to you was my last attempt of reaching out to her – a clumsy, inappropriate attempt of gaining her attention, I admit. It might be difficult to grasp the extent to which politics, in those days, could form as well as ruin a friendship. Also among those, like your mother and I, who shared the same goals. We wanted social justice and equality. We wanted the end of the horrible living and working conditions of workers (which included small children), and the end of the inhuman powerlessness to which those unable to work – whether due to work accidents, ruined health, old age or innate disabilities – succumbed. We wanted the abolition of the frightening power of employers over those in their service as well as those desperate to find work, and the unspeakable abuses which came of it. We hated intensely the dehumanizing Poor Law5 and wished for its replacement by proper 4 This event is fictional, but inspired by the true story of Captain Sir Tom Moore who in the early days of the coronavirus pandemic, at the age of 99, began to walk one hundred lengths of his garden in aid of The Association of National Health Service Charities, aiming at raising £1,000 by his 100th birthday on 30 April 2020. On that day, the total raised by his walk had increased to over £32.79 million. He died in February 2021, tested positive for Covid-19. https://www.bbc.com/news/uk-england-beds-bucksherts-55881753. 5 A system of poor relief the roots of which can be traced back to the early 16th century. The New Poor Law of 1834 – the main principles of which were to condition poor relief on residence in workhouses and to make workhouses so uninviting, so that no-one would choose to reside in them
148
THE NEVER WRITTEN MEMOIR OF A GUILD SOCIALIST
rights which would secure livable working conditions and free education, health- and unemployment insurance for all. We loathed, as well, the charity offered by the wealthy – which, however graciously intended, confirmed the inferiority of the receivers and condemned them to eternal gratitude. We fought not only for decent material conditions, but for the dignity of working class people. We fought for the rights and full recognition of women, intellectually, politically, economically, culturally, and as mothers. We fought for sexual freedom, within and outside of marriage. Proudly, we called ourselves socialists and suffragettes (a combination which, back then, was not always obvious, and to which I shall return). – But underneath all those common goals some differences were lurking. It was more than just different views on which political means would serve our causes better than others. We evaluated the nature and scope of human capabilities differently. We understood freedom differently. Relatedly, we grasped the relationship of politics to art and aesthetics on entirely different terms. I believed in the collective capabilities of humans to form their own destiny. I am not referring to ›the state‹, ›the nation‹ or any similar construction. I have in mind the kind of democratic practices which may flourish in smaller groups – based on creative vision no less than sensible down-to-earth approaches. Democracy need not be a distant experience, a negligible stake in the chambers of high-level political trade-offs and power games. Democracy is not simply the least harmful of political orders (›the worst form of Government except for all those other forms…‹, as Churchill stated two World Wars later6). For me, back then, democracy was a dream. As a suffragette I demanded my right to vote, and to stand as a candidate in Parliamentarian Elections; but I came to dream of another kind of democracy as well: a society based on the engaged, creative efforts of numerous self-organizing groups. It was among the guild socialists that I first encountered, just around the outbreak of the First World War, this dream of democracy expressed as a concrete societal vision: a democracy emerging from below, from small factory work-groups, unions and their sub-fractions, farmers’ co-operatives, consumer-groups or local groups engaged in matters of common welfare. In fact, there was not just one vision. Whereas pluralism and self-organization from below constituted common elements of unless as a last resort – remained in force until 1948 and the introduction of welfare state legislation in Britain. See Lynn Hollen Lees, The Solidarities of Strangers: The English Poor Laws and the People, 1700–1948 (Cambridge, 1999). – Below, the letter describes Beatrice Webb’s unsuccessful battle against the Poor Law in 1905–11. 6 In the House of Commons, 11 November 1947. Richard Langworth (ed), Churchill by Himself: The Definitive Collection of Quotations (New York, 2008), p. 574.
149
CHRISTIANE MOSSIN
the democratic dream of the guild socialists, the details of how such a dream might be realized in practice were subjects of variegated proposals. The guild socialists constituted a manifold and non-dogmatic move ment the members of which contributed with a diversity of talents, strategic initiatives, social and philosophical ideas. There was a bunch of newspaper editors, journalists, critics, satirical writers and cartoonists such as William Mellor, Norman and Monica Ewer, Maurice Reckitt, Ivor Brown, Will Dyson, George Lansbury and Francis Meynell. There were solicitors, priests and civil servants; I remember in particular Delisle Burns, a former secret service agent and jesuit priest, turned atheist. Another extraordinary figure was Eva Reckitt who, like her brother Maurice, had defied her conservative-religious upbringing in one of the country’s leading capitalist families, and devoted her organizational skills and social radicalism to the movement. Lecturers and organizers of working class education (through the Workers’ Educational Association delivering free adult education throughout the country) constituted crucial contributors as well: William Temple, G.D.H. and Margaret Cole, R.H. Tawney, Arthur Greenwood, Alfred Zimmern. Numerous politicians, many from the Independent Labour Party, were more or less closely associated; among them Clifford Allen who was also the founder of the No-Conscription Fellowship. Especially significant were the many t rade union leaders who joined the movement: Among the most influential agitators and strike leaders were Ellen Wilkinson, national organiser for The Amalgamated Union of Co-operative Employees, George Hicks, national organiser of The Operative Bricklayers’ Society, and Mary Macarthur, General Secretary of The National Federation of Women Workers.7 Many of these names are probably somewhat familiar to you; later, in the 1920’s and afterwards, they became famous Labour or Communist politicians, leaders, publishers or writers. Today, the memories of their battles and (shifting) political positions have naturally faded. I mention them for the sole reason of providing some impression of the richness and tolerance of the movement. Catholics intermingled with Anglicans and atheists, pacifists with soldiers, playful and artistic approaches with fact-obsessed research, women with men. Some had working class background, others came from middle or upper class families. The more influential members were undoubtedly intellectuals (by virtue of formal education or self-learning) – lovers of statistics no less than poetry and science fiction.8 But this did not mean ordinary 7 These and other names can be found in Margaret Cole’s listing and description of members and associates of the guild socialist movement, in her autobiography Growing up into Revolution, p. 66ff. 8 »Science fiction« refers especially to William Morris’ novel News from Nowhere (Mineola, New York, 2004), originally published in 1890, envisioning
150
THE NEVER WRITTEN MEMOIR OF A GUILD SOCIALIST
workers’ and soldiers’ experiences and initiatives were disregarded. The whole point was to develop a living movement the philosophical ideas of which grew on the basis of existing organizational forms and battles (especially those of trade unions) – just as, conversely, know ledge and utopian ideas were meant to flow from the movement’s ›philosophers‹ to its broader crowds. To some extent, this ambition was crowned with success. Huge parts of the movement’s intellectual work was intimately connected to existing trade union goals and bat tles. We established an enormous archive comprising the most detailed facts about the numerous local unions throughout the country – localizations, developments in membership and particular issues of challenge, relevant employer- and factory-details, records of meetings, negotiations, battles etc. We analyzed all these facts, compared various local units, found overall traits of development. But we also provided research ›on demand‹. We gathered specific information and provided counseling to particular unions confronted with particular challenges. We supported strikes through pamphlets, newspaper articles, press conferences, organizational, strategic and logistic help. We tossed out as much advance information as we could about the government or huge industrialists (Delisle Burns, the former MI5 agent was invaluable in this respect).9 You see, these were intense times. During the ›Great Labour Unrest‹ 1911–14 the country had practically been in a state of civil war. World War I did not bring internal violent conflict to a halt, only slightly tamed it. Indeed, the war changed power balances: The shortage of labour power in a situation of expanding war industries gave workers new possibilities of pressuring the government as well as industrialists.10 We engaged ourselves in all aspects of these power balances and battles, on the side of the workers. And indeed, when the movement peaked, just after the end of the first World War, it had achieved broad support. One of the most crucial members – who came to shape guild socialist visions significantly and inspired masses of people, through written works, lectures, adult education, committee work, meetings and debates all over the country – was G.D.H. Cole (»God Damn Hell a socialist-utopian society. It was crucial for G.D.H. Cole, as it was for some of the first-generation guild socialists (mentioned in the letter below). »Statistics« played a huge role in the fact-based social research carried out by guild socialists; but so did aesthetic practices and visions (these characte ristics of the movement will be unfolded below). 9 Margaret Cole, Growing up into Revolution, p. 62, 64, 94–95. 10 In the war period, strikes were largely carried out illegally. See James E. Cronin, »Strikes and Power in Britain, 1870–1920.« International Review of Social History 32, no. 2 (1987): 144–67. As experienced by Margaret Cole: Growing up into Revolution, p. 34–35, 62.
151
CHRISTIANE MOSSIN
Cole«, as some of his friends used to call him11). Cole did not invent guild socialism. Ideas of building modern society on a variety of self-organizing ›guilds‹ (inspired by medieval guilds constituting whole ›life worlds‹ of collective regulation, safety and solidarity) had been gradually developed and promoted since the turn of the century, especially through the journal New Age and writers such as Arthur Penty, Alfred Richard Orage (editor of The New Age) and Samuel George Hobson.12 But while honoring these New Age ideas, Cole took them to another level of radicality as well as detailed, systematic elaboration: Freeing them of medieval nostalgia, he envisioned a society penetrated by democracy through and through, absent traditional forms of hierarchy and authority. Naturally, it took some years for this vision to mature. But a new era of guild socialism certainly began already in the early war years when the young Cole and his friend William Mellor grasped the budding ideas of guild socialism, provoked the Fabian Society to the point of scandalous conflict, founded the National Guilds League and managed to capture the Fabian Research Department for their own purposes while lea ving the Fabian Society as such.13 This is when guild socialism entered my life. At that time – as in decades to follow – the Fabian Society was dominated by the thinking of your namesake, Beatrice, and her husband Sidney Webb. For your mother, this couple came to embody her political hopes in opposition to mine: hopes not of self-organizing local units, but of a collectivist state responsible for the lives of its citizens, for their safety, decency and dignity. But I am proceeding too quickly, already. Allow me to take a step back and explain to you how your mother and I ended up in the Fabian Society in the first place, and the nature of that Society. Otherwise, I fear it will not be understandable how the conflict between guild socialism and Fabianism could lead to a conflict between the two of us which, ironically, proved to be much harder than the one between Cole and the Webbs. We were not originally Fabians, indeed quite far from it. Our political activism began in the militant part of the suffragette movement, in Emmeline Pankhurst’s ›The Women’s Social and Political Union‹. We had been socialists from an early age, but had, like Emmeline Pankhurst 11 Margaret Cole, Growing up into Revolution, p. 75. 12 Margaret Cole, The life of Cole (London, 1971), p. 50–58. See also Wallace Martin, The New Age under Orage, (Manchester, 1967). 13 The conflict referred to unfolded in 1914–15 and featured Mellor and Cole (at that time young members of the Fabian Society) on the one side, and the Webbs on the other. The letter will return to the main events and the issues of dispute. See also note 28 on the Fabian Society.
152
THE NEVER WRITTEN MEMOIR OF A GUILD SOCIALIST
herself14, experienced difficulties when trying to engage, as women, in socialist political work. If allowed admission to socialist groups at all, our initiatives were largely disregarded. Surely, the situation in the beginning of the 20th c. was far from unequivocal. Local socialist groups (unions as well as branches of the various socialist parties) differed great ly in their opinions on women as political combatants. Many found women’s suffrage would be harmful to the progression of socialism – since enfranchisement was most likely to be granted to propertied women only. Simultaneously, however, the significance of women union leaders and shop stewards, and of new women worker organizations, was becoming apparent (take, for instance, Mary Macarthur, the first woman to be elected to the National Executive of The Shop Assistants’ Union and a leading member of The National Anti-Sweating League – before she founded, in 1906, The National Federation of Women Workers); and female members of unions and parties were growing in number.15 The number of male suffragists was expanding, as well; prominent figures such as socialist reformers and politicians Keir Hardie, G eorge Lansbury and Frederick Pethick-Lawrence, reporter and commentator Henry Nevinson, businessman and philantropist Henry Harben, artists H.G. Wells and Israel Zangwill, and philosopher Bertrand Russell advocated equalization and liberation of women, in issues of marriage, divorce, parenthood, heritage, education, employment and politics. In 1907, some of them even founded an organization: The Men’s League for Women’s Suffrage.16 But I was young and without patience for gradual processes. When I decided to leave my position as a teacher in a Manchester girls’ school, and my remaining unfruitful socialist engagements in the city, it was due to intellectual boredom and political restlessness, more than material distress. In truth, I was a privileged middle class girl whose father had been progressive enough to allow his daughter an education.17 14 Emmeline Pankhurst who founded The Women’s Social and Political Union (WSPU) in 1903 was refused membership of the local branch of The Independent Labour Party in 1993 on account of her sex (but later joined the party nationally). The letter returns to Emmeline Pankhurst and the WSPU below. 15 On the complex issues of the relationship between socialism and the politi cal rights and roles of women, see Nan Sloane, The Women in the Room: Labour’s Forgotten History (London 2020); and Sheila Rowbotham: »Foreword«, in Barbara Winslow, Sylvia Pankhurst – Sexual politics and political activism (London, 1996). 16 For examinations of the role of male suffragists, see Angela John and Claire Eustance (ed.), The Men’s Share?: Masculinities, Male Support and Wo men’s Suffrage in Britain, 1890–1920 (London, 2013). 17 Universities and colleges gradually became open to women in the late 19th/ early 20th century. The first university to grant degrees to women (London
153
CHRISTIANE MOSSIN
Unlike your mother whose early, unrewarded political aspirations had emerged in the sawdust covered halls of The Birmingham Railway Carriage and Wagon Company. Two young escapists on the run, we met on the last day of February 1911 in the unlikeliest and yet most appropriate of places: in the Royal Court Theatre, London. It was an altogether crazy day. I had been in London for about a year, scraping a living as an actress in marginal roles. In my college days I had achieved some experience as an amateur actress in one of the student organized women clubs (student life was strictly divided according to sex); just about enough, combined with a zealous spirit, to gain access to some of the sloppier establishments of the London theatre scene. The Royal Court Theatre was of course in an entirely different league. A few years earlier J.E. Vedrenne and Harley Granville-Barker had shaken up the Edwardian S tage, presenting modern political drama in abundance, most famously a r ange of Bernard Shaw plays. The glorious Vedrenne-Barker-years had ended in 190718, but the Royal Court Theatre remained a center of controversial drama. That February afternoon in 1911, the theatre hosted the illegal staging of Oscar Wilde’s Salomé. The play had been banned by the Lord Chamberlain’s censorship since 1892 (a ban not lifted until 1931); it had been privately performed on a few occasions in London in the beginning of the 20th century, but never before in a theatre. Organizer of the performance, as well as leading actress, was Adeline Bourne. Apart from her appearances in avant-garde theatre, she was known as cofounder of the Actresses’ Franchise League. With the support of her group, the New Players, she gave to the audience a scandalous interpretation of the role of Salomé. The audience consisted mostly of women, and everyone understood what was at stake. This was not just a crazily erotic and aggressive Salomé. This was a »a twentieth century suffragette asking for Mr Churchill’s head on a charge sheet«, as expressed in The Bystander’s condemning review. Indeed, we were witnessing a suffragette army incorporated in the exotic veil-dressed figure of Miss Bourne. In contrast to The Bystander, and most other reviewers, the militant Votes for Women was greatly pleased to find that Miss Bourne ›was terrible as an army with banners‹.19 Your mother and I were swept up by this militant Salomé and the stir she was causing. We came alone, but left together. And shortly thereafter, University) did so in 1878, the last (Cambridge University) as late as 1948. Margaret Cole (born 1893) provides vivid (and largely critical or sarcastic) descriptions of educational life for girls and women, in girl’s schools and universities/colleges. Growing up into Revolution, chapter II–IV. 18 See James Woodfield, English Theatre in Transition 1881–1914 (London 2016), chapter 4. 19 A description of this theatrical event (which took place at the Court Theatre on February 27 and 28, 1911), including quotations from journal reviews,
154
THE NEVER WRITTEN MEMOIR OF A GUILD SOCIALIST
we attended our first meeting in the Actresses’ Franchise League which was open to anyone involved in the theatrical profession. Your mother, just arrived in London and unemployed, initially had no such involve ment; but Miss Bourne used her contacts to find work for us, as prompter and stagehand, primarily. Besides, we came to work for the West London Methodist Mission, dedicated to relieving the neediest people of London, and, from its establishment in 1887, closely associated with the suffrage movement. The Actresses’ Franchise League was in principle neutral with respect to suffrage tactics: militancy was neither condemned nor endorsed. However, several members took part in the expanding militant operations of ›The Women’s Social and Political Union‹; in overall, personal relations and friendships across the two organizations were many and close.20 Before long, we were unyieldingly involved in the WSPU. I remember vividly the first time we met Christabel Pankhurst – Emmeline Pankhurst’s oldest daughter who by then was the chief coordinator for the WSPU and no less charismatic than her mother. It was at a tea meeting in the splendid surroundings of the Grand Hall of the Criterion Restaurant, frequently used by suffrage organizations. What a beautiful, luxurious and amusing beginning! And what hardship soon to follow.21 can be found in Judith Walkowitz, Nights Out: Life in Cosmopolitan London (New Haven, 2012), p. 84–85. 20 The militant WSPU, along with the lives of their iconic leaders, Emmeline and Christabel Pankhurst, and Christabel’s sisters Sylvia and Adela (originally members of the WSPU, but expelled by Christabel in 1913) have been subjected to various studies. See for instance Martin Pugh, The Pankhursts: The History of One Radical Family (NY 2008), Krista Cowman, Women of the Right Spirit: Paid Organisers of the Women’s Social and Political Union (WSPU), 1904–18 (Manchester 2007), June Purvis, Emmeline Pankhurst: A Biography (London, 2003), & Christabel Pankhurst: A Biography (London, 2018). The Pankursts themselves wrote detailed autobiographical works: Christabel Pankhurst, Unshackled, the story of how we won the vote (London 1959), Emmeline Pankhurst, Suffragette: My Own Story (London 1979), Sylvia Pankhurst (with a foreword by Emmeline Pankhurst), The Suffragette: The History of the Women’s Militant Suffrage Movement (Mineola, New York, 2015). Regarding Sylvia Pankhurst, see also notes 23, 26, 27. For an exploration of the activist work (on stage and off) and networks of the The Actresses’ Franchise League, the first feminist political theatre group of the twentieth century, see Naomi Paxton, Stage Rights!: The Actresses’ Franchise League, Activism and Politics 1908–58 (Manchester 2018). – As to the very diverse landscape of suffrage movements, see Harold L. Smith, The British Women’s Suffrage Campaign 1866–1928 (Abingdon, 2007). 21 The Criterion Restaurant was used as a meeting place among suffrage organizations in general, and in particular by the Actresses’ Franchise League. Descriptions of Criterion meetings can be found in the diary of Kate Parry
155
CHRISTIANE MOSSIN
You are probably familiar with some of the scandals surrounding the Pankhurst family. In the eyes of posterity, Sylvia Pankhurst (the second daughter) came out as the heroine, her mother Emmeline and sister Christabel as the cruel fanatics.22 There is some truth in this. As to the conflict which eventually led to the expulsion of Sylvia from the WSPU, by her sister’s hand, I was – and still am – univocally on the side of Sylvia. She believed that emancipation of women and other suppressed people, in particular the poor, should go together. Over the years, she had developed close relationships with socialists and trade unions. Contrarily, Emmeline and Christabel held that the suffrage movement should stay clear of any other political issues than women issues. When Sylvia spoke publicly at a meeting in November 1913 in support of trade union organizer Jim Larkin, it was the finishing blow to the strained patience of mother and sister. But also other important issues of difference bred the family rift. Sylvia found it more and more difficult to accept the explicit anti-democratic position of the WSPU as far as the organization itself was concerned.23 The issue had come up already in 1907 when a group of members had demanded increased member-involvement in WSPU decisions. Emmeline responded by strengthening even further the autocratic tendencies. She insisted democratic organization would be inefficient; the WSPU should rather be constituted as ›an army in the field‹.24 This dispute ended with the departure of a range of members who established a competing organization, Women’s Freedom L eague25. The issue of democratic involvement was not hereby settled within the WSPU, though, but remained disturbing to Sylvia and others in the coming years. – A final issue of conflict concerned, naturally, the militant methods and increasing violence. By the time your mother and I got involved in the militant operations of the WSPU, risk and violence had reached an excessive level. Whereas earlier tactics primarily comprised loud protest marches or gatherings Frye (a member of the AFL): Kate Parry Frye (ed. Elisabeth Crawford), Campaigning for the Vote: Kate Parry Frye’s Suffrage Diary (London 2013). See for instance the following dates: February 4th, November 4th and December 16th, 1910. 22 Simon Webb suggests they were early fascists: Suffragette Fascists: Emmeline Pankhurst and Her Right-Wing Followers (Yorkshire 2020). 23 On Sylvia’s critique of and conflict with the WSPU and her sister, see f.inst. Rachel Holmes, Sylvia Pankhurst: Natural Born Rebel (London 2020), chapter 17–19; Katherine Connelly, Sylvia Pankhurst: Suffragette, Socialist and Scourge of Empire, (London 2013), chapter 2–3. 24 Emmeline Pankhurst, Suffragette: My Own Story, p. 59. 25 See Lynne Graham-Matheson and Helen Matheson-Pollock, Mrs Despard and the Suffrage Movement: Founder of The Women’s Freedom League, Yorkshire, 2020.
156
THE NEVER WRITTEN MEMOIR OF A GUILD SOCIALIST
outside Parliament (maintained in spite of forceful police attempts to remove the protesters), public speeches and newsletters, 1911-tactics implied window smashing and assaults on police officers. Importantly, these tactics drew essentially on our own bodies; violent acts were carried out with the deliberate intention of ensuring our arrest. Emmeline saw imprisonment as a means to draw attention to our cause. Since 1909 hunger strike in prison had constituted a core method of protest. Your mother and I – like so many other women – experienced several shorter and longer periods of imprisonment; and we were both awarded The Hunger Strike Medal. You have no doubt heard about the force-feeding we endured, carried out by doctors while our bodies were held by wardresses, rubber tubes forced up our nostrils or down our throats, the latter method implying the insertion of a steel gag into the mouth so as to screw it as open as possible. Not seldom, food entered the lungs. Some died from force-feeding; many were permanently physically damaged afterwards.26 For us all, I think, it was the kind of nightmare that can never be obliterated. In 1912, arson was adopted as a tactic as well. At this point, tensions between the WSPU and other suffrage organizations had heavily increased, as well as tensions within the WSPU itself. It is hard to describe our feelings in this period. After little more than a year in the organi zation we were exhausted beyond words. A strange combination of pride (over what I had been able to endure) and humiliation (because of what had been done to me) had captured me, and I couldn’t come to terms with it. Had I proven my true independence, beyond all physical pain, or had my enemies gotten to me, forced themselves into my head, my body, my phantasies forever? I think your mother gained a clearer perspective before I did. It troubled her that it was not just our enemies, but the WSPU leadership itself that brought this suffering upon us. We were indeed soldiers of an army. We gave our bodies. We won medals for it. As you can see, it is not without reason that Emmeline and Christabel Pankhurst have gone down in history as militant fanatics. Yet, their personal bravery should be remembered; they served themselves in the army they established – in street fights with the police, hunger stri king in prisons, or (increasingly) in hiding, underground. The energy and 26 Accounts of arson tactics and force feeding can be found in Diane Atkinson, Rise Up Women!: The Remarkable Lives of the Suffragettes (London, 2019), chapter 7; Shirley Harrison, Sylvia Pankhurst: The Rebellious Suffragette (Leeds, 2012), chapter 8 and 10; Rachel Holmes, Sylvia Pankhurst: Natural Born Rebel, part III. Sylvia Pankhurst chronicles herself the increa sing militancy of the movement, and the consequences of its activism: imprisonment, hunger strikes, and forced feeding. Sylvia Pankhurst, The Suffragette: The History of the Women’s Militant Suffrage Movement. See for instance chapter II, X, XI.
157
CHRISTIANE MOSSIN
hope they awoke in women should be recalled as well. Whether their militant methods furthered or harmed the suffrage movement in the longer run is difficult to say. Maybe they did both. I’d like to think so. But when Sylvia was expelled from the WSPU in 1913, your mother and I could take no more. We felt destroyed by the preceding years. Without hesitation, we followed Sylvia who established her own organization (formerly a branch of the WSPU run by Sylvia), the East London Federation of Suffragettes, which, apart from political agitation, f ocused on the improvement of working class life through the setting up of a cost-price, wholesome food restaurant (which during the war became a distress centre for women struggling to pay the rent), a toy factory to provide work and decent wage to women (functioning as well as a crèche), a nursery and clinic for young mothers. It is noteworthy that Sylvia later, in 1916, changed the name of her organization to the Workers’ Suffrage Federation, in recognition of the fact that non-agricultural male laborers had also not been granted the vote.27 Sylvia was the one who – for your mother and me – proved that socialism and women’s liberation not only could, but should, go hand in hand. It was at this stage of our political journey that the Fabian Society en tered our lives – and quite naturally, really. We had known of the Fabian Society for years, of course, but previously regarded it with contempt. It had at the time a unique status. Although not impressive in terms of membership (around 3000 members before the war), it largely managed to set the agendas for national socialist debate, by means of numerous publications, lectures, summer schools, political campaigns – and powerful works of art (the Fabian ›star‹ above them all was Bernard Shaw; but artists like Harley Granville Barker and St. John Ervine were renowned Fabians as well).28 Since 1911, the ›Webb-partnership‹, 27 Accounts and discussions of Sylvia Pankhurst’s East London work can be found in Shirley Harrison, Sylvia Pankhurst: The Rebellious Suffragette, chapter 15; Rachel Holmes, Sylvia Pankhurst: Natural Born Rebel, chapter 20–22; Katherine Connelly, Sylvia Pankhurst: Suffragette, Socialist and Scourge of Empire, chapter 3; Barbara Winslow, Sylvia Pankhurst – Sexual politics and political activism, chapter 3. 28 The Fabian Society was founded in 1884 – and quickly became a leading academic society, dedicated to the gradual furthering of Britain’s transition to socialism, through science, education, ideational development, and art. Early Fabians included prominent figures such as Ramsay MacDonald, Graham Wallas, Annie Besant, Charles Marson, Bertrand Russell, Bernard Shaw, H.G. Wells, Frank Podmore, Edward R. Pease, Henry Hyde Champion, Edith Nesbit, Emmeline Pankhurst (who left the society in 1900) and Sidney and Beatrice Webb. The Fabian Society still exists today, operating as a Labour-affiliated think tank. The relationship between the Fabian Society
158
THE NEVER WRITTEN MEMOIR OF A GUILD SOCIALIST
the intellectual, political and organizational partnership of Beatrice and Sidney Webb, had been almost synonymous with the Fabian Society. The ›Webb-partnership‹ was by then already two decades old: Bea trice and Sidney had begun collaborating in 1890 when Beatrice accepted Sidney as a partner in the enormous research project she had set out to do, namely to analyze the history and current situation of trade unionism. Two years later, she accepted to marry him as well. Since then, they had conducted a great number of research projects together, pu blished co-authored works, organized political campaigns, been part of committee work, and founded the London School of Economics. In this period, Sidney had been an influential, Beatrice a more reluctant member of the Fabian Society. But after the failure of her immense efforts to get the Poor Law abolished (I shall return to these events in a short while), Beatrice decided to give herself to the Fabian Society with no reservation, hoping the latter would mature into a breeding ground of constitutional ideas capable of guiding a future socialist transformation of British state and society.29 Our entry into the Fabian world happened ›naturally‹ in the sense that Fabianism constituted, at the time, an inevitable common reference point for non-militant socialists. Many of Sylvia Pankhurst’s socialist connections – leading figures of unions, the Labour Party and the Independent Labour Party – were Fabians. At the same time, Fabianism marked a major change for us. Previously, we had scorned the Fabian Society due to its declared gradualist, reformist standpoint. The name ›Fabian Society‹ was inspired by the Roman general Fabius (Quintus Fabius Maximus Verrucosus). Fabius had been famous for his gradualist strategy: and the Labour party (founded in 1900) was, however, a matter of dispute (some Fabians advocated, instead, a connection to the Liberal Party or the Independent Labour Party, or no party connection at all), until the end of World War I (see the letter below). G.D.H. Cole and Margaret Cole provi ded extensive accounts and analyses of the development of the Fabian Society, see G.D.H. Cole, The Fabian Society Past and Present. Fabian Society: Tract Series. no. 258. (London 1942); Margaret Cole: The Story of Fabian Socialism (London 1961). For a more recent historical study, see Edward Reynolds Pease, The History of the Fabian Society (New York, 2015). 29 The Webbs provided groundbreaking historical and social research, especially in relation to trade unionism, industrial democracy, the cooperative movement, and English local government – while constituting, as well, some of the most influential institutional developers of their time. Beatrice Webb describes the partnership in her autobiographical work Our Partnership (London 1948) (covering only the period 1892–1911). Margaret Cole has edited a volume dedicated to the »Webb-partnership«: The Webbs and their work (London, 1949); she describes, moreover, »the partnership« in her biography of Beatrice Webb: Beatrice Webb (London 1946), chapter V–XVI.
159
CHRISTIANE MOSSIN
persistence over time, wearing down the enemy, waiting – and then striking at the right moment. Due to this strategy he was nicknamed ›the Delayer‹.30 Also, Fabianism had been known for its strategy of ›permeation‹: to influence governing class circles (tories and liberals) so as to gradually turn them into socialists ›from within‹. When we became members just before the war a new strategy was under development, though. ›Permeation‹ had utterly failed, it was deemed, and instead connections between the Fabian Society and the Labour Party were building up. Could the Fabian Society assist the insignificant Labour Party in developing into a powerful political player? This was Sidney Webb’s idea already then – an idea which came to materialize over the following years and determine the route of the Fabian Society thereafter.31 But let me explain the events in the proper order. In 1913–14, your mother and I had renounced our earlier militancy – and thought for a while we had found, in Sylvia’s organization and in the Fabian Society, some peaceful political homes. But it turned out we had stepped right into another battle zone. Tensions between the young guild socialists, with Cole and Mellor in front, and the Webbs and their followers had already reached a high level. Whereas the former were meeting the conflict in a youthful, defiant spirit of truth seeking, the latter were hoping to downplay it. In fact, the Webbs thought highly of the talented young Oxford graduates Cole and Mellor and wanted them as their allies, not enemies. Too late they realized the seriousness of the young men as far as their dedication to guild socialism was concerned. In 1912, Beatrice had established a ›Control of Industry Committee‹, soon to be called the Fabian Research Department. Mellor joined from the beginning, Cole the following year. The committee was meant to provide argumentative fuel for a denunciation of workers control, to work against the increasing influence of syndicalist ideas among workers. Of course, the opposite happened. In 1915 tensions culminated at a heated members meeting of the Fabian Society. Cole and Mellor had drafted a daring manifesto called ›The Right Moment‹ – ironically playing at the Fabian motto. The message was: No more delay, no more waiting or gradualist work, the ›right 30 See the Fabian Society’s own account on their webpage: https://fabians.org. uk/about-us/our-history/. 31 In 1918, Sidney Webb, by then a member of Labour’s executive committee, drafted clause IV of the Constitution of the Labour Party as well as the party’s first important policy statement, Labour and the new social order; a report on reconstruction (London, 1918). Later, he served in both of Ramsay MacDonald’s Labour ministries, as president of the Board of Trade in 1924, and as Secretary of State for Dominion Affairs and Secretary of State for the Co lonies (1929–31). For an account of the strategy of permeation, see R.C.K Ensor, »Permeation«, in Margaret Cole, The Webbs and their work, chapter V.
160
THE NEVER WRITTEN MEMOIR OF A GUILD SOCIALIST
moment‹ is here, now!! The manifesto required a complete end to any strategy of ›permeation‹ of tories and liberals, but also an end to collaborations with the Labour party. The Fabian Society should free itself from any bonds to party-politics, denounce its own constitution and devote itself to industry research. Cole and Mellor presented a series of resolutions embodying the proposals of the manifesto – all rejected. I was present at the meeting and remember being paralyzed by confusion, thinking: They must have known this would never be accepted by the majority of members? Afterwards, Cole resigned from the Fabian Society; Mellor stayed so that he could continue working in the Fabian Research Department. The year after, Beatrice allowed membership of the Department without membership of the Society. This meant Cole could return to the Department – which was now completely devoted to research in support of guild socialist ideas.32 Interestingly, the Webbs accepted that their creation, the Fabian Research Department, had been captured by the guild socialists. They accepted, even, that it occupied several rooms of the house of the Fabian Society in Tothill Street!33 I believe they were bitterly disappointed but not hateful. And as it should turn out, Cole and his wife Margaret later became friends with the Webbs. Indeed, the Coles and the Webbs came to share a lifelong common history.34 After the death of the guild socialist movement, Cole returned to the Fabian Society. In his life time, he managed to resign four times from the Executive Committee of the Fabian Society – and died its president.35 Whereas the leading characters of the conflict managed to find a modus vivendi during the years of the feud, and to become friends and allies 32 I rely on Margaret Cole’s account and interpretation of these events. In 1918 The Fabian Research Department changed its name to the Labour Research Department. Margaret Cole, The Story of Fabian Socialism, p. 150–155; The Life of Cole, p. 49–50. 33 The Fabian Society resided in 25 Tothill Street, Westminster, until 1928. Margaret Cole describes vividly the house and the various groups inhabi ting it in Growing up into Revolution, p. 60. 34 Cole later recognized the Webbs as extraordinary social scientists no less than institutional reformers. See especially his tribute to Beatrice Webb in »Beatrice Webb as an Economist«, in Margaret Cole, The Webbs and their Work, chapter XVII. It was Beatrice Webb with whom Cole had the most rewarding exchange »because it was more her way to move the talk on to the plane of fundamental ideas« (ibid., p. 281). Cole regretted, moreover, his »cocksureness« at the time of the conflict: »They were exceedingly good to me; and the end of it was an abiding friendship as well as a firm assu rance that Beatrice Webb was the greatest woman I had been privileged to know.« (ibid., p. 280). – See also note 43. 35 Margaret Cole, The Story of Fabian Socialism, p. 146.
161
CHRISTIANE MOSSIN
afterwards, the history of the relationship between your mother and me fell out very differently. Our common history ended as a result of that conflict – strangely, considering the battles and hardship we had overcome together in the preceding years. But let me explain to you more carefully the true content of the conflict. I believe it touches upon the very core question of modern political existence. And although I held firmly on to my own beliefs, then as well as later, I remained haunted by the nagging thought that there was something my dream failed to take into account. The guild socialists dreamt of a kind of democracy beyond parliamentarism, a society democratized in all its organizational parts – and with small, local groups as the essential units of decision making. Cole later came to develop this dream into a complete institutional model, as outlined in detail in his book from 1920 Guild Socialism Restated. But already at the time of the conflict with the Webbs, the main principles were clear. Guilds in a modern understanding – primarily the various branches and sub-branches of industry, as anchored in concrete production groups – were to make out the crucial units of decision-making in a complex network of coordination and delegation that would connect local and national, particular and overall concerns. Obviously, this vision had much in common with syndicalism as it advocated worker’s self organization in small democratic units forming the basis of higher levels of decision making. However, in contrast to the syndicalists, guild socialists were more concerned with the forms of future societal organization than with a supposed grand, soon-to-come catastrophe by which established structures would collapse. Ownership was envisioned as common and public, but management a matter of pluralist self-organization. Small, local units should be in charge of their own life-domains – by means of consensus decisions, or decisions by those with particular expertise in a given area, rather than simple majority decisions, and in an atmosphere of debate and co-operation ensuring continuous exchanges of knowledge, experiences, observations and creative ideas. For reasons of overall coordination, higher-level units would be necessary; but the higher levels should be composed of delegates elected by the basic groups and always accountable to those groups. To the extent possible, traditional hierarchy and authority should be avoided: the higher levels of the overall structure would be designated by only few and precisely demarcated tasks. Ultimately, this would make superfluous the state as such.36 36 For a discussion of this vision, and in particular the tensions between functionalism and individual freedom and creativity it inhabits, see Christiane Mossin, »Vergessene Potenziale assoziativen Lebens. Pluralismus,
162
THE NEVER WRITTEN MEMOIR OF A GUILD SOCIALIST
In the early war years, Cole’s focus was primarily the production groups of the industry.37 But gradually he incorporated into his vision the consumer-side as well (which already had a history of organization in Britain, namely in the form of the cooperative movement). Moreover, he integrated guilds beyond industrial production, the ›civile guilds‹, those of teachers, doctors, nurses or lawyers. A coordinating organ, ›the commune‹ was supposed to ensure that multiple connections across the network of guilds, cooperatives or other associations could develop and flourish. Hierarchical mechanisms were to be tamed, horizontal connections certainly not.38 There is no need to go deeper into the details of the institutional model envisioned by Cole – nei ther in its early, nor later manifestations. Clearly, many elements were too constructed. Indeed, Cole emphasized himself, when publishing Guild Socialism Restated in 1920, that he simply wanted to show that guild socialism was not just a vague or abstract dream, that one could in fact work out a complete societal model: a concrete alternative to the existing state and capitalism!39 But if guild socialism were to be realized in practice it would have to happen through the existing workers’ and consumers’ organizations, local councils and other groups engaged in matters of common welfare – not through intellectual con struction. His institutional model was, in that sense, marked by a certain paradoxicality. But he did not intend to impose it on the society builders of the future, the plurality of organizations; he simply meant to inspire and encourage.40 It is important to highlight the dimensions of creativity and hopeful, life-embracing battling spirit characterizing the guild socialists. Although scientific approaches were seen as crucial, and functional organization a Funktionalismus und Freiheit bei G.D.H. Cole und H.J. Laski«, Forschungsjournal Soziale Bewegungen, Heft 3, September 2016 (ed. Jürgen Kocka, Frank Adloff), p.181–190. 37 See G.D.H. Cole, The World of Labour: A Discussion of the Present and Future of Trade Unionism (Abingdon, 2017); Self-government in Industry (Abingdon, 2010). 38 G.D.H. Cole, Guild Socialism Restated (London, 1980), chapter V–VIII. In his Social Theory, Cole provides the theoretical (sociological) foundation underpinning his institutional model. G.D.H. Cole, Social Theory (London 1920). 39 G.D.H. Cole, Guild Socialism Restated, p. 27–28. 40 In the last part of his introduction to Cole’s Guild Socialism Restated, Richard Vernon adresses this tension between providing a »blueprint« and remaining open to unpredictable revolutionary forces of the future. R ichard Vernon, »Introduction«, in G.D.H. Cole, Guild Socialism Restated. See also LP. Carpenter, G.D.H. Cole. An Intellectual Biography (Cambridge, 1973), chapter 2, on the utopian elements of Cole’s societal model.
163
CHRISTIANE MOSSIN
core ingredient in the guild socialist vision, it should be recalled that all rational constructions were underpinned by ideals of human creativity and freedom. According to Cole himself, it was William Morris’ s cience fiction novel News from Nowhere which had made him a socialist.41 That novel lived in many guild socialist hearts, I think, my own included. Not that we adopted all its elements. Morris attacked industrialization while advocating the virtues of traditional craft. Guild socialists (at least those of Cole’s generation) believed industrialization could work for the benefit of humans if employed with consideration. But the utopian gist of the book – the idea that ultimately, all individuals are artists of some kind, that work should be free and creative to the extent possible, and ›dirty work‹ reduced to a minimum – was our utopian gist as well, even if we realized that creative anarchy and rational organization might not always add up. It was our dream that if human self-organization could be set free, on the basis of the best possible institutional conditions, along with options of dialogue and knowledge-sharing across society, dynamic creativity and functional solutions could indeed, to a large extent, go hand in hand. Guild socialists lived those ideals to a high extent. A certain light-hearted, humorous, life-embracing spirit penetrated our common activities, not least in the Fabian Research Department where I came to work as a volunteer for a longer period. Ecstatic discussions until early morning or noisy singing in the streets after hard data-obsessed work were part of that common life we led. Childish playfulness often filled the office. Even poetry recitation in restaurant-basements during air-raids happened quite frequently.42 Cole himself – the most unsocial of socialists, in the words of his wife Margaret – found various channels of creative expression other than constructing possible functional institutions of the future; he wrote chants for the movement and, later, together with Margaret, more than 30 detective stories! Beatrice and Sidney Webb, in contrast, resented the influence of syndicalist ideas in British worker movements. The Fabian Society should, in their view, work for the repudiation, on scientific grounds, of the idea of self-organization within industry. They found that existing examples of self-organizing industrial units had already proven to be failures. If not outright dysfunctional, they were constituted as small, closed corporations serving their members’ interests; in other words, they were just another expression of capitalism. The Webbs believed in state-collectivism. The state should not only own the means of production, but be responsible for overall planning and organization, welfare rights and 41 Margaret Cole, The Life of Cole: p. 33–34. See also LP. Carpenter, G.D.H. Cole. An Intellectual Biography, chapter 1. 42 Margaret Cole, Growing up into Revolution, p. 71–73. The restaurant bars in question would be the Criterion Bar or Oddenino’s.
164
THE NEVER WRITTEN MEMOIR OF A GUILD SOCIALIST
security. Certainly, this did not imply blind state-centralism. Developing the forms of local council government constituted a core concern – and dialogue with unions and cooperatives an integral part of their vision. But all local or functional entities were ultimately to be incorporated into an all-responsible socialist state.43 As Margaret Cole later remarked, on the basis of the advantages of retrospective analysis, both visions implied in fact utopian elements. Whereas guild socialists were in love with shop stewards, mining checkweighmen and other trade unionists, the Webbs cultivated the image of the enlightened civil servant dedicated to efficiency, respectability and collective welfare. These different utopian images bore witness, as well, to differences of battling spirit. The Webbs welcomed no joyous anarchy or artistic playfulness, but highlighted cool scientific thought, selfcontrol, efficiency and respectability – virtues that marked their own life style, as well.44 What I find remarkable, however, is that in spite of arguably utopian elements, the Webbs anticipated to a large extent the modern welfare state, 40 years in advance. Previously I mentioned Beatrice’s battle to get the Poor Law abolished. From 1905–09 she participated in the ›Royal Commission on the Poor Laws and Relief of Distress‹ set up by the Parliament, meant to investigate the consequences of the existing Poor Law and suggest future reforms. The commission worked for 4 years – after which it was unable to reach internal agreement. Accordingly, two conflicting reports were published, a ›Majority report‹ and a ›Minority report‹, the latter signed by Beatrice Webb and George Lansbury (who, as 43 The Webbs laid out this vision in A Constitution for the Socialist Commonwealth of the Great Britain (London 1920). As noted previously, in spite of their state centralist thinking, they acknowledged greatly the significance of trade unions, cooperatives and local government. Many years later, Cole finds that he had interpreted them too rigidly at the time of the conflict: »They had been dismissed often enough as inhuman, mechanistic, mere schemers of social projects into which men and women must be made to fit regardless of personality or private desire« – but this common understan ding had failed to see the nuances of their vision. And further: »In my cocksureness, I very thoroughly misunderstood Beatrice Webb, regarding her and Sidney as the quintessential representatives of bureaucratic state collectivism (…) I was not, I think, wholly wrong; for the Webbs, both in their dislike of disorder and untidy thinking and in their opposition to Syndicalism, were disposed in those days to lean over towards bureaucracy. But it took me a long time to discover that, at all events in Beatrice Webb, this leaning over involved an effort, because her natural sympathies were on the side of vo luntary organization (…)«. G.D.H. Cole, »Beatrice Webb as an Economist«, in Margaret Cole (ed.), The Webbs and their Work, p. 276, 280. 44 Margaret Cole, The Story of Fabian Socialism, p. 146–49.
165
CHRISTIANE MOSSIN
you might remember, became leader of the Labour Party in the 1930’s). Although not part of the commission, Sidney Webb contributed substantially to the Minority Report as well. The two reports differed both with respect to their analyses of poverty and with respect to the offered solutions. Beatrice’s Minority Report argued against the dominating view at the time: that poverty was a matter of individual responsibility. Instead, the Minority Report called for a structural view and ana lyzed, systematically, the various causes of poverty. It found that only a small part of the recipients of poor relief were working-able men; most were women, children, elderly, or physically or mentally disabled persons. Moreover, the report argued that it should be the responsibility of the state (not private charity) to secure a basic minimum for all, and it outlined a comprehensive program of provision for those destitute, organized according to the differentiated causes of poverty identified. The existing Poor Law – along with the terrifying, dehumanizing workhouses pertaining to it – should be completely abolished and replaced by a system of state-guaranteed rights.45 The Minority Report has often been called one of the first systematic descriptions of the principles of the modern welfare state.46 Was the time just not ripe? Or were circumstances unfortunate? In any case, the Liberal Government ended up ignoring the Minority Report as well as the Majority Report. Two years of campaigning, from 1909–11, did not help – although the Webbs managed to acquire 16.000 members for their ›National committee for the Prevention of Destitution‹ and engage diverse groups for their cause. Although unsuccessful, this 6 year long battle bears witness to some of the most impressive features of the Webbs: their dedication, their persistence, their analytical capacities, and, not least, their strong conviction that all individuals should be entitled to a dignified life and no-one labelled ›undeserving poor‹. It bears witness, as well, to the overall characteristics of their vision: A collective state, responsible for all individuals. 45 Sidney Webb, Beatrice Webb, The Break Up of the Poor Law: Being the Minority Report of the Poor Law (London, 2009). Beatrice Webb’s battle is des cribed by Margaret Cole in The Story of Fabian Socialism, p. 138ff, and by Beatrice Webb herself in Our partnership (New York, 1948), chapter 7–8. 46 As expressed, f.inst. in a Guardian editorial from 2009 (19 February): »A hundred years ago the seed that was to grow into the welfare state was plan ted, when Beatrice Webb and other members of a royal commission on the poor laws issued their minority report. It was a document which the young William Beveridge, then working as a researcher for Sidney and B eatrice, used as a template more than 30 years later when he drew up his own plan for universal welfare in the middle of the second world war.« https://www. theguardian.com/commentisfree/2009/feb/19/beatrice-webb-tribute.
166
THE NEVER WRITTEN MEMOIR OF A GUILD SOCIALIST
How could these differences of political vision ruin our friendship so dramatically? In many ways, your mother and I wanted the same. We both strove for equality and democracy and believed in everyone’s right to flourish. Yet, our views on the capacities and potentials of human beings were entirely different. I believed it was possible to establish a society based on human self-organization, and I believed that human passion and anarchic creativity and freedom could not only flourish within such a society, but belong to its constituent parts. Your mother did not share these beliefs. She found that in any organization she had experienced, dangerous irrationalism, seduction and power greed had been lurking just under the surface, just waiting to materialize. But if such tendencies can truly not be abolished, I asked her, will they not re emerge on the level of the state, only more powerfully and treacherously? She was far from naive, but still held that nothing was more frightening than smaller groups, left to their own whims and power-dynamics – also when incorporated into large horizontal networks of collaboration. A collectivized state could, at least, due to its comprehensive and multifaceted machinery, work as a stabilizing mechanism. Beyond this argumentation I think she was also longing for a home, a place to rest – and for something that would finally relieve her from the burden of struggle, something that would, for the first time in her life, say: ›You deserve to be happy and I accept responsibility for your happiness‹. But this is my interpretation. It is fair to say, we were both deeply traumatized from our prison experiences. Your mother’s faith in the collective capabilities of humans had crumbled over the years; her previous beliefs in spontaneous forms of solidarity and empathy had been replaced by a misanthropic mind the core message of which was the following: Solidarity, empathy and justice are only possible by virtue of the mediations of state machinery. The implications of this message were in fact even harder than one might realize. What your mother meant was not only that law and state-institutions constituted necessary means of organizing and securing justice; she meant that such state arrangements were the original sources of justice – and not human will, emotion, reason or reflection. Naturally, I reminded her: It was the legal system of the state which had been responsible for our force-feeding in prison. She replied: the state that Beatrice Webb is imagining, the state of the future, the state I believe in, is an entirely different state. And I could not argue with that. Terror still worked in me as well, for sure. But in my case, the strings of terror pulled me towards guild socialism. I embraced, with gratitude, the lighthearted, playful battling spirit of the guild socialists I came to know through the Research Department – although I somehow knew this spirit would never belong to me in quite the same manner as it belonged to my new friends. I was nurtured by this spirit, I drank and 167
CHRISTIANE MOSSIN
drank from it, hoping it would one day erase the tiny sensations of shock which had colonized my body. It did not, but it build me up, it filled me with genuine hope and happiness, and a desire to understand the true collaborative capacities of humans, capacities which I found were being repressed and corrupted by the existing state-capitalism-alliances. And then one day it was all over. Not that it happened in one stroke. But in 1924, when Cole resigned from the Research Department, pro voked by the communists who had gradually taken control over it, it was glaringly clear the guild socialist movement was dead. The movement’s journal Guild Socialist had been terminated the year before; the National Guilds League was dissolved a year later. The movement had experienced some sensational years just after the war. A revolutionary spirit had flowed over the country. Strikes and riots emerged in all parts of the labour force, even in the police. Huge parts of the protesters demanded, apart from better wages, nationalization of industry and workers’ con trol. I guess what we saw was a combination of seriously worsened conditions for workers (wartime price-control was abandoned, and prices increased dramatically; war factories were sold for a song, stimulating speculation on booming capital markets; coal mines were decontrolled; and social services drastically cut) and the extreme energy and desire for change unleashed as a result of the ending of the war. Of course, the most of Europe experienced an energy like that. The Russian Revolution of 1917 played an important role, no doubt. In the first years thereafter, we all believed this was the beginning of a world-wide change.47 The movement peaked 1919–21. Apart from the multiple strikes and widespread support of guild socialist ideas, that period witnessed a real large-scale guild socialist experiment, the National Building Guilds, comprising over 140 local guild committees throughout the country, and stimulated by a public housing program of enormous dimensions.48 But it turned out these blossoming years constituted in fact our death waltz. What happened? As always, Margaret Cole has provided a clear retrospective analysis. Firstly, the government and the capital owners had gotten the better hand. The post-war years were no longer characterized by shor tage of labour power. Government policy was to support industrialists and keep public expenses to a minimum. At first, this situation fueled 47 Margaret Cole describes the post-war years – hope, protest and the decline of the movement – in Growing up into Revolution, p. 86–92. 48 F. Matthews, »The Building Guilds«. In: A. Briggs, J. Saville (eds) Essays in Labour History 1886–1923 (London,1971); Garfield V. Cox, »The English Building Guilds: An Experiment in Industrial Self-Government«, Journal of Political Economy, 29:10 (1921), pp. 777–790; Carl S. Joslyn, »A Catastrophe in the British Building Guilds«, The Quarterly Journal of Economics, 37:3 (1923), pp. 523–534.
168
THE NEVER WRITTEN MEMOIR OF A GUILD SOCIALIST
rebellion. But after some years, the suffering working class people were worn down. The ›Black Friday‹ of 1921, on which the transport and rail unions declined to stand up for the miners in strike action, became the epitome of the collapse of general solidarity. The government could then even withdraw some of the compensating bits and pieces (unemployment support, wage stabilization, promises of increased union influence) they had offered just after the war, in fear of a genuine revolution. As for the successful Building Guilds, they dissolved due to lack of capital, after the ambitious public housing program was suddenly terminated in 1921.49 Secondly, it gradually appeared that communism undermined rather than stimulated our movement. We had not seen that coming. Most of us had considered joining the Communist Party of Great Britain, founded in 1920. And a huge number of guild socialists did. Ultimately, however, I hesitated, as did the Cole’s. We felt uncomfortable about the fact that as communists, we would have to take our orders from the Comintern, an international organization. How could we combine that with our beliefs in local self-organization? At first, communists and non-communists continued working together in the Research Department and the National Guilds League. Only after a while, it became clear that the new-born communists pursued one agenda only: that of engaging in class struggle according to the directions of the Comintern – which included infiltration of any other political group, secret reporting, manipulation and outmaneuvering of non-communists.50 After the Research Department had been taken over by the communists, the Coles moved to Oxford, and for some years, they committed themselves to teaching and research. But as I already indicated, Cole’s political life was far from over; he returned to the Fabian Society and came to work for the Labour party, and contributed to the development of modern state planning. It sounds like betrayal, but it was not necessarily. According to Margaret, he remained a guild socialist in his heart, but lost faith in its possible realization. Instead, he worked for the kind of socialism he deemed realistic.51 If Margaret Cole’s analysis is correct, then guild socialism died due to harsh economic conditions and cruel power relations, and due to the advent of communism. I am sure it is correct; only, I find it opens numerous new questions. Why was it two different ideas of state centralism – that of the Labour Party and that of Communism – which managed to grasp the hearts of a suffering worker population? 49 Margaret Cole, Growing up into Revolution, p. 90–92. Anne Perkins deals with the legacy of »Black Friday« in A Very British Strike (New York, 2007). 50 Margaret Cole, Growing up into Revolution, p. 95–102. 51 Margaret Cole, The life of Cole, p. 50.
169
CHRISTIANE MOSSIN
I was one of the few former guild socialists who did not either join the Communist Party or the Labour Party. I withdrew from political work and went back to acting (the only activity which thereafter could send my mind off to utopian terrains). I married a colleague, but never had children. I died from pneumonia in the snowy winter of 1928. A century has past since the peak of the guild socialist movement – its death waltz – which coincided with the time of your birth. Your mother chose your name wisely. It was indeed Beatrice Webb who incarnated the future, we can see that now. At least important aspects of the future, namely all those aspects which came to be considered enlightened, rational and humanistic: a comprehensive welfare state, constructed like a huge, complex, rational machine – providing rights for all, according to scientific categorization of forms of destitution and, more generally, forms of social status and life-situation. Beatrice Webb had a passion for detailed, systematic data-collection and -organization. She believed in the emancipation of individuals from the misfortunes of destiny and social hierarchy through a rationalized system of rights, developed by scientists and implemented by the cool minds and hands of enlightened civil servants. Much good is ascribable to a system like that: It marks the end of systematic exploitation, no less than coincidental mercy, while providing unquestionable rights for all. But you will no doubt see why I have my reservations. The individual is freed from the bonds of despotism and charity at the cost of being scientificized and instrumentalized. Welfare state law is not just a mechanism of equality; it is in fact a huge production mechanism of differentiation. Law and administration defines life according to complex categorial systems, in order to protect, regulate and stimulate it. Whether or not one finds beauty or uncanniness in such a state machinery, it is noticeably slowly cracking up. Admittedly, the welfare state machine was never as developed in Britain as it was on the continent; this country lets go of its ingrained liberalism only with great reluctance! You could say that Beatrice’s vision came to characterize the continental European states to a larger extent than it did her own country. But in any case, the fundamental principles of the Western welfare state, stronger as well as weaker versions, are increasingly threatened. At least for two reasons. – Firstly, the forces of capitalism were always just tamed and directed, never entirely incorporated by that state (that was of course against the wish of the Webbs; ultimately, they demanded state ownership of industry). The power-relationship between state and market should not be simplified; throughout the 20th and 21st centuries, that relationship has been a matter of mutual constitutionalization and fertilization as much as intimidation or enmity. However, what can be witnessed in multiple Western countries today is that common 170
THE NEVER WRITTEN MEMOIR OF A GUILD SOCIALIST
necessities are in the hands of private companies: infrastructure, medicine, research, water, and medias of communication. As for the latter, social media have just lately proven their immense power: they con trolled the (im)possibilities of a now former American president to start a civil war – just as they, more generally, largely determine what is publicly accepted as truth versus falsity, and who may legitimately intervene in election campaigns. – Secondly, rebellion against ›experts‹, ›bureaucrats‹ and ›established systems‹ is building up, from two sides really: from those who find that the rationalizing calculations and ›political correctness‹ of the ›establishment‹ have become blind to the needs of ordinary people; and from those who experience state institutions to be penetrated by (direct or indirect) forms of discrimination, especially of a racist or patriarchic nature. The allegedly enlightened, rational and humanistic state-machine is cracking up, for reasons of external forces (what escapes its control) and internal features (categorial systems and forms of rationalization resulting in reactions of nausea, claustrophobia, anger or fear). I am not saying that guild socialism, my dream 100 years ago, could provide an answer to such immense problems of today. I am articulating what is obvious: The existing constitutional forms of state and market are increasingly being exposed as blind alleys. And I dare the risk of ridicule when suggesting that exactly the exclusion of pluralist, democratic and horizontal forms of self- organization and coordination, for the dual structure of a tendentiously centralist state and a capitalist market partly controlled by elites, partly subjected to mechanisms beyond the con trol of anyone, has lead Western societies down alleys of stiffened logics and limited outview. A comprehensive democratization of the spheres of production and consumption, in some form or the other, would cons titute a new constitutional path, potentially a substantial refiguration and opening up of present logics. A freeing of human capacities. What is not is possible. Who am I to suggest anything? I did not endure, as you did. You lived through the terrors of the second war, and experienced the materialization of your name-sake’s dream afterwards, at least parts of it, as well as its crumbling moments. I admit, I understand your time no better than I understood my own. Let us not speak of what I am. I vibrate in a quiet storm, in saturated colors. I have no knowledge, yet nothing is closed off to me. I am nearer than you think. You are Beatrice, the one who makes happy. What do you bring? The old world’s graciousness? The living breath behind the welfare machinery? Or something new and inconceivable? You have children, grand children and grand grand children. Estranged children, battling children, unhappy children unable to receive your gifts. Some of them are activists. Some of them are not on speaking terms. 171
CHRISTIANE MOSSIN
I know my story has been full of inconsistencies, of gaps and turns hard to fathom. But I did not intend it otherwise. If the dreams of the past should mean anything to the present, they cannot be presented in a too beautifying mirror. Even if appearing in condensed formations – since the materiality of the lives in which they were embedded is forever gone – they owe it to the present to re-emerge full of stains and conflictuality. The latent inner conflicts of guild socialism was, I gather, the Janus face of its generosity, its embracement of people and viewpoints across classes and lifeforms, science and art, functional rationality and anarchy. As for its external conflict zones, they resonate in the memory of your mother’s exhausted whisper: There can only be human peace due to something beyond human will itself. I ask you to receive the stained mirror I offer. Please, do not mistake its stains for impossibilities. Sincerely, A friend from your mother’s past.
Literatur Diane Atkinson, Rise Up Women!: The Remarkable Lives of the Suffragettes (London, 2019). LP. Carpenter, G.D.H. Cole. An Intellectual Biography (Cambridge, 1973). GDH. Cole, »Beatrice Webb as an Economist«, in Margaret Cole (ed), The Webbs and their Work (London, 1949). GDH. Cole, Guild Socialism Restated (London, 1980). GDH Cole, The Fabian Society Past and Present. Fabian Society: Tract Series. no. 258. (London 1942). GDH Cole, Self-government in Industry (Abingdon, 2010). GDH. Cole, Social Theory (London, 1920). GDH. Cole, The World of Labour: A Discussion of the Present and Future of Trade Unionism (Abingdon, 2017). Margaret Cole, Beatrice Webb (London, 1946). Margaret Cole, Growing up into Revolution (London, 1949). Margaret Cole, The life of Cole (London, 1971). Margaret Cole, The Story of Fabian Socialism (London 1961). Margaret Cole (ed.), The Webbs and their work (London, 1949). Katherine Connelly, Sylvia Pankhurst: Suffragette, Socialist and Scourge of Empire, (London 2013). Krista Cowman, Women of the Right Spirit: Paid Organisers of the Women’s Social and Political Union (WSPU), 1904–18 (Manchester, 2007). Garfield V. Cox, »The English Building Guilds: An Experiment in Indus trial Self Government«, Journal of Political Economy, 29:10 (1921), pp. 777–790. 172
THE NEVER WRITTEN MEMOIR OF A GUILD SOCIALIST
James E. Cronin, »Strikes and Power in Britain, 1870–1920.« International Review of Social History 32, no. 2 (1987): 144–67. Jaques Derrida, Specters of Marx (New York, 2006). R.C.K Ensor, »Permeation«, in Margaret Cole (ed), The Webbs and their work, chapter V. Kate Parry Frye (ed. Elisabeth Crawford), Campaigning for the Vote: Kate Parry Frye’s Suffrage Diary (London 2013). Lynne Graham-Matheson & Helen Matheson-Pollock, Mrs Despard and the Suffrage Movement: Founder of The Women’s Freedom League (York shire, 2020). Shirley Harrison, Sylvia Pankhurst: The Rebellious Suffragette (Leeds, 2012) Rachel Holmes, Sylvia Pankhurst: Natural Born Rebel (London 2020). Angela John and Claire Eustance (ed), The Men’s Share?: Masculinities, Male Support and Women’s Suffrage in Britain, 1890–1920 (London, 2013). Carl S. Joslyn, »A Catastrophe in the British Building Guilds«, The Quarterly Journal of Economics, 37:3 (1923), pp. 523–534. Richard Langworth (ed), Churchill by Himself: The Definitive Collection of Quotations (New York, 2008). Lynn Hollen Lees, The Solidarities of Strangers: The English Poor Laws and the People, 1700–1948 (Cambridge, 1999). Wallace Martin, The New Age under Orage, (Manchester, 1967). F. Matthews, »The Building Guilds«, in A. Briggs, J. Saville (eds) Essays in Labour History 1886– 1923 (London, 1971). William Morris, News from Nowhere (Mineola, New York, 2004). Christiane Mossin, »Vergessene Potenziale assoziativen Lebens. Pluralismus, Funktionalismus und Freiheit bei G.D.H. Cole und H.J. Laski«, Forshungsjournal Soziale Bewegungen, Heft 3, September 2016 (ed. Jürgen Kocka, Frank Adloff), p.181–190. Christabel Pankhurst, Unshackled, the story of how we won the vote (London, 1959). Emmeline Pankhurst, Suffragette: My Own Story (London, 1979). Sylvia Pankhurst (with a foreword by Emmeline Pankhurst), The Suffra gette: The History of the Women’s Militant Suffrage Movement (Mineola, New York, 2015). Naomi Paxton, Stage Rights!: The Actresses’ Franchise League, Activism and Politics 1908–58 (Manchester, 2018). Edward Reynolds Pease, The History of the Fabian Society (New York, 2015). Martin Pugh, The Pankhursts: The History of One Radical Family (New York, 2008). Anne Perkins, A Very British Strike (New York, 2007). June Purvis, Emmeline Pankhurst: A Biography (London, 2003). June Purvis, Christabel Pankhurst: A Biography (London, 2018). Sheila Rowbotham: »Foreword«, in Barbara Winslow, Sylvia Pankhurst – Sexual politics and political activism (London, 1996). Nan Sloane, The Women in the Room: Labour’s Forgotten History (London, 2020). 173
CHRISTIANE MOSSIN
Harold L Smith, The British Women’s Suffrage Campaign 1866–1928 (Abingdon, 2007). Richard Vernon, »Introduction«, in G.D.H. Cole, Guild Socialism Restated (London, 1980). Judith Walkowitz, Nights Out: Life in Cosmopolitan London (New Haven, 2012). Beatrice Webb, Our partnership (New York, 1948). Sidney Webb & Beatrice Webb, A Constitution for the Socialist Commonwealth of the Great Britain (London, 1920). Sidney Webb & Beatrice Webb, The Break Up of the Poor Law: Being the Minority Report of the Poor Law (London, 2009). Simon Webb, Suffragette Fascists: Emmeline Pankhurst and Her Right-Wing Followers (Yorkshire, 2020). Barbara Winslow, Sylvia Pankhurst – Sexual politics and political activism (London, 1996). James Woodfield, English Theatre in Transition 1881–1914 (London, 2016).
174
Julian Voth
Drei Morgen Land und eine Gilde Der berufsständische Gedanke im Distributismus Chestertons und Bellocs. Ein Essay »Ungelenk, aber passend«, so charakterisiert Gilbert Keith Chesterton, in deutschen Landen vor allem für seine Pater-Brown-Geschichten bekannt, die Bezeichnung der von ihm selbst entscheidend geprägten ökonomischen Philosophie namens Distributismus. Wenn demjenigen, der der ganzen Angelegenheit den Lebensodem eingehaucht hat, die Begrifflichkeit ungelenk vorkam, wird unsereiner noch größere Schwierigkeiten damit haben, sich mit dem wuchtigen Ismus aus dem vergangenen Jahrhundert zu versöhnen – stehen jedwede Ismen doch im Ruch der Ideologie, des Dogmas, der Unbeweglichkeit und des Starrsinns. Gestehen wir den Distributisten, die eine Gesellschaft familiär geprägter Kleineigentümer propagieren, dennoch aber den Vorschuss an Sympathie zu, ohne den es kein Verstehen gibt. Und glücklicherweise liefert uns der Distributismus mit dem jovialen Engländer, der seine erbittertsten politischen Gegner zu seinen engsten persönlichen Freunden zählte, auch einen äußerst sympathischen Gewährsmann. Neben dem 1874 geborenen und 1936 verstorbenen Schriftsteller und Journalisten Chesterton machte sich vor allem Hilaire Belloc (1870– 1953) um den distributistischen Gedanken verdient, ein englischer Literat, Newman-Schüler und zeitweise Politiker mit französischen Wurzeln. Beide Vielschreiber waren in ihrem Wirken so untrennbar miteinander verbunden, dass man von dem Zweigespann zuweilen auch nur als »Chesterbelloc« sprach. Auf dem Markt der Weltanschauungen wird heutigentags nur noch ein beschränktes Angebot feilgeboten. Reisen wir in die Entstehungszeit des sperrigen Begriffs zurück, stellt sich die Lage ganz anders dar. Im kulturellen Klima des edwardianischen Englands blühten allerorten neue Ideen und die außerordentliche intellektuelle Energie der Epoche zeigte sich in einem regelrechten Wettkampf der regsten Geister. Die Debatten jener Tage wurden nicht in der Abgeschiedenheit akademischer Elfenbeintürme geführt, sondern in der journalistischen Öffentlichkeit zahlreicher Tageszeitungen, die eine eifrige und wissbegierige Leserschaft ihr Eigen nannten. (Der katholische Bonvivant Chesterton schrieb in jenen Tagen für die protestantisch-abstinenzlerische Daily News, was in etwa der Konstellation gleichkäme, wenn Gregor Gysi eine tägliche Kolumne 175
JULIAN VOTH
im Handelsblatt hätte.) Gleichzeitig war das Zeitalter Eduards VII. geprägt von bedeutenden Sozialreformen, die die Grundlage für den englischen Sozialstaat legten. Diese Umstände dürften für die Genese des distributistischen Gedankens wesentlich sein. Die ersten Distributisten reagierten auf das, was sie als neue Verkörperungen gesellschaftlicher Abhängigkeit und Knechtschaft sahen: den Wohlfahrts- bzw. Sozialstaat. Daneben sahen sie sich mit einer Atmosphäre kultureller Umwälzung und Krisis konfrontiert, die ihre eigenen Ideen beseelten und in der stetigen Konfrontation mit dem Gegner schärften. Unsere beiden Protagonisten waren rhetorisch hochgerüstet und scheuten auch öffentliche Wortgefechte nicht. Ende der 1920er Jahre zogen die Rededuelle zwischen dem Nobelpreisträger Bernard Shaw und Chesterton große Menschenmassen an und wurden zu einem regelrechten Medienereignis. Shaw wollte während eines solchen verbalen Austauschs die Grenzen des Eigentumsrechts mit dem Beispiel seines mitgeführten Regenschirms anschaulich machen, den er von seiner Frau geliehen habe. Manche Abschnitte von Chestertons Ausführungen hätten ihn dazu verleitet, so der Dramatiker, eben diesen Regenschirm auf dem Kopfe seines Kontrahenten landen zu lassen, worauf Chesterton erwiderte, er sei einem einfachen Irrtum aufgesessen: Shawn verzichte keineswegs deswegen darauf, ihm auf das Haupt zu schlagen, weil ihm der Regenschirm nicht gehörte, sondern vielmehr liege der Grund des Unterlassens darin, dass er nicht der Eigentümer von Chestertons Kopf sei. Nun hat der Sozialstaat an sich beim deutschsprachigen Publikum keinen schlechten Ruf und auch englischen Zeitgenossen wie der bereits erwähnte Bernard Shaw sowie H. G. Wells, beide Mitglieder der sozialistischen intellektuellen Bewegung der Fabianer und sowohl Freunde als auch Gegner Chestertons und Bellocs, konnte der Ausbau des Sozialwesens kaum schnell genug gehen. Was störte nun die Distributisten daran? Ihnen erschien die neue Sozialgesetzgebung, die verschiedene Zwangsmaßnahmen im Bereich der Bildung, des Gesundheits- und Versicherungswesens zur Folge hatte, paternalistisch und repressiv. In ihren Augen handelte es sich um nichts anderes als um einen Affront gegen die Freiheit der Armen, die nun in einem System organisierten Mitgefühls wie ein Problem behandelt wurden, das nach einer Lösung verlangte. Man betrachtete die Armen als gesellschaftliches Problem, nicht als Teil der Gesellschaft, der Entbehrung litt – nämlich die Entbehrung derjenigen Freiheit und Unabhängigkeit, die die Reichen genossen. Die Armen wurden nicht mehr nur exploitiert, nein, zu allem Überfluss wurden sie nun auch noch von einem Verwaltungsapparat durchreglementiert. Unsere Distributisten stellen sich hier sowohl gegen die Unterdrücker als auch gegen die Reformer; d. h. gegen die reiche Oberschicht, der es keine Gewissensbisse bereitete, wenn ein Drittel der Bevölkerung habituell kurz vor dem Verhungern stand, und gegen die humanitaristischen 176
DREI MORGEN LAND UND EINE GILDE
Idealisten, seien sie Liberale (die den Sozialstaat einführten) oder Sozialisten (die die Lösung in der Abschaffung des Privateigentums sahen). Kommen wir auf die eingangs aufgeworfene Frage zurück, was es eigentlich mit dem Begriff Distributismus (zunächst auch Distributivismus) auf sich hat. Geprägt hat ihn Hilaire Belloc, der ihn dem Propertarianismus vorzog. Etymologisch lässt sich das Wort auf das lateinische »distribuere« zurückführen, was so viel heißt wie »teilen« oder »verteilen«. Wer hier an die aristotelische Verteilungsgerechtigkeit (iustitia distributiva) denken muss, liegt goldrichtig. Aristoteles, der Platons Vorstellung vom Gemeinbesitz widersprach, gilt den Distributisten überhaupt als Urvater ihres Gedankens. Die verteilende Gerechtigkeit kommt nach Aristoteles bei der Regelung des Gemeinwesens zur Anwendung. Sie kann dem öffentlichen oder politischen Bereich zugeordnet werden, während die ausgleichende Gerechtigkeit (iustitia regulativa) den freiwilligen und unfreiwilligen Verkehr zwischen den Bürgern regelt. Richtmaß der distributiven Gerechtigkeit, führt der Stagirit aus, müsse die Würdigkeit sein. Die gerechte Zuteilung von öffentlichen Gütern habe also proportional zur unterschiedlichen Würdigkeit der Bürger, sprich gemäß ihrem Wert oder Rang zu erfolgen. Der erste Grundsatz der verteilenden Gerechtigkeit lautet daher »Jedem gemäß seinem Wert« beziehungsweise »Jedem gemäß seinem Rang«. Die Distributisten sehen dieses Prinzip verletzt, an dessen Stelle allein die ausgleichende Gerechtigkeit bzw. deren Unterkategorie, die Tausch- oder Marktgerechtigkeit getreten sei. Deren Kernpunkt ist das Äquivalenzprinzip, nach dem der Marktwert einer zum Tausch angebotenen Leistung auch dem Preis zu entsprechen habe, der dem Anbieter dafür entrichtet wird. Für den neoklassischen Ökonomen folgt die Gerechtigkeit diesem Gleichgewicht, sie ist das unwillentliche Nebenprodukt der »unsichtbaren Hand« unter den Bedingungen der vollständigen Konkurrenz (perfect competition). Der Distributist entgegnet darauf, dass die Bedingungen der vollständigen Konkurrenz niemals verwirklicht werden könnten und die Gerechtigkeit als Tugend nicht von menschlicher Intentionalität getrennt werden könne. Die Verteilungsgerechtigkeit müsse vielmehr der ausgleichenden Gerechtigkeit vorausgehen, wie die Produktion dem Austausch von Produkten vorausgehen muss. Ohne Gerechtigkeit kein Gleichgewicht, und die Gerechtigkeit hängt, wie wir noch sehen werden, von der Verteilung der Produktionsmittel ab. Es würde aber noch etwas zu kurz greifen, es bei dieser Prima-facie-Worterklärung bewenden zu lassen. Das Präfix -dis nämlich schafft gleichsam eine räumliche Distanz zu jeder historischen Form von Tributleistung oder Abhängigkeit, vor allem jedoch zu jedweder politischen Ideologie, die Ismus ist – vornehmlich Kapitalismus und Sozialismus. Der Distributismus will nämlich nicht Gegenteil jener Ideologien sein, sondern etwas gänzlich Apartes. Schließlich komplimentiert sich alles 177
JULIAN VOTH
Entgegengesetzte, die sich gegenüberstehenden Pole gehören derselben Art an. Für den Distributisten hängt die Macht sowohl von Kapitalismus als auch Sozialismus von der Lohnknechtschaft ab. Indem der Distributismus dieses System beseitigen will, stellt er sich automatisch vollkommen jenseits des politischen Hufeisens. Der Distributist sieht keine Verteilung von Wohlstand, Geld oder Löhnen vor. Was er verteilen möchte, ist Macht in Form von Eigentum. Was der Distributismus aber nun ist, lässt sich schwerlich in kurze Worte fassen, zumal er den anamorphotischen Gemälden der Renaissance-Meister gleicht: Von ferne betrachtet scheint er die eine Sache zu sein, vom richtigen Winkel aus betrachtet aber eine ganz andere. Gerne beschreibt man den Distributismus mit dem von Chesterton – nicht ohne Selbstironie – selbst entworfenen Bild von den »drei Morgen Land und einer Kuh«, mit denen sich, so wird gesagt, nach distributistischer Idealvorstellung jeder Staatsbürger zum Selbstversorger mausern solle. Sieht man nur den agrarischen Aspekt, verliert man schnell den des Eigentums, der Freiheit und der Gilden aus dem Blick. Tatsächlich adressiert der Distributismus alle Aspekte des menschlichen Lebens. Er ist die Politik einer Philosophie. Chesterton selbst nennt den Distributismus die Politik des verteilten Kleinbesitzes. Belloc führt diesen Gedanken weiter aus, indem er eine distributistische Gesellschaft als eine Gesellschaft präsentiert, »in der Eigentum breit verteilt ist, und wo ein so großer Teil der Familien im Staate einzeln die Produktionsmittel besitzen und somit kontrollieren, dass sie den allgemeinen Charakter der Gesellschaft bestimmen«. Nur in einer solchen Gesellschaft könnten Sicherheit und wirtschaftliches Genügen mit Freiheit verbunden werden. Liest man so manches Plädoyer für den Distributismus, könnte man der falschen Vorstellung anheimfallen, die Freiheit und Unabhängigkeit der Familien und des Einzelnen, die ein System von wohlverteiltem Kleineigentum garantiert, sei das entscheidende Argument für den distributiven Staat. Dabei ließe man jedoch außer Acht, dass die Distributisten nicht nur die kapitalistische Eigentumskonzentration für tadelnswert erachten, sondern auch den freien Wettbewerb und Kommerzialisierung überhaupt. Die Freiheit, deren Sachwalter Chesterton und Genossen sind, ist nicht die anarchische Freiheit eines alternativen Kapitalismus. Ganz im Gegenteil, Belloc zum Beispiel warnt vor der ungehinderten Wirkung des Privateigentums, das, in Abwesenheit aller Sicherungen zur Bewahrung der Unabhängigkeit des kleinen Mannes, unweigerlich zu einer schließlichen Kontrolle der Produktionsmittel durch die wenigen tendiere. Genau aus diesem Grund nehmen die Gilden oder Zünfte (wie man diese Art von berufsständischen Korporationen auch immer nennen mag) eine Schlüsselposition im distributistischen Plan ein. 178
DREI MORGEN LAND UND EINE GILDE
Die Wiedereinsetzung, so Belloc, selbst einer kleinen Zahl von durch Statut und Gilde geschützten Handwerkern in wenigen Produktionsgebieten wäre von allergrößtem Wert: So würde die moralische Wirkung wirtschaftlicher Unabhängigkeit verbreitet und die modernen Menschen mit der Idee vertraut gemacht. Um dem im Kontext einer größeren Anthropologie oder Weltanschauung stehenden Distributismus gerecht zu werden, muss etwas weiter ausgeholt werden, um die eigentümliche Stellung der Gilde innerhalb des Verteilungsstaates zu beleuchten. Zunächst müssen wir uns die Frage stellen, welchem Zweck die menschliche Wirtschaftstätigkeit dient. Die Antwort scheint eine offenkundige zu sein: Damit wir für die nötigen Güter und Dienstleistungen sorgen können, nicht nur für unsere bloße Existenz und unser Überleben, sondern um das menschliche Leben in seiner mannigfaltigen Fülle und Blüte zu ermöglichen. Die von uns produzierten Güter sind kein Selbstzweck, sondern dienen dem menschlichen Leben – einschließlich des familiären, gesellschaftlichen und intellektuellen Lebens. Dass die ökonomischen Güter in erster Linie für den Gebrauch bestimmt sind, mag wie eine Binsenweisheit klingen. Da uns jedoch das kapitalistische Leitmotiv im Ohr liegt, die produzierten Güter seien zunächst für den Verkauf und erst in Folge zum Gebrauch bestimmt, tut es not, diesen Gedanken auszusprechen. Die kapitalistische Wirtschaft fragt nicht als Erstes, ob dieses oder jenes Gut das menschliche Leben fördert, sondern ob es sich verkaufen lässt und ob die Menschen vermittels Werbung und so weiter dazu gebracht werden können, es zu kaufen. Diese Sichtweise sehen die Distributisten im Wesen des Kapitalismus begründet, der, wie Pius XI. in seiner Sozialenzyklika Quadragesimo anno schreibt, in der Trennung von Besitz und Arbeit bestehe. Das für den Kapitalismus charakteristische wirtschaftliche Arrangement ist folgendes: Jemand besitzt die Produktionsmittel und beauftragt andere, um für ihn zu arbeiten und Güter zu erzeugen oder Dienstleistungen zu erbringen, die an die Konsumenten verkauft werden. Diejenigen, die die Produktionsmittel und das Gros der Wirtschaftsmacht besitzen, sind folglich immer mindestens einen Schritt von der tatsächlichen Produktion entfernt. Ein Anteilseigner etwa interessiert sich nur wenig für die Produkte des Unternehmens, Hauptgegenstand seines Interesses sind Dividenden und steigende Aktienkurse. Die Geschäftsführung ihrerseits sorgt sich immer weniger darum, dass die Produkte dem menschlichen Bedarf dienen und hochwertig sind, ja womöglich nicht einmal mehr darum, dass die Produkte gekauft werden. Stattdessen konzentriert sie sich auf die Finanzgeschäfte, Boni, Konsolidierungen etc. Belloc kritisiert, dass indirekt erwirtschafteter Wohlstand, d. h. durch die Arbeit anderer oder Tausch hervorgebrachter, zum Abstraktum wird. Je geringer das Interesse an der Sache, so der Distributist, desto größer 179
JULIAN VOTH
das Interesse am Abstrakten, sprich am Geld. In der produktiven Gesellschaft ist die Güte eines Produktes Prüfstein des Erfolgs. In der kommerzialisierten Gesellschaft zählt nur der durch den Verkauf akkumulierte Wohlstand des Verkäufers. Und dieser Geist des Kommerzes beschränkt sich nicht auf die Wirtschaftstätigkeit im engeren Sinne, sondern nimmt die Gesamtheit des gesellschaftlichen Lebens in Beschlag. Zur Vermeidung dieses kommerziellen Geistes müsse das gesamte Wirtschaftsleben auf den Gebrauch hin orientiert sein. Der vom Distributismus verfochtene Kleinbesitz begünstigt diese Richtung, da der Kleinbesitzer dazu neigen wird, sich auf die Produktion seiner Güter oder die Dienstleistungen zu konzentrieren (und dabei womöglich sogar nach Vorzüglichkeit zu streben), da davon sein Auskommen abhängt. Es zählt nicht seine Raffinesse in Finanzgeschäften, für die er ohnehin wenig Zeit haben wird, sondern seine Anstrengungen als Arbeiter. Die bloße Existenz des verteilten Kleinbesitzes garantiert jedoch noch keine funktionierende Wirtschaft, die ihrem Zweck dient, die Fülle des menschlichen Lebens zu ermöglichen. Es bedarf immer noch gewisser Strukturen, die das Wirtschaftsleben mit größerer Sicherheit auf sein Ziel hinordnen. Wenn einem zerstörerischen Wettbewerb nicht Einhalt geboten und sichergestellt wird, dass der Großteil der Bevölkerung Besitzer produktiven Eigentums werden kann, würde ein distributistisches System bald wieder in kapitalistische Unordnung verfallen. Berufsgemeinschaftliche Zusammenschlüsse sind also notwendig, ergeben sich schon zum Teil aber schon auf natürlichem Wege, da sie den gemeinsamen Interessen der durch die gemeinsame gesellschaftliche Leistung verbundenen Gruppe dienen. Alle Angehörigen der Bäckerszunft etwa (hier fordert der Sprachgebrauch bereits geradezu die berufsständische Organisation) sind an fairen Preisen, an der Verfügbarkeit von Rohmaterialien, einem verlässlichen Markt, Beziehungen zur Obrigkeit oder anderen Industrien, einer geregelten Berufsausbildung und womöglich sogar gemeinsamen Investitionen in teure Maschinen interessiert. Schon vor jedem formellen Zusammenschluss bilden die Bäcker bereits eine distinkte Gruppe, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Pius XI., mit bürgerlichem Name Achille Ambrogio Damiano Ratti, der wie kein zweiter Papst vor und nach ihm von der berufsständischen Ordnung sprach, vergleicht die Angehörigen des gleichen Berufsstands daher auch mit Bürgern derselben Ortsgemeinde, die sich um gemeinsame Bedürfnisse und Interessen kümmern. Aus der natürlichen Funktion der Gilde ergibt sich, dass sie der Hauptort für Wirtschaftsregulierungen sein muss, die zur Vermeidung ökonomischer Anarchie notwendig sind. In unserer Zeit wird gewöhnlich davon ausgegangen, dass diese regulierende Aufgabe der zentralen Autorität des Staates zukommt. Der Distributismus aber geht von Subsidiaritätsprinzip aus, das Belloc bereits einige Jahre vor Papa Ratti formulierte, d. h., dass Einzelverantwortung 180
DREI MORGEN LAND UND EINE GILDE
vor Gesamtverantwortung geht. Anders gesagt: Soweit die Einzelpersonen und kleineren Gemeinschaften fähig und willens sind, ihrer Eigenverantwortung hinsichtlich der Erfüllung der Lebenszwecke zu entsprechen, besteht kein Recht einer gesellschaftlichen Ordnungsgewalt, Aufgaben hinsichtlich dieser Lebenszwecke zu übernehmen. Die Selbstverwaltungskörperschaften haben also den Verantwortungs- oder Zuständigkeitsvorrang. Die Hauptfunktion der distributistischen Gilde besteht darin, ein Handwerk bzw. Gewerbe dergestalt zu leiten, dass gerechte Preise und Löhne gewährleistet sind, unzulässigem Wettbewerb Einhalt geboten wird, (dem Wesen des Distributismus entsprechend, betrifft die Frage der Löhne hauptsächlich Lehrlinge und Gesellen, schließlich soll eine möglichst große Personenzahl im Besitz von Produktionsmitteln sein), dass die Erzeugnisse von hoher Qualität sind und weder Produzenten noch Konsumenten und Umwelt schaden und dass ein Gleichgewicht herrscht zwischen der Anzahl der Arbeiter in einem bestimmten Gewerbe und dem tatsächlichen Bedarf, sodass stetige Arbeit für alle in dem Bereich Tätigen garantiert werden kann. Darüber hinaus würde die Gilde verschiedene subsidiäre Aufgaben übernehmen, die aktuell in den Händen des Staates oder anderer Institutionen liegen, z. B. Renten und Krankenversicherungen, und mithilfe von Genossenschaftsbanken Finanzdienstleistungen für Gildenmitglieder anbieten. Als Gewerbeverband vertritt die Berufsgemeinschaft ihr Gewerbe gegenüber dem Staat und anderen Interessengruppen, etwa Gilden, deren Angehörige als Zulieferer oder Kunden fungieren. Für Belloc und Chesterton war die ideale distributistische Gesellschaft eine christlich-katholische. Entsprechend wären die Gilden, wie ihre historisches Vorbilder, auch religiöse Vereinigungen, die am Gemeindeleben teilnehmen, unter ihren Mitgliedern die christlichen Tugenden fördern und ihre Arbeit durch die gemeinschaftliche Teilnahme an Gottesdiensten (etwa zum Patronatsfest) heiligen. Aber selbst die nicht an eine Offenbarungsreligion gebundene Gilde hat der Wohltätigkeit zu dienen und die Aufgabe, Gerechtigkeit und brüderliche Nächstenliebe zu stärken, ohne die der Einzelne und die Gesellschaft als Ganze unweigerlich der Selbstsucht verfällt, ganz gleich wie vollkommen ihre Institutionen und Rechtsordnungen auch sein mögen. Die Gildenmitglieder haben also nicht nur ihr eigenes Wohlergehen anzustreben. Tatsächlich müssen in den berufsständischen Vereinigungen die gemeinschaftlichen Interessen an vorderster Stelle stehen, und unter diesen nimmt die Ausrichtungen aller Gruppentätigkeiten auf das Gemeinwohl den ersten Platz ein. Der Gilde kommt die Aufgabe zu, die Mitwirkung des Berufsstandes zum allgemeinen Wohl möglichst fruchtbar zu gestalten. Jedwede wirtschaftliche Tätigkeiten werden nicht zum bloßen Selbstzweck bzw. zum Wohl der Gildenmitglieder ausgeübt, sondern für das Gemeinwohl. Erfüllt ein Gewerbe nicht diesen Zweck, 181
JULIAN VOTH
gleiche es, so die Distributisten, eher einem kriminellen Syndikat, das die Gesellschaft übervorteilt. In der distributistischen Gesellschaft wären hauptsächlich die Eigentümer produzierenden Kleinbesitzes Mitglieder ihrer berufsständischen Körperschaft, jedoch müssten auch Lehrlinge und Gesellen ein gewisses Mitspracherecht in der Gilde haben. Zwar sucht der Distributismus, die Produktionsmittel möglichst breit zu verteilen – dies ist sein entscheidendes Wesensmerkmal –, jedoch lässt sich kaum vermeiden, dass eine gewisse Personenzahl im Lohnverhältnis steht, so etwa die Auszubildenden sowie Gesellen, die Erfahrung und Kapital zur Gründung ihres eigenen Betriebs sammeln. Auch muss mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass mancher Geselle sein ganzes Leben lang kein Interesse an einer eigenen Betriebsgründung hat. Ein derartiges Arrangement ist insofern mit dem distributistischen Gedanken vereinbar, als das Arbeitgeber-Arbeitnehmerverhältnis nicht zur Norm wird und der Gesellschaft ihr charakteristisches Gepräge verleiht. In jedem Fall hat die Gilde auch die Mitglieder zu vertreten, die keine Eigentümer von Produktionsmitteln sind. Belloc sieht einen Besteuerungsplan vor, um die Bildung von Großunternehmen und landwirtschaftlichem Großgrundbesitz zu verhindern und Kleinbesitz zu begünstigen. Andere Distributisten weisen darauf hin, dass Selbiges auch durch Gildenbestimmungen mit nur geringer staatlichen Involvierung zu bewerkstelligen sei. Wenn die Größe der einzelnen Unternehmen durch die Körperschaften begrenzt ist, ist die Anzahl der Lehrlinge und Gesellen, die ein Meister einstellen kann, entsprechend eingeschränkt. Der klassische Ort der Gildentätigkeit ist eine bestimmte Stadt oder Gegend. Je nach Sektor, der Quelle der eingesetzten Rohstoffe usw. sind aber auch regionale, nationale und internationale Zusammenschlüsse bzw. Gildenföderationen denkbar, zumal es in vielen Fällen nötig sein wird, dass Industriebranchen überlokal oder -regional agieren. Auch können die Föderationen Differenzen zwischen den Gilden einer Lösung zuführen, genauso wie die einzelnen Gilden begrenzte richterliche Befugnisse bei internen Streitfragen haben. Der Schwerpunkt beruflicher Selbstverwaltung soll jedoch keinesfalls bei diesen zentralen Organisationsstellen liegen, sie dienen vielmehr als Berufungsinstanz bei Schlichtungs- und Schiedsgerichtsfällen und sollen die Zusammenarbeit mit staatlichen und anderen berufsständischen Instanzen erleichtern. Es ist wichtig zu betonen, dass die distributistische Gilde, wie ihr historisches Vorbild, keine freiwillige Berufsvereinigung ist. Will jemand einen bestimmten Beruf ausüben, hat derjenige der entsprechenden Gilde beizutreten und sich den Gildenbestimmungen zu unterwerfen, welche freilich im demokratischen Prozess durch die Mitglieder selbst formuliert werden. Kein Distributist betrachtet dies als Freiheitseinschränkung – liegt den Distributisten die menschliche Freiheit ja besonders am Herzen 182
DREI MORGEN LAND UND EINE GILDE
–, da die wirtschaftliche Freiheit dem Zwecke dient, einen angemessenen Lebensunterhalt zu verdienen und nicht etwa Reichtümer anzuhäufen. Die Institution des Privateigentums, wie Chesterton sagt, ziehe nicht das Recht auf unbegrenztes Eigentum nach sich, genauso wenig wie die Institution der Ehe das Recht auf eine unbegrenzte Anzahl von Ehefrauen nach sich ziehe. Die Gilde dient den Interessen des Berufszweigs bzw. des Gewerbes, indes hat sie der Tatsache Rechnung zu tragen, dass diese Interessen der Gesellschaft als Ganzer untergeordnet sind, seien sie wirtschaftlicher oder anderer Natur. Selbstverständlich dient die Gilde auch dem Streben nach einem angemessenen Wohlstand, jedoch einem Wohlstand, der die Rechte und Nöte anderer Gilden und ihrer Mitglieder, die Konsumenten sowie die wirtschaftlichen, kulturellen und geistigen Bedürfnisse des jeweiligen Landstrichs respektiert und im Blick hat. Kein ökonomischer Aspekt der Berufsorganisationen ist isoliert vom gesellschaftlichen Gemeinwohl zu betrachten, zumal das Stillen rein materieller Bedürfnisse für die Lebens- und somit Glückserfüllung des Menschen nicht hinreichend ist. Tatsächlich, und hier scheint das christliche Tugend- und Wertesystem durch, ohne das der Distributismus nicht denkbar ist, können die materiellen Güter von der wahren menschlichen Erfüllung ablenken. Der Distributismus im Allgemeinen und dessen Gildensystem im Besonderen zielen darauf ab, die wirtschaftliche Tätigkeit solcherweise einzuhegen, um die Gefahr zu minimieren, dass materielle Güter dem »guten Leben« im Wege stehen. In abendländisch-mittelalterlicher Tradition erkennen die Distributisten ein wirtschaftliches Strebevermögen im Menschen an, das jedoch, wie alle anderen menschlichen Begehren auch, zu kontrollieren ist. Nach Wohlstand zu streben, um ein angemessenes Auskommen zu haben, ist Menschenrecht, nach mehr zu streben Habsucht. Wirtschaften und Handeln ist gut und rechtmäßig, aber unter dem sittlichen Gesichtspunkt immer dangerous business, ein gefährliches Geschäft. Die Gilde innerhalb der distributistischen Gesellschaft ist sowohl eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme als auch ein institutionelles Mittel zur Förderung des menschlichen Wohlergehens in seinem persönlichen und gesellschaftlichen Aspekt in diesem Leben und, für Chesterton und Belloc wohl am entscheidendsten, auch im nächsten.
Literatur Aristoteles (1978): Die Nikomachische Ethik. München: dtv. Belloc, Hilaire (2019): Der Sklavenstaat, Bad Schmiedeberg: Renovamen-Verlag. 183
JULIAN VOTH
Belloc, Hilaire (1948): Die Wiederherstellung des Eigentums, Olten: Walter. Chesterton, Gilbert Keith (2002): Autobiographie, Bonn: nova et vetera Verlag. Chesterton, Gilbert Keith (2020): Umriss der Vernunft, Berlin: Matthes & Seitz. Knoll, Manuel (2010): »Die distributive Gerechtigkeit bei Platon und Aristoteles«, in: Zeitschrift für Politik (ZfP), Heft 1, 2010, S. 3–30. Messner, Johannes (1955): Ethik, Innsbruck: Tyrolia. Pius XI. (1931): »Quadragesimo anno«, in: AAS XXIII [1931], S. 177–228.
184
Otto Gerhard Oexle
Luhmanns Mittelalter*
1
I. In dem 1989 erschienenen dritten Band seines Werks Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft geht es N. Luhmann erneut darum, das »Zusammenspiel von strukturellen und semantischen Veränderungen« zu zeigen, das »aus der spätmittelalterlichen Ständegesellschaft in die moderne Gesellschaft übergeleitet hat« (S. 7). Der Vorgang wird – wie schon in den ersten beiden, 1980 und 1981 erschienenen Bänden – beschrieben als eine Systemdifferenzierung, nämlich als »Übergang von primär stratifikatorischer zu primär funktionaler Differenzierung«. Die Unterscheidung von Gesellschaftsstruktur und Semantik geht davon aus, dass in der Semantik, der »sinnhaft-referentiellen Kommunikationsstruktur«, eine »sanftere Mischung von Kontinuitäten und Diskontinuitäten und ein anderer Zeitrhythmus möglich sind«. Denn in der Semantik, im Code der Kommunikation, gibt es probeweise Innovationen, gibt es die Weiterführung obsolet gewordener Ideen, Begriffe und Wörter, welche die Radikalität ›realer‹ Strukturwandlungen »verschleiert«, gibt es den Austausch der Gegenbegriffe. »Diese und viele ähnliche Tricks ermöglichen eine Überschätzung der Kontinuität und eine Unterschätzung der Veränderung, vor allem im 18. Jahrhundert« (S. 8). Von dem ähnlich ausgerichteten Unternehmen der von O. Brunner, W. Conze und R. Koselleck seit 1972 herausgegebenen ›Geschichtlichen Grundbegriffe‹, dem ›Historischen Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland‹, von dem bisher sechs Bände erschienen, setzt Luhmann sich ab, indem er ihm die Bindung bloß an die »Hochbegriffe der literarischen Kultur« vorwirft und ein Theoriedefizit, aufgrund dessen »die Frage nach Korrelationen zwischen soziostrukturellen und begriffs- oder ideengeschichtlichen Veränderungen« nicht beantwortet werden könne (dazu Bd. 1, S. 13f.). Da aber schon die Frage, ob ›moderne‹ Begriffe und Ansätze überhaupt geeignet seien, das Denken älterer *
Die vorliegende Rezension von O. G. Oexle (zu: Niklas Luhmann: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, Bd. 3, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989) sowie die nachfolgende Replik von N. Luhmann sind erstmals abgedruckt in dem von Dieter Simon herausgegebenen Rechtshistorischen Journal, Bd. 10, 1991, S. 53-70 (Löwenklau Gesellschaft e.V. Frankfurt/Main).
185
OTTO GERHARD OEXLE
Gesellschaften zu erschließen, ebenfalls ein Theoriedefizit signalisiere; da ferner der Strukturwandel einer Gesellschaft sich der Beobachtung und Beurteilung durch die Mitlebenden entziehe; und da schließlich eine »hinreichende Abstraktheit des begrifflichen Apparats« zur Analyse fernliegender Kulturen ebenso fehle wie eine Theorie der Evolution der Gesellschaftssysteme, bleibe nur der Versuch und die Demonstration, »daß es vor allem die Komplexität des Gesellschaftssystems und die Kontingenz seiner Operationen ist, deren Veränderung mit Änderungen der Semantik beantwortet wird. Man kann das begreifen und damit auch die Distanz zu fremdem Denken begreifen ...« (ebd., S. 15). Die ›Semantik‹ läuft den Strukturänderungen voraus und hinterher, sie »antezipiert und registriert Veränderungen, und dies in einem Getümmel von Kontroversen, die ihrerseits den Blick ablenken von dem, was geschieht« (Bd. 3, S. 8), – und doch darauf verweisen. Der Strukturwandel entzieht sich also der unmittelbaren Beobachtung und Beschreibung durch die Zeitgenossen. Erst nachdem er »vollzogen und praktisch irreversibel geworden« sei, übernehme die Semantik »die Aufgabe, das nun sichtbar Gewordene zu beschreiben« (ebd.). In Europa habe sich dafür um 1800, mit dem Beginn der Moderne, die Unterscheidung von ›Geschichte‹ und ›Ideologie‹ als »Zwillingsform« herausgebildet. Aber erst im 19. Jahrhundert (das nicht mehr Gegenstand der Untersuchungen ist) und in vollem Umfang sogar erst in unseren Tagen hätten sich die »Realfolgen der neuen Gesellschaftsformation« ganz gezeigt. Erst jetzt stelle sich einer neuen Semantik die Aufgabe, »den Sachverhalten mit einer Gesellschaftstheorie neuen Zuschnitts gerecht zu werden« (S. 8), und diese Semantik heiße: ›Soziologie‹. Der Wissenssoziologe sieht sich in der Rolle des Beobachters, der beobachtet, wie die an einem politisch-sozialen Diskurs oder an anderen Diskursen Beteiligten sich wechselseitig beobachten; es sei seine Aufgabe, »Beobachter zu beobachten, Beschreibungen zu beschreiben, Unterscheidungen zu unterscheiden« (S. 446f.). Dabei wird der (Historikern durchaus nicht unvertraute) Sachverhalt hervorgehoben, dass Theorien, die Gesellschaften über sich selbst entwickeln (also zum Beispiel die Stände-Reflexion in den Ständegesellschaften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit), diese Gesellschaften nicht erschöpfend beschreiben können, dass eine vergangene Gesellschaft mit ihren eigenen Begriffen von sich nicht ausreichend analysiert werden kann, dass also eine soziologisch sinnvolle Theorie gesellschaftlicher Differenzierung in dieser Hinsicht mehr leistet. Offen bleibt dabei nur, ob eine solche Theorie wirklich ›alles‹ leistet, wie Luhmann anzunehmen scheint, auch wenn er einem solchen Zugriff seinerseits Optimierbarkeit zuschreibt. Aber steht der wissenssoziologische Beobachter denn wirklich außerhalb der Geschichte: steht er (a) außerhalb der Prozesse, die er beschreibt? Und kann er (b) wirklich davon ausgehen, dass seine 186
LUHMANNS MITTELALTER
Kategorien, dass seine Semantik frei sind von geschichtlicher Gewordenheit, frei von geschichtlicher Bedingtheit?
II. Fünf thematische Zugriffe auf den Wandlungsprozess vom Mittelalter zur Moderne sind es, die der vorliegende Band vorstellt. Das erste Kapitel (»Am Anfang war kein Unrecht«) zeigt den Diskurs über Recht und Unrecht im 16. bis 18. Jahrhundert, die Zeit also zwischen dem Ende der hierarchischen Ordnungsvorstellungen des Mittelalters und den transzendenten Legitimationen des Rechts einerseits und andererseits der (noch nicht vorhandenen) historischen Positivität. Hier geht es deshalb um die Frage, ob die Unterscheidung von Recht und Unrecht ihrerseits auf Recht oder auf Unrecht beruht. Dieser Diskurs organisierte sich als Theorie der Entstehung von Eigentum. Analog zur Adelstheorie, die mit der am Anfang stehenden Tüchtigkeit (virtus) des Spitzenahnen argumentiert, wobei sich in der Geschichte des adligen Hauses Herkunft und Verdienst ständig wechselseitig illuminieren, wird im gleichen »Erklärungsduktus« die Theorie des Eigentums dahingehend entwickelt, dass der Ersterwerb legitimiert: »Der Ersterwerb ist der Grund des Rechts« (S. 12). Im Hintergrund steht hier immer noch die Unterscheidung von Polis und Oikos und die Realität des ›Hauses‹, d.h. der politische Sinn von Eigentum (Eigentum konstituiert persönliche Individualität und politische Partizipation) und die Bindung der Theoriebildung an die noch immer relevanten Formen der Subsistenzwirtschaft im Sinne der alteuropäischen Ökonomik. Auch der Eigentumsdiskurs geht aus von der Annahme, der Anfang sei der Grund der Ordnung. Sie wird naturrechtlich gedacht, im Sinne einer naturrechtlichen Theorie des Gemeineigentums, das dann in Privateigentum überführt wurde, sich also nach ›Mein‹ und ›Dein‹ differenzierte. So steht am Anfang die Paradoxie eines »Eigentums ohne Eigentumsmerkmale« (S. 22), eines Eigentums nämlich, dem das wesentliche Merkmal jeglichen Eigentums fehlt: die Exklusivität. Auf diese Weise kann die Frage von Recht und Unrecht über die Eigentumstheorie entschieden werden – in der Theorie eines Eigentums, das keine Rechtsverletzung bedeutet: »Am Anfang war kein Unrecht. Das Recht entsteht ohne Rechtsbruch wie von selber; aber wenn es einmal entstanden ist, kann man an den Formen des Rechts erkennen, was Recht und was Unrecht ist« (S. 24). Diese unerkannte Paradoxie des Anfangs wird aber schon im 17. Jahrhundert aufgelöst, sie wird »entparadoxiert«, wiederum ohne dass dies erkannt würde. Jetzt findet man den Gedanken, dass das Privateigentum eine bessere Nutzung der Güter darstellt, oder dass die 187
OTTO GERHARD OEXLE
Gütergemeinschaft ohnedies nur zu Streit führe. In der Folge differenzieren sich weitere Positionen aus, die eine Entparadoxierung und Begründung des Rechts versuchen: Eigentum wird notwendig in dem Maß, wie die Zivilisation Fortschritte macht (H. Grotius); Eigentum wird durch Konsens legitimiert (Pufendorf); Eigentum wird erlaubt unter der Bedingung der Rücksicht auf das allgemeine Wohl (F. Hutcheson). Oder aber – und jetzt zunehmend unter den Bedingungen der sich entfaltenden Geldwirtschaft: Eigentum wird legitim durch Arbeit (J. Locke) oder unter der Bedingung nützlichen Verhaltens (Chr. Wolff). Die wirtschaftswissenschaftliche Theorie der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hat dann die »Entparadoxierungsprobleme des Rechts abgehängt. Sie interessiert sich für die Genese und die Vorteile der Arbeitsteilung. Sie ist schon Reflexionstheorie des Wirtschaftssystems und daher schon Systemtheorie. Sie hat darzustellen, wie – ein anderes Paradox! – aus eigensüchtigem Verhalten gemeinsamer Wohlstand entsteht. Dies wird über Arbeitsteilung bewiesen« (S. 45). Die bisher bestehende Einheit von juridischer, ökonomischer und politischer Rationalität löst sich damit auf, »und Adam Smith ist der Autor, dessen Gesamtwerk dieser Gesamttradition noch verpflichtet ist – und sie auflöst« (ebd.). Die funktionale Differenzierung hat sich definitiv ausgeformt. In analoger und ebenso spannender wie brillanter Weise interpretiert Luhmann in den folgenden Kapiteln die Paradoxien und die nicht wahrgenommenen Entparadoxierungen im Hinblick auf Willkür und Bindung politischer Entscheidungen (Kap. 2: »Staat und Staatsräson im Übergang von traditionaler Herrschaft zu moderner Politik«); die Transformierung der Religion zu einem Teilsystem, das sich, nach dem Zerfall von Metaphysik und Kosmologie und dem Zerfall der an diese gebundenen Ethik, in Konkurrenz mit anderen Teilsystemen befindet (Kap. 4: »Die Ausdifferenzierung der Religion«), sowie – in unmittelbarem Zusammenhang damit stehend – die Entstehung der Moral (oder Ethik im modernen Sinn) als einer »gesellschaftsweit zirkulierenden Kommunikationsweise« (S. 434), auf dem Weg über die europäische Moralistik der Frühen Neuzeit, also der an-ethischen Beschreibung menschlichen Verhaltens, die auf Beobachtung beruht (Kap. 5: »Ethik als Reflexionstheorie der Moral«).
III. Eine in jeder Hinsicht zentrale Position eignet dem dritten Kapitel des Bandes über »Individuum, Individualität, Individualismus«. Sein Thema ist die Genese der Moderne, insofern sie sich vom Mittelalter absetzt mit der Eröffnung des Gegensatzes zwischen Individuum und Gesellschaft. 188
LUHMANNS MITTELALTER
»Das europäische Mittelalter bietet im Großen und Ganzen das Bild einer stratifizierten, auf Rangunterschieden aufgebauten Gesellschaft. Zugleich war jedoch in hohem Maße – und besonders dort, wo der Adel auf dem Lande lebte – eine segmentäre Differenzierung nach Familien, Häusern, Herrschafts- und Klientelverhältnissen des Adels erhalten geblieben ... Jedenfalls war ein Leben außerhalb von Familien kaum denkbar; und wenn es überhaupt vorkam, war es unglücklich, riskant und kurz« (S. 165f.). Das Individuum konnte im Mittelalter, so die These, nur leben in der Bindung an Haus und Familie, in der »Inklusion«. Und nur in dieser »Inklusion« als Mitglied einer ihm vorgegebenen und vorgeordneten Gruppe konnte es überhaupt Individuum sein. Gerade umgekehrt sei es nun in der Moderne. Hier könne das Individuum »nicht mehr durch Inklusion, sondern nur noch durch Exklusion definiert werden. Das ist der strukturelle Grund für die neuartige (post-naturrechtliche) Dramatik von ›Individuum und Gesellschaft‹« (S. 158). In der vormodernen Welt Alteuropas habe es, auch in der »Art, wie Kommunikation gelehrt und praktiziert wurde, ... zunächst keinen ›Platz‹ für Individualität im modernen Sinne« gegeben (S. 173). »Weder in den Biographien noch in den Romanen findet man deshalb vor dem 18. Jahrhundert nennenswerte Spuren moderner Individualität. Über das Individuum konnte nicht amplifizierend gesprochen, das heißt nicht so gesprochen werden, als ob es sich um einen Sachverhalt von Bedeutung handele« (S. 174f.). Der Weg vom Mittelalter zur Moderne ist also der Weg von der »Inklusion« des Individuums zu seiner »Exklusion«, das heißt: dass das Individuum jetzt nicht mehr nur einem gesellschaftlichen Teilsystem angehören kann, dass es vielmehr sich in den verschiedensten Systemen (Wirtschaft, Recht, Politik usw.) engagieren muss, gerade deshalb als Individuum aber »nur außerhalb der Gesellschaft« leben kann. Der Einzelne kann »nur als System eigener Art in der Umwelt der Gesellschaft sich reproduzieren, wobei für ihn die Gesellschaft eine dazu notwendige Umwelt ist« (S. 158). Luhmann weiß natürlich, dass das Problem dieser »Inklusion« des Individuums ein modernes Problem ist, und auch, dass »die Sehnsucht danach ... ein spezifisch modernes Phänomen« darstellt (S. 159). Er weiß zudem, dass dieses Problem seit den Anfängen der modernen Soziologie in dieser involviert ist, oder richtiger: dass es sogar den Beginn der modernen Soziologie konstituiert. »Vom Individuum spricht die Soziologie seit ihren Anfängen« (S. 149). Und in der Tat hat die Soziologie »ihren geschichtlichen Weg« begonnen in einer »Zeit ideologischer und politischer Kontroversen um Individualismus (Liberalismus) und Kollektivismus (Sozialismus), die ihr das Thema Individuum und Gesellschaft vorlegten«; und so seien denn damals »große Theorieleistungen entstanden, auf die man auch heute immer wieder gern zurückgreift« (ebd.). Diese Theorie reguliere »das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft so, 189
OTTO GERHARD OEXLE
daß jede Option für die eine oder die andere Seite als sinnlos oder als naiv dargestellt werden kann« (ebd.). Luhmann möchte nun aber »aus der Ideengeschichte mehr lernen können, als die klassische Soziologie sich zugemutet hatte«, er möchte Erkenntnisse, welche mit der soziologischen Klassik beiseitegeschoben wurden und verlorengingen, wiedergewinnen, um dadurch »die Grund thesen der klassischen Soziologie zugleich (zu) verifizieren und (zu) kritisieren: verifizieren, indem wir zeigen, daß die gesellschaftliche Evolution tatsächlich eine Individualitätssemantik produziert in dem Maße, als sie gesellschaftliche Strukturen ändert; und kritisieren, indem wir zeigen, daß diese These sich selbst mitmeint und entsprechend ausgearbeitet werden muß« (S. 153f.). Nun könnte sich Luhmann mit seiner Annahme eines evolutiven Prozesses von der (mittelalterlichen) Inklusion zur (modernen) Exklusion natürlich auch auf Historiker berufen, wenn er dies nur wollte. Jacob Burckhardt hat bekanntlich diese Theorie vorgebracht, als er 1860 in seinem Buch über Die Kultur der Renaissance in Italien die »Ausformung« des »modernen Menschen« in der Renaissance beschrieb als einen Prozess der zweifachen Emanzipation des Individuums: einerseits von den Mächten des Glaubens und der Religion, andererseits von den Mächten der Gemeinschaft, also von Familie, Haus, Korporation, Gemeinde usw. Burckhardts Theorie der Renaissance, die vor allem eine Deutung der Moderne im Gegensatz zum Mittelalter ist, wurde von ihm selbst später, in den 1880er Jahren, ausdrücklich widerrufen. In der Geschichtswissenschaft hat sie derzeit keine Konjunktur mehr. Umso deutlicher aber fällt auf, wie sehr das Deutungsschema Burckhardts, abgelöst von dem Ort seiner Geburt, noch immer die Gunst der Historiker genießt, wie der »Erklärungsduktus« des Burckhardt’schen Schemas von 1860 anderenorts unbefangen verwendet wird. So hat man in der Mediävistik das Schema benutzt, um zum Beispiel für das 11. Jahrhundert den Übergang von einer vorgeblich »archaischen« Kultur des Frühmittelalters zu einer »Aufbruchsepoche« des Hochmittelalters mit sozialer Mobilität und wachsender Individualität anzunehmen (K. Bosl); oder man sieht einen solche Durchbruchsprozess von Individualität in der Bildung von konsensuellen Gruppen (Gemeinden) vor allem im 14. und 15. Jahrhundert, wodurch das Spätmittelalter im Zeichen eines sogenannten »Kommunalismus« zu einer Zwischen-Zeit »zwischen Mittelalter und Moderne« werde (P. Blickle); oder man verwendet mit Th. Nipperdey (und anderen) Burckhardts auf die Renaissance bezogenes Individualisierungs- und Emanzipations-Theorem, um die Modernisierungsvorgänge des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts zu beschreiben. Die Individualisierungs-These ist also zunächst einmal ein Deutungsschema der Geschichte in der Moderne, das rückblickend eingesetzt wird, um Mittelalter und Moderne zu unterscheiden im Sinne einer 190
LUHMANNS MITTELALTER
Legitimation der Moderne, wobei in neuerer Zeit – bezeichnenderweise – immer unklarer wurde, ob diese Moderne denn schon im 11. Jahrhundert begann, – oder ob das Mittelalter erst um 1800 endete. In diese Problematik ist Luhmann, der sich mit J. Burckhardt mehr an die traditionelle Epochenschwelle der Zeit um 1500 hält (und mit dem 16. Jahrhundert eine zur Moderne führende Übergangszeit beginnen lässt), mehr verstrickt, als ihm deutlich zu sein scheint. Dies wird aber auch aus der Geschichte der soziologischen Klassiker deutlich, vor allem anhand der Theorien von F. Tönnies, É. Durkheim und G. Simmel. Denn sie alle haben sich wie Luhmann mit dem Gegensatz von Moderne und Mittelalter befasst und mit diesem Gegensatz die Fundamente ihrer soziologischen Theorien gebaut. Ferdinand Tönnies hat in Gemeinschaft und Gesellschaft (1887) die Lage des Individuums in der modernen Gesellschaft im Zeichen von Individualismus, Rationalismus und Relativismus und in der Auslieferung an die omnipräsenten Kontrakt-Verhältnisse beschrieben, die das Individuum der Fatalität der Moderne preisgeben. Daraus resultierte seine Beschwörung des »Zeitalters der Gemeinschaft«, des Mittelalters nämlich, das dem Menschen vor allem Bindungen vermittelte, soziale (und damit auch geistige) Bindungen in Familie und Haus, in Freundschaft und Nachbarschaft, in Gilde und Zunft, in Dorf, Pfarrei und Stadtgemeinde. Dieses Mittelalter von Tönnies ist eine Projektion, die begründet ist in der Ablehnung der als bindungslos, destruktiv und permanent »revolutionär« verurteilten Moderne. In gleichartigen Überlegungen hat Émile Durkheim (De la division du travail social, 1893; explizit in der Vorrede zur zweiten Auflage dieses Buches von 1902) den »Anomien« der modernen Gesellschaft das positive Beispiel der mittelalterlichen Korporation und der mittelalterlichen Kommune (als einem »System von Korporationen«) entgegengestellt. Und dies sei die Exemplarität der mittelalterlichen Zunft für die moderne Gesellschaft: ihre »moralische Rolle«, ihr Charakter als ein »religiöses Kollegium«. Wenn wir nun – so Durkheim – die korporative Organisation des Mittelalters für »unentbehrlich« halten und annehmen, dass sie »in unseren modernen Gesellschaften« erneut eine »beträchtliche Rolle« zu spielen habe, so nicht wegen ihres ökonomischen Nutzens, sondern wegen des »moralischen Einflusses, den sie haben könnte«. In analoger Weise hat schließlich auch Georg Simmel seiner Theorie der Moderne, die er 1900 unter dem Titel Philosophie des Geldes veröffentlichte, den Gegensatz von Moderne und Mittelalter zugrunde gelegt. Die Moderne ist für Simmel die Epoche der »absoluten« Veränderung und Bewegung, die Epoche der »Nicht-Dauer« und eines universalen »Heraklitismus«. Und für diesen »absoluten Bewegungscharakter der Welt« gebe es »kein deutlicheres Symbol als das Geld«. Das Geld ist »nichts als der Träger einer Bewegung, in dem eben alles, was nicht Bewegung ist, völlig ausgelöscht ist, es ist sozusagen actus purus; es 191
OTTO GERHARD OEXLE
lebt in kontinuierlicher Selbstentäußerung aus jedem gegebenen Punkt heraus und bildet so den Gegenpol und die direkte Verneinung jedes Fürsichseins« (Philosophie des Geldes, 1977, S. 582f.). Gerade dieses Fürsich-Sein sei nun aber ein Kennzeichen des Mittelalters; es charakterisiere den Menschen des Mittelalters, dass er sich »in bindender Zugehörigkeit zu einer Gemeinde oder zu einem Landbesitz, zum Feudalverband oder zur Korporation« befindet; »seine Persönlichkeit war eingeschmolzen in sachliche oder soziale Interessenkreise, und die letzteren wiederum empfingen ihren Charakter von den Personen, die sie unmittelbar trugen. Diese Einheitlichkeit hat die neuere Zeit zerstört« usw. (G. Simmel, Das Geld in der modernen Kultur, 1896). Daraus resultiert nach Simmel die »unvergleichliche innere und äußere Bewegungsfreiheit« des Menschen in der Moderne, seine Selbständigkeit und Unabhängigkeit, mithin also die »Herausarbeitung des Individuellsten«, zugleich aber auch die allgemeine Ausgleichung und Nivellierung, die »Herstellung immer umfassenderer sozialer Kreise durch die Verbindung des Entlegensten unter gleichen Bedingungen« (ebd.). Ebenso wie Ralf Dahrendorf mit seinen Reflexionen über das Problem der ›Optionen‹ und der ›Ligaturen‹ in der Gesellschaft der Moderne (Lebenschancen. Anläufe zur sozialen und politischen Theorie, 1979) befindet sich auch Luhmann auf diesem Pfad der Reflexion über die Moderne im Hinblick auf Bindung und Freiheit des Individuums, und dies in der kontradiktorischen Gegenüberstellung mit dem Mittelalter – oder besser: mit dem, was man dafür hält. Luhmanns Reflexionen partizipieren somit an einer längst etablierten ›Semantik‹, an einem traditionellen modernen Diskurs über das Mittelalter, in dem anhand des Mittelalters über die Moderne geredet wird.
IV. Ist die Einsicht in diesen Sachverhalt, ist also die Historisierung der Fragestellung ein Nachteil? Zu vermuten ist eher, dass eine solche Historisierung die Komplexität der Fragestellung und der Erkenntnis erhöht, und zwar in mehreren Hinsichten. (1) Zuerst ist auf folgendes hinzuweisen: die Einsicht in die Historizität dieser »Semantik« von Moderne und Mittelalter macht darauf aufmerksam, dass diese Semantik des absoluten Gegensatzes beider Epochen viele »unbequeme Tatsachen« eliminiert, die in diesem Schema gar nicht erst zur Sprache kommen – und es handelt sich nicht nur um Einzeltatsachen, sondern um ganze Bereiche, die nicht zur Erkenntnis zugelassen werden. Das stellt dann zugleich die Frage nach der Existenz anderer »Semantiken« über Moderne und Mittelalter. 192
LUHMANNS MITTELALTER
So stellt Luhmann zum Beispiel die mittelalterliche Gesellschaft ausschließlich als Ständegesellschaft dar, und das heißt: wesentlich als Adelsgesellschaft (vgl. dazu auch in Bd. 1 von Gesellschaftsstruktur und Semantik, 1980, das Kapitel »Interaktion in Oberschichten: Zur Transformation ihrer Semantik im 17. und 18. Jahrhundert«, S. 72ff.). Das Bürgertum kommt nicht vor – weder in der Frühen Neuzeit noch, was gravierender ist, im Blick auf das Mittelalter. Für eine derartige Sicht der Dinge gibt es natürlich auch in der Geschichtswissenschaft Beispiele. Auch H.-U. Wehler etwa hat seine Deutsche Gesellschaftsgeschichte (Erster Band: Vom Feudalismus des Alten Reiches bis zur Defensiven Modernisierung der Reformära 1700–1815, 1987) aufgebaut auf dem Kontrast der Modernisierung zum mittelalterlichen »Feudalismus« und zur »Ständegesellschaft«. Und natürlich gibt es auch Mediävisten, auf die man sich bei solchem Vorgehen berufen könnte und die das Mittelalter exklusiv bestimmt sehen durch konstitutive Faktoren wie die »überwiegend agrarische Struktur«, die »Partikularisierung des öffentlichen Lebens«, die »Adelsherrschaft«, das »christliche Kirchentum«, denen dann noch die »lateinische Antike als Traditionsmacht« an die Seite gestellt wird, aber nichts sonst (H.-D. Kahl, »Was bedeutet: ›Mittelalter‹?«, in: Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte 40, 1989, S. 15– 38). Aber wo bleiben in solchen Deutungen »moderne« Phänomene wie die gewillkürten, auf Konsens und Vertrag beruhenden Einungen (Conjurationen) seit dem Frühmittelalter, von denen bedeutende Wirkungen bis in die Moderne ausgegangen sind (es sei nur an die Stadtkommune und an die Universität erinnert)? Außer Betracht bleibt hier auch die Verrechtlichung der okzidentalen Kultur durch die Aneignung des antiken Rechts und überhaupt die Verwissenschaftlichung dieser Kultur durch die dreifache Antikenrezeption (Philosophie, Recht, Medizin). Ausgeschlossen bleibt die Tatsache, dass im Nominalismus des 14. Jahrhunderts schon längst eine Wissenschaft begründet wurde, die jeglicher Metaphysik, Ontologie und Kosmologie den Boden entzog und die in der Begründung der wissenschaftlichen Erkenntnis auf das Einzelne allen Varianten ›moderner‹ Wissenschaft bis heute zugrunde liegt. Luhmann kennzeichnet die Gesellschaft des Mittelalters als »segmentäre« und »stratifikatorische« Gesellschaft, und er stellt ihr die moderne Gesellschaft mit dem Prinzip der funktionalen Differenzierung gegenüber; »diese Differenzierungsform« sei »nur ein einziges Mal realisiert worden: in der von Europa ausgehenden modernen Gesellschaft« (Bd. 1,1980, S. 27). Bei näherer Betrachtung sieht es freilich ganz anders aus: keineswegs ist die Gesellschaft des Mittelalters nur »segmentär« oder nur »stratifikatorisch«; vielmehr findet sich schon im Mittelalter der Einzelne in einer Vielzahl von gruppenbezogenen Identitäten: in Familie, Haus, Geschlecht, gewiss – aber auch in Gilde, Zunft, Bruderschaft, Kommune und anderen Formen eines auf Konsens begründeten, 193
OTTO GERHARD OEXLE
gruppenbezogenen Vertragsverhältnisses und von »Verbrüderungen« (M. Weber). Und ebenso konstitutiv ist die Spannung zwischen ständischer Schichtung und den diese Stände nivellierenden oder übergreifenden Formen der Bindung, wie sie jede Gilde und jede bäuerliche oder städtische Kommune darstellt. Die spannungsreiche Gemengelage vielfältiger und unterschiedlicher Formen der Gruppenbindung; die Spannung zwischen ›natürlichen‹ und ›gemachten‹ (›künstlichen‹) Bindungen des Individuums in Gruppen; die Polarität von Ständebildung und Gruppenbindungen; die immer wieder neu einsetzende Ausformung von Gruppen mit ihrerseits entstehender ständischer Qualität – dies alles charakterisiert die Gesellschaft des mittelalterlichen Okzidents; und diese Gesellschaft ist in ihrer Struktur ebenso singulär wie die aus ihr entstandene Kultur der okzidentalen Moderne. Nun verhält es sich freilich keineswegs so, dass dieses und vieles andere dieser Art erst entdeckt werden müsste. Der vielgerühmte (aber offensichtlich wenig gelesene) Otto Hintze hat in seiner fulminanten Abhandlung über Weltgeschichtliche Bedingungen der Repräsentativverfassung von 1931 die »mittelalterliche ständische Verfassung« und die »moderne Repräsentativverfassung« als »Glieder einer zusammenhängenden historischen Entwicklungsreihe« gesehen und in der umfassenden Darstellung dieses Sachverhalts ein noch heute exemplarisches (und zugleich ein in der deutschen Wissenschaftstradition singuläres) Muster einer integrierenden Sozial-, Verfassungs- und Mentalitätengeschichte vorgelegt. Der französische Mediävist Marc Bloch wiederum hat in seinem Buch La société féodale von 1939/40 (deutsche Übersetzung unter dem Titel Die Feudalgesellschaft, 1982), in prononciertem Gegensatz zu den aus dem 18. und 19. Jahrhundert tradierten Denk-Schemata vom »Feudalismus«, die Vasallität als Vertragsverhältnis dargestellt, als ein Vertragsverhältnis, das sich in einem Gegensatz polarer Spannung befand zu allen auf Familie und Verwandtschaft beruhenden Bindungen des Individuums und zugleich in einem Spannungsverhältnis mit den auf Konsens und Vertrag beruhenden Bindungen von der Art jener, die in den Schwureinungen und Kommunen in Erscheinung traten. Und vor allem Max Weber hat in seiner historisch ungewöhnlich reichhaltigen Theorie der Genese des Okzidents das okzidentale Mittelalter in eine Antike und Mittelalter, Frühe Neuzeit und Moderne umfassende diachronische Betrachtung einbezogen, die zugleich auch außereuropäische Kulturen vergleichend berücksichtigte. Auch er widmete im Hinblick auf das Mittelalter den Vertragsverhältnissen, den konsensuellen, ›gewillkürten‹ Bindungen der Menschen, die auf Interessenwahrnehmung, Interessenverbindung und Interessenausgleich beruhen, seine besondere Aufmerksamkeit, weil gerade von ihnen bedeutende geschichtliche Wirkungen für die Moderne ausgegangen sind. Man lese dazu Webers Abhandlung über Die Stadt (postum veröffentlicht 1920/21) oder seine 194
LUHMANNS MITTELALTER
Ausführungen über das spezifisch okzidentale Phänomen der »Verbrüderung« in den Gesammelten Aufsätzen zur Religionssoziologie oder die Ausführungen über die geschichtliche Bedeutung der ›Willkür‹, also der gruppenbezogenen »Sonderrechtsinstitute« der »Einverständnisgemeinschaften oder vergesellschafteten Einungen« und über ihre Auseinandersetzung mit der »politischen Anstalt« (in der Rechtssoziologie von Wirtschaft und Gesellschaft). Gleichartiges gilt für Webers Interesse am mittelalterlichen Mönchtum als einer außerordentlich folgenreichen Form »systematischer«, »disziplinierter«, »methodischer« Lebensführung in Gruppen und deren Folgen für die Modernisierung in den nachmittelalterlichen Jahrhunderten. Sich an dieses und vieles andere zu erinnern bedeutet, sich darüber klarzuwerden, dass eine Theorie der Modernisierung, die das Mittelalter (in einer Reduzierung auf »Feudalgesellschaft« oder »Ständegesellschaft«) als den Gegensatz zur Moderne hinstellt, unzulänglich bleibt, weil sie von vornherein nicht in der Lage ist, die Modernität des okzidentalen Mittelalters und damit die mittelalterlichen Voraussetzungen der Modernisierung in ihre Überlegungen einzubeziehen, und das heißt: ihre eigene Komplexität deutlich zu erhöhen. In anderen wissenschaftlichen ›Semantiken‹ der Moderne ist, so meine ich, diese Frage umfassender und deshalb besser erörtert, weil sie das Mittelalter nicht durch Abstoßung ausschließen, sondern als Erklärungsfaktor für die Dynamik der Modernisierungsvorgänge im Okzident von vornherein einbeziehen. Sehr anschaulich manifestiert sich das Dilemma übrigens auch in Luhmanns Rechtssoziologie, die – in eklatantem Gegensatz zur Rechtssoziologie Max Webers – dem Mittelalter nur den Typus des traditionalen, des »guten, alten« Rechts zubilligt, um die Vorstellung von der Rechts-Setzung und von der Veränderbarkeit des Rechts der Moderne zu reservieren (dazu treffend die Kritik von J. Rückert, Autonomie des Rechts in rechtshistorischer Perspektive, 1988, S. 19ff.). Dabei werden die Schübe mittelalterlicher Gesetzgebung seit dem 12. Jahrhundert (dazu A. Wolf, in: H. Coing (Hg.), Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Bd. 1, 1973, S. 517ff.) ebenso übersehen wie die durchgängige Existenz gruppengebundenen, gewillkürten ›Sonderrechts‹ im ganzen Mittelalter. (2) Luhmanns Theorie der modernen Gesellschaft mit ihrer These vom Prozess fortschreitender Individualisierung verfährt also nach einem traditionellen, historisch gewordenen und historisch vermittelten Muster von Deutungen der Geschichte. Das Wahrnehmungsmodell ›Von der stratifikatorischen zur funktionalen Differenzierung‹ entspricht außerdem älteren Schemata der Theoriebildung, deren »Erklärungsduktus« es wiederholt, etwa dem vom evolutiven Prozeß der fortschreitenden Rationalisierung (das man gerne Max Weber unterschiebt, vgl. W. Schluchter, Die Entwicklung des okzidentalen Rationalismus, 1979); 195
OTTO GERHARD OEXLE
oder dem Schema vom fortschreitenden Prozess der Zivilisation, von der grobianischen zur polizierten Gesellschaft (Norbert Elias, Über den Prozeß der Zivilisation, 21969); oder dem Schema der fortschreitenden Säkularisierung, als eines Wandels von einer christlichen Gesellschaft zu einer aufgeklärten. Wie problematisch solche Wechselseitig exklusiven Deutungen des Wandels »vom Mittelalter zur Moderne« sind, erweist sich immer dann, wenn man auch hier »unbequeme« Überlegungen und Sachverhalte in die Betrachtung einbezieht: mit der Frage zum Beispiel, ob denn das Mittelalter wirklich eine christliche »Einheitskultur« war (allein schon die Profanitäts-Schübe der mittelalterlichen Gesellschaft, zum Beispiel in der Rechtsrezeption oder in der Entstehung dessen, was man die ›Höfische Kultur‹ nennt, lassen daran zweifeln), oder ob denn die Moderne wirklich so profan ist, wie oft behauptet wird (die zunehmende Rolle von Religion und Religiosität – nicht Kirchlichkeit! – in den modernen Gesellschaften lässt auch daran zweifeln). Die auffallende Parallelität solcher Deutungsmuster scheint ihre Tauglichkeit im Einzelnen zu reduzieren; zumindest müsste diese vor dem vergleichenden Hintergrund aller dieser modernisierungstheoretischen Ansätze auf der Grundlage einer Gegenüberstellung von Mittelalter und Moderne einmal geprüft werden. Auch darin scheint also zunächst einmal eine umfassende Historisierung der Theorien geboten. Auffallend ist jedenfalls auch der gemeinsame Gegensatz zu jenen Mittelalter-Deutungen, wie sie von M. Weber, O. Hintze und M. Bloch (später u.a. auch von O. Brunner) vorgeschlagen wurden; im Gegensatz zu den eben genannten beruhen sie nicht auf dem Kontrast von Mittelalter und Moderne, sondern sie fragen nach der Modernität des Mittelalters und damit nach den mittelalterlichen Bedingungen der Moderne. Der Prozess der Modernisierung wird dann nicht vom vormodernen Mittelalter abgesetzt, er wird vielmehr so gefasst, dass das Mittelalter mit einbezogen ist. Diese Ansätze sind deshalb allein schon ihrer empirischen Grundlage nach viel breiter angelegt. (3) Luhmann hat auf die wechselseitige Bedingung von Historismus und Funktionalismus in der Moderne hingewiesen: »Historismus und Funktionalismus entstehen gleichzeitig und hängen zusammen« (Gesellschaftsstruktur und Semantik, Bd. 1, S. 9). Die Historisierung seiner eigenen funktionalistischen Theorie hat er jedoch vermieden. Vielleicht spricht er dieser Theorie sogar ›Objektivität‹ zu; zumindest suggeriert er das. Das Vermeiden der Historisierung beruht aber vielleicht bloß auf einem Missverständnis. Denn bedeutet Historisierung wirklich eine Relativierung? Oder ist sie nicht viel eher ein Ansporn dazu, die Theoriebildung auf eine ganz neue Ebene zu heben? Max Webers Reflexionen geben dazu reichlich Stoff zum Nachdenken. Denn Max Weber hat die historische Bedingtheit seines Denkens nie zu verbergen versucht, sondern er hat stets aufs deutlichste ausgesprochen, dass er sich selbst als »Mitglied der bürgerlichen Klassen«, über die er schrieb, erkannte, als 196
LUHMANNS MITTELALTER
einen »Sohn« seiner Zeit und seiner Kultur und ihrer Geschichte. Er selbst wies immer wieder darauf hin, dass seine Wahrnehmungsweisen und Erkenntnisse sozial und historisch bedingt seien, so auch in seiner berühmten ›Vorbemerkung‹ zum ersten Band der Gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie (1920). Am Ende dieses Essais hat er (was wenig zur Kenntnis genommen wurde und wird) die Konsequenz aus der Einsicht in die historisch-kulturelle Vermitteltheit aller Erkenntnis gezogen: mit dem Hinweis darauf, dass er »allen Grund« habe, »über den Wert seiner Leistung sehr bescheiden zu denken«; mit der nachdrücklichen Empfehlung an den Leser, sich des »vollkommen provisorischen Charakters« dieser Aufsätze bewusst zu sein; und mit der Feststellung, dass sie dazu bestimmt seien, »bald ›überholt‹ zu werden«, und zwar »in einem ungleich stärkeren Maß und Sinn..., als dies letztlich von aller wissenschaftlicher Arbeit gilt«. Ich neige zu der Auffassung, dass die offensichtlich nicht nachlassende Faszination, die noch heute (und derzeit wieder einmal zunehmend) in allen Kulturwissenschaften von den Arbeiten Max Webers ausgeht, mit bedingt ist durch Webers klare Einsicht in die Historizität, in die Aspektivität und Relationalität seiner eigenen Erkenntnis.
197
Niklas Luhmann
Mein »Mittelalter« Bei allem modischen Bemühen um Dezentrierung – ich frage mich doch, weshalb ein Buch, dessen Thesen sich mit dem 17. und 18. Jahrhundert befassen und dessen Material vorwiegend dieser Zeit entnommen ist, im Blick auf seine Behandlung des Mittelalters rezensiert wird. Immerhin gibt das den Anlaß für einige Bemerkungen zu dieser Epochenbezeichnung. Wenn ich das Mittelalter, die mittelalterliche Gesellschaft, die mittelalterliche Semantik usw. erwähne, denke ich nur an eine eingeführte Epochenbezeichnung, die den Vorteil hat, daß man nicht genauer angeben muß, wovon man redet. Die Rede vom Mittelalter erspart einem scharfe Abgrenzungen, wie sie etwa mit Jahresdaten verbunden wären, und markiert zunächst einmal nur, daß es viele Unterscheidungen gibt, auf die es im vorliegenden Zusammenhang nicht ankommt. Solche offene oder latente Markierung der Nichtmarkierung ist Voraussetzung für jeden Einsatz theoretischer Begrifflichkeit. Der Begriff des Mittelalters ist aber, wenn überhaupt ein Begriff, jedenfalls kein theoretisch fixierter, theoretisch verwendbarer Begriff. Inhaltliche Aussagen über das, was im Mittelalter vorkam, sind damit noch nicht festgelegt. Die Auswahl dessen, was in bestimmten Theoriezusammenhängen bedeutsam wird, entscheidet sich erst auf Grund der Ausarbeitung der Theorie. Wenn (und nur wenn) es um die Genese der an Funktionen orientierten Form gesellschaftlicher Differenzierung geht (und das war mein Thema), kommt als Gegenbegrifflichkeit die Form der Rangdifferenzierung, der Stratifikation, in Betracht. Meine Hypothese ist außerdem, daß eine deutliche Prominenz einer bestimmten Differenzierungsform die damit der Gesellschaft auferlegten Beschränkungen sichtbar werden läßt, und daß gerade dies dazu dienen kann, den Bedarf für, und den Vollzug von, radikalen Änderungen deutlich werden zu lassen. Das geschieht aber nicht im Mittelalter. Die dafür relevante Diskussion von Adelskriterien hat, wenn man von der juristischen Diskussion seit dem 14. Jahrhundert einmal absieht, ihren Schwerpunkt in der zweiten Hälfte des 16. und im frühen 17. Jahrhundert1. Sie ist aber, wie viel diskutiert wird, bereits Symptom einer Krise des Adels. Krise des Adels, darunter kann man die Finanzprobleme der alten Familien verstehen oder auch das Nachdrängen immer neuer Familien in 1 Siehe nur Ellery Schalk, From Valor to Pedigree: Ideas of Nobility in France in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Princeton N.J. 1986; Claudio Donati, L’idea di nobiltà in Italia: Secoli XIV–XVIII, Roma – Bari 1988.
198
MEIN »MITTELALTER«
die Zone der Steuerfreiheit oder auch die politische Praxis, heterogene Territorien in der neuen Form des Staates durch Nobilitierungen zu konsolidieren. Auch das sind keine Affären des Mittelalters. Aber die allgemeine These, daß es, soziologisch gesehen, um ein Auswechseln der vorherrschenden Form gesellschaftlicher Differenzierung geht, weist ins Mittelalter zurück; und sie wäre empirisch empfindlich für den Fall, daß sich herausstellen sollte, daß es im Mittelalter keinen Adel und keine stratifizierte Gesellschaftsordnung gegeben habe. Die Annahme einer solchen Ordnung schließt nicht aus, daß man auch die bereits anlaufenden Trends zu funktionaler Differenzierung bis ins Mittelalter zurückverfolgen kann – etwa die soeben angedeuteten Erscheinungen der Geldwirtschaft und der stadtstaatlichen bzw. territorialstaatlichen Politik, deren Auswirkungen auf den Adel dann zum Problem werden. Die Tragweite von Stratifikation ist, wie die Tragweite jeder Differenzierungsform, immer dadurch begrenzt, daß sie Inklusionen und Exklusionen erzeugt, so daß für Exklusionen sozial akzeptable Auffangvorrichtungen bereitgestellt werden müssen. Das war nicht Thema des rezensierten Buches, würde aber manche nicht-behandelte Einrichtungen des Mittelalters und der Frühmoderne erklären können. Zum Beispiel Korporationen wie Klöster und Militärorganisationen. Die Inklusion / Exklusion wird über Familienhaushalte geregelt (den heutigen Familienbegriff gibt es noch nicht). Daher werden haushaltslose Existenzmöglichkeiten zum Problem. Man kann Mönch oder Nonne sein, Soldat oder Bettler. Auch Piratenschiffe nehmen solches Personal auf. Und natürlich ist die Lebenserwartung geringer; Ausgeschlossene, deren Zahl man nicht unterschätzen sollte, dezimieren sich schneller. Was Semantik betrifft, muß man dem Umstande Rechnung tragen, daß die normalen Reziprozitätserwartungen unterbrochen sind. Das Problem läßt sich über Himmel oder Hölle lösen, über eine seelenheilswirksame Stiftungs- und Schenkungsökonomie oder über Kriminalität. Ein direkter Bezug zur Stratifikation ist dann nicht mehr so leicht zu erkennen. Aber vieles, was es im Mittelalter »auch noch gibt«, ließe sich auf diese Weise der Differenzierungsform zuordnen – vor allem, wenn man die Überlegung weiterverfolgt, daß sich diese Ordnung der Exklusionen beim Übergang zu funktionaler Differenzierung ebenfalls ändern wird. Das Modell für die »totale Institution« korporativer Aufnahme von Ausgeschlossenen ist heute die psychiatrische Anstalt2, das Modell für Lebensformen von aus allen Funktionsbereichen Ausgeschlossenen etwa die brasilianischen »favelas«. Immer aber zwingt die Spezifikation solcher Forschungsinteressen dazu, viele andere Dinge, die es im Mittelalter gegeben hat, beiseite zu lassen. Daß es in den Städten »bürgerliche« Schichten gibt, ist geradezu 2 Siehe Erving Goffman, Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, Chicago 1961.
199
NIKLAS LUHMANN
eine Voraussetzung für die Ausdifferenzierung einer Adelsschicht. Man sollte mir nicht unterstellen, daß ich das übersehen hätte. Auch sonst wäre Unzähliges zu nennen und je nach Themenzuschnitt auch für die Geschichte der Änderung der Differenzierungsform relevant zu machen. Das Common Law entwickelt sich auf Grund einer hochzentralisierten Königsherrschaft in Differenz zum kanonischen Recht und zum Zivilrecht, und es mag bedeutsam gewesen sein, daß die Richter wegen der schlechten Straßenverhältnisse im Winter nicht reisen konnten, sondern am Kamin saßen und, wie Juristen es eben tun, über ihre Fälle plauderten3. Aber erst im Konflikt mit dem Stuart-Regime entwickelt sich eine deutliche Differenz von politischem System und Rechtssystem, und James I muß sich von Coke darüber belehren lassen, daß seine natural reason nicht ausreichte, um die artificial reason einer langen Rechtstradition zu begreifen und zu beeinflussen. Oder: doppelte Buchführung wird aus nicht genau bekannten, vielleicht im Verhältnis zu Banken liegenden Gründen im Mittelalter entwickelt; aber ein Instrument planmäßiger Informationsgewinnung für Zwecke der Unternehmensführung wird sie wohl erst im 19. Jahrhundert. Oder: die aus der Antike bekannten Mischformen von oraler und literaler Kultur mit Schwerpunkt in der Oralität4 beginnen sich im Mittelalter in Richtung auf Schrift zu verschieben. Viele Erfindungen (große, organisierte Schreibwerkstätten, Paginierungen usw.) sind bereits gemacht, als die Erfindung der mechanischen Druckpresse unter gleichzeitig vorhandenen Marktbedingungen (Differenzierung von Wirtschaft gegen Politik und Religion) die Situation rasch und irreversibel verändert5. Es liegt mir, um nur noch dies zu sagen, ganz fern, den Phänomenreichtum des Mittelalters zu unterschätzen, nur kommt man, wissenschaftlich gesehen, nicht sehr weit, 3 Wer diese Konstruktion für zu gewagt hält, mag sich an einen Rechtshistoriker halten. Siehe Mathew Hale, The History of the Common Law of England, posthum 1713, zitiert nach der Ausgabe Chicago 1971, S. 162, der die Kohärenz des Common Law zurückführt auf die zwölf Richter in Scharlach-Roben, die »acquaint one another with their judgements, sit near one another in Westminster Hall, whereby their judgements are necessarily communicated to one another ...« 4 Siehe für die Allmählichkeit und Differenziertheit des Lernvorgangs, der immer mehr Möglichkeiten der Ausnutzung von Schrift einführt, Rosalind Thomas, Oral Tradition and Written Record in Classical Athens, Cambridge Engl. 1989. Das vorherrschende Forschungsinteresse richtet sich allerdings immer noch auf die inzwischen wohl unbestrittene Resistenz der Oralität gegen Schrift. 5 Hierzu jetzt, diesen Bruch betonend, Michael Giesecke, Der Buchdruck in der frühen Neuzeit: Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien, Frankfurt am Main, im Druck.
200
MEIN »MITTELALTER«
wenn man versucht, all dies unter dem Begriff des Mittelalters zusammenzufassen. Daß die Soziologie, um damit zu schließen, ebenso wie die Geschichtswissenschaft für alle ihre Aussagen »Objektivität« in Anspruch nimmt, versteht sich von selbst. Wie anders könnte sie behaupten, Wissenschaft zu sein? Das schließt aber Reflexion ihres eigenen historischen und gesellschaftlichen Standorts nicht aus, sondern ein. Ich sehe nicht, wie das, wie Oexle andeutet, sich wechselseitig ausschließende Optionen sein könnten. Im Gegenteil: gerade wenn eine soziologische Theorie universelle Geltung für alles Soziale beansprucht, muß sie sich selbst einschließen, sich selbst in ihrem eigenen Objektbereich vorfinden. Das gilt für alle Wissenschaften, auch zum Beispiel für die Physik, und gehört zu den Einsichten, die sich in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten in den »co gnitive sciences« durchgesetzt haben. Auch der Physiker kann nur beobachten und seine Beobachtungsinstrumente verfeinern, wenn er physikalisch funktioniert; der Linguist spricht über Sprache; Freud hat seine Theorien zur Selbstsublimierung erfunden (wenn man ihm überhaupt glauben darf); und ebensowenig habe ich ein Problem damit, zu konzedieren, daß die Soziologie zur Selbstbeschreibung der modernen Gesellschaft in der modernen Gesellschaft beiträgt und ihre Überzeugungsmittel der gesellschaftlichen Kommunikation verdankt, die sie erforscht. Aber das ist ein Zugeständnis, das die Objektivitätsbedingungen der Forschung nicht beeinträchtigt, denn Objektivität kann es überhaupt nur unter diesen Bedingungen geben.
201
III Genossenschaften in Gegenwart und Zukunft
Oscar Kiesswetter
Merkmale und Besonderheiten der italienischen Genossenschaften 1. Die Ursprünge der italienischen Genossenschaftsbewegung aus geopolitischer und ideologischer Sicht Um aktuelle und bevorstehende Entwicklungen des Genossenschaftswesens in Italien zu verstehen, muss man die besondere politische Situation bei der Entstehung der ersten Kooperativen, aber auch die im XX. Jahrhundert erreichte wirtschaftliche Bedeutung gegenwärtig halten. Die ersten cooperative sind Mitte des 19. Jahrhunderts zeitgleich mit jenen in anderen europäischen Ländern, somit noch vor der Gründung des italienischen Königreichs entstanden.1 Sie haben von Anfang an auch einen im internationalen Vergleich besonderen, zweiten Förderauftrag übernommen, der als Folge der damaligen geopolitischen Situation entstanden ist. 1.1 Geopolitische Lage und soziale Funktion der genossenschaftlichen Selbsthilfe Nach dem Ausbruch blutiger Aufstände gegen soziale und wirtschaftliche Missstände im Königreich Piemont-Sardinien hatte der Monarch Karl Albert von Savoyen im Jahre 1848 das nach ihm benannte Albertinische Statut als erste Verfassung in einem italienischen Reich erlassen. Darin wurde den Untertanen das Recht auf freie, unbewaffnete Versammlungen2 gewährt und diese Vereinsfreiheit ermöglichte die Gründung erster, auf kollektiver Selbsthilfe basierender Vorhaben.3 1 Die Unità d’Italia, die Einigung der verschiedenen italienischen Teilgebiete zu einem einzigen Königreich, erfolgte 1861. 2 Art. 32 des Albertinischen Statuts lautet in der deutschen Übersetzung des Autors: Es wird das Recht anerkannt, sich friedlich und unbewaffnet zu versammeln, unter Einhaltung der Gesetze, die eine Ausübung (des Versammlungsrechts – Anm. des Autors) im öffentlichen Interesse regeln können. 3 Diese Rahmenbedingungen ermöglichten im Jahre 1854 die Eröffnung der ersten Konsumgenossenschaft in Turin und 1856 die Gründung der ersten Produktionsgenossenschaft in der heutigen Provinz Savona, beide im Gebiet
205
OSCAR KIESSWETTER
Das von demselben Monarchen am 17. März 1861 ausgerufene Königreich Italien vereinigte erstmals seit der Antike nahezu alle von italienischsprachiger Bevölkerung bewohnten Gebiete zu einem einzigen Nationalstaat.4 Die neue parlamentarische Monarchie war allerdings von einer schwerwiegenden Zweiteilung zwischen dem wohlhabenderen, strukturierten Norden des Landes und dem ärmeren, ländlich geprägten Mezzogiorno in Süditalien gekennzeichnet. Das Ungleichgewicht spitzte sich mit der intensiven Industrialisierung Norditaliens5 weiter zu, wobei ein ineffizienter, von der Einigung überforderter Verwaltungsapparat eine Vereinheitlichung der Gesetzeslage6 nur schleppend vorantreiben und in den ehemals verfeindeten Teilgebieten lediglich mangelhafte Dienst- und Sozialleistungen erbringen konnte. Diese Situation bildete die Voraussetzungen für die Entwicklung eines zusätzlichen, im internationalen Vergleich heute noch einzigartigen Förderauftrages. Denn während sich in anderen Ländern die Mitglieder in Genossenschaften zusammenschlossen, um gemeinsam wirtschaftliche Leistungen zu erbringen, versuchte das italienische Unternehmensmodell, auch fehlende oder unzureichende Leistungen der öffentlichen Hand mit echter Subsidiarität zu ergänzen. Ihre sozialen Zusatzleistungen richteten Genossenschaften nicht nur an die eigenen Mitglieder, sondern dehnten sie, als eine Art zweiter Förderauftrag, auch auf andere Zielgruppen aus. In Anbetracht des damaligen Königreichs Sardinien-Piemont..Die ersten Genossenschaften setzten sich für die Förderung der von Landflucht und Industrialisierung an den Rand der Gesellschaft gedrängten Menschen ein und ihr ursprünglicher Förderauftrag galt den Mitgliedern, für die man gemeinsam bessere Arbeitsbedingungen und Einkaufsmöglichkeiten oder günstigere Kredite erzielen wollte. 4 Die Hauptstadt war anfangs Turin, wo bereits der König und das Parlament von Piemont-Sardinien ihren Sitz hatten, 1865 wurde sie nach Florenz und 1871 endgültig nach Rom verlegt, nachdem 1870 auch der Kirchenstaat erobert und in das Königreich eingegliedert worden war. 5 Die Industrialisierung löste zwar ein zaghaftes Wirtschaftswachstum aus, verursachte aber gleichzeitig eine starke Landflucht und Zuwanderung aus dem Süden, weil zahllose Tagelöhner in die Städte drängten, wo arbeitsintensive Industriebetriebe angesiedelt waren und die Baustellen großer öffentlicher Projekte standen. 6 Die genossenschaftliche Gesellschaftsform wurde im Handelskodex aus dem Jahr 1882, dem ersten umfassenden Zivilgesetzbuch des vereinten Königreichs Italien, verankert. Um die Genossenschaften von den Aktiengesellschaften wirksam abzugrenzen, entnahm der Gesetzgeber die Prinzipien der demokratischen Governance unmittelbar aus der gängigen Praxis. Das ProKopf-Stimmrecht, die Höchstgrenze des Kapitaleinsatzes und die Möglichkeit, ohne Satzungsänderungen neue Mitglieder und Kapitalanteile aufzunehmen, erhielten dadurch ihre erste gesetzliche Anerkennung.
206
MERKMALE UND BESONDERHEITEN DER ITALIENISCHEN GENOSSENSCHAFTEN
zunehmender Landflucht und Auswanderung trat die genossenschaftliche Selbsthilfe an die Stelle fehlender staatlicher Sozialleistungen und verwirklichte schlagkräftige Initiativen zum gemeinsamen Unfallschutz und zur Absicherung alter oder arbeitsunfähiger Mitglieder bzw. ihrer Hinterbliebenen, die in den Städten nicht mehr auf die Hilfsbereitschaft der ländlichen Großfamilien zurückgreifen konnten und auf das Almosen meist kirchlicher Institutionen angewiesen waren. Gleichzeitig entstanden auch genossenschaftsähnliche wechselseitige Hilfsorganisationen, die erste Ansätze von Sozialleistungen bei Unfall, Krankheit und Arbeitslosigkeit gewährten und Gelder für die Ausbildung der Kinder und die Absicherung der Witwen bereitstellten. Die società operaie di mutuo soccorso (Deutsch: Wechselseitige Arbeiterhilfsgesellschaften) hatten sich dieselben Grundsätze gegeben wie die unternehmerisch ausgerichteten Genossenschaften, übten aber keine eigene gewerbliche Tätigkeit zur Mitgliederförderung aus.7 Als eine Organisationsform, die parallel zu den genossenschaftlichen Unternehmen entstand, trugen die Hilfsgesellschaften entscheidend zum sozialen Verantwortungsgefühl der Genossenschaften bei. 1.2 Die intellektuelle Differenzierung und ihre langfristigen Folgen Die zunehmende Verbreitung genossenschaftlicher Initiativen wurde von den vorherrschenden Denkrichtungen mit differenzierten Ansätzen begleitet, sowohl in der liberalen Weltanschauung als auch in der Arbeiterbewegung und in der frühen kirchlichen Soziallehre. –
Die Demokraten mit ihrem Vordenker Giuseppe Mazzini setzten auf Genossenschaften, um die wirtschaftliche Entwicklung Italiens voranzutreiben und die schwächeren Teile der Gesellschaft zu schützen. Die These, dass Kapital und Arbeit in dieselben Hände gehören und das gemeinsame Interesse über dem Gewinnstreben eines Einzelnen stehen muss, wurde zu einem Grundsatz der genossenschaftlichen Theorie. In dieser Unternehmensform sollten die Arbeiter über reine Lohnforderungen hinauswachsen und in der Unternehmensverwaltung eine demokratisch verteilte Verantwortung übernehmen. Die Annäherung des Proletariats an die bürgerliche Mittelschicht sollte nicht mit Streikmaßnahmen und
7 Die Anhänger des bedingungslosen Industrialisierungsfortschritts befürchteten, dass diese selbstverwalteten Vereinigungen auch Forderungen nach sozialer Sicherheit, angemessener Entlohnung oder gar das Streikrecht erheben könnten und zwangen sie dazu, sich in den Satzungen ausdrücklich und ausschließlich auf soziale Hilfeleistungen bei Krankheit, Unfall und Arbeitsunfähigkeit ihrer Mitglieder zu beschränken.
207
OSCAR KIESSWETTER
–
–
Klassenkampf erfolgen, sondern durch die Eigeninitiative der genossenschaftlich organisierten Arbeiter. Dieser Ansatz war in den Augen Mazzinis der richtige Weg, um Armut, Bildungsrückstände und soziale Ungerechtigkeiten zu überwinden. Genossenschaften wurden als soziale und demokratische Weiterentwicklung des rein kapitalistischen Unternehmertums betrachtet, das sich im industrialisierten Norden Italiens auf dem Vormarsch befand und von verheerenden sozialen Auswirkungen begleitet war. Die italienischen Sozialisten sahen hingegen in der Gründung von Genossenschaften eine nahezu gewerkschaftspolitische Forderung, da man kooperative Unternehmen als Mittel für die Emanzipation der Arbeiterklasse betrachtete. Während die Gewerkschaften das Spannungsverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber für sich beanspruchten, galten Genossenschaften als das Instrument, um die allgemeinen Lebensbedingungen der Arbeiter zu verbessern. Die junge italienische Genossenschaftsbewegung begann damals, sich in Verbänden zu organisieren und dehnte ihren Wirkungsbereich auf nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens aus. Aus gewerkschaftlicher Sicht trug sie dazu bei, die Interessen der Arbeiter zu wahren, die Gegensätze zwischen Kapital und Arbeit zu überwinden und den Klassenkampf in eine pragmatische Richtung zu lenken. Die Beziehung zwischen der mächtigen katholischen Kirche und der italienischen Genossenschaftsbewegung war von einer staatspolitischen Entwicklung beeinflusst: Am 20. September 1870 besetzten italienische Truppen den bisher unabhängigen Kirchenstaat und gliederten ihn in das Königreich ein. Die Kirche antwortete auf den Verlust ihrer weltlichen Macht und aller bisherigen Privilegien mit der Exkommunikation des Königshauses und mit dem Verbot für Katholiken, aktiv am politischen Leben teilzunehmen.8 Dies hatte zur Folge, dass Katholiken sich verstärkt in sozialer Hinsicht engagierten. Papst Leo XIII. rief in der am 15. Mai 1891 veröffentlichten Enzyklika Rerum Nova rum die Gläubigen zu verstärkter Bewusstseinsbildung und aktiver Präsenz gegenüber den sozialen Problemen in der Arbeitswelt
8 Im Jahr 1874 erließ Papst Pius IX. die erst 1919 von Papst Benedikt XV. widerrufene Bulle Non expedit (Deutsch: Nicht angebracht), d. h. ein politisches Engagement war für Katholiken nicht angebracht, was zu einem Verzicht auf das passive Wahlrecht und zu einer langjährige Stimmenthaltung bei politischen Wahlen führte und fünfzig Jahre lang keine katholische Partei entstehen ließ. Die Versöhnung zwischen Kirche und Reich erfolgte erst 1929 mit den Lateranverträgen, die Rom als Hauptstadt Italiens und im Gegenzug die völkerrechtliche Souveränität des Vatikans anerkannten.
208
MERKMALE UND BESONDERHEITEN DER ITALIENISCHEN GENOSSENSCHAFTEN
auf und empfahl die Bildung von katholischen Gewerkschaftsorganisationen sowie von Unternehmen, in denen Arbeiter am Eigentum beteiligt waren.9 Der Einsatz der Katholiken konzentrierte sich in der Folge auf das Bankwesen, um mit genossenschaftlicher Selbsthilfe Armut und Wucher in ländlichen Gebieten zu bekämpfen. Pioniere in diesem Bereich waren vielfach Priester, die eine echte katholische Geldorganisation aufbauten.10 Diese drei Seelen der italienischen Genossenschaftsbewegung vernetzten sich und gründeten 1886 in Mailand eine nationale Föderation mit dem Auftrag, die stark differenzierten Mitglieder zu koordinieren und eine einheitliche Entwicklung derselben zu fördern.11 Die spürbare kulturelle und ideologische Differenzierung gegenüber dem sozialistischen Genossenschaftsansatz, die starke Gründungswelle kirchennaher Kooperativen und die Absicht, die katholischen Kräfte bei der Bewältigung der Probleme der Nachkriegszeit zu koordinieren, führten am 14. Mai 1919 zum Austritt der katholisch geprägten Genossenschaften aus dem Sammelverband und zur Errichtung der eigenen Confederazione Cooperativa Italiana, der sich bis zum ersten Kongress 7.365 sog. weiße, d. h. der katholischen Sozialdoktrin nahestehende Genossenschaften anschlossen. Zu den langfristigen Folgen dieser ideologischen Differenzierung innerhalb der italienischen Genossenschaftsbewegung gehört auch eine entsprechend zersplitterte Verbandslandschaft, deren Organisationen jeweils politischen oder gewerkschaftlichen Lagern nahestanden. Erst 2014 unternahm die italienische Genossenschaftsbewegung einen Versuch der Vereinheitlichung, indem die drei größten nationalen Genossenschaftsverbände die Alleanza delle Cooperative Italiane gründeten, eine Allianz mit dem (immer noch fernen) Ziel, eine einheitliche Vertretung der italienischen Genossenschaften darzustellen.
9 Vgl. Rerum novarum 39: Wir gedenken hier der mannigfachen Genossenschaften, Vereine und geistlichen Orden … Gründungen der Kirche und der frommen Gesinnung ihrer Kinder… Der sittliche Charakter ihres Zweckes sagt schon der bloßen Vernunft, dass sie, auf dem Naturrecht gründend, ein natürliches und unbestreitbares Recht des Bestandes haben. 10 Die 1892 in Mira bei Venedig gegründete erste katholische Genossenschaftsbank schrieb in der Satzung als Bedingungen für Mitgliedschaft und Kreditgewährung einen ehrlichen und sittlich einwandfreien Lebenswandel und eine christliche Einstellung bei Kindererziehung und Sonntagsruhe vor. 11 Diesem ersten Genossenschaftsverband gehörten anfangs 248 Unternehmen mit 70.000 Mitgliedern an. Daraus ging 1893 die Lega delle Cooperative e delle Mutue hervor, die heute noch besteht.
209
OSCAR KIESSWETTER
2. Die Anerkennung der sozialen Funktion der Genossenschaften in der Verfassung der Republik Italien Die bedeutende Rolle der italienischen Genossenschaften beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und die Erfolge bei der Entwicklung Italiens vom Agrarland zur Industrienation änderten nichts am gemeinwirtschaftlichen Förderauftrag. Die wachsende Bedeutung der funzione sociale wurde in Artikel 45 der am 1. Jänner 1948 in Kraft getretenen Verfassung der Italienischen Republik12 mit folgendem Wortlaut ausdrücklich anerkannt: Die Republik erkennt die soziale Aufgabe des Genossenschaftswesens an, sofern es nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit und ohne Zwecke der Privatspekulation aufgebaut ist. Das Gesetz fördert und begünstigt mit den geeignetsten Mitteln seine Entfaltung und sichert durch eine zweckdienliche Aufsicht seine Eigenart und Zielsetzung.13 Diese im internationalen Vergleich seltene Verankerung in einem Grundgesetz war das Ergebnis langwieriger Verhandlungen unter den Abgeordneten, denn auch im verfassungsgebenden Konvent bestanden unterschiedliche politische Anschauungen des liberalen, katholischen und sozialistisch-kommunistischen Lagers, die mit der antifaschistischen Überzeugung in Einklang gebracht werden mussten. Umfang und Zielsetzung dieser Arbeit verhindern ein näheres Eingehen auf die Position der Kommunisten um Palmiro Togliatti, die neben dem individuellen und dem kollektiven (staatlichen) Eigentum die Genossenschaften als dritte Form des Eigentums im Grundgesetz definieren wollten. Auch die Forderung der Christdemokraten, die Genossenschaften ausdrücklich mit der christlich-sozialen Lehre zu verknüpfen und als eigenständige privatwirtschaftliche Unternehmensform anzuerkennen, kann hier nicht näher erörtert werden. Die eher allgemein gehaltene und bis heute unveränderte Formulierung konnte es vermeiden, der Genossenschaftsbewegung eine ideologische Färbung zu geben, da sie sich auf die Grundsätze beschränkte, die bei der Umsetzung der sozialen Aufgabe einzuhalten sind, um Anerkennung und Förderungen zu erhalten. 12 Am 2. Juni 1946 hatten sich die Italiener in einer Volksbefragung, bei der erstmals auch Frauen wahlberechtigt waren, mit einer Mehrheit von 54,27% für die Staatsform der Republik entschieden. Die gleichzeitig gewählte verfassunggebende Versammlung arbeitete in der Folge das republikanische Grundgesetz aus. 13 Offizielle deutsche Übersetzung der italienischen Verfassung, veröffentlicht von der Autonomen Region Trentino-Südtirol. Siehe www.regione.taa.it/ Moduli/943_COSTITUZIONE%202018.pdf (Abruf am 29.3.2020).
210
MERKMALE UND BESONDERHEITEN DER ITALIENISCHEN GENOSSENSCHAFTEN
Entsprechend kohärent erscheint aus heutiger Sicht auch die dem Staat übertragene Zuständigkeit für die Aufsicht über das Genossenschaftswesen. Diese muss gewährleisten, dass die Prinzipien der sozialen Relevanz und des Verzichtes auf private Spekulation, die als Voraussetzung für staatliche Förderungen gelten, in jeder Hinsicht eingehalten werden. Die Positionierung des Art. 45 im dritten Abschnitt der Verfassung unter der Überschrift Wirtschaftliche Beziehungen bedeutet eine eindeutige Zuordnung der Genossenschaften zur Unternehmenswelt, obwohl ihre Zielsetzung nicht in der Gewinnmaximierung besteht. Auch für sie gilt somit die von Art. 41 für die private Unternehmenstätigkeit vorgesehene Auflage, nicht gegen den gesellschaftlichen Nutzen und die Grundrechte von Freiheit, Sicherheit und menschlicher Würde zu verstoßen. Ihre von der Verfassung anerkannte Ausrichtung (auch) auf soziale Aufgaben macht eindeutige Gegenseitigkeitsbezogenheit zur Bedingung, um Anerkennung, Schutz, Förderung und Kontrolle seitens der Republik zu erhalten. Zur Abgrenzung gegenüber anderen Unternehmensformen mit einer stärkeren Eigenkapitalausstattung haben Genossenschaften jedoch die zusätzliche Pflicht, auf Privatspekulationen zu verzichten.
3. Aktuelle Dimension der italienischen Bewegung Die in diesem Beitrag erläuterten Besonderheiten italienischer Genossenschaften sind nicht nur für den internationalen Vergleich auf akademischer Ebene interessant, sondern auch in der gelebten Praxis. Sie betreffen nämlich ein Genossenschaftssystem, das zu den mitgliederund umsatzstärksten in Europa gehört und für die Beschäftigungsund Wirtschaftslage in Italien eine bedeutende Rolle spielt. Daher ist an dieser Stelle ein kurzer Blick auf eine kürzlich erschienene Studie des nationalen Statistikamtes angebracht, der man die aktuelle Dimension der genossenschaftlichen Unternehmenswelt in Italien entnehmen kann.14 Die Datenbasis bezieht sich zwar auf das Jahr 2015, aber trotz der schnelllebigen Entwicklung vor allem bei innovativen Modellen kleinerer Genossenschaften vermitteln die quantitativen Angaben einen korrekten Eindruck von Dimension und Potenzial des Sektors. 14 Das nationale Statistikamt ISTAT (www.istat.it) hat mit dem Forschungsinstitut EURICSE (www.euricse.eu) im Jahr 2019 einen Bericht über Struktur und Performance der italienischen Genossenschaften herausgegeben, der erstmals eine umfassende Analyse der Zusammensetzung und der Wirtschaftskraft dieser Unternehmen in Italien enthält. Siehe www.istat.it/it/ files/2019/01/Rapporto_cooperative.pdf (Zugriff: 30.3.2020).
211
OSCAR KIESSWETTER
Die 59.027 aktiven Genossenschaften sind nicht gleichmäßig über das Staatsgebiet verteilt.15 Sie entsprechen einem Anteil von nur 1,3% aller Unternehmen, beschäftigen aber 1,2 Mio. Mitarbeiter, d.h. immerhin 7,1% aller Beschäftigten Italiens. 85% dieser Mitarbeiter haben ein festes Anstellungsverhältnis. Die mit 28,6 Mrd. Euro berechnete Wertschöpfung entspricht einer Quote von 4,0% an der nationalen Wertschöpfung (ohne Banken und Versicherungen). Das System der italienischen Genossenschaften besteht zu 49,8% aus Arbeits- und zu 24,2% aus Sozialgenossenschaften; jeweils 6,5% sind landwirtschaftliche Produktions- und Konsumgenossenschaften. Bemerkenswert sind auch die 812 Konsortialbildungen und Unternehmensgruppen, die eine Genossenschaft an der Konzernspitze aufweisen und insgesamt 2.000 Unternehmen umfassen. Die Netzwerke unter genossenschaftlicher Führung weisen eine wesentliche stärkere Beschäftigungslage auf und erbringen doppelt so viel Umsatz als andere Gruppenbildungen.16 Dies beweist, dass italienische Genossenschaften das sechste I.C.A.-Prinzip der Kooperation zwischen Genossenschaften konsequent umsetzen.17
4. Besondere Merkmale des italienischen Genossenschaftswesens Das moderne italienische Genossenschaftswesen weist im internationalen Vergleich einige Besonderheiten auf, die in der Folge kurz aufgezeigt werden, wobei in diesem Abschnitt vor allem betriebswirtschaftliche Merkmale dieser Rechtsform behandelt werden, während im nächsten 15 Über 50% der aktiven cooperative sind in fünf Regionen konzentriert: Latium und Lombardei weisen einen Anteil von je 14% auf, gefolgt von Sizilien (10,5%), Kampanien (10,1%) und Apulien (9,3%). 16 Genossenschaftliche Unternehmensgruppen haben durchschnittlich 96,6 Mitarbeiter (andere Gruppen 20,7) und erbringen im Durchschnitt eine Wertschöpfung von 3,5 Mio. Euro (andere Gruppen 1,7 Mio. €). 17 Die International Co-operative Alliance (I.C.A., deutsch vielfach auch Internationaler Genossenschaftsbund I.G.B.) hat beim Kongress in Manchester im Jahre 1995 anlässlich ihres hundertjährigen Bestehens sieben Prinzipien definiert, die eine inzwischen weltweit anerkannte Definition des gemeinsamen Wertesystems genossenschaftlicher Unternehmen darstellen. Der sechste Grundsatz lautet: Genossenschaften dienen den Interessen ihrer Mitglieder am wirksamsten und stärken die Genossenschaftsbewegung am ehesten durch Zusammenarbeit zwischen den örtlichen, regionalen, nationalen und internationalen Strukturen.
212
MERKMALE UND BESONDERHEITEN DER ITALIENISCHEN GENOSSENSCHAFTEN
genossenschaftliche Erfolgsmodelle erörtert werden, die aus der sozialen Funktion einen eigenen Unternehmenszweck entwickelt haben. 4.1 Die Beschränkung der Gewinnverteilung Der in der Verfassung vorgeschriebene Verzicht auf Privatspekulationen18 wird mitunter irrtümlicherweise als ein Verbot der Gewinnerwirtschaftung für die genossenschaftlichen Unternehmen betrachtet, während lediglich der Gewinnverteilung klare Grenzen gesetzt sind, die im Zivilgesetzbuch eindeutig definiert sind.19 Demzufolge müssen italienische Genossenschaften in ihren Satzungen klare Beschränkungen vorsehen, und zwar: – – – –
Ein Verbot der Ausschüttung von Dividenden auf das tatsächlich eingezahlte Kapital, die den Höchstzinssatz der Postobligationen um mehr als zweieinhalb Prozent übersteigen. Ein Verbot der Verzinsung der Finanzinstrumente der Mitglieder in einem Ausmaß, das die Maximalhöhe der Dividenden um mehr als zwei Prozent übersteigt. Ein Verbot der Verteilung der Rücklagen unter den Mitgliedern. Die Pflicht, bei der Auflösung der Genossenschaft das Restvermögen nach Abzug des Kapitals und der allenfalls angereiften Dividenden an die Mutualitätsfonds zu übertragen. 4.2. Die Mutualitätsfonds
Der italienische Gesetzgeber der Nachkriegszeit hat die einschlägigen Bestimmungen zum Genossenschaftswesen mehrfach novelliert, um bei veränderten sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Entwicklung der Bewegung zu steuern. So mussten zu Beginn der neunziger Jahre vor dem Hintergrund globalisierter Finanzmärkte der erschwerte Zugang zum Kapitalmarkt und die chronischen Unterkapitalisierung italienischer Genossenschaften 18 Der Begriff der privaten Spekulation hat eine lange akademische Debatte darüber ausgelöst, ob das Verbot einer Spekulationsabsicht für die Mitglieder oder für das Unternehmen oder gar für beide gelten soll. Die Diskussion unter den Vätern der Verfassung hatte ihren Ursprung in der Unsicherheit, ob man eine betriebswirtschaftlich gesunde Gewinnerwirtschaftung auch schon als spekulative Ausrichtung betrachten müsse oder ob die Definition erst auf eine exzessive Gewinnmaximierung, die vor Spekulationsgeschäften nicht Halt macht, anzuwenden sei. 19 Vgl. Art. 2514 ZGB.
213
OSCAR KIESSWETTER
überwunden werden, die ihr Vermögen nur mit dem Cashflow aus der Bilanz stärken konnten. Das Gesetz Nr. 59 vom 31. Januar 1992 hat eine erste umfassende Reform der Kapitalausstattung der Genossenschaften vorgesehen20 und die anerkannten Genossenschaftsverbände erstmals ermächtigt, Mutualitätsfonds in Form von Aktiengesellschaften ohne Gewinnabsicht oder Vereinen zu errichten.21 Seitdem müssen alle Genossenschaften an den Mutualitätsfonds ihres Verbandes alljährlich einen dreiprozentigen Anteil ihres Bilanzgewinnes22 und nach einer eventuellen Auflösung auch das verbliebene Reinvermögen überweisen. Die von den Fonds verwalteten Finanzmittel werden ausschließlich zur Förderung von Neugründungen bzw. zur Zeichnung von Beteiligungen bei bestehenden Genossenschaften verwendet.23 Mit dieser Maßnahme hat der Gesetzgeber einen Teil der Förderung direkt in die Hände der Genossenschaftsbewegung verlegt und auch die Beschaffung der erforderlichen Geldmittel der bewährten genossenschaftlichen Selbsthilfe überlassen. Das Prinzip der Gegenseitigkeit beschränkt sich somit nicht nur auf die interne Förderung der Mitglieder während der Existenz der Genossenschaft, sondern umfasst auch eine externe Mutualität, die auch noch nach ihrer Auflösung zum Tragen kommt und ein generationsübergreifendes Wirken ermöglicht. 4.3 Die vorwiegende Mutualität Streng genommen enthalten weder das Grundgesetz noch das Zivilgesetzbuch eine eindeutige Definition für genossenschaftliche Unternehmen und ihre Ausrichtung auf Gegenseitigkeit. Die Verfassung nennt lediglich Merkmale, die das Genossenschaftswesen aufweisen muss, um 20 Neben der Möglichkeit, Schuldverschreibungen herauszugeben wurden neue Kategorien von Mitgliedern eingeführt, die nicht in der Genossenschaft mitarbeiten, sondern sie ausschließlich mit Kapitaleinlagen unterstützen. 21 Da in Italien keine Pflicht zur Mitgliedschaft bei einem Revisionsverband besteht, zahlen verbandsunabhängige Genossenschaften ihre Beiträge an vergleichbare Fonds des Ministeriums bzw. der autonomen Regionen. 22 Der zu Gunsten der Mutualitätsfonds eingezahlte Gewinnanteil wird vom Fiskus als steuerlich relevanter Aufwand des Geschäftsjahres betrachtet und verringert somit die Besteuerungsgrundlage. 23 Außerdem kann ein Mutualitätsfonds auch einzelne Projekte in Eigenregie betreiben und finanzieren, Schulungsmaßnahmen für leitende Mitarbeiter der angeschlossenen Genossenschaften veranstalten und Studien über wirtschaftliche und soziale Themen durchführen, die für die ganze Bewegung von besonderem Interesse sind.
214
MERKMALE UND BESONDERHEITEN DER ITALIENISCHEN GENOSSENSCHAFTEN
Förderungen und Begünstigungen beanspruchen zu dürfen, das Zivilgesetzbuch definiert im Artikel 2511 Genossenschaften nur als Gesellschaften mit veränderlichem Kapital, die auf Gegenseitigkeit ausgerichtet sind. Um diese Ausrichtung festzustellen, definiert der Artikel 2512 ZGB als Genossenschaften mit überwiegend gegenseitiger Ausrichtung jene, die –
–
–
ihre Tätigkeit vorwiegend zugunsten der Mitglieder ausüben, seien diese Verbraucher oder Nutzer von Gütern oder Dienstleistungen (z. B. müssen Verkäufe von Gütern und Dienstleistungen an Mitglieder mehr als fünfzig Prozent des Umsatzes im Bilanzjahr ausmachen); sich bei der Ausübung ihrer Tätigkeit vorwiegend der Arbeitsleistungen der Mitglieder bedienen (z. B. müssen die Löhne an mitarbeitende Mitglieder mehr als fünfzig Prozent der Personalkosten betragen); sich bei der Ausübung ihrer Tätigkeit vorwiegend der Einbringung von Gütern oder der Leistung von Diensten durch die Mitglieder bedienen (z. B. müssen die von den Mitgliedern eingebrachten Rohstoffe bzw. Produkte mehr als die Hälfte des Wareneinkaufes ausmachen).
Eine Geschäftsabwicklung, die überwiegend mit Mitgliedern erfolgt (Italienisch prevalenza)24 ist der Kern der internen Mitgliederförderung.25 Italienische Genossenschaften müssen demnach zwei miteinander verbundene Bedingungen erfüllen, und zwar einerseits die genossenschaftlichen Grundsätze in der Satzung verankern, andererseits den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit in der Mitgliederförderung abwickeln. Diese Kombination von formalrechtlichen Vorgaben und betrieblichen Auflagen stellt eine wirksame Bestimmung dar, damit Genossenschaften sowohl ihrer mitgliederorientierten Förderung als auch ihrer sozialen Aufgabe nachkommen können. Allerdings könnten Genossenschaften, die sich auf Grund ihrer Ausrichtung auf das Gemeinwesen nicht nur auf ihre Mitgliederbasis beschränken, durch diese Bestimmungen die mit der überwiegenden Gegenseitigkeit verbundenen Steuervorteile verlieren, so z. B. die Sozialgenossenschaften, die ihren Förderauftrag und ihre Unternehmenstätigkeit vornehmlich auf ihr soziales Umfeld ausrichten, weil sie 24 Die prevalenza muss aus dem Jahresabschluss hervorgehen und im Geschäftsbericht zahlenmäßig nachgewiesen werden, wobei die Revision dieses Merkmal noch einer eigenständigen Prüfung unterzieht. 25 In Italien wird die Mitgliederförderung auch interne Mutualität genannt, um sie von der externen zu unterscheiden, die den gemeinwirtschaftlichen Förderungsauftrag italienischer Genossenschaften bezeichnet.
215
OSCAR KIESSWETTER
definitionsgemäß das allgemeine Interesse der Gemeinschaft an der Förderung des Menschen und an der sozialen Integration der Bürger bezwecken.26 Sozialgenossenschaften sind somit eindeutig jene Kategorie, die per definitionem und im Sinne der Verfassung eine echte soziale Aufgabe ausüben, aber für sie ist es nahezu unmöglich, die quantitativen Auflagen betreffend die vorwiegende Gegenseitigkeit zu erfüllen, denn die Erwirtschaftung einer überwiegenden Gegenseitigkeit entspricht nicht ihrer Strategie. Sie betreiben neben der internen Mitgliederförderung vor allem eine Geschäftspolitik, bei der die externe Förderung des Umfeldes im Vordergrund steht, was streng genommen ihre soziale Aufgabe wäre, sie könnten jedoch nicht in den Genuss jener Förderungen kommen, die den Kooperativen mit vorwiegender Mitgliederförderung vorbehalten sind. Sie sind daher von einer Sonderbestimmung ope legis als Genossenschaften auf überwiegende Gegenseitigkeit eingestuft worden.27
5. Die soziale Aufgabe als Unternehmenszweck Die Entstehung von Genossenschaftsmodellen mit einer sozialen Aufgabe als Unternehmenszweck wird erst verständlich, wenn man die Entwicklung in Italien in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts betrachtet, als verschiedene Zustände und Ereignisse eine neuerliche Herausforderung für die Selbsthilfe darstellten. Dazu gehörte in erster Linie die allgegenwärtige Präsenz des Staates mit einer vielfach parteibezogenen, unwirksamen Reformpolitik. Dem stand der gesteigerte Tatendrang junger Generationen gegenüber, der nicht nur in Studentenunruhen mündete sondern auch eine kollektive Forderung nach gesellschaftlicher Erneuerung und gestärkter Privatinitiative enthielt, um einen effizienteren 26 Definition der Sozialgenossenschaften gemäß Art. 1 des Gesetzes Nr. 381 vom 8. November 1991. 27 Das Ministerialdekret vom 30. Dezember 2005 trägt den Titel Ausnahmeregelungen für die Kriterien zur Definition der Prävalenz gemäß Art. 2513 ZGB. Auch Genossenschaften, die im Bereich des fairen Handels tägig sind, gelten als Unternehmen mit überwiegender Gegenseitigkeit, weil es sich dabei um einen Sektor von besonderer sozialer Bedeutung handelt, so dass da rin tätige Genossenschaften den sozialen Auftrag der Verfassung erfüllen. Sie werden ope legis denen mit überwiegender Gegenseitigkeit gleichgestellt, damit sie nicht von den Förderungen ausgeschlossen werden. Das Dekret enthält auch eine interessante Definition des fairen Handels, und zwar Verkauf, auch unter Mithilfe von ehrenamtlich arbeitenden Mitgliedern, von Produkten, die … direkt von Unternehmen in Entwicklungsländern oder von Sozialgenossenschaften … gekauft werden, wobei die Zahlung eines Mindestpreises unabhängig von den üblichen Marktschwankungen garantiert wird.
216
MERKMALE UND BESONDERHEITEN DER ITALIENISCHEN GENOSSENSCHAFTEN
Sozialstaat zu verwirklichen. Intellektuelle und gewerkschaftliche Kreise trugen diese Bewegungen mit und auch die katholische Kirche begann, nach Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils, aktiv in die soziale Problematik Italiens einzugreifen.28 Zusätzlich verursachte die schwere Wirtschaftskrise in den ersten Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts eine zweistellige Inflation, verbunden mit hoher Arbeitslosigkeit. Somit litt der Sozialstaat, dem die Effizienz einer territorialen, bürgernahen Präsenz fehlte, unter dem ausufernden Bedarf nach Dienstleistungen, die aber wegen der zunehmenden Staatsverschuldung nicht erbracht werden konnten. Der Staat als einziger Träger der Sozialleistungen wurde in Frage gestellt und eine ausgeglichene Präsenz von nicht profitorientierten privaten Anbietern gefordert: So konnte die Suche nach innovativen Formen der Selbsthilfe beginnen. 5.1 Der zweite Förderauftrag der Sozialgenossenschaften Vor diesem Szenario reagierte die italienische Genossenschaftsbewegung schneller als der Gesetzgeber und entwickelte das innovative Modell der Sozialgenossenschaften, die eine interne Mitgliederförderung als primären Gesellschaftszweck überwanden, um auch externe, benachteiligte Personen, unabhängig von ihrem Mitgliederstatus, zur Zielgruppe des erweiterten, zweiten Förderauftrags zu machen. Initiativen dieser Art entstanden vor allem in der Folge der italienischen Psychiatriereform, die nach der Schließung der geschlossenen Anstalten die Krankenbetreuung in externe territoriale Strukturen verlegt hatte.29 Für diese neue Herausforderung erwiesen sich genossenschaftliche Akteure mit einer Mitgliederbasis aus Ärzten, Pflegepersonal und Familienangehörigen als besonders geeignet.30 Ähnliche Vorhaben widmeten sich der 28 In der Abschlussdokumentation des Konzils liest man die Befürchtung, dass das Wirtschaftswachstum, das bei vernünftiger und humaner Lenkung die sozialen Ungleichheiten mildern könnte, allzu oft zu deren Verschärfung führt und mitunter sogar zur Verschlechterung der Lage der sozial Schwachen und zur Verachtung der Notleidenden. Der Reformwille der postkonziliaren Kirche verfolgte das Ziel, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, die Löhne zu erhöhen, das Beschäftigungsverhältnis zu sichern sowie Anreize zu eigener Unternehmungslust zu bieten. Als zielführende Hilfseinrichtung wurde u. a. ein organisatorischer Verbund genossenschaftlicher Art vorgeschlagen. 29 Vordenker der Psychiatriereform in Italien war der international bekannte Psychiater Franco Basaglia, der in der geschlossenen psychiatrischen Anstalt von Triest bahnbrechende Reformansätze verwirklichte. 30 Franco Basaglia hatte Insassen der Anstalt in genossenschaftliche Formen der Arbeitstherapie eingebunden.
217
OSCAR KIESSWETTER
Behandlung der zunehmenden Suchterkrankungen, denen das öffentliche Sanitätswesen weder Erfahrung noch Ressourcen entgegenstellen konnte. Erst zwanzig Jahre31 nach den ersten Pioniervorhaben schuf der Gesetzgeber ein klares normatives Gefüge, um dieses besondere Genossenschaftsmodell anzuerkennen, dem im Wesentlichen zwei Tätigkeitsbereiche übertragen wurden: a) Dienstleistungen im Sozialbereich, im Gesundheitswesen und in der Erziehung;32 b) Verschiedene Tätigkeiten im Landwirtschafts-, Industrie-, Handels- oder Dienstleistungssektor, die auf die Arbeitseingliederung von benachteiligten Personen abzielen.33 Zu den Kategorien der Benachteiligten gehören physische, psychische und sensorielle Invaliden, ehemaligen Insassen von psychiatrischen Anstalten und Personen, die in psychiatrischer Behandlung sind, Suchtkranke, Alkoholiker, Minderjährige im arbeitsfähigen Alter aus schwierigen Familienverhältnissen, Häftlinge und Verurteilte, die zu haftalternativen Maßnahmen zugelassen sind.34 Bei Sozialgenossenschaften, die eine Arbeitseingliederung dieser Personen betreiben, müssen die Benachteiligten mindestens dreißig Prozent der Arbeitnehmer darstellen und sie müssen, soweit es mit ihrer Situation vereinbar ist, auch Mitglieder der Genossenschaft sein. 31 Die Gründung der ersten Arbeitsgenossenschaft in der psychiatrischen Anstalt von Triest erfolgte am 3. Mai 1972, das Gesetz Nr. 381 zur Anerkennung der Sozialgenossenschaften wurde am 8. November 1991 erlassen. 32 Auf Grund dieser Auflistung im Art. 1 des Gesetzes Nr. 381/1991 werden Sozialunternehmen, die Dienstleistungen in diesen Bereichen erbringen, vielfach als Genossenschaften vom Typ A bezeichnet. Sie sind heute aus italienischen Kindergärten und Schulen nicht mehr wegzudenken, führen aber auch sanitäre Einrichtungen, Seniorenheime, Fortbildungsstätten und Kulturbetriebe und haben eine Angebotspalette entwickelt, die den ganzen Lebenszyklus umfasst. 33 In Anlehnung an die vorherige Fußnote werden Sozialunternehmen, die Benachteiligte in den Arbeitsmarkt eingliedern, vielfach als Genossenschaften vom Typ B bezeichnet. 34 Aus heutiger Sicht ist diese Auflistung stark reform- und ergänzungsbedürftig, weil sie Menschen von der Arbeitseingliederung in Sozialgenossenschaften ausschließt, die nach anderen Bestimmungen auf EU-Ebene und selbst in Italien als sozial schwach bzw. benachteiligt gelten. Zu neuen Zielgruppen könnten in erster Linie Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende, Zugewanderte und Asylsuchende gehören, aber auch für Eltern, die wieder in die Erwerbsarbeit einsteigen, für Personen mit niedriger Bildung, Studienabbrecher oder ältere Arbeitssuchende könnten Produktiv(Sozial)Genossenschaften einen Weg aus der Arbeitslosigkeit darstellen.
218
MERKMALE UND BESONDERHEITEN DER ITALIENISCHEN GENOSSENSCHAFTEN
Um den Anforderungen einer behindertengerechten und berufsorientierten Arbeitsbegleitung begegnen zu können, dürfen Sozialgenossenschaften die Sonderkategorie der freiwilligen Mitglieder vorsehen, die ihre Arbeit unentgeltlich leisten und eine unverzichtbare Stütze der Unternehmenstätigkeit darstellen.35 Sozialgenossenschaften machen aus Benachteiligten Beteiligte und bieten diesen – im Unterschied zu karitativen Vorhaben und geschützten Werkstätten – ein vollwertiges Arbeitsverhältnis und eine angemessene Entlohnung.36 Sie tragen zu einem erhöhten Verantwortungsbewusstsein und Selbstwertgefühl der benachteiligten Mitarbeiter bei und verhelfen ihnen langfristig zum Aufbau einer eigenen Rentenposition, die sie auch im Alter finanziell absichert. Sie wirken als Trägerorganisationen sozialer Dienste jenseits der Reichweite des Staates oder profitorientierter Dienstleister bzw. als Job-Motoren für benachteiligte Arbeitnehmer, gleichzeitig sind sie aber auch lebensechte Lernstellen für die demokratische Beteiligung benachteiligter Menschen am Entscheidungsprozess in Unternehmen. Die positiven gesellschaftlichen Auswirkungen italienischer Sozialgenossenschaften sind auch von der EU37 ausdrücklich anerkannt worden, da sie unter anderem den Schutz der Rechtsordnung als zusätzliches Element ihrer Unternehmenskultur betreiben und somit ihre in der Verfassung verankerte soziale Aufgabe auch mit einer aktiven Rolle im Kampf gegen das organisierte Verbrechen umsetzen, indem sie beispielsweise mit der Verwaltung konfiszierter Vermögen der Mafia betraut wurden. Das EU-Parlament bezog sich mit dieser Äußerung spezifisch auf jene italienischen Sozialgenossenschaften, die an der Seite des Staates im langwierigen Kampf gegen das organisierte Verbrechen und die Wirtschaftskriminalität wirken, indem sie beschlagnahmte Vermögenswerte verwalten, die vielfach in der Landwirtschaft, im Bausektor und im Handel angesiedelt sind und wieder dem legalen wirtschaftlichen Kreislauf zugeführt werden müssen. Die Übertragung an Sozialgenossenschaften verhindert, dass sie bei öffentlichen Versteigerungen wieder in die Hände von Mittelsmännern mit mafiösen Interessen gelangen. 35 Die Anzahl der freiwilligen Mitglieder, die vielfach aus dem familiären Umfeld der Benachteiligten stammen, darf die Hälfte aller Mitglieder nicht überschreiten. Sie haben lediglich Anspruch auf eine Arbeitsunfall- und Berufskrankheitsversicherung, sowie auf die Rückerstattung tatsächlich bestrittener und belegter Ausgaben. 36 Bei der Entlohnung von benachteiligten Mitarbeitern fallen keine Sozialabgaben oder Rentenbeiträge an, da diese vom Staat als Fördermaßnahme verrechnet werden. 37 Vgl. EU-Parlament – Plenarsitzungsdokument vom 12.6.2013 Bericht über den Beitrag der Genossenschaften zur Überwindung der Krise (2012/2321(INI)).
219
OSCAR KIESSWETTER
Einige dieser Genossenschaften haben als überaus wirksames Community Empowerment das Netzwerk Cooperative Libera Terra38 gebildet und damit eine Trendwende in der Zivilcourage ausgelöst. Sie stellen u. a. Arbeitsplätze für die unbestraften Mitarbeiter der früheren Mafiabosse bereit, verzichten im Sinne des Gemeinwohls auf die vom organisierten Verbrechen angestrebte Gewinnmaximierung und ermöglichen eine nachhaltige Bewirtschaftung im Interesse des sozialen und wirtschaftlichen Umfeldes. Das Modell der italienischen Sozialgenossenschaften, das bei der Entstehung seiner Zeit weit voraus war, verzeichnet heute auf Grund demographischer und sozialer Veränderungen einen bestimmten Modernisierungsbedarf, nicht nur bei den Kategorien benachteiligter Menschen. So wird es zum Beispiel immer schwieriger, benachteiligte Mitarbeiter am Ende ihrer Ausbildung in einer Sozialgenossenschaft in den ersten, ungeschützten Arbeitsmarkt einzugliedern, da dieser wegen der lang anhaltenden Konjunkturkrise kaum neue Arbeitsplätze schafft. Diese Entwicklung stellt die Sozialgenossenschaften in betriebswirtschaftlicher Hinsicht vor neue Herausforderungen, weil ihre bisherige Funktion als vorübergehende Ausbildungsstätte zu der eines dauerhaften Arbeitgebers geworden ist.39 Wenn benachteiligte Arbeitnehmer ihr ganzes Berufsleben in ihren Sozialgenossenschaften zubringen und dort sogar das Rentenalter erreichen, wird die Selbsthilfe zur genossenschaftlichen Normalität. Diese Entwicklung muss Sozialgenossenschaften veranlassen, ihre Betreuungsfunktion auch über das aktive Berufsleben hinaus fortzuführen, um benachteiligte Mitarbeiter auch im Rentenalter wirksam zu begleiten.40 Gesellschaftliche Unsicherheiten und Bedrohungen veranlassen die Bürger in Italien, ihre zivile Selbstorganisationsfähigkeit wieder verstärkt einzusetzen, um neuen sozialen Bedarfslagen zu begegnen und Einrichtungen der Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten, während dem Sozialstaat zunehmend Mittel entzogen werden. Auch in Zukunft wird die soziale Aufgabe der Genossenschaften vor neue Herausforderungen gestellt sein. 38 Libera Terra bedeutet wörtlich freies Land, sinngemäß (von der Mafia) befreites Land. Siehe: www.libera.it und www.liberaterra.it (Zugriff 29.03.2020). 39 Wenn auf Grund dieser Veränderungen Sozialgenossenschaften nicht mehr als reine Ausbildungsstätte zur Arbeitsintegration sondern als competitor auf dem freien Markt tätig werden, müssen dringend auch neue Managementfunktionen aufgebaut und finanziert werden. 40 Auf diesem Gebiet könnte Italien das Knowhow der im Ausland bereits erfolgreichen Seniorengenossenschaften übernehmen und als innovatives Sondermodell eine Sozialgenossenschaft für die besondere Zielgruppe benachteiligter Rentner entwickeln.
220
MERKMALE UND BESONDERHEITEN DER ITALIENISCHEN GENOSSENSCHAFTEN
5.2 Der dritte Förderauftrag der Bürgergenossenschaften Die jüngsten Entwicklungen in Italien scheinen vom siebten I.C.A.-Prinzip41 geprägt zu sein, wonach sich Genossenschaften gezielt für die nachhaltige Entwicklung der Gemeinschaft einsetzen, indem sie auch ihr soziales und territoriales Umfeld fördern. In einer ganz aktuellen Innovationswelle dehnen italienische Genossenschaften den zweiten Förderauftrag nochmals aus, indem sie – über ihre Mitgliederbasis hinaus – eine ganze Gemeinschaft im örtlichen Umfeld des Unternehmens mit ihrer Tätigkeit fördert. Das Engagement für diese Gemeinschaft als besondere Form der sozialen Verantwortung ist das Unternehmensziel der cooperative di comunità,42 die eine Abdeckung von aktuellen oder zukünftigen Bedürfnissen der gesamten Bevölkerung anstreben. Denn vielerorts zieht sich die öffentliche Hand progressiv aus dem Bereich der Sozialdienste zurück, während z. B. die Abwanderung aus entlegenen Gebieten zunimmt, die Nahversorgung in strukturschwachen Randzonen schwächelt, Gemeingüter für eine schonende Nutzung wiedergewonnen werden müssen und verlassene Bahnhöfe und andere Gebäude auf sinnvolle Wiederbelebung warten.43 Wo öffentliche Körperschaften überfordert und Privatunternehmer nicht interessiert sind, können Multi-Stakeholder-Kooperativen innovative Lösungsansätze erbringen und zielführende Maßnahmen setzen, um die Abwanderung einzudämmen, aber auch um aktiven Umweltschutz 41 Der siebte Grundsatz der International Co-operative Alliance (I.C.A.) mit dem Titel Sorge für die Gemeinschaft lautet: Genossenschaften arbeiten für die nachhaltige Entwicklung des Gemeinwesens durch Maßnahmen, die von ihren Mitgliedern gebilligt werden. 42 Comunità bedeutet wörtlich Gemeinschaft. In diesem Zusammenhang bezieht sich der Begriff meist auf eine territoriale aber auch auf die soziale Gemeinschaft. Eine cooperativa di comunità ist somit eine Genossenschaft für eine kollektive Zielgruppe. Zur Gemeinschaft im weitesten Sinne gehören nicht nur alle Menschen, die ein Territorium bevölkern, sondern auch förderungswürdige oder schutzbedürftige immaterielle Elemente der Gemeinschaft, wie die Nahversorgung, die Umwelt, der soziale Zusammenhalt, die Infrastruktur oder ganz einfach die nachhaltige Erschließung und Nutzung des Lebensraumes. 43 Der vielerorts aufgekommene Eindruck, dass sich die Bürgergenossenschaften quasi als logische Folge aus den Sozialgenossenschaften heraus entwi ckelt haben, stellt ein aktuelles Diskussionsthema auf akademischer und normativer Ebene dar. Von den in der Fußnote 48 aufgelisteten Regionalgesetzen definiert jenes der Emilia Romagna tatsächlich die Bürgergenossenschaften als eine Kategorie, die im weiteren Sinn zu den cooperative sociali gehören.
221
OSCAR KIESSWETTER
und ökologische Energiegewinnung zu betreiben, um alte Berufe zu bewahren oder lokale Produkte zu vermarkten. Dabei fördern sie auch den sozialen Zusammenhalt, weil sie Entstehungsprozesse und Organisationsmodelle anwenden, die sich nur dann erfolgreich entwickeln können, wenn von Anfang an alle Bürger mit einbezogen werden.44 Die Entwicklung des territorialen Umfeldes und die Produktion von Dienstleistungen, die grundsätzlich für die gesamte lokale Gemeinschaft erbracht werden, stärken die Verankerung dieser neuartigen genossenschaftlichen Unternehmen im Lokalbereich, wodurch die Grenzen zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern weiter verschwimmen, was nochmals die Gemeinwirtschaftstauglichkeit der italienischen Genossenschaften mit ihrer sozialen Aufgabe beweist. Die ersten konkreten Beispiele, die aus einem kollektiven Bewusstsein heraus entstanden sind, zeigen, dass zu den möglichen Einsatzbereichen genossenschaftlich organisierter Bürger Schülertransporte und Schulverpflegung ebenso gehören, wie aktiver Denkmalschutz und betreute Freizeitaktivitäten für die Bevölkerung, unter Nutzung und gleichzeitiger Wahrung der Infrastruktur eines Dorfes. Ein solches Genossenschaftsmodell, das aus der gemeinsamen Bedarfslage heraus entsteht, verwirklicht spezifische Tätigkeiten, die zielgerecht der örtlichen Situation angepasst sind: Es kann das nur mehr sporadisch geöffnete Postamt weiterführen oder das aufgegebene Dorfgasthaus übernehmen, um dadurch zur Verbesserung des Dienstleistungsangebotes und der Beschäftigungslage in benachteiligten Gemeinden beizutragen. Die Tatsache dass man zum jetzigen Zeitpunkt die italienischen Bürgergenossenschaften45 nur anhand ihrer ersten Erfahrungen und der darin verwirklichten Tätigkeiten beschreiben kann, bestätigt, dass es sich noch nicht um ein konsolidiertes Modell mit eindeutigen Definitionen und klaren Merkmalen handelt. Die Verschiedenheit der bisherigen Initiativen beweist aber gleichzeitig auch, dass es sich um Experimente der Selbsthilfe handelt, die auf spezifische lokale Bedürfnisse eingehen. In anderen Worten: Sie sind alle verschieden, weisen aber allesamt ein Innovationspotenzial auf, das zu einem dauerhaften Erfolg dieses Modells führen könnte. 44 Die ersten Erfahrungen bestätigen bereits, dass der Entstehungsprozess einer erfolgreichen Bürgergenossenschaft von der Basis ausgehen muss und nicht mit einer Verordnung top-down oder im Rahmen eines Förderprojektes ausgelöst werden kann. 45 Der Begriff Bürgergenossenschaft ist nicht die wörtliche Übersetzung von cooperativa di comunità. Er wird in diesem Text verwendet, weil die erste Initiative dieser Art im zweisprachigen Südtirol, die 2016 gegründete BGO Bürgergenossenschaft Obervinschgau mit Sitz in Mals, diese Bezeichnung gewählt hat. Siehe: www.da.bz.it (Zugriff 29.03.2020).
222
MERKMALE UND BESONDERHEITEN DER ITALIENISCHEN GENOSSENSCHAFTEN
Für die Cooperative di Comunità fehlt bis heute eine gesetzliche Regelung, was einmal mehr beweist, dass sich die italienische Genossenschaftsbewegung schneller an neue soziale und wirtschaftliche Bedürfnisse anpasst, als dies beim Gesetzgeber der Fall ist. Ein Gesetzesvorschlag zur Anerkennung, Regelung und Förderung der Bürgergenossenschaften ist am 23. März 2018 in der italienischen Abgeordnetenkammer eingereicht worden, wartet aber seitdem auf die parlamentarische Behandlung.46 Einzelne Regionen Italiens sind hingegen bereits aktiv geworden und haben autonome Gesetze erlassen, um der Entstehung erster Bürgergenossenschaften Rechnung zu tragen und ihre Förderung zu regeln.47
6. Andere Erfolgsmodelle italienischer Genossenschaften Die engen Grenzen des vorliegenden Beitrags verhindern eine auch nur kurze Erläuterung anderer Unternehmensmodelle, die zwar nicht eine vorwiegend soziale Ausrichtung verwirklichen, aber vom Ausland betrachtet doch als Besonderheiten des Genossenschaftswesens in Italien gelten könnten. Auch die Produktions- und Arbeitsgenossenschaften, die den internationalen Erfahrungen in Form und Substanz sehr ähnlich sind, haben in Italien Besonderheiten entwickelt, die ihren Unternehmenszweck und ihre betriebswirtschaftlichen Zielsetzungen kennzeichnen. Erwähnenswert wären: – Die Confidi, Garantiegenossenschaften, die kollektive Bürgschaften für ihre Mitglieder leisten und damit eine wirksame Finanzierungshilfe für kleine und mittlere Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen darstellen. – Die cooperative del sapere, wörtlich Genossenschaften des Wissens, deren Mitglieder gemeinsam intellektuelle Berufe ausüben, bei denen sich diese Rechtsform gut eignet, um Spezialisten aus 46 http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/stampati/pdf/18PDL0003830. pdf (Abruf am 30.3.2020). 47 Regionalgesetze mit zum Teil sehr unterschiedlichen Bestimmungen zur Anerkennung der Cooperative di Comunità gibt es bereits in folgenden Regionen: ABRUZZEN: Regionalgesetz Nr. 25 v. 8.10.2015; BASILICATA: Regionalgesetz Nr. 12 v. 20.3.2015; EMILIA ROMAGNA: Regionalgesetz Nr. 12 v. 17.7.2014; LIGURIEN: Regionalgesetz Nr. 14 v. 7.4.2015; LOMBARDEI: Regionalgesetz Nr. 36 v. 6.11.2015; SARDINIEN: Regionalgesetz Nr. 35 v. 2.8.2018; SIZILIEN: Regionalgesetz Nr. 25 v. 27.12.2018; TOSKANA: Regionalgesetz Nr. 24 v. 8.5.2014; PIEMONT: Regionalgesetz Nr. 14 v. 5.4.2019; UMBRIEN: Regionalgesetz Nr. 2 v. 11.4.2019.
223
OSCAR KIESSWETTER
–
unterschiedlichen Fachbereichen zu vernetzen und dabei das Profitbestreben der Kapitalgesellschaften zu vermeiden. Die genossenschaftliche Form der Berufssozietäten erleichtert die Ausbildung des Nachwuchses und der Praktikanten, die in einer Sonderkategorie von Mitgliedern ihre Stellung in der Kanzlei festigen und ihren Berufseintritt wettbewerbsfähiger gestalten können, ohne auf eine gleichberechtigte Teilhabe an der demokratischen Unternehmenssteuerung verzichten zu müssen, weil ihre Erfahrung und ihr Dienstalter geringer sind als jene der Seniorpartner. Die Genossenschaften zur Betriebsnachfolge, vielfach workers’ buyout genannt, die von Arbeitnehmern italienischer Krisenbetriebe gegründet werden, um ihren Arbeitsplatz zu retten und die bisherige Produktionstätigkeit in genossenschaftlicher Form fortzuführen.48 Dieses Modell bewährt sich zunehmend auch für Übernahmen im Rahmen der Betriebsnachfolge von Familienunternehmen, wenn sich die bisherige Belegschaft einer gemeinsamen unternehmerischen Herausforderung stellen will.
7. Südtirol als Schnittstelle von zwei Genossenschaftskulturen Bei der Entstehung der ersten Genossenschaften war Südtirol noch Teil der Gefürsteten Grafschaft Tirol49 und gehörte zum Habsburgerreich, in dem die Gründung von Genossenschaften 1873 erstmals erlaubt und geregelt worden war.50 Daraufhin entstanden vielerorts Initiativen mit dem vorrangigen Ziel, der durch Industrialisierung und Abwanderung verarmten ländlichen Bevölkerung eine selbstverwaltete Lebensgrundlage zu sichern. In Südtirol waren die ersten Genossenschaftsgründungen, von denen Impulse zur wirtschaftlichen Entwicklung ausgingen, Landwirtschafts-, 48 Mit einem Startkapital aus Eigenmitteln und Beiträgen der staatlichen Arbeitslosenunterstützung, die in das Genossenschaftsvermögen einfließen, können sich entlassene Mitarbeiter zu neuen Arbeitergenossenschaften zusammenschließen, Betriebszweige oder ganze Unternehmen übernehmen und fortführen. 49 Das Kronland umfasste sowohl Nordtirol (das heutige österreichische Bundesland Tirol) als auch die seit 1918 zu Italien gehörenden Gebiete des deutschsprachigen Südtirols (die heutige Autonome Provinz Bozen) und des vorwiegend italienischsprachigen Welschtirols (die heutige Autonome Provinz Trient). 50 Das Genossenschaftsgesetz vom 9. April 1873 ist im Reichsgesetzblatt der österreichisch-ungarischen Monarchie Nr. 70 vom 17. Mai 1873 veröffentlicht. Vor diesem Zeitpunkt waren nur einzelne Konsumvereine in Böhmen und erste Arbeitergenossenschaften in Wien entstanden.
224
MERKMALE UND BESONDERHEITEN DER ITALIENISCHEN GENOSSENSCHAFTEN
Energie- und Kreditgenossenschaften51, die sich, in Ermangelung herausragender österreichischer oder einheimischer Pioniere, an den Modellen von F. W. Raiffeisen und H. Schulze-Delitzsch ausrichteten. Im engen Rahmen dieses vorwiegend informativen Beitrages muss eine historische Erörterung der Geschicke der Südtiroler Genossenschaften während des Ersten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit ausbleiben. Relevant sind hingegen die Auswirkungen des nach fast einjährigen Friedensverhandlungen am 10. September 1919 unterzeichneten und am 16. Juli 1920 in Kraft getretenen Staatsvertrags von Saint-Germain-en-Laye, der neben der völkerrechtlichen Auflösung von Österreich-Ungarn auch den Übergang von Südtirol zu Italien besiegelte, zusammen mit den Gebieten Trentino, Friaul, Istrien und Triest.52 Das ursprünglich von österreichischen Wurzeln und Gesetzen geprägte Genossenschaftswesen in Südtirol wurde in den Folgejahren konsequent italienisiert.53 Die relevanten geopolitischen Umwälzungen um 1918 haben zwei unterschiedliche Kulturen in Kontakt gebracht, die sich gegenseitig bereichert und ein vielseitiges, erfolgreiches System hervorgebracht haben, das Elemente des deutschen Raiffeisenmodells in wirksamer Weise mit der sozialen Ausrichtung italienischer Genossenschaften vereint. Dabei ist die wechselseitige Einflussnahme nicht bloß ein theoretisches Gebilde oder ein interessanter Studiengegenstand geblieben, sondern zu einem konkreten unternehmerischen Schwerpunkt geworden. Heute bildet Südtirol als Provinz Bozen zusammen mit der Nachbarprovinz Trient die Autonome Region Trentino Südtirol, zu deren eigenständigen Kompetenzen auch die Entfaltung des Genossenschaftswesens und die Aufsicht über die Genossenschaften gehören. Im Rahmen dieser Zuständigkeit hat die Autonome Provinz Bozen ein wirksames System an Förderungen vorgesehen, das neben der allgemeinen Wirtschaftsförderung54 51 Die erste genossenschaftliche Sennerei Südtirols wurde 1871 in Niederdorf gegründet, der erste Spar- und Darlehenskassenverein nach dem System Raiffeisen 1889 in Welschellen im Gadertal und die erste Obstgenossenschaft 1893 in Meran. 52 Neben völkerrechtlich relevanten Abmachungen und Reparationspflichten sah dieser Staatsvertrag die Gründung des Völkerbunds und der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) vor. 53 Trotzdem enthalten die geltenden Satzungen vieler vor dem Jahr 1918 gegründeten und noch aktiven Genossenschaften einen expliziten Hinweis darauf, dass sie eine Fortsetzung jenes Unternehmens darstellen, das gemäß dem Genossenschaftsgesetz der österreichisch-ungarischen Monarchie gegründet worden war. 54 Die Genossenschaften kommen auch in den Genuss der allgemeinen, im Rahmen der Wirtschaftspolitik beschlossenen Unternehmensförderungen, die zum Beispiel für einzelne Bereiche wie Handel, Handwerk, Gewerbezonen, Innovation usw. unterschiedliche Förderungen vorsehen können.
225
OSCAR KIESSWETTER
zusätzliche Maßnahmen zugunsten von Genossenschaften vorsieht, die in Folge kurz erwähnt werden. Bereits 1993 waren Maßnahmen zur Förderung des Genossenschaftswesens beschlossen worden55, die im Laufe der Zeit immer wieder ergänzt oder abgeändert worden sind, um Auflagen und Inhalte zu aktualisieren und die Förderungen den tatsächlichen Bedürfnissen anzupassen. Derzeit werden vor allem Sozialgenossenschaften aber auch genossenschaftliche Unternehmen für die Betriebsübernahme gefördert, ferner innovative Genossenschaften mit einer besonderen sozialen Bedeutung sowie solche, die sich die Eingliederung in den Arbeitsmarkt von Frauen, Jugendlichen unter 30 Jahren oder Arbeitslosen über 50 Jahren zum Ziel setzen.56 Dabei werden sowohl umfangreiche Kapitalerhöhungen zur Stärkung des Vermögens als auch Investitionen in Betriebsgüter, einschließlich Immobilien und Liegenschaften, sowie Beteiligungen und Betriebsübernahmen mit öffentlichen Beiträgen unterstützt.57 Die aktuelle Bedeutung und die wirtschaftliche Tragweite der Südtiroler Genossenschaften können anhand nachstehender Zahlen zum 31.12.2019 zusammengefasst werden:58 •
942 eingetragene (davon 891 aktive) Genossenschaften,59 – 841 Unternehmen weisen eine vorwiegende Mitgliederförderung auf.
55 Landesgesetz Nr. 1 vom 8. Jänner 1993, zuletzt 2016 novelliert mit neuen Anwendungsrichtlinien und Kriterien für die Beitragsvergabe. Siehe: http:// lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/205139/beschluss_vom_12_juli_2016_ nr_778.aspx?view=1 (Zugriff 30.03.2020). 56 Die letzte Novellierung der Beitragskriterien definiert erstmals auch Asylantragsteller, anerkannte Flüchtlinge, Personen mit subsidiärem oder humanitärem Schutzstatus und Einwanderer aus Nicht-OECD-Staaten als Zielgruppen, denen bei der Gründung eines genossenschaftlichen Unternehmens Beiträge im Sinne des Landesgesetzes Nr. 1/1993 gewährt werden können. 57 Damit sich Genossenschaften in Südtirol besser auf die neuen Herausforderungen einer wachsenden Konkurrenz vorbereiten und im Wettbewerb erfolgreicher bestehen können, enthalten die aktuellen Beitragskriterien auch Förderungen für die Managementberatung, für die Aus- und Fortbildung der Führungskräfte sowie für den fachlichen Beistand von Spezialisten bei Machbarkeitsstudien, die neue Vorhaben oder Umstrukturierungen bestehender Betriebszweige zum Gegenstand haben. 58 Siehe: http://www.provinz.bz.it/arbeit-wirtschaft/genossenschaften/ genossenschaften.asp (Zugriff 29.03.2020). 59 Am 31.12.2019 sind 108 Genossenschaften in freiwilliger Auflösung oder Zwangsliquidierung.
226
MERKMALE UND BESONDERHEITEN DER ITALIENISCHEN GENOSSENSCHAFTEN
•
•
Vier anerkannte Genossenschaftsverbände mit folgenden Mitgliederzahlen:60 – Raiffeisenverband Südtirol mit 331 Mitgliedsgenossenschaften. – Cooperazione Autonoma Dolomiti mit 173 Mitgliedsgenossenschaften. – Bund der Genossenschaften Südtirols Legacoopbund mit 190 Mitgliedern. – A.G.C.I. Alto Adige-Südtirol mit 80 Mitgliedern. Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche der bestehenden Genossenschaften sind: – Landwirtschaft mit 93 Unternehmen, – Kreditwesen mit 41 Raiffeisenkassen und zwei Garantiegenossenschaften, – Produktion von Gütern und Dienstleistungen mit 354 Genossenschaften, – Wohnbau mit 119 Genossenschaften, – Einzelhandel mit 12 Konsumgenossenschaften, – Konsortien mit 9 Netzwerken, – Andere Kategorien mit 312 genossenschaftlichen Unternehmen.
Von den 942 Genossenschaften sind 224 im Sozialbereich aktiv, davon 83 in der Arbeitseingliederung Benachteiligter.
8. Schlussbemerkung Italiens Genossenschaften sind lebendig und kreativ. Sie unterziehen sich einem steten Entwicklungsprozess und erneuern selbst konsolidierte Lösungen, um ihren Förderauftrag wirksam auf die Veränderungen im sozialen und wirtschaftlichen Umfeld abzustimmen und das Unternehmen besser auf neue Bedürfnisse von Mitgliedern, anderen Menschen und territorialem Umfeld auszurichten. Die Genossenschaftsverbände gehen dabei weit über die reine Revisionsfunktion hinaus und übernehmen eine aktive Promotionsrolle. Einerseits streben sie die Einbindung neuer Zielgruppen in bestehende Genossenschaftsmodelle an und tragen dadurch zur Vergrößerung der Mitgliederbasis bei, andererseits fördern sie die Entwicklung innovativer Unternehmensformen, um das genossenschaftliche Modell in neuen Bereichen zu etablieren. Aller Vielseitigkeit, man könnte sagen aller Phantasie des movimento cooperativo zum Trotz, fehlen im italienischen System, und erst recht in 60 168 Genossenschaften gehören keinem Verband an und werden vom zuständigen Amt der Landesverwaltung geprüft.
227
OSCAR KIESSWETTER
Südtirol, immer noch einzelne Modelle, die sich hingegen im Ausland bereits erfolgreich entwickelt haben und die sehr wohl auch in Italien zur Ergänzung der bestehenden Vielseitigkeit beitragen oder eine Antwort auf neue Bedürfnisse darstellen könnten. Dazu gehören zum Beispiel genossenschaftliche Lösungen für die zunehmenden Wohnprobleme in städtischen Ballungszentren: Die interessanten Erfahrungen deutscher Wohnungsgenossenschaften mit ihrem intergenerationellen, seniorengerechten oder sozialen Wohnungsangebot könnten übernommen bzw. italienischen Verhältnissen angepasst werden. Außerdem fehlt in Italien derzeit noch eine (nicht nur genossenschaftliche) Antwort auf die Folgen der demographischen Entwicklung, die auf die beiden Lebensabschnitte der Senioren abgestimmt ist. Im Ausland bieten Seniorengenossenschaften und Zeitbanken den noch rüstigen Rentnern Beschäftigung und aktiven Lebensinhalt nach dem Ende ihres Berufslebens. Ebenso sind es genossenschaftliche Unternehmensmodelle, die Menschen mit steigendem Pflegebedarf im hohen Alter zugleich betreutes Wohnen, persönliche Pflegedienste und Beistand bei täglichen Lebensbedürfnissen anbieten. Das an und für sich vielseitige und erfolgreiche italienische Genossenschaftswesen kann sein ganzes Potenzial wirksam und effizient nur durch regen Kulturaustausch über die Grenzen hinweg entfalten, bei dem italienische Eigenarten über die Staatsgrenzen hinaus bekanntgemacht werden, aber im Gegenzug positive ausländische Erfahrungen übernommen oder an italienische Gegebenheiten angepasst werden.
228
Susanne Elsen
Genossenschaften als Organisationen sozialer Transformation und Entwicklung Von Italien lernen Einführung Im Zuge der Corona-Pandemie hat die Forderung nach Unabhängigkeit im Bereich von Schlüsselsektoren der lokal-regionalen Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, welche seit mehr als 30 Jahren mit wachsender Abhängigkeit von den Weltmärkten gefordert wird, neue Brisanz erhalten. Die Potenziale von Genossenschaften sind damit aus neuer Perspektive zu betrachten. Sie entstehen aus konkreten Lebensverhältnissen und sind in der Lage, mehr als andere Unternehmensformen, spezifische Bedürfnisse zu decken, lokale Potenziale zu nutzen und damit die Resilienz der Gemeinwesen zu stärken. Die sozialkulturelle Einbindung macht Genossenschaften zu Akteuren der ökonomischen, ökologischen und sozialen Sicherung und Entwicklung. Wie zahlreiche Untersuchungen zeigen, kann die kooperative Struktur von Genossenschaften eine Verteilung von Lasten in Krisenzeiten und damit eine höhere wirtschaftliche Stabilität bewirken. Die Bündelung der Kräfte, Reziprozität, Demokratie, Selbsthilfe und Selbstorganisation sind wirksame soziale und wirtschaftliche Strategien und gleichzeitig Modelle einer zukunftsfähigen Wirtschaftskultur. Die Möglichkeiten der lokal-regionalen Wertschöpfung durch Konsortien und Sekundärgenossenschaften werden derzeit vielerorts auch zur Schaffung von Wirtschaftskreisläufen erkannt. Dieser Beitrag setzt sich auseinander mit den Potenzialen genossenschaftlicher Lösungsansätze und bezieht sich vergleichend für das deutsche Genossenschaftswesen auf Entwicklungen in Italien.
Potenziale der Genossenschaften als Organisationen gesellschaftlicher Transformation Genossenschaften verbinden soziale und wirtschaftliche Funktionen und sind dem Bereich der nicht primär profitorientierten Unternehmen 229
SUSANNE ELSEN
zuzurechnen. In der internationalen Diskussion werden sie dem »Dritten« oder »Intermediären« Sektor, jenseits von Staat und Markt zugerechnet (Elsen 2007: 265 – 273). Es handelt sich bei dieser Zuordnung dabei eher um die zu einer Handlungslogik als zu einem abgegrenzten Sektor, welche geprägt ist von Mischungsverhältnissen der Logiken des Marktes (Kapital), des Staates (Recht und Gesetz) und Formen der Gemeinschaftlichkeit, die gekennzeichnet sind von Reziprozität und direkten sozialen Beziehungen. Diese Mischung bricht die Einseitigkeit der Marktlogik und integriert solidarische, zivilgesellschaftliche und lebensweltliche Belange in ökonomisches Handeln. Diese Mischung der Handlungslogiken durch die lebensweltliche Einbettung birgt Antworten auf komplexe Fragestellungen. Jürgen Habermas stellt die Rationalitäten, Strukturen und Handlungsmuster der Systeme Staat und Markt denen der kommunikativ strukturierten Lebenswelten gegenüber. Während das System Markt durch die Logik des Kapitals, der Konkurrenz und privaten Interessendurchsetzung und der Staat durch Macht und Gesetz dominiert sind, steuern sich Lebenswelten durch Verständigung und Solidarität (Habermas 1985: 158). Genossenschaften als lebensweltlich verankerte, hybride Formen des Wirtschaftens kompensieren nicht nur Mängel und Fehler der Systeme Staat und Markt, sondern sind auch in ihrer eigenen Logik als gesellschaftliche Korrektive und Gegenentwürfe zur reinen Kapitallogik zu betrachten. Auch das Konzept der reflexiven Modernisierung betont die Bedeutung der Mischlogik und der Multiperspektivität hybrider Lösungen. In seinem 1993 erschienenen Buch Die Erfindung des Politischen beschreibt Ulrich Beck das Konzept der reflexiven Modernisierung, das von der Wahrnehmung der Risiken der industriellen Moderne ausgeht. Dieses Konzept verabschiedet sich von der Vorstellung der wachstumsorientierten Modernisierung als Prozess immer weiterer funktionaler Differenzierung und Spezialisierung, welche Zusammenhänge und Handlungsfolgen ausblenden. Reflexive Modernisierung ist eine »Spezialisierung auf den Zusammenhang« (Beck 1993: 189). Sie erfordert integrative Lösungsansätze, die auf der Aufhebung von Trennungslogiken, auf kooperativer Wissensproduktion, der Entmonopolisierung von Sachverstand sowie der demokratischen Öffnung von Diskursen, Institutionen und Entscheidungen für gesellschaftliche Relevanzmaßstäbe basieren. Damit begründet Beck einen notwendigen Wandel in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in der Weltrisikogesellschaft (Beck 2008). Die genossenschaftliche Organisationsform erfüllt mit ihrer integrierenden Logik, der demokratischen Struktur und der lebensweltlichen Einbindung diese Voraussetzungen. Die Stärke der Genossenschaften liegt in ihrer Mischlogik. Die verschiedenen Rationalitäten und die Einbindung in die Lebenswelt erzeugen neue Kombinationen und lebensnahe Möglichkeiten, auch solche, die erfolgreich in den Markt münden, 230
GENOSSENSCHAFTEN ALS ORGANISATIONEN SOZIALER TRANSFORMATION
z.B. neue Produktivgenossenschaften im Bereich Recycling, der Biolandwirtschaft oder in sozialen Pflege- und Gesundheitsdiensten. Genossenschaften sind hybride Organisationen des Sowohl-als-Auch, Organisationsformen, die sowohl kulturelle, soziale und ökologische, als auch ökonomische Ziele verfolgen, im ökonomischen Bereich agieren, aber Teil der organisierten Zivilgesellschaft sind. Genossenschaften kommt aus diesem Grunde die Rolle von Innovatoren im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Geschehen zu. Das sozialökonomische Potential dieser hybriden Organisationen liegt in der Möglichkeit der Bündelung von Kräften und der Mitgliederwirtschaft. Wertschöpfung und Wertverteilung folgen der Zweckbestimmung, die von den Mitgliedern definiert wird, und nicht Investoreninteressen. Monetäres Kapital hat dienende Funktion, während soziales Kapital als Basis von Kooperation eine zentrale Rolle spielt. Einen starken Impuls erfährt die genossenschaftliche Bewegung gegenwärtig durch das wachsende Bewusstsein der Zivilgesellschaft für die notwendige öko-soziale Transformation zur Bewältigung des Klimawandels, der veränderten Demographie und der Folgen der jüngsten Pandemie, welche das Globalisierungsparadigma in Frage stellt. Die immer deutlicheren Folgen des Marktversagens, der Naturmissachtung und der sozialen Gleichgültigkeit stärken gesellschaftliche Strömungen, die alternative Vorstellungen von Wohlfahrt und einem guten Leben vertreten. Die wachsende Kritik an der Externalisierung sozialer und ökologischer Effekte erklärt das Ansteigen öko-sozial orientierter Ökonomien und das Interesse an alternativen Wirtschafts- und Lebenskonzepten, die den sozialen und ökologischen Erfordernissen Rechnung tragen (Elsen 2019). Sie sind Gegenentwürfe zur industriellen Moderne, die im Glauben an technische Machbarkeit und grenzenloses Wachstum realisiert wurden. Eine Rückbesinnung auf kleinere Maßstäbe in Bezug auf organisatorische Einheiten, Re-Lokalisierung und die Adaption sozialer und ökologischer Effekte wirtschaftlicher und technologischer Entwicklungen sind dringende Erfordernisse. Eine Schlüsselfunktion in der Transformation kommt der Gestaltung der Arbeitswelt im lokal-regionalen Kontext zu. Der Konsumökonom Niko Paech (2015) entwirft folgende Vorstellungen von Arbeit, Wirtschaft, Gemeinwesen und Genossenschaften in der Postwachstumsgesellschaft: Der Industrieoutput sei höchstens halb so groß, ergänzt um eine Regionalökonomie. Letztere ließe sich durch Komplementärwährungen stabilisieren. So verbliebe Kaufkraft in der Region und Finanzspekulationen verlören an Boden. Genossenschaften wären die dominante Unternehmensform, weil sie über eine demokratische Steuerung Kapitalverwertungszwänge dämpfen könnten. Produkte wären reparaturfreundlich und langlebig. Dienstleister würden den vorhandenen Bestand an Gütern erhalten, pflegen, optimieren oder umbauen. Aus Konsumenten würden 231
SUSANNE ELSEN
moderne Selbstversorger. Sie arbeiteten infolge des ca. 50-prozentigen Industrierückbaus durchschnittlich 20 Stunden und nutzten die freigestellte Zeit, um handwerkliche und soziale Kompetenzen zu entwickeln. Gemeinschaftsgärten, offene Werkstätten, Reparatur-Cafés, künstlerische Aktivitäten, Gemeinschaftsnutzung und Netzwerke der gegenseitigen Hilfe würden dazu beitragen, ein modernes Leben mit weniger Geld und industrieller Produktion zu ermöglichen. Genossenschaften nehmen in diesem Zukunftsmodell auch deshalb eine besondere Rolle ein, da sie als Schule der Demokratie wirken, wo Eigenverantwortung und Partizipation gelebt werden. Die Basis aller Entscheidungen sind die Mitglieder, die in Genossenschaften als Eigentümer mit ihrer Einlage haften und gleichberechtigt, das heißt mit jeweils einer Stimme, ihr Mitbestimmungsrecht ausüben können. Es zählt jeder Einzelne als Mitglied, nicht vorrangig das Kapital, welchem dienende Funktion zukommt. Die gewählten bzw. berufenen Vertreter der Mitglieder, Aufsichtsrat und Vorstand, müssen den Mitgliedern gegenüber Rechenschaft ablegen und sich die Zustimmung für ihr Handeln einholen.
Potenziale gilt es zu erkennen und zu entfalten Bei diesen idealisierend erscheinenden wirtschaftskulturellen Spezifika handelt es sich um Potenziale auf der Basis der weltweit gültigen Genossenschaftsgesetze. Ihre Entfaltung ist an Voraussetzungen gebunden. Die Kriterien müssen tatsächlich gelebt werden, was insbesondere in entwickelten Marktgesellschaften, welche weitgehend auf der Kapitallogik beruhen, genossenschaftliche Bildungs- und Identitätsarbeit erfordert. Genossenschaften und andere assoziative Formen lebensweltlichen Wirtschaftens ergänzen oder ersetzen fehlende, unzureichende oder unpassende Lösungen des Marktes oder des Staates, oder sie stellen sich als alternative Gegenentwürfe dar. Je mehr sie in ihren Zielen und ihrer sozioökonomischen Praxis Alternativen zum dominanten System darstellen, desto stärker stehen sie im politischen und institutionellen Gegenwind. Es bedarf also der Zulassung der diversen, lebensnahen Lösungen, welche die Möglichkeiten der Gesellschaften zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen erweitern. Dies erfordert einen ermöglichenden gesellschaftlichen Rahmen »für die Vermehrung gemeinsamer und assoziativer Tätigkeiten, die grundlegend sind für eine globale Zivilgesellschaft, in der das Prinzip der Selbstverwaltung in einer Vielzahl von Räumen bürgerschaftlichen Engagements (…) zu seinem Recht kommt« (Adloff/ Leggewie 2015: 66). Lokale Genossenschaften antworten auf konkrete Bedarfe. Die (Re-)Produktion und Bewirtschaftung des Gemeinwesens ist Kontext, Ziel und Grundlage dieses Wirtschaftens. Lokale Räume 232
GENOSSENSCHAFTEN ALS ORGANISATIONEN SOZIALER TRANSFORMATION
können Labore für Politiken der Möglichkeiten werden. Neue Erscheinungsformen sozial innovativer Kräfte, die im Aktionsraum Lebenswelt verankert sind, dürfen nicht marginalisiert, also als Abweichung eines Normalzustandes betrachtet, sondern gerade auf institutioneller Ebene als Evolutions- und Stabilitätsfaktor erkannt werden (Beck/Lau 2004). Der systematischen Einleitung und Begleitung lokaler Entwicklung von unten in der Kultur des Community Development (Elsen 2019), kommt im Zusammenhang der Gründung lokaler Genossenschaften, insbesondere von Sozialgenossenschaften, eine zentrale Rolle zu. Integrierte Ansätze lokaler Entwicklung verknüpfen das Recht auf soziale Sicherung und die Option sozialproduktiver Teilhabe. Beispiele sind Seniorengenossenschaften, die in Verbindung mit Zeitbanken oder CoHousing neue Solidar- und Reziprozitätsformen schaffen und bürgerschaftliches Engagement in eigener und gemeinsamer Sache produktiv machen oder die lokale Bewirtschaftung von Gemeingütern in Form von Bürgergenossenschaften, die Gemeinschaftseinrichtungen erhält, Teilhabemöglichkeiten erschließt und gleichzeitig ein drängendes Gegenwarts- und Zukunftsproblem löst. Ein Beispiel aus der Umweltpolitik, verbunden mit sozialen und demokratisierenden Effekten sind Energiegenossenschaften, die in kooperativer Selbstorganisation Kontrolle über die Einspeisung, die Pflege der Netze, den Preis und die Gewinnverwendung im Energiebereich gewährleisten.
Von Italien lernen Wie alle Genossenschaften sind auch die italienischen und die deutschen den Grundsätzen verpflichtet, die von der International Cooperative Alliance (ICA) 1995 formuliert wurden. Doch verweist bereits die Gegenüberstellung der gesetzlichen Grundlagen der italienischen und der bayerischen Verfassungen auf zwei verschiedene Linien, die sich seit dem frühen 20. Jahrhundert herausgebildet und im weiteren Verlauf, auseinanderentwickelt haben. Beide Verfassungen enthalten Artikel zur expliziten Förderung von Genossenschaften. Artikel 45 der italienischen Verfassung von 1947 besagt: »Die Republik erkennt die soziale Funktion der Kooperation, der Gegenseitigkeit und der nicht spekulativen Ziele an.« (La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.) Die gesellschaftliche Funktion von Genossenschaften und ihr nicht primär profit-orientierter Charakter werden also explizit betont. Dies definiert Genossenschaften als soziale und solidarische Unternehmen und als Gegenentwürfe zur Ökonomie der Profitmaximierung. In Italien entwickelte sich eine diversifizierte, gesellschaftlich 233
SUSANNE ELSEN
eingebundene Genossenschaftslandschaft »von unten«, die aus dem Kontext der Zivilgesellschaft, wirksam auf sich je verändernde gesellschaftlichen Fragen und Problemlagen antwortete (Kiesswetter 2018). In dieser Entwicklung lassen sich vier gesellschaftliche Phasen und jeweilige Genossenschaftstypen unterscheiden welche analog auf jeweilige Problemstellungen antworten: Seit Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1970er Jahre geht es, wie in anderen europäischen Ländern um die kooperative Organisation von Arbeit insbesondere auf dem Land und um grundlegende Versorgung insbesondere im städtischen Raum. Der anschließende Aufbruch der Sozialgenossenschaften seit den 1980er Jahren mit der Organisation sozialer und gesundheitlicher Dienste, antwortete auf die sozialen Bedürfnisse, welche mit der Veränderung der Familienstrukturen, der Urbanisierung und der wachsenden Erwerbstätigkeit der Frauen einhergingen. Seit Erlass des Gesetzes zur Regelung von Sozialgenossenschaften 1991 in Italien sind zahlreiche Kooperativen im Gesundheits- und Sozialbereich oder Produktivgenossenschaften mit beschäftigungsorientierten, sozialen und ökologischen Zielsetzungen entstanden. Sozialgenossenschaften arbeiten in der Landwirtschaft, im Handwerk, in Bildung und Kultur, in Industrie und Handel. Die Förderungswürdigkeit dieses produktivgenossenschaftlichen Typs mit sozialer Zielsetzung erfordert einen Anteil von mindestens 30 Prozent Mitgliedern mit sozialen Integrationsproblemen. Sozial- und Gesundheitsgenossenschaften ermöglichen bedarfsspezifische und kosteneffiziente Lösungen im Sozialund Gesundheitswesen, da keine Ressourcenabflüsse an Investoren oder Overheadkosten an hierarchische Organisationsstrukturen der Gesundheits- oder Sozialwirtschaft abgeführt werden. Auch im Fall öffentlicher Förderung ermöglichen Sozialgenossenschaften optimale Ressourcennutzung, Transparenz und die demokratische Mitsprache bzw. die Selbstvertretung der NutzerInnen. Genossenschaftsgründungen im Bereich sozialer und gesundheitlicher Dienste reagieren auf neue soziale Bedürfnisse und die Selbstvertretungsansprüche Betroffener. Als demokratische Organisationsformen sind sie auch aus der Perspektive der Emanzipation und des Empowerments benachteiligter Menschen bzw. der Realisierung ihrer sozialen Rechte von Interesse, da sie Alternativen gegenüber der Entwertung im Arbeitsmarkt und der wohlfahrtsstaatlichen Bevormundung darstellen. Seit Ende der 1990er Jahre antworten Bürgergenossenschaften (Cooperative di Comunità) auf die komplexen Herausforderungen insbesondere peripherer ländlicher Räume welche unter Abwanderung junger, qualifizierter Menschen, der Ausdünnung der Infrastrukturen und einem Mangel an Zukunftsperspektiven leiden. Bürgergenossenschaften als Multistakeholder-Unternehmen entwickeln in den betroffenen Gebieten abgestimmte Konzepte unter Einbeziehung möglichst aller Kräfte 234
GENOSSENSCHAFTEN ALS ORGANISATIONEN SOZIALER TRANSFORMATION
vor Ort (Kiesswetter 2018, Elsen/Angeli/Bernhard/Nicli 2020). In einigen Regionen Italiens werden derzeit gesetzliche Rahmenbedingungen für diese Genossenschaftsform verabschiedet. Als jüngste Entwicklung lassen sich genossenschaftliche Firmenübernahmen durch Mitarbeitende (Workers BuyOut) nennen, welche Anteile übernehmen und damit die Unternehmen gegen die Schließung schützen (Kiesswetter 2018). Diese genossenschaftlichen Übernahmen werden, wie auch Neugründungen, über einen genossenschaftlichen Mutualitätsfonds kofinanziert, welcher eine der Säulen des italienischen Genossenschaftswesens bildet. Bemerkenswert am italienischen Weg ist, dass der Veränderungsdruck von unten zur permanenten Anpassung der gesetzlichen Grundlagen geführt hat, während Deutschland fast fünfzig Jahre an einer einzigen Genossenschaftsreform gearbeitet hat, die dann 2006 endlich erlassen wurde. Das italienische Genossenschaftswesen konnte zudem die historische Phase des italienischen Faschismus weitgehend unbeschadet überleben, denn in Italien existieren gesellschaftstragende Strukturen unterhalb der jeweiligen Regime. Sicher liegt einer der Gründe darin, dass Menschen in Italien vielfach Lösungen für politische, soziale und ökonomische Pro bleme selber schaffen mussten und müssen. Es gibt, insbesondere im Süden Italiens Bereiche, bei denen man von Staatsversagen sprechen kann und was den Arbeitsmarkt betrifft, auch von Marktversagen. Bei den italienischen Sozialgenossenschaften, die oft als beispielhafte Ansätze sozialer Innovation anzusehen sind, ist zu betonen, dass es in Italien vielfach an Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens mangelt und Betroffene bzw. ihre Angehörigen zur genossenschaftlichen Selbsthilfe griffen und greifen müssen. Während Deutschlands Wohlfahrtswesen unter der Macht und dem Eigeninteresse der Wohlfahrtskonzerne riskiert, sich immer weiter von den Interessen der Anspruchsberechtigten des Sozialstaates zu entfernen, hat Italien zwar kreative lokale Sozialgenossenschaften, aber diese sind keine Regeleinrichtungen und garantieren damit nicht die generelle Versorgung im jeweiligen Bereich.
Die Entwicklung in Deutschland Die Gründung von Genossenschaften und die deutsche Genossenschaftsbewegung waren in ihren Anfängen eng mit dem Kampf für bessere, menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen verknüpft. Allerdings fiel die genossenschaftliche Kernidee, nämlich die der Selbsthilfe Mittelloser, der besonderen historischen Situation zum Opfer. Durch die Entwicklungen im Nationalsozialismus und in den Nachkriegsjahren wurde 235
SUSANNE ELSEN
in Deutschland der sozialreformerische Ansatz weitgehend zurückgedrängt. Während der NS-Zeit wurden Genossenschaften als demokratische Strukturen systematisch bekämpft und der Großteil bis Anfang der 1940er Jahre aufgelöst (Brendel 2011). Als demokratische Alternativen, die von den Mitgliedern gesteuert werden, waren sie nicht mit dem Führerprinzip vereinbar. Die Kapitalorientierten Genossenschaften im Kredit- und Wohnungsbereich wurden dem Führerprinzip unterstellt, verloren aber damit den Kern genossenschaftlicher Wirtschaftskultur und wurden zum Zusammenschluss in großen Einheiten gezwungen, was zusätzlich mit einem Verlust der Identifikation der Mitglieder einherging. Sozialreformerische Konsum- und Produktivgenossenschaften wurden verboten. Für das deutsche Verständnis des Genossenschaftswesens, auch in der Nachkriegszeit, lässt sich stellvertretend Artikel 153 der bayerischen Verfassung von 1946 heranziehen, der zwar zunächst erstaunlich kritisch klingt, jedoch auch den spezifisch mittelständischen Charakter des deutschen Genossenschaftswesens spiegelt: »Die selbständigen Kleinunternehmen und Mittelstandsbetriebe (…) sind in der Gesetzgebung und Verwaltung zu fördern und gegen Überlastung und Aufsaugung zu schützen. Sie sind in ihren Bestrebungen, ihre wirtschaftliche Freiheit und Unabhängigkeit sowie ihre Entwicklung durch genossenschaftliche Selbsthilfe zu sichern, vom Staat zu unterstützen. (…)« Genossenschaften dienten der Stärkung der Kleinunternehmen gegenüber den großen industriellen Konzernen aber auch gegenüber den Habenichtsen, die als nicht selbsthilfefähig deklariert wurden (Elsen 2007). Deutschlands Genossenschaftswesen hat sich von diesem Identitätsverlust kaum wieder erholt und das mangelnde öffentliche Interesse an der genossenschaftlichen Wirtschaftskultur verlieh ihm eine eher marginale Position in der Unternehmenslandschaft. Das historische Gedächtnis für eine Alternative zur kapitalistischen Wirtschaftsweise wurde ausgelöscht. Die genossenschaftlichen Großstrukturen leiden unter mangelnder Mitgliederidentifikation. Es entstanden quasi monopolistische Prüfverbände, die mit teuren Gründungsverfahren und Pflichtprüfungen Neugründungen insbesondere kleiner und innovativer Genossenschaften in Deutschland über Jahrzehnte verhinderten. In der Folge erstarrte das deutsche Genossenschaftswesen und konnte kaum neue Gründungen verzeichnen. Hierzu trug auch die Entwicklung im Osten Deutschlands bei, wo staatskollektivistische Genossenschaften kaum Bezüge zur demokratischen Genossenschaftskultur erkennen ließen. Gerade in der Phase der Wende hätten genossenschaftliche Lösungen für zahlreiche DDR-Betriebe eine Alternative zur Schließung oder zur Übernahme durch Investoren dargestellt, doch sowohl die mächtigen Kapitalinteressen als auch die Hoffnungen der Bevölkerung nach den Erfahrungen der Mangelwirtschaft ließen diese Lösungen nicht zu. Das falsche 236
GENOSSENSCHAFTEN ALS ORGANISATIONEN SOZIALER TRANSFORMATION
Verständnis, das mangelnde öffentliche Interesse und das fehlende historische Gedächtnis waren sowohl Folgen als auch Ursachen einer marginalen Position der Genossenschaften in der deutschen Wirtschaftslandschaft (Elsen/Walk 2016). Diese Tendenzen spiegeln sich nicht zuletzt in der Forschung. Die sich verstärkenden gesellschaftlichen Ökonomisierungstendenzen seit den 1980er Jahren wirkten sich auch auf die Genossenschaftsforschung aus. Während in den Sozialwissenschaften nur noch lückenhaft zum Thema geforscht wurde, richteten sich immer mehr Genossenschaftsinstitute an rein betriebswirtschaftlichen und juristischen Analysen aus (Laurinkari 2002). Nicht nur wurde das zivilgesellschaftliche Potenzial von Genossenschaften in den theoretischen Debatten in Deutschland viele Jahre stiefmütterlich behandelt, sondern insgesamt wurde die alternative genossenschaftliche Gestaltungskraft zu wenig diskutiert. Mit der Gesetzesnovellierung, die am 18. August 2006 in Kraft trat, wurde auch in Deutschland eine Wiederbelebung der Genossenschaftsidee für die aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfordernisse ermöglicht. Neu ist die Öffnung der Rechtsform für soziale, gesundheitliche und kulturelle Zwecke (Sozial- und Gesundheitsgenossenschaften) nach italienischem Vorbild. Für Deutschland bedeutet dies eine Möglichkeit, aber auch eine Herausforderung, sich einem zeitgemäßen Modell des Wohlfahrtsstaates zuzuwenden, in dem die Forderung nach gesellschaftlicher Teilhabe und Selbstvertretung der Anspruchsberechtigten in einem gestaltenden Sozialstaat Realität werden könnte. Dem steht jedoch die mangelnde Erfahrung der überwiegend auf mittelständische Gründungen orientierten Genossenschaftsverbände und insbesondere die Organisation sozialpolitischer Belange durch die Wohlfahrtsindustrie entgegen. Die genossenschaftlichen Potenziale erfordern zu ihrer Entfaltung insbesondere im Kontext von Sozialgenossenschaften Betroffener ein förderliches Umfeld, eine starke Dezentralisierung, die Akzeptanz und Stärkung von Selbstorganisation und die Integration in eine gestaltende Sozialpolitik. Erst in den vergangenen ca. zehn Jahren kam es, nicht zuletzt durch die internationale Finanzkrise, zu einem Wandel hinsichtlich der Rückbesinnung auf die demokratiepolitische und gemeinwohlfördernde Bedeutung von Genossenschaften. In der Diskussion wurde zunehmend die Idee der Genossenschaften als Form solidarischer Ökonomie diskutiert und an den zivilgesellschaftlichen und emanzipatorischen Attributen von Genossenschaften angeknüpft. Was hier diskutiert wird, ist also insbesondere eine Aufgabe aktiver Arbeitsmarkt- und Gesellschaftspolitik. Eine aktive Sozialpolitik und eine echte Subsidiarität, die nicht die großen Wohlfahrtskonzerne bevorzugt, würde in Deutschland durch die Förderung der genossenschaftlichen Selbstvertretung auch aber nicht nur, Benachteiligter eine 237
SUSANNE ELSEN
tiefgreifende soziale und sozialpolitische Innovation bewirken. Vor allem aber braucht es Kontexte der Bildung, des sozialen Lernens und Experimentierens und damit auch das Zulassen von Scheitern.
Ausblick Die aktuelle Situation kumulativer gesellschaftlicher Probleme resultierend aus Finanzkrise, der Klimakrise des Erkennens der negativen Folgen der Weltmarkabhängigkeiten und einer Hinwendung zu gesellschaftlicher Neuorientierung, fordert dazu auf, die Potenziale des Genossenschaftswesens neu zu analysieren und zu erschließen. Insbesondere im Bereich der nicht primär kapitalorientierten Bedarfsdeckung mit Grundgütern und Dienstleistungen im lokal-regionalen Kontext, haben sie ihre Kompetenzen und sind jetzt gefragt. Genossenschaften sind, wie zahlreiche Untersuchungen weltweit zeigen, durch ihre kooperative Struktur und die Verantwortungsübernahme der Mitglieder auf der Basis (relativer) Gleichheit gerade in Krisenzeiten stabile Unternehmensformen. Die Entwicklung von Genossenschaften im sozialen und gesundheitlichen Sektor, im Bereich von Bildung, Kultur und Ökologie sowie im Bereich der Organisation von Einrichtungen der Infrastruktur sind angesichts der Situation des öffentlichen Sektors aber auch der Ansprüche der Gestaltung einer partizipativen Bürgergesellschaft zentrale Herausforderungen unserer Zeit. Insbesondere die anspruchsvolle Form der Sozialgenossenschaften Betroffener wäre die konsequenteste soziale Innovation des deutschen Wohlfahrtssystems, sofern diese verbunden wird mit einer gestaltenden Sozial- und Gesellschaftspolitik, die die förderlogischen Voraussetzungen hierfür gewährleistet.
Literatur Adloff, Frank/Leggewie, Claus (2014): Das konvivialistische Manifest, Bielefeld: Transcript. Beck, Ulrich (1993): Die Erfindung des Politischen, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Beck, Ulrich (2008) Weltrisikogesellschaft, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Beck, Ulrich/Lau Christoph (2004). Entgrenzung und Entscheidung, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Brendel, Marvin (2011): »Genossenschaftsbewegung in Deutschland – Geschichte und Aktualität«, in: Michaela Allgeier (Hg.): Solidarität, Flexibilität Selbsthilfe, Wiesbaden: VS-Verlag. 238
GENOSSENSCHAFTEN ALS ORGANISATIONEN SOZIALER TRANSFORMATION
Elsen, Susanne (1997): Gemeinwesenökonomie, Neuwied: Luchterhand. Elsen, Susanne (2007): Die Ökonomie des Gemeinwesens, Weinheim und München: Juventa Verlag. Elsen, Susanne (2014): »Soziale Innovation, ökosoziale Ökonomien und Community Development«, in: Elsen, S./Lorenz, W. (Hg.), Soziale Innovation, Partizipation und gesellschaftliche Entwicklung, Bozen University Press, Bozen. Elsen, Susanne (2015): »Gemeinwesen, Gemeingüter und ökosoziale Wende«, in: Elsen, Susanne/Reifer, Günther et.al. (Hg.), Die Kunst des Wandels, München: oekom Verlag. Elsen, Susanne (2019): Eco-Social Transformation and Community-Based Economy, London, New York: Routledge. Elsen, Susanne/Walk, Heike (2016): »Genossenschaften und Zivilgesellschaft. Historische Dynamiken und zukunftsfähige Potentiale einer öko-sozialen Transformation«, in: Forschungsjournal Soziale Bewegungen (2016/3), S. 60–73. Habermas, Jürgen (1985): Die neue Unübersichtlichkeit, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Kiesswetter, Oscar (2018): Genossenschaften made in Italy. Norderstedt: BoD. Laurinkari, Juhani (2002): »Das Genossenschaftswesen in einer im Wandel begriffenen Welt«, in: Markus Hanisch (Hg.): Genossenschaftsmodelle zwischen Auftrag und Anpassung, Berlin : Inst. für Genossenschaftswesen, S. 13–29. Paech, Niko (2015): »Gesellschaft an der Wachstumswende. Vom Wachstumsdogma zur Postwachstumsökonomie«, in: Elsen, Susanne/Reifer, Günther et.al. (Hg.), Die Kunst des Wandels, München oekom Verlag.
239
Jerzy Kaczmarek
Sozialgenossenschaften in Polen1 Rechtslage Seit dem 27. April 2006 gibt es in Polen ein Sozialgenossenschaftsgesetz, das alle genossenschaftlichen Aktivitäten, die bislang unter verschiedenen Gesetzen geregelt wurden, unter sich versammelt. Eine Sozialgenossenschaft soll, zum Zeitpunkt ihrer Gründung, aus mindestens drei natürlichen Personen bestehen (die innerhalb eines Jahres noch zwei weitere Personen als Mitglieder und/oder als Beschäftigte aufnehmen müssen). Sie können aber auch durch zwei juristische Personen (Nichtregierungsorganisationen, territoriale Selbsverwaltungen, kirchliche Organisationen) gegründet werden. Ziel der Sozialgenossenschaften soll es sein, sozial Benachteiligten in ihrem konkreten Lebensumfeld Unterstützung anzubieten. Zu den benachteiligten Personen gehören nach diesem Gesetz: Arbeitslose, Alkohol- oder Drogenabhängige, Personen, die einen Entzug oder eine Therapie machen, körperlich Behinderte sowie psychisch auffällige und instabile Menschen; Obdachlose und Flüchtlinge sowie Personen, die nach einem Gefängnisaufenthalt Integrationshilfen benötigen. Sozialgenossenschaften sollen soziale Ziele durch wirtschaftliche Tätigkeit verwirklichen. Mitglieder und Mitarbeiter leiten das Unternehmen auf der Grundlage ihrer eigenen Arbeit. Im Art. 2.1. des Gesetzes heißt es dementsprechend: »Eine Sozialgenossenschaft dient 1) der sozialen Wiedereingliederung ihrer Mitglieder und Angestellten, […] ihre Tätigkeit zielt darauf ab, Fähigkeiten zur Teilnahme am Leben in der örtlichen Gemeinschaft (Kommune) zu vermitteln, wieder herzustellen und aufrecht zu erhalten 2) und damit die berufliche Wiedereingliederung ihrer Mitglieder und Angestellten zu ermöglichen […]. Eine Sozialgenossenschaft kann soziale, erzieherische und kulturelle Aktivitäten zum Wohle ihrer Mitglieder, Angestellten und ihres lokalen Umfelds sowie sozial nützliche Aktivitäten im Bereich der öffentlichen Aufgaben durchführen […].« (Dz. U. 2006 Nr 94 poz. 651). Sozialgenossenschaften erhalten in der Regel finanzielle Unterstützung aus kommunalen oder EU-Mitteln und sind von der Steuer befreit. Der 1 Jerzy Kacmarek ist plötzlich und unerwartet am 7.4.2021 verstorben. Er war dem Bayreuther Soziologen ein lieber Kollege und Freund. Wir sind sehr traurig über seinen frühen Tod. Sein Beitrag wurde vom Herausgeber überarbeitet.
240
SOZIALGENOSSENSCHAFTEN IN POLEN
Staat oder lokale Verwaltungseinheiten unterstützen sie mit Zuschüssen, Darlehen, Bürgschaften, Beratung oder Rückerstattung von Überprüfungskosten. Die Unterstützung »wird durch Beschluß der zuständigen Behörden (zumeist auf der Ebene der territorialen Selbstverwaltung oder im Rahmen eines Programms des für Arbeit und Soziales zuständigen Ministers) für Zwecke gewährt, die den Aufbau und die Entwicklung sozialer Kooperativen fördern«. (ibid.)
Die Geschichte der Sozialgenossenschaften in Polen Wie in den meisten anderen europäischen Gesellschaften beginnt die Geschichte der Genossenschaften in Polen bereits im Mittelalter. Orden, Klöster, Gilden und Zünfte schufen ein komplexes System von Unterstützungsleistungen für ihre Mitglieder. Überliefert sind berufsgenossenschaftliche Strukturen bei Bergbaukassen und Firschereigenossenschaften (Leszczyński 2017: S. IX). Insbesondere im 19. Jahrhundert nahmen die Genossenschaftsgründungen an Fahrt auf. Das hatte mit der Industrialisierung, aber auch mit der Teilung Polens zu tun. Für viele Polen waren Genossenschaften so etwas wie ein Ersatz für einen eigenständigen Staat, der nicht existierte. Sehr schnell entwickelten sich Genossenschaften nach dem Ersten Weltkrieg, als Polen seine Unabhängigkeit wiedergewann. In vielen Genossenschaftsprogrammen dieser Zeit finden sich bereits sozialgenossenschaftliche Postulate, besonders bei christlichen Autoren wie Aleksander Wóycicki. Er schrieb, dass die Genossenschaften neben materiellen Zielen auch soziale Ideale realisieren sollen, insbesondere im Bereich von Bildung und Ausbildung (Wóycicki 2017: S. 77). Das Solidaritätsprinzip (caritas) habe »eine große moralische Bedeutung im gesellschaftlichen Leben und sei daher ein praktisches, modernes Instrument zur Förderung (bürgerlicher) Tugenden« (ibid., S. 78). Obwohl das Sozialgenossenschaftsgesetz in Polen erst im Jahre 2006 verabschiedet wurde, gab es bereits früher quasi-sozialgenossenschaftliche Aktivitätsformen. Das beste und wichtigste Beispiel ist »Barka« (»Die Barke«), die im Jahre 1989 durch zwei Psychologen – Tomasz und seine Frau Barbara Sadowski – gegründet wurde. In Władysławowo bei Poznań bezogen sie mit 25 Personen, die unter psychischen Problemen litten, das Gebäude einer verlassenen Schule. Darunter waren auch Personen, die nach der Verbüßung einer Gefängnisstrafe wieder in das normale Arbeitsleben eingegliedert werden sollten. Sehr schnell entstanden andere »Barka«-Gemeinschaften und heute ist »Barka« eine Dachorganisation, die verschiedene Vereine, Stiftungen und Sozialgenossenschaften umfasst. Die ersten »Barka«-Sozialgenossenschaften befassten sich mit Landwirtschaft, Gartenbau und der Herstellung und Reparatur von Möbeln. 241
JERZY KACZMAREK
Im Rahmen dieser »Barka«-Aktivitäten entstand im Jahre 2002 eine »Fachschule für Sozialarbeit«, die ihre Ziele vor allem darin sah, »Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. »Wir gehen vom Individuum zur Gesellschaft. Wir glauben, dass ein Mensch, der sich seiner selbst bewusst ist, der die Welt um sich herum versteht und seinen Platz in dieser Welt sieht, konfliktfreier und lebensfroh durchs Leben gehen wird.« (Leśniak 2009: S. 84). Inzwischen gibt es etwa ein Dutzend Vereine, die das Programm der Schule in die Praxis umsetzen. Eine dieser Vereinigungen widmet sich ausdrücklich der Gründung und den Prinzipien von »Sozialgenossenschaften« und fördert ein »soziales Unternehmertum«. Sie hat ein »Zentrum für Sozialwirtschaft« in Poznań gegründet, das Menschen hilft, sich auf dem Arbeitsmarkt zurechtzufinden. Die quasi-sozialgenossenschaftlichen Aktivitäten von »Barka« nahmen sich italienische Sozialgenossenschaften zum Vorbild. Bereits 1995 machten die Mitglieder von »Barka« in Rom Bekanntschaft mit Sozialgenossenschaften und übersetzten das italienische Genossenschaftsgesetz ins Polnische. Dieser Text gab den Anstoß für weitere Diskussionen und die künftige Verabschiedung eines ähnlichen Gesetzes in Polen. Die Vertreter von »Barka« gaben ihre Stellungnahmen zu dem Gesetzentwurf ab und nahmen an Sitzungen der Parlamentsausschüsse teil, die sich mit dem Gesetzentwurf befassten. Eine bedeutende Rolle spielte hierbei die katholische Kirche mit ihrer für den damaligen Staat nicht unproblematischen Soziallehre. Wie Barbara Sadowska schrieb: »Die philosophischen und ideologischen Grundlagen für die Schaffung von sozialem Unternehmertum haben ihre Wurzeln im Christentum. Sie finden ihre philosophischen Grundlagen in päpstlichen Enzykliken.« (Sadowska 2009: S. 111). Besonderer Nachdruck wird hier auf zwei Enzykliken von Papst Johannes Paul II. (»Laborem Exercens« und »Centesimus Annus«) gelegt. Tomasz Sadowski weist in diesem Zusammenhang zudem auf die grosse Bedeutung der Enzyklika von Benedikt XVI. »Caritas in Veritate« hin (Sadowski 2009: S. 336).
Entwicklung der Sozialgenossenschaften nach der Verabschiedung des Gesetzes Seit 2006, als das Sozialgenossenschaftsgesetz verabschiedet wurde, ist ihre Zahl in Polen ständig gewachsen. Die Abbildung (1) zeigt, wie sich die Zahl der Sozialgenossenschaften in Polen von 2006 bis 2017 verändert hat, Ende Dezember 2017 waren in Polen 1600 Sozialgenossenschaften registriert. Allerdings waren nicht alle Genossenschaften aktiv. Wie die Daten zeigen, waren Ende 2016 von 1.400 Genossenschaften 900 aktiv, während 300 kein Einkommen und keine Beschäftigung aufwiesen und 200 sich in Auflösung befanden. 242
SOZIALGENOSSENSCHAFTEN IN POLEN
Was die geographische Lage betrifft (siehe Abb. 2), war der Anteil der aktiven Sozialgenossenschaften in der Woiwodschaft Großpolen im 2016 am höchsten (15%), gefolgt von der Woiwodschaft Schlesien (10%) und der Woiwodschaft Masowien (9%). Die geringste Anzahl von Genossenschaften gab es in den Woiwodschaften Heiligkreuz und Oppeln (jeweils 3%).
Abb. 1. Die Zahl der Sozialgenossenschaften in Polen; Quelle: Spółdzielnie socjalne w 2016 r., S. 1.
Abb. 2. Sozialgenossenschaften in Polen (Verteilung nach den Woiwodschaften); Quelle: Spółdzielnie socjalne w 2016 r., S. 2.
243
JERZY KACZMAREK
Interessant ist die Unterteilung der Sozialgenossenschaften nach der vorherrschenden Art ihrer Tätigkeit (siehe Abb. 3). Die Daten für das Jahr 2016 zeigen die Art der Tätigkeit, die die Genossenschaften zum Zeitpunkt der Registrierung offiziell deklariert haben, sowie die tatsächliche Tätigkeit in einer bestimmten Branche entsprechend den erzielten Einnahmen. Daraus ist ersichtlich, dass die Angaben über den Zweck der Genossenschaft nicht immer mit ihren tatsächlichen Aktivitäten übereinstimmen. Die vier vorherrschenden Tätigkeitsbereiche, sowohl die deklarierten als auch die tatsächlich stattfindenden, sind: Beherbergungsbetriebe und Gastronomie, Verwaltungs- und Unterstützungsdienstleistungen, Verarbeitungsindustrie, Gesundheitsfürsorge und Sozialhilfe. Was die Zahl und Struktur der Beschäftigten betrifft, so beschäftigten die Sozialgenossenschaften in Polen im Jahr 2016 4,2 Tausend Menschen mit einem regulären Arbeitsvertrag. Die größte Zahl der Vollzeitbeschäftigten gehörte zur Altersgruppe der 31 bis 50-jährigen (49%), jeweils 25% der Beschäftigten war jünger oder älter. 58% der Beschäftigten sind Frauen. 26% der Beschäftigten mit regulärem Arbeitsvertrag isind Menschen mit Behinderungen. Von der Dynamik der Beschäftigung zeugt die Tatsache, dass, Ende 2017 bereits 5,5 Tausend Vollzeitbeschäftigte in Sozialgenossenschaften tätig waren (Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r., S. 20).
Abb. 3. Haupttätigkeiten der Sozialgenossenschaften; Quelle: Spółdzielnie socjalne w 2016 r., S. 3.
244
SOZIALGENOSSENSCHAFTEN IN POLEN
Der ökonomische Erfolg der Sozialgenossenschaften lässt sich nur schwer beziffern. Die meisten Genossenschaften (56%) erzielten 2016 Einnahmen zwischen 100.000 und einer Million Złoty (zum gegenwärtigen Zeitpunkt: 1 Euro = 4,68,- Zloty), während 35% der Genossenschaften Einnahmen zwischen 10.000 und 100.000 Złoty verzeichneten. 5% erwirtschafteten über eine Million Złoty, 4% unter 10 Tausend Złoty. 39% der Genossenschaften erzielten ein ausgeglichenes Finanzergebnis, 37% ein negatives Ergebnis, 24% erzielten Gewinne. Vergleicht man dies mit der Situation im folgenden Jahr (2017) ist ein positiver Trend feststellbar: 44,8% der Genossenschaften erzielten eine positive, 39,2% eine negative, 16% eine ausgeglichene Jahresbilanz. Obwohl die Zahl der Genossenschaften mit einem negativen Ergebnis um mehr als 2 Prozentpunkte zunahm, stieg gleichzeitig der Anteil der Genossenschaften mit einem positiven Ergebnis deutlich um mehr als 20 Prozentpunkte an. Im selben Jahr (2017) nahmen 16,8% der Sozialgenossenschaften Darlehen oder Kredite auf.
Abb. 4. Schwierigkeiten der Sozialgenossenschaften; Quelle: Spółdzielnie socjalne w 2016 r., S. 8.
Im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit berichten die Sozialgenossenschaften über verschiedene Schwierigkeiten und Hindernisse. Abbildung 4 zeigt, dass, wie zu vermuten war, finanzielle Fragen an erster Stelle stehen. Das betrifft vor allem die hohen Lohnnebenkosten (44%), fehlende Unterstützung seitens des Staates (41%) sowie hohe Haushaltsbelastungen (notwendige Investitionen und Löhne) (32%). Die zu große Konkurrenz auf dem regulären Markt beklagen 40%, unklare Rechtsvorschriften 31% der Befragten. 245
JERZY KACZMAREK
Fallbeispiele Nachfolgend möchte ich einige Sozialgenossenschaften vorstellen, die ihren Sitz in Wielkopolska haben, d.h. in der Woiwodschaft mit der höchsten Anzahl von Sozialgenossenschaften im Land. An erster Stelle ist hier die Genossenschaft »Znajome« (»Die Bekannten«) von Kaźmierz zu nennen, die sich selbst als eine Sozialgenossenschaft beschreibt, die »aus Leidenschaft gegründet« wurde. Sie ist noch sehr jung (2017 gegründet) und der Name »Znajome« bezieht sich auf ihre Gründerinnen, fünf junge, sehr engagierte Frauen. Die Aktivitäten der Genossenschaft konzentrieren sich auf die Herstellung und den Verkauf von Kunsthandwerk und die Organisation von Workshops sowie Beratungstätigkeiten. »Znajome« organisiert Workshops (Keramik, Nähen, Sticken, Häkeln und Patchwork). In der Ferienzeit werden Sommer- und Winterlager für Kinder organisiert. Darüber hinaus bietet die Genossenschaft Diätberatung an. Eine weitere Dienstleistung, die von »Den Bekannten« erbracht wird, ist die Organisation von Veranstaltungen aller Art – einschließlich Geburtstagsfeiern für Kinder (Catering). Am Sitz der Genossenschaft gibt es zudem ein für die Öffentlichkeit zugängliches Café. »Znajome« betreiben auch einen Kunsthandwerksladen. Auf ihrer Website regen sie zum Kauf ihrer Produkte an: »Wir laden Sie herzlich in unseren Laden ein, der ein Antipode der gegenwärtigen billigen chinesischen Waren ist! All die kleinen Dinge, die wir verkaufen, werden von uns mit den höchsten Sorgfalt aus hochwertigen regionalen Materialien handgefertigt. Wir hoffen, dass die Freude, die die Produktion unserer Servietten, Körbe und Taschen bereitet, ebenfalls an ihre künftigen Besitzer übergeht. Wir bemühen uns um Sorgfalt und Qualität« (http://znajome.org/sklep/). Während der Coronavirus-Pandemie setzte die Genossenschaft den Verkauf ihrer Produkte über das Internet fort. Die Genossenschaft »Wykon« (»Ausführung«) wurde von zwei juristischen Personen gegründet, dem Landkreis Poznań und der Gemeinde Pobiedziska und hat ihren Sitz in Pobiedziska. Sie befasst sich mit Reinigungsdiensten, Gartenarbeiten und der Pflege von alten und kranken Menschen. Die Sozialgenossenschaft »Uciec Dysforii« (»Flucht aus der Dysphorie«) hat ihren Sitz in Oborniki. Die Gründer der Genossenschaft erklären ihren Namen, der auch den Zweck der Genossenschaft definiert, mit den folgenden Worten: »Das Wort ›Dysphorie‹ wird verwendet, um die Stimmung einer Person zu beschreiben, die aufgrund verschiedener (weitgehend externer) Faktoren Schwierigkeiten hat, mit der sie umgebenden Realität zurechtzukommen. Die Folge davon ist eine Neigung zu Wut, Selbsthass, Reizbarkeit, Aggression und Ausbrüchen, die der Situation nicht angemessen sind, sowie die Unfähigkeit, Freude zu empfinden. Heutzutage sind wir alle von Dysphorie bedroht. Wir 246
SOZIALGENOSSENSCHAFTEN IN POLEN
wollen, dass diejenigen, die in der Sozialgenossenschaft »Flucht aus der Dysphorie« arbeiten, und diejenigen, denen wir Dienste anbieten, einen positiven Einfluss auf die täglichen Aktivitäten des jeweils anderen ausüben damit wir gemeinsam den Zuständen der Dysphorie entkommen können. Dies ist ein sehr wichtiges Ziel, das wir uns gesetzt haben.« (https://uciecdysforii.pl/). Der Tätigkeitsbereich der Genossenschaft ist sehr breit und umfasst Pflegedienste für ältere und behinderte Menschen, physiotherapeutische Angebote und Rehabilitationsdienste sowie die Vermietung von medizinischen Geräten. Die Partner der Genossenschaft sind Körperschaften wie die Pfarrei, das Rathaus, das Bezirksamt und die Genossenschaft Barka. Die Genossenschaft »Finezja« (»Finesse«), ist in der Stadt Konin zu finden. Es handelt sich um eine Milchbar mit einem breiten Angebot an Gerichten. »Finezja« arbeitete auch während des Coronavirus-Lockdowns und bot die kostenlose Lieferung von Speisen nach Hause an. Die Sozialgenossenschaft »Ale Smacznie« (»Aber Lecker«) aus Dąbie ist ebenfalls auf Catering und »Essen auf Rädern« spezialisiert. Sie bietet täglich Mahlzeiten in einer Kantine an, die sich in einer der Schulen befindet. »Ale Smacznie« wird vom »Europäischen Landwirtschaftsfonds für ländliche Entwicklung: Europa investiert in ländliche Gebiete« kofinanziert. Eine breitere Palette von Dienstleistungen bietet die Genossenschaft »Dobry Adres« (»Gute Adresse«) von Słupca, die mit dem Zentrum für berufliche Aktivitäten zusammenarbeitet. Sie betreibt ein Restaurant in Piotrowice in der Nähe von Słupca, bietet Catering-Verkäufe an, die auch während des Lockdowns stattfanden, organisiert Sonderveranstaltungen und Geschäftstreffen. Neben dem Gaststättengewerbe verkauft »Dobry Adres« auch Büromaterialien und stellt Werbematerialien her. Die Sozialgenossenschaft »Baza Łężyn« (»Basis Łężyn«) befindet sich zwischen Seen und Wäldern in der Nähe von Konin und beschäftigt sich hauptsächlich mit touristischen Dienstleistungen. Für Urlauber bietet sie die Vermietung von Unterkünften an und einen großen Parkplatz von einem halben Hektar. Eine zusätzliche Dienstleistung von »Baza Łężyn« ist der Service und die Reparatur von Gartenund Haushaltsgeräten. Die Sozialgenossenschaft »Komunalka Rzgów« (»Kommunaler Wirtschaftsbetrieb Rzgów«) wurde 2016 auf Initiative des Bezirksamtes in Konin und des Gemeindeamtes Rzgów gegründet. Der Hauptgegenstand ihrer Tätigkeit ist die Sammlung von Altkleidern, Möbeln und Haushaltsgegenständen verschiedenster Art. Darüber hinaus bietet sie Gartenund Reinigungsarbeiten sowie Transportdienstleistungen an. Im Jahr 2017 wurde der Genossenschaft das Zertifikat »Zakup Prospołeczny« (»Soziales Kaufhaus«) verliehen, das an herausragende sozial-ökonomische Einrichtungen vergeben wird. Eine weitere Sozialgenossenschaft heißt »Efekt« (»Effekt«) und wurde 2016 gegründet. Ihr Sitz befindet 247
JERZY KACZMAREK
sich in der Kleinstadt Kleczew. Die Genossenschaft ist auf kleine Renovierungs- und Bauarbeiten, die Pflege von Grünflächen, die Reinigung von Autos und Traktoren, von Häusern und Bürogebäuden spezialisiert. Einer der Gründe für die Einrichtung der Genossenschaft waren, wie die Gründer schreiben, soziale Ziele: »... die Notwendigkeit, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. Ihre Motivation, ihr Leben zu ändern um aus einer schwierigen Situation herauszukommen, bedeutet für sie eine enorme Verpflichtung zur Arbeit. Bislang haben fünf Personen bei uns Arbeit gefunden, aber wir hoffen, dass es bald noch viel mehr sein werden, denn der Bedarf in dieser Branche ist enorm. Wir träumen nicht von einem Haufen Geld, sondern von einem normalen, fairen Lohn« (http://efekt.spoldzielnie.org/o-nas-2/). Zum Schluss noch ein paar Worte über eine weitere Sozialgenossenschaft aus Kleczew: »Inter Media«, ebenfalls 2016 gegründet. Sie ist ein Beispiel für eine Genossenschaft, die eine hochspezialisierte Tätigkeit betreibt, nämlich einen regionalen Fernsehsender, der auf der Website ttr24.pl verfügbar ist. Man findet dort sowohl Berichte aus dem Leben der örtlichen Gemeinde als auch Musik-Programme. Die Genossenschaft erbringt Dienstleistungen für externe Einrichtungen in Form von Film- und Werbeproduktionen.
Zusammenfassung Aus den obigen Beispielen wird ersichtlich, dass sich die Sozialgenossenschaften nach der Verabschiedung des Gesetzes im Jahr 2006 rasch zu entwickeln begannen, obwohl es bereits unter anderen Gesetzen Genossenschaften mit einem ähnlichen Profil gab, deren bestes Beispiel die in ganz Polen bekannte »Barka« ist. Das Tätigkeitsfeld der Genossenschaften ist sehr breit gefächert und umfasst neben so populären Branchen wie der Gastronomie oder der Kranken- und Altenpflege auch Projekte wie den Betrieb eines eigenen Regionalsenders. Diese Vielfalt erlaubt es uns, optimistisch in die Zukunft der Sozialgenossenschaften in Polen zu blicken. Neben den ganz offensichtlichen Erfolgen haben die Genossenschaften jedoch auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die ihr frühes Ende herbeiführen. Viele dieser Misserfolge haben ihre Wurzeln in finanziellen Problemen, unklaren gesetzlichen Regelungen oder in konkurrierenden Angeboten auf dem Markt. Die Stärke der Genossenschaften liegt jedoch in der Kreativität ihrer Mitglieder, der Leidenschaft, mit der sie ihre Arbeit angehen, ihrem Sinn für Solidarität und Gemeinschaft, sowohl innerhalb der Genossenschaft als auch im Verhältnis zu ihren Kunden. Es wäre sicher interessant, die Aktivitäten der Sozialgenossenschaften während des durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Lockdowns zu verfolgen. Obwohl meine Beobachtungen sicher 248
SOZIALGENOSSENSCHAFTEN IN POLEN
unvollständig sind, scheint es mir, dass Anlass zu Optimismus für die Zukunft des Genossenschaftswesens in Polen besteht.
Literatur Dz. U. 2006 Nr 94 poz. 651. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Leszczyński F.K. (2017): »Spółdzielczość – kurs nieobrany?«, in: Leszczyński F.K. (Hg.), Spółdzielczość jako organizacja gospodarcza w II RP, Warszawa: Oficyna Naukowa. Leśniak G. (2009): »Grupy samokształceniowe, SAS-y (uniwersytety ludowe), Szkoła Animacji Socjalnej«, in: Sadowska B. (Hrsg.), Nowy początek. Społeczna gospodarka rynkowa 1989–2009, Poznań: Fundacja Pomocy Wzajmnej Barka. Sadowska B. (2009): »Obywatelska batalia o ustawy nowej generacji i aktywną politykę społeczną«, in: Sadowska B. (Hrsg.), Nowy początek. Społeczna gospodarka rynkowa 1989–2009, Poznań: Fundacja Pomocy Wzajmnej Barka. Sadowski T. (2009): Podsumowanie i rekomendacje, in: Sadowska B. (Hrsg.), Nowy początek. Społeczna gospodarka rynkowa 1989–2009, Poznań: Fundacja Pomocy Wzajmnej Barka. Wóycicki A. (2017): Moralne znaczenie spółdzielczości, in: Leszczyński F.K. (Hrsg.), Spółdzielczość jako organizacja gospodarcza w II RP, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Internetquellen http://bazalezyn.pl/ [Zugang: 01.07.2020] http://efekt.spoldzielnie.org/o-nas-2/ [Zugang: 01.07.2020] http://komunalkarzgow.pl/ [Zugang: 01.07.2020] http://spoldzielniadabie.pl/ [Zugang: 01.07.2020] http://spoldzielniadobryadres.pl/ [Zugang: 01.07.2020] http://wykon.spoldzielnie.org/ [Zugang: 30.06.2020] http://znajome.org/sklep/ [Zugang: 30.06.2020] https://finezja.konin.pl/ [Zugang: 30.06.2020] https://ttr24.pl/ [Zugang: 01.07.2020] https://uciecdysforii.pl/ [Zugang: 30.06.2020] Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r., in: file:///C:/ Users/UAM/Downloads/spoldzielnie_jako_podmioty_ekonomii_ spolecznej_w_2017%20(2).pdf [Zugang: 19.06.2020] Spółdzielnie socjalne w 2016 r., in: file:///C:/Users/UAM/Downloads/spoldzielnie_ socjalne_2016_.pdf [Zugang: 01.07.2020] 249
Thomas Horn
Bürgerstiftungen Das genossenschaftliche Prinzip der Selbsthilfe Einleitung Genossenschaften wurden im 19. Jahrhundert aus der wirtschaftlichen Not heraus geboren. Maßgeblich angetrieben durch die beiden Sozialreformer Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch wurde ein System geschaffen, das zu Recht bis heute als eine der nachhaltigsten Wirtschaftsformen der Welt angesehen werden kann, das Genossenschaftswesen. In unserer heutigen Zeit herrscht auch Mangel in vielen Bereichen. Zum Glück ist die Mangelernährung oder fehlende Schulen auf dem Land nicht mehr flächendeckend eine der größten Herausforderungen unserer heutigen Gesellschaft. Allerdings gibt es bis heute Bereiche, in denen staatliche Organe oder Behörden ihrer Zuständigkeit nicht oder nur geringfügig nachkommen. Ursache hierfür sind häufig leere Kassen oder zu schmale kommunale Budgets. Betroffen sind alle Bereiche des alltäglichen Lebens, wie z.B. fehlende Spielplätze, Musikinstrumente in Schulen oder die aktive Unterstützung von Menschen mit einem Handicap. Um diese Missstände zu beseitigen, haben sich Menschen in unterschiedlichen Organisationen zusammengeschlossen, häufig in Form von Bürgerstiftungen. Die Bürgerstiftungen haben den gleichen Antrieb, wie Raiffeisen und Schulze-Delitzsch vor 170 Jahren, nämlich die Hilfe zur Selbsthilfe. In diesem Beitrag wird deutlich werden, wie stark Bürgerstiftungen von ihrer Grundstruktur her den Genossenschaften ähneln. Es beginnt mit ihrem lokalen Wirken für die Menschen in einer bestimmten Region. Sie sind eine nachhaltige Institution, da die Bürgerstiftungen Bleibendes schaffen, denn letztendlich sollen auch künftige Generationen davon profitieren können.
Warum wurden im 19. Jahrhundert Kreditgenossenschaften gegründet? Zu Beginn des 19. Jahrhunderts und dem Schrecken der Napoleonischen Kriege setzte in Deutschland schrittweise der Übergang von der Agrarin die Industriegesellschaft ein. Die Geschwindigkeit der industriellen 250
BÜRGERSTIFTUNGEN
Revolution wurde durch den raschen Ausbau des Eisenbahnnetzes noch beschleunigt. Leidtragend waren die Menschen des gewerblichen Mittelstands, wie z.B. Schreiner, Dreher oder Tuchmacher. Diese kleinen Betriebe konnten mit den immer stärker werdenden großen Manufakturen nicht konkurrieren, da es aufgrund fehlenden Kapitals nicht möglich war, in neue Maschinen zu investieren. Kredite konnten die Menschen nicht aufnehmen, da es keine Banken gab, die ihnen das notwendige Kapital zur Verfügung stellen wollten. Zudem gab es noch die Wucherer, die Gelder gegen hohe Zinsen verliehen, was viele Handwerker mit ihren Familien in den Ruin trieb. Auf dem Land ging es den Menschen noch schlechter. Durch Missernten gab es zahlreiche Hungersnöte. Saatgut oder Futtermittel waren teuer, weshalb die Menschen in großer Armut lebten. Zwei Männer, die unabhängig voneinander mit der Not der Menschen durch ihre Arbeit konfrontiert wurden, entwickelten ein nachhaltiges Wirtschaftssystem, welches den Menschen dauerhaft helfen würde. Die Rede ist von Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch. Raiffeisen gründete während seiner Zeit als Bürgermeister von Weyerbusch/Westerwald den »Brodverein«, um die Menschen mit Lebensmitteln versorgen zu können. Zwei Jahre später gründete er den »Flammersfelder Hülfsverein«, ebenfalls eine genossenschaftliche Wohltätigkeitseinrichtung mit karitativem Charakter. Die Vereine wurden durch Spenden finanziert, was zwar die Not spontan linderte, jedoch nur vorrübergehend Bestand hatte, da man immer auf neue Spender angewiesen war. Im Jahre 1864 wandelte Raiffeisen den von ihm gegründeten Wohltätigkeitsverein in den Heddesdorfer Darlehnskassen-Verein um, die erste Raiffeisenbank. Die gleichen Beweggründe hatte Hermann Schulze-Delitzsch. Der Jurist und Anhänger der liberalen Bewegung in der Paulskirche hieß eigentlich Hermann Schulze. Da der Name Schulze unter den Parlamentariern häufig war, bekam er den Zusatz zu seiner Heimatstadt Delitzsch. Sein oberstes Anliegen war es, die Wettbewerbsfähigkeit von Handwerkern und Kleinunternehmern zu stärken.1 Diese Wettbewerbsfähigkeit wurde vor allem durch das Fehlen von Krediten für den gewerblichen Mittelstand verursacht. Er stand vor dem gleichen Problem wie Raiffeisen, denn die Kraft des Einzelnen reichte nicht aus, um mit den veränderten Herausforderungen zurande zu kommen. Den richtigen wirtschaftlichen Rahmen sah Schulze-Delitzsch in den Genossenschaften oder Assoziationen, die zu diesem Zeitpunkt bereits in England existierten. Im Jahre 1849 gründete er die erste Rohstoff-Assoziation für Schuhmacher. In einer Publikation über »Vorschuss- und Kreditvereine« verwendete er 1855 das erste Mal den Begriff »Volksbank«. An der Ausarbeitung des 1 Eichwald/Lutz 2011: S. 32 ff.
251
THOMAS HORN
Genossenschaftsgesetzes, welches im Jahre 1889 vom Deutschen Reichstag ratifiziert wurde, war Schulze-Delitzsch maßgeblich beteiligt. Die Basis des Genossenschaftsgesetzes und aller existierenden Genossenschaften sind die genossenschaftlichen Grundwerte: Selbsthilfe – Selbstverantwortung – Selbstverwaltung.
Genossenschaftliche Prinzipien gestern und heute Wie bereits erläutert, bilden die genossenschaftlichen Prinzipien seit über 170 Jahren die Basis aller Genossenschaften. Dies wird auch in Zukunft so sein. Doch welche Bedeutung haben diese Werte und wie werden sie umgesetzt? Selbstverantwortung heißt, dass die Mitglieder für ihr Handeln selbst einstehen müssen, indem sie eine Solidarhaftung für die Genossenschaft übernehmen. Nachdem die unbeschränkte Haftung bei Genossenschaften aufgegeben wurde, beschränkt sich die Solidarität auf die Haftung mit dem Geschäftsanteil.2 In der Vergangenheit wie auch in der Zukunft bietet aber die Solidarität innerhalb der Genossenschaft gerade den sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen eine Chance für wirtschaftliche Prosperität. Selbstverantwortung bedeutet aber auch, dass die Mitglieder der Genossenschaft eigenverantwortlich handeln und für eventuelle Fehlentscheidungen einstehen müssen; und das ohne Hilfe von außen oder von Seiten des Staates, wenn eine wirtschaftliche Schieflage eintritt. Das Prinzip der Selbstverwaltung bedeutet, dass die Mitglieder die Geschicke der Genossenschaft selbst in die Hand nehmen. Wie bereits bei der Selbstverantwortung beschrieben wurde, will die Genossenschaft ein externes Mitspracherecht verhindern. Aus diesem Grund sind die Organe der Verwaltung der Aufsichtsrat bzw. der Vorstand. Die demokratische Selbstbestimmung wird durch die Vertreterversammlung sichergestellt, wobei jedes Mitglied eine Stimme besitzt. Selbsthilfe bedeutet zunächst einfach im Sinne des Wortes, dass man sich bei der Lösung von Problemen selbst hilft und nicht auf die Hilfe anderer baut – seien es beispielsweise der Staat oder karitative Einrichtungen. Indem die Kräfte der Gemeinschaft mobilisiert werden, wird die Situation des Einzelnen verbessert.3 Zu Zeiten Raiffeisens und Schulze-Delitzschs gab es keinerlei Hilfen von Seiten des Staates, egal ob in materieller oder in finanzieller Hinsicht. Die Menschen waren auf sich allein gestellt. In der heutigen Zeit zieht sich der Staat bzw. die Kommunen in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ebenfalls zurück, meistens aus Spargründen. Die Menschen sind wieder auf sich allein gestellt 2 Eichwald/Lutz 2011: S. 48. 3 Eichwald/Lutz 2011: S. 44 f.
252
BÜRGERSTIFTUNGEN
und zur Eigeninitiative gezwungen. Diese Eigeninitiative wird in Form von Bürgerstiftungen umgesetzt.
Bürgerstiftungen Wie bereits beschrieben, gibt es auch in unserer heutigen, hochtechnisierten Gesellschaft Bereiche, in denen ein Mangel vorherrscht. Glücklicherweise ist es nicht mehr flächendeckend das Fehlen von Lebensmitteln, jedoch spart die öffentliche Hand bei kommunalen Aufgaben oder im Bildungsbereich aufgrund leerer Haushaltskassen. Um diesen Missstand beheben zu können, haben sich Bürger in Städten und Kommunen zusammengeschlossen und sogenannte Bürgerstiftungen gegründet. Stellt sich nun die Frage, was Bürgerstiftungen denn im Allgemeinen sind. Eine Bürgerstiftung ist eine unabhängige, autonom handelnde, gemeinnützige Stiftung von Bürgern für Bürger. Sie engagiert sich nachhaltig und dauerhaft für das Gemeinwesen in einem geografisch begrenzten Raum. Eine Bürgerstiftung ist wirtschaftlich und politisch unabhängig. Ihr Ziel besteht darin, langfristig einen Kapitalstock aufzubauen, um aus den Erträgen lokale gemeinnützige Vereine und Initiativen zu fördern.
Bürgerstiftungen in Zahlen Zum 30.06.2018 gab es in Deutschland 410 Bürgerstiftungen, Tendenz steigend.4 Das Stiftungskapital lag bei 423 Mio. €, was einer deutlichen Steigerung von knapp 7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.5 Es verfügen bereits 87 Bürgerstiftungen über ein Stiftungskapital von mehr als 1 Mio. €. Die größte Bürgerstiftung Deutschlands ist die BürgerStiftung6 Hamburg mit einem Stiftungskapital von 44 Mio. €, die kleinste Stiftung ist die Bürgerstiftung Denkendorf mit einem Kapital von 15.000 €.
Aktive Bürgerschaft der Genossenschaften Von den 410 Bürgerstiftungen, die es 2018 in Deutschland gab, wurden 352 Bürgerstiftungen von einer Genossenschaft unterstützt. Die Stiftung »Aktive Bürgerschaft« versteht sich als Zentrum für das Bürgerengagement der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Mehrere Stifter 4 Aktive Bürgerschaft 2019: S. 3. 5 Ebd. 6 Schreibweise angelehnt an die Genossenschaftliche FinanzGruppe.
253
THOMAS HORN
fungierten bei der Errichtung der Aktiven Bürgerschaft. Es waren die Genossenschaftliche FinanzGruppe, Regionalverbände, und der Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), welcher zugleich Schirmherr der Aktiven Bürgerschaft ist. Die Genossenschaftliche FinanzGruppe besteht u.a. aus der Deutschen Zentralgenossenschaftsbank (DZ Bank AG), der Fondsgesellschaft Union Investment, Bausparkasse Schwäbisch Hall und der R+V Versicherung. Bürgerstiftungen sind in ihrem Aufbau und ihrer Ausrichtung den Genossenschaften sehr ähnlich und haben u.a. gleiche Zielsetzungen. Einige Prinzipien sollen an dieser Stelle Erwähnung finden:7 1. Prinzip der Selbsthilfe (Selbstverantwortung, Selbstorganisation, Selbstkontrolle) 2. Regionalitätsprinzip 3. Identitätsprinzip Prinzip der Selbsthilfe Bürgerstiftungen kümmern sich um Projekte, die von öffentlicher Hand nicht unterstützt werden. Dabei werden die Projekte selbst geplant, durchgeführt sowie die Finanzierung sichergestellt. Dies ist ein großer Vorteil, da häufiger Projekte in kürzerer Zeit und zu geringeren Kosten umgesetzt werden können. Dadurch, dass Kommunen oder andere staatliche Stellen keinerlei finanzielle Beiträge leisten, ist eine Mitsprache dieser Stellen auch nicht erwünscht, was sich bei der Geschwindigkeit der Umsetzung deutlich bemerkbar macht. Die Unabhängigkeit von Politik bzw. Parteien ist eine wichtige Komponente. Dies ist ebenfalls eine direkte Parallele zu den Genossenschaftsbanken, die bis heute selbstbestimmt und frei von externen Entscheidungen sind. Regionalitätsprinzip Das Genossenschaftswesen ist eines der nachhaltigsten Wirtschaftsmodelle. Die Nachhaltigkeit bezieht sich auf die wirtschaftliche Förderung der Menschen und der Region, in der sie leben. Die lokale Begrenzung ist hierbei der entscheidende Faktor, der sich damit deutlich von geschäftlichen Bestrebungen von globalen Kapitalgesellschaften unterscheidet. Bürgerstiftungen handeln nach dem gleichen Prinzip. Aus diesem Grund gibt es auch so viele Bürgerstiftungen in Deutschland, da sich jede Stiftung nur um eine bestimmte Region kümmert und diese fördert. Die Bürger verhalten sich solidarisch mit den Menschen in ihrer Heimat, indem 7 Aschhoff/Henningsen 1996: S. 145 ff.
254
BÜRGERSTIFTUNGEN
sie lokale Bürgerstiftungen gründen. Hierdurch können regionale Projekte zum Wohle aller Menschen realisiert werden. In vielen unterschiedlichen Regionen sind zu diesem Zweck Bürgerstiftungen entstanden. Identitätsprinzip Die wichtigste Voraussetzung, dass Menschen sich für ihre Mitmenschen und die Heimat engagieren ist, dass sie gemeinsame Ziele und Wertevorstellungen haben. Wenn sich die Menschen mit ihrer Heimat verbunden fühlen, engagieren sie sich dafür. Durch eine gestärkte Identität wird das Prinzip der Selbsthilfe gefördert. Gemeinsame Ziele können so durch Selbstorganisation zu einer schnelleren Umsetzung eines Projektes führen.
Zusammenfassung Vor über 170 Jahren definierten Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch die genossenschaftlichen Prinzipien. Hintergrund waren Hungersnöte und eine weitverbreitete wirtschaftliche Not der Menschen. Da es keine Hilfe bzw. Unterstützung von staatlicher Seite gab, wurde der Begriff »Hilfe zur Selbsthilfe« ein wichtiges Grundprinzip. Bis heute bilden diese Prinzipien die Basis aller Genossenschaften. In unserer hochmodernen Gesellschaft existiert glücklicherweise keine flächendeckende Hungersnot mehr, jedoch gibt es zahlreiche Projekte, die von Städten und Kommunen nicht umgesetzt werden, häufig aus finanziellen Gründen. Ähnlich wie bei den Genossenschaften im 19. Jahrhundert schließen sich Menschen zusammen und gründen Bürgerstiftungen. Bürgerstiftungen sind von der Grundstruktur den Genossenschaften sehr ähnlich und sie haben viele Gemeinsamkeiten. Die wichtigsten Parallelen sind der Zusammenschluss von Menschen, mit dem Ziel in einer festgelegten Region Projekte umzusetzen, die von kommunalen Trägern nicht unterstützt werden, wie z.B. die Errichtung von Spielplätzen sowie die Förderung von Musikschulen und zahlreichen weiteren Maßnahmen. Die meisten regionalen Bürgerstiftungen in Deutschland, die unter dem Dachverband der Aktiven Bürgerschaft zusammengefasst sind, werden von genossenschaftlichen Primärinstituten unterstützt. Durch gelebte Prinzipien, wie Selbsthilfe, Identitätsprinzip oder der Regionalität, realisieren die Mitglieder der regionalen Bürgerstiftung viele Projekte ehrenamtlich vor Ort. Dies geschieht schneller und unbürokratischer, als kommunale Träger dies bewerkstelligen 255
THOMAS HORN
könnten. Die Förderung des regionalen Lebens ist das gemeinsame Ziel der Mitglieder einer solchen Bürgerstiftung. Aus diesem Grund ist der Stiftungszweck breit gefächert. Er umfasst den kulturellen Sektor, Jugend und Soziales, das Bildungswesen, Natur und Umwelt und Denkmalschutz. Die Bürgerstiftungen sind ein gutes Beispiel dafür, dass die Grundsätze von Raiffeisen und Schulze-Delitzsch bis heute aktuell sind.
Literatur Aktive Bürgerschaft (2019): Geschäftsbericht 2019. Aktive Bürgerschaft (2013): Diskurs Bürgerstiftungen – Was Bürgerstiftungen bewegt und was sie bewegen, Berlin. Aschhoff, G./E. Henningsen (1996): The German Cooperative System. Its History and Strength, Frankfurt/Main: Fritz Knapp Verlag. Eichwald, B./K. Lutz (2011): Erfolgsmodell Genossenschaften. Möglichkeiten für eine werteorientierte Marktwirtschaft, Wiesbaden: Deutscher Genossenschafts-Verlag. Förderverein Hermann Schulze-Delitzsch (2008): Hermann Schulze-Delitzsch. Weg-Werk-Wirkung, Delitzsch. Nida-Rümelin, J., & M. Rechenauer (2011): Zur Ethik genossenschaftlicher Unternehmungen: Gutachten für die Akademie Deutscher Genossenschaften ADG, Montabaur. Rauter, A. (1986): »Die genossenschaftlichen Prinzipien und die Bedeutung für den genossenschaftlichen Fortschritt«, in: J. Laurinkari (Hg.): Die Prinzipien des Genossenschaftswesens in der Gegenwart, 162–175. Nürnberg. Schäfer, V. (2020): The Cooperative Idea as an Institutionalization of Adam Smith’s Moral Philosophy. Illustrated Using the Example of German Cooperative Banks, Berlin: Verlag Dr. Köster.
256
Silvia Wiegel
Warum sich Seniorengenossenschaften gründen 1. Einleitung Bei heutigen Genossenschaften in Deutschland ist eine Brüderlichkeitsethik im Sinne Max Webers oftmals nur schwer erkennbar.1 Diese Beobachtung stützt sich zum einen darauf, dass seit der Novellierung des Genossenschaftsgesetzes im Jahr 1973 die Weisungsbefugnis der Generalversammlung einer Genossenschaft abgeschafft und der Vorstand zu einem eigenverantwortlichen, d. h. allein entscheidungsbefugten Organ einer Genossenschaft wurde.2 Zum anderen stellt sich bei den hohen Mitgliederzahlen in den derzeit größten Genossenschaften, etwa in den Volks- und Raiffeisenbanken mit zuletzt über 18.500 Mitgliedern, die Frage, ob ein direkter Austausch und gegenseitige Förderung der Mitglieder im Sinne des Selbsthilfegrundsatzes noch möglich ist.3 Schließlich ist das gemeinsame Handeln von Menschen zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels einer der drei idealtypischen Grundgedanken der genossenschaftlichen Wirtschaftsweise.4 Die Beteiligung der Mitglieder steht dabei im Vordergrund.5 Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass nicht jede eingetragene Genossenschaft ausschließlich genossenschaftlich handelt. Aber auch Umgekehrtes ist zu beobachten: Des Öfteren sind genossenschaftlich agierende Vereinigungen von Menschen in einer anderen oder gar ohne Rechtsform vorzufinden, etwa in derjenigen eines eingetragenen Vereins. Vieles spricht dafür, dass das Förderprinzip aktuell – ob bei eingetragenen oder nicht eingetragenen Genossenschaften – eine Renaissance erlebt. Ist die Suche nach einer Veränderung sozialer Verhältnisse doch seit jeher meist der Ansporn dazu, sich in einer Gruppe für das gemeinsame Anliegen zu engagieren. 1 Bonus 1994. 2 Bundesgesetzblatt 1973: Teil I, Nr. 82: Gesetz zur Änderung des Gesetzes betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. Vom 9. Oktober 1973. 3 Statista 2021. 4 Die zwei anderen, bereits seit dem 19. Jahrhundert bestehenden Grundsätze sind ›Selbstverwaltung‹ und ›Selbstverantwortung‹. (Deutscher Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) e.V.i.L. 1987: 75). 5 Kruck 1997: S. 333.
257
SILVIA WIEGEL
Im Bereich sozialer Dienstleistungen ist dies seit den 1990er Jahren in besonderer Weise zu beobachten. Obwohl erst 2006 mit einer erneuten Novelle des Genossenschaftsgesetzes auch soziale und kulturelle Zwecke als alleinige Förderzwecke einer Genossenschaft rechtlich legitimiert wurden, finden sich seit den 90ern vermehrt in anderer Rechtsform eingetragene Organisationen, die sich dem Namen nach vor allem dem Wohle betagter Menschen widmen. Gemeint sind Seniorengenossenschaften, die damals u. a. aufgrund der Förderung durch die Regierungen der Bundesländer Hessen und Baden-Württemberg entstanden. Seit einigen Jahren gibt es diese Sozialgenossenschaften auch in anderen Bundesländern, u.a. in Bayern. Im Jahr 2016 lag die Anzahl solcher Organisationen im ganzen Bundesgebiet bei 220, auch 2017 hat es circa 200 dieser Seniorengenossenschaften über ganz Deutschland hinweg verteilt gegeben.6, 7, 8 Ihre Anzahl ist damit in etwa gleich hoch geblieben. Dabei stellt sich die grundlegende Frage, warum es eigentlich zur vermehrten Gründung dieser Vereinigungen in den vergangenen Jahrzehnten kommt? Welche Erwartungen und Motive der Mitglieder führen zu deren Gründung und weshalb werden diese nicht (bereits) von anderen Akteuren gestillt? Diesem Fragenkomplex widmete sich von April 2018 bis April 2019 ein Forschungsprojekt an der Universität Bayreuth. Doch waren dies nicht die einzigen Fragen, die sich der Forschungsgruppe nach der Entdeckung dieses Phänomens auch im oberfränkischen Raum stellten. Der vorliegende Aufsatz möchte einen ersten Einblick in das Projekt vermitteln.
2. Grundfragen und empirische Arbeit des Forschungsprojektes In den Seniorengenossenschaften treffen mehrere gesellschaftliche Entwicklungen aufeinander: Im Zuge des demographischen Wandels werden die Menschen zum einen nicht nur älter, sondern haben nach ihrer Verrentung oder Pensionierung noch etwa 20 Jahre Lebenszeit ›vor sich‹.9 Im Unterschied zu früheren Generationen gibt es daher für die 6 Köstler 2017: S. 178. 7 Consozial Nürnberg 2016: S. 15. 8 Amtliche Zahlen sind nicht bekannt, da Seniorengenossenschaften in den unterschiedlichsten Rechtsformen oder eben auch ohne Rechtsform zu Tage treten und es u.a. aus diesen Gründen keine Dachorganisation gibt (Köstler 2018: S. 8). 9 Im Jahr 2019 waren nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes 22 Prozent der deutschen Bevölkerung über 65 Jahre alt. (Statistisches Bundesamt:
258
WARUM SICH SENIORENGENOSSENSCHAFTEN GRÜNDEN
jüngeren Alten so etwas wie Zukunft im Älterwerden. Der Blick auf diese Zukunft wird aber von anderen gesellschaftlichen Trends getrübt, die das eigene Handeln zur Gestaltung dieser Zukunft erschweren. Dazu gehört die zunehmende Defamilialisierung, die Ausweitung der Bildungsphase der Kinder und – damit einhergehend – deren relativ später Berufseintritt und steigende Mobilität; daraus wiederum folgend die Notwendigkeit, für das eigene Älterwerden Vorsorge treffen zu müssen. In psychischer Hinsicht führt dies oftmals zu der Erfahrung der eigenen Funktionslosigkeit und einem wachsenden Bedürfnis nach Anerkennung und sozialer Integration. Ein im Frühjahr 2018 erschienener Artikel in der Bayreuther Lokalzeitung gab Anlass, den Blick zu weiten und die Frage zu stellen, welche Personen tatsächlich in einer Seniorengenossenschaft Mitglied werden.10 Daran schließt sich die Frage an, inwiefern diese Organisationen an die Stelle oder in Konkurrenz zu anderen, früheren Akteuren (Kinder, Nachbarschaft, Freunde, Bekannte, Wohlfahrtsstaat) treten und Erwartungen der Altenhilfe und -pflege erfüllen. Oder etwas allgemeiner: Welche Dienste oder Hilfen werden in solchen Organisationen am meisten angeboten und nachgefragt? In einem weiteren Zeitungsartikel hieß es, dass sich in der genannten Seniorengenossenschaft »Menschen […] gegenseitig helfen, damit sie möglichst lange zu Hause wohnen bleiben können, wenn sie alt oder behindert sind. Und damit sie weniger einsam sind.«11 Neben der Frage nach dem ›Warum‹ stellen sich beim Lesen dieses Artikels also auch andere, grundlegendere Fragen: • • • •
• •
Wie gehen wir mit Hilfe- und Pflegebedürftigkeit um? Was ist der Sinn von Arbeit und welche Arbeit ergibt Sinn? Wie viel Professionalisierung braucht eine Gesellschaft? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus, dass der moderne Wohlfahrtsstaat zu einer weitgehenden Monopolisierung von (sozialen) Dienstleistungen und somit auch des von den Seniorengenossenschaften bearbeiteten Feldes geführt hat? Was folgt daraus, dass der Wohlfahrtsstaat aus seiner Perspektive das ,bürgerschaftliche Engagement’ immer noch nur als Randphänomen der von ihm ›gestifteten‹ Wohltaten betrachtet? Ist die Zukunftsorientierung unserer ökonomisch-industriellen, heißt auf Gewinn und Innovationen ausgerichteten Gesellschaft,
Ältere Menschen, Zugriff: 12.03.2021). Ein Mann, der damals sein 65. Lebensjahr vollendet hatte, hatte durchschnittlich noch 17,94 Jahre Lebenszeit vor sich. Bei einer Frau lag die Lebenserwartung bei 21,11 Jahren. (Statistisches Bundesamt: Lebenserwartung, Zugriff: 12.03.2021). 10 Rauscher 2018a. 11 Rauscher 2018b.
259
SILVIA WIEGEL
•
– verwiesen sei auf deren Jugendlichkeitswahn – auf eine immer älter werdende Gesellschaft übertragbar? Welche Auswirkungen hat diese Orientierung für die Institution Familie, den Generationenzusammenhang, die Wohnsituation und die Konsumgewohnheiten?
Nicht allen Fragen konnte im Rahmen des Projektes ausführlich nachgegangen werden, war das Projekt doch auf zwei Semester begrenzt. Nichtsdestotrotz wurden auf den verschiedensten empirischen Wegen einige der Fragen beantwortet. Nachdem die Forschungsgruppe zunächst mit dem Vorstand einer der drei Seniorengenossenschaften in Oberfranken in Kontakt getreten waren, nahmen wir an Mitgliederversammlungen dieses Vereins teil. Im Juni und Juli 2018 erfolgte eine postalische Befragung der damaligen 1.391 Mitglieder dieser Organisationen. Der Rücklauf der Fragebögen war erstaunlich hoch: Die Umfrage wurde von 643 Mitgliedern ausgefüllt, rund 46 Prozent der versendeten Fragebögen kamen zurück. Die Befragung umfasste die sozialstrukturellen, familiären und Engagement-Hintergründe der Mitglieder, sowie deren Mitgliedschafts-Erwartungen an die Seniorengenossenschaften und ihre ›tatsächliche‹ Teilnahme am Austausch von Hilfeleistungen innerhalb ihrer Vereine. Von November 2018 bis April 2019 fanden dann Einzelinterviews mit 15 Mitgliedern mithilfe eines Leitfadens statt. Dieser Leitfaden bezog sich nochmals auf die Beziehungsnetzwerke der Mitglieder, auf die Erwartungen an ihre Seniorengenossenschaften und sprach explizit die kritischen Aspekte der Bezahlung von Hilfeleistungen und der Konkurrenz zu anderen Dienstleistern an. Im April 2019 schloss das Projekt mit einer Präsentation der Ergebnisse im Rahmen einer Tagung ab. Hieran nahmen rund 50 Mitglieder von vier Seniorengenossenschaften aus der Region teil.
3. Mitglieder und Tätigkeit von Seniorengenossenschaften Es zeigt sich, dass sich unter den Mitgliedern – entgegen aller Beteuerungen seitens des fördernden Sozialministeriums hinsichtlich Intergenerationalität und der Bemühungen der Seniorengenossenschaftler, vor allem junge Menschen wie Schüler als Mitglieder zu gewinnen – überwiegend Menschen in einem Alter von über 65 Jahren befinden (ca. 78 Prozent von 617 antwortenden Befragten). Die Mehrheit davon wiederum ist zwischen 65 und 79 Jahre alt. Es handelt sich bei den Mitgliedern von Seniorengenossenschaften daher tatsächlich dem Namen entsprechend vor allem um ältere Menschen, zumeist jenseits der Pensionierung oder 260
WARUM SICH SENIORENGENOSSENSCHAFTEN GRÜNDEN
Verrentung, wobei insbesondere die jungen Senioren vertreten sind. Diese Situation wird von den Organisatoren erkannt und zum Anlass genommen, einen höheren Anteil an jüngeren Mitgliedern anzustreben. Die Intention dahinter ist ganz eindeutig ein geschlossenes System, in dem die Jüngeren den Älteren Hilfen im Alltag erbringen sollen, und umgekehrt ebenso die Älteren den Jüngeren. Dass aber trotz niedrigem Anteil an jüngeren Mitgliedern auch zum Zeitpunkt der Umfrage schon die Nachfrage an Hilfeleistungen gestillt wurde, stellte sich erst im Zuge des Forschungsprojektes heraus. Hinsichtlich der horizontalen Sozialstruktur fällt in der Befragung auf, dass die Mitglieder keinem speziellen Milieu entstammen. Ihr Bildungs- und ökonomischer Hintergrund entspricht weitgehend dem ihrer Alterskohorte in Deutschland. Allein die (ehemaligen) beruflichen Tätigkeiten unterscheiden sich. Typisch für Mitglieder von Seniorengenossenschaften sind Berufe im Bereich Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung.12 Bei der vertikalen Sozialstruktur der Mitglieder ist hingegen neben dem Alter auch noch der Kontakt und Austausch innerhalb der Familie oder in anderen privaten Netzwerken bedeutsam. Dies gibt einen weiteren Hinweis darauf, weshalb Personen in Seniorengenossenschaften Mitglied werden. Trotz teils großer Entfernungen zwischen den Wohnorten haben die Mitglieder – zumeist mit zwei Kindern – relativ häufig Kontakt zu ihren Familienangehörigen. ›Relativ häufig‹ meint hier wöchentlich (39 Prozent) oder täglich (33 Prozent von 608 Befragten). Daraus geht aber noch nicht hervor, was genau die Mitglieder mit ›Kontakt‹ meinen. Bei genauerem Nachfragen taucht hier die Tendenz auf, dass sie selten alltägliche Hilfeleistungen von ihrer Familie erhalten. Dieses Thema des Hilfebedarfs ist von großer Scham besetzt, denn zum einen neigen die Mitglieder eher dazu, keine eindeutige Aussage hierzu zu treffen (›manchmal‹). Zu dieser Erkenntnis gelangte die Forschungsgruppe zum anderen auch durch die Beschreibungen von einzeln interviewten Mitgliedern, wenn es um vermittelte Hilfeleistungen über den Verein geht: »Dann wird halt gerne mal was erzählt und ja, die hat schon wieder jemanden gehabt zum helfen und / und so / und was weiß ich so, das Tratschen, das hält bestimmt Manche davon ab, dass sie dann wissen es wird weiter getratscht im Ort im Dorf […] dass die Frau so und so, dass die Berta oder die Anne oder so, dass die nicht mehr alleine zurechtkommt und das wird als Manko angesehen«13.
Neben den sozialstrukturellen Merkmalen der Mitglieder ist auch die Art und Weise des Austausches von Leistungen innerhalb einer 12 Genauere Ausführungen zu den (ehemaligen) beruflichen Tätigkeiten sind der bevorstehenden Gesamtpublikation des Forschungsprojektes zu entnehmen. 13 Interview Nr. 9, Z. 525ff.
261
SILVIA WIEGEL
Seniorengenossenschaft hervorzuheben. In jeder Einzelnen finden sich unterschiedliche Umsetzungsformen. Bei allen drei im Rahmen des Projektes genauer untersuchten Organisationen gründet die Art des Austausches von Hilfeleistungen aber wie bei einem Tauschring14 auf der Annahme der Gleichwertigkeit von Leistungen und des Fortbestehens des Vereins. Im Genaueren wird der Tausch von »Arbeit gegen Arbeit und Zeit gegen Zeit«15 mit einem Entgeltsystem kombiniert: Nach Anfrage einer helfenden Leistung, der Vermittlung und der Durchführung der Hilfeleistung bezahlt der Leistungsempfänger acht Euro an den Verein, wovon sechs Euro dem Leistungsgeber vergütet und zwei Euro als Ausgleich für den organisatorischen Aufwand im Verein einbehalten werden.16 Am Ende des Monats wird dem Leistungsgeber das Entgelt ausbezahlt oder auf seinem so genannten Zeitkonto gutgeschrieben.17 So können sich ältere Menschen, die vielleicht mit 67 noch »körperlich fit sind« Unterstützungsleistungen ansparen, die sie selbst »vielleicht in zehn Jahren […] gut brauchen können«18. Doch warum benötigen die Mitglieder die Leistungen ihrer Seniorengenossenschaft? Sind ein hohes Alter, ein spezieller Berufsbereich und die fehlende familiale Unterstützung die einzigen Gründe dafür?
14 Tauschringe kamen in den 1980er Jahren in Kanada auf und schließen an die Vorgänger des ›Labour Exchange Systems‹ (Robert Owen), der Tauschwährungssysteme (u.a. Silvio Gesell) und des ›Local Exchange Trading Systems‹ (Offe/Heinze 1990: S. 131ff.) an. In Deutschland folgen Tauschringe »grundsätzlich den Prinzipien der Gegenseitigkeit und der Eigenverantwortung, möchten wohlfahrssteigernd wirken und dehnen sich nur lokal aus. Gemeinsam ist ihnen auch eine zur Landeswährung komplementäre, interne Verrechnungswährung sowie zinsloses Wirtschaften.« (Hubert 2004: S. 127). Sie entstehen häufig aufgrund des Zwecks einer wirtschaftlichen (Not-)Versorgung, verfolgen aber auch Ideale der politischen Unabhängigkeit, Vernetzung oder Ökologie (Douthwaite/Diefenbacher 1998: S. 83ff; 104–108). Die Bedeutung von Tauschringen ist in der Literatur umstritten. Laut Heinze (1998) stellen sie nur eine Ergänzung zum bestehenden nationalen Währungssystem dar. Grund hierfür ist sicherlich ihre uneinheitliche, da lokale Ausgestaltung. Seniorengenossenschaften wiederum seien laut Hubert (2004: S. 118–124) eine aktuelle Erscheinungsform der Tauschsysteme, würden aber aufgrund der Mitgliedschaft von Personen ohne tatkräftige Leistungen innerhalb des Systems sowie der Möglichkeit des Ansparens eines Zeitguthabens das Prinzip der Gegenseitigkeit durchbrechen. 15 J.A.Z. (Zugriff: 27.08.2018a). 16 Rauscher 2018. 17 J.A.Z. (Zugriff: 27.08.2018b). 18 Rauscher 2018b.
262
WARUM SICH SENIORENGENOSSENSCHAFTEN GRÜNDEN
4. Ursachen der Entstehung von Seniorengenossenschaften Zunächst lässt sich vermuten, dass Seniorengenossenschaften gerade in den Regionen entstehen, in denen es an Infrastruktur fehlt. Sie finden sich aber auch in Ballungsräumen wie Berlin oder München.19 An mangelnder Infrastruktur wie einem wenig ausgebauten öffentlichen Nahverkehr allein kann es daher nicht liegen, weshalb sich Seniorengenossenschaften gründen. Die Ursachen sind anderer und komplexerer Natur und werden im Folgenden genauer beleuchtet. Nicht zu bezweifeln ist, dass das Handlungspotenzial älterer Menschen durch die zunehmende Defamilialisierung – also den Geburtenrückgang, bzw. die späten Erstgeburten mit Anfang 30 und die erhöhte Mobilität der erwachsenen Kinder – erschwert wird.20, 21 Interessant ist etwa, dass sich die materiellen Transfers an die jüngere Generation im Jahr 2014 im Vergleich zu 1996 fast verdoppelt haben. Der Anteil an instrumentellen Hilfen für die Eltern hingegen halbierte sich im selben Zeitraum.22 Insbesondere die Ideologie der immerwährenden Jugendlichkeit befördert Autonomie-Erwartungen, die einer Reziprozitäts-Erwartung (›Generationenvertrag‹) zunehmend entgegenstehen. Realität und Vorstellungen weichen also voneinander ab. Wie sich in vielen Interviews gezeigt hat, ist diese Differenz einer der Gründe, weshalb Menschen in einer Seniorengenossenschaft Mitglied werden. Die Menschen haben aufgrund des Wegzugs ihrer Kinder oder eines eigenen Umzugs, oder wegen des Todes ihrer Partnerin/ihres Partners nicht genug oder sogar gar keine direkten festen Beziehungen zu Verwandten und/oder Nicht-Verwandten, und sind daher häufig von Alterseinsamkeit betroffen, d. h., sie haben »wenig Ansprechpartner«23, wie es eines der interviewten Mitglieder prägnant beschreibt. Es »[...] liegt aber meistens nicht am fehlenden Willen der Kinder, sondern daran, dass die woanders wohnen, dass die teilweise hunderte von Kilometern weg wohnen, [...] wohnt eine Tochter also ziemlich weit weg, ist ja klar, gerade die Leute, die studiert haben, die haben dann ja meistens irgendwo anders eine Anstellung gekriegt und von daher gerade jetzt zum Beispiel […] im Herbst, es muss das Wetter passen, dass man im Herbst [...] ein wenig jetzt noch einmal Rasen mäht oder das Laub zusammen fegt und da muss man oft spontan sein […] und wenn jetzt ein Kind 300 […] [oder] 400 Kilometer weg wohnt und dann heißt 19 Consozial Nürnberg 2016: S. 15. 20 Hill/Kopp 2013: S. 255–278. 21 Statistisches Bundesamt (Zugriff: 13.03.2021). 22 Klaus/Mahne 2016: S. 257. 23 Interview Nr. 3, Z. 291.
263
SILVIA WIEGEL
es: Mensch, morgen soll schönes Wetter sein und so. Kannst du mal kommen und […] [den] Rasen mähen?«24
Das Ausleben der von Senioren oft anvisierten Selbstbestimmtheit, etwa in der Mobilität, führt(e) im Falle der Kinder der befragten Mitglieder zwar dazu, dass diese ihrem Wunschstudium nachgehen können. Im Falle der Mitglieder selbst hingegen kommt es dadurch zu Handlungseinschränkungen. Selbstzuschreibungen von eigener handwerklicher oder technischer Unfähigkeit oder Unwissenheit, sowie Inaktivität können in solchen Fällen nicht durch das Hinzuziehen eines jüngeren Familienmitglieds kompensiert werden. Eine andere Aussage eines Mitglieds, dass es sein ›größter Fehler‹ gewesen sei, dass seine drei Kinder studiert hätten, treibt diesen Ursachen-Faktor der Differenz von Realität und Erwartungshaltung noch auf die Spitze. Die betagten Eltern sind häufig auf sich allein gestellt. Dass sich in der Mitgliederumfrage ein Altersdurchschnitt von etwa 73 Jahren herausgestellt hat, und, dass sich zugleich etwa 70 Prozent der Mitglieder von ihrer Mitgliedschaft Hilfe für sich selbst erwarten, ist daher keine Besonderheit (n = 420). Allzu schnell allerdings scheinen sozialpolitische Akteure auf diese veränderte Situation betagter Menschen mit einem aktivierenden Programm zu reagieren. Ihre Hochglanzprospekte zielen auf eine Förderung des so genannten ›bürgerschaftlichen Engagements‹ der ›Senioren‹ ab, um deren Integration und damit Produktivität für das gesellschaftliche Ganze gewinnbringend zu nutzen. Dies ist beispielsweise in den seniorenpolitischen Gesamtkonzepten des Bayerischen Staatsministeriums zu lesen.25 Seniorengenossenschaften sind allerdings keine ›Patchwork-Nachbarschaften‹ und schon gar kein Familienersatz, wie sich im Projekt herausgestellt hat. Denn sie agieren über Stadtviertel- oder Ortsgrenzen hinweg und füllen nur einen kleinen Teil26 des Alltags eines Menschen. Die befragten Mitglieder äußern hingegen sehr häufig, dass sie sich Hilfe ›in Not‹ auf eine »unbürokratische«27, 28 Art und Weise wünschen.29 Ein zweiter Faktor für die Entstehung von Seniorengenossenschaften liegt daher im derzeitigen Verhältnis von Bürgern zum Wohlfahrtsstaat 24 Interview Nr. 9, Z. 245ff. 25 StMAS (2006), S. 24, 27, 30, 43. 26 Bei einer Auszählung der innerhalb von drei Quartalen stattfindenden Veranstaltungen einer solchen Seniorengenossenschaft mit damals (2019) rund 600 Mitgliedern ergab sich, dass im Durchschnitt eine bis zwei Veranstaltungen pro Woche für normale Mitglieder gedacht sind, die sich nicht an der Organisation des Vereins beteiligen. (Forschungsprojekt über Seniorengenossenschaften (Zugriff: 12.10.2019).) 27 Interview Nr. 1, Z. 1.374. 28 Interview Nr. 5, Z. 666. 29 Mitgliederumfrage 2018, Antworten zu Frage 11.
264
WARUM SICH SENIORENGENOSSENSCHAFTEN GRÜNDEN
begründet. Die Mitglieder, welche den Interviews nach mit physischen und/oder psychischen, unberechenbaren, kurzen oder dauerhaften Krankheiten umzugehen haben, haben häufig negative Erfahrungen mit staatlichen Institutionen gemacht; ob fehlerhafte Pflegebedarfs-Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherungen oder eine Enttäuschung durch den Wohlfahrtsstaat im Allgemeinen. Diese Erfahrungen hängen mit der zunehmenden »Ökonomisierung und Vermarktung der Sozialen Dienste und [der] Freien Wohlfahrtspflege«30 zusammen. Deren vermehrte Orientierung an einer betriebswirtschaftlichen Logik und die vom Staat ausgehenden Aufträge zur Erfüllung des sozialen Dienstleistungsbedarfs, welche wiederum in einer zunehmenden bürokratischen Kontrolle münden, sind den Mitgliedern der Seniorengenossenschaften ein Dorn im Auge.31 Sie wollen keine Unternehmen, die nur teure Gesamtpakete von Sachgütern und Dienstleistungen verkaufen. Das verdeutlicht folgende Schilderung einer der Befragten. Diese Frau erwartet sich von Ihrer Mitgliedschaft einerseits, dass sich ihr soziales »Netzwerk verdichte[t]«, dass es ein »Entgegensteuern« zur »Vereinsamung« geben wird, und, dass man nur »gemeinsam bewältigen« kann, »was [einem] alleine schwer fällt«. Sie denkt anderseits auch, dass die Leistungen über ihre Seniorengenossenschaft »besser und billiger als [diejenigen von einem] bezahlte[n] Dienstleister« sind, der für kleine Aufgaben »eh nicht kommt«. Diese Aussagen stammen von einer 59-jährigen Frau, die drei Kinder und zusammen mit ihrem Ehemann ein monatliches Einkommen von 2.000 bis 3.000 Euro hat. Sie ist seit 2010 in der aktuell größten oberfränkischen Seniorengenossenschaft Mitglied.32 Interessant ist, dass diese Befragte zum Zeitpunkt der Umfrage nur Dienste angeboten hat; darunter Begleitung, Beaufsichtigung, Beratung, Essens-, Einkaufsund Fahrdienste, sowie Bildungsangebote.33 Sie scheint also die erwähnte Möglichkeit des Ansparens von Hilfeleistungsstunden wahrzunehmen. Ein anderes Mitglied begründet seine Mitgliedschaft in einem Interview folgendermaßen: »[…] wenn man das anschaut: schon die Arbeitskraft ist unterbezahlt, überall; egal wo man hinschaut. Und Sozialleistungen, sei es von der Rentenversicherung, gesetzlichen Krankenversicherung etc. – nur immer wieder abgebaut, wieder was gekürzt, wieder was gekürzt. Beiträge hochgegangen«34. 30 Möhring-Hesse 2008: S. 141. 31 Möhring-Hesse 2008: S. 141f. 32 Die ›Seniorengemeinschaft Kronach Stadt und Land e.V.‹ hatte im September 2020 bereits über 1.000 Mitglieder. 33 Mitgliederumfrage. 2018, Antworten zu den Fragen 1, 2, 4, 13, 14, 15, 23, 25. 34 Interview Nr. 5, Z. 703ff.
265
SILVIA WIEGEL
Dass die Mitglieder vom deutschen Staat enttäuscht sind, zeigt sich auch an anderer Stelle. So bemängeln die Mitglieder nicht nur die finanzielle staatliche Infrastruktur, sondern darüber hinaus die eingangs schon angesprochene Verkehrsinfrastruktur. Die Mitglieder können ihren gewünschten Grad an Selbstbestimmtheit in Form von Mobilität auch deshalb nur dann aufrechterhalten, wenn sie entweder ihe Mobilität einschränken oder trotz hohen Alters selbst mit dem Auto zu ihren Terminen fahren und sich dabei selbst gefährden. Andere verkaufen dafür ihr Haus (im ländlichen Raum) und ziehen in eine kleinere Wohnung in der Stadt oder gleich in ein Alten- und/oder Pflegeheim.35 Oder sie werden Mitglied in einer Seniorengenossenschaft, wo sie Hilfe auf Gegenseitigkeit erwarten. Eine dritte Ursache, die neben bestimmten Erwartungen zur Entstehung von Seniorengenossenschaften führt, basiert ebenfalls auf den Erfahrungen der Mitglieder mit unserer auf den größten finanziellen Nutzen ausgerichteten Gesellschaft. Sie vertreten aufgrund dieser Erfahrungen Werte, die sie von ihrer sozialen Umwelt hervorstechen lassen, denn sie gehen von Gerechtigkeit aus. Zwar sagen viele der Mitglieder in den Interviews, dass für sie die finanzielle Vergütung nicht im Vordergrund steht, weil durch das Hinzuziehen von Geld zuallererst der Verein erhalten wird. Auch ohne diese Vergütung würden sie Dienstleistungen innerhalb der Seniorengenossenschaft erbringen. Nur nebenbei erwähnen die Mitglieder in den Einzelinterviews, dass sie ein »kleine[r] symbolischer Betrag«36 zur Erbringung der Dienstleistungen anspornt. Dadurch sei das Verhältnis zueinander geklärt und keiner müsse einem anderen in der Schuld stehen. Dies zeigt sich auch in der Mitgliederumfrage. Fast ein Viertel spricht sich dort für ›klare Verhältnisse‹ aus (n = 104). Allerdings sagen ebenso viele Mitglieder, dass sie sich durch die Bezahlung ihrer erbrachten Leistungen eine ›finanzielle Aufbesserung‹ ihrer Rente erhoffen. Es geht daher nicht nur darum, dass die Mitglieder unabhängig von Wohlfahrtsverbänden selbst entscheiden wollen, wie viel Geld sie wofür ausgeben oder bekommen, sondern auch darum, welche Art des Zusammenlebens sie sich wünschen. Die Mitglieder nehmen wahr, dass es einen Unterschied zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Mitgliedern gibt. Diesen versuchen sie durch gemeinsames Handeln auszugleichen. Die Genossenschaft scheint dafür die geeignete Form zu sein. Denn Genossenschaften funktionieren nur, wenn Leistungsdifferenzen zwischen den Mitgliedern offengelegt werden und sie trotz finanzieller Unterschiede gleichberechtigt in der Mitbestimmung sind. Dies – so verdeutlichen es die Seniorengenossenschaften – kann auch umgesetzt werden, ohne sich in der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft zu 35 Interview Nr. 9. 36 Interview Nr. 2, Z. 115ff.
266
WARUM SICH SENIORENGENOSSENSCHAFTEN GRÜNDEN
organisieren, und, ohne ein an finanziellem Profit ausgerichtetes Unternehmen zu gründen.
5. Schlussfolgerung Bei der Fragestellung in diesem Aufsatz ging es vor allem um ein grundsätzliches Hinterfragen des Phänomens und um Begriffsarbeit. Eine erste Antwort, weshalb sich Seniorengenossenschaften heute gründen, lautet: Seniorengenossenschaften entstehen aufgrund eines Bündels an Ursachen, die miteinander zusammenhängen und deren Folgen nicht immer an der Oberfläche zu sehen sind. Vor allem folgende drei Ursachen können dabei benannt werden: (1) Differenz zwischen der Lebensrealität und den Lebensvorstellungen; (2) Konflikt zwischen Bürgern und der derzeitigen Gestalt des Wohlfahrtsstaates; (3) Gerechtigkeitsvorstellungen bei Wahrnehmung sozialer Unterschiede. Insgesamt sind Seniorengenossenschaften vielleicht trotz all ihrer Neutralitätsbekundungen – oder gerade wegen dieser – als Konkurrenz zum Staat und dessen Sozialsicherungsystem zu sehen. Denn sie handeln im selben Feld wie die staatliche Sozialpolitik – genauer, die seniorenpolitischen Maßnahmen der Länder und Kommunen – und die Wohlfahrtsverbände. Seniorengenossenschaften sind jedoch kein Ersatz für Familien, auch wenn sie Tätigkeiten der Hauswirtschaft, Versorgung und neuerdings auch in Bayern offiziell der Pflege übernehmen. Ungebrochen bleibt aber das große gesellschaftliche Interesse an ihnen.37 Ein Blick ›zurück‹ auf die Enstehungsgründe von Seniorengenossenschaften zeigt jedenfalls auf, dass nicht allein ein höheres Alter von Menschen Erwartungen nach gegenseitiger Hilfe hervorbringt, sondern, dass Reziprozität auch als Grundbestandteil des modernen gesellschaftlichen Zusammenlebens gesehen wird.
Literatur- und Quellenverzeichnis Quellen Forschungsprojekt über Seniorengenossenschaften: Eigene Auszählung und Berechnung anhand des öffentlich zugänglichen Veranstaltungskalenders der Seniorengenossenschaft J.A.Z. Unter: https://www.jaz-bayreuth.de/ veranstaltungen/ (Zugriff: 12.10.2019). Forschungsprojekt über Seniorengenossenschaften: Leitfadeninterviews von November 2018 bis April 2019. (Nr. 1, 2, 3, 5, 9) 37 Köstler 2017: S. 178.
267
SILVIA WIEGEL
Forschungsprojekt über Seniorengenossenschaften: Mitgliederumfrage unter drei oberfränkischen Seniorengenossenschaften. Juni/Juli 2018.
Literatur Bonus, Holger (1994): Das Selbstverständnis moderner Genossenschaften. Rückbindung von Kreditgenossenschaften an ihre Mitglieder, Tübingen: Mohr Siebeck. Deutscher Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) e.V.i.L. (Hg.) (1987): Schulze-Delitzsch. Ein Lebenswerk für Generationen, Wiesbaden: Deutscher Genossenschaftsverlag Douthwaite, Richard/Hans Diefenbacher (1998): Jenseits der Globalisierung. Handbuch für lokales Wirtschaften, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag. Heinze, Rolf G. (1998): Die blockierte Gesellschaft. Sozioökonomischer Wandel und die Krise des »Modell Deutschland«, Opladen: Westdeutscher Verlag. Hill, Paul B./Johannes Kopp (2013): Familiensoziologie. Grundlagen und theoretische Perspektiven. 5. Aufl., Wiesbaden: SpringerVS. Darin: Kapitel 4: Familie in der modernen Gesellschaft, S. 255–278. Hubert, Eva-Maria (2004): Tauschringe und Marktwirtschaft. Eine ökonomische Analyse lokaler Komplementärökonomien. Berlin: Duncker & Humblot. Klaus, Daniela/Katharina Mahne (2016): »Zeit gegen Geld? Der Austausch von Unterstützung zwischen den Generationen«, in: Mahne, Katharina/ Julia K. Wolff/Julia Simonson/Clemens Tesch-Römer (Hg.), 2016, S. 257– 268. Köstler, Ursula (2017): »Seniorengenossenschaften: Bürgerschaftliches Engagement als Hilfe zur Selbsthilfe«, in: Schmale, Ingrid/Johannes Blome-Drees (Hg.), 2017, S. 175–187. Köstler, Ursula (2018): »Seniorengenossenschaften. Ein morphologischer Überblick zu gemeinwirtschaftlichen Gegenseitigkeits-Gebilden der sozialraumorientierten Daseinsvorsorge«, in: ZögU, Beiheft 50. 2018, S. 1–122. Kruck, Werner (1997): Franz Oppenheimer – Vordenker der sozialen Marktwirtschaft und Sozialhilfegesellschaft, Berlin: Verlag Arno Spitz. Darin: Kapitel 4.1 Herrschaft und Genossenschaft als disjunktive Grundbegriffe der Soziologie, S. 331–342. Mahne, Katharina/Julia K. Wolff/Julia Simonson/Clemens Tesch-Römer (Hg.) (2016): Altern im Wandel. Zwei Jahrzehnte Deutscher Alterssurvey (DEAS), Wiesbaden: SpringerVS. Möhring-Hesse, Matthias (2008): »Verbetriebswirtschaftlichung und Verstaatlichung. Die Entwicklung der Sozialen Dienste und der Freien Wohlfahrtspflege«, in: ZSR 54, Heft 2. 2008, S. 141–160. Offe, Claus/Rolf G. Heinze (1990): Organisierte Eigenarbeit – Das Modell Kooperationsring, New York/Frankfurt a. M.: campus. 268
WARUM SICH SENIORENGENOSSENSCHAFTEN GRÜNDEN
Schmale, Ingrid/Johannes Blome-Drees (Hg.) (2017): Genossenschaften innovativ. Genossenschaften als neue Organisationsform in der Sozialwirtschaft, Wiesbaden: SpringerVS.
Internetressourcen Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration (StMAS) (Hg.): Wegweiser zur Gründung und Gestaltung von «Seniorengenossenschaften. Neue Formen verbindlicher Unterstützung im Alter. München. 2016. Unter: hhttps://www.bestellen.bayern.de/application/ap plstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APG xNODENR:292885,AARTxNR:10010455,AARTxNODENR:335845,USERx BODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMAS,AKATxNAME:StMAS,ALLE:x)=X (Zugriff: 01.11.2019). Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen (StMAS) (Hg.): Seniorenpolitisches Konzept. Regensburg. 2006. Unter: https://www.bestellen.bayern.de/application/eshop_app000002?SID=1202748 218&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:292885, AARTxNR:10010062,AARTxNODENR:336033,USERxBODYURL:artdtl. htm,KATALOG:StMAS,AKATxNAME:StMAS,ALLE:x)=X (Zugriff: 01.11. 2019). Consozial Nürnberg – 26. Oktober 2016 I Prof. Dr. Doris Rosenkranz I www.nachbar-plus.de (Zugriff: 01.11.2019). J.A.Z. – Jung und Alt zusammen in Stadt und Landkreis Bayreuth e.V. (2018a): »Verein«. Unter: https://www.jaz-bayreuth.de/verein/ (Zugriff: 27.08.18). – (2018b): »Mitgliedschaft«. Unter: https://www.jaz-bayreuth.de/ mitgliedschaft/ (Zugriff: 27.08.18). Rauscher, Peter (2018a): »Großes Interesse an JaZ«, in: Nordbayerischer Kurier. 13.04.2018. – (2018b): »Tauschbörse für Helfer und Hilfsbedürftige«. 26.03.2018. Unter: http://www.nordbayerischer-kurier.de/nachrichten/tauschborse-furhelfer-und-hilfsbedurftige_653133 (Zugriff: 07.06.2018). Statista: Entwicklung der Zahl der Mitglieder der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland von 1970 bis 2019. 24.06.2020. Unter: https:// de.statista.com/statistik/daten/studie/71940/umfrage/volksbanken-undraiffeisenbanken-anzahl-der-mitglieder/ (Zugriff: 08.01.2021). Statistisches Bundesamt (Destatis): Bevölkerung. Ältere Menschen. Die Bevölkerungsgruppe der älteren Menschen ab 65 Jahren. Unter: https:// www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Demografischer-Wandel/AeltereMenschen/bevoelkerung-ab-65-j.html (Zugriff: 12.03.2021). Statistisches Bundesamt (Destatis): Bevölkerung. Sterbefälle und Lebenser wartung. Unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/ Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/_inhalt.html (Zugriff: 12.03.2021). 269
SILVIA WIEGEL
Statistisches Bundesamt (Destatis): Geburten. Daten zum durchschnittlichen Alter der Mutter bei Geburt insgesamt und 1. Kind nach Bundesländern. Unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/ Geburten/Tabellen/geburten-mutter-alter-bundeslaender.html (Zugriff: 13.03.2021).
270
Markus Römer
»Die waren völlig überrascht, dass da plötzlich wieder ein Bäcker kommt.« Von der gegenwärtigen Dynamik traditionellen Gesellenwanderns Den uralten Brauch der Gesellenwanderung pflegen heute nur noch wenige Handwerker. In den Medien tauchen die Gesellinnen und Gesellen mit ihrer malerischen Kluft regelmäßig auf, den meisten Menschen in Deutschland ist der Brauch der »Walz« zumindest in Ansätzen ein Begriff. Dagegen weiß kaum jemand, dass auch Bäcker, Brauer und Schuhmacher auf Wanderschaft gehen können. Dieser Beitrag erläutert den historischen Hintergrund des Gesellenwanderns und gibt Einblick in den besonderen Lebens- und Lernmodus, der auch heute noch damit verbunden ist. Die persönlichen Motive, heutzutage auf die Walz zu gehen, werden aufgezeigt, die Bedeutung der Gesellenvereinigungen, in denen viele der Reisenden organisiert sind, wird beleuchtet. Am Beispiel des Bäckerhandwerks wird gezeigt, welche Fragen und Probleme aufkommen können, wenn die Walz-Tradition in einem Gewerk jahrzehntelang eingebrochen war, dann aber wiederbelebt werden soll.
Wandern damals: Ungeliebte Pflicht oder »Hochschulstudium« des Handwerks? Schriftliche Quellen zeugen davon, dass die Wanderschaft bereits im 14 Jh. bei Handwerkern des deutschsprachigen Raumes verbreitet war. Abenteuerlust, Wissensdurst oder die bloße Notwendigkeit der Arbeitssuche trieb die Handwerker auf die Straßen. Das Wandern war zunächst freiwillig, erst zum Ende des 15 Jh. bildete sich eine Wanderpflicht heraus. Für die Zünfte war die Einführung der Wanderpflicht ein Instrument, um mit einem Überschuss an Arbeitskräften und einer Vielzahl aufstiegswilliger Gesellen umzugehen, die in den Meisterstand drängten. Wanderzeiten von bis zu zehn Jahren wurden von Gesellen gefordert, dazu kamen oft noch sogenannte »Mutjahre«, d. h. Arbeitsjahre nach Abschluss der Walz im Herrschaftsbereich einer 271
MARKUS RÖMER
Zunft. Erst dann durfte die Meisterprüfung abgelegt und – bei bestandener Prüfung – die Aufnahme in den Meisterstand beantragt werden. Der eigentliche Sinn des Wanderns wurde von Zeitgenossen vor allem in der fachlichen Weiterbildung sowie in der persönlichen Entwicklung gesehen. Der Handwerksforscher Rudolf Wissell, selbst ein ehemaliger Wandergeselle, sprach in Bezug auf das Gesellenwandern gar von einer »Hochschule des Handwerks, eine[r] Art Hochschulstudium in der freien Schule des Lebens«.1 Die Lehrjahre waren damals oft wenig lehrreich. Sie bestanden zum Großteil in der Ausführung niedriger Arbeiten und waren in vielen Fällen von Demütigungen begleitet.2 Die Wanderjahre galten als die Zeit, in der der freigesprochene Geselle sein Handwerk eigentlich erlernte. Außerdem sollten die Gesellen durch den Kontakt mit fremden Sitten und Gebräuchen eine gewisse persönliche Reife, Welt- und Menschenkenntnis erlangen. Diese Vorteile des Wanderns werden auch in einer wichtigen historischen Quelle, der »Oetting-Spielbergischen Wanderordnung« von 1785 betont: »Nachdem er [der Lehrling] einige Jahre zum Theil mit Erlernung der ersten Anfangsgründe seines Handwerks, noch mehr aber mit den niedrigsten häuslichen Verrichtungen zugebracht hat, tritt er roh an Sitten und Kenntnissen aus der Lehre. Welche Schule kann dann wohl besser für ihn seyn, als wenn er große, volkreiche, wegen seines Handwerks berühmte Städte besucht? Hier lernt er neben den nützlichsten Vortheilen seines Handwerks […] Bescheidenheit und bessere Sitten. Gebildeter und fähiger kommt er in sein Vaterland zurück.«3
Die Wanderordnung wendete sich u. a. gegen den »Mißbrauch« nur in nahe gelegene Ortschaften und Städte zu wandern. Sie schrieb jedem Gewerk bestimmte Städte vor, in denen das Handwerk zur »Vollkommenheit« gereift war und die deswegen von den Gesellen vornehmlich besucht werden sollten. Auch wenn mitunter nachlässig betrieben: Um 1785 war das Gesellenwandern, wie in den Jahrhunderten davor, noch die Regel und allgemein verbreitet unter Handwerkern.4 Nur in Ausnahmefällen, z. B. wenn ein Meistersohn die väterliche Werkstatt übernahm, konnte die Wanderpflicht umgangen werden. Gesellen, die nicht wanderten, hatten oft einiges an Hohn und Spott zu ertragen. In einem alten fränkischen Wanderlied heißt es: »Wann der Sonntag kommt herbei, Daß wir Brüder beisammen sein, 1 2 3 4
Wissell 1971 Bd. 1: S. 301. Wadauer 2005: S. 32. Aloys 1785: S. 9. Kocka 2016.
272
»DIE WAREN VÖLLIG ÜBERRASCHT, DASS DA PLÖTZLICH EIN BÄCKER KOMMT«
Da geht dann Das Reden an Von fremden Ländern, die man gesehen, Daß einm möcht das Herz zergehen. Das ist unsere größte Freud Burschen die das Reisen freut. Mancher hinterm Ofen sitzt, Zwischen den Kindern die Ohren spitzt, Keine Stund von Haus Ist kommen hinaus, Den soll man als Gesell erkennen Oder gar als Meister nennen, Der nichts weiß als von der Stadt Wo er drin gelernet hat?«5
In einem anderen Lied heißt es: »Es mag ein feiger Muttersohn Hier bleiben bei den Pathen, Und hinterm Ofen ihm mit Hohn Die Porsteräpfel braten: Wir haben hierzu keine Lust, Es sehnt sich unsre frische Brust Nach lobenswerten Thaten. […] Wenn Montags wir beisammen sind Und unsre Reisen zählen, Da möchte manches Hätschelkind Sich halb zu Tode quälen, Das nur in seiner Mutterstadt Beim Vater ausgelernet hat Und helfen Rüben schälen.«6
Die Bedeutung der Gesellenbruderschaften Die Gesellen waren während ihrer Reise nicht auf sich gestellt. Schon im 14. Jh. gründeten sich Gesellenbruderschaften, die den Reisenden in vielerlei Hinsicht zur Seite standen.7 Ohne dieses Unterstützungssystem wären massenhafte Wanderungsbewegungen schwer denkbar gewesen. 5 Schade 1865: S. 131. 6 Schade 1865: S. 114. 7 Reininghaus 1981: S. 29ff.
273
MARKUS RÖMER
Der Historiker Michael Stürmer bemerkt: »Die Existenz der Gesellenbruderschaften und die Wanderpflicht bedingten einander.«8 Da Gasthäuser in damaliger Zeit kaum existierten, schufen die Brüderschaften Herbergen für ihre Wandergesellen. Hier stand ein Altgeselle bereit, um dem Wanderer vor Ort Arbeit zu vermitteln. Falls ein Geselle während seiner Aufenthaltszeit erkrankte oder gar verstarb, kam die Bruderschaft für die Kosten auf. Im Krankheitsfalle geschah dies in Form eines Darlehens, im Todesfall erhob die Bruderschaft Anspruch auf etwaiges Werkzeug oder anderen Besitz, um ihre Auslagen auszugleichen. Die Bruderschaften spielten außerdem eine entscheidende Rolle, wenn es um die Organisation von Arbeitskämpfen ging. Um bei schlechten Arbeitsbedingungen oder als zu gering empfundenen Lohn Druck auf einzelne Meister oder auch ganze Zünfte auszuüben, bediente man sich des »Verrufs«. Wurde ein Meister durch eine Bruderschaft verrufen, so zogen die Gesellen aus der Werkstatt ab und kein Geselle sprach mehr um Arbeit dort vor. Der Verruf wurde nur intern kommuniziert und möglichst lange von der Bruderschaft geheim gehalten, da ansonsten Sanktionen durch die Zunft und die Obrigkeit zu befürchten waren. Der erste Verruf ist 1352 nachgewiesen, in einzelnen Fällen – wie z. B. in Danzig im Jahre 1751 – zogen alle Gesellen aus einer Stadt aus.9 Insbesondere wegen ihrer Streiklust waren die Bruderschaften ein Dorn im Auge der Zünfte und der Obrigkeit. Als Reaktion auf einen ausufernden Streik Augsburger Schustergesellen im Jahre 173110 wurde die sogenannte Reichshandwerksordnung erlassen. In dieser heißt es: »Woferne aber bisheriger Erfahrung nach, die Gesellen unter irgends einigem Prætext sich weiter gelüsten liessen, einen Aufstand zu machen, folglich sich zusammen zu rottiren, und […] keine Arbeit mehr zu thun, oder selbst Haufenweis auszutreten, und was dahin einschlagenden rebellischen Unfugs mehr wäre, dergleichen grosse Frevler oder Missethäter sollen nicht allein […] mit Gefängniß- Zuchthauß- VestungsBau- und Galeeren-Strafe beleget, sondern auch […] am Leben gestraft werden.«11
Trotz der Androhung härtester Strafen kam der Gesellenstand nicht zur Ruhe. 1803 wurden schließlich die als besonders streiklustig bekannte Gesellenbruderschaften der Tischler in einer konzertierten Aktion deutscher Städte im Großteil Deutschlands verboten. Es folgten Verbote von Bruderschaften anderer Gewerke.12 8 Stürmer 1979: S. 158. 9 Reininghaus 1981: S. 224. 10 Grießinger 1981: S. 152 ff. 11 Internetquelle: http://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_ id=3604&language=german [Zugriff: 12.12.19]. 12 Grießinger 1981: S. 272 ff.
274
»DIE WAREN VÖLLIG ÜBERRASCHT, DASS DA PLÖTZLICH EIN BÄCKER KOMMT«
Da die Gesellengilden äußerst verschwiegen waren und kaum schriftliche Aufzeichnungen hinterließen, sind ihre ausführlich dokumentierten Auseinandersetzungen mit der Obrigkeit heute ein wichtiger Zugang für die Forschung. Der Historiker Wilfried Reininghaus stellt fest: »Die Geschichte der Gilden war also über viele Jahrhunderte die Geschichte ihrer Verbote, wobei die Kontinuität der Verbote ein Indiz für die Wirkkraft der geschworenen Einung darstellt.«13
Der Wandel der Walz vom Massenphänomen zur Ausnahmeerscheinung Die genaue Zahl derer, die über die Jahrhunderte auf die Walz gingen, verbleibt im Dunkel der Geschichte. Denn erst ab dem 18 Jh. etablierten sich Reisedokumente und Meldepflichten für Wandergesellen und erst im 19. Jh. war das polizeiliche Meldewesen so etabliert, dass Wanderbewegungen detaillierter erfasst werden konnten.14 Für frühere Zeiten kann die Zahl der Reisenden nur geschätzt werden. Zumindest aber im 18. und 19. Jh. war geographische Mobilität ein gesellschaftliches Massenphänomen und die Wandergesellen machten einen bedeutsamen Teil dieses Phänomens aus.15 Auf der Straße mischten sie sich unter ein buntes Volk. Wie die Historikerin Sigrid Wadauer für diese Zeit festhält: »Wandern ist ja nur eine der möglichen Dimensionen von Mobilität […]. Mobil sind neben Arbeitern, Stromern, Vagabunden, Bettlern, Fahrenden und Gesinde auch Studenten, Kaufleute, Bildungs- und Lustreisende.«16 Eine Hochrechnung geht für die Stadt Wien für das Jahrzehnt von 1830–1840 von ca. 140.000–160.000 jährlich ankommenden Gesellen aus. 1840 hatte Wien etwa 356.000 Einwohner. Drei von vier in Wien arbeitenden Gesellen waren Wandergesellen.17 Erst im Zuge der im deutschsprachigen Raum spät einsetzenden Industrialisierung verringerte sich die Zahl der zünftig wandernden Gesellen. Spätestens mit der Einführung der Gewerbefreiheit im Deutschen Reich um 1871 und der damit verbundenen Abschaffung der Zünfte war es auch hier mit der Wanderpflicht vorbei: Jeder, der ein Handwerk ausüben wollte, benötige hierfür nur noch einen leicht zu beschaffenden Gewerbeschein. Zwar gründeten sich ab 1891 vereinzelt Gesellenvereinigungen, die es sich zum Ziel gesetzt hatten, das traditionelle, zünftige Wandern 13 Reininghaus 1981: S. 80. 14 Elkar 1984: S. 262 ff. 15 Kocka 2016. 16 Wadauer 2005: S. 40. 17 Ehmer 2000: S. 169.
275
MARKUS RÖMER
wiederzubeleben. Sie nannten sich nun – wohl in Anlehnung an Arbeitskolonnen des Bergbaus – »Schächte«. Jedoch nahmen nur noch wenige Gesellen die Entbehrungen der Walz freiwillig auf sich. In den 1950er Jahren erfuhr das Wandern noch einmal einen gewissen Aufschwung, Anfang der 70er Jahre schien es dann endgültig vor dem Aus zu stehen – das Wirtschaftswunder und die Verheißungen der Konsumgesellschaft schienen die Wandermoral zu Boden gerungen zu haben. Diese Talsohle kann heute als überwunden gelten: Seit Ende der 1970er begeben sich wieder mehr Handwerker auf die Walz.18 Die letzten Jahrzehnte waren voller Dynamik für das Gesellenwandern. Seit Mitte der 90er Jahre ist eine bis heute anhaltende Zunahme der Bewegung der sogenannten »Freireisenden Wandergesellen« festzustellen (zu den Freireisenden s. u.). Trotzdem bleibt die Walz insgesamt gesehen eine Ausnahmeerscheinung, was folgende Zahlen verdeutlichen: 77.700 Junggesellinnen und -gesellen erhielten 2018 ihren Gesellenbrief19, nur ca. 400–500 Gesellinnen und -gesellen befinden sich momentan auf Wanderschaft.
Walz heute: Motive zu wandern und Reaktionen der »Kuhköppe« Die »zünftigen Regeln«, die von modernen Wandergesellen einzuhalten sind, sind zahlreich und muten z. T. krass an: Meist wird eine Wanderzeit von drei Jahren und einem Tag gefordert. Während dieser Zeit ist der Besuch des eigenen Herkunftsortes tabu. Für Unterkunft und Mobilität darf kein Geld ausgeben werden und auch das Mobiltelefon sucht man im minimalistischen Gepäck der Wandergesellen vergebens. Einige der Regeln im Überblick: • Persönliche Voraussetzungen: unter 30 Jahre alt, Gesellenbrief, ledig, schulden-, vorstrafenfrei sowie kinderlos (bei manchen Schächten: Gewerkschaftszugehörigkeit notwendig) • Wanderzeit: 3 Jahre und einen Tag (bei manchen Schächten nur 2 Jahre) • »Bannmeile« von 50 Kilometern um Wohnort muss während der Wanderschaft eingehalten werden • Äußerliches Erscheinungsbild und Besitz: – Kluft muss während der Walz in Öffentlichkeit getragen werden, hierzu gehört auch ein Wanderstock (Stenz) 18 Lemke 2002: S. 198 f. u. Bohnenkamp/Möbus 2012: S. 68. 19 Internetquelle: https://www.zdh-statistik.de/application/index.php?mID= 3&cID=778 [Zugriff: 26.11.19].
276
»DIE WAREN VÖLLIG ÜBERRASCHT, DASS DA PLÖTZLICH EIN BÄCKER KOMMT«
•
– Besitz wird im traditionellen Bündel transportiert – Mobiltelefone sind verboten, bei Reisestart darf kein Bargeld mitgenommen werden Mobilität: Es darf kein Geld für Transport und Logis ausgegeben werden, es darf kein eigenes Fahrzeug genutzt werden
Angesichts solcher Regeln, denen sich moderne Wandergesellen – anders als ihre historischen Vorbilder – freiwillig unterwerfen, stellt sich die Frage: Warum Wandern? Die Zeiten, in denen eine Wanderpflicht existierte, sind lange vorbei. Auch Zünfte oder Bruderschaften, die früher mit härtesten Sanktionen jeden Gesellen dazu bewegten, auf Wanderschaft zu gehen, gibt es nicht mehr. Was bekommt man also zurück, wenn man sich auf dieses Regelwerk einlässt? Was motiviert heute zum Wandern? Eine wichtige Rolle spielt die Abenteuerlust. Ein bereits »einheimisch« gewordener, also von der Wanderschaft zurückgekehrter Wandergeselle bemerkt zu den Motiven seiner Entscheidung, auf die Walz zu gehen: »Es ist ganz klar, es war ein großer Teil auch Abenteuerlust. Man hat ganz schnell gemerkt, das wird eine große Herausforderung, nicht nur handwerklich, sondern auch menschlich und persönlich.«20
Eine andere wiederkehrende Antwort der Gesellen auf die Frage nach der Motivation ist: Mehr lernen im eigenen Handwerk. Zwar sind die Ausbildungsinhalte der Lehrzeit heutzutage festgelegt, Junggesellen besitzen einiges an Know-how in ihrem Gewerk. Aber neben der Abenteuerlust ist der Weiterbildungswille nach wie vor eine wichtige Motivation für die Walz. Einer der Interviewpartner beschreibt den speziellen Lernmodus der Walz so: »Das finde ich das schönste auf Wanderschaft, dass du diese Freiheit hast, einerseits zu lernen als Geselle, aber im Modus zu sein wie ein Lehrling. Du kommst wo an und du darfst was lernen, nicht: Du musst was leisten. Natürlich leistest du was. Aber du hast Toleranz. Und auch: Ich muss nicht arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern nur, um zu überleben und habe so die Freiheit, was zu lernen.«21
Auf Wanderschaft besteht die Möglichkeit, sich spannende Arbeitgeber und Projekte auszusuchen. Auch außeralltägliche, seltene Handwerkstechniken können erlernt werden, mit denen man im normalen Berufsleben sonst nicht in Berührung käme. Einige Gesellen nehmen außerdem die Chance wahr, sich in angrenzenden Gewerken auszuprobieren. Angesichts zunehmender Spezialisierung im Handwerk, angesichts von Leistungsdruck und Alltagstrott nutzen die Gesellen eine traditionsreiche 20 MBä 6.10 21 MDa 9.19
277
MARKUS RÖMER
»ökologische Nische«, um für ein paar Jahre ihren Horizont zu erweitern. Ökonomisch sind sie während dieser Zeit relativ unabhängig, denn sie beschränken ihre Bedürfnisse radikal. Auch diese Beschränkung auf das Wesentliche und die hierdurch gewonnene Freiheit machen z. T. sicherlich die Faszination der Lebensform Walz aus. In der wissenschaftlichen Literatur ist gar vom »Antiökonomismus« der Walz die Rede.22 Ein Wandergeselle bemerkt: »Wir kommen einfach mit so wenig aus. Wo man dann erst den Horizont dafür bekommt: Eigentlich leben wir alle in absolutem Überfluss und das Wenige macht glücklich, weil alles andere ist halt ne Belastung. Das kommt erst mit der Zeit, dass man das versteht und leben kann.«23
Auch hinsichtlich der Jobflexibilität ist die Walz unschlagbar. Wenn eine Arbeit nicht mehr als erfüllend bzw. lehrreich empfunden wird und die Reisekasse einigermaßen gefüllt ist, zieht der Wandergeselle weiter. Nicht, dass Arbeitgeber schnöde im Stich gelassen werden. Jedoch wird die Flexibilität der Wandergesellen von Arbeitgebern meist akzeptiert: Um Arbeit vorsprechende Gesellen werden kurzfristig angestellt, genauso kurzfristig kann das Arbeitsverhältnis auch wieder enden. Ein Interviewpartner berichtet: »Es gab keine Diskussion, dass man nur drei Monate bleibt, das hat man gesagt und das wurde akzeptiert. Und wenn man nach zwei Wochen weitergezogen ist, weil die Arbeit nicht so toll war, war einem auch keiner böse. Dann hat man gesagt: ›Zieht der Wandergeselle eben weiter, ist ja auf Wanderschaft.‹«24
Auf Wanderschaft zu gehen, wird von vielen Interviewpartnern als Privileg angesehen. Die Kluft wird in dem Bewusstsein getragen, dass die Gesellschaft den Wanderer als Teil einer homogenen Gruppe wahrnimmt. Denn die internen Strukturen der Wandergesellenkultur, wie z. B. die Zugehörigkeit zu einer der unterschiedlichen Gesellenvereinigungen, spielen in der Außenwahrnehmung keine Rolle. Für den Laien ist Wandergeselle gleich Wandergeselle. Hieraus wächst für jeden Wandergesellen die Verantwortung, sich so zu verhalten, dass der nächste Geselle gerne gesehen ist: »Du hast halt ne Uniform auch an. Du repräsentierst da eigentlich auch – klar das bist immer noch du, aber – du repräsentierst in dem Moment eigentlich die ganzen Wandergesellen. Dem muss man sich eigentlich immer bewusst sein. […] Darum sollte man sich immer auch so verhalten, dass die Leute einen auch gerne sehen als Wandergesellen.«25 22 Wadauer 2005: S. 242. 23 MBo 5.20 24 UBä 2 14.19 25 LBo 11.57
278
»DIE WAREN VÖLLIG ÜBERRASCHT, DASS DA PLÖTZLICH EIN BÄCKER KOMMT«
Als echte »Hingucker« stehen die Wandergesellen heute, wo immer sie auftauchen, im Mittelpunkt. Von den »Kuhköppen«, also von der nicht-wandernden Bevölkerung, wird man als zünftiger Geselle oft als Attraktion wahrgenommen und angestaunt. Das ist nicht immer angenehm. Viele Interviewpartner berichten davon, wie nervend und ermüdend es sein kann, wenn man ständig ungefragt fotografiert wird oder immer gleiche Fragen beantworten muss. Ein Wandergeselle, der erst seit einigen Wochen auf der Straße ist beschreibt das Gefühl, das dabei entstehen kann, so: »In Städten hab ich´s erlebt, dass du teilweise auch wie ne Attraktion bist. Die Leute schauen dich an, die Leute zeigen auf dich: ›Hey guck mal, nen Wandergeselle.‹ Sie haben schon mal irgendwo was von dem Thema gehört, sehen die Kluft sehen die Klamotten und sprechen über dich und photographieren dich, obwohl du es gar nicht willst vielleicht. Sie fragen aber nicht. Sie stellen sich einfach vor dich, gucken in dein Gesicht mit der Linse und machen einfach ein Photo. Manchmal ist auch so, wenn du sagst: ›Hey, Sie können doch bitte vorher fragen.‹ Dann drehen sie sich weg und gehen. Man wird vielleicht, ich weiß es nicht, man wird als Mensch nicht betrachtet, sondern als Schausteller, Attraktion so.«26
Solchen unschönen Erfahrungen, die aus der ultimativen Sichtbarkeit der Wandergesellen in der Öffentlichkeit herrühren, stehen schöne gegenüber. So berichten die Gesprächspartner von der unvermuteten Hilfsbereitschaft und Unterstützung völlig fremder Menschen. Da werden Schlafplätze angeboten, Essen spendiert oder Mitfahrgelegenheiten tun sich unversehens auf. Derselbe Interviewpartner berichtet von seinen ersten Anhalter-Erfahrungen: »Manchmal hab ich den Daumen rausgehalten, manchmal hatte ich auch keine Lust zum Trampen, hab mich einfach auf die Leitplanke gesetzt bei der Auffahrt, ne Zigarette geraucht und auf einmal hielten Leute an. Das war auch so´n Moment, wo ich dachte: ›Hey krass, ich kümmer mich hier um gar nichts und die Leute halten einfach an und fahren mich dahin, wo ich hin will.‹«27
Es kann auch vorkommen, dass man von wildfremden Personen eingeladen wird, wie ein anderer Wandergeselle berichtet: »Ich hab das manchmal auch gemerkt jetzt in der Weihnachtszeit. Bin ich auf dem Weihnachtsmarkt, möchte nen Glühwein. Geh ich zu nem Glühweinstand, ganz normale Situation, ich will nen Glühwein kaufen. Steh ich da, kommt halt die Bedienung. Was möchtest du haben? Nen Glühwein. Geht sie weg. Hol ich halt mein Geld raus, möchte ganz 26 TZi 10.15 27 TZi 2.29
279
MARKUS RÖMER
normal bezahlen. Kommt auf einmal von der Seite irgendeine fremde Person, ein Typ, sagt: ›Hey, du bist Wandergeselle, ich geb dir das aus.‹«28
Selbst gerade leerstehende Wohnungen werden angeboten: »Was wir dann auch machen, wenn wir nicht so viel Geld haben, wir gehen zu Bäckern oder Fleischern und fragen nach ner Reiseunterstützung. Mit unserem kleinen Sprüchlein. […] Dann war da diese Bedienung, die wusste gar nicht, was Wanderschaft ist. Und meinte ich, hören Sie doch einfach mal zu. Dann habe ich da mein Gedicht vorgetragen und habe erklärt, wie das alles so ist. Sie sagte: ›Ich kann dir das und das anbieten.‹ Was von Herzen kommt, wird von Herzen gern genommen. Dann hat sie mir das so eingepackt und fragte: ›Na, wo pennst du denn heute so? […] Ja, ich hab hier so ne Wohnung, die nutze ich gerade nicht, da kannst du rein.‹«29
Vielleicht sind es genau solch außeralltägliche Erfahrungen, die die schwer zu beschreibende Faszination des Lebensmodus Walz ausmachen? Auf jeden Fall ist die Walz auch heute noch ein Abenteuer, eine Lebensphase voller Überraschungen und unerwarteter Lerneffekte und Aha-Erlebnisse. Zwar bringen nur wenige Gesellinnen und Gesellen den Mut und die Neugier – und vielleicht auch die notwendige Radikalität – mit, sich auf diesen Lebensmodus einzulassen. Deswegen bleibt die Walz in der heutigen Zeit eine Ausnahmeerscheinung. Ungefähr seit den 1990er Jahren wird aber wieder häufiger gewandert. Und: Neuerdings gehen auch wieder Gesellinnen und Gesellen auf Wanderschaft, deren Gewerke jahrzehntelang nicht auf der Straße zu sehen waren. Dies gilt z. B. für Bäcker, Brauer und Schuhmacher.
Ein Blumenstrauß an Gewerken – zu Besuch auf der Sommerbaustelle der Freireisenden Wie oben angesprochen, handelt es sich bei den Freireisenden um eine Teilgruppe der Wandergesellen, die in den letzten 25 Jahren sehr viel Zulauf bekommen hat. Wahrscheinlich – offizielle Zahlen existieren nicht – stellen die Freireisenden mit ca. 180 Reisenden momentan die größte Teilgruppe der Wandergesellen. Im Rahmen einer Feldforschung auf der Sommerbaustelle der freireisenden Wandergesellen konnte der Autor Einblicke in deren Alltagskultur gewinnen. Mehrere Gesellinnen und Gesellen erklärten sich dazu 28 LBo 12.50 29 LBo 14.43
280
»DIE WAREN VÖLLIG ÜBERRASCHT, DASS DA PLÖTZLICH EIN BÄCKER KOMMT«
bereit, an leitfadengestützten Interviews teilzunehmen, die mittels Tonbands aufgenommen wurden. Die sogenannte Sommerbaustelle ist ein jährlich stattfindendes Gemeinschaftsprojekt der Freireisenden. Ziel der Baustelle ist es, wie sie sagen »Der Gesellschaft etwas zurückzugeben«. Im Juli und August 2019 wurde im Rahmen der Sommerbaustellenarbeit ein denkmalgeschütztes Stallgebäude renoviert und ausgebaut. Das Gebäude ist Teil eines größeren gemeinnützigen Wohnprojektes in Fürstenwalde, in der Nähe von Berlin. Die Baustelle konnte auf Anfrage des Autors besucht werden. Zum Zeitpunkt des Besuchs waren ca. 70 Gesellinnen und Gesellen anwesend, die für mehrere Wochen unentgeltlich auf dem Bau oder in der sonstigen Sommerbaustellen-Infrastruktur wie z. B. Küche, Bar oder Garten arbeiteten. Folgende Gewerke waren zum Zeitpunkt der dreitägigen Feldphase vor Ort (z. T. nur in Form einzelner Personen): • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Bäcker Bierbrauer Bootsbauer Buchbinder Dachdecker Elektriker Feintäschner Gärtner Harfenbauer Holzbildhauer Hutmodisten Köche Konditoren Landwirte Maurer Schuhmacher Steinmetze Tischler Zimmerer Zweiradmechaniker
Viele der oben aufgeführten Gewerke beleben mit ihrer Wanderschaft über Jahrhunderte gepflegte, aber in Vergessenheit geratene, Traditionen. Denn die bei Laien verbreitete Annahme, dass von jeher nur Bauhandwerker auf Wanderschaft gehen, ist nicht korrekt. Zwar rekrutieren sich die Wandergesellen sehr häufig aus dem Bau- und insbesondere aus dem Zimmererhandwerk. Allerdings war dieser Überhang an wandernden Bauhandwerkern nicht immer so gegeben. Vom 14. Jh. bis ins 19. Jh. waren grundsätzlich alle Handwerksberufe auf der Straße anzutreffen. Nur in einzelnen Gewerken, in denen der Verrat von Berufsgeheimnissen 281
MARKUS RÖMER
befürchtet wurde, existierten Wanderverbote. So z. B. bei den Nürnberger Brillenmachern, Drahtziehern und Goldschlägern.30 Die pauschale Eingrenzung der Wanderschaft auf die Baugewerke wurde erst im Zuge der oben erwähnten Wiederaufnahme der zünftigen Walz ab 1891 vollzogen. Neben Gewerken, die früher wanderten und diese Tradition nun wieder aufleben lassen, sind heute auch Gewerke unterwegs, die – alleine schon auf Grund ihrer vergleichsweise recht kurzen Geschichte – ihre Wandertätigkeit erst vor wenigen Jahren aufnehmen konnten. Dies betrifft z. B. vereinzelt anzutreffende Zweiradmechaniker, Elektriker oder ähnlich »moderne« Gewerke. Das wirft die Frage auf: Darf bei den Freireisenden grundsätzlich Jede oder Jeder wandern? Trotz des oben ersichtlichen »bunten Blumenstraußes« an Gewerken wird diese Frage von Zeit zu Zeit intern diskutiert. Es geht hier um Grundsätzliches: Bei den Traditionsschächten dürfen nach wie vor nur Bauhandwerker und auch keine Frauen wandern; bei den Freireisenden wandern dagegen sehr viele Frauen und sehr viele Nicht-Bauhandwerker. Trotzdem gibt es auch bei den Freireisenden Grenzen, was das »Erwandern« von Gewerken angeht. Diese Grenzen sind jedoch – anders als bei den Schächten – nicht das Ergebnis eines offiziellen internen Abstimmungsprozesses oder gar verbindlich fixiert. Die Grenzen sind eher informeller Art, außerdem sind sie im ständigen Fluss, so dass nichts Letztgültiges darüber ausgesagt werden kann. Einige Freireisende sehen diese Frage ganz pragmatisch: Wenn jemand etwas auf der Walz dazulernen, sich in seinem Gewerk weiterentwickeln kann, sollte ihm auch die zünftige Wanderung ermöglicht werden. Ein Wandergeselle bemerkt lapidar: »Wenn du mir erklären kannst, dass du was lernen kannst in den Betrieben, dann Alter, klar, reis!«31 Aber auch dieser Interviewpartner sieht gewisse Grenzen, die es zu beachten gilt. Diese rühren z. B. daher, dass bei manchen Berufen die Kommunikation mit Menschen im Vordergrund steht, die kurze Aufenthaltsdauer des Wandergesellen dann aber der guten Ausübung des Berufs entgegensteht: »Auch Sozialberufe, das geht nicht. Wenn nen Kindergärtner auf Wanderschaft gehen würde und nach zwei, drei Monaten wieder weiterziehen würde – das ist einfach so ein Verlust für die Kinder, das würde ich denen nicht zumuten wollen.«32
Die pragmatische Sichtweise a lá »Wandern = Lernen« beinhaltet weitere Tücken. So berichtet derselbe Gesprächspartner von einem Trompetenbauer, der alle einschlägigen Betriebe in Deutschland ansteuerte, jedoch 30 Wissel 1971 Bd. 1: S. 321. 31 RZi 1.24 32 RZi 2.25
282
»DIE WAREN VÖLLIG ÜBERRASCHT, DASS DA PLÖTZLICH EIN BÄCKER KOMMT«
nirgendwo bei den Kernprozessen »Hand anlegen« durfte. Er beendete seine Walz frühzeitig. Ein weiterer Faktor, der bei der Erwanderung von Berufen, die bisher nicht auf der Walz waren, eine Rolle spielt, ist die Tradition. Ein einheimischer freigereister Wandergeselle berichtet von einem weiter zurückliegenden Fall, bei dem intern über die Erwanderung diskutiert wurde: »Was bei mir damals ein großes Thema war, war ein Zweiradmechaniker, der sich sehr in den Kreisen bewegte hat und sehr gerne auf Wanderschaft gehen wollte damals. Hat´s dann auch geschafft, weil man gesagt hat: ›Auch er hat´s verdient, sein Handwerk in dem Maße zu repräsentieren.‹ Hat aber nen Moment gedauert, weil einige Gegenstimmen doch laut waren. […] Weil die Gemeinschaft natürlich schon daran interessiert ist, die Tradition nicht zu verwässern. Deswegen wird heutzutage ja der Ohrring auch immer noch mit nem selbstgeschmiedeten Nagel in ner Kneipe auf nem Tresen geschlagen. Da wird schon viel noch extrem hochgehalten.«33
Tradition spielt also eine wichtige Rolle, wenn die Frage, wer zünftig wandern kann, innerhalb der Gemeinschaft der Freireisenden beantwortet wird. Andererseits pflegen viele Freireisenden eine gewisse kritische Distanz zu allzu selbstverständlich daherkommenden Traditionsauslegungen. Mehrere Interviewpartner wiesen darauf hin, dass viele der heute als »traditionell«, also althergebracht geltenden Verhaltensweisen keinesfalls alt sind. Darunter fällt z. B. der heute übliche Brauch, beim »Losbringen«, also zu Beginn der Walz, übers Ortsschild zu steigen und eine Flasche zu vergraben. Auch das »Nageln«, d. h. das Stechen eines Ohrloches mittels eines Hammers und eines Nagels, wird erst seit einigen Jahren wieder praktiziert. Als Beispiel für diese tradtionsskeptische Grundhaltung sei folgender Interviewauszug wiedergegeben: »Ich kann zum Beispiel mit dem Begriff ›zünftig‹ nichts anfangen. Mit Zünften haben wir nichts zu tun. Zünfte sind reine Meisterzusammenschlüsse, […] die als Kartell gehandelt haben und jungen Menschen das Meisterrecht verwehrt haben und in die Fremde geschickt haben auf gut Glück, dass sie verrecken. […] Ich weiß nicht, wie man sich damit brüs ten will und kann und den Begriff so ins Positive drängt. […] Und wenn ich mir viele Aspekte anschaue, wie wir heute wandern, dann kann ich schwarz auf weiß unterschreiben: Da ist nichts traditionell, nada, njet, null. Fritz Ulrich hat vor 100 Jahren die Kluft erfunden.«34
Hier wird u. a. darauf angespielt, dass die heute existierenden Schächte sich selbst auch als »Gesellenzünfte« bezeichnen. Die Wörter »Zunft« oder »zünftig« finden aber auch im Alltagssprachgebrauch 33 MBä 10.09 34 RZi 21.53
283
MARKUS RÖMER
der Wandergesellen – z. B. in Verbindung mit der Kleidung (»zünftige Kluft«) – oft Verwendung. Aus Sicht des Gesprächspartners in historisch unreflektierter Weise. Abschließend ist festzustellen: Die Freireisenden legen Wert auf eigenverantwortliches Handeln und individuelle Entscheidungsfreiheit. Ein gegebenes Versprechen, ein gesprochenes Wort wird sehr ernst genommen, von Gesellinnen und Gesellen wird erwartet, dass sie zu ihrem Wort stehen. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch: Wenn jemand für die Erwanderung einer Person eines neuen Gewerkes persönlich eintritt, liegt die Verantwortung für diese Entscheidung letztendlich beim ihr oder ihm – ein ausdrückliches Verbot durch die Gemeinschaft ist dann schwer vorstellbar.
Im Schacht organisiert oder freireisend unterwegs? Die Frage, ob im Schacht gereist werden soll oder nicht, muss jeder Geselle selbst entscheiden. Die Entscheidungsfreiheit ist aber begrenzt. Zum einen sind es in letzter Instanz die Schächte selbst, die die Entscheidung treffen, ob ein Bewerber innerhalb der jeweiligen Organisation erwandert wird oder nicht. Zum anderen: Wenn ein Bewerber nicht das »richtige« Handwerk und das »richtige« Geschlecht mitbringt, ist bei fast allen Schächten die Erwanderung von vorneherein ausgeschlossen. Denn von den acht existierenden Schächten werden nur in einem alle Gewerke erwandert und nur drei erwandern Handwerkerinnen. Die größte Wahlfreiheit haben männliche Bauhandwerker, sie können sich theoretisch zwischen sieben unterschiedlichen Schächten entscheiden – oder eben frei reisen. Dagegen existieren momentan nur zwei Schächte, die auch Nicht-Bauhandwerker erwandern. Dies sind der 1986 gegründete »Freie Begegnungsschacht« sowie die »Vereinigten Löwenbrüder und Schwestern Europas«, die sich im Jahr 2016 gründeten. Ersterer erwandert alle Handwerker, die ein begründetes Interesse an der Walz mitbringen, letzterer erwandert ausschließlich Lebensmittelgewerke (zu Details s. u.). Beide Schächte erwandern Frauen. Handwerkerinnen werden nur noch in einer weiteren Wandergesellenorganisation, nämlich im 1979 gegründeten Schacht »Axt & Kelle« erwandert. Allerdings dürfen auch hier nur Baugewerke reisen. Die Verhältnisse der Schächte untereinander sind z. T. kompliziert und für Außenstehende im Detail kaum nachvollziehbar. Interne schachtpolitische Verstrickungen reichen weit zurück:35 35 Vgl. zum Folgenden: Bohnenkamp/Möbus 2012: S. 54 ff.
284
»DIE WAREN VÖLLIG ÜBERRASCHT, DASS DA PLÖTZLICH EIN BÄCKER KOMMT«
Im Jahr 1891 gründete sich die Gesellenbruderschaft der »Rechtschaffenen Fremden«, die sich als legitime Nachfolgerin der Zünfte und als Bewahrerin der zünftigen Wanderschaft verstand. Die Rechtschaffenen waren in zwei separaten Gesellschaften organisiert, die jeweils unterschiedliche Baugewerke erwanderten. Die Aufteilung der Gewerke auf zwei Bruderschaften missfiel jedoch einigen Gesellen. Noch im selben Jahr gründeten einige Rechtschaffene heimlich einen neuen Schacht, den sogenannten »Rolandschacht«. Die Folgen waren eine jahrzehntelang währende Feindschaft und zahlreiche blutige Auseinandersetzungen zwischen Rechtschaffenen und Rolandsbrüdern – denn bis heute gilt es als unehrenhaft, von einem Schacht zu einem anderen zu wechseln. Auch zwischen den damals schon zahlreichen freireisenden Handwerkern – unter ihnen viele Nicht-Bauhandwerker – und den Schächten gab es Auseinandersetzungen. Diese verschärften sich, nachdem sich um das Jahr 1910 zwei neue Schächte aus dem Kreise der Freireisenden gründeten: die »Freien Vogtländer« und die »Fremden Freiheitsbrüder«. Bohnenkamp und Möbus resümieren für jene Zeit: »Die Schachtgeschichten gerieten oft genug zu Schlachtgeschichten«36. In der neueren Geschichte der Schächte hat besonders die Gründung von Axt & Kelle Unruhe erzeugt und für Auseinandersetzungen gesorgt.37 Aus der Friedensbewegung und der ökologischen Bewegung hervorgegangen, waren für die Gründer von Axt & Kelle die offen geäußerte politische Meinung und sichtbare politische Aktion unveräußerliche Rechte jedes Wandergesellen. Z. T. beteiligten sich Angehörige des Schachtes an Hausbesetzungen u. ä. Aktionen, die die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zogen. Mit diesem Verhalten eckten die »Kellies« bei den Traditionsschächten erheblich an. Denn hier gilt bis heute, dass sich Wandergesellen möglichst zurückzuhalten haben, wenn es um Politik geht. Teilnahme an politischen Aktionen oder Demos sind – mit Ausnahme der Teilnahme an gewerkschaftlich organisierten Demonstrationen anlässlich des Maifeiertags – nicht gerne gesehen. Wie in der Gründungsphase der Traditionsschächte kam es Anfang der 80er Jahre teils zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen von Axt & Kelle und anderen Schachtgesellen. Konfliktstoff war ausreichend vorhanden, zu allem Überfluss war die Schachtzugehörigkeit für Eingeweihte oft auf den ersten Blick zu erkennen. Auch heute noch erkennen sich die Wandergesellen der unterschiedlichen Vereinigungen auf der Straße oft auf Anhieb. Internes Erkennungsmerkmal ist unter anderem die sogenannte »Ehrbarkeit«, ein gehäkeltes Band, welches nach Art einer Krawatte vor der Brust getragen wird. Die Angehörigen 36 Bohnenkamp/Möbus 2012: S. 56 (Hervorh. im Original). 37 Bohnenkamp/Möbus 2012: S. 71 ff. u. Lemke 2002: S. 214 ff.
285
MARKUS RÖMER
von Axt & Kelle tragen stattdessen ein Ohrgehänge. So endeten zufällige Zusammentreffen auf der Straße zum Teil wenig erfreulich. Diese Streitigkeiten sind heute etwas abgekühlt, aber auch heute noch gibt es Unterschiede zwischen den »Traditionsschächten« und den in den letzten Jahrzehnten neugegründeten Schächten. Letztere sind auch nach wie vor nicht, wie es bei den älteren Schächten der Fall ist, in der C.C.E.G, der Vereinigung der Gesellenzünfte Europas, organisiert.38 Die Geschichte der Schächte und das z. T. vorbelastete Verhältnis derselben untereinander ist den meisten Handwerkern, die sich für die Wanderschaft interessieren, nicht bekannt. Viele Interviewpartner berichten, dass sie vor ihrer Wanderschaft keinerlei Kenntnis von der Existenz unterschiedlicher Schächte gehabt hätten. Die Schachtzugehörigkeit ist häufig einfach das Resultat eines mehr oder weniger zufälligen Kontakts. Andere Interviewpartner berichten wiederum, dass sie sich aus Überzeugung für einen bestimmten Schacht bzw. fürs freie Reisen entschieden hätten. Zusammenfassend könnte man sagen: Für einige Wandergesellen ist die Frage nach der Schachtzugehörigkeit bzw. nach den organisatorischen Rahmenbedingungen der eigenen Reise nicht essentiell – für andere trifft diese Frage in die Mitte der eigenen Identität; in diesem oder jenem Schacht oder eben freireisend unterwegs zu sein, ist dann Ausdruck der individuellen Interpretation des Gesellenwanderns. Eine Definition des Gesellenwanderns, die die Bedeutung der Schachtorganisation für die zünftige Walz hervorhebt, findet sich im »Verzeichnis immaterielles Kulturerbe« der UNESCO. Dort heißt es zur »Handwerksgesellenwanderschaft Walz«: »Auf die Walz zu gehen heißt nicht nur, sich als Handwerker in Kluft auf Reisen zu begeben. Entscheidend ist vielmehr in eine Gemeinschaft eingebunden zu sein, was ein kontinuierliches Tradieren von älteren Generationen an die Jüngeren ermöglicht. Der Schacht oder die Gesellschaft bildet mit seinen einheimischen Gesellen und ihren Herbergen, wo auch die traditionellen geheimen Versammlungen (das Aufklopfen) abgehalten werden, das Netzwerk, in dem sich der reisende Geselle bewegt und auf welches er immer zurückgreifen kann. Somit ist die Walz als der allgemein sichtbare Aspekt des zünftigen Handwerksreisens nur ein Teil der damit zusammenhängenden Tradition, die letztlich durch die lebenslängliche Verbundenheit der einzelnen Gesellen mit ihren Gesellschaften zusammengehalten und weitergetragen wird.«39
38 C.C.E.G steht für: Confédération Compagnonnages Européens – Europäische Gesellenzünfte. 39 Internetquelle: https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielleskulturerbe/immaterielles-kulturerbe-deutschland/handwerker-walz [Zugriff: 12.12.19].
286
»DIE WAREN VÖLLIG ÜBERRASCHT, DASS DA PLÖTZLICH EIN BÄCKER KOMMT«
Die Walz wurde 2014 in das UNESCO-Verzeichnis aufgenommen. Der Verfasser des obigen Textes ist ein einheimischer Wandergeselle, er ist in einer Gesellenbruderschaft organisiert. Im Interview unterschied er die sichtbare Seite der Walz – die zeitlich begrenzte Reisezeit – von ihrer unsichtbaren Seite: der dauerhaft bestehenden Gesellenbruderschaft. Aus seiner Sicht ist die Fokussierung der Freireisenden Wandergesellen auf die Reisezeit problematisch, da die Fragen der Weitergabe der Tradition und der Unterstützung durch das Netzwerk ausgeklammert werden: »Das ist eben das Problem, die Freireisenden sagen, ich bin nicht in der Gesellschaft, ich mach mein eigenes Ding […] Der Wandergeselle in Kluft ist ja eigentlich nur der sichtbare Teil der Tradition. Das Netzwerk, das sind die Einheimischen.«40
Für den Autor des Kulturerbe-Artikels hat die Frage »Schacht oder Freireisend?« eine grundsätzliche Bedeutung. Ohne längerfristig bestehendes Netzwerk ist für ihn die Walz gewissermaßen unvollständig. Er weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass gerade in geschichtlichen Situationen, in denen die Walz verboten war, wie z. B. in der ehemaligen DDR oder zur Zeit des Nationalsozialismus, dem Wandergesellennetzwerk eine entscheidene Rolle bei der Bewahrung der Tradition zukam. Aber auch wenn an prominenter Stelle platziert: Der Eintrag im UNESCO-Verzeichnis spiegelt nicht die Meinung aller Wandergesellen wider. Im Rahmen der auf der Sommerbaustelle der Freireisenden geführten Interviews wurde den Interviewpartnern folgender Teilausschnitt des Eintrags vorgelegt: »Der Schacht oder die Gesellschaft bildet mit seinen einheimischen Gesellen und ihren Herbergen […] das Netzwerk, in dem sich der reisende Geselle bewegt und auf welches er immer zurückgreifen kann. Somit ist die Walz […] nur ein Teil der damit zusammenhängenden Tradition, die letztlich durch die lebenslängliche Verbundenheit der einzelnen Gesellen mit ihren Gesellschaften zusammengehalten und weitergetragen wird.«
Ein einheimischer freigereister Wandergeselle bemerkt dazu: »Wenn man in irgendeiner Stadt in Deutschland in Kluft ankommt, dann repräsentiert man das [Gesellenwandern] auch und die anderen [die Einheimischen] nicht. Deswegen ist das [Gesellenwandern] für mich einfach so auf die wirkliche Wanderschaft zu reduzieren.«41
Auch andere freireisende Gesprächspartner lehnen die zentrale Bedeutung ab, die im UNESCO-Eintrag der Schachtorganisation zugewiesen wird. Eine dem Eintrag ähnliche Sichtweise äußert dagegen ein auf der Sommerbaustelle zufällig anwesender Schacht-Aspirant: 40 FZi 16.19 41 MBo 13.05
287
MARKUS RÖMER
»Das mit dem Netzwerk war z. B. auch ein ganz großer Punkt für mich, wieso ich in nem Schacht reisen will. Ich war mal auf nem Kongress […] nem großen Treffen, was alle zwei Jahre stattfindet. Und da war ein Wandergeselle, der vor 60 Jahren gereist ist. Der hatte seinen Rollator dabei […] Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe: Du bist lebenslänglich [Name des Schachtes], du gehörst lebenslänglich dem Schacht an, du kannst immer wieder Leuten was weitergeben.«42
Eine Schachtzugehörigkeit wirkt sich aber auch schon während der Reisezeit auf den Alltag von Wandergesellen aus. So haben Schachtgesellen Pflichten gegenüber ihrem Schacht, z. B. die Zureisepflicht zu bestimmten, schachtinternen Terminen. Auch sollten sie sich regelmäßig auf einer Herberge ihres Schachtes melden. Zwar existieren inzwischen auch Herbergen für die Freireisenden. Und ebenso wie die in Schächten organisierten Gesellen halten sich die Freireisenden an die oben aufgeführten Regeln der »zünftigen Walz«. Eine Zureise- oder gar Meldepflicht haben sie aber nicht. Diese Freiheit und Ungebundenheit hat nicht nur Vorteile, wie ein freireisender Geselle es empfindet: »Darum habe ich die Schachtgesellen auch immer ein bisschen beneidet. Die haben halt so ne Kontinuierlichkeit da drin, die sind halt wie ne kleine Familie. Treffen sich im besten Falle zweimal im Jahr, wo sie dann auch alle sind, auch mehrere Tage oder Wochen. Das schweißt halt vielmehr zusammen. Wir haben ja auch unsere Treffen und es gibt auch Leute, die man immer wieder sieht, aber es ist halt nicht diese Kontinuierlichkeit drin. […] [Herbergen] gibt’s freireisend auch organisiert, wir Freireisenden haben auch fünf Herbergen, wo dann aber auch alle anderen Wandergesellen hindürfen, da kann man sich auch treffen, aber […] wir haben halt nicht diese Pflichttermine. Freireisend bedeutet: Du kannst machen was du willst. Du musst jetzt nicht irgendwo sein, du musst nicht zu dem und dem Termin an dem und dem Ort sein. Du musst auch nicht zur Sommerbaustelle kommen. Aber beim Schacht hast du halt deine Zureisepflicht, wenn du da ein Treffen hast, dann musst du da auch hin.«43
Auch nach dem Ende der Wanderschaft ist die Bindung an die anderen freigereisten Wandergesellen eher locker und freiwillig. Es gibt zwar seit einigen Jahren sogenannte »Einheimischentreffen«, auf denen sich Gesellinnen und Gesellen treffen, die ihre Walz abgeschlossen haben, also »einheimisch« geworden sind. Hier sind aber laut Interviewpartnern eher Personen anzutreffen, die vor kurzem gereist sind. Längerfristig 42 TZi 29.02 43 EZw 19.08
288
»DIE WAREN VÖLLIG ÜBERRASCHT, DASS DA PLÖTZLICH EIN BÄCKER KOMMT«
geht der Kontakt zur Gruppe meist verloren. Ein schon länger einheimisch geschriebener, freigereister Wandergeselle bemerkt: »Man kann als Freireisender nach Hause gehen und sich nie mehr irgendwo melden. Man hat als Freireisender gegenüber der Gruppe keine Verpflichtungen.«44
Zwar sind auch bei den Schachtgesellen längst nicht alle Einheimischen lebenslang aktiv im Schacht. Ein Interviewpartner schätzte die Zahl der Aktiven auf ungefähr die Hälfte der einheimischen Wandergesellen. Unterm Strich ist die Wahrscheinlichkeit, dass man als Schachtgeselle dem Wandergesellentum lebenslang verbunden bleibt, aber wohl deutlich höher als bei den Freireisenden.
Die »Erfindung« der Bäckerwalz Ein um Arbeit vorsprechender wandernder Zimmermann – selten, aber denkbar. Aber wie reagieren Bäckermeister, wenn plötzlich ein wandernder Bäcker vor ihnen steht? Diese Frage trieb Urs Büttner um, als er in deutschen Backstuben vorsprach. Die Reaktionen schildert er wie folgt: »Die waren völlig überrascht, dass da plötzlich wieder ein Bäcker kommt. Ganz viele haben halt gesagt, die kennen das halt auch noch vom Großvater, dass der Großvater losgezogen ist. Aber dadurch, dass dieses Wissen ob der Wanderschaft so tief in der deutschen Bevölkerung verankert ist, war das kein Problem.«45
Büttner ging von 1991 bis 1996 auf die Walz und ist wahrscheinlich der erste Bäcker, der nach dem zweiten Weltkrieg wanderte. Nach Abschluss seiner Lehre unzufrieden mit der eigenen Berufswahl, stand für Büttner schon die Überlegung einer beruflichen Umorientierung im Raum. Durch Zufall traf er zwei Wandergesellen. Diese brachten ihn auf die Idee, auf die Walz zu gehen, um sein Handwerk richtig kennenzulernen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Büttner noch nie etwas davon gehört, dass Bäcker auf Wanderschaft gehen könnten bzw., dass es hierfür historische Vorbilder gab. Seine Neugier war geweckt: »Dann bin ich halt mal in die Staatsbibliothek in Berlin gegangen und in die Amerikagedenkbibliothek und hab da einfach mal nachgelesen, Wanderschaft, Bäcker, Handwerk, die drei Schlagworte und habe Bücher gefunden, wo das eben drinstand, dass Bäcker auf Wanderschaft gewesen sind. Das war dann die Bestätigung.«46 44 MBo 15.00 45 UBä 2, 14.19 46 UBä 2, 2.45
289
MARKUS RÖMER
Doch mit der Erkenntnis, dass Bäcker einst wanderten, fingen die Fragen erst an. Ganz praktische Probleme, wie z. B. welche Bekleidung für einen wandernden Bäcker angemessen wäre, mussten geklärt werden. »Und dann war halt eben bei diesen Stammtischabenden immer so die Frage, was hat der Bäcker denn überhaupt an als Kluft? Und dann waren die meisten eigentlich der Meinung, dass ich für die Bevölkerung klar erkenntlich sein sollte als Wandergeselle […] dann ziehst du deine Berufsfarben an, lässt dir eine Kluft machen in den traditionellen Berufsfarben.«47
Es wird deutlich: Auch, wenn es sich im Falle der Bäckerwalz nicht um eine moderne Erfindung, sondern um die Wiederbelebung einer eingeschlafenen Tradition handelt, ergaben sich für Büttner zahlreiche praktische Probleme. Man könnte stattdessen vielleicht von einer kreativen Neu-Interpretation der Walztradition sprechen. Eine Ursache für die abgebrochene Tradierung liegt in der Zeit des Nationalsozialismus. Da die zünftige Wanderschaft den neuen Machthabern gut mit der eigenen Ideologie vereinbar schien, wurde von offizieller Seite zunächst versucht, die Schächte gleichzuschalten und das Wandern nach eigener – wenig zünftiger – Vorstellung zu gestalten. So wurden Vorgaben zur Bekleidung erlassen, ein einheitlicher Wanderstock ausgegeben sowie Ablauf und Dauer der Wanderung festgelegt. Da diese Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg zeitigten, wurde am 13. Dezember 1936 von der Deutschen Arbeitsfront (DAF) per Dekret bestimmt, dass die Gesellenorganisationen aufzulösen und ihre Vermögenswerte zu beschlagnahmen seien. Die Aktivitäten der Schächte und die Wandertätigkeit kamen auch dann noch nicht endgültig zum Erliegen, die Gesellen mussten aber vor dem Polizeiapparat auf der Hut sein. Erst während des Krieges gab es dann keine Fremdgeschriebenen mehr.48 Urs Büttner resümiert, wie sich das Gesellenwandern nach dieser Zwangspause neu organisierte: »Nach dem Krieg traten die Schächte relativ schnell wieder auf den Plan. Die hatten eben ihre organisatorischen Strukturen, auf die sie zurückgreifen konnten. Bei den Bäckern und anderen Gewerken, die vor dem Krieg freireisend unterwegs waren, gab es solche Strukturen aber nicht. Zwar hatten die Bäcker vor dem Krieg eigene Wanderbücher, die vom damaligen Bäckerverband »Germania« rausgegeben wurden. Über so eins bin ich mal bei meinen Recherchen zur Bäckerwalz gestolpert. Aber der zünftige Schnack wird ja bis heute immer nur mündlich weitergeben. Die Wandergesellenkultur lebt eigentlich hauptsächlich von 47 UBä 2, 3.52: Anmerkung: Als Berufsfarbe der Bäcker gilt das Pepita-Muster, ein schwarz-weißes Karo-Muster. 48 Bohnenkamp/Möbus 2012: S. 63 ff und Lemke 2002: S. 75 ff.
290
»DIE WAREN VÖLLIG ÜBERRASCHT, DASS DA PLÖTZLICH EIN BÄCKER KOMMT«
der mündlichen Überlieferung. Und nach dem Krieg gab es halt nur noch ganz wenige Bäcker, die diesbezüglich Wissen weitergeben konnten und die waren in keinem Schacht organisiert. Und so ist das Wissen von der Gewohnheit wandernder Bäcker wohl irgendwie langsam verschwunden.«49
»Erwandert«, d. h. auf die Straße gebracht und mündlich in die überlieferten Regeln der zünftigen Walz eingewiesen, wurde Büttner schließlich von einem Maurer. Die Reaktionen der Personen, die ihm auf der Straße begegneten, beschreibt Büttner als durchmischt. Von anderen Wandergesellen wurde er zum Teil angefeindet, ihm wurde vorgehalten, er hätte »als Bäcker nichts auf der Straße verloren«. Die meisten Laien hielten ihn fälschlicherweise für einen Zimmerer. Seine größte Sorge, ob es möglich sein würde, Arbeit zu finden, konnte er, wie oben beschrieben, schnell entkräften. Seine Reise führte ihn unter anderem nach Südamerika. Rückblickend sagt Büttner heute: »Auf Wanderschaft habe ich meinen Beruf lieben gelernt.«50 Auch weil seine Daseinsberechtigung als wandernder Bäcker immer wieder hinterfragt wurde, beschäftigte sich Büttner intensiv mit historischen Quellen. U. a. rezipierte er Rudolf Wissells »Des alten Handwerks Recht und Gewohnheit«.51 Wissell wertete in seinem sieben Bände umfassenden Werk zahlreiche Quellen aus und trug sie in Auszügen zusammen. Im Kapitel »Handwerksrecht und Gewohnheit der Bäcker« findet sich ein Beispiel für das zünftige Grüßen des Bäckers beim Eintreten in die Herberge. Die Überbringung des zünftigen Handwerkergrußes war über Jahrhunderte von zentraler Bedeutung für die Wandergesellen. Denn angesichts des massenhaften Auftretens umherziehenden Volkes ergab sich – z. B. in den Herbergen der Gesellenbruderschaften – das Problem, den zünftigen Gesellen vom Herumtreiber zu unterscheiden. Erst in Folge der Reichshandwerksordnung von 1731 setzten sich offizielle Ausweisdokumente, sogenannte »Kundschaften« durch. Bis dahin war der Handwerksgruß, der auch als »Ausweis« bezeichnet wurde, die einzige Legitimation, um Zugang zu kostenloser Unterkunft, zu Begrüßungstrunk und weiteren Vergünstigungen zu erlangen. Deswegen wurde das zünftige Grußritual geheim gehalten. Fragen zu solchen Interna beantwortet auch heute noch kein zünftiger Wandergeselle. Um einen Eindruck von der Komplexität der Verhaltensregeln zu vermitteln, denen sich Wandergesellen damals und z. T. auch heute noch 49 UBä 3, 5.45 50 UBä 1, 15.53 51 Wissell 1971.
291
MARKUS RÖMER
unterwerfen, sei an dieser Stelle das folgende, bei Wissel zu findende Ritual wiedergegeben, das vom Anfang des 18 Jh. datiert:52 Der ankommende Wandergeselle musste mit geschultertem Bündel an die Herbergstür anklopfen, eintreten, die Tür schließen und dann das unten wiedergegebene Sprüchlein aufsagen. Falls er in der Sommerzeit die Tür geöffnet vorfand, musste er diese schließen, um dann anzuklopfen. Nach Betreten der Herberge ergab sich folgende Wechselrede zwischen Wandergesellen und Herbergsvater: Wandergeselle: »Mit Gunst ihr Brüder, wo oder welcher ist der Herr Vater? Mit Gunst Herr Vater, ich will ihn und die Frau Mutter angesprochen haben, er wolle heute über Nacht mich beherbergen. Ich will mich verhalten, was einem ehrlichen Bäckerknecht gehöret, gebühret und anstehet, es sei gleich hier oder anders wo.« Herbergsvater: »Wenn Ihr Euch verhaltet, wie Ihr angelobet, so könnt Ihr Euer Bündel ablegen.« [Wandergeselle legt sein Bündel ab] Wandergeselle: »Mit Gunst, dass ich mein Bündel mag ablegen. Gott ehre Euch, Ihr Brüder.«
Falls der zünftige Gruß nicht korrekt überbracht wurde, hatte das z. T. unangenehme Konsequenzen. Zwar ist nichts darüber bekannt, wie die Sanktionen heutzutage ausfallen, aus autobiographischen Berichten von Wandergesellen früherer Zeiten lassen sich diesbezüglich aber durchaus Einblicke gewinnen. So beschreibt der Grazer Zuckerbäcker Ludwig Funder, der von 1862–1869 wanderte, die empörte Reaktion Hamburger Bäckergesellen, auf sein – aus ihrer Sicht – unzünftiges Einwandern: »Ich zeigte ihnen mein Wanderbuch. Sie nahmen es und warfen es zur Erde und stießen es mit dem Fuße in einen Winkel. […] Sie drohten mir, stießen und schlugen mich, bis einer endlich für mich Einsprache tat und den andern vorstellte, daß ich, wie sie ja sähen, mit den Zunftbräuchen nicht bekannt sei.«53
Auch Urs Büttner rezipierte solche autobiographischen Texte, um Kenntnisse zu sammeln und um ein Gefühl für die historische Walz der Bäckergesellen zu bekommen. Innerhalb des Bäcker- und Konditorenhandwerks inspirierte Büttner mit seiner kreativen Neubegründung der Bäckerwalz einige Nachahmer. In Büttners Fußstapfen trat z. B. auch Michael Schmitz54, der 2010 sein Bündel schnürte, um in die Welt zu ziehen. Das Gesellenwandern schien dem 52 Vgl. zum folgenden: Wissel 1971 Bd. 7: S. 323 f. 53 Funder 2000: S. 72. 54 Name geändert.
292
»DIE WAREN VÖLLIG ÜBERRASCHT, DASS DA PLÖTZLICH EIN BÄCKER KOMMT«
damaligen Junggesellen wie geschaffen dafür »etwas zu reisen und sich im Handwerk weiterzubilden«. Auch bei Schmitz spielte die Abenteuerlust eine große Rolle. Während seiner dreijährigen Wanderzeit arbeitete er unter anderem in Indien, Neuseeland und den USA. Für ihn ist besonders die persönliche Entwicklung, die er in dieser Zeit machte, bemerkenswert: »Ich konnte vorher backen und habe das sicherlich auch verbessert in der Zeit, wo ich unterwegs war. Aber der größte Step, den man macht, ist einfach persönlich. Wenn man jeden Tag mit 100, 200 unterschiedlichen Menschen in Kontakt kommt und kommen muss, weil man Fragen, Bitten, Nöte hat, die man kommunizieren muss und wenn wir sagen, wir dürfen im deutschsprachigen Raum für Reise und Unterkunft kein Geld ausgegeben, dann muss man erstens von A nach B kommen und zweitens muss man abends irgendwie einen Schlafplatz finden. Das ist hier du da ziemlich aufwändig, hat mich aber persönlich ein ganzes Stück nach vorne gebracht.«55
Frei nach Wissell ist festzustellen: Die »Hochschule der freien Schule des Lebens« ist geöffnet und wartet offenbar auch heute noch darauf, dass sich eifrige Studenten immatrikulieren. Im Jahr 2016 gründete sich die Gesellenvereinigung »Vereinigte Löwenbrüder und Schwestern Europas«. Die Vereinigung hat es sich zum Ziel gesetzt, Lebensmittelhandwerker wie z. B. Bäcker, Konditoren, Brauer, Fleischer und Köche auf die Straße zu bringen. Auch Gärtner und Landwirte werden im Schacht erwandert. Wie Urs Büttner berichtet, sind die Junggesellinnen und -gesellen dieser Gewerke unterschiedlich leicht für die Walz zu begeistern. So gehen nach Büttners Beobachtung auffallend viele weibliche Konditoren auf die Walz. Fleischer und Köche scheinen bis jetzt dagegen wenig interessiert an einer Wiederbelebung ihrer eigenen Wandertradition. Woran das liegt, vermag Büttner nicht zu sagen. Aber vielleicht werden auch diese Gewerke demnächst wieder der Faszination Walz erliegen?
Literatur Aloys, Johann (1785): Fürstlich Oetting-Oetting und Oetting-Spielbergische Wanderordnung, Oettingen: Johann Heinrich Lohse. Bohnenkamp, Anne/Frank Möbus (2012): Mit Gunst und Verlaub!: Wandernde Handwerker: Tradition und Alternative, Göttingen: Wallenstein. Elkar, Rainer S. (1984): »Wandernde Gesellen in und aus Oberdeutschland. Quantitative Studien zur Sozialgeschichte des Handwerks vom 17. bis zum 19. Jahrhundert«, in: Engelhardt, U. (Hg.): Handwerker in der Industrialisierung, Stuttgart: Klett-Cotta, S. 262–293. 55 MBä 22.11
293
MARKUS RÖMER
Ehmer, Josef (2000): »Tramping Artisans in Nineteenth-Century Vienna«, in: Siddle, D. (Hg.): Migration, Mobility and Modernization, Liverpool: University Press, S. 164–185. Funder, Ludwig (2000): Aus meinem Burschenleben. Gesellenwanderung und Brautwerbung eines Grazer Zuckerbäckers 1862–1869, Wien: Böhlau. Grießinger, Andreas (1981): Das symbolische Kapital der Ehre. Streikbewegungen und kollektives Bewusstsein deutscher Handwerksgesellen im 18. Jh, Frankfurt am Main: Ullstein. Kocka, Jürgen (2016): Die wandernde Gesellschaft: Aspekte der Migration im Deutschland des 19. Jahrhunderts, in: WZB Mitteilungen (151), S. 6–9. Lemke, Grit (2002): Wir waren hier, wir waren dort: Zur Kulturgeschichte des modernen Gesellenwanderns, Köln: PapyRossa. Reininghaus, Wilfried (1981): Die Entstehung der Gesellengilden im Spätmittelalter, Wiesbaden: Steiner. Schade, Oskar (1865): Deutsche Handwerkslieder, Leipzig: Vogel. Stürmer, Michael (1979): Der Herbst des alten Handwerks. Quellen zur Sozialgeschichte des 18. Jahrhunderts, München: Deutscher Taschenbuch-Verlag. Wadauer, Sigrid (2005): Die Tour der Gesellen: Mobilität und Biographie im Handwerk vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main: Campus. Wissell, Rudolf (1971): Des Alten Handwerks Recht und Gewohnheit. 2. Aufl., Bd. 1 – 7, Berlin: Colloquium. (Originalausgabe erschien 1929 unter gleichem Titel)
Internetquellen Deutsches Historisches Institut: Reichshandwerksordnung von 1731: http:// ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=3604&language=german [Zugriff 12.12.19]. UNESCO-Verzeichnis immaterielles Kulturerbe Deutschland: Gesellenwanderschaft Walz: https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielleskulturerbe/immaterielles-kulturerbe-deutschland/handwerker-walz [Zugriff: 12.12.19]. Zentralverband des Deutschen Handwerks: Statistik Berufsausbildung 2018: http://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_ id=3604&language=german [Zugriff: 12.12.19].
294
Autorinnen und Autoren Susanne Elsen ist Professorin für Sozialwissenschaft an der Freien Universität Bozen. Sie vertritt in Forschung, Lehre, Theorie- und Praxisentwicklung Ansätze der Sozial-Ökologischen Transformation, der Gemeinwesenentwicklung und der Solidarökonomie. Sie verfügt über langjähre Erfahrung in diesem Feld im europäischen und internationalen Raum. Veröffentlichungen (Auswahl): »Soziale Innovation, Transformation und Empowerment während der Covid-19-Krise«, in: POLITIKA 2021 (mit K. Crepaz); »Genossenschaften und Soziale Landwirtschaft – Potentiale sozialökonomischer Entwicklung ländlicher Räume in Italien«, in: Zeitschrift für Gemeinwirtschaft und Gemeinwohl 1/2021 (mit L. Fazzi); »Soziale Landwirtschaft als Soziale Innovation ländlicher Räume: von Italien lernen«, in: Blätter der Wohlfahrtspflege (2020); »Solidarische Ökonomie«, in: Blätter der Wohlfahrtspflege, 6/2018. Thomas Horn, Dr., absolvierte 2005 bis 2008 eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Im Jahr 2009 begann er sein nebenberufliches Studium der Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie der Rechtswissenschaft im Nebenfach an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität in Frankfurt am Main. M.A. 2012, Promotion 2014. Mitarbeit im Genossenschaftshistorischen Informationszentrum (GIZ) des BVR in Berlin. 2019 wurde er Wissenschaftlicher Mitarbeiter im GIZ und Abteilungsleiter bei der Volksbank Mittelhessen in Gießen. Veröffentlichungen (Auswahl): Mittelständische Kreditinstitute in Kriegszeiten. Unternehmenspolitik von Genossenschaftsbanken und Sparkassen unter dem Einfluss des Ersten Weltkrieges 1914 bis 1918 und den ersten Nachkriegsjahren. Ein Vergleich (2015); The Cooperative Movement. A Revolutionary Idea that Made History (2018); »Genossenschaftsbanken zwischen Kriegsende und der Währungsreform 1918–1924« in: Beiträge zur 13. Tagung zur Genossenschaftsgeschichte (2019). Jerzy Kaczmarek, Prof. Dr., Master in Soziologie an der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań, Polen. 1994 bis 2000 Assistent am Institut für Soziologie der Universität in Poznań, Promotion 2000. 2000 bis 2013 Senior Lecturer an der Schule für Geisteswissenschaften und Wirtschaft in Jarocin. Leiter des Soziologischen Komitees der ›Poznań Friends of Science Association‹. 2004–2008 Leiter des Arbeitsbereiches für ›Visual Sociology‹ am Institut für Soziologie der Universität von Poznań. 2000–2016 Koordinator das Erasmus Programms des Instituts. Im Jahr 2015 habilitierte er im Fach der Soziologie. Seit 2017 ist er Leiter 295
AUTORINNEN UND AUTOREN
des ›Department of Sociology of Social Diversification‹ an der Universität von Poznań. Veröffentlichungen (Auswahl): »De-Re-Bord. Socio-spatial transformations in German-Polish ›interstices‹. Practices of debordering and rebordering« (Projekt 2018–2020); »The invisible city. The aims and non-institutional forms of space modification of the big cities in Poland and methodological research problems concerning the use of visual data« (Projekt 2009–2011). Georg Kamphausen, apl. Prof. (i.R.) Dr., Studium der Soziologie, Neueren Geschichte und Theologie an den Universitäten Bielefeld und Tübingen. 1983 Promotion mit einer religionssoziologischen Arbeit (Hüter des Gewissens. Zum Einfluss sozialwissenschaftlichen Denkens in Theologie und Kirche, 1986). Habilitationsschrift Die Erfindung Amerikas in der Generation von 1890 (Velbrück Wissenschaft 2002). Ab 1983 wissenschaftlicher Assistent, ab 2001 apl. Prof. für Soziologie an der Universität Bayreuth. Arbeitsschwerpunkte in der Historischen Soziologie. Pensionierung im April 2021, danach Gründung des »Bayreuther Instituts für Soziologie und Sozialpolitik« (BISO). Oscar Kiesswetter, Dr., ist italienischer Wirtschaftspublizist und Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der Sozialgenossenschaft SOPHIA für soziale Innovation und Forschung in Bozen. Aktueller Schwerpunkt seiner Arbeit sind die Schaffung von betriebswirtschaftlichen Grundlagen für innovative Unternehmensmodelle und der grenzüberschreitende Wissenstransfer über Besonderheiten und Merkmale der italienischen Genossenschaftsbewegung. Veröffentlichungen (Auswahl): »30 Jahre gesetzliche Regelung der Sozialgenossenschaften in Italien«, in: Zeitschrift für Gemeinwirtschaft und Gemeinwohl 4/2021; »Sozialgenossenschaften – Glänzende Vergangenheit, ungewisse Zukunft«, in: SOZIALwirtschaft_aktuell Mai 2019; »›Fare rete‹ Das italienische Genossenschaftswesen und die Aktualität seiner sozialen Funktion«, in: S. Elsen/S. Frei/R. Sundby (Hg.): Participatory Democracy and Social Development (2014); » Innovative Geschäftsmodelle italienischer Genossenschaften als Antwort auf Sparkurs und Reformen«, in: Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen 1/2013. Arnd Kluge, PD Dr., Studium der Geschichte, Mathematik, Soziologie und Erziehungswissenschaften in Münster und Bonn, Promotion über die »Geschichte der deutschen Bankgenossenschaften«. Wissenschaftliche Hilfskraft am Genossenschaftsinstitut an der Universität Marburg. Ausbildung zum Archivar des Höheren Dienstes. Seit 1993 Stadtarchivar Hofs. 2018 Habilitation im Fach Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Regensburg. 296
AUTORINNEN UND AUTOREN
Veröffentlichungen (Auswahl): Die Zünfte (2009); »Genossenschaftsgeschichte – ein zukunftsweisender Ansatz? Plädoyer für eine Ergänzung der Genossenschaftswissenschaft«, in: Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen 2/1992; »Internationale genossenschaftsgeschichtliche Vergleiche – Das Beispiel der spanischen und deutschen Genossenschaftsbanken«, in: B. Jöstingmeier (Hg.): Aktuelle Probleme der Genossenschaften aus rechtswissenschaftlicher und wirtschaftswissenschaftlicher Sicht (1994); »Genossenschaften in der Geschichte«, in: T. Brockmeier/U. Fehl (Hg.): Volkswirtschaftliche Theorie der Kooperation in Genossenschaften (2007). Niklas Luhmann (1927–1998), studierte von 1946–1949 Rechtswissenschaft in Freiburg. Nach seiner Tätigkeit an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer war er von 1965–1968 Abteilungsleiter an der Sozialforschungsstelle in Dortmund. Promotion und Habilitation 1966 an der Universität Münster. Seit 1968 Lehrstuhl für Soziologie an der Universität Bielefeld, Emeritierung 1993. Veröffentlichungen (Auswahl): Soziologische Aufklärung (6 Bände) (1970–1995); Gesellschaftsstruktur und Semantik (4 Bände) (1980– 1995); Beobachtungen der Moderne (1992). Christiane Mossin, PhD, lecturer and researcher at Copenhagen Business School. Based in continental philosophical traditions, her work explores political, legal and cultural aspects of societal transformations while building on interdisciplinary approaches in the intersection between political philosophy and sociology, conceptual history, law and literature. Veröffentlichungen (Auswahl): »Masses on the stages of democracy. Democratic promises and dangers in self-dramatizations of masses«, in: Thesis 11 1/2021; »Past and Present Futures of Democracy: The Danish Peasants Movement as Democracy Instigator and Cultural Mytholo gizer«, in L.B. Kaspersen/L. Egholm (Hg.): Civil society – between concepts and empirical grounds (2021); »Vergessene Potenziale assoziativen Lebens. Pluralismus, Funktionalismus und Freiheit bei G.D.H. Cole und H.J. Laski«,. In: Forschungsjournal Soziale Bewegungen 3/2016. Otto Gerhard Oexle (28.08.1939–16.05.2016), Professor für Geschichte des Mittelalters, war von 1987–2004 Direktor im Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen. Oexle zählte zu den international führenden Mittelalterhistorikern seiner Zeit. Große Anerkennung erwarb er sich in der Zusammenarbeit zwischen der deutschen und der französischen Mittelalterforschung. Veröffentlichungen (Auswahl): Die Wirklichkeit und das Wissen (2011); Die Repräsentation der Gruppen (1998); Das Bild der Moderne 297
AUTORINNEN UND AUTOREN
vom Mittelalter und die moderne Mittelalterforschung (1990); Das entzweite Mittelalter (1992). Markus Römer: Studium der Soziologie in Bayreuth und Bielefeld, dort Diplom-Abschluß, zurzeit Leiter der Verwaltung BBZ und der Lehrgänge bei der Handwerkskammer Oldenburg. Doktorand (bei Georg Kamphausen) zum Thema »Auf der Walz: Über das Sammeln von Erfahrungen und die Erfindung von Traditionen«. Michael Schmid, Prof. Dr., Studium der Soziologie, Politischen Wissenschaft, Wirtschaftssoziologie und Promotion an der Universität Heidelberg; Habilitation, Assistenz und Professur an der Universität Augsburg; pensionierter Professor für Allgemeine Soziologie an der Universität der Bundeswehr/München. Veröffentlichungen (Auswahl): Erklärende Soziologie. Grundlagen, Vertreter und Anwendungsfelder eines soziologischen Forschungsprogramms (mit A. Maurer) (2010); Forschungsprogramme. Beiträge zur Vereinheitlichung der soziologischen Theoriebildung (2017); Der »Neue Institutionalismus«. Studien zum Vergleich seiner Forschungsprogramme (2018). Knut Schulz, Prof. Dr., geboren 1937 in Berlin. Studium der Geschichte, Germanistik und Philosophie an der Freien Universität Berlin. Staatsexamen 1963, Promotion 1966, Habilitation 1972. 1972–2003 Professur für Geschichte des Mittelalters am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin. Veröffentlichungen zur Verfassungs-, Sozialund Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters, insbesondere zu städtischen Gruppen und Korporationen, Migration und Identität, u.a.: Ministerialität und Bürgertum in Trier. Veröffentlichungen (Auswahl): Handwerksgesellen und Lohnarbeiter (1985); »Denn sie lieben die Freiheit so sehr …« Kommunale Aufstände und Entstehung des europäischen Bürgertums im Hochmittelalter (1992, 2. Auflage 1995); Die Freiheit des Bürgers (Aufsatzsammlung, 2008); Handwerk, Zünfte und Gewerbe (2010). Julian Voth studierte Theologie in Augsburg und verbrachte mehrere Jahre in den USA. Neben Lektoratsarbeiten trat er vor allem als Übersetzer und Herausgeber der Werke Chestertons und Bellocs mit besonderem Fokus auf das Thema Distributismus hervor. Veröffentlichungen (Auswahl): G. K. Chesterton: Umriss der Vernunft (Übersetzung, 2020); Hilaire Belloc: Der Sklavenstaat (Herausgabe, zusammen mit P. Liehs, 2019); Hilaire Belloc: Die Wiederherstellung des Eigentums (Herausgabe, zusammen mit P. Liehs, 2021). 298
AUTORINNEN UND AUTOREN
Johannes Weiß, Prof. Dr., Studium der Philosophie, Soziologie und Psychologie an den Universitäten Köln, Freiburg und Bonn, Promotion in Philosophie Universität Köln 1969. 1975 Habilitation an der Universität Duisburg, 1981–2007 Prof. für Soziologische Theorie und Philosophie der Sozialwissenschaften an der Universität Kassel, 1991–1993 Gründungsdirektor des Instituts für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig. Veröffentlichungen (Auswahl): Weltverlust und Subjektivität. Zur Kritik der Institutionenlehre Arnold Gehlens (1971); Max Webers Grundlegung der Soziologie (1975, 2. Auflage 1992); Vernunft und Vernichtung. Zur Philosophie und Soziologie der Moderne (1983); Handeln und handeln lassen. Über Stellvertretung (1998); Marx oder Weber? Zur Aktualisierung einer Kontroverse (Herausgabe zusammen mit S. Bökler, 1987); Die Jemeinigkeit des Mitseins, Die Daseinsanalyse Martin Heideggers und die Kritik der soziologischen Vernunft (2001). Silvia Wiegel studierte Soziologie und Erziehungswissenschaften im Bachelor an der Universität Bayreuth und der Adam-Mickiewicz-Universität in Posen (Polen). Dieses erste Studium schloss sie 2018 mit einer Arbeit über die »Motive zum ehrenamtlichen Engagement im Vorstand einer Seniorengenossenschaft« ab. Für ihre Abschlussarbeit im Master Soziologie an der Universität Bayreuth (2018–2021) befasste sie sich mit den »Motiven zur Gründung von Organisationen der Solidarischen Landwirtschaft als Genossenschaft«. Silvia Wiegel ist derzeit Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Juniorprofessur für Ernährungssoziologie an der Universität Bayreuth. Veröffentlichungen: Der Beitrag von ›Seniorengenossenschaften‹ zur sozialen Integration alter Menschen, in: Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen 3/2020.
299
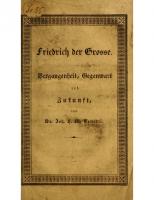


![Ostpreussen - deutsch: In Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft [Reprint 2019 ed.]
9783111478890, 9783111111889](https://dokumen.pub/img/200x200/ostpreussen-deutsch-in-vergangenheit-gegenwart-und-zukunft-reprint-2019nbsped-9783111478890-9783111111889.jpg)


![Computer und Künstliche Intelligenz: Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft [1 ed.]
3658377674, 9783658377670, 9783658377687](https://dokumen.pub/img/200x200/computer-und-knstliche-intelligenz-vergangenheit-gegenwart-zukunft-1nbsped-3658377674-9783658377670-9783658377687.jpg)
![Legitimität: Vergangenheit, Gegenwart und digitale Zukunft des Staates und seiner Herrschaftsgewalt in einem Begriff [1 ed.]
9783428559008, 9783428159000](https://dokumen.pub/img/200x200/legitimitt-vergangenheit-gegenwart-und-digitale-zukunft-des-staates-und-seiner-herrschaftsgewalt-in-einem-begriff-1nbsped-9783428559008-9783428159000.jpg)


![Genossenschaften in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft [1. ed.]
9783958322462](https://dokumen.pub/img/200x200/genossenschaften-in-vergangenheit-gegenwart-und-zukunft-1nbsped-9783958322462.jpg)