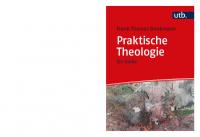Einführung in die praktische Theologie: Eine zeitgemäße Erörterung neuer Probleme und brennender Fragen 9783111715766, 9783111255057
195 118 8MB
German Pages 111 [124] Year 1914
Polecaj historie
Table of contents :
Inhalt
Erstes Kapitel. Das Wesen der praktischen Theologie
Zweites Kapitel. Das Weich Gottes und die Kirche
Drittes Kapitel. Die Kirche und die Gnadenmittel
Viertes Kapitel. Die selbständige Lebensäußerung der Gemeinde
Fünftes Kapitel. Die Ortsgemeinde als das vornehmste Subjekt der kirchlichen Tätigkeit
Sechstes Kapitel. Die Ämter in der Gemeinde
Siebentes Kapitel. Die Tätigkeiten der Kirche
Citation preview
Einführung in die praktische Theologie
Einführung in die praktische Theologie Eine zeitgemäße Erörterung neuer Probleme und brennender Fragen Bon
D. Eugen Sachsse ordentl. Professor in Bonn
Kon« 1914 A. Marcus & E. Webers Verlag
Die nachstehende Darlegung ist veranlaßt durch das letzte Werk des leider zu früh verstorbenen Profeffors Paul Drews in Halle: Das Problem der praktischen Theologie (Tübingen 1910). Er hat dadurch Anregung gegeben, den Umfang und die Aufgabe der praktischen Theologie aufs neue festzulegen er hat Vorschläge gemacht, welche der Prüfung, Ergänzung, Berichtigung bedürfen. Seine Vorschläge haben nicht die Be achtung gefunden, welche sie verdienen. Wenn ich dazu das Wort ergreife, so geschieht es in der Überzeugung, daß vor allem die praktische Theologie die Aufgabe hat, in den gegen wärtigen kirchlichen Kämpfen und Bestrebungen das Ziel der kirchlichen Arbeit festzustellen und dadurch zur Klarheit zu führen. Zugleich möchte ich mit dieser Einführung meinen ehe maligen Schülern, den alten wie den jungen, ein bleibendes Denkmal unserer langjährigen gemeinsamen Arbeit hinterlassen. Bonn, 1. April 1914.
Gugen Sachffe.
Anhakt. Seite
Erstes Kapitel: Das Wesen der praktischen Theologie....................
1
Zweites Kapitel: DaS Reich Gottes und die Kirche..........................34 Drittes Kapitel: Die Kirche und die Gnadenmittel..........................55 Viertes Kapitel: Die selbständige LebenSLußerung der Gemeinde Fünftes Kapitel: Die Ortsgemeinde als das vornehmste Subjekt der kirchlichen Tätigkeit...................................................................84 Sechstes Kapitel: Die Ämter in der Gemeinde....................................91 Siebentes Kapitel: Die Tätigkeiten der Kirche.................................... 102
76
Erstes Kapitel.
Aas Wesen der praktischen Theologie. § 1. Geschichte der praktischen Theologie. Die praktische Theologie ist unter allen theologischen Disziplinen als letzte wiffenschaftlich ausgestaltet worden. Eine dogmatische Wissenschaft gibt es, seit Origenes in seinem Werke jieqI &Qxd>v die christliche Glaubenswahrheit darstellte; die exegetische Wissenschaft wurde von Origenes begründet und später besonders von der antiochenischen Schule gepflegt. Die christliche Geschichtsschreibung hat ihren Anfang durch Hegesippus und später durch Eusebius gefunden. Aber vergeblich sehen wir uns nach einer Darstellung der praktischen Theologie um; dies geschah erst nach der Reformation. Zwar den Namen „praktische Theologie" finden wir schon früh, aber nicht zur Bezeichnung einer besonderen theologischen Disziplin, sondern um das Wesen der ganzen theologischen Wissenschaft zu bezeichnen. Nicht erst Kant hat eine Wissen schaft der reinen Vernunft von der Wissenschaft der prak tischen Vernunft unterschieden. Schon Thomas von Aquino hat in aller Ausführlichkeit die Frage behandelt, ob die Theologie eine spekulative oder eine praktische Wissenschaft sei'). Zuerst scheint es ihm, sie sei eine praktische Wissen schaft, denn sie bezweckt die operatio tiominis, sie enthält die 1) Summa I, quaestio 1. Sachsse, Praktische Theologie.
2
scientia moralis, quae est practica. Dann aber scheint sie ihm speculativa zu sein, weil sie sich mehr mit Gott als mit den Taten der Menschen beschäftigt. So kommt er zu dem Schluß: die Theologie sei beides, aber magis speculativa quam practica; denn die Handlungen der Menschen kämen nur soweit in Betracht, als sie zur Erkenntnis Gottes nötig seien. Also ihm ist Erkenntnis Gottes das Wesen der Theologie. Dieselbe Frage behandelt Duns Scotus: Utrum theologia sit practica?'). Er bestreitet die Meinung des Aristoteles, daß die speculatio nobilior sei als die praxis, die speculatio ist nur um ihrer selbst willen da, die Theologie erstrebe aber ein höheres Ziel: die dilectio. Paulus sagt: finis legis est dilectio, Math. 22 heißt es: im Gebot der Liebe sei das Gesetz und die Propheten enthalten. Augustinus sagt: wer die Liebe hat, hat alles, was in den heiligen Schriften latet et patet. Dieses Ziel erstrebt die Theologie, darum ist sie simpliciter practica. Ähnlich äußert sich Luther in seinen Tischreden?): Die wahre rechtschaffene Theologie stehet in Praktiken, Brauch und Übung und ihr Fundament und Grundfeste ist Christus, daß man sein Leiden, Sterben und Auferstehung mit dem Glauben ergreife. Aber alle, die es heutigen Tages nicht mit uns halten und unsere Lehre nicht für sich haben, die machen ihnen eine speku lative Theologiam, da sie sich nach der Vernunft und wie sie von Sachen spekulieren richten. Denn sie können aus den Ge danken nicht kommen: wer Gutes tut und fromm ist, dem geht's wohl. Aber es heißt nicht also, sondern: wer Gott fürchtet und vertrauet, dem geht's zuletzt wohl. Darum gehört solche spekulative Theologie in die Hölle und zum Teufel. Luther betont die Wahrheit, daß alle Theologie auf Glauben an Gott,, also auf einem sittlich-religiösen Willen beruhe; sie beruht nicht auf einem uninteressierten Wissenstrieb, wie etwa Natur erkenntnis oder Weltgeschichte, sondern auf einem praktischen Verhalten, aus dem der Wissenstrieb erwachse. Schwindet der Glaube, dann schwindet die Theologie und sinkt zur natürlichen 1) Sententiae prologus quaestio 4. 2) Erlanger Ausgabe Band 57, 9. Seite.
Gottesvermutung herab. In all diesen Verhandlungen ist nicht die Rede von einer besondern Disziplin der praktischen Theologie. Dieser Sprachgebrauch setzt sich in der protestantischen Theologie fort. Johann Heinrich Alsted zu Herborn definiert in seinem compendium tbeologicum die Theologie nicht als Wissenschaft, sondern als habitus mixtus ex theoria et praxi, cognitione veri et actione boni. Er teilt die ganze theologische Wissen schaft ein in 1. theologia naturalis, 2. theologia catechetica, die fünf Hauptstücke, 3. theologia didactico-polemica, Dogmatik und Polemik, begründet auf der Schrift, 4. theologia casuum conscientiae (teils Ethik, teils Seelsorge), 5. theologia profetica, diese teilt er in rhctorica et politia ecclesiastica. Der Name praktische Theologie ist ihm fremd. Johannes Hoornbeck be zeichnet die systematische Theologie als theologia practica (1663), der erste Teil enthält die Dogmatik, der zweite die Ethik. Er stellte den Grundsatz auf: theologia tota nisi practica est. Auch die lutherischen Theologen, Johann Gerhard, Abraham Calov lehren, wie Duns Scotus, daß die ganze Theologie praktisch sei. In der Tat beruht die Theologie nicht nur auf dem natürlichen Erkenntnistrieb, welcher die Welt begreifen will, sondern sie setzt praktische Erfahrungen voraus. Die religiöse Spekulation der allgemeinen Vernunft schafft wohl eine natür liche Gotteserkenntnis, aber nicht eine christliche Theologie. Diese kann nur erwachsen auf dem Boden der christlichen Er fahrung. Das Evangelium sagt uns: Gott habe seinen eingebornen Sohn in die Welt gesandt, damit er uns von Sünde und Tod erlöse und zum ewigen Leben führe. M. Claudius sagt davon: man könnte sich für die bloße Idee wohl brand marken und rädern lassen. Aber für uns ist das Evangelium nicht bloß Idee, sondern Erfahrung und Wirklichkeit. In Jesus Christus wird uns die Heiligkeit Gottes offenbar, dadurch werden wir von unsrer Sünde täglich überzeugt und gedemütigt. In Christus wird uns auch die Liebe Gottes offenbar, welche den Sünder retten will,' dadurch werden wir zum Glauben und zum Frieden geführt und erfahren ihn täglich. In Christus haben wir einen neuen Geist empfangen, welcher uns einen heiligen Sinn gibt, daß wir täglich die Sünde überwinden. Das ist eine praktische
Erfahrung des ganzen Geistes: wir erkennen Gott als die heilige Liebe, unser Gefühl wird mit Glück erfüllt, unser Wille wird geheiligt und zu jedem Opfer bereit. Diese Erfahrung ist heute nicht so häufig. Die Herzen sind so weltlich, daß die Heiligkeit Gottes wenig Eindruck macht, so stolz, daß sie sich auch vor Gott nicht demütigen wollen, sie halten jeden über wältigenden Eindruck Gottes fern von sich. Und die christlichen Kirchen hindern vielfach diese Erfahrung. Die römische Kirche setzt an ihre Stelle sakramentliches Tun und Gehorsam gegen ihre Diener, in der evangelischen Kirche bemüht man sich, Zu stimmung zu gewissen Lehren zu erreichen, die man innerlich nicht glaubt. Dadurch entsteht ein Scheinwesen, welches die Kirchen für viele unerträglich macht, sie kehren ihnen den Rücken und folgen ihrer Vernunft. Sie suchen das Glück im Genuß irdischer Güter, in Ausbreitung der Kenntnisse, in Freiheit des Individuums, in Änderung der bestehenden Ordnungen, in andrer Verteilung des Besitzes und machen das Elend nur größer. Die einzige Rettung der Menschen besteht darin, daß sie durch Christus erneuert werden zu Gottes Kindern. Aus dieser praktischen Erfahrung erwächst die christliche Theologie. Die denkenden Christen wollen sich klar werden über die Güter, welche sie von Christus empfangen haben, über Gottes Ziele mit der Menschheit, über ihr Verhältnis zur Welt und ihre Aufgaben darin. Schon in ältester Zeit erwuchs aus der mang die yvwatg} die Voraussetzung der theologischen Erkenntnis war immer das Kindesverhältnis zu Gott. Wer die christliche Theologie nur mit dem allgemeinen Verstände betreibt, ist ein schlechter Theologe. Darum sagte Bernhard: tantum deus cognoscitur, quantura diligitur und Spener erklärte nur die theologia regenitorum für eine rechte Theologie. Die Grundlage der Theologie ist also eine praktische Er fahrung, die Praxis ist auch ihr Ziel. Es gewährt eine ge wisse Befriedigung, die äiristlichen Erfahrungen wissenschaftlich darzulegen, ihrem Ursprung, ihrem Zusammenhang, ihren Wirkungen nachzuforschen. Aber diese Forschung dient dem Zweck, diese Erfahrungen andern zu vermitteln, sie ihnen ver ständlich zu machen. Wenn das Christentum das höchste Glück
5
und die höchste sittliche Kraft gewährt, so ist es Pflicht, andere daran Teil nehmen zu lassen, das Reich Christi auszubreiten. Das soll die Theologie tun, indem sie die göttliche Wahrheit immer deutlicher herausstellt, das Wesentliche vom Unwesent lichen unterscheidet, sie mit den Ergebnissen der weltlichen Wisienschaft in Verbindung setzt und so dem christlichen Glauben die Anerkennung der Aufrichtigen gewinnt. Darum ist die Theologie auch nach ihrem Ziele eine praktische Wissenschaft, etwa wie die philosophische Ethik. Aber sie ist wertvoller als diese,- sie allein kann die sittlichen Schäden der Menschheit und dadurch ihr Elend heilen. Nicht nur die gebildeten Christen sollten die göttliche Wahrheit darstellen, um ihr in der geistigen Welt Raum und Anerkennung zu erwerben. Von Anfang an hatten alle Christen das Bedürfnis und die Pflicht, auf ihre Genossen einzuwirken; die Geförderten belehrten die Anfänger, erklärten ihnen die göttliche Wahrheit, durch Wort und Wandel zeigten sie ihnen den Weg, den sie wandeln sollten, sie lasen die Schrift vor, sie beteten mit ihnen, sie verwalteten die Stiftungen Christi. Diese praktische Tätigkeit wurde bald besonders befähigten Gliedern der Gemeinde übertragen,- so entstand ein Amt in der Gemeinde. Ein weiterer Schritt war, daß die Träger des Amtes belehrt wurden, wie sie die Pflichten des Amtes richtig ausführten,diesen Teil der Theologie nennen wir heute „praktische Theo logie". Diese Anleitung zur Führung des Amtes wurde in Bruchstücken behandelt. Es wurden zunächst die Quadersteine behauen, aus welchen das Gebäude der praktischen Theologie errichtet werden sollte. Das erste Bruchstück war die Standesmvral. Die Träger des Amtes sollten als Vorbilder der Gemeinde einen muster haften Wandel führen. Diesen beschrieb Ambrosius in der Schrift: de officiis ecclesiasticis; hier legt er im Anschluß an Ciceros Werk de officiis seinem Klerus den Wandel dar, den er führen sollte- es ist mehr Ethik als praktische Theologie. Von den zahlreichen Nachfolgern nenne ich nur zwei: Hieronymus: de vita clericorum et sacerdotum, und aus dem Mittelalter den Abt Trithemius (j 1516): de institutione vitae sacerdo-
6
talis. Die sittliche Führung des Pfarrers ist das erste Stück der praktischen Theologie. Sodann wurden die Vorsteher der Gemeinden bald be auftragt, die Belehrungen und Ermahnungen bei den Versamm lungen zu halten. Man überlegte, wie das zweckmäßig und eindringlich geschehe. Chrysostonius gibt im fünften Buche seines Werkes neqi leQcoovvrjs den Bischöfen eine kurze Anleitung, wie sie predigen sollen. Augustin verfaßte die erste Theorie der Predigt in der Schrift de doctrina christiana; in den ersten drei Büchern handelte er vom Stoff der Predigt, im vierten von der Form und dem Vortrag der Predigt im An schluß an Ciceros Schrift: de oratore. Aber die Predigt trat je länger je mehr zurück. Karl der Große verlangte zwar von den Priestern, sie sollten fleißig zum Volke predigen, aber nur wenige vermochten es. Erst seit etwa 1100 wurde die Predigt in der abendländischen Kirche regelmäßig geübt,- seitdem wurden auch Anleitungen zur Predigt verfaßt unter dem Titel: de arte praedicatoria. Die Reformation machte die Predigt zum Haupt stück des Gottesdienstes- die Anleitung zum Predigen war seit dem ein wichtiger Teil der theologischen Bildung. Ein drittes Gebiet der praktischen Arbeit in der Gemeinde mar die persönliche Seelsorge. Darüber verfaßte der Papst Gregorius Magnus die Schrift: Regulae pastoralis seu de cura pastorali über. Er belehrt die Priester, wie die ver schiedenen Stände in der Gemeinde und die verschiedenen Cha raktere zu behandeln seien. Allen Priestern wurde geboten, sich diese Schrift zu beschaffen. Je länger je mehr wurde die Seelsorge im Beichtstuhl geübt, so nahm diese praktische Arbeit die Form der Beichtbelehrung und Beichtzucht an. Seit 700 kamen in der altbritischen, fränkischen und germanischen Kirche zahlreiche libri poenitentiales auf; daran schlossen sich bald Be lehrungen für die Beichtväter: de casibus conscientiae. Die dritte Lateransynode 1179 unter Alexander III. bestimmte in canon 18: an jeder Metropolitankirche solle ein Professor der Theologie sein, um die Priester zur cura anitnarum anzuleiten. Seitdem wurde das kanonische Recht und die Moral als theologia practica bezeichnet und der theologia speculativa entgegengesetzt.
7
Eine vierte praktische Arbeit war die Unterweisung der jungen Christen. In der alten Kirche wurden nur erwachsene -Heiden unterwiesen, welche zum Christentum übertreten wollten. Wir erkennen diese Tätigkeit deutlich aus den 24 Katechesen des Cyrill von Jerusalem 338. Auf die einleitende Katechese -folgten 18 Katechesen zur Erklärung des Symbols- nach der Taufe empfingen die jungen Christen noch fünf mystagogische Katechesen, in denen das Geheimnis des heiligen Abendmahls erklärt wurde. Augustin verfaßte eine Anleitung zu dieser Arbeit: de catechizandis rudibus. Eine Anleitung zur Unter weisung getaufter Christenkinder findet sich in der alten Kirche nicht. Als bei den deutschen Völkern die Kindertaufe allgemein wurde, erstreckte sich die katechetische Arbeit auf getaufte Christen kinder. Sie nahm die Form der Beichtbelehrung an- so Gerson: de trahendis pueris ad Christum. Die Reformation schlug ganz neue Wege zur Erziehung der christlichen Jugend ein; mit den Katechismen entwickelte sich die Katechetik als Kunst der christlichen Erziehung. Das letzte Stück praktischer Belehrung waren die An leitungen zur richtigen Verwaltung der gottesdienstlichen Handlungen. Je mehr das kirchliche Handeln zum sakramentlichen wurde, um so wichtiger und zahlreicher wurden die Belehrungen über richtigen Vollzug der kirchlichen Handlungen, besonders der Messe. Jsidorus Hispalensis behandelte in dem Buch de officiis ecclesiasticis erstens den Ursprung der liturgischen Handlungen, sodann den Ursprung der kirchlichen Ämter. Rabanus Maurus verfaßte eine institutio clericorum; Theodulf von Orleans capitula ad presbyteros parochiae suae. So war der Stoff der praktischen Theologie von ver schiedenen Seiten in Angriff genommen worden, aber die Zu sammenfassung fehlte. Die Reformation änderte daran nichts. Erasmus Sarcerius schrieb zur Seelenpflege ein pastorale, Poria sammelte aus Luthers Schriften ein pastorale Luther!, Andreas Gerhard von Ipern (Hyperius) schrieb in Marburg eine Schrift de catechesi und eine de formandis concionibus saeris. Nicolaus Hemniing in Kopenhagen gab 1566 heraus: pastor sive pastoris optimus vivendi agendique modus. Er
8
behandelt 1. das religiöse und sittliche Leben des Pfarrers, 2. sein Familienleben, 3. sein öffentliches Leben, 4. sein kirch liches Tun. Das Buch enthält eine Pastoralethik. Das Verdienst, das erste System der praktischen Theologie aufgestellt zu haben, gebührt einem Herborner Theologen: Wilhelm Zepper gab 1595 die politia ecclesiastica heraus. In drei Teilen behandelt er das ganze Gebiet der praktischen Theologie: von den kirchlichen Funktionen, von den kirchlichen Ämtern, vom kirchlichen Regiment. Die Kirche hat vier Funk tionen : 1. Die Lehre des göttlichen Worts. Hier behandelt er nur Katechetik und Pädagogik, Predigt und Seelsorge folgen erst später. 2. Verwaltung der Zerimonien: Taufe, Abend mahl, Trauung, Beerdigung. Die Ordnung des Gottesdienstes fehlt noch. 3. Die Kirchenzucht. Hier wird auch die Seelsorge behandelt. 4. Die Verwaltung des kirchlichen Besitzes. Sodann behandelt er sechs kirchliche Ämter: 1. Der pastor. Hier wird die Lehre von der Ordination und von der Predigt dargestellt. 2. Der inspector. Er ist Nachfolger der Apostel. 3. Der Pres byter. 4. Die Diakonen. Hier gibt er eine Anleitung zur Armenpflege. 5. Die Ökonomen oder Haushalter der Gemeinde. 6. Die Kirchendiener. Das Kirchenregiment wird ausgeübt in der Gemeinde vom Presbyterium, im Kreise von dem conventus classicus, der nur aus dem Inspektor und den Pfarrern besteht, in der Provinz von der synodus particularis, über die ganze Kirche regiert synodus generalis. Das Konsistorium ist ihm gar keine kirchliche Behörde, sondern die vom Staate eingesetzte kirchliche Aufsicht. Ihm folgte Gisbert Boetius in Utrecht. Sein Haupt werk ist Selectae disputationes theologicae, 4 Teile in 5 Bänden. Er teilt die theologische Wissenschaft in zwei Teile: 1. theologia thetica oder didactica, das ist die Glaubenslehre, welcher Exe gese und Kirchengeschichte als Grundlage dienen. 2. theologia practica. Diese umfaßt die theologia moralis seu casuistica, sodann die theologia ascetica, welche die praxis devotionis be handelt, endlich die politica ecclesiastica. Er faßt also die Bezeichnung praktische Theologie weiter als wir. Die prak tische Theologie in unserm Sinne behandelte er besonders unter
den« Titel politica ecelesiastica (4 Bände, Amsterdam 1663). Er disponiert wie Zepper und folgt ihm in mancher Beziehung. Seitdem wurde das System der praktischen Theologie in der reformierten Kirche mehrfach dargestellt. Auch den Namen „praktische Theologie" braucht die Dortrechter Synode in sessio 18: optandum esset, ut in collegiis et academiis adolescentum animi theologia practica imbuerentur et de variis conscientiarum casibus instruerentur. Diese reformierten Arbeiten blieben im lutherischen Deutsch land unbekannt, es blieb bei der stückweisen Behandlung. Hartmann gab im Anschluß an Zepper ein pastorale evangelicum heraus 1678, Joh. Fecht in Rostock las seit 1699 öfter eine instructio pastoralis (herausgegeben von seinem Sohne 1717); er behandelt darin das private und amtliche Tun des Pfarrers ohne wissenschaftliches System. Salomon Deyling in Leipzig gab 1734 heraus: institutiones prudentiae pastoralis; er schildert die Klugheit des Pfarrers: 1. vor Übernahme des Amtes, 2. bei Übernahme des Amtes, 3. während der Amtsführung; die letztere wird nach allen Beziehungen dargestellt. Sehr ver breitet war auch das Werk von Ludwig Christian Mieg in Gießen: meletemata sacra de officiis pastoris evangelici 1747. Erst um die Wende des Jahrhunderts begann man die Bruch stücke zu einem System zu verbinden. Der erste war I. F. C. Gräffe in Göttingen. Schon 1795 gab er ein Lehrbuch der allgemeinen Katechetik nach Kantischen Grundsätzen in 3 Bänden heraus; dann folgte 1803 die Pastoraltheologie nach ihrem ganzen Umfang in 2 Bänden. Als zweiter verfaßte Ludwig Hüffell das Werk: Über das Wesen und den Beruf des evan gelischen Geistlichen, 2 Bände, 1821. Der dritte ist Friedrich Schleiermacher, der seit 1821 eine Vorlesung über praktische Theologie hielt, welche erst 1850 gedruckt wurde. Es ist also ein Irrtum, daß Schleiermacher als erster ein System der praktischen Theologie aufgestellt habe. Diese Erkenntnis hat sich schon lange durchgesetzt, sie gilt nicht mehr, wie Drews meint, als Ketzerei. Wohl aber hat er ihren Zusammenhang mit der theologischen Wissenschaft neu begründet und ihren Wert nachdrücklich betont. Das geschah schon in seiner „Dar-
10
stellung des theologischen Studiums" 1811. Er begründet das theologische Studium nicht auf dem Begriff der'Wissenschaft, sondern auf der Tatsache der christlichen Kirche. Die Theologie ist ihm überhaupt eine praktische Wiffenschaft, sie ist „der In begriff derjenigen wissenschaftlichen Kenntnisse und Kunstregeln, ohne deren Anwendung ein christliches Kirchenregiment unmöglich ist". Also die praktische Kirchenleitung ist der letzte Zweck der theologischen Wiffenschaft, nicht aber theoretische Erkenntnis. Wohl aber beruht dieses Handeln auf einer wissenschaftlichen Erkenntnis- es setzt voraus: 1. die philosophische Theologie, Dogmatik und Ethik- 2. die historische Theologie, Exegese der heiligen Schrift und Kirchengeschichte- 3. aus dieser Grundlage erwächst die praktische Theologie als „die Technik zur Erhaltung und Vervollkommnung der SHrdje"1).2 Auf ihn folgte Claus Harms mit seiner „Pastoraltheologie", 1830; er teilte: der Prediger, der Katechet, der Priester. Eine wesentliche Förderung unserer Wissenschaft brachte Carl Immanuel Nitzsch?). Er de finiert sie als Theorie der kirchlichen Ausübung des Christen tums, während die Ethik die sittliche Ausübung des Christen tums behandelt. Bei ihm ist die Kirche nicht mehr, wie bei Schleiermacher, nur Objekt des kirchlichen Handelns, sondern zugleich Subjekt des kirchlichen Handelns, welches seine Organe schafft. Seitdem hat die weitere Behandlung der praktischen Theologie nicht geruht- ich nenne nur die wichtigsten. R. Haas: Wissenschaftliche Darstellung des geistlichen Berufs, 1834- Ph. Marheinecke: Entwurf der praktischen Theologie, 1837; A. Vinet: Pastoraltheologie, Paris 1850 (deutsch von Hasse, 1852); C. B. Moll: Das System der praktischen Theologie, 1853; I. H. A. Ebrard: Vorlesungen über praktische Theologie, 1854; F. Ehrenfeuchter: Die praktische Theologie, I. Abt., 1859; W- Otto: Evangelische praktische Theologie, 1869; G. von Zezschwitz: System der praktischen Theologie, 1876/78; Th. Harnack: Praktische Theologie, 1877; I. v. Ovsterzee: Prak tische Theologie, 1878; Knocke: Grundriß der praktischen Theo1) Vorlesungen Seite 25. 2) Praktische Theologie 3 Teile 1847-1867.
11
~~
logie, 1889; Achelis: Praktische Theologie, 1890/91. Sie ist bedeutsam, weil sie die freie Liebestätigkeit aufnimmt. (Einen Auszug daraus gibt der Verfasser in seinem „Grundriß der praktischen Theologie"). Kraus: Praktische Theologie, 1890/93. Noch ist zu erwähnen die Sammlung von Lehrbüchern der praktischen Theologie: Hering (Homiletik), Rietschel (Liturgik), Sachsse (Lehre von der kirchlichen Erziehung), Köstlin (Seelsorge), Wurster (Innere Mission), Köhler (Kirchenrecht).
§ 2. Wegriff der praktischen Theologie. Darin hat Schleiermacher Recht: die Theologie ist nicht aus der Wissenschaft entsprungen, sondern ans der Tatsache der christlichen Kirche, die vor der Theologie da war. Wodurch aber wird mir die christliche Kirche bedeutsam und wertvoll? Es gibt viele Religionsgemeinschaften unter den Menschen: eine buddhistische, eine muhamedanische, eine jüdische, eine persische; ich weise sie unbedenklich der Geschichte zu, denn andern Wert haben sie für mich nicht. Warum weise ich nicht auch die christliche Religion der uninteressierten Geschichtswissenschaft zu? Es gibt Gelehrte, die das tun. Damit stellen sie sich außer halb der christlichen Kirche, ihnen scheint die Kirche nur ein vergängliches Gebilde. Für solche gibt es keine Theologie, sondern nur Religionswissenschaft. Das ist ein fundamentaler Irrtum für alle, welche durch die christliche Religion etwas Wesentliches empfangen haben und noch immer empfangen. Es gibt Menschen, welche die Kirche zum Glauben an Christus geführt hat; sie haben in Christo die selige Gemeinschaft mit Gott und dadurch die Vollendung ihres geistigen Lebens emp fangen. Die Frage nach Gott liegt allen Menschen nahe. Wir kennen die Welt, wir sehen ihre Größe, die Macht, die Gesetz mäßigkeit, die Weisheit, die darin herrscht. Wir selbst sind Glieder dieser Welt, ohne unser Zutun hineingeboren, aus gestattet mit leiblichen und geistigen Kräften. Sie nötigt uns staunende Verehrung ab. Wir fragen: woher kommt diese Welt? wo ist ihre Einheit, ihr Ursprung, ihr Ziel? Sie gibt darauf keine klare Antwort. Alle Religionen, alle Weltweisen
12
haben sich bemüht, diese Fragen zu beantworten,' aber die Antworten lauten sehr verschieden. Wir suchen den unbekannten Gott auf dem Wege des Intellekts. Die Welt ist nicht durch Zufall entstanden, wir sehen darin zuviele Spuren der Weis heit. Ihr Urheber kann nicht eine bewußtlose Kraft sein, er ist denkender Geist. Diese Vermutung sprach Anaxagoras aus/ damit beginnt eine neue Welterkenntnis. Aber unser Intellekt vermutet nur den unbekannten Gott, finden können wir ihn nicht, er ist zu hoch, zu fern. Andere ahnen ihn auf betn Wege des Gefühls. Die Welt ist unendlich groß, die Sternenwelt in ihrer erhabenen Majestät füllt uns mit Bewunderung/ was ist dagegen unsre kleine Erde? was bin ich anders, als ein verschwindender Punkt? Die Welt ist auch ewig,' ihr Ursprung verschwindet im Dunkel der Vergangenheit und ihre Dauer reicht in die fernsten Zeiten. Ich dagegen bin von gestern her und werde morgen nicht mehr sein. Das erfüllt uns mit demütigem Staunen gegen den unbekannten Urheber der Welt/ wir sind nichts gegen ihn. Manche überwinden dies Gefühl der Nichtigkeit durch Phantasie: ich bin nicht nur Leib, sondern auch denkender Geist, erhaben über den Stoff/ daher verwandt mit dem unendlichen Geist, wie ein Funken aus dem ewigen Feuer und werde in dasselbe zurückkehren. Das sind kühne Gedanken, aber ohne Wahrheit. Oder man sucht den un bekannten Gott auf dem Wege der Sittlichkeit. Mein Gewissen bezeugt mir ein göttliches Gesetz, dessen Übertretung Unrecht ist, dessen Erfüllung mir Befriedigung bringt. Ich verwerfe die Uumäßigkeit, die Unzucht, die Unwahrheit, den Haß/ ich lobe die Mäßigkeit, die Reinheit des Wandels, das Wohlwollen, die Wahrheit und strebe ihnen nach als dem Guten. So er kenne ich Pflichten gegen die Menschen und erfülle sie, so gut ich es vermag. Dadurch hoffe ich das Wohlgefallen des unbekannten Gottes zu erwerben und warte auf die Ewigkeit. Aber ihn selbst finde ich nicht. So bleibe ich in Ungewißheit und wandle im Dunkeln. Alle diese Versuche führen nicht zu dem erstrebten Ziele. Daraus wird uns eins klar: wenn eine Gemeinschaft mit Gott für uns möglich ist, so kann es nur geschehen, wenn er sich zu uns herabläßt, wenn er uns in seine Gemeinschaft auf-
13
nehmen will- ohne seinen Willen können wir uns nicht in seine Gemeinschaft eindrängen. Und in diese Gemeinschaft will er uns aufnehmen durch Jesus Christus. Wir haben an Jesu Christo eine ganz außerordentliche Erfahrung gemacht: er hat uns den höchsten Gott offenbart als heilige Liebe, nicht durch Worte und Lehre, sondern indem er uns in seine Liebesgemein schaft erhoben hat. Wir haben eine Ahnung des höchsten Gottes, aber können ihn nicht finden. Die Weisen haben über ihn gegrübelt und ihre Vermutungen ausgesprochen. Jesus war kein Weltweiser, sondern dadurch verschieden von allen Menschen, daß er in Gott lebte. Das ist das Geheimnis seiner Person, welches die Welt noch heute nicht erkennt. Er lebte in der ewigen Liebe Gottes und war mit ihm eins,' darum wußte er ihn als Vater und sich als seinen Sohn. Dieses Leben in Gott bewährte er dadurch, daß er alle Menschen mit dieser göttlichen Liebe umfaßte und es als seine Aufgabe er kannte, sie alle in diese Liebesgemeinschaft aufzunehmen. Darin bestand das Reich Gottes, das er brachte. „Gleichwie mich mein Vater liebt, also liebe ich euch, Bleibet in meiner Liebe. Ich in ihnen und du in mir, auf daß sie vollkommen seien in eins." Diese Aufgabe erfüllte er, indem er die Sünde über wand. Alle Menschen sind Knechte der Sünde- durch sündige Lust hat sie alle verlockt, Gott zu verlassen, durch Leid und Tod führt sie zu Unglauben und Verzweiflung. Jesus über wand alle sündige Lust und im höchsten Leid behauptete er Glauben und Gehorsam. Darum war er allein vor Gott wohlgefällig und fähig, die Menschen aus der Sünde zu erlösen. Er empfing von dem Vater die Macht, den Menschen die Sünde zu vergeben und ihnen ein neues Herz zu schenken. Diese Macht ward durch seinen Tod nicht vernichtet, sondern vollendet, indem Gott ihn von den Toten auferweckte und zu göttlicher Herrlichkeit erhob. Als der Erhöhte stiftet er durch seinen Geist die Gemeinde, in welcher Gnade und Friede, Ver gebung und ewiges Leben herrscht. Der Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung von den Toten sind die höchsten Offen barungen der Liebe Gottes,' wer das nicht erfahren hat, kennt das Evangelium nicht. Durch die Erfahrung dieser Liebe sind
14
wir gewiß der Vergebung, haben wir die Krafr, alle Sünde zu überwinden. Darum sind wir gewiß, daß wir durch den Tod nicht vernichtet werden, sondern zu seiner Herrlichkeit ge langen. Das haben wir nicht durch uns, sondern durch Jesus Christus, durch den Geist, den er uns geschenkt hat. Darum glauben wir an ihn als den Heiland,- wir können es nicht lassen und sind gewiß, daß wir durch ihn Sünde und Tod überwinden: „ich lebe und ihr sollt auch leben." Durch diese Offenbarung wissen wir, daß wir wertvoll in Gottes Augen sind, daß er uns zu seinen Kindern angenommen hat. Denn er hat uns die Vergebung der Sünden und einen neuen Geist geschenkt, dadurch wir den höchsten Gott erkennen, verehren, lieben und ihm vertrauen. Durch diesen Geist überwinden wir die uns anklebende Sünde, werden heilig und selig und des ewigen Lebens gewiß. Durch diese Offenbarung in Christo wird mir beides deutlich, das Gesetz und das Evangelium, meine Sünde und Gottes ewige Gnade. Das ist das große Gut, welches ich durch das Evangelium gewonnen habe. Ich kenne den verborgenen Gott, der mich und die Welt ins Dasein gerufen hat, ich kenne seine Allmacht und Weisheit, Heiligkeit und Liebe, ich weiß, daß die Leiden dieser Zeit Erziehungs mittel der ewigen Liebe sind, die uns bessern und heiligen will. Das weiß ich, nicht weil es mir gesagt wird, sondern weil ich die Kraft Gottes an meinem Herzen erfahren habe, die mich mit heiliger Liebe, göttlicher Kraft erfüllt, weil ich in ewiger Gemeinschaft mit ihm lebe. Dieses Evangelium hat mein Herz gewonnen durch die göttliche Liebe, welche mir entgegenkam, durch die heilige Schönheit Jesu Christi, die ich auf seinem Angesicht erkenne, durch die erhabene Sittenlehre, die er ver kündet, durch seine herrlichen Verheißungen für die Zukunst. Das alles macht überwältigenden Eindruck auf jedes auf richtige Gemüt. Nur eins schreckt viele von diesem Evangelium ab: daß es unsre Sünde offenbar macht, daß es Bekehrung des Herzens fordert, das es uns mit Anbietung der Vergebung zuvor kommt. Das findet der stolze Mensch empörend. Was? ich sollte nicht leisten können, was Gott von mir fordert?
15
Und wenn ich es bisher nicht gehalten habe, sollte es mir bei redlichem Willen nicht gelingen? Das sind nicht die schlechtesten Herzen, die so denken- sie sangen wenigstens an, den Willen Gottes zu tun. Es gibt kein höheres Gebot, als das Gesetz: liebe Gott über alles und den Nächsten wie dich selbst. Tue das, so wirst du leben! So hat Jesus oft zu Suchenden ge sprochen. Aber wer das redlich versucht, macht bald die Er fahrung, daß er nicht weit kommt- die Selbstliebe, die Welt liebe, die Sinnlichkeit ist zu mächtig. Sie kämpfen redlich, anhaltend, aber jeder Tag überzeugt sie aufs neue, daß sie unfähig sind, das Gesetz zu halten. Nun erst entdecken sie täglich neue Sünden, in denen sie bisher harmlos gewandelt haben- denn ihre Augen werden schärfer. Dabei müssen sie bekennen, daß ihre Gottesliebe sehr schwach ist. Und das bringt endlich zum Berzweislen: ich bin willig, das Gesetz zu halten und vermag es nicht! Durch diese Erfahrung werden wir bereit, die Gnade anzunehmen, welche die Sünde vergibt und einen neuen Geist mitteilt, dadurch wir die Kraft empfangen, Gott wirklich zu lieben. Erkenntnis der eigenen Sünde und Erfahrung der in Christo geschenkten Gnade machen das Wesen des Christen tums aus- beides ist verbunden im Glauben an Christum. Einst begegneten sich zwei Gemeinschoftsführer. Wie geht es dir, lieber Bruder? fragte der eine. Der andere antwortete: Immer höher, immer höher, immer näher zu Gott. Und wie geht es dir? Immer kleiner, immer tiefer in Erkenntnis der Sünde! war die Antwort. Beide waren einseitig, sie trennten, was verbunden ist. Der Christ wächst beständig, sowohl in der Erkenntnis seiner Sünde wie in Erfahrung der Gnade. In beiden besteht das Wachstum des Glaubens. Wer sich bekehrt, hat Erkenntnis seiner Sünde, aber einen Anfang. Vieles Böse ist ihm unbewußt, die dunklen Falten seines Herzens werden ihm allmählich deutlich. Die volle Erkenntnis unserer Sünde bringt erst die Einigkeit. Wer ohne solche Erkenntnis glaubt Gott näher zu kommen, täuscht sich- er fällt in Enthusiasmus und Schwärmerei. Wer nur an Sündenerkennt nis wächst ohne Erfahrung der Gnade, wird trübselig und fällt in Berzweistung. Nur der Glaube ist göttlich, in welchem
16
~
Sündenerkenntnis und Gnadenerfahrung verbunden sind. Solche leben in Gott und haben darin die Vollendung ihres geistigen Lebens. Dies Leben ist unter allen Erfahrungen die höchste Fülle, die höchste Seligkeit, darum habe ich darin meine Vollendung gefunden- dadurch ist Christus für mich der Heiland geworden. Es ist nicht pantheistische Versenkung in die allumfassende Natur nach Art der Buddhisten, denn ich weiß, daß Gott heiliger sitt licher Wille ist. Es ist auch nicht hellenische Selbstvergötterung, welche den heiligen Gott nicht kennt und den Menschen zur irdischen Schönheit führen will. Sondern es ist kindliche Hin gabe an den übernatürlichen Gott, der die Welt geschaffen hat, der heiliger Wille und ewige Liebe ist, der sich uns in Christo als gnädiger Vater entboten hat. Christus hat durch seinen Geist in uns ein neues Leben erweckt, welches wir früher nicht kannten- das ist eine Tatsache, die wir erfahren haben, die über allem Zweifel feststeht. Dieses neue Leben ist zugleich seliges Leben in Gott und die höchste Beherrschung der Welt. Es befähigt uns, alle Sünde zu überwinden, die Welt den Zwecken Gottes dienstbar zu machen und auch die Leiden freudig zu ertragen. Dies Leben schafft die höchste Sittlichkeit, die höchste Arbeitskraft, die höchste Geduld. Darin besteht seine Seligkeit. Darum übertrifft es jede andre Art von Leben- als Leben in Gott ist es reicher als das Leben in sinnlichem Genuß, als das Leben mit der Natur, als das Leben in der Kunst oder Wissenschaft oder Staatsverwaltung. All diesem Leben gegenüber hat es einen absoluten Wert: alles natürliche Leben vergeht, nur das Leben in Gott ist ewiges Leben. Darum kann es sich nicht in das Weltleben auflösen, wohl aber kann es das letztere durchdringen, umgestalten, heiligen. Die Folge dieser Erfahrung ist, daß Christus, der Urheber dieses Lebens mir das gottgesandte Haupt der Menschheit ist, seine Aufgabe ist die Vollendung der Menschheit und seine Gemeinde ist das Werkzeug, das er sich schafft, durch welches er seine Aufgabe ausführen will. Auf dieser Erfahrung beruht die Theologie- dem Christen ist sie eine Wissenschaft, die es mit
17
wirklichen Dingerl zu tun hat, ja, die höchste Wissenschaft, weil sie die höchsten Wahrheiten erforscht. Wer Christum nur er fahren hat als einen begabten Weisen, als ein Vorbild mensch licher Tugend, als einen unter vielen Wohltätern der Mensch heit, für den gibt es keine Theologie, der kann nicht Theologe sein. Das Christentum ist ihm einer von den vielen vergeb lichen Versuchen, Gott zu finden. Die christliche Theologie scheint ihm eine Mißgeburt, welche auf hergebrachten Vor urteilen und antiquierten Meinungen beruht. Sie ist ihm keine Wissenschaft, daher gehört fie nicht auf die Universität. .Infolge dieses Irrtums beginnt man jetzt Universitäten ohne theologische Fakultäten zu begründen. Da wird die Theologie verwandelt in allgemeine Religionswiffenschaft, die einen Teil der philosophischen Fakultät bildet. Bei diesen Gelehrten werden die Theologen gering geschätzt als unklare Köpfe, welche in überwundenen Vorurteilen leben- nur dann werden sie einiger maßen geachtet, wenn sie die christliche Überzeugung bekämpfen. Diese ganze Anschauung ist ein Irrtum solcher Gelehrten, die einen zu engen Gesichtskreis haben, die nichts davon wissen, daß es eine Offenbarung Gottes gibt, daß dem mensch lichen Geist ein ewiges Ziel gesteckt ist, und daß ihm in Christo die Möglichkeit gegeben ist, dieses Ziel zu erreichen. Diese großen Wahrheiten sind ihnen verschleiert, darum können sie die Universitas literarum nicht würdigen und halten einen Torso für das Ganze. Wer aber durch Christus zum Leben in der Gemeinschaft mit Gott erhoben ist, der hat etwas ganz Neues, überaus Großes erfahren und seinem Wissen eröffnen sich ganz neue Wahrheiten. Er hat zunächst das Verlangen, die erfahrene Lebensvollendung genau und klar zu erkennen, er will sie unterscheiden von den Lebenserfahrungen, die er bisher gemacht hatte, ihr Wesen und ihr Ideal schauen, sodann ihren Zusammen hang mit Christo und seiner Gemeinde, er will diese Erkenntnis mit den Welterkenntnissen zu einer einheitlichen Weltanschauung verbinden, er will darin seine Stelle und Aufgabe erkennen. So entsteht die thetische oder positive Theologie, welche sich als Dogmatik und Ethik gestaltet hat. Diese Wissenschaft ist der Philosophie nicht untergeordnet, sondern steht ihr gegenüber Sachsse, Praktische Theologie.
2
selbständig, sofern sie die Prinzipien des Seins, des Ich unddie letzten Ziele der Welt und des Ich klar macht. Ja sie ist der Philosophie übergeordnet, wenn diese die letzte und höchste Erfahrung an Christo nicht kennt. Dann gilt der Satz: philosophia quaerit, theologia habet veritatem. Dabei wird die Theologie allezeit von der Philosophie lernen, was die Methode der Erkenntnis betrifft. Die Philosophie ist nicht ancilla theologiae, auch nicht nach Kants Ausdruck die Magd, welche der Herrin die Fackel vorträgt- sondern beide sind Schwestern, welche nach den höchsten Zielen trachten- aber die Theologie hat höhere Mittel als die Philosophie. Wer dieses neue Leben erkennt, der fragt weiter: wie und wann ist dieses Leben zustande gekommen, wie hat die Mensch heit es aufgenommen, wie hat es sich geschichtlich verändert, wie ist es verunreinigt oder wieder verklärt worden? Das ist Aufgabe der geschichtlichen Theologie. Wir erkennen dieses neue Leben am deutlichsten aus den Evangelien, sodann aus den Schriften der Apostel, also aus dem 9ieuen Testament. Vorbereitet wurde es durch das geistige Leben Israels, wie wir es erkennen im alten Testament. Das alte und neue Testament sind die geschichtlichen Quellen, aus denen wir den Ursprung, das Wachstum und die Vollendung des neuen Lebens erkennen. Daher ist Verständnis und Er klärung der heiligen Schriften erste Aufgabe der historischen Theologie- die Exegese bildet ihre Grundlage. Sodann er kennen wir aus der Geschichte der Kirche, wie dies neue Leben in der Menschheit sich entwickelt und ausgebreitet hat, wie cs entartete oder wieder hergestellt wurde. So werden wir be fähigt, ein richtiges Urteil zu fällen über die Kirche der Gegenwart. Und daraus ergibt sich ein drittes Bestreben. Die erfahrne Lebensvollendung fordert, daß wir sie auch andern zugänglich machen. Dazu nötigt uns sowohl der ausdrückliche Befehl Christi, welcher will, daß sein Evangelium zu allen Menschen gebracht werde, als auch die Liebe zu den Menschen. Geschlechter vergehen und neue kommen- auch diese sollen das Evangelium kennen. Es gibt Völker, die es noch nicht gehört haben, auch
19
diesen soll es gebracht werden. Es soll die ganze Menschheit umgestalten und erneuern zu einem heiligen Gottesvolke. Diese Lebensvollendung als Besitz der ganzen Menschheit gedacht, ist die Vollendung der christlichen Gemeinde, soweit dies in der gegenwärtigen Welt möglich ist. Diese Aufgabe ist nicht dem Einzelnen gestellt, sondern der ganzen Gemeinde und wie sie diese Aufgabe zu lösen hat, das ist die Frage, welche die prak tische Theologie beantwortet. Die praktische Theologie hat es also zu tun mit einer Tätigkeit bjer Gemeinde Christi, und zwar mit der höchsten Tätigkeit, welche gedacht werden kann, denn sie hat die Ausbreitung und Vollendung der Gemeinde zum Zweck. Die Gemeinde ist sowohl das Subjekt wie das Objekt dieser Arbeit. Um diese Aufgabe zu lösen, bedarf die Gemeinde einer Theorie dieses Handelns. So kommen wir zu der Definition: die praktische Theologie ist die Wiffenschaft von der Tätigkeit der Gemeinde zu ihrer Vollendung auf Erden. Zu demselben Begriff gelangen wir, wenn wir die vor handenen Definitionen der praktischen Theologie prüfen. Voelius nennt sie: scientia sacra regendi ecclesiam visibilem. Er nennt nicht das tätige Subjekt, auch ist die Tätigkeit mit i-egere zu eng bestimmt, sie eignet nur dem Kirchenregiment. Predigen, Katechisieren ist kein regere, gehört aber zur prak tischen Theologie. Marheineke sagt: „sie ist die Wissenschaft, welche den Zweck hat, mittels des Begriffs aller seiner Funk tionen den evangelischen Geistlichen in den Stand zu setzen, daß er eine seiner Bestimmung angemessene Wirkung in seinem Amte auszuüben vermöge" *). Dann würde die Tätigkeit des Regiments, der Ältesten nicht zur praktischen Theologie ge hören und das ist unrichtig. Das Subjekt der praktischen Tätigkeit ist nicht ein Stand in der Kirche: der clerus. Das ist römische Irrlehre, sondern die Kirche selbst, welche sich ihre Organe schafft und zu verschiedenen Zeiten verschiedene Organe gehabt hat. Also ist jede Definition abzulehnen, welche nicht die Kirche zum Subjekt der Tätigkeit macht. Oosterzee sagt: „sie ist die Wissenschaft von der Tätigkeit für das Reich Gottes 1) Prakl. Theol. § 27.
20
in ihrem ganzen Umfange aufgefaßt, wie sie speziell durch die Hirten und Lehrer der christlichen Gemeinde geübt wird". Der Nebensatz widerspricht dem Hauptsatz und macht die Definition falsch. Wenn Knote sie „die Theorie der Selbstbetätigung der Kirche durch ihre berufenen Organe" nennt, so ist letzter Zu satz überflüssig, da eine Gesellschaft immer nur durch ihre be rufenen Organe wirkt, auch ist der Zweck der Tätigkeit nicht deutlich. Nitzsch nennt sie „die Theorie von der kirchlichen Ausübung des Christentums" und unterscheidet sie von der Ethik als sittlicher Ausübung des Christentums. Aber bei der Kürze des Ausdrucks wird nicht deutlich, wer ausübt. Und der sonn tägliche Kirchenbesuch eines Gemeindegliedes gehört auch zur kirchlichen Ausübung des Christentums, aber nicht zur prak tischen Theologie. Ebenso undeutlich ist die Definition von Krauß: sie ist „Theorie des Kirchendienstes". Was ist Kirchen dienst und wer leistet ihn? Soviel ist also klar: die praktische Theologie ist die Wissenschaft von einer Tätigkeit der Kirche. Aber diese Definition ist unvollständig,' die Kirche übt mancherlei Tätigkeit, sie schafft eine Wissenschaft, sie wirkt ein auf die Staatsgesetze, und das gehört nicht zur praktischen Theologie. Mit welcher Tätigkeit hat es nun die praktische Theologie zu tun? Sie unterscheidet sich von andern Tätigkeiten durch den Zweck- also muß die Definition den Grundbegriff durch den Zweck der Tätigkeit bestimmen. Marheineke unterläßt das, denn „eine seiner Bestimmung angemessene Wirksamkeit" ist kein deutlicher Zweck. Schleiermacher bezeichnet als den Zweck: „Erhaltung und Vervollkommnung der Kirche". Ehrenfeuchter bezeichnet den Zweck kürzer und treffender, wenn er sagt: sie ist die Wissenschaft vom Handeln der Kirche „zu ihrer Selbst erbauung" ‘). Dieser schon im Neuen Testament häufig an gewandte Begriff ist klar und bezeichnend. Er wurde seitdem vielfach angenommen. Harnack nennt sie die „Wiffenschaft von den Lebenstätigkeiten der Kirche behufs ihrer Selbsterbauung". Weniger geschickt ist die Zweckbestimmung von Zezschwitz: „sie ist die Theorie von der fortgehenden Selbftverwirklichung der 1) Prakt. Theol. S. 180.
-
21
Kirche in der Welt" x). Wenn er diese unklare Bestimmung deutlich macht durch den späteren Zusatz „zu dem Ziele der Vollendung und Erscheinung des Reiches Gottes in der Welt", so ist dagegen zu sagen, daß das Reich Gottes niemals Pro dukt der menschlichen Arbeit ist, sondern Gottes Gabe. Achelis ist daher zu der Definition zurückgekehrt: sie ist „die Lehre von der Tätigkeit der Kirche zu ihrer Selbsterbauung". Harnack setzt hinzu: „durch Verwaltung von Wort und Sakrament". Dann würde die Ordnung des Gebetes nicht in die praktische Theologie gehören. Durch welche Mittel sie ihre Tätigkeit ausübt, das gehört nicht in die Definition, sondern muß im grundlegenden Teil entwickelt werden. Dieser Zweck gibt der praktischen Theologie ihren Zusamnienhang. Auch die Philo sophie hat ein Rhetorik, eine Pädagogik, eine Politik, eine geistige Bildung hervorgebracht. Aber der Zweck: Erbauung der Gemeinde gibt diesen Tätigkeiten ihre Einheit und ihr Gepräge. Die Theologie hat die Ausgabe, theologische Bildung mitzu teilen, d. h. die auf bestimmtem Wissen beruhende Fähigkeit, die christliche Wahrheit zu begründen und auszubreiten,' an dieser Aufgabe hat die Disziplin der praktischen Theologie völligen Anteil, sie bildet die Spitze dieser Aufgabe. Es hat immer Gelehrte gegeben, welche den eigentümlichen Wert des Christentums nicht erkannten und darum der Theologie den Charakter einer besonderen Wissenschaft absprachen und sie von der Universität verweisen wollten, die einst als erste Fakultät bewertet wurde. So gibt es auch Theologen, welche die praktische Theologie als wissenschaftliche Disziplin nicht wollen gelten lassen und die Vertreter derselben als wissen schaftlich minderwertig einschätzen, weil sie nur eine Technik oder gar einen Drill betreiben. Drews bekämpft dieses ab fällige Urteil über die praktische Theologie und sagt mit Recht: „wenn die Theologie überhaupt die Aufgabe hat, theologische Bildung, d. h. die auf bestimmtem Wissen beruhende Fähigkeit richtigen Urteilens zu übermitteln, so nimmt die praktische Theologie an dieser Aufgabe völligen Anteil" (S. 15). Ja 1) Prakt. Theol. S. 5.
22
noch mehr: nur das praktische Ziel gibt der Theologie ihre Einheit ebenso wie der Jurisprudenz und der medizinischen Fakultät,- die abstrakte Wissenschaft ist nur ihre Grundlage, nicht ihr Ziel. Die Theologie hat ebenso wie Jurisprudenz und Medizin das Recht, in der Universitas literarum eine be sondere Fakultät zu bilden. Darum nennt Schleiermacher die praktische Theologie die Krone des theologischen Studiums. Jene Theologen find noch hinter Schleiermacher zurückgeblieben,sie merken nicht, daß sie den Ast absägen, auf dem sie selbst sitzen. Nimmt man der Theologie dieses Ziel, dann löst man sie auf, ihre Disziplinen werden untergebracht in den andern Fakultäten: das Christentum wird behandelt in Religions geschichte, Dogmatik in der philosophischen Weltanschauung, die christliche Ethik in der allgemeinen Ethik, die Kenntnis der heiligen Schrift in der Sprachwissenschaft und der Kultur geschichte, die Homiletik in der Rhetorik, die Katechetik in der Erziehungslehre, das Kirchenrecht in der Jurisprudenz. In der Tat hat man schon angefangen, Hochschulen zu begründen ohne Theologie. Aber diese vertreten nicht die Universitas literarum, sondern nur Bruchstücke der Wissenschaft, darum ihnen der Name Universität zu Unrecht beigelegt wird. § 3.
Umfang der praktischen Theologie.
Drews beklagt mit Recht, daß der Stoff der theologischen Wissenschaft so gewachsen sei, daß er in sechs Semestern nicht von Studenten bewältigt werden könne. Die älteste Geschichte der Menschheit, die Geschichte der heidnischen Religionen, der Ursprung des Christentums, sodann die Geschichte des 19. Jahr hunderts müssen dem Studenten bekannt werden. Dasselbe gilt von der praktischen Theologie- ihr Stoff ist so außer ordentlich vermehrt worden, daß die Frage entsteht: was davon soll dem Studierenden vorgetragen werden? was soll der späteren Zeit zugewiesen werden? Um diese Frage zu beant worten, stellen wir zunächst den gesamten Stoff fest. Soll irgendein Gegenstand gebildet werden, so muß der Arbeiter ein klares Bild haben von der Gestalt, die er ihm
23 Heben will. Soll die Gemeinde Christi ausgebaut werden, so müssen die Arbeiter ein ideales Bild der vollendeten Gemeinde haben, die sie erstreben. Dieses Bild muß die praktische Theo logie zuerst darstellen,' wir entnehmen es aus der Schrift und 6er Dogmatik: die Gemeinde soll zum Glauben an Christum -geführt und durch die Lebensgemeinschaft mit ihm in sein Bild verwandelt werden. Aus diesem Ziele der Arbeit muß das ganze Tun abgeleitet werden. Es ist deshalb unverständlich, wenn Drews die Praktiker tadelt, daß sie durch solche Ableitung Zeit und Mühe nutzlos verschwenden. Wenn er zum Beweise gesuchte oder verfehlte Deduktionen anführt, wenn er manche Deduktionen zu breit findet, z. B. die Deduktion des Kirchen liedes bei Nitzsch, so folgt daraus doch nur, daß die Deduktion richtig und kurz sein muß. Würde man arbeiten ohne Blick auf das Ziel, so würde man planlos arbeiten. Das gibt er selbst zu, wenn er zum Schlüsse sagt (Seite 31): „Nun geht -es freilich ohne Deduktion nicht ab,' wie wäre das möglich? Aber sie muß in den Schranken bleiben, die sachlich geboten sind." Völlig einverstanden! Sodann müssen die Mittel aufgezeigt werden, durch welche die Gemeinde diesem Ziele angenähert wird. Um geistige Veränderung an Menschen herbeizuführen, sind geistige Mittel erforderlich. Als solche Mittel besitzt die Gemeinde das WortGottes, sodann die Stif tungen Christi, endlich das Vorbild, die Ausübung des christlichen Wandels. Diese Mittel lernen wir kennen durch die Dogmatik und Ethik- sie sind die Voraussetzung der praktischen Theologie. Diese Mittel hat man angewandt, seit eine christliche Ge meinde da ist; wie man das getan hat, lernen wir aus der Geschichte. Diese muß also unsre Führerin sein. Darum ist eine Kenntnis des bisherigen Verfahrens notwendig. Wir sollen das Wort predigen, taufen, Abendmahl feiern, wie sollen wir das machen? Das praktische Wirken hat eine lange Geschichte hinter sich, ist das Resultat einer langen Entwicklung. Die müssen wir kennen; dann erst können wir die Frage beant worten, ob wir die gewordene Praxis beibehalten oder ob wir sie ändern. Der Praktiker bedarf also ein umfangreiches Wissen um die Vergangenheit der Gemeinde.
24
Freilich hat Drews recht, daß der geschichtliche Stoff wie ein breiter Strom in die praktische Theologie eingedrungen sei und alles überflutet habe. Die Katechetik von Zezschwitzgibt davon ein abschreckendes Beispiel,' auch andre Theologen bringen zuviel geschichtlichen Stoff und gehen zu sehr in Einzel heiten. Hier muß als Regel gelten: der geschichtliche Stoff darf nur so weit herangezogen werden, als er zum Verständnis der Gegenwart erforderlich ist. Die Kirchengeschichte vom 6. bis 11. Jahrhundert ist für die praktische Theologie nicht so wichtig wie die Kirchengeschichte des 18. und 19. Jahr hunderts. Andrerseits geht Drews selbst hier zu weit, wenn er fordert, der praktische Theologe solle in kleineren Vor lesungen die geschichtlichen Voraussetzungen der praktischen Arbeiten vortragen, er solle Vorlesungen halten über Geschichte der Predigt, des Gottesdienstes, des Kirchenliedes, der Katechese, der Mission. Wo soll der Student Zeit hernehmen, um dies alles zu hören? Bisher wurde die ganze praktische Theologie in zwei vierstündigen Vorlesungen behandelt- bei jeder Disziplin wurde in großen Zügen die geschichtliche Entwicklung gegeben, soweit sie zum Verständnis nötig war. Daneben hörte vielleicht einer noch Geschichte der Mission oder des Kirchenliedes. Aber wenn man ihm zumutet, die Geschichte aller dieser Arbeiten in besonderen Vorlesungen zu hören, dann wird der geschichtliche Stoff außerordentlich vermehrt und der Student versagt. Drews fordert mit Recht, man solle die praktische Theologie den Studenten ganz anders vortragen, als den praktischen Geistlichen- aber hier mutet er den Studenten zu, wofür nur ältere Theologen Zeit haben. Es muß also dabei bleiben, daß die notwendige geschichtliche Grundlage der praktischen Theologie den Studierenden in der Hauptvorlesung gegeben werde. Weiter muß der praktische Arbeiter die gegenwärtigen sittlichen und religiösen Zustände der christlichen Gemeinde kennen. Das geistige Leben der abendländischen Völker hat sich seit zwei Jahrhunderten völlig verändert. Die Kritik, welche die Reformation an der katholischen Kirche übte, wurde Prinzip der wissenschaftlichen Forschung. Die Wissenschaft ging vom Zweifel aus und suchte auf allen Gebieten die Wahrheit.
25
Die Aufklärung hat manche Vorurteile und Irrtümer beseitigt, eine neue Erkenntnis der Natur und des Geisteslebens herbei geführt, den Wert der Welt und des irdischen Lebens schätzen gelehrt. Sie hat auch die Lehren der evangelischen Kirche kritisch behandelt, und manche haben an Stelle des alten Evangeliums ein neues Evangelium gesetzt, welches im Rationalismus seine erste Gestalt fand. Die christliche Ge meinde kann das alte Evangelium nicht aufgeben- dadurch sind kirchliche Kämpfe entstanden, deren friedliche Beilegung noch sehr fern scheint. Diese Kämpfe führten weiter zu politischen Kämpfen. Nicht nur die Wissenschaft soll frei seht, auch der Wille soll frei sein. Das Individuum lehnte sich auf gegen viele Ordnungen, die durch Religion, Sitte, Geschichte eine Autorität hatten. Die Revolution sollte neue staatliche und sittliche Ordnungen herbeiführen. Der Kamps ging gegen das absolute Königtum, das Volk sollte bestimmen über seine Ge setze. Endlich wurden auch die sozialen Zustände verändert. Die Naturwissenschaft entdeckte Kräfte, den Dampf, die Elektrizi tät, welche eine Veränderung der Arbeit und des Verkehrs herbeiführten. Eisenbahnen und Schiffe erleichterten den Aus tausch der Güter, führten einen Weltverkehr herbei- in Fabriken konnte man die täglicheit Bedürfnisse billiger und besser her stellen, als durch Handarbeit. Es trat eine völlige Verschiebung der Bevölkerung ein. Die Fabriken verursachten eine Ausamnilung vieler Arbeiter, denn sie zahlten höhere Löhne, junge Leute zogen in Scharen dahin, lebten ohne Heimat, ohne Er ziehung, ohne Familie. Ihre Heimat wurde das Wirtshaus, Alkohol und Unzucht wurden die Würze des armseligen Lebens. Auch zog ein großer Teil der Bevölkerung vom Lande in die Stadt, weil sie dort angenehmer lebten. Diese war auf solchen Zuwachs nicht vorbereitet, es fehlte an Wohnungen, die Ar beiter und ihre Fantilien wurden in ungesunden, schmutzigen Wohnungen zusamntengepfercht, so daß die Gesundheit Schaden nahm- auch die Arbeit in den Fabriken rieb die Kräfte auf und meist mußten Frauen und Kinder mitarbeiten, um leben zu können. Die Städte waren diesen Notständen nicht ge wachsen, auch die christlichen Gemeinden nicht. Die Bevölkerung
26
der großen Städte vermehrte sich ins Ungemessene, aber die Zahl der Kirchen, der Pfarrer blieb dieselbe, die staatlich bet» faßte Kirche konnte nicht helfen, die unübersehbaren Gemeinden wurden vernachlässigt. Dabei wurde die äußere Lage der Ar beiter immer schlimmer- die Bedürfnisse wuchsen, die Nahrung und Kleidung wurde teurer und der Lohn genügte nicht. Ver heiratete Männer mußten mit ihren Kindern Mangel leiden, das Elend der Frauen und Kinder war groß. Herzzerreißende Schilderungen kamen aus den großen Städten Hamburg, Berlin. Nur wenige wurden reich, die meisten verarmten und lebten elend. Die Unzufriedenheit wuchs, die Arbeiter ballten sich zusamnien und verlangten Abhilfe. Sie forderten ausreichenden Lohn, Einschränkung der Arbeit, Ruhe des Feiertags, gesunde Wohnungen, Pflege bei Krankheit. Manche forderten mehr: Anteil am Gewinn der Unternehmer, eine andere Verteilung des Besitzes oder wenigstens der Arbeitsmittel. Wer will ihnen das verübeln? Ein großer Teil dieser Arbeiter bekämpft zu gleich die christliche Kirche, den bestehenden Staat und seine Ordnungen, erstrebt eine völlige Umwälzung aller Verhältnisse, die soziale Revolution. Das ist der große Kampf, der unsre Zeit bewegt. Was soll die evangelische Kirche dabei tun? Man sagt: sie soll sozial wirken. Was heißt das? Die Kirche hat von Anfang tut eine Gemeinschaft gebildet, also sozial ge wirkt. Das hat auch die Familie, der Staat, getan. Das Evangelium hat auch von Anfang an die Gemeinschaft der Familie sittlich gevrditet: die Heiligkeit der Ehe, die Fürsorge der Eltern für ihre Kinder, Gehorsam und Pietät der Kinder gegen ihre Eltern, die Fürsorge der Familie für die Dienst boten, den Gehorsam der Dienstboten gegen ihre Herren, das hat sie von allen ihren Gliedern als göttliches Gebot gefordert. Wer diese Grundsätze verachtet, streitet wider das Evangeliunl. Sie hat auch die allgemeinen Grundsätze der Staatsgemeinschaft festgelegt: Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist! Jedermann sei untertan der Obrigkeit! Wer diese Grundsätze bekämpft, streitet wider die christliche Sittlichkeit. Aber eine Staats verfassung, staatliche Gesetze schreibt das Evangelium nicht vor verschiedene Verfassungen sind zulässig: die Monarchie, die
Oligarchie, die Demokratie. Aber unter sozialer Gemeinschaft verstehen wir heute etwas andres: die Ordnung des wirt schaftlichen Lebens, die Verteilung der Arbeit auf die Stände, die Produktion der irdischen Lebensbedürfnisse und ihren Er werb, den Besitz des Landes, die Ordnung des Eigentums und des Verdienstes. Das Evangelium hat keine soziale Ordnung vorgeschrieben, sondern nur die sittlichen Grundsätze der Arbeit. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen; der Arbeiter ist seines Lohnes wert; brich dem Hungrigen dein Brot und liebe deinen Nächsten. Diese sittlichen Grundsätze soll die christliche Ge meinde vertreten gegen jedermann, aber soziale Gesetze hat sie nicht zu erlassen, das ist Sache des Staates, wenn es not wendig ist. Die soziale Not der schlesischen Weber hat viel Aufsehen und Mitleid erregt. Durch die Fabriken wurden Ge webe besser und billiger hergestellt als durch die Handarbeit. Dadurch wurden die Löhne der schlesischen Heimarbeiter so niedrig, daß sie davon nicht leben konnten, sie hungerten und wurden elend. Wer sollte da helfen? Zunächst jeder sich selbst. Die Weber mußten die Heimarbeit aufgeben, in den Fabriken arbeiten oder andre Arbeit suchen. Wenn sie nicht wollten, so mußten die Verständigen sie belehren; wer es vermochte, mußte ihnen Gelegenheit zu andrer Arbeit verschaffen. Wenn die Weber zu andrer Arbeit nicht fähig waren, so mußte die Barmherzigkeit ihrer Not abhelfen. Der Staat oder einfluß reiche Männer mußten Veranstaltungen treffen, ihnen Arbeit zu verschaffen, aber nicht die christliche Gemeinde. Die kann nur die sittlichen Grundsätze des sozialen Lebens vertreten. Den Faulen, Trunksüchtigen, Verschwendern soll sie entgegen treten; wenn sie darben, ernten sie nur, was sie gesät haben. Wenn die Arbeiter ihre Lage auf gesetzliche Weise verbessern wollen, so kann sie das nur billigen. Den Besitzenden soll sie vorhalten, daß sie ihr Eigentum nicht verprassen sollen, daß es anvertrautes Gut ist, dafür sie Gott Rechenschaft geben sollen, daß sie insonderheit schuldig sind, den Dürftigen zu helfen. Den Armen soll sie vorhalten, daß sie fleißig und mäßig sind und nicht murren. So soll die Gemeinde geistlich wirken. Allen soll sie predigen Liebe zu Gott und den Brü-
28
dern, Fleiß und Sparsamkeit, sittlichen Wandel und Mäßigkeit. Aber sie soll nicht nur predigen, sondern der Not steuern durch Werke der Liebe. Insonderheit von den Reichen soll sie fordern, daß sie sich der Dürftigen annehnien. Die alten Christen waren reich an Werken der Liebe und haben dadurch das Heidentum überwunden. Das muß die gegenwärtige Christenheit wieder lernen. In einer christlichen Gemeinde darf kein Armer frieren, kein Kind hungrig zu Bette gehen: dafür muß jede Gemeinde sorgen- wenn sie das versäumt, hat sie ihre Pflicht nicht getan. Die christlichen Herren müssen für ihre Arbeiter sorgen, daß sie ausreichenden Lohn, gesunde Wohnungen erhalten, daß die Kranken und Dürftigen versorgt werden. Die Kirche soll nicht nur von den Armen fordern, daß sie mäßig und bescheiden sind- sie soll die christlichen Reichen nachdrücklich an ihre Pflicht erinnern. Das hat sie bisher vielfach versäumt. Und den Notständen gegenüber, wie sie in großen Städten sich aus gebildet haben, sind besondere Anstrengungen erforderlich- da helfen die kleinen Gaben nicht, zu denen manche noch bereit sind. Es müssen Einrichtungen getroffen werden, daß die Armen und Elenden versorgt werden. Christliche Männer und Frauen sollen sich aufmachen, die Armen zu besuchen und ihnen persönlich zu helfen. Damit ist ein Anfang gemachtwir nennen diese Arbeiten innere Mission. Aber es muß viel mehr geschehen. Die Heilsarmee hat durch ihre Liebe zu den Elenden viele Vorurteile überwunden und Anerkennung gefunden. Das muß die ganze evangelische Kirche tun, sie muß aus ihrem Schlummer erwachen und ihren Glauben beweisen durch barmherzige Liebe. Hier ist ein großes Gebiet der Arbeit. Staatsgesetze können allein nicht helfen. Die staatliche Ver sicherung für Invalide und Kranke ist gut- aber das Gesetz ist kalt- diese Einrichtungen sind zweischneidige Schwerter. Sie befördern die Unmündigkeit und Trägheit, ziehen Faulheit und Frechheit, Simulation und Betrug groß. Nur die persönliche Liebe kann helfen. Ihre Arbeiten darzustellen ist Aufgabe der praktischen Theologie. Es ist ein großer Mangel in den Vor schlägen von Drews, daß er diese Pflicht der praktischen Theologie nicht erwähnt. Die Kenntnis dieser Arbeiten, ihre
—
29
Eingliederung in das geordnete Gemeindewesen und ihre Be urteilung darf in keiner praktischen Theologie fehlen. Ebenso muß der praktische Theologe den gegenwärtigen Zustand der christlichen Kirche kennen, ihre Ordnungen und Einrichtungen, deshalb beschloß Schleiermacher die historische Theologie mit der Forderung einer „kirchlichen Statistik"'), welche zur praktischen Theologie überleitet. Nitzsch gibt eine ausführliche Kirchenkunde unter der Überschrift: das evangelische kirchliche Leben und der jetzige Zeitpunkts. Drews hat diese Vorarbeit erweitert zu einer „evangelischen Kirchenkunde", welche das evangelische Leben in den einzelnen Landeskirchen darstellt. Davon sind bisher folgende Bände erschienen: Die Landeskirche des Königreichs Sachsen von P. Drews; Die evangelische Kirche der Provinz Schlesien von M. Schian; Die evangelische Kirche Badens von A. Ludwig- Die evangelisch-lutherische Kirche in Baiern von H. Beck- Die evangelische Kirche in Thüringen von P. ©laue. Andere Gebiete werden demnächst erscheinen. Clemen beabsichtigt in seinen Studien zur praktischen Theologie auch außerdeutsche Kirchengebiete darzustellen. Das ist eine gewaltige Vermehrung des Stoffes. So wertvoll diese Arbeiten dem Theologen sind, so ist doch festzuhalten, daß die deutsche „prak tische Theologie" sich auf Deutschland beschränken muß. Auch kann nicht für jedes deutsche Kirchengebiet eine besondere prak tische Theologie verfaßt werden, sondern die gemeinsamen Zu stände des evangelischen Deutschland sind die Voraussetzung der praktischen Theologie. Höchstens kann man dem Studenten zu muten, daß er die Geschichte und die kirchlichen Zustände seiner Heimat kennen lernt. Ferner muß der praktische Theologe das religiöse Leben der Gegenwart kennen, seine Vorzüge und seine Nachteile, die herrschenden Bestrebungen, die Irrtümer und Sünden. So ist neben der evangelischen Kirchenkunde religiöse Volkskunde zu lehren. Auch davon hat Nitzsch einen Anfang-''). Nun ist das religiöse Leben verschieden in verschiedenen Gegenden 1) Kurze Darstellung des theol. Studiums § 232—250. 2) Prakt. Theologie, Band I, Seite 336—478. 3) Prakt. Theol. III, 163-202.
30
und Ständen. Anders ist es in Nord-, anders in Süddeutsch land, anders im Osten, anders im Westen. Auch gestaltet es sich verschieden in den Ständen. So ist das religiöse Leben der Bauern dargestellt in Gebhardt: Zur bäuerlichen Glaubens und Sittenlehre, 1890; l'Houet: Zur Psychologie des Bauern tums, 1905. Über das religiöse Leben der Arbeiter sind mehrere Schriften erschienen'). Ebenso hat das religiöse Leben der Kleinbürger, der Gebildeten, der Offiziere, des Adels seine eigentümliche Gestalt! Aber daraus folgt nicht, daß nun für jeden Stand eine besondere praktische Theologie zu verfassen ist. Die verschiedenen Gegenden und verschiedenen Stände haben vieles gemeinsam. Überall finden sich die beiden Grund irrtümer, welche schon Jesus bekämpfte: der Pharisäismus, welcher um Gott eifert, aber seine Gnade erlangen will durch eigene Leistungen. Daraus stammt die Veräußerlichung der Religion, das Zerimonien- und Gesetzeswesen, der Hochmut, die Selbstgerechtigkeit, die Lieblosigkeit. Ebenso finden wir überall den Sadduzäismus, welcher zugleich zwei Herren dienen will: Gott und der Welt. Daraus stammt die Sucht nach Reichtum, der Dienst der Lüste, der Weltgenuß und die Un mäßigkeit, sittliche Schlaffheit und Leichtsinn. Und ebenso sind für alle Gegenden und Stände dieselben Güter wertvoll; alle suchen Erkenntnis der Wahrheit, sie wollen Klarheit haben über Ursprung, Aufgabe und Ziel der Welt und des eignen Lebens. Alle begehren den guten Willen und tadeln das Laster. Alle begehren Glück und Frieden für das Herz, suchen die Seligkeit und scheuen das Elend. Allen bringt das Evangelium diese Güter, allen hilft es aus jenen beiden Grundirrtümern. Darum bedürfen alle Gegenden und Stände dieses Evangelium; es soll den Christen nahegebracht werden durch Predigt, Unterricht, Seelsorge, Vorbild. Das ist die Hauptaufgabe der praktischen Theologie; daneben lehrt sie, wie man bei Gelegenheit einzelne Güter besonders betonen, vor einzelnen Sünden warnen soll. Um das richtig zu unterscheiden, bedarf der praktische Theologe Kenntnis des menschlichen Herzens, psychologischen 1) Vgl. Drews, Seite 61.
31
Blick und psychologische Erfahrung. Man hat neuerdings die Religionspsychologie wissenschaftlich bearbeitet und verspricht sich davon einen großen Erfolg. Als erster hat Borbrodt eine Psychologie des Glaubens geschrieben (1895). P. Drews gab einen Aufsatz heraus: Dogmatik oder Psychologie')7 Er ver spricht sich von dieser Disziplin die größte Förderung der prak tischen Theologie. Besonders eingehend hat F. Niebergall diese Frage behandelt: Die Bedeutung der Religionspsychologie für die Praxis^). Wie predigen wir dem modernen Menschen1 3)? 2 Er stellt verschiedene religiöse Typen der Gegenwart dar und untersucht, wie sie durch Umgebung, Familienüberlieferung, Veranlagung, Temperament entstanden sind. Das gehört in die religiöse Volkskunde. Wir können hier manche wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Praktische Seelenkunde war von je die Voraussetzung aller praktischen Arbeit, sowohl bei der Seel sorge, wie bei der Predigt, wie bei der Erziehung. Aber so wenig wir durch die Logik richtig denken lernen, sowenig lernen wir durch ein System der Religionspsychologie andere richtig beurteilen. Das ist eine Gabe, die angeboren ist. Das geistige Leben des Menschen ist ein Geheimnis, in das wir nicht hinein schauen können, nur Gott sieht es. Wir kennen überhaupt nur wenige Menschen, die meisten Menschen sind uns un bekannt. Gott selbst muß das Herz durch seine Wahrheit er greifen,- dazu hat er sein Evangelium gegeben, daß es alle Herzen zur religiösen Höhe, zum Glauben an Christum führe. Dies Evangelium sollen wir allen Menschen nahe bringen, wie der Säemann seinen Samen auf alles Land streut; wo guter Boden ist, da wird er Frucht bringen. Wenn wir diese Wahr heiten vortragen, wenn wir dabei dem eignen Gefühl Ausdruck geben, dann erwecken wir andre Herzen, ein Gefühl entzündet sich am andern. Das ist unsre vornehmste Arbeit. Dabei bemerken wir öfters religiöse Irrtümer, verkehrte Neigungen; diesen treten wir entgegen, indeni wir solchen die Wahrheit als
1) Zeitschrift für Theologie und Kirche 1898, Seite 134. 2) Zeitschrift für Theologie und Kirche 1909, Seite 411. 3) 3. Stuft. 1909.
32
heilsame Medizin darreichen. Die Stolzen demütigen wir durch das heilige Gesetz, die Lieblosen bekehren wir, indem wir ihnen die Schönheit der Liebe vorstellen, die Verzagten richten wir auf durch die Verkündigung der göttlichen Gnade. Solche praktische Religionspsychologie hat es immer gegeben- aber zumeist ist der praktische Theologe Säemann, welcher den Samen auf den ganzen Acker streut, selten ein Gärtner, der einzelne Blumen begießt und pflegt. Endlich bleibt noch die Frage zu beantworten: wer soll die praktische Arbeit in der christlichen Gemeinde tun? Daß die Eltern ihre Kinder, die Herrschaft ihre Dienstboten, der Bruder den Bruder geistlich versorgen soll, das fordert die christliche Liebe. Aber wer soll die Arbeit in der Gemeinde tun? Darf jeder jedes tun oder sollen gewisse Arbeiten gewissen Personen übertragen werden? Aus der Geschichte der Kirche lernen wir, daß die Ordnung zu verschiedenen Zeiten verschieden war. Im Anfang der Gemeinde wirkte das Charisma, dann bildeten sich gewisse Ämter, die sich bisher erhalten haben. Soll das so bleiben? Oder sollen neue Ämter begründet werden, um der geistlichen Not der Gemeinde zu begegnen? Diese Frage zu beant worten ist eine wichtige Aufgabe der praktischen Theologie.
§ 4. Ausgestaltung der praktischen Theologie. Dieser ganze umfangreiche Stoff der praktischen Theologie kann nicht in Vorlesungen während des akademischen Studiums vorgetragen werden- nur die Grundlagen sind den Studenten mitzuteilen. Nach meiner Erfahrung verwendet der Student nur die beiden letzten Semester auf die praktische Theologie auch liebt er es nicht, wenn die Vorlesung öfter als viermal in der Woche gehalten wird. Es ist also Aufgabe der Lehrer, die Grundlagen der praktischen Theologie in zwei vierstündigen Vorlesungen zusammenzudrängen. Das ist schwer, aber es muß gemacht werden. Neben diesen großen Vorlesungen kann gelegentlich eine zweistündige Vorlesung über ein geschichtliches Thema gehalten werden: Geschichte des christlichen Gottes dienstes, der Predigt, der Taufe und Konfirmation, des Kirchen-
33
liebes, der Kirchenzucht, der äußeren Mission, der inneren Mission. Ferner muß in einem homiletischen und katechetischen Seminar die erste Anleitung zu praktischer Ausübung gegeben werden. Drews beklagt das als einen Notstand (S. 79), er möchte diese Arbeit lieber dem Predigerseminar überlaffen. Aber sie kann den Fakultäten nicht abgenommen werden. Den Kandidaten wird durch die erste Prüfung die licentia concionandi et catechizandi verliehen; also muß ein Anfang der Aus übung der ersten Prüfung vorhergehen. Handelt es sich nun um den Stoff der beiden großen Vorlesungen, so bestand der selbe früher aus zwei Hauptteilen: Gemeindedienst und Kirchen regiment- jetzt muß ein dritter Hauptteil hinzugefügt werden: Erbauung der Gemeinde durch charismatische Liebesarbeit. Die Erbauung der Gemeinde geschieht zunächst durch das geordnete Amt, dieses hat den Gottesdienst, die Predigt, die Jugend erziehung, die Seelsorge auszuführen. Die Zusammenfaffung der Gemeinden geschieht durch das Kirchenregiment- hier ist die Verfassung der Kirchen, hier sind auch die rechtlichen Ordnungen der Einzelgemeinde, ihre Vermögensverwaltung zu behandeln. Die Liebestätigkeit vollzieht sich in Form von freien Vereinen: die äußere, die innere Mission, der Gustav Adolfs-Verein, der Evangelische Bund sind hier zu behandeln. Bei den einzelnen Disziplinen ist zunächst eine ge schichtliche Darstellung der bisherigen Arbeit zu geben, so weit dies zum Verständnis der Gegenwart erforderlich ist, kurz, übersichtlich, nur die hervorspringenden Punkte der Veränderung darstellend. Dann ist das Ziel der Arbeit zu entwickeln, aus dem Ziele ist die Arbeit zu entwickeln, teils durch psychologische Deduktion, teils nach der Schrift. W. Caspar: hat den Ver such gemacht, den historischen Stoff für die praktische Theologie gesondert darzustellen *). So dankenswert diese Darstellung ist, so wenig würde es zweckmäßig sein, die ganze praktische Theo logie in zwei Teile zu zerlegen: 1. die historische Grundlage, .2. die Deduktion der praktischen Arbeit. Man würde beim 1) Die geschichtlichen Grundlagen des gegenwärtigen evangelischen Gemeindelebens, 2. Stuft. 1908. 3 Sachsse, Praktische Theologie.
34
zweiten Teile immer genötigt sein, auf den historischen Teil zurückzugreifen. Sondern die gesamte praktische Theologie ist zu teilen nach den drei Subjekten, welche die Tätigkeit ausüben: der Gemeindedienst, das Kirchenregiment, die freie charis matische Arbeit. Der umfangreichste und bedeutsamste Teil ist der Gemeindedienst, während das Kirchenregiment und die freie Arbeit weniger Raum beanspruchen. Die erste Vorlesung hat deshalb nur einen Teil des Gemeindedienstes zu behandeln, etwa die Katechetik und die Liturgik. Eingeleitet wird er durch die Prinzipienlehre, welche das Wesen des Reiches Gottes und der Kirche, die Gnadenmittel und die religiöse Betätigung, die Bedeutung der Einzelgemeinde und die Entstehung der Ämter darstellt. Der zweite Teil enthält den Abschluß des Gemeindedienstes, Homiletik und individuelle Seelsorge, sodann die Dar stellung des Kirchenregimentes und der freien Liebestätigkeit. Die weitere Ausbildung in praktischer Theologie muß dem Predigerseminare und den« späteren Privatstudium zugewieseu werden.
Zweites Kapitel.
Das Weich Kottes und die Kirche. Jesus bezeichnet als Zweck seines Kommens die Auf richtung des Reiches Gottes- daß der Anbruch dieses Reiches unmittelbar bevorstehe, ist der Inhalt der frohen Botschaft, welche Gott ihm aufgetragen hat: Marc. 1,15. Die Zeit ist erfüllet und das Reich Gottes ist nahe- bekehret euch und glaubet an das Evangelium! Gott herrscht überall und nichts kann seinem Willen widerstehen: die Sonnen laufen ihre gewiesene Bahn, die Sterne gehen auf und unter nach seinem Willen, kein Sperling fällt vom Dach ohne ihn. Dieses Reich Gottes bestehet von Ewigkeit und braucht nicht erst zu kommen. Wie kann denn Jesus sagen, die Herrschaft Gottes sei nahe? Gott hat in dem Reich der Welt Wesen mit freiem Willen erschaffen, die ihm
35
ungehorsam sein können. Nur wenn freie Geister sich abkehren von dem Willen Gottes, dann gibt es ein Gebiet, wo Gott nicht herrscht, nämlich wo die Sünde regiert. Will also Jesus das Gottesreich bringen, so kann er's nur zu sündigen Geistern bringen, so muß es geistiger Art sein und so versteht Jesus den Ausdruck. Den Namen hat er aus dem Alten Bunde: in Israel hatte Gott seine Herrschaft aufgerichtet, dort sollte sein Gesetz herrschen, der theokratische König war sein Stellvertreter. Aber Israel hatte oft Gottes Gesetz verworfen, den Götzen gedient. Die Propheten hatten geweissagt, es solle ein großer König aus Davids Geschlecht aufkommen, Israel von Sünde und Elend heilen und Frieden anrichten auf Erden. Daniel hatte geweissagt, es sollen vier Reiche auf Erden kommen, dann aber sollte an Stelle dieser Reiche das Gottesreich herbei geführt werden, das ewig bleibt (Dan. 2, 44). Es solle das Reich, Gewalt und Macht unter den, Himmel dem heiligen Volk des Höchsten gegeben werden, des Reich ewig ist und alle Gewalt wird ihm dienen und gehorchen (Dan. 7, 27). Dieses verheißene Reich aufzurichten, erkannte Jesus als seine Aufgäbe,' aber er verstand sie anders als die Propheten. Sie hatten in bilderreicher Sprache von dem zukünftigen König alles Heil des Leibes und der Seele erwartet: er sollte Glück, Reichtum, Frieden und Fülle bringen, er sollte auch Vergebung der Sünden und ein neues Herz bringen. Die Zeitgenossen Jesu hielten sich an die irdischen Erwartungen: er sollte Frei heit bringen vom Druck der Römer, Sieg, Reichtum, Ehre. Diesen Erwartungen tritt Jesus nachdrücklich ent gegen, darum wandte sich die Menge des Volkes bald von ihm ab. Auf die Frage der Pharisäer: wann kommt das Reich Gottes? antwortet er: es kommt nicht mit sichtbarer Wahrnehmung, man wird auch nicht sagen: siehe hier oder da ist es. Denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch (Luc. 17, 20). Den Gedanken, ein großes Weltreich mit irdischer Herrlichkeit zu gründen, weist er als satanische Versuchung ab und w oft das begeisterte Volk ihn zum König machen wollte, entzog er sich diesem stürmischen Verlangen. In voller Klar heit schlug er einen anderen Weg ein. Daraus erklärt sich,
36
daß er sich nicht sofort als den Messias, als den kommenden König bezeichnete- dadurch hätte er nur irdische Erwartungen bestärkt. Von Anfang an handelte er in der Erkenntnis: mein Reich ist nicht von dieser Welt! Das Reich Gottes ist geistiger Art, die Güter, die er bringen wollte, sind geistiger Natur. Welches die Güter des Gottesreiches sind, das schildert er oft in Gleichnissen: das verlorene Schaf wird vom Hirten zur Herde zurückgebracht, der verlorene Sohn wird vom Vater freudig aufgenommen, die Menschen werden von einem reichen Mann zum Abendmahl geladen, von einem Könige zur Hoch zeit seines Sohnes, der König erläßt seinem Knechte die große Schuld von 10000 Talenten, es ist ein Schatz, eine, kostbare Perle, die man findet. Jesus vergleicht sich mit einem Säe mann, der guten Samen säet, mit einem Arzt, der die Kranken heilt, mit einem Helden, der den Starken überwindet. Doch bezeichnet Jesus auch die Güter des Gottesreichs ohne Bild: er bringt den Menschen die Gnade Gottes, die Liebe Gottes, den Schutz Gottes, so daß sie auf ihn als ihren Vater ver trauen dürfen, weil er väterlich zu ihnen gesinnt ist. Er ist gekommen, den Menschen die Vergebung der Sünden zu bringen und hat dazu die Vollmacht, damit macht er sie zugleich frei von den Strafen der Sünde. Darum beseitigt er auch die Folgen der Sünde- er heilet viele Kranke, treibt die Teufel aus und beruft sich auf diese Wirkungen als Beweis, daß das Reich Gottes da ist (Luc. 9, 2, Matth. 11, 3—5). Vor Pilatus nennt er die Wahrheit als das Gut, welches er den Menschen bringen wolle, in ihrer Mitteilung besteht sein Reich und seine königliche Würde. Die Wahrheit ist nicht ein Begriff für unsere Erkenntnis, sondern die Lebensfülle, welche alle Sehnsucht des Herzens stillt und volles Genügen gibt. Darum nennt er sie das ewige Leben (Joh. 3,16; 10,28). Sind das die Güter des Gottesreiches, so gehört eine bestimmte Gesinnung zu ihrein Empfang. Jesus selbst be zeichnet diese Gesinnung: Bekehret euch und glaubet an das Evangelium! (Marc. 1, 15). Das fordert er von allen ohne Ausnahme. In seinen Reden macht er diese Forderung deutlich. Die, welche nach irdischen Schätzen trachten, dem Mammon
37
dienen, ihre eigene Ehre bei den Menschen suchen, unversöhnlich find zu ihren Brüdern, können diese Güter nicht empfangen und find fern vom Reiche Gottes. Gottesliebe und Nächsten liebe ist die Gesinnung derer, welche geeignet sind zum Reiche Gottes. Darum sind diese beiden Gebote die größten/ wer das einsieht, ist nicht ferne vom Reiche Gottes (Marc. 12, 34). In der Bergpredigt schildert Jesus im einzelnen die Gesinnung derer, welche tüchtig sind zu seinem Reiche. Die arm sind am Geiste, die Leid tragen, die Sanftmütigen, die Barmherzigen, die Friedenstifter, die reinen Herzens sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, die demütig und anspruchslos sind, wie die Kinder, die allen gerne dienen, welche auch Ver folgung und unverdiente Schmach geduldig tragen und ihre Sache dem Herrn befehlen, die nicht den sündigen Bruderrichten, aber ihre eigene Sünde erkennen und strenge beurteilen, welche den zornigen Gedanken, den unzüchtigen Blick, das un bedachte rasche Wort an sich mißbilligen, welche auch die lieben, die ihnen Böses tun und den Feinden gern vergeben — das sind die Leute, welche zum Reiche Gottes geeignet sind. Und weil kein Mensch diese Gesinnung hat, darum sind alle arg, darum ist seine erste Forderung, daß sie sich demütigen vor Gott, ihre Sünde bekennen und sich bekehren. Wer das nicht will, der wird nicht ins Reich Gottes kommen (Joh. 3, 3—5), darum sind die Pharisäer ferner vom Reich Gottes, als die Ehe brecher und Sünder/ denn sie sind voll Dünkel, ihre inneren Sünden richten sie nicht und bieten Gott dafür äußerliche, selbsterdachte Werke, die keinen Wert haben. Darum vergleicht er den Eingang in das Gottesreich mit einer engen Pforte, die nur wenige finden und er verkündet, daß die Kinder dieses Reiches in dieses Reich nicht eingehen werden, weil sie diese Gesinnung verschmähen. Das ist der oberste Grundsatz Jesu: die Güter des ReichesGottes empfangt man nicht durch irgendwelche Leistungen, sondern allein durch eine Gesinnung: Denmt, Gottvertrauen, Glaube, Wahrhaftigkeit, Liebe, Versöhnlichkeit, und alle Werke haben nur insofern Wert, als sie Äußerung dieser Gesinnung sind. Jesus trat auf mit der Predigt: das Reich Gottes ist nahe/ aber bald änderte er seine Predigt ab: das Reich Gottes
38 ist da! In seiner Person war es erschienen. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Geberden, sondern ist inwendig in euch (Luc. 17, 2). Wenn ich die Teufel durch Gottes Finger austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen (Luc. 11,19). Dem zweifelnden Johannes läßt er sagen, das Reich Gottes sei da- den Jüngern sagt er, .seit den Tagen Johannis rissen viele das Reich Gottes an sich (Math. 11,12). Er vergleicht es mit einem Saatfeld, auf das er guten Samen säe, mit einer kostbaren Perle, die man finde. Darum preist er seine Jünger selig, daß fie sehen dürfen, was viele Propheten und Könige vergeblich zu sehen begehrten (Luc. 10, 23). Diese Predigt von dem Wesen des Reiches Gottes und seinen Gaben war der Anfang des Evangeliums, das er von Anfang an allem Volke predigte. Aber seine Jünger führte er dann zu weiterer Erkenntnis des Evangeliums. Er brachte das Reich Gottes, weil er nicht nur ein Prophet war, sondern der Sohn Gottes, der König dieses Reiches. Als sie zu dieser Erkenntnis gelangt waren, da bekannte Petrus im Namen aller Jünger: Du bist Christus der Sohn Gottes! Und Jesus bezeugte: das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel (Matth. 16,17). Von da ab verkündete er, nicht allem Volk, sondern seinen Jüngern ein weiteres Geheimnis: er müsse vieles leiden, voll deni Volk verworfen und getötet werden, dann aber werde er von den Toten auf erstehen. Oft hat er davon zu ihnen geredet. Als Petrus ihm widersprach, da fuhr er ihn als einen Versucher an: Gehe hinter lnich, Satan, denn du meinest nicht, was göttlich, sondern was inenschlich ist (Marc. 8,33). Ein andermal sagte er: ich muß mich taufen lassen mit einer Taufe und wie bin ich bedrängt, bis sie vollzogen ist (Luc. 12, 50). Auch gab er ihnen die Er klärung, warum das notwendig sei. Er nennt sich den guten Hirten, der sein Leben dahingibt für seine Herde, um sie vom Wolf zu erretten (Joh. 10,15). Ein andermal sagt er ihnen: er müsse sein Leben dahingeben als ein Lösegeld für viele (Marc. 10, 45). Zuletzt gibt er ihnen die Erklärung bei der Einsetzung des Abendmahls: durch sein Blut solle der neue Bund geschlossen werden zur Vergebung der Sünden (Marc. 14,24).
39 Uttb was er verkündete, das geschah: er starb am Kreuze und stand auf von den Toten. Darum predigten seine Jünger sofort nach seiner Auferstehung, daß er sein Leben für unsre Sünde geopfert habe und durch die Macht Gottes auferweckt und zu himmlischer Herrlichkeit erhoben sei. Das ist die Zentral wahrheit des Evangeliums- wer sie ablehnt, kennt das Evan gelium nicht. Mit Recht hat Albrecht Ritschl gesagt, für den Christen sei es ein synthetisches Urteil a priori, daß Christus von den Toten auferstanden ist. Dies Gottesreich ist für alle Menschen bestimmt, nicht nur für Israel. Schon die Propheten hatten geweissagt, alle Völker sollten in Zion das Gesetz lernen, alle Lande sollten voll Gotteserkenntnis werden, wie Wasser den Meeresgrund bedeckt. Jesus weiß, daß er diese Verheißung erfüllen soll. Zwar sollen die Jünger zunächst nicht zu den Samaritern und Heiden gehen, sondern zu den verlorenen Schafen aus Israel (Matth. 10,6). Dennoch verkündet er von Anfang an, sie seien das Licht der Welt, das Salz der Erde- die Welt ist der Acker, auf den er guten Samen streut, unter den Zweigen des Senfbaumes sollen die Völker wohnen, das Evangelium voni Reich soll gepredigt werden allen Völkern (Matth. 24,14). Diese Aussprüche für unecht zu erklären ist kein Grund vor handen- im Gegenteil, dann würde Jesus hinter den Erwar tungen der alten Propheten zurückbleiben. Sein letzter Befehl an die Jünger war: Gehet in alle Welt und machet alle Völker zu meinen Jüngern. Das ist die große Aufgabe, die er seiner Gemeinde hinterlassen hat. Das Reich Gottes ist da seit dem Auftreten Jesu, es soll durch die Arbeit der Jünger sich ausbreiten auf der ganzen Erde. Aber durch diese Arbeit kann es nicht vollendet werden. Da die Menschen frei sind, können sie der Predigt vorn Reiche widerstreben, sie können die Jünger verfolgen. Das hat Jesus an sich selbst erfahren, das hat er seinen Jüngern von Anfang an verheißen. Sie werden euch verfolgen um meines Namens willen (Matth. 5,10). Sie werden euch in den Bann tun, ja wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst (Joh. 16,1). Gottes Auserwählte sollen so bedrängt werden, daß sie schreien
~ 40 Tag und Nacht (Luk. 18,7). Nun ist auch die Verfolgung von Gott geordnet zum Heil, zur Bewährung) aber sie entspricht nicht der vollen Befriedigung, die Jesus bringen will, sie must ein Ende nehmen- aber wir können sie nicht-beseitigen. Ja noch mehr: die Bösen werden auch in die Gemeinde des Herrn einbringen und das göttliche Leben verunreinigen; es wird Un kraut unter dem Weizen wachsen, das Netz wird sein voll guter und fauler Fische. Endlich hat dies ganze irdische Leben infolgeder Sünde Veränderungen erfahren, die unser Glück hindern: der Acker ist verflucht, Krankheit und Tod, Seuchen und Hunger herrschen auf Erden. Alle diese Leiden sind für den Sünder heilsam, wie für den Knaben die Rute: durch Arbeit wird er vor Müßiggang, durch Leiden vor Weltseligkeit bewahrt. Aber wenn wir frei sind von Sünde, dann müssen diese Ruten auf hören, sie entsprechen nicht dem ersten Schöpfungswillen Gottes. Soll das Reich Gottes vollendet werden, so muß die Sünde völlig vernichtet und der elende Zustand der Welt völlig ver ändert werden. Dann erst ist das Reich Gottes vollendet. Und diese Vollendung seines Reiches wird Jesus auch herbeiführen er wird die unfruchtbaren Bäume abhauen und die Spreu ver brennen. Aber diese Vollendung wird er herbeiführen durch eine zweite Ankunft- das ist die Hoffnung, welche er seinen Jüngern hinterlassen hat, als er von der Welt genommen wurde. Schon in der ältesten Rede Jesu wird diese Hoffnung als eine den Jüngern bekannte Wahrheit vorausgesetzt (Matth. 10, 23). Jesus wird wiederkommen, die Gottlosen vertilgen, die Toten auferwecken, seine Gemeinde in einen herrlichen Zu stand versetzen, den Erlösten einen verklärten Leib geben und ihnen eine neue Welt als Wohnplatz anweisen, die ihrem neuen Wesen entspricht, ohne Sünde, Schmerzen, Tod. Dieser herr liche Zustand 'am Ende dieser Welt wird auch schlechtweg „das Reich Gottes" genannt. Es ist jetzt schon da, aber verborgen, in Unscheinbarkeit, dann aber ist es offenbar in Herrlichkeit. Darum sollen die Jünger täglich bitten: dein Reich komme! Darum sagt er ihnen: Wenn ihr sehet, daß dies alles geschieht, so erkennet, daß das Reich Gottes nahe ist (Luc. 21, 31). Einige werden den Tod nicht schmecken, bis sie des Menschen Sohn
41
sehen kommen in seinem Königreich (Matth. 16,28). Dieses Reich hatte der Schächer im Sinn, als er sprach: Gedenke an mich, wenn du kommst in deinem Königreich (Luc. 23, 42). Es ist also eilt Irrtum, daß Jesus den Ausdruck „Reich Gottes" nur in eschatologischem Sinn gebrauche- er braucht ihn in doppeltem Sinn: er nennt so das gegenwärtige geistige Reich, das noch unscheinbar ist, und er nennt so auch das Reich der Herrlichkeit, welches er am Ende der Welt herbeiführen wird. Durch seine erste Ankunft hat er das Reich Gottes begründet, bei seiner zweiten Gegenwart wird er es vollenden. Die
älteste Gemeinde
hoffte,
daß
Jesus
bald
wieder
kommen werde, um sein Reich zu vollenden, Paulus hoffte das zu erleben (1 Theff. 4, 15); erst gegen das Ende seines Lebens gab er diese Hoffnung auf (Phil. 2,17). Die ganze Gemeinde war noch in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts von dieser Erwartung erfüllt. Hat Jesus selbst seine Wiederkunft als nahe bevorstehend erwartet? Die Jünger warteten sehn süchtig darauf; noch bei der Himmelfahrt fragten sie (Akt. 1,6): wirst du dann das Reich aufrichten dem Volke Israel? Da lehnt es Jesus ausdrücklich ab, irgendeine Zeitbestimnmng zu geben: euch gebühret nicht zu wissen Zeiten oder Stunden, welche der Vater in seiner Macht festgesetzt hat.
Er weist sie
auf die Aufgabe hin, das Evangelium zu predigen bis an die Enden der Erde; im übrigen haben sie in Geduld zu warten, wann er kommen wird. Angesichts dieser bestimmten Erklärung Jesu müssen wir sagen: er kann über den Zeitpunkt seiner Wiederkunft nichts Bestimmtes verkündet haben, sonst wäre er mit sich in Widerspruch getreten. Aber ist jene Erklärung Jesu so zuverlässig? Zwar ist Lucas ein zuverlässiger Geschicht schreiber, aber für jedes Wort kann er nicht bürgen.
Manche
Kritiker beanstanden diesen Ausspruch, weil er den Evangelien widerspreche. So müssen wir die Evangelien fragen. Zunächst finden wir da dasselbe: die Jünger erwarten sehnsüchtig die Vollendung des Reiches durch seine Wiederkehr. Jesus lehnt es ab, darüber Auskunft zu geben, weist aber darauf hin, daß es länger dauern werde, als sie meinen (Marc. 13,33): Sehet zu und wachet, denn ihr wisset nicht, wann die Zeit ist. Er
42
vergleicht sich einem Hausherrn, der über Land ziehet und dessen Wiederkunft ganz unsicher ist: vielleicht kommt er spät oder um Mitternacht oder beim Hahnenschrei oder erst des Morgens früh. „Wer aushält bis zum Ende, der soll gerettet werden" (Marc. 13, 83). Er vergleicht sich mit einem Bräutigam, der so spät kommt, daß alle Jungfrauen darüber entschlafen (Matth. 25). Er sagt auch: zuvor solle das Evangelium allen Völkern ge predigt werden (Marc. 13,10), und das war nicht in wenig Jahrzehnten zu erreichen. Ferner sagt Jesus (Marc. 13,32): Von jenem Tage oder Stunde weiß niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern allein der Vater. Also stimmen die Evangelien mit der Apostelgeschichte durchaus überein. Bei einer so bestimmten Erklärung Jesu müssen wir behaupten: Über den Zeitpunkt seiner Wiederkunft kann Jesus nichts ausgesagt haben. Aber es gibt in den Evangelien Aussprüche, die dem widersprechen. Matth. 16, 28 sagt der Herr: Wahrlich ich sage euch: Unter denen, die hier stehen, sind einige, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie sehen den Sohn des Menschen kommen in seiner Königsherrschaft. Also die Wiederkunft soll erfolgen, ehe alle jetzt lebenden Menschen ge storben sind,' das wäre jedenfalls während der nächsten hundert Jahre. Aber bei Marcus lautet der Ausspruch anders 9,1: Unter denen, die hier stehe», sind einige, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie sehen das Reich Gottes in Kraft kommen. Das Reich Gottes kam in Kraft schon am Pfingstfeste, da empfingen die Jünger die Kraft des heiligen Geistes (Akt. 1, 8). Auch Luc. 17, 22 redet Jesus davon, die Jünger würden begehren, einen Tag des Menschensohnes zu sehen und würden ihn nicht sehen. Also jede Machtwirkung des Geistes ist ein Kommen des Menschensohnes. Das haben Jesu Zeit genossen noch erlebt. Matthäus hat das Wort Jesu irrtümlich gedeutet auf die letzte Ankunft in Herrlichkeit. In der letzten großen Rede sagt Jesus: Ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dieses alles geschieht (Matth. 24, 34, Marc. 13, 30). Dieses Geschlecht: das kann nur zeitlich verstanden werden: die jetzt lebenden Menschen. Zwar gebraucht Jesus den Ausdruck öfter in sittlichem Sinne:
43
Matth. 12, 39, dies böse und ehebrecherische Geschlecht- Matth. 17,17, Marc. 9,19, dies ungläubige und verkehrte Geschlecht. So wollte man auch hier erklären: dies ungläubige und ver stockte Geschlecht der Juden wird nicht vergehen, bis daß dies alles geschieht. Aber das ist unmöglich- Jesus will eine Zeit bestimmung geben, wann dies alles geschieht- wie das Knospen des Feigenbaums anzeigt, daß der Sommer nahe ist, so sollen gewiffe Ereignisse anzeigen, daß der Menschensohn nahe ist. Also diese Ereignisse soll das lebende Geschlecht noch sehen, sie sollen während der nächsten 50 Jahre eintreten. Dann aber setzt Jesus hinzu: Über jenen Tag und Stunde weiß niemand etwas, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht des Menschen Sohn, sondern allein der Vater (Matth. 24, 36, Marc. 13,32). Hier scheint Jesus sich zu widersprechen. Niemand weiß etwas über jenen Tag und Stunde und eben hatte er gesagt, diese Ereignisse solle das lebende Geschlecht noch sehen. Aber jene Ereigniffe, welche das lebende Geschlecht noch sehen wird, sind nicht die Wiederkunft Christi, sondern die Vorzeichen, die ihr vorangehen: die Christen sollen verfolgt werden, die Menschen werden einander verraten, der Gräuel der Verwüstung soll stehen an heiliger Stätte, falsche Christi und Propheten werden aufstehen, die Sonne und der Mond soll verdunkelt werden, die Sterne werden vom Himmel fallen, des Himmels Kräfte werden erschüttert werden. Das sind die Vorzeichen der Wieder kunft Christi. Einen Teil dieser Vorzeichen hat das gegen wärtige Geschlecht noch erlebt, namentlich die Zerstörung Je rusalems. Eilt andrer Teil jener Vorzeichen ist bis heute nicht erfüllt worden. Wie lange diese Vorzeichen währen, wie bald nach jenen Vorzeichen er wiederkommen werde, davon hat Jesus nichts gesagt, darüber Auskunft zu geben, lehnt er ab. Es ist verständlich, daß die Jünger bald nach der Zerstörung Jerusalems das Ende dieser Welt erwarteten- aber Jesus hat das nicht gesagt. Endlich scheint Matth. 10, 23 zu widersprechen. Jesus verkündet seinen Jüngern bei der ersten Aussendung, daß sie von den Juden sollen gehaßt und verfolgt werden. „Wenn sie euch in einer Stadt verfolgen, so fliehet in eine andere. Ihr
44
werdet die Städte Israels nicht zu Ende bringen, bis des Menschen Sohn kommt." Hier will Jesus nichts aussagen über die Zeit seiner Wiederkunft, sondern weissagt, daß sie immer noch eine israelitische Stadt finden werden, die sie freundlich aufnimmt. Daß sie seine Wiederkunft noch erleben werden, ist damit nicht gesagt. Jesus läßt es ganz unbestinimt, wann er wiederkommt. So fällt also zwischen das Abscheiden Christi und seine Wiederkunft in Herrlichkeit ein Zeitraum, der von den ersten Jüngern recht kurz gedacht wurde. Das ist die Periode der Kirche. Jesus selbst hat diesen Zeitraum vorhergesehn und einige Anordnungen getroffen. Math. 16,16 hat er die Grün dung einer besonderen ixxXtjoia verheißen, damit das jüdische Volk verworfen. Petrus soll sie begründen durch sein mutiges Zeugnis und sie soll nicht untergehn. Joh. 20, 22 gibt er allen Jüngern den Auftrag, an seiner Statt in die Gottes gemeinschaft aufzunehmen durch die Vergebung der Sündener verheißt ihnen den heiligen Geist, durch welchen sie befähigt werden, sein Reich auf Erden fortzusetzen. Joh. 14, 16. 26. Luc. 24,49. Diese Verheißung ging am Pfingfttage in Er füllung, durch die Predigt des Petrus wurden 3000 bekehrt und damit war die Kirche Christi gegründet. Was ist die Kirche Christi? Sie ist die irdische Gemeinde Christi während seiner Abweseuheit. Vor der Himmelfahrt war er sichtbar bei ihr gegenwärtig, nach der Wiederkunft wird er wieder sichtbar bei ihr sein. In der Zwischenzeit ist er un sichtbar. Aber auch in dieser Zeit ist er allein in seiner Ge meinde wirksani, nicht nur weil er durch sein Lebcnswerk sie begründet und ihr seinen Charakter aufgeprägt hat, nicht nur, weil er sein Wort ihr hinterlassen hat, sondern weil er als der auferstandene und erhöhte König bei ihr ist alle Tage bis an der Welt Ende, weil er sie mit seinem Geiste erfüllt. Er wirkt in ihr als der Auferstandene, der Lebendige, teilt in ihr durch seinen Geist die Güter des Reiches Gottes aus wie in den Tagen seines Fleisches: Vergebung der Sünden und Kind schaft bei Gott, Wahrheit, Freiheit und ewiges Leben. Er er neuert die Herzen seiner Jünger zur Gesinnung des Glaubens
und der Demut, zur Gottes- und Nächstenliebe, zum Siege über Sünde und Tod. Darum sagte Petrus (Act. 2,33): Nachdem er erhöhet ist zur Rechten Gottes, hat er dies aus gegossen, was ihr sehet und höret. Und als er den Lahmen gesund gemacht hatte, verkündete er (Act. 3,16): Durch den Glauben an Jesus hat sein Name diesen Mann, den ihr sehet und kennt, gesund gemacht. Christus ist bei seiner Gemeinde, aber unsichtbar. Die Kirche Christi ist also die durch den Geist Christi berufene und geheiligte Gemeinde auf Erden, in welcher der Geist Gottes wohnt, die teilhaftig ist der Güter des Reiches Gottes, in deren Herzen die Liebe Gottes ausgegoffen ist, die mit Christo in einem neuen Leben wandeln. Darum ist Christus die schaffende, erhaltende und belebende Kraft der Kirche. Er verhält sich zu seiner Gemeinde, wie der Geist zum Leib: wie der Geist alle Glieder belebt und regiert, so Christus seine Gemeinde. Darum heißt sie auch der Leib Christi: er ist das Haupt dieses Leibes (Ephes. 1,23), jeder einzelne ist ein Glied an diesem Leibe (Röni. 12,5). Diese lebendige Gemeinschaft wird auch mit einer Ehe verglichen,' Christus ist der Mann, welcher regiert und sorgt, die Gemeinde die Braut, welche von ihrem Manne empfängt, was sie hat (Eph. 5, 23). Endlich wird diese Ge meinschaft auch abgebildet durch ein Gebäude: die Gemeinde ist der Tempel Gottes, darinnen Gottes Herrlichkeit wohnt, wie einst die Wolke im Allerheiligsten (1 Cor. 3, 16); Christus wird bald als Fundament (1 Cor. 3, 9), bald als Eckstein bezeichnet (Eph. 2, 22), während die einzelnen Seelen als lebendige Bau steine auf ihm erbaut werden. Darum ist die Kirche das Ab bild der Vollkommenheit Christi, welches seine geistige Schön heit der Welt offenbaren soll. Sie soll immer mehr das Abbild des Erlösers werden, in welchem sein verborgenes Wesen der Welt offenbar wird. Und indem er die ganze Kirche mit seiner Vollkvnimenheit erfüllt, wird er gleichsam selbst erfüllt, wie wenn er vorher ein leeres Gefäß wäre (Eph. 1,23). Die Kirche ist in der Welt, aber nicht von der Welt, vielmehr steht ihr Leben im Gegensatz zum Weltleben; aber sie ist in die Welt hineingesetzt, um Seelen für Christum zu gewinnen und
46
das geistige Leben der Menschheit umzugestalten. Dieses geistige Leben, das von Christo stammt, macht das Wesen der Kirche aus. Wer dies neue Leben von Christo hat, gehört zu seiner Kirche; wer es nicht hat, gehört noch nicht zur Kirche, er kennt und versteht die Kirche gar nicht. Die Kirche kann also nicht gesehen werden, sondern wird geglaubt- was man mit Augen sieht, ist nicht die Kirche, sondern ihr Gewand, gewisse äußere Handlungen oder Ordnungen, die sie verrichtet. Darum ist die Kirche ihrem Wesen nach unsichtbar, sichtbar wird sie durch Handlungen, Einrichtungen, Ordnungen, in denen das neue Leben Gestalt gewinnt. Diese sind für die Welt erkennbar, aber nicht das neue Leben. Diese äußeren Ordnungen und Handlungen machen nicht das Wesen der Kirche aus, sie sind zum Teil veränderlich, der Entwicklung unterworfen, aber auch die unveränderlichen Ord nungen machey nicht das Wesen der Kirche aus, sondern sind nur Merkmale. Die Kirche ist nur da, wo Christus die Herzen zu neuem Leben erweckt hat- wo das nicht ist, da ist keine Kirche Christi, sondern ein toter Leichnam. Darum ist die Kirche die communio sanctorum, die Gemeinschaft derer, die durch den Geist Christi ergriffen und geheiligt ftnb1). Die Apologie er läutert das also: ecclesia principaliter est societas fidei et Spiritus sancti in cordibus2). Und Luther sagt: es weiß gott lob ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche sei, nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören 3). Diese Erkenntnis ist später verdunkelt worden, indem man gegenüber den Schwärmern die Kirche als eine Anstalt mit festen Ordnungen beurteilte. Aber wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein und gehört auch nicht zu seiner Kirche. Das neue Leben aus Gott macht das Wesen des Christentums, also auch der christlichen Kirche aus. Daran muß festgehalten werden, nur in diesem Leben besteht der unvergängliche Wert der Kirche. 1) Conf. aug. art. VII. 2) Apol. art. VI § 5. 3) Antic. Smalcald. III, 12.
47
So ist also folgender Unterschied zwischen Reich Gottes und Kirche: das Reich Gottes ist ein geistliches Reich, das ewig be steht im Himmel und auf Erden, die Kirche ist die Gestalt des Reiches Gottes, welche es trägt auf Erden zwischen der Himmel fahrt und der Wiederkunft Christi. Die Kirche ist also nicht ewig, sondern ihre irdische Form vergeht- wenn man von einer jenseitigen triumphierenden Kirche redet, so ist das ein unge nauer Ausdruck. Daher tritt auch nach dem Pfingstfest der Name Reich Gottes zurück, an seine Stelle tritt der Name ifcxkrjala Gemeinde, womit nicht nur die Ortsgemeinden, sondern auch die Gesamtheit der Gläubigen auf Erden bezeichnet wurde (Math. 16, 18). Aber welches sind die irdischen Formen der Kirche? Alles geistige Leben besteht in Vorstellungen, Gefühlen, Entschlüssen,' es tritt heraus entweder in Worten oder in Taten. Dann erst hat es seine Vollendung, dadurch wird es mir gegen ständlich und zugleich dauernd. Ohne dieses Heraustreten würde das geistige Leben nur in zusammenhangslosen Wallungen bestehen, hat es sich aber befestigt in Wort und Tat, so knüpft das Ich hieran an, entzündet sich aufs neue, es ist eine stetige, zusammenhängende Entwicklung möglich. Diese Regel gilt auch bei dem neuen Leben, das Christus in uns entzündet. Auch das religiöse Leben besteht in Vorstellungen, Gefühlen, Ent schlüssen/ diese werden zur Lehre, zum Lied, zum Gebet, zum Tun. Dadurch wird dieses Leben erkennbar, unterscheidet sich von anderen Lebensbewegungen. Das war schon anfänglich bei den Jüngern Christi/ in der Kirche bekam dies Wort und Tun Ordnung und Regel in Lehre und Gottesdienst. Das neue Leben ist ursprünglich eine Beziehung auf Gott: Glaube, Demut, Liebe gegen Gott. Aber es findet seine Darstellung durch das Wort als Lehre und Gebet, durch die Tat, indem es unser Tun ändert. Denn die Welt ist Gottes Werk und als Gottes Kinder können wir sie nur gemäß seinem Willen benutzen. Daher gestaltet dieses Leben unser Verhalten zum Leibe, zum Besitz, zur Familie, zum Staat, zur Menschheit um: es heiligt uns. Indem es unser sittliches Tun in der Welt umgestaltet, geht es doch in keiner dieser Beziehungen
48
auf, seine Einheit bleibt immer die Beziehung der Seele auf Gott. Diese einheitliche Beziehung bedarf ihre besondere Dar stellung, und die Handlungen, in denen sie sich darstellt, sind die Berleiblichung der Kirche. Diese Berleiblichung der Kirche ist um der Menschen willen nötig. Alles geistige Leben entsteht nicht isoliert in den Individuen, sondern vollzieht sich in Gemeinschaft, da entsteht es, wächst, erlischt. Darum ist es genreinschaftbildend. Eine solche Gemeinschaft ist um so wichtiger und dauerhafter, je wesentlicher und wichtiger das geistige Leben ist, das ihre Grundlage bildet. Das Leben zur Natur hat eine gemeinsame Bearbeitung derselben, gemeinsame Bekämpfung ihrer Schä digungen bewirkt, die Ordnung der Volksgenossen hat gemein same Sitte und Recht erzeugt: die Behauptung der Nationalität zur Staatsgemeinschaft. Auch die Wiffenschaft, die Kunst haben von je solche Gemeinschaften gebildet. Die notwendigsten und verbreitetsten Gemeinschaften sind Familie und Staat, weil sie allgemeinen Bedürfniffen abhelfen. Könnten diese Gemeinschäften nicht auch das religiöse Leben pflegen? Zn gewissen Zeiten und bei gewissen Völkern wurde das religiöse Leben von der Familie oder vom Staate geordnet. Die alten Familien häupter waren zugleich Priester wie Abraham- sowohl die morgenländischen Staaten wie Griechenland und Rom ordneten den Dienst der Götter als Staatsangelegenheit, denn die Götter waren Götter des Volkes. Aber diese Gemeinschaft genügt nicht für die christliche Religion- denn das Christentuni ist Menschheitsreligion, das neue Leben aus Gott soll zu allen Völkern kommen. Da es unmöglich ist, daß alle Völker in einem Staate sich vereinigen, so muß die christliche Geniein schaft von der staatlichen verschieden sein. Auch fühlen sich alle Christen, welche verschiedenen Staaten angehören, durch ihren Glauben verbunden, stehen also in einer Genieinschaft, die irgendwie Darstellung finden muß. Auch darum ist der Staat dazu nicht geeignet, weil er nur Rechtsgemeinschaft ist, wenn er auch sittliche Gesinnung als Grundlage voraussetzt. Das christliche Leben greift über das irdische Rechtsleben weit hinaus, es ist eine Gemeinschaft in ewigen Gütern. Diese
49
Güter haben wir durch andre Menschen empfangen, bilden also mit ihnen dadurch eine Gemeinschaft, wir haben den Drang, diese Gemeinschaft zu Pflegen und zu befestigen, auch andern den Zugang zu eröffnen. Schon Jesus bildete auf Crden eine solche Gemeinschaft mit seinen Jüngern, und diese Gemeinschaft breitete sich aus seit dem Pfingstfest. Daher ist das christliche Leben gemeinschaftbildend und diese Gemeinschaft ist die Kirche. Ein gemeinsames Wirken kann aber nur ge schehen nach einer festgesetzten Ordnung. Darum muß das Reich Gottes gewisse Ordnungen annehmen, damit es zur menschlichen Gemeinschaft wird. Das ist gleichsam der Leib, den es bildet und dieses verleiblichte Gottesreich ist die Kirche. Die Kirche ist also unsichtbar und sichtbar,' unsichtbar, sofern sie eine Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe ist, sichtbar, sofern diese Gemeinschaft gewisse irdische Ordnungen hat. Diese Unterscheidung einer unsichtbaren und sichtbaren Kirche hat die Reformation gebildet im Gegensatz zum Papsttum. Dieses kennt nur eine sichtbare Kirche. Bellarmin sagt: die Kirche sei so visibilis et palpabilis wie das Königreich Frankreich und die Republik Venedig. Ihre Merkmale sind, daß sie denselben Glauben bekennt, dieselben Sakramente hat und unter der Herrschaft der rechtmäßigen Hirten, insonderheit des Papstes steht. Das geistliche Leben wird dabei nicht beachtet- der Katholik ist überzeugt, dies geistliche Leben werde durch die äußere Ordnung verbürgt. Aber die Reformatoren hatten sich überzeugt, daß diese äußeren Ordnungen da sein können und doch das Wesentliche fehlt, nämlich die geistliche Herrschaft Christi, Frömmigkeit, Glaube und Liebe. Deshalb widersprachen sie: ecclesia est principaliter societas fidei et Spiritus sancti in cordibus; wo das fehlt, ist keine Kirche Christi. Also un sichtbare und sichtbare Kirche sind nicht zwei verschiedene Sub jekte, sondern dasselbe Subjekt nach zwei wesentlichen Seiten betrachtet: unsichtbar ist sie, sofern Christus sein Leben in ihr auswirkt, sichtbar, sofern sie gewisse Ordnungen und Tätig keiten vollzieht. Daneben bildete sich bald, besonders durch Melanchthon, eine andere Unterscheidung aus. Er ging von der Beobachtung Sachsse, Praktische Theologie.
4
-
50
aus, daß in der Kirche immer Ungläubige, Gottlose und Heuchler sich befinden,' darum unterschied er ecclesia late dicta und proprie dicta. Jene ist die sichtbare Kirche, die Menge betet,, die durch die Taufe berufen sind- diese ist die unsichtbare Kirche, die Summe der vere credentes sparsi per totum orbem. Dann wäre also die unsichtbare Kirche ein Teil der sichtbaren Kirche. Aber diese sparsi sind überhaupt keine Gemeinschaft, sondern ein mysticum corpus Christi. Und wenn die vocati die Kirche ausmachen, so fehlt ihr das Wesentliche: Glaube und Liebe. So wird die Kirche zu einer Anstalt degradiert oder es wird der Versuch gemacht, die credentes von den vocati abzusondern. Beides ist ein Mißgriff, daher ist diese Unterscheidung falsch. Auch die Ungläubigen, welche zur Kirche gehören, sind durch die Berufung geheiligt und sollen durch die Gemeinschaft zum Glauben geführt werden. Das ist der Dienst, den Christus von seiner Gemeinde fordert, zu welchem er sie durch seinen Geist ausrüstet. Insofern hat die Kirche eine Aufgabe an ihren noch ungläubigen Gliedern- aber sie ist nicht Anstalt, sondern sie ist die geordnete Gemeinde der Gläubigen. Diese Arbeit der Kirche ist zugleich ein Wirken des Heiligen Geistes, der sie erfüllt und ein Tun Christi, welcher ihr den Geist ge sandt hat. Das Wirken der Kirche, des Heiligen Geistes und Christi ist in allen Tätigkeiten der Kirche untrennbar verbunden. Albrecht Nitschl') unterscheidet Reich Gottes und Kirche so: Die gläubige Gemeinde Christi ist die Kirche, sofern sie sich zu gemeinsamem Gottesdienst verbindet und sich rechtliche Ord nungen gibt- sie ist Reich Gottes, sofern sie in der Wechsel wirkung sittlichen Handelns aus dem Motiv der Liebe besteht. Aber das Wesen des Reiches Gottes besteht nicht nur in der Liebe zum Nächsten, sondern ist vor allem Vertrauen, Demut und Liebe zu Gott und diese betätigt sich im Gottesdienst.. Insofern ist die anbetende Gemeinde Reich Gottes- sofern sie die Anbetung und den gemeinsamen Gottesdienst ordnet, wird sie Kirche. Und ebenso schafft das gegenseitige Handeln aus dem Motiv der Liebe gewisse Ordnung in Armenpstege und 1) Rechtfertigung und Versöhnung III § 35.
51
~
Hilfeleistung- auch diese Ordnungen gehören zum Wesen der Kirche. Die Gemeinde, sofern sie von frommer und liebevoller Gesinnung erfüllt ist, ist das Reich Gottes, sofern sie Be tätigung dieser Gesinnung ordnet, ist sie Kirche. Die pro testantische Kirche in Deutschland hat die gottesdienstliche Ge meinschaft besonders gepflegt und die Liebesgemeinschaft zurück gestellt. Heute wird vielfach die gottesdienstliche Gemeinschaft zurückgestellt und die Liebesgemeinschaft als das Wesentliche beurteilt. Auch das ist verkehrt. Beides soll gleichermaßen in der Gemeinde geübt werden. Ist dies das Wesen der Kirche, so ergibt sich als oberster Grundsatz alles kirchlichen Handelns: nur dasjenige kirchliche Tun ist richtig und wertvoll, welches das neue Leben aus Gott erweckt oder fördert. Dieser Grundsatz ist von großer Trag weite. Die Kirche ist ihrem Wesen nach nicht eine rechtlich geordnete Gemeinschaft, deren Gesetzen man sich zu unterwerfen hat, um dadurch in den Besitz der himmlischen Güter zu kommen, sondern sie ist der Besitz dieser Güter. Sie ist nicht eine irdische Anstalt, durch welche die Gottesherrschaft auf Erden verwirklicht werden soll, sondern sie ist die verwirklichte Gottesherrschaft, wenn auch zunächst nur im Geist. Die Ge meinschaft der Heiligen ist nicht Produkt der Kirche, sondern die Kirche selbst. Sie begann beim Pfingstfest durch die Aus gießung des Heiligen Geistes. Darum ist das erste in der Kirche nicht gewisse Ordnungen und Einrichtungen, welche das göttliche Leben erzeugen sollen, sondern das vom Geist gewirkte neue Leben. Dies ist daher die Voraussetzung alles kirchlichen Tuns, es breitet das neue Leben weiter aus durch Worte und Taten, durch Ordnungen und Einrichtungen. Die Kirche ge staltet sich nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Die Ordnungen und Einrichtungen sind nicht Zweck, sondern Mittel zu einem höheren Zweck, darum von unter geordnetem Wert und veränderlich- wenn sie den Zweck nicht erreichen, sind sie abzuschaffen. Hierauf beruht die Entwick lungsfähigkeit der Kirche- bei rohen Völkern sind andre Ord nungen zweckmäßig als bei gebildeten. Daher sind zu ver schiedenen Zeiten verschiedene kirchliche Ordnungen berechtigt-
52
wenn man eine Form für alleinberechtigt erklärt, fällt man in Irrtum, hindert die gesunde Entwicklung. Das ist der Irrtum der römischen Kirche, sie erklärt veränderliche Ordnungen für wesentlich und unabänderlich. Eine solche Ordnung ist das Papsttum und der von ihm abhängige Episkopat. Es ist nach gewiesen, daß der Episkopat erst im Laufe des zweiten Jahr hunderts seine herrschende Stellung erlangt hat- den Primat hat das Papsttum erst in den folgenden Jahrhunderten durch geschichtliche Verhältnisse erworben und auch nur tut Abendland. Aber selbst wenn die Verfassung der römischen Kirche älter wäre, niemals könnte sie unveränderlich und heilsnotwendig sein. Dadurch würde die christliche Kirche zur Gesetzeskirche und ein äußerlicher Gehorsam bekäme göttlichen Wert. Gewiß müssen in der Kirche Ordnungen sein, aber nur soweit sie dem Zwecke dienen, das neue Leben aus Gott zu fördern- dienen sie diesem Zwecke nicht, so sind sie abzuschaffen- diese Vollmacht hat der Herr seiner Gemeinde gegeben. Den zuchtlosen und ungebildeten Germanen gegenüber war einst die weltliche Herr schaft des Klerus heilsam. Die getauften Heiden Afrikas sind heute nicht reif genug, die Kirche zu regieren, sie bedürfen die Leitung europäischer Missionare, aber nur so lange, bis sie selbständig geworden sind. Wollte man dann die Herrschaft der Europäer aufrechterhalten, so würde daraus eine Knecht schaft, welche dem Geiste Christi nicht entspricht. Im Mittelaller war der Gehorsam gegen die Hierarchie heilsam, als aber die Völker mündig wurden, als Luther das Evangelium von der Freiheit eines Christenmenschen wieder verkündigte, da war die Knechtung unter die alte Hierarchie ein Widerstand gegen die Wahrheit. Die Privatbeichte konnte Kindern und unmün digen Völkern als eine heilsame Zucht auferlegt werden, aber mündige Christen empfinden sie als unberechtigte und unerträg liche Menschenknechtschaft. Keine Verfassung kann das Leben aus Gott schaffen- wer eine bestimmte Verfassung für heils notwendig erklärt, stellt das Äußerliche dem Innern, die Form dem Wesen gleich, er nimmt die Schale und glaubt auch den Kern noch zu haben, nachdem er längst vertrocknet ist. So tvird die Kirche ein Leichnam ohne Geist, das kirchliche Tun
53
wird mechanisiert. Dieses Verderben ist in der römischen Kirche chronisch geworden. Auch die evangelische Kirche hat sich davor zu hüten. Die fleischliche Trägheit mechanisiert leicht alle kirchlichen Geschäfte, nachdem sie durch Ordnung geregelt sind- Schriftverlesung, Gebete, Predigten werden geplappert. Alle diese Werke sind wertlos, wenn sie nicht Ausdruck geist lichen Lebens sind. Und ein zweiter Grundsatz ergibt sich für alles kirchliche Handeln. Besteht das Wesen der Kirche aus dem neuen Leben in Gott und hat sie nur die Aufgabe, dieses Leben zu wecken und zu fördern, so ist es nicht ihre Aufgabe, die Natur zu verändern, das neue Leben soll sich gestalten unter den irdischen Naturbedingungen. Allerdings im Anfang der Kirche, als das göttliche Leben in besonderer Kraft sich offenbarte, da machte es auch die Natur in besonderer Weise seinen Zwecken dienst bar: es geschahen Wunder und Zeichen, sie gaben den Beweis, daß der Geist ist ein Herr über die Natur. Jesus hat die Wundergabe den Aposteln ausdrücklich verliehen (Matth. 10, 8; Luc. 10, 19), um dem Evangelium den Eingang zu den Un gläubigen zu erleichtern,- Paulus beruft sich darauf, daß er unter den Korinthern die Zeichen und Wunder eines Apostels gegeben habe (2. Kor. 12,12). Aber schon die apostolischen Konstitutionen sagen (VIII, 1): die Wundergabe sei den Jüngern gegeben worden, um der Ungläubigen willen und sei überflüssig, wenn es keine Gottlosen mehr gäbe. Seitdem ist die Wunder gabe verschwunden, Chrysostomus bezeugt, sie komme nicht mehr tior!). Die Wunder, welche seitdem erzählt werden, beruhen auf Leichtgläubigkeit oder erhitzter Phantasie und tragen viel fach das Gepräge rohen Aberglaubens. Die Kirche bedarf sie nicht,- sie soll auf die Seelen wirken, nicht die Natur ver ändern. Der Heilige Geist wirkt ethisch auf den bewußten Geist und dieser wirkt dann naturgemäß vermittelst des Leibes auf die umgebende Natur. So wird allerdings die Natur verändert und dem Geiste dienstbar gemacht, aber unter Be nutzung des natürlichen Zusammenhangs. Die römische Kirche
54
behauptet, der Heilige Geist wirke heute noch ebenso wunderbar wie vor Zeiten: Krankenheilungen, himmlische Erscheinungen, Blutschwitzen und Augenverdrehen von Statuen kämen noch heute vor. Auch tote Gegenstände, Reliquien, Gebeine oder Kleider von Heiligen besäßen solche Wunderkraft, und man verschmäht es nicht, sie zu kirchlichen Schaustellungen zu ge brauchen. Dieser Aberglaube ist schon früh in die Gemeinde eingeschlichen: in Jerusalem trug man die Kranken auf die Straße, damit der Schatten des Petrus sie gesund machte (Act. 5,15), die Schweißtücher des Paulus wurden auf die Kranken gelegt, damit die Seuchen von ihnen wichen (Act. 19,12). Die alte Kirche hat daraus gefolgert, der Geist übe einen heiligenden Einfluß auf die Materie aus und hat deshalb zahl reiche Weihen und Segnungen eingerichtet, um der Materie diese Kraft mitzuteilen. Die apostolischen Konstitutionen feigen1): „Der Bischof soll das Waffer oder das Ol segnen; wenn er nicht da ist, soll der Presbyter segnen und der Diakon dabei stehn. Er soll also sprechen: Herr Zebaoth, du Gott aller Kraft ... heilige jetzt durch Christum dieses Wasser und Ol, auf den Namen des Darbringers oder der Darbringerin und gib ihm Kraft, daß es Gesundheit wirke, Krankheit vertreibe, böse Geister verjage, jede Nachstellung abwehre durch Christum, unsre Hoffnung." Das Weihwasser, das Salz, das Ol, der Chrysam, Kerzen und Palmzweige werden geweiht, Amulette und Medaillen, welche einen schützenden Einfluß auf den Träger haben sollen. Dieser Aberglaube ist in römischen Landstrichen sehr groß. Manche Naturereignisse, Gewitter, Krankheiten an Menschen und Vieh werden auf dämonische Einflüsse geschoben und durch Weihen bekämpft. So wird die Kirche zu einem physischen Machtreich; es ist ganz konsequent, daß sie auch Sakramente einsetzen könne, ohne an Christi Einsetzung ge bunden zu sein. Aber was eine Machterweiterung der Kirche zu sein scheint, dient ihr zum Schaden: diese Anschauung zieht den Aberglauben groß, die Religion ist eine abergläubische Scheu vor der unheimlichen Macht, die der Kirche verliehen ist 1) VIII, 29.
55
und das arme Volk ist bereit zu äußeren Leistungen, um die Machtwirkungen der Kirche sich nutzbar zu machen,- es schwindet das kindliche Vertrauen zu dem gnädigen Vater im Himmel, welches Christus seinen Kindern verliehen hat. Darum sind alle kirchlichen Handlungen verwerflich, durch welche die Natur soll verändert werden- die Natur zu verändern, hat der Herr seiner Macht vorbehalten. Solche Weihungen und Segnungen bilden einen großen Teil der praktischen Theologie in der römischen Kirche. Wir verwerfen sie, denn der Herr hat seine Gemeinde nur beauftragt, auf die vernünftige Kreatur zu wirken, sie zur Wahrheit, Gnade und ewigem Leben zu führen. Die Weihung von Kirchen und Friedhöfen hat keine magische Wirkung, sondern übergibt sie in feierlicher Weise dem kirch lichen Gebrauch.
Drittes Kapitel.
Die Kirche und die Onadenmittet. Geistiges Leben in der gnädigen Gemeinschaft Gottes ist für den Menschen nur möglich, wenn Gott sich zu ihm herab läßt, sich ihm offenbart. Kein Mensch kann diese Gemeinschaft an sich reißen, auch wenn die Anlage dazu in uns gesetzt ist; diese kann sich nur als Ahnung, als Sehnsucht äußern. Auch die Offenbarung Gottes in der Natur führt nicht zum Leben in Gott. In der Natur erfahren wir eine unendliche Macht, eine überlegene Weisheit, aber sie gibt uns Rätsel auf, die wir nicht lösen können- phantastische Einfälle, ästhetische Stim mungen, welche abwechseln mit Furcht vor dem großen un bekannten Gott, bilden das Wesen der Naturreligionen, denn die Natur bezeugt nicht auf eine zweifellose Weise die Ge sinnung Gottes gegen uns. Das Christentum beruht auf der -Überzeugung, daß der unbekannte Gott die Liebe ist, und daß er diese Liebe auf vollkommene Weise in Jesu von Nazaret offenbart habe: er lebte im Vater und der Vater in ihm, er war mit dem Vater eins, wie der Vater hat das Leben in ihm
56
selber, so hat er dem Sohne gegeben, zu haben das Leben in ihm selber, in ihm wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig. Dazu ist er auf die Erde gekommen, daß er uns die Liebe des Vaters offenbare, damit er uns zu Gott führe und Leben mit Gott in uns wirke- ohne dies Leben sind wir tot; durch ihn haben wir Leben und volles Genügen. Gott hätte dieses Leben durch besondere Offenbarung in jedem neu erzeugen sönnen; aber die Erfahrung beweist, daß Gott dieses Leben nur int geschichtlichen Zusammenhang mit Jesus erzeugte; darum ist er das Haupt, der Heiland der Menschen. Geistiges Leben kann sich nur äußern vermittelst des leiblichen Organes, das ist die Bedeutung des Leibes, daß er geistiges Leben darstellen und dadurch in denen erzeugen kann, die dazu veranlagt sind. Darum ward das ewige Wort Fleisch, damit wir seine Herr lichkeit erkennten und durch ihn zu Gott kämen. Alles geistige Leben kann sich auf zweierlei Weise erkennbar machen: durch Wort und durch Handlung; so hat Jesus uns das göttliche Leben kund getan, darum berichten die Evangelien, was Jesus getan und gelehrt hat (Act. 1,1). Also gibt es zwei Mittel, durch welche das Leben mit Gott in uns erzeugt wird: das Wort Jesu, das Tun Jesu. Das sind die beiden Gnaden mittel, durch die Gott seine Gemeinde gegründet hat, durch welche er sie erhält. Schon das Wort des zwölfjährigen Knaben war ein Ausdruck seines geistigen Lebens. Als er auftrat, zeugte er von dem Gnadenwillen Gottes, von der Aufgabe, die er habe, von den Gütern, die er bringe, wie diese Güter sich verhalten zu den irdischen Gütern, wie wir uns verhalten sollen zu ihm und zu der Welt. Das stellte er dar in kurzen Sinnsprüchen, in ausgeführten Gleichnissen, in lehrhafter oder polemischer Wechselrede. Durch dieses Wort führte er viele dahin, daß sie glaubten an den gnädigen Vater im Himmel, an Jesus seinen Sohn, daß sie durch diesen Glauben göttliches Leben und die Seligkeit erfuhren, daß sie stark wurden, alle Sünde zu über winden, alle irdischen Güter gering zu achten gegen die ewigen Güter. Dies Wort Jesu war das vornehmste Gnadenmittel und seine Zuhörer bekannten, teils bewundernd, teils wider-
57
strebend, daß sein Wort gewaltig und holdselig war. Diese Worte Jesu wurden von seinen Jüngern in treuem Gedächtnis bewahrt, sie erzählten davon, als er geschieden war, sie ver vollständigten ihre Erinnerungen, schrieben sie auf und über lieferten sie denen, welche gläubig wurden. So entstanden in der ältesten Gemeinde feste Stücke der evangelischen Erzählung. Schon in der ersten Generation fingen viele an, aufzuschreiben und zu sammeln, was die Jünger erzählt hatten. Man schrieb zuerst die Worte Jesu auf, dann auch die Taten Jesu. Sc entstanden viele Evangelien (Luk. 1,1). Aber diese wurden zunächst nicht gleich geachtet den mündlichen Berichten der Augenzeugen- noch Papias sagt: es sei ihm wichtiger gewesen, des Herrn Worte und Taten zu erfahren durch mündliche Be richte der Augenzeugen, als durch geschriebene Evangelien. Aber als die Augenzeugen dahinstarben, da wurde die münd liche Erzählung unsicher und die christliche Gemeinde kam in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts zu der Überzeugung, daß vier Evangelien unter den vielen treue und zuverlässige Berichte über die Worte und Taten des Herrn enthielten. Diese Überzeugung findet sich schon bei Justin und Jrenäus beweist sogar aus verschiedenen Gründen, daß es nur vier Evangelien geben könne. Wie im alten Testament sich die Herrlichkeit Gottes offenbart habe auf vier Tieren, so die Herrlichkeit des Sohnes in den vier Evangelien. Es ist die Überzeugung der christlichen Kirche, daß sie uns den wirklichen Jesus vor Augen stellen, daß durch sie Jesus selbst zu uns redet. Diese Treue kommt den Evangelien nicht darum zu, weil der heilige Geist sie den Schriftstellern diktiert hätte, sondern die Reden und Gleichnisse Jesu prägten sich den Jüngern unauslöschlich ein, die Kraft des Gedächtnisses war größer bei einem Geschlecht, das nicht immer Stift und Papier zur Hand hatte- durch den Geist Jesu wurde ihnen das Ver ständnis eröffnet, daß sie klar schauten, was sie zuerst nur in Bruchstücken erkannt hatten. Diese Darstellung begann alsbald nach der Erhöhung Christi, etwa um 60 nach Christo war die synoptische Tradition abgeschlossen. Auf Grund derselben ver faßte Markus sein Evangelium, dann Lukas und Matthäus,-
58
etwa zwischen 60 und 80. Das vierte Evangelium enthält Ergänzungen und Berichtigungen, die von einem Augenzeugen herrühren. Ob Trübungen des äußeren Herganges, Gedächtnis fehler in der Darstellung sich eingeschlichen haben, können wir im Einzelnen nicht mehr feststellen- aber was Jesus verkündet hat, steht in der Hauptsache unzweifelhaft fest. Die Erzäh lungen der Evangelien werden bestätigt durch gelegentliche Aussprüche des Apostels Paulus. Er kennt Aussprüche Jesu, die sich in unsern Evangelien nicht finden (1. Thess. 5,15, 1. Kor. 7,10; 9,14, Act. 20, 35). Er kennt noch Christen, die Jesus gekannt haben nach dem Fleisch (2. Kor. 5,16). Er bezeugt von Jesu, daß er geboren ist aus dem Samen Davids (Röm. 1,3), daß er in seinem ganzen Leben dem Vater gehor sam war (Röm. 5,19), daß er von keiner Sünde wußte (2. Kor. 5,21). Dabei war er arm auf Erden (2. Kor. 8,9), nahm Knechtsgestalt an (Phil. 2, 6), er war sanftmütig und gütig (2. Kor. 10, 1), er hat uns geliebt und alles zu unserm Heil getan (Gal. 2, 20, Röm. 15, 7, Eph. 5,1), er war demütig und suchte nichts für sich (Phil. 2, 5); auf seinem Angesicht erkennen wir die Herrlichkeit Gottes (2. Kor. 4, 6). Seine Apostel hat er beauftragt, Zeichen und Wunder zu verrichten (2. Kor. 12, 12). Vom Ende seines Lebens bezeugt Paulus, daß Jesus das heilige Mahl eingesetzt hat (1. Kor. 11,13), er ward verraten, er hat ein schönes Bekenntnis abgelegt vor Pontius Pilatus (1. Tim. 6, 13), er hat gelitten (Col. 1, 24, Röm. 15, 3), er ist um unserer Sünden willen gekreuzigt worden und gestorben (Röm. 6, 6, 2. Kor. 13,4, Gal. 3,1,13, 1. Kor. 2, 8), er ist begraben (1. Kor. 15, 3) und am dritten Tage auferweckt von den Toten (Röm. 1, 4; 4,24, 1. Kor. 15,3, Eph. 1,20). Der Inhalt der Predigt Jesu war nicht das Gesetz, sondern das Evangelium, die Botschaft vom Gottesreich, das er bringe, von der Gnade für die Sünder, von der Be kehrung und dem ewigen Heil, das uns durch Christus gebracht werde. Dies ist das wahrhaftige Gotteswort, darauf unser Glaube ruht, das in uns neues Leben erzeugt hat. Das ver danken wir dem Geiste, der die Apostel erfüllte, der die Ge meinde befähigte, diese Schriften vor andern auszuwählen und
59
zu bewahren. Nur dadurch ist dieses Wort auf uns gekommen. Es ist also das Gnadenmittel, durch welches Jesus noch heute in unser Herz redet, seinen Geist uns mitteilt und göttliches Leben in uns erzeugt, darum ist dieses Wort das vornehmste Gnadenmittel, welches Jesus seiner Gemeinde hinterlaffen hat. Das göttliche Leben ging von Christo in besonderer Kräftig keit und Reinheit auf die Jünger über, welche Jesus erwählt hatte,' sie sollten seine Zeugen sein, er sandte ihnen den Geist, der sie in alle Wahrheit leitete und erinnerte an alles, was er geredet hatte. Darum sagte er: wer euch hört, der hört mich. Durch die Predigt der Apostel wurde die Kirche ge gründet. Sie haben Jesu Wort treu bewahrt, sie sind Vor bilder der Gemeinde wegen der Kraft und Reinheit des gött lichen Lebens, sie sind auch Lehrer der Gemeinde, weil sie dies neue Leben in grundlegender Weise lehrend dargestellt und die Verkündigung Christi ausgeführt haben: das Wesen und den Ursprung des neuen Lebens, seine Beziehung auf Christi Leben, Tod und Auferstehung, den Zusammenhang dieser Taten Gottes mit unserm Heil, die irdische Ausgestaltung des christlichen Wandels, die Heilsvollendung. Es ist auffällig, wie überein stimmend die Predigt der Apostel mit den Worten Jesu ist und doch wie verschieden. Übereinstimmend, denn Jesus stand im Mittelpunkt ihrer Predigt,' verschieden, denn die Reichspredigt wurde zur Predigt von Jesu Tod, Auferstehung, himmlischer Herrlichkeit und siegreicher Wiederkehr. Sie haben nichts ge lehrt, was nicht Jesus schon verkündet hätte,' sie haben das Evangelium nicht gefälscht, sondern vollendet. Diese Übereinstimmung der Apostel mit dem Heiland wird von vielen modernen Theologen bestritten,' sie behaupten, Jesus habe sich nicht als Gottes Sohn bekannt, nicht Glauben an seine Person gefordert, nicht von seinem Versöhnungstode, von seiner Auferstehung gesprochen- das seien nur Auffassungen der Apostel. Den vorhandenen Gegensatz schildert in klarer Weise Johannes Weiß- er sagt*): „Das Urchristentum ist Christusreligion, d. h. im Mittelpunkt steht das innige Glaubensverhältnis zum er1) Paulus und Jesus Seite 5.
—
60
höhten Christus. Diese Form der Religion hat durch die Jahr tausende hindurch als das eigentliche Christentum gegolten und es gibt noch heute ungezählte Christen, die keine andere Form des Glaubens kennen und wünschen. Sie leben in innigster Seelengemeinschaft mit dem Herrn, beten zu ihm und sehnen sich darnach, ihn von Angesicht zu schauen. Daneben geht eine religiöse Strömung her, welche ein religiöses Verhältnis zum erhöhten Christus nicht mehr zu finden vermag und ihr volles Genügen daran hat, sich von Jesu von Nazaret zum Vater führen zu lassen. Beide Formen religiösen Lebens stehen in unserer Kirche nebeneinander,' es wäre zu wünschen, daß sie sich duldeten und daß die Predigt des Evangeliums keine von ihnen vergewaltigte." Aber diese neue Form widerspricht nichk nur der Predigt der Apostel, was Weiß anerkennt, sondern auch vielen Aussprüchen Jesu, die glaubhaft überliefert sind. Sie ist eine Folge der Aufklärung, die seit 200 Jahren bei uns aufgekommen ist. Sie beruht nicht auf einem tieferen Verständnis des Evangeliums, sondern auf Zweifeln des Ver standes. Sie hat uns von manchen Vorurteilen freigemacht, aber das Evangelium verflacht nach den Grundsätzen der Ver nunft. Sie hat keine rechte Erkenntnis der Sünde, darum kein Verständnis der Erlösung Christi. Er gilt ihr nicht als der eingeborene Sohn Gottes, der uns von Sünde und Tod erlöst hat, sondern als erhabner Mensch, der durch Lehre und Vorbild unsre sittliche Hebung wirkt. Damit sinkt das Evan gelium zum Noniismus herab, das Christentum ist eine ver besserte Gesetzesreligion. Dann bleiben wir in der natürlichen Selbstgenügsamkeit, kommen aber nicht zum Leben in Gott. Dieses minderwertige Christentum soll nicht vergewaltigt, aber durch die Predigt von Sünde und Gnade, durch das Zeugnis von dem Sohne Gottes, von seinem Tode und seiner Auf erstehung überwunden werden. Nur dieses biblische Evangelium hat göttliche Kraft, wirkt Gnade und ewiges Leben. Darum sagt Luther mit Recht: von diesem Evangelium können wir nicht weichen, es falle Himmel und Erde und was nicht bleiben will. Weiß bekennt offen, daß dies neue Evangelium von dem urchristlichen, insonderheit paulinischen Evangelium weit ent-
61
fernt ist, spricht aber die Hoffnung aus, es werde allmählich in unsrer Kirche zur Herrschaft kommen. Ich teile diese Hoffnung nicht, denn damit würde unsre Kirche die göttliche Wahrheit von sich stoßen, ihre Kraft verlieren. Wenn Weiß meint, der geschichtliche Jesus habe seine Jünger in das un mittelbare Erleben der Gotteskindschaft geführt, ohne für sich in ihrer Frömmigkeit eine Stellung zu verlangen, so muß er die großen Aussprüche Jesu über sich selbst für ungeschichtlich erklären, er widerspricht damit der Erfahrung seiner Apostel und seiner Gemeinde. Die Apostel haben das Evangelium zunächst mündlich ver kündet- nur gelegentlich und in Beziehung auf gewisse Verhält nisse haben sie Briefe geschrieben. Diese Briefe hat die Kirche im zweiten Jahrhundert gesammelt und ebenfalls als normative Lehrbilduug, als göttliche Offenbarung gegenüber aller mensch lichen Meinung anerkannt. Hier kann die Frage entstehen, ob diese Briefe wirklich von den Aposteln stammen, deren Namen sie tragen. Wir können diese Frage der Forschung überlassen die Gemeinde hat diesen Briefen kein Ursprungszeugnis aus gestellt, den Verfasser des Hebräerbriefes kennen wir nicht, sie hat über ihren Wert geurteilt. So gab es zwei Sammlungen: das Evangelium und den Apostolos und beide wurden normativ, als man sich von der Urzeit entfernte und die mündlichen Nach richten unsicher wurden. Dies geschriebene Wort hatte den un bestreitbaren Vorzug: es enthielt die Lehre und das Leben Christi sowie die Lehre seiner Apostel in ursprünglicher Gestalt. Es gibt kein Mittel, wodurch wir Christum so deutlich erkennen, wie dieses Wort. Darum ist es das durch den heiligen Geist der Kirche gestiftete Gnadenmittel, welches die Kirche nicht ent behren kann, ohne zu entarten. Auf allen Gebieten gilt das Gesetz, daß originale Geister für die neuen Wahrheiten den treffendsten durchschlagenden Ausdruck finden. So auch bei Christo- daher kann man seine Ausdrücke nicht ändern, ohne die Wahrheit selbst zu schädigen. So oft man versucht hat, seine Ausdrücke zu ändern, die Bibel aus dem Semitischen ins Japhetitische zu übersetzen, wurde die Wahrheit undeutlich und das neue Leben matt. Darum eignet
62
der Schrift ein unvergänglicher Wert. Lessing meinte zwar in seinen Streitschriften, das Christentum könne weiterbestehen, auch wenn die Schriften der Apostel und Evangelisten verloren gingen, denn seine Wahrheiten seien in soviele Systeme über gegangen, daß sie auf der Schrift nicht mehr beruhten. Aber so konnte er nur urteilen, weil er die Schrift als ein Lehrbuch ansah. Sie ist ein Lebensbuch, kein System kann ihre Wahr heit ausschöpfen, kein Leben Jesu macht die Evangelien über flüssig. Wohin die christliche Gemeinde ohne die Schrift kommt, das haben wir im Mittelalter erfahren- nur durch die Schrift ist das Christentum gereinigt worden. Allerdings sind die einzelnen Schriften des neuen Testaments durch das Urteil der Gemeinde ausgewählt worden und über manche Schriften hat das Urteil lange geschwankt- dem Hebräerbrief, der Offenbarung Johannis haben viele widersprochen, und der Brief des Barnabas ist erst allmählich allgemein verworfen worden. Dies Urteil der alten Kirche kann durch spätere Festsetzungen nicht beseitigt werden. Chemnitz erklärt mit Recht gegenüber den Festsetzungen des tridentinischen Konzils: die Schriften, über welche die alte Kirche im Zweifel war, kann die gegenwärtige nicht für ka nonisch erklären, auf sie darf man kein Dogma gründen. Diese Zweifel der alten Kirche beweisen nicht nur ihre Vorsicht, sondern auch ihre Weisheit- denn die bestrittenen Schriften sind an Gehalt den unbestrittenen nicht gleich. So ist also das Wort Christi, wie es im neuen Testament vorliegt, das einzige Mittel, dadurch wir Christum erkennen- dies Mittel hat der Herr durch Wirkung seines Geistes geschaffen und die Gemeinde hat es durch die Wirkung desselben Geistes bewahrt. Durch dieses Wort sendet der erhöhte Herr fortwährend Lebensströme auf seine Gemeinde, führt sie zur Buße und zum Glauben, zur Heiligung und Seligkeit. Darum sagt die confessio augustana: ecclesia est communio sanctorum, ubi verbum recte docetur. Auch das alte Testament beruht auf göttlicher Offenbarung, ist aber berechnet für einen niederen Standpunkt, darum dem neuen Testament nicht gleichwertig. Jesus wertete es als das Wort seines himmlischen Vaters, dabei betonte er seine Unvoll kommenheit. Die christliche Gemeinde übernahm es aus dem
Judentum als heilige Schrift und bewies daraus, daß Jesus der verheißene Messias war. Sein Wert für uns besteht nicht darin, daß wir durch seine Weissagungen Jesus als Heiland erkennen, sondern daß wir Christi Predigt, die aus dem alten Testament erwachsen ist, richtig verstehen. Darum ist es für die christliche Gemeinde unentbehrlich. So muß also die Kirche, wenn sie das göttliche Leben schaffen, erhalten, fördern will, dies Wort als das vornehmste Mittel anwenden. Die christliche Kirche ist die Kirche des göttlichen Worts, und den rechten Ge brauch dieses Wortes zu lehren, das ist die vornehmste Auf gabe der praktischen Theologie. Geistiges Leben äußert sich auch durch Handlungen,' die Miene, die unwillkürliche Bewegung offenbart einen geistigen Vorgang oft deutlicher als das Wort. Vor allem muß es zur Tat werden, wenn es in andern erweckt werden soll, die Tat ist wirksamer als das Wort. Jesus hat sein Leben in Gott offenbart durch die Tat: durch den heiligen Wandel, durch Gebet, durch barmherzige Liebe, durch Sanftmut gegen seine Feinde, durch Geduld im Leid, durch Gehorsam bis zum Tode. Auch durch außerordentliche Kräfte, welche von ihm ausgingen. Als er den Gichtbrüchigen heilte, als er den Lazarus erweckte, als er der großen Sünderin vergab, ging eine Tat von ihm aus. Solche Werke verrichtet er nicht mehr, sie werden uns erzählt, fallen also unter das Gnadenmittel des Wortes. Aber noch heute will er als der Erhöhte durch Taten bei uns sein. Das ist das Geheimnis seiner Person. Kraft der Auferstehung ist er erhöht zur Rechten der Majestät und wirkt fort in seiner Gemeinde. Das sind nicht die Nachwirkungen seiner Lebens arbeit : ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Er macht sein Wort lebenskräftig, durch das Wort sendet er den heiligen Geist, sammelt, erleuchtet, heiligt seine Gemeinde, er hört ihre Gebete. Aber er hat seiner Gemeinde auch zwei Stiftungen hinterlassen, durch welche er noch heute unmittelbar auf jede Seele wirkt: die Taufe und das heilige Abendmahl. Daß Jesus die Taufe eingesetzt hat, ist nur mit Unrecht bezweifelt worden. Johannes, der in vielen Dingen genauere Kenntnis verrät, als die Synoptiker haben, berichtet, daß die
64
Jünger bei Lebzeiten Jesu und in seinem Aufträge viele getauft hätten (Joh. 4,1. 2). Matthäus berichtet, der Auferstandene habe seinen Jüngern befohlen, sie sollten alle Völker taufen (28,19). Demgemäß fordert Petrus in seiner ersten Predigt die heilsbegierigen Juden sofort auf, sie sollten sich taufen lassen (Act. 2, 38). Als Paulus sich bekehrt hatte, wurde er sofort getauft (Act. 9, 18); seine Taufe bezeugt er selbst (Röm. 6, 3; 1. Cor. 12,13); er bezweifelt auch nicht, daß alle Christen in Rom, die er doch persönlich nicht kannte, getauft sind (Röm. 6, 3). So steht denn fest, daß die Taufe von An fang an in der christlichen Gemeinde als etwas Selbstverständ liches galt, nieniand wurde ein Jünger Jesu ohne durch die Taufe. Diese unzweifelhafte Tatsache bestätigt die Nachricht, daß Jesus selbst die Taufe eingesetzt hat; nicht aber sind die Worte Jesu (Joh. 4.1, Matth. 28,19) erdichtet worden, um diese Tatsache zu erklären. Fraglich kann nur sein, ob Mat thäus die Worte der Einsetzung wörtlich mitteilt. Nach Mat thäus hat Jesus gesagt: taufet sie in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Diese Form der Taufe kommt sonst im neuen Testament nicht vor. Petrus fordert (Act. 2, 38): lasset euch taufen enl xä> övbfMxi ’lrjaov XoioxoVf auf Grund des Namens Jesu Christi. Der Name ist nicht ein leerer Schall, sondern bezeichnet den Inhalt, das Wesen der Person. Gott hat diesen Jesus erhöht, zu einem Herrn und Christ gemacht. Auf Grund dieser Tatsache sollen sie sich diesem Herrn durch die Taufe übergeben, so daß sie sein Eigentum werden. Auch Paulus nennt an allen Stellen nur Jesus als Ziel der Taufe, nie Vater, Sohn und Geist. Act. 19, 5 wurden die Johannesjünger von ihm getauft eis x6 dvo/m xov xvqmv I %. Ähnlich heißt es Gal. 3, 27; Röm. 6, 3 «V %qiox6v ßamio&fjvai. Hier wird der Name Christi oder Christus selbst als das Ziel der Taufe bezeichnet: sie werden in Christum ein getaucht, eingepflanzt, mit ihm vereinigt. Act. 10, 48 befiehlt Petrus, sie sollen getauft werden ev xcp dvö/xa-u I nicht: im Namen, Auftrag Jesu, sondern durch die Taufe werden sie versetzt in den Bereich des Namens Jesu, des erhöhten Herrn. In diesen Stellen ist nur die Präposition verschieden; einig
65
ftnb sie darin, daß nur der Herr Jesus als Grundlage und Liel der Taufe genannt wird, nicht aber Vater, Sohn, Geist. Diese Form findet sich nur einmal im neuen Testament, nämlich Matth. 28,19. Und nun entsteht die Frage: hat Jesus diese ausführlichere Form eingesetzt und wird sie in allen andern Stellen nur abgekürzt, oder hat Jesus die Taufe nur in der einfachen Form geboten: ev xq> dvöfiaxt stov und hat Matthäus die spätere feierlichere Form dafür eingesetzt? Möglich wäre es, Laß Jesus die vollere Form gebraucht hat, da er sich bewußt war, daß durch ihn die Menschen zum Vater kommen und den heiligen Geist empfangen sollten. Andrerseits war im Anfang, als nur Inden getauft wurden, kein Bedürfnis, den Vater zu nennen, da sie als Abrahams Kinder Gott zum Vater hatten. Als aber viele Heiden getauft wurden, die bisher den Götzen dienten, da war es notwendig, den Vater als Ziel der Taufe neben Jesus zu nennen. So ist es wahrscheinlich, daß Jesus nur die Taufe auf seinen Namen befahl, daß aber die Apostel, vom Geiste Jesu geleitet, diesen Zusatz machten. Der historische Hergang läßt sich nicht mehr sicher feststellen,- dem Inhalt nach sind beide Formen gleich: wer auf den Namen Jesu getauft wird, wird dadurch zugleich ein Kind des Vaters und eine Be hausung des heiligen Geistes. Dies wurde in der volleren Form zum Ausdruck gebracht. Die Apostellehre und Justin schreiben die trinitarische Formel vor, die christliche Gemeinde hat später entschieden, daß die Taufe auf den Namen Jesu zu lässig sei, wenn er nicht exklusiv gemeint sei. Was bedeutet die Taufe? Waschungen und Tauchbäder waren im Morgenlande ■eine allgemeine Sitte, sie wurden auch in heidnischen und in der jüdischen Religion als religiöse Zerimonien verwendet. Aber von diesen Zerimonien unterscheidet sich die christliche Taufe dadurch, daß sie nur einmal, zum Eintritt in den christlichen Glauben, angewandt wurde und nicht wiederholt werden konnte. Die jüdische Proselytentaufe kann nicht Ursprung der christlichen Taufe sein; denn dann würde man die getauften Proselyten nicht noch einmal getauft haben. Sondern die christliche Taufe ist eine Weiterbildung der Johannestaufe. Johannes hat sie nicht entlehnt, weder von Heiden noch von den Essenern. Er Sachsse, Praktische Theologie.
5
66
hat sie selbständig eingesetzt für alle, die in das bevorstehende Reich Gottes eingehen wollten. Nach ihm hat Jesus die Taufe eingesetzt für seine Jünger- aber nun bekam sie einen ganz, andern Wert. Jesus war der eingeborene Sohn Gottes, ber durch seinen Tod die Versöhnung der Menschen vollbracht und durch seine Auferstehung den Tod überwunden hatte. Nun ist er der erhöhte Herr, der lebendig in seiner Gemeinde ist, sie durch seinen Geist erneuert und zur Vollendung führt. In dem Befehl der Taufe liegt die Zusage, daß er uns annimmt zu seinem Eigentum und uns teilhaftig macht seiner himmlischen Güter. Ist Christus nicht auferstanden, so kann uns die Taufe auf ihn nichts helfen, denn er ist tot. Dann ist die Taufe nur eine kraftlose Zerimonie. Aber er ist auferstanden, nimmt uns kraft seiner Verheißung zu seinem Eigentum an und verleiht uns ewiges Leben und Seligkeit. Das ist der Wert der Taufe., Aber hat uns Gott nicht schon durch sein Wort Gnade, Ver gebung und ewiges Leben verliehen? Was soll dann noch die Taufe'? Eine ausdrückliche Erklärung wird uns nicht gegeben, wir müssen sie aus den Tatsachen folgern. Act. 2, 38 wird bei vielen Zuhörern durch die Predigt von dem gekreuzigten und auferstandenen Heiland Erkenntnis der Sünde und Ver langen nach Gottes Gnade erweckt- erschüttert fragen sie: was sollen wir tun? Da antwortet Petrus: ändert euren Sinn und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und ihr werdet empfangen die Gaben des heiligen Geistes. Also durch die Predigt von Christo wird Erkenntnis der Sünde und Verlangen nach der Gnade erweckt, die Gott allen anbietet- durch die Taufe wird diese Gnade jedem einzelnen zugeeignet, so daß er von dem erhöhten Herrn die Vergebung der Sünden und die Gabe des heiligen Geistes empfängt. Damit erklärt Petrus das Wort Jesu: getauft werden in seinen Namen. Die Taufe ist nicht Symbol der bereits empfangenen Gnade, sondern durch die Taufe kommt die durchs Wort begonnene Gnade zum Abschluß: Gott selbst teilt dem einzelnen mit, was er allen durchs Wort angeboten hat: die Vergebung der Sünden und den heiligen Geist. Als Jesus auf Erden wandelte, sprach er zu betn Gicht-
~
67
brüchigen: deine Sünden sind dir vergeben. Was er sprach, das geschah. Heute redet er zu jedem einzelnen nicht mehr durch das Wort, sondern durch die Taufe, welche nach seiner Einsetzung erteilt wird- wenn wir getauft werden, tut er an uns nach seiner Verheißung. Die Taufe ist also nicht Symbol einer geistigen Gabe, die er zu anderer Zeit gibt, sondern reale Mitteilung dieser Gabe: der Vergebung und des heiligen Geistes sie ist die reale Einpflanzung der Seele in Christum. Dieselbe Anschauung hat Paulus von der Taufe. Röm. 6. Durch die Taufe ist unser alter Mensch mit Christo gekreuzigt, ist der Leib der Sünde vernichtet, wir sind mit Christo begraben in den Tod. So können wir nun in Neuheit des Lebens wandeln. Und was wir können, das sollen wir auch tun. Ebenso schildert er 1. Cor. 6,11 die Wirkung der Taufe: ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden in dem Namen des Herrn Jesu Christi und in dem Geiste unsres Gottes. Auch hier wird die Vergebung der Sünden und die Gabe des Geistes als Wirkung der Taufe geschildert. Ebenso 1. Cor. 12, 13: durch einen Geist sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Gal. 3,27: Alle, die ihr in Christum getauft wurdet, habt Christum angezogen. Darum macht er Tit. 3, 5 von der Taufe unser Heil abhängig: er hat uns errettet durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des heiligen Geistes. Das sagt er von der Taufe, weil wir durch sie die Vergebung der Sünden und den heiligen Geist empfangen. So geben uns Petrus und Paulus eine übereinstimmende Erklärung des Wortes Jesu: getauft werden in dem Namen Christi. Aber kommt denn auf die Wassertaufe soviel an? Ist nicht die geistige Wirkung Christi die Hauptsache? Unzweifelhaft, auch ist Christus nicht an die Wassertaufe gebunden. Act. 10, 44 wird der heilige Geist vor der Taufe allen mitgeteilt, die das Evangelium hören, und dann erst empfingen sie die Taufe als Bestätigung der empfangenen Gnade. Aber das wird aus drücklich als eine Ausnahme bezeichnet- Gott wollte die Apostel belehren, daß auch für die Heiden die Gabe des heiligen Geistes bestimmt sei. Jesus selbst hat für die Aufnahme in sein Reich die Wassertaufe eingesetzt- nicht als ob die äußere Wassertause
68
eine magische Wirkung hätte- sondern nur der durchs Wort gewirkte Glaube kann diese Gaben empfangen. Aber die Wafsertaufe soll ein Siegel sein für den Gläubigen und ein Erkennungs zeichen gegenüber der Welt- sie ist notwendig zur Bildung einer Gemeinde. Durch diese Ordnung wird das unsichtbare Reich Gottes sichtbar. Darum sagen die Dogmatiker mit Recht: die necessitas verbi est absoluta, die necessitas sacramenti est ordinata. Als zweite religiöse Handlung hat Jesus die Feier des heiligen Mahles eingesetzt. Daß er die Wiederholung befohlen hat, wird durch das Zeugnis des Paulus über allen Zweifel erhoben (1 Cor. 11,23—25). Matthäus und Markus haben bei der Einsetzung nicht die Worte: Das tuet zu meinem Ge dächtnis! Daraus haben einige Theologen gefolgert, Jesus habe die Wiederholung nicht beabsichtigt. Aber die feierlichen Worte: Das ist mein Leib! Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute! beweisen, daß er für alle Jünger eine wertvolle dauernde Stiftung hinterlassen wollte. Daß die Jünger ihn so verstanden haben, zeigt die Wiederholung des Mahles, die wir in der jerusalemischen Gemeinde und in allen Paulinischen Gemeinden finden. Daß die Apostel das Mahl ohne solchen Auftrag sollten wiederholt haben, ist psychologisch undenkbar. Der Zu satz bei Lukas und Paulus macht nur die Absicht Christi deutlich. Was soll dieses Mahl? Die Worte der Einsetzung sind Gegenstand eindringender Untersuchung und großen Streites gewesen - Einmütigkeit ist bis heute nicht erzielt. Die Schwierig keit liegt darin, daß das Abendmahl nicht eine Lehre, sondern eine Handlung ist. Jede Handlung ist nicht einfach, sondern vielseitig- wie das Licht aus verschiedenen Strahlen besteht, so kann eine Handlung eine Mehrheit von Gaben in sich schließen. Das ist hier der Fall. Jesus sagt: Das tuet zu meinem Ge dächtnis. Damit gibt er seiner Gemeinde ein Gebot- sie soll nicht nur dankbar seiner gedenken, sondern durch die Feier dieses Mahles verkünden, daß er sein Leben für sie gelassen, daß er aus Liebe zu uns den Tod aus sich genommen hat. Paulus versteht die Absicht des Meisters richtig, wenn er sagt: so oft ihr dieses Brot esset und von diesem Kelche trinkt, sollt
69
ihr des Herrn Tod verkünden, bis daß er kommt. So sollen wir es feiern, als ein Gedächtnismahl dankbarer Liebe. Das hat Zwingli mit Recht betont, das Abendmahl ist ein Gedächtnis mahl des Todes Christi für seine Gemeinde,- sein Mangel war, daß er nichts anderes darin fand. So oft die Gemeinde dieses Mahl feiert, ist der Herr zugegen, nicht als Zuschauer, sondern als himmlischer Gastgeber, der seine Gaben austeilt,- das rechte Verständnis dieser Gaben bildet die Schwierigkeit. Die erste Gabe bezeichnet Jesus mit den Worten: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, welches für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Dieser Bund ist einmal geschlossen auf Golgata, als Jesus sein Leben dahin gab/ er kann nicht zum zweitenmal geschlossen werden. Aber die Gabe dieses Bundes soll der Gemeinde immer aufs neue dargeboten werden in dem Kelche, darum nennt Jesus den Kelch den neuen Bund. Diese Gabe bedürfen die Christen täglich, Jesus will ihren Glauben stärken, indem er sie jedem persönlich in sichtbarer Gestalt darreicht. Damit verbindet er eine zweite Gabe, indem er sagt: das ist mein Leib. Wir sollen in diesem Mahl seinen Leib essen und sein Blut trinken. Was heißt das? Das buch stäbliche Verständnis dieser Worte ist unmöglich- denn als Jesus diese Worte sprach, saß er in seinem Leibe neben den Jüngern, er konnte ihnen also seinen Leib nicht zu essen geben. Die römische Kirche versteht unter Leib nicht den Leib Christi, in dem er neben ihnen saß, sondern einen himmlischen Stoff, den Gott einst im Leibe der Maria geschaffen hat, den er immer wieder schaffen kann. Jesus schafft ihn bei der Einsetzung des Abendmahls, indem er das Brot in seinen Leib verwandelt und jedem Priester gibt er die Macht dasselbe zu tun; dann ist das Brot nicht mehr Brot, sondern Leib Christi. Aber Jesus spricht hier die Identität des Brotes aus mit dem Leibe, in dem er vor ihnen saß, den er am Kreuze geopfert hat. Das leugnet die römische Anschauung, darum tut sie den Worten Jesu Gewalt an. Warum nennt denn Jesus das Brot seinen Leib? Zwingli faßt das bildlich: Das Brot ist ein Abbild seines Leibes, es soll uns seinen Tod vor Augen stellen. Jesus will dadurch uns der Vergebung gewiß machen, unsern Glauben und
- 70 unsre Liebe mehren. Luther verwarf das als ungenügend, das heilige Mahl ist nicht nur ein Abbild, sondern eine Stiftung Christi, dadurch er uns mit seinem Leibe und Blute speisen will. Luther hatte allen Grund, Zwinglis Lehre als ungenügend abzulehnen,' er behauptet, in, mit und unter dem Brot sei der verklärte Leib Christi, so daß wir ihn beim Genuß des Mahles real empfangen. Damit lehrt er nicht die Identität des Leibes und des Brotes, sondern das räumliche Beisammensein beider. Diese Meinung bietet eine große Schwierigkeit. Wenn der erhöhte Christus seinen verklärten Leib unter dem Brote dar bietet, so haben die Jünger bei der Einsetzung die Gabe des Abendmahls gar nicht empfangen, denn damals war der Leib Christi noch nicht verklärt, denn er saß neben ihnen. Das ist abzuweisen; das erste Abendmahl war ein vollkommenes Abend mahl, gab den Jüngern alles, was die Gemeinde empfangen soll. Es muß also die Beziehung des Brotes zum Leibe anders vorgestellt werden. Joh. 6,54 sagt der Herr: wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der hat das ewige Leben. Das heißt: wir sollen die Person Jesu völlig in uns aufnehmen, mit ihr eins werden, wie mit dem Brote, das wir esten. Diese Aufnahme kann nicht leiblich geschehen, sondern auf geistige Weise,- Jesus sagt das selbst, wenn er hinzusetzt: Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist kein nütze. Jesu Fleisch essen und Blut trinken heißt also: völlig mit ihm vereinigt werden, aber auf eine unsichtbare, geistige Weise. Und das geschah im ersten Abendmahl. Dagegen wendet man mit Unrecht ein: Das sei keine reale Aufnahme. Diese geistige Aufnahme ist viel realer als die leibliche und die Voraussetzung dafür, daß wir einst auch leiblich mit ihm vereint werden. Es ist ein verbreiteter Irrtum, als ob das Leibliche realer wäre als das Geistige,' das Leibliche vergeht, das Geistige ist ewig und die Voraussetzung jeder weiteren leiblichen Entwicklung. Diese völlige Aufnahme soll geschehen durch das heilige Abend mahl, dann essen wir Jesu Leib und trinken sein Blut. Hier erfahren wir ein Geheimnis, das alle Vorstellung übersteigt. Darin hatte Luther Recht, daß er die reale Aufnahme Christi im Abendmahl festhielt- darin Unrecht, daß er sie materiell
71
verstand und vom Glauben unabhängig machte. Das heilige Mahl ist also nicht nur ein Mahl des Gedächtnisses an Jesu Tod, nicht nur ein Mahl der Versöhnung, dadurch wir der Vergebung gewiß werden, sondern ein Mahl der völligen Ver einigung mit Christo- indem wir die Wirkung seines Todes empfangen, versetzt er uns in die Gemeinschaft seines Lebens, daß wir in ihm leben und er in uns. Dann sind wir mit Christo ewig vereint, durch ihn mit Gott und wissen uns als Glieder der himmlischen Gemeinde. Dann ist an uns das Gebot des Herrn erfüllt: Sie sind alle eins, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir, daß auch sie in uns eins seien. Darum ist das heilige Abendmahl der Höhepunkt des christ lichen Gottesdienstes, die sichtbare Vereinigung mit dem er höhten Herrn. Taufe und Abendmahl sind also nicht menschliche Ein richtungen, sondern Stiftungen Christi, in welchen der erhöhte Herr fort und fort in seiner Gemeinde wirksam ist- wir haben nicht auf den Diener zu sehen, sondern auf den Herrn, der durch diese Handlungen seine himmlischen Gaben mitteilt. Die eine wirkt Aufnahme in die Gemeinde durch die Wiedergeburt, die andere Befestigung im Glauben und Heiligung. Das ist die einzigartige Bedeutung dieser Handlungen. Ihre Kraft beruht auf der Einsetzung Christi und auf der Treue Christi, welcher seine Verheißungen hält. Das ist der unterscheidende Vorzug der Sakramente vor allen andern kirchlichen Zerimonien, daß Christus selbst in ihnen handelt. Darum konnte nur Christus Sakramente einsetzen- weder ein Apostel noch die Kirche hat die Macht, an irgend einen Ritus eine besondere Gnadenwirkung Christi zu knüpfen. Kirchliche Zerimonien sind andächtige Feiern, verbunden mit Predigt des Wortes und Gebet. Dahin gehören die Konfirmation, die Trauung, die Priesterweihe. Aber Sakramente sind das nicht, denn eS fehlt die Einsetzung Christi. Melanchton meinte1), man könne die Buße als drittes Sakrament rechnen, aber sie ist kein ritus, sondern Predigt des Evangeliums. Auch die Ordination will
72
er als Sakrament gelten fassen1),2 3weil 4 Jesus seine Jünger anblies (Joh. 20, 22); aber hier fehlt der Befehl, die Handlung zu wiederholen. Also auch die Sakramente haben ihre Kraft nur durch das Wort Christi und so gibt es in Wahrheit nur ein Gnaden mittel der Kirche: Das Wort Christi, mag es uns nun verkündet werden oder als verkörpertes Wort im Sakrament nahe treten. Darum werden die Sakramente das verbum visibile genannt: Augustin sagt: accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. Die Confessio augustana sagt*): promissiones per sacramenta exhibentur et ostenduntur. Die Gnaden wirkungen sind dieselben: Vergebung der Sünden, Rechtfertigung und Heiligung. Darum haben wir im Worte alles und die Notwendigkeit der Sakramente beruht nicht darin, daß sie uns etwas gäben, das wir durch das Wort noch nicht hätten, sondern auf der Einsetzung Christi, welcher den schwachen Glauben durch sichtbare Zeichen stärken will. Mit Recht sagt Chemnitz'): Im Sakrament wird uns keine Gnade angeboten, die wir nicht im Wort schon hätten. Daher seien die Sakramente zwar auch necessaria ad salutem tamquam causa Instrumentalis, scd non tarn praecisa est necessitas sacramentorum ad salutem. sicut fidei et verbi. Und die apologia sagt1): idem est effectusverbi et ritus. Die Notwendigkeit der Sakramente beruht nicht auf den Gesetzen des geistigen Lebens wie das Wort, sondern auf der Stiftung Christi, welcher seiner Gemeinde nicht nur das Notwendige, sondern den Wohlstand schenkte. Darum dürfen sie der Gemeinde nicht fehlen; die confessio lehrt: ecclesia est congregatio sanctorum, ubi verbum recte docetur et sacramenta rite administrantur. Das sind die Mittel, durch welche die Verbindung der irdischen Gemeinde mit ihrem Haupte erhalten, das geistige Leben unter den Menschen gefördert und aus gebreitet wird. 1) 2) 3) 4)
Loci theol. XIII. Art. XIII. Examen conc. trid. IV pag. 242. Art. XIII.
73
So ist also nächst der Verkündigung des göttlichen Wortes die Verwaltung der Sakramente die zweite Aufgabe der gläu bigen Gemeinde. Diese beiden Geschäfte machen das Wesen der kirchlichen Tätigkeit aus, wo sie nach dem Willen des Herrn ausgeübt werden, da ist die wahre Kirche Christi. Durch diese Funktionen wird die unsichtbare Kirche sichtbar. Sie sind zum Bestand der Kirche ebenso notwendig wie ausreichend. Not wendig, um die Gemeinde vor ungesunder Schwärmerei zu be hüten. Es hat zu allen Zeiten Christen gegeben, welche sich des Geistes rühmten ohne Wort und Sakrament- indem sie die Verbindung mit dem historischen Christus verschmähten, sind sie in naturalistischen Pantheismus oder rationalistischen Vernunft glauben verfallen und von der Wahrheit abgeirrt. Diese Irr tümer sind außerordentlich verbreitet in der evangelischen Kirche und verführen viele in Aberglauben, die sich der Aufklärung rühmen. Aber sie sind ausreichend gegenüber der römischen Kirche, welche eine bestimmte Verfassung und menschliche Satzungen für heilsnotwendig erklärt. Es gibt noch andere Mittel, durch welche der Glaube erweckt und gefördert wirddurch die Versuchungen der Welt und die Trübsale der Zeit ist die Gemeinde allezeit mächtig gefördert worden- aber diese Mittel hat Gott sich vorbehalten, nicht der Gemeinde anvertraut. Auch durch den christlichen Wandel und das Gebet wird das neue Leben gefördert, aber das sind geistliche Gaben, die durch das Wort und Sakrament mitgeteilt werden- darum ge hören sie nicht zu den Gnadenmitteln, sondern zu ihren Wirkungen. Wohl mag noch anderes dazu kommen, damit die Kirche Gestalt gewinnt, aber es beruht auf menschlicher Er wägung und ist veränderlich. Um das Wort zu verkünden und die Sakramente zu verwalten, muß die Kirche mancherlei Ord nungen der Ausführung treffen. Christus hat nur geboten, daß sein Evangelium verkündet, seine Sakramente verwaltet werden- wie? wo? wann das geschehen müsse, darüber hat er nichts geboten, das soll die Gemeinde ordnen kraft des in ihr herrschenden Geistes. Wie das zweckmäßig, nachdrücklich, schön geschehe, darüber kann man verschiedener Meinung sein und das ist man von je gewesen - die Zeit, die Bildung, die Volks»
74
jttte hat von je großen Einfluß auf kirchliche Bräuche gehabtdie morgenländischen Völker haben andre kirchliche Sitten aus gebildet, als die abendländischen. Diese Verschiedenheit schadet nicht, man muß mancherlei Riten vertragen können. Aber all diese Ordnungen und Ausführungen müssen sich an zwei Regeln binden, wenn sie nicht schaden sollen. Die erste lautet: die Stiftungen Christi müssen rein erhalten werden, d. h. es darf nichts dazu getan und nichts davon abgetan werden. Das Evangelium darf nicht verstümmelt werden, wenn z. B. die Gemeinde die Predigt von der Auferstehung Christi abtun wollte, so würde sie das Evangelium verfälschen. Oder wenn sie dazu tun wollte die Lehre von einer doppelten Sittlichkeit oder von der Verdienstlichkeit guter Werke, so würde sie das Evangelium verunreinigen. Wenn sie beim Abendmahl der Gemeinde den Kelch entzieht, so hat sie es verstümmelt, oder wenn sie zuvor die Elemente opfert für die Sünden der Ge meinde, so hat sie das Abendmahl verunreinigt. Ja sie kann die Sakramente schon verunreinigen, wenn sie an sich unver werfliche Zerimonien in solcher Masse hinzufügt, daß dadurch die Stiftung Christi unkenntlich gemacht wird. Daß bei der Taufe das Wort verkündet, gebetet, gesegnet, den Paten ein Gelübde abgenommen wird, das macht die Stiftung des Herrn nur deutlicher, aber in der römischen Kirche ist eine Menge andrer Zerimonien zur Wassertaufe hinzugefügt: der Teufel wird ausgetrieben, das Kind wird wiederholt bekreuzigt, mit Speichel bestrichen, mit Ol gesalbt, Salz wird ihm in den Mund, Kerzen in die Hand gegeben, ein weißes Kleid wird ihm angezogen, so daß man gar nicht mehr weiß, was denn wesentlich an der Taufe ist. Kann man auch in jedem Ritus ein Symbol finden, so wird doch die Hauptsache der Taufe Et menschlichem Schutt zugedeckt, dadurch das Sakrament verunreinigt. Die evangelische Kirche hat deshalb viele dieser Symbole abgetan, zuletzt auch den Exorzismus. Je niehr Zerimonien vermehrt werden, um so mehr erstarrt das geistliche Leben. Die römische und noch mehr die griechische Kirche bestätigen diese Tatsache. Die andere Regel lautet: die Gnadenmittel sind nicht so zu verwalten, als ob sie eine magische Kraft besäßen, so daß
75
der mechanische Vollzug derselben bei Gott wohlgefällig machte. Zweck der Gnadenmittel ist nur, daß sie die Einwirkung des erhöhten Christus auf die Seele vermitteln sollen, sie sollen den Glauben an ihn und seine Gnade erwecken oder mehren. Daher lehrt die confessio augustana1), die Sakramente seien nichts nütze, wenn nicht der Glaube dabei sei, welcher der Verheißung traut- diejenigen werden verworfen, welche den Glauben nicht fordern, sondern lehren, daß sie ex opere operato recht fertigen. Darnach soll das Wort zuerst den Glauben er wecken, dann erst kann die gläubige Seele die im Sakrament angebotene Gnade ergreifen. Die persönliche Beziehung zu Christo durch den Glauben ist die Voraussetzung des Sakra ments. Niemals darf die Gemeinde dasselbe so verwalten, als wenn der äußere Vollzug desselben ein heilsames frommes Werk wäre, durch welches wir wohlgefällig werden. Der er höhte Herr will im Sakrament den Menschen seine Gaben schenken, aber nur den Menschen, welche ihr Herz ihm zu wenden und nach seiner Gnade verlangen. Ohne das sind die Sakramente nicht nur wirkungslos, sondern schädlich. Indem sie zu Christo hinführen, sind die Sakramente zu gleich gemeinschaftbildend- die Gläubigen werden zu einer Ge meinschaft verbunden, sie werden der Leib Christi, welcher innerlich durch Glaube und Liebe, äußerlich durch das Wort und die Sakramente zusammengehalten wird. Darum bekennt die Gemeinde: ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller (Ephes. 4, 5). Darin besteht das Wesen der Kirche, ein Weiteres ist nicht notwendig. Von jeher war dies der Grund von Spaltungen, daß man für notwendig erklärte, was Gott freigelassen hat. Wir müssen lernen, die alte Engherzig keit abzustreifen und nicht meinen, die menschlichen Ordnungen und Bräuche, in denen wir aufgewachsen sind, seien die besten oder gar allein richtig. Das ist ein beschränkter Sinn, welcher die geistige Freiheit des Reiches Gottes verkümmert. In neces-
sariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. 1) Art. XIII.
Viertes Kapitel.
Die selbständige Lebensäußerung der Gemeinde. Die Gemeinde verwaltet die Stiftungen, welche der Herr ihr hinterlassen hat, um das göttliche Leben in den Herzen zu erzeugen und zu mehren. Aber dieses Leben muß sich selb ständig äußern. Ein Kind ist abhängig von seiner Mutter, der es Leben und Nahrung verdankt, aber es ist zugleich selbst tätig: es nimmt die Nahrung, lächelt die Mutter an, streckt das Händchen nach ihr aus, weint bei ihrer Abwesenheit. Ein Kind, welches dieser Beziehung zur Mutter nicht selbst Aus druck gibt, ist ein Kretin. So nimmt die Gemeinde nicht passiv von dem Herrn Gnade um Gnade hin, sondern sie betätigt das neue Leben, indem sie die Gnade annimmt, nach ihr verlangt, sich dem Herrn hingibt. Diese geistige Hingabe an ihn ist die erste Betätigung des neuen Lebens: wir nehmen die Gnade durch den Glauben au und antworten ihm durch Gebet, indem wir Dank, Lob, Bitte und Gelübde ihm darbringen. Es ist ein Fehler, wenn ein Christ von der Gemeinde sich zurückzieht und auf Privatgottesdienst sich beschränkt, dabei verkümmert das neue Leben, nur in der Gemeinschaft kann es wachsen. Die Lebensäußerung der Gemeinde ist also der gemeinsame Glaube und das gemeinsame Gebet. Diese Tätigkeit nennen wir mit Recht Gottesdienst, denn sie bezieht sich allein auf den Gott, der uns nahetritt. Dann erst kehren wir wieder zur Welt zurück und betätigen das neue Leben als Bekenntnis des Glaubens, als Liebe zu den Brüdern, als Heiligung des Willens und des Wandels, als Geduld im Leid. Die Apostel rechnen in manchen Aussprüchen diese Betätigung des Glaubens auch zum Gottesdienst. Paulus nennt das den vernünftigen Gottesdienst der Christen, wenn sie ihre Leiber Gott hingeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer (Röm. 12,1). Jakobus sagt: ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott
77
dem Vater ist der: die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich von der Welt unbefleckt behalten (Jac. 1,27). Petrus fordert von den Christen, daß sie geistliche Opfer dar bringen, sie sollen sich enthalten von fleischlichen Lüsten und einen guten Wandel führen, damit sie verkündigen die Tugenden dessen, der sie zu seinem wunderbaren Lichte berufen hat (1. Pet. 2, 5—12). Gewiß, wer sich Gott zum Eigentum hingibt, sagt den Sünden ab, wandelt in der Liebe und der Heiligung. Der Glaube kann nicht ohne solche Werke sein. Darauf wollen die Apostel hinweisen. Von Anfang an hat es Christen gegeben, welche die Versammlungen der Christen besuchten, den Glauben bekannten, aber sie waren träge in ihren Sünden, man ver mißte bei ihnen Heiligung und Liebe. Solchen bezeugen die Apostel, daß ihr Gottesdienst eitel sei, sie sollen Gott dienen von Herzen, durch heiligen Wandel in der Welt. Aber wenn die Christen zusammenkommen, dann ist wenig Gelegenheit, ihren Wandel zu betätigen. Wohl sind sie erfüllt von Liebe zu den Brüdern, in den ältesten Zeiten fand diese Liebe Ausdruck in den Liebesmahlen, die mit der Versammlung verbunden waren, in dem Bruderkuß. Diese Betätigung der Liebe ver schwand aus den Versammlungen, als die Gemeinden groß wurden. Nur ein Rest davon ist geblieben: von Anfang an sammelte man beim Gottesdienst Liebesgaben für die Armen, so sammeln wir noch heute Gaben am Schluß der Gottes dienste. Die Tätigkeit der Gemeinde besteht darin, daß sie die dargebotene Gnade gläubig aufnimmt. Diesen Glauben betätigt sie sofort durch gemeinsames Gebet und gemeinsames Bekenntnis. Im Gebet wenden wir uns zu dem gnädigen Gott, bringen ihm Dank, Bitte, Gelübde dar. Sodann geben wir unserm Glauben Ausdruck durch gemeinsames Bekenntnis- dadurch werden wir uns selbst klar und erkennbar für die Ungläubigen. Das Bekenntnis war ursprünglich frei, in Worten der Schrift oder im Liede fand es seinen Ausdruck. Nur die Katechumenen lernten ein formuliertes Taufbekenntnis,' noch Augustin bezeugt, daß die Getauften das Symbol nicht im Gottesdienst hörten. Später nahm man ein festes Bekenntnis in den Gottesdienst
78
auf- Jacobus von Edessa bezeugt, zuerst habe es Petrus Gnapheus in die Liturgie von Antiochien aufgenommen (um 470); es war das Symbol von Nieaea. Seitdem wurde es in viele morgenländische Liturgien aufgenommen. Es dauerte lange, bis Rom sich zu dieser Aufnahme verstand, Rabanus Maurus und Remigius erwähnen es nicht in ihren Erklärungen der Messe. Auf Wunsch der gallischen Kirche verfügte Papst Leo 809: ego licentiam dedi cantandi symbolum, non autem cantando quippiam addendi, minuendi seu mutandi1).2 3Erst Bene dikt VIII. fügte das Credo in die Messe ein auf Wunsch des Kaisers Heinrich II.*). Luther nahm es 1523 in die Formula missae auf; in der deutschen Messe von 1526 gestaltete er es um zu dem Gemeindelied: Wir glauben all an einen Gott. Die protestantischen Liturgien haben zum großen Teil das alte gallische Symbol, andere haben ein Glaubenslied, andere über haupt kein Bekenntnis. Die preußische Agende von 1829 nahm es auf, ihr folgte Bayern 1879, Sachsen 1881, Anhalt 1883, Baden gab den Gebrauch frei. Das gallische Symbol ist allen andern überlegen durch Kürze und Klarheit der Sprache, durch Kraft des Glaubens, durch Reichtum der christlichen Wahrheit; es hat daher mit Recht allgemeine Verbreitung im Abendland gefunden. Ihm ist nur ebenbürtig das römische Symbol, welches im vierten Jahrhundert in Rom herrschte ^). Dieses aber ist jetzt ganz außer Gebrauch. Daher kann für den gottes dienstlichen Gebrauch nur das gallische Symbol, das sogenannte symbolum apostolieum, in Betracht kommen. Alle modernen Symbole sind dagegen matt. Das gilt auch von dem Be kenntnis, welches Nitzsch vorgeschlagen t)at4). Das gottesdienstliche Tun der versammelten Gemeinde beschränkt sich also auf zwei Handlungen: Aufnahme des an» 1) Baronius Annales IX p. 551. 2) Daniel, Codex liturg. 1,126, Fun cf, Katholische Liturgik 1,166. 3) August Hahn, Symbole und Glaubcnsregeln der alten Kirche Sette 13. 4) Verhandlungen der evangelischen Generalsynode in Berlin 1846. Zweite Abteilung Sette 79.
79
gebotenen Heiles durch Glauben, Bekenntnis und gemein sames Gebet. Man hat dieses Handeln der Gemeinde wohl als Opfer bezeichnet. Ursprünglich nannte man die dargebrachten Liebes gaben ein Dankopfer für Gott, später bezeichnete man das ganze gottesdienstliche Tun als ein Opfer. Melanchton unterscheidet Sakrament und Opfer in folgen der Weises: theologi recte distinguere solent sacramentum et
sacrificium. Sacramentum est cerimonia vel opus, in quo deus nobis exibet hoc, quod offert annexa cerimoniae promissio; econtra sacrificium est cerimonia vel opus, quo nos deo reddimus, ut cum honore afficiamus. Nach dieser Regel unter scheidet Zezschwitz beim Gottesdienst der Gemeinde das sakramentliche Tun und das sakrifizielle Tun. Sakramentliches Tun ist die Predigt des Wortes und die Verwaltung der Sakramente, Anbetung ist sakrifizielles Tun. Aber die Ver kündigung des Worts ist kein sakramentliches Tun, und das Gebet ein Opfer zu nennen ist gefährlich. Er meint das Dankopfer für die empfangenen Gaben, aber in der alten Kirche wurde aus dem Dankopfer ein Sühnopfer, welches der Priester darbrachte für Lebende und Tote,' dadurch wurde das Opfer Christi am Kreuz entwertet,' an die Stelle der realen Erlösung setzte man ein Abbild. Die Lehre, daß der Kultus ein Opfer für unsre Sünden sei, ist ein Rückfall auf den jüdischen Standpunkt. Wir verschmähen diese Ausdrücke und unterscheiden im Gottesdienst die Verwaltung der Gnadenmittel und die Anbetung. Damit haben wir alle Handlungen umschrieben, welche im kirchlichen Tun vorkommen. Die Gemeinde verwaltet die verliehenen Gnadenmittel, das Wort Gottes und die Sakra mente, durch welche in ihr das neue Leben erweckt oder gestärkt wird. Sodann gibt sie diesem neuen Leben Ausdruck durch Gebet, durch Betätigung der Liebesgemeinschaft und durch Be kenntnis. Mit diesen Handlungen befaßt sich die praktische Theologie und andere gibt es nicht. 1) Apologia art. 24 de missa.
80
Aber wo bleiben gewisse kirchliche Handlungen, welche eine große Bedeutung haben, wie die Konfirmation, die Trauung, die Beerdigung, die Ordination der Pfarrer? Man pflegt sie mit Taufe und Abendmahl als liturgische Akte zusammen zufassen und als Sakramentalien oder Sakramente zweiter Ordnung jenen anzuhängen und dieser Tätigkeit den Namen Liturgik zu geben. In diesem Verfahren steckt entweder römischer Irrtum, welcher der Kirche die Macht beilegt, Sakramente zu schaffen, oder es ist eine unüberlegte Zusammenstellung ganz ungleichartiger Handlungen, veranlaßt durch den äußerlichen Umstand, daß sie nach einer feierlichen, kirchlich vorgeschriebenen Form vollzogen werden. Diese äußerliche Ähnlichkeit hebt nicht den fundamentalen Vorzug der Sakramente auf. Die christ liche Gemeinde nimmt Teil an dem irdischen Ergehen ihrer Mitglieder, reicht ihnen in allen Lebenslagen den Beistand des Wortes dar zur Belehrung, Stärkung, Tröstung, begleitet sie mit Danksagung und Fürbitte. Aus dieser Liebesgemeinschaft haben sich jene kirchlichen Handlungen entwickelt. All diesen Handlungen ist ein ritus gemeinsam, der sich auch in andern Religionen findet: die Handauflegung. Sie ist kein sakra mentaler Akt, durch welchen eine göttliche Gnade mitgeteilt wird, dann müßte sie von Christo eingesetzt sein, sondern ein natürlicher menschlicher Akt, der schon in den ältesten Zeiten vorkommt. Der sterbende Jakob segnete seine Enkel Ephraim und Manasse, indem er ihnen die Hände auflegte und weissagte, was Gott an ihnen tun werde. Die Handauflegung war das Zeichen, daß Jakobs Gebet für sie geschehe (Gen. 48,14.18). Ebenso legte Jesus den Kindern die Hände auf, als er sie segnete (Mark. 10,16); er gab dadurch zu erkennen, daß er für sie sein Gebet zu Gott sandte. Zuweilen heilte Jesus Kranke, indem er ihnen die Hände auflegte. Auch hier ist Handauflegung das Zeichen, daß Jesus für sie zu Gott betete (Mark. 8, 23; 16,18). Ebenso heilte Paulus einen Kranken unter Handauflegung (Act. 28, 8). Hier ist immer die Hand auflegung Zeichen der Fürbitte. Sodann wurde die Handauf legung das Zeichen für Übertragung eines Amtes. Die Söhne Israels legten ihre Hände auf die Leviten, um ihnen den
81
Dienst am Heiligtum zu übertragen (Num. 8,10). Die Ge meinde in Jerusalem erwählte sieben Männer voll heiligen Geistes, damit sie zu Tische dienten, die Apostel übertrugen ihnen dies Amt durch Handauflegung (Act. 6,6). Als Barnabas und Saulus von Gott erwählt wurden zur Arbeit der Mission, da wurde ihnen das Amt durch Handauflegung übertragen (Act. 13, 3). Dabei wurde über sie gebetet; also die Hand auflegung bezeugte beides, daß über sie gebetet, und daß ihnen das Amt übertragen wurde. In der Apostelgeschichte wird zweimal erzählt, daß getaufte Christen bei der Handauflegung der Apostel die Gaben des Geistes empfangen hätten (Act. 8, 18; 19, 6). Auch hier ist die Handauflegung nicht als Ur sache der Geistesmitteilung zu verstehen, sondern als sichtbares Zeichen der auf sie gerichteten Fürbitte. Dasselbe ergibt sich aus 1. Tim. 4, 14: Paulus ermahnt den Timotheus, er solle nicht vernachlässigen die ihm zuteil gewordene Gnadengabe und erwähnt, daß sie ihm zuteil geworden sei kraft einer Weissagung unter Auflegung der Hände. Der Grund der Gabe ist eine Weissagung, die Handauflegung das begleitende äußere Zeichen. Nicht so scharf drückt Paulus sich aus (2. Tim. 1, 6): halte lebendig die Gnadengabe Gottes, welche in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. Auch hier ist gemeint, Timotheus habe die Gnadengabe empfangen durch die Fürbitte des Paulus, welche von der Handauflegung begleitet war. Dieser abgekürzte Ausdruck hat von Alters her Veranlassung gegeben, ein Sakra ment der Ordination aufzustellen, welches durch Handauslegung vollzogen wurde und den heiligen Geist mitteilte. Aber der Herr hat niemals solche Einrichtung getroffen; die Apostel hatten Macht, durch ihre Fürbitte den heiligen Geist mit zuteilen und begleiteten diese Fürbitte mit dem Zeichen der Handauflegung. Die Handauflegung ist nur ein menschlicher Ritus, durch welchen sichtbar gemacht wird, auf wen die Für bitte sich bezieht. Das ist keine leere Zeremonie, denn die Fürbitte ist wirksam und der Herr hat ihr Verheißung zugesagt; aber die Kraft der Handlung besteht in der Fürbitte, deren Zeichen die Handauflegung ist; nicht etwa in einer Geistes ausströmung, die von den Händen des Segnenden ausgeht. Sachsse, Praktische Theologie.
6
-
82
Solche naturalistische Vorstellungen liegen dem natürlichen Menschen nahe, sind aber als Anfänge des Aberglaubens ab zuweisen. Die genannten liturgischen Handlungen bestehen also aus der Verkündigung des Wortes und der Fürbitte, die letz tere wird durch Handaufleguug sichtbar gemacht. Wenn das Kind durch Unterweisung zum Glauben an Christum geführt und dadurch befähigt ist, die Güter des Abendmahls zu emp fangen, so wird es als gläubiges Glied von der Gemeinde anerkannt und durch Fürbitte dem Herrn befohlen, daß er es behüte und vollende. Das geschieht unter Handaufleguug. Wenn ein Brautpaar den Ehebund schließen will, so wird ihm Art und Segen des christlichen Ehestandes aus Gottes Wort dargelegt und auf sein Gelübde schallt die Fürbitte der Ge meinde zum Thron des Höchsten empor, daß er sie zeitlich und ewig segnen wolle. Das geschieht unter Handauflegung. Wenn ein Diener des Wortes gelobt hat, das Evangelium rein zu verkünden und alle Kräfte in seinen Dienst zu stellen, so bittet die Gemeinde für ihn, daß Gott ihn dazu mit seinem Geiste ausrüsten und kräftigen wolle. Das geschieht unter Hand auflegung. Wenn ein Christ gestorben ist, so gedenkt die Ge meinde dankbar der Wohltaten, welche Gott ihm erwiesen und durch ihn auch andern hat zuteil werden lassen, aus Gottes Wort wird den Lebenden Mahnung, Trost und Hoffnung dar gereicht und Fürbitte für sie an Gott gerichtet, daß sie das ewige Ziel erlangen. Das geschieht unter Handauflegung. Für die Verstorbenen zu bitten widerspricht der evangelischen Wahr heit. Auch die Absolution ist nichts andres als Verkündigung des Evangeliums und die an Gott gerichtete Bitte, den Buß fertigen die Vergebung zu erteilen. Alle diese Handlungen sind tröstlich, erbaulich- aber ihr Wesen und Kraft besteht immer nur int Wort und in der Fürbitte. Es sind geschichtlich ge wordene Formen, das Wort auszuteilen, die Fürbitte darzu bringen- sie gehören zum Wohlstand der Gemeinde, aber sie sind nicht heilsnotwendig. Es gab Zeiten, da hatte die Gemeinde keine Trauung, keine Konsirmation- es ist denk bar, daß sie wieder in Abgang kommen. Sie sind Formen, in denen die Gemeinde Wort unb Fürbitte ausübt, darum
können sie nicht mit den Sakramenten zusammengestellt werden. Die Anbetung als die erste und vornehmste Äußerung des Glaubens gebührt nur Gott, und zwar dem Gott, der sich in Jesu Christo geoffenbart hat. Er hat uns seine Liebe bewiesen, von ihm empfangen wir alle gute Gaben, er hat verheißen, uns aus aller Not zu helfen, darum sollen wir ihn allein an beten. Aber alle Gnade und Hülfe hat er uns geschenkt durch seinen Sohn, der mit dem Vater eins ist; darum können wir den Vater nicht anrufen ohne den Sohn. Das ist das Ge heimnis der Person Christi, welches wir durch den Glauben er fahren haben. Christus ist nicht nur unser Lehrer und Vor bild, sondern der Erlöser, an den wir glauben, der Heiland, den wir anbetend anrufen. Paulus wünscht den christlichen Gemeinden Gnade und Frieden von Gott dem Vater und dem Herrn Jesu Christo (Röm. 1, 7, 1. Kor. 1, 3, 2. Kor. 1, 2, Gal. 1, 3). Er betet zu dem Vater durch Jesus Christus (Röm. 1, 8). Seitdem die Gemeinde Christum erkannt hat als den erhöhten Herrn, hat sie auch ihm Anbetung erwiesen: Thomas füllt vor ihm nieder mit dem Bekenntnis: mein Herr und mein Gott (Joh. 21, 28), Stefanus rief ihn sterbend an: Herr Jesu, nimm nieinen Geist auf (Act. 7, 59). Das wurde bald das Merkmal der Jünger, daß sie Jesus im Gebet an riefen (Act. 9, 14. 21; 22, 16, 1. Kor. 1, 2). Paulus rief ihn an, daß er den Pfahl im Fleisch von ihm nehme (2. Kor. 12,6). So rufen die Christen den Vater und den Sohn an, denn die beiden find eins und können nicht getrennt werden, gleichviel, ob wir unsere Bitte an beit Vater oder den Sohn richten. Beim Pfingstfest ist es üblich, das Gebet auch an den heiligen Geist zu richten. Das aber ist ein Mißbrauch, wenn man das Merkmal des Glaubens darin findet, daß die Christen nur den Sohn anbeten. Das heißt, den Vater verachten, der den Sohn gesandt hat. Kreaturen anzurufen, ist den Christen unmöglich; solche Ehre gebührt ihnen nicht und sie können auch nicht helfen. Darum verwerfen wir es, die Heiligen anzurufen, denn wir sind der Meinung, daß hier zwischen anrufen und anbeten tat sächlich kein Unterschied sei. Auch sind die Heiligen nicht die
Mittler, durch welche wir-unsre Gebete vor Gott bringen,' wir kennen nur einen Mittler: Jesus Christus. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit, er ist die weltumfassende Persönlichkeit, allgegenwärtig bei seiner Gemeinde. Darum beten wir ihn an mit den himmlischen Heerscharen als unsern Herrn und König.
Fünftes Kapitel.
Die Hrtsgemeinde als das vornehmste Subjekt der kirchlichen Tätigkeit. Die Kirche ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die auf Erden sich erbaut durch Wort und Sakrament, die sich betätigt durch gemeinsames Gebet und Bekenntnis. Alle Gläubigen auf Erden bilden die eine Gemeinde der Heiligen. Aber um die Gnadenmittel zu verwalten, um Anbetung zu üben, müssen die Gläubigen zusammenkommen, sie müssen also zusammen wohnen. Darum ist die örtliche Gemeinde das vornehmste Subjekt der kirchlichen Tätigkeit. Das hängt mit unsrer irdischen Beschränktheit zusammen. Wir sind an den Ort ge bunden, darum können wir nicht mit denen zusammenarbeiten, die uns fern sind. Wir fühlen uns geistig verbunden mit allen Christen auf der ganzen Erde- aber mit den Christen in Berlin, London, New-Iork, Philadelphia können wir nicht das Abendniahl feiern ober beten. Im Reich der Vollendung werden alle Heiligen um den Thron ihres Königs versammelt sein, eine Herde bilden, sich persönlich alle kennen- jetzt aber gliedern sie sich in Ortsgemeinden, welche in demselben Hause ihren räum lichen Mittelpunkt haben. Das war von Anfang an die Ge stalt der Christenheit. Am Pfingstfest entstand die erste Ge meinde zu Jerusalem, dann entstanden Gemeinden in Judäa, Samaria, Galiläa (Act. 9,31), dann in Damaskus (Act. 9, 10), Antiochien (Act. 11,19). Besonders durch Paulus wurde das Evan gelium zu den Heiden gebracht- er predigte es in Kleinasien, Maze donien, Griechenland. Sobald an einem Orte eine Mehrheit von Gläubigen war, bildete sich eine Gemeinde. Paulus erkannte sie als
85
selbständige Körper an, die ihr eignes Leben führten, er schrieb Briefe an sie. Von diesen Gemeinden zweigten sich bald wieder Tochtergemeinden ab, die ebenfalls selbständig wurden wie die Mutter. So füllte sich der Erdkreis mit einer Menge christ licher Gemeinden- nicht nur die gesamte Christenheit führte den Namen ex-Aqota (Matth. 16,18), sondern jede Ortsgemeinde führte diesen Namen, daher gab es viele btxhjolai. So ist die Ortsgemeinde die wichtigste Form kirchlichen Seins, das vor nehmste Subjekt der kirchlichen Tätigkeit. Sie hat alles, was zum Wesen der Kirche gehört: sie ist die Gemeinde der Gläubigen, welche in geordneter Weise die Gnadenmittel verwaltet, das Wort und die Sakramente, sie betätigt ihren Glauben durch gemeinsames Gebet und Bekenntnis. Es kann nichts ange geben werden, was ihr zum geistlichen Leben fehlt. Rvm be urteilt die Bischöfe als Nachfolger der Apostel, die Gemein schaft mit ihnen als Bedingung der Zugehörigkeit zur christ lichen Gemeinde. Aber das ist menschliche Satzung- das Wesen der Kirche besteht nicht in Satzungen, sondern in gläubigen Personen, welche Wort und Sakrament haben. Wo diese sind, da wird sich die rechte Ordnung bilden. So ist die Voraus setzung, daß in jeder Gemeinde ein Kern gläubiger Christen ist, welche befähigt sind, über rechte Verwaltung des Wortes und der Sakramente zu wachen. Trifft das bei allen Ge meinden zu? Die Glieder einer Gemeinde sind das heute nicht geworden durch freie Entscheidung, sondern durch die Geburt. Als unmündige Kinder sind sie getauft worden, zu gläubigen Christen sollen sie erst erzogen werden. Bei vielen wird das nicht erreicht. Es gibt in der evangelischen Kirche Gemeinden, die sind wie willenlose Herden, sie tun, was die kirchlichen Oberen vorschreiben. Das entspricht nicht dem Wesen der christlichen Gemeinde, das ist die Wirkung der römischen Priester kirche oder der Bürokratie des staatlichen Landeskirchentums. Aber das Tote soll lebendig werden, dann erst kann die Ge meinde ihre Aufgabe erfüllen. Paulus schreibt in seinen Briefen stets an die Gemeinden und belehrt sie, wie sie ihr Verhalten einrichten sollen. Auch bei uns soll das Tote lebendig werden. Aber die Christen haben die Freiheit, dem Evangelium zu
86
widerstreben, dem Irrtum anzuhangen, der Sünde zu dienen. In unsrer Zeit ist der Irrtum weit verbreitet, die Sünde eine Macht geworden- das Evangelium wird von Christen ver worfen und bekämpft. Solche sollen nicht mitwirken bei Ordnung der christlichen Gemeinde. Kinder und junge Leute haben dabei überhaupt nicht mitzureden. Aber auch die Erwachsenen, welche konfirmiert sind und ein gewisses Alter haben, sollen nicht mit reden, wenn sie das Evangelium verwerfen,- nur die Gläubigen haben mitzureden. Aber woran kann man den Glauben er kennen? Hier entsteht eine Schwierigkeit, da niemand dem andern ins Herz sehen kann. So kann man nur gewisse Merk male aufstellen- daß jemand nicht einen unchristlichen Lebens wandel führe, nicht die Geringschätzung des Evangeliums be zeuge, daß er die kirchliche Gemeinschaft betätige durch Teil nahme am Gottesdienst und Abendmahl. Diese Forderung ist wichtig. Wenn alle Steuerzahler mitzureden haben, dann kann es geschehen, daß die, welche dem Evangelium ferne stehen, die kirchlichen Dinge ordnen, daß sie Prediger bestellen, welche das Evangelium verwerfen, wie das heute oft geschieht. Das heißt nicht die Gemeinde erbauen, sondern zerstören. Ein Weg zur Besserung ist es, daß nur solche zu Verwaltern der Gemeinde bestellt werden, welche am Gottesdienst und Abendmahl regel mäßig teilnehmen. Das müssen die fordern, welche mit Ernst Christen sein wollen. Sonst wird in der Gemeinde Unglaube und Irrlehre einreißen. Wenn Agitatoren das unwissende Volk aufreizen, Irrlehren zu Predigern des Evangeliums zu bestellen, dann wird die Verwirrung groß und die christliche Gemeinde zerrüttet. Die Ortsgemeinde hat dafür zu sorgen, daß Wort und Sakramente richtig verwaltet werden. Dabei soll sie den geistigen Zusammenhang mit den andern Genieinden bewahren. Auch dazu sind gewisse Ordnungen nötig, die sich geschichtlich gebildet haben. Wenn jede Gemeinde selbständig alles anordnet, dann zerfällt die Kirche und die Gemeinde wird leicht die Beute von Agitatoren, die sie auf Abwege führen. Als Luther an fing, die Gemeinden zu erneuern, da war er zuerst der Meinung, jede Gemeinde solle alles gemäß dem Worte Gottes einrichten-
87 ~ er billigte es, daß die Gemeinde Leißnig sich eine eigene Kirchen ordnung gab. Aber bald kam er von diesem Plan zurück, denn es drohte Verwirrung einzureißen. Er ersuchte den Kur fürsten, die Reformation der Genieinden durch bewährte Männer einzuführen und begründete diese Forderung damit, daß die Obrigkeit nicht nur für Ausführung der zweiten Tafel sorgen solle, sondern auch der ersten Tafel. Kurfürst Johann erließ 1528 den Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherrn; so be kamen die Gemeinden eine gleichmäßige Ordnung und der Willkür wurde gewehrt. Niemals haben die christlichen Gemeinden independentistisch gelebt, ohne sich um einander zu kümmern. Sie wußten, daß sie Glieder am geistlichen Leibe Christi waren und durch diese Gemeinschaft verbunden bleiben mußten. „Ihr seid ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid auf einerlei Hoffnung eures Berufes. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater unser aller" (Ephes. 4, 4. 5). Diese Einheit muß erhalten bleiben. Die Gemeinden sind stärker im Kampf gegen die umgebende Welt, ihre Sünden und Irr tümer, wenn sie untereinander verbunden sind. Auch haben die Gemeinden ein verschiedenes Maß christlichen Lebens und christlicher Erkenntnis- die bewährten, gereiften Gemeinden haben ein gewisses Ansehen bei den schwachen und wirken fördernd auf sie ein. Die Einheit des Glaubens gestaltet sich aus zur Einheit der Lehre, zur Einheit der Sittlichkeit, zur Einheit des Gvttcsdienstes. Diese Einheit ist jeder Gemeinde bei ihrer Begründung geschichtlich mitgegeben worden- von An fang hat nian sich beniüht, sie durch Ordnungen zu bewahren. Zuerst war die Autorität der Apostel das Band, welches die Einheit bewahrte- das Apostelkonzil (Act. 15) machte den ein gerissenen Streitigkeiten ein Ende. Die Apostel, Propheten, Evangelisten reisten von einer Gemeinde zur andern, durch ihren persönlichen Einfluß erhielten sie die Einheit. Sodann schrieben die Vorsteher größerer Gemeinden an benachbarte Gemeinden, um die Gemeinschaft zu erhalten. Als in Korinth t. I. 95 Streitig keiten ausgcbrochen waren, schrieb Clemens in Rom an die Gemeinde und ermahnte zum Frieden. Ignatius in Antiochien schrieb um d. I. 110 mahnende Briefe an die umliegenden Ge-
~
88
meinden. Auch besuchten sich die Bischöfe und verständigten sich, Amtsantritte der Bischöfe, Strafsachen, Empfehlungen wurden mitgeteilt. Seit 150 traten die Gemeinden durch Bischöfe zusanimen, um das gemeinsame Verhalten zu überlegen. In Kleinasien wurden die ersten Synoden gegen die Montanisten gehalten. Tertullian berichtet, die Schrift des Pastor sei von jedem Konzil unter die apokryphen und falschen Schriften ge stellt worden^. Im dritten Jahrhundert wurden Synoden in allen Provinzen abgehalten. Bald ging man in Ordnung aller kirchlichen Dinge zu weit, daß den Ortsgemeinden keine Frei heit mehr blieb. Tertullian berichtet, daß einige Christen am Sabbat beteten, ohne zu knien, während die andern knieten. Das habe in den Gemeinden große Unruhe erregt. Tertullian ermahnt, man solle daran kein Ärgernis nehmen, sondern Frei heit walten lassen. „Wir aber enthalten uns des Knieens nur am Sonntage als dem Tage der Auferstehung1 3)." 2 Bedeutender war der Streit um den Ostertermin. Als Polykarp von Smyrna den Bischof Anicet in Rom besuchte, stellte sich heraus, daß man den 14. Nisan in Kleinasien als Todestag des Herrn feierte, ohne auf den Wochentag zu achten, in Rom aber feierte man die Auferstehung des Herrn nur am Sonntag und dem gemäß den Tod am Freitag vorher. Beide trugen kein Be denken, die verschiedene Sitte bestehen zu lassen. Aber gegen Ende des zweiten Jahrhunderts mißbilligte Bischof Victor von Rom die asiatische Sitte, und als das Morgenland bei seiner Gewohnheit blieb, hob er die Kirchengemeinschaft mit ihm auf. Jrenäus mißbilligte das und hielt ihm den Anicet als Beispiel üor3). Der Zug der Kirche ging dahin, in allen Gemeinden Gleichförmigkeit in der Lehre und den kirchlichen Bräuchen herbeizuführen. Dies wurde durch die ökumenischen Konzilien erstrebt. Leider haben sie die Einheit der Kirche nicht erreicht; die Christenheit teilte sich in die morgenländische und abendländische Kirche) die letztere zerspaltete sich wieder durch die Reformation.
1) De pudicitia 10. 2) De oratione 18. 3) Eusebius hist, eccles. V 23, 24.
89
Die Einigkeit herzustellen, scheint unmöglich. In der evan gelischen Kirche Deutschlands wurde der Landesherr Regent der christlichen Gemeinden und übte diese Gewalt durch die Konsistorien aus. Er forderte Einheit des Bekenntnisses gegenüber den Jrrtüniern, Einheit des christlichen Wandels gegenüber den Un sitten, Einheit des Gottesdienstes und der kirchlichen Bräuche gegenüber der Willkür. Sodann hatte er für die Ausbildung, Berufung und die richtige Amtsführung der Pfarrer zu sorgen. Dadurch wurde ein Staatskirchentum aufgerichtet, die Herrschaft der weltlichen Obrigkeit in der Kirche- die Tätigkeit der Ge meinde wurde sehr eingeschränkt. Begründet wurde diese un genügende Einrichtung durch die Behauptung, das Recht der Bischöfe fei auf die Landesfürsten übergegangen. Im letzten Jahrhundert forderte die Gemeinde nicht nur mehr politische Rechte, sondern auch niehr Freiheit für die kirchliche Arbeit. Es ist nur zu loben, wenn die Gemeinde sich au der kirchlichen Arbeit beteiligen will- aber die Grundlagen der evangelischen Kirche dürfen nicht angegriffen werden. Rechte Verkündigung des biblischen Evangeliums und rechte Verwaltung der Sakra mente niüssen bleiben. Wir fordern nicht von den Predigern dieselbe Dogmatik, aber dasselbe Evangelium- verschiedene theologische Richtungen werden immer sein und führen dazu, das Evangelium besser zu verstehen. Aber die Freiheit der Richtungen darf nicht dahin führen, daß das Evangelium untergraben wird. Das hat die Aufklärung getan, wenn sie behauptet, Jesus habe ein anderes Evangelium gepredigt, als seine Apostel. Dieser Irrtum wird nicht dadurch Wahrheit, daß viele ihn teilen. Die Aufklärung hat uns von manchem Jrrtuni befreit, aber sie beruht nicht auf religiöser Kraft, sondern aus Kritik- es ist ihr bis heute ver borgen, daß das Evangelium Jesu das Evangelium der Apostel in sich enthält. Die Lehre von dem doppelten Evangelium ist ein kräftiger Jrrtuni, den die evangelische Kirche überwinden muß. Das ist die große Ausgabe der Gegenwart, an der alle gläubigen Christen mitarbeiten müssen. Die Gemeinden haben dafür zu sorgen, daß das alte Evangeliuni unverkürzt ge predigt wird.
90 Der rechte Glaube gestaltet sich aus zu christlicher Sitt lichkeit. Sie soll sich beweisen in fleißigem Besuch der Gottes dienste, in der Pflege des neuen Lebens. In der ältesten Zeit kamen die Christen täglich zusammen, sie führten ein gemein sames Leben.
Auch heute genügt es den Christen nicht, wenn
sie nur Sonutags tut Gottesdienst zusammenkommen; sie wollet! öfter Gottes Wort hören.
Man komme diesem Verlangen ent
gegen durch freie Vorträge, durch biblische Besprechungen. Schon in Korinth gab es besondere Hausgemeinden- dies Recht hätte man den Pietisten nie bestreiten sollen.
Daß die Gefahr der
Überhebung oder der Trennung vorliegt, ist nicht ohne weiteres zu behaupten - solche Versammlungen können auch zur Förderung des gemeinsamen Lebens dienen. Auch der kirchliche Gesang kann ein Band der Gemeinschaft werden, wenn die alten Choräle oder der kirchliche Kunstgesang geübt wird zur Belebung der Gottesdienste. trieben werden.
Auch die Liebesarbeit
soll gemeinsam ge
Es soll keine christliche Gemeinde sein, wo die
Kranken vergessen werden, wo die Kinder hungern oder frieren wo das noch der Fall ist, tut die Gemeinde ihre Pflicht nicht. Auch durch angemessene Geselligkeit kann die Gemeinschaft gefördert werden, patriotische oder kirchliche Feste führen die Christen zusammen und machen sie bekannt.
Es ist zweckmäßig,
besondere Vereinshäuser zu errichten, welche den Mittelpunkt der freien Gemeinschaft bilden. Die christliche Jugend soll man auch versammeln zu leiblicher Übung und harmlosem Spieldabei müssen die Alten sorgen, daß nicht ein leichtfertiges, unchristliches Treiben einreiße. In einer christlichen Gemeinde darf nicht Unzucht oder Trunkenheit herrschen, solchen Sünden soll der Geist der Gemeinde sich widersetzen- wo solche Sünden vorkommen, soll freundliche Ermahnung und heiliger Ernst ihnen entgegentreten. Wer von solchen Sünden nicht lassen will, dem bedeute man, daß er nicht zur christlichen Gemeinde gehört.
Die christliche Gemeinschaft ist nur dauerhaft, wenn
sie auf gemeinsamem Glauben und frommer Gesinnung beruht. Dann aber soll man den Christen Freiheit lassen- viele Gesetze töten das Leben, Mannigfaltigkeit schadet nicht, wenn in der Hauptsache Einheit herrscht.
Die Vorsteher sollen nicht über
91
die Gemeinden herrschen, sondern ihre Freiheit achten und Ge hilfen ihrer Freuds sein- dann wird sich eine friedvolle Zusammen arbeit ergeben. Dahin muß jede Gemeinde streben.
Sechstes Kapitel.
Die Ämter in der Gemeinde. Alle Christen sind ein priesterlich Volk, der alttestamentliche Unterschied zwischen Priester und Laien ist aufgehobenals Kinder Gottes sind alle berechtigt zu Gott zu nahen, zu beten, sein Wort zu verkünden, die Sakramente zu verwalten. Aber um der Ordnung willen müssen einzelne mit diesen Ge schäften beauftragt werden. Was allen gemein ist, das darf der einzelne nicht an sich reißen, so sagt Luther in der baby lonischen Gefangenschaft. In jeder Gemeinde besteht der Unter schied zwischen niündigen und unmündigen Christen. In der Familie haben die Eltern ihre Hausgenossen zu Gebet und Schriftlesen anzuhalten- als ihr Gehülfe tritt der Lehrer hinzu. Aber auch unter den Erwachsenen ist ein Unterschied in Glaube, Erkenntnis, Fähigkeit der Rede- indem die Gemeinde die Be fähigten beauftragt, entsteht ein Amt in der Gemeinde- auch dadurch wird die Kirche sichtbar. Jesus hat nur ein Amt ein gesetzt: nachdem er die Zwölf durch seine Predigt zum Glauben geführt hatte, berief er sie, das Evangelium andern zu predigen und durch die Taufe in die Gemeinde aufzunehmen. Darum nannte er sie Apostel (Matth. 10, 2, Marc. 6, 30, Luc. 6,13). Der Name bezeichnet zunächst jeden Abgesandten. Darum heißt es Joh. 13, 16: Der Gesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Paulus nennt den Epaphroditus den Apostel der Philipper, weil sie ihn mit einer Gabe zu ihm gesandt haben (Phil. 2, 25). Auch die Boten, welche eine Gabe der griechischen Gemeinden nach Jerusalem bringen sollten, werden Apostel der Gemeinden genannt (2. Kor. 8, 23). Hier ist noch kein Amts name. Aber die Zwölf in Jerusalem nahmen eine hervorragende Stellung ein: als die ersten Jünger Jesu verkündeten sie sein
92
Evangelium, gründeten die ersten Gemeinden. Sie gehen zur Revision nach Samarien und billigen, was andere dort gewirkt haben (Act. 8,14). Als Paulus seine Wirksamkeit entfaltete, legte er Wert darauf, von den Zwölfen anerkannt zu werden (Gal. 2,2); er nennt sie die Angesehenen, die für Säulen galten. So wurde ihr Name der Amtsname für solche Männer, welche Jesus selbst beauftragt hatte, sein Evangelium auf Erden auszubreiten und die sich durch Wunder ausweisen konnten. In diesem Sinne nimmt Paulus den Namen für sich und Barnabas in Anspruch. So in der Überschrift der Briese an die Römer, an die Korinther, an die Galater. Er begründet es daniit, daß er den Herrn gesehen hat (1. Kor. 9,1), daß er seine Lehre von dem Herrn empfangen hat (I.Kor. 11,23, Gal. 1,12), daß er die Merkmale eines Apostels gegeben habe, nämlich Wunder und Zeichen (2. Kor. 12, 12). Und zwar habe er Auftrag für die Heiden empfangen, wie jene für die Beschneidung (Röm. 11, 13; Gal. 2, 9). Daher werden Paulus und Barnabas in der Apostelgeschichte Apostel genannt (Act. 14, 4. 14); Paulus selbst nennt den Barnabas einen Apostel (1. Kor. 9,6; Gal. 2,9). Auch Jakobns, den Bruder des Herrn, bezeichnet er also (Gal. 1,19, I.Kor. 15,7). Weiter dehnt Paulus den Apostelnamen nicht aus; denn Röm. 16, 7 ist zu übersetzen: wohlbekannt bei den Aposteln. Wohl kennt er falsche Apostel (2. Kor. 11,13), die es nicht sind, wie auch Offenb. Joh. 2, 2. Clemens von Rom, Ignatius, Polykarp, Justinus geben biefeit Ehrennamen nur den Zwölfen und dem Paulus. Apostel sind also nur die Männer, welche Jesus selbst durch Offenbarung zur Begründung seines Reiches berufen hat. Ihr Amt beschränkte sich nicht aus eine Ortsgemeinde, sondern erstreckte sich auf die ganze Kirche und starb mit ihnen aus. Neben ihnen gab es schon in der ältesten Gemeinde Christen, welche durch den Geist befähigt wurden, der Gemeinde zu dienen. Paulus zählt diese Gaben auf 1. Kor. 12,28. Er kennt Propheten, welche den Willen Gottes kund tun; Agabus und andere verkündeten eine große Hungersnot (Act. 12, 28), Agabus verkündete, Paulus solle in Jerusalem gebunden und den Heiden überliefert werden (Act. 21, 10). Judas und Silas waren
93
solche Propheten (Act. 15, 32). Sie redeten in Ekstase, aber verständliche Worte. Sie beschränkten sich nicht auf eine Ge meinde,' wo sie auftraten, hatten sie ein besonderes Ansehen. Justin der Märtyrer kennt noch solche Propheten^)- erst die montanistische Bewegung brachte sie um ihr Ansehen. Sodann gab es Lehrer, welche durch den Geist das Evangelium deutlich machten- zu ihnen gehörten wohl auch die Katecheten (Gal. 6,6). Jakobus warnt die Christen, sie sollten sich nicht zu dieser Arbeit drängen (Jac. 3, 1). Timotheus besaß die Gabe der Lehre (1. Tim. 4, 14). Auch die Apostellehre (13, 2) kennt Lehrer, welche sich zeitweise in einer Gemeinde niederlassen. Weiter kennt Paulus Christen, welche Kräfte und Heilungen ausüben, welche die Gabe der Unterstützung, des Regiments, des Zungenredens besitzen. Das alles waren Geistesgaben, aber nicht Ämter. Wo eine Gemeinschaft sich versammelt zu einem bestimmten Zwecke, da müssen Männer beauftragt werden, die Versammlung zu berufen und zu leiten, diejenigen Handlungen anzugeben, welche zur Erreichung des Zweckes nötig sind. Die erste christ liche Gemeinde bildete sich in Jerusalem- die vom Herrn be rufenen Aposteln waren zugleich die ersten Vorsteher dieser Ge meinde. Bald stellte sich heraus, daß sie alle erforderliche Arbeit nicht leisten konnten- auf ihre Veranlassung wählte die Ge meinde sieben Männer, welche die gemeinsamen Mahlzeiten und die Pflege der Bedürftigen besorgen sollten, während die Apostel die gemeinsamen Gottesdienste, das Gebet und die Verkündigung des Wortes wahrnahmen (Act. 6). Act. 15, 2. 6. 22 hören wir, daß in Jerusalem neben den Aposteln Älteste waren. Es scheint nicht, daß dies die gewählten Armenpsteger waren, sondern andere Beamte. Wann und wozu sie gewählt wurden, wird nicht berichtet- vermutlich werden sie die Apostel vertreten haben, wenn diese abwesend waren. Von Paulus und Barnabas wird berichtet, daß ne in jeder neuen Gemeinde Älteste einsetzten zur Leitung der Gemeinde- denn so war es in Jerusalem, so in den jüdischen Gemeinden (Act. 14, 23). Von ihnen sagt Paulus, 1) Dialogus 39, 81, 88.
94
daß sie berufen seien vom heiligen Geiste, zu weiden die Ge meinde des Herrn (Act. 20,17); darum nennt er sie auch Aufseher, Bischöfe (v. 28). Dabei ist es auffallend, daß bei den großen Mißgriffen, die in Korinth und Galatien vorkamen, der Apostel niemals die Ältesten an ihre Pflicht erinnert, sondern sich an die Gemeinden selbst wendet. Wir dürfen daraus wohl schließen, daß diese Männer damals gewisse Aufträge hatten, aber kein Amt mit Autorität. Doch werden die Christen ermahnt, sich Männern wie Stefanas in Korinth willig unter zuordnen (1. Kor. 16, 15). Erst in der Gemeinde zu Philippi finden wir zwei Ämter zur Verwaltung der Gemeinde: die Bischöfe und die Diakonen (Phil. 1, 1); dasselbe war un zweifelhaft in vielen Gemeinden der Fall. Auch Petrus er mahnt die Presbyter, die Gemeinde des Herrn zu weiden und zu beaufsichtigen von Herzen (1. Petr. 5, 1. 2). Wir schließen aus diesen fragmentarischen Nachrichten, daß nach dem Vorbild der jüdischen Gemeinden in jeder christlichen Gemeinde die Ältesten oder ein gewählter Ausschuß der Ältesten den Vor stand bildeten, welcher die Leitung und Aufsicht der Gemeinde hatte; darum hießen sie auch Mazonoi Dieser Vorstand ver teilte unter sich die notwendigen Geschäfte: die Anordnung der Versammlungen und der Liebesmahle, die Sammlung und Auf bewahrung der Gaben, die Verteilung an Arme, den Unterricht der jungen Christen, die Aufsicht über den Wandel. Zur Aus führung waren ihnen jüngere Christen als Gehülfen beigeordnet (öiuxovoi). Reden durfte in den Versammlungen jeder; es war natürlich, wenn keine Apostel und Propheten zugegen waren, daß dann die Befähigten sich der Lehre unterzogen; die Presbyter sollen besonders geehrt werden, die sich abmühen im Wort und in der Lehre (1 Tim. 5,17). Die Lehre wurde allmählich Pflicht der Ältesten, wenn keine Propheten und Lehrer vorhanden warenx). Über die Austeilung des heiligen Mahles fehlen uns ge nauere Nachrichten; nur das sehen wir, daß es von der täg lichen gemeinsamen Mahlzeit schon in Korinth getrennt wurde (1. Kor. 11, 34), also rein religiösen Charakter bekam. Auch 1) Apostellehre 15.
-
95
berichtet Plinius, daß die Mahlzeiten getrennt von dem Wort dienst zu späterer Stunde gehalten wurden. Allmählich trat eine Änderung dieser Ordnung ein. In den Pastoralbriesen findet sich ein Kollegium der Alten, welche eine Ehrenstellung einnehmen- einer der Ältesten hat die Oberleitung und sührt allein den Namen biiaxonog, die Diakonen wurden seine Gehülfen. Aus den Eigenschaften, die von ihm gefordert werden, schließen wir, daß er den Gottesdienst leitete, die gemeinsame Kasse und die gespendeten Liebesgaben verwahrte. Die Ober herrschaft des Bischofs ist bei Ignatius völlig ausgebildet und hat sich im zweiten Jahrhundert überall durchgesetzt. Allmählich wurde aus dem Dienst ein Amt, aus dem Auftrag der Ge meinde eine Herrschaft über die Gemeinde. Zugleich schlich sich die alttestamentliche Anschauung des Priestertums ein, welches für die Gemeinde Gott Opfer darzubringen habe. So hat sich in der christlichen Gemeinde ein Amt ausgebildet, welches die Fülle aller geistlichen Gaben und die Vollmacht aller religiösen Verrichtungen in sich trug. Die Bischöfe waren als Nachfolger der Apostel mit dem Geist ausgerüstet, darum befähigt, die gött liche Wahrheit darzulegen- sie hatten die Gemeinde zu regieren, den Gottesdienst anzuordnen, die Armen zu versorgen, die Sittenzucht aufrecht zu erhalten- sie allein hatten den Anftrag, zu binden und zu lösen, sowie die Fähigkeit, geistliche Gaben zu übertragen. Bei ihren Geschäften standen ihnen die Pres byter als Gehülfen zur Seite- aus dem früheren Primat der Bischöfe war ein Supremat geworden. Eine Veränderung der bischöflichen Würde brachte die geschicht liche Entwicklung im Abendland. Im Mvrgenlande, in Afrika und Italien war der Bezirk des Bischofs nicht groß: in der Regel eine größere Stadt mit umgebenden Dörfern. In Spanien und Gallien breitete sich das Christentum zunächst in den römischen Kolonien aus, die Christen daselbst wurden dem Bischof unterstellt. Die umwohnenden Heiden wurden von da aus allmählich bekehrt, blieben aber dem Bischof unterstellt, so hatte der Bischof viele Gemeinden zu verwalten, sein Sprengel hatte die Größe einer Prvvinz. Dasselbe war in Deutschland der Fall- die Be kehrung der Germanen geschah von wenigen Mittelpunkten
96
aus- dort war der Sitz des Bischofs- die umliegenden Ge meinden verwaltete er durch delegierte Presbyter und Dia konen. An der Kathedrale lebten oft die Presbyter zusammen, bildeten ein beratendes Kollegium, welches bei Vakanzen den Bischof zu vertreten und für baldige Wiederbesetzung zu sorgen hatte, dort wurden auch junge Kleriker ausgebildet. Die Herr schaft über den Sprengel betätigte der Bischof durch Visitationen und die Firmung. Die Presbyter auf den Dörfern gewannen bald eine selbständigere Stellung durch kirchliche Stiftungen, die ihnen zuflössen. Sie galten zwar immer als Beamte des Bischofs und unterstanden seiner Aufsicht- aber abberufen oder absetzen konnte er sie nicht nach Willkür, sondern durch ein ge richtliches Verfahren. Die Reformation schuf eine ganz neue Verfassung. Als die Bischöfe sich dem Evangelium versagten, mußte Luther dazu übergehen, selbst Pfarrer einzusetzen: denn das sei Gottes Ord nung. Schon früher sagte er, wir werden allesamt durch die Taufe zu Priestern geweiht- wer getauft ist, darf sich rühmen, daß er zum Priester, Bischof, Papst geweiht sei. Aber nicht jedem ziemt es, solches Amt zu üben - bettn weil wir alle Priester sind, soll niemand sich herfürtun und ohne unser Be willigen das tun, deß wir alle gleiche Gewalt haben. Denn was allen gemein ist, darf niemand ohne der Gemein und Befehl an sich nehmen. Um der Ordnung willen hat Gott ge ordnet, daß der öffentliche Dienst an Wort und Sakrament von der Gemeinde einzelnen Personen übertragen werde. Daher sagt die confessio augustana (art. V.): ut hatte fidem consequamur, institutum est Ministerium docendi evangelium et porrigendi sacramenta. Das war nach Luthers Meinung die ursprüngliche Aufgabe der Bischöfe und so stellt er das alte Bisckiossamt wieder her. Eine geordnete Gemeinde ist da, wenn, die Gemeinde sich um das Amt versammelt hat. Nicht das Amt ist das erste, welches eine gläubige Gemeinde schafft, sondern die gläubige Gemeinde ist das erste, welche das Amt ordnet. Nicht die halten wir für Bischöfe, welche vorgeben, Nachfolger der Apostel zu sein, sondern welche von der Gemeinde berufen werden und Christi Wort und Sakrament verwalten. Daher
97
sagen die Schmalkaldischen Artikel: ubicunque eat ecclesia, ibi est jus administrandi evangelium, quare necesse est, ecclesiam retinere jus vocandi, eligendi et ordinandi ministros. Huc pertinent sententiae Christi, quae testantur, clavea ecclesiae datas esse, non certis personis. Nun können wir die alte Streitfrage beantworten: Hat Jesus das Predigt amt eingesetzt? Jesus hat nur den Apostolat eingesetztdie Apostel sollten die Botschaft vom Reich allen Völkern bringen. Die Bischöfe sind keine Apostel, denn ihre Tätigkeit beschränkt sich auf bestimmte Gemeinden- aber sie haben die Aufgabe, das Evangelium zu predigen und zu taufen über nommen im Auftrag der Kirche. Das kirchliche Amt übernimmt also den Auftrag der Apostel in beschränkter Weise- daß aber in jeder Gemeinde ein Mann damit betraut wird, daß er die Verwaltung, die Armenpflege, die Sittenzucht dazu übernimmt, beruht nicht auf einer Einsetzung Christi, sondern auf geschicht licher Entwicklung und innerer Zweckmäßigkeit. Es wäre wohl möglich, daß int Lauf der Zeit die Gemeinde eine andere Ordnung als zweckmäßiger bevorzugte. Anders ist die reformierte Anschauung vom kirchlichen Amte. Calvin kehrts, Gott habe von Anfang an bestimmte Männer berufen, die seinen Willen verkündeten. Er hätte sich ja jedem besonders offenbaren können, aber um die menschliche Gemein schaft, Liebe und Pietät zu pflegen, habe er sein Wort immer durch berufene Männer predigen lassen. Zu dem Zweck habe er drei vergängliche Ämter und zwei dauernde gestiftet. Ver gänglich, weil nur für die grundlegende Zeit bestimmt, waren die Apostel, Propheten, Evangelisten - als bleibende Ämter setzte er ein die Lehrer und Hirten, letztere werden auch Bischöfe oder Älteste genannt. Calvin sieht also in einer Ordnung, die Paulus traf, ein göttliches Gebot- wo die Lehrer eingesetzt sind, darauf bleibt er die Antwort schuldig. Ebenso lehrt die Con fessio helvetica posterior von Bullinger 1566: apostoli per omnes mundi ecclcsias ordinarunt pastores et doctores ex praecepto Christi, per quorum successores hucusque ecclesiam 1) Instit. IV, 3. Sachsse, Praktische Theologie.
98
docuit atque gubernavit. Aber ein solches praeceptum Christi ist nicht nachweisbar- eine geschichtlich gewordene Ordnung wird für ein Gebot Christi ausgegeben. Diese reformierte Lehre vom Amt ist als lutherisch verteidigt worden von Stahl, Löhe, Vilmar. Daß dies ein Irrtum war, haben Höfling, Harleß, Zezschwitz überzeugend nachgewiesen.
§ 2.
Die Funktionen des Hemeindepfarrers.
Nach römischer Lehre hat der Gemeindepfarrer zwei Be fugnisse, die potestas ordinis und die potestas jurisdictionis. Die erstere besteht in dem Auftrag, das Meßopfer darzubringen für die Sünden der Gemeinde: ordinis potestas ad verum Christi domini Corpus in sacrosancta eucharistia refertur1); est potestas consecrandi, offerendi et ministrandi corpus et sanguinem salvatoris2). Dazu rechnet der Katechismus 3) noch die Tätigkeiten, welche die Menschen zum Empfang der Eucharistie geschickt machen: ordinis potestas non solum consecrandae eucharistiae vim et potestatem continet, sed ad eam accipiendam hominum animos praeparat et idoneos reddit et cetera omnia complectitur, quae ad eucharistiam quovis modo referri possunt. Dann würde die potestas ordinis auch eine gewisse Lehrtätigkeit und die Vergebung der Sünden in sich be greifen. Die potestas jurisdictionis tota in Christi corpore mystico versatur; ad eam enim spectat, Christianum populum gubernari et moderari et ad aeternam coelestemque beatitudinem dirigere4). Diese Unterscheidung ist nicht klar, das letztere gebührt auch der potestas ordinis. Wir sagen also deutlicher, zur potestas jurisdictionis gehören alle diejenigen Tätigkeiten, welche sich nicht aus die Eucharistie beziehen d. h. die Verwaltung der übrigen Sakramente, die Bußzucht, die Lehrtätigkeit an Jung und Alt, die Verwaltung der Gemeinde. Darum wird die 1) 2) 3) 4)
Cat. Rom. II, 7 quaest. 6. Conc. trid. 8686. 23, 1. Quaest. 7. Cat. Rom. II, 7, 6.
99
potestas absolvendi zur potestas jurisdictionis gerechnet Es ist daher unrichtig, wenn Walter, Philipps, Klee, dem Priester noch eine dritte Funktion überweisen: die potestas magisterii; denn einerseits ist das Lehren ein Mittel, durch welches er beide potestates ausführt,- andrerseits verwirft das Konzil (sess. 23, 1) es als einen Irrtum: eos qui non praedicant, prorsus non esse sacerdotes. Das Predigen ist keine not wendige Funktion des Gemeindeamtes. Die potestas ordinis hat jeder Priester kraft der Weihen, welche ihm den character indelebilis verleihen. Die potestas jurisdictionis hängt von dem besondern Auftrag des Bischofs ab und kann wieder ent zogen werden. Dagegen lehrt die evangelische Kirche, das Pfarramt habe zwei Funktionen: das Wort Gottes zu verkünden und die Sakramente zu verwalten?). Das entspricht dem Grundsatz, daß Gott allein durch Wort und Sakrament Glauben und Seligkeit wirke. Darum wird das Pfarramt kurzweg genannt: Ministerium verbi et sacramentorum. Diese klare Bestimmung ist in der lutherischen Kirche da durch undeutlich geworden, daß an manchen Stellen noch eine dritte Funktion des Pfarramts genannt wird: die potestas clavium (Conf. august. 28). Sofern man darunter das Recht der Kirchenzucht meint, steht sie nicht dem Pfarramt, sondern dem Gemeindevorstaud zu. Wenn man aber darunter die Absolution in der Privatbeichte meint, so ist sie nichts anderes als die Verkündigung des Evangeliums an den einzelnen. Sie verkündet den gewissen Willen Gottes, jedem Bußfertigen zu vergeben. Der Streit, ob die Absolution deklarativ oder effektiv sei, kann nur in ersterem Sinne entschieden werden. Gottes Vergebung habe ich, sobald ich die Sünde von Herzen bereue und Gnade begehre, nicht erst dann, wenn der Diener sie mir verkündet,- diese Verkündigung soll nur meinen Glauben stärken. Die potestas clavium des Dieners ist also nichts von 1) Conc. trid. 23, 1 Cat. Rom. II, 5 quaest. 54. 2) Conf. Aug. 28 § 12 ecclesiae potestas suum mandatum habet evangelii docendi et administrandi saeramenta.
100
der praedicatio evangelii verschiedenes, sondern eine Art der selben. Calvin sagt daher mit Recht: Cum de clavibus agitur, semper cavendum est, ne facultatem aliquam somniemus ab evangelii praedieatione separatam. So ist also das Pfarramt eine unter Leitung des Heiligen Geistes geordnete Einrichtung, kraft welcher die der Kirche an vertrauten Stiftungen Christi, Wort und Sakrament um der Ordnung willen solchen Personen zur öffentlichen Verwaltung übergeben werden, welche durch Frömmigkeit und theologische Bildung sich geeignet erweisen. Deshalb ist dieses Amt der Mittelpunkt der christlichen Gemeinde, von welchem Ströme des Lichtes und des Geistes ausgehen. Vorbild des Pfarrers soll der Hirte Jesus sein. Zweck ist, daß die Herde Leben und volles Genügen hat- die Mittel dazu sind, daß der Hirt die Schafe kennt (Joh. 10,13), daß er vor ihnen hergeht (V. 4), und daß er bereit ist, sein Leben für sie hinzugeben. Damit er dieser Pflicht genüge, darf die Gemeinde nicht zu groß fein; mehr als 3000 Seelen kann ein Pfarrer nicht versorgen. Das ist der schlimmste Notstand unsrer Zeit, daß wir unübersehbare Gemeinden und zu wenig geistliche Kräfte haben. Daher sind in großen Gemeinden zur Unterstützung der Pfarrer semina ristisch ausgebildete Seelsorger anzustellen. Solche hat Wichern ausgebildet in den Brüdern des Rauhen Hauses, Engelbert in der Diakonenanstalt zu Duisburg, Christlieb int Johanneum zu Bonn, später in Barmen. In der Stadtmission zu Berlin und zu Hamburg hat diese Arbeit große Bedeutung gewonnen; sie muß weiter ausgebreitet werden. § 3.
Die anderen Ämter in der Gemeinde.
Die Verwaltung des Wortes und der Sakramente ist die wichtigste Tätigkeit der Gemeinde, aber nicht die einzige. Die Gemeinde soll dafür sorgen, daß alles bei ihr ordentlich zu geht, daß ihre Armen versorgt, daß die Bösen und Gott losen zurecht gewiesen werden. Zwar soll die Versorgung der Armen von der ganzen Gemeinde geschehen, aber schon die Apostel forderten, daß besondere Männer zur Pflege der
101
Dürftigen in Jerusalem eingesetzt wurden (Act. 6). In den Paulinischen Gemeinden besorgten das die Bischöfe, ihnen wurden Diakonen als Gehülfen beigegeben (Phil. 1, 1). Ebenso soll die Gemeinde die Sünde nicht dulden und Zucht des Wandels fordern- das hat Jesus selbst geboten (Matth. 18) und daher fordert Paulus in Korinth von der ganzen Gemeinde, daß sie Zucht übe gegen einen groben Sünder (1. Kor. 5, 5). Aber bei großen Gemeinden ist das unausführbar, daher wurde die Sittenzucht bald von den Vorstehern der Gemeinde geübt. Auch sind bei einer Gemeinde mancherlei Anordnungen zu treffen über Ort und Zeit, über Besitz und Einrichtungen, wo die Gemeinde ebenso mitzubestimmen wie beizusteuern hat. Daher ist jeder Gemeinde ein Vorstand nötig, welcher diese Dinge im Auftrag der Gemeinde ordnet. Die evangelische Kirche hat von Ansang an einen solchen Vorstand gefordert (Presbyterium, Gemeindekirchenrat). Bei der hervorragenden Wichtigkeit des Pfarramtes ist es naturgemäß, daß der Pfarrer diesen Vorstand leitet, und daß seine Mitglieder den Pfarrer unterstützen. Diese Ämter beruhen nicht auf göttlicher Ein setzung, wie Calvin behauptet, sondern sind apostolische Ein richtungen, die sich noch heute als zweckmäßig darstellen. Wenn diese Ämter in lutherischen Gebieten weniger gepflegt sind als in reformierten, so lag das an der Unmündigkeit der Gemeinden. Jetzt fordern die evangelischen Gemeinden mit Recht, daß sie bei der Verwaltung ihrer Angelegenheiten mitsprechen- alle neueren Kirchenordnungen befriedigen diese Forderung. Neben den geordneten Ämtern hat es allezeit in der Kirche charismatische Dienste gegeben. Der Pfarrer soll solche Gaben nicht unterdrücken, sondern als Beihilfe gerne annehmen und pflegen. Durch Betonung ihrer Amtswürde und Furcht vor Unordnungen haben manche Pfarrer solche Arbeit gehindert und eifrige Christen sich entfremdet. Andrerseits wollen manche geistlich wirken unter Umgehung der kirchlichen Beamten, drängen sich hervor, pflegen einen unchristlichen Enthusiasmus und richten Spaltungen an. Darum bedarf ein Pfarrer heute große Weisheit, damit er heilsame Mitarbeit nicht abweist und schädliche Mitarbeit auf den rechten Weg führt.
Schon früh wurden außer den Vorstehern der Gemeinde niedere Beamte berufen für gewisse Verrichtungen. Die aposto lischen Konstitutionen bezeichnen als solche: den Vorleser, den Vorsänger, den Türhüter. Die römische Kirche unterscheidet vier niedere und drei höhere Ämter: ostiarii, lectores, exorcistae, acoluthi; sodann: subdiaconi, diaconi, presbyteri. Nur wer diese sieben Weihen empfangen hat, ist fähig das Meßopfer darzubringen. In der evangelischen Kirche wurden für die niederen Dienste Kantoren, Organisten, Küster angestellt.
Siebentes Kapitel.
Me Tätigkeiten der Kirche. Die Kirche hat nur eine Aufgabe: Das göttliche Leben, welches Christus in die Menschheit gebracht hat, in den Herzen zu wecken, zu erhalten, zu fördern, auszubreiten. Findet sich etwas im Umfang der kirchlichen Tätigkeiten, was nicht diesem Zwecke dient, so ist es als ungehörig auszuscheiden. 1. Diese Tätigkeit wird zunächst ausgeübt in der Ortsge meinde- denn nur da findet der Verkehr von Person zu Person statt. Darum ist die Tätigkeit der Ortsgemeinde das erste und vornehmste Stück der praktischen Tbeologie. Wir nennen sie Ge meindedienst, er bildet den ersten Teil der praktischen Theologie. Das Subjekt dieser Tätigkeit ist immer die Gemeinde, sie übt ihn aus durch die berufenen Organe oder Beamte. Verschieden ist das Objekt dieser Tätigkeit. Sie erstreckt sich auf die ganze Genieinde im Gottesdienst. Der Pastor bietet der ganzen Gemeinde das Wort und das Abendmahl dar zur Befestigung und Beförderung des neuen Lebens, sie betätigt es durch gemeinsame Anbetung, Bekenntnis, Gelübde. Die Theorie des Gottesdienstes heißt Liturgik. Im Gottesdienst wird das Wort nicht nur gelesen, sondern in freier Rede verkündigt, aus Erfahrung bezeugt, auf die
103
Bedürfnisse der Gemeinde angewandt. Die Theorie der kirch lichen Rede heißt Homiletik. Sodann erstreckt sich die Tätigkeit des Pfarrers auf solche, die noch nicht zur Gemeinde gehören, aber in sie aufgenommen werden sollen. Es werden beständig in jeder Gemeinde Kinder geboren, welche zu Christo geführt werden sollen. Auch leben in der Ortsgemeinde Heiden und Juden, welche gewonnen werden sollen. Das ist die ausbreitende Tätigkeit der Gemeinde sie geschieht durch Taufe und Erziehung. Die Theorie der christlichen Erziehung nennen wir Katechetik. Sie bildet den dritten Teil des Gemeindedienstes. Endlich bezieht sich die Tätigkeit der Gemeinde auf solche, die zwar zu ihr gehören, aber besonderer Förderung bedürfen durch Belehrung, Ermahnung, Tröstung. Die Theorie dieser Tätigkeit nennen wie Poimenik. Sie wird ausgeübt bei per sönlichen Vorgängen, Eheschließung, Beerdigung- diese werden durch kirchliche Feier geweiht mit Wort und Gebet. Sie geschieht vor jeder Abendmahlsseier durch besondere Vorbereitung. Das ist die geordnete Seelsorge. Außerdem gibt es eine freie Seel sorge bei persönlichen Bedürfnissen, bei Leiden, bei Irrtum, bei sittlicher Gefährdung und sündigem Wandel. Damit ist der Gemeindedienst des Pfarrers umschrieben- er wird dargestellt in der Liturgik, Homiletik, Katechetik, Poimenik. Sodann gibt es Gemeindedienste, die der Pfarrer in Ge meinschaft mit den Vorstehern der Gemeinde ausüben soll. Das ist zunächst die Pflege der Armen. In Jerusalem wurden Männer erwählt, welche den Tischen dienen sollten, weil die Arbeit den Aposteln zuviel wurde (Act. 6). Es wurden Männer voll heiligen Geistes erwählt, welche die Arbeit der Apostel an den Bedürftigen unterstützen sollten. Daher hat die evangelische Kirche von Anfang an gefordert, daß Vorsteher sein sollten, welche sich der Armen annähmen. Diese Arbeit ist keineswegs dadurch überflüssig geworden, daß neuerdings die bürgerliche Gemeinde die Pflicht der Armenpflege übernommen hat. Die bürgerliche Armenpflege muß sich aus das Allernotwendigste beschränken, um nicht Faulheit und Frechheit groß zu ziehen sie muß nur dafür sorgen, daß kein Armer verhungert noch
104
erfriert. Aber zu einem menschenwürdigen Leben gehört mehr und dafür muß die christliche Gemeinde sorgen. Darum ist die kirchliche Armenpflege durch die bürgerliche Armenpflege nicht überflüssig geworden, sondern sie muß sie ergänzen, mit ihr Hand in Hand gehen. Sodann soll der Gemeindevorstand mit dem Pfarrer Sittenzucht üben. In der christlichen Gemeinde soll Trunken heit, Unzucht, Ehebruch, Betrug und Diebstahl nicht vorkommen. Der Pfarrer soll solche ermahnen, daß sie von ihren Sünden ablassen- wenn sie solche Vermahnung verachten, dann soll der Gemeindevorstand sie in Zucht nehmen. Die Grundsätze dieser Zucht hat der Herr Matth. 18,15—18 ausgesprochen - ihr Zweck ist, daß der Sünder sich bessere. Es ist unerträglich, wenn in einer christlichen Gemeinde offenbare Trunkenbolde oder Ehebrecher zum Abendmahl zugelassen werden. Hier liegt eine große Versäumnis vieler Gemeindevorsteher vor,- sie lehnen die Sittenzucht ab unter dem Vorwände, sie wollten nicht Richter über ihre Brüder sein. Gewiß hat der Herr gesagt: richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet. Aber hier handelt es sich nicht um ein liebloses, selbstgerechtes Richten,- sondern die Vorsteher sollen solchen Sündern bezeugen, daß sie kein Teil haben am Reiche Gottes, wenn sie sich nicht bekehren- dadurch sollen sie aus ihrer Sünde errettet werden. Die vielfach ver säumte Sittenzucht ist neuerdings ein Bedürfnis geworden, weil es Gemeindeglieder gibt, die sich nicht trauen, ihre Kinder nicht taufen lassen. Solche können nicht kirchliche Ämter bekleiden, nicht Paten sein. Und das sollte man notorischen Sündern ge statten? Wenn hier der Gcmeindevorstand versagt, dann nmß der Pfarrer den sittlichen Mut haben zu tun, was der Wille des Herrn und die Ehre der Gemeinde fordert. Der Vorstand hat auch die äußeren Angelegenheiten einer Gemeinde zu besorgen. Jede Genieinde bedarf ein Gotteshaus, ein Pfarrhaus, eine Schule, ein Gemeindehaus. Sie bedarf irdisches Gut, um die kirchlichen Beamten zu besolden, um die gemeinsamen Kosten zu bestreiten. Wenn Vermögen vorhanden ist, hat der Vorstand es zu verwalten,- wenn nicht, hat er dafür zu sorgen, daß die nötigen Mittel beschafft werden. Er hat
105
Rechnung zu führen und Rechenschaft abzulegen. Als Paulus in Achaja gesammelt hatte für die armen Christen in Jeru salem, sandte er das Geld durch Vertreter der Gemeinden hin, damit sie sich überzeugten, daß die gesammelten Gelder an die Bedürftigen abgeliefert seien. So soll der Vorstand dafür sorgen, daß alles redlich zugehe. Vor allem hat der Vorstand der Gemeinde dafür zu sorgen, daß die rechten Männer zu Predigern und Vorstehern gewählt werden- denn davon hängt das Wohl der Gemeinde ab. Wenn die Prediger nicht das biblische Evangelium verkünden, nicht treu sind in ihrem Amte, nicht einen vorbildlichen Wandel führen, dann entartet die Gemeinde, dann nehmen die Seelen Schaden. Man fordert heute, die verschiedenen Richtungen in der evangelischen Kirche müßten einträchtig zusammenwirken. Gewiß hat es zu allen Zeiten verschiedene Richtungen gegeben wie verschieden waren nicht Petrus und Paulus, Jakobus und Johannes? Aber bei aller Verschiedenheit waren sie einig in dem Evangelium- einmütig verkündeten sie, daß Gott seinen eingeborenen Sohn zu unsrer Erlösung in die Welt gesandt habe, daß Jesus durch seinen Gehorsam bis zum Tode uns wohlgefällig gemacht und aus dem Dienst der Sünde befreit habe, daß er durch seine Auferstehung das ewige Leben gebracht habe und als der erhöhte Herr durch seinen Geist seine Ge meinde vollende. Über dieses Evangelium sind wir heute nicht einig- es gibt Prediger, welche leugnen, daß Jesus der ein geborene Sohn Gottes sei, daß er durch seinen Gehorsam bis zum Tode uns versöhnt habe und am dritten Tage auferstanden sei. Diese predigen nicht das Evangelium, sondern sein Gegenteil. Das sind nicht verschiedene Formen desselben Evangeliums, sondern ausschließende Gegensätze, verschiedene Religionen. Da bei ist keine Gemeinschaft des Glaubens und der Gottcsverehrung möglich. Man hat vorgeschlagen, diesen Gegensatz so zu überwinden, daß die evangelische Kirche aufhört, eine Gemein schaft des Glaubens und des Bekenntnisses zu sein- man will sie verwandeln in eine Vereinigung zur Pflege evangelischen Lebens, in welche-r beide Arten des Glaubens berechtigt sind. Diese Vereinigung- behält ein gemeinsames Regiment, gemein-
106
sames Vermögen, das Regiment soll dafür sorgen, daß inner halb jeder Ortsgemeinde beide Arten des Glaubens zu ihrem Rechte kommen. Man hat bereits in der Schweiz und in Holland angefangen, dieses Prinzip durchzuführen. Ein solcher Versuch wird in Deutschland scheitern an dem Widerstand der Kirchen regierungen und auch der Gemeinden, wenn sie erst merken, daß es sich um das biblische Evangelium handelt. Sollte man wirklich versuchen es durchzuführen, dann bleibt den Bekennern des biblischen Evangeliums nur übrig, sich zu einer neuen Gemeinschaft zusammenzuschließen, die Prediger, welche das biblische Evangelium verwerfen, nicht anzuerkennen, ihre Kon firmation für ungültig zu erklären. Das bedeutet die Auflösung der evangelischen Kirche- sie spaltet sich in eine altevangelische und eine unitarische Kirche. So ist es in England geschehen, als die Unitarier aus der englischen Kirche ausschieden. Aber die Erfahrung hat gezeigt, daß die Unitarier ebenso wenig religiöse Kraft haben, wie einst die Arianer. Darum halten wir an der Hoffnung, daß diese Spaltung dem evangelischen Deutschland erspart bleibt. Freilich geben unsere unitarischen Christen die Hoffnung nicht auf, in der evangelischen Kirche ihr Recht durchzusetzen. Wo sie die Mehrheit haben, wählen sie unitarische Prediger. An manchen Orten haben sie sich mit politischen Parteien verbündet, die zunächst keine kirchlichen Interessen verfolgen. Aber durch das Schlagwort von Freiheit des Glaubens lassen sie sich als Bundesgenossen bereit finden und sind bemüht, ihre Gesinnungs genossen in die Vertretungen der kirchlichen Gemeinden zu bringen. Es gibt bereits Gemeinden, in welchen das biblische Evangelium nicht mehr gepredigt wird, wo die gläubigen Christen genötigt sind, besondere Gottesdienste veranstalten. Diesen Bestrebungen ist entgegenzutreten - es sind nur solche Gemeinde vorsteher zu wählen, welche dem biblischen Evangelium anhangen. Überall genügt es nicht für einen Gemeindevorsteher, daß er Kirchensteuer bezahlt und rechtschaffen ist- er muß auch kirchliches Interesse betätigt haben. Wo das fehlt, muß eine Wahl als unzulässig beanstandet werden - jeder hat das Recht, Widerspruch zu erheben. Man sagt wohl, man solle die Trägen durch Be-
rufung in ein Amt zur Mitarbeit erziehen. Das kann glücken, wenn die Trägen nur träge sind. Aber Gegner des Evangeliums kann man nicht in eine Stelle berufen, in welcher sie das Evangelium vertreten sollen. Hier liegt die wichtigste Aufgabe der evangelischen Gemeinden, daß sie Anhänger des biblischen Evangeliums in die Vertretung der Gemeinde wählen. 2. Das göttliche Leben wird erhalten und gefördert durch gewisse Ordnungen, welche die Gemeinde aufstellt. Diese Ord nungen beziehen sich zunächst auf die Tätigkeit jeder Gemeinde, sodann auf die Verbindung der einzelnen Gemeinden. So entsteht das Kirchenrecht,- dieses bildet den zweiten Teil der praktischen Theologie. Sohm hat die Behauptung ausgestellt, Kirchenrecht stehe mit dem Wesen der Kirche in Widerspruch. Das Wesen der Kirche sei geistlich, das Wesen des Rechts weltlich- darum sei es undenkbar, daß das Reich Gottes menschliche Verfassungs formen, daß der Leib Christi menschliche (rechtliche) Herrschaft an sich trage (Sohm: Kirchenrecht Seite 1). Aber das Reich Gottes will eingehen in die Form der menschlichen Gemein schaft, jede menschliche Gemeinschaft gibt sich zu ihreni Bestände gewisse Ordnungen, welche ihrem Zwecke angemessen sind. So auch die Kirche- diese Ordnungen bilden das Kirchenrecht. So hat die Kirche eine doppelte Seite: eine göttliche und mensch liche, gleichwie der Heiland selbst. Sie wird gewirkt durch den Geist Jesu Christi,' dieser Geist schafft und belebt sie, er wirkt göttliches Leben in den Herzen, wirkt Erkenntnis der Wahrheit, sittliches Tun- er verbindet die Herzen durch Glaube und Liebe zur innigsten Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft bedarf gewisser Ordnungen, in denen das göttliche Leben erkennbar wird. Von Anfang an hatte Jesus seinen Aposteln einen Auftrag gegeben, ihnen ein Amt anvertraut- das war der Anfang der kirchlichen Organisation. Kraft dieses Auftrags verlangten die Apostel Gehör, Glauben, Gehorsam und er wurde ihnen von den Gläubigen willig geleistet. Hier bestand zunächst keine rechtliche Nötigung, sondern eine geistliche Nötigung; aber aus dieser bildete sich eine rechtliche Ordnung. Nächst den Aposteln waren die Propheten und Lehrer Träger des Geistes Christi, auch sie fanden deshalb Beachtung, Ehrfurcht, Gehorsam;
108
die Gläubigen beugten sich dem Geiste, der aus ihnen sprach. Schon zu den Zeiten der Apostel bildeten sich in jeder Gemeinde besondere Ämter, welche das Wort zu verkünden, die Eucharistie zu verwalten, die Gemeinde zu regieren hatten. Man wählte dazu solche Männer, die vom Geiste Christi erfüllt waren. Wir erkennen diese Entwicklung an der Geschichte des Paulus: in seinen ältesten Briefen kennt er keine Ämter, sondern Gnaden gaben (1. Kor. 11, 28). Außer den Aposteln, Propheten und Lehrern nennt er: Wunderkräfte, die Gnadengabe der Heilungen, Unterstützungen, Regierungen, Sprachengaben. Wo er die Korinther tadelt, wendet er sich nicht an ihre Vorsteher, sondern an die ganze Gemeinde- die Ämter waren damals nur ein Auftrag, keine Würde. Das war nach wenigen Jahren andersals er an die Philipper schrieb, redet er die Gemeinde samt ihren Bischöfen und Dienern an. Das waren die ersten Ge meindeämter. Daneben hatten die Ältesten der Gemeinde ein gewisses Ansehen, aus ihnen wurden die Beamten gewählt. So erhielten die einzelnen Gemeinden ihre Verfassung. Dann wurde die Verbindung der Gemeinden geordnet durch Synoden und Oberbischöse, bis die abendländische Kirche ihre Spitze in dem röniischen Bischof fand. Als die Reformation eintrat, ver sagten ftd) die Bischöfe, die Gemeinden waren zur Selbstver waltung unreif. In dieser Not wurde das jus reformandi den Landesfürsten übertragen und damit ihnen das Regiment der Kirche übergeben. Unter diesem Nvtdach lebt die evangelische Kirche in Deutschland noch heute- ihr Bestreben geht dahin, der gläubigen Gemeinde und den Lehrern berechtigten Einstuß auf das Regiment der Kirche zu erwerben. Die Fürsten würden dieses schwierige Amt gern abgeben, sobald sie die rechten Hände dazu fänden. Eine gewisse Ehrenstellung in der Kirche werden sie mit Recht beanspruchen. Für das evangelische Kirchenrecht gilt als oberster Grund satz, daß Christus allein in der Kirche herrscht und alle Beamte der Kirche nur seine Diener sind- daher muß alles in der Kirche geordnet werden gemäß deni Evangelium, wie es Gott in der heiligen Schrift offenbart hat. Es hat zuerst darzustellen die Verfassung der Kirche, wie sie sich gestaltet in der Orts-
109
gemeinde, in den Synoden, in dem Kirchenregiment. Das Kirchenregiment hat die gesetzgebende Gewalt und die Aufgabe, die Ausführung der Gesetze zu überwachen. Es ordnet die Pflichten und Rechte der kirchlichen Beamten, der Gemeinde vertretung, der Pfarrer, der Ältesten, insonderheit die Vorbildung der Pfarrer, ihre Berufung und Ordination, ihre Amtsführung. Sodann ordnet das Kirchenregiment die kirchlichen Handlungen: den Gottesdienst, die Feier des Abendmahls, der Taufe, der Konfirmation, der Trauung, der Beerdigung. Weiter hat das Kirchenregiment die Verwaltung der Gemeinden und ihres Besitzes zu ordnen. Endlich hat das Kirchenregiment die Rechte der evangelischen Kirche zu vertreten gegenüber der weltlichen Obrigkeit, gegen andere christliche Kirchen, gegen Judentum und Heiden. In der akademischen Vorlesung über praktische Theologie sind nur zwei Kapitel des Kirchenrechts zu behandeln: Die Geschichte der Kirchenverfassung und die Gemeindeverwaltung des evangelischen Pfarrers. Die geistliche Arbeit des Pfarrers ist nicht aus dem Kirchenrecht, sondern aus seiner religiösen Aufgabe abzuleiten. 3. Von Anfang an hat sich in der rechtlich geordneten Kirche die charismatische Tätigkeit erhalten, die vom Geiste Christi gewirkt wurde. Ursprünglich gab es neben den kirch lichen Beamten Apostel, Propheten und Lehrer, welche vom Geiste Christi berufen wurden und von der Gemeinde anerkannt wurden. Diese charismatische Arbeit wurde zwar zurückgedrängt, hat aber nie ganz aufgehört. In der evangelischen Kirche wurde sie wieder lebendig, als man merkte, daß die staatlich verfaßte Kirche nicht allen Aufgaben gewachsen war. Die Kirche soll sich ausbreiten auf der ganzen Erde- diese Pflicht hatte das evangelische Kirchenregiment vergessen. Die Kirche soll durch Liebe alle Arniut überwinden, soll die Kranken pflegen, die Irrenden zurechtbringen- diese Aufgabe hat das evangelische Kirchenregiment nur sehr unvollkonimen erfüllt. Christen, welche diese Mängel schmerzlich enipfanden, haben sich zusammen getan, um diesen Mängeln abzuhelfen. So hat die charis matische Tätigkeit der evangelischen Kirche zu Vereinen geführt, welche der Kirche dienen wollten. Der freie Verein ist die
110
moderne Form der charismatischen Tätigkeit. Diese Vereine und ihre Arbeit darzustellen, das bildet den dritten Teil der praktischen Theologie. Dahin gehören die Vereine für Heiden mission, welche das Evangelium zü den Heiden bringen. Sodann die Vereine, welche das Evangelium verteidigen gegenüber den Angriffen der römischen Kirche: Der Gustav-Adolfs-Verein und der evangelische Bund. Endlich die Vereine, welche den leib lichen und geistigen Schäden der evangelischen Christen abhelfen wollen,' wir fassen sie zusammen unter dem Namen der „Inneren Mission". Zahllos sind diese Vereine, sie aufzuzählen ist un möglich. Es gibt Vereine, die sich der Jugenderziehung widmen: Krippen, Kinderbewahranstalten, Kinderschulen (Oberlin), Kinder gottesdienste, Waisenhäuser, Rettungshäuser, Erziehungsvereine (Bräm in Neukirchen), Knaben- und Mädchenhorte, Jugend vereine, Handarbeitsschulen, Mägdeschulen, Mägdeherbergen, Herbergen für Arbeiterinnen, Vereine für Ladenmädchen, für Jungfrauen, für Lehrlinge, für Handwerksburschen, Herbergen zur Heimat (die erste in Bonn durch Perthes), Jünglings vereine, Vereine junger Kaufleute, christlicher Studenten, christ licher Studentinnen. Andere Vereine wollen zunächst leibliche Not beseitigen,' die Taubstummen (zuerst Samuel Heinike in Leipzig), Blinde, Idioten, Epileptische, Verkrüppelte, Irre sollen geheilt und erzogen werden. Diesem Zwecke dienen auch Kinder heilanstalten und Ferienkolonien. Vor allem haben sich Vereine zur Ausbildung von Diakonissen und zur Krankenpflege aus gebreitet, Diakonenhäuser, der Diakonieverein, der Verein vom roten Kreuz. Andere Vereine wirken direkt zur Hebung der geistlichen Not und zur Förderung christlichen Lebens: Die Vereine für Bibelverbreitung, für Traktate, für Volksbibliotheken, Kolportage, Evangelisation und christliche Vorträge. Die Ge fährdeten sucht man zu bewahren, indem man die Diaspora im Ausland, die Hollandsgänger, Erntegänger, Schiffer, Kanal arbeiter, Seeleute, Kellner, Auswanderer besucht. Die Ver lorenen sucht man zu retten in Magdalenenasylen, Trinker-' asylen, Arbeiterkolonien, man besucht gefallene Mädchen, ent lassene Gefangene und geht in die Gefängnisse. Man bekämpft die soziale Not durch freie Armenpflege, Stadtmission, durch
111
Beschaffung reinlicher und ausreichender Wohnungen, durch Arbeitervereine und Beförderung der Sonntagsruhe. Aber die Innere Mission har es nicht nur mit Armen und Elenden zu tun, sondern ebenso mit unchristlichen Reichen- ihr Zweck ist die Herzen zu gewinnen, die leiblichen Nöte bekämpft sie nur, weil sie das christliche Leben hindern. . So ist in der evangelischen Kirche ein Kampf erwacht wider Sünde und Unglauben, Not und Elend der Christen. Groß ist Sünde und Elend, aber größer muß werden die helfende Liebe. Die alten Christen haben die Feindschaft der Heiden überwunden durch ihre große Liebe. Das Mittel müssen wir heute wieder anwenden- die bloße Predigt des Evangeliums hilft nicht. Nur die Kirche wird die Gegner des Christentums überwinden, welche am reichsten ist an Werken der Liebe.
Carl Georgi, UniversitätS-Buchdruckerei, Bonn.
A. Marcus & E. Webers Verlag in Bonn.
Luthers Werke in Auswahl. Unter Mitwirkung von Albert Leitzmann herausgegeben von
Otto Clemen. Vier Bände. — Preis in Leinen gebunden je 5 Mark. Diese neue Ausgabe will den jungen Theologen, Germanisten und Historikern die wichtigsten Schriften Luthers in einer den wissenschaft lichen Anforderungen entsprechenden Textform in die Hand geben. Diesen Zweck können die Ausgaben mit modernisierten deutschen und übersetzten lateinischen Texten naturgemäß nicht erfüllen, die Erlanger und die bisher einzig wissenschaftlich brauchbare Weimarer Ausgabe sind aber für die meisten unerschwinglich. Unsere Ausgabe bietet die deutschen Texte nach den Originaldrucken. Die germanistische Revision und Beseitigung der Versehen der alten Drucker hat Prof. A. Leitzmann besorgt. Die alte Interpunktion ist nur da geändert worden, wo sie geeignet war, ein Mißverständnis zu erzeugen. In den lateinischen Texien ist durch maßvolle Modernisierung der Inter punktion das Verständnis erleichtert worden. Über weiterhin begegnende Schwierigkeiten helfen die Anmerkungen hinweg. Die Einleitungen zu den einzelnen Schriften sind möglichst kurz gehalten. Deutsche Literatur-Zeitung: Clemens' Luther, auf 4 Bände berechnet und in seiner ganzen Anlage an die Lietzmannschen „Kleinen Texte" angelehnt, will mit der Einführung in den Urtext zum quellenmäßigen Studium Luthers, seiner Geschichte, Theologie und Sprache hinleiten, es ist also vor allem die Ausgabe, die man künftig unseren Studenten zur An schaffung empfehlen wird. — . . . jede Schrift mit knapper Einleitung, kenntnisreich, geschmackvoll und stets mit eigenem, gesunden Urteil, so daß diese neue Luther-Ausgabe gute Aufnahme und weite Verbreitung in jedem Sinne verdient. Christliche Welt: Der Weimarer Ausgabe in ihrem Werte verwandt, nur in einem freilich Großen, ihr nahestehend, der Unvollständigkeit, dafür in einem, nicht Geringen, ihr überlegen, der Handlichkeit. Solch ein Buch ladet zum Studium ein, ich sollte meinen, unwiderstehlich. Archiv für Neformationsgeschichte: Die neue Ausgabe soll, auch in der Auswahl, den „ganzen Luther" zeigen, ihn allseitig als Reformator und Begründer einer neuen Kultur, als Erbauungsschriftsteller, Bibelüber setzer und -Erklärer, Polemiker, Satiriker zur Geltung bringen. Die Ausgabe erhebt, indem sie sich, wie selbstverständlich, an die WA. anlehnt, gleichwohl Anspruch auf selbständige Bedeutung, insofern sie die dort vorgetragenen Forschungsergebnisse' nie ungeprüft übernimmt, auch in Einleitungen und Anmerkungen, besonders zu Luthers früheren Schriften, manche Ergänzung und Berichtigung bringt. Literarischer Ratgeber des Dürerbundes: Im vorigen Bericht wurde der Wunsch nach einer guten und knappen Auswahl aus Luthers Werken ausgesprochen. Diese erfüllt jetzt die Ausgabe von Clemen und Leitz mann. Die Originaltexte sind mit aller denkbaren Genauigkeit wieder gegeben- wir empfinden darüber eine besondere Freude, denn nur da durch lernen wir den echten und ganzen Luther kennen. Historische Zeitschrift: Es wurden die einzelnen Stücke mit kurzen, geschickt abgefaßten Einleitungen versehen, in denen auf kritische Fragen und
A. Marcus & E. Webers Verlag in Bonn. Literatur hingewiesen ist. Die Weimarer Lutherausgabe wurde natürlich vielfach benutzt, doch hat (Sternen recht, wenn er für seine Ausgabe selbständige Bedeutung in Anspruch nimmt. — Der Druck ist recht sorgfältig. Kirchliche Rundschau: ... So wird diese Neuausgabe ein unentbehrliches Hilfsmittel für das Studium Luthers werden.
Inhaltsverzeichnis. Band I. Seite Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum. 1517 . . 1 Ein Sermon von Ablatz und Gnade. 1518......................................... 10 Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute. 1518 . 15 Unterricht auf etlich Artikel, die ihm von seinen Abgönnern aufgelegt und zugemessen werden. 1519............................................................. 148 Ein Sermonvon der Betrachtung des heiligenLeidens Christi. 1519 154 Ein Sermon von der Bereitung zum Sterben.1519...................... 161 Ein Sermon von dem Sakrament der Buße. 1519......................... 174 Ein Sermon von dem heiligen bochwürdigen Sakrament der Taufe. 1519 185 Ein Sermon von dem hochwürdlgen Sakrament des heiligen wahren Leichnams Christi und von den Bruderschaften. 1519.................... 196 Ein Sermon von dem Bann. 1520 ...................................................... 213 Bon den guten Werken. 1520 .................................................................. 227 Ein Sermon von dem neuen Testament, d. i. von der heiligen Messe. 1520 299 Bon dem Papsttum zu Nom wider den hochberühmten Romanisten zu Leipzig. 1520 ............................................................................................ 323 An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung. 1520 ....................................................................................... 362 De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium. 1520 .... 426 Band II. Ein Sendbrief an den Papst Leo X. Bon der Freiheit eines Christen menschen. 1520 1 Warum des Papsts und seiner Jünger Bücher verbrannt sind. 1520 28 Eine kurze Form der zehen Gebote, eine kurze Form des Glaubens, eine kurze Form des Vaterunsers. 1520 ......................................... 38 Grund und Ursach aller Artikel D. Martin Luthers, so durch römische Bulle unrechtlich verdammt sind. 1521.................................................. 60 Das Magnificat verdeutschet und ausgelegt. 1520 und 1521 ... 133 De votis monastitis iudicium. 1521..................................................... 188 Eine treue Vermahnung zu allen Christen, sich zu verhüten vor Auf ruhr und Empörung. 1522 ................................................................... 299 Von beider Gestalt des Sakraments zu nehmen. 1522 ..................... 311 Welche Personen verboten sind zu ehelichen. Vom ehelichen Leben. 1522 335 Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei. 1523 360 Daß eine christliche Versammlung oder Gemeine Recht und Macht habe, alle Lehre zu urteilen usw. 1523 ........................................................ 395 Ordnung eines gemeinen Kasten. 1523 ................................................... 404 Bon Ordnung Gottesdienst in der Gemeine. 1523 ............................... 424 Formula Missae et Communionis. 1523 . . ............................... 427 An die Ratsherrn aller Städte deutsches Landes, daß ste christliche Schulen aufrichten und halten sollen. 1524 .................................... 442
A. MarcuS & E. Webers Verlag in Bonn. Band III.
Sette
Von Kaufshandlung und Wucher. 1524 Ermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben. 1525 ............................................................................................ Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern. 1525 Ein Sendbrief von dem harten Büchlein wider die Bauern. 1525 .
47 69 75
De servo arbitrio.
94
Deutsche Messe.
1526
1
1526 ...................................................................................... 294
Das Tausbüchlein aufs neue zugerichtet.
1526 .................................. 310
Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können. 1526 .... 317 Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis. 1528 ............................................ 352
Band IV. Der große Katechismus. 1529 ............................................................................. 1 Ein Traubüchlein für die einfältigen Pfarrherrn. 1529 ...................... 100 Vermahnung an die Geistlichen, versammelt auf dem Reichstag zu Augsburg. 1530 ............................................................................................ 104 Eine Predigt, daß man Kinder zur Schulen halten solle. 1530 . . 144 Warnung an seine lieben Deutschen. 1531........................................... 194 Etliche Fabeln aus Aesopo. 1530 229 Von der Winkelmesse und Pfaffenweihe. 1533 ...................................... 239 Schmalkaldische Artikel. 1538 ...................................................................... 292 Wider Hans Worst. 1541 . .-................................................................. 321 Anfang der Gegenschrift gegen den Melsunger Pfarrer Joh. Lening, die Doppelehe Landgraf Philipp von Hessen betreffend. 1542 . . 379 Neue Zeitung vom Rhein. 1512................................................................... 386 Eine welsche Lügenschrift von Doctoris Martini Luthers Tod, zu Rom ausgegangen. 1545 ...................................................................................... 388 Contra XXXII articulos Lovaniensium theologistarum. 1545 . 392 An Kurfürsten zu Sachsen und Landgrafen zu Hessen von dem ge fangenen Herzog zu Braunschweig. 1545 ............................................ 399 Vorrede zu Band I der Opera Latina der Wittenberger Ausgabe. 1545 421
Einleitung in das Alte Testament Mit Einschluss der Apokryphen und der Pseudepigraphen Alten Testaments von
Eduard König ord. Professor der Theologie und Geheimer Konsistorialrat, Bonn.
XII, 840 Seiten. — Ermässigter Preis M. 6.—. Die „Einleitung ins Alte Testament“ von Ed. König wurde von der Kritik des In- und Auslandes allgemein als eine sehr schätzenswerte Leistung bezeichnet, und C. H. Cornill gibt in seinem Grundriss der Einleitung ins Alte Testament (1908, 8. 7) über das Werk sein Urteil dahin ab, dass „um des gewaltigen Stoffreichtums und des durchaus selbständigen Durchdringens der ganzen Disziplin willen dies grossartige Einleitungswerk als die bedeutendste Erscheinung der letzten Jahre anerkannt werden muss“.
A. Marcus & E. Webers Verlag in Bon»
Handschriften der Reformationszeit. Ausgewählt von Georg Mentz 1912. XXXIII S. 50 Tafeln. In Leinenband M. 6.—, in Ganzpergament M. 12.—. (Tabulae in usum Sch darum, editae sub cura Johannis Lietzmann Bd. V.) Dieses in erster Linie zur Einführung in das Quellenstudium der Re formationszeit bestimmte Tafelwerk dürfte auch in weiteren Kreisen leb haftem Interesse begegnen. Auf 50 Lichtdrucktafeln (18 X 24) werden etwa 90 Schriftproben vornehmlich der theologischen und politischen Führer und Förderer der Reformation dargeboten. Die Tafeln enthalten in sorg fältiger Faksimilereproduktion Briefe und Aktenstücke, welche auch inhaltlich für die Entwickelung der reformatorischen Bewegung von Bedeutung sind: der Text gibt die buchstabengetreue Umschrift und Literaturnachweise, bei den weniger bekannten Persönlichkeiten auch einige biographische Notizen. Vertreten sind folgende Gruppen: Humanisten (Erasmus, Reuchlin, Mutian, Pirkheimer, Hutten, Scheurl); Theologen (Luther, Melanchthon, Bugenhagen, Jonas, Crnciger, Amsdorf, Spalatin, Major, Carlstadt, Agricola, Müntzer, Osiander, Bucer, Brenz, Schnepf, Wenz, Linck, U. Rhegius, Corvinus, Bullinger, Oecolampadius, Zwingli, Calvin u. a. m. sowie die für Überlieferungsgeschichte bedeutsamen Männer (Mathesius, Aurifaber, Veit Dietrich, Roerer, Schlaginhaufen); Fürsten (die sächsischen Kurfürsten, Georg und Moritz von Sachsen, Philipp von Hessen, Ulrich von Württem berg, die Braunschweigischen Herzöge, Georg von Brandenburg, Albrecht von Mansfeld, Wolf v. Anhalt, Wilhelm v. Neuenahr, Maria v. Jülich, Elisabeth v. Rochlitz); Kanzler, Räte und Sekretäre (Christian Beyer, Gregor Brück, Melchior v. Ossa, F. Burckhardt, Feige, Leonh. Eck; Hans v. d. Planitz, Eberh. v. d. Tann, Christ, v. Karlowitz, Fachs, Laz. Spengler, Fröhlich, Gereon, Sailer, Joh. Sturm, Schertlin; Wolf, Lauenstein, Aitinger, Bing u. a.)
Vollständige Verzeichnisse beider Sammlungen stehen auf Wunsch unberechnet zu Diensten.



![Kirche und Praktische Theologie: Eine Studie über die Bedeutung des Kirchenbegriffes für die Praktische Theologie anhand der Konzeptionen von C. I. Nitzsch, C. A. Gerhard von Zezschwitz und Fr. Niebergall [Reprint 2014 ed.]
3110162679, 9783110162677](https://dokumen.pub/img/200x200/kirche-und-praktische-theologie-eine-studie-ber-die-bedeutung-des-kirchenbegriffes-fr-die-praktische-theologie-anhand-der-konzeptionen-von-c-i-nitzsch-c-a-gerhard-von-zezschwitz-und-fr-niebergall-reprint-2014nbsped-3110162679-9783110162677.jpg)
![Praktische Theologie: Register [Erste und zweite Auflage., Reprint 2022]
9783112688502](https://dokumen.pub/img/200x200/praktische-theologie-register-erste-und-zweite-auflage-reprint-2022-9783112688502.jpg)

![Leben, Leib und Liturgie: Die Praktische Theologie Wilhelm Stählins [Reprint 2012 ed.]
9783110866384, 9783110143645](https://dokumen.pub/img/200x200/leben-leib-und-liturgie-die-praktische-theologie-wilhelm-sthlins-reprint-2012nbsped-9783110866384-9783110143645.jpg)

![Praktische Theologie [2 ed.]
9783110447316, 9783110447200](https://dokumen.pub/img/200x200/praktische-theologie-2nbsped-9783110447316-9783110447200.jpg)